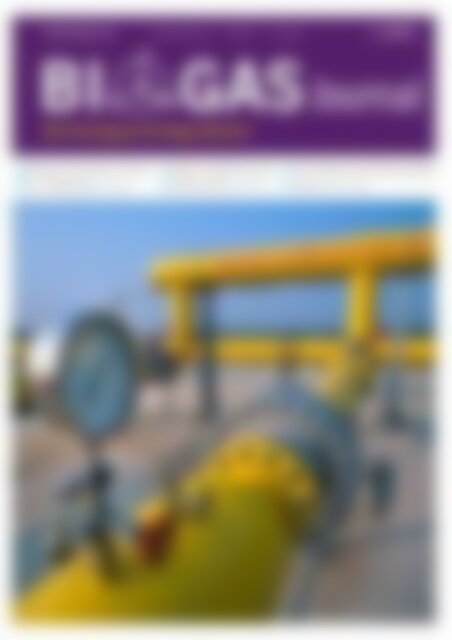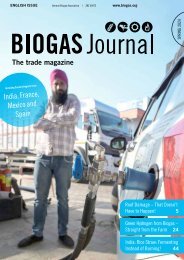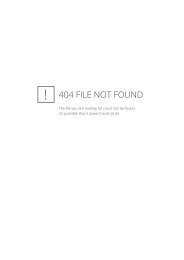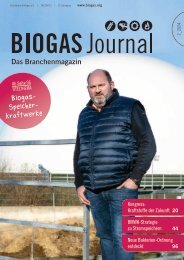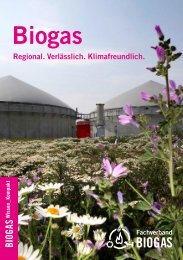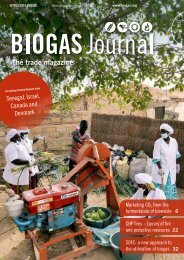1_2018 Leseprobe
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
www.biogas.org Fachverband Biogas e.V. | ZKZ 50073 | 21. Jahrgang<br />
1_<strong>2018</strong><br />
Bi<br />
GaS Journal<br />
Das Fachmagazin der Biogas-Branche<br />
Biogas Convention: So war<br />
es in Nürnberg S. 26<br />
Silphie: Ergebnisse aus<br />
Gärversuchen S. 72<br />
Recht: Wenn der Direktvermarkter<br />
pleite ist S. 101<br />
Gasnetz und Biomethanhandel<br />
Adressfeld
Inhalt<br />
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Alles aus einer Hand - Ihren Anforderungen entsprechend!<br />
Adsorber<br />
Produktion<br />
Flachbett- &<br />
Schüttbettadsorber<br />
auf Basis<br />
nachwachsender<br />
Rohstoffe<br />
Kunststoff &<br />
Edelstahl<br />
Aktivkohle-Wechsel<br />
kurze<br />
Reaktionszeit<br />
Entsorgung<br />
inkl. Nachweis<br />
kurze Lieferzeiten<br />
flexible<br />
Liefermengen<br />
Logistik<br />
Auslegung inkl.<br />
Standzeitberechnung<br />
Optimierungsberatung<br />
Qualitätskontrolle<br />
Service<br />
Beladungsuntersuchung<br />
Labor<br />
Natürlich besser!<br />
• Dotierte Aktivkohle<br />
zur Entschwefelung &<br />
Reinigung von technischen<br />
Gasen<br />
• entfernt zusätzlich in<br />
einem Schritt Siloxane,<br />
VOC´s und Mercaptane<br />
• hergestellt in Deutschland<br />
• lange Standzeiten, weniger<br />
Wechsel<br />
Sparen Sie Kohle und sichern Sie sich ihr Angebot!<br />
AdFiS products GmbH<br />
Am Kellerholz 14<br />
D-17166 Teterow<br />
2<br />
Telefon: +49 (0) 3996 15 97-0<br />
Fax: +49 (0) 3996 15 97-99<br />
E-Mail: sales@adfis.de<br />
web: www.adfis.de
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Editorial<br />
Warum Biogas ein Klimakiller<br />
oder ein Klimaretter sein kann!<br />
Liebe Leserinnen und Leser,<br />
knapp 90 Milliarden Kubikmeter Erdgas<br />
wird Deutschland in 2017 verbrauchen –<br />
jede vierte Kilowattstunde (kWh), ob<br />
Strom, Wärme oder Kraftstoff, kommt aus<br />
dem Netz der meist gelben Leitungen. Wir<br />
können unser Biogas zu Biomethan veredeln<br />
– und es ins Erdgasnetz einspeisen.<br />
Damit wartet ein riesiger Absatzmarkt mit<br />
Chancen für Speicher,- Wärme- und Mobilitätsanwendungen<br />
auf die Branche.<br />
In diesem Heft beschäftigen wir uns mit<br />
unserem Tor zur Welt und dem, was heute<br />
normalerweise darin zu finden ist: Themen<br />
wie Herkunft, Marktplayer, Preisbildung,<br />
Speicher werden von unseren Redakteuren<br />
auf den Seiten 38 bis 53 intensiv beleuchtet.<br />
Schließlich beschäftigen wir uns mit<br />
der praktischen Umsetzung, den Handelshindernissen<br />
und wie wir das Tor zur Welt<br />
auch nutzen können.<br />
Motiviert von dem Glauben, dass Erdgas<br />
gegenüber der Nutzung von Kohle und Erdöl<br />
heute schon sauberer mit weniger Schadstoffen<br />
verbrennt und gleichzeitig weniger<br />
Kohlendioxid emittiert, lautet der neue Slogan<br />
des DVGW „Gas wird Grün“. Gleichzeitig<br />
ist Erdgas zwar besser, aber noch lange<br />
nicht erneuerbar und noch immer fossil.<br />
Daher sieht die Gaswirtschaft als Zukunftsperspektive<br />
den stärkeren Einsatz von Biogas<br />
und anderen erneuerbaren Gasen. Gemeint<br />
ist meist „Power-to-Gas“ (PtG) oder<br />
vergleichbare Verfahren. Egal bei welcher<br />
Konferenz im Klima- oder Energiesektor,<br />
die Umwandlung von überschüssigem<br />
Strom aus Wind und Sonne zu Gas soll mittelfristig<br />
ein fester Bestandteil im Energiesystem<br />
werden.<br />
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in der<br />
Vergangenheit oft das energiepolitische<br />
Dreieck als Bewertungskriterium zitiert. Die<br />
Versorgungssicherheit, die Bezahlbarkeit<br />
und die Umweltverträglichkeit waren dabei<br />
ihre Eckpunkte dieses Dreiecks. Sofern weiterhin<br />
auf fossiles Erdgas gesetzt wird, ist<br />
Deutschland auf den Import angewiesen.<br />
Nur 8 Prozent ist deutsches Erdgas, 40 Prozent<br />
stammen aus Russland. Den Rest steuern<br />
die europäischen Nachbarn wie Niederlande<br />
und Norwegen bei. Eine Vision mit<br />
grünem Gas ist hier aufgrund einer zukünftigen<br />
Vielzahl von inländischen Einspeisern<br />
sicher ein guter Weg für die Sicherheit der<br />
Versorgung. Zumindest, sofern die Potenziale<br />
auch genutzt und genügend erneuerbare<br />
(Bio-) Gasanlagen zugebaut werden.<br />
Bei der Bezahlbarkeit stellt sich zunächst<br />
die Frage, wie sich die Rahmenbedingungen<br />
und Kosten relativ zum Status quo entwickeln.<br />
Während die einen Wissenschaftler<br />
die Fortschritte bei der erneuerbaren<br />
Energieerzeugung würdigen, sehen andere<br />
die noch fehlende Effektivität in der Umsetzung<br />
von Strom ins Gasnetz als Stolperstein.<br />
Allerdings kann aus meiner Sicht die<br />
Politik mit den richtigen Rahmenbedingungen<br />
starken Einfluss ausüben – es ist also<br />
mehr eine Frage des Willens und weniger<br />
der Technologie.<br />
Im Gegensatz zu Europa sehen einige Autoren<br />
in den USA die Umweltwirkung von<br />
Erdgas kritisch. Hier werden hohe Verluste<br />
des maroden Leitungsnetzes, verbunden<br />
mit der Klimawirkung von Methan, zu einem<br />
Klimakiller hochgerechnet. Könnte<br />
Biogas so auch zum Klimakiller werden?<br />
Die Antwort haben wir selber in der Hand.<br />
Zum einen wollen wir ja gerade die unselige<br />
Förderung von Erdgas und die damit<br />
verbundenen Methanemissionen verdrängen<br />
und minimieren. Zum zweiten zeigt<br />
das deutsche Gasnetz mit recht geringen<br />
Verlustraten und hohen Standards, dass es<br />
auch deutlich besser geht als in den USA.<br />
Des Weiteren werden bei der Güllevergärung<br />
sogar aktiv Methanemissionen aus der<br />
Landwirtschaft eingefangen.<br />
Aber es sollte uns motivieren, unseren eigenen<br />
Umgang mit Methan zu sensibilisieren.<br />
Wenige Prozentpunkte an Undichtigkeiten<br />
in unseren Biogasanlagen reichen, die Klimawirkung<br />
massiv zu schmälern. Wir in der<br />
Biogasbranche sollten weiterhin alles tun,<br />
um solche Diskussionen im Keim zu ersticken.<br />
Das machen wir am besten, indem<br />
wir unsere Anlagen professionell bauen, betreiben<br />
und warten. Regelmäßige Kontrolle<br />
durch Dichtigkeitsproben, Gaskameras<br />
und Emissionsmessungen sollten nicht als<br />
Last, sondern als Chance verstanden werden.<br />
Schließlich ist jedes Methanmolekühl<br />
umgesetzt in Energie auch ein Gewinn für<br />
den Betreiber.<br />
Dann, davon bin ich überzeugt, ist der Klimaretter<br />
Biogas – auch im Gasnetz – weiterhin<br />
auf dem richtigen Weg.<br />
Herzlichst Ihr<br />
Dipl.-Ing. (FH) Hendrik Becker<br />
Vizepräsident des Fachverbandes Biogas e.V.<br />
3
Inhalt<br />
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Biogas Convention<br />
12.–14. Dezember 2017, Nürnberg<br />
26 Seide: „Fossile Energieträger<br />
brauchen ein CO 2<br />
-Preisschild“<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Editorial<br />
3 Warum Biogas ein Klimakiller<br />
oder ein Klimaretter sein kann!<br />
Dipl.-Ing. (FH) Hendrik Becker,<br />
Vizepräsident des Fachverbandes Biogas e.V.<br />
AKTUELLES<br />
6 Meldungen<br />
8 Bücher<br />
10 Termine<br />
11 Biogas-Kids<br />
12 Fossiles LNG kann nur eine Brücke sein<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
18 Strom plus Wärme plus Bioraffinerie<br />
Von Dipl.-Journ. Wolfgang Rudolph<br />
22 Box und Miete bestens kombiniert<br />
Von Dipl.-Journ. Wolfgang Rudolph<br />
POLITIK<br />
34 Neuer Schwung im weltweiten<br />
Klimaschutz<br />
Von Stefan Küper<br />
36 Transformationstechnologien<br />
gewinnen an Bedeutung<br />
Von Dr. Peter Röttgen<br />
Titelthema<br />
38 Gas: Potenzielles Medium<br />
für die Energiewende<br />
Von Dierk Jensen<br />
42 Notwendig, aber derzeit unrentabel:<br />
Gasspeicher in Deutschland<br />
Von Bernward Janzing<br />
46 Europäische Biomethanstrategie<br />
notwendig<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
PRAXIS<br />
54 Stoffstrombilanzverordnung<br />
Neue Regelung seit Anfang Januar<br />
Von M.Sc. Ramona Weiß<br />
56 Ein zweites Leben für Dosierer<br />
Von Dipl.-Journ. Wolfgang Rudolph<br />
60 Nahwärme<br />
Ein Ort setzt auf Holz und Biogas<br />
Von Dipl.-Geogr. Martin Frey<br />
4
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Inhalt<br />
titelFoto: iStock_DarioEgidi<br />
Fotos: Fachverband Biogas e.V., Fotolia_Reinhard Tiburzy, Energiepark Hahnennest, Manuel Maciejczyk<br />
72<br />
96<br />
WISSENSCHAFT<br />
64 Optimale Nutzungsdauer von Biogasanlagen<br />
– Reparaturkosten entscheiden<br />
Von Clemens Fuchs, Jessy Blaschke,<br />
Joachim Kasten, Katharina Skau und<br />
Frank Rixen<br />
68 Was bringt Repowering wirklich?<br />
Von Dipl.-Journ. Wolfgang Rudolph<br />
72 Donau-Silphie liefert vielversprechende<br />
Gaserträge<br />
Von Dr. Angelika Konold-Schürlein<br />
INTERNATIONAL<br />
Kenia<br />
76 Premiere mit Avocados<br />
Von Oliver Ristau<br />
Finnland<br />
82 Klima-Kapriolen, Biogas und<br />
Kreislaufwirtschaft<br />
Von Dierk Jensen<br />
Finnland<br />
86 Weg von der Pipeline-Wirtschaft,<br />
hin zur Bioökonomie<br />
Interviewer: Dierk Jensen<br />
Indien<br />
88 Gaushalas mit Biogasanlagen verknüpfen<br />
Von Abhijeet Mukherjee<br />
VERBAND<br />
Aus der Geschäftsstelle<br />
90 Betreiberbeirat wählte und<br />
diskutierte Änderungen im EEG<br />
Von Dr. Stefan Rauh und<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Manuel Maciejczyk<br />
94 Aus den Regionalgruppen<br />
96 Aus den Regionalbüros<br />
96 Sicherheit auf Biogasanlagen in Chile<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Manuel Maciejczyk<br />
98 Wohlklingende Passagen im<br />
Koalitionsvertrag<br />
Von Bernward Janzing<br />
RECHT<br />
100 Clearingstelle EEG<br />
Von Elena Richter und Dr. Martin Winkler<br />
101 Wenn der Direktvermarkter pleite ist ...<br />
Von Dr. Helmut Loibl<br />
Produktnews<br />
104 Produktnews<br />
106 Impressum<br />
5
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Energiewende-Bilanz 2017: Rekorde bei<br />
Erneuerbaren, aber keine Fortschritte beim<br />
Klimaschutz<br />
Berlin – Erneuerbare Energien waren im<br />
Jahr 2017 auf Rekordkurs: 36,1 Prozent<br />
des Stroms wurden von Windkraft-, Biomasse-,<br />
Solar- und Wasserkraftanlagen geliefert.<br />
Das sind 3,8 Prozentpunkte mehr<br />
als 2016 – einen stärkeren Zuwachs gab es<br />
noch nie. Dazu hat vor<br />
allem die Windenergie<br />
beigetragen: sowohl<br />
aufgrund des weiteren<br />
Zubaus als auch infolge<br />
guter Windbedingungen<br />
2017. Damit<br />
wurde erstmals mehr<br />
Strom aus Wind produziert<br />
als aus Steinkohle<br />
und Atomkraft. Diese<br />
fielen auf das niedrigste<br />
Niveau seit 1990.<br />
Das zeigt die Studie<br />
„Die Energiewende im<br />
Stromsektor: Stand der<br />
Dinge 2017“, die Agora<br />
Energiewende kürzlich vorgelegt hat.<br />
Die Energiewende kommt damit beim<br />
Zuwachs der Erneuerbaren Energien und<br />
beim Ausstieg aus der Atomenergie gut voran.<br />
Eine schlechte Bilanz war 2017 jedoch<br />
bei den Treibhausgasemissionen zu verzeichnen:<br />
Das dritte Jahr in Folge stagnierte<br />
der Ausstoß des klimaschädlichen CO 2<br />
,<br />
statt wie geplant zu sinken. Denn während<br />
im Stromsektor die Emissionen infolge des<br />
Rückgangs der Steinkohleverstromung<br />
2017 leicht zurückgingen, stiegen sie im<br />
Verkehrs-, Gebäude- und Industriesektor<br />
aufgrund des höheren Mineralöl- und Erdgasverbrauchs.<br />
„Der gegenwärtige Trend<br />
läuft darauf hinaus, dass Deutschland im<br />
Jahr 2020 seine Emissionen nur um 30<br />
Prozent statt wie geplant um 40 Prozent<br />
gegenüber 1990 vermindert“, sagt Dr. Patrick<br />
Graichen, Direktor von Agora Energiewende.<br />
Wesentliche Ursache hierfür ist die Entwicklung<br />
beim Energieverbrauch: Im vergangenen<br />
Jahr wurden 0,8 Prozent mehr<br />
Energie verbraucht als 2016 – Strom,<br />
Diesel und Erdgas legten zu. Es wird damit<br />
nahezu unmöglich, die von der Bundesregierung<br />
im Energiekonzept 2010 beschlossenen<br />
Energieeffizienzziele für 2020 (minus<br />
20 Prozent Primärenergie- und minus<br />
10 Prozent Stromverbrauch gegenüber<br />
Mehr als 60 Terawattstunden Strom wurden im Jahr 2017 per Saldo exportiert, das entspricht rund<br />
10 Prozent des in Deutschland verbrauchten Stroms.<br />
2008) zu erreichen. „Die Energieeffizienz-<br />
Fortschritte sind zu gering, um zusätzliche<br />
Verbräuche aus Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum<br />
auszugleichen oder sogar<br />
zu überkompensieren“, sagt Graichen.<br />
Auch die Stromverkäufe ins Ausland sind<br />
erneut gestiegen: Mehr als 60 Terawattstunden<br />
Strom wurden im Jahr 2017 per<br />
Saldo exportiert, das entspricht rund 10<br />
Prozent des in Deutschland verbrauchten<br />
Stroms. Der Grund: Da Deutschland die<br />
zweitniedrigsten Börsenstrompreise Europas<br />
hat, lohnt es sich für Deutschlands<br />
Kohle- und Gaskraftwerksbetreiber, ihren<br />
Strom an unsere Nachbarn zu verkaufen.<br />
Die Erlöse hierfür beliefen sich unterm<br />
Strich auf etwa 1,4 Milliarden Euro – die<br />
oft besondere Aufmerksamkeit bekommenden<br />
Stunden mit negativen Strompreisen<br />
fallen in der Gesamtbilanz hingegen kaum<br />
ins Gewicht.<br />
Die Börsenstrompreise 2017 stiegen im<br />
Vergleich zu 2016 aufgrund höherer Importpreise<br />
für Kohle und Erdgas leicht.<br />
Haushaltsstrom dürfte <strong>2018</strong> im Schnitt<br />
daher um 1,4 Prozent mehr kosten und<br />
erstmals die Marke von 30 Cent pro Kilowattstunde<br />
überspringen. Im Gegensatz<br />
dazu haben die Erneuerbare-Energien-<br />
Auktionen 2017 gezeigt, wie billig Windund<br />
Solarstrom inzwischen sind: Die garantierten<br />
Vergütungen<br />
für die Kilowattstunde<br />
Solarstrom sanken<br />
auf unter 5 Cent, für<br />
Windkraft-Onshore auf<br />
unter 4 Cent und die<br />
für Windkraft-Offshore<br />
auf unter 2 Cent. Damit<br />
ist Strom aus leistungsstarken<br />
neuen Erneuerbare-Energien-Anlagen<br />
nunmehr durchweg<br />
Foto: fotolia_psdesign1<br />
günstiger als Strom aus<br />
neuen konventionellen<br />
Kraftwerken.<br />
„Bei den Erneuerbaren<br />
Energien sind wir 2017<br />
mit Blick auf Ausbau und Kostensenkung<br />
gut vorangekommen. Beim Klimaschutz<br />
steht das Vorreiterland Deutschland jedoch<br />
kurz vor dem Scheitern. Dies hat drei Ursachen:<br />
Erstens steigen die Emissionen<br />
im Verkehr, vor allem im Güterverkehr, seit<br />
Jahren an; zweitens steigert die Industrie<br />
ihre Effizienz nicht in dem Maße, wie sie<br />
ihre Produktion erhöht; und drittens verbleibt<br />
der CO 2<br />
-schädlichste Energieträger,<br />
die Braunkohle, auf konstant hohem Niveau.<br />
Wenn die neue Regierung hier nicht<br />
schnell gegensteuert, wird Deutschland<br />
seine Klimaschutzziele für 2020 und auch<br />
für 2030 massiv verfehlen“, mahnt Agora-<br />
Direktor Patrick Graichen.<br />
Die Studie „Die Energiewende im Stromsektor:<br />
Stand der Dinge 2017“ steht unter<br />
www.agora-energiewende.de zum kostenfreien<br />
Download bereit. Die rund 60-seitige<br />
Publikation beschreibt in zehn Kapiteln<br />
mit zahlreichen Abbildungen die wesentlichen<br />
Trends. Sie basiert auf aktuell verfügbaren<br />
Daten aus zahlreichen öffentlichen<br />
Quellen.<br />
6
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Aktuelles<br />
Schnell Motoren und Emission Partner arbeiten<br />
in Sachen Abgasnachbehandlung zusammen<br />
Amtzell – Anlass für die Zusammenarbeit war die<br />
Absenkung des Formaldehydgrenzwertes für Biogasanlagen,<br />
die den Emissionsminderungsbonus<br />
beziehen. Erstes gemeinsames Projekt ist daher die<br />
Umstellung der Oxidationskatalysatoren auf das<br />
neue, von beiden Firmen entwickelte Katalysatorwechselsystem.<br />
„Die kontinuierliche und langfristige Einhaltung der<br />
Emissionen unserer Blockheizkraftwerke ist unser<br />
erklärtes Ziel. Dies wollen wir gemeinsam mit der<br />
Motorentechnologie von Schnell und dem Emissions-<br />
Know-how von Emission Partner flächendeckend für<br />
unsere Kunden umsetzen“, erklärt Bernd Brendel,<br />
Geschäftsführer der Schnell Motoren GmbH.<br />
„Mit dem neuen Wechselsystem ermöglichen wir<br />
unseren Kunden den weiteren Bezug des Emissionsminderungsbonus,<br />
reduzieren die Montagezeit<br />
beim Tausch und ermöglichen die Wartung der<br />
Katalysatoren während des normalen Services vor<br />
Ort,“ beschreibt Produktmanager Enrico Lagoda die<br />
Innovation.<br />
„Mit der Schnell Motoren GmbH haben wir einen<br />
starken und kompetenten Partner gefunden, der in<br />
Deutschland über sein sehr großes Servicenetzwerk<br />
diese Katalysatoren auf den Bestandsanlagen verbauen<br />
und warten kann,“ bestätigt Dirk Goeman,<br />
Geschäftsführer bei Emission Partner, die Kooperation.<br />
Die Zusammenarbeit soll über die jetzt eingesetzten<br />
Oxidationskatalysatoren für Erstausrüstung<br />
und Service hinausgehen. Auch im Hinblick auf die<br />
Neuregelung der TA Luft wollen beide Firmen bei neuen<br />
Projekten zusammenarbeiten.<br />
Foto: Schnell Motoren GmbH<br />
Biogas B-Line-BHKW der<br />
Schnell Motoren GmbH<br />
mit 250 Kilowatt elektrischer<br />
Leistung und einem elektrischen<br />
Wirkungsgrad<br />
von 45,5 Prozent.<br />
EnviTec Biogas realisiert drittes Bauprojekt in China<br />
Lohne/Saerbeck – Die Marktpräsenz des niedersächsischen<br />
Biogasanlagenbauers EnviTec Biogas<br />
in China schreitet voran. Derzeit punktet EnviTec<br />
vor allem mit seiner innovativen EnviThan-Gasaufbereitungstechnologie<br />
in Fernost. Mit dem Bau einer<br />
ersten Biogasanlage plus Gasaufbereitung in der<br />
nordchinesischen Provinz Hebei verzeichnet der aus<br />
Lohne und Saerbeck agierende Biogas-Allrounder<br />
nun das dritte erfolgreiche Bauprojekt in der Volksrepublik<br />
– ein viertes Projekt befindet sich im Bau.<br />
„Unser Kunde, die Dingzhou Sifang Leo Livestock<br />
Science and Technology Co. Ltd., hat mit der soeben<br />
in Betrieb genommenen Anlage in Dingzhou, Provinz<br />
Hebei, ein Vorzeigeobjekt für die gesamte Region<br />
geschaffen“, so Jörg Fischer, Mitglied des Vorstands<br />
Biogasanlage plus Gasaufbereitung in der nordchinesischen Provinz Hebei.<br />
Ein Projekt der deutschen EnviTec Biogas AG.<br />
der EnviTec Biogas AG. Die mit Rindergülle, Maisstroh<br />
und -silage betriebene Anlage wurde seitens EnviTec<br />
in nur sechs Monaten gebaut und fertiggestellt.<br />
Die Jahresgasleistung der Anlage liegt bei 13.500.000<br />
Nm³ Rohgas. „Die gesamte Technologie der Biogasanlage<br />
und der EnviThan-Gasaufbereitung wurde an<br />
unserem Standort Saerbeck gefertigt und in Seecontainern<br />
verstaut“, so Projektleiter Andrea Bosse. Die<br />
insgesamt sechs Fermenter wurden vor Ort in einem<br />
Betonwerk gegossen. „Dank detaillierter Planung seitens<br />
des Kunden konnten wir die Umsetzung auch interkulturell<br />
gut meistern“, erklärt Bosse. Das Team der<br />
Dingzhou Sifang Leo Livestock Science and Technology<br />
Co. Ltd. hatte innerhalb seiner eigenen Designabteilung<br />
alle EnviTec-Planungen auf Chinesisch übersetzt.<br />
Foto: EnviTec Biogas AG<br />
„Die Anlage zeichnet sich vor allem aber durch ihren<br />
Leuchtturmcharakter aus“, so Bosse weiter. Ein angegliedertes<br />
Besucherzentrum inklusive Labor und<br />
Schaltzentrale wurde architektonisch so geplant und<br />
umgesetzt, dass Besucher per Glasgang und -tunnel<br />
die Anmischstrecke und Technik einsehen können.<br />
Das erzeugte Biomethan wird als Compressed Natural<br />
Gas (CNG) in Flaschentrailer abgefüllt und als<br />
Kraftstoff weiter vertrieben.<br />
Eine weitere, in der ostchinesischen Hafenstadt<br />
Yantai von EnviTec im Frühjahr realisierte EnviThan-<br />
Anlage beliefert bereits eine Tankstelle vor Ort. „Unser<br />
Kunde dort, die Shandong Minhe Biological Scitech<br />
Co. Ltd, liefert das Rohgas aus der bestehenden<br />
Biogasanlage“, sagt Stefan Laumann, zuständiger<br />
Abteilungsleiter der Gasaufbereitung bei EnviTec.<br />
Die hier installierte CNG-Anlage komprimiert das<br />
Biomethan von etwa 13,5 bar auf 200 bar in Flaschenanhänger.<br />
„CNG wird dort hauptsächlich für<br />
Autos verwendet“, so Laumann.<br />
Der CNG-Markt in China wächst stetig. „Derzeit<br />
haben wir mit unserem Vertriebspartner insgesamt<br />
vier Mitarbeiter in China, die die hohe Anzahl an Anfragen<br />
bedienen“, berichtet Finanzvorstand Fischer<br />
weiter. China setze vermehrt auf Erneuerbare, weil<br />
vor allem die Megacities im Qualm der Kraftwerke zu<br />
ersticken drohen, „und auf dem Land sieht es ähnlich<br />
aus, da die örtlichen Betriebe die Reste nach<br />
der Ernte einfach abbrennen“, so Fischer. Aktuell ist<br />
EnviTec dabei, eine Joint-Venture-Gesellschaft in<br />
China zu gründen. Diese werde künftig vor allem für<br />
den After-Sales-Service zuständig sein.<br />
7
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Bücher<br />
Wohlstand ohne Wachstum –<br />
das Update<br />
Absolut empfehlenswert<br />
ist das neue<br />
Buch „Wohlstand<br />
ohne Wachstum –<br />
Grundlagen für eine<br />
zukunftsfähige Wirtschaft“<br />
von Tim Jackson.<br />
Es ist ein Update<br />
des vor sieben<br />
Jahren erstmals erschienenen Buchs, das<br />
sich schnell zum Standardwerk entwickelte.<br />
Die brisante Diagnose des renommierten<br />
britischen Ökonomen lautete damals:<br />
„Unsere gesamte Wirtschaftsordnung baut<br />
auf ewigem Wachstum auf – aber nun brauchen<br />
wir einen anderen Motor“ – und daran<br />
hat sich auch heute nichts geändert.<br />
In Zeiten zunehmender Ungleichheit und<br />
Umweltzerstörung ist die Notwendigkeit,<br />
umzusteuern, dringlicher denn je, und so<br />
kommt die komplett überarbeitete Neuauflage<br />
der „Bibel der Wachstumskritik“<br />
gerade zur rechten Zeit. Das Buch bietet<br />
eine fundierte Analyse der Auswirkungen<br />
der Finanz- und Wirtschaftskrisen und des<br />
ungebrochenen Strebens nach Wachstum,<br />
legt den Fokus auf die ganze Welt und schildert<br />
die Chancen und Herausforderungen<br />
einer Postwachstumsgesellschaft, die die<br />
ökologischen Grenzen unseres Planeten<br />
nicht überschreitet und trotzdem in Wohlstand<br />
lebt.<br />
Der Autor schreibt, dass die Wirtschaft<br />
von morgen in materieller Hinsicht nicht<br />
wachsen sollte. Fortgesetztes materielles<br />
Wachstum würde unsere Fähigkeit gefährden,<br />
innerhalb des sicheren Handlungsraumes<br />
unseres Planeten zu bleiben, und<br />
den künftigen Wohlstand untergraben. Es<br />
sei dringend eine gesellschaftliche Debatte<br />
über Auswege aus der Wachstumsfalle<br />
notwendig.<br />
Das vorherrschende Wirtschaftsmodell<br />
beruhe auf einer stetigen exponentiellen<br />
Ausdehnung des Umfangs der Wirtschaft.<br />
Seit Mitte des 20. Jahrhunderts sei die globale<br />
Wirtschaft um durchschnittlich 3,65<br />
Prozent pro Jahr expandiert. Sollte sie bis<br />
zum Ende des 21. Jahrhunderts in derselben<br />
Geschwindigkeit weiter expandieren,<br />
wäre sie 200 Mal größer als im Jahr 1950.<br />
Wie würde eine Welt aussehen, in der alle<br />
das Einkommen erreichen können, das<br />
man sich im reichen Westen erwartet, fragt<br />
Jackson In einer gerechteren und beträchtlich<br />
reicheren Welt müsste die globale Wirtschaftsleistung<br />
im Jahr 2100 am Ende 30<br />
Mal größer sein als heute und über 326 Mal<br />
größer als um 1950. Diese außerordentliche<br />
Steigerung der globalen Wirtschaftsaktivität<br />
stehe in vollkommenem Widerspruch<br />
zur endlichen Ressourcenbasis und der<br />
fragilen Ökologie, von der unser Überleben<br />
abhängt.<br />
Wohlstand sei mehr als materieller Genuss.<br />
Er gehe über materielle Interessen hinaus.<br />
Wohlstand sei tief in der Lebensqualität,<br />
der Gesundheit und dem Glück der Familien<br />
verankert. Er zeige sich in der Stärke<br />
der Beziehungen und im Vertrauen in die<br />
Gemeinschaft. Er äußere sich in der Zufriedenheit<br />
bei der Arbeit und in dem Bewusstsein,<br />
dass wir Werte und Ziele teilen.<br />
Wohlstand bedeute, dass wir fähig sind,<br />
uns als menschliche Wesen zu entwickeln<br />
und ein gutes Leben zu führen – und dies<br />
alles innerhalb der ökologischen Grenzen<br />
eines endlichen Planeten. Die Herausforderung<br />
für unsere Gesellschaft bestehe<br />
darin, Bedingungen zu schaffen, die dies<br />
möglich machen. Das sei die vordringlichste<br />
Aufgabe unserer Zeit.<br />
oekom verlag München, 2017, 367 Seiten,<br />
19,95 Euro. ISBN: 978-3-96006-840-9<br />
Neue<br />
Sonderhefte!<br />
Fachverband Biogas e.V. | ZKZ 50073 | 20. Jahrgang<br />
www.biogas.org Dezember 2017<br />
Bi GaS Journal<br />
Das Fachmagazin der Biogas-Branche<br />
SonderheFt<br />
Feststoffdosierer: Gefahren Brandschutz: neues nachschlagewerk<br />
verfügbar S. 32 reinigung planen S.<br />
Fermenter: Sichere<br />
nicht unterschätzen S. 10<br />
40<br />
AnlAgensicherheit<br />
Biogas Journal Sonderheft Anlagensicherheit<br />
Das aktuelle Heft finden Sie<br />
auf der Homepage (www.biogas.org)<br />
DIN A4-Format<br />
Bestellnr.: BVK-14<br />
Preis auf Anfrage<br />
www.biogas.org Fachverband Biogas e.V. | ZKZ 50073 | 20. Jahrgang<br />
Bi gaS Journal<br />
Das Fachmagazin der Biogas-Branche sondERhEFT<br />
Regenwasser auffangen,<br />
was dann? S. 6<br />
REgEnwassER-<br />
ManagEMEnT<br />
Technik und Pflanzen<br />
kombiniert S. 12<br />
Dezember 2017<br />
Verdunster<br />
im Einsatz S. 30<br />
Digitale auSgaBe – erhältlich unter www.biogas.org<br />
Aktualisiert<br />
18.12.2017<br />
Biogas Journal Sonderheft Regenwasser-Management<br />
digital verfügbar<br />
Erstmal gibt es vom Biogas Journal ein digitales Sonderheft. Darin wird die Thematik der<br />
„Niederschlagswasser-Behandlung“ aufgegriffen. Auf 40 Seiten finden Sie Informationen<br />
zu den rechtlichen Gegebenheiten der Niederschlagswasser-Behandlung. Außerdem werden<br />
verschiedene Verfahren zur Reinigung des verschmutzten Niederschlagswassers vorgestellt.<br />
Sie können das komplette Sonderheft unter<br />
www.biogas.org<br />
kostenlos downloaden und in Ihrem pdf-Reader lesen<br />
und dort auch Seiten ausdrucken.<br />
8
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Aktuelles<br />
ERFAHRUNG<br />
IST DIE BASIS<br />
JEDER INNOVATION<br />
Bei allem, was wir tun, verlieren wir nie aus den Augen, worum es für Sie geht:<br />
effiziente Technik und eine einfache Handhabe.<br />
Als Erfinder der elastomerbeschichteten Drehkolbenpumpe und Innovationstreiber<br />
für Einbring- und Aufbereitungstechnik sehen wir uns bei Vogelsang dem guten Ruf der<br />
deutschen Maschinenbauindustrie und ihrem Beitrag zur Energiewende verpflichtet.<br />
Seit der Gründung des Unternehmens 1929 liefern wir technische Lösungen, deren<br />
Funktionalität, Qualität und Zuverlässigkeit von unseren Kunden weltweit hoch geschätzt<br />
werden und unseren Wettbewerbern als Vorbild dienen.<br />
Unser umfassendes Know-how und die langjährige Erfahrung im Bereich Biogas nutzen<br />
wir, um unseren Kunden als kompetenter Partner zur Seite zu stehen. Mit schlagkräftiger<br />
Pump-, Zerkleinerungs-, Desintegrations- und Feststoffdosiertechnik ebenso wie mit<br />
unseren individuellen Beratungsleistungen.<br />
vogelsang.info<br />
ENGINEERED TO WORK<br />
9
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Termine<br />
Alle Termine finden Sie auch auf der Seite www.biogas.org/Termine<br />
1. Februar<br />
4. Biogasfachtagung NORD –<br />
Werterhaltung und Optimierung für den<br />
Betrieb von Biogasanlagen<br />
Werlte<br />
www.gruenbeck.de<br />
2. Februar<br />
Biologisch-Dynamisch<br />
Mitterteich<br />
green-energy-zintl.de<br />
7. Februar<br />
Oberfränkisches Biogas-Fortbildungsseminar<br />
Bad Staffelstein – Kloster Banz<br />
www.weiterbildung.bayern.de<br />
7. Februar<br />
Umgang mit (finanziellen) Krisensituationen<br />
und Wertermittlung von Biogasanlagen<br />
Lüchow<br />
biogas@leb.de<br />
7. bis 8. Februar<br />
The reference event for the French biogas<br />
sector<br />
Biogaz Europe <strong>2018</strong><br />
Nantes<br />
www.biogaz-europe.com<br />
EEG Intensivschulungen <strong>2018</strong> –<br />
Nutzen Sie die Chance!<br />
Zur Vorbereitung auf die Ausschreibungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes bietet die<br />
Fachverband Biogas Service GmbH ab Januar <strong>2018</strong> wieder Intensivschulungen an. In<br />
Workshops mit maximal 20 Teilnehmern werden rechtliche und ökonomische Anforderungen<br />
diskutiert sowie die wichtigsten Fallstricke dargestellt. Anmeldeunterlagen und<br />
weitere Informationen stehen Ihnen unter www.service-gmbH.biogas.org zur Verfügung.<br />
31. Januar<br />
EEG-Intensivschulung<br />
Osnabrück<br />
www.biogas.org<br />
22. Februar<br />
EEG-Intensivschulung<br />
Schwäbisch Hall<br />
www.biogas.org<br />
Mathias Waschka<br />
Beratung und Vertrieb<br />
für landwirtschaftliche Erzeugnisse<br />
Trocknungstechnik bis 1,5 MW<br />
Mobil schallged. Varianten<br />
bis 500 kW 45 dB(A)<br />
1. Februar<br />
EEG-Intensivschulung<br />
Westerrönfeld<br />
www.biogas.org<br />
21. Februar<br />
EEG-Intensivschulung<br />
Fulda<br />
www.biogas.org<br />
27. Februar<br />
EEG-Intensivschulung<br />
Dresden<br />
www.biogas.org<br />
28. Februar <strong>2018</strong><br />
EEG Intensivschulung<br />
Potsdam<br />
www.biogas.org<br />
Bundesweite Infotage zum<br />
Thema Flexibilisierung<br />
Schubboden-Trocknungscontainer<br />
Die Vor-Ort-Stromerzeugung in Biogasanlagen wird über das EEG hinaus nur eine<br />
Zukunft haben können, wenn die Anlagen konsequent auf flexible Fahrweise umgestellt<br />
werden. Nur so bringen sie ihren stärksten Pluspunkt im Zusammenspiel der<br />
Erneuerbaren zur Geltung. Unter der Überschrift „Biogas – für die Zukunft gerüstet“<br />
bieten seit Mitte Oktober die „Infotage zu Flexibilisierung und Wärmenutzung“ eine<br />
Grundlage für die Entscheidungsfindung.<br />
Tel.<br />
Fax<br />
Mobil<br />
info@m-waschka.de<br />
www.m-waschka.de<br />
04482 - 908 911<br />
04482 - 908 912<br />
0151 - 23510337<br />
Termine:<br />
24. Januar, Erbach, Baden-Württemberg<br />
08. Frebruar, Rendsburg, Schleswig-Holstein<br />
21. Februar, Dorsten, Nordrhein-Westfalen<br />
06. März, Potsdam, Brandenburg<br />
13. März, Triesdorf, Bayern<br />
Weitere Informationen im Internet unter www.kwkkommt.de<br />
10
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
BIOGAS-KIDS<br />
Aktuelles<br />
Aus Biogas wird Biomethan<br />
Biogas hat einen Nachteil: Als Gas ist es nur dort verfügbar,<br />
wo es produziert wird – in der Umgebung der<br />
jeweiligen Biogasanlagen. Dabei kann mit Biogas mehr<br />
als nur Strom und Wärme gewonnen werden. Einem<br />
anderen Energieträger kann das Biogas helfen, noch<br />
„grüner“ – also umweltfreundlicher zu werden: nämlich<br />
Erdgas. Erdgas ist eine wichtige, aber nicht erneuerbare<br />
Energieform, die aus begrenzten Lagerstätten unter<br />
der Erde gewonnen wird. Weil Erdgas jedoch in vielen<br />
Häusern und Fabriken zum Heizen, zum Kochen, zur<br />
Stromproduktion und inzwischen auch für Fahrzeuge<br />
genutzt wird, besteht ein riesiges, rund 505.000 km langes<br />
Erdgasnetz in Deutschland. Da liegt es doch nahe,<br />
das umweltfreundliche Biogas einzuspeisen. Und genau<br />
das wird schon getan. Allerdings muss das Biogas dazu<br />
veredelt werden, das heißt, es muss exakt die Qualität<br />
des Erdgases erhalten. Das ist notwendig, damit die<br />
Heizungen oder Motoren, die mit Erdgas arbeiten, diese<br />
Mischung vertragen. Erreicht wird das durch spezielle<br />
technische Aufbereitungsverfahren, bei denen das<br />
Biogas getrocknet und Schwefel entzogen und auch<br />
der Brennwert angepasst wird. Fertig ist das BioErdgas,<br />
das Fachleute Biomethan nennen. Es kann nun anteilig<br />
dem Erdgas beigemengt werden – und macht auf<br />
Futter für die<br />
Vögel im Winter<br />
Du benötigst:<br />
• ein wenig Reisig<br />
• Draht, einen Apfel<br />
• einen Stab oder Stock<br />
• einen Strick zum Aufhängen<br />
Wenn viel und lange Schnee im Winter<br />
liegt, brauchen die Vögel unsere Hilfe,<br />
denn sie finden kaum noch etwas zu<br />
fressen. Über einen leckeren Apfel freuen sie sich<br />
bestimmt! Aus dem Reisig bindest du mit Draht<br />
einen Kranz, so dass der Apfel dazwischen passt.<br />
Den Apfel spießt du mit dem Stab auf und schiebst<br />
diesen durch das Reisig. Dann den Strick befestigen<br />
und an den Baum hängen. Du kannst natürlich<br />
auch noch fertige Netze aufhängen. Suche dir<br />
einen Baum, den du gut beobachten kannst und<br />
du wirst sehen – es schmeckt …<br />
diese Weise das Erdgas tatsächlich „grüner“. Jetzt kann<br />
es überall hin zu den Verbrauchern transportiert oder<br />
auch in einem der riesigen, unterirdischen Erdgasspeicher<br />
zwischengespeichert werden.<br />
Bis zum Jahr 2030 sollen auf diese<br />
Weise 10 Prozent des gesamten<br />
Erdgasverbrauchs in Deutschland<br />
durch Biomethan ersetzt werden.<br />
Damit hilft das Biogas, die begrenzten<br />
Erdgasvorräte zu schonen.<br />
Mehr Erneuerbare Energien gewünscht<br />
Gute Nachrichten für Biogas! 95 Prozent der Deutschen<br />
wollen mehr Erneuerbare Energien. Eine 2017<br />
durchgeführte Umfrage zeigt, dass für die überwältigende<br />
Zahl der Menschen der Ausbau der Energiegewinnung<br />
aus Wind, Sonne, Biogas und Co. ein<br />
wichtiges Anliegen ist. Dabei zeigte sich auch, dass<br />
viele Bürger nichts gegen Windräder, Solarmodule<br />
oder Biogasanlagen in ihrer Nachbarschaft haben.<br />
In der Nähe von Kohlekraftwerken dagegen möchte<br />
kaum einer leben. Als wichtigste Vorteile der<br />
Erneuer baren Energien zählen die Befragten die Zukunftssicherung<br />
und den Klimaschutz auf. So stimmten<br />
beispielsweise 75 Prozent der Teilnehmer der<br />
Aussage zu, dass die Erneuerbaren zu einer sicheren<br />
Zukunft von Kindern und Enkeln beitragen. Schließlich<br />
tragen Eltern und Großeltern Verantwortung für<br />
ihre Familien und wollen nur das Beste für ihre Kids.<br />
Shutterstock<br />
www.agrarkids.de<br />
Landwirtschaft entdecken und verstehen –<br />
Die Fachzeitschrift für Kinder<br />
11
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Fossiles LNG kann nur<br />
eine Brücke sein<br />
Mitte Oktober fand in Hamburg eine von Euroforum Deutschland SE organisierte Tagung<br />
zum Thema „Small scale LNG“ statt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand der Energieträger<br />
Flüssigerdgas (LNG = Liquefied Natural Gas). Es wurde deutlich, dass in Deutschland<br />
Seehafen-Terminals, Tankstellen und Fahrzeuge zu Wasser und zu Land gar nicht bis<br />
kaum existieren.<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
LNG-Barge im Hamburger<br />
Hafen. Bei der LNG Hybrid<br />
Barge handelt es sich um<br />
ein Flüssiggaskraftwerk,<br />
das die Kreuzfahrtschiffe<br />
während ihrer Liegezeiten<br />
im Hamburger<br />
Hafen emissionsarm und<br />
umweltfreundlich mit<br />
Energie versorgt.<br />
Eines ist klar: Im gesamten Mobilitätssektor<br />
müssen die CO 2<br />
-Emissionen deutlich gesenkt<br />
werden. Biogene Kraftstoffe wie Biodiesel,<br />
Bioethanol und Biomethan leisten<br />
dazu heute schon einen wichtigen Beitrag.<br />
Ihr nachhaltiges Potenzial wird jedoch aktuell aufgrund<br />
politischer Entscheidungen (Tank-Teller-Diskussion<br />
etc.) nicht ausgeschöpft. Hinzu kommt, dass im Jahr<br />
2015 die Treibhausgasminderungsquote das vorher<br />
geltende Biokraftstoffquotengesetz abgelöst hat.<br />
Seitdem muss die Mineralölwirtschaft mengenmäßig<br />
weniger biogene Kraftstoffe einsetzen, was ziemlich<br />
paradox ist.<br />
Seit 2015 muss die Mineralölwirtschaft pro Jahr 3,5<br />
Prozent der durch den Kraftstoffverbrauch emittierten<br />
Treibhausgase einsparen. 2017 steigt dieser Wert auf<br />
4 Prozent an. 2020 soll die jährliche Einsparungsquote<br />
auf 6 Prozent ansteigen. Der Einsatz von Biokraftstoffen<br />
stellt eine Möglichkeit zur Erreichung der Einsparquote<br />
dar. Dazu muss das tatsächliche Einsparpotenzial<br />
des jeweiligen Biokraftstoffs berücksichtigt werden.<br />
Die Mindestanforderung an einen Biokraftstoff bezüglich<br />
seines Treibhausgas-Einsparpotenzials im Vergleich<br />
zu herkömmlichen Kraftstoffen ist durch die<br />
Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung festgelegt.<br />
Laut der Verordnung ist eine Erhöhung dieser Mindestanforderung<br />
von anfangs 35 Prozent auf 50 Prozent am<br />
1. Januar 2017 und auf 60 Prozent ab dem 1. Januar<br />
<strong>2018</strong> vorgesehen.<br />
Moderne Biokraftstoff-Produktionsstätten erreichen<br />
die höchste Minderungsstufe spielend, weil parallel<br />
durch den Anfall von Koppelprodukten Futtermittel<br />
produziert werden und weil aus Reststoffen über den<br />
Biogasprozess weitere Energie erzeugt wird und so im<br />
Gesamtsystem mehr CO 2<br />
-Emissionen gesenkt werden.<br />
Biomethan aus Rest- und Abfallstoffen senkt als gasförmiger<br />
Kraftstoff die CO 2<br />
-Emissionen gegenüber den<br />
fossilen Kraftstoffen sogar um mehr als 90 Prozent<br />
Nun helfen aber nicht nur regenerative Kraftstoffe, die<br />
CO 2<br />
-Emissionen zu senken. Auch bei der motorischen<br />
Verbrennung von Erdgas wird weniger CO 2<br />
emittiert, als<br />
dies bei Benzin- beziehungsweise Dieselmotoren der<br />
Fall ist. Erdgasbetriebene Pkw stoßen im Vergleich zum<br />
Benziner 23 Prozent weniger und im Vergleich zum<br />
Diesel 35 Prozent weniger CO 2<br />
aus. An die biogenen<br />
Kontrahenten reicht Erdgas in Sachen CO 2<br />
-Vermeidung<br />
jedoch nicht heran.<br />
Komprimiertes Erdgas, kurz CNG genannt, eignet sich<br />
gut im Pkw-Bereich sowie für Bau- und Landmaschinen.<br />
Für mittelschwere bis schwere Lkw sowie in der<br />
Binnen- und Seeschifffahrt ist CNG jedoch nicht geeignet.<br />
Hier kommt flüssiges Erdgas als sogenanntes LNG<br />
infrage. Neben dem Vorteil der CO 2<br />
-Reduktion ist bei<br />
der Verbrennung von Erdgas als Kraftstoff positiv, dass<br />
quasi kein Feinstaub emittiert wird.<br />
Das erste biogene LNG in Deutschland soll im nächsten<br />
Jahr an der Biogasanlage in Hahnennest/Ostrach in<br />
Baden-Württemberg produziert werden (siehe Biogas<br />
Journal 5_17, Seite 39). Der Energieversorger Erdgas<br />
Südwest wird die Anlage bauen und betreiben. Laut<br />
der dort tätigen Projektentwicklerin Tatiana Demeusy<br />
Foto: RAG<br />
12
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Aktuelles<br />
liegt das Bio-LNG-Erzeugungspotenzial im Jahr 2030<br />
in Deutschland bei 1,083 Millionen Tonnen pro Jahr.<br />
Der prognostizierte LNG-Bedarf liege in 2030 dagegen<br />
bei lediglich 526.000 Tonnen pro Jahr.<br />
Zwar denkt die Erdgaswirtschaft über regenerative<br />
Gase nach. Aber Bio-LNG aus Biomethan hat sie dabei<br />
gar nicht auf dem Schirm, wie auf der Tagung in<br />
Hamburg deutlich wurde. Die Akteure denken eher in<br />
Richtung Wasserstoff und synthetisches Methan aus<br />
Power-to-Gas-Anwendungen. Diese Energieträger sollen<br />
dann importiert werden aus Regionen, die mehr<br />
Wind- und Solarenergie preiswert erzeugen können,<br />
als es in Deutschland möglich wäre. Die Sache hat nur<br />
einen Haken: Es könnten neue Abhängigkeiten in der<br />
Energieversorgung und neue Krisenregionen wie in der<br />
Region um den Persischen Golf entstehen.<br />
Filippo Checcucci, Manager für die Länder Deutschland<br />
und Österreich im Unternehmen Gas Natural Fenosa,<br />
richtete den Blick auf den globalen LNG-Markt.<br />
Das Unternehmen ist ein großer Energieversorger in<br />
Spanien und Lateinamerika. Es ist laut Checcucci<br />
Hauptlieferant von LNG im Atlantik- und Mittelmeerraum.<br />
Es verfügt selbst über eine Flotte von zwölf<br />
LNG-Tankern. „Erdgas ist der fossile Brennstoff mit<br />
dem größten Wachstumspotenzial in der Zukunft. Der<br />
Erdgasanteil wird beim Primärenergieeinsatz auf 26<br />
Prozent in 2035 steigen. 1990 lag er noch bei 21 Prozent“,<br />
berichtete der Referent.<br />
Die Erdgasproduktion werde von 2013 bis 2040 um 47<br />
Prozent ansteigen. 85 Prozent dieser Steigerung würden<br />
durch Non-OECD Staaten generiert. In 2040 werde<br />
die USA mit 850 Milliarden (Mrd.) Kubikmetern (m³)<br />
der größte Erdgasverbraucher sein. Checcucci stellte in<br />
Aussicht, dass die neuen LNG-Importländer 20 Prozent<br />
der globalen Nachfrage importieren werden. Hierzu gehören<br />
Länder wie Vietnam, Thailand oder Singapur.<br />
In Russland werde der Erdgasverbrauch aufgrund von<br />
eingeführten Effizienzmaßnahmen um 15 Mrd. m³ zurückgehen.<br />
Der Iran werde die Erdgasproduktion um<br />
80 Prozent steigern und 290 Mrd. m³ erreichen. Diese<br />
Produktionssteigerung werde hauptsächlich im Land<br />
verbraucht werden. Neue Erdgasproduzenten würden<br />
in den Markt kommen, die bisher kein Öl gefördert hätten.<br />
Diese Länder würden vor allem Schiefergasquellen<br />
erschließen.<br />
Niederlande werden als Erdgaslieferant<br />
ausfallen<br />
Während also neue Länder zu Förderländern aufsteigen,<br />
geht in anderen Ländern die Erdgasförderung zu<br />
Ende. In Europa ist hiervon vor allem die Niederlande<br />
betroffen. „In zehn Jahren wird die Niederlande kein<br />
Erdgas mehr nach Deutschland exportieren. Auch Norwegen<br />
wird seine Exporte nach Deutschland zurückfahren,<br />
weil Erdgasfelder erschöpft sind“, blickte Marcel<br />
Tijhuis, Projektmanager LNG beim Gasinfrastrukturunternehmen<br />
N.V. Nederlandse Gasunie, voraus. Das<br />
Fotos: Martin Bensmann<br />
Filippo Checcucci, Manager für die Länder<br />
Deutschland und Österreich im Unternehmen<br />
Gas Natural Fenosa.<br />
bedeutet, dass es in Deutschland ab 2026 eine Erdgas-<br />
Versorgungslücke geben wird. Tijhuis sieht in dieser Lücke<br />
eine gute Chance für LNG als Energieträger. Darum<br />
will Gasunie mit der Oiltanking GmbH in Hamburg und<br />
dem Unternehmen Royal Vopak in Rotterdam ein Joint<br />
Venture bilden, dessen<br />
Gründung die EU im<br />
Juli bereits abgesegnet<br />
hat. Das Konsortium<br />
will in Brunsbüttel an<br />
der Elbe einen LNG-<br />
Terminal bauen und<br />
betreiben. Die Machbarkeitsstudie<br />
dazu ist<br />
in Arbeit.<br />
Über den Terminal mit<br />
Landungsbrücke sollen<br />
„Erdgas ist der fossile<br />
Brennstoff mit dem größten<br />
Wachstumspotenzial in der<br />
Zukunft“<br />
Filippo Checcucci<br />
4 bis 5 Mrd. m³ LNG pro Jahr umgeschlagen werden.<br />
An Ort und Stelle sollen rund 220.000 m³ LNG zwischengelagert<br />
werden können. Schiffe bis 210.000 m³<br />
LNG-Ladungsmenge können den Terminal anfahren.<br />
Ferner sollen Lkw-Tankwagen beladen werden können<br />
und der Terminal soll an das Netz von Gaspool angeschlossen<br />
werden. So ist auch eine Regasifizierung des<br />
LNG mit Einspeisung ins Erdgasnetz denkbar.<br />
Brunsbüttel bietet Standortvorteile<br />
Wie Tijhuis erklärte, spricht für den Standort Brunsbüttel,<br />
dass dort Überseeschiffe, die den Hamburger Hafen<br />
anfahren, betankt werden können. Ebenso könnten<br />
dort Schiffe LNG bunkern, die durch den Nord-Ostsee-<br />
Kanal in die Ostsee fahren und das Baltikum als Zielort<br />
haben. Außerdem könnten Dienstleister mit kleinen<br />
Bunkerschiffen bis 1.400 m³ Kapazität andere Schiffe<br />
versorgen.<br />
Eine LNG-Versorgungs-Barge (Barge – sprich Bartsch –<br />
ist ein Lastkahn) ist seit Oktober 2014 im Hamburger<br />
Hafen in Betrieb. Bei der LNG Hybrid Barge handelt es<br />
sich um ein Flüssiggaskraftwerk, das die Kreuzfahrt-<br />
Marcel Tijhuis, Projektmanager LNG beim<br />
Gasinfrastrukturunternehmen N.V. Nederlandse<br />
Gasunie.<br />
13
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
An einer kleinen, ausgeförderten Gaslagerstätte in Oberösterreich wird gegenwärtig die Speicherung von Wasserstoff<br />
erprobt. Gleichzeitig soll CO 2<br />
verpresst werden. In der Lagerstätte soll aus Wasserstoff und CO 2<br />
Methan,<br />
also neues Erdgas entstehen. Federführend in dem Projekt ist die RAG in Österreich.<br />
schiffe während ihrer Liegezeiten im Hamburger Hafen<br />
emissionsarm und umweltfreundlich mit Energie versorgt.<br />
Der Energieträger LNG verursacht im Gegensatz<br />
zu schiffseigenen Generatoren keine Schwefeloxide oder<br />
Rußpartikel und der Ausstoß von Stickoxiden und Kohlendioxid<br />
wird deutlich verringert. Daher ist die Umweltbilanz<br />
bei der Nutzung von Flüssiggas sehr viel besser<br />
als bei schiffseigenen Generatoren, die während ihres<br />
Aufenthalts in Hamburg abgeschaltet werden können.<br />
Foto: RAG<br />
Bei der LNG Hybrid Barge wird die Energie<br />
in Blockheizkraftmotoren und Generatoren<br />
mittels Flüssiggas erzeugt. Die<br />
fünf Generatoren erzeugen insgesamt<br />
eine Leistung von 7,5 Megawatt (50/60<br />
Hz). Der so gewonnene Strom wird flexibel,<br />
je nach Bedarf, in das Versorgungsnetz<br />
des jeweiligen Kreuzfahrtschiffes<br />
eingespeist. 2016 war das erste Jahr, in<br />
dem die Hybrid Barge die AIDAsol über<br />
eine komplette Kreuzfahrtsaison 16 Mal<br />
mit Energie beliefert hat.<br />
Meyer Logistik testet LNG-Lkw<br />
Und auch im Straßengüterverkehr sollen<br />
mittelschwere bis schwere Lkw mit LNG<br />
umweltfreundlicher betrieben werden.<br />
Hersteller wie Volvo, Scania oder Iveco<br />
bieten erste Modelle an. Die Uniper-Tochter Liqvis und<br />
der Lebensmittel-Logistikdienstleister Meyer Logistik<br />
haben im April die erste öffentliche LNG-Tankstelle in<br />
Berlin eröffnet. Die hochmoderne Tankanlage befindet<br />
sich in Grünheide am östlichen Berliner Ring (A10)<br />
auf dem Betriebsgelände von Meyer Logistik. Sie steht<br />
auch externen Spediteuren und Fuhrunternehmen zur<br />
Verfügung und dient der Kraftstoffversorgung mit LNG<br />
entlang den Hauptverkehrsrouten in Europa. Sie ist da-<br />
Wir machen Ihre Biogasanlage fit für die Zukunft.<br />
Die Schmack Service-Kompetenz:<br />
Lassen Sie sich beraten –<br />
kompetent und unverbindlich!<br />
Technischer<br />
Service<br />
Betriebsführung<br />
Modernisierung<br />
Biogasanlage<br />
Biologischer<br />
Service<br />
Profitieren Sie jetzt von mehr als 20 Jahren<br />
Biogas-Know-how.<br />
Schmack ist der kompetente Service-Partner rund<br />
um Ihre Biogasanlage. Von der Beratung über<br />
Optimierung bis hin zur Betriebsführung sind wir<br />
gerne für Sie da. www.schmack-biogas.de<br />
Schmack Biogas Service GmbH · 24-Stunden-Service-Hotline: Tel. +49 (0) 9431 751-277<br />
info@schmack-biogas.com<br />
14
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Aktuelles<br />
mit Teil des „Blue Corridor“ Projekts der Europäischen<br />
Union.<br />
Mit LNG betriebene Lkw zeichnen sich durch eine im<br />
Vergleich zu Lkw, die konventionelle Kraftstoffe verbrauchen,<br />
deutlich höhere Umweltverträglichkeit aus.<br />
Sie stoßen nicht nur deutlich weniger Kohlendioxid,<br />
Stickoxide und Feinstaub aus, sondern sind auch wesentlich<br />
leiser als vergleichbare Fahrzeuge. Nach vorläufigen<br />
Berechnungen von Meyer Logistik können in<br />
fünf Jahren pro Lkw rund 50.000 Kilogramm CO 2<br />
eingespart<br />
werden. Mit einer Reichweite von 1.500 Kilometern<br />
sind LNG-Lkw bei niedrigeren Kraftstoffkosten<br />
und geringerem Schadstoff- und Treibhausgasausstoß<br />
so leistungsstark wie ihre Diesel-Pendants.<br />
Liqvis liefert anfänglich rund 600.000 kg LNG pro Jahr<br />
und sorgt für den Betrieb der hochmodernen Tankanlage.<br />
Über Uniper hat Liqvis direkten Zugang zu LNG-<br />
Kapazitäten und kann das LNG zu marktgerechten<br />
Konditionen bereitstellen. Meyer Logistik stellt mit<br />
zunächst 20 LNG-Lkw die Lebensmittelversorgung im<br />
Großraum Berlin sicher. Iveco verfügt als erster Hersteller<br />
über ein 400 PS starkes LNG-Nutzfahrzeug, den<br />
Stralis 440S40 T/P.<br />
Parallel erfolgt eine wissenschaftliche Begleitforschung<br />
durch den Deutschen Verein des Gas- und<br />
Wasserfaches e.V. am Engler-Bunte-Institut (DVGW-<br />
EBI). Daniel Stähr präsentierte auf der Hamburger<br />
Tagung erste Ergebnisse. Die Lkw-Fahrer von Meyer,<br />
die mit den LNG-Fahrzeugen unterwegs sind, mussten<br />
einen Fragebogen ausfüllen. „Nach Angaben der Fahrer<br />
ist LNG nicht so unsicher, wie zunächst gedacht.<br />
Der Tankvorgang stellte sich als unkompliziert heraus.<br />
Die Technologie steckt nicht mehr in den ‚Kinderschuhen‘.<br />
Die Leistung (u. a. beim Anfahren, Bergfahrt)<br />
wurde teilweise schwächer empfunden. Die Fahrer<br />
sind neugierig und lassen sich auch überzeugen“, resümierte<br />
Stähr.<br />
Anfang August wurde eine Referenzfahrt mit einem<br />
LNG- und einem Diesel-Lkw vorgenommen. Die Strecke<br />
war 420 Kilometer lang. Es handelte sich dabei<br />
um Iveco Stralis-Modelle. Der LNG-Lkw hat 22,3 Kilogramm<br />
Kraftstoff pro 100 Kilometer verbraucht, der<br />
Diesel-Lkw verbrauchte 26,3 Liter auf 100 Kilometer.<br />
Der LNG-Lkw stieß dabei 613 Gramm CO 2<br />
pro Kilometer<br />
aus und der Diesel im Schnitt 697 Gramm CO 2<br />
pro Kilometer. Stähr machte aufmerksam: „Bei einem<br />
Vergleich der JEC-Werte (JEC = Joint Research Centre-<br />
EUCAR-CONCAWE collaboration) unter Einberechnung<br />
des gemessenen Verbrauchs ergibt sich statt 13,6<br />
Prozent eine CO 2<br />
-Minderung von 22,6 Prozent gegenüber<br />
Diesel.“ Wenn die Preisdifferenz zwischen LNG<br />
und fossilem Diesel nur 5 Cent pro Kilometer beträgt,<br />
dann benötigt der LNG-Lkw rund 700.000 Kilometer<br />
Laufleistung, bis er in die Wirtschaftlichkeit fährt.<br />
Ist Ihr Abgaswärmetauscher defekt?<br />
Sparen Sie bares Geld!<br />
Bis zu<br />
500 €<br />
Prämie<br />
Sieht Ihr Wärmetauscher auch so aus?<br />
Wir liefern Ihnen einen Neuen!<br />
Beste Qualität -<br />
Made in Germany<br />
Kassieren Sie bis zu<br />
500,- Euro Wechselprämie.<br />
Senden Sie uns einfach ein Foto Ihres defekten<br />
Apparates – wir setzen uns umgehend mit<br />
Ihnen in Kontakt und besprechen die restlichen<br />
Details. Die Höhe der Prämie orientiert sich an<br />
der Größe des Wärmetauschers.<br />
THERM<br />
Unsere Leistung - Ihr Erfolg<br />
Energiepark 26/28 91732 Merkendorf<br />
+49 9826-65 889-0 info@enkotherm.de<br />
www.enkotherm.de<br />
15
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Underground Sun Conversion – „Erdgeschichte im Zeitraffer“<br />
Strom<br />
Der aus erneuerbaren Energiequellen<br />
(Sonne + Wind) erzeugte<br />
Strom wird mittels Elektrolyseverfahren<br />
in H 2 umgewandelt.<br />
4 H 2<br />
Elektrolyse<br />
Projektpartner:<br />
Faulschlamm<br />
Hoher Druck<br />
undurchlässige Schichten<br />
Lagerstätte<br />
Nutzung natürlicher Erdgaslagerstätten<br />
zur Umwandlung und Speicherung von<br />
erneuerbarer Energie<br />
Natürliche Entstehung und heutige Nutzung von Erdgas<br />
Die natürliche Bildung von Erdgas dauert(e) viele Millionen Jahre.<br />
Im 20. Jhdt. etabliert sich Erdgas aufgrund seiner Flexibilität und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten<br />
als einer der bedeutendsten (fossilen) Energieträger.<br />
Bildung von Faulschlamm<br />
Die Sonne liefert Energie für organisches<br />
Wachstum. Abgestorbene<br />
Kleinstlebewesen sinken auf den<br />
Meeresboden ab und werden mit<br />
Sand und Schlick bedeckt. Dabei<br />
entsteht Faulschlamm.<br />
Erzeugung von erneuerbarem Erdgas in wenigen Wochen –<br />
ein nachhaltiger Kohlenstoffkreislauf entsteht<br />
CO 2<br />
H 2<br />
Schlamm & Schlick<br />
CO 2<br />
Entstehung von Erdgas<br />
Im Laufe der Jahrtausende lagerten sich viele<br />
Schlammschichten darüber ab. Unter hohem Druck<br />
und Sauerstoffabschluss wandelten Mikroorganismen<br />
den Faulschlamm um. Erdgas entstand und<br />
sammelte sich in Lagerstätten zwischen undurchlässigen<br />
Schichten.<br />
erneuerbares Erdgas<br />
CH 4<br />
energetische Nutzung<br />
Mikroorganismen wandeln die<br />
eingebrachten Stoffe (H 2 + C0 2)<br />
in erneuerbares Erdgas (CH 4)<br />
und Wasser (H 20) um.<br />
Aufsuchung und<br />
Förderung<br />
Im 20. Jahrhundert beginnt<br />
die Förderung von Erdgas aus<br />
diesen Lagerstätten.<br />
CH 4<br />
H 2 0 Verwertung<br />
Underground<br />
Sun Conversion<br />
250 Mio. Jahre 50 Mio. Jahre 1900<br />
2017<br />
LNG-Aktivitäten in Österreich<br />
Thomas Pleßnitzer von der Rohöl-Aufsuchungs Aktiengesellschaft<br />
(RAG) aus Wien berichtete über die erste<br />
LNG-Tankstelle in Ennshafen. Am Standort können<br />
Das österreichische Konsortium steht unter der Führung der RAG. Projektpartner sind: Montanuniversität Leoben, Universität für<br />
Bodenkultur Wien (Department derzeit IFA Tulln), rund acib 12 GmbH Tonnen (Austrian Centre verflüssigtes of Industrial Biotechnology), Erdgas Energieinstitut gelagert an der Johannes<br />
Kepler Universität Linz, Axiom Angewandte Prozesstechnik GmbH.<br />
werden, das entspricht rund 60 bis 90 Lkw-Tankfüllungen.<br />
Angeliefert wird das Erdgas mit dem RAG-eigenen<br />
Das Projekt Underground Sun Conversion wird im Rahmen des Energieforschungsprogrammes des österreichischen<br />
Klima- und Energiefonds<br />
LNG-Tankwagen.<br />
– dotiert aus den Mitteln des<br />
Das<br />
bmvit<br />
Erdgas<br />
– als Leitprojekt<br />
stammt<br />
gefördert.<br />
unter anderem aus<br />
RAG-Erdgaslagerstätten und wird in der RAG-eigenen<br />
LNG-Anlage im oberösterreichischen Gampern aufberei-<br />
www.underground-sun-conversion.at<br />
tet, wo etwa 2 Tonnen LNG pro Tag hergestellt werden,<br />
©BOKU<br />
2 H 2 O<br />
Zukünftig soll der Prozess in<br />
der natürlichen Lagerstätte<br />
kopiert und um Millionen<br />
von Jahre abgekürzt werden.<br />
Innerhalb weniger Wochen<br />
wird durch die Underground<br />
Sun Conversion Technologie<br />
so „erneuer bares Erdgas“<br />
gebildet.<br />
Grafik: RAG Östereich<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Redakteur Biogas Journal<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Tel. 0 54 09/90 69 426<br />
E-Mail: martin.bensmann@biogas.org<br />
die dann an der LNG-Tankstelle Ennshafen genutzt werden<br />
können. Das entspricht einer<br />
Betankung von 10 bis 15 LNG-Lkw<br />
pro Tag. In Ennshafen sollen künftig<br />
auch Schiffe mit LNG bebunkert<br />
werden.<br />
Pleßnitzer berichtete im Weiteren<br />
von dem Forschungsprojekt<br />
„Underground Sun Storage“<br />
zur Speicherung von Wind- und<br />
Sonnenenergie in natürlichen<br />
Erdgaslagerstätten. Diese Projekt<br />
wird als „Underground Sun<br />
Conversion“-Projekt fortgeführt.<br />
Es soll erstmals möglich werden,<br />
direkt in einer Erdgaslagerstätte<br />
Erdgas durch einen von der RAG<br />
gezielt initiierten mikrobiologischen<br />
Prozess natürlich zu erzeugen<br />
und gleich dort zu speichern.<br />
Mit dieser weltweit einzigartigen<br />
und innovativen Methode wird der<br />
natürliche Entstehungsprozess<br />
von Erdgas nachgebildet, aber<br />
gleichzeitig um Millionen von Jahren<br />
verkürzt – Erdgeschichte im<br />
Zeitraffer.<br />
Aus überschüssiger Sonnen- oder<br />
Windenergie und Wasser wird<br />
zunächst in einer oberirdischen<br />
Anlage Wasserstoff erzeugt. Gemeinsam<br />
mit CO 2<br />
wird dieser<br />
Wasserstoff in eine vorhandene<br />
(Poren-)Erdgaslagerstätte eingebracht.<br />
In über 1.000 Metern Tiefe<br />
wandeln natürlich vorhandene<br />
Mikroorganismen diese Stoffe in<br />
relativ kurzer Zeit in erneuerbares<br />
Erdgas um, das anschließend<br />
direkt dort in der Lagerstätte gespeichert,<br />
bei Bedarf jederzeit<br />
entnommen und über die vorhandenen<br />
Leitungsnetze zum<br />
Verbraucher transportiert werden<br />
kann. Infos unter http://www.underground-sun-conversion.at/das-<br />
projekt/kurzbeschreibung.html<br />
Fazit: Fossiles LNG kann nur eine Brücke sein hin zu<br />
regenerativen Kraftstoffen. Denn spätestens ab 2040<br />
muss auch Erdgas durch grüne Gase ersetzt werden,<br />
wenn die Klimaschutzziele erreicht werden sollen.<br />
16
Sonic Cut Thru Heavy<br />
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Aktuelles<br />
DIE NEUE<br />
FLYGT<br />
EINBAU-<br />
GARNITUR<br />
BIS-1 mit Midsize- oder Kompakt-Mixer<br />
• Flexibel und problemlos einsetzbar<br />
• Für Behälter bis zu 12 Metern<br />
• Einfach zu bedienen<br />
Lassen Sie nicht jeden bei sich rumrühren.<br />
Jetzt informieren unter www.xylem.de/biogas.<br />
Fragen per E-Mail an biogas.de@xyleminc.com<br />
oder telefonisch unter 0511/7800 610.<br />
Unsere Biogas-Experten beraten Sie gern.<br />
xylem.de/biogas<br />
Vollgas im Fermenter.<br />
P HAN T O M<br />
Das Rührwerk<br />
Entschwefelung<br />
Warum Entschwefelungs mittel?<br />
– Schnelle und zuverlässige Bindung von schädlichem<br />
Sulfid und Schwefelwasserstoff<br />
– Fördert den Methanertrag und die Spurenelementverfügbarkeit<br />
– Schnelle Reaktivität durch amorphe Struktur des<br />
Eisenhydroxids<br />
Produktempfehlung:<br />
Sie ziehen ihre Kreise.<br />
Effizient. Zuverlässig. Legendär.<br />
MethaTec ® Detox S Premium<br />
MethaTec ® Detox S Turbo<br />
Heavy-Duty Rührwerke<br />
MethaTec ® Detox S Aktiv<br />
PTM GmbH ۰ D-87719 Mindelheim<br />
+49 82 61 ⃒ 738 182<br />
info@propeller-technik-maier.de<br />
www.propeller-technik-maier.de<br />
MethaTec ® Detox S „feucht“<br />
www.terravis-biogas.de<br />
17<br />
Ihre Ansprechpartner:<br />
Johannes Joslowski, Tel.: 0251 . 682-2056<br />
johannes.joslowski@terravis-biogas.de<br />
Jens Petermann, Tel.: 0251 . 682-2438<br />
jens.petermann@terravis-biogas.de<br />
FELD<br />
SILO<br />
FERMENTER<br />
ENERGIE
Strom plus Wärme plus Bioraffinerie<br />
Mit fast 1.000 Erdgastankstellen<br />
und 100.000<br />
Erdgasfahrzeugen<br />
verfügt Deutschland<br />
über eine gute<br />
Basis für einen Ausbau<br />
klimafreundlicher<br />
Mobilität. Biomethan<br />
in komprimierter oder<br />
verflüssigter Form spielt<br />
gegenwärtig jedoch<br />
als Kraftstoff nur eine<br />
untergeordnete Rolle.<br />
Wie können Biogasanlagen nach dem Auslaufen der Festvergütung für die Stromeinspeisung<br />
wirtschaftlich weiterbetrieben werden? Welche Alternativen gibt es, um Produkte, die<br />
beim Gärprozess entstehen, zu vermarkten? Diese und ähnliche Fragen bewegen gegenwärtig<br />
Anlagenbetreiber. Antworten darauf gab es beim Biogas-Fachgespräch mit dem Thema<br />
„Perspektiven für Biogasbestandsanlagen bis 2030“ Ende November im DBFZ in Leipzig.<br />
Deutlich wurde dabei, dass die hiesige Biogasbranche von erfolgreichen Innovationen bei<br />
unseren europäischen Nachbarn profitieren kann.<br />
Von Dipl.-Journ. Wolfgang Rudolph<br />
2016 produzierten in Deutschland rund<br />
9.200 Biogasanlagen 32,37 Terawattstunden<br />
(TWh) elektrische Energie und trugen<br />
dadurch mit 17,2 Prozent zur Stromerzeugung<br />
aus erneuerbaren Quellen und 74 Prozent<br />
aus Biomasse bei. Insgesamt stieg der Anteil der<br />
Erneuerbaren mit 188,3 TWh el<br />
auf 31,7 Prozent des<br />
Bruttostromverbrauchs. Mit diesen Zahlen charakterisierte<br />
Jaqueline Daniel-Gromke, Arbeitsgruppenleiterin<br />
im Bereich Biochemische Konversion am DBFZ, die<br />
Situation im Biogasbereich.<br />
Diese sei zudem gekennzeichnet durch eine zunehmend<br />
nachfrageorientierte Stromproduktion und die<br />
Umstellung der Förderung von der Festvergütung zu einem<br />
Ausschreibungsmodell. „Die in den EEG-Novellen<br />
von 2012 und 2017 gesetzten Anreize für die Flexibilisierung<br />
der Anlagen wirken“, konstatiert die Wissenschaftlerin.<br />
Etwa 2.600 mit Biogas oder Biomethan angetriebene<br />
BHKW würden Flexprämien erhalten. Nach Erhebungen<br />
des DBFZ umfasst das 2017 eine installierte<br />
Leistung von 1,8 Gigawatt elektrisch (GW el<br />
). „Bei einer<br />
Leistungsreserve aller Biogasanlagen von insgesamt<br />
4,5 GW el<br />
ist das beachtlich“, urteilte Daniel-Gromke.<br />
Weniger erfolgreich war dagegen die erste Ausschreibung<br />
für Biomasse im September 2017. Das ausgeschriebene<br />
Volumen von 122 MW el<br />
wurde mit den<br />
schließlich bezuschlagten 27,5 MW el<br />
nicht einmal zu<br />
einem Viertel ausgeschöpft.<br />
Der von Daniel-Gromke beschriebene Status quo bildet<br />
die Ausgangslage für das im Frühjahr 2017 gestartete<br />
Forschungsprojekt „Biogas 2030“. Ziel des vom Umweltbundesamt<br />
beauftragten Verbundvorhabens ist,<br />
Optionen aufzuzeigen, wie Biogas-Bestandsanlagen<br />
bis 2030 ökonomisch und ökologisch sinnvoll weiterbetrieben<br />
werden können. Die Untersuchung und Bewertung<br />
der unterschiedlichen Betreibermodelle läuft<br />
noch bis Ende <strong>2018</strong>. Die Aufbereitung zu Biomethan<br />
und Nutzung als Kraftstoff zeichnet sich jedoch nach<br />
Ansicht der DBFZ-Wissenschaftlerin schon als eine realistische<br />
Option für Bestandsanlagen ab.<br />
Klimaschutz durch Bio-CNG und Bio-LNG<br />
Dem stimmt auch Prof. Dr. Frank Scholwin, Direktor<br />
des Instituts für Biogas, Kreislaufwirtschaft und Energie<br />
zu. „Gegenwärtig umfasst der Marktanteil von komprimiertem<br />
Biomethan (Bio-CNG, Compressed Natural<br />
Gas) als Kraftstoff energiebasiert zwar nur 0,4 Prozent.<br />
Mit knapp 1.000 Erdgastankstellen und 100.000 Erdgasfahrzeugen<br />
verfügt Deutschland im europäischen<br />
18
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Aktuelles<br />
Fotos: Carmen Rudolph<br />
Benjamin Berg, Cryo Pur:<br />
„Unsere Aggregate erzeugen aus Biogas den<br />
Kraftstoff Bio-LNG und gleichzeitig flüssiges<br />
CO 2<br />
. Sie sind für Anlagen mit einer Kapazität<br />
von 200 bis 2.000 Nm³/h einsetzbar.“<br />
Jaqueline Daniel-Gromke, DBFZ:<br />
„Ziel unseres Forschungsprojektes ist, Optionen<br />
aufzuzeigen, wie Biogas-Bestandsanlagen<br />
bis 2030 ökonomisch und ökologisch<br />
sinnvoll weiterbetrieben werden können.“<br />
Prof. Dr.-Ing. Frank Scholwin, Institut für<br />
Biogas, Kreislaufwirtschaft & Energie:<br />
„Die stärkere Berücksichtigung des<br />
Klimagas-Minderungspotenzials bei der<br />
Biokraftstoffquote ab 2020 verbessert die<br />
Marktchancen für Bio-CNG und Bio-LNG.“<br />
Vergleich jedoch über eine relativ gute Basis für einen<br />
Ausbau klimafreundlicher Mobilität“, schätzte er ein.<br />
Als Treiber könnten sich hier die stärkere Berücksichtigung<br />
des Klimagas-Minderungspotenzials bei der Festlegung<br />
der Treibhausgasminderungsquote im Bereich<br />
Mobilität ab 2020 sowie die Diskussion um Dieselgate<br />
und Feinstaubbelastung erweisen. Schließlich senke<br />
Erd- oder Biogas als Kraftstoff die Feinstaubemission<br />
gegenüber einem bereits relativ sauberen Euro-VI-Dieselmotor<br />
um 90 Prozent und den Stickoxidausstoß um<br />
70 Prozent.<br />
Neben Bio-CNG, das eine 200 bis 300 Mal höhere<br />
Energiedichte als Biomethan besitzt, wachse die Bedeutung<br />
von Bio-LNG (Liquified Natural Gas), also<br />
verflüssigtem Biomethan. Wegen seiner gegenüber<br />
Bio-CNG nochmals gut 2 bis 2,5 Mal höheren Energiedichte<br />
ermöglicht es größere Reichweiten im Lkw-<br />
Verkehr. Mit den „LNG Blue Corridors“ (http://lngbc.<br />
eu/) gibt es dazu ein spezielles EU-Projekt. Ziel ist, die<br />
Haupttransitlinie durch Europa mit LNG-Tankstellen<br />
auszustatten. Das Transitland Österreich hat zudem<br />
angekündigt, CO 2<br />
-, Stickoxid- und Feinstaubemissionen<br />
bei der Lkw-Maut zu berücksichtigen.<br />
Kryotanks als Speicher<br />
Bio-LNG bietet mehrere interessante Verwendungsmöglichkeiten.<br />
So besteht die Option, es in sogenannten<br />
Kryotanks zu speichern. Dies ist zwar technisch<br />
relativ aufwendig. Dafür kann das Bio-LNG jedoch zu<br />
einem beliebigen Zeitpunkt entspannt und dann entweder<br />
ins Erdgasnetz eingespeist oder in einem BHKW<br />
verstromt werden. Es ist mit Tankwagen auch über weitere<br />
Strecken transportwürdig und selbst als klimaneutraler<br />
Kraftstoff einsetzbar.<br />
Praxisbeispiele gibt es bereits in Skandinavien und<br />
Frankreich. So transportieren die Stadtwerke Göteborg<br />
(Schweden) verflüssigtes Biomethan mit Tankwagen<br />
von einem Anlagenkomplex im 130 Kilometer entfernten<br />
Lidköping und speisen es nach dem Entspannen<br />
ins lokale Erdgasnetz. Außerdem treibt CNG kommunale<br />
Fahrzeuge an. In Skogn (Norwegen) ging 2017<br />
die bislang größte Bio-LNG-Anlage Europas in Betrieb.<br />
Sie verflüssigt Methangas, das bei der Vergärung von<br />
Fischabfällen und Klärschlämmen aus der Papierfabrikation<br />
entsteht.<br />
Aufhorchen lassen auch die Aktivitäten der französischen<br />
Firma Cryo Pur bei der Entwicklung und Realisierung<br />
kryogener Biogasaufbereitungen. Darüber<br />
berichtete Cryo Pur-Manager Benjamin Berg beim Biogasfachgespräch.<br />
Die Gründer des jungen Unternehmens<br />
mit Sitz in Palaiseau bei Paris kommen aus der<br />
Forschung und halten mehrere Patente auf dem Gebiet<br />
In Deutschland gibt es<br />
etwa 200 Biogasaufbereitungsanlagen<br />
mit einer<br />
Einspeisekapazität<br />
von etwa 120.000 m³<br />
Biomethan pro Stunde.<br />
Dessen Weiterverarbeitung<br />
zu Kraftstoffen<br />
ist bei entsprechenden<br />
Rahmenbedingungen<br />
eine Option für den<br />
Weiterbetrieb von<br />
Bestandsanlagen.<br />
19
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Die Biogasanlage der<br />
GraNott Gas GmbH<br />
im thüringischen<br />
Grabsleben produziert<br />
stündlich 1.050 Nm³<br />
Biogas. Davon werden<br />
700 Nm³ zu Biomethan<br />
aufbereitet. Bei Anlagenkomplexen<br />
dieser<br />
Art und Größe könnte<br />
eine ergänzende Verarbeitung<br />
zu Bio-CNG<br />
oder sogar Bio-LNG<br />
schon in naher Zukunft<br />
wirtschaftlich sein.<br />
der kryogenen CO 2<br />
-Abscheidung. Das Besondere an dem<br />
von ihnen entwickelten Verfahren ist nach Bergs Worten<br />
der geringe Energieverbrauch, Flexibilität in Bezug auf<br />
die Durchflussmenge und die Kompaktheit der Anlage,<br />
die sich für Biogasmengen von 200 bis 2.000 Normkubikmeter<br />
pro Stunde (Nm³/h) modellieren lässt.<br />
Die Reinigung des Biogases als auch die anschließende<br />
Trennung in Methan sowie hochreines CO 2<br />
, beides dann<br />
bereits in flüssiger Form, erfolgen in einem geschlossenen<br />
System durch eine aufeinander abgestimmte Abfolge<br />
von Druckänderungen mit Differenzen bis zu 14 bar<br />
und Temperaturen zwischen -75 °C und -160 °C. Nach<br />
einer Demonstrationsanlage mit einer Kapazität von 120<br />
Nm³/h Biogas auf dem Gelände eines Pariser Klärwerkes<br />
ging vor Kurzem der erste kommerzielle Cryo Pur-Aufbereitungs-<br />
und Verflüssigungskomplex in Ergänzung<br />
zu einer landwirtschaftlichen Biogasanlage neben dem<br />
Milchviehstall eines Landwirts im nordirischen Greenville<br />
in Betrieb. Sie verarbeitet stündlich 300 Nm³ Biogas.<br />
Für drei weitere Projekte dieser Art in Frankreich und<br />
Italien erhielt die Firma Cryo Pur den Zuschlag<br />
Studie verdeutlicht Chancen und Risiken<br />
„Wegen der hohen Kosten und den fast nicht vorhandenen<br />
LNG-Nutzfahrzeugen in Deutschland ist der Markt<br />
recht überschaubar. Und so ist die Produktion von LNG<br />
für Betreiber von Biogasanlagen hierzulande gegenwärtig<br />
oft keine wirkliche Option“, sagt Scholwin.<br />
Doch wie sieht es mit CNG aus? Wären Bau und Betrieb<br />
einer Biogasanlage wirtschaftlich, die das produzierte<br />
Biogas direkt vor Ort als Kraftstoff anbietet? Diese Frage<br />
stellten sich die Vertreter der Gemeinde Neukirch<br />
in der Lausitz (Sachsen) und Landwirte der ortsansässigen<br />
Agrargemeinschaft Oberland. Beide präferierten<br />
solch einen innovativen Ansatz, um anfallende Reststoffe<br />
wie Wirtschaftsdünger aus zwei Milchviehställen<br />
oder Grünschnitt der Gemeinde regional zu nutzen. Sie<br />
beauftragten den Biogasexperten mit der Anfertigung<br />
einer entsprechenden Machbarkeitsanalyse. Das Sächsische<br />
Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und<br />
Geologie unterstützte die Studie mit einer Zuwendung.<br />
„In einem ersten Schritt erkundeten wir dafür das lokale<br />
Absatzpotenzial von Biomethan als Kraftstoff“,<br />
erläuterte Scholwin die Herangehensweise. Im Pkw-<br />
Bereich erwies sich dieses als nicht ausreichend. Zwei<br />
ortsansässige Spediteure beziffern ihren Verbrauch<br />
mit 40.000 Liter Diesel pro Monat. Das entspricht 33<br />
Tonnen CNG. Damit wäre die Mindestauslastung einer<br />
CNG-Tankstelle von monatlich 15 Tonnen CNG gegeben.<br />
Vorausgesetzt, die Logistikunternehmen stellen<br />
zumindest Teile ihres Fuhrparks auf Gasantrieb um.<br />
Der ÖPNV fiel als Abnehmer von CNG komplett aus.<br />
Denn zum Erstaunen der Studienautoren werden zumindest<br />
in Sachsen bei Ausschreibungen der Kommunen<br />
zwar Hybrid- und Brennstoffzellenbusse bei der<br />
Förderung berücksichtigt, nicht aber solche mit Erdgasantrieb.<br />
Im landwirtschaftlichen Bereich könnte<br />
sich gemäß Analyse durch Umstellung eigener Technik<br />
und von Traktoren in Nachbarbetrieben je nach saisonalem<br />
Arbeitsanfall ein Bedarf von 2 bis 10 Tonnen<br />
CNG pro Monat ergeben.<br />
Dieser Ausgangslage setzte Scholwin unterschiedliche<br />
Konzepte der Produktion von Biogas mit der Aufbereitungsmöglichkeit<br />
von Teilströmen zu CNG gegenüber.<br />
In seiner Analyse begründete der Biogasexperte anhand<br />
detaillierter Zahlen, dass eine Biogasanlage mit<br />
750 kW elektrischer Leistung und zusätzlicher Produktionskapazität<br />
für 15 Tonnen CNG pro Monat die wirtschaftlich<br />
günstigste Variante darstellt.<br />
Standort für Vergärungsanlage, Aufbereitung und CNG-<br />
Tankstelle wäre laut Konzept das Gewerbegebiet der<br />
Gemeinde Neukirch. Dort gibt es außerdem einen potenziellen<br />
Großabnehmer für die erzeugte thermische<br />
Energie. „Der Wärmeerlös ist bei dieser erfolgversprechendsten<br />
Konzeptvariante das Zünglein an der Waage“,<br />
betonte Scholwin. Erst durch die Gewinne aus dem<br />
Verkauf von Strom und Wärme, die quasi eine Querfinanzierung<br />
der Kraftstoffbereitstellung ermöglichen,<br />
ist rechnerisch die Wirtschaftlichkeit gegeben.<br />
Um diese weiter zu verbessern, könnte im Sommer,<br />
wenn der Wärmebedarf geringer ist, aber die Kraftstoffnachfrage<br />
etwa bei Landmaschinen ansteigt, das BHKW<br />
heruntergefahren und ein Teil des Biogases zu Bio-CNG<br />
oder künftig sogar Bio-LNG aufbereitet werden. „Das<br />
Beispiel Cryo Pur zeigt, dass dafür bald kleine aber dennoch<br />
effizient arbeitende Aggregate auf dem Markt verfügbar<br />
sind“, sieht Scholwin realistische Perspektiven<br />
für die Umsetzung eines solchen Konzepts.<br />
Autor<br />
Dipl.-Journ. Wolfgang Rudolph<br />
Freier Journalist<br />
Rudolph Reportagen – Landwirtschaft,<br />
Umwelt, Erneuerbare Energien<br />
Kirchweg 10 · 04651 Bad Lausick<br />
Tel. 03 43 45/26 90 40<br />
E-Mail: info@rudolph-reportagen.de<br />
www.rudolph-reportagen.de<br />
20
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Aktuelles<br />
10 Jaaa!hre Biogas aus Rüben.<br />
Das Ende der Steinzeit.<br />
Ihre Anlage. Ihre Entscheidung. Ihr Substrat.<br />
FELICIANA KWS RZ#NT#CR#energy<br />
Für noch mehr Energieleistung. Sauber!<br />
CHARLEENA KWS RZ#CR#energy<br />
Die Blattgesunde für Spitzenerträge. Made in Germany!<br />
Ihre passende Sorte und auch die beste Beratung<br />
aus 10 Jaaa!hren Biogas finden Sie unter:<br />
www.energieruebensaatgut.de<br />
Beide Sorten sind auch für die Rinderfütterung geeignet.
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Entleerung der Box einer<br />
Trockenvergärungsanlage.<br />
Die Durchsickerungsfähigkeit<br />
des Prozesshaufens bestimmt<br />
bei diesem Verfahren<br />
maßgeblich die Effizienz der<br />
Biogasproduktion.<br />
Box und Miete bestens kombiniert<br />
Beim Forschungsprojekt FermKomp geht es um das Zusammenspiel von Feststoffvergärung<br />
und nachfolgender Kompostierung mit möglichst geringen Emissionen. Die Ergebnisse<br />
wurden jetzt während eines Workshops vorgestellt.<br />
Von Dipl.-Journ. Wolfgang Rudolph<br />
In den vergangenen Jahren erreichte Deutschland<br />
einen kräftigen Anstieg bei der Erfassung und Verwertung<br />
biologisch abbaubarer Abfälle. Lag die<br />
Menge 2013 noch bei etwa 12 Millionen (Mio.)<br />
Tonnen (t), beträgt sie gegenwärtig fast 13,6 Mio. t.<br />
Ursache dafür sind das Inkrafttreten gesetzlicher Regelungen<br />
wie der Bioabfallverordnung und die Pflicht zur<br />
getrennten Bioabfallsammlung aus Privathaushalten.<br />
Die Bioabfälle werden laut Statistischem Bundesamt<br />
in etwa 900 Kompostierungs- und 337 Vergärungsanlagen*<br />
behandelt.<br />
Zunehmend erfolgt die Verwertung kombiniert. Das<br />
heißt, dem anaeroben Prozess in einer Biogasanlage<br />
schließt sich noch eine aerobe Nachkompostierung der<br />
Gärreste an. Die dabei erzeugten qualitativ hochwertigen<br />
Komposte verbessern die Humusbilanz der Böden<br />
und ersetzen mineralische Düngemittel. Zudem genießen<br />
integrierte Bioabfallvergärungs- und Kompostierungsanlagen<br />
mit ihrer stofflichen und zugleich energetischen<br />
Nutzung von Abfällen eine hohe politische<br />
und gesellschaftliche Akzeptanz.<br />
Ein Problem bei dieser Verwertungsmethode sind jedoch<br />
die freigesetzten Klimagase. Diverse Forschungsvorhaben<br />
zeigten, dass in der Praxis – insbesondere<br />
während der Rotte der Gärprodukte mit natürlicher oder<br />
aktiver Belüftung – zum Teil erhebliche Emissionen<br />
überwiegend von Methan, aber auch von Lachgas und<br />
Ammoniak entstehen. Um hier gegenzusteuern, fanden<br />
sich Wissenschaftler und Praktiker vom Deutschen Biomasseforschungszentrum<br />
(DBFZ), der Großmann Ingenieur<br />
Consult GmbH (GICON) und dem Sachverständigenbüro<br />
Dr. Reinhold & Kollegen im Verbundprojekt<br />
FermKomp zusammen.<br />
Die Ergebnisse des vom Bundesministerium für Wirtschaft<br />
und Energie unterstützten Vorhabens stellten<br />
die Projektteilnehmer bei einem Side-Workshop am<br />
20. November während der 7. Statuskonferenz des<br />
Förderprogramms „Energetische Biomassenutzung“ in<br />
Leipzig vor. Ausgangspunkt der wissenschaftlichen Untersuchungen<br />
bildete die Kombination der zweistufigen<br />
Trocken-Nass-Fermentation (GICON-Verfahren) mit einer<br />
Mietenkompostierung. Im Gegensatz zur Nass- und<br />
Pfropfenstromfermentation von Bioabfällen, bei denen<br />
für eine nachfolgende Behandlung zunächst eine Separation<br />
in feste und flüssige Fraktionen notwendig ist,<br />
sind die Gärreste aus der sogenannten Boxenvergärung<br />
unmittelbar für eine Kompostierung geeignet.<br />
Materialstruktur beeinflusst<br />
biologischen Abbau<br />
„Ziel des Projektes ist, die beiden Verfahrensstufen<br />
optimal aufeinander abzustimmen, um zum einen die<br />
Effizienz der Trockenvergärung zu erhöhen, aber ebenso,<br />
um die Klimagasemissionen während der Nachrotte<br />
zu minimieren“, erläuterte Harald Wedwitschka<br />
vom DBFZ. Eine herausragende Rolle spiele in diesem<br />
Zusammenhang die Materialstruktur der Einsatzstoffe.<br />
Sie müsse während der anaeroben Zersetzung der<br />
leicht abbaubaren organischen Stoffe sowohl eine Perkolation<br />
von Flüssigkeiten ermöglichen als auch die<br />
Durchdringung mit Luft während der aeroben Stufe.<br />
Andernfalls verringere sich der biologische Abbau und<br />
es können vor allem bei der Kompostierung erhebliche<br />
Treibhausgasemissionen entstehen. „Dies führt zu<br />
Druck auf das offene Kompostierungsverfahren bis hin<br />
zu Forderungen nach einer Einhausung und Fassung<br />
22
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Aktuelles<br />
Fotos: Carmen Rudolph<br />
Bei der Mietenkompostierung von Gärprodukten können erhebliche Treibhausgasemissionen<br />
entstehen. Das Forschungsprojekt FermKomp untersuchte, wie<br />
sich dem durch ein optimales Zusammenspiel von Vergärung und Nachrotte<br />
entgegenwirken lässt.<br />
Beim GICON-Verfahren<br />
entsteht der größte Teil<br />
des Biogases nicht in<br />
der Box, sondern beim<br />
Durchströmen des mit<br />
Organik angereicherten<br />
Perkolats durch einen<br />
Hochleistungsreaktor<br />
mit Füllkörpern.<br />
der Abluftströme“, sagte der ebenfalls am DBFZ tätige<br />
Projektleiter Torsten Reinelt. Eine tatsächliche Quantifizierung<br />
der entweichenden Gase, etwa mittels Windtunnelmessungen,<br />
wie dies im Rahmen des Projekts<br />
erfolgte, sei jedoch sehr aufwändig.<br />
Um Handlungsempfehlungen für die Praxis zu entwickeln,<br />
wurde daher der Einsatz einer sogenannten<br />
Substratlanze getestet. Mit seiner selbstabdichtenden<br />
Lanzenspitze ermöglicht das Gerät die Entnahme von<br />
Gasproben in einer definierten Tiefe der Kompostmiete.<br />
Die Substratlanze erwies sich als geeignete Methode<br />
für die Schnelltests zur Gaszusammensetzung in den<br />
Poren des Haufwerks.<br />
Kein Automatismus zwischen Vergärung<br />
und Kompostierung<br />
Beim zweistufigen GICON-Verfahren erfolgt der biologische<br />
Abbau durch Berieselung des Prozesshaufens in der<br />
Box mit Flüssigkeit. Das entstehende Perkolat wird nur<br />
zum Teil im Kreislauf geführt, sodass sich in einem Zwischenspeicher<br />
Organik anreichert. Zur Methanisierung<br />
strömt das angereicherte Perkolat durch einen Hochleistungsreaktor<br />
mit Füllkörpern. Die Trennung der Methanbildung<br />
im Reaktor von der Hydrolyse in der Box (Perkolator)<br />
ermöglicht, dass die Prozesse unter den für die<br />
jeweiligen Mikroorganismen optimalen Bedingungen ablaufen<br />
und sich somit ein deutlich höherer Methangehalt<br />
erzielen lässt. Ein Vorteil des zweiphasigen Verfahrens ist<br />
außerdem die Regelbarkeit der Biogasproduktion.<br />
In welchem Umfang sich Organik aus dem Bioabfall<br />
herauslöst, wird neben Temperatur und pH-Wert insbesondere<br />
von der Durchsickerungsfähigkeit des Prozesshaufens<br />
bestimmt. Diese kann sich im Verlauf der<br />
Berieselung, etwa durch Verdichtung des durchfeuchteten<br />
Materials, verändern. Speiseabfälle neigen eher<br />
zu solch einer Verdichtung als Grünschnitt. „Daher<br />
ist es wichtig, die Zusammensetzung des Substratgemischs<br />
sowie die Eigenschaften der einzelnen Kompo-<br />
23
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
nenten bei Durchfeuchtung durch Tests festzustellen<br />
und die Umlaufmenge des Perkolats entsprechend zu<br />
regulieren“, riet Michael Tietze, Fachbereichsleiter<br />
Forschung Bioenergie bei GICON.<br />
Durchriesele die Flüssigkeit das Haufwerk zu schnell,<br />
bleibe nicht genügend Zeit für die biologischen Umsetzungsprozesse.<br />
Verbleibe das Perkolat zu lange im<br />
Substrat oder komme es sogar zum Anstauen, könne<br />
die organische Last so weit ansteigen, dass Versäuerung<br />
eintrete und die Biologie gehemmt werde. Geeignete<br />
Parameter für die Substratbewertung und eine dementsprechende<br />
Betriebsführung seien die Feuchtrohdichte<br />
(Lagerungsdichte) und die Permeabilität (Durchlässigkeit).<br />
Gegebenenfalls empfehle sich eine Konditionierung<br />
des Bioabfalls vor Einbringung in die Boxen. Bei<br />
den Versuchsreihen während des Projekts FermKomp<br />
habe es sich bewährt, dem in aller Regel stark heterogenen<br />
Bioabfall gezielt Grünschnitt beizumengen<br />
und beides in einem Schredder mit langsamlaufenden<br />
Schneidwerkzeugen zu zerkleinern, was zugleich die<br />
Homogenität des Einsatzmaterials verbessert. „Diese<br />
Maßnahme erhöhte sowohl die Stabilität der Verfahrensführung<br />
als auch die Effizienz des Gesamtprozesses<br />
spürbar“, so Tietzes Fazit. Allerdings habe man<br />
ebenfalls festgestellt, dass die Vorkonditionierung<br />
des Substrats nicht automatisch einen Vorteil für eine<br />
emissionsarme Kompostierung schafft.<br />
Torsten Reinelt (DBFZ),<br />
Projektleiter:<br />
„Emissionsmessungen an offenen Kompostmieten<br />
sind sehr aufwändig. Eine Alternative<br />
sind Schnelltests mit Substratlanzen.“<br />
Dr. Jürgen Reinhold<br />
(Sachverständiger):<br />
„Durch eine angepasste Rotteprozessführung<br />
lassen sich Klimagasemissionen bei der aeroben<br />
Mietenkompostierung stark reduzieren.“<br />
Rotteprozessführung ist Stellschraube für<br />
Emissionen<br />
Durch welche Einstellungen und Verfahrensweisen sich<br />
Klimagasemissionen aus den Rottemieten minimieren<br />
lassen, darüber berichtete Dr. Jürgen Reinhold während<br />
des Workshops. Die zum Teil hohen Emissionen<br />
beim Betrieb von Kompostierungsanlagen resultieren<br />
seiner Ansicht nach meistens aus ungenügender fachlicher<br />
Praxis. Mangelhafte Mietengeometrie, zu wenig<br />
Strukturmaterial und zu lange Umsetzintervalle führten<br />
zu schlechter Belüftung und ungenügender Sauerstoffversorgung.<br />
Aus Untersuchungen sei mittlerweile bekannt, dass die<br />
Methanemission, bedingt durch den Kamineffekt, mit<br />
der Rottetemperatur zunimmt, dass mit dem Wassergehalt<br />
in der Miete die Lachgasemission ansteigt und<br />
dass bei einer hohen Dichte des Rottegutes auch eine<br />
höhere Ammoniakemission zu erwarten ist. „Die Intensivrotte<br />
sollte daher weniger als drei Wochen andauern<br />
und die Rottetemperatur dabei unter 60 Grad Celsius<br />
bleiben“, so Reinhold, der auch Vorstandsmitglied in<br />
der Bundesgütegemeinschaft Kompost ist.<br />
GASSPEICHER FÜR FLEXIBLE STROMPRODUKTION<br />
Umweltfreundliche und effektive Speicherkonzepte für Biogas-, Substrat, Gülle, Si-<br />
Sickerwasser, Rübenmus- und Gärrestelagerung haben bei bei uns eine lange Tradition.<br />
Wir bieten Ihnen individuell angepasste Lösungen für jede Anforderung - - vom runden runden<br />
zum bis zum eckigen eckigen Biogasspeicher bis zu bis 40.000 zu 40.000 m³ Speichervolumen m³ - möglich. - möglich.<br />
bis<br />
Profitieren Sie Sie von von unserer unserer langjährigen langjährigen Erfahrung Erfahrung und und Kompetenz! Kompetenz!<br />
BIO<br />
GAS<br />
SPEICHER<br />
HOCH<br />
SIlO SILO<br />
däCHER DÄCHER<br />
MOBIlE MOBILE<br />
GAS<br />
SPEICHER<br />
Sattler 24<br />
Ceno TOP-TEX GmbH<br />
Am Sattlerstrasse Eggenkamp 1, A-7571 14 | D-48268 Rudersdorf Greven Am Eggenkamp 14, D-48268 biogas@sattler-global.com<br />
Greven<br />
biogas@sattler-global.comwww.sattler-ceno-toptex.com<br />
Telefon: T: +43 3382 +49 733 2571 0 969 0<br />
T: +49 2571 969 0
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Aktuelles<br />
Für eine emissionsarme Mietenkompostierung rät der<br />
Sachverständige zum einen, vor dem Ansetzen der Miete<br />
mit einer Federwaage die Feuchtrohdichte zu ermitteln<br />
und dies bei der Festlegung von Form und Höhe<br />
zu berücksichtigen. Mit zunehmender Feuchtrohdichte<br />
müssten die Mieten also kleiner werden. Bei einer<br />
Feuchtrohdichte von 0,45 bis 0,50 Kilogramm (kg)<br />
Frischmasse (FM) pro Liter (l) kann eine Dreiecksmiete<br />
demzufolge mit einer Höhe von 3,30 Meter angelegt<br />
werden. Bei 0,55 bis 0,60 kg FM/l sollte sie nicht höher<br />
als 2 Meter sein.<br />
Zum anderen empfehle sich eine regelmäßige Kontrolle<br />
des Restgasgehaltes (inerter Luftstickstoff) mit der<br />
Substratlanze als Indikator für die Methanemissionen.<br />
Die Messergebnisse bestimmen dann die weitere Prozessgestaltung<br />
der Rotte. So sollte bei einem in 80<br />
Zentimeter Tiefe gemessenen Restgasgehalt in den<br />
Rottegutporen von 37 bis 50 Volumenprozent ein verstärktes<br />
Umsetzen zur Förderung der Durchlüftung des<br />
Rottegutes erfolgen. Bei einem Restgasgehalt unter 37<br />
Volumenprozent ist beim Umsetzen eine Anpassung<br />
der Mietenhöhe nach den genannten Maßgaben der<br />
Feuchtrohdichte erforderlich.<br />
„Der Emission klimarelevanter Gase lässt sich durch<br />
eine Kontrolle und entsprechende Justierung der aeroben<br />
Rotteprozessführung entgegenwirken. In dieser<br />
Hinsicht ist also durchaus eine Gleichwertigkeit von offener<br />
Mietenkompostierung und eingehausten Anlagen<br />
erreichbar“, schlussfolgerte Reinhold.<br />
*Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes verfügten<br />
im Jahr 2015 in Deutschland insgesamt 1.392 Biogasanlagen<br />
(inklusive kombinierter Kompostierung und Vergärung)<br />
über eine Genehmigung für den Einsatz von organischen<br />
Abfällen. Jedoch arbeiteten im Berichtszeitraum<br />
nur 337 Anlagen, die wirklich Bioabfälle (ausschließlich<br />
Michael Tietze (GICON):<br />
„Für die Effizienz der Boxenvergärung ist es<br />
wichtig, die Umlaufmenge des Perkolats auf<br />
die Substrateigenschaften abzustimmen.“<br />
oder anteilig) einsetzten. Nach einer Erhebung des DBFZ<br />
wurden Ende 2016 in knapp 90 Abfallvergärungsanlagen<br />
Bio- und Grünabfälle aus getrennter Sammlung (Biotonne,<br />
Grünschnittannahme) verarbeitet.<br />
Autor<br />
Dipl.-Journ. Wolfgang Rudolph<br />
Freier Journalist<br />
Rudolph Reportagen – Landwirtschaft,<br />
Umwelt, Erneuerbare Energien<br />
Kirchweg 10 · 04651 Bad Lausick<br />
Tel. 03 43 45/26 90 40<br />
E-Mail: info@rudolph-reportagen.de<br />
www.rudolph-reportagen.de<br />
Harald Wedwitschka (DBFZ):<br />
„Ziel ist, Trockenvergärung und Nachrotte so<br />
zu kombinieren, dass die Effizienz insgesamt<br />
steigt und wenig Emissionen entstehen.“<br />
+++ GE JENBACHER +++ MWM +++ MAN +++ 2G +++ TEDOM +++ SCHNELL +++ DEUTZ +++<br />
BEST % PRICE<br />
%BEST % PRICE<br />
AKTION JAHRESBEVORRATUNG<br />
Jetzt Sonderpreise für Ihre Paketbestellung anfordern<br />
SONDERPREISE SICHERN »<br />
SCHNELL. GÜNSTIG. ZUVERLÄSSIG.<br />
25
BIOGAS Convention 2017<br />
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
12.–14. Dezember 2017, Nürnberg<br />
Seide: „Fossile Energieträger<br />
brauchen ein CO 2<br />
-Preisschild“<br />
Die 27. BIOGAS Convention & Trade Fair zieht eine positive Bilanz. Über 5.000<br />
Teilnehmer besuchten die dreitägige Veranstaltung. Neben der weltgrößten reinen<br />
Biogas-Fachmesse mit 253 Ausstellern nutzten die Besucher der Convention vor<br />
allem das vielfältige Angebot an Vorträgen und Workshops, um sich über die neuesten<br />
Entwicklungen und Potenziale der Branche zu informieren.<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Besonders viel Zuspruch erhielt in diesem<br />
Jahr der Workshop 3: „Techniken zur Aufbereitung<br />
und Vermarktung von Gärprodukten“.<br />
„Wir spüren sehr deutlich, dass<br />
die Systemdienstleistungen der Biogastechnologie<br />
stark an Bedeutung gewinnen. Die Optimierung<br />
der Nährstoffkreisläufe in der Landwirtschaft,<br />
aber auch im Bereich der Verwendung von Bioabfällen<br />
nimmt dabei eine zunehmend wichtigere Rolle ein“,<br />
sagte der Hauptgeschäftsführer des Fachverbandes<br />
Biogas, Dr. Claudius da Costa Gomez, nach der Tagung.<br />
Auch wenn die klassischen Themen wie „EEG“ und<br />
„Ausschreibungen“ nach wie vor von hohem Interesse<br />
für die Betreiber sind, ist der Wandel in der Branche zu<br />
spüren. „Allein über den Stromverkauf lässt sich eine<br />
Biogasanlage in Zukunft nicht mehr betreiben. Die<br />
Themen Kreislaufwirtschaft und Diversifizierung der<br />
landwirtschaftlichen Produktionsprozesse gewinnen<br />
stark an Bedeutung“, betonte der Verbandsvertreter.<br />
„Die Betreiber konzentrieren sich auf Effizienzsteigerung,<br />
Flexibilisierung und das Nährstoffmanagement<br />
durch Gärprodukte“, erklärte da Costa Gomez. „Neue<br />
Anlagen werden unter den gegebenen Rahmenbedingungen<br />
in Deutschland kaum noch gebaut.“ Ohne das<br />
Auslandsgeschäft würde es einige deutsche Firmen<br />
schon nicht mehr geben, ist sich der Verbandsvertreter<br />
sicher. Vor allem Frankreich und Italien stehen im Fo-<br />
26
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Jahrestagung<br />
Fotos: Thomas Geiger<br />
Horst Seide, Präsident des Fachverbandes Biogas e.V.<br />
kus der Unternehmen. Auch Russland und<br />
die Türkei haben im Vergleich zu 2015 an<br />
Bedeutung gewonnen.<br />
Dem insgesamt gestiegenen internationalen<br />
Interesse hat der Fachverband Biogas<br />
mit zahlreichen englischsprachigen Workshops<br />
und Panels Rechnung getragen.<br />
Über den Biogas-Markt auf dem Sub-Kontinent<br />
berichtete der Geschäftsführer des<br />
Indischen Biogas Verbandes IBA, Gaurav<br />
Kedia. Er stellte die Entwicklung und Herausforderungen<br />
in seiner Heimat dar. Zwischen<br />
dem indischen und dem deutschen<br />
Biogasverband besteht seit zwei Jahren<br />
eine Partnerschaft.<br />
Die Firmenvertreter zeigten sich sehr erfreut<br />
über die Qualität der Messegespräche.<br />
Zum Großteil konnten Sie die Zielgruppen<br />
erreichen, die sie mit dem Messeauftritt anvisiert<br />
hatten: Anlagenbetreiber, Landwirte,<br />
und Unternehmer aus der Biogasbranche.<br />
Mehr als 80 Prozent der ausstellenden<br />
Firmen erwarten im Anschluss an die BIO-<br />
GAS Convention ein Nachmessegeschäft.<br />
Insgesamt<br />
bewerteten die befragten<br />
Aussteller die wirtschaftliche<br />
Situation der Branche<br />
besser als 2015. 44 Prozent<br />
erwarten eine steigende oder<br />
stark steigende Tendenz und<br />
30 Prozent gleichbleibende<br />
Verhältnisse.<br />
„Dieses positive Gesamtergebnis<br />
sollte allerdings<br />
nicht über die aktuelle Situation<br />
der Biogasfirmen in<br />
Deutschland hinwegtäuschen“, bemerkte<br />
da Costa Gomez. „Von einer stabilen<br />
Lage sind wir in der Biogasbranche noch<br />
weit entfernt.“ Der Hauptgeschäftsführer<br />
fordert daher mehr politische Stabilität,<br />
verlässliche Rahmenbedingungen und ein<br />
klares Bekenntnis zum Gelingen der Energiewende<br />
– mit Biogas – ein.<br />
Horst Seide, Präsident des Fachverbandes<br />
Biogas e.V., beklagte am Mittwochvormittag<br />
in der Plenumsveranstaltung in seiner<br />
Rede den energiepolitischen Stillstand<br />
in Deutschland. Drei Monate nach der<br />
Bundestagwahl habe Deutschland immer<br />
noch keine neue Regierung. Die zügige<br />
Regierungsbildung sei aber wichtig, damit<br />
drängende energiepolitische Themen bearbeitet<br />
und die energiepolitischen Weichen<br />
in Richtung mehr Klimaschutz gestellt<br />
würden.<br />
Unzufrieden zeigte sich Seide auch mit<br />
dem Ausgang der ersten Ausschreibungs-<br />
27
BIOGAS Convention 2017<br />
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Daniel Hölder, Geschäftsführer<br />
der C.E.T.<br />
Clean Energy Trading<br />
GmbH (CET)<br />
Prof. Dr. Gerald Linke,<br />
Vorstandsvorsitzender<br />
des DVGW e.V.<br />
runde für Biomasseanlagen für eine Anschlussförderung<br />
nach den ersten 20 Jahren EEG-Laufzeit. „Unser<br />
Strom in den Ausschreibungen ist ein anderer Strom als<br />
aus Wind- und Solarenergie. Denn wir haben verlässlichen<br />
Strom. Wir haben eine riesige Biobatterie. Wenn<br />
im Januar oder Februar Wind und Solar wegen der sogenannten<br />
Dunkelflaute nicht liefern, dann können wir<br />
die Biomasse in unseren Silos verstromen. Egal, ob<br />
Stromerzeugung in Regelenergie oder nach Fahrplan –<br />
wir können liefern, bedarfsgerecht“, hob Seide hervor.<br />
Leider werde diese Leistung heute zu schlecht monetär<br />
honoriert. Dann sei es kein Wunder, wenn Anlagenbetreiber<br />
kein Geld verdienten und sie ihre Anlagen künftig<br />
stilllegten. „Es ist eine der größten Sünden dieser Zeit,<br />
alte Kohlekraftwerke im Markt zu halten und Erneuerbare-Energien-Anlagen<br />
aus der Erzeugung zu drängen.<br />
Die Kohlekraftwerke machen uns die Preise kaputt“,<br />
betonte der Verbandspräsident. So langsam dämmere<br />
es auch den größten Skeptikern, dass Deutschland mit<br />
einem solchen energiewirtschaftlichen Dilemma nicht<br />
die Pariser Klimaziele erreicht.<br />
Bei den Sondierungsgesprächen zur Jamaika-Koalition<br />
hätten die Politiker offensichtlich gemerkt, dass es so<br />
nicht weitergeht, dass Kohlekraftwerke abgeschaltet<br />
werden müssen. „Sogar die Forderung der vergangenen<br />
Monate – die anfangs ziemlich weit hergeholt klang –,<br />
fossilen CO 2<br />
-Ausstoß im Strombereich zu besteuern,<br />
wurde in den Sondierungen diskutiert“, verdeutlichte<br />
Seide. Nun sei die Besteuerung nicht mehr fern. Die<br />
nächste Regierung müsse in dem Punkt liefern. Das<br />
habe dann auch Auswirkungen auf den Gebotshöchstpreis<br />
für Biogas in der Ausschreibung.<br />
Wenn weniger Kohlestrom eingespeist werde, dann<br />
steige der Preis für die bedarfsgerechte Stromerzeugung.<br />
Bei der CO 2<br />
-Bepreisung falle auch immer der<br />
Begriff „CO 2<br />
-Vermeidungskosten“. Dabei geht es um<br />
die Kosten, um eine Tonne CO 2<br />
einzusparen. „Uns wird<br />
oft vorgehalten, dass die kleinen 75-kW-Gülleanlagen<br />
eine zu hohe Förderung bekommen. Schauen wir aber<br />
genauer hin, dann stellen wir fest, dass die kleinen Anlagen<br />
diejenigen sind, die die geringsten Vermeidungskosten<br />
haben, weil sie einen negativen CO 2<br />
-Rucksack<br />
Mehr Effizienz in der Rührwerktechnik<br />
Rührwerke für Biogas-Anlagen<br />
Europaweit – seit 1990<br />
Kundenorientierte Entwicklungsprozesse sind die Grundlage für<br />
eine erfolgreiche Zusammenarbeit<br />
www.peters-mixer.com<br />
Maschinenbau Peters GmbH<br />
Euregiostraße 7 | 4700 Eupen<br />
Belgium<br />
Tel.: +32 (0)87 74 44 57<br />
info@peters-mixer.be<br />
Einbau unseres „Methabox Systems“<br />
in Tragluftdächern 28 für<br />
flexible Gasspeicherung<br />
3 Photos from stock.adobe.<br />
com: ghavasi, Franco<br />
Nadalin, Elina Leonova<br />
Unsere Rührwerke sind optimal einsetzbar für anspruchsvolle Substrate<br />
und hohen TS-Gehalt<br />
Hochwertiges Material<br />
für eine sichere Montage
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong> BIOGAS Convention 2017<br />
Präsidium gewählt<br />
Am Dienstag, den 12.12. wählten die Mitglieder des<br />
Fachverbandes die Vertreter für das Präsidium für<br />
die nächsten vier Jahre. Alter und neuer Präsident<br />
ist Horste Seide, Vizepräsident bleibt Hendrik Becker.<br />
Für den ausgeschiedenen Gottfried Gronbach<br />
wurde Christoph Spurk als Vertreter der Planer und<br />
Hersteller neu gewählt.<br />
Das Präsidium von links: Prof. Dr. Kilian Hartmann,<br />
Hendrik Becker, Holger Kübler, Horst Seide, Dr. Sarah<br />
Gehrig, Christoph Spurk und Josef Götz.<br />
vorweisen können“, klärte Seide auf. Darum hofft er,<br />
dass die nächste Bundesregierung im EEG 2017 eine<br />
sogenannte De-minimis-Regelung (Bagatellbeihilfemöglichkeit)<br />
nutzt und die 75-kW-Grenze aufhebt und<br />
stattdessen die Grenze für Gülle vergärende Anlagen<br />
bei 150 kW einzieht. Dann würden mehr landwirtschaftliche<br />
Reststoffe in den Anlagen eingesetzt. In das<br />
100-Tage-Programm der nächsten Bundesregierung<br />
gehöre diese Aufgabe auf jeden Fall hinein.<br />
Neben dem Thema Stromenergiewende ging Seide<br />
auch auf die Wärmewende ein. Er beklagte, dass die<br />
Erneuerbare Wärmewende stagniert und Ölheizungen<br />
gefördert werden. Es gebe jedoch eine Möglichkeit, die<br />
Erneuerbaren im Heizungskeller konkurrenzfähig zu<br />
machen. Aber wie sieht die aus? Seide: „Die fossilen<br />
Energieträger brauchen ein CO 2<br />
-Preisschild!“ Damit<br />
verlören die fossilen Energieträger ihre Wettbewerbsvorteile.<br />
Obwohl die Argumentation der Biogasbranche schlüssig<br />
und nachvollziehbar sei und die politischen Vertreter<br />
ihr weitgehend zustimmten, komme immer die Frage:<br />
Ja, aber der Mais? „Ich entgegne dann: Wir könnten<br />
auch Blumen oder Blühpflanzen vergären und damit<br />
die Biodiversität erhöhen. Es müsste nur entsprechend<br />
gefördert werden. Wir könnten diejenigen sein, die die<br />
Insekten fördern, die Bienen schützen. Biogas kann<br />
mehr sein als Maisanbau sowie Strom- und Wärmeerzeugung“,<br />
erklärte Seide abschließend. Wenn Politik<br />
und Biogasbranche das umsetzen, dann bekommt der<br />
Begriff „Flower Power“ eine ganz andere Bedeutung.<br />
Dass grünen Gasen die Zukunft gehört, davon ist nicht<br />
nur der Fachverband Biogas überzeugt. „Ja, Gas muss<br />
grün werden!“, sagte Prof. Dr. Gerald Linke, Vorstandsvorsitzender<br />
des DVGW e.V. (Deutscher Verein des Gasund<br />
Wasserfaches) während seines Plenum-Vortrages.<br />
Der Slogan „Gas kann grün“ habe das Jahr 2017 geprägt,<br />
insbesondere vor der Bundestagwahl und im<br />
Vorfeld der Jamaika-Sondierungen. „Wir haben alle<br />
ein Interesse daran, dass die nächste Bundesregierung<br />
das Thema Klimaschutz weiter vorantreibt. Dabei spielen<br />
die grünen Gase eine ganz entscheidende Rolle“,<br />
sagte Linke.<br />
Der DVGW arbeite zurzeit an einer Roadmap für erneuerbare<br />
Gase. Vor dem Hintergrund der Klimaziele und der<br />
angestrebten Grenze der Erderwärmung von maximal 2<br />
©<br />
Für Drücke bis 15 mbar!<br />
Über- & Unterdrucksicherung, auch<br />
als SN DRYLOCK SMART© für Ihre<br />
Biogasanlage lieferbar!<br />
Flüssigkeitslos – absolut frostsicher<br />
Wartungsarm – keine tägliche Kontrolle<br />
Stufenlos einstellbare Auslösedrücke – bis 15 mbar<br />
Ultrakompakt – für alle Flansche!<br />
Die wirtschaftlichste Lösung für Ihre Biogasanlage!<br />
SN Energy GmbH // Gustav-Weißkopf-Str. 5 // 27777 Ganderkesee // +49 4222 - 8058060 // info@snenergy.de // www.snenergy.de<br />
29
BIOGAS Convention 2017<br />
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Dr.-Heinz-Schulz-Ehrenmedaille verliehen<br />
In diesem Jahr hat der Fachverband Biogas zwei<br />
herausragende Akteure der Biogasbranche mit der<br />
Dr.-Heinz-Schulz-Ehrenmedaille ausgezeichnet. Einer<br />
der beiden geehrten ist der Schweizer Dr. Arthur<br />
Wellinger. Er gehört von Anfang an zur deutschen<br />
Biogas-Community. Bei den ersten Biogastagungen<br />
und bei der Verbandsgründung war er eine wichtige<br />
Persönlichkeit. Er brachte immer viel Expertise<br />
mit und hat sich weltweit für die Biogasproduktion<br />
eingesetzt. So hat er sich auch besonders für die<br />
Gründung des Europäischen Biogasverbandes<br />
stark gemacht.<br />
Der zweite Geehrte ist sicherlich den meisten in der<br />
Biogasszene bekannt. Seine Name ist ganz wesentlich<br />
mit der deutschen Biogaserfolgsgeschichte<br />
verbunden. Die Medaille erhielt Josef Pellmeyer, der<br />
von 2001 bis 2013 Präsident des Verbandes war und<br />
heute Ehrenpräsident ist. Er bewirtschaftet einen<br />
landwirtschaflichen Betrieb, betreibt zwei Biogasanlagen<br />
– eine davon mit Gaseinspeisung – sowie<br />
ein Kompostwerk. Unter seiner Regie brachte er den<br />
jungen Verband in ruhige Fahrwasser und machte<br />
ihn im Laufe der Jahre zu einem wichtigen Ansprechpartner<br />
der Politik.<br />
Von links: Fachverbandspräsident Horst Seide, der geehrte Dr. Arthur Wellinger und Laudator Harm<br />
Grobrügge, Vizepräsident des Europäischen Biogasverbandes.<br />
Von links: Fachverbandspräsident Horst Seide, der geehrte Josef Pellmeyer und Laudatorin Kerstin<br />
Ikenmeyer vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie, die<br />
die Rede anstelle von Ministerialrat Dr. Rupert Schäfer hielt, der terminlich verhindert war.<br />
Fotos: Thomas Geiger<br />
Grad Celsius stellte der Referent fest, dass<br />
weltweit nur noch 1.000 Gigatonnen CO 2<br />
ausgestoßen werden dürfen. Für Deutschland<br />
ergebe sich daraus ein Budget von 1,1<br />
Prozent oder 10 Gigatonnen. Laute das Ziel<br />
1,7 Grad Celsius, dann dürfe Deutschland<br />
nur noch 5,23 Gigatonnen emittieren, bei<br />
1,5 Grad Celsius sind es nur noch 2,34 bis<br />
2,67 Gigatonnen. Erkenntnis: Das Budget<br />
fällt sozusagen in sich zusammen.<br />
„Die Kohle in der Verstromung und die nicht<br />
vorhandenen CO 2<br />
-Vermeidungsfortschritte<br />
im Verkehrssektor belasten das deutsche<br />
Budget. Deutschland hat sein CO 2<br />
-Budget<br />
praktisch aufgebraucht. Als Gaswirtschaft<br />
wissen wir aber, dass wir den Klimazielen<br />
merklich näher kommen können“, erklärte<br />
Linke. Erreichbar sei dies mit einer Drei-<br />
Punkte-Strategie: 1. Fuel switch, 2. Content<br />
switch und 3. Modal switch.<br />
Fuel switch bedeute, sich von treibhausgasintensiven<br />
Energieträgern wie Kohle<br />
und Öl zu verabschieden und stattdessen<br />
Erdgas einzusetzen. Denn Erdgas sei der<br />
Energieträger mit den geringsten fossilen<br />
CO 2<br />
-Emissionen. „Wenn wir das machen,<br />
dann können wir laut Umweltbundesamt<br />
und Deutschem Brennstoffinstitut bis zu<br />
44 Prozent der CO 2<br />
-Emissionen einsparen.<br />
Dazu sollte zunächst die Braunkohleverstromung<br />
und danach die Steinkohleverbrennung<br />
aufhören“, machte Linke klar.<br />
Spätestens beim sogenannten Content<br />
switch kämen die Erneuerbaren Gase zum<br />
Einsatz. Denn am Ende sei auch Erdgas<br />
ein fossiler Energieträger. Wenn die Emissionen<br />
weiter gesenkt werden sollen, dann<br />
müsse das Emissionsprofil dieses Energieträger<br />
beeinflusst werden. Dazu würden<br />
andere Energieträger benötigt: wie zum<br />
Beispiel Biomethan, Syngas oder Wasserstoff.<br />
Linke: „Hier haben wir nach unseren<br />
Berechnungen ein Potenzial, den Foodprint<br />
von Erdgas bis 2050 um bis zu 50 Prozent<br />
zu senken.“<br />
Im dritten strategischen Punkt, dem Modal<br />
switch, gehe es um die Kopplung von Strom<br />
und Gas. Überschüssiger, fluktuierender erneuerbarer<br />
Strom werde zum gasförmigen<br />
Energieträger und bei Lücken in der Stromversorgung<br />
zur Elektrizitätsbereitstellung<br />
verwendet. Die Kraft-Wärme-Kopplung<br />
(KWK) spiele dabei eine große Rolle. Es sei<br />
bekannt, dass sich die Residuallast durch<br />
KWK zu 80 Prozent decken lasse.<br />
Im mittelschweren und schweren Lastverkehr<br />
gebe es keine bessere Lösung als Gas<br />
30
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
INNOVATIVE Jahrestagung<br />
EINBRINGTECHNIK<br />
FÜR BIOGAS- UND<br />
RECYCLINGANLAGEN<br />
in Form von LNG-Kraftstoff oder Bio-LNG.<br />
„Mit dem Biomassepotenzial Deutschlands<br />
ließe sich Bio-LNG in einem Umfang<br />
produzieren, dass mit der Menge die Hälfte<br />
des deutschen Schwerlasttransportverkehrs<br />
bereits 2030 emissionsfrei gestellt<br />
werden könnte. Die Energiedrehscheibe<br />
Erdgasnetz muss konsequent genutzt werden“,<br />
warb Linke. In der strombasierten<br />
Gasproduktion gewinnt das Erdgasnetz<br />
weiter an Bedeutung. Power-to-Gas (PtG)<br />
ist hier das Schlagwort. Das Deutsche<br />
Brennstoffinstitut bearbeitet diesen Pfad<br />
im Rahmen der Roadmap Erneuerbare<br />
Gase. Projektziel ist laut Linke ein Ausbaupfad<br />
für Wasserstoff und Wasserstoff-<br />
Konzentrationen im Erdgasnetz.<br />
Zum einen werde untersucht, was die<br />
Stromseite benötigt, um Überschussstrom<br />
zu integrieren und daraus Stromgas herzustellen.<br />
Auf der anderen Seite könne aber<br />
auch eine Zielsetzung sein, dass einfach<br />
mehr grünes Gas im Erdgasnetz sein soll.<br />
Aus diesen Ansätzen sollte ein gesamter<br />
PtG-Bedarf bestimmt werden mit makroökonomischen<br />
Kostenansätzen. Die gesamtwirtschaftliche<br />
Sinnhaftigkeit müsse<br />
ermittelt werden. Erste Ergebnisse zeigten:<br />
Soll das Ziel von 80 Prozent Treibhausgasminderung<br />
erreicht werden, dann seien 16<br />
Gigawatt installierte PtG-Leistung notwendig.<br />
Sollen 95 Prozent Minderung erreicht<br />
werden, dann verdoppele sich die PtG-<br />
Leistung fast.<br />
Erdgas werde noch lange im System bleiben,<br />
selbst bei 60 Prozent Treibhausgasminderung<br />
werde Erdgas der dominante<br />
Energieträger sein, weil dann die Verdrängung<br />
gegen Kohle einsetze. Später müsse<br />
Erdgas durch grünes Gas ersetzt werden.<br />
Biomethan aus Biogas werde einen stabilen<br />
Sockel bilden, andere grüne Gase<br />
müssten wesentlich zulegen. Der Gasbedarf<br />
werde von heute über 800 Terawattstunden<br />
(TWh) auf etwa 480 TWh sinken.<br />
Der DVGW will die 10-Prozent-Wasserstoffgrenze<br />
im Erdgasnetz aufheben. Er<br />
hält 25 Prozent Wasserstoff im Erdgasnetz<br />
für machbar. Alternativ könnte Wasserstoff<br />
auch methanisiert werden, um einen bekannten<br />
Energieträger zu bekommen. Der<br />
DVGW hat dem Bundeswirtschaftsministerium<br />
Anfang Dezember vergangenen Jahres<br />
ein Förderprogramm vorgeschlagen,<br />
„mit einem Volumen von 1,1 Milliarden<br />
Euro“, gab Linke bekannt. Damit sollen<br />
NEU!<br />
Jetzt auch als BIG-Mix Globe!<br />
Der BIG-Mix im ISO Seecontainer<br />
für den weltweiten Einsatz.<br />
BIG-Mix 35 bis 210m³<br />
effektiver Vorschub bei niedrigem<br />
Eigenstromverbrauch<br />
für 100% Mist und Grassilage<br />
mit Misch- und Aufbereitungsbereich<br />
komplett aus Edelstahl<br />
Biomischer 12 bis 80m³<br />
für 100% Mist und Grassilage<br />
massive Edelstahlkonstruktion<br />
mit Misch- und Aufbereitungsbereich<br />
auf Wunsch komplett aus Edelstahl<br />
Von links: Dr. Claudius da Costa Gomez, Reiner Gansloser und Horst Seide im Gespräch während der<br />
Mitgliederversammlung, als Stimmzettel ausgezählt wurden. Da der Fachverband Biogas in diesem Jahr sein<br />
25-jähriges Bestehen feiert, befragte da Costa Gomez Gansloser und Seide zu den Anfängen ihrer Biogasaktivitäten.<br />
Gansloser, einer der Mitbegründer des Verbandes, erinnerte sich, dass sich eine kleine Gruppe von<br />
Akteuren immer bei Erich Holz auf dem Demeter-Betrieb, dem Karlshof in Aspach bei Backnang in Württemberg,<br />
traf. Dort wurde auch eine Biogasanlage von Aktivisten der Biogas-Bundschuh-Gruppe in Eigenregie<br />
gebaut. Er selber sei auch Demeter-Landwirt. „Die Ökolandwirte waren diejenigen, die begannen, sich mit der<br />
Biogasthematik auseinanderzusetzen“, reklamiert Gansloser. Auch Seide erinnert sich noch gut an die ersten<br />
Treffen zum Wissensaustausch in Weckelweiler. Das sei damals schon eine ziemlich bunte Truppe gewesen.<br />
Schließlich haben unter anderem auch die Kontakte zu den süddeutschen Biogas-Fans Seide später dazu<br />
gebracht, selbst in die Biogasproduktion einzusteigen.<br />
31<br />
KOMBI-Mix 8 und 12m³<br />
speziell für Kleinbiogasanlagen<br />
optional mit Vertikalmischschnecke<br />
für unterschiedlichste Substrate<br />
komplett aus Edelstahl<br />
Konrad Pumpe GmbH<br />
Fon +49 2526 93290<br />
Mail info@pumpegmbh.de<br />
www.pumpegmbh.de
BIOGAS Convention 2017<br />
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Franz Kustner, links, und Josef Götz, Präsidiumsmitglied des Fachverbandes Biogas e.V. Götz<br />
dankte Kustner während der Tagung im Namen des Fachverbandes Biogas für dessen hohes<br />
Engagement in der Politik sowie im Bayrischen Bauernverband für die Bioenergienutzung.<br />
Kustner war viele Jahre Vorsitzender des Landesfachausschusses Erneuerbare Energien im<br />
Bayrischen Bauernverband sowie Vorsitzender des Kreisbauernverbandes.<br />
PtG-Anlagen über einen Zeitraum von 10 Jahren mit<br />
einer jährlich installierten Leistung von 150 Megawatt<br />
aufgebaut werden.<br />
Während einige Energiewirtschaftsexperten Erneuerbare<br />
Gase in mittlerer Zukunft aufstreben sehen, werfen<br />
andere den Blick auf die nahe Zukunft und erkennen<br />
Einkommens-Chancen für die direkte Biogasverstromung.<br />
Daniel Hölder von der C.E.T. Clean Energy Trading<br />
GmbH – vormals Clean Energy Sourcing –, eine<br />
100-prozentige Tochtergesellschaft der BayWar.e. renewable<br />
energy GmbH, sagte: „Für die Masse der Biogasanlagen<br />
ist die Stromproduktion heute und in naher Zukunft<br />
das zentrale Thema. Und dabei geht es vor allem<br />
um Flexibilität in der Stromproduktion durch Biogas.“<br />
Die Preise für Wind- und Solarstrom seien in den vergangenen<br />
Ausschreibungsrunden stark gefallen. Das<br />
seien die geringsten Erzeugerpreise für Neuanlagen im<br />
Strommarkt. Wind und PV seien die „Arbeitspferde“<br />
der Strombereitstellung. Angesichts dieses Preisgefüges<br />
müssten Anlagenbetreiber und Direktvermarkter<br />
schauen, wo Platz ist für die Stromproduktion mit Biogasanlagen.<br />
Er machte deutlich, dass die Zukunft der<br />
Biogasverstromung in den Angebotstälern der Windund<br />
Solarstromerzeugung liege.<br />
Flexibilität heiße, sowohl Regelenergiemärkte als auch<br />
kurzfristige Strommärkte zu erschließen. Bei Letzteren<br />
gehe es um den eigentlichen Ausgleich zwischen Bedarf<br />
und Erzeugung. Die Frage ist nun, was der Strom<br />
im Kurzfristmarkt wert ist. „Der kurzfristige Stromhandel<br />
findet innerhalb Europas ganz wesentlich in<br />
Deutschland statt, weil der Markt hier am stärksten<br />
liberalisiert ist. Wir können heute Preissteigerungen<br />
im Day-Ahead-Markt und im Intraday-Handel sehen“,<br />
führte Hölder aus.<br />
Als Beispiel nannte er den Januar 2017, als kaum<br />
Wind- und Solarenergie ins Stromnetz eingespeist worden<br />
sind und zudem in Frankreich mehrere Atomkraftwerke<br />
vom Netz abgekoppelt waren. Die Situation habe<br />
zu steigenden Strompreisen im Kurzfristmarkt geführt.<br />
Hölder geht davon aus, dass solche Preissituationen<br />
ab 2020 viel häufiger auftreten. Er begründete dies<br />
damit, dass in Deutschland bis Ende 2019 5 Gigawatt<br />
Leistung durch Abschalten von Kohlekraftwerken aus<br />
dem Markt gehen. Gleichzeitig würden etwa 8 bis 10<br />
Gigawatt Leistung durch Wind- und PV-Anlagen in Betrieb<br />
genommen.<br />
„Der Januar 2017 ist ein Beispiel für die Strompreisentwicklung<br />
im Kurzfristmarkt in der nahen Zukunft<br />
und nicht erst in 15 oder 20 Jahren. Ab 2020 können<br />
wir solche Preissprünge als Alltag erwarten. Darin liegt<br />
BIOGASANALYSE<br />
GASANALYSENTECHNIK<br />
BIOGASANALYSENTECHNIK<br />
WASSERANALYSENTECHNIK<br />
AGRARMESSTECHNIK<br />
PRONOVA Analysentechnik GmbH&Co.KG<br />
Groninger Straße 25 I 13347 Berlin<br />
Tel +49 (0)30 455085-0 – Fax -90<br />
info@pronova.de I www.pronova.de<br />
FOS/TAC 2000<br />
automatischer Titrator zur Bestimmung<br />
von FOS, TAC und FOS/TAC<br />
SSM 6000 ECO<br />
SSM 6000<br />
der Klassiker für die Analyse<br />
von CH 4<br />
, H 2<br />
S, CO 2<br />
, H 2<br />
und O 2<br />
mit<br />
und ohne Gasaufbereitung<br />
mit proCAL für SSM 6000,<br />
die vollautomatische,<br />
prüfgaslose Kalibrierung<br />
32<br />
www.pronova.de
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
BIOGAS Convention 2017<br />
für Biogasanlagen eine große Chance“, blickte Hölder<br />
voraus. Der Kurzfristmarkt sei nicht so ein endlicher<br />
Markt wie der Regelenergiemarkt. Für Biogasanlagen<br />
sei es wichtig, heute zu flexibilisieren – und zwar so,<br />
dass sie in allen Strommärkten parallel unterwegs sein<br />
können.<br />
Mit den in den Jahren 2000 bis 2002 gebauten Anlagen<br />
fielen demnächst nach dem Ende der ersten Vergütungsperiode<br />
rund 500 MW aus dem ersten EEG. Das<br />
EEG 2017 mit seiner Systematik böte genug Volumen<br />
für eine doppelte Überbauung der installierten Leistung<br />
dieser Anlagen. Damit hätten diese Anlagenjahrgänge<br />
später gute Aussichten, in der richtigen Flexibilisierung<br />
Geld zu verdienen.<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Redakteur Biogas Journal<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Tel. 0 54 09/90 69 426<br />
E-Mail: martin.bensmann@biogas.org<br />
Den Mitgliederservice<br />
live erleben konnten die<br />
Tagungsteilnehmer am<br />
zweiten Tag<br />
Dosiertechnik vom Marktführer<br />
Wirtschaftlich | Zuverlässig | Sicher<br />
Rondomat<br />
PolyPro + Rondomat<br />
PolyPro + Multimix<br />
Für alle Substrate von 5 – 246 m 3<br />
Fliegl Agrartechnik GmbH | D-84453 Mühldorf | Telefon: +49 (0) 8631 307-0 | biogas@fliegl.com<br />
33
Politik<br />
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Neuer Schwung im weltweiten Klimaschutz<br />
Rund zwei Jahre ist es nun her, dass die Weltgemeinschaft sich in Paris auf ein zu Recht als historisch<br />
bezeichnetes Klimaabkommen einigte. Vor gut einem Jahr erhielt diese Aufbruchstimmung allerdings mit<br />
der Wahl Trumps zum Präsidenten und einer damit beginnenden klimapolitischen Geisterfahrt der US-<br />
Regierung einen empfindlichen Dämpfer. Doch der Klimagipfel im November in Bonn und der One Planet<br />
Summit gut drei Wochen später in Paris haben deutlich gezeigt: Die Weltgemeinschaft geht zwar noch<br />
längst nicht im notwendigen Tempo voran, aber der Wille und das Engagement für eine konsequentere<br />
Umsetzung des Pariser Klimaabkommens wächst. Vielerorts entsteht sogar neuer Schwung.<br />
Von Stefan Küper<br />
In Bonn und insbesondere in Paris ist<br />
sehr klar geworden, wie wichtig das<br />
Zusammenspiel zwischen der Politik<br />
und ihren Rahmensetzungen einerseits<br />
und dem Verhalten von Wirtschaft und<br />
Investoren andererseits ist. Auf politischer<br />
Ebene geht es etwa um ambitionierte sowie<br />
verbindliche Klimaschutzziele für die<br />
Jahre 2030 und 2040, über die bis 2050<br />
Treibhausgasneutralität (Netto-Null-Emissionen)<br />
erreicht werden muss.<br />
Und es geht um die Bereitschaft, endlich<br />
einen tatsächlich relevanten CO 2<br />
-Preis einzuführen,<br />
der Investitionen in fossillastige<br />
Geschäftsfelder unrentabel macht. Der<br />
Kinder demonstrieren während der Bonner Klimakonferenz gegen den Klimawandel.<br />
Foto: Vario Images<br />
Über Germanwatch e.V.<br />
Die Umwelt- und Entwicklungsorganisation engagiert<br />
sich seit 1991 für globale Gerechtigkeit<br />
und den Erhalt der Lebensgrundlagen. Im Fokus<br />
der Arbeit der gemeinnützigen Organisation<br />
stehen die Politik und Wirtschaft des globalen<br />
Nordens mit ihren weltweiten Auswirkungen.<br />
Germanwatch engagiert sich insbesondere in<br />
den Bereichen Klimapolitik und -finanzierung,<br />
Unternehmensverantwortung, Landnutzung,<br />
Welternährung und Handel sowie Bildung für<br />
nachhaltige Entwicklung.<br />
Seit vielen Jahren sind Expertinnen und Experten<br />
der Organisation kritische Beobachter der UN-<br />
Klimaverhandlungen. Aber auch in der deutschen<br />
und europäischen Klimapolitik mischt sich Germanwatch<br />
immer wieder mit Initiativen und Studien<br />
ein. Germanwatch finanziert sich unter anderem<br />
über Beiträge seiner Mitglieder und Spenden:<br />
https://www.germanwatch.org<br />
Twitter: @Germanwatch<br />
europäische Emissionshandel hat dieses<br />
Ziel bisher nicht erreicht. Wenn eine entsprechende<br />
Reform des Emissionshandels<br />
<strong>2018</strong> nicht gelingt, müssen CO 2<br />
-Mindestpreise<br />
– wie es sie zum Beispiel in Großbritannien<br />
bereits gibt – eingeführt werden.<br />
Der französische Präsident Macron hat in<br />
Paris Deutschland die Hand gereicht, um<br />
eine solche Initiative in Europa und in der<br />
G20 voranzubringen.<br />
Dies hätte direkte Auswirkungen auf die<br />
Wirtschaft: Es würde den Unternehmen,<br />
Investoren, Banken und Versicherungen<br />
erlauben, ihre Geschäfte viel konsequenter<br />
als bisher an den Zielen des Paris-Abkommens<br />
auszurichten. Wenn es zudem einen<br />
„Klima-Stresstest“ für Unternehmen gäbe,<br />
der prüfen würde, ob und wie sie auf diese<br />
Herausforderungen eingestellt sind, dann<br />
könnte der Finanzmarkt endlich auch eine<br />
positive Hebelwirkung entfalten. Vorreiter<br />
wie etwa der weltgrößte Versicherer AXA<br />
zeigen, wie das aussehen könnte: Axa kündigte<br />
in Paris an, keine neuen Kohle- und<br />
Teersandprojekte mehr zu versichern sowie<br />
seine Investitionen in Erneuerbare Energien<br />
zu verfünffachen. Auch die Weltbank<br />
wird ab 2019 keine Öl- und Gasförderungen<br />
mehr finanzieren.<br />
Vor dem Pariser „Finanzierungsgipfel“<br />
im November war Bonn knapp zwei Wochen<br />
lang Welt-Klimahauptstadt. Mehr als<br />
25.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer,<br />
viele Staatsgäste, viele hundert Vertreter<br />
von Medien und Zivilgesellschaft – es war<br />
eine Konferenz der Superlative. Und das<br />
zum ersten Mal unter der Präsidentschaft<br />
eines vom Klimawandel besonders bedrohten<br />
Inselstaates: Fidschi. Gemessen an<br />
diesem Rahmen erscheinen die Ergebnisse<br />
auf den ersten Blick als weniger bedeutend.<br />
Auf den zweiten Blick muss man aber<br />
feststellen, dass im eigentlichen Arbeitsprogramm<br />
immerhin das erreicht wurde,<br />
was erreicht werden sollte – wenn auch mit<br />
Schwachpunkten.<br />
Und mindestens ebenso wichtig waren die<br />
politischen Signale, die Bonn gesendet<br />
hat: Die internationale Gemeinschaft – mit<br />
der bemerkenswerten Ausnahme der US-<br />
34
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Politik<br />
Regierung – steht geschlossen zum Pariser Klimaabkommen.<br />
Es geht darum, einen gefährlichen Klimawandel<br />
zu vermeiden und die Erwärmung auf deutlich<br />
unter 2 Grad – möglichst 1,5 Grad – zu begrenzen, die<br />
von der globalen Klimakrise betroffenen Menschen zu<br />
unterstützen und die Finanzströme dementsprechend<br />
umzulenken. Die Weltgemeinschaft hat diese Richtung<br />
eingeschlagen, ist allerdings bisher noch viel zu langsam<br />
auf dem Weg.<br />
Klimaschutz: Trump ist nicht die USA<br />
Unzählige Kommunen, Regionen und Unternehmen<br />
zeigten in vielen Veranstaltungen auf, was sie bereits<br />
für den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel<br />
tun. Insbesondere Vertreter aus den USA<br />
machten so auch deutlich, dass heute mehr Amerikanerinnen<br />
und Amerikaner denn je für ernsthaften Klimaschutz<br />
sind und ihr Präsident in dieser Frage nicht<br />
für sie spricht. Wie brachte es Arnold Schwarzenegger<br />
später beim Gipfel in Paris auf den Punkt? Nicht die<br />
USA stiegen aus dem Pariser Abkommen aus, es sei nur<br />
Donald Trump, der aussteige.<br />
Eine breite Koalition aus US-Bundesstaaten, Städten<br />
und Unternehmen hat unter dem Slogan „We are still<br />
in“ sogar Pläne vorgelegt, wie sie das amerikanische<br />
Klimaziel auch ohne Maßnahmen auf der Bundesebene<br />
einhalten wollen. Und sie kann erste Erfolge vorweisen:<br />
Trotz Trump hat sich der Ausstieg aus der Kohle in den<br />
USA zuletzt beschleunigt, nicht verlangsamt.<br />
Beachtlich war denn auch die in Bonn vorgestellte und<br />
wenig später in Paris bereits erweiterte Vorreiter-Allianz<br />
zum Kohleausstieg von rund 30 Ländern und Regionen<br />
sowie vielen Konzernen. Und nicht zuletzt überraschten<br />
mehr als 50 große und mittelständische Unternehmen<br />
sowie Branchenverbände aus Deutschland,<br />
darunter sechs DAX-30-Konzerne, mit der Forderung<br />
an die nächste Bundesregierung, eine überzeugende<br />
Umsetzungsstrategie für den Klimaschutzplan 2050<br />
als Modernisierungsprogramm für Deutschland vorzulegen.<br />
All dies waren wichtige Signale, die weltweit die<br />
Dynamik zu mehr Klimaschutz befördern.<br />
„Regelbuch“ mit Kontrollfunktion<br />
soll kommen<br />
Im konkreten Arbeitsprogramm der Bonner Konferenz<br />
ging es darum, wichtige Beschlüsse beim Klimagipfel<br />
Ende <strong>2018</strong> vorzubereiten. Dort soll nämlich ein „Regelbuch“<br />
zur Umsetzung des Pariser Abkommens verabschiedet<br />
werden. Dieses muss zum Beispiel sicherstellen,<br />
dass die Klimaschutz- und Finanzzusagen aller<br />
Staaten überprüfbar und vergleichbar sind. Zudem<br />
musste die Grundlage für eine regelmäßige Erhöhung<br />
dieser Zusagen gelegt werden. Denn derzeit würde die<br />
Umsetzung aller angekündigten nationalen Klimaschutzziele<br />
die Erderwärmung auf bestenfalls 3 Grad<br />
begrenzen – noch deutlich zu viel zur Abwendung eines<br />
hochgefährlichen Klimawandels. Dazu gab es in der<br />
Foto: fotofinder/ © Lauter/teamwork<br />
Premierminister Frank Bainimarama (Fidschi) spricht bei der Eröffnung des US Climate<br />
Centers während der UN-Klimakonferenz (United Nations Framework Convention on Climate<br />
Change, 23nd Conference of the Parties, kurz COP 23) in Bonn. Unter dem Motto „Americas<br />
Pledge – We are still in“ bekräftigen US-amerikanische Politiker und Firmen ihr Festhalten<br />
an den Zielen des Paris Agreement.<br />
letzten Nacht der Klimakonferenz einen Durchbruch:<br />
Von <strong>2018</strong> bis 2020 wird es die erste Nachbesserungsrunde<br />
für diese Klimaziele geben.<br />
Enttäuschend hingegen verliefen die Verhandlungen<br />
zur Unterstützung der Menschen in armen Ländern, die<br />
schon heute von den Folgen des Klimawandels durch<br />
Wetterextreme oder steigenden Meeresspiegel besonders<br />
betroffen sind. Fortschritte gab es zwar bei einigen technischen<br />
Fragen, doch noch immer fehlt die Bereitschaft,<br />
ausreichend Gelder dafür zu mobilisieren. Da sind gerade<br />
reiche Industrienationen wie Deutschland gefragt.<br />
Was den Klimaschutz zu Hause angeht, droht der einstige<br />
Vorreiter Deutschland zurückzufallen. Die CO 2<br />
-<br />
Emissionen sind seit 2009 nicht mehr gesunken. Das<br />
Klimaziel für 2020 – 40 Prozent Emissionsminderung<br />
im Vergleich zu 1990 – droht krachend verfehlt zu werden<br />
und auch zum dringend notwendigen Kohleausstieg<br />
gibt es noch keine Entscheidung.<br />
Der Germanwatch-Vorsitzende Klaus Milke resümierte:<br />
„Für die politische Glaubwürdigkeit Deutschlands brauchen<br />
wir einen Fahrplan zum sozialverträglichen Kohleausstieg<br />
– beginnend mit der Abschaltung der älteren<br />
Hälfte der Kohlekraftwerke bis 2020 – sowie eine Wende<br />
in der Verkehrs- und Landwirtschaftspolitik.“ Kanzlerin<br />
Merkel habe sich auch bei der Klimakonferenz in Bonn<br />
erneut zu den Klimazielen 2020 und 2030 bekannt.<br />
„Den Worten müssen Taten folgen. Vor allem die gegenüber<br />
dem Klimawandel verletzlichsten Staaten erwarten<br />
die Einlösung dieses Versprechens.“<br />
Autor<br />
Stefan Küper<br />
Pressesprecher<br />
Germanwatch e.V.<br />
Dr. Werner-Schuster-Haus<br />
Kaiserstr. 201 · 53113 Bonn<br />
Tel. 02 28/6 04 92-23<br />
E-Mail: kueper@germanwatch.org<br />
35
Politik<br />
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Transformationstechnologien<br />
gewinnen an Bedeutung<br />
Die Energiewende ist ein faszinierendes Großprojekt mit einem entscheidenden Vorteil: Sie verbindet<br />
Klimaschutz mit Wirtschaftswachstum. Damit ist sie für alle Interessengruppen hoch interessant. Nun<br />
gilt es, die begonnene Modernisierung der Energiewirtschaft engagiert und erfolgreich fortzuführen.<br />
Von Dr. Peter Röttgen<br />
Damit die Vorteile stärker wirksam<br />
werden, muss der Ausbau<br />
der Erneuerbaren Energien<br />
erhöht, die Kohleverstromung<br />
beendet und das Energieversorgungssystem<br />
flexibilisiert werden. Entscheidend<br />
ist dabei, die Sektoren besser<br />
miteinander zu vernetzen sowie Energieerzeugung<br />
und Energieverbrauch besser aufeinander<br />
abzustimmen. Die neue Bundesregierung<br />
muss zügig die Weichen stellen,<br />
um die Energieversorgung auf die Zukunft<br />
auszurichten und effektiven Klimaschutz<br />
zu gewährleisten.<br />
Es ist nicht zielführend, noch länger voneinander<br />
isoliert organisierte Welten für<br />
Strom, Gas und Wärme zu haben. Über<br />
die Sektorenkopplung können die Wege<br />
optimiert werden, sodass Energie den<br />
technisch und ökonomisch optimalen<br />
Weg zum Verbrauch nimmt. Das gilt für<br />
industrielle Prozesse ebenso wie für den<br />
Verbrauch in Haushalten, in der Wärmeversorgung<br />
oder in der Mobilität. Heute<br />
stehen dem noch zahlreiche formale Barrieren<br />
gegenüber, sodass beispielsweise<br />
eine Nutzung von Erneuerbarem Strom im<br />
Fernwärmebereich oder die Umwandlung<br />
in Wasserstoff, der beispielsweise die Effizienz<br />
von Biogasanlagen steigern kann,<br />
wirtschaftlich noch nicht hinreichend attraktiv<br />
ist.<br />
Gegenwärtig verhindert vor allem das System<br />
aus Abgaben und Umlagen, dass Erneuerbare<br />
Energie in dem Umfang genutzt<br />
wird, wie es möglich wäre. Stattdessen gibt<br />
es die Kostenproblematik von Einspeisemanagement<br />
und Redispatch, die zu minimieren<br />
ist. So werden etwa die technischen<br />
Potenziale in der Speicherung, sei es über<br />
Batterien als Kurzzeitspeicher, Langzeitspeicher<br />
oder über die vorhandene Gasinfrastruktur,<br />
eingeschränkt.<br />
Zeitliche und örtliche<br />
Umwandlung sowie Speicherung<br />
Würden Speicher als neue vierte Säule des<br />
Energiesystems neben Erzeugung, Transport<br />
und Verbrauch eingeordnet, könnte<br />
dies maßgeblich dazu beitragen, dass sie<br />
mehr und ökonomisch sinnvoller als Flexibilitätsoption<br />
eingesetzt werden. Denn das<br />
heutige System kennt sie eigentlich nicht<br />
und belastet sie deshalb zumeist als Letztverbraucher<br />
wie einen Konsumenten. Je<br />
mehr Erneuerbare Energie im System ist,<br />
desto wichtiger wird dieses Anliegen – vor<br />
allem bei steigenden Energieanteilen aus<br />
volatilen Quellen.<br />
Das moderne Energiesystem sollte deshalb<br />
Transport nicht nur als örtliche Komponente<br />
kennen, sondern auch als zeitliche, also<br />
nicht nur Transport von A nach B, sondern<br />
auch von jetzt nach später. Darüber hinaus<br />
ist aber auch die Einengung auf den Begriff<br />
Speicherung nicht hilfreich, wenn man bedenkt,<br />
dass es vielfach auch allein um die<br />
Umwandlungen in andere energetische<br />
Nutzungsformen wie Strom in Wärme geht,<br />
weshalb der Begriff Transformationstechnologien<br />
wohl an Bedeutung gewinnen wird.<br />
Strom ist sicher wichtig, aber eine sogenannte<br />
„all electric-world“ ist technologisch<br />
unrealistisch, allein wenn wir bedenken,<br />
um wieviel Energie es geht, und wir<br />
uns die Frage stellen, mit welcher Speichertechnologie<br />
der saisonale Ausgleich<br />
bei großem Anteil Erneuerbarer Energie<br />
erfolgen soll. Die Bedeutung von Gas wird<br />
dabei häufig unterschätzt, wobei hier die<br />
Technologien sowohl zur Speicherung als<br />
auch zur Stromerzeugung längst in großem<br />
Umfang vorhanden sind. Wenn jedoch die<br />
vorhandene Gasinfrastruktur genutzt wird,<br />
ist wesentlich, dass Erdgas zunehmend<br />
und maßgeblich durch Erneuerbare Gase<br />
substituiert wird. Die Versorgungssicherheit<br />
kann dabei in jedem Fall schon heute<br />
gewährleistet werden und Biogas spielt dabei<br />
eine wichtige Rolle.<br />
Ausbaudeckel müssen weg –<br />
CO 2<br />
-Bepreisung muss kommen<br />
Für einen wirklich effektiven Klimaschutz<br />
wird schnell mehr Erneuerbare Energie<br />
benötigt. Deshalb muss die Deckelung des<br />
Ausbaus aufgehoben werden. Es ergibt keinen<br />
Sinn, einerseits von den Erneuerbaren<br />
Energien mehr Markt zu fordern und ihnen<br />
zugleich einen Riegel vorzuschieben.<br />
Welche Geschäftsmodelle sollen sich entwickeln,<br />
wenn sie von vornherein limitiert<br />
sind? Wenn also Markt, dann für alle und<br />
mit fairen Rahmenbedingungen, die insbesondere<br />
den Charakter der Emissionsfreiheit<br />
auch honorieren. Eine CO 2<br />
-Bepreisung<br />
ist hier der richtige Hebel. Sie ist ein marktkonformer<br />
Ansatz, der saubere Energieerzeugung<br />
finanziell honoriert.<br />
Mit dem europäischen Emissionshandel<br />
alleine kann Deutschland seine Klimaschutzziele<br />
nicht erreichen. Berechnungen<br />
des BEE zeigen, dass auch im Zeitraum<br />
2021 bis 2030 nicht die notwendige Emissionsreduzierung<br />
erreicht wird. Ein europäischer<br />
Mindestpreis von 20 Euro pro Tonne<br />
alleine würde ebenso nicht ausreichen, die<br />
nationalen Klimaschutzziele zu erreichen,<br />
weshalb die Kopplung mit einer nationalen<br />
CO 2<br />
-Steuer notwendig ist.<br />
In einer aktuellen Studie hat der BEE herausgearbeitet,<br />
dass im Stromsektor eine<br />
nationale CO 2<br />
-Bepreisung in Höhe von lediglich<br />
20 Euro je Tonne ausreichen würde,<br />
um die nationalen Klimaschutzziele<br />
zu erreichen. In Kombination mit einem<br />
europäischen Mindestpreis können Emissionsverlagerungen<br />
ins Ausland und ebenso<br />
Stromimporte nach Deutschland weitgehend<br />
vermieden werden. Der Strompreis<br />
36
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Politik<br />
Windstrom wird zu grünem Gas<br />
bleibt stabil, wenn im Gegenzug die<br />
Stromsteuer stark abgesenkt wird, wie<br />
das der BEE seit langem fordert. Darüber<br />
hinaus steigt der Marktwert Erneuerbarer<br />
Energie an der Börse, die EEG-<br />
Umlage sinkt, Stromkunden können<br />
spürbar entlastet werden.<br />
CO 2<br />
-Preisschild für fossile<br />
Brennstoffe im Wärmebereich<br />
Ähnlich verhält es sich im Wärmebereich.<br />
Bislang gibt es im Wärmemarkt<br />
nicht die richtigen Anreize, moderne<br />
Technologien und Erneuerbare Energie<br />
einzusetzen, da die Kosten für<br />
eine Entsorgung der Emissionen in der<br />
Atmosphäre nach wie vor nicht beim<br />
Anlagenbetrieb anfallen, sondern stillschweigend<br />
vergesellschaftet werden.<br />
Die CO 2<br />
-Bepreisung soll eine klimafreundliche Wärmeversorgung<br />
auf Basis Erneuerbarer Energien belohnen,<br />
die damit verbundenen Steuereinnahmen jedoch rückvergütet<br />
werden. Das bedeutet: Wer Emissionen spart,<br />
verbessert sich wirtschaftlich; wer mehr emittiert, muss<br />
mehr bezahlen. Dabei muss der Gesetzgeber darauf<br />
achten, dass die Rückverteilung gerecht ist, besonders<br />
mit Blick auf einkommensschwächere Haushalte.<br />
Beispielsweise in der Schweiz wurde bereits vor Jahren<br />
eine CO 2<br />
-Bepreisung in Form einer Abgabe mit<br />
einem Rückerstattungsmodell erfolgreich eingeführt.<br />
In Deutschland würde eine Energiesteuer mit CO 2<br />
-Gewichtung<br />
schon bei relativ geringem CO 2<br />
-Preis von 25<br />
Euro je Tonne Kohlendioxid eine Lenkungswirkung und<br />
Vorzieheffekte zugunsten klimafreundlicherer Energieträger<br />
bewirken. Ergänzend steht es der Politik offen,<br />
mit weiteren sozialpolitischen Maßnahmen das Rückverteilungsmodell<br />
zu modifizieren.<br />
Laufzeitbudget für Kohlekraftwerke<br />
Es gibt auch Widerstände gegen marktwirtschaftliche<br />
Lösungsansätze wie die CO 2<br />
-Bepreisung, wobei es an<br />
alternativen Vorschlägen mangelt. Zudem erscheint<br />
eine Kombination mit ordnungsrechtlichen Ansätzen<br />
nötig, um die Pariser Klimaschutzziele – und damit die<br />
Begrenzung der Erderwärmung auf deutlich unter 2<br />
Grad – tatsächlich einzuhalten. Dies betrifft insbesondere<br />
den Kohleausstieg. Denn grundsätzlich sind auch<br />
hier zumindest marktorientierte Lösungen denkbar, die<br />
auch die Versorgungssicherheit gewährleisten. Dafür<br />
bietet sich ein Modell an, bei dem den Kohlekraftwerken<br />
ein jährliches Budget an Volllaststunden der jährlichen<br />
Stromerzeugung zugewiesen wird. Diese wären<br />
dann noch am Netz, würden aber nicht mehr durchgängig<br />
Strom erzeugen.<br />
Dies hätte eine Reihe von Vorteilen: Die Klimaschutzziele<br />
könnten passgenau erreicht werden. Die Versorgungssicherheit<br />
wäre sichergestellt, da die (meisten)<br />
Kraftwerke weiterhin in Zeiten hohen Stromverbrauchs,<br />
wie etwa in Kältephasen oder bei niedriger Wind- und<br />
Solarstromerzeugung, zur Verfügung stünden beziehungsweise<br />
von den Betreibern bestmöglich eingesetzt<br />
werden könnten.<br />
Die Kraftwerksbetreiber würden sich an den Börsenstrompreisen<br />
orientieren und vor allem Strom erzeugen,<br />
wenn diese hoch sind. Zu Zeiten niedriger Strompreise,<br />
wenn die Erneuerbaren Energien günstig Strom erzeugen,<br />
würden sie weitgehend oder ganz runtergefahren<br />
werden. Grundsätzlich könnte durch eine – gewisse –<br />
Handelbarkeit von Volllaststunden auch den Marktteilnehmern<br />
überlassen werden, ob sie einige Kohlekraftwerke<br />
ganz abschalteten, weil sich ein Betrieb mit verringerten<br />
Volllastunden bei konkreten Kraftwerken nicht<br />
rechnen würde. Das wäre dann ein Marktmodell.<br />
Die höhere Flexibilität im System würde sich unter anderem<br />
durch niedrigere Redispatch- und Abregelungskosten<br />
für Erneuerbare Energien für die Stromkunden<br />
positiv auswirken. Gleichzeitig ist natürlich die soziale<br />
Frage aufzunehmen. Das heißt, es ist sicherzustellen,<br />
dass über ein Transformationsprogramm die Zukunft<br />
der betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br />
sichergestellt ist. Dabei sollte auch bedacht werden,<br />
dass die weltweite innovative Entwicklung sicher von<br />
niemandem aufgehalten werden kann und Arbeitsplätze<br />
in der deutschen Kohleverstromung in jedem Fall das<br />
Problem der Zukunftsfähigkeit haben.<br />
Autor<br />
Dr. Peter Röttgen<br />
Geschäftsführer<br />
Bundesverband Erneuerbare Energie e.V.<br />
Invalidenstraße 91 · 10115 Berlin<br />
Tel. 030/2 75 81 70-0<br />
E-Mail: info@bee-ev.de<br />
www.bee-ev.de<br />
37
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Gas: Potenzielles Medium<br />
für die Energiewende<br />
Mehr als zwölf Mal so lang wie der Äquator ist das deutsche Gasnetz. Zwar öffnet es sich<br />
mittlerweile den grünen Gasen, trotzdem beträgt der Anteil von Biomethan, Wasserstoff & Co.<br />
erst rund 1 Prozent. Ein Blick in die Röhre.<br />
Von Dierk Jensen<br />
Über 500.000 Kilometer<br />
lang ist das deutsche<br />
Gasnetz.<br />
38
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
praxis / Titel<br />
Deutsches Erdgas-Fernleitungsnetz<br />
Foto: Fotolia_Sergii Ryzhkov<br />
39
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
40 Prozent des in<br />
Deutschland verbrauchten<br />
Erdgases<br />
kommen aus Russland.<br />
Erdgas bietet heute an vielen Stellen deutliche<br />
CO 2<br />
-Vorteile und könnte im Strommarkt,<br />
im Wärmemarkt und im Verkehr helfen,<br />
schnell große Potenziale zu heben. Solche<br />
Lösungen sollte die Politik zulassen und<br />
belohnen – auch und gerade weil wir das Gas künftig<br />
zunehmend regenerativ erzeugen können“, so Dr. Timm<br />
Kehler, Vorstand Zukunft Erdgas. Er setzt noch einen<br />
drauf: „Moderne Technologien mit Erdgas bringen uns<br />
heute schnell voran beim Klimaschutz. Und auch in Zukunft<br />
wird Gas mit seinem weit ausgebauten Netz eine<br />
Schlüsselrolle spielen. In einer nahezu klimaneutralen<br />
Volkswirtschaft wird das dann grüne Gas aus Biomasse,<br />
Wind- und Sonnenenergie sein. Hier muss die kommende<br />
Regierung Weichen stellen, um die Entwicklung<br />
von Märkten für grünes Gas angemessen zu fördern.“<br />
Der Erdgasverbrauch liegt in den 27 Mitgliedstaaten<br />
der EU bei 490 Milliarden Kubikmetern und in<br />
Deutschland bei rund 90 Milliarden. Marktprognosen<br />
gehen sogar von einem Anstieg auf 550 Milliarden Kubikmeter<br />
bis zum Jahr 2020 aus (Deutschland: bis zu<br />
95 Milliarden). Woher kommt das Erdgas aber bislang?<br />
So kommen auf den deutschen Gasmarkt aktuell rund<br />
40 Prozent aus Russland, 21 Prozent aus Norwegen,<br />
29 Prozent aus Holland, weitere Länder stehen mit 3<br />
Prozent zu Buche und eben 7 Prozent kommen aus der<br />
einheimischen Produktion wie beispielsweise aus Förderstätten<br />
im Elbe-Weser Gebiet. Noch stammen 160<br />
Milliarden Kubikmeter aus europäischer Förderung,<br />
doch wird dieser Anteil bis 2020 auf 140 Milliarden<br />
Kubikmeter schrumpfen.<br />
Vor allem werde die Förderung von deutschem aber<br />
auch holländischem Erdgas nach Ansicht von Marktexperten<br />
in den nächsten Jahren noch weiter zurückgehen.<br />
Von daher spielen sowohl Lieferungen aus Russland<br />
als auch Flüssiggas zukünftig eine zentrale Rolle<br />
in den strategischen Überlegungen der im Gasgeschäft<br />
tätigen Unternehmen.<br />
Kontroverse um Nord Stream II<br />
Nicht zuletzt deshalb haben Gazprom, Wintershall,<br />
E.on, Gasunie und GDF Suez vor Jahren die Pipeline<br />
„Nord Stream“ gebaut, deren Erweiterung um einen<br />
weiteren Rohrstrang gegenwärtig<br />
in den EU-Gremien<br />
und den Ostsee-Anrainerstaaten<br />
kontrovers diskutiert<br />
wird. Große Marktteilnehmer<br />
wie die aus der E.on-Abspaltung<br />
hervorgegangene Uniper<br />
SE in Düsseldorf warnen<br />
indes vor einer Verhinderung<br />
der geplanten Nord Stream<br />
II, weil die europäische Eigenversorgung<br />
tendenziell<br />
sinke und auf neue Importquellen<br />
angewiesen sei.<br />
„Die Gasmärkte in Deutschland<br />
und Nordwesteuropa<br />
sind durch ein hohes Maß<br />
an Wettbewerbsintensität<br />
und Liquidität geprägt“,<br />
bekräftigt Dr. Nicole Karczmaryzki<br />
von der Uniper SE<br />
und wünscht sich dies für<br />
den ganzen Kontinent. „In<br />
einigen osteuropäischen<br />
Mitgliedstaaten sind die Vorgaben<br />
des 3. EU-Energiebinnenmarkt-Pakets<br />
allerdings<br />
noch nicht umgesetzt. Dies<br />
steht der Realisierung eines einheitlichen europäischen<br />
Binnenmarktes noch entgegen. Deshalb sollte<br />
die Politik die Umsetzung dieser Vorgaben konsequent<br />
vorantreiben“, fordert Dr. Karczmaryzki seitens des Aktienunternehmens,<br />
das unter anderem im Bereich der<br />
Gasspeicherung aktiv ist, sich aber auch im Segment<br />
der Power-to-Gas-Technologie an den Standorten Falkenhagen<br />
und Hamburg-Reitbrook engagiert.<br />
Unabhängig davon, ob Nord Stream II gebaut wird<br />
oder nicht: Die bereits bestehenden zwei Rohrleitungen<br />
erstrecken sich von der russischen Küste bis nach<br />
Lubmin bei Greifswald über eine Länge von 1.200<br />
Kilometer durch die Ostsee. Von Lubmin aus verteilt<br />
der Fernleitungsnetzbetreiber Gascade Gastransport<br />
GmbH, eine Unternehmenstochter von BASF und Gaz-<br />
Foto: Fotolia_Reinhard Tiburzy<br />
40
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
praxis / Titel<br />
prom, das russische Gas über die neu gebauten Leitungen<br />
NEL (nach Niedersachsen) und OPAL (bis an die<br />
tschechische Grenze bei Brandov).<br />
Steigende Auslastung von NEL und OPAL<br />
„Die von uns durchgeleiteten Gasmengen steigen“,<br />
bekundet Gascade Pressesprecher George Wüstner.<br />
Dabei verbindet das Netz von Gascade Deutschland<br />
mit Polen, Tschechien, Belgien und den Niederlanden<br />
und ermöglicht Transporte nach Frankreich und Großbritannien.<br />
Im Übrigen gibt es im Gasnetz der Gascade<br />
auch drei Einspeisepunkte für Biogas, in die in den<br />
vergangenen zwei Jahren mehr als 130 Millionen Kilowattstunden<br />
eingespeist wurden.<br />
Gegenüber der Wasserstoffeinspeisung ins Netz gibt<br />
sich Wüstner eher bedeckt: „Das Thema erfordert<br />
noch umfangreiche Abstimmungen und Studien, bei<br />
denen die nachgelagerten Netzbetreiber, danach angeschlossenen<br />
Letztverbraucher und die verschiedenen<br />
Anlagen und Systeme berücksichtigt werden müssen.“<br />
Unterdessen sieht der Deutsche Verein des Gas- und<br />
Wasserfaches (DVGW) eine hohe Dringlichkeit, das<br />
bestehende Gasnetz in bestimmten Teilbereichen an<br />
neue „Gas-Beschaffenheiten“ anzupassen.<br />
„Dies gilt auch für angeschlossene Verbraucher sowie<br />
industrielle Prozesse. Derzeit können 10 Prozent Wasserstoff<br />
ins Erdgasnetz eingespeist werden, bei Kraftstoff-Anwendungen<br />
aktuell 2 Prozent“, heißt es aus<br />
den Reihen des DVGW, der sich aktuell mit mehreren<br />
Forschungsprojekten befasst, die Wasserstoff-Anwendungen<br />
weiterzuentwickeln. Damit will der DVGW den<br />
Ansatz weiter voranbringen, „im Sinne einer zukünftigen<br />
Nutzungsstrategie der Netze generell den Wechsel<br />
von Gasen in der Gasinfrastruktur zu organisieren.“<br />
Welches Gas die Versorgungsunternehmen entweder<br />
über die Spotmärkte wie an der EEX-Börse in Leipzig<br />
oder durch Verträge mit den Erzeugern am Ende<br />
ordern, ist den insgesamt 17 in Deutschland tätigen<br />
Fernleitungsnetzbetreibern letztlich egal. Sie fragen<br />
nicht nach der Herkunft, sondern werden schließlich<br />
nur für ihre Durchleitungs-Dienstleistung, aufmerksam<br />
beobachtet von der Bundesnetzagentur, vergütet.<br />
Dazu gehört auch das Leitungsmanagement von unterschiedlichen<br />
energiehaltigen Erdgasen.<br />
Umstellung: von L-Gas auf H-Gas<br />
So gibt es niederkalorische Gase, sogenannte L-Gase<br />
mit Methangehalten von knapp 80 Prozent, und hochkalorische<br />
Gase mit 95,5 Prozent Methananteil, die<br />
man in der Branche als H-Gase tituliert. Im Frühjahr<br />
2015 startete eines der größten Infrastrukturprojekte<br />
der deutschen Erdgasversorgung, bei der das komplette<br />
Gassystem von L-Gas auf H-Gas umgestellt werden<br />
soll. Der Grund hierfür ist, dass die Fördermengen für<br />
L-Gas („Low Calorific Gas“ – mit niedrigem Brennwert)<br />
in Deutschland und Niederlanden immer mehr abnehmen.<br />
Dies macht den Wechsel auf H-Gas notwendig.<br />
Während L-Gas bisher vorwiegend in Teilen von Hessen,<br />
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-<br />
Pfalz, Sachsen-Anhalt sowie in Bremen verbraucht<br />
wird, ist der überwiegende Teil Deutschlands bereits<br />
seit mehreren Jahrzehnten mit H-Gas („High calorific<br />
Gas“ – mit höherem Brennwert) aus Norwegen, Russland<br />
und Großbritannien versorgt. Die Gasumstellung<br />
(„Marktraumumstellung“) der betroffenen Regionen<br />
auf H-Gas erfolgt wie im Netzentwicklungsplan festgeschrieben<br />
bis zum Jahr 2030.<br />
Neben dem über Pipelines abgewickelten Gasimport<br />
aus Norwegen und Russland gewinnt der Handel und<br />
Transport mit LNG (Liquid Natural Gas) an Bedeutung.<br />
Während in Holland schon seit geraumer Zeit<br />
LGN anlandet, gibt es in Deutschland bis dato keine<br />
Häfen, die LNG annehmen, lagern und weiterleiten.<br />
Bisher noch nicht, denn schon im Jahr <strong>2018</strong> will man<br />
in Brunsbüttel mit dem Bau eines LNG-Terminals beginnen.<br />
Zu den Investoren gehört unter anderen auch<br />
der in Hamburg ansässige Mineralölkonzern Marquard<br />
& Bahls, dessen Tochterunternehmen Mabagas sich<br />
im Jahr 2015 aus dem deutschen Biogas-Geschäft<br />
zurückzog.<br />
Das deutsche Gasnetz ist 505.000 Kilometer – das<br />
entspricht einer Strecke von mehr als zwölf Mal um<br />
den Äquator herum – lang. Wenn nun aber durch Energieeffizienzmaßnahmen<br />
der Gasverbrauch im Wärmebereich<br />
schrumpft, dann stellt sich die brennende<br />
Frage, wie das weitverzweigte deutsche Gasnetz, das<br />
immer mehr mit den europäischen Nachbarländern<br />
zusammenwächst, sinnvoll genutzt werden kann? Um<br />
genau diese Frage zu beantworten, hat sich ein Konsortium<br />
aus den Firmen Mitnetz Strom, Ontras und Enso<br />
Netz gebildet.<br />
Unter dem Projekttitel „SoViel“ haben diese Unternehmen<br />
die BTU Cottbus-Senftenberg beauftragt, eine<br />
Studie anzufertigen, in der die Einsatzmöglichkeiten<br />
verschiedener PtX-Technologien ausgelotet werden<br />
sollen. Welche Optionen bietet beispielsweise die Gas-<br />
Mobilität, über die der Erdgas-Experte Dr. Heiko Lohmann<br />
nüchtern feststellt, dass „die zwar funktioniert,<br />
aber man politisch nicht unterstützt hat“?<br />
Autor<br />
Dierk Jensen<br />
Freier Journalist<br />
Bundesstr. 76<br />
20144 Hamburg<br />
Tel. 040/88 177 776<br />
E-Mail: dierk.jensen@gmx.de<br />
www.dierkjensen.de<br />
41
Technische Einrichtungen<br />
des Erdgasspeichers<br />
Rüdersdorf in Brandenburg<br />
Foto: Rainer Weisflog<br />
Notwendig, aber derzeit unrentabel:<br />
Gasspeicher in Deutschland<br />
Unternehmen bauen Erdgasspeicher-Kapazitäten ab. Dabei wird die Gasinfrastruktur<br />
künftig mehr denn je gebraucht.<br />
Von Bernward Janzing<br />
Deutschland hat zu viele Erdgasspeicher –<br />
das zumindest sind die Signale des Marktes.<br />
Im letzten Frühjahr stellte die Berliner<br />
Erdgasspeicher GmbH die Vermarktung der<br />
Kapazitäten ihres Speichers ein, damit der<br />
im Jahr 2023 außer Betrieb gehen kann. „Angesichts<br />
der derzeit schwierigen wirtschaftlichen Situation für<br />
Speicher ist ein wirtschaftlich nachhaltiger Betrieb<br />
nicht weiter aufrechtzuerhalten“, erklärt die Firma.<br />
Sie ist damit kein Einzelfall. Das Energieunternehmen<br />
Innogy hatte schon 2016 den Gasspeicher Kalle in<br />
Hoogstede in Niedersachsen stillgelegt. Mitbewerber<br />
Uniper vermarktet den niedersächsischen Speicher<br />
Krummhörn seit April 2017 nicht mehr. Diese drei<br />
Projekte machen alleine gut 4 Prozent der gesamten<br />
Speichermenge in Deutschland aus, die bislang noch<br />
bei gut 23 Milliarden Kubikmetern [entsprechend 233<br />
Terawattstunden (TWh)] liegt.<br />
Der Schwund ist ein deutliches Signal, dass der Speichermarkt<br />
aus Sicht der Betreiber durch ein Überangebot<br />
geprägt ist. Aus der Branche ist bereits das Wort<br />
„Schweinezyklus“ zu hören; es wurden in den vergangenen<br />
Jahren viele Kapazitäten zugebaut, sodass nun<br />
die Preise verfallen. Vor allem ist derzeit der Sommer-<br />
Winter-Spread, also die Differenz zwischen dem Preis<br />
der Einspeicherung im Sommer und der Ausspeicherung<br />
im Winter, zu gering, um den Betreibern die<br />
notwendigen Einnahmen zu sichern. Wo nicht einmal<br />
mehr die Fixkosten gedeckt werden, sind die Speicher<br />
dann nicht mehr zu halten.<br />
Keine regulativen Eingriffe vorhanden<br />
Das aber könnte im Netz irgendwann zu Problemen<br />
führen. Denn es gibt in Deutschland keine gesetzliche<br />
Verpflichtung und keine klare Zuweisung der Verantwortung<br />
für die Versorgungssicherheit mit Gas. Es herrscht<br />
42
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Gassektor ohne strategische Reserve<br />
Im deutschen Gasmarkt gibt es eine solche Reserve<br />
nicht. Sie war immer mal wieder Thema, im Jahr 2015<br />
ließ das Bundeswirtschaftsministerium das Instru-<br />
praxis / Titel<br />
der pure Markt, und sollte der mal nicht im<br />
Sinne einer sicheren Versorgung agieren, was<br />
Ökonomen dann schlicht „Marktversagen“<br />
nennen, gibt es keine regulativen Eingriffe.<br />
Ansatzweise war das im Februar 2012 zu erleben,<br />
als es in Süddeutschland aufgrund einer<br />
Kältewelle und reduzierter Gasflüsse aus Russland<br />
zu Versorgungsengpässen kam. Auch für<br />
den Winter 2017/<strong>2018</strong> befürchtet der Verband<br />
der deutschen Fernleitungsnetzbetreiber<br />
(FNB) eine Versorgungslage, die „weitere<br />
Herausforderungen mit sich bringen“ wird.<br />
Es bestehe in ganz Süddeutschland nämlich<br />
ein „weiter zunehmender Kapazitätsbedarf“.<br />
Eine „nachhaltige Entspannung der Situation“<br />
könne „erst mittelfristig mit Umsetzung<br />
der erforderlichen Netzausbaumaßnahmen<br />
erreicht werden“. Die Befüllung der Speicher<br />
in Süddeutschland müsse daher „unter Beobachtung<br />
bleiben“.<br />
Das Problem im Gasmarkt: Es kann niemand<br />
zuverlässig sagen, ob das jeweilige Verhalten<br />
der Marktakteure der Versorgungssicherheit<br />
gerecht wird, oder ob es ausschließlich auf<br />
wirtschaftlichen Gesichtspunkten beruht. Es<br />
habe „der letzte Winter auch gezeigt, dass<br />
Händler die Erdgasspeicher vorrangig zur<br />
Portfoliooptimierung einsetzen“, schreibt der<br />
FNB in seinem „Winterausblick 2017/18“.<br />
Ob diese wirtschaftlich getriebene Speichernutzung<br />
auch immer den Erfordernissen des<br />
Gasbedarfs eines kalten Winters entspreche,<br />
sei „kritisch zu hinterfragen“.<br />
Der Markt soll es richten<br />
Diskussionen, ob eine Regulierung bei den<br />
Gasspeichern eingeführt werden soll, kommen<br />
zwar immer wieder auf, bisher aber<br />
ohne konkrete Folgen. Während im Strommarkt<br />
die Stilllegung von „systemrelevanten“<br />
Kraftwerken durch die Übertragungsnetzbetreiber<br />
und die Bundesnetzagentur möglich ist – man gesteht<br />
hier ein, dass der Markt die Versorgungssicherheit nicht<br />
zur Zufriedenheit gewährleistet –, geht man im Gasspeichersektor<br />
bislang davon aus, dass der Markt zur<br />
Genüge funktioniert.<br />
Immerhin waren die deutschen Speicher zu Beginn<br />
dieses Winters gut gefüllt. Die Daten sind auch transparent;<br />
das Energiewirtschaftsgesetz verlangt einen<br />
diskriminierungsfreien Zugang zu Speicherdienstleistungen,<br />
zugleich sind die Speicherbetreiber verpflichtet,<br />
ihre Speichertarife und -kapazitäten offenzulegen.<br />
„Insgesamt liegen die deutschen Speicherfüllstände<br />
in der Größenordnung des Vorjahres und damit auf einem<br />
guten Niveau“, betonten zu Beginn der Heizperiode<br />
die deutschen Fernleitungsnetzbetreiber. Mit 194<br />
Terawattstunden waren die Speicher im Inland Ende<br />
November zu 83 Prozent befüllt, wie beim Gasspeicherverband<br />
Gas Infrastructure Europe nachzulesen<br />
ist. Der Wert sinkt in diesen Wintertagen im Schnitt<br />
um etwa einen halben Prozentpunkt pro Tag. In Europa<br />
lag der Befüllungsgrad Ende November im Mittel bei<br />
80 Prozent.<br />
Neben Fragen einer Regulierung der Gasspeicherung<br />
wird auch eine Strategische Reserve immer wieder<br />
diskutiert, ein Instrument, das es im Ölmarkt gibt.<br />
Deutschland bunkert Ölmengen, die ausreichen sollen,<br />
den Bedarf im Notfall für mindestens 90 Tage decken<br />
zu können, eine Konsequenz aus der von Ölkrise 1973.<br />
43
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Foto: innogy<br />
Untergrundspeicher Xanten mit einem Arbeitsgasvolumen von knapp<br />
0,2 Milliarden Kubikmetern für die konstante Erdgasversorgung der Region<br />
Niederrhein. Der Speicher ist an das Fernleitungsnetz der Thyssengas im<br />
Marktgebiet NetConnect Germany (NCG) angeschlossen und ist seit dem<br />
1. April 2017 Bestandteil des innEXpools.<br />
Gasspeicher in Deutschland<br />
Deutschland verdankt seine vielen Gasspeicher der günstigen Geologie.<br />
Weltweit steht die Bundesrepublik mit ihren Speicher-Kapazitäten<br />
derzeit an vierter Stelle hinter den USA, Russland und der Ukraine. Als<br />
größter Speicherbetreiber in der EU – gefolgt von Italien, Frankreich und<br />
Österreich – verfügt Deutschland fast über ein Viertel der europäischen<br />
Kapazitäten.<br />
Hierzulande betreiben rund 20 Unternehmen an knapp 40 Standorten 47<br />
Untertagespeicher. Deren Fassungsvermögen beläuft sich in der Summe<br />
auf rund 23 Milliarden Kubikmeter Gas, was etwa einem Viertel des<br />
jährlichen Erdgasverbrauchs in Deutschland entspricht. Bei den Speichern<br />
handelt es sich einerseits um Kavernenspeicher, andererseits um<br />
Porenspeicher. Sie befinden sich in Tiefen zwischen 500 Metern und 2.500<br />
Metern unter der Erde.<br />
Kavernenspeicher sind künstlich erzeugte Hohlräume in unterirdischen<br />
Salzstöcken, die durch kontrolliertes Auflösen des Salzes mit Wasser<br />
(Aussolung) geschaffen werden. Sie können eine Höhe von mehreren<br />
100 Metern und einen Durchmesser von bis zu 80 Metern erreichen und<br />
werden vorwiegend zur Deckung kurzzeitiger Spitzennachfrage eingesetzt.<br />
Die Mitglieder des Bundesverbandes Erdgas, Erdöl und Geoenergie<br />
(BVEG) betreiben in Deutschland 244 Kavernen in 27 Speicheranlagen.<br />
Das Speichervolumen dieser Kavernen beträgt nach Zahlen des BVEG<br />
13,2 Milliarden Kubikmeter, was einen Anteil von 55 Prozent am genutzten<br />
Speichervolumen in Deutschland entspricht.<br />
Der Rest entfällt auf Porenspeicher. Das sind natürliche unterirdische<br />
Speicher, die die natürliche Porosität und Durchlässigkeit von Sandsteinschichten<br />
nutzen. Darin lagert sich das Erdgas ein. Das können ausgeförderte<br />
Erdöl- und Erdgaslagerstätten sein, aber auch Aquifere, ursprünglich<br />
mit Wasser gefüllte Gesteinsschichten, aus denen das Wasser durch<br />
Injektion von Erdgas verdrängt wird. Der Porenspeicher eignet sich aufgrund<br />
des großen Speichervolumens vorwiegend zur Deckung saisonaler<br />
Schwankungen. Die deutschen Anlagen dieses Typs haben in der Summe<br />
ein Arbeitsgasvolumen von 10,6 Milliarden Kubikmeter.<br />
Nicht nur die Geologie bestimmt die Standorte. Die Speicher befinden sich<br />
zudem meist in der Nähe von Verbrauchszentren und wichtigen Koppelbeziehungsweise<br />
Grenzübergangspunkten des deutschen Ferngasleitungssystems.<br />
ment in einer Studie untersuchen. Das Ergebnis war,<br />
dass „die Auswirkungen auf den Endkundenpreis bei<br />
kompletter Weitergabe und bei ansonsten gleichbleibenden<br />
Entgelten für den Haushaltskundenbereich je<br />
nach Dimensionierung zwischen 0,6 und 2,4 Prozent“<br />
lägen. Offenbar war das zu viel. Die Politik verlässt sich<br />
daher weiterhin allein auf die Kräfte des Marktes und<br />
beruhigt sich damit, dass die Erdgasnachfrage bislang<br />
immer gedeckt werden konnte. Der Druck, die Bevorratung<br />
stärker zu reglementieren, ist also derzeit gering.<br />
Man lässt einen Markt weiterhin alleine wirken, der<br />
längst grenzüberschreitend stattfindet – und das kann<br />
kritisch werden. In Deutschland seien die geologischen<br />
Voraussetzungen für unterirdische Gasspeicher<br />
zwar besonders günstig, sagt Sebastian Bleschke,<br />
Geschäftsführer der Initiative Erdgasspeicher. Doch<br />
die wirtschaftlichen Bedingungen seien nicht in allen<br />
Ländern gleich.<br />
Um Versorgungssicherheit zu gewährleisten, haben<br />
einige Staaten – anders als Deutschland – eine strategische<br />
Gasreserve oder auch Netzreserve eingerichtet.<br />
Auf der einen Seite ist dies nachvollziehbar, da die<br />
Sicherheit der Gasversorgung jederzeit garantiert sein<br />
muss. Auf der anderen Seite führt dies aber zwangsläufig<br />
zu einer Marktverzerrung, weil Gasversorgungsunternehmen<br />
– anders als in Deutschland – Geld dafür<br />
erhalten, dass sie Verantwortung für Versorgungssicherheit<br />
übernehmen.<br />
Umlage belastet Speichernutzer<br />
Darüber hinaus werden Nutzer von Gasspeichern in<br />
Deutschland durch zwei Umlagen schwer belastet.<br />
Zum einen gibt es die Marktraumumstellungsumlage,<br />
mit der die Umstellung jener Teilnetze finanziert wird,<br />
in denen heute noch L-Gas (Low) fließt, die aber künftig<br />
H-Gas (High) durchleiten werden. Zum anderen<br />
existiert ein Konvertierungsentgelt, das zu bezahlen<br />
ist, wenn der Marktgebietsverantwortliche die richtige<br />
Gasqualität entsprechend der Verbrauchsanforderungen<br />
bereitstellt. „Diese Umlagen stellen erhebliche<br />
Kostenbelastungen dar, die die Konkurrenz im Ausland<br />
nicht zahlt“, sagt Bleschke.<br />
Damit schlägt eines der größten Infrastrukturprojekte<br />
der deutschen Erdgasversorgung, das im Mai 2015<br />
gestartet wurde, auf den Gasmarkt durch. Denn die L-<br />
Gas-Gebiete, die ein Drittel des deutschen Netzes abdecken,<br />
werden nach und nach auf H-Gas umgestellt.<br />
Das wird nötig, weil L-Gas aus Quellen in Deutschland<br />
und den Niederlanden stammt und weniger verfügbar<br />
ist. Der kontinuierliche Rückgang der L-Gas-Aufkommen<br />
und die daraus resultierende Ankündigung der<br />
Niederlande, die Lieferung von L-Gas ab 2020 zu reduzieren<br />
und 2030 einzustellen, lässt Deutschland keine<br />
andere Wahl. L-Gas wird heute vorwiegend in Teilen<br />
von Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,<br />
Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt sowie in Bremen<br />
verbraucht. Der überwiegende Teil Deutschlands wird<br />
44
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
praxis / Titel<br />
bereits seit mehreren Jahrzehnten mit H-Gas aus Norwegen,<br />
Russland und Großbritannien versorgt.<br />
Erdgas wird als letzter fossiler Energieträger<br />
ausscheiden<br />
Kritiker wenden mitunter ein, der Ausbau der Erdgasinfrastruktur<br />
zementiere die fossile Energieversorgung. Dabei<br />
ist aber zu beachten, dass das Erdgas unter den fossilen<br />
Energieträgern am CO 2<br />
-ärmsten verbrennt und damit<br />
auch noch Teil des Energiemixes sein wird, wenn Kohle<br />
und Öl aus Klimaschutzgründen keine Rolle mehr spielen.<br />
Erdgas hat an den deutschen Gesamt-CO 2<br />
-Emissionen<br />
heute einen Anteil von 20 Prozent. Geht man davon<br />
aus, dass aus Gründen des Klimaschutzes zuerst alle anderen<br />
fossilen Energien komplett ausgemustert werden,<br />
dann kommt das Erdgas logischerweise erst an die Reihe,<br />
wenn minus 80 Prozent schon erreicht sind. Das soll um<br />
2050 der Fall sein. Bis dahin wird das Gasnetz also noch<br />
gebraucht.<br />
Hinzu kommt, dass das Gasnetz in Zukunft auch die Speicherung<br />
und Verteilung von grünem Gas übernehmen<br />
kann. Unter dem Motto „Gas kann grün!“ publizierten im<br />
August zehn Verbände und Vereinigungen der deutschen<br />
Erd- und Biogaswirtschaft sowie der Heizungsindustrie<br />
ein gemeinsames Papier. Darin betonen sie, dass die gewünschte<br />
CO 2<br />
-Reduzierung mittels Sektorkopplung sich<br />
nur deshalb erreichen lasse, „weil wir in Deutschland bereits<br />
über eine sehr gut entwickelte und breit akzeptierte<br />
Gasinfrastruktur verfügen“. Damit ließen sich „Erdgas,<br />
Biomethan, synthetisches Methan und in vielen Bereichen<br />
auch synthetischer Wasserstoff transportieren und<br />
speichern“.<br />
Die Verbände betonen: „Die Kopplung von Strom- und<br />
Gasinfrastrukturen und damit die umfassende Nutzung<br />
von Strom aus Wind und Sonne sowohl in Strom- als auch<br />
in Gasanwendungen kann der Energiewende in Deutschland<br />
neuen Schub verleihen.“ Denn im Zuge der Sektorenkopplung<br />
werden Strom- und Erdgasnetze zunehmend<br />
als Gesamtsystem betrachtet werden müssen.<br />
Während über Stromspeicher viel diskutiert wird, geht allzu<br />
oft unter, dass Deutschland mit den Gasspeichern bereits<br />
heute ausreichend Energiespeicher hat, um auch die<br />
viel diskutierte „Dunkelflaute“ – also Windstille bei Nacht<br />
oder an sonnenarmen Tagen – zu überbrücken. Dazu noch<br />
eine Zahl: Die 233 Terawattstunden an speicherbarem<br />
Gas würden beim Einsatz in hocheffizienten Gaskraftwerken<br />
(Wirkungsgrad 60 Prozent) rund 140 Terawattstunden<br />
Strom ergeben. Das ist genug, um das Land drei<br />
Monate lang mit Elektrizität voll zu versorgen.<br />
Jobvielfalt Biogas<br />
Deine Karriere bei ÖKOBIT<br />
Für unseren Standort in Föhren bei Trier<br />
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt:<br />
• Referent Genehmigungsverfahren (m/w)<br />
• Bauleiter (m/w)<br />
• Planungsingenieur (m/w)<br />
• Monteure für den Bau von Biogasanlagen (m/w)<br />
• Leitmonteure für den Bau von Biogasanlagen (m/w)<br />
• Servicetechniker Anlagentechnik (m/w)<br />
• Servicetechniker BHKW (m/w)<br />
• Baustellenleiter Servicetechnik (m/w)<br />
Für unseren Standort in Boppard suchen wir<br />
zum nächstmöglichen Zeitpunkt:<br />
• Anlagenfahrer (m/w)<br />
• Betriebselektriker (m/w)<br />
Ausführliche Informationen zu den genannten Stellenanzeigen<br />
findest du auf unserer Karriereseite:<br />
www.oekobit-biogas.com/karriere<br />
Autor<br />
Bernward Janzing<br />
Freier Journalist<br />
Wilhelmstr. 24a · 79098 Freiburg<br />
Tel. 07 61/202 23 53<br />
E-Mail: bernward.janzing@t-online.de<br />
Wir freuen uns auf deine Bewerbung, bevorzugt per E-Mail an<br />
karriere@oekobit-biogas.com<br />
45
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Der internationale Biomethan-<br />
Handel in Europa steckt noch in<br />
den Kinderschuhen. Erste Mengen<br />
werden zwischen Deutschland<br />
und der Schweiz sowie zwischen<br />
Deutschland und Schweden<br />
gehandelt.<br />
Europäische<br />
Biomethanstrategie<br />
notwendig<br />
Foto: Fotolia_JonasGinter<br />
In Deutschland speisen rund 200 Biogasanlagen Biomethan in Erdgasqualität in das<br />
Erdgasnetz ein. Pro Jahr sind das rund 950 Millionen Kubikmeter, was 1 Prozent des<br />
deutschen Erdgasverbrauchs oder 12 Prozent der deutschen Erdgasförderung entspricht.<br />
Dieses Gas wird bislang hauptsächlich in Deutschland verbraucht. Die spannende Frage<br />
lautet: Können grüne Gase wie Biomethan auch international gehandelt werden?<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Ja, das ist heute schon möglich, aber es gibt<br />
noch erheblichen Optimierungsbedarf für den<br />
Handel“, sagt Sandra Rostek, Leiterin des<br />
Hauptstadtbüros Bioenergie des Fachverbandes<br />
Biogas e.V. in Berlin. Zurzeit werde das<br />
deutsche Biomethan überwiegend verstromt. Kleinere<br />
Mengen würden als Kraftstoff genutzt – entweder als<br />
Reinkraftstoff oder als Beimischung zum Erdgas – oder<br />
sie würden in Gasthermen als Mischungspartner im<br />
Erdgas zur Wärmegewinnung verfeuert.<br />
„Wir haben schon länger die gefestigte Erkenntnis, dass<br />
kaum ein Energieträger so gut für das internationale<br />
Geschäft geeignet ist wie Biomethan. Darüber hinaus<br />
findet in vielen europäischen Ländern eine Trendwende<br />
statt in der Weise, dass nationales Autarkiedenken im<br />
Zusammenhang mit der Energieversorgung abnimmt.<br />
Es gibt große Chancen für Biomethan, international<br />
gehandelt zu werden, weil es viele Länder mit einem<br />
großen Bedarf gibt“, erklärt Rostek.<br />
Sie verweist beispielweise auf die Niederlande, die<br />
eine ambitionierte Treibhausgasminderungsquote im<br />
Verkehrssektor formuliert haben. Das Land versucht<br />
nun, diese Quote auch mit Biomethan-Importen zu erfüllen,<br />
weil die eigene Produktion nicht ausreicht. Auch<br />
Italien sei an ausländischem Biomethan aus Klimaschutzgründen<br />
interessiert, weil Erdgas in der Energieversorgung<br />
einen hohen Stellenwert hat und dort über<br />
880.000 Erdgasfahrzeuge angemeldet sind.<br />
„Wir müssen beim Biogas über den Tellerrand des EEG<br />
hinausschauen. Der Fachverband Biogas ist daher<br />
auch für Biomethan als Kraftstoff. Er plädiert für eine<br />
Förderung des internationalen Biomethanhandels“,<br />
betont Rostek. Etliche Länder in Europa hätten ein großes<br />
Reststoffpotenzial, das über die Biogasproduktion<br />
erschlossen werden könnte. Das Land könne aber bedarfsmäßig<br />
die potenziellen Biomethanmengen nicht<br />
verbrauchen. Daher sei es klug, diese Energiemengen<br />
zu exportieren. Und umgekehrt könnten heimische<br />
Marktakteure dann eben in anderen Ländern Absatzmärkte<br />
erschließen, die hierzulande allzu schleppend<br />
aufwachsen.<br />
Positiv ist laut Rostek, dass die EU-Kommission den<br />
internationalen Handel von Biomethan grundsätzlich<br />
befürwortet. Sie beklagt aber auch, dass sich das<br />
Bundesumweltministerium in Berlin zu diesem Thema<br />
bisher sehr bedeckt hält. Warum soll Biomethan<br />
nicht international gehandelt werden können, wo doch<br />
Bioethanol und Biodiesel und die für die Produktion<br />
notwendigen Rohstoffe über Ländergrenzen hinweg<br />
verkauft werden? Vorhandene Massenbilanzierungssysteme<br />
für Biomethan sind praxiserprobt und dürften<br />
kein Hemmnis darstellen.<br />
Hinderlich dagegen ist, dass derjenige, der Biomethan<br />
liefern will – zum Beispiel aus den Niederlanden nach<br />
Deutschland oder umgekehrt –, in den Biogasregistern<br />
beider Länder angemeldet sein muss und die standar-<br />
46
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
praxis / Titel<br />
disierte internationale Verbindung<br />
derzeit noch fehlt. In Deutschland<br />
bietet die Deutsche Energie-<br />
Agentur (dena) die Plattform für<br />
das Register. Das Biogasregister<br />
Deutschland ist eine Plattform zur<br />
standardisierten und einfachen<br />
Dokumentation von Nachweisen<br />
über Biogasmengen und -qualitäten<br />
im Erdgasnetz. Es ist ein System, mit dem Biomethan<br />
von der Produktion bis zum Verbrauch zertifiziert<br />
und nachverfolgt werden kann. Es richtet sich an<br />
Produzenten, Händler und Verbraucher von aufbereitetem<br />
und in das Erdgasnetz eingespeistem Biomethan.<br />
Lästige Kapazitätsbuchungen<br />
an Ländergrenzen<br />
Ein weiteres Problem ist, dass aufgrund mangelnder<br />
Klarheit in den Regularien bisweilen an den Ländergrenzen<br />
Kapazitäten für den Biomethantransport gebucht<br />
werden müssen – obwohl das Gas nicht physisch,<br />
sondern nur virtuell im anderen Land verbraucht wird.<br />
„Will jemand von Deutschland nach Italien durch Österreich<br />
Biomethan liefern, dann muss er womöglich in<br />
Österreich eine Gebühr für die Durchleitung bezahlen“,<br />
ärgert sich Rostek.<br />
Um den europäischen Biomethanhandel zu vereinfachen,<br />
haben verschiedene Akteure, zu denen auch<br />
der Fachverband Biogas e.V. und die European Biogas<br />
Association zählen, das ERGaR-Projekt ins Leben gerufen<br />
(nähere Infos unter www.ergar.org). ERGaR soll eine<br />
europäische Plattform sein und die nationalen Biogasregister<br />
ergänzen und verbinden. ERGaR wird den<br />
Nachweis der sicheren Vermarktung bieten und eigene<br />
Qualitätsstandards schaffen. Es ist ein übergeordnetes<br />
Zertifizierungssystem, keine Handelsplattform. Seit<br />
2014 wird die Plattform konzipiert.<br />
Mittlerweile sind die Abläufe und Prozesse komplett<br />
durchdacht und praxistauglich. Am 15. Dezember<br />
2017 nun wurde ERGaR bei der EU-Kommission eingereicht<br />
mit dem Ziel, dass es durch die Kommission<br />
als internationales Nachweissystem anerkannt wird.<br />
Ein weiterer wichtiger Erfolg des Projekts ist, dass die<br />
Kommission im Entwurf der neuen RED II-Richtlinie<br />
erstmals die Empfehlung der Marktakteure aufgreift,<br />
das gesamte europäische Gasnetz als ein zusammenhängendes<br />
Massenbilanzsystem zu begreifen. Auch<br />
dies dürfte dazu beitragen, dass der Handel mit Biomethan<br />
künftig einfacher werden wird.<br />
Gute Marktsituation für Biomethan<br />
in Deutschland<br />
Jüngst hat auch die bmp greengas GmbH aus München<br />
entschieden, dass sie dem ERGaR-Projekt beitreten<br />
will. Das süddeutsche Unternehmen hat nach<br />
eigenen Angaben jährlich etwa 2,4 Terawattstunden<br />
Bilanzkreisvolumen Biomethan, was rund einem Viertel<br />
„Der Fachverband<br />
Biogas plädiert für<br />
eine Förderung des<br />
internationalen<br />
Biomethanhandels“<br />
Sandra Rostek<br />
der in Deutschland produzierten<br />
Menge entspricht. Die bayrischen<br />
Gashandelsprofis haben das Ziel,<br />
mit ihrem langjährigen Know-how<br />
und mithilfe der durch die Übernahme<br />
von der Erdgas Südwest<br />
im Verbund mit der EnBW nochmals<br />
deutlich erhöhten Stabilität<br />
den Einsatz von Grünen Gasen in<br />
Deutschland und Europa voranzubringen und damit zur<br />
Erreichung der klimapolitischen Ziele beizutragen.<br />
Der Leiter des Einkaufs bei bmp, Johannes Klaus, sagt<br />
zum europäischen Biomethanhandel: „Zunächst müssen<br />
wir einmal feststellen, dass die Marktsituation in<br />
Deutschland für hier produziertes Biomethan sehr gut<br />
ist. Es gibt einen Handel in das europäische Ausland,<br />
aber dieser macht aktuell noch einen eher geringen<br />
Anteil am Gesamtmarkt aus. Dabei handelt<br />
es sich zumeist um Biomethan aus Rest- und<br />
Abfallstoffen, das in den aktuellen EEG-Regimen<br />
eine tendenziell niedrigere EEG-Förderung<br />
erhält. Davon werden Mengen nach Schweden<br />
oder in die Schweiz verkauft.“ Das sind nach<br />
seiner Erkenntnis die Hauptmärkte.<br />
Laut bmp-Vertriebsleiter Stefan Schneider finden<br />
von den rund 930 Millionen Normkubikmetern Biomethan,<br />
die in Deutschland jährlich produziert werden,<br />
über 80 Prozent den Weg ins EEG. Das heißt, dass diese<br />
Menge in Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen verstromt<br />
und gleichzeitig die Wärme genutzt wird. Die Stromvergütung<br />
ist im EEG geregelt. Die restlichen 20 Prozent<br />
kommen in der Gasmobilität sowie in Gasthermen als<br />
CO 2<br />
-entlastende Alternative zu Erdgas zum Einsatz.<br />
Klaus fügt hinzu, dass es im europäischen Ausland<br />
auch andere Förderprogramme gibt. So gibt es zum<br />
Beispiel Länder wie Großbritannien mit sogenannten<br />
„feed-in tariff“-Systemen. Da werde das Biomethan in<br />
einem mit dem Deutschen nicht vergleichbaren System<br />
behandelt. „Der Biomethan-Produzent bekommt für<br />
jede Kilowattstunde, die er ins Erdgasnetz einspeist,<br />
einen garantierten Preis. Ausländisches Biomethan<br />
ist in einigen Ländern gegenüber dem inländischen<br />
Produkt schlechter gestellt, was den Handel mit Biomethan<br />
in diesen Ländern deutlich erschwert“, erklärt<br />
der Fachmann.<br />
Biomethan von Deutschland<br />
nach Schweden<br />
Als Alternative gebe es aktuell zwei wesentliche Märkte,<br />
die interessant seien. „Das ist zum einen der Transportsektor,<br />
in dem Quoten oder Tickets erlöst werden<br />
können. So sind zum Beispiel Biomethanmengen von<br />
Deutschland nach Schweden transferiert worden, weil<br />
die EU-Kraftstoffpolitik entsprechende Anreize zur<br />
Grünstellung des Kraftstoffmarktes im Gassegment<br />
macht. In diesem Bereich setzen die Nationalstaaten<br />
die EU-Vorgaben um“, ergänzt Klaus.<br />
Quelle: St. Galler Stadtwerke<br />
Die St. Galler Stadtwerke<br />
in der Schweiz<br />
bieten Erdgas mit<br />
5 Prozent und 20<br />
Prozent Biogasanteil<br />
sowie ein 100-Prozent-<br />
Biomethan-Produkt<br />
an. Es kommt dort als<br />
Heiz- und Kochgas zum<br />
Einsatz.<br />
47
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Ausländische<br />
Handelsakteure<br />
suchen in Deutschland<br />
ausschließlich Biomethan<br />
aus Rest- und<br />
Abfallstoffen.<br />
Zum anderen existiere der sogenannte „voluntary<br />
market“, der nach Klaus‘ Angaben für Privatkunden<br />
interessant ist, die „Grüne Gase“ einkaufen wollen<br />
anstatt normales Erdgas. Die seien auch dazu bereit,<br />
einen höheren Preis zu bezahlen. Dieser Markt sei insbesondere<br />
in Schweden und in der Schweiz lebendig.<br />
„Wobei beide Länder sicherlich auch versuchen, selbst<br />
möglichst viel Biomethan zu produzieren. Allerdings<br />
begrenzt die jeweilige Ländergröße und jeweilige geographische<br />
Lage die heimische Biomethanproduktion,<br />
sodass gewisse Mengen importiert werden müssen“,<br />
erläutert Klaus.<br />
Schweizer importieren nennenswerte<br />
Mengen<br />
Schneider weiß zu berichten, dass Schweizer Energieversorger<br />
in Deutschland unterwegs sind, um einzelne<br />
Biomethanproduktionsanlagen direkt an sich zu binden.<br />
So stiegen beispielsweise Schweizer Akteure direkt<br />
in deutsche Biomethanprojekte ein, exportierten<br />
das Biomethan in den Alpenstaat und versorgten dort<br />
ihre Kundschaft. „Die Schweizer importieren schon<br />
seit etwas mehr als fünf Jahren nennenswerte Mengen“,<br />
so Schneider.<br />
Foto: Martin Bensmann<br />
Dass Gasmengen ins deutsche Biogasregister bei der<br />
dena eingestellt werden, sei nicht zwingend. Es sei auch<br />
möglich mit anderen Gutachten oder Zertifikaten zu<br />
handeln. Aber immerhin würden 80 Prozent der deutschen<br />
Biomethanmenge über das dena-Biogasregister<br />
gehandelt. Schneider: „Wenn mit anderen Gutachten<br />
oder Qualitätsnachweisen gehandelt wird, die den Kriterienkatalog<br />
genauso zusammengestellt haben, dann<br />
ist das kein Problem. Diese Mengen könnten ebenfalls<br />
bilateral verkauft werden. Die jeweiligen Register bieten<br />
jedoch eine Standardisierung und dadurch eine<br />
gewisse zusätzliche Sicherheit für den Endkunden.“<br />
Klaus führt dazu ein Beispiel an: Wenn ein ausländischer<br />
Einkäufer eine Biomethananlage in Deutschland<br />
findet, die Biomethan aus Rest- und Abfallstoffen produziert,<br />
dann kann der ausländische Partner dem deutschen<br />
Produzenten eine Vertragsbasis vorschlagen. Es<br />
gehe dann darum, wie der Nachweis und in welcher<br />
Ausgestaltung er von Land A in das Land B kommt. Hier<br />
gibt es aktuell keinen Standard, sodass Geschäfte im<br />
Moment noch mit vielen Unsicherheiten und gewissen<br />
Risiken verbunden sind. Hier empfehlt es sich, einen<br />
Spezialisten einzusetzen.<br />
Einzelgeschäfte hingen immer von den Anforderungen<br />
des jeweiligen Endkunden ab. Daran orientierten sich<br />
alle Einzelgeschäfte, die die Europäer bilateral miteinander<br />
vereinbaren. „Klar können wir Grünes Gas nach<br />
Deutschland importieren, aber wir müssen uns als<br />
Händler überlegen, welchen Wert es für den Endkunden<br />
hat“, hebt Schneider hervor.<br />
Uneinheitliche Förder- und<br />
Vergütungssysteme<br />
Ein großes Handelshemmnis in Europa ist nach seiner<br />
Darstellung, dass die Förderung und die Vergütungsleistung<br />
des Biomethans in allen Ländern ein Stück<br />
weit anders ausgestaltet sind. „Bei uns kommt die Biomethanförderung<br />
ja eigentlich über das EEG mit der<br />
Stromvergütung am Generator. Andere Länder dagegen<br />
bekommen zum Beispiel eine Förderung bei der Errichtung<br />
der Einspeiseanlage. In Österreich werden bis zu<br />
30 Prozent der Investitionskosten durch den Staat bereitgestellt.<br />
Weil die Förderprogramme in den Ländern<br />
verschieden sind, kann nicht einfach Biomethan von<br />
einem Land ins andere Land gehandelt werden“, erklärt<br />
Schneider.<br />
So könne Biomethan aus Dänemark oder Österreich<br />
aktuell keine deutsche EEG-Vergütung bekommen.<br />
Grund: Das EEG fordere, dass nur in Deutschland produziertes<br />
Biomethan nach EEG vergütet werden kann.<br />
Auch ein beispielsweise in Österreich bereits gefördertes<br />
Biomethan könne nicht nach Deutschland ins<br />
EEG-System gelangen, weil die EEG-Bedingungen eine<br />
Doppelförderung ausschließen.<br />
Darüber hinaus sei zu beachten, dass Gas mit „Grünen<br />
Eigenschaften“ immer nur einmal mit diesen Eigenschaften<br />
in einem Land vermarktet werden kann. In<br />
48
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
praxis / Titel<br />
®<br />
WDV MOLLINÉ<br />
Messtechnik die zählt<br />
einem anderen Land sei das dann nicht<br />
mehr gewünscht. Vor allem, wenn es dort<br />
tatsächlich auch physisch zum Einsatz<br />
kommt. Transparenz und Nachweise seien<br />
notwendig, um die Doppelnutzung der grünen<br />
Eigenschaft ausschließen zu können.<br />
Klaus betont, dass jeder Biomethanmarkt<br />
seine eigenen Interessen und eigenen Preise<br />
hat. Er sieht es als große Herausforderung<br />
an, diese Fakten alle auf einen Nenner<br />
zu bringen. Biomethan von Produzenten,<br />
die bereits in den Genuss einer Förderung<br />
kamen, hat einen anderen Marktpreis als<br />
das, das komplett ohne Subventionen produziert<br />
wurde.<br />
„Für eine getrennte Vermarktung<br />
von Gas und biogener Eigenschaft<br />
ist ein wirtschaftlicher Mehrwert<br />
entscheidend“<br />
Johannes Klaus<br />
Nun kann aber nicht nur Biomethan als<br />
Gas zusammen mit grünen Eigenschaften<br />
gehandelt werden. Vielmehr können die<br />
grünen Eigenschaften auch abgetrennt und<br />
separat gehandelt werden. So könnte zum<br />
Beispiel theoretisch ein Biomethanproduzent<br />
in Österreich die grünen Eigenschaften<br />
nach Schweden verkaufen. Der schwedische<br />
Einkäufer hat genug Gas, aber ihm<br />
fehlen die biogenen Eigenschaften. Dann<br />
könne es Sinn machen, das grüne Biomethan<br />
aus Österreich nicht physisch teuer<br />
nach Schweden zu liefern, sondern nur die<br />
biogenen Eigenschaften.<br />
Es muss dann jedoch sichergestellt sein,<br />
dass der österreichische Biomethanerzeuger<br />
die grünen Eigenschaften nicht noch<br />
ein zweites Mal verkauft. Der österreichische<br />
Produzent kann das Methan ohne die<br />
grünen Eigenschaften nur noch als Erdgas<br />
vermarkten. „Wenn wir Biomethan physisch<br />
transportieren, dann transportieren<br />
wir immer das Gas mit seinen grünen Eigenschaften.<br />
Das ist aneinandergekoppelt.<br />
Massenbilanziell müssen die Mengen erfasst<br />
werden. In Deutschland benötigen wir<br />
für die EEG-Nutzung sowohl das physische<br />
Gas als auch die grünen Eigenschaften“,<br />
macht Schneider aufmerksam.<br />
Im Kraftstoffsektor, so Klaus, ist auch beides<br />
aneinandergekoppelt, auch über Ländergrenzen<br />
hinweg. Die Abtrennung der<br />
grünen Eigenschaften gehe nur im freien<br />
Markt. „Für eine getrennte Vermarktung<br />
von Gas und biogener Eigenschaft ist ein<br />
wirtschaftlicher Mehrwert entscheidend.“<br />
Seit 2016 gibt es ein Abkommen zum<br />
Herkunftsnachweisaustausch zwischen<br />
Deutschland und Österreich. Das Abkommen<br />
beinhaltet unter anderem, dass eine<br />
Schnittstelle eingerichtet wird zwischen<br />
dem dena-Biogasregister und dem AGCS-<br />
Register in Österreich.<br />
Dies bietet die Möglichkeit, Biomethan<br />
bidirektional zu handeln. Die ERGaR versucht,<br />
auf einer Metaebene eine Schnittstelle<br />
zu bilden, sodass einzelne Länder<br />
nicht mehr miteinander<br />
einzelne Vereinbarungen<br />
treffen müssen,<br />
sondern vielmehr eine<br />
Schnittstelle mit der<br />
ERGaR – welche die<br />
länderspezifischen Anforderungen<br />
versucht<br />
zu standardisieren –<br />
eingehen.<br />
Wie die einzelnen Grünen Gase in Zukunft<br />
preislich aufgestellt sein werden, können<br />
die bmp-greengas-Experten heute nicht<br />
prognostizieren. Heute seien Wasserstoff<br />
und Synthesegas aus Power-to-Gas-Anwendungen,<br />
in denen preiswerter Wind- und<br />
Solarstrom genutzt werden, deutlich teurer<br />
in der Produktion als Biomethan aus nachwachsenden<br />
Rohstoffen oder Abfallstoffen.<br />
Schneider: „Das wird gefühlt in den nächsten<br />
fünf Jahren allemal noch so sein. Wir gehen<br />
nicht davon aus, dass in den nächsten<br />
fünf Jahren so viele Power-to-Gas-Anlagen<br />
gebaut werden, die genauso viel Energie<br />
produzieren wie alle Biomethananlagen,<br />
die es heute in Deutschland gibt.“<br />
bmp greengas beabsichtigt, das Geschäft<br />
mit neuen Grüngas-Produkten und -Dienstleistungen<br />
weiter auszubauen. Dazu zählt<br />
zum Beispiel Bio-LNG, das nach Ansicht<br />
des Unternehmens eine echte Alternative<br />
für den Mobilitätsmarkt ist und die Stickoxidbelastung<br />
schneller und effizienter<br />
reduzieren kann, als es der zeitintensivere<br />
Ausbau der E-Mobilität ermöglicht.<br />
Biomethan aus Rest- und<br />
Abfallstoffen ist gefragt<br />
Erfahrungen im internationalen Biomethanhandel<br />
hat auch die ARCANUM<br />
Energy aus Unna in Nordrhein-Westfalen<br />
gesammelt. Marcel Leue, Berater für den<br />
49<br />
Auszug aus unserem<br />
Produktsortiment<br />
Gaszähler<br />
Systemtechnik<br />
Wärmezähler<br />
Stromzähler<br />
INFOS ANFORDERN – Fax: 07 11 / 35 16 95 - 29<br />
E-Mail: info@molline.de<br />
www.molline.de/kontakt<br />
www.molline.de
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Erdgas-Transportnetz<br />
Schweiz<br />
Absatzpfad Biomethan, sagt, dass der Biomethanhandel<br />
in Europa noch in den Kinderschuhen steckt. Er bestätigt,<br />
dass insbesondere Lieferungen von Deutschland<br />
in die Schweiz stattfinden, die auch von Arcanum abgewickelt<br />
werden. Darüber hinaus existiere ein gewisses<br />
Interesse in Großbritannien, wobei es dabei aber eher<br />
um Zertifikate gehe, also um die grünen Eigenschaften<br />
des Biomethans.<br />
„Einkäufer aus der Schweiz kommen auf uns zu und<br />
suchen Biomethan aus Rest- und Abfallstoffen. NawaRo-Gas<br />
ist im Ausland eher problematisch und wird<br />
weniger gewünscht aufgrund des negativen Images von<br />
Energiepflanzen. Abfallgas ist zudem preislich attraktiver<br />
als NawaRo-Gas. Letzteres ist etwa 1 Cent pro<br />
Kilowattstunde teurer. Wenn wir als Makler von einem<br />
Schweizer Einkäufer kontaktiert werden, dann suchen<br />
wir für ihn das passende Biomethan zum passenden<br />
Preis mit der notwendigen Zertifizierung“, berichtet<br />
Leue.<br />
Für eigene Kunden, aber auch für Fremdkunden<br />
wird im Hause Arcanum die Massenbilanzierung<br />
vorgenommen. In der Regel sei es so,<br />
dass die gekaufte Gasmenge in Deutschland in<br />
einen Bilanzkreis gegeben und anschließend<br />
von einem Schweizer Akteur in die Schweiz<br />
transportiert werde. In der Schweiz bestehe<br />
ein bestimmtes Anreizsystem. Dabei handele<br />
es sich um eine CO 2<br />
-Abgabe, die um rund 1,4<br />
Cent je kWh (aktuell 84 CHF je Tonne CO 2<br />
)<br />
reduziert werde, wenn Biomethan eingesetzt<br />
wird. Ab dem Jahr <strong>2018</strong> steigt die CO 2<br />
-Abgabe<br />
auf 96 CHF je Tonne CO 2<br />
. Deutsches Biogas<br />
werde leider von der Schweiz in der CO 2<br />
-Besteuerung<br />
noch nicht anerkannt. Immer, wenn<br />
deutsches Biomethan per Erdgasleitungsnetz<br />
über die Grenze gehe, dann werde daraus per Hauptzollamt<br />
Erdgas.<br />
Quelle: VSG<br />
Schweizer Energieversorger bieten Erdgas-<br />
Biomethan-Mischprodukte an<br />
„Der ökologische, biogene Mehrwert des Biomethans<br />
wird an der Grenze sozusagen abgetrennt und gelangt<br />
separat in die Schweiz. Dadurch wird für deutsches<br />
Biomethan die volle CO 2<br />
-Steuer fällig. Genutzt wird<br />
das Gas in dem Alpenstaat hauptsächlich von den<br />
Energieversorgern als Beimischprodukt zum Erdgas.<br />
Viele Stadtwerke haben dem „klassischen“ Erdgasprodukt<br />
ihrer Kunden einen Anteil von 5 bis 10 Prozent<br />
Biomethan beigemischt. Die Kunden setzen es zur<br />
Wärmegewinnung ein. Die Kunden haben aber auch<br />
die Möglichkeit, das Mischgasprodukt abzulehnen“,<br />
stellt Leue dar.<br />
WACHSTUMS-<br />
MARKT<br />
FRANKREICH<br />
Nutzen Sie den Biogas-Boom<br />
Unser deutsch-französisches Berater-Team räumt für für Sie Sie alle alle<br />
Hürden beiseite.<br />
In akkordierter Zusammen arbeit unterstützen wir wir Sie: Sie:<br />
→ Gestaltung des rechtlichen Rahmens:<br />
von der Firmengründung bis zum Genehmigungsverfahren<br />
→ Erstellung von Finanzierungskonzepten<br />
→Beantragung von Investitionszuschüssen<br />
→ Verhandlungen mit französischen Banken und und Investoren<br />
→Bei Markteintritt und -erschließung<br />
→ Deutsch-französische Steuerberatung<br />
Ihr Ihr Kontakt zu uns:<br />
biogas@sterr-koelln.com<br />
50<br />
WWW.STERR-KOELLN.COM<br />
WWW.STERR-KOELLN.COM<br />
RECHTSANWÄLTE<br />
RECHTSANWÄLTE<br />
WIRTSCHAFTSPRÜFER<br />
WIRTSCHAFTSPRÜFER<br />
STEUERBERATER<br />
STEUERBERATER<br />
UNTERNEHMENSBERATER<br />
UNTERNEHMENSBERATER<br />
BERLIN<br />
PARIS BERLIN<br />
FREIBURG PARIS<br />
STRASBOURG<br />
FREIBURG<br />
STRASBOURG
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
praxis / Titel<br />
Weil die Energieversorger so konsequent vorgingen, sei<br />
der Biomethanabsatz in der Schweiz auf recht hohem<br />
Niveau. Die grünen Eigenschaften gelangen in Form<br />
von Qualitätsnachweisen über die Grenze. Über den<br />
Weg der Massenbilanzierung könne Arcanum sicherstellen,<br />
dass der grüne Mehrwert den Energieversorger<br />
erreicht. Für den grünen Mehrwert werde auch ein Preis<br />
festgelegt. Leue ergänzt: „Es gibt in der Schweiz aber<br />
auch Kunden, die nur die grünen Eigenschaften des<br />
Biomethans haben wollen ohne den Gastransport.“<br />
Die CO 2<br />
-Steuer ließe sich nur sparen, wenn eine Pipeline<br />
zum Beispiel von Deutschland direkt in die Schweiz<br />
gelegt würde, durch die nur Biogas strömt. Die grünen<br />
Eigenschaften, die in die Schweiz gehen, werden aus<br />
dem Massenbilanzsystem von Arcanum ausgebucht.<br />
Per Dokument belegt Arcanum, dass die Mengen aus<br />
dem deutschen System raus sind. Die Werte der grünen<br />
Eigenschaften werden an das interne System der<br />
Schweizer Akteure übergeben.<br />
Laut Leue macht jeder Marktteilnehmer im Grunde seine<br />
eigene Massenbilanz. Die Biogas-Clearingstelle in der<br />
Schweiz habe ein wachendes Auge auf das Bilanzsystem.<br />
„Die kontrollieren sowohl die inländisch produzierte<br />
Biomethanmenge als auch auf freiwilliger Basis die<br />
importierten Mengen“, weiß der Consultant. Hinderlich<br />
im Marktgeschehen sei, dass immer, wenn Biomethan<br />
ins Ausland gelange, es keine zentrale Stelle gebe, bei<br />
der Zertifikate beziehungsweise grüne Eigenschaften gebündelt<br />
und nach Verbrauch gelöscht werden.<br />
Für den physikalischen Gasfluss fallen Entgelte an, die<br />
von Land zu Land individuell ausgestaltet sind. In der<br />
Schweiz existiert zum Beispiel kein Entry-Exit-System<br />
wie in Deutschland, wo bei der Durchleitungsgebühr<br />
die Leitungslänge keine Rolle spielt. In der Schweiz<br />
dagegen werden die Durchleitungskosten danach bestimmt,<br />
wo der Gasabnehmer seinen Sitz hat und wie<br />
lang der Weg des Gases durch die Leitung zu ihm ist.<br />
Wichtiges Urteil vom Europäischen<br />
Gerichtshof<br />
Interesse an deutschem Biomethan von schwedischer<br />
Seite hat auch Leue festgestellt. Im Zusammenhang<br />
mit Schweden verweist er auf ein Urteil des Europäischen<br />
Gerichtshofs (EuGH) von Mitte 2017. In dem<br />
konkreten Fall ging es darum, dass ein Akteur aus<br />
Deutschland nach REDcert zertifiziertes Biomethan in<br />
den schwedischen Kraftstoffsektor bringen wollte. Daraufhin<br />
hat die schwedische Energieagentur den Import<br />
abgelehnt mit der Begründung, dass sie REDcert nicht<br />
anerkennt.<br />
Daraufhin wurde der Fall vor den EuGH gebracht und<br />
dort verhandelt. Das Urteil des Gerichtshofs besagt,<br />
dass ein Inlandsvorbehalt aufgrund dieser Begründung<br />
nicht möglich sein darf. Wenn die schwedische Energieagentur<br />
grundsätzlich das System einer Massenbilanzierung<br />
akzeptiert, dann müssen auch europaweit<br />
diese Systeme anerkannt werden. Wenn es jedoch einen<br />
Inlandsvorbehalt wie im deutschen EEG gibt, dann<br />
bleibt dieser Vorbehalt bestehen. Leue ist sich sicher,<br />
dass der Biomethanhandel Fahrt aufnehmen könnte,<br />
wenn Hemmnisse wie die unterschiedlichen Massenbilanzierungssysteme<br />
standardisiert würden. Jedes Land<br />
habe verschiedene Anforderungen an ein Biomethangas,<br />
wodurch es schwierig sei, einen Markt zu schaffen,<br />
der richtig harmonisch ist.<br />
Arcanum selbst ist aktiv, um den Biomethanhandel zu<br />
vereinfachen. Mit Biomethanmarkt.de hat das Unternehmen<br />
eine Initiative gestartet, um ursprünglich das<br />
Portfolio – insbesondere am Jahresende – auszugleichen<br />
und um automatisiert und standardisiert handeln<br />
Beiden wurde<br />
„maßgeschneidert“<br />
verkauft!<br />
Unsere maßgeschneiderten Mikronährstoffmischungen basieren immer auf exakter<br />
Analyse und bedarfsindividueller Produktion. Jede einzelne Mischung. Garantiert.<br />
www.schaumann-bioenergy.eu · Telefon +49 4101 218-5400<br />
51
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
zu können. Produzenten und Verbraucher<br />
können sich auf der Plattform registrieren.<br />
Sie können selber ein Angebot oder ein Gesuch<br />
einstellen. „Wenn einer der Handelspartner<br />
das Gebot oder Gesuch sieht, kann<br />
er mit nur zwei Mausklicks das Geschäft<br />
bestätigen“, freut sich Leue. Dadurch ist<br />
der Handel dann schon zustande gekommen.<br />
Im Vorfeld werden Rahmenverträge<br />
unterzeichnet, mit denen die Akteure die<br />
Bedingungen akzeptieren.<br />
Über die Plattform ist es möglich, alle<br />
EEG-Produkte zu handeln. Separat lassen<br />
sich auch Kraftstoffgas, Bilanzkreisflexibilität<br />
und auch individuelle<br />
Biomethanqualitäten, die Produzenten<br />
selber definieren, handeln. Die Plattform<br />
ist auch in englischre Sprache verfügbar.<br />
Dahinter steckt die Idee der internationalen<br />
Markterschließung. Zurzeit sind aber<br />
nur Deutschland und die Schweiz auf der<br />
Plattform vertreten.<br />
dena-Analyse sieht Zukunft für<br />
grüne Gase<br />
Biomethan und anderen grünen Gasen<br />
misst die Deutsche Energie-Agentur (dena)<br />
große Bedeutung bei. In einer kürzlich veröffentlichten<br />
Analyse, in der die Rolle und<br />
der Beitrag von Biomethan im Klimaschutz<br />
heute und im Jahr 2050 untersucht worden<br />
sind, kommen die Autoren zu dem Schluss,<br />
dass ein erhebliches Potenzial an nachhaltig<br />
nutzbarer Biomasse für den Ausbau der<br />
Biomethanerzeugung in Deutschland – unter<br />
Berücksichtigung der Nahrungs- und<br />
Futtermittelproduktion – bereitsteht.<br />
Biomethan könne einen signifikanten Beitrag<br />
zur treibhausgasneutralen und kosteneffizienten<br />
Energieversorgung sowie zur<br />
Gewährleistung der Versorgungssicherheit<br />
in Deutschland leisten. Derzeit werden, so<br />
die Analyse, in Deutschland jährlich etwa<br />
96 bis 106 TWh Hs<br />
Biogas aus industriellen<br />
Rest- und Abfallstoffen, kommunalen Reststoffen,<br />
in geringem Maße aus Stroh, tierischen<br />
Exkrementen sowie Energiepflanzen<br />
erzeugt. Hiervon werden aktuell rund 9<br />
TWh Hs<br />
, also etwa 10 Prozent, zu Biomethan<br />
aufbereitet. Durch die konsequente Erschließung<br />
von Rest- und Abfallstoffen,<br />
tierischen Exkrementen und in geringem<br />
Maße Energiepflanzen können 71 bis 88<br />
TWh Hs<br />
zusätzliches Biogas erzeugt werden.<br />
Ein weiteres Biomethanpotenzial stelle die<br />
Umrüstung von 10 bis 20 Prozent der etwa<br />
9.000 bestehenden Biogasanlagen dar,<br />
wodurch in den kommenden Jahren etwa<br />
10 bis 21 TWh Hs<br />
Biomethan erzeugt werden<br />
könnten. In Summe betrage das mobilisierbare<br />
Biomethanpotenzial bis zu 118<br />
TWh Hs<br />
. Regularien wie die Industrieemissionsrichtlinie<br />
(IED) und die Verordnung<br />
über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden<br />
Stoffen (AwSV) erschweren die<br />
Erzeugung von Biomethan aus Abfall- und<br />
Reststoffen.<br />
Um die Biogaserzeugung der bestehenden<br />
9.000 Biogasanlagen zu optimieren, die<br />
nicht an das Gasnetz angeschlossen sind,<br />
müssen laut dena-Analyse die Rahmenbedingungen<br />
zur Biogasaufbereitung und<br />
-einspeisung, wie zum Beispiel das Genehmigungsrecht,<br />
verbessert werden. Durch<br />
den Einsatz von 118 TWh Hs<br />
Biomethan<br />
könnten<br />
ffmehr als 12 Mio. Pkw (durchschnittliche<br />
Fahrleistung: 14.000 km/a, durchschnittlicher<br />
Verbrauch: umgerechnet<br />
5 kg/100 km) betrieben werden oder<br />
ff185.000 Lkw (durchschnittliche<br />
Fahrleistung: 120.000 km/a, durchschnittlicher<br />
Verbrauch: umgerechnet<br />
38 kg/100 km) betrieben werden oder<br />
ffüber 8 Mio. Einfamilienhäuser beheizt<br />
oder<br />
ffan die 12,5 Mio. 4-Personenhaushalte<br />
mit Strom versorgt werden.<br />
Und, so die Studie: „In 2050 fließt durch<br />
das Gasnetz weitestgehend CO 2<br />
-neutral<br />
erzeugtes Gas aus Power-to-Gas-Anlagen<br />
und Biomethan. Damit dient die Gasinfrastruktur<br />
als Transportmittel und Speicher<br />
für dezentral erzeugte erneuerbare Gase,<br />
um die dargebotsabhängige Erzeugung aus<br />
Sonnen- und Windenergie an den jeweiligen<br />
Verbrauchszentren zu ergänzen. […]<br />
Ein europäischer Markt für erneuerbare<br />
Gase existiert und wird durch das europaweit<br />
vernetzte Gasnetz getragen. Das Gasnetz<br />
– ergänzt um den Transport von LNG –<br />
ermöglicht so den systemoptimalen und<br />
kosteneffizienten Einsatz von erneuerbaren<br />
Gasen und dient der Sektorkopplung.<br />
Ein klares politisches Bekenntnis für erneuerbare<br />
Gase schafft Vertrauen bei Investoren,<br />
der Energiewirtschaft und den<br />
Akteuren, die auf Biomethan und andere<br />
erneuerbare Gase heute und in Zukunft<br />
setzen. Bereits getätigte Investitionen in<br />
die rund 200 Biogasaufbereitungsanlagen<br />
sowie die dezentrale Erdgasinfrastruktur<br />
können dadurch gesichert und für systemdienliche<br />
Aufgaben ertüchtigt werden.<br />
Die heimischen Biogaspotenziale sollten<br />
kontinuierlich erschlossen und durch die<br />
Aufbereitung und Einspeisung von Biomethan<br />
systemoptimal für die Umsetzung<br />
der Energiewende verfügbar gemacht werden.<br />
Durch die Kombination von Biogasanlagen<br />
mit PtG-Technologien kann das<br />
Potenzial zur Erzeugung an erneuerbaren<br />
Gasen erhöht und die CO 2<br />
-Reduktion optimiert<br />
werden.“<br />
Fest steht: Deutschland wird auf eigener<br />
Fläche etwa 10 Milliarden Kubikmeter<br />
Biomethan nachhaltig bereitstellen können,<br />
was etwa 11 Prozent des Verbrauchs<br />
entspricht. Dann bleibt noch eine Menge<br />
von 80 bis 85 Milliarden Kubikmeter, die<br />
grün werden muss. Das bedeutet, dass diese<br />
Menge in Zukunft aus regenerativen Gasen<br />
wie Wasserstoff und Synthesemethan<br />
produziert werden muss. Dazu wird noch<br />
mehr Wind- und Solarstrom benötigt. Diese<br />
beiden Ressourcen sind somit nicht nur<br />
zur Elektrizitätserzeugung wichtig, sondern<br />
auch für die künftige Gasversorgung.<br />
Parallel müssen Brennstoffmengen durch<br />
intensive solarthermische Nutzung ersetzt<br />
werden. Dann könnte auch die Menge der<br />
benötigten regenerativen Gase sinken. Die<br />
CO 2<br />
-Neutralisierung des Verkehrssektors<br />
kommt noch dazu. Dieser Sektor hat heute<br />
in Deutschland einen Energieverbrauch<br />
von rund 720 Terawattstunden. Würde dieser<br />
Sektor komplett gasifiziert, wären noch<br />
einmal 72 Milliarden Kubikmeter Grüngas<br />
notwendig.<br />
Dann muss noch der Heizölsektor grün werden.<br />
Wie viel regeneratives Gas Deutschland<br />
in Zukunft benötigt und selbst aus<br />
Biomasse und Strom produziert, hängt von<br />
der Akzeptanz der Bevölkerung ab, von den<br />
politischen Rahmenbedingungen und von<br />
dem Umfang der Solarthermienutzung.<br />
Sehr wahrscheinlich werden grüne Gase<br />
künftig in nennenswerter Menge importiert<br />
werden.<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Redakteur Biogas Journal<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Tel. 0 54 09/90 69 426<br />
E-Mail: martin.bensmann@biogas.org<br />
52
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
praxis / Titel<br />
Biogas_115x77_EVIT.qxp_EVIT 07.12.17 18:00 Seite 1<br />
Februar <strong>2018</strong><br />
28<br />
DAU<br />
Sind Sie<br />
mit Ihrem<br />
KWK-Bonus<br />
zufrieden?<br />
Letzter Termin für Betreiber von Biogasanlagen<br />
und anderen KWK-Anlagen, zur Sicherstellung von<br />
- Güllebonus<br />
- KWK-Bonus<br />
- NawaRo-Bonus<br />
- Einsatzstoffenklassen-Vergütung<br />
- 60% KWK-Kriterium<br />
Dazu benötigen Sie den Nachweis durch einen<br />
zugelassenen Umweltgutachter. Stichtag für das<br />
Jahr 2017 ist der 28. Februar <strong>2018</strong>.<br />
EVIT GmbH Energie-Unternehmensberatung und Umweltgutachterorganisation für Strom-, Wärmeund<br />
Kälteversorgung sowie Strom aus erneuerbaren Energien und Wasserkraft<br />
Passende Rührtechnik für jedes Substrat<br />
Wir<br />
sind die Umwelt-<br />
gutachter-<br />
KWK-Experten!<br />
Anmeldetermin nicht<br />
verpassen! Setzen Sie sich<br />
mit uns in Verbindung:<br />
Ingenieurbüro<br />
Unternehmensberatung<br />
Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing.<br />
Hansjörg Pfeifer<br />
Dipl.-Ing. Adam Bürger<br />
Schleißheimer Straße 180<br />
80797 München<br />
Telefon 089/30 00 60-0<br />
Telefax 089/30 00 60-60<br />
Rietstraße 3<br />
78050 VS-Villingen<br />
Telefon 077 21/ 998 88 12<br />
Telefax 077 21/ 998 88 20<br />
E-Mail info@evitgmbh.de<br />
www.evitgmbh.de<br />
www.umweltgutachter.eu<br />
Ihr starker Partner für:<br />
l mobile Feststoffbeschickung<br />
besonders geeignet<br />
für Umbau-/<br />
Sanierungsarbeiten<br />
und in<br />
Störfällen<br />
Substrat-<br />
Aufbereitungs- und<br />
Zerkleinerungstechnik<br />
für jedes Substrat<br />
die richtige Aufbereitungstechnik:<br />
l Prallzerkleinerer<br />
HPZ 1200<br />
l speziell für verschleißintensive<br />
Substrate oder<br />
organische<br />
Abfälle<br />
Anlagenbau<br />
NEU<br />
– Alle Rührwerkstypen<br />
– Über 25 Jahre Erfahrung<br />
– Optimierung, Nachrüstung, Tausch<br />
Tel. +49.7522.707.965.0 www.streisal.de<br />
Schubbodencontainer<br />
in<br />
Stahlbauweise<br />
l Volumen<br />
40 – 200 m 3 , als<br />
Twin bis 300 m 3<br />
l VA-Schubrahmen,<br />
Kunststoffauskleidung<br />
l wahlweise<br />
Dosier- oder<br />
Fräswalzen<br />
Zugbodensystem in<br />
Betonbauweise<br />
l Ober-/Unterflur<br />
befahrbar<br />
l Volumen<br />
80 – 175 m 3<br />
l VA-Schubrahmen,<br />
Kunststoffauskleidung<br />
l hydr. Verschlussrampe<br />
l hydraulische<br />
Abdeckung<br />
Kompaktsystem<br />
l komplett aus<br />
Edelstahl<br />
l Volumen<br />
13 – 33 m 3<br />
l mit 2 Dosierwalzen<br />
AGROTEL GmbH • 94152 NEUHAUS/INN • Hartham 9<br />
Tel.: + 49 (0) 8503 / 914 99- 0 • Fax: -33 • info@agrotel.eu<br />
53<br />
Ein UnTERnEHMEn<br />
DER HUninG GRUPPE<br />
HUNING Anlagenbau GmbH & Co. KG<br />
Wellingholzhausener Str. 6, D-49324 Melle<br />
Tel. +49 (0) 54 22/6 08-2 60<br />
Fax +49 (0) 54 22/6 08-2 63<br />
info@huning-anlagenbau.de<br />
www.huning-anlagenbau.de
Praxis<br />
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Stoffstrombilanzverordnung<br />
Neue Regelung seit Anfang Januar<br />
Mit der Verabschiedung des novellierten Düngegesetzes ist die Aufzeichnung der Nährstoffströme zum<br />
1. Januar <strong>2018</strong> für Landwirte und Betreiber von Biogasanlagen verpflichtend geworden. Die neue Verordnung<br />
über den Umgang mit Nährstoffen im Betrieb, auch Stoffstrombilanzverordnung (StoffBilV) genannt, konkretisiert,<br />
wie die Nährstoffsaldierung auf betrieblicher Basis ausgestaltet werden muss.<br />
Von M.Sc. Ramona Weiß<br />
Im Gegensatz zum Nährstoffvergleich,<br />
der im Rahmen der Düngeverordnung<br />
angefertigt wird, handelt es sich bei<br />
der Stoffstrombilanz um eine „Hoftor“-<br />
Berechnung. Dabei werden sämtliche<br />
Nährstoffein- und -austräge in dem System<br />
„Biogasanlage“ oder „Landwirtschaftlicher<br />
Betrieb“, sofern vorhanden, abzugslos<br />
(einschließlich der „unvermeidbaren<br />
Verluste“) berücksichtigt. Nährstoffe, die<br />
beispielsweise in Form von Futtermitteln<br />
oder Saatgut in den Betrieb kommen, werden<br />
mit den Mengen an pflanzlichen und<br />
tierischen Erzeugnissen, wie zum Beispiel<br />
Gülle, Wirtschaftsdünger, Ackerfrüchte<br />
oder Nutztiere, verglichen, die den Betrieb<br />
wieder verlassen.<br />
Der Bundesrat hat am 24. November über<br />
das Verfahren abgestimmt, nach dem die<br />
Stoffstrombilanzierung in Zukunft erfolgen<br />
muss. Zentrale Forderung des Ausschusses<br />
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit<br />
war es, eine allgemein gültige<br />
Obergrenze von 175 Kilogramm (kg) Stickstoff<br />
(N) pro Hektar (ha) einzuführen. Da<br />
Biogasanlagen in der Regel aus steuerrechtlichen<br />
Gründen von landwirtschaftlichen<br />
Betrieben getrennt sind, verfügen diese<br />
über keine eigenen Flächen, deshalb hätte<br />
diese Art der Bilanzierung unter keinen<br />
Umständen durchgeführt werden können.<br />
Der Fachverband Biogas hat sich daher für<br />
eine Auswahlmöglichkeit zwischen dem<br />
neu vorgeschlagenen und dem bereits enthaltenen<br />
System ausgesprochen, bei dem<br />
die Differenz zwischen Nährstoffzu- und<br />
-abfuhr nicht mehr als 10 Prozent zwischen<br />
einem berechneten, theoretischen Wert und<br />
den tatsächlich zu- und abgeführten Nährstoffmengen<br />
betragen darf. Der Bundesrat<br />
ist dieser Empfehlung, die auch von zahlreichen<br />
landwirtschaftsnahen Gremien und<br />
Verbänden unterstützt wurde, gefolgt.<br />
Damit haben Landwirte in Zukunft die<br />
Wahl, ob die Stoffstrombilanz auf Basis einer<br />
Stickstoffobergrenze in Höhe von 175<br />
Kilogramm N/ha angefertigt wird oder auf<br />
Grundlage des berechneten prozentualen<br />
Verhältnisses. Der Betriebsinhaber muss<br />
spätestens drei Monate nach der Zu- und<br />
Abfuhr von Düngemitteln sowie Nutztieren,<br />
Saatgut oder Ackerfrüchten die entsprechenden<br />
Nährstoffmengen an Stickstoff<br />
und Phosphor aufzeichnen und die Belege<br />
sieben Jahre lang aufbewahren. Des Weiteren<br />
muss er jährlich spätestens sechs Monate<br />
nach Ablauf des festgelegten Bezugsjahres<br />
die betrieblichen Stoffstrombilanzen<br />
für Stickstoff bewerten. Als Bezugsjahr gilt<br />
entweder das Wirtschafts- oder Düngejahr.<br />
Ziele der neuen Verordnung<br />
Ziel der Stoffstrombilanzverordnung ist, wie<br />
bereits durch die Novellierung von Düngegesetz<br />
und Düngeverordnung angestrebt,<br />
Nährstoffverluste in die Umwelt so weit wie<br />
möglich zu vermeiden und die Effizienz der<br />
Düngung zu erhöhen. Mittelfristig soll die<br />
neue Verordnung dazu beitragen, dass die Nitratbelastung<br />
im Grundwasser reduziert wird.<br />
Wer muss bilanzieren? Die Pflicht zur Erstellung<br />
einer Stoffstrombilanz gilt ab dem<br />
1. Januar <strong>2018</strong> für viehstarke Betriebe<br />
mit über 50 Großvieheinheiten (GVE) oder<br />
mehr als 30 Hektar landwirtschaftlicher<br />
Nutzfläche jeweils bei einer Tierbesatzdichte<br />
von mehr als 2,5 GVE/ha. Ab dem<br />
Jahr 2023 werden zudem auch Betriebe ab<br />
20 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche oder<br />
mehr als 50 GV zur Bilanzierung verpflichtet.<br />
Die StoffBilV gilt bereits ab dem 1. Januar<br />
<strong>2018</strong> unabhängig der Betriebsgröße<br />
auch für Betriebe, die eine Biogasanlage<br />
unterhalten, sofern dort Wirtschaftsdünger<br />
aus tierischen Ausscheidungen wie Gülle<br />
oder Mist eingesetzt wird.<br />
Grundsätzlich ist nur eine kleine Gruppe<br />
landwirtschaftlicher Betriebe von der Bilanzierung<br />
ausgenommen. Hierunter fallen<br />
demnach Betriebe, die Gärprodukte von<br />
maximal 750 Kilogramm aufnehmen und<br />
bei denen zudem keine Anhaltspunkte für<br />
einen Verstoß innerhalb des Nährstoffvergleichs<br />
nach der Düngeverordnung vorliegen.<br />
Gerechnet mit einem Stickstoffanfall<br />
von 5 Kilogramm pro Rind und Jahr, dürfte<br />
ein Kleinbauer maximal 7,5 Rinder halten,<br />
wenn er die Gülle an eine Biogsanlage liefert<br />
und im Gegenzug wieder den Nährstoffgehalt<br />
als Gärprodukt erhält (Annahme: 20<br />
Kubikmeter Gülleanfall pro Rind).<br />
Übertragen auf einen rein ackerbaulichen<br />
Betrieb entspräche das einem Feld von 4<br />
Hektar (Annahme 1 ha NawaRo entspricht<br />
40 Kubikmeter Gärprodukt). Jeder Betrieb,<br />
der Gärprodukte mit mehr als 750 Kilogramm<br />
aufnimmt, muss eine Bilanz erstellen.<br />
In der Folge könnte es dazu kommen,<br />
dass sich Landwirte womöglich weigern,<br />
Gärprodukte aus Biogasanlagen aufzunehmen,<br />
wenn sie sonst von den Kriterien zur<br />
Erstellung einer Stoffstrombilanz ausgenommen<br />
wären.<br />
Konsequenz<br />
Wer vorsätzlich nicht oder nicht richtig aufzeichnet,<br />
wird einer Beratung zum nachhaltigen<br />
und ressourceneffizienten Umgang<br />
mit Nährstoffen unterzogen oder mit einer<br />
Ordnungswidrigkeit belangt. Basieren die<br />
falschen Aufzeichnungen auf Verstößen<br />
gegenüber den Vorgaben der Düngeverordnung<br />
wie Sperrfristen, Lagerkapazität<br />
oder anderen Kriterien, können die Strafen<br />
Cross-Compliance relevant sein.<br />
Autorin<br />
M.Sc. Ramona Weiß<br />
Fachreferentin Abfall, Düngung und Hygiene<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Angerbrunnenstr. 12 · 85356 Freising<br />
Tel. 0 81 61/98 46 820<br />
E-Mail: ramona.weiss@biogas.org<br />
www.biogas.org<br />
54
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Praxis<br />
Unsere Produkte:<br />
Gasdruckerhöhung<br />
für Biogas, Erdgas, Klärgas, etc.<br />
Zum Einsatz in den Ex-Zonen 1 und 2 gemäß der<br />
ATEX Richtlinie 2014/34/EU<br />
MAPRO® Gasverdichter sind keine Zündquellen<br />
NEU! Wartung zum Festpreis<br />
Der STORM-Service<br />
für Ihre Biogas-Anlage<br />
- Störungsbehebung<br />
- Instandsetzung<br />
- Wartung/Inspektion<br />
- Ersatzteilversorgung<br />
Schnell und kompetent - überall<br />
in Ihrer Nähe - 24 h täglich*<br />
Seitenkanalverdichter<br />
0-800 mbar | 0-1900 m³/h<br />
Radialventilatoren<br />
0-155 mbar | 0-2600 m³/h<br />
Drehschieberkompressoren<br />
0,5-3,5 bar | 22-2900 m³/h<br />
Mehrstufige-Zentrifugalverdichter<br />
0-950 mbar | 0-3550 m³/h<br />
August Storm GmbH & Co. KG · August-Storm-Straße 6 · 48480 Spelle<br />
Fon: +49 5977 73-0 · Fax: +49 5977 73-138 · www.a-storm.com · info@a-storm.com<br />
MAPRO® Deutschland GmbH<br />
www.maprodeutschland.com<br />
E-Mail: deutschland@maproint.com<br />
Tel.: +49 (0) 211 98485400<br />
Grünsalz (0176) 476 494 69<br />
Unser Grünsalz hilft Biogasanlagenbetreibern,<br />
die billig und unkompliziert schon im Fermenter<br />
entschwefeln wollen. Hervorragende Wirkung!<br />
Angebot: BigBag mit 1 to für nur<br />
498,00 € netto frei BGA in Deutschland<br />
Alle Angebote unter www.ilmaco-vertrieb.de<br />
ILMACO Vertrieb oHG mb@ilmaco.de<br />
Fischerstr. 13 · 84137 Vilsbiburg · (0176) 476 494 69<br />
Sachverständigenbüro<br />
Gernandt Osterkamp Stengert<br />
Unser Unternehmen ist seit rund 20 Jahren in der Biogas-Branche tätig.<br />
Leistungen<br />
• Ursachenermittlung bei Leistungsreduzierungen<br />
• Detaillierte Ermittlung von Schadenursachen<br />
• Durchführung von Leistungstests<br />
• Verhandlungsführung bei Lösungsfindung mit Versicherer, Betreiber,<br />
Herstellern und Servicefirmen auf Basis bestehender Verträge<br />
• Ausarbeitung von gerichtsfesten Gutachten<br />
• Kurzfristige Realisierung von Beweissicherungsterminen<br />
Kleinenbremer Straße 16, 32457 Porta Westfalica Tel. 0 57 22 / 9 12 90 - 0 / Fax - 99<br />
Biogas CLEAN und COOL!<br />
Wir machen Ihr Biogas sauber und trocken. Mit den individuellen Anlagen von Züblin<br />
Umwelttechnik zur Reinigung und Kühlung von Biogas: Der Aktivkohlefilter CarbonEx ® zur<br />
Feinentschwefelung, die GasCon Gaskühleinheit zur Kühlung, der BioSulfidEx oder –<br />
unser neuestes Produkt – der BioBF zur biologischen Vorentschwefelung.<br />
www.zueblin-umwelttechnik.com<br />
Züblin Umwelttechnik GmbH, Otto-Dürr-Str. 13, 70435 Stuttgart, Tel. +49 711 8202-0, umwelttechnik@zueblin.de<br />
Stuttgart • Berlin • Chemnitz • Dortmund • Hamburg • Nürnberg • Straßburg • Mailand • Rom • Bukarest<br />
55
Praxis<br />
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Mitarbeiter der Firma<br />
Eckart beim Anbringen<br />
von 12 Millimeter starken<br />
Robalonplatten an der<br />
Behälterinnenwand und<br />
den Konusschnecken<br />
eines Feststoffmischers.<br />
Ein zweites<br />
Leben für<br />
Dosierer<br />
Der in Österreich entwickelte<br />
Sinterkunststoff Robalon verlängert<br />
werksseitig montiert oder als<br />
Nachrüstung die Standzeit stark<br />
beanspruchter Komponenten von<br />
Biogasanlagen.<br />
Von Dipl.-Journ. Wolfgang Rudolph<br />
Die Biogasanlage Ardorf hoch<br />
im Norden Niedersachsens,<br />
nur wenige Kilometer von der<br />
Nordseeküste entfernt, produziert<br />
seit nunmehr zehn Jahren<br />
regenerative Energie. Den Komplex mit einer<br />
installierten Leistung von 2,7 Megawatt<br />
(MW) betreibt die Naturgas Ardorf GmbH<br />
& Co. KG im Auftrag von fünf Landwirten<br />
in der Region Wittmund. Die Anlage speist<br />
nicht nur Strom ins Netz, sondern liefert<br />
auch Wärme für rund 100 Haushalte und<br />
öffentliche Gebäude in Ardorf. Für die Turnhalle<br />
und das Lehrschwimmbecken erfolgt<br />
dies kostenlos.<br />
Der jährliche Input besteht aus 20.000 Tonnen<br />
(t) Mais, 6.000 t Gras, 6.000 t Getreide-<br />
GPS und 2.000 bis 3.000 t Rüben. Dieser<br />
Substratmix führte zu einer erhöhten Abnutzung<br />
der Grundmulde des Dosierers. Als die<br />
Stahlbleche an einigen Stellen bedenklich<br />
Fotos: Werkbilder<br />
dünn wurden, entschloss man sich 2010 zu<br />
einer Auskleidung des Behälters mit dem in<br />
der Branche damals noch weitgehend unbekannten<br />
Sinterkunststoff Robalon.<br />
„Dieses Experiment haben wir keinen<br />
Tag bereut“, sagt Geschäftsführer Rewert<br />
Wolbergs. Eine kürzlich durchgeführte Begutachtung<br />
habe ergeben, dass nach inzwischen<br />
sieben Betriebsjahren praktisch<br />
kein Verschleiß zu erkennen ist. Wegen der<br />
guten Erfahrungen kleidet der Betreiber<br />
nachfolgend auch die achtkantigen Schneckengehäuse<br />
der gut 20 Meter langen Feststoffzuführung<br />
der beiden Fermenter mit<br />
dem innovativen Werkstoff aus.<br />
Die Biogasanlage in Ardorf wurde damit<br />
zum Vorreiter eines Trends in der Anlageninstandhaltung.<br />
Nach Angaben von Servicebetrieben,<br />
die Robalon-Auskleidungen<br />
ausführen, nutzen heute jährlich etwa 40<br />
Biogasproduzenten diese Möglichkeit, um<br />
die Lebensdauer von Komponenten zum<br />
Mischen, Dosieren und Fördern fester Substrate<br />
zu verlängern.<br />
Bei Instandhaltung sind<br />
Alternativen gefragt<br />
Eine hohe Materialbeanspruchung gehört<br />
seit jeher zu den Herausforderungen im<br />
Biogasbereich. Das ständige Einwirken von<br />
chemischen Substanzen, insbesondere organischer<br />
Säuren, und Feuchtigkeit sowie<br />
die mechanische Beanspruchung durch<br />
holzige und sandige Bestandteile in den<br />
Substraten beschleunigt den Verschleiß von<br />
Behältern, Misch- und Förderschnecken<br />
aus Metall. Nicht selten müssen diese Baugruppen<br />
daher schon wenige Jahre nach Inbetriebnahme<br />
ausgewechselt werden.<br />
In Zeiten ausreichender Förderung der<br />
Biogasproduktion und eines jungen Anlagenbestands<br />
ließe sich der Austausch<br />
verschlissener Teile oder auch ganzer Baugruppen<br />
finanziell verkraften. Mittlerweile<br />
sind die Anlagen im Schnitt älter und damit<br />
insgesamt reparaturanfälliger. Die Kosten<br />
steigen, während die Erlöse für die Stromeinspeisung<br />
und gegebenenfalls den Wärmeverkauf<br />
gleich geblieben sind. Betreiber<br />
machen sich zudem Gedanken darüber,<br />
welche Investitionen zur Vorbereitung auf<br />
den Betrieb nach Auslaufen der 20-jährigen<br />
EEG-Förderung unter veränderten Rahmenbedingungen<br />
unerlässlich sind.<br />
Diese Situation eröffnet Produktinnovationen,<br />
die sich bislang außerhalb der Branche<br />
bewährt haben, Marktchancen im Bio-<br />
56
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Praxis<br />
Der verschleißfeste Kunststoff Robalon-S<br />
ist im Biogasbereich vielseitig einsetzbar.<br />
gasbereich. Eines dieser Produkte ist der Werkstoff Robalon. Er<br />
wurde vom österreichischen Kunststoffspezialisten Röchling Leripa<br />
Papertech ursprünglich für extrem belastete Maschinenteile<br />
bei der Stoffaufbereitung in der Papierindustrie entwickelt. Die<br />
vor einigen Jahren gestartete Anwendung im Biogasbereich, vornehmlich<br />
bei der Substratmischung, -dosierung und -förderung,<br />
erfolgt in Deutschland über die Firma Burdorf Landmaschinen in<br />
Wallenhorst (Niedersachsen) und deren Kooperationspartner.<br />
Ein Kunststoff macht Karriere im Biogasbereich<br />
Ausgangsmaterial für Robalon ist ultrahochmolekulares Polyethylen,<br />
kurz UHMW-PE. UHMW steht für ultra high molecular weight,<br />
denn der Kunststoff besteht aus sehr langkettigen und daher<br />
schweren Kohlenstoffmolekülen. Der Messwert dafür ist das Molekulargewicht.<br />
Ab einem Molekulargewicht von 1 Million Gramm<br />
pro mol (g/mol) spricht man von UHMW-PE. Mit zunehmendem<br />
Molekulargewicht verbessert sich die Verschleißfestigkeit. Standardmäßig<br />
werden Qualitäten mit einem Molekulargewicht von<br />
bis zu 5 Mio. g/mol verwendet. Besonders verschleißfeste Sonderqualitäten<br />
weisen 7 bis über 9 Mio. g/mol auf. Für die im Agrarund<br />
Biogasbereich eingesetzte Variante Robalon-S verwendet der<br />
Hersteller Röchling nach eigenen Angaben UHMW-PE mit einem<br />
Molekulargewicht von 9,2 Mio. g/mol.<br />
Im Werk in Oepping wird der Spezialkunststoff mit dem graphitartigen<br />
Schmiermittel Molybdändisulfid, Vernetzern zur Herausbildung<br />
dreidimensionaler Moleküle und UV-Stabilisatoren legiert. In<br />
einem speziellen Langzeit-Sinterpressverfahren entsteht daraus<br />
schließlich Robalon in Form von Platten oder Rundstäben.<br />
Der Hochleistungswerkstoff ist extrem abriebfest. Er korrodiert<br />
nicht und ist beständig gegenüber Frost bis -200 Grad Celsius.<br />
Ebenso wenig „kratzen“ ihn Säuren oder Laugen. Dabei ist er mit<br />
einer Dichte von 0,93 Gramm pro Kubikzentimeter ein montagefreundliches<br />
Leichtgewicht. Eine Robalon-Platte mit den Kantenmaßen<br />
1 mal 1 Meter und der einbautypischen Stärke von 12<br />
Millimetern wiegt nur etwa 11 Kilogramm (kg).<br />
Zum Vergleich: Eine Stahlplatte gleicher Größe bringt mehr als<br />
94 kg auf die Waage. „Durch die spezielle Herstellungstechnologie<br />
übersteht das Material auch starke Schlageinwirkungen und<br />
zeigt keinerlei Neigung zu Spannungsrissen“, verweist Helmut<br />
Gumpenberger, der bei Röchling den Einsatz von Robalon in der<br />
Agrar- und Biogassparte managt, auf ein weiteres Merkmal. Doch<br />
nicht nur deshalb eigne sich der Spezialkunststoff insbesondere für<br />
57
Praxis<br />
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Mit Robalon bekleidete Konusschnecken im Feststoffmischer<br />
sind eine kostengünstige Alternative etwa zum Aufschweißen<br />
von Edelstahl. Da sie dabei kaum schwerer werden, wird auch<br />
der Antrieb geschont.<br />
Mit Robalon ausgekleidete Gehäuse für<br />
Förderschnecken verlängern die Standzeit von<br />
Beschickungstechnik erheblich.<br />
die Auskleidung von Dosierbehältern und<br />
Mischschnecken oder die Herstellung von<br />
Förderschnecken. Durch den eingebauten<br />
Selbstschmiereffekt zeige Robalon ein gutes<br />
Gleitverhalten. Auch könnten Substrate<br />
nicht festkleben oder im Winter anfrieren.<br />
In Verbindung mit dem geringen Gewicht<br />
ermögliche dies etwa bei Schnecken zum<br />
Mischen oder Fördern von Feststoffen eine<br />
Energieeinsparung von bis zu 20 Prozent.<br />
Bearbeiten lasse sich Robalon, das in Platten<br />
bis zu einer Länge von 12 Metern gefertigt<br />
wird, ähnlich wie Holz mit spanabhebenden<br />
Verfahren.<br />
Platten-Puzzle wird vor Ort<br />
zusammengefügt<br />
Zu den Servicebetrieben, die Robalon für<br />
die Instandhaltung von Biogasanlagen<br />
verwenden, gehört die Landmaschinen-<br />
Neumann-GbR. Das Unternehmen mit Sitz<br />
in Barßel (Niedersachsen) beschichtet mit<br />
dem Werkstoff Behälterinnenräume als<br />
auch Schnecken. „Erst kürzlich haben wir<br />
Robalonplatten auf den beiden vertikalen<br />
Mischschnecken des stationären Trioliet-<br />
Feststoffdosierers einer Biogasanlage in Littel<br />
bei Wardenburg aufgebracht“, berichtet<br />
Teamleiter Hennig Siewe.<br />
Als weiteres Beispiel nennt er einen Kunden,<br />
bei dem vor zwei Jahren der Mischerbehälter<br />
ausgekleidet wurde. Die Originalschnecken<br />
seien jetzt stark verschlissen, während am<br />
Behälter keine Abnutzung auftrat. Die neuen<br />
Schnecken sollen deshalb nach dem Willen<br />
des Anlagenbetreibers nun gleich einen<br />
Überzug aus Robalon bekommen.<br />
Die benötigten Teile werden in Österreich<br />
gemäß den Maßvorgaben der entsprechenden<br />
Dosierer und Mischer einschließlich<br />
der Bohrungen für die Anbringung vorgefertigt.<br />
Vor Ort fügen dann Mitarbeiter das<br />
Puzzle zusammen. Zur Befestigung im Behälter<br />
oder an den Schneckenwindungen<br />
setzen sie durch die Bohrungen Gewinde-<br />
Schweißbolzen und schrauben daran die<br />
Platten fest. Die Behälterwände werden dabei<br />
nicht durchbohrt. An der Außenseite ist<br />
von der Befestigung nichts zu sehen. Sind<br />
die Platten montiert, erfolgt das Abdichten<br />
der Bohrungen mit Spezialsilikon und einer<br />
Schutzkappe sowie das Verschweißen der<br />
Plattenstöße mit Fülldraht aus Polyethylen.<br />
„Für viele Anlagenbetreiber ist ein zweites<br />
Leben für den Mischer durch solch einen<br />
Behälter im Behälter eine interessante Alternative<br />
zum aufwändigen Behälterwechsel<br />
oder Aufschweißen von Edelstahl“, weiß<br />
Siewe. Bei abgenutzten Mischerschnecken<br />
komme neben dem besonderen Gleiteffekt<br />
hinzu, dass sie nach der Belegung mit Robalon<br />
kaum schwerer sind und daher die bestehenden<br />
Antriebskomponenten weniger belasten<br />
als eine neue, schwerere Schnecke.<br />
Auskleidung kann auch<br />
werksseitig erfolgen<br />
Wer sich eine spätere Nachrüstung ersparen<br />
will, kann sich die Beschickungstechnik<br />
gleich beim Hersteller mit dem Hochleistungskunststoff<br />
belegen lassen und Förderschnecken<br />
aus diesem Material verbauen.<br />
Solch eine Option bietet zum Beispiel die<br />
Firma Eckart im niederbayerischen Schaufling<br />
an. Gefragt ist dieses Angebot nach Angabe<br />
des Unternehmens vor allem bei den<br />
großen Bauformen mit mehreren Konusschnecken.<br />
In diesem Segment seien mittlerweile<br />
die Hälfte der verkauften Dosierer<br />
mit Robalon ausgestattet.<br />
In einem vollständig ausgekleideten großen<br />
Beschickungssystem mit 100-Kubikmeter-<br />
Dosierer und langer Förderschnecke würden<br />
bis zu 70 Quadratmeter Robalonplatten<br />
verbaut. „Die Mehrkosten liegen bei etwa<br />
1.000 Euro pro Quadratmeter Kunststoff.<br />
Dafür verlängert sich aber auch die Lebensdauer<br />
um mehr als das Doppelte im<br />
Vergleich zu Edelstahl“, sagt Produktmanager<br />
Tobias Lallinger. Eckart bietet auch<br />
die Nachrüstung von Behältern und Konusschnecken<br />
an und gibt darauf eine Garantie<br />
von 4.000 Betriebsstunden beziehungsweise<br />
vier Jahre. „Anlagenbetreiber sollten<br />
allerdings nicht zu lange warten“, rät Lallinger.<br />
Wenn die Wand des Stahlbehälters<br />
bereits zu dünn ist, könnten daran keine<br />
Schweißbolzen angesetzt werden. Eine<br />
Auskleidung mit Robalon sei dann nicht<br />
mehr möglich.<br />
Autor<br />
Dipl.-Journ. Wolfgang Rudolph<br />
Freier Journalist<br />
Rudolph Reportagen – Landwirtschaft,<br />
Umwelt, Erneuerbare Energien<br />
Kirchweg 10 · 04651 Bad Lausick<br />
Tel. 03 43 45/26 90 40<br />
E-Mail: info@rudolph-reportagen.de<br />
www.rudolph-reportagen.de<br />
58
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Praxis<br />
ÜBERWACHUNG VON BIOGAS-ANLAGEN<br />
Der BHKW-Service von WELTEC.<br />
Immer in Ihrer Nähe.<br />
Biogas 401<br />
Mehrkanal-Gasanalysator<br />
Biogas 905<br />
Mehrkanal-Gasanalysator<br />
SENSOREN<br />
Die beiden Gas-Analysatoren Biogas 401<br />
und Biogas 905 über wachen kontinuierlich<br />
oder dis kon ti nuierlich die Qualität des<br />
Biogases auf die Gaskompo nenten hin.<br />
Optional warnen zusätzliche Umgebungsluft-Sensoren<br />
frühzeitig vor gesundheitsge<br />
fähr denden, explo sions fähigen und<br />
nichtbrenn baren Gasen und Dämpfen.<br />
❯❯❯ Biogas Know-how seit 2001 ❮❮❮<br />
EINSATZBEREICHE:<br />
■ Biogas-Produktionsanlagen<br />
■ Kläranlagen<br />
■ Deponien<br />
GTR 210 IR<br />
CH 4 + CO 2<br />
TOX 592<br />
O 2 + H 2 S<br />
Trierer Str. 23 – 25 · 52078 Aachen<br />
Tel. (02 41) 97 69-0 · www.ados.de<br />
s e i t 1 9 0 0<br />
Ihre Vorteile<br />
• alle gängigen Motoren<br />
• langjährige & geschulte Mitarbeiter<br />
• 24/7 Notdienst<br />
Organic energy worldwide<br />
WELTEC BIOPOWER GmbH<br />
04441-999 78-0<br />
info@weltec-biopower.de<br />
Fest und abnehmbar montierbarer Wartungsumlauf für alle Biogasanlagen-Behälter!<br />
EasyFlex<br />
Willerfang 8<br />
26655 Westerstede<br />
sicher<br />
zeiteinsparend<br />
kostengünstig<br />
Motiv2015_85x118 15.06.2015 16:25 Seite 1<br />
Jetzt informieren!<br />
Telefon: 04409 9729680<br />
eMail: info@EasyFlexMultiSteg.de<br />
www.EasyFlexMultiSteg.de<br />
Für die Revision nach BetrSichV §15(15)<br />
Austauschgeräte und Ersatzbaugruppen vom Original-Hersteller<br />
› passgenau<br />
› sicher, da ATEX-konform<br />
› wirtschaftlich durch kurze Stillstandszeit<br />
› mit voller Garantie<br />
› kurze Lieferzeit<br />
ATEX Ventilatoren<br />
für Biogas Zone 1 und 2<br />
(Kat.II 2G und II 3G)<br />
Anfragen bitte stets mit Ihrer Gerätenummer. Bezug und<br />
Installation in Deutschland über unsere Servicepartner möglich.<br />
MEIDINGER AG<br />
Landstrasse 71 4303 Kaiseraugst / Schweiz<br />
Tel. +41 61 487 44 11 service@meidinger.ch www.meidinger.ch<br />
59
Praxis<br />
Biogas Journal Große Mengen | 1_<strong>2018</strong><br />
Holzhackschnitzel<br />
lagern auf dem<br />
Hof vor dem ersten<br />
Holzheizkraftwerk.<br />
Nahwärme<br />
Ein Ort setzt<br />
auf Holz<br />
und Biogas<br />
In nur zehn Jahren hat die Energiegenossenschaft Weilerwärme eG im Nordschwarzwald<br />
ein Nahwärmeprojekt auf die Beine gestellt, das auf eine Vielzahl von Einspeiseanlagen<br />
setzt – wobei auch eine Biogasanlage dazu gehört.<br />
Von Dipl.-Geogr. Martin Frey<br />
Vorstand Klaus<br />
Gall präsentiert im<br />
Besucherraum des<br />
Heizkraftwerkes das<br />
Modell einer Übergabestation.<br />
Wer von Freudenstadt aus in das nordöstlich<br />
gelegene Pfalzgrafenweiler<br />
kommt, ahnt kaum, welche Innovationskraft<br />
in der etwas mehr als 7.000<br />
Einwohner zählenden und sich über<br />
mehrere Teilorte reichenden Gemeinde steckt. 2008<br />
war die Energiegenossenschaft Weilerwärme eG die<br />
erste Nahwärmegenossenschaft in Baden-Württemberg.<br />
Heute gilt der Ort als größtes Bioenergiedorf des<br />
Bundeslandes. Zum Zusammenschluss zählen über<br />
800 Bürger, und rund 80 Prozent aller Gebäude sind<br />
über ein Nahwärmenetz angebunden.<br />
Fotos: Martin Frey<br />
„Es war ursprünglich gar nicht geplant, den ganzen Ort<br />
zu versorgen“, berichtet Vorstand Klaus Gall, der im<br />
Hauptberuf Architekt ist und die Genossenschaft mit<br />
zwei weiteren Vorständen und einer überschaubaren<br />
Anzahl an Mitarbeitern lenkt. Das Angebot sprach sich<br />
aber schnell in der Bevölkerung herum, und so betreiben<br />
die Akteure heute ein über 28 Kilometer langes<br />
Wärmenetz, an das knapp 600 Liegenschaften mitsamt<br />
kommunaler Gebäude, Schwimmbäder, Sporthallen<br />
und Kirchen angeschlossen sind.<br />
ORC-Holzheizkraftwerke und Biogasanlage<br />
Das Nahwärmenetz wird von insgesamt 17 Wärmeerzeugern<br />
versorgt, die eine Wärmeleistung von 16,8 Megawatt<br />
(MW) erbringen. Von dem Jahreswärmebedarf<br />
werden 85 Prozent in Kraft-Wärme-Kopplung produziert.<br />
Die Grundlast von 6,9 MW erbringen dabei im<br />
Wesentlichen zwei Holzheizkraftwerke mit einer Leistung<br />
von 5,8 MW th<br />
und 560 kW el<br />
. Diese werden durch<br />
die zwei Gesellschafter als eigenständige GmbH betrieben,<br />
die die Wärme an die Genossenschaft verkaufen.<br />
Eingesetzt werden jährlich 40.000 Kubikmeter<br />
Holzhackschnitzel. Dank der Organic-Rankine-Cycle-<br />
(ORC)-Technologie haben die Anlagen einen besonders<br />
hohen Wirkungsgrad.<br />
Des Weiteren speist am westlichen Ortsrand eine Biogasanlage<br />
mit 380 Kilowatt (kW) Leistung ins Netz,<br />
die dem Landwirte-Ehepaar Tanja und Eberhard Braun<br />
gehört, die den dortigen Heuwasenhof betreiben. Eben-<br />
60
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Praxis<br />
falls für die Grundlast arbeiten noch drei über den Ort verteilte<br />
Gas-BHKW mit zusammen 680 kW th<br />
Leistung.<br />
Mittel- und Spitzenlast<br />
Für die Mittellast stehen bei Bedarf in Möbelfabriken drei Holzhackschnitzelanlagen<br />
sowie zwei Holzspänekessel mit 4,2 MW<br />
bereit und decken etwa 7 Prozent des Jahreswärmebedarfs. Die<br />
restlichen 8 Prozent liefern acht Ausfallreserve- und Spitzenlastkessel,<br />
die mit Gas und Öl betrieben werden und weitere 5,7 MW th<br />
bereithalten.<br />
Die Energiegenossenschaft Weilerwärme eG konnte mit den genannten<br />
Anlagen 2016 über 26 Megawattstunden Wärme verkaufen<br />
und so dazu beitragen, über 2,5 Millionen Liter Heizöl<br />
einzusparen. Das eingesetzte Holz stammt komplett aus Wäldern<br />
und der Landschaftspflege aus einem Umkreis von weniger als 50<br />
Kilometern. „Jedes Jahr verbleiben somit etwa 1 Million Euro in<br />
der Region“, so Gall zum Faktor regionale Wertschöpfung.<br />
Biogasanlage als Partner des Nahwärmenetzes<br />
Die Biogasanlage der Familie Braun befindet sich am westlichen<br />
Ortsrand von Pfalzgrafenweiler. Der Heuwasenhof hat den Schwerpunkt<br />
auf Milchviehbetrieb und Kälberaufzucht. Die täglich benötigten<br />
34 Tonnen Substrat stammen vor allem aus Rindergülle,<br />
ergänzt durch Maissilage sowie GPS und Grassilage. Die beiden<br />
BHKW-Motoren haben zusammen eine installierte Leistung von<br />
1.030 kW el<br />
mit einer Höchstbemessungsleistung für die EEG-Vergütung<br />
bei 475 kW el<br />
. Nach Eberhard Brauns Worten dürfte dabei<br />
die thermische Leistung etwas höher liegen als die elektrische. Die<br />
Anlage liefert jährlich etwa 1.500 Megawattstunden Wärme in das<br />
Nahwärmenetz der Genossenschaft.<br />
Gebaut im Jahr 2005, wurde die Biogasanlage inzwischen mehrfach<br />
umgerüstet und erweitert. „Im Frühjahr 2017 haben wir sie<br />
auf die flexible Fahrweise umgerüstet. Dazu wurde ein zusätzlicher<br />
Motor installiert und die Flexibilitätsprämie beantragt“, berichtet<br />
Braun. Er könne nun das Biogas für acht Stunden speichern. Ende<br />
2017 lief die Anlage bereits im Regelenergiebetrieb.<br />
Braun muss damit klarkommen, dass die Energiegenossenschaft<br />
im Sommer nur eine sehr geringe Wärmemenge abnimmt. „<strong>2018</strong><br />
wollen wir daher in die flexible Fahrweise übergehen.“ Durch die<br />
Umbauten an der Anlage könne er künftig im Winter mehr Wärme<br />
produzieren – eben dann, wenn sie auch gebraucht wird.<br />
Vorteil für Bürger und Umwelt<br />
Von dem Nahwärmeprojekt profitieren die Bürger in Pfalzgrafenweiler,<br />
aber auch die Umwelt: So können jährlich fast 7.000<br />
Tonnen CO 2<br />
eingespart werden. Die Wärmeübergabestationen<br />
verschaffen den Kunden einen Platzgewinn gegenüber den bisherigen<br />
Heizungsanlagen. Ein weiterer Pluspunkt: Der hohe Anteil<br />
Erneuerbarer Energien im Nahwärmenetz und der Einsatz der<br />
Kraft-Wärme-Kopplung verbessern die energetische Beurteilung<br />
der Gebäude: „Das schlägt sich direkt im Energieausweis nieder“,<br />
argumentiert Klaus Gall.<br />
Um die Nahwärme zu beziehen, müssen Interessenten Mitglied<br />
in der Genossenschaft werden und zwei Geschäftsanteile je 500<br />
Euro erwerben. Der Arbeitspreis für die Wärme liegt mit etwa 9<br />
Cent pro kWh etwas höher als der Öl- und Gaspreis. Einen Grundpreis<br />
gibt es nicht. Alle Abnehmer müssen sich vertraglich ver-<br />
Führender<br />
Partner für<br />
Biogasaufbereitung<br />
Unsere Anlagen liefern<br />
Energie für 133.000 Häuser<br />
oder 275.000 Autos<br />
Unsere umfassende Erfahrung bei Prozesstechnologien ermöglicht es<br />
uns, sichere und innovative Lösungen zur Biogasaufbereitung und –<br />
als zweiten Wertstrom – zur CO 2 -Rückgewinnung für Ihre spezifischen<br />
Anforderungen zu entwickeln und zu liefern.<br />
Nach der Installation steht Ihnen unser breites Angebot an Serviceleistungen<br />
wie 24/7-Online-Service, Vor-Ort-Service und Ersatzteile<br />
zur Verfügung. Wir nennen das Serious Service.<br />
Unsere besten Praxisbeispiele finden Sie auf:<br />
biogas.pentair.com<br />
61
Praxis<br />
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Holzheizkraftwerk, das<br />
in das Nahwärmenetz<br />
von Pfalzgrafenweiler<br />
einspeist.<br />
Blick in den<br />
Betriebshof.<br />
pflichten, den Nahwärmeanschluss als Hauptheizung<br />
einzusetzen und mindestens 50 Prozent der bestellten<br />
Wärme abzunehmen.<br />
In einer Vollkostenrechnung könne die Nahwärme immerhin<br />
rund 20 Prozent günstiger sein als bei einer<br />
individuellen Heizung: Die Investitionskosten sind wesentlich<br />
günstiger als bei einer eigenen Heizungsanlage,<br />
die gemäß E-Wärme-Gesetz mindestens 15 Prozent<br />
erneuerbare Energieträger enthalten muss. Außerdem<br />
entfallen jährliche Wartungskosten sowie Schornsteinfegergebühren.<br />
Einstieg ins Strom- und Mobilitätsgeschäft<br />
Wer die Akteure der Energiewende in Pfalzgrafenweiler<br />
kennenlernt, ist vom Enthusiasmus dort sofort angetan:<br />
„Unsere Vision ist, die Energiewende vor Ort mit den<br />
Bürgern umzusetzen“, ist das Credo von Klaus Gall.<br />
Auf dem Weg dorthin sind sie schon ein gutes Stück<br />
vorangekommen. Hilfreich seien dabei immer auch Synergieeffekte,<br />
die gezielt genutzt werden – etwa jene,<br />
die sich beim Verlegen der Nahwärmeleitungen ergeben.<br />
Klaus Gall: „Wenn wir einen Graben ausheben,<br />
verlegen wir stets auch Leerrohre.“<br />
So ermögliche die Genossenschaft moderne Breitbandversorgung<br />
und könne künftig sogar eigene Stromkabel<br />
zum Kunden legen. Als Stromlieferant werde man<br />
günstiger als externe Anbieter sein, da die sonst üblichen<br />
Netznutzungsentgelte entfielen. Bis dahin können<br />
die Bürger heute schon mittels einer Kooperation<br />
mit der Genossenschaft Bürgerwerke eG aus Heidelberg<br />
hochwertigen Ökostrom über die Energiegenossenschaft<br />
beziehen.<br />
Und auch in das Segment Elektromobilität sind Gall<br />
und Co. mit „Weiler e Mobil“ bereits eingestiegen:<br />
„Bevor wir Strom verschenken, verfahren wir ihn lieber“,<br />
sagt Gall. Derzeit würden zwölf Elektromobile und<br />
sechs E-Fahrräder zur Miete angeboten. Der Zuspruch<br />
sei so groß, dass Gall gerade weitere Fahrzeuge ordere.<br />
Der Strom für die E-Mobilität stammt folgerichtig<br />
aus dem Genossenschaftsprojekt „Weilerstrom“, unter<br />
dessen Dach inzwischen fast 100 kWp eigene Photovoltaikanlagen<br />
betrieben werden – unter anderem eine<br />
PV-Dachanlage auf dem Schulzentrum mit 99 kWp und<br />
eine Freiflächenanlage mit 388 kWp.<br />
Konjunkturprogramm für das örtliche<br />
Handwerk<br />
Die Weilerwärme ist aber bei weitem kein Selbstläufer:<br />
Alles ist mit viel Arbeit verbunden, und am Anfang<br />
habe es viel Skepsis in der Bevölkerung gegeben, erinnert<br />
sich Vorstand Gall. Erst als Pfalzgrafenweiler als<br />
Bioenergiedorf ausgezeichnet worden war und als das<br />
Wärmenetz sich ausbreitete, sei sie breitem Interesse<br />
gewichen. Auch technische Fragen bereiteten viel<br />
Kopfzerbrechen – etwa, wie die Druckverhältnisse im<br />
Wärmenetz angesichts so vieler Einspeiseanlagen gehandhabt<br />
werden können. Letzten Endes seien aber<br />
immer Lösungen gefunden worden. Auch, dass sich<br />
Heizungsbauer überzeugen ließen, die schließlich<br />
künftig weniger Einzelheizungen verkaufen können.<br />
Gall: „Etliche werben jetzt damit, dass sie Experten<br />
für Übergabestationen sind und den Anschluss an<br />
Nahwärmenetze beherrschen.“<br />
In der näheren Zukunft will die WeilerWärme eG noch<br />
einen Schritt weiter gehen und ein „echter Energiedienstleister“<br />
werden – „so etwas wie ein Bürger-Stadtwerk.“<br />
Die Macher aus dem Nordschwarzwald sind zuversichtlich:<br />
Unterm Strich sei die Genossenschaft „ein<br />
kleines Konjunkturprogramm“ – sowohl für das örtliche<br />
Handwerk als auch für die ganze Gemeinde.<br />
Autor<br />
Dipl.-Geogr. Martin Frey<br />
Fachjournalist<br />
Fachagentur Frey – Kommunikation für Erneuerbare<br />
Energien<br />
Gymnasiumstr. 4 · 55116 Mainz<br />
Tel. 0 61 31 / 61 92 78-0<br />
E-Mail: mf@agenturfrey.de<br />
www.agenturfrey.de<br />
62
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Praxis<br />
Mischen – Fördern –<br />
Zerkleinern<br />
Doppelmembrangasspeicher | Emissionsschutzabdeckungen<br />
Gasspeicher | EPDM-Hauben<br />
Folienbecken | Leckagefolien<br />
Baur Folien GmbH<br />
Gewerbestraße 6<br />
D-87787 Wolfertschwenden<br />
0 83 34 99 99 1-0<br />
0 83 34 99 99 1-99<br />
info@baur-folien.de<br />
d www.baur-folien.de<br />
Ihr Partner für die Energie<br />
der Zukunft<br />
Alter beschädigter Kolben Altes Gummi ist entfernt Der erneut vulkanisierte Kolben<br />
Als Weltmarktführer von Exzenterschneckenpumpen<br />
und Spezialist in der<br />
Biogastechnologie bieten wir für die<br />
Biogasproduktion angepasste Misch- und<br />
Fördersysteme. Die Einsatzmöglichkeiten<br />
unserer NEMO® Exzenterschneckenpumpen,<br />
TORNADO® Drehkolbenpumpen<br />
sowie NETZSCH Zerkleinerungssysteme<br />
reichen vom Mischen über Fördern bis hin<br />
zum Zerkleinern.<br />
Segment-Kolben Linear-Kolben Flügel-Kolben<br />
Registrieren und sofort Kaufen in unserem Webshop<br />
WWW.BENEDICT-THO.NL | E: info@benedict-tho.nl | T: 0031 545 482157 |<br />
NEMO® B.Max®<br />
Mischpumpe<br />
63<br />
NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH<br />
Geschäftsfeld Umwelt & Energie<br />
Tel.: +49 8638 63-1010<br />
info.nps@netzsch.com<br />
www.netzsch.com
Wissenschaft<br />
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Optimale Nutzungsdauer von Biogasanlagen –<br />
Reparaturkosten entscheiden<br />
Die ersten Biogasanlagen im landwirtschaftlichen Bereich verlieren in den nächsten Jahren<br />
ihre feste Einspeisevergütung. Die Betreiber stehen vor der Frage, ob und wie die Anlagen<br />
weiter betrieben werden können. Besonders bei einer flexiblen Fahrweise von Biogasanlagen<br />
werden einige Bauteile wie beispielsweise Anlasser oder Lager stärker gefordert und müssen<br />
eventuell schneller ersetzt werden als im Volllastbetrieb. An der Hochschule in Neubrandenburg<br />
wurde ein Beratungstool entwickelt, das sich mit der Fragestellung nach dem<br />
optimalen Zeitpunkt für Ersatz- oder Erweiterungsinvestitionen beziehungsweise für die<br />
Stilllegung einer Anlage beschäftigt.<br />
Von Clemens Fuchs, Jessy Blaschke, Joachim Kasten, Katharina Skau und Frank Rixen<br />
Das Betreiben von Biogasanlagen über den<br />
Zeitraum der festen Einspeisevergütung<br />
hinaus wirft viele Fragen auf. Im Zentrum<br />
der Überlegungen steht, ob sich ein Weiterbetrieb<br />
bei teuren Rohstoffen und steigenden<br />
Reparaturen wirtschaftlich lohnt. Dazu muss der<br />
Betreiber schon vor Ablauf der 20 Jahre Festvergütung<br />
entscheiden, ob er weiterhin oder unter Umständen<br />
auch bereits vorzeitig Ersatz- beziehungsweise Erweiterungsinvestitionen<br />
von zum Teil großem Finanzumfang<br />
tätigen will. Bezüglich des aus wirtschaftlicher Sicht<br />
besten Zeitpunkts für solche Investitionen bestehen<br />
große Unsicherheiten.<br />
Abbildung 1: Titelblatt des Beratungstools<br />
Bei diesen Entscheidungen will das an der Hochschule<br />
Neubrandenburg entwickelte Beratungstool Hilfestellung<br />
geben. Es lässt sich unter Eingabe der maßgeblichen<br />
Einflussfaktoren die optimale Nutzungsdauer<br />
einer Biogasanlage bestimmen. Der Betreiber kann so<br />
abschätzen, ob sich Reparaturen oder zum Beispiel die<br />
Investition in ein neues BHKW noch lohnen und sich<br />
infolgedessen die Nutzungsdauer um einige Jahre nach<br />
vorn oder hinten verschiebt. So kann es auch vorkommen,<br />
dass der Rückbau einer Biogasanlage schon vor<br />
Ablauf der 20 Jahre Festvergütung sinnvoll erscheint.<br />
Aufbau des Beratungstools<br />
Das Beratungstool wurde in Excel programmiert und<br />
startet mit einem Titelblatt, das auch eine Übersicht<br />
über die dann folgenden vier Eingabeformulare gibt:<br />
(1) Grunddaten, (2) Laufende Betriebskosten, (3) Rohstoffkosten<br />
und (4) Reparaturen (siehe Abbildung 1).<br />
In einem fünften Tabellenblatt werden die Ergebnisse<br />
sowohl numerisch als auch grafisch dargestellt. Die detaillierten<br />
Berechnungen können bei Interesse in einer<br />
sechsten Kalkulationstabelle nachvollzogen werden.<br />
Im ersten Schritt gibt der Anwender die Grunddaten in<br />
eine Eingabemaske ein (siehe Abbildung 2). Die Anfangs-<br />
und bereits erfolgten Erweiterungsinvestitionen<br />
werden festgehalten sowie die laufenden Betriebskosten,<br />
die Rohstoffkosten und der Aufwand für Wartung<br />
und Reparaturen angezeigt, sodass die Anwender hier<br />
bereits einen vollständigen Überblick zur technischen<br />
und wirtschaftlichen Situation erhalten.<br />
Die Funktionsweise des Beratungstools<br />
wird am Beispiel einer Biogasanlage mit<br />
insgesamt 1.060 Kilowatt (kW) erläutert.<br />
Die betreffende Anlage wurde im Jahr<br />
2003 mit einer Größe von 170 kW für<br />
700.000 Euro erbaut, es folgten in 2005<br />
eine Erweiterung um zusätzliche 190 kW<br />
und in 2013 eine weitere Vergrößerung<br />
um 170 kW. Die Kosten der Erweiterungen<br />
betrugen 300.000 Euro beziehungsweise<br />
570.000 Euro. Es wird in einem weiteren<br />
Schritt angenommen, dass der Betreiber<br />
der Anlage die im EEG 2017 vorgeschriebene<br />
doppelte Überbauung (600.000<br />
Euro) vornimmt, um seine Anlage zu flexibilisieren<br />
und durch die Verdopplung der<br />
64
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Wissenschaft<br />
Abbildung 2: Grunddaten und zusammenfassende Übersicht an einem Beispiel<br />
Beratungstool zur Ermittlung der optimalen Nutzungsdauer<br />
1. Grunddaten der Biogasanlage<br />
Werte bitte nur in weiße<br />
Kalkulationszinssatz<br />
p.a.<br />
Felder eintragen! 3%<br />
Investition<br />
Investition/<br />
Erweiterungen<br />
Jahr lfd. Jahr Größe<br />
in kW<br />
gesamte<br />
Anlagengröße,<br />
kW<br />
Investitionssumme<br />
in €<br />
Volllaststunden,<br />
h p.a.<br />
max. 8.760 h<br />
p.a.<br />
Summe laufender<br />
Betriebskosten, €<br />
p.a.<br />
Summe Kosten<br />
Rohstoffe, € p.a.<br />
Summe Wartung<br />
und Reparaturen,<br />
€ p.a.<br />
Vergütung, Cent/kWh<br />
Erst-Investition Beginn 0<br />
1. Jahr<br />
700.000 €<br />
Inbetriebnahme 2003 1 170 170 8.000 44.182 € 124.247 € 0 € 17 0<br />
mögliche<br />
2004 2 170 8.000 44.182 € 124.247 € 18.000 € 17 0<br />
Erweiterungen<br />
Kommentare: 2005 3 190 360 300.000 € 8.000 86.856 € 263.111 € 43.000 € 20 0<br />
2006 4 360 8.000 86.856 € 263.111 € 37.000 € 20 0<br />
2007 5 360 8.000 86.856 € 263.111 € 15.000 € 20 0<br />
2008 6 360 8.000 86.856 € 263.111 € 110.000 € 20 0<br />
2009 7 360 8.000 86.856 € 263.111 € 44.000 € 20 0<br />
2010 8 360 8.000 86.856 € 263.111 € 29.000 € 20 0<br />
2011 9 360 8.000 86.856 € 263.111 € 33.500 € 20 0<br />
2012 10 360 8.000 86.856 € 263.111 € 43.500 € 20 0<br />
2013 11 170 530 570.000 € 8.000 125.038 € 387.358 € 39.000 € 20 0<br />
2014 12 530 8.000 125.038 € 387.358 € 51.000 € 20 0<br />
2015 13 530 8.000 125.038 € 387.358 € 113.000 € 20 0<br />
2016 14 530 8.000 125.038 € 387.358 € 140.000 € 20 0<br />
2017 15 530 8.000 125.038 € 387.358 € 65.950 € 20 0<br />
<strong>2018</strong> 16 530 8.000 125.038 € 387.358 € 84.450 € 20 0<br />
2019 17 530 8.000 125.038 € 387.358 € 34.450 € 20 0<br />
nach EEG 2017 2020 18 530 1060 600.000 € 4.000 196.588 € 382.108 € 90.950 € 17,4 0<br />
Flexibilsierung 2021 19 1060 4.000 196.588 € 382.108 € 34.450 € 17,4 0<br />
2022 20 1060 4.000 196.588 € 382.108 € 154.450 € 17,4 0<br />
2023 21 1060 4.000 196.588 € 382.108 € 34.450 € 17,4 0<br />
2024 22 1060 4.000 196.588 € 382.108 € 49.450 € 17,4 0<br />
2025 23 1060 4.000 196.588 € 382.108 € 50.950 € 17,4 0<br />
2026 24 1060 4.000 196.588 € 382.108 € 164.450 € 17,4 0<br />
2027 25 1060 4.000 196.588 € 382.108 € 39.450 € 17,4 0<br />
2028 26 1060 4.000 196.588 € 382.108 € 100.950 € 17,4 0<br />
2029 27 1060 4.000 196.588 € 382.108 € 106.450 € 17,4 0 2029<br />
2030 28 1060 4.000 196.588 € 382.108 € 308.450 € 17,4 0<br />
2031 29 1060 4.000 196.588 € 382.108 € 79.450 € 17,4 0<br />
2032 30 1060 4.000 196.588 € 382.108 € 89.450 € 17,4 0<br />
Rückbau der Anlage 2033 31 -1060 0 4.000 0 € 0 € 0 € 17,4 0<br />
el.<br />
th.<br />
Vorläufiges<br />
Ergebnis<br />
opt. N (kein<br />
Ersatz)<br />
Jahr<br />
Abbildung 3: Auszug der Eingabemaske „Laufende Betriebskosten“<br />
2_Laufende_Kosten<br />
Beratungstool zur Ermittlung der optimalen Nutzungsdauer<br />
2. Laufende Betriebskosten der Biogasanlage<br />
Biologische Betreuung 500 €/Monat<br />
Angaben aus Grunddaten<br />
(die ersten vier Spalten)<br />
Versicherungsschutz 5 €/Monat und kW<br />
Energiekosten 7,0% der erzeugten Energie<br />
Zukauf zum Preis von 0,16 €/kWh<br />
Arbeitsaufwand 5 Akh/kW el. p.a.<br />
Stundenlohn 15 €/Akh<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />
Jahr lfd. Jahr gesamte Volllaststunden,<br />
Biologische Versicherungs-<br />
Energie-<br />
Arbeits-<br />
Weitere Weitere Summe laufender<br />
Anlagengröße,<br />
h Betreuung, € schutz, € p.a. kosten, € p.a. kosten, € p.a.<br />
Betriebskosten, einschl.<br />
kW p.a. p.a.<br />
Arbeit, € p.a.<br />
Beginn 0<br />
1. Jahr<br />
2003 1 170 8.000 6.000 10.200 15.232 12.750 44.182<br />
2004 2 170 8.000 6.000 10.200 15.232 12.750 44.182<br />
2005 3 360 8.000 6.000 21.600 32.256 27.000 86.856<br />
2006 4 360 8.000 6.000 21.600 32.256 27.000 86.856<br />
Kapazität eine Vergütung von etwa 17 Cent<br />
pro Kilowattstunde (kWh) zu erzielen.<br />
Nach der Erweiterung halbieren sich die Volllaststunden<br />
auf 4.000 Stunden pro Jahr. Die<br />
Anlage wird derzeit zu 60 Prozent mit Maissilage<br />
und zu 40 Prozent mit Gülle betrieben.<br />
Nach dem Jahr 2023 soll der Maisanteil auf<br />
50 Prozent reduziert werden, der Ersatz erfolgt<br />
dann durch 10 Prozent Ganzpflanzensilage.<br />
Im Jahr 2030 stünde eine Investition<br />
in einen Motor und weitere Reparaturen im<br />
Gesamtumfang von etwa 300.000 Euro an,<br />
zu denen aber nicht mehr geraten wird. Die<br />
Empfehlung vorwegnehmend ergibt sich aus<br />
den Berechnungen somit eine optimale Nutzungsdauer<br />
von 27 Jahren.<br />
Unter „laufende Betriebskosten“ (siehe<br />
Tabelle 2 in Abbildung 3) fallen beispielsweise<br />
die biologische Betreuung, der<br />
Arbeitsaufwand und die Kosten für zugekaufte<br />
Energie an. Der Anwender legt im<br />
nächsten Schritt seine verwendeten Gärsubstrate<br />
dar und beziffert deren Kosten in<br />
Tabelle 3. Auf die Darstellung von Tabelle<br />
Seite 1<br />
65
Wissenschaft<br />
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Abbildung 4: Reparatur- und Wartungskosten der Beispielanlage<br />
Kosten in Euro<br />
350.000<br />
300.000<br />
250.000<br />
200.000<br />
150.000<br />
100.000<br />
50.000<br />
Sum. Rep.<br />
Wartungen / Unterhaltung, €<br />
kum. Summe in % von Ao<br />
120%<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32<br />
Nutzungsjahre<br />
0%<br />
Abbildung 5: Reparatur- und Wartungskosten zweier weiterer Biogasanlagen<br />
Kosten in Euro<br />
Kosten in Euro<br />
350.000<br />
300.000<br />
250.000<br />
200.000<br />
150.000<br />
100.000<br />
50.000<br />
0<br />
250.000<br />
200.000<br />
150.000<br />
100.000<br />
50.000<br />
0<br />
Summe Reparaturen<br />
Wartungen/Unterhaltung<br />
kum. Summe in % von Ao<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031<br />
Nutzungsjahre<br />
Summe Reparaturen<br />
Wartung/Unterhaltung<br />
kum. Summe in % von Ao<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31<br />
Nutzungsjahre<br />
160%<br />
140%<br />
120%<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
180%<br />
160%<br />
140%<br />
120%<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
3 wird an dieser Stelle aus Platzgründen<br />
verzichtet, ebenso wie auf das Formular für<br />
die Eingabe der Reparaturkosten (Tabelle<br />
4). Die Reparaturkosten und ihre Prognose<br />
nehmen ganz entscheidend Einfluss auf die<br />
Ermittlung der optimalen Nutzungsdauer<br />
und werden daher nachfolgend detailliert<br />
analysiert.<br />
Reparaturkosten als zentrales<br />
Element<br />
Ein besonderes Augenmerk des Beratungstools<br />
liegt auf den Wartungs- und<br />
Reparaturkosten, die im Hinblick auf den<br />
Nutzungszeitraum die zentrale Rolle spielen.<br />
Im Rahmen einer Bachelorarbeit an<br />
der Hochschule Neubrandenburg wurden<br />
diese Kosten auf drei Betrieben erhoben.<br />
Dabei haben die Anlagenbetreiber selbst<br />
die Kosten beziffert und für die vergangene<br />
Laufzeit aufgezeichnet. Aus diesen Zahlen<br />
heraus wurden die noch zu erwartenden<br />
und anstehenden Kosten für die restliche<br />
Betriebszeit beziehungsweise eventuell darüber<br />
hinaus abgeleitet.<br />
Für den Anwender ergibt das Beratungstool<br />
so den zusätzlichen Nutzen, die vergangenen<br />
und noch kommenden Kosten für Reparaturen<br />
und Wartung zu visualisieren und<br />
eventuell größere Kostenblöcke zu identifizieren.<br />
Bei der Berechnung der optimalen<br />
Nutzungsdauer spielen diese geschätzten<br />
Kosten in der Zukunft eine tragende Rolle<br />
und beeinflussen die Betriebsdauer erheblich.<br />
In einem Berechnungsbeispiel der Bachelorarbeit<br />
zeigt sich, dass die optimale<br />
Nutzungsdauer wie in dem genannten Bei-<br />
66
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Wissenschaft<br />
Abbildung 6: Ergebnisdarstellung für Beispielbetrieb<br />
Beratungstool zur Ermittlung der optimalen Nutzungsdauer<br />
5. Ergebnisse und Empfehlungen entsprechend den<br />
eingegebenen Daten für die Biogasanlage<br />
Name der Biogasanlage: Beratungstool_Biogasanlage_optN_1.01<br />
Inbetriebnahme: im Jahr: 2003<br />
gesamte Anlagen-größe, kW<br />
1060 kW<br />
Optimale Nutzungsdauer:<br />
27 Jahre<br />
im Jahr erreicht im Jahr 2029<br />
Hinweise: Die Nutzungsdauer kann vom EEG-Förderzeitraum von z.B. 20<br />
bzw. 30 Jahren abweichen, wenn z.B. in ein neues EEG gewechselt wurde<br />
und damit der 20-Jahres-Zeitraum neu anlief.<br />
Druchschnittlicher Überschuss:<br />
64.499 € p.a.<br />
Kapitalwert 1.170.281 €<br />
...<br />
FINALBeratungstool_Biogasanlage_optN_1.01<br />
Beträge in € p.a.<br />
(linke Y-Achse)<br />
1.500.000 €<br />
1.000.000 €<br />
500.000 €<br />
0 €<br />
-500.000 €<br />
-1.000.000 €<br />
Entwicklung wichtigster Leistungen und Kosten<br />
sowie optimale Nutzungsdauer (+) einer Biogasanlage<br />
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32<br />
Beginn<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
2009<br />
2010<br />
2011<br />
2012<br />
2013<br />
2014<br />
2015<br />
2016<br />
2017<br />
<strong>2018</strong><br />
2019<br />
2020<br />
2021<br />
2022<br />
2023<br />
2024<br />
2025<br />
2026<br />
2027<br />
2028<br />
2029<br />
2030<br />
2031<br />
2032<br />
2033<br />
2034<br />
2035<br />
Nutzungsjahr der Biogasanlage<br />
Volllaststunden p.a.<br />
(rechte Y-Achse)<br />
9.000<br />
Wartung und<br />
Reparaturen<br />
6.000<br />
Kosten<br />
Rohstoffe<br />
3.000<br />
laufende<br />
Betriebskosten<br />
0<br />
Investitionssumme<br />
-3.000<br />
Summe Erlöse<br />
-6.000<br />
-9.000<br />
Kapitalwert<br />
opt. N (kein<br />
Ersatz)<br />
Volllast-stunden,<br />
h p.a.<br />
spiel bei 27 Jahren liegt. In Jahr 28 sind<br />
eine Investition in einen neuen Motor und<br />
weitere Reparaturen abzusehen, was bei<br />
der geringeren Vergütung pro kWh nach<br />
Ablauf der Festvergütung nicht mehr wirtschaftlich<br />
wäre (siehe Abbildung 4).<br />
Die kumulierten Reparaturkosten der hier<br />
untersuchten Biogasanlagen übersteigen<br />
in der Regel ab dem 20. Betriebsjahr die<br />
Anschaffungskosten Ao. Dieselbe Beobachtung<br />
basiert auf den Datenerhebungen<br />
in zwei weiteren Beispielanlagen. Der orange<br />
gekennzeichnete Punkt in Abbildung<br />
5 zeigt jeweils, dass dort nach 19 beziehungsweise<br />
20 Jahren die kumulierten<br />
Kosten für Reparaturen und Wartung/Unterhaltung<br />
die Anschaffungskosten übersteigen.<br />
Die optimalen Nutzungsdauern, die das Beratungstool<br />
für diese beiden Anlagen ausweist,<br />
liegen bei 19 beziehungsweise 17<br />
Jahren und damit noch unter den 20 Jahren<br />
der EEG-Förderung. Dies liegt vor allem<br />
daran, dass diese beiden Biogasanlagen<br />
kein tragfähiges Wärmekonzept entwickeln<br />
konnten und außerdem auf den Güllebonus<br />
verzichten mussten.<br />
Ermittlung der optimalen<br />
Nutzungsdauer und<br />
Ergebnisdarstellung<br />
In dem dann folgenden zentralen Schritt<br />
errechnet das Beratungstool die optimale<br />
Nutzungsdauer der Anlage. Dabei wird<br />
vorausgesetzt, dass der Weiterbetrieb so<br />
lange sinnvoll ist, wie positive Deckungsbeiträge<br />
erzielt werden können. Die Berechnung<br />
der Deckungsbeiträge (e t<br />
- a t<br />
)<br />
und des Kapitalwertes (KW) erfolgen nach<br />
der Formel<br />
N<br />
KW = ∑ (e t<br />
- a t<br />
) q -t<br />
t=0<br />
mit der Anzahl der Nutzungsjahre N sowie<br />
dem Zinsfaktor p.<br />
In einer weiteren Tabelle des Biogasanlagen-Beratungstools<br />
werden die Ergebnisse<br />
dargestellt (Abbildung 6). Für das hier vorgestellte<br />
Beispiel ist deutlich zu erkennen,<br />
dass der Kapitalwert zunächst stark ansteigt<br />
und am Ende des achten Jahres bereits<br />
der Pay-off der damals noch kleineren<br />
360-kW-Anlage erreicht wird. Bis zum Jahr<br />
17 ist ein weiterer, allerdings gebremster<br />
Zuwachs im Kapitalwert festzustellen. Mit<br />
dem Wechsel ins EEG 2017 ist jedoch nur<br />
noch eine moderate Seitwärtsentwicklung<br />
zu verzeichnen. Auch wenn der Plan (Abbildung<br />
2) einen Rückbau der Biogasanlage<br />
erst nach 30 Nutzungsjahren, das heißt<br />
im Jahr 2033, vorsieht, so wäre doch zu<br />
überlegen, die Anlage bereits nach 27 Jahren<br />
stillzulegen, da im 28. Jahr überproportional<br />
hohe Reparaturkosten anstehen<br />
würden.<br />
Für den Anwender des Beratungstools<br />
werden zum einen in der linken Tabelle<br />
die Eckdaten der Anlage dargestellt, zum<br />
anderen verdeutlicht eine Grafik rechts die<br />
Entwicklung der wichtigsten Leistungen<br />
und kennzeichnet das Jahr der optimalen<br />
Nutzungsdauer in deren Kontext (rotes<br />
Kreuz in Abbildung 3 rechts oben). Im Praxisgebrauch<br />
ermöglicht das Beratungstool<br />
die Darstellung der Ergebnisse als pdf-<br />
Dokument.<br />
Interessierte können das Beratungstool<br />
zur Ermittlung der optimalen Nutzungsdauer<br />
bei Biogasanlagen per E-Mail<br />
anfordern beim Autor Clemens Fuchs<br />
unter: cfuchs@hs-nb.de<br />
5_Ergebnisse Seite 1<br />
Autoren<br />
Clemens Fuchs<br />
Jessy Blaschke<br />
Joachim Kasten<br />
Katharina Skau<br />
Hochschule Neubrandenburg<br />
Fachbereich Agrarwirtschaft und<br />
Lebensmittelwissenschaften<br />
Brodaer Str. 2 · 17033 Neubrandenburg<br />
Tel. 03 95/56 93 - 22 06<br />
E-Mail: skau@hs-nb.de<br />
Dipl. Ing. (FH) Frank Rixen<br />
Parkweg 3<br />
18190 Groß Lüsewitz<br />
67
Trocknungssysteme wie<br />
hier für Holzhackschnitzel<br />
sind eine Möglichkeit,<br />
die Gesamteffizienz der<br />
Biogasanlage durch Wärmenutzung<br />
zu verbessern.<br />
Wissenschaft<br />
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Was bringt Repowering wirklich?<br />
Ein Forschungsprojekt untersuchte deutschlandweit den Erfolg von Repoweringmaßnahmen<br />
an Biogasanlagen. Als Maßstab für die Energieeffizienz diente dabei erstmals die<br />
Kennziffer „Brennstoffausnutzungsgrad“.<br />
Thermische Speicher<br />
eines Nahwärmenetzes.<br />
Der Ausbau der<br />
Wärmenutzung bietet<br />
ein großes Potenzial<br />
für die Verbesserung<br />
des Brennstoffnutzungsgrades<br />
und<br />
damit der Effizienz von<br />
Biogasanlagen.<br />
Von Dipl.-Journ. Wolfgang Rudolph<br />
Biogasanlagen unterliegen einem ständigen<br />
technischen und baulichen Anpassungsdruck<br />
an die aktuellen Rahmenbedingungen<br />
und den Stand der Verfahrensentwicklung.<br />
Es gibt also über die Jahre eine Reihe<br />
guter Gründe für Repoweringmaßnahmen. Doch nicht<br />
immer steckt hinter dem aus der Windenergiebranche<br />
übernommenen Scheinanglizismus eine wirkliche Anlagenoptimierung.<br />
„Der Begriff wird in der Praxis breit ausgelegt, da es<br />
keine Kriterien oder Kennzahlen gibt, die Repowering<br />
exakt eingrenzen“, sagt Jan Postel vom Deutschen Biomasseforschungszentrum<br />
(DBFZ) in Leipzig. Manchmal<br />
handele es sich bei näherem Hinsehen eher um<br />
Wartungsarbeiten oder die Beseitigung akuter Probleme.<br />
Beim Repowering gehe es dagegen um mittel- oder<br />
langfristig geplante technische Modifikationen zur gezielten<br />
Steigerung des Nutzungsgrades.<br />
Dabei werde entweder das Ziel verfolgt, bei gleichem<br />
Energieertrag die Inputmenge zu reduzieren beziehungsweise<br />
eine breitere Palette an Substraten einzusetzen.<br />
Oder der Betreiber strebe eine Leistungssteigerung bei<br />
gleichbleibenden Fütterungsmengen an. Letzteres erfolge<br />
vorwiegend durch bauliche Komponenten, durch<br />
die sich der rechtliche Status der Biogasanlage nicht<br />
verändert, etwa durch die Erneuerung der Einbringtechnik<br />
oder ein verbessertes Fütterungsprogramm.<br />
Mit dieser Begriffsdefinition und Beschreibung arbeitete<br />
auch das von Postel geleitete Team an einem vom<br />
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft<br />
68
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Wissenschaft<br />
Fotos: Carmen Rudolph<br />
Erik Fischer, DBFZ:<br />
„Die energetische Bilanzierung über den<br />
mittleren Brennstoffausnutzungsgrad<br />
bewertet Biogasproduktion und Biogaskonversion<br />
in ihrer Gesamtheit.“<br />
Jan Postel, DBFZ, Projektleiter:<br />
„Repowering definieren wir als mitteloder<br />
langfristig geplante technische<br />
Modifikationen zur gezielten Steigerung<br />
des Nutzungsgrades.“<br />
Modulares System zur<br />
Fremdkörperabscheidung<br />
und Zerkleinerung<br />
NEU: WANGEN<br />
geförderten Forschungsprojekt zum Thema<br />
Repowering. Im Rahmen der wissenschaftlichen<br />
Untersuchung wurden an mehr als<br />
200 Biogasanlagen entsprechende Maßnahmen<br />
im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit<br />
sowie mögliche Effizienzsteigerung und<br />
Emissionsminderung ausgewertet.<br />
Die Grundlage dafür lieferte eine ausführliche<br />
Betreiberbefragung. Bei zehn Anlagen<br />
nahmen die Forscher zudem eine energetische<br />
Bilanzierung auf Grundlage eines<br />
neu eingeführten Bewertungssystems vor,<br />
das nicht auf dem im Labor ermittelten<br />
möglichen Gasertrag basiert, sondern – in<br />
Anlehnung an die in der Kraftwerksbranche<br />
gängige Berechnungspraxis – den<br />
Wirkungsgrad der gesamten Umwandlung<br />
in elektrische und thermische Energie betrachtet.<br />
Wärmenutzung und<br />
Leistungserhöhung der BHKW<br />
häufigste Maßnahmen<br />
Das Durchschnittsalter der ausgewerteten<br />
Biogasanlagen betrug 7,5 Jahre. In<br />
diesem Zeitraum wurden im Schnitt 3,5<br />
Repoweringmaßnahmen pro Anlage vorgenommen.<br />
Der Ausbau der Wärmenutzung<br />
und die Leistungserhöhung der Blockheizkraftwerke<br />
stellen mit jeweils mehr als 70<br />
Prozent die am häufigsten umgesetzten<br />
Maßnahmen dar, gefolgt von dem Ersatz<br />
von Alt-BHKW mit etwa 41 Prozent. Die<br />
gasdichte Abdeckung von Gärrestlagern<br />
sowie die Erhöhung der Fermentervolumina<br />
wurden jeweils von rund 35 Prozent, ein<br />
Substratwechsel von etwa 28 Prozent der<br />
Betreiber realisiert. Seltener erfolgten die<br />
Implementierung von Satelliten-BHKW,<br />
eine Substrataufbereitung und die Nachrüstung<br />
von Wärmespeichern.<br />
Die am häufigsten genannten Gründe<br />
für die Umsetzung von Repoweringmaßnahmen<br />
waren die Steigerung des Wirkungsgrades<br />
und die Akzeptanz in der<br />
Bevölkerung, etwa durch den Bau eines<br />
Wärmenetzes, sowie die Verbesserung der<br />
Substratausnutzung. Eine Konsequenz aus<br />
dem dadurch optimierten Anlagenbetrieb<br />
sehen die DBFZ-Forscher in der Einsparung<br />
von Anbauflächen für Energiepflanzen,<br />
die als Input in Biogasanlagen zum<br />
Einsatz kommen.<br />
Diese Fläche umfasst nach Schätzungen<br />
etwa 1,5 Millionen (Mio.) Hektar (ha).<br />
Wobei das Hauptsubstrat Mais auf rund<br />
1 Mio. ha wächst. „Nach unseren Berechnungen<br />
ermöglicht schon eine Substratreduzierung<br />
von 5 Prozent bei der Hälfte<br />
des derzeitigen Anlagenbestandes eine<br />
Reduzierung der NawaRo-Anbaufläche um<br />
35.730 ha“, so der am Projekt beteiligte<br />
DBFZ-Wissenschaftler Erik Fischer.<br />
Grad der Brennstoffausnutzung<br />
als Maßstab<br />
Die große Mehrheit der befragten Anlagenbetreiber,<br />
etwa 78 Prozent, bewertete den<br />
ökonomischen Erfolg der durchgeführten<br />
Repoweringmaßnahmen positiv. Dies ist<br />
nach Postels Ansicht allerdings auch ökonomischen<br />
Anreizen der bisherigen EEG<br />
geschuldet. Dass diese nicht immer zu einer<br />
Effizienzsteigerung der Gesamtanlage<br />
+ =<br />
Die WANGEN X-UNIT kommt<br />
überall dort zum Einsatz, wo<br />
Fremdkörper und Störstoffe<br />
aus Fördermedien separiert<br />
und zerkleinert werden müssen.<br />
Link zum Video<br />
Pumpenfabrik<br />
Wangen GmbH<br />
Simoniusstrasse 17<br />
88239 Wangen i.A., Germany<br />
www.wangen.com · info@wangen.com<br />
Die Pumpen Experten. Seit 1969.<br />
BiogasJournal_55x241_DE.indd 1 13.12.20176911:14:20
Wissenschaft<br />
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Der elektrische Wirkungsgrad von BHKW hat sich in den<br />
vergangenen Jahren deutlich erhöht. Für die Effizienz der Gesamtanlage<br />
ist jedoch die Nutzung der thermischen Energie<br />
ebenso von Bedeutung.<br />
Verteilstation eines Nahwärmenetzes. Bei den im Rahmen<br />
des DBFZ-Forschungsprojektes untersuchten Biogasanlagen<br />
stieg die Nutzwärmeausspeisung im Laufe der Repoweringmaßnahmen<br />
im Schnitt um 21 Prozent.<br />
Hausanschlussstation eines<br />
Nahwärmenetzes. Die Erhöhung der führen, zeige sich zum Beispiel, wenn weiterhin<br />
ein Wärmenutzungskonzept fehlt. Auch<br />
Akzeptanz von Biogasanlagen, etwa<br />
durch den Bau eines Wärmenetzes,<br />
die Anpassung des Einsatzstoffspektrums<br />
gehört zu den häufigsten Gründen<br />
mit Blick auf die Einsatzstoffvergütungsklassen<br />
im EEG 2012 seien rein ökonomisch<br />
für die Durchführung von Repoweringmaßnahmen.<br />
motivierte Maßnahmen. Eine objektive Bewertung<br />
des Erfolgs von Repoweringmaßnahmen<br />
liefere nach Ansicht das Forscherteams die<br />
Verknüpfung von energetischer und ökonomischer Effizienz.<br />
Dies sei umso wichtiger, da künftig Biogasanlagenbetreiber<br />
verstärkt über einen Betrieb ohne eine<br />
Vergütung nach dem EEG nachdenken müssen.<br />
Eine Messlatte für die Energieeffizienz von Biogasanlagen<br />
sehen die DBFZ-Forscher in der Berechnung des<br />
mittleren Brennstoffausnutzungsgrades. Diese Kennziffer<br />
ist in der Energietechnik etabliert und ermöglicht<br />
die Bewertung und den Vergleich verschiedener Energieerzeugungspfade<br />
anhand ihrer Effizienz der Ausnutzung<br />
der im Brennstoff enthaltenen Energie. Im Falle<br />
von Biogasanlagen sind das der Brennwert der zugeführten<br />
Trockensubstanz (TS) und des tatsächlich fermentierbaren<br />
Anteils der organischen Substanz (FoTS).<br />
„Die energetische Bilanzierung über den mittleren<br />
Brennstoffausnutzungsgrad begreift die Biogasanlage<br />
als eine Art Blackbox“, erläutert Fischer. Die Systemgrenze<br />
sei dabei quasi der Hofzaun der Biogasanlage.<br />
Es werde also nicht zwischen Biogasproduktion und<br />
Biogaskonversion unterschieden, sondern bewerte beide<br />
Prozessschritte in ihrer Gesamtheit.<br />
Als Beispiel nennt Postel im Gespräch mit dem Biogas<br />
Journal die Verstromung mittels BHKW. Bei diesen Aggregaten<br />
stiegen die elektrischen Wirkungsgrade durch<br />
Weiterentwicklung der Technik deutlich. Neue BHKW<br />
erreichen laut Herstellerangaben unter optimalen Testbedingungen<br />
43 bis 48 Prozent elektrischen Wirkungsgrad.<br />
„Auf den ersten Blick ist aus ökonomischer Sicht<br />
Biogaskontor<br />
Köberle GmbH<br />
Wir können mit Druck umgehen<br />
NEU ÜU-ST<br />
für Drücke bis<br />
20mbar<br />
Bullaugen für alle Einsatzfälle<br />
Für Kernbohrung Auf Stahlplatte nach In Tauchhülse für Über-/Unterdrucksicherung<br />
oder Futterhülse<br />
Kundenmaß<br />
Blick um die Ecke<br />
ÜU-TT<br />
Ø300 + Ø400 mm<br />
für Folienhauben<br />
Zubehör: Leuchten, Rosetten, Futterhülsen, Sonnenschutzhauben, etc.<br />
70<br />
Weitere Komponenten: Luftdosierstationen zur Entschwefelung, Füllstandsüberwachung, Messtechnik, Warnschilder<br />
Über-/Unterdrucksicherung<br />
ÜU-GD<br />
für Betondecken<br />
www.biogaskontor.de • info@biogaskontor.de • Germany 89611 Obermarchtal • Tel +49(0)737595038-0
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Wissenschaft<br />
ein BHKW mit hohem elektrischen Wirkungsgrad zielführend.<br />
Denn höhere elektrische Wirkungsgrade können die<br />
Effizienz einer Biogasanlage steigern, wenn keine vollständige<br />
Nutzung der Abwärme erfolgt“, sagt Postel.<br />
Allerdings sollte für ein wirksames Repowering seiner<br />
Ansicht nach zwischen Wirkungsgrad und Nutzungsgrad<br />
der Gesamtanlage unterschieden werden. Letztendlich<br />
müsse der Nutzungsgrad der Gesamtanlage<br />
gesteigert werden. Insbesondere die Ausweitung des<br />
Nutzwärmeabsatzes sei hierbei ein tragendes Moment.<br />
Denn die daraus folgende höhere Nutzwärmeabgabe<br />
ermögliche eine spürbare energetische Effizienzsteigerung<br />
der Gesamtanlage.<br />
Wärmenutzung ist wichtiger Effizienztreiber<br />
Die zugeführte Einsatzstoffmenge, die eingespeiste<br />
Nettoenergiemenge und die Nutzwärmemenge als<br />
Basis für die Berechnung des mittleren Brennstoffausnutzungsgrades<br />
wurden an den zehn für das Forschungsprojekt<br />
ausgewählten Biogasanlagen über das<br />
Betriebstagebuch, Abrechnungen oder entsprechende<br />
Mengenzähler erfasst. Beim Vergleich der Ergebnisse<br />
von modernisierter im Vergleich zur Altanlage zeigte<br />
sich, dass Repoweringmaßnahmen positive Auswirkungen<br />
auf die Energieeffizienz haben können.<br />
Bei den untersuchten Biogasanlagen stieg zum Beispiel<br />
die Nutzwärmeausspeisung im Laufe der Repoweringmaßnahmen<br />
bezogen auf die jeweiligen<br />
Nettowärmemengen von 38 Prozent auf 59 Prozent.<br />
Insgesamt wurden so 21 Prozentpunkte mehr Nutzwärme<br />
bereitgestellt. „Im Allgemeinen bietet der Ausbau<br />
der Wärmenutzung ein großes Potenzial, ebenso<br />
wie die Maßnahmen zur Steigerung der Gasausbeute“,<br />
resümiert Postel.<br />
Bei unvollständiger Nutzwärmeauskoppelung sei aus<br />
energetischer Sicht eine Verminderung des Substrateinsatzes<br />
bis hin zur Übereinstimmung der Energieproduktion<br />
mit der jahreszeitlich variierenden Abnahme<br />
sinnvoll. Ein alleiniger BHKW-Wechsel zeige hingegen<br />
keinen Einfluss auf die Gesamtenergiebilanz. „Hier<br />
geht eine Erhöhung des elektrischen Wirkungsgrades<br />
zumeist mit einer Verminderung des thermischen Wirkungsgrades<br />
einher“, erläutert der Wissenschaftler.<br />
Hinweis: Der Abschlussbericht kann auf<br />
www.dbfz.de unter der Rubrik Publikationen<br />
als Report Nr. 28 eingesehen werden.<br />
Autor<br />
Dipl.-Journ. Wolfgang Rudolph<br />
Freier Journalist<br />
Rudolph Reportagen – Landwirtschaft,<br />
Umwelt, Erneuerbare Energien<br />
Kirchweg 10 · 04651 Bad Lausick<br />
Tel. 03 43 45/26 90 40<br />
E-Mail: info@rudolph-reportagen.de<br />
www.rudolph-reportagen.de<br />
Die Substitution von<br />
Mais durch Stroh, das<br />
hier gemeinsam mit<br />
anderen Feststoffen<br />
vor der Zugabe in den<br />
Fermenter mit einem<br />
Rotacut zerkleinert<br />
wird, kann die Effizienz<br />
der Anlage verbessern<br />
und führt außerdem zu<br />
einer Verringerung der<br />
NawaRo-Anbaufläche.<br />
71
Wissenschaft<br />
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Donau-Silphie liefert vielversprechende<br />
Gaserträge<br />
Bienen fliegen gerne<br />
die Silphieblüten an<br />
und sammeln Nektar.<br />
Die Biogasabteilung SensoPower der Firma Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH hat<br />
gemeinsam mit dem Energiepark Hahnennest GmbH & Co.KG und der Metzler &<br />
Brodmann Saaten GmbH Versuche zur Vergärbarkeit der „Donau-Silphie“ durchgeführt.<br />
Ziel war, die bereits langjährigen Erfahrungen des Energieparks Hahnennest mit der<br />
Vergärung der Donau-Silphie in vergleichenden Versuchen zu verifizieren.<br />
Von Dr. Angelika Konold-Schürlein<br />
Die Donau-Silphie (Durchwachsene Silphie,<br />
Silphium perfoliatum) gilt im Bereich der<br />
Biogassubstrate inzwischen als aussichtsreiche<br />
Alternative zum Mais. Der Energiepark<br />
Hahnennest betreibt eine Biogasanlage,<br />
in der seit einigen Jahren auch Donau-Silphie als<br />
Gärsubstrat zum Einsatz kommt. In Kooperation mit<br />
der Metzler & Brodmann Saaten GmbH wird die Durchwachsene<br />
Silphie angebaut und unter dem Markennamen<br />
„Donau-Silphie“ vermarktet.<br />
Bisher gibt es nur wenige Versuchsergebnisse und Erfahrungen<br />
zur Vergärung von Silphie und den damit<br />
verbundenen Gaserträgen. Um genauere Kenntnisse<br />
über die Vergärbarkeit, mögliche Gasausbeuten und einen<br />
Vergleich zur Vergärung von Silomais zu erhalten,<br />
wurden in Versuchsfermentern (Durchflussfermenter)<br />
verschiedene Gärtests mit Silomais und Donau-Silphie<br />
vorgenommen.<br />
Fotos: Energiepark Hahnennest<br />
Versuchsaufbau und Ergebnisse<br />
Das Pflanzenmaterial für den Versuch wurde von der<br />
Biogasanlage Hahnennest zur Verfügung gestellt. Der<br />
Versuch fand in den vier Versuchsfermentern der Firma<br />
Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH statt. Vom<br />
Energiepark Hahnennest wurden folgende Substrate<br />
bereitgestellt: Silomais (Ernte 2016), früh geerntete<br />
Silphie (Ernte 13.8.2016) und spät geerntete Silphie<br />
(Ernte 23.9.2016). Diese wurden in den vier Versuchsfermentern<br />
über neun Wochen hinweg eingesetzt.<br />
In allen Fermentern wurde durch die Zugabe eines Spurenelementpräparates<br />
(SensoPower liquid) eine ausreichende<br />
Versorgung mit Nährstoffen sichergestellt. Neben<br />
der Erfassung der Gaserträge und Methangehalte<br />
des Biogases wurden auch die Inhaltsstoffe der Substrate<br />
analysiert und Analysen der Fermenterinhalte<br />
erstellt.<br />
Besonders auffällig waren bei den Substratanalysen die<br />
großen Unterschiede zwischen dem Trockensubstanzgehalt<br />
(TS-Gehalt) des Maises und dem der Silphie. Sie<br />
lagen um rund 10 Prozentpunkte auseinander. Obwohl<br />
72
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Wissenschaft<br />
die Silphie zu beiden Erntezeitpunkten nur einen TS-Gehalt von 16 bis 19 Prozent<br />
aufwies, trat kaum Flüssigkeit aus dem Substrat aus. Dies deckt sich auch mit den<br />
Aussagen der Biogasanlagenbetreiber in Hahnennest, die bei der Silphie nur einen<br />
sehr geringen Austritt von Sickersaft nach der Silierung (Silostockhöhe 3,5 Meter)<br />
beobachten. Die organische Trockensubstanz (oTS, Ermittlung bei 550 °C) der<br />
Silphie wies mit rund 90 Prozent oTS etwas niedrigere Werte auf als der Mais mit<br />
96 Prozent (siehe Tabelle 1 auf Seite 74).<br />
Früh geerntete Silphie brachte beste Gaserträge im Versuch<br />
In Tabelle 1 sind auch die Ergebnisse der Gasmengen- und -qualitätserfassung<br />
aufgeführt. Der Mais und die früher geerntete Silphie konnten im Versuch die<br />
höchsten Gaserträge erzielen. Bezogen auf die oTS konnte mit der früh geernteten<br />
Silphie der höchste Gasertrag (840 Liter/kg oTS) erreicht werden. Bei der Vergärung<br />
von Mais lag der Methangehalt bei rund 52 Prozent. Bei der Vergärung der<br />
Silphie konnten Methangehalte zwischen rund 51 Prozent und fast 54 Prozent<br />
erzielt werden.<br />
Daneben konnte die sehr gute Abbaubarkeit der Silphie im Biogasprozess bestätigt<br />
werden. Während das silierte Substrat eher verholzt und schlecht abbaubar wirkte,<br />
konnte bei den Ziehungen von Proben aus dem Fermenter beobachtet werden,<br />
dass das Gärsubstrat sehr flüssig war und kaum unabgebautes Ausgangssubstrat<br />
enthielt. Diese Beobachtung deckte sich auch mit den analysierten oTS-Gehalten<br />
der Fermenterinhalte. Sie waren vergleichbar mit denen von Mais oder sogar geringer,<br />
was auf einen guten Substratabbau durch die Mikroorganismen hinweist.<br />
Nach Abschluss der fünfwöchigen Versuchsreihe für den Energiepark Hahnennest<br />
wurde in den Fermentern 104 (Mais), 105 (frühe Ernte Donau-Silphie) und 107<br />
(späte Ernte Donau-Silphie) zusätzlich zu den Spurenelementen vier Wochen lang<br />
noch SensoPower Hybrid, ein seit mehreren Jahren auf dem Markt verfügbares Additiv<br />
der Firma Phytobiotics eingesetzt. Der Fermenter 106 wurde zum Vergleich<br />
ohne den Zusatz von SensoPower Hybrid aber unter Zugabe von Spurenelementen<br />
weitergeführt.<br />
In dem Produkt SensoPower Hybrid wird der Wirkstoff Sangrovit ® mit einem Enzym<br />
kombiniert. Während Sangrovit das Wachstum der für den Biogasprozess<br />
wichtigen Mikroorganismen fördert, unterstützt das Enzym den Aufschluss der<br />
Substrate und macht die Nährstoffe für die Mikroorganismen so schneller ver-<br />
Die Durchwachsene<br />
Silphie bildet eine enorme<br />
Menge an Biomasse.<br />
»Mit N·DYN hole ich<br />
mehr Energie<br />
aus meiner Anlage.«<br />
N·DYN Da ist mehr drin.<br />
Innovative Additive<br />
für Ihren maximalen<br />
Biogas-Ertrag<br />
N·DYN Additive sind die optimal abgestimmte<br />
Kombination ertragsteigernder<br />
Produkte für den Bedarf von Biogasanlagen.<br />
4 Stabilisieren die biologischen Prozesse<br />
4 Sparen Substrat<br />
4 Senken Ihren Eigenstromverbrauch<br />
4 Erhöhen den Methan-Ertrag<br />
4 Steigern die Leistung<br />
4 Werden seit Jahren erfolgreich<br />
eingesetzt<br />
N·DYN orientiert sich bei der Rezeptur und<br />
Dosierung der Additive an den neuesten<br />
wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die N•DYN<br />
Additive schaffen auf diese Weise optimale<br />
Wachstums- und Stoffwechsel-Bedingungen<br />
für Bakterien im Fermenter und steigern<br />
zuverlässig und nachhaltig den Wirkungsgrad.<br />
Mit N·DYN gewinnen Sie mehr Energie<br />
aus Ihrer Anlage!<br />
DIE NEUE GENERATION<br />
FERMENTER-ADDITIVE<br />
73<br />
Trouw Nutrition<br />
Deutschland GmbH<br />
Gempfinger Straße 15<br />
86666 Burgheim<br />
Tel. 08432 89-0<br />
Fax 08432 89-150<br />
milkivit@nutreco.com<br />
www.milkivit.com
Wissenschaft<br />
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Tabelle 1: Ergebnisse der Gasmengenmessung in den Versuchsfermentern<br />
Bezeichnung Versuchsfermenter 104 105 106 107<br />
Substrat<br />
Mais<br />
(2016)<br />
Silphie<br />
(13.08.2016)<br />
Silphie<br />
(23.09.2016)<br />
Silphie<br />
(23.09.2016)<br />
Trockensubstanz Futter % der FS 27,3 17,4 18,9 18,9<br />
Trockensubstanz Fermenterinhalt % der FS 8,5 8,0 8,5 9,8<br />
organische Trockensubstanz Futter % der TS 96 89 90 90<br />
organische Trockensubstanz Fermenterinhalt % der TS 78,0 74,3 75,7 78,5<br />
durchschn. erzeugte Gasmengen l/kg FS 207 129 117 115<br />
l/kg oTS 790 840 692 678<br />
durchschn. Gasqualität % Methan 52,4 51,4 53,6 52,4<br />
Tabelle 2: Einfluss von SensoPower Hybrid auf die Gaserträge<br />
Bezeichnung Versuchsfermenter 104 105 106 107<br />
Substrat<br />
Mais<br />
(2016)<br />
Silphie<br />
(13.08.2016)<br />
Silphie<br />
(23.09.2016)<br />
Einsatz von SensoPower Hybrid X X X<br />
Silphie<br />
(23.09.2016)<br />
erzeugte Gasmenge ohne SensoPower Hybrid l/kg FS 207 129 117 115<br />
l/kg oTS 790 791 792 793<br />
erzeugte Gasmenge mit SensoPower Hybrid l/kg FS 320 158 156 165<br />
l/kg oTS 1220 1027 919 976<br />
Erhöhung des Gasertrages 55 % 30 % 16 % 23 %<br />
fügbar. Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 dargestellt.<br />
Es zeigt sich deutlich, dass sowohl bei der Vergärung<br />
von Mais als auch von Silphie die Gasausbeute deutlich<br />
gesteigert werden kann.<br />
Dies ist zum einen sicherlich auf die längere Verweilzeit<br />
zurückzuführen. Dass SensoPower Hybrid dennoch<br />
eine höhere Gasausbeute bewirkt, zeigt sich beim Vergleich<br />
der Fermenter 106 und 107, die beide mit dem<br />
gleichen Pflanzenmaterial beschickt wurden. Durch die<br />
längere Verweilzeit konnte der Gasertrag in Fermenter<br />
106 ohne den Einsatz von Hybrid noch einmal um 16<br />
Prozent gesteigert werden, während im Fermenter 107<br />
mit Einsatz von SensoPower Hybrid der Gasertrag sogar<br />
um 23 Prozent erhöht werden konnte.<br />
Warum nicht auch bei Ihnen?<br />
Fördern Sie Ihr Image und das der Branche!<br />
von der Biogasanlage Erdmann<br />
QR-Code scannen oder unter:<br />
Installieren Sie eine Ladebox<br />
an Ihrer EE-Anlage!<br />
74
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Wissenschaft<br />
Fazit: Bisher gibt es im Bereich der Vergärung von<br />
Durchwachsener Silphie in Biogasanlagen nur wenig<br />
Erfahrung und kaum Daten. Mit dem in diesem Bericht<br />
beschriebenen Versuch konnten die auf der Biogasanlage<br />
Hahnennest getätigten Beobachtungen und ermittelten<br />
Gaserträge verifiziert werden. Die in Hahnennest<br />
und auch in den Versuchen beobachteten Gaserträge<br />
liegen deutlich über den bisher in der Literatur angegebenen<br />
Werten. So weist der Biogasertragsrechner<br />
des KTBL einen Gasertrag von 480 Normliter pro Kilogramm<br />
(Nl/kg) oTS mit 58 Prozent Methan aus. Das<br />
entspricht einem Methanertrag von etwa 278 Nl Methan/kg<br />
oTS.<br />
J. Köhler und R. Müller sprechen in ihrer Anbauanleitung<br />
für die Aussaat von Durchwachsener Silphie<br />
Silphium perfoliatum L. (2015) von einem Methanertrag<br />
in Höhe von 285 Nl/kg oTS. In dem vorliegenden<br />
Versuch wurde bei der Vergärung von Donau-Silphie<br />
ein Biogasertrag von bis zu 840l/kg oTS erreicht. Das<br />
entspricht 432 Nl Methan pro kg oTS. Die sehr guten<br />
Gasausbeuten, eine gute Silierbarkeit und die Bildung<br />
von sehr wenig Sickersaft trotz niedriger TS-Gehalte sowie<br />
die gute Abbaubarkeit des optisch verholzt wirkenden<br />
Pflanzenmaterials zeigen, dass die Donau-Silphie<br />
eine sehr gute Alternative zum Einsatz von Mais in Biogasanlagen<br />
darstellt. Durch den Einsatz von Additiven,<br />
wie Sensopower Hybrid, kann die Vergärbarkeit noch<br />
optimiert werden.<br />
Autorin<br />
Dr. Angelika Konold-Schürlein<br />
Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH<br />
Marketing und Produktmanagement<br />
Fürschlag 1 · 91564 Neuendettelsau<br />
Tel. 0 98 74/50 48 28 11<br />
Mobil: 01 51/14 08 60 16<br />
E-Mail: a.konold@phytobiotics.com<br />
Silphieernte mit dem<br />
Maishäcksler mit GPS-<br />
Erntevorsatz.<br />
75
Gute<br />
International<br />
Aussichten: Hannes Muntingh,<br />
links, und John Chege diskutieren<br />
den Einfluss von Afrikas<br />
Sonne auf die Biogasproduktion<br />
im<br />
Fermenter.<br />
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Kenia<br />
Premiere mit Avocados<br />
Nairobi<br />
Avocados sind wegen ihrer wertvollen Nährstoffe bei Anhängern der gesunden<br />
Ernährung beliebt. Dass auch die Produktionsreste eine energiereiche<br />
Ressource sind, will ein Avocadoölproduzent aus Kenia zeigen. Mit deutscher<br />
Unterstützung wird daraus Biogas für Küche und Tank.<br />
Optisch wie Steinkohle:<br />
Avocadokerne in Kisten<br />
bei Olivado in Kenia.<br />
Von Oliver Ristau<br />
Sie sehen aus wie typische Steinkohle-Eier,<br />
so wie sie früher in zahlreichen Kohlekellern<br />
alter Häuser zu finden waren – teilweise von<br />
einer weißen Schicht wie Asche überzogen,<br />
als wären sie bereits angezündet worden.<br />
Fotos: Oliver Ristau<br />
Doch tatsächlich handelt es sich um Kerne von Avocadofrüchten,<br />
die Haut geschwärzt von Luft und Hitze.<br />
Sie lagern in Kisten aus dicken Holzlatten, die verloren<br />
mitten auf einem Feld frisch aufgeworfener roter<br />
Erde stehen. Hinter einem Erdwall aus gleicher Farbe<br />
zeichnet sich gegen den blauen Himmel die typische<br />
Halbkreisform eines Gärbehälterdachs ab.<br />
Hier im kenianischen Muranga, rund eine Stunde Autofahrt<br />
Richtung Norden von Kenias Hauptstadt Nairobi<br />
entfernt, unterhält die neuseeländische Firma Olivado<br />
eine der größten Produktionsstätten Afrikas für Bio-<br />
Avocadoöl. Unscheinbar erhebt sie sich inmitten von<br />
kleinen Plantagen, auf deren trockenen Böden Mangos,<br />
Ananas und eben Avocados wachsen. Am Eingang zum<br />
Betrieb hinter einem einfachen Holztor erwartet Hannes<br />
Muntingh die Besucher. Der hellhäutige Südafrikaner<br />
arbeitet seit knapp drei Jahren hier und ist dafür<br />
zuständig, eine nachhaltige Lösung für die Abfälle zu<br />
entwickeln, die nach dem Pressen der nährstoffreichen<br />
Früchte übrig bleiben – so wie die Kerne in den Holzkisten.<br />
76
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
International<br />
„Es ging darum, eine<br />
Alternative für die Entsorgung<br />
der Produktionsabfälle zu<br />
schaffen“<br />
Hannes Muntingh<br />
Immer mehr Reste fallen an, seit die Neuseeländer<br />
vor zehn Jahren in Kenia eine<br />
Zweigstelle eröffneten. Die Zahl der Kleinbauern,<br />
die die Früchte mit der dunkelgrünen<br />
Haut hier anliefern, ist von ein paar<br />
hundert auf aktuell rund 1.500 angestiegen.<br />
Insgesamt kommen so mehr als 4.000<br />
Tonnen Früchte pro Jahr zusammen. Daraus<br />
presst Olivado Öl, das vor allem in Industrieländer<br />
exportiert wird. Dort schätzt<br />
eine wachsende Zahl ernährungsbewusster<br />
Verbraucher die Eigenschaften des Pflanzenöls,<br />
das reich an ungesättigten Fettsäuren<br />
ist. Wo die Kisten mit den Kernen in<br />
der Sonne stehen, soll künftig eine neue<br />
Lagerhalle für frische Früchte Platz finden.<br />
Doch so attraktiv das Exportprodukt auch<br />
ist, bei der Produktion fallen jede Menge<br />
Reststoffe an – Schalen, Fruchtfleisch<br />
und Kerne. Weil das Öl nur rund 11 Prozent<br />
am Gewicht ausmacht, summieren<br />
sich die Reste auf über 3.500 Tonnen, wie<br />
Muntingh vorrechnet. „Es ging darum, eine<br />
Alternative für die Entsorgung der Produktionsabfälle<br />
zu schaffen“, erzählt er. Bisher<br />
mussten die weitgehend flüssigen Reste<br />
mit Lkw nach Nairobi auf die Deponie gebracht<br />
werden.<br />
Und das ist teuer: „Die Transport- und Entsorgungskosten<br />
machen etwa 5 Prozent der<br />
gesamten Kosten des Unternehmens aus.“<br />
Zugleich verfügen die Abfälle noch über<br />
viel Energie. Eine gewisse Partie Öl bleibt<br />
im Fruchtfleisch gebunden, auch die Kerne<br />
sind Kraftpakete. Das will sich Olivado<br />
künftig zunutze machen – und zwar, um<br />
daraus Biogas zu erzeugen.<br />
Muntingh lebt seit 2008 in Kenia, war<br />
vor seiner Zeit bei Olivado selbstständiger<br />
Berater für Biogasanlagen und hat in Zusammenarbeit<br />
mit öffentlichen Geldgebern<br />
vor allem kleine Projekte für Landwirte realisiert.<br />
Jetzt ist der 42-Jährige für Großes<br />
zuständig. Ab der Erntesaison <strong>2018</strong> (März<br />
bis September) sollen die Fruchtreste vergoren<br />
werden und einen Jahresertrag von<br />
rund 3.500 Kubikmeter Rohbiogas bringen.<br />
Bei einem Anteil von 64 Prozent beträgt<br />
das erwartete Methanvolumen 2.300<br />
Kubikmeter. Das entspreche in etwa dem<br />
Äquivalent von 286.000 Litern<br />
Diesel, so Muntingh.<br />
Der Südafrikaner hat dafür ein<br />
eigenes Konzept realisiert und<br />
auf das Know-how deutscher<br />
Spezialisten zurückgegriffen.<br />
„Bisher kenne ich keine Anlage,<br />
die auf der Welt in nennenswerter Weise<br />
Biogas aus Avocadoresten herstellt“, sagt<br />
er. Einer von zwei Faulbehältern, die die<br />
Weltpremiere möglich machen sollen, ist<br />
auf einer Anhöhe hinter der Fabrik bereits<br />
zu sehen.<br />
Biogas statt Diesel und Netzstrom<br />
Die Sonne steht fast senkrecht am Himmel.<br />
Ein paar Wolken schützen bisweilen<br />
vor der intensiven Einstrahlung. Einzelne<br />
Bäume auf dem sandigen Vorplatz spenden<br />
Schatten. Auf dem Gelände herrscht wenig<br />
Betrieb. Ein paar Mitarbeiter tragen Kisten<br />
vorbei. „Im Moment ist keine Erntesaison“,<br />
sagt Muntingh. Immerhin 60 Mitarbeitern<br />
gibt die Fabrik einen Job. Jetzt haben sie<br />
viel Instandhaltungsarbeiten zu erledigen.<br />
Der Energiemanager führt die Besucher<br />
aus der Sonne in die leeren Produktionshallen.<br />
Es ist ruhig, dunkel und angenehm<br />
kühl. Alle Maschinen stehen still. Nur in<br />
einem Nebenraum herrscht Betrieb. Hier<br />
lagern noch Kisten voller Früchte aus der<br />
vergangenen Saison. Mitarbeiter zeigen sie<br />
lächelnd. Im Hintergrund der Maschinenhalle<br />
steht ein 120 Kilowatt starker Elektroboiler<br />
an der Wand, der bisher die Wärme<br />
für den Prozess liefert.<br />
Die wird dafür gebraucht, um die Avocado<br />
bei Temperaturen von 40 bis 45 Grad Celsius<br />
zu pressen. Künftig soll der Boiler nur<br />
noch als Reserve dienen, ebenso wie das<br />
Dieselaggregat hinter der Fabrik, das dafür<br />
vorgesehen ist, dann anzuspringen, wenn<br />
bei Stromausfällen die Elektrizitätsversorgung<br />
gesichert werden muss. Ihre Tage sind<br />
gezählt. Künftig sollen Wärme und Strom<br />
vollständig mit Biogas erzeugt werden.<br />
Muntingh verlässt die Halle durch den<br />
Hinterausgang. Dort steigt das Gelände<br />
sofort steil an. Es ist nur noch Platz für<br />
den 24.000 Liter Kunststofftank, in dem<br />
alle Abfälle zusammenfließen. „Sie werden<br />
automatisch hineingefördert, durchmischt<br />
und anschließend in die Fermenter<br />
gepumpt“, erklärt er. „Er wird mit einem<br />
Sensor zur Bestimmung von pH-Wert, der<br />
Temperatur und anderen wichtigen Parametern<br />
ausgestattet. So können wir immer<br />
Rührwerk<br />
optimieren,<br />
Kosten<br />
reduzieren!<br />
Steigern Sie die Effizienz Ihrer<br />
Bio gas anlage und reduzieren Sie<br />
Ihre Stromkosten. Tauschen Sie<br />
z. B. ein altes 18,5-kW-Tauchmotor-<br />
Rührwerk durch ein effizientes<br />
11-kW-Stallkamp-Modell aus und<br />
sparen Sie – bei gleicher Rührleistung<br />
– rund 4.000 Euro jährlich*.<br />
Der Tausch amortisiert sich meist<br />
schon im ersten Jahr. Kontaktieren<br />
Sie unsere Spezialisten!<br />
| pumpen<br />
| lagern<br />
| rühren<br />
| separieren<br />
* Die Höhe der tatsächlichen Ersparnis ist abhängig von<br />
Laufzeit, Strompreis, TS-Gehalt, Fermenterauslegung<br />
und Wirkungsgrad des Rührwerks.<br />
77<br />
Tel. +49 4443 9666-0<br />
www.stallkamp.de<br />
MADE IN DINKLAGE
International<br />
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Schwarze Folien: Der<br />
zweite Fermenter soll<br />
bis zur Erntesaison im<br />
März fertig sein.<br />
Eigenregie: Muntinghs<br />
Team hat die beiden<br />
Fermenter für die<br />
Avocadoölfabrik selber<br />
gebaut.<br />
den Zustand des Substrats vor der Zufütterung kontrollieren.“<br />
Neben dem Prozesswasser werden künftig<br />
auch die flüssigen Gärreste zugeführt. Die Avocadokerne<br />
werden zuvor in einer Mühle mit einer Kapazität von<br />
zwei Tonnen pro Stunde zerstoßen.<br />
Gülle soll nicht dazugemischt werden – mit Ausnahme<br />
zum Start des Gärprozesses oder wenn entsprechende<br />
Bakterien zur Initiierung der Gärprozesse benötigt werden.<br />
Gründe sind zum einen die Logistik. Denn für den<br />
Lebensmittelbetrieb ist ein hoher hygienischer Standard<br />
Voraussetzung. Deshalb ist am Standort der Fermenter<br />
ein eigener kleiner betonierter Gülletank platziert worden.<br />
Zum anderen habe sich unter den Landwirten in<br />
der Umgebung schnell herumgesprochen, dass Gülle<br />
ein potenzieller Rohstoff für die Biogasanlage ist. „Es<br />
ist schon bemerkenswert, wie schnell die Preise plötzlich<br />
gestiegen sind“, so der Biogas-Profi.<br />
Mehr Früchte – höhere Auslastung<br />
Stattdessen will Muntingh künftig andere Fruchtabfälle<br />
nutzen, um die Auslastung der Anlage zu steigern.<br />
„So wie es aktuell steht, werden wir mit der nächsten<br />
Expansion der Fabrik in der Hauptsaison mehr Reste<br />
produzieren, als wir für die tägliche Biogasproduktion<br />
brauchen können.“ Das seien etwa 70 bis 80 Tonnen<br />
täglich inklusive des Prozesswassers. „Wir werden deshalb<br />
bis zu 50 Prozent der Kerne lagern und in der Nebensaison<br />
zufüttern. Für diese Zeit überlegen wir auch,<br />
Fruchtabfälle von Nachbarbetrieben, die Mangos und<br />
Ananas verarbeiten, einzusetzen.“<br />
Und schließlich will Olivado durch die Verarbeitung<br />
weiterer Feldfrüchte die Fabrik unabhängiger von der<br />
Avocadosaison machen. Geplant sei, künftig Öl aus<br />
Macadamianüssen zu pressen und Mangos selbst zu<br />
verarbeiten. „So werden wir mehr Abfälle in verschiedenen<br />
Saisons zur Verfügung haben“, sagt Muntingh.<br />
Nun ist es Zeit, die Anlage in Augenschein zu nehmen.<br />
Muntingh erklimmt die Anhöhe hinter der Fabrik über<br />
eine Metalltreppe, stapft über trockenes Gras, vorbei<br />
an vereinzelten Sträuchern und dürren Nadelhölzern,<br />
auch eine mit Wellbech zusammengefügte Hütte bleibt<br />
rechts liegen. Dann weist ein handgemaltes Holzschild<br />
unautorisierte Personen an, nicht weiterzugehen.<br />
Links bleibt der Blick an einem anderen Schild hängen,<br />
das vor „temporären Abfallteichen“ warnt, die mit<br />
rot-weißem Absperrband gegen den Zutritt gesichert<br />
sind. Der Besucher tut gut daran, die Warnung ernst<br />
zu nehmen, denn das schwarze Erdreich ist sumpfig.<br />
In diesem Areal hat Olivado bis vor Kurzem noch einen<br />
Teil seiner Reste deponiert, berichtet Muntingh und<br />
streicht sich Strähnen blonden Haars aus der Stirn, die<br />
der Wind aufwirbelt.<br />
Es riecht nach Erde und reifem Obst. „Wir haben dafür<br />
die Genehmigung der kenianischen Abfallbehörde für<br />
die Übergangszeit, bis die Biogasanlage arbeitet“, erklärt<br />
er. Diese offenen Lager werden mittlerweile nicht<br />
mehr gebraucht. Denn auch wenn die Stromproduktion<br />
noch nicht aufgenommen wurde, anfallende Reste werden<br />
bereits verarbeitet.<br />
78
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
International<br />
Flüssigtank: Hinter der Fabrik nimmt der Kunststoffbehälter 24.000 Liter Abfälle auf.<br />
Fermenter mit undurchlässiger<br />
Folie ausgekleidet<br />
Und zwar in einem der beiden ockergelben<br />
Fermenter, die einen Steinwurf entfernt im<br />
Erdreich stecken. Nur die obersten Partien<br />
der Garbehälter liegen frei. Dem anderen<br />
fehlt noch das Dach und gestattet so dem<br />
Betrachter den Blick in die Tiefe. Ausgekleidet<br />
ist der betonierte und je 1.400 Kubikmeter<br />
Substrat und Gas fassende Vergärer<br />
mit zwei dicken, schwarzen und wasserundurchlässigen<br />
Folien.<br />
Der erste Fermenter ist schon seit einigen<br />
Wochen in Betrieb. In dem Maschinenraum<br />
des Kolosses überprüft John Chege die Gasproduktion.<br />
Er ist Mitarbeiter der ersten<br />
Stunde. „John war Farmer, und wir haben<br />
uns vor ein paar Jahren im Rahmen eines<br />
Projektes für zwei kenianische Schulen<br />
kennengelernt“, erzählt Muntingh, während<br />
sich beide begrüßen. Ihm sei das hohe technische<br />
Verständnis von Chege aufgefallen<br />
und deshalb habe er ihm einen Job in seiner<br />
Firma angeboten.<br />
„Ich bin froh, dass er mich zusammen mit<br />
einem zweiten Kollegen auch zu Olivado<br />
begleitet hat“, gesteht der Südafrikaner.<br />
Nicht nur, weil sie den Bau bisher in Eigenregie<br />
umgesetzt haben. Sondern vor<br />
allem für die Zeit des Betriebs. Denn wenn<br />
die Anlage einmal rund um die Uhr läuft,<br />
gibt es viel zu tun, um die konstante Gasproduktion<br />
zu überwachen. Bei Problemen<br />
wird Muntinghs Team auf sich selbst angewiesen<br />
sein. Es gibt keine externen Dienstleister,<br />
die helfen könnten. Chege ist zufrieden<br />
mit der Gasproduktion. „Noch lassen<br />
wir das Biogas an die Außenluft ab, aber<br />
das wird sich ändern, sobald das gesamte<br />
Equipment und die Generatoren da sind“,<br />
erklärt der bescheiden wirkende Kenianer<br />
in seinem grünen Arbeitsoverall. „Ich<br />
wünsche mir, dass in unserem Land immer<br />
mehr Menschen diese Energiequelle nutzen<br />
werden“, sagt er noch, dann beginnt<br />
er mit Muntingh durch die Bullaugen den<br />
Zustand im Innern des Fermenters zu inspizieren.<br />
Wichtiger Partner: Biogasszene<br />
Deutschland<br />
Ein Großteil des technischen Equipments<br />
stammt aus Deutschland. So hat Verbio<br />
einen Teil der Beregnungsdüsen geliefert.<br />
Konzeptioniert wurde das BHKW<br />
vom Elektrotechnik-Meisterbetrieb Jürgen<br />
Schwarz aus Krefeld. Zum Einsatz<br />
kommen ein 130 kW elektrisch starker<br />
Generator von MTU und einer mit 125<br />
kW elektrisch von Liebherr. Die Lieferung<br />
übernimmt die Manfred Stumpf Energiesysteme<br />
aus Oberschwarzach.<br />
Den größten Einfluss auf Muntinghs Arbeit<br />
hatte aber das Biogaskontor aus Obermarchtal<br />
unter Leitung von Gründer und<br />
Geschäftsführer Erwin Köberle. Das Unternehmen<br />
hat vier Bullaugen, Beregnungsdüsen,<br />
Luftdosierstationen zur Entschwefelung<br />
sowie Pumpen und Anzeigetechnik<br />
„zum Vorzugspreis“ geliefert, wie Köberle<br />
dem Biogas Journal berichtet. Hintergrund<br />
der guten Beziehungen ist, dass der Südafrikaner<br />
vor seiner Zeit in Kenia in Köberles<br />
Betrieb ein mehrmonatiges Praktikum<br />
79<br />
WWW.TERBRACK-MASCHINENBAU.DE
International<br />
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Denn noch steht der finale Erfolg aus. Erst wenn klar<br />
ist, dass die Bakterien aus dem bunten Fruchtcocktail<br />
tatsächlich Tag für Tag das notwendige Biogas produzieren<br />
können, wird die Rechnung aufgehen. Erst dann<br />
wird die regenerative Strom- und Wärmeproduktion<br />
funktionieren. Muntingh ist zuversichtlich, hat im Vorfeld<br />
alles gelesen, was er zum Thema im Internet finden<br />
konnte. Und er ist für den Input aus Deutschland dankbar.<br />
„Biogaskontor war ein ganz wichtiger Partner, um<br />
das Projekt hier in Kenia entwickeln zu können“, sagt<br />
er. „Ohne die Unterstützung der Deutschen wäre das<br />
schwer geworden.“<br />
Avocadosumpf: Bisher lagerten die Produktionsreste<br />
unter freiem Himmel.<br />
Expansion: Die rote Erde soll einer neuen Fabrikhalle weichen.<br />
Expansion nach ganz Afrika<br />
Muntingh plant schon die nächsten Schritte. Denn die<br />
Firma erwartet, dass die Anlage teils deutlich mehr<br />
Strom und Wärme produzieren könnte, als die Fabrik<br />
benötigt. Es gebe zwar eine Art Einspeisetarif in Höhe<br />
von etwa 9 Eurocent je Kilowattstunde, um überschüssigen<br />
Strom an das Netz zu verkaufen. Doch das sei<br />
wenig attraktiv. Der Energiemanager plant stattdessen,<br />
das Biogas zu Biomethan aufzureinigen, in Flaschen<br />
abzufüllen und als Kochgas zu verkaufen. Aktuell wartet<br />
Olivado auf die dafür notwendigen Maschinen aus<br />
Indien. Außerdem schwebt ihm vor, das Gas als Kraftstoff<br />
einzusetzen. „Wir planen, unsere Fahrzeuge künftig<br />
mit eigenem Biomethan zu betanken.“<br />
Während Muntingh den Rückweg zur Fabrikhalle antritt,<br />
berichtet er von den Schwierigkeiten, das Projekt<br />
zu entwickeln. „In Kenia ist kaum technisches Equipment<br />
zu bekommen“, sagt er. Deshalb war die Hilfe aus<br />
Deutschland so wichtig. Die gibt es auch bei der Finanzierung,<br />
einer weiteren Klippe, die es zu umschiffen<br />
galt. „Die lokalen Banken haben zunächst nicht verstanden,<br />
was wir hier vorhaben“, sagt er. Dafür aber die<br />
Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft<br />
(DEG), eine Tochter der bundeseigenen KfW-Bankengruppe.<br />
Sie hat 20 Prozent zur Finanzierung des rund 1<br />
Million Euro teuren Vorhabens beigetragen.<br />
Und das Konzept soll Schule machen. „Das Potenzial,<br />
Biogas in Afrika zu gewinnen, ist enorm“, sagt<br />
Muntingh zum Abschied des Besuchs bei Olivado.<br />
Die Gesellschaft hat deshalb eine eigene Tochter gegründet,<br />
um das Konzept auch außerhalb von Kenia<br />
zu verbreiten. Dann könnten die schwarzen Kerne der<br />
Avovado auch anderswo in den Tropen zu einem wichtigen<br />
Energieträger werden. Die Optik dafür jedenfalls<br />
hätten sie.<br />
Für alle Fälle: Für Wartung oder sontige Unterbrechungen<br />
hält Olivado Backup-Lösungen vor.<br />
gemacht hat. „Er hat in der Zeit auch bei uns gewohnt,<br />
war ein Teil der Familie“, so Köberle. „Der Hannes war<br />
überall dabei“, erinnert er sich an den engagierten<br />
Praktikanten von damals und hofft, dass dessen Euphorie<br />
für das Projekt am Ende auch berechtigt sein wird.<br />
Autor<br />
Dipl.-Pol. Oliver Ristau<br />
Redaktion und Kommunikation<br />
Sternstraße 106 · 20357 Hamburg<br />
Tel. 040/38 61 58 22<br />
E-Mail: ristau@publiconsult.de<br />
80
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Visuelle International<br />
Kontrolle Ihrer<br />
Biogas-Produktion.<br />
Gas Technologie von APROVIS<br />
Biogasanlagen im Bauherrenmodell<br />
PAULMICHL GmbH<br />
Kisslegger Straße 13 · 88299 Leutkirch · Tel. 07563/8471<br />
Fax 0 75 63/80 12 www.paulmichl-gmbh.de<br />
info.lumi@papenmeier.de · www.lumiglas.de<br />
F.H. Papenmeier GmbH & Co.KG · Telefon 0 23 04-205-0<br />
FriCon – Gaskühlsysteme<br />
ActiCo – Aktivkohlefilter<br />
Gaswärmeübertrager<br />
Verdichter<br />
Wartung & Service<br />
91746 Weidenbach-Triesdorf · Tel.: +49 (0) 9826 / 6583 - 0 · info@aprovis.com<br />
mit getrennter Hydrolyse…<br />
...der Turbo für jede Biogasanlage<br />
Mehr Leistung durch zweistufige Vergärung.<br />
Ertüchtigung und Optimierung bestehender<br />
Biogasanlagen.<br />
Nachrüstung der Hydrolyse bei NAWARO<br />
Biogasanlagen.<br />
Wir garantieren die herstellerunabhängige<br />
Beratung und Planung.<br />
www.aprovis.com<br />
INNOVAS Innovative Energie- & Umwelttechnik<br />
Anselm Gleixner und Stefan Reitberger GbR<br />
Margot-Kalinke-Str. 9 80939 München<br />
Tel.: 089 16 78 39 73 Fax: 089 16 78 39 75<br />
info@innovas.com www.innovas.com<br />
Lumiglas optimiert Ihren Biogas-Prozess.<br />
Fernbeobachtung mit dem Lumiglas<br />
Ex-Kamera-System.<br />
Lokale oder globale Paketlösungen<br />
schaffen kostengünstig<br />
Sicherheit.<br />
Unser<br />
Info-Material:<br />
Paketlösung für<br />
die Biogaserzeugung.<br />
Gleich heute anfordern!<br />
81
International<br />
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Finnland<br />
Helsinki<br />
Klima-Kapriolen,<br />
Biogas und<br />
Kreislaufwirtschaft<br />
Wenige Biogasanlagen sind in Finnland in Betrieb. Die Verstromung<br />
ist nicht lohnend. Das Gas muss seinen Weg in die<br />
Mobilität, in Industrieprozesse oder in den Wärmesektor finden.<br />
Die Finnen wollen nun eine Kreislaufwirtschaft etablieren. Eine<br />
Chance für mehr Biomethanproduktion.<br />
Von Dierk Jensen<br />
Anne Paadar,<br />
Mitarbeiterin der Jeppo<br />
Biogas Ab, vor der<br />
öffentlichen Biogastankstelle<br />
in Jeppo.<br />
Es ist Ende Oktober. Die Sonne scheint. Während<br />
die finnischen Radiosender tagsüber<br />
für den frühen Abend den ersten Schneefall<br />
ankündigen, rauschen Dutzende Mähdrescher<br />
in Westfinnland über die Felder, um<br />
Bohnen, Raps und Hafer zu dreschen. Die Temperatur<br />
liegt bei etwas über 0 Grad, die Landwirte auf ihren<br />
Traktoren und Erntemaschinen tragen Mützen und<br />
Handschuhe. Als gegen späten Nachmittag tatsächlich<br />
die Sonne weicht und die ersten zarten Flocken fallen,<br />
da wirkt der goldgelb aufblitzende Hafer auf den Korntanks<br />
vollends surreal.<br />
Kurt Stenvall nickt. „Ja, so eine späte Ernte hatten wir<br />
hier noch nie“, seufzt der Endfünfziger. Der Geschäftsführer<br />
der Jeppo Biogas Ab, eine der nördlichsten Biogasanlagen<br />
Europas im Westen Mittelfinnlands, weiß<br />
Fotos: Dierk Jensen<br />
auch nicht so recht, was er sagen soll, zuckt ziemlich<br />
ratlos die Schultern. „Wir hatten in dieser Region einen<br />
extrem kalten Sommer, nie über 20 Grad Celsius. Als<br />
dann das Getreide Ende September endlich reif war,<br />
setzte der Regen ein, vier Wochen lang“, klagt Stenvall<br />
über das extreme Wetter. Klimawandel?<br />
Während an diesem denkwürdigen Oktobertag zumindest<br />
auf den Feldern der finnische Elch steppt, ist an<br />
der Tankstelle der Jeppo Biogas Ab eher weniger los.<br />
„In der Regel fahren hier täglich bis maximal fünf Autofahrer<br />
vor und tanken Biomethan“, erklärt Stenvall<br />
nüchtern. Es sei weniger Nachfrage vorhanden, als<br />
noch vor vier Jahren beim Start der Biogasanlage die<br />
Investoren hofften, räumt er freimütig ein.<br />
Mehr Gasfahrzeuge notwendig<br />
Richtig erstaunlich ist die schwache Nachfrage nach<br />
diesem Kraftstoff allerdings nicht, denn in ganz Finnland<br />
gibt es gegenwärtig gerade mal 3.500 angemeldete<br />
Gasautos. Zwar hat sich die aktuelle Koalitionsregierung<br />
in Helsinki das energie- und klimapolitische<br />
Ziel gesetzt, in den nächsten Jahren bis zu 50.000<br />
gasbetriebene Autos auf die Straßen zu bringen, doch<br />
hilft dies den Anbietern von Biomethan augenblicklich<br />
noch nicht sonderlich weiter.<br />
Trotzdem setzt Stenvall auf die Mobilität, weil seiner<br />
Ansicht nach der finnische Strommarkt bei einem Verbraucherpreis<br />
von 11 Cent pro Kilowattstunde für die<br />
Biogasnutzung wenig wirtschaftliche Perspektiven biete.<br />
Obendrein weckt der Markt für landwirtschaftliche<br />
Zugmaschinen neue Hoffnungen. So beabsichtigt der<br />
skandinavische Hersteller Valtra, mit einem neuen mit<br />
Biomethan betriebenen Traktor eine klimafreundlichere<br />
Ära in der Landwirtschaft einzuläuten. Klar, dass<br />
das neue Valtra-Modell auch schon auf der Biomethan-<br />
Tankstelle von Jeppo für Promotionszwecke betankt<br />
wurde.<br />
82
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
International<br />
Dennoch, nur ein kleiner Anteil des in<br />
Jeppo erzeugten Biogases, maximal<br />
der Energiewert von 5 Gigawattstunden,<br />
geht bislang in die Tanks. Dabei<br />
ist die Biogasanlage, deren Fermenter-<br />
Technologie von der niedersächsischen<br />
Weltec Biopower GmbH geliefert wurde,<br />
erstaunlich groß. So verarbeitet sie<br />
aktuell rund 70.000 Kubikmeter Gülle,<br />
die von rund 150 Viehhaltern mit einer<br />
Betriebsgröße von 20 bis 200 Hektar<br />
Land bezogen wird. In der Mehrzahl<br />
sind es Schweinehalter, von denen fünf<br />
große gewerbliche Schweinezüchter<br />
sind, die ohne Land produzieren.<br />
Darüber hinaus werden noch 50.000 Kubikmeter Gemüse-<br />
und Schlachtabfälle sowie etwas Gras und Stroh<br />
aus kommunaler Flächenpflege vergoren. Insgesamt<br />
erzeugt die Anlage jährlich rund 4,5 Millionen Kubikmeter<br />
Biogas, an der zu einem guten Drittel der kleine<br />
lokale Stromnetzbetreiber Jeppo Kraft Andelslag, zu<br />
22,5 Prozent das Fleischverarbeitungsunternehmen<br />
Snellman Ab in Jakobstad und weitere sechs in der Region<br />
aktive Unternehmen beteiligt sind.<br />
Sören Antfolk, Bullenmäster, bringt im Auftrag der<br />
Biogasanlage in Jeppo die Gärreste auf die Felder der<br />
Güllelieferanten.<br />
Geschäftsführer Kurt Stenvall auf<br />
dem Gelände der Biogasanlage<br />
in Jeppo.<br />
Druckwasserwäsche veredelt das Rohgas<br />
Eine Verstromung ist in Jeppo wegen der niedrigen<br />
Einspeisevergütung bis heute keine wirtschaftliche<br />
Option. Stattdessen wird das Biogas mit einer Druckwasserwäsche<br />
zu Biomethan veredelt und zwei großen<br />
Unternehmen bereitgestellt. Zum einen ist es der nur<br />
ein paar Kilometer entfernte Hersteller von Sandpapieren,<br />
das Unternehmen Mirka, der das Gas per Pipeline<br />
für die Dampferzeugung nutzt und dafür den früher eingesetzten<br />
Brennstoff Holzhackschnitzel einspart.<br />
„Wir können unser Biomethan für den halben Preis<br />
im Vergleich zur festen Biomasse bereitstellen“, hebt<br />
Stenvall hervor. Der zweite große Gaskunde ist der Mitgesellschafter<br />
der Biogasanlage, der Fleischverarbeiter<br />
Snellman Ab im 40 Kilometer entfernt gelegenen Jakobstad;<br />
via Gastank-Lastzüge wird das Unternehmen<br />
mit Biomethan versorgt und deckt damit den Wärmebedarf<br />
für dessen Schinken- und Wurstherstellung.<br />
Dagegen spielt die Bereitstellung von Wärme qua Biogas<br />
in der Region von Jeppo keine Rolle. Das hat gute<br />
Gründe. „Nur im Süden Finnlands existiert überhaupt<br />
ein Gasnetz. Weiter im Norden gibt es hingegen viele<br />
regionale Wärmenetze, die auf der Basis von Holz<br />
betrieben werden“, erklärt Stenvall in seinem gemütlichen<br />
Büro, „das ist im Gegensatz zu Biogas von Fall zu<br />
Fall auch günstiger, weil in der finnischen Holzindustrie<br />
einfach viel Restholz anfällt.“<br />
Angesichts dessen, und das wiederholt Stenvall gerne,<br />
sehe er für Biogas in einem CO 2<br />
-freien Finnland bis<br />
2045 vor allem in der Mobilität das eigentliche Einsatzgebiet.<br />
„50.000 Gasautos in Finnland bis 2030 ist<br />
für uns also tatsächlich eine gute Perspektive“, unterstreicht<br />
Stenvall und verweist<br />
auf einen Kraftstoffpreis, der<br />
unter 1 Euro liege. Allerdings<br />
mahnt der Biogasbetreiber<br />
eine langfristig verlässliche<br />
Energiestrategie seitens Helsinki<br />
und Brüssel an.<br />
Apropos Holz. Davon hat Finnland<br />
reichlich. Fast 90 Prozent<br />
der gesamten Landfläche ist<br />
von Wald bedeckt. Trotz einer<br />
intensiven Holz- und Papierindustrie<br />
wachse der Forstbestand,<br />
so beteuern zumindest<br />
die amtlichen Statistiken. Wie<br />
dem auch sei, die feste Biomasse<br />
spielt im Gegensatz zu<br />
anderen europäischen Ländern<br />
in der Energieversorgung<br />
eine große Rolle. Rund ein<br />
Fünftel des Primärenergieverbrauchs<br />
deckt Finnland mit<br />
Holz ab. Eine Besonderheit ist<br />
die energetische Nutzung von<br />
Torf, der nach finnischer Diktion<br />
als nachwachsender Rohstoff<br />
zu bewerten sei – wächst<br />
doch Torf, wenngleich sehr<br />
langsam, über einen langen<br />
Zeitraum nach: rund 1 Zentimeter<br />
pro hundert Jahre.<br />
Aber nicht nur die energetische<br />
Verwertung der festen Biomasse wird als wichtig<br />
erachtet, auch deren stoffliche Verwertung. Diesbezüglich<br />
bringt es der finnische Umweltminister Tiilikainen<br />
(siehe Interview auf Seite 86) auf den Punkt: „Wir wollen<br />
weg von der Pipeline – hin zur Kreislaufwirtschaft“. Mit<br />
diesem Motto will sich Finnland in Zeiten weltweit knapper<br />
werdender Ressourcen international positionieren;<br />
dafür hat die amtierende Regierung einen ambitionierten<br />
„Fahrplan für eine Kreislaufwirtschaft bis 2025“<br />
aufgelegt.<br />
„50.000 Gasautos in<br />
Finnland bis 2030 ist für<br />
uns also tatsächlich eine<br />
gute Perspektive“<br />
Kurt Stenvall<br />
Teil der Druckwasserwäsche,<br />
die das<br />
Rohgas reinigt, sodass<br />
es anschließend in<br />
Erdgasqualität vorliegt.<br />
83
International<br />
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Der Technische Direktor<br />
Ilkka Virkajärvi vor der<br />
Biogasversuchsanlage<br />
bei Turku, die Stickstoff<br />
mikrobiologisch separiert.<br />
Ductor führt unter<br />
der Federführung von<br />
Virkajärvi in Laboren<br />
des Helsinki Science<br />
Park mikrobiologische<br />
Versuche durch.<br />
Kreislaufwirtschaft: mehr Werkstoffe aus<br />
Biomasse<br />
Obendrein haben die Finnen Ende 2016 in Helsinki<br />
den ersten internationalen Kongress zum Thema Kreislaufwirtschaft<br />
veranstaltet, der vom finnischen Innovationsfonds<br />
Sitra organisiert wurde. Die Botschaft dieses<br />
Kongresses war klar umrissen: Statt auf Werkstoffe mit<br />
fossiler Provenienz wollen die Finnen vornehmlich auf<br />
holzbasierte Materialien setzen. Manche Kongressteilnehmer<br />
träumten sogar von Flugzeugen aus Holzverbundstoffen.<br />
Bis es dazu tatsächlich kommt, ist sicherlich noch ein<br />
langer Weg zu gehen. Dass dieses Ziel aber konsequent<br />
verfolgt wird, bekräftigen Mitarbeiter von Sitra, die mit<br />
einem Jahresetat von 30 Millionen Euro aktuell den<br />
Schwerpunkt ihrer Aktivitäten in diesen Bereich setzen;<br />
so bereitet die Sitra derzeit den zweiten internationalen<br />
Kreislaufwirtschafts-Kongress vor, der in Japan<br />
stattfinden soll.<br />
In dieser von der finnischen Regierung proklamierten<br />
Etablierung einer Kreislaufwirtschaft sollen auch die<br />
Vorteile von Biogas eine integrale Rolle einnehmen.<br />
In der energetischen Verwertung von Reststoffen aus<br />
Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft sowieso, aber<br />
auch in der Aufbereitung von urbanen und industriellen<br />
Abwässern. Darüber hinaus pflichtet Umweltminister<br />
Tiilikainen dem Biogasprozess auch hinsichtlich eines<br />
nachhaltig gestalteten Nährstoffmanagements eine<br />
große Bedeutung bei.<br />
Gärrestaufbereitung: Lösung von Ductor<br />
Große Hoffnungen setzt die Politik unter anderen in<br />
das noch junge finnische Unternehmen Ductor, das mit<br />
einigen Patenten sowohl auf spezielle Bakterienstämme<br />
als auch auf das Verfahren zur mikrobiologischen<br />
Stickstoff- und Phosphattrennung in die Biogasbranche<br />
drängt. Geschäftsführer Ari Ketola erläutert bei der<br />
Präsentation der Versuchsanlage in der Nähe der südfinnischen<br />
Stadt Turku, wie er sagt, “die großen Chancen<br />
der von seiner Firma entwickelten Biotechnologie”<br />
für diejenigen Biogasanlagen-Betreiber, die bislang<br />
ein Problem mit latenter<br />
Nährstoffüberfrachtung<br />
haben.<br />
Durch das neuartige Verfahren<br />
können Stickstoffe<br />
und Phosphate zukünftig<br />
auf kostengünstige<br />
Art und Weise separiert<br />
werden. Dies bringe zwei<br />
Vorteile. Einerseits können<br />
die von Stickstoff<br />
befreiten Gärreste problemlos<br />
aufs Feld gebracht werden, andererseits lässt<br />
sich die separierte Fraktion als Dünger gewinnbringend<br />
und gezielt im Pflanzenbau einsetzen. Ob sich die auf<br />
einem Flyer zu lesende Zeile „Ductors bahnbrechende<br />
Innovation wird die Welt verändern“ bewahrheiten wird,<br />
sei jedoch dahingestellt, denn eine Landwirtschaft,<br />
die gewerbliche Viehhaltung ohne Flächenbindung<br />
betreibt, steht eben im krassen Widerspruch zu einer<br />
Kreislaufwirtschaft und verkörpert vielmehr eine industrielle<br />
Wirtschaftsweise, bei der die natürlichen Kapazitäten<br />
der Kulturlandschaften offensichtlich schon<br />
heute deutlich überreizt werden.<br />
Ansonsten gäbe es die Nährstoffüberfrachtung in vielen<br />
Regionen in dem extremen Ausmaße gar nicht.<br />
Dass Ductor nun für diese Art von Fleischproduktion<br />
mit angeschlossenen Biogasanlagen eine profitable<br />
Lösung offeriert, ist zwar ehrenwert, aber letztlich dann<br />
doch nur eine Fehlerkorrektur im falschen Rahmen.<br />
Nichtsdestoweniger: Das Ductor-Verfahren ist nicht nur<br />
wegen der Novelle der Düngeverordnung hochinteressant.<br />
Es ist ein intelligentes Verfahren, um Nährstoffe<br />
nachhaltig zu managen.<br />
So liegen nach Aussage von Aarre Viiala, Geschäftsführer<br />
der deutschen Unternehmenstochter von Ductor,<br />
schon vier Bestellungen aus den Reihen der deutschen<br />
Biogaswirtschaft auf seinem Düsseldorfer Schreibtisch.<br />
Es fehlen nur noch die letzten Genehmigungen<br />
von den Behörden, dann geht es nach dem Start eines<br />
Versuchsreaktors im emsländischen Haren in die<br />
nächste Runde des finnischen Newcomers. Im Sinne<br />
der Kreislaufwirtschaft ist Ductor politische Rückendeckung<br />
aus Helsinki auf jeden Fall sicher.<br />
Autor<br />
Dierk Jensen<br />
Freier Journalist<br />
Bundesstr. 76<br />
20144 Hamburg<br />
Tel. 040/88 177 776<br />
E-Mail: dierk.jensen@gmx.de<br />
www.dierkjensen.de<br />
84
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
International<br />
Beratung · Planung · Fertigung · Montage<br />
seit<br />
1946<br />
Machen Sie mehr aus Ihrer Biogasanlage<br />
Installation und Reparatur von Pumpen,<br />
Rührwerken, Separatoren und Edelstahlbehältern.<br />
Als autorisierte Servicewerkstatt setzen wir auf<br />
hochwertige Komponenten unseres Partners<br />
HARMS Systemtechnik GmbH · Alt Teyendorf 5 · 29571 Rosche<br />
Telefon: 0 58 03.98 72 77 · www.harms-system.de<br />
Schalldämpfer · Schallschutzwände<br />
Maschinen-Kapselungen · Lüftungsbauteile<br />
Telefon (0 21 71) 70 98-0 · Telefax (0 21 71) 70 98-30<br />
www.stange-laermschutz.de · info@stange-laermschutz.de<br />
Handymat<br />
Störung ruft Handy<br />
8-12V Meldeeingänge<br />
2-230V Fernschalter<br />
Netzausfall-Akku<br />
Stecker-Netzteil<br />
Einstellungen mit<br />
Handymat-App<br />
Bollrath elektronik Tel: 02872-2503<br />
Die Gutachtergemeinschaft Biogas ist ein<br />
Team selbstständiger Experten verschiedenster<br />
Fachrichtungen, das Sie umfassend<br />
und kompetent zu allen Fragen rund<br />
um Biogasanlagen beraten und unterstützen<br />
kann.<br />
Gutachter<br />
Gemeinschaft<br />
Biogas<br />
Gutachtergemeinschaft Biogas GmbH<br />
Lantbertstr. 50 . 85356 Freising<br />
Tel +49 / 8161/ 88 49 546<br />
E-Mail info@gg-biogas.de<br />
www.gg-biogas.de<br />
Zweigniederlassung Lübeck:<br />
Ovendorferstr. 35 . 23570 Lübeck<br />
Tel +49 / 4502 / 7779 05<br />
Sachverständigenbüros<br />
auch in Krefeld, Burscheid (Köln) und Lüneburg<br />
Wertgutachten (Ertrags-, Zeit- und Verkehrswert)<br />
Erneuerungsgutachten zur EEG-Laufzeitverlängerung<br />
Schadensgutachten (Technik, Bau, Biologie)<br />
Bescheinigungen von Umweltgutachtern<br />
Gutachten zu Investitionsentscheidungen<br />
85
International<br />
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Interview<br />
»Weg von der Pipeline-Wirtschaft,<br />
hin zur Bioökonomie«<br />
Im Gespräch mit dem finnischen Umweltminister Kimmo Tiilikainen<br />
von der Finnischen Zentrumspartei über die Energie- und Klimapolitik<br />
Finnlands.<br />
Interviewer: Dierk Jensen<br />
Biogas Journal: Herr Tiilikainen, welche<br />
energie- und klimapolitischen Ziele verfolgt<br />
die finnische Regierung?<br />
Kimmo Tiilikainen: Unsere Regierung bekennt<br />
sich klar zu den Vereinbarungen, die<br />
auf der Pariser Klimakonferenz getroffen<br />
worden sind. Wir wollen unseren Beitrag<br />
dazu leisten und haben dafür in 2016<br />
ehrgeizige Ziele gesetzt: Die Erneuerbaren<br />
Energien sollen in Finnland bis zum Jahr<br />
2030 einen Anteil von 50 Prozent am Energieverbrauch<br />
haben, die Kohlenutzung wird<br />
bis 2030 beendet sein, und wir wollen bis<br />
dahin die energetische Nutzung von Erdöl<br />
um die Hälfte kürzen. Unser aktueller Klimaplan<br />
beinhaltet eine Reduzierung der<br />
CO 2<br />
-Emissionen bis 2030 um 39 Prozent<br />
in Relation zu 2005. Und bis 2045 wollen<br />
wir klimaneutral sein.<br />
Biogas Journal: Klima- und Energiepolitik<br />
ist die eine Seite der Medaille. Wie beurteilen<br />
Sie die Bedeutung für eine nachhaltige<br />
Ressourcen-Wirtschaft?<br />
Tiilikainen: Es gibt zwei große und ernste<br />
Probleme in der Welt. Das erste ist der<br />
Klimawandel, das zweite ist der Mangel an<br />
Ressourcen. Beide Probleme müssen wir<br />
lösen, um Zukunft gestalten zu können.<br />
Daher hat die finnische Regierung fünf<br />
strategische Ziele definiert, um den Herausforderungen<br />
der Zukunft begegnen zu<br />
können. Dazu gehören die Förderung der<br />
Bioökonomie, der Kreislaufwirtschaft und<br />
der grünen Ökonomie. Wir wollen dahin.<br />
Nicht zuletzt deswegen haben wir den ersten<br />
Welt-Kreislaufwirtschafts-Kongress in<br />
Helsinki in 2016 veranstaltet, um diesem<br />
Thema eine angemessene Aufmerksamkeit<br />
zu geben.<br />
Es gilt: Weg von der Pipeline-Ökonomie,<br />
hin zur Bioökonomie. So war es für uns in<br />
der Vergangenheit wichtig, das Abwasser-<br />
Management zum Schutz der Ostsee zu<br />
etablieren, um die Nährstoffeinträge zu<br />
reduzieren. Allerdings reicht dies allein<br />
nicht. Wir müssen die Nährstoffe im Sinne<br />
der Kreislaufwirtschaft auch wieder dorthin<br />
zurückbringen, woher sie kommen. Wir<br />
müssen Abwässer oder landwirtschaftliche<br />
Abfälle so behandeln, dass die in ihr enthaltenen<br />
Nährstoffe gut dosiert als Dünger<br />
eingesetzt werden können. In diesem Kontext<br />
ist auch die Produktion von Biogas eine<br />
Option, um die Nährstoffe sinnvoller zu<br />
nutzen und die anfallenden Restnährstoffe<br />
auf Felder zurückzubringen.<br />
Biogas Journal: Passiert im Bereich einer<br />
kreislauforientierten Bioökonomie in Finnland<br />
denn schon Konkretes?<br />
Tiilikainen: Es geht im Generellen ja letztlich<br />
um eine industrielle Symbiose, bei der<br />
Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft kombiniert<br />
werden. Dafür gibt es in Finnland<br />
bereits sehr gute Beispiele. Im Oktober<br />
2017 hat beispielsweise eine der größten<br />
Bioraffinerien in Europa im mittelfinnischen<br />
Äänekoski, betrieben von der Metsä-<br />
Gruppe, ihre Produktion aufgenommen.<br />
Dort ist mehr als 1 Milliarde Euro investiert<br />
worden.<br />
Der Leitgedanke bei dieser Anlage ist, wie<br />
die Nebenprodukte bei der Zellstoffherstellung<br />
optimal verwertet werden können. So<br />
fallen bei der Zellstofferzeugung rund 5<br />
bis 20 Prozent verwertbare Abfälle an, die<br />
schon heute rund 20 Prozent des Umsatzes<br />
ausmachen. Wobei es noch viele innovative<br />
Ideen gibt, wie diese Abfälle durch neue<br />
Produkte eine noch höhere Wertschöpfung<br />
erreichen. Klar ist doch: Wir müssen noch<br />
große Schritte zu Steigerung der Materialeffizienz<br />
gehen.<br />
Um diesen Prozess zu beschleunigen, stellen<br />
wir seitens der Regierung Fördermittel<br />
bereit und setzen auf enge Kooperation zwischen<br />
privaten Unternehmen und öffentlichen<br />
Institutionen. Aber unabhängig dieser<br />
Ansätze einer kreislaufwirtschaftsorientierten<br />
Bioökonomie gibt es noch einen weiteren<br />
Aspekt, der nicht zu vernachlässigen<br />
ist: Wir müssen als Verbraucher in Zukunft<br />
nicht mehr alles selber besitzen, wir können<br />
es auch teilen.<br />
Biogas Journal: Das klingt alles sehr gut.<br />
Es klingt ein bisschen so, als ob Finnland<br />
ein Garten Eden wäre. Jedoch gibt es einige<br />
Teufelchen in diesem Paradies, nämlich<br />
eine Handvoll finnischer Atomkraftwerke.<br />
Wie vereinen sie diese Atompolitik mit ihren<br />
ehrgeizigen klimapolitischen Plänen?<br />
Tiilikainen: Mmmh, da gibt es in der Tat<br />
unterschiedliche Haltungen gegenüber<br />
unserer Atomkraft. Ich würde sagen, die<br />
Atomkraft ist sicherlich nicht der beste Weg<br />
einer zukunftsfähigen Energieproduktion,<br />
doch ist sie immerhin CO 2<br />
-frei. Wir betrachten<br />
daher die Atomenergie mittelfristig als<br />
eine Komponente auf dem Weg hin zu einer<br />
klimaneutralen Energieerzeugung.<br />
Allerdings sollte man die Verhältnismäßigkeit<br />
nicht aus den Augen verlieren. So<br />
Foto: Dierk Jensen<br />
86
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
International<br />
macht die Elektrizität nicht mehr als 30<br />
Prozent des finnischen Energieverbrauchs<br />
aus. Das Stromsegment wird nur zu einem<br />
Drittel aus Atomstrom gespeist. Die größere<br />
Herausforderung liegt doch in den<br />
Sektoren Verkehr und Wärme, wo es darum<br />
geht, den Umbau von fossilen hin zu Erneuerbaren<br />
Energien voranzubringen.<br />
Biogas Journal: … also ist die Atomkraft<br />
kein Teufelszeug?<br />
Antwort: Ohh, (Tiilikainen macht ein kleine<br />
Pause) … wenn die Atomkraft in der denkbar<br />
sichersten und gewissenhaftesten Art<br />
und Weise genutzt wird, ist es, nein, kein<br />
Teufelswerkzeug.<br />
Biogas Journal: Hat die finnische Regierung<br />
denn eine Roadmap für den Transformationsprozess<br />
im Verkehrssektor?<br />
Tiilikainen: Wir haben in unserem Klimaplan<br />
klare Ziele für den Verkehrssektor gesetzt:<br />
50 Prozent weniger Emissionen bis<br />
2030 im Vergleich zum Jahr 2005. Dabei<br />
ist es der schnellste Weg, Emissionen im<br />
Verkehr zu reduzieren, indem man die erneuerbaren<br />
Komponenten in jedem Kraftstoff<br />
auf 30 Prozent bis 2030 anhebt. Wir<br />
bieten dazu finanzielle Anreize an, damit<br />
sich die Finnen für E-Fahrzeugen entscheiden.<br />
Ich bin mir sicher, dass damit<br />
den elektrischen Antriebssystemen der<br />
Marktdurchbruch gelingen wird. Zudem<br />
stehen für uns der Schwertransport sowie<br />
der Schiff- und Flugverkehr im Fokus, auch<br />
diese Bereiche müssen ihre Emissionen<br />
reduzieren.<br />
Biogas Journal: Wie ist die Haltung der finnischen<br />
Regierung gegenüber dem geplanten<br />
Gaspipeline-Projekt Nord Stream 2?<br />
Tiilikainen: Wir nehmen die gleiche Haltung<br />
wie gegenüber Nord Stream 1 ein. Es ist<br />
für uns keine ökonomische oder politische<br />
Frage, sondern eine der Umwelt. Der Bau<br />
einer solchen Leitung verursacht ökologische<br />
Effekte, bei denen wir denken, dass<br />
diese in der Umweltverträglichkeitsprüfung<br />
klar berücksichtigt werden müssen.<br />
Biogas Journal: Themenwechsel. Sind Sie<br />
zufrieden mit der derzeitigen europäischen<br />
Energiepolitik?<br />
Tiilikainen: Im Allgemeinen unterstützen<br />
wir die EU-Energiepolitik. Wir meinen, dass<br />
Vieles auf gutem Weg ist. Sind doch mit den<br />
europäischen Vorgaben, ob nun Elektromobilität<br />
oder der Ausbau des europäischen<br />
Netzes, gute Entwicklungen vorangebracht<br />
worden. Finnland eilt zwar den von der EU<br />
gesetzten Klimazielen weit voraus, doch<br />
hoffen wir daher umso mehr, dass auch die<br />
anderen EU-Länder nachziehen werden.<br />
Kein Zweifel besteht doch daran, dass die<br />
Preise für CO 2<br />
-Emissionen steigen müssen,<br />
damit die Klimapolitik europaweit weiter<br />
vorankommt. Der finnische Wald ist dabei<br />
eine wirksame CO 2<br />
-Senke. Der jährliche<br />
Zuwachs des finnischen Waldes bewirkt<br />
jährlich eine Einsparung von 40 Millionen<br />
Tonnen CO 2<br />
. Das müsste neu bewertet werden,<br />
damit die nachhaltige Bioökonomie<br />
noch größere Unterstützung findet und der<br />
Wald als Klimaschutz-Instrument aktiver<br />
als bisher eingesetzt werden kann.<br />
Wir in Finnland haben in den vergangenen<br />
Jahren das jährliche Waldwachstum<br />
nahezu verdoppelt, dafür muss es meiner<br />
Meinung nach einen noch stärkeren ökonomischen<br />
Anreiz geben als bisher. Klimapolitik<br />
muss so ausgerichtet werden, dass die<br />
Waldpolitik auch tatsächlich einen aktiven<br />
Beitrag leisten kann.<br />
Biogas Journal: Welche Rolle spielt Biogas<br />
in Finnland?<br />
Tiilikainen: Die Rolle von Biogas wird größer.<br />
Die größten Chancen liegen dabei im<br />
Verkehrssektor. Biomethan aus Biogas<br />
kann auf einfache Weise Erdgas im Verbrennungsmotor<br />
ersetzen. Biogas ist aber<br />
derzeit leider nicht profitabel allein durch<br />
die Energiegewinnung, sondern erst durch<br />
eine Kombination von energetischer und<br />
stofflicher Nutzung. Erst durch eine sinnvolle<br />
Weiterverwertung der Nährstoffe, wie<br />
sie in den Städten anfallen, wird Biogas<br />
wirtschaftlich.<br />
Biogas Journal: Finnische Biogaserzeuger<br />
kritisieren, dass es keine langfristige Biogasstrategie<br />
gäbe …<br />
Tiilikainen: Das finnische Wirtschaftsministerium<br />
stellt gerade deswegen finanzielle<br />
Mittel bereit, um die Wirtschaftlichkeit<br />
der Biogasproduktion in Finnland zu<br />
verbessern. In <strong>2018</strong> werden wir zusätzlich<br />
neue Beihilfen für die Umstellung von<br />
Fahrzeugen auf Gasantriebe einführen.<br />
Aber natürlich, wir starten auf einem niedrigen<br />
Niveau, und es braucht Zeit, bis sich<br />
dies etabliert hat. Mir ist die Kritik seitens<br />
der Biogasproduzenten bekannt; ja es<br />
stimmt, es gibt aktuell Schwierigkeiten, die<br />
ich nicht verleugnen kann. Wir sind aber<br />
dabei, substanzielle Änderungen durchzusetzen,<br />
um das wirtschaftliche Umfeld für<br />
Biogaserzeugung nachhaltig zu ändern.<br />
Biogas Journal: Was halten Sie eigentlich<br />
von der deutschen Energiewende?<br />
Tiilikainen: Ich bin nicht die Person, die<br />
Empfehlungen an die deutsche Energiepolitik<br />
geben mag. Ich kann als finnischer<br />
Umweltminister aber so viel sagen, dass ich<br />
schon verärgert bin, wenn schon mal vereinbarte<br />
Emissionsziele dann doch nicht<br />
erreicht werden. Wir haben europaweite<br />
Ziele, aber jede einzelne Regierung macht<br />
natürlich ihre eigene Politik.<br />
Biogas Journal: Der Europäische Emissionsrechtehandel<br />
ist ziemlich zahnlos. Die<br />
Preise für Emissions-Zertifikate sind am<br />
Boden. Wie kann man das ändern?<br />
Tiilikainen: Ja, die Preise sind im Moment<br />
eindeutig zu niedrig. Die in der Vergangenheit<br />
vorgenommenen Änderungen am<br />
Handelsschema für Emissionsrechte sind<br />
letztlich ein Resultat dieser niedrigen<br />
Preise. Ich hoffe daher, dass die Preise für<br />
CO 2<br />
-Emissions-Zertifikate wieder ansteigen<br />
werden, denn das ist sehr essenziell für<br />
eine erfolgreiche europäische Energie- und<br />
Klimapolitik in Zukunft. Wir müssen uns<br />
aber noch bis 2021 gedulden – wenn die<br />
nächste Handelsphase beginnt. Wenn unsere<br />
Bemühungen nicht ausreichen, müssen<br />
wir eben noch mehr machen.<br />
Biogas Journal: Herr Tiilikainen, vielen<br />
Dank für das Gespräch.<br />
Interviewer<br />
Dierk Jensen<br />
Freier Journalist<br />
Bundesstr. 76<br />
20144 Hamburg<br />
Tel. 040/88 177 776<br />
E-Mail: dierk.jensen@gmx.de<br />
www.dierkjensen.de<br />
87
International<br />
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Indien<br />
Gaushalas mit<br />
Biogasanlagen<br />
verknüpfen<br />
Neu-Delhi<br />
Zurzeit arbeitet Indien intensiv an einem Konzept für Geflügel- und Milchwirtschaftsbetriebe,<br />
einschließlich Gaushalas, aus der Perspektive technischer,<br />
finanzieller und sozialer Nachhaltigkeit. Eine Gaushala ist eine Art Pflege- und<br />
Futterstation für Kühe in Indien. Sie konzentrieren sich aufgrund der religiösen<br />
Bedeutung von Kühen im Hinduismus und die damit verbundene kulturelle<br />
Sensibilität in Bezug auf ihr Wohlergehen auf eine gute Behandlung der Kühe.<br />
Von Abhijeet Mukherjee<br />
Zwar gibt es im ganzen Land eine<br />
Reihe von florierenden Geflügelund<br />
Milchviehbetrieben sowie<br />
Gaushalas, aber ihre Nachhaltigkeit<br />
bleibt ein Thema, das im<br />
Fokus behalten werden muss. Vor allem<br />
Gaushalas, in denen Milchvieh und andere<br />
Rinder untergebracht sein können,<br />
benötigen große Mengen Rinderfutter und<br />
Nahrungsergänzung, manchmal antibiotische<br />
Medikamente und andere Mittel. Die<br />
Gaushalas sind genauso wie die Milchviehwirtschaft<br />
in Indien in den vergangenen<br />
Jahrzehnten stark gewachsen, sodass im<br />
Land ein großer Viehbestand entstanden<br />
ist. Nach einem stetig wachsenden Erfolg<br />
bei der Milchproduktion und Viehzucht im<br />
Laufe der Jahre sieht sich die Branche jetzt<br />
mehreren Herausforderungen gegenüber.<br />
Ein chronischer Mangel an Rinderfutter in<br />
Kombination mit der schlechten Qualität<br />
des Futters ist zum Haupthemmnis geworden.<br />
Bei dem derzeitigen System intensiver<br />
Viehzucht wird großer Wert auf die Fütterung<br />
mit Konzentratfutter gelegt, was die<br />
Kosten für die Milchproduktion erhöht und<br />
den Profit für die Eigentümer/Landwirte erheblich<br />
gesenkt hat.<br />
Eine nachhaltige Milchviehwirtschaft in<br />
Indien ist ein neues Konzept, das die ordnungsgemäße<br />
und effiziente Nutzung von<br />
Ressourcen berücksichtigt, ohne sie auszubeuten.<br />
Zwar kann der Ansatz dieser<br />
modernen Methode für die Milchviehwirtschaft<br />
ausgefeilt wirken, aber die meisten<br />
ihrer wichtigen Elemente haben ihren Ursprung<br />
in traditionellen Landwirtschaftsmethoden.<br />
Bei den wichtigsten Aspekten der nachhaltigen<br />
Milchviehwirtschaft geht es um drei<br />
Hauptelemente:<br />
1. Augenmerk auf der Tierhaltung<br />
Die Wahl der richtigen Rasse ist der erste<br />
Aspekt, der in der Milchviehwirtschaft und<br />
in den Gaushalas berücksichtigt werden<br />
muss. Die meisten Landwirte wählen die<br />
Tierrasse ausschließlich nach dem Milchertrag,<br />
ohne sich Gedanken über ihre Eignung<br />
für das lokale Klima, die Verfügbarkeit<br />
von Futter, die Widerstandsfähigkeit<br />
gegen Krankheiten und Schädlinge und die<br />
Umweltbedingungen zu machen. Der indische<br />
Biogasverband ist der Ansicht, dass<br />
einheimische Rassen wie Murrah-Büffel<br />
oder Sindhi- oder Desi-Kühe geeigneter für<br />
das indische Klima sind.<br />
2. Blick auf das Ökosystem<br />
Die Rindertypen mit hohen Milcherträgen<br />
von heute benötigen eine stabile Versorgung<br />
mit Qualitätsfutter. Während das<br />
meiste Rinderfutter für die herkömmliche<br />
Milchviehwirtschaft auf dem Markt gekauft<br />
wird, muss nachhaltiges Milchviehfutter<br />
intern angebaut oder lokal im Dorf gekauft<br />
werden. Während Trockenfutter lokal gekauft<br />
werden kann, muss Grünfutter intern<br />
auf dem Hof angebaut werden. Bajra-Napier-Hybriden<br />
können auf fruchtbarem und<br />
gut bewässertem Land angebaut werden,<br />
während Guinea-Gras auf kargen, regen-<br />
88
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
International<br />
abhängigen Böden angebaut werden kann.<br />
Neben dem Anbau von organischem Futter<br />
ist es wichtig, sicherzustellen, dass Mist,<br />
Urin und andere Abfälle in einer Kompostgrube<br />
entsorgt werden. Nicht behandelter<br />
Klärschlamm sollte nicht auf Ackerflächen<br />
aufgetragen werden, nur kompostierte organische<br />
Stoffe dürfen als Dünger verwendet<br />
werden. Wenn jemand eine Biogasanlage<br />
hat, löst er nicht nur das Problem der<br />
Abfallentsorgung, sondern er produziert<br />
auch fertigen Dünger für die Feldfrüchte.<br />
3. Augenmerk auf der Energie<br />
Zwar ist die Milchviehwirtschaft keine<br />
energieintensive Wirtschaftsart (nicht<br />
bei Betrachtung der Milchverarbeitung),<br />
aber es besteht ein Bedarf an Strom und<br />
Wärme. Statt sich auf den äußerst unzuverlässigen<br />
Netzstrom des Elektrizitätswerkes<br />
zu verlassen, verwenden Landwirte<br />
Dieselgeneratoren, deren Betrieb teuer ist.<br />
Es wäre vernünftiger, Biogas zu nutzen, da<br />
die Brennstoffzufuhr jederzeit verfügbar<br />
ist. Tatsächlich kann das von einer einzigen<br />
Kuh erzeugte Biogas den täglichen<br />
Kochbedarf einer Person decken. Außerdem<br />
kann Biogas auch für den Zweck der<br />
Milcherhitzung und -kühlung verwendet<br />
werden. Solarstromzellen sind heutzutage<br />
ziemlich preisgünstig, sodass Landwirte es<br />
sich leisten können, ihren gesamten Haushalt<br />
zu beleuchten.<br />
Programm für Biogas in Gaushalas<br />
Auf diese Weise kann eine nachhaltige<br />
Milchviehwirtschaft nicht nur für kleine<br />
Landwirte erreichbar sein, sie ist auch umweltfreundlich,<br />
weil sie die Kohlenstoffemissionen<br />
verringert und die organische<br />
Fruchtbarkeit erhöht. Nach Schätzungen<br />
des Animal Welfare Board of India gibt es<br />
mehr als 4.000 Gaushalas, wobei rund<br />
1.000 von ihnen mehr als 200 Rinder aufweisen.<br />
In letzter Zeit hat die Regierung Programme<br />
zur Erzeugung von Biogas in Gaushalas<br />
gefördert und will den Entwicklern von<br />
Biogasprojekten in Gaushalas alle notwendige<br />
Unterstützung zukommen lassen.<br />
Das nationale Biogas- und Dungmanagementprogramm<br />
(NBMMP) und das Biogasstromprogramm<br />
(netzfern) (BPP) sind die<br />
laufenden Flagship-Programme des MNRE<br />
in dieser Hinsicht, die sich im Einklang mit<br />
den gegenwärtigen Anforderungen weiterentwickeln.<br />
Tatsächlich gibt es diese Programme<br />
zwar bereits seit mehreren Jahren,<br />
aber Biogasprojekte in<br />
Gaushalas bleiben weiterhin<br />
deutlich hinter ihrem<br />
wirklichen Potenzial zurück.<br />
Neben Regierungspolitik<br />
braucht es eine Reihe<br />
an Erfolgsgeschichten, die<br />
den notwendigen Schwung<br />
für Projektentwickler erzeugen,<br />
weitere solche Projekte<br />
in die Wege zu leiten.<br />
Eine Biogasanlage wurde<br />
kürzlich in der Shree Lalji<br />
Maharaj Gaushala in Gujarat<br />
errichtet. Die Anlage erzeugt<br />
Biogas aus Rinderdung und wandelt<br />
es mit einheimischer Technologie in Bio-<br />
CNG um. Die Gaushala hat einen Viehbestand<br />
von rund 250 Rindern. Eine weitere<br />
Gaushala mit einer ähnlichen Anzahl an<br />
Rindern in der Nachbarschaft stellt auch<br />
Futtervorräte bereit.<br />
Etwa 200 bis 250 Kubikmeter Biogas werden<br />
produziert, was wiederum rund 100<br />
Kilogramm Bio-CNG erzeugt, das auch als<br />
CBG (komprimiertes Biogas) bekannt ist.<br />
CBG ist eine preislich wettbewerbsfähige<br />
Erneuerbare Energie und wird in dem vorstehend<br />
aufgeführten Fall zum täglichen<br />
Kochen im nahegelegenen Shree Lalji Maharaj-Tempel<br />
für durchschnittlich 1.000<br />
Tempelbesucher verwendet.<br />
Die Kompressionsanlage für das Füllen<br />
des Gases in die Kaskaden wurde mit der<br />
Möglichkeit entwickelt, das CBG auch als<br />
Kraftstoff für Fahrzeuge zu nutzen. Der<br />
produzierte Biodünger wird in Tankwagen<br />
auf die in der Nähe gelegenen Felder des<br />
Betriebes gebracht, auf denen Baumwolle,<br />
Weizen, Reis, Ölsaaten und Gemüse angebaut<br />
werden.<br />
Zentrale Merkmale der Anlage:<br />
ffEinzelner voll durchmischter Faulbehälter<br />
(CSTR) auf der Grundlage eines<br />
modularen Faulbehälters mit faserverstärkten<br />
Kunststoffwänden (FRP).<br />
ffBetrieb bei mesophilen Temperaturen<br />
mit Heizung.<br />
ffEin richtiger eigener Mischmechanismus.<br />
ffDer Faulbehälter verfügt über ein<br />
Gasauffangsystem vom Doppelmembrantyp.<br />
ffGesundheits-, Sicherheits- und<br />
Umweltthemen (HSE) werden berücksichtigt.<br />
Fotos: Abhijeet Mukherjee<br />
Typische Gaushala in Indien, in denen Rinder gehalten werden. An<br />
diesen Tierhaltungsanlagen würde die Errichtung von Biogasanlagen<br />
zur Güllevergärung Sinn machen.<br />
ffGasreinigungssystem für die Entfernung<br />
von H 2<br />
S, Feuchtigkeit und CO 2<br />
.<br />
ffNur ein Mindestmaß an manuellem Eingreifen<br />
ist notwendig, weil die Anlage<br />
automatisiert ist.<br />
ffOnline-Analysen messen die Zusammensetzung<br />
des Biogases.<br />
Kostenökonomie<br />
Die Ökonomie der Errichtung solcher Anlagen<br />
hängt sehr stark von den lokalen Anforderungen<br />
ab. Nach Angaben von Atmos<br />
Power Pvt. Ltd. betrugen die spezifischen<br />
Kapitalkosten für die vorstehend beschriebene<br />
Anlage rund 14.000 Indische Rupien pro<br />
Kubikmeter (INR/m 3 ), was etwa 200 Euro/<br />
m 3 entspricht – ohne das Gasaufbereitungssystem.<br />
Mit Gasaufbereitung sind 25.000<br />
INR/m 3 (etwa 360 Euro/m 3 ) aufzubringen.<br />
Fazit: Diese Biogasanlage dient als ein Beispiel,<br />
bei dem Abfall aus dem Viehsektor zur<br />
Ressource für den Kochbedarf geworden<br />
ist. Es besteht auch die Möglichkeit, das<br />
erzeugte CBG für den Fahrzeugtransport zu<br />
verwenden. Solche Biogasanlagen können<br />
zum Schlüssel werden, um das enorme<br />
Potenzial zu nutzen, das in den ländlichen<br />
Gegenden Indiens in den reichlichen Mengen<br />
von Biomasseabfällen (hauptsächlich<br />
in Form von Tierdung) verborgen ist!<br />
Autor<br />
Abhijeet Mukherjee<br />
Projektkoordinator<br />
Indian Biogas Association<br />
233, Tower-B2, Spaze-i-Tech Park,<br />
Sector-49, Sohna Road, Gurgaon,<br />
Harayana-12<strong>2018</strong>, Indien<br />
Tel: +91 124 4988 622<br />
abhijeet@biogas-india.com<br />
www.biogas-india.com<br />
89
Aus der<br />
Verbandsarbeit<br />
Bericht aus der Geschäftsstelle<br />
Betreiberbeirat wählte und<br />
diskutierte Änderungen im EEG<br />
Das Jahr <strong>2018</strong> wird wieder neue Herausforderungen für die<br />
Biogasbranche und den Fachverband Biogas bringen: So geht<br />
die neue Düngeverordnung in ihr erstes vollständiges Jahr<br />
inklusive neuer Stoffstrombilanz und neuer Abgasgrenzwerte.<br />
Wir als Geschäftsstelle werden unsere Mitglieder in den vielfältigen<br />
Themengebieten unterstützen. Hierzu zählt neben der<br />
politisch-fachlichen Arbeit insbesondere die Bereitstellung von<br />
Arbeitshilfen und Schulungen.<br />
Von Dr. Stefan Rauh und Dipl.-Ing. agr. (FH) Manuel Maciejczyk<br />
Neue Jahre bringen aber nicht nur neue Herausforderungen, sondern<br />
auch Chancen. So ist die Durchwachsene Silphie erstmals greeningfähig<br />
und mit der zweiten Runde der Ausschreibungen ergeben sich<br />
neue Perspektiven, insbesondere für Bestandsanlagen. Hier ist der<br />
Verband gefordert, die Rahmenbedingungen so zu verändern, dass<br />
es nicht nur für einen kleinen Teil der Branche eine Perspektive gibt.<br />
Die Resultate der ersten Ausschreibungsrunde und die daraus resultierenden<br />
Forderungen für Änderungen im EEG waren zentraler Diskussionspunkt bei der<br />
Sitzung des Betreiberbeirat im Rahmen der Biogas Convention in Nürnberg. Die<br />
Betreiber sehen Änderungsbedarf insbesondere beim Vergütungshöchstwert<br />
(16,90 ct/kWh), der für Anlagen unter 500 kW in seltenen Fällen auskömmlich<br />
ist. Positiv gesehen wurden die Vorschläge der Geschäftsstelle, wonach kleinere<br />
Anlagen einen höheren Vergütungshöchstwert erhalten sollen.<br />
Sehr begrüßt wurde auch die Idee der Geschäftsstelle, die Güllekleinanlagenklasse<br />
für Bestandsanlagen zu öffnen, sodass eine Anschlussperspektive außerhalb<br />
der Ausschreibungen eröffnet wird. Kontroverser diskutiert wurde die<br />
genaue Ausgestaltung dieser Regelung. Einig waren sich die Betreiber, dass die<br />
Beschränkung auf 75 kW installierte Leistung aufgehoben werden muss, damit<br />
auch Betriebe mit größerem Gülleaufkommen diesen Weg nutzen können. Allerdings<br />
konnte hier die Frage der Vergütungshöhe und Größenbegrenzung nicht<br />
abschließend geklärt werden.<br />
Neben fachlichen Diskussionen fand auch die Wahl der Sprecher des Betreiberbeirat<br />
für die kommende Amtszeit des Präsidiums statt. Neuer Sprecher des<br />
Betreiberbeirates ist der bisherige Stellvertreter Winfried Vees aus Baden-Württemberg.<br />
Der neue Stellvertreter ist Hennig Gottschalk aus Niedersachsen. Der<br />
90
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Verband<br />
Fachverband präsent auf CSU-Bundesparteitag<br />
Foto: Thomas Geiger Fotos: AEE e.V.<br />
Gemeinsam mit dem Bundesverband Erneuerbare<br />
Energie e.V. und anderen befreundeten Verbänden<br />
hat der Fachverband Biogas im Wahljahr 2017<br />
besondere Präsenz auf den Bundesparteitagen<br />
verschiedener Parteien gezeigt. Der Gemeinschaftsstand,<br />
auf dem sich Besucher und Delegierte zu<br />
allen Erneuerbaren gleichermaßen informieren<br />
Von links: Dr. Stefan Rauh, Präsidiumsmitglied Josef Götz, der neue stellvertretende Betreiberbeiratssprecher<br />
Henning Gottschalk, der langjährige Betreiberbeiratssprecher Erhard Oelsner, der neue Betreiberbeiratssprecher<br />
Winfried Vees und Fachverbandspräsident Horst Seide.<br />
langjährige Sprecher Erhard Oelsner aus<br />
Thüringen wurde für sein Engagement mit<br />
der Ehrennadel ausgezeichnet.<br />
Neue Formaldehydemissionswerte<br />
ab <strong>2018</strong><br />
Wie bereits im Oktober 2017 bekanntgegeben,<br />
hat die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft<br />
Immissionsschutz (LAI) eine<br />
Absenkung des bisherigen Emissionswertes<br />
zum Erhalt des Luftreinhaltebonus von 40<br />
Milligramm pro Kubikmeter (mg/m³) auf<br />
jetzt neu 20 mg/m³ ab dem 1. Juli <strong>2018</strong><br />
beschlossen. Im Rahmen eines Workshops<br />
auf der Biogas Convention wurde von Behördenseite<br />
klar geäußert, dass sowohl der<br />
neue Emissionswert als auch der Stichtag<br />
konnten, wurde von den Entscheidungsträgern<br />
sehr gut<br />
angenommen. Egal, ob bei<br />
den Grünen, der SPD oder der<br />
CSU – die jeweilige Parteiprominenz<br />
ließ sich gerne mit<br />
Botschaften Pro Erneuerbare<br />
ablichten.<br />
Und nicht nur das: Es wurde<br />
auch intensiv darüber diskutiert,<br />
was nun als nächstes<br />
geschehen muss in der Energiewende.<br />
Von Kohleausstieg<br />
über CO 2<br />
-Preis bis hin zu<br />
Perspektiven für Biogas in den Ausschreibungen<br />
oder im Kraftstoffmarkt – alle Brennpunkte wurden<br />
thematisiert. <strong>2018</strong> wird die Reihe fortgesetzt – als<br />
nächstes hat bereits die CDU einen Parteitag anvisiert,<br />
wenn auch noch ohne fixen Termin. Fehlt also<br />
zur Einhaltung das Ergebnis harter Verhandlungen<br />
sind und auch wesentlich striktere<br />
Vorschläge in der Diskussion der zuständigen<br />
LAI vorlagen.<br />
Seitens des Fachverbandes wird derzeit<br />
ein Liste möglicher Anbieter von Gasreinigungs-<br />
und Abgasnachbehandlungssystemen<br />
sowie Messinstituten erstellt, um den<br />
Umrüst- und Messbedarf auf den Anlagen<br />
zu kanalisieren und zu unterstützen. Sollte<br />
sich die Befürchtung bestätigen, dass die<br />
vorhandenen Kapazitäten an Abgasnachbehandlungssystemen<br />
und Messeinrichtungen<br />
nicht ausreichen, um die Frist einzuhalten,<br />
wird der Fachverband bei der LAI noch<br />
einmal eindringlich eine Fristverlängerung<br />
fordern. Weitere Details und Empfehlungen<br />
„nur noch“ eine Regierung, um die nächste Phase<br />
der Energiewende einzuläuten und endlich wirklich<br />
die Weichen für den Klimaschutz zu stellen.<br />
Text: Sandra Rostek<br />
zum Luftreinhaltebonus fasst der Fachverband<br />
in aktuellen Betreiberfaxen und Firmenrundmails<br />
zusammen.<br />
Neben der Frist zum Erhalt des Luftreinhaltebonus<br />
weist der Fachverband Biogas nochmal<br />
auf den Stichtag der Biogasanlagen hin,<br />
die im Jahr 2015 einen Formaldehydgrenzwert<br />
von größer 40 mg/m³ hatten (siehe LAI-<br />
Vollzugsempfehlung vom Dezember 2015).<br />
Diese Anlagen müssen bereits ab dem 5. Februar<br />
<strong>2018</strong> einen Emissionswert von 30 mg/<br />
m³ einhalten, ungeachtet des Luftreinhaltebonus,<br />
der über das EEG geregelt ist.<br />
Baustelle „zur Prüfung<br />
befähigte Person“<br />
Wie bereits berichtet, gibt es seit März<br />
2017 intensive Diskussionen über die<br />
notwendige Qualifikation von zur Prüfung<br />
befähigten Personen gemäß Betriebssicherheitsverordnung<br />
(BetrSichV). In einem<br />
Gerichtsverfahren in Schleswig-Holstein<br />
wurde durch das Gericht geäußert, dass ein<br />
Maschinenbaustudium nicht als einschlägiges<br />
Studium gemäß Pkt. 3.3 Anhang 2<br />
der BetrSichV eingestuft wird. Eine solche<br />
Sichtweise hätte dramatische Folgen für<br />
die Biogasbranche, da ein Großteil der zur<br />
Prüfung befähigten Personen ein solches<br />
Maschinenbaustudium vorweist.<br />
Aus diesem Grund hatte der Fachverband<br />
das Problem intensiv in relevante Bund-<br />
Länder-Arbeitsgruppen getragen und auf<br />
eine Konkretisierung der Frage in der dafür<br />
relevanten Technischen Regel für Betriebs-<br />
91
Verband<br />
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Neue Mitarbeiter im Fachverband<br />
Jenny Förster ist<br />
seit dem 1. Dezember<br />
im Referat Energierecht<br />
und -handel als<br />
Volljuristin tätig.<br />
Die gebürtige Leipzigerin<br />
hat das Jurastudium<br />
mit Schwerpunkt<br />
des internationalen<br />
Privatrechts an der<br />
Universität Leipzig mit dem 1. Juristischen Staatsexamen<br />
abgeschlossen.<br />
Die juristische Praxisausbildung, das Referendariat,<br />
hat sie in Oberbayern am Landgericht Ingolstadt<br />
und Oberlandesgericht München absolviert. In Bayern<br />
hat sie auch das 2. Juristische Staatsexamen<br />
absolviert. Während der Ausbildung hat Förster das<br />
juristische Handwerk unter anderem als langjährige<br />
wissenschaftliche Mitarbeiterin der Kanzlei Wittner<br />
Rechtsanwälte in Leipzig gelernt.<br />
Markus Fürst ist seit<br />
Januar dieses Jahres<br />
der neue Berater für<br />
Entwicklungszusammenarbeit<br />
und Wirtschaft<br />
(EZ-Scout).<br />
Als Nachfolger von<br />
Clemens Findeisen<br />
unterstützt Markus Fürst im Auftrag des Bundesministeriums<br />
für wirtschaftliche Zusammenarbeit<br />
und Entwicklung (BMZ) den Fachverband und seine<br />
Mitglieder beim Engagement in Entwicklungs- und<br />
Schwellenländern. Zu seinem Aufgabenspektrum<br />
gehören vor allem die Vernetzung der Angebote der<br />
deutschen Entwicklungszusammenarbeit (EZ) und<br />
der Unternehmen der Biogas- und Bioenergiebranche.<br />
Fürst ist seit 15 Jahren in der deutschen Biogasbranche<br />
zu Hause und war bereits für einige der großen<br />
Biogas-Unternehmen aus Anlagenbau und -Betrieb in<br />
Schlüsselpositionen des Bereichs Projektentwicklung<br />
und -management tätig. In den vergangenen drei<br />
Jahren beriet er im Auftrage des BMZ mehrere Privatsektor-Fachverbände<br />
in Uganda (Ostafrika), darunter<br />
die Uganda National Biogas Alliance (UNBA).<br />
Ramona Weiß ist<br />
seit dem 15. November<br />
2017 im Referat<br />
Abfall, Düngung und<br />
Hygiene in Freising<br />
tätig. Als Fachreferentin<br />
in diesem Bereich<br />
übernimmt sie die bisherigen<br />
Aufgaben von<br />
Florian Strippel, der fortan die Service GmbH leitet.<br />
Nach ihrem geowissenschaftlichen Bachelorstudium<br />
hat Weiß ein Masterstudium in Umweltplanung und<br />
Ingenieurökologie an der Technischen Universität<br />
München-Weihenstephan absolviert. Die Schwerpunkte<br />
dabei waren „Regenerative Energien und<br />
Nachwachsende Rohstoffe“ sowie „Umweltrecht“.<br />
Ihr umweltpolitisches Interesse brachte die gebürtige<br />
Münchnerin in ihrer Projektarbeit über die Stromerzeugung<br />
in Bayern mittels Regenerativer Energien<br />
ein. Mit einer Masterarbeit zur Bioabfallverwertung<br />
im Landkreis Fürstenfeldbruck erstellte Ramona Weiß<br />
eine Machbarkeitsstudie zu Errichtung und Betrieb einer<br />
landkreiseigenen Biogasanlage und weckte damit<br />
großes Interesse weit über den Landkreis hinaus.<br />
Erhard Oelsner (links) aus Thüringen wurde von<br />
Dr. Stefan Rauh, Geschäftsführer Fachverband<br />
Biogas e.V., für sein langjähriges Verbands-<br />
Engagement mit der Ehrennadel des Fachverbandes<br />
Biogas ausgezeichnet.<br />
Foto: Fachverband Biogas e.V.<br />
sicherheit (TRBS) 1203 gedrängt. Aktuell<br />
zeichnet sich ab, dass die TRBS 1203 im<br />
Rahmen der anstehenden Überarbeitung<br />
in diesem Punkt neu formuliert wird. Die<br />
bereits seit Längerem in Planung befindliche<br />
Qualifizierung der Befähigten Personen<br />
durch den Fachverband Biogas wird an die<br />
besonderen Bedürfnisse in Bezug auf notwendige<br />
Kenntnisse im Bereich Elektrotechnik<br />
angepasst und soll im ersten Halbjahr<br />
<strong>2018</strong> starten.<br />
Im Schulungsverbund Biogas stehen derzeit<br />
weitere Aufnahmen neuer Bildungseinrichtungen<br />
an sowie die ersten nach<br />
vier Jahren erforderlichen Auffrischungsschulungen<br />
gemäß der Technischen Regel<br />
für Gefahrstoffe (TRGS) 529. Hierzu<br />
hatte sich der Schulungsverbund Biogas<br />
seine geplanten Schulungsinhalte und<br />
den eintägigen Umfang bereits durch die<br />
relevanten Gremien auf Bund-Länder-Ebene<br />
bestätigen lassen. Ob und wie andere<br />
Auffrischungsschulungen außerhalb des<br />
Schulungsverbundes den Anforderungen<br />
der TRGS 529 gerecht werden, muss durch<br />
die jeweiligen Anbieter oder durch den Betreiber<br />
abgeklärt werden.<br />
Sitzung des Firmenbeirates<br />
Im Rahmen der Biogas Convention fand<br />
die 3. Sitzung des Firmenbeirats im Jahr<br />
2017 statt. Ein wichtiges Thema dabei war,<br />
wie die Nachfolge für die Herren Spurk und<br />
Gayer, die aus dem Gremium ausgeschieden<br />
sind, zu regeln sei. Nachdem Neuwahlen<br />
in Verbindung mit einer Firmenvollversammlung<br />
abgelehnt worden waren, wurde<br />
beschlossen, auf Kandidaten des letzten<br />
Wahlgangs zurückzugreifen. So werden<br />
aus dem Kreise der Anlagenhersteller Jörg<br />
Meyer zu Strohe von der Firma PlanET sowie<br />
aus dem Kreis der Planer Alfons Himmelstoß<br />
von der Firma AEV Systems in den<br />
Firmenbeirat nachberufen. Weiterhin wurde<br />
neben aktuellen Themen wie der Güllelagerproblematik<br />
in Schleswig-Holstein<br />
und der TRAS 120 über notwendige EEG-<br />
Anpassungsmaßnahmen in den Bereichen<br />
Güllekleinanlagen und Flexibilisierung diskutiert.<br />
Für <strong>2018</strong> will der Firmenbeirat verstärkt<br />
aktuelle Themen in Form von Firmenfachgesprächen<br />
aufgreifen und erörtern.<br />
Referat International<br />
Im Rahmen der Biogas Convention fand<br />
auch ein Treffen der Arbeitsgruppe International<br />
im Fachverband Biogas statt.<br />
Themen dieser Sitzung waren neben einem<br />
interessanten Bericht zu den asiatischen<br />
Märkten (Vincent Choy, Asia Pacific Biogas<br />
Alliance) auch eine Vorstellung der Finanzierungs-<br />
und Partnerschaftsangebote der<br />
deutschen Entwicklungszusammenarbeit<br />
(Verick Schick, Agentur für Wirtschaft &<br />
Entwicklung) sowie eine Vorstellung der<br />
internationalen Aktivitäten des Fachverbandes<br />
Biogas.<br />
Seit dem 2. Januar <strong>2018</strong> steht als Nachfolger<br />
von Clemens Findeisen Markus Fürst<br />
als neuer EZ-Scout zu allen Fragen rund um<br />
92
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Erste Mitarbeiter<br />
in den Ruhestand<br />
verabschiedet<br />
Agnes Koch, die viele Jahre im Bereich der Verwaltung<br />
des Fachverbandes Biogas e.V. tätig war,<br />
wurde in Nürnberg im Rahmen der Biogas Convention<br />
offiziell in den Ruhestand verabschiedet.<br />
Dr. Claudius da Costa Gomez, Hauptgeschäftsführer<br />
des Fachverbandes Biogas e.V., hielt die<br />
Dankesrede und überreichte ein Geschenk.<br />
Ebenfalls in den Ruhestand verabschiedet wurde<br />
Volker Schulze, der das Regionalbüro Ost<br />
als Regionalreferent aufgebaut und geleitet hat.<br />
Er bleibt dem Fachverband noch eine Weile erhalten,<br />
da er stundenweise im Mitgliederservice<br />
tätig sein wird.<br />
die Themen Finanzierungs- und Partnerschaftsangebote<br />
der deutschen Entwicklungszusammenarbeit<br />
im Fachverband zur<br />
Verfügung.<br />
EU-Parlament stimmt für<br />
Änderungen beim Greening<br />
Mitte Dezember wurden im EU-Parlament<br />
Änderungen bei der EU-Agrarpolitik verabschiedet.<br />
Damit wird ab <strong>2018</strong> die Liste<br />
der ökologischen Vorrangflächen innerhalb<br />
der Vorgaben zum Greening erweitert. Neu<br />
aufgenommen wurden:<br />
ffFlächen mit Durchwachsener Silphie<br />
Silphium perfoliatum (Faktor: 0,7)<br />
Fotos: Thomas Geiger<br />
ffFlächen mit Miscanthus (Faktor: 1,0)<br />
ffFür Honigpflanzen genutzte Brachflächen<br />
(mit pollen- und nektarreichen<br />
Arten) (Faktor: 1,5).<br />
Dank der Unterstützung des EU-Abgeordneten<br />
Albert Dess wurde damit ein Teil der<br />
langjährigen Forderungen des Fachverbandes<br />
Biogas bei den Änderungen umgesetzt.<br />
In den Stellungnahmen und bei den Besuchen<br />
in Brüssel hatte der Fachverband sogar<br />
weitreichendere Ergänzungen (Riesenweizengräser,<br />
Mischkulturen) gefordert, die leider<br />
nicht vollständig aufgenommen wurden.<br />
Der Fachverband Biogas wird sich weiter<br />
für günstige Rahmenbedingungen für alternative<br />
Energiepflanzen einsetzen. In<br />
diesem Zusammenhang ist auch eine Informationsoffensive<br />
unter anderem zur<br />
Durchwachsenen Silphie im Biogas Journal<br />
geplant. Darüber hinaus wird die Seite<br />
http://www.farbe-ins-feld.de/ grundlegend<br />
überarbeitet, um den Mitgliedern mehr Informationen<br />
bereitzustellen.<br />
CLENS-Insolvenz und ihre Folgen<br />
Die Insolvenz von CLENS, einem Direktvermarkter<br />
von Strom, überraschte die Geschäftsstelle<br />
im November. Dank der guten<br />
Zusammenarbeit der Referate Mitgliederservice<br />
und Energierecht und -handel mit<br />
den Gremien (Arbeitskreis Direktvermarktung,<br />
Betreiberexpertengruppe Direktvermarktung,<br />
Juristischer Beirat) gelang<br />
es in enger Abstimmung mit betroffenen<br />
Betreibern und dem Insolvenzverwalter,<br />
die Mitglieder immer mit aktuellen Informationen<br />
zu versorgen. Durch das positive<br />
Zusammenwirken aller Beteiligten wurde<br />
das Ziel erreicht, die Branche vor größerem<br />
Schaden zu bewahren. Im Januar sind<br />
schon Gespräche mit den genannten Gremien<br />
geplant, um in einer Arbeitshilfe die<br />
Erfahrungen der letzten Wochen festzuhalten<br />
und für den Fall der Fälle den Mitgliedern<br />
gebündelt zur Verfügung stellen zu<br />
können.<br />
Autor<br />
Dr. Stefan Rauh<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Manuel Maciejczyk<br />
Geschäftsführer<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Angerbrunnenstr. 12 ∙ 85356 Freising<br />
Tel. 0 81 61/98 46 60<br />
E-Mail: info@biogas.org<br />
93<br />
Nutzen Sie die Flexibilisierungsprämie<br />
und sichern Sie sich<br />
Verband<br />
neue Einkünfte neben der Landwirtschaft!<br />
Mit PlanET <strong>2018</strong><br />
in die Flexprämie<br />
Mit dem PlanET Rendite-Konzept<br />
„BHKW Flex“ sind Sie auf der<br />
sicheren Seite:<br />
• Rendite finanziert Ihre Investition<br />
• Stabiles Ertragsmodell für<br />
Altanlagen<br />
• Sicherer Einstieg in die Flexibilitätsprämie<br />
Unsere Lösung für Bestandsanlagen:<br />
Das PlanET Gasmanagement.<br />
PlanET eco ® Gasakku<br />
• Herstellerunabhängige<br />
Flex-Technik<br />
• Einfache Nachrüstung<br />
• Kostengünstiger Speicherraum<br />
www.planet-biogas.com<br />
Telefon 02564 3950 - 191
Verband<br />
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Regionalgruppe Oberbayern<br />
Umweltministerin besuchte<br />
Biogasanlage Hintermaier<br />
In der Regionalgruppe Oberbayern fanden<br />
im Jahr 2017 zahlreiche Veranstaltungen<br />
statt: Regionalgruppentreffen,<br />
bei denen wichtige Fachthemen vermittelt<br />
wurden, aber auch einige politische<br />
Termine mit Bundestags- und Landtagsabgeordneten<br />
im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.<br />
Hier war sicherlich der Besuch von<br />
Ulrike Scharf, Umweltministerin in Bayern,<br />
auf der Biogasanlage Hintermaier ein besonders<br />
öffentlichkeitswirksamer Termin<br />
mit positiver Resonanz in der Presse.<br />
Die letzte Zusammenkunft in 2017 fand<br />
am 27. November im Landkreis Trostberg<br />
statt. Hier fanden sich knapp 90 Teilnehmer<br />
ein, um sich über die neue Düngeverordnung<br />
und die neue AwSV und deren<br />
Auswirkungen auf Biogasanlagen zu informieren.<br />
Florian Strippel, Ansprechpartner<br />
der Fachverband Biogas Service GmbH,<br />
stellte die neuen Anforderungen sehr anschaulich<br />
und informativ dar.<br />
Als weiterer Referent konnte Alois Ilmberger,<br />
FZ Agrarökologie Pfaffenhofen, gewonnen<br />
werden. Zuständig für die Region<br />
berichtete er über Fachrechtskontrollen<br />
zur Verbringungs- und Düngeverordnung.<br />
Er wies eindringlich auf die Melde-, Mitteilungs-<br />
und Aufzeichnungspflichten hin und<br />
stellte den fachrechtlichen Kontrolltatbestand<br />
auf Grundlage der neuen Düngeverordnung<br />
dar.<br />
Ein weiterer Termin steht bereits fest: Am 1.<br />
Februar <strong>2018</strong> trifft sich die Regionalgruppe<br />
in 84435 Lengdorf. Hierfür konnte unter<br />
anderem bereits Rechtsanwalt Dr. Helmut<br />
Loibl als Referent gewonnen werden.<br />
Autorin<br />
Helene Barth<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Regionalgruppe Niederbayern<br />
Biogasstammtisch: Ergebnisse der ersten<br />
Biomasse-Ausschreibung vorgestellt<br />
Die Regionalgruppe lud am 28.<br />
November zum 45. Biogasstammtisch<br />
nach Rottersdorf<br />
bei Landau ein. Zahlreiche<br />
Betreiber von Biogasanlagen<br />
informierten sich über die Ergebnisse der<br />
ersten Biomasse-Ausschreibung im September<br />
und die Änderungsvorschläge des<br />
Fachverbandes.<br />
Der Geschäftsführer des Fachverbandes<br />
Biogas, Dr. Stefan Rauh, analysierte die<br />
Umsetzung der ersten Ausschreibung für<br />
Biomasseanlagen. Zu Beginn erläuterte<br />
Rauh die Rahmenbedingungen für die Teilnahme<br />
an einer Ausschreibung. Wichtig sei,<br />
dass Bestandsanlagen für eine Anschlussförderung<br />
an der Ausschreibung teilnehmen<br />
müssten. Der Gebotshöchstwert lag dieses<br />
Jahr bei 16,90 ct/kWh, zudem sei der Wert<br />
begrenzt auf die Höhe der bisher ausgezahlten<br />
Vergütung. Nach einem Zuschlag sei<br />
der Wechsel in die neue Vergütungsphase<br />
frühestens nach 12 und spätestens nach 36<br />
Monaten zu vollziehen. Insgesamt habe der<br />
Anlagenbetreiber die Möglichkeit, an drei<br />
Ausschreibungen teilzunehmen.<br />
Für eine Anschlussvergütung müssten unterschiedliche<br />
technische Voraussetzungen<br />
eingehalten werden, so Rauh. So müsse<br />
zum Beispiel auf der Anlage eine gasdichte<br />
Mindestverweilzeit von 150 Tagen eingehalten<br />
werden. Zusätzlich müsse bedarfsgerecht<br />
Strom erzeugt werden können. Der<br />
Nachweis erfolge durch eine Bestätigung<br />
des Umweltgutachters. Eine weitere Voraussetzung<br />
für eine Vergütung sei der Maisdeckel,<br />
der den Anteil von Mais auf 50 Prozent<br />
des gesamten eingesetzten Substrats<br />
verringere.<br />
Die erste Ausschreibung für Biomasseanlagen<br />
fand am 1. September 2017 statt.<br />
Von dem gesamten Ausschreibungsvolumen<br />
von 122 MW installierter Leistung<br />
wurden 77 Prozent nicht ausgeschöpft, so<br />
Rauh. Diese nicht bezuschlagte Leistung<br />
werde im Jahr <strong>2018</strong> neu ausgeschrieben.<br />
Bei einer Teilnahme an der Ausschreibung<br />
müsse der Anlagenbetreiber eine finanzielle<br />
Sicherheit hinterlegen sowie eine gültige<br />
Genehmigung vorweisen. Diese müsse für<br />
Neuanlagen aus dem Jahr 2017 sein und<br />
bei Bestandsanlagen noch mindestens zehn<br />
Jahre gültig sein.<br />
Als Zwischenfazit nach der ersten Durchführung<br />
der Ausschreibung fasste Rauh zusammen,<br />
dass die Rahmenbedingungen weiter<br />
zu verbessern seien. So fordere der Fachverband<br />
unter anderem, den Ausschreibungsturnus<br />
auf zwei Ausschreibungen pro Jahr<br />
anzuheben. Der Vergütungszeitraum sei bei<br />
einem vorzeitigen Wechsel zu erhöhen und<br />
der Gebotshöchstwert müsse höher angesetzt<br />
werden. Aktuell werden weitere Wünsche<br />
an das neue Ausschreibungsmodell intern<br />
diskutiert, so Rauh. Jedoch seien viele<br />
Forderungen abhängig von den zukünftigen<br />
politischen Rahmenbedingungen.<br />
Text: C.A.R.M.E.N. e.V.<br />
94
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Verband<br />
Regionalgruppe Schleswig-Holstein<br />
Kooperation mit der Netzwerkagentur<br />
Erneuerbare Energien Schleswig-Holstein (EE.SH)<br />
Der Fachverband Biogas, Regionalgruppe<br />
Schleswig-Holstein,<br />
hat einen neuen Kooperationspartner:<br />
die Netzwerkagentur<br />
Erneuerbare Energien Schleswig-Holstein<br />
(EE.SH). Die EE.SH wurde<br />
gegründet, um die wirtschaftlichen Chancen<br />
zu fördern, die sich für schleswigholsteinische<br />
Unternehmen aus der Energiewende<br />
ergeben. Hier bietet sich eine<br />
Kooperation mit den unterschiedlichen<br />
Verbänden der Erneuerbaren-Branche an.<br />
Im Bereich Biogas sollen gemeinsam die<br />
Themen Direktvermarktung und Kopplung<br />
von Strom- und Wärmesektor aufgenommen<br />
werden.<br />
Die erste gemeinsame Veranstaltung zur<br />
neuen Düngeverordnung in den Räumen<br />
der Fachhochschule Kiel in Osterrhönfeld<br />
war mit 100 Teilnehmenden und hochkarätigen<br />
Referenten gleich ein Erfolg. Dr. Uwe<br />
Schleuß vom Ministerium für Energiewende,<br />
Landwirtschaft, Naturschutz und Digitalisierung<br />
erklärte, dass die Verordnung<br />
bundesweit gelte, allerdings durch Ausführungsbestimmungen<br />
der Länder ergänzt<br />
werde. Insbesondere in den Stickstoff- und<br />
Phosphatüberschussgebieten müssen betriebliche<br />
Anpassungen erfolgen.<br />
Foto: Silke Weyberg<br />
Dr. Helmut Loibl, Rechtsanwalt und Sprecher<br />
des juristischen Beirats des Fachverbandes,<br />
ging schwerpunktmäßig auf die<br />
Lagerkapazitäten und die erweiterten Ausbringungssperrfristen<br />
ein. Es gilt zu prüfen,<br />
ob die Lagerkapazitäten ausreichen und die<br />
neuen Anforderungen an den Bau von Gärrestlagern,<br />
die in der AwSV festgelegt sind,<br />
zu beachten. Hans-Ulrich Martensen, Sprecher<br />
der Regionalgruppe Schleswig-Holstein,<br />
sah zusätzliche Anforderungen auf<br />
die Biogasanlagenbetreiber zukommen. Die<br />
genehmigungsrechtlichen Voraussetzungen<br />
für den Bau von Gärrestlagern müssen gegeben<br />
sein und die Ausweitung der Dokumentationspflichten<br />
wird für viele Anlagenbetreiber<br />
eine echte Herausforderung sein.<br />
Erste gemeinsame Fachveranstaltung der Regionalgruppe<br />
Schleswig-Holstein und der Netzwerkagentur<br />
Erneuerbare Energien Schleswig-Holstein<br />
(EE.SH) in der FH Kiel.<br />
Autorin<br />
Dipl.-Ing. agr. Silke Weyberg<br />
Regionalreferentin Nord<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Ostring 6 · 31249 Hohenhameln<br />
Tel. 0 51 28/33 35 510<br />
E-Mail: silke.weyberg@biogas.org<br />
IHR KRAFTWERK:<br />
FLEXIBEL & OPTIMIERT.<br />
Wir machen Ihre KWK-Anlage fit!<br />
Besuchen Sie uns auf der<br />
E-world energy & water<br />
vom 6.-8. Februar <strong>2018</strong><br />
Halle 1, Stand 200<br />
Profitieren Sie von unseren Optimierungslösungen:<br />
Prognose der Lasten für alle<br />
Commodities<br />
Berechnung der bestmöglichen<br />
Anlagenfahrpläne<br />
Haben Sie Fragen zum Cross-Commodityund<br />
Demand-Side-Management?<br />
natGAS Aktiengesellschaft Tel: +49 331 2004 0<br />
Jägerallee 37 H Fax: +49 331 2004 199<br />
14469 Potsdam info@natgas.de<br />
Deutschland<br />
www.natgas.de<br />
Zugang zu allen Märkten<br />
Direktvermarktung von Strom aus EE- und KWK-<br />
Anlagen<br />
Integrierter Ansatz von Stromhandel und Technik<br />
95
Verband<br />
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Die Regionalgruppen in Niedersachsen haben gewählt<br />
und trafen sich zu einer Klausurtagung im<br />
Landvolkhaus in Niedersachsen. Themen waren die<br />
Planung der Winterarbeit und drängende inhaltliche<br />
Fragen wie neue Grenzwerte für den Luftreinhaltebonus<br />
oder aber auch die Umsetzung<br />
von AwSV und Düngeverordnung.<br />
Regional<br />
büro<br />
NORD<br />
Bei den Themen wird auch eng mit dem<br />
Landvolk Niedersachsen innerhalb des Biogasforums<br />
kooperiert. Die politische Lobbyarbeit soll in<br />
Zukunft innerhalb des LEE in Niedersachsen koordiniert<br />
werden, der federführend vom BWE und<br />
vom Fachverband vorangetrieben wird. Daher war<br />
ein Teil der Klausurtagung dem Austausch mit den<br />
Vertretern des BWE in Niedersachsen gewidmet<br />
über die zukünftige Arbeit.<br />
Foto: Fachverband Biogas e.V.<br />
Sicherheit auf Biogasanlagen in Chile<br />
In vielen Schwellen- und Entwicklungsländern<br />
stellt das Thema Sicherheit<br />
auf Biogasanlagen eine grundlegende<br />
Basis für ein weiteres erfolgreiches<br />
Wachstum dar. Im Rahmen eines Anfang<br />
November 2017 durch die Deutsche<br />
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit<br />
(GIZ) sowie weitere chilenische<br />
Partner organisierten Workshops zum Thema<br />
Sicherheit auf Biogasanlagen konnte<br />
der Fachverband Biogas seine umfangreichen<br />
Kenntnisse und Erfahrungen durch<br />
den Geschäftsführer Manuel Maciejczyk<br />
einbringen.<br />
In diversen Diskussionsrunden wurden neben<br />
einer Vorstellung des deutschen Biogasmarktes<br />
auch die komplexen Themen<br />
„Gefährdungen und Sicherheitsmaßnahmen“,<br />
„Erfahrungen aus Schadensfällen<br />
und Unfällen“ sowie „Positive Praxisbeispiele“<br />
intensiv diskutiert. Die Tatsache,<br />
dass der Sitzungsraum aus allen Nähten<br />
platzte und fast 100 Teilnehmer anwesend<br />
waren, zeigt das Interesse der dortigen<br />
Biogasbranche und Behördenvertreter an<br />
dem Thema.<br />
Erfreulicherweise war auch festzustellen,<br />
dass der vom Fachverband Biogas erstellte<br />
Leitfaden „Safety first! Guidelines for the<br />
safe use of biogas technology“ in seiner<br />
spanischen Version teilweise die<br />
Grundlage einer chilenischen Biogasnorm<br />
darstellt. In der „Reglamento<br />
de Seguridad Nacional“,<br />
die seit Mitte 2017<br />
veröffentlicht ist, finden<br />
sich zahlreiche in Deutschland<br />
bekannte und bewährte<br />
Anforderungen an<br />
den sicheren Betrieb von<br />
Biogasanlagen. Insbesondere für Deutsche<br />
Biogasunternehmen dürfte das damit eingeführte<br />
Sicherheitsniveau bekannt sein<br />
und einen Vorteil gegenüber qualitativ und<br />
preislich niedriger angesiedelten Konkurrenten<br />
aus dem Ausland bringen.<br />
Weitere Diskussionspunkte im Rahmen<br />
des Workshops und der Besichtigung einer<br />
Abwasserbehandlungsanlage mit 8 Megawatt<br />
elektrischer Leistung in der Nähe<br />
von Santiago de Chile waren die sichere<br />
Instandhaltung, das Thema Qualifizierung<br />
und der Brandschutz auf Biogasanlagen.<br />
An dieser Stelle sei auch nochmal der GIZ<br />
für die hervorragende Organisation der Veranstaltung<br />
gedankt.<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Manuel Maciejczyk<br />
Geschäftsführer<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Angerbrunnenstr. 12 · 85356 Freising<br />
Tel. 0 81 61/98 46 60<br />
E-Mail: info@biogas.org<br />
Foto: Manuel Maciejczyk<br />
96
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Verband<br />
Repowering<br />
Flexibilisierung<br />
Gärrestaufbereitung<br />
Wärmespeicher<br />
Greenline GmbH & Co KG<br />
Jägerweg 12 · 24941 Flensburg<br />
WOLF SYSTEM GMBH | Am Stadtwald 20 | 94486 Osterhofen<br />
+49 (0) 9932 37-0 | mail@wolfsystem.de | WWW.WOLFSYSTEM.DE<br />
Tel. 0461 3183364-0<br />
www.greenline-energy.de<br />
BIOGASBEHÄLTER – Fermenter, Gärrestlager, Vorgruben, ...<br />
Bauen mit System!<br />
© Fotolia.com – Jarous<br />
www.pronova.de<br />
Für den weiteren Ausbau unseres Teams suchen wir einen<br />
Vertriebsmitarbeiter (m/w) für den Bereich<br />
Rauchgas und Biogasanalyse<br />
Innen- und Außendienst<br />
Einsatzort: Berlin<br />
Wir bieten<br />
• Abwechslungsreiche Tätigkeiten<br />
• Flache Hierarchien<br />
• Fachliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten<br />
• Stabile Arbeitsverhältnisse<br />
• Kollegiales Arbeitsklima<br />
Ihre Aufgaben<br />
• Kundenakquise bundesweit auch vor Ort, teilweise europ. Ausland<br />
• Klärung der Applikationen beim Kunden und Erstellung des<br />
Angebotes nach Rücksprache Technik<br />
• lfd. Kundenbetreuung<br />
• Ideen zur Produktweiterentwicklung<br />
• Erschließung neuer Märkte<br />
Ihr Profil<br />
• Abgeschlossene technische Berufsausbildung mit kaufmännischem<br />
Hintergrund<br />
• Idealerweise mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Vertrieb;<br />
Wir geben aber auch Berufsanfängern eine Chance<br />
• Hohe Kunden- und Serviceorientierung<br />
• Bereitschaft zu deutschlandweiten Reisen<br />
• Englischkenntnisse<br />
• Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise<br />
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte<br />
Ihre aussagefähige Bewerbung mit Gehaltsvorstellung an:<br />
karriere@pronova.de<br />
Ihre Alte ist nicht dicht?<br />
Dichten durch Beschichten!<br />
Beschichtung als Betonschutz<br />
und / oder Dämmung,<br />
ihrer alten oder neuen<br />
Biogasanlage / Güllebehälter.<br />
Tel. 03525/8753610<br />
www.nilpferdhaut.de<br />
www.pronova.de<br />
Für den weiteren Ausbau unseres Serviceteams suchen wir<br />
Mitarbeiter/Techniker (m/w) für den<br />
Service von Biogas-Analysesystemen<br />
Mitarbeiter (m/w) Innendienst, Mitarbeiter (m/w) Außendienst<br />
Einsatzort: Berlin<br />
Wir bieten<br />
• Abwechslungsreiche Tätigkeiten<br />
• Flache Hierarchien<br />
• Fachliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten<br />
• Stabile Arbeitsverhältnisse<br />
• Kollegiales Arbeitsklima<br />
Ihre Aufgaben<br />
• Betreuung und Ausführung von Wartungsmaßnahmen<br />
bundesweit vor Ort<br />
• Inbetriebnahme von Neugeräten und Konfiguration der<br />
Geräte nach Kundenanforderungen<br />
• Behebung von Störungen sowie Fehleranalyse<br />
• Ersteinweisung der Kunden<br />
• Kundenbetreuung und Beratung<br />
Ihr Profil<br />
• Abgeschlossene Berufsausbildung zum Mechaniker,<br />
Elektriker oder Mechatroniker<br />
• Idealerweise mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Service;<br />
Wir geben aber auch Berufsanfängern eine Chance<br />
• Hohe Kunden- und Serviceorientierung<br />
• Bereitschaft zu deutschlandweiten Reisen<br />
• Englischkenntnisse<br />
• Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise<br />
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte<br />
Ihre aussagefähige Bewerbung mit Gehaltsvorstellung an:<br />
karriere@pronova.de<br />
97
Verband<br />
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Wohlklingende Passagen<br />
im Koalitionsvertrag<br />
In Niedersachsen hat die Große Koalition den Weg für die kommenden<br />
fünf Jahre definiert. Die Branche der Erneuerbaren zeigt sich einigermaßen<br />
optimistisch – auch wenn die Pläne der neuen Landesregierung<br />
oft unkonkret bleiben.<br />
Von Bernward Janzing<br />
Immerhin sitzt Praxiserfahrung mit Biogas<br />
nun auch am Kabinettstisch von<br />
Hannover. Landwirtschaftsministerin<br />
Barbara Otte-Kinast (CDU) betreibt<br />
eine Anlage auf ihrem Hof in Beber<br />
(Bad Münder). Sie ist auch sonst bestens<br />
mit den Belangen der Landwirtschaft vertraut<br />
– als Vorsitzende des Niedersächsischen<br />
LandFrauenverbandes Hannover,<br />
als Mitglied im Landvolkvorstand, als Mitglied<br />
des Finanzausschusses der Landwirtschaftskammer<br />
Niedersachsen.<br />
Auch der neue Umweltminister Olaf Lies<br />
(SPD) habe ein „offenes Ohr für die Erneuerbaren“<br />
sagt Silke Weyberg, Regionalreferentin<br />
Nord beim Fachverband<br />
Biogas. Lies sehe auch das Biogas als Teil<br />
der Energiewende und werde nun wohl vor<br />
allem das Thema Güllevergärung angehen.<br />
Und ebenso sei Wirtschaftsminister Bernd<br />
Althusmann (CDU) den Erneuerbaren Energien<br />
gegenüber „aufgeschlossen“.<br />
Entsprechend enthält auch der Koalitionsvertrag<br />
der Großen Koalition mit dem Titel<br />
„Gemeinsam für ein modernes Niedersachsen“<br />
einige Passagen, die von Vertretern<br />
der Erneuerbaren Energien wohlwollend<br />
aufgenommen werden: „Erneuerbare Energien<br />
werden wir mit Nachdruck vorantreiben“,<br />
heißt es da zum Beispiel. Was freilich<br />
auch damit zusammenhängen dürfte, dass<br />
in Niedersachsen nach Zahlen des Landesverbandes<br />
Erneuerbare Energien (LEE)<br />
rund 53.000 Arbeitsplätze unmittelbar an<br />
dieser Branche hängen.<br />
Politik will dezentrale<br />
Betreibermodelle unterstützen<br />
Energiethemen nehmen daher im Koalitionsvertrag<br />
viel Raum ein. Unter der<br />
Überschrift „Energieland Niedersachsen“<br />
betonen die Koalitionäre, dass die Energiewende<br />
Niedersachsen „große Wachstumsund<br />
Entwicklungschancen“ eröffne. Neben<br />
der Biomasseproduktion, der Solarenergie<br />
und der Geothermie gelte dies insbesondere<br />
für die Windenergie: „Als Windenergieland<br />
Nr. 1 sind wir Spitzenreiter beim Ausbau<br />
der Erneuerbaren Energien. Wir wollen<br />
diese Führungsrolle weiter ausbauen und<br />
damit zukunftssichere Arbeitsplätze und<br />
Wertschöpfung in Niedersachsen generieren.“<br />
Zur Stärkung der Öffentlichkeits- und<br />
Bürgerbeteiligung wollen die Koalitionäre<br />
dezentrale Betreiber- und Investitionsmodelle<br />
unterstützen, zum Beispiel Genossenschaftsmodelle.<br />
Ein wenig zurückhaltender als Biogasreferentin<br />
Weyberg, die selbst einige Jahre<br />
für die CDU im Landtag von Niedersachsen<br />
saß, äußert sich unterdessen Michael<br />
Kralemann von der Fakultät Ressourcenmanagement<br />
an der HAWK Hochschule<br />
Hildesheim/Holzminden/Göttingen. Er<br />
vertritt auch das 3N Kompetenzzentrum<br />
Niedersachsen Netzwerk Nachwachsende<br />
Rohstoffe und Bioökonomie. „Im Koalitionsvertrag<br />
ist nicht viel Konkretes drin“,<br />
sagt Kralemann, der eine Prognose über<br />
die künftige Landespolitik daher noch für<br />
schwierig hält.<br />
Die Zukunft des Biogases in Niedersachsen<br />
sieht Kralemann vor allem in Regionen, in<br />
denen man für die Abnahme von Gülle noch<br />
Geld bekommt, sowie dort, wo mit der Nutzung<br />
der entstehenden Wärme Einnahmen<br />
zu erzielen sind: „Die künftigen Biogasanlagen<br />
werden nicht mehr die Bonuskönige<br />
sein“, sagt er – also nicht mehr jener Typus,<br />
der erst wirtschaftlich wurde durch maximale<br />
Kombination der einst gewährten<br />
Boni im EEG.<br />
Niedersachsen: nur zwei Kreise<br />
ohne Biotonne<br />
Optimistisch äußert sich Kralemann zum<br />
Thema Biotonne. „Da geht was“, sagt er.<br />
Mit Ausnahme von zwei Landkreisen habe<br />
Niedersachsen inzwischen flächendeckend<br />
die Biotonne eingeführt. Natürlich nutzen<br />
nicht alle Bürger sie, weil sich vor allem auf<br />
dem Land die Eigenkompostierung anbietet.<br />
Aber die Erfahrungen mit der Biotonne<br />
seien gut.<br />
Unterdessen wurde gerade das Ergebnis<br />
der niedersächsischen Biogas-Inventur veröffentlicht.<br />
Danach waren Ende 2016 im<br />
Land 1.634 überwiegend landwirtschaft-<br />
98
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Verband<br />
liche Biogasanlagen mit einer<br />
installierten elektrischen Leistung<br />
von insgesamt 990 Megawatt<br />
in Betrieb. Diese Anlagen<br />
erzeugen etwa 23 Prozent des<br />
erneuerbaren Stroms. Das<br />
komme dem Klima nicht nur<br />
durch die Verdrängung fossil<br />
erzeugten Stroms, sondern<br />
auch durch die Vermeidung<br />
von Methanemissionen zugute:<br />
Ein Milchviehbetrieb mit<br />
100 Kühen vermeide jährlich<br />
100 Tonnen Treibhausgas,<br />
wenn er die Gülle möglichst<br />
innerhalb weniger Tage in eine<br />
Biogasanlage überführt.<br />
Um das Biogas wieder nach<br />
vorne zu bringen, hält auch Regionalreferentin<br />
Weyberg die<br />
Strategie für zwingend, Alternativen<br />
zum Mais noch stärker<br />
zu entwickeln. Denn der habe<br />
dem Biogas in der öffentlichen<br />
Debatte zugesetzt, obwohl er<br />
überwiegend als Viehfutter<br />
genutzt wird. „Wir müssen aus<br />
der Rolle heraus, Teil des Problems<br />
zu sein, wir sind Teil der<br />
Lösung“, sagt Weyberg. Deswegen<br />
sei die stärkere Fokussierung<br />
auf Gülle ein wichtiges<br />
Thema für die Branche.<br />
Wirtschaftsdünger:<br />
42 Millionen Tonnen<br />
könnten vergoren<br />
werden<br />
Der noch junge Landesverband<br />
Erneuerbare Energien (LEE)<br />
Niedersachsen-Bremen hat<br />
sich dieses Themas bereits angenommen<br />
und betont: „Niedersachsen hat<br />
ein großes Potenzial an Gülle.“ 2015 seien<br />
7,8 Millionen Tonnen an landwirtschaftlichen<br />
Reststoffen, Gülle und Mist vergoren<br />
worden. Das Potenzial in Niedersachsen<br />
liege jedoch bei rund 42 Millionen Tonnen.<br />
Durch die Gülle- und Mistvergärung ließe<br />
sich die Emission von fast 5 Millionen Tonnen<br />
CO 2<br />
vermeiden.<br />
Und deswegen fordert der LEE: „Es ist<br />
notwendig, hierfür die genehmigungsrechtlichen<br />
Tatbestände anzupassen.“ Die<br />
Umstellung von Biogasanlagen auf überwiegend<br />
Gülle-/Festmistvergärung müsse „genehmigungsrechtlich<br />
einfach und schlank<br />
Foto: Fotolia_ chris74<br />
möglich“ sein. So müssten zum Beispiel<br />
Gülle- und Gärdüngerlagerung als ein<br />
Rechtsbereich behandelt werden. Dazu gehöre<br />
auch, dass Gülleläger ohne Änderung<br />
der Baugenehmigungen für Gärsubstrat jedweder<br />
Herkunft zugelassen werden und die<br />
systematische Benachteiligung von Gärrest<br />
gegenüber Gülle, insbesondere im Wasserrecht,<br />
beendet wird. Dafür gebe es ohnehin<br />
keine fachliche Grundlage.<br />
Im EEG müsse unterdessen, so der LEE,<br />
eine auskömmliche Vergütung auch jenseits<br />
der 75-Kilowatt-Klasse verankert werden.<br />
Denn nur dann könnten sich Biogasanlagen<br />
„als klimafreundlicher Bearbeiter von Gülle<br />
und Reststoffen aus der Landwirtschaft in<br />
sinnvollen, strukturangepassten Größenordnungen<br />
entwickeln“. In den vergangenen<br />
Jahren dominierten diese Kleinanlagen<br />
den Neubau: Von 88 seit 2013 installierten<br />
Neuanlagen seien 64 kleine Gülleanlagen<br />
gewesen, ergab die Biogas-Inventur.<br />
Konkrete Hinweise, wie weit die Landespolitik<br />
Niedersachsens in Zukunft auf die<br />
Bundesgesetzgebung einwirken wird, um<br />
auch größere Gülleanlagen zu ermöglichen,<br />
gibt es jedoch noch nicht. Wie es in Koalitionsverträgen<br />
so üblich ist, bleibt auch<br />
das Hannoveraner Papier recht allgemein.<br />
Es schreibt lediglich fest: „Damit die Biomasseverstromung<br />
trotz auslaufender Förderung<br />
fortgesetzt werden kann, wollen wir<br />
die notwendige Planungssicherheit für Investitionen<br />
schaffen.“<br />
Politik will Tierproduktion stärker<br />
an Fläche binden<br />
Der Umgang mit der Gülle hat es zwar nicht<br />
bis in den Koalitionsvertrag geschafft, in den<br />
Wahlprogrammen der beiden Regierungsparteien<br />
war er jedoch vor der Wahl Thema.<br />
Die CDU hatte angekündigt, sie werde „Projekte<br />
zur alternativen Güllenutzung statt<br />
der bisher praktizierten Ausbringung durch<br />
finanzielle Anreize fördern.“ Auch die SPD<br />
will die Belastung von Boden, Oberflächenund<br />
Grundwasser durch Nährstoffeinträge<br />
wie Gülle verringern und propagiert daher<br />
Nährstoffkreisläufe, die „durch eine stärker<br />
an Agrarflächen gebundene Tierhaltung geschlossen“<br />
werden. Das Biogas dürfte dabei<br />
auch eine wichtige Rolle spielen.<br />
Deutlicher als zum Biogas positionieren<br />
sich die Koalitionäre zum Thema Windkraft.<br />
„SPD und CDU wollen die Windenergie an<br />
Land und auf See ausbauen sowie die Solarenergie,<br />
die kommunalen Energie- und<br />
Klimaschutzagenturen und die Klimaschutzagentur<br />
Niedersachsen (KEAN) stärken“,<br />
heißt es in der Vereinbarung, die den<br />
Untertitel „Für Innovation, Sicherheit und<br />
Zusammenhalt“ trägt.<br />
Zur weiteren Stärkung der Windenergie<br />
werde das „Deutsche Offshore-Industrie-<br />
Zentrum“ in Cuxhaven weiterentwickelt:<br />
„Wir machen uns die Forderungen des Cuxhavener<br />
Appells zu eigen und werden uns<br />
beim Bund für die Erhöhung der Ausbauziele<br />
für Windenergie auf See von 15 auf<br />
20 Gigawatt bis zum Jahr 2030 einsetzen.“<br />
Im Cuxhavener Appell haben die fünf norddeutschen<br />
Bundesländer zahlreiche Forderungen<br />
zur Zukunft der deutschen Offshore-<br />
Industrie formuliert.<br />
Der Koalitionsvertrag betont ferner, dass<br />
auch der Verkehrs- und Mobilitätssektor<br />
„einen bedeutenden Beitrag zur Erreichung<br />
der klima- und energiepolitischen Ziele des<br />
Landes leisten“ könne. Die Elektromobilität,<br />
die Entwicklung alternativer Antriebssysteme<br />
wie Gas- und Wasserstoffantriebe,<br />
die Stärkung des Fahrradverkehrs und<br />
eines emissionsarmen ÖPNV seien hierbei<br />
vorrangig zu betrachten. Gemeinsam mit<br />
Kommunen und der regionalen Wirtschaft<br />
wolle das Land Lösungen entwickeln, um<br />
die Lade- und Tankstelleninfrastruktur landesweit<br />
für Fahrzeuge und Elektrofahrräder<br />
auszubauen.<br />
Und bei der Solarenergie hat es die Zusage<br />
eines Pilotprojektes in die Koalitionsvereinbarung<br />
geschafft. Mit einem solchen wolle<br />
man die „Nutzung der Solarthermie für<br />
Nahwärmenetze sowie den Einsatz in Wohngebäuden<br />
und landeseigenen Einrichtungen<br />
fördern“. Der neugegründete LEE wird<br />
bei allen cleveren Projekten zur Seite stehen<br />
– und natürlich auch weitere vorschlagen:<br />
„Wir müssen der Politik als Think Tank<br />
Ideen präsentieren“, sagt Biogasexpertin<br />
Weyberg. Und dazu sei es „unerlässlich,<br />
die Sektoren Strom, Wärme und Mobilität<br />
gemeinsam zu denken“. Was sich übrigens<br />
auch im Koalitionsvertrag widerspiegelt, der<br />
dafür eintritt, dass im EEG die „Sektorkopplung<br />
künftig stärker berücksichtigt“ wird.<br />
Autor<br />
Bernward Janzing<br />
Freier Journalist<br />
Wilhelmstr. 24a · 79098 Freiburg<br />
Tel. 07 61/202 23 53<br />
E-Mail: bernward.janzing@t-online.de<br />
99
Recht<br />
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Clearingstelle EEG<br />
Zwei Voten zur Inbetriebnahme, zum Verund<br />
Ersetzen und zur Zusammenfassung von<br />
Satelliten-BHKW veröffentlicht<br />
Die Clearingstelle EEG hat in zwei Voten Fragen zum Ver- und Ersetzen (Votum 2017/39) sowie zur Inbetriebnahme<br />
und zur Anlagenzusammenfassung bei Satelliten-BHKW (Votum 2017/25) beantwortet.<br />
Von Elena Richter und Dr. Martin Winkler<br />
Votum zum gleichzeitigen Ver- und Ersetzen von BHKW<br />
Im Votum 2017/39 (abrufbar unter https://<br />
www.clearingstelle-eeg.de/votv/2017/39)<br />
hat die Clearingstelle EEG geklärt, ob in<br />
dem konkreten Einzelfall das aus einer Vor-<br />
Ort-Anlage herausgelöste Satelliten-BHKW<br />
den Inbetriebnahmezeitpunkt der Vor-Ort-<br />
Anlage „mitnehmen“ konnte und ob sich<br />
der Zubau eines „Flex-BHKW“ an der Vor-<br />
Ort-Anlage darauf auswirkt.<br />
In dem Fall wurde eine Vor-Ort-Anlage<br />
2005 mit einem BHKW in Betrieb genommen<br />
und 2007 und 2011 jeweils um ein<br />
BHKW erweitert. Anfang 2014, noch vor<br />
Inkrafttreten des EEG 2014, versetzte der<br />
Betreiber das 2011 zugebaute BHKW an<br />
einen Satellitenstandort, um dort eine eigenständige<br />
Wärmesenke zu erschließen.<br />
Anschließend wollte der Betreiber die<br />
Vor-Ort-Anlage um ein neues BHKW (sogenanntes<br />
Flex-BHKW) erweitern, um den<br />
Betrieb der Vor-Ort-Anlage zu flexibilisieren<br />
und an einer Ausschreibung teilnehmen<br />
zu können. Die durchschnittliche Bemessungsleistung<br />
der Vor-Ort-Anlage sollte sich<br />
durch diese Vorgänge nicht erhöhen.<br />
Die Clearingstelle EEG hat entschieden,<br />
dass das Satelliten-BHKW das Inbetriebnahmejahr<br />
2005 aus der Vor-Ort-Anlage<br />
an den Satellitenstandort „mitgenommen“<br />
hat. Denn als das BHKW 2011 in die Vor-<br />
Ort-Anlage eingebaut wurde, wurde es Teil<br />
der Vor-Ort-Anlage, sodass für alle BHKW<br />
dieser Anlage einheitlich das Inbetriebnahmejahr<br />
2005 galt. Da das BHKW nach dem<br />
Versetzen am Satellitenstandort als rechtlich<br />
eigenständige Anlage weiterbetrieben<br />
wurde, blieb die Inbetriebnahme bestehen.<br />
Dass ein Flex-BHKW in die Vor-Ort-Anlage<br />
eingebaut wird, ändert daran nichts, weil<br />
der Zubau erst nach dem 31. Juli 2014 erfolgt<br />
ist. Denn die „Sperrwirkung der Austauschregelung“,<br />
die die Clearingstelle EEG<br />
in der Empfehlung 2012/19 (https://www.<br />
clearingstelle-eeg.de/empfv/2012/19)<br />
begründet hat, um beim gleichzeitigen<br />
Ver- und Ersetzen von BHKW eine „Vermehrung“<br />
von Inbetriebnahmezeitpunkten<br />
und damit von alten Vergütungssätzen zu<br />
verhindern, ist entbehrlich, wenn aus einer<br />
vor dem 1. August 2014 in Betrieb genommenen<br />
Vor-Ort-Anlage vor dem 1. August<br />
2014 ein BHKW entfernt und als eigenständige<br />
Anlage versetzt worden ist sowie<br />
an der Vor-Ort-Anlage das versetzte BHKW<br />
nach dem 31. Juli 2014 ersetzt wird.<br />
In diesem Fall ist sowohl der Vor-Ort-Anlage<br />
als auch dem Satelliten-BHKW eine eindeutige<br />
Höchstbemessungsleistung gemäß<br />
Paragraf 101 Absatz 1 EEG 2014/EEG<br />
2017 zugeordnet. Damit hat der Gesetzgeber<br />
bereits eine ausdrückliche Regelung<br />
zur Begrenzung alter Vergütungsansprüche<br />
getroffen.<br />
Votum zur Inbetriebnahme und zur Zusammenfassung von Satelliten-BHKW<br />
Im Votum 2017/25 (https://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2017/25)<br />
wurde zum<br />
einen geklärt, dass es für die „Inbetriebnahme“<br />
im Sinne des EEG 2009 nicht<br />
ausreicht, wenn die Biogasanlage (hier:<br />
ein einzelnes BHKW) auf dem Gelände des<br />
Herstellers und damit quasi „vorsorglich“<br />
in Betrieb gesetzt wird, auch wenn dies im<br />
Auftrag des künftigen Anlagenbetreibers<br />
erfolgt. Die Biogasanlage konnte daher erst<br />
in Betrieb genommen werden, nachdem sie<br />
an ihrem vorgesehenen Standort errichtet<br />
und dort vom Anlagenbetreiber in Betrieb<br />
gesetzt wurde. Zum anderen hat das Votum<br />
2017/25 geklärt, dass ein nach dem<br />
1. Januar 2012 in Betrieb genommenes,<br />
rechtlich eigenständiges Satelliten-BHKW<br />
für die Vergütungsermittlung auch dann mit<br />
der Vor-Ort-Anlage zusammenzufassen ist,<br />
von der es mit Biogas beliefert wird, wenn<br />
die Vor-Ort-Anlage selber vor dem 1. Januar<br />
2012 in Betrieb genommenen wurde. Denn<br />
Paragraf 19 Absatz 1 Satz 2 EEG 2012<br />
(Zusammenfassung von Biogasanlagen,<br />
die über denselben Fermenter miteinander<br />
verbunden sind) gilt zwar nur für die Vergütung<br />
von Neuanlagen im Sinne des EEG<br />
2012; die Vergütung dieser Neuanlagen<br />
soll aber unter Berücksichtigung auch der<br />
verbundenden Bestandsanlagen ermittelt<br />
werden.<br />
Autoren<br />
Elena Richter und Dr. Martin Winkler<br />
Mitglieder der Clearingstelle EEG<br />
Charlottenstr. 65 · 10117 Berlin<br />
Tel. 030/206 14 16-0<br />
E-Mail: post@clearingstelle-eeg.de<br />
100
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Recht<br />
Wenn der Direktvermarkter pleite ist ...<br />
Die meisten Biogasanlagenbetreiber dürften mittlerweile ihren Strom direkt vermarkten, regelmäßig im<br />
sogenannten Marktprämienmodell. Damit erhalten sie einen Teil ihrer Vergütung nicht mehr vom Netzbetreiber,<br />
an dessen Solvenz regelmäßig kein Zweifel bestehen dürfte, sondern von einem frei gewählten Vertragspartner.<br />
Wie ein aktueller Beispielfall zeigt, kann dieser – aus welchen Gründen auch immer – in finanzielle<br />
Schieflage geraten und seinen Zahlungspflichten eventuell nicht mehr nachkommen. Worauf es dann<br />
ankommt, soll dieser aktuelle Praxisbericht zeigen.<br />
Von Dr. Helmut Loibl<br />
Der zentrale Punkt jedes Direktvermarktungsvertrages<br />
soll und<br />
muss die Absicherung des Anlagenbetreibers<br />
sein. Insoweit<br />
ist zwischen zwei Arten von<br />
Direktvermarktern zu unterscheiden: denjenigen,<br />
die eine Solvenz aufweisen, die<br />
durchaus mit so mancher Großbank vergleichbar<br />
ist, und allen anderen. Wenn der<br />
Vertragspartner selbst keinerlei Zweifel an<br />
seiner Bonität und Zahlungsfähigkeit verbleiben<br />
lässt, kann im Einzelfall durchaus<br />
auf eine zusätzliche Absicherung verzichtet<br />
werden. Hier sollte allerdings auf eine kurzfristige<br />
Kündbarkeit des Vertrages geachtet<br />
werden, falls sich diese Einschätzung ändern<br />
sollte.<br />
Bei allen anderen Vertragspartnern ist aus<br />
meiner Sicht – und das zeigt auch die Praxiserfahrung<br />
– eine ausreichende Sicherheit<br />
unabdingbar. Diese sollte unbedingt von einem<br />
Kreditinstitut oder einer Versicherung<br />
mit Sitz in Deutschland stammen. Nicht<br />
etwa, dass ausländische Banken weniger<br />
vertrauenswürdig wären, es geht schlicht<br />
und einfach um die Kommunikation und<br />
um die nachweisbare Zustellung von Zahlungsaufforderungen,<br />
die im Ausland deutlich<br />
schwieriger sind. Weiterhin muss die<br />
Sicherheit ohne jede Einschränkung erfolgen,<br />
also unwiderruflich, selbstschuldnerisch,<br />
auf erstes Anfordern usw. Hier ist<br />
auf die juristisch korrekte Formulierung zu<br />
achten.<br />
Ganz entscheidend ist zudem, wann die<br />
Sicherheit vorliegen muss: Regelmäßig<br />
möchten Direktvermarkter diese erst nach<br />
Vermarktungsstart beibringen. Das ist viel<br />
zu spät: Meines Erachtens muss die Sicherheit<br />
bereits vorliegen, bevor der Direktvermarkter<br />
die Anlage in seinen Bilanzkreis<br />
ummeldet, ansonsten stehen regelmäßig<br />
mindestens ein bis zwei Monate an Zahlung<br />
„im Feuer“. Was die Praxis zudem zeigt: Es<br />
kommt nicht nur darauf an, ob eine Sicherheit<br />
vereinbart ist, sondern und vor allem<br />
darauf, ob der Anlagenbetreiber diese erhalten<br />
hat. Gerade bei sich verlängernden<br />
Verträgen wird leider nicht selten übersehen,<br />
dass die Sicherheit schon lange ausgelaufen<br />
ist. Hier steht jeder Anlagenbetreiber<br />
selbst in der Pflicht, sich darum im<br />
ureigensten Interesse zu kümmern, denn:<br />
Ist keine Sicherheit da, geht der Anspruch<br />
ins Leere, wenn der Direktvermarkter insolvent<br />
ist. Dass eine vertragliche Pflicht<br />
zur Vorlage einer Sicherheit vorliegt, spielt<br />
dann keine Rolle.<br />
A.A.T. Agrarservice, Transport und Handel GmbH<br />
Steintor 2a<br />
19243 Wittenburg<br />
A.A.T. .....GmbH Steintor 2a 19243 Wittenburg<br />
Frau<br />
«Name_Zeile_1»<br />
Bürgschaft: auf die besten drei<br />
Monate abstellen<br />
Ein weiterer entscheidender Punkt ist die<br />
Höhe der Bürgschaft: Diese muss – wie<br />
die Praxiserfahrungen zeigen – mindestens<br />
drei volle Monate desjenigen Betrages<br />
abdecken, den der Anlagenbetreiber von<br />
seinem Direktvermarkter zu erhalten hat.<br />
Wichtig hierbei: Stellen Sie auf die drei<br />
besten, nicht auf drei durchschnittliche<br />
Monate ab. Und bedenken Sie: Die Stromvergütung<br />
ist eine Netto-Vergütung, auf die<br />
die Umsatzsteuer hinzuzurechnen ist. Insoweit<br />
sollte im Einzelfall kritisch geprüft<br />
werden, ob die Sicherheit rein netto oder<br />
brutto inklusive Umsatzsteuer festgelegt<br />
werden sollte, insoweit sollte gegebenenfalls<br />
Rücksprache mit dem Steuerberater<br />
gehalten werden.<br />
Die drei Monate reichen aber – auch das<br />
zeigt die Praxis – nur aus, wenn die Zahlungsfristen<br />
im Vertrag entsprechend klar<br />
und eindeutig geregelt sind. Ein konkretes<br />
Beispiel: Im Oktober 2017 wurde Strom<br />
geliefert, laut Vertrag ist der Betrag hierfür<br />
bis 25. des Folgemonats fällig. Der Direktvermarkter<br />
hat also bis 25. November<br />
2017, 24.00 Uhr Zeit, die Forderung zu<br />
begleichen. Also kann der Anlagenbetreiber<br />
erst am 26. November, wenn kein Geld<br />
da ist, die nötige Nachfrist setzen. Hier ist<br />
im Vertrag darauf zu achten, dass diese so<br />
bestimmt ist, dass noch im gleichen Kalendermonat<br />
eine Kündigung möglich ist.<br />
Regelmäßig lassen sich hier die Direktvermarkter<br />
auf eine Nachfrist von drei Bankarbeitstagen<br />
ein. Im Beispielfall fällt allerdings<br />
der 25. November 2017 auf einen<br />
Samstag, sodass der Direktvermarkter bis<br />
zum Montag, den 27. November um 24.00<br />
Maissilage<br />
sicher handeln<br />
Geschäftsführer: Christian Scharnweber<br />
Handelsregister Schwerin HRB 3377<br />
GMP + - B2 und GMP + - B4.1<br />
UST-Id-Nr.: DE 162151753<br />
Commerzbank AG, Schwerin<br />
Kreissparkasse Ludwigslust<br />
Raiffeisenbank Mölln e.G.<br />
038852 - 6040<br />
Christian 038852 Scharnweber - 6040<br />
www.aat24.de<br />
Telefon: 038852 – 604 0<br />
Telefax: 038852 – 604 30<br />
E-mail: mail@aat24.de<br />
URL: www.aat24.de<br />
101
Recht<br />
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Uhr Zeit hat, zu zahlen. Die Nachfrist kann also erst<br />
am 28. November gesetzt werden bis zum 1. Dezember<br />
2017. Wer dann ins EEG zurückmelden will, kann<br />
dies – da jetzt schon Dezember ist – nicht mehr zum 1.<br />
Januar <strong>2018</strong>, sondern erst zum 1. Februar.<br />
Hintergrund: In die EEG-Festpreisvergütung kann nur<br />
zu Beginn des übernächsten Monats gewechselt werden.<br />
Folge im Beispielfall: Die drei Monate Sicherheit<br />
reichen also nicht aus. Entweder, Anlagenbetreiber vereinbaren<br />
in einem solchen Fall also vier Monate Bürgschaft,<br />
was eher praxisfern ist. Oder man vereinbart als<br />
Zahltag einen deutlich früheren Termin, also den 21.<br />
oder 22. des Folgemonats, dann ist sichergestellt, dass<br />
die drei Monate Sicherheit auch in jedem Einzelfall<br />
ausreichend sind.<br />
Ausfallvergütung: biogasspezifisch regeln<br />
Häufig argumentieren Direktvermarkter damit, dass die<br />
drei Monate gar nicht mehr nötig wären, weil sich die Gesetzeslage<br />
geändert habe: Zum einen wäre es möglich,<br />
mit der Frist von fünf Werktagen zum Monatswechsel<br />
in die sogenannte Ausfallvergütung zu wechseln. Das<br />
sind 80 Prozent der jeweiligen EEG-Vergütung. Diese<br />
Aussage ist zwar zutreffend und in anderen Sparten wie<br />
Windenergie interessant, aber nicht im Biogasbereich,<br />
wie folgendes Beispiel zeigt: Eine Biogasanlage erhält<br />
im Schnitt 22,3 Cent pro Kilowattstunde (ct/kWh), der<br />
aktuelle Marktpreis liegt bei 4 ct/kWh. Damit erhält der<br />
Anlagenbetreiber vom Netzbetreiber eine Marktprämie<br />
in Höhe von 18,3 ct/kWh, die 4 ct/kWh Marktwert sollten<br />
vom Direktvermarkter kommen, der ausfällt.<br />
Bei diesem Beispiel wäre ein Wechsel in die 80-Prozent-Ausfallvergütung<br />
geradezu grotesk: Der Betreiber<br />
würde dann 80 Prozent von 22,3 ct/kWh bekommen,<br />
also 17,84 ct/kWh. Bleibt er beim Direktvermarkter,<br />
erhält er schon 18,3 ct/kWh, also deutlich mehr vom<br />
Netzbetreiber als Marktprämie. Diese Variante der Ausfallvergütung<br />
ist für Biogasanlagen daher regelmäßig<br />
der falsche Weg.<br />
Zum anderen wird argumentiert, dass nach dem aktuellen<br />
EEG „jederzeit“ der Direktvermarkter ausgetauscht<br />
werden kann. Das ist zutreffend, allerdings heißt das<br />
nicht, dass von heute auf morgen das Entgelt gesichert<br />
werden kann. In der Praxis stellen sich hier gleich zwei<br />
Probleme:<br />
1. Die Anlage muss durchgängig fernsteuerbar sein<br />
für den Direktvermarkter, ansonsten entfällt der Anspruch<br />
auf die Marktprämie (die, wie gezeigt wurde,<br />
der erhebliche Teil der Vergütung ist!). Die Direktvermarkter<br />
haben aber denkbar unterschiedliche Steuerboxen,<br />
erfahrungsgemäß kann es<br />
auch einige Zeit dauern, bis diese<br />
funktionsfähig eingebaut sind. Ein<br />
Wechsel von heute auf morgen ist<br />
also in vielen Fällen schon aus diesem<br />
technischen Grund nicht immer<br />
möglich.<br />
2. Die Anlage muss in den Marktprämien-Bilanzkreis<br />
des neuen<br />
Direktvermarkters wechseln, ansonsten<br />
laufen die kWh in den<br />
Bilanzkreis des insolventen Direktvermarkters<br />
und werden weiter<br />
nicht vergütet. Der Wechsel des<br />
Bilanzkreises geht allerdings auch<br />
nicht von heute auf morgen, nach<br />
einer Vorgabe der BNetzA hat dieser<br />
zum 10. auf die Meldung folgenden<br />
Werktag zu erfolgen. Ein<br />
Beispiel: Wer also beispielsweise<br />
am 30. November 2017 den Direktvermarkter<br />
gewechselt hat und die Ummeldung<br />
noch am gleichen Tag veranlasst hat, konnte faktisch<br />
erst zum 14. Dezember 2017 in den neuen Bilanzkreis<br />
wechseln, erst ab diesem Tag kann also der neue Direktvermarkter<br />
über den Strom verfügen und wird hierfür<br />
auch erst ab diesem Zeitpunkt zahlen.<br />
Foto: www.landpixel.de<br />
Alle Optionen offenhalten<br />
Letztlich sollte jeder Anlagenbetreiber im Falle der Insolvenz<br />
des Direktvermarkters alle Möglichkeiten offen<br />
haben, zu reagieren: Er soll sowohl den Direktvermarkter<br />
wechseln als auch die Ausfallvergütung wählen oder<br />
aber in die EEG-Festpreisvergütung zurückkehren können.<br />
Daher ist die längste Wechselfrist entscheidend,<br />
also die zurück zur Festpreisvergütung, die nur zu Beginn<br />
des übernächsten Monats erfolgen kann. Bleibt<br />
also im November die Zahlung für Oktober aus, muss<br />
der Vertrag so gestaltet sein, dass die Nachfristsetzung<br />
und Kündigung noch im November möglich ist, sodass<br />
dann mit Wirkung ab Januar in die EEG-Festpreisvergütung<br />
zurückgekehrt werden kann. Damit stehen die<br />
102
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Recht<br />
Zahlungen für Oktober, November und Dezember im<br />
Feuer, diese drei Monate sind also auch komplett abzusichern.<br />
Jeder Anlagenbetreiber muss im Fall des Falles aber<br />
gut bedenken, wie er dann „richtig“ reagiert. Insbesondere<br />
alle Betreiber, die die Flexibilitätsprämie geltend<br />
machen, sollten keinesfalls in die 80-Prozent-Ausgleichsvergütung<br />
oder in die EEG-Festpreisvergütung<br />
zurückkehren. Hier besteht die erhebliche Gefahr, dass<br />
damit endgültig der Anspruch auf die Flexibilitätsprämie<br />
entfällt. Das ergibt sich zwar so nicht aus dem<br />
Gesetz, allerdings deutet dies die Gesetzesbegründung<br />
an. Hier sollte kein Risiko eingegangen werden. Wer<br />
also die Flexprämie weiterhin sicher erhalten möchte,<br />
der sollte stets und durchgängig in der Direktvermarktung<br />
bleiben und gegebenenfalls einen neuen Direktvermarkter<br />
suchen.<br />
Fazit: Zusammenfassend ist also festzuhalten: Die<br />
Insolvenz eines Direktvermarkters ist für einen Anlagenbetreiber<br />
wenig dramatisch, wenn er über eine<br />
ausreichende Sicherheit verfügt. Hier können viele<br />
Fehler gemacht werden, angefangen vom Nichteinholen<br />
der vertraglich vereinbarten Sicherheit bis hin zu<br />
unzureichenden Absicherungssummen. Auch bei der<br />
Vertragsgestaltung ist Vorsicht geboten, etwa wenn die<br />
zu setzenden Nachfristen im Falle der Nichtzahlung<br />
zu lange oder die vereinbarten Zahlungszeitpunkte zu<br />
spät festgelegt sind.<br />
Im Ergebnis können zwei dringende Empfehlungen<br />
abgegeben werden: 1. Lassen Sie Ihre Direktvermarktungsverträge<br />
von Fachleuten prüfen. Die hier entstehenden<br />
Kosten sind ein winziger Bruchteil bezogen<br />
auf den Schaden, der ohne eine solche Prüfung entstehen<br />
kann. Und 2. Lassen Sie sich Ihre Sicherheit<br />
nicht mit „Lockangeboten“ von Direktvermarktern<br />
abkaufen oder unter die wirklich benötigte Summe<br />
herunterhandeln. Eine Sicherheit sollte ihren Namen<br />
verdienen und Ihnen im Fall des Falles auch wirkliche<br />
Sicherheit geben.<br />
Autor<br />
Dr. Helmut Loibl<br />
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht<br />
Sprecher des juristischen Beirates/Fachverband Biogas<br />
Kanzlei Paluka Sobola Loibl & Partner<br />
Prinz-Ludwig-Str. 11<br />
93055 Regensburg<br />
Tel. 09 41/585 71-0<br />
E-Mail: loibl@paluka.de<br />
www.paluka.de<br />
Rotoren und Statoren<br />
für Excenterschneckenpumpen aller Hersteller.<br />
In Deutschland gefertigt im Originalmaß und aus<br />
demselben Material<br />
25% bis 40% billiger<br />
Alle Angebote unter www.ilmaco-vertrieb.de<br />
ILMACO Vertrieb oHG mb@ilmaco.de<br />
Fischerstr. 13 · 84137 Vilsbiburg · (0176) 476 494 69<br />
Komponenten für Biogasanlagen<br />
Tragluftfolienabdeckungen • gasdichte Rührwerksverstellungen<br />
Xylem Rührwerks- und Pumpentechnik • Schaugläser<br />
Wartungs- und Kontrollgänge • Über/Unterdrucksicherungen<br />
Emissionsschutzabdeckung, etc.<br />
Industriestraße 10 • 32825 Blomberg • info@nesemeier-gmbh.de<br />
Tel.: 05235/50287-0 • Fax 05235/50287-29<br />
Rechtsanwälte und Notare<br />
Seit vielen Jahren beraten und vertreten wir vornehmlich<br />
Betreiber und Planer kompetent und umfassend im<br />
- Recht der Erneuerbaren<br />
- Energien<br />
- Vertragsrecht<br />
- Gewährleistungsrecht<br />
- Energiewirtschaftsrecht<br />
- Umweltrecht<br />
- Immissionsschutzrecht<br />
- öffentlichen Baurecht<br />
- Planungsrecht<br />
Ihre Ansprechpartner:<br />
RAuN Franz-Josef Tigges*<br />
RAuN Andreas Schäfermeier**<br />
RA W. Andreas Lahme*<br />
RA Dr. Oliver Frank*<br />
RA‘in Martina Beese<br />
RA Dr. Mathias Schäferhoff<br />
RA Daniel Birkhölzer*<br />
RA‘in Katharina Vieweg-Puschmann LL.M.<br />
* Fachanwalt für Verwaltungsrecht<br />
** Fachanwalt für Insolvenzrecht<br />
Kastanienweg 9, D-59555 Lippstadt<br />
Tel.: 02941/97000 Fax: 02941/970050<br />
kanzlei@engemann-und-partner.de<br />
www.engemann-und-partner.de<br />
103
Produktnews<br />
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Neues Spannsystem für Silageabdeckung<br />
Zum einen sind die richtige Ausführung<br />
und die Art der Abdeckung entscheidende<br />
Faktoren für die spätere Qualität des<br />
eingelagerten Raufutters. Zum anderen<br />
sind die Abdeckung von Silage und das<br />
anschließende Entnehmen des Futters<br />
Foto: HUESKER Synthetic GmbH<br />
Mit der neuartigen<br />
Silageabdeckung ist ein<br />
vollflächiger Abschluss,<br />
insbesondere auch an<br />
den Rändern, möglich.<br />
arbeitsintensive Vorgänge. Mit dem neuen<br />
Agritec ® Silage Safe bietet HUESKER<br />
nun eine Systemlösung für eine schnelle<br />
und effiziente Abdeckung. Direkt vor der<br />
Einlagerung kann das Spannsystem montiert<br />
und die Silage somit luftdicht, insbesondere<br />
an den<br />
Rändern, verschlossen<br />
werden. Futterverluste<br />
werden<br />
dadurch deutlich reduziert.<br />
Ein Silieren<br />
in mehreren Schichten<br />
ist möglich. Ohne große Anstrengung<br />
kann die Silage schnell und einfach geöffnet<br />
werden.<br />
Außerdem werden keine Sandsäcke oder<br />
Reifen, wie sonst üblich, zur Beschwerung<br />
benötigt. Ein integrierter Betonschutz der<br />
Fahrsilowände wird durch eine bauseitige<br />
Silofolie gewährleistet. Regenwasser kann<br />
seitlich ablaufen und wird durch perforierte<br />
PVC-Drainagerohre abgeleitet. Weitere Vorteile<br />
sind eine zu erwartende Lebensdauer<br />
von mindestens 10 Jahren sowie der niedrige<br />
Anschaffungspreis.<br />
Infos unter: HUESKER Synthetic GmbH<br />
Marketing Industrie & Agrar, Im Brömken 5<br />
48249 Dülmen, Tel. 0 25 94/89 27-824<br />
E-Mail: thesing@HUESKER.de, www.HUESKER.de<br />
Neues Enzymprodukt<br />
JBS bringt eine neue Komposition ausgewählter<br />
und hochaktiver Enzyme auf<br />
den Markt, die in nahezu allen Substratmischungen<br />
die Gasausbeute erhöht. Ein<br />
einzigartiger Wirkmechanismus ermöglicht<br />
auch bei vermeintlich guter Abbaurate eine<br />
enorme Wirkung auf die Faseraufspaltung<br />
und Viskosität. Testmengen für Neukunden<br />
stehen seit Dezember zur Verfügung und<br />
können risikolos mit einer Geld-zurück-<br />
Garantie getestet werden.<br />
Infos unter: joachim behrens scheessel gmbh<br />
Celler Str. 60, 27374 Visselhövede<br />
Jan Nottorf, Tel. 0 42 62/20 74-445<br />
E-Mail: jan.nottorf@jbs.gmbh.<br />
Foto: joachim behrens scheessel gmbh<br />
Neu entwickelter Rührflügel<br />
Die Wirtschaftlichkeit von Biogasanlagen<br />
hängt maßgeblich von deren Leistungsfähigkeit<br />
ab, die durch nötige Wartungen<br />
und Ersatzteile sichergestellt wird. Der<br />
Qualität der zu ersetzenden Komponenten<br />
hat sich nun die NewTec Energy Solutions<br />
GmbH angenommen und ihr Serviceprogramm<br />
entsprechend erweitert. Die Experten<br />
des spezialisierten Unternehmens<br />
haben einen Rührflügel aus Polyamid für<br />
hydraulische Tauchrührwerke entwickelt,<br />
der auch härtesten Einsatzbedingungen<br />
langlebig standhält und den Anlagenertrag<br />
maximiert.<br />
Nur Einsatz und Verarbeitung innovativer<br />
Materialien können die Lebensdauer der<br />
Rührflügel aus Polyamid für<br />
hydraulische Tauchrührwerke.<br />
Bestandteile einer Biogasanlage deutlich<br />
verlängern. Eine Anlage kann auf Dauer<br />
nur dann wirtschaftlich betrieben werden,<br />
wenn auch elementare Bestandteile, wie<br />
Foto: NewTec Energy Solutions GmbH<br />
etwa die Rührflügel, langlebig und zuverlässig<br />
arbeiten. Das beständige Material<br />
mit seiner effizienten Flügelstellung sorgt<br />
für eine bessere Durchmischung des Substrates<br />
und die Minimierung der unliebsamen<br />
Schwimmdeckenbildung. So entstehen<br />
geringere Futtermengen bei gleicher<br />
Gasbildung, was die Effizienz der Anlage<br />
auch im laufenden Betrieb erhöht und den<br />
Ertrag steigert.<br />
Infos unter: NewTec Energy Solutions GmbH<br />
Schulstr. 52, 44534 Lünen<br />
Tel. 0 23 06/7 64 88-22<br />
E-Mail: info@newtec-biogas.com<br />
www.newtec-biogas.com<br />
104
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Produktnews<br />
bewährte<br />
Produkte !<br />
Abgaskatalysatoren<br />
Für jedes in Deutschland zugelassene BHKW.<br />
Hohe Lebensdauer durch hervorragende Schwefelresistenz<br />
mit über 30 mg /mm 2 (andere oft nur 25<br />
mg). In Deutschland gefertigt.<br />
Zu sehr günstigen Preisen (netto plus Fracht)<br />
z.B. für MWM TCG 2016 V12: nur 2.950 €<br />
Alle Angebote unter www.ilmaco-vertrieb.de<br />
ILMACO Vertrieb oHG mb@ilmaco.de<br />
Fischerstr. 13 · 84137 Vilsbiburg · (0176) 476 494 69<br />
Schwingungsmessungen<br />
am Biogasmotor<br />
und<br />
Lärmgutachten für die<br />
Gesamtanlage<br />
bundesweiter Einsatz<br />
Ingenieurbüro Braase<br />
040 64917028<br />
www.Braase.de<br />
THERM<br />
Abgaswärmetauscher<br />
Dampferzeuger<br />
Gaskühler / Gaserwärmer<br />
Sonderanwendungen<br />
Zusatzkomponenten<br />
Energiepark 26/28 91732 Merkendorf<br />
+49 9826-65 889-0 info@enkotherm.de<br />
www.enkotherm.de<br />
www.michael-kraaz.de<br />
M I K - Service<br />
Günstig & Bewährt –<br />
einfache Technik<br />
Tragluftdächer<br />
Silodächer<br />
Feststoffdosierer<br />
Schubbodensanierung<br />
in verstärkter<br />
Edelstahl-Lösung<br />
Schubboden-<br />
Trockner<br />
Konzentrator /<br />
Gärresttrockner<br />
Mobile Werkstatt Hagemeier e.K.<br />
Am Wasserfeld 8 • 27389 Fintel<br />
N E U / oder Ersatzteile<br />
Reparatur gängiger Typen<br />
Siebkörbe<br />
Separatoren<br />
mobil/stationär<br />
Tel. 051 32 / 588 663<br />
Tel.: 04265 / 13 65<br />
Fax: 04265 / 83 94<br />
E-Mail: info@axel-hagemeier.de<br />
Web: www.axel-hagemeier.de<br />
Tel. 04441-921477<br />
49377 Vechta<br />
Fax 921478 / www.mik-service.de<br />
105
IMPRESSUM<br />
Biogas Journal | 1_<strong>2018</strong><br />
Made in Germany<br />
Qualität setzt sich durch – seit 1887<br />
• Tauchmotorrührwerke GTWSB<br />
mit/ohne Ex-Schutz<br />
• Tauchmotorpumpen AT<br />
• Drehkolbenpumpen DK<br />
• Vertikalpumpen VM/VG<br />
• Über-/Unterdrucksicherung<br />
Franz Eisele u. Söhne GmbH u. Co. KG • Hauptstraße 2–4 • 72488 Sigmaringen<br />
Telefon: +49 (0)7571 / 109-0 • E-Mail:info@eisele.de • www.eisele.de<br />
EIS-ME-M-17009_AZ_Motiv-B_85x56.5_RZ.indd 1 31.01.17 18:38<br />
B<br />
IMPRESSUM<br />
Herausgeber:<br />
Fachverband Biogas e. V.<br />
Dr. Claudius da Costa Gomez (V.i.S.d.P.)<br />
Andrea Horbelt (redaktionelle Mitarbeit)<br />
Angerbrunnenstraße 12 · 85356 Freising<br />
Tel. 0 81 61/98 46 60<br />
Fax: 0 81 61/98 46 70<br />
E-Mail: info@biogas.org<br />
Internet: www.biogas.org<br />
ISSN 1619-8913<br />
Redaktion:<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Fachverband Biogas e. V.<br />
Tel. 0 54 09/9 06 94 26<br />
E-Mail: martin.bensmann@biogas.org<br />
Anzeigenverwaltung & Layout:<br />
bigbenreklamebureau GmbH<br />
An der Surheide 29 · 28870 Ottersberg-Fischerhude<br />
Tel. 0 42 93/890 89-0<br />
Fax: 0 42 93/890 89-29<br />
E-Mail: info@bb-rb.de<br />
Internet: www.bb-rb.de<br />
Druck: Druckhaus Fromm, Osnabrück<br />
Das BIOGAS Journal erscheint sechsmal im Jahr auf Deutsch.<br />
Zusätzlich erscheinen zwei Ausgaben in englischer Sprache.<br />
Aktivkohle (0176) 476 494 69<br />
Für alle in Deutschland zugelassenen Kohlefilter<br />
TOP-Aktivkohle mit 2,0% Kaliumjodid<br />
Aktivkohle-Filter befüllen oder durch uns befüllen<br />
lassen (kostet extra) und dabei deutlich sparen.<br />
Angebot: BigBag mit 0,5 to für nur<br />
1.499,00 € netto frei BGA in Deutschland<br />
Fordern Sie Ihr konkretes Angebot an unter<br />
www.ilmaco-vertrieb.de<br />
ILMACO Vertrieb oHG mb@ilmaco.de<br />
Fischerstr. 13 · 84137 Vilsbiburg · (0176) 476 494 69<br />
Die Zeitschrift sowie alle in ihr enthaltenen Beiträge sind urheberrechtlich<br />
geschützt. Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die<br />
Meinung des Verfassers wieder, die nicht unbedingt mit der Position<br />
des Fachverbandes Biogas e.V. übereinstimmen muss. Nachdruck,<br />
Aufnahme in Datenbanken, Onlinedienste und Internet, Vervielfältigungen<br />
auf Datenträgern wie CD-Rom nur nach vorheriger schriftlicher<br />
Zustimmung. Bei Einsendungen an die Redaktion wird das<br />
Einverständnis zur vollen oder auszugsweisen Veröffentlichung<br />
vorausgesetzt. Für unverlangt eingehende Einsendungen wird keine<br />
Haftung übernommen. Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe<br />
sinnerhaltend zu kürzen.<br />
106
Modulare<br />
Dosiertechnik<br />
03/2011<br />
2011<br />
06/2010<br />
Silagemanagement<br />
10/2011<br />
2012<br />
Hydrozym<br />
03/2012<br />
LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTE AUS EINER HAND<br />
2013<br />
Hydrozym Redux<br />
01/2013<br />
TRGS-Konformität<br />
02/2014<br />
Individuelle<br />
Spurenelemente<br />
02/2014<br />
2014<br />
2015<br />
Umzug in<br />
Bürokomplex<br />
Lengenbostel<br />
03/2014<br />
Hydrozym GPS<br />
08/2014<br />
Dosierschränke<br />
04/2015<br />
A1-Analytik-Labor<br />
08/2015<br />
Bakterien<br />
Fermator<br />
03/2016<br />
2016<br />
Bakterien<br />
Bodenvitalität<br />
05/2015<br />
Technisches<br />
BGA-Controlling<br />
02/2016<br />
+59,8 dt/ha<br />
+7,4 Stärke in dt/ha<br />
2017<br />
SaM-Agrar<br />
09/2017<br />
<strong>2018</strong><br />
Hydrozym DP<br />
06/2017<br />
Biogas-Technik<br />
10/2017<br />
Aktuelle Angebotsartikel.<br />
Damit Technik funktioniert. LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTE AUS EINER HAND<br />
LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTE AUS EINER HAND<br />
Zündkerze<br />
Denso GE3-5 # 6103<br />
MANN Ölfilter HU947/2x<br />
Passend für viele<br />
MAN- und Hagl-Motoren<br />
Wird gerne genommen<br />
und häufig angefragt!<br />
MANN Ölfilter H12110/2x<br />
Passend für viele<br />
MTU-Motoren<br />
MANN Luftfilter C24650/1x<br />
Passend für viele<br />
MAN- und Hagl-Motoren<br />
Beru 14GZ-LL-2<br />
Passend für viele<br />
MAN-Motoren<br />
Zündspule Motortech blau<br />
06.50.055 M14<br />
Standard für viele<br />
MAN-Motoren<br />
SaM-Power GmbH<br />
Stand: 10/2017<br />
Schmiedestraße 9 · 27419 Sittensen - Lengenbostel<br />
Fon: (0 42 82) 6 34 99 - 10 · Fax: (0 42 82) 6 34 99 - 19<br />
Mail: info@sam-power.de · www.sam-power.de<br />
SaM-Power GmbH<br />
Schmiedestraße 9 · 27419 Sittensen - Lengenbostel<br />
Fon: (0 42 82) 6 34 99 - 10 · Fax: (0 42 82) 6 34 99 - 19<br />
Mail: info@sam-power.de · www.sam-power.de<br />
107
FORMALDEHYD<br />
EMISSIONSMINDERUNGSBONUS<br />
FÜR ALLE MAN-MOTOREN!<br />
2 0 m g / N m ³<br />
Flansch<br />
DN100 PN6/10<br />
Flanschabstand 300 mm<br />
Strömungsverteiler<br />
zur sicheren<br />
Anströmung<br />
Vergrößerte<br />
Oberfläche<br />
Robustere<br />
Matrix<br />
Aktivere<br />
Beschichtung<br />
passend für:<br />
• HAGL<br />
• DREYER & BOSSE<br />
• SEVA<br />
• AVS<br />
Jetzt online bestellen und 20 Euro sparen!<br />
Gutscheincode: FORMALDEHYD<br />
WWW.EMISSION-PARTS.DE/UNIKAT<br />
Sofort lieferbar!<br />
1 Stück: 1295€<br />
ab 4 Stück: 1195€<br />
HABEN SIE FRAGEN?<br />
UNSERE EXPERTEN BERATEN SIE GERNE!<br />
Emission Partner GmbH & Co. KG<br />
Industriestraße 5<br />
26683 Saterland-Ramsloh<br />
Vertrieb<br />
Geschäftsbreich Biogas<br />
+49 4498 92 326 26<br />
shop@emission-parts.de<br />
Wir verstehen Biogas!