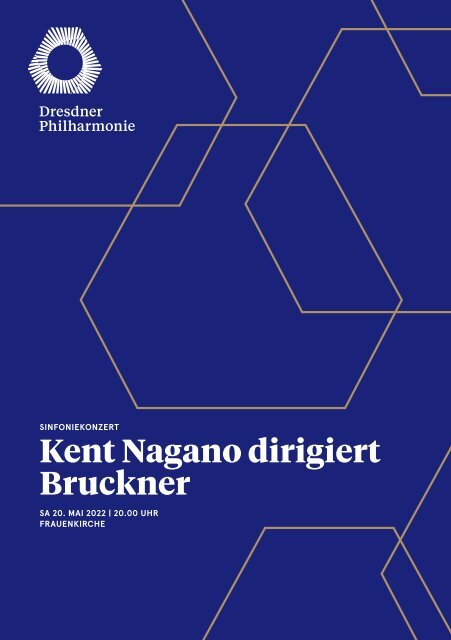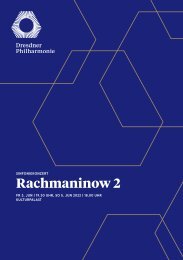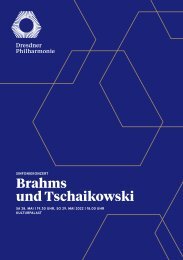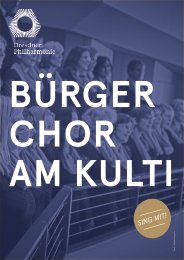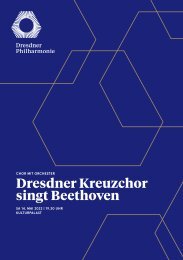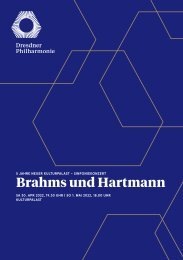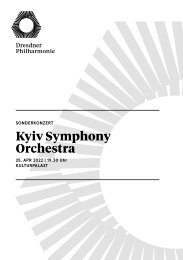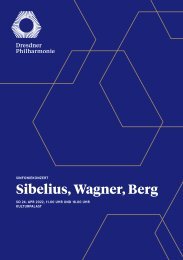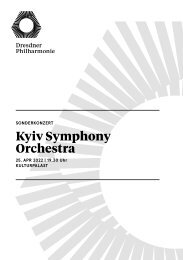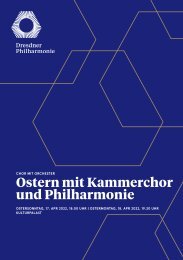2022_05_20_Kent_Nagano
Toshio Hosokawa Intermezzo aus der Oper „Stilles Meer“ (2016) Charles Ives „The Unanswered Question“ (1906/1935) Anton Bruckner Sinfonie Nr. 6 A-Dur (1879-1881) Kent Nagano | Dirigent Dresdner Philharmonie
Toshio Hosokawa
Intermezzo aus der Oper „Stilles Meer“ (2016)
Charles Ives
„The Unanswered Question“ (1906/1935)
Anton Bruckner
Sinfonie Nr. 6 A-Dur (1879-1881)
Kent Nagano | Dirigent
Dresdner Philharmonie
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
SINFONIEKONZERT<br />
<strong>Kent</strong> <strong>Nagano</strong> dirigiert<br />
Bruckner<br />
SA <strong>20</strong>. MAI <strong><strong>20</strong>22</strong> | <strong>20</strong>.00 UHR<br />
FRAUENKIRCHE
30. SEP BIS 15. OKT <strong><strong>20</strong>22</strong><br />
KULTURPALAST DRESDEN<br />
Richard Wagner<br />
Der Ring<br />
des Nibelungen<br />
Konzertante Aufführungen<br />
FR 30. SEP <strong><strong>20</strong>22</strong> Das Rheingold<br />
SO 2. OKT <strong><strong>20</strong>22</strong> Die Walküre<br />
SA 8. OKT <strong><strong>20</strong>22</strong> Siegfried<br />
SA 15. OKT <strong><strong>20</strong>22</strong> Götterdämmerung<br />
MAREK JANOWSKI | Dirigent<br />
DRESDNER PHILHARMONIE<br />
ticket@dresdnerphilharmonie.de | dresdnerphilharmonie.de
PROGRAMM<br />
Toshio Hosokawa (* 1955)<br />
Intermezzo aus der Oper »Stilles Meer« (<strong>20</strong>16)<br />
für vier Schlagzeuger<br />
Charles Ives (1874 – 1954)<br />
»The Unanswered Question« (1906/1935)<br />
für Trompete, zwei Flöten, Oboe, Klarinette und Streicher<br />
Adagio<br />
Anton Bruckner (1824 – 1896)<br />
Sinfonie Nr. 6 A-Dur WAB 106 (1879-1881)<br />
Majestoso<br />
Adagio. Sehr feierlich<br />
Scherzo. Nicht schnell – Trio. Langsam<br />
Finale: Bewegt, doch nicht zu schnell<br />
<strong>Kent</strong> <strong>Nagano</strong> | Dirigent<br />
Dresdner Philharmonie<br />
Im Rahmen der Dresdner Musikfestspiele
JÜRGEN OSTMANN<br />
In Kürze<br />
Klang als Mittel, mit übernatürlichen<br />
Kräften in Verbindung zu treten, religiöse<br />
Inhalte zu vermitteln, einen gemeinsamen<br />
Glauben zu festigen – solche<br />
Vorstellungen verbanden sich zu allen<br />
Zeiten und in allen Kulturen mit Musik.<br />
Sie bestimmen auch, wenngleich in ganz<br />
unterschiedlicher Weise, die drei Werke<br />
unseres Konzerts.<br />
Der US-Amerikaner Charles Ives war ein<br />
Nonkonformist, und das sowohl als Musiker<br />
wie auch in seiner Einstellung zur Religion.<br />
In seinem um 1906 entstandenen<br />
Werk »The Unanswered Question« bezog<br />
er sich auf Ideen »transzendentalistischer«<br />
Denker wie Ralph Waldo Emerson<br />
(1803-1882) oder Henry David Thoreau<br />
(1817-1862). Drei Klangschichten lassen<br />
sich unterscheiden: Die Streicher verkörperten<br />
»das Schweigen der Druiden,<br />
die nichts wissen, sehen und hören«, eine<br />
Trompete stellt »die ewige Frage nach der<br />
Existenz«, und ein Flötenquartett sucht<br />
nach »der unsichtbaren Antwort«.<br />
Toshio Hosokawa absolvierte sein Kompositionsstudium<br />
in Deutschland, ließ<br />
sich aber auch durch die Musik, Ästhetik<br />
und Spiritualität seiner japanischen Hei-<br />
mat beeinflussen. Seine vierte Oper »Stilles<br />
Meer« (<strong>20</strong>16) versteht er als Requiem<br />
für die Opfer des Tohoku-Erdbebens und<br />
der Reaktorkatastrophe von Fukushima<br />
im Jahr <strong>20</strong>11. Das Libretto verbindet ein<br />
jahrhundertealtes Stück des No-Theaters<br />
mit der Geschichte einer Frau, die durch<br />
den Tsunami Ehemann und Sohn verliert.<br />
Einer Schamanin gleich, nimmt sie<br />
singend Kontakt mit den Verstorbenen<br />
auf. Angeregt durch <strong>Kent</strong> <strong>Nagano</strong>, der die<br />
Hamburger Uraufführung der Oper leitete,<br />
schrieb Hosokowa ein instrumentales<br />
Intermezzo, dessen Schlagzeugklänge an<br />
japanische Taiko-Trommeln erinnern.<br />
Der tief gläubige Anton Bruckner komponierte<br />
alle seine Werke, ob geistlich oder<br />
weltlich, »zur größeren Ehre Gottes«. Mit<br />
seiner Sechsten, zwischen 1879 und 1881<br />
komponierten Sinfonie muss er sehr zufrieden<br />
gewesen sein – schließlich nahm<br />
er an ihr, ganz untypisch für ihn, keine<br />
nachträglichen Überarbeitungen mehr<br />
vor. Im Konzertleben wurde die Sechste<br />
dennoch lange Zeit vernachlässigt,<br />
vielleicht wegen der Abweichungen vom<br />
gewohnten Bruckner-Bild: Zwar enthält<br />
die Sinfonie manche typischen Züge,<br />
diese allerdings in konzentrierter Form.<br />
Ihr fehlt die Monumentalität, die viele<br />
mit Bruckner verbinden.<br />
2
Im Geist schamanischer Gebete<br />
Toshio Hosokawas Intermezzo<br />
aus »Stilles Meer«<br />
Toshio Hosokawas Entwicklung ist schwer<br />
zu verstehen ohne einen kurzen Blick in<br />
die Geschichte seines Landes. Japan hatte<br />
sich ja vom 16. bis ins späte 19. Jahrhundert<br />
fast hermetisch von der Außenwelt<br />
abgeschlossen und in dieser Zeit eine sehr<br />
eigenständige, originelle Kultur entwickelt.<br />
Erst auf Druck der USA und Europas<br />
öffnete sich der Inselstaat danach dem<br />
internationalen Handel. Während der<br />
rasanten »Modernisierung« der nächsten<br />
Jahrzehnte wurden allerdings die einst<br />
beherrschenden japanischen Traditionen<br />
weitgehend an den Rand gedrängt – und<br />
daran änderte sich bis in die Zeit von Hosokawas<br />
Jugend nicht viel. Obwohl seine<br />
Mutter noch das japanische Instrument<br />
Koto (eine Art Zither) spielte, begeisterte<br />
sich der Sohn eher für Mozart und Beethoven.<br />
Nach ersten Studien in Tokio kam<br />
er 1976 nach Berlin, um bei dem Koreaner<br />
Isang Yun Komposition zu erlernen.<br />
Seine Ausbildung setzte er 1983 bis 1986<br />
in Freiburg bei Klaus Huber und Brian<br />
Ferneyhough fort. Angeregt durch eine<br />
Äußerung Hubers, erwachte erst jetzt sein<br />
Interesse an japanischer Musik, mit der<br />
er sich fortan intensiv auseinandersetzte.<br />
Überrascht stellte er fest, dass einige Mittel<br />
der avantgardistischen europäischen<br />
Musik in der japanischen Tradition schon<br />
seit jeher gebräuchlich sind.<br />
Seitdem komponiert Hosokawa als Grenzgänger<br />
zwischen zwei Kulturen: Seine<br />
Partituren verlangen bisweilen japanische<br />
Instrumente neben den europäischen,<br />
oder sie lassen westliche Instrumente<br />
3
Toshio Hosokawa<br />
fast japanisch klingen. Auf asiatische<br />
Einflüsse verweist auch Hosokawas<br />
Kommentar zur neueren Entwicklung<br />
seines Schaffens: »Musik war für mich<br />
stets ein Mittel, die Harmonie zwischen<br />
Mensch und Natur zu finden. Nach dem<br />
Tohoku-Erdbeben von <strong>20</strong>11 fing sie jedoch<br />
an, sich grundlegend zu verändern. Ich<br />
begann neu über die Existenz der Musik<br />
nachzudenken und darüber, wie sie sein<br />
sollte. Wir haben die urtümliche Kraft<br />
und den Schrecken der Natur vergessen<br />
und preisen sie in sentimentaler Weise.<br />
Durch unser unbegründetes Vertrauen<br />
in die Beherrschbarkeit der Natur stehen<br />
wir kurz davor, die menschlichen Lebensgrundlagen<br />
zu zerstören. Was kann Musik<br />
in einer solchen Zeit bewirken? Musik ist<br />
eine Form des Schamanismus; Menschen<br />
beten mit ihrer Hilfe und besänftigen die<br />
Geister der Verstorbenen, indem sie durch<br />
sie eine Brücke zwischen dem Hier und<br />
dem Jenseits formen. Seit <strong>20</strong>11 habe ich<br />
Stücke im Geist schamanischer Gebete<br />
komponiert.«<br />
4
Hosokawa konzipierte seine vierte Oper<br />
»Stilles Meer«, die <strong>20</strong>16 unter der Leitung<br />
von <strong>Kent</strong> <strong>Nagano</strong> an der Staatsoper<br />
Hamburg uraufgeführt wurde, als eine Art<br />
Requiem für die Opfer des Erdbebens und<br />
der Reaktorkatastrophe von Fukushima.<br />
Die Hauptfigur Claudia (eine deutsche<br />
Ballett-Tänzerin) hat durch den Tsunami<br />
ihren Ehemann und ihren Sohn verloren.<br />
Hosokawa sieht sie als eine Schamanin,<br />
die durch ihren Gesang mit den Seelen<br />
der Toten Verbindung aufnimmt. Auf<br />
Anregung <strong>Kent</strong> <strong>Nagano</strong>s komponierte er<br />
nachträglich noch ein Intermezzo, das<br />
zwei Szenen der Oper verbindet. Mit vier<br />
Schlagzeugern besetzt, erinnert es an die<br />
japanische Tradition der Taiko-Trommelensembles.<br />
TOSHIO HOSOKAWA<br />
* 23. Oktober 1955 in Hiroshima<br />
Intermezzo aus der Oper<br />
»Stilles Meer«<br />
ENTSTEHUNG<br />
<strong>20</strong>16<br />
WIDMUNG<br />
den Opfern des Tōhoku-Erdbebens und<br />
des Tsunamis<br />
URAUFFÜHRUNG DER OPER<br />
24. Januar <strong>20</strong>16 in der Staatsoper Hamburg,<br />
Dirigent: <strong>Kent</strong> <strong>Nagano</strong><br />
IN DIESEM KONZERT ERSTMALS VON DER<br />
DRESDNER PHILHARMONIE GESPIELT<br />
BESETZUNG<br />
Zwei große Trommeln, eine kleine Trommel,<br />
Bongos<br />
DAUER<br />
ca. 5 Min.<br />
5
Ewige Frage,<br />
schweigende Druiden<br />
Charles Ives’<br />
»The Unanswered Question«<br />
Wer sich mit Leben und Werk des USamerikanischen<br />
Komponisten Charles<br />
Ives beschäftigt, stößt immer wieder auf<br />
eine eigenartige, scheinbar widersprüchliche<br />
Mischung aus Bodenständigkeit<br />
und Mystizismus, aus Realitätssinn und<br />
gedanklicher Radikalität. Schon Ives’<br />
Vater George muss als Organist und Chorleiter,<br />
Musiklehrer und Dirigent diverser<br />
Blaskapellen ein sehr praktischer Mann<br />
gewesen sein – einerseits. Doch andererseits<br />
experimentierte er mit Vierteltönen,<br />
Polytonalität und Raumklangwirkungen,<br />
lange bevor diese Eingang in die neue<br />
Musik fanden. Ihn trieb dabei nicht<br />
kompositorischer Ehrgeiz, sondern reine<br />
Neugier. Anders als sein Vater entschied<br />
sich Charles Ives gegen eine Musiker-<br />
Laufbahn. Er arbeitete zunächst bei einer<br />
Versicherungsgesellschaft und führte<br />
später erfolgreich ein eigenes Unternehmen;<br />
das Komponieren betrachtete er als<br />
Freizeitbeschäftigung, auch wenn es ihn<br />
zeitweise kaum weniger beanspruchte als<br />
sein Brotberuf. An Aufführungen seiner<br />
Musik dachte er nicht, und so musste er<br />
auch keine Rücksicht auf Interpreten und<br />
Publikum nehmen. Er konnte mit den<br />
Traditionen der europäischen Klassik<br />
brechen, zahlreiche Neuerungen des<br />
<strong>20</strong>. Jahrhunderts vorwegnehmen und<br />
zum ersten wirklich eigenständigen Komponisten<br />
der USA werden.<br />
6
Charles Ives<br />
In vielen Werken verarbeitete Ives<br />
musikalische Eindrücke, die auf seine<br />
Kindheit in der Kleinstadt Danbury in<br />
Connecticut zurückgehen – das erklärt<br />
die häufigen Zitate aus Märschen und<br />
Fiedeltänzen, christlichen Hymnen und<br />
volkstümlichen Liedern. Andere Kompositionen,<br />
unter ihnen auch »The Unanswered<br />
Question«, befassen sich mit<br />
Ideen der »transzendentalistischen«<br />
Denker seiner neuenglischen Heimat.<br />
Intellektuelle wie Ralph Waldo Emerson<br />
(1803-1882) oder Henry David Thoreau<br />
(1817-1862) glaubten an eine übermaterielle<br />
Daseins-Ebene, lehnten allerdings<br />
religiöse Dogmen ab. Stattdessen traten<br />
sie für eine intuitive Spiritualität ein,<br />
die auf der Einheit von Gott, Natur und<br />
Mensch beruhen sollte. Mystische Vorstellungen<br />
– doch sie hatten praktische<br />
Konsequenzen: Die Bewegungen für Sklavenbefreiung,<br />
Frauenrechte und Naturschutz<br />
erhielten von den amerikanischen<br />
Transzendentalisten wichtige Impulse.<br />
Ives schrieb »The Unanswered Question«<br />
um das Jahr 1906. In den 1930ern bearbeitete<br />
er das Stück noch einmal, doch<br />
uraufgeführt wurde es erst 1946 von<br />
einem Studenten-Kammerorchester.<br />
7
Ralph Waldo Emerson, aus dessen Gedicht »The<br />
Sphinx« Ives den Titel »The Unanswered Question«<br />
entlehnte<br />
Die Besetzung ist in drei Klanggruppen<br />
unterteilt: Die Streicher spielen einen impulslosen,<br />
ruhig-sphärischen, wohlklingenden<br />
Hintergrund, die Trompete eine<br />
sich wiederholende atonale Passage und<br />
die Holzbläser eine Reihe ineinander verwobener<br />
Phrasen, die zunehmend schneller,<br />
lauter und misstönender werden. Wie<br />
der Titel (»Die unbeantwortete Frage«)<br />
schon ahnen lässt, liegt der Komposition<br />
ein metaphysisches, ziemlich rätselhaftes<br />
Programm zugrunde. Für Ives verkörperten<br />
die Streicher »das Schweigen der<br />
Druiden, die nichts wissen, sehen und<br />
hören«, die Trompete stellt »die ewige<br />
Frage nach der Existenz«, und das Holzbläserquartett<br />
sucht nach »der unsichtbaren<br />
Antwort« – offenbar vergeblich.<br />
8
CHARLES IVES<br />
* <strong>20</strong>. Oktober 1874 in Danbury, Connecticut<br />
† 19. Mai 1954 in New York City<br />
»The Unanswered Question«<br />
ENTSTEHUNG<br />
1906, Überarbeitung 1935<br />
URAUFFÜHRUNG<br />
11. Mai 1946, Uraufführung der revidierten<br />
Fassung in der Columbia University (New York),<br />
Dirigent: Theodore Bloomfield<br />
17. März 1984, Uraufführung der Erstfassung in<br />
New York, Dirigent: Dennis Russell Davies<br />
ERSTMALS VON DER DRESDNER<br />
PHILHARMONIE GESPIELT<br />
<strong>20</strong>. Oktober 1974, DDR-Erstaufführung<br />
zum 100. Geburtstag des Komponisten,<br />
Dirigent: Hartmut Haenchen<br />
ZULETZT<br />
25. November <strong>20</strong>17, Dirigent:<br />
Antonello Manacorda<br />
BESETZUNG<br />
Trompete, 4 Flöten (oder alternative Bläser),<br />
Streicher<br />
DAUER<br />
ca. 7 Minuten<br />
9
Konzentration statt<br />
Monumentalität<br />
Anton Bruckners Sechste Sinfonie<br />
Anton Bruckner ist oft als »Musikant<br />
Gottes« bezeichnet worden – und dies,<br />
obwohl die meisten geistlichen Kompositionen<br />
des Österreichers relativ früh<br />
entstanden und die Sinfonien, weltliche<br />
Werke für den Konzertsaal also, später<br />
den größten Teil seiner Schaffenskraft<br />
beanspruchten. Das Etikett hat trotzdem<br />
seine Berechtigung, denn es gibt<br />
wohl keinen anderen Komponisten des<br />
19. Jahrhunderts, der so fest in volkstümlicher<br />
Frömmigkeit und katholischer<br />
Glaubenspraxis wurzelte wie er. Ob Messe<br />
oder Sinfonie, Bruckner schrieb alles zur<br />
größeren Ehre Gottes: »O.A.M.D.G.« (Omnia<br />
ad maiorem Dei gloriam), wie in manchem<br />
seiner Manuskripte zu lesen ist.<br />
Schon aus diesem Grund liegt es nahe,<br />
die Sinfonien, obwohl ohne liturgische<br />
Funktion, auch einmal in einer Kirche erklingen<br />
zu lassen. Auch choralartige und<br />
fugierte Abschnitte wecken kirchliche<br />
Assoziationen, ebenso Bruckners Orchesterbehandlung,<br />
die an eine Orgel und<br />
ihre Register erinnert: Wechselnde, aber<br />
in sich stabile, reine Klangfarben stehen<br />
einander blockhaft gegenüber, statt sich<br />
subtil zu vermischen oder ineinander<br />
überzugehen.<br />
Hinzu kommt noch, dass die Sinfonien<br />
wegen ihres gewaltigen Umfangs gelegentlich<br />
als »domhaft« bezeichnet<br />
worden sind. Ihre Zeitdauern sinnvoll zu<br />
10
»Bruckners Ankunft im Himmel«, Scherenschnitt<br />
von Otto Böhler, 1890<br />
gestalten, verlangt ein gleichsam architektonisches<br />
Denken. Gerade in dieser<br />
Hinsicht ist die zwischen 1879 und 1881<br />
entstandene Sechste allerdings nicht<br />
ganz typisch: Zwar enthält sie alle Charakteristika<br />
einer echten Bruckner-Sinfonie:<br />
das Majestätische der Themenentfaltung,<br />
das Weihevolle des Adagios, die<br />
kraftvolle Motorik der Scherzosätze. Doch<br />
diese Züge bietet sie in gestraffter Form.<br />
Gemeinsam mit der Ersten zählt sie zu<br />
den kürzesten Sinfonien Bruckners, und<br />
auch ihre Besetzung ist nicht größer<br />
als etwa bei Schumann oder Brahms.<br />
Manche Musikfreunde mögen diese<br />
Konzentration aufs Wesentliche als einen<br />
Vorzug betrachten, während andere die<br />
gewohnte Monumentalität vermissen.<br />
Vielleicht zählte die Sechste ja sogar aus<br />
diesem Grund lange Zeit zu den seltener<br />
aufgeführten unter den neun – erst<br />
in den letzten Jahrzehnten gewann sie<br />
deutlich an Beliebtheit. Bruckner selbst<br />
hielt sie offenbar für besonders gelungen.<br />
Jedenfalls fand er ausnahmsweise einmal<br />
nichts am fertigen Werk zu verbessern,<br />
sodass es nur in einer gültigen Fassung<br />
existiert.<br />
11
Vollständig gespielt wurde die Sechste<br />
zu seinen Lebzeiten dennoch nie – oder<br />
zumindest nicht öffentlich: Die Wiener<br />
Philharmoniker, die am 11. Februar 1883<br />
unter der Leitung von Wilhelm Jahn<br />
den zweiten und dritten Satz vortrugen,<br />
gaben Bruckner immerhin während einer<br />
»Novitätenprobe« die Möglichkeit, sein<br />
Werk komplett zu hören. Doch selbst die<br />
Aufführung der weniger problematischen<br />
Mittelsätze war damals offenbar noch<br />
riskant genug. So urteilte etwa Bruckners<br />
Intimfeind Eduard Hanslick in der Neuen<br />
Freien Presse: »Das Adagio konnte, trotz<br />
seiner ermüdenden Wiederholung derselben<br />
Figuren und unabsehbar ausgesponnener,<br />
teilweise an ‚Meistersinger‘-Motive<br />
anklingender Rosalien durch eine gewisse<br />
feierliche Sanftmut der Stimmung für<br />
sich einnehmen. Der groteske Humor des<br />
in lauter unerklärlichen Gegensätzen sich<br />
müde taumelnden Scherzo fand mich dagegen<br />
völlig ratlos.« Alle vier Sätze führte<br />
erst Gustav Mahler im Februar 1899, mehr<br />
als zwei Jahre nach Bruckners Tod, auf –<br />
zwar nicht ohne eigenmächtige Kürzungen<br />
und Änderungen der Instrumentierung,<br />
doch mit glänzendem Erfolg.<br />
ANTON BRUCKNER<br />
* 4. September 1824 in Ansfelden,<br />
Oberösterreich<br />
† 11. Oktober 1896 in Wien<br />
SINFONIE NR. 6 A-DUR<br />
WAB 106<br />
ENTSTEHUNG<br />
1879-1881<br />
URAUFFÜHRUNG<br />
11. Februar 1883, Wien: Uraufführung der beiden<br />
Mittelsätze, Dirigent: Wilhelm Jahn<br />
26. Februar 1899, Wien: erste Gesamtaufführung<br />
einer gekürzten Fassung durch Gustav Mahler<br />
14. März 1901, Stuttgart: Uraufführung der<br />
Fassung des (fehlerhaften) Erstdrucks,<br />
Dirigent: Karl Pohlig<br />
ERSTMALS VON DER DRESDNER<br />
PHILHARMONIE GESPIELT<br />
28. Januar 19<strong>20</strong>, Dirigent: Kurt Striegler<br />
9. Oktober 1935: Uraufführung der<br />
Originalfassung (unter Benutzung der Ausgabe<br />
von Robert Haas), Dirigent: Paul van Kempen<br />
(Chefdirigent 1934-1942)<br />
ZULETZT<br />
14. Mai <strong>20</strong>17, Dirigent: Marek Janowski<br />
BESETZUNG<br />
2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte,<br />
4 Hörner, 3 Trompeten, 3 Posaunen, Tuba,<br />
Pauken, Streicher<br />
DAUER<br />
ca. 60 Minuten<br />
12
DIRIGENT<br />
KENT<br />
NAGANO<br />
<strong>Kent</strong> <strong>Nagano</strong> gilt als einer der<br />
herausragendsten Dirigenten<br />
sowohl für das Opern- als auch<br />
für das Orchesterrepertoire. Seit<br />
September <strong>20</strong>15 ist er Generalmusikdirektor<br />
der Hamburgischen<br />
Staatsoper und Chefdirigent des<br />
Philharmonischen Staatsorchesters<br />
Hamburg. Von <strong>20</strong>06 bis <strong>20</strong><strong>20</strong><br />
war er Musikdirektor des Orchestre<br />
symphonique de Montréal und<br />
wurde im Februar <strong>20</strong>21 zum Ehrendirigenten<br />
ernannt. Bereits <strong>20</strong>06<br />
war er zum Ehrendirigenten des<br />
Deutschen Symphonie-Orchesters<br />
Berlin ernannt worden und <strong>20</strong>19<br />
zum Ehrendirigenten von Concerto<br />
Köln. Als gefragter Gastdirigent<br />
arbeitet <strong>Kent</strong> <strong>Nagano</strong> mit den<br />
weltweit führenden internationalen<br />
Orchestern zusammen. Seine<br />
CD-Produktionen erscheinen bei<br />
Labels wie BIS, Decca, Sony Classical,<br />
FARAO Classics und Analekta.<br />
Anlässlich seines 70. Geburtstags<br />
<strong>20</strong>21 erschien eine 3-CD-Box mit<br />
Werken von Olivier Messiaen beim<br />
Label BR Klassik. Im September<br />
<strong>20</strong>21 veröffentlichte <strong>Kent</strong> <strong>Nagano</strong><br />
sein zweites Buch: In »10 Lessons<br />
of my Life« erinnert er sich an sehr<br />
persönliche und prägende Begegnungen.<br />
Darunter sind die isländische<br />
Popkünstlerin Björk, Frank<br />
Zappa, Leonard Bernstein, Pierre<br />
Boulez und der Nobelpreisträger<br />
für Physik Donald Glaser.<br />
BIOGRAPHIE ONLINE<br />
13
ORCHESTER<br />
DRESDNER<br />
PHILHARMONIE<br />
Musik für alle – Die Dresdner<br />
Philharmonie steht für Konzerte<br />
auf höchstem künstlerischen<br />
Niveau, musikalische Bildung für<br />
jedes Alter und den Blick über den<br />
musikalischen Tellerrand hinaus.<br />
Gastspiele auf fast allen Kontinenten<br />
und die Zusammenarbeit mit<br />
Gästen aus aller Welt haben den<br />
Ruf des Orchesters in der internationalen<br />
Klassikwelt verankert. Seit<br />
der Konzertsaison <strong>20</strong>19/<strong>20</strong><strong>20</strong> ist<br />
Marek Janowski zum zweiten Mal<br />
Chefdirigent und künstlerischer<br />
Leiter der Dresdner Philharmonie.<br />
BIOGRAFIE ONLINE<br />
14
KONZERTVORSCHAU<br />
FR 3. JUN <strong><strong>20</strong>22</strong> | 19.30 UHR<br />
SO 5. JUN <strong><strong>20</strong>22</strong> | 18.00 UHR<br />
KONZERTSAAL<br />
SINFONIEKONZERT<br />
RACHMANINOW 2<br />
Schostakowitsch: Violinkonzert Nr. 1 a-Moll<br />
Rachmaninow: Sinfonie Nr. 2 e-Moll<br />
Kahchun Wong | Dirigent<br />
Vilde Frang | Violine<br />
Dresdner Philharmonie<br />
SA 11. JUN <strong><strong>20</strong>22</strong> | 19.30 UHR<br />
SO 12. JUN <strong><strong>20</strong>22</strong> | 18.00 UHR<br />
KONZERTSAAL<br />
SINFONIEKONZERT<br />
ROMEO UND JULIA<br />
Satie: Musik zu ›Parade – Ballet réaliste‹ nach einem<br />
Thema von Jean Cocteau<br />
Saunders: ›Still‹ für Violine und Orchester<br />
Prokofjew: Suite Nr. 2 aus dem Ballett ›Romeo und Julia‹<br />
Maxime Pascal | Dirigent<br />
Carolin Widmann | Violine<br />
Dresdner Philharmonie<br />
FR 17. JUN <strong><strong>20</strong>22</strong> | 19.30 Uhr<br />
KONZERTSAAL<br />
SINFONIEKONZERT<br />
STARKE STÜCKE<br />
Sibelius: Sinfonie Nr. 3 C-Dur<br />
Strawinski: Violinkonzert in D-Dur<br />
Ravel: Boléro<br />
Nicholas Collon | Dirigent<br />
Leila Josefowicz | Violine<br />
Dresdner Philharmonie<br />
15
IMPRESSUM<br />
HERAUSGEBER<br />
Intendanz<br />
der Dresdner Philharmonie<br />
Schloßstraße 2, 01067 Dresden<br />
T +49 351 4866-282<br />
dresdnerphilharmonie.de<br />
TEXT<br />
Jürgen Ostmann<br />
Der Text ist ein Originalbeitrag<br />
für dieses Heft;<br />
Abdruck nur mit ausdrücklicher<br />
Genehmigung des Autors.<br />
BILDNACHWEISE<br />
Wikimedia commons S.7/8/11<br />
Kazu Ishikawa S.4<br />
Anne Zeuner S.13<br />
Björn Kadenbach S.14<br />
CHEFDIRIGENT UND<br />
KÜNSTLERISCHER LEITER<br />
Marek Janowski<br />
INTENDANTIN<br />
Frauke Roth (V.i.S.d.P.)<br />
REDAKTION<br />
Dr. Claudia Woldt und<br />
Adelheid Schloemann<br />
MUSIKBIBLIOTHEK<br />
Die Musikabteilung der<br />
Zentralbibliothek (2. OG) hält<br />
zu den aktuellen Programmen<br />
der Philharmonie für<br />
Sie in einem speziellen Regal<br />
am Durchgang zum Lesesaal<br />
Partituren, Bücher und CDs<br />
bereit.<br />
Preis 2,50€<br />
Änderungen vorbehalten.<br />
Die Dresdner Philharmonie als Kultureinrichtung der Landeshauptstadt<br />
Dresden (Kulturraum) wird mitfinanziert durch<br />
Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag<br />
beschlossenen Haushaltes.<br />
MEDIZINISCHES Gesundheitspartner<br />
LABOR der Dresdner<br />
OSTSACHSEN<br />
Philharmonie<br />
DRESDEN<br />
BAUTZEN<br />
GÖRLITZ<br />
16
SINFONIEKONZERT<br />
ROMEO&<br />
JULIA<br />
SA 11. JUN <strong><strong>20</strong>22</strong> | 19.30 UHR<br />
SO 12. JUN <strong><strong>20</strong>22</strong> | 18.00 UHR<br />
KULTURPALAST<br />
ERIC SATIE<br />
Musik zu ›Parade – Ballet réaliste‹<br />
nach einem Thema von Jean Cocteau<br />
REBECCA SAUNDERS<br />
›Still‹ für Violine und Orchester<br />
SERGEI PROKOFJEW<br />
Suite Nr. 2 aus dem Ballett<br />
›Romeo und Julia‹<br />
MAXIME PASCAL | Dirigent<br />
CAROLIN WIDMANN | Violine<br />
DRESDNER PHILHARMONIE<br />
Tickets ab 18 € | 9 € Schüler:innen, Junge Leute<br />
ticket@dresdnerphilharmonie.de | dresdnerphilharmonie.de<br />
© Lennard Rühle
TICKETSERVICE<br />
Schloßstraße 2 | 01067 Dresden<br />
T +49 351 4 866 866<br />
MO – MI 10 – 15 Uhr<br />
DO, FR 14 – 19 Uhr<br />
SA, SO, feiertags geschlossen<br />
Änderungen entnehmen Sie der Homepage<br />
ticket@dresdnerphilharmonie.de<br />
Bleiben Sie informiert:<br />
dresdnerphilharmonie.de<br />
kulturpalast-dresden.de