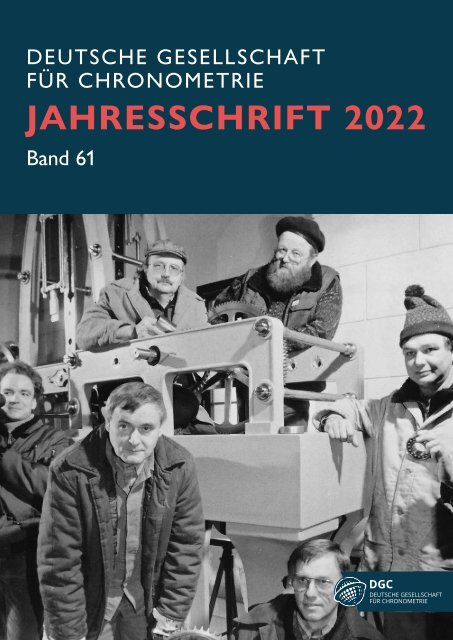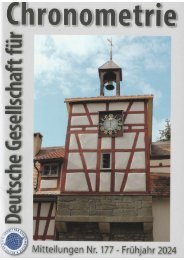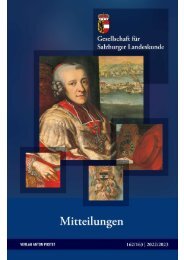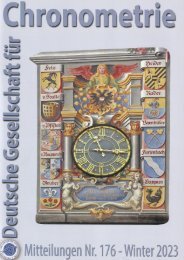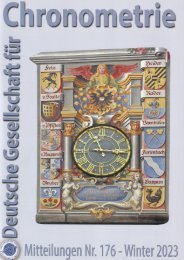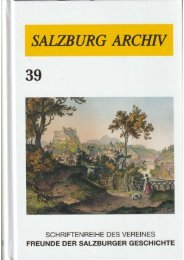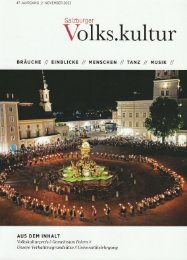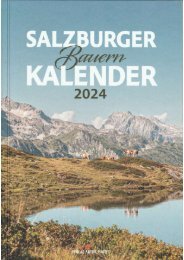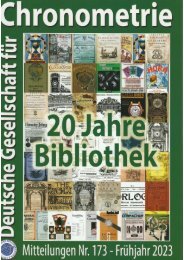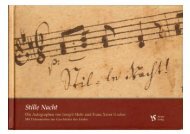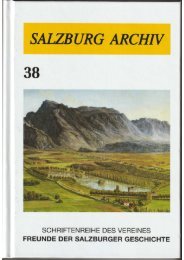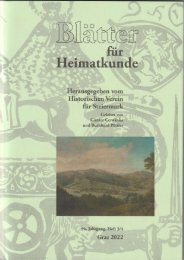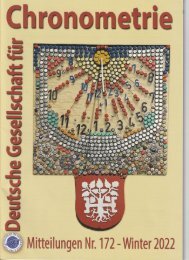TUStPeterDGCJahresschrift2022
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
DEUTSCHE GESELLSCHAFT<br />
FÜR CHRONOMETRIE<br />
JAHRESSCHRIFT 2022<br />
Band 61
Michael Neureiter<br />
»… zur allgemeinen Benachrichtigung über den<br />
unaufhaltsamen Zeitverfluß …«<br />
Das Turmuhrwerk 1780 der Stiftskirche<br />
St. Peter, Salzburg<br />
Die Restaurierung und Revitalisierung des Werks<br />
von Johann Bentele sen.<br />
»Es ist eine herrliche Sache um die Erfindung der<br />
Uhrwerke …, daß man den Erfindern und Vervollkommnern<br />
derselben für diesen der Menschheit<br />
erwiesenen immerfort dauernden Dienst großen<br />
Dank, große Achtung schuldig ist und immer<br />
schuldig bleiben wird.« meinte Karl Friedrich Buschendorf<br />
1 im Vorwort zu seinem Buch »Gründlicher<br />
Unterricht von Thurmuhren« 1805. 2<br />
Die Uhren in der Benediktinerabtei St. Peter in<br />
Salzburg, dem ältesten Kloster im deutschen<br />
Sprachraum, standen durch Jahrhunderte im<br />
Dienst des klösterlichen Lebens, des Gebets, der<br />
Liturgie, der Arbeit. An den Uhren orientierten<br />
sich das Chorgebet und die Mahlzeiten, die<br />
Gottesdienste und das Studium, die Wirtschaftsbetriebe<br />
und die Freizeit… Uhren wurden für<br />
Wohnräume und Türme angeschafft. Sie sorgten<br />
als Schlaguhren für die akustische Zeitanzeige<br />
auf Schellen und Glocken, zu der dann die optische<br />
Zeitanzeige auf Zifferblättern kam, zuerst<br />
nur mit einem Stundenzeiger, später – mit höherer<br />
Genauigkeit der Uhrwerke – auch mit einem<br />
Minutenzeiger.<br />
Abb. 1: Das Turmuhrwerk 1780,<br />
das Johann Bentele sen. für<br />
die Stiftskirche St. Peter schuf.<br />
Es wurde 2021 restauriert und<br />
revitalisiert.
104 MICHAEL NEUREITER – BAD VIGAUN<br />
Uhren im Stift St. Peter<br />
In den Abteirechnungen von St. Peter, die seit 1306<br />
vorliegen, tauchen unter Abt Wolfgang Walcher<br />
im Jahr 1505 ein Uhrkasten und eine Zahlung<br />
an einen Georius für eine alte Uhr (»antiquo horologio«)<br />
auf. 3 1561 gab es einen Aufwand für das<br />
Frauenkloster »umb ain schlaguhr und wöckher«,<br />
Küsslman wurden dafür 12 Pfund bezahlt. 4 1588 reparierte<br />
Uhrmacher Hans Fischer die »uhr auf dem<br />
schlafhaus« und »kleine schlachurlen« (Schlaguhren)<br />
um 3 Gulden. 5 1595 fertigt »Andre urmacher<br />
zu Burkhausen« um 32 Gulden eine neue »uhr auf<br />
das schlaffhaus«. 6 Sie wird sich im oder unterhalb<br />
des Dachreiters befunden haben, der in zeitgenössischen<br />
Ansichten den Quertrakt mit Zellen und<br />
Dormitorium der Brüder zeigt. Dieser wurde unter<br />
Abt Amand Pachler (1657 – 1673) abgetragen, was<br />
zum heutigen geräumigen Konventhof führte. 7 Die<br />
Uhr auf dem Schlafhaus hatte ausgedient.<br />
1710 wurden 226 Gulden für »Johann Hauckher,<br />
raths burger und uhrmacher zu Burghausen«,<br />
ausgegeben, und zwar wegen »ainer neugemachten<br />
uhr in dem thürnl ob St. Veiths capelln«<br />
und für einen neugemachten Brater (Bratenwender)<br />
mit Wasserantrieb. 8 Dieser wurde wohl für<br />
die Küche angeschafft und wird mit dem Wasser<br />
des St. Peterarms des Almkanals angetrieben<br />
worden sein? Es ist dies eine äußerst seltene Form<br />
eines Bratenwenders, war doch ein nahes Fließgewässer<br />
die Voraussetzung. 9<br />
Das Türmchen über der Veitskapelle/Marienkapelle<br />
ist auf Ansichten zu sehen, allerdings<br />
noch nicht auf dem Kupferstich von 1619, 10 aber<br />
schon nach der Errichtung der oberen Bibliothek:<br />
Der Bibliothekssaal des Abtes Albert III.<br />
Keuslin (1626-1657) über der Veitskapelle wurde<br />
1653 geschaffen. 11 Die Ansichten 1657 und 1767<br />
zeigen das »thürnl« – auf der älteren ohne und<br />
auf der jüngeren mit Zifferblatt!<br />
Abb. 2: St. Peter von Norden, Gouache von Thiemo<br />
Sing (?) 1657: Der Turm der Stiftskirche ohne<br />
Zifferblätter, auf dem Quertrakt im Konventhof<br />
(»Schlafhaus«) der Dachreiter und dahinter links<br />
das Türmchen der Veitskapelle heute Marienkapelle.<br />
31<br />
Abb. 3: St. Peter von Westen, Gouache von Franz<br />
Xaver König (?) 1767: Hier ist das Türmchen auf der<br />
Veitskapelle (nun Marienkapelle) noch vorhanden, und<br />
zwar mit Zifferblättern. Auch der Stiftskirchturm trägt<br />
Zifferblätter. 32 1772 ist auf dem Kupfer stich von Johann<br />
B. und Joseph Seb. Klauber (gestal tet nach F. X. König<br />
1769) dieses Türmchen nicht mehr vorhanden!
DAS TURMUHRWERK 1780 DER STIFTSKIRCHE ST. PETER, SALZBURG<br />
105<br />
Zu den Uhren von St. Peter gehören auch fünf<br />
Sonnenuhren, drei im Konventhof, die Sonnenuhr<br />
im Stiftshof mit dem hl. Benedikt und eine<br />
Sonnenuhr im Kolleghof am Kolleg St. Benedikt,<br />
entstanden 1926.<br />
Turmuhren der Stiftskirche<br />
1710 baute Johann Hauckher aus Burghausen die<br />
neue Uhr für das Türmchen der Veitskapelle. 1714<br />
verrechnete er eine nicht näher definierte Leistung<br />
mit 86 Gulden und 30 Kreuzern. 12 Möglicherweise<br />
handelte es sich hier um eine Ausgabe<br />
für die Turmuhr der Stiftskirche? Aufgrund der<br />
Höhe des Betrags kann es kaum eine Neuanschaffung<br />
gewesen sein.<br />
Während mehrere Ansichten aus dem 17. Jahrhundert,<br />
darunter der Kupferstich »Jetzige Form<br />
deß Uhralten Closters St. Peter in Saltzburg« 1699,<br />
keine Zifferblätter am Stiftskirchturm zeigen,<br />
sind solche im Kupferstich nach Franz Anton<br />
Danreiter 1740 vorhanden.<br />
Es ist eine weitergehende Untersuchung wert,<br />
ob die Stiftskirche erst anfangs des 18. Jahrhunderts<br />
mit einer Turmuhr ausgestattet wurde: Der<br />
Dom mit seinen 1652 / 55 fertiggestellten Türmen<br />
erhielt 1683 von Jeremias Sauter eine neue Turmuhr.<br />
Im Salzburger Land sind die gotische Turmuhr<br />
von Schloss Haunsperg in Oberalm um 1580<br />
oder die im Kern ebenfalls noch gotische Turmuhr<br />
von Buchberg bei Bischofshofen aus der<br />
1. Hälfte des 17. Jahrhunderts, die erst kürzlich<br />
diese Zuordnung erfuhr, eine Erwähnung wert.<br />
Hans Sauter, der Vater des Jeremias, reparierte<br />
schon 1650 um 38 Gulden die Uhr in Vigaun.<br />
Vielleicht reichten im Kloster bis etwa 1700 die<br />
erwähnte Uhr auf dem Schlafhaus und andere<br />
Uhren in Innenräumen für die Orientierung in<br />
den Tageszeiten?<br />
Abb. 4: St. Peters Kirchen …, Kupferstich in: Franz Anton Danreiter:<br />
Die saltzburgische Kirchenprospect, Augsburg, um 1740.
106 MICHAEL NEUREITER – BAD VIGAUN<br />
Ohne Zweifel handelte es sich um die Turmuhr<br />
der Stiftskirche, als Johann Joseph Nidermayr<br />
1744 sieben Gulden für »ausbuzen und richten<br />
der Thurm-Uhr« verrechnete. 13<br />
Ab dem Jahr 1754 ließ der 1753 gewählte Abt<br />
Beda Seeauer »den alten Kirchenthurm, der fast<br />
vermodert … und zum Falle geneigt war, nicht<br />
nur erhöhen, sondern in jene herrliche Gestalt,<br />
vermittelst welcher er noch heut zu Tage als die<br />
vornehmste Zierde unsers Gotteshauses … und<br />
der ganzen Stadt pranget, umschaffen und durchaus<br />
mit Kupfer überdecken …«. 14 Der erneuerte<br />
Turm erhielt nun »den rhythmisch gegliederten<br />
und fein geschwungenen Helm, der 1756, dem Geburtsjahr<br />
Mozarts, dem Nagelfluhprisma aufgesetzt<br />
wurde«. 15 Franz Martin meint zu den reichgegliederten<br />
Turmhelmen des 18. Jahrhunderts:<br />
»Die prächtigsten Beispiele von solchen sind die<br />
Turmhelme von St. Peter und St. Sebastian«. 16<br />
Nun war auch die vorhandene Turmuhr dran:<br />
Der neue Turm wurde um 24 Schuh (ca. 8 m)<br />
höher, deshalb gab es laut Abteirechnungen<br />
den ersten Auftrag an ein Mitglied der Familie<br />
Bentele: Jacob Bentele, seit 1730 in Salzburg und<br />
nach dem Tod Joseph Christoph Schmidts 17 als<br />
Hof-Großuhrmacher tätig, wurde 1758 mit der<br />
»Ibersetzung und vollständige(n) Reparation der<br />
Uhr und Zeiger-Werk in dem neuen Thurm« 18 beauftragt<br />
und verrechnete dafür 112 Gulden. Es ist<br />
anzunehmen, dass die Neuplatzierung des vorhandenen<br />
Uhrwerks um ein Geschoss höher als<br />
vorher erfolgte. Vom Uhrwerk zu den Zifferblättern<br />
führte die Zeigerleitung mit einer kompletten<br />
Umdrehung pro Stunde. Diese wurde durch<br />
die vier Zeigerwerke jeweils hinter den Zifferblättern<br />
auf ein Zwölftel und die Stundengeschwindigkeit<br />
übersetzt.<br />
Abb. 5: Der Turm der Stiftskirche St. Peter mit<br />
dem 1756 aufgesetzten Helm. Die vier Zifferblätter<br />
weisen auch heute die alte Zeigerstellung mit langen<br />
Stunden- und kurzen Minutenzeigern auf.
DAS TURMUHRWERK 1780 DER STIFTSKIRCHE ST. PETER, SALZBURG<br />
107<br />
Das alte Uhrwerk blieb nicht lange am neuen<br />
Standort: Abt Beda schenkte es Ende der 1770er-<br />
Jahre an die dem Stift inkorporierte Pfarre Abtenau<br />
und »ließ dahin die alte Klosterthurm-Uhre<br />
brauchbar machen«. 19 Das Uhrwerk dürfte aus<br />
der Zeit um 1700 stammen und ist in der Pfarrkirche<br />
Abtenau vorhanden. Es wurde für den<br />
neuen Einsatz vermutlich vom Spindelgang auf<br />
den nunmehrigen Hakengang umgebaut. Auf die<br />
neue steinerne Pendellinse, typisch für die Familie<br />
Bentele, wurde ein Schild mit dem Doppelwappen<br />
von St. Peter und Abt Beda Seeauer montiert. 20<br />
Über ein Vorgängerwerk dieses Uhrwerks konnte<br />
noch nichts in Erfahrung gebracht werden, ein<br />
solches dürfte aber aufgrund der Klosteransichten<br />
unwahrscheinlich sein. 21<br />
Kein Zweifel, dass der Umbau des Werks für<br />
Abtenau in der Werkstatt von Johann Bentele<br />
sen. erfolgte: Sie befand sich im Haus der Benteles,<br />
heute Kaigasse 3, das Jacobs zweite Frau 1747<br />
in die Ehe mitgebracht hatte. Johann sen., der<br />
Neffe Jacobs, war 1769 als Hof-Großuhrmacher<br />
angestellt worden.<br />
Die neue Turmuhr 1780 …<br />
1777 / 80 erhielt die Stiftskirche den neuen Hochaltar.<br />
Nach neuen Beichtstühlen und »neuen Kirchenstühlen<br />
von hartem Holz« wurde »im Jahre<br />
1780 eine gleicher massen neue Thurm-Uhr … mit<br />
einem Stunden und Viertelstunden Schlagwerke<br />
herbeygeschaffet«. 22<br />
Abb. 6: Das frühere Turmuhrwerk von St. Peter übersiedelte in den Turm<br />
der Pfarrkirche Abtenau: Im Bild das 115 cm breite Werk mit einem sehr<br />
ungewöhnlichen Hilfsgehwerk in der Mitte.
108 MICHAEL NEUREITER – BAD VIGAUN<br />
Abb. 7: Die Inschrift »1851 K. P.« auf der Innenseite der Türe der Uhrstube mag vom Salzburger Uhrmacher<br />
Kaspar Posch stammen, der die Uhr 1865 reparierte?<br />
Die Uhrstube ist von der Stiftskirche über insgesamt<br />
114 Stufen zu erreichen. Das tägliche Aufziehen<br />
der Turmuhr diente der Kondition: Zum<br />
Stiegensteigen kamen ja etwa 300 Kurbelumdrehungen<br />
zum Hochziehen der drei gut 70 kg<br />
schweren Steingewichte dazu.<br />
In der Uhrstube fand ich u. a. eine bemerkenswerte<br />
Inschrift von Franz Martin, 1924 bis 1950<br />
Leiter des Salzburger Landesarchivs und verdienter<br />
Landeshistoriker:<br />
»Benütze treu die flüchtige Zeit<br />
Sie bringt dich mit jeder Stunde<br />
Stets näher in die Ewigkeit!<br />
FM. 1927 Ostern!«
DAS TURMUHRWERK 1780 DER STIFTSKIRCHE ST. PETER, SALZBURG<br />
109<br />
Abb. 8: Der Salzburger Archivar, Kunst- und Landeshistoriker Franz Martin dokumentierte einen Besuch bei<br />
der Turmuhr zu Ostern 1927.<br />
Abb. 9: Das Turmuhrwerk von St. Peter vor der<br />
Restaurierung 2021: vorne das Viertelstundenschlagwerk,<br />
in der Mitte das Gehwerk und hinten<br />
das Stundenschlagwerk.<br />
Johann Bentele sen. baute die neue Uhr, die in<br />
vier Raten zwischen April und September 1780<br />
bezahlt wurde und insgesamt 700 Gulden kostete.<br />
23 Sein erstes eigenes Werk, das er 1764 für<br />
die Pfarrkirche Golling baute, kostete 200 Gulden:<br />
Das Turmuhrwerk für St. Peter war auch<br />
besonders groß und aufwändig. Weitere drei<br />
kleinere Aufträge an ihn bzw. seinen Sohn Johann<br />
Bentele jun. sind in den Abteirechnungen<br />
nachgewiesen. 24<br />
Im Turmuhrwerk 1780 sind die drei Teilwerke<br />
nebeneinander angeordnet – diese Bauweise<br />
kam in der Mitte des 18. Jahrhunderts auf. Von<br />
der Aufzugsseite gesehen liegt das Gehwerk in<br />
der Mitte, links ist das Viertelstundenschlagwerk<br />
und rechts das Stundenschlagwerk angeordnet.<br />
Hinten hängt das Pendel, das vom Hakenrad<br />
über den Anker bewegt wird – es handelt sich<br />
um die sogenannte »Clementsche Hemmung«,<br />
erstmals 1671 gebaut von William Clement in<br />
London für das Kings College in Cambridge.
110 MICHAEL NEUREITER – BAD VIGAUN<br />
Abb. 10: Die drei Steingewichte hängen<br />
mit hölzernen Umlenkrollen an Hanf seilen,<br />
der Aufzug erfolgt mit einer Kurbel.
DAS TURMUHRWERK 1780 DER STIFTSKIRCHE ST. PETER, SALZBURG<br />
111<br />
An der Pendelstange hängt die 38 kg schwere<br />
Pendellinse, wie bei den meisten Bentele-Turmuhren<br />
aus Untersberger Marmor. Das Pendel<br />
ist sechs Meter lang und braucht für eine Halbschwingung<br />
2,5 Sekunden, führt also in einer Minute<br />
24 Halbschwingungen durch. Die Zeigerleitung<br />
zu den vier Zifferblättern am Turm außen<br />
läuft am Werk hinten nach oben, die Zeigerleitung<br />
zur Orgeluhr durch das Kontrollzifferblatt<br />
seit dem 20. Jahrhundert nach vorne und dann<br />
nach unten, früher lief sie vom Gehwerk hinten<br />
gleich nach unten. Von den beiden Schlagwerken<br />
führten Drahtzüge nach oben in die Glockenstube<br />
zu den Schlaghämmern an zwei Glocken,<br />
die als Schlag- und Läutglocken verwendet wurden.<br />
Die drei jeweils gut 70 kg schweren Gewichte<br />
aus Untersberger Marmor sorgten etwa 180 Jahre<br />
lang für die optische Zeitanzeige auf fünf Zifferblättern<br />
(vier Zifferblätter am Turm und Orgelzifferblatt)<br />
und für die akustischen Schlagsignale<br />
auf zwei Glocken.<br />
… und ihre Restaurierung<br />
Das Projekt hatte laut Angebot »die Restaurierung<br />
des Turmuhrwerks und seine Adaptierung für<br />
einen Demonstrationsbetrieb« zum Ziel. Das Angebot<br />
vom 23. 08. 2020 wurde durch die Erzabtei<br />
St. Peter (Erzabt Korbinian Birnbacher OSB) angenommen,<br />
der Auftrag erfolgte am 07. 09. 2020.<br />
Am 12. 10. 2020 folgte die Bewilligung durch die<br />
Abteilung für Spezialmaterien des Bundesdenkmalamts<br />
(Abteilungsleiter Gerd Pichler).<br />
In der Umsetzung ging es zuerst um den Abbau<br />
des etwa 450 kg schweren Werks und sein Zerlegen<br />
in etwa 400 Einzelteile. Sie wurden in die<br />
Werkstatt des Kleinunternehmens »horologium«<br />
nach Bad Vigaun gebracht und dort gründlich<br />
gereinigt: zuerst in einem Kristallsoda-Bad zum<br />
Lösen hartnäckiger Verschmutzung, dann mit<br />
Bürsten, Spachteln, Schustermesser, Schleifvlies,<br />
Putzwatte und Öl, und zwar ausschließlich händisch<br />
ohne irgendeine maschinelle Unterstützung.<br />
Abb. 11: Das zerlegte Werk nach der gründlichen Reinigung vor dem Wiederaufbau:<br />
links die Teile des Gestells mit geschmiedeter Oberfläche, unten und rechts die Teile mit polierter,<br />
feuerverzinnter Oberfläche.
112 MICHAEL NEUREITER – BAD VIGAUN<br />
12<br />
Dabei wurde bald eine Besonderheit des Werks<br />
deutlich: Es zeigten sich nämlich geschmiedete<br />
Oberflächen und glatte Oberflächen, die nach<br />
dem Reinigen einen Silberglanz bekamen. Eine<br />
Expertise eines Freundes, des Metallrestaurators<br />
Georg Riemer, bestätigte »kaum nennenswerte<br />
Korrosionserscheinungen« und klärte die glatten<br />
Flächen: Es handelt sich beim Großteil des Werks<br />
um feuerverzinnte Teile, das geht bis zu den Keilen<br />
und den ganz wenigen Schrauben.<br />
Die Verzinnung ist eine Besonderheit, die eher<br />
selten zu finden ist, z. B. bei den Turmuhren von<br />
Johann Bentele sen. für den Dom (1782) und für<br />
die Pfarrkirche Mülln (1799) sowie bei der Salzburger<br />
Rathausuhr seines Sohnes Johann jun.<br />
(1802). Wir finden diese aufwändige Oberflächenbehandlung<br />
auch schon beim Werk des Salzburger<br />
Glockenspiels von Jeremias Sauter anfangs<br />
des 18. Jahrhunderts. Wegen der nur geringen<br />
Rostspuren konnte bei der Restaurierung eine<br />
zusätzliche Oberflächensicherung unterbleiben.<br />
Das Hakenrad ist das Herz des Gehwerks, es<br />
bewegt den Anker und mit ihm das Pendel. In<br />
St. Peter ist es wie meist aus Messing gefertigt und
DAS TURMUHRWERK 1780 DER STIFTSKIRCHE ST. PETER, SALZBURG<br />
113<br />
13<br />
Abb. 12: Die feuerverzinnte Schlossscheibe<br />
des Viertelschlagwerks nach<br />
der Reinigung: Sie steuert die Zahl der<br />
Schläge (1 – 4) zu den Viertelstunden.<br />
Abb. 13: Ein Blick auf das Gehwerk<br />
und das Stundenschlagwerk auf der<br />
Rückseite zeigt den Kontrast zwischen<br />
geschmiedeten und feuerverzinnten<br />
Teilen. Links die in den Turm aufsteigende<br />
Zeigerleitung.<br />
Abb. 14: Eines der elf Lagerstützräder<br />
aus Messing mit dem Bronzereif.<br />
14<br />
mit den Speichen verschraubt: Das erleichtert bei<br />
stärkerer Abnützung den Austausch. Der Anker,<br />
die Welle und der Laterntrieb sind wie das darunterliegende<br />
Zwischenrad feuerverzinnt.<br />
Eine kostenintensive Besonderheit des Turmuhrwerks<br />
von St. Peter (und der Domuhr 1782)<br />
sind die Lagerstützräder, die das Auslaufen der<br />
Messinglager verhindern: Erst beim Reinigen<br />
der stark verschmutzten Teile stellte sich heraus,<br />
dass die Lagerstützräder aus Messing außen mit<br />
einem Bronzering versehen sind und damit weniger<br />
Abnützung zeigen.<br />
Der Wiederaufbau des Werks war einfach, weil<br />
das Gestell bestens markiert ist – mit Dreiecken<br />
in der unteren und mit Punkten in der oberen<br />
Ebene. Dazu kommen häufige Kennzeichnungen<br />
vor allem mit »G« für Teile des Gehwerks und<br />
»V« bzw. »S« für solche des Viertel- bzw. des<br />
Stundenschlagwerks.<br />
Johann Bentele sen. schuf mit seinem großen<br />
Werk für St. Peter eine Kostbarkeit: Die Reinigung<br />
der beiden Windflügel, die als Windbremse<br />
den gleichmäßigen Ablauf sicherstellen, brachte
114 MICHAEL NEUREITER – BAD VIGAUN<br />
zutage, dass diese mit goldfarbenen Ornamenten<br />
verziert waren, Reste konnten erhalten werden.<br />
Eine weitere noch nie vorgefundene Überraschung.<br />
Die Uhrmacher der Familie Bentele schroteten<br />
bei Umbauten von alten Werken oft die vorhandenen<br />
dekorativen Gestellbekrönungen ab und<br />
beseitigten sie, vermutlich auch beim alten Werk<br />
von St. Peter, das nach Abtenau geschenkt wurde.<br />
Andererseits krönten sie ihre neuen besonderen<br />
Werke mit Holzvasen auf den vier Eckpfeilern.<br />
Neben St. Peter war dies auch bei den Werken<br />
von Johann Bentele sen. für den Dom und die<br />
Pfarrkirche Söll in Tirol sowie beim Werk seines<br />
Sohnes Johann jun. für das Salzburger Rathaus<br />
der Fall. Jeremias Sauter hatte für das Glockenspielwerk<br />
Vasen aus Blech gestaltet.<br />
Das Kontrollzifferblatt war nur zu reinigen. Es<br />
zeigt das Wappen von St. Peter mit den gekreuzten<br />
Schlüsseln und das Wappen von Abt Beda<br />
Seeauer mit zwei Dromedaren und zwei baumbestandenen<br />
Seen. Das Zifferblatt hat nur einen<br />
(ergänzten) Minutenzeiger: Damit war beim<br />
Aufziehen die Kontrolle der Anzeige auf den<br />
Zifferblättern außen möglich. Im Schriftbalken<br />
darunter: »Gemacht im Jahre 1780 von J. Bendele.<br />
Reparirt im Jahre 1865 von Kaspar Posch.«<br />
15<br />
Abb. 15: Der Windflügel des Viertelschlagwerks<br />
mit Resten der goldfarbenen<br />
Ornamente.<br />
Abb. 16: Im Bild die Holzvasen von<br />
St. Peter: rechts die zwei vorhandenen<br />
und mit den Knospen ergänzten Vasen,<br />
links die beiden im Zuge der Restaurierung<br />
neu angefertigten Vasen.<br />
Abb. 17: Im Bild der Blick durch das<br />
Kontrollfenster auf das Kontrollzifferblatt:<br />
Die Zeigerleitung, auf der der<br />
Minutenzeiger sitzt, führt zur Orgeluhr.
DAS TURMUHRWERK 1780 DER STIFTSKIRCHE ST. PETER, SALZBURG<br />
115<br />
16<br />
17
Abb. 18: Das Zifferblatt der Orgeluhr mit verstellten Zeigern (alte Zeigerstellung<br />
mit langem Stunden- und kurzem Minutenzeiger) am derzeit leeren Orgelkasten.<br />
Die Aufsatzfiguren der Heiligen Petrus (oben, urspr. Gottvater), Rupert<br />
(links) und Vitalis stammen vom ehemaligen Hochaltar Hans Waldburgers 1625.<br />
Rupert war der erste Bischof von Salzburg und erster Abt von St. Peter, er hat<br />
ein Salzfass als Attribut.
118 MICHAEL NEUREITER – BAD VIGAUN<br />
Das Turmuhrwerk versorgte mit der Minutenbewegung<br />
die vier Zifferblätter am Turm außen<br />
und das Zifferblatt der Orgel. Das Orgelzifferblatt<br />
im Gehäuse von 1618 / 20, das 1762 / 63 umgebaut<br />
wurde, wurde auch schon vom Vorgängerwerk<br />
der Turmuhr 1780 angetrieben, das sich heute in<br />
Abtenau befindet. Das Orgelzifferblatt hat (wie<br />
die Zifferblätter am Turm außen) noch heute die<br />
alte Zeigerstellung und wird mit dem Einbau der<br />
neuen Orgel von St. Peter 2024 elektronisch betrieben<br />
werden.<br />
Die Turmuhr 1780 von St. Peter ist restauriert<br />
und revitalisiert: Sie kann in Betrieb genommen<br />
werden, um so die Funktionsweise eines solchen<br />
Werks erlebbar zu machen. Ihren Dienst für die<br />
öffentliche Zeitanzeige haben längst elektrische<br />
Uhren mit elektronischer Steuerung übernommen.<br />
Im Turm von St. Peter werden aber am historischen<br />
Werk der Fortschritt in der »Vervollkommnung«<br />
der Technik und die Kunstfertigkeit<br />
vergangener Generationen sichtbar, die Erzabtei<br />
hat eine Kostbarkeit erhalten und gesichert.<br />
Abb. 19: Freude über ein gelungenes Werk bei der Präsentation des restaurierten und revitalisierten Uhrwerks<br />
im Turm der Stiftskirche St. Peter: v.l. Erzabt Korbinian Birnbacher OSB, Baumeister Daniel Bleierer<br />
(Baumanagement) und Turmuhrmacher Michael Neureiter.
DAS TURMUHRWERK 1780 DER STIFTSKIRCHE ST. PETER, SALZBURG<br />
119<br />
Abb. 20: Die Turmuhr Annaberg 1779 von Johann<br />
Bentele sen. mit den Wappen von St. Peter und Abt<br />
Beda Seeauer.<br />
Abb. 21: Das Turmuhrwerk im Nordturm des Salzburger<br />
Doms, geschaffen von Johann Bentele sen. im<br />
Jahr 1782, ist die »Jüngere Schwester« der Uhr von<br />
St. Peter. Es ist mit seiner Breite von 206 cm wohl<br />
das größte Turmuhrwerk landesweit.<br />
Zeitkünder und Zeitzeugen<br />
Die Uhrmacherdynastie Bentele prägte Salzburg<br />
von 1736 bis 1824. 25 Jacob, Johann sen. und Johann<br />
jun. nahmen hintereinander die Funktion<br />
eines Hofuhrmachers wahr. Dazu wurden sie<br />
durch die jeweiligen Erzbischöfe ernannt. Diese<br />
regierten von 1328 bis zum Reichsdeputationshauptschluss<br />
1803 Salzburg als selbstständiges<br />
Territorialfürstentum.<br />
Im Stift St. Peter befindet sich in der Prälatur<br />
auch eine Standuhr mit dem Wappen eines<br />
Grafen Truchseß-Zeil, bezeichnet mit »Johannes<br />
Bentele in Salzburg«. 26 Abt Beda Seeauer besorgte<br />
für das zu St. Peter gehörige Vikariat zu Annaberg<br />
1779 eine völlig neue Turmuhr von Johann<br />
Bentele sen. 27 1813 gab es eine neue Turmuhr<br />
für die Stiftspfarre Grödig, geliefert von Johann<br />
Bentele jun. Das große Werk Jeremias Sauters für<br />
Maria Plain – die Wallfahrtskirche gehörte und<br />
gehört zu St. Peter – wurde von Johann sen. 1785<br />
umgebaut.<br />
Weitere Turmuhren aus der Bentele-Werkstatt<br />
sind zahlreich, in der Turmuhren-Datenbank<br />
www.turmuhrenaustria.at sind derzeit 20 gründlich<br />
erfasst. So gab es neue Turmuhren u.a. für<br />
Golling (1764), Salzburg-Franziskanerkirche<br />
(1765), Puch-Urstein (1785), Mülln (1799), Salzburg-Rathaus<br />
(1802), Zell am See (1811), Kuchl-<br />
Georgenberg (1812), Hallein, Mattsee-Zellhof …<br />
Umbauten waren wegen der Kostbarkeit des Materials<br />
noch häufiger, etwa in Lamprechtshausen-<br />
Arnsdorf (1781), Dürrnberg (1788), Kuchl (1789),<br />
Oberalm und Vigaun (beide 1790), St.Jakob am<br />
Thurn (1793)… 28<br />
Turmuhren sind Zeit-Künder und Zeit-Zeugen:<br />
Sie hatten durch Jahrhunderte die Aufgabe der<br />
»allgemeinen Benachrichtigung über den unaufhaltsamen<br />
Zeitverfluß« 29 als Zeit-Künder. Nur<br />
mehr wenige alte Turmuhrwerke sind nach wie<br />
vor als solche Zeitanzeiger im Einsatz. Und:<br />
Turmuhren sind Zeit-Zeugen und belegen die<br />
Entwicklung der Zeitmessung und ihre Fortschritte<br />
über Jahrhunderte: Die Turmuhr 1780<br />
der Erzabtei St. Peter ist ein interessanter Zeuge<br />
für die »Vervollkommner derselben (Uhrwerke)<br />
für diesen der Menschheit erwiesenen immerfort<br />
dauernden Dienst«. 30
120 MICHAEL NEUREITER – BAD VIGAUN<br />
Anmerkungen<br />
1 Karl Friedrich Buschendorf, 1756 – 1811, war<br />
»Theologe, Technologie, Schriftsteller« und publizierte<br />
zu verschiedensten Themen (Deutsche<br />
Biographie https://www.deutsche-biographie.de/<br />
sfz022_00368_1.html, abgerufen am 30. 08. 2021).<br />
Im Interimsregister der Enzyklopädie der Neuzeit<br />
und in der Deutschen Digitalen Bibliothek wird<br />
sein Geburtsjahr mit 1763 angegeben.<br />
2 Buschendorf, Karl Friedrich: Gründlicher Unterricht<br />
von Thurmuhren …, Leipzig 1805. (Facsimile-Edition<br />
des Fachkreises Turmuhren der<br />
Deutschen Gesellschaft für Chronometrie, Nürnberg<br />
2010), S. III.<br />
3 Tietze, Hans: Die Denkmale des Benediktinerstiftes<br />
St. Peter in Salzburg. Wien 1913. (Österreichische<br />
Kunsttopographie Bd. XII), S. XXXI f., auch<br />
digital: https://diglib.tugraz.at/die-denkmale-desbenediktinerstiftes-st-peter-in-salzburg-1913-12,<br />
abgerufen am 31 .08. 2021.<br />
4 Ebda. S. XXXVIII.<br />
5 Ebda. S. XLII.<br />
6 Ebda. S. XLIII.<br />
7 Fuhrmann, Franz: Die Baugeschichte von Kirche<br />
und Kloster, in: St. Peter in Salzburg. Das älteste<br />
Kloster im deutschen Sprachraum. 3. Landesausstellung<br />
1982, Salzburg 1982, S. 174 – 180, hier S. 178.<br />
8 Tietze: Denkmale St. Peter S. CXXVIII.<br />
9 Freundliche Auskunft von Wolfgang Komzak, Leiter<br />
des Museums für Turmuhren und Bratenwender<br />
»Uhrenstube Aschau«, 7432 Oberschützen,<br />
Burgenland.<br />
10 Hahnl, Adolf: Conservando cresco: Die Bibliotheksräume<br />
von St. Peter, in: Plus librorum. Beiträge<br />
von Adolf Hahnl zur Salzburger Kunstgeschichte,<br />
Salzburg 2013, S. 173 – 198, hier S. 174.<br />
(aus: Barock in Salzburg. Festschrift für Hans<br />
Sedlmayr, Salzburg und München 1977, S. 9 – 56).<br />
11 Hahnl: Conservando cresco, S. 176.<br />
12 Tietze: Denkmale St. Peter, S. CXL.<br />
13 Ebda. S. CXLVII.<br />
14 Berhandtsky, Placidus: Auszug der Neuesten Chronick<br />
des alten Benediktiner Klosters zu St. Peter in<br />
Salzburg. Teil 1, Salzburg 1782. S. 309 f., auch digital:<br />
https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/<br />
bsb10800708?page=1, abgerufen am 31. 08. 2021.<br />
15 Fuhrmann: Baugeschichte, S. 179.<br />
16 Martin, Franz: Von unseren Kirchtürmen, in:<br />
ders.: Aus Salzburgs Vergangenheit. Gesammelte<br />
Aufsätze, Salzburg 1942 (Beiheft zu den Mitteilungen<br />
der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde),<br />
S. 10 – 14, hier S. 13.<br />
17 Joseph Christoph Schmidt war 1712 Werkstattnachfolger<br />
von Jeremias Sauter, der das Werk<br />
des Salzburger Glockenspiels baute. 1733 lieferte<br />
der »Bürger und Hofuhrmacher« Schmidt eine<br />
Hängeuhr in das Stift St. Peter. (Tietze: Denkmale<br />
St. Peter S. CXLV).<br />
18 Specification der Bau-Unkosten des Neuen Thurn-<br />
Gebäu zu St. Peter, Handschrift 1754 ff., Archiv der<br />
Erz abtei St. Peter. Hier darf ich dem Archivar von St. <br />
Peter, Gerald Hirtner, für seine Hilfe sehr danken!<br />
19 Berhandtsky, Placidus: Auszug der Neuesten Chronick<br />
des alten Benediktiner Klosters zu St. Peter in<br />
Salzburg. Teil 2, Salzburg 1782. S. 252., auch digital:<br />
https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/<br />
bsb10721386?page=,1, abgerufen am 31. 08. 2021.<br />
20 Mehr zu diesem Turmuhrwerk in: Michael Neureiter:<br />
Uhren auf Tennengauer Türmen. Zeit-Künder<br />
und Zeit-Zeugen aus vier Jahrhunderten und<br />
zwölf Gemeinden, in: Forschungen des Museum<br />
Burg Golling, Bd. 1, Golling 2015, S. 111 – 121, hier<br />
S. 114 f., auch digital: https://www.horologium.at/<br />
files/Dokumente/Publikationen/FestschriftUrba -<br />
nekZeitkuender2015.pdf, abgerufen am 30. 08. 2021.<br />
21 Im Langhaus der Stiftskirche befinden sich an<br />
der Südseite zwei Bilder von F. X. König (1757 / 61)<br />
mit Ansichten des Klosters – eine zeigt den Turm<br />
mit Zifferblättern nach dem Turmausbau in der<br />
1750er-Jahren, die andere den Turm vor dem<br />
Umbau ohne Zifferblatt! In diesem Beitrag zeigt<br />
die Abbildung 2 von 1657 keine Zifferblätter, die<br />
Abbildung 4 aus 1740 sehr wohl!<br />
22 Berhandtsky: Chronick Teil 2, S. 250.<br />
23 Das Jahreseinkommen eines Universitätsprofessors<br />
soll in dieser Zeit 300 Gulden ausgemacht<br />
haben, das eines Lehrers 22, das eines Dienstmädchens<br />
12.<br />
24 Tietze: Denkmale St. Peter S. CLXIX, CLXXXIII,<br />
CLXXXIV und CXCII.<br />
25 Siehe dazu Michael Neureiter: Das Bentele-Jahrhundert<br />
1734 bis 1826. Eine Großuhrmacher-<br />
Familie prägt die Salzburger Uhrenlandschaft,<br />
in: Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für<br />
Chronometrie Nr. 59, Herbst 2019, Nürnberg 2019,<br />
S. 56 – 63, auch digital: https://www.yumpu.com/<br />
xx/document/read/62824909/dasbentelejahrhundert1734bis1826,<br />
abgerufen am 30. 08. 2021.
DAS TURMUHRWERK 1780 DER STIFTSKIRCHE ST. PETER, SALZBURG<br />
121<br />
26 Tietze: Denkmale St. Peter 132 nennt als Standort<br />
der Standuhr den Psallierchor.<br />
27 Berhandtsky: Chronick Teil 2, S. 252.<br />
28 Siehe auch das Bentele-Gutachten von Rositha<br />
Preiß aus 1990 auf www.horologium.at, der Website<br />
Michael Neureiters: https://www.yumpu.com/<br />
xx/document/read/63025366/preissbentele, abgerufen<br />
am 30. 08. 2021.<br />
29 Buschendorf: Gründlicher Unterricht, S IV.<br />
30 Ebda. S. III. Karl Friedrich Buschendorf starb wie<br />
Johann Bentele sen. im Jahr 1811.<br />
31 Hahnl, Adolf: Die Bauentwicklung des Petersklosters,<br />
in: St. Peter in Salzburg. Das älteste Kloster im<br />
deutschen Sprachraum. 3. Landesausstellung 1982,<br />
Salzburg 1982, Katalog, S. 312 f.<br />
32 Ebda. S. 313.<br />
Bildnachweis<br />
Erzabtei St. Peter, Kunstsammlung, M 1370.2: 2<br />
Erzabtei St. Peter, Kunstsammlung, M 1370.4: 3<br />
horologium, Chris Hofer: 1, 10, 17–19<br />
horologium, Michael Neureiter: 6, 7–9, 11–16, 20, 21<br />
http://www.ubs.sbg.ac.at/sosa/graphiken/salzburg.<br />
htm, abgerufen am 28 08 2021: 4<br />
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:<br />
Kirchturm_von_St._Peter_Salzburg.jpg,<br />
abgerufen am 28 08 2021: 5<br />
SALZBURG24/Wurzer: Autorenfoto<br />
Michael Neureiter<br />
Geboren in Hallein, Studium der Theologie und Philosophie (Schwerpunkt<br />
Geschichte) an der Universität Salzburg, mit seiner Familie<br />
(Gattin Franziska und drei Kinder) zuerst wohnhaft im Stift St. Peter<br />
in Salzburg und seit 1983 in Bad Vigaun. Berufe bei der Erzdiözese<br />
Salzburg und in der Erwachsenenbildung, vor allem in der katholischen<br />
Bibliotheksarbeit. Politisches Engagement im Salzburger Landtag, u. a.<br />
als dessen Zweiter Präsident. Seit der Jugend Interesse am Kulturgut<br />
Turmuhren, 2003 als Autodidakt Gewerbeschein als Uhrmacher. Zuerst<br />
Sammeln, dann Konzentration auf das Dokumentieren vom Turmuhrwerken,<br />
auf das Restaurieren und das Revitalisieren möglichst am<br />
»Tatort«. Arbeiten u.a. zu den Salzburger Uhrmacherfamilien Sauter<br />
und Bentele, Entwicklung der Turmuhren-Datenbank www.turmuhrenaustria.at<br />
mit Werken aus derzeit 16 europäischen Staaten, Erschließung<br />
der Projekte und Publikationen auf www.horologium.at.<br />
2020 Nominierung mit »Initiativen für historische Turmuhren« für den<br />
EU-Kulturpreis »Europa Nostra«.