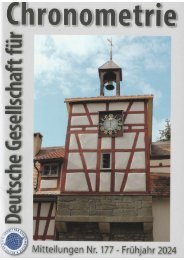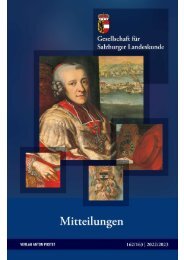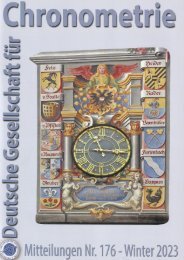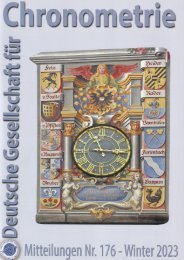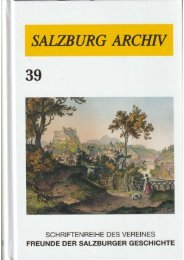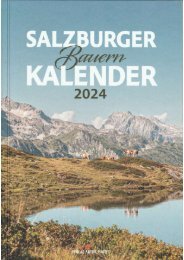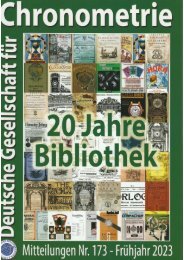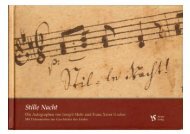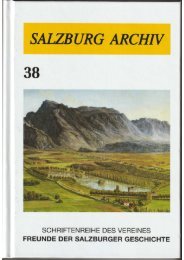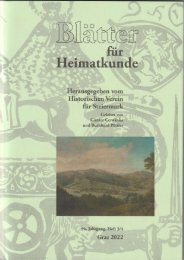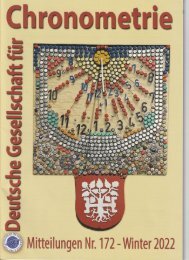WolfgangvRSbgerVolkskultur
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Wolfgang von Regensburg<br />
REFORMER, POLITIKER, EINSIEDLER?<br />
TEXT Michael Neureiter // FOTOS Wikimedia Commons, Markus Fanninger,<br />
Augustin Kloiber, Michael Neureiter, Verlag St. Peter/Reinhard Weidl<br />
dieses Heiligen hat die Gegenden von Mondsee und<br />
Abersee besonders geprägt, auch wenn er wohl nur<br />
gut ein Jahr hier lebte.<br />
Das Leben einer prägenden Persönlichkeit …<br />
Mit sieben Jahren wurde Wolfgang einem Weltpriester<br />
übergeben, der ihn im elterlichen Hause<br />
unterrichtete. Etwa mit zehn kam er zu den Benediktinern<br />
in Reichenau am Bodensee zur damals üblichen<br />
Kleriker-Ausbildung und um 946 an die Domschule<br />
in Würzburg zum Abschluss des Studiums.<br />
Entgegen seinem Wunsch, sich in die Einsamkeit<br />
zurückzuziehen und Mönch zu werden, folgte er 956<br />
der Bitte des neuen Erzbischofs von Trier Heinrich,<br />
seines Freundes aus der Studienzeit, und wurde<br />
dort Lehrer an der Domschule und Seminarregens,<br />
war aber noch immer nicht Priester. 964 starb der<br />
Die Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Wolfgang heute<br />
(© Wikimedia Commons, C. Stadler/Bwag).<br />
2024 wird ein „Wolfgang-Jahr“: Der hl. Wolfgang<br />
hat Salzburg-Bezug und wurde um das Jahr 924 im<br />
Schwabenland geboren. Geburtstag und Geburtsjahr<br />
sind nicht verbürgt und wir sind auf Schätzungen<br />
angewiesen. Er mag bei seinem Ableben 994<br />
etwa siebzig Jahre alt gewesen sein. Seine Eltern sollen<br />
aus Pfullingen gekommen sein, einer Kleinstadt<br />
im Landkreis Reutlingen in Baden-Württemberg.<br />
Auch wenn das Geburtsjahr nicht sicher ist: Es<br />
tut gut, sich einer vor 1.100 Jahren geborenen Persönlichkeit<br />
zu erinnern, die ihrem Jahrhundert, dem<br />
„saeculum obscurum“, dem „dunklen Jahrhundert“,<br />
ihren eigenen Stempel aufdrückte und auch in die<br />
folgenden Jahrhunderte hinein wirkte. Die Verehrung<br />
Thomas<br />
Schwanthaler<br />
integrierte das<br />
Gnadenbild, die<br />
gotische Statue des<br />
hl. Wolfgang (um<br />
1430), in seinen<br />
Doppelaltar für<br />
die Kirche von<br />
St. Wolfgang, und<br />
zwar in den linken<br />
Tabernakel.<br />
(© Wikimedia<br />
Commons,<br />
Wolfgang Sauber).<br />
64
Das Benediktinerkloster<br />
St. Emmeram<br />
in Regensburg wurde<br />
um 739 gegründet<br />
und bestand bis zur<br />
Säkularisation 1803.<br />
(© Wikimedia<br />
Commons, Nikater).<br />
Erzbischof auf einer Romreise mit Kaiser Otto I. an<br />
der Pest. Er empfahl aber vor seinem Tod Wolfgang<br />
dem Kaiser und bat um seinen Schutz, weil jener wegen<br />
seiner strengen Lebensauffassung einigen verhasst<br />
war. Der Kaiser nahm Wolfgang in die Reichskanzlei<br />
in Köln, was diesem aber nicht zusagte. Er<br />
trat schon ein Jahr später in das strenge, erst 934<br />
begründete Benediktinerkloster Maria Einsiedeln<br />
ein, wurde Lehrer und 968 zum Priester geweiht.<br />
971 wurde er als Missionar nach Ungarn entsandt<br />
und 972 zum Bischof von Regensburg ernannt. Erzbischof<br />
Friedrich, Salzburgs letzter „Abterzbischof“,<br />
der auch Abt von St. Peter war, weihte ihn zum Bischof.<br />
Wolfgang verließ das Kloster, legte aber das<br />
Mönchtum und den Habit der Benediktiner nicht ab.<br />
Als Bischof war er auch Abt des Benediktinerklosters<br />
St. Emmeram in Regensburg und des 748<br />
gegründeten Klosters Mondsee, das zum Bischofsgut<br />
gehörte. Dieses wurde von seinen Vorgängern nachweislich<br />
immer wieder auch bei Entscheidungen<br />
aufgesucht. Wolfgang zeigte sich rasch als Reformer:<br />
Er gab St. Emmeram einen Abt, baute die Bibliothek<br />
und Schule aus und machte das Kloster zu einem<br />
Brennpunkt religiösen und kulturellen Lebens.<br />
Regensburg wurde zu einem „zweiten Athen“. Buchmalerei<br />
und Goldschmiedekunst blühten auf. Mehr<br />
als hundert Klöster wurden von seinen Reformen<br />
erfasst. Er sicherte auch dem Konvent seines Eigenklosters<br />
Mondsee seine vollen Rechte. Böhmen, das<br />
zum Regensburger Missionsgebiet gehörte, erhielt<br />
um 973 mit seiner Zustimmung eine selbstständige<br />
kirchliche Organisation. Das Bistum Prag wurde<br />
gegründet. Nach dem Tod Kaiser Ottos I. 973 gab es<br />
einen heftigen Streit um die Herrschaft im Reich zwischen<br />
seinem Sohn Otto II., der schon 967 im Alter<br />
von zwölf Jahren vom Papst zum Mitkaiser gekrönt<br />
worden war, und seinem Cousin, dem Bayernherzog<br />
Heinrich II. dem Zänker. Wolfgang waren als Freund<br />
und Erzieher des Herzogs und als Reichsfürst die<br />
Hände gebunden. Er wollte nicht in den Aufstand<br />
des Herzogs hineingezogen werden und zog sich<br />
976 in sein Eigenkloster Mondsee zurück.<br />
Wir wissen nicht, ob Wolfgang in dieser Zeit<br />
auch tatsächlich als Einsiedler am Falkenstein lebte,<br />
wovon die Legende weiß. Belegt ist, dass er schon im<br />
Spätherbst 977 nach Regensburg zurückkehrte.<br />
Wolfgangs an Initiativen reiches Leben fand ein<br />
jähes Ende: 994 machte er sich auf der Donau auf die<br />
Reise nach Pöchlarn, um mit Erzbischof Hartwig von<br />
65
Der Deckel der ehemaligen<br />
Tumba des hl. Wolfgang<br />
aus dem 14. Jahrhundert im<br />
südlichen Seitenschiff der<br />
Basilika St. Emmeram in<br />
Regensburg (© Wikimedia<br />
Commons, Schmeissnerro).<br />
Salzburg eine Arrondierung des Mondseer Streubesitzes<br />
in der Ostmark zu verhandeln und geschlossene<br />
Güterkomplexe zu schaffen. Auf dem Weg wurde<br />
er schwer krank. Er ließ sich in Pupping, heute<br />
im Bezirk Eferding, an Land bringen und verstarb<br />
am 31. Oktober 994 in der dortigen Otmarkapelle.<br />
Diese war vielleicht eine Stiftung der Regensburger<br />
Kaufmannschaft.<br />
Der Verstorbene wurde zurück nach Regensburg<br />
gebracht und in St. Emmeram, wo er sein Reformwerk<br />
begonnen hatte, beigesetzt. 1052 wurde<br />
er heiliggesprochen und in der neu errichteten<br />
Wolfgang-Krypta beigesetzt, in deren Altar sich<br />
der Wolfgang-Schrein befindet. Er ist Patron von<br />
Regensburg und Bayern.<br />
… und die vielfältige Legende<br />
Schon bald nach dem Tode des hl. Wolfgang<br />
erschien eine beachtliche Reihe von Lebensbeschreibungen.<br />
Sie enthalten wie viele Heiligenleben<br />
des Mittelalters Historisches und Legendäres bunt<br />
nebeneinander. Das älteste erhaltene Dokument<br />
stammt von Arnold, Prior von St. Emmeram, der<br />
es um 1037 schrieb. Sein Mitbruder Othloh – seine<br />
Vita St. Wolfgangi entstand um 1045 – ist ebenfalls<br />
fast ein zeitgenössischer Berichterstatter. Beide<br />
heben den historischen Aufenthalt Wolfgangs in<br />
Mondsee 976/977 nicht eigens hervor. Es ist nicht<br />
von der Hand zu weisen, dass Wolfgang sich in diesem<br />
Mondseer Jahr auch um den Besitz am Abersee<br />
kümmerte. Darauf beziehen sich die „Landshuter<br />
Wolfgangsdrucke“: „leben und legend des himelfürsten<br />
und heyligen peichtigers San Wolfgangs, was der<br />
almechtig got durch inn gewürckt, von kintheit auff piß<br />
ann sein endt […]“ steht auf dem Titelblatt der Landshuter<br />
Wolfgangsdrucke. („Beichtiger“ bedeutet „Bekenner“.)<br />
Das Buch wurde im Benediktinerkloster<br />
Mondsee zusammengetragen und erschien 1515<br />
in Landshut, verlegt durch Johann Weyssenburger.<br />
1516 und 1522 gab es inhaltsgleiche Neuauflagen,<br />
1516 auch eine in Latein. In den Texten und den<br />
50 großteils vorzüglichen Holzschnitten des Buchs<br />
geht es um legendäre Züge und um wirklichkeitsnahe<br />
Begebenheiten. Wir kennen weder den Autor bzw.<br />
die Autoren noch die Namen des Künstlers oder der<br />
Künstler. Sicher ist, dass vorangehende Beschreibungen<br />
der Vita des Heiligen bekannt waren. Unverkennbar<br />
ist auch eine stilistische Verwandtschaft<br />
der Holzschnitte mit Meistern der Donauschule,<br />
mit Albrecht Altdorfer und Wolf Huber. Beide hatten<br />
Verbindungen zum Kloster Mondsee. Dessen<br />
Mönche waren auch die Betreuer der Wallfahrt nach<br />
St. Wolfgang am Abersee. Im Kloster Mondsee wurde<br />
sein Andenken durch die Jahrhunderte bis zur Aufhebung<br />
1791 in Ehren gehalten.<br />
Die Legenden in den Wolfgangsdrucken (folgende<br />
Zitate nach Bleibrunner) berichten vom Aufenthalt<br />
66
in Mondsee und schildern in dichterischer Ausschmückung<br />
der durch die Kriegswirren veranlassten<br />
Flucht in Wolfgangs Eigenkloster Mondsee<br />
einige wundersame Begebenheiten. Die Legenden,<br />
wie Wolfgang „an das Gebirg kam, das Falkenstein<br />
genannt wird“, werden dann zur Grundlage für<br />
die Entstehung der Wallfahrt, für die Kirche von<br />
St. Wolfgang u. a. m.<br />
Wolfgangs „frommer, andächtiger Bruder“, der<br />
mit ihm aus Regensburg kam, konnte demnach<br />
oben am Falkenstein den Mangel an Wasser nicht ertragen:<br />
Wolfgang fiel auf die Knie und betete. „Dann<br />
stieß er seinen Stab an einen Felsen und sogleich trat<br />
eine schöne lautere Quelle aus ihm hervor, die noch<br />
heut dort vor der Menschen Augen fließt.“ An das Wasserwunder<br />
erinnert die Brunnkapelle.<br />
Eine andere Begebenheit in der Legende ist der<br />
Hackelwurf: Im Blick auf den See und das herrliche<br />
Tal flehte Wolfgang zu Gott, er möge ihm den Platz<br />
bezeichnen, wo er seinen schuldigen Dank abstatten<br />
könne. Einer Eingebung folgend, warf er sein Beil<br />
„und fand es bei einem großen See auf einem harten<br />
Fels liegen“. Die Hackelwurfkapelle erinnert daran.<br />
(Ein Beilwurf diente nach altem deutschem Recht<br />
der Ermittlung einer Grenze und war somit auch ein<br />
Längenmaß. Der Beilwurf von beachtlicher Länge ist<br />
Sinnbild des Besitzergreifens.)<br />
Wolfgang machte sich nach der Legende umgehend<br />
an den Bau einer Hütte und nicht unweit davon<br />
eines Kirchleins zum hl. Johannes. Während der Arbeit<br />
erschien ihm der Teufel und bot seine Mithilfe<br />
an, wenn ihm nach vollendetem Werk als Lohn der<br />
erste Besucher dieser Kirche geopfert werde. Auf<br />
das Gebet des Heiligen hin überschritt die Schwelle<br />
dann ein Wolf, mit dem der ergrimmte und schreiende<br />
Teufel vorliebnehmen musste.<br />
Zu den Legenden und ihrer teils üppigen Phantasie<br />
gehört auch, dass Wolfgang einen Jäger traf,<br />
der ihn erkannte und dies in Regensburg kundtat.<br />
Daraufhin gab Wolfgang trotz Widerstrebens dem<br />
Wunsch der Regensburger nach seiner Heimkehr<br />
nach und beschloss zurückzukehren.<br />
Ein Holzschnitt aus den Landshuter Wolfgangsdrucken zeigt<br />
Wolfgang mit dem Beil, dem „Hackel“. (© Michael Neureiter)<br />
Der Teufel beim Kirchenbau. Deckenfresko der<br />
Wolfgangkapelle in der Pfarrkirche St. Wolfgang,<br />
geschaffen 1714 vom Salzburger Hofmaler Jacob Zanusi.<br />
(© Wikimedia Commons, Wolfgang Sauber)<br />
67
Rastkapelle und kommt zur Falkensteinbauernkapelle.<br />
In Ried überschreitet man den Dittlbach, die<br />
alte Grenze zwischen Salzburg und Oberösterreich,<br />
und kommt in St. Wolfgang an. Die Pfarr- und Wallfahrtskirche<br />
zum hl. Wolfgang wurde 1183 erstmals<br />
erwähnt, als Filialkirche der Klosterpfarre Mondsee.<br />
Eine steinerne Kirche ist urkundlich 1291 belegt.<br />
Der Altar von Michael Pacher wurde 1481 fertiggestellt<br />
und ist der einzige komplett erhaltene Altar<br />
des Malers und Bildschnitzers, der 1498 in Salzburg<br />
starb. Der Doppelaltar von Thomas Schwanthaler<br />
wurde 1676 vollendet und trägt das Gnadenbild des<br />
hl. Wolfgang um 1430 (Abb. b). In der Wolfgangkapelle<br />
befindet sich der Bußstein, der nach der Legende<br />
die Abdrücke der Hände und Füße des Heiligen zeigt.<br />
Das Wallfahrtskirchlein auf dem Falkenstein (© Michael Neureiter)<br />
Verehrung am Abersee …<br />
Oben auf dem Falkenstein steht das Wallfahrtskirchlein<br />
„zu unserer Lieben Frau und dem heiligen<br />
Wolfgang“, 1626 erbaut und 1692 erneuert. Eine<br />
Kapelle wurde schon 1350 urkundlich erwähnt.<br />
Sicher stand hier schon im fünfzehnten Jahrhundert,<br />
zur Zeit der Hochblüte der Wallfahrt, eine Kapelle.<br />
Von 1639 bis 1811 gab es hier auch eine Klausnerei,<br />
Fundamente wurden 2012 gefunden. Hier soll sich<br />
auch die legendäre Einsiedelei des Heiligen befunden<br />
haben.<br />
Von der Wallfahrt ist erstmals 1306 zu lesen,<br />
sie dürfte aber schon viel früher eingesetzt haben.<br />
St. Wolfgang soll um 1500 nach Rom, Santiago de<br />
Compostela und Aachen die beliebteste Wallfahrtsstätte<br />
in Europa gewesen sein. In Spitzenzeiten sollen<br />
jährlich etwa 300.000 Pilgerinnen und Pilger<br />
am Falkenstein gewesen sein, andere schreiben von<br />
80.000. Im 18. Jahrhundert wird von 18.800 jährlichen<br />
Besucherinnen und Besuchern an den Stätten<br />
am Abersee berichtet. Das Falkensteinkirchlein ist<br />
der Höhepunkt einer Reihe von Gedenkkapellen entlang<br />
des Wegs von St. Gilgen/Fürberg bis Ried und<br />
St. Wolfgang: Nach der Schächerkapelle erreicht<br />
man die Lichtung unterhalb des Falkensteinkirchleins,<br />
trifft danach auf die Brunnkapelle, passiert<br />
die Schlafkapelle, die Hackelwurfkapelle und die<br />
Das Altarbild des Wallfahrtskirchleins auf<br />
dem Falkenstein (© Michael Neureiter) von<br />
Adam Pürkmann (um 1630) zeigt Christus, Maria und<br />
Wolfgang mit Wolfgangs pilgern an der Donau,<br />
im Hintergrund Regensburg. Wolfgang ist hier<br />
als Bischof mit einer Kirche dargestellt.<br />
68
Das Oberbild des Altars der Wolfgangkapelle der<br />
Stiftskirche St. Peter in Salzburg wurde von Franz<br />
Xaver König um 1775 geschaffen und zeigt den<br />
Heiligen im Habit mit Kirche, Mitra und Hacke.<br />
(© Verlag St. Peter, Reinhard Weidl)<br />
Ein Wolfgangiflascherl und Wolfgangihackeln im Bestand des<br />
Heimatkundlichen Museums St. Gilgen (© Augustin Kloiber)<br />
… und Erinnerung landesweit<br />
Zur Erinnerung nahmen die Wallfahrerinnen<br />
und Wallfahrer gerne Pilgerzeichen mit, denen<br />
Wirksamkeit zugeschrieben wurde. Die „Wolfgangiflascherln“<br />
enthielten Wasser aus der Brunnkapelle.<br />
Das „Wolfgangihackel“, eine verkleinerte Nachbildung<br />
des vom Heiligen geschleuderten Beils, sollte<br />
gegen viele Erkrankungen und Unheil wirken.<br />
Die Verehrung des hl. Wolfgang war und ist<br />
weit verbreitet, der 280 km lange Wolfgangweg von<br />
Regensburg nach St. Wolfgang ist in zwölf Etappen<br />
gegliedert und erfreut sich großer Beliebtheit bei<br />
Wandrerinnen, Wanderern, Bikerinnen und Bikern.<br />
Im Land Salzburg gibt es zahlreiche Darstellungen<br />
des heiligen Wolfgang in vielen Kirchen und Kapellen.<br />
Er ist Patron von Filialkirchen bzw. Kapellen<br />
in Fusch an der Glocknerstraße/Bad Fusch, Mauterndorf,<br />
St. Michael im Lungau und Salzburg/St. Peter.<br />
Gotische Aufsatzstatuette<br />
des heiligen Wolfgang,<br />
15. Jahrhundert, aus<br />
der Wolfgangkapelle<br />
St. Michael im Lungau.<br />
Der Heilige ist mit<br />
Kirchenmodell und<br />
Hackel dargestellt.<br />
(© Markus Fanninger).<br />
69
Grabmal des Kaisers solle „im Gebiet zu Mansee“<br />
errichtet werden. 1518 wurde der „Valkenstein“ als<br />
Standort des geplanten Grabmals erwähnt. 1518<br />
war Maximilian nochmals in St. Wolfgang und besuchte<br />
seine Grabstätte „auf einem sehr hohen perg<br />
des Saltzburgischen gepirgs“. Der Kaiser nahm aber<br />
etwas mehr als einen Monat später von seinem Projekt<br />
am Falkenstein Abstand und ordnete in seinem<br />
Testament die Beisetzung in der Burgkapelle in Wiener<br />
Neustadt an. Möglicherweise hatte dazu eine Intervention<br />
Leonhards von Keutschach beigetragen?<br />
Maximilian starb am 12. März 1519 in Wels und<br />
wurde am 3. Februar in der Georgskapelle in Wiener<br />
Neustadt beigesetzt. Vom großen Vorhaben des<br />
kaiserlichen Grabmals gab es bereits vierzehn große<br />
Standbilder, in der Hofkirche in Innsbruck stehen<br />
heute 40 „Schwarze Mander“.<br />
Die aquarellierte Federzeichnung auf Pergament im<br />
Ferdinandeum Innsbruck (Inv. Nr. AD 40) wird aufgrund eines<br />
Programms, das Maximilian 1512 seinem Geheimschreiber<br />
betreffend die kaiserliche Grabstiftung diktierte, als Chor<br />
einer Grabkapelle (auf dem Falkenstein?) gedeutet. (© )<br />
Ein Grabmal für Maximilian I.<br />
auf dem Falkenstein<br />
In der Blütezeit der Wallfahrten hat auch Kaiser<br />
Maximilian I. die idyllische Landschaft des Abersees<br />
mehrmals besucht. Nachdem ihm 1504 das Gebiet<br />
des Benediktinerstifts Mondsee zuerkannt worden<br />
war, traf er am 1. Dezember 1506 im Kloster Mondsee<br />
den Salzburger Erzbischof Leonhard von Keutschach,<br />
dem Maximilian kurz zuvor das soeben erworbene<br />
Gebiet verpfändet hatte. 1511 folgte ein<br />
zweiter Besuch. Ab 1514 wurde festgehalten, das<br />
Literatur<br />
Friedrich Barth: St. Wolfgang. Ein Heimatbuch,<br />
St. Wolfgang im Salzkammergut 1975.<br />
Hans Bleibrunner (Hg.): Das Leben des heiligen Wolfgang nach<br />
dem Holzschnittbuch des Johann Weyssenburger aus dem Jahr<br />
1515, Regensburg 1967.<br />
Walther Brauneis: Stift Mondsee und das Grabmalprojekt für<br />
Maximilian I., in: Das Mondseeland. Geschichte und Kultur,<br />
Katalog der Ausstellung des Landes Oberösterreich 1981 in<br />
Mondsee, S. 71–80.<br />
Walther Brauneis: Die Grabmalpläne Kaiser Maximilian I. und<br />
der St.-Georg-Ritterorden, in: Symposium zur Geschichte von<br />
Millstatt und Kärnten, Millstatt 1984, S. 20.<br />
Dehio Salzburg. Stadt und Land<br />
(Die Kunstdenkmäler Österreichs), Wien 1986.<br />
Rudolf Zinnhobler: Der heilige Wolfgang und Österreich, in:<br />
Georg Schwaiger und Josef Staber: Regensburg und Böhmen.<br />
Festschrift zur Tausendjahrfeier des Regierungsantritts Bischof<br />
Wolfgangs von Regensburg und der Errichtung des Bistums<br />
Prag, Regensburg 1972, S. 95–103.<br />
70