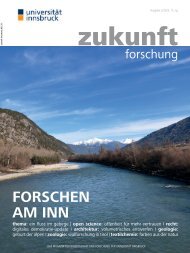Zukunft Forschung 02/2022
Das Forschungsmagazin der Universität Innsbruck
Das Forschungsmagazin der Universität Innsbruck
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Ausgabe 2/2<strong>02</strong>2, 14. Jg.<br />
zukunft forschung <strong>02</strong> | 22<br />
zukunft<br />
forschung<br />
GRENZFRAGEN<br />
thema: grenzen in der forschung | pharmazie: neuer blick auf arzneimittel<br />
wirtschaft: die visualisierung der arbeit | holzbau: geeignet für großbauten<br />
rechtswissenschaft: menschenrechte schützen | informatik: lernende roboter<br />
DAS MAGAZIN FÜR WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG DER UNIVERSITÄT INNS BRUCK
Rider: Roman Rohrmoser / Photo: Tom Klocker<br />
hybrid<br />
Steigfelle<br />
Aus dem Herz der Alpen,<br />
auf die Berge der Welt …<br />
… auf unseren contour Steigfellen<br />
mit hybrid Klebertechnologie<br />
#wearebackcountry<br />
contourskins.com<br />
contourskins<br />
2 zukunft forschung <strong>02</strong>/22<br />
Foto: Andreas Friedle
EDITORIAL<br />
LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,<br />
Grenzen prägen manchmal offensichtlich, manchmal subtil<br />
unseren Alltag, grenzen etwas real, symbolisch oder<br />
auch nur im Kopf ein, aus oder ab. Sie markieren – ganz<br />
wertfrei betrachtet – Übergänge und bieten daher viele spannende<br />
Anknüpfungspunkte für Wissenschaft und <strong>Forschung</strong>,<br />
weshalb „Grenzen“ diesmal den inhaltlichen Schwerpunkt<br />
unseres Magazins bilden.<br />
Ein großes Thema, das zahlreiche WissenschaftlerInnen an der<br />
Universität Innsbruck beschäftigt, ist die Teilung Tirols nach<br />
dem Ersten Weltkrieg. Die Folgen dieser Grenzziehung greifen<br />
wir beispielhaft anhand einer zeithistorischen Untersuchung<br />
zur Südtiroler Option auf. Grenzen sind aber auch in Hinblick<br />
auf Migration und Rechtsprechung von Bedeutung, beidem<br />
räumen wir in der aktuellen Ausgabe Platz ein. Grenzen als<br />
Übergänge hingegen beschäftigen MeteorologInnen, die Gebirgsgrenzschichten<br />
als Entstehungsorte für Wetter und Klima<br />
besser verstehen wollen. Aber auch Architektur- und Literaturforschung<br />
erweitern den Blick und das Verständnis von Grenzen<br />
im vorliegenden Magazin.<br />
Darüber hinaus vermitteln wir, wie gewohnt, spannende Einblicke<br />
in die große Bandbreite aktueller Projekte an der Universität<br />
Minion<br />
Innsbruck: So wird an der österreichweit einzigen Professur für<br />
Klinische Pharmazie für mehr Therapiesicherheit<br />
DE<br />
bei KrebspatientInnen<br />
geforscht. Aber auch über Menschenrechtsschutz<br />
und Tierwohl in Österreich sowie über die <strong>Zukunft</strong> von Hochhäusern<br />
in Holzbauweise und über viele weitere Neuigkeiten<br />
berichten wir auf den folgenden Seiten.<br />
PEFC zertifiziert<br />
Dieses Produkt<br />
stammt aus<br />
nachhaltig<br />
bewirtschafteten<br />
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei Lektüre und angenehme<br />
Wäldern und<br />
Weihnachtsfeiertage!<br />
kontrollierten<br />
Quellen<br />
www.pefc.at<br />
TILMANN MÄRK, REKTOR<br />
ULRIKE TANZER, VIZEREKTORIN FÜR FORSCHUNG<br />
Myriad<br />
PEFC zertifiziert<br />
Dieses Produkt<br />
stammt aus<br />
nachhaltig<br />
bewirtschafteten<br />
Wäldern und<br />
kontrollierten<br />
Quellen<br />
www.pefc.at<br />
IMPRESSUM<br />
Herausgeber & Medieninhaber: Leopold-Franzens-Universität Inns bruck, Christoph-Probst-Platz, Innrain 52, 6<strong>02</strong>0 Inns bruck, www.uibk.ac.at<br />
Projektleitung: Büro für Öffentlichkeitsarbeit und Kulturservice – Mag. Uwe Steger (us), Dr. Christian Flatz (cf), Mag. Eva Fessler (ef); publicrelations@uibk.ac.at<br />
Verleger: KULTIG Werbeagentur KG – Corporate Publishing, Maria-Theresien-Straße 21, 6<strong>02</strong>0 Inns bruck, www.kultig.at<br />
Redaktion: Mag. Melanie Bartos (mb), Mag. Andreas Hauser (ah), Mag. Stefan Hohenwarter (sh), Lea Lübbert, BSc (ll) Lisa Marchl, MSc (lm),<br />
Fabian Oswald, MA (fo), Mag. Susanne Röck (sr) Lektorat & Anzeigen: MMag. Theresa Koch Layout & Bildbearbeitung: Mag. Andreas<br />
Hauser, Florian Koch Fotos: Andreas Friedle, Universität Inns bruck Druck: Gutenberg, 4<strong>02</strong>1 Linz<br />
PEFC zertifiziert<br />
Dieses Produkt<br />
stammt aus<br />
nachhaltig<br />
bewirtschafteten<br />
Wäldern und<br />
kontrollierten<br />
Quellen<br />
www.pefc.at<br />
PEFC zertifiziert<br />
Dieses Produkt<br />
stammt aus<br />
nachhaltig<br />
bewirtschafteten<br />
Wäldern und<br />
kontrollierten<br />
Quellen<br />
www.pefc.at<br />
Foto: Uni Inns bruck<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/22 3
BILD DER<br />
WISSENSCHAFT
INHALT<br />
TITELTHEMA<br />
8<br />
METEOROLOGIE. Das Projekt TEAMx will neue Erkenntnisse<br />
über die Prozesse in der Gebirgsgrenzschicht gewinnen, um<br />
Wetterprognosen und alpine Klimaprojektionen zu verbessern. 8<br />
ZEITGESCHICHTE. Mit digitalen Hilfsmitteln verschiebt Eva<br />
Pfanzelter die Grenzen der Geschichtswissenschaften und erzählt<br />
von der Südtiroler Option. 12<br />
MIGRATION. Zivilgesellschaftliches Engagement zum Schutz von<br />
Migrant*innen läuft offizieller Politik meist zuwider. Julia Mourão<br />
Permoser untersucht die daraus entstehenden Konflikte. 14<br />
LITERATURWISSENSCHAFT. Julia Pröll befasst sich mit<br />
ermächtigenden Potenzialen von Grenzerfahrungen, wie sie sich<br />
in der französischsprachigen Migrationsliteratur artikulieren. 16<br />
TITELTHEMA. Grenzen – ob real, symbolisch oder<br />
auch nur im Kopf – markieren Übergänge und bieten<br />
daher Anknüpfungspunkte für Wissenschaft und<br />
<strong>Forschung</strong>. Einige davon stellt Ihnen diese Ausgabe<br />
von ZUKUNFT FORSCHUNG vor.<br />
30<br />
GESCHICHTE. Was Europäer*innen übereinander denken, was<br />
„europäisch“ ist und was nicht, wird am <strong>Forschung</strong>szentrum<br />
„Europakonzeptionen“ erforscht.18<br />
FORSCHUNG<br />
STANDORT. Rektor Tilmann Märk und Vizerektorin Ulrike Tanzer<br />
über viele Jahre im Wissenschaftsmanagement, die <strong>Forschung</strong>sleistung<br />
der Uni Innsbruck und regionale Kooperationen. 24<br />
WIRTSCHAFT. Andreas Eckhardt forscht zur <strong>Zukunft</strong> der Arbeit<br />
und untersucht, wie virtuelle Organisationen Unternehmen helfen<br />
können, auf die Herausforderungen unserer Zeit zu reagieren. 26<br />
RECHTSWISSENSCHAFT. Verena Murschetz beobachtet,<br />
wie es um die Einhaltung von Menschenrechten<br />
in heimischen Justizanstalten, Polizeianhaltezentren<br />
und anderen Orten des Freiheitsentzugs steht.<br />
36<br />
INFORMATIK. Justus Piaters Roboter soll aus gelernten Bewegungen<br />
neue erschließen und mit dem Menschen interagieren lernen. 28<br />
PHARMAZIE. Anita Weidmann will einen neuen Blick auf<br />
Medikamente etablieren, der dabei helfen soll, die Arzneimitteltherapiesicherheit<br />
zu verbessern. 34<br />
ETHNOLOGIE. Nadja Neuner-Schatz im Interview über das<br />
Verhältnis von Landwirt*innen zu ihren Tieren, den Begriff<br />
Tierwohl und über „Forschen zwischen Nähe und Distanz“. 42<br />
HOLZBAU. Der Holzbau boomt, allerdings nicht<br />
bei Großbauten. Das Projekt BIGWOOD will daher<br />
Barrieren und Vorurteile gegenüber dem Einsatz von<br />
Holz bei mehrgeschoßigen Gebäuden abbauen.<br />
RUBRIKEN<br />
EDITORIAL/IMPRESSUM 3 | BILD DER WISSENSCHAFT: FORSCHUNGSSTATION HINTEREISFERNER 4 | NEUBERUFUNG: BARBARA SCHNEIDER-MUNTAU 6 | FUNDGRUBE VER GANGEN -<br />
HEIT: 100 JAHRE BERUFUNG BRUNO SANDER 7 | MELDUNGEN 22 + 41 | GURGL CARAT 33 | WISSENSTRANSFER 38 – 40 | PREISE & AUSZEICHNUNGEN 45 – 47 | ZWISCHENSTOPP:<br />
SCOTT HILL 48 | SPRUNGBRETT INNS BRUCK: BARBARA WEBER 49 | ESSAY: REGULIEREN JENSEITS DER GRENZE von Andreas Th. Müller 50<br />
Bei genauem Hinsehen erkennt man inmitten der Bergwelt der Ötztaler<br />
Alpen einen kleinen Container, in dem große Datenmengen für die Wissenschaft<br />
generiert werden. In der <strong>Forschung</strong>sstation am „Hinteren Eis“<br />
auf über 3.000 Metern befindet sich ein weltweit einzigartiges System<br />
zur Beobachtung der Gletscherentwicklung: Mit einem terrestrischen<br />
Laserscanner wird die Oberfläche des Hintereisferners seit 2016 regelmäßig<br />
abgetastet und damit die Veränderung der Masse des Gletschers<br />
in Echtzeit vermessen. Die so gewonnenen Informationen über einen<br />
der größten Gletscher Tirols fließen in die Arbeit zahlreicher Forscher*innen<br />
an der Fakultät für Geo- und Atmosphärenwissenschaften ein.<br />
Fotos: AdobeStock / Dominik Kindermann(1), Andreas Friedle (1), proHolz Tirol (1); COVERFOTO: AdobeStock / Dominik Kindermann(1); BILD DER WISSENSCHAFT: Eva Fessler<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/22 5
NEUBERUFUNG<br />
BARBARA SCHNEIDER-MUNTAU<br />
(*1975) studierte von 1995 bis 2003 Bauingenieurwesen<br />
– Vertiefung Geotechnik<br />
– an der Technischen Universität Darmstadt.<br />
Jeweils ein Studienjahr verbrachte<br />
sie in Florenz (1998 – 1999) und in Lausanne<br />
(2001 – 20<strong>02</strong>). Sie promovierte ab<br />
2006 an der Uni Innsbruck am Arbeitsbereich<br />
für Geotechnik und Tunnelbau.<br />
Im Anschluss an ihre Beschäftigung als<br />
Senior Scientist in diesem Arbeitsbereich<br />
wurde sie im April 2<strong>02</strong>2 Professorin für<br />
Bodenmechanik an der Universität Innsbruck.<br />
ROLE MODEL IN DER TECHNIK<br />
Barbara Schneider-Muntau legt ihren Fokus auf die Erarbeitung<br />
nachhaltiger Lösungsansätze, um den Berg zu stabilisieren.<br />
Den meisten Spaß hatte Barbara<br />
Schneider-Muntau schon immer<br />
an den mathematischen und naturwissenschaftlichen<br />
Fächern. Nach<br />
dem Abitur fiel ihre Wahl auf das Bauingenieurwesen,<br />
weil „es so vielfältig ist,<br />
und man sich nicht schon zu Studienbeginn<br />
auf eine bestimmte Richtung festlegen<br />
muss.“ Sie begann ihr Studium in<br />
Darmstadt und entschied nach dem Vordiplom,<br />
sich in Geotechnik zu vertiefen.<br />
„Die Nähe zur Naturwissenschaft – zur<br />
Geologie und Geografie – und der hohe<br />
Frauenanteil der Arbeitsgruppe haben<br />
mich angezogen“, erinnert sie sich. Um<br />
andere Universitäten kennenzulernen,<br />
verbrachte sie jeweils ein Jahr in Florenz<br />
und Lausanne, für ihre Diplomarbeit zog<br />
es sie erneut in die Berge. Am Arbeitsbereich<br />
für Geotechnik der Universität<br />
Innsbruck schrieb sie ihre Diplomarbeit<br />
über Murprozesse.<br />
Schneider-Muntau arbeitete nach ihrem<br />
Abschluss drei Jahre als Projektingenieurin<br />
bei AlpS im Naturgefahrenmanagement<br />
und promovierte anschließend<br />
an der Universität Innsbruck zum Thema<br />
„Modellierung von Kriechhängen“. Sie<br />
beschreibt sich selbst als neugierigen und<br />
umtriebigen Menschen und fühlt sich<br />
damit in der <strong>Forschung</strong> gut aufgehoben.<br />
„Routine ist für mich schrecklich! In der<br />
Wissenschaft gibt es immer neue Ideen“,<br />
so Schneider-Muntau.<br />
Ihren <strong>Forschung</strong>sschwerpunkt setzt<br />
sie seitdem auf die möglichst realitätsnahe<br />
numerische Modellierung natürlicher<br />
Prozesse. „Es geht primär darum,<br />
wie der Boden belastet wird und welche<br />
Verformung daraus resultiert“, erklärt sie.<br />
In <strong>Zukunft</strong> will Schneider-Muntau ihren<br />
Fokus auf die Berechnung von durch den<br />
Klimawandel bedingten Szenarien und<br />
dessen Einfluss auf die Veränderung geotechnischer<br />
Phänomene legen.<br />
Modellierung & Klimawandel<br />
Durch den Klimawandel ändern sich<br />
die äußeren Faktoren, die in die Modellierung<br />
einbezogen werden, so Schneider-Muntau.<br />
So könne dessen Einfluss<br />
auf den Boden abgeschätzt werden. Eine<br />
Veränderung der Geschwindigkeit der<br />
Schneeschmelze würde sich beispielsweise<br />
deutlich auf die Hangstabilität auswirken.<br />
„Die Berechnung wird immer wichtiger,<br />
vor allem wenn man in Richtung<br />
nachhaltiger Lösungsansätze denkt“, betont<br />
sie. Man merke an der Art der Prozesse,<br />
dass ein Wandel stattfinde. „Mich<br />
interessiert, was getan werden kann, um<br />
den Berg zu stabilisieren. Aber eben nicht,<br />
indem beispielsweise große Betonbauwerke<br />
errichtet werden, sondern auf eine<br />
sanfte und natürliche Art und Weise“,<br />
erzählt sie. Ihre Expertise in dieser Thematik<br />
bringt sie ebenfalls in den nächsten<br />
österreichischen Sachstandsbericht zum<br />
Klimawandel – dem „Austrian Assessment<br />
Report“ (ARR) – ein.<br />
Vorbild für Ingenieurinnen<br />
Schneider-Muntau ist die zweite Professorin<br />
innerhalb der Fakultät für Technische<br />
Wissenschaften. „Es freut mich besonders,<br />
hier als Role Model wirksam zu sein“. Studentinnen<br />
kommen gerne zu ihr, erzählt<br />
sie, denn „die Befürchtung, als Frau nicht<br />
ernst genommen zu werden, fällt weg.“<br />
Sie nimmt ihre Vorbildfunktion sehr ernst:<br />
„Wir haben ungefähr 17 Prozent Frauenanteil<br />
unter den Studierenden – und das<br />
müsste nicht so wenig sein. Es ist höchste<br />
Zeit, dass sich da was tut.“ ll<br />
6 zukunft forschung <strong>02</strong>/22<br />
Foto: Andreas Friedle
FUNDGRUBE VERGANGENHEIT<br />
EIN GEFÜGIGER FORSCHER<br />
Vor 100 Jahren wurde Bruno Sander zum Professor für Mineralogie und Petrographie bestellt. Seine<br />
Berufung war umstritten, für die Universität aber ein Glücksfall, gilt er doch als Pionier der Gefügekunde.<br />
Als Bruno Sander am 1. Oktober 1922<br />
zum Professor der Mineralogie<br />
und Petrographie an der Universität<br />
Innsbruck ernannt wurde, war seiner<br />
Berufung ein intensiver Briefwechsel vorausgegangen.<br />
Sander sei zwar, schrieb<br />
etwa der Wiener Mineralogie-Ordinarius<br />
Friedrich Becke, ein hochgeschätzter Geologe,<br />
seine Beschäftigung mit dem eigentlichen<br />
Fach aber nur rudimentär. „Einem<br />
solchen Mann die Professur für Mineralogie<br />
und Petrographie zu übertragen, halte<br />
ich für unmöglich“, schlussfolgerte Becke.<br />
Dennoch, in Innsbruck hielt man an Sander<br />
fest, der daher am 23. November 1922<br />
seine Antrittsvorlesung halten konnte.<br />
„Sander dachte sehr fraktal“, sagt Bernhard<br />
Fügenschuh, Professor für Strukturgeologie<br />
an der Universität Innsbruck:<br />
„Er verfolgte unter anderem die Frage, ob<br />
sich die Symmetrie von Kristallen in der<br />
Symmetrie von Gesteinen und schließlich<br />
von Gebirgen abbildet.“ Sanders Interesse<br />
galt der kristallografischen Vorzugsorientierung<br />
– der Textur, wie es heute heißt.<br />
Er untersuchte die Lage und Orientierung<br />
von Kristallen bzw. deren Achsen im Gestein<br />
und stellte die Frage nach dem Zusammenhang.<br />
Sein Arbeitsgerät war – unter<br />
anderem – ein mit einem Mikroskop<br />
verbundener Universaldrehtisch, mit dem<br />
er Gesteinsdünnschliffe charakterisierte.<br />
„Sander bestimmte für jeden einzelnen<br />
Kristall die Orientierung. Eine mühevolle<br />
Arbeit“, weiß Fügenschuh. Vor allem, da<br />
Sander dies, farblich hinterlegt, auf Papier<br />
übertrug. Die derart entstandenen „Farbmosaike“<br />
(siehe Abb. rechts) veranschaulichten<br />
etwa die Dominanz bestimmter<br />
kristallografischer Orientierungen im<br />
untersuchten Gestein gegenüber anderen<br />
Kristallen. Sander gab dieser Methode den<br />
Namen Achsenverteilungsanalyse (AVA).<br />
„Dieser Ansatz war genial und hat heute<br />
noch Bestand“, sagt Fügenschuh. Vor allem,<br />
da Sander das kristallografische Denken,<br />
das auf den einzelnen Kristall abzielt,<br />
mit Hilfe der AVA auf die benachbarten<br />
Kristalle ausdehnte.<br />
BRUNO SANDER (1884 – 1979)<br />
studierte an der Universität Innsbruck,<br />
promovierte 1907 im Fach Geologie und<br />
habilitierte sich 1912. Ab 1913 war er an<br />
der Geologischen Reichsanstalt (später<br />
Staatsanstalt) tätig, 1922 erfolgte die Berufung<br />
zum Professor für Mineralogie und<br />
Petrographie in Innsbruck. Sander wurde<br />
national und international mit Preisen,<br />
Ehrendoktoraten und -mitgliedschaften<br />
ausgezeichnet. Mit dem Sanderit trägt ein<br />
Mineral, mit dem Bruno-Sander-Haus ein<br />
Innsbrucker Universitätsgebäude und im<br />
ostantarktischen Viktorialand der Sanderpass<br />
seinen Namen. Unter Anton Santer<br />
war Sander auch als Schriftsteller tätig. Er<br />
gehörte zur Brenner-Gruppe und veröffentlichte<br />
in den Zeitschriften Der Brenner,<br />
Wort im Gebirge und Seefelder Zeitung.<br />
Das Porträt Sanders stammt von Wilfried<br />
Kirschl (1930 – 2010) und entstand 1965<br />
anlässlich der Ehrenringvergabe durch die<br />
Stadt Innsbruck an Bruno Sander.<br />
Sanders wissenschaftliche Tätigkeit begann<br />
mit geologischen Kartierungsarbeiten,<br />
so erstellte er Kartenblätter für Modena<br />
und Brixen. Die geologische Feldarbeit<br />
und die damit verbundene Analyse der<br />
äußeren und inneren Gestaltung geologischer<br />
Körper führte zum Konzept der Gefügekunde,<br />
das Sander weltweit bekannt<br />
machte. Seine aus den Dünnschliff-Untersuchungen<br />
abgeleitete Erkenntnis, dass<br />
die Gefügesymmetrie die grundlegende<br />
Eigenschaft natürlich deformierter Gesteine<br />
ist, darf als Sanders wichtigster Beitrag<br />
zur Strukturgeologie angesehen werden.<br />
Dünnschliffe fürs Gebirge<br />
Sein Arbeitsgebiet im Gelände war das<br />
Tauernfenster: eine Region in Tirol, Salzburg<br />
und Kärnten, im Westen scharf abgegrenzt<br />
durch das Wipptal, mit klaren,<br />
ost-west-verlaufenden Grenzen bis zur<br />
Line Schladming – Mauterndorf im Osten.<br />
„Innerhalb des Tauernfensters gibt es eine<br />
Struktur mit Zentralgneiskernen wie dem<br />
Zillertaler-, Tuxer- und Ahornkern. Das<br />
waren Symmetriefragen, die Sander beschäftigten“,<br />
sagt Fügenschuh. Im großen<br />
Gebirgsmaßstab suchte Sander jene Symmetrien,<br />
die er in Dünnschliffen von Tauern-Gesteinen<br />
gefunden hatte. Im Zuge<br />
dessen beschäftigte er sich auch mit den<br />
Faltenachsen im Gebirge und definierte, so<br />
Fügenschuh, „eine B-Achsen-Kinematik“.<br />
Wisse man, wie Faltenachsen im Gebirge<br />
verlaufen, wisse man auch, wie der Schub<br />
darauf, nämlich normal, gewirkt habe.<br />
„Das hat sich als teilrichtig herausgestellt.<br />
Es trifft auf niedermetamorphe Gebirgsbereiche<br />
zu. Im Kernbereich von Gebirgen<br />
verlaufen Bewegung aber oft parallel zu<br />
den Faltenachsen“, erklärt Fügenschuh.<br />
33 Jahre nach seiner Berufung emeritierte<br />
Sander – als Begründer einer weltweit<br />
renommierten „Innsbrucker mineralogisch-geologischen<br />
Schule“ und als Verfasser<br />
internationaler Standardwerke wie<br />
„Gefügekunde der Gesteine“ oder seine<br />
„Einführung in die Gefügekunde der geologischen<br />
Körper“. <br />
ah<br />
Foto: <strong>Forschung</strong>sinstitut Brenner-Archiv / Johannes Plattner; Institut für Mineralogie und Petrographie / Bernhard Fügenschuh<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/22 7
8 zukunft forschung <strong>02</strong>/22<br />
Foto: Andreas Friedle
TURBULENTE FRAGEN<br />
Die Grenzschicht ist die erdnächste Schicht der Atmosphäre. Sie ist hochrelevant für Wetter<br />
und Klima, da in ihr sämtliche Austauschprozesse zwischen Erdoberfläche und Atmosphäre<br />
stattfinden. Besonders komplex sind diese Prozesse über dem Gebirge. In dem Projekt TEAMx<br />
will eine internationale Gemeinschaft von Forscherinnen und Forschern neue Erkenntnisse<br />
über die Prozesse in dieser Gebirgsgrenzschicht gewinnen, um Wetterprognosen und alpine<br />
Klimaprojektionen zu verbessern.<br />
Foto: Andreas Friedle<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/22 9
TITELTHEMA<br />
DIE i-BOX ist ein System aus<br />
mehreren Messstationen, um<br />
ein möglichst vollständiges<br />
Bild der Grenzschichtprozesse<br />
im Inntal erzeugen zu können.<br />
Im Mittelpunkt des Interesses<br />
stehen dabei die Turbulenzen,<br />
da die Turbulenzstruktur eine<br />
wichtige Rolle bei Austauschprozessen<br />
von Impuls, Masse<br />
und Energie zwischen der Erdoberfläche<br />
und der Atmosphäre<br />
spielt. Zum Einsatz kommen<br />
dabei u. a. Sonic Anemometer,<br />
also Sensoren, die – wie hier<br />
am Arbeser Kogel – mittels<br />
akustischer Signale Turbulenzen<br />
in der Atmosphäre messen<br />
können.<br />
Das Tal im wattig-weißen Frühnebel,<br />
die Berghänge hingegen im gleißenden<br />
Sonnenlicht – für die einen fantastische<br />
Aussicht nach mühevollem Aufstieg,<br />
für andere, vor allem für Meteorologinnen<br />
und Meteorologen, ein Blick auf den oberen<br />
Rand der atmosphärischen Grenzschicht. Mit<br />
einem Mantel, der die Erdoberfläche umhüllt,<br />
verglich der deutsche Meteorologe und Klimatologe<br />
Karl Schneider-Carius (1896 – 1959)<br />
jene unterste Schicht der Atmosphäre und benannte<br />
sie nach peplos – altgriechisch für Mantel<br />
– Peplosphäre.<br />
Weniger metaphorisch ist heute die Bezeichnung<br />
atmosphärische Grenzschicht<br />
(atmospheric boundary layer, ABL) in Verwendung,<br />
was nichts daran ändert, dass sie<br />
im Zentrum zahlreicher <strong>Forschung</strong>svorhaben<br />
steht. Kein Wunder, ist der – im Schnitt – erste<br />
Kilometer über der Erdoberfläche doch<br />
höchst relevant für unser Wetter und Klima.<br />
„Die Grenzschicht ist vor allem interessant,<br />
weil in ihr alle Austauschvorgänge zwischen<br />
Erdoberfläche und freier Atmosphäre<br />
stattfinden“, erläutert Mathias Rotach vom<br />
Institut für Atmosphären- und Kryosphärenwissenschaften<br />
der Universität Innsbruck.<br />
Ausgetauscht werden etwa Impuls, Wärme,<br />
Wasser und Spurenstoffe, Schadstoffe eingeschlossen.<br />
„Verdunstung passiert an der<br />
Erdoberfläche. Wasserdampf steigt auf und<br />
kondensiert, es kommt zur Wolkenbildung<br />
und zum Niederschlag. Dies wird durch die<br />
Grenzschicht bewerkstelligt“, beschreibt Rotach<br />
einen solchen Austauschvorgang. Angetrieben<br />
werden diese Austausche durch eine<br />
„chaotische Bewegung“, die Turbulenz. In<br />
der Folge wirken sie sich auf so unterschiedliche<br />
Phänomene wie Klima, Sturmsysteme,<br />
Luftverschmutzung oder Gletscherschmelze<br />
aus. „Der Output von atmosphärischen<br />
Modellen wird daher von Kolleginnen und<br />
Kollegen genutzt, um z. B. hydrologische Modelle<br />
zu erstellen“, erklärt Rotach.<br />
Das Verständnis der atmosphärischen<br />
Turbulenz und der Art und Weise, wie sie in<br />
Wetter- und Klimamodellen berücksichtigt<br />
wird, stammt allerdings von Beobachtungen<br />
und Messungen über flachem Gelände, Austauschprozesse<br />
über komplexem Gelände wie<br />
z. B. über Gebirgen sind vielschichtiger. Rund<br />
30 Prozent der Erdoberfläche bestehen aus<br />
solch komplexem Gelände, das mangelnde<br />
Wissen über die darüber, in der Gebirgsgrenzschicht<br />
(mountain boundary layer, MoBL)<br />
stattfindenden Austauschprozesse führt zu<br />
Unsicherheiten bei Wettervorhersagen und<br />
Klimaprojektionen über Berggebieten, aber<br />
10 zukunft forschung <strong>02</strong>/22<br />
Foto: Ivana Stiperski (1), Grafik: TEAMx (1)
TITELTHEMA<br />
AUSTAUSCHPROZESSE sind in der Grenzschicht<br />
über Bergen komplexer als über flachem<br />
Gelände, zudem wird vermutet, dass der vertikale<br />
Transport in Richtung freier Atmosphäre über<br />
Bergen im Durchschnitt intensiver ist.<br />
auch über die globalen Wasser-, Energie- und<br />
Kohlenstoffkreisläufe.<br />
In TEAMx, einem Projekt, dessen voller Name<br />
Multi-scale transport and exchange processes<br />
in the atmosphere over mountains – programme<br />
and experiment lautet, hat sich nun eine internationale<br />
Gemeinschaft von Forscherinnen und<br />
Forschern zum Ziel gesetzt, das Verständnis<br />
dieser Prozesse in der MoBL zu verbessern.<br />
Langfristige Ziele von TEAMx, das vom Innsbrucker<br />
Institut für Atmosphären- und Kryosphärenwissenschaften<br />
koordiniert wird, sind<br />
die Optimierung numerischer Modelle und<br />
Beobachtungssysteme für die Anwendung<br />
über bergigem Gelände, die Verbesserung<br />
von Wettervorhersagen und Klimawandelszenarien<br />
über Gebirgen sowie die genauere<br />
Charakterisierung der globalen Kreisläufe von<br />
Wasser, Energie und Spurengasen.<br />
Messkampagne im Inntal<br />
„Im Frühjahr 2<strong>02</strong>4 wird die große TEAMx-<br />
Messkampagne starten“, berichtet Rotach.<br />
Mit Spezialausrüstungen ausgestattete internationale<br />
<strong>Forschung</strong>sgruppen werden einen<br />
„luftigen“ Brenner Basistunnel samt Zulaufstrecken<br />
unter die Lupe nehmen: das Inntal<br />
in seiner West-Ost-Ausrichtung, das von<br />
Norden nach Süden verlaufende Etschtal,<br />
sowie das Alpenvorland in Süddeutschland<br />
„Prozesse in der Gebirgsgrenzschicht sind für<br />
angewandte Simulationen wichtig – das kann<br />
die Luftqualität, die Wasserversorgung, die<br />
Stromerzeugung durch Erneuerbare Energien<br />
oder die Landwirtschaft betreffen.“ Mathias Rotach<br />
und Norditalien. Vor allem das Inntal bringt<br />
– abseits seiner geografischen Lage – optimale<br />
Voraussetzungen mit, gibt es doch, so Rotach,<br />
„wahrscheinlich keine andere alpine Region,<br />
die derart dicht mit ständigen Messstationen<br />
besetzt ist“. Eine davon ist die von Rotach<br />
initiierte Innsbruck-Box, in Anlehnung an<br />
Apple kurz i-Box genannt. „Um eine Theorie<br />
der Grenzschichtforschung über flachem<br />
und homogenem Gelände zu überprüfen, benötigt<br />
man nur einen Punkt, eine stationäre<br />
Messstation. Nur: Diese Homogenität gibt es<br />
eigentlich nirgends, eventuell in der Wüste“,<br />
sagt Rotach. Zur Überprüfung benötigt es also<br />
auch Höhe, man bedient sich z. B. In-situ-Sensorik<br />
an Masten oder bodengebundener Fernsondierungsverfahren.<br />
Nur: Mit der Höhe allein<br />
ist es auch nicht getan. „Mit der i-Box haben<br />
wir ein dreidimensionales Arrangement“,<br />
erklärt Rotach. Sechs Stationen, an charakteristischen<br />
Plätzen im zentralen Inntal (Nordund<br />
Südhang, Tallage, Bergkamm, Wiese,<br />
Wald, bebautes Gebiet…) aufgestellt, bilden<br />
die i-Box, gemessen werden vor allem Turbulenz,<br />
aber auch Temperatur, Feuchte, CO 2 ,<br />
Sonneneinstrahlung etc. Die vorliegenden, bis<br />
zu zehn Jahre zurückreichenden Messreihen<br />
sollen auch helfen, „Daten aus der TEAMx-<br />
Messkampagne, die wir vielleicht nicht einordnen<br />
können, mit schon vorhandenen zu<br />
vergleichen“, schildert Mathias Rotach.<br />
Die Messkampagne erstreckt sich über ein<br />
komplettes Jahr (Frühjahr 2<strong>02</strong>4 bis Frühjahr<br />
2<strong>02</strong>5) und umfasst zwei Extensive Observation<br />
Periods (EOPs), eine im Sommer und eine im<br />
Winter. Die bestehenden Beobachtungs-<br />
und Überwachungsnetze<br />
werden mit zahlreichen<br />
Instrumentierungen und Messverfahren<br />
ergänzt: Das Karlsruher<br />
Institut für Technologie etwa<br />
rückt dem Inntal mit seinem KITcube<br />
zu Leibe, ein mobiles Gesamtbeobachtungssystem,<br />
das ein Atmosphärenvolumen<br />
von ca. zehn Kilometer Seitenlänge<br />
vermessen kann; die Technische Universität<br />
Braunschweig wiederum reist mit einem speziellen<br />
<strong>Forschung</strong>sflugzeug an, das in der tief<br />
gelegenen MoBL fliegen und messen kann.<br />
Davon Flugstunden gebucht hat unter anderem<br />
Rotachs Institutskollegin Ivana Stiperski,<br />
die in dem Projekt UNICORN – gefördert im<br />
Rahmen des ERC-Consolidator-Programms –<br />
ein neuartiges Framework zum Verständnis<br />
von oberflächennahen Turbulenzen in komplexem<br />
Gelände entwickeln will. ah<br />
AUSGANGSPUNKT des<br />
Projekts TEAMx war die 33.<br />
International Conference on<br />
Alpine Meteorology, die 2015<br />
in Innsbruck stattfand. Am<br />
Schlusstag diskutierte eine<br />
Runde von Forscherinnen<br />
und Forschern die Möglichkeit<br />
einer groß angelegten<br />
Messkampagne, wie sie schon<br />
in der Vergangenheit durchgeführt<br />
worden waren. 2017<br />
erfolgte die Einsetzung einer<br />
Coordination and Implementation<br />
Group, 2018 die Einrichtung<br />
eines Koordinationsbüros<br />
in Innsbruck, 2019 der erste<br />
TEAMx-Workshop in Rovereto<br />
mit 92 Teilnehmerinnen und<br />
Teilnehmern aus elf Nationen.<br />
In dem über die beteiligten Institutionen<br />
finanzierten Projekt<br />
wird eine breite Kampagne mit<br />
zahlreichen bodengestützten<br />
In-situ-, Fernerkundungs- und<br />
Flugzeugmessungen vorbereitet,<br />
die von Frühjahr 2<strong>02</strong>4 bis<br />
Frühjahr 2<strong>02</strong>5 dauern wird. An<br />
der Kampagne beteiligen sich<br />
Universitäten, <strong>Forschung</strong>seinrichtungen<br />
und Wetterdienste<br />
aus elf Ländern in<br />
Europa und den USA.<br />
Info: www.teamxprogramme.org<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/22 11
TITELTHEMA<br />
VOM ZÄHLEN<br />
ZUM ERZÄHLEN<br />
Mit digitalen Hilfsmitteln verschiebt die Zeithistorikerin Eva<br />
Pfanzelter die Grenzen der Geschichtswissenschaften und erzählt<br />
von der Südtiroler Option.<br />
EVA PFANZELTER: „Es handelt sich um einen einzigartigen Bestand, der umfassende und<br />
vielschichtige Daten über die Migrationsströme aus und nach Südtirol enthält.“<br />
Ein grünes R prangt auf der Karteikarte<br />
in den Händen von Eva<br />
Pfanzelter. Auf dem postkartengroßen<br />
Dokument der „Dienststelle<br />
Umsiedlung Südtirol“ finden sich ein<br />
Name, das Geburtsdatum, Angaben zur<br />
Familie und zum Beruf, handschriftliche<br />
Vermerke, Stempel und Markierungen.<br />
267.000 solche Karteikarten befinden<br />
sich im Tiroler Landesarchiv, zusammen<br />
mit den dazugehörigen Akten. Sie<br />
erzählen über jene Menschen, die 1939<br />
für die Auswanderung aus Südtirol gestimmt<br />
hatten.<br />
Diese Dokumente einzeln zu erfassen,<br />
erscheint wie eine Sisyphusarbeit. Mit<br />
Unterstützung von Robotern und künstlicher<br />
Intelligenz können die Forscher*innen<br />
um Eva Pfanzelter vom Institut für<br />
Zeitgeschichte diesen einzigartigen Datenbestand<br />
nun digitalisieren. Die Karten<br />
wurden in Zusammenarbeit mit Innsbruck<br />
University Innovations bereits automatisiert<br />
gescannt und werden nun mit<br />
Hilfe der von der Universität Innsbruck<br />
mitentwickelten und auf künstlicher Intelligenz<br />
basierenden Schrifterkennungssoftware<br />
Transkribus eingelesen. Ein vorgegebenes<br />
Raster erklärt der Software,<br />
wo welche Informationen zu finden sind.<br />
Dann wird die Software an zahlreichen<br />
Karten trainiert, bis ein Modell entsteht,<br />
mit dem der Computer alle Informationen<br />
auf den Karten identifizieren kann.<br />
„Je besser das Trainingsmodell ist, desto<br />
weniger müssen die Daten später manuell<br />
korrigiert werden. Bis Ende dieses Jahres<br />
hoffen wir, alle Informationen in einer<br />
Datenbank zu haben, die wir dann mit<br />
der Unterstützung von Freiwilligen noch<br />
nachbearbeiten werden.“<br />
Einzigartige Datensammlung<br />
Die umfangreiche Datenbank liefert einen<br />
guten Überblick über die deutschsprachige<br />
Bevölkerung Südtirols mit Geburtsdaten,<br />
Familienzusammenhängen und<br />
Berufen. Öffentlich zugänglich wird sie<br />
sowohl der Familienforschung als auch<br />
anderen <strong>Forschung</strong>svorhaben reichhaltige<br />
Informationen bieten. „Es handelt<br />
sich hier um einen einzigartigen Bestand,<br />
der umfassende und vielschichtige Daten<br />
über die Migrationsströme aus und nach<br />
Südtirol enthält“, betont Eva Pfanzelter.<br />
Der zugrunde liegende Bestand der<br />
„Dienststelle Umsiedlung Südtirol“ geht<br />
auf das Optionsabkommen zwischen<br />
dem Deutschen Reich und Italien zurück.<br />
Bei der Italianisierung Südtirols während<br />
des Faschismus in den zwanzig Jahren<br />
vor diesem Abkommen ging es vor allem<br />
darum, das neu erworbene Territorium so<br />
italienisch wie möglich zu machen. Das<br />
bedeutete, die Verwendung der deutschen<br />
Sprache und Kultur einzuschränken.<br />
„Der Brenner wurde sehr rasch zum<br />
Statussymbol für die Grenze zwischen<br />
Italien und dem deutschsprachigen Ausland“,<br />
erklärt die Zeithistorikerin: „Für<br />
Mussolini war der Brenner die nördliche<br />
Grenze Italiens, die nicht angetastet wer-<br />
12 zukunft forschung <strong>02</strong>/22<br />
Foto: Andreas Friedle
TITELTHEMA<br />
JENBACH bietet sich als Untersuchungsgemeinde an, da hier<br />
einerseits im Jenbacher Museum ein Bereich der Dauerausstellung<br />
der „Option“ gewidmet ist, der längst auf eine Neuinterpretation<br />
wartet. Andererseits ist Jenbach auch eine typische Gemeinde mit<br />
Arbeitsmigration, da mit den „Heinkel Werken“ (Bild) der größte<br />
Tiroler Rüstungsbetrieb hier beheimatet war. Neben tausenden<br />
Zwangsarbeiter*innen wurden in der Kriegszeit auch Arbeitskräfte<br />
aus Südtirol rekrutiert. Neben der typischen Südtiroler Siedlung<br />
nehmen die Forscher*innen weitere migrantische Aspekte wie<br />
Ressentiments, Vorurteile, kulturelle und soziale Auseinandersetzungen,<br />
aber ebenso Integration und Anpassung in den Blick.<br />
DAS KANALTAL im Dreiländereck Italien-Österreich-Slowenien<br />
mit dem Zentrum Tarvis ist für die Optionsgeschichte von besonderem<br />
Interesse, weil hier fast die gesamte deutschsprachige<br />
Bevölkerung nach der Umsiedlungsabmachung zwischen Hitler<br />
und Mussolini abgewandert und auch nicht mehr zurückgekehrt<br />
ist. So war das Kanaltal nach dem Krieg zu einem weitgehend<br />
italienischsprachigen Gebiet geworden, was mit großen wirtschaftlichen<br />
und kulturellen Änderungen einhergeht. Um diese<br />
nachzuzeichnen, analysieren die Innsbrucker Historiker*innen auch<br />
die Aktenbestände der Dienststelle Umsiedlung Südtirol zu einzelnen<br />
Migrant*innen aus dem Kanaltal.<br />
den durfte. Gleichzeitig war Südtirol aber<br />
das südlichste deutschsprachige Gebiet,<br />
der Brenner eine Grenze, die sprachlich<br />
Zusammengehörendes radikal trennte.“<br />
Adolf Hitlers Pakt mit Italien stand<br />
diese Grenze im Wege. Nach Verhandlungen<br />
kam es im Juni 1939 zum Optionsabkommen,<br />
in dem den deutschsprachigen<br />
Südtiroler*innen die Möglichkeit gegeben<br />
wurde, entweder ins Deutsche Reich auszuwandern<br />
oder italienisch zu werden.<br />
Rund 130.000 Südtiroler Haushalte gaben<br />
in der Abstimmung eine sogenannte Optionserklärung<br />
ab, etwa 86 Prozent davon<br />
entschieden sich für eine Auswanderung<br />
ins Deutsche Reich. In der Folge verließen<br />
75.000 Südtiroler*innen das Land in<br />
Richtung Innsbruck, der ersten Station bei<br />
der Ausreise. Nach dem Zweiten Weltkrieg<br />
kehrte von diesen rund ein Drittel<br />
– zunächst illegal und dann in Folge der<br />
Rücksiedlungsabkommen von 1948 legal<br />
– in die Provinz Bozen zurück.<br />
Grenzen im Kopf<br />
Diese Teilung Tirols hat die Identität der<br />
Menschen in die Region erschüttert. Bis<br />
spät in die 1990er-Jahre bleibt die Suche<br />
nach einer Südtiroler Identität sehr präsent:<br />
„Gibt es so etwas wie eine Südtiroler<br />
Identität, oder gibt es sie nicht?“<br />
Diese Identitätskrise traf aber auch die<br />
Menschen in Nord- und Osttirol, da die<br />
Brennergrenze das Selbstverständnis<br />
des ehemaligen Kronlandes durchbrach.<br />
„Wenn wir uns die Region der heutigen<br />
Euregio anschauen und auf Identitätsfragen<br />
hin beleuchten, dann merkt man<br />
sehr schnell, dass die Phase der Italianisierung<br />
im Faschismus als eine Form der<br />
Kolonialisierung gelesen werden kann“,<br />
sagt Eva Pfanzelter. So seien die Freiheitsbestrebungen<br />
des Trentino damals begraben<br />
worden und Südtirol gleichzeitig<br />
die Region geworden, die aufgrund der<br />
Identitätskrise immer mehr Autonomie<br />
verlangen konnte. Dasselbe passierte in<br />
Nordtirol, das zwar als Teil Österreichs<br />
fest verankert war, dem aber ein Stück<br />
des Kernlandes fehlte. „Wenn man die<br />
Zeit des Faschismus als interne Kolonialisierung<br />
begreift, sind diese Identitätsfragen<br />
sehr komplex und vielschichtig, die<br />
ganz viele Grenzlinien überschreiten und<br />
wo es keine eindeutigen Zuschreibungen<br />
gibt“, resümiert die Zeithistorikerin. „Die<br />
ganze Region hat sich mit dieser neuen<br />
Grenze gesellschaftspsychologisch und in<br />
ihrer Identität verändern müssen.“<br />
Von den Zahlen zur Geschichte<br />
Den Innsbrucker Historiker*innen stehen<br />
aber für die Analyse solcher Fragen nicht<br />
nur die Unterlagen der „Optionskartei“<br />
zur Verfügung. Einerseits untersuchen<br />
sie als Fallbeispiele die Gemeinde Jenbach<br />
und das norditalienische Kanaltal im Detail.<br />
Andererseits hat Eva Pfanzelter mit<br />
ihrem Team bereits weitere 25.000 Karteikarten<br />
aus dem Staatsarchiv in Bozen digitalisiert<br />
und ausgewertet. Sie enthalten<br />
Informationen zu jenen Menschen, die<br />
nach 1945 wieder nach Südtirol zurückgekehrt<br />
sind. Durch den Abgleich der<br />
beiden Datenbanken können die Wissenschaftler*innen<br />
die Migrationsströme besser<br />
nachzeichnen. Und damit erklärt sich<br />
auch das grüne R auf vielen Karteikarten<br />
im Tiroler Landesarchiv. Der Buchstabe<br />
steht für die Rückübersiedelung nach<br />
Südtirol, die weitgehend auch in den<br />
Nordtiroler Akten vermerkt sind.<br />
Während die Archivarbeit normalerweise<br />
detaillierte Einblicke in Einzelschicksale<br />
liefert, bietet die Digitalisierung großer Bestände<br />
zunächst vor allem Zugang zu<br />
quantitativen Daten. Die Schwierigkeit besteht<br />
nun darin, diese beiden Zugänge zusammenzuführen.<br />
„Das ist eine große Herausforderung,<br />
aber natürlich auch sehr<br />
spannend“, sagt Pfanzelter. „Wir als Geisteswissenschaftler*innen<br />
müssen unsere<br />
komplexe Sprache reduzieren auf Nullen<br />
und Einsen, zumindest auf Wortteile oder<br />
quantifizierbare Dinge, wollen aber doch<br />
auch unsere diskursiven Fähigkeiten einbringen.<br />
Es geht für uns also auch um die<br />
Frage, wie kommt man vom Zählen wieder<br />
zum Erzählen.“<br />
cf<br />
Fotos: Das Alte Jenbach https://www.jenba.ch/industrie/die-heinkel-werke/ (1), https://www.sprachinseln.it/de/reimmichlkalenderbeitrag-kanaltal-2010.html (1)<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/22 13
TITELTHEMA<br />
GRENZEN DER MORAL<br />
Zivilgesellschaftliches Engagement zum Schutz von Migrant*innen läuft offizieller Politik von<br />
Nationalstaaten meist zuwider. Die daraus entstehenden Dilemmas und Konflikte stehen im Kern<br />
eines aktuellen Projekts von Julia Mourão Permoser.<br />
Bei ihrem Antrittsbesuch in Brüssel<br />
Anfang November betonte<br />
die neue italienische Ministerpräsidentin<br />
Giorgia Meloni, in der Migrationspolitik<br />
einen Fokus auf Außengrenzsicherung<br />
legen zu wollen. Kurz<br />
davor war bekannt geworden, dass ihre<br />
Regierung Schiffen von Seenotrettungs-<br />
Organisationen mit insgesamt rund 1.000<br />
geretteten Flüchtlingen ein Anlegen an<br />
italienischen Häfen untersagt. „Italien<br />
erlässt hier Verordnungen und Gesetze,<br />
die das Betreten des Hafens verbieten.<br />
Zugleich gibt es internationale Regelungen,<br />
die zur Rettung aus Seenot verpflichten<br />
– welche Norm zählt mehr?<br />
Diese Dilemmas und Konflikte, die ja<br />
fast immer auch mit Werten und Fragen<br />
der Moral verbunden sind, interessieren<br />
mich“, sagt Julia Mourão Permoser<br />
vom Institut für Politikwissenschaft,<br />
derzeit Gastprofessorin an der Universität<br />
Wien. „Zu Wertekonflikten gibt es<br />
einiges an <strong>Forschung</strong>sliteratur, im Fokus<br />
stehen dort aber meist Fragen wie die<br />
gleichgeschlechtliche Ehe, Abtreibung,<br />
sexuelles Verhalten – also der Gegensatz<br />
zwischen konservativ-religiösen und liberal-säkularen<br />
Einstellungen“, erklärt<br />
sie. Migrationspolitik ist genauso „moralisch“,<br />
folgt aber anderen Trennlinien.<br />
Vor allem im Gegensatz zwischen säkularen<br />
und religiösen Positionen ergeben<br />
sich hier teils völlig andere Standpunkte<br />
als bei den „klassischen“ Moralfragen.<br />
In ihrem Projekt „Migration as Morality<br />
Politics“ sieht sich Mourão Permoser<br />
politische Konflikte rund um Migration<br />
genauer an, insbesondere in Bezug auf<br />
die normativen Trennlinien.<br />
Zivilgesellschaft<br />
„Ich interessiere mich für zivilgesellschaftliches<br />
Engagement, das im Widerstand<br />
zu nationaler oder europäischer<br />
Politik stattfindet. Politik, die von diesen<br />
Akteur*innen aus grundsätzlichen<br />
Gründen als illegitim oder unmoralisch<br />
abgelehnt wird“, sagt die Politikwissenschaftlerin.<br />
Sie untersucht dabei Schutzräume,<br />
in denen Menschen, die nicht die<br />
Erlaubnis haben, sich in einem Land aufzuhalten,<br />
Schutz vor der Staatsmacht erhalten<br />
und in denen die Durchsetzungs-<br />
14 zukunft forschung <strong>02</strong>/22<br />
Fotos: AdobeStock / Giorgos (1), Foto Schuster (1)
TITELTHEMA<br />
möglichkeit des Staates verhindert oder<br />
zumindest erschwert wird. „Damit sind<br />
wir in einem sehr konfliktreichen Bereich,<br />
wir haben es mit normativ heiklen<br />
Themen zu tun: Ist dieses Engagement<br />
legitim? Gibt es prinzipielle Gründe, es<br />
abzulehnen oder gutzuheißen, und welche<br />
sind das?“ Drei Fallbeispiele beleuchtet<br />
die Politikwissenschaftlerin mit einer<br />
Mitarbeiterin konkret: Rettungsaktionen<br />
an den Grenzen, unter anderem Seenotrettung<br />
vor allem im Mittelmeer, wo<br />
(meist) Nichtregierungsorganisationen<br />
Migrant*innen vor dem Ertrinken retten<br />
und in europäische Häfen bringen; die<br />
Kirchenasyl-Bewegung, die vor allem,<br />
aber nicht nur in Deutschland und den<br />
USA verbreitet ist; und die wachsende<br />
Bewegung der „Sanctuary Cities“, wo<br />
Stadt- und Regionalverwaltungen im<br />
Widerspruch zu nationalen Vorgaben irreguläre<br />
Migrant*innen nicht verfolgen<br />
oder vor Verfolgung und Abschiebung<br />
bewusst schützen.<br />
„Sanctuary Cities sind in den USA formalisierter<br />
als in Europa und die Praxis<br />
sieht zum Beispiel so aus, dass es städtischen<br />
Institutionen, Behörden und Beamten<br />
verboten wird, bei Krankenhausaufenthalten,<br />
Schuleinschreibungen oder<br />
bei der Meldung eines Verbrechens nach<br />
dem Aufenthaltsstatus der Person zu fragen<br />
oder solche Informationen an nationale<br />
Einwanderungsbehörden weiterzugeben.“<br />
Im Gegensatz dazu steht die Politik<br />
in manchen europäischen Ländern,<br />
zum Beispiel im Vereinigten Königreich:<br />
„Im Vereinigten Königreich ist es Pflicht,<br />
bei Kontakten mit staatlichen Behörden<br />
den Aufenthaltsstatus anzugeben und<br />
diese Stellen müssen diese Information<br />
auch an Einwanderungsbehörden weitergeben.<br />
Dadurch wird der Zugang zu<br />
Leistungen verhindert – auch zu jenen,<br />
zu denen irreguläre Migrant*innen aufgrund<br />
allgemeiner Grundrechte einen<br />
Anspruch hätten –, denn jeder Kontakt<br />
mit den Behörden führt potenziell zu<br />
einer Abschiebung. Das Argument für<br />
diese Regel ist, irreguläre Migration effizienter<br />
verfolgen zu können.“ Sanctuary<br />
Cities, teils unter anderer Bezeichnung,<br />
gibt es aber auch in Europa: Barcelona,<br />
Palermo und Mailand sind Beispiele,<br />
Wales als Region bietet – soweit unter<br />
den strengen Regeln im Vereinigten Königreich<br />
möglich – unterstützende Informationen<br />
für irreguläre Migrant*innen,<br />
Asylwerber*innen und Menschen mit<br />
abgelehntem Asylstatus.<br />
Schutz vor Verfolgung<br />
Im Mittelmeer sind es humanitäre Organisationen<br />
aus der Zivilgesellschaft, die<br />
Menschen aus Seenot retten. „Diese Bewegung<br />
ist transnational, besteht sowohl<br />
aus einzelnen kleinen Crews als auch<br />
großen NGOs wie etwa Seawatch, SOS<br />
Méditerranée oder Ärzte ohne Grenzen<br />
und besteht ebenfalls schon seit Mitte<br />
der 2000er-Jahre“, erläutert Julia Mourão<br />
Permoser. Die Kirchenasyl-Bewegung<br />
wiederum bietet Verfolgten Schutz in<br />
kirchlichen Liegenschaften – entweder in<br />
Kirchen selbst oder anderswo mit Unterstützung<br />
der Kirchen.<br />
Rechtlich umstritten sind alle drei Formen,<br />
wird doch der (National-)Staat an<br />
der Durchsetzung geltenden Rechts gehindert.<br />
„Allein bei der Seenotrettung sehen<br />
wir immer wieder Gerichtsverfahren,<br />
JULIA MOURÃO PERMOSER (*1980 in<br />
Rio de Janeiro, Brasilien) forscht am Institut<br />
für Politikwissenschaft der Universität<br />
Innsbruck, derzeit bekleidet sie eine Gastprofessur<br />
an der Universität Wien. Bevor<br />
sie Mitarbeiterin der Universität Innsbruck<br />
wurde, hatte sie <strong>Forschung</strong>sstellen an<br />
der Universität Wien und an der Freien<br />
Universität Brüssel inne. Ihre Hauptforschungsinteressen<br />
sind Migration, der<br />
politische Umgang mit Diversität, die Rolle<br />
von Normen und Werten in der Politik<br />
sowie gegenwärtige Herausforderungen<br />
liberaler Demokratien im Hinblick auf<br />
den zunehmenden Pluralismus moderner<br />
Gesellschaften.<br />
die Seenotretter*innen werden wegen<br />
Schlepperei und Beihilfe zu illegaler Migration<br />
angeklagt. Die Seenotretter*innen<br />
argumentieren dabei mit ihrer Pflicht,<br />
Menschen zu retten, die über staatlichem<br />
Recht steht, der Staat dagegen – in Europa<br />
ist das zuletzt meist Italien als klagende<br />
Partei – mit der Durchsetzung geltenden<br />
Rechts auf seinem Staatsgebiet.“<br />
Auch die Seenotrettung selbst hat sich in<br />
den vergangenen Jahren verändert: Die<br />
eingesetzten Boote sind deutlich größer<br />
und werden von hochprofessionellen<br />
Crews betrieben – damit einhergehen<br />
aber auch höhere staatliche Auflagen,<br />
die den Einsatz erschweren. „Auch das<br />
Kirchenasyl ist umstritten – in Deutschland<br />
wird es geduldet, aber auch das<br />
wirft Fragen nach der Trennung von Kirche<br />
und Staat auf: Warum sollte die Kirche<br />
Flüchtlinge aufnehmen dürfen, ein<br />
Fußballverein aber zum Beispiel nicht?“<br />
Und auch in den USA gab es, vor allem<br />
unter Präsident Trump, Klagen gegen die<br />
Sanctuary Cities.<br />
Verlagerung der Grenzen<br />
Mourão Permoser befasst sich auch mit<br />
einer weiteren moralischen Frage in Bezug<br />
auf die Grenzen Europas: Die EU<br />
verschiebt ihre Grenzen weiter nach außen<br />
und lagert den Grenzschutz nach<br />
Libyen aus. „Die libysche Küstenwache<br />
stoppt Migrant*innen und schickt sie zurück.<br />
Dafür bekommt sie Gelder, Training<br />
und Equipment von der EU. Ein Abschieben<br />
in Länder, in denen Betroffene verfolgt<br />
und misshandelt werden, ist laut<br />
EU-Verträgen und Genfer Menschenrechtskonvention<br />
verboten. In diesem<br />
Fall erledigt das allerdings Libyen für die<br />
EU – und Libyen hat weder die Menschenrechtskonvention<br />
unterschrieben<br />
noch unterliegt es EU-Recht“, sagt<br />
Mourão Permoser. „Das ist eindeutig eine<br />
Strategie, um geltendes Recht zu umgehen.“<br />
Und auch die Binnengrenzen<br />
verschieben sich: „Grenzschutz“ passiert<br />
längst nicht mehr nur an nationalen<br />
Grenzen, Migrant*innen drohen auch innerhalb<br />
der EU Kontrollen – eben nicht<br />
nur durch Polizei, sondern auch im alltäglichen<br />
Kontakt mit Behörden und öffentlichen<br />
Institutionen. „Gegen eben<br />
diese innerlichen und äußerlichen Verschiebungen<br />
der Grenzen kämpfen die<br />
Aktivist*innen, die im Zentrum meines<br />
<strong>Forschung</strong>sprojektes stehen.“ sh<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/22 15
TITELTHEMA<br />
GRENZÜBERSCHREITUNG<br />
ALS RESSOURCE<br />
Migrationsliteratur verhandelt Grenzerfahrung auf zahlreichen Ebenen.<br />
Julia Pröll vom Institut für Romanistik spannt in ihrer <strong>Forschung</strong> einen Bogen zwischen Migration,<br />
Medizin und Krankheit(serfahrung) und macht dabei die ermächtigenden Potenziale von<br />
Grenzerfahrungen in französischsprachiger Migrationsliteratur deutlich.<br />
JULIA PRÖLL: „Migrationsautor*innen legen ihren Schwerpunkt weniger auf den traumatischen Effekt der Exilerfahrung, sondern nutzen<br />
ihre Literatur oft für transkulturelle Identitätsentwürfe.“<br />
16 zukunft forschung <strong>02</strong>/22<br />
Foto: Andreas Friedle
TITELTHEMA<br />
Krankheit und Migration zählen<br />
zu jenen Erfahrungen im Leben<br />
eines Menschen, die potenziell<br />
krisenbehaftet sind. In literarischen Darstellungen<br />
wird gerade das Exil, das ein<br />
erzwungenes Verlassen der Heimat bedeutet,<br />
häufig mit Krankheit gleichsetzt.<br />
Tatsächlich waren es Sätze wie „Das Exil<br />
ist eine Krankheit. Sie ergreift den Geist,<br />
das Gemüt“ der österreichischen Autorin<br />
Hilde Spiel, oder „Das Exil […] ist […] eine<br />
Schule des Taumels“ des in Rumänien<br />
geborenen Schriftstellers Emile Cioran,<br />
welche die Romanistin Julia Pröll dazu<br />
inspiriert haben, sich mit den vielfältigen<br />
Wechselbeziehungen zwischen Migration,<br />
Medizin und Krankheitserfahrung auseinanderzusetzen.<br />
Dazu untersuchte die Literaturwissenschaftlerin<br />
unter anderem literarische Texte<br />
von chinesischen und vietnamesischen<br />
Autorinnen und Autoren, die in Frankreich<br />
leben und auf Französisch schreiben.<br />
„Ist dieser ‚Schwindel‘, von dem Cioran<br />
spricht und der die Autorinnen und Autoren<br />
beispielsweise dann ergreift, wenn sie<br />
die chinesischen Ideogramme gegen das<br />
Alphabet eintauschen, nur negativ zu sehen?<br />
Oder besitzt er auch ein produktives<br />
Potenzial? Anders gesagt: Wenn alle meine<br />
bisherigen Bezugspunkte ins Wanken<br />
geraten, inwiefern kann dies dennoch als<br />
der Beginn von etwas – heilsam – Neuem<br />
gesehen werden?“, beschreibt Julia Pröll<br />
jene Fragen, die ihr <strong>Forschung</strong>sinteresse<br />
an der Schnittstelle von literarischem und<br />
medizinischem Diskurs leiten.<br />
Transkulturelles<br />
Die Analyse der Darstellung von Krankheit<br />
und Medizin in literarischen Texten,<br />
die im Kontext von kulturellen Kontakten<br />
entstehen, eröffnete für die Literaturwissenschaftlerin<br />
neue Perspektiven auf<br />
verschiedene gesamtgesellschaftlich relevante<br />
Bereiche. So zeigte sich für Pröll in<br />
der Auseinandersetzung mit asiatischer<br />
Migrationsliteratur in Frankreich seit den<br />
„Texte aus der Migrationsliteratur könnten in die Ausbildung von<br />
medizinischem Personal einfließen, damit es sich besser auf die<br />
Bedürfnisse der Patient*innen aus aller Welt einstellen kann.“ <br />
JULIA PRÖLL ist promovierte Juristin und<br />
assoziierte Professorin für Französische<br />
Literatur- und Kulturwissenschaft am<br />
Institut für Romanistik. Sowohl ihre an der<br />
Universität Innsbruck erstellte Dissertation<br />
(2006) als auch ihre Habilitationsschrift<br />
(2014) sind preisgekrönt. Von 2014<br />
bis 2016 forschte sie im Rahmen eines<br />
Humboldt-Stipendiums an der Universität<br />
des Saarlandes. Ihr <strong>Forschung</strong>sinteresse<br />
fokussiert seit mehreren Jahren auf das<br />
relativ neue <strong>Forschung</strong>sfeld der Medical<br />
Humanities im Lichte französischsprachiger<br />
Migrationsliteratur. Sie ist auch (Mit-)<br />
Gründerin und (Mit-)Herausgeberin der<br />
Online-Zeitschrift Re:visit. Humanities &<br />
Medicine in Dialogue (journal-revisit.org),<br />
die im Dezember 2<strong>02</strong>2 erstmals erscheint.<br />
Julia Pröll<br />
1980er-Jahren, „dass Migrationsautorinnen<br />
und -autoren ihren Schwerpunkt<br />
nicht auf den traumatischen Effekt der<br />
Exilerfahrung legen, wie man es vielleicht<br />
etwas vorschnell vermuten würde,<br />
sondern sich viel mehr auf Identitätsbildungsprozesse<br />
fokussieren. Das heißt, sie<br />
nutzen ihre Literatur für transkulturelle<br />
Identitätsentwürfe und verrücken Grenzen<br />
zwischen ‚Fremd‘ und ‚Eigen‘, gerade<br />
ind em sie für das ‚Fremde im Eigenen‘<br />
sensibilisieren.“<br />
Diese Literatur verhandelt für Pröll<br />
daher Migration nicht als Schwäche,<br />
sondern durchaus als Stärke; sie sieht in<br />
Migrant*innen folglich nicht ausschließlich<br />
(passive) Patient*innen oder „angstmachende“<br />
Träger*innen gefährlicher<br />
Krankheiten. Vielmehr wird gerade durch<br />
die literarische Figur des erkrankten Migranten<br />
eine spannende Perspektive auf<br />
den Kontakt von Gesundheits- und Medizinsystemen<br />
ermöglicht. „Unterschiedliche<br />
Körper- und Krankheitskonzepte<br />
werden häufig zusammen gedacht und<br />
spannungsreich aufeinander bezogen. So<br />
kommen neben medizinischen Erklärungen<br />
für Krankheitssymptome durchaus<br />
auch andere Konzepte, wie beispielsweise<br />
Geisterglaube, vor“, erklärt die Literaturwissenschaftlerin:<br />
„Dies vermag zu verdeutlichen,<br />
dass auch Medizin kulturelle<br />
Wurzeln hat und dass die – westlich geprägte<br />
– Medizin nicht das Deutungsmonopol<br />
für Krankheit hat. So kommt es in<br />
der von mir untersuchten Literatur häufig<br />
zu einer wohltuenden Relativierung der<br />
Perspektiven, wovon letztlich auch ein<br />
Gesundheitssystem profitieren kann, das<br />
sich mehr und mehr mit Migrant*innen<br />
als Patient*innen zu beschäftigen hat und<br />
dies ohne Arroganz tun soll.“<br />
„Lebenswissen“ im Kontakt<br />
In der literarischen Analyse der „Trias“<br />
von Migration, Krankheit und Medizin<br />
sieht Julia Pröll großes Potenzial und<br />
auch eine kulturelle Bereicherung für das<br />
„reale“ Leben auf unterschiedlichen Ebenen.<br />
„Durch die Analyse von literarischen<br />
Texten in diesem Themenfeld ist mir bewusst<br />
geworden, dass sich darin sehr viel<br />
‚Lebenswissen‘ befindet, das an anderer<br />
Stelle so nicht greifbar werden kann.<br />
Oder eben anders greifbar wird, wie beispielsweise<br />
in den naturwissenschaftlich<br />
orientierten Life Sciences.“<br />
Die Literatur sieht Pröll daher als besonders<br />
geeigneten „Lehrmeister“, um<br />
Grenzen im Kopf zu überwinden, was<br />
etwa Vorurteile gegenüber Menschen betrifft,<br />
die aus anderen Kulturen kommen.<br />
Die Erschließung dieser Texte könne daher<br />
sowohl für die Geisteswissenschaften<br />
als auch für die Medizin von großem Vorteil<br />
sein, denn eigentlich, so Pröll, seien ja<br />
beides „Lebenswissenschaften“: „Literarische<br />
Texte von Migrationsautor*innen<br />
könnten etwa in die Ausbildung von medizinischem<br />
Personal einfließen, damit<br />
dieses sich besser auf die Bedürfnisse ihrer<br />
Patientinnen und Patienten aus aller<br />
Welt einstellen kann. Menschen artikulieren<br />
Symptome nicht überall auf der Welt<br />
gleich, Körperbeschreibungen sind sehr<br />
unterschiedlich. In dieser Hinsicht können<br />
wir aus der Migrationsliteratur sehr viel<br />
lernen“, ist Pröll überzeugt. mb<br />
MIT MEDICAL HUMANITIES wird<br />
ein interdisziplinäres <strong>Forschung</strong>sfeld an<br />
der Schnittstelle zwischen Medizin und<br />
Geistes- bzw. Kulturwissenschaften beschrieben.<br />
Die Universität Innsbruck verfügt<br />
über ein eigenes <strong>Forschung</strong>szentrum zu<br />
diesem Themenbereich, das am Center für<br />
Interdisziplinäre Geschlechterforschung<br />
angesiedelt ist. Die zahlreichen Innsbrucker<br />
Forscher*innen vereinen darin vielseitige<br />
Perspektiven auf Zusammenhänge<br />
zwischen Gesundheit und Gesellschaft<br />
oder Gesundheit und Umwelt wie etwa<br />
transkulturelle Gesundheitskommunikation,<br />
Körperbilder oder Geschlechterkonzepte.<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/22 17
TITELTHEMA<br />
EIN KONZEPT VON<br />
EUROPA<br />
Was Europäer*innen übereinander denken, was „europäisch“ ist<br />
und was nicht, und wie sich das alles historisch entwickelt hat: Das wird<br />
am <strong>Forschung</strong>szentrum „Europakonzeptionen“ erforscht.<br />
EINE EUROPAKARTE AUS 1743<br />
mit damals aktuellen Grenzen, in gelb<br />
das damalige Heilige Römische Reich<br />
Deutscher Nation.<br />
G<br />
renzen spielten jahrhundertelang in<br />
Europa für den Alltag der Menschen<br />
praktisch keine Rolle“, sagt Stefan<br />
Ehrenpreis. Der Historiker leitet das <strong>Forschung</strong>szentrum<br />
„Europakonzeptionen“<br />
– ein zentraler <strong>Forschung</strong>sgegenstand ist<br />
dort, wie sich Europäer*innen gegenseitig<br />
wahrnehmen, was sie eint und was sie<br />
trennt. Nationale Grenzen sind heute zwar<br />
innerhalb der Europäischen Union für EU-<br />
Bürger*innen weitgehend aufgehoben,<br />
spielen aber eine große Rolle in den Köpfen<br />
und nach außen. Und sie sind ein noch sehr<br />
junges Phänomen, wie Ehrenpreis erläutert:<br />
„Bis ins frühe 19. Jahrhundert waren Grenzen<br />
höchstens im rechtlichen Sinn relevant,<br />
etwa, wenn es darum ging, welchem Landesherren<br />
man gegenüber verpflichtet war<br />
und Steuern abliefern musste, und natürlich<br />
darum, welche Gesetze generell galten.“ Für<br />
Reisende hatten die Grenzen zwischen einzelnen<br />
politischen Einheiten darüber hinaus<br />
18 zukunft forschung <strong>02</strong>/22<br />
Fotos: J. M. Hasic – Homann {Erben} 1743 (1), Andreas Friedle (1)
TITELTHEMA<br />
keine besondere Bedeutung, oft waren sie nicht<br />
einmal exakt definiert: „Man wusste natürlich,<br />
welches Dorf welchem Fürsten gehört, aber wo<br />
genau die Grenze zwischen den Dörfern verläuft,<br />
war nicht immer klar – und eben über<br />
weite Strecken irrelevant.“<br />
Zaristisches Kontrollbedürfnis<br />
Eine Ausnahme bildete lange Zeit Russland:<br />
Schon für das 16. Jahrhundert ist belegt,<br />
dass man sich bei Einreise in das Zarenreich<br />
im ersten Dorf anmelden und beim jeweils<br />
verantwortlichen Adeligen auch ein Formular<br />
mit Fragen zu weiteren Zielen und dem<br />
Zweck der Reise ausfüllen musste, eine Art<br />
Passbrief, den man auch bei weiteren Stationen<br />
erneut vorzeigen musste. „Das ist nur mit<br />
einem gewissen Kontrollbedürfnis des Zaren<br />
zu erklären, der zu jeder Zeit informiert sein<br />
wollte, welche Fremden sich in seinem Gebiet<br />
aufhielten. Dieses Verhalten war mit ein<br />
Grund dafür, und auch das wissen wir aus<br />
Quellen, dass der Rest Europas Russland<br />
damals noch nicht als europäische Macht begriff,<br />
sondern als etwas strukturell Anderes,<br />
wo man sich auch anders zu benehmen hatte“,<br />
sagt der Historiker. Dieses Verhältnis zu<br />
Russland sollte sich erst im 18. und 19. Jahrhundert<br />
ändern. „Ab dem 18. Jahrhundert,<br />
unter Peter dem Großen, hat Russland sich<br />
geöffnet und expandierte, und das führte<br />
dazu, dass das Reich auch nicht mehr als so<br />
fremd wahrgenommen wurde.“ Diese mental<br />
maps, durch unterschiedliche Sichtweisen,<br />
Konzepte und Praktiken geprägte Konstruktionen<br />
von europäischen Gemeinsamkeiten<br />
und Unterschieden, wandeln sich stetig, und<br />
dementsprechend verschieben sich auch definitorische<br />
Grenzen des „Europäischen“.<br />
Generelle Überlegungen über ein europäisches<br />
Mächtegleichgewicht sind bereits aus<br />
dem 15. Jahrhundert belegt, etwa in den Memoiren<br />
des französischen Diplomaten Philippe<br />
de Commynes (1447 – 1511). Die bisher erste<br />
bekannte Quelle für eine Benennung dessen,<br />
was wir heute als „europäische Werte“ bezeichnen<br />
würden, hat Stefan Ehrenpreis gemeinsam<br />
mit seinem Kollegen Niels Grüne in<br />
Korrespondenz rund um den Spanischen Erbfolgekrieg<br />
(1701 – 1714) entdeckt: „Der Konflikt<br />
war vielschichtig und ist kaum in einem Satz<br />
zusammenzufassen. Aber kurz umrissen standen<br />
sich damals in Europa Österreich mit dem<br />
Heiligen Römischen Reich, die Niederlande<br />
und England auf der einen und hauptsächlich<br />
Frankreich auf der anderen Seite gegenüber,<br />
auf dem Spiel stand das Mächtegleichgewicht<br />
auf dem Kontinent – der französische König<br />
Ludwig XIV. wollte sich selbst die Herrschaft<br />
über Spanien sichern, die Gegenparteien wollten<br />
das verhindern. Und die Kriegsparteien<br />
schlossen den französischen König Ludwig<br />
XIV. sozusagen aus Europa aus – er verhalte<br />
sich uneuropäisch, wie ein Tyrann, das kenne<br />
man nur von außerhalb Europas, vom russischen<br />
Zaren oder vom osmanischen Sultan.“<br />
Die Mächte definierten auch Merkmale Europas,<br />
denen Ludwig XIV. nicht (mehr) entsprach:<br />
Die Mitbeteiligung der Stände an der<br />
Politik, eine gewisse regionale Selbstverwaltung<br />
und der Schutz des Privateigentums.<br />
Nationalismus<br />
Das 19. Jahrhundert bildet in vielerlei Hinsicht<br />
eine Zäsur im Verständnis von Grenzen<br />
und Zugehörigkeiten: Der damals aufkeimende<br />
Nationalismus beförderte eine genauere<br />
Definition von Staatlichkeit und Staaten,<br />
das schließt auch die Staatsgrenzen mit ein;<br />
und schon im Wiener Kongress 1815 wurden<br />
in der damals erfolgten Aufteilung Europas<br />
Grenzverläufe recht detailliert benannt. Damals<br />
entsteht der moderne Staat mit seinen<br />
Symbolen, die wir bis heute kennen: Reisepässe,<br />
Grenzbalken, Nationalflaggen und -wappen,<br />
dazu kommen später heutige Selbstverständlichkeiten<br />
wie nationale Telefonvorwahlen<br />
und Internet-Domains.<br />
„Das 19. und 20. Jahrhundert bringen bekanntlich<br />
große Umwälzungen. Die Öffnung<br />
Russlands endete mit der Revolution 1917, da<br />
entstanden auch neue mental maps in Europa<br />
– Russland wurde erst Hoffnungsgebiet für<br />
Sozialisten und Kommunisten, der Zweite<br />
Weltkrieg und der Kalte Krieg brachten dann<br />
erneut neue Grenzen und Zuschreibungen“,<br />
sagt Stefan Ehrenpreis. Gleichzeitig halten<br />
sich andere Konzepte teils über Jahrhunderte<br />
– wenn etwa ein Kommentator in der Financial<br />
Times während der Finanzkrise noch 2011<br />
den damals aktuellen Konflikt in der Eurozone<br />
zwischen nördlichen und südlichen Mitgliedsstaaten<br />
auf den Dreißigjährigen Krieg<br />
und den Unterschied zwischen (vermeintlich)<br />
prassenden Katholik*innen und sparsamen<br />
Protestant*innen bezieht. „Generell wurde<br />
und wird ein Europa-Argument genauso oft<br />
als Mittel des Ausschlusses verwendet wie als<br />
eines der Einigung“, betont der Historiker.<br />
„Auch historisch ist das leicht belegt: Europa<br />
als Konzept wurde und wird ganz unterschiedlich<br />
benutzt, mit ganz unterschiedlichen<br />
Folgen. Nicht nur Historikerinnen und<br />
Historiker wissen: Quellenkritik ist stets angebracht,<br />
auch, wenn es um Europa und seine<br />
Grenzen geht.“<br />
sh<br />
STEFAN EHRENPREIS ist<br />
seit 2014 Universitätsprofessor<br />
im Arbeitsbereich Geschichte<br />
der Neuzeit am Institut für<br />
Geschichtswissenschaften<br />
und Europäische Ethnologie<br />
der Universität Innsbruck.<br />
Ehrenpreis ist auch Leiter des<br />
<strong>Forschung</strong>szentrums „Europakonzeptionen“<br />
der Universität.<br />
Dieses Zentrum will zur wissenschaftlichen<br />
Aufklärung über<br />
Vorstellungen und Wahrnehmungen<br />
von Europa beitragen.<br />
Sowohl innerhalb als auch<br />
außerhalb Europas entstanden<br />
Bilder des Kontinents und soziale<br />
Praktiken seiner Lebenswelten,<br />
die zur Wirklichkeit<br />
europäischer Gesellschaften<br />
gehörten und gehören. Das<br />
<strong>Forschung</strong>szentrum untersucht<br />
die Entstehung von Narrativen<br />
und Praktiken zu Europa als<br />
auch deren Wandel in Vergangenheit<br />
und Gegenwart.<br />
Neben Texten werden auch<br />
visuelle und künstlerisch-ästhetische<br />
Quellen genutzt und<br />
so die Zusammenarbeit der<br />
„Buchwissenschaften“ mit den<br />
„Bildwissenschaften“ in Innsbruck<br />
systematisch gestärkt –<br />
beteiligt sind hier insbesondere<br />
die Institute der geisteswissenschaftlichen<br />
Fakultäten.<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/22 19
TITELTHEMA<br />
NEUE MÄCHTE, ALTE LÄNDER<br />
Im Mittelpunkt der noch jungen Grenzraumforschung am Bereich<br />
Baugeschichte und Denkmalpflege stehen Architektur, Städtebau<br />
und Bildmedien in europäischen Grenzräumen. In diesen Gebieten,<br />
die im Laufe der Geschichte – meist aufgrund kriegerischer<br />
Auseinandersetzungen – ihre nationale Zugehörigkeit gewechselt<br />
haben, wurden von den neuen Machthabern bewusst bauliche<br />
Aneignungsstrategien eingesetzt, die von Wissenschaftler*innen<br />
rund um Klaus Tragbar anhand methodischer Ansätze aus verschiedenen<br />
Disziplinen untersucht werden. Einen Schwerpunkt<br />
bilden Südtirol/Alto Adige und das Trentino, wo sich zahlreiche<br />
Beispiele für die Italianisierung der Regionen finden. Der von<br />
Klaus Tragbar und Volker Ziegler herausgegebene Band Planen<br />
und Bauen im Grenzraum/Planning and Building in Border<br />
Regions bietet einen Überblick über das Thema.<br />
TRENTINO NOSTRO<br />
Die Abbildung zeigt das Cover der 1916<br />
erschienenen Publikation Trentino nostro<br />
von Antonio Rossaro. Die Illustration des<br />
1890 geborenen Architekten, Malers und<br />
Grafikers Giorgio Wenter Marini in den italienischen<br />
Nationalfarben ist ein eindrucksvolles<br />
Beispiel dafür, wie irredentistischen<br />
Schriften für den Anschluss des Trentino an<br />
Italien warben.<br />
K.K. BAHNHOF TRIENT<br />
Das 1859 eröffnete k.k. Bahnhofsgebäude wurde nach dem<br />
Ersten Weltkrieg von Italien als unzulänglich angesehen.<br />
Angiolo Mazzoni schrieb, es lasse „besonders vom architektonischen<br />
Gesichtspunkt aus viel zu wünschen übrig“ und<br />
sei „bar jeglichen Gefühls für Modernität“. 1933 wurde der<br />
Bahnhof abgerissen.<br />
BAHNHOF DER FERROVIE DELLO STATO IN TRIENT<br />
Der Bahnhof von Angiolo Mazzoni (errichtet 1933 bis 1936)<br />
war nach dem in Florenz der zweite Bahnhofsneubau des<br />
Rationalismus, der modernità und italianità ausstrahlen sollte.<br />
Das prägnante horizontale Flugdach verleiht dem Gebäude<br />
Dynamik, die Pfeilerhalle Monumentalität.<br />
20<br />
Fotos: Attilio Brunialti: Le nuove provincie Italiane. Bd. 2: L’Alto Adige. Turin 1919 Rossaro, Antonio: Trentino nostro. Parma 1916, Umschlag; Historische Postkarte, Sammlung Bereich Baugeschichte und Denkmalpflege; Klaus Tragbar<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/22
TITELTHEMA<br />
NARODNI DOM IN TRIEST<br />
Im Frühjahr 1900, in einer Zeit großer Spannungen<br />
zwischen der slowenischen und der<br />
italienischen Bevölkerung in Triest, beschlossen<br />
die slowenischen Vereine den Bau des Narodni<br />
dom (19<strong>02</strong>–1904), eines repräsentativen,<br />
multifunktionalen Gebäudes, das nach dem<br />
Entwurf von Max Fabiani auf der Piazza della<br />
Caserma errichtet wurde.<br />
DER BRAND DES NARODNI DOM<br />
Nach dem Ersten Weltkrieg benannte die<br />
nunmehr italienische Stadtregierung die<br />
Piazza della Caserma nach dem Irredentisten<br />
Guglielmo Oberdan um. Im Dezember<br />
1918 und im August 1919 wurden Räume im<br />
Narodni dom demoliert, und am 13. Juli 1920<br />
setzte Francesco Giunta, später Sekretär des<br />
Partito Nazionale Fascista, das Gebäude in<br />
Brand.<br />
NARODNI DOM, ANSICHT 2<strong>02</strong>0<br />
Die heutige Ansicht zeigt das Ergebnis der städtebaulichen Umgestaltung<br />
des Ventennio: Der zwischen 1924 und 1926 errichtete Palazzo<br />
Arrigoni verdrängt buchstäblich das Narodni dom in die zweite Reihe.<br />
Am 13. Juli 2<strong>02</strong>0, 100 Jahre nach dem Brand, wurde das Gebäude an<br />
die slowenische Gemeinschaft in Triest zurückgegeben.<br />
Fotos: Historische Postkarte, Sammlung Bereich Baugeschichte und Denkmalpflege; Mladika, 2<strong>02</strong>0, 4, S. 4 oben; Pemič, Monika: Das slowenische Vereinshaus Narodni dom und die städtebauliche und politische Italianisierung<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/22 21<br />
der Stadt Triest, in: Tragbar, Klaus/Ziegler, Volker (Hg.): Planen und Bauen im Grenzraum / Planning and Building in Border Regions (Innsbrucker Beiträge zur Baugeschichte 1). Berlin/München 2019, S. 103–123, hier S. 104
KURZMELDUNGEN<br />
NOBELPREIS FÜR<br />
ANTON ZEILINGER<br />
Von 1990 bis 1999 forschte Anton Zeilinger an der Universität<br />
Innsbruck und führte hier zahlreiche seiner Experimente durch.<br />
Ich gratuliere Anton Zeilinger herzlich<br />
zum Nobelpreis. Es ist eine<br />
große Stunde für die österreichische<br />
Physik, aber auch für die Universität<br />
Innsbruck, an deren Institut für Experimentalphysik<br />
Anton Zeilinger von 1990<br />
bis 1999 forschte und lehrte und wo er<br />
mehrere der gewürdigten bahnbrechenden<br />
Experimente durchgeführt hat, so<br />
die erste Quantenteleportation mit Photonen<br />
im Jahr 1997“, freute sich Rektor<br />
Tilmann Märk nach der Verkündigung<br />
der diesjährigen Preisträger durch die<br />
Schwedische Akademie der Wissenschaften<br />
Anfang Oktober.<br />
Das Experiment zur Quantenteleportation<br />
war das erste, das den Quantenzustand<br />
eines Teilchens auf ein anderes<br />
Teilchen in der Distanz übertrug. Zeilingers<br />
Erfolge waren nicht zuletzt auch ein<br />
Grund dafür, die Quantenphysik in Innsbruck<br />
auszubauen und führten später<br />
zur Gründung des Akademie-Instituts<br />
für Quantenoptik und Quanteninformation<br />
in Innsbruck und Wien. An der Universität<br />
Innsbruck forschen heute über 20<br />
Arbeitsgruppen im Bereich der Quantenphysik,<br />
unter anderem auch an der Entwicklung<br />
eines universellen Quantencomputers.<br />
<br />
PROMINENTE FORSCHER*INNEN WERDEN BEVORZUGT<br />
<strong>Forschung</strong>sarbeiten von renommierten Forscher*innen werden trotz gleicher Qualität deutlich<br />
besser bewertet als Arbeiten weniger bekannter Forscher*innen. Zu diesem Ergebnis<br />
kam ein Team von Wissenschaftler*innen unter der Leitung von Jürgen Huber vom Institut für<br />
Banken und Finanzen der Universität Innsbruck in einer kürzlich veröffentlichten Studie. „Unsere<br />
Ergebnisse zeigen deutlich, dass die unterschiedlichen Informationen über den Verfasser die<br />
Bewertung der Qualität des <strong>Forschung</strong>sartikels stark beeinflussen“, sagt Jürgen Huber. Sein<br />
Kollege Rudolf Kerschbamer führt das Ergebnis auf den „Halo-Effekt“ zurück: „Dieses aus der<br />
Sozialpsychologie bekannte Phänomen besagt, dass Handlungen und Werke von Personen,<br />
von denen man einen positiven Eindruck hat, grundsätzlich positiver wahrgenommen werden<br />
als jene von unbekannten Personen oder von Personen, denen man nicht so viel zutraut.“<br />
KURRENT LESEN<br />
MIT TRANSKRIBUS<br />
Handschriften sind so individuell wie<br />
Menschen. Dennoch sind Computer<br />
heute in der Lage, handschriftliche Texte<br />
in unterschiedlichsten Sprachen automatisch<br />
zu erkennen. Die von der Universität<br />
Innsbruck mitentwickelte Software-Plattform<br />
Transkribus macht diese Technologie<br />
der Wissenschaftsgemeinde, interessierten<br />
Archiven und der breiten Öffentlichkeit<br />
zugänglich. Über 90.000 Nutzerinnen<br />
und Nutzer aus aller Welt verwenden die<br />
Plattform bereits, um handschriftliche Dokumente<br />
lesbar und durchsuchbar zu machen.<br />
Eine immer größer werdende Gruppe<br />
interessiert sich für ihre Familiengeschichte<br />
und begibt sich in Kirchenbüchern, Verträgen<br />
oder in historischen Dokumenten auf<br />
die Suche nach ihren Vorfahren.<br />
Transkribus arbeitet mit neuronalen Netzen.<br />
Diese maschinenlernenden Methoden<br />
haben den großen Vorteil, dass sie nicht<br />
mehr speziell für eine bestimmte Handschrift<br />
programmiert werden müssen. „Die<br />
Benutzerinnen und Benutzer bringen der<br />
Maschine bei, die Schrift zu lesen“, sagt<br />
ÜBER 90.000 Nutzer*innen verwenden<br />
Transkribus, um handschriftliche Dokumente<br />
les- und durchsuchbar zu machen.<br />
Günter Mühlberger von der Arbeitsgruppe<br />
Digitalisierung/Archivierung an der Universität<br />
Innsbruck und Verwaltungsratsvorsitzender<br />
der europäischen Genossenschaft<br />
READ-COOP: „Und eine Maschine ermüdet<br />
nicht, das heißt, sie kann auch Tausende,<br />
Hunderttausende oder Millionen von<br />
Seiten automatisiert verarbeiten.“ Die verwendete<br />
Technologie ist unabhängig von<br />
der Sprache und der eigentlichen Schriftart.<br />
Transkribus erkennt nicht nur Kurrentschrift<br />
oder moderne Handschriften, sondern<br />
auch mittelalterliche Schriften, Hebräisch,<br />
Arabisch oder indische Schriften.<br />
22<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/22<br />
Fotos: Jaqueline Godany (1), Universität Innsbruck (1)
STANDORT<br />
DIE JAHRHUNDERTCHANCE<br />
Rektor Tilmann Märk und Ulrike Tanzer, Vizerektorin für <strong>Forschung</strong>, sprechen über viele Jahre im<br />
Wissenschaftsmanagement, die <strong>Forschung</strong>sleistung der Uni Innsbruck und regionale Kooperationen.<br />
ZUKUNFT: Herr Märk, Sie haben 2003 das<br />
Amt des Vizerektors für <strong>Forschung</strong>, 2011<br />
das Amt des Rektors angetreten. War diese<br />
lange Zeit im Wissenschaftsmanagement<br />
Ihr Plan?<br />
TILMANN MÄRK: Dazu muss ich etwas<br />
weiter ausholen. Als junger PostDoc in<br />
den USA habe ich festgestellt, dass wir in<br />
Österreich und an der Universität Innsbruck,<br />
was das internationale Niveau<br />
betrifft, weit hinten lagen. Zurück in<br />
Innsbruck hatte ich die Vision, dass es<br />
schön wäre, wenn die Universität Innsbruck<br />
wieder an das Vorkriegsniveau<br />
anschließen könnte, immerhin zieren die<br />
Eingangshalle des Hauptgebäudes die<br />
Büsten von vier Nobelpreisträgern. Ich<br />
war dann als Vorsitzender des Assistentenverbandes<br />
im Rahmen des UOG 75<br />
universitätspolitisch tätig, die Situation<br />
im akademischen Senat als Vertreter der<br />
Assistentinnen und Assistenten war aber<br />
frustrierend. Daher habe ich mich dann<br />
auf die <strong>Forschung</strong> konzentriert, mir aber<br />
immer gedacht, wenn später die Chance<br />
bestehen würde, tatsächlich etwas bewegen<br />
zu können, dann würde ich das gerne<br />
tun. 2003 hatte ich daher die Hoffnung,<br />
mit diesem neuen Instrument, dem UG<br />
20<strong>02</strong>, die Universität entsprechend voranzubringen.<br />
Es war für mich die Jahrhundertchance,<br />
mit 59 war ich auch in<br />
einem guten Alter, von der Wissenschaft<br />
ins Wissenschaftsmanagement zu wechseln.<br />
Das Vizerektorat für <strong>Forschung</strong> war<br />
2003 eine wichtige Funktion, ging es uns<br />
doch darum, die <strong>Forschung</strong> neu zu organisieren<br />
und quer über die Fächer entsprechende<br />
Leistungen zu ermöglichen.<br />
Und wenn man sich die damaligen und<br />
heutigen Zahlen der Wissensbilanz vergegenwärtigt,<br />
kann ich nur sagen, dass<br />
uns das gelungen ist.<br />
ZUKUNFT: Wenn Sie die universitäre Situation<br />
von 2003 mit der heutigen vergleichen<br />
– wo sehen Sie inhaltlich die größten<br />
Unterschiede und Entwicklungen?<br />
MÄRK: Die Haltung vieler Universitätsangehöriger<br />
in Hinblick auf ihre Arbeit<br />
TILMANN MÄRK: „2003 hatte ich die Hoffnung, mit diesem neuen Instrument, dem UG<br />
20<strong>02</strong>, die Universität entsprechend voranzubringen. Aus heutiger Sicht zurecht.“<br />
hat sich stark verändert. Es war ein notwendiger<br />
Paradigmenwechsel der Mitarbeitenden<br />
und der Universität vom<br />
20. ins 21. Jahrhundert. Um es an einigen<br />
Beispielen festzumachen: Früher<br />
gab es kaum aktive unternehmerische<br />
Tätigkeiten der Universität bzw. an der<br />
Universität, auch damit zusammenhängend,<br />
dass bis dahin Erfindungen dem<br />
Ministerium gehörten. Das UG 20<strong>02</strong> ermöglichte<br />
gemeinsame Ausgründungen<br />
auf der Basis von Entdeckungen und Erfindungen,<br />
eine kommerzielle Nutzung<br />
solcher Ergebnisse war vorher nahezu<br />
verpönt. Ähnliches gilt für das, was man<br />
heute als third mission bezeichnet. Indirekt<br />
hat man diese Verantwortung zwar<br />
schon immer wahrgenommen, indem<br />
man zum Beispiel die Studierenden auf<br />
dem aktuellsten Wissensstand ausgebildet<br />
und somit stark in die Gesellschaft<br />
hineingewirkt hat. Hinzugekommen ist<br />
nun aber das aktive Hineinwirken, Universitäten<br />
haben sich geöffnet, sie sind<br />
nun Orte, an denen Wechselwirkung mit<br />
der Gesellschaft stattfindet. Dazu kommt<br />
ein dritter Punkt und zwar das von mir<br />
initiierte Schwerpunktsystem: Vor dem<br />
UG 20<strong>02</strong> waren Forscherinnen und Forscher<br />
hauptsächlich alleine aktiv – mit<br />
dem Schwerpunktsystem gelang es, dazu<br />
überzugehen, komplexere Fragestellungen<br />
in kompetenten Teams zu lösen<br />
und auch aufgrund von kritischer Masse<br />
nach außen hin erfolgreicher zu wirken.<br />
ZUKUNFT: Frau Tanzer, quasi zur Halbzeit<br />
dieser 20 Jahre, nämlich 2014, wurden<br />
Sie an die Universität Innsbruck berufen.<br />
Was für einen Eindruck hatten Sie von<br />
Ihrem neuen Arbeitsplatz?<br />
ULRIKE TANZER: Es war ein sehr positiver.<br />
Ich habe mich auf eine Professur<br />
beworben, die auch die Leitung des<br />
<strong>Forschung</strong>sinstituts Brenner-Archiv beinhaltet<br />
hat. In Innsbruck angekommen,<br />
bin ich sofort besucht worden: vom Leiter<br />
des <strong>Forschung</strong>sservicebüros, von der<br />
Leiterin der Personalentwicklung. Das<br />
kannte ich von meiner früheren Universität<br />
nicht, dass die zentrale Verwaltung<br />
sofort Kontakt aufnimmt und zeigt, welche<br />
Möglichkeiten es gibt. Die Universität<br />
Innsbruck hat sich mir als sehr moderne<br />
und vielfältige Universität präsentiert.<br />
24 zukunft forschung <strong>02</strong>/22<br />
Fotos: Andreas Friedle
STANDORT<br />
ZUKUNFT: 2017, als Vizerektorin für <strong>Forschung</strong>,<br />
erklärten Sie, ein spezielles Augenmerk<br />
auf den wissenschaftlichen<br />
Nachwuchs und Frauen in der Wissenschaft<br />
zu legen. Ist Ihnen das gelungen?<br />
TANZER: Die Uni Innsbruck hatte damals<br />
bereits eine große Anzahl an Fördermöglichkeiten<br />
für den wissenschaftlichen<br />
Nachwuchs, die weiter ausgebaut<br />
wurden. Es gibt die Möglichkeit interner<br />
Karriereverläufe, zudem Förderungen<br />
wie Doktoratsstipendien, Mentoringprogramme,<br />
Preise und Auszeichnungen, die<br />
teilweise speziell für Frauen entwickelt<br />
wurden. Das ist, denke ich, nicht schlecht<br />
gelungen. Natürlich wird man aber immer<br />
einen Punkt finden, bei dem man nicht<br />
erfolgreich war, und man kann natürlich<br />
nicht alles umsetzen, was man sich vorstellt.<br />
Mit den Doktoratskollegs haben wir<br />
zudem erstmals strukturierte Möglichkeiten<br />
für Doktoratsstudierende entwickelt.<br />
ZUKUNFT: Wenn es um das Messen wissenschaftlicher<br />
Leistungen geht, werden<br />
alljährlich die unterschiedlichsten Rankings<br />
erstellt. Kann man <strong>Forschung</strong>sleistung<br />
überhaupt ranken und vergleichen?<br />
MÄRK: Natürlich kann man ranken, es gibt<br />
verschiedene Indikatoren, um zumindest<br />
näherungsweise solide Aussagen treffen<br />
zu können. Schwierig ist aber, verschiedene<br />
Arten von Universitäten zu vergleichen<br />
– das muss man im Hinterkopf behalten<br />
und sich eine bessere Differenzierung<br />
wünschen. Wir haben weltweit in etwa<br />
20.000 Universitäten, die Universität Innsbruck<br />
befindet sich in den verschiedenen<br />
Rankings je nach gewichteter Leistung<br />
zwischen Platz 200 und 400 – unter den ein<br />
bis zwei Prozent der besten Universitäten.<br />
Vergleicht man aber das Umfeld dieser Positionen,<br />
sind vor und hinter uns Universitäten,<br />
die mit ganz anderen Ressourcen<br />
und besseren Arbeitsbedingungen ausgestattet<br />
sind. In Wirklichkeit sind wir daher<br />
sehr effizient und auch insofern besser, als<br />
es die Rankings abbilden. In Deutschland<br />
wird pro Studierendem das Doppelte, in<br />
der Schweiz das Drei- bis Fünffache, in<br />
den USA das Fünf- bis Zehnfache ausgegeben.<br />
Dennoch können wir uns mit Top-<br />
Universitäten vergleichen und – Stichwort<br />
Physik – mit der Spitze mithalten. Absolut<br />
gesehen sind die Rankings in Ordnung, sie<br />
zeigen, wie viel man leistet. Sie zeigen aber<br />
nicht immer, wie viel man pro Input leistet.<br />
Da sind wir sehr gut – und, das sage<br />
ich nach wie vor, wir würden wesentlich<br />
„Es braucht mehr Initiativen, um<br />
der Wissenschaftsskepsis<br />
entgegenzuwirken. Das ist für<br />
unsere weitere gesellschaftliche<br />
Entwicklung von enormer<br />
B edeutung.“ <br />
Ulrike Tanzer<br />
weiter vorne liegen, wenn man die Universitäten<br />
in Innsbruck nicht getrennt hätte.<br />
TANZER: Ich sehe das ähnlich, auch wenn<br />
ich als Germanistin Rankings differenzierter<br />
gegenüberstehe, da nur bestimmte<br />
Publikationen in Rankings bewertet<br />
werden. Als Geisteswissenschaftlerin<br />
ist man gewohnt, in anderen Feldern zu<br />
publizieren, wobei sich in den letzten<br />
Jahren in der geisteswissenschaftlichen<br />
Publikationskultur einiges verschoben<br />
hat. Ich war während meiner Amtszeit<br />
die einzige Vizerektorin für <strong>Forschung</strong><br />
in Österreich, die aus einem geisteswissenschaftlichen<br />
Fach gekommen ist – das<br />
sagt auch etwas über den Stellenwert<br />
aus, den die Geisteswissenschaften in der<br />
<strong>Forschung</strong>slandschaft haben.<br />
ZUKUNFT: Herr Märk, vor 15 Jahren meinten<br />
Sie, dass die Kooperation mit der Tiroler<br />
Wirtschaft ausbaufähig wäre. Konnte<br />
sie ausgebaut werden?<br />
MÄRK: Ja, das war 2003 ein wichtiges Ziel<br />
für mich. Es war klar, dass wir gegenüber<br />
unseren „Konkurrenten“ finanziell im<br />
Nachteil sein werden und daher möglichst<br />
viel zusätzliche finanzielle Mittel<br />
lukrieren müssen. In diesem Punkt<br />
können wir auf eine Erfolgsgeschichte<br />
zurückblicken: Der Jahreswert der eingeworbenen<br />
Drittmittel hat sich von circa<br />
zehn Millionen auf fast 60 Millionen<br />
Euro erhöht; besonders bemerkenswert<br />
ist, dass auch für eine Volluniversität ein<br />
vergleichsweiser großer Anteil unserer<br />
Drittmittel als Auftragsforschung aus<br />
der Region kommt; wir konnten zudem<br />
den „Förderkreis 1669“ und die Stiftung<br />
der Universität Innsbruck einrichten, in<br />
denen wichtige Partner aus Industrie,<br />
Politik und Kultur die Universität finanziell<br />
und als Netzwerk unterstützen; mit<br />
dem Land Tirol und der Industrie sind<br />
wir Kooperationen eingegangen, um z.B.<br />
Lücken in der Ausbildung oder der <strong>Forschung</strong>slandschaft<br />
gemeinsam zu schließen;<br />
und wir haben wahrscheinlich in<br />
Österreich die größte Zahl an Stiftungsprofessuren<br />
eingeworben, zuletzt auch<br />
Professuren, die von der FFG sehr kompetitiv<br />
vergeben werden.<br />
TANZER: Bei dieser österreichweiten Ausschreibung<br />
konnten wir überproportional<br />
gut abschneiden, zuletzt mit der Professur<br />
für „Aktive Mobilität“. Wichtig für<br />
diese Stiftungsprofessuren sind nicht nur<br />
die <strong>Forschung</strong>sleistung, sondern auch<br />
Kooperationen mit Firmen.<br />
ZUKUNFT: Viele dieser Kooperationen<br />
sind regionale Kooperationen. Ist Regionalität<br />
Chance oder Gefahr für eine Universität<br />
wie die Innsbrucker?<br />
MÄRK: Dazu eine klare Antwort: Wir sind<br />
eine Bundeseinrichtung, wirken aber im<br />
Land Tirol. Regionalität ist daher insofern<br />
okay, indem wir uns etwas an den<br />
Bedürfnissen der Region – was die Ausbildung<br />
und <strong>Forschung</strong>sexpertise betrifft<br />
– ausrichten, aber immer – was die Qualität<br />
der Ausbildung und <strong>Forschung</strong> betrifft<br />
– auf internationalem Niveau. Dieses<br />
Niveau ist der Gradmesser, nationale<br />
und internationale Vergleiche zeigen,<br />
dass wir in diesem Bereich top sind. Am<br />
Ende zeigt ja auch die stark gestiegene,<br />
hohe Zahl an ausländischen Mitarbeitenden,<br />
über 40 Prozent, und Studierenden,<br />
über 50 Prozent, wie attraktiv die Universität<br />
Innsbruck überregional und international<br />
gesehen wird. ah<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/22 25
WIRTSCHAFT<br />
DIE VIRTUALISIERUNG<br />
VON ORGANISATIONEN<br />
Andreas Eckhardt forscht zur <strong>Zukunft</strong> der Arbeit und untersucht, wie virtuelle<br />
Organisationen Unternehmen helfen können, auf die Herausforderungen unserer Zeit zu reagieren.<br />
Klimakrise, Fachkräftemangel, immer<br />
kürzer werdende Entwicklungszyklen<br />
und eine Arbeitswelt,<br />
die immer digitaler wird – auf alle diese<br />
Entwicklungen müssen Unternehmen<br />
aktuell reagieren. Eine Lösung, mit diesen<br />
Herausforderungen umzugehen,<br />
sieht Andreas Eckhardt, Professor für<br />
Wirtschaftsinformatik, in der virtuellen<br />
Organisation. „Darunter ist eine Organisationsform<br />
zu verstehen, die primär in<br />
der virtuellen Welt existiert. Die Belegschaft<br />
arbeitet dabei komplett virtuell,<br />
zeitlich und örtlich ungebunden, Firmengebäude<br />
und Büros gibt es nahezu nicht<br />
mehr“, so Eckhardt, der am Institut für<br />
Wirtschaftsinformatik, Produktionswirtschaft<br />
und Logistik der Universität Innsbruck<br />
forscht.<br />
Diese Organisationsform funktioniert<br />
bereits vor allem für Unternehmen des<br />
Informationssektors, die Wissensarbeiter*innen<br />
beschäftigen, wie beispielsweise<br />
Programmierer*innen, Designer*innen<br />
oder Texter*innen. Doch für<br />
Eckhardt ist die virtuelle Organisation<br />
langfristig auch in anderen Branchen<br />
denkbar: „Im Austausch mit Firmen<br />
bemerke ich häufig noch Vorbehalte<br />
gegenüber einer Virtualisierung der eigenen<br />
Organisation. Die digitale Transformation<br />
ist jedoch nicht mehr aufzuhalten<br />
– sie findet statt, egal ob einzelne<br />
Unternehmen mitmachen oder nicht.<br />
Auch Industrie-Produkte und deren Fertigung<br />
werden immer digitaler, es gibt<br />
sogar bereits erste virtuelle Fabriken, in<br />
denen ausschließlich Roboter in der Fertigung<br />
agieren und Menschen nur noch<br />
die Prozesskontrolleure sind. Meiner<br />
Meinung nach ist es nur eine Frage der<br />
Zeit, bis sogenannte First-Mover auch in<br />
der Produktion vollständig virtuell agieren<br />
und so den Weg für weitere Unternehmen<br />
bereiten.“<br />
Neue Arbeitswelt<br />
Dabei bringt der Schritt in die digitale<br />
Welt diverse Vorteile mit sich: Sind Mitarbeiter*innen<br />
nicht mehr an einen bestimmten<br />
Ort gebunden, erweitert das<br />
den Radius für Unternehmen, geeignete<br />
Fachkräfte zu finden. Wegfallendes<br />
Pendeln und das Einstellen von Reisetätigkeiten<br />
wirken sich positiv auf die<br />
CO 2 -Bilanz aus, und insgesamt können<br />
virtuelle Unternehmen sich schneller und<br />
kostengünstiger auf neue Anforderungen<br />
einstellen. Wie die Transformation hin zu<br />
einer virtuellen Organisation gelingen<br />
kann, daran forscht Eckhardt bereits seit<br />
2017. Konkret beschäftigt er sich unter<br />
anderem damit, wie Mitarbeiter*innen<br />
darauf vorbereitet werden können, sich<br />
in einer virtuellen Organisation zurechtzufinden.<br />
„Dass Menschen aus dem Homeoffice<br />
arbeiten, das gibt es nicht erst seit dem<br />
Beginn der Corona-Pandemie. Die Literatur<br />
zu virtuellen Teams geht zurück<br />
bis in die 1980er-Jahre. In einer meiner<br />
Studien, die Ende 2019 erschienen ist,<br />
habe ich gemeinsam mit Kolleg*innen<br />
ein dreistufiges Modell präsentiert, wie<br />
ANDREAS ECKHARDT ist seit 2<strong>02</strong>0<br />
Universitätsprofessor für Wirtschaftsinformatik<br />
am Institut für Wirtschaftsinformatik,<br />
Produktionswirtschaft und Logistik<br />
der Universität Innsbruck. Er promovierte<br />
und absolvierte seine akademische Ausbildung<br />
an der Goethe-Universität in<br />
Frankfurt am Main. Neben der Virtualisierung<br />
von Organisationen forscht er<br />
zu Themen wie Cybersecurity, Electronic<br />
Commerce sowie der ethischen Entwicklung<br />
und Nutzung von IT-Systemen. Vor<br />
seiner akademischen Laufbahn arbeitete<br />
er als Projektmanager für DaimlerChrysler<br />
Taiwan in Taipeh.<br />
die vollständige Virtualisierung der eigenen<br />
Organisation gelingen kann. Kurz<br />
darauf kam die Corona-Pandemie und<br />
unser Gedankenkonstrukt wurde plötzlich<br />
Realität“, berichtet Eckhardt. Heute,<br />
drei Jahre später, haben viele Arbeitnehmer*innen<br />
sich an das flexible Arbeiten<br />
aus dem Homeoffice gewöhnt. Unternehmen<br />
stehen nun vor dem Problem,<br />
dass sie ihre Belegschaft wieder zurück<br />
in die Büros holen müssen, obgleich viele<br />
Arbeitnehmer*innen dies gar nicht<br />
mehr wollen. Schuld daran sind nicht<br />
zuletzt auch die – derzeit stark steigenden<br />
– Kosten für die Bereitstellung und<br />
das Heizen von Bürogebäuden, welche<br />
Unternehmen rechtfertigen müssen.<br />
Hinzu kommt die verbreitete Meinung,<br />
dass beim dauerhaften Arbeiten aus<br />
dem Home office das soziale Miteinander<br />
verloren geht. Ein Argument, das für<br />
Andreas Eckhardt nur bedingt zählt: „Es<br />
gibt bereits erste <strong>Forschung</strong>sergebnisse,<br />
die zeigen, dass Mitarbeiter*innen auch<br />
in einer völlig virtuellen Arbeitsumgebung<br />
starkes Vertrauen zueinander fassen<br />
können, ohne sich jemals in Präsenz<br />
gesehen zu haben. Nicht jeder Mensch<br />
braucht den direkten Kontakt zu Kolleginnen<br />
und Kollegen.“<br />
Neue Organisationsform<br />
Teil der <strong>Forschung</strong> von Andreas Eckhardt<br />
sind auch Dezentralisierte Autonome<br />
Organisationen (engl.: decentralized<br />
autonomous organizations), kurz DAOs.<br />
Sie stellen die Extremform der virtuellen<br />
Organisation dar. Bei diesem Organisationstypus<br />
arbeiten Menschen komplett<br />
virtuell und dezentralisiert über den Globus<br />
hinweg verteilt zusammen an einem<br />
gemeinsamen Ziel. DAOs weisen keine<br />
hierarchischen Management-Strukturen<br />
mehr auf, alle Regeln, Rollen und Prozesse<br />
dieser Unternehmung sind als Code<br />
26 zukunft forschung <strong>02</strong>/22<br />
Foto: Andreas Friedle
WIRTSCHAFT<br />
„Es gibt bereits erste <strong>Forschung</strong>sergebnisse, die zeigen, dass Mitarbeiter*innen auch in einer völlig virtuellen<br />
Arbeitsumgebung starkes Vertrauen zueinander fassen können, ohne sich jemals in Präsenz gesehen zu<br />
haben. Nicht jeder Mensch braucht den direkten Kontakt zu Kolleg*innen.“<br />
Andreas Eckhardt<br />
primär auf der Ethereum-Blockchain in<br />
sogenannten Smart Contracts hinterlegt.<br />
Diese sind für alle Mitglieder der Blockchain<br />
transparent einsehbar. Entscheidungen<br />
innerhalb einer DAO trifft die virtuelle<br />
Gemeinschaft der beteiligten Akteure.<br />
Sowohl im Zusammenhang mit virtuellen<br />
Organisationen als auch mit ihrer<br />
Extremform, den DAOs, ergeben sich<br />
jedoch gerade aus Perspektive der Länder<br />
der Europäischen Union, in denen<br />
die Rechte von Arbeitnehmer*innen und<br />
das Prinzip des Sozialstaats wichtige Errungenschaften<br />
darstellen, viele Fragen:<br />
Wie etwa soll mit einer global verteilten<br />
Belegschaft umgegangen werden? Muss<br />
ich jemandem, den ich außerhalb meines<br />
Landes anstelle, trotzdem die Vorteile<br />
meines Sozialsystems zukommen lassen?<br />
Rechtlich ist das noch nicht geklärt.<br />
„Diesen offenen Fragen müssen wir uns<br />
stellen. Denn es ist auch klar, dass die EU<br />
weltweit gesehen eine Sonderrolle beim<br />
Arbeitnehmer*innen-Schutz einnimmt.<br />
Trotz teils berechtigter Kritik an diesen<br />
neuen virtuellen Organisationsformen<br />
muss Europa konkurrenzfähig bleiben.<br />
Spätestens, wenn virtuelle Organisationen<br />
sich in anderen Erdteilen wie Asien<br />
und Amerika noch stärker durchsetzen,<br />
können wir sie nicht mehr ignorieren.<br />
Das funktioniert in einer globalisierten<br />
Welt nicht“, betont Andreas Eckhardt.<br />
Allerdings gibt es derzeit noch keinen<br />
allgemeinen Rechtsrahmen für DAOs auf<br />
globaler oder EU-Ebene. Die einzige Ausnahme<br />
ist der US-Bundesstaat Wyoming.<br />
Dort können DAOs seit dem vergangenen<br />
Jahr den Rechtsstatus einer LLC (Limited<br />
Liability Company) erlangen, die<br />
stark Gesellschaften mit beschränkter<br />
Haftung in unserem Wirtschaftssystem<br />
ähnelt. Die weitere Entwicklung verfolgt<br />
wohl nicht nur Andreas Eckhardt mit<br />
Spannung. <br />
lm<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/22 27
INFORMATIK<br />
SCHRITT FÜR SCHRITT<br />
Justus Piater lehrt seinem Roboter das Lernen – mit Erfolg. So lernte der Roboter, wie sich<br />
Objekte bewegen, wenn er sie anschubst, und wie er diese stapeln kann. Nun soll er sich aus gelernten<br />
Bewegungen neue erschließen und mit dem Menschen interagieren lernen.<br />
Am 25. Jänner 1921 erblickte der<br />
Roboter das Licht der Welt. An<br />
diesem Tag gab das Prager Nationaltheater<br />
erstmals das Drama R. U. R.<br />
von Karel Čapek. Millionen menschenähnlicher<br />
Maschinen dienen darin den<br />
Menschen als billige Arbeitskräfte und<br />
übernehmen Tätigkeiten in Haushalt<br />
und Industrie. Čapeks Bruder Josef gab<br />
den Maschinen einen Namen – Robota,<br />
tschechisch für Frondienst oder Zwangsarbeit.<br />
Heute kommen Roboter vielseitig zum<br />
Einsatz, etwa in Industrie oder Medizin,<br />
sie erkunden für Menschen gefährliche<br />
Regionen – oder mähen einfach Rasen.<br />
Gemeinsam ist ihnen, dass sie für ihre<br />
Aufgaben programmiert wurden. Aber<br />
kann man Roboter mit derart vielen Daten<br />
füttern, dass sie die ihnen gestellten<br />
Aufgaben jederzeit und überall erfüllen<br />
können? Und was passiert, wenn die<br />
Realität nicht dem Programmierten entspricht?<br />
Justus Piater, Robotik-Spezialist<br />
am Institut für Informatik der Universität<br />
Innsbruck, wählt daher einen anderen<br />
Weg – er will Roboter lehren, selbstständig<br />
zu lernen. Erste Schritte sind schon<br />
gemacht, nun wendet er sich mit seinem<br />
Team dem nächsten zu.<br />
Nicht ganz 100 Jahre nach der Uraufführung<br />
von R. U. R. erblickte auch am<br />
Innsbrucker Informatikinstitut ein Roboter<br />
das Licht der Welt: Im Rahmen des<br />
EU-Projekts Xperience (2011 – 2015) und<br />
unterstützt durch die Universität Innsbruck<br />
entstand Robin, der sein Wissen<br />
durch Lernen aus Erfahrung bezieht. Robin<br />
„schubste“ unterschiedliche Gegenstände<br />
– Bauklötze, Schachteln, Bälle… –,<br />
beo bachtete deren „Reaktion“ und clusterte<br />
die sensormotorischen Daten, die<br />
er von diesem Prozess via Kamera und<br />
Kraftsensoren erhielt. „In der Folge ordnet<br />
er ein Objekt aufgrund visueller Features<br />
einem Cluster zu und weiß, wie sich<br />
dieses Objekt dann erwartungsgemäß<br />
verhält“, erklärt Piater. Robin lernte also,<br />
dass runde Objekte rollen, wenn er sie anschubst,<br />
Klötze aber nicht. Mit diesem erlernten<br />
Wissen ausgestattet schickten die<br />
Informatiker ihren Roboter in die nächste<br />
Schulstunde. Robin agierte nun mit zwei<br />
Objekten, schaute, was passiert, wenn er<br />
einen Ball auf einen Bauklotz oder eine<br />
Schachtel auf einen Ball stellt, clusterte<br />
wiederum die sensormotorischen Daten<br />
und lernte, so Piater, „im Zuge von zig<br />
Interaktionen, wie man Türme baut“.<br />
Bewegungen generalisieren<br />
Im bisherigen Lernprozess agierte Piaters<br />
Roboter als Einzelkämpfer, nun gehen<br />
die Innsbrucker Informatikerinnen und<br />
Informatiker daran, auch das humane<br />
Umfeld einzubinden. In dem EUREGIO-<br />
Projekt OLIVER – Open-Ended Learning<br />
for Interactive Robots (2019 – 2<strong>02</strong>2), wollten<br />
sie in Zusammenarbeit mit der Uni Bozen<br />
Robotern beibringen, Aufgaben, die von<br />
ihren Designern nicht speziell vorgesehen<br />
sind, sowie kollaborative Aufgaben<br />
auszuführen. „Unser Fokus lag zunächst<br />
darauf, wie Roboter von einer gelernten<br />
Bewegung auf ähnliche Bewegungen<br />
generalisieren können“, berichtet Piater.<br />
Maschinelles Lernen, erläutert der Informatiker,<br />
basiere auf der Annahme, dass<br />
die Daten, die das trainierte Modell in der<br />
Praxis sieht, statistisch gesehen dieselben<br />
Daten wie im Training sind. Doch was<br />
wenn nicht? „Dann funktioniert das System<br />
nicht“, sagt Piater und nennt ein Beispiel:<br />
„Ein Roboter hat gelernt, einen Stift<br />
28<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/22<br />
Fotos: Andreas Friedle
INFORMATIK<br />
DER ROBOTER LERNT, von einer gelernten<br />
Bewegung auf ähnliche Bewegungen<br />
zu generalisieren.<br />
von A nach B zu legen. Soll er ihn aber mit<br />
der gleichen Bewegung nach dem weiter<br />
entfernten C legen, weiß er nicht, was zu<br />
tun ist. Er hat diese – längere – Bewegung<br />
im Training nicht gesehen.“ Dem Roboter<br />
fehlt die Fähigkeit, zu extrapolieren, sich<br />
aus Bekanntem Neues zu erschließen.<br />
Um diese Fähigkeit zu verbessern, setzt<br />
Piaters Team auf ein anderes künstliches<br />
neuronales Netzwerk (KNN) als üblich.<br />
Ein KNN besteht aus künstlichen Neuronen<br />
(Units), die über mehrere Eingänge Informationen<br />
als reale Zahlenwerte erhalten<br />
und diese mit einem Faktor multiplizieren.<br />
Die Resultate werden summiert und ergeben<br />
das Aktionspotenzial der Unit. „In<br />
sogenannten Equation Learner Networks<br />
berechnen Units hingegen ausdrucksstärkere<br />
Funktionen. Nicht die Summe, sondern<br />
z. B. das Produkt von zwei Eingängen.<br />
Oder die Sinusfunktion von lediglich<br />
einem Eingang“, erklärt Piater. Der Hintergedanke<br />
dabei: „Viele reale physikalische<br />
Prozesse sind durch derartige Funktionen<br />
beschrieben. Daher sollten wir auch solche<br />
Funktionen für die Repräsentation dieser<br />
Prozesse verwenden, damit die Repräsentation<br />
die realen physikalische Prozesse<br />
möglichst genau widerspiegelt.“ Darauf<br />
fußte die Annahme der Informatiker, dass<br />
Roboter mit Equation Learner Networks<br />
besser extrapolieren können. Und die Annahme<br />
konnten sie in der Simulation und<br />
im Praxisversuch bestätigen – obwohl der<br />
Roboter diese Bewegung nicht gelernt hatte,<br />
bewegte er den Stift von A nach C. Genauer<br />
gesagt: Nicht ganz bis nach C.<br />
„Im Prinzip funktionierte die Exploration<br />
auf die größere Strecke sehr gut. Es<br />
kam allerdings zu systematischen Abweichungen“,<br />
räumt Piater ein. Es zeigte<br />
sich, dass der Roboter die neue, weitere<br />
Bewegung zwar ausführen konnte, je<br />
weiter sie aber wurde, desto größer wurden<br />
die Abstände zum eigentlichen Ziel.<br />
Die Lösung fand Matteo Saveriano, ein<br />
inzwischen an der Università di Trento<br />
tätiger Mitarbeiter Piaters, gemeinsam<br />
mit Dissertant Héctor Pérez Villeda. „Sie<br />
entwickelten mit Hilfe von Quadratic<br />
Programing eine Methode, die gezeigte<br />
Bedingungen imitiert und dabei Randbedingungen<br />
erfüllt“, erläutert Piater. Dem<br />
Roboter werden Bewegungen gezeigt, die<br />
er lernt, zu rekonstruieren – inklusive der<br />
festgelegten Bedingung, dass die Bewegung<br />
von einem Anfang bis zu einem Ende<br />
reichen muss. In Kombination mit der<br />
erlernten Explorationsfähigkeit aus dem<br />
ersten Schritt gelingt es dem Roboter nun<br />
tatsächlich, den Stift von A nach C zu bewegen<br />
– egal, wie weit entfernt C auch ist.<br />
Robotik & Affordanzen<br />
Auf die Kollaboration mit Menschen<br />
zielt mit ELSA, kurz für Effective Learning<br />
of Social Affordances for Human-Robot<br />
Interaction, ein anderes Innsbrucker<br />
Robotik-Projekt ab. In französisch-österreichischer<br />
Zusammenarbeit wollen Forscherinnen<br />
und Forscher aus Informatik<br />
und Psychologie Robotern beibringen,<br />
sogenannte Affordanzen zu erkennen.<br />
„Der Begriff stammt aus der Psychologie<br />
und bezeichnet Aktionsmöglichkeiten,<br />
die ein Objekt einem Aktor bietet. In EL-<br />
SA haben wir den Begriff auf die soziale<br />
Ebene erweitert, nämlich auf Menschen,<br />
die ihrem Umfeld Interaktionsmöglichkeiten<br />
anbieten“, erklärt Piater. Durch<br />
das Erkennen solcher Affordanzen sollen<br />
Roboter lernen, mit ihrem menschlichen<br />
Umfeld zielgerichteter zu interagieren:<br />
„Menschen haben unterschiedliche Fähigkeiten,<br />
zum Beispiel, wenn sie bestimmte<br />
Werkzeuge bei sich haben. Jemanden mit<br />
einer Schere kann ein Roboter bitten, ein<br />
Blatt Papier durchzuschneiden. Die gleiche<br />
Bitte ohne Schere in der Nähe ergibt<br />
aber keinen Sinn, das muss ein Roboter<br />
allerdings auch begreifen“, erläutert Piater.<br />
Das bis 2<strong>02</strong>6 laufende Projekt, angesiedelt<br />
am Institut für Informatik und am<br />
„Digital Science Center“ (DiSC) der Uni<br />
Innsbruck, soll das Handlungsrepertoire<br />
von Robotern in Zusammenarbeit mit<br />
Menschen deutlich erweitern.<br />
Ein weiterer Schritt also zum humanoiden<br />
Roboter, wie ihn Čapek in R. U. R. konzipierte?<br />
„Aus wissenschaftlicher Sicht ist<br />
es extrem interessant, daran zu arbeiten.<br />
Wir lernen dabei viel über Intelligenz,<br />
Autonomie und wie der Mensch funktioniert“,<br />
sagt dazu Piater: „Ob aber jemals<br />
humanoide Roboter im Einsatz sein werden,<br />
ist offen, da die Komplexität immens<br />
ist. Möglicherweise kommt man mit spezialisierten<br />
Robotern viel weiter.“ ah<br />
JUSTUS PIATER (*1968 in Bremen) studierte<br />
Informatik an der TU Braunschweig<br />
sowie der Universität Magdeburg und<br />
schloss 1994 mit dem Diplom ab. An<br />
der University of Massachusetts machte<br />
er einen M. Sc. (1998) und einen Ph. D.<br />
(2001) in Computer Science. Nach einer<br />
Zeit als PostDoc am <strong>Forschung</strong>sinstitut<br />
INRIA Rhône-Alpes wechselte er 20<strong>02</strong> an<br />
die Université de Liège in Belgien. 2010<br />
wurde er an das Institut für Informatik<br />
der Universität Innsbruck berufen, wo er<br />
die Arbeitsgruppe Intelligent and Interactive<br />
Systems leitet.<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/22 29
RECHTSWISSENSCHAFT<br />
30 zukunft forschung <strong>02</strong>/22<br />
Foto: Andreas Friedle
RECHTSWISSENSCHAFT<br />
MENSCHENRECHTE<br />
IN ÖSTERREICH SCHÜTZEN<br />
Verena Murschetz beobachtet seit sieben Jahren, wie es um die Einhaltung von Menschenrechten in<br />
Justizanstalten, Polizeianhaltezentren und anderen Orten des Freiheitsentzugs in Tirol und Vorarlberg<br />
steht. Im Interview gibt Murschetz, Professorin für Strafrecht und Strafprozessrecht an der Universität<br />
Innsbruck, Einblick in ihre Tätigkeit und erzählt, wie diese in <strong>Forschung</strong> und Lehre einfließt.<br />
Seit dem Jahre 2012 wird in Österreich<br />
das OPCAT, eine Ergänzung<br />
zum Anti-Folter-Übereinkommen der<br />
Vereinten Nationen, umgesetzt: Expert*innen-Kommissionen<br />
auf regionaler und Bundesebene<br />
machten seither durchschnittlich<br />
450 Besuche pro Jahr in Einrichtungen des<br />
Freiheitsentzugs. Im Zuge dieser Kontrollmaßnahmen<br />
wurden in bis zu 80 Prozent<br />
der Fälle Defizite festgestellt. Die Juristin<br />
Verena Murschetz leitet die Kommission für<br />
Tirol und Vorarlberg. Im Folgenden spricht<br />
sie über Menschenrechtsschutz in Praxis,<br />
<strong>Forschung</strong> und Lehre.<br />
ZUKUNFT: Was ist OPCAT und wie wird<br />
es umgesetzt?<br />
VERENA MURSCHETZ: Als fakultatives<br />
Zusatzprotokoll zum Antifolter-Abkommen<br />
trägt OPCAT den Staaten, die es<br />
ratifizieren, auf, einen sogenannten Nationalen<br />
Präventionsmechanismus einzurichten.<br />
Darunter ist ein zusätzlicher<br />
Kontrollmechanismus zu verstehen, der<br />
durch Kontrollbesuche präventiv vor<br />
Menschenrechtsverletzungen schützen<br />
soll. In Österreich involviert dieser<br />
die Volksanwaltschaft und sechs Länderkommissionen<br />
sowie eine Bundeskommission.<br />
Diese haben die Aufgabe,<br />
unangekündigte Besuche in Einrichtungen,<br />
welche die Freiheit entziehen oder<br />
auch nur potenziell entziehen können,<br />
zu machen und darüber zu berichten. In<br />
Österreich sind wir vergleichsweise gut<br />
aufgestellt und können daher nicht nur<br />
die klassischen Orte des Freiheitsentzugs<br />
wie Justizanstalten, Polizeianhaltung und<br />
Psychiatrien, sondern auch Alten- und<br />
Pflegeheime, Einrichtungen für Kinder<br />
und Jugendliche und für Menschen mit<br />
Behinderungen besuchen.<br />
ZUKUNFT: Sie sind seit 2015 Leiterin der<br />
Kommission 1 für Tirol und Vorarlberg.<br />
Was machen Sie und Ihre Kommission<br />
ganz konkret?<br />
MURSCHETZ: Als Kommissionsleiterin<br />
entscheide ich zunächst, welche Einrichtungen<br />
wir prüfen und in welcher<br />
Expert*innen-Zusammensetzung. Wir<br />
gehen dann unangekündigt in die Institutionen,<br />
führen Gespräche mit den<br />
Insass*innen, Klient*innen oder Bewohner*innen,<br />
aber auch mit dem Personal<br />
und der Leitung. Wir protokollieren<br />
alle Gespräche und treffen dann zu bestimmten<br />
Themen wie zum Beispiel zu<br />
freiheitsbeschränkenden Maßnahmen<br />
Feststellungen und eine menschenrechtliche<br />
Beurteilung. Das heißt, wir erklären<br />
im Protokoll und auch in einem abschließenden<br />
Gespräch vor Ort, warum etwas<br />
menschenrechtlich zu beanstanden ist<br />
und formulieren konkrete Empfehlungen<br />
bzw. Verbesserungsvorschläge. Das<br />
Protokoll über den Besuch erhält dann<br />
die Volksanwaltschaft und kommuniziert<br />
die Beanstandungen und Empfehlungen<br />
an das zuständige Ministerium<br />
bzw. die Landesregierung sowie die zuständigen<br />
Trägerinstitutionen.<br />
ZUKUNFT: Kommt es im Zuge solcher Besuche<br />
auch manchmal zu Anzeigen?<br />
MURSCHETZ: Ja, wenn ein Problem so<br />
schwerwiegend ist, dass es strafrechtlich<br />
relevant ist, wie z. B. jüngst der<br />
Pflegeskandal in Salzburg. Das ist nicht<br />
so häufig, kommt aber vor. Aber es ist<br />
nicht unsere Aufgabe, nachträglich zu<br />
prüfen, ob ein Verschulden vorliegt,<br />
zum Beispiel, wenn ein Suizid während<br />
eines Freiheitsentzugs stattgefunden hat.<br />
Unser Ziel ist es, strukturelle Probleme<br />
aufzudecken und konkrete Empfehlungen<br />
zur Beseitigung der festgestellten<br />
Defizite vorzuschlagen.<br />
ZUKUNFT: Ist es in der Alltagspraxis nicht<br />
schwierig, rechtliche von strukturellen<br />
oder sozialen Problemen abzugrenzen?<br />
MURSCHETZ: In meiner Kommission<br />
sind verschiedene Expert*innen vertreten.<br />
Wir haben zwei Jurist*innen, eine<br />
davon ist auch Sozialpädagogin, einen<br />
Psychiater, einen diplomierten Gesundheits-<br />
und Krankenpfleger, eine Fachsozialbetreuerin<br />
für Altenarbeit, eine<br />
Psychologin und einen Experten für Behindertenrecht.<br />
Die Zusammensetzung<br />
und Stärke der Kommission richten sich<br />
„Wir merken, dass unsere Besuche sehr viel bewirken, gerade im<br />
Sozial- und Gesundheitsbereich. Insbesondere bei Alten- und<br />
Pflegeheimen stellen wir eine hohe Reflexionsbereitschaft und<br />
Offenheit für unsere Vorschläge fest.“<br />
nach der Einrichtung und den konkreten<br />
Schwerpunkten, die wir prüfen. In<br />
einem gemeinsamen Protokoll hält jedes<br />
Kommissionsmitglied seine Wahrnehmungen<br />
fest und bewertet diese aus<br />
seiner Expertise. Rein rechtlich gesehen<br />
gibt es für die jeweiligen Einrichtungen<br />
verschiedene, aber klare Vorgaben, z. B.<br />
das Strafvollzugsgesetz für Justizanstalten,<br />
das Heimaufenthaltsgesetz, das<br />
Unterbringungsgesetz oder die Behindertenrechtskonvention.<br />
Insofern ist die<br />
Einschätzung nicht so schwer.<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/22 31
RECHTSWISSENSCHAFT<br />
VERENA MURSCHETZ ist seit 2011<br />
Universitätsprofessorin für Strafrecht und<br />
Strafprozessrecht einschließlich des Europäischen<br />
und Internationalen Strafrechts<br />
an der Universität Innsbruck, wo sie sich<br />
2006 habilitierte. Murschetz studierte<br />
Rechtswissenschaften in Innsbruck und<br />
an der University of California at Los<br />
Angeles. Sie ist Mitglied in zahlreichen<br />
nationalen und internationalen Vereinigungen<br />
und setzt sich u. a. als Leiterin<br />
der Kommission 1 der österreichischen<br />
Volksanwaltschaft für den Schutz der<br />
Menschenrechte ein, die auch einen<br />
wissenschaftlichen Schwerpunkt ihrer<br />
Arbeit bilden.<br />
ZUKUNFT: Gehen Sie selbst auch bei allen<br />
Besuchen mit?<br />
MURSCHETZ: Im Schnitt macht die Kommission<br />
ca. vier Besuche im Monat – in<br />
unterschiedlicher Besetzung. Ich selbst<br />
habe bereits alle Arten von Einrichtungen<br />
besucht, bin aber aufgrund meines<br />
wissenschaftlichen Schwerpunkts am<br />
häufigsten in Justizanstalten mitgegangen.<br />
Inzwischen begleite ich die Besuche<br />
seltener, bin aber an jeder Protokollerstellung<br />
beteiligt und trage für jedes Protokoll<br />
auch die Letztverantwortung.<br />
ZUKUNFT: Menschenrechte sind ja auch<br />
Ihr <strong>Forschung</strong>sgegenstand. Ich gehe<br />
davon aus, dass sich Ihre Tätigkeit als<br />
Kommissionsleiterin und als Rechtswissenschaftlerin<br />
gegenseitig befruchten…<br />
MURSCHETZ: Genau. Als Wissenschaftlerin<br />
ist für mich zunächst die theoretische<br />
Beurteilung von Normen und Erkenntnissen<br />
der Rechtsprechung wichtig. Aber<br />
dann in der Praxis zu sehen, inwieweit<br />
diese Normen und gerichtlichen Entscheidungen<br />
umgesetzt werden, welche<br />
Probleme es gibt beziehungsweise aus<br />
welchem Grund rechtliche Vorgaben<br />
eben nicht eingehalten werden, ist natürlich<br />
sehr spannend und bereichernd.<br />
Auch bei der wissenschaftlichen Bearbeitung<br />
oder Erstellung von Reformvorschlägen<br />
hat man natürlich mehr Gewicht,<br />
wenn man die Praxis gut kennt.<br />
Insgesamt befruchtet dieses Praxiswissen<br />
und gesteigerte Problembewusstsein<br />
meine <strong>Forschung</strong>, das heißt Publikationen,<br />
Vorträge, Tagungen etc., ungemein.<br />
Meine Tätigkeit in der Kommission ist<br />
aber nicht nur für meine wissenschaftliche<br />
Arbeit, sondern auch für die Lehre<br />
sehr interessant. Ich habe im Jahr, in<br />
dem ich die Kommissionsleitung übernommen<br />
habe, ein Seminar zum Thema<br />
Strafvollzug und Menschenrechte gestartet.<br />
Wir besuchen im Zuge dessen auch<br />
immer eine Justizanstalt und ich lade relevante<br />
Praktikerinnen und Praktiker in<br />
meine Lehrveranstaltungen ein, die ich<br />
über meine Funktion als Kommissionsleiterin<br />
kennengelernt habe.<br />
„Bei der wissenschaftlichen<br />
Bearbeitung oder Erstellung von<br />
Reformvorschlägen hat man<br />
natürlich mehr Gewicht, wenn<br />
man die Praxis gut kennt.“<br />
ZUKUNFT: Das heißt, das Thema kommt<br />
auch in der Lehre gut an?<br />
MURSCHETZ: Ja, das Seminar ist immer<br />
sehr gut besucht, und durch die Studierenden<br />
werden viele interessante<br />
Themen beleuchtet. Was sie in ihren<br />
Seminararbeiten theoretisch bearbeiten<br />
und beurteilen müssen, können sie dann<br />
eben auch praktisch hinterlegen. Und seit<br />
ich das Seminar – und seit letztem Jahr<br />
auch eine Vorlesung im Straf- und Maßnahmenvollzugsrecht<br />
– anbiete, steigt die<br />
Zahl der Diplomand*innen, die sich in ihren<br />
Arbeiten mit wichtigen Aspekten aus<br />
Straf- und Maßnahmenvollzug beschäftigen,<br />
sehr stark an. Das bringt auch das<br />
in Österreich wissenschaftlich eher stiefmütterlich<br />
behandelte Fach weiter.<br />
ZUKUNFT: Kehren wir noch einmal zurück<br />
zur Kommission. Haben Sie eine besondere<br />
Erfolgsgeschichte zu erzählen?<br />
MURSCHETZ: Sagen wir so: Wir merken,<br />
dass unsere Besuche sehr viel bewirken,<br />
gerade im Sozial- und Gesundheitsbereich.<br />
Insbesondere bei Alten- und<br />
Pflegeheimen stellen wir eine hohe Reflexionsbereitschaft<br />
und Offenheit für<br />
unsere Vorschläge fest. Und unsere Berichte<br />
bieten den Einrichtungen oft auch<br />
eine Argumentationsbasis für von ihnen<br />
selbst gewünschte Verbesserungen zum<br />
Schutz der Menschenrechte. Besonders<br />
freut mich, dass wir uns vor allem im Sozial-<br />
und Gesundheitsbereich, aber auch<br />
im Justizbereich, Respekt verschaffen<br />
konnten, Respekt nicht als gefürchtetes<br />
Kontrollorgan, sondern vielmehr Respekt<br />
als Expert*innenteam.<br />
ZUKUNFT: Können Sie konkrete Beispiele<br />
aus den angeführten Bereichen nennen?<br />
MURSCHETZ: Der österreichische „Nationaler<br />
Präventionsmechanismus“, kurz<br />
NPM, hat zum Beispiel die Abschaffung<br />
der Netzbetten in Psychiatrien, dringend<br />
nötige Aufstockungen von Nachtdiensten<br />
uvm. bewirkt. Es ist durch die Besuche<br />
und Berichte der Kommissionen auch<br />
schon mehrfach zu Schließungen desaströser<br />
Einrichtungen gekommen, wie die<br />
Schließung eines als Frühstückspension<br />
genehmigten Hauses, in dem psychisch<br />
schwerst kranke Menschen ohne Betreuung<br />
durch qualifiziertes Personal lebten.<br />
Der Pflegeskandal in Salzburg zeigt besonders,<br />
wie wichtig die unabhängige<br />
Kontrolle durch den NPM ist. ef<br />
32<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/22<br />
Foto: Andreas Friedle
GURGL CARAT<br />
START INS KONGRESSLEBEN<br />
Das Kongress- und Eventzentrum Gurgl Carat feierte nach der<br />
pandemiebedingten Zwangspause seine offizielle Eröffnung.<br />
R<br />
und 100 Gäste aus Tourismus, Wissenschaft<br />
und Politik trafen sich im<br />
Juli 2<strong>02</strong>2 in Obergurgl, um an der<br />
offiziellen Eröffnung des Gurgl Carat<br />
teilzunehmen. Das höchstgelegene Konferenzzentrum<br />
Europas weist bereits eine<br />
bewegte Geschichte auf. Nach der Fertigstellung<br />
im Januar 2<strong>02</strong>0 und ersten Veranstaltungen<br />
schloss sich im März 2<strong>02</strong>0 die<br />
Covid-bedingte Pause an. Die offizielle Eröffnungsfeier<br />
mit Segnung des Gebäudes<br />
markierte den formellen Neustart nach<br />
der Pandemie. Langfristig soll das Gurgl<br />
Carat nicht nur zur Belebung des Dorfzentrums<br />
beitragen, sondern aus Obergurgl<br />
die Top-Kongressdestination der Alpen<br />
für internationale Gäste machen.<br />
Blick in die <strong>Zukunft</strong><br />
Das Gurgl Carat kann nun erstmals sein<br />
volles Potenzial entfalten. Insbesondere<br />
die moderne Veranstaltungstechnik der<br />
UNTER DEM MOTTO „Alpiner Raum<br />
für Inspiration“ finden im Gurgl Carat<br />
seit Januar 2<strong>02</strong>0 Meetings, Kongresse,<br />
Produktvorführungen und kulturelle Veranstaltungen<br />
statt. Bis zu 500 Personen<br />
fasst das futuristische Gebäude, dessen<br />
Form an einen geschliffenen Diamanten<br />
erinnert. Damit ist die Eventlocation im<br />
Dorfzentrum eine Hommage an Gurgl,<br />
den „Diamant der Alpen“. Das Gurgl<br />
Carat reiht sich in die lange Kongressund<br />
Wissenschaftstradition des Tiroler<br />
Ortes ein. Die Verbindung von Wirtschaft,<br />
Wissenschaft und Kultur zeigt sich auch<br />
in der Betreibergesellschaft, die aus Ötztal<br />
Tourismus, Universität Innsbruck und<br />
Gemeinde Sölden besteht.<br />
Location sei zukünftig ein großer Wettbewerbsvorteil.<br />
„Das Gurgl Carat ist<br />
aufgrund seiner Ausstattung besonders<br />
für technisch aufwendige Events wie<br />
Hybrid-Konferenzen, Live- Schaltungen,<br />
Podiumsdiskussionen und Produktpräsentationen<br />
geeignet“, betont Gurgl-Carat-Geschäftsführer<br />
Felix Kupfer. Auch<br />
die Gäste der Eröffnungsfeierlichkeiten<br />
erhielten einen Vorgeschmack auf die<br />
technischen Möglichkeiten. Im größten<br />
Saal, Schalfkogel, der Platz für bis zu 500<br />
Personen bietet, präsentierten die Gastgeber<br />
das Herzstück des Gebäudes – die 100<br />
m² Frontleinwand mit Full-HD-Projektion.<br />
Nun gilt es, das moderne Eventzentrum<br />
mit der vorhandenen Infrastruktur<br />
bestmöglich zu verbinden, um neue Synergien<br />
zu schaffen. Der Grundstein dafür<br />
ist mit der Ötztal Tourismus Congress<br />
GmbH gelegt, die vom Ötztal Tourismus,<br />
der Gemeinde Sölden und der Universität<br />
Innsbruck betrieben wird. Das gemeinsame<br />
Ziel: Obergurgl langfristig als Kongressstandort<br />
und Universitätsdorf zu<br />
etablieren. Ernst Schöpf, Bürgermeister<br />
der Gemeinde Sölden, ist überzeugt, dass<br />
dank der Zusammenarbeit und der guten<br />
Infrastruktur in Obergurgl die besten<br />
Voraussetzungen für den aufstrebenden<br />
Kongresstourismus gegeben seien. Auch<br />
Sara Matt, Leiterin der Transferstelle der<br />
Universität Innsbruck, betont die Vorteile<br />
des Standorts Obergurgl: „Wissenschaft<br />
passiert hier oben viel effizienter als bei<br />
einem Treffen im Büro.“ Abseits des städtischen<br />
Trubels und mitten in der Natur<br />
herrschen nicht nur ideale <strong>Forschung</strong>sbedingungen,<br />
vor allem sei auf 1.900 Metern<br />
Raum für ergiebige Gespräche und Gedankenaustausch<br />
auf höchstem Niveau.<br />
Standort mit Tradition<br />
Dass das modernste Kongresszentrum<br />
Österreichs ausgerechnet in Obergurgl<br />
steht, ist kein Zufall. Seit der Gründung<br />
des Bundessportheims im Jahr 1951, dem<br />
heutigen Universitätszentrum Obergurgl,<br />
finden in dem kleinen Bergdorf regelmäßig<br />
Veranstaltungen und Fortbildungen<br />
statt. Die neue Location soll nicht nur die<br />
Tagungstradition des Ortes fortführen,<br />
sondern auch den ganzjährigen Kongresstourismus<br />
stärken. „Eine Location auf<br />
diesem (Höhen-)Niveau in Verbindung<br />
mit der hochqualitativen Ausrichtung der<br />
Hotel- und Nächtigungsbetriebe und der<br />
einzigartigen alpinen Umgebung ist ein<br />
Alleinstellungsmerkmal in diesem Segment“,<br />
ist sich der CEO des Ötztal Tourismus<br />
Oliver Schwarz sicher. Es gehe nun<br />
darum, diese drei Dinge zusammenzuführen,<br />
um den Tourismus im MICE-Bereich<br />
(Meetings, Incentives, Conventions,<br />
Exhibitions) in Gurgl weiter voranzutreiben.<br />
Fotos: Gurgl Carat<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/22 33
PHARMAZIE<br />
NEUER BLICK AUF<br />
ARZNEISTOFFE<br />
Anita Weidmann, Professorin für Klinische Pharmazie an der Uni Innsbruck, will mit ihrer Arbeit einen<br />
neuen Blick auf Medikamente etablieren, der dabei helfen soll, die Arzneimitteltherapiesicherheit zu<br />
verbessern und zur globalen Herausforderung in Bezug auf Patient*innensicherheit beiträgt.<br />
„Wir haben versucht, die<br />
Auswirkungen der Therapie für<br />
die Patientinnen und Patienten<br />
ganzheitlich darzustellen.“<br />
<br />
Anita Weidmann<br />
Wirkstoffsuche und Wirkstoffentwicklung,<br />
Technologien,<br />
um diese möglichst effizient<br />
an ihr Ziel im Körper zu bringen, und<br />
die Analyse von Wechsel- und Nebenwirkungen<br />
einzelner Wirkstoffe sind<br />
<strong>Forschung</strong>sarbeiten, die gemeinhin im<br />
Bereich der Pharmazie verortet werden.<br />
An der Universität Innsbruck wurde Anfang<br />
2<strong>02</strong>1 mit dem österreichweit einzigen<br />
Lehrstuhl für Klinische Pharmazie<br />
ein Fachgebiet eingerichtet, das auch die<br />
Erfahrungen der Patient*innen mit ihren<br />
Medikamenten im Blick hat.<br />
„In der klinischen Pharmazie haben<br />
wir uns für einen anderen Blickwinkel<br />
entschieden und zwar den, wie<br />
Patientinnen und Patienten im Laufe<br />
ihrer gesamten Behandlungsspanne mit<br />
Medikamenten umgehen. Unsere <strong>Forschung</strong>srichtung<br />
zielt darauf ab, wissenschaftliche<br />
Evidenzen zu schaffen,<br />
wie Pharmazeut*innen zur Patient*innensicherheit<br />
beitragen können. Die<br />
eigenen Erfahrungen der Patientinnen<br />
und Patienten mit den Medikamenten<br />
sind dabei wesentlich“, erklärt Anita<br />
Weidmann, Professorin für Klinische<br />
Pharmazie an der Uni Innsbruck. „Dieser<br />
neue <strong>Forschung</strong>sbereich an der Uni<br />
Innsbruck entspricht auch einer globalen<br />
Direktive der Weltgesundheitsorganisation<br />
WHO, die sich zum Ziel gesetzt hat,<br />
die Patient*innensicherheit weltweit zu<br />
verbessern und flächendeckend zu standardisieren.“<br />
ANITA WEIDMANN will mithilfe ihrer wissenschaftlichen Arbeit die Erfahrungen von<br />
Patientinnen und Patienten während ihrer Chemotherapie verbessern.<br />
34<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/22<br />
Fotos: Colourbox.de (1), Andeas Friedle (1)
PHARMAZIE<br />
Prognosen sagen voraus, dass es 2030<br />
über 22 Millionen Krebspatient*innen<br />
pro Jahr geben wird. Dementsprechend<br />
wird ein großer Fokus auf die Krebstherapie<br />
und Entwicklung neuer Wirkstoffe<br />
gerichtet. Anita Weidmann will<br />
allerdings auch die Erfahrungen der Patient*innen<br />
im Verlauf der Behandlung<br />
verbessern. In einer qualitativen Studie<br />
hat sie deshalb gemeinsam mit ihrem<br />
Team die Erfahrungen von Krebspatientinnen<br />
und -patienten untersucht. Dabei<br />
begleiteten die Wissenschaftler*innen<br />
16 Menschen, die aufgrund ihrer Darmkrebs-Diagnose<br />
in ein bestimmtes Behandlungsschema<br />
fielen, über ihren gesamten<br />
Behandlungszeitraum.<br />
„Wir haben versucht, die Auswirkungen<br />
der Therapie für die Patientinnen<br />
und Patienten ganzheitlich darzustellen<br />
– sowohl was die Lebensqualität als<br />
auch was andere interne und externe<br />
Einflussfaktoren wie beispielsweise die<br />
finanzielle Situation betrifft“, erklärt die<br />
Klinische Pharmazeutin. „Da betreuende<br />
Angehörige im Verlauf einer Therapie<br />
auch eine wesentliche Rolle spielen,<br />
haben wir auch ihre jeweils engste Bezugs-<br />
und damit Betreuungsperson in<br />
die Studie aufgenommen und befragt“,<br />
beschreibt Weidmann das Studiendesign.<br />
Basis dieser qualitativen Studie war das<br />
sogenannte patients lived experience model,<br />
das von den Wissenschaftlerinnen und<br />
Wissenschaftlern durch intensive, systematische<br />
Literaturrecherche für den<br />
onkologischen Bereich angepasst wurde.<br />
Im Anschluss wurden die Patientinnen<br />
und Patienten über den Zeitraum ihrer<br />
sechsmonatigen Behandlung insgesamt<br />
vier mal interviewt.<br />
Ernüchterung & Überforderung<br />
„Unsere Gespräche haben gezeigt, dass<br />
viele Patientinnen und Patienten nach<br />
der Diagnose Darmkrebs eine Chemotherapie<br />
begonnen haben, weil ihre<br />
Hoffnung auf Heilung größer war als<br />
die Angst vor den Nebenwirkungen der<br />
Behandlung. Leider waren sie dann gegen<br />
Ende der Behandlung allerdings oft<br />
desillusioniert, weil sie feststellten, dass<br />
es keine Heilung gibt und dass sie sich<br />
wohl anders entschieden hätten, wenn<br />
sie zu Beginn der Behandlung die richtigen<br />
Fragen gestellt und mehr Informationen<br />
zu ihrem Fall gehabt hätten“, so<br />
Weidmann.<br />
ANITA WEIDMANN, geboren und aufgewachsen<br />
im deutschen Rheinhessen,<br />
absolvierte ihr Pharmaziestudium an der<br />
Robert Gordon University in Schottland,<br />
wo sie 2007 promovierte. Sie war einige<br />
Jahre als Apothekerin in öffentlichen<br />
und Krankenhausapotheken in Großbritannien<br />
tätig, absolvierte Auslandsaufenthalte<br />
und lehrte und forschte im<br />
Bereich Clinical Pharmacy an der Robert<br />
Gordon University. Seit Jänner 2<strong>02</strong>1 ist<br />
sie Universitätsprofessorin für Klinische<br />
Pharmazie an der Uni Innsbruck. Zudem<br />
ist sie Gastprofessorin an der Universität<br />
Graz und der Robert Gordon University<br />
und Mitglied der Expert*innengruppe zur<br />
Verschreibung von Generika im österreichischen<br />
Bundesministerium für Soziales,<br />
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz,<br />
sowie im wissenschaftlichen<br />
Beirat der European Society of Clinical<br />
Pharmacy und der österreichischen Plattform<br />
Patientensicherheit.<br />
Es zeigte sich auch, dass die Patientinnen<br />
und Patienten zwar mit der Behandlung<br />
an sich und mit dem medizinischen<br />
Personal sehr zufrieden waren, in den<br />
Phasen zu Hause allerdings oft mit den<br />
Nebenwirkungen überfordert waren.<br />
Auch ihr Empfinden darüber, ein aktives<br />
Mitbestimmungsrecht zu haben, war oft<br />
nicht vorhanden. „Die Auswirkung der<br />
Medikamentierung auf die Lebensqualität<br />
– nicht die des Krebses selbst – wurde<br />
von allen Befragten als beträchtlich angegeben.<br />
Auch die Betreuungspersonen, die<br />
als Ungeschulte in den Zeiten zu Hause<br />
auch für die Medikamentengabe verantwortlich<br />
waren, fühlten sich oft überfordert“,<br />
erläutert Anita Weidmann.<br />
Insgesamt hat die Studie gezeigt, dass<br />
das System sehr gut funktioniert, Patient*innen<br />
und deren Angehörige aber<br />
teilweise komplett überfordert sind, weil<br />
der Zugang zur Information meist relativ<br />
generisch gehalten wird. Diese Überforderung<br />
führt dazu, dass Patient*innen,<br />
wenn sie zu Hause sind, öfter Ärztinnen<br />
und Ärzte oder die Notaufnahme kontaktieren<br />
und so zusätzlichen Druck auf<br />
das Gesundheitssystem aufbauen.<br />
Individualisierte Information<br />
„Dieser zusätzliche Druck könnte vermieden<br />
werden, wenn man Patient*innen<br />
und Angehörige sowohl bei der Diagnose<br />
als auch bei der Entlassung aus dem<br />
Krankenhaus richtig schult, ihnen genau<br />
erklärt, was auf sie zukommen wird,<br />
welche Medikamente sie bei welchen<br />
Symptomen und Nebenwirkungen verabreichen<br />
können und ab welchem Punkt<br />
sie wieder ärztliche Hilfe in Anspruch<br />
nehmen müssen. Ein individuell zugeschnittenes<br />
Beratungsgespräch könnte<br />
den Patientinnen und Patienten sowie ihren<br />
pflegenden Angehörigen Einiges erleichtern<br />
und am Ende auch das Gesundheitssystem<br />
entlasten“, ist die Klinische<br />
Pharmazeutin überzeugt. Zudem glaubt<br />
Anita Weidmann, dass auch individuelle<br />
Informationsgespräche während der Behandlung<br />
und eine gezieltere Förderung<br />
des Austausches zwischen Patientinnen<br />
und Patienten ihre Erfahrungen mit der<br />
Behandlung verbessern könnten.<br />
„Auch wenn alle in der Krebstherapie<br />
tätigen Ärztinnen und Ärzte sowie das<br />
Pflegepersonal sehr genau wissen, wie es<br />
den Patientinnen und Patienten geht,<br />
glauben wir, mit qualitativen Studien wie<br />
dieser, wissenschaftliche Evidenz zu<br />
schaffen, um die sich stets wandelnden<br />
Erfahrungen der Patient*innen mit ihren<br />
Arzneitherapien festzuhalten, um die Betreuung<br />
in dieser Hinsicht verbessern<br />
und standardisieren zu können. Denn<br />
eine Verbesserung der Erfahrungen der<br />
Patient*innen ist auch für den Behandlungserfolg<br />
wesentlich“, ist Weidmann<br />
überzeugt. <br />
sr<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/22 35
HOLZBAU<br />
NATURQUARTIER WEISSACHE: Unterberger Immobilien errichtete 2<strong>02</strong>1 in Kufstein Tirols bislang größten Wohnbau in Massivholz.<br />
ÜBERZEUGUNGSARBEIT<br />
Der Holzbau boomt, allerdings nicht bei Großbauten. Das Projekt BIGWOOD will daher Barrieren und<br />
Vorurteile gegenüber dem Einsatz von Holz bei mehrgeschoßigen Gebäuden abbauen.<br />
Es sind spektakuläre Bauten, die es<br />
immer wieder in die Schlagzeilen<br />
schaffen: 84 Meter ragt das Wiener<br />
HoHo in die Höhe, bietet auf knapp<br />
20.000 Quadratmetern Platz für Büros, ein<br />
Fitnessstudio, ein Hotel und ein Restaurant.<br />
Ähnlich aufsehenerregend ist das<br />
Mjøstårnet im norwegischen Brumunddal:<br />
85,5 Meter hoch ist der Wolkenkratzer,<br />
in dem man auch wohnen kann. Und gar<br />
86,6 Meter misst der Ascent Tower in Milwaukee,<br />
USA. Gemeinsam ist ihnen Holz<br />
als Baustoff, sie sind damit die – aktuell<br />
– höchsten Holzhäuser der Welt. Doch es<br />
muss nicht nur Höhe sein. In München<br />
entstand auf dem ehemaligen Gelände<br />
der Prinz-Eugen-Kaserne ein ökologisches<br />
Vorzeigeprojekt: Von den 1.800 Wohnungen<br />
wurden 566 in Holzbauweise gebaut,<br />
die damit das größte zusammenhängende<br />
Holzbauquartier Deutschlands bilden.<br />
Nicht ganz so beeindruckend nimmt<br />
sich im Vergleich dazu das Naturquartier<br />
Weißache in Kufstein aus, doch der Fünfgeschoßer<br />
in Gebäudeklasse 5 ist – abgesehen<br />
von Tiefgarage und Treppenläufen<br />
– ein reiner und damit Tirols größter Vollholzwohnbau.<br />
Wie diese Leuchtturmprojekte zeigen,<br />
eignet sich der nachhaltige Baustoff Holz<br />
für mehrgeschoßige und großvolumige<br />
Gebäude. Die Praxis zeigt aber: Gerade<br />
bei Großbauten, ob im Wohnungsbau<br />
oder bei Geschäftsgebäuden, gibt es noch<br />
zahlreiche Vorurteile, Bedenken und Barrieren.<br />
Diese abzubauen ist Ziel des Interreg-Projekts<br />
BIGWOOD. Geführt von der<br />
Universität Bozen wollen die Projektpartner<br />
– Arbeitsbereich Holzbau der Universität<br />
Innsbruck, proHolz Tirol und der bellunesische<br />
Unternehmerverband Centro<br />
Consorzi – ein überregionales Netzwerk<br />
etablieren, um alle Akteure im Holzbausektor<br />
auf den neusten Stand der Technik<br />
zu bringen.<br />
„Im privaten Sektor hat Bauen mit Holz<br />
in den letzten Jahren – mit einem preisbedingten<br />
Dämpfer 2<strong>02</strong>0 und 2<strong>02</strong>1 – sehr<br />
stark angezogen. Mit BIGWOOD zielen<br />
wir auf die größere Ebene, auf Wohnbauträger<br />
und öffentliche Auftraggeber, ab“,<br />
sagt Anton Kraler vom Arbeitsbereich<br />
Holzbau und erklärt warum: „Auch wenn<br />
es für viele der Traum ist: Wir haben nicht<br />
die Fläche, dass alle in einem Einfamilienhaus<br />
wohnen können. Wir müssen daher<br />
Raum nachhaltig und platzschonend nützen<br />
sowie kompakter und energieeffizienter<br />
bauen.“ Das BIGWOOD-Team will<br />
daher Überzeugungsarbeit leisten – vor<br />
allem aber Lösungen liefen. Helfen soll<br />
dabei ein Vorführmodell der anderen Art:<br />
In einer Koproduktion der Uni Innsbruck<br />
36<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/22<br />
Fotos: Alex Gretter (1), proHolz Tirol (4), Arbeitsbereich Holzbau (1)
HOLZBAU<br />
und der HTL Imst entstand ein transportables<br />
Mock-Up einer Wohnanlage der<br />
Gebäudeklasse 5 in Massivholzbauweise,<br />
anhand dessen Holzlösungen bis ins Detail<br />
anschaulich dargestellt werden.<br />
Holz-Lösungen<br />
„Geht es um Holzbau, hört man vor allem<br />
zwei Vorbehalte: Holz ist hellhörig und<br />
Holz brennt“, weiß Kraler. Kein Wunder<br />
also, dass sich der Holzbauexperte<br />
intensiv mit diesen Themen befasst. Im<br />
Betonbau regelt die Masse des Materials<br />
den Luftschallschutz, vergleichbare Massewerte<br />
mit Holz wären nur mit extrem<br />
dicken Wänden erreichbar – und daher<br />
aufgrund des Raumverlusts wirtschaftlich<br />
nicht umsetzbar. Im Holzbau setzt<br />
man daher auf Mehrschaligkeit. „Ähnlich<br />
wie bei Skirennen. Zwei, drei Fangnetze<br />
hintereinander federn den Sturz eines<br />
Läufers ab“, zieht Kraler einen sportlichen<br />
Vergleich. Mit Feder-Masse-Systemen<br />
lässt sich, so zeigen die Erfahrungen, der<br />
gesetzlich vorgeschriebene, in Österreich<br />
sehr strenge Luftschallschutz einhalten.<br />
„Auch für den Trittschallschutz können<br />
wir Lösungen anbieten“, führt der Wissenschaftler<br />
weiter aus. Um Trittschall zu<br />
vermeiden, benötigt es immer eine Mehrschaligkeit.<br />
Im Betonbau kommt Styrolose<br />
als Schüttmaterial zum Einsatz – für Holz<br />
ist der Kunststoff zu leicht, man bedient<br />
sich daher eines Naturmaterials: Kies.<br />
„Beim mehrgeschoßigen Holzwohnbau<br />
in der Innsbrucker Schützenstraße, den<br />
ich 2006 mitbetreuen durfte, kam erstmals<br />
Kies zum Einsatz. Heute ist es Standard“,<br />
erinnert sich Kraler.<br />
Auf Lösungen kann der Holzbau auch<br />
im Brandschutz verweisen. Holz brennt,<br />
logisch, wenn aber, dann gleichmäßig<br />
und langsam – und dieses Brandverhalten<br />
kann genau berechnet und eingeschätzt<br />
werden. Verlangt etwa die Statik eines Gebäudes<br />
zehn Zentimeter dicke Holzwände<br />
und das Abbrennverhalten des Holzes beträgt<br />
zwei Zentimeter in 30 Minuten, bedeutet<br />
dies, dass mit einer zwölf Zentimeter<br />
dicken Wand die Statik des brennenden<br />
Gebäudes für mindestens eine halbe Stunde<br />
gewährleistet ist. „Brandschutz zielt ja<br />
primär darauf ab, dass ein Gebäude lange<br />
genug stehen bleibt, damit Mensch und<br />
Tier es im Brandfall sicher verlassen können“,<br />
erläutert Kraler: „Es geht um Brandverhalten<br />
und Feuerwiderstand. Dafür<br />
können wir Lösungen bieten.“<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
HOLZBAU-MOCK-UP ON TOUR: Im<br />
Rahmen des Interreg-Projekts BIGWOOD<br />
entstand ein Vorführmodell der anderen<br />
Art. 1 Ein klassisches Rendering zeigt einen<br />
mögliche Wohnanlage der Gebäudeklasse 5<br />
in Massivholzbauweise. 2 Schülerinnen<br />
und Schüler der HTL Imst und proHolz Tirol<br />
konstruierten in Zusammenarbeit mit der<br />
Universität Innsbruck das entsprechende<br />
Mock-Up. 3 + 4 Das Mock-up ist<br />
zerlegbar und zeigt Strukturen wie z.B.<br />
Rahmenbauweise oder Holzschichten 5 Für<br />
Wohnbauträger, Planer und Architekten<br />
werden die angewandten Lösungen<br />
inklusive möglicher Materialien im Detail<br />
präsentiert.<br />
Lösungen für Objekte der Gebäudeklasse<br />
5, die von Kraler und seinen Projektmitarbeitern<br />
Julian Meyer und Benjamin<br />
Wolf intensiv mit Bauträgern sowie<br />
Expertinnen und Experten aus Architektur,<br />
Ingenieurwesen und Holzbau diskutiert<br />
und auch auf Wirtschaftlichkeit<br />
hinterfragt wurden. Das Ergebnis ist ein<br />
Online-Tool, das detaillierte Holzbau-Lösungen<br />
für Wände, Decken, Balkone, Terrassen,<br />
Fensteranschlüsse etc. bietet. „Immer<br />
mit spezieller Berücksichtigung der<br />
Komponenten Statik, Schall- und Brandschutz.<br />
Ein weiteres Augenmerk liegt<br />
auf dem Wärme- und Feuchteschutz“,<br />
beschreibt Kraler das Projektergebnis,<br />
das auch Vorschläge für Beschaffenheit<br />
und Qualität der zu verwendenden Materialien<br />
beinhaltet. Für ihn ist das Tool<br />
eine Argumentationshilfe, um Bedenken<br />
gegen einen mehrgeschoßigen Holzbau<br />
„fachlich fundiert zu entkräften“.<br />
Veranschaulicht werden die Holzbau-<br />
Lösungen mit dem Mock-Up. Das mittels<br />
3D-Druck von Schülerinnen und Schülern<br />
der HTL Imst sowie von proHolz Tirol gebaute<br />
Modell lässt sich leicht zerlegen und<br />
eröffnet so Blicke auf unterschiedliche<br />
Strukturen und Holzschichten, auf die<br />
Rahmenbauweise, auf Fenster, Fassaden<br />
und weitere Details. Mittels QR-Codes auf<br />
Infoflyern, so der Plan, geht‘s dann direkt<br />
zum Online-Tool. Seit Spätherbst 2<strong>02</strong>2 ist<br />
das Mock-Up auf Tour und kommt auf<br />
Veranstaltungen von Projekt- und assoziierten<br />
Partnern wie der HTL Imst oder<br />
dem Netzwerk Passivhaus zum Einsatz –<br />
und soll helfen, Vorurteile, Bedenken und<br />
Barrieren gegenüber mehrgeschoßigem<br />
Holzbau abzubauen.<br />
ah<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/22 37
WISSENSTRANSFER<br />
DIGITALE<br />
INNOVATIONEN ERARBEITEN<br />
Unternehmen und Organisationen aller Branchen sehen im Bereich Digitalisierung immer mehr<br />
Chancen. Das Institut für Informatik hat mit DIGIT einen Sparringpartner für die Umsetzung innovativer<br />
Ideen gegründet.<br />
Noch immer landen in Österreich<br />
zu viele Lebensmittel im Abfall.<br />
Im Handel tragen fehlerhafte<br />
Bestandsdaten, nicht optimierte Bestellungen<br />
und zu wenig Flexibilität bei der<br />
Preisbildung zu hohen Abfallmengen bei.<br />
Das Institut für Informatik versucht, gemeinsam<br />
mit dem Handelsunternehmen<br />
MPREIS, mit Mitteln der Datenanalyse<br />
und IT verschiedene Strategien zur Abfallvermeidung<br />
im Frischebereich (Obst,<br />
Gemüse, Molkereiprodukte) zu einem<br />
Gesamtprozess zusammenzufügen. So<br />
soll die Menge der in Filialen vernichteten<br />
Lebensmittel stark reduziert werden.<br />
„Das gemeinsame Projekt mit MPREIS<br />
ist nur ein Beispiel unserer Kooperation<br />
mit Unternehmen“, erzählt Ruth Breu,<br />
Leiterin des Instituts für Informatik der<br />
Mehr Informationen zu DIGIT, dem<br />
Entwicklungszentrum für digitale<br />
Innovation finden Sie hier:<br />
http://digit-uibk.at/<br />
Universität Innsbruck. Andere Projekte<br />
laufen derzeit zum Beispiel mit Hollu,<br />
planlicht, Bartenbach, Zumtobel und Riederbau.<br />
Viele dieser Projekte haben interdisziplinären<br />
Charakter und werden in<br />
Kooperation mit anderen Instituten, zum<br />
Beispiel im Bereich Bauingenieurwesen,<br />
Ökologie und Chemie durchgeführt.<br />
Gemeinsame Projekte<br />
Mit dem Entwicklungszentrum für digitale<br />
Innovation DIGIT hat Ruth Breu eine<br />
Plattform initiiert, die den Austausch von<br />
Wissen zwischen Universität sowie Unternehmen<br />
und Organisationen im Bereich<br />
Digitalisierung fördern soll. Die Partner<br />
erhalten Zugang zum Know-how der Forscherinnen<br />
und Forscher in anwendungsorientierten<br />
Bereichen, können Projektvorhaben<br />
verfolgen und sich direkt mit Studierenden<br />
vernetzen. „Wir konnten in den<br />
letzten beiden Jahren die Zahl drittmittelgeförderter<br />
Projekte in Kooperation mit<br />
Unternehmen in Westösterreich signifikant<br />
steigern“, sagt Breu. „Wir führen<br />
aber auch industriefinanzierte Projekte in<br />
Kooperation durch oder erledigen Auftragsforschung.<br />
In den nächsten Jahren<br />
werden wir auch verstärkt Angebote für<br />
die Weiterbildung entwickeln.“ <br />
DIGITAL INNOVATION HUB WEST:<br />
Für klein- und mittelständische Unternehmen<br />
gibt es neben DIGIT die Angebote<br />
des Digital Innovation Hub West. Der DIH<br />
West erleichtert KMUs den Zugang zu<br />
Know-how und Infrastruktur von Hochschulen<br />
und <strong>Forschung</strong>seinrichtungen.<br />
Es ist ein Zusammenschluss von acht<br />
Hochschulen und <strong>Forschung</strong>seinrichtungen<br />
(wissenschaftlichen Einrichtungen mit<br />
Digitalisierungsschwerpunkt) in Salzburg,<br />
Tirol und Vorarlberg, der<br />
drei Standortagenturen sowie<br />
Wirtschaftskammer Tirol und<br />
Industriellenvereinigung Tirol:<br />
https://dih-west.at/<br />
38 zukunft forschung <strong>02</strong>/22<br />
Foto: MPREIS
WISSENSTRANSFER<br />
DER SCHNEEPROPHET<br />
Künstliche Schneeerzeugung benötigt viel Wasser und Energie. Das<br />
Start-up lumiosys will Skigebieten beim Energiesparen helfen<br />
Werden in Tirol die Schneekanonen<br />
eingeschaltet, schnellt der<br />
Stromverbrauch in die Höhe. Bis<br />
zu 30 Kilowatt benötigt der Betrieb einer<br />
Schneekanone. In großen Skigebieten stehen<br />
mitunter über 1.000 Maschinen zur<br />
Schneeerzeugung. Dafür werden enorme<br />
Mengen an Energie und Wasser benötigt.<br />
Michael Warscher und Ulrich Strasser<br />
vom Institut für Geographie haben gemeinsam<br />
mit ihrem ehemaligen Kollegen<br />
Florian Hanzer das Start-up lumiosys<br />
gegründet, das den Skigebieten beim<br />
Energiesparen helfen will. Mit der von<br />
ihnen entwickelten Software „Schneeprophet“<br />
(www.schneeprophet.at) können<br />
die Kunden über ein Webinterface Daten<br />
zur Schneedecke abrufen. Basierend auf<br />
den aktuellen Wetterprognosen, Schneehöhen-<br />
und Wetterstationsmessungen<br />
KLIMABERICHT FÜR ÖSTERREICH<br />
sowie Beschneiungsdaten aus den Skigebieten<br />
simuliert die Software die Pistenverhältnisse<br />
in der <strong>Zukunft</strong> – detailliert<br />
und hochaufgelöst. Die Betreiber können<br />
so für jeden Punkt auf der Piste und abhängig<br />
von der Beschneiungsstrategie die<br />
Höhe der Schneedecke in den kommenden<br />
zwei Wochen abrufen. Dabei informiert<br />
die Software auch über den mit der<br />
jeweiligen Strategie verbundenen Energieund<br />
Wasserverbrauch. Die Simulationen<br />
lassen sich auch für frühere Zeiten generieren,<br />
um damit beispielsweise Strategien<br />
aus der letzten Saison zu überprüfen.<br />
Im vergangenen Winter wurde die<br />
Software in zwei Skigebieten in Vorarlberg<br />
und Osttirol im Pilotbetrieb eingesetzt.<br />
In diesem Winter geht das Unternehmen<br />
nun auf den Markt und mit den<br />
ersten Kunden in die neue Saison. Viele<br />
Skigebiete sind aufgrund der hohen<br />
Energiekosten und dem Bestreben nach<br />
einem nachhaltigen Betrieb bereits stark<br />
für das Thema sensibilisiert. Die Unternehmensgründer<br />
schätzen das Einsparungspotenzial<br />
der Software konservativ<br />
auf zehn Prozent, in manchen Fällen könne<br />
es aber auch noch deutlich mehr sein.<br />
Jedenfalls leistet die Software einen Beitrag<br />
für einen nachhaltigen Skitourismus<br />
und sorgt für perfekte Pistenbedingungen<br />
bei gleichzeitig minimalem Mitteleinsatz.<br />
Die Universität Innsbruck hält<br />
über die Uni-Holding eine Beteiligung an<br />
dem Start-up. <br />
Mehr als 120 Wissenschaftler*innen erarbeiten in den kommenden drei Jahren einen<br />
neuen, umfassenden Klimabericht für Österreich. „Nur wenige Nationalstaaten erstellen<br />
einen eigenen Klimabericht. Österreich nimmt mit dieser nationalen Analyse eine internationale<br />
Vorreiterrolle ein. Das übergeordnete Ziel des Berichts ist, eine österreichspezifische<br />
Synthese der wissenschaftlichen Erkenntnisse mit nationalen und internationalen Daten zu<br />
erstellen. Es wird in diesem Kontext aber auch darum gehen, Wissenslücken zu definieren.<br />
Daraus erwarte ich mir über diesen Bericht hinaus einen generellen Booster für die Klimaforschung<br />
in Österreich, denn diese interdisziplinäre Zusammenarbeit ist bisher einzigartig“,<br />
sagt Projektleiterin Margreth Keiler vom Institut für Geographie der Universität Innsbruck. Die<br />
Autor*innen streben eine wissenschaftliche Erhebung und Bewertung der bisherigen, aktuellen<br />
und potenziellen künftigen Auswirkungen des Klimawandels in Österreich an.<br />
AQT, das Quanten-Spin-off der Universität<br />
Innsbruck, erhält eine europäische<br />
Innovationsförderung.<br />
QUANTENCOMPUTER<br />
IN DER CLOUD<br />
Der EIC Accelerator ist ein Förderinstrument<br />
des Europäischen Innovationsrates<br />
(EIC) im EU-Rahmenprogramm<br />
Horizon Europe und unterstützt einzelne<br />
Unternehmen bei der Entwicklung und<br />
Skalierung von hochrisikoreichen Innovationen.<br />
Das Innsbrucker Quanten-Spin-off<br />
Alpine Quantum Technologies GmbH<br />
(AQT) erhielt im Oktober diese Förderung<br />
zugesprochen. Das Besondere an den<br />
Finanzierungen im EIC Accelerator ist, dass<br />
sie neben einem Förderanteil zusätzlich<br />
auch einen Eigenkapital-Anteil umfassen<br />
können, eine sogenannte Blended-<br />
Finance- Finanzierung: Der Eigenkapitaleinstieg<br />
erfolgt dabei durch den EIC Fund, der<br />
eigens für diesen Zweck etabliert wurde<br />
und ähnlich wie ein Venture Capital Fonds<br />
funktioniert, aber genau dort unterstützen<br />
soll, wo die private Finanzierungsinitiative<br />
noch nicht ausreicht.<br />
Ziel ist es, dass die allerbesten technologiebasierten<br />
Ideen sehr rasch wachsen<br />
können – und zwar in Europa. Jedes<br />
einzelne Projekt erhält relativ hohe Förderbzw.<br />
Finanzierungsvolumina, damit die<br />
Unternehmen die Produktentwicklung<br />
abschließen und den internationalen<br />
Markteinstieg schaffen können. AQT will<br />
mit der Investition den ersten europäischen<br />
Cloud-Zugang für seine Quantencomputer<br />
realisieren. Mit seinen Systemen<br />
hat AQT bereits relevante Anwendungen<br />
im Bereich der Chemie, Finanzen (Portfolio-Optimierung,<br />
Risiko-Management) und<br />
Cybersecurity umgesetzt.<br />
Fotos: lumiosys (1), AQT (1)<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/22 39
WISSENSTRANSFER<br />
STATT VORLESUNG INS KINO<br />
Im Oktober 2<strong>02</strong>2 zeigte das 21. INFF – Innsbruck Nature Film Festival<br />
fantastische neue Filme zu den Themen Natur, Umwelt und Nachhaltigkeit.<br />
Die Studierenden wurden aktiv in das<br />
Gespräch eingebunden und so konnten<br />
Standpunkte aus verschiedensten Disziplinen<br />
ausgetauscht werden.<br />
RUND 3.000 Besucherinnen und Besucher sahen sich die 41 Filme aus 25 Ländern an.<br />
Über 40 Filme wurden heuer auf<br />
dem Innsbruck Nature Film Festival<br />
gezeigt. Die Jury prämierte<br />
Beiträge über eine Freundschaft zwischen<br />
Mensch und Wal, die Machenschaften der<br />
Holzmafia, die ungewisse Suche nach dem<br />
Schneeleoparden und noch einige mehr.<br />
Wieder einmal war die Universität Innsbruck<br />
über ihre Transferstelle aktiv am<br />
Festival beteiligt und organisierte unter<br />
anderem sieben Science Glimpses, bei denen<br />
Wissenschaftler*innen ihre Expertise<br />
mit dem Publikum teilen konnten. Weiterhin<br />
waren Angehörige der Universität in<br />
der Jury aktiv, waren – wieder zusammen<br />
mit dem Land Tirol – am „Boden Preis“<br />
beteiligt und stellten über das Vizerektorat<br />
für <strong>Forschung</strong> den neuen Preis „Agricultural<br />
Biodiversity“ zur Verfügung, der eigens<br />
zum 100-jährigen Bestehen der Gendatenbank<br />
Tirol ausgeschrieben wurde.<br />
Mit dabei war auch ein neues Format,<br />
dass die Studierenden der Uni ins Kino<br />
brachte: der „uibk-studentsday @ INFF“<br />
wurde von Günter Scheide, Mitarbeiter<br />
der Transferstelle und Koordinator der<br />
Zusammenarbeit zwischen Universität<br />
und Filmfestival, konzipiert und ins Leben<br />
gerufen. An einem Montagmorgen<br />
besuchten 100 Studierende der Universität<br />
Innsbruck das Metropolkino für eine<br />
eigens für sie organisierte Vorführung. Gezeigt<br />
wurde der Film „Paradiese aus Menschenhand<br />
– Die Rückkehr der Moore.“<br />
„Ich habe diesen Film ausgewählt, weil<br />
ich der Ansicht bin, dass dieser für viele<br />
Disziplinen Unterschiedliches enthält,<br />
aber insbesondere sehr positive Botschaften<br />
hat und zeigt, dass Moore ein tolles<br />
Habitat sind und Menschen viel Positives<br />
bewirken können“, sagt Günter Scheide.<br />
Nach dem Motto „Statt Vorlesung<br />
ins Kino!“ gab es im Anschluss an die<br />
Filmvorführung eine Diskussionsrunde,<br />
an der sich sechs Professor*innen aus<br />
unterschiedlichen Fachbereichen sowie<br />
ein Vertreter des Landes, verantwortlich<br />
für den Schutz der Moore, beteiligten.<br />
Neues Format<br />
„Bei Experimenten weiß man nie so<br />
richtig, wie sie ausgehen“, sagt Günter<br />
Scheide. „Neue Formate und Ideen auszuprobieren<br />
ist aber das, was die Zusammenarbeit<br />
zwischen Uni und Festival<br />
ausmacht und dafür sorgt, dass wir uns<br />
immer weiterentwickeln. Deswegen wird<br />
es den Students Day im nächsten Jahr<br />
wohl wieder geben und wir fangen jetzt<br />
schon an, uns Gedanken zu machen, wie<br />
wir ihn verbessern können.“<br />
Filmkuratorin Katja Trippel und der<br />
Leiter des Festivals, Johannes Kostenzer,<br />
besuchten die Veranstaltung, um den<br />
Students Day gemeinsam zu eröffnen.<br />
„Ich habe mich sehr gefreut, dass der<br />
neue uibk-studentsday @ INFF geklappt<br />
hat!“, sagt Katja Trippel. „Als Biologe und<br />
Geografin haben Johannes und ich ganz<br />
begeistert den vollen morgendlichen Kinosaal<br />
begrüßt und die Studierenden bestärkt,<br />
dass sie superinteressante und<br />
ebenso wichtige Fächer studieren. Ich<br />
finde es großartig, dass sie den Lernstoff<br />
dank der INFF-Filme auf so coole Art und<br />
Weise präsentiert bekommen. Und wer<br />
weiß, vielleicht weckt es ja bei der einen<br />
oder dem anderen die Lust, selbst in die<br />
Filmwelt einzusteigen…“<br />
FÜR DAS INFF 2<strong>02</strong>3 werden Volunteers<br />
und Mitglieder für die nächste<br />
Nominierungsjury gesucht. Interessierte<br />
können sich unter hello@inff.eu<br />
melden.<br />
40<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/22<br />
Fotos: Mario Kain
KURZMELDUNGEN<br />
HAUS DER PHYSIK<br />
Am Campus Technik der Universität Innsbruck entsteht<br />
ein großes und modernes Zentrum der Naturwissenschaften.<br />
Die sehr erfolgreichen und stetig<br />
wachsenden Physikinstitute der<br />
Universität Innsbruck sind über<br />
verschiedene Standorte verteilt und brauchen<br />
bereits jetzt mehr als den zur Verfügung<br />
stehenden Platz. Bald werden sie in<br />
einem eigenen Haus der Physik zusammenkommen.<br />
Es wird am Campus Technik<br />
der Universität Innsbruck errichtet,<br />
soll mit Wintersemester 2<strong>02</strong>8 in Betrieb<br />
gehen und wird den gestiegenen Ansprüchen<br />
an Universitätsinfrastruktur, insbesondere<br />
in den naturwissenschaftlichen<br />
Fächern, in hervorragender Weise gerecht.<br />
Das Haus der Physik ist für rund 850<br />
Studierende und 500 Mitarbeiter*innen<br />
der Uni Innsbruck konzipiert. Die Bundesimmobiliengesellschaft<br />
investiert<br />
180,8 Millionen Euro in den Universitätsneubau,<br />
an denen sich das Land Tirol mit<br />
drei Millionen Euro beteiligt. Die Investition<br />
wird über Mieten vom Wissenschaftsministerium<br />
refinanziert. Nach Abschluss<br />
des EU-weiten Wettbewerbs, bei dem 40<br />
Architekturbüros eingereicht hatten, präsentierten<br />
Mitte Oktober Wissenschaftsministerium,<br />
Bundesimmobiliengesellschaft,<br />
Universität Innsbruck, Land Tirol<br />
und Stadt Innsbruck das Siegerprojekt.<br />
Auf 25.000 m² sind ein lichtdurchfluteter<br />
Eingangsbereich, ein zweistöckiger<br />
Hörsaal für 300 Personen, Seminar- und<br />
Praktikumsräume, Büros und Laborflächen<br />
vorgesehen. Die Labore nehmen die<br />
größte Fläche im neuen Haus der Physik<br />
ein.<br />
ULTRAKALTE MINI-TORNADOS<br />
Wirbel sind in der Natur allgegenwärtig:<br />
Durch Rühren lassen sich Wasserstrudel<br />
erzeugen. Wird die Atmosphäre<br />
aufgewühlt, können gewaltige Tornados<br />
entstehen. So verhält es sich auch in der<br />
Quantenwelt, nur dass dort viele identische<br />
Wirbel gleichzeitig entstehen – der Wirbel<br />
ist quantisiert. In vielen Quantengasen<br />
konnten solche quantisierten Wirbel bereits<br />
nachgewiesen werden. „Das ist deshalb<br />
interessant, weil solche Wirbel ein klarer<br />
Hinweis für das reibungsfreie Strömen eines<br />
Quantengases – die sogenannte Suprafluidität<br />
– sind“, sagt Francesca Ferlaino<br />
vom Institut für Experimentalphysik der<br />
Universität Innsbruck.<br />
Ferlaino forscht mit ihrem Team an<br />
Quantengasen aus stark magnetischen Elementen.<br />
Für solche dipolaren Quantengase,<br />
in denen die Atome stark wechselwirken,<br />
konnten die Quanten-Wirbel bisher noch<br />
nicht nachgewiesen werden. Die Wissenschaftler*innen<br />
haben nun eine neue<br />
Methode entwickelt: „Wir nutzen die Richtungsabhängigkeit<br />
des Quantengases, dessen<br />
Atome sich wie viele kleine Magnete<br />
verhalten, um das Gas umzurühren“, erklärt<br />
Manfred Mark. Dazu legen die Forscher*innen<br />
ein Magnetfeld so an ihr Quantengas<br />
an, dass dieses zunächst runde, pfannkuchenartig<br />
geformte Gas aufgrund von<br />
Magnetostriktion elliptisch verformt wird.<br />
Indem sie das Magnetfeld drehen, können<br />
die Physiker*innen das Quantengas rotieren<br />
lassen. Bei ausreichend hoher Rotationsgeschwindigkeit<br />
bilden sich entlang des<br />
Magnetfelds auffällige Streifen mit Wirbeln.<br />
Diese sind ein besonderes Charakteristikum<br />
dipolarer Quantengase und wurden nun an<br />
der Universität Innsbruck zum ersten Mal<br />
beobachtet.<br />
NEUER FORSCHUNGSBEREICH: DATA SCIENCE<br />
Im Zuge der weltweit fortschreitenden Digitalisierung und Vernetzung fallen stetig wachsende<br />
Datenmengen an. Für die Verarbeitung und Nutzung dieser Daten werden wissenschaftlich<br />
ausgebildete Fachkräfte sowie neue Methoden und Ansätze benötigt, um wissenschaftlichen<br />
Erkenntnisgewinn und auch die Steigerung der Wertschöpfung zu ermöglichen.<br />
Die Universität Innsbruck hat nun eine Stiftungsprofessur für Data Science eingerichtet, die<br />
Know-how auch für die regionale Wirtschaft bereitstellt. Finanziert wird sie von Innio Jenbacher<br />
GmbH & Co OG, der Industriellenvereinigung Tirol, der TINETZ-Tiroler Netze GmbH, der<br />
Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft und der D. Swarovski KG. Besetzt wurde<br />
die Stelle mit Adam Jatowt, einem Experten im Bereich Natural Language Processing und<br />
Information Retrieval. Vor seinem Ruf nach Innsbruck war Jatowt an der Kyoto University und<br />
am National Institute of Advanced Industrial Science and Technology in Japan tätig.<br />
DICHTEVERTEILUNG eines rotierenden<br />
di polaren Bose-Einstein-Kondensats mit<br />
quantisierten Wirbeln.<br />
Fotos: Filippo Bolognese Images (1), Ella Maru Studio (1)<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/22 41
ETHNOLOGIE<br />
TIERWOHL ZWISCHEN<br />
STALL UND FORSCHUNG<br />
Nadja Neuner-Schatz über das Verhältnis von Landwirt*innen zu ihren Tieren, den Begriff Tierwohl,<br />
den öffentlichen Tierwohl-Diskurs und über „Forschen zwischen Nähe und Distanz“.<br />
ZUKUNFT: Sie erforschen den Begriff „Tierwohl“<br />
und das Mensch-Tier-Verhältnis in<br />
der Tiroler Landwirtschaft. Können Sie<br />
diese kurz beschreiben?<br />
NADJA NEUNER-SCHATZ: Die Landwirtschaft<br />
in Tirol ist recht klein strukturiert.<br />
Die größten Höfe haben vielleicht 80 bis<br />
100 Rinder, die meisten sind viel kleiner –<br />
Schweinemast gibt es praktisch nicht. Das<br />
geht gerade im Tiroler Oberland auf das<br />
ehemalige Erbsystem zurück, bei dem die<br />
Höfe aufgeteilt wurden. In diesen kleinen<br />
Strukturen ist die Konkurrenz riesengroß,<br />
auch um Flächen und Einfluss. Das merkt<br />
man unter anderem am Nischendasein<br />
der Bio-Landwirt*innen, deren Anliegen<br />
von der Standesvertretung oft nicht mitgetragen<br />
werden.<br />
ZUKUNFT: Und persönlich? Besteht da ein<br />
Bezug zum Thema?<br />
NEUNER-SCHATZ: In der Europäischen Ethnologie<br />
ist es nicht unüblich, eine persönliche<br />
Nähe zu seinem Thema zu haben.<br />
Das hat auch damit zu tun, dass wir Alltagskultur<br />
erforschen. Ich bin auf einem<br />
landwirtschaftlichen Betrieb im Tiroler<br />
Oberland aufgewachsen, habe während<br />
des Studiums Abstand zur Landwirtschaft<br />
gewonnen und lebe jetzt wieder auf einem<br />
kleinen Bauernhof. Dieses Forschen „zwischen<br />
Nähe und Distanz“ wird in meinem<br />
Fach immer wieder thematisiert, es kennzeichnet<br />
auch unsere qualitativen Metho-<br />
42 zukunft forschung <strong>02</strong>/22<br />
Fotos: Coulorbox.de (1), Andreas Friedle (2)
ETHNOLOGIE<br />
den. In meinem <strong>Forschung</strong>sfeld erachte<br />
ich die Nähe als hilfreich. Es geht ja immer<br />
auch darum, wie man als Forscherin<br />
vom Feld wahrgenommen wird. Im ländlichen<br />
Umfeld wird der Wissenschaft oft<br />
mit Skepsis begegnet, da ist es gut, nicht<br />
als allzu fremd zu gelten. Ich versuche,<br />
tragfähige <strong>Forschung</strong>sbeziehungen aufzubauen,<br />
was Vertrauen auf beiden Seiten<br />
voraussetzt. Vorwissen und Sprachkenntnisse<br />
mitzubringen ist da sicher von<br />
Vorteil. In der landwirtschaftlichen Praxis<br />
gibt es viele dialektale Ausdrücke für Tätigkeiten<br />
oder Dinge, für die ich gar keine<br />
anderen Wörter oder nur umständliche<br />
Umschreibungen kenne.<br />
ZUKUNFT: Wie genau sieht das <strong>Forschung</strong>sprojekt<br />
also aus?<br />
NEUNER-SCHATZ: Ein erster Schritt war es,<br />
die Tierwohl-Debatte nachzuverfolgen.<br />
Wer ist daran beteiligt, welche Positionen<br />
nehmen die maßgeblichen Akteur*innen<br />
ein? Ich wollte sehen, ob die Alltagswahrnehmung,<br />
dass plötzlich alle über Tierwohl<br />
reden, auch belegbar ist. Dafür habe<br />
ich über 400 Meldungen aus dem Online-<br />
Archiv der österreichischen Presseagentur<br />
APA gesichtet. Die Auswertung zeigt, dass<br />
der Tierwohl-Diskurs ab den 2010er-Jahren<br />
öffentlich wird. Ein spannender Befund:<br />
Die ersten, die über Tierwohl sprechen,<br />
kommen nicht aus der Tierschutzbewegung.<br />
Es ist vor allen anderen die Agrarpolitik,<br />
die Tierwohl in die öffentliche Debatte<br />
um die Nutztierhaltung einbringt.<br />
Was kommt also vom öffentlichen Diskurs<br />
über Tierwohl in der Landwirtschaft an?<br />
Um das herauszufinden, gehe ich klassisch<br />
ethnografisch vor, besuche Rinderbetriebe<br />
in Tirol und führe Gespräche mit den Bauern<br />
und Bäuerinnen.<br />
ZUKUNFT: Was bedeutet Tierwohl denn<br />
überhaupt?<br />
NEUNER-SCHATZ: Es gibt seit etwa 70<br />
Jahren agrarwissenschaftliche und veterinärmedizinische<br />
Definitionen von<br />
Tierwohl, im öffentlichen Diskurs und in<br />
der Politik spielen diese aber kaum eine<br />
Rolle. In diese Lücke springen die Label<br />
und Gütesiegel des Lebensmitteleinzelhandels,<br />
sie versuchen Standards oder<br />
Kriterien zu definieren und ökonomisch<br />
zu verwerten. Die Bauernvertreter*innen<br />
verstehen diese Standards – so das Narrativ<br />
des Diskurses – als überzogene oder<br />
zu wenig abgegoltene Forderungen, die<br />
an ihrer Praxis vorbeigehen. Auffällig ist,<br />
dass sich Konsument*innen oder deren<br />
NADJA NEUNER-SCHATZ studierte<br />
Europäische Ethnologie an der Universität<br />
Innsbruck, untersuchte unter anderem<br />
den Wissensbestand zu Trachten im Ötztal<br />
und erforscht nun im Rahmen ihrer<br />
Dissertation die Bedeutung des Begriffes<br />
„Tierwohl“ für das Mensch-Tier-Verhältnis<br />
in der kleinbäuerlichen Lebensmittelproduktion<br />
in Tirol, ein Projekt, bei dem<br />
Europäische Ethnologie, Human Animal<br />
Studies und Agrarsoziologe ineinandergreifen.<br />
Vertretung im öffentlichen Diskurs kaum<br />
zu Wort melden. Für den deutschen<br />
Sprachgebrauch ist Tierwohl ein neuer<br />
Begriff, der sich anfänglich beispielsweise<br />
in EU-Dokumenten findet, wo das englische<br />
Animal Welfare zuvor als Tierschutz<br />
übersetzt wurde, dann als Tierwohlfahrt,<br />
um schließlich auf Tierwohl verkürzt zu<br />
werden. Animal Welfare wiederum wurde<br />
Mitte der 1960er-Jahre als wissenschaftliches<br />
Konzept im sogenannten „Brambell<br />
Report“ erstmals definiert und vom britischen<br />
Landwirtschaftsministerium in die<br />
Debatte um die intensive Nutztierhaltung<br />
eingebracht. Das geschah als Reaktion auf<br />
die öffentliche Empörung, die Ruth Harrisons<br />
Buch „Animal Machines“ ausgelöst<br />
hatte. Was für die Landwirt*innen damals<br />
wohl ziemlich überraschend war, in<br />
ihrem Verständnis hatten sie den Hunger<br />
nach dem Zweiten Weltkrieg besiegt. Die<br />
Haltungsbedingungen der Tiere waren ob<br />
der enormen Produktivitätssteigerung in<br />
den Nachkriegsjahren kaum diskutiert<br />
worden.<br />
ZUKUNFT: Wie bewerten Landwirt*innen<br />
in Tirol denn das Wohlergehen ihrer Tiere?<br />
NEUNER-SCHATZ: Die Frage stelle ich immer<br />
und die Antwort ist einstimmig:<br />
„Das sehe ich doch. Ich erkenne doch<br />
auf den ersten Blick, ob es meiner Edelweiß<br />
gut geht oder nicht.“ Das ist auf das<br />
Selbstverständnis der Landwirt*innen<br />
zurückzuführen: Das Wohlergehen der<br />
Tiere liegt für sie in der Qualität ihrer Beziehung,<br />
also darin, ein enges Verhältnis<br />
zu den Tieren zu haben und täglichen<br />
Umgang zu pflegen.<br />
ZUKUNFT: Überschneidet sich dieses<br />
Selbstverständnis mit der wissenschaftlichen<br />
Definition von Tierwohl?<br />
NEUNER-SCHATZ: Das Stichwort dazu liefert<br />
der Nutztier-Ethnologe Christoph<br />
Winckler: Er betrachtet Tierwohl als ein<br />
Zusammenspiel vieler Faktoren. Da spielt<br />
die Mensch-Tier-Beziehung zwar eine<br />
maßgebliche Rolle, aber es sind auch viele<br />
Umgebungsfaktoren wie Weide, Stall und<br />
Nahrung im Spiel. Dazu gibt es viel spannende<br />
<strong>Forschung</strong>, zum Beispiel wie Rinder<br />
auf menschliche Nähe reagieren, oder<br />
ob Kühe sich erschrecken, wenn man zu<br />
laut spricht. Und gleichzeitig ist das der<br />
emotionale Knackpunkt. Vorschriften,<br />
wie groß ein Standplatz sein muss, kann<br />
man festlegen, nachlesen und umsetzen.<br />
Aber eine Beziehung, die man pflegt, lässt<br />
sich nur schwer mit Zahlen bewerten.<br />
Wenn das Wohlergehen der Tiere infrage<br />
gestellt wird, wird aber eben auch diese<br />
Beziehung kritisiert, und dann fühlen<br />
sich viele Landwirt*innen persönlich angegriffen.<br />
ZUKUNFT: Wie wird es mit dem Projekt<br />
nun weitergehen?<br />
NEUNER-SCHATZ: Nach der Förderung<br />
durch den TWF wird mein Projekt mittlerweile<br />
auch durch ein DOC-Stipendium<br />
der ÖAW unterstützt und derzeit arbeite<br />
ich als Universitätsassistentin im Fach<br />
Europäische Ethnologie weiter daran. Es<br />
steht die zweite Feldforschungsphase an,<br />
es wird also noch eine Reihe von Interviews<br />
geben. Dann soll ein schönes Buch<br />
daraus werden.<br />
fo<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/22 43
PREISE & AUSZEICHNUNGEN<br />
LANDESPREIS FÜR<br />
WISSENSCHAFT<br />
Der Wissenschaftspreis des Landes Tirol ging in diesem Jahr an den<br />
Musikwissenschaftler Federico Celestini. Milijana Pavlović wurde mit dem<br />
Förderpreis ausgezeichnet.<br />
Der mit 14.000 Euro dotierte Tiroler<br />
Landespreis für Wissenschaft 2<strong>02</strong>2<br />
ging an Federico Celestini, Leiter des<br />
Instituts für Musikwissenschaft. „Mit seiner<br />
musikwissenschaftlichen Arbeit trägt Federico<br />
Celestini maßgeblich zur überregionalen<br />
Strahlkraft der <strong>Forschung</strong> am Institut für<br />
Musikwissenschaft bei und prägt den internationalen<br />
musikwissenschaftlichen Diskurs“,<br />
gratulierte Kulturlandesrätin Beate Palfrader<br />
dem Preisträger und zitierte weiters aus dem<br />
Jurypro tokoll: „Hervorzuheben ist insbesondere<br />
die Gründung der <strong>Forschung</strong>sstelle Gustav<br />
Mahler in Innsbruck und Toblach, mit der sich<br />
Innsbruck als Zentrum der internationalen<br />
Mahler-<strong>Forschung</strong> positioniert hat. Die hohe<br />
internationale Reputation des Ausgezeichneten<br />
spiegelt sich auch in zahlreichen Preisen<br />
und Funktionen wider.“ Die Vergabe des Preises<br />
an Celestini wird auch als wichtiges Signal<br />
zur Anerkennung der wissenschaftlichen<br />
Leistungen in einem so genannten „kleinen<br />
Fach“ sowie zur Stärkung der wissenschaftlichen<br />
Zusammenarbeit in der Euregio angesehen.<br />
Federico Celestini studierte Violine sowie<br />
Musikwissenschaft, Literaturwissenschaft und<br />
Ästhetik in Rom. Seit 2011 lehrt und forscht er<br />
als Universitätsprofessor am Institut für Musikwissenschaft<br />
der Universität Innsbruck.<br />
Der mit 4.000 Euro dotierte Förderpreis ging<br />
an Milijana Pavlović, die ebenfalls am Institut<br />
für Musikwissenschaft tätig ist. Sie setzt sich<br />
in ihrer <strong>Forschung</strong> mit dem Zusammenhang<br />
zwischen Musik und Gewalt, dem Holocaust<br />
und Antisemitismus auseinander. Weitere<br />
Schwerpunkte sind Geschlechterforschung<br />
sowie Musik und Literatur. Seit 2<strong>02</strong>1 ist sie<br />
stellvertretende Leiterin der <strong>Forschung</strong>sstelle<br />
Gustav Mahler.<br />
FEDERICO CELESTINI, Beate<br />
Palfrader und Milijana Pavlović<br />
(v. l.) bei der Übergabe der<br />
Auszeichnungen im Innsbrucker<br />
Landhaus. Der Landespreis<br />
für Wissenschaft wird seit<br />
1984 jährlich zur Anerkennung<br />
von hervorragenden Leistungen<br />
auf dem Gebiet der<br />
Wissenschaft von der Tiroler<br />
Landesregierung auf Vorschlag<br />
einer Jury verliehen.<br />
Foto: Land Tirol / Krepper<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/22 45
PREISE & AUSZEICHNUNGEN<br />
BIRTH-AWARD<br />
Christian Huck vom<br />
Institut für Analytische<br />
Chemie und Radiochemie<br />
wurde von der<br />
US-amerikanischen<br />
wissenschaftlichen<br />
Gesellschaft für<br />
Nah-Infrarot-Spektroskopie<br />
CNIRS mit dem Gerald-Birth-Award<br />
ausgezeichnet. Huck arbeitet seit Jahren an<br />
der Optimierung und der Kalibrierung analytischer<br />
Messverfahren wie der Nah-Infrarot-<br />
Spektroskopie und der Raman-Spektroskopie.<br />
Zum Einsatz kommt diese Expertise in<br />
Projekten zur Qualitätssicherung im Lebensmittelbereich,<br />
im Bereich pharmazeutischer<br />
Pflanzenwirkstoffe, in der Landwirtschaft<br />
und in der Biomedizin.<br />
HERVORRAGENDE LEHRE<br />
Ende September wurde<br />
vom Bundesministerium<br />
für Bildung,<br />
Wissenschaft und<br />
<strong>Forschung</strong> in Wien der<br />
„Ars Docendi“ – der<br />
österreichische Staatspreis<br />
für exzellente<br />
Lehre – vergeben. Marina Hilber, Assistenzprofessorin<br />
am Institut für Geschichtswissenschaften<br />
und Europäische Ethnologie, erhielt<br />
für ihre Lehrveranstaltung „<strong>Forschung</strong>slabor:<br />
Ausstellungsprojekt – Medizingeschichte im<br />
Montafon“ einen Anerkennungspreis. Im<br />
Rahmen der Lehrveranstaltung nahmen die<br />
Studierenden nicht nur die Rolle der Ausstellungsmacher*innen<br />
ein und erarbeiteten relevante<br />
medizin-historische Inhalte, sondern<br />
konnten auch gestalterisch bei der museologischen<br />
Konzeption aktiv werden.<br />
PROMOTIONSPREIS<br />
Im September hat die<br />
Deutsche Bunsen-Gesellschaft<br />
Christina<br />
Maria Tonauer vom<br />
Institut für Physikalische<br />
Chemie in<br />
Anerkennung ihrer<br />
exzellenten Grundlagenarbeit<br />
zur „Spektroskopie von Eis“ als effizientem<br />
Druck- und Temperaturmarker für<br />
Exoplaneten-Benchmarking-Experimente mit<br />
dem Agnes-Pockels-Promotionspreis 2<strong>02</strong>2<br />
ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand im<br />
Rahmen der Bunsen-Tagung an der Justus-<br />
Liebig-Universität in Gießen statt.<br />
MARTIN RINGBAUER will mit Qudits das volle Potenzial gespeicherter Ionen ausnutzen.<br />
STARTING GRANT<br />
Martin Ringbauer erhielt für seine experimentelle <strong>Forschung</strong> zu<br />
neuartigen Quantencomputern einen ERC Starting Grant.<br />
Solange wir zurückdenken können,<br />
arbeiteten Computer mit null<br />
und eins. Diese binäre Art der Informationsverarbeitung<br />
war so erfolgreich,<br />
dass Computer aus dem täglichen<br />
Leben nicht mehr wegzudenken sind<br />
und nun auch eine neue Generation von<br />
Computern, basierend auf der Quantenmechanik,<br />
nach diesem binären Vorbild<br />
entwickelt wird. „Die Bausteine heutiger<br />
Quantencomputer können allerdings<br />
deutlich mehr als nur Null und Eins,“<br />
erklärt Martin Ringbauer. Die Innsbrucker<br />
Quantencomputer arbeiten etwa<br />
mit einzelnen gefangenen Ionen, die<br />
jeweils acht mögliche Zustände haben:<br />
„Zwingt man dem Quantencomputer<br />
die gewohnte binäre Rechenweise auf,<br />
so verschenkt man wertvolle Rechenleistung.“<br />
Für diese experimentelle <strong>Forschung</strong><br />
zu neuartigen Quantencomputern erhielt<br />
Ringbauer im Sommer einen Starting<br />
Grant des Europäischen <strong>Forschung</strong>srats<br />
(ERC). Die mit rund 1,5 Millionen<br />
Euro dotierte Förderung ist die höchste<br />
Auszeichnung für erfolgreiche Nachwuchswissenschaftler*innen<br />
in Europa.<br />
In seinem ERC-Projekt will Ringbauer<br />
einen Quantencomputer auf Basis sogenannter<br />
Quantum Digits, kurz Qudits,<br />
konstruieren, um das volle Potenzial der<br />
gespeicherten Ionen ausnutzen zu können.<br />
„Mit Qudits zu rechnen, ist nicht<br />
nur natürlicher für die Hardware, sondern<br />
auch ideal für viele der Anwendungen,<br />
für die wir Quantencomputer entwickeln,“<br />
sagt der Physiker. Mit dem<br />
neuen Quantencomputer möchte Ringbauer<br />
beispielsweise fundamentale Effekte<br />
in der Teilchenphysik untersuchen,<br />
um ein besseres Verständnis für unser<br />
Universum zu entwickeln. <br />
MARTIN RINGBAUER (*1990 in Wien)<br />
studierte an der Universität Wien Physik<br />
und Mathematik. 2016 promovierte er<br />
in der experimentellen Quantenphysik<br />
in der Arbeitsgruppe von Andrew<br />
White an der University of Queensland in<br />
Australien. Nach einem PostDoc an der<br />
Heriot-Watt University in Schottland kam<br />
er 2018 als Erwin-Schrödinger-Fellow in<br />
die Arbeitsgruppe von Rainer Blatt an der<br />
Universität Innsbruck.<br />
46 zukunft forschung <strong>02</strong>/22<br />
Fotos: Uni Inns bruck (1), Theresa Nairz (1), BMBWF / Martin Lusser (1), Blickfang (1)
PREISE & AUSZEICHNUNGEN<br />
EHRENKREUZ<br />
FÜR EVA LAVRIC<br />
Die Romanistin Eva Lavric wurde mit dem österreichischen<br />
Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse ausgezeichnet.<br />
ENDE OKTOBER überreichte Rektor Tilmann Märk die Auszeichnung an Eva Lavric.<br />
Eva Lavric ist eine Wissenschaftlerin<br />
und Universitätslehrerin von<br />
großem internationalen Renommee<br />
und mit einer großen thematischen<br />
Bandbreite“, betonte Rektor Tilmann<br />
Märk bei der Verleihung der Auszeichnung:<br />
„Zusammenfassend lässt sich feststellen,<br />
dass Eva Lavrics <strong>Forschung</strong>sleistung,<br />
<strong>Forschung</strong>sbreite und <strong>Forschung</strong>stiefe<br />
beeindruckend ist und dass sie Außergewöhnliches<br />
für die Verbindung von<br />
Theorie und Praxis geleistet hat.“ In Vertretung<br />
des Bundespräsidenten konnte<br />
Märk ihr die höchste Auszeichnung für<br />
EVA LAVRIC (*1956 in Wien) studierte<br />
an der Universität Wien Lehramt für Germanistik<br />
und Romanistik, danach unterrichtete<br />
sie vier Jahre an verschiedenen<br />
Schulen. 1983 begann ihre Universitätslaufbahn<br />
als Assistentin am Institut für<br />
Romanische Sprachen der Wirtschaftsuniversität<br />
Wien, wo sie sich 1998 habilitierte.<br />
Ab 2003 war sie als Professorin für<br />
Romanische Sprachwissenschaft an der<br />
Universität Innsbruck tätig.<br />
Wissenschaftler*innen in Österreich verleihen,<br />
das österreichische Ehrenkreuz<br />
für Wissenschaft und Kunst I. Klasse.<br />
Der Leiter des Instituts für Romanistik,<br />
Paul Danler, bedankte sich bei Lavric<br />
für ihren unermüdlichen Einsatz für das<br />
Institut, ihre innovativen Ideen nicht nur<br />
in <strong>Forschung</strong> und Lehre, sondern auch<br />
im Bereich der Institutsleitung, die sie<br />
mehrere Jahre innehatte und für die Öffentlichkeitsarbeit,<br />
die Lavric mit ausgesprochenem<br />
Elan und Schwung über<br />
viele Jahre prägte. Der Studiendekan der<br />
Philologisch-kulturwissenschaftlichen<br />
Fakultät, Gerhard Pisek, würdigte Lavrics<br />
außerordentliches Engagement und<br />
betonte die schier unerschöpfliche Energie,<br />
mit der sie innovative Lehrveranstaltungen<br />
leitete und an Projekten mitwirkte.<br />
Pisek unterstrich insbesondere die<br />
Vielfalt an ansprechenden Themen, von<br />
der Linguistik des Fußballs über Unternehmenskommunikation<br />
und Linguistic<br />
Landscaping bis hin zur sprachlichen<br />
Gestaltung von Weinverkostungen, mit<br />
denen Lavric Studierende immer wieder<br />
motivieren und begeistern konnte.<br />
STIPENDIUM<br />
Mit einem<br />
L’ORÉAL-UNESCO<br />
Österreich Stipendium<br />
FOR WOMEN<br />
IN SCIENCE wurde<br />
Ende November Larissa<br />
Traxler vom Institut<br />
für Molekularbiologie<br />
ausgezeichnet. Sie forscht seit einem<br />
Jahr als Postdoc in der Arbeitsgruppe von<br />
Jerome Mertens und untersucht, wie der<br />
zelluläre Zuckerstoffwechsel neurodegenerative<br />
Krankheiten fördert.<br />
Vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft<br />
und <strong>Forschung</strong> erhielt Larissa<br />
Traxler in diesem Jahr außerdem einen<br />
Award of Excellence, den Staatspreis für<br />
die besten Dissertationen in Österreich.<br />
MEILENSTEIN<br />
Wie kann Quanteninformation<br />
über lange<br />
Strecken transportiert<br />
werden? Matthias<br />
Bock aus der <strong>Forschung</strong>sgruppe<br />
um<br />
Rainer Blatt hat in<br />
seiner Doktorarbeit<br />
an der Universität des Saarlandes nicht<br />
weniger als einen Meilenstein in der Quantenforschung<br />
gesetzt: Er ermöglichte es,<br />
die Quanteneigenschaften eines Atoms und<br />
eines Photons über 20 Kilometer herkömmliche<br />
Glasfaser hinweg zu verschränken: ein<br />
neuer Rekord – bislang war dies weltweit<br />
nur über 900 Meter gelungen. Dafür wurde<br />
er mit dem Eduard-Martin-Preis ausgezeichnet.<br />
EISKALTE EXPERIMENTE<br />
Bei der Arbeit mit Helium-Nanotröpfchen<br />
sind Wissenschaftler*innen<br />
des Instituts<br />
für Ionenphysik und<br />
Angewandte Physik<br />
auf ein überraschendes<br />
Phänomen gestoßen:<br />
Treffen die ultrakalten Tröpfchen<br />
auf eine harte Oberfläche, verhalten sie<br />
sich wie Wassertropfen. Ionen, mit denen<br />
sie zuvor dotiert wurden, bleiben so beim<br />
Aufprall geschützt und werden nicht neutralisiert.<br />
Der Erstautor dieser Arbeit, Paul<br />
Martini, wurde dafür von der Österreichischen<br />
Physikalischen Gesellschaft mit dem<br />
Fritz-Kohlrausch-Preis ausgezeichnet.<br />
Fotos: Uni Inns bruck (1), IQOQI (1), Privat (2)<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/22 47
ZWISCHENSTOPP INNS BRUCK<br />
FELSENFESTE<br />
ÜBERZEUGUNGEN<br />
Der amerikanische Philosoph Scott Hill untersucht am Institut für<br />
Christliche Philosophie verschiedene Formen von Meinungsresilienz.<br />
Und lebt hier in Innsbruck seinen Traum.<br />
Scott Hill ist im Juli mit seiner Familie<br />
nach Innsbruck gekommen,<br />
um für zwei Jahre im Rahmen des<br />
Euregio-Projekts Resilient Beliefs: Religion<br />
and Beyond als Postdoktorand zu<br />
forschen. Sowohl am Institut für Christliche<br />
Philosophie als auch in seiner dörflichen<br />
Wohnumgebung in der Nähe von<br />
Innsbruck fühlt er sich schon sehr wohl.<br />
„Das ist wahrscheinlich die beste Zeit<br />
meines Lebens“, meint er dankbar. „Ich<br />
werde wohl nie wieder einen Job haben,<br />
der mir so viel Zeit für die <strong>Forschung</strong><br />
lässt, wie ich aktuell habe.“<br />
Die Gelegenheit, all seine Kräfte in die<br />
<strong>Forschung</strong> und ins Schreiben investieren<br />
zu können, war einer der Gründe, warum<br />
sich Scott Hill dafür entschieden hat,<br />
seine Lehraufträge in den USA, unter<br />
anderem an der University of Massachusetts<br />
Amherst und der Auburn University,<br />
auszusetzen und an die Universität<br />
Innsbruck zu kommen. Aber auch die<br />
spannenden und inspirierenden Gespräche<br />
mit Katherine Dormandy und<br />
Winfried Löffler, die das Euregio-Projekt<br />
leiten, sowie die guten Erfahrungen<br />
von anderen Postdocs aus seinem Umfeld<br />
mit dem Innsbrucker Institut für<br />
Christliche Philosophie haben ihn dazu<br />
bewogen, seine Zelte in den Vereinigten<br />
Staaten abzubrechen. Außerdem glaubt<br />
Scott Hill zutiefst an das Projekt, in das<br />
er mehrere seiner <strong>Forschung</strong>sinteressen<br />
einfließen lassen kann.<br />
Aliens & Verschwörungstheorien<br />
Es sind vor allem verschiedene erkenntnistheoretische<br />
und ethische Fragestellungen,<br />
die Hill in Verbindung mit<br />
resilienten Meinungen beschäftigen. –<br />
Resiliente Meinungen sind Meinungen<br />
oder Überzeugungen, die Menschen auf<br />
keinen Fall aufgeben, sondern im Gegenteil<br />
vehement gegen Einwände und<br />
Gegengründe verteidigen. – Ein Thema,<br />
an dem Scott Hill in diesem Zusammenhang<br />
arbeitet, sind Verschwörungstheorien:<br />
Wie man sozialwissenschaftliche<br />
Erkenntnisse dazu vermittelt und wie<br />
die Wissenschaft mit Verschwörungstheorien,<br />
mit Verschwörungstheoretikern<br />
und ihren Anhängern umgeht und<br />
umgehen soll. „Ein anderes Thema, das<br />
mich interessiert, sind Aliens“, erzählt<br />
der Philosoph. „Wissenschaftler lehnen<br />
es ab, Dinge mit Außerirdischem zu erklären.<br />
Natürlich haben sie damit recht.<br />
Was ich aber wissen möchte, ist zum<br />
Beispiel, was passieren müsste, um diese<br />
Überzeugung rational zu überwinden“,<br />
erläutert er. Scott Hill stellt aber auch<br />
die moralische Verantwortung des Menschen<br />
gedanklich auf die Probe. „Einige<br />
Philosophen sind der Meinung, die Vorstellung,<br />
dass wir moralisch verantwortlich<br />
sind, sei so tief in uns verwurzelt,<br />
dass wir nicht in der Lage sind, diese<br />
aufzugeben“, erklärt er einen weiteren<br />
Ausgangspunkt seiner philosophischen<br />
Überlegungen. „Ich will wissen, ob das<br />
stimmt und welche Folgen sich daraus<br />
ergeben.“ Aber auch Fragen wie „Kann<br />
ich als Individuum durch mein Verhalten,<br />
zum Beispiel durch vegane Ernährung,<br />
einen Unterschied machen?<br />
Ist man schuldig, wenn man durch<br />
sein Kaufverhalten Massentierhaltung<br />
unterstützt? Kann man Schuldgefühlen<br />
trauen?“ zählen zu den <strong>Forschung</strong>sinteressen<br />
von Scott Hill. Nicht zuletzt<br />
denkt er über die Frage nach, wie viel<br />
freier Wille bleibt, wenn man an Gottes<br />
schöpferisches Wirken glaubt. „Alle<br />
diese Fragen fallen in den Themenkreis<br />
resilienter Überzeugungen, und ich bin<br />
sehr dankbar, daran arbeiten zu können“,<br />
betont er.<br />
„Die Zeit hier Innsbruck ist<br />
wahrscheinlich die beste meines<br />
Lebens. Ich werde wohl nie<br />
wieder einen Job haben, der mir<br />
so viel Zeit für die <strong>Forschung</strong><br />
lässt, wie ich aktuell habe.“<br />
Philosophische Gespräche führt Scott<br />
Hill im Übrigen nicht nur gerne in universitären<br />
Räumen, sondern auch beim<br />
Wandern. „Manchmal organisieren Kolleginnen<br />
und Kollegen Almwanderungen.<br />
Es gibt nichts Besseres, als zu wandern<br />
und dabei zu philosophieren und<br />
dann gutes Essen und ein Bier oben auf<br />
der Alm zu genießen“, schwärmt er und<br />
kann schon jetzt auf viele schöne Erinnerungen<br />
zurückblicken.<br />
ef<br />
48 zukunft forschung <strong>02</strong>/22<br />
Foto: Andreas Friedle
SPRUNGBRETT INNS BRUCK<br />
GEBURTSHILFE IN ST. GALLEN<br />
Barbara Weber hat sich 2009 als erste Informatikerin an der Uni Innsbruck habilitiert.<br />
Heute ist sie Professorin an einer der führenden Wirtschaftsuniversitäten in Europa.<br />
Im Jahr 2019 hatte eine deutliche<br />
Mehrheit des St. Galler Stimmvolks<br />
eine IT-Bildungsoffensive des schweizerischen<br />
Kantons gutgeheißen. Daraufhin<br />
wurde an der Universität St. Gallen<br />
(HSG) ein Informatik-Fachbereich etabliert,<br />
an dessen Aufbau die Tirolerin Barbara<br />
Weber maßgeblich beteiligt ist. Sie<br />
kam 2019 als Lehrstuhlinhaberin für den<br />
Fachbereich Software Engineering aus<br />
Dänemark in die Schweiz und ist Gründungsdekanin<br />
der neu etablierten School<br />
of Computer Science an der Universität<br />
St. Gallen. Seit dem Vorjahr wird hier ein<br />
Master in Computer Science angeboten<br />
und in diesem Jahr wurden auch die ersten<br />
Bachelorstudierenden begrüßt.<br />
Barbara Weber profitiert in ihrer neuen<br />
Funktion von Erfahrungen, die sie<br />
als junge Wissenschaftlerin bei der Etablierung<br />
des Informatik-Schwerpunkts<br />
an der Universität Innsbruck sammeln<br />
konnte. Nach ihrem BWL-Studium befasste<br />
sie sich in ihrer Doktorarbeit<br />
schwer punktmäßig mit einem Thema aus<br />
der Wirtschaftsinformatik und wechselte<br />
2004 an das hier kurz zuvor gegründete<br />
Institut für Informatik. „Ich konnte miterleben,<br />
wie die Informatik innerhalb von<br />
zehn Jahren rapide gewachsen ist und im<br />
Jahr 2011 aus zwei Instituten mit 130 Angestellten<br />
bestand, zahlreiche interdisziplinäre<br />
Kooperationen mit anderen Fachbereichen<br />
der Universität vorweisen und<br />
beeindruckende Summen an Drittmitteln<br />
lukrieren konnte“, erzählt Weber. „Diese<br />
Erfahrungen sind in meiner derzeitigen<br />
Rolle aus vielerlei Hinsicht wertvoll. An<br />
der School of Computer Science haben<br />
wir 2<strong>02</strong>2 mittlerweile 13 Professorinnen<br />
und Professoren und an die 80 Mitarbeitende.“<br />
Software für Anwender<br />
Mit Tirol verbindet sie noch ihre Familie,<br />
aber auch beruflich gibt es nach wie<br />
vor Kontakte: „Ich habe weiterhin aktive<br />
<strong>Forschung</strong>szusammenarbeiten mit der<br />
Wirtschaftsinformatik, mit einzelnen<br />
Kolleginnen und Kollegen und ehemaligen<br />
Mitarbeitenden stehe ich in Kontakt<br />
und versuche generell die Entwicklungen<br />
aus der Ferne mitzuverfolgen“, sagt<br />
Weber. Wissenschaftlich beschäftigt sich<br />
die Informatikerin mit flexiblen prozessorientierten<br />
Informationssystemen und<br />
der Verständlichkeit für den Endverbraucher.<br />
Zurzeit arbeitet sie an neuroadaptiven<br />
Softwaresystemen, die den<br />
emotionalen und kognitiven Zustand<br />
von Nutzer*innen berücksichtigen. Anhand<br />
der gesammelten Daten richten sich<br />
die Systeme selbstständig neu aus und<br />
integrieren dabei auch das „Internet der<br />
Dinge“. Weber untersucht, wie Applikationen<br />
nutzergerechter gestaltet werden<br />
können, um den Endverbraucher in personalisierter<br />
Form in seinen Bedürfnissen<br />
zu unterstützen. Die Unterstützung von<br />
Benutzern steht auch im Zentrum eines<br />
vom Schweizerischen Nationalfonds geförderten<br />
Projekts. Darin möchte Weber<br />
ein umfassendes Verständnis dafür erlangen,<br />
wie Analysten Process-Mining in der<br />
Praxis durchführen, d. h. den „Prozess<br />
des Process-Mining“, um methodische<br />
Anleitungen und operative Unterstützung<br />
zu entwickeln, die Neulingen bei<br />
der Analyse wirksam helfen.<br />
BARBARA WEBER (*1977) studierte an<br />
der Universität Innsbruck Betriebswirtschaftslehre<br />
und promovierte 2003 im<br />
Fachbereich Wirtschaftsinformatik. Von<br />
2004 bis 2016 arbeitete sie am Institut<br />
für Informatik der Uni Innsbruck und<br />
leitete hier im Arbeitsbereich Quality<br />
Engineering einen eigenen <strong>Forschung</strong>sbereich<br />
zur flexiblen IT-Unterstützung von<br />
Geschäftsprozessen und Arbeitsabläufen.<br />
2009 habilitierte sie sich als erste Frau<br />
an der Universität Innsbruck für das Fach<br />
Informatik.<br />
In den nächsten Jahren möchte Weber<br />
den Aufbau der Informatik an ihrer Universität<br />
weiter vorantreiben. „Das beinhaltet,<br />
St. Gallen als Informatik-Standort in<br />
Lehre und <strong>Forschung</strong> zu etablieren, internationale<br />
Sichtbarkeit unserer <strong>Forschung</strong><br />
zu erreichen, gleichzeitig aber auch eine<br />
positive Wirkung für die Region zu erzielen,<br />
sodass die Informatik an der Universität<br />
St. Gallen als Erfolgsgeschichte wahrgenommen<br />
wird“, blickt Weber in die <strong>Zukunft</strong>.<br />
Nach ihrer Zeit als Dekanin – sie hat<br />
gerade ihre zweite Amtsperiode begonnen<br />
– plant Weber ab Mitte 2<strong>02</strong>4 ein Sabbatical<br />
und freut sich schon jetzt auf mehr Zeit für<br />
spannende <strong>Forschung</strong>.<br />
cf<br />
Foto: Universität St. Gallen (HSG)<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/22 49
ESSAY<br />
REGULIEREN JENSEITS<br />
DER GRENZE<br />
Der Jurist Andreas Th. Müller über das Völkerrecht als Recht zu<br />
Koordinierung von näher oder ferner gelegenen Nachbarn.<br />
„Das ‚moderne‘<br />
Völkerrecht, gerne<br />
mit dem 1648<br />
geschaffenen<br />
Westfälischen System<br />
in Verbindung<br />
gebracht, geht von der<br />
souveränen Gleichheit<br />
der Staaten aus,<br />
gesteuert vom Leitbild<br />
der ‚Arena‘, nicht des<br />
‚Turmes‘.“<br />
ANDREAS TH. MÜLLER<br />
(*1977) studierte Philosophie<br />
und Rechtswissenschaften<br />
an der Universität Innsbruck.<br />
Beide Studien schloss er 2003<br />
mit dem Magister ab, zudem<br />
2009 den Master of Laws an<br />
der Yale Law School. Der Promotion<br />
2010 an der Universität<br />
Innsbruck folgte 2016 die<br />
Habilitation. Müller lehrt und<br />
forscht seit 2005 in Innsbruck,<br />
seit 2018 ist er Universitätsprofessor<br />
am Institut für Europarecht<br />
und Völkerrecht.<br />
Für das Völkerrecht spielen Staatsgrenzen<br />
eine entscheidende Rolle. Denn<br />
während die Grenzen eines Staates den<br />
äußeren Rahmen für seine nationale Rechtsordnung<br />
bilden, ist das Völkerrecht jenes<br />
Recht, das jenseits dieser Grenzen reguliert:<br />
im Verhältnis inter nationes, zwischen den<br />
Staaten, international.<br />
In der Bedeutung der Grenzen manifestiert<br />
sich die Territorialität des heutigen Völkerrechts.<br />
In seinem Zentrum stehen Staaten als<br />
Territorialsubjekte, d. h. als Rechtssubjekte,<br />
die dadurch charakterisiert sind, dass sie sich<br />
über einen Teil der Erdoberfläche erstrecken.<br />
Das war nicht immer so, verstand sich das<br />
Völkerrecht doch lange mehr als Recht inter<br />
reges, also zwischen Monarchen.<br />
Das „moderne“ Völkerrecht, gerne mit<br />
dem 1648 geschaffenen Westfälischen System<br />
in Verbindung gebracht, geht von der souveränen<br />
Gleichheit der Staaten aus, gesteuert<br />
vom Leitbild der „Arena“, nicht des „Turmes“<br />
(Douglas M. Johnston). Es versteht sich von<br />
daher im Kern als Recht zu Koordinierung<br />
von näher oder ferner gelegenen Nachbarn.<br />
Vor allem nach 1945 sind dem Völkerrecht<br />
neben diesen horizontalen auch vermehrt<br />
vertikale Funktionen zugewachsen, etwa die<br />
Ansiedlung des Monopols legaler Gewaltausübung<br />
beim UN-Sicherheitsrat. Wie gerade<br />
der Überfall Russlands auf die Ukraine<br />
schmerzlich bewusst macht, steht das Völkerrecht<br />
gegenwärtig in beiderlei Hinsicht auf<br />
dem Prüfstand. Dies enthebt es freilich nicht<br />
seiner Hauptaufgabe: des permanenten Ringens<br />
um Zähmung und Kontrolle politischer<br />
und militärischer Macht durch von der Staatengemeinschaft<br />
gemeinsam angenommene<br />
Regeln.<br />
Aber auch jenseits der Kardinalfrage von<br />
Krieg und Frieden ist das Völkerrecht als<br />
Recht „jenseits der Grenze“ gefordert. Nur<br />
einige wenige Herausforderungen seien genannt:<br />
Während ein Staat über das, was innerhalb<br />
seiner Grenzen geschieht, abgesehen etwa<br />
von universalen Menschenrechtsstandards,<br />
frei disponieren kann, gilt es zu regeln, wie die<br />
„Governance“ von Räumen jenseits der Summe<br />
der Staatsgebiete erfolgen soll: Welches<br />
Regime gilt für die Weltmeere, namentlich für<br />
den für die wirtschaftliche Ausbeutung immer<br />
attraktiver werdenden Tiefseeboden? Wer entscheidet<br />
über die Polarregio nen, die durch die<br />
Eisschmelze immer mehr Begehrlichkeiten<br />
auf sich ziehen? Und als völkerrechtliche Frage<br />
par excellence: Welche Rechtsregeln gelten<br />
jenseits der planetaren Grenze, also im Weltraum?<br />
Schon seit Jahrzehnten ist ein space law<br />
im Aufbau begriffen, das sich gegenwärtig vor<br />
allem mit Fragen von Weltraummüll und der<br />
Regulierung der immer wichtiger werdenden<br />
privaten Weltraumnutzer beschäftigt. Dass<br />
sich funktional verwandte Fragen in einem anderen<br />
„entgrenzten“ Raum stellen, wird nicht<br />
überraschen. Denn auch der „Cyberraum“<br />
generiert fundamentale Herausforderungen.<br />
Als Kehrseite von Globalisierung, komplexen<br />
Lieferketten, erhöhter Mobilität und intensiviertem<br />
Austausch auf allen Ebenen<br />
stellt sich auch immer mehr die Frage, wie<br />
sehr die „westfälische“ Grundprämisse des<br />
Völkerrechts, dass es nämlich eine Vielzahl<br />
grundsätzlich selbstständiger und räumlich<br />
einigermaßen klar abgegrenzter Staaten gibt,<br />
noch trägt. In verschiedensten Zusammenhängen<br />
wird nach der völkerrechtlichen Relevanz<br />
von „extraterritorialen“ Phänomenen<br />
gefragt: angefangen von militärischen Auslandseinsätzen,<br />
traditioneller, aber auch Cyber-Spionage<br />
über Wirtschaftssanktionen,<br />
Plattformregulierung im Ausland, Migrationsströme<br />
bis hin zu Treibhausgasemissionen.<br />
Keine Herausforderung markiert die<br />
Grenze des Denkens und Handelns in Grenzen<br />
so deutlich wie jene des Klimawandels.<br />
Denn hier sind alle zugleich Täter und Opfer,<br />
freilich in ganz unterschiedlichem Maße und<br />
mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten, zu<br />
Klimaschutz und Klimaanpassung beizutragen.<br />
Hier, soweit sind sich die meisten einig,<br />
wird man nur durch intensivierte globale Zusammenarbeit<br />
vorwärts kommen. Hier ist das<br />
Völkerrecht, mit all seinen Grenzen, einmal<br />
mehr unverzichtbar. <br />
50 zukunft forschung <strong>02</strong>/22<br />
Foto: privat
52 zukunft forschung <strong>02</strong>/22<br />
Foto: Andreas Friedle