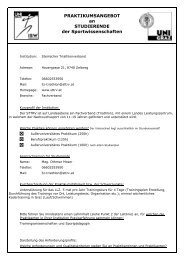Einteilung der Obligationen
Einteilung der Obligationen
Einteilung der Obligationen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Einteilung</strong> <strong>der</strong> <strong>Obligationen</strong><br />
Schuldrechtliche Ansprüche werden mittels actiones in personam geltend gemacht. Nach <strong>der</strong> Art ihrer<br />
Entstehung unterteilt Gaius in den Institutiones diese in obligationes ex contractu und obligationes ex<br />
delicto (Gai. 3,88: infra). Diese Unterscheidung wurde bereits von den iuris prudentes im 1. Jh. v. - 1.<br />
Jh. n. Chr. entwickelt. Prinzipiell respektieren dieses Schema auch die den Obligationsverhältnissen<br />
zuzuordnenden Klagen, insofern diese entwe<strong>der</strong> sachverfolgend o<strong>der</strong> pönal sind (doch existieren auch<br />
gemischte Klagen, wie z. B. die actio legis Aquiliae, o<strong>der</strong> die condictio ex causa furtiva, welche,<br />
obgleich aufgrund eines Deliktes gewährt, sachverfolgend ist).<br />
In den Libri VII rerum cottidianarum sive aureorum (ein Werk unbekannter Urheberschaft, das die<br />
Gaianischen Institutiones paraphrasiert) findet sich die Unterscheidung <strong>der</strong> <strong>Obligationen</strong> in ex<br />
contractu, ex maleficio, sowie proprio iure ex variis causarum figuris (vgl. infra: Gai. 2 aur. D. 44,7,1<br />
pr.). Die neue dritte Kategorie – bereits angedeutet in Gai. 3,91 (infra) - soll offenbar all jene<br />
Geschäftsverhältnisse umfassen, die nicht in das Schema ex contractu passten (wie etwa das oportere<br />
bei Teilungsklagen, die actio aquae pluviae arcendae o<strong>der</strong> die condictio ex causa furtiva).<br />
Die Iustinianischen Institutionen kennen vier Kategorien: ex contractu, quasi ex contractu, ex<br />
maleficio, quasi ex maleficio (I. 3,13,3: siehe infra).<br />
Schema<br />
I. Vertragliche Schuldverhältnisse (erlaubte Handlungen)<br />
Contractus – pactum – Quasi-Verträge<br />
A) Obligationes re contractae: mutuum; Realverträge des ius gentium (commodatum, depositum<br />
[Streitverwahrung; *depositum irregulare], pignus als obligatorischer Pfandvertrag), fiducia<br />
B) Obligationes verbis contractae (sponsio/stipulatio [adstipulatio, adpromissio], dotis dictio,<br />
promissio iurata liberti/libertae)<br />
C) Obligationes litteris contractae<br />
D) Obligationes consensu contractae (emptio-venditio, locatio-conductio, societas, mandatum)<br />
E) ‚Innominatverträge’ (siehe im Kontext <strong>der</strong> Realverträge)<br />
F) Pacta<br />
G) Quasi-Verträge (negotiorum gestio, solutio indebiti, tutela, legatum per damnationem und legatum<br />
sinendi modo, seit Iustinian auch die communio incidens)<br />
II. Deliktische Schuldverhältnisse (unerlaubte Handlungen)<br />
Zivile – prätorische – Quasi-Delikte<br />
A) Furtum (ab später Republik autonom davon: rapina)<br />
B) Damnum iniuria datum (später auch: gewaltsame Sachbeschädigung durch bewaffnete Bande)<br />
C) Iniuria<br />
D) Prätorische Strafklagen: actio quod metus causa, actio de dolo<br />
E) Quasi-Delikte (Iustinian): Klagen gegen iudex qui litem suam fecit, edictum de effusis vel deiectis<br />
und de posito aut suspenso, Haftung für Dritte bei furtum und damnum (Angestellte/Gehilfen des<br />
nauta, caupo, stabularius)<br />
1
Grundlegende Texte zur Einführung<br />
1) Paul. 2 inst. D. 44,7,3 pr.<br />
Obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum aut servitutem nostram faciat,<br />
sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid vel faciendum vel praestandum.<br />
Übersetzung: Das Wesen <strong>der</strong> Schuldverhältnisse besteht nicht darin, dass etwas zu unserem<br />
Gegenstand o<strong>der</strong> zu unserer Dienstleistung gemacht wird, son<strong>der</strong>n dass ein an<strong>der</strong>er uns<br />
verpflichtet/zwingt, etwas hinzugeben, zu tun o<strong>der</strong> zu leisten.<br />
2) Gai. 3,88-91<br />
Nunc transeamus ad obligationes. Quarum summa divisio in duas species diducitur : omnis enim<br />
obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto. § 89. Et primus videamus de his quae ex contractu<br />
nascuntur. Harum autem quattuor genera sunt: aut enim re contrahitur obligatio aut verbis aut litteris<br />
aut consensu. § 90. Re contrahitur obligatio velut mutui datione. proprie in his<br />
[fere] rebus contingit quae pon<strong>der</strong>e numero mensura constant, qualis est pecunia numerata vinum<br />
oleum frumentum aes argentum aurum. Quas res aut numerando aut metiendo aut pendendo in hoc<br />
damus, ut accipientium fiant et quandoque nobis non eaedem, sed aliae eiusdem naturae reddantur.<br />
Unde etiam mutuum appellatum est, quia quod ita tibi a me datum est, ex meo tuum fit. § 91. Is<br />
quoque, qui non debitum accepit ab eo qui per errorem solvit, re obligatur. Nam proinde ei condici<br />
potest SI PARET EUM DARE OPORTERE, ac si mutuum accepisset. Unde quidam putant pupillum aut<br />
mulierem, cui sine tutoris auctoritate non debitum per errorem datum est, non teneri condictione, non<br />
magis quam mutui datione. Sed haec species obligationis non videtur ex contractu consistere, quia is<br />
qui solvendi animo dat, magis distrahere vult negotium quam contrahere.<br />
Übersetzung: Wir wollen nun zu den Schuldverhältnissen/Verpflichtungen/<strong>Obligationen</strong> übergehen.<br />
Deren Haupteinteilung wird auf zwei Arten zurückgeführt: denn jede Obligation entsteht entwe<strong>der</strong> aus<br />
einem Vertrag o<strong>der</strong> einem Delikt. § 89. Und zuerst wollen wir solche betrachten, die aus einem<br />
Vertrag entstehen. Von ihnen gibt es vier Gattungen: eine Verpflichtung wird nämlich vereinbart<br />
durch Sachübergabe o<strong>der</strong> durch Worte o<strong>der</strong> durch schriftliche Eintragung o<strong>der</strong> durch<br />
Willensübereinkunft. § 90. Durch eine Sachübergabe kommt eine Obligation zB durch Hingabe einer<br />
Darlehenssumme zustande. erfolgt eigentlich bei denjenigen<br />
Sachen, die nach Gewicht, Zahl o<strong>der</strong> Maß bestimmt werden, wie es Bargeld, Wein, Öl, Erz, Silber,<br />
Gold ist. Diese Sachen übergeben wir durch Zuzählen, Zumessen o<strong>der</strong> Zuwiegen in <strong>der</strong> Absicht, dass<br />
sie ins Eigentum des Empfängers übergehen und dass uns später einmal nicht dieselben Sachen,<br />
son<strong>der</strong>n an<strong>der</strong>e <strong>der</strong>selben Beschaffenheit zurückerstattet werden. Daher wird das Rechtsgeschäft auch<br />
‚mutuum’ (‚Darlehen’) genannt, weil das, was <strong>der</strong>art dir von mir hingegeben worden ist, ‚ex meo<br />
tuum’ (‚aus dem Meinigen zum Deinigen’) wird. § 91. Wer etwas nicht Geschuldetes von jemandem<br />
annimmt, <strong>der</strong> irrtümlich gezahlt hat, ist ebenfalls aufgrund von Sachübergabe verpflichtet. Denn gegen<br />
ihn kann mit <strong>der</strong> Kondiktionsformel „wenn es sich erweist, dass er zu geben verpflichtet ist“ in<br />
<strong>der</strong>selben Weise geklagt werden, wie wenn er ein Darlehen erhalten hätte. Daher meinen manche, dass<br />
ein Mündel o<strong>der</strong> eine Frau, dem o<strong>der</strong> <strong>der</strong> ohne Zustimmung des Vormunds etwas nicht Geschuldetes<br />
irrtümlich hingegeben worden ist, ebenso wenig aufgrund <strong>der</strong> Kondiktion hafte wie bei <strong>der</strong> Hingabe<br />
des Darlehens. Aber diese Art <strong>der</strong> Verpflichtung beruht offensichtlich nicht auf einem Vertrag, weil<br />
<strong>der</strong>jenige, <strong>der</strong> mit <strong>der</strong> Absicht, eine Schuld zu erfüllen, zahlt, eher ein Rechtsgeschäft<br />
beenden/auflösen als begründen will.<br />
3) Gai. 2 aur. D. 44,7,1 pr.<br />
Obligationes aut ex contractu nascuntur aut ex maleficio aut proprio quodam iure ex variis causarum<br />
figuris.<br />
Übersetzung: Die <strong>Obligationen</strong> entstehen entwe<strong>der</strong> durch einen Vertrag o<strong>der</strong> durch eine Unrechtstat<br />
o<strong>der</strong> auch ‘eigenen Rechts’ aus unterschiedlichen Fallfiguren.<br />
2
4) I. 3,13<br />
Nunc transeamus ad obligationes. obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius<br />
solvendae rei secundum nostrae civitatis iura. § 1. Omnium autem obligationum summa divisio in duo<br />
genera dicitur: namque aut civiles sunt aut praetoriae. civiles sunt, quae aut legibus constitutae aut<br />
certe iure civili comprobatae sunt. praetoriae sunt, quas praetor ex sua iurisdictione constituit, quae<br />
etiam honorariae vocantur. § 2. Sequens divisio in quattuor species diducitur: aut enim ex contractu<br />
sunt aut quasi ex contractu aut ex maleficio aut quasi ex maleficio. [...]<br />
Übersetzung: Jetzt wollen wir zu den Schuldverhältnissen übergehen. Das Schuldverhältnis ist ein<br />
rechtliches Band, durch das wir nach den Rechten unserer Gemeinschaft gezwungen werden,<br />
irgendeine Leistung zu erbringen. § 1. Die oberste <strong>Einteilung</strong> aller <strong>Obligationen</strong> beruht bekanntlich in<br />
zwei Arten: denn sie sind entwe<strong>der</strong> zivilrechtlich o<strong>der</strong> prätorisch. Zivilrechtlich sind diejenigen, die<br />
entwe<strong>der</strong> durch Gesetze eingeführt o<strong>der</strong> jedenfalls vom Zivilrecht anerkannt worden sind. Prätorisch<br />
sind diejenigen, die <strong>der</strong> Prätor aufgrund seiner Gerichtsverwaltung eingeführt hat; sie werden auch<br />
amtsrechtliche/honorarechtliche Schuldverhältnisse genannt. § 2. Die weitere <strong>Einteilung</strong> ergibt vier<br />
Arten. Denn entwe<strong>der</strong> beruhen die <strong>Obligationen</strong> auf Vertrag o<strong>der</strong> Quasi-Vertrag o<strong>der</strong> auf Delikt o<strong>der</strong><br />
Quasi-Delikt. [...]<br />
Prozessrecht<br />
5) Fixe Formelbestandteile nach Gai. 4,39-43<br />
Partes autem formularum hae sunt: demonstratio intentio adiudicatio condemnatio. § 40.<br />
Demonstratio est ea pars formulae quae praecipue ideo inseritur, ut demonstraretur res, de qua<br />
agitur, velut haec pars formulae: QUOD AULUS AGERIUS NUMERIO NEGIDIO HOMINEM VENDIDIT; item<br />
haec QUOD AULUS AGERIUS NUMERIUM NEGIDIUM HOMINEM DEPOSUIT. § 41. Intentio est ea<br />
pars formulae, qua actor desi<strong>der</strong>ium suum concludit: velut haec pars formulae SI PARET NUMERIUM<br />
NEGIDIUM AULO AGERIO SESTERTIUM X MILIA DARE OPORTERE; item haec QUIDQUID PARET NUMERIUM<br />
NEGIDIUM AULO AGERIO DARE FACERE ; item haec SI PARET HOMINEM EX IURE QUIRITIUM<br />
AULI AGERII ESSE. § 42. Adiudicatio est ea pars formulae, qua permittitur iudici rem alicui ex<br />
litigatoribus adiudicare, velut si inter coheredes familiae erciscundae agatur, aut inter socios<br />
communi dividundo, aut inter vicinos finium regundorum. Nam illic ita est QUANTUM AIUDICARI<br />
OPORTET; IUDEX TITIO ADIUDICATO. § 43. Condemnatio est ea pars formulae, qua iudici condemnandi<br />
absolvendive potestas permittitur: velut haec pars formulae IUDEX NUMERIUM NEGIDIUM AULO<br />
AGERIO SESTERTIUM X MILIA CONDEMNA. SI NON PARET, ABSOLVE; item haec IUDEX NUMERIUM<br />
NEGIDIUM AULO AGERIO DUMTAXAT CONDEMNA. SI NON PARET, ABSOLVITO; item haec IUDEX<br />
NUMERIUM NEGIDIUM AULO AGERIO CONDEMNATO; et reliqua, ut non adiciatur DUMTAXAT .<br />
Übersetzung: Die einzelnen Teile <strong>der</strong> Klagformeln sind nun folgende: Sachverhaltsbeschreibung,<br />
Klagebegehren/-antrag, Zuerkennungsermächtigung und Verurteilungsermächtigung. § 40. Die<br />
Sachverhaltsbeschreibung ist <strong>der</strong>jenige Teil <strong>der</strong> Klagformel, <strong>der</strong> vorzugsweise dazu eingefügt wird,<br />
dass die Sache, um die prozessiert wird, beschrieben wird, zum Beispiel folgen<strong>der</strong> Teil <strong>der</strong><br />
Klagformel: DA DER KLÄGER DEM BEKLAGTEN EINEN SKLAVEN VERKAUFT HAT, ferner folgen<strong>der</strong>:<br />
DA DER KLÄGER BEIM BEKLAGTEN EINEN SKLAVEN IN VERWAHRUNG GEGEBEN HAT. § 41. Der<br />
Klagantrag ist <strong>der</strong>jenige Teil <strong>der</strong> Klagformel, in dem <strong>der</strong> Kläger sein Begehren zusammenfasst, zum<br />
Beispiel folgen<strong>der</strong> Teil <strong>der</strong> Klagformel: WENN ES SICH ERWEIST, DASS DER BEKLAGTE DEM KLÄGER<br />
10.000 SESTERZEN GEBEN MUSS; ferner folgen<strong>der</strong>: ALLES, WAS ERWIESENERMASSEN DER BEKLAGTE<br />
DEM KLÄGER GEBEN ODER LEISTEN ; ferner folgen<strong>der</strong>: WENN ES SICH ERWEIST, DASS DER<br />
SKLAVE NACH QUIRITISCHEM RECHT DEM KLÄGER GEHÖRT. § 42. Die Zuerkennungsermächtigung ist<br />
<strong>der</strong>jenige Teil <strong>der</strong> Klagformel, in welchem dem Richter eingeräumt wird, eine Sache einer <strong>der</strong><br />
Streitparteien zuzusprechen, zum Beispiel, wenn unter Miterben wegen <strong>der</strong> Aufteilung des Erbes o<strong>der</strong><br />
unter Gesellschaftern wegen <strong>der</strong> Teilung einer gemeinsamen Sache o<strong>der</strong> unter Nachbarn wegen<br />
3
Grenzberichtigung geklagt wird; denn dort lautet es dann folgen<strong>der</strong>maßen: WIE VIEL ZUERKANNT<br />
WERDEN MUSS, ERKENNE, RICHTER, DEM TITIUS ZU. § 43. Die Verurteilungsermächtigung ist<br />
<strong>der</strong>jenige Teil <strong>der</strong> Klagformel, in welchem <strong>der</strong> Richter die Macht zur Verurteilung o<strong>der</strong> zum<br />
Freispruch zugestanden wird, zum Beispiel folgen<strong>der</strong> Teil <strong>der</strong> Klagformel: RICHTER, VERURTEILE DEN<br />
BEKLAGTEN GEGENÜBER DEM KLÄGER ZU 10.000 SESTERZEN; WENN ES SICH NICHT ERWEIST, SPRICH<br />
FREI; ferner dieser: RICHTER, VERURTEILE DEN BEKLAGTEN GEGENÜBER DEM KLÄGER ZU<br />
HÖCHSTENS ; WENN ES SICH NICHT ERWEIST, SOLLST DU FREISPRECHEN; ferner dieser:<br />
RICHTER, DU SOLLST DEN BEKLAGTEN GEGENÜBER DEM KLÄGER VERURTEILEN und so weiter, ohne<br />
Zusatz von HÖCHSTENS .<br />
6) Variable Formelbestandteile<br />
a) Exceptio nach Gai. 4,119<br />
Omnes autem exceptiones in contrarium concipiuntur, quam adfirmat is cum quo agitur. Nam si verbi<br />
gratia reus dolo malo aliquid actorem facere dicat, qui forte pecuniam petit quam non numeravit, sic<br />
exceptio concipitur SI IN EA RE NIHIL DOLO MALO AULI AGERII FACTUM SIT NEQUE FIAT: item si dicat<br />
contra pactionem pecuniam peti, ita concipitur exceptio sI INTER AULUM AGERIUM ET NUMERIUM<br />
NEGIDIUM NON CONVENIT, NE EA PECUNIA PETERETUR; et denique in ceteris causis similiter concipi<br />
solet [...].<br />
Übersetzung: Alle Einreden aber werden in gegensätzlichem Wortlaut zu dem formuliert, was<br />
<strong>der</strong>jenige behauptet, mit dem <strong>der</strong> Prozess geführt wird. Denn wenn <strong>der</strong> Beklagte behauptet, dass <strong>der</strong><br />
Kläger etwas in böser Absicht getan hat (dass er etwa Geld for<strong>der</strong>t, das er nicht ausgezahlt hat), so<br />
wird die Einrede folgen<strong>der</strong>maßen formuliert: WENN IN DIESER SACHE NICHTS MIT ARGLIST DES<br />
KLÄGERS GESCHEHEN IST UND NICHTS GESCHIEHT; wenn er ferner sagt, Geld werde gegen eine<br />
Vereinbarung gefor<strong>der</strong>t, so wird die Einrede folgen<strong>der</strong>maßen formuliert: WENN ZWISCHEN DEM<br />
KLÄGER UND DEM BEKLAGTEN KEINE ÜBEREINKUNFT BESTEHT, DASS DIESES GELD NICHT<br />
GEFORDERT WERDE; und schließlich wird in allen an<strong>der</strong>en Fällen üblicherweise ähnlich formuliert<br />
[…].<br />
b) Exceptio rei venditae et traditae<br />
Diese Einrede wird zB in die Formel <strong>der</strong> rei vindicatio eingefügt: [...] SI NON AULUS AGERIUS SERVUM<br />
NUMERIO NEGIDIO VENDIDIT ET TRADIDIT, [...].<br />
Übersetzung: […] wenn <strong>der</strong> Kläger den Sklaven nicht dem Beklagten verkauft und übergeben hat,<br />
[…].<br />
4
Römisches Strafrecht<br />
7) Ulp. 18 ed. D. 9,2,9 pr.-1<br />
Item si obstetrix medicamentum de<strong>der</strong>it et inde mulier perierit, Labeo distinguit, ut, si quidem suis<br />
manibus supposuit, videatur occidissse: sin vero dedit, ut sibi mulier offerret, in factum actionem<br />
dandam, quae sententia vera est: magis enim causam mortis praestitit quam occidit. § 1. Si quis per<br />
vim vel suasum medicamentum alicui infundit vel ore vel clystere vel si eum unxit malo veleno, lege<br />
Aquilia eum teneri, quemadmodum obstetrix supponens tenetur.<br />
Übersetzung: Wenn eine Hebamme ein Medikament gegeben hat und die behandelte Frau in <strong>der</strong> Folge<br />
gestorben ist, so unterscheidet Labeo, dass, wenn sie es mit eigenen Händen verabreicht hat, diese<br />
Handlung als ‚Töten’ anzusehen ist; wenn sie es aber <strong>der</strong> Frau gegeben hat, damit diese es selbst<br />
einnehme, dann muss eine actio in factum gewährt werden, und diese Ansicht ist richtig. Sie hat<br />
nämlich vielmehr eine Todesursache gesetzt als getötet. § 1. Wenn jemand unter Einsatz von Gewalt<br />
o<strong>der</strong> durch Überredung einer Person entwe<strong>der</strong> durch den Mund o<strong>der</strong> mittels eines Klistiers ein<br />
Medikament einflößt, o<strong>der</strong> wenn er sie mit einer giftigen Substanz eingerieben hat, so haftet er<br />
aufgrund <strong>der</strong> lex Aquilia in gleicher Weise wie die Hebamme haftet, die ein Medikament verabreicht.<br />
8) Marcian. 14 inst. D. 48,8,3,2<br />
Sed ex senatus consulto relegari iussa est ea, quae non quidem malo animo, sed malo exemplo<br />
medicamentum ad conceptionem dedit, ex quo ea quae acceperat decesserit.<br />
Übersetzung: Doch aufgrund eines Senatsbeschlusses ist die Relegation einer Frau veranlasst worden,<br />
die zwar nicht in böser Absicht, aber durch ihr Handeln ein schlechtes Beispiel abgebend ein Mittel<br />
zur För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Fruchtbarkeit verabreicht hat, an dem die Frau, die es eingenommen hat, gestorben<br />
ist.<br />
9) Ulp. 18 ed. D. 9,2,7,8<br />
Proculus ait, si medicus servum imperite secuerit, vel ex locato vel ex lege Aquilia competere<br />
actionem.<br />
Übersetzung: Proculus sagt, wenn ein Arzt einen Sklaven nicht fachgemäß operiert hat, so steht<br />
entwe<strong>der</strong> die Klage aus dem Behandlungsvertrag o<strong>der</strong> die aus <strong>der</strong> lex Aquilia zu.<br />
Fragen:<br />
a) Welcher Vertrag ist gemeint?<br />
b) Legen die Juristen bei <strong>der</strong> Beurteilung <strong>der</strong> Fachkompetenz des Arztes einen objektiven o<strong>der</strong> einen<br />
subjektiven Maßstab an?<br />
c) Warum steht nur eine <strong>der</strong> beiden Klagen zur Verfügung?<br />
10) a) Ulp. 18 ed. D. 9,2,5,3<br />
Si magister in disciplina vulneraverit servum vel occi<strong>der</strong>it, an Aquilia teneatur, quasi damnum iniuria<br />
de<strong>der</strong>it? et Iulianus scribit Aquilia teneri eum, qui eluscaverat discipulum in disciplina: multo magis<br />
igitur in occiso idem erit dicendum. proponitur autem apud eum species talis: sutor, inquit, puero<br />
discenti ingenuo filio familias, parum bene facienti quod demonstraverit, forma calcei cervicem<br />
percussit, ut oculus puero perfun<strong>der</strong>etur: dicit igitur Iulianus iniuriarum quidem actionem non<br />
competere, quia non faciendae iniuriae causa percusserit, sed monendi et docendi causa: an ex<br />
locato, dubitat, quia levis dumtaxat castigatio concessa est docenti: sed lege Aquilia posse agi non<br />
dubito, [...]<br />
10) b) Paul. 22 ed. D. 9,2,6<br />
[...] praeceptoris enim nimia saevitia culpae adsignatur.<br />
5
Übersetzung: a) Wenn ein Lehrer beim Unterricht einen Sklaven verletzt o<strong>der</strong> getötet hat, haftet er<br />
dann nach <strong>der</strong> lex Aquilia, weil er wi<strong>der</strong>rechtlich einen Schaden zugefügt hat? Und Iulian schreibt,<br />
dass nach <strong>der</strong> lex Aquilia haftet, wer einem Schüler beim Unterricht ein Auge ausgeschlagen hat;<br />
dasselbe muss daher umso eher gesagt werden, wenn er getötet worden ist. Bei ihm wird folgen<strong>der</strong><br />
Fall erörtert: Ein Schuster schlug, wie er sagt, einem bei ihm als Lehrling tätigen frei geborenen<br />
Knaben, einem Haussohn, <strong>der</strong> das, was er ihm gezeigt hatte, unzureichend ausführte, mit einem<br />
Leisten <strong>der</strong>art fest auf das Genick, dass dem Knaben ein Auge ausfloss. Iulian sagt nun, eine actio<br />
iniuriarum sei zwar nicht zu gewähren, weil er den Lehrling ja nicht geschlagen habe, um eine<br />
Personenverletzung zu begehen, son<strong>der</strong>n um ihn zu belehren; er erwägt aber, ob die Klage aus dem<br />
Lehrlingsvertrag erhoben werden könne, da einem Lehrherrn nur leichte Züchtigung erlaubt sei; ich<br />
habe aber keinerlei Bedenken, dass nach <strong>der</strong> lex Aquilia geklagt werden kann, [...].<br />
b) [...] denn allzu große Heftigkeit des Lehrers wird dem Verschulden (culpa) zugerechnet.<br />
Fragen:<br />
a) Erklären Sie beide inscriptiones.<br />
b) Erläutern Sie die diskutierte Frage einer Haftung im Rahmen <strong>der</strong> locatio conductio und <strong>der</strong> lex<br />
Aquilia.<br />
c) Warum ist die Subsumption des Tatbestandes unter die lex Aquilia problematisch?<br />
d) Aus welchem Grund wird eine Haftung wegen iniuria (Personenverletzung) abgelehnt?<br />
e) Wer kann mit <strong>der</strong> Vertragsklage und mit <strong>der</strong> Deliktsklage was einfor<strong>der</strong>n? Sind die beiden Klagen<br />
kumulierbar?<br />
11) Ulp. 18 ed. D. 9,2,11 pr.<br />
Item Mela scribit, si, cum pila quidam lu<strong>der</strong>ent, vehementius quis pila percussa in tonsoris manus eam<br />
deiecerit et sic servi, quem tonsor habebat, gula sit praecisa adiecto cultello: in quocumque eorum<br />
culpa sit, eum lege Aquilia teneri. Proculus in tonsore esse culpam: et sane si ibi tondebat, ubi ex<br />
consuetudine ludebatur vel ubi transitus frequens erat, est quod ei imputetur: quamvis nec illud male<br />
dicatur, si in eo loco periculoso sellam habenti tonsori se quis commiserit, ipsum de se queri debere.<br />
Übersetzung: Ebenso schreibt Mela, dass, als einige Ball spielten und es sich zutrug, dass <strong>der</strong> Ball mit<br />
solcher Wucht auf die Hand eines Barbiers geschleu<strong>der</strong>t wurde und diese nach unten drückte, wodurch<br />
einem Sklaven, den <strong>der</strong> Barbier gerade als Kunden bediente, mit dem angesetzten Messer die Kehle<br />
durchschnitten wurde, <strong>der</strong>jenige <strong>der</strong> Beteiligten nach <strong>der</strong> lex Aquilia zu haften hätte, den die culpa<br />
treffe. Für Proculus trifft den Barbier das Verschulden: In <strong>der</strong> Tat, wenn er dort rasierte, wo für<br />
gewöhnlich Ball gespielt wurde o<strong>der</strong> wo reger Durchgangsverkehr herrschte, gibt es etwas, was ihm<br />
vorgehalten werden kann. Trotzdem wäre es auch kein schlechtes Argument, würde man vertreten,<br />
dass jemand, <strong>der</strong> sich einem Barbier anvertraut, <strong>der</strong> seinen Sessel an einem gefährlichen Ort<br />
aufgestellt hat, sich bei sich selbst beklagen muss.<br />
Fragen:<br />
a) Welchen Beteiligten am Unfall könnte ein Verschulden angelastet werden?<br />
b) Warum wirft Proculus dem tonsor Verschulden nach <strong>der</strong> lex Aquilia vor?<br />
c) Was meint Ulpian, wenn er schreibt, <strong>der</strong> Barbierkunde müsse sich bei sich selbst beklagen?<br />
d) Unter welcher Voraussetzung würde auch <strong>der</strong> Ballspieler lege Aquilia haften?<br />
6
12) Paul. 11 ed. D. 4,2,8,2<br />
Quod si de<strong>der</strong>it ne stuprum patiatur , hoc edictum locum habet, cum viris bonis iste<br />
metus maior quam mortis esse debet.<br />
Übersetzung: Wenn etwas gegeben hat, um nicht sexuell missbraucht zu<br />
werden, so findet dieses Edikt Anwendung, weil rechtschaffenen Menschen diese Furcht mehr<br />
bedeuten muss als <strong>der</strong> Tod.<br />
Fragen:<br />
a) Um welches Delikt handelt es sich?<br />
b) Bestehen Zweifel an <strong>der</strong> Beachtlichkeit?<br />
c) Welche Rechtsmittel stehen den Opfern zur Verfügung, was werden sie damit bewirken?<br />
d) Diskutieren Sie den Fall, wenn sich das erpresste Gut mittlerweile bei einem unbeteiligten Dritten<br />
befindet (Klagemöglichkeiten? Herausgabe?).<br />
13) Formel <strong>der</strong> actio furti nec manifesti (nach Gai. 4,37; Lenel 328)<br />
Si paret Aurelio Iunio a Publio Domitio ope consiliove Publii Domitii furtum factum esse cucumae<br />
aereae, quam ob rem Publium Domitium pro fure damnum deci<strong>der</strong>e oportet, quanti ea res fuit, cum<br />
furtum factum est, tantae pecuniae duplum iudex Publium Domitium Aurelio Iunio condemna; si non<br />
paret absolve.<br />
Übersetzung: Wenn es sich erweist, dass dem klagenden Aurelius Iunius vom beklagten Publius<br />
Domitius mit dessen Beihilfe o<strong>der</strong> auf dessen Anstiftung ein Kupferkessel gestohlen wurde, aus<br />
welchem Sachverhalt <strong>der</strong> Beklagte als Dieb Sühne zu leisten verpflichtet ist, dann soll <strong>der</strong> Richter den<br />
Beklagten Publius Domitius dem Kläger Aurelius Iunius in den doppelten Geldbetrag des Wertes<br />
verurteilen, den die Sache zur Zeit <strong>der</strong> Begehung <strong>der</strong> Tat gehabt hat; wenn es sich nicht erweist, soll er<br />
ihn freisprechen.<br />
14) Formel <strong>der</strong> actio furti nec manifesti (noxalis) (Lenel 328)<br />
Si paret Lucillae a Sticho servo Fulviae furtum factum esse equi, quam ob rem Fulviam pro fure<br />
damnum deci<strong>der</strong>e aut Stichum noxae de<strong>der</strong>e oportet, quanti ea res fuit, cum furtum factum est, tantae<br />
pecuniae duplum dare aut Stichum noxae de<strong>der</strong>e iudex Fulviam Lucillae condemna; si non paret<br />
absolve.<br />
Übersetzung: Wenn es sich erweist, dass <strong>der</strong> (klagenden) Lucilla von Stichus, dem Sklaven <strong>der</strong><br />
(beklagten) Fulvia ein Pferd gestohlen wurde, aus welchem Sachverhalt die Beklagte entwe<strong>der</strong> als<br />
Diebin Buße zu bezahlen o<strong>der</strong> den Stichus zur Sühne auszuliefern verpflichtet ist, dann soll <strong>der</strong><br />
Richter die Beklagte Fulvia <strong>der</strong> Klägerin Lucilla entwe<strong>der</strong> in den doppelten Geldbetrag des Wertes<br />
verurteilen, den die Sache zur Zeit <strong>der</strong> Begehung <strong>der</strong> Tat gehabt hat, o<strong>der</strong> in die Auslieferung des<br />
Stichus zur Sühne verurteilen; wenn es sich nicht erweist, soll er sie freisprechen.<br />
7
Gewaltunterworfene und Angestellte, Stellvertretung<br />
15) Actio depositi de peculio deve in rem verso<br />
Quod Cornelia apud Neratium, qui in Cassii potestate est, lectum deposuit, qua de re agitur<br />
(demonstratio), quidquid ob eam rem Neratium, si liber esset ex iure Quiritium, Corneliae dare facere<br />
oportet ex fide bona (intentio), eius iudex Cassium Corneliae dumtaxat de peculio et si quid dolo malo<br />
Cassii factum est, quo minus peculii esset, vel si quid in rem Cassii inde versum est, condemna. Si non<br />
paret, absolve (condemnatio).<br />
Übersetzung: Klageformel aus dem Verwahrungsvertrag im Rahmen eines Pekuliums o<strong>der</strong> wegen<br />
Bereicherung (des Gewalthabers): Wenn (sofern) Cornelia (= Klägerin) dem Neratius (= Beklagter,<br />
Gewaltunterworfener), <strong>der</strong> in <strong>der</strong> Gewalt des Cassius (= Gewalthaber) ist, das Bett, um das es hier<br />
geht, in Verwahrung gegeben hat (demonstratio), was immer aus diesem Grund <strong>der</strong> Neratius, wenn er<br />
nach quiritischem Recht frei wäre, <strong>der</strong> Cornelia nach Treu und Glauben zu leisten verpflichtet wäre<br />
(intentio), dann verurteile, Richter, den Cassius <strong>der</strong> Cornelia in höchstens den Wert des Pekuliums<br />
o<strong>der</strong> in (höchstens) den Wert, den dieses hätte, wenn <strong>der</strong> Cassius nicht arglistig bewirkt hätte, dass<br />
(etwas) nicht im Pekulium ist (bei Privatkonkurs), o<strong>der</strong> in (höchstens) den Wert, den das hat, was dem<br />
Vermögen des Cassius zugewendet worden ist. Wenn sich dies nicht erweist, sprich ihn frei<br />
(condemnatio).<br />
Anmerkung: Der Zusatz si liber esset ist bei einer formula in ius concepta notwendig. SklavInnen<br />
können nach ius civile nicht verklagt werden/klagen, da sie keine liberi und daher auch keine cives<br />
sind. Um die Klagslegitimation bei einer formula in ius concepta zu erreichen, muss <strong>der</strong> Prätor die<br />
libertas fingieren.<br />
16) Actio venditi quod iussu<br />
Quod iussu Clodii Allius Flavio, cum is in potestate Clodii esset, fundum vendidit, qua de re agitur,<br />
quidquid ob eam rem Flavium Allio dare facere oportet ex fide bona, eius iudex Clodium Allio<br />
condemna. Si non paret absolve.<br />
Übersetzung: Wenn (sofern) Allius (Kläger) dem Flavius (Beklagter, filius familias) auf Geheiß des<br />
Clodius (pater familias), als dieser in <strong>der</strong> Gewalt des Clodius stand, ein Grundstück verkauft hat, um<br />
das es hier geht, so verurteile, Richter, dem Allius den Clodius in alles das, was <strong>der</strong> Flavius dem Allius<br />
nach Treu und Glauben zu leisten verpflichtet ist. Wenn sich dies nicht erweist, sprich ihn frei.<br />
17) Scaev. 1 resp. D. 15,3,20 pr.<br />
Pater pro filia dotem promisit et convenit, ut ipse filiam aleret: non praestante patre filia a viro<br />
mutuam pecuniam accepit et mortua est in matrimonio. respondi, si ad ea id quod creditum est<br />
erogatum esset, sine quibus aut se tueri aut servos paternos exhibere non posset, dandam de in rem<br />
verso utilem actionem.<br />
Übersetzung: Ein Vater hat für seine Tochter eine Mitgift versprochen und vereinbart, dass er selbst<br />
für den Unterhalt <strong>der</strong> Tochter aufkommen werde. Als <strong>der</strong> Vater nicht leistete, nahm die Tochter von<br />
ihrem Ehegatten ein Gelddarlehen auf und verstarb später während aufrechter Ehe. Ich habe<br />
geantwortet, es sei eine actio de in rem verso utilis zu gewähren, wenn diejenige, die das Darlehen<br />
empfangen hat, es für Dinge verwendet hat, ohne die sie entwe<strong>der</strong> sich selbst nicht erhalten o<strong>der</strong> die<br />
väterlichen SklavInnen nicht verpflegen konnte.<br />
Anmerkung: Der Jurist empfahl wahrscheinlich deshalb eine actio utilis, weil die Musterformel im<br />
prätorischen Edikt nur vom ‚filius familias’ sprach.<br />
8
Fragen<br />
a) Inscriptio? Textüberlieferung?<br />
b) Erörtern Sie Sachverhalt und Rechtsprobleme.<br />
c) Muss vorausgesetzt werden, dass die Frau während <strong>der</strong> Ehe filia familias bleibt? Verfügt sie<br />
über ein peculium?<br />
d) Verstieß die Darlehensaufnahme <strong>der</strong> Tochter gegen das SC Macedonianum? Gegen das SC<br />
Velleianum?<br />
e) Worin mag <strong>der</strong> Jurist hier eine versio in rem erblickt haben?<br />
9
Emptio venditio<br />
Prätorisches Edikt<br />
18) Formel <strong>der</strong> actio empti (LENEL, EP 3 , 299)<br />
Quod Aulus Agerius de Numerio Negidio hominem quo de agitur emit, qua de re agitur, quidquid ob<br />
eam rem dare facere oportet ex fide bona, eius iudex Numerium Negidium Aulo Agerio condemnat; si<br />
non paret, absolvito.<br />
Übersetzung: Wenn (sofern) <strong>der</strong> Kläger (Aulus Agerius) vom Beklagten (Numerius Negidius) den<br />
besagten Sklaven gekauft hat, um den prozessiert wird, möge <strong>der</strong> Richter den Beklagten zur Leistung<br />
all dessen an den Kläger verurteilen, was dieser aufgrund von Treu und Glauben schuldig ist; wenn es<br />
sich nicht erweist, spreche er ihn frei.<br />
19) Formel <strong>der</strong> actio de dolo (LENEL, EP 3 , 114)<br />
Si paret dolo malo Numerii Negidii factum esse, ut Aulus Agerius Numerio Negidio fundum quo de<br />
agitur mancipio daret, neque plus quam annus est, cum experiundi potestas fuit, neque ea res arbitrio<br />
iudicis restituetur, quanti ea res erit, tantam pecuniam iudex Numerium Negidium Aulo Agerio<br />
condemnato; si non paret absolvito.<br />
Übersetzung: Wenn es sich erweist, dass NN absichtlich (dolo malo) gehandelt hat, sodass AA dem<br />
NN das Grundstück, um das prozessiert wird, übereignet hat, und we<strong>der</strong> ein Jahr seit dem Zeitpunkt,<br />
an dem die Klageführung (erstmals) möglich wurde, verstrichen ist, noch das Streitobjekt aufgrund <strong>der</strong><br />
Ermächtigung des Richters restituiert wurde, dann verurteile, Richter, den NN dem AA in den<br />
Geldbetrag, den <strong>der</strong> Streitgegenstand wert sein wird; wenn es sich nicht erweist, sprich ihn frei.<br />
Ädilizisches Edikt<br />
20) Actio redhibitoria<br />
Ulp. 1 ed. aedil. curul. D. 21,1,1,1<br />
Aiunt aediles: ‚Qui mancipia vendunt, certiores faciant emptores, quid morbi vitiive cuique sit, quis<br />
fugitivus errove sit noxave solutus non sit: eademque omnia, cum ea mancipia venibunt, palam recte<br />
pronuntianto. quodsi mancipium adversus ea venisset, sive adversus quod dictum promissumve fuerit<br />
cum veniret, fuisset, quod eius praestari oportere dicetur: emptori omnibusque ad quos ea res pertinet<br />
iudicium dabimus, ut id mancipium redhibeatur. […]’.<br />
Übersetzung: Die Ädilen schreiben (in ihrem Edikt) vor: „Diejenigen, die Sklaven verkaufen, müssen<br />
die Käufer darüber in Kenntnis setzen, welche Krankheit o<strong>der</strong> Mangelhaftigkeit je<strong>der</strong> einzelne hat,<br />
wer zur Flucht o<strong>der</strong> zum Vagabundieren neigt o<strong>der</strong> von einer Straftat nicht befreit ist. All diese<br />
Mängel sind, wenn solche Sklaven zum Verkauf kommen, wahrheitsgemäß offen zu legen. Ist aber ein<br />
Sklave entgegen diesen Regeln verkauft worden, o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>s als bei Verkaufsabschluss versprochen<br />
und zugesagt, das heisst, als <strong>der</strong> Verkäufer (nach Zivilrecht) zu leisten sich verpflichtet erklärt hat,<br />
werden wir dem Käufer und allen, die diese Angelegenheit betrifft, eine Klage darauf gewähren, dass<br />
dieser Sklave zurückgegeben wird. […]“.<br />
21) Actio quanti minoris (LENEL, EP 3 , 561)<br />
Si paret homini quo de agitur, quem As As de No No emit, vitii quid, cum veniret, fuisse [...] neque<br />
plus quam annus est, cum experiundi potestas fuit, quanto ob id vitium is homo, cum veniret, minoris<br />
fuit, tantam pecuniam iudex Nm Nm Ao Ao condemnato; nisi paret absolvito.<br />
10
Übersetzung: Wenn es sich erweist, dass <strong>der</strong> Sklave, um den es geht, den <strong>der</strong> Kläger vom Beklagten<br />
gekauft hat, bereits zum Zeitpunkt des Kaufvertragsabschlusses bestimmte Mängel aufwies [...] und<br />
nicht mehr als ein Jahr verstrichen ist seit dem Zeitpunkt, als es möglich wurde, den Mangel<br />
festzustellen, soll <strong>der</strong> Beklagte dem Kläger in den Differenzbetrag verurteilt werden, den <strong>der</strong> Sklave<br />
aufgrund seines Mangels wert ist; wenn es sich nicht erweist, soll er freigesprochen werden.<br />
Historische Entwicklung<br />
22) Cic. off. 3,65<br />
Nam cum ex duodecim tabulis satis esset ea praestari, quae essent lingua nuncupata, quae qui<br />
infitiatus esset dupli poenam subiret, a iuris consultis etiam reticentiae poena est constituta:<br />
Quidquid enim est in praedio vitii, id statuerunt, si venditor sciret, nisi nominatim dictum esset,<br />
praestari oportere.<br />
Übersetzung: Denn während es nach den XII Tafeln genügte, dass das geleistet werde, was<br />
ausdrücklich erklärt worden war, und <strong>der</strong>, <strong>der</strong> ableugnete, die Bestrafung auf den doppelten Wert<br />
erlitt, wurde von den Rechtsgelehrten auch für das Verschweigen (<strong>der</strong> Mängel an einem Gegenstand)<br />
eine Strafe eingeführt. Denn sie hielten fest, dass je<strong>der</strong> Mangel, den das Grundstück hat, wenn <strong>der</strong><br />
Verkäufer ihn kannte, sofern er ihn nicht ausdrücklich genannt hatte, (dem Käufer) ersetzt werden<br />
muss.<br />
23) Cic. off. 3,54<br />
Vendat aedes vir bonus, propter aliqua vitia, quae ipse norit, ceteri ignorent, pestilentes sint et<br />
habeantur salubres, ignoretur in omnibus cubiculis apparere serpentes, male materiatae<br />
et ruinosae, se hoc praeter dominum nemo sciat; quaero, si haec emptoribus venditor non<br />
dixerit aedesque vendi<strong>der</strong>it pluris multo, quam se venditurum putarit, num id iniuste aut<br />
improbe fecerit?<br />
Übersetzung: Ein rechtschaffener Mann verkauft sein Haus wegen irgendwelcher Mängel, die er selbst<br />
kennt, von denen die übrigen aber nichts wissen – es sei übel riechend, gelte aber als <strong>der</strong> Gesundheit<br />
för<strong>der</strong>lich; es sei unbekannt, dass in allen seinen Räumen Schlangen hervorkröchen, dass es aus<br />
schadhaftem Baumaterial und einsturzgefährdet sei -, aber dies wisse, abgesehen vom Hausherrn,<br />
niemand. Ich frage nun, wenn dies <strong>der</strong> Verkäufer den Käufern nicht gesagt und das Haus viel teurer<br />
verkauft hat, als er es verkaufen zu können glaubte, handelte er dann nicht unrechtmäßig, o<strong>der</strong><br />
unredlich?<br />
24) Ulp. 44 Sab. D. 4,3,37<br />
Quod venditor ut commendet dicit, sic habendum, quasi neque dictum neque promissum est: si vero<br />
decipiendi emptoris causa dictum est, aeque sic habendum est, ut non nascatur adversus dictum<br />
promissumve actio, sed de dolo actio.<br />
Übersetzung: Was ein Verkäufer als Anpreisung (<strong>der</strong> Ware) sagt, darf we<strong>der</strong> als Zusicherung noch als<br />
Versprechen aufgefasst werden. Wenn es aber gesagt worden ist, um den Käufer zu täuschen, muss es<br />
zwar gleichfalls dahingehend aufgefasst werden, dass im Hinblick auf eine Zusicherung o<strong>der</strong> ein<br />
Versprechen keine Klage begründet ist, wohl aber eine Klage wegen Arglist.<br />
11
Error<br />
25) Ulp. 28 Sab. D. 18,1,11,1<br />
Quod si ego me virginem emere putarem, cum esset iam mulier, emptio valebit: in sexu enim non est<br />
erratum. ceterum si ego mulierem ven<strong>der</strong>em, tu puerum emere existimasti, quia in sexu error est, nulla<br />
emptio, nulla venditio est.<br />
Übersetzung: Wenn ich glaubte, eine Jungfrau zu kaufen, die aber bereits eine Frau ist, wird <strong>der</strong> Kauf<br />
gültig sein, da bezüglich des Geschlechtes kein Irrtum vorliegt. Wenn ich aber eine Frau verkaufte, du<br />
aber einen Knaben zu kaufen glaubtest, kommt kein Kaufvertrag zustande, weil Irrtum bezüglich des<br />
Geschlechtes vorliegt.<br />
Periculum est emptoris<br />
26) Bacchus verkauft Priscilla vier Amphoren apulischen Jahrgangsweins um 800 Sesterzen. Der<br />
Wein soll Priscilla am übernächsten Tag zugestellt werden. Tags darauf überschwemmt <strong>der</strong> Tiber<br />
infolge heftiger Unwetter den Weinkeller des Bacchus und sein gesamtes Amphorenlager wird<br />
vernichtet.<br />
Fragen:<br />
a) Muss Bacchus den Kaufpreis zurückerstatten?<br />
b) Benötigt Priscilla o<strong>der</strong> Bacchus einen Tutor beim Vertragsabschluss?<br />
27) Clio verkauft Helena, <strong>der</strong> Sklavin <strong>der</strong> Fulvia, ein Purpurgewand mit Goldstickerei. Sie<br />
vereinbaren, dass das Kleid am darauffolgenden Tag von Helena abgeholt werden würde. Nachts wird<br />
das Gewand aus dem Geschäft Clios gestohlen.<br />
Fragen:<br />
a) Wird Clio mit <strong>der</strong> actio venditi gegen Fulvia durchdringen?<br />
b) Än<strong>der</strong>t sich etwas, wenn das Kleid eine Massenware aus <strong>der</strong> Manufaktur wäre?<br />
c) Wie würde die Klagsformel aussehen?<br />
12
Addendum für Interessierte<br />
Zur Entwicklung <strong>der</strong> emptio – venditio<br />
nach Cicero’s Überlieferung<br />
A) Cic. off. 3,65<br />
Nam cum ex duodecim tabulis satis esset ea praestari, quae essent lingua nuncupata, quae qui<br />
infitiatus esset dupli poenam subiret, a iuris consultis etiam reticentiae poena est constituta:<br />
Quidquid enim est in praedio vitii, id statuerunt, si venditor sciret, nisi nominatim dictum esset,<br />
praestari oportere.<br />
Übersetzung: Denn während es nach den XII Tafeln genügte, dass das geleistet werde, was<br />
ausdrücklich erklärt worden war, und <strong>der</strong>, <strong>der</strong> ableugnete, die Bestrafung auf den doppelten Wert<br />
erlitt, wurde von den Rechtsgelehrten auch für das Verschweigen (<strong>der</strong> Mängel an einem Gegenstand)<br />
eine Strafe eingeführt. Denn sie hielten fest, dass je<strong>der</strong> Mangel, den das Grundstück hat, wenn <strong>der</strong><br />
Verkäufer ihn kannte, sofern er ihn nicht ausdrücklich genannt hatte, (dem Käufer) ersetzt werden<br />
muss.<br />
B) Cic. off. 3,54<br />
Vendat aedes vir bonus, propter aliqua vitia, quae ipse norit, ceteri ignorent, pestilentes sint et<br />
habeantur salubres, ignoretur in omnibus cubiculis apparere serpentes, male materiatae<br />
et ruinosae, se hoc praeter dominum nemo sciat; quaero, si haec emptoribus venditor non<br />
dixerit aedesque vendi<strong>der</strong>it pluris multo, quam se venditurum putarit, num id iniuste aut<br />
improbe fecerit?<br />
Übersetzung: Ein rechtschaffener Mann verkauft sein Haus wegen irgendwelcher Mängel, die er selbst<br />
kennt, von denen die übrigen aber nichts wissen – es sei übel riechend, gelte aber als <strong>der</strong> Gesundheit<br />
för<strong>der</strong>lich; es sei unbekannt, dass in allen seinen Räumen Schlangen hervorkröchen, dass es aus<br />
schadhaftem Baumaterial und einsturzgefährdet sei -, aber dies wisse, abgesehen vom<br />
Hausherrn/Eigentümer, niemand. Ich frage nun, wenn dies <strong>der</strong> Verkäufer den Käufern nicht gesagt<br />
und das Haus viel teurer verkauft hat, als er es verkaufen zu können glaubte, handelte er darin nicht<br />
unrechtmäßig o<strong>der</strong> unredlich?<br />
C) Cic. off. 3,66-67<br />
Ut, cum in arce augurium augures acturi essent iussissentque T. Claudium Centumalum, qui<br />
aedes in Caelio monte habebat, demoliri ea, quorum altitudo officeret auspiciis, Claudius<br />
proscripsit insulam, emit P. Calpurnius Lanarius: huic ab auguribus illud idem denuntiatum<br />
est. Itaque Calpurnius cum demolitus esset cognossetque Claudium aedes postea proscripsisse,<br />
quam esset ab auguribus demoliri iussus, arbitrum illum adegit, QUIDQUID SIBI DARE FACERE<br />
OPORTERET EX FIDE BONA. M. Cato sententiam dixit, huius nostri Catonis pater. Ut enim ceteri<br />
ex patribus, sic hic, qui illud lumen progenuit, ex filio est nominandus. Is igitur iudex ita<br />
pronuntiavit, cum in vendundo rem eam scisset et non pronuntiasset, emptori damnum praestare<br />
oportere. § 67. Ergo ad fidem bonam statuit pertinere notum esse emptori vitium, quod nosset<br />
venditor. Quod si recte iudicavit, non recte frumentarius ille, non recte aedium pestilentium<br />
venditor tacuit. Sed huiusmodi reticentiae iure civili comprehendi non possunt; quae autem<br />
possunt diligenter tenentur. M. Marius Gratidianus, propinquus noster, C. Sergio Oratae<br />
vendi<strong>der</strong>at aedes eas, quas ab eodem ipse paucis ante annis emerat; eae serviebant, sed hoc in<br />
mancipio Marius non dixerat, adducta res in iudicium est. Oratam Crassus, Gratidianum<br />
defendebat Antonius. Ius Crassus urgebat, „quod vitii venditor non dixisset sciens, id oportere<br />
praestari“, aequitatem Antonius, „quoniam id vitium ignotum Sergio non fuisset, qui illas aedes<br />
vendidisset, nihil fuisse necesse dici nec eum esse deceptum, qui id quod emerat, quo iure esset,<br />
teneret“.<br />
13
Übersetzung: So hat, da die Auguren auf dem Kapitol die Vogelschau abhalten wollten und dem T.<br />
Claudius Centumalus, <strong>der</strong> ein Haus auf dem Mons Caelius besaß, befohlen hatten, die Teile<br />
abzutragen, <strong>der</strong>en Höhe die Vogelschau beeinträchtigte, Claudius das Haus zum Verkauf angeboten;<br />
P. Calpurnius Laenarius kaufte es. Diesem wurde jener Sachverhalt von den Auguren zur Kenntnis<br />
gebracht. Deshalb zog Calpurnius, nachdem er die Abreißarbeit vollendet und erfahren hatte, dass<br />
Claudius das Haus erst angeboten hatte, nachdem ihm von den Auguren das Abtragen befohlen<br />
worden war, jenen vor den (Schieds-)Richter (arbiter) (mit <strong>der</strong> Formel): „Was immer er geben und<br />
leisten müsse nach Treu und Glauben.“ M. Cato verkündete den Urteilsspruch, unseres Zeitgenossen<br />
Vater (werden nämlich die übrigen nach ihren Vätern, so ist dieser, <strong>der</strong> jenes glänzenden Mannes<br />
Vater war, nach seinem Sohne zu benennen). Dieser hat als Richter (iudex) so entschieden, dass, da er<br />
beim Verkauf diesen Sachverhalt gewusst, aber nicht zur Kenntnis gebracht hatte, dem Käufer für den<br />
Schaden Erstz geleistet werden müsse. § 67. Er stellte also fest, dass unter Treu und Glauben fallen<br />
müsse, wenn dem Käufer ein Mangel bekannt sei, den <strong>der</strong> Verkäufer kannte. Wenn er darin richtig<br />
urteilte, war das Schweigen jenes Getreidehändlers nicht richtig, nicht richtig das des Verkäufers eines<br />
‚ungesunden’ Hauses. Aber Fälle <strong>der</strong>artigen Verschweigens können vom Zivilrecht nicht erfasst<br />
werden. In Fällen aber, wo dies möglich ist, wird mit Sorgfalt geahndet. M. Marius Gratidianus, unser<br />
Verwandter, hatte dem C. Sergius Orata das Haus verkauft, das er selbst von demselben wenige Jahre<br />
vorher gekauft hatte. Dieses unterlag Servituten/Belastungen, aber das hatte Marius nicht in dem<br />
Kaufvertrag genannt. Der Fall wurde vor Gericht gebracht. Crassus verteidigte Orata, Antonius<br />
Gratidianus. Crassus pochte auf das formale Recht/den Wortlaut (ius): „Für Mangel, den <strong>der</strong><br />
Verkäufer wissentlich nicht genannt hat, muss Ersatz geleistet werden;“ auf die<br />
Billigkeit/Gerechtigkeit (aequitas) Antonius: „Da ja dieser Mangel dem Sergius nicht unbekannt<br />
gewesen sei, <strong>der</strong> jenes Haus verkauft habe, sei es keineswegs nötig gewesen, ihn zu nennen, und <strong>der</strong><br />
sei nicht getäuscht worden, <strong>der</strong> wusste, welchem Recht (welcher Rechtsbeschränkung) das Kaufobjekt<br />
unterlag.“<br />
Ad Cic. off. 3,66-67: QUIDQUID SIBI DARE FACERE OPORTERET EX FIDE BONA nach dem Urteil des<br />
Richters M. Porcius Cato (2.-1. Jh. v. Chr.), <strong>der</strong> Vater ‚unseres’ (den Cicero kennt) Cato (Uticensis).<br />
D) Cic. off. 3,58-60<br />
C. Canius, eques Romanus, nec infacetus et satis litteratus, cum se Syracusas otiandi, ut ipse<br />
dicere solebat, non negotiandi causa contulisset, dictitabat se hortulos aliquos emere velle, quo<br />
invitare amicos et ubi se oblectare sine interpellatoribus posset. Quod cum percrebuisset,<br />
Pythius ei quidam, qui argentariam faceret Syracusis, venales quidem se hortos non habere, sed<br />
licere uti Canio, si vellet, ut suis, et simul ad cenam hominem in hortos invitavit in posterum<br />
diem. Cum ille promisisset, tum Pythius, qui esset ut argentarius apud omnes ordines gratiosus,<br />
piscatores ad se convocavit et ab iis petivit, ut ante suos hortulos postridie piscarentur, dixitque<br />
quid eos facere vellet. Ad cenam tempori venit Canius; opipare a Pythio adparatum convivium,<br />
cumbarum ante oculos multitudo, pro se quisque, quod ceperat, adferebat, ante pedes Pythii<br />
pisces abiciebantur. § 59. Tum Canius „quaeso“, inquit, „quid est hoc, Pythi? tantumne<br />
piscium? tantumne cumbarum?“ Et ille: „Quid mirum?“ inquit, „hoc loco est Syracusis<br />
quidquid est piscium, hic aquatio, hac villa isti carere non possunt.“ Incensus Canius cupiditate<br />
contendit a Pythio, ut ven<strong>der</strong>et. Gravate ille primo. Quid multa? impetrat. Emit homo cupidus et<br />
locuples tanti, quanti Pythius voluit, et emit instructos. Nomina facit, negotium conficit. Invitat<br />
Canius postridie familiares suos, venit ipse mature, scalmum nullum videt. Quaerit ex proximo<br />
vicino, num feriae quaedam piscatorum essent, quod eos nullos vi<strong>der</strong>et. „Nullae, quod sciam,“<br />
ille, „sed hic piscari nulli solent. Itaque heri mirabar quid accidisset.“ § 60. Stomachari<br />
Canius, sed quid faceret? Nondum enim C. Aquilius, collega et familiaris meus, protulerat de<br />
dolo malo formulas; in quibus ipsis, cum ex eo quaereretur, quid esset dolus malus,<br />
respondebat, cum esset aliud simulatum, aliud actum. Hoc quidem sane luculente, ut ab homine<br />
perito definiendi. Ergo et Pythius et omnes aliud agentes, aliud simulantes perfidi, improbi,<br />
malitiosi. Nullum igitur eorum factum potest utile esse, cum sit tot vitiis inquinatum.<br />
14
Übersetzung: Als C. Canius, ein römischer Ritter, ein Mann nicht ohne Witz und einige Bildung, sich<br />
nach Syrakus begeben hatte – zu einer Erholung, wie er selbst zu sagen pflegte, nicht, um Geschäfte<br />
zu machen –, ließ er immer wie<strong>der</strong> ins Gespräch einfließen, er wolle irgendeinen Park (hortuli)<br />
kaufen, in den er Freunde einladen und wo er sich ohne ungebetene Gäste ergehen könne. Als sich<br />
dies herumgesprochen hatte, sagte ein gewisser Pythius, <strong>der</strong> in Syrakus ein Bankgeschäft betrieb, er<br />
habe zwar keinen Park zu verkaufen, aber Canius dürfe, wenn er wolle, sich in dem seinen wie zu<br />
Hause fühlen, und zugleich lud er ihn zu einem Essen für den folgenden Tag in seinen Park ein. Als<br />
jener zugesagt hatte, rief Pythius, <strong>der</strong> ja als ein Bankbesitzer bei allen Ständen angesehen war, Fischer<br />
zusammen und ersuchte sie, tags darauf vor seinem Park zu fischen. Auch sagte er ihnen, was sie nach<br />
seinem Wunsche tun sollten. Canius kam zur abgemachten Zeit: ein prachtvolles Gastmahl ist von<br />
Pythius zubereitet, vor seinen Augen ein Gewimmel von Booten, ein je<strong>der</strong> brachte an, so gut er<br />
konnte, was er gefangen hatte; vor die Füße des Pythius wurden die Fische geworfen. § 59. Da sagte<br />
Canius: „Ich bitte dich, was soll das bedeuten, Pythius? So viele Fische? So viele Boote?“ Und jener<br />
sagte: „Warum wun<strong>der</strong>st du dich? Von hier bezieht Syrakus alle Fische, hier liegt seine<br />
Wasserversorgung, die können auf dieses Anwesen nicht verzichten.“ Begeistert bittet Canius Pythius,<br />
er möchte ihm verkaufen. Jener gibt sich zunächst spröde. Doch was soll ich viel erzählen? Er setzt<br />
sich durch. Der begüterte Mann kauft in seiner Begeisterung so teuer, wie Pythius wollte, und zwar<br />
mitsamt <strong>der</strong> Einrichtung. Er trägt die Darlehensfor<strong>der</strong>ung (ins Schuldenbuch des<br />
Gläubigers/Kreditgebers) ein (nomina facere), schließt das Rechtsgeschäft ab. Da lädt tags darauf<br />
Canius seine Freunde ein, kommt selbst früh, sieht aber nicht ein Ru<strong>der</strong>. Er fragt den nächsten<br />
Nachbarn, ob die Fischer einen Feiertag hätten, weil er keinen von ihnen sähe. „Nein, soviel ich<br />
weiß“, antwortet jener, „aber hier pflegt niemand zu fischen. § 60. Deshalb wun<strong>der</strong>te ich mich gestern,<br />
was geschehen sei.“ Da kam dem Canius <strong>der</strong> Magen hoch (stomachari). Aber was hätte er tun sollen?<br />
Es hatte ja noch nicht C. Aquilius, mein Kollege und Freund, die Prozessformeln bezüglich arglistiger<br />
Täuschung (im Edikt) kundgetan. Als man ihn fragte, was in ebendiesen unter arglistige Täuschung<br />
falle, antwortet er: „Wenn das eine vorgetäuscht, das an<strong>der</strong>e getan wird“ (aliud simulatum, aliud<br />
actum). Das freilich ist ziemlich einleuchtend gesagt, eben von einem Meister <strong>der</strong> Definition. Also<br />
sind Pythius und alle, die eines tun, an<strong>der</strong>es vortäuschen, treulos, unredlich und arglistig; keine ihrer<br />
Handlungen kann also nützlich sein, da sie mit so vielen Fehlern befleckt ist.<br />
Ad Cic. off. 3,58-60: Der Canius-Pythius-Fall spielt vor Einführung <strong>der</strong> formula de dolo malo durch<br />
den Juristen C. Aquilius Gallus, einen Freund Ciceros. 66 v. Chr. sind sie collegae als Prätoren. In<br />
jener Zeit besitzt Aquilius Gallus (laut Plinius) das schönste Haus auf dem Viminal.<br />
15
Mandatum<br />
Über amicitia, fides, officium, mandatum<br />
Sind die Bürger einan<strong>der</strong> freund,<br />
so bedarf es keines Rechtsschutzes.<br />
Aristot. NE 8,1 (1155a 26-27)<br />
28) Paul. 32 ed. D. 17,1,1,4<br />
Mandatum nisi gratuitum nullum est: nam originem ex officio atque amicitia trahit, contrarium vero<br />
est officio merces: interveniente enim pecunia res ad locationem et conductionem potius respicit.<br />
Übersetzung: Ein Auftrag, <strong>der</strong> nicht unentgeltlich ist, ist nichtig; denn <strong>der</strong> Auftrag hat seinen Ursprung<br />
in Pflichtgefühl und Freundschaft; mit Freundschaftspflicht aber ist Lohn unvereinbar. Kommt<br />
nämlich Geld ins Spiel, so stellt die Angelegenheit/das Rechtsverhältnis eher eine locatio-conductio<br />
dar.<br />
29) Gai. 3,162<br />
In summa sciendum aliquid gratis de<strong>der</strong>im, quo nomine, si mercedem<br />
statuissem, locatio et conductio contraheretur, mandati esse actionem, veluti si fulloni polienda<br />
curandave vestimenta aut sarcinatori sarcienda.<br />
Übersetzung: Schließlich muss man wissen, dass eine Klage wegen Auftrags anwendbar ist, wenn ich<br />
irgend etwas umsonst zu tun vergeben habe, was, falls ich deswegen einen Lohn festgesetzt habe, den<br />
Abschluss eines Werkvertrages bedeutet hätte, zum Beispiel, wenn ich Kleidungsstücke einem<br />
Klei<strong>der</strong>reiniger/Walker zum Stärken o<strong>der</strong> Reinigen übergeben habe o<strong>der</strong> einem Schnei<strong>der</strong> zum<br />
Ausbessern.<br />
30) I. 3,27,13<br />
In summa sciendum est mandatum, nisi gratuitum sit, in aliam formam negotii ca<strong>der</strong>e: nam mercede<br />
constituta incipit locatio et conductio esse et ut generaliter dixerimus: quibus casibus sine mercede<br />
suscepto officio mandati aut depositi contrahitur negotium, his casibus interveniente mercede locatio<br />
et conductio contrahi intellegitur. et ideo si fulloni polienda curandave vestimenta de<strong>der</strong>is aut<br />
sarcinatori sarcienda nulla mercede constituta neque promissa, mandati competit actio.<br />
Übersetzung: Schließlich muss man wissen, dass ein Auftrag, wenn er nicht unentgeltlich ist, unter<br />
einen an<strong>der</strong>en Typus eines Rechtsgeschäfts fällt. Denn durch die Vereinbarung eines Entgelts wird <strong>der</strong><br />
Vertrag ein Dienst- o<strong>der</strong> Werkvertrag. Um es allgemein zu sagen: In allen Fällen, in denen durch die<br />
unentgeltliche Übernahme einer Pflicht ein Auftrags- o<strong>der</strong> Verwahrungsvertrag begründet wird, sieht<br />
man, wenn ein Entgelt vereinbart wird, einen Dienst- o<strong>der</strong> Werkvertrag zustande gekommen. Und<br />
deswegen wird eine Auftragsklage gewährt, wenn du Kleidung ohne Vereinbarung o<strong>der</strong> Versprechen<br />
eines Entgelts einem Klei<strong>der</strong>reiniger zum Stärken o<strong>der</strong> Reinigen o<strong>der</strong> einem Schnei<strong>der</strong> um Ausbessern<br />
gegeben hast.<br />
16
Frankreich: Code civil (1804)<br />
Mandat – Bevollmächtigung<br />
Im Rechtsvergleich<br />
Art 1984 cc fr: Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le<br />
pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par<br />
l’acceptation du mandataire.<br />
Österreich: ABGB (1811)<br />
§ 1002 ABGB: Der Vertrag, wodurch jemand ein ihm aufgetragenes Geschäft im Namen des an<strong>der</strong>en<br />
zur Besorgung übernimmt, heißt Bevollmächtigungsvertrag.<br />
Deutschland: BGB (1896, 1900)<br />
§ 662 BGB: Vertragstypische Pflichten beim Auftrag (Auftrag, unentgeltlich)<br />
Durch die Annahme eines Auftrags verpflichtet sich <strong>der</strong> Beauftragte, ein ihm von dem Auftraggeber<br />
übertragenes Geschäft für diesen unentgeltlich zu besorgen.<br />
§ 675 BGB: Entgeltliche Geschäftsbesorgung (Dienst- o<strong>der</strong> Werkvertrag, entgeltlicher ‚Auftrag’)<br />
(1) Auf einen Dienstvertrag o<strong>der</strong> einen Werkvertrag, <strong>der</strong> eine Geschäftsbesorgung zum Gegenstand<br />
hat, finden, soweit in diesem Untertitel nichts Abweichendes bestimmt wird, die Vorschriften <strong>der</strong> §§<br />
663, 665 bis 670, 672 bis 674 und, wenn dem Verpflichteten das Recht zusteht, ohne Einhaltung einer<br />
Kündigungsfrist zu kündigen, auch die Vorschrift des § 671 Abs 2 entsprechende Anwendung.<br />
Schweiz: OR (1911: Artt 1-551, 1936: Artt 552-880)<br />
OR 394 I: Durch die Annahme eines Auftrages verpflichtet sich <strong>der</strong> Beauftragte, die ihm übertragenen<br />
Geschäfte o<strong>der</strong> Dienste vertragsgemäß zu besorgen.<br />
II: Verträge über Arbeitsleistung, die keiner beson<strong>der</strong>en Vertragsart dieses Gesetzes unterstellt sind,<br />
stehen unter den Vorschriften über den Auftrag.<br />
Italien: Codice civile 1942 (1989)<br />
Art 1703 cc it: Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere una o più atti<br />
giuridici per conto dell’altra.<br />
17
Abgrenzungen<br />
in Rechtssystemen mit römischrechtlicher Basis<br />
Gefälligkeit: Kein Rechtsbindungswille des/r Beauftragten; dort, wo BeauftragteR das rechtlich<br />
geschützte, insbeson<strong>der</strong>e wirtschaftliche Interesse für BittstellerIn nicht erkennen<br />
kann<br />
Rat/Auskunft: Für unentgeltliche und nicht gewerbsmäßige Erteilung einer Auskunft besteht keine<br />
vertragliche Haftung, sofern nicht erkennbare, beson<strong>der</strong>e Bedeutung für<br />
AnfragendeN vorliegt<br />
Ermächtigung: Einseitige Willenserklärung, Befugnis, im Innenverhältnis (inter partes) auf fremde<br />
Rechnung handeln zu dürfen<br />
Auftrag: Vertrag, Pflicht, im Innenverhältnis (inter partes) auf fremde Rechnung handeln zu<br />
sollen, Tätigkeit (Wirken) ist geschuldet<br />
Vollmacht: Einseitige Willenserklärung, die (gegen Dritte) ermächtigt, im Außenverhältnis in<br />
fremdem Interesse handeln zu können, durch Rechtsgeschäft erteilte<br />
Vertretungsmacht, begründet ein Recht (Können), abstrakt (unabhängig vom<br />
Rechtsgrund)<br />
Vollmacht ohne Auftrag: zB Generalvollmacht für Anwalt/Anwältin ohne beson<strong>der</strong>en Auftrag<br />
Auftrag ohne Vollmacht: sog. indirekte Stellvertretung<br />
Arbeitsvertrag: Subordinationsverhältnis, Einordnung in fremde Betriebsorganisation, auf<br />
bestimmte o<strong>der</strong> unbestimmte Zeit zur Leistung von Arbeit, ArbeitnehmerIn mehr<br />
o<strong>der</strong> weniger unselbständig tätig und sozial abhängig<br />
Werkvertrag: Bestimmter Erfolg, Leistungsinhalt (Werk) ist geschuldet. Ähnliche Unterteilung<br />
<strong>der</strong> Dienstleistungsverträge (contrats de service) in Westschweiz nach contrats de<br />
résultats und contrats de moyens<br />
Gesellschaft: Gemeinsamer Zweck und Interessen, Verfügungen durch Beschlüsse<br />
Arbeitsvertrag sui generis: Entspricht keinem gesetzlichen Typus, zB Dienstleistung, die<br />
unkörperliches Ergebnis beinhaltet, o<strong>der</strong> Dauervertrag, <strong>der</strong> we<strong>der</strong> Auftrag noch<br />
Werkvertrag ist (SchauspielerIn, Musik-Ensemble, Wartungs- o<strong>der</strong><br />
Tankstellenvertrag, etc)<br />
Gemischte o<strong>der</strong> zusammengesetzte Verträge: Absorptionstheorie – wo Elemente eines Vertragstypus –<br />
zB Auftrag – überwiegen, kommt dessen Reglement zur Anwendung<br />
18
Geschlecht und Recht<br />
Drei Dinge sind es, die mich dem Schicksal zu Dank verpflichten:<br />
erstens, dass ich als Mensch zur Welt kam und nicht als Tier;<br />
zweitens, dass ich ein Mann ward und nicht ein Weib;<br />
drittens, dass ich ein Hellene bin und nicht ein Barbar.<br />
(Thales von Milet; Diog. Laert. 1,33)<br />
31) Aristot. pol. 1,13, 1259b, 21-40–1260b, 1-20: Auf eine je an<strong>der</strong>e Weise nämlich herrscht das Freie<br />
über das Dienende, das Männliche über das Weibliche und <strong>der</strong> Mann über das Kind. Und in ihnen<br />
allen sind zwar die Seelenteile vorhanden, aber sie sind es unterschiedlich. Der Sklave verfügt nämlich<br />
überhaupt nicht über das klug Beratschlagende, das Weibliche verfügt zwar darüber, doch ohne<br />
Entscheidungsgewalt/Autorität/Effektivität (es ist unwirksam), das Kind verfügt zwar ebenfalls<br />
darüber, doch über ein noch nicht Fertiges.<br />
32) Gai. 1,190<br />
Feminas vero perfectae aetatis in tutela esse fere nulla pretiosa ratio suasisse videtur; nam quae<br />
vulgo creditur, quia levitate animi plerumque decipiuntur et aequum erat eas tutorum auctoritate regi,<br />
magis speciosa videtur quam vera; mulieres enim quae perfectae aetatis sunt, ipsae sibi negotia<br />
tractant et in quibusdam causis dicis gratia tutor interponit auctoritatem suam, saepe etiam invitus<br />
auctor fieri a praetore cogitur.<br />
Übersetzung: Dass aber geschlechtsreife Frauen unter Vormundschaft stehen sollen, scheint durch<br />
kein stichhaltiges Argument zu überzeugen, denn <strong>der</strong> Grund, <strong>der</strong> im allgemeinen dafür angeführt wird,<br />
dass sie aufgrund <strong>der</strong> Leichtfertigkeit ihres Gemütes meistens zu ihrem Nachteil getäuscht würden und<br />
es daher billig wäre, dass sie von <strong>der</strong> auctoritas von Vormün<strong>der</strong>n geleitet würden, scheint mehr ein<br />
Vorwand als ein echter Grund zu sein. In <strong>der</strong> Tat erledigen Frauen, die das geschlechtsreife Alter<br />
erreicht haben, ihre Angelegenheiten selbst, während <strong>der</strong> Vormund nur in bestimmten Fällen seine<br />
förmliche Zustimmung zu erteilen hat; oft wird <strong>der</strong> wi<strong>der</strong>strebende Tutor sogar vom Prätor<br />
gezwungen, seine auctoritas zu geben.<br />
33) a) TU 11,27<br />
Tutoris auctoritas necessaria est mulieribus quidem in his rebus: si lege aut legitimo iudicio agant, si<br />
se obligent, si civile negotium gerant, si libertae suae permittant in contubernio alieni servi morari, si<br />
rem mancipii alienent.<br />
Übersetzung: Die Zustimmung eines Vormunds benötigen Frauen zumindest in folgenden<br />
Angelegenheiten: Wenn sie im Legisaktionenverfahren o<strong>der</strong> im iudicium legitimum prozessieren,<br />
wenn sie ein Schuldverhältnis eingehen, wenn sie ein (förmliches) Rechtsgeschäft des ius civile<br />
abschließen, wenn sie ihrer Freigelassenen erlauben, in einem contubernium mit einem fremden<br />
Sklaven zu leben, wenn sie res mancipi veräußern.<br />
b) Gai. 2,80; 85<br />
Nunc admonendi sumus neque feminam neque pupillum sine tutore auctore rem mancipi alienare<br />
posse; nec mancipi vero feminam quidem posse, pupillum non posse. […] § 85. Mulieri vero etiam<br />
sine tutore auctore recte solvi potest; nam qui solvit, liberatur obligatione, quia res nec mancipi, ut<br />
proxume diximus, a se dimittere mulieres etiam sine tutore auctore possunt. Quamquam hoc ita est, si<br />
accipiat pecuniam; at si non accipiat et habere se dicat et per acceptilationem velit debitorem sine<br />
tutore auctore liberare, non potest.<br />
Übersetzung: Jetzt muss man bedenken, dass we<strong>der</strong> eine Frau noch ein unmündiges Kind/Mündel<br />
ohne Zustimmung des Vormunds eine res mancipi veräußern kann, dass aber eine Frau eine res nec<br />
19
mancipi veräußern kann, nicht aber das Mündel. [...] § 85. Einer Frau aber kann auch ohne<br />
Zustimmung des Vormunds wirksam zur Erfüllung einer Schuld geleistet werden; denn wer erfüllt,<br />
wird von seiner Schuld befreit, weil Frauen, wie gerade eben gesagt, res nec mancipi auch ohne<br />
Zustimmung des Vormunds aufgeben können. Freilich ist das nur <strong>der</strong> Fall, wenn sie das Geld in<br />
Empfang nimmt; wenn sie es aber nicht in Empfang nimmt, son<strong>der</strong>n nur sagt, sie habe es, und den<br />
Schuldner durch Empfangsanerkenntnis ohne Zustimmung des Vormunds befreien will, kann sie es<br />
nicht.<br />
34) Marcian. 3 reg. D. 12,6,40 pr.<br />
Qui exceptionem perpetuam habet, solutum per errorem repetere potest: sed hoc non est perpetuum.<br />
nam si quidem eius causa exceptio datur cum quo agitur, solutum repetere potest, ut accidit in senatus<br />
consulto de intercessionibus: ubi vero in odium eius cui debetur exceptio datur, perperam solutum non<br />
repetitur, veluti si filius familias contra Macedonianum mutuam pecuniam acceperit et pater familias<br />
factus solverit, non repetit.<br />
Übersetzung: Wer eine immerwährende Einrede hat, kann das irrtümlich Bezahlte zurückfor<strong>der</strong>n.<br />
Aber das ist nicht immer <strong>der</strong> Fall. Denn wenn nämlich die Einrede dem gewährt wird, <strong>der</strong> geklagt<br />
wird, so kann er zwar das Geleistete zurückfor<strong>der</strong>n, wie es aufgrund des Senatsbeschlusses über die<br />
Interzessionen geschieht; wenn aber die Einrede zur Bestrafung dessen, dem etwas geschuldet wird,<br />
gewährt wird, so kann das fälschlich Gezahlte nicht zurückgefor<strong>der</strong>t werden, wie wenn zB <strong>der</strong><br />
Hausohn entgegen dem SC Macedonianum Geld als Darlehen erhalten hat und nachdem er pater<br />
familias geworden war, es zurückgezahlt hat, so kann er es nicht zurückfor<strong>der</strong>n.<br />
35) Scaev. 6 resp. D. 46,1,63<br />
Inter creditricem et debitorem pactum intercesserat, ut, si centum, quae mutua de<strong>der</strong>it, ubi primum<br />
petita fuissent, non solverentur, ornamenta pignori data intra certum tempus liceret ei ven<strong>der</strong>e et si<br />
quo minoris venissent, quodque sortis vel usurarum nomine deberetur, id creditrici red<strong>der</strong>etur, et<br />
fideiussor acceptus est: quaesitum est, an fideiussor in universam summam obligari potuerit. respondit<br />
secundum ea quae proponerentur teneri fideiussorem in id, quod minus ex pignoribus venditis<br />
redactum esset.<br />
Übersetzung: Zwischen einer Gläubigerin und einem Schuldner wurde die Vereinbarung getroffen,<br />
dass, sobald die hun<strong>der</strong>t, die als Darlehen gegeben worden waren, zum ersten Mal gefor<strong>der</strong>t und nicht<br />
zurückbezahlt würden, die dafür verpfändeten Schmuckstücke innerhalb einer bestimmten Zeit<br />
verkauft werden dürften, und wenn <strong>der</strong> Verkaufserlös zu gering wäre, dass dennoch all das, was an<br />
Kapital und Zinsen noch geschuldet werde, <strong>der</strong> Gläubigerin geleistet werden solle. Dafür wurde ein<br />
Bürge aufgenommen. Es wurde die Rechtsfrage gestellt, ob <strong>der</strong> Bürge für die gesamte Schuld hafte. Er<br />
antwortete: Nach dem vorgetragenen Sachverhalt haftet <strong>der</strong> Bürge nur in <strong>der</strong> Höhe jenes Betrages, <strong>der</strong><br />
durch den Min<strong>der</strong>erlös des Pfandes noch offen ist.<br />
Fragen:<br />
a) Sachverhalt? Rechtsfragen?<br />
b) Was ist bei Rechtsgeschäften zu beachten, in die Frauen involviert sind?<br />
c) Ist dies ein Fall, <strong>der</strong> unter die Bestimmung des SC Velleianum fällt?<br />
d) Was bedeutet <strong>der</strong> Min<strong>der</strong>erlös aus dem Pfandverkauf für das Bestehen <strong>der</strong> Schuld?<br />
e) Welches Problem entsteht bezüglich des Bürgen?<br />
SCVell-Relikt im römisch-gemeinen Recht (ausdrückliche Ablehnung):<br />
§ 1349 ABGB: Fremde Verbindlichkeiten kann ohne Unterschied des Geschlechtes je<strong>der</strong>mann auf<br />
sich nehmen, dem die freie Verwaltung seines Vermögens zusteht.<br />
20
36) C. 4,28,3<br />
Impp. Severus et Antoninus Macrino. Si filius familias aliquid mercatus pretium stipulanti venditori<br />
cum usurarum accessione spondeat, non esse locum senatus consulto, quo fenerare filiis familias<br />
prohibitum est, nemini dubium est: origo enim potius obligationis quam titulus actionis consi<strong>der</strong>andus<br />
est. [a. 198]<br />
Übersetzung: Die Kaiser (Septimius) Severus und Antoninus (Caracalla) an Macrinus. Wenn ein<br />
Haussohn, <strong>der</strong> etwas gekauft hat, dem Verkäufer, <strong>der</strong> sich den Preis samt Zinsen versprechen lässt, mit<br />
dem Wort spondeo zusagt, so zweifelt niemand daran, dass <strong>der</strong> (Macedonianische) Senatsbeschluss,<br />
demzufolge es verboten ist, Haussöhnen ‚Geld gegen Zinsen zu verleihen’, hier nicht zur Anwendung<br />
kommt: Es ist nämlich vielmehr <strong>der</strong> Ursprung des Schuldverhältnisses in Betracht zu ziehen als die<br />
Bezeichnung <strong>der</strong> Klage. [198 n. Chr.]<br />
Fragen:<br />
a) Wo ist dieses Gesetz überliefert?<br />
b) ‚Fenerare’ heißt ‚Geld gegen Zinsen verleihen’. Entspricht das dem typischen mutuum?<br />
c) Sachverhalt? Rechtsfragen? Lösungsvorschlag?<br />
d) Betrifft das SC Macedonianum auch Haustöchter?<br />
e) Werden weibliche und männliche Gewaltunterworfene unterschiedlich behandelt?<br />
21