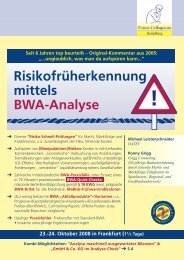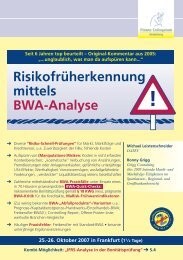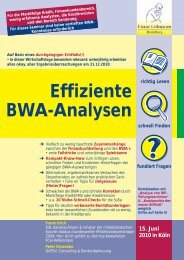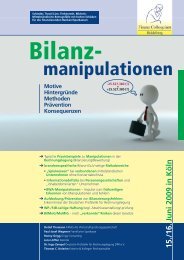Banken-Times - Grigg Consulting
Banken-Times - Grigg Consulting
Banken-Times - Grigg Consulting
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Fachbeirat<br />
Bales, Klaus<br />
Bereichsleiter Problemkreditmanagement<br />
Vertreter des Vorstandes,<br />
Sparkasse Rhein-Nahe<br />
Becker, Axel<br />
Revisionsleiter, Taunus-Sparkasse<br />
Blümler, Peter<br />
Rechtsanwalt, euprax Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,<br />
München<br />
Carl, Ekkehart<br />
Staatsanwalt, Schwerpunktstaatsanwaltschaft<br />
Wirtschaftskriminalität, Bochum<br />
Dehnke, Frank<br />
Leiter Unternehmenssteuerung,<br />
Stadtsparkasse Remscheid<br />
Engel, Dr. Markus<br />
Justitiar, Sparkasse Saarbrücken<br />
Fröhlich, Joachim<br />
CEFA, Leiter Treasury,<br />
Volksbank Wetzlar-Weilburg eG<br />
<strong>Grigg</strong>, Ronny<br />
<strong>Consulting</strong>, Financial Analyst<br />
Hahne, Klaus D.<br />
stellv. Leiter Steuerabteilung, HSH Nordbank<br />
Helfer, Michael<br />
Bereichsleiter Revision, Berliner Volksbank<br />
Lang, Dr. Volker<br />
Rechtsanwalt und Partner, Balzer Kühne<br />
Lang Rechtsanwälte, Bonn<br />
Pegelow, Thorsten<br />
Leiter Kostenmanagement, Hamburger<br />
Sparkasse<br />
Reuse, Svend<br />
Leiter Controlling / Gesamtbanksteuerung,<br />
Sparkasse Mülheim / Ruhr<br />
Schuppener, Jörg<br />
TMC Turnaround Management Consult<br />
GmbH, Dortmund<br />
Staffa, Rainer<br />
Vorstandsmitglied, Volksbank Mittelhessen eG<br />
Strehl, André<br />
Vertriebsdirektor, Volksbank Rhein-Ruhr,<br />
Duisburg<br />
Struwe, Hans<br />
Partner Bereich <strong>Banken</strong>, PWC, Frankfurt<br />
Timmer, Klaus<br />
Personalleiter Großregion NRW,<br />
Deutsche Bank, Düsseldorf<br />
Veith, Michael<br />
Leiter Recht / Abwicklung,<br />
Stadtsparkasse Remscheid<br />
Wagner, Dr. Klaus-R.<br />
RA und Notar, FA StR, Wiesbaden<br />
Weis, Ditmar<br />
Sanierungs- und Insolvenzberater<br />
Wimmer, Prof. Dr. Konrad<br />
Leiter Business Center Finance,<br />
msg systems, München<br />
Ausgabe Oktober 2007<br />
<strong>Banken</strong>-<strong>Times</strong> 2007 S. 33<br />
<strong>Banken</strong>-<strong>Times</strong><br />
Fachinformation für die Kreditwirtschaft<br />
Notfallmanagement/Business Continuity Management<br />
Jörg Bretz, Prüfungsleiter, Bereich<br />
<strong>Banken</strong>aufsicht, Deutsche Bundesbank,<br />
Hauptverwaltung Frankfurt<br />
Die Notwendigkeit eines Notfallmanagements<br />
ergibt sich bankaufsichtlich aus der<br />
Verpflichtung des § 25a KWG nach einem<br />
angemessenen Risikomanagement und<br />
wird in Abschnitt AT 7.3 der MaRisk in groben<br />
Zügen dargestellt. Darüber hinaus rechnet<br />
sich das Notfallmanagement betriebswirtschaftlich,<br />
wenn der Geschäftsbetrieb<br />
trotz eines Ausfallereignisses nahezu reibungslos<br />
weiterlaufen kann.<br />
Bevor die Planung beginnen kann, müssen<br />
in einem ersten Schritt die kritischen<br />
Geschäftsaktivitäten und -prozesse herausgearbeitet<br />
werden. Nur für diese rechnet<br />
sich der Aufwand des Notfallmanage-<br />
Mit freundlicher und<br />
fachlicher Unterstützung von:<br />
ments, während weniger wichtige Aktivitäten<br />
bis nach dem Ende der Krise warten<br />
können. Anhand standardisierter Szenarien<br />
wie z. B. Brand, Überfall oder Systemausfall<br />
werden deren Auswirkungen auf die<br />
kritischen Geschäftsprozesse analysiert.<br />
Ergebnis der Szenarioanalysen sind z. B.<br />
Übersichten, die der Dauer eines Ausfalls<br />
die entstehenden Kosten bzw. entgangenen<br />
Gewinne gegenüber stellen. Auf Basis dieser<br />
Analysen kann die Geschäftsleitung<br />
qualifiziert entscheiden, welche Aktivitäten<br />
in Notfallsituationen auf welchem<br />
Niveau betrieben werden sollen. Beispielsweise<br />
könnte sich bei Ausfall eines Handelsabwicklungssystems<br />
der Eigenhandel<br />
auf das Absichern der Position beschränken.<br />
Bei Ausfall der Kontoführungsanwendung<br />
könnten Barauszahlungen manuell<br />
anhand von Listen disponiert werden. Ein<br />
ISU<br />
www.ISU-Institut.com<br />
www.abit.net<br />
vertrieb@abit.de<br />
Institut für die Standardisierung<br />
von Unternehmenssanierungen
<strong>Banken</strong>-<strong>Times</strong> 2007, S. 34<br />
Ausfall der Anbindung an das Rechenzentrum<br />
wäre nicht so einfach zu kompensieren<br />
und müsste dem entsprechend anders<br />
berücksichtigt werden.<br />
Ausgehend von der Notfallstrategie der<br />
Geschäftsleitung werden durch die Fachbereiche<br />
die konkreten Maßnahmen ergriffen,<br />
die für jeden kritischen Geschäftprozess<br />
das spezifizierte Niveau in Ausfallsituationen<br />
sicherstellen. Ganz wichtig ist in<br />
diesem Zusammenhang die fachlich präzise<br />
Definition der maximal tolerablen Ausfallzeit<br />
von Anwendungen. Während der Fachbereich<br />
sicherstellen muss, dass er diese<br />
maximale Ausfallzeit durch Ausfallverfahren<br />
kompensiert, ist die IT in der Verantwortung,<br />
innerhalb dieser Zeit die Anwendung<br />
wieder herzustellen. Besondere Aufmerksamkeit<br />
ist der Behandlung kritischer Infrastrukturkomponenten<br />
zu widmen, die meist<br />
redundant betrieben werden, um einen Ausfall<br />
möglichst unwahrscheinlich zu machen.<br />
Über die technischen und organisatorischen<br />
Maßnahmen hinaus ist eine entscheidungsfähige<br />
Krisenorganisation zu etablieren,<br />
deren erste Funktion es sein wird, die aktuelle<br />
Situation hinsichtlich ihres Einflusses<br />
auf das Gesamtinstitut zu analysieren.<br />
Kommt sie zu der Entscheidung, dass der<br />
Normalbetrieb nicht aufrechterhalten werden<br />
kann, wird sie den Krisenfall ausrufen<br />
und dies den Entscheidungsträgern kommunizieren.<br />
Mitglieder im Krisenstab sind<br />
üblicherweise die Geschäftsleitung und<br />
Verantwortliche für kritische Geschäftsaktivitäten<br />
und Ressourcen.<br />
Um arbeiten zu können benötigt der Krisenstab<br />
Ausweichräumlichkeiten sowie geeignete<br />
Kommunikationswege. Hierbei ist<br />
zu berücksichtigen, dass eine Krise auch<br />
außerhalb der üblichen Geschäftszeiten<br />
auftreten kann. Meist werden kaskadierende<br />
Benachrichtigungswege festgelegt<br />
(Benachrichtigungswege nach dem Dienstweg<br />
z.B. vom Abteilungsleiter über den<br />
Gruppenleiter zum Mitarbeiter). Hierbei sind<br />
Vertretungsregelungen einzubeziehen.<br />
Nach Ende der Krise wird der Krisenstab<br />
die Aktivierung der Wiederanlaufpläne veranlassen<br />
und sich nach der Rückkehr zum<br />
Normalbetrieb auflösen. Nun greifen wieder<br />
die üblichen Entscheidungs- und Kommunikationsstrukturen.<br />
Im Rahmen der Notfallplanung ist für jede<br />
kritische Geschäftaktivität und jede kritische<br />
Ressource schriftlich festzulegen, wie zu<br />
welchem Zeitpunkt der Krise zu handeln<br />
ist. Wesentlich ist, dass das Krisenpersonal<br />
anhand der Geschäftsfortführungspläne<br />
die kritischen Geschäftsprozesse bzw.<br />
Ressourcen auf dem von der Geschäftslei-<br />
tung gewünschten Niveau weiter betreiben<br />
kann. Der Detaillierungsgrad der Konzepte<br />
wird je nach Notfallstrategie und Komplexität<br />
der Organisation unterschiedlich sein.<br />
Beispielsweise werden eingearbeitete Vertreter<br />
weniger detaillierte schriftliche Anleitungen<br />
benötigen als Mitarbeiter anderer<br />
Organisationseinheiten oder gar in der Krise<br />
von Zeitarbeitsfirmen angemietetes Personal.<br />
Wenn der Krisenstab die Rückkehr zum<br />
Normalbetrieb anordnet, sind die Wiederanlaufpläne<br />
auszuführen, für die grundsätzlich<br />
dasselbe wie für die Geschäftsfortführungspläne<br />
gilt. Der erfolgreiche Wiederanlauf ist<br />
an den Krisenstab zu kommunizieren.<br />
Um die Geschäftsfortführungs- und Wiederanlaufpläne<br />
ausführen zu können, muss<br />
jeder Mitarbeiter die für ihn relevanten Passagen<br />
des Notfallkonzepts sowie die Krisenkommunikationswege<br />
verfügbar haben.<br />
Bei elektronischen Dokumenten ist hierauf<br />
besonderes Augenmerk zu lenken.<br />
Zur Qualitätssicherung der Notfallkonzepte<br />
haben sich am Markt mindestens jährliche<br />
Notfalltests etabliert. Obwohl diese vordergründig<br />
Kosten verursachen, sind angemessene<br />
Tests der einzige Weg herauszufinden,<br />
ob die bereits vorgenommenen<br />
Investitionen in Notfallkonzepten Früchte<br />
tragen werden.<br />
Die telefonische Überprüfung der Kommunikationsverbindungen<br />
ist der preiswerteste<br />
Test, der angesichts der raschen Veränderung<br />
von Telefonnummern üblicherweise<br />
halbjährlich durchgeführt wird. Hinsichtlich<br />
der Geschäftsaktivitäten und Ressourcen<br />
sollten im ersten Schritt analysiert werden,<br />
ob sich Geschäftsstrategie und Risikosituation<br />
geändert haben und ob die Notfallstrategie<br />
noch angemessen ist. Danach ist zu<br />
analysieren, ob die Notfallmaßnahmen noch<br />
zielführend sind. Wenn dieser so genannte<br />
„Schreibtischtest“ erfolgreich durchlaufen<br />
wurde, sollte im nächsten Schritt Notfälle<br />
für einzelne Geschäftsprozesse getestet<br />
SEMINARTIPP<br />
4. Juni 2008 in Frankfurt/M.:<br />
Interne und externe Bedrohungen der<br />
IT-Sicherheit in <strong>Banken</strong><br />
Beispiel zur Immobilienbewertung bei Anwendung der BelWertV<br />
Ronny <strong>Grigg</strong>,<br />
<strong>Grigg</strong> <strong>Consulting</strong> | Financial Analyst<br />
Die Beleihungswertverordnung ist seit<br />
dem 01.08.2006 verbindlich für Pfandbriefinstitute<br />
(§16 BelWertV Abs. 4) vorgeschrie-<br />
BUCHTIPP<br />
IT-Sicherheitsmanagement in<br />
<strong>Banken</strong> und Sparkassen, 2007,<br />
ca. 320 Seiten<br />
ben. Für alle anderen Kreditinstitute gelten<br />
nach h. M. die bisherigen Verwaltungsvorschriften<br />
und die Schreiben der <strong>Banken</strong>aufsicht<br />
zum Realkreditausweis (vgl. <strong>Banken</strong>-<br />
<strong>Times</strong> 2007 S. 27, Sönksen/Klemmer). Die<br />
kontroverse Diskussion der Kreditwirtschaft,<br />
insbesondere zu den Anforderungen an<br />
werden. Hierbei sind planmäßig möglichst<br />
realitätsnahe Krisensituationen durchzutesten,<br />
um die Wirksamkeit der Notfallmaßnahmen<br />
gegen diese Szenarien zu validieren.<br />
Wenn die einzelnen Geschäftsprozesse in<br />
Krisensituationen sicher reagieren, kann im<br />
nächsten Schritt der Gesamtnotfall getestet<br />
werden. Erst mit dem Gesamtnotfalltest ist<br />
es möglich, sämtliche Abhängigkeiten von<br />
Geschäftsaktivitäten und Ressourcen in<br />
Krisensituationen zu überprüfen.<br />
Sämtliche Tests sind in geeigneter Weise<br />
zu protokollieren, um insbesondere aus<br />
den fehlgeschlagenen Aktivitäten Rückschlüsse<br />
auf den Aktualisierungsbedarf der<br />
Pläne zu schließen.<br />
Damit die Notfallaktivitäten strukturiert<br />
durchgeführt werden können, ist die Benennung<br />
eins Notfallkoordinators hilfreich und<br />
üblich. Dieser hat die Aufgabe, die zentralen<br />
Rahmenbedingungen der Geschäftsleitung<br />
für die Durchführung der Notfallkonzeption<br />
regelmäßig zu überprüfen, die Dokumentation<br />
von Geschäftsfortführungs- und<br />
Wiederanlaufplänen einzufordern, an die<br />
Durchführung der Notfalltests zu erinnern,<br />
die Testaktivitäten zu koordinieren und zu<br />
unterstützen und an die Geschäftleitung zu<br />
berichten.<br />
PRAXISTIPPS<br />
• Wurden die kritischen Geschäftsaktivitäten<br />
und -prozesse identifiziert<br />
und anhand standardisierter Szenarien<br />
wie z. B. Brand, Überfall, Systemausfall<br />
analysiert?<br />
• Hat die Geschäftsleitung als Basis<br />
sämtlicher Notfallpläne die globale<br />
Notfallstrategie festgelegt?<br />
• Ist der Krisenstab definiert und mit<br />
zugehöriger Kriseninfrastruktur (Räume,<br />
Technik, Kommunikationswege)<br />
ausgestattet?<br />
• Wurden für sämtliche kritische Geschäftsaktivitäten<br />
und kritische Ressourcen<br />
Notfallpläne erstellt und<br />
kommuniziert?<br />
• Werden zur Qualitätssicherung der<br />
Notfallkonzepte mindestens jährlich<br />
Notfalltests durchgeführt und dokumentiert?<br />
• Werden die Ergebnisse der Notfalltests<br />
zur Verbesserung der Notfallplanung<br />
genutzt?<br />
• Wird das Notfallmanagement zentral<br />
koordiniert?<br />
den Gutachter, haben die Erleichterungen<br />
bei den Kleindarlehen bis 400.000,00 Euro<br />
(§ 24 BelWertV) und die Vorteile der Anwendung<br />
einer aufsichtlich favorisierten und<br />
damit bundeseinheitlichen Methodik bei<br />
der Beleihungswertermittlung in den Hintergrund<br />
treten lassen. Die Methoden zum
<strong>Banken</strong>-<strong>Times</strong> 2007, S. 35<br />
Ertrags-, Sach- und Vergleichswertverfahren<br />
sind nicht neu. Jedoch werden erstmalig<br />
dezidiert Bandbreiten und Erfahrungssätze,<br />
sowie die Berechnungsnormen<br />
vorgegeben. Am Beispiel eines Mehrfamilienhauses<br />
(MFH) in einer Großstadt wird<br />
die Beleihungswertermittlung am Praxisfall<br />
vorgestellt.<br />
Zur Ermittlung des Beleihungswerts sind der<br />
Ertragswert und der Sachwert des Beleihungsobjekts<br />
getrennt zu ermitteln (§ 4<br />
Abs. 1 BelWertV). Das Ertragswertverfahren<br />
(§§ 8 bis 13 BelWertV) nimmt eine<br />
dominierende Rolle im Rahmen der Wertermittlung<br />
ein. Bei der Ermittlung des Rohertrags<br />
(§ 10 BelWertV) darf nur der nachhaltige<br />
Ertrag ohne Umlagen berücksichtigt<br />
werden. Als nachhaltig wird die im Mietpreisspiegel<br />
durchschnittliche Nettokaltmiete von<br />
6,50 Euro/m² monatlich übernommen, die<br />
tatsächliche Miete liegt bei 7,11 Euro/m².<br />
Beim Gewerbe und den Garagen werden die<br />
tatsächlichen Mieten als nachhaltig eingeschätzt.<br />
Der Leerstand einer Wohnung wird<br />
als normale Fluktuation eingestuft, jedoch<br />
mit einem Abschlag versehen. Einen besonderen<br />
Schwerpunkt mit sehr konkreten Vorgaben<br />
bilden die Bewirtschaftungskosten<br />
(§ 11 BelWertV). Der ermittelte Rohertrag<br />
von 131.622,00 Euro ist um die üblicherweise<br />
beim Vermieter verbleibenden Bewirtschaftungskosten<br />
(BeWiKo) zu kürzen.<br />
Dafür sind ertragsmindernde, aus langfristiger<br />
Markterfahrung gewonnene Einzelkostenansätze<br />
für Verwaltungskosten, Instandhaltungskosten,<br />
das Mietausfallwagnis<br />
anzusetzen, sowie objektartenspezifisch ein<br />
Modernisierungsrisiko zu berücksichtigen.<br />
Die Einzelkostenansätze haben sich innerhalb<br />
vorgegebener Bandbreiten zu bewegen,<br />
sofern nicht die besonderen Umstände<br />
des Einzelfalls einen höheren Ansatz erfordern.<br />
Die Mindesthöhe für den Bewirtschaftungskostenabzug<br />
insgesamt beträgt 15 %<br />
des Rohertrags. Im vorliegenden Fall mussten<br />
Anpassungen vorgenommen werden,<br />
siehe Tabelle.<br />
Gerichte bestätigen Umsatzsteuerfreiheit des Vertriebs von Finanzprodukten<br />
Klaus D. Hahne,<br />
stellv. Leiter der Steuerabteilung, HSH<br />
Nordbank AG, Hamburg/Kiel<br />
Der Reinertrag von 98.252,00 Euro ist zu<br />
kapitalisieren (§ 12 BelWertV). Bei wohnwirtschaftlicher<br />
Nutzung darf der Kapitalisierungszinssatz<br />
nicht unter 5,0 %, bei<br />
gewerblicher Nutzung nicht unter 6,0 %<br />
in Ansatz gebracht werden (Mindestsätze).<br />
Gem. Gutachterausschuss werden<br />
bei vergleichbaren Objekten 6,5% Liegenschaftszinsen<br />
als ortsüblich angegeben,<br />
welcher zum Ansatz kommt. Zunächst wird<br />
der Verzinsungsbetrag des Bodenwerts<br />
vom Reiner-trag abgezogen (gespaltenes<br />
Ertragswertverfahren). Es verbleibt ein<br />
Gebäudereinertrag von 67.396,00 Euro.<br />
Die vorgegebenen Erfahrungssätze für die<br />
Nutzungsdauer baulicher Anlagen, z. B.<br />
bei Wohngebäuden max. 80 Jahre, sind zu<br />
berücksichtigen. Das zu bewertende Objekt<br />
wurde im Jahr 1900 erstellt und im Jahr<br />
2000 umfangreich modernisiert. Es wird eine<br />
neue Gesamtnutzungsdauer von 50 Jahren<br />
ab dem Jahr 2000, ergo eine Restnutzungsdauer<br />
von 43 Jahre angesetzt. Gemäß der<br />
Vervielfältigertabelle errechnet sich ein<br />
Gebäudeertragswert von 967.807,00 Euro.<br />
Unter Hinzurechnung des Bodenwerts<br />
von 474.700,00 Euro ergibt sich somit ein<br />
Ertragswert von 1.442.507,00 Euro. Es wird<br />
ein pauschaler Wertabschlag von 10 % vorgenommen,<br />
da ein Instandhaltungsrückstau<br />
(§ 4 Abs. 5 BelWertV) vorliegt. Der angepasste<br />
Ertragswert liegt bei 1.298.256,00<br />
Euro. Der Sachwert (§§ 14 bis 18) des<br />
Beleihungsobjekts setzt sich aus dem<br />
Bodenwert und dem zu ermittelnden Wert<br />
der baulichen Anlage inkl. Außenanlagen<br />
zusammen. Über die Methodik macht die<br />
BelWertV keine näheren Angaben. Im vorliegenden<br />
Fall wurde das Indexverfahren<br />
nach Preisen von 1913 gewählt. Hieraus<br />
ergibt sich ein Sachwert von 1.385.139,00<br />
Euro. Maßgeblich für die Ermittlung des<br />
Beleihungswerts ist regelmäßig der Ertragswert,<br />
der nicht überschritten werden darf<br />
(§ 4 Abs.3 BelWertV). Der Beleihungswert<br />
wird abgerundet auf 1.298.000,00 Euro<br />
festgesetzt.<br />
Bewirtschaftungskosten gem.<br />
gem. BelWertV Anpassung<br />
(BeWiKo)<br />
Hausverwaltung Höchstsatz für BLW auf<br />
Verwaltungskosten 6.040,00 € 6.046,84 € 6.046,84 €<br />
Mietausfallwagnis 5.199,80 € 2.847,00 € 5.359,44 €<br />
Instandhaltungskosten 18.762,87 € 12.965,00 € 18.789,47 €<br />
Modernisierungsrisiko - € 3.174,62 € 3.174,62 €<br />
Summe 30.002,67 € 25.033,46 € 33.370,37 €<br />
Rohertrag 143.696,00 € 131.622,00 € 131.622,00 €<br />
In % des Rohertrags 20,88% 19,02% 25,35%<br />
Die Frage der umsatzsteuerlichen Behandlung<br />
des Vertriebs von Finanzprodukten<br />
war in den vergangenen Jahren ein äußerst<br />
umstrittenes Thema: Nach Auffassung<br />
der Finanzverwaltung sollten insbesondere<br />
Bestandspflege- bzw. Kontinuitätsprovisionen<br />
im Vertrieb von Fondsanteilen und<br />
mehrstufige Vermittlungsstrukturen der<br />
Umsatzbesteuerung unterliegen. Dies hätte<br />
eine erhebliche Erhöhung der Vertriebskosten<br />
mit sich gebracht. Die Finanzwirtschaft<br />
hat sich deshalb gegen diese Auffassung<br />
zur Wehr gesetzt. Diese Bemühungen<br />
waren von Erfolg gekrönt, wie zwei aktuelle<br />
Gerichtsentscheidungen zeigen. Mit diesen<br />
Urteilen sollten die Problembereiche – ganz<br />
im Sinne des Produktvertriebs – gelöst sein.<br />
Der Vertrieb von Fondsanteile wird zumeist<br />
nicht von der Kapitalanlagegesellschaft<br />
(KAG) selbst durchgeführt, sondern auf<br />
Berechnungsübersicht unter<br />
www.FC-Heidelberg.de → <strong>Banken</strong>-<strong>Times</strong><br />
→ Ausgabenübersicht → Oktober<br />
downloaden.<br />
PRAXISTIPPS<br />
• Die hauseigenen Beleihungswertvorschriften<br />
und (Neu)Bewertungsprozesse<br />
müssen sehr aufmerksam<br />
mit den erhöhten Anforderungen der<br />
BelWertV abgeglichen werden.<br />
• Je nach Übereinstimmungsgrad und<br />
Anpassungsaufwand sollte mit Blick<br />
auf Best Practice und zukünftige Prüfungen<br />
eine freiwillige Anwendung der<br />
BelWertV ernsthaft erwogen werden.<br />
• Nutzen Sie die Kleindarlehensgrenze<br />
von 400.000,00 Euro für die Geschäftsprozessoptimierung<br />
und Steigerung<br />
des Vertriebs von privaten<br />
Baufinanzierungen (vgl. den interessanten<br />
Beitrag in der <strong>Banken</strong>-<strong>Times</strong><br />
2007 S. 30 von Fischer/Wettlaufer)<br />
• Eine Software oder eine einheitliche<br />
Tabellenkalkulation zur standardisierten<br />
Beleihungswertermittlung sollte<br />
zum Einsatz kommen (siehe auch<br />
MaRisk BTO 1.2 zu den Anforderungen<br />
an die Prozesse im Kreditgeschäft)<br />
SEMINARTIPPS<br />
Beleihungswertermittlung<br />
– Sicherheitenbewertung in der<br />
Bau-/Immobilienfinanzierung,<br />
am 08.11.2007, Frankfurt a.M.,<br />
Infos unter www.FC-Heidelberg.de<br />
Neue Vorgaben der <strong>Banken</strong>aufsicht für<br />
Immobilienfinanzierungen:<br />
BelWertV • SolvV • KWG-Novelle<br />
am 06.11.2007, Düsseldorf,<br />
Infos unter www.FC-Heidelberg.de<br />
Finanzdienstleister (insbesondere <strong>Banken</strong>,<br />
Sparkassen, Versicherungen, Finanzmakler)<br />
ausgegliedert. Diese vermitteln die<br />
Fondsanteile an ihre Kunden / Mandanten<br />
und erhalten dafür eine Vergütung (Vermittlungs-<br />
bzw. Vertriebsprovision) von<br />
der KAG. Diese wird oftmals in zwei Komponenten<br />
aufgeteilt:<br />
● Über einen Anteil an dem von der KAG<br />
erhobenen Ausgabeaufschlag partizipiert<br />
der Vertrieb in erster Linie an Portfolioumschichtungen<br />
der Investoren.
<strong>Banken</strong>-<strong>Times</strong> 2007, S. 36<br />
●<br />
Um den Vertrieb von Fondsanteilen an<br />
langfristig orientierte Anleger extra zu vergüten,<br />
zahlen KAG ihren Vertriebspartnern<br />
oftmals zusätzlich eine bestandsabhängige<br />
Vergütung über die Laufzeit<br />
des Investments des Anlegers (sog. „Kontinuitätsprovisionen“<br />
oder „Bestandspflegeprovisionen“).<br />
Diese wird aus den<br />
laufenden Verwaltungskosten getragen.<br />
Je länger der Investor i. d. S. die Anteilsscheine<br />
in seinem Portfolio hält, desto<br />
höher fällt auch die insgesamt für die Vermittlung<br />
der Fondsanteile gezahlte Vergütung<br />
aus. Somit erhält der Vermittler<br />
einen Anreiz, möglichst langfristig orientierte<br />
Investoren für ein Investment in den<br />
Fonds zu gewinnen und damit die vereinnahmten<br />
Provisionen zu steigern.<br />
Die Finanzverwaltung (insbes. OFD Frankfurt<br />
a. M., Vfg. v. 8.4.2003) hat aus dieser<br />
Vergütungsstruktur abgeleitet, dass neben<br />
der umsatzsteuerfreien Vermittlung der<br />
Fondsanteile eine zusätzliche steuerpflichtige<br />
Leistung vorliegen müsse. Die Leistung<br />
soll in einer gezielten Einflussnahme<br />
auf die Kunden dahingehend bestehen,<br />
dass diese ihre Fondsanteile weiterhin im<br />
Bestand halten.<br />
Der Bundesfinanzhof hat der Verwaltungsansicht<br />
nun in einem Urteil vom 19.4.2007<br />
(Az. V R 31/05) eine klare Absage erteilt<br />
und bestätigt damit ein Urteil des Finanzgerichts<br />
Düsseldorf (Az. 5 K 2030/03 U) aus<br />
2005. Die Auffassung der Finanzverwaltung<br />
könne sich nicht, so das Gericht, auf<br />
vertragliche Vereinbarungen stützen und<br />
basiere lediglich auf Fiktionen. Insbesondere<br />
fehle in der betreffenden Vertriebsvereinbarung<br />
eine vertragliche Leistungsverpflichtung,<br />
für die eine Bestandsprovision<br />
als Gegenleistung gezahlt werde.<br />
In allen Fällen, in denen die Zahlung von<br />
Vertriebsprovisionen nicht an die Erbringung<br />
besonderer „Nachbetreuungs- und<br />
Beratungsarbeiten“ gebunden ist, fällt somit<br />
keine Umsatzsteuer auf Kontinuitätsprovisionen<br />
an. Damit besteht nunmehr Planungssicherheit<br />
nicht nur für die KAG, sondern<br />
auch für die im Vertrieb tätigen Institute.<br />
PRAXISTIPPS<br />
• Die Ausgestaltung von Vertriebsprovisionen<br />
beim Absatz von Finanzinstrumenten<br />
ist für die Umsatzsteuerbefreiung<br />
unerheblich.<br />
• Auch Bestandspflege- oder Kontinuitätsprovisionen<br />
unterliegen nicht der<br />
Umsatzsteuer.<br />
• Die Vermittlung von Krediten und Finanzinstrumenten<br />
ist ebenfalls umsatzsteuerfrei.<br />
• Dies gilt auch in mehrstufigen Vertriebsstrukturen,<br />
soweit von den Mitgliedern<br />
solcher Strukturen „echte“<br />
Vermittlungstätigkeiten erbracht werden.<br />
In ähnlicher Weise war auch die Besteuerung<br />
von Vermittlungsleistungen in mehrstufigen<br />
Vertriebsstrukturen umstritten. In<br />
diesem Punkt wurden von der Finanzverwaltung<br />
(zuletzt Schreiben vom 25.11.2005,<br />
Az. IV A 6 – S 7160 a – 67/05) und dem<br />
Bundesfinanzhof (Urteil vom 9.10.2003,<br />
Az. V R 5/03) gefordert, dass unmittelbare<br />
vertragliche Beziehungen zwischen einer<br />
Vertragspartei (Emittent eines Wertpapiers,<br />
Investor, Kreditgeber, Kreditnehmer u. a.)<br />
und dem Vermittler des Geschäfts bestehen<br />
müssen. Nur in diesen Fällen sei eine vereinnahmte<br />
Vermittlungsprovision umsatzsteuerbefreit.<br />
In allen anderen Fällen – insbesondere<br />
bei den Leistungen sog. „Untervermittler“,<br />
die vertragliche Beziehungen<br />
ausschließlich zu vorgeschalteten „Hauptvermittlern“<br />
haben – falle beim Vertrieb von<br />
Finanzprodukten und der Vermittlung von<br />
Krediten Umsatzsteuer an. Diese wäre beim<br />
Leistungsempfänger regelmäßig nicht als<br />
Vorsteuer abziehbar und würde deshalb zu<br />
einer Kostenbelastung im Vertrieb führen.<br />
Von dieser Rechtsauffassung waren insbesondere<br />
mehrstufige Vertriebsstrukturen<br />
betroffen, die sowohl bei den sog. „Strukturvertrieben“<br />
wie auch im <strong>Banken</strong>- und<br />
Versicherungsbereich bestehen. Die Vermeidung<br />
einer Umsatzbesteuerung hätte für<br />
diese Vertriebsstrukturen einen erheblichen<br />
Reorganisationsbedarf mit sich gebracht.<br />
Der Europäische Gerichtshof hat jedoch<br />
mit Urteil vom 21.6.2007 (Rs. C-453/05 –<br />
Volker Ludwig) im Rahmen der Auslegung<br />
des europäischen Umsatzsteuerrechts die<br />
Auffassung der Finanzverwaltung verworfen<br />
und den Bundesfinanzhof „überstimmt“.<br />
Nach seiner Auffassung ausschließlich der<br />
Inhalt der erbrachten Tätigkeit maßgeblich,<br />
ohne dass es auf die vertraglichen Verhältnisse<br />
ankommt. Entscheidend sei, dass<br />
auf den Abschluss eines Vertrags über das<br />
Finanzprodukt oder den Kredit zwischen den<br />
Parteien hingearbeitet wird. Von der Streuerbefreiung<br />
ist damit eine typische Maklertätigkeit<br />
abgedeckt, die auch von „Untervermittlern“<br />
regelmäßig durchgeführt wird.<br />
Mit den beiden vorliegenden Entscheidungen<br />
des Bundesfinanzhof und des Europäischen<br />
Gerichtshofs bestätigt sich somit<br />
die grundsätzliche Steuerbefreiung des<br />
Vertriebs von Finanzinstrumenten. Dies<br />
betrifft neben der Kreditvermittlung auch die<br />
Vermittlung von Wertpapieren, Zertifikaten,<br />
Fondsanteilen und Anteilen an Gesellschaften<br />
(z. B. Anteile an sog. geschlossenen<br />
Fonds). Die insoweit bislang bestehende<br />
Rechtsunsicherheit wird durch die<br />
Entscheidungen im Sinne der Finanzwirtschaft<br />
beseitigt. Bestehende Vertriebsstrukturen<br />
können damit ohne umsatzsteuerliche<br />
Risiken beibehalten und fortgeführt<br />
werden.<br />
BUCHTIPP<br />
Hahne (Hrsg.), Die Umsatzsteuer in<br />
Kreditinstituten, Heidelberg 2007,<br />
Infos unter www.FC-Heidelberg.de<br />
<strong>Banken</strong>-<strong>Times</strong> kostenlos<br />
bestellen<br />
Mit diesem Newsletter informieren wir unsere<br />
Kunden und weitere interessierte Kreise über<br />
aktuelle Fachthemen aus der Kreditwirtschaft.<br />
Der E-Mail-Versand der <strong>Banken</strong>-<strong>Times</strong> erfolgt<br />
nach vollständigem Ausfüllen und Rücksenden<br />
des nachstehenden Coupons kostenlos.<br />
Name:<br />
Vorname:<br />
Position:<br />
Abteilung:<br />
Unternehmen:<br />
E-Mail:<br />
Impressum<br />
Redaktion<br />
RA Dr. Patrick Rösler<br />
(verantwortlicher Redakteur im Sinne des Presserechts)<br />
Dipl. Kfm. Dr. Christian Göbes<br />
Dipl. Kfm. Frank Sator<br />
Stefan Renz<br />
RAin Dr. Christiane Seidel<br />
Manuskripte<br />
Über elektronisch übersandte Manuskripte an<br />
info@FC-Heidelberg.de freuen wir uns. Mit der Übersendung<br />
übertragen Sie uns das Verlagsrecht zur Veröffentlichung<br />
in der <strong>Banken</strong>-<strong>Times</strong>.<br />
Urheber- und Verlagsrechte<br />
Alle Beiträge in dieser Zeitschrift sind urheberrechtlich<br />
geschützt, jede anderweitige Nutzung bedarf der schriftlichen<br />
Genehmigung des Verlages.<br />
Anzeigen, Sponsoring und Abos<br />
Informationen beim Verlag<br />
Verlag<br />
Finanz Colloquium Heidelberg GmbH<br />
Plöck 32a, 69117 Heidelberg<br />
Tel. 06221/6018-64. Fax -63<br />
info@FC-Heidelberg.de<br />
www.FC-Heidelberg.de<br />
Druck<br />
WM Druck GmbH, Wiesloch<br />
Erscheinungsweise<br />
10x pro Jahr, Juli/August und Dezember/Januar Doppelausgaben