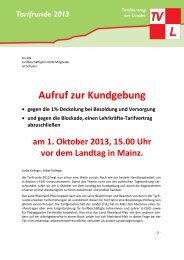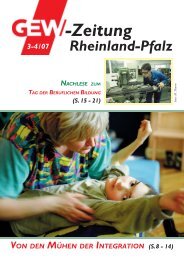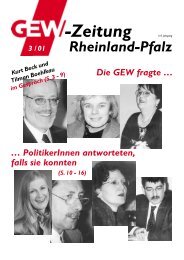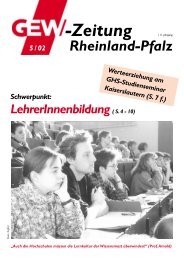Diskussion um neues Hochschulgesetz (S. 20 - 28) - GEW
Diskussion um neues Hochschulgesetz (S. 20 - 28) - GEW
Diskussion um neues Hochschulgesetz (S. 20 - 28) - GEW
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Fotos: Bernhard Clessienne<br />
1-2/ 03<br />
Schwerpunkt Hochschulen:<br />
<strong>Diskussion</strong> <strong>um</strong> <strong>neues</strong> <strong>Hochschulgesetz</strong><br />
(S. <strong>20</strong> - <strong>28</strong>)<br />
-Zeitung<br />
112. Jahrgang<br />
Rheinland-Pfalz<br />
Jetzt reicht‘s<br />
<strong>GEW</strong> protestiert gegen Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen:<br />
„Würde sich Beck <strong>um</strong> die Bildung wie <strong>um</strong> den FCK kümmern...“<br />
(S. 6-7)
Kol<strong>um</strong>ne / Inhalt / Impress<strong>um</strong><br />
Alles<br />
wunnebar?<br />
Es gibt Schlimmeres, als vermisst zu werden.<br />
So nervt es Redaktionsmitglieder<br />
ganz und gar nicht, wenn sie in Monaten,<br />
in denen keine <strong>GEW</strong>-Zeitung erscheint,<br />
gefragt werden, wieso diesmal nur<br />
die Bundeszeitung kam. Ist doch irgendwie<br />
ein Kompliment. Schließlich ist das<br />
Wichtigste für eine Zeitung, dass Interesse<br />
an ihr besteht. Ob Interesse gleichzeitig<br />
Zustimmung zu den Inhalten bedeutet,<br />
steht auf einem anderen Blatt. Muss ja auch nicht unbedingt sein;<br />
schließlich ist es unser Anspruch, ein <strong>Diskussion</strong>sfor<strong>um</strong> unserer Gewerkschaft<br />
und kein <strong>GEW</strong>-Amtsblatt zu liefern.<br />
Während die E&W in elf Monaten herauskommt, produzieren wir nur neun<br />
Ausgaben. Doppelausgaben gibt es in diesem Jahr im Februar (1-2), im<br />
April (4-5) und im Juli (7-8); im Januar wurde also keine und im Mai<br />
sowie im August werden keine <strong>GEW</strong>-Zeitungen der Bundeszeitung beigelegt.<br />
Wir bitten unsere regelmäßigen MitarbeiterInnen, sich diese Termine<br />
zu notieren. Apropos MitarbeiterInnen: Nach Zeiten der Stagnation steigt<br />
deren Zahl in letzter Zeit kontinuierlich. Das ist sehr erfreulich, denn im<br />
großen Angebot an Printmedien, die in die Briefkästen unserer LeserInnen<br />
flattern, können wir uns nur durch Authentizität behaupten. So war das<br />
Manuskriptangebot für diese Ausgabe so groß, dass wir beim Seiten<strong>um</strong>fang<br />
ans absolute obere Limit gehen mussten, was wir uns eigentlich gar nicht<br />
leisten können. Aber wenn sich KollegInnen schon die Mühe machen, sich<br />
schreibend an den Schreibtisch zu setzen, ist es für uns selbstverständlich,<br />
diese Texte auch möglichst bald zu bringen. Nur bitten wir <strong>um</strong> Verständnis,<br />
wenn an der einen oder anderen Stelle Kürzungen un<strong>um</strong>gänglich sind; wir<br />
müssen bei der Entscheidung über die Länge von Artikeln bzw. die Häufigkeit<br />
bestimmter Themen darauf achten, was von allgemeinem Interesse ist<br />
und was nur wenige tangiert.<br />
Logischerweise ist unser Platzmangel bei Doppelausgaben immer besonders<br />
groß, da zwischen den Erscheinungsterminen häufig viel Berichtenswertes<br />
geschehen ist. So wollten wir natürlich auf die <strong>GEW</strong>-Aktivitäten in der<br />
Tarifrunde eingehen, auch wenn diese schon fast zwei Monate zurück liegen.<br />
Immerhin durften wir ein Nov<strong>um</strong> erleben: Warnstreiks nach Aufrufen<br />
der <strong>GEW</strong> Rheinland-Pfalz! Gemischte Gefühle riefen allerdings die Ergebnisse<br />
der Tarifverhandlungen unter den Beschäftigten hervor. Bei einer „Drei<br />
vor dem Komma“ dachte man eigentlich an drei Prozent mehr im Jahr. Was<br />
jetzt durch die lange Laufzeit dabei herauskam, ist weit davon entfernt und<br />
frustriert verständlicherweise insbesondere die unteren Lohngruppen im<br />
Öffentlichen Dienst, z<strong>um</strong>al die Kompensationsmaßnahmen wie z.B. die<br />
Streichung des Arbeitszeitverkürzungstages bitter sind. Mehr war aber wohl<br />
nicht drin angesichts des Gejammers von den leeren Kassen, das von der<br />
Aus dem Inhalt <strong>GEW</strong>-ZEITUNG Rheinland-Pfalz Nr. 1-2 / <strong>20</strong>03:<br />
Kol<strong>um</strong>ne Seite 2<br />
Kommentar: Nein z<strong>um</strong> Krieg … Seite 3<br />
Bildungspolitik Seiten 4 - 7<br />
Schulen Seiten 8 - 12<br />
Tarifpolitik Seiten 14 - 15<br />
Berufliche Bildung Seiten 16 - 19<br />
SCHWERPUNKT: Hochschulen Seiten <strong>20</strong> - <strong>28</strong><br />
Alter + Ruhestand Seite 29<br />
<strong>GEW</strong>-Fortbildung Seiten 30 - 31<br />
Rechtsschutz Seiten 32 - 34<br />
Tipps + Termine / Kreis + Region Seiten 35 - 39<br />
Schulgeist Seite 40<br />
Masse der Medien unkritisch übernommen wurde und die Klischees von den<br />
faulen Staatsdienern noch verstärkte. Als seien die Beschäftigten verantwortlich<br />
die für Misswirtschaft der politischen Elite wie z.B. in Berlin oder eine<br />
verfehlte rot-grün-schwarz-gelbe Steuerpolitik, die die Starken reicher und<br />
den Staat ärmer machte. Ja, und ob (bzw. wie) der Tarifabschluss für die<br />
BeamtInnen übernommen wird, steht - z<strong>um</strong> Redaktionsschluss - noch in<br />
den Sternen.<br />
Womit wir bei einem weiteren Thema wären, das zu gemischten Gefühlen<br />
führte. Just zu dem Zeitpunkt, als unser Landesverband unter dem Motto<br />
„Jetzt reicht´s“ eine Protestveranstaltung in Mainz veranstaltete, <strong>um</strong> die Rücknahme<br />
der Arbeitszeitverlängerungen und all der weiteren Verschlechterungen<br />
unserer Arbeitsbedingungen in der letzten Dekade einzufordern, schnürte<br />
die Landesregierung ein <strong>neues</strong> „Sparpaket“, das die materielle Situation der<br />
Beschäftigten weiter einschränken wird: Streichung der Leistungsprämie und<br />
der Jubilä<strong>um</strong>szuwendung, Zuzahlungen bei der Beihilfe, drastische Reduzierung<br />
der Beförderungsstellen, all dies wird die Motivation z<strong>um</strong> Beispiel<br />
bei den StudienrätInnen, die seit ewigen Zeiten auf ihre Beförderung warten,<br />
zweifellos immens steigern.<br />
Es bleibt also bei dem Muster: Die Politik gibt weniger und will dafür mehr<br />
Leistung. Wie absurd: Jetzt sollen sich die Schulen Qualitätsprogramme aus<br />
den Rippen schneiden, ominöse Standards erfüllen, sich weiteren Tests unterziehen,<br />
Förderpläne für SchülerInnen formulieren und was sonst noch<br />
verlangt wird, statt überhaupt mal eine ordentliche Grundversorgung zu<br />
schaffen. Was nützt der schönste Förderplan, wenn es keine Fördermittel gibt<br />
oder gar mangels Vertretungskräften der reguläre Unterricht nicht garantiert<br />
werden kann? Das sind alles nichts anderes als Alibiveranstaltungen, die der<br />
uninformierten Öffentlichkeit sinnvolle Konsequenzen aus PISA vorgaukeln<br />
wollen.<br />
Ist doch alles wunnebar. Sieht man ja bei den „neuen Ganztagsschulen“. Da<br />
hat eine Untersuchung - 70 000 EURO sollen von der Landesregierung<br />
dafür locker gemacht worden sein - ergeben, dass rund<strong>um</strong> Zufriedenheit<br />
herrsche. Man reibt sich verwundert die Augen. Hat nicht die <strong>GEW</strong>-Umfrage<br />
erheblichen Nachbesserungsbedarf ermittelt? Bei der Suche nach den<br />
Gründen für solch widersprüchliche Ergebnisse ließe sich auf das spätestens<br />
seit der kritischen Theorie bekannte „erkenntnisleitende Interesse“ wissenschaftlicher<br />
Forschung verweisen. Aber die Erklärung ist einfacher: Die <strong>GEW</strong><br />
befragte die Personalräte, das beauftragte Forschungsinstitut holte überwiegend<br />
die Meinungen von Eltern ein. Dass es da zu unterschiedlichen Einschätzungen<br />
kommen musste, liegt auf der Hand und muss nicht weiter<br />
erläutert werden.<br />
Vielleicht ist das alles auch furchtbar unwichtig angesichts dessen, was<br />
möglicherweise z<strong>um</strong> Zeitpunkt des Erscheinens unserer Zeitung schon traurige<br />
Realität sein könnte: ein Krieg gegen den Irak. Blutvergießen für Ölvorkommen.<br />
Wenn wir diesmal unseren Orden für sprachliche Fehlleistungen<br />
verleihen, so ist das ganz und gar nicht witzig, sondern unfassbar deprimierend.<br />
Die Chancen für einen Krieg am Golf seien gesunken, meinte neulich<br />
ein amerikanischer Regierungsbeamter. „Chancen für einen Krieg“ statt<br />
„Chancen für den Frieden“. Was soll man da noch sagen?<br />
Günter Helfrich<br />
Impress<strong>um</strong> <strong>GEW</strong>-ZEITUNG Rheinland-Pfalz<br />
Herausgeber: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Rheinland-Pfalz, Neubrunnenstr. 8, 55116<br />
Mainz, Tel.: (0 61 31) <strong>28</strong>988-0, Fax: (06131) <strong>28</strong>988-80, E-mail: <strong>GEW</strong>@<strong>GEW</strong>-Rheinland-Pfalz.de<br />
Redaktion: Günter Helfrich (verantw.) und Karin Helfrich, Postfach 22 02 23, 67023 Ludwigshafen,<br />
Tel./ Fax: (0621) 564995, e-mail: <strong>GEW</strong>ZTGRL1@aol.com; Ursel Karch ( Anzeigen), Arnimstr.<br />
14, 67063 Ludwigshafen, Tel.: (0621) 69 73 97, Fax.: (0621) 6 33 99 90, e-mail:<br />
UKarch5580@aol.com; Antje Fries, Rheindürkheimer Str. 3, 67574 Osthofen, Tel./Fax: (0 62 42)<br />
91 57 13, e-mail: antje.fries@gmx.de<br />
Verlag, Satz und Druck: Verlag Pfälzische Post GmbH, Winzinger Str. 30, 67433 Neustadt a.d.W.,<br />
Tel.: (06321) 8 03 77; Fax: (0 63 21) 8 62 17; e-mail: VPP.NW@t-online.de, Datenübernahme per<br />
ISDN: (0 63 21) 92 90 92 (Leonardo-SP - = 2 kanalig)<br />
Manuskripte und Beiträge: Die in den einzelnen Beiträgen wiedergegebenen Gedanken entsprechen<br />
nicht in jedem Falle der Ansicht des <strong>GEW</strong>-Vorstandes oder der Redaktion. Nur maschinengeschriebene<br />
Manuskripte können angenommen werden. Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine<br />
Gewähr übernommen. Manuskripte und sonstige Zuschriften für die Redaktion der <strong>GEW</strong>-Zeitung<br />
Rheinland-Pfalz werden nach 67023 Ludwigshafen, Postfach 22 02 23, erbeten.<br />
Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten; für Nichtmitglieder jährlich Euro 18,-- incl. Porto<br />
+ MWSt. (Bestellungen nur beim Herausgeber.) Kündigung 3 Monate vor Ablauf des Kalenderjahres.<br />
Im anderen Falle erfolgt stillschweigend Verlängerung <strong>um</strong> ein weiteres Jahr.<br />
Anzeigenpreisliste Nr. 12 beim Verlag erhältlich. Redaktionsschluss: jeweils der 5. des Vormonats.<br />
2 <strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 /<strong>20</strong>03
NEIN z<strong>um</strong> Krieg gegen den Irak<br />
<strong>GEW</strong> für eine politische Lösung des Irak-Konfliktes<br />
Weltweit: Antikriegsdemonstrationen<br />
am 18. u.<br />
19. Jan. <strong>20</strong>03…<br />
… in Turin<br />
… in Amsterdam,<br />
London<br />
und New York.<br />
Fotos aus dem<br />
Internet.<br />
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft<br />
(<strong>GEW</strong>) sagt Nein zu einem<br />
Krieg gegen den Irak.<br />
Der massive Truppenaufmarsch in der<br />
Golfregion unter Führung der USA<br />
droht eine Kriegmaschinerie in Gang<br />
zu setzen, die einer politischen Lösung<br />
des Konflikts den Boden entzieht. Die<br />
Welt wird mit einer unkalkulierbaren<br />
Eskalation der Gewalt konfrontiert,<br />
bevor endgültig geklärt ist, ob der Irak<br />
überhaupt über das Bedrohungspotenzial<br />
verfügt, das die USA zur Rechtfertigung<br />
einer militärischen Intervention<br />
vorgeben.<br />
Mit dem DGB und seinen Gewerkschaften<br />
erklärt die <strong>GEW</strong>:<br />
Es ist nicht Sache einer Supermacht<br />
oder einzelner Staaten, über Krieg<br />
und Frieden in der Welt zu entscheiden.<br />
Nur die Vereinten Nationen<br />
sind berechtigt, im Falle des Verstoßes<br />
gegen UN-Resolutionen über die<br />
Wahl der Mittel und deren Einsatz<br />
zu befinden. Daher lehnt die <strong>GEW</strong><br />
einen Krieg gegen den Irak ab.<br />
<strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 /<strong>20</strong>03<br />
Die <strong>GEW</strong> verkennt nicht die Gefahr,<br />
die von einem welt<strong>um</strong>spannenden Terrorismus<br />
ausgeht. Ebenso ist sich die<br />
Bildungsgewerkschaft der Bedrohung<br />
durch das undemokratische und menschenverachtende<br />
Terror-Regime Saddam<br />
Husseins bewusst.<br />
Das Regime missachtet Beschlüsse des<br />
UN-Sicherheitsrates, ignoriert internationale<br />
Abkommen und verstößt gegen<br />
völkerrechtliche Verträge.<br />
Saddam Hussein hat Kriege gegen die<br />
eigene Bevölkerung und Nachbarstaaten<br />
geführt.<br />
Er hat chemische Massenvernichtungswaffen<br />
gegen die kurdische Bevölkerung<br />
im Norden Iraks eingesetzt.<br />
Sein Regime bedroht die Existenz Israels<br />
und schürt den Konflikt im Nahen<br />
Osten.<br />
Befürchtungen hinsichtlich der Fähigkeit<br />
des Irak, atomare, biologische und<br />
chemische Waffen zu produzieren und<br />
zu verbreiten, sowie die Bereitschaft, sie<br />
auch gezielt einzusetzen, sind durch den<br />
Waffenbericht des Irak und die Tätigkeit<br />
der UN-Waffeninspekteure bisher<br />
nicht ausgerä<strong>um</strong>t.<br />
Gegen die Bedrohung durch den Terrorismus<br />
und den Staatsterror Saddam<br />
Husseins muss die Staatengemeinschaft<br />
angemessene multilaterale Konzepte<br />
entwickeln. Auf der Basis einer globalen<br />
Rechtsordnung muss den Menschenrechten<br />
unter Achtung internationalen<br />
Rechts durch völkerrechtlich legitimierte<br />
weltpolizeiliche Maßnahmen Geltung<br />
verschafft werden.<br />
Vor diesem Hintergrund stellt<br />
die <strong>GEW</strong> fest:<br />
• Ein Krieg gegen den Irak ist völkerrechtlich<br />
nicht gerechtfertigt: Es fehlt der<br />
Beweis eines Verstoßes gegen die UN-<br />
Resolution 1441.<br />
• Ein Krieg gegen den Irak verbietet sich<br />
aus h<strong>um</strong>anitären Gründen: Opfer wäre<br />
wieder einmal mehr die notleidende<br />
irakische Bevölkerung, und zwar in<br />
einem vielfach höheren Ausmaß als im<br />
Golf-Krieg wie ein internes UN-Papier<br />
feststellt.<br />
• Ein Krieg gegen den Irak hätte unkalkulierbare<br />
politische und ökonomische<br />
Folgen: Die internationale Allianz ge-<br />
Kommentar<br />
gen den Terrorismus wäre gefährdet und<br />
die Lage im Nahen Osten werde sich<br />
weiter destabilisieren.<br />
Aus dieser Überzeugung<br />
• unterstützt die <strong>GEW</strong> mit dem DGB<br />
und seinen Gewerkschaften die Bundesregierung<br />
in ihrer Haltung, sich<br />
weder militärisch noch finanziell an einem<br />
neuerlichen Irak-Krieg zu beteiligen.<br />
Sie fordert die Bundesregierung<br />
auf, diese Position in den kommenden<br />
Wochen unmissverständlich deutlich zu<br />
machen. Dies schließt eine klare Ablehnung<br />
im UN-Sicherheitsrat ein;<br />
• fordert die <strong>GEW</strong> Bundeskanzler<br />
Gerhard Schröder und Außenminister<br />
Joschka Fischer auf, im Verbund mit<br />
anderen Staaten eine Politik zur Solidarisierung<br />
der Staatengemeinschaft<br />
gegen einen Irak-Krieg zu verfolgen;<br />
• appelliert die <strong>GEW</strong> an die Abgeordneten<br />
des Deutschen Bundestages, auch<br />
die Bundesregierung in diesem Bemühen<br />
zu unterstützen;<br />
• drängt die <strong>GEW</strong> die US-amerikanischen<br />
Bildungsgewerkschaften, Position<br />
gegen den Irak-Krieg zu beziehen<br />
und ihre Haltung gegenüber der Bush-<br />
Administration in der Öffentlichkeit<br />
deutlich zu machen<br />
• ruft die <strong>GEW</strong> ihre Mitglieder und<br />
die Pädagoginnen und Pädagogen in<br />
Europa auf, sich am „europaweiten<br />
Aktionstag gegen den Krieg“ am 15.<br />
Februar <strong>20</strong>03 zu beteiligen und örtliche<br />
Aktionen der Friedensbewegung zu<br />
unterstützen.<br />
Angesichts der historischen Rolle und<br />
Verantwortung Deutschlands ruft die<br />
<strong>GEW</strong> (...) auf, den Irak-Konflikt in<br />
allen Bildungseinrichtungen z<strong>um</strong> Thema<br />
zu machen.<br />
Die <strong>GEW</strong> unterstützt den Appell der<br />
IG Metall:<br />
Die Welt braucht eine Politik zur<br />
Prävention von Kriegen, nicht aber<br />
Präventionskriege.<br />
Geschäftsführender Bundesvorstand<br />
der Gewerkschaft Erziehung<br />
und Wissenschaft<br />
3
Bildungspolitik<br />
Vergleichen lohnt sich!<br />
Qualitätsmanagement, Schulprogramm, Schulentwicklung in Rheinland-Pfalz …<br />
Die Gymnasiallehrerin<br />
Bettina<br />
Gerhard ist stellvertretende<br />
<strong>GEW</strong>-<br />
Vorsitzende und<br />
Mitglied im HPR<br />
Gymnasien.<br />
Seit September <strong>20</strong>02 ist<br />
es amtlich: jetzt ist es „die<br />
Aufgabe jeder einzelnen<br />
Schule, bis z<strong>um</strong> Ende des<br />
Schuljahres <strong>20</strong>02/03 ihr<br />
Qualitätsprogramm zu<br />
entwickeln und zu vereinbaren.“<br />
Die Arbeitsanweisung<br />
erreichte die<br />
Schulen über die elektronische<br />
Mail, ohne den<br />
Umweg über das Amtsblatt<br />
zu nehmen oder die<br />
übliche Form einer Verwaltungsvorschrift<br />
- und auch ohne<br />
die Zustimmung der Hauptpersonalräte.<br />
In den Schulen rieb man sich verdutzt<br />
die Augen. Klar es hatte diverse Ankündigungen<br />
gegeben, das „Rahmenkonzept<br />
für pädagogisches Qualitätsmanagement<br />
und pädagogische Schulentwicklung“<br />
stammt bereits aus dem<br />
Jahr 1999, der Landtag hat sich mit<br />
breiter Mehrheit für Qualitätsentwicklung<br />
in den Schulen ausgesprochen, in<br />
der Koalitionsvereinbarung und in der<br />
Regierungserklärung wird bekräftigt,<br />
dass das Qualitätsmanagement fortgesetzt<br />
wird, Ministerin Ahnen hat im<br />
Februar <strong>20</strong>02 in einer Presseerklärung<br />
einzelne Punkte verbindlich angekündigt.<br />
Es soll also keiner sagen, er habe<br />
nichts gewusst - oder doch? Wie kommt<br />
es eigentlich, dass jetzt nach drei Jahren<br />
wiederholter Ankündigungen die<br />
Kollegien in Konferenzen, Dienstbesprechungen<br />
und Personalversammlungen<br />
je nach Temperament achselzuckend,<br />
wütend, unmutig, gereizt oder<br />
auch gleichgültig reagieren und sich<br />
z<strong>um</strong> Teil - oft gerade diejenigen, die in<br />
den letzten Jahren viel dazu beigetragen<br />
haben, dass die eigene Schule sich<br />
weiterentwickelt hat - heftig gegen die<br />
Verordnung von oben wehren, ein<br />
Qualitätsprogramm formulieren zu<br />
müssen?<br />
Ein paar Gründe liegen, wie ich meine,<br />
auf der Hand, andere sind vielleicht<br />
nicht ganz so offensichtlich, lassen sich<br />
aber im Vergleich mit anderen Ländern<br />
entdecken.<br />
1. Das Papier „Qualitätsentwicklung<br />
an Schulen <strong>20</strong>02 - <strong>20</strong>06“ ist ausgesprochen<br />
schlecht kommuniziert worden.<br />
Das Gespräch wurde nicht mit den<br />
Schulen, den Betroffenen gesucht, sondern<br />
auf der Ebene Politik - Massenmedien<br />
geführt. Viel hörte sich deshalb<br />
an wie das übliche Beruhigungsritual<br />
seitens der Verantwortlichen gegenüber<br />
der Öffentlichkeit. Schließlich müssen<br />
die BildungspolitikerInnen auf die<br />
PISA-Ergebnisse reagieren und Handlungsfähigkeit<br />
trotz fehlender Ressourcen<br />
beweisen. Die Schulen kennen diese<br />
Form der Kommunikation über sie statt<br />
mit ihnen und reagieren entsprechend<br />
(nicht).<br />
2. Auch in anderen Bundesländern hat<br />
man in den letzten Jahren verbindliche<br />
Schulprogramme eingeführt, an der<br />
Qualität des Unterrichts scheint dieser<br />
Umstand aber wenig verändert zu haben,<br />
sonst hätte die öffentliche Berichterstattung<br />
diesen Punkt spätestens bei<br />
der <strong>Diskussion</strong> über die PISA-E Studie<br />
stärker herausgestellt.<br />
3. Stell dir vor, 1700 Schulen schreiben<br />
ihr Qualitätsprogramm, und niemand<br />
merkt’s! bzw. niemand liest sie.<br />
„Die Schulaufsicht nimmt die Qualitätsprogramme<br />
entgegen und führt den<br />
Dialog (!) mit den Schulen über die<br />
darin formulierten Vorhaben“, so verkündet<br />
das MBFJ. Glaubt jemand<br />
ernsthaft, dass es angesichts der schieren<br />
Menge an Papier für das Ergebnis<br />
der Arbeit von 30.000 Lehrerinnen<br />
und Lehrern eine angemessene Rückkoppelung<br />
mit der Schulaufsicht geben<br />
kann? Kann es verwundern, dass die<br />
KollegInnen den Eindruck haben, für<br />
den Papierkorb zu produzieren?<br />
4. Innovation, Veränderung, Entwicklung,<br />
Qualitätssicherung sind Prozesse,<br />
die von denjenigen getragen werden<br />
müssen, die für sie verantwortlich sind.<br />
Sie setzen Motivation, Engagement für<br />
und Identifikation mit der Aufgabe<br />
voraus. Die Einführung eines Qualitätsentwicklungsprozesses<br />
im Top-<br />
Down-Verfahren widerspricht der Zielsetzung.<br />
5. Die Anordnung mittels Qualitätsprogramm<br />
und Vergleichsarbeiten die<br />
Schulqualität zu verbessern, trifft die<br />
Schulen am Ende einer Dekade, die<br />
Verschlechterungen der Lern- und Arbeitsbedingungen<br />
in bis dato nicht gekanntem<br />
Ausmaß gebracht hat bei<br />
gleichzeitig wachsenden Anforderungen<br />
an die Schulen und dramatisch gealterten<br />
Kollegien. Die Maßnahmen zur<br />
Qualitätsentwicklung müssen in diesem<br />
Kontext als zusätzliche Belastung,<br />
die nicht auch noch geschultert werden<br />
kann, empfunden werden.<br />
Gleichzeitig kann es gar keinen Zweifel<br />
daran geben, dass die Qualitätsentwicklung<br />
in der Schule eine dringliche<br />
inhaltliche Aufgabe ist. Viele Kolleginnen<br />
und Kollegen beteiligen sich aktiv<br />
an der Bewältigung der anstehenden<br />
Probleme, haben Entwicklungsansätze<br />
für ihre Schule ausprobiert und vorangetrieben,<br />
Kooperationsformen gefunden<br />
und kultiviert, im Bereich der<br />
Schwerpunktbildung - z<strong>um</strong> Beispiel im<br />
mathematisch-naturwissenschaftlichen<br />
Bereich an den Gymnasien - gute Konzepte<br />
erarbeitet und <strong>um</strong>gesetzt, Fortbildungen<br />
besucht, <strong>um</strong> fehlende Kompetenzen<br />
für die anstehenden Aufgaben<br />
zu erwerben. Alle diese Kolleginnen<br />
und Kollegen hätten sich über eine<br />
ministerielle Unterstützung gefreut, die<br />
sie in dem vorliegenden Papier vermissen.<br />
Ja, doch, auch seitens des Ministeri<strong>um</strong>s<br />
wird den Schulen versichert, dass sie<br />
Unterstützung erwarten können. Genannt<br />
werden die Schulaufsicht, ModeratorInnen<br />
bzw. BeraterInnen und<br />
Pädagogische Serviceeinrichtungen.<br />
Eine Datenbank mit allen im Land zur<br />
Verfügung stehenden Personen soll erstellt<br />
werden. So genau weiß nämlich<br />
offensichtlich niemand, welche Berater,<br />
Moderatoren wen, wo, mit welchem<br />
Ziel „beraten“. Mit anderen Worten:<br />
Erst jetzt wird versucht zu ergründen,<br />
welche Personen oder Gruppen mit<br />
welchen Kompetenzen es eigentlich gibt,<br />
die von den Schulen angefragt werden<br />
können. Der Abgabetermin für die<br />
Qualitätsprogramme ist aber schon<br />
Ende des Schuljahres...<br />
4 <strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 /<strong>20</strong>03
Auch die inhaltlichen Bestandsaufnahme<br />
steckt noch in den Anfängen. Eine<br />
Reihe von Fragen harren noch der Beantwortung:<br />
* Was brauchen die Schulen an Unterstützung?<br />
* Was müssen die Unterstützer können?<br />
* Wie können die Personen gefunden<br />
werden?<br />
* Wie können sie qualifiziert werden?<br />
Es mag ja sein, dass es 500 Personen in<br />
Rheinland-Pfalz gibt, die für Beratungstätigkeit<br />
in den Schulen entlastet<br />
werden. Nur: damit gibt es noch kein<br />
Konzept, keine systematische, zielgerichtete<br />
Unterstützung der Schulen und<br />
kein speziell dafür ausgebildetes Team,<br />
das auch über genügend Zeit und materielle<br />
Ressourcen verfügt, <strong>um</strong> Schulen<br />
bei ihrem Schulentwicklungsprozess<br />
zu begleiten und zu beraten.<br />
… und anderswo<br />
Dabei gibt es überzeugende Konzepte,<br />
Erfahrungen, wie Reformprozesse initiiert<br />
und auch implementiert werden<br />
können. Auf einer Tagung der Bertelsmann<br />
Stiftung in Zusammenarbeit mit<br />
der baden-württembergischen Akademie<br />
für Lehrerfort- und Weiterbildung<br />
Ende Oktober <strong>20</strong>02 in Schwäbisch<br />
Hall kamen Kolleginnen und Kollegen<br />
aus zehn verschiedenen Ländern für<br />
eine Woche zusammen, <strong>um</strong> gemeinsam<br />
über die notwendigen Veränderungen<br />
beim Lernen, Lehren und Leiten in einer<br />
Kultur des Wandels nachzudenken<br />
(„Learning, Teaching and Leading in<br />
a Culture of Change“). Geleitet wurde<br />
das Seminar von Norm Green und seinem<br />
Team, das vor 10 Jahren begonnen<br />
hat, den Schulbezirk Durham in<br />
Kanada, der bei nationalen Vergleichen<br />
durch besonders schlechte Ergebnisse<br />
aufgefallen war, systematisch <strong>um</strong>zugestalten<br />
mit dem Ziel, die Unterrichtsergebnisse<br />
deutlich zu verbessern.<br />
Das Ergebnis ist überzeugend und<br />
mittlerweile hinreichend dok<strong>um</strong>entiert<br />
1 . TeilnehmerInnen waren neben<br />
LehrerInnen, SchulleiterInnen und<br />
Schulaufsichtsbeamten auch Verantwortliche<br />
für Schulentwicklung aus so<br />
verschiedenen Ländern wie Norwegen,<br />
R<strong>um</strong>änien, den Niederlanden und Irland.<br />
Die Schulentwicklung ist in den einzelnen<br />
Ländern unterschiedlich weit<br />
<strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 /<strong>20</strong>03<br />
gediehen, der Anstoß<br />
für den jeweiligen Prozess<br />
hatte verschiedenen<br />
Ursachen, die Ausgangslagen<br />
sind nicht<br />
unbedingt miteinander<br />
zu vergleichen und<br />
Rheinland-Pfalz ist<br />
wieder ganz anders.<br />
Trotzdem: Es war interessant<br />
zu hören, welchen<br />
Weg die anderen<br />
Länder eingeschlagen<br />
haben.<br />
Z<strong>um</strong> Beispiel Irland:<br />
Die Republik ist gerade<br />
dabei, in allen<br />
Schulen die Schulentwicklung anzustoßen,<br />
auch hier geht man den Weg<br />
über schuleigene Entwicklungspläne.<br />
Die Umsetzung für die 3.300 Grundschulen<br />
erfolgt in vier Schritten über<br />
einen Zeitra<strong>um</strong> von vier Jahren, d. h.<br />
jedes Jahr werden ungefähr 800 Schulen<br />
neu einbezogen. Das Land stellt<br />
hierfür einen Etat von zusätzlichen 2<br />
Millionen Pfund zu Verfügung. Jede<br />
Schule erhält individuelle Beratung,<br />
nach den ersten Vorgesprächen findet<br />
für das ganze Kollegi<strong>um</strong> (bei sehr kleinen<br />
Schulen auch im Verbund mit der<br />
Nachbarschule) eine einwöchige Fortbildung<br />
statt. Zeit, die eigenen Ziele<br />
zu formulieren, die Schritte für die<br />
Umsetzung zu planen, einen Zeitplan<br />
aufzustellen und die schulinterne Evaluation<br />
vorzubereiten. Das „School<br />
Development Planning Team“ hat die<br />
Aufgabe, die Schulen mit Ideen, den<br />
notwendigen Instr<strong>um</strong>enten und den<br />
Rahmenbedingungen auszustatten.<br />
Die Team-Mitglieder sind für diese<br />
Aufgabe speziell vorbereitet, hierfür<br />
auch komplett freigestellt, über eMail<br />
ständig erreichbar (die Schulen haben<br />
die Garantie, dass alle Anfragen innerhalb<br />
von 48 Stunden beantwortet<br />
sind.). Die ModeratorInnen sind untereinander<br />
vernetzt und haben ihre<br />
Arbeit miteinander koordiniert, <strong>um</strong><br />
sicher zu stellen, dass die Beratungsqualität<br />
nicht von den einzelnen Menschen<br />
abhängt, sondern strukturell<br />
gleichwertig ist. Die Devise lautet:<br />
„Only teachers can make the change.“<br />
Deshalb lassen die Länder, deren<br />
Schulsystem durch kontinuierliche<br />
Qualitätsverbesserung geprägt ist, ihren<br />
Schulen große Gestaltungsfreiräu-<br />
me, bereiten die Lehrerinnen und Lehrer<br />
intensiv auf die neuen Aufgaben vor<br />
und stellen ausreichende zusätzliche<br />
Mittel zur Verfügung. Alle drei Voraussetzungen<br />
fehlen in Rheinland-Pfalz.<br />
Der OECD-Bildungsforscher Andreas<br />
Schleicher verglich bei der bildungspolitischen<br />
Konferenz der <strong>GEW</strong> „Paradigmenwechsel<br />
nötig“ ebenfalls die<br />
deutsche Reaktion auf PISA mit der in<br />
anderen Ländern, in denen seiner Meinung<br />
nach die Debatte deutlich konstruktiver<br />
verläuft. Nirgends sei das<br />
Bedürfnis, Bildungsreformen nur unter<br />
der Prämisse der unmittelbaren<br />
Umsetzbarkeit zu diskutieren, so groß<br />
wie hier zu Lande. „Natürlich braucht<br />
man kurzfristige Reformen“, sagte<br />
Schleicher. „Aber was wir vor allem<br />
brauchen, ist eine Klärung der Fernziele<br />
- unabhängig davon, ob sie<br />
übermorgen realisiert werden können.“ 2<br />
Vielleicht sollte das Ministeri<strong>um</strong> nicht<br />
nur den Schulen ein Qualitätsprogramm<br />
verordnen, sondern sich selbst<br />
den gleichen Kriterien unterwerfen.<br />
Learning by doing wäre ein wichtiger<br />
Effekt, aber selbstverständlich könnte<br />
Kundenorientierung und Qualitätskontrolle<br />
auch bei der Schulaufsicht<br />
nicht schaden.<br />
Bettina Gerhard<br />
Anmerkungen:<br />
1 Z<strong>um</strong> Beispiel in dem Film von Reinhard Kahl:<br />
Die Stille Revolution. Das Durham Board of<br />
Education, Ontario, Kanada. V erlag Bertelsmann<br />
Stiftung. ISBN 3-89<strong>20</strong>4-<strong>28</strong>9-6<br />
2 zit. nach Frankfurter Rundschau vom <strong>28</strong>. November<br />
<strong>20</strong>02<br />
Bildungspolitik<br />
5
Bildungspolitik<br />
Würde sich Beck <strong>um</strong> die Bildung wie <strong>um</strong> den FCK kümmern...<br />
<strong>GEW</strong>-Mitglieder fordern Rücknahme der Verschlechterungen im Bildungswesen<br />
Trotz Vorweihnachtsstress, trotz<br />
Jahresabschlussfeiern in den Bildungseinrichtungen:<br />
Über 400<br />
<strong>GEW</strong>-Mitglieder verlangten unter<br />
dem Motto „Jetzt reicht´s!“ am 18.<br />
Dezember vergangenen Jahres, dem<br />
Jahrestag der Verkündigung des<br />
„Maßnahmenpaketes“ von 1992, in<br />
Mainz im Eltzer Hof die Einhaltung<br />
des einstigen Versprechens der<br />
Landesregierung, die Arbeitszeitverlängerungen<br />
auf zehn Jahre zu befristen.<br />
Dass die Veranstaltung zu einem vollen<br />
Erfolg wurde, lag auch an der<br />
gelungenen Regie: Plakate und andere<br />
Materialien der <strong>GEW</strong>-Kampagne<br />
„Rettet die Bildung“ sowie eine<br />
Power-Point-Präsentation visualisierten<br />
die <strong>GEW</strong>-Forderungen, denen<br />
sich die TeilnehmerInnen auf Unterschriftenlisten<br />
anschließen konnten.<br />
Die Moderatorin Margarete Ruschmann<br />
vom SWR sorgte mit Interviews<br />
der RednerInnen dafür, dass<br />
die Protestversammlung nicht nur<br />
aus der Aneinanderreihung von<br />
Statements bestand. Großen Beifall<br />
gab es für die satirischen Anmerkungen<br />
des kurpfälzischen Kabarettisten<br />
Hans-Peter Schwöbel und die musikalischen<br />
Beiträge der SchülerInnen-<br />
Bigband der IGS Bretzenheim, die<br />
eindrucksvoll bewiesen, was Schule<br />
zu leisten vermag.<br />
In einer engagierten Eingangsrede<br />
stellte der <strong>GEW</strong>-Landesvorsitzende<br />
Tilman Boehlkau dar, was den Beschäftigten<br />
durch Eingriffe in die<br />
Besoldung noch alles droht: unter<br />
anderem ein 10%-Abschlag beim<br />
Gehalt sowie die Kürzung bzw. Streichung<br />
des Urlaubs- und des Weihnachtsgeldes.<br />
Im Zusammenhang<br />
mit der Tarifrunde <strong>20</strong>02/<strong>20</strong>03 wies<br />
er auf ein Nov<strong>um</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
hin: Warnstreiks nach Aufrufen der<br />
<strong>GEW</strong> an acht Kindertagesstätten<br />
und sechs Ganztagssonderschulen.<br />
Boehlkau z<strong>um</strong> Anlass der Protestversammlung:<br />
„Mit der Streichungsund<br />
Kürzungsorgie in den 90-iger<br />
Jahren, durch die nach unseren Berechnungen<br />
etwa 6.500 Stellen eingespart<br />
wurden, haben die Lehrkräfte<br />
ihren Beitrag zur Sanierung des Landeshaushalts<br />
schon mehrfach geleistet.“<br />
Das „ständige Draufsatteln“<br />
durch Kürzung der Stundentafeln,<br />
Streichung der Altersermäßigung,<br />
Abschaffung bzw. Kürzung der Drittelpauschale,Arbeitszeitverlängerungen<br />
usw. hätte die LehrerInnen<br />
zutiefst demotiviert. Zusätzliche<br />
Qualität ließe sich nur entwickeln,<br />
wenn die Arbeitsbedingungen verbessert<br />
würden.<br />
Der <strong>GEW</strong>-Landesvorsitzende kritisierte<br />
auch die Reaktionen der Politik<br />
auf die verheerenden Ergebnisse<br />
der PISA-Studie: „Was fällt der Bildungsbürokratie<br />
ein? Nichts außer<br />
Leistungstests, Sprachtests, Vergleichsarbeiten,<br />
Qualitätsprogramme<br />
entwickeln, sprich: Mehrarbeit und<br />
Mehrbelastung für die Lehrerinnen<br />
und Lehrer.“<br />
Auf die Ursachen der Haushaltslö-<br />
Fotos: Bernhard Clessienne<br />
6 <strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 /<strong>20</strong>03
cher, mit denen die Arbeitgeber ihr<br />
Verlangen nach einer Nullrunde begründen,<br />
ging der DGB-Landesvorsitzende<br />
Dietmar Muscheid ein.<br />
Schuld seien Fehler bei den Unternehmenssteuerreformen,<br />
die dazu<br />
geführt hätten, dass große Unternehmen<br />
praktisch keine Steuern mehr<br />
zahlten. Auch die geplante Zinsertragssteuer<br />
sei ein Geschenk an finanziell<br />
Starke. Wie Boehlkau kritisierte<br />
Muscheid ebenfalls die angestrebten<br />
Öffnungsklauseln sowie die<br />
„Giftliste“ der Landesregierung:<br />
„Das ist Gift für die Motivation.“<br />
Die Beschäftigten im Bildungswesen<br />
leisteten gute Arbeit und hätten auch<br />
das Recht auf gute Bezahlung. Der<br />
DGB-Landesvorsitzende abschließend:<br />
„Wer wie die Landesregierung<br />
Versprechen nicht einhält, muss sich<br />
nicht über Politikverdrossenheit<br />
wundern.“<br />
Für die Landesschülervertretung<br />
sprach deren „Außenreferentin“ Stephanie<br />
Mayfield, Gymnasiastin aus<br />
Speyer. Labsal auf gequälte Lehrerseelen,<br />
die sich als PädagogInnen<br />
und nicht als Vergleichstestcoachs<br />
verstehen, war ihre Antwort auf die<br />
Frage der Moderatorin, wie die<br />
<strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 /<strong>20</strong>03<br />
Wunschlehrkraft aus SchülerInnenperspektive<br />
aussehe: motiviert sein<br />
und auf die SchülerInnen eingehen<br />
müsse diese, Kritik annehmen, den<br />
SchülerInnen helfen, ihre Begabungen<br />
und Schwächen kennen zu lernen,<br />
sich nicht auf das frontalunterrichtliche<br />
Vermitteln und Abprüfen<br />
von Wissen beschränken. Mayfield:<br />
„Von daher sind unsere Anforderungen<br />
an Lehrkräfte weitaus größer als<br />
die des Ministeri<strong>um</strong>s.“ Die Schülervertretung<br />
unterstütze die <strong>GEW</strong>-<br />
Forderungen nach weniger Wochenstunden<br />
und kleineren Klassen:<br />
„Schülerinnen und Schüler haben<br />
nichts von gestressten Lehrkräften,<br />
die keine Zeit haben, auf sie einzugehen.“<br />
Dass Heinz Putzhammer vom DGB-<br />
Bundesvorstand als <strong>GEW</strong>-Veteran<br />
genau weiß, wo die Lehrkräfte der<br />
Schuh drückt, zeigte sich gleich zu<br />
Anfang seiner Rede. Das <strong>GEW</strong>-Motto<br />
„Rettet die Bildung“ wandelte er<br />
<strong>um</strong> in „Rettet die Bildung vor den<br />
Kultusministerien“. Das einstige<br />
<strong>GEW</strong>-Bundesvorstandsmitglied:<br />
„Unser schlechtes Abschneiden bei<br />
PISA ist das Ergebnis von <strong>20</strong> Jahren<br />
Sparen und Kürzen im Bildungswe-<br />
sen.“ Wie Dietmar Muscheid kritisierte<br />
Putzhammer „Steuergeschenke<br />
an die, die es gar nicht nötig haben.“<br />
Es sei nicht hinnehmbar, dass<br />
Unternehmen auf eine gute Infrastruktur<br />
in Deutschland pochten,<br />
aber keine Steuern zahlen wollten.<br />
Angesichts von 10 Billionen privaten<br />
Vermögens halte der DGB auch<br />
an der Forderung nach einer Wiedereinführung<br />
der Vermögenssteuer<br />
fest.<br />
Im Zusammenhang mit den PISA-<br />
Ergebnissen stellte Putzhammer<br />
insbesondere das Versagen bei der<br />
Integration von Migrantenkindern<br />
heraus: „Dafür brauchen wir zusätzliche<br />
Stellen für Erzieherinnen und<br />
Lehrkräfte“. Tosenden Beifall gab es<br />
für seine Abschlussbemerkung, die<br />
direkt an den rheinland-pfälzischen<br />
Ministerpräsidenten gerichtet war<br />
und eine Parallele zwischen der misslichen<br />
Situation des 1. FCK und<br />
dem Bildungswesen zog: „Wenn der<br />
FCK auf einem Abstiegsplatz steht,<br />
fährt Beck gleich hin und setzt alle<br />
Hebel in Bewegung. Das sollte er<br />
auch für das Bildungswesen tun!“<br />
Günter Helfrich<br />
Wir fordern:<br />
• Qualifizierter Unterricht mit qualifiziertem<br />
Personal<br />
• Qualität hat ihren Preis – deshalb keine<br />
Absenkung (Öffnungsklausel) der<br />
Bezahlung von Lehrkräften<br />
• Freiwerdende Ressourcen für Verbesserungen<br />
im Bildungsbereich nutzen<br />
• Verringerung der Arbeitsbelastung<br />
durch Rücknahme der Arbeitszeitverlängerungen<br />
• Reduzierung der Unterrichtsverpflichtung<br />
der Lehrkräfte für Fachpraxis und<br />
der Pädagogischen Fachkräfte<br />
• Fördern statt Auslesen<br />
• Kleinere Klassen<br />
• Wiedereinführung der Altersermäßigung<br />
als Beitrag zur LehrerInnen-<br />
Gesundheit<br />
• Personalreserve in allen Schularten<br />
statt Aushilfsverträge<br />
• Mehr Lehrkräfte für Schulen mit besonderen<br />
Aufgaben und Belastungen<br />
• Entlastungsstunden auch für Grundschulen<br />
• Bessere Arbeitsbedingungen für Schulleitungen<br />
und Verwaltungskräfte<br />
Bildungspolitik<br />
7
Schulen<br />
Ein Tag in der Ganztagsschule in Wörth<br />
<strong>GEW</strong>- und DGB-VertreterInnen besuchten die Regionale Schule<br />
Am 8. Januar besuchten Eva-Maria<br />
Stange, Bundesvorsitzende der<br />
<strong>GEW</strong>, Dietmar Muscheid, Vorsitzender<br />
des DGB-Bezirks West, Jutta<br />
Stephany, Mitglied des HPR<br />
GHS/Reg.Sch. und Tilman Boehlkau,<br />
Vorsitzender der <strong>GEW</strong> Rheinland-Pfalz,<br />
die neue Ganztagsschule<br />
in Wörth am Rhein.<br />
Der Vormittag war geprägt von Gesprächen<br />
mit der Schulleitung, der<br />
Personalratsvorsitzenden und ElternvertreterInnen.<br />
Schulleiter Joachim<br />
Paul gab einen Einblick in die Entwicklung<br />
der Schule von einer verbundenen<br />
Grund- und Hauptschule<br />
über die Hauptschule hin zu einer<br />
der ersten Regionalen Schulen im<br />
Land Rheinland-Pfalz (Start 1992)<br />
und der Entwicklung zu einer Ganztagsschule<br />
neuer Form seit Beginn<br />
des Schuljahres <strong>20</strong>02/<strong>20</strong>03. Konrektor<br />
Fritz Hock informierte über die<br />
organisatorischen Rahmenbedingungen<br />
sowie die Gliederung der<br />
neuen Ganztagsschule (in der 5. und<br />
6. Klasse je drei Klassen in der verpflichtenden<br />
sowie in den Klassenstufen<br />
7 - 10 in der neuen freiwilligen<br />
Form). Es sei dabei hervorgehoben,<br />
dass die Lern- und Förderstunden<br />
ausschließlich von Lehrkräften<br />
betreut werden. Der Einsatz von<br />
Lehrkräften liegt am Nachmittag bei<br />
V.r.n.l.: Jutta Stephany, Mitglied im Hauptpersonalrat Grund-, Haupt- und<br />
Regionale Schulen, Tilman Boehlkau, Vorsitzender der <strong>GEW</strong>-Rheinland-Pfalz,<br />
Joachim Paul, Schulleiter der Regionalen Schule / Ganztagsschule Wörth<br />
60%, für eine neue Ganztagsschule<br />
damit ungewöhnlich hoch.<br />
Die Personalratsvorsitzende Sonja<br />
Schalck verdeutlichte das hohe Engagement<br />
der KollegInnen bei der<br />
Erstellung des Konzepts sowie der<br />
täglichen Arbeit in der neuen Ganztagsschule.<br />
Die ElternvertreterInnen<br />
gaben einen anschaulichen Bericht<br />
darüber, was sich im täglichen Ablauf<br />
ihrer Kinder z<strong>um</strong> Positiven gewendet<br />
hat („Die Kinder kommen<br />
entspannter nach Hause. Der Stress<br />
für Eltern und Schüler bei den Hausaufgaben<br />
ist fast gänzlich entfallen.“).<br />
Während des Inforamtionsaustauschs<br />
wurde u. a. festgestellt, dass<br />
es an hinreichender rä<strong>um</strong>licher Ausstattung<br />
fehlt, da die Stadt Wörth<br />
montan nicht genügend Geld aufbringen<br />
kann, <strong>um</strong> das Projekt in dem<br />
Maße zu unterstützen, wie es notwendig<br />
wäre. Es wurde kritisiert, dass<br />
das Land den Trägern der neuen<br />
Ganztagsschulen keine Mittel zur<br />
Verfügung stellt, <strong>um</strong> die notwendigen<br />
rä<strong>um</strong>lichen Voraussetzungen zu<br />
schaffen bzw. zu garantieren. Dies<br />
zeigte sich ganz deutlich an fehlenden<br />
Freizeiträ<strong>um</strong>en für die SchülerInnen.<br />
Auch für die LehrerInnen<br />
fehlt es zurzeit noch an geeigneten<br />
Arbeits- und Teamrä<strong>um</strong>en. Wer die<br />
Ganztagsschule will (so wie das Land<br />
und verschiedene<br />
Schulträger),<br />
der muss auch<br />
gewährleisten,<br />
dass die notwendigen<br />
Um- und<br />
Erweiterungsbauten<br />
bis z<strong>um</strong><br />
Start der Ganztagsschuleerledigt<br />
sind. Es<br />
kann aber festgehaltenwerden,<br />
dass die<br />
Stadt Wörth die<br />
neue Ganztags-<br />
schule nach ihrenMöglichkeiten<br />
fördert.<br />
Die Teilnehme-<br />
rInnen nahmen zusammen mit den<br />
Fünft- und Sechstklässlern das Mittagessen<br />
ein, das von der Kantine<br />
von DaimlerChrysler geliefert wird.<br />
Jeden Tag stehen zwei Menüs zur<br />
Auswahl. Die SchülerInnen und<br />
LehrerInnen verfügen über eine<br />
„School-Card“, über die am Ende<br />
des Monats die Abrechnung für das<br />
Mittagessen gebucht wird (Kosten je<br />
Tag: 3,00 EUR).<br />
Der Nachmittag wurde von den<br />
<strong>GEW</strong>- und DGB-Gästen dazu genutzt,<br />
<strong>um</strong> sich am Ergänzungsunterricht<br />
bzw. an Fördermaßnahmen zu<br />
beteiligen sowie an verschiedenen<br />
Projekten teilzunehmen, die jeden<br />
Mittwoch Nachmittag von überwiegend<br />
außerschulischem Personal<br />
angeboten werden.<br />
Eva-Maria Stange, Bundesvorsitzende<br />
der <strong>GEW</strong>, beim Besuch der Regionalen<br />
Schule / Ganztagsschule Wörth<br />
Eva-Maria Stange stellte z<strong>um</strong> Abschluss<br />
des Schulbesuchs fest: „Ganztagsschulen<br />
stellen einen Schritt in<br />
die richtige Richtung dar, <strong>um</strong> den<br />
Herausforderungen, die an das Bildungssystem<br />
gestellt werden, zu entsprechen.<br />
Allerdings muss sichergestellt<br />
werden, dass die notwendigen<br />
Ressourcen zur Verfügung stehen.<br />
Wenn die Wirtschaft, das Handwerk<br />
und die Industrie immer wieder die<br />
Ganztagsschule fordern, dann müssen<br />
sie auch bereit sein, den Staat<br />
durch Steuereinnahmen in die Lage<br />
8 <strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 /<strong>20</strong>03
zu versetzen, das Projekt flächendeckend<br />
als verbindliche Ganztagsschule<br />
und nicht als Betreuungsschule<br />
einzuführen. Die Stadt Wörth<br />
könnte mehr leisten, wenn DaimlerChrysler<br />
- als ehemals größter<br />
Steuerzahler - mittlerweile nicht<br />
z<strong>um</strong> Subventionsempfänger geworden<br />
wäre und somit die Steuermindereinnahmen<br />
für die Kommune<br />
dramatische Auswirkungen angenommen<br />
haben.“<br />
Weiter sagte die Bundesvorsitzende:<br />
„Das hohe Engagement der Schulleitung,<br />
des Personalrates und des<br />
<strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 /<strong>20</strong>03<br />
Personals ist besonders hervorzuheben.<br />
Das außerschulische Personal<br />
stellt eine Bereicherung für den<br />
Schulalltag dar. Ich gehe davon aus,<br />
dass diese Personen auch professionell<br />
arbeiten, allerdings sind sie (in<br />
aller Regel) keine ausgebildeten PädagogInnen<br />
und können von daher<br />
das professionelle Personal nicht ersetzen.“<br />
Abschließend stellten die GewerkschaftsvertreterInnen<br />
fest, dass sich<br />
der Tag gelohnt hat - wohlwissend,<br />
dass nicht alle neuen Ganztagsschulen<br />
im Land so gute Startbedingun-<br />
gen hatten und haben wie die Regionale<br />
Schule in Wörth. „Theorie ist<br />
die eine Seite, Praxis die andere. Jetzt<br />
kann ich mitreden, auch wenn ich<br />
nur einen punktuellen Einblick in<br />
eine Ganztagsschule erhalten habe.<br />
Andere Ganztagsschulen laufen<br />
anders und unter schwierigeren Bedingungen,<br />
das ist mir bewusst,“ sagte<br />
der DGB-Vorsitzende Dietmar<br />
Muscheid und bedankte sich bei der<br />
Schulleitung und den KollegInnen<br />
für die Zeit, die sie uns zur Verfügung<br />
standen.<br />
Tilman Boehlkau<br />
<strong>GEW</strong>-Umfrage an „neuen Ganztagsschulen“<br />
beweist erheblichen Nachbesserungsbedarf<br />
Auf reges Interesse bei den Medien<br />
stieß eine Pressekonferenz der <strong>GEW</strong><br />
Rheinland-Pfalz am 17. Januar, bei<br />
der Tilman Boehlkau die Ergebnisse<br />
der <strong>GEW</strong>-Umfrage zur Situation<br />
an den neuen Ganztagsschulen vorstellte.<br />
Boehlkau einleitend: „Der Start der<br />
neuen Ganztagsschulen ist im Großen<br />
und Ganzen gelungen, allerdings<br />
nur, weil sich das Personal über die<br />
Maßen hinaus engagiert und zahlreiche<br />
Überstunden sowohl in den Ferien<br />
als auch während der Schulzeit<br />
in Kauf genommen hat.“ Dies<br />
jedenfalls gehe aus den Rückmeldungen<br />
der Personalräte hervor, die die<br />
Adressaten der <strong>GEW</strong>-Befragung waren.<br />
„Der im Prinzip positive Tenor der<br />
Rückmeldungen kann allerdings<br />
nicht verdecken, dass es Probleme bei<br />
der Personalausstattung sowie dem<br />
Ra<strong>um</strong>programm gibt,“ stellte der<br />
<strong>GEW</strong> Landesvorsitzende fest. Nicht<br />
zufriedenstellend geregelt seien Vertretungen<br />
bei Krankheitsfällen, nicht<br />
genügend Lehrkräfte für Differenzierungen,<br />
damit nicht zu große Lerngruppen<br />
entstehen, sowie nicht ausreichendes<br />
Personal für die Mittagsbetreuung<br />
und z. T. nicht ausreichend<br />
qualifiziertes Personal. Bemängelt<br />
wurde laut <strong>GEW</strong>-Umfrage<br />
in vielen Fällen das Fehlen von zusätzlichen<br />
Stunden für Verwaltungskräfte<br />
(Schulsekretärinnen und<br />
Hausverwalter) an den Schulen. Boehlkau<br />
forderte für die neuen Ganztagsschulen<br />
eine Lehrerfeuerwehr<br />
(Vertretungsreserve) einzurichten,<br />
damit das Ganztagsschulprogramm<br />
auch bei Stundenausfall realisiert<br />
werden könne. Auch eine Erhöhung<br />
der Verwaltungsstunden sei dringend<br />
erforderlich.<br />
Eine besondere Schwachstelle der<br />
neuen Ganztagsschulen seien fehlende<br />
Rä<strong>um</strong>e, <strong>um</strong> die zusätzlichen Angebote<br />
ohne Einschränkungen<br />
durchführen zu können. Benannt<br />
wurden insbesondere Küchen- und<br />
Speiserä<strong>um</strong>e, Aufenthalts-, Hausaufgaben-,<br />
Freizeit-, Projekt- und Ruherä<strong>um</strong>e<br />
für die GanztagsschülerInnen<br />
sowie Arbeits- und Ruherä<strong>um</strong>e<br />
für die Lehrkräfte. Der <strong>GEW</strong>-Landes-vorsitzende<br />
kritisierte, „dass das<br />
Land die Städte und Gemeinden<br />
nicht mit finanziellen Mitteln unterstützt,<br />
<strong>um</strong> die notwendigen rä<strong>um</strong>lichen<br />
Voraussetzungen zu schaffen<br />
bzw. zu garantieren.“<br />
Ein besonders hoher Nachbesserungsbedarf<br />
bestehe bei der Organisation<br />
des Ganztagsangebotes: An<br />
80% der Schulen werde das „Ganztagsangebot“<br />
nur am Nachmittag als<br />
ergänzendes Angebot unterbreitet,<br />
Schulen<br />
nur an 9,7% der Schulen handele<br />
es sich <strong>um</strong> echten Ganztagsunterricht,<br />
d. h., der Unterricht und<br />
Zusatzangebote werden rhythmisiert,<br />
also sinnvoll auf Vor- und<br />
Nachmittag verteilt durchgeführt.<br />
„Gerade diese Form der Ganztagsschule<br />
stellt die Schule der Zukunft<br />
dar, wie sie auch in den führenden<br />
PISA-Nationen üblich ist,“ stellte<br />
Boehlkau fest.<br />
Kritik übte der <strong>GEW</strong>-Landesvorsitzende<br />
an der Praxis, Pädagogische<br />
Fachkräfte oft nur mit befristeten<br />
Verträgen einzustellen. „Es ist<br />
sicherzustellen, dass nur in Ausnahmefällen<br />
befristete Verträge angeboten<br />
werden, nämlich dann, wenn<br />
die Befristung durch ein zeitlich<br />
eindeutig begrenztes Projekt begründet<br />
ist,“ forderte Boehlkau.<br />
„Die Ganztagsschule in neuer Form<br />
benötigt - trotz positiver Ansätzenoch<br />
erhebliche Nachbesserungen<br />
von Seiten der Politik, damit sie<br />
sich zu einer qualitativ guten Ganztagsschule<br />
entwickelt und nicht<br />
eine Aufbewahrungseinrichtung<br />
wird!“, sagte Boehlkau z<strong>um</strong> Abschluss.<br />
Im folgenden Artikel werden die<br />
Ergebnisse der Umfrage im einzelnen<br />
vorgestellt.<br />
pm-gew<br />
9
Schulen<br />
Ganztagsschule - gelungen oder nicht?<br />
Zusätzliche Belastungen für Personal<br />
Von den z<strong>um</strong> Schuljahr <strong>20</strong>02/<strong>20</strong>03 gestarteten 81 neuen Ganztagsschulen<br />
haben sich an der Umfrage der <strong>GEW</strong> Rheinland-Pfalz 41 Schulen beteiligt.<br />
Das entspricht einem Prozentsatz von 50,6 %. Damit kann das Umfrageergebnis<br />
als repräsentativ angesehen werden.<br />
Folgende Schularten beteiligten sich<br />
an der Umfrage:<br />
1. 16 Grundschulen<br />
2. 7 Grund- und Hauptschulen<br />
3. 12 Hauptschulen<br />
4. 5 Regionale Schulen und<br />
5. 1 Realschule<br />
Gefragt wurden die örtlichen Personalräte<br />
der neuen Ganztagsschulen.<br />
Der Fragebogen war aus Sicht einiger<br />
Betroffener zu <strong>um</strong>fangreich und<br />
zu detailliert, für andere wieder<strong>um</strong><br />
nicht genau genug (Frage 2: „Die<br />
SchülerInnen kommen aus den Klassenstufen...“,<br />
hier fehlte der<br />
Hinweis, dass unter die<br />
Klassenstufe die Anzahl der<br />
gemeldeten GTS-SchülerInnen<br />
aufzuschreiben<br />
war!), sodass z<strong>um</strong> Teil Fragen<br />
nicht exakt genug beantwortet<br />
wurden. Auf der<br />
anderen Seite legten einige<br />
Schulen ausführliche Pläne<br />
bei, aus denen hervorgeht,<br />
wie das Nachmittagsangebot<br />
von wem gestaltet und<br />
genutzt wird (Frage 19:<br />
„Folgende zusätzlichen Angebote<br />
- z<strong>um</strong> normalen<br />
‚Halbtagsbetrieb‘ - stellt<br />
unsere Schule den SchülerInnen<br />
zur Verfügung“).<br />
Als Fazit stellen 39 neue<br />
Ganztagsschulen fest: „Der<br />
Start der neuen Ganztagsschule<br />
ist im Großen und Ganzen gelungen“<br />
und begründen dies u. a. wie<br />
folgt: ...“weil sich das Personal über<br />
die Maßen hinaus engagierte und<br />
zahlreiche Überstunden sowohl in<br />
den Ferien als auch während der<br />
Schulzeit in Kauf nahm.“ Eine neue<br />
GTS (HS) schreibt: „Der Start der<br />
neuen Ganztagsschule ist nicht gelungen,<br />
weil noch Organisatorisches<br />
überwiegt, die zusätzliche Belastung<br />
durch Aufsicht, Konferenzen, Be-<br />
sprechungen, Eingrenzung der Freirä<strong>um</strong>e<br />
jedem deutlich spürbar wird.“<br />
Obwohl die große Mehrheit der neuen<br />
Ganztagsschulen die Unterstützungsleistungen<br />
durch z.B. IFB,<br />
LMZ oder ADD positiv bewertete,<br />
wurden unter diesem Punkt folgende<br />
Anmerkungen gemacht (Auswahl):<br />
• Die Zeit zur Errichtung der GTS<br />
war überaus knapp bemessen und<br />
nur durch übermäßigen Einsatz einzuhalten.<br />
• Die Lehrerwochenstunden, die zu-<br />
gewiesen wurden, sollten erhöht werden,<br />
damit kleinere Gruppen gebildet<br />
werden können. Die GTS soll<br />
eine zufriedenstellende Förderung<br />
der Kinder ermöglichen und keine<br />
Aufbewahrungsstätte sein.<br />
• Wir brauchen mehr Anrechnungsstunden.<br />
• Vorhandene Kritik an dem System<br />
der GTS sollte ernst genommen und<br />
eventuelle Änderungen <strong>um</strong>gesetzt<br />
werden.<br />
Auf die Frage der <strong>GEW</strong> Rheinland-<br />
Pfalz, welche Änderungen an den<br />
Rahmenbedingungen noch vorgenommen<br />
werden müssen, damit die<br />
neue GTS gelingt, antworteten die<br />
Schulen sehr differenziert:<br />
• Mehr Personal für die Mittagsbetreuung,<br />
Vertretung bei Krankheitsfällen,<br />
Sach- und Geldzuweisungen<br />
für Spiele und Materialkosten, kleinere<br />
Gruppen;<br />
• Zuweisung von Mehrarbeitsstunden<br />
für die Schreibkraft der Schule<br />
(Schulträger); mehr Sekretärinnen-<br />
Stunden;<br />
• Problemfeld Mittagessen: Zuschuss<br />
für sozial schwache Familien.<br />
• Gut wäre es, wenn nur professionelles<br />
Personal einzustellen wäre (Bezahlung!).<br />
Die Schülerpopulation am<br />
Nachmittag ist schwieriger als<br />
am Vormittag.<br />
• Personalzuweisung für mehr<br />
Differenzierung, besseres<br />
Ra<strong>um</strong>angebot, bessere Ausstattung<br />
mit Lehrmitteln, qualitativ<br />
besseres Angebot in Freizeiterziehung;<br />
• Personalausstattung zu dünn,<br />
Lehrerfeuerwehr für GTS.<br />
• Die Zuweisung von Lehrerwochenstunden<br />
muss deutlich<br />
erhöht werden. Die Klassenmesszahl<br />
muss deutlich gesenkt<br />
werden.<br />
• SchulsozialarbeiterInnen/ErzieherInnen<br />
aus Jugendarbeit<br />
sollten angestellt werden; Angebot<br />
von Supervision für LehrerInnen.<br />
• Ein dickes Minus für die<br />
ADD! Dauernd wechselnde<br />
Ansprechpartner, die sich alle gerade<br />
einarbeiten, falsche Computereintragungen<br />
bei Verträgen, falsche oder<br />
gar keine Honorierung von Zusatzkräften<br />
(z. B. StudentInnen bei der<br />
Essensbetreuung).<br />
• Mehr Zeit für Verwaltungsaufgaben<br />
und Teambesprechungen!<br />
Eine Schwachstelle der neuen Ganztagsschule<br />
ist die rä<strong>um</strong>liche Ausstattung<br />
bzw. bauliche Maßnahmen, die<br />
ergriffen werden müssten, <strong>um</strong> die<br />
10 <strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 /<strong>20</strong>03
GTS zu realisieren:<br />
23 Schulen forderten eine verbesserte<br />
rä<strong>um</strong>liche Ausstattung, 19 Schulen<br />
waren mit dem Ra<strong>um</strong>programm einverstanden,<br />
forderten aber Nachbesserungen,<br />
falls die Schule weitere<br />
Ganztagsgruppen erhält. Die Schulen<br />
forderten insbesondere folgende<br />
baulichen Veränderungen bzw. Ergänzungen,<br />
weil die Voraussetzungen<br />
für die GTS sonst nicht gegeben<br />
wären:<br />
• Einrichtung einer Küche, Umbau<br />
von Rä<strong>um</strong>en zu einer Mensa bzw.<br />
Speisera<strong>um</strong>,<br />
• Ruhera<strong>um</strong> für Lehrkräfte, Bürorä<strong>um</strong>e<br />
für GTS-Kräfte,<br />
• eigene Rä<strong>um</strong>e für GanztagsschülerInnen<br />
(z.B. Aufenthaltsrä<strong>um</strong>e,<br />
Hausaufgabenra<strong>um</strong>, Computerra<strong>um</strong>,<br />
Freizeiträ<strong>um</strong>e, Musikra<strong>um</strong>,<br />
Ruhera<strong>um</strong> für SchülerInnen ...),<br />
• Gruppenrä<strong>um</strong>e (wir nutzen die<br />
Flure!),<br />
• An- bzw. Ausbau von Sporthallen.<br />
Die Angebote an den verschiedenen<br />
Ganztagsschulen sind wie folgt organisiert:<br />
An 33 Schulen gelten die<br />
zusätzlichen Angebote nur am Nachmittag,<br />
Angebote an Vor- und Nachmittagen<br />
bieten nur vier Ganztagsschulen.<br />
Die beiden Formen nebeneinander<br />
existieren nur an vier Schulen.<br />
35 der Ganztagsschulen werden mittags<br />
mit Essen beliefert, an 5 Schulen<br />
muss das Essen außerhalb der<br />
<strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 /<strong>20</strong>03<br />
Schule eingenommen werden, nur<br />
eine der 41 Schulen bietet selbst gekochtes<br />
Mittagessen für die SchülerInnen<br />
an.<br />
Ein weiterer Kritikpunkt aus den<br />
neuen Ganztagsschulen stellt die<br />
Personalzuweisung dar: Nur an 24<br />
der 41 Schulen entspricht die Personalzuweisung<br />
den Vorgaben des<br />
Ministeri<strong>um</strong>s für Bildung, Frauen<br />
und Jugend (MBFJ). <strong>20</strong> Schulen<br />
sind der Meinung, dass die Personalzuweisung<br />
ausreicht, 13 sind mit<br />
der Personalzuweisung nicht zufrieden.<br />
Nur die Hälfte der neuen Ganztagsschulen<br />
ist mit der Sachmittelzuweisung<br />
von Seiten des Trägers zufrieden.<br />
Die <strong>GEW</strong> Rheinland-Pfalz hat in<br />
ihrem Beschluss zur Ganztagsschule<br />
vom<br />
29. August <strong>20</strong>01 und 23. Oktober<br />
<strong>20</strong>02 als eine wichtige Voraussetzung<br />
z<strong>um</strong> Gelingen der neuen Ganztagsschulen<br />
festgestellt, dass das zusätzliche<br />
pädagogische Personal<br />
grundsätzlich mit unbefristeten Stellen<br />
anzustellen ist. Die 41 neuen<br />
Ganztagsschulen, die der <strong>GEW</strong> die<br />
Fragebogen zurücksandten, meldeten,<br />
dass 22 der Verträge für Pädagogische<br />
Fachkräfte befristet sind,<br />
dagegen wurden 15 unbefristete<br />
Stellen eingerichtet.<br />
31 Schulen haben hinreichend qualifiziertes<br />
Personal gefunden.<br />
Tilman Boehlkau<br />
Bücherspalte<br />
<strong>GEW</strong>-Handbuch für<br />
Lehrerinnen und Lehrer<br />
4. Auflage 1998 Loseblattausgabe<br />
- Gesamtwerk mit Spezialordner<br />
3. überarbeitete Fassung<br />
Stand Juni <strong>20</strong>01<br />
Das rund 1.400 Seiten starke<br />
Werk enthält alle wichtigen Gesetze<br />
und Verwaltungsvorschriften<br />
für den Schulbereich in<br />
Rheinland-Pfalz.<br />
Mitglieder: 19,90 Euro<br />
Nichtmitglieder: 31,00 Euro<br />
jeweils zzgl. Porto<br />
BAT/BAT-O<br />
Textfassung mit Erläuterungen<br />
392 Seiten, 8.Aufl. <strong>20</strong>02<br />
Euro 5,60 zzgl. Porto<br />
Rund <strong>um</strong>s Geld im öffentlichen<br />
Dienst<br />
Der Ratgeber mit den praktischen<br />
Tipps und wichtigen Informationen<br />
<strong>um</strong>s Geld für Beschäftigte<br />
im öffentlichen Dienst<br />
260 Seiten, Aufl. <strong>20</strong>02<br />
Euro 2,10 zzgl. Porto<br />
111 Tipps zu Sozialleistungen<br />
DGB-Broschüre mit Tipps für<br />
Erwerbstätige, Arbeitslose oder<br />
allein Erziehende zu Leistungen<br />
wie Arbeitslosengeld, Wohngeld,<br />
Sozialhilfe u.v.m.<br />
185 Seiten, 2. Aufl. <strong>20</strong>02<br />
Euro 4,90 zzgl. Porto<br />
Bestellungen an:<br />
<strong>GEW</strong> Rheinland-Pfalz<br />
Neubrunnenstr. 8 · 55116 Mainz<br />
Klassenfahrten nach Berlin<br />
(incl. Transfer, Unterkunft,<br />
Programmgestaltung nach Absprache).<br />
Broschüre anfordern bei:<br />
Biss, Freiligrathstr. 3, 10967 Berlin,<br />
Tel. (030) 6 93 65 30<br />
Psychotherapeutische Praxis<br />
Dipl.-Psychologe H. von Vangerow<br />
• Beihilfeberechtigte<br />
c/o Euteneuer, Kurfürstemstr. 87a<br />
56068 Koblenz T: 0178 / 392 71 36<br />
Schulen<br />
11
Schulen<br />
Ministeri<strong>um</strong> erfüllt endlich Forderung der <strong>GEW</strong><br />
„Die <strong>GEW</strong> begrüßt die Entscheidung<br />
des Ministerrates in seiner<br />
Haushaltsklausur, alle 1.340 GrundschullehrerInnen,<br />
die noch in 3/4-<br />
Zwangsteilzeit-Stellen beschäftigt<br />
sind, in einem Stufenplan bis <strong>20</strong>04<br />
auf volle Planstellen zu übernehmen!“,<br />
sagte der <strong>GEW</strong>-Landesvorsitzende<br />
Tilman Boehlkau vor der Presse.<br />
Damit habe die Landesregierung<br />
nun endlich die schon seit zwei Jahren<br />
erhobene Forderung der <strong>GEW</strong><br />
nach Gleichbehandlung der GrundschullehrerInnen<br />
erfüllt. „Während<br />
die Lehrkräfte der anderen Schularten<br />
ab dem laufenden Schuljahr volle<br />
Planstellen erhalten, wurden<br />
GrundschullehrerInnen weiterhin<br />
mit 3/4-Teilzeitverträgen eingestellt.<br />
Das führte dazu, dass eine Reihe von<br />
qualifizierten Kräften - z<strong>um</strong> Teil<br />
während des laufenden Schuljahres<br />
- in Nachbarbundesländer abwanderten,<br />
weil sie dort volle Planstellen<br />
angeboten erhielten,“ stellte<br />
Boehlkau fest. „Die Folge hiervon<br />
war, dass einige Stellen im Grundschulbereich<br />
nicht besetzt werden<br />
konnten oder nachträglich vakant<br />
wurden.“<br />
Boehlkau forderte das Ministeri<strong>um</strong><br />
für Bildung, Frauen und Jugend auf,<br />
auch den als Vertretungsreserve eingestellten<br />
Lehrkräften an Grundschulen<br />
die gleichen Bedingungen<br />
anzubieten, d. h. diesen LehrerInnen<br />
Stellen in vollem Umfang zur Verfügung<br />
zu stellen. „Wenn dies nicht<br />
gleichzeitig <strong>um</strong>gesetzt wird, dann<br />
werden ka<strong>um</strong> noch Lehrkräfte zu finden<br />
sein, die die schwierige Arbeit<br />
eines Feuerwehrlehrers, einer Feuerwehrlehrerin<br />
auf sich nehmen,“ sagte<br />
der <strong>GEW</strong>-Landesvorsitzende. Die<br />
Vertretungssituation an den Grundschulen<br />
gäbe heute schon Anlass zur<br />
Sorge, weil nicht alle Vertretungsstellen<br />
besetzt werden könnten. „So<br />
müssen zurzeit Schulen auch auf Personen<br />
zurückgreifen, die keine bzw.<br />
keine volle LehrerInnenausbildung<br />
haben. Diese Praxis darf nicht wei-<br />
CDU: Längst überfälliger Schritt<br />
Theater satt<br />
Als „längst überfälligeEntscheidung“<br />
bezeichnete<br />
der bildungspolitische<br />
Sprecher der<br />
CDU-Landtagsfraktion,<br />
Josef Keller,<br />
die Ankündigung<br />
der SPD/<br />
FDP-Landesregierung,<br />
auch<br />
Grundschullehrerinnen<br />
und<br />
Deutscher Spitzenreiter - und besser als Finnland - ist die Wiesbadener<br />
Helene-Lange-Schule, seit 1986 integrierte Gesamtschule.<br />
Noten gibt es hier erst ab der 7. Klasse, dafür aber den Offenen<br />
Unterricht, viel Kombinationen von Theorie und Praxis, SchülerInnen<br />
präsentieren ihre Ergebnisse nach außen, putzen ihre Rä<strong>um</strong>e<br />
selbst und finanzieren mit dem Ersparten Theaterpädagogen<br />
für den Unterricht.<br />
Kennzeichnend ist der hohe Anspruch, den SchülerInnen wie<br />
Lehrkräfte an sich stellen. ly<br />
Grundschullehrern eine volle Stelle<br />
anzubieten.<br />
Josef Keller: „Die von den Lehrerverbänden<br />
und der CDU schon seit langem<br />
geforderte Maßnahme kommt viel<br />
zu spät. Viele hochqualifizierte Grundschullehrerinnen<br />
und -lehrer sind in<br />
andere Bundesländer abgewandert, wo<br />
sie eine volle Beamtenstelle erhalten<br />
haben.<br />
Besonders nachteilig für die rheinlandpfälzischen<br />
Schulen ist, dass darunter<br />
sehr viele Lehrerinnen und Lehrer mit<br />
ter <strong>um</strong> sich greifen, denn für qualifizierten<br />
Unterricht ist qualifiziertes<br />
Personal erforderlich“, so der <strong>GEW</strong>-<br />
Landesvorsitzende.<br />
Auf Ablehnung stößt bei der <strong>GEW</strong><br />
die Aussetzung der Leistungsprämie/<br />
Leistungszulage durch den Ministerrat.<br />
„Nach den gesetzlichen Vorschriften<br />
handelt es sich bei dem hierfür<br />
zur Verfügung stehenden Geld <strong>um</strong><br />
einen Bestandteil der Besoldung. Die<br />
KollegInnen haben die finanzielle<br />
Grundlage für die Prämie bzw. die<br />
Zulage selbst erarbeitet“, stelle Boehlkau<br />
fest und forderte für den Bereich<br />
der Schulen wiederholt die Umwandlung<br />
dieser Mittel in Planstellen. „Die<br />
Schulen des Landes brauchen dringend<br />
eine Vertretungsreserve in allen<br />
Schularten, wie die Ergebnisse der<br />
Umfrage der <strong>GEW</strong> gezeigt haben.<br />
Wenn die Leistungsprämie/Leistungszulage<br />
ausgesetzt wird, dient sie<br />
nur der Haushaltskonsolidierung.<br />
Dies kann die <strong>GEW</strong> nicht widerspruchslos<br />
hinnehmen!“, meinte Tilman<br />
Boehlkau. pm-gew<br />
Mangelfächern waren (Musik, Kunst<br />
und Sport).“<br />
Josef Keller: „Jetzt, wo auch eine Lehrerknappheit<br />
im Grundschulbereich<br />
droht und nicht genügend Lehrerinnen<br />
und Lehrer für die Ganztagsschule zur<br />
Verfügung stehen, reagiert die SPD/<br />
FDP-Landesregierung. Das alles hat<br />
mit einer weitsichtigen Politik nichts<br />
zu tun!“<br />
pm-cdu<br />
HLS: Exzellente Ergebnisse<br />
Lesen Punkte<br />
Helene-Lange-Schule 579<br />
PISA-Sieger Finnland 546<br />
Deutschland 484<br />
Naturwissenschaft Punkte<br />
Helene-Lange-Schule 598<br />
PISA-Sieger Finnland 540<br />
Deutschland 487<br />
Mathematik Punkte<br />
PISA-Sieger Japan 557<br />
Helene-Lange-Schule 540<br />
Deutschland 490<br />
Quelle: Der Spiegel 45/<strong>20</strong>02<br />
12 <strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 /<strong>20</strong>03
Klasse(n) Fahrt<br />
Studien- und Schulfahrten z<strong>um</strong> Pauschalpreis. Wählen Sie Ihr nächstes<br />
„Lehrziel“ im Katalog „Studien- und Schulfahrten“. Wir organisieren die komplette Reise. Von der Anfahrt bis zur<br />
Rückfahrt, inklusive Unterkunft, Verpflegung und pädagogischem Programm – kompetent, lehrreich und preisgünstig in<br />
einem Zug. Alles aus einer Hand. Alles mit der Bahn. Also: Schauen Sie doch mal rein in unseren „Studien- und<br />
Schulfahrten“-Katalog.<br />
Ich möchte mehr Infos über ❏ „Studien- und Schulfahrten“ ❏ „Jugendgruppenreisen“ (Zutreffendes ankreuzen)<br />
Bitte schicken Sie den/die gewünschten Katalog/e an folgende Adresse:<br />
Privatanschrift: Schulanschrift:<br />
Name, Vorname: Name der Schule:<br />
Straße, N<strong>um</strong>mer: Straße, N<strong>um</strong>mer:<br />
PLZ, Ort: PLZ, Ort: <strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz<br />
Bestell-Coupon bitte schicken an:<br />
DB Reise&Touristik AG, Mehrtagesschulfahrten und Jugendgruppenreisen Weitere Informationen in allen<br />
Postfach 1701, 76006 Karlsruhe DB ReiseZentren und Reisebüros<br />
E-Mail: schulenjugendkarlsruhe@bahn.de mit DB-Lizenz.<br />
<strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 /<strong>20</strong>03<br />
13
Tarifpolitik<br />
Kindertagesstätten an Warnstreiks beteiligt<br />
Trierer Volksfreund vom 18.12.<strong>20</strong>02<br />
Acht kommunale Kindertagesstätten<br />
sind am 17.12.02 dem Aufruf der<br />
<strong>GEW</strong> zur Beteiligung an den Warnstreiks<br />
der Gewerkschaften des öffentlichen<br />
Dienstes gefolgt. An Einrichtungen<br />
in Wörrstadt, Carlsberg,<br />
Kriegsfeld, Kaiserslautern und Wittlich<br />
ruhte die Arbeit jeweils für rund<br />
vier Stunden. Die Erzieherinnen<br />
nahmen an den Kundgebungen in<br />
Worms, Kaiserslautern und Trier teil.<br />
Die Eltern waren rechtzeitig vorher<br />
informiert und gebeten worden, ihre<br />
Kinder an diesem Tag möglichst<br />
nicht in die Kindertagesstätte zu bringen<br />
oder - bei Streikbeginn <strong>um</strong> 11.30<br />
Uhr in Wittlich - früher abzuholen.<br />
Für berufstätige Eltern hatte die Gewerkschaft<br />
Notdienste eingerichtet.<br />
„Die Eltern haben den Warnstreiks<br />
großes Verständnis entgegen gebracht“,<br />
betonte der <strong>GEW</strong>-Landes-<br />
vorsitzende Tilman Boehlkau vor der<br />
Presse. „Hierfür bedankt sich die<br />
<strong>GEW</strong> bei den betroffenen Eltern<br />
ausdrücklich, aber auch bei den am<br />
Streik teilnehmenden Kolleginnen,<br />
die mitgeholfen haben, Notdienste<br />
vor Ort zu organisieren.“ Boehlkau<br />
wies auch auf die Warnstreiks angestellter<br />
pädagogischer Fachkräfte an<br />
sechs Ganztagssonderschulen in<br />
Rheinland-Pfalz am 18.12.02 hin.<br />
pm-gew<br />
Bild links: Das Team von der Kriegsfelder Kita auf dem Weg z<strong>um</strong> Warnstreik<br />
in Kaiserlautern. Bei der Kundgebung sagte Hans Adolf Schäfer<br />
vom <strong>GEW</strong>-Landesvorstand in einem Grußwort u.a.: „Wir alle in den<br />
Gewerkschaften Ver.di, GdP, BAU und <strong>GEW</strong> lassen uns nicht unterkriegen.<br />
Denn: Wer heute den Kopf in den Sand steckt, wird morgen<br />
mit den Zähnen knirschen.“<br />
Bild unten (im Zeitungsausschnitt): Erni Schaaf-Peitz vom <strong>GEW</strong>-Vorstandsbereich<br />
Jugendhilfe und Sozialarbeit sagte beim Warnstreik am<br />
17.12.02 in Trier u.a.: „Wir haben Anspruch auf gutes Geld für gute<br />
Arbeit, denn Bildung gibt es nicht z<strong>um</strong> Nulltarif. Dies wissen auch die<br />
Eltern der Kinder aus unseren Kindertagesstätten. Sie haben sich mit<br />
uns solidarisch erklärt und unsere Protestaktion unterstützt.“<br />
Foto: Nora John<br />
14 <strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 /<strong>20</strong>03
<strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 /<strong>20</strong>03<br />
Tarifpolitik<br />
DEKRA-Beschäftigte wollen für Tarifvertrag streiken<br />
Trotz wiederholter Aktionen und<br />
Gesprächsangebote will die Geschäftsleitung<br />
der DEKRA Akademie<br />
bisher nicht mit der <strong>GEW</strong> über<br />
einen Tarifvertrag verhandeln. Nachdem<br />
drei Warnstreikrunden den Arbeitgeber<br />
nicht an den Verhandlungstisch<br />
bringen konnten, hat die<br />
<strong>GEW</strong> im Januar eine Urabstimmung<br />
bei der DEKRA Akademie durchgeführt.<br />
Das bundesweite Ergebnis ist<br />
eindeutig: 81,36% der Gewerkschaftsmitglieder<br />
votierten für weitere<br />
Arbeitskampfmaßnahmen. Das<br />
Ergebnis übersteigt damit die notwendige<br />
75%-tige Zustimmung bei<br />
weitem.<br />
Nachdem die Beschäftigten der DE-<br />
KRA Akademie im Jahr <strong>20</strong>02<br />
wieder<strong>um</strong> keine Gehaltserhöhungen<br />
erhalten hatten, will die <strong>GEW</strong> mit<br />
den Tarifverhandlungen Einkommensverbesserungen<br />
für ihre Mitglieder<br />
erreichen. Darüber hinaus<br />
sollen die allgemeinen Arbeitsbedingungen<br />
tariflich festgeschrieben und<br />
weiterentwickelt werden. Die DEK-<br />
RA Akademie ist der größte unter<br />
den nicht tarifgebundenen Weiterbildungsträgern<br />
in Deutschland.<br />
„In Rheinland-Pfalz fand die Urabstimmung<br />
an allen drei Aus- und<br />
Weiterbildungszentren - also Kaiserslautern<br />
mit seiner Außenstelle Altenglan,<br />
Ludwigshafen mit seiner<br />
Außenstelle Mainz, Mayen mit seinen<br />
Außenstellen Gerolstein und<br />
Trier - gleichzeitig statt“, erklärte der<br />
Vorsitzende der <strong>GEW</strong> Rheinland-<br />
Pfalz, Tilman Boehlkau, vor der Presse.<br />
„Wir haben durch die Urabstimmung<br />
das eindeutige Vot<strong>um</strong> der Beschäftigten<br />
für den Streik: Jetzt ist die<br />
Geschäftsleitung aufgefordert, sofort<br />
in Verhandlungen einzutreten. Sollte<br />
sie jedoch weiterhin nicht gesprächsbereit<br />
sein, werden wir bald<br />
massive Arbeitskampfmaßnahmen<br />
einleiten!“, so Boehlkau, dessen Gewerkschaft<br />
es nicht weiter hinnehmen<br />
will, dass die Beschäftigten bei<br />
der DEKRA Akademie ohne Tarifvertrag<br />
bleiben.<br />
„Die <strong>GEW</strong> startete ihren Arbeits-<br />
kampf am 21. Januar in Stuttgart.<br />
Während einer zentralen Kundgebung<br />
vor der dortigen DEKRA-Zentrale<br />
haben Beschäftigte aus ganz<br />
Deutschland deutlich gemacht, dass<br />
ihre Geduld ein Ende hat“, erläuterte<br />
Peter Blase-Geiger, zuständiger<br />
Gewerkschaftssekretär der <strong>GEW</strong><br />
Rheinland-Pfalz, die weitere Vorgehensweise.<br />
Blase-Geiger berichtete,<br />
dass an der zentralen Streikveranstaltung<br />
in Stuttgart auch zahlreiche<br />
DEKRA-Beschäftigte aus Rheinland-Pfalz<br />
teilnahmen.<br />
Sehr gut besucht war dann am folgenden<br />
Tag eine für Rheinland-Pfalz<br />
zentrale Streikversammlung in Mayen.<br />
Die mehr als 40 TeilnehmerInnen<br />
sprachen sich einstimmig dafür<br />
aus, die Streiks bei DEKRA Akademie<br />
fortzuführen. „Falls die Geschäftsleitung<br />
bei ihrer Haltung<br />
bleibt, Tarifverhandlungen mit der<br />
<strong>GEW</strong> abzulehnen, werden wir weiter<br />
streiken.“, so eine Teilnehmerin<br />
der Versammlung. Besonders verärgert<br />
zeigten sich die Streikenden<br />
darüber, dass sich am Vortag niemand<br />
von der Geschäftsleitung getraut<br />
hatte, zu den Kundgebungsteilnehmern<br />
in Stuttgart zu sprechen.<br />
Großen Applaus erhielten die Kollegen<br />
und Kolleginnen von DE-KRA<br />
Mannheim, die sich jetzt auch den<br />
Arbeitskampfmaßnahmen angeschlossen<br />
haben. Auf der Versammlung,<br />
die in der Gaststätte „Alter<br />
Fritz“ stattgefunden hat, wurde vereinbart,<br />
an zukünftigen Streiktagen<br />
auch in DEKRA-Einrichtungen Präsenz<br />
zu zeigen, an denen bisher nicht<br />
gestreikt wird. Außerdem wurde über<br />
die Streiktaktik diskutiert und überlegt,<br />
wie man sich gegenüber Streikbrechern<br />
verhalten kann.<br />
„Die rheinland-pfälzische Beteiligung<br />
an den Streikaktionen ist vorbildlich“,<br />
lobte Bernd Huster, Gewerkschaftssekretär<br />
der <strong>GEW</strong>, die<br />
anwesenden Kolleginnen und Kollegen.<br />
Er sicherte die volle Unterstützung<br />
seiner Gewerkschaft zu und<br />
wünschte den Streikenden einen langen<br />
Atem.<br />
pm-gew<br />
15
Berufliche Bildung<br />
Wandel der Lernkulturen<br />
Z<strong>um</strong> For<strong>um</strong> „Neue Lehr- und Lernkultur“ beim Tag der Beruflichen Bildung <strong>20</strong>02<br />
Die wesentlichen Elemente eines modernen Lehr-/Lernverständnisses entstammen<br />
der Ermöglichungsdidaktik, die eine neue Lernkultur prägt. Grundgedanken<br />
des Lernkulturwandels sind in dieser Zeitschrift in loser Folge dargestellt<br />
und kommentiert worden. In diesem Beitrag geht es <strong>um</strong> einige Perspektiven<br />
der Ausbildungspraxis unseres LehrerInnennachwuchses - eventuell<br />
in der Hochschule, mit Bestimmtheit im Studienseminar. Es geht auch <strong>um</strong><br />
Auswirkungen auf Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen, exemplarisch<br />
dargestellt am For<strong>um</strong> Neue Lehr- und Lernkultur am Tag der Beruflichen Bildung<br />
<strong>20</strong>02. Und es geht <strong>um</strong> Teilbereiche einer Kultur der Rückmeldung.<br />
„Ah, da kommt ja die coole Truppe<br />
wieder“, meinten SchülerInnen, als sie<br />
einer Gruppe von Referendaren mit<br />
ihrem Fachleiter im Treppenhaus der<br />
Schule begegneten. Was war voraus<br />
gegangen? Im Rahmen ihrer Hospitation<br />
hatte das Team in dieser - allen<br />
Beteiligten unbekannten - Klasse Unterricht<br />
vorbereitet, durchgeführt und<br />
nachbereitet. Und war gut angekommen<br />
mit ihrer praktizierten Lernkultur.<br />
Dabei hatten sie nur gemacht, was<br />
heute sowieso von Lehrkräften verlangt<br />
wird: Lernprozesse so geplant<br />
und arrangiert, dass Schülerinnen und<br />
Schüler „sich zu selbst bestimmten<br />
und selbstständigen Lernern in der<br />
Gesellschaft entwickeln können und<br />
das lebensbegleitende Lernen als individuellen<br />
Auftrag verinnerlichen“.<br />
(Expertise „Innovative Fortbildung<br />
der Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen<br />
Schulen“, <strong>20</strong>01, S. 11.) SchülerInnen<br />
finden das cool.<br />
In einer lebendigen Lernkultur<br />
haben alle Beteiligte die Möglichkeit<br />
selbstgesteuert zu lernen<br />
Unser eingangs geschildertes Kollegenteam<br />
hatte konsequent die Leitidee<br />
der Ermöglichungsdidaktik berücksichtigt,<br />
allen Beteiligten im<br />
Lernprozess selbst gesteuertes Arbeiten<br />
zu eröffnen. Sie hatten mit ihrem<br />
Lernarrangement bei den Lernern einen<br />
Eindruck hinterlassen, den diese<br />
mit der Vokabel „cool“ belegten. Damit<br />
machten die SchülerInnen<br />
zugleich deutlich, dass diese Art zu<br />
lernen nicht Alltag ist. Höchste Zeit,<br />
Lehrkräfte noch intensiver und nachhaltiger<br />
auf ihre neue Rolle vorzubereiten.<br />
Denn was für das neue Lernen in der<br />
Schule - nicht erst seit PISA, aber nun<br />
verstärkt - angestrebt wird, muss auch<br />
für die Ausbildungsstrukturen der<br />
Lehrerbildung - gleichgültig, ob in<br />
der ersten, zweiten oder dritten Phase<br />
- gelten: Ausbildungsveranstaltungen<br />
haben mindestens die gleichen<br />
Erfahrungen zu ermöglichen, die in<br />
einer lebendigen Lernkultur im Unterricht<br />
möglich und notwendig und<br />
deshalb unverzichtbar sind.<br />
Selbststeuerung erfordert erhöhtes<br />
Verantwortungsbewusstsein<br />
und ein Höchstmaß an Selbstreflexion.<br />
Das bedeutet im Einzelnen:<br />
1. LehrerInnen können ein eigenes<br />
Lehr-/Lern-Konzept aufbauen.<br />
2. Handlungs- und Denkweisen, die<br />
besonders günstig und schlüssig für<br />
das Lernen im Modus der Selbsterschließung<br />
angesehen werden, stehen<br />
im Mittelpunkt.<br />
3. Es werden Gründe offen gelegt,<br />
war<strong>um</strong> bestimmte pädagogische Ansätze<br />
und Handlungen wünschenswert<br />
sind (Instr<strong>um</strong>entcharakter des<br />
Wissens).<br />
4. Veranstaltungen sind konsequent<br />
ermöglichungsdidaktisch konzipiert.<br />
5. Unverzichtbare Arbeitsorientierungen<br />
sind selbstständiges und widerspruchsfreies<br />
Denken und Handeln.<br />
6. Schlüsselbegriffe des Lernens werden<br />
passgenau z<strong>um</strong> Konzept verwendet.<br />
7. Im Ausbildungshandeln wird ein<br />
Höchstmaß an Autonomie realisiert.<br />
8. Interaktiven Lern- und Arbeitsweisen<br />
wird Vorrang eingerä<strong>um</strong>t.<br />
9. In Rückmeldesituationen gilt die<br />
Orientierung am Gesichtspunkt der<br />
kommunikativen Symmetrie (Hilfsmittel:<br />
Selbst- und Fremdeinschätzung).<br />
10. Ausbildungshandeln beruht auf<br />
der Überzeugung: Lerner können<br />
selbstständig denken (als Fähigkeit der<br />
Konstruktion).<br />
11. Es wird eine stringente Fehlerkultur<br />
vertreten (z.B.: Lerner entdecken<br />
selbst, dass das, was sie fehlerhaft tun<br />
und beschreiben, keinen Sinn ergibt;<br />
Fehler werden als wichtige Hinweise<br />
zur Erschließung des begrifflichen<br />
Netzwerks von Lernern genutzt).<br />
12. Sprache und Anschauungsmaterialien<br />
schaffen Erfahrungsrä<strong>um</strong>e, die<br />
Anlass bieten zu Reflexion und Abstraktion.<br />
Fazit: Selbststeuerung erfordert erhöhtes<br />
Verantwortungsbewusstsein<br />
und ein Höchstmaß an Selbstreflexion.<br />
Wenn wir eine Veranstaltung unter<br />
den dargestellten Prämissen ausrichten,<br />
dann wollen wir (Selbst-) Verantwortung<br />
und (Selbst-)Reflexion steigern<br />
in den Bereichen der<br />
* pädagogischen Inhalte,<br />
* Verfahren und Abläufe,<br />
* und Gestaltung.<br />
Bei der Auswahl von Methoden<br />
ist zu fragen, welche Wertigkeiten<br />
diese im Hinblick auf die Ermöglichung<br />
von Aneignung und<br />
Selbststeuerung besitzen.<br />
Diese Sätze waren unsere Leitlinie für<br />
das For<strong>um</strong> Neue Lehr- und Lernkultur<br />
am Tag der beruflichen Bildung<br />
<strong>20</strong>02 in Mainz.<br />
Den Anfang machte eine kleine Inszenierung,<br />
die erstens verdeutlichen<br />
sollte, dass Wandel und (Lern-)Kultur<br />
untrennbar zusammengehören,<br />
und zweitens die Zuschauer<br />
schrittweise zu Beteiligten machen<br />
wollte.<br />
Wir präsentierten z<strong>um</strong> Ausklang der<br />
Inszenierung und als Übergang zur<br />
Selbsterschließungsphase in einem<br />
kleinen Power-Point-“Film“ die Konstruktion<br />
unserer Beschäftigung mit<br />
der neuen Lernkultur und ermöglichten<br />
damit den KollegInnen, ihre Kon-<br />
16 <strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 /<strong>20</strong>03
strukte z<strong>um</strong> Wandel der Lernkultur<br />
abzuarbeiten, zu visualisieren und zu<br />
verbalisieren. Es sind dies Blickwinkel,<br />
die sich in den Sphären einer unmittelbaren<br />
Welterfahrung und des<br />
zwischenmenschlichen Umgangs bewegen.<br />
Damit wurde im ersten Schritt<br />
ein episodisches Element über Lernkultur<br />
angeboten, welches in der Regel<br />
eine differenzierte Auffassung vom<br />
neuen Lernen unterstützt. Bedingung<br />
ist, dass vielfältiges und systematisch<br />
vernetztes Wissen über Lernsituationen<br />
bereits vorhanden ist. Dies setzten<br />
wir bei unserem TeilnehmerInnenkreis<br />
voraus.<br />
Denk- und<br />
Handlungsansätze<br />
der Lerner,<br />
ihre Hypothesen<br />
über<br />
die Sachen<br />
und Menschen,<br />
ihre Erfahrungswelt<br />
und<br />
ihre Zugriffsweisen<br />
in dieser<br />
Welt werden<br />
z<strong>um</strong> Ausgangspunkt<br />
der Lernprozesse.<br />
Im zweiten Schritt konnten die KollegInnen<br />
ihr Erfahrungswissen wissenschaftsförmig<br />
machen, indem sie<br />
ausgegebene Textbausteine, so genannte<br />
„Schnipsel“ als Literaturfundstellen,<br />
in die Architektur ihrer Alltagsdidaktik<br />
einbauten. Ihnen war es<br />
damit möglich, sich mit den zwischen<br />
<strong>um</strong>gänglichen und wissenschaftlichen<br />
Blickwinkeln bestehenden Differenzen<br />
auseinander zu setzen und diese<br />
Auseinandersetzung zu reflektieren.<br />
Wo dies nicht geschieht, bleibt in wesentlichen<br />
Bereichen Unverständnis<br />
oder gar Unmündigkeit zurück.<br />
Schließlich ging es uns dar<strong>um</strong>, den<br />
Beteiligten zu ermöglichen, ihre<br />
Denk- und Handlungsansätze, ihre<br />
Hypothesen über Sachen und Menschen,<br />
ihre Erfahrungswelt und die<br />
Zugriffsweisen in dieser Welt in den<br />
Mittelpunkt der Veranstaltung zu rücken.<br />
<strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 /<strong>20</strong>03<br />
In der Reflexion wird Wert auf<br />
die Aufdeckung des Erkenntnisprozesses<br />
gelegt.<br />
Natürlich war wie immer die Zeit zu<br />
kurz, den vielen Verästelungen persönlich<br />
geprägter Vorstellungen nachzugehen.<br />
Und es fehlte auch die Zeit,<br />
die Entstehungsprozesse der mehrheitsfähigen<br />
Aussagen in der Tiefe zu<br />
analysieren. Und dennoch haben wir<br />
in dem relativ kleinen Zeitra<strong>um</strong> eine<br />
beeindruckende Vielfalt der konstruktiv-kritischen<br />
Auseinandersetzung mit<br />
dem Thema erlebt. Die so erzeugten<br />
(unscharfen) Wirklichkeiten waren<br />
keine Abbilder der Außenwelt Schule<br />
und Unterricht, sondern passende<br />
Konstruktionen, die von manchen anderen<br />
geteilt werden konnten - oder<br />
auch nicht. Immerhin hatten wir den<br />
TeilnehmerInnen die Möglichkeit eröffnet,<br />
ihren Erkenntnisprozess in der<br />
Auseinandersetzung mit der Thematik<br />
aufzudecken.<br />
Über Kommunikation kann es<br />
z<strong>um</strong> Aufbau intersubjektiver<br />
Welten kommen.<br />
Ein Ergebnis war indes unübersehbar:<br />
Hinter den Leitgedanken der Ermöglichungsdidaktik<br />
schimmern die Konturen<br />
eines durchweg positiven, aufgeklärten<br />
Menschenbildes durch - das<br />
machten die verschiedenen Gruppen<br />
in ihren Beiträgen mehr als deutlich.<br />
Anders ausgedrückt: Ohne positive<br />
Grundeinstellung z<strong>um</strong> Menschen, seinen<br />
Möglichkeiten und Fähigkeiten,<br />
wird die konsequente Hinwendung zu<br />
Selbsterschließungsprozessen nur<br />
schwer zu verwirklichen sein.<br />
Berufliche Bildung<br />
Für weitere Rückmeldungen hatten<br />
wir am Ende der Veranstaltung vorrangig<br />
zwei Wege eröffnet. Wir haben<br />
z<strong>um</strong> einen vorbereitete Ansichts-Postkarten<br />
vom Wandel der Lernkultur<br />
ausgegeben und z<strong>um</strong> anderen unsere<br />
eMail-Adressen z<strong>um</strong> Informationsaustausch<br />
angeboten. Dahinter steckt<br />
die Vorstellung, Lernprozesse erst<br />
dann als erfolgreich zu betrachten,<br />
wenn Rückmeldungen erbracht, eingeordnet<br />
und bewertet werden. Die<br />
ausdifferenzierten Deutungsmuster<br />
können dann Gegenstand weiterer Erörterungen<br />
werden.<br />
Zunächst zur Postkarten-Aktion: Von<br />
den 18 Rücksendungenwaren<br />
12 überwiegendzustimmend,<br />
ja in ihrenBekundungen<br />
sogar stark<br />
positiv ausgeprägt.<br />
Wir stellten<br />
für diese<br />
KollegInnen<br />
fest: Über Kommunikation<br />
ist<br />
es bei aller vorsichtigenEinschätzung<br />
der<br />
Rückmeldungen<br />
zu einem<br />
weitgehend intersubjektiven Verständnis<br />
vom Wandel der Lehr- und<br />
Lernkultur gekommen. Und jede Einzelaussage<br />
gäbe bei Bedarf genügend<br />
Anlass zu tieferer Betrachtung.<br />
Sechs Rückmeldungen waren eher<br />
ablehnend, drei davon stark negativ<br />
besetzt.<br />
Damit holen uns die bekannten Befunde<br />
über LehrerInnen in unserem<br />
Land ganz schnell ein: In fast allen<br />
Erhebungen wird höchstens ein Drittel<br />
der Lehrerschaft als eher innovationsfreudig<br />
und ein Drittel als eher<br />
innovationsresistent dargestellt. Eine<br />
Schwierigkeit, sich zu wandeln, liegt<br />
darin, „dass Lehrerinnen und Lehrer<br />
z<strong>um</strong> Teil Verhaltens- und Handlungsmuster<br />
aufgeben müssen, die erprobt<br />
und ihnen vertraut sind und als bewährt<br />
erscheinen“ (Expertise Innovative<br />
Fortbildung der Lehrerinnen und<br />
Lehrer an beruflichen Schulen, <strong>20</strong>01,<br />
S. 11).<br />
17
Berufliche Bildung<br />
Innovation nach kritischer Aufnahme<br />
und Verarbeitung neuer<br />
pädagogischer, didaktischer und<br />
methodischer Ansätze, ist ein<br />
besonderer Aspekt der Lehrerprofession.<br />
Das ist übrigens ein Befund, der nicht<br />
nur für bereits tätige LehrerInnen zu<br />
gelten scheint, sondern auch für diejenigen,<br />
die diesen Beruf erst ergreifen<br />
wollen. In nahezu allen Rückmeldungen<br />
zur Ausbildung im Studienseminar<br />
stoßen wir auf die gleichen<br />
Begründungen. Konzepte und Ausbildungsveranstaltungen<br />
werden<br />
besonders dann abgelehnt, wenn sie<br />
nicht in die eigene Lernbiografie und<br />
Erfahrungswelt integriert werden<br />
können. Und das, obwohl doch gerade<br />
vom Nachwuchs Innovation erwartet<br />
wird. Nachhaltig und stimmig<br />
im Konzept praktizieren nur drei von<br />
zehn Absolventen des Studiensemi-<br />
nars für das Lehramt an berufsbildenden<br />
Schulen die neue Lernkultur -<br />
und das erst in jüngster Zeit.<br />
Allerdings lohnt sich der Aufwand für<br />
diese drei. Übrigens auch dann, wenn<br />
es nur eine(r) wäre. (Eigentlich gehört<br />
innovatives Handeln grundsätzlich<br />
z<strong>um</strong> LehrerInnendasein, wenngleich<br />
es unter mancher Betrachterperspektive<br />
nicht immer der Schlüssel für Erfolg<br />
und Karriere zu sein scheint.)<br />
Das innovationsresistente Drittel können<br />
wir auch am Tag der beruflichen<br />
Bildung vorweisen, eventuell auch mit<br />
der oben zitierten Begründung.<br />
Aber dem innovationsfreudigen Drittel<br />
ist es offenbar gelungen, einige<br />
Unentschlossene, wenn auch längst<br />
nicht alle, mit ins Boot zu holen. Und<br />
das stimmt hoffnungsfroh innerhalb<br />
einer Gewerkschaft, die sich der Bildung<br />
verschrieben hat. (Wo diejenigen,<br />
die keine Karte geschickt haben,<br />
anzusiedeln sind, müssen sie selbst<br />
GRÜNE gegen verkürzte Berufsschulzeit<br />
Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Landtag<br />
fordern die Landesregierung auf, die<br />
seit 1998 verkürzten Berufsschulzeiten<br />
für Tischler dem gesetzlich geforderten<br />
Normalmaß anzugleichen: „Seit vier<br />
Jahren verhindern Landesinnung und<br />
Landesfachverband Holz die Angleichung<br />
der Berufsschulzeit in der Tischlerausbildung.<br />
Gerade hat die Landesregierung<br />
die Verringerung der Unterrichtsstunden<br />
bis <strong>20</strong>04 verlängert. Frau<br />
Ahnen gibt damit ein fatales Signal an<br />
andere Innungen und Kammern, die<br />
ebenfalls die Berufsschulzeit verkürzen<br />
wollen“, erklärte Nils Wiechmann , bildungspolitischer<br />
Sprecher von Bündnis<br />
90/DIE GRÜNEN im Landtag.<br />
Durch das Berufsbildungsgesetz ist die<br />
Regel-Unterrichtszeit für Ausbildungsberufe<br />
seit 1997 auf 1440 Stunden fest-<br />
gelegt. Für Tischler hatte das Bildungsministeri<strong>um</strong><br />
die Berufsschulzeit<br />
seit 1998 probeweise auf 1<strong>28</strong>0 Stunden<br />
verkürzt. Es erhoffte sich davon<br />
mehr Ausbildungsplätze. Doch die<br />
Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge<br />
ist in den vergangenen vier<br />
Jahren nicht gestiegen, sondern <strong>um</strong> 16<br />
Prozent zurückgegangen. Dies geht<br />
aus der Antwort der Landesregierung<br />
auf die Kleine Anfrage „Verkürzung<br />
der Unterrichtszeit in Ausbildungsberufen<br />
an rheinland-pfälzischen Berufsschulen“<br />
hervor.<br />
„Die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe<br />
sinkt auch bei verkürzten Ausbildungszeiten.<br />
Dies müsste für Frau<br />
Ahnen Grund genug sein, den ´Versuch`<br />
beim Tischlerhandwerk so<br />
schnell wie möglich zu beenden“, fordert<br />
Nils Wiechmann.“ Hinzu<br />
kommt: Von der Kürzung der Unterrichtsstunden<br />
sind die allgemeinbildenden<br />
Fächer Sozialkunde und<br />
Wirtschaftslehre mit 25% betroffen,<br />
der berufsbezogene Unterricht `nur`<br />
mit 11%. Dies ist im Hinblick auf<br />
die Ergebnisse der PISA-Studie und<br />
aktuelle rechtsradikale Äußerungen<br />
von Schülern an berufsbildenden<br />
Schulen eindeutig der falsche Weg“.<br />
pm-b/g<br />
entscheiden.)<br />
Nun zu den eMail-Kontakten. Es hat<br />
sich bestätigt, was viele Experten zu<br />
diesem Bereich sagen: Es funktioniert<br />
nicht. Bis heute ist kein einziger Kontakt<br />
aufgenommen worden. Man<br />
kann dies mit der Bemerkung beiseite<br />
wischen: Was soll’s. Man kann aber<br />
auch danach fragen, wie es <strong>um</strong> die<br />
notwendigen Reflexionsstrukturen in<br />
unserem (Bildungs-) Alltag bestellt ist.<br />
Soll das etwa heißen, dass sie unterentwickelt<br />
sind? Wir klopfen uns ans<br />
die eigene Brust und antworten kurz<br />
und knapp: Ja!<br />
Menschen sind lernfähig und<br />
lernwillig, aber meist nicht so<br />
und nicht dann, wenn andere es<br />
wollen, sondern wie sie selber es<br />
für richtig halten.<br />
Insgesamt kann jedoch die optimistische<br />
Botschaft der neuen Lehr- und<br />
Lernkultur auch am Ende einer solchen<br />
Tagung und erst recht in der<br />
Reflexion darüber weitergegeben werden:<br />
„Menschen sind lernfähig und<br />
lernwillig, aber meist nicht so und<br />
nicht dann, wie und wenn andere es<br />
wollen, sondern wie sie selber es für<br />
richtig halten“ (Horst Siebert, Pädagogischer<br />
Konstruktivismus, Neuwied<br />
1999, S. 195).<br />
Peter Markwerth<br />
odsmarkw@uni-koblenz.de<br />
www.uni-koblenz.de/~odssslb/<br />
index.html<br />
P.S. Vorstehende Gedanken können auch<br />
als Antwort auf die Reform der Lehrerbildung<br />
gesehen werden.<br />
Über den Autor:<br />
Peter Markwerth, Zweites Staatsexamen<br />
für berufsbildende Schulen in<br />
Elektrotechnik und Deutsch, 18 Jahre<br />
Lehrer in Ludwigshafen, 13 Jahre Fachleiter<br />
für Deutsch am Studienseminar<br />
für berufsbildende Schulen in Speyer,<br />
seit 1991 Leiter des Studienseminars für<br />
berufsbildende Schulen in Neuwied.<br />
Realisiert dort mit seinen MitarbeiterInnen<br />
den Lernkulturwandel, hat ein<br />
Qualitätsmanagementsystem verankert<br />
und die Ausbildung modularisiert. Vorsitzender<br />
der Fachgruppe Schulaufsicht<br />
und Schulverwaltung in Rheinland-<br />
Pfalz seit <strong>20</strong>02.<br />
18 <strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 /<strong>20</strong>03
<strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 /<strong>20</strong>03<br />
Berufliche Bildung<br />
Chancen und Risiken des kommenden Altenpflegegesetzes<br />
Sabine Nugel ist<br />
Referentin im<br />
MBFJ, Abteilung<br />
4 D, Berufsbildende<br />
Schulen,<br />
mit Zuständigkeit<br />
u.a. für die FachschulenSozialwesen,<br />
Altenpflege,<br />
Berufssonderpädagogik,Hauswirtschaft.<br />
17 unterschiedlicheAusbildungsgrundlagen<br />
in 16 Bundesländernnähern<br />
sich ihrem<br />
Ende.<br />
Am 24.10.02<br />
hat der Zweite<br />
Senat des Bundesverfassungsgerichts<br />
sein Urteil<br />
einstimmig<br />
gefällt und den<br />
Normenkontrollantrag<br />
des<br />
Freistaates Bayern in den meisten<br />
Punkten abgewiesen.<br />
Konkret heißt das, dass die dreijährige<br />
Altenpflegeausbildung künftig<br />
ein vom Bund gesetzlich geregelter<br />
Gesundheitsfachberuf ist, während<br />
die Altenpflegehilfe weiterhin ein<br />
landesrechtlich zu regelnder sozialpflegerischer<br />
Beruf bleibt.<br />
Mit Inkrafttreten des Altenpflegegesetzes<br />
und der ebenfalls vom Bund<br />
erlassenen Ausbildungs- und Prüfungsordnung<br />
z<strong>um</strong> 01.08.<strong>20</strong>03 soll<br />
ein bundeseinheitlicher Mindestkonsens<br />
v.a. bei den folgenden Kernpunkten<br />
erreicht werden:<br />
* eine Ausbildungsdauer von drei<br />
Jahren<br />
* der Schutz der Berufsbezeichnung<br />
* der Anspruch auf Ausbildungsvergütung.<br />
Die Durchführung und inhaltliche<br />
Gestaltung lässt weiterhin relativ<br />
weitreichende regionalspezifische<br />
Ausführungen zu.<br />
Mit der inhaltlichen Orientierung<br />
Gleichbehandlung gefordert<br />
In einem Schreiben an Bildungsministerin<br />
Ahnen wies der <strong>GEW</strong>-Landesvorsitzende<br />
Tilman Boehlkau auf Probleme<br />
im Zusammenhang mit der Ansparstunde<br />
für die LehrerInnen an Berufsbildenden<br />
Schulen hin:<br />
(...) „Für LehrerInnen an Gymnasien,<br />
die wegen des vorverlegten Abiturtermins<br />
in der 13. Klasse bis z<strong>um</strong> 31.<br />
März eine erhöhte Unterrichtsver-<br />
der Altenpflege an den Strukturen<br />
des Krankenpflegegesetzes und mit<br />
der gesetzlichen Zuordnung der Altenpflege<br />
zu den Gesundheitsfachberufen<br />
ist der Weg der Annäherung<br />
zwischen Alten- und Krankenpflege<br />
geebnet worden.<br />
Mit diesem gesteckten Rahmen wird<br />
es künftig erheblicher Anstrengungen<br />
bedürfen, die Profilbildung der<br />
Altenpflege in Richtung eines erkennbaren<br />
gerontologischen Profils<br />
mit adäquater Qualifizierung im interaktiv-kommunikativen<br />
Bereich zu<br />
entwickeln.<br />
Durch eine zunehmende Nachfrage<br />
nach (alten-)pflegerischen Leistungen<br />
hat sich der Pflegebedarf inhaltlich-qualitativ<br />
sowohl im ambulanten<br />
als auch im stationären Bereich<br />
verändert. Im stationären Bereich<br />
steigt der Anteil an hochbetagten,<br />
schwer pflegebedürftigen, bettlägrigen<br />
Seniorinnen und Senioren<br />
ebenso wie von schwerpflegebedürftigen<br />
dementen, aber physisch hochaktiven<br />
älteren Menschen. Altenpflege<br />
entwickelt sich hier zur Altenkrankenpflege<br />
einerseits sowie zur gerontopsychiatrischen<br />
Pflege und Aktivierung<br />
andererseits. Bei der sich<br />
ausweitenden häuslichen Pflegearbeit<br />
gewinnen auch hauspflegerische<br />
Tätigkeiten im Grenzbereich zwischen<br />
traditioneller Kranken- und<br />
Alten(-kranken)-pflege sowie Hauswirtschaft<br />
als <strong>neues</strong> pflegerisches<br />
Anwendungsfeld zunehmende Bedeutung.<br />
Beiden Entwicklungen muss Rechnung<br />
getragen werden. Dabei reicht<br />
die bloße formale Angleichung an<br />
pflichtung von 26 Stunden haben, entfällt<br />
in diesem Schuljahr die Verpflichtung<br />
zur Ansparstunde.<br />
Eine vergleichbare Situation besteht an<br />
Berufsbildenden Schulen, wenn Bildungsgänge<br />
z<strong>um</strong> Schulhalbjahr enden<br />
(oder - selten - beginnen) und wenn bei<br />
bestimmten Organisationsformen im<br />
Blockunterricht die wöchentliche Unterrichtsverpflichtung<br />
der Lehrkräfte<br />
die Krankenpflegeausbildung ebenso<br />
wenig aus wie die Einheitlichkeitsvorstellungen<br />
von Pflegeberufen aus<br />
der Sicht der Krankenpflege.<br />
Es muss vielmehr die Chance zu einer<br />
strukturellen und inhaltlichen<br />
Reform genutzt werden.<br />
Mit der geschaffenen „Modellklausel“<br />
in § 4 (6) des Altenpflegegesetzes<br />
können zeitlich befristete Ausbildungsangebote<br />
zur Weiterentwicklung<br />
der Pflegeberufe unter bestimmten<br />
Bedingungen erprobt werden.<br />
Hier können erste Schritte hin<br />
zu einer integrierten Ausbildung der<br />
Alten- und Krankenpflege mit deutlicher<br />
Profilentwicklung beider Berufsbilder<br />
gegangen werden. Gleichzeitig<br />
kann damit verhindert werden,<br />
dass sich die Altenpflege - durch ihr<br />
„Einzelberufsgesetz“ steht sie isoliert<br />
da - dem Reformbestreben im Berufsbereich<br />
„Pflege“ entzieht.<br />
Es bleibt abzuwarten, inwieweit die<br />
16 Bundesländer die im Gesetz vorgesehenen<br />
länderrechtlichen Freiheiten<br />
für sich nutzen und/oder zu Mindestvereinbahrungen<br />
untereinander<br />
gelangen, die dem erklärten Ziel einer<br />
bundeseinheitlichen Regelung<br />
Rechnung tragen.<br />
Der Wandel vom sozial-pflegerischen<br />
Beruf Altenpflege z<strong>um</strong> medizinischpflegerisch<br />
orientierten Gesundheitsfachberuf<br />
erleichterte die längst überfällige<br />
bundes-einheitliche Regelung.<br />
Um die aufgezeigten Chancen als<br />
Wegbegleiter des Entwicklungsprozesses<br />
des neuen „Gesundheitsfachberufs<br />
Altenpflege“ fördernd zu nutzen,<br />
gilt es, die Risiken zu bearbeiten,<br />
wann immer sie sich zeigen.<br />
Sabine Nugel<br />
innerhalb des Schuljahres erheblichen<br />
Schwankungen unterliegt.<br />
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft<br />
fordert Sie auf, für Gleichbehandlung<br />
der LehrerInnen an Berufsbildenden<br />
Schulen durch eine analoge<br />
Regelung hinsichtlich der Verpflichtung<br />
zur Ansparstunde Sorge zu<br />
tragen.“ (...)<br />
19
Schwerpunkt<br />
Autokratische Entscheidungsstrukturen<br />
<strong>Diskussion</strong> <strong>um</strong> ein <strong>neues</strong> rheinland-pfälzisches <strong>Hochschulgesetz</strong><br />
Wurden Probleme der Hochschulen vor ein<br />
paar Jahren noch ausschließlich unter<br />
quantitativen Gesichtspunkten, nämlich<br />
im Hinblick auf die Entwicklung der<br />
Anzahl der Studierenden betrachtet,<br />
obwohl die Strukturprobleme in den<br />
Hochschulen mehr als augenfällig waren,<br />
so haben zunehmende Finanzprobleme<br />
und geändertes Studierverhalten<br />
Druck in die Reformbewegungen der<br />
Hochschullandschaft gebracht. Das war<br />
erstmals mit der 5. HRG (Hochschulrahmengesetz)<br />
- Novelle der Fall, als bereits viele<br />
Paragraphen zur Organisation einer Hochschule gestrichen<br />
wurden.<br />
Zunehmend wurde nach Modellen einer Verbesserung der Leistungsfähigkeit<br />
des Hochschulsystems ohne finanziellen Ausbau<br />
gesucht. Rheinland-Pfalz stellte in dieser Umbruchphase mit dem<br />
Personalbemessungskonzept (PBK) und dem Mittelbemessungsmodell<br />
(MBM) ein <strong>neues</strong> Finanzierungskonzept vor, das<br />
mittlerweile in den Hochschulen auch zähneknirschend als Verhandlungsgrundlage<br />
akzeptiert wird.<br />
Nun galt es noch, eine <strong>um</strong>fassende Strukturreform durchzuführen.<br />
Wie andere Bundesländer auch, hat nun die Landesregierung<br />
Rheinland-Pfalz ein <strong>neues</strong> <strong>Hochschulgesetz</strong> (HochSchG) vorgelegt,<br />
in dem nach den Prinzipien des new public management -<br />
man kennt dies aus den Kommunalverwaltungen als „Neues Steuerungsmodell“<br />
der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung<br />
- völlig und unserer Ansicht nach unakzeptable<br />
neue Steuerungsansätze in die Hochschulen hineingetragen<br />
werden. Unakzeptable insbesondere deshalb, weil Mitbestimmungs-,<br />
Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte der in Forschung,<br />
Studi<strong>um</strong> und Lehre Beschäftigten zugunsten autokratischer Entscheidungsstrukturen<br />
eingeschränkt werden und weil Vertretungen<br />
der Wirtschaft ohne demokratische Legitimation in die interne<br />
Hochschulpolitik hineinregieren.<br />
Um die Stellungnahme der Landesfachgruppe Hochschule und<br />
Forschung in der <strong>GEW</strong> Rheinland-Pfalz einordnen zu können,<br />
haben wir uns erlaubt, einen Aufsatz von Dorothea May aus dem<br />
<strong>GEW</strong>-Handbuch für Personalräte und Gremienmitglieder zur<br />
„Flexibilierung der Hochschulhaushalte“, <strong>20</strong>01 voranzustellen.<br />
Barbara Hellinge<br />
Die Dipl.-Mediatorin (FH) Barbara Hellinge M.A. ist Vorsitzende<br />
der <strong>GEW</strong>-Landesfachgruppe Hochschule und Forschung, Mitglied im<br />
Vorstand des HPR des MWWFK und arbeitet als wissenschaftliche Angestellte<br />
an der FH Trier (Allg. Studienberatung und ECTS-Hochschulkoordination).<br />
Was bringt das „New public management“?*<br />
Woher kommt das NPM-Konzept historisch? Ist es<br />
auf deutsche Hochschulverhältnisse übertragbar?<br />
Gegebenenfalls unter Berücksichtigung welcher Besonderheiten<br />
ist es übertragbar? WeIche Elemente<br />
kennzeichnen einen <strong>neues</strong> Verwaltungsverständnis?<br />
Bringt NPM mehr Hochschulautonomie?<br />
1. Definition, Herkunft, Anwendungsbereich<br />
Entstanden zu Beginn der achtziger Jahre in den Ländern mit einer<br />
überwiegend angelsächsischen Verwaltungstradition steht das<br />
Konzept des new public management (NPM) für ein grundsätzlich<br />
<strong>neues</strong> Verständnis der Aufgaben und Organisation öffentlicher<br />
Verwaltung, Wesentlich für die unter dem Begriff des NPM<br />
subs<strong>um</strong>ierten Reformstrategien ist, dass der hoheitliche, bürokratische<br />
Charakter, der Verwaltung lange Zeit geprägt hat, als unzeitgemäß<br />
und ineffektiv betrachtet wird. Verwaltung soll nunmehr<br />
als modernes Dienstleistungsunternehmen konzipiert werden,<br />
Bislang untergeordneten Einheiten sollen größere Eigenständigkeit<br />
und Autonomie hinsichtlich der Erledigung ihrer Aufgaben<br />
und Verantwortung für einen wirtschaftlichen und effektiven Einsatz<br />
der Mittel gewährt werden, Dabei richtet sich der Blick der<br />
Verwaltungsreformer stark auf betriebswirtschaftliche Instr<strong>um</strong>en-<br />
* Entnommen aus: Peer Pasternack (Hrsg.): Flexibilisierung der Hochschulhaushalte.<br />
Handbuch für Personalräte + Gremienmitglieder, Schüren <strong>20</strong>01<br />
tarien, deren Übertragung auf Verwaltungsstrukturen im Kozept<br />
des NPM eine zentrale Rolle spielt,<br />
Dies sind insbesondere: Setzen auf Wettbewerb, Einführung von<br />
Marktelementen, „leistungsgerechte“ Bezahlung, „Kundenorientierung“,<br />
Abbau bürokratischer Strukturen, Deregulierung, Ergebnisorientierung,<br />
Controlling und Evaluation, Entwicklung eines<br />
Leitbildes und einer corporate identity, Steuerung über Zielvereinbarungen,<br />
Beschränkung auf die Kernaufgaben, Auslagerung<br />
und Verselbständigung von Verwaltungseinheiten, Verflachung der<br />
Hierarchien, Stärkung der Eigenverantwortung der MitarbeiterInnen,<br />
gezielte Personalentwicklung. Projektorganisation, Verbesserung<br />
der Kommunikationsstrukturen, Transparenz, durch die sowohl<br />
intern als auch extern Abläufe und Entscheidungswege durchschaubar<br />
und damit beurteilbar und diskutierbar werden, die Bereitschaft,<br />
Schwachstellen aufzuspüren und zu beseitigen sind weitere<br />
Elemente des reformierten Verwaltungsverständnisses.<br />
In Deutschland haben die Ideen des NPM ebenfalls zu einem strategischen<br />
Umschwung im öffentlichen Sektor geführt. Dieser ist<br />
eng mit dem von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung<br />
entwickelten „Neuen Steuerungsmodell“<br />
verknüpft und hat dazu geführt, dass in Staats-, Landes- und Kommunalverwaltungen<br />
das klassische bürokratische RegulierungsmodelI<br />
immer mehr ins Wanken gerät. Statt über Erlasse und Verfügungen<br />
zu steuern, wird auf Kontraktmanagement, d.h. den Abschluss<br />
von Zielvereinbarungen zwischen der Leitung der Verwaltung<br />
und den ausführenden Einheiten, gesetzt. Das Selbstverständnis<br />
einer bloß exekutiven Verwaltung wird zugunsten einer stärke-<br />
<strong>20</strong> <strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 /<strong>20</strong>03
en Managementorientierung aufgegeben. Wenngleich die Ideen<br />
des NPM nicht alle wirklich neu zu nennen sind, haben sie doch<br />
unter dem Problemdruck sinkender Finanzen und zugleich wachsender<br />
Aufgaben eine Schubkraft bekommen, die zunehmend die<br />
Ansprüche an öffentliche Institutionen und deren Selbstverständnis<br />
verändert und zu neuen Zielsetzungen und Verfahren führt.<br />
Staatliche Hochschulen<br />
- als sehr<br />
spezifische Körperschaftenöffentlichen<br />
Rechts<br />
-bleiben davon<br />
nicht ausgenommen.<br />
Denn auch<br />
die Hochschulen<br />
geraten zunehmend<br />
unter erheblichenRationalisierungs-<br />
und<br />
Optimierungsdruck.<br />
Ihre<br />
immer wichtiger<br />
werdende Rolle in<br />
einer wissensbasiertenÖkonomie,<br />
die ihre Expansion(wach-<br />
€<br />
sendeStudierendenzahlen)wünschenswert macht, lässt die Hochschulen z<strong>um</strong> volkswirtschaftlich<br />
bedeutsamen (aber auch kostspieligen) Produktionsfaktor werden,<br />
der selber zunehmend den Kriterien ökonomischer Rationalität<br />
unterworfen wird. Nicht nur für ihre Verwaltungsteile, sondern<br />
für die Institution Hochschule insgesamt gilt: Leistungsfähigkeit<br />
und Effizienz des Mitteleinsatzes müssen gesteigert und nachgewiesen<br />
werden, Hochschulen müssen sich nicht nur für den globalen<br />
Wettbewerb stark machen, sie müssen sich selber im (internationalen)<br />
Wettbewerb behaupten.<br />
Dennoch sind aufgrund der Spezifität der Einrichtung Hochschule<br />
die Grundsätze, die in der Industrie und in Anlehnung daran<br />
für die öffentliche Verwaltung entwickelt wurden, nur bedingt übertragbar.<br />
Die <strong>Diskussion</strong> darüber, wo, in welchem Maße dies möglich<br />
ist und welche gesetzlichen Änderungen dafür notwendig sind,<br />
bestimmt wesentlich die gegenwärtige Hochschulstrukturdebatte.<br />
Das new public management muss in ein new university management<br />
transformiert werden.<br />
2. Hochschulreform vor dem Hintergrund des NPM<br />
Zu den wichtigsten Elementen des NPM, die in die hochschulischen<br />
Reformansätze Eingang gefunden haben, gehören:<br />
Trennung von normativer und strategischer Kompetenz und operativer<br />
Verantwortung:<br />
In den Debatten zur Novellierung der <strong>Hochschulgesetz</strong>e besteht<br />
weitgehend Einmütigkeit, dass Parlament und Regierung sich zunehmend<br />
aus der Detailsteuerung der Hochschulen qua Gesetz<br />
und Verordnung zurückziehen und sich auf die Formulierung von<br />
staatlichen Zielen und daraus abgeleiteten Leistungsaufträgen an<br />
die Hochschulen beschränken sollten. Dies entspricht dem im<br />
<strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 /<strong>20</strong>03<br />
Hochschulen<br />
NPM entwickelten Prinzip der klaren Trennung zwischen normativen<br />
und übergeordneten strategischen Entscheidungen der politischen<br />
Behörden einerseits und operativen Kompetenzen und Verantwortlichkeiten<br />
der Verwaltung andererseits.<br />
Diese Trennung - (irreführenderweise) verbunden mit dem Schlagwort<br />
der „Autonomie“ der Hochschulen - soll dadurch vollzogen<br />
werden, dass alle fachlichen<br />
Entscheidungen in<br />
die Hochschulen verlagert<br />
werden, da dort größere<br />
Problemnähe und<br />
daher größere Problemlösungskompetenz<br />
als von<br />
ministerieller Intervention<br />
erwartet wird. In der<br />
Organisation der Binnenstrukturen<br />
der Hochschulen<br />
soll das Prinzip<br />
fortgesetzt werden, auch<br />
wenn die Zuordnungen<br />
noch unterschiedlich und<br />
im Fluss sind. Mehrheitlich<br />
wird den Senaten<br />
oder vergleichbaren Gremien<br />
strategische Kompetenz<br />
und (beschränkte)<br />
Aufsichtsfunktion, den<br />
Hochschulleitungen und<br />
Dekanen operative Verantwortung<br />
zugesprochen. Letztere sollen insbesondere durch die<br />
Verfügung über die Haushaltsmittel entsprechend gestärkt werden.<br />
Zusammenführung von Fachverantwortung und Haushaltsverantwortung:<br />
Die gewünschte Stärkung der Verantwortlichkeit dezentraler Bereiche<br />
im NPM ist damit verbunden, dass diesen eine weitgehend<br />
eigenständige Verfügung über den Einsatz benötigter Ressourcen<br />
ermöglicht wird. Für die Finanzierung der Hochschulen durch den<br />
Staat bedeutet dies, dass diese aus dem strengen kameralistischen<br />
Korsett befreit werden muss. Durch Globalzuweisung und die damit<br />
einhergehende Flexibilisierung der Haushaltsbewirtschaftung<br />
werden die Voraussetzung dafür geschaffen, dass die Hochschulen<br />
die nötigen Handlungs- und Bewegungsspielrä<strong>um</strong>e erhalten, weil<br />
sie selbständig über den Einsatz der Mittel bestimmen können.<br />
Deregulierung und Übertragung staatlicher Befugnisse:<br />
Der Rückzug des Staates aus einer engen Fachaufsicht verlangt eine<br />
Neuverteilung der bisher vom Staat erfüllten Aufgaben. Dieser<br />
Rückzug, der in den jeweiligen Bundesländern unterschiedlich stark<br />
verfolgt wird, ist mit der Aufgabe gesetzlicher Detailregelungen<br />
verbunden. Die Frage, wie weitgehend der Regelungsverzicht sein<br />
soll, steht im Zentr<strong>um</strong> der gegenwärtigen Debatten im Rahmen<br />
der Novellierungsbestrebungen der <strong>Hochschulgesetz</strong>e. Es zeichnet<br />
sich jedoch ab, dass mit einer Verlagerung bisher staatlicher Kompetenzen<br />
in die Hochschulen auch die gesetzlichen Organisationsvorgaben<br />
zur Gruppenuniversität in Gänze zur Disposition gestellt<br />
werden, wie dies in den Experimentierklauseln der <strong>Hochschulgesetz</strong>e<br />
einiger Länder schon jetzt der Fall ist.<br />
21
Schwerpunkt<br />
Neue Entscheidungs- und Leitungsstrukturen/ Aufsichtsräte:<br />
Die Verlagerung der Kompetenzen und Verantwortlichkeiten in<br />
die ausführenden Bereiche und die Schaffung von flexiblen dezentralen<br />
Organisationsstrukturen verlangt eine Absage an die hierarchisch<br />
gegliederte Verwaltung und bedingt einen <strong>um</strong>fassenden<br />
Umbau der traditionellen Entscheidungs- und Leitungsstrukturen.<br />
Im Hochschulbereich betrifft dies sowohl das Verhältnis Staat/<br />
Hochschule als auch die Binnenverhältnisse. Zusammen mit der<br />
Haushaltsverantwortung wird ein Teil der bisherigen staatlichen<br />
Steuerungsfunktionen der Hochschulen unmittelbar in die Hochschulen<br />
verlagert werden (z.B. der, der die Organisation von Lehre<br />
und Forschung betrifft). Ein anderer Teil wird durch Rahmenvorgaben<br />
und die Verknüpfung der Mittelvergabe an Zielvereinbarungen<br />
oder/und Leistungsindikatoren zwar eine neue Form und<br />
auch eine neue Gestalt erhalten, aber bei dem Staat verbleiben.<br />
Unterschiedliche Konzepte bestehen hinsichtlich der Frage, wem<br />
die Aufsichtsfunktion über die Hochschulen zukommen soll und<br />
wie diese institutionalisiert werden soll. Insbesondere die Hochschulen,<br />
die sich möglichst weitgehend von der Ministerialbürokratie<br />
lösen wollen, verbinden dies mit der Einführung von Hochschulräten,<br />
denen aufsichtsratähnliche Kompetenzen übertragen<br />
werden.<br />
Output- statt Inputsteuerung / Controlling und Evaluation / Total<br />
quality management:<br />
Im Unterschied zu einer Steuerung durch rechtliche und hierarchische<br />
Kontrollen steht im NPM die Ausrichtung auf Ergebnisvorgaben<br />
im Vordergrund. Dabei wird die Überprüfung der ordnungsgemäßen<br />
Verausgabung vorab veranschlagter finanzieller und<br />
personeller Mittel im Rahmen kameralistischer Haushaltsführung<br />
durch Überprüfung der tatsächlichen Leistung abgelöst. Hierzu<br />
bedarf es aussagekräftiger Messgrößen und Methoden zur Kosten-<br />
, Leistungs- und Wirkungsmessung.<br />
Für die Hochschulen werden dementsprechend sowohl Verfahren<br />
und Indikatoren zur Kontrolle des effizienten Mitteleinsatzes als<br />
auch zur Qualität der erbrachten Leistungen entwickelt. Dies betrifft<br />
sowohl die Leistungsbewertung der Institution als auch die<br />
der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (inklusive Professoren und<br />
Professorinnen), deren leistungsgemäße Bezahlung ebenfalls zur<br />
Debatte steht. In der Schwierigkeit, konsensfähige Kriterien der<br />
Leistungsbemessung aufzustellen und total quality management<br />
in die Hochschulen einzuführen, zeigt sich jedoch die Spezifität<br />
der Institution Hochschule in besonderem Maße.<br />
Wettbewerbsorientierung:<br />
Der Wettbewerbsgedanke, der im NPM als Triebfeder für die Verbesserung<br />
der Leistungsqualität und der Kosteneffizienz angesehen<br />
wird, ergreift zunehmend auch den Hochschulbereich. Parti-<br />
ell stehen die Hochschulen schon jetzt im nationalen und internationalen<br />
Wettbewerb <strong>um</strong> Studierende, <strong>um</strong> Ausstattung, <strong>um</strong> wissenschaftliches<br />
Personal, eine Konkurrenz, die sich jedoch bisher<br />
eher quasi naturwüchsig hergestellt hat. Zunehmend wird jedoch<br />
die Wettbewerbsorientierung als bewusstes Steuerungs- und Ausleseinstr<strong>um</strong>ent<br />
eingesetzt und ähnlich wie in einigen Bereichen<br />
der kommunalen Verwaltungen ausgebaut: durch die Verknüpfung<br />
der Mittelvergabe an Leistungsvergleiche, durch bench-marking<br />
und durch die Schaffung interner Märkte oder dadurch, dass Aufträge<br />
nach außen gegeben oder <strong>um</strong>gekehrt Aufträge von außen in<br />
die Hochschulen hereingeholt werden. Auch die <strong>Diskussion</strong> <strong>um</strong><br />
die Auswahl der Studierenden durch die Hochschulen oder <strong>um</strong>gekehrt<br />
die Auswahl der Hochschulen durch die Studierenden mit<br />
dem Einsatz von Bildungsgutscheinen sind in diesem Kontext zu<br />
sehen.<br />
Management by objectives - Kontraktmanagement und Zielvereinbarungen:<br />
Anfänglich in erster Linie in der Mitarbeiterführung in der Wirtschaft<br />
eingesetzt, gehört das Konzept des management by objectives<br />
zu den mittlerweile gängigen Maßnahmen im Repertoire des<br />
NPM. Zielvereinbarungen wurden aus der Personalentwicklung,<br />
auch bekannt als eine Form des Mitarbeitergesprächs, auf Organisationseinheiten<br />
übertragen. An die Stelle prozessregulierender<br />
Vorgaben der vorgesetzten Seite tritt das Aushandeln der zu erreichende<br />
Ziele zwischen der vorgesetzten und der ausführenden Einheit<br />
und die Festlegung der Rahmenbedingungen, insbesondere<br />
die Zusicherung der notwendigen materiellen Ressourcen.<br />
Kontraktmanagement und Zielvereinbarungen stellen ein Managementinstr<strong>um</strong>ent<br />
dar, das sich nicht zuletzt wegen der damit verbundenen<br />
Planungssicherheit für die ausführenden Einheiten<br />
vergleichsweise breiter Akzeptanz im Hochschulbereich erfreut, und<br />
zunehmend sowohl hochschulextern - im Verhältnis Hochschule/<br />
Staat - in Form von Innovationspakten oder konkreter gefassten<br />
Leistungsverträgen als auch hochschulintern, im Verhältnis Hochschulleitung/Fakultäten<br />
eingesetzt wird.<br />
3. Bewertung<br />
Das Konzept des NPM enthält sowohl Elemente, deren Übertragung<br />
auf den Hochschulbereich dazu beitragen kann, verkrustete<br />
(Macht-) Strukturen aufzubrechen, als auch solche, die geeignet<br />
sind, Handlungsspielrä<strong>um</strong>e nicht zu erweitern, sondern im Gegenteil<br />
noch weiter einzuschränken. Im Abschmelzen hierarchischer<br />
Weisungsbefugnisse und der stärkeren Ausrichtung auf die<br />
eigentlichen Akteure liegt ein Reformpotenzial, das für alle Beteiligten<br />
zufriedenstellendere Ergebnisse bringen kann. Damit sich<br />
dieses Potenzial entfalten kann, muss jedoch dafür Sorge getragen<br />
werden, dass bürokratische Macht nicht <strong>um</strong>standslos durch die<br />
Budgetmacht einzelner ersetzt und die wenig nützliche aber auch<br />
wenig störende Kontrolle des Einhaltens von Verwaltungsvorschriften<br />
durch eine scharfe Ergebniskontrolle anhand zweifelhafter Indikatoren<br />
abgelöst wird.<br />
Dorothea May<br />
Literatur<br />
Budäus, Dietrich (1994): New Puplic Management. Konzepte und Verfahren zur Modernisierung<br />
öffentlicher Verwaltungen, Berlin.<br />
Naschold, Frieder (1995): Ergebnissteuerung, Wettbewerb, Qualitätspolitik, Entwicklungspfade<br />
des öffentlichen Sektors in Europa, Berlin.<br />
22 <strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 /<strong>20</strong>03
<strong>GEW</strong>-Stellungnahme: „Mangelhafte Qualität<br />
der politisch Verantwortlichen“<br />
Folgende Stellungnahme formulierte die Landesfachgruppe Hochschule<br />
und Forschung des <strong>GEW</strong>-Landesverbands Rheinland-Pfalz<br />
z<strong>um</strong> Entwurf des „Landesgesetz(es) über die Hochschulen in<br />
Rheinland-Pfalz (HochSchG)“:*<br />
1.<br />
Wir begrüßen, dass in Zeiten blamabler PISA- und OECD-Bewertungen<br />
(Education at a Glance, <strong>20</strong>02) die Landesregierung zeigt, dass<br />
sie sich mit einem einheitlichen <strong>Hochschulgesetz</strong> den neuen Erfordernissen<br />
des Bildungsmarktes stellt.<br />
Damit sollen<br />
• der Bologna-Prozess im Gesetz verankert werden,<br />
• die Neuordnung der befristeten Arbeitsverhältnisse im Hochschulbereich<br />
aufgrund der 5. und 6. Novelle des Hochschulrahmengesetzes<br />
(HRG) in Landesrecht <strong>um</strong>gesetzt werden,<br />
• die Hochschuldienstrechtsreform vorangetrieben werden<br />
• die Rechte der verfassten Studierendenschaft ebenso wie<br />
• die Garantie auf Studiengebührenfreiheit für ein erstes berufsqualifzierendes<br />
Studi<strong>um</strong> sowie für konsekutive Studiengänge, die nach einem<br />
Bachelor-Abschluss z<strong>um</strong> Master führen, aufgrund der 6. HRG-<br />
Novelle aufgenommen werden,<br />
• das Gleichstellungsgebot im Geschlechterverhältnis geregelt werden,<br />
• die Deregulierungsmöglichkeiten aufgrund der HRG-Novellierungen<br />
zur Rechtsstellung der Hochschule ausgeschöpft werden.<br />
Diese Vorhaben sind dem Gesetzgeber immer dann gelungen, wenn er<br />
die Regelungen des HRG aufgrund dort bereits vorhandener Detailregelungen<br />
übernimmt, wie z.B. bei der<br />
• Stärkung der sozialen und familiären Belange der Studierenden,<br />
• Stärkung der Rechte der verfassten Studierendenschaft,<br />
• Übernahme des Leitprinzips „Gender Mainstreaming“,<br />
• Stärkung der Frauenförderung,<br />
• Übernahme von Elementen des Qualitätsmanagements wie Qualitätssicherung<br />
in Forschung , Studi<strong>um</strong> und Lehre sowie studentische<br />
Lehrevaluation,<br />
• Ausgestaltung von Prüfungsordnungen und Studienplänen,<br />
• Studiengebührenfreiheit für ein erstes berufsqualifzierendes Studi<strong>um</strong><br />
sowie für konsekutive Studiengänge, die nach einem Bachelor-Abschluss<br />
z<strong>um</strong> Master führen.<br />
Der Gesetzesentwurf ist immer dann misslungen, wo das Land nicht<br />
mehr zu seiner Verantwortung für Ausbildung und Wissenschaft steht<br />
und Prinzipien des new public management nicht in ein new university<br />
management transformiert. Fälschlicherweise werden unter dem<br />
Schlagwort der „Autonomie“ der Hochschule Elemente des new public<br />
management nachvollzogen. Diese Elemente sind die Trennung zwischen<br />
normativer und strategischer Kompetenz sowie operativer Verantwortung.<br />
Dies führt dann für den Bereich der Finanzautonomie zu<br />
einer Kaschierung von Haushaltskürzungen und einer Flucht aus der<br />
Verantwortung für eine wissenschaftsadäquate, qualitätsfördernde Hochschulfinanzierung.<br />
Für den Bereich der Übertragung staatlicher Befugnisse auf die Hochschulen,<br />
verbunden mit einer Deregulierung der Organisationsrechte<br />
bei<br />
<strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 /<strong>20</strong>03<br />
Hochschulen<br />
• schlichter Übernahme von Führungsstrukturen großer Kapitalgesellschaften<br />
(Hochschulrat, Gemeinsame Kommission) und<br />
• monokratischer Leitungsstruktur<br />
führt dies dazu, dass die Gruppenuniversität in Gänze zur Disposition<br />
steht.<br />
2. Im Einzelnen<br />
2.1. Z<strong>um</strong> Verhältnis Staat - Hochschule - Gesellschaft<br />
Die <strong>GEW</strong> kritisiert grundsätzlich den Rückzug des Staates aus seiner<br />
Verantwortung für die Hochschulen des Landes durch den Einzug des<br />
Hochschulrats (§ 75) als Organ der Hochschule. Nicht nur für die Gewerkschaften<br />
sind Bildung und Wissenschaft gesellschaftliche Aufgaben,<br />
die - demokratisch legitimiert und öffentlich realisiert - zur Optimierung<br />
des Erkenntnisprozesses und zur demokratischen Qualifizierung<br />
aller Menschen beitragen sollen.<br />
Der vorliegende Entwurf für ein rheinland-pfälzisches <strong>Hochschulgesetz</strong><br />
wird diesem Anspruch nicht gerecht.<br />
Der Entwurf bricht mit Formen grundgesetzlich geschützter demokratischer<br />
Teilhabe an den Hochschulen. „Die Hochschulleitung werde durch<br />
Managementfunktionen gestärkt“, so der Minister. Damit werden den<br />
Hochschulen dirigistische Strukturen übergestülpt, die nicht einmal mehr<br />
den in der sonst gar nicht mehr als sich so vorbildlich erwiesenen Wirtschaft<br />
gängigen betriebswirtschaftlichen Prinzipien von Partizipation,<br />
flachen Hierarchien und Dezentralisierung genügen.<br />
2.1.1 Der Hochschulrat<br />
Die einschneidendste Veränderung der Leitungsstrukturen der Hochschulen<br />
ist die Einführung eines Hochschulrates, der je nach Größe der<br />
Hochschule aus 6 bis 8 Personen besteht, die weder der Hochschule<br />
noch dem zuständigen Ministeri<strong>um</strong> angehören dürfen. Sie sollen zu<br />
gleichen Teilen vom zuständigen Ministeri<strong>um</strong> und vom höchsten Selbstverwaltungsgremi<strong>um</strong><br />
der jeweiligen Hochschule, dem Senat, berufen<br />
werden.<br />
Dem Hochschulrat stehen im Wesentlichen Kompetenzen zu, die bisher<br />
die höchsten Selbstverwaltungsorgane der Hochschulen hatten. Er stimmt<br />
der Grundordnung der jeweiligen Hochschule zu, und ohne seine Zustimmung<br />
können weder grundsätzlichen Strukturfragen von Forschung,<br />
die Grundsätze zur Mittelverteilung noch ein Gesamtentwicklungsplan<br />
<strong>um</strong>gesetzt werden.<br />
Damit wird das Demokratie- und Rechtsstaatprinzip tangiert, weil<br />
• die Zustimmungsträger des Hochschulrats nicht demokratisch legitimiert<br />
sind und sie keinem demokratisch legitimierten Gremi<strong>um</strong> mehr<br />
verantwortlich sind. Er verstößt gegen das Rechtsstaatsprinzip,<br />
• weil er als ein mit externen Mitgliedern besetztes Organ weitreichend<br />
in die Selbstverwaltungsangelegenheiten der Hochschule eingreift.<br />
Die demokratische Selbstverwaltung der Hochschulen wird dadurch<br />
* Ähnliche Stellungnahmen haben auch der DGB und der<br />
Hauptpersonalrat des Wissenschaftsministeri<strong>um</strong>s abgegeben.<br />
Diese sind unter www.<strong>GEW</strong>-Rheinland-Pfalz.de nachzulesen.<br />
Die gerasterten Textpassagen sind Forderungen der <strong>GEW</strong> z<strong>um</strong><br />
neuen <strong>Hochschulgesetz</strong>. red<br />
23
Schwerpunkt<br />
ebenso ausgehebelt wie die hochschulpolitische Verantwortung demokratisch<br />
legitimierter politischer Instanzen des Landes Rheinland-Pfalz.<br />
Schließlich wird der Wirtschaft durch die Hochschulräte ein direkter<br />
Zugriff auf die Hochschulen eröffnet.<br />
Wir setzen dieser Politik eine andere Vorstellung von Hochschule<br />
entgegen, die von gesellschaftlicher Verantwortung, weitergehender Demokratie<br />
und Aufklärung getragen wird, und setzen dem unsere Forderung<br />
entgegen, den durchaus auch von uns gewollten in seinen Aufgaben<br />
erweiterten Senat (durch Wegfall der Versammlung) unter Ausschöpfung<br />
der verfassungsrechtlichen Mitwirkungsmöglichkeiten aller<br />
Gruppen verbindlich zu besetzen und das Hochschulkuratori<strong>um</strong> zu<br />
stärken.<br />
Der Hochschulrat besteht zur Hälfte aus Mitgliedern „aus den Bereichen<br />
Wirtschaft und öffentlichem Leben“. Wir verstehen unter den Vertretungen<br />
der Wirtschaft Vertretungen der Unternehmer und Arbeitnehmer.<br />
Vertretungen aus dem öffentlichen Leben setzen sich dann z.B.<br />
zusammen aus Kirchen, weiteren Verbänden, Umweltschutzgruppen,<br />
Bürgerinitiativen, NGO, Agendainitiativen.<br />
Angesichts der Finanzknappheit der Hochschulen fragen wir uns auch,<br />
wer eigentlich die „angemessene Aufwandsentschädigung“ bezahlen soll?<br />
2.2 Mitwirkung und Mitbestimmung an den Hochschulen<br />
Die Hochschulen haben ihre Arbeit in den Dienst der Gesellschaft zu<br />
stellen und zur Lösung der drängenden Probleme beizutragen. Die verschiedenen<br />
gesellschaftlichen Gruppen sind an der Formulierung der<br />
Ziele von Bildung und Wissenschaft zu beteiligen und müssen an den<br />
Ergebnissen von Forschung und Lehre gleichermaßen teilhaben können.<br />
Nur bei Entscheidungen, die Forschung und Lehre unmittelbar<br />
betreffen, verlangt das Karlsruher Verfassungsgerichtsurteil von 1973<br />
einen „maßgebenden“ (50% der Sitze) bzw. „ausschlaggebenden“ (mehr<br />
als 50% der Stimmen) Einfluss der Gruppe der ProfessorInnen.<br />
Unter Berücksichtigung des Karlsruher Urteils schlagen wir also vor,<br />
bei allen satzungsgemäßen Entscheidungen, die nicht unmittelbar Forschung<br />
und Lehre betreffen, mindestens die Vertretungen der Arbeitnehmerinnen<br />
und Arbeitnehmer in neu zu schaffende Organe wie z.B.<br />
„beratende Beiräte“ mit einzubeziehen.<br />
Da darüber hinaus der Beteiligung der Mitglieder der Hochschule an<br />
den Entscheidungsprozessen über Ziele, Inhalte und Methoden von<br />
Lehre, Studi<strong>um</strong> und Forschung eine wesentliche Bedeutung im Rahmen<br />
der Wissenschaftsfreiheit sowohl der einzelnen WissenschaftlerInnen<br />
als auch der Organisation zukommt, gilt es zur Stärkung der Mitwirkungsmöglichkeiten<br />
aller Hochschulmitglieder die Kooperation und<br />
Entscheidungsbeteiligung von akademischen Gremien, studentischer Interessenvertretung<br />
sowie Personalvertretung auf allen Ebenen zu institutionalisieren.<br />
2.3 Hochschulpolitische Korrektive<br />
2.3.1 Verbindung von Wissenschaft und Politik<br />
Da<br />
• der alte § 98 UG z<strong>um</strong> Haushaltsvoranschlag der Hochschule sowie<br />
• die Ziff. 9 im § 9 Auftragsangelegenheiten „die Aufstellung des Haushaltsvoranschlags<br />
gemäß § 98 Abs. 1“ entfallen,<br />
• die Hochschulen nur noch z<strong>um</strong> Landeshaushalt Stellung nehmen (§<br />
101 Abs.4)<br />
• der Hochschulhaushalt aus dem Landeshaushalt ausgegliedert werden<br />
soll (§ 101 Abs. 2 erster Satz) sowie<br />
• mit dem Hochschulrat eine Institution mit weitreichenden hochschulpolitischen<br />
Steuerungsmöglichkeiten geschaffen worden ist, der keinem<br />
demokratisch legitimierten Gremi<strong>um</strong> verantwortlich ist,<br />
müssen die Hochschulen gegenüber Politik und Gesellschaft nur noch<br />
in geringem Maße Rechenschaft über ihr Tun ablegen. Die hochschulpolitische<br />
Verantwortung demokratisch legitimierter Instanzen unseres<br />
Landes (Landtag) wird damit untergraben. Parallel zu den Anstrengungen<br />
des Staates müssen die Hochschulen eine Debatte über ihr Profil<br />
und ihre Leistungsfähigkeit führen. Sie müssen nachweisen, dass sie<br />
in der Lage sind, die Mittel, die ihnen Staat und Gesellschaft zur Verfügung<br />
stellen, auch effektiv nutzen.<br />
2.3.2 Öffnung des Verhältnisses zwischen Hochschule und<br />
Gesellschaft<br />
Da sich darüber hinaus die Verbindung mit allen gesellschaftlichen<br />
Kräften durch eine relativ einseitige Verbindung zugunsten der Wirtschaft<br />
(s. Zusammensetzung Hochschulrat und Gemeinsame Kommission)<br />
verlagert hat, und damit eine Hochschulautonomie immer dann<br />
nicht mehr gewahrt ist, wenn die Hochschule ihre Autonomie an ein<br />
mit externen, hochschulfernen Mitgliedern besetztes Kontrollorgan der<br />
Wirtschaft abgeben muss, halten wir es dringend für angebracht, ein<br />
politisches Korrektiv zu fordern. Es ist entlarvend, wenn einerseits in<br />
der entsprechenden Pressemitteilung des Ministeri<strong>um</strong>s mit dem Hochschulrat<br />
dafür gesorgt werde, „so Zöllner, dass die Hochschulen sich<br />
gegenüber der Gesellschaft öffnen“ (Pressemitteilung des MWWFK, S.<br />
2), andererseits in der Begründung z<strong>um</strong> Entwurf des <strong>Hochschulgesetz</strong>es<br />
offen gelegt wird, dass das auch schon bisher vorhandene „Hochschulkuratori<strong>um</strong><br />
der Verbindung von Hochschule und Gesellschaft<br />
dient,“ während „der Hochschulrat interne Entscheidungsprozesse durch<br />
externen Sachverstand unterstützen“ (Begründung S. 2.1.1) soll.<br />
Dieses Korrektiv muss mindestens darin bestehen, -wie in anderen Bundesländern<br />
auch -, dass Hochschulen ebenso wie mit dem fachlich zuständigen<br />
Ministeri<strong>um</strong> (s. §2 Abs. 9 ) auch Zielvereinbarungen mit<br />
dem Landtag treffen können.<br />
2.3.3 Gruppenvertretung in Gremien (insbes. § 78)<br />
• Mitwirkungsrechte:<br />
Die <strong>GEW</strong> fordert die in § 37 Abs. 2 Satz 2 deregulierten Mitwirkungsrechte<br />
zugunsten einer verbindlichen gesetzlichen Regelung zurückzunehmen,<br />
wiewohl sie sich einer differenzierten Experimentierklausel<br />
zu diesem Problemhorizont im Gesetz nicht verschließen wird.<br />
• Wenn auch nicht in § 72 ausdrücklich als Hochschulorgan genannt,<br />
so erfahren wir doch aus der Begründung, dass die Gemeinsame Kommission<br />
„ein weiteres zentrales Gremi<strong>um</strong> in jeder Hochschule“ ist. Dies<br />
hat aber zur Folge, dass entspr. § 37 Abs.2 Satz 2 alle Mitgliedergruppen<br />
vertreten sein müssen. Wenn also die Hälfte der Mitglieder dieses<br />
Gremi<strong>um</strong>s aus dem Senat entsandt werden, muss die Gemeinsame Kommission<br />
aus mindestens 8 Mitgliedern bestehen. Nur so können alle<br />
Mitgliedergruppen „stimmberechtigt an Entscheidungen mit“wirken.<br />
2.3.4 Konflikt zwischen Hochschulautonomie und Personalvertretung<br />
(insbes. § 76 Abs. 2 Ziff. 7 und 8 sowie § 8)<br />
Die Autonomie der Hochschule mit einem nach ständerechtlich orientierten<br />
Klassenwahlrecht wird bei gleichzeitiger Übertragung von Entscheidungsrechten<br />
des Senats nunmehr auf die Hochschulleitung weiter<br />
gestärkt. Diese Verlagerung der Kompetenzen von satzungsautonomen<br />
Gremien auf den /die PräsidentIn macht die Mitbestimmung zunächst<br />
transparenter. Der Senat trifft aber weiterhin satzungsautonome Ent-<br />
24 <strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 /<strong>20</strong>03
scheidungen, die den Mitbestimmungsrechten der Personalvertretung<br />
entzogen sind. Damit entsteht immer dann ein Konflikt zwischen<br />
Zuständigkeitsangelegenheiten der Dienststellenleitung und Selbstverwaltungsangelegenheiten<br />
der Hochschulorgane, wenn die/der PräsidentIn<br />
auf die satzungsautonomen Entscheidungen der Hochschulorgane<br />
verweist. Sie/Er bezeichnet sich dann als nur ausführendes Organ und<br />
bewirkt, dass Mitbestimmungsrechte der Personalvertretung nicht wahrgenommen<br />
werden können. Der Hauptpersonalrat beim MWWFK<br />
bezieht sich in seiner Stellungnahme z<strong>um</strong> neuen <strong>Hochschulgesetz</strong> ausdrücklich<br />
auf diese Problematik. Er zeigte bereits in seiner Stellungnahme<br />
z<strong>um</strong> Universitätsgesetz im Jahre 1995 Lösungswege auf.<br />
Bereits damals forderte er durch eine Änderung des LPersVG oder innerhalb<br />
des Universitätsgesetzes eine Änderung der Rechtsbeziehung<br />
zwischen den satzungsautonomen Organen einerseits und dem Personalrat<br />
im Rahmen seiner Zuständigkeiten andererseits in der Form,<br />
dass die Beteiligungsrechte und die Konfliktregelungsinstr<strong>um</strong>ente der<br />
Personalvertretung zur Wirkung kommen können.<br />
Die <strong>GEW</strong> schließt sich auch der neuen Stellungnahme des Hauptpersonalrats<br />
ausdrücklich an.<br />
2.3.5 Deregulierung<br />
Die Begründung für das neue <strong>Hochschulgesetz</strong> liefert die erklärte Absicht<br />
einer „Stärkung der Hochschulautonomie durch Deregulierung<br />
und Global- statt<br />
Detailsteuerung“.<br />
Der Gesetzesentwurf<br />
wird seinem<br />
eigenen Anspruch<br />
in keiner Weise gerecht.<br />
Weder wird<br />
konsequent dereguliert<br />
noch konsequent<br />
global gesteuert.<br />
In den<br />
Abschnitten Organisation,Finanzierung<br />
sowie<br />
Mitgliedschaft<br />
wird dereguliert<br />
und global gesteuert,<br />
eine verdichtete<br />
Detailsteuerung<br />
finden wir in den<br />
Abschnitten Stu-<br />
di<strong>um</strong> und Lehre<br />
und Personalwesen.<br />
In diesem Zusammenhang<br />
sind die<br />
gehäuften Hinweise<br />
auf „das Nähere regelt die Grundordnung“ sowie „ das Nähere<br />
regelt das fachlich zuständige Ministeri<strong>um</strong>“ entlarvend.<br />
Wir fordern den Gesetzgeber auf, sich mindestens an die Bestimmungen<br />
der 5. HRG-Novelle § 58 Abs. 2 zu halten, wo die Grundordnung<br />
„ der Genehmigung des Landes“ bedarf und dies nicht einer Politik der<br />
Kungelei zwischen Mitgliedern des Hochschulrats, denen der Gemeinsamen<br />
Kommission und des Senat zu überlassen.<br />
<strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 /<strong>20</strong>03<br />
Hochschulen<br />
Wer Innovationen will, muss Partizipation ermöglichen. Innovation<br />
erfolgt nicht durch top-down-Entscheidungen, sondern durch die Mitwirkung<br />
aller Beteiligten. Die <strong>GEW</strong> will den Aushandlungsprozess.<br />
Sie mahnt daher eine differenzierte Regelungsdichte immer dort an,<br />
wo es <strong>um</strong> Beteiligungs-, Mitwirkungs-, Mitbestimmungsrechte geht,<br />
wie sie andererseits für die Rücknahme von Detailregelungen immer<br />
dort eintritt, wo es dar<strong>um</strong> geht, den Hochschulen Gestaltungsspielrä<strong>um</strong>e<br />
in Forschung, Studi<strong>um</strong> und Lehre zu eröffnen.<br />
2.3.6 verstärktes Quor<strong>um</strong><br />
Selbstverständlich muss ein/e so starke/r PräsidentIn auch abwählbar<br />
sein. Dafür sorgt das Gesetz mit einer Stimmenmehrheit von drei Vierteln<br />
der Senatsmitglieder.<br />
Dem stellt die <strong>GEW</strong> die Forderung nach einer Verabschiedung der<br />
Grundordnung durch den Senat ebenfalls mit 3/4 Mehrheit bei.<br />
Damit kann das zentrale Organ der Hochschule in seinem Stand gegenüber<br />
Hochschulleitung UND Hochschulrat mindestens in Teilen<br />
gestärkt werden und versinkt mit seiner Beschränkung auf eine Richtlinienkompetenz<br />
nicht in die Bedeutungslosigkeit.<br />
2.4 Personal und Nachwuchsförderung<br />
2.4.1. Arbeitsplatzbedingungen<br />
Die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen<br />
insbesondere der wissenschaftlichen<br />
und<br />
nicht-wissenschaftlichen<br />
MitarbeiterInnen sind<br />
z.Zt. weder aufgabengerecht<br />
noch wettbewerbsadäquat<br />
ausgestaltet.<br />
Die hohe Zahl ungeschützterBeschäftigungsverhältnisse<br />
schafft<br />
darüber hinaus große<br />
Motivationsprobleme.<br />
Die Flexibilisierung der<br />
wissenschaftlichen Arbeitskraft<br />
stellt die Kontinuität<br />
und damit<br />
Qualität der wissenschaftlichen<br />
Arbeit<br />
grundsätzlich in Frage.<br />
Neues<br />
<strong>Hochschulgesetz</strong><br />
Kommt dann noch hinzu,<br />
dass<br />
• Hochschulen auch in<br />
einer anderen Rechtsform<br />
errichtet werden<br />
können (§6 Abs 1)<br />
• Fachbereiche in Teilfachbereiche<br />
als Untereinheiten gegliedert werden können (§ 87 Abs.<br />
1)<br />
• Hochschulen bei Forschungsschwerpunkten auch Abweichungen von<br />
gesetzlichen Organisationsformen zulassen können (12 Abs. 2),<br />
bedarf es dringend der Aufnahme von Verhandlungen <strong>um</strong> eine tarifvertragliche<br />
Regelung der Beschäftigungsverhältnisse für das wissenschaftliche<br />
Personal in den Hochschulen.<br />
25
Schwerpunkt<br />
2.4.2 Gruppenzugehörigkeit<br />
• Zur Gruppe der Wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
an Universitäten und Fachhochschulen werden detaillierte Regelungen<br />
geschaffen (§ 46; § 57 Abs. 1; § 37, Abs. 2:Satz 3 ). Wir lehnen<br />
eine Unterscheidung zwischen Wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und<br />
Mitarbeitern an Universitäten, Wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeitern an Fachhochschulen und Fachhochschulassistentinnen<br />
und -assistenten ab.<br />
Wir fordern eine einheitliche Personalkategorie mit einheitlichen Aufgabenstellungen<br />
und Arbeitsbedingungen.<br />
Auch geben wir zu Bedenken, dass aufgrund der Änderung des § 135<br />
HG im Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) nunmehr auch noch<br />
die FH-AssistentInnen eingeschränkte Schutzrechte haben. Sowohl die<br />
Mitbestimmungs- als auch die Mitwirkungsrechte der FH-AssistentInnen<br />
werden durch das neue <strong>Hochschulgesetz</strong> stark eingeschränkt.<br />
• Für Doktorandinnen/Doktoranden ist zukünftig nach § 34 ein förmlicher<br />
Rechtsstatus vorgesehen. In § 34 haben eingeschriebene DoktorandInnen<br />
„Rechte und Pflichten der Studierenden“, bilden aber nach<br />
§ 37 (2) Nr. 3 für die Vertretung in den Gremien zusammen mit den<br />
akademischen MitarbeiterInnen eine Gruppe. Dies erscheint uns ein<br />
Widerspruch und auch im Hinblick auf die Interessenlage nicht sachgerecht.<br />
• Da im Personalvertretungsrecht die Wahlen im Geschäftsbereich des<br />
MWWFK sich nach der Gruppenzugehörigkeit der Beschäftigten regelt,<br />
mahnt die <strong>GEW</strong> für die Beschäftigten in wissenschaftlichen und<br />
zentralen Einrichtungen (§ 91) ebenso wie für DoktorandInnen entspr.<br />
§ 56 Abs. 5 eine Regelung zur Gruppenzugehörigkeit an, da<br />
ansonsten bei Personalratswahlen und Wahlen der Stufenvertretungen<br />
Wahlanfechtungsklagen drohen.<br />
2.4.3 Lehrauftragsvergabe<br />
• In § 64 Abs. 3 ist völlig neu vorgesehen, dass Lehraufträge an hauptberufliches<br />
akademisches Personal im Fachgebiet, für das sie berufen<br />
oder eingestellt sind, nicht zulässig sein sollen. Aus der Begründung ist<br />
zu entnehmen, dass hiermit aber wohl nur Vollzeitbeschäftigte gemeint<br />
sind.<br />
Daher drängen wir auf eine Klarstellung insofern, als Teilzeitbeschäftigte<br />
von diesem Verbot nicht erfasst werden.<br />
• Da offenbar damit auch Wissenschaftliche MitarbeiterInnen in Drittmittelprojekten,<br />
deren Dienstaufgaben sich in der Regel ausschließlich<br />
auf die Forschung beziehen, sowie Teilzeitbeschäftigte erfasst sind, könnten<br />
an diesen Personenkreis keine Lehraufgaben übertragen werden,<br />
was sie insbesondere im Hinblick auf die Gewinnung von Lehrkapazität<br />
und den Nachweis von Lehrerfahrung für die Bewerbung auf eine<br />
Professur oder eine Juniorprofessur benachteiligen würde.<br />
• § 121 (1) Ebenso wie den beamteten wissenschaftlichen MitarbeiterInnen<br />
sollte auch den auf Dauer angestellten wissenschaftlichen MitarbeiterInnen<br />
die Möglichkeit gegeben werden, selbständige Lehraufträge<br />
zu erhalten.<br />
2.4.4 Schutzbedürftigkeit der ehrenamtlichen Gremienmitglieder<br />
In § 37 Abs. 3 sollten stärkere Schutzrechte für Mitglieder in Hochschulgremien<br />
geregelt werden. Wir fordern, das Problem des Freizeitausgleichs<br />
für eine Teilnahme an Gremienarbeit (z. B. analog zu den<br />
Regelungen des LPersVG) endlich zu regeln. Gemeinsam mit dem<br />
Hauptpersonalrat schlägt die <strong>GEW</strong> die Aufnahme folgenden Passus in<br />
die Gesetzesvorlage vor:<br />
„Die Hochschulmitglieder dürfen wegen ihrer Tätigkeit in der Selbst-<br />
verwaltung weder bevorzugt noch benachteiligt werden; sie sind in diesen<br />
Funktionen an Weisungen nicht gebunden. Für Mitglieder in Organen,<br />
Gremien und Kommissionen nach diesem Gesetz oder nach der<br />
Grundordnung der Hochschule gelten die Vorschriften des Landespersonalvertretungsgesetzes<br />
für Rheinland-Pfalz über Arbeitszeitversä<strong>um</strong>nis<br />
sowie über den Schutz der Mitglieder der Personalvertretungen vor<br />
Versetzung, Abordnung oder Kündigung entsprechend Satz 2 gilt entsprechend<br />
für Mitglieder von Gremien, die von Organen nach diesem<br />
Gesetz oder nach der Grundordnung eingesetzt werden.“<br />
2.4.5 Juniorprofessuren<br />
• In § 48 werden die dienstlichen Aufgaben von HochschullehrerInnen<br />
geregelt. Die <strong>GEW</strong> ist der Auffassung, dass an dieser Stelle auch konkret<br />
auf die Aufgaben der Juniorprofessur eingegangen werden sollte<br />
und schlägt daher folgenden Passus in die Aufnahme des Gesetzes vor:<br />
§ 48 Abs. X: „JuniorprofessorInnen haben die Aufgabe, sich durch die<br />
selbständige Wahrnehmung der ihrer Hochschule obliegenden Aufgaben<br />
in Wissenschaft und Kunst, Forschung und Lehre sowie der wissenschaftlichen<br />
Weiterbildung für die Berufung zu Professoren zu qualifizieren.<br />
Die Voraussetzungen hierfür sind bei der Ausgestaltung des<br />
Dienstverhältnisses und der Funktionsbeschreibung der Stelle zu gewährleisten.“<br />
• Ebenso fehlt im § 50 (2) die Ausformulierung der Bestellung von<br />
JuniorprofessorInnen.<br />
Die <strong>GEW</strong> schlägt folgenden Passus zur Aufnahme in das Gesetz vor:<br />
„JuniorprofessorInnen werden vom Präsidenten auf Vorschlag des Fachbereiches<br />
bestellt. Der Vorschlag wird von einer Auswahlkommission<br />
des Fachbereiches, die wie eine Berufungskommission zusammengesetzt<br />
ist, unter Einbeziehung von Gutachten auswärtiger sachverständiger<br />
Personen erstellt; der Senat wirkt bei der Erstellung des Besetzungsvorschlages<br />
wie bei den Vorschlägen zur Berufung von ProfessorInnen mit.“<br />
• § 56 (1): Zur Lösung des Problems der Bewährung einer Juniorprofessur,<br />
die eng mit einer Verlängerung verknüpft ist, wird angeregt, für<br />
Bewährungsentscheidungen eine verbindliche Rahmenregelung (Zuständigkeit,<br />
Verfahren, Kriterien, etc.) vorzusehen.<br />
Wir schlagen folgenden Text zur Aufnahme ins Gesetz vor: „Die Entscheidung<br />
über die Bewährung einer Juniorprofessur trifft der Fachbereichsrat<br />
unter Berücksichtigung von Gutachten, davon mindestens 2<br />
externen Gutachten. Die GutachterInnen werden vom Fachbereichsrat<br />
bestimmt. Das Nähere regeln Satzungen der Hochschule.“<br />
Im Hinblick auf die schwächere Rechtsstellung der Juniorprofessuren<br />
und in Anbetracht, dass sie die vorherigen Dienstverhältnisse der AssistentInnen<br />
und OberassistentInnen ablösen, wird angeregt, dass dieser<br />
Personenkreis in den Schutzbereich des Personalrats aufgenommen wird.<br />
2.4.6 Berufungen<br />
zu § 50 (3) Satz 2: Aus Gründen der Sachnähe und der fachlichen<br />
Verantwortung sollte dem vorschlagenden Fachbereich auf jeden Fall<br />
die Gelegenheit zur Stellungnahme eingerä<strong>um</strong>t werden. Die Reihenfolge<br />
auf dem Berufungsvorschlag ist seitens des Fachbereiches eingehend<br />
zu begründen. Die Hochschule stellt die fachliche Qualifikation<br />
fest und trifft eine sachverständige Aussage über die wissenschaftliche<br />
Eignung und die notwendige Lehrbefähigung. Das Auswahlverfahren<br />
ist mit der Garantie der Wissenschaftsfreiheit besonders eng verknüpft.<br />
2.4.7 Kostenneutralität<br />
Die <strong>GEW</strong> hält eine kostenneutrale Umsetzung des <strong>Hochschulgesetz</strong>es<br />
für nicht durchführbar. Auf das Personal der Hochschulen kommen<br />
viele neue Aufgaben bei Beibehaltung der alten zu.<br />
26 <strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 /<strong>20</strong>03
Statt angekündigter Deregulierungen folgen Detailregelungen so z.B.<br />
in § 24 Studienberatung; §71 Studienkonten; § 26. Abs. 3: Diploma<br />
Supplement; § 25 Leistungspunktesystem; § 19.5 Einführung dualer<br />
Studiengänge; § 23 Fernstudi<strong>um</strong>, Multimedia, Informations- und<br />
Kommunikationstechnik und § 30 Hochschulgrade.<br />
Diese bedürfen einer erheblichen Mehrarbeit insbesondere der Mitglieder<br />
der Gruppen entspr. § 37, Abs. 2 Ziff. 3 und 4. Eine vom Gesetzgeber<br />
vorgesehene Kostenneutralität ist damit nicht gegeben. Die Kosten<br />
der Mehrarbeit müssten sich z<strong>um</strong>indest in der künftigen parametrischen<br />
Ausgestaltung des PBK erhöhend niederschlagen. Tun sie es<br />
nicht, dann wird unter Kostenneutralitätsgesichtpunkten den Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeitern zusätzliche Arbeit aufgebürdet und der<br />
Minister kommt seiner Fürsorgepflicht nicht in gebührender Weise nach.<br />
Kostenneutralität ist nach Meinung der <strong>GEW</strong> auch nicht mit der Einführung<br />
einer Reform der LehrerInnenausbildung durchzuhalten. Vielmehr<br />
erfordert dieses mehr qualifiziertes Personal an den Universitäten<br />
insbesondere in den neuen Ausbildungsinhalten der Bildungswissenschaften.<br />
2.4.8 Streichung der Inkompatibilitätsregelung § 37 Abs.<br />
1 Satz 5<br />
§ 37 regelt in Satz 5 die Mitwirkung im Fachbereichsrat von Personalratsmitgliedern.<br />
Dort heißt es: „Mitglieder der Hochschule, die Aufgaben<br />
der Personalvertretung wahrnehmen, dürfen dem Fachbereichsrat<br />
und Ausschüssen, die für Personalangelegenheiten akademischer und<br />
nichtwissenschaftlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuständig<br />
sind, nicht angehören.“<br />
Da auch im Fachbereichsrat entspr. § 87 Abs. 2 Ziff. 11 nur noch über<br />
Grundsätze der Verteilung von Stellen und Mittel beschlossen wird,<br />
werden keine Personalangelegenheiten des Personals entspr. § 37 Abs. 2<br />
Ziff 3 und 4 diskutiert.<br />
Die <strong>GEW</strong> fordert die ersatzlose Streichung des § 37 Abs. 1 Satz 5.<br />
2.5 Finanzierung: Preisgabe statt Investition und Verantwortungsübernahme<br />
Trotz der erwähnten blamablen Ergebnissen der PISA-Studie und der<br />
für die deutsche Bildungs- und Wissenschaftspolitik desaströsen Bewertung<br />
durch die OECD (Education at a glance, <strong>20</strong>02) halten die politisch<br />
Verantwortlichen in Rheinland-Pfalz an ihrem Rückzug des Staates<br />
bzw. der Landesregierung aus der Verantwortung für Bildung und<br />
Wissenschaft fest.<br />
Dies zeigt sich vor allem im zentralen Abschnitt Finanzierung<br />
(§§100,101). Hier wird eine ideologische Kehrtwende von der Bedarfsgerechtigkeit<br />
(siehe Universitätsgesetz § 97) zur „Leistungsgerechtigkeit“<br />
vollzogen. So ist z.B. von einer belastungsorientierten Finanzierung<br />
der Hochschule spätestens im § 101 nicht mehr die Rede.<br />
• Der Personalhaushalt der Hochschulen ist über das PBK bereits jetzt<br />
nicht mehr - trotz Leistungs- und (fragwürdiger) Belastungsparameter<br />
- ausfinanziert.<br />
Künftig können Hochschulen<br />
• eigene (!), (nicht Eigenbetriebe) Betriebe bilden (§ 101, Abs. 5),<br />
• auch in einer anderen Rechtsform errichtet werden(§6 Abs 1),<br />
• bei Forschungsschwerpunkten auch Abweichungen von bisher gesetzlichen<br />
vorgeschriebenen Organisationsformen zulassen(12 Abs. 2).<br />
Der Spagat zwischen Hochschulen, die einerseits nach new-public-management-Konzepten<br />
agieren und andererseits als öffentliche Einrichtungen<br />
betrachtet werden, ist nach Meinung der <strong>GEW</strong> dem Gesetzgeber<br />
nicht gelungen: Der weltweite Austausch von Produkten und Dienst-<br />
<strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 /<strong>20</strong>03<br />
Hochschulen<br />
leistungen (GATS) sowie die orts- und zeitunabhängige Be- und Verarbeitung<br />
digitalisierbarer Daten und Informationen zieht weitreichendere<br />
grundlegende Umstrukturierungen sowohl der Arbeits- und Geschäftswelt<br />
wie auch der Art und Weise des Forschens, Lehrens und<br />
Lernens nach sich als sie im Horizont des Gesetzgebers sind.<br />
Den mit diesen einschneidenden Veränderungen einhergehenden Innovationsnotwendigkeiten<br />
müssen sich auch die Hochschulen stellen.<br />
Nach wie vor besteht ihre primäre Aufgabe darin, Wissen zu erzeugen<br />
und Wissen zu vermitteln. Das europäische Erfolgsmodell des gesellschaftlichen<br />
Umgangs mit Wissen, von der Akademie Platons über die<br />
mittelalterlichen Universitäten bis hin zur modernen staatlichen Hochschule<br />
wird durch das Finanzierungsmodell des Gesetzgebers, ohne dass<br />
ein zukunftsträchtiges Ersatzmodell präsentiert wird, arg beschädigt.<br />
Für die <strong>GEW</strong> ist es im Sinne einer zukunftsorientierten und auch<br />
„marktorientierten“ Hochschulpolitik un<strong>um</strong>gänglich, verstärkt in die<br />
Bildungseinrichtungen des Landes zu investieren, z<strong>um</strong>indest aber die<br />
notwendige finanzielle Ausstattung sicherzustellen. Andererseits muss<br />
ein Regelwerk zur Finanzierung und Mitwirkung bzw. Mitbestimmung<br />
geschaffen werden, das die Hochschulen und Forschungsschwerpunkte<br />
bei Errichtung (und Überführung?) in eine andere Rechtsform<br />
in die Lage versetzt, nicht nur überlebens- sondern auch wettbewerbsfähig<br />
zu bleiben.<br />
Damit die wissenschaftlichen Einrichtungen des Landes Rheinland-<br />
Pfalz auch in Zukunft in einer inzwischen globalen Konkurrenz <strong>um</strong><br />
Studienanfänger, Drittmittel und andere Forschungsaufträge national<br />
und international bestehen können, muss die Landesregierung investieren<br />
und sich nicht zurückziehen.<br />
2.6 Studienkonten<br />
Weil Bildung Teil öffentlicher Daseinsfürsorge ist und daher öffentlich<br />
finanziert werden muss, muss ein Studi<strong>um</strong> gebührenfrei bleiben. Der<br />
Bereich Hochschule und Forschung im <strong>GEW</strong>-Landesverband Rheinland-Pfalz<br />
unterstreicht daher seine Ablehnung von Studiengebühren.<br />
Studiengebühren sollen als Instr<strong>um</strong>ente eingesetzt werden, <strong>um</strong> die angeblich<br />
zu hohe Zahl an Langzeitstudierenden (die die Lehre tatsächlich<br />
ka<strong>um</strong> belasten) zu senken und den Hochschulen zusätzliche Einnahmen<br />
zu sichern. Bildungspolitische Steuerung über den Geldbeutel<br />
ist ein Eingeständnis, dass man offenbar über andere Wege keine Akzente<br />
setzen kann.<br />
Die finanziellen und strukturellen Probleme lassen sich nur durch eine<br />
grundlegende inhaltliche Veränderung von Hochschule und Forschung<br />
lösen. Mit der Einführung von Studiengebühren wird dieser Weg aber<br />
verbaut.<br />
Einen neuen Weg versucht die rheinland-pfälzische Landesregierung<br />
mit dem Studienkontenmodell. Die <strong>GEW</strong>-Rheinland-Pfalz hält das<br />
Studienkonten - Modell entspr. § 61 (HochSchG Grundsatz der Gebührenfreiheit,<br />
Studienkonto) wie es z.Zt. auf der Internet-Seite des<br />
MWWFK präsentiert wird, für prüfenswert, wenn<br />
• Sicherheiten bzw. Garantien für eine Festschreibung der Ausstattung<br />
des Studienkontos mindestens in der vorgeschlagenen Form (zweifache<br />
Regelstudienzeit + <strong>20</strong>% Aufschlag) gegeben werden,<br />
• Auswirkungen auf eine Studienreform aus der Hochschule heraus<br />
zugunsten der Studierbarkeit eines Studi<strong>um</strong>s plausibel gemacht werden<br />
können,<br />
• eine gesetzlich geregelte Zweckbindung der Weiterbildungseinnahmen<br />
ausschließlich für Maßnahmen und Projekte innerhalb der wissenschaftlichen<br />
Weiterbildung erfolgt,<br />
• eine gesetzlich geregelte Zweckbindung der Mittel aus der Refinan-<br />
27
Schwerpunkt<br />
zierung der Studienkonten zugunsten der Verbesserung der Lehre erfolgt.<br />
Sie wird insbesondere prüfen, ob das Studienkonten-Modell geeignet<br />
ist, die generelle Einführung von Studiengebühren über Studienkontenmodelle<br />
(z.B. nach dem NRW -Modell) zu verhindern.<br />
3. Sonstiges<br />
3.1. Zentren für Lehrerbildung (§ 93)<br />
Die Einrichtung der Zentren für LehrerInnenbildung wird grundsätzlich<br />
begrüßt, da sie die Voraussetzungen schaffen, eine grundlegende<br />
Neuordnung der LehrerInnenbildung in Angriff zu nehmen. Leider<br />
liegen jedoch bisher widersprüchliche Aussagen zu diesem Themenkomplex<br />
vor.<br />
Da heißt es einmal: „Im <strong>Hochschulgesetz</strong>, das die Einrichtung eines<br />
solchen Zentr<strong>um</strong>s an den Universitäten vorgeben wird, werden die Gestaltungs-<br />
Steuerungs-, Kontroll- und Eingriffsaufgaben und Rechte<br />
dieser Einrichtung sowie ihre Zusammensetzung bestimmt“ ( so „Reformkonzept<br />
zur Lehrerbildung“ S. 9).<br />
Dann wieder<strong>um</strong> an anderer Stelle: „Das Nähere zur Zusammensetzung,<br />
Struktur, Organisation und Mitwirkung im Zentr<strong>um</strong> für Lehrerbildung<br />
regelt das fachlich zuständige Ministeri<strong>um</strong> im Einvernehmen<br />
mit dem für das Schul- und Unterrichtswesen zuständigen Ministeri<strong>um</strong><br />
durch Rechtsverordnung.“(so § 93 Abs. 3).<br />
Mit solchen Regelungen schiebt nicht nur ein Ressort dem anderen die<br />
Verantwortung für die Umsetzung zu, sondern damit gibt der Gesetzgeber<br />
wichtige politische Entscheidungsbereiche an die Exekutive ab,<br />
die er nach unserem Verständnis selbst regeln muss.<br />
Daher fordern wir solche wesentlichen Punkte wie „Struktur, Organisation<br />
und Mitwirkung“ in das Gesetz aufzunehmen und die Mitwirkung<br />
in den Gremien verbindlich zu regeln.<br />
Die <strong>GEW</strong> fordert eine gesetzliche Festlegung auf eine „Einrichtung der<br />
Fachbereiche“ und nicht nur per Rechtsverordnung, z<strong>um</strong>al ja auch für<br />
zentrale Einrichtungen die/der PräsidentIn die Stellen und Mittel entsprechend<br />
den Grundsätzen des Senats zuweist.<br />
Da die Fachbereiche für die Gewährleistung und Sicherstellung des<br />
Lehrangebotes verantwortlich sind, sollte ihnen dann bei den Zentren<br />
für Lehrerbildung als fachbereichsübergreifende wissenschaftliche Einrichtung<br />
ebenso wie den Zentren selbst auch Mitwirkungsrechte zugestanden<br />
werden.<br />
Da der Senat mit Zustimmung des Hochschulrats den Gesamtentwicklungsplan<br />
oder allgemeine Grundsätzen über die Verteilung von Stellen<br />
und Mitteln auf der Grundlage des Hochschulhaushaltes des Landes<br />
mit seinen Leistungs- und Belastungsparametern (PBK, MBS) beschließt,<br />
LehrerInnenausbildung andererseits genuine Aufgabe der<br />
Universitäten ist, sollte der Gesetzgeber bereits im Gesetz die Sicherstellung<br />
der finanziellen Ausstattung der Zentren für LehrerInnenbildung<br />
verankern.<br />
Darüber hinaus haben wir folgende Fragen:<br />
• Werden die Zentren für LehrerInnenbildung zentrale Einrichtungen<br />
unter der Verantwortung mehrerer Fachbereiche, des Senats oder unter<br />
der/des Präsidenten?<br />
• Wie werden die Studienseminare mit den Zentren verzahnt? Was<br />
heißt „die Studienseminare werden Sitz und Stimme in den Zentren<br />
haben?“<br />
• Wer aus den LehrerInnenzentren unterbreitet wem (dem Hochschulrat?,<br />
dem Senat?) die dort erarbeiteten „Vorschläge zur Studienstruktur<br />
und Studienreform“(§ 93 Abs. 1 Ziff.1)?<br />
• Wie werden sich die Zentren für LehrerInnenbildung in den Gremien<br />
der Hochschule vertreten finden?<br />
3.2. Frauenförderung und Gender Mainstreaming<br />
Wiewohl wir es begrüßen, dass die Prinzipien und Methoden der Frauenförderung<br />
und des Gender Mainstreaming in das Gesetz aufgenommen<br />
worden sind, hat die <strong>Diskussion</strong> des Entwurfs gezeigt, dass es Klärungsbedarf<br />
zwischen dem Leitprinzip „Gender Mainstreaming“ und<br />
seinen Methoden und denen der Frauenförderung gibt.<br />
Der Gesetzgeber sollte dieses in der Begründung für § 2 Abs. 2 nachholen.<br />
3.3. Studienkollegs<br />
Wir begrüßen die Einbindung von Studienkollegs in die Hochschule in<br />
der vorgeschlagenen Form, fragen jedoch auch hier -ähnlich wie bei<br />
den Zentren für LehrerInnenbildung -<br />
• Wie werden sich die Internationalen Studienkollegs in den Gremien<br />
der Hochschule vertreten finden, z<strong>um</strong>al der Senat die Ordnung über<br />
die Aufnahme- und Feststellungsprüfung erlassen soll?<br />
3.4. Folgen für die Gesellschaft und die Natur<br />
In § 106 Abs. 4 Satz 2 „kann die Studierendenschaft insbesondere<br />
auch zu solchen Fragen Stellung beziehen, die sich mit ... der Anwendung<br />
der wissenschaftlichen Erkenntnisse und der Abschätzung ihrer<br />
Folgen für die Gesellschaft und die Natur beschäftigen.“ Die Übernahme<br />
des Prinzips der Nachhaltigen Entwicklung wurde in der „Rio-<br />
Deklaration“ von 1992 von VertreterInnen fast aller Regierungen der<br />
Welt für den Wissenschafts- und Bildungsbereich für verbindlich erklärt.<br />
Die europäischen Hochschulen haben diesen Auftrag in der Copernicus-Charta<br />
der Europäischen Hochschulrektoren spezifiziert und<br />
als verbindliches Leitprinzip ihrer Arbeit übernommen. Einige Hochschulen<br />
in Rheinland-Pfalz haben die Grundsätze der Copernicus-Charta<br />
bereits explizit als Leitbild übernommen.<br />
Diese bereits im HRG (6. Novell.) festgelegte Aufgabe fordert die <strong>GEW</strong><br />
als Aufgabe der ganzen Hochschule in § 2 gesetzlich zu regeln.<br />
Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass eine Novellierung notwendig<br />
ist, dass sich in der vorliegenden Form aber lediglich die von der<br />
OECD-Studie attestierte mangelhafte Qualität der deutschen wissenschaftlichen<br />
Einrichtungen auf die der politisch Verantwortlichen übertragen<br />
lässt.<br />
<strong>28</strong> <strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 /<strong>20</strong>03
Schwerpunkt Hochschulen<br />
DGB: „Das Prinzip der demokratischen<br />
Selbstverwaltung wahren“<br />
Z<strong>um</strong> Entwurf eines neuen Landesgesetzes<br />
über die Hochschulen in Rheinland-Pfalz<br />
nahm auch der DGB Stellung:<br />
1. Z<strong>um</strong> Gesetzentwurf im<br />
Allgemeinen<br />
Wir begrüßen, dass sich die Landesregierung<br />
in Zeiten großer bildungspolitischer<br />
Herausforderungen mit einem<br />
einheitlichen <strong>Hochschulgesetz</strong> den neuen<br />
Erfordernissen des Bildungsmarktes<br />
stellt.<br />
Bildung und Wissenschaft sind gesellschaftliche<br />
Aufgaben, die zur Optimierung<br />
des Erkenntnisprozesses und zur<br />
demokratischen Qualifizierung aller<br />
Menschen beitragen sollen. Das schließt<br />
sowohl die Chancengerechtigkeit beim<br />
Hochschulzugang als auch die demokratische<br />
Teilhabe an den Ergebnissen<br />
von Forschung, Studi<strong>um</strong> und Lehre ein.<br />
Demokratische <strong>Diskussion</strong> und Entscheidungen<br />
über Inhalt und Methode<br />
von Studi<strong>um</strong>, Lehre und Forschung<br />
sollen als praktische Erfahrung für das<br />
gesellschaftliche Wirken der Hochschulmitglieder<br />
verwirklicht werden. In diesem<br />
Sinne kommt der Demokratie in<br />
den Hochschulen eine besondere Bedeutung<br />
zu.<br />
Eine zeitgemäße, den Erfordernissen des<br />
Bildungsmarktes entsprechende Neuordnung<br />
des Hochschulwesens muss<br />
daher eine Stärkung der demokratischen<br />
Teilhabe aller Gremien der studentischen<br />
Interessenvertretung sowie<br />
der Personalvertretung beinhalten.<br />
Eine Hochschulautonomie, die zugleich<br />
auch der Verbindung der Hochschule<br />
mit den gesellschaftlichen Kräften dient,<br />
muss dabei getragen werden von innerhochschulischer<br />
und ministerieller Entbürokratisierung<br />
und Abbau dirigistischer<br />
Leitungsstrukturen.<br />
Mit dem neuen <strong>Hochschulgesetz</strong> sollen<br />
* die Entwicklung eines einheitlichen<br />
europäischen Hochschulwesens („Bologna-Prozess“)<br />
im Gesetz verankert werden,<br />
* die Neuordnung der befristeten Arbeitsverhältnisse<br />
im Hochschulbereich<br />
<strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 /<strong>20</strong>03<br />
aufgrund der 5. und 6. Novelle des<br />
Hochschulrahmengesetzes (HRG) in<br />
Landesrecht <strong>um</strong>gesetzt werden,<br />
* die Hochschuldienstrechtsreform vorangetrieben<br />
werden,<br />
* die Rechte der verfassten Studierendenschaft<br />
ebenso wie<br />
* die Garantie auf Studiengebührenfreiheit<br />
für ein erstes berufsqualifizierendes<br />
Studi<strong>um</strong> sowie für konsekutive<br />
Studiengänge, die nach einem Bachelor-Abschluss<br />
z<strong>um</strong> Master führen, aufgrund<br />
der 6. HRG-Novelle aufgenommen<br />
werden,<br />
* das Gleichstellungsgebot im Geschlechterverhältnis<br />
geregelt werden,<br />
* die Deregulierungsmöglichkeiten aufgrund<br />
der HRG-Novellierungen zur<br />
Rechtstellung der Hochschule ausgeschöpft<br />
werden.<br />
Diese Vorhaben sind dem Gesetzgeber<br />
immer dann gelungen, wenn er die Regelungen<br />
des HRG aufgrund dort bereits<br />
vorhandener Detailregelungen übernimmt,<br />
wie z.B. bei der<br />
* Stärkung der sozialen und familiären<br />
Belange der Studierenden<br />
* Stärkung der Rechte der verfassten<br />
Studierendenschaft<br />
* Übernahme des Leitprinzips „Gender<br />
Mainstreaming“<br />
* Stärkung der Frauenförderung<br />
* Übernahme von Elementen des Qualitätsmanagements<br />
wie Qualitätssicherung<br />
in Forschung , Studi<strong>um</strong> und Lehre<br />
sowie studentische Lehrevaluation.<br />
* Ausgestaltung von Prüfungsordnungen<br />
und Studienplänen<br />
* Studiengebührenfreiheit für ein erstes<br />
berufsqualifizierendes Studi<strong>um</strong> sowie<br />
für konsekutive Studiengänge, die nach<br />
einem Bachelor-Abschluss z<strong>um</strong> Master<br />
führen.<br />
Der Gesetzesentwurf ist immer dort<br />
misslungen, wo das Land sich aus seiner<br />
Verantwortung für Ausbildung und<br />
Wissenschaft zurückzieht und Prinzipien<br />
des new public management nicht<br />
in ein new university management<br />
überträgt. Fälschlicherweise werden<br />
unter dem Schlagwort der „Autonomie“<br />
der Hochschule Elemente des new public<br />
management nachvollzogen.<br />
Für den DGB bedeutet Hochschulautonomie<br />
weniger Dirigismus und Regelungsdichte<br />
durch die Ministerien<br />
und mehr Handlungsfreiheit der Hochschulen<br />
selbst, ohne allerdings die Landesregierung<br />
aus ihren finanziellen und<br />
bildungspolitischen Verpflichtungen zu<br />
entlassen.<br />
Hochschulautonomie darf jedoch nicht<br />
zu verdeckten Haushaltskürzungen<br />
und einem Rückzug aus der Verantwortung<br />
für eine wissenschaftsadäquate,<br />
qualitätsfördernde Hochschulfinanzierung<br />
führen.<br />
Staatliche Befugnisse können nur dann<br />
den Hochschulen übertragen werden,<br />
wenn gleichzeitig das Prinzip der demokratischen<br />
Selbstverwaltung gewahrt<br />
bleibt - sonst führt dies dazu,<br />
dass die Gruppenuniversität als Ganzes<br />
in Frage gestellt wird.<br />
2. Z<strong>um</strong> Gesetzentwurf im<br />
Besonderen<br />
2.1. Z<strong>um</strong> Verhältnis Staat -<br />
Hochschule - Gesellschaft<br />
Der DGB kritisiert den Rückzug des<br />
Staates aus seiner Verantwortung für<br />
die Hochschulen des Landes durch den<br />
Einzug des Hochschulrats (§ 75) als<br />
Organ der Hochschule. Bildung ist eine<br />
gesellschaftliche Aufgabe; die Aufgabe<br />
des Staates darf daher nicht auf die<br />
Finanzierung der Hochschule reduziert<br />
werden. Staat und Politik haben<br />
grundsätzliche Entscheidungen zu treffen<br />
und politisch zu verantworten.<br />
Diesem Anspruch wird der vorliegende<br />
Entwurf für ein rheinland-pfälzisches<br />
<strong>Hochschulgesetz</strong> nicht gerecht.<br />
An die Stelle demokratischer Entscheidungsprozesse<br />
in gewählten Gremien<br />
soll die Stärkung der Hochschulleitung<br />
durch „Managementfunktionen“ treten.<br />
Damit werden für die Hochschulen<br />
dirigistische Strukturen eingeführt,<br />
die nicht einmal den in der Wirtschaft<br />
gängigen betriebswirtschaftlichen Prinzipien<br />
von Partizipation, flachen Hierarchien<br />
und Dezentralisierung genügen.<br />
1
2.1.1 Der Hochschulrat<br />
Die einschneidendste Veränderung der<br />
Leitungsstrukturen der Hochschulen ist<br />
die Einführung eines Hochschulrates,<br />
der je nach Größe der Hochschule aus<br />
6 bis 8 Personen besteht, die weder der<br />
Hochschule noch dem zuständigen Ministeri<strong>um</strong><br />
angehören dürfen. Sie sollen<br />
zu gleichen Teilen vom zuständigen<br />
Ministeri<strong>um</strong> und vom höchsten Selbstverwaltungsgremi<strong>um</strong><br />
der jeweiligen<br />
Hochschule, dem Senat berufen werden.<br />
Dem Hochschulrat stehen im Wesentlichen<br />
Kompetenzen zu, die bisher die<br />
höchsten Selbstverwaltungsorgane der<br />
Hochschulen hatten. Er stimmt der<br />
Grundordnung der jeweiligen Hochschule<br />
zu; ohne seine Zustimmung können<br />
weder grundsätzliche Strukturfragen<br />
von Forschung und Grundsätze zur<br />
Mittelverteilung noch ein Gesamtentwicklungsplan<br />
<strong>um</strong>gesetzt werden.<br />
Mit dem Hochschulrat wird eine Institution<br />
geschaffen, deren Mitglieder<br />
weder selbst demokratisch legitimiert,<br />
noch einem demokratisch legitimierten<br />
Gremi<strong>um</strong> verantwortlich sind.<br />
Als ein mit externen Mitgliedern besetztes<br />
Organ greift er weitreichend in<br />
die Selbstverwaltungsangelegenheiten<br />
der Hochschule ein.<br />
Die demokratische Selbstverwaltung,<br />
innerhalb derer die Hochschule durch<br />
ihre gewählten Gremien über sich selbst<br />
entscheidet, wird damit ebenso aufgegeben<br />
wie die hochschulpolitische Verantwortung<br />
des Landes.<br />
Schließlich wird der Wirtschaft durch<br />
die Hochschulräte ein direkter Zugriff<br />
auf die Hochschulen eröffnet.<br />
Wir setzen dieser Politik eine andere<br />
Vorstellung von Hochschule entgegen,<br />
die von gesellschaftlicher Verantwortung,<br />
weitergehender Demokratie und<br />
Aufklärung getragen wird; der (durch<br />
Wegfall der Versammlung) in seinen<br />
Aufgaben erweiterte Senat sollte deshalb<br />
unter Ausschöpfung der verfassungsrechtlichenMitwirkungsmöglichkeiten<br />
aller Gruppen verbindlich besetzt<br />
werden.<br />
Der Hochschulrat besteht zur Hälfte<br />
aus Mitgliedern „aus den Bereichen<br />
Wirtschaft und öffentlichem Leben“.<br />
„Wirtschaft“ <strong>um</strong>fasst dabei sowohl die<br />
Unternehmen als auch die ArbeitnehmerInnen<br />
und ihre Interessenverbände<br />
(wie auch für die Zusammensetzung<br />
des Akkreditierungsrates bereits angemerkt).<br />
Vertretungen aus dem öffentlichen<br />
Leben setzen sich dann z.B. zusammen<br />
aus Kirchen, weiteren Verbänden,<br />
Umweltschutzgruppen, Bürgerinitiativen,<br />
NGO, Agendainitiativen.<br />
2.1.2 Mitwirkung und Mitbestimmung<br />
an den Hochschulen<br />
Die Hochschulen müssen sich gegenüber<br />
der Gesellschaft öffnen und ihre<br />
Arbeit in den Dienst der gesellschaftlichen<br />
Weiterentwicklung stellen. Deshalb<br />
müssen die verschiedenen gesellschaftlichen<br />
Gruppen an der Formulierung<br />
der Ziele von Bildung und Wissenschaft<br />
beteiligt werden und an den<br />
Ergebnissen von Forschung und Lehre<br />
gleichermaßen teilhaben können.<br />
Als Vorbild für diesen Beteiligungsprozess<br />
sollte die Institution der Räte im<br />
öffentlich-rechtlichen Rundfunk dienen.<br />
Der DGB schlägt deshalb vor, den<br />
Hochschulrat als Instr<strong>um</strong>ent gesellschaftlicher<br />
Beratung und Kontrolle<br />
einzurichten, der gesellschaftliche Beteiligung<br />
und Teilhabe gewährleistet,<br />
ohne in die Selbstverwaltungsangelegenheiten<br />
oder die unmittelbaren Entscheidungen<br />
über Forschung und Lehre<br />
einzugreifen.<br />
Im Rahmen der Wissenschaftsfreiheit<br />
kommt darüber hinaus der Beteiligung<br />
der Mitglieder der Hochschule an den<br />
Entscheidungsprozessen über Ziele, Inhalte<br />
und Methoden von Lehre, Studi<strong>um</strong><br />
und Forschung eine wesentliche<br />
Bedeutung zu. Um die Mitwirkungsmöglichkeiten<br />
aller Hochschulmitglieder<br />
zu stärken, gilt es daher, die Kooperation<br />
und Entscheidungsbeteiligung<br />
von akademischen Gremien, studentischer<br />
Interessenvertretung sowie der<br />
Personalvertretung auf allen Ebenen zu<br />
institutionalisieren.<br />
2.2 Vorschläge für hochschulpolitische<br />
Korrektive<br />
2.2.1 Verbindung von Wissenschaft<br />
und Politik<br />
Nach dem vorliegenden Entwurf müssen<br />
die Hochschulen gegenüber Politik<br />
und Gesellschaft nur noch in geringem<br />
Maße Rechenschaft über ihr Handeln<br />
ablegen:<br />
* der alte § 98 UG z<strong>um</strong> Haushaltsvoranschlag<br />
der Hochschule sowie<br />
* die Ziff. 9 im § 9 Auftragsangelegen-<br />
Schwerpunkt Hochschulen<br />
heiten „die Aufstellung des Haushaltsvoranschlags<br />
gemäß § 98 Abs. 1“ entfallen,<br />
* die Hochschulen nehmen z<strong>um</strong> Landeshaushalt<br />
nur noch Stellung (§ 101<br />
Abs.4)<br />
* der Hochschulhaushalt soll aus dem<br />
Landeshaushalt ausgegliedert werden<br />
(§ 101 Abs. 2 erster Satz) und<br />
* mit dem Hochschulrat wird eine Institution<br />
mit weitreichenden hochschulpolitischen<br />
Steuerungsmöglichkeiten<br />
geschaffen, die keinem demokratisch<br />
legitimierten Gremi<strong>um</strong> verantwortlich<br />
ist.<br />
Damit wird die hochschulpolitische<br />
Verantwortung des Landes (Landtag)<br />
untergraben. Parallel zu den Anstrengungen<br />
des Staates müssen die Hochschulen<br />
aber eine Debatte über ihr Profil<br />
und ihre Leistungsfähigkeit führen;<br />
sie müssen nachweisen, dass sie in der<br />
Lage sind, die Mittel, die ihnen Staat<br />
und Gesellschaft zur Verfügung stellen,<br />
auch effektiv nutzen.<br />
2.2.2 Öffnung des Verhältnisses zwischen<br />
Hochschule und Gesellschaft<br />
Aus einem berechtigten Anspruch an<br />
die Verbindung der Hochschule mit<br />
allen gesellschaftlichen Kräften wird im<br />
Gesetzentwurf eine relativ einseitige<br />
Verbindung zugunsten der Wirtschaft<br />
(Zusammensetzung von Hochschulrat<br />
und Gemeinsamer Kommission); eine<br />
Hochschulautonomie ist damit immer<br />
dann nicht mehr gewahrt, wenn die<br />
Hochschule ihre Autonomie an ein mit<br />
externen, hochschulfernen Mitgliedern<br />
besetztes Kontrollorgan der Wirtschaft<br />
abgeben muss. Deshalb müssen wir ein<br />
politisches Korrektiv fordern.<br />
Gemäß einer Pressemitteilung des Ministeri<strong>um</strong>s<br />
soll der Hochschulrat dazu<br />
beitragen, dass sich die Hochschulen<br />
gegenüber der Gesellschaft öffnen. Der<br />
Gesetzentwurf weist jedoch in seiner<br />
Begründung dem bereits bestehenden<br />
Hochschulkuratori<strong>um</strong> diese Funktion<br />
zu; der Hochschulrat dient hier nicht<br />
mehr als Verbindungsglied zur Gesellschaft,<br />
sondern soll „interne Entscheidungsprozesse<br />
durch externen Sachverstand<br />
unterstützen.“ (Begründung Seite<br />
2)<br />
Der DGB fordert deshalb, dass - wie<br />
in anderen Bundesländern auch - die<br />
Hochschulen Zielvereinbarungen sowohl<br />
mit dem fachlich zuständigen<br />
2 <strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 /<strong>20</strong>03
Schwerpunkt Hochschulen<br />
Ministeri<strong>um</strong> (s.§2 Abs.9) als auch mit<br />
dem Landtag treffen können.<br />
2.2.3 Gruppenvertretung in Gremien<br />
(insbes. § 78)<br />
* Mitwirkungsrechte: Der DGB fordert<br />
die in § 37 Abs. 2 Satz 2 deregulierten<br />
Mitwirkungsrechte zugunsten einer<br />
verbindlichen gesetzlichen Regelung zurückzunehmen,<br />
wiewohl er sich einer<br />
differenzierten Experimentierklausel zu<br />
diesem Regelungsproblem im Gesetz<br />
nicht verschließen wird.<br />
* Wenn auch nicht in § 72 ausdrücklich<br />
als Hochschulorgan genannt, so<br />
erfahren wir doch aus der Begründung,<br />
dass die Gemeinsame Kommission „ein<br />
weiteres zentrales Gremi<strong>um</strong> in jeder<br />
Hochschule“ ist. Dies hat aber zur Folge,<br />
dass entspr. § 37 Abs.2 Satz 2 alle<br />
Mitgliedergruppen vertreten sein müssen.<br />
Wenn also die Hälfte der Mitglieder<br />
dieses Gremi<strong>um</strong>s aus dem Senat entsandt<br />
werden, muss die Gemeinsame<br />
Kommission aus mindestens 8 Mitgliedern<br />
bestehen. Nur so können alle Mitgliedergruppen<br />
„stimmberechtigt an<br />
Entscheidungen mit“wirken.<br />
2.2.4 Konflikt zwischen Hochschulautonomie<br />
und Personalvertretung<br />
(insbes. § 76 Abs. 2 Ziff. 7 und 8 sowie<br />
§ 8)<br />
Durch die Übertragung von Entscheidungsrechten<br />
des Senats auf die Hochschulleitung<br />
wird die Autonomie der<br />
Hochschule gestärkt und die Mitbestimmung<br />
zunächst transparenter. Der Senat<br />
trifft aber weiterhin satzungsautonome<br />
Entscheidungen, die den Mitbestimmungsrechten<br />
der Personalvertretung<br />
entzogen sind. Ein Konflikt entsteht<br />
immer dann, wenn der Präsident/<br />
die Präsidentin auf die Entscheidungen<br />
der Hochschulorgane verweist und<br />
die Mitbestimmungsrechte der Personalvertretung<br />
nicht wahrgenommen<br />
werden können.<br />
Der Hauptpersonalrat beim MWWFK<br />
bezieht sich in seiner Stellungnahme<br />
z<strong>um</strong> neuen <strong>Hochschulgesetz</strong> ausdrücklich<br />
auf diese Problematik. Er zeigte<br />
bereits in seiner Stellungnahme z<strong>um</strong><br />
Universitätsgesetz im Jahre 1995 Lösungswege<br />
auf. Bereits damals forderte<br />
er entweder eine Änderung des<br />
LPersVG oder eine Regelung innerhalb<br />
des Universitätsgesetzes, die die Rechtsbeziehung<br />
zwischen den satzungsauto-<br />
<strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 /<strong>20</strong>03<br />
nomen Organen einerseits und dem<br />
Personalrat im Rahmen seiner Zuständigkeiten<br />
andererseits so verändert, dass<br />
die Beteiligungsrechte und die Konfliktregelungsinstr<strong>um</strong>ente<br />
der Personalvertretung<br />
zur Wirkung kommen können.<br />
Der DGB schließt sich auch der neuerlichen<br />
Stellungnahme des Hauptpersonalrats<br />
ausdrücklich an.<br />
2.2.5 Deregulierung<br />
Die Begründung für das neue <strong>Hochschulgesetz</strong><br />
formuliert die Absicht einer<br />
„Stärkung der Hochschulautonomie<br />
durch Deregulierung und Global- statt<br />
Detailsteuerung“.<br />
Der Gesetzesentwurf wird seinem eigenen<br />
Anspruch in keiner Weise gerecht.<br />
Weder wird konsequent dereguliert noch<br />
konsequent global gesteuert. In den<br />
Abschnitten Organisation, Finanzierung<br />
sowie Mitgliedschaft wird dereguliert<br />
und global gesteuert, eine verdichtete<br />
Detailsteuerung finden wir in den<br />
Abschnitten Studi<strong>um</strong> und Lehre und<br />
Personalwesen.<br />
Die Hinweise „das Nähere regelt die<br />
Grundordnung“ oder“ das Nähere regelt<br />
das fachlich zuständige Ministeri<strong>um</strong>“<br />
machen zudem deutlich, wo Regulierungsabsicht<br />
und -interesse besteht.<br />
Wir fordern den Gesetzgeber auf, sich<br />
mindestens an die Bestimmungen der<br />
5. HRG-Novelle § 58 Abs. 2 zu halten,<br />
in der die Grundordnung „ der<br />
Genehmigung des Landes“ bedarf und<br />
dies nicht einer Politik der „Interessensabsprache“<br />
zwischen Mitgliedern des<br />
Hochschulrats, der Gemeinsamen Kommission<br />
und des Senats zu überlassen.<br />
Wer Innovationen will, muss Partizipation<br />
ermöglichen. Innovation erfolgt<br />
nicht durch top-down-Entscheidungen,<br />
sondern durch die Mitwirkung aller<br />
Beteiligten. Der DGB will den Aushandlungsprozess.<br />
Er mahnt daher eine<br />
differenzierte Regelungsdichte immer<br />
dort an, wo es <strong>um</strong> Beteiligungs-, Mitwirkungs-,<br />
und Mitbestimmungsrechte<br />
geht, wie er andererseits für die Rücknahme<br />
von Detailregelungen immer<br />
dort eintritt, wo es dar<strong>um</strong> geht, den<br />
Hochschulen Gestaltungsspielrä<strong>um</strong>e in<br />
Forschung, Studi<strong>um</strong> und Lehre zu eröffnen.<br />
2.2.6 verstärktes Quor<strong>um</strong><br />
Selbstverständlich muss ein/e so starke/r<br />
PräsidentIn auch abwählbar sein.<br />
Dafür sorgt das Gesetz mit einer Stimmenmehrheit<br />
von drei Vierteln der Senatsmitglieder.<br />
Der DGB fordert<br />
darüber hinaus, dass auch die Verabschiedung<br />
der Grundordnung durch<br />
den Senat mit 3/4 Mehrheit erfolgen<br />
muss. Damit kann das zentrale Organ<br />
der Hochschule in seinem Stand gegenüber<br />
Hochschulleitung UND Hochschulrat<br />
mindestens in Teilen gestärkt<br />
werden und versinkt mit seiner Beschränkung<br />
auf eine Richtlinienkompetenz<br />
nicht in die Bedeutungslosigkeit.<br />
2.3 Personal und Nachwuchsförderung<br />
2.3.1. Arbeitsplatzbedingungen<br />
Die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen,<br />
insbesondere der wissenschaftlichen<br />
und nicht-wissenschaftlichen<br />
MitarbeiterInnen, sind z.Zt. weder<br />
aufgabengerecht noch wettbewerbsadäquat<br />
ausgestaltet. Die hohe Zahl ungeschützter<br />
Beschäftigungsverhältnisse<br />
schafft darüber hinaus große Motivationsprobleme.<br />
Die Flexibilisierung der<br />
wissenschaftlichen Arbeitskraft stellt die<br />
Kontinuität und damit die Qualität der<br />
wissenschaftlichen Arbeit grundsätzlich<br />
in Frage. Kommt dann noch hinzu, dass<br />
* Hochschulen auch in einer anderen<br />
Rechtsform errichtet werden können (§6<br />
Abs 1),<br />
* Fachbereiche in Teilfachbereiche als<br />
Untereinheiten gegliedert werden können<br />
(§ 87 Abs.1),<br />
* Hochschulen bei Forschungsschwerpunkten<br />
auch Abweichungen von gesetzlichen<br />
Organisationsformen zulassen<br />
können (12 Abs. 2),<br />
bedarf es dringend der Aufnahme von<br />
Verhandlungen <strong>um</strong> eine tarifvertragliche<br />
Regelung der Beschäftigungsverhältnisse<br />
für das wissenschaftliche Personal<br />
in den Hochschulen.<br />
2.3.2 Gruppenzugehörigkeit<br />
* Zur Gruppe der Wissenschaftlichen<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an<br />
Universitäten und Fachhochschulen<br />
werden detaillierte Regelungen geschaffen<br />
(§ 46; § 57 Abs. 1; § 37, Abs. 2:Satz<br />
3 ). Wir lehnen eine Unterscheidung<br />
zwischen Wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeitern an Universitäten,<br />
Wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeitern an Fachhochschulen<br />
und Fachhochschulassistent-<br />
3
innen und Assistenten ab. Wir fordern<br />
eine einheitliche Personalkategorie mit<br />
einheitlichen Aufgabenstellungen und<br />
Arbeitsbedingungen. Auch geben wir zu<br />
bedenken, dass aufgrund der Änderung<br />
des § 135 HG im Landespersonalvertretungsgesetz<br />
(LPersVG) nunmehr<br />
auch noch die FH-AssistentInnen eingeschränkte<br />
Schutzrechte haben. Sowohl<br />
die Mitbestimmungs- als auch die<br />
Mitwirkungsrechte der FH-AssistentInnen<br />
werden durch das neue <strong>Hochschulgesetz</strong><br />
stark eingeschränkt.<br />
* Für Doktorandinnen/Doktoranden ist<br />
zukünftig nach § 34 ein förmlicher<br />
Rechtsstatus vorgesehen. In § 34 haben<br />
eingeschriebene DoktorandInnen<br />
„Rechte und Pflichten der Studierenden“,<br />
bilden aber nach § 37 (2) Nr. 3<br />
für die Vertretung in den Gremien zusammen<br />
mit den akademischen MitarbeiterInnen<br />
eine Gruppe. Dies erscheint<br />
uns ein Widerspruch und auch<br />
im Hinblick auf die Interessenlage nicht<br />
sachgerecht.<br />
* Da sich im Personalvertretungsrecht<br />
Wahlen im Geschäftsbereich des MW-<br />
WFK nach der Gruppenzugehörigkeit<br />
der Beschäftigten regeln, mahnt der<br />
DGB für die Beschäftigten in wissenschaftlichen<br />
und zentralen Einrichtungen<br />
(§ 91) ebenso wie für DoktorandInnen<br />
entspr. § 56 Abs. 5 eine Regelung<br />
zur Gruppenzugehörigkeit an, da<br />
ansonsten bei Personalratswahlen und<br />
Wahlen der Stufenvertretungen Wahlanfechtungsklagen<br />
drohen.<br />
2.3.3 Lehrauftragsvergabe<br />
* In § 64 Abs. 3 ist völlig neu vorgesehen,<br />
dass Lehraufträge an hauptberufliches<br />
akademisches Personal im Fachgebiet,<br />
für das sie berufen oder eingestellt<br />
sind, nicht zulässig sein sollen. Der<br />
Begründung ist zu entnehmen, dass diese<br />
Regelung offenbar nur Vollzeitbeschäftigte<br />
erfassen soll. Daher drängen<br />
wir auf eine Klarstellung , die Teilzeitbeschäftigte<br />
von diesem Verbot ausnimmt.<br />
* Der Gesetzentwurf bezieht allerdings<br />
auch Wissenschaftliche MitarbeiterInnen<br />
in Drittmittelprojekten, deren<br />
Dienstaufgaben sich in der Regel ausschließlich<br />
auf die Forschung konzentrieren<br />
ein. Damit können an diesen<br />
Personenkreis keine Lehraufgaben übertragen<br />
werden, was sie insbesondere im<br />
Hinblick auf die Gewinnung von Lehr-<br />
kapazität und den Nachweis von Lehrerfahrung<br />
für die Bewerbung auf eine<br />
Professur oder eine Juniorprofessur benachteiligen<br />
würde.<br />
* § 121 (1) Ebenso wie den beamteten<br />
wissenschaftlichen MitarbeiterInnen<br />
sollte auch den auf Dauer angestellten<br />
wissenschaftlichen MitarbeiterInnen die<br />
Möglichkeit gegeben werden, selbständige<br />
Lehraufträge zu erhalten.<br />
2.3.4 Schutzbedürftigkeit der ehrenamtlichen<br />
Gremienmitglieder<br />
In § 37 Abs. 3 sollten stärkere Schutzrechte<br />
für Mitglieder in Hochschulgremien<br />
geregelt werden. Wir fordern, das<br />
Problem des Freizeitausgleichs für eine<br />
Teilnahme an Gremienarbeit (z. B.<br />
analog der Regelungen des LPersVG)<br />
endlich zu regeln. Der DGB schlägt die<br />
Aufnahme folgenden Passus in die Gesetzesvorlage<br />
vor:<br />
„Die Hochschulmitglieder dürfen wegen<br />
ihrer Tätigkeit in der Selbstverwaltung<br />
weder bevorzugt noch benachteiligt<br />
werden; sie sind in diesen Funktionen<br />
an Weisungen nicht gebunden. Für<br />
Mitglieder in Organen, Gremien und<br />
Kommissionen nach diesem Gesetz oder<br />
nach der Grundordnung der Hochschule<br />
gelten die Vorschriften des Landespersonalvertretungsgesetzes<br />
für Rheinland-<br />
Pfalz über Arbeitszeitversä<strong>um</strong>nis sowie<br />
über den Schutz der Mitglieder der Personalvertretungen<br />
vor Versetzung, Abordnung<br />
oder Kündigung entsprechend<br />
Satz 2 gilt entsprechend für Mitglieder<br />
von Gremien, die von Organen nach<br />
diesem Gesetz oder nach der Grundordnung<br />
eingesetzt werden.“<br />
2.3.5 Juniorprofessuren<br />
* In § 48 werden die dienstlichen Aufgaben<br />
von HochschullehrerInnen geregelt.<br />
Der DGB ist der Auffassung, dass<br />
an dieser Stelle auch konkret auf die<br />
Aufgaben der Juniorprofessur eingegangen<br />
werden sollte und schlägt daher folgenden<br />
Passus in die Aufnahme des<br />
Gesetzes vor: § 48 Abs. X: „JuniorprofessorInnen<br />
haben die Aufgabe, sich<br />
durch die selbständige Wahrnehmung<br />
der ihrer Hochschule obliegenden Aufgaben<br />
in Wissenschaft und Kunst, Forschung<br />
und Lehre sowie der wissenschaftlichen<br />
Weiterbildung für die Berufung<br />
zu Professoren zu qualifizieren.<br />
Die Voraussetzungen hierfür sind bei<br />
der Ausgestaltung des Dienstverhältnis-<br />
Schwerpunkt Hochschulen<br />
ses und der Funktionsbeschreibung der<br />
Stelle zu gewährleisten.“<br />
* Ebenso fehlt im § 50 (2) die Ausformulierung<br />
der Bestellung von JuniorprofessorInnen.<br />
Der DGB schlägt folgenden<br />
Passus zur Aufnahme in das<br />
Gesetz vor: „JuniorprofessorInnen werden<br />
vom Präsidenten auf Vorschlag des<br />
Fachbereiches bestellt. Der Vorschlag<br />
wird von einer Auswahlkommission des<br />
Fachbereiches, die wie eine Berufungskommission<br />
zusammengesetzt ist, unter<br />
Einbeziehung von Gutachten auswärtiger<br />
sachverständiger Personen erstellt;<br />
der Senat wirkt bei der Erstellung<br />
des Besetzungsvorschlages wie bei<br />
den Vorschlägen zur Berufung von ProfessorInnen<br />
mit.“<br />
* § 56 (1): Zur Lösung des Problems<br />
der Bewährung einer Juniorprofessur,<br />
die eng mit einer Verlängerung verknüpft<br />
ist, wird angeregt, für Bewährungsentscheidungen<br />
eine verbindliche<br />
Rahmenregelung (Zuständigkeit, Verfahren,<br />
Kriterien, etc.) vorzusehen. Wir<br />
schlagen folgenden Text zur Aufnahme<br />
ins Gesetz vor: „Die Entscheidung über<br />
die Bewährung einer Juniorprofessur<br />
trifft der Fachbereichsrat unter Berücksichtigung<br />
von Gutachten, davon<br />
mindestens 2 externen Gutachten. Die<br />
GutachterInnen werden vom Fachbereichsrat<br />
bestimmt. Das Nähere regeln<br />
Satzungen der Hochschule.“<br />
Im Hinblick auf die schwächere Rechtsstellung<br />
der Juniorprofessuren und in<br />
Anbetracht, dass sie die vorherigen<br />
Dienstverhältnisse der AssistentInnen<br />
und OberassistentInnen ablösen, wird<br />
angeregt, dass dieser Personenkreis in<br />
den Schutzbereich des Personalrats aufgenommen<br />
wird.<br />
2.3.6 Kostenneutralität<br />
Der DGB hält eine kostenneutrale<br />
Umsetzung des <strong>Hochschulgesetz</strong>es für<br />
nicht durchführbar. Auf das Personal<br />
der Hochschulen kommen viele neue<br />
Aufgaben bei Beibehaltung der alten<br />
zu.<br />
Statt angekündigter Deregulierungen<br />
folgen Detailregelungen so z.B. in § 24<br />
Studienberatung; §71 Studienkonten;<br />
§ 26. Abs. 3: Diploma Supplement; §<br />
25 Leistungspunktesystem; § 19.5 Einführung<br />
dualer Studiengänge; § 23<br />
Fernstudi<strong>um</strong>, Multimedia, Informations-<br />
und Kommunikationstechnik und<br />
§ 30 Hochschulgrade.<br />
4 <strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 /<strong>20</strong>03
Schwerpunkt Hochschulen<br />
Diese sind mit der bestehenden Personalkapazität<br />
nicht zu bewältigen.<br />
Stattdessen brauchen die Hochschulen<br />
mehr für die Durchführung der neuen<br />
Aufgaben qualifiziertes Personal; zusätzlich<br />
muss der derzeitige Personalbestand<br />
für die Bewältigung der neuen<br />
Aufgaben qualifiziert werden.<br />
Wenn schon Prinzipien und Methoden<br />
neuer Steuerungsmodelle auf die Hochschulen<br />
übertragen werden, dann müssen<br />
sie auch zur Personalentwicklung<br />
verpflichtet werden.<br />
Wir fordern, Aufgaben der Personalentwicklung<br />
an geeigneter Stelle als Aufgabe<br />
der Hochschule im Gesetz zu verankern.<br />
Kostenneutralität ist nach Meinung des<br />
DGB auch nicht mit der Einführung<br />
einer Reform der LehrerInnenausbildung<br />
durchzuhalten. Vielmehr erfordert<br />
dieses mehr qualifiziertes Personal<br />
an den Universitäten insbesondere in<br />
den neuen Ausbildungsinhalten der Bildungswissenschaften.<br />
2.3.7 Streichung der Inkompatibilitätsregelung<br />
§ 37 Abs. 1 Satz 5<br />
§ 37 regelt in Satz 5 die Mitwirkung<br />
im Fachbereichsrat von Personalratsmitgliedern.<br />
Dort heißt es: „Mitglieder<br />
der Hochschule, die Aufgaben der Personalvertretung<br />
wahrnehmen, dürfen<br />
dem Fachbereichsrat und Ausschüssen,<br />
die für Personalangelegenheiten akademischer<br />
und nichtwissenschaftlicher<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuständig<br />
sind, nicht angehören.“<br />
Da auch im Fachbereichsrat entspr. §87<br />
Abs. 2 Ziff. 11 nur noch über Grundsätze<br />
der Verteilung von Stellen und<br />
Mittel beschlossen wird, werden keine<br />
Personalangelegenheiten des Personals<br />
entspr. § 37 Abs. 2 Ziff 3 und 4 diskutiert.<br />
Der DGB fordert die ersatzlose Streichung<br />
des § 37 Abs. 1 Satz 5.<br />
2.4 Finanzierung<br />
Vor allem im zentralen Abschnitt Finanzierung<br />
(§§ 100, 101) wird der<br />
Rückzug des Staates bzw. der Landesregierung<br />
aus der Verantwortung für<br />
Bildung und Wissenschaft deutlich.<br />
Hier wird eine Kehrtwende von der<br />
Bedarfsgerechtigkeit (siehe Universitätsgesetz<br />
§ 97) zur „Leistungsgerechtigkeit“<br />
vollzogen. So ist z.B. von einer belastungsorientierten<br />
Finanzierung der<br />
<strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 /<strong>20</strong>03<br />
Hochschule spätestens im § 101 nicht<br />
mehr die Rede.<br />
Der Spagat zwischen Hochschulen, die<br />
einerseits nach new-public-management-Konzepten<br />
agieren und<br />
andererseits als öffentlich Einrichtungen<br />
betrachtet werden, ist nach Meinung<br />
des DGB dem Gesetzgeber nicht<br />
gelungen: Der weltweite Austausch von<br />
Produkten und Dienstleistungen<br />
(GATS) sowie die orts- und zeitunabhängige<br />
Be- und Verarbeitung digitalisierbarer<br />
Daten und Informationen<br />
zieht weitreichende grundlegende Umstrukturierungen<br />
sowohl der Arbeitsund<br />
Geschäftswelt wie auch der Art und<br />
Weise des Forschens, Lehrens und Lernens<br />
nach sich. Den mit diesen einschneidenden<br />
Veränderungen einhergehenden<br />
Innovationsnotwendigkeiten<br />
müssen sich auch die Hochschulen stellen.<br />
Nach wie vor besteht ihre primäre Aufgabe<br />
darin, Wissen zu erzeugen und<br />
Wissen zu vermitteln. Das europäische<br />
Erfolgsmodell des gesellschaftlichen<br />
Umgangs mit Wissen, von der Akademie<br />
Platons über die mittelalterlichen<br />
Universitäten bis hin zur modernen<br />
staatlichen Hochschule wird durch das<br />
Finanzierungsmodell des Gesetzgebers<br />
z<strong>um</strong>indest in Frage gestellt.<br />
Für den DGB ist es im Sinne einer zukunftsorientierten<br />
und auch „marktorientierten“<br />
Hochschulpolitik un<strong>um</strong>gänglich,<br />
verstärkt in die Bildungseinrichtungen<br />
des Landes zu investieren,<br />
z<strong>um</strong>indest aber die notwendige finanzielle<br />
Ausstattung sicherzustellen.<br />
Andererseits muss ein Regelwerk zur<br />
Finanzierung und Mitwirkung bzw.<br />
Mitbestimmung geschaffen werden, das<br />
die Hochschulen und Forschungsschwerpunkte<br />
bei Errichtung (und<br />
Überführung?) in eine andere Rechtsform<br />
in die Lage versetzt, nicht nur<br />
überlebens- sondern auch wettbewerbsfähig<br />
zu bleiben.<br />
Damit die wissenschaftlichen Einrichtungen<br />
des Landes Rheinland-Pfalz<br />
auch in Zukunft in einer inzwischen<br />
globalen Konkurrenz <strong>um</strong> Studienanfänger,<br />
Drittmittel und andere Forschungsaufträge<br />
national und international<br />
bestehen können, muss die Landesregierung<br />
investieren und sich nicht<br />
zurückziehen<br />
2.5 Studienkonten<br />
Weil Bildung Teil öffentlicher Daseinsfürsorge<br />
ist und daher öffentlich finanziert<br />
werden muss, muss ein Studi<strong>um</strong><br />
gebührenfrei bleiben. Der DGB Rheinland-Pfalz<br />
unterstreicht daher seine<br />
Ablehnung von Studiengebühren.<br />
Die finanziellen und strukturellen Probleme,<br />
die zur Rechtfertigung von Studiengebühren<br />
dienen, lassen sich nur<br />
durch eine grundlegende inhaltliche<br />
Veränderung von Hochschule und Forschung<br />
lösen. Mit der Einführung von<br />
Studiengebühren wird dieser Weg aber<br />
verbaut.<br />
Einen neuen Weg versucht die rheinland-pfälzische<br />
Landesregierung mit<br />
dem Studienkontenmodell. Der DGB<br />
hält das Studienkonten - Modell entspr.<br />
§ 61 (HochSchG Grundsatz der<br />
Gebührenfreiheit, Studienkonto) für<br />
prüfenswert, wenn<br />
* Sicherheiten bzw. Garantien für eine<br />
Festschreibung der Ausstattung des Studienkontos<br />
mindestens in der vorgeschlagenen<br />
Form (zweifache Regelstudienzeit<br />
+ <strong>20</strong>% Aufschlag) gegeben<br />
werden<br />
* Auswirkungen auf eine Studienreform<br />
aus der Hochschule heraus zugunsten<br />
der Studierbarkeit eines Studi<strong>um</strong>s plausibel<br />
gemacht werden können<br />
* eine gesetzlich geregelte Zweckbindung<br />
der Weiterbildungseinnahmen<br />
ausschließlich für Maßnahmen und<br />
Projekte innerhalb der wissenschaftlichen<br />
Weiterbildung erfolgt<br />
* eine gesetzlich geregelte Zweckbindung<br />
der Mittel aus der Refinanzierung<br />
der Studienkonten zugunsten der Verbesserung<br />
der Lehre erfolgt<br />
* wenn eine Sozialklausel zur Beanspruchung<br />
des Bonus’ für die wissenschaftliche<br />
Weiterbildung eingerichtet<br />
wird.<br />
Der DGB wird insbesondere prüfen, ob<br />
das Studienkonten-Modell geeignet ist,<br />
die generelle Einführung von Studiengebühren<br />
über Studienkontenmodelle<br />
(z.B. nach dem NRW -Modell) zu verhindern.<br />
5
3. Sonstiges<br />
3.1. Zentren für Lehrerbildung<br />
(§ 93)<br />
Die Einrichtung der Zentren für LehrerInnenbildung<br />
wird grundsätzlich<br />
begrüßt, da sie die Voraussetzungen<br />
schaffen, eine grundlegende Neuordnung<br />
der LehrerInnenbildung in Angriff<br />
zu nehmen. Leider liegen jedoch<br />
bisher widersprüchliche Aussagen zu<br />
diesem Themenkomplex vor.<br />
Da heißt es einmal: „Im <strong>Hochschulgesetz</strong>,<br />
das die Einrichtung eines solchen<br />
Zentr<strong>um</strong>s an den Universitäten vorgeben<br />
wird, werden die Gestaltungs-,<br />
Steuerungs-, Kontroll- und Eingriffsaufgaben<br />
und Rechte dieser Einrichtung<br />
sowie ihre Zusammensetzung bestimmt“<br />
(so „Reformkonzept zur Lehrerbildung“<br />
S. 9).<br />
Dann wieder<strong>um</strong> an anderer Stelle:<br />
„Das Nähere zur Zusammensetzung,<br />
Struktur, Organisation und Mitwirkung<br />
im Zentr<strong>um</strong> für Lehrerbildung<br />
regelt das fachlich zuständige Ministeri<strong>um</strong><br />
im Einvernehmen mit dem für<br />
das Schul- und Unterrichtswesen zuständigen<br />
Ministeri<strong>um</strong> durch<br />
Rechtsverordnung.“(so § 93 Abs. 3).<br />
Mit solchen Regelungen schiebt nicht<br />
nur ein Ressort dem anderen die Verantwortung<br />
für die Umsetzung zu, sondern<br />
damit gibt der Gesetzgeber wichtige<br />
politische Entscheidungsbereiche an<br />
die Exekutive ab, die er nach unserem<br />
Verständnis selbst regeln muss.<br />
Daher fordern wir solche wesentlichen<br />
Punkte wie „Struktur, Organisation<br />
und Mitwirkung“ in das Gesetz aufzunehmen<br />
und die Mitwirkung in den<br />
Gremien verbindlich zu regeln.<br />
Der DGB fordert eine gesetzliche Festlegung<br />
auf eine „Einrichtung der Fachbereiche“<br />
und nicht nur per Rechtsverordnung,<br />
z<strong>um</strong>al ja auch für zentrale<br />
Einrichtungen die/der PräsidentIn die<br />
Stellen und Mittel entsprechend den<br />
Grundsätzen des Senats zuweist. Da die<br />
Fachbereiche für die Gewährleistung<br />
und Sicherstellung des Lehrangebotes<br />
verantwortlich sind, sollte ihnen dann<br />
bei den Zentren für Lehrerbildung als<br />
fachbereichsübergreifende wissenschaftliche<br />
Einrichtung ebenso wie den Zentren<br />
selbst auch Mitwirkungsrechte zugestanden<br />
werden.<br />
Da der Senat mit Zustimmung des<br />
Hochschulrats den Gesamtentwick-<br />
lungsplan oder allgemeine Grundsätzen<br />
über die Verteilung von Stellen und<br />
Mitteln auf der Grundlage des Hochschulhaushaltes<br />
des Landes mit seinen<br />
Leistungs- und Belastungsparametern<br />
(PBK, MBS) beschließt, LehrerInnenausbildung<br />
andererseits genuine Aufgabe<br />
der Universitäten ist, sollte der<br />
Gesetzgeber bereits im Gesetz die Sicherstellung<br />
der finanziellen Ausstattung<br />
der Zentren für LehrerInnenbildung<br />
verankern.<br />
Darüber hinaus haben wir folgende<br />
Fragen:<br />
* Werden die Zentren für LehrerInnenbildung<br />
zentrale Einrichtungen unter<br />
der Verantwortung mehrerer Fachbereiche,<br />
des Senats oder unter der/des<br />
Präsidenten?<br />
* Wie werden die Studienseminare mit<br />
den Zentren verzahnt? Was heißt „die<br />
Studienseminare werden Sitz und<br />
Stimme in den Zentren haben?<br />
* Wer aus den LehrerInnenzentren unterbreitet<br />
wem (dem Hochschulrat?,<br />
dem Senat?) die dort erarbeitete „Vorschläge<br />
zur Studienstruktur und Studienreform“(§<br />
93 Abs. 1 Ziff.1)?<br />
* Wie werden sich die Zentren für LehrerInnenbildung<br />
in den Gremien der<br />
Hochschule vertreten finden?<br />
3.2 Frauenförderung und Gender<br />
Mainstreaming<br />
Obwohl wir es begrüßen, dass die Prinzipien<br />
und Methoden der Frauenförderung<br />
und des Gender Mainstreaming<br />
in das Gesetz aufgenommen worden<br />
sind, hat die <strong>Diskussion</strong> des Entwurfs<br />
gezeigt, dass es Klärungsbedarf zwischen<br />
dem Leitprinzip „Gender Mainstreaming“<br />
und seinen Methoden und<br />
denen der Frauenförderung gibt. Der<br />
Gesetzgeber sollte dieses in der Begründung<br />
für § 2 Abs. 2 nachholen.<br />
3.3 Studienkollegs<br />
Wir begrüßen die Einbindung von Studienkollegs<br />
in die Hochschule in der<br />
vorgeschlagenen Form, fragen jedoch<br />
auch hier -ähnlich wie bei den Zentren<br />
für LehrerInnenbildung -<br />
Wie werden sich die Internationalen<br />
Studienkollegs in den Gremien der<br />
Hochschule vertreten finden, z<strong>um</strong>al der<br />
Senat die Ordnung über die Aufnahme-<br />
und Feststellungsprüfung erlassen<br />
soll?<br />
Schwerpunkt Hochschulen<br />
3.4 Folgen für die Gesellschaft<br />
und die Natur<br />
In § 106 Abs. 4 Satz 2 „kann die Studierendenschaft<br />
insbesondere auch zu<br />
solchen Fragen Stellung beziehen, die<br />
sich mit ... der Anwendung der wissenschaftlichen<br />
Erkenntnisse und der Abschätzung<br />
ihrer Folgen für die Gesellschaft<br />
und die Natur beschäftigen.“ Die<br />
Übernahme des Prinzips der Nachhaltigen<br />
Entwicklung wurde in der „Rio-<br />
Deklaration“ von 1992 von VertreterInnen<br />
fast aller Regierungen der Welt<br />
für den Wissenschafts- und Bildungsbereich<br />
für verbindlich erklärt. Die europäischen<br />
Hochschulen haben diesen<br />
Auftrag in der Copernicus-Charta der<br />
Europäischen Hochschulrektoren spezifiziert<br />
und als verbindliches Leitprinzip<br />
ihrer Arbeit übernommen. Einige<br />
Hochschulen in Rheinland-Pfalz haben<br />
die Grundsätze der Copernicus-Charta<br />
bereits explizit als Leitbild übernommen.<br />
Diese bereits im HRG (6. Novell.)<br />
festgelegte Aufgabe fordert der DGB als<br />
Aufgabe der GANZEN Hochschule in<br />
§ 2 gesetzlich zu regeln.<br />
Birgit Groß<br />
Leiterin des Fachbereiches<br />
Bildung/Berufliche Bildung/ Hochschule<br />
im DGB Rheinland-Pfalz<br />
6 <strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 /<strong>20</strong>03
Schwerpunkt Hochschulen<br />
HPR: „Höchst ambivalente Gefühle“<br />
Abschließend zur <strong>Diskussion</strong> über<br />
das geplante neue <strong>Hochschulgesetz</strong><br />
hier auch die Stellungnahme des<br />
Hauptpersonalrats für den Geschäftsbereich<br />
des Ministeri<strong>um</strong>s für<br />
Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung<br />
und Kultur.<br />
„(...) Entsprechend der gesetzlichen<br />
Aufgabenstellung möchte der HPR sich<br />
im Wesentlichen darauf beschränken,<br />
zu denjenigen Fragen und Regelungskomplexen<br />
Stellung zu nehmen, welche<br />
die Rechtsstellung bzw. die Aufgaben<br />
der Personalvertretungen im Hochschulbereich<br />
berühren. Daneben sollen<br />
jedoch auch einige Punkte kommentiert<br />
werden, die das politische Verständnis<br />
des HPR zu Fragen der Hochschulen<br />
berühren. In den wenigsten Punkten<br />
wird der HPR explizite Lösungsvorschläge<br />
unterbreiten - etwas Derartiges<br />
war in der Kürze der zur Verfügung<br />
stehenden Zeit nicht zu leisten -, sondern<br />
er beschränkt sich darauf, Probleme<br />
aufzuzeigen und damit den Anstoß<br />
zu geben, nach Lösungen hierfür zu<br />
suchen. Dabei werden z. T. auch Probleme<br />
aufgezeigt, die schon in den jetzt<br />
geltenden Gesetzesfassungen vorhanden<br />
sind. Im Weiteren bezieht sich die Bezugnahme<br />
auf Paragrafen - soweit nicht<br />
ausdrücklich etwas Anderes gesagt ist -<br />
auf den LHG-Entwurf.<br />
Die Stellungnahme ist gegliedert in fünf<br />
Teile:<br />
1. eine grundsätzliche Wertung der beabsichtigten<br />
Novellierung,<br />
2. die Behandlung von Grundkonflikten<br />
zwischen Hochschulautonomie und<br />
Personalvertretung anhand ausgewählter<br />
Beispiele,<br />
3. Ausführungen zur vorgesehenen neuen<br />
Hochschulstruktur, hier insbesondere<br />
zur Einführung des Hochschulrates,<br />
4. Ausführungen zur demokratischen<br />
Teilhabe an diesen Strukturen und<br />
5. Ausführungen zu weiteren Einzelfragen<br />
des vorgelegten Gesetzentwurfes.<br />
1. Einführung<br />
1.0. Bei der Novellierung des Universitätsgesetzes<br />
im Jahre 1995 hatte der<br />
Hauptpersonalrat den damals vorgeleg-<br />
<strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 /<strong>20</strong>03<br />
ten Gesetzentwurf in seiner Tendenz,<br />
die gesellschaftliche Aufgabe des Abbaus<br />
der Benachteiligung von Frauen stärker<br />
als bisher zur Aufgabe auch und<br />
gerade der Hochschulen zu machen,<br />
begrüßt. Ebenso begrüßt hatte es der<br />
Hauptpersonalrat, dass verstärkt Elemente<br />
einer demokratischen Beteiligung<br />
aller Statusgruppen der Hochschulangehörigen<br />
eingebracht werden sollten.<br />
Dabei wurde auch z<strong>um</strong> Ausdruck gebracht,<br />
dass der Hauptpersonalrat<br />
hierzu weitergehende Vorstellungen hat.<br />
Zur Vermeidung von Wiederholungen<br />
sei diesbezüglich auf die Stellungnahme<br />
des HPR vom 11.01.1995, Az.:<br />
B05/15.94, verwiesen, die aus Anlass<br />
der Anhörung des Gesetzentwurfes im<br />
Ausschuss für Wissenschaft und Weiterbildung<br />
vorgelegt worden war.<br />
Weiter hatte der HPR anhand zweier<br />
Beispiele auf Probleme hingewiesen, die<br />
sich aus dem Spannungsfeld zwischen<br />
autonomer Selbstverfassung der Hochschulen<br />
einerseits und den Beteiligungsrechten<br />
der Personalvertretung andererseits<br />
ergeben. Er hatte diesbezüglich Lösungen<br />
vorgeschlagen, welche bewirken<br />
sollten, dass im Hochschulbereich die<br />
Beteiligungsrechte der Personalvertretung<br />
nicht hinter dem zurückstehen<br />
müssen, was sonst in jeder Dienststelle<br />
des Landes Rheinland-Pfalz rechtlich<br />
geregelt ist. Für eine Personalvertretung<br />
„zweiter Klasse“ gibt es nämlich keine<br />
ersichtliche Rechtfertigung.<br />
Diesen Vorschlägen wurde damals im<br />
Gesetzgebungsverfahren nicht gefolgt.<br />
Die vom HPR aufgezeigten Probleme<br />
sind dann auch in der Tat aufgetreten,<br />
wie die Auseinandersetzung aus Anlass<br />
der Erstellung des Rahmenplanes zur<br />
Frauenförderung in der Johannes Gutenberg-Universität<br />
Mainz gezeigt hat.<br />
Der HPR wird dies deshalb im Abschnitt<br />
2 erneut vortragen.<br />
1.1. Der jetzt vorgelegte Entwurf für<br />
die Novellierung des LHG löst bezüglich<br />
der beabsichtigten Modernisierung<br />
der Leitungs- und Gremienstruktur<br />
beim HPR unter dem Aspekt der damaligen<br />
Stellungnahme höchst ambivalente<br />
Gefühle aus.<br />
Einerseits ist die ausdrücklich vorgese-<br />
hene Stärkung der Kompetenzen der<br />
Hochschulleitung (s. LHG-Entwurf,<br />
Begründung, S. 2 (zu Teil A, Ziffer 2))<br />
gegenüber dem bisherigen Rechtsstand<br />
geeignet, die damals aufgezeigten Probleme<br />
- wenigstens teilweise - zu mildern.<br />
Insoweit könnte der HPR dies<br />
begrüßen.<br />
Der Preis, der dafür zu zahlen ist, erscheint<br />
dem HPR jedoch als zu hoch.<br />
Die damals begrüßte stärkere demokratische<br />
Teilhabe bei Entscheidungen betreffend<br />
die inneren Angelegenheiten<br />
der Hochschulen, welche dem Selbstverfassungsbereich<br />
zuzuordnen sind, ist<br />
zwar der äußeren Form nach zuerst<br />
einmal nicht berührt, jedoch durch die<br />
Zurücknahme von Kompetenzen der<br />
Selbstverwaltungsorgane (a. a. O., S.3)<br />
Senat und Fachbereichsrat sehr wohl<br />
dem Inhalt nach deutlich zurückgenommen.<br />
Dies kann der HPR keinesfalls<br />
begrüßen. Hierzu soll im Abschnitt<br />
4 weiter Stellung genommen werden.<br />
Kritisch gesehen wird die Einführung<br />
eines Hochschulrats mit den dort vorgesehenen<br />
Befugnissen. Hierzu wird im<br />
Abschnitt 3 gesondert Stellung genommen.<br />
1.2. Der HPR begrüßt, dass mit<br />
dem vorgelegten Entwurf die „grundsätzliche<br />
Berücksichtigung geschlechtsspezifischer<br />
Auswirkungen von Vorschlägen<br />
und Entscheidungen in Form<br />
des ‚Gender Mainstreaming‘ ... als besondere<br />
Hochschulaufgabe verankert“<br />
wird (s. LHG-Entwurf, Begründung,<br />
S. 3 (zu Teil A, Ziffer 5)). Damit wird<br />
‚Gender Mainstreaming‘ (GM) als Ziel<br />
und als Methode verbindlich vorgeschrieben.<br />
Durch eine - möglicherweise missverständliche<br />
- Formulierung im Entwurf<br />
der amtlichen Begründung wird jedoch<br />
der Eindruck erweckt, dass diese Aufgabe<br />
primär den Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten<br />
zugeordnet wird<br />
(a. a. O., S. 5). Dies hielte der HPR<br />
für falsch. Die Aufgabe, das Ziel und<br />
die Methoden des GM zu beachten, ist<br />
primär Aufgabe der Hochschule als<br />
Ganzes und damit vor allem der Hochschulleitung,<br />
welche dann hierfür die<br />
Gewährleistung zu geben hat. Selbst-<br />
7
verständlich haben dabei die Frauenund<br />
Gleichstellungsbeauftragten eine<br />
wichtige Anregungs- und Überwachungsfunktion.<br />
Das ist aber etwas<br />
anderes, als eine primäre Zuständigkeit<br />
für die Durchführung der Aufgabe<br />
des GM. Der HPR möchte deshalb<br />
vorschlagen, im Entwurf der amtlichen<br />
Begründung eine entsprechende Klarstellung<br />
vorzunehmen.<br />
2. Konfliktfelder für die<br />
Personalvertretung<br />
Nachdem der vorgelegte Gesetzentwurf<br />
darauf angelegt ist, die Autonomie der<br />
Hochschule, was ihre inneren Angelegenheiten<br />
betrifft, durch eine weitgehende<br />
Deregulierung weiter zu stärken,<br />
wird das in der o. g. Stellungnahme<br />
des HPR vom 11.01.1995 aufgezeigte<br />
Spannungsfeld ebenfalls weiter verstärkt.<br />
Wo früher wenigstens im Prinzip noch<br />
Weisungsbefugnisse des Ministeri<strong>um</strong>s<br />
bestanden, werden diese jetzt zurückgenommen,<br />
ohne dass die Hochschulleitung<br />
mit entsprechenden Befugnissen<br />
ausgestattet wird.<br />
2.1. Der HPR hatte damals aufgezeigt,<br />
dass in zentralen Aufgaben der Hochschule,<br />
für welche die Hochschulleitung<br />
die Organisationsverantwortung hat<br />
und haben muss (z. B. bei Fragen des<br />
Arbeitsschutzes), es wegen der gegenüber<br />
den wissenschaftlichen Einrichtungen<br />
sowie den Hochschullehrerinnen<br />
und Hochschullehren fehlenden Weisungsbefugnis<br />
zu Problemen kommt,<br />
die auch die Aufgaben und Befugnisse<br />
der Personalvertretung berühren (a. a.<br />
O., zu Abschnitt 2.2).<br />
2.1.1. An dieser Situation wird sich<br />
nach dem Entwurf nur insoweit etwas<br />
ändern, als bisherige Befugnisse der<br />
Gremien Senat bzw. Fachbereichsrat<br />
auf die Hochschulleitung (Präsidentin<br />
oder Präsident) bzw. auf die Fachbereichsleitung<br />
(Dekanin oder Dekan)<br />
übergehen sollen. Jedoch bleibt schon<br />
offen, inwieweit die Hochschulleitung<br />
in Angelegenheiten, welche den Fachbereichen<br />
zugeordnet sind, ein diesbezügliches<br />
Weisungsrecht gegenüber den<br />
Fachbereichsleitungen haben soll.<br />
2.1.2. Verstärkt wird dies auch<br />
dadurch, dass die Abgrenzung zwischen<br />
wissenschaftlichen Aufgaben, welche<br />
den wissenschaftlichen Einrichtungen<br />
zugeordnet sind, und den allgemeinen<br />
Dienstleistungsaufgaben, welche der<br />
Hochschule insgesamt zugeordnet sind<br />
und für die somit die Hochschulleitung<br />
die Organisationsverantwortung hat,<br />
mehr als unklar ist. War dies schon<br />
bisher unklar (wie z. B. wegen der Sonderregelung<br />
für die Johannes Gutenberg-Universität<br />
Mainz bezüglich der<br />
Aufgabe der Förderung der sozialen<br />
Belange der Studierenden durch den<br />
Allgemeinen Hochschulsport), so wird<br />
z. B. durch die Änderung in § 91<br />
LHG-Entwurf bezüglich der ausdrücklichen<br />
Erwähnung der Rechenzentren<br />
und der Aufgaben der Informationsund<br />
Kommunikationstechnik zusätzliche<br />
Unklarheit eingebracht.<br />
Der HPR hielte es für äußerst problematisch,<br />
wenn z. B. einem Hochschulrechenzentr<strong>um</strong>,<br />
welches als wissenschaftliche<br />
Einrichtung etabliert ist, die<br />
Zuständigkeit für die Telekommunikationsanlage<br />
oder auch die Zuständigkeit<br />
für die Verwaltungsdatenverarbeitung<br />
übertragen würden, ohne dass die<br />
Hochschulleitung dementsprechende<br />
Weisungs- und Durchgriffsbefugnisse<br />
hätte.<br />
2.1.3. Ein weiteres Beispiel für diese<br />
Konfliktsituation ist die Frage der Weiterbildung<br />
des Personals. Diese Aufgabe<br />
ist nach § 8 Ziff. 7 den Selbstverwaltungsaufgaben<br />
zugeordnet.<br />
Andererseits sind die Personalangelegenheiten,<br />
zu denen gewiss auch die<br />
Weiterbildungsarbeit gehört, den Auftragsangelegenheiten<br />
zugeordnet.<br />
Nimmt in diesem Spannungsfeld die<br />
Hochschulleitung ihre Aufgabe wahr<br />
bzw. lässt sie im Auftrag durch ihre<br />
zentrale Verwaltung durchführen, so<br />
greifen unzweifelhaft die diesbezüglichen<br />
Mitbestimmungsrechte der Personalvertretung.<br />
Nimmt sich jedoch ein<br />
Selbstverwaltungsorgan, wie z. B. der<br />
Senat, dieser Aufgabe an, so wird von<br />
Seiten der Hochschule - analog zu den<br />
Erfahrungen beim Erlass von Frauenförderplänen<br />
(s. hierzu unter 2.2.) -<br />
z<strong>um</strong>indest in Zweifel gezogen werden,<br />
dass der Personalrat dazu mitzubestimmen<br />
hat. Auch insoweit bleibt es bei<br />
der Kritik, dass es aber im Hochschulbereich<br />
keine Personalvertretung „zweiter<br />
Klasse“ geben darf. Dies verlangt<br />
dann aber klare Regelungen, die helfen,<br />
dies zu vermeiden.<br />
Schwerpunkt Hochschulen<br />
2.1.4. Eine neue Konfliktzone ergibt<br />
sich aus der in § 56 Abs. 1 Satz 4 des<br />
Entwurfs vorgesehenen Möglichkeit,<br />
dass die Dekanin oder der Dekan in<br />
begründeten Fällen wissenschaftlichen<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern<br />
auch die selbständige Wahrnehmung<br />
von Aufgaben in Forschung und Lehre<br />
übertragen kann. So sehr diese Regelung<br />
dem Inhalt nach zu begrüßen ist, so<br />
kritisch ist sie zu sehen im Hinblick auf<br />
die Beteiligungsrechte der Personalvertretung.<br />
Nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 4 und 5<br />
LPersVG hat der Personalrat Mitbestimmung<br />
bei der Übertragung (und<br />
damit auch beim Entzug) von Aufgaben.<br />
Dies ist unkritisch, soweit solche<br />
Übertragungen von der Dienststellenleitung,<br />
d. h. von der Präsidentin bzw.<br />
dem Präsidenten, vorgenommen werden.<br />
Problematisch ist jedoch die Situation,<br />
wie sie nach dem LHGEntwurf<br />
gegeben ist, weil diese Befugnis den<br />
Dekaninnen und Dekanen zugeordnet<br />
ist.<br />
Auch hier besteht aus den oben aufgezeigten<br />
Gründen die Gefahr, dass das<br />
Mitbestimmungsrecht der Personalvertretung<br />
ins Leere läuft. Es stellt sich<br />
nämlich die Frage, ob die Dienststellenleitung<br />
die diesbezügliche Wahrnehmung<br />
der Befugnisse durch Dekanin<br />
bzw. Dekan als i. S. d. LPersVG beabsichtigte<br />
Maßnahme anrechnen lassen<br />
müssen und somit - z<strong>um</strong>indest auf Antrag<br />
nach § 81 LPersVG hin - das Mitbestimmungsverfahren<br />
einleiten müssen,<br />
oder ob solche Übertragung von<br />
Aufgaben oder auch deren Entzug der<br />
Mitbestimmung durch die Personalvertretung<br />
deshalb entzogen sind, weil es<br />
sich hier nicht <strong>um</strong> einen Maßnahme<br />
der Dienststellenleitung handelt.<br />
Besonders problematisch ist dies im<br />
Falle des Entzugs von Aufgaben, weil<br />
hier die Schutzbedürftigkeit der betroffenen<br />
Person eine Beteiligung der Personalvertretung<br />
besonders erforderlich<br />
macht.<br />
2.1.5. In diesem Zusammenhang ist<br />
noch auf ein anderes Problem hinzuweisen,<br />
welches allerdings auch schon<br />
bei der bisher geltenden Fassung besteht.<br />
An mehreren Stellen der geltenden Gesetze<br />
bzw. des Entwurfes ist die Rede<br />
von der Zuordnung des Personals (§<br />
43,Abs. 2, § 44 Abs. 2, § 56 Abs. 1<br />
Satz 1, § 60). Dabei finden sich fol-<br />
8 <strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 /<strong>20</strong>03
Schwerpunkt Hochschulen<br />
gende Fallgestaltungen:<br />
Zuordnung zu<br />
- der Hochschule als Gesamtes<br />
- zu einer Zentralen Einrichtung<br />
- zu einer gemeinsamen Einrichtung<br />
mehrerer Fachbereiche<br />
- zu einem Fachbereich<br />
- zu einer wissenschaftlichen Einrichtung<br />
eines Fachbereiches<br />
- zu Professorinnen und Professoren.<br />
Es ist jedoch an keiner Stelle festgelegt,<br />
wer wann über diese Zuordnung entscheidet.<br />
Dies ist nun nicht lediglich ein<br />
abstraktes Problem, sondern es hat in<br />
der Johannes Gutenberg-Universität<br />
Mainz aus Anlass der Zusammenlegung<br />
der früheren Fachbereiche Pharmazie<br />
und Chemie zu einem Fachbereich diesbezüglich<br />
erhebliche Probleme gegeben,<br />
weil es Streit darüber gab, wer nach der<br />
Zusammenlegung Vorgesetzter ist.<br />
Nachfrage des HPR bei der Rechtsabteilung<br />
des MWWFK hat als Auskunft<br />
ergeben, dass diese Zuordnung von der<br />
Präsidentin bzw. dem Präsidenten aus<br />
Anlass der Einstellung getroffen werde.<br />
Hiergegen ist nichts einzuwenden. Doch<br />
sollte dies zur Vermeidung von Unklarheiten<br />
und daraus resultierender Kompetenzstreitigkeiten<br />
auch unmissverständlich<br />
so geregelt werden.<br />
2.1.6. Aus allen diesen Gründen ist<br />
der HPR der Auffassung, dass in Fragen,<br />
für welche die Hochschule als Ganzes<br />
die Gewährleistung zu geben hat<br />
und für die somit die Hochschulleitung<br />
verantwortlich einzustehen hat, die<br />
Leitung diesbezügliche Weisungsbefugnisse<br />
erhalten muss und zwar sowohl<br />
gegenüber den einzelnen Professorinnen<br />
und Professoren - wie z. B. im geschilderten<br />
Fall des Arbeitsschutzes - als auch<br />
gegenüber den Fachbereichen, deren<br />
wissenschaftlichen Einrichtungen, den<br />
zentralen Einrichtungen etc. und deren<br />
Leitungen. Dies gilt insbesondere<br />
auch für Angelegenheiten, in denen die<br />
Hochschulleitung eine Gewährleistungspflicht<br />
bezüglich der Wahrung der<br />
Rechte der Personalvertretung hat.<br />
Alternativ oder auch ergänzend dazu<br />
ist auch die Einrichtung einer personalvertretungsrechtlichen<br />
Beziehung zwischen<br />
Senat bzw. Fachbereichsleitung<br />
etc. einerseits und der Personalvertretung<br />
andererseits vorzusehen, wie sie<br />
schon in der o. g. Stellungnahme aus<br />
1995 vorgeschlagen worden war (a. a.<br />
<strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 /<strong>20</strong>03<br />
O., S. 5). Auf die diesbezügliche Begründung<br />
wird in vollem Umfang verwiesen.<br />
Dies steht nach Auffassung des HPR<br />
auch nicht in Widerspruch zur weiter<br />
gehenden Delegierung von Aufgaben<br />
und Befugnissen, wie sie sich aus dem<br />
Ziel der Deregulierung ergibt. Es bedeutet<br />
vielmehr lediglich, dass derjenige,<br />
der nach Außen in der Organisationsverantwortung<br />
steht, auch die diesbezüglichenDurchsetzungsinstr<strong>um</strong>ente<br />
und die personalvertretungsrechtlichen<br />
Pflichten und Befugnisse haben<br />
muss.<br />
2.2. Bezüglich der Aufgabe der<br />
Hochschulen, „die tatsächliche Durchsetzung<br />
der Gleichberechtigung von<br />
Frauen und Männern“ zu fördern und<br />
„auf die Beseitigung bestehender Nachteile“<br />
hinzuwirken (§ 2 Abs. 2 LHG-<br />
Entwurf), hatte der HPR schon zu der<br />
Vorgängerregelung in § 2 Abs. 2 UG<br />
eingehend dargelegt, inwieweit die für<br />
die Hochschulen normierten Zuständigkeiten<br />
die ansonsten gegebenen Beteiligungsrechte<br />
der Personalvertretung<br />
gefährden. Die Regelung, wie sie damals<br />
in § 127 UG ihren Niederschlag fand,<br />
wurde vom HPR als unzureichend kritisiert.<br />
Die Vorschläge, die er zur Lösung<br />
des Problems vorgetragen hatte,<br />
wurden nicht in das UG bzw. in das<br />
FHG aufgenommen, so dass sie hier<br />
erneut vorgetragen werden. Wegen der<br />
genaueren Begründung verweisen wir<br />
auf die o. g. Stellungnahme des HPR<br />
aus dem Jahr 1995.<br />
Zu erwähnen ist, dass die Befürchtungen<br />
keinesfalls übertrieben waren. Es<br />
ist hier im Hause hinreichend bekannt,<br />
dass es anlässlich des Erlasses eines Rahmenplans<br />
für die Frauenförderung<br />
durch den Senat der Johannes Gutenberg-Universität<br />
Mainz zu Auseinandersetzungen<br />
kam, die letztlich darin<br />
endeten, dass die zuvor mit dem örtlichen<br />
Personalrat abgeschlossene Dienstvereinbarung<br />
teilweise für nichtig erklärt<br />
wurde, weil der Personalrat insoweit<br />
keine Zuständigkeit besäße. Dies<br />
betraf jedoch alles Punkte, die in einer<br />
„normalen“ Dienststelle unzweifelhaft<br />
in die Zuständigkeit der Personalvertretung<br />
gefallen wären.<br />
Auch zur Bereinigung dieser Situation<br />
wird auf den entsprechenden Vorschlag<br />
aus der Stellungnahme aus 1995 zu-<br />
rückgegriffen (a. a. O., S. 4).<br />
Erwähnenswert ist, dass nach dem bisherigen<br />
Entwurf sogar die damals ausdrücklich<br />
hierfür eingeführte spezialgesetzliche<br />
Regelung über die Beteiligung<br />
der Personalvertretung bei der<br />
Bestellung von Frauenbeauftragten (§<br />
127 UG, § 95 FHG) weggefallen ist.<br />
Auf Nachfrage des HPR wurde dies als<br />
redaktionelles Versehen bezeichnet.<br />
Obwohl der HPR - wie 1995 schon<br />
ausgeführt - diese spezialgesetzliche Regelung<br />
für nicht geeignet ansieht, die<br />
Beeinträchtigung der Rechtsstellung der<br />
Personalvertretung zu kompensieren (a.<br />
a. O., S. 4), so möchte er doch anmerken,<br />
dass wenigstens dieser Rechtsstand<br />
wieder vorzusehen ist, sollten unsere<br />
weiter gehenden Vorstellungen hierzu<br />
nicht realisiert werden.<br />
3. Gesellschaftliche Öffnung<br />
Nach dem Entwurf soll die Entscheidungstruktur<br />
der Hochschulen zukünftig<br />
durch die Einrichtung eines Hochschulrates<br />
(§ 75) als zentrales Organ<br />
(§ 72 Abs. 2) und einer Gemeinsamen<br />
Kommission (§ 78) geändert werden.<br />
Diese Gremien sollen mit „grundlegenden<br />
Beratungs- und Zustimmungsrechten“<br />
ausgestattet sein. Laut Presseerklärung<br />
vom 25.09.<strong>20</strong>02 erklärte Staatsminister<br />
Professor Zöllner, dass damit<br />
dafür gesorgt werde, dass sich die Hochschulen<br />
gegenüber der Gesellschaft öffnen.<br />
Diese Absicht wird vom HPR begrüßt,<br />
jedoch steht der hier vorgeschlagene<br />
Weg in Widerspruch z<strong>um</strong> erklärten<br />
Ziel.<br />
Z<strong>um</strong> Einen ist festzuhalten, dass mit<br />
dem Kuratori<strong>um</strong> schon bisher eine Öffnung<br />
gegenüber der Gesellschaft existiert.<br />
Es ist dem HPR diesbezüglich<br />
keine durchgreifende Kritik bekannt.<br />
Inwiefern die jetzt vorgesehenen Gremien<br />
hier ein Mehr an Öffnung bringen<br />
sollen, bleibt unerfindlich. Im Übrigen<br />
ist die im GEntwurf vorgesehene<br />
Größe und Zusammensetzung nicht<br />
geeignet, die Gesellschaft zu repräsentieren,<br />
der gegenüber ja die Öffnung<br />
vorangetrieben werden soll. Es fällt<br />
schon auf, dass die explizite Erwähnung<br />
der Wirtschaft neben den anderen gesellschaftlichen<br />
Kräften den Eindruck<br />
erweckt, als ob Wirtschaft etwas „außerhalb<br />
der Gesellschaft Stehendes“ sei.<br />
Dies kann aber nicht im Interesse der<br />
9
von Minister Zöllner vorgestellten Zielsetzung<br />
sein. Es ist deshalb durch eine<br />
geeignete Formulierung klarzustellen,<br />
dass und wie sich gesellschaftliche Kräfte<br />
in diesen Gremien wieder zu finden<br />
haben und dass die Wirtschaft hierbei<br />
höchstens einen Teil darstellt.<br />
Als problematisch und möglicherweise<br />
als unzulässiger Eingriff in die Selbstverwaltungsbefugnisse<br />
der Hochschule<br />
zu werten sind die weitreichenden<br />
Kompetenzen des Hochschulrates. Personen,<br />
welche nicht der Hochschule<br />
angehören, haben nach dem Entwurf<br />
über ihre Mitentscheidungsbefugnisse<br />
maßgeblichen Einfluss auf hochschulund<br />
forschungsbezogene Entscheidungen<br />
der Hochschulen.<br />
Dies ist insbesondere deshalb bedenklich,<br />
weil die Mitglieder des Hochschulrats<br />
und (teilweise) der Gemeinsamen<br />
Kommission - anders als insoweit die<br />
gewählten Mitglieder der Kollektivorgane<br />
der Hochschule - keine ausreichende<br />
demokratische Legitimation für die<br />
Mitentscheidung in Angelegenheiten<br />
der Hochschule haben. Sie sind auch -<br />
im Unterschied zu Präsidentin oder<br />
Präsident bzw. Dekanin oder Dekan -<br />
nicht gegenüber einem demokratisch<br />
legitimierten Organ verantwortlich.<br />
Dass dies insgesamt eine rechtlich problematische<br />
Angelegenheit sein kann,<br />
zeigt allein schon die Rechtsprechung<br />
der Verfassungsgerichte z<strong>um</strong> Bereich der<br />
Personalvertretung, der ja in wesentlichen<br />
Teilen ihrer Aufgaben eine gleichberechtigte<br />
Mitentscheidungsbefugnis<br />
wegen des Fehlens einer demokratischen<br />
Legitimation abgesprochen wurde.<br />
Unklar ist der Verfahrensweg, auf welchem<br />
die von der Hochschule zu berufenden<br />
Mitglieder vorgeschlagen werden.<br />
Es ist weiter keine Möglichkeit der<br />
Abberufung von Mitgliedern des Hochschulrates<br />
vorgesehen. Und letztlich<br />
führt die Amtszeit von fünf Jahren für<br />
Mitglieder des Hochschulrates gegenüber<br />
einer Amtszeit von drei Jahren bzw.<br />
einem Jahr bei Senats- und Fachbereichsratsmitgliedern<br />
auch in dieser<br />
Hinsicht zu einem unausgewogenen<br />
Verhältnis.<br />
4. Demokratische Legitimation<br />
Wie schon in der Einleitung angesprochen,<br />
ist die Verstärkung der Befugnis-<br />
se der Leitungen (Hochschulleitung,<br />
Fachbereichsleitung) gegenüber den<br />
Kollektivorganen aus der Sicht demokratischer<br />
Teilhaber aller Hochschulangehöriger<br />
nicht zu begrüßen.<br />
4.1. Weiter ist nicht zu begrüßen,<br />
dass die Kollektivorgane selbst nicht<br />
nach Kriterien der demokratischen Teilhabe,<br />
sondern in einer ständerechtlich<br />
orientierten Weise gewählt und zusammengesetzt<br />
sind. Der Versuch, insoweit<br />
Verbesserungen anzufordern, findet<br />
allerdings leider seine Grenze in der<br />
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts.<br />
Was hierzu kritisch anz<strong>um</strong>erken<br />
ist, wurde schon in der o. g. Stellungnahme<br />
des HPR im Jahr 1995<br />
ausgeführt.<br />
Es gibt allerdings einen Bereich, der<br />
entschieden verbessert werden kann<br />
und dem die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts<br />
nicht entgegenstehend<br />
dürfte. Es handelt sich hierbei<br />
<strong>um</strong> die Beschlussfassung über die<br />
Grundordnung der Hochschule.<br />
Die Grundordnung ist sozusagen die<br />
Verfassung (oder wenn man es weniger<br />
hochtrabend ausdrücken will: die Satzung)<br />
der jeweiligen Hochschule. Es ist<br />
aber allgemein üblich, dass für den<br />
Erlass oder für die Änderung von Regelungen<br />
mit Verfassungs- bzw. Satzungsrang<br />
eine qualifizierte Mehrheit<br />
erforderlich ist, damit nicht knappe<br />
Mehrheiten die verfassungs- bzw. satzungsmäßigen<br />
Rechte der Minderheit<br />
einfach beschneiden können. Dies hat<br />
also auch für die Grundordnung zu<br />
gelten.<br />
In Anbetracht der Tatsache, dass nach<br />
§ 81 Abs. 4 Satz 2 die Abwahl der<br />
Präsidentin bzw. des Präsidenten mit<br />
einer Mehrheit von drei Vierteln zulässig<br />
ist, möchte der HPR dieses Quor<strong>um</strong><br />
auch für den Erlass bzw. die Änderung<br />
der Grundordnung vorschlagen.<br />
4.2. Ein Problem der demokratischen<br />
Legitimation wurde schon für<br />
den Hochschulrat aufgezeigt (s. oben<br />
zu 3.). Auch die Gemeinsame Kommission<br />
(GK) ist hiervon betroffen. Die<br />
GK ist zwar kein Organ der Hochschule,<br />
wie sich aus der abschließenden<br />
Aufzählung der Organe in § 72 ergibt,<br />
sie ist jedoch ein Gremi<strong>um</strong>. Für dieses<br />
gilt zwar wegen der Entsendung von<br />
Mitgliedern des Hochschulrates eine<br />
besondere von § 37 abweichende Zu-<br />
Schwerpunkt Hochschulen<br />
sammensetzung, aber wenigstens für die<br />
vom Senat zu entsendenden Mitglieder<br />
müsste die in § 37 Abs. 2 Satz 2 geregelte<br />
Teilnahme aller Mitgliedergruppen<br />
vorgesehen werden. Dies kollidiert<br />
dann aber mit der Größe der GK, denn<br />
bei drei zu entsendenden Mitgliedern<br />
können nicht vier Mitgliedergruppen<br />
berücksichtigt werden. Für den Fall,<br />
dass nicht wegen des Verzichts auf die<br />
Installierung des Hochschulrates auch<br />
die GK entbehrlich wird, ist dies ist<br />
durch eine Erhöhung der Zahl der GK<br />
Mitglieder auf je vier zu korrigieren.<br />
5. Einzelpunkte<br />
Im folgenden werden noch einige Einzelpunkte<br />
angesprochen, zu denen der<br />
Hauptpersonalrat Anregungen einbringen<br />
möchte:<br />
5.1. Aus einer Vielzahl von Änderungen<br />
ergibt sich, dass mit dem neuen<br />
<strong>Hochschulgesetz</strong> die Aufgaben der<br />
Hochschulen insgesamt und damit die<br />
Belastung der Beschäftigten zunehmen<br />
wird. Beispielhaft genannt seien die<br />
Einführung dualer Studiengänge (§ 19<br />
Abs. 5), Fernstudi<strong>um</strong> unter intensivem<br />
Einsatz der Multimedia-, Informations-<br />
und Kommunikationstechnik (§<br />
23), Verstärkung der Studienberatung<br />
(§ 24), Leistungspunktesystem (25), der<br />
Ausschluss von Schriftstücken in elektronischer<br />
Form (§ 26 Abs. 3), die Einführung<br />
von Studienkonten (§ 71) etc..<br />
Diese Änderungen sind zwar als Verbesserungen<br />
zu begrüßen oder sind aus<br />
rechtlichen Gründen unabweisbar, sie<br />
gehen aber unzweifelhaft einher mit<br />
einer vermehrten Arbeitsbelastung. Die<br />
Aussage, dass der GEntwurf insgesamt<br />
als kostenneutral bezeichnet werden<br />
könne, ist nur dann gerechtfertigt, wenn<br />
vorgesehen ist, diese vermehrte Arbeitslast<br />
ohne Kompensation auf die Beschäftigten<br />
der Hochschulen abzuwälzen.<br />
Hiergegen verwahrt sich der HPR<br />
mit Nachdruck. Kostenneutralität auf<br />
dem Rücken der Beschäftigten verträgt<br />
sich nicht mit Fürsorgepflicht. Er fordert<br />
deshalb, dass bei der weiteren Entwicklung<br />
des PBK diese Aufgabenzunahme<br />
entsprechend berücksichtigt<br />
wird.<br />
5.2. Der HPR wendet sich gegen die<br />
in § 37 Abs. 1 Satz 5 vorgesehene -<br />
allerdings schon im UG und FHG enthaltene<br />
- Inkompatibilitätsregelung<br />
10 <strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 /<strong>20</strong>03
Schwerpunkt Hochschulen<br />
betreffend gleichzeitiger Zugehörigkeit<br />
zur Personalvertretung und zu Hochschulgremien.<br />
Soweit solche Gremien<br />
wegen der Kompetenzverlagerung auf<br />
die jeweiligen Leitungen keine Zuständigkeit<br />
in Personalangelegenheiten<br />
mehr besitzen, ist die Regelung inhaltsleer.<br />
Soweit es in Teilen noch Gründe<br />
für eine Inkompatibilität geben sollte,<br />
ist die Regelung entbehrlich, weil es<br />
schon in § 31 Abs. 2 LPersVG eine Inkompatibilitätsregelung<br />
gibt, die den<br />
konkreten Bedürfnissen der Vermeidung<br />
von Funktionskonflikten völlig genügt.<br />
Der HPR fordert deshalb die ersatzlose<br />
Streichung des Satzes 5.<br />
5.3. Die Schutzrechte für ehrenamtliche<br />
Mitglieder der Hochschulgremien,<br />
wie sie in § 37 Abs. 3 vorgesehen<br />
sind, erscheinen dem HPR als unzureichend.<br />
Er schlägt statt dessen folgende<br />
Formulierung vor:<br />
„Die Hochschulmitglieder dürfen wegen<br />
ihrer Tätigkeit in der Selbstverwaltung<br />
weder bevorzugt noch benachteiligt<br />
werden; sie sind in diesen Funktionen<br />
an Weisungen nicht gebunden. Für<br />
Mitglieder in Organen, Gremien und<br />
Kommissionen nach diesem Gesetz oder<br />
nach der Grundordnung der Hochschule<br />
gelten die Vorschriften des Landespersonalvertretungsgesetzes<br />
für Rheinland-Pfalz<br />
über Arbeitszeitversä<strong>um</strong>nis<br />
sowie über den Schutz der Mitglieder<br />
der Personalvertretungen vor Versetzung,<br />
Abordnung oder Kündigung entsprechend.<br />
Satz 2 gilt entsprechend für<br />
Mitglieder von Gremien, die von Organen<br />
nach diesem Gesetz oder nach der<br />
Grundordnung eingesetzt werden.“<br />
5.4. Der HPR wendet sich dagegen,<br />
dass bezüglich der Finanzierung der<br />
Hochschulen vom Prinzip der Bedarfsdeckung<br />
auf eine rein leistungs- und<br />
belastungsorientierte Mittelbemessung<br />
übergegangen wird. Damit entzieht sich<br />
der Staat seiner Verantwortung dafür,<br />
die Hochschulen entsprechend dem gesellschaftlichen<br />
Bedarf an Forschung<br />
und Lehre mit den erforderlichen Mitteln<br />
auszustatten. Der HPR hält dies<br />
insgesamt für den falschen Ansatz. Was<br />
in Zeiten der finanziellen Engpässe<br />
noch zur Not hinzunehmen ist, nämlich,<br />
dass anhand leistungs- und belastungsorientierter<br />
Kriterien Transparenz<br />
und Berechenbarkeit geschaffen wird<br />
hinsichtlich der Verteilung des Mangels,<br />
das kann und darf nicht z<strong>um</strong> staatli-<br />
<strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 /<strong>20</strong>03<br />
chen Finanzierungsprinzip verallgemeinert<br />
werden. Der HPR hat dies auch<br />
schon aus Anlass der <strong>Diskussion</strong>en über<br />
das Personalbemessungskonzept mehrfach<br />
kritisch angemerkt.<br />
Aber selbst wenn man der im GEntwurf<br />
vorgezeichneten Linie folgen wollte,<br />
so ist festzustellen, dass sie nicht<br />
wenigstens konsequent durchgehalten<br />
wird. Ist nämlich in § 100 noch von<br />
der Orientierung an „Leistungen und<br />
Belastungen“ die Rede, so ist in § 101<br />
Abs. 1 der Bezug auf die Belastungen<br />
und damit auch noch der letzte Rest<br />
eines Hinweises auf eine evtl. bedarfsorientierte<br />
Finanzierung verschwunden!<br />
5.5. Dass zur Stärkung der Hochschulautonomie<br />
die Haushalte der Hochschulen<br />
aus dem Landeshaushalt herausgenommen<br />
werden sollen, wird<br />
nicht kritisiert. Allerdings ist auch dies<br />
nicht konsequent durchgehalten. So findet<br />
sich in § 101 Abs. 4 die Festlegung,<br />
dass die Hochschulen eine schriftliche<br />
Stellungnahme z<strong>um</strong> Landeshaushalt<br />
abgeben. Was dies bei der Ausgliederung<br />
aus dem Landeshaushalt bedeuten soll,<br />
ist unklar. Unklar ist auch die Regelung<br />
in § 80 Abs. 8, wonach der Haushaltsvoranschlag<br />
der Hochschule zu erläutern<br />
ist. Findet dies im Rahmen der<br />
Aufstellung des Landeshaushalts statt<br />
oder bei welcher anderen Gelegenheit?<br />
5.6. Es bestehen Unklarheiten hinsichtlich<br />
der hochschulrechtlichen Gruppenzugehörigkeiten<br />
und deren Auswirkungen<br />
auf die personalvertretungsrechtlichen<br />
Gruppenzugehörigkeiten,<br />
weil das LPersVG in § 99 Abs. 2<br />
LPersVG auf Regelungen des UG verweist:<br />
In § 32 Abs. 2 Satz 3 UG waren die<br />
Bibliothekare des höheren Dienstes<br />
zwar der Gruppe 3 zugeordnet. Sie<br />
zählten damit aber noch nicht z<strong>um</strong><br />
wissenschaftliche Personal i. S. d. § 43<br />
UG. Personalvertretungsrechtlich waren<br />
sie deshalb je nach Beschäftigungsstatus<br />
der Gruppe der Angestellten bzw.<br />
der Beamtinnen und Beamten zugeordnet.<br />
Im jetzt vorliegenden GEntwurf<br />
sind in § 37 Abs. 2 die Bibliothekare<br />
des höheren Dienstes nicht mehr genannt.<br />
Auch in § 46 werden sie nicht<br />
genannt. Der HPR schließt daraus, dass<br />
diese Beschäftigten in Zukunft nicht<br />
nur personalvertretungsrechtlich sondern<br />
auch hochschulrechtlich der Grup-<br />
pe der nichtwissenschaftlichen Beschäftigten<br />
zuzurechnen sind.<br />
In § 32 Abs. 2 Satz 4 UG wurden<br />
Lehrkräfte für besondere Aufgaben in<br />
der Laufbahn der Lehrer für Fachpraxis<br />
der Gruppe 4 zugeordnet. Diese<br />
besondere Zuordnung ist in § 37 Abs.<br />
2 jetzt entfallen. Es ist unklar, welche<br />
Auswirkungen dies auf die personalvertretungsrechtlicheGruppenzugehörigkeit<br />
hat.<br />
Die Assistentinnen und Assistenten an<br />
Fachhochschulen werden nach § 37<br />
Abs. 2 Nr. 3 jetzt hochschulrechtlich der<br />
Gruppe der wissenschaftlichen Beschäftigten<br />
zugeordnet. Sie werden in § 57<br />
ausdrücklich als wissenschaftliche Beschäftigte<br />
benannt. Über den Verweis<br />
in § 99 Abs. 2 LPersVG führt dies<br />
dazu, dass sie jetzt auch personalvertretungsrechtlich<br />
zur Gruppe der wissenschaftlichen<br />
Beschäftigten gehören.<br />
Der HPR hat schon an anderer Stelle<br />
ausgeführt, dass und war<strong>um</strong> er von<br />
dieser Zuordnung nichts hält, obwohl<br />
dies dem artikulierten Wunsch von Beschäftigten<br />
dieser Gruppe entspricht. Er<br />
sieht nämlich für diese Beschäftigten<br />
primär nur negative Auswirkungen.<br />
Bedenklich und inkonsequent ist<br />
allerdings, dass dieser Beschäftigtengruppe<br />
in § 37 Abs. 2 Satz die eigenständige<br />
Vertretung in Gremien zuerst<br />
einmal verweigert wird. Sie erhalten<br />
damit auf ihr damaliges Begehren hin<br />
jetzt Steine statt Brot, insoweit jetzt die<br />
negativen Auswirkungen, z. B. im personalvertretungsrechtlichen<br />
Bereich,<br />
z<strong>um</strong> Tragen kommen, ohne dass dem<br />
positive Auswirkungen hinsichtlich der<br />
Repräsentanz in den Hochschulgremien<br />
gegenüber stehen.<br />
Der HPR fordert, alle diese Zuordnungen<br />
dahin gehend zu prüfen, ob sie im<br />
Hinblick auf das hochschulrechtliche<br />
Wahlrecht und in der Folge auch für<br />
das personalvertretungsrechtliche Wahlrecht<br />
widerspruchsfrei sind. Ansonsten<br />
sind bei den aufgezeigten Unklarheiten<br />
mit Wahlanfechtungen sowie - bei<br />
deren Erfolg - mit kosten- und arbeitsintensiven<br />
Wiederholungswahlen zu<br />
rechnen.<br />
5.7. In § 64 Abs. 3 ist völlig neu vorgesehen,<br />
dass Lehraufträge an hauptberufliches<br />
akademisches Personal im<br />
Fachgebiet, für das sie berufen oder eingestellt<br />
sind, nicht zulässig sein sollen.<br />
Aus der Begründung ist zu entnehmen,<br />
11
dass hiermit aber wohl nur Vollzeitbeschäftigte<br />
gemeint sind. Deshalb ist auf<br />
eine Klarstellung zu drängen, dass Teilzeitbeschäftigte<br />
von diesem Verbot nicht<br />
erfasst werden.<br />
Offenbar sind damit auch Wissenschaftliche<br />
Mitarbeiter in Drittmittelprojekten,<br />
deren Dienstaufgaben sich<br />
in der Regel ausschließlich auf die Forschung<br />
beziehen, erfasst. Somit könnten<br />
auch an diesen Personenkreis keine<br />
Lehraufgaben übertragen werden, was<br />
sie insbesondere im Hinblick auf die<br />
Gewinnung von Lehrkapazität und<br />
den Nachweis von Lehrerfahrung für<br />
die Bewerbung auf eine Professur oder<br />
eine Juniorprofessur benachteiligen<br />
würde. Deshalb ist auch dieser Personenkreis<br />
aus dem Verbot auszunehmen<br />
5.8. In § 101 Abs. 5 ist vorgesehen,<br />
dass die Hochschulen eigene Betriebe<br />
bilden können. Dies hat zu Unklarheiten<br />
über die damit möglichen<br />
Rechtsformen eigener Betriebe geführt.<br />
Rückfragen in der Rechtsabteilung des<br />
MWWFK erbrachte folgende Antwort:<br />
Die „eigenen Betriebe“ sind angelehnt<br />
an die Organisation eines Landesbetriebes<br />
gem. § 26 LHO; dort sind allerdings<br />
nur Betriebe des Landes geregelt. Mit<br />
den ‚eigenen Betrieben‘ soll auch den<br />
Hochschulen die Möglichkeit gegeben<br />
werden, wirtschaftlich selbstständige<br />
Einheiten mit der Doppik zu führen,<br />
obwohl sie rechtlich zur Hochschule<br />
gehören. Privatrechtlich organisierte<br />
Einheiten werden durch diese Formulierung<br />
nicht ermöglicht.“<br />
Der HPR schlägt deshalb zur Vermeidung<br />
von Missverständnissen vor, in<br />
§101 Abs. 5 hinter den Worten „eigene<br />
Betriebe“ einen Hinweis auf § 26 LHO<br />
einzufügen.<br />
5.9. Soweit Punkte aus der o. g. Stellungnahme<br />
des HPR aus dem Jahr<br />
1995 damals keine Berücksichtigung<br />
Schwerpunkt Hochschulen<br />
fanden, nimmt der HPR sie jetzt wieder<br />
auf. Zur Vermeidung von Wiederholungen<br />
wird insoweit auf die beigefügte<br />
Anlage verwiesen.<br />
Dem HPR liegen zwei Stellungnahmen<br />
örtlicher Personalräte vor, die er wegen<br />
der Kürze der zur Verfügung stehenden<br />
Zeit nicht mehr in seine Stellungnahme<br />
einarbeiten konnte. Er gibt daher<br />
diese Stellungnahmen als Anlage weiter,<br />
ohne sie damit zugleich zu seiner<br />
Auffassung zu machen. Der HPR behält<br />
sich jedoch vor, nach Prüfung dieser<br />
Vorschläge sowie nach Prüfung hier<br />
noch nicht abschließend diskutierter<br />
Punkte noch eine ergänzende Stellungnahme<br />
nachzureichen.<br />
Hauptpersonalrat<br />
für den Geschäftsbereich des Ministeri<strong>um</strong>s<br />
für Wissenschaft, Weiterbildung,<br />
Forschung und Kultur Rheinland-Pfalz<br />
12 <strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 /<strong>20</strong>03
„Altern hat Zukunft“<br />
Paul B. Baltes, Direktor am Max-<br />
Planck-Institut für Bildungsforschung<br />
in Berlin, ist einer der weltweit<br />
führenden Köpfe auf dem Gebiet<br />
der Altersforschung. Sein Beitrag<br />
z<strong>um</strong> Thema „Altern hat Zukunft“<br />
wurde von der Wochenzeitschrift<br />
„Die Zeit“ der Redaktion von „Aktiver<br />
Ruhestand“ in der <strong>GEW</strong>-Baden-Württemberg<br />
zur Verfügung<br />
gestellt. Einige seiner Thesen möchte<br />
ich auch unseren Mitgliedern in<br />
Rheinland-Pfalz vorstellen.<br />
Paul B. Baltes beschäftigt sich als Psychologe<br />
und Gerontologe mit der<br />
Zukunft des Alterns und des Alters,<br />
wobei er hervorhebt, dass alle<br />
menschlichen Lebensjahre ihre jeweiligen<br />
Stärken und Schwächen haben.<br />
Man dürfe deshalb das Altern nicht<br />
nur als ökonomische Belastung, sondern<br />
auch als Chance für Fortschritt<br />
und Innovation betrachten.<br />
Was jedoch die Statistik der Altersverteilung<br />
angehe, so ergebe sich eine<br />
dramatische Unterrepräsentation der<br />
Die <strong>GEW</strong> gratuliert<br />
im März <strong>20</strong>03<br />
z<strong>um</strong> 70. Geburtstag<br />
Herrn Karl Heinz Hoch<br />
05.03.1933<br />
Im Kirschgarten 21 · 55<strong>28</strong>6 Wörrstadt<br />
z<strong>um</strong> 75. Geburtstag<br />
Herrn Edmund Theiß<br />
08.03.19<strong>28</strong><br />
Langenhahner Str. 7 · 56457 Westerburg<br />
Herrn Walter Gundacker<br />
24.03.19<strong>28</strong><br />
Waldstr. 17 · 66999 Hinterweidenthal<br />
Herrn Fritz Seibel<br />
25.03.19<strong>28</strong><br />
Erlenbrunner Str. 186 · 66955 Pirmasens<br />
Herrn Helmut Ruf<br />
30.03.19<strong>28</strong><br />
Am Fichtenhain 12 · 66482 Zweibrücken<br />
<strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 /<strong>20</strong>03<br />
älteren Bevölkerung in den Parlamenten.<br />
So seien nur 1,6% der Abgeordneten<br />
im Bundestag älter als 65<br />
und gar nur 0,4% (1 Person) z<strong>um</strong><br />
Zeitpunkt der Erfassung älter als 70<br />
Jahre alt. Baltes stellte fest, dass der<br />
Lebensverlauf unserer Fähigkeiten<br />
von der Kindheit bis ins hohe Alter<br />
nicht durch eine einzige Kurve abgebildet<br />
werden könne. Das Zusammenspiel<br />
von Biologie, Körper, Kultur<br />
und Geist sei vielmehr sehr komplex.<br />
Die verschiedenen Lebensalter<br />
bildeten jeweils unterschiedliche<br />
Qualitäten aus. Es gebe Leistungsund<br />
Wissensbereiche, in denen ältere<br />
Erwachsene zu den Besten zählten.<br />
Wo Lebenserfahrung und Geisteskraft<br />
gefordert seien, könnten vor<br />
allem ältere Menschen glänzen.<br />
Nicht zuletzt im Alltagsleben werde<br />
deutlich, wie wichtig es sei, die Kompetenz<br />
aller Altersgruppen zu nutzen.<br />
Vor allem in Fragen der „emotionalen<br />
Intelligenz“ nehme die Leistungsfähigkeit<br />
im Durchschnitt mit wachsendem<br />
Alter zu.<br />
Während in den ersten vier Wahlperioden<br />
seit Beginn der Bundesrepu-<br />
z<strong>um</strong> 80. Geburtstag<br />
Frau Ruth Price Kemna<br />
12.03.1923<br />
Schillerstr. 9 · 67655 Kaiserslautern<br />
Herrn Matthias Ksellmann<br />
25.03.1923<br />
Flurstr. 1 · 55758 Niederwörresbach<br />
z<strong>um</strong> 87. Geburtstag<br />
Herrn Karl Theodor Lucae<br />
30.03.1916<br />
Wingertstr. 19 · 67292 Kirchheimbolanden<br />
z<strong>um</strong> 91. Geburtstag<br />
Herrn Alfred Kall<br />
29.03.1912<br />
Heimatpfad 3 · 66953 Pirmasens<br />
z<strong>um</strong> 92. Geburtstag<br />
Frau Anna Sittel<br />
16.03.1911<br />
Eichwaldweg 2 · 66482 Zweibrücken<br />
Alter + Ruhestand<br />
blik Deutschland der Anteil der über<br />
60jährigen noch bis 25% betrug,<br />
habe sich diese Gruppe im Parlament<br />
auf 10% und weniger reduziert. Dies<br />
sei gerade mal ein Drittel des prozentualen<br />
Anteils der über Sechzigjährigen.<br />
Die über Siebzigjährigen,<br />
sie bilden mehr als zehn Millionen<br />
der Wahlbevölkerung, würden von<br />
einer einzigen Person dieser Altersgruppe<br />
vertreten. In den meisten anderen<br />
Ländern gebe es eine stärkere<br />
Beteiligung der Alten in den Parlamenten<br />
als bei uns, wo der „Jugendwahn“<br />
regiere und die Älteren oft als<br />
„Ausschuss“ gesehen würden.<br />
In der gemeinsamen Anstrengung<br />
aller Lebensalter und Generationen,<br />
so Paul B. Baltes, liege die Quelle<br />
<strong>um</strong>fassender politischer Vernunft,<br />
die auf Weitblick und Rücksicht<br />
gründe. Gerade in einer Zeit, da<br />
immer mehr Leute immer älter würden,<br />
sei es notwendig, die besonderen<br />
Fähigkeiten aller Lebensalter in<br />
die Politikentscheidungen einzubringen.<br />
Edmund Theiß<br />
Der Landesvorstand<br />
29
<strong>GEW</strong>-Fortbildung<br />
Den Zeitdieben auf der Spur<br />
Ihre Eindrücke vom Ende Oktober vergangenen Jahres durchgeführten <strong>GEW</strong>-<br />
Fortbildungsseminar „Selbst- und Zeitmanagement“, das speziell für junge<br />
<strong>GEW</strong>-KollegInnen angeboten wurde und gut besucht war, schildert im Folgenden<br />
die Teilnehmerin Rebekka Bartsch.<br />
Am ersten Tag lernten sich die SeminarteilnehmerInnen<br />
durch ein<br />
„erdkundliches“ Spiel näher kennen.<br />
Eine buntgemischte Truppe. Danach<br />
stellten wir bildlich dar, wie wir uns<br />
selbst in unserer selbst-gemanagten<br />
Zeit sehen. Die Bilder machten uns<br />
bewusst, welche zentralen Punkte<br />
anzugehen waren und wo unsere<br />
Schwachpunkte lagen. Im Plen<strong>um</strong><br />
tauschten wir uns aus.<br />
Jetzt wurde Runde 2 begonnen. Unsere<br />
persönlichen Arbeitsgewohnheiten<br />
und Ziele wurden analysiert.<br />
Welche typischen Fehler macht man<br />
- davon recht viele, wie man feststellen<br />
konnte. Auch in der Zielformulierung<br />
war man oft zu ungenau. Wir<br />
lernten einige Methoden kennen, die<br />
uns den Alltag erleichterten: z.B. die<br />
Tagesplanung. Wie setzt man Prioritäten?<br />
Was ist wirklich wichtig?<br />
Ganz zentrale Fragen, die jeden be-<br />
treffen. Ein Film informierte über<br />
die „Zeitproblematik“ früher - heute,<br />
Kombination Geld und Zeit,<br />
Zeitnotstand - Güterwohlstand, Zeit<br />
erleben Rituale und Strategien. Der<br />
Film löste einige kontroverse Gespräche<br />
aus, die wieder<strong>um</strong> zur Aufgabenund<br />
Prioritätenanalyse genutzt wurden.<br />
In kleinen Gruppen setzten wir<br />
uns zusammen, <strong>um</strong> ein Konzept für<br />
ein ausgewähltes Gruppenmitglied<br />
zu entwerfen. In unserer Gruppe erarbeiteten<br />
wir einen strukturierten<br />
Arbeitsplan. Dies schuf die Möglichkeit,<br />
Gelerntes und Neues an einem<br />
konkreten Beispiel <strong>um</strong>zusetzen.<br />
Am zweiten Tag wurden zunächst die<br />
Ergebnisse des Vortages im Plen<strong>um</strong><br />
besprochen. Neue Themen wie z.B.<br />
die Zeitdiebe, Gesprächsvorbereitungen,<br />
Gesprächsführung waren nur<br />
einige Punkte. Uns wurde bewusst<br />
gemacht, wie man mehr steuern<br />
kann und dass man auch delegieren<br />
muss, <strong>um</strong> Zeit zu haben. Einige Strategien<br />
aus unserem Alltag brachten<br />
wir ins Plen<strong>um</strong> ein und diskutierten<br />
sie: Umgang mit dem AB, Fax oder<br />
e-mail. Vor- und Nachteile und optimale<br />
Nutzung dieser Geräte für<br />
uns.<br />
Anschließend setzten wir uns mit<br />
dem Thema Stress auseinander. Wie<br />
manage ich Belastungen? Welcher<br />
Stress ist schlecht und hemmt mich?<br />
Wie kann ich dem Stress „ein<br />
Schnippchen schlagen“?<br />
Nach diesem Themenblock sollten<br />
wir für uns selbst Pläne entwerfen,<br />
wie wir uns in Zukunft managen<br />
wollen und welche Fehler wir in<br />
Angriff nehmen. Dies wurde im Plen<strong>um</strong><br />
erörtert. In einem abschließenden<br />
Gespräch konnten wir endlich<br />
unser Lob und unseren Dank an die<br />
Referentin, Ute Sprekelmayer, die<br />
das Seminar so super professionell<br />
gestaltet hat, loswerden. Ein dickes<br />
Lob auch an die <strong>GEW</strong>, die dieses<br />
Seminar angeboten hat, und wir hoffen<br />
auch auf zukünftige Seminare.<br />
Ein dickes Lob ging auch an die<br />
Gruppe, in der auf jeden zugegangen<br />
ist.<br />
Umfangreiches Repertoire der Konfliktbewältigung<br />
„Wie gehen wir mit einer intriganten<br />
Sekretärin <strong>um</strong>? Einer Frau, die<br />
es versteht, Kollegen und Kolleginnen<br />
gegeneinander auszuspielen und<br />
dabei ihre Machtposition zu genießen?“<br />
In dem zweitägigen Seminar<br />
der <strong>GEW</strong> in der Evangelischen Bil-<br />
Attraktive <strong>GEW</strong>-Seminare<br />
Interessierten KollegInnen aus<br />
allen Bildungsbereichen bietet<br />
die <strong>GEW</strong> im März zwei weitere<br />
Seminare auf der Ebernburg<br />
in Bad Münster am<br />
Stein an. Vom 10.-11. März<br />
geht es mit Uwe Becker als Referenten<br />
<strong>um</strong> das Thema „Konfliktmanagement“,<br />
vom 13-<br />
14. März <strong>um</strong> „Stressbewälti-<br />
dungsstätte auf der Ebernburg in Bad<br />
Münster am Stein war dies nur ein<br />
Problem am Rande, für den ein oder<br />
anderen bedrückend, aber dennoch<br />
weniger bedeutungsvoll als der<br />
oftmals schwierige Umgang mit<br />
SchülerInnen, Eltern und KollegIn-<br />
gung“. Referieren wird hier die Dipl.-<br />
Psychologin und Psychotherapeutin<br />
Anni Braun. Beide Fortbildungsveranstaltungen<br />
stehen unter der bewährten<br />
Leitung von Mehmet Kilic. Schriftliche<br />
Anmeldungen an:<br />
<strong>GEW</strong> RLP, Neubrunnenstr. 8, 55116<br />
Mainz, Fax: 06131/<strong>28</strong>98880,<br />
Monika.Rockert@<strong>GEW</strong>-Rheinland-<br />
Pfalz.de.<br />
nen. Den SeminarteilnehmerInnen<br />
wurde ein <strong>um</strong>fangreiches Repertoire<br />
der Konfliktbewältigung angeboten,<br />
das dazu helfen soll, den beruflichen<br />
Alltag rationaler und emotional weniger<br />
belastet zu bewältigen. Der<br />
Moderator Uwe-Klaus Becker führte<br />
den TeilnehmerInnen noch einmal<br />
die Binsenweisheit vor Augen, dass<br />
es KollegInnen gibt, mit denen man<br />
gut auskommt, aber auch andere, die<br />
schwierig sind. Becker demonstrierte<br />
mit einem Instr<strong>um</strong>entari<strong>um</strong> an<br />
Verhaltensregeln, wie man die un<strong>um</strong>gängliche<br />
Zusammenarbeit mit<br />
kritischen Partnern aus dem Berufsleben<br />
weitgehend emotionsfrei zu<br />
gestalten vermag.<br />
Zentrales Thema waren die Tipps zur<br />
verbalen Konfliktlösung. Becker<br />
nannte dabei fünf Phasen eines Gesprächs:<br />
30 <strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 /<strong>20</strong>03
1. Kontaktaufnahme - Hier geht es<br />
zunächst dar<strong>um</strong>, für ein offenes<br />
freundliches Gesprächsklima zu sorgen.<br />
2. Informationsphase oder Kontraktphase.<br />
In dieser Phase wird ein gemeinsamer<br />
Plan für das Gespräch<br />
vereinbart. Die Themen des Gesprächs<br />
und der Zeitrahmen werden<br />
festgelegt, die Vorgehensweise wird<br />
abgestimmt. Letztlich muss hier in<br />
allen Punkten ein Konsens gefunden<br />
werden.<br />
3. In der Arg<strong>um</strong>entationsphase werden<br />
Ideen entwickelt, es werden Arg<strong>um</strong>ente<br />
und Vorschläge angeführt,<br />
es kann aber in dieser Phase durchaus<br />
ein Dissens offenkundig werden.<br />
Wichtig ist es, vorher schon die eigenen<br />
Ziele für sich zu präzisieren.<br />
4. In dem Augenblick, wo es zur<br />
Beschlussphase kommt, werden die<br />
Entscheidungen formuliert. Es<br />
kommt z<strong>um</strong> Konsens, Auftrag und<br />
Zeitrahmen werden festgelegt.<br />
5. Die Abschlussphase ist das formale<br />
Ende des gesamten Prozesses.<br />
Wichtig ist dabei, in einer entspannten<br />
Atmosphäre sich gegenseitig<br />
<strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 /<strong>20</strong>03<br />
Dank und Wertschätzung zukommen<br />
zu lassen.<br />
Durch eine Vielfalt der Methoden,<br />
durch Rollenspiele, Besprechungen<br />
und Analysen von Fallbeispielen oder<br />
in Gruppenarbeit wurden die unterschiedlichsten<br />
Problemstellungen<br />
bewältigt. Ganz besonders tiefgehend<br />
das Fallbeispiel, wo eine Gruppe<br />
von LehrerInnen als (fiktives) Beraterteam<br />
einer Rettungsmannschaft<br />
Anweisungen geben sollte, wer der<br />
Reihenfolge nach aus einer Gruppe<br />
von sechs Personen aus einem von<br />
Hochwasser bedrohten Höhlensystem<br />
gerettet werden sollte. Es war die<br />
Entscheidung zu treffen, Menschen<br />
ihrer Wertigkeit nach einzuordnen.<br />
Dies ging den Beteiligten unter die<br />
Haut, wenn es auch keine authentische<br />
Situation war. Der eine oder andere<br />
verweigerte sich, andere waren<br />
bereit, Prioritäten zu setzen. Niemand<br />
fühlte sich dabei wohl.<br />
Ach ja, und die eingangs erwähnte<br />
Sekretärin wird und darf weiterhin<br />
versuchen zu intrigieren, aber die<br />
KollegInnen, die das <strong>GEW</strong>-Seminar<br />
besucht hatten, werden zukünftig<br />
Freie Montessori-Schule Landau/Pfalz (derzeit vier Klassen) sucht<br />
z<strong>um</strong> Schuljahr <strong>20</strong>03/<strong>20</strong>04 Lehrkräfte für die Primar- und Sekundarstufe<br />
1 (alle Lehrämter).<br />
Erwartet werden Teamfähigkeit, die Bereitschaft zur Mitarbeit in<br />
einer vorbereitenden Planungsgruppe und ggf z<strong>um</strong> Erwerb des<br />
Montessori-Diploms.<br />
Bieten können wir eine am öffentlichen Dienst orientierte Bezahlung.<br />
Bewerbungen erbeten an:<br />
Gernot Zeitlinger-Brückmann, Annweilerstraße 7, 76829 Landau oder<br />
mail: zeitlinger@ifb.bildung-rp.de<br />
<strong>GEW</strong>-Fortbildung<br />
gelassener, mit größerer Distanz und<br />
mit erweiterter Professionalität dieser<br />
sowie anderen Herausforderungen<br />
begegnen und mit den betroffenen<br />
Funktionsträgern in aller Kühle<br />
das Einmaleins des Konfliktmanagements<br />
durchspielen. Dieses Konfliktmanagement<br />
bildet das Raster, das<br />
dazu führt, Abmachungen mit<br />
schwierigen Menschen im beruflichen<br />
Umfeld zu treffen, seien es<br />
SchülerInnen, Eltern oder LehrerInnen,<br />
ggf. auch Angehörige der Schulleitung<br />
und der Schulaufsicht, der<br />
ADD.<br />
Kurt Ludwig,<br />
BBS Südliche Weinstraße/Standort<br />
Edenkoben<br />
31
Rechtsschutz<br />
Eine unliebsame Weihnachtsüberraschung<br />
Pünktlich am Heiligen Abend erreichte die rheinland-pfälzischen Pensionärinnen<br />
und Pensionäre ein Merkblatt der Oberfinanzdirektion über eine unerfreuliche<br />
Änderung der Beihilfeverordnung.<br />
Absicht oder Gedankenlosigkeit:<br />
Jedenfalls war bei der OFD für einige<br />
Tage keiner zu erreichen, der Erläuterungen<br />
oder Erklärungen geben<br />
konnte. Die Mitarbeiterinnen und<br />
Mitarbeiter der OFD hätten<br />
sicherlich den Ärger und die Besorgnis<br />
der Kolleginnen und Kollegen zu<br />
hören bekommen.<br />
Was war geschehen: Im Rahmen seiner<br />
- wie es die Rheinpfalz nannte -<br />
Giftliste hatte das rheinland-pfälzische<br />
Kabinett beschlossen, die Beihilfefähigkeit<br />
für Wahlleistungen<br />
und Chefarztbehandlungen abzuschaffen<br />
und eine Kostendämpfungspauschale<br />
einzuführen.<br />
Um weiterhin Anspruch auf Beihilfen<br />
für die Aufwendungen für Wahlleistungen<br />
zu erhalten, wurde eine<br />
„Versicherung“ mit einem Monatsbeitrag<br />
von 13. 00 € für den Beihilfeberechtigten<br />
und seine Angehörigen<br />
angeboten. Dieses Angebot ist<br />
inakzeptabel, ist jedoch eine Besserstellung<br />
der rheinland-pfälzischen<br />
Beihilfeberechtigten gegenüber den<br />
Beihilfeberechtigen anderer Bundesländer<br />
darstellt.<br />
Was können wir unseren Mitglieder<br />
raten? Wenn sie weiterhin Chefarztbehandlungen<br />
und Wahlleistungen<br />
im Krankenhaus in Anspruch nehmen<br />
wollen, - empfehlen wir die<br />
notwendige Erklärung bis 31. März<br />
<strong>20</strong>03 abzugeben, damit die Beihilfefähigkeit<br />
der Wahlleistungen bzw.<br />
der Chefarztbehandlung erhalten<br />
bleibt. Nach unseren Information<br />
kann die Private Krankenkasse kein<br />
günstigeres Angebot machen. Zusätzlich<br />
raten wir Ihnen, die Erklärung<br />
mit einem Zusatz zu versehen:<br />
Diese Erklärung erfolgt vorbehaltlich<br />
der gerichtlichen Klärung der Rechtmäßigkeit<br />
der Zahlung z<strong>um</strong> Erhalt<br />
der Beihilfefähigkeit der Wahlleistungen.<br />
Es ist aber auf jeden Fall zu<br />
beachten, dass ein einmal ausgesprochener<br />
Verzicht auf die Wahlleistungen<br />
in der Regel dazu führt, dass auf<br />
Dauer keine Beihilfe zu Wahlleistungen<br />
gezahlt wird. Nur bei der Einstellung,<br />
der Übernahme vom Beamtenverhältnis<br />
auf Widerruf in ein<br />
Beamtenverhältnis auf Probe und bei<br />
der Umwandlung des Beamtenverhältnis<br />
auf Probe in ein Beamtenverhältnis<br />
auf Lebenszeit, besteht eine<br />
zusätzliche Wahlmöglichkeit. Auch<br />
bei der Rückkehr aus einer Beurlaubung<br />
oder beim Eintritt in den Ruhestand<br />
besteht die Wahlmöglichkeit<br />
nicht.<br />
Was meines Erachtens aber noch<br />
schwerer wiegt ist die Kostendämpfungspauschale,<br />
die für alle Beihilfeberechtigten<br />
zu einer finanziellen<br />
Belastung führt, die zusammen mit<br />
den z<strong>um</strong> 01.01.<strong>20</strong>03 bei vielen Privatkrankenkasse<br />
in Kraft tretenden<br />
Erhöhungen leicht 2 % des Einkommens<br />
ausmacht.<br />
Diese Kostendämpfungspauschale ist<br />
nach Besoldungsgruppen gestaffelt,<br />
wobei man nicht auf die Laufbahnen<br />
(mittlerer, gehobener, höherer<br />
Dienst) - wie z.B. Berlin abstellt.<br />
Vielmehr beträgt die Kostendämpfungspauschale<br />
- leider werden nur<br />
die Kosten des Arbeitgebers gedämpft<br />
- 150,00 € für Beamtinnen<br />
und Beamte in A 9 bis A 11, 300,00<br />
€ für die Gruppen A 12 bis A 15,<br />
für die Gruppen A 16 bis B 3 sind es<br />
450,00 € je Jahr.<br />
Die Pauschale vermindert sich bei<br />
Teilzeitbeschäftigten entsprechend<br />
der Arbeitszeit, bei Beihilfeberechtigten<br />
mit berücksichtigungsfähigen<br />
Kinder <strong>um</strong> je 40,00 € je Kind. Sie<br />
entfällt bei Empfängern von Anwärterbezügen,<br />
Witwen und Witwern<br />
im Jahr des Todesfalles des Partners,<br />
bei Waisen und bei Mitgliedern der<br />
gesetzlichen Krankenversicherung.<br />
In dem Merkblatt wird dargelegt,<br />
dass die Kostendämpfungspauschale<br />
die bisherige Zuzahlung zu den<br />
Arzneimittelkosten ersetzt. Bei dieser<br />
Zuzahlung handelt es sich jedoch<br />
nicht <strong>um</strong> eine Kürzung der Beihilfe-<br />
erstattungsbetrages sondern <strong>um</strong> einen<br />
Betrag, der nicht beihilfefähig<br />
war. Zur Erläuterung: Ein einzelner<br />
Beihilfeberechtigter erhält für ein<br />
Arzneimittelkosten bis 61,36 € keine<br />
Beihilfe, bei 50% Beihilfe wird<br />
der Beihilfebetrag so <strong>um</strong> 30,78 €<br />
gekürzt, jetzt werden jedoch 300,00<br />
€ von der auszuzahlenden Beihilfe<br />
abgezogen. Bei einem/einer Beihilfeberechtigten<br />
mit zwei Kindern<br />
wurde bisher die Beihilfe <strong>um</strong> 18,41<br />
€ gekürzt, jetzt verliert er/sie 2<strong>20</strong>,00<br />
€ (bei den Besoldungsgruppen A 12<br />
bis A 15).<br />
Für unsere Kolleginnen und Kollegen<br />
im Ruhestand ergibt sich folgendes:<br />
Die Kostendämpfungspauschale<br />
richtet sich nach dem Ruhegehaltssatz<br />
und beträgt höchstens 70%.<br />
Dies bedeutet: Pensionärinnen und<br />
Pensionären der Besoldungsgruppe A<br />
12, deren Pension 60% beträgt,<br />
werden 180,00 € der Beihilfe einmalig<br />
im Jahr als Kostendämpfungspauschale<br />
einbehalten. Abgesehen<br />
davon, dass die privaten Krankenkassen<br />
sich - nach unbestätigten Meldungen<br />
- verpflichtet haben, diese<br />
Kostendämpfungspauschale nicht zu<br />
versichern, würde eine Versicherung<br />
auch wenig Sinn machen: Die Krankenkassen<br />
müssen Kosten deckend<br />
arbeiten und müssten bei den meisten<br />
Versicherten die Pauschale als<br />
Versicherungsleistung zahlen. Deshalb<br />
wäre die Höhe der Pauschale bei<br />
der Beitragskalkulation zu berücksichtigen.<br />
Es würde höchstenfalls die<br />
Gesamts<strong>um</strong>me der Pauschale auf alle<br />
Personen gleichmäßig verteilt, die<br />
eine entsprechende Versicherung<br />
abschließen.<br />
Was hat die <strong>GEW</strong>, hat der DGB als<br />
Spitzenorganisation zu dieser Sache<br />
gesagt: Bei der kurzfristig einberufenen<br />
Anhörung (Einladungsfrist drei<br />
Arbeitstage) wiesen die Vertreter von<br />
<strong>GEW</strong> und DGB nachdrücklich darauf<br />
hin, dass dieses Verfahren nicht<br />
als Beteiligungsverfahren akzeptiert<br />
werden kann und dass Zweifel an der<br />
Rechtmäßigkeit der Kostendämpfungspauschale<br />
bestehen. Dies wird<br />
auch daran deutlich, dass das VG<br />
Gelsenkirchen einen entsprechen-<br />
32 <strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 /<strong>20</strong>03
den Vorlagebeschluss zur Entscheidung<br />
an das Bundesverfassungsgericht<br />
gegeben hat (Az. 2BvL 11/02).<br />
Was raten wir nun unseren Mitgliedern?<br />
Die Landesrechtsschutzstelle<br />
(<strong>GEW</strong>-Landesrechtsschutzstelle,<br />
Neubrunnenstraße 8. 55116 Mainz)<br />
<strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 /<strong>20</strong>03<br />
ist gerne bereit<br />
den MitgliedernindividuellEmpfehlungen<br />
für das<br />
weitere Vorgehen<br />
zu geben:<br />
Sobald Ihnen<br />
ein Beihilfebescheid<br />
vorliegt,<br />
bei dem eine<br />
Kürzung des<br />
Beihilfebetrages<br />
durch die<br />
Kostendämpfungspauschale<br />
vorgenommen<br />
wurde, können Sie eine Kopie des<br />
Bescheids an die Landesrechtsschutzstelle<br />
schicken. Sie erhalten dann<br />
<strong>um</strong>gehend eine Empfehlung, ob Sie<br />
sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt<br />
Widerspruch gegen den Bescheid<br />
einlegen sollen. Wenn - wie<br />
Jubilä<strong>um</strong>szuwendung wird gestrichen<br />
Gleich nach Weihachten erreichte<br />
uns nun die zweite Grausamkeit der<br />
Giftliste. Die finanzielle Zuwendung,<br />
die beim 25-, 40- und 50-jährigen<br />
Jubilä<strong>um</strong> gezahlt wurden, sollen<br />
ab 1. März <strong>20</strong>03 wegfallen.<br />
Bisher betrug die Jubilä<strong>um</strong>szuwendung<br />
• bei einer Dienstzeit von 25 Jahren<br />
306,78 EUR,<br />
• bei einer Dienstzeit von 40 Jahren<br />
409,03 EUR und<br />
• bei einer Dienstzeit von 50 Jahren<br />
511,29 EUR.<br />
Neben der Jubilä<strong>um</strong>surkunde soll es<br />
ein Sachgeschenk geben, das jedoch<br />
aus steuerrechtlichen Gründen den<br />
Wert von 40.- EUR nicht übersteigen<br />
darf.<br />
Reisekosten: Einsatz hat sich gelohnt<br />
Im September <strong>20</strong>01 fuhr eine Klassenleiterin<br />
mit ihrer Abschlussklasse,<br />
unterstützt durch eine weitere<br />
Lehrkraft, mit der Deutschen Bahn<br />
für fünf Tage nach Dresden, <strong>um</strong> dort<br />
einen Schullandheimaufenthalt<br />
durchzuführen. Auch die dortigen<br />
Museen sowie die Festung Königsstein<br />
standen auf dem zusammen mit<br />
den Schülerinnen und Schülern ausgearbeiteten<br />
Programm.<br />
Nach der Rückkehr beantragten die<br />
beiden Lehrkräfte auf dem Dienstweg<br />
bei der ADD die Zahlung der<br />
nachgewiesenen, dienstlich veranlassten<br />
und detailliert nachgewiesenen<br />
Kosten in Höhe von 345,50 DM<br />
bzw. 332,00 DM.<br />
Nach knapp drei Monaten wurden<br />
von der Reisekostenstelle der ADD<br />
beiden jeweils 126,40 DM überwiesen.<br />
In dem Bescheid war auch nicht<br />
dargelegt, wie sich der Betrag jeweils<br />
zusammensetzt. Dagegen wandten<br />
sich die beiden Kollegen per Widerspruch.<br />
Nach rund drei Wochen<br />
wurden jeweils weitere 70 DM überwiesen.<br />
Die Kollegen hielten auch<br />
danach ihren Widerspruch aufrecht,<br />
da ihrer Meinung nicht sein kann,<br />
dass die jeweils genehmigten Dienstreisen<br />
zu einem großen Teil privat<br />
finanziert werden sollen.<br />
Der Widerspruchsbescheid der ADD<br />
Rechtsschutz<br />
bisher üblich - der Beihilfebescheid<br />
keine Rechtsbelehrung enthält, beträgt<br />
die Widerspruchsfrist ein Jahr,<br />
weshalb dann eine sofortige Reaktion<br />
nicht erforderlich ist. Vielmehr<br />
kann die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes<br />
abgewartet werden.<br />
Bei Redaktionsschluss dieser<br />
Zeitung war noch nicht bekannt, ob<br />
das Land - analog z<strong>um</strong> Vorgehen des<br />
Landes Nordrhein-Westfalen in die<br />
Beihilfebescheid einen Hinweis aufnimmt,<br />
dass die Bescheide vorläufig<br />
sind, soweit sie die Kostendämpfungspauschale<br />
betreffen.<br />
Natürlich können Sie auch sofort<br />
Widerspruch einlegen und ihre Bereitschaft<br />
erklären, dass den Widerspruch<br />
bis zur Entscheidung des<br />
Bundesverfassungsgerichtes ruhen<br />
lassen, sofern das Land dazu bereit<br />
ist.<br />
Klaus Bundrück<br />
So müssen die Kolleginnen und Kollegen<br />
mit langer Dienstzeit zur Sanierung<br />
des Haushalts beitragen.<br />
Nun ja, vielleicht ist es „tröstlich“,<br />
dass ein Großteil der jetzigen Lehrkräfte<br />
eine Dienstzeit von 40 Jahren<br />
nicht erreichen wird...<br />
kb<br />
von Anfang Februar <strong>20</strong>02 wies das<br />
Ansinnen der Kollegen zurück, so<br />
dass beide fristgerecht nach der Zusage<br />
des Rechtsschutzes durch die<br />
<strong>GEW</strong>-Landesrechtsschutzstelle Klage<br />
beim Verwaltungsgericht einlegten.<br />
Nach der Erhebung der beiden Klagen<br />
im März <strong>20</strong>02, die das Gericht<br />
zusammenfasste und parallel bearbeitete,<br />
wurden im August jeweils weitere<br />
15 DM z<strong>um</strong> Ausgleich der sogenannten<br />
Nebenkosten überwiesen,<br />
und in der mündlichen Verhandlung<br />
Anfang Dezember erklärte sich die<br />
ADD bereit, jeweils weitere 27,50<br />
DM zur Abdeckung der entstande-<br />
33
Rechtsschutz<br />
nen Kosten für die Bahnfahrt zu zahlen.<br />
Im anschließenden Urteil des<br />
Verwaltungsgerichtes wurde für<br />
Recht erkannt, dass dem einen Kollegen<br />
noch weitere 21 DM, dem anderen<br />
Kollegen noch 12,50 DM<br />
durch die ADD zu zahlen sind.<br />
Im Ergebnis kann festgehalten werden,<br />
dass den beiden Kollegen jeweils<br />
die Bahnfahrtkosten in voller Höhe<br />
und auch die Kosten durch die Nutzung<br />
des ÖPNV in Dresden erstattet<br />
wurden. Die Kosten für die Eintritte<br />
in die Museen, den dortigen<br />
außerschulischen Lernorten, sind<br />
ebenfalls in voller Höhe zu erstatten.<br />
Die Klasse hatte bei der Anreise ihr<br />
gesamtes Gepäck mittels Gepäckser-<br />
vice vom Bahnhof z<strong>um</strong> Jugendgästehaus<br />
bringen lassen und bei der<br />
Abreise auch wieder zurück z<strong>um</strong><br />
Bahnhof. Die auf die Lehrkräfte anteilig<br />
entfallenen Kosten von jeweils<br />
insgesamt 8 DM müssen - so das<br />
Gericht - nicht von der ADD übernommen<br />
werden. Es kann zugemutet<br />
werden, so das Gericht, dass die<br />
Lehrkräfte ihr Gepäck selbst z<strong>um</strong><br />
Unterkunftsort und zurück tragen.<br />
Die Höhe des verminderten Tagegeldes<br />
gemäß der einschlägigen Verwaltungsvorschrift<br />
von 1991 akzeptierte<br />
das Gericht und sah keine direkte<br />
Notwendigkeit, die VV im Lichte des<br />
neuen Landesreisekostengesetzes neu<br />
zu fassen. Auch hat das Gericht der<br />
ADD nicht auferlegt zu prüfen, ob<br />
von der Festlegung, dass in Ausnahmefällen<br />
eine erhöhte Aufwandsvergütung<br />
gezahlt werden kann, Gebrauch<br />
zu machen ist.<br />
Die <strong>GEW</strong>-Landesrechtsstelle empfiehlt<br />
jeder Kollegin und jedem Kollegen,<br />
dass dann, wenn die durch<br />
eine Schulfahrt nachgewiesenen<br />
Kosten deutlich über dem Geldbetrag<br />
liegen, den die ADD Reisekostenstelle<br />
erstattet hat, sich direkt an<br />
sie zu wenden und sich beraten zu<br />
lassen. Der gewerkschaftliche<br />
Rechtsschutz lohnt sich!<br />
d.r.<br />
Zahlreiche Änderungen im Landesbeamtengesetz<br />
Mit Dat<strong>um</strong> 27.06.<strong>20</strong>02 wurde eine<br />
größere Anzahl dienstrechtlicher<br />
Vorschriften im rheinland-pfälzischen<br />
Landesbeamtengesetz (LBG)<br />
geändert. Die wesentlichen Änderungen<br />
sollen hier kurz dargestellt<br />
werden:<br />
1. In § 12 wird für die Mitglieder<br />
des Landesrechnungshofes die Möglichkeit<br />
eröffnet, befördert zu werden<br />
vor Ablauf einer Erprobungszeit<br />
von mindestens sechs Monaten. Für<br />
die übrigen Beamten bleibt es bei der<br />
Erprobungszeit von mindestens<br />
sechs Monaten.<br />
2. In § 18 Absatz 2 wird eine gesonderte<br />
Ermächtigungsgrundlage z<strong>um</strong><br />
Erlass von Prüfungsordnungen für<br />
Beamte besonderer Fachrichtungen<br />
eingeführt. Dies ist für den Schulbereich<br />
von besonderer Bedeutung,<br />
speziell für Lehrkräfte an berufsbildenden<br />
Schulen, <strong>um</strong> Bedarfsfächer<br />
leichter abdecken zu können.<br />
3. In § 26 ist festgelegt, dass in Laufbahnvorschriften<br />
berufliche Tätigkeiten,<br />
die vor dem Eintritt in das<br />
Beamtenverhältnis ausgeübt wurden,<br />
auf den Vorbereitungsdienst<br />
angerechnet werden können.<br />
4. In § 27 ist die bisherige Regelung<br />
aufgehoben worden, nach der ein<br />
Nachweis über eine ggf. erforderliche<br />
technische oder ähnliche Vorbildung<br />
gefordert wurde.<br />
5. In § 54 Absatz 1 ist klargestellt<br />
worden, dass der Beamte in den<br />
Ruhestand tritt mit dem Ende des<br />
Monats, in dem er die Altersgrenze<br />
erreicht. Für die Lehrkräfte bleibt es<br />
bei der gesetzlichen Altersgrenze<br />
z<strong>um</strong> Schuljahresende nach Vollendung<br />
des 64. Lebensjahres.<br />
6. In § 55 Absatz 2 wurde das Antragsrecht<br />
des Beamten eingefügt,<br />
die gesetzliche Altersgrenze <strong>um</strong> bis<br />
zu drei Jahren hinauszuschieben.<br />
7. In § 56 a Absatz 1 ist die bisherige<br />
Altersgrenze von 50 Jahren, ab der<br />
ein Beamter wegen begrenzter<br />
Dienstfähigkeit nicht in den Ruhestand<br />
versetzt werden soll, weggefallen.<br />
Dies hat zur Folge, dass auch bei<br />
jüngeren Beamten von der Regelung<br />
der begrenzten Dienstfähigkeit Gebrauch<br />
gemacht werden kann.<br />
8. In den §§ 57, 58 und 61 wird die<br />
Pflicht zur Einholung eines amtsärztlichen<br />
Gutachtens durch die<br />
Pflicht zur Vorlage eines ärztlichen<br />
Gutachtens ersetzt.<br />
9. In § 61 Absatz 3 wird die Möglichkeit<br />
der Wiederberufung ins Beamtenverhältnis<br />
auch auf die Fälle<br />
der begrenzten Dienstfähigkeit ausgedehnt.<br />
10. In § 61 a ist neu die zentrale<br />
medizinische Verbindungsstelle verankert.<br />
Deren Aufgabe ist es, die<br />
Qualität der ärztlichen Untersu-<br />
chung zu sichern, daher werden ihr<br />
im erforderlichen Umfang die Personalakte<br />
des betroffenen Beamten,<br />
der Untersuchungsauftrag und die<br />
Akten des Amtsarztes bzw. des ärztlichen<br />
Gutachters zur Einsicht vorgelegt.<br />
Die zentrale medizinische<br />
Verbindungsstelle prüft die Plausibilität<br />
des Untersuchungsauftrages,<br />
des Gutachtens und die Einhaltung<br />
einheitlicher Bewertungskriterien<br />
und teilt dem untersuchenden Arzt<br />
das Ergebnis mit.<br />
Das ärztliche Gutachten sowie das<br />
Ergebnis der zentralen medizinischen<br />
Verbindungsstelle werden<br />
dem Dienstvorgesetzten mitgeteilt.<br />
Der betroffene Beamte erhält eine<br />
Kopie.<br />
11. In § 80 b wird geregelt, dass Altersteilzeit<br />
sowohl von vollzeit- als<br />
auch teilzeitbeschäftigten Beamten<br />
in Anspruch genommen werden<br />
kann. Für Teilzeitbeschäftigte<br />
kommt nur das Blockmodell in Frage.<br />
In Fällen des § 87 a ist auch eine<br />
unterhälftige Beschäftigung möglich.<br />
Für die Lehrkräfte wird auf das<br />
Schuljahr als Start- und Endpunkt<br />
abgestellt.<br />
12. Wer detailliertere Informationen<br />
wünscht, wendet sich bitte schriftlich<br />
an die <strong>GEW</strong>-Landesrechtsschutzstelle<br />
in Mainz, Fax 06131/<br />
<strong>28</strong>988-30<br />
d.r.<br />
34 <strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 /<strong>20</strong>03
<strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 /<strong>20</strong>03<br />
Tipps + Termine<br />
300 Taschenbuch-Tipps für Lehrkräfte, Eltern, Kinder<br />
Anfang März <strong>20</strong>03 erscheint die<br />
Neuauflage der Taschenbuch-Tipps<br />
der AG Jugendliteratur und Medien<br />
der <strong>GEW</strong>. Sie enthält über 300 annotierte<br />
Taschenbuchempfehlungen<br />
in drei Altersstufen und einer Rubrik<br />
„Sachbücher“ mit Verfasser- und<br />
Schlagwort-Register. Titel, für die<br />
Handreichungen für den Unterricht<br />
vorliegen, sind besonders gekennzeichnet,<br />
ebenso solche, zu denen es<br />
MCs oder CDs gibt.<br />
Auf der vierten Umschlagseite kann<br />
bei Bedarf eingedruckt werden:<br />
„Überreicht von der Gewerkschaft<br />
Erziehung und Wissenschaft<br />
(<strong>GEW</strong>)“.<br />
Bilderbuch-Englisch ten an, und dann geht’s richtig los:<br />
„Mit Bilderbüchern Englisch lernen“<br />
von Heide Niemann bietet nach einem<br />
theoretischen Einstieg ins Thema<br />
einen angenehm kurzen und prägnanten<br />
Überblick über die Bedeutung<br />
des Bilderbuchs im Unterricht<br />
allgemein und im frühen Englisch-<br />
Unterricht im Besonderen mit Kriterien<br />
zur Auswahl von Bilderbüchern.<br />
Ein erstes Praxiskapitel leitet z<strong>um</strong><br />
Bücherbasteln auf verschiedene Ar-<br />
Anhand von vierzehn englischen Bilderbüchern<br />
zeigt Niemann mit<br />
jeweils mehreren Umsetzungsmöglichkeiten,<br />
wie curricul<strong>um</strong>bezogen,<br />
fächerübergreifend, handlungsorientiert<br />
und Leselust machend gearbeitet<br />
werden kann. Ein überschaubares<br />
Glossar an notwendiger „Classroom<br />
Language“ folgt, bevor einzelne<br />
Arbeitsblätter und eine Liste ausgewählter<br />
Bilderbücher mit farbigen<br />
Ausländerkinder und sexuelle Gewalt<br />
Sexueller Missbrauch ist eine alltägliche<br />
Menschenrechtsverletzung, die<br />
jedes Kind, unabhängig von Geschlecht,<br />
Alter, Schicht, Herkunft<br />
oder Kultur, treffen kann. Jedes Kind<br />
hat ein Recht auf Schutz vor sexueller<br />
Gewalt.<br />
Deutschland ist de facto ein Einwanderungsland.<br />
Soziale Arbeit im Allgemeinen<br />
hat auf diese Tatsache reagiert<br />
und Konzepte interkultureller<br />
Arbeit entwickelt. In der Präventi-<br />
onsarbeit gegen sexuellen Missbrauch<br />
ist die Einbeziehung interkultureller<br />
Aspekte jedoch relativ neu<br />
und keineswegs selbstverständlich.<br />
So berücksichtigen die vorliegenden<br />
Konzepte die multikulturelle Gesellschaftsstruktur<br />
Deutschlands nur<br />
ansatzweise.<br />
Welche Aspekte der Präventionsarbeit<br />
müssen verändert werden, <strong>um</strong><br />
auch schwarze Deutsche und MigrantInnen<br />
zu erreichen? Auf welche<br />
Weise muss die Tatsache, dass MigrantInnen<br />
einer anderen Kultur angehören<br />
und in Deutschland rassistischen<br />
Erfahrungen ausgesetzt sind,<br />
in die Präventionsarbeit einbezogen<br />
werden? Die Autorin beantwortet<br />
diese und andere Fragen und gibt<br />
zudem einen <strong>um</strong>fassenden Überblick<br />
über die bereits vorhandenen Ansätze<br />
interkultureller Präventionsarbeit<br />
und über den aktuellen Stand der<br />
<strong>Diskussion</strong>. Insbesondere die kulturspezifischen<br />
und antirassistischen<br />
Ansätze mit ihren Kontroversen werden<br />
am Beispiel der sexuellen Gewalt<br />
Die TB-Tipps eignen sich hervorragend<br />
als Werbung für die Bildungsgewerkschaft<br />
<strong>GEW</strong> und können auf<br />
allen Veranstaltungen, Personalversammlungen,<br />
Tagungen usw. ausgelegt<br />
oder verteilt werden.<br />
Bestelladresse: Heinz Dörr, Bahnhofstr.<br />
43, 8862 Überlingen (auch per<br />
Fax 07551-68019).<br />
Beispielseiten das Buch beenden, das<br />
selbst größten Skeptikern des Fremdsprachenunterrichts<br />
gefallen müsste,<br />
lässt sich mit den vielfältigen, bunten,<br />
h<strong>um</strong>orvollen, spielerischen Unterrichtsideen<br />
doch generell die Lust<br />
am Buch wecken.<br />
(tje)<br />
Heide Niemann: Mit Bilderbüchern<br />
Englisch lernen. Seelze-Velber <strong>20</strong>02.<br />
14,90 Euro.<br />
an schwarzen Deutschen und MigrantInnen<br />
ausführlich dargestellt.<br />
pm<br />
Melanie Reinke: Das Recht jedes<br />
Kindes auf Schutz vor sexuellem<br />
Missbrauch. Präventionsarbeit im<br />
interkulturellen Kontext<br />
183 Seiten, 25,90 Euro<br />
Tect<strong>um</strong> Verlag<br />
Neustadt 12, 35037 Marburg<br />
Tel. (06421) 48 15 23<br />
Fax. (06421 ) 43 47 0<br />
e-mail: tect<strong>um</strong>.verlag@t-online.de<br />
http://www.tect<strong>um</strong>-verlag.de<br />
35
Kreis + Region<br />
Kreise Kusel und Zweibrücken<br />
Eine Fahrt nach Dresden<br />
Endlich war es soweit. Wie alljährlich in den Herbstferien startete<br />
eine Gruppe der <strong>GEW</strong>-Kreisverbände Kusel und Zweibrücken ihre<br />
Herbstfahrt, in diesem Jahr nach Dresden. Was alle erwartete, war<br />
ungewiss. Die Flutwelle, die sich im August über große Teile Ostdeutschlands<br />
ergossen hatte, war an diesem Septembermorgen noch<br />
nicht vergessen. Das ursprünglich gebuchte Hotel in Dresden war<br />
infolge Hochwasserschäden noch nicht bezugsfertig. So war man<br />
mit gemischten Gefühlen unterwegs.<br />
Bei einem ersten Zwischenstopp in Weimar konnten die TeilnehmerInnen<br />
interessante Eindrücke sammeln, angefangen vom Besuch<br />
des Goethehauses bis z<strong>um</strong> Flanieren in den historischen Gassen<br />
Weimars.<br />
In Dresden war abends nach der Ankunft rein äußerlich von den<br />
Spuren des Hochwassers ka<strong>um</strong> noch etwas zu erblicken. Bei einer<br />
Stadtrundfahrt am nächsten Tag mit anschließendem Stadtrundgang<br />
durch das historische Zentr<strong>um</strong> Dresdens wurde außer den<br />
Sehenswürdigkeiten der Stadt die bemerkenswerte Leistung der<br />
Dresdener erkennbar: Das Hochwasser hatte seine Spuren hinterlassen,<br />
aber wenn wir nicht durch unsere Reiseleiterin immer wieder<br />
darauf hingewiesen worden wären, wir hätten nur wenig davon<br />
bemerkt. Ein Beispiel: Im Innenhof des Zwingers war der ganze<br />
Erdbereich bereits ausgetauscht, viele Museen und öffentlichen<br />
Gebäude waren für die Öffentlichkeit wieder zugänglich. Die Infrastruktur<br />
der Stadt war vollkommen intakt, Busse und Straßenbahnen<br />
verkehrten normal.<br />
An diesem Tag stand noch der Besuch von Schloss Pillnitz auf<br />
dem Programm. Hier am „Lustschloss“ Augusts des Starken sah<br />
man noch größere Spuren der Flutkatastrophe. Die Gebäude waren<br />
noch nicht wieder für die Öffentlichkeit zugänglich.<br />
Von hier ging die Fahrt über Pirna weiter in die Sächsische Schweiz<br />
zur Bastei. Phantastisch war der Ausblick über ein einmaliges<br />
Schluchtenlabyrinth mit bizarr aufragenden Felsen.<br />
Als nächstes Ziel stand die Festung Königstein auf dem Programm.<br />
Die auf einem Bergmassiv für Feinde uneinnehmbare Burg aus<br />
dem 15. Jahrhundert bot der Gruppe einen abwechslungsreichen<br />
Abschluss dieses Tages.<br />
Auf der Fahrt durch die vielen kleineren Orte sah man die verheerenden<br />
Verwüstungen, die die Jahrhundertflut angerichtet hatte.<br />
Voller Eindrücke erreichte die Gruppe am Abend Dresden, wo<br />
man sich von der Reiseführerin verabschiedete, die allen einen<br />
interessanten, informativen und erlebnisreichen Tag beschert hatte.<br />
Die Reiseführerin verabschiedete sich mit den Worten: „Wir<br />
haben viel in den letzten Wochen<br />
durchgemacht und an Leid erfahren,<br />
aber das Schlimmste wäre, wenn die<br />
Touristen nicht mehr kommen würden.<br />
Das, wovon dieses Land lebt und pulsiert,<br />
darf nicht aus- bleiben.“<br />
Der dritte Tag führte zu einem Ganztagesausflug<br />
in den Spreewald nach<br />
Lübbenau. In diesem<br />
Erholungsparadies gibt es 194 befahrbare<br />
Fließe, so nennt man hier die Wasserstraßen.<br />
Eine dreistündige Kahnfahrt bei herrlichem Sonnenschein<br />
sorgte für Entspannung und Erholung.<br />
Der vierte Tag stand zur freien Verfügung, etwa zu einem Einkaufsb<strong>um</strong>mel<br />
oder z<strong>um</strong> Besuch eines der vielen Museen in Dresden.<br />
Viele nutzten auch die Zeit, <strong>um</strong> der Semperoper einen Besuch<br />
abzustatten. Wie auch immer,<br />
der Tag war viel zu kurz.<br />
Die Heimreise kam schneller als erwartet.<br />
Die Mit- tagspause wurde<br />
mit einem Auf- enthalt in Erfurt,<br />
der Landeshaupt- stadt von Thüringen,<br />
verbunden.<br />
Bei einem Nachtreffen konnten die TeilnehmerInnen dieser Tage<br />
Bilder und Eindrücke austauschen.<br />
Viele der Gruppe freuen sich schon auf die Fahrt im nächsten Jahr,<br />
die nach Polen führen wird. Veranstaltet wird die Fahrt wieder von<br />
den <strong>GEW</strong>-Kreisverbänden Kusel und Zweibrücken. Informationen<br />
über diese Fahrt können angefordert werden bei: <strong>GEW</strong>-Kreisverband<br />
Zweibrücken, Gregor Simon, Schweizer Ring 6 in 66482<br />
Zweibrücken (Email: g.si@gmx.de)<br />
gs<br />
Bezirksverband Rheinhessen Pfalz<br />
Fachgruppe Integrierte Gesamtschulen<br />
Einladung zur Mitgliederversammlung<br />
am Dienstag, 18. März <strong>20</strong>03 <strong>um</strong> 15.00 Uhr<br />
Bildungsstätte Erbacher Hof in Mainz, Grebenstraße<br />
TO: Neuwahl des Fachgruppenvorstands<br />
gez. Claudia Niggemann<br />
Kreis Worms-Alzey-Frankenthal<br />
Was bedeutet „Enneagramm“?<br />
Eine Veranstaltung abseits von üblichen Gewerkschaftsthemen fand<br />
im vergangenen Sommer bei der <strong>GEW</strong> - Worms-Alzey-Frankenthal<br />
statt: ein Einführungsseminar<br />
in das<br />
Enneagramm, ein psychologisches<br />
und spi- rituelles System<br />
mit Wur- zeln in der<br />
frühchristli- chen Mystik<br />
und der sufisti- schen Weisheit.<br />
Frühchs- ristliche Wüstenmönche<br />
ka- men zu der<br />
Erkenntnis, dass es neun<br />
Grundtypen von Persönlichkeiten<br />
mit signifikant<br />
unterschiedli- chen Verhaltensweisen<br />
gibt. Jedoch wehren sich die Kenner dieser Lehre gegen<br />
die Behauptung, es handle sich <strong>um</strong> Schubladen-Klassifizierungen.<br />
Vielmehr werden zahlreiche „Subtypen“ und Verknüpfungen<br />
zwischen den Grundtypen aufgezeigt. Auch die Festlegung auf<br />
bestimmte Typen ist nicht kategorisch gemeint: Viel eher sollen<br />
die dem jeweiligen Typus zugrunde liegenden Möglichkeiten weiter<br />
entwickelt und damit voll ausgeschöpft werden.<br />
Der Referent in Worms, Realschullehrer Gerhard Ahnen, ist<br />
mittlerweile hauptberuflich als Enneagrammlehrer tätig. Er ver-<br />
36 <strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 /<strong>20</strong>03
weist auf die Nützlichkeit des Enneagramms nicht nur in Partnerschaften,<br />
sondern auch im Berufsleben, in der Seelsorge, im pädagogischen<br />
und therapeutischen Bereich, <strong>um</strong> unbewusste Verhaltensmuster<br />
durchschauen zu lernen und deren Auswirkungen zu<br />
verstehen. So soll es besser gelingen, Gesetzmäßigkeiten z.B. im<br />
Schülerverhalten zu entdecken, Motive zu verstehen und der Verschiedenartigkeit<br />
von SchülerInnen stärker gerecht zu werden.<br />
Als Folge des Seminars in Worms hat sich mittlerweile eine monatlich<br />
zusammenkommende Gruppe im Ra<strong>um</strong> Oppenheim/<br />
Wörrstadt gebildet, deren Mitglieder sich begeistert äußerten, wie<br />
konstruktiv sich ihr <strong>neues</strong> Wissen auswirke. Das nächste ganztägige<br />
Einführungsseminar mit Gerhard Ahnen und veranstaltet vom<br />
KV Worms-Alzey-Frankenthal findet am 14. März im „Hagenbräu“<br />
in Worms statt. Wer sich anmelden möchte, kann dies bei<br />
Kreisvorsitzendem Jörg Pfeiffer (Tel. 06241-78368 oder E-Mail<br />
wo-az-ft@gew-rhp.de) tun. Weitere Informationen bzw. Kursangebote<br />
gibt es bei Gerhard Ahnen (Tel. 06233-63156, E-Mail<br />
GerhardBuntspecht@t-online.de).<br />
ga/tje<br />
Kreis Worms-Alzey-Frankenthal<br />
Weiterhin Mitgliederzuwachs<br />
Bei der <strong>GEW</strong> - Worms-Alzey-Frankenthal geht es weiter aufwärts:<br />
So konnte Kreisvorsitzender Jörg Pfeiffer bei der Mitgliederversammlung<br />
im November von einem erfreulichen Mitgliederzuwachs<br />
von 3,5 Prozent berichten.<br />
Außer den regelmäßigen Vorstandssitzungen hielt der KV im abgelaufenen<br />
Jahr die Kontakte zu allen politischen Parteien aufrecht<br />
und kann es als besonderen Erfolg werten, dass ein immerhin<br />
zehn Jahre andauernden Konflikt mit dem Wormser Oberbürgermeister<br />
beigelegt werden konnte: Die <strong>GEW</strong> stritt konsequent für<br />
die Angleichung der Sekretärinnenstunden an die Empfehlungen<br />
des Städtetags (dessen Vorsitzender der Wormser OB ist!), so dass<br />
die Schulen nun endlich besser ausgestattet werden, wenngleich<br />
diese Empfehlung auch schon fast wieder zehn Jahre alt ist.<br />
Kritisch begleitete die <strong>GEW</strong> die Einrichtung der ersten Ganztagsschule<br />
auf Wormser Gebiet. Z<strong>um</strong> Thema Altersteilzeit konnten<br />
in mehreren Veranstaltungen über <strong>20</strong>0 Kolleginnen und Kollegen<br />
lernen, wie sie ihr persönliches Modell berechnen.<br />
Z<strong>um</strong> Foto: Heinrich Rudolf Bock, Karl-Heinz Wippel, Klaus Arnold<br />
und Ernst-Josef Bonnkirch wurden von Kreisvorsitzendem Jörg Pfeiffer<br />
(3.v.l.) und Landesvorsitzendem Tilman Boehlkau (rechts) für 25 bzw.<br />
40 Jahre <strong>GEW</strong>-Mitgliedschaft geehrt.<br />
<strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 /<strong>20</strong>03<br />
Kreis + Region<br />
Garant für kreative Angebote ist Pfeiffer-Stellvertreter Werner Breuder,<br />
der auch das PZ in Alzey leitet. „Sinnesgarten“, „Figurentheater“<br />
oder „Zaubern“ waren nur einige seiner Angebote für den<br />
<strong>GEW</strong>-Kreisverband im Jahr <strong>20</strong>02. Ausgebuchte Personalratsschulungen<br />
in Worms, Frankenthal und Alzey unter Mitwirkung von<br />
Alexander Witt, Sybilla Hoffmann und Jörg Pfeiffer vervollständigen<br />
die Aktivitäten des KV.<br />
Landesvorsitzender Tilman Boehlkau rief zur Teilnahme am Protest<br />
gegen die Bildungspolitik der Landesregierung auf und half<br />
später bei den jährlichen Mitglieder-Ehrungen: 40 Jahre hält Klaus<br />
Arnold der <strong>GEW</strong> aus dem Kreis Worms-Alzey-Frankenthal die<br />
Treue. 25 Jahre lang sind Christa Berger, Heinrich Rudolf Bock,<br />
Ernst-Josef Bonnkirch, Erich Denger und Jürgen Faltermann dabei.<br />
Auch Volker Gallé, Hans-Werner Kloster, Manfred Morgenstern,<br />
Reinhard Quick, Gerlinde Rößick und Karl-Heinz Wippel gehören<br />
der <strong>GEW</strong> seit 25 Jahren an.<br />
(tje)<br />
Kreis Westerwald<br />
Wolf: „Unterrichtsausfall zu hoch“<br />
Die <strong>GEW</strong>-Westerwald zog auf ihrer Mitgliederversammlung Ende<br />
vergangenen Jahres in Wirges eine positive Bilanz: Die Gewerkschaft<br />
ist von <strong>28</strong>0 auf 315 Mitglieder angewachsen. Dieser Erfolg<br />
beruhe vor allem auf der intensiven gewerkschaftlichen Arbeit am<br />
Studienseminar Westerburg, erklärte der Kreisvorsitzende Erwin<br />
Wolf.<br />
Besonders aktiv sei auch die Fachgruppe sozialpädagogische Berufe<br />
mit ihrer Sprecherin Marina Freund gewesen.<br />
Unzufrieden ist die Gewerkschaft mit der Unterrichtsversorgung.<br />
Die <strong>GEW</strong> erwarte von der Landesregierung entschiedene Schritte<br />
in Richtung Unterrichtsgarantie. Der Unterrichtsausfall sei nach<br />
wie vor zu hoch. „Mit jeder ausgefallenen Stunde wird der zukünftigen<br />
Generation Bildung vorenthalten!“, sagte Wolf.<br />
Zur Abdeckung von Vertretungs- und Förderunterricht würden<br />
dringend Lehrkräfte benötigt. Die <strong>GEW</strong> lehne die Beschäftigung<br />
von VertretungslehrerInnen ohne erstes oder zweites Staatsexamen<br />
ab. Das gelte <strong>um</strong> so mehr, da die <strong>Diskussion</strong> <strong>um</strong> die PISA-Studie<br />
und auch die Qualitätsanforderungen des Ministeri<strong>um</strong>s an jede<br />
einzelne Schule gezeigt hätten, dass qualifizierter Unterricht nur<br />
mit qualifizierten Lehrkräften erreicht werden könne.<br />
„Dieser Bildungsnotstand heute ist die Folge der Fehler von gestern,<br />
die zur Zeit wiederholt werden“, stellte Wolf klar und führte das<br />
Beispiel Studienseminar Westerburg an. Es gebe nicht einmal genügend<br />
BewerberInnen für die bereit gestellten Ausbildungsplätze.<br />
Schuld daran seien unter anderem die schlechten Ausbildungsund<br />
Arbeitsbedingungen für junge Lehrerinnen und Lehrer und<br />
das schlechte Berufsimage. Das werde sich erst dann ändern, wenn<br />
die Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer geachtet und ihr Beruf anerkannt<br />
werde.<br />
Wolf: „Auch in der Zeit klammer Kassen verlangt die <strong>GEW</strong> von<br />
der Landesregierung mehr Mittel für die Bildungsfinanzierung z<strong>um</strong><br />
Beispiel für den qualitativen und quantitativen Ausbau von ganztägigen<br />
Bildungseinrichtungen. Die Rahmenbedingungen für<br />
Ganztagsschulen müssen stimmen. Ganztagsschulen dürfen keine<br />
Billiglösungen sein. Das gilt sowohl für die eingerichteten als auch<br />
jetzt in Aussicht genommenen Schulen. Ganztagsschulen dürfen<br />
nicht gegen den Willen der dort Beschäftigten eingerichtet werden.“<br />
37
Kreis + Region<br />
Der Kreisvorstand der <strong>GEW</strong> Westerwald habe sich ein Bild von<br />
der Arbeit der neuen Ganztagsschule in Wirges gemacht und die<br />
wichtigsten Anliegen der Kolleginnen und Kollegen an den Landesvorstand<br />
gemeldet: kleinere Klassen in der Ganztagsschule,<br />
höhere Zuweisung von Verwaltungsstunden und Erhöhung der<br />
Schulleitungspauschale.<br />
Weiter belegte der Kreisvorsitzende an zahlreichen Beispielen, dass<br />
die <strong>GEW</strong>-Westerwald in der abgelaufenen Periode eine Vielzahl<br />
von Aktivitäten und Veranstaltungen im Interessen ihrer Mitglieder<br />
unternommen hat.<br />
Kreis Ludwigshafen / Speyer<br />
<strong>Diskussion</strong> mit der Bundesvorsitzenden<br />
Ende November vergangnenen Jahres fand die alljährliche Mitgliederversammlung<br />
der <strong>GEW</strong> Ludwigshafen / Speyer statt. Dieses<br />
Mal musste nicht gewählt werden und so konnten zahlreiche<br />
Jubilarinnen und Jubilare geehrt werden und die <strong>GEW</strong>-Bundesvorsitzende<br />
Dr. Eva-Maria Stange zur PISA-Studie referieren.<br />
Von den 131 KollegInnen, die zu ehren waren, nahm knapp die<br />
Hälfte an der MV teil. Auf 25 Jahre Mitgliedschaft konnten 76<br />
KollegInnen blicken, 30 Jahre in der <strong>GEW</strong> waren 38 Kolleginnen,<br />
13 KollegInnen waren schon vor 40 Jahren der <strong>GEW</strong> beigetreten<br />
und vier <strong>GEW</strong>erkschafterInnen halten sogar bereits seit 50 Jahren<br />
ihrer Gewerkschaft die Treue.<br />
Helmut Thyssen hob in seiner Laudatio hervor, dass jede Gruppe<br />
für ein besonderes Problem der Bildungs- bzw. Schulpolitik steht.<br />
Die Gruppe der 50 Jährigen repräsentiert die Generation der GründerInnen,<br />
die den Lehrerverein zu einer Gewerkschaft innerhalb<br />
des DGB formte. Die KollegInnen, die vor 40 Jahren in die <strong>GEW</strong><br />
eintraten, sind die VertreterInnen, die aus der Volksschule eine<br />
attraktive Grund- und Hauptschule gestalten wollten. Und was<br />
sei bloß aus diesem Vorhaben „Hauptschule“ geworden. Die KollegInnen<br />
schließlich, die vor 25/30 Jahren der <strong>GEW</strong> beitraten,<br />
lösten eine heftige <strong>Diskussion</strong> <strong>um</strong> die Schulstruktur und die Bildungsinhalte<br />
aus. Und die sei immer noch nicht beendet. Auch<br />
die Forderung „25 Schüler in der Klasse sind genug!“, die sie aufstellten,<br />
feiert 25jähriges Jubilä<strong>um</strong>. Thyssen: „Es ist ein trauriges<br />
Jubilä<strong>um</strong>, denn erfüllt wurde die Forderung nicht. Im Gegenteil,<br />
unter dem Deckmantel der von Studien wie MARKUS und PISA<br />
wird inzwischen die Relevanz von Klassenstärke für den Lernerfolg<br />
der SchülerInnen wieder bestritten.“<br />
Die Bundesvorsitzende warb in ihrem Referat dafür, sich an der<br />
PISA-Studie für LehrerInnen zu beteiligen, <strong>um</strong> empirisch nachzuweisen,<br />
dass die Ausbildung der deutschen LehrerInnen geändert<br />
werden muss. Eine Umgestaltung des Unterrichts und eine Änderung<br />
der Bildungsinhalte im vorschulischen Bereich seien dringend<br />
notwendig. Die Untersuchungsergebnisse der Shell-Studie,<br />
dass Bildung in Deutschland vererbt wird, und die Aussage der<br />
UNICEF-Studie, dass es kein zweites Land auf dieser Welt gibt, in<br />
dem Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern so geringe Aufstiegschancen<br />
haben wie in Deutschland, müsste unseren BildungpolitikerInnen<br />
den Schlaf rauben.<br />
Für den Erfolg der Lernenden habe ihr Engagement die größte<br />
Bedeutung, und dieses Engagement werde vor dem Schuleintritt<br />
geweckt. „Was ErzieherInnen versä<strong>um</strong>en, können GymnasiallehrerInnen<br />
nicht wieder gerade biegen“, so das Resümee von Eva-<br />
Maria Stange zu den vorliegenden Studien.<br />
Fotos: Lucas Schmitt<br />
Ihre Konsequenzen für das deutsche Bildungswesen: Fachhochschulausbildung<br />
für ErzieherInnen, gleiche Mittelzuweisung vom<br />
Vorschulbereich bis z<strong>um</strong> Gymnasi<strong>um</strong>, ständige Evaluierung der<br />
Schulen, aber keine flächendeckenden Leistungstests, Abbau der<br />
selektiven Maßnahmen (Schuleingangstests, Sitzenbleiben, dreigliedriges<br />
Schulwesen) statt dessen langes gemeinsames Lernen und<br />
starker Ausbau der Fördermaßnahmen. Dieses Erfolgskonzept der<br />
skandinavischen Länder bräuchten die deutschen Bildungspolitiker<br />
nur zu übertragen, allerdings auch mit den dafür notwendigen<br />
Mitteln.<br />
Die lange und lebhafte <strong>Diskussion</strong>, die sich anschloss, zeigte, dass<br />
dieses Thema wieder aufgegriffen werden muss. Deutlich wurde<br />
aber auch, dass in der Frage der Einschätzung der „Ganztagsschulen<br />
in neuer Form“ noch viel <strong>Diskussion</strong>sbedarf zwischen <strong>GEW</strong>-<br />
Spitze und <strong>GEW</strong>-Basis besteht.<br />
Z<strong>um</strong> kulturellen Abschluss der Veranstaltung trug der chilenische<br />
Emigrant Juan Miranda-Moraga lateinamerikanische Lieder vor.<br />
U.K.<br />
Kreis Rhein-Lahn<br />
Thema „frühzeitige Einschulung“<br />
Gut 50 PädagogInnen aus dem gesamten Rhein- Lahn- Kreis waren<br />
Ende vergangenen Jahres in Nastätten zu einer engagierten<br />
<strong>Diskussion</strong> z<strong>um</strong> Thema „frühzeitige Einschulung“ zusammengekommen:<br />
Im Blickpunkt der von Bernd Huster, Leiter der Geschäftsstelle<br />
Nord der <strong>GEW</strong> Rheinland-Pfalz in Koblenz, moderierten Fachtagung<br />
standen insbesondere - wie sollte es anders sein! - die Ergebnisse<br />
der internationalen PISA-Studie. Dort war unter den offensichtlichen<br />
Defiziten des deutschen Bildungswesens auch eine im<br />
Vergleich zu anderen Staaten relativ spät einsetzende allgemeine<br />
und gezielte Bildungseinwirkung bei den Kindern festgestellt worden.<br />
Das rheinland-pfälzische Bildungsministeri<strong>um</strong> hatte dies z<strong>um</strong><br />
Anlass genommen, die Eltern gut entwickelter Kinder zu ermuntern,<br />
verstärkt von der Möglichkeit der frühzeitigen Aufnahme in<br />
die Grundschule Gebrauch zu machen und für einen „kindgemäßen<br />
und flexiblen Einschulungstermin“ zu werben. Eine generelle<br />
Vorverlegung des Einschulungsalters vom sechsten auf das fünfte<br />
Lebensjahr wird von der Ministerin derzeit jedoch nicht angestrebt.<br />
In einem Impuls-Referat ging die Diplom-Pädagogin Ursel Rhode<br />
vom Bopparder „FoKuS-Team“, einem privaten Fortbildungsinstitut<br />
mit Fachberatung für kommunale Kindergärten, zunächst<br />
auf die entwicklungspsychologischen Aspekte der Fünf- bis Sie-<br />
38 <strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 /<strong>20</strong>03
enjährigen im Blick auf die Kriterien der „Schulreife“ und „Schulfähigkeit“<br />
ein. Die Sozialpädagogin riet zu einer differenzierten<br />
Entscheidung, die den jeweiligen Entwicklungsstand des Kindes<br />
berücksichtigt.<br />
Die PädagogInnen waren sich in Nastätten weitgehend darüber<br />
einig, dass eine vorgezogene Einschulung nicht unreflektiert als<br />
„Allheilmittel“ gegen Defizite im deutschen Bildungswesen angesehen<br />
werden sollte. Viel wichtiger sei es, die Rahmenbedingungen<br />
für die pädagogische Arbeit in den Kindertagesstätten und<br />
Schulen zu verbessern. „Bei Klassenstärken bis zu 30 Kindern in<br />
der Grundschule ist eine gezielte und individuelle Förderung angesichts<br />
des sehr unterschiedlichen Entwicklungsniveaus nur begrenzt<br />
möglich“, beschrieb ein Grundschullehrer die Situation.<br />
Den Erzieherinnen ging es dar<strong>um</strong>, eine stärkere Kompetenz bei<br />
der Beratung der Eltern in den für die Einschulung wichtigen Fragen<br />
zu gewinnen, <strong>um</strong> möglichen Fehlentscheidungen vorzubeugen.<br />
Einvernehmen herrschte bei der <strong>GEW</strong> darüber, dass die Bildungsarbeit<br />
- vor allem die gezielte Sprachförderung - im Kindergarten<br />
verstärkt werden sollte. Eine wichtige Voraussetzung für<br />
einen reibungslosen Übergang sei die Intensivierung der Zusammenarbeit<br />
zwischen Grundschulen und den Kindertagesstätten,<br />
stellten die TagungsteilnehmerInnen übereinstimmend fest.<br />
Willi Schmiedel<br />
Kreis Donnersberg<br />
Langjährige <strong>GEW</strong>-Mitglieder geehrt<br />
Trotz widriger Bedingungen machten sich in Eiseskälte gut zwanzig<br />
Mitglieder auf den Weg zur alljährlichen Mitgliederehrung im<br />
Rahmen des Weihnachtsstammtisches der <strong>GEW</strong> im Donnersbergkreis.<br />
Äußerst eindrucksvoll gab Bernd Knell mit neueren und<br />
unbekannten Weihnachtsliedern der Festlichkeit den richtigen<br />
Rahmen.<br />
Zu sehen gab es allerlei bei der Führung durch den angrenzenden<br />
Wichtelkindergarten. Heidi Geiger, Leiterin der Einrichtung, fand<br />
die richtigen Worte zu dieser ungemein heimeligen und liebevoll<br />
hergerichteten Einrichtung.<br />
Mit einer Ausnahme, nämlich als es <strong>um</strong> ihn selber ging, ehrte Hans<br />
Adolf Schäfer, Vorsitzender der <strong>GEW</strong> im Donnersbergkreis, die<br />
Jubilare. Es galt 42 LehrerInnen sowie 14 ErzieherInnen für langjährige<br />
Mitgliedschaft auszuzeichnen. So wurden u.a. für 25 Jahre<br />
Mitgliedschaft Gabriele Eckert, Carl-Anton von Gleichenstein,<br />
Edith Jung, Anna-Maria Neufeld und Karl Heinz Taeffner sowie<br />
für 30 Jahre Mitgliedschaft Friedrich Orth ausgezeichnet. Seit 35<br />
<strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 /<strong>20</strong>03<br />
Kreis + Region<br />
Jahren bei der <strong>GEW</strong> sind Wolfgang Dommach, Dieter Glaser, Ursula<br />
Giehl und Maria Walther. Gar 40 Jahre dabei sind Ulrich<br />
Dittrich, Gernot Fürwitt, Erich Klein und Robert Scholl sowie 45<br />
Jahre bei der <strong>GEW</strong> zu Hause Irmgard Edinger und Hans Adolf<br />
Schäfer. Sage und schreibe 50 Jahre <strong>GEW</strong> haben Werner Deßloch<br />
und Werner Kühlwetter hinter sich.<br />
Und man glaubt es ka<strong>um</strong>, die unverwüstliche, ewig junge Liselotte<br />
Ludwig ist seit 60 Jahren Mitglied der <strong>GEW</strong>. Kein Wunder, dass<br />
sie im Anschluss zusammen mit Werner Deßloch so allerlei aus<br />
den vergangenen Jahrzehnten zu berichten wusste.<br />
pbg<br />
Studienreisen / Klassenfahrten<br />
8-Tage-Busreise z.B. nach<br />
WIEN ÜF 192,-- €<br />
BUDAPEST ÜF 192,-- €<br />
LONDON ÜF 254,-- €<br />
PRAG ÜF 199,-- €<br />
PARIS ÜF 224,-- €<br />
ROM ÜF 238,-- €<br />
10-Tage-Busreise z.B. nach<br />
SÜDENGLAND Ü 213,-- €<br />
TOSKANA Ü <strong>20</strong>2,-- €<br />
SÜDFRANKREICH Ü 230,-- €<br />
(Unterbringung in<br />
Selbstversorgerunterkünften)<br />
Alle Ausflugsfahrten inklusive.<br />
Flug- und Bahnanreise sowie andere Ziele (z.B. Ferienparks<br />
in den Niederlanden oder Belgien) auf Anfrage möglich!<br />
REISEBÜRO KRAUSE GMBH · MÜNSTERSTR. 55a · 44534 LÜNEN<br />
TEL: (0 23 06) 7 57 55-0 · FAX: (0 23 06) 7 57 55-49 · E-mail: info@rsb-krause.de<br />
Testauswertung von letzter Seite<br />
Zählen Sie nun zusammen, wie oft Sie A, B oder C angekreuzt<br />
haben.<br />
Vorwiegend A: Unfit<br />
Sicher, Sie nehmen Ihre Dienstpflichten und Ihren pädagogischen Auftrag<br />
ernst und führen beides verantwortlich aus. Sie wären nicht nur eine gute<br />
Lehrkraft, sondern auch ein wertvolles Mitglied in jedem Kollegi<strong>um</strong>, enthielten<br />
Ihre Reaktionen nicht zu viele authentische, fast schon normale<br />
Anteile. So werden Sie auf Dauer im Schulalltag keine wirkliche Arbeitszufriedenheit<br />
erlangen können. Schade.<br />
Vorwiegend B: Halbfit<br />
Ihrem beruflichen Engagement fehlt es an nichts und Ihre Bereitschaft, es<br />
allen recht zu machen, macht sie zu einer vielseitig verwendbaren Arbeitskraft.<br />
Leider verbrauchen KollegInnen wie Sie zu schnell Ihre Reserven.<br />
Für die zweite Hälfte Ihrer Dienstjahre sollten Sie sich daher auf Teilzeit<br />
oder Frühverrentung einrichten.<br />
Vorwiegend C: Topfit<br />
Glückwunsch: Mit Ihnen hat der Dienstherr das große Los gezogen. Mit<br />
Ihrer bodenständigen Einstellung und Ihrer robusten Konstitution werden<br />
Sie bis zur Pensionierung Ihren Job durchziehen können, ohne sich selbst<br />
unnötig Stress aufzuhalsen.<br />
39
<strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz<br />
Beilage zur E&W<br />
Schulgeist<br />
<strong>GEW</strong> Rheinland-Pfalz<br />
Neubrunnenstraße 8 · 55116 Mainz<br />
Telefon: 06131-<strong>28</strong>988-0 • FAX 06131-<strong>28</strong>988- 80<br />
E-mail: <strong>GEW</strong>@<strong>GEW</strong>-RLP.de<br />
Wie Wie fit fit sind sind Sie Sie für für den den Lehrerjob<br />
Lehrerjob<br />
Fitness-Check für Berufsanfänger und Quereinsteiger<br />
Sie suchen die echte Herausforderung<br />
und möchten täglich Ihre<br />
Grenzen erfahren? Ihr professioneller<br />
Horizont ist offen für pädagogisches<br />
Upgrading? Laufbahntechnische<br />
Unebenheiten sind für<br />
Sie von sekundärer Bedeutung?<br />
Dieser Test hilft, Enttäuschungen<br />
und Reinfälle rechtzeitig zu vermeiden.<br />
So geht’s: Lesen Sie die nachfolgenden<br />
Situationsbeschreibungen<br />
durch. Kreuzen Sie von den Antworten<br />
diejenige an, die Ihrer Reaktionsweise<br />
am nächsten kommt. Ihr persönliches<br />
Fitnessprofil finden Sie auf<br />
der vorherigen Seite.<br />
1. Ihr Dienstort ist 37 km von Ihrer<br />
Wohnung entfernt. Sie sind <strong>um</strong><br />
6.30 Uhr losgefahren, jedoch auf der<br />
Strecke in einen Stau geraten. Knapp<br />
vor Unterrichtsbeginn erreichen sie<br />
die Schule, hasten ins Lehrerzimmer<br />
und kramen dabei die Arbeitsblätter<br />
für die erste Stunde aus der Tasche.<br />
Vor dem Kopierer hat sich eine<br />
Schlange gebildet, Kollegin X versucht<br />
gerade, einen Papierstau zu<br />
beheben. Als Sie an der Reihe sind,<br />
schellt es.<br />
A) Wie so oft verwünschen Sie die Tatsache,<br />
dass der Dienstherr Sie nicht der<br />
freien Stelle in der Schule Ihres Wohnortes<br />
zugewiesen hat.<br />
B) Sie machen sich bittere Vorwürfe,<br />
dass Sie nicht schon <strong>um</strong> 6.00 Uhr aufgebrochen<br />
sind, hechten zu Ihrem Fach<br />
und greifen panikartig zu Freiarbeitsmaterial.<br />
C) Sie marschieren schnurstracks ins<br />
Klassenzimmer und kündigen der Klasse<br />
einen schriftlichen Test an, den Sie<br />
spontan an der Tafel entwerfen.<br />
2. Zu Beginn der 4. Stunde gehen<br />
Sie mit Ihrer Klasse in den Filmra<strong>um</strong>.<br />
Auf dem Flur spricht Sie un-<br />
vermittelt eine Schülermutter an.<br />
Die Klasse bewegt sich lärmig weiter<br />
in Richtung Filmra<strong>um</strong>. Der<br />
Hausmeister teilt Ihnen von hinten<br />
mit, dass der Projektor leider mal<br />
wieder defekt ist. Eine Schülerin<br />
möchte von Ihnen den Ra<strong>um</strong>schlüssel<br />
haben und ein Junge berichtet<br />
atemlos, dass sich „da hinten welche<br />
kloppen“.<br />
A) Für einen Moment fühlen Sie sich<br />
überfordert und würden am liebsten<br />
alles stehen und liegen lassen. Zwar gelingt<br />
es Ihnen die nötige Ruhe und Festigkeit<br />
aufzubringen, <strong>um</strong> das Chaos zu<br />
ordnen, aber wie immer in solchen Situationen<br />
fühlen Sie sich ausgebremst<br />
und der rechte Spaß will nicht mehr<br />
aufkommen.<br />
B) Sie haben das Gefühl, jetzt alles im<br />
Griff haben zu müssen. Sie verabreden<br />
knapp und unter Druck mit der Schülermutter<br />
einen Gesprächstermin, bedanken<br />
sich bei dem Hausmeister, streichen<br />
der Schülerin übers Haar, trennen<br />
die Streithähne und schicken die<br />
Kinder zurück in die Klasse. (Dabei<br />
bemühen Sie sich die richtige Reihenfolge<br />
einzuhalten.) Auf dem Weg überlegen<br />
Sie fieberhaft, welche Unterrichtsinhalte<br />
das ausgefallene Vorhaben sinnvoll<br />
ersetzen könnten.<br />
C) Sie lassen die Schülermutter stehen,<br />
ignorieren den Hausmeister, stauchen<br />
mit Donnerstimme die Kids zusammen<br />
und scheuchen sie zurück in die Klasse.<br />
Einzelarbeit für den Rest der Stunde.<br />
3. Es ist kurz vor Ende der 6. Stunde.<br />
Als mangelfachunterrichtende<br />
Lehrkraft haben Sie in sechs verschiedenen<br />
Klassen unterrichtet. In der<br />
ersten Pause hatten Sie Aufsicht, in<br />
der zweiten Pause wurden Sie gleich<br />
zu Beginn ans Telefon gerufen. Im<br />
Anschluss an den Unterricht ist ein<br />
Dienstgespräch mit dem Schulleiter<br />
vorgesehen. Seit drei Stunden unter-<br />
drücken Sie den dringenden<br />
Wunsch, die Toilette aufzusuchen.<br />
A) Ka<strong>um</strong> hat es geschellt und sich die<br />
Klasse geleert, flitzen Sie z<strong>um</strong> WC.<br />
Notfalls wird das Dienstgespräch eben<br />
ohne Sie beginnen müssen. Arbeitsrechtliche<br />
Vorschriften über die Einhaltung<br />
von Pausen kommen Ihnen in den<br />
Sinn.<br />
B) Sie überlegen, ob zwischen Unterrichtsschluss<br />
und Beginn des Dienstgespräches<br />
Zeit für einen Gang zur Lehrertoilette<br />
ist. Notfalls werden Sie, <strong>um</strong><br />
pünktlich zu sein, noch eine weitere<br />
Stunde einhalten müssen.<br />
C) Ihre Blase hat das Fassungsvermögen<br />
eines LKW-Tanks und meldet sich<br />
immer erst nach Dienstschluss.<br />
4. Konferenz. Es ist 17.45 Uhr. Seit<br />
14.00 Uhr schleppt sich die <strong>Diskussion</strong><br />
durch eine kilometerlange Tagesordnung.<br />
Kein Punkt, der direkt<br />
und ohne Umwege zur Abstimmung<br />
käme. Gerade wird das Für und Wider<br />
eines neuen Vorhängeschlosses<br />
am Tor z<strong>um</strong> Schulgarten in aller<br />
Ausführlichkeit erwogen. Sie müssen<br />
noch zur Autowerkstatt, <strong>um</strong> ihren<br />
Wagen abzuholen und für den morgigen<br />
Tag stehen Vorbereitungen an.<br />
A) Angesichts der fortgeschrittenen Zeit<br />
bitten Sie in sachlichem Ton die Konferenz,<br />
sich auf das Wesentliche zu beschränken<br />
und <strong>Diskussion</strong>en<br />
nötigenfalls abzukürzen. (Missbilligende<br />
Blicke versuchen Sie zu ignorieren.)<br />
B) Wie immer versuchen Sie, das Notwendige<br />
in jedem <strong>Diskussion</strong>spunkt zu<br />
sehen, auch wenn Ihnen die noch zu<br />
erledigenden Arbeiten unter den Nägeln<br />
brennen und es wieder einmal auf<br />
eine Nachtschicht hinausläuft.<br />
C) In der Ruhe liegt die Kraft. Während<br />
Sie äußerlich wirken als wären Sie<br />
ganz bei der Sache, erfreut sich Ihr Geist<br />
an allerlei Tagträ<strong>um</strong>ereien.<br />
Regina Erich<br />
40 <strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 1-2 /<strong>20</strong>03