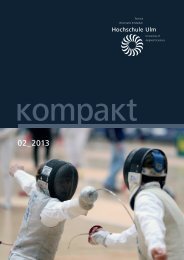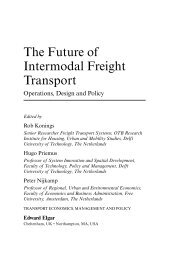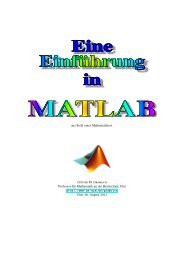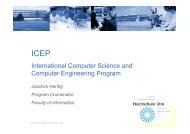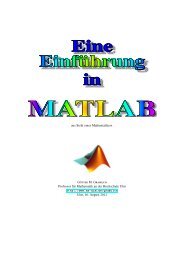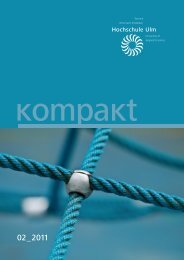Elektronische Marktplätze - Übersicht, Beispiele ... - Hochschule Ulm
Elektronische Marktplätze - Übersicht, Beispiele ... - Hochschule Ulm
Elektronische Marktplätze - Übersicht, Beispiele ... - Hochschule Ulm
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Inhaltsverzeichnis<br />
<strong>Elektronische</strong> <strong>Marktplätze</strong> -<br />
<strong>Übersicht</strong>, <strong>Beispiele</strong> und Trends<br />
Studienarbeit<br />
im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen / Logistik<br />
Fachbereich Produktionstechnik und Produktionswirtschaft<br />
der <strong>Hochschule</strong> <strong>Ulm</strong><br />
Prüfer: Prof. Dr. Hartwig Baumgärtel<br />
vorgelegt von:<br />
Berkant Alexander Noeth<br />
Matrikelnummer: 131832<br />
<strong>Ulm</strong>, den 30. August 2008
Inhaltsverzeichnis 1<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
INHALTSVERZEICHNIS.............................................................................................................................................1<br />
ABBILDUNGSVERZEICHNIS ....................................................................................................................................3<br />
TABELLENVERZEICHNIS.........................................................................................................................................3<br />
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS ..................................................................................................................................4<br />
1 EINLEITUNG ......................................................................................................................................................5<br />
2 ELEKTRONISCHE MARKTPLÄTZE.............................................................................................................7<br />
2.1 DEFINITION ELEKTRONISCHER MARKTPLÄTZE .........................................................................................................7<br />
2.2 ENTWICKLUNGSSTUFEN DER ELEKTRONISCHEN BESCHAFFUNG ................................................................................8<br />
2.2.1 Sell- Side- Lösungen ....................................................................................................................................9<br />
2.2.2 Buy- Side- Lösungen ..................................................................................................................................10<br />
2.2.3 <strong>Elektronische</strong>r Marktplatz .........................................................................................................................11<br />
2.3 FORMEN VON ELEKTRONISCHEN MARKTPLÄTZEN ..................................................................................................12<br />
2.3.1 Fokus des elektronischen Marktplatzes .....................................................................................................12<br />
2.3.2 Zugang zum elektronischen Marktplatz .....................................................................................................14<br />
2.3.3 Teilnehmerbeziehungen des elektronischen Marktplatzes .........................................................................14<br />
2.3.4 Betreibermodelle elektronischer <strong>Marktplätze</strong>............................................................................................15<br />
2.3.5 Abgrenzung elektronischer <strong>Marktplätze</strong> ....................................................................................................16<br />
2.4 TRANSAKTIONSMECHANISMEN ELEKTRONISCHER MARKTPLÄTZE...........................................................................17<br />
2.4.1 Kataloge ....................................................................................................................................................17<br />
2.4.2 Auktionen und Ausschreibungen (Reverse Auctions).................................................................................18<br />
2.4.3 Börsen........................................................................................................................................................20<br />
2.5 STANDARDS...........................................................................................................................................................21<br />
2.5.1 Katalogstandards.......................................................................................................................................21<br />
2.5.2 Transaktionsstandards...............................................................................................................................22<br />
2.5.3 Prozessstandards .......................................................................................................................................22<br />
2.5.4 Identifikations- und Klassifikationsstandards............................................................................................22<br />
3 FUNKTIONALITÄTEN ELEKTRONISCHER MARKTPLÄTZE AM BEISPIEL SUPPLYON ............24<br />
3.1 VORSTELLUNG VON SUPPLYON .............................................................................................................................24<br />
3.2 FUNKTIONALITÄTEN VON SUPPLYON.....................................................................................................................25<br />
3.2.1 Sourcing & Engineering ............................................................................................................................25<br />
3.2.1.1 SupplyOn Business Directory....................................................................................................25<br />
3.2.1.2 SupplyOn Sourcing Manager.....................................................................................................26<br />
3.2.1.3 SupplyOn Document Manager...................................................................................................27<br />
3.2.1.4 SupplyOn Collaboration Folders................................................................................................28<br />
3.2.2 Logistik-Funktionalitäten...........................................................................................................................29<br />
3.2.2.1 SupplyOn EDI und WebEDI......................................................................................................29<br />
3.2.2.2 SupplyOn Inventory Collaboration ............................................................................................32<br />
3.2.3 Qualität......................................................................................................................................................33<br />
3.2.3.1 SupplyOn Performance Monitor................................................................................................33<br />
3.2.3.2 SupplyOn Project Management .................................................................................................34<br />
3.2.3.3 SupplyOn Problem Solver .........................................................................................................35
4 CHANCEN UND RISIKEN ELEKTRONISCHER MARKTPLÄTZE........................................................36<br />
4.1 CHANCEN ELEKTRONISCHER MARKTPLÄTZE ..........................................................................................................36<br />
4.2 RISIKEN ELEKTRONISCHER MARKTPLÄTZE.............................................................................................................37<br />
5 ENTWICKLUNG UND AUSBLICK ...............................................................................................................39<br />
LITERATURVERZEICHNIS.....................................................................................................................................41<br />
EHRENWÖRTLICHE ERKLÄRUNG .............................................FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.<br />
2
Abbildungsverzeichnis 3<br />
Abbildungsverzeichnis<br />
Abb. 1: Buy-Side- und Sell-Side-Lösungen................................................................................ 9<br />
Abb. 2: Die Funktion elektronischer <strong>Marktplätze</strong> als Intermediare........................................ 11<br />
Abb. 3: Fokus elektronischer <strong>Marktplätze</strong>................................................................................ 13<br />
Abb. 4: <strong>Übersicht</strong> der elektronischen Beschaffungslösungen .............................................. 17<br />
Abb. 5: Einkauf über hierarchischen Produktkatalog bei Mercateo ...................................... 18<br />
Abb. 6: Das Produktportfolio von SupplyOn............................................................................ 25<br />
Abb. 7: Aufbau des SupplyOn Business Directory ................................................................. 26<br />
Abb. 8: SupplyOn Sourcing Manager- Beispiel einer Auktion ............................................... 27<br />
Abb. 9: Funktionsprinzip des SupplyOn Document Managers .............................................. 28<br />
Abb. 10: Funktionsprinzip des SupplyOn Project Manager.................................................... 29<br />
Abb. 11: SupplyOn EDI und WebEDI......................................................................................... 31<br />
Abb. 12: Funktionsprinzip des Inventory Collaboration ......................................................... 32<br />
Abb. 13: SupplyOn Performance Monitor................................................................................. 33<br />
Abb. 14: SupplyOn Projekt Management.................................................................................. 34<br />
Abb. 15: SupplyOn Problem Solver .......................................................................................... 35<br />
Abb. 16: Metamärkte ................................................................................................................... 40<br />
Tabellenverzeichnis<br />
Tab. 1: Einsparpotentiale bei Auktionen................................................................................... 20<br />
Tab. 2: <strong>Übersicht</strong> der Standards................................................................................................ 21
Abkürzungsverzeichnis 4<br />
Abkürzungsverzeichnis<br />
AGB Allgemeine Geschäftsbedingungen<br />
APQP Advanced Product Quality Planning<br />
B2B Business-to-Business<br />
B2C Business-to-Consumer<br />
BME Bundesverband für Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V.<br />
C2C Consumer-to-Consumer<br />
CPFR Collaborative Planning Forecasting and Replenishment<br />
DUNS Data Universal Numbering System<br />
EANCOM European Article Number Communication<br />
EDI Electronic Data Interchange<br />
EDIFACT Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport<br />
ETIM Elektrotechnisches Informationsmodell<br />
ISBN International Standard Book Number<br />
IT Informationstechnologie<br />
LuT Liefer- und Transportdaten<br />
MLK Multilieferantenkatalog<br />
MRO Maintenance, Repair and Operations<br />
PZN Pharmazentralnummer<br />
RFID Radio Frequency Identification<br />
SCOR Supply Chain Operation Reference-Modell<br />
UN United Nations<br />
UN/SPSC United Nations Standard Products and Services Classification<br />
VMI Vendor Managed Inventory<br />
XML Extensible Markup Language
Einleitung<br />
1 Einleitung<br />
Die modernen Kommunikationsmittel haben zweifellos wie alle Lebensbereiche auch die<br />
Welt der Wirtschaft revolutioniert. Dabei führten der globale Wettbewerb, kurze Produktlebenszyklen<br />
und immer komplexer werdende Produkte zu gestiegenen Kundenanforderungen<br />
und zur zunehmenden gegenseitigen Abhängigkeit der Unternehmen.<br />
Diesem Wandel konnte man erst mit Hilfe elektronischer Medien gerecht werden. Was<br />
anfänglich mit einfachem Austausch von Geschäftsinformationen begann, hat sich heutzutage<br />
zu hoch komplexen Informationsnetzwerken entwickelt, die aus dynamischen<br />
Wirtschaftssektoren wie der Automobil- und Elektroindustrie nicht mehr weg zu denken<br />
sind. Das Internet verbindet somit Millionen von Geschäfts- und Endkunden miteinander<br />
und ermöglicht noch nie da gewesene Möglichkeiten für die elektronische Beschaffung<br />
und den Vertrieb.<br />
In diesem Zusammenhang gewinnen elektronische <strong>Marktplätze</strong>, die eine Vielzahl von<br />
Anbietern und Kunden zusammenführen und die Geschäftspartner durch verschiedenste<br />
automatisierte Funktionalitäten unterstützen, in der globalisierten Geschäftswelt immer<br />
mehr an Bedeutung. Zu dieser Entwicklung tragen u.a. Faktoren wie die gesunkenen<br />
Teilnahmekosten für den Markt, der Druck der Geschäftspartner in bestimmten Branchen<br />
und die vielen Vorteile elektronischer <strong>Marktplätze</strong> bei. In dieser Arbeit soll der Stellenwert<br />
dieser Technologie für heutige Unternehmen anhand einer näheren Darstellung<br />
elektronischer <strong>Marktplätze</strong> und ihren Funktionalitäten verdeutlicht werden.<br />
Dazu wird im ersten Kapitel auf die Definition und die Hintergründe der Entwicklung<br />
elektronischer <strong>Marktplätze</strong> eingegangen. Anschießend erfolgen die Kategorisierung und<br />
die Erläuterung der Transaktionsmechanismen elektronischer <strong>Marktplätze</strong> und die Vorstellung<br />
von Standards, die die weite Verbreitung dieser Technologie erst ermöglichten.<br />
Im dritten Kapitel werden am Beispiel von SupplyOn, einem kollaborativen elektronischen<br />
Marktplatz, der durch die Zusammenarbeit von mehreren Automobilzulieferern<br />
entstanden ist, die einzelnen Funktionalitäten moderner <strong>Marktplätze</strong> in den Bereichen<br />
Beschaffung, Logistik und Projektmanagement näher dargestellt.<br />
<strong>Elektronische</strong> <strong>Marktplätze</strong> bergen bedeutende Potentiale zur Generierung von Mehrwert.<br />
Dieser Tatsache wird im letzten Kapitel Rechnung getragen. Ferner werden Risiken be-
Einleitung 6<br />
handelt, die für Verkäufer sowie Käufer durch die Benutzung von elektronischen <strong>Marktplätze</strong>n<br />
entstehen können. Den Schluss der Arbeit bildet ein Blick auf die Trends der vergangenen<br />
und der kommenden Jahre.
<strong>Elektronische</strong> <strong>Marktplätze</strong> 7<br />
2 <strong>Elektronische</strong> <strong>Marktplätze</strong><br />
2.1 Definition elektronischer <strong>Marktplätze</strong><br />
In der Fachliteratur ist man von einer einheitlichen Begriffsbestimmung elektronischer<br />
<strong>Marktplätze</strong> noch weit entfernt. Deshalb ist es hilfreich, zuerst die volkswirtschaftlichen<br />
Begriffe Markt und Marktplatz näher zu bestimmen, um die typischen Merkmale elektronischer<br />
Märkte auszuarbeiten.<br />
Der physische, traditionelle Markt wird von Kollmann als ein „ [...] konkreter, räumlich<br />
konzentrierter und realer Ort der Zusammenkunft von persönlich anwesenden Anbietern<br />
und Nachfragern zum Zwecke der Durchführung von wirtschaftlichen Transaktionen<br />
[...]“ 1 definiert. Das wesentliche Merkmal eines Marktes ist es, dass er eine Institution<br />
bildet, bei der sich Anbieter und Nachfrager treffen. 2 Die Teilnehmer kommen eventuell<br />
mit den charakteristischen Marktphasen der Information, Selektion, Vereinbarung und<br />
Abwicklung 3 zu einem Vertrag und tauschen Werte aus. Zusätzlich dient der Markt den<br />
Teilnehmern als ein Instrument der Preisbildung. 4<br />
Der Marktplatz ist demnach ein konkreter Ort, der einen bestimmten Ausschnitt des<br />
Marktes abbildet, innerhalb dem sich Marktteilnehmer begegnen. Er dient also als Infrastruktur<br />
für Marktveranstaltungen, bei der „ [...] ein abgrenzbarer Kreis von Marktteilnehmern<br />
zur Vorbereitung und Durchführung von Geschäften zusammenkommt.“ 5<br />
Im Vergleich dazu zeichnet sich ein elektronischer Marktplatz durch die virtuelle Anwesenheit<br />
der Marktteilnehmer und die zeitliche und räumliche Unabhängigkeit aus. Kollmann<br />
definiert in diesem Zusammenhang elektronische <strong>Marktplätze</strong> als „[…] einen konkreten<br />
nicht realen Ort der Zusammenkunft von nur über vernetzte elektronische Daten-<br />
1 Kollmann, T. (2001), S.35<br />
2 Vgl. Schmid, B. (1999), S.205<br />
3 Langenohl, T. (1994), S. 18<br />
4 Vgl. Samuelson, P. et al. (1998), S. 27<br />
5 Wimmer, F. (1993)
<strong>Elektronische</strong> <strong>Marktplätze</strong> 8<br />
leitungen miteinander verbundenen Anbietern und Nachfragern zum Zwecke der Durchführung<br />
von wirtschaftlichen Transaktionen, […] „ 6<br />
„Die virtuellen Business-to-Business <strong>Marktplätze</strong> sind dagegen Internet-Seiten, auf denen<br />
mehrere Anbieter von Waren oder Dienstleistungen und mehrere Nachfrager nach<br />
diesen Produkten zusammenkommen, um Handelstransaktionen abzuwickeln.“ 7 <strong>Elektronische</strong><br />
<strong>Marktplätze</strong> können als eine Weiterentwicklung der traditionellen Märkte betrachtet<br />
werden, in denen die Kommunikation der Marktteilnehmer mit Hilfe der Informationstechnologien<br />
optimiert wurde. Ein wesentlicher Unterschied ist jedoch, dass die<br />
Marktteilnehmer über virtuelle Märkte keinen oder einen wesentlich geringeren sozialen<br />
Kontakt aufbauen können. Für viele Anbieter ist jedoch genau dieser persönliche Kontakt<br />
von essentieller wirtschaftlicher Bedeutung, um lang anhaltende und intensive Kundenbindung<br />
zu erreichen.<br />
2.2 Entwicklungsstufen der elektronischen Beschaffung<br />
<strong>Elektronische</strong> <strong>Marktplätze</strong> sind ein Konzept der elektronischen Beschaffung (engl.: e-<br />
Procurement). Nenninger definiert den Begriff e-Procurement als „ […] die Nutzung von<br />
Informations- und Kommunikationstechnologien für die elektronische Unterstützung und<br />
Integration von Beschaffungsprozessen.“ 8 Dabei kann man zwischen zwei grundsätzlichen<br />
Konzepten der elektronischen Beschaffung unterscheiden. 9<br />
Beim bilateralen e-Procurement ist die Beschaffung auf ein einzelnes beschaffendes<br />
Unternehmen ausgerichtet, das die technische Lösung selbst betreibt oder dazu einen<br />
Dienstleister beauftragt hat. Die Lieferanten werden organisatorisch und technisch in die<br />
Lösung integriert.<br />
Beim e-Procurement über elektronische <strong>Marktplätze</strong> agieren Lieferanten nicht direkt mit<br />
den e-Procurement-Systemen der Käufer, sondern über den elektronischen Marktplatz,<br />
der als eine generalisierte Schnittstelle mit zusätzlicher Funktionalität von vielfältigen<br />
Lieferanten genutzt werden kann. 10<br />
6<br />
Kollmann, T. (2001), S. 39<br />
7<br />
Berlecon Research (1999)<br />
8<br />
Nenninger, M. (1999)<br />
9<br />
Vgl. Schabacker, F. (2001), S. 54<br />
10<br />
Vgl. Schabacker, F. (2001), S.54
<strong>Elektronische</strong> <strong>Marktplätze</strong> 9<br />
Grundsätzlich kann man im e-Procurement zwischen Buy-Side-, Sell-Side- und Marktplatzlösungen<br />
unterscheiden (s. Abb. 1). Auf die einzelnen Konzepte wird in diesem Kapitel<br />
noch näher eingegangen. Die Entwicklung dieser Lösungen hat zwar nicht parallel<br />
stattgefunden, doch das Hauptziel war bei allen gleich: Verkäufer und Käufer elektronisch<br />
zusammen zu führen, um weitestgehend automatisiert Informationen auszutauschen<br />
und Geschäftstransaktionen durchzuführen. Die ersten beiden Generationen der e-<br />
Commerce-Lösungen 11 konnten diese Intentionen jedoch nur teilweise verwirklichen, da<br />
der Fokus entweder nur auf der Käuferseite (Buy-Side) oder der Verkäuferseite (Sell-<br />
Side) lag. Die Einführung derartiger Systeme war zu Anfang mit bedeutenden Schwierigkeiten<br />
verbunden. So waren beispielsweise nur große Unternehmen dazu fähig, die<br />
hohen Anbindungskosten zu finanzieren. Erst die dritte Generation des e-Commerce<br />
ermöglichte mit seinen elektronischen <strong>Marktplätze</strong>n die Vorteile der Sell-Side-Lösung<br />
für den Verkäufer mit den Vorteilen der Buy-Side-Lösung für den Käufer zu vereini-<br />
gen. 12<br />
Abb. 1: Buy-Side- und Sell-Side-Lösungen (in Anlehnung an: Schubert (2000))<br />
2.2.1 Sell- Side- Lösungen<br />
Die erste Generation des e-Commerce war verkäuferorientiert (Sell-Side) und wurde mit<br />
den Absichten entwickelt, die Vertriebskosten durch die Automatisierung von Prozessen<br />
zu minimieren (beispielsweise die Automatisierung des Auftragseingangs und der Auftragsabwicklung)<br />
und durch die Gründung von E-Shops das Angebotsportfolio 24 Stunden<br />
am Tag und 7 Tage die Woche Kunden zugänglich zu machen. Der Kunde bekam<br />
die Möglichkeit, Aufträge online zu setzen und im Idealfall den aktuellen Status seines<br />
Auftrages zu verfolgen (tracking & tracing). Man erhoffte sich durch eine erhöhte Kun-<br />
11 Electronic Commerce ist die Gesamtheit aller Mechanismen, Prozesse und Bausteine zur in formationstechnischen<br />
Unterstützung von Handelstransaktionen zwischen Marktteilnehmern (Merz (1998), S. 18)<br />
12 Vgl. Net Market Makers (1999), S.4
<strong>Elektronische</strong> <strong>Marktplätze</strong> 10<br />
denzufriedenheit und –bindung bessere Absatzzahlen zu erzielen. Jedoch war diese<br />
Technologie für den professionellen Business-to-Business-Einkäufer weniger von Interesse,<br />
da vorhandenen Geschäftsbeziehungen zu den Verkäufern und die speziell verhandelten<br />
Preise und Konditionen bei den Einkaufsprozessen keine Beachtung fanden. Als<br />
Reaktion dazu wurden individuelle Sell-Side-Lösungen entwickelt, bei der diese<br />
Faktoren berücksichtigt wurden. Das Problem, dass sich Käufer in den<br />
unterschiedlichsten Lösungen ihrer Zulieferer zurechtfinden mussten, bestand jedoch<br />
weiterhin.<br />
2.2.2 Buy- Side- Lösungen<br />
Bei der Entwicklung von Buy-Side-Lösungen haben sich die Käufer besonders an den<br />
positiven Erfahrungen und den offen gebliebenen Herausforderungen der verkäuferseitigen<br />
Anwendungen orientiert. Man hat den Fokus dieser Technologie auf den elektronischen<br />
Geschäftsverkehr aus Sicht des Käufers gelegt und die gesamten Prozesse für den<br />
professionellen Einkauf so angepasst, dass eine optimale Abwicklung der Beschaffungsprozesse<br />
sichergestellt wurde. 13<br />
Diese Lösung erlaubte es dem Einkäufer, die vielen verschiedenen Verkäufer und deren<br />
Produkte mittels Multilieferantenkataloge (MLK) zu vergleichen und transparent darzustellen.<br />
14 Die Einkäufer mussten sich dadurch nicht mehr in die verschiedensten Prozesse<br />
und Masken der Sell-Side-Lösungen einarbeiten. Buy-Side-Lösungen ermöglichten die<br />
Umsetzung von unternehmensindividuellen Einkaufsprozessen (wie zum Beispiel interne<br />
Genehmigungsverfahren). Zusätzlich ließ sich diese Technologie viel leichter an die Backend-Systeme<br />
des Einkäufers anbinden, da es nicht mehr notwendig war, mehrere voneinander<br />
unabhängige Sell-Side-Lösungen mit vollständigen Schnittstellen an das eigene<br />
System zu integrieren.<br />
Käuferseitige Systeme sind jedoch sehr komplex und erfordern zur Einführung und zum<br />
Betrieb ein tiefes IT-Verständnis. Außerdem ist ihre Ankopplung an Verkäufer von bestimmten<br />
Faktoren abhängig. So sind Buy-Side-Lösungen beispielsweise nur für Verkäufer<br />
interessant, die mit dem Käufer ein entsprechendes Handelsvolumen aufweisen können.<br />
Deshalb kann diese Technologie nur von Unternehmen eingesetzt werden, die die<br />
13 Vgl. Pörnig, T. et al. (2000)<br />
14 Vgl. Hepp, M. et al. (2005), S.4
<strong>Elektronische</strong> <strong>Marktplätze</strong> 11<br />
entsprechenden IT-Kompetenzen besitzen und ein bestimmtes Einkaufsvolumen erreicht<br />
haben. 15<br />
2.2.3 <strong>Elektronische</strong>r Marktplatz<br />
<strong>Elektronische</strong> <strong>Marktplätze</strong> verbinden die Vorteile der Buy-Side- und Sell-Side-Lösungen<br />
und bieten besonders für die Unternehmen eine Alternative, die finanziell und technisch<br />
nicht in der Lage sind, eigene Lösungen einzusetzen. Bei diesem Konzept werden das<br />
Vertriebssystem des Verkäufers und das Beschaffungssystem des Käufers durch homogenisierte<br />
Schnittstellen an den elektronischen Marktplatz angebunden. Das bedeutet,<br />
dass Geschäftstransaktionen nicht direkt mit dem Geschäftspartner abgewickelt werden.<br />
Vielmehr laufen die Prozesse über den elektronischen Marktplatz ab, der die Funktion<br />
eines Intermediär hat (s. Abb. 2). 16 Ein e-Markt schafft bei Transaktionen u.a. durch zusätzliche<br />
Dienstleistungen einen Mehrwert und stellt deshalb für die Geschäftspartner<br />
und den Betreiber des Marktplatzes einen Anreiz dar. Dies können schlichte Dienstleistungen<br />
sein, wie beispielsweise die Zusammenführung von Anbieter und Nachfrager (<br />
buyer/seller matching), Statusüberwachung von Bestellungen (order status tracking) oder<br />
Transaktionsmanagement. 17 Aber besonders weiterentwickelte Funktionen zur Optimierung<br />
des Lieferantenmanagements, der Beschaffung und vor allem die bessere Koordination<br />
der Prozesse in der gesamten Supply Chain machen diese Technologie für eine Vielzahl<br />
von Teilnehmer interessant.<br />
Abb. 2: Die Funktion elektronischer <strong>Marktplätze</strong> als Intermediare (in Anlehnung an Fieten (2002))<br />
15<br />
Vgl. Tanner, C. et al. (2002), S.3<br />
16<br />
Vgl. Weller, T. (2002)<br />
17<br />
Vgl. Bärwolff, M. (2003), S.8
<strong>Elektronische</strong> <strong>Marktplätze</strong> 12<br />
Das e-Market-Konzept eröffnet besonders für kleine und mittelständische Unternehmen<br />
die Möglichkeiten des kostengünstigen weltweiten Vertriebs und Einkaufs. 18 Die IT-<br />
Infrastruktur wird dabei vom Marktplatzbetreiber zur Verfügung gestellt und gepflegt,<br />
wodurch sich hohe Investitionen für die Käufer und Verkäufer erübrigen. Für den Verkäufer<br />
ist der e-Markt im Vergleich zu Buy- Side Lösung interessanter, da das potentielle<br />
Handelsvolumen auf dem Markt viel höher ist als das allein stehende Einkaufsvolumen<br />
der vorhandenen Kunden. <strong>Elektronische</strong> <strong>Marktplätze</strong> sind aus diesen Gründen heute für<br />
die meisten Unternehmen die attraktivste Form des e-Commerce. 19<br />
2.3 Formen von elektronischen <strong>Marktplätze</strong>n<br />
Trotzt der vielen verschiedenen Kategorisierungsmerkmale für elektronische <strong>Marktplätze</strong><br />
in der Fachliteratur können gemeinsame Ansätze erkannt werden. Die unterschiedlichen<br />
Intentionen der Marktbetreiber ermöglichen es, im Wesentlichen 4 Kriterien herauszukristallisieren.<br />
20 Demnach kann eine Unterscheidung nach folgenden Gesichtspunkten<br />
erfolgen:<br />
• Fokus des Marktplatzes<br />
• Zugang zum Marktplatz<br />
• Teilnehmerbeziehungen des Marktplatzes<br />
• Betreiber des Marktplatzes<br />
2.3.1 Fokus des elektronischen Marktplatzes<br />
Die auf e-Märkten angebotenen Güter und Dienstleistungen können nach Zielgruppen<br />
spezifiziert werden. Dabei unterscheidet man, ob Produkte und Dienstleistungen auf<br />
<strong>Marktplätze</strong>n entweder nur für bestimmte Kunden und Branchen relevant sind oder ob<br />
die Vermarktung branchenübergreifend erfolgen soll.<br />
Vertikale e-Märkte sind industriespezifisch und haben ihren Fokus auf eine bestimmte<br />
Wirtschaftsbranche, für die nur bestimmte Produktgruppen und Dienstleistungen in Frage<br />
kommen. 21 Diese Konzentration ermöglicht den Betreibern der Plattformen eine optimale<br />
18<br />
Vgl. Fieten, R. (2001), S.24-26<br />
19<br />
Vgl. Kaplan, S.( 2001)<br />
20<br />
Vgl. Fieten, R. (2001), S.16 und Grieger, M. (2003)<br />
21<br />
Vgl. Minderlein, M. (2002), S.2
<strong>Elektronische</strong> <strong>Marktplätze</strong> 13<br />
Einstellung auf die speziellen Anforderungen der gehandelten Güter. Für die Betreiber<br />
vertikaler <strong>Marktplätze</strong> sind gute Branchenkenntnisse von essentieller Bedeutung. In diesem<br />
Zusammenhang sind viele Betreiber vertikaler <strong>Marktplätze</strong> entweder selbst als aktive<br />
Marktteilnehmer auf dem Markt tätig oder beschäftigen Branchenexperten, die das<br />
notwendige Wissen mitbringen. Klassische Vertreter sind in den Bereichen Automobilindustrie,<br />
Energiewirtschaft und Chemie zu finden. Der Marktplatz cc-chemplorer, 22 der<br />
sich auf Produkte der chemischen und pharmazeutischen Industrie spezialisiert hat sowie<br />
Covisint, 23 der größte elektronische Marktplatz der Automobilindustrie, sind als <strong>Beispiele</strong><br />
zu erwähnen.<br />
Abb. 3: Fokus elektronischer <strong>Marktplätze</strong> (in Anlehnung an Fieten (2001))<br />
Die Zielgruppe horizontaler <strong>Marktplätze</strong> ist durch die angebotenen Güter und Dienstleistungen<br />
dagegen stets branchenübergreifend. Die Produkte werden in fast allen Unternehmen<br />
jedes Wirtschaftszweiges benötigt. Hierzu zählen vor allem MRO-Materialien,<br />
einfache Dienstleistungen und Güter der Informationstechnik. Es handelt sich also um<br />
überwiegend standardisierte und allgemein gebräuchlich Produkte, die gar nicht oder nur<br />
bedingt in den eigentlichen Produktionsprozess eingehen. Die Güter, die auf dem größten<br />
22 unter: www.cc-chemplorer.com<br />
23 unter: www.covisint.com
<strong>Elektronische</strong> <strong>Marktplätze</strong> 14<br />
B2B-Marktplatz Deutschlands Mercateo 24 gehandelt werden, können von der Finanzbranche<br />
also genauso genutzt werden wie von der Automobilbranche.<br />
2.3.2 Zugang zum elektronischen Marktplatz<br />
Vor der Benutzung eines elektronischen Marktplatzes müssen sich die Teilnehmer<br />
grundsätzlich registrieren. Wenn dieser Prozess der Registrierung und Zulassung ohne<br />
Beschränkung für jeden potentiellen Marktteilnehmer möglich ist, spricht man von offenen<br />
<strong>Marktplätze</strong>n. Einige wenige offene <strong>Marktplätze</strong> können jedoch vor der Benutzung<br />
des Marktes bestimmte Attribute (wie beispielsweise einen bestimmten Umsatz oder eine<br />
Mindestqualitätsanforderung für die angebotenen Produkte) verlangen. Der überwiegende<br />
Teil der heutigen <strong>Marktplätze</strong> fallen unter diese Kategorie.<br />
Bei geschlossenen <strong>Marktplätze</strong>n ist die Aufnahme von neuen Geschäftspartnern nur über<br />
vergleichsweise komplexe Prozesse in der realen Welt möglich. Kandidaten, die einen<br />
geschlossenen Markt benutzen möchten, müssen zuerst individuell von der Verkäuferund<br />
Käufergemeinschaft zugelassen oder eingeladen werden. Gewöhnlich sind horizontale<br />
Märkte offen. Mit zunehmendem vertikalen Charakter des e-Marktes wird der Zugang<br />
jedoch begrenzt und diese so genannten semi-offenen Modelle sind dann nur noch bestimmten<br />
Nutzergruppen nach Branche und Region zugänglich. 25<br />
2.3.3 Teilnehmerbeziehungen des elektronischen Marktplatzes<br />
Ein weiteres Unterscheidungskriterium für elektronische <strong>Marktplätze</strong> ist der juristische<br />
Stand der Geschäftspartner. Die elektronische Handelstransaktionen finden nicht nur<br />
zwischen Unternehmen (B2B- Business to Business) statt, sondern auch unter Unternehmen<br />
und Konsumenten (B2C- Business to Consumer) oder zwischen Konsumenten<br />
untereinander (C2C- Consumer to Consumer). Dabei muss berücksichtigt werden, dass<br />
die verschiedenen Kombinationen unterschiedliche Anforderungen an den Marktplatz<br />
stellen. Bei der Errichtung der Schnittstelle eines elektronischen Marktes zu einem Unternehmen<br />
muss auf die Integrationsfähigkeit mit den Backend- System geachtet werden,<br />
wohingegen bei den Konsumenten die Benutzerfreundlichkeit eine dominierende Rolle<br />
spielt.<br />
24 unter: www.mercateo.de<br />
25 Vgl. Nenninger, M. et al. (2002), S. 43
<strong>Elektronische</strong> <strong>Marktplätze</strong> 15<br />
2.3.4 Betreibermodelle elektronischer <strong>Marktplätze</strong><br />
Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Betreibermodelle von elektronischen <strong>Marktplätze</strong>n,<br />
bei denen die Betreiber jeweils unterschiedliche Intentionen verfolgen. 26<br />
Verkäufergetriebene E-<strong>Marktplätze</strong>, auch angebotsseitige <strong>Marktplätze</strong> genannt, sind in<br />
der Regel eher selten, weil sie nicht dem Interesse der Verkäufer dienen. Durch die Möglichkeit<br />
des Käufers, auf <strong>Marktplätze</strong>n mit Preisvergleichsfunktion die Produkte verschiedener<br />
Hersteller vergleichen zu können, erhöht sich der Kostendruck, was unvorteilhaft<br />
für den Betreiber ist. Deshalb werden die Betreiber versuchen, <strong>Marktplätze</strong> zu<br />
gründen, auf denen sie ihre Produkte informationsorientiert vermarkten und ihren<br />
Schwerpunkt auf Differenzierungsmerkmale ihrer Angebote legen können. 27 Es können<br />
sich beispielsweise verschiedene Unternehmen einer Branche zu einem Konsortium zusammenschließen<br />
und einen Markt gründen, um ihren Kunden ein optimales Gesamtportfolio<br />
direkt aus den Händen der Anbieter zur Verfügung zu stellen.<br />
Omnexus 28 ist ein typisches Beispiel für einen verkäufergetriebenen Markt, der von<br />
Chemie-Riesen wie Bayer, BASF, Dupont und DOW gegründet wurde. Auf Omnexus<br />
können Käufer unter anderem Produkt- und Preisvergleiche erstellen und haben einen<br />
Online-Produktkatalogen zur Verfügung.<br />
Käufergetriebene <strong>Marktplätze</strong> haben zum Ziel, die optimalsten Geschäftspartner zu finden<br />
und die Kosten der Lieferantensuche zu senken. 29 Wird ein Bedarf nicht durch einen<br />
optimalen Zulieferer gedeckt, können eventuell nicht bedarfsgerechte oder verteuerte<br />
Produkte höhere Kosten beim Käufer verursachen. Ferner erreicht man durch einen e-<br />
Markt höhere Preistransparenz und kann geringere Einkaufspreise erzielen. Ein nachfrageseitiger<br />
Marktplatz entsteht entweder dadurch, dass ein Unternehmen seine erfolgreiche<br />
Buy-Side-Lösung als Chance erkennt und durch die Erweiterung zu einem elektronischen<br />
Marktplatz auch andere Lieferanten an sich binden möchte oder dass sich mehrere<br />
Unternehmen zu einem Beschaffungsverbund zusammenschließen und einen Marktplatz<br />
betreiben, um beispielsweise durch Beschaffungsbündelung Einkaufkosten zu reduzieren.<br />
26 Vgl. Forzi, T. (2005), S. 2ff.<br />
27 Vgl. Bakos , Y. (1998), S.12<br />
28 unter: www.omnexus.com<br />
29 Vgl. Bakos, Y. (1997), S.15
<strong>Elektronische</strong> <strong>Marktplätze</strong> 16<br />
SupplyOn 30 ist als Einkaufsplattform der Automobilzuliefererindustrie ein typischer Vertreter<br />
für Buy-Side-<strong>Marktplätze</strong>.<br />
Zu der dritten Kategorie zählen die neutralen <strong>Marktplätze</strong> -so genannte Broker Plattformen-<br />
die mit der Absicht gegründet werden, einen Teil des Mehrwertes, der für die Nutzer<br />
des e-Marktes entsteht, als Gebühren abzuschöpfen. 31 Dabei beteiligen sich die<br />
Betreiber nicht als Käufer oder Verkäufer auf dem Markt, sondern handeln als<br />
Dienstleister. Solche Intermediäre bieten den Vorteil, dass sie die Marktplatzdienstleistungen<br />
mit zusätzlichen Funktionen wie Logistik und Finanzierung kombinieren und eine<br />
von Unternehmen unabhängige neutrale Plattform zur Verfügung stellen, von der alle<br />
Marktteilnehmer profitieren.<br />
2.3.5 Abgrenzung elektronischer <strong>Marktplätze</strong><br />
<strong>Elektronische</strong> <strong>Marktplätze</strong> sind durch eine n:m-Beziehung gekennzeichnet, d.h. zahlreiche<br />
Anbieter treffen auf dem Markt auf eine Vielzahl von Käufern. Die in Kapitel 2.2.1<br />
und 2.2.2 vorgestellten Buy-Side- bzw. Sell-Side-Lösungen, die ein Unternehmen mit<br />
seinen Zulieferern bzw. Kunden verbinden, weisen eine n:1- bzw. eine 1:m- Beziehung<br />
auf. Zwischen derartigen Einkaufs- bzw. Verkaufsplattformen (e-Shops) und den in Kapitel<br />
2.3.4 vorgestellten käufergetriebenen (Buy-Side-Marktplatz) und verkäufergetriebenen<br />
<strong>Marktplätze</strong>n (Sell-Side-Marktplatz), die durch die Zusammenarbeit von mehreren<br />
einkaufenden oder verkaufenden Unternehmen entstanden sind (Konsortien) und bei denen<br />
stets eine m:n- Beziehung herrscht, ist zu unterscheiden. Zur besseren <strong>Übersicht</strong> über<br />
elektronische Beschaffungslösungen soll Abb. 4 dienen.<br />
30 www.supplyon.com<br />
31 Vgl. Bakos, Y. (1997), S.16
<strong>Elektronische</strong> <strong>Marktplätze</strong> 17<br />
Abb. 4: <strong>Übersicht</strong> der elektronischen Beschaffungslösungen (in Anlehnung an Iksal, C. (2001), S. 57)<br />
2.4 Transaktionsmechanismen elektronischer <strong>Marktplätze</strong><br />
Zur Bildung des optimalen Preises verwenden elektronische <strong>Marktplätze</strong> verschiedene<br />
Instrumente der Preisbildung. Zu den Wichtigsten zählen Kataloge, Auktionen, Ausschreibungen<br />
und Börsen, auf die in diesem Kapitel näher eingegangen wird. 32<br />
2.4.1 Kataloge<br />
Verkäufer haben auf den meisten elektronischen <strong>Marktplätze</strong>n die Möglichkeit ihr Produktportfolio<br />
mittels Katalogsysteme ihren potentiellen Kunden zu präsentieren. Die<br />
Kunden greifen über den Marktplatz auf die Kataloge zu. Das bedeutet, dass eine Vielzahl<br />
von Katalogen der verschiedenen Verkäufer durch den Marktplatzbetreiber gesammelt,<br />
zu einem Gesamtkatalog zusammengefasst und den Käufern zugänglich gemacht<br />
werden. Der Käufer erhält somit die Möglichkeit, sich über Produkte zu informieren und<br />
sie miteinander zu vergleichen. Ein weiterer Nutzen besteht darin, dass Angebote herstellerunabhängig<br />
und produktbezogen gesucht werden können und durch die Prozessautomatisierung<br />
zwischen Käufern und Verkäufern die Transaktionskosten reduziert werden.<br />
Für die Beschaffung über Kataloge sind besonders Produkte eignet, die relativ feste Preise<br />
aufweisen und deren Beschaffung mit hohen Suchkosten verbunden sind. Dazu zählen<br />
vor allem indirekte Güter (C-Güter), also Artikel mit hohem Bestellaufwand bei niedrigem<br />
Wert, die sich in Produktkatalogen optimal beschreiben lassen.<br />
32 in Anlehnung an Wirtz, B. (2001), S. 192
<strong>Elektronische</strong> <strong>Marktplätze</strong> 18<br />
Die Katalogdaten werden dabei von den Anbietern in Form von standardisierten Katalogformaten<br />
(s. Kapitel 2.5.1 für Katalogstandards) an den Marktplatzbetreiber übertragen.<br />
Moderne <strong>Marktplätze</strong> bieten Funktionen, die für die Synchronisierung der Katalogdaten<br />
auf dem Marktplatz und im Backend-System des Verkäufers sorgen, um damit die Aktualisierung<br />
und Pflege der Daten zu erleichtern.<br />
Der Online-Marktplatz Mercateo bietet zum Beispiel in seinem Multilieferantenkatalog<br />
über 3,5 Mio. Artikel von über 10.000 Herstellern und 355 Handelspartnern 33 und ist<br />
somit einer der führenden Online-Händler für Geschäftskunden aller Branchen. Unter<br />
www.mercateo.com finden Geschäftskunden in verschiedenen Produktkategorien ein<br />
umfangreiches B2B-Sortiment von Büromaterial über Labor- und IT-Bedarf bis hin zur<br />
Betriebs- und Lagerausstattung.<br />
Abb. 5: Einkauf über hierarchischen Produktkatalog bei Mercateo (Quelle: www.mercateo.de)<br />
2.4.2 Auktionen und Ausschreibungen (Reverse Auctions)<br />
Die Verbreitung des Internets und die damit entstandene Möglichkeit, zeit- und ortsgebunden<br />
Gebote abgeben zu können, haben dazu geführt, dass Auktionen, eine der ältesten<br />
33 http://www.mercateo.com/pages/firma-unternehmen/unternehmen.html (Stand 08.02.2008)
<strong>Elektronische</strong> <strong>Marktplätze</strong> 19<br />
Handelsformen, zunehmend online realisiert werden. Dabei haben sich besonders die<br />
klassische Auktion und die reverse Auktion auf elektronischen <strong>Marktplätze</strong>n etabliert.<br />
Bei der klassischen Auktion wird der Preis vom Käufer bestimmt. Den Zuschlag für das<br />
Angebot erhält dabei derjenige, der das höchste Gebot in einem vordefinierten Zeitraum<br />
abgegeben hat. Reverse Auktionen sind Ausschreibungen, bei denen um eine Nachfrage<br />
absteigend geboten wird, wobei das niedrigste Gebot den Zuschlag erhält. 34 Sie werden<br />
deshalb auch „Auktionen für Einkäufer“ genannt. 35 Für Einkäufer stellen Ausschreibungen<br />
eine günstige, planungssichere und ungewöhnlich markttransparente Einkaufsoption<br />
dar. 36 Darüber hinaus gibt es weitere Auktionsmechanismen in verschiedenen Konstellationen<br />
wie beispielsweise die Vickrey und First-Price Sealed Bid Auktionen, auf die hier<br />
jedoch nicht näher eingegangen wird.<br />
Während bei herkömmlichen Auktionen die Zulieferer im Mittelpunkt des One-to-Many-<br />
Marktmechanismuses stehen, sind es bei reversen Auktionen die Einkäufer. Ein Käufer<br />
bittet in einer reversen Auktion bei einer Gruppe in Frage kommender Zulieferer um Angebote.<br />
Der Einkäufer profitiert von diesem Transaktionsmodell durch die Einholung des<br />
niedrigsten Angebots.<br />
Mit 212 Mio. registrierten Benutzern ist Ebay ohne Zweifel die bekannteste Plattform für<br />
klassische Auktionen. Ebay ist mittlerweile in 33 internationalen Märkten auf vier Kontinenten<br />
präsent. Weniger bekannt ist dagegen eBay Business, der B2B-Marktplatz für<br />
Unternehmen, Betriebe, Handwerker, Unternehmensgründer und Insolvenzverwerter aus<br />
unterschiedlichsten Branchen wie der Bauindustrie, Metallindustrie, Medizin und vielen<br />
mehr. Auf diesem Marktplatz sind insbesondere Investitionsgüter, Sonderposten und<br />
Insolvenzwaren zu ersteigern. 37<br />
Aufgrund der dynamischen Preisfindung können bei Auktionen und Ausschreibungen<br />
innerhalb kürzester Zeit hohe Einsparungen erzielt werden. So sind beispielsweise laut<br />
IBM Consulting bei der Beschaffung von Büromaterial über Auktionen durchschnittlich<br />
15% Einsparungen möglich. Darüber hinaus sind im Bereich Haustechnik & Verwaltung,<br />
34 Vgl. Kellermann, K. (2005), S.71<br />
35 Vgl. Arndt, T. (2002), S. 89<br />
36 Vgl. Biethahn, J. (2002), S. 171<br />
37 http://pages.ebay.de/aboutebay.html?_trksid=m40
<strong>Elektronische</strong> <strong>Marktplätze</strong> 20<br />
Informationstechnologie und Leasing von Firmenwagen ebenfalls enorme Kostenreduzierungen<br />
erzielbar (s. Tab. 1). 38<br />
2.4.3 Börsen<br />
Tab. 1: Einsparpotentiale bei Auktionen (Quelle: IBM)<br />
Börsen fungieren als Matching-Systeme, die die Koordinationsfunktion für das Angebot<br />
und die Nachfrage übernehmen. Die Preisfindung auf Börsen erfolgt dynamisch, d.h. es<br />
findet eine gleichzeitige Abgabe von Angebots- und Nachfragegeboten statt. Der Käufer<br />
erstellt dabei sein Gebot auf dem Marktplatz, ohne die potentiellen Lieferanten direkt zu<br />
kontaktieren. Anhand der eingetragenen Gebotskriterien selektiert das Matching-System<br />
eine Reihe von geeigneten Verkäufern und leitet das Gebot an diese weiter. Diese können<br />
das Gebot dann annehmen oder ablehnen. Der Käufer kann anschließend unter den abgegebenen<br />
Angeboten das Beste wählen.<br />
Börsen bieten besonders den Vorteil der Anonymität bei der Gebotsabgabe. Bei einigen<br />
<strong>Marktplätze</strong>n besteht auch die Möglichkeit, dass der Marktplatzbetreiber während der<br />
Angebots- und Vertragsphase als Zwischenhändler agiert, wodurch strategische Informationen<br />
und Rückschlüsse auf die Solvenz des Käufers für den Verkäufer unbekannt blei-<br />
ben. 39<br />
38 http://www-05.ibm.com/services/ch/bcs/bcsserv/scm/download_scm/e_sourcing_factsheet.pdf<br />
(Stand: 11.02.2008)<br />
39<br />
Vgl. Hepp, M. (2005), S.8
<strong>Elektronische</strong> <strong>Marktplätze</strong> 21<br />
2.5 Standards<br />
Die unterschiedlichen Systeme und die Vielzahl der Benutzer eines Marktplatzes erfordern<br />
eine „gemeinsame Sprache“, mit der die Geschäftspartner optimal kommunizieren<br />
können. Dies wird durch die Benutzung von Standards erreicht. Diese Standards sind<br />
häufig Charakteristika und zugleich Hemmschwelle elektronischer <strong>Marktplätze</strong>. Ohne<br />
Standards müssten sämtliche technische und betriebswirtschaftliche Transaktionen individuell<br />
zwischen Abnehmer und Verkäufer vereinbart werden. Die Anzahl und Einsatzbereiche<br />
der heute eingesetzten Standards ist sehr breit. Standards können nach ihrem<br />
Einsatzbereich in Katalogstandards, Transaktionsstandards, Prozessstandards und Identifikations-<br />
und Klassifikationsstandards unterteilt werden. 40 Tabelle 2 gibt eine <strong>Übersicht</strong><br />
über die wichtigsten Standards, die nun näher erläutert werden sollen.<br />
2.5.1 Katalogstandards<br />
Tab. 2: <strong>Übersicht</strong> der Standards (Quelle: Prozeus (2007))<br />
Katalogstandards dienen dem reibungslosen Austausch von Produktkatalogen zwischen<br />
Geschäftspartnern und der Festlegung der entsprechenden Datenstruktur, um eine fehlerfreie<br />
Datenübertragung zu ermöglichen. <strong>Elektronische</strong> <strong>Marktplätze</strong> stellen die unterschiedlichen<br />
Produktkataloge der Lieferanten auf einer gemeinsamen Plattform dar. Die-<br />
40 Prozeus (2007), S.1ff.<br />
Art Einsatz Standard<br />
Identifikationsstandards<br />
Zur eindeutigen Identifikation von Produkten<br />
und Firmen<br />
Klassifikationsstandards Zur einfachen Suche nach Produkten<br />
Katalogaustauschformate<br />
Transaktionsstandards<br />
Prozessstandards<br />
Zum Datenaustausch zwischen Anbieter<br />
und Kunden<br />
Als Basis für die Automatisierung von<br />
Geschäftsprozessen<br />
Zur Automatisierung komplexer Geschäftsabläufe<br />
DUNS®, EAN/GTIN, EPC,<br />
GRAI/GIAI,<br />
ILN/GLN,NVE/SSCC, PZN,<br />
UPIK<br />
eCl@ss, ETIM, GPC,<br />
proficl@ss, UNSPSC<br />
BMEcat, cXML, Datanorm,<br />
Eldanorm, PRICAT, RosettaNet,<br />
xCBL<br />
EANCOM®, EDIFICE,<br />
GS1-XML, OAGIS, ODET-<br />
TE, openTRANS, RosettaNet,<br />
UBL<br />
ECR, ebXML, RosettaNet,<br />
SCOR
<strong>Elektronische</strong> <strong>Marktplätze</strong> 22<br />
se Kataloge werden in Form einer standardisierten Katalogdatei von den Verkäufern eingespielt.<br />
BMEcat ist z.B. ein vom Bundesverband für Materialwirtschaft, Einkauf und<br />
Logistik entwickelter Standard zum Austausch von Katalogdaten auf XML-Basis, der<br />
ausschließlich im deutschsprachigen Raum verwendet wird. 41 Im internationalen Umfeld<br />
sind besonders die Formate cXML und RosettaNet von Bedeutung. RosettaNet wird besonders<br />
in der Elektroindustrie zur Optimierung der Supply Chain eingesetzt.<br />
2.5.2 Transaktionsstandards<br />
Transaktionsstandards legen die Struktur und die Semantik der Geschäftsdaten (wie beispielsweise<br />
Rechnungen oder Bestellungen) fest, die zwischen den Geschäftspartnern<br />
ausgetauscht werden. Ein weltweit verbreiteter Standard ist EDIFACT (Electronic Data<br />
Interchange for Administration, Commerce and Transport). Der von der UN entwickelte<br />
Standard kann branchenübergreifend verwendet werden. So gibt es beispielsweise das<br />
Untersystem EDITEX für die Textilindustrie oder EANCOM für die Konsumgüterwirtschaft.<br />
2.5.3 Prozessstandards<br />
Prozessstandards dienen als Grundlage zur Automatisierung und Optimierung von komplexen<br />
Geschäftsprozessen. Dazu zählen unter anderem die automatische Bearbeitung<br />
von Auftragseingängen, gemeinsame Bedarfsvorhersagen (Joint Forecasting), Vendor<br />
Managed Inventory und CPFR (Collaborative Planning Forecasting and Replenishment),<br />
bei dem die Geschäftspartner von der Geschäftsplanung bis zu Replenishment-<br />
Aktivitäten zusammenarbeiten.<br />
2.5.4 Identifikations- und Klassifikationsstandards<br />
Identifikationsstandards wie die ISBN- Nummer bei Büchern oder der Barcode bei Konsumgütern<br />
sollen Produkte weltweit eindeutig kennzeichnen. EAN ist der bekannteste<br />
Identifikationsstandard, der Informationen zum Produkt, zum Herstellungsland und zum<br />
Hersteller enthält. Experten erwarten, dass in diesem Bereich in naher Zukunft die Radiofrequenztechnologie<br />
(RFID) enorm an Bedeutung gewinnen wird.<br />
41 unter: http://www.bmecat.org
<strong>Elektronische</strong> <strong>Marktplätze</strong> 23<br />
Der Einsatz von Klassifikationsstandards erleichtert für die Kunden die Suche nach bestimmten<br />
Produkten innerhalb eines Katalogs. Produkte lassen sich durch Standards wie<br />
eCl@ass oder UN/SPSC (United Nations Standard Products and Services Classification)<br />
in Warengruppen und Untergruppen zuordnen, weltweit einheitlich beschreiben und nach<br />
bestimmten Synonymen und Schlagworten suchen.
Funktionalitäten elektronischer <strong>Marktplätze</strong> am Beispiel SupplyOn 24<br />
3 Funktionalitäten elektronischer <strong>Marktplätze</strong> am<br />
Beispiel SupplyOn<br />
3.1 Vorstellung von SupplyOn<br />
SupplyOn ist ein im Sommer 2000 auf Initiative von mehreren führenden Automobilzulieferern<br />
ins Leben gerufener, geschlossener elektronischer Marktplatz.<br />
Das Unternehmen mit dem Hauptsitz in Hallbergmoos bei München ist der größte Anbieter<br />
von webbasierten Services für Supply Chain Management in der Automobil- und Fertigungsindustrie.<br />
Prozentual sind folgende Firmen an SupplyOn beteiligt, 42 die in den<br />
ersten 3 Jahren nach der Gründung insgesamt 50 Mio. € in das Unternehmen investierten:<br />
• Robert Bosch GmbH : 30,50 %<br />
• ZF Friedrichshafen AG : 12,25 %<br />
• Continental AG : 30,50 %<br />
• Schaeffler Gruppe : 15,25 %<br />
• SAP AG : 8,50 %<br />
Weltweit wickeln drei Viertel aller Tier-1-Zulieferer der Automobilindustrie ein Transaktionsvolumen<br />
von über 50 Milliarden Euro pro Jahr über SupplyOn ab, darunter Kunden<br />
wie BERU, BMW, Hella, MANN+HUMMEL, Schindler, Webasto und ZF. 43<br />
SupplyOn bietet seinen Kunden integrierte Lösungen für die Bereiche Einkauf, Verkauf,<br />
Logistik, Engineering und Qualitätsmanagement an, die zur Optimierung des operativen<br />
Tagesgeschäfts dienen. Das Gründungsziel war es, eine Plattform zu schaffen, bei der<br />
durch standardisierte Geschäftsprozesse und einheitliche Formate, Produkte von der Idee<br />
bis zur Auslieferung abgebildet werden können. Man hat dabei auf die einheitliche<br />
Kommunikation viel Wert gelegt, da in der Automobilbranche das Verhältnis zwischen<br />
Lieferanten und Kunden sehr stark von Informationsflüssen geprägt ist.<br />
Durch die Nutzung von SupplyOn hat man die Möglichkeit Prozesskosten zu reduzieren,<br />
die Logistik zu optimieren und die nationale sowie internationale Verflechtung der Au-<br />
42 www.supplyon.com/anteilseigner.html (Stand: 26.6.2008)<br />
43 www.supplyon.com
Funktionalitäten elektronischer <strong>Marktplätze</strong> am Beispiel SupplyOn 25<br />
tomobilbranche zu fördern. Die Plattform soll auch mittelständischen Unternehmen einen<br />
engen Kontakt zu zahlreichen Kunden ermöglichen, ohne dass diese hohe Summen für<br />
neue IT-Systeme investieren müssen.<br />
3.2 Funktionalitäten von SupplyOn<br />
SupplyOn bietet seinen Kunden ein umfassendes Portfolio im Bereich Engineering,<br />
Sourcing, Logistik und Qualität an (s. Abb. 6), mit dem die Abwicklung von Geschäftsprozessen<br />
von der Produktidee über die Entwicklung bis hin zur Serienproduktion<br />
schnell, effizient und ohne Medienbrüche möglich ist. In diesem Kapitel erfolgt nun die<br />
Vorstellung der einzelnen Services des Gesamtportfolios.<br />
3.2.1 Sourcing & Engineering<br />
Abb. 6: Das Produktportfolio von SupplyOn (Quelle: SupplyOn)<br />
3.2.1.1 SupplyOn Business Directory<br />
Business Directory von SuppyOn ist ein international ausgerichtetes Lieferantenverzeichnis,<br />
in dem detaillierte Informationen über die in SupplyOn registrierten Unternehmen<br />
hinterlegt sind. Dazu gehören unter anderem Kontaktinformationen, Zertifikate und
Funktionalitäten elektronischer <strong>Marktplätze</strong> am Beispiel SupplyOn 26<br />
ein nach Materialgruppen zugeordnetes Produktportfolio (s. Abb. 7). Im Lieferantenverzeichnis<br />
können auch Informationen über Zulieferer durch eigene Daten ergänzt werden.<br />
Über einen Link gelingt man schnell auf den Performance Monitor, auf dem die aktuellen<br />
Performance-Bewertungs-Daten der Geschäftspartner analysiert werden können.<br />
Business Directory ermöglicht Marktteilnehmern eine hohe Markttransparenz, verringert<br />
die Zeit der Lieferantensuche und senkt damit die Prozesskosten beim Einkauf. Die Hersteller<br />
erhalten die Möglichkeit, ihr gesamtes Portfolio einem großen Kundenkreis zu<br />
präsentieren und ihre strategischen Geschäftspartner durch SupplyOn enger an sich zu<br />
binden. 44<br />
Abb. 7: Aufbau des SupplyOn Business Directory (Quelle: SupplyOn)<br />
3.2.1.2 SupplyOn Sourcing Manager<br />
SupplyOn Sourcing ist ein auf die Bedürfnisse der Automobilindustrie abgeschnittenes<br />
Tool, das zur Erstellung von Anfragen und der Bearbeitung von Auktionen und Angebotsauswertungen<br />
dient. Durch den integrierten Ansatz sind alle Prozesse des Einkaufs<br />
aufeinander abgestimmt. Die einheitliche, standardisierte Bedieneroberfläche hilft die<br />
digitalisierten Arbeitsvorgänge strukturierter, schneller und einfacher abzuwickeln. Zu-<br />
44 http://www.supplyon.com/lieferantenstammdaten-verwalten.html (Stand: 12.7.2008)
Funktionalitäten elektronischer <strong>Marktplätze</strong> am Beispiel SupplyOn 27<br />
sätzlich erreicht man eine deutlich geringere Fehlerquote, da die gesamte Abwicklung<br />
elektronisch erfolgt.<br />
SupplyOn bietet beim Erstellen von Angeboten Vorlagen wie beispielsweise materialgruppenspezifische<br />
Angebotsformulare, die individuell angepasst werden können. Ferner<br />
sind Online-Auktionen nach unterschiedlichen Regeln möglich. Eine effiziente Kommunikation<br />
während des gesamten Einkaufprozesses wird dabei durch die Möglichkeit des<br />
Herunterladens eingegangener Angebotsabgaben, Versenden von technischen Zeichnungen<br />
und sonstigen Anhängen sichergestellt.<br />
Advanced Reporting, ein auf Excel basierendes Tool, sorgt dafür, dass die abgewickelten<br />
Anfrageprozesse optimal ausgewertet und verglichen werden. Der Einkäufer kann alle<br />
abgegebenen Angebote in einer <strong>Übersicht</strong> darstellen lassen. Dabei werden die Informationen<br />
zu den einzelnen Lieferanten auf zusätzlichen separaten Datenblättern angezeigt. 45<br />
Abb. 8: SupplyOn Sourcing Manager- Beispiel einer Auktion (Quelle: SupplyOn)<br />
3.2.1.3 SupplyOn Document Manager<br />
Der Document Manager stellt sicher, dass Lieferanten Zugang zu benötigten Dokumenten<br />
wie technische Zeichnungen, AGB´s und Lastenhefte erhalten und unterstützt die<br />
Lieferanten sowie die Einkäufer beim Änderungsmanagement. Mit Hilfe einer XML-<br />
45 http://www.supplyon.com/einkaufsprozesse.html (Stand: 12.7.2008)
Funktionalitäten elektronischer <strong>Marktplätze</strong> am Beispiel SupplyOn 28<br />
Schnittstelle zwischen SupplyOn und dem internen Dokumentenverwaltungssystem des<br />
Einkäufers (s. Abb.9) werden Informationen über Änderungen an Dokumenten durch<br />
eine automatisch generierte Nachricht direkt an alle Lieferanten weitergeleitet, die mit<br />
dem Dokument arbeiten. Der Lieferant bestätigt den Erhalt der Nachricht ebenfalls elektronisch.<br />
Bei Ausschreibungen und Anfragen über den Sourcing Manager kann man durch<br />
einen Link die Lieferanten auf die entsprechenden Dateien verweisen.<br />
Der Document Manager garantiert, dass alle Geschäftspartner stets mit den aktuellsten<br />
Dateien arbeiten und verhindert dadurch Missverständnisse. Bei Änderungen an Dokumenten<br />
müssen die betroffenen Lieferanten also nicht mehr manuell benachrichtigt werden.<br />
Ferner entfällt der Aufwand für das Kopieren und Scannen der entsprechenden Unterlagen.<br />
Somit werden Prozesskosten gesenkt und eine klare und schnelle Kommunikation<br />
gewährleistet. 46<br />
Abb. 9: Funktionsprinzip des SupplyOn Document Managers (Quelle: SupplyOn)<br />
3.2.1.4 SupplyOn Collaboration Folders<br />
SupplyOn bietet mit den Collaboration Folders virtuelle Projekträume, in denen Unternehmen,<br />
die an einem Projekt beteiligt sind, entsprechende Projektdateien zentral und<br />
effizient miteinander austauschen können. Dokumente wie Protokolle, Pläne, Stücklisten<br />
und technische Zeichnungen können bidirektional erstellt und geändert werden, d.h. mehrere<br />
Projektbeteiligte haben die Möglichkeit, Dokumente zu bearbeiten und abzuspeichern.<br />
Änderungen an Dateien sind durch das automatische Erstellen von neuen Dokumentenversionen<br />
jederzeit nachvollziehbar. Dies sorgt für Transparenz und vermindert<br />
46 http://www.supplyon.com/img/downloads/Broschueren/DE_SupplyOn_SRM.pdf (Stand: 12.7.2008)
Funktionalitäten elektronischer <strong>Marktplätze</strong> am Beispiel SupplyOn 29<br />
den Kommunikationsaufwand mit internen und externen Geschäftspartnern. Zugriffsrechte<br />
stellen sicher, dass einzelne Projektbeteiligte nur Zugang auf für sie relevante<br />
Ordner und Dokumente erhalten. Durch die Integration von Projekt-Ordnern im Windows<br />
Explorer können die Geschäftspartner auf einer gewohnten Oberfläche arbeiten.<br />
Die Benutzung von Collaboration Folders bietet den Vorteil, dass bei Entwicklungsprojekten,<br />
in denen Teams aus verschiedenen Abteilungen und Unternehmen (Lieferanten,<br />
Kunden, Vertriebspartner, Konstruktionsabteilungen, Projektleiter usw.) involviert sind,<br />
alle Beteiligte stets mit den aktuellsten Dokumenten arbeiten und demzufolge Missverständnisse<br />
vermieden werden. Die Fehlerhäufigkeit nimmt ab und es findet eine effektivere<br />
Kommunikation statt, die zur Minimierung der Entwicklungszeiten und der Projektkosten<br />
beiträgt. Die Einführung der Produkte kann somit früher und kostengünstiger er-<br />
folgen. 47<br />
Abb. 10: Funktionsprinzip des SupplyOn Project Manager (Quelle: SupplyOn)<br />
3.2.2 Logistik-Funktionalitäten<br />
3.2.2.1 SupplyOn EDI und WebEDI<br />
Kunden von SupplyOn haben die Möglichkeit, entweder durch die direkte Integration<br />
ihres EDI-Systems an SupplyOn oder auch mittels WebEDI direkt über das Internet,<br />
standardisierte Logistik- und Finanzprozesse zwischen ihrem Unternehmen und ihren<br />
Lieferanten schnell und übersichtlich abzuwickeln. Das einkaufende Unternehmen<br />
schließt sein klassisches EDI-System dazu an den SupplyOn EDI-Server an. Die vom<br />
Unternehmen gesendeten Daten wie Lieferabrufe oder Rechnungsinformationen werden<br />
47 http://www.supplyon.com/virtueller-projektraum.html (Stand: 12.7.2008)
Funktionalitäten elektronischer <strong>Marktplätze</strong> am Beispiel SupplyOn 30<br />
vom SupplyOn EDI-Server konvertiert und anschließend dem Lieferanten in Form von<br />
Webformularen zur Verfügung gestellt. Diese können die Daten auf der SupplyOn-<br />
Plattform ansehen, ausdrucken oder herunterladen, um sie in internen Applikationen weiter<br />
zu verwenden. Die Lieferanten werden außerdem bei der Versandabwicklung durch<br />
ein Liefer- und Transportdaten-Tool unterstützt, mit dem unter anderem automatisch Lieferscheine,<br />
Transport- und Versandlabel erstellt werden können. Das einkaufende Unternehmen<br />
erhält im Voraus Versandinformation zu den aktuellen Bestellungen und der<br />
Lieferant wird über jede neue EDI-Nachricht per E-Mail informiert. Web-EDI beschleunigt<br />
den Kommunikationsprozess in der Lieferkette und ermöglicht auch besonders kleinen-<br />
und mittelständischen Unternehmen die Vorteile von EDI zu nutzen, da diese keine<br />
Investitionskosten für ein eigenes EDI-System benötigen und über den SupplyOn EDI-<br />
Server mit ihren Kunden kommunizieren können. Man hat Transparenz über Informationsflüsse<br />
und wird zusätzlich von diversen Monitoring- und Reportingtools unterstützt.<br />
SupplyOn bietet mit seinen EDI-Funktionen folgende Prozessunterstützungen (s. Abb.<br />
11):<br />
� Bestellprozesse: Lieferabruf, Einzelbestellung, Versuchsteileabruf, Auftragsbestätigung<br />
� Lieferprozesse: Liefer- und Transportdaten (LuT), Etiketten und Lieferdokumente,<br />
Speditionsavis<br />
� Finanzprozesse: Gutschriftsanzeigen, Rechnungen, Zahlungsavise, Verrech-<br />
nungsanzeigen 48<br />
48 http://www.supplyon.com/img/downloads/Broschueren/DE_SupplyOn_SCM.pdf (Stand: 12.7.2008)
Funktionalitäten elektronischer <strong>Marktplätze</strong> am Beispiel SupplyOn 31<br />
Abb. 11: SupplyOn EDI und WebEDI (Quelle: SupplyOn)
Funktionalitäten elektronischer <strong>Marktplätze</strong> am Beispiel SupplyOn 32<br />
3.2.2.2 SupplyOn Inventory Collaboration<br />
Durch Funktionalitäten wie Vendor Managed Inventory (VMI), Anliefersteuerung und Kanban<br />
ermöglicht SupplyOn die Realisierung von effizienten Dispositionsmethoden, bei denen<br />
die Verwaltung des Kundenlagers durch den Lieferanten übernommen wird. Der Grundgedanke<br />
des VMI ist es, dass Lieferanten starre Lieferprozesse umgehen und mehr Gestaltungsfreiraum<br />
für die Optimierung ihrer Produktion und ihrer Transportauslastung schaffen können.<br />
Dabei gibt der Kunde alle Informationen über Änderungen an Lagerbestand, Bruttobedarfe<br />
und Unterwegsbestände an seinen Lieferanten weiter, damit dieser bei Bedarf das Lager<br />
selbstständig aufstocken kann. Davor werden zwischen den Geschäftspartnern für jedes Bauteil<br />
ein Minimal- und ein Maximallagerbestand vereinbart. Bei Engpässen werden die Lieferanten<br />
rechtzeitig über eine automatische Warnmeldung des Systems benachrichtigt (s.<br />
Abb.12).<br />
Der Lieferant kann den Versand seiner Waren zeitlich flexibel gestalten. Dadurch hat er die<br />
Möglichkeit, seine Produktion besser zu planen, seine Kapazitäten optimal auszulasten und<br />
Lager-, Verwaltungs- und Frachtkosten zu reduzieren. Somit erreicht man mehr Transparenz<br />
über Bestände in der Lieferkette und stellt eine verbrauchsgesteuerte Anlieferung und produktionssynchrone<br />
Fertigung sicher. Die Visualisierung und die Simulation von möglichen zukünftigen<br />
Lagerbeständen ermöglichen es, kritische Liefersituationen rechtzeitig zu erkennen<br />
und entsprechende Maßnahmen einzuleiten. 49<br />
Abb. 12: Funktionsprinzip des Inventory Collaboration (Quelle: SupplyOn)<br />
49 http://www.supplyon.com/img/downloads/Broschueren/DE_SupplyOn_SCM.pdf (Stand: 12.7.2008)
Funktionalitäten elektronischer <strong>Marktplätze</strong> am Beispiel SupplyOn 33<br />
3.2.3 Qualität<br />
3.2.3.1 SupplyOn Performance Monitor<br />
Der Performance Monitor ist ein Tool zum effizienten Austausch und zur detaillierten Auswertung<br />
von Lieferantenbeurteilungen in Bezug auf Produktqualität und Liefertreue. Die unternehmensinternen<br />
Bewertungsdaten des Kunden werden dabei automatisch in einem einheitlichen<br />
Format auf die SupplyOn-Plattform geladen. Diese Informationen können vom Lieferanten<br />
in Form von strukturierten Abfragen betrachtet werden. Man hat dabei die Möglichkeit,<br />
aktuelle sowie historische Daten in unterschiedlichster Form zu verdichten, zu analysieren<br />
und tabellarisch sowie graphisch zu veranschaulichen. Ein ausgeklügeltes Sicherheitssystem<br />
sorgt dafür, dass die Informationen nur für die Mitarbeiter des bewertenden Unternehmens<br />
und dem Lieferanten zugänglich sind.<br />
Abb. 13: SupplyOn Performance Monitor (Quelle: SupplyOn)<br />
Der Performance Monitor automatisiert und standardisiert den oft konzernweit nicht einheitlichen<br />
Prozess der Kommunikation von Lieferantenbewertungsdaten und eröffnet Kunden wie<br />
auch Lieferanten neue Möglichkeiten. Befugte Mitarbeiter können jederzeit auf die aktuellsten<br />
Bewertungen durch eine benutzerfreundliche Oberfläche zentral zugreifen. Die dadurch<br />
geschaffene Transparenz und die detaillierten Auswertungsmöglichkeiten von der Konzernbis<br />
zur Teileebene helfen Lieferanten, Schwachstellen schneller zu identifizieren und entsprechende<br />
Maßnahmen zu ergreifen. Die Funktion hilft somit dem Lieferanten, versteckte Poten-
Funktionalitäten elektronischer <strong>Marktplätze</strong> am Beispiel SupplyOn 34<br />
tiale zu erkennen, die Leistungsfähigkeit und das Qualitätsbewusstsein zu erhöhen und damit<br />
die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu sichern. 50<br />
3.2.3.2 SupplyOn Project Management<br />
SupplyOn Projekt Management dient der strukturierten Planung und der effizienten Abwicklung<br />
von Entwicklungsprojekten mit Partnern. Dabei hilft das Tool sowohl die Phase der Qualitätsvorausplanung<br />
(APQP) als auch die der Projektsteuerung optimal zu gestalten. Die große<br />
Auswahl an Vorlagen ermöglicht eine einfache und übersichtliche Gliederung und Terminierung<br />
der Projekte. Nach der Erstellung von Meilensteinen werden einzelne Teilaufgaben an<br />
die jeweiligen Verantwortlichen mitgeteilt. Die Projektbeteiligten, die sowohl interne als auch<br />
externe Partner sein können, haben die Möglichkeit, die ihnen zugeordneten Aufgaben in ihrer<br />
Mailbox mit allen notwendigen Informationen übersichtlich darstellen zu lassen. Fortschritte<br />
im Projektverlauf sind durch Status-Reports stets für jedermann nachvollziehbar.<br />
Durch die Visualisierung von Problemen mit Ampelfunktionen und die automatische Benachrichtigung<br />
der Projektbeteiligten bei Terminüberschreitungen sinkt der administrative Aufwand<br />
und ermöglicht den Beteiligten die Konzentration auf die fachlichen Themen. Das Tool<br />
dient also der nachhaltigen Vermeidung von Verzögerungen, der besseren Transparenz, Senkung<br />
der Projektkosten und somit der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens.<br />
Abb. 14: SupplyOn Projekt Management (Quelle: SupplyOn)<br />
50 http://www.supplyon.com/lieferantenbewertung.html (Stand: 12.7.2008)
Funktionalitäten elektronischer <strong>Marktplätze</strong> am Beispiel SupplyOn 35<br />
3.2.3.3 SupplyOn Problem Solver<br />
Der Problem Solver unterstützt durch die elektronische Abwicklung und Abbildung von zentralen<br />
Reklamationsprozessen das Qualitätsmanagement, das in der Automobilindustrie von<br />
entscheidender Bedeutung ist. Reklamationen werden auf Basis der 8D-Methode51 aus dem<br />
internen Qualitätsmanagementsystem des Kunden über SupplyOn an den Lieferanten weitergeleitet<br />
(s. Abb.15). Der Käufer hat dabei die Möglichkeit, sich jederzeit über den Status der<br />
Reklamation und die Fortschritte des Lieferanten zu informieren. Ferner dienen automatische<br />
Erinnerungsmeldungen des Tools zur Verhinderung von Terminüberschreitungen.<br />
Abb. 15: SupplyOn Problem Solver (Quelle: SupplyOn)<br />
51<br />
Die 8D-Methode ist eine Standardmethode im Qualitätsmanagement, die ein Problem mit unbekannter Ursache<br />
durch einen teamorientierten Problemlösungsprozess und einer festgelegten Schrittfolge offen legt. Zusätzlich<br />
dient sie als Berichtsform zur Fortschrittsverfolgung somit gleichzeitig als Aktionsplan.<br />
(http://www.faes.de/Basis/Basis-Lexikon/Basis-Lexikon-8D-Methode/basis-lexikon-8d-methode.html)
Chancen und Risiken elektronischer <strong>Marktplätze</strong> 36<br />
4 Chancen und Risiken elektronischer <strong>Marktplätze</strong><br />
Die Teilnahme an elektronischen <strong>Marktplätze</strong>n birgt sowohl für beschaffende Unternehmen<br />
als auch für Lieferanten enorme Potentiale. Dazu zählen vor allem Kosten- und Zeitersparnisse<br />
beim Einkauf bzw. Vertrieb und die Erschließung neuer Märkte. Jedoch dürfen die Risiken,<br />
die im Zusammenhang mit dem Einsatz von elektronischen <strong>Marktplätze</strong>n stehen, nicht außer<br />
Acht gelassen werden. Diese Chancen und Risiken sollen nun genauer betrachtet werden.<br />
4.1 Chancen elektronischer <strong>Marktplätze</strong><br />
Moderne elektronische <strong>Marktplätze</strong> unterstützen Unternehmen bei allen Phasen der Geschäftsabwicklung<br />
und bieten unabhängig von der Branche und Größe der Unternehmen bedeutende<br />
Einsparpotentiale. Das in vielen Branchen existierende Problem der Vernichtung der<br />
Restmengen von verderblichen Waren und gebrauchten Investitionsgütern kann durch elektronische<br />
<strong>Marktplätze</strong> minimiert werden. Meist ist es für die Unternehmen nicht rentabel, nach<br />
einem geeigneten Abnehmer zu suchen, da die Suche mehr Kosten verursacht, als man durch<br />
den Absatz der Ware erzielen könnte.<br />
Ferner ermöglichen elektronische <strong>Marktplätze</strong> den Unternehmen globale Präsenz. Lieferanten<br />
haben somit die Möglichkeit, ihre Produkte und Dienstleistungen weltweit einer Vielzahl von<br />
Kunden zugänglich zu machen. Dies stellt besonders für kleine- und mittelständische Firmen<br />
ganz neue Potentiale zur Neukundengewinnung dar. Ferner entfällt die Notwendigkeit von<br />
Investitionskosten für eigene Beschaffungs- und Vertriebslösungen.<br />
<strong>Elektronische</strong> <strong>Marktplätze</strong> bieten Unternehmen die Chance, einfacher und kostengünstiger<br />
Geschäfte zu generieren und zu pflegen. Die dabei entstehenden Wertschöpfungen können<br />
folgendermaßen zusammengefasst werden: 52<br />
� Erzielung günstiger Preise für Güter und Dienstleistungen durch Bedarfsbündelungen<br />
auf elektronischen Märkten<br />
� Verringerung von Maverick Buyings 53 durch Prozessautomatisierung<br />
52 Vgl. Boston Consulting Group (2000), S. 10<br />
53 Einkäufe, die trotz Rahmenverträge von anderen Lieferanten bezogen werden
Chancen und Risiken elektronischer <strong>Marktplätze</strong> 37<br />
� Senkung der Marketing- und Vertriebskosten, da Neukunden schneller erreicht und<br />
Lieferantenbeziehungen effizienter gepflegt werden können<br />
� Senkung der Transaktionskosten durch die geringe Fehlerquote bei Bestellungen, rationalisierte<br />
Genehmigungsprozesse, geringere Kosten für Lieferantenbewertungen und<br />
automatisierte Rechnungsstellungsprozesse<br />
� Geringe Einkaufspreise und Maximierung des Gewinns bei Auktionen und Ausschreibungen<br />
durch die hohe Markttransparenz und dem erhöhten Wettbewerb<br />
� Senkung der Lagerkosten durch erhöhte Effizienz in der Supply Chain<br />
� Senkung der Nacharbeit und der Wertminderung von Lagerbeständen<br />
� Senkung der Durchlaufzeiten durch kollaboratives Design und Projektmanagement (<br />
bessere Produkte und beschleunigte Markteinführung)<br />
� Verbesserte Auslastung der Anlagen und Arbeitskräfte durch Reorganisation der Wertekette<br />
und der besseren Planung der Kapazitäten<br />
4.2 Risiken elektronischer <strong>Marktplätze</strong><br />
Die Teilnahme an einem elektronischen Marktplatz ist für Nachfrager sowie Anbieter auch<br />
mit unterschiedlichen Nachteilen verbunden.<br />
Die Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens werden auf einem elektronischen<br />
Marktplatz weltweit angeboten. Die damit verbunden Markttransparenz und erhöhte Wettbewerbsintensität<br />
führt dazu, dass die Kaufentscheidung über den Preis ausgetragen wird und<br />
die Margen für die Anbieter geringer werden. Durch Strategien wie Kostenführerschaft oder<br />
Produktdifferenzierung kann dieser Nachteil jedoch kompensiert werden, wodurch die Teilnahme<br />
an einem Marktplatz sich für Unternehmen trotzdem als rentabel erweisen kann. 54<br />
Vor allem bei der Teilnahme an kollaborativen <strong>Marktplätze</strong>n, bei denen ein reger Datenaustausch<br />
stattfindet, besteht die Gefahr, dass strategisch wichtige Daten in die falschen Händen<br />
gelangen. Deshalb muss der Marktplatz ein ausgeklügeltes Benutzermanagementsystem anbieten<br />
und hohe Sicherheitsstandards einhalten, um Unbefugten den Zugang zu Daten zu verhindern.<br />
54 Vgl. Dümpe, O. (1999), S.1-13
Chancen und Risiken elektronischer <strong>Marktplätze</strong> 38<br />
Ferner ist die Teilnahme an einem elektronischen Markt für Unternehmen mit verschiedenen<br />
Kosten verbunden. Der Marktplatzbetreiber hat die Kontrolle über die Transaktionen, die über<br />
den Markt durchgeführt werden und kann, abhängig von der Form des e-Markts, von den<br />
Marktteilnehmern Gebühren verlangen. Außerdem können durch die technische Integration<br />
des Systems an den Marktplatz, eine fehlende B2B-Infrastruktur vieler Unternehmen 55 und<br />
Umschulungskosten für die Mitarbeiter zusätzliche Kosten entstehen.<br />
Eines der wichtigsten Kriterien für die erfolgreiche Umsetzung eines e-Marktes ist die kritische<br />
Masse, die in der Startphase erreicht werden muss, um die Lösung dauerhaft etablieren<br />
zu können. Ohne die kritische Masse ist der Markt weder für Zulieferer noch für Käufer attraktiv,<br />
da der Käufer durch eine zu geringe Anzahl an Zulieferern nicht genug Transaktionsvolumen<br />
erreichen kann, um einen Mehrwert durch den Marktplatz zu erzielen. Ein Markt mit<br />
einer geringen Anzahl an Abnehmern stellt dagegen für Verkäufer geringe Absatz- und Profitchancen<br />
dar. 56<br />
Ein weiteres Problem sorgt vor allem bei Zulieferern für ein ungutes Gefühl, die bei konsortialen<br />
e-Märkten die Absprache von großen Abnehmern befürchten. Die Bedarfsbündelung<br />
führender Abnehmer zu Zwecken der Verbesserung der Konditionen muss streng von Kartellämtern<br />
überwacht werden, um die Zusammenballung von Einkaufsmacht zu verhindern. 57<br />
55 Vgl. ISM/Forrester Research (2003)<br />
56 Vgl. Bärwolff M. (2003), S.13<br />
57 Vgl. Fieten, R. (2001), S.26
Entwicklung und Ausblick 39<br />
5 Entwicklung und Ausblick<br />
Zu Zeiten des Internet-Booms entstanden hunderte von elektronischen <strong>Marktplätze</strong>n durch so<br />
genannte Start-Up-Unternehmen, die jedoch die Phase der Konsolidierung nicht überlebt haben.<br />
58 Ein häufiger Grund für das Scheitern war die kritische Masse, ohne die die Teilnahme<br />
am Markt mit höheren Anbindungskosten verbunden war und für die Teilnehmer zunehmend<br />
unattraktiv wurde. Das Transaktionsvolumen und die Einkünfte des Marktplatzes sanken und<br />
der Markt musste aufgeben. Übrig blieben vor allem Betreiber, die ein wirksames Geschäftsmodell<br />
hatten, erfolgreiche Allianzen gründeten oder zusätzliche wertschöpfende Dienstleistungen<br />
anboten. So mussten zwischen 2000 und 2005 über 1000 e-Märkte schließen. 59 In der<br />
Zwischenzeit haben sich jedoch e-Märkte in ausgesuchten Branchen durch die Verbreitung<br />
von Standards und zusätzlichen Funktionalitäten längst etabliert. Bei Teilnehmern von Sourcingparts<br />
60 lief 2005 bereits ein Drittel des Geschäftes über den Marktplatz. 80 Prozent der<br />
Befragten der Studie gaben ferner an, dass sie vorhätten, in den kommenden Jahren noch<br />
mehr Geschäfte über den Online-Marktplatz abwickeln zu wollen. 61<br />
Im Bereich B2B geht der Trend bei ausgewählten Industrien vor allem in Richtung vertikale<br />
Beschaffungsmarktplätze mit gemeinsamem Supply Chain Management. Durch <strong>Marktplätze</strong><br />
wie Covisint oder SupplyOn wird über reine Transaktionsprozesse hinaus intensive und langfristige<br />
interorganisationale Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen geschaffen. 62 Die<br />
Unterstützung von Geschäftsbeziehungen während des gesamten Produktlebenszykluses<br />
(Entwicklung neuer Produkte, internetbasierte Prozessabwicklung und Durchführung gemeinsamer<br />
Projekte) ermöglichen noch nie da gewesene Möglichkeiten der effektiven Zusammenarbeit.<br />
Um Absatzrückgänge zu verhindern, wird für kleinere Zulieferer oder Käufer die Teilnahme<br />
an elektronischen <strong>Marktplätze</strong>n in bestimmte Branchen dabei immer obligatorischer.<br />
Kollaborative <strong>Marktplätze</strong> bieten bereits ein breites Spektrum an zusätzlichen Dienstleistungen<br />
an. Dieser Trend wird sich weiter fortsetzen und Marktplatzbetreiber werden zunehmend<br />
58 Vgl. Baldi, S. (2001), S.17<br />
59 Vgl. Andréoli, A. (2006)<br />
60 unter www.sourcingparts.com<br />
61 Vgl. SourcingParts (2005)<br />
62 Vgl. Forrester Research (2001)
Entwicklung und Ausblick 40<br />
mit der Unterstützung von externen Dienstleistern und Partnern 63 und durch die verstärkte<br />
Zusammenarbeit und Vernetzung von <strong>Marktplätze</strong>n untereinander, ihren Kunden ganzheitliche<br />
Konzepte anbieten. Da Marktteilnehmer auch zahlreiche Geschäftsbeziehung zu Unternehmen<br />
anderer Branchen pflegen, 64 werden sich so genannte „Networked Marketplaces“<br />
oder „Value Trust Networks“ entwickeln, die alle Bedürfnisse der Marktteilnehmer durch die<br />
Integration von vor allem vertikalen Märkten in horizontale Märkte, befriedigen werden. 65<br />
Diese Metamärkte bilden für die Teilnehmer einen „one point of entry“, 66 durch den der Benutzer<br />
Zugang zu Funktionalitäten mehrerer vertikaler und horizontaler Märkte erhält (s.<br />
Abb.16).<br />
63<br />
Vgl. Baldi, S. (2001)<br />
64<br />
Vgl. Schneider et al. (2000)<br />
65<br />
Vgl. Morgan, S. (2000)<br />
66<br />
Forrester (2000)<br />
Abb. 16: Metamärkte (Quelle: PricewaterhouseCoopers)
Literaturverzeichnis 41<br />
Literaturverzeichnis<br />
Andréoli, A. (2006): What future for e-Marketplaces?, 2006<br />
http://www.procurementleaders.com/magazines/procurement-magazine-oct-2006/procurementarticles/future-of-emarketplaces/<br />
(Stand:7.2.2008)<br />
Arndt, T. (2002): Erfolgreich auf B2B- <strong>Marktplätze</strong>n- Effizienz und Produktivität in E-Procurement und<br />
Sales, Galileo Press, 1. Auflage, Bonn, 2002<br />
Bakos, Y. (1997): Reducing Buyer Search Costs- Implications for Electronic Markets, in: Management<br />
Science, Vol.43, No.12, 1997, http://pages.stern.nyu.edu/~bakos/emkts.pdf (Stand: 2.2.2008)<br />
Bakos, Y. (1998): Towards Friction-Free Markets: The Emerging Role of Electronic Marketplaces,<br />
New York, 1998, http:www.stern.nyu.edu/~bakos (Stand:3.2.2008)<br />
Baldi, S. (2001): Betreiberstrukturen von elektronischen B2B <strong>Marktplätze</strong>n - Modelle und Implikationen,<br />
Ilmenau, 2001<br />
Bärwolff, M. (2003): State and Prospects of Electronic Marketplaces, Paris, 2003<br />
Berlecon Research (1999): Virtuelle Vermittler: Business-to-Business <strong>Marktplätze</strong> im Internet, Studie,<br />
Berlin, 1999<br />
Biethahn, J.; Nomikos, M. (2002): Ganzheitliches E-Business - Technologien, Strategien, und Anwendungen<br />
unter besonderer Berücksichtigung der Anforderungen von kleinen und mittelständischen<br />
Unternehmen, Oldenburg Verlag, München/Wien, 2002<br />
Boston Consulting Group (2000): The B2B opportunity: Creating advantage through e-marketplaces,<br />
Boston, 2000, http://www.bcg.com/publications/files/B2BOpp_Oct_00_rep.pdf (Stand: 6.3.2008)<br />
Dümpe, O.(1999): Chancen und Risiken von Netzmärkten für Anbieter- eine spieltheoretische Analyse,<br />
Diskussionspapier des Lehrstuhls für BWL und Wirtschaftsinformatik der Universität Augsburg,<br />
Augsburg, 1999<br />
Fieten, R. (2001): Märkte im Fokus- <strong>Elektronische</strong> <strong>Marktplätze</strong>: Chance oder Risiko für den Mittelstand?<br />
, IKB Deutsche Industriebank AG, Düsseldorf, 2001 (Stand: 24.1.2008)<br />
Forrester (2000): The eMarketplace Shakeout, Cambridge, 2000<br />
Forrester Research (2001) Research Report on eBusiness, Cambridge
Literaturverzeichnis 42<br />
Forzi, T.; Laing, P. (2005): Leitfaden- Betreibermodelle elektronischer <strong>Marktplätze</strong>, Aachener Competence<br />
Center – Electronic Commerce (ACC-EC), Aachen, 2005,<br />
http://www.ec-net.de/EC-Net/Redaktion/Pdf/Beschaffung-Maerkte/Materialien/betreibermodelleem,property=pdf,bereich=<br />
ec_net,sprache=de,rwb=true.pdf (Stand:22.1.2008)<br />
Grieger, M. (2003): Electronic Marketplaces: A literature review and a call for supply chain management<br />
research, in: European Journal of Operational Research, Jahrgang 2003/144, S. 287-289,<br />
Frederiksberg, 2003<br />
Hepp, M.; Schinzer, H. (2005): B2B-<strong>Marktplätze</strong> im Internet, Würzburg, 2005<br />
http://www.heppnetz.de/files/b2b-mp-hepp-schinzer.pdf (Stand: 12.1.2008)<br />
Iksal, C.; Gassner, M. (2001): Prognose, Potentiale und Typen von Online-<strong>Marktplätze</strong>n, in: B2B-<br />
Erfolg in eMarkets- von der Beschaffung über eProcurement zu Net Market Maker, Nenninger (Hrsg.),<br />
Braunschweig, 2001<br />
ISM/Forrester Research (2003): Press Release: ISM/Forrester Research Announce Results Of Latest<br />
Report On eBusiness,<br />
http://www.forrester.com/ ER/Press/Release/0,1769,815,00. html (Stand:15.1.2008)<br />
Kaplan S.; Swahney, M. (2000): Revolution im Einkauf- die neuen elektronischen <strong>Marktplätze</strong>, in:<br />
Harvard Business Manager, Jg. 2000, Heft 6, Hamburg, 2000 (Stand:11.1.2008)<br />
Kellermann, K. (2005): <strong>Elektronische</strong> Beschaffungslogistik bei KMU- Chancen, Risiken, Spannungsfelder,<br />
DUV Verlag, 2005<br />
Kollmann, T. (2001): Virtuelle <strong>Marktplätze</strong>- Grundlagen, Management, Fallstudien, Vahlen Verlag,<br />
1.Auflage, 2001<br />
Langenohl, T. (1994): Systemarchitekturen <strong>Elektronische</strong>r Märkte, Diss., St. Gallen, 1994<br />
Minderlein, M. (2002): IT-Kompaktkurs eBusiness: eProcurement II, Begleitskript, 2002,<br />
http://www.bw.fh-deggendorf.de/kurse/eb2/skripten/skript5.pdf (Stand:12.1.2008)<br />
Morgan, S. (2000): The B2B Internet Report- Collaborative Commerce, 2000<br />
Nenninger, M.; Lawrenz, O. (2002): B2B-Erfolg durch eMarkets und eProcurement, Vieweg Verlag, 2.<br />
Auflage, Wiesbaden, 2002<br />
Nenninger, M. (1999): Electronic Procurement- Neue Beschaffungsstrategien durch Desktop Purchasing<br />
Systeme, Arbeitsstudie, KPMG, München, 1999<br />
Net Market Makers (1999): Digital Market Places: Enabling the Internet Economy, Studie, Berkeley,<br />
1999
Literaturverzeichnis 43<br />
Pörnig, T., Sallaba, G. (2000): Siemens Buy-Side Marktplatz- E-Procurement-Konzeption zur Umsetzung<br />
neuer Einkaufsstrategien, in: Jahresbericht Frauenhofer Institut für Fabrikbetrieb- und automatisierung,<br />
2000<br />
Prozeus (2007): eBusiness-Standards auf einen Blick, Institut der deutschen Wirtschaft Köln Consult<br />
GmbH und GS1 Germany GmbH, 2007<br />
http://www.prozeus.de/imperia/md/content/prozeus/prozeus_materialien/prozeus_glossar_eb_standar<br />
ds_2007.pdf<br />
Samuelson, P.; Nordhaus, W. (1998): Economics, McGraw-Hill Book Company, 16. Auflage, Boston,<br />
1998<br />
Schabacker, F. (2001): Ein Marktplatz macht noch kein E-Procurement, in: Computerwoche, Jg. 2001,<br />
Heft 4, 2001<br />
Schmid, B. (1999): <strong>Elektronische</strong> Märkte- Merkmale, Organisation und Potentiale, Vahlen Verlag, 2.<br />
Auflage, St. Gallen, 1999<br />
Schneider/Schnetkamp (2000): E-markets-B2B-Strategien im Electronic Commerce, Wiesbaden,<br />
2002<br />
SourcingParts (2005): <strong>Elektronische</strong> <strong>Marktplätze</strong> sind den Kinderschuhen entwachsen, Genf, 2005,<br />
http://www.commercemanager.info/magazine/news_h11923_elektronische_marktplaetze<br />
_sind_den.html (Stand: 23.1.2008)<br />
Tanner, C.; Wölfle, R. (2002): E-Procurement: Wo liegen die Potenziale für Ihren Einkauf?, Basel,<br />
2002<br />
Weller, T. (2000): BtoB eCommerce- The Rise of eMarketplaces, Equity Research, 2000<br />
Wimmer, F. (1993): Handwörterbuch der Betriebswirtschaftslehre, Schäffer-Poeschel Verlag, 5. Auflage,<br />
Stuttgart, 1993<br />
Wirtz, B. (2001): Zukunftsperspektiven des E-Business, in: E-Business- Potentiale und Risiken für<br />
den Mittelstand, S-174-201, DG Bank (Hrsg.), Frankfurt am Main, 2001