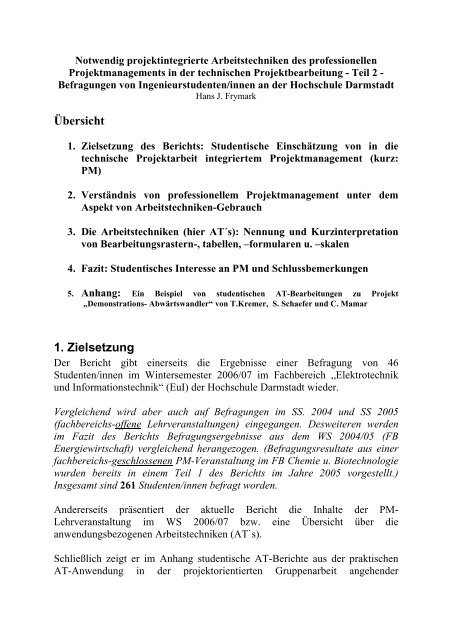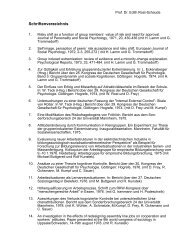Frymark - Hochschule Darmstadt
Frymark - Hochschule Darmstadt
Frymark - Hochschule Darmstadt
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Notwendig projektintegrierte Arbeitstechniken des professionellen<br />
Projektmanagements in der technischen Projektbearbeitung - Teil 2 -<br />
Befragungen von Ingenieurstudenten/innen an der <strong>Hochschule</strong> <strong>Darmstadt</strong><br />
Hans J. <strong>Frymark</strong><br />
Übersicht<br />
1. Zielsetzung des Berichts: Studentische Einschätzung von in die<br />
technische Projektarbeit integriertem Projektmanagement (kurz:<br />
PM)<br />
2. Verständnis von professionellem Projektmanagement unter dem<br />
Aspekt von Arbeitstechniken-Gebrauch<br />
3. Die Arbeitstechniken (hier AT´s): Nennung und Kurzinterpretation<br />
von Bearbeitungsrastern-, tabellen, –formularen u. –skalen<br />
4. Fazit: Studentisches Interesse an PM und Schlussbemerkungen<br />
5. Anhang: Ein Beispiel von studentischen AT-Bearbeitungen zu Projekt<br />
„Demonstrations- Abwärtswandler“ von T.Kremer, S. Schaefer und C. Mamar<br />
1. Zielsetzung<br />
Der Bericht gibt einerseits die Ergebnisse einer Befragung von 46<br />
Studenten/innen im Wintersemester 2006/07 im Fachbereich „Elektrotechnik<br />
und Informationstechnik“ (EuI) der <strong>Hochschule</strong> <strong>Darmstadt</strong> wieder.<br />
Vergleichend wird aber auch auf Befragungen im SS. 2004 und SS 2005<br />
(fachbereichs-offene Lehrveranstaltungen) eingegangen. Desweiteren werden<br />
im Fazit des Berichts Befragungsergebnisse aus dem WS 2004/05 (FB<br />
Energiewirtschaft) vergleichend herangezogen. (Befragungsresultate aus einer<br />
fachbereichs-geschlossenen PM-Veranstaltung im FB Chemie u. Biotechnologie<br />
wurden bereits in einem Teil 1 des Berichts im Jahre 2005 vorgestellt.)<br />
Insgesamt sind 261 Studenten/innen befragt worden.<br />
Andererseits präsentiert der aktuelle Bericht die Inhalte der PM-<br />
Lehrveranstaltung im WS 2006/07 bzw. eine Übersicht über die<br />
anwendungsbezogenen Arbeitstechniken (AT`s).<br />
Schließlich zeigt er im Anhang studentische AT-Berichte aus der praktischen<br />
AT-Anwendung in der projektorientierten Gruppenarbeit angehender
Ingenieure. (Diese AT-Berichte sind nicht zu verwechseln mit den studentischen<br />
Projektpräsentationen.)<br />
Der hier vorliegende Folgebericht (nach einem ersten Bericht im Jahre 2005;<br />
vgl. SuK-CD Forschungsberichte 5 ) hat „geschlossene“,<br />
fachbereichsgebundene Lehrveranstaltungen zu Projektmanagement (PM) zum<br />
Untersuchungsgegenstand, also Veranstaltungen eines technischen<br />
Fachbereiches. Für jedermann „offene“ PM-Lehrveranstaltungen im FB SuK<br />
sind davon zu unterscheiden.<br />
Projektleiter waren die Professoren Dr.L. Petry (Elektrizitätswirtschaft) und Dr.<br />
H. Schmidt-Walter (Elektrotechnik, Antriebstechnik)<br />
Projektthemen waren z:B:<br />
- Planung einer Photovoltaik-Anlage<br />
- Fertigung eines Demonstrations-Abwärtswandlers<br />
- Planung eines Energiekonzepts „Hofgut Oberfeld“<br />
- Versorgung eines Rechteckgenerators<br />
- Entwurf und Bau eines Operationsverstärkers<br />
- Galvanisch getrennte Übertragung von breitbandigen Videosignalen<br />
- Schaltnetzteil: Sperrwandler – Abwärtswandler<br />
- Gleichstrommaschine<br />
- Entwicklung einer RE-Demoanlage<br />
- Konzept Windkraftanlage<br />
- Konzept Biogasanlage<br />
Die Funktion des Verfassers bestand und besteht in der Durchführung des<br />
Projektmanagements vermittels der praktischen Anwendung projektadäquater<br />
Arbeitstechniken (AT´s) in den wirklichkeitsnah arbeitenden studentischen<br />
Projektgruppen . Bezeichnend ist die bewusst „prozessuale Integration“ von<br />
technischer Projektbearbeitung bzw. Projektberichterstellung und der<br />
systematischen, innovativ-kreativen, transparenten , somit effizienten<br />
Gruppenarbeit unter den Bedingungen von effektiven<br />
Projektmanagementanweisungen. Hierzu liegt ein Paper vor.<br />
Bereits im SS 2006 wurde in den Fachgebieten Elektromechanik (Prof.Dr.A.<br />
Gräßer) und Mikroelektronik (Prof.Dr.T. Schumann) dieser „integrative“<br />
Anspruch erfolgreich eingelöst, wenn auch im WS 2006/2007 ergänzend<br />
modifiziert und im Interesse von Studenten und Projektkoordinatoren – wie die<br />
Befragungsergebnisse zeigen - methodisch und didaktisch weiterentwickelt.
Für die Möglichkeit der Praxiserprobung in Ihren Fachgebieten dankt der<br />
Verfasser ausdrücklich. Als Realisierer mehrerer betrieblicher Projekte und<br />
langjähriger Dozent (seit 1985) in der fundierten Diplom-Ingenieurausbildung<br />
der Staatlichen Berufsakademie Baden-Württemberg sieht er an der <strong>Hochschule</strong><br />
<strong>Darmstadt</strong> besondere Chancen mitarbeitsintensiver Formen forschenden Lernens<br />
in einer gleichsam fundierten und praxisnahen Hochschullehre so wie dies BDI<br />
und VDI von Staatlichen <strong>Hochschule</strong>n und Staatlichen Berufsakademien<br />
erwarten dürfen.<br />
2. Verständnis von professionellem Projektmanagement<br />
unter dem Aspekt von Arbeitstechniken-Gebrauch<br />
Einleitend ist nunmehr das didaktische Verständnis von „Projektmanagement“ (-<br />
Lehre) zu nennen:<br />
Feststellung:<br />
- Projektmanagement (PM)-Lehre ist weitmehr als Managementraining.<br />
- Managementtraining(MT) ist aber Teil der Projektmanagement-Lehre<br />
Überhaupt: Ist Projektmanagement(PM) die systematische und transparente<br />
Erreichung eines Zweckes – und zwar unter gruppendynamischen Bedingungen<br />
– dann ist die Lehre von der PM die Einführung und Unterweisung in die<br />
arbeitstechnischen Bedingungen dieses Entwicklungsprozesses.<br />
Mit dieser Feststellung wird das Rad nicht neu erfunden, sondern lediglich auf<br />
Arbeitsbedingungen verwiesen, die mehr als nur betriebspädagogischer,<br />
gruppenpsychologischer und planungsspezifischer Natur sind.<br />
Insoweit meinen 69 Prozent der befragten Studenten, daß das Thema<br />
Projektmanagement ihr Interesse gefunden habe. Auch wird geäußert, es seien<br />
„genügend Arbeitstechniken“ präsentiert worden.<br />
Ist MT die Verhaltensschulung bzw. Aneignung oder Anwendung von Sozial-<br />
und Führungstechniken, so ist aktives Projektmanagement in seiner<br />
professionellen Variante – und zwar unterstützt durch Kreativitätstechniken<br />
bzw. Hilfsarbeitstechniken (HAT`s) – die Anwendung von „Allgemeinen<br />
Arbeitstechniken“ (AAT`s), wie Planungs- und Organisationstechniken,<br />
einerseits und „Besonderen Arbeitstechniken“ (BAT`s) wie Projektkosten-<br />
und/oder Prototypkosten andererseits.<br />
Projektmanagement-Lehre geht also über gruppenpädagogische und<br />
gruppendynamische Steuerungs- und Innovationsmechanismen, aber auch über<br />
Zeitmanagement und interdisziplinäre Risikoanalysen u.a.m. hinaus und hat -
insbesondere in der ingenieurwissenschaftlichen Fachbereichen - auch die<br />
Kostenaspekte zum Verwertungsziel.<br />
Wie der Verband Deutscher Ingenieure(VDI) immer wieder fordert wird neben<br />
Schlüsselqualifikationen auch das Kostenbewußtsein des Ingenieurs zu fördern<br />
sein. Diesen Anspruch gilt es auch in der Projektmanagement-Lehre einzulösen.<br />
„Nicht“ meinen interessanterweise nur 24 Prozent der befragten Studenten.<br />
Von dieser Prämisse ausgehend arbeiteten die befragten Studenten/innen in<br />
ihren themenzentrierten Projektgruppen von Sitzungstermin zu Sitzungstermin<br />
stets mit Arbeitstechniken, die die Projektbearbeitung so weit möglich<br />
erleichtern sollte , andererseits in der Berufspraxis je nach Anforderungsraster<br />
mehr oder weniger anzutreffen sind.<br />
Natürlich richtet sich die Effektivität der Gruppenarbeit auch nach der Größe der<br />
Projektgruppe: Immerhin meinten 64 Prozent der Befragten die Gruppengröße<br />
war „gerade richtig“. 19 Prozent sagten „zu groß“ und 17 Prozent „zu klein“.<br />
Die Lehr-Veranstaltung selbst gab nach 100 Prozent der befragten Studenten<br />
„genügend Gelegenheit, um Fragen zu stellen“.<br />
Insoweit angemerkt werden muß, dass im hochschulinternen Mikrokosmos der<br />
studentischen Projektgruppe gearbeitet, andererseits gleichsam auf den<br />
Mikrokosmos des professionellen Projektmanagements im Betrieb vorbereitet<br />
wird.<br />
3. Die Arbeitsttechniken: Bearbeitungsraster,- tabellen und<br />
-formulare<br />
Die Arbeitstechniken sollen hier kurz vorgestellt werden, ihre Anwendung im<br />
Anhang des hier vorliegenden Beitrages anhand von studentischen AT-<br />
Berichten zudem detailliert präsentiert werden. Zwei AT-Berichte wurden<br />
ausgewählt. Sie sind exemplarisch für die AT-Anwendung und hinsichtlich ihrer<br />
Prägnanz übersichtlich. Folgende AT`s waren unter Innovations-,<br />
Entscheidungs-, Planungs- und Kostengesichtspunkten zu bearbeiten.<br />
Die Arbeitstechniken in Kürze sind:<br />
1. das Sitzungsdokumentationsblatt (Transparenz der Arbeitstermine)<br />
2. das Projektthemenformular (Niederschrift der Aspekte etc.)<br />
3. das IHK-Formular „Projektauftrag“ (Thema und Mittel)<br />
4. die Anforderungsliste/Pflichtenheft (techn. Hauptmerkmale)
5. das Skalenraster zur interdisziplinären Risikoanalyse (Hobbs)<br />
6. das Diagrammraster zum Projekt(ablauf)plan: Zeitdiagramm<br />
7. die Liste „Ablauffolge“ zum Netzplan (mit Netzplanstruktur)<br />
8. der Projektinvestitionsantrag (Begründung der Arbeitsmittel)<br />
9. die Kostenkalkulation des Prototyps (Projektkosten)<br />
10. der Morphologische Kasten /Entscheidfindung v. Merkmalsausprägungen<br />
11. der Zielbaum zur Entscheidungsvorbereitung (Gewichtung der Teilziele)<br />
12. das Brainwriting zur Mitarbeiterbefragung (Organisationshemmnisse)<br />
13. die Nutzwertanalyse (NWA) zur Entscheidung/Selektion<br />
14. der konventionelle oder elektronische Laufzettel zur Teilebegleitung<br />
15. die Ersatzinvestitionsrechnung zur Produktionsmittel-Entscheidung<br />
16. das Matrixformular zur (interdisziplinären) Zuordnung von Spezialisten<br />
aus objekt- und verrichtungsbezogenen Aufgabenbereichen<br />
79 Prozent der im WS befragten Studenten meinen, dass sie noch nie an solche<br />
Arbeitstechniken in der Projektgruppenarbeit gedacht haben. Und 69 Prozent<br />
sind der Meinung „über die betriebswirtschaftliche Seite des<br />
Projektmanagements“ würden sie gerne noch mehr hören. Überhaupt solle nach<br />
76 Prozent der Befragten „die Kostenseite“ eines Projekts Thema sein.<br />
Nach praktischem Kennenlernen der Arbeitstechniken wird von einer<br />
Projektgruppe unter der Koordination der Studentin Weinrich ein „Handout“<br />
zusätzlich zur AT-Berichterstattung – und zwar zur Erläuterung der AT`s -<br />
gefertigt und vorgelegt. Neben kleinen Einschränkungen (insbesondere in Punkt<br />
14 und 16) soll das Paper hier vorgestellt werden:<br />
1.<br />
„Eine Projektverlaufsdokumentation dient der Übersicht über die Projektarbeit<br />
zu den jeweiligen Terminen. Sie gibt einen groben Einblick in die Projektphasen<br />
und die darin enthaltenen Arbeitstechniken.<br />
2.<br />
Das (Arbeitsformular) „Projektthema“ gibt Einblicke in die Grundideen und<br />
Zielperspektive des Projektes. Dabei werden gleichzeitig auch Schwerpunkte,<br />
Probleme und Nebeneffekte des Projektes erläutert.<br />
.<br />
3.<br />
Das (Formular) „Projektauftrag gibt Aufschluß über die konkrete Festlegung<br />
von Terminen über die `wahrscheinlich` benötigen Mittel, eine Konkrete<br />
Zielfindung und die Gliederung des Personals.<br />
4.<br />
Im Skalenformular „Risikolanalyse“ geht es um die Einschätzung von<br />
Schweregrad und Wahrscheinlichkeit möglicher, auftretender Risiken. Diese<br />
Risiken werden unterteilt in zum Beispiel technische, personelle, finanzielle und<br />
rechtliche usw.. Hierbei wird das Verhältnis von Schweregrad zu
Wahrscheinlichkeit in den Vordergrund gestellt, da erst dies über die Risiken<br />
Aufschluß gibt.<br />
5.<br />
Beim (Formularraster) „Projektplan“ werden die einzelnen Aktivitäten in einem<br />
Zeitplan gegliedert. Dieser wird mit Hilfe eines Balkendiagramms in (z.B.)<br />
Wochen unterteilt.<br />
6.<br />
Bei dem (Strukturformular) Netzplantechnik wird ein Strukturplan graphisch<br />
dargestellt, der Aufschluß über die Ablauffolge und jeweilige Zeitdauer der<br />
Vorgänge des Projekts gibt. (Zeitpuffer wären zu bestimmen. d.V.)<br />
7.<br />
Beim Formular „Projektinvestitionsantrag“ werden die voraussichtlichen Kosten<br />
aufgelistet. Dieser dient zur Planung der Wirtschaftlichkeit und der<br />
Genehmigung des Projekts beim Vorgesetzten.<br />
8.<br />
Beim (Formblatt) „Gesamtkosten“ handelt es sich um eine Gesamtübersicht und<br />
genaue Aufschlüsselung der Gesamtkosten.<br />
9.<br />
Das (Raster) des „Mophologischen Kastens“ ist eine kreaktive analytische<br />
Methode um komplexe Problembereiche vollständig zu erfassen und alle<br />
möglichen Lösungen vorurteilslos zu betrachten.<br />
10.<br />
Das (Arbeitsraster) „Entscheidungsbaum“ ist eine spezielle Darstellungsform<br />
von Entscheidungsregeln. Er veranschaulicht aufeinander folgende,<br />
hierarchische Entscheidungen und hilft hierbei das Hauptziel nach Effektivität<br />
und Effizienz zu unterscheiden. (Hauptziel, Unterziele, Subunterziele von<br />
Qualitätserfolg und Wirtschaftlichkeit. d.V.)<br />
11.<br />
Das Arbeitsformular zum „Brainwriting“ gibt jedem Mitarbeiter des Projektes<br />
die Möglichkeit, sich über bestimmte Fragen zum (z.B.) organisatorischen<br />
Ablauf zu äußern. Dabei gibt der Moderator einen bestimmte Zeitvorgabe (zur<br />
Beantwortung, d.V.) vor und wertet die Ergebnisse anschließend aus.<br />
12.<br />
Bei der Nutzwertanalyse wird in einem Entscheidungsbaum<br />
Abwägungsschwerpunkte für das anzuschaffende Objekt festgelegt Im zweiten<br />
Teil der Nutzwertanalyse werden mögliche Anschaffungsobjekte an Hand der<br />
Abwägungsschwerpunkte bewertet. Somit ergibt sich bei der Summierung der<br />
Teilnutzwerte eineEntscheidung für oder gegen eine Anschaffung.<br />
13.<br />
Der zu bearbeitende „Laufzettel“ gliedert alle nötigen Tätigkeiten und zeigt<br />
welcher Mitarbeiter für welche Aufgaben eingeteilt ist. Der Status der
momentanen Bearbeitung wird ebenfalls festgehalten. Der „Laufzettel“ dient<br />
dabei zur Qualitätssicherung.<br />
14.<br />
Die durchzuführende Ersatzinvestitionsrechnung ..“dient der Emittlung der<br />
Amortisation, dies bedeutet wie lange eine Maschine im Einsatz sein muß, damit<br />
sie sich selbst finanziert..“ (Weinrich)<br />
Hier ist korrekturhalber anzufügen, daß der Amortsationsgrad in Jahren<br />
definiert erkenntlich macht wann eine Ersatzinvestition im Verhältnis zur<br />
abgezahlten Erstinvestition hinsichtlich ihrer Jahresbetriebskosten rechnet bzw.<br />
gen Null geht oder zumindest einen kurzen oder kürzeren Zeitraum benötigt als<br />
eine weitere in Aussicht genommene Ersatzinvestition(d.Verf.).<br />
15<br />
Das zu bearbeitende Dokumentationsraster zur „Organisationsanalyse“ (..die<br />
Matrixorganisation der Projektaufbaustruktur, d.Verf.) dient der Gliederung der<br />
Aufgaben bereiche, die in verrichtungsbezogene und objektbezogene Bereiche<br />
eingeteilt. Hierbei wird die Anzahl der Mitarbeiter für jeden Aufgabenbereich<br />
bestimmt (Weinrich).<br />
Ergänzungshalber muß hier angemerkt werden, dass die Matrixorganisation<br />
auch die notwendig interdisziplinäre Zusammensetzung der in die Projektgruppe<br />
delegierten Mitarbeiter dokumentiert (d.Verf.).<br />
16.<br />
Im Nachtrag muß der Verfasser des Berichts noch auf die Anwendung der<br />
Stückkostenkalkulation zur Erfassung der Prototypenkosten, dem<br />
Projektergebnis, verweisen. Hierzu liegt den Gruppen ein dezidiertes<br />
Kalkulationsschema (Bullinger u.A.) vor, welches bis zu den<br />
projektbetrieblichen Selbstkosten durchgerechnet wird. Diese Kosten sind nicht<br />
mit dem kaufmännischen Katalogpreis und schon gar nicht mit dem Marktpreis<br />
zu verwechseln. Es geht stets nur um die produktionsbedingten Kosten.<br />
4. Fazit: Interesse am „Projektmanagement“<br />
Nach dieser Erfahrung mit den Arbeitstechniken im Projektmanagement stellen<br />
über zwei Drittel der Studenten fest, das Thema Projektmanagement“ hat mein<br />
Interesse gefunde“n. Nur 7 % der Befragten meinen… das Thema habe sie nicht<br />
motiviert. 52 % meinen ausdrücklich “ja“ und immerhin 41% meinen“<br />
bedingt“.<br />
Wenn die gruppenpädagogische Seite des Projektmanagement nicht zu<br />
unterschätzen ist, dann ist bemerkenswert, wenn 36% der Befragten „nicht“<br />
wissen, ob dieser gruppenpädagogische Aspekt noch stärker präsentiert werden<br />
soll. Ganze 24 % meinen sogar „nein“, was wiederum für eine diesbezüglich
intensive Unterweisung spricht . Teamarbeit und Kooperationswille sind<br />
Grundvoraussetzung im Ingenieurberuf (Staufenbiel 2006)<br />
Auf die Nutzung der Arbeitstechniken angesprochen, meinte eine Projektgruppe<br />
(„Hofgut II“ ) sie habe zur Bestimmung des Energieaufwandes u.a.m. diese<br />
AT`s kaum anwenden können, was wiederum die Projektgruppe „Hofgut I“<br />
nicht bestätigen konnte.<br />
Es muß hier bemerkt werden , dass das regelmäßige Zusammentreffen so<br />
mancher Projektgruppe zu wünschen übrig ließ. Die meisten (kleineren)<br />
Gruppen arbeiteten intensiv. Eine Projektgruppe mit 8 Teilnehmern hatte teils<br />
mit sich selbst zu tun… Wie schon gesagt: 19 % der Befragten schätzten ihre<br />
Gruppe als zu groß ein. Andererseits gab es auch bei kleinen Gruppen interne<br />
„Querelen“ und „Ausschlußforderungen“.<br />
Im Vergleich dazu meinen 77% der Studenten/innen (Pop: 48) aus „offenen“<br />
PM-Lehrveranstaltungen im SS. 2005, dass genügend Arbeitstechniken<br />
präsentiert wurden. In den „geschlossenen“ Veranstaltungen waren dies (s.o.)<br />
79% der Befragten. In „offenen“ Veranstaltungen hat bisher die Hälfte der<br />
Befragten „noch nicht“ an solche Arbeitstechniken gedacht. In den<br />
geschlossenen Veranstaltungen waren dies drei Viertel der Befragten.<br />
Der Kostenseite der Thematik messen in „offenen“ Veranstaltungen(V) 83 %<br />
(SS 2005) und in „geschlossenen „ 76 % besondere Bedeutung bei. 85% aus<br />
„offenen“ V. (fachübergreifende Richtungen) würden gerne noch mehr über PM<br />
hören wobei dies bei „geschlossenen“ V. (technische Richtungen) nur 60 %<br />
sind. Bleibt zu reflektieren inwieweit das PM-Bewußtsein von Technikern noch<br />
geringer ausgeprägt ist als das von Nichttechnikern.<br />
Nach den Staufenbiel-Ratgebern 2006 zu urteilen, müssen angehende Ingenieure<br />
zunehmend PM-Fähigkeiten entwickeln, Teamarbeit beherzigen,<br />
Kostenbewußtsein entfachen und Kreativtätstechniken sowie Kooperation<br />
akzeptieren. Industrie und Gewerbe benötigen demnach kooperationswillige<br />
Techniker und nicht nur den Eigenbrödler im „stillen Kämmerlein“ Auch sind<br />
Ingenieure zunehmend in Absatz und Vertrieb als sachkundige Verkäufer tätig,<br />
die vorort beim Kunden ansatzweise entwickeln und Projekte entfachen.<br />
„Schlüsselqualifikationen“ (VDI/BDI) sind anzueignen. Aber auch allgemein ist<br />
Bewußtsein von Technologiefolgen zu entwickeln. Diese wird verstärkt in die<br />
Risikoanalyse eingehen müssen. Abschätzungen von Projektwirkungen sind<br />
nicht nur technologisch relevant, sondern wie Gesetzesfolgeabschätzungen auch<br />
gesellschaftlich unter dem Aspekt von Kosten und Rechtssicherheit nicht ohne<br />
Bedeutung.
Und genau hier im Vertriebsbereich setzt auch die Frage nach den<br />
Präsentationsfähigkeiten nicht nur von Ingenieuren an. Befragt wurde so im WS<br />
2004/05 beispielsweise Studenten/innen (Pop: 48) aus dem Fachbereich<br />
Energiewirtschaft (Prof.Dr.M. Rebstock), die zu gut 90% die<br />
gruppendynamischen Aspekte für wichtig halten und zu 75 % den<br />
psychoanalytischen Themen von Streß und Lampenfieber in der<br />
Präsentationssituation große Bedeutung zumessen. Kein Wunder, wenn 95 %<br />
der Befragten die „Präsentationsanalyse“ (Hill) für wichtig empfinden und 93 %<br />
sich stark für „Wissensspeicherung“ in Anbetracht des anstehenden Vortrages<br />
interessieren.<br />
Bleibt abschließend die Frage inwieweit gerade bei geschlossenen und mehr<br />
technischen Zielgruppen-Veranstaltungen neben Projektmanagement der Lehre<br />
von den Präsentationsmethoden und –techniken noch größere Bedeutung<br />
zukommen sollte. Dem obligatorischen Besuch der PM-Lehrveranstaltung wird<br />
der der Präsentation folgen müssen. Der Techniker „stellt vor“ oder „verkauft“<br />
nicht nur sein technisches Produkt/Projekt, sondern auch seine Person im Sinne<br />
von Selbstdarstellung und Verhaltensmustern, die gleichsam erfolgreich<br />
„verkauft“ werden müssen.<br />
Im Anhang dieses Beitrages findet sich ein ausgewähltes Beispiel der<br />
Berichterstattung von 15 bzw. 16 angewandten Arbeitstechniken in den<br />
Lehrveranstaltungen im WS 2006/07. Es ist das Projektthema „Demonstrations-<br />
Abwärtswandler“ der Studenten Kremer, Schaefer und Mamar. Der AT-Bericht<br />
ist besonders übersichtlich gehalten und insofern exemplarisch .<br />
Zur Person:<br />
Der Verfasser des Berichts ist Promotionsabsolvent der postuniversitären Deutschen<br />
<strong>Hochschule</strong> für Verwaltungswissenschaften Speyer mit universitären Studien in den<br />
Wirtschafts- und Rechtswissenschaften. Neben Industrie- (Vertriebsausbau) und<br />
Verwaltungserfahrung (Abteilungsaufbau), Forschungstätigkeiten im Bund-/Länder-Institut<br />
Speyer (Bürokratieforschung/Projektmanagement) Auslandsaufenhalten, dann<br />
Hochschullehre (LA) an Universität Mainz, danach Hessische Verwaltungsfachhochschule<br />
Frankfurt und schließlich (20 Jahre) Staatliche Studienakademie/Berufsakademie des Landes<br />
Baden-Württemberg (Diplom-Ingenieurwesen), zstl. Projektbegleitungen in Spanien,<br />
Recherchen zum Thema „Geldautomatenkriminalität, Kreditkartenfälschung und<br />
Bankenhaftung“. Ein Bericht hierzu soll folgen – und zwar zusammen mit der südhess.<br />
Anwaltsnotarin Gabriele Fromm-<strong>Frymark</strong>, die u.a. hierin international bekannt geworden ist<br />
(ARTE, RTL, ABC) .<br />
Info-Hinterlegungen ggf. über das Kanzleisekretariat der Rechtsanwältin und Notarin G.<br />
Fromm-<strong>Frymark</strong>, Tel: 06207-82136 ( Frau J.Kohl Frau A.Jöst, Frau U.Hartmann)<br />
Sprechzeiten mit Dr. Hans J. <strong>Frymark</strong> (i.S. Prof. Projektmanagment) für Darmstädter<br />
Studenten/innen mittwochs, nur 18 bis 19 Uhr über Tel. 0175/6670749<br />
(ggf.Auslandsgespräch)<br />
Anhang: Ein Beispiel von studentischen Arbeitstechniken
Projekt Demonstrations- Abwärtswandler<br />
Präsentation der Arbeitstechniken<br />
Vortragende: Thomas Kremer, Simon Schaefer, Christian Mamar<br />
Dozent: Dr. <strong>Frymark</strong><br />
12.01.2007
Projektverlaufsdokumentation<br />
Projektthema: Demonstrations-Abwärtswandler<br />
Nr. Datum Projektphase<br />
1 27.10.06<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
03.11.06<br />
10.11.06<br />
17.11.06<br />
24.11.06<br />
01.12.06<br />
08.12.06<br />
15.12.06<br />
(Ablaufplan)<br />
Innovation<br />
Innovation<br />
Zielsetzung<br />
Planung<br />
Entscheidungsphase<br />
Entscheidungsphase<br />
Organisation / Koordination<br />
Dokumentation<br />
9 05.01.06 Projektpräsentation<br />
Projekt Demonstrations- Abwärtswandler<br />
Bearbeitungsthema<br />
(Aspekt)<br />
Risikoanalyse<br />
Projektauftrag<br />
Projektplan<br />
Projektinvestition<br />
Probleme / Ausprägungen<br />
Nutzwertanalyse (NWA)<br />
Kostenvergleichsrechnung<br />
Dokumentationsraster<br />
Vorbereitung der Präsentation<br />
Arbeitstechnik<br />
(d. Teamarbeit)<br />
Risikoanalyse<br />
IHK-Formular<br />
Netzplantechnik<br />
Investitionsantrag<br />
Morphologischer Kasten<br />
Brainwriting<br />
NWA<br />
Laufzettel<br />
Ersatzinvestition<br />
Matrixorganisation<br />
Einschätzung
1 – Risikoanalyse<br />
1. Technische Risiken<br />
2. Personelle Risiken<br />
3. Finanzielle Risiken<br />
4. Klimatische Risiken<br />
5. Zeitplanerische Risiken<br />
6. Vertragliche Risiken<br />
Projekt Demonstrations- Abwärtswandler<br />
höchst<br />
unwahrscheinlich<br />
Wahrscheinlichkeit<br />
relativ wahrscheinlich äußerst<br />
wahrscheinlich<br />
Schweregrad<br />
trivial relativ sehr gravierend<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />
-
1 – Risikoanalyse (2)<br />
Projekt Demonstrations- Abwärtswandler<br />
höchst<br />
unwahrscheinlich<br />
Wahrscheinlichkeit<br />
7.g. arbeitsrechtliche -<br />
7.h. nachbarschaftsrechtliche -<br />
relativ wahrscheinlich äußerst<br />
wahrscheinlich<br />
Schweregrad<br />
trivial relativ sehr gravierend<br />
7. Rechtliche Risiken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />
7.a. werksvertragliche<br />
7.b. kaufvertragsrechtliche<br />
7.c. baurechtliche<br />
7.d. gewerbespezifische<br />
7.e. sicherheitsrechtliche<br />
7.f. emissionsrechtliche<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-
2 – Projektauftrag<br />
Projekt Demonstrations- Abwärtswandler<br />
1. Beschreibung des Problems:<br />
Aufbau eines Tiefsetzstellers zu Unterrichtszwecken inkl. Messtechnik und Visualisierung<br />
2. Zielsetzung/ Priorität: Motivation der Studenten durch praktische Vorführung des gelehrten<br />
Stoffes<br />
3. Rahmenbedingungen: VDE-Vorschriften, Vorgaben durch Professor, Abmessungsvorgaben<br />
4. Erwartete Effekte: Entlastung von Prof. Dr. Schmidt-Walter<br />
5. Projektabschluss: vorr. 12. 01. 2007<br />
6. Berichterstattung: alle<br />
7. Starttermin: 13.10.2006<br />
8. Auftraggeber: h_da; SW<br />
9. Projektmoderator: alle<br />
10. Verteiler: h_da; SW; FRY
Projekt Demonstrations- Abwärtswandler<br />
3 – Das Projektthema Konzept und Aspekte<br />
Thema (Beschreibung):<br />
Demonstrations-Abwärtswandler:<br />
Es soll ein Abwärtswandler zu Vorführungszwecken gebaut werden. Die Visualisierung<br />
von dazugehörigen Messwerten soll über einen PC mit Beamer ermöglicht werden.<br />
Themenaspekte (Schwerpunkte):<br />
- Anschauliche Demonstration der Funktionsweise eines Abwärtswandlers in der<br />
Vorlesung.<br />
- Visualisierung via PC / Beamer<br />
Probleme:<br />
- Aufbau/ Gehäuse - Messtechnik - Möglichkeiten der Visualisierung<br />
- Störeinflüsse - Termindruck - Absprache mit Partnergruppe<br />
- Sicherheit (Berührungsschutz)<br />
- Abmessungen klein halten (Mobilität)
Projekt Demonstrations- Abwärtswandler<br />
3 – Das Projektthema Konzept und Aspekte (2)<br />
Themenbegründung:<br />
Verbesserung der Unterrichtsmethoden der Vorlesung „Schaltnetzteile“.<br />
Zielperspektive (Die Projektabsicht):<br />
Motivation der Studenten durch praktische Vorführung des gelehrten Stoffes.<br />
Nebeneffekte (des Projektziels):<br />
- Entlastung von Prof. Schmidt-Walter - moderne Unterrichtsmöglichkeiten<br />
Projektmitglieder in der Seminararbeit:<br />
Thomas Kremer, Christian Mamar, Simon Schaefer
4 – Netzplantechnik (1)<br />
Projekt Demonstrations- Abwärtswandler<br />
Nr. Vorgang Zeitdauer (Wochen)<br />
1 Schaltungsdimensionierung 1,5<br />
2 Messtechnik-Planung 3<br />
3 Materialauswahl 1<br />
4 Gehäusedimensionierung 1<br />
5 Platinenlayout 1<br />
6 Bauteil-Bestellung 1<br />
7 Platine ätzen 2<br />
8 Gehäusebau 1<br />
9 Zusammenbau 2<br />
10 Test / Fehlersuche / Optimierung 4<br />
11 Abgabe / Präsentation 1<br />
12 Dokumentation 12<br />
Strukturplan:<br />
3<br />
12<br />
1 2 4 5 7 9 10 11<br />
6<br />
8
5 – Netzplantechnik (2)<br />
Balkendiagramm:<br />
Projekt Demonstrations- Abwärtswandler<br />
Nr. Vorgang Woche: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />
1 Schaltungsdimensionierung<br />
2 Messtechnik-Planung<br />
3 Materialauswahl<br />
4 Gehäusedimensionierung<br />
5 Platinenlayout<br />
6 Bauteil-Bestellung<br />
7 Platine ätzen<br />
8 Gehäusebau<br />
9 Zusammenbau<br />
10 Test / Fehlersuche / Optimierung<br />
11 Abgabe / Präsentation<br />
12 Dokumentation
6 – Projektinvestitionen<br />
Material<br />
Produktionsmittel<br />
Arbeitskosten<br />
Projekt Demonstrations- Abwärtswandler<br />
Gehäuse<br />
Schaltung<br />
Messtechnik Σ 1480,00€<br />
PC Σ 1000,00€<br />
Werkzeuge/Werkstätte Σ 600,00€<br />
Messtechnik Σ 1200,00€<br />
40€/Std. 3 Personen Σ 5760,00€<br />
4 Std./KW 12KW<br />
Energiekosten Strom 17ct/kWh +10€ NK<br />
(Heizkosten etc)<br />
Σ 30,00€<br />
Gesamt Σ 10.070,00€
7 – Realistische Kostenabschätzung<br />
Projekt Demonstrations- Abwärtswandler<br />
Für Material zzgl.<br />
Materialgemeinkosten 1480,00€<br />
+20%<br />
� Materialkosten<br />
296,00€<br />
Σ 1776,00€<br />
Fertigungskosten 5790,00€<br />
5% der Produktionsmittel (2800€) 140,00€<br />
Energiekosten 30,00€<br />
Gesamt Σ 7736,00€
8 – Morphologischer Kasten<br />
Parameter<br />
(Bestandteile/Funktionen)<br />
Projekt Demonstrations- Abwärtswandler<br />
Ausprägungen<br />
(Lösungsmöglichkeiten)<br />
Eingangsspannung DC 5V 12V 24V 50V<br />
Ausgangsleistung 1W 5W 10W 20W<br />
Ausgangsspannung 1V 2V 5V 12V<br />
Baugröße DIN A4 2xDIN A4 2xDIN A3 Schrank<br />
Messtechnik Nur analog Nur LED<br />
LED Anzeige<br />
und Oszi.<br />
Nur Oszi.
9 – Entscheidungsbaum<br />
Baugröße<br />
Projekt Demonstrations- Abwärtswandler<br />
Darstellung<br />
der<br />
Funktionen<br />
des AW<br />
Funktionalität Darstellung<br />
Erweiterbarkeit<br />
Sicherheit<br />
Übersichtlichkeit<br />
Realitätsbezug<br />
Präsentierbarkeit
Projekt Demonstrations- Abwärtswandler<br />
10 – Nutzwertentscheidungstechniken - Zielgewichtung<br />
Ziele Maßnahmen<br />
(M)<br />
A1 - Abwärtswandler A2 - Softwaresimulation<br />
Punktwert Teilnutzwert Punktwert Teilnutzwert<br />
Baugröße 20 +2 40 +5 100<br />
Erweiterbarkeit 5 +3 15 +5 25<br />
Sicherheit 5 +4 20 +4 20<br />
Übersichtlichkeit 20 +4 80 -4 -80<br />
Realitätsbezug 30 +5 150 -4 -120<br />
Präsentierbarkeit 20 +5 100 +2 40<br />
Summen 100 405 -15<br />
Zielwertskala:<br />
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
11 – Brainwriting<br />
Fragen:<br />
a) Was könnte man am Projekt noch verbessern?<br />
b) Sind Sie mit der Arbeitsteilung zufrieden?<br />
Antwortendokumentation:<br />
Projekt Demonstrations- Abwärtswandler<br />
1. a) Die Aufgaben müssten klarer feststehen, das Projekt entwickelt sich selbstständig.<br />
b) Ja<br />
Besser wäre es, wenn das gesamte Projekt klar vorbestimmt wäre.<br />
2. a) mehr Zeit<br />
b) Nein<br />
3. a) Mehr Kommunikation mit dem Auftraggeber<br />
b) Ja
12 – Ersatzinvestitionsrechnung<br />
Ausgaben- / Kostenart Altes Neues<br />
Summe Anschaffungskosten 1480€ 100€<br />
1.) Kapitalkosten<br />
1.1 Abschreibungen - -<br />
1.2 kalkulatorische Zinsen - -<br />
2.) Sachkosten<br />
2.1 Raumkosten 60€ -<br />
2.2 Energiekosten (Strom) 30€ 10€<br />
2.3 Instandhaltung 20€ 20€<br />
2.4 Datenträger - -<br />
3.) Personalkosten 5760€ -<br />
4.) Gemeinkosten - -<br />
Summe jährliche Betriebskosten 110€ 30€<br />
Minderkosten 80€<br />
Projekt Demonstrations- Abwärtswandler<br />
Amortisation:<br />
Anschaffungskosten<br />
Minderkosten<br />
100€<br />
=<br />
= 1,<br />
25Jahre<br />
80€
13 – Laufzettel<br />
Projekt Demonstrations- Abwärtswandler<br />
Art der Tätigkeit oder<br />
Aufgewandte Zeit als<br />
Kurzzeichen Gruppenleiter Sacharbeiter Zuarbeiter Registratur Zeit<br />
1. Platinenlayout - C. Mamar 10 Std.<br />
2. Schaltplan<br />
zeichnen<br />
3. Projektverlaufs-<br />
dokumentation<br />
4. Bauteilauswahl -<br />
5. Dimensionierung<br />
und Berechnung<br />
- S. Schaefer 6 Std.<br />
- S. Schaefer 3 Std.<br />
-<br />
C. Mamar<br />
T. Kremer<br />
S. Schaefer<br />
S. Schaefer<br />
T. Kremer<br />
C. Mamar<br />
20 Std.<br />
20 Std.<br />
6. Bestellung - T. Kremer S. Schaefer 4 Std.<br />
7. Aufbau - C. Mamar T. Kremer 20 Std.<br />
8. Test und Revision -<br />
T. Kremer<br />
S. Schaefer<br />
C. Mamar<br />
40 Std.
Projekt Demonstrations- Abwärtswandler<br />
14 – Dokumentationsraster zur Organisationsanalyse<br />
Matrixanalyse:<br />
objektbezogene<br />
Aufgabenbereiche<br />
Platine<br />
Gehäuse<br />
Messtechnik<br />
Anzahl der<br />
Mitarbeiter<br />
verrichtungsbezogene<br />
Aufgabenbereiche<br />
Planung Realisierung Kontrolle<br />
3<br />
2<br />
3<br />
1<br />
2<br />
2<br />
3<br />
2<br />
3
Projekt Demonstrations- Abwärtswandler<br />
15 – Dokumentationsraster zur Organisationsanalyse (2)<br />
Kontakte mit<br />
Angebots-<br />
Konstruktion<br />
Terminfest-<br />
Legung<br />
Terminüber-<br />
Wachung<br />
Termin-<br />
Änderung<br />
Termin-<br />
Mahnung<br />
Sonstiges Gesamt<br />
0,5 0,5 0 0 0 1,0<br />
Vorrichtungs-<br />
Konstruktion 0,25 0,25 0 0 0 0,5<br />
Arbeitsvorbereitung<br />
Arbeitspläne<br />
0,5 0,5 0 0 0 1,0<br />
Einkauf 0,25 0,25 0 0 0,5 1,0<br />
Materialbestellung 0,25 0,25 0 0 0,5 1,0<br />
Montage 0,25 0,25 0 0 0 0,5<br />
Revision 1,0 1,0 0 0 0 2,0<br />
Versand 0 0 0 0 0 0<br />
Zeitangaben in Stunden<br />
Gesamt<br />
6h