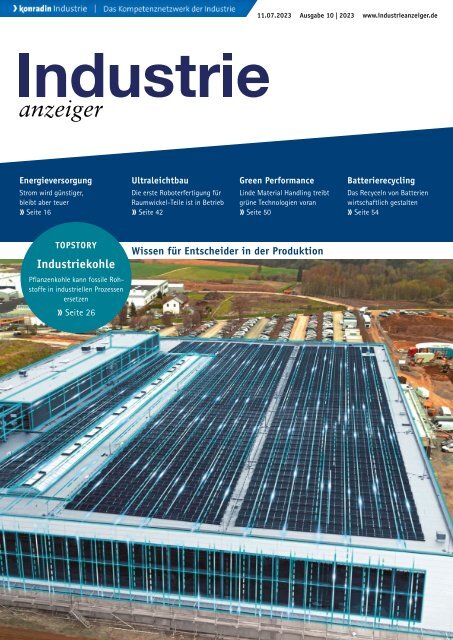Industrieanzeiger 10.2023
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
11.07.2023 Ausgabe 10 | 2023 www.industrieanzeiger.de<br />
Energieversorgung<br />
Ultraleichtbau<br />
Green Performance<br />
Batterierecycling<br />
Strom wird günstiger,<br />
bleibt aber teuer<br />
» Seite 16<br />
Die erste Roboterfertigung für<br />
Raumwickel-Teile ist in Betrieb<br />
» Seite 42<br />
Linde Material Handling treibt<br />
grüne Technologien voran<br />
» Seite 50<br />
Das Recyceln von Batterien<br />
wirtschaftlich gestalten<br />
» Seite 54<br />
TOPSTORY<br />
Industriekohle<br />
Pflanzenkohle kann fossile Rohstoffe<br />
in industriellen Prozessen<br />
ersetzen<br />
» Seite 26<br />
Wissen für Entscheider in der Produktion
Macht alles<br />
ganz einfach.<br />
Konnektivität<br />
Performance<br />
Service<br />
Sicherheit<br />
Flach bauen<br />
cyber ® iTAS ® system 2 –<br />
das Antriebssystem für FTS.<br />
Das cyber ® iTAS ® system 2 ist die nächste Generation unseres kompakten<br />
Servoantriebssystems für Fahrerlose Transportsysteme (FTS) und autonome<br />
mobile Roboter (AMR) mit Fahrzeugmassen zwischen 1 t und 3 t. Es macht<br />
Fahrzeugherstellern die Realisierung von Features in den Bereichen Sicherheit,<br />
Performance, Konnektivität, Flach bauen und Service jetzt viel, viel einfacher.<br />
Mehr erfahren<br />
WITTENSTEIN – eins sein mit der Zukunft<br />
www.wittenstein-cyber-motor.de<br />
cyber motor<br />
2 <strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023
» MEINUNG<br />
Einfacher ist oft besser<br />
Gut, dass die Auswirkungen unseres Handelns in unser aller Fokus gerückt sind.<br />
Ob der Digitalisierungshype und manch andere Ideologie der Umwelt und dem<br />
Weltklima wirklich nützen, sollte dennoch gelegentlich hinterfragt werden.<br />
Immer wieder höre ich, an zunehmender Digitalisierung führe kein Weg vorbei,<br />
wenn wir unseren Planeten retten wollen. Keine Frage, ohne Digitalisierung<br />
geht´s nicht. Das gilt besonders für gewerbliche Anwendungen und vor allem<br />
auch für Produktionsprozesse. Doch wir sollten gut abwägen, wie viel davon an<br />
welcher Stelle sinnvoll ist. Ein Grundsatz, für den viele geniale Konstrukteure<br />
standen, verliert zunehmend an Bedeutung: Die einfachste Lösung, die alle An -<br />
for derungen erfüllt, ist die Beste! Die Komplexität vieler Prozesse steigt so dramatisch,<br />
dass sie ohne künstliche Intelligenz nicht mehr zu beherrschen sind. Die<br />
Folge: Datenvolumina wachsen mit kaum vorstellbarer Geschwindigkeit.<br />
Vor kurzem habe ich beim Aachener Werkzeugmaschinen-Kolloquium gelernt,<br />
100 GB Daten für zehn Jahre nutzbar zu halten, verursache soviel CO 2<br />
wie eine<br />
Tonne Rohstahl. So gesehen haben wir aus unserem letzten Urlaub Bilddaten<br />
mitgebracht, die mehr als eine Tonne wiegen. Angesichts eines Datenvolumens<br />
von rund 3 GB pro gestreamten Film, wird mir schwindelig, wenn ich bedenke,<br />
welche Mengen an Filmen gestreamt werden – auch von der Generation Friday<br />
for Future. Und: Mancher hält Bitcoins für umweltfreundlicher als Bargeld. Doch<br />
eine Bitcoin-Transaktion soll – je nach Quelle – 500 bis gut 700 kg CO 2<br />
verursachen.<br />
Im Auftrag der Niederländischen Zentralbank haben Forscher ermittelt,<br />
dass ein Bezahlvorgang mit Cash einen Fußabdruck von 0,0046 kg hinterlässt!<br />
Neuerdings wird propagiert, dass digitale Zwillinge jedes einzelnen Produkts<br />
auch die Nutzungsphase abbilden sollen. Dass das einen wirklichen Fortschritt in<br />
Sachen Nachhaltigkeit bringt, sehe ich (noch) nicht. Das Datenaufkommen wird<br />
aber endgültig explodieren, und wenn nicht komplett neue Wege gefunden werden,<br />
Daten zu erheben, zu verarbeiten, zu speichern und nutzbar zu halten, wird<br />
das die Klima- und Umweltsituation eher verschlechtern als verbessern.<br />
Der Verbraucher hat dadurch nur marginale Vorteile – wenn überhaupt. Er wird<br />
aber absolut gläsern. Davon profitieren in erster Linie große (Digital-)Konzerne.<br />
Und es ist ein Türöffner für die staatliche Lenkung sowohl geschäftlicher als<br />
auch privater Aktivitäten. Ob das gut ist, muss jeder selbst entscheiden.<br />
Mona Willrett<br />
Redakteurin <strong>Industrieanzeiger</strong><br />
mona.willrett@konradin.de<br />
NEU<br />
GN 3971, GN 3975<br />
Kegelrad- und<br />
Schneckengetriebe<br />
∙ Hohe Drehmomentübertragung<br />
∙ Robust und langlebig, da im<br />
Aluminium-Gehäuse gekapselt<br />
∙ Wartungsfrei<br />
∙ Vielseitig einsetzbar<br />
Folgen Sie uns auch auf diesen Kanälen:<br />
Anwendungsbeispiele,<br />
CAD-Daten und Bestellung.<br />
Einfach QR-Code scannen.<br />
Twitter:<br />
hier.pro/DfK03<br />
LinkedIn:<br />
hier.pro/3G7xq<br />
ganternorm.com<br />
<strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023 3
» INHALT 10 | 2023 145. JAHRGANG<br />
TOPSTORY<br />
Pflanzenkohle<br />
Pflanzenkohle kann fossile Rohstoffe<br />
in industriellen Prozessen<br />
ersetzen.<br />
» Seite 26<br />
Bild: Tobias Meyer<br />
Biomasse wie Holz kann neben der Energie auch Pflanzenkohle produzieren,<br />
und damit einen Teil des CO 2<br />
langfristig binden.<br />
» Seite 26<br />
NEWS & MANAGEMENT<br />
Industrienews<br />
Europäisches Lieferkettengesetz überlastet viele Firmen 08<br />
Mobilfunk sicher mit der Unternehmens-Cloud verbinden 10<br />
Schuler forciert Digitalisierung der Batteriefertigung 12<br />
Stahl lässt sich auch nachhaltig herstellen 14<br />
Rückblick auf die Horn Technologietage 2023 15<br />
» Industriestrompreis<br />
Stromkosten für Industrie und Gewerbe: Einblicke und<br />
Aussichten 16<br />
Nachhaltigkeit<br />
Mittels digitaler Tools und Daten Nachhaltigkeit fördern 18<br />
Klimamanagement<br />
Treibhausgas-Bilanz schafft Orientierung bei der<br />
Klimatransformation 20<br />
WBA-Serie: Nachhaltigkeit als Faktor<br />
Nachhaltigkeit im Werkzeugbau messen und befähigen 22<br />
TECHNIK<br />
TOPSTORY<br />
» Pflanzekohle<br />
Unternehmen kämpfen mit Energiepreisen und CO 2<br />
-Reduzierung:<br />
Mit Pflanzenkohle könnte Abhilfe geschaffen werden 26<br />
Energiemanagement-System<br />
Durch den Einsatz eines Energiemanagement-Systems<br />
kann die Effizienz im Unternehmen gesteigert werden 30<br />
Retrofitting<br />
Durch eine Maschinenüberholung lässt sich die<br />
Energieeffizienz merklich steigern 32<br />
Antriebstechnik<br />
Einfluss der europäischen Ökodesignrichtlinie auf<br />
die Antriebstechnik 34<br />
TITEL » Gleichstromnetze<br />
Sektorenkopplung zeigt wie die Energieversorgung<br />
von morgen aussehen könnte 36<br />
Oberflächentechnik<br />
Die VW-Lackiererei Osnabrück dosiert sauberes Lösungsmittel<br />
stromlos zu – ein doppeltes Plus für Nachhaltigkeit 40<br />
» Ultraleichtbau<br />
Zulieferer und Anlagenbauer Gradel hat die erste automatische<br />
Fertigung für Raumwickel-Bauteile installiert 44<br />
3D-Druck<br />
Wie Götz Maschinenbau als Zerspanungsunternehmen<br />
den 3D-Druck in die Serie bringt 47<br />
Intralogistik<br />
Nachhaltige Lösungen von Linde Material Handling unterstützen<br />
die Kunden bei der Klimatransformation 50<br />
Präzisionswerkzeuge<br />
Neue Laserhärteanlage für Werkzeughalter sorgt bei<br />
Mapal für ein Plus an Qualität und Nachhaltigkeit 52<br />
» Batterierecycling<br />
Mehrere Forschungseinrichtungen haben Wege entwickelt,<br />
Rohstoffe aus Batterien wirtschaftlich zu recyceln 54<br />
Menschzentrierte Industrie 4.0<br />
Kognitives Teaming zwischen Mensch und cyber physischem<br />
Produktionssystem soll die Prozesseffizienz optimieren 56<br />
Qualitätssicherung<br />
Thyssenkrupp Rasselstein reduziert Walzschäden und<br />
Bandrisse mit einer Messtechnik-Lösung von IMS 58<br />
Energieeffizienz<br />
Smarte Lösung für Sicherheitsbremsen sparen<br />
Ressourcen und Energie 60<br />
PRODUKTE & SERVICE<br />
Meinung 03<br />
Augenblicke der Technik 06<br />
Produkte 64<br />
Impressum 64<br />
Vorschau 65<br />
Zuletzt 66<br />
4 <strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023
Bild: Linde Material Handling<br />
Die Lösungen von Linde Material Handling setzen auf dynamische,<br />
klimafreundliche Technologien.<br />
» Seite 50<br />
Leistung übersetzt in Effizienz<br />
Industrie-<br />
Schraubenkompressoren<br />
mit SIGMA PROFIL<br />
Serien CSD und CSDX<br />
Bild: Fraunhofer IPA / Rainer Bez<br />
Im Projekt „DeMo-<br />
Bat“ ist vielfältige<br />
Hardware für die<br />
automatisierte Demontage<br />
entstanden,<br />
so beispiels -<br />
weise dieser Kleinteilegreifer.<br />
» Seite 54<br />
NEU<br />
ZUM TITELBILD<br />
Phoenix Contact investiert zum 100. Jubiläum in die Energieversorgung<br />
von morgen. Das neue Gebäude 60 zeigt auf<br />
weltweit einzigartige Weise die Vernetzung der Sektoren<br />
Energie, Mobilität, Infrastruktur und Gebäude. Mehr dazu im<br />
Beitrag auf Seite 36. Bild: Phoenix Contact<br />
• Sechs Druckvarianten für eine<br />
optimale Anpassung an<br />
individuelle Anforderungen<br />
• Neue Verdichterblöcke mit<br />
optimiertem SIGMA PROFIL<br />
• Höchste Effizienzklasse<br />
für das Antriebssystem<br />
(Festdrehzahl: IE4, SFC: IE5)<br />
• Drehzahlgeregelter Lüfter<br />
spart Energie<br />
Folgen Sie uns auch auf diesen Kanälen:<br />
Twitter:<br />
hier.pro/DfK03<br />
LinkedIn:<br />
hier.pro/3G7xq<br />
www.kaeser.com<br />
<strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023 5
Photovoltaikmodule, Kabel oder gleich ein ganzer Bagger – die<br />
Meldungen zu Diebstählen auf Baustellen sind teilweise kurios<br />
und durchgehend präsent. Doch viele Delikte werden erst gar nicht<br />
zur Anzeige gebracht, weil eine mangelhafte Dokumentation der<br />
Materialien und Geräte die Meldung erschwert. Auch scheuen<br />
Bauunternehmen den administrativen Aufwand oder gehen davon<br />
aus, dass die Straftat sowieso nicht aufgeklärt wird. Eine moderne<br />
Kameratechnik wie Video Guard sorgt dafür, dass es erst gar nicht<br />
zu einer Straftat kommt. Im Regelfall wirkt die Kamerabewachung<br />
an sich bereits abschreckend und präventiv. Detektiert das System<br />
unerwünschte Personen, wird der hochauflösende Stream an die<br />
Alarmzentrale übermittelt. Geschulte Mitarbeiter sichten das Material<br />
und reagieren zunächst mit einer direkten Ansprache, die<br />
über Lautsprecher am Kameraturm erfolgt. In der Regel vertreibt<br />
das die Eindringlinge. Falls nicht, helfen die Aufzeichnungen bei<br />
der Identifikation der Täter und erleichtern die Aufklärung von<br />
Straftaten. Bild: Video Guard<br />
6 <strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023
» Augenblicke<br />
der Technik<br />
<strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023 7
» NACHRICHTEN<br />
Europäisches Lieferkettengesetz<br />
Komplizierte Vorgaben überlasten<br />
Unternehmen zusätzlich<br />
Das europäische Lieferkettengesetz schreibt vor, wie Firmen die Auswirkungen ihrer Aktivitäten<br />
auf die Menschenrechte und die Umwelt berücksichtigen müssen. Wegen des bürokratischen<br />
Aufwands sind viele Unternehmen deutlich überfordert.<br />
Beim europäischen<br />
Lieferkettengesetz berichten<br />
Verbände und<br />
ihre Mitglieder von<br />
einem hohen bürokratischen<br />
Aufwand.<br />
Das deutsche Lieferkettengesetz bereitet Industrieunternehmen<br />
gerade genug Kopfschmerzen – nun<br />
kommt das europäische obendrauf. Brüssel bezieht<br />
große Teile der kleineren und mittleren Unternehmen<br />
mit ein, verschärft Sorgfaltspflichten und Haftungen.<br />
VDMA-Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann warnte<br />
schon vor der Abstimmung des EU-Parlaments,<br />
dass es Zeit sei die Notbremse zu ziehen. WSM-<br />
Hauptgeschäftsführer Christian Vietmeyer und Tim<br />
Geier, Geschäftsführer Der Mittelstandsverbund, Büro<br />
Brüssel, zeigen die immense Belastung für ihre Mitglieder<br />
auf.<br />
Das EU-Parlament hat seine Position für die Verhandlungen<br />
mit den EU-Ländern über Regeln zur Integration<br />
von Menschenrechten und Umweltauswirkungen<br />
in die Unternehmensführung angenommen.<br />
Mit den neuen Vorschriften würden Unternehmen<br />
gesetzlich verpflichtet, negative Auswirkungen ihrer<br />
Tätigkeiten auf die Menschenrechte und die Umwelt,<br />
wie Kinderarbeit, Sklaverei, Umweltverschmutzung<br />
oder Verlust der biologischen Vielfalt, zu ermitteln<br />
und erforderlichenfalls zu verhindern, zu beenden<br />
oder abzumildern. Außerdem müssen sie die Auswirkungen<br />
ihrer Partner in der Wertschöpfungskette auf<br />
Bild: Renate Wefers/stock.adobe.com<br />
die Menschenrechte und die Umwelt bewerten, und<br />
zwar nicht nur bei den Zulieferern, sondern auch im<br />
Zusammenhang mit dem Verkauf, dem Vertrieb, dem<br />
Transport, der Lagerung und der Abfallbewirtschaftung<br />
und anderen Bereichen.<br />
„Der Maschinen- und Anlagenbau in Europa setzt<br />
sich bereits heute für Menschenrechte und Umweltschutz<br />
in den Lieferketten ein“, sagt VDMA-Hauptgeschäftsführer<br />
Thilo Brodtmann. Man unterstütze<br />
die Ziele der Europäischen Union, soziale und ökologische<br />
Standards in Geschäftsbeziehungen zu verfestigen.<br />
Die Anforderungen gingen aber vor allem für<br />
mittelständische Unternehmen deutlich zu weit und<br />
würden den Menschenrechtsschutz in der Welt nicht<br />
verbessern. „Mittelständische Firmen können nicht<br />
alle Stufen ihrer Lieferketten in fernen Ländern kontrollieren,<br />
weil sie die dafür erforderlichen Informationen<br />
angesichts fehlender Marktmacht gar nicht<br />
erhalten. Schon gar nicht können sie Einfluss auf ihre<br />
Kunden ausüben, so Brodtmann.<br />
Der Mittelstandsverbund, der Verband deutscher Maschinen-<br />
und Anlagenbauer VDMA und der Wirtschaftsverband<br />
Stahl- und Metallverarbeitung<br />
(WSM) bemängeln in ihren jeweiligen Statements<br />
unter anderem folgende Punkte:<br />
• Vom Europäischen Lieferkettengesetz sind nahezu<br />
alle Unternehmen betroffen.<br />
• Es gibt keinen einheitlichen Standard für alle EU-<br />
Mitgliedsstaaten.<br />
• Mittelständische Unternehmen sind schlichtweg<br />
überfordert mit der Masse an Bürokratie.<br />
So gelten die neuen Vorschriften für in der EU ansässige<br />
Unternehmen, unabhängig von ihrer Branche,<br />
einschließlich Finanzdienstleistungen, mit mehr<br />
als 250 Beschäftigten und einem Umsatz von über<br />
40 Mio. Euro sowie für Muttergesellschaften mit<br />
mehr als 500 Beschäftigten und einem Umsatz von<br />
über 150 Mio. Euro. Nicht-EU-Unternehmen mit einem<br />
Umsatz von mehr als 150 Mi0. Euro, wenn mindestens<br />
40 Mio. in der EU erwirtschaftet wurden,<br />
werden ebenfalls einbezogen.<br />
8 <strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023
Alles dreht<br />
sich um<br />
weniger<br />
CO2 und<br />
mehr<br />
Zukunft.<br />
Iqony bietet passgenaue Lösungen<br />
für die Herausforderungen der<br />
Energiewende. Als Partner für alle<br />
Themen rund um Dekarbonisierung,<br />
Dezentralisierung und Digitalisierung<br />
stehen wir Ihnen und Ihrem Unternehmen<br />
mit ingenieur tech nischer<br />
und energie wirtschaftlicher<br />
Kompetenz zur Seite.<br />
www.iqony.energy<br />
<strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023 9
» NACHRICHTEN<br />
Network-Slicing-Management<br />
Mobilfunk sicher mit der Cloud des Unternehmens verbinden<br />
Telekom und Ericsson haben eine spezielle<br />
Network-Slicing-Lösung für Unternehmen<br />
in einem Testlauf erfolgreich validiert.<br />
Ein Network-Slice dient der sicheren<br />
Verbindung von öffentlichem Mobilfunk<br />
mit der Cloud eines Unternehmens.<br />
DAs Slice-Design-Tool der Network-Slicing-Management-Lösung<br />
macht die<br />
Konfiguration von Unternehmensgeräten<br />
durch die Mitarbeitenden überflüssig,<br />
eine Konfiguration erfolgt automatisiert.<br />
Network Slicing ist ein zentrales architektonisches<br />
Merkmal von 5G Standalone<br />
(SA), mit dem mehrere virtuelle Netze auf<br />
einer einzigen physischen Netzinfrastruktur<br />
geschaffen werden können.<br />
Ein Beispiel: Ein kontinuierlicher Austausch<br />
zwischen den Maschinen einer<br />
Produktionsanlage ist nicht mehr allzu<br />
fern. Denn die effiziente Steuerung einzelner<br />
Maschinen innerhalb einer industriellen<br />
Produktion erfordert eine Vernetzung<br />
zwischen den Geräten in einer hoch<br />
aggregierten und damit extrem komplexen<br />
Form. Dabei addieren sich Millionen<br />
oder gar Milliarden von Statusmeldungen,<br />
die immerfort durch Sensoren erfasst,<br />
Anzeige<br />
C-TEILE<br />
MANAGEMENT<br />
EXPLORE<br />
MORE<br />
Bild: Quality Stock Arts/stock.adobe.com<br />
Telekom und Ericsson<br />
haben gemeinsam eine<br />
Network-Slicing-<br />
Lösung entwickelt. Diese<br />
integrierte Lösung<br />
kann entsprechende<br />
Network-Slices für<br />
Cloud-basierte Anwendungen<br />
von Unternehmen<br />
konfigurieren.<br />
übermittelt und ausgewertet werden.<br />
Dies erfordert Netzkapazitäten, die über<br />
Slices bereitgestellt werden können. Für<br />
jedes Slice können unterschiedliche<br />
Dienstmerkmale und Qualitätsparameter<br />
bereitgestellt werden, die an die Kundenbedürfnisse<br />
angepasst sind. Die Slices sind<br />
dabei vollständig voneinander isoliert. Mit<br />
diesen technischen Voraussetzungen können<br />
neue, differenzierte Dienste und Geschäftsmodelle<br />
entwickelt werden.<br />
Kohlenstoffdioxid-reduzierter Stahl<br />
Thyssenkrupp Steel und Mercedes-Benz arbeiten zusammen<br />
Bild: Thyssenkrupp Steel Europe<br />
Mercedes Benz setzt ab 2026 Kohlenstoffdioxidreduzierten<br />
Stahl von Thyssenkrupp Steel in seiner<br />
PKW-Neuwagenflotte ein.<br />
Thyssenkrupp Steel und Mercedes-Benz<br />
werden ihre Zusammenarbeit auf den Bereich<br />
von CO 2 -reduzierten Stahl ausweiten.<br />
Beide Unternehmen haben eine entsprechende<br />
Absichtserklärung unterzeichnet.<br />
Ab Ende 2026 soll Mercedes-Benz<br />
CO 2 -reduzierte Produkte von Thyssenkrupp<br />
Steel zur Integration in die eigene<br />
PKW-Neuwagenflotte erhalten. Zu diesem<br />
Zeitpunkt soll auch die Inbetriebnahme<br />
der neuen Direktreduktionsanlage (DR-<br />
Anlage) am Standort Duisburg von Thyssenkrupp<br />
abgeschlossen sein.<br />
Die neue DR-Anlage ist zentraler Bestandteil<br />
der grünen Transformation von<br />
Thyssenkrupp und wird in Verbindung mit<br />
Einschmelzaggregaten sowie unter Verwendung<br />
von grünem Wasserstoff betrieben.<br />
Im Vergleich zum herkömmlichen<br />
Hochofenprozess lassen sich die produktionsbedingten<br />
CO 2 -Emissionen bei der<br />
Stahlherstellung durch diese innovative<br />
Technologie bei gleichbleibender Produktqualität<br />
signifikant verringern – was<br />
auch den CO 2 -Footprint von Produkten<br />
mit hohem Stahlanteil, zum Beispiel in<br />
der Automobilindustrie, mindert.<br />
Die Stahlproduktion von Thyssenkrupp<br />
Steel soll bis spätestens 2045 vollständig<br />
klimaneutral sein. Die Auftragsvergabe<br />
zum Bau der wasserstoffbasierten Direktreduktionsanlage<br />
in Verbindung mit innovativen<br />
Einschmelzaggregaten an die<br />
SMS Group im März dieses Jahres ist<br />
hierzu ein entscheidender Schritt. Damit<br />
startet eines der weltweit größten industriellen<br />
Dekarbonisierungsprojekte, mit<br />
dem zukünftig bereits über 3,5 Mio. t CO 2<br />
pro Jahr vermieden werden können. Die<br />
Direktreduktionsanlage hat eine Kapazität<br />
von 2,5 Mio. t direkt reduziertem<br />
Eisen und kann durch das innovative Konzept<br />
nahtlos in das bestehende Hüttenwerk<br />
integriert werden. Dies ermöglicht<br />
die Beibehaltung aller nachfolgenden<br />
Prozessschritte ab dem Stahlwerk und gewährleistet<br />
dadurch eine gleichbleibend<br />
hohe Produktqualität. So kann nicht nur<br />
auf effiziente Weise die bestehende Anlagenstruktur<br />
genutzt werden, die Kunden<br />
erhalten auch weiterhin das komplette,<br />
hochwertige Produktportfolio in der gewohnten<br />
Premiumqualität. Dies macht<br />
den über diese Produktionsroute erzeugten<br />
CO 2 -reduzierten Stahl gerade für die<br />
Automobilindustrie interessant.<br />
10 <strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023
Innovativ Bewegen<br />
Branchenreport Intralogistik<br />
Vollautomatisierte Lagerstrukturen sind die Ausnahme<br />
Bild: Fox Bread/stock.adobe.com<br />
Der neue Branchenreport von Addverb analysiert<br />
die aktuelle Situation in der Intralogistik.<br />
Addverb Technologies, ein Anbieter von<br />
Robotik- und Automatisierungslösungen<br />
mit Sitz in Indien, hat einen neuen europäischen<br />
Branchenreport veröffentlicht.<br />
Die Studie „Unlock the True Potential<br />
of Your Warehouse“ untersucht die aktuelle<br />
Situation in der Intralogistik-Branche.<br />
Sie analysiert, inwieweit Modernisierungen<br />
helfen können, dem Fachkräftemangel<br />
entgegenzuwirken. Addverb befragte<br />
Branchenexperten und Entscheider<br />
aus den Niederlanden, Deutschland und<br />
Großbritannien. Vollautomatisierte Lagerstrukturen<br />
sind eher die Ausnahme<br />
Der Grad der Automatisierung ist in allen<br />
drei untersuchten Regionen unterschiedlich.<br />
So berichtet fast die Hälfte der deutschen<br />
Befragten (42 %) von einem sehr<br />
geringen Automatisierungsgrad im Lagerbereich<br />
ihres Unternehmens. In den Niederlanden<br />
(42 %) und in Großbritannien<br />
(36 %) gibt jeweils eine Mehrheit an, dass<br />
in ihren Unternehmen in diesem Bereich<br />
bereits eine Mischung aus manuellen und<br />
automatisierten Prozessen besteht.<br />
Auf die Frage nach der Umsetzung einer<br />
vollständigen Automatisierung in den<br />
einzelnen Regionen gaben nur einige wenige<br />
Befragte (11 % in Deutschland, 10 %<br />
in den Niederlanden und 7 % in Großbritannien)<br />
an, in bereits vollautomatisierten<br />
Lagerstrukturen zu arbeiten.<br />
Hochtemperatur-Wärmespeicher<br />
Überschüssiger Strom in Wärme umwandeln<br />
Der Hersteller von Gießerei- und Thermoprozessanlagen<br />
Otto Junker hat in Kooperation<br />
mit weiteren Industrieunternehmen<br />
das Hochtemperatur-Wärmespeichersystem<br />
multiTess entwickelt. Das System<br />
kann überschüssigen Strom aus erneuerbaren<br />
Quellen mit einem Wirkungsgrad<br />
von 98 % in Wärme umwandeln. Zudem<br />
ermöglicht das System aufgrund der<br />
Power-to-Heat-Module, die Otto Junker<br />
entwickelt hat, eine Rückverstromung.<br />
Am Solar-Institut Jülich (SIJ) der FH<br />
Aachen wurde seit 2017 das Speicherkonzept<br />
multiTess (multifunktionaler thermischer<br />
Stromspeicher) für eine dezentrale<br />
und flexible Strom- und Wärmeversorgung<br />
entwickelt. Im Gegensatz zum herkömmlichen<br />
Power-to-Heat-Ansatz, bei<br />
dem zumeist Warmwassererzeugung und<br />
-speicherung in Verbindung mit Fernwärme<br />
im Mittelpunkt stehen, wird die Wärme<br />
im thermischen Stromspeicher von<br />
multiTess bei bis zu 1.100 °C gespeichert.<br />
Die neue Power-to-Heat-Technologie von Otto<br />
Junker mit thermischem Stromspeicher ermöglicht<br />
die Rückverstromung.<br />
Diese Wärme kann bei Bedarf wieder verstromt<br />
werden. Zusätzlich können auch<br />
externe Wärmequellen – etwa die Abwärme<br />
aus industriellen Prozessen – einbezogen<br />
werden. Ebenso ist es denkbar, die<br />
gespeicherte Wärme nicht nur zur Stromproduktion,<br />
sondern auch zur Einspeisung<br />
in öffentliche Fernwärmenetze oder zur<br />
Bereitstellung von Prozesswärme für die<br />
Industrie zu nutzen.<br />
Bild: Otto Junker<br />
Drahtwälzlager:<br />
Nachhaltigkeit<br />
durch Erneuerung<br />
Durch den Wechsel des Drahtwälzlagers<br />
lassen sich bis zu 60% der Kosten gegenüber<br />
einer neuen Drehverbindung einsparen.<br />
Oftmals genügt ein Austausch der Laufringe,<br />
Wälzkörper oder des Käfigs, um das Lager<br />
wieder funktionsfähig zu machen. Lassen Sie<br />
sich beraten!<br />
NEU:<br />
Online-Portal & E-Shop für<br />
Drahtwälzlager & Linearsysteme<br />
MeinFranke<br />
Franke GmbH, Aalen<br />
info@franke-gmbh.de<br />
<strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023 11
» NACHRICHTEN<br />
Projekt „Enlarge“<br />
Schuler treibt die Digitalisierung der Batterieproduktion voran<br />
Bei Schuler in Göppingen ist nun der offizielle<br />
Startschuss für das vom Bundesministerium<br />
für Bildung und Forschung<br />
(BMBF) öffentlich geförderte Projekt „Enlarge<br />
– Interoperable Produktion als Enabler<br />
für eine datengetriebene Batterie-<br />
Wertschöpfungskette“ mit dem offiziellen<br />
Förderkennzeichen 03XP0539A gefallen.<br />
Dabei geht es um die Bündelung der<br />
Kompetenzen deutscher und europäischer<br />
Unternehmen. Ziel ist es, den wachsenden<br />
Markt für Anlagen zur Batteriezellfertigung<br />
besser bedienen zu können und ein<br />
Gegengewicht zu etablierten Anbietern,<br />
vor allem aus dem asiatischen Raum, zu<br />
schaffen. Die Laufzeit des Projekts ist auf<br />
drei Jahre angesetzt.<br />
„Ziel ist eine flexible, vernetzte und adaptive<br />
Batterieproduktion“, erklärt Dr. Hermann<br />
Uchtmann, der bei Schuler für entsprechende<br />
Lösungen zuständig ist. „Nur<br />
so kann der Maschinen- und Anlagenbau<br />
in Deutschland und Europa bei der Ausrüstung<br />
der weltweit im Aufbau befindlichen<br />
Gigafabriken mitbieten.“<br />
Das Enlarge-Projekt soll deshalb einheitliche<br />
Schnittstellen für den Datenaustausch<br />
schaffen. Ausgehend von existierenden<br />
Standards wie EPCIS, ISO/IEC 19987, OPC<br />
UA und damit verbundenen Companion<br />
Specifications (CS) entsteht auf diese<br />
Weise eine Art Meta-Standard für die<br />
Die Partner des Projekts „Enlarge“ wollen den Markt der Batteriezellenfertigung besser bedienen.<br />
Batteriezellfertigung, der den Einstieg von<br />
Anbietern erleichtert und die Vernetzung<br />
der Systeme untereinander ermöglicht.<br />
Dabei konzentriert sich das Projekt auf die<br />
Anwendungsfälle Rückverfolgbarkeit, Batteriepassport<br />
und Prozessoptimierung.<br />
Projektpartner neben der Schuler Pressen<br />
GmbH sind FFT Produktionssysteme<br />
GmbH & Co. KG, European EPC Competence<br />
Center GmbH (EECC), Elabo GmbH,<br />
Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau<br />
e.V., die Fraunhofer-Einrichtung<br />
Forschungsfertigung Batteriezelle FFB,<br />
das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik<br />
und Automatisierung IPA, das<br />
wbk Institut für Produktionstechnik des<br />
Karlsruher Instituts für Technologie sowie<br />
der Lehrstuhl für Production Engineering<br />
of E-Mobility Components (PEM) der<br />
RWTH Aachen University. Zu den assoziierten<br />
Projektpartnern zählen Siemens<br />
AG, Saueressig Group, Nanofocus AG, Sick<br />
AG und Maschinenbau Kitz GmbH. Der<br />
Projektträger Jülich (PtJ) vertritt in dieser<br />
Funktion das Bundesministerium für Bildung<br />
und Forschung (BMBF).<br />
Bild: Schuler<br />
Anzeige<br />
Zum Titelbild<br />
Blaupause für industrielle Gleichstromnetze<br />
11.07.2023 Ausgabe 10 | 2023 www.industrieanzeiger.de<br />
Energieversorgung<br />
Ultraleichtbau<br />
Green Performance<br />
Batterierecycling<br />
Phoenix Contact investiert zum 100. Jubiläum<br />
in die Energieversorgung von<br />
morgen. Das neue Gebäude 60 zeigt auf<br />
weltweit einzigartige Weise die Vernetzung<br />
der Sektoren Energie, Mobilität,<br />
Infrastruktur und Gebäude. Eine wesentliche<br />
Grundlage für die Sektorenkopplung:<br />
Der Einbau eines Gleichstromnetzes.<br />
Solche Netze bringen die<br />
Energiewende entscheidend voran, denn<br />
regenerative Energiequellen, Batteriespeicher<br />
und Elektromobilität basieren<br />
auf Gleichstrom und lassen sich leichter<br />
integrieren. Zudem kann ein Gleichstromnetz<br />
Verlustleistungen wirksam<br />
reduzieren, etwa durch die Nutzung der<br />
Rekuperationsenergie, wenn Elektromotoren<br />
bremsen. Erfahren Sie mehr darüber<br />
im Beitrag auf Seite 36.<br />
Strom wird günstiger,<br />
bleibt aber teuer<br />
» Seite 16<br />
TOPSTORY<br />
Industriekohle<br />
Pflanzenkohle kann fossile Rohstoffe<br />
in industriellen Prozessen<br />
ersetzen<br />
» Seite 26<br />
Die erste Roboterfertigung für<br />
Raumwickel-Teile ist in Betrieb<br />
» Seite 42<br />
Linde Material Handling treibt<br />
grüne Technologien voran<br />
» Seite 50<br />
Wissen für Entscheider in der Produktion<br />
Das Recyceln von Batterien<br />
wirtschaftlich gestalten<br />
» Seite 54<br />
Bild: Phoenix Contact<br />
12 <strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023
Startklar für neue<br />
Mobilitätslösungen.<br />
Am besten auf<br />
rechtssicherem Boden.<br />
JANA WOLLENZIN, RECHTSANWÄLTIN<br />
<strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023 13
» NACHRICHTEN<br />
ZVEI<br />
Philipp Steinberger wird in den Vorstand berufen<br />
Philipp Steinberger, CEO von Wöhner, ist<br />
in den Gesamtvorstand des Zentralverbands<br />
der Elektroindustrie in Deutschland<br />
(ZVEI) gewählt worden. Als Anbieter innovativer<br />
Lösungen im Bereich Elektrotechnik<br />
prägt Wöhner die Branche bereits seit<br />
über 90 Jahren entscheidend mit.<br />
Als einer der wichtigsten Industrieverbände<br />
Deutschlands vertritt der ZVEI die<br />
Interessen der Elektro- und Digitalindustrie<br />
– und damit einer Hightech-Branche,<br />
die mit einem breit gefächerten und<br />
äußerst dynamischen Produktportfolio<br />
immer stärker in den Fokus rückt und den<br />
Takt vorgibt auf dem Weg zu einer<br />
CO 2 -neutralen Industriegesellschaft. Der<br />
Zentralverband hat eine entscheidende<br />
Funktion für das Innovationspotenzial<br />
Deutschlands. Mit ihrem Fokus auf<br />
Gleichstrom-Technologien und intelligente<br />
Stromnetze trägt die gesamte Branche<br />
entscheidend zur Energiewende und Zukunftsfähigkeit<br />
des Landes bei – ein Ziel,<br />
Philipp Steinberger, Geschäftsführer von Wöhner,<br />
ist jetzt Mitglied im Vorstand des ZVEI.<br />
das sich auch Wöhner auf die Fahnen geschrieben<br />
hat.<br />
„Gleichstrom-Technik und intelligente,<br />
KI-gestützte Stromverteilung sind wichtige<br />
Schlüssel zu einer noch effizienteren<br />
und sichereren Stromversorgung. Um das<br />
umzusetzen, brauchen wir Austausch und<br />
Kooperation zwischen allen Akteuren aus<br />
Wirtschaft und Politik, Wissenschaft und<br />
Gesellschaft. Ich freue mich sehr, den<br />
Dialog als ZVEI-Vorstandsmitglied nun<br />
noch stärker mitzugestalten“, so Philipp<br />
Steinberger.<br />
Der Verband begreift sich als Motor des<br />
Fortschritts, fördert den Erfahrungs- und<br />
Meinungsaustausch zwischen den Mitgliedern<br />
über aktuelle technische, wirtschaftliche,<br />
rechtliche und gesellschaftspolitische<br />
Themen im Umfeld der Elektroindustrie<br />
und erarbeitet gemeinsame<br />
Positionen. Er zählt mehr als 1.100 Mitgliedsunternehmen,<br />
die rund 90 % der<br />
Mitarbeitenden der Elektro- und Digitalindustrie<br />
in Deutschland beschäftigen.<br />
Unter den Mitgliedern finden sich Global<br />
Player genauso wie Mittelständler und<br />
Familienunternehmen. Mit seinem umfangreichen<br />
Service- und Leistungsspektrum<br />
sowie Tochtergesellschaften in nahezu<br />
allen Teilen der Welt engagiert sich<br />
Wöhner seit 1993 im ZVEI.<br />
Durch seine neue Funktion als Mitglied<br />
des Vorstands bieten sich Philipp<br />
Steinberger interessante Möglichkeiten,<br />
die Branchenentwicklung noch stärker<br />
mitzugestalten.<br />
Bild: Wöhner<br />
Nachhaltigkeit<br />
Stahl aus recyceltem und erneuerbarem Material<br />
Bild: Ejot<br />
Die Zusammenarbeit zwischen Arcelormittal<br />
, Ejot und Finkernagel ist ein gutes Beispiel<br />
für eine Kooperation von Hersteller,<br />
Weiterverarbeiter und Endprodukthersteller<br />
zur Verringerung von Umweltauswirkungen.<br />
Arcelormittal Hamburg produziert<br />
hochgradig CO 2 -reduzierten XCarb-Stahl<br />
aus recyceltem und erneuerbarem Ma -<br />
terial mit deutlich geringerem CO 2 -Fußabdruck<br />
als konventionell hergestellter<br />
Stahl. Diesen verarbeitet das Drahtwerk<br />
Dr. Uwe Braun, CEO<br />
von Arcelormittal<br />
(links), Markus Rathmann,<br />
Chief Supply<br />
Chain Officer der Ejot<br />
Gruppe (mitte) und<br />
Timo Finkernagel,<br />
Geschäftsführer von<br />
Finkernagel.<br />
Finkernagel weiter. Ejot wiederum stellt<br />
aus dem gezogenen Draht in Kaltumformung<br />
Schrauben her, die am Ende für die<br />
Batterien in Elektroautos oder für die Befestigung<br />
von Solarmodulen verwendet<br />
werden.<br />
Seit 2021 bündelt der weltweit führende<br />
Stahlhersteller Arcelormittal mit der<br />
Dachmarke XCarb alle Bestrebungen<br />
Richtung klimaneutraler Stahlproduktion<br />
durch Investitionen in Technologien und<br />
Start-ups, durch die Vergabe von Zertifikaten<br />
für CO 2 -Einsparungen in der Stahlherstellung<br />
und insbesondere durch kohlenstoffarme<br />
Herstellungsvarianten. Der<br />
XCarb-Stahl aus recyceltem und erneuerbarem<br />
Material wird in einem Elektrolichtbogenofen<br />
unter Verwendung von erneuerbarem<br />
Strom und abhängig von der<br />
Stahlsorte bis zu hundertprozent Schrott<br />
hergestellt. Bei diesen Stahlprodukten liegen<br />
die Emissionen teilweise bei bis zu<br />
333 kg CO 2 -Äquivalenten pro Tonne des<br />
Endproduktes.<br />
„Wir schaffen dank der Kooperation eine<br />
Wertschöpfungskette, die auf die Klimaziele<br />
der beteiligten Unternehmen einzahlt,“<br />
sagt Dr. Uwe Braun, CEO von Arcelormittal<br />
Hamburg. „Es zeigt sich, dass<br />
Stahl mit geringen Kohlenstoffemissionen<br />
für den Aufbau der Infrastruktur, die wir<br />
für den Übergang zur Kohlenstoffneutralität<br />
benötigen, von entscheidender<br />
Bedeutung ist.“<br />
14 <strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023
Horn Technologietage 2023<br />
Wer Prozesse beherrscht, erreicht mehr<br />
Nach vier Jahren Corona-bedingter Pause<br />
hatte die Paul Horn GmbH mitte Juni wieder<br />
Kunden, Partner und Pressevertreter<br />
zu den Horn Technologietagen eingeladen.<br />
Mehr als 3300 Gäste hatten ihr Kommen<br />
angekündigt, etwa die Hälfte reiste<br />
aus 37 Ländern an. Das übergreifende<br />
Thema der Hausausstellung lautete „Prozesse<br />
beherrschen“. Welche Vielfalt an<br />
Prozessen und Technologien die Tübinger<br />
beherrschen, erlebten die Besucher nicht<br />
nur beim Rundgang durch alle drei geöffneten<br />
Werke am Stammsitz, sondern auch<br />
in acht Fachvorträgen.<br />
Das 1969 gegründete Familienunternehmen<br />
wird heute von den Geschäftsführern<br />
Markus Horn und Matthias Rommel geführt.<br />
Die Firmengruppe erwirtschaftete<br />
2022 mit 1500 Mitarbeitern weltweit einen<br />
Umsatz von rund 300 Mio. Euro. „Damit<br />
sind wir wieder auf dem Vor-Corona-<br />
Niveau von 2018 und 2019“, sagte Markus<br />
Horn stolz. Rund 200 Mio. Euro trug der<br />
Heimatmarkt zu diesem Ergebnis bei. Jährlich<br />
produziert Horn viele Millionen<br />
Schneidplatten – trotz einer durchschnittlichen<br />
Losgröße von 100 Stück mit einem<br />
Automatisierungsgrad von bis zu 97 %.<br />
Mit dem Greenline genannten Verfahren<br />
ist dabei eine Auslieferung von Sonderwerkzeugen<br />
innerhalb von fünf Arbeitstagen<br />
nach Zeichnungsfreigabe möglich.<br />
Zu den spannendsten Themen der Technologietage<br />
gehörten die Ergebnisse des<br />
vom Bundesministerium für Bildung und<br />
Forschung (BMBF) geförderten Verbundprojekts<br />
Zyklomed. Die beteiligten Partner<br />
Index, Horn, Beutter Präzisions-Komponenten<br />
und wbk Institut für Produktionstechnik<br />
am Karlsruher Institut für Technologie<br />
(KIT) bündelten ihr Know-how in<br />
der Medizintechnik und entwickelten<br />
neue Fertigungsverfahren, um Implantate<br />
mit multifunktionalem sowie unrund-bionischem<br />
Design wirtschaftlich herzustellen.<br />
Hierbei lag der Fokus auf den drei<br />
Fertigungsverfahren Rotationsunrunddrehen,<br />
Polygondrehen und Dreh-Wirbelfräsen.<br />
Sie basieren alle auf dem gleichen<br />
kinematischen Prinzip mehrerer synchronisiert<br />
rotierender Achsen. Während das<br />
Grundprinzip bekannt ist, ist die Anwendung<br />
auf unrunde und geschwungene<br />
Formen extrem anspruchsvoll. Gleichzeitig<br />
muss die praktische Umsetzung den<br />
hohen Qualitätsanforderungen der Medizintechnik<br />
genügen. Die Projektpartner<br />
entwickelten die neuen Fertigungsverfahren<br />
entlang der gesamten Prozess- und<br />
Lieferkette, von der Maschinen und<br />
Steuerungstechnik, über das Werkzeugdesign<br />
bis zum Prototypen- und Vorserienprozess.<br />
Hello<br />
visitors!<br />
Welcome to the world’s leading trade<br />
fair for production technology.<br />
<strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023 15
Industrie und Gewerbe unter Strom: Energiekosten werden zunehmend zum wettbewerbskritischen Faktor.<br />
Bild: marcus_hofmann/stock.adobe.com<br />
Stromkosten für Industrie und Gewerbe: Einblicke und Aussichten<br />
Günstiger, aber teuer<br />
Für Industriekunden sind die Stromkosten im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr<br />
deutlich gesunken. Trotzdem bleibt in Deutschland Strom und Energie für Industrie und<br />
Gewerbe im internationalen Vergleich hoch. Eine kurzfristige Entlastung ist nicht in Sicht.<br />
» Michael Grupp, freier Journalist in Stuttgart<br />
Einen berechenbaren und bundesweit gültigen<br />
Strompreis für gewerbliche und industrielle<br />
Abnehmer existiert nicht. Die Kosten hängen von<br />
zahlreichen Faktoren ab – zum Beispiel vom Standort<br />
des Verbrauchers. So ist die Energieversorgung in<br />
Mecklenburg-Vorpommern sowie im Osten der Republik<br />
am teuersten, tendenziell günstiger wird es in<br />
der Mitte und im Süden Deutschlands. Dafür gibt es<br />
mehrere Gründe: In dünn besiedelten Regionen wie<br />
Mecklenburg-Vorpommern oder auch Schleswig-<br />
Holstein verteilen sich die Kosten auf weniger Verbraucher.<br />
Darüber hinaus wirkt die Energiewende als<br />
Kostentreiber: Schwankende Stromeinspeisungen<br />
aus regenerativen Energiequellen kosten Geld; dafür<br />
muss eine neue Infrastruktur aufgebaut werden. Das<br />
wirkt sich in Form von steigenden Netzentgelten vor<br />
allem in Regionen mit hoher dezentraler Einspeisung<br />
aus – beispielsweise im Norden mit einem vergleichsweise<br />
hohen Anteil an Windkraft. Insgesamt<br />
machen Netzentgelte circa 20 % des Strompreises<br />
für Industrie und Gewerbe aus.<br />
Mehr Kohle für Kohle<br />
Parallel zu einer global steigenden Nachfrage ist<br />
auch der Preis für Kohle gestiegen. Dazu kamen Probleme<br />
in Frankreichs Atomreaktoren sowie Versorgungsprobleme<br />
bei Kohlekraftwerken, weil aufgrund<br />
niedriger Pegelstände der Schiffsverkehr längere Zeit<br />
behindert war.<br />
Inzwischen hat sich der Markt laut der BDEW-<br />
Strompreisanalyse (April 2023) wieder teilweise<br />
beruhigt. Der durchschnittliche Strompreis für kleine<br />
16 <strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023
MANAGEMENT «<br />
bis mittlere Industriebetriebe ist beim Neuabschluss<br />
eines Vertrages wieder gesunken und liegt derzeit im<br />
Jahresmittel 2023 bei rund 27 ct/kWh. Für kleine bis<br />
mittlere Industriebetriebe hat sich damit der Strompreis<br />
gegenüber dem 2. Halbjahr 2022 fast halbiert.<br />
Bestandskunden zahlen nach einer Auswertung des<br />
Bundesverbands der Energie und Wasserwirtschaft<br />
derzeit im Durchschnitt rund 19 ct/kWh.<br />
Stichwort Vertragsneuabschluss: Ein neuer Vertrag<br />
birgt derzeit das Risiko eines hohen Einstiegspreises,<br />
wogegen langfristige Vereinbarungen Preisspitzen<br />
abfedern – allerdings einen Preisaufschlag für das<br />
Risiko des Stromanbieters beinhalten. Vor einem<br />
Wechsel ist deshalb immer ein Gespräch mit dem<br />
bisherigen Versorger ratsam.<br />
Energie als globaler Wettbewerbsfaktor<br />
Nach Einschätzung der Unternehmensberatung PwC<br />
bedroht die derzeitige Energiekrise Schlüsselsektoren<br />
der deutschen Industrie, allen voran energieintensive<br />
Unternehmen wie zum Beispiel die Stahl-, Zementoder<br />
Papierindustrie. Mehr noch: Die Krise könnte<br />
eine Deindustrialisierung Europas anstoßen. Die<br />
deutsche Industrie werde besonders hart von den<br />
deutlich gestiegenen Gaspreisen getroffen, befürchtet<br />
demnach auch eine aktuelle Studie der PwC-<br />
Tochter Strategy&. „Viele Unternehmen könnten sich<br />
zukünftig dazu entscheiden, ihre Produktion innerhalb<br />
Europas neu aufzustellen oder gänzlich<br />
aus Europa abzuziehen“, meinte Strategy&-Europachef<br />
Andreas Späne.<br />
Entlastung kam und kommt vonseiten der Politik,<br />
beispielsweise durch den Wegfall der EEG-Umlage.<br />
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) verpflichtete<br />
seit 2001 alle Netzbetreiber, vorrangig Strom aus<br />
erneuerbaren Energien abzunehmen und den Betreibern<br />
dafür eine feste Vergütung zu zahlen. Damit<br />
war die EEG-Umlage in der Vergangenheit ein erheblicher<br />
Bestandteil der deutschen Energieversorgung<br />
und machte rund 10 % der Gesamtkosten aus.<br />
Industriestrom für wenige Cent<br />
Aktuell wird in der Politik über weitere Entlastungen<br />
diskutiert. Der Bundeswirtschaftsminister Robert<br />
Habeck Ende April 2023: „Die ganze Wirtschaft<br />
redet derzeit intensiv über einen Industriestrompreis,<br />
und ich denke, dass wir das machen müssen.<br />
Wenn wir die Preise deckeln, verlieren wir Geld.<br />
Wenn wir sie nicht deckeln, verlieren wir womöglich<br />
die Industrien der Zukunft.“ Zum Thema Zeithorizont<br />
ergänzt SPD-Chef Lars Klingbeil: „Manche Leute<br />
reden vom Jahr 2030. Es geht aber um die nächsten<br />
zwölf Monate.“ Im Gespräch sind ein Subventions-<br />
Zeitraum von vier bis fünf Jahren sowie ein Preiskorridor<br />
von vier bis sieben Cent pro kWh für einen<br />
„klar definierten Empfängerkreis“. Dazu zählen vor<br />
allem energieintensive Wirtschaftszweige im internationalen<br />
Wettbewerb.<br />
Bei Börsenstrompreisen über sechs ct/kWh sollen<br />
Unternehmen dann die Differenz erstattet bekommen.<br />
Maßgeblich ist der durchschnittliche Börsenstrompreis<br />
im jeweiligen Jahr. Anfang Mai hat Robert<br />
Habeck dazu ein Arbeitspapier vorgelegt, das zurzeit<br />
in Politik, Verbänden und Unternehmen diskutiert<br />
wird. Wann die Maßnahmen greifen, steht allerdings<br />
noch in den Sternen. Eins ist aber sicher: Ohne<br />
Subventionen wird Strom in Deutschland für Industrie<br />
und Gewerbe teurer bleiben als noch in 2021.<br />
Selbst ist der Strom<br />
Wie können Unternehmen ihre Stromkosten minimieren,<br />
bis die Preise weiter sinken bzw. Subventionen<br />
entlasten? Nach den seit 2015 verpflichtenden<br />
Energie-Audits für Unternehmen mit einem Gesamtenergie-Verbrauch<br />
ab 500.000 kWh pro Kalenderjahr<br />
lassen sich weitere Einsparungen vielerorts nur noch<br />
durch Verbrauchs- und Produktions-Änderungen<br />
umsetzen. Dazu zählt vor allem die Vermeidung von<br />
Lastspitzen, weil diese maßgeblich die Gesamtkosten<br />
beeinflussen. Das ist beispielsweise durch eine<br />
gezielte Produktionssteuerung sowie abgestimmte<br />
Zeitpläne für Wärme und Kühlung möglich.<br />
Der Atomausstieg erhöht die Abhängigkeit des deutschen<br />
Strommarktes von Importen.<br />
Bild: Thomas Bethge/stock.adobe.com<br />
<strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023 17
» MANAGEMENT<br />
Mit digitalen Tools und Daten echte Nachhaltigkeit fördern<br />
Keine Chance für Greenwashing<br />
Das Kommunizieren unverbindlicher Zielsetzungen zur CO 2 -Reduktion mit dem Ziel, Kunden ein<br />
grünes Image vorzuspielen, gehört leider immer noch zum Standardrepertoire vieler Marketingabteilungen.<br />
Der Übergang von der Absicht zum tatsächlichen nachhaltigen Handeln ist eine<br />
Herausforderung. Ökobilanzierungslösungen unterstützen Unternehmen auf diesem Weg.<br />
» Dominic Kurtaz, Managing Director EuroCentral, Dassault Systèmes<br />
Tatsächliches nachhaltiges<br />
Handeln jenseits<br />
des Greenwashings ist<br />
für viele Unternehmen<br />
immer noch eine große<br />
Herausforderung.<br />
Bild: Christian/stock.adobe.com<br />
Der ökologische Wandel wird angesichts der rasant<br />
fortschreitenden Erderwärmung immer<br />
dringlicher. Eine wesentliche Umstellung unseres<br />
Handels ist daher essenziell. Die größte Verantwortung<br />
liegt bei der Wirtschaft, die für etwa 70 % der<br />
weltweiten Umweltverschmutzung verantwortlich<br />
ist. Ansätze wie die Kreislaufwirtschaft und die Bekämpfung<br />
von Greenwashing in der Industrie sind<br />
unerlässlich, um Nachhaltigkeit tatsächlich zu fördern<br />
und so den größten Herausforderungen unserer<br />
Zeit zu begegnen.<br />
Ein Trend hin zu einem größeren Bewusstsein für<br />
Nachhaltigkeit ist bereits heute zu erkennen. Dies<br />
spiegelt sich in dem wachsenden Produktangebot<br />
wider, das darauf abzielt, den ökologischen Fußabdruck<br />
jedes Einzelnen zu verringern. Eine Umfrage<br />
von Futerra – einer internationalen Strategie- und<br />
Kreativagentur für Nachhaltigkeit – zeigt, dass die<br />
meisten Verbraucher bereit sind, nachhaltige Marken<br />
zu wählen, sofern die Preise vergleichbar sind. Etwa<br />
ein Drittel würde für nachhaltige Produkte mehr bezahlen.<br />
Dieser Wandel der Verbrauchergewohnheiten<br />
und der Nachfrage ist einerseits eine große Chance,<br />
Einfluss auf das Angebot zu nehmen. Andererseits<br />
wird diese Bereitschaft auch in einigen Fällen von<br />
Unternehmen ausgenutzt, um beispielsweise durch<br />
‚Greenwashing‘ Gewinne zu erzielen.<br />
Unter dem Begriff Greenwashing werden Marketing-<br />
und PR-Maßnahmen verstanden, die einem<br />
Unternehmen in der Öffentlichkeit ein besonders umweltfreundliches<br />
und verantwortungsbewusstes<br />
Image verleihen – allerdings ohne hinreichende<br />
Grundlage. Dieses Vorgehen kann von der Fokussierung<br />
auf besonders positive Aspekte – die jedoch<br />
18 <strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023
nicht der ganzen Wahrheit entsprechen –<br />
bis hin zur Zurückhaltung negativer Merkmale<br />
eines Produkts reichen. Im Jahr 1986<br />
prägte der Umweltschützer Jay Westerfield<br />
in einem Essay erstmals die Bezeichnung<br />
Greenwashing. Darin kritisierte er<br />
ein Luxushotel wegen Plakate, die die<br />
Gäste aufforderten, durch die mehrmalige<br />
Nutzung von Handtüchern der Umwelt zu<br />
helfen. Die Wiederverwendung von Handtüchern<br />
senkt zwar den Bedarf an Wasser<br />
und Strom, diese Bitte war jedoch eine<br />
Strategie der Hotelleitung, um die Kosten<br />
für die Reinigung zu senken.<br />
Laut einer Umfrage von Harris Poll – einem<br />
internationalen Marktforschungsunternehmen<br />
– geben weltweit 58 % der<br />
Unternehmen zu, Greenwashing zu betreiben.<br />
Dies ist zum einen darauf zurückzuführen,<br />
dass die Verbraucher bei ihren<br />
Kaufentscheidungen immer stärker auf<br />
Nachhaltigkeit achten. Zum anderen ist<br />
es für Unternehmen kostengünstiger, in<br />
Werbestrategien zu investieren, die den<br />
Anschein von Umweltbewusstsein erwecken,<br />
als ganze Geschäftsmodelle und<br />
Prozesse umzustellen.<br />
Der Übergang zum tatsächlichen nachhaltigen<br />
Handeln ist eine Herausforderung.<br />
Er erfordert eine Betrachtung des<br />
gesamten Produktlebenszyklus entlang<br />
der Wertschöpfungskette. Auch die Auswirkungen<br />
durch die Nutzung der Waren<br />
und die dadurch entstehenden Abfälle<br />
müssen hier berücksichtigt werden. Ökobilanzierungslösungen<br />
unterstützen Unternehmen<br />
auf diesem Weg. Dabei handelt<br />
es sich um wissenschaftlich basierte Softwarelösungen,<br />
mit denen Umweltbelastungen<br />
von Produkten, Werkstoffen und<br />
Prozessen ermittelt werden können. Bislang<br />
wurden Ökobilanzen vor allem dazu<br />
genutzt, die Auswirkungen vergangener<br />
Maßnahmen zu dokumentieren. Das Potenzial<br />
dieser Lösungen reicht jedoch viel<br />
weiter: Schon in der Entstehungsphase<br />
des Produktes besteht die Möglichkeit,<br />
dessen Umweltauswirkungen zu ermitteln<br />
und von vornherein zu reduzieren. Dies ist<br />
möglich, indem Berechnungen von Lebenszyklusanalysen<br />
bereits in Design-,<br />
Konstruktions- und Fertigungssoftware<br />
integriert werden. So haben alle Beteiligten<br />
jederzeit Einblick in die Auswirkungen<br />
ihres Handelns und können gezielt nachhaltigere<br />
Maßnahmen und Optionen wählen.<br />
Auf diese Weise wird die Ökobilanz<br />
bereits von Anfang an verbessert.<br />
Die Ökobilanzierungslösung Sustainable<br />
Innovation Intelligence auf der 3D-Experience<br />
Plattform unterstützt Unternehmen<br />
beim Einsatz eines virtuellen Zwillings von<br />
Produkten oder Prozessen dabei, Nachhaltigkeitsanforderungen<br />
bereits in der Entwicklung<br />
zu berücksichtigen und zu messen.<br />
Somit tragen Lösungen wie die von<br />
Dassault Systèmes maßgeblich dazu bei,<br />
Unternehmen fundierte und evidenzbasierte<br />
Erkenntnisse zu liefern, um nachhaltige<br />
Modelle zu etablieren. So ist es<br />
Anwendern möglich Betriebskosten zu<br />
senken sowie die größten Herausforderungen<br />
im Zusammenhang mit der Dekarbonisierung<br />
von Wertschöpfungsketten,<br />
der nachhaltigen Produktion sowie der<br />
Energie- und Wassernutzung zu meistern.<br />
Gleichzeitig erleichtern Ökobilanzierungslösungen<br />
den Einstieg in die Kreislaufwirtschaft<br />
– ein regeneratives System, das zukünftig<br />
unabdingbar sein wird, um den<br />
Ressourcenverbrauch zu reduzieren und<br />
sich zukunftsfähig aufzustellen.<br />
Über Dassault Systèmes<br />
Dassault Systèmes (DS) ist ein multinationales Software-Entwicklungsunternehmen<br />
mit mehreren Sitzen. In Europa befindet sich der Hauptsitz im französischen Vélizy-<br />
Villacoublay. Das Unternehmen ist bekannt für 3D Design Software, 3D Digital Mockup<br />
und für Product-Lifecycle-Management (PLM)-Lösungen. Am 5.6.1981 wurde es als<br />
eigene Konzerngesellschaft des Unternehmens Dassault Aviation gegründet. DS ist<br />
Entwickler von CATIA, einer CAD/CAM-Anwendung, und gehört zur Groupe Dassault.<br />
<strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023 19
» MANAGEMENT<br />
Treibhausgas-Bilanz schafft Orientierung bei der Klimatransformation<br />
Braucht die Klimaneutralität eine<br />
besondere Struktur?<br />
Konzerne und KMU sind gesetzlich verpflichtet, ihren Ausstoß an Treibhausgasen zu reduzieren.<br />
Ein Klimamanagement, das allen Anforderungen gerecht wird, lässt sich mit einer genormten<br />
Treibhausgas-Bilanz durchführen. Verifiziert wird diese von der DQS.<br />
» Tyrone Adu-Baffour, Normexperte der DQS<br />
Die Klimatransformation als umfassendes Betriebsziel:<br />
Damit nicht nur die eigenen Prozesse<br />
im Unternehmen, sondern auch die Lieferkette<br />
umweltverträglich funktionieren, bedarf es eines<br />
wirksamen übergreifenden Klimamanagements.<br />
Weniger betriebliche Treibhausgase (THG) zu emittieren<br />
ist dabei ein Schwerpunkt, doch es ist nicht<br />
der einzige. Auch der Ausgleich durch den Erwerb<br />
von CO 2 -Zertifikaten und anderen Kompensationsmitteln<br />
ist relevant.<br />
Eine THG-Bilanz zu erstellen ist ein guter Ausgangspunkt<br />
für ein erfolgreiches Klimamanagement.<br />
Sie liefert den Status quo der betrieblichen Emissionen<br />
und bildet die Datenbasis für Maßnahmen, mit<br />
denen sich der künftige Ausstoß verringern lässt.<br />
Planung, Entwicklung, Handhabung und Berichterstattung<br />
einer THG-Bilanz sind dabei Größen, für die<br />
es Grundsätze und Leitlinien gibt. Formuliert werden<br />
diese in einer Norm, der ISO 14064–1, die wiederum<br />
auf dem GHG Protocol basiert. Hierbei handelt es<br />
sich um eine transnationale Standardreihe mit der<br />
man Emissionen festhalten und abrechnen kann.<br />
Wie ist die Norm gegliedert?<br />
Zunächst werden die Parameter vorgestellt und<br />
festgelegt, angefangen mit der Bilanzierungsperi-<br />
Bild: Shutterhold/stock.adobe.com<br />
Um den Klimawandel aufhalten zu können, ist Klimaneutralität Bedingung. Viele Betriebe suchen nach Wegen, ihre Prozesse<br />
verlustfrei anzupassen.<br />
20 <strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023
ode. Anwender der Norm etablieren Organisationsgrenzen<br />
innerhalb derer sich die Auswertung bewegt.<br />
Der Hauptteil des Regelwerks beschreibt die<br />
unterschiedlichen Bestandteile der Bilanz und die<br />
Anforderungen, die der Ausführende jeweils zu erfüllen<br />
hat. Besonderes Augenmerk verdient dabei<br />
der Anhang der Norm. Wer die einzelnen Aspekte<br />
des Prozedere ausführlicher erläutert haben möchte,<br />
dem zeigen anschauliche Beispiele, wie man vorgeht.<br />
Ein ganz neues Thema befindet sich auch darunter:<br />
Die sogenannten „indirekten THG-Emissionen“.<br />
Dabei handelt es sich um den vor- und nachgelagerten<br />
Ausstoß der Wertschöpfungskette.<br />
Wesentliche Abschnitte im Überblick<br />
Die Norm ist im Hauptteil in mehrere Kapitel unterteilt.<br />
Kapitel 4 nennt ihre Grundsätze – am wichtigsten<br />
ist hier, dass alle THG-bezogenen Angaben der<br />
Realität entsprechen. Fünf weitere Grundsätze haben<br />
folgende Inhalte:<br />
• Relevanz: Die ausgewählten THG-Daten, die Informationen<br />
und angewendeten Methoden sollten<br />
sich an den Bedürfnissen der Bilanz-Anwender<br />
orientieren.<br />
• Vollständigkeit: Sämtliche THG-Emissionen und<br />
-Entzüge werden in die Auswertung einbezogen.<br />
• Konsistenz: Die THG-relevanten Informationen<br />
müssen miteinander vergleichbar sein.<br />
• Korrektheit: Abweichungen und Unsicherheiten<br />
dürfen nicht in die Bilanz fließen.<br />
• Transparenz: Alle Daten und Informationen, die den<br />
Ausstoß betreffen, müssen offengelegt werden.<br />
Das fünfte Kapitel der Norm behandelt den Bilanzrahmen.<br />
Emissionen aus direkten und indirekten<br />
Quellen und -Senken kommen in die Untersuchung.<br />
Bedingung ist, dass das Unternehmen Einfluss auf<br />
sie nehmen kann. Das Kapitel formuliert Wesentlichkeitskriterien<br />
in Bezug auf indirekte Emissionen<br />
und Organisationsgrenzen – und es hilft dabei, die<br />
THG-Quellen und -Senken zu identifizieren. Schließlich<br />
teilt es die Emissionen in verschiedene Kategorien<br />
ein.<br />
In Kapitel 6 geht es darum, den Ausstoß und Entzug<br />
der Treibhausgase zu quantifizieren. Dazu ermittelt<br />
man die Aktivitätsdaten aus den THG-Quellen<br />
und -Senken. Dies geschieht unternehmensspezifisch<br />
anhand eines geeigneten Ansatzes, der im Anhang<br />
der Norm ausführlich erläutert und dokumentiert<br />
wird. Als Bezugsgröße dient ein Basisjahr mit belastbaren<br />
Daten.<br />
Die Kapitel 7 und 8 befassen sich mit Initiativen,<br />
die den Ausstoß von Treibhausgas durch den Betrieb<br />
reduzieren sollen. Das entsprechende Qualitätsmanagement<br />
ist ebenfalls Gegenstand dieser Kapitel.<br />
Eine Treibhausgas-Bilanz unterstützt Unternehmen dabei, geeignete Initiativen zur<br />
Klimatransformation zu identifizieren und umzusetzen.<br />
Wie lassen sich Maßnahmen oder Tätigkeiten des<br />
Unternehmens identifizieren, die zur fortlaufenden<br />
Verbesserung des Klimamanagements beitragen können?<br />
Die Ausführungen an dieser Stelle sind für die<br />
THG-Bilanz jedoch nur mittelbar relevant.<br />
Kapitel 9 und 10 gehen auf die letzten Schritte ein:<br />
Soll das Ergebnis der Bilanz veröffentlicht werden,<br />
wird ein Bericht erstellt. Die Bilanz zu verifizieren ist<br />
auch möglich – Voraussetzung ist der Bericht. Wie<br />
genau die Berichterstattung aussehen soll, wie sie<br />
geplant und erstellt wird, all das legt ISO 14064–1 in<br />
einer Reihe von Anforderungen fest. Die Verifizierung<br />
wiederum erfolgt durch einen zugelassenen Dritten,<br />
z. B. die DQS. Eine zusätzliche Spezifikation,<br />
ISO 14064–3, liefert die Regeln für diesen Vorgang.<br />
Rechtlicher Hintergrund<br />
Seit dem 31.08.2021 müssen Unternehmen<br />
ihre Klimaschutz-Bemühungen verstärken.<br />
Die Treibhausgasneutralität ist in<br />
Deutschland für 2045 geplant (statt<br />
2050) – bis 2030 sollen die Emissionen<br />
um 65 % sinken. Ab 2024 gilt für Unternehmen<br />
zudem die Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung.<br />
Bild: Nataliia/stock.adobe.com<br />
<strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023 21
» MANAGEMENT<br />
WBA-Serie: Nachhaltigkeit als wettbewerbsdifferenzierender Faktor<br />
Nachhaltigkeit im Werkzeugbau<br />
messen und befähigen<br />
Original Equipment Manufacturer (OEM) müssen sowohl die interne Produktion als auch die gesamte<br />
Lieferkette nachhaltiger gestalten, um ökologischen und sozialen Aspekten gerecht zu<br />
werden. Infolgedessen werden die Zulieferer vermehrt anhand verschiedener Nachhaltigkeitskriterien<br />
bewertet. Für Werkzeugbaubetriebe bedeutet dies, dass die Nachhaltigkeit zu einem<br />
wettbewerbsdifferenzierenden Faktor wird.<br />
» Prof. Dr. Wolfgang Boos, Gerret Lukas, Julian Schweins, Leonhard Klisch<br />
Abbildung 1: Mögliche Indikatoren und Kriterien in den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit.<br />
Grafik: WBA<br />
In der Industrie findet derzeit ein Paradigmenwechsel<br />
statt – neben der finanziellen Perspektive<br />
werden aufgrund geänderter Ansprüche der Interessengruppen<br />
zunehmend ökologische und soziale Aspekte<br />
in die Beurteilung von Unternehmen einbezogen.<br />
Die Erfüllung nachhaltigkeitsbezogener Anforderungen<br />
ermöglicht beispielsweise den Zugang zu<br />
Kapital, die Sicherung zukünftiger Aufträge oder die<br />
Rekrutierung qualifizierten Personals. Zur zielführenden<br />
Steigerung der Nachhaltigkeit in den drei<br />
Dimensionen Ökonomie, Ökologie und Soziales bedarf<br />
es jedoch zunächst der Transparenz über die gegenwärtige<br />
Nachhaltigkeitsleistung.<br />
Dazu müssen spezifische Ansätze zur Messung der<br />
Nachhaltigkeitsleistung entwickelt werden, da bestehende<br />
Ansätze in der Einzel- und Kleinserienfertigung<br />
nur bedingt anwendbar sind. Hierfür können<br />
beispielsweise Kennzahlen definiert und im Nachhaltigkeitscontrolling<br />
integriert werden, wodurch die<br />
Messbarmachung der Nachhaltigkeit entlang des<br />
Werkzeuglebenszyklus ermöglicht wird. Aufbauend<br />
auf der geschaffenen Transparenz lässt sich anschlie-<br />
22 <strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023
starlim ist der<br />
weltweit größte<br />
Verarbeiter von<br />
Flüssig-Silikon.<br />
Als Vollanbieter übernehmen wir die gesamte<br />
Produktionskette von der Idee bis zum<br />
fertigen Produkt. Dadurch sparen Sie<br />
wertvolle Zeit und Ressourcen.<br />
Kontaktieren Sie uns jetzt für ein<br />
unverbindliches Angebot.<br />
www.starlim.com<br />
<strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023 23
» MANAGEMENT<br />
ßend eine strukturierte Steigerung der Nachhaltigkeitsleistung<br />
initiieren. Dies bietet die Chance, sich<br />
im internationalen Wettbewerb als Vorreiter zu positionieren<br />
und damit die Wettbewerbsfähigkeit langfristig<br />
zu sichern, da das Differenzierungsmerkmal<br />
Nachhaltigkeit in Niedriglohnstandorten schwierig<br />
zu imitieren ist.<br />
Ein systematisches Nachhaltigkeitscontrolling<br />
umfasst die Ausgestaltung und Verwendung von<br />
Kennzahlensystemen. Dabei ist die ganzheitliche<br />
Betrachtung der Nachhaltigkeit entscheidend. Diese<br />
wird gewährleistet, indem die drei Dimensionen<br />
Ökonomie, Ökologie und Soziales anhand ausgewählter<br />
Kennzahlen und Indikatoren berücksichtigt<br />
werden. Eine in der Praxis etablierte Grundlage für<br />
die Messung der Nachhaltigkeitsperformance anhand<br />
von Kennzahlen und Indikatoren stellen die<br />
GRI-Richtlinien dar. Die GRI-Richtlinien sind ein<br />
weltweit anerkannter Standard für die standardisierte<br />
Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten. Anhand<br />
der GRI lassen sich Indikatoren zur Messbarmachung<br />
der Nachhaltigkeit im Werkzeugbau definieren.<br />
Dazu sind die spezifischen Randbedingungen<br />
von Werkzeugbaubetrieben zu berücksichtigen. Abbildung<br />
1 zeigt eine Auswahl von Indikatoren für<br />
den Werkzeugbau, die sich an den GRI-Indikatoren<br />
orientieren.<br />
Die Erhebung von ökologischen und sozialen<br />
Daten ist im Vergleich zu ökonomischen Daten mit<br />
Über die WBA<br />
Die Werkzeugbau Akademie (WBA) steht<br />
der Branche mit einer starken Community<br />
und einem umfangreichen Dienstleistungsangebot<br />
zur Seite. Als Kompetenz-<br />
Center im Cluster Produktionstechnik auf<br />
dem RWTH Aachen Campus ist sie Teil eines<br />
der größten Forschungslabore Europas<br />
im Bereich der Produktionstechnik. Durch<br />
die enge Zusammenarbeit mit führenden<br />
Hochschuleinrichtungen und mehr als<br />
80 Mitgliedsunternehmen stellt sie die<br />
Verbindung zwischen Wissenschaft und<br />
Industrie her.<br />
einem höheren Aufwand verbunden, sodass die Datenerhebung<br />
eine zentrale Herausforderung darstellt.<br />
Die IIoT-Plattform mit modularem Dashboard<br />
der WBA stellt eine potenzielle Lösung dar, indem<br />
sie sämtliche Maschinen- und Werkzeugdaten in einer<br />
Plattform aggregiert und analysiert. Eine Analyse<br />
der gesammelten Energiedaten zeigt, dass ein<br />
signifikanter Anteil des Gesamtenergieverbrauchs<br />
auf nicht wertschöpfende Zeiten entfällt. Grundsätzlich<br />
sollte für produzierende Unternehmen eine<br />
möglichst hohe Maschinenauslastung im Vordergrund<br />
stehen, jedoch lassen sich bereits durch das<br />
reine Ausschalten der Maschinen an Wochenenden,<br />
Feiertagen oder nach Schichtende bei Ein- und<br />
Zweischichtbetrieb signifikante Energieeinsparpotenziale<br />
realisieren.<br />
Eine weitere Herausforderung stellt die vermehrt<br />
geforderte Betrachtung der Nachhaltigkeit entlang<br />
des gesamten Werkzeuglebenszyklus dar. Der Zugriff<br />
auf ökologische und soziale Daten von Lieferanten<br />
und Subunternehmen ist zwar nur selten<br />
gegeben, für die Gestaltung einer nachhaltigen<br />
Lieferkette und die Umsetzung einer ganzheitlichen<br />
Kreislaufwirtschaft jedoch fundamental. Es<br />
gilt folglich, Daten aus externen Datenquellen wie<br />
z.B. Marktdaten, Umweltdaten oder Compliance-<br />
Daten der Lieferanten und Kunden in das Nachhaltigkeitscontrolling<br />
zu integrieren. Dies erfordert eine<br />
effiziente und digitale Vernetzung der relevanten<br />
Entitäten entlang des Werkzeuglebenszyklus<br />
unter Berücksichtigung der Datensicherheit und<br />
des Datenschutzes.<br />
Weiterführende Informationen enthält die Studie<br />
„Erfolgreich Nachhaltigkeit messen im Werkzeugbau“,<br />
die in Kürze kostenlos auf der Website der<br />
WBA Aachener Werkzeugbau Akademie GmbH heruntergeladen<br />
werden kann (über das Scannen des<br />
QR-Code unter dem Artikel). Darüber hinaus verfolgt<br />
die WBA das Ziel, einen unabhängigen Standard zur<br />
Ermittlung von CO 2<br />
-Äquivalenten im Werkzeug, den<br />
CO 2<br />
-Werkzeugpass, zu etablieren.<br />
24 <strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023
SPECIAL<br />
» Nachhaltigkeit<br />
Nachhaltigkeit ist das Top-Thema in allen Branchen. Was<br />
Industrieunternehmen heute schon für ihre CO 2 -Neutralität tun<br />
und welchen Beitrag beispielsweise Retrofitting und industrielle<br />
Gleichstromnetze leisten, zeigt unser Sonderteil.<br />
Mit Pflanzenkohle<br />
CO 2<br />
-positiv werden<br />
» Seite 26<br />
Energiemanagement -<br />
system steigert Effizienz<br />
» Seite 30<br />
Durch Retrofitting<br />
Energie effizienz erhöhen<br />
» Seite 32<br />
Antriebstechnik für eine<br />
nachhaltige Produktion<br />
» Seite 34<br />
Bild: viks_jin/stock.adobe.com<br />
Blaupause für industri -<br />
elle Gleichstromnetze<br />
» Seite 36<br />
Volkswagen dosiert<br />
stromlos im EX-Bereich<br />
» Seite 40<br />
Das Thema Nachhaltigkeit und nachhaltige Produktion treibt viele Unternehmen um. Gerade auch<br />
alternative Energieträger wie Wasserstoff sollen künftig eine größere Rolle spielen.<br />
<strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023 25
TOPSTORY » Pflanzenkohle<br />
Biomasse wie Holz kann neben der Energie<br />
auch Pflanzenkohle produzieren, und damit<br />
einen Teil des CO 2 langfristig bindet.<br />
Bild: Tobias Meyer<br />
Mit Pflanzenkohle CO 2 -positiv werden<br />
Zukunftsfähige Kohle<br />
Derzeit kämpfen Unternehmen mit Lieferengpässen, Energiepreisen und der<br />
CO 2 -Thematik: Einen Lösungsansatz bieten Biomasse-Kraftwerke, die neben Wärme<br />
und Strom auch Pflanzenkohle als Rohstoff produzieren und dadurch im besten Fall<br />
sogar CO 2 -positiv arbeiten.<br />
» Tobias Meyer, freier Mitarbeiter des <strong>Industrieanzeiger</strong>s<br />
26 <strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023
Pflanzenkohle wird aktuell industriell noch kaum<br />
genutzt. Künftig könnte man damit aber fossile<br />
Rohstoffe durch regional erzeugte ersetzen. „Um das<br />
sinnvoll zu gestalten, reicht es aber nicht, nur Holz<br />
vom Weltmarkt zu verfeuern. Eine ganzheitliche Betrachtung<br />
des Systems ist zwingend notwendig“, erklärt<br />
Ulrich Grauvogel, Senior Fellow und zuständig<br />
für den Bereich Biomassenachhaltung beim Kraftwerksbauer<br />
Syncraft. Denn Regionalität und Selbstversorgung<br />
boomt derzeit nicht nur im Gemüsegarten,<br />
sondern auch in der Industrie: Wer kann, versucht<br />
energetisch grün und unabhängiger zu werden. Dabei<br />
kann neben der Photovoltaikanlage auf dem Dach<br />
auch ein Biomasse-Kraftwerk entsprechende Möglichkeiten<br />
eröffnen. Neben Strom produziert es vor allem<br />
Wärme und auch Pflanzenkohle. Diese kann künftig<br />
in bestimmten Bereichen fossile Rohstoffe wie<br />
Steinkohle ersetzen, aber auch Beton oder Asphalt klimatisch<br />
verträglicher und ausgelaugte Böden wieder<br />
fruchtbarer machen.<br />
Würde die Biomasse nur verfeuert, ist der Prozess der<br />
Wärmegewinnung nach derzeitiger Definition lediglich<br />
klimaneutral. Denn das während der Verbrennung in<br />
die Atmosphäre entlassene CO 2 wird von den nachwachsenden<br />
Bäumen in gleicher Menge wieder gebunden.<br />
Kommt neben der Energieerzeugung aus der<br />
Kraft-Wärmekopplung noch die Pflanzenkohle ins<br />
Spiel, kann man aber auch klimapositiv werden: Ein Teil<br />
des Kohlenstoffs der Biomasse wird im Prozess so nicht<br />
in CO 2 , sondern in der Kohle umgewandelt. Diese darf<br />
nun natürlich nicht selbst verfeuert oder anderweitig<br />
chemisch umgesetzt werden, da sonst wieder CO 2 daraus<br />
entstehen würde. Möchte man den klimapositiven<br />
Effekt erzielen, muss die Kohle langfristig gebunden<br />
werden, etwa als Zuschlagstoff in Beton.<br />
Vom Klimasünder zum CO 2<br />
-Speicher<br />
Marcel Huber (links) und Ulrich Grauvogel vor dem Herzstück eines<br />
Syncraft-Kraftwerks, dem Schwebefestbettvergaser.<br />
Das Schema des Kraftwerks zur Gas- und Kohleproduktion.<br />
Entsprechende Pilotprojekte laufen bereits, etwa an<br />
einem Bahnhof in Bregenz. Beim neuen Technikgebäude<br />
zur Versorgung der künftigen Liftanlagen wurde<br />
besonders der Einsatz von klimafreundlichen Materialien<br />
berücksichtigt. Die ÖBB-Projektleitung hat daher<br />
in Kooperation mit heimischen Firmen den sogenannten<br />
Klimabeton eingesetzt. Bei diesem wird ein Teil<br />
des notwendigen Zements durch technischen Kohlenstoff<br />
– ein anderer Begriff für die Pflanzenkohle – ersetzt,<br />
wodurch sich die CO 2 -Bilanz des Betons in Summe<br />
reduziert. Begleitend analysiert wurde das Projekt<br />
auch von der Bautechnischen Versuchsanstalt an der<br />
HTL Rankweil. Dabei wurden sowohl die technischen<br />
als auch die ökologischen Anforderungen an den Beton<br />
erfüllt. Das Ergebnis der Ökobilanz zeige laut ÖBB,<br />
dass durch den Einsatz des Klimabetons 41% CO 2 im<br />
Vergleich zum herkömmlichen Standardbeton eingespart<br />
werden konnten. In dem Bregenzer Gebäude stecken<br />
etwa 100 m³ Beton, was einer Einsparung von ca.<br />
7660 kg CO 2 entspricht. Für die gleiche Menge müsste<br />
ein durchschnittlicher PKW-Fahrer auf gut 50.000 km<br />
verzichten. Harald Schreyer, Projektleiter der ÖBB-Infrastruktur<br />
AG, hebt das Potential des Klimabetons für<br />
die Zukunft hervor und freut sich, dass man durch die<br />
EINFACH EINLAGERN<br />
Die erzeugten Mengen Pflanzenkohle sind derzeit noch<br />
verhältnismäßig gering. Dennoch wird schnell ersichtlich,<br />
dass der Rohstoff künftig ein Baustein zur Dekarbonisierung<br />
sein kann. Denn technologisch ist bereits heute alles<br />
serienreif, bis hin zur endgültigen, gefahrlosen Einlagerung.<br />
Wie auch grüner Stahl könnte grüner Beton künftig<br />
zunehmend gefragt sein. Damit aber wirklich mit besserem<br />
Gewissen betoniert werden kann, sollte man künftig auch<br />
den immer öfter unter ökologisch fragwürdigen Bedingungen<br />
geförderten Sand mit berücksichtigen.<br />
Bild: Tobias Meyer<br />
Bild: Tobias Meyer<br />
<strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023 27
TOPSTORY » Pflanzenkohle<br />
Bild: Tobias Meyer<br />
Bild: Circular Carbon<br />
Kooperation mit lokalen Unternehmen einen vorerst<br />
kleinen, aber wichtigen Beitrag in Richtung Klimaneutralität<br />
auf den Baustellen leisten konnte: „Ich hoffe,<br />
dass dieser Beitrag in Zukunft noch größer wird.“ Zur<br />
Verdeutlichung, was hier für Potentiale schlummern:<br />
Im Jahr 2021 wurden in Deutschland fast 55 Mio. m³<br />
Beton zu Baustellen und Firmen geliefert.<br />
Das Rückwärtskraftwerk<br />
Der Prozess im Kraftwerk ist keine reguläre Verfeuerung.<br />
Stattdessen hat der Syncraft-Gründer Marcel<br />
Huber mit seinem Team von Verfahrenstechnikern ein<br />
eigenes System entwickelt: „Statt Kohle in einen<br />
Heizkessel zu stecken, kommt sie bei uns heraus, daher<br />
nennen wir das auch Rückwärtskraftwerk.“ In der<br />
Vorstufe erhitzen sich die Holzhackschnitzel auf<br />
500 °C und verwandeln sich dabei in Kohle. Diese<br />
wandert ins Herzstück der Anlage, den Schwebefestbettvergaser.<br />
Sein Geheimnis ist, dass dort die<br />
Schwerkraft und Gasströmung entgegengesetzt arbeiten.<br />
Die feine Kohle möchte also eigentlich fallen,<br />
Die Verfahrenstechnik samt Gasmotoren liefert Syncraft, lediglich das Gebäude übernimmt<br />
der Hersteller nicht.<br />
Im Hamburger Hafen werden die Schalen von Kakaobohnen zu Pflanzenkohle verarbeitet.<br />
Möglich sind aber auch andere Ausgangsstoffe.<br />
wird aber durch den von unten zugeführten Luftstrom<br />
in der Schwebe gehalten. Die Temperatur steigt dabei<br />
auf 850 °C, der Pyrolyse-Effekt bricht die organischen<br />
Verbindungen zu Gasen auf, die oben abgegriffen<br />
werden. „So bleibt alles ideal gelockert, egal wie fein<br />
das Hackgut vorher strukturiert war“, erklärt Huber.<br />
So kann die Kohle sehr gleichmäßig vergaßt werden.<br />
Der Feststoff wird dann abgeschieden, zwecks Explosionsschutz<br />
befeuchtet und in Bigpacks gefüllt.<br />
Das gewonnene Gas besteht zu etwa 40 % aus Wasserstoff<br />
und wird anschließend nochmals gereinigt.<br />
Dabei wird beispielsweise der Ammoniak entfernt, da<br />
dieser mit für die Stickoxide in Abgasen verantwortlich<br />
ist. Speziell auf das Holzgas hin optimierte Verbrennungsmotoren<br />
der Firma Jenbacher erzeugen<br />
dann den Strom über Generatoren. Verkauft hat Syncraft<br />
bereits 36 Kraftwerke, 8 alleine seit Beginn des<br />
Ukraine-Kriegs. „Vorher war lokale Energie kaum gefragt,<br />
inzwischen hat sich das komplett gewandelt“,<br />
so Huber. Mit einem elektrischen Wirkungsgrad von<br />
30 % und einem Brennstoffnutzungsgrad von bis zu<br />
92 % zählen die Holzkraftwerke nach seiner Aussage<br />
zu den rentabelsten in der gesamten Bioenergiebranche.<br />
Sie sollen sich nach fünf bis zehn Jahren amortisieren,<br />
je nach Wertigkeit der produzierten Wärme.<br />
Künftig könnten aber die Pflanzenkohleerzeugung<br />
der primäre Faktor werden.<br />
Ökologisch ganzheitlich denken<br />
Voraussetzung dafür ist aber die gleichbleibende Stabilität<br />
der genutzten Biomasse-Systeme. Wer also<br />
nicht garantieren kann, dass in den Wäldern, die das<br />
genutzte Holz produzieren, auch entsprechend viel<br />
nachwächst, lügt sich klimatechnisch selbst in die<br />
Tasche. Bereits den Punkt Holzerzeugung selbst sicher<br />
in der Hand zu haben, ist Grundlage der ganzheitlichen<br />
Strategie, für die sich auch Ulrich Grauvogel<br />
einsetzt: „Der Idealfall ist erreicht, wenn der Kraftwerksbetreiber<br />
den Rohstoff Holz nicht zukaufen<br />
muss, sondern selbst erzeugt.“ Das kann auf sogenannten<br />
Kurzumtriebsplantagen geschehen. Dabei<br />
werden auf Agrarflächen schnellwachsende Gehölze<br />
wie Pappel oder Weide gepflanzt und bereits nach<br />
wenigen Jahren geerntet. Der Vorteil dieser Baumarten<br />
ist, dass sie anschließend selbst wieder austreiben<br />
und der Kreislauf von vorne beginnt. Der Anbau kann<br />
entweder in Eigenregie erfolgen, was das Energieunternehmen<br />
laut Grauvogels Erfahrung auch interessant<br />
für die Mitarbeiter mache. Denn diese sind nicht<br />
nur technisch im Anlagenbetrieb sondern auch pflanzenbaulich<br />
gefordert. Die eigene Versorgung durch<br />
solche Plantagen habe zudem den Vorteil, dass man<br />
mit durchgehend gleicher Rohstoffqualität arbeitet.<br />
Das wiederum wirkt sich auf die Qualität der Pflan-<br />
28 <strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023
Wellenfedern &<br />
Sicherungsringe<br />
Kleiner, leichter und kompakter bauen<br />
Innovative Design Lösungen für Ihre Anwendung<br />
Bild: ÖBB/Hämmerle<br />
Die Österreichische Bundesbahn hat für ein Bauprojekt in Bregenz bereits<br />
Klimabeton eingesetzt.<br />
Wellenfedern<br />
• Bis zu 50%<br />
Bauraumeinsparung<br />
• Exakte Vorspannkraft<br />
• Keine Werkzeugkosten<br />
für Sonderanfertigung<br />
zenkohle aus. Eine Tonne Kohle binde demnach 1,2 t<br />
CO 2 , was etwa der Hälfte des im Holz gespeicherten<br />
Kohlenstoffs entspricht. Der Rest gelangt durch den<br />
Schornstein in die Luft und wird von nachwachsenden<br />
Bäumen der Wälder oder Plantagen wieder gebunden.<br />
Landwirtschaft als Absatzmarkt<br />
Der Einstieg in die Pflanzenkohle-Produktion kann<br />
auch bereits vor dem eigenen Bedarf oder einer fertig<br />
konzipierten Umstellung auf das neue Produkt erfolgen.<br />
Denn derzeit kann der Rohstoff problemlos vermarktet<br />
werden. Landwirte etwa setzen ihn zur<br />
Bodenverbesserung ein, indem sie ihn unter die Gülle<br />
mischen. Deren Düngewirkung bleibt so länger in den<br />
von den Pflanzen nutzbaren Schichten vorhanden, da<br />
die Kohle wie ein Nährstoff-Schwamm funktioniert.<br />
Diese Kundschaft hat auch das junge Unternehmen<br />
Circular Carbon im Fokus, es hat sich mit einem<br />
ähnlichen Ansatz der Pflanzenkohle verschrieben.<br />
Der Ausgangsstoff ist dabei die Schale der Kakaobohne.<br />
Der Reststoff kann auf Grund seines giftigen<br />
Theobromin-Gehalts kaum ohne weiteres genutzt<br />
oder kompostiert werden. Die hier mit über 600 °C<br />
durchgeführten Pyrolyse aber bricht auch solche<br />
Stoffe auf. Die so erzeugte Pflanzenkohle kann neben<br />
der Bodenverbesserung auch in Tierfutter eingesetzt<br />
werden, wodurch sie langfristig ebenfalls über die<br />
Gülle im Boden landet. Denn zersetzt wird der<br />
schwarze Stoff von Mikroorganismen kaum, er überdauert<br />
tausend Jahre und mehr. Die Abwärme des<br />
Prozesses wird hier natürlich ebenfalls direkt genutzt,<br />
etwa durch die direkt im Hamburger Hafen benachbarte<br />
Kakaorösterei. Laut Aussage des Start-Ups<br />
sei ihre Pflanzenkohle zudem durch Veredelungsprozesse<br />
anpassbar, man forsche kontinuierlich an neuen<br />
Anwendungen und Ausgangsstoffen. Auch hier<br />
soll es nicht bei einem System bleiben: Zugeschnitten<br />
auf die potentiellen Kunden entwickelt und steuert<br />
Circular Carbon den Bau einer Karbonisierungsanlage<br />
und betreibt diese nach Fertigstellung.<br />
www.syncraft.at<br />
www.circular-carbon.com<br />
Spirolox® Sicherungsringe<br />
• 360° geschlossene<br />
Anlagefläche<br />
• Keine störenden Ösen<br />
• Einfache Montage<br />
& Demontage<br />
+49 (0) 234 923610<br />
www.tfc.eu.com<br />
SalesDE@tfc.eu.com<br />
CAD Downloads<br />
Beratung bei Designauswahl<br />
Kostenlose Muster<br />
Mehrsprachige<br />
Katalogproduktion<br />
Für die Produktion Ihrer mehrsprachigen oder versionierten<br />
Kataloge sind wir bestens gerüstet – speziell wenn es<br />
um das Know-how beim Projektmanagement Ihrer hochkomplexen<br />
Aufträge geht.<br />
Individuelle Tools, die perfekt auf Ihr Projekt abgestimmt sind,<br />
beschleunigen und vereinfachen den Gesamtprozess.<br />
Wir können viel für Sie tun, sprechen Sie uns an.<br />
druck@konradin.de<br />
www.konradindruck.de<br />
<strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023 29
» TECHNIK<br />
Energiemanagement-System steigert Effizienz<br />
Produktion nachhaltiger gestalten<br />
Mit Wechselrichtern, Frequenzumrichtern und Lösungen für die Elektromobilität entwickelt und fertigt<br />
Kostal Industrie Elektrik zahlreiche Produkte für eine nachhaltigere Zukunft. In Kombination mit einem<br />
Energiemanagement-System sorgen diese nun auch im eigenen Unternehmen für mehr Nachhaltigkeit.<br />
» Sebastian Hankel, Vertriebsleiter Norddeutschland, Econ Solutions<br />
Mit der Software Econ4 führte Kostal eine ABC-Analyse durch, die zeigte, dass ein Großteil der<br />
elektrischen Energie nicht auf die Produktion entfiel.<br />
Bild: Econ Solutions<br />
Der Stammsitz von Kostal Industrie<br />
Elektrik in Hagen ist seit 2015<br />
ISO-50001-zertifiziert und damit Vorreiter<br />
im Bereich Energiemanagement. Anfangs<br />
reichten hierfür der Hauptzähler des Energieversorgers<br />
und Excel-Tabellen aus. Anhand<br />
der Anschlussleistungen der Maschinen<br />
sowie ihren geschätzten Auslastungen<br />
und Laufzeiten wurde der Verbrauch<br />
errechnet. Doch Vergleiche mit Daten aus<br />
mobilen Messungen zeigten schnell, dass<br />
die Resultate nicht mit dem tatsächlichen<br />
Verbrauch übereinstimmten.<br />
„Um unseren Anforderungen gerecht zu<br />
werden, war schnell klar, dass wir ein<br />
Energiemanagement-System benötigen,<br />
welches uns bei der Erfassung von Energiedaten<br />
unterstützen kann“, erklärt Dominik<br />
Felske, zuständig für die Werkserhaltung<br />
bei Kostal Industrie Elektrik. Die<br />
Wahl fiel auf Econ Solutions, denn dieses<br />
Energiemanagement-System erfüllte die<br />
gesuchten Anforderungen: einfache Installation<br />
der Messgeräte, Herstellerunabhängigkeit<br />
und intuitive Handhabbarkeit<br />
sowie eine Software, die ohne Installation<br />
über einen Webbrowser nutzbar ist.<br />
„Außerdem hat mir gefallen, dass Econ<br />
Solutions nicht wie viele andere Anbieter<br />
rein aus dem Messtechnik-Bereich<br />
kommt, sondern auf das Thema Energie<br />
spezialisiert ist“, ergänzt Felske.<br />
Das System besteht im Wesentlichen<br />
aus dem Energie- und Leistungsmessgerät<br />
Econ Sens3 und der Energiemanagement-Software<br />
Econ4. Zum Start erweiterte<br />
Kostal die vorhandenen Zähler um<br />
rund 20 der Messgeräte. Sie erfassen den<br />
Stromverbrauch an den wichtigsten Knotenpunkten<br />
der Produktion und Gebäudetechnik.<br />
Alle Messdaten, auch die der<br />
bestehenden Messgeräte, fließen automatisch<br />
in die Software ein. Heute sind<br />
über 470 verschiedene Messgeräte der<br />
Kostal Gruppe integriert. Damit misst<br />
Gruppe neben Strom jetzt auch Erdgas,<br />
Heizöl, Wärme- und Kältemengen sowie<br />
Druckluft.<br />
Zuerst mit der Software eine ABC-Analyse<br />
durchgeführt. Das Ergebnis: Ein großer<br />
Teil der benötigten elektrischen Energie<br />
entfiel nicht nur auf die Produktion,<br />
sondern besonders die Lüftungstechnik<br />
und der Kältetransport trugen wesentlich<br />
dazu bei. Um den Verbrauch hier zu reduzieren,<br />
setzte das Unternehmen die eigenen<br />
Frequenzumrichter ein und optimierte<br />
die Betriebsparameter so, dass die benötigte<br />
Energieaufnahme sich reduzierte.<br />
Dies ermöglichte zudem ein präziseres<br />
Ansteuern der Motoren, sodass die Pumpen<br />
und Ventilatoren nur den exakt notwendigen<br />
Volumendurchsatz erzeugen.<br />
Für den Stromverbrauch in der Produktion<br />
ermittelte ein Energieteam mithilfe<br />
der Software die relevanten Kennzahlen,<br />
um die vorhandenen Prozesse zu optimieren.<br />
Eine besondere Herausforderung<br />
stellte hier die Darstellbarkeit der verschiedenen<br />
Herstellungsprozesse dar. Jedoch<br />
hat sich oftmals gezeigt, dass der<br />
Bezug auf hergestellte Stückzahlen die<br />
beste Variante darstellte. Auf dieser Basis<br />
konnten die Prozesseigner Maßnahmen<br />
zur Effizienzsteigerung definieren.<br />
Bei der Drucklufterzeugung ist der<br />
Kennwert „kWh zugeführter elektrischer<br />
Energie pro m 3 hergestellter Druckluft“<br />
ausschlaggebend. „Dadurch wissen wir,<br />
dass wir hier schon relativ effizient arbeiten.<br />
Um noch besser zu werden, haben<br />
wir Optimierungsmaßnahmen eingeleitet<br />
und kommunizieren die Kennzahl dauerhaft“,<br />
berichtet Felske. „Ein besonderer<br />
Vorteil des Econ-Systems ist der automatische<br />
Berichtsversand, so kann man alle<br />
Prozesseigner und die Personen, die einen<br />
Einfluss auf den Energieverbrauch des<br />
30 <strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023
Unternehmens haben, über aktuelle<br />
Messdaten informieren.“<br />
Lastspitzen und unnötige<br />
Kosten vermeiden<br />
Das Spitzen- und Ladelastmanagement überwacht dauerhaft den Strombezug und regelt ihn dynamisch<br />
nach individuellen Vorgaben.<br />
Um Zusatzkosten durch Lastspitzen zu<br />
vermeiden, setzt Kostal Econ Peak ein.<br />
Das Spitzen- und Ladelastmanagement<br />
überwacht dauerhaft den Strombezug<br />
und regelt ihn nach individuellen Vorgaben<br />
dynamisch entsprechend der Verbrauchssituation.<br />
Beispielsweise läuft an<br />
einem Standort ein Notstromaggregat zur<br />
turnusmäßigen Prüfung immer dann,<br />
wenn das Econ Peak eine bevorstehende<br />
Lastspitze erkennt. Somit wird die regelmäßige<br />
Funktionsprüfung des Aggregates<br />
genutzt, um Lastspitzen zu glätten.<br />
Der Standort in Hagen geht einen anderen<br />
Weg. Auf das Verbrennen von fossilen<br />
Energieträgern wird hier verzichtet. Man<br />
nutzt stattdessen die eigenen Produkte,<br />
wie PV-Wechselrichter und Batteriespeicher,<br />
die an ca. 400-kWp-Photovoltaikanlagen<br />
betrieben werden, um die anfallenden<br />
Leistungsspitzen zu reduzieren. Ebenso<br />
entwickelt das Unternehmen AC/DC<br />
Wallboxen, die ein bidirektionales Laden<br />
ermöglichen. Am Standort Hagen wird eine<br />
Testanlage für die Wallboxen betrieben:<br />
Prognostiziert das Econ Peak eine<br />
Lastspitze, wird hier bisher der Ladestrom<br />
reduziert, in Verbrauchstälern werden die<br />
Batterien dann wieder geladen. Zukünftig<br />
könnte mit diesem Feature auch aus den<br />
Fahrzeugbatterien kurzfristig Strom ins<br />
Unternehmensnetz eingespeist werden.<br />
An jedem Standort gibt es einen Energiebeauftragten,<br />
der das Energiemanagement<br />
vor Ort im Blick behält. Zudem hat<br />
jede Gesellschaft ein Nachhaltigkeits-<br />
Team. Die Prozesseigner erhalten monatliche<br />
Berichte mit den für sie wichtigen<br />
Daten und Kennzahlen. „Nachdem die<br />
Vorlagen einmal angelegt sind, geht das<br />
monatliche Versenden vollkommen automatisch.<br />
Das war auch ein Argument für<br />
Econ. Denn so wichtig das Energiemanagement<br />
auch ist, es sollte unterstützen<br />
und dabei keine wichtigen zeitlichen Ressourcen<br />
verbrauchen – unser Hauptgeschäft<br />
ist schließlich die Produktion“, erklärt<br />
Dominik Felske.<br />
Bild: Econ Solutions<br />
GREEN<br />
PERFORMANCE<br />
Nachhaltige Höchstleistung<br />
Sie fragen sich, ob sich ein Maximum an Logistikleistung mit einem<br />
Minimum an Kosten und Emissionen verträgt? Wir treten gern den<br />
Beweis an und beraten Sie ganzheitlich bei der Wahl des richtigen<br />
Energiesystems für Ihre Flotte – von der Analyse Ihrer Anforderungen<br />
bis zur Umsetzung. Das nennen wir Green Performance. www.linde-mh.de/green-performance<br />
<strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023 31
» TECHNIK<br />
Retrofit einer Fräsmaschine<br />
Clever nachgerüstet<br />
Neuanschaffung oder Retrofit? Eine Frage, die ein Fertigparketthersteller einfach beantworten<br />
kann, denn an einer seiner Bestandsfräsmaschinen wurde ein Retrofit umgesetzt. Jetzt ist diese<br />
für die nächsten zehn Jahre gut und sicher gerüstet und dazu wesentlich energieeffizienter.<br />
» Jörg Peßl, Regional Sales Manager, Pilz Österreich<br />
Mit der Planung und Umsetzung der Maschinenüberholung einer Fräsmaschine wurde der Automatisierer Pilz beauftragt.<br />
Bild: Pilz<br />
Parkettböden aus Eichen-, Kirsch- oder<br />
Nussholz, darunter ganz besondere<br />
Produktkreationen, sind Markenzeichen<br />
von Scheucher Parkett. Dass das Unternehmen<br />
mit natürlichen und langlebigen<br />
Produkten nicht nur die Umwelt mit Blick<br />
auf sein Portfolio in den Fokus nimmt,<br />
sondern durchgängig im eigenen Haus<br />
umwelt- und ressourcenschonend handelt,<br />
unterstreicht auch die derzeit größte, betriebseigene<br />
Photovoltaikanlage Österreichs.<br />
Und wenn es um die Instandhaltung<br />
des Maschinenparks geht, plant<br />
Scheucher auch in der eigenen Fertigung<br />
nachhaltig.<br />
Ursprünglich sollte an einer der Bestandsfräsmaschine<br />
nur „ganz harmlos“<br />
eine Förderkette getauscht werden. Diese<br />
zählt zu den essenziellen Verschleißteilen<br />
der 1996 in Betrieb genommenen Maschine.<br />
Lediglich Abweichungen von nur +/-<br />
fünf Hundertsteln sind Vorgabe. „Dann haben<br />
wir gemerkt, dass auch die Steuerung<br />
nicht mehr den Standards entspricht. Und<br />
schnell waren wir bei der Überlegung angelangt:<br />
neuanschaffen oder nachrüsten“,<br />
erzählt Karl Kaufmann, Betriebsleiter bei<br />
Scheucher. Die Entscheidung fiel schnell –<br />
auch im Sinne der Nachhaltigkeit – zugunsten<br />
eines kompletten Retrofits aus.<br />
„Dann kam der nächste Schritt: einen<br />
Partner zu finden, der alles für uns aus einer<br />
Hand umsetzt“, betont Kaufmann einen<br />
der wichtigsten Punkte.<br />
Hier kam das Automatisierungsunternehmen<br />
Pilz ins Spiel. Das Unternehmen<br />
mit der Kernkompetenz Sicherheit ist ein<br />
Lösungsanbieter mit einem umfassenden<br />
Dienstleistungsangebot: Mit Sicherheitsberatung<br />
und Engineering bietet es einen<br />
durchgängigen Service von der sicherheitstechnischen<br />
Überprüfung des Maschinenparks<br />
über die Risikoanalyse bis<br />
zur Systemintegration und Verifikation<br />
beim Kunden. Und das alles mit Blick auf<br />
die Sicherheit für Mensch, Maschine –<br />
aber auch die Umwelt. Letzteres ist fest<br />
in den Konzernzielen verankert: von der<br />
Entwicklung energiesparender Produkte<br />
über die ökologische Gestaltung von Gebäuden<br />
bis hin zum umweltbewussten<br />
Arbeiten. Maschinen, die mechanisch<br />
noch weitere 10 bis 15 Jahre einwandfrei<br />
laufen, muss man nicht entsorgen, sondern<br />
nur an die aktuellen Standards und<br />
Sicherheitsvorschriften anpassen, so wie<br />
bei Scheucher.<br />
32 <strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023
Pilz hat den von Scheucher gewünschten<br />
ganzheitlichen Ansatz im Fokus: „Wir<br />
denken in Lösungen“, bekräftigt Peßl. Das<br />
Unternehmen war daher für die Gefahrenanalyse<br />
und das sich daraus ergebende<br />
Sicherheitskonzept verantwortlich und<br />
hat im Zuge des anschließenden Umbaus<br />
das komplette Engineering sowie auch<br />
die Programmierung bis hin zur Validierung<br />
übernommen. „Man hätte auch vier,<br />
fünf verschiedene Gewerke für die jeweiligen<br />
Teilaufgaben beauftragen können.<br />
Aber wir wollten einen einzigen Ansprechpartner<br />
und alles aus einer Hand“,<br />
erklärt Karl Kaufmann. Ausschlaggebend<br />
dabei war unter anderem auch, dass Pilz<br />
herstellerunabhängig berät. In die Planung<br />
bzw. das Konzept einbezogen wurden<br />
auch bereits verbaute Komponenten<br />
anderer Hersteller. Gilt es neue Produkte<br />
zu verbauen, können Kunden auf Pilz-<br />
Komponenten zurückgreifen.<br />
So auch beim Parketthersteller: Hier<br />
sind etwa ein zusätzliches Sicherheits-<br />
Lichtgitterpaar PSENopt II für Finger-,<br />
Hand- und Körperschutz sowie Komponenten<br />
für das Schutztürmanagement<br />
aus dem modularen Schutztürsystem von<br />
Pilz verbaut worden: die Taster-Unit PITgatebox<br />
sowie das Schutztürsystem<br />
PSENmlock für sichere Verriegelung und<br />
sichere Zuhaltung. Der Lösungsansatz des<br />
Automatisierers bleibt darüber hinaus<br />
durchgängig: Normalerweise wird die Gefahrenzone<br />
abgeriegelt. Anders hingegen<br />
in der holzverarbeitenden Industrie. Denn<br />
dort sind der Funkenflug und die sich daraus<br />
ergebenden Brände eine große Herausforderung.<br />
Konkret bedeutet das, die<br />
Maschine muss jederzeit zugänglich sein.<br />
Vor dem Hintergrund dieser Anforderung<br />
wurde die Verriegelung über das Schutztürsystem<br />
PSENmlock ihrer aktuellen<br />
Funktion entsprechend „nur einfach“ anders<br />
angewendet, das heißt hier in umgekehrter<br />
Richtung verbaut. Und dadurch<br />
eine branchenspezifische Lösung geschaffen.<br />
Das Ergebnis: eine enorme Energieeinsparung.<br />
Denn sämtliche Fräsmaschinen<br />
haben pro Seite jeweils fünf Motoren, die<br />
alle im Leerlauf mitliefen, auch wenn<br />
nicht aktiv benötigt. Durch die Umrüstung<br />
konnte dieser unnötige Energieverbrauch<br />
behoben werden. Jetzt laufen immer<br />
nur die Motoren, die aktiv benötigt<br />
werden. „Wir sparen dadurch rund 80<br />
Prozent an Energie nur bei dieser einen<br />
Maschine ein“, ergänzt der Betriebsleiter.<br />
Und Scheucher betont abschließend,<br />
dass die Vertrauensbasis der wichtigste<br />
Aspekt dafür ist, alles aus einer Hand umsetzen<br />
zu lassen: „Oft bekommt man null<br />
Support und, wenn man die Bedienungsanleitung<br />
liest, ist man meist besser dran.<br />
Daher werden wir ganz sicher beim<br />
nächsten Projekt wieder mit Pilz zusammenarbeiten.“<br />
iJaw<br />
Spannkraftmessung<br />
während der Bearbeitung<br />
Höhere Produktivität<br />
Geringere Teilekosten<br />
Mehr Sicherheit bei der Bearbeitung<br />
Die Nachrüstlösung für alle<br />
bestehenden Drehmaschinen ist jetzt<br />
verfügbar. Keine Integration in<br />
die Maschinensteuerung notwendig!<br />
JETZT BERATEN LASSEN:<br />
07325 -16 500<br />
Besuchen Sie uns auf der<br />
EMO IN HANNOVER:<br />
18.- 23. 09. 2023<br />
HALLE<br />
3<br />
STAND<br />
I 06<br />
Bild: Pilz<br />
Ursprünglich sollte nur<br />
die Förderkette getauscht<br />
werden. Dann<br />
wurde die Maschine<br />
einem Retrofit unterzogen<br />
und arbeitet<br />
jetzt energieeffizienter.<br />
RÖHM GMBH ROEHM.BIZ<br />
INFO@ROEHM.BIZ TEL +49 7325 16 0<br />
<strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023 33
» TECHNIK<br />
Wachstum der Elektromotoren in den letzten 15 Jahren – ein Blick zurück<br />
Antriebstechnik für eine<br />
nachhaltige Produktion<br />
Vor fast 15 Jahren wurde mit der Ökodesignrichtlinie der Europäischen Union das erste<br />
große Umweltpaket in der Gesetzgebung verabschiedet. Die europäische Ökodesignrichtlinie<br />
greift in viele Bereiche der Energieumwandlung ein. Einen großen Einfluss hatte<br />
und hat sie in der Industrie – insbesondere bei der Antriebstechnik.<br />
» Gregor Dietz, Marktmanager, SEW-Eurodrive<br />
Die Umwandlung einer Energieart in<br />
eine andere ist nie zu 100 % gegeben,<br />
jeder Wandlungsprozess ist verlustbehaftet.<br />
Der Anteil der Verlustenergie<br />
muss bezahlt werden, trägt aber nicht<br />
zum nutzbaren Ergebnis bei. Seit dem Bau<br />
der ersten Elektromotoren um das Jahr<br />
1880 lag das Entwicklungsziel bei einer<br />
Neukonstruktion aus Preisgründen stets<br />
beim effizienten Einsatz des Materials.<br />
Um sich erfolgreich dem Wettbewerb zu<br />
stellen, waren Kostensenkungsprogramme<br />
der produzierenden Firmen ein immer<br />
wiederkehrender Zyklus. Trotz gleicher<br />
Abgabeleistung fanden die Ingenieure<br />
und Techniker immer wieder Wege, Elektromotoren<br />
mit insgesamt weniger, aber<br />
besserem Material zu bauen. Hilfreich<br />
war stets auch die Weiterentwicklung der<br />
verfügbaren Bauteile, beispielsweise<br />
Zum Jahreswechsel<br />
2022/2023 erweiterte<br />
SEW-Eurodrive sein<br />
Portfolio um neue<br />
Netzmotoren der<br />
Energie-Effizienz -<br />
klasse IE4.<br />
Bild: SEW<br />
höhere Blechqualität und geringere<br />
Blechdicke, fortschrittliche Berechnungsund<br />
Simulationsmethoden und veränderte<br />
Herstellungsprozesse.<br />
Um die Jahrtausendwende fand ein<br />
prägender Sinneswandel statt. Neben<br />
dem monetären Einfluss der Materialmenge<br />
rückte immer mehr die Energieeffizienz<br />
ins Zentrum. Die Wiederentdeckung<br />
des Wirkungsgrades von Elektromotoren<br />
als Entscheidungskriterium stellte<br />
enorme Herausforderungen an die produzierenden<br />
Firmen. Schnell wurde klar,<br />
dass ein höherer Wirkungsgrad mit einem<br />
höheren Verkaufspreis einhergeht. In den<br />
folgenden knapp 10 Jahren wurde die Berücksichtigung<br />
der Energieeffizienz nach<br />
dem Prinzip der Freiwilligkeit den Kräften<br />
im europäischen Markt überlassen. Jedoch<br />
war der Gesetzgeber nicht zufrieden<br />
mit dem Anteil der freiwilligen Nutzer.<br />
Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen<br />
verhinderten den großflächigen<br />
Erfolg und Absatz.<br />
Um einen fairen Wettbewerb mit vergleichbaren<br />
Produkten zu gewährleisten,<br />
verfasste und verabschiedete die Industrie<br />
Normen mit den Wirkungsgradklassen<br />
IE1 bis IE4 für den Betrieb von Elektromotoren<br />
am Netz. Diese wurden vom<br />
europäischen Gesetzgeber respektiert und<br />
im Jahr 2009 verabschiedete Europa das<br />
erste Gesetz, das den Mindestwirkungsgrad<br />
von Elektromotoren vorgibt. In dieser<br />
Verordnung 640/2009/EG wurde nicht<br />
nur eine Stufe vorgegeben, sondern eine<br />
zeitlich gestaffelte Erhöhung des Mindestwirkungsgrades.<br />
Ferner wurde für die<br />
34 <strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023
Bild: SEW<br />
betroffenen Motoren ein Leistungsbereich<br />
festgeschrieben. Die Vielfalt der bereits<br />
realisierten Lösungen der Elektromotoren<br />
führte zu einer begrenzten Anzahl<br />
von Ausnahmen im Gesetz. Der Gesetzgeber<br />
nahm die Fortsetzung der<br />
Weiterentwicklung der Materialen und<br />
Prozesse für sich in Anspruch und forderte<br />
2011 die Industrie auf, Produkte<br />
schon mit dem Mindestwirkungsgrad IE2<br />
anzubieten.<br />
Mit dem 2017 Erreichten gab sich die<br />
EU aber nicht zufrieden. 2019 wurde das<br />
Gesetz ergänzt und ausgeweitet. Neben<br />
der Reduzierung von Ausnahmen und damit<br />
der Festlegung von Mindestgrenzwerten<br />
für weitere Motoren wurde für wenige<br />
Motorleistungen die weitere Steigerung<br />
der Effizienz auf den IE4-Level vorgegeben.<br />
Die Ausnahmereduzierung und<br />
Ausweitung fand zum 1.7.21 statt. Zum<br />
1.7.23 wird die letzte Stufe mit dem<br />
IE4-Level des aktuellen Gesetzes in Kraft<br />
treten.<br />
Stellt man die Entwicklung der letzten<br />
Jahre nebeneinander, so wird deutlich,<br />
dass der Effizienzgedanke den Konstruktionsprozess<br />
dominiert und der Menge des<br />
eingesetzten Materials nachrangig geworden<br />
ist. Das heißt, bei gleicher Leistung<br />
ist der Motor gewachsen und stellt<br />
damit eine Herausforderung beim Einbau<br />
in Maschinen und Anlagen dar. Am Beispiel<br />
eines 0,75-kW-Elektromotors ist erkennbar,<br />
dass das Bauvolumen um über<br />
30 % und seine Masse – die Menge des<br />
eingesetzten Materials – um über 45 %<br />
gestiegen ist. Der Gesetzgeber gibt den<br />
Mindestwirkungsgrad vor und überlässt<br />
die Realisierung den produzieren Firmen<br />
und den Marktkräften, den nötigen Preis<br />
und die wirtschaftliche Rentabilität zu<br />
erreichen. Vereinzelte nationale Fördermaßnahmen<br />
zum Wohle der Wirtschaft<br />
sind nur der berühmte Tropfen auf dem<br />
heißen Stein.<br />
Neben der Energieeffizienz kommen<br />
jetzt zwei weitere Aspekte ins Spiel. Die<br />
Themen Nachhaltigkeit und Kreislaufeffizienz<br />
flankieren nun das Thema Energie.<br />
Hier setzt der europäische Gesetzgeber<br />
unmittelbar auf eine regulatorische Vari-<br />
Die energiesparenden<br />
Motoren der Baureihe<br />
DRN erzielten einen<br />
großen Erfolg. Im<br />
Februar 2021 wurde<br />
das einmillionste<br />
Exemplar übergeben.<br />
ante und wird bis Mitte der 2020er Jahre<br />
Vorgaben und Grenzwerte für Produkte<br />
bestimmen. Schwierig werden dann gegenläufige<br />
Tendenzen in Einklang zu bringen:<br />
Materialeffizienz könnte der Energieeffizienz<br />
im Weg stehen, kreislaufkonforme<br />
Bauteile den Anspruch an technisch<br />
sicheren und hochqualitativen Produkten<br />
konterkarieren. Verlässt man den<br />
europäischen Fokus und blickt sich in der<br />
Welt um, so erkennt man, was in einzelnen<br />
Ländern an weiteren und anderen<br />
Vorgaben zu erfüllen ist. Die Aufgaben<br />
und Hürden nehmen nicht ab, und es<br />
werden weitere hinzukommen. Etliche<br />
davon sind bereits sichtbar und spürbar.<br />
Aber auch hier werden die Industrie und<br />
die dort beschäftigten fähigen Köpfe eine<br />
Lösung finden.<br />
<strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023 35
Bild: Phoenix Contact<br />
Ein Gleichstromnetz im industriellen Einsatz sorgt dafür, dass sich Energiespeicher und Erneuerbare leichter integrieren lassen.<br />
Sektorenkopplung zeigt wie die Energieversorgung von morgen aussehen könnte<br />
Blaupause für industrielle<br />
Gleichstromnetze<br />
Das neue Produktions- und Technologiezentrum von Phoenix Contact schafft 18.485 m 2 neue<br />
Nutzfläche für 400 Arbeitsplätze. Die Besonderheit: die Vernetzung der Sektoren Energie,<br />
Mobilität, Infrastruktur und Gebäude – eine Blaupause im Sinne einer All Electric Society.<br />
Eine wesentliche Grundlage für die Sektorenkopplung: Der Einbau eines Gleichstromnetzes.<br />
» Thorsten Sienk, Fachredakteur, Phoenix Contact<br />
Das Gebäude mit der internen Nummer<br />
60 macht mit seiner Einweihung<br />
im Sommer 2023 die heutigen Möglichkeiten<br />
für optimierte Energieketten von<br />
der Erzeugung über die Verteilung bis hin<br />
zu Speicherung und Verbrauch erlebbar.<br />
Hierbei integriert das Unternehmen z. B.<br />
thermische Energie zu einem Wärmenetzwerk<br />
auf lokaler Ebene – realisiert mit<br />
Wärmepumpen und einem 1500 m 3 großen<br />
Eisspeicher. Das Ziel dabei: Integration<br />
und Nutzung der kompletten Abwärme<br />
aller Prozesse. Elektrisch betrachtet,<br />
kommen im ersten Ausbauschritt Batteriespeicher,<br />
zwei PV-Anlagen und ein partielles<br />
Gleichstromnetz zum Einsatz. Daran<br />
angebunden ist unter der Prämisse<br />
„Vehicle to Grid“ bidirektional ausgelegte<br />
Ladeinfrastruktur für Elektromobilität.<br />
Gerade die strategische Entscheidung,<br />
ein Gleichstromnetz für den industriellen<br />
Einsatz zu installieren, bringt die Energiewende<br />
entscheidend voran: Regenerative<br />
Energiequellen, Batteriespeicher und<br />
Elektromobilität basieren auf Gleichstrom<br />
und lassen sich leichter integrieren. Zudem<br />
kann ein Gleichstromnetz Verlustleistungen<br />
wirksam reduzieren, etwa<br />
durch die Nutzung der Rekuperationsenergie,<br />
wenn Elektromotoren bremsen.<br />
Frank Stührenberg, CEO von Phoenix Contact,<br />
ist angesichts dieser nachhaltigen<br />
Werte von der Entscheidung, das neue<br />
Gebäude mit einem Gleichstromnetz auszurüsten,<br />
jeden Tag mehr überzeugt.<br />
Gleichstrom gebe der All Electric Society<br />
schließlich als notwendiges Energieverteilnetz<br />
einen gehörigen Innovationsbooster.<br />
Das neue Gebäude lässt sich insofern<br />
„mit einer Miniatur unseres Marktpotenzials<br />
vergleichen“.<br />
Gelebte Sektorenkopplung<br />
Und wer zieht ein? Hauptnutzer wird der<br />
eigene Maschinenbau der Ostwestfalen.<br />
Chris-Jörg Rosen, Leiter des Unternehmensbereichs<br />
und Mitinitiator des DC-<br />
Smart-Grids schätzt am Gleichstrom die<br />
Möglichkeit, Bremsenergie ohne aufwändige<br />
Rückspeisetechnik im Energieverbund<br />
zu behalten. Bis dato liegen seines Wissens<br />
aber noch keine industriellen Anwendungen<br />
vor, die Bremsenergie in signifikanter<br />
Menge zurückspeisen. Das Unternehmen<br />
betritt mit dem DC-Netz folglich<br />
neues Terrain „indem wir einen weiträumigen<br />
DC-Bus im Gebäude 60 aufsetzen.<br />
36 <strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023
Damit gehen wir über kurzfristige Zwischenspeicherungen<br />
hinaus und managen<br />
komplett den Energiefluss von Quelle und<br />
Senke.“ Komplex wird das Ganze, da das<br />
Unternehmen am Stammsitz in Blomberg<br />
ganz unterschiedliche Ökosysteme per<br />
DC-Bus miteinander verbinden will –<br />
damit also eine echte Sektorenkopplung<br />
betreibt. „Wir haben es mit multidirektionalen<br />
Energieflüssen zu tun“, sagt Rosen.<br />
Nachhaltig ab der Installation<br />
Erhebliche Effizienzgewinne resultieren<br />
aus dem einfacheren Aufbau der Netze.<br />
Wer auf Gleichstrom setzt, benötigt keine<br />
dreiadrigen Leitungen mehr für einphasige<br />
AC-Energieströme oder sogar fünfadrige<br />
Kabel für den klassischen AC-Kraftstrom.<br />
Stattdessen reichen zwei Leiter<br />
aus für plus und minus. Rosen: „Das ist<br />
die natürliche Form, wie Elektronen fließen<br />
– von einem zum anderen Pol. Es gibt<br />
in der Natur keinen Wechselstrom.“ Der<br />
Wegfall von Leitern spart auf direkte Wese<br />
Isolierungsmaterial und vor allem Kupfer.<br />
Laut Schätzungen liegt hier ein Einsparpotenzial<br />
bis 50 %.<br />
Auf Verbraucherseite bringt der Wechsel<br />
bei der Energieversorgung von AC zu<br />
DC ebenfalls gravierende Einsparungen<br />
mit sich. Heutige Verbraucher arbeiten in<br />
der Regel mit einem AC-Eingangskreis.<br />
Der Wechselstrom wird dann geräteintern<br />
in Gleichstrom gewandelt. Werden Geräte<br />
direkt mit Gleichstrom versorgt, fällt der<br />
Gleichrichter weg. Rosen stellt sich hier<br />
die Frage, wie die Geräte von Morgen<br />
aussehen, die direkt am DC-Netz hängen.<br />
„Wir sparen Bauteile und können damit<br />
kleiner werden.“<br />
Blaupause für die All Electric<br />
Society<br />
Zurück ins Gebäude 60: Das Unternehmen<br />
befindet sich Stand heute laut eigenen<br />
Angaben in der glücklichen Lage, vor<br />
allem aufgrund der Ladetechnik aus dem<br />
Bereich Elektromobilität gut aufgestellt<br />
zu sein und Gleichstromnetze mit erprobter<br />
Technik aus einem System heraus ausrüsten<br />
zu können. Die Rede ist hier vor allem<br />
vom Produktprogramm Charx mit<br />
Lösungen für das Schnellladen von Fahrzeugen<br />
direkt mit Gleichstrom. Die Erfahrung<br />
des Unternehmens im Umgang mit<br />
hohen Gleichstromleistungen macht es<br />
vergleichsweise einfach, dieses Knowhow<br />
auf industrielle Anwendungen zu<br />
übertragen – vor allem in der Verknüpfung<br />
der Fabrikautomation mit der Gebäudetechnik<br />
sowie regenerativer Energieerzeugung.<br />
Diese Sektorenkopplung ist<br />
mehr denn je gefragt, um Energie zu sparen,<br />
Leistungsflüsse zu harmonisieren sowie<br />
batteriebasierte Energiespeicher und<br />
die „Regenerativen“ zu integrieren. Und<br />
dann ist da noch das Lastmanagement,<br />
das ebenfalls von der Einbindung von stationären<br />
Energiespeichern – Stichwort<br />
„Peak-Shaving“ – profitiert.<br />
Gebäude bieten heute weit mehr als<br />
das sprichwörtliche Dach über dem Kopf.<br />
Technisch-energetisch betrachtet, haben<br />
sie eine Schlüsselposition inne für die<br />
sinnvolle Verknüpfung von Solarenergie,<br />
Leittechnik, Produktion, Batteriespeicher<br />
und auch Ladesäulen. Gebäude sind damit<br />
der Ort für gelebte Sektorenkopplung.<br />
Und diese Kopplung ist notwendig für<br />
eine nachhaltige, „elektrifizierte“ Gesellschaft,<br />
die ihren Energiebedarf zu 100 %<br />
aus regenerativen Quellen deckt.<br />
Industrie<br />
fachjobs24.de – hier finden Arbeitgeber<br />
qualifizierte Fachund<br />
Führungskräfte<br />
und engagierten Nachwuchs<br />
Einzigartiges Netzwerk zielgruppenspezifischer<br />
Branchen-Channels<br />
Augenoptik<br />
EINFACH,<br />
SCHNELL UND<br />
FÜR NUR<br />
249€<br />
Preis zzgl. MwSt<br />
Sprechen Sie Nutzer von Branchen-<br />
Fachmedien an: die Interessierten<br />
und Engagierten ihres Fachs<br />
Erreichen Sie die Wechselwilligen,<br />
schon bevor sie zu aktiven Suchern<br />
werden<br />
Für optimales Personalmarketing:<br />
Präsentieren Sie sich als attraktiver<br />
Arbeitgeber der Branche<br />
Handwerk<br />
Architektur<br />
Arbeitswelt<br />
Wissen<br />
Bild: Phoenix Contact<br />
Im Impuls- und Hochstromlabor<br />
treibt Phoenix<br />
Contact Produkte und<br />
Lösungen für die Gleichstromtechnik<br />
voran.<br />
28<br />
Print-Partner<br />
34<br />
Online-Partner<br />
Das Stellenportal für Ihren Erfolg!
» TECHNIK<br />
Smartes Monitoring spart Energie und Geld<br />
Strom- und Gasflüsse unter<br />
Beobachtung<br />
Nur was sich messen lässt, kann auch verbessert werden. Wer die Energieeffizienz seiner<br />
Produktion steigern möchte, benötigt daher Transparenz über die Verbräuche. Die intelligente<br />
Analyse von Daten ist die Grundlage für eine nachhaltige Fabrik.<br />
» Markus Strehlitz, freier Journalist in Mannheim<br />
Produktionsprozesse benötigen viel Energie. Mit<br />
den gestiegenen Preisen für fossile Brennstoffe<br />
und Strom ist somit der Druck für die fertigenden<br />
Unternehmen gewachsen, ihren Energieverbrauch im<br />
Griff zu halten. Wem dies nicht gelingt, der muss<br />
existenzbedrohende Folgen befürchten.<br />
Dafür benötigt man jedoch zunächst mal Wissen.<br />
„Eine Fabrik ist wie eine Black Box“, sagt Bernd Groß,<br />
CTO der Software AG. „Man steckt Energie hinein und<br />
bekommt Produkte heraus.“ Die Schwierigkeit bestehe<br />
nun darin, zu verstehen, an welcher Stelle in den<br />
Fertigungsprozessen wie viel Energie verbraucht wird<br />
und wo es Möglichkeiten für Optimierungen gibt.<br />
Die Antwort auf diese Herausforderung sind Daten.<br />
Wenn diese aus den Fertigungsprozessen zusammengeführt<br />
und analysiert werden, erhalten Unternehmen<br />
Sensoren und Messgeräte liefern die Daten, auf die Nutzer über entsprechende Software-<br />
Lösungen zugreifen, um den Energieverbrauch in der Fertigung zu steuern.<br />
Bild: 1st footage/stock.adobe.com<br />
die nötige Transparenz über ihren Energieverbrauch.<br />
Wie dies konkret aussieht, zeigt die Modellfabrik ETA<br />
(Energy Technologies and Applications in Production),<br />
die ein Team von Wissenschaftlern der TU Darmstadt<br />
aufgebaut hat. An einer Fertigungslinie, in der Steuerplatten<br />
produziert werden, lassen sich Lösungen zur<br />
Steigerung der Energieeffizienz durchspielen. Dabei<br />
werden die Daten von rund 3.000 Punkten kontinuierlich<br />
erfasst. Das Spektrum der gesammelten Daten ist<br />
breit: Energieverbrauch, Maschinenleistung und -geschwindigkeit,<br />
Wasserverbrauch, Schleifdruck sowie<br />
Kühl- und Hydrauliksystemdaten.<br />
Schleifen vor dem Härten ist effizienter<br />
Die Daten werden auf der IoT-Plattform der Software<br />
AG zusammengeführt und die Prozesse mit einer<br />
Process-Mining-Software analysiert. Dank dieser<br />
Analysen lässt sich erkennen, in welchem Prozessschritt<br />
Energie unnötig verbraucht wird und wie effizienter<br />
produziert werden kann. So konnten die Experten<br />
zum Beispiel erkennen, dass der Zeitpunkt des<br />
Schleifens eine wichtige Rolle spielt. Im ursprünglichen<br />
Verfahren erfolgte das Schleifen nach dem Härten.<br />
Die Auswertung der Daten zeigte jedoch auf,<br />
dass der umgekehrte Weg der effizientere ist.<br />
„Mit einer IoT-Plattform wie der unseren ist es<br />
möglich, den Energieverbrauch in unterschiedlichen<br />
Bereichen einer Fabrik zu analysieren und zu visualisieren“,<br />
so Groß. Mit Hilfe des Domain-Wissens von<br />
Fachexperten, mit denen die Software AG zusammenarbeitet,<br />
ließen sich dann daraus die entsprechenden<br />
Schlüsse ziehen. Wichtig ist laut Groß dabei,<br />
dass eine solche Plattform offen gestaltet sei,<br />
um alle Systeme und Maschinen anbinden zu können.<br />
Dann könne sie als Basis für ein smartes Energie-Monitoring<br />
und -management dienen.<br />
Wie sich Daten nutzen lassen, um die Energieeffizienz<br />
einer Fabrik zu verbessern, hat auch Autobauer<br />
Stellantis erkannt. Das Unternehmen nutzt dafür<br />
38 <strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023
Software des WZL-Spinoffs Iconpro. In dieser laufen<br />
Daten von den verschiedenen Sensoren zusammen,<br />
die in den Anlagen den Energieverbrauch erfassen.<br />
Dazu zählen etwa Sensoren, die den Gasfluss messen.<br />
Hinzu kommen historische Daten – also zum Beispiel<br />
der Stromverbrauch aus den vergangenen Jahren.<br />
Diese werden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz<br />
analysiert. Ein Dashboard stellt dann die realen Energieverbräuche<br />
über einen zeitlichen Verlauf hinweg<br />
und pro Energieträger sowie Werk dar.<br />
Dabei erkennt das System automatisch die Activity<br />
States. Dazu zählen etwa Powering Up und Down – also<br />
Beginn und Ende der Produktion. Eine zusätzliche<br />
Kurve zeigt den idealen Verlauf des Energieverbrauchs.<br />
System informiert Anwender in Echtzeit<br />
Der Vergleich ermöglicht eine Anomalie-Detektion.<br />
„Damit lässt sich zum Beispiel erkennen, dass an einem<br />
bestimmten Tag im Winter der Energieverbrauch<br />
für das Heizen der Innenräume im Verhältnis<br />
zur Außentemperatur höher war als üblich“, erklärt<br />
Iconpro-Geschäftsführer Markus Ohlenforst. „Und<br />
das System kann außerdem zeigen, auf welchen<br />
Activity State der erhöhte Verbrauch zurückzuführen<br />
ist. Ein Beispiel wäre etwa, wenn beim Powering Up<br />
für die Produktion der Fluss eines Energieträgers zu<br />
früh eingeschaltet wurde.“<br />
Damit der Verlauf nicht permanent beobachtet<br />
werden muss, gibt das System zukünftig auch eine<br />
Alarmmeldung per E-Mail. So wird der Anwender in<br />
Echtzeit informiert, falls der Energieverbrauch in der<br />
Produktion nicht den normalen Werten entspricht.<br />
Stellantis implementiert die Software in seinen<br />
Werken Brampton in Kanada, Saltillo in Mexiko sowie<br />
Betim in Brasilien. Für ein Werk erwarte das Unternehmen<br />
dadurch – konservativ geschätzt – Einsparungen<br />
von 250.000 bis 300.000 Dollar pro Jahr,<br />
berichtet Ohlenforst. Generell könne man davon ausgehen,<br />
dass sich mit einer solchen Lösung die Energiekosten<br />
um zwei bis fünf Prozent reduzieren lassen.<br />
Für ein Werk, bei dem die Ausgaben für Energie weit<br />
im zweistelligen Millionenbereich liegen, kommt somit<br />
schon einiges an Einsparungen zusammen.<br />
Carbon Footprint lässt sich berechnen<br />
Klare Ziele hat auch Rittal. Das Unternehmen, das<br />
unter anderem Schaltschränke und IT-Infrastruktur<br />
für Rechenzentren anbietet, hat in seinem Werk in<br />
Haiger die Fertigungsmaschinen und -anlagen mit<br />
Energiemessgeräten ausgerüstet. Diese liefern ihre<br />
Werte an das Oncite Production System (DPS) von<br />
German Edge Cloud, das wie Rittal zur Friedhelm Loh<br />
Gruppe gehört. Das DPS ist eine Plattform zum agilen<br />
Management der Fertigungsprozesse. Der Abgleich<br />
der Energiedaten zu diesen Prozessen und zum jeweiligen<br />
Produkt bringe die Erkenntnisse, die Fertigungs-<br />
und Werksleiter brauchen, so Dieter Meuser,<br />
CEO Digital Industrial Solutions bei German Edge<br />
Cloud. „Theoretisch lässt sich das runterrechnen bis<br />
hin zum Product Carbon Footprint.“<br />
Die Lösung bei Rittal legt die Basis für ein smartes<br />
Energiemanagement. Ziel ist die optimale Versorgung<br />
mit Energie. Dank der Datentransparenz lassen<br />
sich Optimierungen durchführen – wie etwa die feingranulare<br />
Abstimmung von Stromverfügbarkeit und<br />
Stromverbrauch. „Smartes Energiemanagement sollte<br />
Fabrikbetreiber letztlich auch in die Lage versetzen,<br />
energieintensive Fertigungsvorgänge in energiegünstige<br />
Zeiten zu verlegen“, sagt Meuser. „Eine solche<br />
Entscheidung kann man auf der neuen Datenbasis<br />
heute schon recht zuverlässig treffen.“<br />
Webhinweis<br />
Wie sich die Software von Iconpro in<br />
einem Lackierprozess für das Energiemonitoring<br />
nutzen lässt, zeigt dieses Video:<br />
http://hier.pro/4chpF<br />
Bild: Software AG<br />
„Eine Fabrik ist wie<br />
eine Black Box“, sagt<br />
Bernd Groß, CTO der<br />
Software AG. „Man<br />
steckt Energie hinein<br />
und bekommt<br />
Produkte heraus.“<br />
<strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023 39
» TECHNIK<br />
Gerade auch auf die Lackiertechnik kommt es an im Blick auf die Umweltverträglichkeit – im Bild die Anlage bei VW Osnabrück.<br />
Bild: Volkswagen Osnabrück<br />
Leitungs-Wasserdruck treibt den Proportionaldosierer an<br />
VW dosiert stromlos im Ex-Bereich<br />
der Lackiererei<br />
Zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt Volkswagen Osnabrück für mehr Nachhaltigkeit in der<br />
Lackiererei: Um VOC-freie Lösungsmittel zu dosieren, kommt ein Atex-Proportional dosierer von<br />
LDT/Dosatron zum Einsatz, der ohne elektrischen Strom arbeitet. Dies spart zusätzlich Energie.<br />
Beide Effekte zusammen unterstützen die umfangreiche Umweltpolitik von VW.<br />
» Jens Voigt, Sales & Marketing bei LDT Dosiertechnik<br />
Um die Emissionen flüchtiger, organischer Verbindungen<br />
(VOC = volatile organic compounds)<br />
zu reduzieren, spült die VW Osnabrück GmbH ihre<br />
Lackiersysteme mit neu entwickelten, wassermischbaren<br />
und VOC-freien Lösemitteln. Das geschieht in<br />
regelmäßigen Abständen und nach jedem Farbwechsel<br />
neu. Dazu wird eine 1,5 %-ige Lösung dosiert. Die<br />
Herausforderung besteht darin, diese Dosiereinheit<br />
direkt im Ex-geschützen Bereich zu installieren, um<br />
kurze Wege und weniger Armaturen zu realisieren.<br />
Als Lösung präsentiert die LDT Dosiertechnik GmbH<br />
aus Hamburg den Atex-Proportionaldosierer Typ<br />
D3IL2VFK des französischen Herstellers Dosatron, der<br />
den gestellten Anforderungen mehr als gerecht wird.<br />
Denn mit einer Dosiergenauigkeit und Reproduzierbarkeit<br />
von +/-3 % liegt er deutlich besser als die<br />
Vorgaben von +/-10 %. Und mit seiner geringen<br />
Zudosierrate von 0,2 bis 2 % wird der Proportionaldosierer<br />
lediglich durch Wasser angetrieben und benötigt<br />
keinen elektrischen Strom. Das reduziert nicht<br />
40 <strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023
Sie suchen Personal?<br />
Bei uns finden Sie talentierte Mitarbeitende für<br />
Praktikum, Aushilfsjob und Berufseinstieg!<br />
Gutschein-Code:<br />
Jetzt<br />
kostenlos testen!<br />
4-wöchige Premium-Anzeige*<br />
im Wert von über 142 EUR<br />
Promo2023<br />
unistellenmarkt.de<br />
*Der Gutschein ist innerhalb von drei Monaten nach Erscheinen dieser Magazin-Ausgabe nur online einlösbar unter www.unistellenmarkt.de. Der Gutschein gilt nur für eine kostenlose vierwöchige<br />
Premiumanzeige an einem Standort; nicht für andere Produkte des UNIstellenmarktes bzw. Maßnahmen auf dem Campus sowie Zusatzleistungen oder für mehrere Standorte. Der Gutschein kann nur<br />
vor Abschluss des Bestellvorgangs eingelöst werden. Die Barauszahlung des Gutscheins sowie die nachträgliche Anrechnung sind nicht möglich. Der Gutschein ist pro Nutzer nur einmalig einzulösen<br />
und nicht übertragbar. Eine Kombination mit anderen Gutscheinen ist nicht möglich. Jeder gewerbliche und kommerzielle Weiterverkauf des Gutscheins ist untersagt. Der Gutschein wird nicht erstattet,<br />
wenn der Kunde die mit dem Gutschein bezahlte vierwöchige Premium-Anzeige im Rahmen seiner Mängelrechte rügt.<br />
<strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023 41
» TECHNIK<br />
Wassernetz keinen Einfluss auf die Dosiergenauigkeit<br />
ebenso wie die Leitungslängen.<br />
Die hohe Dosiergenauigkeit und Reproduzier -<br />
barkeit verschaffen dem Betreiber einen wirtschaft -<br />
lichen Vorteil, weil er höher konzentrierte Medien<br />
verwenden kann. Eine Überdosierung ist auf Grund<br />
der Konstruktion ausgeschlossen. Die einfache Bauweise<br />
mit nur wenigen Bauteilen macht das Gerät<br />
sehr wartungsfreundlich und leicht zu handhaben.<br />
Eine Besonderheit ist die Atex-Ausführung dieses<br />
Proportionaldosierers: Durch die Verwendung<br />
spezieller Atex-zertifizierter Materialien ist er für die<br />
Ex-Zonen 0, 1, 2 sowie für M1 zugelassen und lässt<br />
sich sogar für höchste Explosionsschutz-Anforderungen<br />
im Bergbau unter Tage einsetzen.<br />
Schnittzeichung eines Dosatron-Proportionaldosierers. Die Geräte kommen mit vergleichs -<br />
weise wenigen Bauteilen aus.<br />
nur die VOC-Emissionen wie gewünscht, sondern<br />
verringert auch die Energiekosten der Lackieranlage.<br />
Der Investitionsumfang für diese Dosiertechnik ist<br />
zudem geringer als bei einer elektrischen Dosier -<br />
lösung mit einer Ex-geschützten und ansteuer -<br />
fähigen Dosierpumpe. Die vor Ort vorhandene<br />
Wasser leitung wird weiterverwendet. Dosierer und<br />
Armaturen wie Filter und pneumatische Absperrventile<br />
werden in die Leitung integriert und platzsparend<br />
auf einer zentralen Montageplatte installiert.<br />
Bild: LDT Dosiertechnik<br />
Service-Videos helfen in der Wartung<br />
Die hochwertigen Atex-Zulassungen verlangen, dass<br />
diese speziellen Dosierer generell nur von autorisiertem<br />
Fachpersonal gewartet werden – ähnlich wie bei<br />
elektrischen, Ex-geschützten Dosierpumpen. Um<br />
Volkswagen in die Lage zu versetzen, Service und<br />
Wartung selbstständig und eigenverantwortlich<br />
durchzuführen, haben LDT und Dosatron gemeinsam<br />
eine Schulung bei Volkswagen Osnabrück durch -<br />
geführt sowie ein detailliertes Service-Video zur<br />
Verfügung gestellt. Derart geschult mit offizieller<br />
Bescheinigung, ist Volkswagen Osnabrück nun gut<br />
aufgestellt, auch die letzte Hürde zu meistern – die<br />
Labs-Freiheit des Dosierers.<br />
Lackbenetzungsstörende Substanzen (Labs) dürfen<br />
weder direkt noch indirekt auf die Substrate oder in<br />
den Lack verschleppt werden. Denn sie unterbrechen<br />
Wasserdruck reicht als Antrieb<br />
Das Funktionsprinzip: Der Dosatron-Proportional -<br />
dosierer dosiert einem Wasserstrom ein Konzentrat<br />
proportional zur durchfließenden Wassermenge zu.<br />
Er benötigt keinen elektrischen Strom als Antrieb,<br />
sondern lediglich den Wasserdruck der angeschlossenen<br />
Wasserleitung. Das Dosiermedium wird durch<br />
einen volumetrischen Hydraulikmotor selbstständig<br />
angesaugt und vermischt sich mit dem Antriebswasser.<br />
Die Dosiermenge verhält sich immer proportional<br />
zum Wasserdurchsatz, entsprechend der manuell<br />
eingestellten Dosierrate. Konstruktionsbedingt haben<br />
eventuelle Durchsatz- und Druckschwankungen im<br />
Die neue Dosiereinheit im Ex-Bereich der Lackiererei. Sie stellt<br />
die 1,5 %-ige Lösung für den Spülprozess her.<br />
Bild: Volkswagen Osnabrück<br />
42 <strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023
die vollständige und gleichmäßige Benetzung einer<br />
Oberfläche mit Lack (sogenannte Krater bildung).<br />
Auch Bauteile, die in der Lackiererei eingesetzt werden,<br />
dürfen keine derartigen Substanzen enthalten.<br />
Volkswagen Osnabrück zerlegte daher den Atex-<br />
Dosierer vor seinem ersten Einsatz in seine Bestandteile<br />
und spülte diese mit Lösemittel, um selbst<br />
geringste Spuren von Silikon zu entfernen. Nach der<br />
Trocknung wurde er wieder montiert.<br />
„Seit der Inbetriebnahme des Dosierers im August<br />
2021 sind keine negativen Auffälligkeiten aufgetreten,<br />
die Einstellung ist einfach und die Dosierung ist<br />
konstant gut“, bestätigt Dennis Wermann, Betreiber<br />
und zuständiger Bediener in der Instandhaltung<br />
Lackiererei bei VW Osnabrück. Den Weg zu dieser<br />
Lösung fasst er so zusammen: „Auf der Suche nach<br />
einer Dosiereinheit für geringe Zumischraten eines<br />
VOC-freien Spülmediums stießen wir auf die Firma<br />
LDT. Das Projektteam von LDT und Dosatron konnte<br />
nicht nur nach unserer Anforderung eine kostengünstige<br />
und ressourcenschonende Dosiereinheit<br />
anbieten, gleichzeitig fand es eine Lösung für den<br />
Betrieb in einem Ex-geschützten Bereich.“<br />
Im Zuge der Zusammenarbeit wurde die bestehende<br />
Anlagentechnik auf den Atex-Dosierer umgerüstet<br />
und das Betreiberpersonal bei Volkswagen Osnabrück<br />
von LDT und Dosatron mit Hilfe von eigens<br />
erstellten Videos über die Funktionsweise und die<br />
Instandhaltung geschult. Nach der Umstellung auf<br />
das umweltfreundlichere Spülmedium zeigte sich<br />
schnell die hohe Dosiergenauigkeit des Proportionaldosierers.<br />
Dosatron-Dosierer inzwischen etabliert<br />
bei Volkswagen<br />
Die Volkswagen AG setzt Dosatron Proportional -<br />
dosierer bereits seit geraumer Zeit in verschiedenen<br />
Werken in Reinigungsanlagen zur Teilereinigung<br />
ein. Von den Vorteilen des Atex-Dosierers<br />
konnte sich die Volkswagen Osnabrück GmbH überzeugen<br />
und nutzt diesen ebenfalls erfolgreich. Die<br />
umgesetzte Dosierlösung bietet dabei nicht nur<br />
technische Vorteile. Vor allem durch ihre Genauigkeit,<br />
Nachhaltigkeit und hohe Effizienz unterstützt<br />
sie die Umweltbestrebungen der Volkswagen AG<br />
(Info-Box unten).<br />
Umwelterklärung von VW<br />
Die Lackieranlage im VW-Werk Osnabrück:<br />
Als Spülmedium nutzt sie wassermischbare,<br />
VOC-freie Lösungsmittel.<br />
Bild: Volkswagen Osnabrück<br />
In der Umwelterklärung 2018 verpflichtet sich die Volkswagen Aktiengesellschaft<br />
zur fort laufenden Verbesserung der Umweltverträglichkeit<br />
ihrer Produkte, ihrer Standorte und Dienstleistungen. Unter dem 2011<br />
ins Leben gerufenen Umweltprogramm „Think Blue. Factory“ zur<br />
Verringerung der Umweltbelastung und zur Verbesserung der<br />
Ressourceneffizienz wurden die gesetzten Ziele zur Reduzierung der<br />
Umwelt belastung bis 2018 um 25 % gegenüber 2010 bereits im<br />
Jahr 2016 erreicht.<br />
Als neues Ziel hinsichtlich der Umweltverträglichkeit gilt nun das<br />
Programm „Zero Impact Factory“, im dem bis 2025 die Umweltauswirkungen<br />
um weitere 20 % pro Fahrzeug oder Komponententeil reduziert<br />
werden sollen. Bezogen auf 2010 wird also – ermittelt aus Energieund<br />
Wasserverbrauch, Abfallbeseitigung sowie CO 2<br />
– und Lösemittelemissionen<br />
– eine Senkung um 45 % angestrebt.<br />
Um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, will VW alle Prozesse auf<br />
mögliche Verbesserungen hin untersuchen, so auch im Werk der Volkswagen<br />
Osnabrück GmbH. Ein großes Potential bietet die Lackiererei,<br />
in der mit großen Mengen Material, Wasser und Energie umgegangen<br />
wird. Denn beim Lackieren entstehen üblicherweise Emissionen organischer<br />
Lösemittel in der Luft, Abfall durch Lackschlämme, große<br />
Abwassermengen und dies bei hohem Energiebedarf der Anlagen.<br />
<strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023 43
» TECHNIK<br />
Vollautomatisiert: Neun Roboter-Achsen für das Raumwickeln<br />
Die Leichtbau-Revolution startet in<br />
der Raumfahrt<br />
Der Luxemburger Maschinenbauer Gradel hat im Mai die erste vollautomatisierte Fertigung für<br />
ultraleichte Raumwickel-Teile in Betrieb genommen. Dass die Linie primär für die Raumfahrt<br />
konzipiert ist, tut ihrer Bedeutung keinen Abbruch: Von den hochgesteckten Vorgaben dieser<br />
Branche profitieren alle Anwender der Ultraleichtbau-Technologie „xFK in 3D“.<br />
» Olaf Stauß, Redakteur Konradin Industrie<br />
Die Fertigungsanlage „Gradel<br />
Robotic Additive Manufacturing“<br />
wickelt eine ‚xFK in 3D‘-Leichtbaustruktur.<br />
Direkt im Wickelkopf<br />
werden die Faserstränge mit Harz<br />
imprägniert – ein Novum.<br />
Bild: Gradel<br />
Es war ein harter Weg bis hierher“,<br />
fasste Claude Maack die vier Jahre bis<br />
zur Einweihung der Roboter-Anlage zusammen,<br />
geschäftsführender Gesellschafter<br />
der Gradel Sarl. In diesen vier Jahren<br />
hatte das in der Nuklear- und der Raumfahrttechnik<br />
tätige Unternehmen alles<br />
getan, um bei sich den Ultraleichtbau zu<br />
etablieren – die eigene Struktur umgebaut,<br />
investiert, Mitarbeiter eingestellt<br />
und dem Chef den Rücken freigeschaufelt.<br />
Anlass war die Begeisterung Maacks,<br />
als er bei Rainer Kurek die Raumwickel-<br />
Technologie „xFK in 3D“ für ultraleichte<br />
Teile kennenlernte. Kurek ist Geschäftsführer<br />
der Technologieberatung Automotive<br />
Management Consulting. Er war<br />
schon 2015 auf die Technologie aufmerksam<br />
geworden und treibt sie seither<br />
voran – vor allem im Automobilbau, der<br />
ureigensten Zielrichtung der AMC GmbH.<br />
Faszinieren konnte er Maack bei der ersten<br />
Begegnung 2018 mit dem manuell<br />
gewickelten „Shanghai-Bracket“: Mit<br />
rund 180 g hält die grazile Struktur fast<br />
10 t Last stand.<br />
Die Inbetriebnahme des roboterisierten<br />
Raumwickelns durch Gradel ist nun der<br />
Schritt hin zur Industrialisierung für alle<br />
Branchen, ein Höhepunkt. „Ein großer Tag<br />
für uns“, sagte auch Kurek bei der<br />
„Inauguration“ der Roboter-Linie im<br />
luxemburgischen Hautcharage.<br />
Die dort installierte Anlage bietet<br />
optional neun Achsen und besteht aus<br />
drei Robotern, die auf einer 10 m langen<br />
X-Schiene verfahren und beim Raum -<br />
wickeln kooperieren können. Ein weiterer<br />
Roboter ist in einem Reinraum unter -<br />
gebracht für Aerospace-Anwendungen.<br />
Die Anlage wickelt vollautomatisiert und<br />
maßgeschneidert mit Geschwindigkeiten<br />
zwischen 25 und 600 mm/s. Zwei große<br />
Industrieöfen schließen sich an.<br />
Die Bedeutung dieser Technologie erschließen<br />
am besten die Duftmarken, die<br />
ihre Akteure immer wieder mit manuell<br />
gewickelten Strukturen ‚xFK in 3D‘ gesetzt<br />
haben. 2015 begann es mit einem<br />
Fahrrad-Flaschenhalter, der nur 9 g<br />
wiegt – aber die 500 g des halben Liters<br />
Wasser in der Flasche trägt. Später folgte<br />
ein Flaschenhalter für Le Mans, der<br />
mit 23 g Eigengewicht auch den hohen<br />
44 <strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023
Beschleunigungen im Motorsport standhält.<br />
Und derzeit entsteht ein Schul -<br />
pavillon mit 3 x 5 m² Grundfläche, der<br />
aus 72 Raumwickel-Teilen zusammen -<br />
gesetzt wird und nicht mehr als 80 kg<br />
wiegt. Vier starke Männer könnten ihn<br />
packen und wegtragen.<br />
Strukturen von klein bis extrem groß.<br />
Sie deuten das Potenzial der Technologie<br />
an. Allen ist eines gemein: Mit einem<br />
Minimum an Masse tragen sie Lasten, die<br />
ein hohes Vielfaches ihres Eigengewichts<br />
ausmachen. Eine ultraleichte Option für<br />
Satelliten und Raketen ebenso wie für<br />
Automobile, Flugzeuge und Anwendungen<br />
bis in die Architektur hinein.<br />
Gramm-Gewichte stemmen Tonnen-<br />
Lasten. In diesem Gewichts-Kontext verdeutlicht<br />
eine bloße Zahl, was die Roboter-Fertigung<br />
„Gradel Robotic Additive<br />
Manufacturing“ (Gram) in Luxemburg zu<br />
leisten vermag: „Gram kann pro Stunde bis<br />
zu 14 Kilogramm Struktur wickeln, ohne<br />
metallische Buchsen“, sagt Claude Maack.<br />
Ein ultraleichter Autositz wie ihn Gradel<br />
schon gewickelt hat, ließe sich in 15 bis<br />
30 min fertigen, je nach Auslegung.<br />
Was verbirgt sich hinter ‚xFK in 3D‘?<br />
Das Prinzip ist leicht erklärt, aber nicht<br />
einfach umzusetzen: Dreidimensional im<br />
Raum verlegte Fasern folgen den errechneten<br />
Lastpfaden eines Bauteils – und<br />
verbleiben die einzige Masse der Struktur.<br />
Damit dies wirklich funktioniert, mussten<br />
Grundlagen erforscht, Know-how aufgebaut<br />
und diffizile Fragen gelöst werden<br />
bis heute: Wie lässt sich die Struktur aus<br />
FEM-Analysen entwickeln, wie entsteht<br />
der Wickelplan? Welche Harze und Fasern<br />
(für die das „x“ steht) sind möglich? Wie<br />
lassen sich die Strukturen auslegen und<br />
mit welchen Kennwerten wie reproduzierbar<br />
fertigen? Und zuletzt: Mit welchen<br />
Faser-Harz-Systemen werden sie<br />
nachhaltig, geht Flachs oder Basalt?<br />
Die AMC ertüchtigte diese Technologie<br />
mit ihren Partnern in einer digitalen<br />
Prozesskette bis in erste Automobil -<br />
anwendungen hinein, über die aber nicht<br />
oder nur schemenhaft geredet wird. Als<br />
Maack und Kurek im November 2018 ihre<br />
Kooperation beschlossen, begann eine<br />
neue Phase. Der Luxemburger entwickelte<br />
einen ambitionierten Plan, das Raum -<br />
Die automatisierte Roboteranlage<br />
Gram macht die Fertigung von<br />
Ultraleichtbauteilen reproduzierbar<br />
und serienfähig. Hier entstehen<br />
Antennenhalter für Satelliten.<br />
Bild: Stauß<br />
Claude Maack, CEO von Gradel: „Wir wollen<br />
diese Ultraleichtbau-Technologie multiplizieren.<br />
Dazu bieten wir Wissen, Maschinen und unsere<br />
intensive Begleitung an.“<br />
wickeln in der Raumfahrt zu etablieren.<br />
Man könnte ihn eine Art Marschallplan<br />
nennen. Denn der Maackplan zielt direkt<br />
auf die Industrialisierung und will nichts<br />
dem Zufall überlassen.<br />
Den Anfang machte eine Marktstudie<br />
für die Raumfahrt. Aerospace signalisierte,<br />
dass automatisiertes Fertigen eine<br />
Grundvoraussetzung sei, ohne manuelle<br />
Elemente. Also beantragte Gradel ein<br />
Förderprojekt mit dem „Luxembourg<br />
Institute of Science & Technology“ (List),<br />
das die „Luxembourg Space Agency“<br />
(LSA) bewilligte.<br />
Bild: Gradel<br />
Der 3D-gewickelte Antennenhalter für die Raumfahrt erzielt eine Gewichtseinsparung von<br />
71 % gegenüber herkömmlichen Konstruktionen.<br />
Bild: Gradel<br />
<strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023 45
» TECHNIK<br />
Bild: Gradel<br />
Halterung eines Reaktionsrads aus „xFK in 3D“ das<br />
bei Satelliten der Lageregelung dient. Sie wurde im<br />
F+E-Projekt mit dem List hergestellt und getestet.<br />
Die ESA begleitete das Forschungs -<br />
vorhaben. Mit Thales Alenia Space, Airbus<br />
und OHB Systems waren renommierte<br />
Partner mit an Bord, die AMC liefert<br />
weiterhin ihre Unterstützung. Noch 2019<br />
stellte Gradel zwei ausgewiesene Roboterwickel-Experten<br />
ein, heute umfasst<br />
das Leichtbau-Team bereits 16 Ingenieure.<br />
„Durch die Pandemie konnten wir in<br />
Ruhe entwickeln“, blickt Maack zurück.<br />
Die jetzt in Betrieb genommene „voll<br />
industrialisierte“ Wickelanlage ist die<br />
dritte, ihre Vorläufer hatten eher proto -<br />
typischen Charakter. Bei ihr sind bis zu<br />
sechs Faserspulen gleichzeitig im Einsatz.<br />
Völlig neu ist der Prozess, die Fasern im<br />
Wickelkopf auch gleich zu imprägnieren<br />
und „nass“ zu wickeln. Denn bereits vorimprägnierte<br />
Tow Pregs finden in der<br />
Raumfahrt keinen Einsatz, ebensowenig<br />
wie in anderen potenziellen Zielbranchen<br />
mit begrenzten Stückzahlen. Patentieren<br />
ließ sich Gradel die Prozessüberwachung<br />
unter besagtem Namen „Gram“.<br />
Gradels Plan sieht ein Budget von<br />
12 Mio. Euro inklusive Fördergeldern vor.<br />
„In der Raumfahrt kommen wir gut<br />
voran“, meint Maack. Doch für einen<br />
Mittelständler müssen sich Investitionen<br />
schneller amortisieren, als in Aerospace<br />
machbar. Darüber hinaus muss der Ultraleichtbau<br />
in die Breite gehen, wenn er<br />
wirklich Nachhaltigkeitseffekte erzielen<br />
soll – das ist Claude Maack äußerst<br />
wichtig (http://hier.pro/zxBkb). Gradel hat<br />
daher sein Geschäftsmodell in Absprache<br />
mit AMC erweitert: Branchen wie<br />
Aerospace bedienen die Luxemburger als<br />
Zulieferer direkt mit ‚xFK in 3D‘-Strukturen.<br />
Für größere Stückzahlen liefern sie<br />
die Anlagen – inklusive Projektierung,<br />
Wissenstransfer, Service und intensiver<br />
Begleitung. Dies könnte für Industriezweige<br />
wie Luftfahrt, Fahrzeugbau,<br />
Sportgeräte oder auch Möbel und Architektur<br />
der Fall sein.<br />
Um Absatzfelder ist dem Gradel-CEO<br />
nicht bange. „Auf 256 Milliarden Euro<br />
schätzt McKinsey den Leichtbau-Markt.<br />
Unsere Technologie könnte zehn Prozent<br />
abdecken. Bestünde nur zu geschätzten<br />
vier Prozent ein Interesse daran, entstünde<br />
ein Bedarf an 3700 Anlagen, den<br />
wir alleine nie decken könnten.“ Zwei<br />
weitere Problemstellungen hält Maack<br />
für gravierender, für die Gradel im<br />
Rahmen seines Investitionsplans aber<br />
schon Lösungen avisiert hat.<br />
Erstens: Wie können ‚xFK in 3D‘-Strukturen<br />
im Blick auf die Rohstoffe wirklich<br />
nachhaltig sein, wenn hohe Mengen<br />
nachgefragt werden? Neben den Fasern<br />
betrifft das auch die Harze. Als Lösung<br />
hat die Forschungsinstitution List die<br />
sogenannten „Vitrimere“ ausgemacht.<br />
Dabei handelt es sich laut Maack um<br />
biobasierte Materialien mit Festigkeitswerten<br />
nahe denen von Epoxidharzen,<br />
aber mit Vorteilen wie bei Thermoplasten:<br />
Sie lassen sich thermomechanisch<br />
umformen, verschweißen, recyceln und<br />
eröffnen produktionstechnisch neue<br />
Möglichkeiten. List hat bereits Patente<br />
darauf und arbeitet mit Gradel als<br />
Maschinenbau-Partner zusammen – ein<br />
Zukunftsprojekt.<br />
Die zweite Engstelle ist die zunächst<br />
naheliegendere: Wie soll das komplexe<br />
Wissen um Raumwickel-Strukturen und<br />
ihre industrielle Produktion effizient<br />
weitergegeben werden? So dass sich die<br />
Kosten für Kunden in Grenzen halten?<br />
Denn darin steckt Know-how aus verschiedensten<br />
Disziplinen innerhalb der<br />
digitalen Prozesskette: FEM-Simulation,<br />
Werkstofftechnik, Robotik und Wickeltechnologie,<br />
Maschinentechnik und<br />
Werkzeugbau etc.. Um dieses Wissen in<br />
Software und eine praktikable Bedienoberfläche<br />
zu gießen, arbeitet Gradel<br />
mit dem südkoreanischen KI-Experten<br />
Data Design Engineering Sarl mit Sitz in<br />
Luxemburg zusammen. Claude Maack:<br />
„Unsere Vision ist es, dass die Software<br />
einen geschulten Maschinenbau-Ingenieur<br />
durch den gesamten Auslegungsprozess<br />
führt, ohne dass er dafür<br />
Spezialkenntnisse benötigt.“ Auch dieses<br />
F+E-Projekt läuft schon an und ist auf<br />
drei Jahre angelegt.<br />
www.gradellw.com/gram<br />
Jubel bei Gradel: Die „Inauguration“ der vollautomatisierten Fertigung Gram legt den Grundstein für<br />
die Industrialisierung.<br />
Bild: Gradel<br />
46 <strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023
Götz Maschinenbau testete die Stratasys-Technologie SAF<br />
Wie ein Zerspaner den<br />
3D-Druck in die Serie bringt<br />
Götz Maschinenbau kaufte zwei der ersten 3D-Drucker H350 der neuen Stratasys-Technologie<br />
SAF und hat kurz darauf vier weitere geordert. Über die Hälfte der gedruckten Teile sind<br />
Serienteile für Kunden – und das, obwohl Götz zu 95 % ein Zerspanungsdienstleister ist. Wie<br />
erklärt sich der Erfolg? Wir haben das Unternehmen in Ötigheim besucht.<br />
» Olaf Stauß, Redakteur Konradin Industrie<br />
Bild: Stauß<br />
Typisch Mittelständler: Philipp Götz liebt es, schnell<br />
und pragmatisch zu gestalten und Lösungen zu<br />
finden – genau dies ist im 3D-Druck gefragt.<br />
Unsere SAF-Anlagen laufen rund um<br />
die Uhr“, sagt Philipp Götz. Er ist<br />
Geschäftsführer der Götz Maschinenbau<br />
GmbH & Co. KG, neben Bruder Lukas und<br />
Vater Roland, dem Firmengründer. Da er<br />
den 3D-Druck-Bereich vor zehn Jahren ins<br />
Familienunternehmen geholt hat, kennt er<br />
die Verfahren und stellt der noch neuen<br />
SAF-Technologie von Stratasys ein gutes<br />
Zeugnis aus: „Die mit SAF gedruckten<br />
PA11-Teile schätze ich qualitativ besser<br />
ein als die aus einer Lasersinter- oder einer<br />
MultiJet-Anlage“, sagt er und beruft sich<br />
dabei auf Praxiserfahrungen. „Wir haben<br />
wenig bis gar keinen Verzug. Die Maßhaltigkeit<br />
ist topp, die Wiederholgenauigkeit<br />
besser als bei anderen Verfahren.“<br />
Dies deckt sich damit, wie Stratasys das<br />
Verfahren und seine Vorteile erklärt, das<br />
nun knapp zwei Jahre am Markt ist. „SAF“<br />
steht für „Selective Absorption Fusion“ und<br />
geht wie der MultiJet-Prozess von HP auf<br />
Erfinder Prof. Neil Hopkinson zurück. Im<br />
Pulverbett bringen piezoelektrische Druckköpfe<br />
eine Energieabsorber-Flüssigkeit<br />
dort auf, wo Material generiert werden<br />
soll. Unter Infrarot verschmelzen die<br />
benetzten Pulver-Partikel, die anderen<br />
werden später beim Entpacken entfernt.<br />
Dem Lasersintern voraus hat SAF, dass der<br />
Energieeintrag flächig und nicht linienförmig<br />
erfolgt. Da alle Zonen defacto gleichzeitig<br />
erhitzt werden, ist die Verzugs -<br />
neigung vergleichsweise gering. Vom HP-<br />
Verfahren unterscheidet sich SAF darin,<br />
dass für das Benetzen der auszuhärtenden<br />
Bereiche ein einziges Fluid ausreicht.<br />
Nachhaltig durch Wegfall des<br />
Spritzguss-Werkzeugs<br />
„Wir haben schnell Kunden gefunden, die<br />
diese SAF-Teile von uns wollten“, sagt der<br />
junge Firmenchef – ein Grund für das<br />
Ordern vier weiterer Anlagen, die in Ötigheim<br />
noch ausstehen. Auf dem ersten<br />
H350-Drucker bei Götz entstehen Teile<br />
aus PA11, einem Bio-basierten Kunststoff,<br />
dessen erneuerbare Rohstoffe aus Rizinusöl<br />
gewonnen werden. Der zweite SAF-<br />
Drucker produziert PA12-Bauteile mit<br />
höherer Steifigkeit und für höhere Toleranzanforderungen.<br />
Als drittes Material<br />
soll in Kürze PP verfügbar sein.<br />
Stratasys propagiert das SAF-Verfahren<br />
aufgrund seiner Genauigkeit und Reproduzierbarkeit<br />
als Alternative zum Spritzguss<br />
– üblicherweise für vielleicht 5.000, 10.000<br />
oder 20.000 Stück pro Jahr: Je kleiner das<br />
Teil und je höher die Komplexität, desto<br />
lohnender ist SAF – und nachhaltiger, weil<br />
nicht aufwändig ein Werkzeug gebaut<br />
werden muss. In Webinaren gibt der israe-<br />
Diese 3D-gedruckte Absaughaube soll eine Blechkonstruktion ersetzen. Bewähren sich die<br />
Prototypen, die mit SAF gefertigt wurden, spart der Kunde Zeit und Geld.<br />
Bild: Stauß<br />
<strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023 47
» TECHNIK<br />
Bild: Stratasys<br />
Bild: Stauß<br />
lische Druckerhersteller für ausgewählte<br />
Praxisbeispiele einen Break-even-Point an,<br />
ab wann erst Spritzgießen lohnt.<br />
Ein absoluter Ausreißer in dieser Betrachtung<br />
ist eine Komponente für den<br />
ICE, die ebenfalls in Ötigheim additiv produziert<br />
wird: ein großer Einfüllstutzen für<br />
Spritzwasser mit integriertem Sieb. Das<br />
Bauteil mit Deckel und Scharnier, dreh -<br />
barem Verschluss und herausnehmbarem<br />
Sieb entsteht in einem einzigen Druckjob.<br />
Spritzgießen würde ein extrem aufwändiges<br />
Werkzeug erfordern und sich erst ab<br />
248.200 Teilen rechnen, so kalkuliert<br />
Stratasys. Götz druckt davon 250 bis 300<br />
Stück im Jahr mit SAF.<br />
Solche Serien – oft auch mit höherer<br />
Stückzahl – nutzt der 3D-Druckdienstleister<br />
als Grundlast für die SAF-Anlagen.<br />
Den verbleibenden Platz im Bauraum füllt<br />
er mit aktuell angeforderten Teilen. Dem<br />
kommt zugute, dass die Teilequalität bei<br />
Götz Maschinenbau in<br />
Ötigheim erhielt den<br />
ersten 3D-Drucker<br />
H350 der neuen<br />
Stratasys-Technologie<br />
„Selective Absorption<br />
Fusion“ (SAF).<br />
So funktioniert SAF:<br />
Nach jedem Auftragen<br />
einer Pulverschicht<br />
bringen Piezo-Druckköpfe<br />
eine infrarotsensible<br />
Flüssigkeit<br />
auf. Bei der nun<br />
folgenden Infrarot-<br />
Bestrahlung verschmelzen<br />
die<br />
benetzten Material -<br />
bereiche.<br />
SAF nicht von der Position im Bauraum<br />
abhängt, weil das Pulverbett flächig beheizt<br />
wird. Es sind hohe Packungsdichten<br />
ohne Qualitätseinbußen möglich.<br />
Einer der Gründe, warum Philipp Götz<br />
auf Serien setzt: „Wir wollen den<br />
3D-Druck als zweites Standbein aufbauen.<br />
Langfristig ziele ich auf Umsätze zwischen<br />
drei und fünf Millionen Euro.“ Mit<br />
SAF scheint dies für ihn realistisch zu<br />
werden. „Um die Anlagen auszulasten,<br />
brauchen wir ein Grundrauschen von<br />
wiederkehrenden oder aus Serien<br />
stammenden Teilen, die den Bauraum zu<br />
mindestens 50 bis 60 Prozent füllen.“ Den<br />
Rest füllen die immer noch relevanten<br />
Prototypen- und Design-Bauteile. Als<br />
weitere 3D-Druckverfahren nutzt das<br />
Familien unternehmen FDM, Polyjet und<br />
DLP. „Die Masse sind aber heute schon<br />
SAF-Bau teile mit ihren schönen Oberflächen<br />
und niedrigeren Kosten.“<br />
Was Götz Maschinenbau zugute<br />
kommt: Weil der Mittelständler die Rolle<br />
des Alpha- und Beta-Testers innehatte,<br />
verfügt er über einen Vorsprung bei der<br />
„Selective Absorption Fusion“. Noch vor<br />
dem Stratasys-Headquarter erhielten die<br />
Badener einen H350-Drucker. „Die ganze<br />
Führungsriege war bei uns“, schmunzelt<br />
Philipp Götz. „Wir haben in dieser Zeit viel<br />
gelernt. Aber auch Stratasys hat profitiert,<br />
weil wir Fehler aufgedeckt und Verbesserungsvorschläge<br />
gemacht haben.“<br />
Dieser Erfahrungsvorsprung erklärt den<br />
Erfolg des Unternehmers mit SAF aber<br />
nicht alleine. Der Kern der Geschäftstätigkeit<br />
liegt sogar woanders. Götz Maschinenbau<br />
beschäftigt zurzeit 125 Mitarbeiter,<br />
davon nur sechs im 3D-Druck. Das Gros ist<br />
in der Zerspanung tätig. Die additive Technik<br />
macht gerade mal geschätzte 5 % des<br />
Umsatzes aus, wenn auch mit „Tendenz<br />
steil wachsend“. Als Zerspanungs-Dienstleister<br />
produziert Götz „alles“ von Einzelteilen<br />
bis hin zu kleinen und mittleren Serien<br />
für unterschiedlichste Branchen.<br />
Wichtigstes Kennzeichen ist, dass die<br />
Dienstleistung nicht beim gefrästen Teil<br />
endet. Je nach Bedarf erstreckt sie sich<br />
über das Schweißen oder Oberflächen -<br />
finishing bis in die Baugruppenmontage<br />
oder sogar den Maschinenbau hinein. Das<br />
ist auch für den 3D-Druck wichtig. „Und<br />
wo wir etwas nicht im eigenen Hause erledigen<br />
können, greifen wir auf unser<br />
großes Netzwerk zurück.“ Götz verfügt<br />
weiter über vier moderne Zeiss-Mess -<br />
maschinen und Know-how beim Vermessen<br />
und in der Qualitätssicherung.<br />
Der junge CEO sieht darin „den riesigen<br />
USP“ seines Unternehmes, Genauigkeiten<br />
zu erfüllen, die additive Technik nicht leisten<br />
kann. Reichen Zehntel-Toleranzen des<br />
3D-Drucks nicht aus, „dann muss ich zerspanend<br />
ran“, sagt Götz. „Sind Form- und<br />
Lagetoleranzen, Bezugsflächen oder Passungen<br />
vorgegeben, dann realisieren wir<br />
sie mit unserem großen Maschinenpark<br />
und Know-how.“ Gerade diese Expertise<br />
des Lohnfertigers sei häufig Türöffner bei<br />
3D-Druck-Kunden. Auch könne sein Team<br />
beraten, wo eher additive und wo zerspanende<br />
Technik empfehlenswert sei.<br />
Dafür weiß er Beispiele, so etwa Einstellringe<br />
für Fräsmaschinen. „Statt die<br />
48 <strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023
Industrie<br />
Bild: Stauß<br />
Ein Blick in die von Götz Maschinenbau<br />
entwickelte Entpackstation. Der Bediener kann<br />
mit beiden Händen in ihr arbeiten.<br />
Prüflehren aus dem Vollen zu fräsen,<br />
haben wir unsere Rohlinge aus Kunststoff<br />
selbst gedruckt und dann erst zerspant.“<br />
Das hat dem Kunden hohe Kosten<br />
erspart. Ein weiteres Beispiel: Auf<br />
Götz‘ Schreibtisch liegt eine 3Dgedruckte<br />
Absaughaube aus Kunststoff,<br />
die derzeit in Dauertests geprüft wird.<br />
Bisher entsteht sie als Blech-Schweißkonstruktion<br />
und muss oft nachbearbeitet<br />
werden. „Verlaufen die Tests positiv,<br />
wird sie künftig 3D-gedruckt. Sie bietet<br />
dann eine höhere Qualität, ist günstiger<br />
und schneller erhältlich.“<br />
Günstiger und schneller, auf Zuruf<br />
„über Nacht“ drucken. Das sind die Argumente,<br />
die in der Branche zählen. Wird<br />
die additive Technik richtig eingesetzt,<br />
bietet sie große Flexibilität – fordert sie<br />
aber auch. Viele Aufträge kommen so<br />
zustande: „Anfang der Woche hat jemand<br />
angefragt, ob er bis Freitag spezielle<br />
Teile haben kann – egal, wie sie<br />
entstehen. Funktionieren sie, winkt uns<br />
ein Serienauftrag.“ Götz konnte die Prototypen<br />
im vorgegebenen Zeitfenster<br />
drucken und liefern.<br />
Schon 27 Jahre: Nachtschicht<br />
als „Geisterschicht“<br />
Diese Wendigkeit scheint der Unternehmerfamilie<br />
in die Wiege gelegt zu sein.<br />
Schon Vater Roland Götz, der 1980 die<br />
Firma gründete, packte Neues mit Elan<br />
an. Vor 27 Jahren ließ er Maschinen mit<br />
Verkettung installieren und betrieb vermutlich<br />
das „erste Kleinunternehmen<br />
mit der Nachtschicht als Geisterschicht“,<br />
erzählt der Sohn. Philipp Götz selbst<br />
Sieht nicht zufällig wie R2-D2 aus: Die neue<br />
Entpackstation heißt „R2-G2“ als Referenz an<br />
den Firmengründer Roland Götz.<br />
studierte Maschinenbau, hatte aber<br />
schon früh alle Abteilungen durchlaufen.<br />
Als er in den 3D-Druck einsteigen wollte,<br />
musste er die Familie nicht lange überzeugen.<br />
Seither ist das Geschäftsfeld<br />
dynamisch gewachsen.<br />
Stratasys hat Götz Maschinenbau<br />
wohl aufgrund dieser Dynamik einge -<br />
laden, Alpha- und Beta-Kunde für die<br />
H350-Drucker zu werden. Und bekommt<br />
diese Dynamik selbst zu spüren. Als die<br />
SAF-Anlagen in Ötigheit zu fertigen<br />
begannen, vermisste Philipp Götz eine<br />
geeignete Lösung für das Entpacken der<br />
gedruckten Teile, die den Bediener nicht<br />
zu viel Pulverstaub aussetzt. Am Markt<br />
fand er nichts Zufriedenstellendes, also<br />
kümmerte er sich selbst darum. In sieben<br />
Monaten entstand eine Entpackungs -<br />
anlage, mit der es „durch einen überraschend<br />
einfachen Mechanismus“ gelingt,<br />
staubfrei das Pulver zu entfernen, zu<br />
reinigen und gebrauchsfertig neu zu<br />
mischen. Die Anlage sieht aus wie R2-D2<br />
aus Star Wars und heißt „R2-G2“ – eine<br />
Referenz an den Vater Roland Götz.<br />
Händler verkaufen R2-G2 bereits.<br />
Ein weiterer Coup des Hidden Champions:<br />
Die Unternehmerfamilie hat<br />
jüngst die Goa Innoventure AG gegründet<br />
mit Steinbeis im Bunde. Goa investiert<br />
in Start-ups, unterstützt sie und<br />
macht sie in der Region groß. Götz<br />
Maschinenbau steuert Know-how bei,<br />
Steinbeis managt den Innovations -<br />
prozess. Der Vertrieb und Bau des<br />
R2-G2 beispielsweise wird Thema eines<br />
dieser Start-ups sein. Es sorgt jetzt<br />
schon für Cashflow.<br />
Bild: Stauß<br />
Das<br />
Kompetenz-<br />
Netzwerk<br />
der Industrie<br />
16 Medienmarken für alle<br />
wichtigen Branchen der Industrie<br />
Information, Inspiration und<br />
Vernetzung für Fach- und<br />
Führungskräfte in der Industrie<br />
Praxiswissen über alle Kanäle:<br />
Fachzeitschriften, Websites, Events,<br />
Newsletter, Whitepaper, Webinare<br />
Die passenden Medien für<br />
Sie und Ihre Branche:<br />
konradin.de/industrie<br />
media.industrie.de<br />
<strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023 49
Bild: Linde Material Handling<br />
Egal ob 18 oder weniger als 3,5 t: Ein klimafreundlicher Antrieb hilft den Gabelstaplern von Linde Material Handling, ihre Last zu heben.<br />
Nachhaltigkeit und Umschlagleistung in Einklang bringen<br />
Bereit für den Spagat<br />
Die betrieblichen CO 2<br />
-Emissionen reduzieren, ohne dabei das Umsatzvolumen zu verringern: Mit<br />
neuen Produkten, Softwarelösungen und zugeschnittenen Dienstleistungen unterstützt<br />
Linde Material Handling die Kunden, ihr anspruchsvolles Ziel zu erreichen.<br />
Heike Oder, Pressereferentin bei Linde Material Handling<br />
Unter dem Banner „Green Performance“ fasst der<br />
Warenumschlagspezialist Linde Material Handling<br />
(MH) die unterschiedlichsten Angebote zusammen.<br />
Was sie alle eint ist die Fähigkeit, bei gleichbleibend<br />
hoher Umschlagleistung den Treibhausgas-Ausstoß<br />
zu reduzieren. Energiesparend und kostensenkend<br />
sind sie obendrein. Die Maßnahmen des Herstellers<br />
reichen von hoch performanten Fahrzeugmodellen mit<br />
Lithium-Ionen-Batterien über die erste selbst entwickelte<br />
Brennstoffzelle bis hin zu Lösungen für das Batterielade-<br />
und Energiemanagement. Auch softwaregestützte<br />
Beratungsleistungen sowie Batterie-Recycling<br />
bietet das Unternehmen zu diesem Zwecke an.<br />
„Die Suche nach sparsamen, klimafreundlichen<br />
Energielösungen stellt unsere Kunden vor große<br />
Herausforderungen,“ so Stefan Prokosch, Senior Vice<br />
President Brand Management bei Linde MH. Zahlreiche<br />
Gespräche mit Flurförderzeugbetreibern und<br />
Netzwerkpartnern weisen alle in eine Richtung: Von<br />
Staplern und Lagertechnikgeräten wird erwartet,<br />
dass sie die betrieblichen Treibhausemissionen senken<br />
– oder zumindest, dass sie erheblich dazu beitragen.<br />
Gleichzeitig sollen die Fahrzeuge weiterhin die<br />
gewohnt hohe Leistungsfähigkeit erbringen und<br />
auch noch kostenfreundlich sein.<br />
Ein erster großer Schritt ist Linde MH dabei mit der<br />
neuen Staplergeneration gelungen. Die Linde X-Elektrostaplermodelle<br />
sind den Verbrennern erstmals<br />
auch in anspruchsvollen Außeneinsätzen ebenbürtig<br />
– sie vereinen die Vorteile beider Antriebsoptionen.<br />
Im Betrieb abgasfrei, potenziell klimaneutral, ergonomisch,<br />
geräuscharm und servicefreundlich, sind<br />
die Stapler mit Lithium-Ionen-Batterie die perfekte<br />
Alternative zum Diesel- oder Treibgasstapler. Im April<br />
2023 ging die nächstgrößere Baureihe in den Verkauf:<br />
Die Vorteile der neuen Staplergeneration gelten<br />
jetzt auch für Lasten von 3,5 bis fünf t. Dass es Linde<br />
MH mit der Umstellung auf saubere Elektrostapler<br />
50 <strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023
TECHNIK «<br />
ernst meint, hatte der Hersteller bereits im vergangenen<br />
Jahr gezeigt: Die Elektrifizierung der Schwerstapler<br />
im Traglastbereich von zehn bis 18 t war der<br />
Einstieg in den Bereich „grüne Flurförderzeuge“. Für<br />
alle Linde-Fahrzeugmodelle gibt es nun durchgängig<br />
eine elektrische Antriebsvariante.<br />
Auch beim Thema Batterierecycling ist Linde MH<br />
vorangekommen. Die strategische Kooperation mit<br />
dem Unternehmen Li-Cycle ermöglicht es, Materialien<br />
umweltgerecht zurückzugewinnen, sobald eine<br />
ausgelieferte Lithium-Ionen-Batterie das Ende ihrer<br />
Lebensdauer erreicht hat. „Kunden von Linde MH<br />
können sich darauf verlassen, dass die Batterien am<br />
Ende der Nutzungszeit recycelt werden. Bis zu 95 Prozent<br />
der Rohstoffe lassen sich rekuperieren und dem<br />
Materialkreislauf wieder zuführen,“ erklärt Prokosch.<br />
Wasserstoff ist eine weitere Energieart, die rasant<br />
an Bedeutung gewinnt. Denn auch dieser Grundstoff<br />
lässt sich potenziell aus regenerativen Quellen wie<br />
Sonne, Wind oder Wasser gewinnen – und ist somit<br />
nachhaltig. Auf der Messe LogiMAT in Stuttgart präsentierte<br />
Linde MH in diesem Jahr das erste eigene<br />
Brennstoffzellensystem. Mit der Markteinführung finden<br />
die Stacks mit 24 V Spannung und 1,8 kW Leistung<br />
ihren Einsatz bei Schleppern und Kommissionierern,<br />
zukünftig auch in Niederhubwagen und Doppelstockbeladern<br />
der Marke Linde. „Wir haben mit Linde<br />
HyPower ein außerordentlich robustes, leistungsfähiges<br />
und benutzerfreundliches Brennstoffzellensystem<br />
entwickelt“, so der oberste Markenverantwortliche des<br />
Unternehmens. Linde MH sei nun in der Lage, seinen<br />
Kunden im Segment Lagertechnik eine komplette One<br />
Stop Shop-Lösung anzubieten, bestehend aus Fahrzeug,<br />
Brennstoffzellensystem und Service.<br />
Wasserstoffbetriebene Stapler profitieren vor<br />
allem von kurzen Tankzeiten. Sie sind für den Innenund<br />
Außenbereich gleichermaßen geeignet, und sie<br />
besitzen die Abgasfreiheit. Ihre Vorteile spielen die<br />
Fahrzeuge insbesondere in Mehrschichteinsätzen mit<br />
vielen Betriebsstunden aus. Kommen die neuen Vehikel<br />
aber nicht in Frage, so kann man mit Linde MH<br />
dennoch nachhaltige Elemente bei sich einbauen.<br />
„Denjenigen Kunden, die aus verschiedenen Gründen<br />
weiter auf Dieselstapler setzen, bieten wir mit<br />
hydriertem Pflanzenöl eine Option, mit der auch sie<br />
die CO ² -Emissionen ihrer Fahrzeuge um bis zu<br />
90 Prozent reduzieren können“, betont Prokosch.<br />
Der Anspruch von „Green Performance“ bezieht<br />
sich aber nicht nur auf Produkte. Softwarelösungen<br />
und Beratungsangebote leisten ebenfalls ihren Beitrag<br />
für eine nachhaltige Zukunft. Das intelligente<br />
Batterielademanagement connect:charger hilft dabei,<br />
Energielastspitzen bei den Kunden zu vermeiden<br />
und die Ladestrategie situationsbedingt anzupassen<br />
– immer mit dem Ziel, den Energieverbrauch und die<br />
Energiekosten bei maximaler Verfügbarkeit zu optimieren<br />
und erneuerbare Energien bestmöglich zu berücksichtigen.<br />
Die unternehmensweite Integration<br />
aller energierelevanten Aspekte gelingt derweil mit<br />
dem Linde Energy Manager. Das System ermittelt<br />
vorausschauend den Energieverbrauch unter Berücksichtigung<br />
aller Erzeuger und Verbraucher und plant<br />
den Energieeinkauf. So lassen sich CO ² -Emissionen<br />
wie auch Energiekosten effektiv reduzieren.<br />
Auch im Außeneinsatz<br />
bewährt sich die neue<br />
Staplergeneration des<br />
Herstellers aus Aschaffenburg<br />
– abgasfrei,<br />
geräuscharm und<br />
energiesparend.<br />
Bild: Linde Material Handling<br />
Bild: Linde Material Handling<br />
Stefan Prokosch ist<br />
Senior Vice President<br />
Brand Management<br />
bei Linde MH. Er<br />
kennt die Herausforderungen,<br />
vor denen<br />
seine Kunden stehen.<br />
Linde Material Handling<br />
Der Hersteller von Gabelstaplern und Lagertechnikgeräten<br />
ist in mehr als 100 Ländern<br />
vertreten. Als Unternehmen der Kion<br />
Group verfügt Linde Material Handling über<br />
ein extensives Vertriebs- und Servicenetzwerk:<br />
Zahlreiche Dienstleistungen erweitern<br />
das Angebot des Intralogistik-Spezialisten.<br />
<strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023 51
» TECHNIK<br />
Neue Laserhärteanlage für die Serienfertigung von Werkzeughaltern<br />
Ein Plus für Qualität,<br />
Gesundheit und Umwelt<br />
Eine neue Laserhärteanlage soll bei Mapal in der Fertigung von Werkzeugaufnahmen alle<br />
Aufgaben übernehmen, die bisher in der Härterei im Salzbad erledigt werden. Das hat nicht<br />
nur qualitative Vorteile, es schont auch die Gesundheit der Mitarbeiter und die Umwelt.<br />
» Patricia Müller, PR Project Manager, Mapal Dr. Kress KG<br />
Gemeinsam mit dem<br />
Maschinenhersteller<br />
Emag hat Mapal eine<br />
Lösung entwickelt, um<br />
Werkzeugaufnahmen<br />
in Serie mit dem Laser<br />
zu härten.<br />
Durch verschiedene Härteverfahren können unterschiedliche<br />
Werkstoffe härter und damit<br />
widerstandsfähiger gemacht werden. Bei Mapal<br />
werden unter anderem unterschiedliche Werkzeugaufnahmen<br />
gehärtet. Diese sicherheitsrelevanten<br />
Bauteile sind hohen Kräften ausgesetzt. Das Härten<br />
sorgt dafür, dass Werkzeugaufnahmen trotz dieser<br />
Kräfte und trotz des vielfachen Ein- und Auswechselns<br />
eine lange Lebensdauer haben und prozesssicher<br />
ihren Dienst erfüllen.<br />
Die Werkzeugaufnahmen aus Vergütungsstahl<br />
wurden bei Mapal bisher überwiegend im Salzbad<br />
gehärtet – dem gängigen Verfahren. Allerdings<br />
kann dabei nicht Millimeter-genau bestimmt werden,<br />
bis zu welchem Punkt gehärtet wird. Qualitätsprobleme<br />
oder Schwierigkeiten bei der Weiterverarbeitung<br />
der Aufnahmen können die Folge sein.<br />
Bild: Mapal<br />
Aus diesem Grund waren umfassende Qualitätskontrollen<br />
bisher nach dem Härten obligatorisch.<br />
Weitere Nachteile des Härtens in der Salzschmelze<br />
liegen auf der Hand. Die Öfen mit der<br />
offenen Salzschmelze stellen eine Risiko- und Gefahrenquelle<br />
für die Gesundheit der Mitarbeiter<br />
dar. Höchste Konzentration unter erschwerten Bedingungen<br />
ist in der Härterei ein Muss, um sich<br />
selbst und andere nicht zu gefährden. Die Salze<br />
müssen aufwendig entsorgt werden, und für die<br />
Aufrechterhaltung der Temperatur wird zudem sehr<br />
viel Energie in Form von Gas verbraucht.<br />
Eine Alternative zum Salzbad ist das Laserhärten.<br />
Die Mapal-Experten bauten dazu eine vorhandene<br />
Chiron-Maschine um, um Aufnahmen mit dem Laser<br />
zu härten. Diese Maschine war eigentlich zum Laserauftragsschweißen<br />
gedacht. Ob sich das Verfahren<br />
allerdings belastbar für die Aufnahmen eignen würde,<br />
war zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar. Dazu<br />
hat Mapal gemeinsam mit dem Werkzeugmaschi-<br />
Bild: Mapal<br />
Mit 1.100 °C härtet der Laser die erforderlichen Aufnahmezonen<br />
– und das ohne großen Einstell- und Einspann-Aufwand.<br />
52 <strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023
Aktuell werden Schritt für Schritt alle gängigen<br />
Varianten auf das neue Verfahren umgestellt. Bis<br />
Ende des Jahres sollen alle Aufnahmegrößen auf<br />
der Maschine gehärtet werden. Dann ist das Salzbad<br />
in der Härterei Geschichte und damit auch alle<br />
Gefahren, die von ihm ausgehen.<br />
Die Öfen mit der offenen Salzschmelze – bisher das Mittel der<br />
Wahl, um Werkzeugaufnahmen zu härten – stellen eine Risikound<br />
Gefahrenquelle für die Gesundheit der Mitarbeiter dar.<br />
nenlabor (WZL), der RWTH Aachen geforscht und die<br />
Torsionsbeständigkeit, also wie beständig eine lasergehärtete<br />
Aufnahme bei Verdrehung ist, untersucht.<br />
Mit positivem Ergebnis. Das Laserhärten kann das<br />
Salzbad bei dieser Anwendung ersetzen.<br />
Seit rund zwei Jahren härtet Mapal nun mit der<br />
umgebauten Maschine alle Aufnahmen mit der<br />
eigenen Modul-Schnittstelle. Der Laser der Maschine<br />
erhitzt den Vergütungsstahl so stark, dass beim Abkühlen<br />
dieselben Strukturveränderungen wie beim<br />
Salzbad erfolgen und die Aufnahme entsprechend<br />
gehärtet wird. Möglich ist dieses Verfahren, da es<br />
sich bei Vergütungsstahl um sogenannten selbstabschreckenden<br />
Stahl handelt. Das heißt, dass der Vergütungsstahl<br />
die Wärme, die durch den Laser entsteht,<br />
sehr schnell nach innen zieht und sich so sehr<br />
schnell wieder abkühlt – sich also selbst abschreckt.<br />
Erst dadurch stellen sich die entscheidenden Strukturveränderungen<br />
ein. Allerdings ist dieses Verfahren<br />
sehr umständlich und zu aufwendig, um serientauglich<br />
Werkstücke zu härten. Mapal begab sich auf Lösungssuche<br />
und fand mit dem Maschinenhersteller<br />
Emag dafür den perfekten Partner.<br />
Gemeinsam haben die Experten beider Unternehmen<br />
eine Maschine entwickelt, die den HSK innen<br />
und außen per Laser härtet – und das ohne großen<br />
Einstell- und Einspann-Aufwand. Viel Arbeit und<br />
zwei Jahre später war sie fertig – die bislang ein zige<br />
Maschine, die Werkzeugaufnahmen mit dem Laser<br />
härtet. Sie steht in der Aalener Fertigung des Präzisionswerkzeug-Herstellers.<br />
Bild: Mapal<br />
Laser härtet präziser als das Salzbad<br />
Die neue Anlage ist damit nicht nur ein Gewinn für<br />
die Gesundheit der Mitarbeiter, sondern auch in Sachen<br />
Qualität der Aufnahmen. Denn: Der Laser härtet<br />
deutlich präziser als das Salzbad. Davon profitieren<br />
alle vor- und nachgelagerten Prozesse. In der<br />
Folge entsteht deutlich weniger Verzug im Material.<br />
Zu welchem Zeitpunkt der Härtevorgang in den<br />
Prozess eingebaut wird, ist nicht mehr entscheidend.<br />
Zudem kann automatisiert gearbeitet werden<br />
– schließlich wird es immer schwieriger Mitarbeiter<br />
zu finden, die in der Härterei sowie in der Spätoder<br />
Nachtschicht arbeiten möchten. Zwar werden<br />
die Werkstücke im Moment noch von Hand in die<br />
Maschine eingelegt, doch das soll in Kürze ein Roboter<br />
übernehmen. Dann kann der Prozess weitestgehend<br />
und vor allem während der Spät- und<br />
Nachtschicht ablaufen.<br />
Neben den bereits genannten Vorteilen hat die<br />
Maschine auch einen messbar nachhaltigen Vorteil.<br />
Sie benötigt über 80 % weniger Energie, als es beim<br />
Salzbad der Fall ist. Insgesamt leistet sie so einen<br />
großen Beitrag für ein mehr an Gesundheit, Nachhaltigkeit<br />
und Qualität.<br />
Bild: Mapal<br />
Nach dem Bad in der Salzschmelze werden die zu härtenden<br />
Bauteile in der Härterei in Öl abgeschreckt.<br />
<strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023 53
Bild: Fraunhofer IPA / Rainer Bez<br />
Zum Öffnen von Klebeverbindungen<br />
zwischen Ober- und Unterschale<br />
einer Batterie entwickelten die<br />
Partner des Projekts DeMoBat das<br />
Werkzeug namens „Knacker“.<br />
Forschungsprojekte zeigen, wie sich Batterien wirtschaftlich recyceln lassen<br />
Auf, in den nächsten Lebenszyklus<br />
Ressourcen besser auszunutzen, ist nicht nur für unsere Umwelt wichtig. Für ein rohstoffarmes<br />
Land wie Deutschland ist hochwertiges Batterierecycling auch aus Sicht der Wett -<br />
bewerbsfähigkeit elementar. Mehrere Forschungsinstitute zeigen Wege, wie´s gehen könnte.<br />
» Mona Willrett, Redakteurin <strong>Industrieanzeiger</strong><br />
Die Batterien von Elektroautos haben<br />
eine begrenzte Lebensdauer. Nach<br />
zehn Jahren – je nach Nutzung auch schon<br />
früher – reicht die Leistungsfähigkeit meist<br />
für den Einsatz im E-Auto nicht mehr aus.<br />
Am Ende ihres Lebens werden die Energiespeicher<br />
bislang in der Regel geschreddert<br />
und verbrannt. Doch das ist nicht nur aus<br />
Sicht der Nachhaltigkeit sowie des Umwelt-<br />
und Klimaschutzes schlecht. Weil<br />
Deutschland keine eigenen Vorkommen<br />
der in den Batterien enthaltenen seltenen<br />
Rohstoffe wie Lithium, Kobalt oder Nickel<br />
hat und andere Länder – allen voran China<br />
und die USA – die Versorgung strategisch<br />
erheblich cleverer abgesichert haben, sind<br />
die Verfügbarkeit und die Kosten dieser<br />
Materialien ein entscheidender Wettbewerbsfaktor<br />
für die deutsche Industrie.<br />
Vor diesem Hintergrund arbeiten mehrere<br />
Forschungseinrichtungen daran, Batterien<br />
entweder weitere Lebenszyklen zu<br />
ermöglichen oder sie am Ende ihres<br />
Lebens wirtschaftlich und mit geringer<br />
Belastung der Umwelt zu recyceln. Wichtig<br />
dabei: Die rückgewonnenen Wertstoffe<br />
sollen eine gute Qualität haben.<br />
Forscher am Fraunhofer-Institut für<br />
Produktionstechnik und Automatisierung<br />
(IPA) entwickelten beispielsweise im Projekt<br />
DeMoBat (Industrielle Demontage<br />
von Batterien und E-Motoren) neue Konzepte<br />
und Technologien, um elektrische<br />
Komponenten so handhaben und aufbereiten<br />
zu können, dass möglichst wenig<br />
Abfall entsteht und wenig der verwendeten<br />
Rohstoffe verloren geht.<br />
Am Karlsruher Institut für Technologie<br />
(KIT) entwickelten Wissenschaftler ein<br />
Recyclingverfahren, das mechanische<br />
Prozesse und chemische Reaktionen verbindet,<br />
um bis zu 70 % des Lithiums aus<br />
Batterieabfällen zurückzugewinnen. Weil<br />
dazu weder korrosive Chemikalien, noch<br />
hohe Temperaturen oder vorheriges Sortieren<br />
der Materialien nötig sind, erlaubt<br />
die Methode ein kostengünstiges, energieeffizientes<br />
und umweltverträgliches<br />
Recycling von Lithium-Ionen-Batterien.<br />
Einen dritten Weg beschreitet das<br />
Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen<br />
und Umformtechnik (IWU). Im Projekt<br />
Ekoda entwickelten die Forscher eine Bewertungssoftware,<br />
mit deren Hilfe sich<br />
ein detailliertes Zustandsprofil gebrauchter<br />
Fahrzeugkomponenten erstellen lässt.<br />
Sie gibt zudem konkrete Empfehlungen<br />
für eine Second-Life-Nutzung (Kasten).<br />
Automatisierte Demontage<br />
IPA-Leiter Prof. Alexander Sauer unterstreicht<br />
die Bedeutung der Verfügbarkeit<br />
und der Kosten von Batterie- und E-<br />
Motor-Rohstoffen als Wettbewerbsfaktor<br />
– gerade für die deutsche Industrie – und<br />
betont: „Umso wichtiger ist es, ausgediente<br />
Batterien, die noch wertvolle Rohstoffe<br />
enthalten, nicht einfach zu schreddern,<br />
wie das bisher üblich ist.“<br />
Die Grundvoraussetzung, um Batteriekomponenten<br />
wiederverwenden zu können,<br />
sei jedoch, dass die Bestandteile der<br />
Energiespeicher sortenrein demontiert<br />
werden können. Genau daran arbeitete<br />
das IPA seit Ende 2019 mit zwölf Forschungspartnern<br />
im Projekt DeMoBat.<br />
Um die übergeordneten Ziele zu erreichen,<br />
nämlich mehr Nachhaltigkeit im<br />
Umfeld der Elektromobilität, die Sicherung<br />
wirtschaftsstrategischer Rohstoffe<br />
und die Stärkung der Wirtschaftsstandor-<br />
54 <strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023
TECHNIK «<br />
te Baden-Württemberg und Deutschland,<br />
bedurfte es eines ganzheitlichen Ansatzes.<br />
Im Projekt wurden zunächst die<br />
rechtlichen Rahmenbedingungen untersucht.<br />
Hinzu kam eine Analyse der Marktpotenziale<br />
und Rücklaufmengen von Autobatterien.<br />
Daraus leiteten die Projektpartner<br />
mögliche Geschäftsmodelle ab<br />
und bewerteten diese. Ein neu entwickeltes<br />
Life-Cycle-Datenmanagement ergänzte<br />
die Arbeiten, ebenso wie eine Kostenanalyse<br />
von Demontage- und Recyclingnetzwerken<br />
bis ins Jahr 2050.<br />
Ein wichtiger Aspekt für die industrielle<br />
Demontage ist ein entsprechendes Design<br />
der Batterien. Sie sollen so gestaltet sein,<br />
dass sie manuell oder roboterbasiert reparier-<br />
und demontierbar sind. Eine<br />
Schwierigkeit dabei sind die zahlreichen<br />
unterschiedlichen Batteriemodelle, deren<br />
Bauweise aktuell noch ungünstig fürs Recycling<br />
oder alternative Strategien der<br />
Kreislaufwirtschaft ist. Ein Projektergebnis<br />
ist eine Handlungsempfehlung für ein<br />
recycelfreundliches Design.<br />
Zu Beginn müssen die Batterien auf<br />
noch vorhandene Kapazität und Alterserscheinungen<br />
getestet werden. Auch<br />
Temperaturanalysen können hier einfließen.<br />
Dann folgen Tests der Handhabung.<br />
Dazu gehört, wie sich die Batterien öffnen<br />
lassen und Komponenten entnommen<br />
werden können. Dafür entstand in<br />
DeMoBat ein roboterbasierter Demonstrator.<br />
Zudem wurden benötigte Werkzeuge<br />
entwickelt. Der Prozess erfordert<br />
zudem eine leistungsstarke Bildverarbeitung,<br />
die eine Vielzahl an Schrauben<br />
oder Kabel erkennt. Hinzu kommt, dass<br />
die Komponenten beispielsweise durch<br />
Alterungseffekte nicht immer gut erkennbar<br />
sind.<br />
Im Projekt wurden 25 Technologien<br />
konzeptioniert und getestet, von denen<br />
acht vollumfänglich als Demonstrationsund<br />
Erprobungsroboterwerkzeuge aufgebaut<br />
wurden und für den industriellen<br />
Dauerbetrieb einsetzbar wären. Zudem<br />
wurde ein flexibles Demontagesystem<br />
entwickelt, das eine zerstörungsfreie Demontage<br />
bis auf Zellebene abbilden kann.<br />
Ein wichtiger Teil des flexiblen Demontagesystems<br />
ist ein Sicherheitskonzept, falls<br />
eine Batterie in Brand geraten sollte.<br />
Die Partner strebten zudem an, einen<br />
effizienten Wertschöpfungskreislauf zu<br />
etablieren, der zunächst durch mechanisches<br />
Trennen und Rückführen der im<br />
Batteriepack enthaltenen Bestandteile<br />
erfolgen soll. Neben dem teilautomati-<br />
Ein zweites Leben für Autoteile<br />
Gebrauchtwagen oder Unfallautos werden oft mit hohem Energieaufwand verschrottet,<br />
selbst wenn viele Teile noch funktionsfähig sind. Fraunhofer-Forschende<br />
entwickeln im Projekt Ekoda eine bessere Alternative: In einem komplexen<br />
Testverfahren werden zunächst alle Komponenten untersucht. Eine vom<br />
Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU entwickelte<br />
Bewertungssoftware erstellt dann ein detailliertes Zustandsprofil gebrauchter<br />
Komponenten und gibt Empfehlungen für die Weiterverwendung.<br />
Eine erst drei oder vier Jahre alte intakte Batterie könnte beispielsweise in<br />
einem Gebrauchtwagen gleichen Typs eingesetzt werden. Ist der Energiespeicher<br />
schon älter, wäre eine Verwendung in einer kleineren landwirtschaftlichen<br />
Maschine denkbar. Sind mehrere Zellen defekt, könnte die Batterie im stationären<br />
Einsatz, etwa als Stromspeicher für eine Photovoltaikanlage im Eigenheim,<br />
noch gute Dienste leisten. So bekommt das Batteriesystem ein auf seine<br />
Leistungsfähigkeit zugeschnittenes zweites Leben.<br />
Nach demselben Prinzip lassen sich auch andere Autoteile prüfen und einer<br />
sekundären Verwendung zuführen. Entscheidend ist dabei eine sorgfältige,<br />
standardisierte und automatisierte Demontage der Einzelteile, die frühzeitig<br />
auf die mögliche Weiterverwendung der Komponenten zielt.<br />
sierten Öffnen und Separieren der Zellbestandteile<br />
wird ein Hochdruckwasserstrahl<br />
eingesetzt, um die Elektrodenbeschichtung<br />
von den Trägerfolien abzulösen.<br />
Die durchgeführte Ökobilanz zeigt<br />
den Effizienzgewinn: Das Treibhauspotenzial<br />
verringert sich laut IPA um den<br />
Faktor 10 bis 20, so dass Rezyklate mit<br />
geringem CO 2<br />
-Fußabdruck bereitgestellt<br />
werden können.<br />
70 % des Lithiums recyceln<br />
Forscher am KIT arbeiten daran, bis zu<br />
70 % des Lithiums in Batterien zurückzugewinnen<br />
– und zwar ohne dass korrosive<br />
Chemikalien, hohe Temperaturen oder<br />
vorheriges Sortieren der Materialien nötig<br />
sind. Noch ist es laut KIT teuer und wenig<br />
ertragreich, Lithium rückzugewinnen. Die<br />
verfügbaren, meist metallurgischen Verfahren<br />
verbrauchen viel Energie und<br />
hinterlassen schädliche Nebenprodukte.<br />
Dagegen versprechen Ansätze der<br />
Mechanochemie, die mechanische Prozesse<br />
nutzen, um chemische Reaktionen<br />
herbeizuführen, eine höhere Ausbeute bei<br />
niedrigerem Aufwand sowie mehr Nachhaltigkeit.<br />
Ein solches Verfahren hat nun das Institut<br />
für Angewandte Materialien –<br />
Energiespeichersysteme (IAM-ESS) des<br />
KIT zusammen mit dem vom KIT in Kooperation<br />
mit der Universität Ulm gegründeten<br />
Helmholtz-Institut Ulm für<br />
Elektrochemische Energiespeicherung<br />
(HIU) und der EnBW Energie Baden-<br />
Württemberg entwickelt. „Das Verfahren<br />
eignet sich zur Rückgewinnung von Lithium<br />
aus Kathodenmaterialien unterschiedlicher<br />
chemischer Zusammensetzung<br />
und damit für viele verschiedene<br />
marktübliche Lithium-Ionen-Batterien“,<br />
erklärt Dr. Oleksandr Dolotko vom IAM-<br />
ESS. „Es erlaubt ein kostengünstiges,<br />
energieeffizientes und umweltverträgliches<br />
Recycling.“<br />
<strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023 55
Bild: Fraunhofer IWU<br />
Franziska Bocklisch und Antje Ahrens (mit Eye-Tracker) beim Roboter-Rollformen: Die Auswertung, welche Prozessschritte erfahrene Mitarbeitende<br />
besonders im Blick haben, hilft den Prozess sinnvoll zu automatisieren.<br />
Kognitives Teaming von Mensch und cyberphysischen Produktionssystemen<br />
Menschzentrierte Industrie 4.0<br />
Wie arbeiten Menschen mit Maschinen zusammen? Wie können digitale Helfer in der Fabrik<br />
unterstützen, ohne durch ihre Komplexität zu überfordern? Solchen Fragen untersucht ein<br />
Forscherteam am IWU. Das Ziel: Aus dem Nebeneinander von Mensch und Technik soll ein<br />
echtes Miteinander werden. Dadurch lassen sich noch erhebliche Effizienzpotenziale heben.<br />
Kognitionspsychologie beschäftigt sich<br />
mit Aspekten menschlichen Denkens<br />
und Verhaltens etwa von Wahrnehmung,<br />
Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Entscheiden.<br />
Sie erforscht, wie sensorische<br />
Informationen verarbeitet und zu Wissenseinheiten<br />
werden und wie dieses Expertenwissen<br />
die Interpretation von Informationen<br />
und spätere Entscheidungen beeinflusst.<br />
Kognitionspsychologie untersucht<br />
auch, wie der Mensch komplexe<br />
Probleme dank kreativer Strategien löst<br />
und Komplexität sinnvoll reduzieren kann.<br />
Eine vermeintliche Schwäche des Menschen<br />
bei drohender Überforderung ist tatsächlich<br />
eine große Stärke – er reflektiert<br />
die Situation, stellt sie in einen größeren<br />
Zusammenhang und greift auf Erfahrungswissen<br />
zurück. Ein wichtiger Anwendungsbereich<br />
der gewonnenen Erkenntnisse liegt<br />
in der modernen Produktionstechnik. Wie<br />
das Zusammenspiel von Mensch und Technik<br />
künftig noch wertschöpfender gestaltet<br />
werden kann, ist der Schwerpunkt einer<br />
neuen Arbeitsgruppe am Fraunhofer-Institut<br />
für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik<br />
(IWU ) in Chemnitz.<br />
Seit April 2023 leitet Dr. Franziska Bocklisch<br />
am IWU die neue Gruppe „Kognitives<br />
Teaming von Mensch und cyberphysischen<br />
Produktionssystemen“ in der Abteilung<br />
„Mensch in der Produktion“. Sie betont: „In<br />
der technischen Entwicklung, wie auch in<br />
der betrieblichen Umsetzung sollte der<br />
Mensch mit seiner Expertise und seinen<br />
Bedürfnissen im Vordergrund stehen. Unser<br />
Ansatz ist, cyberphysische Systeme an<br />
die kognitiven Fähigkeiten des Menschen<br />
anzupassen – und nicht umgekehrt“.<br />
Viele Innovationen in Robotik, Künstlicher<br />
Intelligenz (KI), Data Analytics oder<br />
in Visualisierungstechnologien prägen die<br />
moderne industrielle Produktion. KI ist<br />
präzise und wiederholgenau – dank beeindruckender<br />
Rechenleistung kann sie<br />
mit riesigen Datenmengen umgehen.<br />
Gleichzeitig haben leistungsfähige Assistenzsysteme<br />
die Komplexität menschlicher<br />
Arbeit in der Produktion mitunter<br />
sogar erhöht. Der Anspruch, dass Technik<br />
den Menschen optimal unterstützen und<br />
ihm mehr Freiraum für wertschöpfende<br />
Kreativität ermöglichen soll, ist also noch<br />
nicht vollständig eingelöst.<br />
Das neue Team am IWU setzt zwar weiterhin<br />
auf die Kombination der jeweiligen<br />
Stärken von Mensch und Technik, betont<br />
jedoch den Team-Gedanken als Voraussetzung<br />
für einen weiteren Qualitätshub.<br />
Zwei wesentliche Kennzeichen von Teamarbeit<br />
sind geteiltes Wissen und gemeinsame<br />
Ziele. Leicht verständliche KI-Algorithmen,<br />
die zur Struktur des menschli-<br />
56 <strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023
TECHNIK «<br />
chen Fachwissens und der Vorgehensweise<br />
von Experten in einem bestimmten<br />
Fachgebiet passen, können zu echten<br />
„Cyber-Gehilfen“ werden. In einer Art<br />
wechselseitigem Coaching zeigt die Technik<br />
dem Menschen, wie sich eine Aufgabenstellung<br />
noch besser lösen lässt, etwa<br />
durch den Rückgriff auf gut strukturierte,<br />
relevante Daten, die ein Assistenzsystem<br />
bereitstellt. Umgekehrt könnten Mitarbeitende<br />
beispielsweise eine KI-Lösung,<br />
die noch nicht alle Entscheidungsoptionen<br />
kennt, stabiler machen. Nimmt man<br />
den Anspruch ernst, Assistenzsysteme<br />
vom Menschen her zu denken, darf die<br />
Kernfrage nicht lauten, was technisch<br />
möglich ist, sondern: was kann der<br />
Mensch gut verarbeiten und welche Lösung<br />
bietet ihm eine tatsäch liche Hilfestellung?<br />
Zu komplexe Systeme erschweren das<br />
Anlernen und Einarbeiten neuer Mitarbeitender.<br />
Sinnvoll entwickelt und eingesetzt,<br />
unterstützen intelligente Systeme hingegen<br />
bei der Sicherung von Kompetenzen<br />
und dem Transfer von Erfahrungswissen.<br />
Vielversprechend sind beispielsweise erste<br />
Forschungsergebnisse zur Beobachtung<br />
von Fertigungsprozessen durch erfahrene<br />
Mitarbeitende. Die Auswertung ermöglicht<br />
gezieltes Nachfragen und damit Prozessbeschreibungen<br />
in einer viel höheren Qualität<br />
– gerade, wenn es darum geht, neuen<br />
Mitarbeitenden zu vermitteln, worauf es<br />
ankommt.<br />
Die Forschenden am Fraunhofer IWU haben<br />
dazu das Roboter-Rollformen, einen<br />
für kleine Stückzahlen geeigneten, mehrstufigen<br />
Umformprozess von Blechen, beobachtet<br />
und systematisch auf verschiedenen<br />
Ebenen beschrieben. Ein Eye-Tracker<br />
folgte dabei den Blicken der technischen<br />
Experten und übertrug sie auf ein Tablet.<br />
Eine Aufzeichnung und Detailauswertung<br />
der menschlichen Blickdaten ermöglichte<br />
dann gezieltes Nachfragen, aus welchen<br />
Gründen ein jeweiliger Prozessabschnitt<br />
ausgeführt wurde und warum bestimmte<br />
Aspekte besondere Aufmerksamkeit erfuhren.<br />
Das lieferte wichtige Ansatzpunkte,<br />
kognitive Assistenzsysteme und zielführende<br />
Automatisierungslösungen zu erstellen.<br />
In einem weiteren Projekt an der TU<br />
Chemnitz untersuchte die Forschungsgruppe<br />
„Human-Cyber-Physical Systems“,<br />
wie Mensch und KI in einem thermischen<br />
Beschichtungsprozess gemeinsame Ziele<br />
erreichen und geteiltes Wissen erlangen<br />
können, damit die Oberflächenqualität<br />
stimmt und dennoch möglichst wenig<br />
Material verbraucht wird.<br />
Es ist wichtig, den Teaming-Gedanken<br />
für ein besseres Miteinander von Mensch<br />
und Technik breit zu verankern. In der betrieblichen<br />
Praxis steht nur selten kognitionspychologische<br />
Exper tise zur Verfügung<br />
– das muss auch nicht sein, wenn<br />
Wissenschaft und Industrie transdisziplinär<br />
zusammenarbeiten und beispielsweise<br />
bereits Studierende sensibilisiert werden,<br />
Technik stärker aus der Perspektive<br />
des Menschen zu gestalten. (mw)<br />
WELTLEITMESSE<br />
FÜGEN ∏ TRENNEN ∏ BESCHICHTEN<br />
LET’S JOIN<br />
THE WORLD!<br />
11. – 15. September 2023<br />
BESUCHEN<br />
SIE UNS!<br />
www.schweissen-schneiden.com<br />
<strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023 57
» TECHNIK<br />
Oberflächeninspektion in der Beizlinie<br />
Keine Chance für Löcher und Falten<br />
Mit einer kombinierten 2D/3D-Oberflächeninspektion des Herstellers IMS Messsysteme konnte<br />
Thyssenkrupp Rasselstein am Standort Andernach Walzschäden und Bandrisse reduzieren. Die<br />
Messtechnik wurde erstmals in einer Beize installiert. Oberflächenfehler werden dabei sicher<br />
erkannt und beurteilt.<br />
IMS Messsysteme und Thyssenkrupp Rasselstein setzen gemeinsam neue Maßstäbe bei<br />
der Erkennung von kritischen Oberflächenfehlern in der Beize.<br />
Bild: IMS Messsysteme<br />
Der Standort Andernach von Thyssenkrupp Rasselstein<br />
ist der weltweit größte Produktionsstandort<br />
für Verpackungsstahl. Die Beize ist dort die erste Verarbeitungsstufe<br />
des Warmbandes auf dem Weg zum<br />
Feinstblech mit Dicken von 0,1 bis 0,5 mm. Idealerweise<br />
werden Oberflächenfehler bereits auf diesem<br />
Vormaterial erkannt, um die hohe Qualität des Endprodukts<br />
zu sichern. Dadurch lassen sich auch<br />
schwerwiegende Probleme wie Bandrisse und Walzenbeschädigungen<br />
in der folgenden Verarbeitung<br />
vermeiden. Aus diesem Grund setzt Thyssenkrupp Rasselstein<br />
seit Jahren moderne Inspektionssysteme für<br />
die Kontrolle der Oberflächenqualität in der Beize ein.<br />
Obwohl bereits aktuelle Detektions- und Klassifizierungstechniken<br />
genutzt werden, verbleibt am Ende<br />
eine Unsicherheit in der Qualitätsbewertung wegen<br />
der Beschaffenheit der Oberfläche des gebeizten<br />
Warmbandes. Zudem erschweren gelegentliche<br />
Pseudofehler wie Zunder oder Wasser den Prozess.<br />
Diese Probleme lassen sich mit herkömmlichen Zeilen-<br />
oder Matrixkameras nie vollständig ausräumen,<br />
auch wenn große Mengen an Trainingsdaten gesammelt<br />
werden. „Allerdings ist die Fehlererkennung mit<br />
einer Höhenvermessung bereits nach kurzer Zeit produktiv<br />
nutzbar, da lediglich numerische Schwellwerte<br />
für kritische Fehlertiefen festgelegt werden müssen“,<br />
versichert Björn Krämer, Bereichsleiter Systemtechnik<br />
Bildverarbeitung bei IMS. „Die Tiefe des Defekts<br />
ist in der Regel das entscheidende Kriterium für<br />
die Schwere eines Defekts.“<br />
Und so schaute sich Thyssenkrupp Rasselstein um<br />
nach einer voll automatisierten, zuverlässigen und<br />
objektiven Fehlererkennung im laufenden Prozess<br />
und setzte einmal mehr auf die Messtechnik von<br />
IMS. Mit der neu implementierten 2D/3D-Oberflächeninspektion<br />
in der Beize wollen die Andernacher<br />
neue Maßstäbe in der Branche setzen.<br />
Bereits im Jahr 2008 startete IMS mit der Entwicklung<br />
von Oberflächen-Inspektionssystemen und lieferte<br />
2010 das erste funktionsfähige 3D-Inspektionssystem<br />
für Brammen im Strangguss aus. Weitere Anwendungsfelder<br />
für Grobbleche, Rohre und die Inspektion<br />
komplexer Profile wurden ebenfalls zeitnah<br />
erschlossen. Die Idee, diese Technik nun auch in der<br />
Beize bei Thyssenkrupp Rasselstein einzusetzen,<br />
führte bereits in der Feldstudie zu guten Ergebnissen.<br />
Es zeigte sich eine deutliche Verbesserung in der automatisierten<br />
Erkennung schwerwiegender Oberflächenfehler<br />
im laufenden Prozess. Beschädigungen<br />
und Ausfälle wurden signifikant reduziert.<br />
„Gemeinsam mit IMS entstand die Idee, die<br />
3D-Technik auch in der Beize zu nutzen, um durch<br />
58 <strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023
die automatische Detektion<br />
und Tiefenvermessung der<br />
Defekte die Auswirkungen<br />
auf den darauffolgenden<br />
Walzprozess zu reduzieren“,<br />
berichtet Yves Unnützer, Ing.<br />
Onlinemesssysteme, Thyssenkrupp<br />
Rasselstein. „Dadurch<br />
sollen Störungen<br />
durch Bandrisse oder Walzenschäden<br />
minimiert werden.“<br />
Die Überlegungen ließen<br />
sich in einer Testinstallation<br />
bestätigen, so dass<br />
zeitnah ein Produktivsystem<br />
installiert wurde. Dieses hat seit der Inbetriebnahme<br />
die Erwartungen erfüllt und zu einer nachhaltigen<br />
Qualitätssteigerung des Walzprozesses beigetragen.<br />
Die Lösung ist seit Ende 2022 im Echtbetrieb. Das<br />
Besondere daran ist, dass zwei Inspektionstechniken<br />
in einem System kombiniert werden. Die Vorteile<br />
dieser Verschmelzung liegen aus Sicht von IMS<br />
auf der Hand. Zum einen erkennt der 3D-Kanal des<br />
Systems zuverlässig schwerwiegende Fehler wie<br />
Schalen, Löcher und Falten, die im Folgeprozess zu<br />
Bandrissen oder Walzenschäden führen können.<br />
Durch die automatische Tiefenvermessung der Fehler<br />
können diese eindeutig erkannt, bewertet und<br />
somit von harmlosen Erscheinungen wie Verschmutzungen<br />
sicher unterschieden werden. Und<br />
ergänzend erkennt der integrierte 2D-Kanal Oberflächenfehler<br />
ohne Höheninformationen wie zum<br />
Beispiel Restzunder. (us)<br />
Sichtbare, offene Schale<br />
auf der Oberfläche<br />
des Warmbandes und<br />
deren Höhenverlauf.<br />
Bild: IMS Messsysteme<br />
PREMIUM TECHNOLOGY<br />
POWERED BY PREMIUM SERVICES<br />
Seit mehr als 100 Jahren stecken wir all unsere Erfahrung und<br />
unser ganzes Herzblut in die Entwicklung hocheffizienter, nachhaltiger<br />
Druckluft-Lösungen und in maßgeschneiderte Services.<br />
<strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023 59
Bild: Mayr Antriebstechnik<br />
Stromerzeugung, Energiemanagement und der Zukauf von Klimazertifikaten sind nicht alles. Einsparpotenzial liegt auch in den Produkten von Mayr.<br />
Smarte Lösungen für Sicherheitsbremsen sparen Ressourcen und Energie<br />
Energieeffizienz im Fokus<br />
Auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit in den Fabriken sind grüne Energien, die Reduktion von<br />
CO 2<br />
-Emissionen, intelligente Kreislaufkonzepte und ressourcenschonende Prozesse wichtige<br />
Stellschrauben. Aber der Weg beginnt im Kleinen, bei jeder einzelnen Komponente – wie bei<br />
schlanken und ressourcenschonenden Motorenbremsen für den Serieneinsatz.<br />
Derzeit sind viele Hersteller auf der Suche nach<br />
einfachen, energieeffizienten und sauberen Lösungen<br />
für mehr Nachhaltigkeit in der Produktion.<br />
Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit schließen sich<br />
dabei nicht aus, im Gegenteil. „Bei der Entwicklung<br />
unserer neuen Motorbremsen-Ausführung Robastop-M<br />
Eco war uns insbesondere der ressourcenschonende<br />
Umgang mit Material wichtig“, erläutert<br />
Andreas Merz, Produktmanager bei Mayr Antriebstechnik<br />
in Mauerstetten. „Hier ist es uns unter anderem<br />
gelungen, den Anteil an Kupfer, das in der Herstellung<br />
viel Energie und Wasser benötigt, deutlich<br />
zu reduzieren.“ Das Ergebnis ist eine neue, schlanke<br />
Version der Bremse, die die Eigenschaften der Motorbremse<br />
auf das Wesentliche reduziert, dem Original<br />
aber laut Angaben des Herstellers in punkto Robustheit<br />
und Zuverlässigkeit in nichts nachstehen soll.<br />
Daneben liegen „saubere“ Elektromotoren in der<br />
Industrie im Trend. Dort, wo möglich, müssen immer<br />
öfter hydraulische oder pneumatische Systeme weichen<br />
und werden durch elektrische Antriebe ersetzt.<br />
Besonders dann, wenn auch mit den elektrischen<br />
Systemen eine entsprechende Leistungsdichte erreicht<br />
wird. Das stellt alle Komponenten, besonders<br />
auch die Sicherheitsbremsen vor neue Herausforderungen.<br />
Deshalb hat Mayr mit der neuen elektromagnetischen<br />
Linearbremse Roba-linearstop ein System<br />
mit hohen Haltekräften im Portfolio, das zudem dynamisch<br />
bremsen kann und mit seinen kurzen<br />
Schaltzeiten überzeugt. „Wir führen als einziger Hersteller<br />
elektrische Linearbremsen, die nach dem Fail-<br />
Safe-Prinzip arbeiten“, erklärt Andreas Merz. Die<br />
60 <strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023
TECHNIK «<br />
Bild: Mayr Antriebstechnik<br />
Bremsen erzeugen die Bremskraft durch Druckfedern<br />
und sind im energielosen Zustand geschlossen. Die<br />
neue Baureihe der elektromagnetischen Roba-linearstop<br />
Bremsen umfasst sechs Baugrößen mit Kräften<br />
von 70 bis 17.000 N.<br />
„Die meisten auf dem Markt verfügbaren Linearbremsen<br />
fungieren als statische Klemmeinheiten und<br />
sind nur dafür konzipiert, die Achsen im Stillstand zu<br />
halten“, erläutert Andreas Merz. „Kommt es allerdings<br />
zu einem Komplettausfall des Antriebs, ist die<br />
Linearbremse auch für das sichere Verzögern der Last<br />
verantwortlich.“ Deshalb sind die Sicherheitsbremsen<br />
auch für solche dynamischen Bremsungen ausgelegt.<br />
Das Unternehmen hat die Bremsen als Sicherheitsbauteil<br />
nach der Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)<br />
freiwillig einer Baumusterprüfung unterzogen.<br />
Leistungsdichte und Energieeffizienz der Bremsen,<br />
egal ob Motorbremse oder Linearbremse, hängen dabei<br />
nicht nur von konstruktiven Faktoren ab: „Ein<br />
weitaus größeres Einsparpotenzial bietet sich im Betrieb<br />
durch die intelligente Ansteuerung der Bremsen“,<br />
erläutert Andreas Merz. „Denn nur beim Einschalten<br />
wird die Bremse kurzzeitig mit einer hohen<br />
Spannung bestromt. In dieser Phase ist eine hohe<br />
Magnetkraft erforderlich. Im weiteren Betrieb reicht<br />
aber eine wesentlich kleinere Magnetkraft aus, um<br />
die Bremse offen zu halten. Deshalb kann dann die<br />
Spannung deutlich abgesenkt werden und damit<br />
sinkt auch der Energieverbrauch.“<br />
Kurze Schaltzeiten und zuverlässige<br />
Schaltzustandskontrolle<br />
Das Modul zum sensorlosen Monitoring kann die Spulentemperatur<br />
überwachen und eine präventive Funktionsüberwachung leisten.<br />
Bild: Mayr Antriebstechnik<br />
Die neue Version von Roba-stop-M<br />
reduziert die beliebten Eigenschaften<br />
auf das Wesentliche.<br />
Für die Sicherheit von Mensch und Maschine sind<br />
gerade bei sicherheitskritischen und vertikalen Achsen<br />
kurze Anhaltewege wichtig. Entscheidend für<br />
den Bremsweg sind dabei die Schaltzeiten der Bremse.<br />
Denn in der Zeit des freien Falls bis die Bremse<br />
schließt und die Verzögerung einsetzt, beschleunigt<br />
sich die Masse zusätzlich – unter Umständen so extrem,<br />
dass die zulässigen Werte der Bremse überschritten<br />
werden. Anwender sollten daher bei der<br />
Auswahl der Sicherheitsbremsen auf möglichst kurze,<br />
verifizierte Schaltzeiten achten – und auch darauf,<br />
dass diese Schaltzeiten über die gesamte Lebensdauer<br />
der Bremse eingehalten werden. Deshalb<br />
ist eine zuverlässige Schaltzustandskontrolle wichtig.<br />
Diese kann bei den Motorbremsen wie auch den Linearbremsen<br />
über das Ansteuermodul erfolgen.<br />
Mayr bietet hier mit dem Modul Roba-brake-checker<br />
eine intelligente Lösung für sensorloses Bremsenmonitoring.<br />
Das Modul kann je nach Anforderung<br />
nur für die Überwachung des Schaltzustands eingesetzt<br />
werden oder aber auch die Spulentemperatur<br />
überwachen und eine präventive Funktionsüberwachung<br />
auf Verschleiß, Funktionsreserve und Fehler<br />
ermöglichen. Das nachrüstbare Modul arbeitet sensorlos<br />
und erkennt durch eine erweiterte Analyse von<br />
Strom und Spannung die Bewegung der Ankerscheibe<br />
und weiß, in welchem Zustand sich die Bremse<br />
befindet.<br />
In einer erweiterten Ausführung ist das Modul Roba-brake-checker<br />
mit einer zusätzlichen Platine mit<br />
kundenspezifischer Schnittstelle (z. B. Ethernet basiert)<br />
ausgestattet. Über diese Schnittstelle kann es<br />
Daten zu Schaltzeit, Strom, Spannung, Widerstand,<br />
Leistung und relativem Anzugsstrom liefern. Damit<br />
sind auch Verläufe auswertbar, Auffälligkeiten im<br />
Prozess lassen sich schnell erkennen und somit<br />
Schlüsse aus komplexen Zusammenhängen ziehen –<br />
ein Vorteil auch in punkto Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit.<br />
Denn Anwender können ihre Wartung<br />
damit vorausschauend und zielgerichtet, nämlich<br />
erst dann, wenn wirklich nötig, durchführen. Darüber<br />
hinaus ist auch die Integration in Fernwartungssysteme<br />
möglich. (hw)<br />
<strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023 61
<strong>Industrieanzeiger</strong> präsentiert Ihnen<br />
Partner der Industrie.<br />
Hier finden Sie leistungsstarke Lieferanten, Dienstleister und kompetente lösungsorientierte Partner<br />
der Industrie!<br />
Antriebstechnik/Fluidtechnik Automatisierung<br />
Arbeitsschutz Betriebsbedarf Gebrauchtmaschinen<br />
HMI Industrie 4.0 Materialfluss/Logistik Robotik<br />
Spanende Fertigung Spanlose Fertigung<br />
Montage-, Handhabungstechnik Kunststoffverarbeitung<br />
Lasertechnik Mikrosystemtechnik/Nanotechnologie<br />
Smart Energy Oberflächentechnik Qualitätssicherung<br />
Verbindungstechnik Verpackungstechnik<br />
Werkstoffe Werkzeug-/Formenbau<br />
Werkzeugmaschinen Schmiermittel Zulieferung<br />
Weitere Fakten zu Unternehmen, Details zum Angebots- und Leistungs spektrum finden Sie im<br />
Firmenverzeichnis auf industrieanzeiger.de.<br />
Unter folgendem Link gelangen Sie zur Übersicht aller Online-Firmenprofile.<br />
Bookmark!<br />
www.industrieanzeiger.de/firmenverzeichnis<br />
C-TEILE-MANAGEMENT<br />
C-TEILE-MANAGEMENT<br />
C-TEILE-MANAGEMENT<br />
Ferdinand Gross GmbH & Co. KG<br />
www.schrauben-gross.de<br />
Ferdinand Gross ist Spezialist für Verbindungstechnik<br />
und C-Teile-Management und bietet Kunden und<br />
Partnern aus der Industrie maßgeschneiderte Dienstleistungen.<br />
Unser Sortiment reicht von Verbindungselementen<br />
über Werkzeuge bis zu Sonder anfertigungen.<br />
Wir sorgen für schnellste Verfügbarkeit von über<br />
107 000 Artikeln. Im Bereich C-Teile-Management<br />
bietet Ferdinand Gross kunden spezifische Lösungen<br />
zur Senkung Ihrer Beschaffungs kosten um bis zu 70 %.<br />
Keller & Kalmbach GmbH<br />
www.keller-kalmbach.de<br />
Ist Ihr C-Teile-Management fit für die Zukunft?<br />
Wir überzeugen Sie mit großem technischen<br />
Know-how bei Verbindungselementen und<br />
bieten Ihnen eine Produktpalette rund um<br />
C-Teile, die kaum Wünsche offen lässt.<br />
Wir stehen für höchste Versorgungssicherheit<br />
und entwickeln kundenindividuelle und maßgeschneiderte<br />
Logistikkonzepte für Produktion<br />
und MRO. Sorgen Sie mit dem passenden C-Teile-<br />
Konzept für effiziente Beschaffungsprozesse und<br />
Abläufe in Ihrem Unternehmen. Diskutieren Sie<br />
mit unseren Experten, wie Sie Ihre Wertschöpfung<br />
steigern können.<br />
Lederer GmbH<br />
www.c-teile-management.info<br />
Wenn es um C-Teile-Management geht, Kanban, Konsignation<br />
& Co., ist Lederer Ihr Partner: Norm- und Standardteile,<br />
Sonder- und Zeichnungsteile, Verbindungselemente<br />
u.v.m. auf Basis aller logistischen Lösungen<br />
und Systeme (eBusiness, RFID, Ein- und Mehr-Behälter-<br />
Kanban etc.). Lederer übernimmt für Sie die Lieferantensuche,<br />
Bestellung und Beschaffung, Bevorratung<br />
und Bereitstellung, Lagerbewirtschaftung und Qualitäts<br />
sicherung, Systempflege und Prozessverbesserung.<br />
– Verbindungselemente<br />
– Norm- und Standardartikel<br />
– Sonder- und Zeichnungsteile<br />
– C-Teile-Management<br />
62 <strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023
C-TEILE MANAGEMENT<br />
CNC-LASERSCHNEIDEN<br />
Energiemanagement<br />
OTTO ROTH GmbH & Co KG<br />
www.ottoroth.de<br />
OTTO ROTH ist sowohl traditionsreiches Handelshaus<br />
für mechanische Verbindungselemente als<br />
auch zertifizierter Hersteller hochpräziser Drehund<br />
Feinbearbeitungsteile.<br />
Das Portfolio von OTTO ROTH umfasst:<br />
- Großhandel mit Verbindungselementen<br />
- Komplettlösungen für Zeichnungsteile<br />
- C-Teile-Management<br />
- Fertigung von Präzisionsdrehteilen<br />
Mit einem umfassenden Sortiment von 100.000<br />
ständig verfügbaren Artikeln, Niederlassungen<br />
in ganz Deutschland sowie einem eigenen Fertigungsstandort<br />
ist OTTO ROTH für sämtliche Anforderungen<br />
rund um die Verbindungstechnik der<br />
ideale Partner.<br />
Schages GmbH & Co.KG<br />
www.schages.de<br />
Punktgenau<br />
Als mehrfach zertifizierter CNC-Laser-Blechbearbeiter<br />
bieten wir:<br />
• Rohrlaserschneiden bis 12 m Länge<br />
• Blechzuschnitte von Mini bis XXL<br />
• CNC-Abkanten bis 4 m/320 t<br />
• Großserien, Einzelteile, Prototypen<br />
• Vorlagen-Vermessung | Datenübernahme<br />
Wir verarbeiten Edelstahl rostfrei bis 50 mm | Stahl<br />
und Alu bis 30 mm | Kupfer und Messing bis 18 mm<br />
Zertifizierungen: ISO 9001 und ISO 14001, Werkseigene<br />
PK nach EN 1090, Mat.-Kennz. nach RL 2014/68/EU<br />
econ solutions GmbH<br />
www.econ-solutions.de<br />
econ solutions bietet Lösungen für be triebliches<br />
Energie management. Die offene Plug & Play Soft- und<br />
Hard ware ist flexibel skalierbar. Sie kann für sich<br />
arbeiten oder Hardware bzw. Systeme herstellerneutral<br />
integrieren. Hinzu kommen Services wie Integration,<br />
Custo mizing, Systemplanung und Schulungen.<br />
Über 600 Unter nehmen setzen bereits auf die<br />
Software econ4, z. B. BASF, Continental, ebm-papst,<br />
TRUMPF Werkzeug maschinen und ZF TRW.<br />
econ solutions mit Hauptsitz in München wurde 2010<br />
gegründet und gehört seit 2017 zur MVV Energie AG.<br />
Durch das MVV-Partnernetzwerk stehen für jede<br />
Energiefrage Spezialisten zur Verfügung.<br />
FLUIDTECHNIK<br />
KOMPONENTEN + SYSTEME<br />
LASERBESCHRIFTUNG/ETIKETTEN<br />
TI Fluid Systems<br />
www.tifluidsystems.com<br />
TI Fluid Systems ist ein weltweit führender Hersteller<br />
von Flüssigkeitsspeicher-, Flüssigkeitstransport- und<br />
Flüssigkeitsabgabesystemen. Mit 100 Jahren Erfahrung<br />
in der Herstellung von Fluid-Technologien für die Automobilindustrie<br />
verfügt das Unternehmen über Produktionsstätten<br />
an 104 Standorten in 29 Ländern und<br />
beliefert alle großen globalen OEMs. In Deutschland hat<br />
TI Fluid Systems im Jahr 2022 sein erstes E-Mobility<br />
Innovation Center in Rastatt in Baden-Württemberg<br />
eröffnet. Es ist zentrale Anlaufstelle für Kunden und<br />
unterstützt bei der effizienteren Produkteinführung<br />
von E-Fahrzeugen. Weitere Zentren folgen im Rahmen<br />
der „Take The Turn”-Unternehmensstrategie in Europa,<br />
Nordamerika und Asien.<br />
RCT® Reichelt Chemietechnik GmbH + Co.<br />
www.rct-online.de<br />
Reichelt Chemietechnik steht für das Prinzip<br />
„Angebot und Vertrieb der kleinen Quantität“ gepaart<br />
mit einer viele Bereiche umfassenden Produktvielfalt<br />
und einem hohen technischen Beratungsservice.<br />
Das Angebot von Reichelt Chemietechnik umfasst<br />
ca. 80 000 Artikel, die aus den Bereichen Schlauchtechnik,<br />
Verbindungselemente, Durchflusstechnik,<br />
Labor technik, Halbzeuge, Befestigungselemente,<br />
Filtration und Antriebstechnik stammen.<br />
Reichelt Chemietechnik GmbH + Co.<br />
Englerstraße 18, 69126 Heidelberg<br />
Tel. 0 62 21/3 12 50, info@rct-online.de<br />
LBT GmbH & Co. KG<br />
www.laser-beschriftung.de<br />
• Materialschonend durch berührungslose Bearbeitung<br />
• An unzugänglichen Stellen, z.B. in Bohrungen wo<br />
Druckverfahren versagen<br />
• BLACK MARKING, ein neues Beschriftungsverfahren<br />
für das Schwarzmarkieren<br />
• Variable Texte und Grafiken aus Kundendaten<br />
• Data-Matrix, Barcode und QR-Code zur<br />
Bauteilnachverfolgung-Traceability<br />
• Data-Matrix Plättchen ECC200 zur<br />
Leiterplattenkennzeichnung per SMD-Automat<br />
• Eigene Produkte wie Etiketten, Frontplatten,<br />
Typenschilder<br />
• Kostengünstig, kurze Lieferzeiten<br />
Fon 089-38 39 42 0 | info@l-b-t.de | www.l-b-t.de<br />
STECKVERBINDER<br />
VERBINDUNGSTECHNIK<br />
WASSERSTRAHL-SCHNEIDEANLAGEN<br />
Stäubli Electrical Connectors GmbH<br />
www.staubli.com<br />
Stäubli entwickelt elektrische Verbindungslösungen<br />
für industrielle Anwendungen in Branchen wie erneuerbare<br />
Energien, Automatisierungstechnik, Energieübertragung,<br />
Bahnindustrie, Schweißautomatisierung,<br />
Prüf- und Messtechnik, Medizintechnik und E-Mobility.<br />
Das umfangreiche Angebot an standardisierten und<br />
kundenspezifischen Steckverbindern zeichnet sich<br />
durch Langlebigkeit, Effizienz und hohe Leistung aus.<br />
Komplettlösungen inklusive Kabelkonfektionierung<br />
reduzieren die Montagekosten und vereinfachen die<br />
Logistik.<br />
Stäubli – Steckverbinderlösungen, die Unternehmen<br />
voranbringen.<br />
Albert Pasvahl GmbH & Co.<br />
www.pasvahl.de<br />
Als Schraubenspezialist mit über 90 Jahren Erfahrung<br />
stehen wir für Qualität und Zuverlässigkeit.<br />
MILLIONS OF SCREWS IN STOCK<br />
• Passschrauben<br />
• Vierkantschrauben<br />
• Verschlussschrauben<br />
• Flachkopfschrauben<br />
• Schrauben mit Zapfen/Spitze<br />
• Rändelschrauben<br />
• Messingschrauben<br />
• Sonderanfertigungen nach Vorgaben<br />
STM Waterjet GmbH<br />
www.stm-waterjet.com<br />
STM Wasserstrahl-Schneidanlagen<br />
Leidenschaft, Know-how und ein unstillbarer Innovationsdrang<br />
haben STM zu einem international führenden<br />
Anbieter von Wasserstrahl-Schneidsystemen gemacht.<br />
Seit über 30 Jahren entwickeln wir an unseren Headquater<br />
in Eben im Pongau, Österreich mit großer Begeisterung<br />
zukunftsfähige Produktions-lösungen vor allem<br />
für die Stahl-, Aluminium-, Metall-, Kunststoff- Verbundstoff-,<br />
Stein- und Glasindustrie.<br />
Der Name STM steht für hochwertige Anlagen, die als<br />
Baukastensystem entwickelt wurden, für individuelle,<br />
hoch effiziente Lösungen, eine ungewöhnlich hohe<br />
Kundenorientierung und unsere Leidenschaft, die<br />
Technologie des immer zu verbessern.<br />
<strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023 63
IMPRESSUM<br />
Lärmfilter<br />
Otoplastiken nach Maß<br />
erscheint dienstags ISSN 0019–9036<br />
Organ des Wirtschaftsverbands Stahl- und Metallverarbeitung e.V.<br />
(WSM), Düsseldorf, Hagen. Die Mitglieder des Verbandes erhalten<br />
den <strong>Industrieanzeiger</strong> im Rahmen ihrer Mitgliedschaft. Zusammenarbeit<br />
im Fachbereich der Gießereitechnik mit der Zentrale für<br />
Gussverwendung, Düsseldorf.<br />
Herausgeberin: Katja Kohlhammer<br />
Mitherausgeber: Prof. Dr.-Ing. Christian Brecher (Werkzeug -<br />
maschinen); Prof. Dr.-Ing. Thomas Bergs (Technologie der<br />
Fertigungsverfahren); Prof. Dr.-Ing. Robert Schmitt (Fertigungsmesstechnik<br />
und Qualitätsmanagement); Prof. Dr.-Ing.<br />
Dipl.-Wirt.-Ing. Günther Schuh (Produktions systematik),<br />
WZL RWTH Aachen<br />
Verlag: Konradin-Verlag Robert Kohlhammer GmbH,<br />
Ernst-Mey-Straße 8, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Germany<br />
Geschäftsführer: Peter Dilger<br />
Verlagsleiter: Peter Dilger<br />
Chefredaktion:<br />
B. A. Alexander Gölz (ag), Phone +49 711 7594–438,<br />
Ernst-Mey-Straße 8, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Germany<br />
Redaktion:<br />
M. A. David Kuhlmann (dak), Phone +49 711 7594–456;<br />
Frederick Rindle (fr), Phone +49 711 7594–539;<br />
Dipl.-Inf. (FH) Uwe Schoppen (us), Phone +49 711 7594–458;<br />
M. A. Nico Schröder (sc), Phone +49 170 6401879;<br />
Dipl.-Ing. Olaf Stauß (os), Phone +49 711 7594–495;<br />
B. A. Hagen Wagner (hw), Phone +49 711 7594–391;<br />
Dipl.-Ing. (FH), Dipl.-Infowirtin (FH) Mona Willrett (mw),<br />
Phone +49 711 7594–285<br />
Ständige freie Mitarbeiter:<br />
Dipl.-Ing. Volker Albrecht (va), Ulrike Dautzenberg (ud),<br />
Karin Faulstroh (kf), Michael Grupp (mg), Sabine Koll (sk),<br />
Markus Strehlitz (ms), Henriette Steuer (hs)<br />
Redaktionsassistenz: Daniela Engel, Phone +49 711 7594–452,<br />
Fax –1452, E-Mail: daniela.engel@konradin.de<br />
Layout: Simkraft Solutions Pvt. Ltd., 400013 Mumbai, Indien<br />
Gesamtanzeigenleiter:<br />
Verantwortlich für den Anzeigenteil:<br />
Joachim Linckh, Phone +49 711 7594–565, Fax –1565<br />
Auftragsmanagement:<br />
Diana Rabalt, Phone +49 711 7594–328, Fax –1328<br />
Leserservice: <strong>Industrieanzeiger</strong> +49 711 7252–209,<br />
konradinversand@zenit-presse.de<br />
Erscheinungsweise: dienstags (15 x jährlich)<br />
Bezugspreis: Inland jährlich 210,00 € inkl. Versandkosten und<br />
MwSt; Ausland 210,00 € inkl. Versandkosten. Einzelpreis 14,10 €<br />
(inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten).<br />
Bestellungen erbitten wir an den Verlag. Sofern die Lieferung nicht<br />
für einen bestimmten Zeitraum ausdrücklich bestellt war, läuft das<br />
Abonnement bis auf Widerruf. Bezugszeit: Das Abonnement kann<br />
erstmals vier Wochen zum Ende des ersten Bezugsjahres gekündigt<br />
werden. Nach Ablauf des ersten Jahres gilt eine Kündigungsfrist<br />
von jeweils vier Wochen zum Quartalsende.<br />
Bei Nichterscheinen aus technischen Gründen oder höherer Gewalt<br />
entsteht kein Anspruch auf Ersatz.<br />
Auslandsvertretungen:<br />
Großbritannien/Irland: Jens Smith Partnership, The Court,<br />
Long Sutton, GB-Hook, Hampshire RG 29 1TA, Phone 01256<br />
862589, Fax 01256 862182, E-Mail: jsp@trademedia.info;<br />
USA: D.A. Fox Advertising Sales, Inc. Detlef Fox, 5 Penn Plaza,<br />
19th Floor, New York, NY 10001, Phone +1 212 8963881,<br />
Fax +1 212 6293988, detleffox@comcast.net<br />
Druck: Konradin Druck, Kohlhammerstraße 1–15,<br />
70771 Leinfelden-Echterdingen, Printed in Germany<br />
© 2023 by Konradin-Verlag Robert Kohlhammer GmbH,<br />
Leinfelden-Echterdingen<br />
Die Hoffmann Group erweitert ihr Sortiment<br />
um Otoplastiken von Cotral Lab. Dieser<br />
Gehörschutz wird individuell gefertigt<br />
und exakt auf den Geräuschpegel am Arbeitsplatz<br />
eingestellt, so dass im Gehörgang<br />
kein Druck- oder Fremdkörpergefühl<br />
entsteht und der Umgebungslärm optimal<br />
gefiltert wird. Präventionstechniker von<br />
Cotral Lab nehmen dafür bei einem Vor-<br />
Ort-Termin von jedem Ohr einen Abdruck.<br />
Zusätzlich werden die Mitarbeiter für Gesundheitsrisiken<br />
durch Lärm sensibilisiert<br />
und jeder einzelne Arbeitsplatz nach der<br />
SAPAN-Methode analysiert. Anschließend<br />
fertigt Cotral Lab im 3D-Verfahren maßgeschneiderte<br />
Otoplasten.<br />
Je nach Arbeitsplatz kommen verschiedene<br />
Gehörschutzmodelle und Filter zum<br />
Einsatz: An Arbeitsplätzen mit sehr hoher<br />
Lärmbelastung dämmt das Modell “Qeos<br />
C-Teile-Management<br />
Sensorgesteuerte Waage löst Bestellungen aus<br />
Bild: Thomas Möller/bitterechtfreundlich.de<br />
Würth Industrie Service hat seine Wiegetechnologie<br />
um das Paletten-Waagensystem<br />
iScalepal erweitert. Dabei handelt es<br />
sich um eine sensorgesteuerte Waage in<br />
Kombination mit einer Europalette. Das<br />
System meldet die Bedarfe von Produktionsmaterialien<br />
und weiteren Artikeln anhand<br />
von Gewicht – und das vom Einsatzort<br />
beim Kunden direkt digital an das<br />
ERP-System von Würth Industrie Service<br />
– und sorgt für einen entsprechenden<br />
Nachschub.<br />
Orange” mit Hochfrequenzfiltern den<br />
Lärm besonders stark in hohen Frequenzen<br />
und reduziert die Lärmbelastung um<br />
17 bis 33 db. Müssen Mitarbeiter in einer<br />
lauten Umgebung gut miteinander kommunizieren,<br />
reduziert “Qeos Green” Geräusche<br />
auf allen Frequenzbändern<br />
gleichmäßig um 17 bis 28 db, ohne den<br />
Ton zu verzerren. Konzentriertes Arbeiten<br />
in Großraumbüros ist hingegen mit dem<br />
Modell “Clear” möglich, das ebenfalls Geräusche<br />
verzerrungsfrei vermindert und<br />
kaum sichtbar ist.<br />
Die Systemfamilie iScale sorgt<br />
für eine nahezu selbständige,<br />
logistische Lagerverwaltung für<br />
C-Teile. Die sensorgesteuerte<br />
Waage ist dabei direkt mit einem<br />
Kanban-Behälter verbunden.<br />
Nun erfolgt die Systemerweiterung<br />
der Wiegetechnologie<br />
mit iScalepal zur effizienten<br />
Produktionsversorgung auf Paletten.<br />
Auch das intelligente<br />
Paletten-Waagensystem basiert<br />
auf höchst präzisen Wiegezellen.<br />
Die Europalette ist dabei<br />
mit einer darunterliegenden, sensorgesteuerten<br />
Waage ausgestattet, welche<br />
permanent das Gewicht auf der Palette<br />
direkt vor Ort beim Kunden prüft, mit dem<br />
bekannten Artikelgewicht abgleicht und<br />
über eine verschlüsselte Schnittstelle an<br />
das Warenwirtschaftssystem des C-Teile-<br />
Anbieters überträgt. Nachdem das Gewicht<br />
einen definierten Wert unterschritten<br />
hat, wird automatisch eine Meldung<br />
erzeugt. Eine Bestellung wird ausgelöst –<br />
die Nachlieferung ist gesichert.<br />
Bild: Cotral Lab<br />
64 <strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023
VORSCHAU «<br />
MESSE EMO<br />
Nach vier Jahren Pause trifft sich die Fertigungsbranche<br />
im September wieder auf ihrer Leitmesse EMO in Hannover.<br />
Exponate und Rahmenprogramm zeigen, wie sich aktuelle<br />
und künftige Herausforderungen meistern lassen.<br />
SCHWEISSEN & SCHNEIDEN<br />
Digitalisierung „erlebbar machen“ will die<br />
Weltleitmesse Schweissen & Schneiden, die<br />
sechs Jahre auf ihren neuen Branchentreff<br />
warten musste. Seither ist viel passiert. Alles<br />
was Rang und Namen hat, ist längst als<br />
Aussteller angemeldet.<br />
BETRIEBSBEDARF<br />
Ein Schweizer Unternehmen produziert in der<br />
Türkei Sicherheitsdruckfarben – mit ihnen<br />
lassen sich Banknoten und Wertdokumente<br />
vor Fälschung schützen. Hochsichere Spezialtore<br />
von Efaflex sorgen dafür, dass Kriminelle<br />
keinen Zugriff auf die eigene Produktionsstätte<br />
haben.<br />
Bild: Hermle<br />
Der <strong>Industrieanzeiger</strong> 11/2023 erscheint am 05.09.2023<br />
Automatisierung<br />
Zufällige Behälterkommissionierung dank Laser und Kamera<br />
rung macht nicht nachhaltiges manuelles<br />
Sortieren überflüssig und dadurch wird<br />
Comau stellt MI.RA/Picker vor, eine intelligente<br />
Automatisierungslösung für<br />
die wahrnehmungsbasierte, zufällige<br />
Behälterkommissionierung. Die vollautomatische<br />
Kommissionierlösung ist an<br />
kommerzielle Roboter jeder Marke sowie<br />
kundenspezifische Behälter oder Greifer<br />
anpassbar und nutzt zwei hochauflösende<br />
Lasersensoren und eine zentrale Kamera<br />
für die autonome Erkennung, Lokalisierung<br />
und Entnahme zufällig platzierter<br />
Gegenstände mit einer Geschwindigkeit<br />
von bis zu 40 Teilen pro<br />
Minute (PPM).<br />
Darüber hinaus garantieren die optimierten<br />
virtuellen Simulationstools und prädiktiven<br />
Algorithmen ein optimales Pfadmanagement<br />
und kollisionsfreie Bewegungsbahnen<br />
für eine präzise und zuverlässige<br />
Leistung bei gleichzeitiger Senkung<br />
der Kosten und potenziellen Risiken.<br />
Die automatisierte Kommissioniesowohl<br />
die Produktivität als auch das<br />
Wohlbefinden der Bediener gesteigert.<br />
Bild: Comau<br />
<strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023 65
» ZULETZT<br />
Ich blieb<br />
Als ich im März 1989 zum <strong>Industrieanzeiger</strong> kam, hatte<br />
ich schon fünf Jahre beim PC Magazin hinter mir.<br />
Das Blatt erschien in den achtziger Jahren beim Verlag<br />
Markt&Technik in Haar bei München. Ich testete dort die<br />
neuesten Drucker und Laptops und schrieb meine Beiträge<br />
mit Wordstar auf einem IBM-PC. An meinem ersten Arbeitstag<br />
im Konradin Verlag sah ich eine elektrische Schreibmaschine<br />
auf meinem Schreibtisch stehen. Ein Schock,<br />
ein technischer Absturz ins Bodenlose. Aber ich blieb.<br />
Der <strong>Industrieanzeiger</strong> erschien damals 104-mal im Jahr.<br />
Jeden Montag endlose Redaktionskonferenzen mit intensiven Reiseberichten. Wo war<br />
ich wann und warum? Mit wem habe ich gesprochen und was mache ich daraus? Jede<br />
Woche zwei Titelseiten, zwei Umbrüche, zwei Drucktermine. Kein Problem, ich blieb.<br />
Hannover wurde mein zweites Zuhause, vor allem wegen der Cebit und der Hannover<br />
Messe. Die Übernachtungen in den Privatquartieren wurden von Jahr zu Jahr<br />
schlimmer. Ich schlief bei Kettenrauchern, Trinkern, Messies und neben dem<br />
Heizungskeller. Im Vergleich zu den Nächten waren die Tage auf der Cebit mit ihren<br />
750.000 Besuchern die reinste Idylle. Die Cebit polarisierte. Egal, ich blieb.<br />
Im Frühjahr 1996 musste ich eine Anwenderreportage über das Internet abliefern.<br />
Weiß jemand, wie viele Rechner 1996 in Deutschland mit einem Internet-Zugang ausgestattet<br />
waren? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich zwei Tage brauchte, um unseren<br />
ersten, auskunftsbereiten Web-User aufzuspüren. Passt schon, ich blieb.<br />
Schon vor 25 Jahren waren einige Kollegen davon überzeugt, dass es den <strong>Industrieanzeiger</strong><br />
nicht mehr lange geben wird. Die Prognosen lagen bei zwei bis maximal drei<br />
Jahren. Der <strong>Industrieanzeiger</strong> blieb. Ich auch.<br />
Bei der Planung der vorliegenden Ausgabe fehlte zum Schluss wie immer ein Zuletzt.<br />
Die Kollegen munterten mich auf, die Rubrik für meinen Abschied zu nutzen. Ich<br />
sei doch so lange dabei gewesen, hätte so viel erlebt. Das stimmt. Also übernahm ich<br />
das Zuletzt, zum letzten Mal. Und jetzt gehe ich. Allen, die noch bleiben, wünsche ich<br />
Erfolg, viel Glück und von Herzen das Beste. Uwe Schoppen<br />
Bild: <strong>Industrieanzeiger</strong><br />
66 <strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023
Deutschland kann seinen<br />
Wohlstand erneuern.<br />
Deutschland kann grüne Industrie<br />
Industrie kann Klimaschutz. Und zwar genau hier,<br />
in Deutschland. Denn hier wird Industrie neu<br />
gedacht. Um unseren Wohlstand zu erneuern und<br />
wettbewerbsfähig zu bleiben.<br />
Mehr erfahren auf bmwk.de/industrie<br />
<strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023 67
Ausfallzeiten vermeiden!<br />
Mit Advanced Analytics identifizieren<br />
wir frühzeitig Schwachstellen in<br />
der Lieferkette und sorgen für eine<br />
stabile Versorgung mit C-Teilen -<br />
intelligent und dynamisch.<br />
68 <strong>Industrieanzeiger</strong> » 10 | 2023