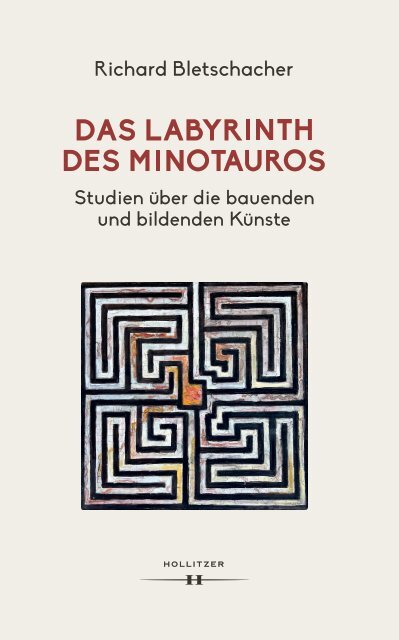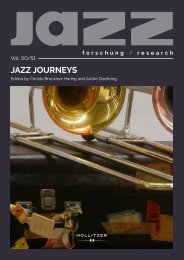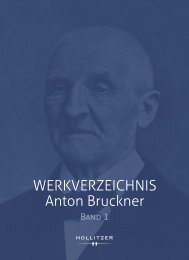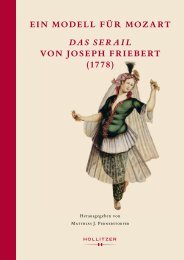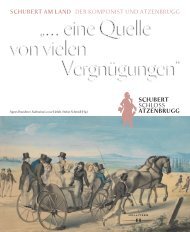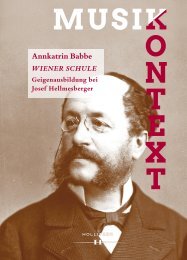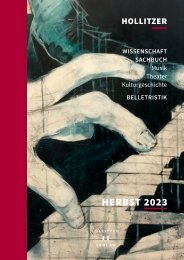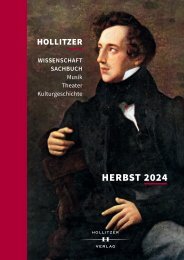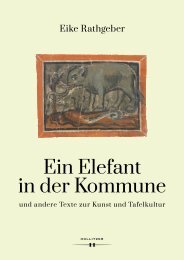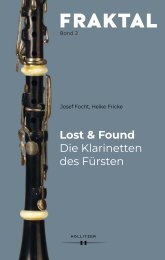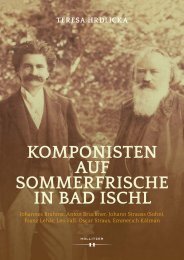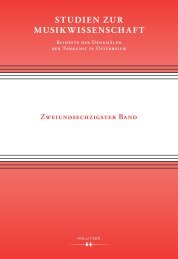Leseprobe_Bletschacher_Minotaurus
- Keine Tags gefunden...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Das Labyrinth des Minotauros
RICHARD BLETSCHACHER<br />
DAS LABYRINTH DES MINOTAUROS<br />
Studien über die bauenden und bildenden Künste
Richard <strong>Bletschacher</strong>: Das Labyrinth des Minotauros.<br />
Studien über die bauenden und bildenden Künste<br />
Hollitzer Verlag, Wien, 2023<br />
Coverbild: © Richard <strong>Bletschacher</strong><br />
Covergestaltung und Satz: Daniela Seiler<br />
Hergestellt in der EU<br />
Alle Rechte vorbehalten<br />
© Hollitzer Verlag, 2023<br />
www.hollitzer.at<br />
ISBN 978-3-99094-165-2
INHALT<br />
Das Labyrinth<br />
7<br />
Der Bau der Pyramiden des Alten Reiches<br />
13<br />
Die bildenden Künste der Etrusker<br />
31<br />
Die Künste des sakralen Bauens und Bildens<br />
in der Epoche der Romanik<br />
37<br />
Die Kunst des Zeichnens<br />
51<br />
Drei Portraits von Albrecht Dürer<br />
77<br />
Giorgio da Castelfranco, genannt Giorgione<br />
85<br />
Zur Baugeschichte der Wiener Hoftheater<br />
129<br />
Putten<br />
139<br />
Amedeo Modigliani und die Frauen<br />
147
Der Maler Georges Rouault<br />
153<br />
Bildende Kunst im Wiener Musiktheater<br />
161<br />
Die Farbe Schwarz<br />
165
DAS LABYRINTH<br />
Eh ich beginne, muss ich eingestehen, dass zwar nicht alles,<br />
aber doch das meiste, was ich im Folgenden schreiben werde,<br />
nicht aus meinem Wissen stammt, sondern aus dem was vor<br />
mir, lange vor mir, schon viele andere niedergeschrieben<br />
haben. Und auch die haben aus uraltem Wissen geschöpft<br />
oder gegraben. Es gibt nicht vieles, das wir aus eigenem<br />
Ahnen oder Erkennen zu wissen meinen. Weitaus das meiste<br />
ist uns aus nicht immer erkannten Quellen und nicht immer<br />
auf erforschliche Weise zugetragen worden. Die alten Buchgelehrten<br />
haben es meist von anderen ihresgleichen durch<br />
Wort oder Schrift erfahren und bei den ältesten Berichten<br />
weiß niemand mehr, wer einst sie erlebt oder erfunden hat.<br />
Ein jeder oder doch die meisten, die je mit den alten<br />
Mythen vertraut gemacht wurden, haben von dem Baumeister<br />
Daidalos gehört, den der alte König Minos von Kreta<br />
mit dem Bau eines Labyrinths betraut habe, um darin die<br />
Schande seiner Familie zu verbergen: den Sohn seiner lüsternen<br />
Gattin Pasiphae. Den habe diese, so heißt es, von einem<br />
Stier empfangen und im Palast geboren. Und er gleiche zu<br />
einem Teile einem Menschen und zum anderen einem Stier.<br />
Minotauros wird er von der Sage genannt. Das Labyrinth,<br />
dessen Eingang bekannt war, sollte in solcher Gestalt gebaut<br />
werden, dass einer, der es betreten habe, den Ausgang nicht<br />
mehr zu finden vermöchte. Dort hinein wurde, nachdem es<br />
vollendet war, der missgestaltete Sohn geführt und darin für<br />
immer den Augen der Welt verborgen gehalten. Um ihn dennoch<br />
nicht durch Hunger sterben zu lassen, wurden ihm von<br />
Zeit zu Zeit junge Menschen zugeführt, die er töten und verschlingen<br />
mochte, da sie ihm nicht entfliehen konnten.<br />
Da sich die Untertanen des kretischen Königs bald über das<br />
Verschwinden ihrer jungen Leute empörten, entschloss sich<br />
der König, die nachbarlichen Mykener zu zwingen, ihm als<br />
Tribut ihrer Unterwerfung alle zehn Jahre zehn Jungfrauen<br />
7
Richard <strong>Bletschacher</strong><br />
und zehn junge Männer zu übergeben, die nun allesamt dem<br />
Minotauros zugeführt wurden zu einem Schicksal, von dem<br />
keiner je mehr erfuhr.<br />
Als einst auch das Los die Athener traf, entschloss sich<br />
der Sohn des Aigeus, Theseus, die Schar der ausgewählten<br />
Opfer anzuführen und das Schiff nach Kreta zu besteigen,<br />
um dort im Dunkel des Labyrinths mit dem Schwert<br />
gegen den Minotauros zu kämpfen und seine Stadt und mit<br />
ihr alle anderen tributpflichtigen griechischen Städte von<br />
der Plage und mit ihr zugleich von der tyrannischen Herrschaft<br />
des Minos zu befreien. In Knossos, dem Wohnsitz<br />
des Minos, angelangt erblickte die Tochter des Königs,<br />
Ariadne, Theseus und empfand Mitleid mit ihm, gab ihm einen<br />
Wollknäuel, den sie ihm riet, am Eingang des Labyrinths<br />
zu befestigen und auf seinem Gang in die unterirdische Tiefe<br />
aufzurollen, bis er auf ihren missgestalteten Halbbruder,<br />
den Minotauros, träfe und ihn mit dem Schwert im Kampfe<br />
besiegte. Danach sollten er und seine Gefährten, durch den<br />
Faden geleitet, wieder zum Eingang zurück und an das Licht<br />
des Tages finden. Dort wolle sie ihn erwarten, um mit ihm<br />
zu entfliehen. Theseus erschlug den Minotauros, befreite<br />
seine Gefährten, kehrte zurück und entfloh gemeinsam mit<br />
Ariadne auf seinem am Ufer zurückgelassenen Schiff.<br />
Diese Erzählung ist der Gründungsmythos von Athen,<br />
denn es wird berichtet, dass, als Theseus siegreich heimgekehrt<br />
war, verabsäumt hatte, die dunklen Segel gegen weiße<br />
zu tauschen und dass sein Vater Aigeus, von der Spitze eines<br />
attischen Felsen dies für ein schlimmes Omen erkannte und<br />
sich hinab in die Fluten stürzte. Seinen Namen trägt seither<br />
das aigaiische Meer. Theseus aber, zum König erwählt, gilt<br />
als der Retter und Gründer der Stadt. Was unterwegs auf der<br />
Insel Naxos der mutigen Ariadne widerfuhr, ist eine schmerzensreiche<br />
und am Ende doch versöhnliche Geschichte, die<br />
hier nicht erzählt werden soll. Auch soll nicht berichtet werden,<br />
was weiter in Knossos geschah, als man was geschehen<br />
war entdeckte. Immerhin gehört es noch zu der Erzählung<br />
8
Das Labyrinth<br />
vom Labyrinth, dass sein Erbauer, vielleicht weil er den<br />
Zorn des alten Minos fürchtete, zwei Paare von kunstvollen<br />
Flügeln gestaltete, mit denen er gemeinsam mit seinem<br />
Sohn Ikaros sich in die Lüfte schwang und über das Meer<br />
hinfliegend entfloh. Der einst an goldenen Schätzen so reiche<br />
und ringsum im Meer so mächtige König Minos aber wurde<br />
nach seinem Tod im Hades zu einem der drei Richter der<br />
Toten bestellt, um so seine im eigenen Leben auf sich geladene<br />
Schuld mit der der nach ihm Gestorbenen zu vergleichen<br />
und zu bemessen.<br />
Wo seither das unerforschte Labyrinth des Daidalos geblieben<br />
ist, weiß niemand mehr zu sagen. Man hat oft danach<br />
gesucht, zuletzt nach der Wiederentdeckung des verschütteten<br />
Palastes im vergangenen Jahrhundert. Zu Zeiten hat man<br />
gemeint, Spuren davon in dessen unterirdischen Gängen zu<br />
finden. Aber in Wahrheit ist es verschollen, zerstört oder hat<br />
nirgendwo anders bestanden als in den Sagen eines untergegangenen<br />
Volkes. Dort ist es besser aufbewahrt als in allem<br />
Wissen der Forscher. Denn nichts ist so gegen das Vergessen<br />
geschützt wie die uralten Mythen, die den Ahnungen und<br />
Hoffnungen der menschlichen Seele entstammen.<br />
Mit dem Mythos von Daidalos und seinem Labyrinth hat<br />
die alte Erzählung nur einen ersten Namen erhalten, nicht<br />
aber einen Anfang genommen. Die Geheimnisse um die verborgenen<br />
Gänge im Innern der Erde reichen zurück bis jenseits<br />
allen geschichtlichen Wissens. Es gab sie, die geheimen<br />
Gänge in den ägyptischen Pyramiden und in den Gebirgen<br />
am Nil. Man hat im Lande der Maya unterirdische Gänge<br />
und Hallen gefunden, die von Menschen geschaffen wurden,<br />
von denen man heute nichts mehr weiß. Man hat Könige und<br />
Kaiser in Gebirgen wohnen lassen, um sie wieder hervortreten<br />
zu lassen, wenn die Zeit gekommen sein wird. Man hat<br />
Schätze verborgen und nach Schätzen gegraben in allen Ländern<br />
der Erde. Man hat heimliche Zeremonien gefeiert an<br />
Orten, die kein Licht je erreicht. Man hat die Unterwelt und<br />
die Hölle tief im Innern der Erde vermutet. So sehr wie man<br />
9
Richard <strong>Bletschacher</strong><br />
am Himmel nach Zeichen und Wegweisungen gesucht hat,<br />
so hat man sie auch unter den sichtbaren Oberflächen von<br />
Ländern und Meeren gesucht. Und die Seelenforschung sucht<br />
heute noch in einem Bereich, von dem unsere Hirne nichts<br />
wissen: im Labyrinth der Brust.<br />
Was nun die Sage vom Labyrinth des Daidalos betrifft, so<br />
kann man mit Recht vermuten, dass sie auf der Insel Kreta,<br />
in Knossos ihren Schauplatz hat, jedoch nicht dort entstanden<br />
ist, sondern auf dem nördlich benachbarten Festland,<br />
das zu jener Zeit sich Hellas nannte. Man weiß, dass sich die<br />
hellenische Kultur, die heute als die mykenische nach ihrem<br />
berühmtesten Herrschaftssitz Mykene auf der Peloponnes<br />
bekannt ist, offenbar mit Waffengewalt gegen die Macht<br />
der minoischen zur Wehr setzte und die Oberhand für lange<br />
Zeit behielt. Kretische Kriegsbeute, die man in Gräbern in<br />
Mykene und Pylos gefunden hat, haben erst in jüngster Zeit<br />
diese These bestätigt.<br />
Der alte Mythos hat aber nicht allein den Bau des Labyrinths<br />
zum Inhalt, sondern auch die Erzählung von einem Stier, der<br />
sich einer menschlichen Frau vermählte. Der Stier war fast<br />
im ganzen Vorderen Orient und in den Ländern um das Mittelmeer<br />
von alters her ein Symbol übermenschlicher Macht.<br />
Vom Apisstier sprechen die ägyptischen Hieroglyphen, vom<br />
Himmelsstier die Keilschrifttafeln der Sumerer und Babylonier.<br />
Zeus, der Herr des griechischen Olymp hat sich selbst<br />
in einen Stier verwandelt, um die phönikische Königstochter<br />
Europa zu entführen, und hat mit ihr auf Kreta eine Nachkommenschaft<br />
gezeugt, die sich heute nach dem Namen ihrer<br />
Mutter Europäer nennt. Im restaurierten Palast von Knossos<br />
kann man die Wandbilder von athletischen Stierspringern<br />
bewundern. Und um die Götter gnädig zu stimmen, wurden<br />
Stiere, oft hundert an der Zahl, geopfert. Weh kam über die<br />
Gefährten des Odysseus, die – vom Hunger getrieben – dem<br />
Sonnengott Helios geweihte Stiere schlachteten gegen des<br />
Odysseus Befehl. Der Stier war den Etruskern und den Iberern<br />
ein Objekt der Verehrung ob seiner männlichen Kraft. Man<br />
10
Das Labyrinth<br />
kann heute noch immer im Stierkampf, der Tauromachie,<br />
in Spanien und im südlichen Frankreich die Spur davon finden.<br />
Die geschmähte Pasiphae, die Weitblickende, wie ihr<br />
Name lautet, war wohl nicht die erste, die sich dem Stier<br />
unterwarf. Der Stier war das Wappen tier und das Symbol des<br />
Südens der damals bekannten Welt, wie es im Norden der<br />
Hirsch und die Hirschkuh waren.<br />
Um nach diesem kleinen, aber bedeutsamen Umweg<br />
zurück zum Labyrinth zu finden, sei nun berichtet von dem<br />
Fortdauern der Labyrinthe in späteren Zeiten und ferneren<br />
Ländern. Die Sage von den geheimen Gängen im Erdinneren<br />
und von den darin verborgenen Schrecknissen oder Schätzen<br />
ist zu keiner Zeit mehr verschwunden. Sie ist zu allen<br />
Zeiten und in allen Ländern immer wieder einmal ans Licht<br />
gekommen, oft ohne dass man erraten konnte woher. In den<br />
Jahrhunderten des erwachenden wissenschaftlichen Denkens<br />
hat man oft versucht, ein Gebilde ähnlich dem einst erbauten<br />
oder ersonnenen wieder erstehen zu lassen. Man hat phantasiereiche<br />
Nachbildungen zu erbauen gesucht, zuerst in Bauten,<br />
dann auch in Pflanzungen. Man hat Irrgänge unter der<br />
Erde gesucht oder Irrgärten in Parkanlagen errichtet. Man hat<br />
Versteckspiele oder geheime Versammlungen in ihnen abgehalten.<br />
Man hat ganze Städte mit geheimen Kellern und Gängen<br />
untergraben, so dass man etwa in der Stadt, in der ich dieses<br />
schreibe, in Wien, von einem Ende der einst ummauerten<br />
Inneren Stadt ans andere gelangen kann, ohne das Licht der<br />
Sonne zu sehen. Man sage nicht, dass dies überall nur geschah,<br />
um Wein oder Pulverfässer zu lagern. Man wühlte sich oft<br />
auch in die Erde, um endlich Geborgenheit zu finden oder um<br />
Dingen zu begegnen, von denen unsere Schulweisheit sich<br />
nichts träumen ließ. Und man hat endlich auch gefunden oder<br />
zu finden gemeint, dass die Natur dem Menschen mit ihren<br />
Geheimnissen sich nie ganz eröffnen will.<br />
Ob all die Berichte, die in späteren Zeiten von Irrgängen<br />
im Inneren der Erde Nachricht geben, den einen Ursprung<br />
haben oder aus weit voneinander entfernten Quellen fließen,<br />
11
Richard <strong>Bletschacher</strong><br />
wer wüsste das zu sagen? Doch will ich einige davon nennen,<br />
denn unsere Literatur ist voll von ihnen. So etwa die<br />
Sage von dem im Inneren des Südtiroler Rosengartengebirges<br />
wohnenden König Laurin, der dort wunderbare Schätze<br />
gehortet haben soll. Oder die Sage des schottischen Sängers<br />
Thomas Rhymour, der von einer Elfenkönigin entführt<br />
wurde in ihr Land unter den Hügeln. Und die nordischen<br />
Sagen von den Höhlen der Trolle, zu denen Henrik Ibsen<br />
seinen von der eigenen Phantasie verfolgten Helden Peer<br />
Gynt hat reisen lassen. Von den Autoren, deren Namen uns<br />
bekannt sind, ist zunächst Dante Alighieri zu nennen, der<br />
von seinem großen Vorbild, dem Römer Vergil, in die finsteren<br />
Schächte der Unterwelt geleitet sein wollte. Dergleichen<br />
Schrecken, wie er dort schaute, hat der Sancho Pansa<br />
des Miguel Cervantes nicht erleben müssen, als er mit seinem<br />
Maultier in ein Erdloch gestürzt und in unterirdischen<br />
Gängen lange Tage fortritt, ehe er, von seinem Herrn Don<br />
Quijote freudig begrüßt, wieder an die Erdoberfläche kam.<br />
Während ich dieses schreibe, erinnere ich mich, dass ich<br />
vor vielen Jahren selbst zwei Erzählungen verfasst habe, die<br />
von verworrenen Labyrinthen berichten.<br />
So wie die Geschichte vom Labyrinth wohl aus vielen Quellen<br />
stammt und doch alle gemeinsam aus dem Heimweh<br />
unserer Seele nach dem Schoß unserer Erde, und so wie sie<br />
keinen erkennbaren Anfang hat, so wird sie wohl auch kein<br />
Ende je finden. Denn sie ist eine Geschichte vom ewigen Forschen<br />
des Menschen, das so wie es den hellen Himmel durchstreift<br />
und ihn mit Wundern und Zeichen belebt, auch nicht<br />
ablassen kann davon, sich in das Innerste der bewohnten Erde<br />
zu wenden.<br />
12
DER BAU DER PYRAMIDEN<br />
DES ALTEN REICHES<br />
Es gibt kaum eine Betrachtung in der Geschichte der Baukunst,<br />
die öfter und von so unterschiedlichen Seiten angestellt<br />
wurde, wie die Frage der Errichtung der ägyptischen<br />
Pyramiden. Dazu ist so Unterschiedliches und oft so wenig<br />
Kompetentes gesagt und geschrieben worden, dass ein Autor,<br />
der es ernst meint mit seiner Arbeit, sich doch eigentlich<br />
hüten sollte, sich in diesen kakophonischen Chor einzumischen.<br />
Nun habe ich allerdings, nun schon vor einigen Jahrzehnten,<br />
für mich selbst einige Überlegungen angestellt und<br />
nach längerem Zögern auch niedergeschrieben, die in manchem<br />
von den vorgetragenen Vermutungen und Behauptungen<br />
abweichen. Darum habe ich mich entschlossen, sie<br />
doch in diesen Band einzufügen, auch wenn sie wahrscheinlich,<br />
ebenso wie fast alles andere bisher Veröffentlichte, vor<br />
der wahren technischen Erfindungsgabe der alten Ägypter<br />
zurückbleiben müssen.<br />
Ehe ich aber beginne, meine Gedanken zu diesem so umstrittenen<br />
Thema darzulegen, will ich bekennen, dass ich<br />
mich keineswegs unter die Ägyptologen oder Archäologen<br />
zählen möchte, auch wenn mich wie manchen anderen nachdenklichen<br />
Menschen diese beiden Gebiete der Forschung<br />
der Menschheitsgeschichte stets angezogen und zuweilen<br />
sogar längerhin gefesselt haben. Und so habe ich mich nebenbei<br />
auch immer wieder einmal in die darauf sich beziehende<br />
Sach- und Fachliteratur versenkt, ohne darum den Anspruch<br />
auf akademisch gegründetes Wissen zu erheben. Diese Wissenschaften,<br />
die sich den ältesten historischen Gegenständen<br />
widmen, sind selbst nicht ebenso alt. Mit den ersten Ausgrabungen<br />
von Pompeji und mit Napoleons Feldzug nach<br />
Ägypten hat alles erst begonnen und man hat sich nach den<br />
ersten zeichnerischen Messungen bald auch daran gemacht,<br />
die Schriften der Alten zu prüfen, um Nachrichten aus<br />
13
Richard <strong>Bletschacher</strong><br />
früherer Zeit über die alten Kulturen zu entdecken. Danach<br />
setzte man den Spaten an nicht nur im Tale des Nil, sondern<br />
auch im Zwischenstromland und in anderen Ländern. Vieles<br />
überaus Staunenswerte hat man seither entdeckt. Manches<br />
ist uns ein Rätsel geblieben. Einige der Fragen, die in weiteren<br />
Kreisen immer wieder aufgeworfen wurden, haben<br />
auch mich beschäftigt. Im Vertrauen darauf, dass die Zeiten<br />
vorüber sind, in denen einem, der die Lösung eines Rätsels<br />
verfehlte, der Kopf vor die Füße gelegt wurde, soll im Folgenden<br />
der Versuch einer Antwort unternommen werden von<br />
einem, der nicht viel mehr als ein wenig Menschenverstand<br />
und ebenso viel Phantasie für sich in Anspruch nehmen kann.<br />
Bauingenieure, Statiker, Religionsforscher, Ethnologen, Historiker<br />
und Astronomen mögen es sich gefallen lassen, einer<br />
Stimme aus dem Abseits vorurteilsfrei solange zuzuhören, bis<br />
sie Argumente zur Entkräftung seiner Hypothese formuliert<br />
haben. Im Vorhinein sei jedoch darauf verwiesen, dass religiöse<br />
Beweggründe für den gewaltigen Bau ebenso wenig wie<br />
davon nicht immer abzugrenzende astrologische Ausrichtungen<br />
Gegenstand der Untersuchung sein können. Es soll genug<br />
damit sein, das Augenscheinliche und Handgreifliche dieser<br />
ungeheuerlichen Unternehmung nachprüfbar darzulegen.<br />
Begonnen sei mit der Behauptung, dass bisher die meisten<br />
Versuche einer Erklärung von einer Kenntnis von Technologien<br />
ausgegangen sind, die aus späteren Epochen stammen,<br />
und dennoch – oder gerade deswegen – zu keinem befriedigenden<br />
Ergebnis führten. Man suchte vor allen anderen die<br />
Frage zu beantworten, wie die riesigen Steinblöcke, die zum<br />
Bau der Jahrtausende überdauernden Werke dienten, in die<br />
Höhe gehievt und fugenlos an die ihnen zugedachten Orte<br />
gestellt werden konnten. Einige gingen dabei von der Überzeugung<br />
aus, dass sie zuerst senkrecht von unten nach oben<br />
gehoben oder gestemmt und danach seitlich verschoben worden<br />
sein mussten. Und man machte sich in der Folge Gedanken<br />
über die technischen Hilfsmittel, mit welchen diese<br />
Steine bewegt werden konnten, von denen die leichteren<br />
14
Der Bau der Pyramiden des alten Reiches<br />
auf ein Gewicht von etwa 2,5 Tonnen, die schwersten aber<br />
auf eines von 40 Tonnen geschätzt werden. Damit scheiterten<br />
solche Überlegungen schon im Ansatz, da dergleichen<br />
Gewichte nur von Hebekränen und Seilen aus einem gehärteten<br />
Metall, vergleichbar unserem Stahl, gehoben werden<br />
können, einem Metall, das in einer Epoche, die wir in Mitteleuropa<br />
noch zur Steinzeit rechnen, auch in dem weit gegen<br />
die Bronzezeit fortgeschrittenen Ägypten nicht zur Verfügung<br />
stand. Auf die untauglichen Versuche der jüngst vergangenen<br />
Jahre, die im besten Falle zeigten, dass mit Kränen<br />
oder Wippen aus Holz und Stricken nur Steinblöcke von weit<br />
geringerem Gewicht und Umfang unversehrt auf eine Ebene<br />
von nur wenigen Metern befördert werden konnten, soll hier<br />
nicht eingegangen werden. Sie mögen für arrangierte Dokumentationen<br />
des Fernsehens recht unterhaltsam sein, können<br />
aber nichts weiter als die Hilflosigkeit der Televisionäre<br />
erweisen. Der zweite Versuch einer Antwort lautet, dass die<br />
Steinblöcke weder gehoben noch gestemmt wurden, sondern<br />
geschoben und gezogen. Aber einerseits konnte weder durch<br />
Schieben noch durch Ziehen eine Verfugung erreicht werden,<br />
die an manchen Stellen – nicht an allen – so eng ist, dass<br />
sie es keinem Grashalm erlaubt, sich zwischen die Ritzen zu<br />
drängen. Andererseits waren die Seitenwände der Quader<br />
nicht groß genug, um Zugriff für die vielen Hände, und die<br />
Standflächen auf den unteren Blöcken nicht breit genug, um<br />
Raum für die vielen Füße zu gewähren, die nötig gewesen<br />
wären, um menschliche Muskelkraft zur Verschiebung der<br />
Kuben einzusetzen. Die Steine konnten bestenfalls, wenn<br />
sie von allen Seiten frei zugänglich waren, mit Menschenoder<br />
Tierkräften, mit Stricken und Rollen auf gleitender<br />
Fläche in sehr geringer Steigung aufwärts bewegt werden.<br />
Diese Bewegungsfreiheit aber war an dem ihnen bestimmten<br />
Standort in unmittelbarer Nachbarschaft anderer Quader<br />
nicht mehr gegeben. Die Steine konnten also am Ende ihres<br />
Weges nicht mehr geschoben oder gezogen werden. Wie aber<br />
wurden sie dann an ihre Stelle gebracht?<br />
15
Richard <strong>Bletschacher</strong><br />
Die erste Überlegung zu dieser Frage führt zu der Behauptung,<br />
dass die Blöcke weder von unten noch von der Seite,<br />
sondern allein von oben auf den Millimeter genau an den<br />
richtigen Platz gefügt werden konnten. Von oben, das will<br />
heißen: Sie mussten von oben nach unten herabgesenkt und<br />
durften danach nicht weiter verschoben werden. Ein unwilliges<br />
Kopfschütteln ist hier zu erwarten. Und es klingt ja auch<br />
irritierend, wenn da einer in der Überzeugung auftritt, dass<br />
jedes Gewicht, um auf eine höhere Ebene gesenkt zu werden,<br />
erst noch um einiges höher gehoben werden muss, um<br />
danach zielgenau abgesenkt zu werden. Die Aufgabe scheint<br />
auf den ersten Blick durch eine solche Manipulation eher<br />
erschwert als erleichtert. Auf den zweiten Blick jedoch lässt<br />
sich erkennen, dass die fugenlose Einsetzung des Steinblockes<br />
auf diese – und nur auf diese Weise – ohne nachträgliche<br />
Rückungen erfolgen kann. Während ein auf dem Boden aufruhender<br />
Stein nur durch seitlich eingesetzte Riesenkräfte<br />
bewegt werden könnte, ist ein schwebender Stein mit dem<br />
kleinen Finger zu lenken. Die Schwerkraft war die stärkste<br />
der Kräfte, die beim Bau der Pyramiden eingesetzt werden<br />
konnten. Dazu musste sie jedoch zuerst überwunden werden.<br />
Wie also wurden die Steine an den höher gelegenen Ort<br />
gebracht, um sie abzusenken?<br />
Man wird sich mit der Antwort darauf ein wenig gedulden<br />
und uns gestatten müssen, noch einmal zurück zu treten,<br />
um die Bedingungen des Landes und der Zeit darzulegen,<br />
unter welchen das Werk bewältigt wurde. Vorab ist dabei<br />
eine Überlegung anzustellen die Werkzeuge, die Baumaterialien<br />
und die Bewegungskräfte betreffend, die den Menschen<br />
dieser Epoche vor etwa viertausendsiebenhundert Jahren zur<br />
Verfügung standen. (Dass die Erbauung der Pyramiden gar<br />
vor sieben- oder mehr tausend Jahren geschehen sein soll,<br />
wie einige phantasievolle Theoretiker neuerdings vermuten,<br />
die sich mehr an astronomischen Kombinationen als an historischen<br />
Erkenntnissen orientieren, wollen wir beiseitelassen.)<br />
Die Epoche, mit der wir uns hier zu befassen haben, ist das<br />
16
Der Bau der Pyramiden des alten Reiches<br />
so genannte Alte Reich der Ägypter, das von ungefähr 2880<br />
bis 2220 währte und danach vermutlich durch einen Wandel<br />
des Klimas und nachfolgende Revolutionen in einer chaotischen<br />
Wirrnis und Zersplitterung endete, die man später als<br />
erste Zwischenzeit bezeichnet hat. Einzig in der Epoche des<br />
Alten Reiches wurden Pyramiden unterschiedlicher Form<br />
und Größe erbaut. Unser Augenmerk richtet sich jedoch<br />
nicht auf die älteren und wesentlich kleineren Stufenpyramiden<br />
und die Bauten des südlichen Sakkara, sondern allein<br />
auf die Werke der vierten Dynastie und hier vor allem auf die<br />
erste und größte der Pyramiden von Gizeh am Unterlauf des<br />
Nils, dem damaligen Zentrum des Reiches. Setzen wir nun<br />
aber einmal mit der klassischen Ägyptologie voraus, dass die<br />
älteste der drei Pyramiden von Gizeh, die des Cheops – auf<br />
ägyptisch nannte er sich Chufu – während der Jahre 2700<br />
bis 2630 vor unserer Zeitrechnung gebaut wurde, so befinden<br />
wir uns noch in einer vorbronzezeitlichen Epoche. Die<br />
einzig vorhandenen metallenen Werkzeuge, Hämmer, Beile,<br />
Winkelmaße und Meißel, waren aus dem weicheren Kupfer<br />
geschmiedet. Daneben dienten den Erbauern Pflöcke und<br />
Balken aus Zedernholz, aus Pflanzenfasern gewundene Stricke<br />
und Seile sowie geschärfte und geschliffene Feuersteine<br />
als Hilfsmittel. Die gebräuchlichen Baumaterialien waren,<br />
wie auch heute noch vor Ort zu überprüfen ist, Steine, Sand<br />
und Wasser, die in großen Mengen verfügbar waren, und<br />
das teure Holz, das vor allem aus dem Libanon eingeführt<br />
werden musste. Die Kräfte, die zur Bewegung dieser Materialien<br />
eingesetzt werden konnten, waren zunächst einmal die<br />
zahlloser durch Befehl gedrungener oder durch Versprechungen<br />
gedungener Arbeiter, die, um den Göttern oder<br />
dem Pharao zu dienen, sich mit ihren Familien in großen,<br />
aus Nilschlammziegeln gemauerten Siedlungen niederließen<br />
und oft ihr ganzes Leben am Bau verbrachten. Denn die<br />
durchschnittliche Lebenserwartung eines ägyptischen Handwerkers<br />
oder Bauern zu jener Zeit wird auf nicht mehr als<br />
dreißig bis fünfunddreißig Jahre geschätzt, Pharaonen und<br />
17
Richard <strong>Bletschacher</strong><br />
Hofbeamte dagegen wurden oft sehr viel älter. Die Erbauer<br />
der Pyramiden waren freie Ägypter, nicht fremde Helfer<br />
oder unterworfene Kriegsgefangene.<br />
Es ist in diesem Zusammenhang vielleicht von Interesse,<br />
die bereits in der Frühzeit dokumentierten Handwerksberufe<br />
anzuführen. Neben den Töpfern, Webern und Korbflechtern<br />
waren dies vor allem die Werkzeugmacher, Schmiede und<br />
Steinmetze. Alles, was mit der Nahrungsbeschaffung und<br />
-zubereitung verbunden war, wurde vermutlich im Verband<br />
der Familien oder Sippen geleistet. Während der vier Monate,<br />
etwa von Mitte Juni bis Anfang Oktober, in welchen der Nil<br />
das Tal überschwemmte, konnten die Bauern auf den Feldern<br />
nicht arbeiten. Um zu pflügen, zu sähen und zu pflanzen,<br />
mussten sie das Abfließen der Gewässer abwarten. Sie konnten<br />
also in dieser Zeit für die Arbeiten am Bau eingesetzt werden,<br />
zumal auch andererseits durch den hohen Wasserstand<br />
des Nil der Transport der Steine auf Booten oder Flößen erst<br />
ermöglicht wurde. Die angeworbenen Arbeiter, seien es nun<br />
Bauern, Flussschiffer oder Handwerker, wurden in Gruppen<br />
eingeteilt, die untereinander wetteiferten. Man schätzt, dass<br />
es sich dabei um fünf durch eigene Namen unterschiedene<br />
Gruppen zu jeweils etwa tausend Männern handelte. Offenbar<br />
scheint es gelungen zu sein, sie vom Sinn dessen, was sie<br />
taten, zu überzeugen. Die Sklaverei war während der Dynastien<br />
des Alten Reiches unbekannt. Erst etwa neunhundert<br />
Jahre später, in der 12. Dynastie unter Pharao Sesotris, begann<br />
man Kriegsgefangene als Arbeitskräfte beim Bau von Bewässerungskanälen<br />
einzusetzen. Aus den in den ausgegrabenen<br />
Siedlungen gefundenen Essensresten konnte man schließen,<br />
dass die Ernährung der Arbeiter keinesfalls mangelhaft war.<br />
Größere Kräfte aber und längere Ausdauer als von Menschen<br />
konnte man von Tieren erwarten, vornehmlich Ochsen,<br />
Eseln und Büffeln. Pferde, und Maultiere wurden erst ab etwa<br />
l700 in Ägypten von den östlichen Kriegsvölkern übernommen.<br />
Diese menschlichen und tierischen Kräfte jedoch waren<br />
nicht die entscheidenden. Als weitaus stärkste aller am Bau<br />
18
Der Bau der Pyramiden des alten Reiches<br />
wirkenden Kräfte wurde – wir haben es schon gesagt – die<br />
Schwerkraft genutzt, die Anziehungskraft der Erde.<br />
Diese genannten und keine anderen Baumaterialien und<br />
Bewegungskräfte bestimmten die Dauer der Arbeit und die<br />
äußere Form des zu schaffenden Werkes. Die Gestalt der<br />
Pyramiden erscheint uns heute so ungewöhnlich, wie sie<br />
damals wohl selbstverständlich erschien. Etwas Vergleichbares<br />
zu schaffen wären wir heute mit den uns gebräuchlichen<br />
Werkstoffen und Bewegungskräften kaum mehr imstande.<br />
Damals aber, vor fast fünftausend Jahren, hätte kein anderes<br />
Gebäude von ähnlichen Ausmaßen entstehen können als<br />
eben dieses in vier Seitenflächen gleichförmig nach oben sich<br />
verjüngende wundersame Gebilde der Grabmäler der Pharaonen.<br />
Und hinzugefügt sei, dass ohne die Nachbarschaft des<br />
Nilstromes, als Träger der schwersten Gewichte, und ohne<br />
die erstaunliche frühzeitige Technik der Wasserkraftnutzung<br />
der Plan eines solch monumentalen Baus gar nicht hätte<br />
gefasst werden können.<br />
Der überwiegende Teil der zu verbauenden Steine wurde<br />
in unmittelbarer Nähe der Pyramiden am Westufer gewonnen,<br />
wie durch petrographische Untersuchungen festgestellt<br />
werden konnte. Die Tatsache aber, dass der feine Kalkstein<br />
für die äußere Verkleidung der Pyramiden in den etwa fünfzehn<br />
Kilometer weit entfernten Steinbrüchen auf dem Ostufer<br />
des Nil gebrochen werden musste, führt unabweisbar<br />
zu der Schlussfolgerung, dass deren Verladung allein auf<br />
dem Wasser geschehen konnte. Während das Brechen und<br />
Behauen der Steine das ganze Jahr über geschehen konnte,<br />
wurde eine Verschiffung vermutlich am besten zu den Zeiten<br />
der alljährlich wiederkehrenden Überschwemmungen<br />
bewerkstelligt, wobei möglicherweise durch Aushebung<br />
von – später wieder zugeschütteten – Kanälen eine größere<br />
Annäherung an die vorgesehenen Baustellen erreicht wurde.<br />
Dies mag auch für die Bausteine der westlichen Steinbrüche<br />
gelten, nachdem man einmal erkannt hatte, dass ihre Fortbewegung<br />
auf dem Wasser leichter zu bewältigen war als auf<br />
19
Richard <strong>Bletschacher</strong><br />
dem Lande. Dieser Gedanke ist keineswegs neu, zumal man<br />
auch an anderen Orten im Ägypten des Alten Reiches die<br />
verblüffenden Kenntnisse des Kanalbaues immer schon sehr<br />
wohl studieren konnte. Für den Transport auf dem Wasser<br />
benutzte man vermutlich Flöße aus starken, runden Holzstämmen,<br />
die man bei der späteren Beförderung der Blöcke<br />
recht gut als Rollen wiederverwenden konnte.<br />
Nach beträchtlichen Mühen war man nun also mit den ersten<br />
Bausteinen am Ort des Geschehens angelangt. Dort hatte<br />
man den Grundriss der geplanten Bauten auf den gewachsenen<br />
Felsboden geritzt oder gezeichnet und ihn nach den Sternbildern<br />
des Nachthimmels ausgerichtet, in einer Weise, die von<br />
den Archäoastronomen auch heute noch bestaunt wird. Im<br />
Messen und Peilen waren die alten Ägypter die unnachahmlichen<br />
Meister. Es war ihnen gelungen, die Ausrichtung der<br />
Seitenwände der Pyramiden nach den Zirkumpolarsternen<br />
des Nordhimmels und die Stellung der drei ältesten Pyramiden<br />
zueinander nach dem Sternbild des Orion mit einer<br />
Genauigkeit zu bestimmen, die uns auch heute noch in staunende<br />
Bewunderung versetzt. Auf diesen Aspekt, der für die<br />
Ägypter von höchster Bedeutung war, und in weiterer Folge<br />
auch die Ausrichtung der Grabkammern und Lichtschächte<br />
bestimmte, soll hier nicht weiter eingegangen werden. Die<br />
Theorien hierüber füllen zahlreiche Bücher. Festgehalten<br />
jedoch muss werden, dass die ägyptischen Gelehrten nicht<br />
nur was die Gestirne betrifft große Meister der Vermessung<br />
waren. Die alljährlichen Überschwemmungen des Nil hatten<br />
zur Folge, dass alle Grundstücke innerhalb des fruchtbaren<br />
Landes Jahr für Jahr neu zu vermessen waren und aller<br />
Besitz neu zugeteilt werden musste. Dies konnte nur durch<br />
Peilung von wenigen festen Bezugspunkten aus geschehen.<br />
Und wenn die Messungen und Rechnungen, die dem Bau der<br />
Pyramiden voraus gingen, großes Wissen, große Geduld und<br />
Sorgfalt erforderten, so gaben die Monumente nach ihrer<br />
Fertigstellung allem Messen und Rechnen ein neues Richtmaß<br />
für spätere Zeiten.<br />
20
Der Bau der Pyramiden des alten Reiches<br />
Hatte man nun auf dem Plateau von Gizeh die Fundamente<br />
des felsigen Bodens für alles Weitere vorbereitet und<br />
sie durch die Anlegung einer Wasserrinne aufs Genaueste<br />
waagrecht ausgerichtet, so rückte man die erste Schicht der<br />
Grundsteine an ihren Platz: immer von innen nach außen<br />
bauend, die inneren Steine zuerst und die Ecksteine zuletzt.<br />
Bevor wir aber zu erklären versuchen, auf welche Weise<br />
die mehr als zwei Millionen gewaltigen Steine von Stufe<br />
zu Stufe immer höher gelangten, wollen wir noch einmal<br />
festhalten, dass nicht allein die Ausrichtung des Grundrisses<br />
und die Neigung der Seitenflächen der Pyramide im Vorhinein<br />
festgelegt, sondern dass auch das verwinkelte System<br />
der inneren Gänge und die Lage der Grabkammern genau<br />
bestimmt werden mussten. Es ist nicht auszudenken, welche<br />
Arbeit zu bewältigen gewesen wäre, wenn eine Aushöhlung<br />
dieser Räume bei steter Einsturzgefahr erst im Nachhinein<br />
mit Hämmern und Meißeln hätte geschehen müssen. Ein<br />
jeder Hohlraum musste durch einen tragenden Stein überdeckt<br />
werden, der seitlich so gut abgestützt war, dass er<br />
weder verrücken noch einbrechen konnte unter der gewaltigen<br />
Last, die nach und nach auf ihn geschichtet wurde.<br />
Statiker haben hieran gewiss auch heute noch einiges zu<br />
bestaunen. Zur Abdeckung der Grabkammer des Königs<br />
etwa wurden die gewaltigsten Blöcke mit einem geschätzten<br />
Gewicht von jeweils 40 Tonnen eingefügt. Dass vor<br />
allem an dieser Stelle die viel bewunderte fugenlose Maßarbeit<br />
durch genaue Vorausberechnung der Position der von<br />
oben abzusenkenden Steine gewahrt wurde, erkennen wir<br />
noch heute, wenn wir die glatten, unverputzten Wände und<br />
Decken der Gänge und Kammern betrachten. Mit welcher<br />
Präzision dabei gearbeitet wurde, lässt uns ein Bericht des<br />
Herodot erahnen, der etwa 2300 Jahre nach Fertigstellung<br />
der Pyramiden Ägypten bereiste. Er will gesehen haben, dass<br />
die Grabkammer des Cheops im Innersten der Pyramide von<br />
einem Wasserteich umgeben war. Da nicht anzunehmen ist,<br />
dass abrinnendes Wasser über all die Jahrhunderte immer<br />
21
Richard <strong>Bletschacher</strong><br />
wieder ersetzt worden ist, muss die Verfugung der Steine<br />
nicht nur vollkommen lückenlos, sondern auch wasserdicht<br />
ausgeführt worden sein.<br />
Die Baumeister und ihre Helfer standen nach Errichtung<br />
des Fundaments nun also vor der entscheidenden Aufgabe,<br />
die zweite und alle folgenden Reihen der Steine an den ihr<br />
vorbestimmten Ort zu bewegen. Die einzige Kraft, die dazu<br />
imstande sein konnte, war – wir haben es schon betont – die<br />
Schwerkraft. Wenn man diesen uns heute so schwer zu fassenden<br />
Gedanken, diesen Rösselsprung der Phantasie, einmal<br />
gewagt hat, sind die danach folgenden Schritte schon<br />
etwas leichter zu erkennen. Und während die Experten weiterhin<br />
die Köpfe schütteln, wagen wir diese Schritte nun und<br />
behaupten: Die bereits gesetzten Steine wurden mit Sand<br />
zugeschüttet, bis sie vollkommen bedeckt waren. Sand war<br />
und ist auch heute noch in unübersehbarer Menge vorhanden.<br />
Und so wurden die nachfolgenden Reihen der Steinquader<br />
sprichwörtlich und tatsächlich in den Sand gesetzt. Nicht<br />
anders als man das auch heute noch mit den um so vieles<br />
kleineren Granitsteinen eines Kopfsteinpflasters zu machen<br />
pflegt. Diese Methode, Straßen zu bauen, ist so lange üblich,<br />
wie es gepflasterte Straßen gibt. Sie ist vielleicht ebenso alt<br />
wie die Pyramiden. Hände für eine solche Arbeit gab es<br />
genug, um den Sand in Körben oder Tüchern aus der Wüste<br />
dorthin zu tragen, wo er dienen sollte. Über das auf solche<br />
Weise aufgeschüttete Polster aus Sand wurden die Steinblöcke<br />
geschoben – und auf der ersten Wegstrecke auch wohl<br />
gezogen – vermutlich auf den Rollen der Baumstämme,<br />
die aus dem Verbund der Flöße gelöst worden waren. Dabei<br />
war darauf zu achten, dass die Steinquader am Bau jeweils<br />
von innen nach außen aufgereiht wurden unter besonderer<br />
Berücksichtigung der auszusparenden Hohlräume für Gänge<br />
und Kammern. Der genaue Zielort der Bausteine wurde von<br />
oben vermessen, vermutlich von Holzgerüsten aus, durch<br />
Lote und genormte Metallstäbe, die in den Sand gesteckt<br />
wurden. Und wenn die senkrechte Ausrichtung und Senkung<br />
22
Der Bau der Pyramiden des alten Reiches<br />
fixiert war, wurde von vielen Händen der Sand neben dem<br />
Steinblock beiseite gekehrt. Er rinnt unter dem Gewicht der<br />
Blöcke hervor. Man braucht dazu nicht unter den Stein zu<br />
greifen. Es genügt, ihn seitlich zu entfernen. Er rinnt und rieselt<br />
durch das Gewicht, das ihn presst, bis auf das letzte Korn.<br />
Wo nicht, dort wurde mit Wasser nachgeholfen, um ihn auszuschwemmen.<br />
Das ist eine Arbeit auch für schwache Hände.<br />
Und es steht zu befürchten, dass die Bauaufseher keine Skrupel<br />
kannten, auch Frauen und Kinder zu diesen Diensten<br />
einzusetzen. Ein jedes Kind hat das Spiel mit dem rieselnden<br />
Sand schon einmal mit leichteren Gewichten im Sandkasten<br />
erprobt. Der Stein senkt sich durch den schwindenden Sand<br />
an seinen vorbestimmten Platz und braucht nicht weiter verschoben<br />
zu werden, wenn zuvor genau gemessen wurde.<br />
Die Ausführung des gewaltigen Werkes erfolgte also,<br />
wenn wir diese Gedanken gelten lassen, nicht in der „Aufrichtung“<br />
der sich nach oben zu verjüngenden Pyramiden<br />
durch senkrechte seitliche Bautürme, sondern gleichsam<br />
von innen heraus durch das Anschleppen und Anhäufen der<br />
Steinblöcke und durch deren Zuschütten mit Sand. Und<br />
die Arbeiten wurden fortgesetzt auf einer dadurch allmählich<br />
sich erhöhenden Ebene der Bautätigkeit. Aus der Ferne<br />
mochte man damals den Eindruck gewinnen, dass ein riesiger,<br />
weit ausgedehnter und flach ansteigender Sandhügel sich<br />
unter den Füßen der Bauleute erhob, einer mächtigen Düne<br />
der nahen Wüste vergleichbar. Und dazu bedurfte es keiner<br />
weiteren Hilfsmittel als der vielen tausend Hände, die den<br />
Sand in kleinen Gefäßen, seien es Weidenkörbe oder Tragtücher<br />
über immer höher wachsende Rampen herbeitrugen.<br />
Diese Rampen wurden vermutlich aus den zum Bau ungeeigneten<br />
Gesteinsbrocken aus den Steinbrüchen erbaut, aus<br />
Bruchstücken, die, von geringerem Ausmaß und Gewicht,<br />
auch von Ochsen und Eseln über die Kanäle herbeigeschafft<br />
und zu Stützmauern verwendet werden konnten, um das<br />
Abrutschen oder Auseinandersickern des aufgehäuften<br />
Sandes zu verhindern. Wenn man nun etwa die Höhe der<br />
23