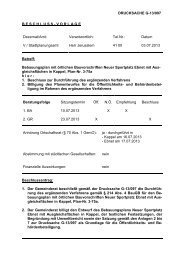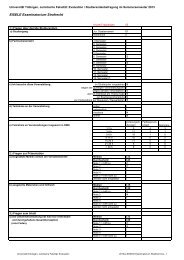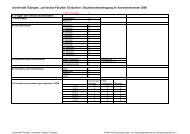Das 6. Strafrechtsreformgesetz - Juristische Fakultät - Universität ...
Das 6. Strafrechtsreformgesetz - Juristische Fakultät - Universität ...
Das 6. Strafrechtsreformgesetz - Juristische Fakultät - Universität ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
U NIVERSITÄT T ÜBINGEN · JURISTISCHE F AKULTÄT<br />
P ROF. DR. GÜNTHER · PROF. DR. DR. KÜHL · PROF. DR. WEBER<br />
Strafrechtliches Seminar im Wintersemester 1998/99<br />
zum Thema „<strong>Das</strong> <strong>6.</strong> <strong>Strafrechtsreformgesetz</strong>“<br />
Diebstahl und Unterschlagung, §§ 242 ff. StGB<br />
von<br />
Frank Fad<br />
Tübingen · Januar 1999
Verfasser:<br />
Stud. iur. Frank Fad<br />
frank.fad@jura.uni-tuebingen.de<br />
URL der Seminararbeit:<br />
http://www.jura.uni-tuebingen.de/kuehl/mat/sem/ws98/diebst.pdf<br />
Technische Aufbereitung:<br />
Ref. Jochen Herkle<br />
c/o Lehrstuhl Prof. Dr. Dr. Kühl<br />
Wilhelmstraße 7<br />
72074 Tübingen<br />
herkle@jura.uni-tuebingen.de<br />
Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen eines von den Professoren<br />
Dr. Hans-Ludwig Günther, Dr. Dr. Kristian Kühl und Dr. Ulrich Weber<br />
im Wintersemester 1998/99 veranstalteten Blockseminars zum Thema<br />
„<strong>Das</strong> <strong>6.</strong> <strong>Strafrechtsreformgesetz</strong>“.<br />
Sie ist veröffentlicht auf der Homepage von Prof. Dr. Dr. Kühl, Inhaber<br />
des Lehrstuhls für Strafrecht, Strafprozeßrecht und Rechtsphilosophie an<br />
der <strong>Universität</strong> Tübingen (http://www.jura.uni-tuebingen.de/kuehl).<br />
Eine Übersicht über die im Volltext eingestellten Seminararbeiten findet<br />
sich unter http://www.jura.uni-tuebingen.de/kuehl/mat_ws98.htm.<br />
Alle Rechte vorbehalten · Copyright © 1999 Frank Fad
Inhaltsverzeichnis<br />
Inhaltsverzeichnis II<br />
Literaturverzeichnis..................................................................................................................III<br />
I. Überblick über die Tatbestände des 19. Abschnitts ..........................................................1<br />
II. Die Änderungen des <strong>6.</strong> StrRG im einzelnen......................................................................1<br />
1. Strafbarkeit der Drittzueignung ..........................................................................................1<br />
a) Frühere Reformbestrebungen .........................................................................................2<br />
b) Rechtslage nach altem Recht..........................................................................................3<br />
aa) Die Figur des „absichtlos-dolosen Werkzeugs“ .......................................................3<br />
bb) Jede Drittzueignung ist eine Sichzueignung ............................................................4<br />
cc) Drittzueignung nur bei mittelbarem wirtschaftlichem Vorteil .................................5<br />
c) Rechtslage nach neuem Recht........................................................................................6<br />
2. Unterschlagung als Auffangtatbestand...............................................................................8<br />
a) Frühere Reformbestrebungen .........................................................................................9<br />
b) Rechtslage nach altem Recht: insbesondere Strafbarkeitslücken ................................10<br />
c) Probleme des neuen Rechts..........................................................................................12<br />
aa) Reichweite der Zueignung......................................................................................12<br />
bb) Versuchsbeginn bei der Drittzueignung.................................................................14<br />
cc) Reichweite der formellen Subsidiarität ..................................................................14<br />
dd) Veruntreuende Unterschlagung, § 246 II ...............................................................15<br />
3. Änderungen in § 244 I ......................................................................................................15<br />
a) Gleichstellung der Schußwaffen mit anderen gefährlichen Werkzeugen<br />
(§ 244 I Nr. 1)...................................................................................................................15<br />
b) Diebstahl mit sonstigen Werkzeugen und Mitteln, § 244 I Nr. 1b...............................17<br />
c) Der „Wohnungseinbruchsdiebstahl“, § 244 I Nr. 3......................................................18<br />
4. Sonstige Änderungen........................................................................................................19<br />
a) § 248 c III .....................................................................................................................19<br />
b) Wegfall von § 244a IV.................................................................................................20<br />
III. Unterbliebene Änderungen, insb. „Entkriminalisierung“ des Ladendiebstahls .......20<br />
1. Frühere Reformbestrebungen ...........................................................................................20<br />
2. Der Gesetzesentwurf der Fraktion „Bündnis 90/Die Grünen“ .........................................21<br />
3. Kritik.................................................................................................................................21
Literaturverzeichnis<br />
Literaturverzeichnis III<br />
Artkämper, Heiko, Hausbesetzer, Hausbesitzer, Hausfriedensbruch, Berlin u.<br />
a. 1995 (zit.: Artkämper)<br />
Arzt, Gunther, u. a. Entwurf eines Gesetzes gegen Ladendiebstahl, Tübingen<br />
1974 (zit.: AE-GLD)<br />
Arzt, Gunther/Weber, Ulrich, Strafrecht: Besonderer Teil. Lehrheft 3: Vermögensdelikte<br />
(Kernbereich), 2. Auflage, 1986 (zit.: Bearbeiter in<br />
Arzt/Weber, LH 3)<br />
Jähnke, Burkhard/Laufhütte,<br />
Heinrich Wilhelm/Odersky, Walter<br />
(Hrsg.)<br />
Leipziger Kommentar zum Strafgesetzbuch, 11. Auflage,<br />
Berlin, New York 1992 ff (zit.: Bearbeiter in LK).<br />
Behm, Ulrich, Umfassen die Schutzobjekte des § 123 Abs. 1 StGB auch<br />
Zubehörflächen? In: GA 1986, 547 (zit.: Behm, GA 1986,<br />
547)<br />
Binding, Karl, Lehrbuch des gemeinen Deutschen Strafrechts: Besonderer<br />
Teil, Leipzig 1896 (zit.: Binding, Lehrbuch)<br />
Bockelmann, Paul, Ist eine berichtigende Auslegung des § 246 statthaft? in:<br />
Monatsschrift für Deutsches Recht 1953, 3 (zit. Bockelmann,<br />
MDR, 1953, 3)<br />
Baumann, Jürgen/Weber, Ulrich/Mitsch,<br />
Wolgang,<br />
Strafrecht Allgemeiner Teil, 10. Auflage, Bielefeld 1995<br />
(zit.: Bearbeiter in Baumann/Weber/Mitsch)<br />
Charalambakis, Aristotelis, Der Unterschlagungstatbestand de lege lata und de lege<br />
ferenda, München 1982<br />
Fahl, Christian, „Drittzueignung“, Unterschlagung und Irrtum über die<br />
eigene Täterschaft, in: <strong>Juristische</strong> Schulung 1998, 24 (zit.:<br />
Fahl, JuS 1998, 24)<br />
Frisch, Wolfgang/Schmid, Werner,<br />
(Hrsg.)<br />
Testschrift für Hans-Jürgen Bruns zum 70. Geburtstag,<br />
Köln u. a. 1978 (zit.: Bearbeiter in Bruns-FS)<br />
Geppert, Klaus, Zur Scheinwaffe und anderen Streifragen zum „Bei-Sich-<br />
Führen“ einer Waffe im Rahmen von §§ 244 und 250<br />
StGB, in: <strong>Juristische</strong> Ausbildung 1992, 498 (zit.: Geppert,<br />
Jura 1992, 498)
Literaturverzeichnis IV<br />
Goltdammer, Die Materialien zum Strafgesetzbuch, Band 2, Berlin<br />
1852 (zit.: Goltdammer, Materialien)<br />
Gössel, Karl Heinz, Strafrecht, Besonderer Teil: Band 2, Straftaten gegen die<br />
Rechtsgüter des Individuums, 1996 (zit.: Gössel, BT 2)<br />
Haft, Fritjof, Grundfälle zu Diebstahl und Raub mit Waffen in: <strong>Juristische</strong><br />
Schulung 1988, 364 (zit.: Haft, JuS 1988, 368)<br />
Hörnle, Tatjana, Die wichtigsten Änderungen des Besonderen Teils des<br />
StGB durch das <strong>6.</strong> Gesetz zur Reform des Strafrechts, in:<br />
<strong>Juristische</strong> Ausbildung 1998, 169 (zit.: Hörnle, Jura 1998,<br />
169)<br />
Hruschka, Joachim, Anmerkung zu OLG Kölnm NJW 1978, 652 in: Neue<br />
<strong>Juristische</strong> Wochenschrift 1978, 1338 (zit.: Hruschka,<br />
NJW 1978, 1338)<br />
Jescheck, Hans-Heinrich/Weigend,<br />
Thomas,<br />
Lehrbuch des Strafrechts: Allgemeiner Teil, 5. Auflage,<br />
Berlin 1996 (zit.: Jescheck/Weigend)<br />
Katzer, Hans, Gelegenheit macht Diebe – OLG Köln NJW 1978, 652<br />
und NZWehrR 1978, 36 sowie BGHSt 30, 44, in: NStZ<br />
1982, 236 (zit.: Katzer, NStZ 1982, 236)<br />
Kotz, Peter, Gelegenheit macht Diebe – OLG KölnNJW 1978, 652<br />
und NZWehrR 1978, 36 sowie BGBSt 30, 44, in: <strong>Juristische</strong><br />
Schulung 1982, 97 (zit.: Kotz, JuS 1982, 97)<br />
Kreß, Claus, <strong>Das</strong> Sechste Gesetz zur Reform des Strafrechts, in: Neue<br />
<strong>Juristische</strong> Wochenschrift 1998, 633 (zit.: Kreß, NJW<br />
1998, 633)<br />
Krey, Volker, Strafrecht Besonderer Teil, Band 2: Vermögensdelikte,<br />
11. Auflage, Stuttgart u. a. 1997 (zit.: Krey, BT 2)<br />
Küper, Wilfried, Strafrecht, Besondere Teil: Definitionen mit Erläuterungen,<br />
2. Auflage, Heidelberg 1998 (zit.: Küper)<br />
Lackner, Karl, Strafgesetzbuch mit Erläuterungen, 21. Auflage, München<br />
1995 (zit.: Bearbeiter in Lackner)<br />
Maurach, Reinhart/Schroeder,<br />
Friedrich-Christian/Maiwald,<br />
Manfred,<br />
Strafrecht Besonderer Teil. Teilband 1: Straftaten gegen<br />
Persönlichkeits- und Vermögenswerte, 8. Auflage, Heidelberg<br />
1995 (zit.: Maurach/Schroeder/Maiwald, BT 1)
Literaturverzeichnis V<br />
Otto, Harro, Die Struktur des strafrechtlichen Vermögensschutzes,<br />
Berlin 1970<br />
Ranft, Otfried, Grundfälle aus dem Bereich der Vermögensdelikte (Teil<br />
2), in <strong>Juristische</strong> Arbeitsblätter 1984, 277 (zit.: Ranft, JA<br />
1984, 227)<br />
Rengier, Rudolf, Strafrecht Besonderer Teil I: Vermögensdelikte, 2. Auflage,<br />
München 1998 (zit.: Rengier, BT I)<br />
Roxin, Claus, Täterschaft und Tatherrschaft, <strong>6.</strong>Auflage, New York,<br />
Berlin 1994 (zit.: Roxin, Täterschaft)<br />
Rudolphi, Hans-Joachim, Der Begriff der Zueignung, in: Goltdammer’s Archiv für<br />
Strafrecht 1965, 33 (zit.: Rudolphi, GA 1965, 33)<br />
Rudolphi, Hans-Joachim/Horn,<br />
Eckhard/Samson, Erich/Günther,<br />
Hans-Ludwig,<br />
Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch (Loseblatt),<br />
<strong>6.</strong> Auflage, Neuwied/Kretel 1995 ff (zit.: Bearbeiter<br />
in SK)<br />
Samson, Erich, Grundprobleme des Unterschlagungstatbestandes (§ 246<br />
StGB), in: <strong>Juristische</strong> Arbeitsblätter 1990, 5 (zit.: Samson,<br />
JA 1990, 5)
I. Überblick über die Tatbestände des 19. Abschnitts<br />
Diebstahl (§§ 242 ff StGB 1 ) und Unterschlagung (§ 246) sind die wichtigsten Tatbestände des<br />
19. Abschnitts des Besonderen Teils. Beides sind Zueignungsdelikte. Sie schützen also das<br />
Eigentum gegen rechtswidrige Zueignung durch Nichtberechtigte.<br />
Die Tatbestandsvoraussetzungen des Grundtatbestand des Diebstahls (§ 242) und der der<br />
Unterschlagung (§ 246) sind seit Erlaß des Strafgesetzbuches für das Deutsche Reich 2 bis zum<br />
Inkrafttreten des Sechsten <strong>Strafrechtsreformgesetz</strong> (<strong>6.</strong> StrRG) vom 2<strong>6.</strong>01.1998 am 01.04.1998<br />
unverändert geblieben. Durch das Erste Gesetz zur Reform des Strafrechts (1. StrRG) vom<br />
25.0<strong>6.</strong>1969 3 wurde der Qualifikationstatbestand des § 243 durch die Regelbeispiele für besonders<br />
schwere Fälle ersetzt. Der früher in § 244 enthaltene Rückfalldiebstahl, der später ganz<br />
aus dem StGB gestrichen wurde, wurde durch einen Qualifikationstatbestand des Waffen- und<br />
Bandendiebstahls ersetzt. Durch das Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch vom<br />
02.03.1974 4 wurde mit der Abschaffung der Übertretungen auch der Mundraub (§ 370 I Nr. 5<br />
a. F.) abgeschafft, so daß für diese Fälle der Vergehenstatbestand des Diebstahls einschlägig<br />
wurde. Der Verbrechenstatbestand des § 244a wurde durch das Gesetz zur Bekämpfung des<br />
illegalen Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen der organisierten Kriminalität<br />
(OrgKG) 5 vom 15.07.1992 eingefügt.<br />
II. Die Änderungen des <strong>6.</strong> StrRG im einzelnen<br />
1. Strafbarkeit der Drittzueignung<br />
Fälle:<br />
Fall 16 : Bauer B beauftragt seinen Knecht K, der selbst ohne Zueignungsabsicht handelt, die<br />
Gänse des Nachbarn N, die sich noch in dessen Gewahrsam befinden, in seinen eigenen Stall<br />
zu treiben, um sie zu behalten.<br />
Fall 2: Knecht K verbringt die Gänse des Nachbarn N, die sich noch in dessen Gewahrsam<br />
befinden, ohne Wissen des Bauern B in dessen Stall, damit dieser sie behalten kann.<br />
Fall 3: Bauer B beauftragt seinen Knecht K, der selbst ohne Zueignungsabsicht handelt, die<br />
Gänse des Nachbarn N, die diesem entlaufen sind, in seinen eigenen Stall zu treiben, um sie<br />
zu behalten.<br />
Fall 4: T, ein Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit der ehemaligen DDR, hat aus<br />
Briefsendungen aufgrund entsprechender Anordnung seines Ministeriums Geld entnommen<br />
und dem Staatshaushalt der DDR zugeführt.<br />
Fall 5: 7 T ist Kassenwart bei einem Fußballverein. Er zahlt eigenmächtig Gelder aus der Vereinskasse<br />
an die Spieler des Vereins aus.<br />
1<br />
§§ ohne Gesetzesangabe sind solche des StGB.<br />
2<br />
RGBl 1871, 127 ff.<br />
3<br />
BGBl I 1969, 645 ff.<br />
4<br />
BGBl I 1974, 469 ff.<br />
5<br />
BGBl I 1992, S. 1302.<br />
6<br />
nach RGSt 48, 58 ff (vereinfacht).<br />
7<br />
nach BGH MDR 1970, 560.<br />
Frank Fad
II. Die Änderungen des <strong>6.</strong> StrRG im einzelnen<br />
a) Frühere Reformbestrebungen<br />
<strong>Das</strong> Strafgesetzbuch für die Preußischen Staaten vom 14.04.1851, das erstmals ein einheitliches<br />
materielles Strafrecht in ganz Preußen einführte8 , definierte in § 215 Diebstahl wie folgt:<br />
„Einen Diebstahl begeht, wer eine fremde bewegliche Sache einem Anderen in der Absicht<br />
wegnimmt, dieselbe sich rechtswidrig zuzueignen“. Diese Definition entsprach dem bis zum<br />
Inkrafttreten des <strong>6.</strong> StrRG geltenden Recht. Auf das Erfordernis einer Bereicherungsabsicht<br />
wurde – im Gegensatz zu früheren Entwürfen9 – verzichtet. Die Bereicherungsabsicht wurde<br />
für überflüssig gehalten. Der Gesetzgeber hat auf eine ausdrückliche Erwähnung der Drittzueignung<br />
verzichtet. In früheren Entwürfen war die Drittzueignungsabsicht dagegen ausdrücklich<br />
erwähnt worden. So etwa im Entwurf des Strafgesetzbuchs für die Preußischen Staaten<br />
nach den Beschlüssen des Königlichen Staatsraths von 1843: „Einen Diebstahl begeht, wer<br />
eine fremde bewegliche Sache ihrem Eigenthümer oder Inhaber ohne dessen Einwilligung in<br />
der Absicht wegnimmt, dieselbe sich oder einem Anderen rechtswidrig zuzueignen“. 10 Der<br />
Sache nach entsprach dieser Vorschlag dem nach dem <strong>6.</strong> StrRG geltenden Recht. Hierdurch<br />
sollte sichergestellt werden, daß auch die unentgeltliche Weitergabe der weggenommenen<br />
Sache an Dritte strafbar ist. Die Erwähnung der Drittzueignung wurde durch den Gesetzgeber<br />
des Preußischen StGB für überflüssig erachtet, weil niemand eine Sache einem anderen zueignen<br />
könne, ohne sie vorher sich zugeeignet zu haben. 11<br />
Im Entwurf eines Strafgesetzbuches für den Norddeutschen Bund vom Juli 1869 wurde der<br />
Diebstahlstatbestand in § 215 wie folgt gefaßt: „Einen Diebstahl begeht, wer eine fremde bewegliche<br />
Sache einem Anderen rechtswidrig in der Absicht wegnimmt, durch deren Zueignung<br />
sich oder einem Anderen Gewinn zu verschaffen.“ 12 Hier wurde also wieder – wie schon<br />
im Entwurf von 1833 – neben der Zueignungsabsicht auch eine Bereicherungsabsicht gefordert.<br />
Die Bereicherungsabsicht wurde für erforderlich erachtet, um sicherzustellen, daß nicht<br />
die bloße Sachentziehung unter den Diebstahl fällt. Daß ein Diebstahl auch dann vorliegen<br />
sollte, wenn der Dieb nicht für sich selbst, sondern für einen Dritten stiehlt, wurde durch die<br />
Drittbereicherungsabsicht sichergestellt. 13 Dieser Änderungsvorschlag wurde allerdings wieder<br />
verworfen.<br />
Nach dem amtlichen Entwurf eines Allgemeinen Deutschen Strafgesetzbuchs nebst Begründung<br />
von 1925 (E 25) sollte beim Diebstahl auf die Zueignungsabsicht ganz verzichtet werden<br />
und statt dessen eine Bereicherungsabsicht erforderlich sein. 14 Begründet wurde dies damit,<br />
daß das typische des Diebstahls in der Bereicherung liege. 15 Der Entwurf eines Strafgesetzbuches<br />
von 1962 (E 62) hat beim Diebstahl und bei der Unterschlagung im Gegensatz<br />
zum E 25 und zum Entwurf von 1927 (E 27) 16 auf eine Bereicherungsabsicht verzichtet. 17<br />
8 Schubert/Regge, Bd. 1, S. XLIV.<br />
9 vgl. z. B. Revidierter Entwurf des Strafgesetzbuches für die königlichen Preußischen Staaten von 1833 (abgedruckt<br />
in Schubert/Regge, Bd. 1, S. 81), der Diebstahl wie folgt definiert: „Wer eine fremde bewegliche Sache,<br />
in der Absicht, sich dieselbe zuzueignen und dadurch sich oder Dritten einen unrechtmäßigen Gewinn zu<br />
verschaffen, ... wegnimmt, begeht einen Diebstahl“.<br />
10 abgedruckt in Schubert/Regge, Bd. 3, S. 67.<br />
11 Goltdammer, Strafgesetzbuch, Bd. 2, S. 467.<br />
12<br />
S. 58.<br />
13<br />
Motive zum Entwurf von 1869, S. 163.<br />
14<br />
§ 296 I des E 25 lautet: „Wer eine fremde bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, sich<br />
oder einem Dritten damit unrechtmäßig zu bereichern, wird ... bestraft“.<br />
15<br />
Begründung zum E 25, S. 151.<br />
16<br />
vgl. § 328 I des E 27, abgedruckt in RT-Drucks., Wahlperiode V, 18. Ausschuß, 1930, Nr. 2<br />
17<br />
E 62, S. 400.<br />
Frank Fad<br />
2
II. Die Änderungen des <strong>6.</strong> StrRG im einzelnen<br />
Auch dieser Entwurf wollte durch Erwähnung der Drittzueignungsabsicht klarstellen, daß<br />
Diebstahl und Unterschlagung verwirklicht sind, wenn der Täter die Sache nicht sich, sondern<br />
einem Dritten zueignet. 18 Aus denselben Gründen wollte bereits der Entwurf der Strafrechtskommission<br />
von 1913 (E 13) 19 und der Entwurf zu einem Deutschen Strafgesetzbuch von<br />
1919 (E 19) 20 die Drittbereicherungsabsicht in den Diebstahlstatbestand aufnehmen.<br />
b) Rechtslage nach altem Recht<br />
Bis zum Inkrafttreten des <strong>6.</strong> StrRG war beim Diebstahl die Absicht des Täters erforderlich,<br />
die Sache sich rechtswidrig zuzueignen. Dieselbe Zueignungsabsicht war auch beim Entziehen<br />
elektrischer Energie (§ 248 c), beim Raub (§ 249), bei der Jagdwilderei (§ 292 Abs. 1 a.<br />
F.) und bei der Fischwilderei (§ 293 I a. F.) erforderlich. Auch bei der Unterschlagung (§ 246)<br />
mußte der Täter sich die Sache zueignen.<br />
aa) Die Figur des „absichtlos-dolosen Werkzeugs“<br />
In Fall 1 hat sich K mangels Zueignungsabsicht nicht wegen Diebstahls (§ 242) strafbar gemacht.<br />
B kann mangels rechtswidriger Haupttat nicht wegen mittäterschaftlichen Diebstahls<br />
(§§ 242, 25 II) oder Anstiftung zum Diebstahl (§§ 242, 26) bestraft werden. <strong>Das</strong> Reichsgericht<br />
hat B wegen Diebstahls in mittelbarer Täterschaft (§§ 242, 25 I Alt. 2) mittels eines gutgläubigen<br />
Werkzeugs bestraft. 21 Problematisch hierbei ist, daß K eben nicht gutgläubig ist,<br />
ihm fehlt lediglich die Zueignungsabsicht. Gegen die Annahme von mittelbarer Täterschaft<br />
wurde eingewandt, daß die bloße Veranlassung einer Tat und die Zueignungsabsicht nicht<br />
ausreichen, um B eine äußere Macht über den Vordermann K zu geben. 22 Hiergegen wird –<br />
von einem funktionalen Tatherrschaftsbegriff ausgehend – vorgebracht, daß die fehlende Absicht<br />
des Täters zu einem Übergewicht des Hintermannes, der das Werkzeug zur Verfolgung<br />
seiner Ziele einsetzt, führt. 23 Der Vordermann kann wegen Beihilfe zum vom Hintermann B<br />
begangenen Diebstahl (§§ 224 I, 27 I) bestraft werden, denn er will mindestens die Tat des<br />
Hintermannes unterstützen. 24<br />
In Fall 2 hilft die Figur des absichtslos-dolosen Werkzeugs indessen nicht weiter. Hier fehlt B<br />
jede Kenntnis von der Tat des K. K kann mangels Haupttat auch nicht wegen Beihilfe zum<br />
Diebstahl bestraft werden.<br />
Zu untersuchen ist, ob mit der Figur des absichtslos-dolosen Werkzeugs auch Fälle der Unterschlagung<br />
gelöst werden können. K macht sich in Fall 3 nicht wegen Unterschlagung (§ 246)<br />
strafbar, da er die Gänse sich hier nicht zueignet. Es fehlt an einem Zueignungswillen des K,<br />
der die Gänse nicht sich, sondern nur B zueignen will. B kann sich aber hier auch nicht wegen<br />
Unterschlagung in mittelbarer Täterschaft (§§ 246, 25 I Alt. 2) strafbar machen. Betrachtet<br />
man K als absichtslos-doloses Werkzeug, so können B zwar die objektiven Tatbeiträge des K<br />
18 E 62, S. 401, 409.<br />
19 vgl. § 355 I des E 13, abgedruckt in Entürfe zu einem Deutschen Strafgesetzbuch, veröffentlicht auf Anordnung<br />
des Reichsjustizministeriums, Berlin 1920, Teil 1, S. 83.<br />
20 vgl. § 359 I des E 19, abgedruckt a. a. O., Teil 2, S. 79, und Denkschrift zum E 19, abgedruckt a. a. O., Teil<br />
3, S. 303.<br />
21<br />
RGSt 48, 58 (59 f), im Originalfall war allerdings die Bösgläubigkeit nicht feststellbar.<br />
22<br />
Roxin¸Täterschaft, S. 341, 643.<br />
23<br />
Cramer in Schönke/Schröder, Vor § 25, Rn. 77; Jescheck/Weigend, S. 669 f; Weber in Bau-<br />
mann/Weber/Mitsch, § 29, Rn. 129.<br />
24 Cramer in Schönke/Schröder, § 25, Rn. 18; Weber in Baumann/Weber/Mitsch, § 29, Rn. 129.<br />
Frank Fad<br />
3
II. Die Änderungen des <strong>6.</strong> StrRG im einzelnen<br />
zugerechnet werden. Erforderlich ist aber eine Manifestation des Zueignungswillens bei K. 25<br />
Dieser liegt hier aber nicht vor, weil K gerade nicht mit Zueignungswillen handelt. Eine Manifestation<br />
des Zueignungswillens ohne Zueignungswillen ist nicht denkbar. 26<br />
Zu einem anderen Ergebnis könnte man nur gelangen, wenn man einer Mindermeinung hinsichtlich<br />
der Zueignung bei der Unterschlagung folgt. Danach sei Unterschlagung als Delikt<br />
mit überschießender Innentendenz zu verstehen und auf eine Manifestation der Zueignung zu<br />
verzichtet. 27 Objektiv müsse nur der Beginn der Aneignung vorliegen. Im übrigen genüge ein<br />
Enteignungsvorsatz. Der Täter müsse den Willen haben, Eigenbesitz zu begründen. 28<br />
Danach könnte in Fall 3 B wegen Unterschlagung in mittelbarer Täterschaft (§§ 246, 25 I<br />
Alt. 2) bestraft werden, weil ihm die objektiven Tatbeiträge seines absichtslos-dolosen Werkzeugs<br />
K zugerechnet werden können, denn eine Manifestation der Zueignung ist nach dieser<br />
Ansicht nicht erforderlich. Der Vorsatz dauernder Enteignung liegt bei B, der die Gänse behalten<br />
will, vor. Der Beginn der Aneignung liegt vor, sobald B durch Einschalten des K als<br />
Werkzeug über ihn Eigenbesitz an den Gänsen erlangt hat. K könnte wegen Beihilfe zur Unterschlagung<br />
(§§ 246, 25 I Alt. 2) strafbar sein.<br />
In anderen Fällen hilft diese Konstruktion aber nicht weiter. So kann T in Fall 4 nicht wegen<br />
Beihilfe zur Unterschlagung (§§ 246, 25 I Alt. 2) bestraft werden, weil auch hochrangige Mitarbeiter<br />
des MfS, die die entsprechenden Anweisungen erteilt haben, die Geldbeträge aus den<br />
Briefsendungen nicht sich, sondern dem Staatshaushalt zueignen wollten.<br />
Die Figur des absichtslos dolosen Werkzeugs ist aber in Fällen der Unterschlagung grundsätzlich<br />
abzulehnen. Der Tatbestand der Unterschlagung setzt das objektive Vorliegen einer<br />
Zueignung voraus und ist kein Delikt mit überschießender Innentendenz. Wenn aber eine<br />
Enteignungsabsicht ausreichen soll, stellt dies ein Verstoß gegen das Analogieverbot<br />
(Art. 103 II GG) dar.<br />
Als Ergebnis ist also festzuhalten, daß mit der Figur des absichtslos-dolosen Werkzeugs nur<br />
in einigen Fällen des Diebstahls, nicht aber Unterschlagungsfälle gelöst werden kann.<br />
bb) Jede Drittzueignung ist eine Sichzueignung<br />
Nach einer Mindermeinung soll jede Drittzueignung eine Sichzueignung sein. 29 Dies wird<br />
damit begründet, daß der Täter die Sache nicht einem Dritten zueignen könne, ohne sie sich<br />
vorher selbst zugeeignet zu haben. Um dem Dritten eine eigentümerähnliche Stellung zu verschaffen,<br />
müsse der Täter sich zuvor eine eigentümerähnliche Stellung anmaßen. Die Drittzueignung<br />
sei somit vom Wortlaut erfaßt. Auch der Wille des Gesetzgebers spreche dafür, denn<br />
schon das Preußische Strafgesetzbuch von 1851 verzichtete auf die Erwähnung der Drittzueignungsabsicht,<br />
weil diese in der Sichzueignung enthalten sei. 30 Da die Drittzueignung auch<br />
in späteren Entwürfen nur zur Klarstellung eingefügt werden sollte, entspreche dies auch noch<br />
dem Willen des aktuellen Gesetzgebers. 31<br />
Nach dieser Auffassung wäre in Fall 1 und in Fall 2 K wegen Diebstahls strafbar, denn er<br />
wollte die Gänse B zueignen. Dazu mußte er sie zuvor sich zueignen, so daß die Zueignungs-<br />
25 Nachweise s. Fn. 105 und Fn. 10<strong>6.</strong><br />
26 Cramer in Schönke/Schröder, § 246, Rn. 11; Fahl, JuS 1998, 24 (25).<br />
27 so Schmidhäuser in Bruns-FS, S. 345 (357 f).<br />
28 Samson in SK § 246, Rn. 40 f; ders. JA 1990, 5 (9), ähnlich Schmidhäuser in Bruns-FS, S. 345 (357 f).<br />
29 BGH NStZ 131 (133); OLG Celle, HannRPfl 47, 34; Rudolphi, GA, 1965, 33 (42 f u. 52 f); Wachenfeld,<br />
ZStW 40, 324; Roxin, LK § 25, Rn. 94f; Wolflast, NStZ 1994, 542 (544).<br />
30 s. o. S. 2.<br />
31 s. o. S. 3.<br />
Frank Fad<br />
4
II. Die Änderungen des <strong>6.</strong> StrRG im einzelnen<br />
absicht bejaht werden kann. B könnte in Fall 1 wegen Anstiftung zum Diebstahl (§§ 242, 26)<br />
bestraft werden.<br />
In Fall 4 wäre T wegen Unterschlagung strafbar, da er den Inhalt der Briefsendungen sich<br />
zueignen mußte, um ihn später an seine Vorgesetzten abführen zu können.<br />
Die h. M. 32 lehnte diese Ansicht aber zu Recht ab. Es ist zweifelhaft, ob eine derartige Auslegung<br />
mit dem Wortlaut vereinbar ist. Der Täter will die entwendete Sache ja gerade nicht<br />
seinem eigenen Vermögen einverleiben. Jedenfalls spricht die systematische Auslegung dagegen,<br />
denn bei anderen Delikten, die besondere Absichten des Täters voraussetzen, wird der<br />
Dritte ausdrücklich erwähnt. So etwa bei der Bereicherungsabsicht beim Betrug (§ 263) und<br />
bei der Erpressung (§ 253) 33 .<br />
cc) Drittzueignung nur bei mittelbarem wirtschaftlichem Vorteil<br />
Bei der Zueignung ist es also erforderlich, daß der Täter unter Anmaßung einer eigentümerähnlichen<br />
Stellung die Sache ihrer Substanz nach seiner Verfügungsgewalt unterwerfen<br />
oder ihren spezifischen Wert seinem Vermögen zuführen will. 34 Abgrenzungsschwierigkeiten<br />
ergeben sich dann, wenn der Täter die Sache unentgeltlich an einen Dritten weitergibt. Nach<br />
einer Literaturmeinung müsse der Täter nicht unbedingt einen geldwerten Vorteil erstreben,<br />
es genüge vielmehr, wenn er als freigiebig erscheinen oder einer Anstandspflicht genügen<br />
wolle. 35 Eine Zueignung wurde teilweise dann angenommen, wenn der Täter sich eine wirtschaftlich<br />
sinnvolle Nutzung der Sache36 oder eine eigentümerähnliche Verfügungsgewalt37 angemaßt habe. Nach anderer Ansicht liegt eine Zueignung dann vor, wenn der Täter bei der<br />
Weitergabe als Schenker oder Quasiberechtigter auftrete. 38 Letztlich unterscheiden sich diese<br />
Auffassungen nur in der Formulierung. Die Rechtsprechung fordert für die Zueignung, daß<br />
der Täter durch die Weitergabe an den Dritten einen – wenn auch nur mittelbaren – wirtschaftlichen<br />
Vorteil im weitesten Sinne erlangt39 und kam damit zu ähnlichen Ergebnissen wie<br />
die h. M. in der Literatur.<br />
Bei der Unterschlagung ergaben sich Abgrenzungsschwierigkeiten, die in jüngster Zeit bei<br />
den sog. „MfS-Fällen“ besonders deutlich wurden. Fraglich war dabei, ob sich T in Fall 4<br />
wegen Unterschlagung strafbar gemacht hat.<br />
Der 5. Strafsenat des BGH sah in Verhalten des T eine Unterschlagung. 40 Der eigene wirtschaftliche<br />
Vorteil des T sei darin zu sehen, daß der Angeklagte die „Idee des Sozialismus“<br />
fördern wollte, was ihm ein eigenes Anliegen war. Da das Fördern von Zielen einer Organisation<br />
als wirtschaftlicher Vorteil im weitesten Sinn gesehen werden kann, könne für das Unterstützen<br />
der Ziele eines Staates nichts anderes gelten. Der Angeklagte habe zudem das Vermögen<br />
der DDR gemehrt, um seine berufliche Stellung und damit sein Einkommen zu sichern.<br />
41<br />
32<br />
Eser in Schönke/Schröder, § 242, Rn. 57.<br />
33<br />
a. A. BGH NStZ 1995, 131 (133).<br />
34<br />
so die von der Rechtsprechung und h. L. vertretene Vereinigungsformel RGSt 61, 232; BGHSt 35, 152;<br />
Lackner, § 242, Rn 21; Eser in Schönke/Schröder, § 242, Rn. 47; Ruß in LK, § 242, Rn. 48; Wessels, BT 2, Rn.<br />
132.<br />
35<br />
Tröndle, § 242, Rn. 20; Ruß in LK, § 242, Rn. 65, Lackner, § 242, Rn. 2<strong>6.</strong><br />
36<br />
Samson in SK, § 242, Rn. 77.<br />
37<br />
Wessels, BT 2, Rn. 154.<br />
38<br />
Eser in Schönke/Schröder, § 242, Rn. 5<strong>6.</strong><br />
39<br />
BGHSt 41, 187 (194); BGH NJW 1985, 812 (813).<br />
40<br />
BGH NStZ 1995, 131 (133).<br />
41<br />
so auch Tröndle, § 246, Rn. 13a.<br />
Frank Fad<br />
5
II. Die Änderungen des <strong>6.</strong> StrRG im einzelnen<br />
Nach der zutreffenden Auffassung des 4. Strafsenats und des großen Senats für Strafsachen<br />
stellte das Verhalten der MfS Mitarbeiter keine Unterschlagung dar. 42 Eine Zueignung unter<br />
dem Gesichtspunkt der Substanztheorie kommt schon deswegen nicht in Betracht, weil nicht<br />
anzunehmen ist, daß die MfS-Mitarbeiter das Geld zunächst dem eigenen Vermögen einverleibt<br />
haben, um es dann dem Staatsvermögen zuzuleiten. 43 Auch wenn man auf die Sachwerttheorie<br />
abstellt, ergibt sich nichts anderes, weil sich T keinen eigenen mittelbaren wirtschaftlichen<br />
Vorteil verschaffen wollte. Zwar wollte T durch sein systemkonformes Verhalten seine<br />
berufliche Existenz und Stellung absichern. Dies genügt jedoch zur Annahme eines wirtschaftlichen<br />
Vorteils nicht, weil letztlich jeder Bedienstete seine berufliche Stellung durch<br />
ordnungsgemäße Erfüllung seiner Aufgaben abzusichern versucht. 44 Aus diesen Gründen haben<br />
sich auch die Mitarbeiter unterhalb der Führungsebene nicht wegen Beihilfe zur Unterschlagung<br />
strafbar gemacht. 45<br />
Auch in Fall 2 hat sich K nicht wegen Unterschlagung strafbar gemacht, denn er erhält durch<br />
seine Tat noch nicht einmal wirtschaftliche Vorteile im weitesten Sinn. Sein Arbeitgeber B<br />
weiß nichts von der Tat, so daß sich K auch keine Vorteile wegen dieser Tat versprechen<br />
kann.<br />
In Fall 5 ist T dagegen wegen Unterschlagung strafbar, denn er erhält als den eigenmächtigen<br />
Zahlungen an die Spieler einen Vorteil im weitesten Sinn, indem er ihnen gegenüber als großzügig<br />
und freigiebig erscheint und sich somit eigene Aufwendungen erspart hat.<br />
Als Ergebnis steht damit fest, daß nach altem Recht nicht alle Fälle rechtswidriger Zueignung<br />
strafbar sind, da die Figur des absichtslos dolosen Werkzeugs nur einige Fälle im Bereich des<br />
Diebstahls schließen kann und eine generelle Auslegung der Drittzueignung als Sichzueignung<br />
nicht vertretbar ist.<br />
c) Rechtslage nach neuem Recht<br />
Durch das <strong>6.</strong> StrRG wurde die Drittzueignung beim Diebstahl, bei der Unterschlagung, beim<br />
Entziehen elektrischer Energie, beim Raub und bei der Jagdwilderei unter Strafe gestellt. Dadurch<br />
sollte sichergestellt werden, daß auch die Drittzueignung strafbar ist. 46 Dadurch haben<br />
sich die oben dargestellten Abgrenzungsschwierigkeiten bei der unentgeltlichen Weitergabe<br />
an Dritte erledigt. 47<br />
Fraglich ist zunächst aber, was unter Drittzueignung zu verstehen ist. Dazu ist zunächst zu<br />
klären, was Zueignung ist. Die Zueignung setzt sich bekanntlich aus Enteignung und Aneignung<br />
zusammen. Der Eigentümer muß dauerhaft aus seiner Rechtsposition verdrängt werden.<br />
Unter Aneignung ist das zumindest vorübergehende Anmaßen einer eigentümerähnlichen<br />
Verfügungsgewalt über die Sache zu verstehen. 48 Um diese eigentümerähnliche Verhältnis zu<br />
begründen, muß der Täter den Willen haben, über die Sache wie ein Eigentümer zu verfügen.<br />
Auch die Drittzueignung setzt sich aus den Elementen der Enteignung und der Aneignung<br />
zusammen. Zur Enteignung muß der Eigentümer dauerhaft aus seiner Position verdrängt werden.<br />
Dies kann der Täter ohne weiteres tun. Der Täter kann aber schon aus logischen Gründen<br />
42 BGHSt 40, 8 (18 ff); 41, 187 (194 ff).<br />
43 BGHSt 41, 187 (195).<br />
44 BGHSt 41, 187 (197).<br />
45 BGHSt 40, 8 (20f).<br />
46 BT Drucks. 13/7164, S. 43.<br />
47 Hörnle, Jura 1998, 169 (170).<br />
48 BGHSt 1,262; Kühl in Lackner, § 242, Rn. 21.<br />
Frank Fad<br />
6
II. Die Änderungen des <strong>6.</strong> StrRG im einzelnen<br />
die Sache nicht einem Dritten aneignen, weil nur der Dritte den Willen haben kann, zu der<br />
Sache ein eigentümerähnliches Verhältnis zu begründen. Er kann dem Täter nur die Möglichkeit,<br />
ein eigentümerähnliches Verhältnis zu der Sache zu begründen, verschaffen. Ob der<br />
Dritte dieses Verhältnis zur Sache begründet, hängt allein von seinem Willen ab und kann<br />
vom Willen des Täters nicht beeinflußt werden.<br />
Drittzueignung liegt also vor, wenn der Eigentümer aus seiner Position dauerhaft verdrängt<br />
wird und einem Dritten die Möglichkeit, die Sache in sein Vermögen einzuverleiben, verschafft<br />
wird. 49<br />
<strong>Das</strong> Verschaffen einer Möglichkeit zur Tatbegehung ist aber eine typische Beihilfehandlung.<br />
Ein Täter, der einem anderen nur die Möglichkeit zur Tatbegehung verschafft, hat regelmäßig<br />
keinen Täterwillen 50 , denn er will die Tat nicht als eigene. Er hat regelmäßig auch keine Tatherrschaft<br />
51 , denn er hält das tatbestandsmäßige Geschehen nicht in den Händen. Es hängt<br />
allein vom Dritten ab, ob dieser sich die Sache aneignet. Durch die Strafbarkeit der Drittzueignung<br />
hat der Gesetzgeber also eine – vom materiellen Unrecht aus betrachtet – typische<br />
Beihilfehandlung als täterschaftliche Handlung qualifiziert. Dies widerspricht den Wertungen<br />
des Allgemeinen Teils, der zwischen Täterschaft und Teilnahme differenziert. Dem Täter<br />
wird die zwingende Strafmilderung gem. §§ 27 II 2, 49 I genommen.<br />
Für eine Strafbarkeit der Drittzueignung beim Diebstahl sprechen jedoch kriminalpolitischen<br />
Gesichtspunkte. Durch sie werden – wie oben dargelegt – Strafbarkeitslücken geschlossen.<br />
Außerdem hat der Gesetzgeber auch bei anderen Tatbeständen Strafbarkeitslücken in der<br />
Weise geschlossen, daß er typische Beihilfehandlungen unter Strafe gestellt hat. So ist z. B.<br />
bei der Hehlerei (§ 259 I) die Absatzhilfe – eine eigentlich typische Beihilfehandlung – als<br />
täterschaftliche Begehung unter Strafe gestellt, um den, der dem Vortäter beim Absatz seiner<br />
Hehlerware hilft, bestrafen zu können. 52 Ein weiteres Beispiel hierfür bildet die Gefangenenbefreiung<br />
(§ 120). Täterschaftlich handelt hier, wer einem Gefangenen beim Entweichen fördert<br />
(§ 120 I Alt. 3). Hier liegt eine zu einem selbständigen Tatbestand erhobene Teilnahme<br />
an der als solcher nicht mit Strafe bedrohten Selbstbefreiung vor, die als gesetzgeberische<br />
Entscheidung trotz der dadurch entstehenden Spannungen hinzunehmen ist. 53<br />
Teilweise wird auch kritisiert, daß der Gesetzgeber auf die MfS-Fälle reagiert habe und dies<br />
eine historisch einmalige Situation sei, die die Änderung nicht rechtfertige. 54 Diese Kritik ist<br />
jedoch unberechtigt. Die Drittzueignung ist kein Problem, das nur bei den MfS-Fällen auftritt.<br />
Es handelt sich vielmehr um eine Strafbarkeitslücke. Die Drittzueignung stellt nämlich eindeutig<br />
ein strafwürdiges Verhalten dar, das mangels Haupttat in manchen Fallkonstellationen<br />
nicht bestraft werden konnte. Auch ist die Gesetzesänderung nicht ausschließlich durch die<br />
MfS-Fälle motiviert, da ein derartiger Vorschlag bereits in früheren Reformentwürfen – zuletzt<br />
im E 62 55 – gemacht wurde.<br />
Nach der geltenden Rechtslage ist nun zwischen der Sichzueignung und der Drittzueignung<br />
abzugrenzen. Fraglich ist also, ob nur die Fälle, die nach früherer Rechtslage nicht strafbar<br />
waren, unter Drittzueignung fallen sollen.<br />
49<br />
ähnlich auch Küper, S. 412.<br />
50<br />
Die Rechtsprechung stellt bei der Abgrenzung von Täterschaft und Teilnahme auf die innere Willensrichtung<br />
ab (vgl. z. B. BGHSt 14, 123 [129]).<br />
51<br />
Nach der h. M. in der Literatur ist Täter, wer Tatherrschaft hat (vgl. statt vieler Wessels, AT, Rn 144).<br />
52<br />
Stree in Schönke/Schröder, § 259, Rn. 35.<br />
53<br />
Lackner in Lackner, § 120, Rn. 8; Eser in Schönk/Schröder, § 120, Rn. 12.<br />
54<br />
Sander/Hohmann, NStZ, 273, (274).<br />
55 s. o. Fn. 18.<br />
Frank Fad<br />
7
II. Die Änderungen des <strong>6.</strong> StrRG im einzelnen<br />
In Fall 1 könnte K sich wegen täterschaftlichen Diebstahls in Form der Drittzueignung strafbar<br />
gemacht haben. Danach wäre die Figur des absichtslos-dolosen Werkzeugs überflüssig<br />
geworden. 56 Da K hier aber nur eine – vom materiellen Unrecht betrachtet – typische Beihilfehandlung<br />
begeht, sollte er auch nach neuem Recht nur wegen Beihilfe zum Diebstahl des B<br />
(§§ 242 I, 27 I) bestraft werden.<br />
In Fall 2 muß dagegen auf die Drittzueignung zurückgegriffen werden, da die Figur des absichtslos-dolosen<br />
Werkzeugs hier nicht weiterhilft. In Fall 4 kann jetzt eine Bestrafung wegen<br />
Diebstahls in Form der Drittzueignung erfolgen.<br />
Fraglich ist ob eine Bestrafung des T in Fall 5 wegen Sichzueignung oder wegen Drittzueignung<br />
erfolgen soll. Da T hier den Spielern die Möglichkeit verschaffen wollte, Geld aus der<br />
Vereinskasse zu erlangen (Drittzueignungsabsicht) und er gleichzeitig als freigiebig und<br />
großzügig erscheinen wollte (Sichzueignungsabsicht), scheinen hier beide Alternativen möglich<br />
zu sein. Abzustellen ist hier auf die Motive des Täters. Es ist nach seinem eigentlichen<br />
Handlungsziel zu fragen. Vorliegend dürfte das Motiv der Drittzueignung im Vordergrund<br />
stehen und die Sichzueignung nur eine untergeordnete Rolle spielen. Daher sollte im vorliegenden<br />
Fall Drittzueignungsabsicht angenommen werden.<br />
Um unangemessene Ergebnisse zu verhindern, sind auch künftig Fälle, in denen der Täter<br />
Sachen für einen seinerseits täterschaftlich handelnden Dritten wegnimmt und eigentlich nur<br />
mit Teilnehmerwillen handelt, als Beihilfe zum Diebstahl gem. §§ 242 I, 27 I zu bestrafen.<br />
Nur wenn ausnahmsweise keine teilnahmefähige Haupttat vorliegt, sollte auf die Drittzueignung<br />
zurückgegriffen werden. Der Umstand, daß dem Täter die Strafmilderung „abgeschnitten“<br />
wird, kann auf der Rechtsfolgenseite berücksichtigt werden.<br />
Als Ergebnis kann festgestellt werden, daß die Strafbarkeit der Drittzueignung zwar zu dogmatischen<br />
Unstimmigkeiten geführt hat, sie aber wegen des kriminalpolitischen Bedürfnisses<br />
dennoch zu billigen ist.<br />
2. Unterschlagung als Auffangtatbestand<br />
Fälle:<br />
Fall 6: T findet im Park eine fremde Sache und nimmt sie mit, um sie zu behalten.<br />
Fall 7: T nimmt Sachen, die der gerade Verstorbene O bei sich getragen hat, weg, um sie zu<br />
behalten.<br />
Fall 8: T hat von E ein Buch geliehen, T verleiht es an G weiter, der T für den Eigentümer<br />
hält. Später verkauft T das Buch an G und übereignet es ihm.<br />
Fall 957 : K hat bei V Waren bestellt. Den Transport führte T, ein Angestellter der von K beauftragten<br />
Transportfirma, durch. Dieser behielt einen Teil der Ware zurück. A, ein Angestellter<br />
des K, bestätigte den vollständigen Empfang der Waren. T verkaufte den zurückbehaltenen<br />
Teil der Waren und teilte den Erlös vereinbarungsgemäß mit A.<br />
Fall 10: 58 T lebt in Köln. Er schließt mit D einen Schenkungsvertrag über ein dem O gehörendes<br />
Fahrrad, das sich in Berlin befindet.<br />
Fall 11: 59 T findet ein Buch und stellt es in das Bücherregal des D, damit dieser es behält.<br />
56 so Hörnle, Jura 1998, 169 (170).<br />
57 nach BGHSt 2, 317, vgl. auch Beispiel bei Rengier, § 5, Rn. 1<strong>6.</strong><br />
58 Beispiel nach Sander/Hohmann, NStZ 1998, 273 (276).<br />
Frank Fad<br />
8
II. Die Änderungen des <strong>6.</strong> StrRG im einzelnen<br />
a) Frühere Reformbestrebungen<br />
In § 225 des Preußischen StGB von 1851 wird die Unterschlagung wie folgt definiert: „Wer<br />
eine fremde bewegliche Sache, deren Besitz oder Gewahrsam er mit der Verpflichtung erlangt<br />
hat, sie zu verwahren, zu verwalten, zurückzugeben oder abzuliefern, zum Nachteile des Eigentümers<br />
oder Inhabers veräußert, verpfändet oder verbraucht oder beiseiteschafft, macht<br />
sich der Unterschlagung strafbar.“ Die Fundunterschlagung und die Unterschlagung von Sachen,<br />
die durch Zufall in den Gewahrsam des Täters gelangen, stellte § 226 gesondert unter<br />
Strafe. Es reichte also nicht aus, daß der Täter die Sache überhaupt in Gewahrsam hat, es<br />
mußte zusätzlich ein Treueverhältnis bestehen. Geschütztes Rechtsgut war also weniger das<br />
Eigentum, sondern das Treueverhältnis. 60 Nach dem Revidierten Entwurf des Strafgesetzbuches<br />
für die königlich Preußischen Staaten von 1836 beging eine Unterschlagung, „wer eine<br />
fremde bewegliche Sache, die er in der Gewahrsam hat, in der Absicht, sich oder Anderen<br />
einen Gewinn zu verschaffen, widerrechtlich zueignet“ 61 Die Unterschlagung war hiernach ein<br />
bloßes Aneignungsdelikt, wie es im wesentlichen der Gesetzeslage bis zum Inkrafttreten des<br />
<strong>6.</strong> StrRG entsprach. 62 Dieser Entwurf wurde jedoch von der Staatskommission verworfen,<br />
weil die bloße Aneignung nicht für strafwürdig empfunden wurde. Die staatliche Verpflichtung<br />
zum Schutz des Eigentums reiche nicht so weit. Durch zivilrechtliche Ansprüche sei der<br />
Schutz des Eigentümers hinreichend gewährleistet. 63<br />
Während im Entwurf eines Strafgesetzbuches für den Norddeutschen Bund von 1869 noch<br />
getrennte Tatbestände für die veruntreuende Unterschlagung und die Fundunterschlagung<br />
vorgesehen waren, 64 wurde in der zweiten Lesung ein einheitlicher Unterschlagungstatbestand<br />
geschaffen. 65 Im Strafgesetzbuch für den Norddeutschen Bund wurde die Unterschlagung<br />
dann als Zueignungsdelikt formuliert. § 246 erhielt die bis zum <strong>6.</strong> StrRG gültige Fassung. Die<br />
Unterschlagung anvertrauter Sachen sollte nicht mehr der Normalfall, sondern eine Qualifikation<br />
der Unterschlagung sein.<br />
Der E 62 hat in § 240 den Tatbestand der Unterschlagung wie folgt gefaßt: „Wer eine fremde<br />
bewegliche Sache sich oder einem anderen widerrechtlich zueignet, wird ... bestraft, wenn die<br />
Tat nicht als Diebstahl, Raub, Betrug, Erpressung, Untreue oder Hehlerei mit Strafe bedroht<br />
ist.“ 66 Um Strafbarkeitslücken, insbesondere im Bereich der Fundunterschlagung67 und der<br />
Leichenfledderei68 sowie bei einem Mittäter, der keinen Gewahrsam hat, 69 zu schließen, sollte<br />
der Tatbestand der Unterschlagung dahingehend ausgeweitet werden, daß es genügten sollte,<br />
wenn jemand eine fremde bewegliche Sache sich oder einem Dritten widerrechtlich zueignet.<br />
70 Dabei sollte die Unterschlagung aber nicht ein Grundtatbestand aller Zueignungsdelikte<br />
59<br />
Beispiel nach Rengier, § 5, Rn. 19.<br />
60<br />
Bockelmann, MDR 1953, 3 (5); Charalambakis, S. 39.<br />
61<br />
§ 594 des Entwurfs, abgedruckt bei Schubert/Regge, Bd, 3, S. 980.<br />
62<br />
Bockelmann, MDR 1953, 3 (5); Charalambakis, S. 40.<br />
63<br />
Berathungs-Protokolle der zur Revision des Strafrechts ernannten Kommission des Staatsraths über den<br />
zweiten Teil des Entwurfs des Strafgesetzbuches, Berlin 1842, S. 387 f, abgedruckt bei Schubert/Regge, Bd. 4 II,<br />
S. 694 f.<br />
64<br />
vgl. §§ 223 und 224 des Entwurfs von 1869, S. 2<strong>6.</strong><br />
65<br />
Schubert, GA 1982, 191 (214 f).<br />
66 E 62, S. 50.<br />
67 s. S. 10, vgl. auch Fall <strong>6.</strong><br />
68 s. S. 11, vgl. auch Fall 7.<br />
69 s. S. 11, vgl auch Fall 9.<br />
70 E 62, S. 408 f.<br />
Frank Fad<br />
9
II. Die Änderungen des <strong>6.</strong> StrRG im einzelnen<br />
sein, ihr sollte vielmehr die Funktion eines subsidiären Auffangtatbestandes zukommen. 71 Um<br />
die Strafbarkeitslücken bei der Fundunterschlagung und der Leichenfledderei zu schließen<br />
verzichtete auch schon der E 25 72 auf das Erfordernis des Gewahrsams ganz. Der Entwurf von<br />
1909 73 , der E 13 74 , der E 19 75 und der E 27 76 verlangten lediglich, daß es sich um eine Sache<br />
handelt, die sich „nicht im Gewahrsam eines anderen befindet“.<br />
b) Rechtslage nach altem Recht: insbesondere Strafbarkeitslücken<br />
Bis zum Inkrafttreten des <strong>6.</strong> StrRG beging eine Unterschlagung, „wer eine fremde bewegliche<br />
Sache, die er in Besitz oder Gewahrsam hat, sich rechtswidrig zueignet“.<br />
Ob und in welchem Zeitraum sich die Sache in Gewahrsam des Täters befunden haben muß,<br />
war umstritten.<br />
Nach einer am Wortlaut orientierten Auffassung war erforderlich, daß die Gewahrsamserlangung<br />
der Zueignung zeitlich vorausging77 . Für diese Auslegung spricht der Wortlaut („hat“).<br />
Außerdem wird vorgebracht, daß das Strafrecht keinen lückenlosen Schutz des Eigentums<br />
gegen jeden Angriff gewährleisten wolle und könne. <strong>Das</strong> Gesetz wurde bewußt auch bei der<br />
Sachentziehung und Gebrauchsanmaßung lückenhaft gelassen. 78<br />
Die von der h. M. 79 und der Rechtsprechung80 vertretene „kleine berichtigende Auslegung“<br />
ließ es genügen, wenn die Gewahrsamserlangung gleichzeitig mit der Zueignung erfolgt.<br />
Hierin wird zum Teil ein Verstoß gegen das Analogieverbot (Art. 103 II GG) gesehen, denn<br />
die Präsensformulierung „hat“ beschreibe eine Beziehung, die als Qualität der Sache dieser<br />
vor Beginn der Tat angehaftet haben muß. 81<br />
Die sog. „große berichtigende Auslegung“ verzichtet ganz auf eine Gewahrsamserlangung<br />
durch den Täter82 . Begründet wird diese Ansicht dadurch, daß die Formulierung „die er in<br />
Besitz oder Gewahrsam hat“ nur ein Abgrenzungskriterium gegenüber dem Diebstahl darstelle.<br />
Durch diese Auslegung könnten sämtliche Lücken zwischen Diebstahl und Unterschlagung<br />
geschlossen werden. Diese Ansicht ist abzulehnen, da sie gegen das Analogieverbot<br />
(Art. 103 II GG) verstößt, indem sie Tatbestandsmerkmale in Abgrenzungskriterien umdeutet.<br />
83<br />
Probleme ergaben sich daraus für Fälle der Fundunterschlagung. So konnte in Fall 6 nach der<br />
strengen Auslegung eine Unterschlagung – selbst wenn eine Manifestation der Zueignung<br />
vorliegen sollte – nicht schon dadurch erfolgen, daß T die Sache ergriffen hat. Nach der h. M.<br />
konnte die Unterschlagung erst durch einen nachfolgenden Zueignungsakt begangen werden.<br />
71<br />
E 62. S. 409.<br />
72<br />
vgl. § 301 des E 25 und Amtrliche Begründung, S. 157.<br />
73<br />
vgl. § 271 I des Entwurfs zu einem Deutschen Strafgesetzbuch, bearbeitet von der hierzu bestellten Sachverständigen-Kommission,<br />
veröffentlicht auf Anordnung des Reichs-Justizamtes, Berlin 1909, S. 54.<br />
74<br />
vgl. § 358 I des E 13. a. a. O., Teil 1, S. 83.<br />
75<br />
vgl. § 364 I des E 19, a. a. O., Teil 2, S. 80, und Denkschrift, a. a. O., Teil 3, S. 310.<br />
76<br />
vgl. § 333 I des E 27, RT-Drucks. 1930, V. Wahlperiode, 18. Ausschuß, 1930, Nr. 2, S. 188.<br />
77<br />
Weber in Arzt/Weber, LH 3, rn. 258; Bockelmann, MDR 1953, 3; Ranft, JA 1984, 277 (286); Tenckhoff, JuS<br />
1984, 775 (777); Schünemann, JuS 1986, 114 (116); Samson, JA 1990, 5.<br />
78<br />
Samson in SK, § 246, Rn. 19.<br />
79<br />
Eser in Schönke/Schröder, § 249, Rn. 10; Wessels, BT 2, Rn. 27<strong>6.</strong><br />
80<br />
BGHSt 4, 76; 35, 152 (161); OLG Celle JR 1987, 253.<br />
81<br />
Samson, in SK, § 246; Schünemann, JuS 1968, 114 (116).<br />
82<br />
Binding, Lehrbuch, S. 143 f; Welzel, S. 345; Schmidhäuser, BT, S. 98.<br />
83<br />
OLG Schlesweig NJW 1979, 882; Wessels, BT 2, Rn. 276; Krey, BT 2, Rn. 165; Tenckhoff, JuS 1984, 775<br />
(776 f).<br />
Frank Fad<br />
10
II. Die Änderungen des <strong>6.</strong> StrRG im einzelnen<br />
Regelmäßig spielte der Streit jedoch keine Rolle, weil sich im bloßen Ergreifen einer Sache<br />
nur selten ein Zueignungswille manifestiert.<br />
Ähnliche Schwierigkeiten bereiteten die Fälle der Leichenfledderei. In Fall 7 kommt ein<br />
Diebstahl (§ 242) des T nicht in Frage, weil ein Toter kein Gewahrsam hat 84 . Nach der engen<br />
Auslegung war die Zueignung durch die Wegnahme selbst nicht möglich. Nach den anderen<br />
Auffassungen reichte es – eine Manifestation des Zueignungswillens vorausgesetzt – aus,<br />
wenn Zueignung und Gewahrsamsbegründung zusammenfielen.<br />
Nach der alten Rechtslage war umstritten, ob unter Besitz auch der mittelbare Besitz zu verstehen<br />
ist. Dieser Streit zeigt sich in Fall 8. Eine Strafbarkeit des T wegen Betruges (§ 263 I)<br />
z. N. des G kommt nicht in Betracht, da der gutgläubige G die nicht abhanden gekommene<br />
Sache (§ 935 I BGB) gem. §§ 929, 2; 932 I BGB gutgläubig erworben hat, so daß bei ihm<br />
kein Vermögensschaden entsteht. 85 Auch eine Bestrafung wegen Betrugs z. N. des E kommt<br />
nicht in Betracht, weil zwischen getäuschten G und dem geschädigten E noch nicht einmal ein<br />
Näheverhältnis besteht 86 , so daß eine Vermögensverfügung ausscheidet. Diebstahl (§ 242)<br />
scheidet aus, weil kein Gewahrsamsbruch vorliegt, denn E war mit dem Gewahrsamswechsel<br />
einverstanden. In Betracht kommt nur eine Unterschlagung. T hatte aber zur Zeit der Veräußerung<br />
weder Gewahrsam noch unmittelbaren Besitz. Die h. M. 87 und die Rechtsprechung 88<br />
wollen Besitz nicht im Sinne des BGB und somit nicht notwendigerweise unter Einschluß des<br />
mittelbaren Besitzes (§ 868 BGB) verstanden wissen. Eine Mindermeinung 89 versteht Besitz<br />
im Sinne des BGB, so daß auch der mittelbare Besitz (§ 868 BGB) eingeschlossen ist. Für die<br />
h. M. spricht aber der Wille des Gesetzgebers. Zur Zeit des Erlasses des StGB gab es bekanntlich<br />
noch kein Bürgerliches Gesetzbuch. Der Gesetzgeber konnte, als er das StGB geschaffen<br />
hat, somit den verrechtlichten Begriff des Besitzes noch gar nicht kennen. Besitz<br />
sollte als rein tatsächliche Sachherrschaft verstanden werden. 90 In Fall 8 bleibt T also straflos.<br />
Umstritten war schließlich auch die Frage, ob ein Mittäter zumindest Mitgewahrsam haben<br />
mußte. In Fall 9 hat sich T wegen Unterschlagung strafbar gemacht. Fraglich ist aber, ob sich<br />
auch A wegen Unterschlagung strafbar gemacht hat. Nach der Rechtsprechung 91 und einer<br />
Ansicht in der Literatur 92 war erforderlich, daß ein Mittäter zumindest Mitgewahrsam an den<br />
Waren haben mußte. Dies war vorliegend nicht der Fall, so daß A nicht wegen mittäterschaftlich<br />
begangener Unterschlagung (§§ 246, 25 II), sondern nur wegen Beihilfe zur Unterschlagung<br />
(§§ 246, 27 I) zu bestrafen ist. Nach anderer Ansicht 93 hatte die Abgrenzung ausschließlich<br />
nach den allgemeinen Regeln für Täterschaft und Teilnahme zu erfolgen. Für diese Ansicht<br />
spricht, daß die Täterschaftsproblematik nicht mit den Auslegungsfragen des § 246 ver-<br />
84 allg. M. vgl. nur Kühl in Lackner, § 242, Rn. 10.<br />
85 nach zutreffender h. M. liegt in der Regel kein Vermögensschaden vor, wenn ein Gegenwert gutgläubig er-<br />
worben wird (vgl. Kühl in Lackner, § 263, Rn 43).<br />
86 Eine Vermögensverfügung liegt also weder nach der h. M., die zwischen Verfügendem und Geschädigten<br />
eine Nähebeziehung fordert und ausreichen läßt (BGHSt 18, 221; Cramer in Schönke/Schröder, § 263, Rn. 66;<br />
Wessels, BT 2, Rn 606) noch nach der Befugnistheorie, die eine rechtliche Verfügungsbefugsnis voraussetzt<br />
(Günther in SK, § 263, Rn. 92 ff), vor.<br />
87 Samson in SK, § 246, Rn. 5; Eser in Schönke/Schröder, Rn. 9; Ruß in LK, § 246, Rn. 10; Tröndle, § 246,<br />
Rn. 9; Kühl in Lackner, Rn. 3; Wessels, BT 2, Rn. 271; Tenckhoff, JuS 1984, 775 (776)<br />
88 RGSt 37, 198 (199 ff); OLG Schleswig NJW 1979, 882 (883).<br />
89 Maurach/Schroeder/Maiwald, BT 1, § 34, Rn. 6 f; Ranft, JA 1984, 277 (286) Otto, S. 25<strong>6.</strong><br />
90 RGSt 37, 198 (200 f).<br />
91 BGHSt 2, 317 (318 f); 8, 272 (273 f).<br />
92 Ruß in LK, § 246, Rn. 24; Kühl in Lackner, § 246, Rn. 12; Samson in SK, § 246, Rn. 24.<br />
93 Schönke/Schröder, § 246, Rn. 27; Maurach/Schröder/Maiwald, BT 1, § 34, Rn. 39; Weber in Arzt/Weber,<br />
LH 3, Rn. 286; Küper, NStZ106,354; Tenckhoff, JuS, 1984, 278; Charalambakis, S. 122 ff.<br />
Frank Fad<br />
11
II. Die Änderungen des <strong>6.</strong> StrRG im einzelnen<br />
mischt werden darf. Außerdem ist § 246 kein eigenhändiges Delikt. Wegen der geplanten<br />
Teilung des Erlöses wäre bei A demnach wohl Mittäterschaft anzunehmen.<br />
c) Probleme des neuen Rechts<br />
<strong>Das</strong> Ziel des Gesetzgebers des <strong>6.</strong> StrRG war, die oben dargestellten Probleme bei der<br />
Fundunterschlagung94 , der Leichenfledderei95 , des nur mittelbaren Besitzes96 und der Mittäterschaft<br />
ohne Gewahrsam97 im Sinne einer Strafbarkeit des Täters wegen Unterschlagung zu<br />
lösen. 98 <strong>Das</strong> bedeutet, daß die obigen Fälle künftig im Sinne der großen berichtigenden Auslegung<br />
zu lösen sind. 99<br />
Da der Gesetzgeber Strafbarkeitslücken schließen wollte, ist zunächst danach zu fragen, ob<br />
die Fälle, in denen bisher eine Bestrafung des Täters nicht möglich waren, wirklich strafwürdiges<br />
Unrecht darstellen. Durch den Unterschlagungstatbestand soll der Schutz des Eigentums<br />
gegen rechtswidrige Zueignungshandlungen sichergestellt werden. In Fall 8 kann es z. B.<br />
keinen Unterschied für das materielle Unrecht machen, ob T das Buch gleich an G übereignet<br />
(§§ 929, 1; 932 I 1 BGB) oder erst an G verleiht und dann übereignet (§§ 929, 2, 932 I 2<br />
BGB). Weil gegen die große berichtigende Auslegung im wesentlichen eingewandt wurde,<br />
daß sie gegen den Wortlaut verstoße, 100 ist davon auszugehen, daß es sich in den obigen Fällen<br />
um wirkliche Strafbarkeitslücken handelte. Da die Neuregelung zu einem umfassenden<br />
Schutz führt, ist sie an sich richtig.<br />
aa) Reichweite der Zueignung<br />
Die Erweiterung des Unterschlagungstatbestandes bereitet aber neue Schwierigkeiten.<br />
Unterschlagung wird häufig als Eigentumsdelikt bezeichnet. 101 Durch eine Unterschlagung<br />
wird das Eigentum als solches aber nicht notwendiger Weise verletzt, denn ein Täter, der sich<br />
eine Sache zueignet, erwirbt nicht das Eigentum an der Sache. <strong>Das</strong> strafwürdige Unrecht der<br />
Unterschlagung ist vielmehr, daß der Täter die Realisierbarkeit der Ansprüche des Eigentümers<br />
aus seinem Eigentum, insbesondere § 985 BGB, gefährdet. Insoweit handelt es sich bei<br />
der Unterschlagung um eine Art Gefährdungsdelikt. Daher muß insbesondere in Fällen der<br />
Drittzueignung sichergestellt werden, daß vom neuen Unterschlagungstatbestand auch nur<br />
solche Handlungen erfaßt werden, in denen eine Gefährdung zumindest möglich ist.<br />
In Fall 10 könnte sich T wegen Unterschlagung strafbar gemacht haben. Eine Drittzueignung<br />
ist nach der für den Diebstahl entwickelten Definition102 anzunehmen, wenn der Eigentümer<br />
aus seiner Position dauerhaft verdrängt wird und einem Dritten die Möglichkeit, die Sache in<br />
sein Vermögen einzuverleiben, verschafft wird. Eine dauerhafte Verdrängung des Eigentümers<br />
kann bei der Unterschlagung aber schon deswegen nicht verlangt werden, weil sonst die<br />
Unterschlagung erst nach einer langen Zeitspanne vollendet ist. Die Möglichkeit einer Aneignung<br />
wurde D aber verschafft. Da aber das Eigentum des O noch in keiner Weise gefährdet<br />
ist, scheint eine Strafbarkeit des T unangemessen. Wenn D das Fahrrad seinem Vermögen<br />
94 s. S. 10, vgl. auch Fall <strong>6.</strong><br />
95 s. S. 11, vgl. auch Fall 7.<br />
96 s. S. 11, vgl. auch Fall 8.<br />
97 s. S. 11, vgl. auch Fall 9.<br />
98 BT-Drucks. 13/7164, S. 43.<br />
99 Wolters, JZ 1998, 397 (399).<br />
100 s. o. Fn. 83.<br />
101 vgl. z. B Wessels, BT 2, Rn. 2.<br />
102 s. o. S. 7.<br />
Frank Fad<br />
12
II. Die Änderungen des <strong>6.</strong> StrRG im einzelnen<br />
nicht einverleibt, wird das Eigentum des O nicht gefährdet. Vom materiellen Unrecht aus gesehen<br />
liegt, hier eine Versuchskonstellation vor, da das angegriffene Rechtsgut nicht verletzt<br />
wurde. Weil die Drittzueignung – wie oben bereits ausgeführt 103 – eine typische Beihilfehandlung<br />
ist, würde materiell ein nach den Wertungen des Allgemeinen Teils strafloser Versuch<br />
der Beihilfe vorliegen. Eine Bestrafung des T wegen Unterschlagung in Form der Drittzueignung<br />
ist daher solange zu vermeiden, bis ein Angriff auf das Eigentum des O erfolgt und<br />
so – materiell gesehen – eine teilnahmefähige Haupttat vorliegt.<br />
Fraglich ist also, wie die Strafbarkeit des T auszuschließen ist. Einer Ansicht zufolge ist dieser<br />
Fall dadurch zu lösen, daß besonders strenge Anforderungen an die Manifestation der Zueignung<br />
gestellt werden. 104 Nach h. M. genügt für eine Zueignung, die zum objektiven Tatbestand<br />
gehört, nicht der bloße darauf gerichtete Wille, es muß vielmehr eine Manifestation des<br />
Zueignungswillens erfolgen. Nach h. M. ist unter Manifestation jede beliebige Handlung, die<br />
als Betätigung des Zueignungswillens verstanden werden kann, zu verstehen. In Betracht<br />
kommen auch objektiv mehrdeutige Handlungen. 105 Nach der strengen Manifestationstheorie<br />
genügen nur solche Handlungen, aus denen ein alle Umstände des Falles kennender Beobachter<br />
auf den Zueignungswillen schließen würde. 106 Nach einer Mindermeinung soll statt<br />
einer Manifestation des Zueignungswillens die Unterschlagung als Delikt mit überschießender<br />
Innentendenz verstanden werden. Objektiv müsse nur eine Aneignung vorliegen. Subjektiv<br />
genüge ein Enteignungsvorsatz. Der Täter müsse also den Willen haben, Eigenbesitz zu<br />
begründen. 107<br />
Stellt man nun in Fall 10 auf eine Manifestation der Zueignung beim Täter T ab, so ist diese<br />
gegeben, denn die Zueignungsabsicht kann sich bereits im Angebot zum Abschluß eines<br />
schuldrechtlichen Vertrages manifestieren. 108 Auch die strenge Manifestationstheorie dürfte<br />
vorliegend wohl zu keinem anderen Ergebnis gelangen, denn für einen gedachten Beobachter<br />
wird die Betätigung des Zueignungswillens deutlich, da der Abschluß eines Schenkungsvertrages<br />
ohne Einwilligung des Berechtigten eindeutig ein Geschäft ist, das nur den Rechtskreis<br />
des Eigentümers betrifft. Auch wenn man auf eine Manifestation bei dem Dritten abstellt,<br />
gelangt man zu keinem anderen Ergebnis. Auch bei diesem manifestiert sich nämlich die Zueignung<br />
in der Annahme des Angebots. Strenge Anforderungen an die Manifestation der Zueignung<br />
zu stellen, reicht also allein nicht aus. Um eine Ausweitung des Tatbestandes zu verhindern,<br />
ist vielmehr der Begriff der Zueignung dahingehend auszulegen, daß der Täter oder<br />
der Dritte eine „sachenrechtsähnliche Beziehung zu dem Gegenstand“ in Form von Gewahrsam<br />
oder Eigenbesitz erlangen muß. 109 Allein der Abschluß eines schuldrechtlichen Vertrages<br />
oder rein tatsächliches Handeln genügt also nicht. Vorliegend hat der Dritte zu dem fremden<br />
Fahrrad keine sachenrechtsähnliche Beziehung begründet, denn er hat am Fahrrad weder Besitz<br />
noch Gewahrsam. <strong>Das</strong> frühere Erfordernis des Besitzes oder Gewahrsams lebt also gewissermaßen<br />
im Zueignungsbegriff fort. 110<br />
103<br />
s. o. S. 7.<br />
104<br />
Sander/Hohmann, NStZ 1998, 273 (276).<br />
105<br />
BGHSt 14 38 (41); Ruß in LK, § 246, Rn. 13.; Eser in Schönke/Schröder, § 246, Rn. 11; Sander/Hohmann,<br />
§ 3, Rn. 13 f; Maurach/Schroeder/Maiwald, § 34, Rn. 28.<br />
106<br />
Wessels BT 2; Weber in Arzt/Weber, LH. 3, Rn. 278 f.<br />
107<br />
Samson in SK, § 246, Rn. 40 f.<br />
108<br />
BGHSt 14, 38 (41); RGSt 58, 230.<br />
109<br />
Rengier, § 5, Rn. 19.<br />
110<br />
Charalambakis, S. 217 f; Rengier, § 5, Rn. 20.<br />
Frank Fad<br />
13
II. Die Änderungen des <strong>6.</strong> StrRG im einzelnen<br />
Ähnliche Schwierigkeiten treten in Fall 11 auf. Eine Strafbarkeit des T ist mangels strafwürdigen<br />
Unrechts auch hier zu vermeiden. Würde man hier verlangen, daß der Täter Eigenbesitz<br />
an dem Buch begründen muß, würde dies nicht ausreichen. Die Begründung von Eigenbesitz<br />
hängt allein vom Willen des D ab. Daher muß auch hier eine Manifestation der Zueignung bei<br />
dem Dritten gefordert werden. Der Dritte muß also mit der Zueignung einverstanden sein und<br />
die Sache seinem Vermögen einverleiben. 111 Dies läßt sich damit begründen, daß auch nach<br />
dem alten Recht die Zueignung nicht bereits durch einen darauf gerichteten Willen des Täters<br />
erfüllt war, sondern eine entsprechende nach außen sichtbare Manifestation erforderlich<br />
war. 112 Bei der Drittzueignung kann daher nichts anderes gelten.<br />
Als Ergebnis kann festgestellt werden, daß bei der Unterschlagung eine Drittzueignung nur<br />
dann anzunehmen ist, wenn der Dritte zu der Sache ein sachenrechtsähnliches Verhältnis begründet<br />
hat und sich die Zueignung bei ihm nach außen erkennbar manifestiert.<br />
bb) Versuchsbeginn bei der Drittzueignung<br />
Nach altem Recht fiel bei der Zueignung wegen der Manifestationstheorie Versuch und Vollendung<br />
häufig zusammen, so daß eine Versuchsstrafbarkeit nur im Fall eines untauglichen<br />
Versuchs denkbar war. 113 Fraglich ist, ob ein Versuchsbeginn bei einer Unterschlagung in<br />
Form der Drittzueignung erst dann vorliegt, wenn eine Manifestation der Zueignung beim<br />
Dritten erfolgt. Da der Täter regelmäßig aber nicht weiß, ob und wann der Dritte eine Zueignungshandlung<br />
vornehmen wird, muß auf seine Vorstellung abgestellt werden. Der Versuchsbeginn<br />
liegt also dann vor, wenn nach der Vorstellung des Täters der Dritte eine Zueignungshandlung<br />
vornehmen wird. Hier können also durchaus Versuch und Vollendung auseinanderfallen.<br />
cc) Reichweite der formellen Subsidiarität<br />
Nach § 246 ist nur dann zu bestrafen, „wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwerer<br />
Strafe bedroht ist“. Da die Unterschlagung gem. § 246 I n. F. nach dem Willen des Gesetzgebers<br />
kein Grundtatbestand aller Zueignungsdelikte, sondern ein Auffangtatbestand sein<br />
soll, wurde eine Subsidiaritätsklausel angefügt. Der Wille des Gesetzgebers geht dahin die<br />
Subsidiarität bezüglich Diebstahl, Raub, Betrug, Erpressung, Untreue oder Hehlerei anzunehmen.<br />
114 Subsidiarität bedeutet, daß eine Strafvorschrift nur hilfsweise für den Fall Anwendung<br />
finden soll, daß nicht schon eine andere Strafvorschrift eingreift. 115<br />
Fraglich ist nunmehr, wie sich eine Unterschlagung zu einem anderen Nichtvermögensdelikte,<br />
das dazu in Tateinheit steht, verhält. Der Wortlaut („die Tat“) spricht dafür, ebenfalls Subsidiarität<br />
anzunehmen. Auch eine systematische Auslegung spricht dafür, denn es gibt Subsidiaritätsklauseln<br />
in §§ 98 I, 99 I, 145d I, 183a, 265 I und § 316 I, die sich nur auf bestimmte<br />
Delikte beziehen. Daraus könnte systematisch geschlossen werden, daß in anderen Fällten<br />
eine generelle Subsidiarität bestehen soll. Der Wille des Gesetzgebers geht aber dahin, die<br />
Subsidiarität nur bei Konkurrenz mit anderen Vermögensdelikten anzunehmen. 116 Der E 62<br />
hat die Subsidiarität der Unterschlagung (§ 240 I E) ausdrücklich nur in bezug auf Diebstahl,<br />
111 Rengier, § 5, Rn. 19.<br />
112 s. o. Fn. 105 und Fn. 10<strong>6.</strong><br />
113 Maurach/Schroeder/Maiwald, § 34, Rn. 3<strong>6.</strong><br />
114 BT-Druck. 13/7164, S. 44; Kreß, NJW 1998, 633 (640).<br />
115 Eser in Schönke/Schröder, vor § 52, Rn. 105; Jescheck/Weigend, S. 734.<br />
116 s. o. Fn. 114.<br />
Frank Fad<br />
14
II. Die Änderungen des <strong>6.</strong> StrRG im einzelnen<br />
Raub, Betrug, Erpressung, Untreue oder Hehlerei angeordnet. 117 Schließlich sprechen auch<br />
Sinn und Zweck der Subsidiaritätsklausel eindeutig für eine Beschränkung auf Vermögensdelikte,<br />
denn § 246 soll einen Auffangtatbestand für Vermögensdelikte darstellen. Der noch<br />
mögliche Wortsinn bildet hier keine Grenze für die Auslegung, da das Analogieverbot nicht<br />
für Konkurrenzfragen gilt, denn die Gesetzeskonkurrenz ist für die meisten Fälle ohnehin<br />
nicht gesetzlich zu regeln. Schließlich werden auch andere Subsidiaritätsklauseln in dieser<br />
Weise ausgelegt 118 . Die Subsidiaritätsklausel bezieht sich also nur auf Vermögensdelikte.<br />
Während eine versuchte Unterschlagung gegenüber einem anderen ebenfalls nur versuchten<br />
Vermögensdelikt unzweifelhaft subsidiär ist, fragt sich, wie sich eine vollendete Unterschlagung<br />
zu einem nur versuchten anderen Vermögensdelikt verhält. Auftreten kann eine solche<br />
Situation etwa in folgendem Fall: Der Täter nimmt einem Toten, den er für einen Schlafenden<br />
hält, Sachen weg. Hier liegt kein vollendeter Diebstahl vor, weil ein Toter keinen Gewahrsam<br />
hat 119 und somit keine Wegnahme vorliegt. Der Täter hat sich vielmehr nur eines untauglichen<br />
Versuchs eines Diebstahls (§§ 242 I, 22) strafbar gemacht. Daneben ist auch eine vollendete<br />
Unterschlagung (§ 246 I) gegeben. Gegen Idealkonkurrenz spricht, daß der versuchte Diebstahl<br />
mit schwerer Strafe bedroht ist, da die Strafmilderung für den Versuch (§§ 23 II, 49 I)<br />
nur fakultativ ist. Selbst bei einer Milderung nach dieser Vorschrift ermäßigt sich das<br />
Höchstmaß nur auf Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten und liegt somit immer<br />
noch über dem der Unterschlagung. Dagegen spricht allerdings, daß bei der Annahme von<br />
Idealkonkurrenz im Tenor des Urteils klargestellt werden kann, daß tatsächlich eine rechtswidrige<br />
Zueignung stattgefunden hat.<br />
dd) Veruntreuende Unterschlagung, § 246 II<br />
Die veruntreuende Unterschlagung ist jetzt in einem eigenständigen Absatz 2 geregelt. Die<br />
Subsidiaritätsklausel bezieht sich nur auf die einfache Unterschlagung nicht auch auf die veruntreuende<br />
Unterschlagung. Dies ergibt sich zum einen aus der systematischen Stellung des<br />
Abs. 2, zum anderen aus Sinn und Zweck der Vorschrift. Bei der veruntreuenden Unterschlagung<br />
ist nicht nur das Eigentum, sondern auch das Treueverhältnis geschützt, was im Schuldspruch<br />
auch Ausdruck finden soll.<br />
3. Änderungen in § 244 I<br />
a) Gleichstellung der Schußwaffen mit anderen gefährlichen Werkzeugen (§ 244 I Nr. 1)<br />
Durch das <strong>6.</strong> StrRG wurde der Diebstahl mit gefährlichen Werkzeugen dem Diebstahl mit<br />
Schußwaffen gleichgestellt. Nach dem Regierungsentwurf (BT-Durchs. 13/7164) sollte § 244<br />
I Nr. 1 unverändert bleiben. Erst in den Beratungen des Rechtsausschusses wurde die Gleichstellung<br />
der Schußwaffe mit anderen gefährlichen Werkzeugen vorgeschlagen und damit begründet,<br />
daß es nicht einzusehen sei, für die Verwendung einer Handgranate, eines Tapetenmessers<br />
oder von Salzsäure eine geringere Mindeststrafe vorzusehen als für die Verwendung<br />
einer Schußwaffe. 120 Die gleiche Änderung erfolgte bei der Raubqualifikation des § 250 I Nr.<br />
1.<br />
117<br />
E 62, S. 50, 409.<br />
118<br />
Eser in Schönke/Schröder, vor § 52, Rn. 106; Jescheck/Weigend, S. 715.<br />
119<br />
s. o. Fn. 84.<br />
120<br />
BT-Drucks 13/9064, S. 17, 18.<br />
Frank Fad<br />
15
II. Die Änderungen des <strong>6.</strong> StrRG im einzelnen<br />
Nach § 244 I Nr. 1a wird nun bestraft, wer eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug<br />
bei sich führt. Unter dem Begriff der Waffe i. S. v. § 244 Nr. 1 a Alt. 1 sind die von<br />
§ 244 I Nr. 1 a. F. erfaßten Schußwaffen und sonstigen Waffen im technischen Sinne – also<br />
solche Gegenstände, die bestimmungsgemäß als Angriffs- oder Verteidigungsmittel zur Herbeiführung<br />
von Verletzungen verwendet werden – zu verstehen. 121 Problematisch ist hingegen<br />
die Frage, was unter einem gefährlichen Werkzeug i. S. v. § 244 I Nr. 1 a Alt. 2 zu verstehen<br />
ist. Als gefährliche Werkzeuge sind jedenfalls solche Gegenstände zu verstehen, die aufgrund<br />
ihrer objektiven Beschaffenheit generell geeignet sind, erhebliche Verletzungen zuzufügen. 122<br />
Fraglich ist, ob auch solche Gegenstände als gefährliche Werkzeuge erfaßt werden sollen, die<br />
nur im Hinblick auf die konkrete Verwendungsabsicht gefährlich sind. Aus systematischen<br />
Gründen ist das Abstellen auf die Verwendungsabsicht problematisch, denn diese wird von<br />
§ 244 I Nr. 1b erfaßt. § 244 I Nr. 1a ist aber allein durch das Bei-Sich-Führen eines entsprechenden<br />
Gegenstandes erfüllt. Wenn man auf eine gefährliche Verwendungsabsicht abstellt,<br />
wäre immer auch § 244 Nr. 1b erfüllt. Die Verwendungsabsicht, die von § 244 I Nr. 1a nicht<br />
verlangt wird, wird auf diese Weise doch wieder erforderlich. 123 Daher empfiehlt es sich, unter<br />
§ 244 I Nr. 1a nur objektiv gefährliche Gegenstände zu subsumieren. 124 Dem steht jedoch der<br />
Wille des Gesetzgebers entgegen, wonach auf die zu § 224 I Nr. 2 entwickelten Grundsätze<br />
zurückgegriffen werden soll. 125 Danach ist ein Werkzeug dann gefährlich, wenn es nach seiner<br />
objektiven Beschaffenheit und nach Art der Verwendung im konkreten Fall geeignet ist, erhebliche<br />
Verletzungen herbeizuführen. 126 Diese Definition kann für § 244 I Nr. 1a Alt. 2 nur<br />
mit der Maßgabe herangezogen werde, daß es nicht auf die konkrete Verwendung, sondern<br />
auf die konkrete Verwendungsabsicht ankommt. Kommt das Werkzeug tatsächlich zum Einsatz<br />
wird nämlich zumeist Raub (§ 249) oder räuberischer Diebstahl (§ 252) vorliegen. Ein<br />
Teil der Literatur folgt dieser Ansicht. 127<br />
Durch die Erweiterung des Tatbestandes kommt der schon bisher umstrittenen Frage, wie<br />
Personen, die durch ihre Berufsausübung verpflichtet sind, gefährliche Werkzeuge mitzuführen,<br />
bei der Begehung eines einfachen Diebstahls ohne jede Verwendungsabsicht zu behandeln<br />
sind. Hierbei geht es z. B. um Fälle, in denen ein Polizeibeamter seine Dienstwaffe bei<br />
der Begehung eines einfachen Diebstahls bei sich führt. Denkbar sind jetzt auch Fälle, in denen<br />
ein Handwerker Messer oder Hämmer bei sich führt. Früher war diese Frage umstritten.<br />
Die Rechtsprechung 128 und mit ihr ein Teil der Literatur 129 lehnte eine Einschränkung in diesen<br />
Fällen ab. Eine Gegenansicht in der Literatur 130 befürwortete eine Einschränkung mit unterschiedlichen<br />
Begründungen. So wird zum Teil vorgebracht, daß bei „Berufswaffenträgern“<br />
das aktuelle Bewußtsein, gerade im Augenblick der Tat eine Waffe bei sich zu führen, fehle 131<br />
121<br />
Günther in SK, § 250, Rn. 9 f; Rengier, § 4, Rn. 12.<br />
122<br />
Günther in SK, § 250, Rn. 11; Schroth, NJW 1998, 2861 (2864).<br />
123<br />
Rengier, BT I, § 4, Rn. 25; Günther in SK, § 250, Rn. 8 a. E; Küper, S. 400.<br />
124<br />
ebenso Schroth, NJW 1998, 2861 (2864); Hörnle, Jura 1998, 179 (172); a. A. Günther in SK, § 250, Rn.<br />
11; Küper, BT, S. 398.<br />
125<br />
BT-Durcks. 13/9064, S. 18.<br />
126<br />
Kühl in Lackner, § 223a, Rn. 5; Stree in Schönke/Schröder, § 223a, Rn. 5.<br />
127<br />
Rengier, BT I, § 4, Rn. 6; Günther in SK § 250, Rn. , 11; Küper, S. 400.<br />
128<br />
BGHSt 30, 44 (45); OLG Köln, NJW 1978, 652.<br />
129<br />
Wessels, BT 2, Rn. 256; Katzer, NStZ 1982, 236; Geppert, Jura 1992, 498; Ruß, in LK, § 244, Rn. 5a.<br />
130<br />
Schünemann¸ JA 1980, 349 (355); Hruschka, NJW 1978, 1338; Kotz, JuS 1982, 97 (100); Haft, JuS 1988,<br />
364 (369); Solbach, NZWehrR, 1977, 161 (162 f); Eser in Schönke/Schröder, E 244, Rn. 5; Tröndle, § 244,<br />
Rn. 4.<br />
131<br />
vgl. z. B. Kühl in Lackner, § 244, Rn. 5<br />
Frank Fad<br />
16
II. Die Änderungen des <strong>6.</strong> StrRG im einzelnen<br />
oder daß mangels innerer Beziehung zwischen Bewaffnung und Tat eine teleologische Reduktion<br />
vorgenommen werden müsse 132 .<br />
Angesichts der tatbestandlichen Erweiterungen des § 244 I Nr. 1 könnte eine Reduktion sinnvoll<br />
sein. 133 Eine Einschränkung ist auch nach neuem Recht abzulehnen. 134 Der gegenüber dem<br />
einfachen Diebstahl des § 242 erhöhte Unrechtsgehalt des § 244 I Nr. 1a ergibt sich durch die<br />
abstrakte Gefährlichkeit des Täters, der ein gefährliches Werkzeug bei sich führt. Auch bei<br />
einer Person, die die Waffe ohne Verwendungsabsicht – z. B. aus beruflichen Gründen – bei<br />
sich führt, ist sie gegeben. 135 Auch hier besteht die Gefahr, daß das gefährliche Werkzeug<br />
dann, wenn der Täter in Bedrängnis gerät, eingesetzt wird. Da es bei den gefährlichen Werkzeugen<br />
auf die Verwendungsabsicht ankommt 136 , wird die tatbestandliche Erweiterung<br />
schließlich auch nicht zu unangemessenen Ausweitungen der Strafbarkeit führen. So ist z. B.<br />
ein Handwerker, der – nur berufsbedingt – einen Hammer bei sich führt und einen Diebstahl<br />
begeht, nicht nach § 244 I Nr. 1a strafbar, weil der Hammer mangels Verwendungsabsicht<br />
kein gefährliches Werkzeug ist 137 .<br />
b) Diebstahl mit sonstigen Werkzeugen und Mitteln, § 244 I Nr. 1b<br />
Nach altem Recht war umstritten ob sog. „Scheinwaffen“ unter § 244 I Nr. 2 fallen. Die<br />
Rechtsprechung138 und ein Teil der Literatur139 nahm dies an, wenn die Scheinwaffe ihrer Art<br />
nach aus der Sicht des Täters ohne weiteres geeignet ist, dem Opfer den Eindruck eines zur<br />
Gewaltanwendung tauglichen Gegenstandes zu vermitteln. Die h. L. 140 lehnte dies aber ab,<br />
weil § 244 Nr. 2 a. F. eindeutig ein Parallele zu § 250 I Nr. 2 a. F. aufweise und die Einbeziehung<br />
der Scheinwaffe hier wegen der doppelten Verwertung der „leeren Drohung“ ersichtlich<br />
verfehlt sei141 .<br />
Der Wortlaut des § 244 I Nr. 1b hat sich gegenüber § 244 I Nr. 2 a. F. dahingehend verändert,<br />
daß der Begriff der „Waffe“, der jetzt in § 244 I Nr. 1a enthalten ist, fehlt. Ansonsten ist der<br />
Wortlaut unverändert geblieben. Nach einer Wortlautinterpretation könnte man auf den ersten<br />
Blick meinen, daß die Scheinwaffenproblematik nach wie vor relevant ist. 142 § 244 I Nr. 1b<br />
soll aber nach dem Willen des Gesetzgebers143 einen Auffangtatbestand darstellen, der die<br />
Scheinwaffen und solche Gegenstände, die zur gewaltsamen Überwindung von Widerstand<br />
eingesetzt werden sollen und objektiv nicht einmal Leibesgefahr begründen (z. B. ein Kabelstück<br />
oder ein Tuch), erfaßt. Auch eine systematische Auslegung des § 244 I Nr. 1b führt zu<br />
132 vgl. z. B. Tröndle, § 244, Rn. 4.<br />
133 so jedenfalls Schroth, NJW 1998, 2861 (2864 f).<br />
134 so haben Rengier, § 4, Rn. 23 und Günther in SK, § 250, Rn. 16 (für § 250 I Nr. 1a) an ihrer Ansicht trotz<br />
der Gesetzesänderung festgehalten.<br />
135 Wessels, BT 2, Rn. 257.<br />
136 s. o. Fn. 127.<br />
137 a. A. aber Schroth, NJW 1998, 2861 (2865).<br />
138 BGHSt 24, 339 (340 ff); für § 250 I Nr. 2 a. F. BGHZ 38, 116 (117)<br />
139 Ruß in LK, § 244, Rn. 9, Gössel, BT 2, § 9, Rn. 17; Wessels, BT 2, Rn. 260; Schünemann, JA 80, 349<br />
(355).<br />
140<br />
Kühl in Lackner, § 244, Rn. 4; Eser in Schönke/Schröder, § 244, Rn. 14; Haft, JuS 1988, 364 (365).<br />
141<br />
Schönke/Schröder, § 250, Rn. 50; Wessels, BT 2, Rn. 338 ff, a. A. BGHSt 24, 339 (342).<br />
142<br />
so Hörnle, Jura 1998, 169 (173 f).<br />
143<br />
dieser kommt sowohl im Bericht des Rechtsausschusses (BT-Drucks. 13/9064, S. 17, 18), als auch im Re-<br />
gierungsentwurf (BT-Drucks. 13/7164, S. 44 f).<br />
Frank Fad<br />
17
II. Die Änderungen des <strong>6.</strong> StrRG im einzelnen<br />
diesem Ergebnis, da § 244 I Nr. 1b sonst keinen Sinn machen würde. Damit steht fest, daß<br />
§ 244 I Nr. 1b die Scheinwaffe einbezieht. 144<br />
Die Einbeziehung der Scheinwaffe beim Diebstahl mit Waffen ist jedoch verfehlt. Weitgehend<br />
unstreitig ist dies für den Raub. Zwar hat die Literatur der insoweit verfehlten Rechtsprechung<br />
145 für den Diebstahl eher zugestimmt als für den Raub. 146 Für den Diebstahl kann<br />
aber nichts anderes gelten als für den Raub. Grund für die Qualifikation des § 244 I Nr. 2 ist<br />
die gesteigerte abstrakte Gefährlichkeit, denn auf eine konkrete Gefährdung des Opfers kann<br />
es schon deshalb nicht ankommen, weil bei Einsatz des Werkzeugs oder des Mittels in der<br />
Regel Raub (§ 249 I) oder räuberischer Diebstahl (§ 252) vorliegen würde. Hat der Täter nur<br />
die Bereitschaft, sich die Sachen notfalls mit Raubmitteln anzueignen, fällt dies nicht unter<br />
§ 244 I Nr. 2. Ist der Täter aber bereit, notfalls eine Scheinwaffe einzusetzen, so soll er den<br />
Qualifikationstatbestand der § 244 I Nr. 2 erfüllen. Da aber nach h. L. ein Raub unter Einsatz<br />
einer Scheinwaffe mangels zusätzlich verwirklichten Unrechts nicht unter § 250 I Nr. 2 fallen<br />
soll 147 , kann bei der Bereitschaft zum Einsatz einer Scheinwaffe beim Diebstahl auch kein<br />
zusätzliches Unrecht vorliegen, so daß die Scheinwaffe von § 244 Nr. 2 nicht erfaßt wird.<br />
Als Ergebnis ist festzuhalten, daß der Gesetzgeber § 244 Nr. 1 wie folgt hätte fassen sollen: In<br />
Nr. 1a wird nur das Beisichführen von Waffen im technischen Sinn und in Nr. 1b das Beisichführen<br />
von Werkzeugen und Mitteln, die der Täter in objektiv gefährlicher Weise zu verwenden<br />
beabsichtigt, erfaßt.<br />
c) Der „Wohnungseinbruchsdiebstahl“, § 244 I Nr. 3<br />
Der sog. Wohnungseinbruchsdiebstahl wurde früher nur vom Regelbeispiel des § 243 I 2 Nr.<br />
1 a. F. erfaßt und war mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu zehn Jahren bedroht. Die<br />
„Wohnung“ war dabei nur ein Unterfall des „umschlossenen Raumes“. Durch das <strong>6.</strong> StrRG<br />
wurde der Wohnungseinbruchsdiebstahl zu einer selbständigen Qualifikation gem. § 244 I Nr.<br />
3 und ist mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zehn Jahren bedroht. Diese Strafverschärfung<br />
begründet der Gesetzgeber damit, daß es sich beim Wohnungseinbruchsdiebstahl<br />
um eine Straftat handele, die tief in die Intimsphäre eingreife und zu ernsten psychischen Störungen<br />
– wie etwa langwierige Angstzustände – führen könne. Zudem seien Wohnungseinbruchsdiebstähle<br />
häufig mit Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder der Verwüstung von<br />
Einrichtungsgegenständen verbunden. 148 Da die Tat, wenn es tatsächlich zu Gewalttätigkeiten<br />
gegen Menschen oder Sachbeschädigungen kommt, nach §§ 223, 240, 249, 303 bestraft werden<br />
kann, kommt es dem Gesetzgeber also auf die abstrakte Gefährlichkeit des Wohnungseinbruchsdiebstahls<br />
an.<br />
Hinsichtlich der Tathandlungen – einbrechen, einsteigen, eindringen oder sich verborgen halten<br />
– kann in vollem Umfang auf die zu § 243 N 2 Nr. 1 entwickelten Auslegungen zurückgegriffen<br />
werden. 149<br />
Bei der Anwendung des § 244 I Nr. 3 wird es künftig vermehrt auf die Definition der Wohnung<br />
– insbesondere in Abgrenzung zu sonstigen umschlossenen Räumen – ankommen. Hier-<br />
144 so auch BGH, NJW 1998, 2914 (2915); Rengier, BT 1, § 4, Rn. 31; Schroth, NJW 1998, 2861 (2865); für §<br />
250 auch Günther in SK, § 250, Rn. 20, 24.<br />
145 s. o. Fn. 138.<br />
146 vgl. z. B. Wessels, BT 2, Rn. 260.<br />
147 s. o. Fn. 140.<br />
148 BT-Drucks 13/7164, S.43.<br />
149 Hörnle, Jura 1998, 169 (171).<br />
Frank Fad<br />
18
II. Die Änderungen des <strong>6.</strong> StrRG im einzelnen<br />
bei könnte man auf die zum Hausfriedensbruch (§ 123) entwickelten Kriterien zum Begriff<br />
der Wohnung zurückgreifen. 150 Eine Wohnung ist demnach also eine bauliche oder sonst abgeschlossene,<br />
zumindest teilweise überdachte Räumlichkeit, die dazu dient, einem oder mehreren<br />
Menschen, wenn auch nur überwiegend oder vorübergehend, Unterkunft zu gewähren. 151<br />
Dabei ist umstritten, ob auch außerhalb des eigentlichen Wohnbereichs gelegene Nebenräume,<br />
wie z. B. Treppenhaus, Garage, Keller-, Boden- und Waschräume, erfaßt sind. Die h. M.<br />
bejaht dies, wenn ein Zusammenhang mit der Wohnung erkennbar ist. 152 Eine Mindermeinung<br />
lehnt dies ab. 153 Teilweise wird sogar die Einbeziehung von offenen Zubehörflächen, wie<br />
Stellplätze, Hofräume und Gärten, befürwortet. 154 Letzteres ist schon mit dem Wortlaut nicht<br />
mehr zu vereinbaren und bereits deshalb abzulehnen. Beim Wohnungseinbruchsdiebstahl<br />
sollte aber auch auf die Einbeziehung von außerhalb des Wohngebäudes gelegenen Nebenräume<br />
verzichtet werden. Der Gesetzgeber hat nämlich zur Begründung der Strafverschärfung<br />
auf die besondere psychische Belastung, die mit einem Eindringen in die Intimsphäre verbunden<br />
ist, 155 abgestellt. Die außerhalb der Wohnung gelegenen Nebenräume gehören nicht zur<br />
Intimsphäre. So wird etwa ein Einbruch in die Garage vom Opfer als deutlich weniger belastend<br />
empfunden als ein Einbruch in das Wohnzimmer.<br />
Beim Wohnungseinbruchsdiebstahl liegen regelmäßig neben § 244 I Nr. 3 auch die Voraussetzungen<br />
des besonders schweren Diebstahls vor, da die Wohnung immer noch unter den<br />
Oberbegriff des umschlossenen Raumes in § 243 I 2 Nr. 1 fällt. §§ 242, 243 I 2 Nr. 1 tritt daher<br />
im Wege der Spezialität hinter § 244 I Nr. 3 zurück. 156<br />
4. Sonstige Änderungen<br />
a) § 248 c III<br />
Bei § 248c wurde auf Vorschlag des Rechtsausschusses157 ein neuer Abs. 3 angefügt, der klarstellt158<br />
, daß auch für das Entziehen elektrischer Energie die Strafantragserfordernisse der<br />
§§ 247 und 248a Anwendung finden. Der alte Abs. 3 wurde zu Abs. 4. Der Gesetzesentwurf<br />
der Bundesregierung159 sah eine Streichung des früheren Abs. 3 vor. Der Bundesrat160 und der<br />
Rechtsausschuß161 haben sich aber mit Zustimmung der Bundesregierung für deren Beibehaltung<br />
ausgesprochen.<br />
150 so jedenfalls Küper, S. 411.<br />
151 Lenckner in Schönke/Schröder, § 123, Rn. 4; Kühl in Lackner, § 123, Rn. 3.<br />
152 RGSt 1, 121; Schäfer in LK, 10. Aufl., § 123, Rn. 9; Kühl in Lackner, § 123, Rn. 3; Lenckner in Schön-<br />
ke/Schröder, § 123, Rn. 4; Küper, S. 411f.<br />
153 Artkämper, S. 57; Behm, GA, 86, 147 (550).<br />
154 Schäfer in LK, 10. Aufl., § 123, Rn. 9; Gössel, S. 442.<br />
155 s. o. Fn. 148.<br />
156 Hörnle, Jura 1998, 169 (171).<br />
157 BT-Drucks. 13/9064.<br />
158 früher wurden die §§ 247, 248a analog angewandt (LG Schweinfurt NJW 1973, 1809; Eser in Schönke/Schröder,<br />
§ 248c, Rn. 16; Samson in SK, § 248 c Rn. 12).<br />
159 BT-Drucks. 13/7164,<br />
160 BT-Drucks. 13/8587, S. 63.<br />
161 BT-Drucks. 13/9064, S. 17.<br />
Frank Fad<br />
19
III. Unterbliebene Änderungen, insb. „Entkriminalisierung“ des Ladendiebstahls<br />
b) Wegfall von § 244a IV<br />
Zur Beseitigung von Wertungswidersprüchen zu § 244, der keine Geringwertigkeitsklausel<br />
enthält, wurde auf Vorschlag des Bundesrates162 mit Zustimmung der Bundesregierung und<br />
des Rechtsausschusses163 die Geringwertigkeitsklausel in § 244a IV gestrichen.<br />
III. Unterbliebene Änderungen, insb. „Entkriminalisierung“ des Ladendiebstahls<br />
1. Frühere Reformbestrebungen<br />
Nach einem im Zusammenhang mit dem Alternativ-Entwurf eines Strafgesetzbuches 1974<br />
vorgelegten Entwurf eines Gesetzes gegen den Ladendiebstahl (AE-GLD) soll der Ladendiebstahl<br />
als Teilbereich der sog. „kleinen Vermögenskriminalität“ in einem gesonderten Gesetz<br />
geregelt werden. Nach § 1 des AE-GLD sollte das Gesetz auf während der Ladenöffnungszeit<br />
von Kunden zum Nachteil des Geschäftsinhabers mit einem Schaden bis zu 500 DM begangene<br />
Delikte des Diebstahls oder des Betruges, der Urkundenfälschung oder der Sachbeschädigung,<br />
wenn sie mit der Entfernung von Sachen aus dem Laden zusammenhängen, Anwendung<br />
finden. Wenn der Täter das 14. Lebensjahr vollendet hat und i. S. v. §§ 827, 828 BGB<br />
deliktsfähig ist, muß er gem. § 2 des AE-GLD neben den üblichen zivilrechtlichen Ersatzansprüchen<br />
den Ladenpreis der Ware oder den Wert des Erlangten, mindestens jedoch 50 DM<br />
als Sanktion an den Ladeninhaber bezahlen. Der Anspruch sollte auf dem Zivilrechtsweg über<br />
das Mahnverfahren durchgesetzt werden (§ 7 AE-GLD). Bei einer sofortigen Zahlung oder<br />
einem Anerkenntnis des Täters ist der Ladeninhaber verpflichtet, einen Antrag auf Erlaß eines<br />
„Eintragungsbefehls“ beim Amtsgericht zu stellen (§§ 5, 6 AE-GLD). Rechtskräftige Eintragungsbefehle<br />
und rechtskräftige Verurteilungen im Mahnverfahren werden gem. § 8 AE-GLD<br />
in einem Zentralregister eingetragen. Die Strafverfolgung sollte nur dann möglich sein, wenn<br />
in einem Zeitraum von zwei Jahren vor der Begehung zwei Sanktionen eingetragen sind<br />
(§§ 9, 10 AE-GLD).<br />
Die Verfasser des AE-GLD versuchen die Nachteile, die durch „Globallösungen“ der sog.<br />
„kleinen Vermögenskriminalität“ – wie z. B. Herabstufung zu Ordnungswidrigkeiten, verfahrensrechtliche<br />
Lösungen, Ausklammerung aus dem Tatbestand – entstehen, zu kompensieren.<br />
164 Durch die über den eigentlichen Schadensersatz hinaus zu leistende Sanktion werde der<br />
Landeinhaber dazu bewegt, selbst verstärkt Maßnahmen zur Prävention zu ergreifen. So könne<br />
der durch die zunehmende Selbstbedienung verursachte Anstieg des Ladendiebstahls verringert<br />
werden. 165<br />
162 BT-Drucks. 13/858, S. 63, 84.<br />
163 BT-Drucks. 13/9064, S. 17.<br />
164 AE-GLD, S. 8 f.<br />
165 AE-GLD, S. 9 f.<br />
Frank Fad<br />
20
III. Unterbliebene Änderungen, insb. „Entkriminalisierung“ des Ladendiebstahls<br />
2. Der Gesetzesentwurf der Fraktion „Bündnis 90/Die Grünen“<br />
Die Fraktion „Bündnis 90/Die Grünen“ forderte in ihrem Antrag vom 18.07.1995 166 den Bundestag<br />
auf zu beschließen, die Bundesregierung aufzufordern, ein Gesetz zur Entkriminalisierung<br />
des Ladendiebstahls, Schwarzfahrens und der Fahrerflucht bei Sachbeschädigung einzubringen.<br />
Durch Ergänzung von § 242 soll von Strafe abgesehen werden, wenn der Diebstahl<br />
– in einem Ladengeschäft zur Öffnungszeit begangen wurde,<br />
– der Täter bisher weder einschlägig verurteilt noch mehrfach (5 mal) ihm gegenüber von<br />
Strafe abgesehen wurde,<br />
– der Wert der gestohlenen Sache 250 DM nicht übersteigt,<br />
– die gestohlene Sache herausgegeben oder ihren Wert ersetzt und<br />
– dem Geschädigten den Ladenpreis, mindestens jedoch 50 DM als Pauschale erstattet wurde.<br />
Im Gegensatz zum AE-GLD verzichten die Verfasser des Antrags auf einen konkreten Vorschlag<br />
zur Formulierung eines Gesetzes. Sie machen keinen Vorschlag, wie das vorgeschlagene<br />
Verfahren umgesetzt werden soll.<br />
Begründet wurde der Gesetzesentwurf mit folgenden Argumenten:<br />
Da strafrechtliche Sanktionen immer das letzte Mittel des Staates zum Schutz hochwertiger<br />
Rechtsgüter sind, müsse eine generelle Strafbarkeit des Ladendiebstahls abgeschafft werden.<br />
Die Pönalisierung nutze weder dem Opfer, noch entfalte sie general- oder spezialpräventive<br />
Wirkungen und behindere den Konfliktausgleich.<br />
Die Entkriminalisierung des Ladendiebstahls sei auch deshalb erforderlich, um Wertungswidersprüche<br />
im Strafgesetzbuch zu korrigieren. Diebstahl sei eine gewaltlose Tat, die deshalb<br />
weniger strafwürdig sei als Gewalttaten.<br />
Die Entkriminalisierung des Ladendiebstahls führe zu einer Entlastung der Strafjustiz.<br />
Bei den Strafrechtsreformen der 70er Jahre wurden zahlreiche Übertretungen zu Ordnungswidrigkeiten<br />
herabgestuft. Beim Diebstahl hingegen erfolgte eine Strafverschärfung, indem<br />
der „Mundraub“ abgeschafft wurde und nun unter den Diebstahlstatbestand mit einer weitaus<br />
härteren Strafe fällt. 167<br />
Da die Kaufhäuser immer Strafantrag stellten, würde die Justiz in die Rolle einer „Beschützerin<br />
von Kaufhäusern und ihren anreizenden aber auch diebstahlsfördernden Verkaufspraktiken“<br />
168 gedrängt.<br />
Trotz der Kriminalisierung des Ladendiebstahls konnte ein starker Anstieg der polizeilich<br />
registrierten Delikte nicht verhindert werden. Ladendiebstahl sei – insbesondere unter jungen<br />
Männern und Frauen – weit verbreitet.<br />
3. Kritik<br />
Nach dem geltenden Recht, ist Ladendiebstahl generell strafbar wie jeder andere Diebstahl.<br />
Die durch die Abschaffung des Mundraubs durch das EGStGB 169 erfolgte Strafschärfung<br />
sollte durch das Strafantragserfordernis für Diebstahl und Unterschlagung geringwertiger Sachen<br />
(§ 248a) kompensiert werden. Außerdem wurde die Möglichkeit geschaffen, das Verfah-<br />
166<br />
BT-Drucks. 13/2005.<br />
167<br />
s. o. S. 1.<br />
168<br />
BT-Drucks. 13/2005, S. 3.<br />
169<br />
s. o. S. 1.<br />
Frank Fad<br />
21
III. Unterbliebene Änderungen, insb. „Entkriminalisierung“ des Ladendiebstahls<br />
ren gegen Erfüllung von Auflagen und Weisungen der Staatsanwaltschaft einzustellen (§ 153a<br />
I StPO). In der Praxis werden Fälle des Ladendiebstahls in der Weis gehandhabt, daß die<br />
Staatsanwaltschaften bei Ersttätern das Verfahren häufig folgenlos gem. § 135 I StPO einstellen.<br />
Bei wiederholter Begehung wird das Verfahren dann gem. § 135a I 1 Nr. 2 StPO gegen<br />
Zahlung eines Geldbetrages eingestellt. Erst bei mehrfacher Begehung wird ein Strafbefehl<br />
beantragt oder Anklage erhoben.<br />
Soweit im Gesetzesentwurf der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vorgetragen wird, daß die<br />
Justiz entlastet werde, ist dies verfehlt. Da es – wie oben dargestellt – in den wenigsten Fällen<br />
zu einer Anklageerhebung kommt, werden die Gerichte nur bei mehrfachen Wiederholungstaten<br />
belastet. Hieran würde sich allerdings auch nach dem vorgelegten Gesetzesentwurf<br />
sowie nach dem AE-GLD nichts ändern, denn nach der 5. bzw. 2. Wiederholung müßten sich<br />
auch nach diesem Entwurf die Gerichte mit den Fällen befassen. Die Staatsanwaltschaften,<br />
die nach dem Gesetzesentwurf prüfen müßten, ob die Voraussetzungen für eine Einstellung<br />
des Verfahrens gegeben sind, wären in gleicher Weise wie nach der geltenden Rechtslage<br />
beschäftigt.<br />
Es mag zwar sein, daß die Kriminalisierung des Ladendiebstahls ein Ansteigen der Taten<br />
nicht hat verhindern können. Es ist aber anzunehmen, daß die Zahl der Taten noch stärker<br />
gestiegen wäre, wenn Ladendiebstahl straffrei gewesen wäre. Da ein Ersttäter bei Begehung<br />
eines Ladendiebstahls nur das Verhängen einer Sanktion zu befürchten hat, ist anzunehmen,<br />
daß sich noch mehr Täter zu einem Ladendiebstahl hinreißen lassen. Außerdem ändert die<br />
Tatsache, daß ein Delikt häufig begangen wird, nichts an dessen Strafwürdigkeit.<br />
Zwar bringt die bisherige Rechtslage Nachteile mit sich, indem das Legalitätsprinzip (§ 152 II<br />
StPO) teilweise durchbrochen wird, ein gewisser Druck auf den Beschuldigten ausgeübt wird,<br />
und ein „Handel“ mit der Einstellung des Verfahrens möglich wird. 170 Die bisherige Rechtslage<br />
hat aber den Vorteil, daß auf den jeweiligen Einzelfall unter Wahrung des Gleichheitsgrundsatzes<br />
flexibel reagiert werden kann. Es kann bereits bei einem Ersttäter eine Strafe verhängt<br />
werden, wenn dies aus den besonderen Umständen des Falles geboten erscheint. In anderen<br />
Fällen kann auch mehr als fünf- bzw. zweimal von einer strafrechtlichen Reaktion abgesehen<br />
werden. Die Regelung nach dem Entwurf und die des AE-GLD würde zu einem starren,<br />
unflexiblen Vorgehen zwingen.<br />
Schließlich ist auch die Ansicht, daß die Kaufhäuser mit ihren Geschäftspraktiken nicht<br />
schutzwürdig seien und Ladendiebstähle nur ein lästiges, aber kein gemeinschädliches Verhalten<br />
seien, falsch. Die durch Ladendiebstähle entstehenden Schäden werden von den Ladeninhaber<br />
in die Kalkulation ihrer Preise einbezogen. Letztlich führen die Ladendiebstähle<br />
dazu, daß die anderen redlichen Kunden den Verlust in Form von höheren Kaufpreisen zu<br />
tragen haben. 171 Daran zeigt sich, daß Ladendiebstahl gerade eine gemeinschädliche Form der<br />
Kriminalität ist.<br />
Fraglich ist, ob der AE-GLD verfassungswidrig ist. Aus dem Rechtsstaatsprinzip ergibt sich,<br />
daß eine Strafe nicht ohne Schuld des Täters verhängt werden kann. Unter Strafe fallen nicht<br />
nur Kriminalstrafen, sondern auch strafähnliche Sanktionen. 172<br />
Die Sanktion gem. § 2 des AE-GLD ist eine strafähnliche Sanktion in diesem Sinne. Zwar<br />
wird die Sanktion nicht an den Staat, sondern an den Geschädigten gezahlt. Dies könnte auf<br />
einen zivilrechtlichen Anspruch hindeuten. Es ist aber nicht Aufgabe des zivilrechtlichen<br />
170 vgl. hierzu AE-GLD, S. 8.<br />
171 vgl. AE-GLD, S. 9.<br />
172 BVerfGE (332 ff); 58, 159 (161 f).<br />
Frank Fad<br />
22
III. Unterbliebene Änderungen, insb. „Entkriminalisierung“ des Ladendiebstahls<br />
Schadensersatzes, eine über den Schadensausgleich hinausgehende Sanktion zu verhängen, da<br />
Schadensersatz nicht zur Bereicherung führen darf. Eine über den Schaden hinausgehende<br />
Kompensation ist daher nur als Strafe möglich. Die Sanktion ist außerdem Rechtsfolge der<br />
Erfüllung eines Straftatbestandes. Der Täter wird in ein Register eingetragen, was bei einer<br />
wiederholten Tatbegehung strafschärfend berücksichtigt werden kann.<br />
Nach dem AE-GLD besteht die Möglichkeit einer Bestrafung des Täters ohne seine Schuld.<br />
Da an die zivilrechtliche Deliktsfähigkeit gem. §§ 827, 828 BGB angeknüpft wird, ist gem.<br />
§ 827, 1 BGB ist das Verschulden nur bei Tätern ausgeschlossen, die sich in einem die freie<br />
Willensbildung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit befinden.<br />
Bei Volljährigen ist der Verschuldensmaßstab im übrigen rein objektiv (§ 276 I BGB). § 20<br />
geht hierüber jedoch hinaus. Bei Jugendlichen wird gem. § 828 II 1 BGB nur auf die Einsichtsfähigkeit<br />
und nicht wie in § 3, 1 JGG auch auf die Fähigkeit, nach dieser Einsicht zu<br />
handeln abgestellt. Noch bedenklicher sind aber die Beweislastregeln des Zivilrechts. Danach<br />
trüge der Täter die Beweislast für Rechtfertigungsgründe und Entschuldigungsgründe. Die<br />
Unschuldsvermutung würde also verletzt werden.<br />
Der AE-GLD verstößt daher gegen das Schuldprinzip und ist verfassungswidrig.<br />
Als Ergebnis folgt daraus, daß der Gesetzgeber des <strong>6.</strong> StrRG es zu Recht unterlassen hat, eine<br />
„Entkriminalisierung des Ladendiebstahls“ vorzunehmen.<br />
Frank Fad<br />
23