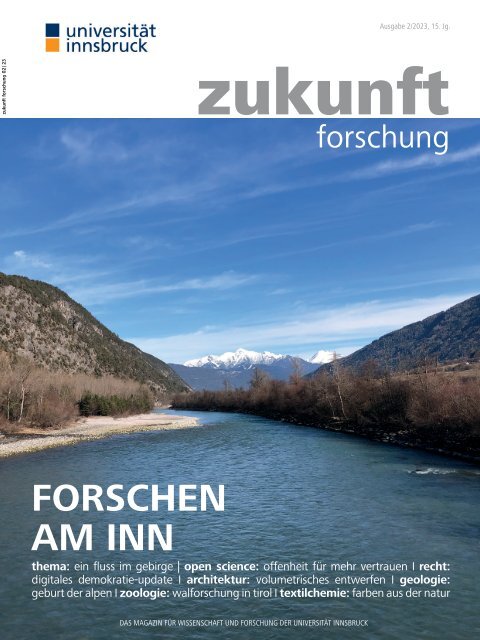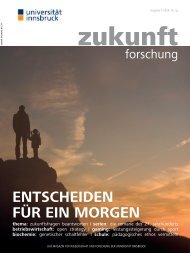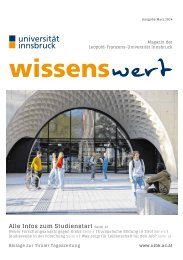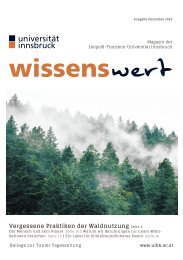Zukunft Forschung 02/2023
Das Forschungsmagazin der Universität Innsbruck
Das Forschungsmagazin der Universität Innsbruck
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Ausgabe 2/2<strong>02</strong>3, 15. Jg.<br />
zukunft forschung <strong>02</strong> | 23<br />
zukunft<br />
forschung<br />
FORSCHEN<br />
AM INN<br />
thema: ein fluss im gebirge | open science: offenheit für mehr vertrauen I recht:<br />
digitales demokratie-update I architektur: volumetrisches entwerfen I geologie:<br />
geburt der alpen I zoologie: walforschung in tirol I textilchemie: farben aus der natur<br />
DAS MAGAZIN FÜR WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG DER UNIVERSITÄT INNS BRUCK
v Rider: Sandra Lahnsteiner | Photo: Christoph Oberschneider<br />
hybrid<br />
Steigfelle<br />
Aus dem Herz der Alpen,<br />
auf die Berge der Welt …<br />
… auf contour Steigfellen<br />
mit hybrid Klebertechnologie<br />
#wearebackcountry<br />
contour_skins<br />
contourskins<br />
contourskins.com<br />
2 zukunft forschung <strong>02</strong>/23<br />
Foto: Andreas Friedle
EDITORIAL<br />
LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,<br />
In dieser Ausgabe von ZUKUNFT FORSCHUNG möchten<br />
wir Sie auf eine interdisziplinäre <strong>Forschung</strong>sreise entlang des<br />
Inns mitnehmen: Der Inn ist seit jeher die Lebensader unserer<br />
Region und wie auch die Alpen und ihre Gletscher ein sensibles<br />
Ökosystem, in dem sich die Folgen der Klimakrise massiv bemerkbar<br />
machen. Als solches ist er ein wichtiges Freiluftlabor für<br />
unsere Naturwissenschaftler:innen, die Impulse zu drängenden<br />
Klima- und Umweltschutzthemen geben. Der Inn ist aber auch<br />
ein Untersuchungsgegenstand von Geschichts-, Erziehungs- und<br />
Literaturwissenschaftler:innen, die ebenso wertvolle neue Perspektiven<br />
auf die Herausforderungen unserer Zeit eröffnen.<br />
An unserem Schwerpunktthema, aber auch an den weiteren Beiträgen<br />
zeigt sich einmal mehr, welche Bedeutung universitäre<br />
<strong>Forschung</strong> für die Bewältigung großer gesellschaftlicher Herausforderungen<br />
hat. So berichten wir beispielsweise in diesem<br />
Heft auch über die Entwicklung nachhaltiger Druckfarben für<br />
die Industrie, über KI-basierte architektonische Entwurfsmethoden<br />
oder Möglichkeiten, wie Demokratien in Krisen resilienter<br />
werden können.<br />
Stolz sind wir auch auf die zahlreichen Preise und Auszeichnungen,<br />
die unsere Forscher:innen in den letzten Monaten<br />
Minion<br />
erhalten<br />
haben. Ganz besonders freuen wir uns, dass unter den<br />
Ausgezeichneten sehr viele Frauen<br />
DE<br />
sind. Denn eines unserer<br />
großen Anliegen ist die Förderung von Frauen in sämtlichen<br />
Bereichen der Universität.<br />
PEFC zertifiziert<br />
Wir danken Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, für Ihr Interesse<br />
Dieses Produkt<br />
stammt aus<br />
und Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen eine interessante<br />
nachhaltig<br />
Lektüre!<br />
bewirtschafteten<br />
Wäldern und<br />
kontrollierten<br />
Quellen<br />
www.pefc.at<br />
VERONIKA SEXL, REKTORIN<br />
GREGOR WEIHS, VIZEREKTOR FÜR FORSCHUNG<br />
Myriad<br />
PEFC zertifiziert<br />
Dieses Produkt<br />
stammt aus<br />
nachhaltig<br />
bewirtschafteten<br />
Wäldern und<br />
kontrollierten<br />
Quellen<br />
www.pefc.at<br />
IMPRESSUM<br />
Herausgeber & Medieninhaber: Leopold-Franzens-Universität Inns bruck, Christoph-Probst-Platz, Innrain 52, 6<strong>02</strong>0 Inns bruck, www.uibk.ac.at<br />
Projektleitung: Büro für Öffentlichkeitsarbeit und Kulturservice – Mag. Uwe Steger (us), Mag. Eva Fessler (ef), Dr. Christian Flatz (cf); publicrelations@uibk.ac.at<br />
Verleger: KULTIG Werbeagentur KG – Corporate Publishing, Sparkassenplatz 2, 6<strong>02</strong>0 Inns bruck, www.kultig.at<br />
Redaktion: Mag. Melanie Bartos (mb), Daniela Feichtner, MA (df) Mag. Andreas Hauser (ah), Mag. Stefan Hohenwarter (sh), Lisa Marchl,<br />
MSc (lm), Fabian Oswald, MA (fo), Mag. Susanne Röck (sr) Lektorat & Anzeigen: Stefanie Steiner, BA Layout & Bildbearbeitung: Mag.<br />
Andreas Hauser, Florian Koch Fotos: Andreas Friedle, Universität Inns bruck Druck: Gutenberg, 4<strong>02</strong>1 Linz<br />
PEFC zertifiziert<br />
Dieses Produkt<br />
stammt aus<br />
nachhaltig<br />
bewirtschafteten<br />
Wäldern und<br />
kontrollierten<br />
Quellen<br />
www.pefc.at<br />
PEFC zertifiziert<br />
Dieses Produkt<br />
stammt aus<br />
nachhaltig<br />
bewirtschafteten<br />
Wäldern und<br />
kontrollierten<br />
Quellen<br />
www.pefc.at<br />
Foto: Uni Inns bruck<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/23 3
BILD DER<br />
WISSENSCHAFT
INHALT<br />
TITELTHEMA<br />
8<br />
ÖKOLOGIE. Gabriel Singer plädiert für einen umfassenden Schutz<br />
noch bestehender Naturräume und sieht intakte Bäche und Flüsse<br />
als Versicherung gegen die Folgen der Klimakrise. 8<br />
GESCHICHTE. Der Inn – vom Transportkorridor in der Antike<br />
bis zur kriegsstrategischen Wasserstraße im Mittelalter. 12<br />
WASSERBAU. Einmündungen von Wildbächen in Gebirgsflüsse<br />
gelten als neuralgische Bereiche bei Hochwasserereignissen. Ein<br />
Team um Bernhard Gems hat diese genauer untersucht. 14<br />
UMWELTGESCHICHTE. Mit einer neu geschaffenen Wasserbaubehörde<br />
sollte der Inn im 18. Jahrhundert begradigt werden. 16<br />
PÄDAGOGIK. Die Lernplattform Aqua MOOC will ein anderes<br />
Bewusstsein für Wasser schaffen und junge Menschen motivieren,<br />
Flüsse zu erforschen, zu dokumentieren und neu zu erleben.18<br />
TITELTHEMA. Der Inn ist nicht nur Lebensader einer<br />
Region, sondern auch ein sensibles Ökosystem und<br />
ein jahrhundertealter Transportweg. Und noch vieles<br />
mehr, wie diese interdisziplinäre <strong>Forschung</strong>sreise von<br />
ZUKUNFT FORSCHUNG zeigt.<br />
24<br />
FORSCHUNG<br />
ZOOLOGIE. Bettina Thalinger und Lauren Rodriguez sind Teil des<br />
europäischen Wal- und Biodiversitätsmonitoring-Projekts eWHALE<br />
und bereiten die große Citizen-Science-Kampagne 2<strong>02</strong>4 vor. 26<br />
THIRD MISSION. PEAK ist die neue Kommunikationsplattform der<br />
Universität Inns bruck für die Bereiche Klima und Nachhaltigkeit. 29<br />
ARCHITEKTUR. Stefan Rutzinger und Kristina Schinegger entwickeln<br />
ein zukunftsweisendes Tool, das volumetrisches Entwerfen via KI in<br />
einer responsiven Computer-Umgebung möglich machen soll. 32<br />
STANDORT. Günther Dissertori, Rektor der ETH<br />
Zürich, über sein Physikstudium in Inns bruck,<br />
universitäre Rankings sowie den fehlenden Zugang<br />
der Schweiz zu EU-Programmen.<br />
30<br />
CHEMIE. Auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft entwickelt Judith<br />
Deriu im Labor natürliche Farbpigmente aus Pflanzen und darauf<br />
basierende, nachhaltige Druckfarben für die Industrie. 34<br />
SOZIALWISSENSCHAFT. Felix Holzmeister über Open Science und den<br />
dadurch angestoßenen Kulturwandel im Wissenschaftsbetrieb. 36<br />
RECHT. Das EU-Projekt REGROUP untersucht, wie Europas<br />
Gesellschaften nach der Pandemie resilienter werden können. 42<br />
GEOLOGIE. Um die jüngste Phase in der<br />
Entstehungsgeschichte der Alpen zu erforschen,<br />
analysiert die Geologin Hannah Pomella feine Risse,<br />
die zerfallendes Uran in Kristallen hinterlässt.<br />
RUBRIKEN<br />
EDITORIAL/IMPRESSUM 3 | BILD DER WISSENSCHAFT: UMGEBUNG EINES SCHWARZEN LOCHS 4 | NEUBERUFUNG: PAVEL OZEROV 6 | FUNDGRUBE VER GANGEN HEIT: 100. GEBURTS-<br />
TAG VON WOLFGANG STEGMÜLLER 7 | MELDUNGEN 29 + 41 | WISSENSTRANSFER 38 – 40 | PREISE & AUSZEICHNUNGEN 45 – 47 | ZWISCHENSTOPP: LUCA BARBIERO 48 | SPRUNG-<br />
BRETT INNS BRUCK: PHILIPP KASTNER 49 | ESSAY: WORTSUCHE „INN“ von Christine Riccabona und Anton Unterkircher 50<br />
Die direkte Umgebung des supermassiven schwarzen Lochs Sgr A*<br />
im Zentrum unserer Galaxie beobachtet mit dem James Webb Space<br />
Telescope (JWST) im Infrarotbereich des Lichtspektrums: Die Aufnahme<br />
entstand am 14. September 2<strong>02</strong>3 als Teil eines <strong>Forschung</strong>sprogramms<br />
unter der Leitung von Nadeen B. Sabha (Institut für Astro- und Teilchenphysik),<br />
das die Sternentstehung im Einflussbereich von Sgr A*<br />
und die damit verbundenen extremen Bedingungen untersucht. Das<br />
Bild beruht auf noch unvollständigen Observationen, dennoch sind<br />
bereits Details wie die von den zahlreichen Sternen angestrahlten Gasund<br />
Staubwolken in unübertroffener Qualität zu erkennen.<br />
Fotos: Andreas Friedle (2), ETH Zürich / Markus Bertschi; COVERFOTO: Florian Koch; BILD DER WISSENSCHAFT: ESA / NASA / CSA / Nadeen B<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/23 5
NEUBERUFUNG<br />
PAVEL OZEROV studierte Sprachwissenschaft<br />
an der Hebräischen Universität in<br />
Jerusalem. Er promovierte 2015 an der La<br />
Trobe University in Melbourne (Australien)<br />
mit einer Studie zur Grammatik des Burmesischen.<br />
Seit der Promotion beschäftigt er<br />
sich insbesondere mit der interaktionalen<br />
Linguistik und der Dokumentation nordostindischer<br />
Sprachen. Er hatte Postdoktoranden-Stellen<br />
der Alexander von Humboldt-<br />
Stiftung an der Universität zu Köln und der<br />
Martin Buber Society an der Hebräischen<br />
Universität in Jerusalem inne. Von 2019<br />
bis 2<strong>02</strong>3 war er Junior-Professor an der<br />
Universität Münster, seit März 2<strong>02</strong>3 ist er<br />
Professor an der Universität Inns bruck.<br />
ÜBER SPRECHEN & SCHREIBEN<br />
Pavel Ozerov befasst sich mit den Unterschieden zwischen gesprochener und<br />
geschriebener Sprache – und er dokumentiert die vielfältigen Sprachen Nordost-Indiens.<br />
Das birmanische Wort für sehen kann<br />
je nach Kontext „Gestern habe ich<br />
dich gesehen“ als auch „Gestern<br />
haben sie den Film gesehen“ bedeuten,<br />
erklärt Pavel Ozerov. Der Linguist ist seit<br />
März 2<strong>02</strong>3 Professor für Allgemeine und<br />
Angewandte Sprachwissenschaft am Institut<br />
für Sprachwissenschaft. Die Amtssprache<br />
Myanmars war die erste Sprache, die<br />
er noch als Student in Jerusalem intensiver<br />
gelernt hat. „Ich war damals für einige<br />
Jahre der einzige Student, der Birmanisch<br />
belegt hat. Die Sprache hat mich fasziniert,<br />
weil sie ganz anders funktioniert als alle<br />
anderen Sprachen, die ich bis dahin kannte“,<br />
erläutert er. Birmanisch kennt zum<br />
Beispiel Wort-Aspekte, die in Form von<br />
kurzen Endungen verwendet werden und<br />
die Dinge wie Absicht, Höflichkeit oder<br />
Stimmung transportieren. „Diese Suffixe<br />
können Nuancen transportieren, die<br />
wir in den meisten westlichen Sprachen<br />
in diesen kurzen Formen praktisch nicht<br />
kennen. Zum Beispiel gibt es Suffixe, die<br />
unerwartetes Handeln ausdrücken, ohne<br />
die Situation zu kontrollieren, oder die die<br />
Aussage als generell höflich, aber zugleich<br />
als zunehmend ungehalten markieren.“<br />
Mimik und Gestik<br />
Über das Birmanische kam Ozerov auf<br />
die tibetobirmanischen Sprachen Nordost-Indiens<br />
– einer der Hotspots ethnolinguistischer<br />
Diversität weltweit: „Wenn Sie<br />
eine halbe Stunde mit dem Auto durch<br />
das Tal, in dem ich hauptsächlich forsche,<br />
fahren, durchqueren Sie elf Dörfer, in<br />
denen sieben unterschiedliche Sprachen<br />
gesprochen werden. Wir wissen bis heute<br />
nicht, wie diese Diversität entstanden<br />
ist.“ Ozerov vergleicht die Unterschiede<br />
zwischen diesen Sprachen etwa mit dem<br />
zwischen süddeutschen Dialekten und<br />
Holländisch: Man hört eine Verwandtschaft,<br />
aber versteht einander nicht ohne<br />
Probleme. „Bei den Beispielen Holländisch<br />
und Bayerisch hat es allerdings<br />
2. 000 Jahre und 1. 000 Kilometer Entfernung<br />
gebraucht, damit sich Aussprache<br />
und Grammatik so auseinanderentwickeln.<br />
In meiner <strong>Forschung</strong> habe ich es<br />
mit Dörfern zu tun, die zwanzig Minuten<br />
zu Fuß voneinander entfernt sind, wo die<br />
Trennung aber genauso klar ist.“ Ozerov<br />
beforscht diese teils nur von wenigen tausend<br />
Menschen verwendeten Sprachen,<br />
ihre Grammatik und Verwandtschaft mit<br />
anderen Sprachen intensiv, katalogisiert<br />
sie und hilft damit bei ihrer Erhaltung.<br />
Neben diesem praktischen Aspekt arbeitet<br />
Ozerov auch theoretisch: Er befasst<br />
sich mit dem Aufbau von gesprochener<br />
Sprache. Und er betont dabei eine Ähnlichkeit<br />
zwischen den Nuancen, die das<br />
Birmanische auch in der Schriftsprache<br />
kennt, und gesprochenem Hebräisch oder<br />
Englisch: „Wir sind so an schriftliche Sprache<br />
gewöhnt, dass uns das beim klassischen<br />
Sprachvergleich gar nicht auffällt:<br />
In mehreren Aspekten hat Birmanisch<br />
Dinge verschriftlicht, die andere Sprachen<br />
durch Mimik und Gestik oder einfach<br />
durch den Kontext des Anwesend-Seins<br />
im gleichen Raum ebenfalls transportieren“,<br />
erläutert der Linguist. Dazu arbeitet<br />
er mit Aufzeichnungen von Alltagsgesprächen<br />
in mehreren Sprachen – wie<br />
Menschen Gedanken zu Sätzen formen,<br />
unterscheidet sich mündlich sehr von der<br />
geschriebenen Kommunikation. „Traditionell<br />
untersuchen Sprachwissenschaftler<br />
komplexe, wohlgeformte und oft künstliche<br />
Sätze, die im Voraus geplant werden<br />
– mit unserer alltäglichen Sprache hat das<br />
allerdings wenig zu tun.“ sh<br />
6 zukunft forschung <strong>02</strong>/23<br />
Foto: Andreas Friedle
FUNDGRUBE VERGANGENHEIT<br />
ALPBACHER WENDE<br />
Wolfgang Stegmüller war der führende Vertreter der analytischen Wissenschaftstheorie im<br />
deutschsprachigen Raum. Den Grundstein zu seinem Schaffen legte er an der Universität Inns bruck.<br />
Als Wolfgang Stegmüller im Sommer<br />
1948 die Alpbacher Hochschulwochen<br />
besucht, hat er seine der traditionellen<br />
Schulphilosophie verpflichtete<br />
Dissertation hinter sich und die ähnlich<br />
gelagerte Habilitationsschrift schon abgabebereit<br />
in der Schublade. Doch Alpbach<br />
wird eine Wende in sein Schaffen bringen,<br />
denn für ihn gänzlich Neues wird dort mit<br />
Karl Popper diskutiert. „In den ersten drei<br />
Jahren meiner Tätigkeit als wissenschaftliche<br />
Hilfskraft war mir der Wiener Kreis<br />
nicht einmal vom Hörensagen bekannt“,<br />
bekennt Stegmüller Jahre später.<br />
Der Wiener Kreis war eine Gruppe Intellektueller,<br />
die sich ab Mitte der 1920er-<br />
Jahre rund um den Physiker und Philosophen<br />
Moritz Schlick bildete. Die Wissenschaftler<br />
fühlten sich – so wie jene der<br />
Berliner Gruppe und des Prager Zirkels<br />
– dem Logischen Empirismus (auch Logischer<br />
Positivismus oder Neopositivismus)<br />
verpflichtet, trotz unterschiedlicher<br />
philosophischer Positionen verband sie<br />
der Versuch, so Stegmüller, „antimetaphysische<br />
Tatsachenforschungen zu betreiben,<br />
die zu einer wissenschaftlichen<br />
Weltauffassung führen sollten.“ Doch<br />
dieses Denken war dem Austrofaschismus<br />
und später den Nationalsozialisten<br />
ein Dorn im Auge, fast alle Wissenschaftler<br />
wurden vom Hochschulbetrieb ausgesperrt<br />
und mussten emigrieren. Nach<br />
dem Krieg kehrte keiner von ihnen auf<br />
Dauer zurück, Empirismus und wissenschaftlich<br />
ausgerichtete Philosophie fand<br />
daher kein Gehör an österreichischen<br />
(und deutschen) Universitäten.<br />
Initialzündung in Alpbach<br />
So müssen nach 1945 außeruniversitäre<br />
Institutionen wie Alpbach in die Bresche<br />
springen. Dort kommt Stegmüller<br />
1948 über Popper erstmals mit dessen<br />
kritischem Rationalismus und dem logischen<br />
Positivismus in Berührung. Ein<br />
Jahr später argumentiert er in Alpbach<br />
schon mit der „Schlickschen Theorie“,<br />
ab 1951 macht sich sein philosophischer<br />
WOLFGANG STEGMÜLLER kam vor<br />
100 Jahren, am 3. Juni 1923, in Natters<br />
bei Inns bruck zur Welt. Er studierte in<br />
Innsbruck Wirtschaftswissenschaften<br />
(Promotion 1945) sowie Philosophie (Promotion<br />
1947) und habilitierte sich 1949<br />
mit dem Thema Sein, Wahrheit und Wert<br />
in der Gegenwartsphilosophie. Ein <strong>Forschung</strong>sstipendium<br />
brachte ihn 1953/54<br />
an die University of Oxford. 1958 wurde<br />
er Professor für Philosophie, Logik und<br />
Wissenschaftstheorie an der Ludwig-Maximilians-Universität<br />
München. Stegmüller<br />
war korrespondierendes Mitglied der<br />
Österreichischen Akademie der Wissenschaften,<br />
der Bayerischen Akademie der<br />
Wissenschaften und des Institut International<br />
de Philosophie in Paris. 1989 wurde<br />
der renommierte Philosoph zum Ehrendoktor<br />
der Universität Inns bruck ernannt.<br />
Stegmüller starb 1991 in München.<br />
Richtungswechsel hin zur Erkenntnisund<br />
Wissenschaftstheorie sowie zur analytischen<br />
Philosophie bemerkbar. 1952,<br />
als 29-Jähriger, veröffentlicht Stegmüller<br />
seine Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie,<br />
im Prinzip seine Habilitation,<br />
allerdings ergänzt um ein Kapitel zum<br />
Logischen Positivismus.<br />
Während seines <strong>Forschung</strong>sjahrs in<br />
Oxford erscheint 1954 Metaphysik, Wissenschaft,<br />
Skepsis. Diese radikale Infragestellung<br />
der Metaphysik ruft an der Universität<br />
Inns bruck heftige Kritik hervor.<br />
Emerich Coreth, Theologe und Philosoph,<br />
wirft Stegmüller „vollendeten Skeptizismus“<br />
vor, der „folgerichtig im Irrationalismus<br />
– und schließlich im Nihilismus“<br />
endet. Der akademische Streit hat Folgen:<br />
1954 ist der streng katholische Heinrich<br />
Drimmel Unterrichtsminister. Der ÖVP-<br />
Politiker attestiert dem Positivismus eine<br />
„zerstörende Wirkung“ und Nähe zum<br />
Bolschewismus und will in seiner Amtszeit<br />
dafür sorgen, dass „in Österreich<br />
kein Positivist Professor“ wird. Folglich<br />
übergeht er 1956 bei der Besetzung einer<br />
Philosophie-Professur in Inns bruck den<br />
erstgereihten Stegmüller.<br />
In Deutschland hat man weniger Berührungsängste.<br />
Stegmüller wird Gastprofessor<br />
in Kiel und Bonn, erhält Rufe<br />
an die Unis in Bonn, Hannover und München.<br />
In München sagt er 1958 zu. Von<br />
dort übt er, wie die Gesellschaft für analytische<br />
Philosophie im Jahr 2001 festhalten<br />
wird, „einen entscheidenden Einfluss bei<br />
der Wiedergeburt der analytischen Philosophie<br />
und der mit logischen Methoden<br />
arbeitenden Wissenschaftstheorie im<br />
deutschen Sprachraum nach der ‚dunklen<br />
Zeit‘ des Nationalsozialismus und der unmittelbaren<br />
Nachkriegszeit“ aus.<br />
Die Universität Inns bruck sollte noch<br />
einmal ins Blickfeld des renommierten<br />
Philosophen rücken. 1964 wird er für eine<br />
neue Philosophie-Professur wieder erstgereiht.<br />
Stegmüller wäre willens gewesen,<br />
doch die Verhandlungen mit dem Ministerium<br />
scheiterten. <br />
ah<br />
Foto: <strong>Forschung</strong>sinstitut Brenner-Archiv / Nachlass Wolfgang Stegmüller / Sig. 033-123-005<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/23 7
DIE RESTWILDNIS<br />
ERHALTEN<br />
Vom kleinen Gletscherbach bis zum mächtigen Fluss: Komplexe<br />
Gewässer-Netzwerke stehen im Mittelpunkt des Interesses von Gabriel Singer<br />
vom Institut für Ökologie. Der Gewässerökologe plädiert für einen umfassenden<br />
Schutz noch bestehender Naturräume und sieht intakte Bäche und Flüsse als<br />
Versicherung gegen die Folgen der Klimakrise.<br />
8 zukunft forschung <strong>02</strong>/23<br />
Foto: Andreas Friedle
Foto: Andreas Friedle<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/23 9
TITELTHEMA<br />
GABRIEL SINGER (*1976) ist<br />
seit 2019 Universitätsprofessor<br />
für Aquatische Biogeochemie<br />
am Institut für Ökologie und<br />
leitet die dortige Arbeitsgruppe<br />
für Fließgewässer-Ökosystem-Ökologie.<br />
Singer studierte<br />
in Wien und war ab 2013<br />
Arbeitsgruppenleiter am Leibniz-Institut<br />
für Gewässerökologie<br />
und Binnenfischerei (IGB)<br />
in Berlin. Seine Arbeit wurde<br />
mehrfach ausgezeichnet,<br />
unter anderem mit einem ERC<br />
Starting Grant. Mit seinem<br />
zehnköpfigen Team erforscht<br />
er Ökosystemfunktionen in<br />
Flussnetzwerken.<br />
ZUKUNFT: Sie betrachten in Ihrer <strong>Forschung</strong><br />
Flüsse und Bäche als Netzwerke. Wie vernetzt<br />
sind unsere Fließgewässer denn noch?<br />
GABRIEL SINGER: Unseren Untersuchungen<br />
liegt die räumliche Struktur unserer Fließgewässer<br />
zu Grunde. Flüsse und Bäche bilden<br />
komplexe Netzwerke mit verschiedenen<br />
Lebensräumen. Ein Bach kann nie isoliert<br />
betrachtet werden, sondern er ist Teil eines<br />
Fließgewässernetzwerkes. Das mag vielleicht<br />
banal klingen, ist es aber ganz und gar nicht.<br />
Viele Prozesse in den verzweigten Fließgewässersystemen<br />
sind bis heute nicht gänzlich<br />
verstanden. Aus zahlreichen Zubringern<br />
zusammengesetzt bietet ein Flussnetzwerk<br />
einen kontinuierlichen Lebensraum für eine<br />
Vielzahl von Organismen. In vielen Regionen<br />
der Erde besitzen aber nur noch die wenigsten<br />
Flüsse und Bäche einen natürlichen Lauf,<br />
unveränderten Wasserhaushalt oder intakten<br />
Sedimenttransport. Das betrifft auch Tirols<br />
größten Fluss, den Inn. Das Abflussregime,<br />
der natürlicherweise oft variable Wasserstand,<br />
ist häufig stark durch menschliche Beeinflussung<br />
verändert. Die Gewässer bleiben<br />
wohl vernetzt, Wasser bewegt sich am Ende<br />
ja „durch“ die Landschaft, aber der Mensch<br />
greift massiv in die Art und Weise ein – was<br />
wiederum Auswirkungen auf die Resilienz<br />
gegenüber Störungen in diesem Wassersystem<br />
hat.<br />
ZUKUNFT: Was ist unter „Störung“ zu verstehen?<br />
SINGER: Unter Störung verstehen wir zum Beispiel<br />
Flutereignisse oder auch das Trockenfallen<br />
von Fließgewässern. Das ist zunächst ganz<br />
normal, ja sogar wichtig für das Zusammenspiel<br />
dieser Lebensräume. Die natürlichen<br />
Schwankungen im Wasserstand von Flüssen,<br />
die zu saisonalen Hoch- und Niedrigwassern<br />
führen, sind für ökologische Vielfalt und<br />
Funktionen wie Selbstreinigung essenziell.<br />
Jedoch verändern menschliche Eingriffe wie<br />
Uferverbauungen, Flussbegradigungen, Entnahmen<br />
für Bewässerung und der Betrieb<br />
von Wasserkraftwerken diese Dynamiken oft<br />
negativ. Diese Eingriffe führen zu einer Fragmentierung<br />
der Flusslandschaften, was weitreichende<br />
Folgen für die Biodiversität und<br />
Ökosysteme hat. In Österreich beispielsweise<br />
ist die längste ungestörte Flussstrecke nur<br />
etwa 60 Kilometer lang, nur 15 Prozent der<br />
Flüsse gelten als ökologisch intakt, und mehr<br />
als die Hälfte der einheimischen Fischarten ist<br />
in ihrem Bestand gefährdet.<br />
ZUKUNFT: Wir leben in Zeiten der Klimakrise,<br />
aber auch der Biodiversitätskrise. Wie ist die<br />
Situation in Bezug auf Fließgewässer zu bewerten?<br />
SINGER: Die Klimakrise befeuert den bereits<br />
durch andere Treiber verursachten Verlust<br />
der Biodiversität. Eine wichtige Ursache für<br />
10 zukunft forschung <strong>02</strong>/23<br />
Foto: Andreas Friedle
TITELTHEMA<br />
das massive Artensterben, das wir auch in<br />
Bächen und Flüssen sehen, ist der Habitatsverlust.<br />
Wir nehmen uns einfach zu viel Lebensraum.<br />
Die Folgen der menschgemachten<br />
Klimakrise zeigen sich aber auch zunehmend<br />
als Ursache für Biodiversitätsverlust und<br />
Artensterben. Fließgewässer werden durch<br />
steigende Temperaturen wärmer mit entsprechenden<br />
Folgen für viele Lebewesen, aber<br />
die noch viel wichtigere Konsequenz ist die<br />
damit verbundene Veränderung der Abflussregime.<br />
Wir wissen, dass Extremereignisse<br />
zunehmen werden. Diese Ereignisse nehmen<br />
Einfluss auf die Störungsdynamik, aber auch<br />
auf die Dynamik, mit der ein gerade gestörter<br />
Lebensraum durch Organismen aus der<br />
Umgebung wiederbesiedelt werden kann: In<br />
fragmentierten Gewässernetzwerken können<br />
sich Habitate nach Extremereignissen nur<br />
noch schlecht oder gar nicht mehr erholen.<br />
Das heißt, Lebewesen sterben an einer Stelle<br />
ab, aber durch die fehlende Konnektivität zu<br />
Quellpopulationen – sofern diese nicht ohnehin<br />
auch in Mitleidenschaft gezogen wurden<br />
– kommt kein neues Leben nach.<br />
ZUKUNFT: Welche Folgen haben diese Veränderungen?<br />
SINGER: Wenn das Abflussregime eines Flusses<br />
umgestaltet wird, treten die Auswirkungen<br />
nicht nur an der Stelle des Eingriffs auf,<br />
sondern erstrecken sich über große Bereiche<br />
des Netzwerkes. Das liegt daran, dass der<br />
Austausch von Arten wie auch der Transport<br />
von Ressourcen beeinträchtigt werden.<br />
Die besondere Struktur der Verbindungen<br />
zwischen den verschiedenen Lebensräumen<br />
ist es, die Flussökosysteme zu solch artenreichen<br />
Umgebungen macht. Wir messen in<br />
Fließgewässern, korrekterweise in Binnengewässern<br />
– gemeinsam mit Seen – eine höhere<br />
Artendichte, also mehr Arten pro Fläche, als<br />
in terrestrischen und marinen Lebensräumen.<br />
Wir beobachten in Binnengewässern<br />
aber auch das schnellste Artensterben. Das<br />
liegt einerseits am Lebensraumverlust und<br />
andererseits an der Verringerung der Vielfalt<br />
der Lebensräume in Fließgewässern durch<br />
ihre „Zähmung“. Teilweise vermuten wir,<br />
dass die derzeit bereits bestehende Fragmentierung<br />
von Flussnetzwerken eine sogenannte<br />
Aussterbensschuld bedingt. Das heißt, wir<br />
rechnen auch bei Aufrechterhaltung des Status<br />
quo mit einem weiteren Verlust an Arten<br />
in der nahen <strong>Zukunft</strong>. Biologische Systeme<br />
reagieren zeitverzögert.<br />
ZUKUNFT: Sie sprechen von vielen bereits unumkehrbaren<br />
Konsequenzen. Welche Schutzmöglichkeiten<br />
gibt es dann noch?<br />
SINGER: Die Biodiversitätskrise und damit<br />
verbunden die Klimakrise werden andere<br />
Ökosysteme und Landschaften schaffen, aber<br />
nicht „keine“. Insofern lässt sich daraus keine<br />
Billigung von Naturzerstörung ableiten.<br />
Unsere Abhängigkeit von funktionierenden<br />
Ökosystemen und Biodiversität wird nicht<br />
verschwinden, wenn der Klimawandel seine<br />
Spur der Zerstörung zieht. Wir sind gut beraten,<br />
Ökosysteme so gut es geht in einem natürlichen<br />
Zustand zu bewahren, weil dieser<br />
„Die Bemühungen rund um Renaturierungen von Fließgewässern<br />
sind inzwischen an vielen Orten zu beobachten und natürlich zu<br />
begrüßen. Aber ich glaube dennoch, dass es wichtig wäre zu<br />
verstehen, dass Systeme, die jetzt noch intakt sind, intakt bleiben<br />
müssen. Wenn also an Ort A etwas demoliert wird und dafür an<br />
Ort B renaturiert, gleicht das diese Eingriffe in die Natur nicht aus.“<br />
<br />
Gabriel Singer, Institut für Ökologie<br />
Zustand die größtmögliche Resilienz bedeutet.<br />
Aus einem Gletscherbach wird ein nicht<br />
minder wichtiger Bergbach werden. Anpassungsfähigkeit<br />
ist in Zeiten des Klimawandels<br />
ein sehr hohes Gut. Daher ist es wichtig<br />
die bestehende Restwildnis an Lebensräumen<br />
im Wasser und an Land möglichst zu erhalten.<br />
Der Erhalt der Biodiversität ist unsere<br />
Versicherung, da intakte Systeme mit diesen<br />
Konsequenzen besser umgehen können. Ich<br />
kann als Ökologe nur immer wieder betonen,<br />
dass unser Überleben als Menschen davon abhängt,<br />
die Biodiversität zu erhalten.<br />
ZUKUNFT: Es werden zunehmend Renaturierungsmaßnahmen<br />
im Bereich von Flüssen<br />
und Bächen durchgeführt oder sind geplant,<br />
auch in Tirol. Ist das der richtige Weg?<br />
SINGER: Die Bemühungen rund um Renaturierungen<br />
von Fließgewässern sind inzwischen<br />
an vielen Orten zu beobachten und natürlich<br />
zu begrüßen. Und den Studierenden<br />
sage ich auch gerne, dass wir ohnehin in das<br />
Zeitalter der Renaturierung eintreten müssen,<br />
um dem Artensterben zu begegnen, sie sich<br />
also auch über ihre beruflichen Aussichten keine<br />
Sorgen machen sollten. Aber ich glaube<br />
dennoch, dass es wichtig wäre, zu verstehen,<br />
dass Systeme, die jetzt noch intakt sind, intakt<br />
bleiben müssen. Wenn also an Ort A etwas demoliert<br />
wird und dafür an Ort B renaturiert,<br />
gleicht das diese Eingriffe in die Natur nicht<br />
aus. Das ist aus ökologischer Sicht nicht möglich.<br />
Aus dem Artenschutz wissen wir, dass es<br />
sehr viel einfacher ist, ein intaktes System zu<br />
schützen als ein kaputtes zu reparieren. Der<br />
erste Schritt sollte künftig immer sein, intakte<br />
Systeme in Frieden zu lassen. mb<br />
PODCAST<br />
Gabriel Singer, Universitätsprofessor<br />
für Aquatische<br />
Biogeochemie, war zu Gast im<br />
Podcast der Universität Innsbruck,<br />
„Zeit für Wissenschaft“:<br />
Im ausführlichen Gespräch erzählt<br />
er mehr über seine Arbeit<br />
in der Natur und im Labor, die<br />
Bedeutung von Wissenschaftskommunikation<br />
und Engagement<br />
im Umweltschutz – und<br />
was vom Kajakfahren<br />
für die <strong>Forschung</strong> gelernt<br />
werden kann.<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/23 11
TITELTHEMA<br />
BEI DER RÜCKEROBERUNG der Stadt Kufstein durch Kaiser Maximilian I. im Jahr 1504 spielte der Inn eine zentrale Rolle.<br />
EIN FLUSS MIT GESCHICHTE<br />
Der Inn: ein Fluss, drei Länder und unzählige Geschichten. Florian Messner, Archäologe an der<br />
Universität Inns bruck, hat sich mit der Geschichte des Gebirgsflusses vom Transportkorridor in der<br />
Antike bis zur kriegsstrategischen Wasserstraße im Mittelalter beschäftigt.<br />
Betrachtet man den Inn heute, ist es<br />
kaum überraschend, dass er für<br />
den Waren- und Truppentransport<br />
genutzt wurde, zieht er sich doch vom<br />
Schweizer Engadin durch Tirol nach Passau.<br />
Der heutige Inn – breit, relativ gerade<br />
verlaufend und tief – hat jedoch wenig<br />
mit dem historischen Fluss gemeinsam.<br />
„Bis ins 19. Jahrhundert prägten zahlreiche<br />
Mäander und Biegungen das Bild<br />
dieses Flusses. Doch auch wenn es viel<br />
schwieriger war als heute, wurde der Inn<br />
im Laufe seiner Geschichte immer wieder<br />
als Wasserstraße genutzt“, erklärt Florian<br />
Messner vom Institut für Archäologien<br />
der Universität Inns bruck.<br />
Im Rahmen seiner <strong>Forschung</strong>sarbeit zur<br />
Belagerung Kufsteins durch den späteren<br />
Kaiser Maximilian I. im Jahr 1504 hat sich<br />
Messner näher mit der historischen Rolle<br />
des Inns als Transportweg auseinandergesetzt.<br />
Archäologische und historische<br />
Belege für den Beginn der Schifffahrt<br />
auf dem Inn fehlen zwar, doch es existieren<br />
starke Hinweise darauf, dass der<br />
Fluss schon in der Ur- und Frühgeschichte<br />
genutzt wurde. „In Schwaz, bekannt<br />
für seine reichen Kupfervorkommen,<br />
wurden sicherlich Waren über den Fluss<br />
transportiert, lange bevor schriftliche<br />
Aufzeichnungen existierten“, ist Florian<br />
Messner überzeugt. Die Römer nutzten<br />
von Veldidena aus, dem heutigen Wilten<br />
12 zukunft forschung <strong>02</strong>/23<br />
Fotos: Institut für Archäologien, Topographia Germaniae, privat
TITELTHEMA<br />
in Inns bruck, mit Sicherheit den Inn, um<br />
Truppen und Waren zu transportieren.<br />
„Sehr wahrscheinlich haben die Römer<br />
auch bereits damals Truppen von Innsbruck<br />
nach Passau – dort war das nächste<br />
Castell – befördert“, erklärt Florian Messner.<br />
Für Truppentransporte wurde der<br />
Inn laut Messner meist nur flussabwärts<br />
genutzt. „Es gab zwar die Möglichkeit,<br />
Transporte mit Hilfe von Zugtieren auch<br />
flussaufwärts durchzuführen, dies wurde<br />
laut meinen Quellenrecherchen aber nur<br />
für Warentransporte genutzt, da der Inn<br />
mit einem Gefälle von rund einem Promille<br />
doch ein recht steiler Fluss ist und<br />
somit flussaufwärts nur sehr schwer beschiffbar<br />
war. Militärische Truppen kamen<br />
hier zu Fuß viel schneller voran“,<br />
erläutert Messner.<br />
Ein einschneidendes Ereignis für die<br />
Nutzung des Inns war die Errichtung<br />
der Saline in Hall im Hochmittelalter.<br />
Um den enormen Holzbedarf für den Betrieb<br />
der Saline zu decken, wurde quer<br />
über den Inn eine Rechenanlage errichtet.<br />
„Diese Konstruktion diente dazu, das im<br />
Oberinntal und im Engadin geschlagene<br />
Holz, das flussabwärts getriftet wurde,<br />
aufzufangen“, erläutert Messner. Diese<br />
Rechenanlage führte dazu, dass der Inn<br />
bis Hall nicht mehr befahrbar war. „Eine<br />
Schleusenanlage war zwar vorhanden,<br />
diese war aber nahezu ausschließlich<br />
dem Landesfürsten vorbehalten“, fügt<br />
Messner hinzu. Hall entwickelte sich dadurch<br />
zu einer Art Frachthafen für Transporte<br />
auf dem Inn. Das dafür verantwortliche<br />
Salzmeieramt koordinierte hier die<br />
Lagerung und den Weitertransport der<br />
Waren von Hall nach Passau.<br />
Militärischer Vorteil<br />
Eine besondere militärische Rolle spielte<br />
der Inn im Jahr 1504 während der Belagerung<br />
Kufsteins. Im Landshuter Erbfolgekrieg<br />
wurde die Stadt im Kampf<br />
um die Nachfolge des Herzogs von Bayern-Landshut<br />
von den pfälzischen Wittelsbachern<br />
erobert. „Tirols Landesfürst<br />
Maximilian verfügte über die größten<br />
und besten Kanonen dieser Zeit. Diese<br />
im Zeughaus in Inns bruck stationierten<br />
Kanonen sollten zur Rückeroberung Kufsteins<br />
natürlich zum Einsatz kommen“,<br />
erklärt Florian Messner. Dank der Wasserstraße<br />
des Inns konnten die Kanonen<br />
schnell und effektiv innerhalb eines Tages<br />
nach Kufstein transportiert werden und<br />
DER KUPFERSTICH von 1679 zeigt den Schiffsverkehr am Inn vor Hall in Tirol.<br />
sorgten so für eine rasche Rückeroberung<br />
der Stadt. Ein Beweis dafür, wie der Inn<br />
nicht nur als Handelsweg, sondern auch<br />
als strategischer Vorteil in Kriegszeiten<br />
genutzt wurde.<br />
Truppentransporte<br />
Auch im Kontext des Dreißigjährigen<br />
Krieges wurde der Inn zu einem strategischen<br />
Transportweg für die Kriegsführung.<br />
„Obwohl Tirol von den direkten<br />
Kriegshandlungen weitgehend verschont<br />
blieb, zogen dennoch Verstärkungstruppen<br />
aus Italien durch das Land“, erläutert<br />
Florian Messner. Die logistischen<br />
Herausforderungen dieser Zeit waren<br />
enorm, denn die Versorgung der Soldaten<br />
war problematisch und die Versorgungsstationen<br />
rar. „Es kam daher häufig<br />
vor, dass die Truppen auf ihrem Weg die<br />
Dörfer plünderten“, beschreibt Messner.<br />
Um die Bevölkerung zu schützen und<br />
FLORIAN MESSNER (*1985) studierte<br />
Geschichte und Archäologie an der Universität<br />
Inns bruck und ist wissenschaftlicher<br />
Projektmitarbeiter an der Universität<br />
Inns bruck. Seine <strong>Forschung</strong>sinteressen<br />
liegen unter anderem in der Blankwaffenund<br />
Rüstungskunde in Mittelalter und<br />
Früher Neuzeit sowie in der Geschichte<br />
der mittelalterlichen Kriegsführung.<br />
die Ordnung aufrechtzuerhalten, wurden<br />
die Soldaten ab Hall möglichst rasch<br />
auf Schiffen durch das Land befördert.<br />
„Diese Maßnahme sollte die Interaktion<br />
zwischen den durchziehenden Truppen<br />
und der lokalen Bevölkerung minimieren<br />
und so Plünderungen verhindern“, fügt<br />
Messner hinzu. Im Jahr 1557 wurde zudem<br />
eine Versorgungsordnung erlassen,<br />
welche die Städte entlang des Inns – Hall,<br />
Kufstein, Rosenheim und Wasserburg –<br />
in die Pflicht nahm, für die Verpflegung<br />
der Soldaten zu sorgen.<br />
Auch die Türkenkriege, die vor allem<br />
im Mittelmeer geführt wurden, haben indirekt<br />
mit dem Inn zu tun. „Für die Galeeren,<br />
die die Kämpfe am Mittelmeer<br />
ausfochten, wurden zahlreiche Ruderer<br />
benötigt. Deshalb hat man in der frühen<br />
Neuzeit begonnen, Todesstrafen in sogenannte<br />
Galeerenstrafen umzuwandeln.<br />
Die Gefangenen wurden also als Ruderer<br />
auf den Galeeren eingesetzt“, erklärt Florian<br />
Messner. Zuerst wurden nur italienische<br />
Strafgefangene dafür eingesetzt,<br />
doch nach und nach begann auch das<br />
Heilige Römische Reich, seine Strafgefangenen<br />
zu verkaufen. „Um diese Hundertschaften<br />
an Gefangenen möglichst<br />
schnell zu transportieren, wurden sie<br />
über den Inn aufwärts bis Hall geschifft<br />
und dann zu Fuß über den Brenner in die<br />
Adriahäfen gebracht, wo sie auf die Galeeren<br />
verfrachtet wurden“, so Messner,<br />
der davon überzeugt ist, dass Flüsse<br />
mehr als Landschaftsmerkmale sind.<br />
„Der Inn zeigt durch seine vielfältige<br />
Nutzung, dass Flüsse dynamische Akteure<br />
sein können, die die Geschichte ihrer<br />
Region mitgestalten“, so der Archäologe<br />
abschließend.<br />
sr<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/23 13
TITELTHEMA<br />
GEFAHREN-HOTSPOTS<br />
Einmündungen von Wildbächen in Gebirgsflüsse gelten als neuralgische Bereiche bei<br />
Hochwasserereignissen. Ein Team um Bernhard Gems vom Arbeitsbereich Wasserbau der<br />
Universität Inns bruck hat diese genauer untersucht.<br />
Hochwasser sind in den Alpen<br />
keine Seltenheit. Erst im August<br />
2<strong>02</strong>3 erreichte der Inn im Tiroler<br />
Oberland seinen 100-jährlichen Scheitelabfluss,<br />
und es wurde aufgrund zahlreicher<br />
kleinräumiger Hochwasser- und<br />
Murenereignisse in vielen Orten Österreichs<br />
Zivilschutzalarm ausgelöst. „Die<br />
topografischen Gegebenheiten im Gebirge<br />
beeinflussen die Eigenschaften der<br />
Prozesse in den Gewässern und somit<br />
auch mögliche Hochwasserereignisse<br />
maßgeblich“, erklärt Bernhard Gems,<br />
assoziierter Professor am Arbeitsbereich<br />
Wasserbau am Institut für Infrastruktur<br />
der Uni Inns bruck. In dem gemeinsam<br />
mit der Freien Universität Bozen durchgeführten<br />
Projekt ECOSED_TT hat er sich<br />
näher mit der Verlagerung von Feststoffen<br />
bei Hochwasserprozessen in alpinen<br />
Gewässern beschäftigt.<br />
Neuralgische Punkte für die Entstehung<br />
von Schäden im Zuge von Hochwasserereignissen<br />
sind oftmals die Schnittstellen<br />
zwischen zwei Gewässern, etwa zwischen<br />
kleinen Seitenzubringern aus Wildbacheinzugsgebieten<br />
und Gebirgsflüssen. „Die<br />
Stellen, an denen steile Wildbäche auf Gebirgsflüsse<br />
treffen, sind ein Hotspot für<br />
die Entstehung von Schäden im Zuge von<br />
Naturgefahrenprozessen“, erklärt Bernhard<br />
Gems.<br />
Zurückzuführen ist dies häufig auf die<br />
enormen Feststoffeinträge aus den Wildbacheinzugsgebieten<br />
und die entsprechend<br />
unzureichenden Abfuhrkapazitäten<br />
der Vorfluter in den Einmündungsbereichen.<br />
Bei Starkregen im Gebirge<br />
können in den Wildbächen Abflussprozesse<br />
mit sehr großen Intensitäten und<br />
entsprechendem Gefahrenpotenzial entstehen<br />
und sich in Form von fluviatilem<br />
oder murartigem Prozessverhalten talwärts<br />
verlagern. Dort münden sie in den<br />
jeweiligen Vorfluter und geben das viele<br />
Wasser, den mittransportierten Sand,<br />
Steine und Geröll sowie Wildholz an den<br />
großen Fluss weiter. An dieser Stelle wird<br />
der Wildbach abgebremst, und es treten<br />
schnell Ablagerungen der eingetragenen<br />
Sedimente auf, die flussaufwärts einen<br />
Rückstau verursachen und dort liegende<br />
Siedlungsgebiete gefährden können.<br />
Diese Prozesse in den Gewässern<br />
umfassen verschiedene Typen von Verlagerungsprozessen<br />
wie Muren, murartige<br />
Einträge oder fluviatile Prozesse.<br />
Letztere werden im Allgemeinen oft als<br />
Hochwasser bezeichnet. „Von fluviatilen<br />
Verlagerungsprozessen spricht man<br />
streng genommen nur bei Anteilen an<br />
Feststoffen am Abflussgemisch bis etwa<br />
20 Prozent, Prozesse mit höheren Feststoffkonzentrationen<br />
werden als murartige<br />
Ereignisse bezeichnet“, verdeutlicht<br />
der Wissenschaftler. Welcher Prozesstyp<br />
an welcher Stelle entlang der Gewässer<br />
eintritt, hängt dabei von zahlreichen Faktoren<br />
ab. So spielen neben dem Niederschlagsereignis<br />
an sich auch die Reliefenergie<br />
des Einzugsgebietes und damit<br />
auch die Neigung der Gewässer sowie<br />
1 2<br />
14 zukunft forschung <strong>02</strong>/23<br />
Fotos: Bernhard Gems (2), Andreas Friedle (1)
TITELTHEMA<br />
die Menge der vorhandenen Sedimente<br />
im Einflussbereich der Gewässer und deren<br />
Zusammensetzung eine Rolle.<br />
Alpine Gegebenheiten<br />
Bestehende Modelle und Untersuchungen<br />
zu Naturgefahrenprozessen im Nahbereich<br />
von Zusammenflüssen zweier<br />
Fließgewässer beschränken sich bis dato<br />
überwiegend auf große Talflüssen beziehungsweise<br />
Voralpenflüsse, die nicht unmittelbar<br />
den topografischen Verhältnissen<br />
von alpinen Wildbächen und Gebirgsflüssen<br />
entsprechen. „Unser Ziel beim<br />
Projekt ECOSED_TT war es, bestehende<br />
Erkenntnisse und Modelle um Daten für<br />
die in alpinen Einzugsgebieten typischerweise<br />
vorherrschenden steilen Gerinne zu<br />
erweitern“, erklärt Bernhard Gems.<br />
Um die Ausprägungen der Gefahrenprozesse<br />
an diesen neuralgischen Punkten<br />
genauer untersuchen zu können, haben<br />
die Wissenschaftler:innen um Gems<br />
einen groß angelegten, adaptierbaren<br />
physikalischen Modellversuch im Wasserbaulabor<br />
der Universität Inns bruck<br />
geplant und errichtet. Anhand des Modells<br />
können Einmündungssituationen<br />
mit verschiedenen Gerinne-Neigungen<br />
und Einmündungswinkeln sowie mit<br />
unterschiedlichen Prozesseigenschaften<br />
und -intensitäten untersucht werden. „In<br />
unserem Modellversuch haben wir zahlreiche<br />
mögliche Szenarien nachgestellt,<br />
wie Einmündungen aussehen können.<br />
Durch die Variation der einzelnen Prozesseigenschaften<br />
sehen wir, wie sich einzelne<br />
Faktoren im Einmündungsbereich<br />
im Sinne räumlich variabler Ablagerungsund<br />
Ero sionsdynamiken auswirken“, beschreibt<br />
Bernhard Gems.<br />
Geländestudien<br />
Um ihre Modelle und Experimente mit<br />
entsprechenden Daten aus der Natur zu<br />
hinterlegen, haben die Wissenschaftler:innen<br />
um Gems auch Erhebungen im Gelände<br />
durchgeführt. „Wir haben anhand<br />
von Ereignis-Chroniken über 135 neuralgische<br />
Einmündungsbereiche in Tirol und<br />
Südtirol ausgewählt, dort die topografischen<br />
Gegebenheiten dokumentiert und<br />
auch Proben entnommen, um detaillierte<br />
Informationen über die Kornverteilungen<br />
der Sedimente zu erhalten“, so Gems.<br />
Daneben kamen auch Daten aus GIS-<br />
Kartierungen zum Einsatz, um genaue<br />
Informationen über die topografischen<br />
Gegebenheiten im Umfeld der Gewässer<br />
miteinzubeziehen. Zusätzlich führten die<br />
Wissenschaftler:innen im Rahmen des<br />
Projektes auch Befliegungen von zwei Gewässerabschnitten<br />
in Nord- und Südtirol<br />
durch. „Herkömmliche Laserscan-Daten,<br />
die uns in der GIS-Datenbank zur Verfügung<br />
stehen, bilden zwar das Umfeld<br />
der Gewässer sehr gut ab, die Gewässer<br />
selbst werden hier aber nur oberflächlich<br />
gescannt“, erklärt Gems. Um auch Daten<br />
über die topografische Beschaffenheit<br />
der Gerinne miteinbeziehen zu können,<br />
griffen die Wissenschaftler:innen auf das<br />
Know-how von Airborne Hydro Mapping<br />
– einem Spin-Off der Universität<br />
Inns bruck – zurück.<br />
„Mithilfe eines sogenannten grünen Lasers,<br />
der anders als herkömmliche Laser<br />
die Wasseroberfläche durchdringen kann,<br />
haben wir so detaillierte Daten über die<br />
Beschaffenheit der Gerinne über insgesamt<br />
zehn Kilometer entlang der Passer in<br />
Südtirol und der Rosanna im Tiroler Oberinntal<br />
erhalten“, erklärt Gems. Wichtige<br />
Daten, die auch in die Verbesserung bestehender<br />
numerischer Modelle einfließen.<br />
„Wir verwenden alle von uns gesammelten<br />
Daten und in der Folge auch unsere<br />
Laborversuche als Benchmark, um numerische<br />
Modelle zu kalibrieren und auf<br />
ihre Qualität zu überprüfen“, verdeutlicht<br />
Bernhard Gems. „Diese numerischen Berechnungen<br />
haben im Vergleich zu den<br />
Experimenten im Wasserbau-Labor den<br />
Vorteil, dass sie mögliche Ereignisse und<br />
deren Folgen auf einer räumlich viel größeren<br />
Skala abbilden können, als es im<br />
Labor möglich ist“, so Gems. „Erkenntnisse,<br />
die einerseits das grundlegende Verständnis<br />
fluviatiler Prozesse erweitern<br />
und andererseits auch wichtige Informationen<br />
beispielsweise für die Gefahrenzonenplanung<br />
darstellen.“ sr<br />
3<br />
DAS VON DER Autonomen Provinz Bozen –<br />
Südtirol finanzierte Projekt ECOSED_TT untersuchte<br />
die Verlagerung von Feststoffen bei<br />
Hochwasserprozessen in alpinen Gewässern<br />
– etwa beim Schnanner Bach, der im Stanzertal<br />
in die Rosanna mündet. ECOSED_TT<br />
wurde von Bernhard Gems (re.) vom Arbeitsbereich<br />
Wasserbau an der Uni Inns bruck in<br />
Kooperation mit der Freien Universität Bozen<br />
geleitet. Im Rahmen des Projekts wurden<br />
zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten erstellt,<br />
so wird Thèo St. Pierre Ostrander (li.) in Kürze<br />
seine Dissertation abschließen.<br />
1 Schnanner Bach: Massiver murartiger<br />
Feststoffeintrag in Folge eines Starkregenereignisses<br />
im August 2018. 2 Einmündung<br />
unter normalen Bedingungen. 3 Am<br />
konfigurierbaren Modell im Wasserbau-Labor<br />
der Uni Inns bruck lässt sich nachstellen, wie<br />
sich einzelne Faktoren im Einmündungsbereich<br />
auswirken.<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/23 15
TITELTHEMA<br />
DIE VERARCHUNG DES INNS<br />
Mit einer neu geschaffenen Wasserbaubehörde sollte der Inn in der zweiten Hälfte des<br />
18. Jahrhunderts gebändigt und begradigt werden. Das Vorhaben dauerte länger als geplant.<br />
Das Amt, das Franz Anton Rangger,<br />
seines Zeichens Ingenieur-Leutnant,<br />
am 22. November 1745 antrat,<br />
war ein neues, vor allem aber kein<br />
leichtes. Die Oberarcheninspektion, so<br />
der Name der frisch geschaffenen Ein-<br />
Mann-Behörde, sollte die Flussverbauungen<br />
am Tiroler Inn nicht nur verbessern,<br />
sondern auch erweitern. Acht Tage benötigte<br />
damals ein Schiffszug von Kufstein<br />
nach Hall, 50 bis 60 Zugpferde brauchte es<br />
dafür. Das Ziel war, diese Transportdauer<br />
auf fünf Tage – und somit die Kosten um<br />
300 Gulden – zu verringern. Erreichen<br />
wollte Rangger dies durch gezielte „Verarchung“:<br />
Mit „Archen“, so der damals in<br />
Tirol geläufige Begriff für Flussverbauungen,<br />
sollte der Inn gebändigt, begradigt,<br />
ja kultiviert werden, um die Schifffahrt zu<br />
optimieren, um neue landwirtschaftliche<br />
Nutzfläche zu gewinnen und Gemeinden<br />
vor Hochwasser zu schützen.<br />
„Diese Überlegungen, dieser ordnende<br />
Blick auf die Natur, entsprechen dem<br />
damaligen Denken des aufgeklärten Absolutismus<br />
bzw. der ökonomischen Aufklärung“,<br />
erläutert Reinhard Nießner<br />
vom Institut für Geschichtswissenschaften<br />
und Europäische Ethnologie. Weitläufige<br />
mäandrierende Schleifen – wie<br />
heute noch bei Kirchbichl – wurden als<br />
Unordnung, ja als Chaos angesehen, es<br />
bedurfte an diesen Passagen einer Verbesserung<br />
der Natur, einer Melioration<br />
– und das vor allem im Dienste der Menschen.<br />
In seinem Dissertationsprojekt<br />
untersucht der gebürtige Oberbayer die<br />
Flusslandschaft des Tiroler Inns als eine<br />
Umweltgeschichte von 1745 bis 1792.<br />
Für seine Arbeit kann er auf einen ergiebigen<br />
Quellenbestand zurückgreifen.<br />
Aus Ranggers Amtszeit (1745–1774) sind<br />
die Berichte seiner „Visitationsreisen“<br />
im Tiroler Landesarchiv dokumentiert,<br />
ebenso jene seines Nachfolgers Gottlieb<br />
Samuel Besser. Sie erlauben nicht nur<br />
eine Rekonstruktion der damaligen Innverbauung,<br />
sondern auch einen Einblick<br />
in den ambivalenten Umgang mit dieser<br />
umfassenden Infrastrukturmaßnahme.<br />
Ambitionierte Pläne<br />
Im 18. Jahrhundert war ein Großteil der<br />
Fläche im Inntal eine weitläufige Flusslandschaft,<br />
an vielen Stellen bis zu dreioder<br />
viermal so breit wie heute. Andernorts<br />
suchte sich der Inn immer wieder<br />
neue Wege. Was in einem Jahr der Hauptstrom<br />
war, war im nächsten ein Seitenarm,<br />
in einem anderen sogar trocken.<br />
Denkbar ungünstig also für die Nutzung<br />
des Inns als Transportweg.<br />
„Der ambitionierte Plan war, den Inn<br />
in vier Jahren zu begradigen“, berichtet<br />
Nießner. Ein Plan, der sich nicht umsetzen<br />
ließ, auch weil häufig die Gemeinden<br />
die Arbeit und Kosten zu schultern hatten.<br />
„Die Gemeinden mussten das Baumaterial<br />
und die Arbeitskräfte stellen“,<br />
weiß Nießner. Ziel der landesfürstlichen<br />
Behörde war in erster Linie die Verbesserung<br />
der Schifffahrt, den Gemeinden<br />
16 zukunft forschung <strong>02</strong>/23<br />
Karten: TLA / Baudirektion / Fasz.9-66_ProfileBesser_1783, TLA / KuP 427_Grenze 1746; Foto: Andreas Friedle
TITELTHEMA<br />
GRENZFLUSS: Auf Basis dieser Karte sollten<br />
die Archen- und Territorialkonflikte zwischen<br />
Bayern und Tirol geschlichtet und ein Verbauungsplan<br />
entworfen werden. Der ideale,<br />
begradigte Verlauf des Inns ist mit gelber<br />
Farbe vorweggenommen (Oberarcheninspektor<br />
Franz Anton Rangger, 1746).<br />
ging es in erster Linie um Hochwasserschutz,<br />
weiters um Anbauflächen. Diese<br />
Interessen kollidierten: Die Schifffahrt<br />
benötigte eine „geradlinige“ Verbauung,<br />
die Gemeinden favorisierten sogenannte<br />
„Wurfarchen“. Quer in den Fluss hineingebaute<br />
Dämme, welche die eigene Uferseite<br />
vor Überschwemmung schützten,<br />
weil sie das Flusswasser auf die andere<br />
Uferseite „warfen“. Verständlich, dass<br />
davon betroffene Gemeinden auf der<br />
anderen Flussseite ähnlich agierten. „Archenkriege“<br />
dieser Art gab es nicht nur<br />
zwischen Gemeinden – etwa zwischen<br />
Kolsass, Weer und Terfens – sondern<br />
auch zwischen Tirol und Bayern. „Seit<br />
1504 war ab Kufstein der Inn die Grenze.<br />
Schon wenige Jahre später begannen<br />
Konflikte, da sich der Verlauf des Inns<br />
immer wieder veränderte. Einmal leitete<br />
diese Seite, einmal die andere den Fluss<br />
um“, schildert Nießner. „Der Bau von<br />
Wurfarchen war den Gemeinden zwar<br />
verboten, fand aber statt. Und waren sie<br />
einmal gebaut, hatten sie große Auswirkungen<br />
und waren nicht so leicht rückzubauen“,<br />
erklärt der Historiker. Insofern,<br />
so Nießner, war der Inn schon zu<br />
Ranggers Zeiten nicht mehr durchgehend<br />
naturbelassen: „Wurfarchen trugen zum<br />
Mäandern des Inns bei. Auch bei Brücken<br />
musste das Flussbett verengt werden.“<br />
Stellen hingegen, an denen Wildbäche<br />
in den Inn mündeten und viel Geschiebe<br />
einbrachten, mussten immer wieder verbreitert<br />
werden. „Dort, wo der Vomper<br />
Bach und der Pillbach in den Inn fließen,<br />
halbierte sich die Flussbreite durch das<br />
Geschiebe, was die Fließgeschwindigkeit<br />
erhöhte und für die Schifffahrt problematisch<br />
war“, erzählt Nießner.<br />
Überschwemmungen<br />
Doch Oberarcheninspektor Rangger<br />
hatte nicht nur die Schifffahrt im Auge.<br />
Auf den 120 Flusskilometern zwischen<br />
Pettnau und Bayern wollte er 450 Hektar<br />
„öder Gründe“ in landwirtschaftlich<br />
nutzbare Fläche verwandeln. „Die Steigerung<br />
des Anbaus war ein zentrales Motiv“,<br />
sagt Nießner, war Tirol, das sich aufgrund<br />
klimatischer und geografischer Bedingungen<br />
nicht selbst versorgen konnte,<br />
doch auf Importe angewiesen. Weiters<br />
erhoffte sich die Wasserbaubehörde von<br />
der Eindämmung des Inns einen verbesserten<br />
Schutz gegen Hochwasser. Wobei<br />
ein Blick auf die Hochwasserereignisse<br />
der damaligen Zeit zeigt, dass viele erst<br />
durch die Nutzung des Flusses, durch<br />
gebaute Infrastrukturen und intensiven<br />
Holzschlag zur Katastrophe führten. In<br />
Inns bruck kam es 1749, 1762, 1772, 1776<br />
und 1789 zu schweren Überschwemmungen<br />
mit zahlreichen Toten. Der Inn führte<br />
zu dieser Zeit dermaßen viel Wasser, dass<br />
er den „ärarischen Holzplatz“ (wo sich<br />
heute die Universitätsgebäude am Innrain<br />
befinden) überschwemmte und das<br />
dort gelagerte Bau- und Brennholz mit<br />
sich riss. Das Holz verkeilte sich an der<br />
Innbrücke, als Folge stand die Innenstadt<br />
unter Wasser.<br />
Anteil an Hochwasserereignissen hatten<br />
aber auch Wildbäche. Diese führten,<br />
so der Eindruck der Zeitgenossen, immer<br />
mehr Geschiebe in den Inn, was zu einer<br />
Erhöhung des Flussbetts und daher zu<br />
Überschwemmungen führte. Dass dies<br />
auch mit menschlichen Handlungen zu<br />
tun hatte, wusste bereits Rangger sehr<br />
genau. Wegen des Holzschlags an steilen<br />
Berghängen in den Seitentälern kam<br />
es vermehrt zu Muren und Geschiebe,<br />
PROFIL einer frei im Wasser stehenden<br />
Arche „ohne Rücken“, d. h. ohne Uferböschung<br />
(Oberarcheninspektor Gottlieb<br />
Samuel Besser, 1783).<br />
das über die Wildbäche schließlich im<br />
Inn landete. Als Lösung für dieses Problem<br />
sah Rangger die Begradigung des<br />
Flusses. Denn durch die erhöhte Fließgeschwindigkeit<br />
hätte der Inn mehr Sediment<br />
abtransportieren können.<br />
Franz Anton Rangger sollte die Melioration<br />
des Inns nicht mehr erleben – die<br />
weitgehende Begradigung erfolgte erst<br />
im Laufe des 19. Jahrhunderts. Doch als<br />
der Inn endlich durchgehend schifffahrtstauglich<br />
war, eroberte die Eisenbahn Tirol.<br />
Für ihre Streckenführung waren weitere<br />
Flussregulierungen und -verbauungen<br />
notwendig. So wie für jene der Inntalautobahn<br />
im 20. Jahrhundert. Der heutige<br />
Verlauf des Inns ist folglich ein Abbild<br />
von Infrastruktur- und Transportprojekten<br />
dreier Jahrhunderte. ah<br />
REINHARD NIESSNER (*1988) studierte<br />
Geschichte sowie Kunst- und Kulturgeschichte<br />
an den Universitäten Augsburg,<br />
Salamanca und Montpellier. Seit 2017<br />
ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am<br />
Institut für Geschichtswissenschaften und<br />
Europäische Ethnologie an der Universität<br />
Inns bruck.<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/23 17
TITELTHEMA<br />
FLÜSSEN EINE<br />
STIMME GEBEN<br />
Die Lernplattform Aqua MOOC will ein anderes Bewusstsein für Wasser schaffen und<br />
junge Menschen motivieren, Flüsse zu erforschen, zu dokumentieren und neu zu erleben.<br />
AQUA MOOC vermittelt Wissen über das biosoziale, adaptive System Fluss, in dem alles mit<br />
allem zusammenhängt (im Bild Schüler:innen in der Marzoller Au / Saalach / Bad Reichenhall).<br />
Der Legende nach verließ der Mount<br />
Taranaki, ein spitzkegeliger Vulkan,<br />
einst nach einem Streit seine<br />
Heimat im heutigen Tongariro National<br />
Park und zog in den Westen der Nordinsel<br />
Neuseelands. Auf dem Weg dorthin grub<br />
er eine tiefe Furche in das Land, die sich<br />
bald mit klarem Wasser füllte – der Whanganui.<br />
Der 320 Kilometer lange Fluss, der<br />
relativ naturbelassen durch zwei Nationalparks<br />
fließt, erhielt 2017 aufgrund<br />
seiner kulturellen Bedeutung für die indigene<br />
Bevölkerung den Status einer juristischen<br />
Person – als erster Fluss weltweit.<br />
Zwei eigens eingesetzte Vertreter können<br />
seither beispielsweise den Fluss bei Gerichtsverfahren<br />
vertreten: Sie geben dem<br />
Whanganui eine Stimme.<br />
„Dieses Verständnis von Flüssen – zum<br />
Beispiel als Ahne – ist ein anderer Umgang<br />
mit Wasser als bei uns. Unserer ist<br />
von einem modernen, europäischen und<br />
funktionalistischen Denken geprägt“,<br />
sagt Reingard Spannring, Soziologin am<br />
Institut für Erziehungswissenschaft der<br />
Universität Inns bruck. Europäische Flüsse<br />
– wie zum Beispiel der Inn – wurden<br />
in den letzten Jahrhunderten reguliert,<br />
um sie schiffbar zu machen, um Ufergebiete<br />
landwirtschaftlich zu nutzen,<br />
um mit ihrer Hilfe Energie zu gewinnen.<br />
„Wir können hier eine Art Generation Gap<br />
beobachten. Eine ältere Generation hat<br />
an Flüssen etwas verändert, die nachfolgende<br />
Generation nimmt dies aber nicht<br />
als Veränderung wahr, sondern erlebt sie<br />
als Umwelt oder Natur“, erklärt Spannring.<br />
Doch können wir Natur, können<br />
wir Wasser auch anders, nicht anthropozentrisch,<br />
als biosozialen Raum, den sich<br />
Menschen, Tiere und Pflanzen teilen, sehen?<br />
Mit dieser Frage hat sich, auf Anregung<br />
der australischen Nachhaltigkeitsforscherin<br />
Shé Hawke, das Projekt Überleben<br />
im Anthropozän auseinandergesetzt,<br />
18 zukunft forschung <strong>02</strong>/23<br />
Fotos: Reingard Spannring, Andreas Friedle
TITELTHEMA<br />
ein Ergebnis der grenzüberschreitenden<br />
<strong>Forschung</strong>sarbeit ist Aqua MOOC, ein kollaborativer<br />
Onlinekurs für Schüler:innen<br />
und Studierende.<br />
AQUA MOOC ist Teil des internationalen<br />
<strong>Forschung</strong>sprojekts Überleben im<br />
Anthropozän und wurde vom Österreichischen<br />
Wissenschaftsfonds FWF und<br />
von der Slowenischen <strong>Forschung</strong>sagentur<br />
ARRS gefördert. Die Lernplattform ist seit<br />
März 2<strong>02</strong>2 online und steht<br />
allen Nutzer:innen gratis zur<br />
Verfügung.<br />
Wissen zu und über Wasser<br />
Ausgangspunkt für das Projekt war<br />
Hawkes Idee, dass junge Menschen mit<br />
Hilfe einer App einen Fluss in ihrer Umgebung<br />
erforschen und dokumentieren<br />
können. Hawke war als Gastforscherin<br />
am slowenischen Science and Research<br />
Centre of Koper, über eine langjährige<br />
Zusammenarbeit mit einem slowenischen<br />
Philosophen kam Spannring ins<br />
Spiel, da Critical Animal Studies und<br />
Umweltbildung zu ihren <strong>Forschung</strong>sbereichen<br />
zählen. „Unser Part war zum<br />
einen inhaltlicher Natur, nämlich die<br />
Literaturrecherche zu Water Literacy,<br />
zu wasserbezogenem Wissen, und die<br />
Überlegung, was Kinder, was Jugendliche,<br />
ja was Menschen über Wasser<br />
lernen sollen“, berichtet Spannring. Die<br />
<strong>Forschung</strong>slandschaft sei von naturwissenschaftlichen<br />
sowie „westlichen“<br />
Zugängen geprägt und lege vor allem<br />
auf die Bedürfnisse der Menschen Wert.<br />
Posthumanistische Ansätze in der Umweltbildungsforschung<br />
hingegen rücken<br />
Fragen nach der Ko-Existenz mit nichtmenschlichen<br />
Anderen, die Verflochtenheit<br />
der unterschiedlichen Lebenswelten<br />
und die gemeinsam geteilte Vulnerabilität<br />
in den Vordergrund. „Mit Hilfe des<br />
Know-hows von Shé Hawke haben wir<br />
versucht, diese Aspekte zu betonen“,<br />
schildert die Inns brucker Forscherin.<br />
„Unser zweiter Part war die digitale<br />
Umsetzung des Projekts“, erläutert<br />
Spannring: „In Zusammenarbeit mit der<br />
Abteilung für digitales Lernen an der<br />
Universität Inns bruck ist aus der App<br />
allerdings etwas größeres und elaborierteres<br />
geworden – nämlich Aqua MOOC.“<br />
Die Abkürzung steht für Massive Open<br />
Online Course – der kollaborative Onlinekurs<br />
enthält in Form von Skripten,<br />
Filmen und Cartoons Unterrichtsmaterial<br />
für Schulen und Universitäten. Aqua<br />
MOOC ist in Modulen aufgebaut und soll<br />
biosoziale Zusammenhänge zwischen<br />
Natur und Kultur vermitteln und die<br />
Teilnehmer:innen dazu anregen, eigene<br />
Erlebnisse an einem Fluss in Form von<br />
Fotos, Texten, Audiomitschnitten oder<br />
Videos zu teilen.<br />
Andere Wahrnehmung<br />
So widmet sich ein Modul dem Einfluss<br />
des Menschen auf den Fluss und zeigt,<br />
warum auch scheinbar kleine Aktivitäten<br />
das System verändern können. Zusammengearbeitet<br />
wurde dabei mit einem<br />
Ökologen und einem Biologen, „um das<br />
zu sehen, was wir Sozialwissenschaftler:innen<br />
nicht sehen“. Was bedeutet<br />
etwa das Laternenlicht an Uferpromenaden<br />
für am/im Wasser lebende Tiere, was<br />
der Lärm von Partys am Fluss, was das<br />
Waschen von Besteck und Geschirr nach<br />
dem Grillen?<br />
In einem anderen Modul wird die <strong>Forschung</strong>smethode<br />
Multispezies-Ethnografie<br />
erklärt, die hilft, das Zusammenleben<br />
des Menschen mit anderen Lebewesen<br />
und dem Fluss zu dokumentieren und<br />
zu verstehen. Für dieses Modul sammelte<br />
Reingard Spannring Erfahrungen mit<br />
zwei Schulklassen. Mit Inns brucker Jugendlichen<br />
besuchte sie die Sillschlucht,<br />
ein Naherholungsgebiet am südlichen<br />
Stadtrand von Inns bruck. „Die 15- bis<br />
16-Jährigen waren mehr mit gruppendynamischen<br />
Fragen beschäftigt als mit dem<br />
Fluss. Einige sagten auch, dass sie Natur<br />
nicht interessiere“, berichtet Spannring.<br />
REINGARD SPANNRING (*1967)<br />
studierte nach der Matura in Bludenz<br />
Soziologie an der Universität Wien und<br />
der University of Sussex. Spannring war in<br />
Wien am Institut für Höhere Studien (IHS)<br />
sowie am Österreichischen Institut für Jugendforschung<br />
tätig. 2006 wechselte sie<br />
an das Institut für Erziehungswissenschaft<br />
der Universität Inns bruck, wo sie begann,<br />
sich auch mit kritischen Tierstudien,<br />
Umweltbildungsforschung, Bildungsphilosophie<br />
und Lehr-Lern-Theorien zu<br />
beschäftigen. Das Mensch-Natur- und<br />
das Mensch-Tier-Verhältnis nehmen in<br />
ihrer Arbeit eine zentrale Stelle ein.<br />
Dafür fand sie die „präzisen Beobachtungen“<br />
der Schüler:innen über den sozialen<br />
Raum Sillschlucht spannend: „Sie berichteten<br />
über die Schlafplätze von Obdachlosen,<br />
über die Orte, wo Partys stattfinden,<br />
wo sich Drogensüchtige aufhalten.“Anders<br />
war das Erlebnis mit Schüler:innen<br />
in Bad Reichenhall. „Sie waren an der<br />
Saalach – in der Marzoller Au – mit allerlei<br />
Messinstrumenten unterwegs. Auf<br />
meine Frage, was sie damit herausfinden<br />
wollen, wussten sie allerdings keine<br />
Antwort“, erinnert sich Spannring: „Das<br />
entspricht der Literatur. Kinder werden<br />
auf das Messen von Daten getrimmt, der<br />
Transfer in ihr Leben, auf Problematiken<br />
in der Natur fehlt allerdings.“<br />
Aqua MOOC soll nun helfen, dies möglich<br />
zu machen, Flüsse, so Spannring, anders<br />
wahrzunehmen, sie als biosoziale<br />
Systeme, dem Menschen, Tiere und Pflanzen<br />
angehören, zu denken. Systeme, denen<br />
man durchaus – auch bei uns – eine<br />
Stimme geben könnte.<br />
ah<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/23 19
TITELTHEMA<br />
LEBENSADER INN<br />
Mit einem Aktionsplan Artenschutz, der federführend von der<br />
Universität Inns bruck erarbeitet wurde, soll der größte Fluss der<br />
Alpen – der Inn – wieder naturnaher gestaltet werden. „Der<br />
Aktionsplan basiert auf einer umfangreichen Analyse der Flusslandschaft<br />
und enthält rund 350 konkrete Maßnahmen für<br />
einen besseren Schutz von Arten und Lebensräumen entlang<br />
der gesamten Innstrecke – von der Quelle in der Schweiz bis zur<br />
Mündung in die Donau“, sagt Leopold Füreder vom Institut für<br />
Ökologie an der Universität Inns bruck. „Jetzt gilt es, den Aktionsplan<br />
zügig umzusetzen und in einem gemeinsamen Monitoring<br />
sicherzustellen, dass die Arten und Ökosysteme am Inn auch tatsächlich<br />
von unserer Arbeit profitieren.“<br />
Der Inn ist einer der wichtigsten Alpenflüsse mit einer großen<br />
ökologischen Bedeutung. Auf 517 Kilometer von seiner Quelle bis<br />
zur Mündung in die Donau durchfließt er drei Alpenländer und<br />
zahlreiche Staustufen, weist aber auch zwischen Imst und Kirchbichl<br />
die längste freie Fließstrecke aller österreichischen Flüsse auf.<br />
Von 2019 bis 2<strong>02</strong>2 erarbeiteten Vertreter:innen aus Wirtschaft,<br />
Wissenschaft und Verwaltung im Rahmen des EU-Interreg-Projekts<br />
INNsieme ein Gesamtkonzept für die Bewahrung<br />
und Wiederherstellung der Artenvielfalt am Inn. Erste Maßnahmen<br />
konnten bereits umgesetzt werden, darunter der Rückbau<br />
von 600 Metern Ufer an der Mattig, die Revitalisierung eines<br />
Feuchtgebiets in Neuötting, die Renaturierung des Schlitterer<br />
Gießen, ein Modellversuch zur Konfliktlösung mit dem Biber am<br />
Völser Gießen, Maßnahmen zum Schutz des Flussuferläufers und<br />
ein erfolgreiches Pilotprojekt zur Wiederansiedlung des Zwergrohrkolbens<br />
mit fast 900 Stecklingen an zwei verschiedenen<br />
Standorten.<br />
Mehr über den Aktionsplan Artenschutz für den Inn<br />
erfahren Sie auf www.innsieme.org/aktionsplan<br />
REVITALISIERUNG VON SEITENBÄCHEN<br />
Im Inn gibt es zahlreiche Fischarten, die zum<br />
Laichen in die Nebenflüsse wandern. Jedoch<br />
haben Hochwasserschutzmaßnahmen viele<br />
dieser Gewässer verändert. In Tirol sind, nach<br />
aktuellen Untersuchungen, lediglich etwa<br />
ein Drittel der Nebenflüsse für Fische erreichbar.<br />
Nur ein Drittel dieser Gewässer bietet<br />
passende Laichplätze. Die von Kraftwerken<br />
verursachten Wasserschwankungen machen<br />
den Inn aber für den Fischnachwuchs ungeeignet.<br />
Dies unterstreicht die Dringlichkeit,<br />
die Nebenflüsse zu revitalisieren, nicht nur<br />
für die Fischpopulation, sondern auch für das<br />
gesamte Ökosystem des Inns.<br />
Fotos: AdobeStock / vladim_ka (1), WWF / Anton Vorauer (3), Kurt Stüber / CC BY-SA 3.0 Deed (1),<br />
Felix Lassacher(1)<br />
ZIELKONFLIKT MIT DEM BIBER<br />
In Tirol erfreut sich der Biber wieder eines stabilen Bestandes.<br />
Allerdings gibt es Bedenken, dass Biberdämme die Wanderung<br />
bestimmter Fischarten behindern. Dies hat zu Diskussionen<br />
darüber geführt, wie verschiedene Tierarten gleichzeitig geschützt<br />
werden können. Fachleute aus drei Ländern haben im<br />
Rahmen des Projekts gemeinsam Lösungen entwickelt, die die<br />
unterschiedlichen Schutzinteressen und die rechtlichen Rahmenbedingungen<br />
berücksichtigen. An ausgewählten Standorten<br />
werden diese Maßnahmen getestet, um ein harmonisches<br />
Miteinander von Bibern und Fischen zu fördern.<br />
20<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/23
TITELTHEMA<br />
DURCHGÄNGIGKEIT WIEDERHERSTELLEN<br />
Wehranlagen, Abstürze und Wasserkraftanlagen sind markante Eingriffe in<br />
den natürlichen Flusslauf. Während sie wichtige Funktionen für Energiegewinnung<br />
und Wasserregulierung erfüllen, behindern sie die Wanderung von<br />
Fischen und Amphibien. Beim österreichisch-bayerischen Inn-Kraftwerk Ering-<br />
Frauenstein hat der Verbund ein naturähnliches Umgehungsgerinne gebaut.<br />
Dieses Gerinne macht nicht nur die Staumauer für Fische passierbar, sondern<br />
bietet auch Lebensräume, die im Bereich von Staumauern sonst fehlen. So<br />
findet dort heute auch die Flussseeschwalbe wieder Brutmöglichkeiten.<br />
WIEDERANSIEDLUNGSPROJEKTE<br />
Mit einer Höhe von 30 bis 80 Zentimetern<br />
unterscheidet sich der Zwerg-Rohrkolben<br />
von anderen Arten seiner Familie.<br />
Dort, wo diese Pflanzen vorkommen, ist<br />
die Flusslandschaft noch intakt. Denn die<br />
Sumpfpflanzen mit den fast kugelrunden<br />
Fruchtständen benötigen zum Überleben<br />
natürliches Fließgewässer, das vegetationsfreie<br />
Bereiche schafft, in denen sie gedeihen<br />
können. Trotz ihrer Bedeutung für<br />
das Ökosystem ist diese Art am Inn bereits<br />
ausgestorben. Ein Wiederansiedlungsprojekt<br />
wurde 2019 gestartet, um die Pflanze<br />
in das Gebiet zurückzubringen.<br />
SCHUTZMASSNAHMEN FÜR SELTENE ARTEN<br />
Der Flussuferläufer, ein Vogel von der Größe einer Amsel<br />
mit weißem Unterleib und olivfarbener Oberseite, war einst<br />
an den meisten großen Flüssen Europas verbreitet. Heute<br />
sind seine Brutgebiete, vornehmlich lockere Kiesbänke in<br />
den Flussauen der Alpen und Voralpen, durch Umweltveränderungen<br />
stark bedroht. Solche Kiesgebiete sind am Inn<br />
heute rar geworden. 2<strong>02</strong>0 wurden in Tirol lediglich neun<br />
brütende Paare dieser Art gezählt. Um die Brutstätten des<br />
Flussuferläufers zu schützen, sollten Menschen die Kiesbänke<br />
am Inn von April bis Juli meiden.<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/23 21
KURZMELDUNGEN<br />
VERSCHÜTTETE<br />
SENSATION<br />
In Tel Shimron im Norden Israels wurde kürzlich ein 3. 800 Jahre<br />
altes Kraggewölbe aus Lehmziegeln entdeckt.<br />
RÖMISCHE ORDEN boten Schutz vor<br />
Nazi-Verfolgung (im Bild der Petersplatz).<br />
KIRCHLICHE HÄUSER<br />
IN ROM BOTEN ZUFLUCHT<br />
Eine Liste von Personen, die 1943 in<br />
kirchlichen Einrichtungen Roms vor der<br />
Nazi-Verfolgung Zuflucht fanden, wurde<br />
kürzlich entdeckt. Im Archiv des Päpstlichen<br />
Bibelinstituts in Rom wurde eine unpublizierte<br />
Namensliste von Personen wiedergefunden,<br />
die in kirchlichen Häusern Roms<br />
vor der nationalsozialistischen Verfolgung<br />
Zuflucht suchten – vor allem Jüdinnen und<br />
Juden. An der Wiederentdeckung und<br />
Untersuchung der Dokumente beteiligt war<br />
der Inns brucker Theologe Dominik Markl.<br />
Die zusammenfassende Liste der Schutz<br />
gewährenden Ordensgemeinschaften – 100<br />
Frauen- und 55 Männerorden – wurde mit<br />
der Anzahl der jeweils beherbergten Personen<br />
schon 1961 durch den Historiker Renzo<br />
de Felice publiziert, doch galt die komplette<br />
Dokumentation bisher als verschollen. Die<br />
nun wieder entdeckten Listen beziehen<br />
sich auf über 4.300 Personen, von denen<br />
3.600 namentlich genannt sind. Aus dem<br />
Vergleich mit den am Archiv der Jüdischen<br />
Gemeinde von Rom aufbewahrten Dokumente<br />
geht hervor, dass ca. 3.200 dieser<br />
Menschen mit Sicherheit Juden waren.<br />
Die kanaanitische Stadt Tel Shimron<br />
wird erst seit 2017 von einem internationalen<br />
Grabungsteam unter<br />
der Co-Leitung von Mario Martin vom<br />
Institut für Alte Geschichte und Altorientalistik<br />
wissenschaftlich bearbeitet. Erst<br />
kürzlich wurde dabei eine eigentlich unmögliche<br />
Entdeckung gemacht: „Wir haben<br />
das erste noch vollständig erhaltene<br />
Kraggewölbe aus Lehmziegeln gefunden.<br />
Dabei handelt es sich um eine Vorform des<br />
Gewölbebaus in der südlichen Levante“,<br />
erläutert Martin, den insbesondere der<br />
außergewöhnliche Erhaltungszustand<br />
überrascht. Da an der Luft getrocknete<br />
Lehmziegel extrem witterungsempfindlich<br />
GRABUNGSAREAL auf der Akropolis von Tel Shimron.<br />
sind, kann er sich den unvergleichlichen<br />
Erhaltungszustand nur dadurch erklären,<br />
dass das Gewölbe und der angrenzende<br />
Gang nur sehr kurz von den Menschen in<br />
Tel Shimron genutzt wurde. „Sprechen wir<br />
von Grabungen in der Levante von vor<br />
4. 000 Jahren, dann finden wir meist nur<br />
die unterste Lage der Gebäudefundamente.<br />
Wie das Gebäude ausgesehen hat, welche<br />
Höhe, Form und Funktion es erfüllte,<br />
das können wir nur gedanklich rekonstruieren“,<br />
so der Archäologe. Umso mehr<br />
freut er sich über das gefundene, aus tausenden<br />
perfekt erhaltenen Schlammziegeln<br />
gebaute Monument, das sich auf der<br />
Akropolis von Tel Shimron befindet.<br />
IN NORDTIROL stark gefährdet ist z. B.<br />
Sparganium natans (Zwerg-Igelkolben).<br />
ROTE LISTE FÜR TIROL<br />
Ein Vierteljahrhundert nach Erscheinen der ersten Tirol-spezifischen Roten Liste für<br />
Gefäßpflanzen liegt nun eine völlig neu konzipierte Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen<br />
Nord- und Osttirols vor: Erstellt wurde sie unter wissenschaftlicher Leitung des<br />
Instituts für Botanik in Zusammenarbeit mit den Tiroler Landesmuseen und dem Land Tirol.<br />
Das umfangreiche Verzeichnis enthält über 3. 000 Pflanzenarten und fasst das Wissen aus<br />
zehn Jahren <strong>Forschung</strong>sarbeit auf 300 Seiten – von A wie Abies alba (Weißtanne) bis Z wie<br />
Ziziphora acinos (Gewöhnlicher Steinquendel) – zusammen. „Was wir heute in Händen<br />
halten, ist das Resultat langjähriger Arbeit von zahlreichen Expertinnen und Experten“, so<br />
der wissenschaftliche Leiter Konrad Pagitz bei der Präsentation. Das Werk dient als wichtige<br />
Grundlage für Naturschutzprojekte und naturschutzrechtliche Verfahren in der Region.<br />
22<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/23<br />
Fotos: pexels / Aliona & Pasha, Andrew Wright / Tel Shimron excavations, Cäcilia Lechner-Pagitz
ZAHLEN<br />
UNIVERSITÄT<br />
INNSBRUCK<br />
International vernetzt:<br />
70 Prozent<br />
der wissenschaftlichen<br />
Publikationen entstehen<br />
gemeinsam mit internationalen<br />
Co-Autor:innen.<br />
Top <strong>Forschung</strong> beim<br />
renommierten Shanghai-Ranking in<br />
17 Fachbereichen<br />
Spitzenforschung in den <strong>Forschung</strong>sschwerpunkten<br />
Alpiner Raum und Physik.<br />
Über<br />
4200 Abschlüsse im<br />
Studienjahr 2<strong>02</strong>1/22 Bachelor,<br />
Master, Diplom und Doktorat.<br />
Rang 1<br />
unter den beliebtesten<br />
Arbeitgebern in Tirol<br />
Dank spannender<br />
Arbeitsinhalte,<br />
familienfreundlicher<br />
Arbeitsbedingungen und<br />
einem internationalen<br />
Arbeitsumfeld.<br />
Kooperation mit 9 europäischen Universitäten<br />
von Reykjavik bis Neapel in der Aurora European<br />
Universities Allianz. Von dieser Zusammenarbeit<br />
profitieren Studierende, Wissenschaftler:innen<br />
und Verwaltungsmitarbeiter:innen.<br />
Beteiligung an<br />
3 FWF-Exzellenzclustern<br />
Die Universität Innsbruck koordiniert den<br />
Exzellenzcluster für Quantenwissenschaften und ist an<br />
zwei Exzellenzclustern zu politischen, sozialen und<br />
kulturellen Entwicklungen Eurasiens und zu Materialien<br />
für Energiekonversion und Speicherung beteiligt.<br />
Beste Spin-off-Strategie:<br />
Österreichweit führend mit aktuell<br />
21 Unternehmensbeteiligungen<br />
durch die 2008 gegründete<br />
Beteiligungsholding der Universität.<br />
51,5 Millionen Euro<br />
öffentlicher <strong>Forschung</strong>smittel<br />
national und international<br />
eingeworben.<br />
Mehr als 25 Prozent Steigerung<br />
in 5 Jahren.<br />
© BfÖ 2<strong>02</strong>3<br />
Wir arbeiten vernetzt.<br />
Seit 1669<br />
/uniinnsbruck<br />
www.uibk.ac.at
STANDORT<br />
VON INNS BRUCK PROFITIERT<br />
Günther Dissertori, Rektor der ETH Zürich, über sein Physikstudium in Inns bruck,<br />
universitäre Rankings, den fehlenden Zugang der Schweiz zu EU-Programmen sowie die<br />
Brücke von Higgs-Teilchen zur Alzheimer-Früherkennung.<br />
ZUKUNFT: Warum haben Sie sich 1988 für<br />
ein Studium an der Universität Inns bruck<br />
entschieden?<br />
GÜNTHER DISSERTORI: Dazu gibt es mehrere<br />
Antworten: Ich wollte auf Deutsch<br />
studieren, also kamen in erster Linie Österreich<br />
oder Deutschland in Frage. Für<br />
mich als Südtiroler war Inns bruck die<br />
Heimuniversität und auch nahe – ich<br />
wollte am Anfang nicht zu weit weg. Ein<br />
Jahr vor der Matura kamen Studierende<br />
der Uni Inns bruck zur Studienberatung<br />
nach Meran an unsere Schule – da habe<br />
ich gespürt, dass Inns bruck passt.<br />
ZUKUNFT: Und wie kam es zur Physik?<br />
DISSERTORI: Ich war naturwissenschaftlich<br />
interessiert, vor allem an Gentechnologie.<br />
Auf meine Frage, was ich denn dafür<br />
in Inns bruck studieren müsste, hieß es<br />
Biologie. Ein Blick ins Biologie-Programm<br />
hat mir gezeigt, dass ich da auch Botanik<br />
machen müsste – auf das Auswendiglernen<br />
von Blumen und Blättern, so meine<br />
damalige Vorstellung, hatte ich aber keine<br />
Lust. Ein Blick ins Programm für Physik<br />
hat mich dann getriggert, Physik zu wählen<br />
– obwohl ich dachte, dass das nur<br />
Nerds studieren und auch schaffen würden.<br />
Bereut habe ich es nie. Ich hatte an<br />
der Universität Inns bruck eine sehr gute<br />
Ausbildung in Physik, von der ich immer<br />
profitiert habe.<br />
ZUKUNFT: Sie studierten quasi in der Vorbereitungsphase<br />
der erfolgreichen quantenphysikalischen<br />
Versuche, die ab den<br />
späten 1990er-, frühen 2000er-Jahren in<br />
Inns bruck durchgeführt wurden. Haben<br />
Sie das als Aufbruchstimmung wahrgenommen?<br />
DISSERTORI: Das Thema Quantenphysik,<br />
diese Entwicklung, dass sich hier<br />
etwas aufbaut, hat man auch als Student<br />
gespürt. Anton Zeilinger war noch in<br />
Inns bruck, als ich begonnen habe. Dann<br />
kamen Peter Zoller und Ignacio Cirac<br />
oder auch Helmut Ritsch. Mich selbst hat<br />
allerdings die Teilchenphysik mehr interessiert.<br />
In der Gruppe von Dietmar Kuhn<br />
war ich sehr gut aufgehoben, er hat mir<br />
sehr früh ermöglicht, ein Sommerpraktikum<br />
am CERN zu machen. Das war für<br />
meine Karriere sicherlich entscheidend.<br />
Genossen habe ich auch die Ausbildung<br />
in Theoretischer Physik bei Josef Rothleitner<br />
und Gebhard Grübl, vor allem Rothleitner<br />
hat mich sehr geprägt.<br />
ZUKUNFT: Wie sehen Sie die Universität<br />
Innsbruck heute?<br />
DISSERTORI: Von der Universität Innsbruck<br />
habe ich zwei Bilder. Einerseits die<br />
europaregionale Universität, die diesbezüglich<br />
eine wichtige Rolle spielt, da sie<br />
an der Schnittstelle von Kulturen liegt.<br />
Andererseits ist sie in gewissen Punkten<br />
„Was macht schlussendlich die<br />
Qualität universitärer Bildung<br />
und <strong>Forschung</strong> aus? Am Ende<br />
sind es die Menschen.“<br />
absolut weltführend. Das finde ich beeindruckend,<br />
dass man sich das erarbeitet<br />
und – etwa auf dem Gebiet der Quantenphysik<br />
– einen Namen geschaffen hat.<br />
Das ist nicht selbstverständlich, darauf<br />
kann man stolz sein.<br />
ZUKUNFT: In Ihrer <strong>Forschung</strong> schlagen Sie<br />
eine Brücke von der Detektion von Higgs-<br />
Teilchen zur Alzheimer-Früherkennung.<br />
Können Sie diese Brücke kurz beschreiben?<br />
DISSERTORI: Zur Detektion von Higgs-<br />
Teilchen wurden spezielle Detektoren<br />
gebaut. Sie können sehr genau hochenergetische<br />
Lichtteilchen, die vom<br />
Zerfall des Higgs-Teilchens stammen,<br />
vermessen. Unsere Gruppe an der ETH<br />
Zürich war massiv in den Bau des Detektors<br />
involviert. Von der Technologie<br />
her praktisch idente Detektoren gibt es<br />
in der medizinischen Bildgebung, in der<br />
Positronen-Emissions-Tomografie, kurz<br />
PET. Dabei kommen kleine Detektoren<br />
rund um den Körper oder Kopf zum<br />
Einsatz. Den nächsten Aspekt lieferten<br />
Forscher:innen an der Medizinischen<br />
Fakultät der Universität Zürich: Für Alzheimer-Früherkennung,<br />
zur Darstellung<br />
von Plaque-Ablagerungen im Gehirn, ist<br />
PET der Goldstandard. Die Vision der<br />
Medizinkolleg:innen war der Bau kleiner<br />
und billiger Scanner, um die Bevölkerung<br />
z. B. ab 50 systematisch zu scannen<br />
und Risikopatient:innen weiter zu untersuchen<br />
bzw. schon früh zu behandeln,<br />
wenn möglicherweise Medikamente auf<br />
den Markt kommen. Das ist die Brücke<br />
vom Higgs-Teilchen zur Alzheimer-Früherkennung.<br />
Wir haben das Projekt durchgezogen,<br />
irgendwann kam die Idee auf,<br />
dies zu kommerzialisieren. Es wurde ein<br />
Startup gegründet, die Firma steht knapp<br />
davor, den ersten Scanner zu verkaufen.<br />
ZUKUNFT: Egal wie man zu Uni-Rankings<br />
steht, Schweizer Universitäten schneiden<br />
in sämtlichen besser ab als österreichische.<br />
Was machen die Schweizer besser?<br />
DISSERTORI: Eine gute Frage. Was macht<br />
schlussendlich die Qualität universitärer<br />
Bildung und <strong>Forschung</strong> aus? Am Ende<br />
sind es die Menschen. Das heißt, in jeder<br />
Organisation, ob es eine Universität oder<br />
ein Unternehmen ist, muss es das Ziel sein,<br />
die allerbesten Leute zu holen. Das muss<br />
das oberste Gebot sein. An der ETH verfolgen<br />
wir das seit über 150 Jahren sehr<br />
systematisch, das wirkt sich mittel- und<br />
langfristig aus. Hat man diese guten Leute,<br />
wird es leichter, andere gute Leute anzuziehen.<br />
Wichtig ist dabei, dass man bei<br />
der Berufung dieser Leute größtmögliche<br />
Autonomie besitzt, dass nicht zu viele<br />
mitreden, da sonst eventuell zu viele Interessen<br />
zusammenkommen und die Exzellenz<br />
leidet. An der ETH besitzen wir diese<br />
Autonomie in einem sehr großen Ausmaß.<br />
Das gesamte Interview finden Sie auf<br />
der Homepage der Uni Inns bruck unter:<br />
www.uibk.ac.at/forschung/magazin<br />
24 zukunft forschung <strong>02</strong>/23<br />
Foto: ETH Zürich / Markus Bertschi
STANDORT<br />
Wir haben intern sehr viele Freiheiten, zu<br />
bestimmen, welche Professuren geschaffen<br />
werden und wie wir sie besetzen. Größtmögliche<br />
Autonomie und Unabhängigkeit<br />
der Institution sind daher zentrale Aspekte<br />
– und die ETH hat in dieser Beziehung<br />
einen gewissen Vorteil gegenüber einer<br />
typischen österreichischen Universität.<br />
ZUKUNFT: Und die finanziellen Mittel?<br />
DISSERTORI: Am Ende kommt man natürlich<br />
nicht ums Geld herum. Denn wie<br />
ziehe ich die besten Leute an? Indem ich<br />
gute Bedingungen offeriere. Gute Bedingungen<br />
heißt auch gute Gehälter, den<br />
wirklichen Top-Leuten geht es aber um die<br />
gute Infrastruktur. Das heißt, Geld muss<br />
in gute Infrastruktur fließen. Da sind wir<br />
in der glücklichen Lage, dass die Grundfinanzierung<br />
der Schweizer Universitäten<br />
und speziell der ETH Zürich schon sehr,<br />
sehr gut ist. Vor allem in Hinblick auf die<br />
Grundfinanzierung: Jede Professorin, jeder<br />
Professor wird von Anfang an sehr<br />
gut ausgestattet und muss nicht jedes Jahr<br />
neu um Ressourcen anfragen. Gut dotierte<br />
Professuren erlauben, Dinge zu verfolgen,<br />
die unmöglich erscheinen und dauern.<br />
An scheinbar verrückten Ansätzen über<br />
Jahre zu forschen, liefert manchmal aber<br />
auch Durchbrüche. Ich möchte aber nochmals<br />
betonen: Ich hatte an der Universität<br />
Inns bruck eine Top-Ausbildung, man sieht<br />
also, dass Top-Ausbildung nicht immer<br />
direkt mit Rankings korreliert. Es sind die<br />
Menschen.<br />
ZUKUNFT: Die Schweiz ist nicht Teil großer<br />
EU-Programme wie Horizon Europe. Wie<br />
sehr schmerzt dieser fehlende Zugang?<br />
DISSERTORI: Es schmerzt aus verschiedensten<br />
Gründen. Es geht nicht nur allein<br />
um Geld, da gibt es Notlösungen – man<br />
kann etwa beim Schweizer Nationalfonds<br />
ähnliche Projekte einreichen. Dieser Wettbewerb<br />
ist allerdings ein anderer, er ist<br />
national, nicht international – den hohen<br />
Level eines ERC Grants kann man innerhalb<br />
eines Landes nicht erreichen. Es<br />
schmerzt auch wegen großer Kooperationsprojekte<br />
in Europa, unter anderem<br />
hatten ETH-Forscherinnen und -Forscher<br />
bei gewissen Projekten die Führung und<br />
mussten diese abgeben. Was das bedeutet,<br />
ist klar. Wenn man Projekte nicht mehr leitet,<br />
kann man sie nicht mehr entsprechend<br />
prägen. Es schmerzt auch, weil immer die<br />
Gefahr besteht, dass auf lange Sicht die<br />
besten Leute nicht mehr in die Schweiz<br />
kommen. Diesen Effekt spüren wir aktuell<br />
noch nicht sehr stark, man darf ihn aber<br />
nicht vernachlässigen. Die Politik unterschätzt<br />
bei Bildung und <strong>Forschung</strong> immer,<br />
wie langfristig die Wertschöpfungsketten<br />
sind – Auswirkungen sieht man nicht in<br />
ein, zwei Jahren, sondern in zehn. Sieht<br />
man sie dann, ist es schon zu spät, denn<br />
es braucht dann wieder zehn Jahre, um zu<br />
GÜNTHER DISSERTORI (*1969 in Meran)<br />
studierte an der Uni Inns bruck Physik.<br />
Für sein Doktorat ging er in die Schweiz<br />
ans CERN und dissertierte über den ALEPH-<br />
Detektor. Am CERN half Dissertori mit, das<br />
CMS-Experiment am großen Teilchenbeschleuniger<br />
aufzubauen, eines jener beiden<br />
Experimente, mit denen es gelang, das<br />
Higgs-Teilchen nachzuweisen. 2001 wurde<br />
er Assistenzprofessor an der ETH Zürich,<br />
2007 ordentlicher Professor. Seit Februar<br />
2<strong>02</strong>2 ist Dissertori Rektor der ETH Zürich<br />
und zeichnet damit für die Lehre an der<br />
Schweizer Hochschule verantwortlich.<br />
korrigieren. Diese systematische Erosion<br />
macht uns große Sorgen.<br />
ZUKUNFT: Gibt es dennoch Kooperationen<br />
mit europäischen Universitäten?<br />
DISSERTORI: Ja, die ETH Zürich ist z. B. als<br />
Mitglied einer der European University<br />
Alliances eingeladen worden und ist<br />
ENHANCE, dem Zusammenschluss von<br />
weiteren neun technischen Universitäten,<br />
beigetreten. Bezüglich der Fördermittel<br />
sind wir assoziiertes Mitglied, bezüglich<br />
der Zusammenarbeit sind wir aber vollkommen<br />
anerkannt – das ist sehr positiv.<br />
Wir sind ENHANCE auch beigetreten, um<br />
der Schweizer Politik zu zeigen, dass wir<br />
nicht am Spielfeldrand stehen, sondern<br />
mitspielen wollen. Schauen wir, wie lange<br />
uns dieses Thema noch beschäftigt.ah<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/23 25
ZOOLOGIE<br />
DER FLUKE HINTERHER<br />
Bettina Thalinger und Lauren Rodriguez vom Institut für Zoologie waren im Sommer unterwegs, um<br />
Wasserproben für das europäische Wal- und Biodiversitätsmonitoring-Projekt eWHALE zu entnehmen<br />
und die große Citizen-Science-Kampagne 2<strong>02</strong>4 vorzubereiten.<br />
26 zukunft forschung <strong>02</strong>/23<br />
Fotos: Bettina Thalinger, Lauren Rodriguez
ZOOLOGIE<br />
Lauren Rodriguez erinnert sich gerne<br />
an den vergangenen Juli, den<br />
sie größtenteils in einem großen,<br />
schaukelnden Schlauchboot rund um<br />
die Azoren-Inseln Pico und Faial verbracht<br />
hat. Ausgerüstet mit Kübel und<br />
Pumpe hat sie nach jeder Walsichtung<br />
zwei Mal Wasser entnommen: einmal<br />
aus dem „frischen“ Fluken-Abdruck –<br />
jener spiegelglatten Wasserfläche, die<br />
die Schwanzflosse eines Wals hinterlässt<br />
– und ein weiteres Mal rund zwanzig<br />
Minuten später. Die aus den USA stammende<br />
Nachwuchswissenschaftlerin ist<br />
PhD-Studentin im Biodiversa+-Projekt<br />
eWHALE, in dem unter Inns brucker Leitung<br />
eine neue Strategie für ein weitreichendes,<br />
nicht-invasives Walmonitoring<br />
mittels Umwelt-DNA entwickelt wird.<br />
In Zusammenarbeit mit der Walbeobachtungsagentur<br />
CW Azores und einem<br />
wissenschaftlichen Team von der Universidade<br />
dos Açores sammelte Rodriguez<br />
im Juli über 80 Wasserproben und testete<br />
dabei verschiedene Filter und Pumpen<br />
sowie die Rahmenbedingungen für die<br />
Probenentnahme an Bord. Für sie und<br />
ihre Projekt-Kolleg:innen aus Portugal,<br />
Frankreich, Italien, Irland, Norwegen<br />
und Island, vor allem aber für Projektleiterin<br />
Bettina Thalinger, Senior Scientist<br />
am Institut für Zoologie, war der vergangene<br />
Sommer sozusagen die Generalprobe<br />
für die kommende Saison. Es galt,<br />
das richtige Timing und die geeigneten<br />
Geräte für die Entnahme und Filterung<br />
des Wassers zu finden, denn 2<strong>02</strong>4 muss<br />
alles nach Plan laufen, um zusammen<br />
mit freiwilligen Helfer:innen möglichst<br />
viele Proben mit hohem Wal-DNA-Gehalt<br />
in den Meeren rund um Europa zu<br />
sammeln.<br />
Proben-Vergleich<br />
„Einmal, als ich mit dem Uni-Team unterwegs<br />
war, hatten wir besonderes Glück:<br />
Wir konnten Delfine und ihre Jungen und<br />
sogar ein Pottwal-Neugeborenes beobachten,<br />
was sehr selten ist. Am selben Tag<br />
haben wir außerdem noch Nördliche Entenwale<br />
gesehen und konnten nicht nur<br />
Wasser-, sondern auch Gewebeproben<br />
entnehmen“, erzählt Lauren Rodriguez<br />
von einem besonderen Feldforschungstag.<br />
Die Fahrten mit dem Team der Universidade<br />
dos Açores dienten vor allem<br />
der gleichzeitigen Entnahme von Gewebe-<br />
und Wasserproben. Rodriguez wird<br />
in ihrer Doktorarbeit unter anderem die<br />
Qualität der populationsgenomischen Informationen<br />
aus beiden Probenvarianten<br />
vergleichen und hat dabei Unterstützung<br />
von gleich drei wissenschaftlichen Betreuer:innen:<br />
Monica Silva von der Universidade<br />
dos Açores sowie Michael Traugott<br />
und Bettina Thalinger von der Universität<br />
Inns bruck. „Wir haben hier an der Universität<br />
Inns bruck langjährige Erfahrung<br />
in der Auswertung von Umwelt-DNA<br />
und eine hervorragende Laborinfrastruktur“,<br />
sagt Michael Traugott, Leiter<br />
der Abteilung für Angewandte Tierökologie,<br />
nicht ohne Stolz und beantwortet<br />
damit die Frage, warum eigentlich gerade<br />
eine österreichische Universität mitten in<br />
den Bergen Walforschung betreibt. „Das<br />
musste ich bei den Walbeobachtungstouren<br />
auch öfter erklären“, ergänzt Lauren<br />
Rodriguez lachend.<br />
Umweltproben als Alternative<br />
Als Umwelt-DNA (englisch: „environmental<br />
DNA“, kurz: eDNA) bezeichnet<br />
man kleinste Mengen Erbgut, die von Organismen<br />
an ihre Umgebung abgegeben<br />
werden. Das große wissenschaftliche Ziel<br />
von eWHALE ist, anhand der im Wasser<br />
enthaltenen Umwelt-DNA solide Daten<br />
zum Populationsbestand zahlreicher,<br />
teils bedrohter Wal- und Hai-Arten zu<br />
schaffen. „Bei manchen Walarten lassen<br />
sich Individuen anhand von äußerlichen<br />
Merkmalen nicht voneinander<br />
unterscheiden. Gewebeproben dürfen<br />
nur unter strengen Auflagen von <strong>Forschung</strong>steams<br />
entnommen werden, sind<br />
schwierig zu bekommen und nicht ganz<br />
unumstritten. Daher eignen sie sich nicht<br />
für ein weitreichendes Monitoring unter<br />
Einbeziehung von Walbeobachtungsanbietern<br />
und Citizen-Scientists“, erklärt<br />
Bettina Thalinger den Grund dafür. Als<br />
Expertin mit langjähriger Erfahrung in<br />
der Analyse von Umwelt-DNA mithilfe<br />
molekularer Methoden ist sie überzeugt,<br />
dass die aus dem Wasser gefilterte Wal-<br />
DNA ausreichend populationsgenomi-<br />
LAUREN RODRIGUEZ bei der Probenentnahme<br />
auf den Azoren.<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/23 27
ZOOLOGIE<br />
DAS INNS BRUCKER eWHALE-Konsortium: Michael Traugott, Bettina Thalinger, Lauren Rodriguez<br />
sche Informationen enthält, um zukünftig<br />
ein nicht-invasives Monitoring zu<br />
implementieren. – Bestätigen soll sich<br />
diese Annahme in den nächsten Wochen<br />
im Labor. Dass die Proben, die Lauren<br />
Rodriguez von den Azoren mitgebracht<br />
hat, auch tatsächlich genügend Wal-DNA<br />
beinhalten, steht bereits nach den allerersten<br />
Auswertungen fest. „Wir waren<br />
natürlich sehr neugierig und haben mit<br />
einem neu entwickelten Primerpaar bereits<br />
Pottwal-DNA nachgewiesen“, freut<br />
sich Thalinger und erklärt: „Ein Primerpaar<br />
ist eine Kombination aus zwei molekularen<br />
Sonden, mit der gezielt ein<br />
kurzes Fragment DNA einer Art – zum<br />
Beispiel Pottwal – in einer Umwelt-Probe<br />
nachgewiesen werden kann.“<br />
Bettina Thalinger selbst war im Sommer<br />
übrigens in Italien und Island, um<br />
dort PhD- und Masterstudierende zu<br />
schulen, die im nächsten Jahr die Probenentnahme<br />
in diesen Ländern begleiten<br />
und die Citizen Scientists anleiten werden.<br />
Gemeinsam mit den Tour-Anbietern<br />
soll so nicht nur eine hohe Anzahl an Proben<br />
im Atlantik und dem Mittelmeer entnommen,<br />
sondern auch mehr Bewusstsein<br />
für den Schutz mariner Lebensräume<br />
geschaffen werden. Bis dahin gibt es aber<br />
noch einiges zu tun: In den kommenden<br />
Wintermonaten werden nicht nur Proben<br />
analysiert, sondern auch Leitfäden für die<br />
Arbeit mit den Citizen Scientists erstellt.<br />
„Wir hatten bereits einen Online-Erfahrungstausch<br />
mit dem ganzen Team. Dabei<br />
hat sich gezeigt, dass die unterschiedlichen<br />
Projektpartner unterschiedliche Entnahme-<br />
und Filtermethoden bevorzugen“,<br />
berichtet Thalinger. „Was funktioniert,<br />
hängt stark vom Land und den<br />
örtlichen Gegebenheiten ab. Der italienische<br />
Anbieter macht die Touren mit einer<br />
Segelyacht und ist eine Woche unterwegs,<br />
der isländische unternimmt kurze, dreistündige<br />
Touren mit einem großen, alten<br />
Segelboot. Die Unterschiedlichkeit der<br />
Projektpartner in eWHALE ist Herausforderung<br />
und Stärke zugleich.“ In einem ist<br />
sich das Innsbrucker eWHALE-Team jedenfalls<br />
einig: „Es ist in jedem Fall äußerst<br />
spannend und bereichernd mit so<br />
einem diversen, internationalen Team zusammenzuarbeiten.“<br />
ef<br />
CITIZEN SCIENTISTS und Whalewatching-Agenturen sind stark in das Projekt einbezogen<br />
(Im Bild das Schiff Opal der beteiligten Walbeobachtungsagentur North Sailing in Island).<br />
BIODIVERSA+ ist eine seit 1. Oktober<br />
2<strong>02</strong>1 laufende Förderinitiative der<br />
Europäischen Kommission. Als Teil<br />
der Biodiversitätsstrategie 2030 der<br />
Europäischen Union will Biodiversa+ eine<br />
Brücke zwischen Wissenschaft, Politik<br />
und Praxis schlagen und Erkenntnisse für<br />
ihre Planung und Umsetzung liefern. Das<br />
Biodiversa+-Projekt eWHALE wird vom<br />
österreichischen Wissenschaftsfonds FWF<br />
sowie von weiteren Fördergremien der<br />
beteiligten Staaten finanziert.<br />
28<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/23<br />
Fotos: Andreas Friedle, Ales Mucha
THIRD MISSION<br />
FOKUS AUF KLIMA<br />
UND NACHHALTIGKEIT<br />
PEAK ist eine neu geschaffene Kommunikationsplattform, auf der<br />
die Universität Inns bruck ihre breit gefächerte wissenschaftliche Expertise<br />
in den Bereichen Klima und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt rückt.<br />
DIE ABBILDUNG wurde mit der Künstlichen Intelligenz Midjourney erstellt, die sie aus dem Projekttitel PEAK (Perspectives on Engagement,<br />
Accountability and Knowledge) angefertigt hat.<br />
Wissenschaftler:innen der Universität<br />
Inns bruck arbeiten zu<br />
zahlreichen Facetten in den Bereichen<br />
Klima, Biodiversität und Nachhaltigkeit.<br />
Um Daten und Fakten, grundlegende<br />
Prozesse, vor allem aber Wege<br />
aus der Klima- und Biodiversitätskrise<br />
besser sicht- beziehungsweise begehbar<br />
zu machen, setzt die Universität Innsbruck<br />
in ihrer Wissenschaftskommunikation<br />
künftig einen noch stärkeren Fokus<br />
auf klimarelevante Themen. Sie nimmt<br />
damit als öffentliche Bildungsinstitution<br />
ihre gesellschaftliche Verantwortung im<br />
Sinne ihrer Third Mission wahr.<br />
„Es geht dabei nicht nur um eine intensivere,<br />
strukturierte und wirksamere<br />
Kommunikation nach außen, sondern<br />
auch darum, unsere Forscher:innen für<br />
Klimakommunikation zu sensibilisieren<br />
und die fächerübergreifende Vernetzung<br />
zu fördern“, verdeutlicht Melanie Bartos<br />
vom Kommunikationsteam der Universität<br />
Inns bruck. Im Rahmen der Tage der<br />
Biodiversität an der Universität für Bodenkultur<br />
in Wien durfte sie am 10. November<br />
2<strong>02</strong>3 das Projekt PEAK offiziell<br />
aus der Taufe heben und präsentieren.<br />
Das Akronym PEAK steht für Perspectives<br />
on Engagement, Accountability and<br />
Knowledge. PEAK versteht sich aber auch<br />
als Hinweis auf einen <strong>Forschung</strong>sschwerpunkt,<br />
der sich aus der einzigartigen Lage<br />
der Universität Inns bruck inmitten der<br />
Berge ergibt: Den alpinen Raum, der von<br />
den Folgen der Klimakrise besonders betroffen<br />
ist und als fakultätsübergreifender<br />
<strong>Forschung</strong>sschwerpunkt bereits seit vielen<br />
Jahren an der Universität verankert<br />
ist. Neben der naturwissenschaftlichen<br />
Perspektive spielen hier Sozial- und Geisteswissenschaften<br />
ebenso eine große Rolle<br />
und thematisieren den gesellschaftlichen<br />
Wandel, zum Beispiel die <strong>Zukunft</strong> bestimmter<br />
Wirtschaftszweige, Verteilungsfragen<br />
oder Konsumgewohnheiten.<br />
Website mit Expert:innen<br />
In einem ersten Schritt entstand als<br />
Kernstück von PEAK eine Website, auf<br />
der klimarelevante Berichte gesammelt<br />
zu finden sind; ebenso integriert sie eine<br />
noch wachsende Liste mit einschlägigen<br />
Expert:innen aus verschiedensten Disziplinen,<br />
die Medienvertreter:innen als<br />
zuverlässige Ansprechpartner:innen in<br />
definierten Themengebieten zur Verfügung<br />
stehen.<br />
„Die PEAK-Seite ist nicht nur als nationale,<br />
sondern auch als internationale<br />
Wirkungsplattform gedacht und deshalb<br />
zweisprachig“, erklärt Melanie Bartos.<br />
So will die Universität langfristig als<br />
Zentrum exzellenter <strong>Forschung</strong> in den<br />
Bereichen Klimaentwicklung und Nachhaltigkeit<br />
auftreten. Aber auch Aus- und<br />
Weiterbildungsformate und Vernetzungsinitiativen<br />
sollen in den kommenden<br />
Jahren im Rahmen von PEAK entstehen.<br />
ef<br />
Mehr Infos zu PEAK – Perspectives on<br />
Engagement, Accountability and Knowledge<br />
auf www.uibk.ac.at/de/peak/<br />
Grafik: Universität Inns bruck<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/23 29
GEOLOGIE<br />
ALS DIE ALPEN AUS<br />
DEM MEER KAMEN<br />
Die Geologin Hannah Pomella erforscht die jüngste Phase in der Entstehungsgeschichte der Alpen.<br />
Dafür verwenden sie und ihre Dissertant:innen unter anderem Sandkastenmodelle und analysieren<br />
feine Risse, die zerfallendes Uran in Kristallen hinterlässt.<br />
GUT GESCHICHTETE KALKSTEINE der ca. 140 bis 130 Millionen Jahre alten Maiolica-Formation in den Bellunesischen Dolomiten. Die<br />
auffälligen Spitzfalten entstanden in einer späteren Phase der Gebirgsbildung vor ca. 13 bis fünf Millionen Jahren.<br />
Auf dem Labortisch steht etwas, das<br />
auf den ersten Blick wie ein bunter<br />
Sandkasten aussieht. Auf Knopfdruck<br />
fängt ein Ende des Kastens an, sich<br />
zu bewegen und schiebt sich langsam auf<br />
das andere Ende zu. Der dazwischenliegende,<br />
sorgsam aufgebaute Stapel aus<br />
verschiedenfarbigen Sandschichten wird<br />
zusammengedrückt. Die Schichten schieben<br />
sich übereinander, dabei entstehen<br />
Falten und Brüche, im Querschnitt des<br />
Sandmodells gut zu erkennen. Was diese<br />
analoge Laborsimulation im Schnelldurchlauf<br />
zeigt, ist das Aufeinanderprallen<br />
der Europäischen und der Afrikanischen<br />
Kontinentalplatten, das über mehrere<br />
Millionen Jahre hinweg zur Entstehung<br />
der Alpen geführt hat.<br />
Die Vergangenheit dieser Berge ist kompliziert.<br />
Das zeigt sich bereits an der enormen<br />
Vielfalt der Gesteine, aus denen die<br />
Alpen bestehen – und daran, dass sie aus<br />
geologischer Sicht sogar als zwei Gebirge<br />
verstanden werden müssen. Da die Bewegung<br />
der Platten andauert, bewegen und<br />
verformen sich die Alpen auch heute noch.<br />
Hier setzt auch das <strong>Forschung</strong>sprojekt der<br />
Strukturgeologin Hannah Pomella an. Die<br />
Assistenzprofessorin am Institut für Geologie<br />
ist bereits seit ihrem Studium an der<br />
Universität Inns bruck tätig und arbeitete<br />
unter anderem an den Vorerkundungen<br />
zum Bau des Brenner Basistunnels mit.<br />
Die Alpen haben in Pomellas wissenschaftlicher<br />
Laufbahn immer eine zentrale<br />
Rolle gespielt – so auch im aktuellen <strong>Forschung</strong>sprojekt<br />
Thermotektonische Entwicklung<br />
des Dolomiten-Indenters.<br />
Steife Berge<br />
Die Geschichte der Alpen beginnt vor etwa<br />
100 Millionen Jahren, als sich Adria<br />
– ein Sporn der Afrikanischen Kontinentalplatte<br />
– und die Europäische Kontinentalplatte<br />
langsam aufeinander zubewegen<br />
und dabei in einer ersten Phase das<br />
Tethysmeer geschlossen wird. Dadurch<br />
entsteht ein erstes Gebirge. Unmengen<br />
an Muscheln, Korallen und andere Meeresorganismen<br />
bilden die Kalk- und Dolomit-Gesteine,<br />
aus denen die heutigen<br />
Nördlichen Kalkalpen oder auch die Dolomiten<br />
der östlichen Südalpen aufgebaut<br />
sind. In der zweiten wichtigen Phase der<br />
Alpenbildung, vor ungefähr 30 Millionen<br />
Jahren, bewegt sich die Afrikanische Kontinentalplatte<br />
nach Norden und schließt<br />
den Penninischen Ozean, ein Seitenarm<br />
des heutigen Atlantiks. Durch diese<br />
Schließung prallen die Europäische und<br />
die Adriatische Kontinentalplatte gegeneinander.<br />
Dabei wird die Europäische<br />
Platte unter die Adriatische gedrückt und<br />
tief in den Erdmantel geschoben, wo sie<br />
mit der Zeit aufgeschmolzen wird. Andere<br />
Teile der Europäischen Platte werden bei<br />
der Kollision abgehobelt, gemeinsam mit<br />
der darüberliegenden Adriatischen Platte<br />
verfaltet und in die Höhe gedrückt – es<br />
wachsen die Alpen, wie wir sie kennen.<br />
Diese Gebirgsbildung hält bis heute an,<br />
denn die Afrikanische Platte schiebt sich<br />
30 zukunft forschung <strong>02</strong>/23<br />
Fotos: Thomas Klotz (2), Andreas Friedle (1),
GEOLOGIE<br />
nach wie vor weiter nach Norden. Das<br />
Südalpin, ein bisher kaum an der Gebirgsbildung<br />
beteiligter und deshalb steifer Teil<br />
der Adriatischen Platte, drückt sich dabei<br />
in die relativ weichen nördlichen Alpen.<br />
Vor allem der östliche Teil des Südalpins,<br />
die Dolomiten, übernehmen die Rolle des<br />
Indenters, des „Eindrückers“.<br />
Um diesen jüngsten Teil der Alpengeschichte<br />
zu erforschen, wendet Pomellas<br />
Arbeitsgruppe eine Kombination aus verschiedenen<br />
Methoden an. An erster Stelle<br />
steht, wie in der Geologie üblich, die<br />
Auf Spaltspuren<br />
Die gesammelten Proben werden in aufwendigen<br />
Schritten im Labor aufbereitet,<br />
um darin eingeschlossene Kristalle zu<br />
gewinnen. Vor allem die Kristalle Zirkon<br />
und Apatit sind für die Spaltspurmethode<br />
interessant, an der der Dissertant Thomas<br />
Klotz arbeitet.<br />
Wie in vielen natürlichen Kristallen<br />
ist in Zirkon und Apatit Uran enthalten.<br />
Dieses zerfällt im Laufe der Zeit und bildet<br />
Alphateilchen, die mit hoher Energie<br />
durch den Kristall schießen. Dadurch<br />
wird der Kristall beschädigt und es entsteht<br />
ein winziger Riss, eine sogenannte<br />
Spaltspur. Wenn der Kristall entsprechend<br />
aufbereitet wurde, können diese Risse<br />
unter dem Mikroskop beobachtet und gezählt<br />
werden. Dadurch lässt sich ableiten,<br />
wie viele Uranatome im Kristall seit seiner<br />
Schließtemperatur bereits zerfallen sind.<br />
„Ab einer gewissen Temperatur gilt ein<br />
Kristall als geschlossen. Das heißt, dass<br />
seine Struktur dann fest und der Kristall<br />
nicht mehr in der Lage ist, die Spaltspuren<br />
zu verheilen“, erklärt Pomella. „Mit der<br />
Methode lässt sich bestimmen, vor wie<br />
viel Zeit er seine Schließtemperatur unterschritten<br />
hat. Bei Zirkon liegt diese bei<br />
ungefähr 200 °C, bei Apatit sind es 100 °C.<br />
Anhand einer weiteren Methode messen<br />
wir, wie Helium aus Apatit-Kristallen diffundiert.<br />
Hier liegt die Schließtemperatur<br />
bei 60 °C.“<br />
Durch diese drei Temperaturen lässt<br />
sich nachverfolgen, in welcher Tiefe sich<br />
der jeweilige Kristall zu einer bestimmten<br />
Zeit in der Erdkruste befand – dank<br />
des geothermischen Gradienten. Unter<br />
der Erdoberfläche nimmt die Temperatur<br />
konstant zu, ungefähr 30 °C pro Kilometer.<br />
Für eine im Gebirge gesammelte Gesteinsprobe,<br />
die Zirkon und Apatit enthält, kann<br />
also ein Pfad durch die Erdkruste bis an<br />
die Oberfläche modelliert werden, da<br />
nachverfolgt werden kann, wann die Umgebungstemperatur<br />
200, 100 oder 60 °C<br />
betragen hat. Werden Gesteinsproben von<br />
beiden Seiten einer Verwerfungszone genommen,<br />
also genau dort, wo sich Platten<br />
oder Gesteinspakete übereinander schieben,<br />
so lässt sich die Hebung von Gesteinen<br />
im Verhältnis zueinander beobachten.<br />
IM SPALTSPURLABOR werden die vorbereiteten Kristalle unter dem Mikroskop bei<br />
1.000-facher Vergrößerung begutachtet und die Spaltspuren ausgewertet.<br />
HANNAH POMELLAS wissenschaftlicher<br />
Blick gilt den Alpen.<br />
Exkursion ins Feld und die Suche nach<br />
geeigneten Gesteinsproben in den Bergen.<br />
Dabei geht es oftmals in eher unerforschtes<br />
und abgelegenes Gelände, denn<br />
es wurde lange davon ausgegangen, dass<br />
eine Untersuchung der internen Verformung<br />
des Dolomiten-Indenters nicht viel<br />
zum Verständnis der Alpenbildung beitragen<br />
kann.<br />
Modelle zusammenschieben<br />
Zu den gewonnenen Abkühldaten kommen<br />
Analogmodelle wie der bereits erwähnte<br />
Sandkasten hinzu, an dem die<br />
Dissertantin Anna-Katharina Sieberer arbeitet.<br />
Bei den analogen Experimenten mit<br />
Sand und Silikon stellen verschieden farbige<br />
Sandlagen verschiedene Gesteine der<br />
Erdkruste dar, die, penibel auf den Labormaßstab<br />
skaliert, im offenen Kasten verteilt<br />
werden. Die Verformung der Schichten<br />
modellieren die Forscher:innen durch<br />
mehrere Phasen des Auseinanderziehens<br />
und Zusammenschiebens in unterschiedliche<br />
Richtungen und vergleichen diese<br />
mit tatsächlich in den Alpen beobachteten<br />
tektonischen Prozessen. Daraus können sie<br />
ableiten, wie das Zusammenschieben der<br />
Platten zeitlich und räumlich verlaufen<br />
sein könnte. „Diese zwei Methoden werden<br />
kombiniert“, sagt Pomella. „Was wir<br />
im analogen Experiment modelliert haben,<br />
können wir gemeinsam mit den Abkühldaten<br />
auf die Natur übertragen. Warum,<br />
wo und in welche Richtung sich ein Stein<br />
hebt, das beantworten die Analogmodelle<br />
und die Arbeit im Gelände. Wann, in welcher<br />
Höhe und in welcher Reihenfolge das<br />
geschieht, schließen wir aus unseren Abkühldaten.<br />
Aus den verschiedenen Abkühlpfaden<br />
und den Analogmodellen eine<br />
geologische Geschichte auszulesen – an<br />
dieser Aufgabe sitzen wir gerade. Und sie<br />
erfordert ordentlich Hirnschmalz.“ fo<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/23 31
ARCHITEKTUR<br />
NEUE DIMENSIONEN<br />
DES ENTWERFENS<br />
Stefan Rutzinger und Kristina Schinegger entwickeln ein zukunftsweisendes Tool, das<br />
volumetrisches Entwerfen via KI in einer responsiven Computer-Umgebung möglich machen soll.<br />
KRISTINA SCHINEGGER und Stefan Rutzinger leiten die <strong>Forschung</strong>sgruppe Konstruktion und Gestaltung (i.sd – Structure and<br />
Design) und teilen sich die gleichnamige Professur an der Fakultät für Architektur. Am Foto sind sie mit zwei Demonstrationsobjekte<br />
aus dem Projekt Computational Immediacy zu sehen. Mehr Informationen: www.structureanddesign.at/<br />
32<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/23
ARCHITEKTUR<br />
„Das Werkzeug unterstützt beim<br />
Experimentieren mit komplexen<br />
Materialien und Formen.“ <br />
<br />
Stefan Rutzinger<br />
Volumetrisches Entwerfen erlaubt<br />
es, die architektonische Form<br />
gleichzeitig mit ihrer inneren Materialverteilung<br />
bereits in frühen Phasen<br />
der Ideenfindung zu entwickeln.<br />
Einer der Pioniere auf diesem Gebiet des<br />
„Raumplans“ war der österreichische<br />
Architekt Adolf Loos (1870–1933), der es<br />
strikt ablehnte, seine Bauten zweidimensional<br />
zu entwerfen. Diese Denkweise bildete<br />
die Grundlage für seinen charakteristischen,<br />
in sich verschachtelten Baustil.<br />
Bis heute gilt seine Herangehensweise als<br />
wichtiger Weg der Formfindung in der<br />
Architektur. Zwar bieten leistungsstarke<br />
Computer Architekt:innen rund 100<br />
Jahre später ganz andere technologische<br />
Möglichkeiten, als sie Loos zur Verfügung<br />
standen, doch werden diese aktuell noch<br />
nicht so umfassend genutzt, wie man<br />
meinen möchte: „Im Vergleich zu den<br />
meisten anderen Branchen hat die Baubranche<br />
einen vergleichsweise niedrigen<br />
Digitalisierungsindex“, berichten Stefan<br />
Rutzinger und Kristina Schinegger vom<br />
Institut für Gestaltung an der Fakultät für<br />
Architektur.<br />
In ihrem <strong>Forschung</strong>sprojekt Computational<br />
Immediacy möchten die beiden nun<br />
die Entwicklung einer volumetrischen<br />
Entwurfsmethode vorantreiben, die das<br />
volle Potenzial computergestützter Technologien<br />
schon in frühen Entwurfsphasen<br />
nutzt. Eingebunden sind sie dabei<br />
in dem am Zentrum für Geometrie und<br />
Computational Design (GCD) der Technischen<br />
Universität Wien angesiedelten<br />
FWF-Spezialforschungsbereich (SFB)<br />
Advanced Computational Design, der das<br />
Wissen von Projektpartner:innen aus verschiedensten<br />
Disziplinen wie Mathematik,<br />
Bauingenieurwissenschaften, Computergrafik<br />
oder eben Architektur vereint.<br />
schaffen will. Es soll vage Vorstellungen<br />
und Formen, aber auch die Eigenschaften<br />
innovativer Materialien in hoher räumlicher<br />
Tiefe abbilden. Mithilfe von 3D-<br />
Punktwolken-Modellierungen werden Ergebnisse<br />
am Computer unmittelbar sichtund<br />
bearbeitbar. Aber auch Rückmeldungen<br />
zu Materialaufwand, CO 2 -Bilanz und<br />
weiteren Faktoren sind bereits in dieser<br />
frühen Entwurfsphase durch die Anwendung<br />
möglich. „Das Werkzeug unterstützt<br />
beim Experimentieren mit komplexen Materialien<br />
und Formen“, weist Rutzinger auf<br />
das Anwendungsgebiet hin, „und erlaubt<br />
es Architekten, gestalterisch anspruchsvolle<br />
und nachhaltige Gebäudekonzepte<br />
zu entwerfen.“<br />
Kanonische Gebäude<br />
Ein wichtiges Feature, mit dem das Werkzeug<br />
Entwerfer:innen außerdem unterstützen<br />
soll, ist eine Autocomplete-Funktion.<br />
Diese kann man sich ähnlich wie<br />
einen auf Künstlicher Intelligenz basierenden<br />
Textgenerator vorstellen, der aus<br />
ein paar wenigen Informationen einen<br />
Text formuliert: Mit einfachen Inputs –<br />
zum Beispiel einer physisch modellierten<br />
Grundform – errechnet das Entwurfswerkzeug<br />
ein hochaufgelöstes Modell<br />
mit vielen Details und macht so eine Idee<br />
räumlich erkundbar. Dazu braucht es im<br />
Hintergrund Algorithmen, welche die<br />
räumliche Struktur, die architektonischen<br />
Elemente und weitere für die Darstellung<br />
relevante Faktoren abbilden, aber auch<br />
eine solide Datengrundlage. Derzeit besteht<br />
diese aus über 200 nach Material und<br />
Bauteilen differenzierten Referenzmodellen<br />
kanonischer Gebäude, aus denen die<br />
Künstliche Intelligenz ihr Wissen über<br />
Architektur beziehen kann. Ein Teil dieser<br />
Referenzmodelle wurde im Rahmen von<br />
Lehrveranstaltungen aufbereitet. „Unsere<br />
Studierenden haben sich in Seminaren mit<br />
diesen kanonischen Bauten auseinandergesetzt<br />
und schließlich in Kleingruppen<br />
Modelle davon erstellt“, erzählt Schinegger.<br />
„So erwerben sie sich grundlegendes<br />
Architekturverständnis, können aber auch<br />
an einem innovativen <strong>Forschung</strong>sprozess<br />
teilhaben“, erklärt sie den Ansatz forschungsgeleiteter<br />
Lehre, wie er am Institut<br />
gelebt wird.<br />
Erste Anwendungen liefern bereits gute<br />
Ergebnisse: Schinegger und Rutzinger zeigen<br />
dazu – wie am Foto auf der linken<br />
Seite – ein von Studierenden aus einfachen<br />
Holzwürfeln angefertigtes Modell<br />
und als Vergleichsobjekt das mithilfe der<br />
Autocomplete-Funktion vom Computer<br />
erzeugte, wesentlich detailreichere Modell,<br />
das auch als 3D-Ausdruck gut funktioniert.<br />
„Der Machine-Learning-Workflow<br />
muss allerdings noch mit zusätzlichen<br />
Referenzmodellen weiter trainiert<br />
werden“, berichten Stefan Rutzinger und<br />
Kristina Schinegger, die gerade das Hearing<br />
für die Verlängerung des SFB-Projektes<br />
absolviert haben.<br />
ef<br />
Raum für frische Ideen<br />
„In frühen Phasen des Entwerfens arbeiten<br />
Architekt:innen und Designer:innen noch<br />
sehr intuitiv und auf Basis ihres impliziten<br />
Wissens. Was entstehen kann, ist oft noch<br />
schwer greifbar“, beschreibt Schinegger<br />
jenes Entwurfsstadium, für welches das<br />
neue Entwurfswerkzeug einen Raum<br />
ERSTE FORSCHUNGSERGEBNISSE wurden als hybride Modellierungsumgebung in<br />
einer öffentlichen Installation im aut (Ausstellung Potenziale 3 im Adambräu) mit dem Titel<br />
Clouder vorgestellt und mit einem Laienpublikum getestet: Die Besucher:innen der Ausstellung<br />
konnten auf einem Tisch mit farbigen Blöcken eine Konstruktion bauen. Mit dem eingescannten,<br />
als Punktwolke dargestellten Ergebnis konnten sie in einem zweiten Schritt weiter<br />
experimentieren. – Die Installation bestand im Wesentlichen aus Bauklötzen, zwei MS-Kinect<br />
Scannern, Ringlichtern, einem Bildschirm, einer Arduino Steuerkonsole und einem Computer.<br />
Fotos: Andreas Friedle, Schinegger / Rutzinger<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/23 33
TEXTILCHEMIE<br />
DRUCKFARBEN<br />
AUS PFLANZEN<br />
Auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft entwickelt Judith Deriu im Labor<br />
natürliche Farbpigmente aus Pflanzen und darauf basierende, nachhaltige<br />
Druckfarben für die Industrie.<br />
DIE NATURFARBEN werden aus Pflanzen oder Reststoffen der Forst- und Landwirtschaft sowie der Lebensmittelindustrie gewonnen.<br />
Farbstoffe aus der Natur werden vom<br />
Menschen schon seit Jahrhunderten verwendet.<br />
Indigo, Karmin, Purpur und Ultramarin<br />
waren bereits in der Antike bekannt<br />
und wurden erst während der industriellen<br />
Revolution von synthetischen Farbstoffen verdrängt.<br />
Am <strong>Forschung</strong>sinstitut für Textilchemie<br />
und Textilphysik in Dornbirn wird seit über 25<br />
Jahren an Farbstoffen aus der Natur geforscht.<br />
Trotz eines Trends hin zu ökologischen Rohstoffen<br />
konnten sich Naturfarbstoffe in der<br />
Textilindustrie bisher noch nicht durchsetzen.<br />
Sie verlieren beim Waschen und im Sonnenlicht<br />
rascher an Farbstärke und sind in der Produktion<br />
teurer als ihre synthetische Konkurrenz.<br />
Das Interesse der Industrie an nachhaltigen<br />
Produkten wächst jedoch stark. Das liegt<br />
einerseits an der verschärften Gesetzgebung<br />
im Bereich Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft,<br />
andererseits wachsen Umweltbewusstsein<br />
und die Bereitschaft der Konsumentinnen<br />
und Konsumenten, mehr Geld<br />
für ökologische und nachhaltige Produkte<br />
auszugeben. In der Lebensmittel- und Kosmetikindustrie<br />
werden Naturfarbstoffe und<br />
natürliche Pigmente bereits erfolgreich eingesetzt.<br />
Judith Deriu arbeitet seit 2016 am Institut<br />
für Textilchemie und Textilphysik und<br />
möchte mit ihren <strong>Forschung</strong>en einen Beitrag<br />
zur Entwicklung der Kreislaufwirtschaft im<br />
Textilsektor leisten. Sie führt die Tradition<br />
des Instituts weiter und nutzt ein uraltes<br />
Verfahren, mit dem aus Pflanzenfarbstoffen<br />
Pigmente hergestellt werden können. „Hier<br />
ist leider viel Wissen verloren gegangen“,<br />
sagt die Chemikerin. „Im Labor versuche ich,<br />
34<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/23<br />
Fotos: Universität Inns bruck (4), privat (1)
TEXTILCHEMIE<br />
dieses Verfahren so weit zu optimieren, dass<br />
die Industriepartner die Pigmente für unterschiedliche<br />
Anwendungen in der Praxis testen<br />
können.“<br />
IM RAHMEN des von der österreichischen<br />
<strong>Forschung</strong>sförderungsgesellschaft (FFG) geförderten<br />
Projekts PiColor arbeitet Judith Deriu<br />
mit den Industriepartnern AGRANA Research<br />
& Innovation Center, Buntwerk Textildruck,<br />
Kelheim Fibres, Offsetdruckerei Schwarzach,<br />
RUEFF Textil, Sun Chemical Group und Verpackungszentrum<br />
Graz zusammen. Ziel ist die<br />
Entwicklung von Pflanzenpigmenten als nachhaltige<br />
und biologisch abbaubare Farbmittel<br />
zur Kolorierung von Textil und Papier.<br />
Farben der Natur<br />
Judith Deriu ist vor allem auf der Suche nach<br />
roten und blauen Farbtönen, denn diese<br />
fehlen bisher weitgehend in der auf Naturfarbstoffen<br />
basierenden Farbpalette. „Daran<br />
arbeiten wir noch, denn diese Pigmente sind<br />
chemisch sehr instabil“, erzählt die Forscherin.<br />
Für Gelb, Ocker, Olivgrün, Braun, Beige<br />
und Schwarz gibt es hingegen bereits Rezepturen,<br />
die für einen industriellen Einsatz interessant<br />
sind. Als Basis für die Pigmente dienen<br />
Reststoffe aus der Forst- und Landwirtschaft<br />
und der Lebensmittelindustrie sowie weitere<br />
Pflanzen, die nicht als Nahrungsmittel dienen.<br />
Schwarz lässt sich etwa aus Holzabfällen<br />
von Sägewerken gewinnen, Olivgrün aus<br />
Zwiebelschalen, Blau aus Heidelbeeren und<br />
Blaualgen und Rot aus Trauben und Beeren.<br />
Indigo und Färbekrapp werden bewusst nicht<br />
verwendet, weil diese in Mitteleuropa nicht<br />
effizient produziert werden können. Wegen<br />
der langen Transportwege und der damit<br />
verbundenen CO 2 -Emissionen vermeidet Judith<br />
Deriu pflanzliche Rohstoffe aus fernen<br />
Ländern.<br />
Aber nicht nur die Farbpigmente basieren<br />
auf nachwachsenden Rohstoffen, auch die<br />
für die Herstellung der Druckfarben notwendigen<br />
Bindemittel und die Trägerfasern sollen<br />
umgestellt werden. Hier ist Judith Deriu<br />
auf der Suche nach natürlichen Alternativen<br />
zu den aus Erdöl produzierten Industrieprodukten.<br />
„Materialien aus fossilen Rohstoffen<br />
belasten die Natur in hohem Ausmaß“, sagt<br />
die Chemikerin. „Aus synthetischen Textilien<br />
lösen sich Mikrofasern, die nicht abgebaut<br />
werden können, und von den auf Textilien gedruckten<br />
Motiven gelangen künstliche Bindemittel<br />
mit Pigmenten als Mikroplastik in die<br />
Umwelt.“ Die Dornbirner Wissenschaftler:innen<br />
kolorieren mit ihrer Pflanzenpigmenten<br />
zum Beispiel biobasierte Zellulosefasern, die<br />
über ein industrielles Verfahren aus Holz hergestellt<br />
werden. Für den Druck auf Textil und<br />
Papier testet Deriu nachhaltige Bindemittel<br />
auf Basis biologisch abbaubarer Polysaccharide,<br />
um die Entstehung von Mikroplastik zu<br />
vermeiden.<br />
Vermarktbare Produkte<br />
Durch Zusammenarbeit mit Industriepartnern<br />
werden verschiedene Druckfarben entwickelt.<br />
Papierdruckfarben für den Offsetdruck aus<br />
„Materialien aus fossilen Rohstoffen belasten die Natur in hohem<br />
Ausmaß. Aus synthetischen Textilien lösen sich Mikrofasern,<br />
die nicht abgebaut werden können, und von den auf<br />
Textilien gedruckten Motiven gelangen künstliche Bindemittel<br />
mit Pigmenten als Mikroplastik in die Umwelt.“ <br />
Judith Deriu<br />
nachhaltigen pflanzlichen Ölen und Harzen<br />
können mit den Pflanzenpigmenten vollständig<br />
nachhaltig gemacht werden. „Unsere<br />
Pigmentpartikel sind für den Papierdruck jedoch<br />
noch zu groß, dafür müssen sie kleiner<br />
als drei Mikrometer werden“, sagt die Chemikerin.<br />
Sehr vielversprechend sind hingegen<br />
die Ergebnisse im Textildruck. „Hier sind wir<br />
gemeinsam mit unseren Partnern aktuell auf<br />
der Suche nach Produkten, die sich vermarkten<br />
lassen.“ In Frage kommen dafür zum<br />
Beispiel Einkaufsbeutel oder Event-T-Shirts.<br />
Im Papierbereich sind Geschenkpapier, Verpackungsmaterialien<br />
und Papiertaschen mögliche<br />
Einsatzgebiete der neuen Farbpigmente<br />
und Druckfarben. Für Kleidung müssen die<br />
Farben noch deutlich weiterentwickelt werden,<br />
damit sie dem häufigen Waschen standhalten<br />
können.<br />
Die Zusammenarbeit mit der Industrie<br />
schafft auch die Basis für ein Netzwerk aus<br />
Wissenschaft, Wirtschaft und allen Beteiligten<br />
entlang der Wertschöpfungskette. Mit im Projektteam<br />
von Judith Deriu sind zum Beispiel<br />
die Textildrucker Buntwerk aus Vorarlberg,<br />
Kelheim Fibres, der weltweit führende Hersteller<br />
von Viskose-Spezialfasern, Sun Chemical,<br />
der wichtigste Hersteller von Druckfarben,<br />
und das Verpackungszentrum Graz, der österreichische<br />
Spezialist für ökologische Verpackungen.<br />
„Um wirklich eine Kreislaufwirtschaft<br />
in der Textil- und Druckindustrie zu<br />
etablieren, müssen alle Beteiligten zusammenarbeiten:<br />
Wissenschaft, Industrie und Konsument:innen.<br />
Meine <strong>Forschung</strong> ist ein kleines<br />
Puzzleteilchen in diesem gemeinsamen Bemühen“,<br />
sagt Judith Deriu. <br />
cf<br />
JUDITH DERIU (*1986)<br />
wurde in der Schweiz geboren<br />
und hat in Amsterdam Biomedizin<br />
und Pharmazeutische<br />
Toxikologie studiert. 2016 kam<br />
sie für ein Doktoratsstudium<br />
an das <strong>Forschung</strong>sinstitut für<br />
Textilchemie und Textilphysik<br />
der Universität Inns bruck und<br />
forscht hier seit der Promotion<br />
als Postdoc. Sie ist Leiterin<br />
eines FFG-Projekts zu Pflanzenpigmenten<br />
als nachhaltige<br />
und biologisch abbaubare<br />
Farbmittel zur Kolorierung von<br />
Textil und Papier (PiColor).<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/23 35
SOZIALWISSENSCHAFT<br />
OPEN SCIENCE: Felix Holzmeister forscht unter anderem zur Wiederholbarkeit wissenschaftlicher Studien.<br />
OFFENHEIT FÜR<br />
MEHR VERTRAUEN<br />
Open Science setzt sich immer weiter durch – warum der dadurch angestoßene Kulturwandel im<br />
Wissenschaftsbetrieb dringend nötig ist, erklärt Ökonom Felix Holzmeister im Interview.<br />
Wie aussagekräftig sind wissenschaftliche<br />
Ergebnisse? Spätestens seit<br />
über 250 Forscher:innen 2015 in<br />
einer Publikation in „Science“ versucht haben,<br />
100 psychologische Experimente zu wiederholen,<br />
um deren Ergebnisse zu verifizieren,<br />
ist das Thema der Replizierbarkeit sozialwissenschaftlicher<br />
Studien breit auf dem Tapet.<br />
Das Ergebnis war nämlich ernüchternd: Nur<br />
36 Prozent der wiederholten Studien erzielten<br />
signifikante Ergebnisse (im Gegensatz<br />
zu 97 Prozent der Originalstudien). Felix<br />
Holzmeister, Ökonom am Institut für Wirtschaftstheorie,<br />
-politik und -geschichte, forscht<br />
zu Replizierbarkeit von wissenschaftlichen Ergebnissen<br />
und erklärt im Interview, warum<br />
Transparenz und Offenheit die Hauptzutaten<br />
für vertrauenswürdige Wissenschaft sind.<br />
ZUKUNFT: Hat sich das Vertrauen in Wissenschaft<br />
als gesamtes in Ihren Augen in<br />
den vergangenen Jahren geändert?<br />
FELIX HOLZMEISTER: Durch groß angelegte<br />
Replikationsstudien und empirische<br />
Belege, die zeigen, dass in der Wissenschaft<br />
so manches falsch laufen kann,<br />
hat sich vermehrt ein Bewusstsein dafür<br />
entwickelt, dass es Probleme gibt, die es<br />
zu adressieren gilt, wenn man Vertrauen<br />
in wissenschaftliche Resultate haben<br />
will. Die Wissenschaft war sich dessen<br />
seit jeher bewusst, aber viele Probleme<br />
wurden schlichtweg verdrängt. Angestoßen<br />
durch empirische Belege, etwa<br />
die Replikationen von 100 Ergebnissen in<br />
der Psychologie, hat sich ein breiter Diskurs<br />
ergeben, um Wege zu finden, wie<br />
man die Situation verbessern kann. Seit<br />
der 2015 erschienenen Studie wurde die<br />
Replizierbarkeit von wissenschaftlichen<br />
Ergebnissen in diversen Fachbereichen<br />
durch systematische Wiederholung von<br />
Studien untersucht. Die Conclusio ist<br />
immer ähnlich: Im Durchschnitt liegt die<br />
Replikationsrate bei circa 50 Prozent – das<br />
entspricht einem Münzwurf. Eine Studie<br />
zu lesen und das Gefühl zu haben, das<br />
Ergebnis eines Münzwurfs entscheidet,<br />
ob dem Resultat vertraut werden kann<br />
und ob es sich bestätigen ließe, wenn die<br />
Studie eins zu eins wiederholt würde, ist,<br />
glaube ich, nicht das, was sich Menschen<br />
unter valider, vertrauenswürdiger <strong>Forschung</strong><br />
vorstellen. Und genau deshalb<br />
gilt es, Replikationsraten zu erhöhen.<br />
36<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/23<br />
Fotos: Andreas Friedle
SOZIALWISSENSCHAFT<br />
FELIX HOLZMEISTER ist Assistenzprofessor<br />
für Experimentelle Verhaltensökonomik<br />
am Institut für Wirtschaftstheorie,<br />
-politik und -geschichte der Universität<br />
Inns bruck. Nach seiner Promotion 2018<br />
in Inns bruck war er für zwei Jahre als<br />
Postdoc am Spezialforschungsbereich<br />
Credence Goods, Incentives and Behavior<br />
tätig. Im Zentrum seiner <strong>Forschung</strong> stehen<br />
zum einen die Entscheidungsfindung<br />
unter Risiko sowie Märkte für Vertrauensgüter<br />
und zum anderen die Replizierbarkeit<br />
wissenschaftlicher Ergebnisse in den<br />
Verhaltenswissenschaften, Erkenntnistheorie<br />
und Open Science.<br />
ZUKUNFT: Woran liegt das?<br />
HOLZMEISTER: Die Ursachen sind sehr<br />
vielfältig. Einerseits liegt es an statistischen<br />
Grundkonzepten, die verwendet<br />
werden – die frequentistische Statistik<br />
definiert Fehlerraten, die toleriert werden<br />
müssen. Ein weiterer Aspekt ist<br />
Heterogenität: Die Variation über Stichproben,<br />
Studiendesigns und analytische<br />
Methoden hinweg bringt Unsicherheit<br />
mit sich, die häufig ignoriert wird. Diese<br />
Faktoren wirken sich unmittelbar auf<br />
Replikationsraten aus. Ein mindestens<br />
ebenso großes Problem sind aber alle<br />
Arten von fragwürdigen wissenschaftlichen<br />
Praktiken bis hin zu Betrug. Erst<br />
kürzlich war Francesca Gino, eine Professorin<br />
der Harvard Business School,<br />
breit in den Medien: Gino wird vorgeworfen,<br />
systematisch Daten manipuliert<br />
zu haben, um die Ergebnisse zu erzielen,<br />
die man eben gerne hätte und die entsprechend<br />
leichter zu publizieren sind.<br />
Alldem zugrunde liegt das Anreizsystem<br />
in der Wissenschaft: Wir haben es mit einem<br />
sehr stark wettbewerbsgetriebenen<br />
System zu tun, in dem sich alles um Impactfaktoren,<br />
Journalrankings, Zitationszahlen<br />
etc. dreht. Wissenschaftler:innen<br />
arbeiten unter dem Druck, immer das<br />
„Bestmögliche“ aus Studien herauszuholen,<br />
um <strong>Forschung</strong>sgelder zu lukrieren,<br />
auf eine Professur berufen zu werden<br />
etc. Das Problem dabei ist: Es gibt viele,<br />
viele Möglichkeiten, den Prozess vom<br />
Studiendesign bis zum letztendlichen Ergebnis<br />
zu schönen und zu beeinflussen.<br />
Zum Beispiel, indem man 100 verschiedene<br />
Tests durchführt, aber nur den Vorteilhaftesten<br />
publiziert und die anderen<br />
99 Ergebnisse unerwähnt lässt. Die Literatur<br />
besteht zu rund 90 Prozent aus signifikanten<br />
Ergebnissen. Nullergebnisse<br />
werden kaum publiziert. Daraus ergibt<br />
sich ein verzerrtes Bild in der Literatur<br />
und das wirkt sich auch unmittelbar auf<br />
die Replizierbarkeit aus. Das Bestmögliche<br />
ist vor dem Hintergrund des Anreizsystems<br />
leider nicht immer das richtige,<br />
sondern viel mehr das überzeugendste,<br />
überraschendste oder signifikanteste Ergebnis.<br />
ZUKUNFT: Wie lässt sich das beheben? Das<br />
klingt danach, als wäre ein Systemwandel<br />
nötig.<br />
HOLZMEISTER: Ja, und der ist zu einem<br />
großen Teil schon angestoßen. In den<br />
vergangenen Jahren hat sich eine große<br />
Community im Bereich Open Science<br />
etabliert, die stark für Transparenz und<br />
Offenheit plädiert, um den gesamten <strong>Forschung</strong>sprozess<br />
für andere nachvollziehbar<br />
zu machen. Dabei werden alle Daten<br />
und Materialien offen zur Verfügung<br />
gestellt und damit auch nachnutzbar<br />
gemacht. Ein weiterer zentraler Aspekt<br />
des Systemwandels ist der Weg hin zu<br />
Confirmatory Research Practices: Die Idee<br />
dahinter ist, dass man den gesamten <strong>Forschung</strong>sprozess<br />
– von Hypothesen und<br />
dem Studiendesign bis hin zu Datenerhebung<br />
und Analyse – festhält und vor<br />
der Durchführung der Studie in einem<br />
öffentlich zugänglichen Repositorium<br />
ablegt. Diese Präregistrierung wird mit<br />
einem Zeitstempel versehen und ist ab<br />
dem Zeitpunkt der Ablage unveränderbar.<br />
So ist nachvollziehbar, was im Vorfeld<br />
geplant war und was im Nachgang<br />
tatsächlich passiert ist. Einen Schritt<br />
weiter gehen sogenannte Registered Reports:<br />
Dabei wird eine Präregistrierung<br />
bei einem Journal eingereicht und begutachtet.<br />
Bei einem positiven Ergebnis des<br />
Reviewprozesses erfolgt dann eine vorläufige<br />
Publikationszusage. Erst im Anschluss<br />
werden die Daten erhoben und<br />
wie geplant analysiert. Abschließend<br />
erfolgt eine Prüfung, ob die Präregistrierung<br />
eingehalten wurde bzw. Abweichungen<br />
transparent dargestellt werden.<br />
Damit entfernt man auch den Anreiz, signifikante<br />
Ergebnisse zu generieren, weil<br />
man den Publikationserfolg schon in der<br />
Tasche hat, unabhängig davon, was die<br />
Daten dann tatsächlich aufzeigen. Die<br />
Qualität von <strong>Forschung</strong> wird also anhand<br />
der Methodik gemessen und nicht<br />
an den Ergebnissen.<br />
ZUKUNFT: Wird dieses Format schon breiter<br />
angewandt?<br />
HOLZMEISTER: Es wird immer mehr. Die<br />
Präregistrierung hat sich mittlerweile in<br />
weiten Teilen der Sozialwissenschaften<br />
schon als Standard etabliert, da es kein<br />
unmittelbares Mitwirken von Journalen<br />
erfordert. Das ist ein beeindruckender<br />
Wandel, weil es innerhalb von sehr kurzer<br />
Zeit passiert ist – in weniger als zehn<br />
Jahren hat es einen deutlichen Umbruch<br />
in den Standards und in der Publikationskultur<br />
gegeben. Das Format der Registered<br />
Reports gibt es auch immer häufiger,<br />
aber das Angebot ist noch sehr stark<br />
von der Disziplin abhängig. Im Bereich<br />
der Psychologie gibt es mittlerweile zum<br />
Beispiel viele Journale, die Registered-Report-Tracks<br />
anbieten, in den Wirtschaftswissenschaften<br />
ist die Nachfrage klar gewachsen<br />
– vieles ist im Entstehen.<br />
ZUKUNFT: Sie tragen auch selbst zu diesem<br />
Kulturwandel bei und schulen junge<br />
Wissenschaftler:innen im Rahmen einer<br />
Summer School.<br />
HOLZMEISTER: Ich versuche meinen Teil<br />
dazu beizutragen, weil ich der Überzeugung<br />
bin, dass es ein Umdenken braucht.<br />
Leider ist Open Science bislang noch in relativ<br />
wenigen Studienplänen vertreten.<br />
Eine Summer School, die sich mit diesem<br />
Thema beschäftigt, erschien daher ein<br />
wünschenswertes Format zu sein. In erster<br />
Linie geht es darum, ein Bewusstsein<br />
für die Problematik und eine Akzeptanz<br />
von Lösungsansätzen zu schaffen. Das<br />
Format richtet sich primär an Nachwuchswissenschaftler:innen<br />
am Anfang ihrer<br />
Karriere. Bei der jungen Generation anzusetzen,<br />
ist der erfolgversprechendste Weg,<br />
um systematisch und nachhaltig ein Umdenken<br />
zu bewirken. Die Summer School<br />
wurde im vergangenen Sommer erstmals<br />
angeboten und war ausgebucht. Die<br />
Nachfrage für das Format zeigt eine Bereitschaft<br />
für einen Systemwandel – das<br />
ist eine erfreuliche Grundlage. Im Sommer<br />
2<strong>02</strong>4 startet die zweite Auflage. sh<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/23 37
WISSENSTRANSFER<br />
DER 3D-DRUCK ermöglicht die Herstellung<br />
komplexer Strukturen in einem<br />
einzigen Prozessschritt. Lorenz Fuchs und<br />
Valerie Goettgens geben ihr Wissen dazu<br />
an Unternehmen weiter: „Gemeinsam<br />
wollen wir neue Methoden entwickeln,<br />
um Produkte mit 3D-Druck effizienter<br />
herzustellen. Diese Techniken wollen wir<br />
dann an die Unternehmen weitergeben,<br />
um ihnen ein nachhaltiges Wachstum zu<br />
ermöglichen.“<br />
3D-DRUCK FÜR ALLE<br />
<strong>Zukunft</strong>sweisende Technologie auch für kleine und mittelständische Unternehmen:<br />
länderübergreifendes Kompetenzzentrum für additive Fertigungsverfahren.<br />
Eine Vielzahl von Innovationen hat<br />
die Industrie in den vergangenen<br />
Jahrzehnten stetig verändert. Doch<br />
nur wenige Technologien haben das Potenzial,<br />
die Grundlagen der Produktion<br />
so tiefgreifend zu transformieren wie die<br />
additiven Verfahren, besser bekannt als<br />
3D-Druck. Diese Technologie ermöglicht<br />
die Herstellung komplexer Strukturen in<br />
einem einzigen Prozessschritt, von individuellen<br />
Prototypen bis zum maßgeschneiderten<br />
Endprodukt. An der Universität<br />
Inns bruck beschäftigt sich die Arbeitsgruppe<br />
Werkstoffwissenschaften rund<br />
um Gerhard Leichtfried mit der additiven<br />
Fertigung von Metallen und Legierungen.<br />
Der Industrieforscher kam 2015 vom Tiroler<br />
Weltmarktführer Plansee an die<br />
Universität Inns bruck. Der Fokus seines<br />
Teams liegt auf der Legierungsentwicklung<br />
und einem tiefen Materialverständnis<br />
bis auf die atomare Ebene.<br />
Ein besonderes Anliegen des Teams<br />
am Institut für Mechatronik ist es, die gewonnenen<br />
Erkenntnisse für den Einsatz<br />
in der Industrie aufzubereiten und das<br />
Know-how auch kleinen und mittleren<br />
Unternehmen zur Verfügung zu stellen.<br />
Gemeinsam mit fünf weiteren <strong>Forschung</strong>seinrichtungen<br />
in Österreich und Bayern<br />
haben die Wissenschaftler:innen nun ein<br />
grenzüberschreitendes Kompetenzzentrum<br />
gegründet, das auch kleinere Unternehmen<br />
bei der additiven Fertigung von<br />
Metallen und Legierungen unterstützt.<br />
Die Universitäten und Fachhochschulen<br />
in Rosenheim, Landshut, Passau, Wels,<br />
Salzburg und Inns bruck haben unterschiedliche<br />
Schwerpunkte und können<br />
so interessierten Unternehmen ein breites<br />
Spektrum an Wissen und Ressourcen zur<br />
Verfügung stellen. Das Netzwerk wird von<br />
der Europäischen Union im Rahmen des<br />
Interreg-Programms finanziell unterstützt.<br />
Zugang zu Know-how<br />
Die am Projekt beteiligten Unternehmen<br />
sind teilweise bereits in der additiven Fertigung<br />
tätig und werden von den Partnern<br />
bei der Entwicklung innovativer Bauteile<br />
unterstützt, in anderen Fällen erleichtert<br />
das Netzwerk den Unternehmen den Einstieg<br />
in die Technologie. „Mit neuen Bauweisen,<br />
die weniger Material verbrauchen,<br />
können wir die Entwicklung hin zu mehr<br />
Nachhaltigkeit in Verkehr, Maschinenbau<br />
und Energie unterstützen“, sagt Valerie<br />
Goettgens vom Inns brucker Team. „Der<br />
3D-Druck macht die Produktion flexibler<br />
und umweltfreundlicher. Leider können<br />
viele kleinere Unternehmen diese Technologie<br />
noch nicht voll nutzen, weil ihnen<br />
entweder die Ressourcen oder das Wissen<br />
fehlen. Unser Ziel ist es, gerade kleinen<br />
und mittleren Unternehmen in der bayerisch-österreichischen<br />
Grenzregion zu helfen,<br />
diese Technologie für sich zu nutzen<br />
oder ihre eigenen Techniken und Produkte<br />
zu verbessern.“ Gemeinsam mit den Partnern<br />
baut das Team um Leichtfried und<br />
Goettgens ein Kompetenzzentrum auf, in<br />
dem Expertinnen und Experten ihr Wissen<br />
austauschen und gemeinsam an neuen<br />
Projekten arbeiten. „So können die Unternehmen<br />
von den neuesten <strong>Forschung</strong>sergebnissen<br />
profitieren“, sind die Wissenschaftler:innen<br />
überzeugt. <br />
Mehr Informationen zu dem grenzüberschreitenden<br />
Kompetenzzentrum und dem<br />
Projekt ReBi finden sie hier:<br />
38 zukunft forschung <strong>02</strong>/23<br />
Fotos: Bernd Linke Photography(1), Universität Inns bruck (1)
WISSENSTRANSFER<br />
STIFTUNGSPROFESSUR<br />
FÜR EISENBAHNBAU<br />
Der neue <strong>Forschung</strong>sbereich Eisenbahnbau und -betrieb wird sich<br />
auf die Themen Oberbau und Fahrweg konzentrieren.<br />
Als innovatives Unternehmen ist es<br />
uns ein Herzensanliegen, Ausbildung<br />
und <strong>Forschung</strong> im Bereich<br />
Eisenbahnwesen in Westösterreich zu<br />
sichern, um unserem hohen Anspruch<br />
auch in <strong>Zukunft</strong> gerecht zu werden“, sagt<br />
Thomas Gamsjäger, Leiter des Geschäftsbereichs<br />
Bahn der Getzner Werkstoffe<br />
GmbH. Der Vorarlberger Hersteller von<br />
Lösungen zur Schwingungsisolierung<br />
und zum Erschütterungsschutz ist spezialisiert<br />
in den Bereichen Bahn, Bau und<br />
Industrie und entwickelt hierfür zukunftsweisende<br />
Polyurethan-Werkstoffe wie Sylomer®,<br />
Sylodyn® oder Sylodamp®. Als<br />
weltweit führender Spezialist auf dem Gebiet<br />
wird das Unternehmen in den nächsten<br />
fünf Jahren insgesamt knapp 700.000<br />
Euro für die Stiftungsprofessur Eisenbahnbau<br />
und -betrieb an der Universität<br />
Inns bruck zur Verfügung stellen.<br />
„An der Universität Inns bruck wurde<br />
über Jahrzehnte eine herausragende<br />
Kompetenz in der Bewertung und Optimierung<br />
des Gleisoberbaus und seiner<br />
Komponenten aufgebaut. Durch die Stiftung<br />
der Firma Getzner wird es möglich,<br />
diese gemeinsam weiterzuentwickeln<br />
und für unsere Studierenden weiterhin<br />
eine forschungsgeleitete Lehre im zukunftsträchtigen<br />
Eisenbahnwesen sicherzustellen“,<br />
betont Rektorin Veronika Sexl.<br />
Mit dem Schwerpunkt im Bereich Oberbau<br />
und Fahrweg ergänzt sich die Professur<br />
an der Universität Inns bruck mit den<br />
<strong>Forschung</strong>sgruppen an den Universitäten<br />
in Graz und Wien. „Mit Harald Loy<br />
konnten wir einen ausgewiesenen Experten<br />
auf dem Gebiet des Eisenbahnwesens<br />
gewinnen, der über langjährige Erfahrung<br />
in der Industrie verfügt und die<br />
Universität sowie Getzner Werkstoffe<br />
sehr gut kennt“, freut sich Sexl. Loy wird<br />
auch einen Schwerpunkt im Bereich<br />
Nachhaltigkeit setzen, um die Bahn als<br />
„grüne“ Alternative für die Mobilität der<br />
<strong>Zukunft</strong> zu positionieren. <br />
HARALD LOY wird einen Schwerpunkt auf<br />
den Bereich Nachhaltigkeit setzen.<br />
REKTORIN Veronika Sexl und Sabine Herlitschka,<br />
Vorstandsvorsitzende der Infineon<br />
Technologies Austria AG.<br />
PARTNERSCHAFT MIT<br />
INFINEON TECHNOLOGIES<br />
Infineon Austria und die Universität<br />
Inns bruck kooperieren bereits seit rund<br />
zehn Jahren. Die Zusammenarbeit in der<br />
Leistungselektronik und der Quantenforschung<br />
wird nun weiter ausgebaut. Im Juli<br />
haben Rektorin Veronika Sexl und Sabine<br />
Herlitschka, Vorstandsvorsitzende der<br />
Infineon Technologies Austria AG, einen<br />
strategischen Kooperationsvertrag unterzeichnet.<br />
Im Fokus stehen <strong>Forschung</strong>en an<br />
Schlüsseltechnologien für die grüne und<br />
digitale Transformation oder den Life-Science-Bereich,<br />
etwa für die Medizintechnik.<br />
Im September eröffnete Infineon ein neues<br />
System-Kompetenzzentrum in Inns bruck.<br />
Es entwickelt erste Referenz-Systeme etwa<br />
für die Elektromobilität, Life Science, erneuerbare<br />
Energien oder die Robotik, um<br />
innovative Anwendungen noch schneller<br />
zur Marktreife und damit zu den Endkunden<br />
zu bringen. Angesiedelt in der<br />
Südbahnstraße im Zentrum von Inns bruck<br />
dienen die Räumlichkeiten auch als Vernetzungsplattform<br />
mit Bildungspartnern und<br />
Studierenden.<br />
ANTENNEN IN ALLEN FORMEN<br />
Unsere Welt wird von Jahr zu Jahr stärker vernetzt und digitalisiert. Neue Funktechnologien<br />
ermöglichen neue Anwendungen. Für im Funksektor unerfahrene Unternehmen<br />
stellt die Integration eines Funksystems mitsamt Antenne in bestehende Produkte eine<br />
große Herausforderung dar. Besonders die Antenne muss für jedes Produkt individuell entwickelt<br />
werden. Am Institut für Mechatronik hat Dominik Mair eine Software für Antennendesign<br />
entwickelt, mit der Antennen für verschiedenste Produkte optimiert werden können.<br />
Die inzwischen patentierte Technologie ermöglicht auch den Einbau in sehr anspruchsvolle<br />
Materialien wie Beton. Demnächst soll ein Spin-off-Unternehmen gegründet werden. Ziel<br />
ist die Entwicklung eines kommerziellen Sensors, der ohne Batterie und Kabel in Beton<br />
verbaut werden kann. Aktuell arbeitet Dominik Mair gemeinsam mit Michael Renzler daran,<br />
die Langzeitstabilität dieser Sensoren zu überprüfen.<br />
Fotos: Universität Inns bruck (2), Infineon (1)<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/23 39
WISSENSTRANSFER<br />
INNCUBATOR BAUT<br />
IOT LAB AUS<br />
Mit dem IoT Lab betreibt der InnCubator ein Leuchtturmprojekt im Bereich Digitalisierung. Durch eine<br />
Förderung des Landes Tirol kann dieses Labor für das „Internet der Dinge“ nun ausgebaut werden.<br />
EIN VOLL AUSGESTATTETES Elektroniklabor und Rapid-Prototyping-Maschinen stehen in <strong>Zukunft</strong> zur Verfügung.<br />
Der InnCubator ist das Gründer- und<br />
Innovationszentrum von Universität<br />
Inns bruck und Wirtschaftskammer<br />
Tirol. Er sieht sich selbst als Spielwiese<br />
für Geschäfts- und Produktideen. Es geht<br />
darum, schnell die erste Version einer Idee<br />
zu entwerfen, diese direkt bei der Kundschaft<br />
zu testen und das Potenzial zu bewerten.<br />
Projekte im Bereich „Internet der Dinge“<br />
(IoT) werden vom InnCubator seit<br />
einigen Jahren speziell unterstützt. Bereits<br />
2<strong>02</strong>0 wurde mit Hilfe des Förderkreises<br />
1669 der Universität Inns bruck<br />
eine kleine Werkstatt aufgebaut – das<br />
IoT Lab. Nach einer erfolgreichen Pilotphase<br />
wird dieses nun mit Mitteln<br />
aus der Leuchtturmförderung für Digitalisierung<br />
des Landes Tirol wesentlich<br />
ausgebaut. „In <strong>Zukunft</strong> wird es<br />
im InnCubator ein voll ausgestattetes<br />
Elektroniklabor und Rapid-Prototyping-<br />
Maschinen sowie ein Serviceangebot geben“,<br />
berichtet Geschäftsführer Robert<br />
Schimpf.<br />
Das Internet der Dinge gilt als Schlüsseltechnologie<br />
der Digitalisierung und<br />
ermöglicht die Vernetzung von Alltagsgegenständen<br />
bis hin zu industriellen<br />
Maschinen über das Internet. Diese Technologie<br />
bietet enorme Potenziale zur Effizienzsteigerung,<br />
Digitalisierung von Geschäftsmodellen<br />
und Innovation. „Gute<br />
Ideen basieren häufig auf ungewöhnlichen<br />
Kombinationen neuer technologischer Errungenschaften“,<br />
sagt Gregor Weihs, Vizerektor<br />
für <strong>Forschung</strong> der Universität Innsbruck.<br />
„Wir wollen die Teilnehmer:innen<br />
anregen, neue Technologien auszuprobieren.<br />
So entwickeln sich kreative Lösungen<br />
und Prototypen für neue Produkte, Prozesse<br />
oder gar Geschäftsideen.“<br />
Entsprechend wird in Zusammenarbeit<br />
mit der Arbeitsgruppe für Mikroelektronik<br />
der Universität Inns bruck ab dem<br />
Frühjahr 2<strong>02</strong>4 auch eine Hands-on-Fortbildung<br />
angeboten, um Mitarbeiter:innen<br />
von Klein- und Mittelbetrieben und sonstige<br />
Interessierte in den Schlüsseltechnologien<br />
der Digitalisierung zu schulen und<br />
im Anschluss konkrete Projekte für das<br />
Unternehmen, begleitet von Expert:innen,<br />
umzusetzen.<br />
Der InnCubator ist auch Teil der Transferstelle<br />
Wissenschaft – Wirtschaft – Gesellschaft<br />
und formt gemeinsam mit seinen<br />
Partnern eine schlagkräftige Einheit,<br />
um das Thema IoT in Tirol bekannter zu<br />
machen und aktiv voranzutreiben. Als Innovationszentrum<br />
unterstützt der InnCubator<br />
den Austausch zwischen Gründungsinteressierten,<br />
Startups und KMU.<br />
Mit dem IoT Lab kann ein umfangreiches<br />
Angebot bereitgestellt werden, welches<br />
die Unterstützung im Prototypenbau auf<br />
konventionellen Maschinen im Holz- und<br />
Metallbereich von InnCubator und WIFI<br />
Tirol ergänzt. <br />
INNCUBATOR<br />
www.inncubator.at<br />
info@inncubator.at<br />
+43-590-905-7800<br />
Egger-Lienz-Straße 116, Inns bruck<br />
40<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/23<br />
Foto: InnCubator
KURZMELDUNGEN<br />
FRÜHWARNSYSTEM<br />
FÜRS KLIMA<br />
Gletscherwände in Grönland geben Hinweise<br />
auf den Wandel des arktischen Klimas.<br />
Es gibt nur wenige Orte weltweit, an<br />
denen Gletscher an Land in Form<br />
eines Eiskliffs enden. An Land müssen<br />
ganz bestimmte Bedingungen existieren,<br />
um langfristig stabile Eismauern hervorzubringen.<br />
Der überwiegende Teil<br />
läuft in flacher werdenden Gletscherzungen<br />
aus, die beispielsweise auch für die<br />
Alpen typisch sind. Nur am Gipfel des<br />
Kilimandscharo, in den Trockentälern der<br />
Antarktis sowie in Nordwestgrönland<br />
und der kanadischen Arktis gibt es diese<br />
raren Eiskliffe an Land. Die Gletscherforscher<br />
Rainer Prinz von der Universität<br />
Inns bruck und Jakob Abermann von der<br />
Universität Graz wollen in einem vom<br />
Wissenschaftsfonds FWF finanzierten und<br />
vor Kurzem gestarteten Projekt die Eiswände<br />
in Grönland näher untersuchen.<br />
Ihr Ziel sind die bis zu 25 Meter hohen<br />
Red Rock Icecliffs, die Teil der Nunatarssuaq-Eiskappe<br />
im nördlichen Landesteil<br />
Avanersuaq sind. Die Wissenschaftler<br />
wollen die Formationen, die besonders<br />
sensibel auf die Veränderung von Umweltfaktoren<br />
reagieren, als Instrument benutzen,<br />
um das lokale grönländische Klima<br />
im Kontext der globalen Erderwärmung<br />
besser zu verstehen. „Veränderte<br />
Klimasignale wirken sich sehr schnell auf<br />
das Gleichgewicht der Gletscher aus“, erklärt<br />
Prinz. „Wenn wir verstehen, in welcher<br />
Weise das Eis auf Veränderungen der<br />
Umweltfaktoren reagiert, können wir<br />
Rückschlüsse auf eine aktuelle Entwicklung<br />
des lokalen Klimas ziehen.“<br />
WECHSELWIRKENDE<br />
QUASITEILCHEN<br />
Bewegt sich ein Elektron durch einen Festkörper,<br />
erzeugt es aufgrund seiner elektrischen<br />
Ladung in der Umgebung eine Polarisation.<br />
Der russische Physiker Lew etcLandau<br />
hat in seinen theoretischen Überlegungen<br />
die Beschreibung solcher Teilchen um deren<br />
Wechselwirkung mit der Umgebung erweitert<br />
und von Quasiteilchen gesprochen. Vor über<br />
zehn Jahren war es dem Team um Rudolf<br />
Grimm vom Institut für Experimentalphysik<br />
der Universität Inns bruck und vom Institut<br />
für Quantenoptik und Quanteninformation<br />
(IQQOI) der Österreichischen Akademie der<br />
Wissenschaften erstmals gelungen, solche<br />
Quasiteilchen in einem Quantengas sowohl<br />
bei attraktiver als auch repulsiver Wechselwirkung<br />
mit der Umgebung zu erzeugen.<br />
Dazu nutzen die Wissenschaftler:innen ein<br />
ultrakaltes Quantengas aus Lithium- und<br />
Kaliumatomen in einer Vakuumkammer. Mit<br />
Hilfe von magnetischen Feldern kontrollieren<br />
sie die Wechselwirkungen zwischen den Teilchen<br />
und mit Hochfrequenzpulsen drängen<br />
sie die Kaliumatome in einen Zustand, in dem<br />
diese die sie umgebenden Lithiumatome<br />
anziehen oder abstoßen. So simulieren die<br />
Forscher:innen einen komplexen Zustand,<br />
wie er im Festkörper durch ein freies Elektron<br />
erzeugt wird. Nun konnten die Forscher:innen<br />
um Grimm in dem Quantengas mehrere<br />
solche Quasiteilchen gleichzeitig erzeugen<br />
und deren Wechselwirkung untereinander<br />
beobachten.<br />
BIOMARKER FÜR ALTERSBEDINGTE KRANKHEITEN<br />
Objektive biologische Messwerte können helfen, den Alterungsprozess in individuellen Personen<br />
zu messen und das Risiko für altersbedingte Erkrankungen zu identifizieren. Da sich das Altern<br />
jedoch aus vielen verschiedenen Prozessen zusammensetzt, gab es bislang keine Übereinstimmung<br />
unter Expert:innen, wie solche Biomarker am besten zur Anwendung kommen könnten. Ein internationales<br />
Team um Chiara Herzog (im Bild) hat nun weltweit bestehende Rahmenstrukturen zur<br />
Biomarker-Erfassung systematisch angepasst und erweitert, um „Biomarker des Alterns“ und deren<br />
klinische Anwendungen zu definieren. Publiziert haben sie diese in der renommierten Fachzeitschrift<br />
Cell. „Die Alternsforschung hat das Potenzial, uns länger und gesünder leben zu lassen“,<br />
sagt Herzog. „Wir haben in dieser Arbeit erstmals eine Übereinstimmung zwischen internationalen<br />
Expert:innen herbeigeführt, wie wir Biomarker des Alterns untersuchen können.“<br />
Fotos: Rainer Prinz (1), Harald Ritsch(1), Patrick Saringer (1)<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/23 41
RECHTSWISSENSCHAFT<br />
IM PROJEKT REGROUP werden Handlungsempfehlungen erarbeitet, wie politische Prozesse fit für die <strong>Zukunft</strong> gemacht werden können.<br />
DIGITALES UPDATE<br />
Die COVID-19-Pandemie war für Europa nicht nur eine Gesundheitskrise, sie verursachte auch<br />
juristische und politische Krisen. Wie Europas Gesellschaften nach der Pandemie resilienter werden<br />
können, untersucht – mit Inns brucker Beteiligung – das EU-Projekt REGROUP.<br />
Am Montag, dem 24. Februar 2<strong>02</strong>0,<br />
wandten sich eine 24-jährige Italienerin<br />
und ihr Freund an die<br />
Leitstelle Tirol: Sie seien am Freitag aus<br />
der Lombardei nach Inns bruck zurückgekehrt,<br />
am Wochenende hätten sie erhöhte<br />
Temperatur gehabt, dazu gekommen<br />
seien auch Lungen- und Halsschmerzen.<br />
Am Dienstag, dem 25., herrschte nach<br />
Tests Gewissheit: Das Corona-Virus hatte<br />
auch Österreich erreicht.<br />
Zwei Wochen später wurde als erste<br />
Schutzmaßnahme Passagierflugzeugen<br />
aus bestimmten Regionen die Landung<br />
in Österreich verboten. Danach ging es<br />
Schlag auf Schlag – Absage von Veranstaltungen,<br />
Schul-, Universitäts- und Geschäftsschließungen,<br />
Ausgangsverbote …<br />
Dem ersten bundesweiten Lockdown vom<br />
16. März 2<strong>02</strong>0 folgten drei weitere, der<br />
letzte, 2<strong>02</strong>1, galt für Ungeimpfte länger als<br />
für Geimpfte und Genesene.<br />
So wie in Österreich brachte die CO-<br />
VID-19-Pandemie nicht nur das öffentliche<br />
Gesundheitssystem an den Rande<br />
des Zusammenbruchs und die Wirtschaft<br />
teilweise zum Erliegen, sondern<br />
sie verursachte auch massive rechtliche<br />
und politische Spannungen. „Corona<br />
hat uns vor Augen geführt, dass in<br />
unseren technologischen Gesellschaften<br />
immer noch große Herausforderungen<br />
bestehen, wenn es zu Krisen kommt“,<br />
sagt Matthias Kettemann, Professor für<br />
Theorie und <strong>Zukunft</strong> des Rechts an der<br />
Universität Inns bruck. So stellen Krisen<br />
Gesellschaften vor das Problem, wie Entscheidungen<br />
zu treffen und zu legitimieren<br />
sind. Ein „normales“ Gesetzgebungsverfahren<br />
– Vorschlag, Begutachtung,<br />
Diskussion, Beschluss – ist etwa ob des<br />
Zeitdrucks nicht oder nur schwer möglich.<br />
„Krisen machen aber auch deutlich,<br />
dass in unserer heutigen Gesellschaft die<br />
Kommunikation zwischen Bürger:innen<br />
und Parlament nicht optimal zu laufen<br />
scheint“, sagt Kettemann. Daher stelle<br />
sich die Frage, „wie wir resiliente demokratische<br />
Strukturen schaffen und politische<br />
Prozesse fit für die <strong>Zukunft</strong> machen<br />
können.“ Antworten darauf und daraus<br />
abgeleitete politische Handlungsempfehlungen<br />
will – mit Inns brucker Beteiligung<br />
– das EU-Projekt REGROUP geben,<br />
42 zukunft forschung <strong>02</strong>/23<br />
Fotos: Parlamentsdirektion / Thomas Topf (1), Andreas Friedle (2)
RECHTSWISSENSCHAFT<br />
MATTHIAS KETTEMANN: „Wir hinterfragen<br />
demokratische Strukturen auf<br />
produktive Art und Weise.“<br />
REGROUP steht für Rebuilding governance<br />
and resilience out of the pandemic<br />
– übersetzt in etwa „Wiederaufbau von<br />
Regierungsfähigkeit und Resilienz nach<br />
der Pandemie“. Das über das Programm<br />
Horizon Europe geförderte EU-Projekt<br />
vereint unter der Führung der Rijksuniversiteit<br />
Groningen (NL) 13 Partner aus elf<br />
Ländern, darunter das Institut für Theorie<br />
und <strong>Zukunft</strong> des Rechts an der Universität<br />
Inns bruck. Die Projektdauer von<br />
REGROUP beträgt drei Jahre, Projektstart<br />
war im September 2<strong>02</strong>2. Die gesamte<br />
Fördersumme für REGROUP beläuft sich<br />
auf rund drei Millionen Euro.<br />
Kettemann und seine Projektmitarbeiterin<br />
Caroline Böck konzentrieren sich in<br />
ihrem Arbeitspaket auf die Nutzung von<br />
digitalen Tools und Plattformen.<br />
„Der erste Teil von REGROUP war eine<br />
Art Bestandsaufnahme in mehreren Ländern“,<br />
berichtet Caroline Böck. Welche<br />
(verfassungs-)rechtlichen Maßnahmen<br />
wurden getroffen, wie kam es zu Entscheidungen,<br />
gab es Machtverschiebungen<br />
zwischen Regierung und Parlament? Dabei<br />
zeigte sich, so Böck, dass Parlamente<br />
aufgrund von Ausgangs- oder Versammlungsbestimmungen<br />
zeitweise gar nicht<br />
arbeitsfähig waren. „Online-Plenarsitzungen<br />
oder -Ausschüsse sind in den Verfassungen<br />
aber nicht vorgesehen“, erläutert<br />
Böck: „Im Fall einer erneuten Gesundheitskrise<br />
mit Ansteckungsgefahr wäre<br />
daher eine juristisch sattelfeste Adaption<br />
notwendig.“ Ein „digitales Update für bestehendes<br />
Recht“ nennt Kettemann daher<br />
einen ersten Schritt, der sicherstellen soll,<br />
dass zukünftige Rechtsetzungsprozesse<br />
digitaler und somit auch resilienter sind.<br />
In einem nächsten Schritt soll bei Entscheidungsfindungen<br />
die Rückbindung an die<br />
Gesellschaft verbessert werden.<br />
„Zu Beginn der Pandemie<br />
waren viele Parlamente gar<br />
nicht arbeitsfähig. Online-<br />
Plenarsitzungen oder Online-Ausschüsse<br />
sind in den<br />
Verfassungen nicht vorgesehen.“<br />
Caroline Böck, Institut für Theorie und <strong>Zukunft</strong> des Rechts<br />
Innovationspotenziale<br />
Neben der Analyse und dem Vergleich<br />
von konkreten Maßnahmen und Entscheidungsfindungen<br />
setzt man bei<br />
REGROUP daher auch auf sogenannte<br />
Mini-Publics, Versammlungen von 20<br />
bis 100 per Los ausgewählten Menschen,<br />
die, erklärt Kettemann, „über politische<br />
Sachverhalte informiert werden, gemeinsam<br />
darüber diskutieren, entscheiden<br />
und die Ergebnisse der Politik als Handlungsempfehlungen<br />
übergeben“. Im Fall<br />
von REGROUP wurde zum Beispiel in<br />
Mini-Publics in Paris, Hamburg, Utrecht,<br />
Florenz und Krakau sowie in einem<br />
transnationalen „Format“ über die Auswirkungen<br />
der COVID-19-Krise und den<br />
Einfluss von Fake News auf das politische<br />
Vertrauen diskutiert. Ziel waren Empfehlungen,<br />
wie Governance und politisches<br />
Vertrauen nach einer durch Fake News<br />
geprägten Pandemie effektiv und demokratisch<br />
verbessert werden können.<br />
„Mini-Publics – ob im echten oder virtuellen<br />
Raum – sind eine Art Demokratielabor,<br />
die es ermöglichen, spannende<br />
Fragen zu stellen“, sagt Kettemann.<br />
Ähnlich interessant sei das Modell der<br />
Beiräte, mit dem in mehreren Ländern –<br />
in Österreich etwa mit dem Klimabeirat<br />
– experimentiert wird, das aber auch auf<br />
digitalen Plattformen wie z. B. mit dem<br />
Oversight Board bei Facebook Anwendung<br />
findet. „Es gibt unterschiedliche<br />
Innovationswege für demokratische Prozesse“,<br />
sind sich Böck und Kettemann einig.<br />
„Unser heutiges Verständnis von repräsentativer<br />
Demokratie beruht auf Annahmen,<br />
die nicht mehr zutreffen“, sind<br />
die Forscher:innen überzeugt. Im Gegensatz<br />
zu früher, als etwa „Abgeordnete in<br />
der weit entfernten Hauptstadt nur mit<br />
großem Zeitaufwand mit den Wähler:innen<br />
zu Hause kommunizieren konnten,<br />
ist heute eine Kommunikation in Echtzeit<br />
möglich.“ Man müsse nur überlegen,<br />
wie. Demokratie-Apps oder die Möglichkeit,<br />
via Smartphone an Entscheidungen<br />
teilzuhaben, wären Modelle, die geprüft<br />
werden. Die Ergebnisse sollen als Policy<br />
Recommendations der EU und ihren Mitgliedstaaten<br />
helfen, digitale Werkzeuge<br />
und Strategien zu entwickeln, um zukünftige<br />
Risiken zu vermeiden bzw. zu<br />
mindern und die gesellschaftliche und<br />
demokratische Widerstandsfähigkeit im<br />
Post-Pandemie-Europa zu verbessern.<br />
„Wir hinterfragen demokratische<br />
Strukturen auf produktive Art und Weise.<br />
Wir haben heute so viele digitale<br />
Möglichkeiten der Kommunikation, mit<br />
denen die demokratische Rückbindung<br />
optimiert werden könnte“, halten Böck<br />
und Kettemann fest. Als Forscher:innen<br />
am 2019 gegründeten Institut für Theorie<br />
und <strong>Zukunft</strong> des Rechts sehen sie es als<br />
ihre Aufgabe, „heute an der Art und Weise,<br />
wie wir Entscheidungen treffen, zu<br />
arbeiten, damit auch nächste Generationen<br />
gute Entscheidungen treffen können<br />
und sich nicht von der Demokratie abwenden.“<br />
ah<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/23 43
NACHHALTIGE ENERGIEWENDE:<br />
REVITALISIERUNGEN DER TIWAG AM INN<br />
Die TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG setzt laufend ökologische Maßnahmen, um die Tiroler Gewässer zu<br />
verbessern – insbesondere am Inn, wie der Blick auf zwei aktuelle Beispiel-Projekte verdeutlicht.<br />
Der Inn weist in Tirol eine lange<br />
freie Fließstrecke auf, wurde aber<br />
im Laufe der Zeit in vielen Bereichen<br />
durch Landnutzung, Eisenbahnoder<br />
Autobahnbau eingeengt, begradigt<br />
und verbaut. Häufig hatte sich dadurch<br />
die Flusssohle eingetieft, ebenso trockneten<br />
viele Au-Bereiche aus – so auch im<br />
Flussabschnitt zwischen Stams und Rietz<br />
im Tiroler Oberland: Als eine der Ausgleichsmaßnahmen,<br />
die im Rahmen des<br />
Kraftwerk-Erweiterungsprojekts Kühtai<br />
durchgeführt werden, revitalisierte<br />
TIWAG zwischen Herbst 2<strong>02</strong>1 und Frühjahr<br />
2<strong>02</strong>3 den Inn in diesem Bereich.<br />
IN LANGKAMPFEN entstand ein über ein<br />
Kilometer langer Seitenarm. Foto: TIWAG/Droneproject<br />
DAS GEWÄSSERBETT DES INN zwischen Stams und Rietz wurde um bis zu 75 Meter aufgeweitet.<br />
<br />
Foto: TIWAG/Droneproject<br />
Vielfältige Lebensräume<br />
und seltene Vögel<br />
Auf einer Länge von rund drei Kilometern<br />
wurden abschnittsweise bestehende Ufersicherungen<br />
entfernt und das Gewässerbett<br />
um bis zu 75 Meter aufgeweitet. Dem<br />
Inn wird damit mehr Platz gegeben, um<br />
wieder eigendynamisch wirken und sich<br />
entwickeln zu können. So entstanden<br />
vielseitige Lebensräume für Gewässerund<br />
Landlebewesen durch Ruhig- und<br />
Flachwasserzonen, Seitenarme, Naturufer,<br />
Schotterflächen und Inseln. Raubäume,<br />
Fischunterstände, Totholz und Steine<br />
bieten Reptilien und Käfern neuen Unterschlupf.<br />
Auch der Zwergrohrkolben, eine<br />
früher für den Inn typische Pflanze, wurde<br />
im Zuge des Projekts wieder angesiedelt.<br />
„Besonders erfreulich und bezeichnend<br />
für die Bedeutung der umgesetzten<br />
Maßnahmen ist, dass sowohl Flussregenpfeifer<br />
als auch Flussuferläufer, zwei<br />
europaweit seltene Vogelarten, sich im<br />
Gebiet der Ausgleichsfläche angesiedelt<br />
haben und an den Uferflächen brüten“,<br />
erklärt TIWAG-Ökologe Martin Schletterer.<br />
Zudem gewährleistet die Dimension<br />
dieser Revitalisierung auch eine positive<br />
Wirkung auf flussauf- und flussabgelegene<br />
Abschnitte und stellt insbesondere in<br />
gewässerökologischer Hinsicht eine bedeutende<br />
Maßnahme als „Trittstein-Biotop“<br />
dar.<br />
Die Wasserbauarbeiten wurden im<br />
Mai 2<strong>02</strong>3 abgeschlossen. In den nächsten<br />
Monaten und Jahren stehen für die ÖkologInnen<br />
der TIWAG noch umfangreiche<br />
begleitende Arbeiten auf dem Programm:<br />
Neben der Bekämpfung von Neophyten<br />
muss sich die Vegetation entsprechend<br />
entwickeln, einige Flächen benötigen<br />
noch Pflege und Nachschau, die im Rahmen<br />
naturkundlicher und gewässerökologischer<br />
Monitoring-Programme erfolgen<br />
werden.<br />
Revitalisierung des<br />
Gießenbaches in Langkampfen<br />
Dass die Nutzung der heimischen Wasserkraft<br />
im Einklang mit der Natur funktioniert,<br />
beweist TIWAG auch in der<br />
Nähe des Laufkraftwerks Langkampfen,<br />
wo in der Niederwasserperiode 2<strong>02</strong>2/23<br />
eine rund drei Hektar große landwirtschaftlich<br />
genutzte Fläche – ebenfalls als<br />
Ausgleichsmaßnahme des Erweiterungsprojekts<br />
Kühtai – aufwendig revitalisiert<br />
wurde. Das Gelände wurde im betroffenen<br />
Bereich abgesenkt und im Mündungsbereich<br />
des Gießenbaches ein mehr<br />
als ein Kilometer langes Seitengewässer<br />
geschaffen. Durch ein Raugerinne ist der<br />
neue Lebensraum auch bei niedrigen<br />
Wasserständen mit dem Inn verbunden.<br />
Zudem bietet der revitalisierte Bereich<br />
bei Hochwasser wichtige Rückzugsräume<br />
für Fische.<br />
Durch das neue Gewässer und die<br />
standortgerechte Bepflanzung kann sich<br />
hier wieder eine Aulandschaft mit ihrem<br />
typischen Ökosystem entwickeln und<br />
damit zu mehr Biodiversität beitragen.<br />
Gefährdete Pflanzenarten wie die Korb-<br />
Weide, Schwarzpappel oder Schwarzerle<br />
sowie seltene Vögel wie der Kleinspecht<br />
finden dort neuen Lebensraum.<br />
Mehr Informationen zu<br />
den vielfältigen Umweltmaßnahmen<br />
der<br />
TIWAG unter<br />
www.tiwag.at/umwelt<br />
– BEZAHLTE ANZEIGE –
PREISE & AUSZEICHNUNGEN<br />
GRENZGÄNGER<br />
Der diesjährige Wittgenstein-Preisträger Hans J. Briegel forscht an der<br />
Schnittstelle von Quanteninformation, maschinellem Lernen und Philosophie.<br />
Hans J. Briegel zählt zu den Pionieren<br />
im Bereich Quanteninformatik und<br />
-technologie. Seine Arbeiten erlauben<br />
Berechnungen, die klassische Computer nicht<br />
leisten können. Seine Erkenntnisse spielen eine<br />
Schlüsselrolle in drei zentralen Bereichen<br />
der Quanteninformatik: die Entdeckung der<br />
messungsbasierten Quanteninformatik als<br />
Herzstück der optisch basierten Quanteninformationsverarbeitung;<br />
die Erfindung des<br />
Quantenrepeaters macht das Quanteninternet<br />
möglich; und seine Entwicklung des Quantenverstärkungslernens<br />
prägt das schnell<br />
wachsende Gebiet der künstlichen Quantenintelligenz.<br />
Mit dem FWF-Wittgenstein-Preis<br />
an Hans J. Briegel ehrt Österreich einen seiner<br />
aktivsten und kreativsten Forschenden in<br />
einem Bereich, in dem Österreich eine führende<br />
Rolle einnimmt“, so die Begründung der<br />
internationalen Jury.<br />
Briegels Arbeitsgruppe erforscht grundlegende<br />
Konzepte der Quantenmechanik und<br />
der statistischen Physik sowie deren Anwendungen<br />
für die Informationsverarbeitung.<br />
Von ihm stammen wegweisende Arbeiten in<br />
den Bereichen Quantencomputer und Quantenkommunikation.<br />
So ist Hans J. Briegel<br />
einer der Erfinder des Einweg-Quantencomputers,<br />
an dessen Realisierung heute mehrere<br />
Unternehmen weltweit arbeiten. Mit der Idee<br />
für Quantenrepeater hat er gemeinsam mit<br />
Kollegen der Universität Inns bruck die Basis<br />
für ein zukünftiges Quanten-Internet gelegt.<br />
Seine aktuellen <strong>Forschung</strong>sinteressen konzentrieren<br />
sich auf das Problem des Lernens und<br />
der Künstlichen Intelligenz in der Quantenphysik<br />
und auf quantenmaschinelles Lernen.<br />
Hans J. Briegel ist Professor und Leiter der<br />
<strong>Forschung</strong>sgruppe Quantum Information and<br />
Computation am Institut für Theoretische<br />
Physik an der Universität Inns bruck. Er studierte<br />
Physik und Philosophie in München<br />
und Edinburgh. Zu den weiteren Stationen<br />
seiner Karriere gehören unter anderem ein<br />
Postdoc-Fellowship an der Harvard University,<br />
eine Gastprofessur an der Universität<br />
Konstanz sowie die langjährige Leitung einer<br />
<strong>Forschung</strong>sgruppe als Wissenschaftlicher Direktor<br />
am Institut für Quantenoptik und<br />
Quanteninformation (IQOQI) der Österreichischen<br />
Akademie der Wissenschaften<br />
(ÖAW) in Inns bruck. 2<strong>02</strong>2 wurde Hans J.<br />
Briegel mit einem ERC Advanced Grant ausgezeichnet.<br />
HANS J. BRIEGEL ist einer<br />
der aktivsten und kreativsten<br />
Forschenden in einem Bereich,<br />
in dem Österreich eine führende<br />
Rolle einnimmt.<br />
Foto: FWF / Dominik Pfeifer<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/23 45
PREISE & AUSZEICHNUNGEN<br />
PRÄVENTIONSFORSCHER<br />
Für seine präventivmedizinischen<br />
Pionierarbeiten<br />
wurde Martin<br />
Widschwendter,<br />
Professor für Krebsprävention<br />
und Screening<br />
an der Uni Inns bruck,<br />
mit einer Folgeförderung<br />
des European Research Council (ERC)<br />
ausgezeichnet. Dieser Proof of Concept<br />
Grant baut auf dem Advanced Grant auf,<br />
der höchsten Auszeichnung des ERC, die<br />
Widschwendter im Jahr 2017 als erster und<br />
bisher einziger österreichischer Onkologe<br />
erhielt. Mit der neuen Förderung soll das gesellschaftliche<br />
Potenzial seiner Arbeiten in der<br />
Krebsvorbeugung ausgeschöpft werden.<br />
MIT MEDAILLE GEWÜRDIGT<br />
Seit mehr als 20 Jahren<br />
setzt sich Roland<br />
Stalder, Professor am<br />
Institut für Mineralogie<br />
und Petrographie, für<br />
die Förderung der<br />
Öffentlichkeitsarbeit in<br />
den Mineralogischen<br />
Wissenschaften ein. Dies wurde von der<br />
Deutschen Mineralogischen Gesellschaft nun<br />
mit der Doris-Schachner-Medaille gewürdigt.<br />
Die Namensgeberin der Auszeichnung ist die<br />
erste deutsche Professorin für Mineralogie.<br />
Doris Schachner wurde 1949 in Aachen zur<br />
ordentlichen Professorin für Mineralogie, Petrographie<br />
und Lagerstättenlehre ernannt.<br />
INNITZER-PREIS<br />
Im November erhielt<br />
Veronika Sexl im Wiener<br />
Erzbischöflichen<br />
Palais aus den Händen<br />
von Kardinal Christoph<br />
Schönborn den<br />
Kardinal-Innitzer-Würdigungspreis<br />
für Naturwissenschaften<br />
2<strong>02</strong>3. Der Wissenschaftspreis,<br />
benannt nach dem Wiener Erzbischof<br />
Kardinal Theodor Innitzer (1875–1955), ist<br />
eine der angesehensten Auszeichnungen<br />
dieser Art in Österreich. Die Rektorin der<br />
Universität Inns bruck wurde für ihre herausragenden<br />
Leistungen auf dem Gebiet der<br />
Krebsforschung ausgezeichnet. Ebenfalls<br />
ausgezeichnet wurde der Theologe Benedikt<br />
Collinet vom Institut für Bibelwissenschaften<br />
und Historische Theologie. Er erhielt einen<br />
Kardinal-Innitzer-Förderungspreis.<br />
WISSENSCHAFTSLANDESRÄTIN Cornelia Hagele, Andreas Bernkop-Schnürch und<br />
Doris Braun bei der Übergabe der Auszeichnungen.<br />
LANDESPREIS FÜR<br />
WISSENSCHAFT<br />
Der mit 14. 000 Euro dotierte Tiroler Landespreis für<br />
Wissenschaft ging in diesem Jahr an den Pharmazeuten<br />
Andreas Bernkop-Schnürch.<br />
Mit seiner wissenschaftlichen<br />
Arbeit trägt Andreas Bernkop-<br />
Schnürch maßgeblich zur internationalen<br />
Reputation und Stärkung<br />
der <strong>Forschung</strong>sarbeit am Institut für<br />
Pharmazie der Universität Inns bruck<br />
bei und gilt als Pionier im Bereich der<br />
Bionanotechnologie“, gratulierte Wissenschaftslandesrätin<br />
Cornelia Hagele<br />
und führte weiter aus: „Neben seiner<br />
universitären Tätigkeit ist Andreas<br />
Bernkop-Schnürch zudem erfolgreich<br />
als Unternehmer im pharmazeutischen<br />
Bereich tätig. Hervorzuheben ist dabei<br />
insbesondere seine gelungene Verbindung<br />
der akademischen <strong>Forschung</strong><br />
mit der praktischen Anwendung der<br />
<strong>Forschung</strong>sergebnisse.“ Der mit 4. 000<br />
Euro dotierte Förderpreis ging an Doris<br />
Braun, die ebenfalls am Institut für<br />
Pharmazie als Dozentin tätig ist. Derzeit<br />
forscht sie als Senior Scientist im Bereich<br />
für Pharmazeutische Technologie. In<br />
ihrer <strong>Forschung</strong> beschäftigt sie sich mit<br />
grundlagenwissenschaftlichen und angewandten<br />
Problemen im Zusammenhang<br />
mit den Materialeigenschaften von<br />
Arzneistoffen und anderen organischen<br />
Molekülen.<br />
Andreas Bernkop-Schnürch ist seit<br />
2003 Professor am Institut für Pharmazie.<br />
Seine <strong>Forschung</strong>sschwerpunkte liegen<br />
in den Bereichen pharmazeutische<br />
Wissenschaften, Wirkstoffabgabe, kontrollierte<br />
Freisetzung, Bionanotechnologie<br />
und Polymertechnik. Er ist Erfinder<br />
verschiedener Technologien im Bereich<br />
der Biotechnologie und Gründer mehrerer<br />
biotechnologischer <strong>Forschung</strong>s- und<br />
Entwicklungsunternehmen. Er zählt zur<br />
Gruppe der Highly cited researchers und<br />
wurde für seine wissenschaftliche Arbeit<br />
bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.<br />
<br />
46 zukunft forschung <strong>02</strong>/23 Fotos: Land Tirol / Anna Krepper (1), Uni Inns bruck (1), EUTOPS (1), Kathpress / Henning Klingen (1)
PREISE & AUSZEICHNUNGEN<br />
AUSGEZEICHNETE<br />
FORSCHERINNEN<br />
Die Quantenphysikerin Francesca Ferlaino und die Informatikerin<br />
Ruth Breu wurden mit Frauenstaatspreisen ausgezeichnet.<br />
REKTORIN VERONIKA SEXL gratulierte den beiden Frauenstaatspreisträgerinnen Ruth<br />
Breu (li.) und Francesca Ferlaino.<br />
Verliehen wurde der Grete Rehor-<br />
Staatspreis Ende November vom<br />
Bundesministerium für Frauen,<br />
Familie, Integration und Medien an<br />
Francesca Ferlaino. Die Experimentalphysikerin<br />
ist eine der erfolgreichsten<br />
Wissenschaftler:innen in Österreich.<br />
Mit ihren <strong>Forschung</strong>en zu den Eigenschaften<br />
von Quantenmaterie sorgt sie<br />
regelmäßig international für Aufsehen.<br />
In ihrem Fach war sie als Frau eine Pionierin<br />
und Vorbild für nachkommende<br />
Generationen von Physikerinnen. Mit<br />
dem von ihr initiierten Projekt Atom*innen<br />
will Francesca Ferlaino einen gemeinsamen<br />
Raum für Wissenschaftlerinnen<br />
in der Physik schaffen, in dem<br />
sich Frauen vernetzen und gegenseitig<br />
unterstützen können und der weibliche<br />
„Role models“ sichtbarer machen soll.<br />
Neben dem Grete Rehor-Staatspreis<br />
wurden acht weitere Grete Rehor-Preise<br />
in den Kategorien Wirtschaft, Bildung,<br />
Wissenschaft und Arbeitswelt, MINT<br />
und Digitalisierung sowie Wirtschaftswissenschaften<br />
vergeben. Der Grete<br />
Rehor-Preis in der Kategorie MINT<br />
und Digitalisierung, gestiftet vom Bundesministerium<br />
für Finanzen, ging an<br />
die Informatikerin Ruth Breu. Mit der<br />
Auszeichnung wurde insbesondere ihr<br />
langjähriges Engagement für Gleichstellung<br />
in den Bereichen Digitalisierung<br />
und Informatik sowie ihr Beitrag zum<br />
Abbau von geschlechterspezifischen<br />
Stereotypen im IT-Bereich gewürdigt.<br />
Breu leitet die <strong>Forschung</strong>sgruppe Quality<br />
Engineering. Ihr Arbeitsgebiet ist die<br />
modellbasierte Erstellung von Softwaresystemen<br />
und deren systematische Qualitätssicherung.<br />
„Mit ihrem Engagement leisten Francesca<br />
Ferlaino und Ruth Breu einen<br />
wichtigen Beitrag, um gesellschaftliche<br />
und geschlechterspezifische Stereotype<br />
im MINT- und Wissenschaftsbereich<br />
aufzubrechen“, freut sich Rektorin Veronika<br />
Sexl, der die Förderung von Frauen<br />
ein besonderes Anliegen ist, über die<br />
beiden Auszeichnungen. <br />
YOUNG ECONOMIST AWARD<br />
Marica Valente vom<br />
Institut für Wirtschaftstheorie,<br />
-politik<br />
und -geschichte<br />
wurde von der Nationalökonomischen<br />
Gesellschaft mit dem<br />
Young Economist<br />
Award 2<strong>02</strong>3 ausgezeichnet. Sie wurde für<br />
eine Arbeit gewürdigt, die sie gemeinsam<br />
mit Melissa Newham von der ETH Zürich<br />
verfasste und in der untersucht wird, wie<br />
sich Zuwendungen von Pharmaunternehmen<br />
an Ärzt:innen – entweder in Form von<br />
Geld- oder Sachleistungen – auf das Verschreibungsverhalten<br />
von Ärzt:innen und<br />
auf die Arzneimittelkosten für Patient:innen<br />
auswirken.<br />
BESTE MASTERARBEIT<br />
Die Absolventin des<br />
Masterstudiums<br />
Nachhaltige Regional-<br />
und Destinationsentwicklung,<br />
Myriam Zollner, wurde<br />
mit dem Young<br />
Researcher Award<br />
des Arbeitskreises Tourismusforschung in<br />
der Deutschen Gesellschaft für Geographie<br />
ausgezeichnet. In ihrer Arbeit hat Zollner<br />
untersucht, inwiefern es möglich ist, über<br />
eine Meta-Analyse die regionalökonomischen<br />
Einkommenseffekte des Tourismus<br />
in Deutschland abzuleiten und ob sich für<br />
einzelne Destinationstypen regionalökonomische<br />
Prognosemodelle erstellen lassen.<br />
L‘OREAL FELLOWSHIP<br />
Die Physikerin Anna<br />
Bychek wurde<br />
Ende November im<br />
Rahmen des Stipendienprogramms<br />
For<br />
Women in Science für<br />
ihre <strong>Forschung</strong> über<br />
ein neuartiges Schema<br />
von aktiven Atomuhren, der sogenannten<br />
Superradiant-Uhr, ausgezeichnet. Mit<br />
den Stipendien wird vielversprechenden<br />
weiblichen Talenten, die zugleich auch Vorbilder<br />
für Mädchen und Frauen mit wissenschaftlichen<br />
Ambitionen sind, das Vorantreiben<br />
ihrer wissenschaftlichen Karrieren<br />
ermöglicht. Die in Russland geborene Wissenschaftlerin<br />
forscht seit 2<strong>02</strong>0 am Institut<br />
für Theoretische Physik in Inns bruck.<br />
Fotos: Uni Inns bruck (1), Paolo Piffer (1), privat (1), L’ORÉAL (1)<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/23 47
ZWISCHENSTOPP INNS BRUCK<br />
QUANTENWELTEN ERKUNDEN<br />
Luca Barbiero entwickelt neue Ideen, wie Quantenmaterie unter extremen Bedingungen<br />
erforscht werden kann. Im Herbst war er in den Quantenlaboren in Inns bruck zu Gast.<br />
Experimente mit Quantengasen<br />
bieten großartige Einblicke in die<br />
Funktionsweise unserer Welt. Die<br />
Bestandteile der Materie können hier<br />
fast wie durch eine Lupe sehr exakt beobachtet<br />
werden. Es ist vor allem das<br />
Zusammenspiel der Teilchen, das die<br />
Wissenschaftler:innen fasziniert. Denn in<br />
der Quantenwelt sind viele Phänomene<br />
zu beobachten, die in unserem Alltag unmöglich<br />
wären. Francesca Ferlaino untersucht<br />
mit ihrem Team am Institut für Experimentalphysik<br />
solche Phänomene und<br />
konnte erst unlängst erstmals Hinweise<br />
auf suprasolide Zustände in ultrakalten<br />
Quantengasen finden.<br />
Luca Barbiero vom Politecnico di Torino<br />
in Italien arbeitete im Herbst zwei<br />
Monate als Gastwissenschaftler mit dem<br />
Team um Ferlaino. Der Theoretische<br />
Physiker interessiert sich schon lange<br />
für Quantensysteme, in denen die Teilchen<br />
über große Distanzen miteinander<br />
wechselwirken. In den Inns brucker Experimenten<br />
sind es genau diese Wechselwirkungen,<br />
die Phänomene zutage<br />
fördern, die bisher unerforscht sind. Es<br />
sind die magnetischen Eigenschaften der<br />
Erbium- oder Dysprosiumatome in den<br />
Experimenten, die für diese richtungsabhängige,<br />
weitreichende Wechselwirkung<br />
verantwortlich sind. Francesca Ferlaino<br />
war eine der weltweit ersten Wissenschaftler:innen,<br />
die diese Elemente in<br />
ihren Experimenten verwendet hat.<br />
Innsbrucker Anziehungskraft<br />
Auf Barbiero übte die Universität Innsbruck<br />
deshalb große Anziehungskraft<br />
aus: „Die Idee, quantenmechanische Effekte<br />
mit Hilfe ultrakalter atomarer Systeme<br />
zu verstehen und zu simulieren, wurde<br />
hier in Inns bruck mitentwickelt. Seitdem<br />
arbeiten einige der einflussreichsten<br />
Wissenschaftler:innen auf diesem Gebiet<br />
hier oder haben viel Zeit an den Physik-Instituten<br />
der Universität Inns bruck<br />
verbracht. Dies und die Möglichkeit, mit<br />
Francescas Team zusammenzuarbeiten,<br />
LUCA BARBIERO (*1983) ist Theoretischer<br />
Physiker und seit 2<strong>02</strong>1 Assistenzprofessor<br />
am Politecnico di Torino. Er<br />
studierte Physik in Turin und forschte als<br />
Postdoc in Italien, Belgien und Spanien.<br />
Im Oktober und November war er als<br />
Gastprofessor am Institut für Experimentalphysik<br />
der Universität Inns bruck tätig.<br />
waren für mich sehr attraktiv.“ Der italienische<br />
Physiker hat am Politecnico di<br />
Torino promoviert und arbeitete dann<br />
mehrere Jahre als Postdoc in Italien, Belgien<br />
und Spanien. 2<strong>02</strong>1 ist er als Assistenzprofessor<br />
wieder an das Politecnico<br />
di Torino zurückgekehrt.<br />
An der Universität Inns bruck hat Barbiero<br />
mit dem Team um Francesca Ferlaino<br />
neue Ideen und Pläne entwickelt, wie<br />
mit dem einzigartigen Know-how der hiesigen<br />
Experimentalphysik das Verhalten<br />
von Quantenmaterie unter sehr ex tremen<br />
Bedingungen untersucht werden kann.<br />
Sein Wissen gab der Physiker auch an die<br />
Studierenden weiter: „Ich habe versucht,<br />
den Studierenden meine Leidenschaft für<br />
die Quantenmaterie zu vermitteln, indem<br />
ich Beispiele vorgestellt habe, bei denen<br />
die Regeln der Quantenphysik zu sehr<br />
spannenden und kontraintuitiven Effekten<br />
führen“, sagt Barbiero. Um Theorie<br />
und Experiment bereits in der Lehrveranstaltung<br />
zusammenzuführen, hielt er das<br />
Seminar gemeinsam mit Manfred Mark<br />
aus dem Team von Ferlaino. „Manfred ist<br />
ein brillanter Experimentalphysiker. Mit<br />
ihm konnte ich sehr konkrete experimentelle<br />
Details direkt mit meinen theoretischen<br />
Konzepten verbinden.“<br />
Für Luca Barbiero hat sich der Besuch<br />
in Inns bruck jedenfalls gelohnt: „Ich denke,<br />
dass es nur sehr wenige Orte auf der<br />
Welt gibt, an denen man so viele brillante<br />
Teams findet, die theoretische oder experimentelle<br />
<strong>Forschung</strong> auf diesem Gebiet<br />
betreiben.“ <br />
cf<br />
48<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/23<br />
Foto: Andreas Friedle
SPRUNGBRETT INNS BRUCK<br />
KANN RECHT LEID<br />
VERMEIDEN?<br />
Den Juristen Philipp Kastner zog es in die Welt, um einen Beitrag<br />
für gerechtere und friedvollere Gesellschaften zu leisten.<br />
Die Verbindung von Recht und<br />
Frieden beschäftigt Philipp Kastner<br />
seit seinem Studium und<br />
aktuell in seiner <strong>Forschung</strong> und Lehre.<br />
„Schon von Beginn an haben mich insbesondere<br />
die politischen Aspekte des Völkerrechts<br />
fasziniert, und so bin ich auch<br />
zur Friedens- und Konfliktforschung gekommen.<br />
Leider gibt es noch immer viel<br />
zu viel vermeidbares Leid und unnötige<br />
Ungerechtigkeit auf der Welt“, so der<br />
Wissenschaftler, der derzeit an der Law<br />
School der University of Western Australia<br />
(UWA) an einem Buch arbeitet, in dem<br />
er Verbindungen von Recht und Frieden<br />
kritisch beleuchtet.<br />
Wie kann das Recht, und insbesondere<br />
das Völkerrecht, effektiver und langfristiger<br />
zum Frieden beitragen? Warum hat<br />
es, trotz vieler Versuche, das Recht noch<br />
immer nicht wirklich geschafft, eine konstruktivere<br />
Rolle zu spielen? „Leider bleibt<br />
das ein aktuelles Thema“, betont Kastner<br />
und fügt hinzu: „Hoffentlich können<br />
theoretische Überlegungen wie die meinen<br />
– nicht nur aus klassisch-westlicher<br />
Sicht, sondern auch unter Einbeziehung<br />
postkolonialer oder queerer Theorien<br />
– neue Lösungsansätze bringen.“ Der<br />
Wissenschaftler möchte seine Studierenden<br />
dazu anregen, mit- und voneinander<br />
zu lernen sowie kritisch und kreativ zu<br />
denken. „Ich unterrichte unter anderem<br />
Völkerstrafrecht und Seerecht im Rahmen<br />
eines Masterstudiums im internationalen<br />
Recht, den ich an der UWA mitaufgebaut<br />
habe. In beiden Fällen versuche ich,<br />
grundlegende politische, historische und<br />
kulturelle Faktoren herauszuarbeiten, die<br />
erklären, warum es auch in diesen Bereichen<br />
frappierende Ungerechtigkeiten gibt<br />
und das Recht paradoxerweise oft eher<br />
den politisch Stärkeren von Nutzen ist“,<br />
erläutert der Rechtsexperte, der sich bereits<br />
in seiner Magisterarbeit an der Uni<br />
Inns bruck mit dem Seerecht beschäftigt<br />
hat. „Auch wenn die Meere für Binnenstaaten<br />
wie Österreich auch eine wichtige<br />
Rolle spielen, ist das im Falle von<br />
Australien freilich sehr viel offensichtlicher.<br />
Noch dazu ist der Campus der UWA<br />
nur ein paar Kilometer vom Ozean entfernt<br />
– eigentlich könnte ich von der Law<br />
School, die direkt am Swan River liegt, in<br />
einem Kajak zum Meer paddeln!“<br />
Music & Law<br />
Durch Zufall und sein musikalisches Talent<br />
ergab sich für den Wissenschaftler<br />
noch eine weitere <strong>Forschung</strong>srichtung –<br />
seit Kurzem bietet er eine Lehrveranstaltung<br />
zum Thema „Music and the Law“<br />
an. Den vielseitigen Rechtsexperten haben<br />
auch die koloniale Vergangenheit und<br />
Gegenwart in Australien geprägt. „Dieser<br />
Kontext hat meine Sensibilität nicht nur<br />
gegenüber indigenen Völkern, sondern<br />
allgemein gegenüber benachteiligten und<br />
diskriminierten Bevölkerungsgruppen geschärft<br />
– insbesondere, wenn es um die<br />
PHILIPP KASTNER studierte in Innsbruck<br />
Rechts- und Politikwissenschaft.<br />
Schon von Beginn an faszinierten ihn die<br />
politischen Aspekte des Völkerrechts, was<br />
ihn zur Friedens- und Konfliktforschung<br />
brachte. Nach Auslandserfahrungen an<br />
der Sciences Po Paris und weiteren Studien<br />
an der McGill University in Montréal<br />
wechselte er an die University of Western<br />
Australia, wo er seit fast zehn Jahren<br />
forscht und lehrt. „Meine Abschlüsse<br />
haben mir international interessante<br />
Möglichkeiten eröffnet. Insofern war die<br />
Uni Inns bruck ein gutes erstes Sprungbrett!“,<br />
freut sich Kastner.<br />
Aufarbeitung oder Beseitigung von Unrecht<br />
geht, das während eines bewaffneten<br />
Konflikts, einer Diktatur oder Kolonialherrschaft<br />
begangen wurde“, sagt Kastner.<br />
Ob es ihn wieder auf andere Erdteile<br />
zieht oder ob er in Australien bleibt, lässt<br />
das „österreichische Känguru“, wie er von<br />
seinen Kolleg:innen scherzhaft genannt<br />
wird, noch offen. <br />
df<br />
Foto: Privat<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/23 49
ESSAY<br />
WORTSUCHE „INN“<br />
Eine Recherche in der <strong>Forschung</strong>sdatenbank „Dokumentation<br />
LiteraturTirol“ von Christine Riccabona und Anton Unterkircher.<br />
„Der Inn und seine<br />
Landschaften, die der<br />
Erzähler durchwandert,<br />
werden geradezu zu<br />
einem Synonym für<br />
Tirol.“<br />
CHRISTINE RICCABONA und<br />
ANTON UNTERKIRCHER<br />
sind Mitarbeiter:innen am <strong>Forschung</strong>sinstitut<br />
Brenner-Archiv.<br />
Sie betreiben gemeinsam mit<br />
Kristin Jenny und Sebastian von<br />
Sauter das „Lexikon LiteraturTirol“:<br />
literaturtirol.at/lexikon<br />
Als Motiv, Kulisse, Schauplatz und Thema<br />
ist der „Inn“ so alt wie die Literatur<br />
des Landes, durch das er fließt. Gesetzt<br />
den Fall, jemand wollte systematisch eine ‚Literaturgeschichte<br />
des Inns‘ erarbeiten, würde<br />
er/sie sicherlich von den Leistungen der Digitalisierung<br />
literarischer Bibliotheksbestände<br />
profitieren, und er/sie würde wohl auch die<br />
umfangreiche Datenbank zur Literatur in Tirol<br />
vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart durchforsten.<br />
Das <strong>Forschung</strong>sinstitut Brenner-Archiv<br />
der Universität Inns bruck betreibt ebendiese<br />
seit mehr als 20 Jahren, ist das Institut doch<br />
zugleich auch Tiroler Literaturarchiv und gemeinsam<br />
mit dem Literaturhaus am Inn eine<br />
wichtige Einrichtung der literarischen Öffentlichkeit<br />
Tirols. Als Output aus dieser Datenbank<br />
wurde 2006 das bio-bibliografische Online-Lexikon<br />
„LiteraturTirol“ generiert, in dem<br />
derzeit 1. 100 Autor:innen aus Nord-, Süd- und<br />
Osttirol geführt und Einblicke in deren Leben<br />
und Werk geboten werden. Das illustrierte,<br />
laufend aktualisierte und kommentierte Online-Lexikon<br />
ist Nachschlagewerk, Findbuch<br />
und Ort der Vermittlung gleichermaßen.<br />
Der Suchlauf „Inn“ fördert naturgemäß all jene<br />
Bücher, Gedichte, Erzählungen, Sagen usw.<br />
zutage, die sich schon im Titel auf ihn beziehen,<br />
wobei dieses Ergebnis überraschenderweise<br />
schmal ausfällt. Zum Beispiel gibt es das<br />
Gedicht „(inn)“ des inzwischen renommierten<br />
Theaterautors Händl Klaus mit folgendem<br />
Vers: „innerhalb der satten : matten : ufer : /<br />
böschung : bricht : beständig : mir : / der Inn<br />
: herein.“ Nennenswert ist auch Lilly Sauters<br />
Gedicht „Innbrücke“.<br />
Der „Inn“ fungiert zudem als Namensgeber<br />
für Institutionen wie den Inn-Verlag, in<br />
dem zahlreiche Bücher Tiroler Literat:innen<br />
nach dem Zweiten Weltkrieg herauskamen,<br />
oder die Literaturzeitschrift „Inn“, die in den<br />
1980er-Jahren erschienen ist und in der viele<br />
bekannte Gegenwartsautor:innen erstmals<br />
publizierten. Und so findet sich etwa auch<br />
eine Anthologie mit dem Titel „Innseits“ aus<br />
dem Jahr 2007, die Aufzählung ließe sich beliebig<br />
fortführen. Darüber hinaus führen biografische<br />
und inhaltliche Kommentierungen<br />
zu den literarischen Texten. Aus diesen rücken<br />
wir nur zwei Beispiele ins Blickfeld: Ein<br />
kleines Stück Kulturgeschichte aus der Zeit<br />
der Inn-Schifffahrt in Tirol, erzählt von Adolf<br />
Pichler in „Zu meiner Zeit. Schattenbilder aus<br />
der Vergangenheit“ (1892). Er schildert darin<br />
anekdotenhaft u. a. seine zehntägige Schiffs-<br />
Reise von Hall nach Wien: Im September 1842<br />
geht er gemeinsam mit einem Freund an Bord<br />
eines Frachtschiffes in Hall. Da die beiden Passagiere<br />
nur zwei Gulden Fahrgeld bezahlen,<br />
müssen sie beim Rudern mithelfen und an den<br />
Ufern Brennholz für die Schiffs-Küche einsammeln.<br />
Dass die Reise per Schiff im 19. Jahrhundert<br />
auch eine Möglichkeit war, „wohlfeiler<br />
zu reisen“, ist vermutlich heute kaum mehr<br />
bekannt.<br />
Franz Gschnitzer (1899–1968), Rektor der Universität<br />
Inns bruck, Jurist, Politiker und Autor<br />
publiziert 1947 unter dem Titel „‚Der Inn‘. Ursprung<br />
– Vereinigung – Hohe Zeit“ eine Eloge<br />
auf den Fluss und seine umliegende Landschaft,<br />
die heute in die Reihe schöngeistiger<br />
Dichtung gehört: Es sind poetisch-kontemplative<br />
Aufzeichnungen einer Wanderung vom<br />
Ursprung des Inns am Maloja-Pass bis zu seinem<br />
Einmünden in die Donau – dabei philosophiert<br />
der Autor über Anfang und Ende als<br />
stetem Kreislauf des Wassers: „Wie sich ein<br />
Tropfen bildet und vergeht oder bestehn<br />
bleibt, ist so sehr dem Zufall preisgegeben –<br />
gleich wie der einzelne Mensch. Als Ganzes<br />
aber ist dies vergänglichste und nachgiebigste<br />
Element das beständigste und unnachgiebigste:<br />
in ständigem Wechsel besteht es sicherer<br />
als unverrückbare Grundfeste und ewige Bewegung<br />
wird ewige Ruhe.“ Der Inn und seine<br />
Landschaften, die der Erzähler durchwandert,<br />
werden geradezu zu einem Synonym für Tirol:<br />
Der Wanderer blickt nicht nur vom Inntal<br />
nach Süden, er wandert auch durch Südtirol<br />
bis an den Gardasee und sinniert über das<br />
„Land im Gebirge, das Nord und Süd verbindet.“<br />
Das scheinbar harmlose Wanderbuch<br />
führt so in seinem poetischen Fluss unterströmig<br />
doch politische Fracht der Tiroler Nachkriegszeit.<br />
50<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/23
BERUFUNG<br />
GEFUNDEN.<br />
Nadine Jasmin Ortner<br />
Universitätsassistentin am Institut für Pharmazie,<br />
Abteilung für Pharmakologie und Toxikologie<br />
Friedrich Vötter<br />
Techniker am Institut für Astro- und<br />
Teilchenphysik<br />
Viele Menschen haben an<br />
der größten Hochschule Westösterreichs ihre Berufung<br />
in <strong>Forschung</strong> und Lehre, aber auch in der Verwaltung gefunden.<br />
Die Molekularbiologin Nadine Jasmin Ortner und der Techniker am<br />
Institut für Astro- und Teilchenphysik Friedrich Vötter sind zwei davon.<br />
Nadine Jasmin Ortner bringt gerne Dinge zu Ende.<br />
Das war schon in ihrem Molekularbiologie-Studium so,<br />
für das die gebürtige Kärntnerin aus ihrem Heimatort<br />
Ossiach nach Wien gezogen ist.<br />
Heute ist sie Universitätsassistentin am Institut für<br />
Pharmazie, in der Abteilung für Pharmakologie und<br />
Toxikologie. Nach einem kurzen Bewerbungskrimi<br />
fand sie hier ihre Traumstelle, wie sie selbst sagt.<br />
Friedrich Vötter ist ein „klassischer Bauernbua“, wie<br />
er sagt. Aufgewachsen auf einem Hof im Wipptal<br />
sahen seine Karrierepläne eigentlich anders aus:<br />
„Ursprünglich bin ich gelernter Karosseriebauer“,<br />
erzählt er.<br />
Mittlerweile ist er seit 22 Jahren an der Universität<br />
Innsbruck tätig und leitet als Techniker die Werkstätte<br />
des Instituts für Astro- und Teilchenphysik.<br />
Wir denken weiter.<br />
Seit 1669<br />
www.uibk.ac.at/karriere<br />
<br />
/uniinnsbruck<br />
© BfÖ 2<strong>02</strong>3
© Mohamad Cheblak/MSF, Libanon 2<strong>02</strong>0<br />
Sekunden mit Bedeutung.<br />
Ärzte ohne Grenzen.<br />
Deine Spende zählt:<br />
Jetzt helfen!<br />
www.aerzte-ohne-grenzen.at<br />
52 zukunft forschung <strong>02</strong>/23 Wir gehen da hin, wo’s weh tut.<br />
Foto: Andreas Friedle