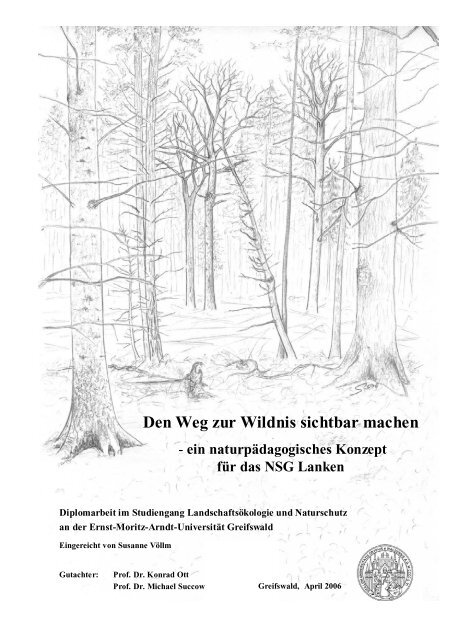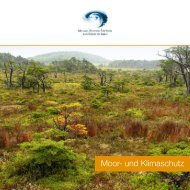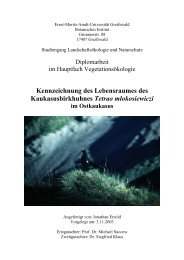Den Weg zur Wildnis sichtbar machen - Michael-Succow-Stiftung
Den Weg zur Wildnis sichtbar machen - Michael-Succow-Stiftung
Den Weg zur Wildnis sichtbar machen - Michael-Succow-Stiftung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Diplomarbeit im Studiengang Landschaftsökologie und Naturschutz<br />
an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald<br />
Eingereicht von Susanne Völlm<br />
Gutachter: Prof. Dr. Konrad Ott<br />
Prof. Dr. <strong>Michael</strong> <strong>Succow</strong><br />
<strong>Den</strong> <strong>Weg</strong> <strong>zur</strong> <strong>Wildnis</strong> <strong>sichtbar</strong> <strong>machen</strong><br />
- ein naturpädagogisches Konzept<br />
für das NSG Lanken<br />
Greifswald, April 2006
Druck auf 100% Recyclingpapier
Im Reich der Wirklichkeit ist man nie so glücklich, wie im Reich<br />
der Gedanken.<br />
Arthur Schopenhauer<br />
Anmerkungen <strong>zur</strong> überarbeiteten Fassung:<br />
In dieser überarbeiteten Version meiner Diplomarbeit ‚<strong>Den</strong> <strong>Weg</strong> <strong>zur</strong> <strong>Wildnis</strong> <strong>sichtbar</strong><br />
<strong>machen</strong> – ein naturpädagogisches Konzept für das NSG Lanken’ wurden Korrekturen bei<br />
Rechtschreibung, Zeichensetzung und Formatierung durchgeführt, sowie minimale<br />
Ergänzungen vorgenommen. Für Hinweise auf weiteren Korrekturbedarf bin ich dankbar.<br />
Neuenkirchen den 13.6.2006<br />
s.voellm@gaia.de
Danksagung<br />
Mein ausdrücklicher Dank gilt meinen Professoren Konrad Ott und <strong>Michael</strong> <strong>Succow</strong> für die<br />
Überlassung eines im Studiengang Landschaftsökologie und Naturschutz durchaus nicht<br />
üblichen, meinen Neigungen aber sehr entgegenkommenden Themas und der Betreuung<br />
während der Ausarbeitung. Gedankt sei auch allen Vordenkern, deren Texte mir als<br />
Grundlage dienten, sowie allen Mitdenkern, die mir mit Hinweisen und Kritik <strong>zur</strong> Seite<br />
standen und deren scharfer Blick Fehler beheben half. Außerdem danke ich der <strong>Michael</strong>-<br />
<strong>Succow</strong>-<strong>Stiftung</strong> zum Schutz der Natur für die Möglichkeit, meine theoretischen<br />
Überlegungen am NSG Lanken entwickeln zu können.
Inhalt<br />
1. Einführung .............................................................................................................. 9<br />
1.1 Aufbau der Arbeit .............................................................................................. 9<br />
1.2 Einführung in das Gebiet ................................................................................... 9<br />
2. Der Wert des Verwilderns................................................................................... 11<br />
2.1 <strong>Wildnis</strong> als räumlich-biologisches und kulturelles Phänomen ........................ 11<br />
2.2 <strong>Wildnis</strong>leitbilder............................................................................................... 13<br />
2.2.1 Sekundäre <strong>Wildnis</strong> in Europa.................................................................... 13<br />
2.2.2 Relative <strong>Wildnis</strong> in Amerika..................................................................... 13<br />
2.3 Prozessschutz ................................................................................................... 14<br />
2.3.1 Auffassungen von Prozessschutz .............................................................. 15<br />
2.3.1.1 Nutzungsprozessschutz ...................................................................... 16<br />
2.3.1.2 Prozessschutz als Bewirtschaftungsstrategie ..................................... 16<br />
2.3.1.3 Prozessschutz als Schutz ökosytemarer Funktionen.......................... 17<br />
2.3.1.4 Prozessschutz als absolutes Nichtstun ............................................... 18<br />
2.3.2 Umweltethische Begründungen ................................................................ 18<br />
2.3.2.1 Anthropozentrische Prozessschutzbegründung.................................. 18<br />
2.3.2.2 Holistische Begründung für Prozessschutz........................................ 19<br />
2.3.2.3 Ökozentrische Begründung................................................................ 20<br />
2.3.2.4 Sentientistische Begründung.............................................................. 21<br />
2.3.2.5 Biozentrische Begründung................................................................. 21<br />
2.4 Wert von <strong>Wildnis</strong> und Verwildern................................................................... 21<br />
2.4.1 Wertkategorien.......................................................................................... 21<br />
2.4.2 Werte von <strong>Wildnis</strong> und Verwildern .......................................................... 22<br />
2.4.2.1 Ökonomische Werte........................................................................... 23<br />
2.4.2.2 Ökologische Werte............................................................................. 23<br />
2.4.2.3 Werte für Persönlichkeit und Identität............................................... 23<br />
2.4.2.4 Eigenwert ........................................................................................... 28<br />
2.5 Erschließung von <strong>Wildnis</strong>schutzgebieten für Umweltbildung ........................ 28<br />
3. Der methodische Baukasten................................................................................ 31<br />
3.1 Generelle Ziele von Themenwegen ................................................................. 31<br />
3.2 Grundsätze von Themenwegen........................................................................ 32<br />
3.2.1 Pädagogisches Arrangement ..................................................................... 32<br />
3.2.2 Zielgruppenorientierung............................................................................ 33<br />
3.2.2.1 Altersgruppen..................................................................................... 33<br />
3.2.2.2 Typologie der Naturerfahrungsarten nach Bögeholz ......................... 35<br />
3.2.2.3 Lernstile nach Kolb............................................................................ 35<br />
3.2.3 Transferleistung......................................................................................... 36<br />
3.2.4 Freiwilligkeit und Selbstverantwortung.................................................... 37<br />
3.2.5 Standards der Öffentlichkeitsarbeit........................................................... 37<br />
3.3 Pädagogische Grundlegung.............................................................................. 39<br />
3.3.1 Begriffe ..................................................................................................... 39<br />
3.3.2 Didaktische Methoden .............................................................................. 45<br />
3.3.2.1 Naturbegegnung – Naturerleben – Naturerfahrung............................ 45<br />
3.3.2.2 Ganzheitliches Lernen........................................................................ 48<br />
3.3.2.3 Exemplarisches Lernen...................................................................... 49<br />
3.3.2.4 Entdeckendes Lernen......................................................................... 49<br />
3.3.2.5 Erlebnisorientierung........................................................................... 49<br />
3.3.2.6 Problemorientierung........................................................................... 50<br />
3.3.2.7 Situationsorientierung ........................................................................ 50<br />
3.3.2.8 Systemorientierung ............................................................................ 50
3.3.2.9 Handlungsorientiertes Lernen............................................................51<br />
3.3.2.10 Reflexives Lernen ............................................................................52<br />
3.3.2.11 Förderung von sinnlicher Wahrnehmung und Körperlichkeit .........52<br />
3.3.2.12 Interaktivität .....................................................................................52<br />
3.3.2.13 Gruppenorientierung ........................................................................53<br />
3.4 Der Möglichkeitsraum......................................................................................53<br />
3.4.1 Bestehende Klassifikationen .....................................................................53<br />
3.4.2 Ebenen des Möglichkeitsraumes...............................................................54<br />
4. Der Drachenpfad – Erleben einer Landschaft im Umbruch............................73<br />
4.1 Der methodische Baukasten in praktischer Anwendung..................................73<br />
4.1.1 Zielsetzungen, Konzeptionstyp, Grundsätze .............................................73<br />
4.2 Zusätzliche allgemeine Überlegungen .............................................................80<br />
4.2.1 Regionale Infrastruktur .............................................................................80<br />
4.2.2 Infrastruktur am <strong>Weg</strong>................................................................................80<br />
4.2.3 Gefahrenpotenzial .....................................................................................81<br />
4.2.4 Vandalismus ..............................................................................................81<br />
4.2.5 Verbote bzw. Gebote.................................................................................81<br />
4.2.6 Konfliktpotenzial.......................................................................................81<br />
4.2.7 Erfolgskontrolle / Evaluation ....................................................................82<br />
4.2.8 Behördliche Genehmigung und TÜV .......................................................82<br />
4.2.9 Versicherung .............................................................................................82<br />
4.2.10 Kosten und Folgekosten..........................................................................82<br />
4.2.11 Werbung..................................................................................................82<br />
4.2.12 Strecke.....................................................................................................83<br />
4.2.13 Kennzeichnung........................................................................................83<br />
4.2.14 Material ...................................................................................................83<br />
4.2.15 Barrierefreiheit ........................................................................................84<br />
4.2.16 Leitfigur...................................................................................................84<br />
4.3 Betreuungsebenen ............................................................................................86<br />
4.3.1 Betreuungsebene Schrift ...........................................................................86<br />
4.3.1.1 '<strong>Weg</strong>begleiter'.....................................................................................86<br />
4.3.1.2 Kinderbuch.........................................................................................87<br />
4.3.2 Betreuungsebene Person ...........................................................................87<br />
4.3.2.1 Umweltbildung...................................................................................87<br />
4.3.2.2 Lokale Veranstaltungen......................................................................88<br />
4.3.3 Betreuungsebene Internet ..............................................................................89<br />
4.4 Teilstrecken- und Stationsbeschreibung des Drachenpfades ...........................90<br />
4.4.1 Eingangsstation .........................................................................................90<br />
4.4.2 Kreuzungspunkt ........................................................................................91<br />
4.4.3 Bildweg – Die Geschichte des Drachens ..................................................92<br />
4.4.3.1 Bildwegstation 1.................................................................................94<br />
4.4.3.2 Bildwegstation 2.................................................................................95<br />
4.4.3.3 Bildwegstation 3.................................................................................95<br />
4.4.3.4 Bildwegstation 4.................................................................................96<br />
4.4.3.5 Bildwegstation 5.................................................................................96<br />
4.4.4 Lehr-Reiche: <strong>Den</strong> Drachen spüren............................................................96<br />
4.4.4.1 Lehr-Reich-Station 1........................................................................101<br />
4.4.4.2 Lehr-Reich-Station 2........................................................................102<br />
4.4.4.3 Lehr-Reich-Station 3........................................................................102<br />
4.4.4.4 Lehr-Reich-Station 4........................................................................103<br />
4.4.4.5 Lehr-Reich-Station 5........................................................................104
4.4.4.6 Lehr-Reich-Station 6........................................................................ 105<br />
4.4.5 Spielraum ................................................................................................ 105<br />
4.4.5.1 Spielraum-Station: Labyrinth........................................................... 107<br />
4.4.5.2 Spielraum-Station: Barfußweg......................................................... 107<br />
4.4.5.3 Spielraum-Station: Mandala............................................................. 107<br />
4.4.5.4 Spielraum-Station: Kletterkiefer oder Holzhaufen .......................... 107<br />
4.4.5.5 Spielraum-Station: Kükelhaus-Erfahrungsstationen........................ 107<br />
4.4.6 Wunderpunkte......................................................................................... 108<br />
4.5 Abwägung und Empfehlung .......................................................................... 108<br />
5. Anhang ................................................................................................................ 110<br />
5.1 Landschaftsgeschichte.................................................................................... 110<br />
5.2 Karte Drachenpfad......................................................................................... 115<br />
5.3 Tabelle Praxisübersicht .................................................................................. 116<br />
5.4 Zeichnungen................................................................................................... 119<br />
6. Literaturverzeichnis........................................................................................... 132<br />
Abbildungsverzeichnis<br />
Abb. 1: Dynamikmodell in Anlehnung an Trommer & Noack............................................. 11<br />
Abb. 2: Methodischer Baukasten........................................................................................... 31<br />
Abb. 3: Lernstile nach Kolb................................................................................................... 36<br />
Abb. 4: Möglichkeitsraum von Themenwegen...................................................................... 54<br />
Abb. 5: Landeslogo Mecklenburg-Vorpommern und Vorschlag für Lankenlogo................ 80<br />
Abb. 6: Vorschlag für die Leitfigur Darsinus........................................................................ 85<br />
Abb. 7: Vorschlag Eingangsstation............................................................................... 91 / 119<br />
Abb. 8: Vorschlag Kreuzungspunkt.............................................................................. 91 / 120<br />
Abb. 9: Vorschlag Bildwegstation 1............................................................................. 94 / 121<br />
Abb. 10: Vorschlag Bildwegstation 2........................................................................... 95 / 122<br />
Abb. 11: Vorschlag Bildwegstation 3........................................................................... 95 / 123<br />
Abb. 12: Vorschlag Bildwegstation 4........................................................................... 96 / 124<br />
Abb. 13: Vorschlag Bildwegstation 5........................................................................... 96 / 125<br />
Abb. 14: Vorschlag Lehr-Reich-Station 1.................................................................. 101 / 126<br />
Abb. 15: Vorschlag Lehr-Reich-Station 2.................................................................. 102 / 127<br />
Abb. 16: Vorschlag Lehr-Reich-Station 3.................................................................. 103 / 128<br />
Abb. 17: Vorschlag Lehr-Reich-Station 4.................................................................. 103 / 129<br />
Abb. 18: Vorschlag Lehr-Reich-Station 5.................................................................. 104 / 130<br />
Abb. 19: Vorschlag Lehr-Reich-Station 6.................................................................. 105 / 131<br />
Abb. 20: Lebensbaum-Labyrinth......................................................................................... 107<br />
Abb. 21: Summstein nach Kükelhaus.................................................................................. 108<br />
Abb. 22: Partnerschaukel..................................................................................................... 108<br />
Abb. 23: Balancierscheibe................................................................................................... 108<br />
Abb. 24: Aktuelles Satellitenbild von Lanken und Umgebung........................................... 110<br />
Abb. 25: Lanken und Umgebung 1694................................................................................ 111<br />
Abb. 26: Lanken und Umgebung 1835................................................................................ 112<br />
Abb. 27: Vegetationskarte des NSG Lanken........................................................................ 114
1. Einführung<br />
Ziel dieser Arbeit ist der Entwurf und die theoretische Begründung eines Erlebnispfads, der<br />
den Besucher eines <strong>Wildnis</strong>schutzgebietes in Deutschland mit dem Gedanken des<br />
Verwildernlassens von Kulturlandschaft vertraut <strong>machen</strong> kann und das Erleben des<br />
Verwilderns ermöglicht.<br />
Mir ist keine solche Einrichtung bekannt, die sich ganz in den Dienst dieser speziellen<br />
Naturschutzthematik stellt. Dies ist sicher auch der Tatsache geschuldet, dass es<br />
ausgesprochen schwierig ist, Prozesse erlebbar zu <strong>machen</strong>. Entsprechende Stationen finden<br />
sich daher nur sporadisch entlang von Themenwegen. Sie behandeln dann auch nicht explizit<br />
das Verwildern, sondern erläutern auch in der Kulturlandschaft erlebbare Prozesse, wie z.B.<br />
das Verrotten von Laub oder Totholz.<br />
Vorliegendes Konzept versucht, das Augenmerk explizit auf das Phänomen des Verwilderns<br />
zu lenken, um die Wertschätzung für <strong>Wildnis</strong> zu erhöhen.<br />
1.1 Aufbau der Arbeit<br />
Die Arbeit beginnt mit einer thematischen Grundlegung. Da es um die Vermittlung des<br />
<strong>Wildnis</strong>schutzgedankens geht, wird zunächst geklärt, was darunter verstanden wird.<br />
Verschiedene <strong>Wildnis</strong>leitbilder werden ebenso abgeleitet, wie unterschiedliche<br />
Auffassungen von der Naturschutzleitlinie 'Prozessschutz'. Im Anschluss wird der Frage<br />
nachgegangen, mit welcher Berechtigung er betrieben und über Bildungsmaßnahmen<br />
propagiert werden kann. Zu diesem Zweck werden die Werte von <strong>Wildnis</strong> besprochen.<br />
Schließlich wird erörtert, ob es gerechtfertigt sein kann, Bildungsmaßnahmen im<br />
<strong>Wildnis</strong>schutzgebiet selbst durchzuführen.<br />
Es folgt eine pädagogische Grundlegung. Sie beginnt mit einer Betrachtung der an<br />
Themenwege gestellten Erwartungen, woraufhin grundsätzliche Prinzipien und didaktische<br />
Methoden erarbeitet werden, die bei der Konzeption von Themenwegen beachtet werden<br />
müssen. Danach folgt eine Erörterung der Elemente, deren man sich bei der praktischen<br />
Umsetzung eines Themenweges bedienen kann. Das Ergebnis ist ein Möglichkeitsraum,<br />
innerhalb dessen sich Themenwegkonzeptionen grundsätzlich bewegen.<br />
Im abschließenden Praxisteil wird der auf diesen Erkenntnissen aufbauende Entwurf des<br />
Drachenweges Lanken vorgestellt. Es handelt sich um eine dreiteilige Konzeption, bestehend<br />
aus den zielgruppenorientierten Teilstrecken Bildweg, Lehr-Reiche und Spielraum. Neben<br />
den im Gelände befindlichen Stationen wird die Möglichkeit von drei weiteren<br />
Betreuungsebenen (Begleitschrift, Person und Internet) in Betracht gezogen.<br />
Daneben werden sich bei der praktischen Umsetzung von Themenwegen allgemein<br />
ergebende Fragestellungen behandelt.<br />
Ich hoffe, in meiner Arbeit der Feststellung von Amesberger et al. (1995, S. 21) Genüge<br />
getan zu haben, die besagt, „daß verantwortungsvolle pädagogische und psychologische<br />
Praxis, die Natur und das Naturverhältnis des Menschen thematisieren und „nutzen“ will,<br />
einer theoretischen Reflexion auf vielerlei Ebenen bedürfen: auf einer geschichtlichen,<br />
philosophischen Ebene genauso wie auf einer erkenntnistheoretischen und<br />
naturwissenschaftlichen, aus einer psychologischen Perspektive gleichwohl wie aus einer<br />
soziologischen Perspektive“.<br />
1.2 Einführung in das Gebiet<br />
An dieser Stelle werden lediglich einige zusammenfassende Ausführungen <strong>zur</strong> Entstehung<br />
und Charakteristik von Lanken gegeben, die ein besseres Verständnis entsprechender Bezüge<br />
in den Folgekapiteln ermöglichen sollen. Eine ausführlichere Darstellung findet sich im<br />
Anhang (siehe 5.1) bzw. bei Brinkmann (2002).<br />
9
10<br />
Einführung<br />
Das heutige NSG Lanken befindet sich etwa 7 km nordöstlich von Greifswald. Seine<br />
Entstehung geht auf holozäne Küstenausgleichsprozesse <strong>zur</strong>ück, die an der Umbiegung der<br />
Küstenlinie zum Ostrand der Dänischen Wiek hin aus angeschwemmten Sandsedimenten ein<br />
Höftland entstehen ließen.<br />
Auf seinem nördlichen Uferbereich haben sich Dünen gebildet, die einen angepflanzten<br />
Dünenkiefernwald (Pinus sylvestris, ~ 165 Jahre alt) tragen. Derzeit wandern hier von Süden<br />
her erste Stiel-Eichen (Quercus robur) und Rotbuchen (Fagus sylvatica) ein.<br />
Auf den südlich gelegenen Strandwällen finden sich nur noch vereinzelte ältere Buchen und<br />
Eichen (~ 150 Jahre alt), sie wurden dort zum größten Teil durch Douglasien (Pseudotsuga<br />
menziesii, ~ 90 Jahre alt) und Fichten (Picea abies, ~ 80 Jahre alt) ersetzt. Im äußersten<br />
Süden gesellen sich Kiefern (~ 165 Jahre alt) dazu.<br />
Die Strandwälle umschließen im Norden und Westen einen verlandeten Strandsee. Hier<br />
kommen Reste eines Stiel-Eichen-Hutewaldes (~ 185 Jahre alt), Birken-Bestände (Betula<br />
pendula, ~ 90 Jahre alt) und Erlen-Wälder (Alnus glutinosa, ~ 80 Jahre alt) vor.<br />
Nach Osten wird das NSG durch die Grundmoränenplatte begrenzt, die hier unter die<br />
holozänen Decksedimente abtaucht und überwiegend einen Laub-Mischwald aus Esche<br />
(Fraxinus excelsior, ~ 115 Jahre alt), Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) und Buche (~ 90<br />
Jahre alt) trägt (alle Altersangaben aus Datenspeicher Wald, Forstamt Jägerhof).<br />
Für die Gegend um Lanken lassen sich Spuren menschlicher Besiedlung seit der Steinzeit<br />
nachweisen. Die wechselvolle Geschichte schlug sich auch in der Nutzung des Gebietes<br />
nieder und ist in verschiedenen Bereichen bis heute <strong>sichtbar</strong>. Größere Areale wurden<br />
zeitweise als Weideflächen genutzt (vgl. Schwedische Matrikelkarte, 1694; Preußisches<br />
Urmesstischblatt, 1835). Ein Teil der Eichenbestände geht auf diese Phase <strong>zur</strong>ück. Für die<br />
erste Hälfte des 19. Jahrhunderts sind Entwässerungsgräben belegt (vgl. Preußisches<br />
Urmesstischblatt, 1835) und spätestens dann begann auch die Anpflanzung von Nadelholz<br />
im Gebiet. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts weisen größere Bereiche Lankens solche<br />
Bestände auf (vgl. Neumessungskarte, 1908).<br />
Lanken wurde 1954 zum Naturschutzgebiet erklärt und im Jahr 2003 an die <strong>Michael</strong>-<br />
<strong>Succow</strong>-<strong>Stiftung</strong> zum Schutz der Natur übertragen. Das Gebiet ist seiner eigendynamischen<br />
Entwicklung überlassen, anthropogene Eingriffe sind lediglich in Form von<br />
Impulsmaßnahme vorgesehen. Sie bestehen in der Stabilisierung des<br />
Landschaftswasserhaushaltes durch Verschluss der Entwässerungsgräben, der im Januar<br />
2006 erfolgte, sowie der Entnahme der gebietsfremden Nadelbaumarten. Diese Maßnahmen<br />
werden neben natürlichen Prozessen, wie z.B. der deutlichen Zunahme von Altbäumen und<br />
Totholz, in den nächsten Jahren den Charakter des Gebietes erheblich verändern.
<strong>Wildnis</strong> als räumlich-biologisches und kulturelles Phänomen<br />
It means something lost and something still present, something remote and at<br />
the same time intimate, something buried into our blood and nerves,<br />
something beyond us and without limit.<br />
2. Der Wert des Verwilderns<br />
11<br />
Edward Abbey<br />
Das von mir erarbeitete naturpädagogische Konzept soll den <strong>Weg</strong> <strong>zur</strong> <strong>Wildnis</strong> <strong>sichtbar</strong><br />
<strong>machen</strong>, es geht folglich darum, den Verwilderungsprozess zu erläutern und den Zweck<br />
eines Schutzgebietes zu verdeutlichen, in dem der Ablauf von Eigendynamik Priorität vor<br />
anderen Naturschutzzielen hat. Da <strong>Wildnis</strong> in unseren Breiten keine Selbstverständlichkeit<br />
ist, muss zunächst geklärt werden, was unter <strong>Wildnis</strong> und <strong>Wildnis</strong>schutz zu verstehen ist.<br />
2.1 <strong>Wildnis</strong> als räumlich-biologisches und kulturelles Phänomen<br />
Natur wird geformt durch das Zusammenwirken zweier dynamischer Prinzipien. Die<br />
Eigendynamik, als das ursprünglich ausschließliche Wirkprinzip der Natur erfährt eine<br />
Gegenkraft durch die menschliche Fähigkeit zu rationaler Zwecksetzung und zielgerichteter<br />
Gestaltung, die fundamental anders ist, als die gestaltende Einwirkung aller anderen<br />
Lebewesen auf ihre Umwelt. Durch diese Zivilisationsdynamik wird aus einer Natur, die<br />
zuvor gleichbedeutend<br />
mit<br />
<strong>Wildnis</strong>dynamik<br />
Absolute<br />
<strong>Wildnis</strong><br />
Relative<br />
<strong>Wildnis</strong><br />
Relative<br />
Kultur<br />
Absolute<br />
Kultur<br />
Abb. 1: Dynamikmodell in Anlehnung an Trommer & Noack (1997)<br />
<strong>Wildnis</strong> war, eine<br />
Natur, die nicht<br />
mehr zwangsläufig<br />
<strong>Wildnis</strong> ist. Sie<br />
differenziert sich in<br />
absolute <strong>Wildnis</strong>,<br />
relative <strong>Wildnis</strong>,<br />
relative Kultur und<br />
absolute Kultur,<br />
wobei sowohl<br />
absolute <strong>Wildnis</strong><br />
als auch absolute<br />
Kultur aus heutiger<br />
Sicht theoretische<br />
Konstrukte sind.<br />
Absolute <strong>Wildnis</strong> bedeutet Natur frei von jeglichem menschlichen Einfluss, im Vergleich<br />
dazu ist vom Menschen beeinflusste <strong>Wildnis</strong> relativ. Ab einem nicht streng definierbaren<br />
Punkt ist der kultivierende Einfluss des Menschen so stark und hat das Prinzip der<br />
Eigendynamik so stark abgewandelt, dass von relativer Kultur oder besser von<br />
Kulturlandschaft gesprochen werden muss. Natur ist somit über den Einfluss der<br />
menschlichen Zivilisationsdynamik zu einem Kontinuum von völlig unbeeinflusst bis völlig<br />
gestaltet geworden.<br />
Neben der Differenzierung in absolut und relativ wird eine zweite Unterscheidung in primär<br />
und sekundär vorgenommen. Sie bezieht sich darauf, ob eine jetzt vorgefundene <strong>Wildnis</strong><br />
schon immer eine solche war oder ob das Gebiet zwischenzeitlich <strong>zur</strong> Kulturlandschaft<br />
gehörte und nun wieder verwildert ist. Eine Verschiebung entlang des Natur-Gradienten in<br />
Richtung absolute primäre <strong>Wildnis</strong> führt zu sekundärer <strong>Wildnis</strong>. Sie kann durch Unterlassen<br />
entstehen, niemals aber durch Tun hergestellt werden. Auf Grund der Nachwirkung früherer<br />
menschlicher Eingriffe ist davon auszugehen, dass sich selbst wenn heute alle weiteren<br />
Einflüsse ausgeschlossen werden könnten, keine Rückentwicklung zu ursprünglicher<br />
Zivilisationsdynamik
12<br />
Wert des Verwilderns<br />
<strong>Wildnis</strong> einstellen würde, sekundäre <strong>Wildnis</strong> mithin nicht identisch mit primärer <strong>Wildnis</strong><br />
sein wird (Scherzinger 1997, Küster 1999, S. 37).<br />
Aus den beiden Differenzierungen ergeben sich vier Kombinationen, mit denen <strong>Wildnis</strong><br />
beschrieben werden kann: primär-relativ, primär-absolut, sekundär-relativ und sekundärabsolut<br />
(vgl. These 10 der Vilmer Prozessschutzthesen, Piechocki et.al. 2004).<br />
Primär-absolute <strong>Wildnis</strong> existiert im Zuge anthropogener Stoffeinträge heute nicht mehr,<br />
sekundär-absolute <strong>Wildnis</strong> wird vermutlich niemals existieren. Sie würde entstehen, wenn in<br />
sekundären <strong>Wildnis</strong>gebieten der vorangegangene menschliche Einfluss vollkommen<br />
ausgelöscht und zukünftiger menschlicher Einfluss unterbunden werden könnte. Absolute<br />
<strong>Wildnis</strong>formen müssen als menschenleer verstanden werden.<br />
Dagegen können primär-relative und sekundär-relative <strong>Wildnis</strong> Menschen mit einer<br />
'wildnistauglichen' Kultur beheimaten. Suchanek (2001, S. 71) zitierte den Sprecher einer<br />
indischen Ethniengruppe: „Das Wenige, was heute noch übrig ist [Anm.: Wald in Indien] ist<br />
da, weil wir und nicht-konsumierende Beschützer hier leben aber nicht gierige Nutzer wie<br />
ihr. Das ganze Problem ist im Grunde ein Problem des Lebensstils.“<br />
<strong>Wildnis</strong> ist aber nicht nur ein räumlich-biologisches, sondern zudem ein kulturelles<br />
Phänomen. Gesellschaftliche oder subjektive Wahrnehmungsweisen von Natur produzieren<br />
* „Topos charakterisiert eine<br />
Raumvorstellung, die in der<br />
kollektiven Phantasie einer<br />
Gruppe oder Gesellschaft in<br />
einem bestimmten historischen<br />
Zeitpunkt entsteht. Das<br />
räumlich Erfahrbare wird mit<br />
Wünschen, Phantasien,<br />
Hoffnungen und Ängsten zu<br />
einem landschaftlichen<br />
Gesamtentwurf verbunden (...).“<br />
(Stremlow & Sidler 2002, S. 28)<br />
innere <strong>Wildnis</strong>bilder, die Werthaltungen, Einstellungen,<br />
Sehnsüchte, Utopien, Ängste und dergleichen repräsentieren.<br />
Sie spiegeln als Topos * die kulturelle Identität des<br />
Betrachters.<br />
Wie vielseitig diese Wahrnehmungen sind, zeigt die Literatur-<br />
und Printmedienanalyse von Stremlow & Sidler (2002), der<br />
zufolge <strong>Wildnis</strong> als Raum des Mythischen, als Raum des<br />
Schreckens und der Bedrohung, als Raum des Idyllischen, als<br />
Lebensraum, als Selbsterfahrungsraum, als utopisches<br />
Modell, als beseelter Ort, als Forderung und als<br />
Forschungsobjekt gesehen wird (Bauer 2005, S. 32).<br />
In der gesellschaftlichen Vorstellung wird der Begriff <strong>Wildnis</strong><br />
zumindest in Mitteleuropa besonders häufig mit den Naturraumtypen Wald und Gebirge<br />
verbunden (Bibelriether 1998, Bauer 2005). Neben der Prägung des Bildes von <strong>Wildnis</strong><br />
durch die Medien, insbesondere das Aufgreifen der Themen Regenwaldabholzung und<br />
Waldsterben in den 1980er Jahren, lässt sich dies auch sprachgeschichtlich erklären. Der<br />
Terminus formte sich an den naturräumlichen Gegebenheiten. Aus Sicht des Land<br />
bebauenden Menschen war <strong>Wildnis</strong> das davon noch unberührte Gebiet, was in Mitteleuropa<br />
überwiegend Wälder oder unwegsame Gebirgsregionen waren. Seine etymologischen<br />
Wurzeln liegen entsprechend im altgermanischen 'walthus', althochdeutschen 'wald' und<br />
mittelhochdeutschen 'walt'. Noch in Zedlers Universallexikon von 1747 wird unter '<strong>Wildnis</strong>'<br />
auf die Begriffe 'Wald' und 'Wüste' verwiesen. Wald wird als ein Ort beschrieben, an dem<br />
keine Sittlichkeit herrscht, weshalb alles was rau, unbändig, eigensinnig, ungezogen,<br />
unfreundlich ist wild genannt wird (Stremlow & Sidler 2002, S. 22ff.). Besonders häufig<br />
taucht <strong>Wildnis</strong> in biblischen Texten im Sinne von 'Wüstenei' auf, arides, unfruchtbares,<br />
unbewohnbares Land ist gleichbedeutend mit gottloser oder gottverlassener <strong>Wildnis</strong> (Unger<br />
2003). Verlassene Siedlungen wurden als 'Wüstung' bezeichnet, sie sind menschenleer, die in<br />
ihnen angelegte Ordnung verfällt, in diesem Zusammenhang spricht man auch heute noch<br />
von 'Verwüstung'. Die Vorstellung von wiederkehrender (sekundärer) <strong>Wildnis</strong> ist also nicht<br />
neu.<br />
Eine weitere, fest verwurzelte Assoziation im Zusammenhang mit <strong>Wildnis</strong> ist die<br />
Abwesenheit von Menschen und deren Spuren (Bibelriether 1998, Bauer 2005), obwohl<br />
entsprechende Gebiete auch früher keineswegs immer absolut frei von menschlichen<br />
Wirkungen gewesen sein dürften. Zwar gab es bis ins 9. Jahrhundert in Mitteleuropa große<br />
geschlossene Waldgebiete, aber auch in ihnen lebten von der Gesellschaft ausgegrenzte<br />
Menschen. Ebenso waren die neu entdeckten <strong>Wildnis</strong>se des 16. und 17. Jahrhunderts alles
<strong>Wildnis</strong>leitbilder<br />
andere als menschenleer. Während aus heutiger Sicht solche Regionen als relative <strong>Wildnis</strong><br />
bezeichnet werden würden, wurden bis in die jüngste Vergangenheit die darin lebenden<br />
Menschen als Un-Menschen oder Wilde abqualifiziert.<br />
<strong>Wildnis</strong> als kulturelles Phänomen zu begreifen ist für die Praxis entscheidend, z.B. um<br />
Ressentiments gegen <strong>Wildnis</strong>schutz zu verstehen und ihnen entsprechend begegnen zu<br />
können.<br />
2.2 <strong>Wildnis</strong>leitbilder<br />
Jede <strong>Den</strong>k- und Kulturform benötigt ihre eigenen kompatiblen Umgangsweisen mit Natur<br />
bzw. <strong>Wildnis</strong> (Jessel 1997), daher unterscheiden sich amerikanisches und europäisches<br />
<strong>Wildnis</strong>leitbild.<br />
2.2.1 Sekundäre <strong>Wildnis</strong> in Europa<br />
In Europa fanden die Menschen ihre Identität in der durch das Wirken von Generationen<br />
geschaffenen regionalen Kulturlandschaft. Sie verstanden ihre Tätigkeit als<br />
Vervollkommnung des Landes. Erst Kultivierung bringt die darin verborgenen Anlagen <strong>zur</strong><br />
Blüte. Der Mensch ist Schöpfer und Beschützer dieser - seiner - Natur. Ihre Dynamik wird<br />
unterdrückt, gesteuert oder eingespannt. Natur wird geordnet in nützlich und schädlich.<br />
Schädliches, wie z.B. die konkurrierenden und bedrohlichen Großsäuger Wolf, Bär und<br />
Luchs, wird ausgemerzt. <strong>Wildnis</strong> wurde in Europa über die Jahrhunderte in Handarbeit<br />
besiegt. Begrenzte der Mangel an Möglichkeiten zunächst die Intensität der<br />
Kultivierungstätigkeiten, so zerstörte seit Beginn der Industrialisierung Maschineneinsatz<br />
das bis dahin vorhandene Bild von Harmonie und Idylle in der Landschaft. Während der<br />
aufkommende Naturschutz zunächst versucht, landschaftliche Eigenart als Spiegel<br />
kultureller Eigenart zu konservieren (vgl. Trommer 1997, Ziegler 2002), entsteht - inspiriert<br />
durch die amerikanische Geschichte - in jüngerer Zeit ein <strong>Wildnis</strong>leitbild für Europa. Da es<br />
hier keine zu schützende primäre <strong>Wildnis</strong> mehr gibt, kann nur Raum <strong>zur</strong> Verfügung gestellt<br />
werden, in dem sich sekundäre <strong>Wildnis</strong> neu etabliert. Dies sollte sowohl groß- als auch<br />
kleinräumig geschehen und die <strong>Wildnis</strong>fläche über Nutzungsaufgabe (verwildern) vermehrt<br />
werden. Auch <strong>Wildnis</strong> auf Zeit (Brachen, Altholzinseln) ist eine Option im europäischen<br />
<strong>Wildnis</strong>schutz (Jessel 1997).<br />
2.2.2 Relative <strong>Wildnis</strong> in Amerika<br />
Als die europäischen Siedler sich in die neue Welt aufmachten, nahmen sie ihre Vorstellung<br />
von Kultur und kultureller Identität mit. Sie trafen auf eine relative <strong>Wildnis</strong> von<br />
gigantischem Ausmaß. Es scheint mir nur verständlich, dass die Zivilisationsdynamik durch<br />
die Auseinandersetzung mit dieser <strong>Wildnis</strong> eine rasante Beschleunigung erfuhr, statt<br />
Kulturlandschaft nach dem Vorbild Europas entstanden Extreme. <strong>Wildnis</strong> wurde nie<br />
vollständig kultiviert, stattdessen kurzerhand in die kulturelle Identität integriert. Das diente<br />
nicht zuletzt auch dazu, sich gegen das alte Europa abzugrenzen.<br />
Die beiden wichtigsten Instrumente <strong>zur</strong> Umsetzung des <strong>Wildnis</strong>schutzgedankens in Amerika<br />
sind Nationalpark und <strong>Wildnis</strong>gebiet.<br />
Die Nationalparkidee entsprach im Grunde einer Strategie der Regionalentwicklung.<br />
Nationalparke waren zunächst spektakuläre Kulisse für Luxustouristen, dann exklusive<br />
Jagdreviere und sind heute das Campingparadies des automobilen Menschen (Trommer<br />
1992, S. 33). Ökologische Begründungen wurden erst nachträglich eingefügt (Trommer<br />
1997), vorher wurde massiv in die Ökologie der betroffenen Räume eingegriffen, um die<br />
jeweiligen Nutzungsinteressen zu befriedigen. Im Gegensatz dazu ist die kommerzielle<br />
Nutzung von <strong>Wildnis</strong>gebieten ausgeschlossen. <strong>Den</strong>noch schaffen auch sie eine 'Freizeit-<br />
Allmende', die dem Naturerleben des urbanen Bürgers, seiner körperlicher Herausforderung<br />
und seelisch-geistigen Inspiration dient (Trommer & Noack 1997, S. 48). Laut US-<br />
Amerikanischem Wilderness Act von 1964 ist eine <strong>Wildnis</strong> wie folgt definiert: „A<br />
13
14<br />
Wert des Verwilderns<br />
wilderness, in contrast with those areas where man and his own works dominate the<br />
landscape, is hereby recognised as an area where the earth and its community of life are<br />
untrammelled by man, where man himself is a visitor who does not remain. (...)“ (Trommer<br />
1992, S. 82). Per Definition zielt das amerikanische <strong>Wildnis</strong>leitbild auf den Schutz absoluter<br />
<strong>Wildnis</strong>, de facto wurden und werden aber relative <strong>Wildnis</strong>se geschützt, weshalb das<br />
Leitbild in seiner Entvölkerung voraussetzenden Radikalität nicht haltbar ist. Die weiten,<br />
menschenleeren Flächen, die 'in contrast with those areas<br />
where man and his own works dominate the landscape'<br />
stehen, von denen im Wilderness Act die Rede ist, waren<br />
nur wenige Jahre zuvor noch von Millionen von Menschen<br />
bevölkert * .<br />
Realitätsnäher ist die 1994 von der IUCN – Welt-Naturschutz-Organisation – aufgestellte<br />
Definition für ein <strong>Wildnis</strong>gebiet als „ein ausgedehntes, ursprüngliches oder leicht<br />
verändertes Landgebiet und/oder marines Gebiet, das seinen natürlichen Charakter bewahrt<br />
hat, in dem keine ständigen oder bedeutenden Siedlungen existieren und dessen Schutz und<br />
Management dazu dienen, seinen natürlichen Zustand zu erhalten“ (Trommer & Noack<br />
1997, S. 124).<br />
Während also der amerikanische <strong>Wildnis</strong>schutzgedanke darauf abzielt, noch vorhandene<br />
relative <strong>Wildnis</strong> zu erhalten, muss er in Europa darauf ausgerichtet werden, sekundäre<br />
<strong>Wildnis</strong> wieder zu etablieren. In beiden Fällen entstehen neue Abhängigkeiten. <strong>Wildnis</strong> wird<br />
<strong>zur</strong> Kulturaufgabe in doppelter Hinsicht. Einerseits benötigt Zivilisation sie als<br />
Ausgleichsraum, andererseits ist ihr Fortbestehen von menschlichen Entscheidungen<br />
abhängig.<br />
2.3 Prozessschutz<br />
„Prozessschutz bedeutet das Aufrechterhalten natürlicher Prozesse (ökologischer<br />
Veränderungen in Raum und Zeit) in Form von dynamischen Erscheinungen auf der Ebene<br />
*<br />
Hemerobie (Grad des Kultureinflusses) ist ebenso<br />
wie Naturnähe ein Kriterium <strong>zur</strong> Bestimmung der<br />
Natürlichkeit eines Untersuchungsobjekts.<br />
Naturnähe und retrospektivisch ausgerichtete<br />
Hemerobie ziehen zu diesem Zweck einen Vergleich<br />
zwischen aktuellem Zustand und einem<br />
historischen, ursprünglichen Zustand, die Naturnähe<br />
vergleicht das Vegetationsbild, die Hemerobie<br />
untersucht die Wirkung kultureller Eingriffe. Sie<br />
kommen auf verschiedenem <strong>Weg</strong>e zum gleichen<br />
Ergebnis. Aktualistisch ausgerichtete Hemerobie<br />
vergleicht den aktuellen mit einem durch<br />
Selbstregulation bestimmten zukünftigen Zustand.<br />
Irreversible Änderungen im Standortpotenzial<br />
werden in diesem Konzept integriert. In allen Fällen<br />
entstehen Abstufungen entlang eines Gradienten<br />
(vgl. Kowarik 1999).<br />
Demnach könnte man Prozessschutz als Schutz von<br />
<strong>Wildnis</strong> verstehen, denn <strong>Wildnis</strong> ist die Ausprägung<br />
von Natur, in der das 'dynamische, sich selbständig<br />
entwickelnde Geschehen' in besonderem Maße<br />
stattfindet. Scherzinger (1997, S. 39f.) sieht im<br />
Prozessschutz die einzige Chance, im Jahrtausende<br />
lang überformten Mitteleuropa großflächige<br />
* Man schätzt, dass der<br />
Eroberung Nordamerikas 11<br />
Millionen Menschen zum Opfer<br />
fielen (Suchanek 2001, S. 16)<br />
von Arten, Biozönosen, Bio- und Ökotopen,<br />
Ökosystemen und Landschaften.“ Als<br />
natürliche Prozesse werden alle selbständig<br />
ablaufenden Prozesse verstanden, die in<br />
ökologischen Systemen zu niedrigeren<br />
Hemerobiestufen * führen (Jedicke 1999, S.<br />
14).<br />
„Begreift man die Natur als wesentlich<br />
dynamisches, sich selbständig<br />
entwickelndes Geschehen, so kann man den<br />
Prozessschutz als diejenige Leitlinie des<br />
Naturschutzes ansehen, die dem Wesen der<br />
Natur am ehesten entspricht und in diesem<br />
Sinne 'naturgemäß' ist.“ (1. Vilmer These<br />
zum Prozessschutz, Piechocki et al. 2004).<br />
** Scherzinger (1997) nennt als<br />
Naturschutzleitlinien Landschaftsschutz,<br />
Artenschutz, Biotopschutz, Sicherung von<br />
Erholungsräumen und Prozessschutz, die<br />
jeweils in verschiedenem Grad dazu<br />
geeignet sind, Teilziele im Naturschutz wie<br />
z.B. Humanbiotope, Arten,<br />
Lebensgemeinschaften, Naturerfahrung,<br />
Prozesse und <strong>Wildnis</strong> umzusetzen.
Prozessschutz<br />
Naturlandschaften mit <strong>Wildnis</strong>charakter zu entwickeln ** . Es gibt allerdings diverse<br />
Auffassungen von Prozessschutz, die nicht alle <strong>Wildnis</strong> zum Ziel haben.<br />
2.3.1 Auffassungen von Prozessschutz<br />
Von den vier grundsätzlichen Naturschutzstrategien nach Scherzinger *** sind die beiden<br />
dynamischen Varianten gleichbedeutend mit Prozessschutz.<br />
Dynamisch-abschirmende Strategie<br />
Für Scherzinger kommen abschirmende Strategien nur auf unbeeinflussten Standorten in<br />
Frage. Unter der Prämisse aktualistisch aufgefasster Hemerobie ist es aber ebenso denkbar,<br />
abschirmenden Prozessschutz auch auf anthropogen überformte Standorte anzuwenden.<br />
Dynamisch-gestaltende Strategie<br />
Gestaltung im Zusammenhang mit Prozessschutz bedeutet, dass Wert auf die Naturnähe der<br />
zukünftig ablaufenden Eigendynamik und ihrer Steuerungsgrößen gelegt und versucht wird,<br />
die Nachwirkungen alter, kultureller Einflüsse mittels Impulsmaßnahmen weitgehend<br />
auszuschalten. Damit soll eine zuvor anthropogen verursachte Richtungsänderung der nach-<br />
folgenden eigendynamischen<br />
Prozesse <strong>zur</strong>ückgenommen<br />
werden. Streng genommen<br />
beginnt der Prozessschutz erst<br />
nach der Impulsmaßnahme.<br />
Die Autoren der Vilmer Thesen<br />
zum Prozessschutz vertreten<br />
unter Nummer 4 die Ansicht,<br />
dass „Eingriffe <strong>zur</strong> Herstellung<br />
eines natürlichen Startpunkts<br />
der Entwicklung“ „begründungspflichtige<br />
(!) Ausnahmen<br />
von der Regel, nicht in das<br />
Naturgeschehen einzugreifen“,<br />
bleiben sollten (Piechocki et al.<br />
2004). Sie merken an, dass<br />
diese Ausnahme in der Praxis<br />
des Prozessschutzes <strong>zur</strong> Regel<br />
zu werden scheint.<br />
***<br />
Strategien im Naturschutz nach Scherzinger (1990, aus Bauer<br />
2005, S. 18)<br />
statisch-abschirmend: Erhalt des Ist-Zustandes, Abschirmung<br />
von Außeneinflüssen, (Zucht, Zoo, Botanischer Garten)<br />
statisch-gestaltend: Erhaltung von erwünschten<br />
Sukzessionsstadien durch gezielte Lenkung bzw. Pflege mit<br />
dem Ziel der Erhaltung oder Schaffung hochwertiger<br />
Sekundärbiotope (z.B. hohe Artenvielfalt, seltene Arten)<br />
Beispiel: Mahd<br />
dynamisch-abschirmend (Schutz von <strong>Wildnis</strong>): Sicherung von<br />
Sukzessionsabläufen auf natürlichen Standorten <strong>zur</strong> Bewahrung<br />
unbeeinflusster Lebensgemeinschaften in ihrer natürlichen<br />
Entwicklung. Beispiel: <strong>Wildnis</strong>-Nationalpark<br />
dynamisch-gestaltend (Schutz von <strong>Wildnis</strong>): Sicherung von<br />
Sukzessionsabläufen auf vom Menschen beeinflussten<br />
Standorten <strong>zur</strong> Erhaltung von natürlichen Prozessen, sowie<br />
Wiederinitialisierung von möglichst natürlichen Prozessen<br />
Beispiel: Auenrenaturierung<br />
Eng mit der Frage nach der Legitimation solcher 'Impulsmaßnahmen' hängt die Überlegung<br />
zusammen, ob Prozessschutz als Instrument <strong>zur</strong> Umsetzung einer Zielsetzung verstanden<br />
werden kann oder ergebnisoffen sein muss (Vilmer Thesen 6 und 9, Piechocki et al. 2004).<br />
Jedicke (1999) unterscheidet zwischen integrativen und segregativen Prozessschutzformen.<br />
Integrativer Prozessschutz<br />
'Nutzungsprozessschutz' bzw. Prozessschutz in Nutzungssystemen ist auf den Erhalt von<br />
anthropogen gesteuerten Prozessen ausgerichtet, welche eine Kulturlandschafts-Dynamik<br />
mit positiven Auswirkungen auf Naturschutzziele als Nebeneffekt bedingen, ohne dass<br />
gezielt betriebene Pflegeeingriffe stattfinden. Im Gegensatz zum segregativen Prozessschutz<br />
wird hier zwischen schutzbedürftigen und negativ zu bewertenden Prozessen differenziert.<br />
Er kann der Konservierung von 'Wunschzuständen' entsprechen, wodurch die Ziele<br />
Biodiversität und Nachhaltigkeit erfüllt werden (Jedicke 1999, S. 14). Wie am Beispiel des<br />
Konzepts von Sturm (1993) zu sehen ist, muss integrativ aber keinesfalls die Konservierung<br />
von 'Wunschzuständen' bedeuten.<br />
15
16<br />
Wert des Verwilderns<br />
Segregativer Prozessschutz<br />
Prozessschutz in Nicht-Nutzungsgebieten gilt als Prozessschutz im engeren Sinne. Von<br />
menschlicher Nutzung freie <strong>Wildnis</strong> kann nur über segregativen Prozessschutz geschützt<br />
werden. Er zielt auf den Erhalt anthropogen ungesteuerter Dynamik auf mindestens aktuell<br />
ungenutzten Flächen, umfasst aber auch ungesteuerte Sukzessionsprozesse auf durch den<br />
Menschen veränderten bzw. beeinflussten Standorten. Er setzt konsequenten Verzicht auf<br />
jegliche (stoffliche) Nutzung voraus (Jedicke 1999, S. 14). Die Prozessschutzdefinition von<br />
Scherzinger (1997) beschreibt diesen Typ als „Entfaltung und Sicherung ungeplanter, durch<br />
Menschen weder gestörter noch gelenkter oder nutzungsbedingt beeinflusster<br />
Entwicklungen, wie sie die Systeme im Zusammenwirken abiotischer und biotischer<br />
Naturkräfte prägen“.<br />
Sowohl integrative als auch segregative Formen von Prozessschutz haben ihren Platz<br />
innerhalb eines Systems differenzierter Landnutzung.<br />
Nach der Intensität der erlaubten Management-Maßnahmen lassen sich vier verschiedene<br />
Konzepte unterscheiden, die im Folgenden skizziert werden.<br />
2.3.1.1 Nutzungsprozessschutz - der Mensch als Fixierer von Systemen<br />
integrativ nicht ergebnisoffen bedingt dynamisch-gestaltend, Prozesse selbst dürfen sich nicht<br />
wandeln<br />
intensive Management-Maßnahmen<br />
Dieses Konzept dehnt den Prozessbegriff auf anthropogene Nutzung aus und integriert eine<br />
dynamische Komponente in die Schutzstrategien für traditionelle Kulturlandschaften.<br />
Jedicke (1999) plädiert dafür, die entsprechenden historischen Nutzungsformen als solche zu<br />
erhalten, statt kostenintensive Pflegemaßnahmen vom Naturschutz initiieren zu lassen. Dazu<br />
gehört auch die Schaffung wirtschaftlicher Rahmenbedingungen, z.B. eine regionale<br />
Produktvermarktung. Naturschutz für Kulturlandschaften sollte primär als Nebenprodukt von<br />
Nutzungsprozessen erfolgen. Ähnlich, allerdings zu Gunsten der Pflegemaßnahmen,<br />
argumentiert Potthast: „Die Berücksichtigung des Prozesscharakters der Natur bedeutet<br />
nicht notwendig die Abwendung von der Erhaltung bestimmter Zustände. (...) Genau<br />
diejenigen ökologischen Interaktionen wären zweckmäßig zu sichern, die ein bestimmtes<br />
Muster, eine bestimmte Struktur erzeugen.“ (Potthast 2001, S. 71). Er erweitert die<br />
strukturorientierten Leitbilder konservierenden Naturschutzes um Prozessaspekte wie<br />
Funktion, Interaktion und Veränderlichkeit, d.h. das beispielsweise die Zuwanderung oder<br />
Abwanderung von Arten oder deren nur zeitweises Auftreten zu akzeptieren sind. Diese<br />
Konzeption verfolgt die Erhaltung der Wechselwirkung zwischen Mensch und<br />
nichtmenschlichen Elementen sowie eines bestimmten Zustandes innerhalb bestimmter<br />
Toleranzgrenzen. Der langfristige Wandel des Systems und damit auch der Wandel der<br />
ablaufenden Prozesse wird aber unterdrückt. Nach meinem Dafürhalten zählen derartige<br />
bedingt dynamisch-gestaltende Naturschutzstrategien nicht zum Prozessschutz. Ungeachtet<br />
dessen haben sie ihre Berechtigung, bspw. um Ersatzbiotope zu schaffen, Kulturbiotope zu<br />
erhalten oder ästhetische Landschaftsbilder zu bewahren.<br />
2.3.1.2 Prozessschutz als Bewirtschaftungsstrategie - der Mensch als 'Trittbrettfahrer'<br />
integrativ theoretisch<br />
ergebnisoffen,<br />
in Praxis<br />
Kompromisse<br />
Grundsätzlich dynamisch-abschirmend mit dynamisch-gestaltenden<br />
Elementen<br />
Nutzung natürlicher Prozesse und Nutzungseingriffe als<br />
Management-Maßnahmen<br />
Diese Ausrichtung geht auf ein von Sturm entwickeltes Waldbaukonzept <strong>zur</strong>ück, das<br />
versucht, natürliche Prozesse als Schutzobjekte in das Nutzungssystem Wald zu integrieren.<br />
Sturm sieht darin die Eckpfeiler naturschutzgerechter Waldbewirtschaftung. Auf gleicher<br />
Fläche sollen zeitgleich ökologisch nachhaltige Erzeugung des Rohstoffes Holz und
Prozessschutz<br />
prozessorientierter Naturschutz stattfinden. Als Referenz dienen ungenutzte Wälder, die als<br />
zufallsbeeinflusste, multivariable Sukzessionsmosaike beschrieben werden. Ziel ist es, diese<br />
Mosaike und alle darin vorkommenden Arten zu schützen, ihre Entwicklung und<br />
Veränderung im Rahmen der Holznutzung nicht wesentlich zu beeinflussen sowie Methoden<br />
und Zielsetzungen der Waldwirtschaft der Naturdynamik fortlaufend anzugleichen (Sturm<br />
1993, S. 11). Um die angestrebte Erhaltung, Entwicklung und selbständige Entstehung<br />
naturnaher, dynamischer Waldökosysteme zu gewährleisten, müssen entsprechende<br />
Entwicklungsbedingungen geschützt werden. Das meint eine anthropogen ungestörte<br />
Konkurrenzdynamik (keine Förderung und Unterdrückung von Arten) und das Zulassen des<br />
Zufalls bzw. von Störungen wie Windwurf, Schneebruch, Brand, Insektenkalamitäten und<br />
das Überflutungsregime von Auen. Weiterhin wird nicht, wie im Naturschutz häufig der Fall,<br />
Wert auf absolute Diversität gelegt, sondern statt dessen auf die im Laufe der Sukzession<br />
mitunter stark schwankende relative Diversität.<br />
Dieser für Nutzungssysteme richtungsweisende Ansatz entspricht im Grundsatz der<br />
Forderung, die Bedürfnisse des Menschen an die Naturgegebenheiten anzupassen. Sturm legt<br />
nahe, dass es in Europa eine relativ-sekundäre, vom Menschen genutzte <strong>Wildnis</strong> geben kann.<br />
In der Praxis wird dieser Gedanke aber durch Kompromisse stark relativiert, da die<br />
spezifischen Nutzenfunktionen von Wäldern für den Menschen nicht automatisch mit dem<br />
Ablauf selbst gesteuerter Prozesse vereinbar sind. Ein Waldbrand z.B. läuft der<br />
Holzproduktion entgegen. Dem Ideal, aus einem sich selbst überlassenen Waldökosystem<br />
nur den sich jeweils anbietenden Nutzen abzuschöpfen, steht in der Realität der Wunsch<br />
nach einem bestimmten Holzsortiment oder einer bestimmten Holzqualität entgegen, zu<br />
dessen Produktion auch hier gezielt in die Prozessabläufe eingegriffen wird. Obwohl es Knut<br />
Sturm war, der den Prozessschutzbegriff geprägt hat, halte ich eine Bezeichnung wie<br />
'Prozessorientierter Waldbau' für dieses Konzept daher für angebrachter.<br />
2.3.1.3 Prozessschutz als Schutz ökosystemarer Funktionen - der Mensch als Ingenieur<br />
segregativ Impulse<br />
zielorientiert,<br />
danach<br />
ergebnisoffen<br />
Dynamisch-gestaltend, Selbstregulation auf möglichst naturnahen<br />
Standorten<br />
Impulsmaßnahmen bzw. Renaturierung als Management-<br />
Maßnahmen<br />
Für Scherzinger ist der Prozessschutz Instrument für Arten- und Habitatschutz. Die<br />
Konzepte Artensicherung und Prozessschutz lassen sich zu einem Gesamtkonzept verbinden,<br />
da Naturnähe von Prozessen eine Funktion der Naturnähe der Artenausstattung ist und<br />
umgekehrt, wobei keine fixe Artenzahl in Zeit und Raum anvisiert, sondern der sich mit<br />
Prozessverläufen einstellende Wandel berücksichtigt wird (Scherzinger 1997, S. 35f).<br />
Renaturierung bzw. Impulssetzungen werden als zentrales Element dieser Konzeption<br />
aufgefasst und wie folgt begründet: Jede Handlung des Menschen setzt Impulse für Prozesse.<br />
Sich automatisch und von selbst einstellende Prozesse sind daher zu einem gewissen Grad<br />
Reaktionen des Systems auf aktuelle (gebietsübergreifende) menschliche Einflüsse bzw. auf<br />
die nachhaltige Beeinflussung der Standorte durch die vorangegangene Nutzung. Die<br />
Reaktionsprozesse sind als solche natürlich, aber dennoch keineswegs automatisch als<br />
naturnah einzustufen bzw. nach dem Prozessschutzkonzept zu schützen. Entscheidend für<br />
die Naturnähe eines Prozesses ist für Scherzinger die Naturnähe seiner abiotischen und<br />
biotischen Steuergrößen. Aus dem allgegenwärtigen Einfluss des Menschen ergibt sich das<br />
Paradox, dass man die Möglichkeit für ungelenkte Prozesse nur dann erhält, wenn man den<br />
auf sie einwirkenden menschlichen Einflüssen weitere Impulse entgegensetzt. Der<br />
Fremdsteuerung soll so weit wie möglich entgegengewirkt werden. Daher ist Prozessschutz<br />
nicht gleichbedeutend mit 'nichts mehr tun', sondern muss sich der Renaturierung als Initial-<br />
Management bedienen (Scherzinger 1997, S. 35ff.). Typische Beispiele sind Vernässungen,<br />
Rückbau von Dämmen und Begradigungen, Entnahme von Fremdländern und<br />
Schalenwildmanagement.<br />
17
18<br />
Wert des Verwilderns<br />
Sekundäre <strong>Wildnis</strong> in Mitteleuropa wird immer dann keine hohe Naturnähe erreichen, wenn<br />
irreversible anthropogene Eingriffe zu Grunde liegen, weiterhin anthropogene Steuerung<br />
dominiert (begradigte Flusssysteme) oder das natürliche Entwicklungspotenzial fehlt<br />
(Mutterbäume für Wiederbewaldung) (Scherzinger 1997, S. 42). Soweit aber die Naturnähe<br />
durch Management erhöht werden kann, sollte darauf nicht verzichtet werden (ebd. S. 44).<br />
Insofern benutzt Scherzinger als Kriterien für Natürlichkeit Naturnähe und reziprok<br />
aufgefasste Hemerobie.<br />
2.3.1.4 Prozessschutz als absolutes Nichtstun – der Mensch als Beobachter<br />
segregativ ergebnisoffen Dynamisch-abschirmend, Selbstregulation unabhängig von der Naturnähe<br />
des Standortpotenzials<br />
Keinerlei Management-Maßnahmen<br />
Kritik an der soeben erläuterten Prozessschutzposition setzt an deren Anschubs- oder<br />
Impulsmaßnahmen an. Als Beispiel sei die Argumentation von Joosten (1997 und April<br />
2006 mündlich) aufgeführt, der sich mit der prinzipiellen Natur menschlicher Handlung im<br />
* Zusammenhang mit Naturschutz auseinandersetzt. Joosten<br />
Natürlichkeit wird gleichgesetzt<br />
geht davon aus, dass eine menschliche Handlung niemals<br />
mit spontaner Entwicklung und als<br />
die Natürlichkeit<br />
Null-Punkt eines Gradienten von<br />
Künstlichkeit verstanden. Sie<br />
selbst wird als nicht abstufbar<br />
aufgefasst.<br />
* eines Naturelements erhöhen kann, weil<br />
jede bewusste menschliche Handlung, selbst der bewusste<br />
Verzicht auf Handlung, einen kulturellen Akt darstellt und<br />
somit unabhängig von ihrer Intention immer die<br />
Künstlichkeit des betroffenen Naturelements erhöht. Er<br />
unterscheidet drei Formen menschlicher Handlung, die dies in zunehmend stärkerem Maße<br />
tun.<br />
1. Bewusst nichts Tun (Handlungen unterlassen)<br />
2. Bewusst einmal Tun (Einmalige Eingriffe)<br />
3. Bewusst dauernd Tun (Regelmäßige Eingriffe)<br />
Ein weiterer Einwand betrifft die Intention von Impulsmaßnahmen. Es wird davon<br />
ausgegangen, dass sie eine bestimmte Vorstellung des Menschen verwirklichen bzw. den<br />
eigendynamischen Abläufen eine Wunsch-Richtung vorgeben sollen. Somit könne ein<br />
solcher Prozessschutz nicht wirklich ergebnisoffen sein, sondern lenke die Entwicklung ganz<br />
gezielt, was die Spontaneität einschränkt und wiederum die Künstlichkeit erhöht (s.o.).<br />
Außerdem wird die Auswahl eines bestimmten historischen Referenzzustands als<br />
Ausgangspunkt für künftige eigendynamische Entwicklungen kritisiert. Welcher vorherige<br />
Zustand wäre beispielsweise herzustellen, ab dem die Entwicklung selbstgesteuert ablaufen<br />
darf und nach welchen Gesichtspunkten wird er ausgewählt?<br />
Diese kritischen Anmerkungen könnten Basis eines radikalen Prozessschutzansatzes sein,<br />
der jegliche anthropogenen Eingriffe in ein System ablehnt und vergangene Eingriffe als<br />
Rahmenbedingungen für die zukünftig ablaufende spontane Entwicklung akzeptiert. Ein<br />
solches Konzept stützt sich als Kriterium für Natürlichkeit auf aktualistisch aufzufassende<br />
Hemerobie.<br />
2.3.2 Umweltethische Begründungen<br />
Grundsätzlich unterscheidet man in der Umweltethik die anthropozentrische von<br />
nichtanthropozentrischen Positionen. Der wesentliche Unterschied liegt darin, dass die<br />
Anthropozentrik direkte moralische Pflichten nur gegenüber Menschen kennt, während<br />
nichtanthropozentrische Positionen diese auch auf andere natürliche Entitäten ausdehnen.<br />
Mithin variiert die Größe der moralischen Gemeinschaft.<br />
2.3.2.1 Anthropozentrische Prozessschutzbegründung<br />
Aus anthropozentrischer Sicht ist Prozessschutz eine von mehreren gleichrangigen Leitlinien<br />
im Naturschutz. Er findet seine Rechtfertigung im Nutzen, den er für Menschen nach sich
Prozessschutz<br />
zieht, denn aus Nutzen lassen sich Werte ableiten, deren Berücksichtigung Sinn moralischen<br />
Verhaltens ist. Bei auf das Wohl des Menschen ausgerichteten Prozessschutzbegründungen<br />
können diese Werte instrumenteller oder inhärenter Natur sein. Intrinsische Werte von Natur<br />
spielen keine Rolle (siehe 2.4.1. Wertkategorien). Hampicke (1999, S. 89) argumentiert, dass<br />
<strong>Wildnis</strong> schon allein aus Respekt für die Minderheit von <strong>Wildnis</strong>fans in einem<br />
Minimalbestand erhalten werden muss. <strong>Wildnis</strong>schutz findet dann für Menschen statt, denen<br />
etwas an <strong>Wildnis</strong> liegt, die Sehnsucht nach <strong>Wildnis</strong> haben oder ihre Persönlichkeit an ihr<br />
bilden wollen. „In eudaimonistischer Perspektive [Anm.: im Hinblick auf die Grundzüge<br />
eines guten menschlichen Lebens] ist der Prozessschutz eine dem Landschaftsschutz, dem<br />
Arten- und Biotopschutz sowie dem Schutz der Umweltmedien durchaus ebenbürtige<br />
Leitlinie des Naturschutzes.“ (7. Vilmer These zum Prozessschutz, Piechocki et al. 2004).<br />
Prozessschutz im Sinne von <strong>Wildnis</strong>schutz trägt dazu bei, Verpflichtungen nachzukommen,<br />
die uns aus Gründen der Gerechtigkeit erwachsen. Intergenerationelle Gerechtigkeit<br />
verpflichtet uns, die Werte von <strong>Wildnis</strong> für zukünftige Generationen zu erhalten,<br />
intragenerationelle Gerechtigkeit erfordert, dass wir nicht von anderen Völkern<br />
<strong>Wildnis</strong>schutz verlangen, selbst aber nicht dazu bereit sind. Die Wälder der temperierten<br />
Laubwaldzone sind durch menschliches Wirken zu 75% zerstört, die verbliebenen 25% sind<br />
die am meisten durch den Menschen veränderten Wälder der Erde. Die Entwicklung<br />
sekundärer Urwälder in Europa ist daher auch der Glaubwürdigkeit wegen erforderlich<br />
(Bibelriether 1998).<br />
Grundsätzlich implizieren instrumentelle und inhärente Nutzwerte deren Verfügbarkeit.<br />
Wenn mit anthropozentrischen Werten für den Schutz von <strong>Wildnis</strong> argumentiert wird, setzt<br />
das voraus, dass die Abschöpfung dieser Werte mit dem Schutzzweck vereinbar ist. Eine<br />
ausführliche Darstellung erfolgt im Kapitel 2.4 Wert von <strong>Wildnis</strong> und Verwildern.<br />
2.3.2.2 Holistische Begründung für Prozessschutz<br />
Das oberste Prinzip des pluralistischen Holismus ist, dass alle natürlichen Entitäten,<br />
Naturwesen wie Gesamtsysteme, als Selbstzwecke zu achten und deshalb so wenig und<br />
schonend wie möglich zu instrumentalisieren sind. Natur gilt als prinzipiell unverfügbar, wer<br />
sie nutzen will, muss dies begründen. In der Praxis relativiert sich dieser Grundsatz der<br />
Nicht-Einmischung <strong>zur</strong> Verpflichtung zu minimaler Einmischung. Diese gilt für jeden,<br />
immer und überall. Für den pluralistischen Holismus ist Prozessschutz ein grundsätzliches<br />
Handlungsprinzip. Im Naturschutz ist der Einsatz anderer Naturschutzleitlinien<br />
begründungspflichtig.<br />
Es liegt in der Natur von Grundsätzen, dass sie nur prima facie gelten, es also Umstände gibt,<br />
unter denen von ihnen abgewichen werden darf oder sogar muss. Beim grundsätzlichen<br />
Prinzip der Nicht-Einmischung ist dies unter anderem immer dann der Fall, wenn es um die<br />
Verteidigung eines menschlichen Lebens geht. In den vom Menschen geschaffenen<br />
Kulturlandschaften zählt außerdem die Sicherstellung grundlegender menschlicher<br />
Bedürfnisse dazu, vorausgesetzt, das Prinzip der Verhältnismäßigkeit wird gewahrt. Das<br />
bedeutet, dass randständige Interessen des Menschen nicht auf Kosten essentieller Interessen<br />
anderer Arten erfüllt werden dürfen. Ebenfalls erlaubt ist die Gewährleistung der Standards<br />
der Kultur und der Humanität, wobei hier das Prinzip des kleinsten moralischen Übels <strong>zur</strong><br />
Anwendung kommen muss, d.h. diese nicht essentiellen Bedürfnisse des Menschen müssen<br />
auf die denkbar schonendste Art umgesetzt werden.<br />
In Nationalparken und Naturschutzgebieten sind zwei weitere Ausnahmen vorstellbar. Wenn<br />
Prozessschutz zum Aussterben einer Art auf überregionaler Ebene führen würde, sind<br />
Eingriffe zu ihren Gunsten zulässig.<br />
Der zweite Punkt entspricht einer Bewertung von Impulsmaßnahmen aus holistischer Sicht:<br />
Die Korrektur von als falsch erkannten menschlichen Handlungen ist – sofern machbar –<br />
geboten. Voraussetzung ist, dass die damit verbundenen neuen Beeinträchtigungen der Natur<br />
nicht größer sind als die alten, die die Eingriffe auszugleichen versuchen. Daher spielt die<br />
Zeit, die seit dem als falsch erkannten Eingriff vergangen ist, eine entscheidende Rolle.<br />
19
20<br />
Wert des Verwilderns<br />
Eine Handlung ist um so negativer zu bewerten, je stärker sie die Selbstentfaltung des<br />
Systems beeinträchtigt bzw. in der Konsequenz gleichbedeutend mit Fremdsteuerung ist. Die<br />
Intention des Korrektureingriffs ist die Aufhebung von menschlichem Einfluss bzw.<br />
menschlicher Zwecksetzung (Restitution), wobei das Augenmerk einzig auf die vergangene<br />
bewusst kultivierende Handlung gerichtet ist, deren Wirkung minimiert oder neutralisiert<br />
wird (minus mal minus ist plus). Dahinter steckt keine Zielvorstellung im Sinne eines<br />
erwünschten Idealzustands oder Idealsystems, es ist nicht als Anstoß einer gewünschten<br />
Entwicklungsrichtung zu verstehen. Prozessschutz aus holistischer Motivation heraus ist<br />
ergebnisoffen. Ein Verzicht auf Restitution unter den genannten Voraussetzungen käme der<br />
Weigerung <strong>zur</strong> Übernahme von Verantwortung für vergangene Handlungen gleich (Gorke<br />
2006).<br />
Entgegen der verbreiteten Auffassung, dass im Holismus Prozesse 'an sich' geschützt<br />
werden, werden sie dort als Ausdruck der Selbstentfaltung von Ökosystemen und ihren<br />
Bestandteilen verstanden. Sie stehen somit in Beziehung zu Strukturen und können folglich<br />
auch nur in diesem Zusammenhang geschützt werden (Scherzinger 1997, S.35f.). Das heißt<br />
nicht, dass Prozesse instrumentell aufgefasst werden, diese sind aber keine um ihrer selbst<br />
Willen zu schützende Entitäten.<br />
2.3.2.3 Ökozentrische Begründung (Selbstwert von ökologischen Systemen)<br />
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelte der Forstingenieur Aldo Leopold aus<br />
Überlegungen, die den Zusammenhang von moralischem Handeln und Ökosystemtheorie<br />
betrafen, die so genannte Land-Ethik als einen Leitfaden für die moralisch korrekte<br />
Handhabung von Natur.<br />
Leopold postulierte eine direkte moralische Verantwortung des Menschen gegenüber dem<br />
Land. Eine dahingehende Ausweitung der moralischen Gemeinschaft war in einer, seiner<br />
Meinung nach, evolutionären Entwicklung von Moral bereits angelegt. Nur eine<br />
Landnutzung, die das Wissen über Natur berücksichtigt, kann eine moralisch korrekte<br />
Landnutzung sein. Der menschliche Umgang mit wilder ebenso wie mit kultivierter Natur<br />
muss sich immer an den neusten Erkenntnissen der Ökologie orientieren, weil nur so der<br />
moralischen Pflicht nachgekommen werden kann, eine (Zer-)Störung des Landes zu<br />
verhindern.<br />
Die Handhabung von Land darf sich nicht allein an wirtschaftlichen Maßstäben und<br />
Eigennutz orientieren, sondern muss immer zugleich auch ethische und ästhetische<br />
Gesichtspunkte berücksichtigen. Seine Aussage „Etwas ist dann richtig, wenn es dazu<br />
beiträgt, die Integrität, Stabilität und Schönheit der Natur zu erhalten, es ist falsch, wenn es<br />
das Gegenteil bewirkt“ (Leopold 1992, S. 174) wird heute als oberste Maxime der Landethik<br />
verstanden. Leopolds Ansatz beeinflusste die Entwicklung des <strong>Wildnis</strong>leitbildes in Amerika<br />
maßgeblich und fand Eingang in Gesetzgebung (z.B. Wilderness-Act 1964, vgl. Trommer<br />
1992) und Praxis des <strong>Wildnis</strong>schutzes (z.B. Wildland-Project, vgl. Westra 2001).<br />
Mehrere Philosophen griffen Leopolds Gedankengang auf und bauten ihn zu einer<br />
ökosystemar ausgerichteten Ethik aus. Dabei übertrugen sie individuelle Konzepte wie<br />
Gesundheit (Callicott), Integrität (Westra) und Besitz von Interessen (Johnson) auf das<br />
System als solches, das demnach als intrinsisch wertvoll und moralisch direkt zu<br />
berücksichtigen gilt. In der Ökozentrik ist nicht das Wohl der Individuen im Ökosystem,<br />
sondern das 'Wohl' des Systems als solches der eigentliche moralische Maßstab. Worin<br />
dieses Wohl besteht, wird aus der Naturwissenschaft (Superorganismustheorie etc.)<br />
abgeleitet. Menschliche Handlung wird danach beurteilt, inwieweit sie negativen oder<br />
positiven Einfluss darauf hat.<br />
Ein schwerwiegendes Problem einer solchermaßen auf Erkenntnisse der Ökologie<br />
angewiesenen Ethik liegt in der Umstrittenheit ökologischer Theorien und Parameter wie<br />
Stabilität oder Integrität. Ohne eindeutige naturwissenschaftliche Aussage kann hier im<br />
Grunde auch keine Aussage über den Grad der Moralität einer Handlung getroffen werden,<br />
da nicht mit Sicherheit gesagt werden kann, welcher Art ihr Einfluss überhaupt ist.
Prozessschutz<br />
Ökozentriker können sich für Prozessschutz aussprechen, da vom Menschen ungesteuerte<br />
Prozesse 'Mittel' für das Ökosystem sein können, sein Fortbestehen zu sichern. Andererseits<br />
wird die Stabilität bestimmter kultivierter Ökosysteme nur durch menschliche Aktivitäten<br />
erreicht bzw. können ungestörte Prozesse auch zum Wandel von Ökosystemen führen. Daher<br />
kann der Ökozentriker eben so gut gegen Prozessschutz argumentieren und es als Pflicht des<br />
Menschen ansehen, steuernd einzugreifen.<br />
Hettinger & Throop (1999) plädieren dafür, die traditionellen Parameter der Ökozentrik<br />
durch Wildheit als zentrale intrinsisch wertvolle Eigenschaft zu ersetzen, womit<br />
Ökozentrismus eindeutig zum <strong>Wildnis</strong>schutz bzw. segregativen Prozessschutz aufrufen<br />
würde.<br />
2.3.2.4 Sentientistische Begründung (Selbstwert von leidensfähigen Organismen)<br />
Sentientisten fassen Prozesse instrumentell und mithin Prozessschutz als Instrument auf, mit<br />
dem Verpflichtungen gegenüber leidensfähigen Individuen nachgekommen werden kann.<br />
Folglich können nur solche Prozesse Beachtung finden, die diesen Wesen nutzen. Prozesse<br />
werden als Grundlage des Erhalts von Lebensbedingungen für leidensfähige Organismen<br />
geschützt. Dieses lässt gewisse Parallelen <strong>zur</strong> Umbrella-Species-Strategie (Wilcox 1984)<br />
erkennen.<br />
2.3.2.5 Biozentrische Begründung (Selbstwert für alle lebenden Organismen)<br />
Im Biozentrismus wird die Auswirkung einer menschlichen Handlung auf das Wohl eines<br />
lebenden Organismus bewertet.<br />
Taylor (1986) hat hierfür Entscheidungshilfen aufgestellt, von denen einige als Begründung<br />
für Prozessschutz Verwendung finden können. Die Nicht-Einmischungsregel besagt, dass<br />
der Mensch die Freiheit von Individuen nicht einschränken darf. Das heißt, wilde<br />
Organismen müssen ihr Leben in <strong>Wildnis</strong> führen und die natürlichen Prozesse, die ihr Leben<br />
beeinflussen, müssen ablaufen können. Hilfeleistungen und Impulsmaßnahmen sind aber<br />
dann begründet und verpflichtend, wenn der Mensch Ursache einer Störung war. Das besagt<br />
die Regel der wiederherstellenden Gerechtigkeit. Zur Lösung konkurrierender Ansprüche hat<br />
Taylor Prioritätsprinzipien aufgestellt, von denen das Prinzip verteilender Gerechtigkeit für<br />
<strong>Wildnis</strong>schutz spricht: Lebewesen, mit denen wir nicht im selben Lebensraum koexistieren<br />
können, muss ein separater Raum für ihr Leben <strong>zur</strong> Verfügung gestellt werden.<br />
2.4 Wert von <strong>Wildnis</strong> und Verwildern<br />
2.4.1 Wertkategorien<br />
Einleitend gebe ich eine Erläuterung der drei aus meiner Sicht entscheidenden<br />
Wertkategorien. Diese schließen sich nicht gegenseitig aus, etwas kann einer, zwei oder allen<br />
drei Wertkategorien angehören.<br />
a) Instrumentelle Werte (Nutzwerte)<br />
Etwas besitzt aus Sicht eines wertenden Wesens (Mensch) instrumentellen Wert, wenn es<br />
ihm einen bestimmten Nutzen stiftet. Es ist dann Mittel zum Zweck ('means to an end') oder<br />
Instrument um ein Ziel zu erreichen. Es sind subjektive Werte, denn sie beziehen sich auf<br />
den individuellen Nutzen eines Subjekts, der für jedes Subjekt anders ausfallen kann.<br />
'Subjektiv' ist im Sinne von 'relativ' zu verstehen. Diese Beliebigkeit der subjektiven<br />
Wertschätzung verhindert, dass eine allgemein gültige moralische Verpflichtung gegenüber<br />
dem Träger des Nutzwertes abgeleitet werden kann. Nutzwerte sind keine moralischen<br />
Werte, es ergeben sich aber so genannte 'Pflichten in Ansehung von', d.h. es besteht eine<br />
indirekte Verpflichtung gegenüber dem Wertträger, um das eigentliche moralische Objekt<br />
(z.B. den Mitmenschen) nicht zu schädigen. Zugleich sind es objektive Werte, denn man<br />
kann gegenüber dem Wertträger eine wissenschaftliche Betrachtungsweise einnehmen, er<br />
21
22<br />
Wert des Verwilderns<br />
wird Objekt der Bewertung und kann nach objektiven Kriterien entlang eines Gradienten<br />
angeordnet werden (A ist im Hinblick auf Zweck X weniger wertvoll als B). Zu<br />
instrumentellen Werten haben wir in der Regel eine stark rational gefärbte Einstellung. Sie<br />
sind stets potenziell ersetzbar.<br />
b) Inhärente Werte (Selbstzwecke)<br />
(auch eudaimonistische Werte, seltener intrinsische Werte oder abgeleitete Eigenwerte<br />
genannt)<br />
Etwas besitzt aus Sicht eines wertenden Wesens (Mensch) inhärenten Wert, wenn es sich<br />
positiv auf sein Wohlergehen auswirkt. Es sind instrumentelle Werte besonderer Art, ihr<br />
Nutzen ist immateriell. Es sind Dinge, die dem wertenden Wesen 'etwas bedeuten', woran<br />
ihm aus ideellen, ästhetischen oder sentimentalen Gründen 'etwas liegt'. Sie sind wesentliche<br />
Optionen eines guten menschlichen Lebens. Typische Beispiele sind alte Bücher,<br />
Kunstwerke, Erinnerungsstücke oder die Heimat. Genau wie die 'harten' instrumentellen<br />
Werte sind sie subjektiv, denn jedes Subjekt gibt seine individuelle Bewertung ab. Daher<br />
lässt sich auch aus ihnen keine direkte, sondern allenfalls eine indirekte moralische<br />
Verpflichtung gegenüber dem Wertträger ableiten. Dinge mit inhärentem Wert können für<br />
den Wertenden zum Selbstzweck werden, dies wird deutlich am Beispiel von Tätigkeiten.<br />
Wenn jemand eine Tätigkeit um der Tätigkeit Willen ausführt, dann ist er nicht zum Sklaven<br />
dieser Tätigkeit, sondern die Tätigkeit zum Selbstzweck für ihn geworden. Der Mensch<br />
schätzt die Sache um seiner selbst Willen und nicht um ihrer selbst Willen. Inhärenten<br />
Werten fehlt die objektive Komponente der 'harten' instrumentellen Werte. Zu inhärent<br />
wertvollen Dingen hat der Wertende eine gewisse emotionale Beziehung, sie sind aus seiner<br />
Sicht nicht ersetzbar.<br />
c) Intrinsischer Wert (Eigenwert, Moralischer Selbstwert)<br />
(gelegentlich auch als inhärenter Wert bezeichnet)<br />
Einheiten die von einem wertenden Wesen (Mensch) über alle Nutzenfunktionen hinaus an<br />
und für sich (nicht aus Sicht des Menschen und nicht für den Menschen!) als wertvoll<br />
betrachtet werden, besitzen intrinsischen Wert. Eigenwerte oder Selbstwerte ('ends in<br />
themselves') existieren jenseits menschlicher Zwecke. Sie sind nur in sofern subjektiv, als<br />
dass sie das Verhalten von Subjekten maßregeln. In erster Linie ist Eigenwert ein objektiver<br />
Wert, denn er bezieht sich auf das Gegenüber, ohne die individuellen Auffassungen des<br />
Subjekts im Bezug auf das Objekt zu berücksichtigen. Er besteht jedoch nicht unabhängig<br />
vom wertenden Menschen. Da es sich nicht um eine subjektiv beliebige Wertschätzung<br />
handelt, zieht er moralische Pflichten für moralische Akteure bzw. moralische Rechte für<br />
seinen Träger nach sich. Es ist ein moralischer Wert. Die große Streitfrage zwischen<br />
ethischen Positionen ist, ob der Mensch anhand bestimmter Kriterien auswählen darf,<br />
welchen Entitäten er moralischen Selbstwert zuschreibt.<br />
2.4.2 Werte von <strong>Wildnis</strong> und Verwildern<br />
Im Folgenden arbeite ich heraus, inwiefern Werte, die Natur für den Menschen hat, in<br />
besonderem Maße in <strong>Wildnis</strong> bzw. verwildernden Gebieten (innerhalb der Tabellen im<br />
Bezug auf das NSG Lanken) ausgeprägt sind. Dabei verstehe ich unter Verwildern die<br />
Umwandlung von menschlich geordneten zu sich selbst regulierenden Systemen.<br />
<strong>Wildnis</strong> Lanken Wertkategorie Vermittlung<br />
Inwiefern gilt der Wert<br />
besonders für <strong>Wildnis</strong>?<br />
Trifft der Wert auf<br />
Lanken zu?<br />
Wie kann der Wert<br />
begründet werden?<br />
Wie kann der Wert<br />
vermittelt werden?
Wert von <strong>Wildnis</strong> und Verwildern<br />
2.4.2.1 Ökonomische Werte<br />
<strong>Wildnis</strong> als Einkommensquelle für Menschen verträgt sich nur unter bestimmten<br />
Bedingungen mit <strong>Wildnis</strong> (sanfte touristische Erschließung, Beispiele: Berggorillas in<br />
Ruanda; Nationalpark).<br />
Die Abschöpfung erneuerbarer Ressourcen der <strong>Wildnis</strong> (Holz, Pilze, Wild, Früchte, Harz<br />
etc.) durch nicht in <strong>Wildnis</strong> lebende Gesellschaften ist allenfalls in engen Grenzen möglich.<br />
Nur so ist eine nutzungsbedingte Veränderung des Artengefüges bspw. auszuschließen. Die<br />
Ausbeutung von nicht erneuerbaren Ressourcen wie Gold und Öl lässt sich mit <strong>Wildnis</strong> in<br />
der Regel nicht vereinbaren. Von großem ökonomischem Wert ist <strong>Wildnis</strong> als Genreservoir<br />
und für die Bionik (technische Innovationen auf Grundlage natürlicher Strukturen).<br />
Lebensraum und damit direkte Lebensgrundlage ist <strong>Wildnis</strong> nur für Menschen mit<br />
bestimmtem Lebensstil, bis zu einem gewissen Grad können auch sie über<br />
Produktgewinnung und Inwertsetzung auf Märkten <strong>Wildnis</strong> <strong>zur</strong> Einkommensquelle <strong>machen</strong>.<br />
<strong>Wildnis</strong> Lanken Wertkategorie Vermittlung<br />
Erlebniswert (Tourismusbranche)<br />
Optionswert (Forschung)<br />
Regionalentwicklung instrumentell vor Ort<br />
medial<br />
2.4.2.2 Ökologische Werte<br />
Dem Naturschutz ist an <strong>Wildnis</strong> gelegen, um die speziell an die Langzeitdynamik dieser<br />
Naturausprägung gebundene Diversität an Arten, Genotypen und Lebensgemeinschaften zu<br />
erhalten (Bibelriether 1998, Scherzinger 1997). Diese Qualitäten können sich auch positiv<br />
auf das Fortbestehen kultivierter Naturflächen und mithin auf die Ökonomie auswirken<br />
(Auffrischung des Genpools, Fischkinderstube etc.). Für den Umweltschutz zählen die<br />
Strukturierungsvorgänge in <strong>Wildnis</strong>, die von großer Wichtigkeit für das menschliche<br />
Überleben sind. Zu diesen so genannten ökologischen Leistungen zählt bspw. die<br />
Stabilisierung des Klimas und globaler Stoffkreisläufe.<br />
Solange nicht bewiesen ist, dass diese in mindestens gleicher Qualität und Quantität auch<br />
von anthropogenen Systemen erzeugt werden können, sind <strong>Wildnis</strong>gebiete vorsorglich zu<br />
erhalten.<br />
<strong>Wildnis</strong> Lanken Wertkategorie Vermittlung<br />
Vorsorge Vogelschutz<br />
Wasserhaushalt<br />
Klimaschutz<br />
instrumentell<br />
inhärent<br />
intrinsisch<br />
vor Ort<br />
medial<br />
2.4.2.3 Werte für Persönlichkeit und individuelle wie gesellschaftliche Identität<br />
Diese Werte liegen in den Effekten, die Natur auf Körper, Seele und Geist des Menschen<br />
hat. Sie beruhen auf Erfahrungen, die eher psychisch-geistig-spiritueller oder physischkörperlich-sinnlicher<br />
Natur sein können. Sie können grundsätzlich auch in Kulturlandschaft<br />
gemacht werden, <strong>Wildnis</strong> bietet aber besonders viele außerordentliche Naturbegegnungen<br />
(Wildwasser, Berge, Raubtiere, Giftpflanzen) und den größeren Kontrast zum Alltag.<br />
Insbesondere der Prozess des natürlichen Werdens und Vergehens ist deutlicher spürbar als<br />
in kultivierten Formen von Natur (vgl. Zucchi 2002, Bibelriether 1998, Trommer & Noack<br />
1997, S. 44). <strong>Wildnis</strong>erfahrung ist mithin intensiver als andere Naturerfahrung, für besonders<br />
naturferne Menschen ist sie daher unter Umständen nicht der optimale Lernort. Die gerade<br />
erst beginnende <strong>Wildnis</strong>entwicklung im überschaubaren Lanken eignet sich dagegen gut für<br />
ein Herantasten an <strong>Wildnis</strong>.<br />
<strong>Wildnis</strong> Lanken Wertkategorie Vermittlung<br />
Erlebniswert<br />
Kontrasterfahrung<br />
Herantasten an <strong>Wildnis</strong><br />
Faszination des<br />
instrumentell<br />
inhärent<br />
direkt vor Ort<br />
medial ungünstiger<br />
23
24<br />
Wert des Verwilderns<br />
<strong>Wildnis</strong> Lanken Wertkategorie Vermittlung<br />
Herausforderungen<br />
Atmosphäre /<br />
Stimmung<br />
Forschung<br />
Wandels<br />
Bildung / Lehre<br />
a) Demutserfahrung – die Konfrontation mit dem Großartigen<br />
Natur lehrt das Staunen und setzt den<br />
Menschen ins rechte Verhältnis. Die<br />
Erfahrung des Ausgeliefertseins oder der<br />
Unausweichlichkeit der Natur zeigt, dass<br />
sich der Mensch trotz all seiner kulturellen<br />
und technischen Leistungen mit<br />
grundsätzlichen Gegebenheiten abfinden<br />
„Staune, dass Du bist, erlebe die Welt als Wunder.<br />
Jedes Blatt hat sein Geheimnis, jeder Grashalm<br />
bleibt ein Rätsel. Verlerne das Staunen nicht, wenn<br />
man dir sagt, wie normal und einfach alles ist .“<br />
Günther Ullmann<br />
muss, z.B. dem Tod oder – weniger drastisch – dem Wetter. Besondere Hingabe an die<br />
Betrachtung ist erforderlich, um den Aspekt des Großartigen auch im Kleinsten zu erkennen<br />
und anzuerkennen.<br />
b) Differenzerfahrungen – die Konfrontation mit dem Anderen<br />
Aus der Gegensätzlichkeit von Natur und Kultur ergibt sich eine ganze Reihe von Werten.<br />
Kontrastierung der Kultur<br />
Die charakterbildenden Potenziale von <strong>Wildnis</strong> werden seit Menschengedenken bei<br />
Initiationsriten ausgenutzt und heutzutage innerhalb der Erlebnispädagogik verwendet. Für<br />
archaische Gesellschaften ist <strong>Wildnis</strong> das ständig Gegenwärtige, der Gang in die <strong>Wildnis</strong><br />
dient ihnen dazu, die Bedeutung von Kultur hervorzuheben. Kulturelle Ordnung soll<br />
gefestigt werden.<br />
Für moderne Gesellschaften dagegen ist <strong>Wildnis</strong> <strong>zur</strong> Rarität geworden, der Gang in die<br />
<strong>Wildnis</strong> dient ihnen dazu, die Bedeutung von Natur (<strong>Wildnis</strong>) zu begreifen. Kulturelle<br />
Ordnung wird in Frage gestellt bzw. der Naturentfremdung entgegen gewirkt (Haubl 1999).<br />
<strong>Wildnis</strong> befreit in diesem Sinne von zivilisatorischen Zwängen, externen Zeitgebern und<br />
gesellschaftlichen Regeln. Die Bedeutung von <strong>Wildnis</strong> als Ort, an dem der zivilisierte<br />
Mensch die Wildheit, die er als Gegenpol <strong>zur</strong> lähmenden Zivilisation braucht, spüren und<br />
sich in ihr üben kann, findet sich bereits bei Henry David Thoreau (Unger 2003, S. 25f.).<br />
Entschleunigung<br />
Die biologisch-ökologischen Zeitmaße und die Stille in der Natur sind Gegenpol zu Hektik<br />
und Konsum moderner Gesellschaften (Unger 2003, S. 29f.). Sie zu erfahren kann<br />
beruhigend wirken und Kontemplation ermöglichen. Natur kann zudem zumindest zeitweise<br />
die Probleme des modernen urbanen Lebens vergessen <strong>machen</strong>. Im besten Falle kann es <strong>zur</strong><br />
Reintegrierung der Sinne kommen. Der moderne Mensch kann Entschleunigung aber auch<br />
als bedrohlich erleben, sie weckt Assoziationen an Stillstand, Hinfälligkeit und Endlichkeit,<br />
die er aus seinem Leben verdrängt hat. Meist reagiert er dann mit Indifferenz (Haubl 1999).<br />
Erholungswert<br />
Prinzipiell kann jede Naturerfahrung erholsam sein, solange sie dem Menschen einen<br />
Ausgleich zum Alltag bietet. Je nach Beruf und überwiegender Tätigkeit sucht er in Natur<br />
mentale Erholung (Relaxation) in Form von Freiheit, Ruhe, Stille, Muße und Einsamkeit<br />
oder körperliche Erholung (Recreation). Wer im Alltag überschüssige Energien ansammelt,<br />
wird in der Natur die körperliche Herausforderung suchen, wen der Alltag physisch<br />
auspowert, zieht entspannendes Nichtstun vor.
Wert von <strong>Wildnis</strong> und Verwildern<br />
Selbsterfahrung, Selbstfindung, Selbstvertrauen<br />
Die Erfahrung der äußeren Natur und Selbsterfahrung sind überaus eng miteinander<br />
verbunden. In der Auseinandersetzung mit äußerer Natur gewinnt der Mensch nicht nur<br />
Erkenntnisse über diese, er erprobt auch seine eigenen Fähigkeiten und lernt sich selbst<br />
kennen. Er erfährt etwas über sein <strong>Den</strong>ken, sein Fühlen, seine Intuitionen und die inneren<br />
Beweggründe seines Handelns. Er entdeckt seine Vorlieben, Ängste, Stärken und<br />
Schwächen, mitunter auch eine ihm völlig unbekannte Seite seines Charakters. Seine<br />
Vergänglichkeit, seine Abhängigkeit aber auch seine Macht können ins Bewusstsein rücken.<br />
Über die pädagogische Arbeit in der Natur kann an den inneren Bildern der Menschen<br />
gearbeitet werden (Amesberger et al. 1995, S. 20f.). Die Auseinandersetzung mit den<br />
eigenen Emotionen kann zu veränderten Einstellungen führen. <strong>Wildnis</strong> ist für Selbstfindung<br />
besonders geeignet, nicht zuletzt, weil der Mensch dort in hohem Maße auf sich selbst<br />
<strong>zur</strong>ückgeworfen ist und kulturelle Einflüsse und Ablenkungen weitgehend fehlen.<br />
Psychische Entwicklung<br />
Die psychische Entwicklung von Kindern hängt nicht allein von Bezugspersonen, sondern<br />
auch von der Erfahrung mit Naturobjekten ab. Natürliche Strukturen erfüllen die im<br />
Menschen angelegten widersprüchlichen Grundbedürfnisse nach Vertrautheit einerseits und<br />
Befriedigung der Neugier andererseits. Naturdynamik bietet ständig neue Reize und<br />
Stimulation (z.B. Jahreszeiten), die Vielfalt der Formen, Materialien und Farben regt die<br />
kindliche Phantasie an, sich mit der Welt und sich selbst als darin befindlich zu befassen.<br />
Zugleich vermittelt Natur Kontinuität und damit die Erfahrung von Verlässlichkeit und<br />
Sicherheit (der Baum begleitet durch die Kindheit). Dass Kinder gerne in der Natur spielen,<br />
liegt weniger an der Naturnähe, als vielmehr an der Tatsache, dass sie hier unkontrolliert<br />
spielen und träumen, Phantasien und Abenteuer ausleben können. Die Lieblingsplätze der<br />
Kinder sind Orte, an denen sie sich frei bewegen können und an denen die Möglichkeit zu<br />
unbeobachtetem Spiel besteht. Das muss nicht Natur sein, auch vom Menschen geschaffene<br />
Orte wie z.B. Baustellen, Schrottplätze oder Ruinen eignen sich. Natur – und hier<br />
insbesondere unkontrollierte Natur – bietet aber eine besondere Unmittelbarkeit und<br />
Freizügigkeit, die von Kindern überdurchschnittlich geschätzt wird. Das zeigen z.B.<br />
Untersuchungen zum Erlebniswert von Brachflächen (Gebhard 1995, S. 41ff.).<br />
Transformation<br />
Dieser besonders von Bryan Norton betonte Wert von Natur beruht darauf, dass der Mensch<br />
über Naturbegegnungen moralische Selbstvervollkommnung erfahren kann. Dinge mit<br />
transformativem Wert lehren den Menschen, zwischen wertvollen und wertlosen Präferenzen<br />
zu unterscheiden.<br />
Ich vertrete die Ansicht, dass der transformierende Wert von Natur umso deutlicher zum<br />
Tragen kommt, je weniger kultiviert Natur ist. Zum Beispiel spielen in einem Garten viele<br />
andere transformierend wirkende Elemente wie Geborgenheit, Beschäftigung oder<br />
Gestaltungsfreiheit eine Rolle, so dass dem Transformationswert der Naturelemente selbst<br />
eine untergeordnete Bedeutung zukommen wird.<br />
Wie Haubl (1999, S. 55) bemerkt, ist Natur eine umso größere Provokation für den, der sie<br />
als vom Menschen zu Bearbeitendes ansieht, desto größer der Kontrast <strong>zur</strong> geordneten<br />
Landschaft mit ihren scharfen Grenzen und geraden Linien ist. Gemessen am Ordnungssinn<br />
des zivilisierten Menschen herrscht in <strong>Wildnis</strong> Chaos und das ist bedrohlich. In <strong>Wildnis</strong><br />
spielt der Mensch eine untergeordnete Rolle, ein zivilisierter Mensch wäre in <strong>Wildnis</strong> sehr<br />
wahrscheinlich nicht einmal überlebensfähig. Dem wird der Versuch entgegengesetzt, Chaos<br />
bzw. <strong>Wildnis</strong> möglichst vollständig zu beherrschen. Der Mensch kann die Erfahrung seiner<br />
eigenen Unbedeutendheit aber auch als etwas Ergreifendes erleben, das sein Verhältnis <strong>zur</strong><br />
wilden Natur in eine andere Richtung führt. Er kann zu dem Schluss kommen, Natur nicht<br />
prinzipiell dem eigenen Verfügungsanspruch zu unterwerfen, denn die eigene Ordnung kann<br />
nicht das Maß aller Dinge sein. Zwar kann der Mensch 'Macher' sein und dennoch Natur<br />
25
26<br />
Wert des Verwilderns<br />
respektieren – ob er dies tut, wird sich dann in seiner Art des Machens spiegeln. Ein<br />
Umgang, der 'Das Andere' vollständig den eigenen Regeln unterwirft, kann nicht auf Respekt<br />
beruhen.<br />
<strong>Wildnis</strong> ist idealer Ort, um Fragen nach Wert und Eigenwert anzustoßen. Ihre<br />
transformierende Wirkung könnte bis <strong>zur</strong> Infragestellung alter Lebensstile reichen. <strong>Wildnis</strong><br />
als Ort konsumfreien Genießens stößt gesellschaftliche Fragen wie Zeitdruck oder<br />
Wachstumsorientierung an. <strong>Wildnis</strong>erfahrung könnte Keimzelle für Visionen von<br />
Lebensweisen sein, die trotz hohem Lebensstandard darauf beruhen, die Bedürfnisse des<br />
Menschen an Natur anzupassen und nicht die Natur an die (vermeintlichen) Bedürfnisse des<br />
Menschen.<br />
Sensibilisierung der sinnlichen Wahrnehmung<br />
Moderne Menschen leiden an optischer und akustischer Reizüberflutung, während andere<br />
Sinnesorgane und der Bewegungsapparat im Zuge von Technisierung, Motorisierung und<br />
elektronischen Medien permanent unterfordert werden. Auf Dauer führt das zum Verlust von<br />
Sensibilität und zum Abstumpfen der Sinne. Die Folge können Wahrnehmungsstörungen,<br />
Verhaltensauffälligkeiten und psychosomatische Krankheiten sein. Natur stellt andere<br />
Anforderungen an die Wahrnehmung, als die geordnete Zivilisationswelt, Sensibilität und<br />
Differenzierungsfähigkeit werden geschult. Naturerleben beugt Zivilisationsleiden wie<br />
Konzentrationsstörung, Kontaktarmut, Mangel an Selbstvertrauen und Mangel an Initiative<br />
vor (Schemel 1998, S. 220, 375).<br />
c) Körpererfahrung – die Konfrontation mit dem Eigenen<br />
Die Beliebtheit von Treckingtouren, Outdoor-Equipment, Abenteuerurlauben und<br />
Überlebenstrainings beweist, dass es ein generelles Bedürfnis nach Aufenthalten in wilder<br />
Natur gibt. Die Natur wird dabei oft ohne Einsicht in ökologische Zusammenhänge<br />
aufgesucht. Das legt nahe, dass es den Menschen nicht um Natur sondern um sich selbst geht<br />
(Trommer 1991, S.10). Sie suchen die Konfrontation mit den eigenen Fähigkeiten, sie<br />
wollen die eigenen Grenzen erkennen oder erweitern. Ähnlich gelagert ist ein Motiv der<br />
frühen <strong>Wildnis</strong>befürworter Robert Marshall und Aldo Leopold. Sie sahen in<br />
<strong>Wildnis</strong>erfahrung eine Prophylaxe gegen soziale Konflikte und Krieg. Der Mensch soll sich<br />
mit den Naturkräften messen, um seinen natürlichen Drang zum Abenteuer auszuleben, sich<br />
körperlich ab<strong>zur</strong>eagieren und seine Triebe auszuleben. Daher sollten die Erholungsformen<br />
auch nicht technisiert sein, sondern körperliche Anstrengung erfordern (Unger 2003, S. 25f.,<br />
29f.). In der Körpererfahrung kann aber auch gerade die Angst vor <strong>Wildnis</strong> begründet liegen,<br />
denn der moderne Mensch kann sich nicht auf seinen Körper verlassen (Haubl 1999, S. 53).<br />
d) Einheitserfahrung – die Konfrontation mit dem Ganzen<br />
Das mentale Eintauchen in eine Landschaft, das Erleben eines Sonnenaufgangs oder das<br />
Meditieren an einem Bach sind Erfahrungen, aus denen sich Kraft schöpfen lässt und ein<br />
Gefühl von Verbundenheit mit Natur resultiert. Solche positiven Selbst- und<br />
Fremderfahrungen liefern Kraft für Innovationen, die Entwicklung von Ideen und Utopien.<br />
Zugleich wird fühlbar, welche Dinge wir zu verlieren drohen (Hilgers 1995, S. 21). Sie<br />
sensibilisieren das Individuum für die elementaren Naturbezüge seiner Existenz und bringen<br />
einen Prozess der reflexiven Aufarbeitung des individuellen Umgangs mit innerer und<br />
äußerer Natur in Gang (Wagner 1995, S. 7). Alter, Siechtum und Tod können als notwendige<br />
Voraussetzung für das Leben begriffen werden und unsere auf Jugend, Schönheit und<br />
Vitalität fixierten gesellschaftlichen Ideale in Frage stellen. Aus diesem Grund wird <strong>Wildnis</strong><br />
demjenigen, der völlige Unabhängigkeit von Natur anstrebt, bedrohlich anmuten (Haubl<br />
1999, S. 55). Für religiöse Menschen kann sie zum Ort der Begegnung mit Gott werden, so<br />
etwa bei dem amerikanischen Transzendentalisten Ralph Waldo Emerson (Unger 2003, S.<br />
25f.).
Wert von <strong>Wildnis</strong> und Verwildern<br />
e) Ästhetische Erfahrung – die Konfrontation mit dem Erhabenen<br />
<strong>Wildnis</strong> lässt sich als ein Kunstwerk für sich und darum als an sich wertvoll auffassen, egal<br />
ob ein Mensch etwas davon hat (Unger 2003, S.25f.). Für<br />
Nohl liegt der Wert der ästhetischen Erfahrung<br />
verwildernder Landschaft darin, dass sie dem Betrachter<br />
die Gabe verleiht, sich auf Neues, Zufälliges, Spontanes,<br />
Geheimnisvolles und Überraschendes einlassen zu<br />
können<br />
***<br />
Im Nebel<br />
Seltsam, im Nebel zu wandern!<br />
Einsam ist jeder Busch und Stein,<br />
Kein Baum sieht den andern,<br />
Jeder ist allein.<br />
Voll von Freunden war mir die Welt<br />
Als noch mein Leben licht war;<br />
Nun, da der Nebel fällt,<br />
Ist keiner mehr <strong>sichtbar</strong>.<br />
Wahrlich, keiner ist weise,<br />
Der nicht das Dunkel kennt,<br />
Das unentrinnbar und leise<br />
Von allen ihn trennt.<br />
* (Nohl 1998, S.138f.), weil sie den ästhetischen<br />
Eindruck des Flüchtigen vermittelt.<br />
Der Betrachter erfährt Natur als sich selbst steuernde<br />
Instanz und eigene Kraft, weshalb Spontannatur eine<br />
ungewöhnliche,<br />
oft ambivalente<br />
– anziehende<br />
wie abstoßende<br />
– Faszination ausübt. Seel spezifiziert drei<br />
ästhetische Wahrnehmungsweisen von Natur. Die<br />
Kontemplation ** entspricht einer sinnlichen<br />
Wahrnehmung der Phänomene, ohne diese zu<br />
deuten. Man lässt das Objekt auf sich wirken und<br />
genießt den Wahrnehmungsprozess, ohne dass<br />
versucht wird, einen<br />
Sinnzusammenhang<br />
oder einen Nutzen<br />
darin zu entdecken. Bei der Korrespondenz wird die<br />
Reflexion in die Anschauung einbezogen, nun werden Nutzen<br />
ermittelt. Unter<br />
und Sinnzusammenhänge<br />
Imagination versteht Seel die<br />
Verknüpfung der Natur mit der Kunst. Das Naturschöne<br />
und das Kunstschöne stehen in einem hierarchielosen<br />
Verhältnis zueinander und vervollkommnen sich<br />
gegenseitig. An Kunst gebildetes, ästhetisches<br />
Verständnis hilft, Naturästhetik wahrzunehmen während<br />
Naturerfahrung die künstlerische Ausdrucksfähigkeit<br />
fördert (Ott 2003, mündlich).<br />
Gebhard verknüpft mit dem Erleben des Naturschönen<br />
einen transformativen Wert von Natur, der aus dem<br />
Erleben der atmosphärischen Wirkung eines<br />
Naturphänomens resultiert. So kann z.B. die mystische<br />
Atmosphäre einer Wanderung im Nebel den Menschen<br />
dazu veranlassen, über seine Rolle in der Welt, den Sinn<br />
seines Lebens oder seinen Umgang mit Natur<br />
nachzusinnen (Gebhard 2005, S.23f.) *** Eine bereits im 17. Jahrhundert<br />
beginnende Ästhetisierung des<br />
Ungeordneten festigte sich im 18.<br />
Jahrhundert <strong>zur</strong> ästhetischen<br />
Kategorie des Erhabenen, die die<br />
kulturgeschichtliche Grundlage für<br />
die Auseinandersetzung mit wilder<br />
Natur bildet (Stremlow & Sidler<br />
2002, S.22ff.). Das Erhabene ist<br />
nicht gleichbedeutend mit dem<br />
Schönen, im Erhabenen schwingen<br />
auch unschöne Töne mit.<br />
**<br />
religiöse Versenkung,<br />
Versunkenheit,<br />
*<br />
Im Gegensatz dazu vermittelt die<br />
traditionelle Kulturlandschaft den<br />
ästhetischen Eindruck des Beständigen.<br />
Die strukturierte, harmonische<br />
Landschaftseinheit kann ästhetisch<br />
unmittelbar genossen werden, sie ist leicht<br />
zu erfassen und erfordert keine geistigen<br />
Anstrengungen. Das Wiedererkennen von<br />
Ordnung erzeugt im Betrachter ein Gefühl<br />
der Freude, die Szene wirkt schön im<br />
Sinne von heimatlich, harmonisch und<br />
ausgeglichen (Nohl 1998, S.138f.)<br />
Beschaulichkeit, Betrachtung<br />
(Duden, 23. Auflage 2004)<br />
.<br />
f) Wissensgewinn bzw. Wissenserhalt<br />
Natur ist Ort ökologischer Bildung. Insbesondere durch<br />
authentisches Erleben werden unrealistische Naturbilder<br />
korrigiert (Haubl 1999, S.55). Die Möglichkeit<br />
menschlichen Eingreifens in Natur und dessen Folgen<br />
Seltsam, im Nebel zu wandern!<br />
Leben ist Einsamsein.<br />
Kein Mensch kennt den andern,<br />
Jeder ist allein.<br />
Hermann Hesse<br />
direkt vor Augen zu haben macht die Abhängigkeit der Natur und vor allem der <strong>Wildnis</strong> vom<br />
guten Willen der Menschen – und damit auch vom eigenen guten Willen – deutlicher, als<br />
Medien dies könnten. Der Nachhaltigkeitsgedanke kann besonders über <strong>Wildnis</strong>gebiete mit<br />
einem hohen Anteil an geschlossenen Kreisläufen vermittelt werden.<br />
27
28<br />
Wert des Verwilderns<br />
Für die Forschung stellen <strong>Wildnis</strong>gebiete wichtige Referenzflächen dar. Neben dem reinen<br />
Studium ungesteuerter Prozesse bzw. deren 'Ergebnissen' wie Sukzessionsvorgängen,<br />
können Erkenntnisse für eine nachhaltige Nutzung von Natur abgeleitet werden.<br />
<strong>Wildnis</strong>gebiete können zudem Monitorfunktion besitzen und Aufschlüsse über Natur-,<br />
Klima- und Kulturgeschichte geben.<br />
2.4.2.4 Eigenwert<br />
Ob jemand <strong>Wildnis</strong> einen eigenen, von jedweden Zwecksetzungen unabhängigen Wert<br />
beimisst, ist Frage seiner umweltethischen Überzeugung. Der Schutz von <strong>Wildnis</strong> lässt sich<br />
auch ohne einen solchen Eigenwert begründen, dafür sprechen die soeben aufgeführten<br />
zweckbezogenen Werte. Auf den Menschen orientierte Werte haben grundsätzlich hohe<br />
Überzeugungskraft. Dagegen sind Eigenwerte vergleichsweise schwer vermittelbar.<br />
Andererseits spricht man ihnen, so sie denn anerkannt werden, eine höhere Verbindlichkeit<br />
zu.<br />
2.5 Erschließung von <strong>Wildnis</strong>schutzgebieten für Umweltbildung und<br />
Öffentlichkeitsarbeit<br />
Erschließung bedeutet immer auch Beeinträchtigung von Natur. Jede Station, jeder Meter<br />
<strong>Weg</strong> stellt einen Eingriff dar und erfordert Folgemaßnahmen wie Verkehrssicherung und<br />
Instandsetzung. Die Anwesenheit der Besucher führt zu einer Beunruhigung von Tieren, was<br />
erfahrungsgemäß noch dadurch verstärkt wird, dass sich ein Teil der Besucher nicht an<br />
Verhaltenshinweise hält. So können Trittschäden und andere Beeinträchtigungen nicht<br />
ausgeschlossen werden (Megerle 2003, S.305ff.). Gerechtfertigt wird die Erschließung von<br />
<strong>Wildnis</strong>schutzgebieten zum einen mit einem unmittelbaren Nutzen für den Menschen. Zum<br />
anderen wird davon ausgegangen, dass <strong>Wildnis</strong>gebiete von veränderten Werthaltungen und<br />
einem Erkenntnisgewinn der Besucher profitieren können.<br />
„Naturschutz und freiraumbezogene Erholung stehen in potenzieller Konfliktbeziehung<br />
zueinander. (...) Im Falle der Bereitstellung von Flächen für die Naturerfahrung ist<br />
sicherzustellen, daß Ziele des Naturschutzes respektiert und ökologische Abwertungen des<br />
Erholungsraums vermieden werden“ (Schemel 1998, S.212). Eine solche mögliche<br />
Vermeidungsstrategie ist die räumliche Trennung. Einzelne kleinere naturnahe Gebiete<br />
könnten als Anschauungsobjekte frei gegeben werden, während andere streng abgeschirmt<br />
werden. In weitläufigen Gebieten wie Nationalparks bietet sich eine Teilerschließung an<br />
(Lang & Stark 2000, S.29ff). Der Standort touristischer Einrichtungen in Schutzgebieten<br />
sollte sich nach den Kriterien Schutzwürdigkeit, ökologische Sensibilität und<br />
Besucheraufkommen richten (Megerle 2003, S.305ff.). Grundsätzlich gilt, dass besonders<br />
empfindliche oder bislang unbeeinträchtigte Bereiche auszuklammern sind. Der Zugang der<br />
Besucher zu Schutzgebieten kann über zwei verschiedene Ansätze geregelt werden. Bei der<br />
Besucherlimitierung wird der Zustrom an Besuchern über Begehungsscheine begrenzt. Der<br />
Einzelne hat mehr Freiraum und gestaltet seinen Aufenthalt im Gebiet weitgehend<br />
unabhängig.<br />
Die Besucherlenkung als die zweite Strategie kanalisiert den Besucherzustrom über das<br />
<strong>Weg</strong>egebot. Die vom <strong>Weg</strong>esystem nicht betroffenen Gebietsteile bilden Rückzugsgebiete für<br />
die Tierwelt. Die Fortbewegung auf festgelegten Bahnen bedeutet allerdings eine gewisse<br />
Distanzierung und nimmt der <strong>Wildnis</strong> ihre Wildheit. Dabei spielt die Gestaltung der <strong>Weg</strong>e<br />
eine wichtige Rolle, Bohlenwege steigern die Distanz, Trampelpfade mindern sie. Über vom<br />
Besucher nicht als Lenkung empfundene Maßnahmen wie die Einrichtung touristischer<br />
'Konzentrationspunkte' (Infozentren, Freigehege, Lehrpfade) oder ein gepflegtes<br />
<strong>Weg</strong>esystem können die unempfindlicheren Räume gezielt so attraktiv gemacht werden, dass<br />
sie bevorzugt aufgesucht werden (positive Lenkung). Auf die Bereiche, deren Besuch nicht<br />
erwünscht ist, sollte nicht hingewiesen werden, um keine Bedürfnisse zu wecken. Direkte<br />
Maßnahmen wie Verbote und Gebote erinnern an Bevormundung und sind möglichst zu<br />
vermeiden (Lang & Stark 2000, S.29ff.; Schemel 1998, S.306).
Erschließung von <strong>Wildnis</strong>schutzgebieten für Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit<br />
Als Entschädigung für den Verlust des unreglementierten Naturkontakts kann dem Besucher<br />
Information und pädagogisch vermitteltes Naturerleben geboten werden (Schemel 1998,<br />
S.303). Dabei bietet es sich an, auch gleich um Verständnis für die Naturschutzmaßnahmen<br />
und die Verhaltensregeln zu werben (Schemel 1998, S.308).<br />
Ein geeignetes Mittel dafür sind Themenwege, die gleichzeitig für Lenkung, Unterhaltung<br />
und Aufklärung sorgen (Lang & Stark 2000, S.29ff.).<br />
Schemel (1998, S.250) führt am Beispiel des Waldschutzgebietes Steinbachtal aus, dass<br />
ruhige Erholungsformen abseits der <strong>Weg</strong>e die Eigenentwicklung des Waldes nicht in Frage<br />
stellen und daher auch im Schutzgebiet in Erwägung gezogen werden können. Auch<br />
Gebhard ist dieser Meinung und betont, dass spielerisches Naturerleben abseits der <strong>Weg</strong>e<br />
speziell für Kinder auch in Schutzgebieten erlaubt sein sollte. Durch Restriktionen<br />
eingeschränkte Erfahrungen bergen die Gefahr, dass Naturkontakt mit Verboten assoziiert<br />
wird und die Kinder die Lust daran verlieren (Schemel 1998, S.309).<br />
Auch im Hinblick auf Lanken stellt sich die Frage, ob ein NSG für Bildungs- und<br />
Erlebniszwecke instrumentalisiert werden darf. Dazu Schemel (1998, S.241): „Das Erleben<br />
naturnaher Räume kann sich heute überwiegend nur in Schutzgebieten abspielen, weil<br />
Räume außerhalb der Schutzgebiete meist nicht als naturnah zu bezeichnen sind.“ Von<br />
Seiten der Natur- und Umweltbildung ist die Zugänglichkeit solcher Flächen demnach<br />
wünschenswert.<br />
Um zu überprüfen, ob eine naturpädagogische Einrichtung mit dem NSG-Status vereinbar<br />
ist, sind §22, Absatz 2 und 4 des Landesnaturschutzgesetzes Mecklenburg-Vorpommern<br />
(vom 22.10.2002, zuletzt geändert am 11.07.2005) relevant:<br />
(2) In Naturschutzgebieten sind alle Handlungen nach Maßgabe der gemäß Absatz 1 zu<br />
erlassenden Rechtsverordnung verboten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder<br />
Veränderung des Naturschutzgebietes oder seiner Bestandteile oder zu einer erheblichen<br />
oder nachhaltigen Störung führen können ( ...).<br />
(4) Soweit es der Schutzzweck erlaubt, können Naturschutzgebiete der Allgemeinheit zu<br />
deren naturkundlichen Unterrichtung zugänglich gemacht werden.<br />
Grundsätzlich spricht aus rechtlicher Sicht folglich nichts gegen Bildungs- und<br />
Erlebnisangebote in einem NSG.<br />
Es bleibt abzuwägen, inwiefern die Maßnahme dem Schutzzweck zuwiderläuft bzw. eine<br />
Störung darstellt. In Weinitschke (1980) wird die gesellschaftliche Aufgabenstellung des<br />
NSG Lanken wie folgt formuliert: „Erhaltung und Regeneration eines feuchten Stieleichen-<br />
Birkenwaldes an der Ostgrenze seiner Verbreitung sowie eines Dünen-Kiefernwaldes mit<br />
charakteristischen Wuchsformen und typischer Begleitflora.“ Außerdem wird dessen<br />
ornithologische Bedeutung hervorgehoben. Das Umweltministerium Mecklenburg-<br />
Vorpommern (2003) nennt als Schutzzweck „Erhalt und Entwicklung eines bewaldeten<br />
Höftlandes an der Südküste des Greifswalder Boddens mit Dünen und Strandwällen sowie<br />
einem davon eingeschlossenen Versumpfungsmoor.“<br />
Weiterhin zu beachten ist die Behandlungsrichtlinie des NSG. Unter Punkt 3.1. wird dort<br />
aufgeführt, dass es nicht gestattet ist, den Zustand des Gebietes zu verändern, zu<br />
beeinträchtigen oder Baumaßnahmen durchzuführen. Punkt 4 der Behandlungsrichtlinie<br />
regelt die Nutzung des Gebietes durch die Öffentlichkeit und besagt: „Die Dünenkiefernzone<br />
im Nordteil des Gebietes ist einschließlich des Wanderweges nach Loissin für die<br />
Naherholung (Wandern und Lagern) freigegeben“. Die übrige NSG-Fläche darf abseits des<br />
durchlaufenden Radwanderweges nicht betreten werden. Sie kann aber nicht als ungestört<br />
eingestuft werden, da Verstöße gegen das <strong>Weg</strong>egebot vorkommen.<br />
Wie noch erörtert werden wird (siehe 3.3.2.1. Naturbegegnung) sollten Menschen Kontakt<br />
zu dem haben können, für dessen Schutz sie Verständnis entwickeln sollen, wobei mediale<br />
29
30<br />
Wert des Verwilderns<br />
Kontakte weniger einprägsam sind, als selbst Erlebtes. Das spricht für eine zielgerichtete<br />
Erschließung des NSG Lanken.<br />
Das seit 50 Jahren weitgehend aus der Nutzung genommene und im Verwildern begriffene<br />
Gebiet hat noch viele vertraute Strukturen. Der von der Kulturlandschaft geprägte Besucher<br />
fühlt sich daher nicht völlig fremd, denn das gewohnte Bild beginnt sich gerade erst<br />
aufzulösen. Eine Erläuterung der Vorgänge und der Beweggründe dafür, diese Vorgänge<br />
zuzulassen, kann möglicherweise dazu beitragen, beginnende Abwehrhaltungen<br />
aufzufangen. Regelmäßig kommende Besucher wachsen gewissermaßen hinein in die<br />
verwildernde Landschaft. Auf eine Lenkung des Besuchers in diesem NSG kann allerdings<br />
aufgrund sensibler Bereiche nicht verzichtet werden. Neben Führungen kommt die<br />
Installation eines Themenweges in Frage. Mit dieser Option befassen sich das nachfolgende<br />
Theorie- und das daran anschließende Praxiskapitel.
Generelle Ziele von Themenwegen<br />
3. Der methodische Baukasten<br />
Möglichkeitsraum<br />
Didaktik<br />
Grundsätze<br />
Erwartungen / Ziele<br />
Abb. 2: Methodischer Baukasten<br />
3.1 Generelle Ziele von Themenwegen<br />
Es ist wichtiger, sich über eine Rosenblüte zu freuen, als ihre<br />
Wurzel unter das Mikroskop zu legen.<br />
Oscar Wilde<br />
Praxis T h e o r i e<br />
Methodischer Baukasten<br />
31<br />
Dieser Teil der Arbeit befasst sich mit<br />
dem Instrument Themenweg. Nach<br />
einer Betrachtung der an Themenwege<br />
gestellten Ziele und Erwartungen<br />
werden grundsätzliche Prinzipien und<br />
didaktische Methoden erarbeitet, die<br />
bei Themenwegkonzeptionen beachtet<br />
werden müssen. Im Kapitel<br />
Möglichkeitsraum (3.4) erfolgt<br />
anschließend eine Erörterung der<br />
Elemente, derer man sich bei der<br />
praktischen Umsetzung von Themenwegen<br />
bedienen kann.<br />
Die im Zusammenhang mit Themenwegen genannten Ziele <strong>machen</strong> deutlich, dass das<br />
Hauptanliegen solcher Einrichtungen die Bewusstseinsbildung ist. Sie entsprechen den<br />
Komponenten, die die Soziologie als die wesentlichen Bestandteile des Bewusstseins<br />
identifiziert hat: Wissen, Einstellung und Verhalten (Brilling & Kleber 1999, S.254).<br />
a) Wissen<br />
Der Wissensschatz von Personen soll durch Weitergabe von Sachinformationen bereichert<br />
werden (z.B. Lang & Stark 2000 Vorwort; Ebers et al. 1998, S.6, 8, 9, 112; Oberwemmer<br />
1998 S.15; Altschwager 1998 S.39; Nutz 2003, S.42; Beyrich 1998, S.11). Sachkenntnis ist<br />
unabdingbar, um eine Situation zu beurteilen und vernünftige Handlungsentscheidungen zu<br />
treffen. Sie kann ein Abgleiten in Emotionalismen und blinden Aktionismus verhindern, ist<br />
aber zugleich auch Voraussetzung für emotionale Reaktion. Um über die Fähigkeiten einer<br />
Pflanze staunen zu können, muss man um diese Fähigkeiten wissen.<br />
b) Einstellungen<br />
Auf Wertvorstellungen und Überzeugungen soll vor allem auf emotionaler Ebene eingewirkt<br />
werden. Außerdem gelten positive Gefühle gegenüber einer Sache gemeinhin als Basis für<br />
Handlungsbereitschaft. Daher sollen Themenwege dazu dienen, Motivation, Interesse,<br />
Begeisterung sowie Verantwortungsbewusstsein zu wecken (z.B. Lang & Stark 2000, S.9,<br />
34; Beyrich 1998, S.11; Ebers et al. 1998, S.6, 12). Über die Ansprache des Gefühls wird<br />
versucht, die Besucher zu sensibilisieren und Betroffenheit aufzubauen (u.a. Lang & Stark<br />
2000, S.9, 34; Beyrich 1998, S.11; Ebers et al. 1998, S.13, 23, 112; Strohschneider 1998,
32<br />
Der methodische Baukasten<br />
S.6). Es geht darum, eine Beziehung herzustellen bzw. Verständnis für eine Thematik zu<br />
schaffen (Ebers et al. 1998, S.112).<br />
c) Verhalten<br />
Über die Beeinflussung von Wissen und Einstellungen wird versucht, Verhaltensänderungen<br />
anzustoßen (z.B. Beyrich 1998, S.11; Lang & Stark 2000, S.9, 34; Beyrich 1998 S.11). Da<br />
Verhalten eine komplexe Mixtur aus persönlicher Werthaltung, Emotionen, Wissen und<br />
Wahrnehmung sowie mit gesamtgesellschaftlichen Haltungen und ökonomischen<br />
Rahmenbedingungen verzahnt ist (Lang & Stark 2000, S.26), ergeben sich eine Vielzahl von<br />
Barrieren und Einflüssen, die einem der Einstellung und dem Wissen entsprechenden<br />
Verhalten entgegen stehen (vgl. Baumgartner 2005; Heiland 2001).<br />
In der Praxis finden sich unterschiedliche Schwerpunktsetzungen. Es gibt Themenwege,<br />
denen in erster Linie an Wissensvermittlung gelegen ist (Prinzip Lernpfad), für andere<br />
besteht das Hauptanliegen im Erzeugen von Verständnis für die angesprochene Thematik<br />
(Prinzip Erlebnispfad) oder es soll in der Hauptsache eine Verhaltensänderung beim<br />
Besucher erzeugt werden (Prinzip der frühen Lehrpfade in Deutschland).<br />
Alle anderen, ebenfalls meist als Zielstellungen formulierten Aspekte können entweder als<br />
Mittel zum Zweck der Bewusstseinsbildung oder als Folgen der angewendeten Methoden<br />
aufgefasst werden. Es ist davon auszugehen, dass sie nicht ausschlaggebender Grund für die<br />
Einrichtung von Themenwegen sondern allenfalls Teilziele oder Nebenprodukte sind. Hierzu<br />
zählen die Vermittlung von Freude und Spaß (z.B. Ebers et al. 1998, S.112; Altschwager<br />
1998, S.39) und der Aufbau von Kompetenzen wie Kommunikationsfähigkeit (z.B. Beyrich<br />
1998, S.11; Ebers et al. 1998, S.13), Förderung von Phantasie (z.B. Ebers et al. 1998, S.112),<br />
Schärfung der Beobachtungsfähigkeit (z.B. Ebers et al. 1998, S.112; Altschwager 1998,<br />
S.39) und ästhetische Bildung (Nutz 2003, S.66).<br />
Auch Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Ebers et al. 1998, S.11), Regionalentwicklung (z.B. Lang &<br />
Stark 2000, S.10; Ebers et al. 1998, S.6) und Besucherlenkung (z.B. Ebers et al. 1998, S.6)<br />
sind als solche Teilziele anzusehen.<br />
3.2 Grundsätze von Themenwegen<br />
Unter Grundsätzen verstehe ich Voraussetzungen, die ein Themenweg als solcher,<br />
unabhängig von seinem Erscheinungsbild erfüllen muss, um Wirkung zeigen zu können.<br />
3.2.1 Pädagogisches Arrangement<br />
Themenwege erheben einen Bildungsanspruch und müssen entsprechend pädagogisch und<br />
didaktisch durchdacht sein. Sie müssen sich von rein auf Sport oder Spaß orientierten<br />
Freizeitangeboten unterscheiden. Über ein pädagogisches Hintergrundkonzept werden die<br />
einzelnen Stationen in einen sinnvollen Gesamtzusammenhang gestellt. Schemel (1998)<br />
weist darauf hin, dass es die Konsumhaltung fördert, wenn Natur über pädagogische<br />
Anleitung vermittelt wird. Sie wird aber immer dann sinnvoll, wenn sich die Bedeutung<br />
eines Elementes ohne sie nicht erschließt. Dies ist gerade bei komplexen Zusammenhängen<br />
häufig der Fall. Fehlende Eigeninitiative im Hinblick auf Naturerleben ist oft auf eine innere<br />
Distanz des Menschen <strong>zur</strong> Natur <strong>zur</strong>ückzuführen, die mit Hilfe didaktischer Aufbereitung<br />
überwunden werden kann. Schließlich kann eine pädagogische Betreuung Natur vor<br />
zerstörerischem Verhalten schützen (Schemel 1998, S.301f.).
Grundsätze von Themenwegen<br />
3.2.2 Zielgruppenorientierung<br />
Zielgruppen werden aus didaktischer Sicht danach differenziert, wie man ihnen Information<br />
jeweils optimal vermittelt. Im Folgenden werden Altersgruppen, Lernstile und<br />
Naturerfahrungstypen vorgestellt.<br />
3.2.2.1 Altersgruppen<br />
a) Kinder (Vorschul- und Grundschulalter)<br />
Kinder sind eine wichtige Zielgruppe für Themenwege, weil sie noch dabei sind, sich ihr<br />
Weltbild aufzubauen. Ermöglicht man ihnen positive Naturkontakte, könnten diese zu einer<br />
ebensolchen Einstellung gegenüber Natur und Naturschutz beitragen (siehe 3.3.2.1).<br />
Kinder leiden heute oft unter Wirklichkeitsverlust, Erlebnismangel und Naturentfremdung.<br />
Diese resultieren aus mangelhaften<br />
Aktionsräumen * , in denen<br />
sie nur noch Erfahrungen aus<br />
zweiter Hand <strong>machen</strong> (vgl.<br />
Blinkert 1998, S.103ff., Hoppe<br />
1998, S.119). Kinder brauchen<br />
jedoch persönliche Erlebnisse und<br />
unmittelbare Erfahrungen. Nur<br />
durch Probieren können sie<br />
lernen, ihre Fähigkeiten und<br />
Grenzen sowie Risiken richtig<br />
einzuschätzen und Verantwortungsbewusstsein<br />
zu entwickeln.<br />
Konstruktivität und Selbstbewusstsein,<br />
Kreativität und<br />
Autonomie, Einfühlungsvermö-<br />
*<br />
Ein Aktionsraum zeichnet sich durch Zugänglichkeit (z.B.<br />
Entfernung, Erlaubnis), Gefahrlosigkeit (z.B. autofrei),<br />
Gestaltbarkeit und Interaktionschancen aus (z.B. andere<br />
Kinder) aus. In den Kindern heute zugänglichen<br />
Nahbereichen ist das Spielen aber meist zu gefährlich, zu<br />
langweilig oder verboten. Kinderaktivitäten erfolgen daher<br />
unter Beaufsichtigung oder im geschützteren Innenbereich.<br />
<strong>Den</strong> Kindern stehen, sofern sie angesichts von Zeit- und<br />
Leistungsdruck überhaupt Muße für eigenes Spiel haben,<br />
zumeist nur vorgefertigte Spielsachen und mediale<br />
Erfahrungen (Filme, Bücher, Computer) <strong>zur</strong> Verfügung.<br />
Tätigkeiten werden ihnen von Maschinen oder Erwachsenen<br />
abgenommen, sie sammeln keine eigenen Erfahrungen mehr<br />
und werden zum Konsumenten degradiert. Ohne eigene<br />
Erlebnisse fehlt ihnen eine wichtige Grundlage der<br />
Kommunikation, was in der Folge zu unterentwickelter<br />
Semantik führen kann (Blinkert 1998; Hoppe 1998).<br />
gen, Beziehungsfähigkeit und Verständnis für soziale Regeln resultieren aus freiem Spiel<br />
und freier Gestaltung (Hoppe 1998, S.118f.; Blinkert 1998, S.109). Kinder brauchen folglich<br />
Räume, denen sie sich nicht anpassen müssen, sondern die sie eigenhändig verändern dürfen,<br />
in denen sie ihrer Phantasie und Kreativität freien Lauf lassen dürfen. An Stelle von<br />
Spielgeräten, die lediglich zu einseitigen Funktionsabläufen animieren (rutschen, wippen,<br />
schaukeln), benötigen sie Spielorte mit funktioneller Unbestimmtheit, die eine Vielzahl von<br />
Gestaltungsmöglichkeiten aufweisen (Blinkert 1998, S.114). Dafür eignen sich<br />
Spiellandschaften mit allenfalls <strong>zur</strong>ückhaltend gestalteten Elementen wie Hügeln, Kuhlen,<br />
Wasser, Holz, Steinen oder naturnahe Spielorte wie Brachen, Wiesen, Bachläufe oder Wald.<br />
Kinder beschäftigen sich dann von ganz allein mit komplexen Spielformen, sie beobachten,<br />
sammeln und experimentieren von sich aus (ebd. S.113).<br />
Wie Kinder die äußere Natur wahrnehmen, wird stark von ihrem sozialen Umfeld geprägt.<br />
Einstellung und Wertmaßstäbe der Bezugspersonen übertragen sich auf das Kind (Gebhard<br />
1995, S. 41ff.). Ist beispielsweise für die Mutter Erde nichts als Dreck, wird das Kind über<br />
kurz oder lang nicht mehr nach Lust und Laune in ihr wühlen. Um ein wirklich<br />
unbefangenes Verhältnis zu Natur entwickeln zu können, braucht es die Gewährung von<br />
Freiheiten, die im Innenbereich gezielt unterdrückt werden, z.B. klettern, sich schmutzig<br />
<strong>machen</strong> oder toben dürfen.<br />
33
34<br />
Der methodische Baukasten<br />
Kinder benötigen neben Gestaltungsfreiräumen auch die Möglichkeit <strong>zur</strong> Körpererfahrung.<br />
Ihre Erlebniswelt ist sinnbezogen, sie erschließen sich ihre Umwelt über direkten Kontakt<br />
mit konkreten Phänomenen. Sie erklären sich diese Phänomene nicht rational, sondern<br />
prägen sich ein, wie sich die Auseinandersetzung damit angefühlt hat. Greifen und Fassen<br />
gehen Begreifen und Erfassen voraus. Begriffe werden erst durch konkrete Handlungen<br />
gebildet. Kinder erfassen bspw. den Sinngehalt von 'Gefrieren' über das Anfassen von Eis<br />
(Megerle 2003, S.271, KindSein e.V. S.37f., 40). Auf Grund dieses Angewiesenseins auf<br />
konkret greifbare Phänomene, sind Kinder einerseits von sich aus sehr interessiert an ihrer<br />
direkten physischen Umwelt, andererseits mit der Betrachtung von Landschaften noch<br />
überfordert (Trommer 1992, 129ff.).<br />
Anreize im Bewegungs- und Sinnesbereich können Erlebnisse bereits im Gedächtnis von<br />
Kleinkindern verankern, für Vorschulkinder sind einfache bildhafte Darstellungen und<br />
Suchaufgaben geeignet. Geschicklichkeitsübungen, spielerische <strong>Den</strong>kaufgaben und<br />
sprachliche Aufforderungen sprechen Kinder ab Grundschulalter an (Lang & Stark 2000,<br />
S.62).<br />
Zwischen 3 und 6 Jahren befinden sich Kinder im so genannten 'Märchenalter' oder<br />
'magischen Alter', in dem sie aufgeschlossen sind für Fragen nach Sinnhaftigkeit, Wesensart,<br />
Gut und Böse oder Werten. Solche Inhalte werden seit jeher über Märchen schon den<br />
Kleinsten näher gebracht (Hoppe 1998, S.120).<br />
Kinder durchleben zunächst die realistische Phase der Wertbildung. Sie nehmen als wahr an,<br />
was sie wahrnehmen und gehen davon aus, dass auch jeder andere genau dasselbe wie sie<br />
wahrnimmt bzw. für wahr nimmt. Aus dieser Sicht ist kritisches <strong>Den</strong>ken nicht notwendig.<br />
Erst mit ca. 4 Jahren entdecken Kinder die Welt der Vorstellung, in der es Wissen gibt, das<br />
nicht der Realität entspringt sondern ausgedacht ist. Außerdem lernen sie, dass andere<br />
Menschen andere Sichtweisen haben können. Sie treten nun in die absolutistische Phase der<br />
Wertbildung ein, in der sie davon ausgehen, dass es nur richtig oder falsch geben kann.<br />
Wenn zwei Menschen zwei verschiedene Behauptungen aufstellen, muss einer Unrecht<br />
haben und über den Vergleich mit der absolut richtigen Wirklichkeit kann festgestellt<br />
werden, wer von beiden Recht hat (Lindner & Leuthold 2005, S.126ff.).<br />
b) Jugendliche und Heranwachsende<br />
Im Alter von 8 bis 12 Jahren sind Jugendliche sehr sachbezogen, sie wollen herausfinden,<br />
wie etwas funktioniert. Danach beginnt die identitätsbezogene Phase, d.h., die jungen<br />
Menschen sind sehr mit sich selbst beschäftigt und alles von außen an sie Herangetragene<br />
wird nach dem Motto „Was hat das mit mir zu tun?“ in Frage gestellt (Bayerisches<br />
Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten 2004). Im Bezug auf Wertbildung ist die<br />
Pubertät die relativistische Phase. Verschiedene Sichtweisen stehen nebeneinander. Es<br />
dominieren Haltungen wie „jeder hat Recht, alles ist wahr, was jemand für wahr hält, alle<br />
Überzeugungen sind gleich richtig“ usw. So gesehen ist kritisches <strong>Den</strong>ken irrelevant<br />
(Lindner & Leuthold 2005, S.126ff.).<br />
Jugendliche und Heranwachsende haben oft Probleme, sich auf sinnliche<br />
Wahrnehmungsübungen oder kontemplative Formen der Begegnung einzulassen.<br />
Vielversprechende Zugangsweisen bieten Kunst (Megerle 2003, S.26), körperliche<br />
Betätigung und geistige Leistungsanforderung (Lang & Stark 2000, S. 62).
Grundsätze von Themenwegen<br />
c) Erwachsene<br />
Erwachsene schätzen Information. Für sie ist das Naturerlebnis ein primär geistiger Prozess,<br />
im Gegensatz zu Kindern und Jugendlichen empfinden sie auch Ruhe und Kontemplation als<br />
Erlebnis (Megerle 2003, S.271, 288). Sie sind in die evaluierende Phase der Wertbildung<br />
eingetreten: Erwachsene <strong>machen</strong> aus Behauptungen Urteile, die argumentativ begründet<br />
werden müssen. Je besser das gelingt, desto plausibler ist die Ansicht. Kritisches <strong>Den</strong>ken ist<br />
notwendig, um begründete Abwägungen vornehmen zu können (Lindner & Leuthold 2005,<br />
S.126ff.).<br />
3.2.2.2 Typologie der Naturerfahrungsarten nach Bögeholz<br />
Bögeholz (in Bauer 2005, S.20) unterscheidet vier grundsätzliche Typen der Naturerfahrung,<br />
die bei der Konzeption eines Themenweges, der sich im weitesten Sinne mit dem Thema<br />
Natur auseinander setzt, beachtet werden sollten.<br />
Der ästhetische Naturerfahrungstyp sucht den Genuss der Schönheit von Natur und besitzt<br />
nur mäßige Motivation zu umweltgerechtem Handeln. Er möchte Ausblicke, Kulissen und<br />
Stimmungen erleben und wählt vermutlich entsprechende Aktivitäten wie Malkurse in der<br />
Natur.<br />
Der soziale Typus beschränkt Naturerfahrung auf eine enge Bindung zu einzelnen Tieren<br />
(Besuch von Tiergärten oder Haltung von Haustieren) und verspürt wenig Motivation für<br />
Umwelthandeln.<br />
Der instrumentell-erkundende Typus hat großes Interesse, Kenntnisse über nutzbare Tiere<br />
und Pflanzen (wie sie etwa durch den Besuch von Heilkräuterkursen vermittelt werden) zu<br />
erlangen, lehnt jedoch soziale Bindungen zu Tieren ab. Er ist grundsätzlich aufgeschlossen<br />
für Naturschutz und Umwelthandeln.<br />
Der ökologisch-erkundende Typus besitzt großes Erkenntnissinteresse und<br />
Verantwortungsgefühl gegenüber Natur und ist stark motiviert für umweltgerechtes Handeln.<br />
Er nimmt beispielsweise an naturkundlichen Exkursionen teil.<br />
3.2.2.3 Lernstile nach Kolb<br />
Konkrete<br />
Erfahrung<br />
Aktives<br />
Experimentieren<br />
Reflektiertes<br />
Beobachten<br />
Abstrakte<br />
Begriffsbildung<br />
Abb. 3: Lernstile nach Kolb<br />
35<br />
Für eine erfolgreiche Konzeption von<br />
Themenwegen ist es entscheidend, welche<br />
grundsätzlichen Lernschemen die potenziellen<br />
Besucher haben können. Kolb<br />
(de.wikipedia.org/wiki/Lernstil) unterscheidet hier<br />
vier Grundtypen.<br />
a) Divergierer bevorzugen konkrete Erfahrung und<br />
reflektiertes Beobachten. Ihre Stärke liegt in ihrer<br />
Vorstellungskraft, sie betrachten Situationen aus<br />
vielen Perspektiven, sind an Menschen interessiert<br />
und haben breit gefächerte kulturelle Interessen.<br />
b) Assimilierer bevorzugen reflektiertes<br />
Beobachten und abstrakte Begriffsbildung, ihre<br />
Stärke liegt in der Erzeugung theoretischer
36<br />
Der methodische Baukasten<br />
Modelle. Sie neigen zu induktiven Schlussfolgerungen, befassen sich lieber mit Dingen oder<br />
Theorien als mit Menschen und integrieren einzelne Fakten zu Konzepten.<br />
c) Konvergierer bevorzugen abstrakte Begriffsbildung und aktives Experimentieren. Ihre<br />
Stärke liegt in der Ausführung von Ideen, sie neigen zu hypothetisch-deduktiven<br />
Schlussfolgerungen und befassen sich ebenfalls lieber mit Dingen oder Theorien als mit<br />
Menschen.<br />
d) Akkomodierer bevorzugen aktives Experimentieren und konkrete Erfahrung, ihre Stärke<br />
liegt in der Ausgestaltung von Aktivitäten, sie neigen zu empirischen Problemlösungen<br />
durch Versuch und Irrtum. Sie befassen sich lieber mit Personen und verlassen sich mehr auf<br />
einzelne Fakten als auf Theorien.<br />
3.2.3 Transferleistung<br />
Transfer bezeichnet die Umsetzung von Erkenntnissen in eine alltagsrelevante Form, in<br />
deren Folge die Bedeutung von erworbenem Wissen und Fähigkeiten sowie der<br />
unterschwellig vorhandenen Werte für das eigene Leben bewusst wird und diese <strong>zur</strong><br />
Anwendung kommen. Daher ist Reflexion ein wichtiges Element für Transfer. Für<br />
Themenwege als quasi Selbstbedienungsangebote ist das eine schwierige Aufgabe, denn auf<br />
Hilfestellung und Motivation seitens einer kompetenten Person muss in der Regel verzichtet<br />
werden. Die Erlebnispädagogik setzt sich sehr intensiv mit dem Transfer auseinander. Sie<br />
unterscheidet drei Modelle (de.wikipedia.org/wiki/Erlebnispädagogik).<br />
Das 'The Mountains Speak for Themselves'-Modell geht davon aus, dass das Erlebnis für<br />
sich spricht und somit an sich bereits reflexiv ist. Eine Aufarbeitung des Erlebten wird nicht<br />
für nötig erachtet. Ein Themenweg kann versuchen, entsprechende Stationen <strong>zur</strong> Verfügung<br />
zu stellen. Bei naturfernen Besuchern werden sich hier aber ohne personelle Unterstützung<br />
nicht die gewünschten Erfolge einstellen.<br />
Im 'Outward Bound'-Modell schließt an das Erlebnis eine von außen angeregte, (verbale)<br />
Reflexion an. Der Bedeutungsgehalt der Erlebnisse soll durch strukturiertes Aufarbeiten<br />
geklärt werden. Es wird davon ausgegangen, dass das Erlebnis ins Bewusstsein gehoben<br />
werden muss, um einen Bezug zum Alltag herstellen zu können. Ein Themenweg kann<br />
versuchen, eine solche Reflexion zu initiieren, z.B. durch Einbau von Ruhestationen,<br />
Aufgabenstellungen, über die Erlebnisse aufgearbeitet, Vergleiche, mit den Erfahrungen<br />
anderer gezogen werden oder über eine Betreuungsebene, die Begleitpersonen einbindet. Es<br />
können auch konkrete Anregungen für umweltfreundliches Verhalten gegeben werden.<br />
Beim metaphorischen Modell wird versucht, Situationen zu schaffen, die isomorph <strong>zur</strong><br />
Alltagsrealität der Teilnehmer sind, so dass die Lehre nicht erst im Nachhinein sondern<br />
bereits während der Aktion gezogen werden kann. Es handelt sich in diesem Sinne um die<br />
maßgeschneiderte Lernsituation. Ein solches spezifisches Eingehen auf den Einzelnen ist<br />
jedoch für Themenwege praktisch nicht leistbar.<br />
Transfer hängt aber nicht nur eng mit Reflexion, sondern auch mit Identifikation zusammen.<br />
Ohne Identifikation mit der Thematik ist eine Bereitschaft <strong>zur</strong> Übertragung wie auch immer<br />
gearteter Information auf das eigene Leben nur schwer vorstellbar. Man kann Naturpfade als<br />
einen Versuch auffassen, Identifikationsmöglichkeiten mit der nicht bzw. wenig kultivierten<br />
Natur anzubieten und den Schutzgedanken in das Alltagsleben zu integrieren. Identifikation<br />
hat aber auch noch eine andere, den <strong>Weg</strong> an sich betreffende Komponente. Wenn die
Grundsätze von Themenwegen<br />
Bevölkerung vor Ort eine Beziehung zum Themenweg besitzt, könnte dadurch ein gewisser<br />
Schutz vor Vandalismus gegeben sein. Vorstellbar ist eine Einbeziehung von Schulen oder<br />
Gemeinden vor Ort in die Planung, Ausführung und Wartung von Themenwegen.<br />
3.2.4 Freiwilligkeit und Selbstverantwortung<br />
Themenwege sind informelle Umweltbildungseinrichtungen, d.h., die Bildung findet<br />
außerhalb schulischer oder universitärer Institutionen oder Veranstaltungen statt<br />
(außercurriculär). Es besteht keine Verpflichtung <strong>zur</strong> Teilnahme, der Besucher bestimmt<br />
zudem selbst, wie lange und wie intensiv er sich darauf einlässt. Themenwege sind ein<br />
Selbstbedienungs- und Selbstbildungs-Angebot. Der Besucher hat hier die Möglichkeit,<br />
Wissen zu erwerben und sich eine Meinung zu bilden. Ob er es annimmt, hängt in<br />
erheblichem Maße von der Art des Angebotes ab. Bei der Konzeption muss bedacht werden,<br />
dass der Besuch einem Freizeitvergnügen entspricht, d.h., das Publikum absolviert sie ohne<br />
konkretes Bildungsziel in einer 'Haltung des aktiven Dösens' (Lang & Stark 2000, S. 47), aus<br />
der es zunächst einmal gelöst werden muss, ohne ihm dabei das Gefühl zu vermitteln, sich in<br />
einer schulischen Veranstaltung zu befinden.<br />
3.2.5 Standards der Öffentlichkeitsarbeit<br />
Öffentlichkeitsarbeit ist das geplante und dauerhafte Bemühen, Verständnis und Vertrauen<br />
für bestimmte Ziele aufzubauen. Mit ihr sind positive Information, Imagepflege, Werbung,<br />
Aufklärung und Erzeugung von Sympathie verbunden (Heidenreich 2005, S.17). Um ein<br />
wirkungsvolles Instrument der Öffentlichkeitsarbeit zu sein, müssen Themenwege deren<br />
Standards erfüllen. Überlegungen zu einer erfolgreichen Öffentlichkeitsarbeit betreffen zum<br />
einen die äußere Erscheinungsform, zum anderen die innere Struktur des benutzten Mediums<br />
(vgl. Beyrich 1998, S.11f.; Prüter et al. 2004).<br />
a) Die äußere Form erfolgreicher Öffentlichkeitsarbeit<br />
Hierzu zählt die Entwicklung eines eigenen Markenzeichens ('Logo') und eines<br />
unverwechselbaren Erscheinungsbilds ('Corporate Design'). Entscheidend hierbei ist, dass<br />
sich ein einheitliches Gestaltungsprinzip in allen <strong>zur</strong> Einrichtung gehörenden Elementen<br />
wiederfindet. Dieses kann die verwendeten Farben, den Stil von Darstellungen und<br />
Schriftzügen, die Materialien aber auch das Layout betreffen. Weiterhin zu beachten ist, dass<br />
die Aufmachung einen eindeutigen Bezug zum Gebiet herstellt, z.B. mittels Farben und/oder<br />
Symbolen charakteristische Elemente der Region aufgreift, dass sie einprägsam ist und dem<br />
Besucher die Identifikation ermöglicht. Für letzteres wird oft eine Leitfigur genutzt, zu der<br />
Menschen in der Regel schnell eine emotionale Beziehung aufbauen.<br />
Ebenso wichtig ist die ansprechende Aufarbeitung der Informationen, die es dem Besucher<br />
ermöglichen muss, sie aufzunehmen und zu verarbeiten. In der Regel wird für die<br />
Öffentlichkeitsarbeit empfohlen, sich auf wenige, kurz und prägnant formulierte<br />
Sachverhalte zu beschränken. Ebers et al. (1998, S.93) weisen jedoch darauf hin, dass<br />
ungewöhnliche Darstellungsweisen offenbar in der Lage sind, auch größere Mengen an<br />
(Text-) Informationen zu kompensieren. Überraschende Effekte (Spiegel), Kunst<br />
(Verfremdungen, Stolpersteine, Installationen, Plastiken) oder Fokussierung (das Lenken des<br />
Blicks z.B. durch ein Rohr) sind Möglichkeiten, über die Darbietungsweise Interesse zu<br />
wecken. Eine Überladung des <strong>Weg</strong>es mit Stationen bzw. eine Überfrachtung der Medien mit<br />
Informationen muss vermieden werden, weil sie <strong>zur</strong> Überforderung des Besuchers führt.<br />
37
38<br />
Der methodische Baukasten<br />
Eine hinreichende Schriftgröße, eine sich vom Hintergrund absetzende Schriftfarbe sowie<br />
eine angemessene Qualität von Abbildungen sind ebenso unabdingbar, wie ein<br />
übersichtliches Layout. Form und Inhalt müssen korrespondieren. Hierbei ist genau zu<br />
überlegen, wie naturnah bzw. wie stark abstrahiert der Informationsträger gestaltet werden<br />
soll. So erscheinen betont ordentliche '<strong>Wildnis</strong>tafeln' eher paradox. Ein weiterer wichtiger<br />
Grundsatz lautet: 'Auffällig unauffällig sein'. Im Falle von Themenwegen sollen die<br />
Stationen Aufmerksamkeit erregen, ohne dabei das Landschaftserleben zu beeinträchtigen.<br />
Damit sie sich sozusagen unübersehbar in die Landschaft einfügen, muss der Aufstellungsort<br />
sehr überlegt ausgewählt werden.<br />
Aber nicht nur die Darstellung, auch die Ausdrucksweise muss beachtet werden. Ein<br />
freundlicher nicht moralisierender Grundton der Ansprache ist ein 'Muss'. Insbesondere<br />
Verbote und Gebote müssen mit Feingefühl transportiert, stets begründet und mit einem<br />
Appell an das Verantwortungsbewusstsein des Besuchers versehen werden. Originelle und<br />
kreative Formulierungen, ein lebendiger Sprachstil und Überschriften, die neugierig <strong>machen</strong>,<br />
tragen dazu bei, den Besucher auch wirklich zu erreichen. Fachausdrücke und<br />
Detailabhandlungen stehen dem eher entgegen. Es hat sich bewährt, viele Verben und<br />
bildhafte Substantive zu nutzen, da diese den Alltagsbezug herstellen. Gleiches erreichen<br />
Redewendungen, geflügelte Worte und Wortspiele. Der Einsatz werbewirksamer Adjektive<br />
wie gewaltig, tosend, einsam, selten oder außergewöhnlich sollte sehr <strong>zur</strong>ückhaltend<br />
erfolgen. Sie lenken ab vom Alltäglichen, dem Kleinen, Ruhigen, Beschaulichen, Sinnlichen<br />
und Leisen. Die Information als solche muss verständlich und sachlich sowie frei von<br />
Übertreibungen und Widersprüchen sein. Im Bezug auf Texte und Abbildungen sind<br />
Urheberechte zu beachten. Gegebenenfalls ist eine mehrsprachige Ausführung der<br />
Textinformationen zu erwägen.<br />
Damit ein unflexibles System wie ein Themenweg dennoch auf unterschiedliche Bedürfnisse<br />
der Besucher eingehen kann, bietet sich eine Kombination verschiedener<br />
umweltpädagogischer Elemente an. Allerdings darf dies nicht in einem<br />
zusammenhangslosen Potpourri unterschiedlicher Stationsarten enden (siehe 3.2.1<br />
Pädagogisches Arrangement).<br />
b) Die innere Struktur erfolgreicher Öffentlichkeitsarbeit<br />
Eine aus Einzelelementen bestehende Öffentlichkeitsarbeit, wie sie bei Themenwegen über<br />
die Aufteilung in Stationen gegeben ist, erfordert einen 'Roten Faden', eine übergeordnete<br />
Thematik auf die jede Einzelstation Bezug nimmt. Jede Station sollte in direktem<br />
Zusammenhang mit dem Ort ihrer Platzierung stehen, da anderenfalls ein deutlicher Verlust<br />
von Authentizität und Sinn zu verzeichnen wäre. Weiteres Merkmal von Besucheransprache,<br />
sei es nun ein Text oder ein Themenweg, ist ein so genannter Spannungsbogen, das bedeutet,<br />
dass auf einen inhaltlichen oder emotionalen Höhepunkt zugearbeitet wird. Es kann auch<br />
mehrerer solcher Punkte geben. Wichtig sind Phasen der Reflexion und Ruhe, in denen das<br />
Erlebte verinnerlicht werden kann bzw. die aufgewühlte Stimmung nach körperlichen<br />
Anstrengungen Gelegenheit zum Abebben hat.<br />
Aus der formalen Überlegung heraus, dass eine Überladung mit Information vermieden<br />
werden muss, folgt, dass eine inhaltliche Informationsauswahl getroffen werden muss. Es<br />
kommt nicht auf die Vielzahl der Fakten an, der Besucher kann während eines Spaziergangs<br />
nicht zum Experten ausgebildet werden. Die ausgewählten Inhalte sollten der Erläuterung
Grundsätze von Themenwegen<br />
von Zusammenhängen dienen und sich am roten Faden orientieren. In diesem<br />
Zusammenhang ist erwähnenswert, dass bereits die Informationsvorauswahl eine<br />
Fokussierung bedeutet. Stellt man dem Besucher bspw. speziell seltene Arten vor, weil diese<br />
in der Regel auch der Grund für die Einrichtung eines Schutzgebietes sind, dann provoziert<br />
man Enttäuschung. Seltenes hat schließlich die Eigenart, nur selten gesichtet zu werden.<br />
Andererseits ist es gerade ein besonderes Erfolgserlebnis, wenn man es dann doch zu<br />
Gesicht bekommt. Die Aufmerksamkeit auf das sicher Sichtbare zu lenken hat dagegen den<br />
Vorteil, das Wunderbare im Alltäglichen zu offenbaren und einen bewussteren Umgang mit<br />
den als selbstverständlich angesehen Dingen an<strong>zur</strong>egen.<br />
3.3 Pädagogische Grundlegung<br />
3.3.1 Begriffe<br />
a) Pädagogik (Lehre von Erziehung und Bildung)<br />
Pädagogik „ist die traditionelle Bezeichnung für die wissenschaftliche Disziplin, die sich mit<br />
Bildung und Erziehung befasst. (...). Ihr kommt die Doppelrolle zu, sowohl Bildungs- und<br />
Erziehungszusammenhänge zu erforschen, als auch – als Handlungswissenschaft – darüber<br />
zu reflektieren, wie Bildungs- und Erziehungspraxis gestaltet und verbessert werden kann“<br />
(de.wikipedia.org/wiki/Paedaogik).<br />
b) Didaktik (Unterrichtslehre)<br />
Auch Didaktik zeichnet sich durch einen Doppelcharakter aus. Einerseits ist sie die<br />
praktische Lehrkunst an sich, also die Kunst des Unterrichtens, die darin besteht, einen<br />
anderen Menschen dazu zu bewegen, etwas Bestimmtes zu lernen. Andererseits bezeichnet<br />
man mit Didaktik auch die theoretische Wissenschaft von der Lehrkunst, die sich mit den<br />
Bedingungen des Lernens, deren Effektivität und Verbesserung befasst (www2.unijena.de/didaktik/did_01/doppelt.htm).<br />
Kurz gesagt: „Didaktik kümmert sich darum, wer,<br />
was, wann, mit wem, wo, wie, womit, warum und wozu lernen soll“ (www2.unijena.de/didaktik/did_01/neunfrag.htm).<br />
c) Erziehung<br />
„Als Erziehung bezeichnet man alle bewußten und gezielten (= intentionalen) Handlungen<br />
und Verhaltensweisen eines relativ erfahreneren Menschen (= Erzieher, Educans), die einen<br />
jeweils weniger Erfahrenen (= Zögling, Educandus) <strong>zur</strong> selbständigen Lebensführung<br />
befähigen sollen“<br />
(www.stangl-taller.at/arbeitsblaetter/wissenschaftpaedagogik/erzwissinhalte.shtml).<br />
Über Erziehung werden festgelegte Inhalte von gesellschaftlicher Relevanz weitergereicht.<br />
Sie zeichnet sich aus durch absichtsvolle und methodische Einwirkung auf Andere, durch<br />
personale Interaktion bei gleichzeitigem hierarchischem Verhältnis und die Weitergabe von<br />
Regeln, Normen, Verhaltens-, <strong>Den</strong>k- und Handlungsweisen. Sie dient der Anpassung und<br />
Vorbereitung des zu Erziehenden an bzw. auf das Leben in der Gesellschaft und ist immer in<br />
einem sozialen Kontext zu sehen. Da sich gesellschaftliche Wert- und Normvorstellungen im<br />
Laufe der Zeit verändern, können auch Erziehungsziele nicht statisch sein<br />
(de.wikipedia.org/wiki/Erziehung).<br />
39
40<br />
Der methodische Baukasten<br />
d) Bildung<br />
„Bildungsarbeit heißt, eine Struktur entwickeln, innerhalb derer sich Menschen Wissen<br />
aneignen und Erfahrungen am Gegenstand <strong>machen</strong> können und sich durch die Verknüpfung<br />
von Wissen und Erfahrung selbst das herausbilden können, was in ihrem<br />
Lebenszusammenhang wichtig ist. Bildung ist ein Bewußtseinsprozeß des Individuums über<br />
seine Vernetzung mit der Umwelt“. (Werner Henkel zitiert in Mitterbauer & Baurecht-Pranzl<br />
1993, S.5). Unter Bildung im Sinne des humboldtischen Bildungsideals wird die<br />
„selbständige und selbstzweckhafte Entfaltung aller Anlagen des Menschen zu einer reifen<br />
und autonomen Persönlichkeit“ (Düwell et al. 2002, S.423) verstanden. Sie ist auf das<br />
individuelle Bewusstsein von Personen gerichtet. Das spezifisch Menschliche soll sich durch<br />
Bildung formen, es geht um die Erlangung von Identität und Mündigkeit. Über Bildung<br />
sollen geistige, kulturelle und lebenspraktische Fähigkeiten (Selbständigkeit,<br />
Problemlösungsfähigkeit, soziale Kompetenz, etc.) entwickelt werden<br />
(de.wikipedia.org/wiki/Bildung). Bildung setzt Bildungswillen der Lernenden,<br />
Urteilsvermögen, Reflexionsfähigkeit und kritische Distanz gegenüber dem Angebot voraus.<br />
Im Gegensatz <strong>zur</strong> Erziehung ist Bildung ein wechselseitiger Prozess zwischen Lehrenden<br />
und Lernenden (Trommer 1997, S.57).<br />
e) Wahrnehmung<br />
Unter Wahrnehmung wird sowohl die Fähigkeit eines Organismus verstanden, mit seinen<br />
Sinnesorganen Information in Form von Reizen aufzunehmen und zu verarbeiten, als auch<br />
die aufgenommene und ausgewertete Information selbst (de.wikipedia.de/wiki<br />
/Wahrnehmung). Dieser Wahrnehmungsprozess ist ein Zusammenspiel physikalischer Reize<br />
mit den beim Wahrnehmenden gegebenen physiologischen und psychologischen<br />
Bedingungen. Ohne sie wäre Auseinandersetzung mit der Umwelt nicht möglich.<br />
Aufgenommene Reize werden im Gehirn gedeutet und hinsichtlich darin liegender<br />
Information geprüft. Das ist Grundvoraussetzung dafür, eine Situation zu durchschauen und<br />
angemessen darauf reagieren bzw. lernen zu können. Neben den objektiven Funktionsweisen<br />
der Sinnesorgane besitzt jeder Mensch seine subjektive Wahrnehmung, d.h. es erfolgt eine<br />
den individuellen Erinnerungen, Stimmungen und <strong>Den</strong>kprozessen angemessene<br />
Verarbeitung der Reize zu Sinnesempfindungen. Wahrnehmung ist kontextabhängig,<br />
Objekte werden immer in Relation zu ihrer Umgebung betrachtet. Sie ist außerdem<br />
erfahrungsabhängig – widersprechen sich Informationen, wird diejenige bevorzugt, die<br />
bisher gemachten Erfahrungen am nächsten kommt. Zudem selektieren die Sinnesorgane,<br />
das Auge nimmt z.B. nur einen Ausschnitt aus dem Spektrum der Lichtwellenlängen wahr<br />
(de.wikipedia.de /wiki/Wahrnehmung). Ebenfalls selektierend wirkt die Funktionstüchtigkeit<br />
des Organs, der Sensibilisierungsgrad sowie die Vorkenntnisse und Motivation des<br />
Individuums. Wahrnehmung ist schließlich in gewisser Weise produktiv, da der Mensch<br />
seine Eindrücke gemäß seiner Erfahrungen und Vorurteile ergänzt. Daher ist die<br />
menschliche Wahrnehmung manipulierbar (Ludwig 2005, S.4).<br />
Unter den sensorischen Bedingungen unterscheidet man 7 Wahrnehmungssysteme.<br />
Visuelle Wahrnehmung über das Auge: Der Sehsinn hat von allen Wahrnehmungsarten<br />
die größte Reichweite und Aufnahmekapazität bei gleichzeitig kürzester Verarbeitungszeit.<br />
Darüber erfolgt Lokalisation und Objektwahrnehmung (Form, Raum, Bewegung, Farbe,<br />
Helligkeit).
Pädagogische Grundlegung<br />
Akustische oder auditive Wahrnehmung über das Gehör: Der Hörsinn liefert<br />
Vorstellungen von Dimensionen, Distanzen und Raumqualität. Für Blinde ist es der<br />
eigentliche Fernsinn. Mit dem Hören verbinden wir eine sehr intensive Form der Aneignung,<br />
vgl. 'Das gehört mir!'. Vollkommene Stille empfinden Menschen oft als unheimlich.<br />
Olfaktorische Wahrnehmung über die Nase: Der Geruchssinn steht in enger Verbindung<br />
zum Limbischen System, das für die emotionale Bewertung von Wahrnehmungen<br />
verantwortlich ist. Gerüche haben daher eine ausgeprägte emotionale Komponente bzw. ein<br />
starkes Konditionierungspotenzial und direkten Einfluss auf das Verhalten.<br />
Geruchsinformationen werden zudem sehr lange gespeichert, daher können Gerüche<br />
Erinnerungen an längst vergangene Erlebnisse hervorrufen und entsprechende Emotionen<br />
auslösen.<br />
Gustatorische Wahrnehmung über die Zunge: Der Geschmacksinn wird vom<br />
Geruchssinn unterstützt.<br />
Taktile (haptische) Wahrnehmung über die Haut: Die Tast-, Wärme- und Kälterezeptoren<br />
des Tastsinnes treten im Bereich der Hände und Füße besonders dicht auf. Es ist der<br />
dominierende Wahrnehmungskanal bei Kleinkindern. Sie ist Grundlage für das Verstehen<br />
komplexer Bezüge und bildlicher Vorstellung. Taktile Wahrnehmung setzt aktives Handeln<br />
voraus, über sukzessives Abtasten wird Materialbeschaffenheit, Oberflächenstruktur und –<br />
sofern möglich – die Raumform erfasst. Die Informationsverarbeitung erfolgt relativ<br />
langsam, da die Einzelinformationen zusammengesetzt werden müssen.<br />
Kinästhetische (haptische) Wahrnehmung über Rezeptoren in Gelenken, Muskeln und<br />
Sehnen: Der Muskel-,Tiefen- oder Stellungssinn dient der unbewussten Wahrnehmung der<br />
Position der Körperglieder zueinander. Es werden nur Reize aus dem Körperinneren<br />
aufgenommen.<br />
Vestibuläre Wahrnehmung über das Gleichgewichtsorgan im Innenohr: Der<br />
Gleichgewichtsinn erlaubt die (unbewusste) Wahrnehmung von Lageveränderungen und<br />
Schwerkraft. Er dient der Wahrung der Körperhaltung sowie der Kontrolle von Bewegungen,<br />
also der Körperkoordination.<br />
Vestibuläre und kinästhetische Wahrnehmung ergeben den Bewegungssinn.<br />
f) Lernen<br />
„Unter Lernen versteht man den individuellen Erwerb von Kenntnissen sowie geistiger und<br />
körperlicher Fertigkeiten und Fähigkeiten“. Lernen kann sowohl bewusst und absichtsvoll<br />
als auch ungeplant beiläufig geschehen (de.wikipedia.org/wiki/Lernen). Die Aufnahme von<br />
Information kann assoziativ oder logisch-linear erfolgen, wofür jeweils unterschiedliche<br />
Gehirnbereiche zuständig sind (Ludwig 2005, S.5).<br />
Ausgehend vom Wissen über Wahrnehmungsprozesse folgert die konstruktivistische<br />
Lerntheorie, dass jedes Individuum seine subjektive Wirklichkeit konstruiert. Somit kann<br />
Wissen nie als solches von einer Person auf eine andere übertragen werden. Lernen ist zu<br />
verstehen als Selbstorganisation von Wissen, Lehren bedeutet, das Umfeld so zu gestalten,<br />
dass der Lernende kognitive Strukturen aufbauen kann. Daraus ergeben sich eine Reihe von<br />
Anforderungen an die Didaktik (www2.uni-jena.de/didaktik/did_03/implikation.htm,<br />
de.wikipedia.org/wiki/Didaktik). Die Lernumgebung sollte reichhaltig, interessant,<br />
multimodal und kommunikationsorientiert gestaltet werden und pragmatische, interaktive<br />
41
42<br />
Der methodische Baukasten<br />
sowie kreative Aufgaben bieten. Lernerfahrungen sollten an Bekanntes anschließen.<br />
Zugleich müssen sie Anreize bieten, über Bekanntes hinauszugehen, also neugierig <strong>machen</strong>.<br />
Der Lernende sollte die Lerngeschwindigkeit selbst bestimmen und sich das Wissen aktiv<br />
aneignen können. Wissen sollte über mehrere Kanäle (kognitiv, emotional, ästhetisch,<br />
pragmatisch) zugänglich gemacht werden, nicht ausschließlich problembezogen sein, sowie<br />
Gebrauchswerte aufweisen. Zudem ist soziale Interaktion (Auseinandersetzung mit dem<br />
Standpunkt anderer) wichtig für affektives und kognitives Lernen (Megerle 2003, S.245).<br />
Affekte wie Angst oder Freude haben Einfluss auf Aufnahmebereitschaft und Lernergebnis,<br />
weil sie die Ausschüttung von Signalstoffen veranlassen, welche die Bildung synaptischer<br />
Verschaltungen stimulieren. Eine mit positiver oder negativer Erregung verbundene<br />
Situation prägt sich ein. Daher erlauben Emotionen auch ein zielgerechtes Erinnern.<br />
Außerdem wird eine Situation immer wieder mit der emotionalen Befindlichkeit in<br />
Verbindung gebracht, in der sie zum ersten Mal erlebt wurde. Dies kann auch dazu führen,<br />
dass bestimmte Situationen gezielt gesucht oder vermieden werden (Gebauer & Harada<br />
2005, Hüther 2004). Ohne Aktivierung emotionaler Zentren können keine Erfahrungen<br />
gemacht werden. Optimale Bedingungen für die Etablierung und Stabilisierung neuer<br />
Verschaltungsmuster im Gehirn herrschen immer dann, wenn es wie z.B. bei Neugier zu<br />
einer moderaten Aktivierung emotionaler Zentren kommt (Hüther 2004, S. 64).<br />
Emotionen verkürzen den Entscheidungsprozess, es wäre viel zu aufwendig, alle<br />
Informationen zusammen zu tragen und zu beurteilen, um eine rein rationale Entscheidung<br />
zu treffen. Eine unreflektierte Umsetzung von Emotion in Handlung, die die Folgen außer<br />
Acht lässt – der so genannte 'blinde Aktionismus' - ist allerdings unerwünscht (Döring-Seipel<br />
2001, S.12).<br />
g) Umweltbildung und Naturbildung<br />
Trommer (1997, S.20) erläutert, dass sich sowohl Umweltbildung als auch Naturbildung mit<br />
der nachhaltig und umweltgerechten Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen<br />
befassen, sich ansonsten aber deutlich unterscheiden.<br />
Die Begriffe Umweltbildung bzw. Umwelterziehung wurden zu Beginn der 1970er Jahre<br />
vom anglo-amerikanischen Begriff 'Environmental Education' abgeleitet. Sie stehen im<br />
Dienste des Umweltschutzes, der auf gesellschaftspolitische Gesundheitsvorsorge und eine<br />
durch Technik 'gesund' erhaltene Umwelt zielt und lösten die Tradition der naturkundlichen<br />
Bildung ab (ebd. S.2 und 29). Umweltbildung ist auf Aktion ausgerichtet und laut Trommer<br />
das passende Bildungskonzept für den urbanen Bereich. Sie umfasst Mensch, Gesellschaft,<br />
Technik und Umweltschutz im Sinne der Wiederherstellung und Entwicklung gesunder<br />
Lebensbedingungen. Hier ist der Tatendrang von Kindern und Jugendlichen unbedingt zu<br />
unterstützen (ebd. S.93). Umweltbildung lehrt umweltfreundliches Verhalten.<br />
Der auf Bernhard Heinrich Blasche (1766-1832) <strong>zur</strong>ückgehende Begriff Naturbildung wird<br />
von Trommer wieder aufgegriffen. „Naturbildung muß vermitteln und dazu anhalten, daß<br />
Menschen die Natur als Kontrast <strong>zur</strong> technisch gestalteten oder manipulierten Zivilisation<br />
wahrnehmen und erkennen und als nichtmenschliche Eigenart, Dynamik, Ursprünglichkeit<br />
und Wildheit schützen lernen.“ (Trommer 1997, S. 20).
Pädagogische Grundlegung<br />
Der Mensch muss sich seiner eigenen verletzlichen Naturhaftigkeit bewusst werden und<br />
nachhaltige Lebensstile entwickeln, die die eigendynamisch wirkenden ökologischen<br />
Potenziale respektieren.<br />
Menschliches Handeln darf prinzipiell die ihn tragende Natur nicht überfordern. Da die<br />
Tragweite menschlicher Handlungen rational aber nicht überschaubar ist, strebt<br />
Naturbildung an, ein entsprechendes 'Gespür' für den Umgang mit Natur zu entwickeln (ebd.<br />
S. 13f.).<br />
„Für das zu entwickelnde didaktische Design einer umfassenden naturbezogenen<br />
Menschenbildung bedeutet das: Es muß Erleben anstoßen und Verstehen einleiten, Gewissen<br />
für den Umgang mit Natur erschließen und verantwortliches Handeln (...) entwickeln (...)“<br />
(Trommer 1992, S.139).<br />
Naturbildung ist das geeignete Bildungskonzept, um Akzeptanz für <strong>Wildnis</strong> zu schaffen. Im<br />
Umgang mit ihr muss Verzichtbereitschaft und Toleranz geübt werden, sie erfordert<br />
Kontemplation und Therapeutisches Nichtstun, was dem Aktionsdrang von Kindern und<br />
Jugendlichen zuwider läuft. In <strong>Wildnis</strong>schutzgebieten geht Eigendynamik vor<br />
menschengemachter Dynamik. Gelernt werden soll, Naturprozesse zu begreifen sowie<br />
Schönheit und Unversehrtheit wahrzunehmen, ohne sie zu stören. (Trommer 1997, S.83f.)<br />
Der Terminus Umweltbildung wird auch als Oberbegriff verstanden. Dazu Brilling & Kleber<br />
(1999, S.5): „Der Terminus Umweltbildung ist außerordentlich unspezifisch. Er wurde von<br />
Seiten der Politik schon in den späten 80er Jahren benutzt, um sich nicht auf eine der damals<br />
gängigen Konzeptionen wie Umwelterziehung, Ökopädagogik oder ökologisches Lernen<br />
festlegen zu lassen. Die Unschärfe des Umweltbildungsbegriffs ist sein Vorteil, wenn man<br />
ihn als Sammelbegriff nutzt, unter dem die genannten sowie weitere kursierende Termini wie<br />
Naturbezogene Pädagogik, Umweltlernen, Naturnahe Erziehung gebündelt werden.“<br />
h) Naturpädagogik<br />
Der Terminus Naturpädagogik beschreibt eine pädagogische Richtung, die der<br />
Umweltbildung zuzuordnen ist, aber kein fest umrissenes Konzept darstellt (Wessels 2005).<br />
Grundlegende Aufgabe ist es, Möglichkeiten für faszinierende Begegnungen mit Natur zu<br />
schaffen. Dies beruht auf folgenden zwei Grundüberlegungen:<br />
1. Naturbegegnungen fördern die gesunde Entwicklung von Kindern<br />
2. Motivation zu umweltgerechtem Handeln geht aus Wertschätzung hervor, die ohne<br />
Kenntnis der Natur und ohne ein positives Grundgefühl der Natur gegenüber nicht bestehen<br />
kann<br />
Als Prinzipien und Schwerpunkte naturpädagogischer Arbeit führt Wessels neben dem<br />
Naturkontakt die Vermittlung von Wissen über Natur, ökologische Zusammenhänge und<br />
adäquates Verhalten an. Außerdem spielen die Vorbildfunktion von Bezugspersonen sowie<br />
Freude, Begeisterung und Spaß eine wichtige Rolle.<br />
i) Erlebnis-Erfahrung-Erkenntnis<br />
Erlebnis, Erfahrung und Erkenntnis sind Stufen unterschiedlicher Involviertheit einer Person<br />
(Lude 2005, S.67).<br />
43
44<br />
Der methodische Baukasten<br />
Erlebnis<br />
Es ist charakteristisch für die menschliche Existenz, dass wir das Leben bewusst vollziehen,<br />
erleben * . Unter einem Erlebnis wird ein emotional verarbeitetes Ereignis verstanden.<br />
Vorgänge der Innen- oder Außenwelt werden mit positiven oder negativen Empfindungen<br />
erknüpft (Schemel 1998, S.290). Ein Erlebnis ist in seiner<br />
Qualität und Wirkung immer ein subjektiver<br />
Bewusstseinsvorgang, er ist unmittelbar und individuell – man<br />
kann sich über Erlebtes austauschen, aber nicht die Erlebnisse als<br />
solche weitergeben. Sie sind auch deshalb nicht beliebig<br />
wiederholbar oder herstellbar, weil sie eng mit der Atmosphäre<br />
*<br />
Die Vorsilbe 'er-' weist auf<br />
einen inneren<br />
Verarbeitungsprozess und<br />
subjektive Aneignung hin<br />
(Ziegenspeck 1998).<br />
einer Situation zusammenhängen (Gebhard 2005, S.24). Ursprünglich ist der Erlebnisbegriff<br />
an Stille, Konzentration und Kontemplation gebunden, es benötigt Disziplin,<br />
Zurückgezogenheit, Hingabe an die Situation sowie Ernsthaftigkeit und ist offen für<br />
Reflexion. Es trägt zwar <strong>zur</strong> Bereicherung der Persönlichkeit bei, ist aber nach außen auf das<br />
die Person tragende größere Ganze (Kultur, Natur, Gesellschaft, Welt) orientiert. Für diese<br />
Art von Erlebnissen ist Natur ein ausgezeichneter Lernort.<br />
Die moderne Auffassung von Erlebnis macht es zu einem innenzentrierten Vorgang, zum<br />
Entertainment. Es geht um flüchtige Glücksmomente, Spaß, Kick, Sensation, um schrille<br />
Erlebnisse der Unterhaltung. Diese Art von Erlebnissen benötigt eine ständige Steigerung<br />
der Reize. Dabei ist Natur nur Kulisse (Gebhard 2005, S.24; Gebhardt 1998, S. 48f.).<br />
Erfahrung<br />
Erfahrung wird in der Philosophie als die empirische Form der Erkenntnis bezeichnet. Vom<br />
Verstand gespeicherte und strukturierte Erlebnisse werden zu Wissen in Form des<br />
'Erfahrungsschatzes'. Über sie kann es zu adäquaten Handlungen kommen, ohne dass eine<br />
rationale Durchdringung stattgefunden hat – man weiß aus Erfahrung, dass etwas<br />
funktioniert, ohne den genauen Grund zu kennen. Führt Erfahrung zu einer Veränderung,<br />
z.B. im Verhalten eines Menschen, so spricht man von Erfahrungslernen (Schemel 1998,<br />
S.207ff, Putensen 2000, S.38).<br />
Erkenntnis<br />
Erkenntnis ist durch analytische Reflexion erworbenes Wissen. Sie bezieht sich auf objektive<br />
Informationen und kann als solche weitergereicht werden. Auch Erkenntnis ist auf sinnlich<br />
vermittelte Daten angewiesen und kann nicht allein auf Sprachbegriffen beruhen. Es wäre<br />
ein Fehler, in der Bildungsarbeit auf rein rationale Belehrungen und verbale Vermittlung<br />
<strong>zur</strong>ückzugreifen. Bereits Comenius kritisierte zu Beginn des 17. Jahrhunderts den<br />
verbalistischen Unterricht seiner Zeit und forderte, die Lehre an die Sinne und die<br />
Anschauung zu knüpfen.<br />
Sprache ist ein Mittel der Benennung, der Grad der Erkenntnis hängt von der Quantität und<br />
Qualität der Assoziationen ab, die mit einem sprachlichen Begriff verbunden werden<br />
können. Diese greifen auf Erfahrungen <strong>zur</strong>ück. Jede rein sprachliche Vermittlung ist abstrakt<br />
und reduziert den Aspektreichtum der Wirklichkeit. Eigene Erfahrungen genießen höhere<br />
Glaubwürdigkeit als berichtete Information und verbleiben länger im Gedächtnis.<br />
Unmittelbare sinnliche Wahrnehmung übermittelt zudem bedeutend mehr Information und
Pädagogische Grundlegung<br />
dies schneller als Sprache. Die Fellmusterung eines Tieres ist z.B. optisch schnell zu<br />
erfassen, seine Beschreibung dagegen füllt Seiten. Nur auf Primärerfahrungen zu setzen,<br />
würde den Menschen jedoch unterfordern und zugleich seine Weiterentwicklung behindern.<br />
Es gehört zu seinen Spezifika, dass er in hohem Maße in der Lage ist, Fremderfahrungen zu<br />
übernehmen (Liedtke 1988).<br />
3.3.2 Didaktische Methoden<br />
Didaktische Methoden versuchen, die Verankerung der Information zu erreichen. Es geht um<br />
die Frage: Wie muss ich die Information überreichen, damit sie angenommen wird?<br />
3.3.2.1 Naturbegegnung – Naturerleben – Naturerfahrung<br />
(Aufgeführt als Methode u.a. bei Strohschneider 1998, S.6; Ebers et al. 1998, S.9, 12, 23;<br />
Beyrich 1998, S.11)<br />
„Naturerleben betont die einzigartige Wahrnehmungskompetenz des lernenden Subjekts“<br />
und „ist auf ästhetische und ethische Wertbildung und das dadurch begründete Handeln im<br />
Bereich des Natur- und Umweltschutzes gerichtet (...)“. In dieser aus der amerikanischen<br />
Naturinterpretation abgeleiteten Lernform geht es darum, Situationen zu schaffen, die<br />
sinnliche Naturerfahrungen ermöglichen und diese reflexiv aufzuarbeiten (Brilling & Kleber<br />
1999, S.158f.).<br />
Naturerfahrung wird oft als Voraussetzung für späteres Engagement im Umwelt- oder<br />
Naturschutz angesehen. Statistisch lässt sich jedoch kein Zusammenhang zwischen<br />
Aufenthalten in Natur bzw. Wissen über Natur und der Einstellung bzw. dem Verhalten<br />
gegenüber Natur belegen. Nicht jeder, der Natur kennt und/oder sie liebt, verhält sich<br />
umweltgerecht ebenso wie nicht jeder, der sich umweltgerecht verhält, über Natur Bescheid<br />
weiß, sie kennt und/oder liebt. Es kann enorme Diskrepanzen zwischen Umweltwissen,<br />
Wertorientierung und Handeln geben. De Haan & Kuckartz (1996, S.167) stellen fest: “Fakt<br />
scheint derzeit aber zu sein, daß schulische Umwelterziehung sich nur positiv auf das<br />
Umweltwissen der Schüler auswirkt, aber auf Einstellung und Verhalten so gut wie keinen<br />
Einfluß besitzt. Die Vermutung, der Kontakt mit der Natur erzeuge positive Gefühle und<br />
diese wiederum würden sich so auswirken, daß man die geliebte Natur schützen wolle,<br />
erweist sich als falsch. Auch kommen Aktivisten von Umweltschutzgruppen überwiegend aus<br />
städtischem Milieu und rekrutieren sich nicht aus der Landjugend“. Es gibt also keinen<br />
kausalen Zusammenhang zwischen Wissen, Einstellungen und Werten einerseits und<br />
umweltgerechtem Verhalten andererseits.<br />
Im Gegensatz dazu zeigt Lude (2005), dass tatsächliches Engagement im Naturschutz häufig<br />
mit Wissen, Gefühl und frühem Naturkontakt einhergeht. Statistisch lässt sich aber nicht<br />
ermitteln, ob Umweltverhalten auf Naturerfahrungen beruht oder ob Naturerfahrungen die<br />
Folge von Umweltverhalten sind (ebd., S.73ff.).<br />
Gebauer & Harada (2005) erläutern, dass der Zugang einer Person <strong>zur</strong> Natur – und damit<br />
auch ihr Verhalten im Bezug auf Natur – unter anderem von den Erfahrungen, Erlebnissen,<br />
Begegnungen und Eindrücken geprägt wird, die sie bereits in der Kindheit macht, wobei<br />
unmittelbare Kontakte wirkungsvoller als indirekte Erfahrungen (Bücher, Erzählungen,<br />
Filme) sind. Über frühe Naturerfahrungen können positive wie negative emotionale<br />
Beziehungen aufgebaut werden. Eine positive Beziehung zu Natur mag zwar kein Garant für<br />
adäquates Verhalten sein, aber sie erhöht die Wahrscheinlichkeit. Es kommt darauf an, ob<br />
45
46<br />
Der methodische Baukasten<br />
die Begegnung auf fruchtbaren Boden fällt, ob andere Einflüsse die Eindrücke wieder<br />
verwischen oder Barrieren einer Umsetzung im <strong>Weg</strong>e stehen (vgl. Baumgartner 2005). Dazu<br />
Lude (2005, S. 81): „Vielfältige Naturerfahrungen bilden eine besonders wichtige<br />
Grundlage für positive Einstellungen <strong>zur</strong> Natur und für Umwelt-/Naturschutzhandeln. Aber<br />
möglicherweise erst dann, wenn nähere Beschäftigung zu einer Reflexion des Erlebten führt.<br />
Und erst dann ändern sich auch die Einstellungen. Das Erlebte kann ansonsten auch als<br />
Normalität wirkungslos versinken.“<br />
Lude (2005) unterscheidet folgende Dimensionen der Naturerfahrung:<br />
• Ästhetische Dimension: Erfahren von Schönheit der Natur, fokussiert auf<br />
Erscheinungsformen von Lebewesen und Landschaften (Bewegungen, Formen,<br />
Farben, Gerüchen, Geräusche etc.)<br />
• Erkundende Dimension: Beobachten und Erforschen der Natur, Naturerfahrungen,<br />
die beruhend auf einer fragenden, nicht am Nutzen orientierten Grundhaltung das<br />
Untersuchen und Erforschen von Natur als Ziel haben. (Tiere und Pflanzen<br />
bestimmen, beobachten etc.)<br />
• Instrumentelle Dimension: Versorgen und Verwerten von Tieren und Pflanzen,<br />
Naturerfahrungen, die auf der von kurz- oder langfristigem Nutzen für den<br />
Menschen motivierten Beschäftigung mit Tieren und Pflanzen beruhen. Trotz<br />
intensivem Kontakt mit den Lebewesen entsteht keine enge soziale Bindung zu<br />
ihnen. (Früchte sammeln, Anbau, Zucht, Jagd etc.)<br />
• Naturschutzbezogene Dimension: Schützen von Arten und Biotopen. Aktivitäten,<br />
zum Schutz und Erhalt von Arten und Lebensräumen (Krötenzaun, Nisthilfe,<br />
Wildgarten)<br />
• Soziale Dimension: Pflegen einer besonderen Beziehung zu einem Tier. Sozial meint<br />
in diesem Falle nicht das gemeinsame Naturerleben mit anderen Menschen sondern<br />
das Erleben von Geselligkeit, Partnerschaft und Zuneigung in einer Sozialbindung<br />
zu einem Tier<br />
• Erholungsbezogene Dimension: Erholung in der Natur. Naturerfahrungen, bei denen<br />
aus dem Aufenthalt in der Natur emotionale Befriedigung geschöpft wird.<br />
(Natursport, Baden, Campen)<br />
• Ernährungsbezogene Dimension: Erwerb oder Verzehr von umweltbewusst<br />
produzierter Nahrung – hierbei geht es nicht um die unmittelbare Naturerfahrung bei<br />
Anbau bzw. Haltung und Ernte, sondern um den Genuss eines gesunden,<br />
umweltschonend produzierten Produkts<br />
• Mediale Dimension: Durch Medien vermittelte Naturerfahrung. Kein direkter<br />
Kontakt <strong>zur</strong> Natur (Filme, Diavorführungen, Bücher, Fotos, Dokumentationen,<br />
Zeitschriften, Internet)<br />
• Gestaltende Dimension: Naturerfahrungen im Zusammenhang mit Handlungen, die<br />
gestaltenden Einfluss ausüben, wie Hütten bauen, Bäche aufstauen<br />
• Spielerisch-herausfordernde Dimension: Naturerfahrungen im Zusammenhang mit<br />
abenteuerlichen oder herausfordernden Handlungen wie Baum erklettern oder<br />
draußen übernachten, wobei es auch zu zerstörerischen Handlungen kommen kann<br />
• Spirituelle Dimension: Naturerfahrungen im Zusammenhang mit spirituellen oder<br />
esoterischen Handlungen in der Natur.
Pädagogische Grundlegung<br />
Themenwege sind eine initiierte Form der Begegnung, wer Natur lieber selbst entdeckt, den<br />
wird diese aufbereitete Naturerfahrung eher stören. Es haftet ihr ein wenig der Geruch von<br />
Konsum an. Naturerleben über das Instrument 'Themenweg' bedeutet immer zu einem<br />
gewissen Grad Mittelbarkeit, selbst wenn zu unmittelbaren Erfahrungen, z.B. etwas<br />
anzufassen, aufgefordert wird. Aber darin könnte die Chance liegen, Menschen, die den<br />
Kontakt sonst nicht herstellen würden, zu erreichen. Er soll den Blick öffnen für Dinge, die<br />
sonst keine Beachtung fänden oder Dinge erklären, die ansonsten auf Unverständnis stoßen<br />
würden. Ein Themenweg kann Hilfestellung geben, vorausgesetzt, die Art und Weise der<br />
Anlage setzt Bezugspunkte <strong>zur</strong> Natur, statt diese zu verbauen. Aber: Naturerleben lässt sich<br />
nicht verordnen. Wie der Einzelne das Angebot umsetzt ist nicht planbar.<br />
Gebhardt (1998) erläutert drei Formen von Erlebnis im Bezug auf Natur. Sie verweisen auf<br />
mögliche Erwartungshaltungen, die man bei Besuchern von Themenwegen vermuten kann.<br />
a) Natur als Erlebnis – der einsame Wanderer<br />
Das Erlebnisideal von Personen, die diese Form des Naturerlebens präferieren, ist die<br />
kontemplativ ausgerichtete Selbstentfaltung. Für sie liegt der Nutzen eines solchen<br />
Erlebnisses im Genuss und stiller Erholung, Ausweitung des Erfahrungsschatzes und im<br />
Erkenntniszuwachs. Der Einzelne nimmt Natur in sich auf, reflektiert, wird sich seiner<br />
Stellung und ihres Wertes für ihn bewusst und dadurch befähigt, verantwortungsvoll mit ihr<br />
umzugehen. Das hohe Komplexitätsniveau und Reflexionsvermögen dieses Erlebnistyps<br />
lässt auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Natur hoffen. Restriktive Maßnahmen<br />
dürften akzeptiert werden, der einsame Wanderer ist vermutlich offen für<br />
Naturerlebnisangebote.<br />
b) Erlebnis in der Natur – der Extrem-Kletterer<br />
Das Erlebnisideal ist in diesem Falle die Bewältigung einer persönlichen Herausforderung<br />
und beruht auf dem modernen Erlebnisverständnis. Der Mensch will in aktiver Tätigkeit<br />
seine Grenzen testen bzw. überwinden, sich beweisen und in Szene setzen. Je höher das<br />
Risiko, desto besser. Natur hat Gebrauchswert und Objektcharakter, ohne sie wäre das<br />
Erlebnis aber nicht möglich. Diese Form des Naturerlebens ist im Vormarsch.<br />
Umweltgerechtes Verhalten wird akzeptiert, solange es die notwendigen Voraussetzungen<br />
für das individuelle Abenteuer garantiert. Sofern aktionszentrierte Räume eingebaut oder<br />
angegliedert sind, werden Naturerlebnisangebote vom Extrem-Kletterer angenommen,<br />
restriktive, betreuerische oder pädagogisierende Maßnahmen dürften aber auf Ablehnung<br />
stoßen.<br />
c) Erlebnis mit Hilfe der Natur – der passive Natur-Konsument<br />
Natur hat für ihn keinen Erlebniswert, sie ist lediglich der Ort für eine Inszenierung. Man<br />
muss sie mit Erlebniselementen wie Musik, Tanzshow und Scheinwerferlicht 'aufpeppen',<br />
um sie interessant und konsumierbar zu <strong>machen</strong>. Diese rein instrumentelle Haltung<br />
gegenüber Natur ist Ausdruck der Suche nach ultimativem Genuss. Umweltgerechtes<br />
Verhalten gilt als sozialer Zwang. Naturerlebnisangebote haben nur eine geringe Chance<br />
angenommen zu werden<br />
Dass Natur von einer immer größeren Zahl von Menschen als Erlebnisort begriffen wird,<br />
bestätigen auch die Untersuchungen von Brämer (1998). Er führt aus, dass dem<br />
47
48<br />
Der methodische Baukasten<br />
Erwartungshorizont zunächst Rechnung getragen werden muss, denn in ihm liegt der Ansatz<br />
eines emotionalen Bezugs zu Natur, der genutzt werden kann und auf keinen Fall über<br />
Belehrungen oder das Abspulen naturwissenschaftlicher Fakten zerstört werden darf (ebd.<br />
S.87f). Pädagogische Bemühungen sollten daher laut Brämer weniger an biologischen<br />
Details als viel mehr am Erleben der Kulisse Landschaft selbst ansetzen und vom<br />
Verständnis der Natur als Kulisse wegführen. Er plädiert für körperliche Aktivität in Form<br />
sanfter Fortbewegung (z.B. wandern), aber auch für Spiele und andere attraktive Aufgaben.<br />
Außerdem betont er die Wichtigkeit von Zeiten der Muße und des selbstbezogenen Genusses<br />
(ebd. S.88).<br />
Einen anderen Standpunkt vertritt Kleber (1998). Er ist der Auffassung, dass dem<br />
Naturkonsument Grenzen seiner Bedürfnisbefriedigung aufgezeigt werden sollten. Es gilt zu<br />
vermitteln, dass Natur niemals nur Konsummittel sondern immer auch Lebenssystem ist,<br />
dass bestimmte Verhaltensweisen störend bzw. zerstörerisch wirken und dass es auch nichtkonsumierende<br />
Formen von Naturerleben gibt. Naturkontakt allein wird das nicht bewirken.<br />
Der Konsument ist auf Grund seiner Erwartungshaltung gar nicht in der Lage, sich auf Natur<br />
als solche einzulassen. Er wird nicht einfach sein Wertesystem verändern oder plötzlich<br />
Rücksicht nehmen auf das, was bislang ausschließlich der Befriedigung seiner Bedürfnisse<br />
gedient hat. Er kann es nicht – es fehlt ihm der Blick und der Sinn dafür. Naturentfremdete<br />
Menschen benötigen behutsame aber konsequente Führung (Kleber 1998, S.165).<br />
Um weder ein 'Reservat für Naturschutzeliten' noch einen 'Tummelplatz für<br />
Erlebnissüchtige' zu produzieren, ist eine breite Angebotspalette von Erlebnismöglichkeiten<br />
anzustreben (Gebhard 1998, S.66f.). Lehrhafte und informative Elemente, stille Erholung,<br />
Führungen für Spezialisten, Veranstaltungen etc. können sich ergänzen, sollten aber<br />
räumlich getrennt werden. Aktivitäten, die das Erleben in der Natur (Extremkletterer) oder<br />
mit Hilfe der Natur (Konsument) anstreben, können dabei auf Räume ausweichen, die für<br />
das Naturerleben selbst (einsamer Wanderer) weniger geeignet sind.<br />
3.3.2.2 Ganzheitliches Lernen<br />
(Aufgeführt als Methode u.a. bei Ebers et al. 1998, S.6, 9, 11, 31; Lang & Stark 2000, S.9,<br />
70; Beyrich 1998, S.10)<br />
In der Regel soll mit 'Ganzheitlichkeit' zum Ausdruck gebracht werden, dass Herz (=<br />
Beziehung aufbauen), Hand = (praktische Erfahrung sammeln) und Verstand = (<strong>Den</strong>ken,<br />
Wissen, Reflexion) gleichzeitig angesprochen sein sollen. Die auf Pestalozzi <strong>zur</strong>ückgehende<br />
Vermutung, dass Kopf, Herz und Hand eine Lerneinheit bilden, ist heute wissenschaftlich<br />
fundierte Gewissheit. Je mehr neuronale Schaltungen im kindlichen Gehirn aktiviert werden,<br />
desto intensiver wird vernetztes Lernen und <strong>Den</strong>ken gefördert (vgl. 3.3.1 Lernen). In der<br />
Naturerlebnis-Pädagogik bezieht sich Ganzheitlichkeit zudem darauf, dass Sachverhalte,<br />
Phänomene und Sinneswahrnehmungen bei der Betrachtung in ihren Zusammenhängen<br />
belassen und nicht analytisch in ihre Bestandteile zerlegt werden. Dieses an Henry Thoreau<br />
erinnernde Prinzip verhindert, dass Lebewesen dem Forscherdrang des Menschen zum Opfer<br />
fallen (Wucherer 2003).
Pädagogische Grundlegung<br />
3.3.2.3 Exemplarisches Lernen<br />
(Aufgeführt als Methode u.a. bei Beyrich 1998, S.10)<br />
Diese Unterrichtsform stellt ein Gegenkonzept zum typischen vortragenden Frontalunterricht<br />
dar. Die Schüler erarbeiten sich das Wissen anhand von repräsentativen Beispielen selbst.<br />
Die Lösungen sollen auf ähnliche Fälle übertragbar sein, möglichst viele Aspekte des Faches<br />
beleuchten und der Ableitung ethischer Grundsätze dienen (http://www.stangltaller.at/Arbeitsblaetter/Wissenschaftpaedagogik/ModelleBildungstheorie.shtml;<br />
de.wikipedia.org/wiki/Frontalunterricht).<br />
3.3.2.4 Entdeckendes Lernen<br />
Die Grundidee dieses Unterrichtsprinzips findet sich bereits in der Antike, eine<br />
wissenschaftliche Diskussion darüber wurde aber erst in den späten 1950er Jahren von<br />
Jerome Bruner im Zusammenhang mit der konstruktivistischen Lerntheorie (vgl. 3.3.1<br />
Lernen) angestoßen. Auf ihn wird die Methode daher <strong>zur</strong>ückgeführt (www2.uni-jena.de<br />
/didaktik/did_03/bruner.htm).<br />
Kinder haben in der Regel von sich aus den Wunsch, Dinge auszuprobieren und zu lernen,<br />
sie stellen sich in ihrem täglichen Tun und Spiel immer wieder selbst gewählten<br />
Lernsituationen – z.B. lernen sie von sich aus laufen. Dabei entwickeln sie eine Vorstellung<br />
von den Konsequenzen der eigenen Handlung, sie lernen abzuschätzen, welche Handlung<br />
den gewünschten Erfolg bringen wird. Solche aktiv erarbeiteten Inhalte prägen sich besser<br />
ein, als von Anderen übernommene (intensivere Verschaltung von Neuronen im Gehirn).<br />
Durch die starke emotionale Beteiligung ('das will ich jetzt wissen') bringt das Kind<br />
zusätzliche intellektuelle Anstrengungen auf und gelangt zu tiefgreifenden Erkenntnissen.<br />
Die Methode beruht auf partizipativen Lernprozessen und selbständigem Forschen, statt<br />
vorgefertigte Lerninhalte zu vermitteln und Belehrungen zu geben. Der Lernende soll den<br />
Fragen, die ein Phänomen bei ihm aufwirft, selbständig nachgehen. Dabei dürfen (und<br />
sollen) auch Fehler gemacht werden. Der Lernbegleiter ist nicht mehr Präsentator von<br />
Wissen sondern Moderator eines Lernprozesses und soll den Lernenden vor wiederholten<br />
Misserfolgen schützen. Diese Methode fördert insbesondere den Erfindungsreichtum, die<br />
Ausdauer, das schlussfolgernde <strong>Den</strong>ken, die Fähigkeit <strong>zur</strong> Problemlösung, Reflexion und<br />
Diskussion. Sie setzt die Fähigkeit zum selbstständigen Arbeiten in gewissem Maße voraus<br />
und fördert sie zugleich (Thiel 2002).<br />
3.3.2.5 Erlebnisorientierung<br />
(z.B. Ebers et al. 1998, S.7, 13)<br />
Erlebnisorientiert zu arbeiten bedeutet, außergewöhnliche, nicht alltägliche Lernsituation zu<br />
erstellen (de.wikipedia.org/wiki/Erlebnispaedagogik). Da Lernen auf erlebnispädagogischer<br />
Grundlage immer subjektives Lernen ist, ist ein Erfolg schwer nachprüfbar, eine<br />
zielgerichtete Wirkung der Erlebnissituation kann nicht angenommen werden (z.B. Putensen<br />
2000, S.38). Es kann lediglich versucht werden, durch geschicktes Arrangement ein Ereignis<br />
herbei zu führen, das zum Erlebnis mit nachhaltigem Lerneffekt werden könnte (z.B.<br />
de.wikipedia.org/wiki/ Erlebnispaedagogik).<br />
Der US-amerikanische Psychologe Mihaly Csikszentmihalyi hält ein Erlebnis dann für<br />
besonders erfüllend, wenn sich das Flow-Gefühl einstellt. Damit bezeichnet er eine<br />
49
50<br />
Der methodische Baukasten<br />
Situation, die sich durch selbstvergessene Hingabe an die Aufgabe auszeichnet. Die völlige<br />
Konzentration auf das Tun lässt keine Aufmerksamkeit für andere Dinge. Man vergisst seine<br />
Sorgen, die Zeit (verzerrtes Zeitgefühl), sogar sich selbst (verspürt z.B. keinen Hunger).<br />
Dabei fällt es Menschen, die im Alltag keine Grenzerfahrungen gewohnt sind, relativ leicht,<br />
auch bei bescheidenen Anforderungen zu Flow-Erlebnissen zu kommen (www.interp.de).<br />
3.3.2.6 Problemorientierung<br />
(Aufgeführt als Methode u.a. bei Ebers et al. 1998, S.31; Beyrich 1998, S.10)<br />
Hierunter wird fallorientiertes Lernen anhand konkreter Problemstellungen verstanden<br />
(Beyrich 1998, S.10). Vorzugsweise handelt es sich um ein Problem mit Bezug <strong>zur</strong> Realität<br />
des Lernenden, z.B. ein Problem, das ihn direkt betrifft oder für dessen Lösung er sich aus<br />
anderen Gründen interessiert und welches er sich im besten Falle selbst gewählt hat.<br />
3.3.2.7 Situationsorientierung<br />
(Aufgeführt als Methode u.a. bei Ebers et al. 1998, S.31; Beyrich 1998, S.10)<br />
Hiermit ist die Orientierung des Lernstoffes auf Situationen aus dem Alltag der Lernenden<br />
gemeint. Aufbauend auf Bekanntem kann dann leichter Neues dazugelernt werden (z.B.<br />
Beyrich 1998, S.10). Der Bezug <strong>zur</strong> Lebenssituation löst zudem Betroffenheit aus, was<br />
wiederum entscheidend für das Überdenken von Lebensstilen ('das geht mich was an!')<br />
sowie die Lern- und Handlungsmotivation ('was kann ich tun?') ist (z.B. Beyrich 1998, S.10).<br />
Möglichkeiten, eine Situation zu erzeugen, die den Besucher umfasst und die Information<br />
mit seinem Alltag verbindet, zeigt Ludwig (2005, S.14) auf:<br />
• Bezug zu Zeit und Ort herstellen (Dieser Baum; In diesem Moment...)<br />
• Metaphern nutzen (Baumkrone, Blätterdach...)<br />
• Vergleiche ziehen (Bäume sind wie riesige Pumpen)<br />
• Beispiele geben (Dieser Baum zeigt uns, wie Bäume Verletzungen heilen)<br />
• Herausforderung bieten, etwas Bestimmtes zu tun<br />
• Aussicht bieten, etwas enthüllen zu können<br />
• Möglichkeit geben, zu helfen<br />
• Ergänzung von etwas Unvollständigem anregen<br />
3.3.2.8 Systemorientierung<br />
(Aufgeführt als Methode u.a. bei Ebers et al. 1998, S.31)<br />
Auf Grund der außerordentlichen Komplexität der Umweltthematik können ohne<br />
Systemverständnis und Systemkompetenz keine Entscheidungen getroffen werden. Es<br />
kommt darauf an, ob ein Individuum eine Verbindung zwischen seiner Handlung und deren<br />
Auswirkung herstellen kann und ob es die erforderlichen Kompetenzen besitzt, mit<br />
komplexen Systemen umgehen zu können. Systemverständnis bedeutet, „Umweltprobleme<br />
nicht als isolierte Ereignisse in linearen Ursache-Wirkungsketten zu betrachten, sondern<br />
eingebettet in ein Netz von ökologischen, ökonomischen und sozialen Zusammenhängen,<br />
zwischen denen komplexe, häufig nicht-lineare Wechselbeziehungen herrschen“. Das<br />
beinhaltet das prinzipielle Wissen um Fern- und Nebenfolgen, irreversiblen Veränderungen<br />
sowie die Anerkennung der Tatsache, dass es oft keine eindeutig optimale Lösung gibt.<br />
Systemkompetenz umfasst strategische Handlungskompetenzen wie:
Pädagogische Grundlegung<br />
• die Befähigung <strong>zur</strong> angemessenen Auswahl und Beurteilung von Information<br />
• das Erkennen der kritischen Aspekte einer Problemsituation<br />
• die Überprüfung und Berücksichtigung unterschiedlicher Sichtweisen<br />
• die Kalkulation langfristiger Folgen und Nebeneffekte eigener Handlungen<br />
• das Treffen umweltverträglicher, sozialverträglicher und den eigenen Interessen und<br />
Werten dienlicher Entscheidungen<br />
• die Übertragung erworbener Kompetenzen auf andere Bereiche bzw. das Erkennen<br />
der Grenzen eines solchen Wissenstransfers (Döring-Seipel 2001 S.12f.)<br />
3.3.2.9 Handlungsorientiertes Lernen<br />
(Aufgeführt als Methode u.a. bei Ebers et al. 1998, S.12, 31)<br />
Der dieser Methode zugrunde liegende Gedanke des 'Selber-Machens' ist das tragende<br />
Element in nahezu allen reformpädagogischen Ansätzen. Theoretisches Wissen und<br />
praktische Fähigkeiten werden integriert vermittelt. Entscheidend dabei ist die<br />
Zielorientierung. Der Lernende soll sich über bewusste, von ihm selbst auf ein Ziel hin<br />
durchdachte und geplante Eigenaktivitäten Kenntnisse aneignen. Dabei kann es sich um<br />
praktisch-konstruktive , ästhetische, spielerische oder dramaturgische Tätigkeit handeln. Ein<br />
so erworbenes Wissen – das ist die entscheidende Grundannahme – ist beim Lernenden<br />
fester verankert, es wird nicht nur 'abgelegt', sondern 'verinnerlicht'. Über die praktische<br />
Notwendigkeit zu kommunizieren oder gar Kooperationen einzugehen, um Lösung zu<br />
finden, kann auch soziales Handeln integriert werden. Der Lernprozess ist weitgehend vom<br />
Lernenden selbst gesteuert, sein Interesse und seine Aktivität entscheiden über den Erfolg,<br />
dieser liegt im wahrsten Sinne des Wortes in seiner Hand. Häufig gehört <strong>zur</strong><br />
Aufgabenstellung, ein materielles oder geistiges Handlungsprodukt zu erstellen. Solche<br />
Produkte bieten Identifikationsmöglichkeit für den Lernenden sowie einen Ansatz <strong>zur</strong><br />
Auswertung und Kritik (vgl. de.wikipedia.org/wiki/Handlungsorientierter_Unterricht;<br />
www.stangl-taller.at/Arbeitsblaetter/Wissenschaftpaedagogik/ModellHandlungsorientiert.<br />
shtml).<br />
Im Zusammenhang mit Themenwegen wird immer wieder von Handlungsorientierung<br />
gesprochen (z.B. Ebers et al. 1998. S.17). Insbesondere Rate-Stationen, bei denen die<br />
Antwort auf eine Fragestellung hinter einer Mechanik verborgen ist, werden regelmäßig als<br />
handlungsorientiert ausgewiesen, weil erst die geforderte Eigenaktivität, also das Betätigen<br />
der Mechanik, <strong>zur</strong> gewünschten Information führt. Hierbei wird Eigenaktivität mit<br />
Handlungsorientierung gleichgesetzt. Es geht beim handlungsorientierten Lernen jedoch<br />
nicht darum, einen Handgriff auszuführen um an eine Information zu kommen, sondern<br />
darum, eine Handlungsstrategie zu entwerfen und auszuprobieren. Die mechanische Station<br />
hat allenfalls für ein Kleinkind einen handlungsorientierten Lerneffekt, es lernt, wie man<br />
bspw. etwas umklappt. Auf das Erlernen der dahinter verborgenen Textinformation hat das<br />
Betätigen der Mechanik dagegen keinen Einfluss, schließlich würde niemand behaupten, aus<br />
einem Buch zu lernen, indem er dessen Seiten umblättert. Das Entscheidende an solchen<br />
Stationen ist das Ausnutzen der Neugier und die Aufforderung, zuerst nachzudenken und<br />
dann sein Wissen selbständig zu überprüfen.<br />
51
52<br />
3.3.2.10 Reflexives Lernen<br />
(Aufgeführt als Methode u.a. bei Beyrich 1998, S.10)<br />
Der methodische Baukasten<br />
„Die Bildung muss reflexiv werden. Das traditionelle Konzept von Umweltbildung sah etwa<br />
vor, durch Wissensvermittlung, Erziehung und Unterricht Umweltbewußtsein zu erzeugen.<br />
Von solchen Automatismen kann heute nicht mehr ausgegangen werden. Notwendig ist<br />
dagegen, den Erwerb von Fähigkeiten zu lernen, die es ermöglichen, bisheriges Wissen zu<br />
überdenken und ggfs. zu ändern.“ (Heidenreich 2005, S.23). Unter Reflexion versteht man<br />
die Umwandlung von Emotionen in Gedanken und die Integration von<br />
Sinneswahrnehmungen in das Bewusstsein. Es handelt sich um einen individuellen geistigen<br />
und seelischen Verarbeitungsprozess, der durch Kommunikation und Kontemplation<br />
stimuliert werden kann. Reflexion führt zu Verinnerlichung, sie ist wichtig beim Aufbau von<br />
Erfahrung aus Erlebnissen und für den Transfer. Reflexion spiegelt sich z.B. in Tagträumen,<br />
Träumen, Erlebnisschilderungen, Tagebucheinträgen, Zeichnungen, Aufsätzen oder<br />
Gedichten (Nutz 2003, S. 69).<br />
3.3.2.11 Förderung von sinnlicher Wahrnehmung und Körperlichkeit<br />
(Aufgeführt als Methode u.a. bei Ebers et al. 1998, S.9, 13; Lang & Stark 2000, S.9, 70;<br />
Beyrich 1998, S.10)<br />
Wache, scharfe Sinne sind als sensorische Voraussetzung für Wissen, Bewusstsein und<br />
Handlungsfähigkeit unverzichtbar. Sie lassen den Menschen einerseits seine gegenständliche<br />
Umwelt erfahren und verorten ihn darin, andererseits stellen sie den Kontakt <strong>zur</strong> eigenen<br />
Befindlichkeit her. Die Überbetonung der Vernunft bei gleichzeitiger Vernachlässigung der<br />
Leiblichkeit führt zum Verkümmern der Sinne. Dem wird mit der Förderung sinnlicher<br />
Wahrnehmung entgegenzuwirken versucht. Sie kann gezielt dazu eingesetzt werden,<br />
bestimmte Phänomene im Wahrnehmungsmuster von Personen zu verankern (Megerle 2003,<br />
S.240).<br />
3.3.2.12 Interaktivität<br />
(Aufgeführt als Methode u.a. bei Strohschneider 1998, S.6; Ebers et al. 1998, S. 24; Lang &<br />
Stark 2000, S.9)<br />
In der Literatur zu Themenwegen wird häufig die 'aktive Einbeziehung des Besuchers' mit<br />
'Interaktivität der Station' gleichgesetzt (z.B. Strohschneider 1998, S.6; Megerle 2003).<br />
Interaktivität bezeichnet das aufeinander bezogene Verhalten zweier oder mehrerer Personen<br />
mit dem Ziel der Kommunikation. Auch im Bereich der Computertechnik kann im Hinblick<br />
auf die wechselseitige Bezugnahme von Mensch und Computer von Interaktivität<br />
gesprochen werden, wenn sowohl der Person als auch dem Rechner unterschiedliche<br />
Wahlmöglichkeiten <strong>zur</strong> Verfügung stehen, wie das z.B. bei einem Schachprogramm der Fall<br />
ist (de.wikipedia.org/wiki/interaktivität). Das Entscheidende an Interaktivität ist die<br />
Wechselbeziehung. Mit Themenwegstationen tritt man in der Regel genauso wenig in<br />
Interaktion, wie mit einem Stuhl, auf den man sich setzt. Von interaktiven Stationen kann<br />
nur gesprochen werden, wenn diese computeranimiert sind. Interaktivität kann sich aber im<br />
direkten Kontakt mit anderen Besuchern oder Lebewesen entlang des Themenweges<br />
ausbilden. Über die Konzeption kann versucht werden, dies an<strong>zur</strong>egen.
Pädagogische Grundlegung<br />
3.3.2.13 Gruppenorientierung<br />
(Aufgeführt als Methode u.a. bei Ebers et al. 1998, S.112)<br />
Im gemeinsamen Lernprozess innerhalb einer Gruppe ergänzen sich die Kompetenzen<br />
einzelner, im Idealfall kann jeder etwas beisteuern und jeder lernt etwas vom anderen.<br />
Situationen, in denen Teamarbeit notwendig ist, fördern soziale Kompetenzen. Darunter<br />
fallen all jene Verhaltensweisen, die einer Person den Umgang mit einer Gruppe<br />
ermöglichen bzw. erleichtern. Dazu gehören beispielsweise einfühlsames Miteinander,<br />
Verantwortung, Vertrauen, Toleranz, Verständnis, kommunikative Fähigkeiten, Solidarität,<br />
Kompromissfähigkeit, Kooperationsbereitschaft, Fairness, Einhaltung von Regeln,<br />
Selbstkontrolle und Hilfsbereitschaft (z.B. Putensen 2000, S.42; de.wikipedia.org/wiki/<br />
Erlebnispaedagogik; Kellner-Rauch 2004, S.7; Beidernikl 2001, S.85). Diese Kompetenzen<br />
sind zudem Voraussetzungen für politisches Handeln.<br />
3.4 Der Möglichkeitsraum<br />
Die Meinungen darüber, was ein Themenweg tatsächlich leisten kann, gehen weit<br />
auseinander.<br />
Heidenreich (2005) ist der Ansicht, ohne Betreuung können selbst gut konzipierte Lehrpfade<br />
nur in den seltensten Fällen Teilaspekte von Umweltbildung umsetzen. Andere Autoren,<br />
bspw. Nutz (2003, S.36), schreiben ihnen eine umfassende Wirkungsweise zu. Demnach<br />
können Themenwege Naturerfahrung bieten, Wissensvermittlung betreiben und rationale<br />
Auseinandersetzung anregen, Natur-Mensch-Konflikte thematisieren, den Wert der<br />
Landschaft kommunizieren und Emotionen wecken. Altschwager (1998) betont, dass dies<br />
nur eine motivierende Wirkung sein kann. Themenwege können einen Funken entzünden, sie<br />
bieten Voraussetzungen zum Naturerlebnis und <strong>zur</strong> Erzeugung von Verständnis und Gefühl.<br />
Um aber von Gefühlsregungen zu umweltbewusstem Handeln zu kommen, bedarf es der<br />
Reflexion und Übung, die am <strong>Weg</strong> nicht erreicht werden kann, sondern z.B. in der Arbeit in<br />
Vereinen stattfinden muss.<br />
Ich gehe davon aus, dass ein Themenweg bei niemandem einen radikalen Umschwung in<br />
Ansichten und Wertvorstellungen bewirken wird, ebenso wenig wie „im Schnelldurchgang“<br />
Experten ausgebildet werden können. Aber Menschen können – im wahrsten Sinne des<br />
Wortes – an etwas herangeführt werden. Dies kann auf verschiedene Art und Weise<br />
geschehen. Mit dem Möglichkeitsraum stelle ich im Folgenden eine mehrstufige Gliederung<br />
vor, nach der Themenwege typisiert werden können und erläutere den Oberbegriff<br />
'Themenweg'.<br />
3.4.1 Bestehende Klassifikationen<br />
In bestehenden Klassifikationen wird entweder auf eine sinnvolle Kombination von<br />
Unterscheidungsmerkmalen verzichtet, oder diese wird zu streng gehandhabt. In allen Fällen<br />
ist eine befriedigende Zuordnung von real existierenden Themenwegen nicht möglich.<br />
Ebers (1998, S.16f., 28) unterschiedet 10 Pfad-Kategorien, die jedoch eher eine<br />
beschreibende Aufzählung als eine Strukturierung darstellen. Nutz (2003, S.43ff.) und<br />
Megerle (2003, S.5ff.) arbeiten unterschiedliche Klassifikationsmerkmale heraus, ihre<br />
Gliederungen bleiben aber unvollständig und unbefriedigend. Die gestaffelte Strukturierung<br />
53
54<br />
Der methodische Baukasten<br />
von Lang & Stark (2000, S.16ff.) gibt einen besseren Überblick, führt aber zu unflexiblen<br />
Typen und einer ebenfalls unbefriedigenden 'Restkategorie'.<br />
3.4.2 Ebenen des Möglichkeitsraumes<br />
Völlig unabhängig von den die Ausgestaltung betreffenden Fragestellungen ist die<br />
ausgewählte Thematik (I). Themenwege können monothematisch oder polythematisch<br />
angelegt sein, sie können sich mit rein naturwissenschaftlichen ebenso wie mit<br />
kulturhistorischen oder beiden Ereignissen zugleich befassen. In der Praxis wird die<br />
Thematik häufig bereits im Namen kenntlich gemacht, z.B. Orchideen-Lehrpfad. Meine erste<br />
Unterteilung erfolgt nach der Intensität des Einbezugs der Besucher, also dem Grad der<br />
Erlebnisstation<br />
(technische)<br />
Installationen<br />
Aufgabenstellung<br />
ohne Installation<br />
Lehrpfad Lernpfad Erlebnispfad<br />
Kunstobjekt (Kunstpfad)<br />
Tafel<br />
flexibel<br />
(Wunderpunkt)<br />
fest<br />
(Schilder-<br />
Information fest installiert<br />
(möblierter Pfad)<br />
Thema<br />
Text und Bild<br />
Info-Schrift bei<br />
Station<br />
Abb. 4: Möglichkeitsraum von Themenwegen<br />
pfad)<br />
Broschüre<br />
Eigenaktivität, der ihnen abverlangt wird (II). Dies ist die Ebene der Kategorien Lehr-, Lern-<br />
und Erlebnispfad. Die nächste Stufe betrachtet die Medien oder Informationsträger, mit<br />
denen die Kategorien arbeiten können (III).<br />
1. 'Station':<br />
a) Gerätschaft (Spielgerät, Kükelhaus-Erfahrungsstation, Bewegungsstation etc.)<br />
b) Aufgabenstellung (Spiel, schöpferische Tätigkeit etc.)<br />
2. Kunstwerk ('Kunstpfad') – Skulptur, Bilderstele etc.<br />
3. Text<br />
a) Schild – fest installiert ('Schilderpfad') oder flexibel ('Wunderpunkt')<br />
b) An Ort und Stelle deponierte Informationsschrift<br />
c) Broschüre, Faltblatt – zum Behalten oder zum Ausleihen<br />
4. Technik ('Technisierter Pfad') – Walkman, Computer<br />
5. Aktionskoffer, Rucksack ('Mobiler Pfad')<br />
6. Person ('Betreuter Pfad')<br />
zum<br />
Mitnehmen<br />
zum<br />
Ausleihen<br />
Technik<br />
(technisierter<br />
Pfad)<br />
Computer<br />
Walkman<br />
Mobiler<br />
Pfad<br />
Aktionskoffer<br />
Aktionsrucksack<br />
Information am Mann<br />
(Nummernpfad)<br />
Person (betreuter Pfad)<br />
Intensität der<br />
Eigenaktivität<br />
Medien<br />
(Betreuungsebene)<br />
Präsenz
Der Möglichkeitsraum<br />
Zuletzt wird nach der Art der Präsenz getrennt (IV). Pfade mit an Ort und Stelle fest<br />
installierter Information ('Möblierte Pfade') sind von solchen zu unterscheiden, bei denen der<br />
Besucher die Information dabei hat und im Gelände lediglich Stationsnummern vorfindet<br />
('Nummernpfade'). Themenwege können ganz individuell aus dieser Fülle der <strong>zur</strong> Verfügung<br />
stehenden Werkzeuge zusammengesetzt werden.<br />
I. Die Thematik – namensgebend für den Themenweg<br />
Bildungseinrichtungen, die stationsartig entlang bemerkenswerter Objekte angelegt sind,<br />
werden je nach didaktischer Ausgestaltung in Lehr-, Lern- und Erlebnispfade unterschieden.<br />
Der Terminus Lehrpfad wird gleichzeitig als Oberbegriff für solche Einrichtungen<br />
verwendet.<br />
Um die Dopplung bzw. Unschärfe des Begriffs zu vermeiden, schlage ich nach Prüfung<br />
weiterer Möglichkeiten * vor, 'Lehrpfad' im Sinne eines Oberbegriffs durch 'Themenweg' zu<br />
ersetzen. Auch dieser Terminus tritt in der Literatur mit unterschiedlicher Bedeutung auf<br />
(Lang & Stark 2000, S.16f.; de.wikipedia.org/wiki/Lehrpfad, Nutz 2003, S.9), diese sind<br />
*<br />
Naturpfad: schließt z.B. auf Kultur bezogene oder in<br />
Gebäuden angelegte Einrichtungen aus<br />
Bildungspfad: zu große Nähe zum Terminus 'Bildungsweg',<br />
assoziiert eine bestimmte Methode in der<br />
Umweltbildung<br />
Umweltbildungspfad: siehe „Bildungspfad“<br />
Umweltpfad: thematische und örtliche Konnotationen<br />
(Assoziation zu Umweltschutz),<br />
Stationspfad: verweist auf die Methode, stationsweise<br />
vorzugehen, impliziert aber Möblierung<br />
55<br />
meines Erachtens aber noch<br />
weitgehend ungefestigt. Ich gehe<br />
daher davon aus, dass der Begriff<br />
'Themenweg' mit der im<br />
Folgenden definierten inhaltlichen<br />
Besetzung eine Chance<br />
hat, sich zu etablieren.<br />
Die Thematik eines <strong>Weg</strong>es ist für<br />
eine Klassifikation völlig<br />
irrelevant. Lehr-, Lern- oder<br />
Erlebnispfade können jeweils zu<br />
jeder beliebigen Thematik konzipiert werden, daher eignet sich der Terminus 'Themenweg'<br />
sehr gut als neuer Oberbegriff. Er weist völlig wertfrei darauf hin, dass entlang eines <strong>Weg</strong>es<br />
eine bestimmte Thematik behandelt wird.<br />
Ein Themenweg ist ein <strong>Weg</strong>, der entlang von mehr oder weniger ausgebauten Stationen<br />
über eine mehr oder weniger eng gefasste Thematik informiert, wobei auf<br />
verschiedenste Formen der Vermittlung <strong>zur</strong>ückgegriffen werden kann und der Ort der<br />
Vermittlung keine Rolle spielt. Ein Themenweg könnte sich z.B. auch auf einem alten<br />
Zechengelände oder in einem geschlossenen Gebäude befinden und muss keineswegs die<br />
Natur zum Gegenstand der Betrachtung haben. Eine vergleichbare Auffassung vertritt<br />
Megerle (2003, S.6).
56<br />
Der methodische Baukasten<br />
Vorteile • Selbst-Bildungs-Angebot, Freiwilligkeit � bessere Verinnerlichung des Wissens<br />
• Selbstbedienungsangebot; Besucher entscheidet selbst über Intensität seiner<br />
Auseinandersetzung und zeitlichen Aufwand<br />
• niedrige Hemmschwelle; kann Leute erreichen, die nicht an Führungen teilnehmen<br />
• übt im sich Einlassen, Einfühlungsvermögen, Hineindenken, sich Zeit nehmen<br />
• für Gruppen ebenso wie für Einzelpersonen geeignet<br />
• kann zielgruppenspezifisch angelegt werden<br />
• Ausrichtung auf ausgewählte Phänomene erhöht Potenzial für bestimmte<br />
Erlebnisse, fokussiert die Aufmerksamkeit<br />
• Anschauung der Objekte vor Ort; direktes Erleben und unmittelbarer Kontakt<br />
• stets präsent, meist ganzjährig nutzbar<br />
• individuell für den Standort und die Zielsetzung konzipierbar<br />
• Aufnahme größere Besuchermengen ohne negative Masseneffekte<br />
• Besucherlenkung<br />
• geringer Personalaufwand<br />
Nachteile • Selbstbedienungsangebot, Besucher ist auf sich allein gestellt<br />
• Transfer und Interpretation des Erlebten müssen allein vollzogen werden<br />
• Ausrichtung des Besuchers auf ausgewählte Phänomene schränkt<br />
Erlebnisfähigkeit ein bzw. führt zu Enttäuschung wenn Phänomen nicht da ist<br />
• Instrumentalisierung des Spazierganges<br />
• Spaziergang wird zum Steh-Event<br />
• erfordert Zeit, Einfühlungsvermögen, Bereitschaft, sich einzulassen<br />
• Lenkung bedeutet Restriktion des Besuchers, nicht jeder will gelenkt werden<br />
• auf einzelnen Besucher als Individuum kann nicht eingegangen werden<br />
• Infrastrukturelle Erschließung demonstriert Verfügungsgewalt über Natur<br />
• thematischer Gegenstand, z.B. Natur, wird zum Konsumgegenstand und<br />
Produktionsfaktor für das Dienstleistungsgewerbe<br />
• wenig Unterhaltungswert für Computergeneration<br />
• Integration aller Bevölkerungsschichten schwierig (z.B. behinderte Menschen)<br />
• relativ unflexibel<br />
• finanzieller und logistischer Aufwand<br />
• Attraktivitätsverlust durch Vandalismus, Verfallserscheinungen, veraltete Konzepte<br />
Abhilfe • Betreuter Themenweg<br />
• Blindenschrift, Mehrsprachigkeit, Barrierefreiheit<br />
II. Die Intensitätskategorien<br />
Historisch betrachtet hat sich eine Entwicklung von Lehr- über Lern- hin zu Erlebnispfaden<br />
vollzogen. Die Intention der Informationsvermittlung liegt allen drei Typen gleichermaßen<br />
zu Grunde. Sie unterscheiden sich aber hinsichtlich der Annahme, was zu einer effektiven<br />
Informationsaufnahme benötigt wird. Während Lehrpfade sich auf rezeptive<br />
Informationsaufnahme beschränken, erfordert der Lernpfad insbesondere geistige<br />
<strong>Den</strong>ktätigkeit und der Erlebnispfad zusätzlich körperliche und schöpferische Aktivitäten. Es<br />
ist also eine Zunahme der vom Besucher abverlangten Eigenaktivität bzw. eine verstärkte<br />
aktive Einbindung des Besuchers zu beobachten.<br />
a) Lehrpfad<br />
Der Lehrpfad wählt eine rein rezeptive Form der Wissensvermittlung, was aber eine<br />
Ansprache des Gefühls z.B. über schöne Bilder, ansprechende Texte oder Gedichte nicht
Der Möglichkeitsraum<br />
ausschließt. Auch wenn der Name auf Belehrung hindeutet, ist es möglich, moderne,<br />
ansprechende Lehrpfade zu konzipieren.<br />
Sie müssen sich weder in sachlich-nüchternen Abhandlungen von Fachwissen erschöpfen,<br />
noch können sie mit 'Schilderpfaden' gleichgesetzt werden, wie von Lang & Stark (2000,<br />
S.9) behauptet.<br />
Informationsmedien, die nur auf rezeptive Aufnahme setzen, müssen größten Wert auf<br />
ansprechende Gestaltung legen, denn nur, wenn Information mit Spannung, Spaß und<br />
Emotion aufgeladen ist, bleibt sie gut im Gedächtnis verankert (vgl. 3.3.1 Lernen). Dabei<br />
können sie neben Texttafeln auch auf die Medien Technik und Kunst <strong>zur</strong>ückgreifen.<br />
Charakteristisch für diesen Typ ist eine geringe Eigenaktivität des Besuchers.<br />
Vorteile • relativ einfache Konzeption, lediglich Aufarbeitung und Aufbereitung von<br />
Sachinformation<br />
• Fertigkonzepte auf dem Markt<br />
Nachteile • rein rezeptive Wissensvermittlung<br />
• Besucher als Aufnehmender, sehr geringe Eigenaktivität<br />
• Effektivität gering, ohne Spaßfaktor unattraktiv<br />
• Fertigkonzepte bewirken Austauschbarkeit, Beliebigkeit<br />
Abhilfe • Über Gestaltung die kognitive und affektive Ebene ansprechen<br />
b) Lernpfad<br />
Der weltweit erste bekannt gewordene Themenweg (1925, Palisade Interstate Park, USA)<br />
war ein Lernpfad. Zuerst wurde Information geliefert und danach in einem Abfrageteil<br />
geistige Eigenleistung eingefordert, mittels der die Information wiederholt und gefestigt<br />
werden sollte. Bei der Umsetzung dieses Konzepts in Deutschland (erstmals 1930) ging das<br />
Moment der Eigenaktivität zunächst verloren. Erst in den 1970er Jahren setzte es sich in<br />
Anlehnung an die Idee des 'Grünen Klassenzimmers' – also eines Unterrichts im Freien –<br />
auch hier durch. Der Typus konfrontiert mit Fragestellungen, die gelöst werden sollen, der<br />
Besucher erarbeitet sich das Wissen selbst. Ursprünglich auf die Zielgruppe 'Schüler'<br />
ausgerichtet, kann diese Art der Information auch bei anderen Zielgruppen angewendet<br />
werden (Ebers et al. 1998, S.12).<br />
Dieser Pfadtyp zeichnet sich durch eine mittlere Eigenaktivität des Besuchers aus.<br />
Vorteile • Fertigkonzepte auf dem Markt, finanzieller Vorteil<br />
• raten, denken, Aufgaben lösen = mittlere Eigenaktivität gefragt<br />
Nachteile • aufwendigere Konzeption, wenn er ortspezifisch sein soll , Sachinformation muss in<br />
Aufgabenstellung umgearbeitet werden<br />
• überwiegend geistige Aktivität<br />
• Fertigkonzepte bewirken Austauschbarkeit, Beliebigkeit<br />
Abhilfe • Verschiedene Schwierigkeitsgrade z.B. für Altersgruppen oder Schulformen<br />
c) Erlebnispfad<br />
Ein 'Erlebnispfad' zielt – anders als die Erlebnispädagogik als solche – nicht vordergründig<br />
auf die Persönlichkeitsentwicklung, sondern will eine Thematik vermitteln. Dabei bedient er<br />
sich erlebnispädagogischer Elemente wie körperlicher Aktivität, Problemlöseaufgaben,<br />
57
58<br />
Der methodische Baukasten<br />
Sinnesübungen oder Aktionen im künstlerischen Bereich. Analog <strong>zur</strong> Erlebnispädagogik<br />
wird versucht, das Erlebnis als Lernsituation zu nutzen. Dabei ergibt sich aus der heute<br />
häufig anzutreffenden Interpretation des Wortes 'Erlebnis' als Kick, Aktion oder<br />
Entertainment das Problem überzogener Erwartungen seitens der Besucher an eine solche<br />
Einrichtung. Die Bezeichnung wird andererseits aber auch unverdienter Weise benutzt. Eine<br />
Fühlbox macht noch keinen Erlebnispfad. Megerle (2003, z.B. S.359) stellt in den von ihr<br />
aufgestellten Qualitätsstandards fest, dass ein (Natur)-Erlebnispfad mindestens an 75%<br />
seiner Stationen den Besucher aktiv einbeziehen muss und an ebenfalls 75% der Stationen<br />
sensorische Anregung erfolgen muss. Im Vergleich zu den beiden anderen Intensitätstypen<br />
Lehr- und Lernpfad legt der Erlebnispfad mehr Gewicht auf die emotionale Sensibilisierung<br />
für das Thema, als auf die Vermittlung von Sachwissen. Ein typischer Erlebnispfad fordert<br />
mithin geistige, kreative und körperliche Aktivität des Besuchers, er ist durch hohe<br />
Eigenaktivität charakterisiert.<br />
Vorteile • Fertigstationen auf dem Markt, finanzieller Vorteil<br />
• Einbeziehung aller Sinne<br />
• hohes Maß an Eigenaktivität gefragt<br />
• körperliche und geistige Aktivität<br />
• Ausgleich von Bewegungsmangel und motorischen Defiziten<br />
• anschauliche, sinnlich erfahr- und erlebbare Aufbereitung von Wissen<br />
Nachteile • sehr aufwendige Konzeption, wenn ortspezifische Ausrichtung angestrebt ist,<br />
Informationen verschiedener Art müssen geschickt verpackt werden<br />
• überzogene Erwartungen (Gleichsetzung von Erlebnis mit Entertainment)<br />
• fördert Konsumhaltung<br />
• bei Anlage in der Natur Gefahr der Ablenkung von dieser bzw. Natur als Kulisse<br />
• Fertigkonzepte bewirken Austauschbarkeit, Beliebigkeit<br />
Abhilfe • Naturbezug gewährleisten<br />
d) Diskussion weiterer Begriffe<br />
Naturerlebnispfad: Ein Naturerlebnispfad ergibt sich aus der Kombination der Kategorie<br />
'Erlebnispfad' mit dem Thema 'Natur' einerseits und der didaktischen Methode des<br />
'Naturerlebens' andererseits. Ein Erlebnispfad in der Natur, der natürliche Objekte benutzt,<br />
um eine positive Lernsituation zu erzeugen, ist noch kein Naturerlebnispfad. Bei einem<br />
solchen müssen zusätzlich Kenntnisse über Natur und Verständnis bzw. Wertschätzung für<br />
Natur vermittelt werden. Dazu Ina Altschwager (1998, S.38): „Übergeordnetes Ziel des<br />
Naturerlebnispfades ist im Sinne einer naturbezogenen Pädagogik die ganzheitliche<br />
Naturerfahrung, das Knüpfen der verloren gegangenen Beziehung zwischen Mensch und<br />
Umwelt: es geht darum, sich wieder als einen Teil der Natur wahrzunehmen. Liebe <strong>zur</strong><br />
Natur soll ermöglicht und geweckt werden. Hierbei steht nicht primär die Wissensbildung im<br />
Vordergrund. Vielmehr stellt, wie es Pestalozzi schon bemerkte, die Bildung des Herzens die<br />
Basis für die Ausbildung von Wissen und Können dar. Der Besucher wird auf dem Pfad<br />
angeregt, sich mit den verschiedenen Erfahrungsbereichen zu beschäftigen, mit denen sich<br />
Natur erschließt“.<br />
Dabei kann sich auf allgemeine Naturphänomene beschränkt werden. Es entstehen dann<br />
Stationen, die identisch auf andere Pfade übertragen werden können, z.B. Weitsprunggrube,<br />
Barfußpfad oder Baumxylophon. Geht man dagegen konkret auf die Situation vor Ort ein,<br />
entstehen individuelle Stationen, die ein spezielles Naturphänomen in der am Ort<br />
vorzufindenden Einmaligkeit darstellen. Beim Natuerlebnispfad ist angestrebt, Natur selbst
Der Möglichkeitsraum<br />
zum Erlebnis werden zu lassen. Dabei können drei Bereiche unterschieden werden: Das<br />
Naturerlebnis als primär geistiger Prozess umfasst ästhetische und erkenntnistheoretische<br />
Erfahrungen mit Natur. Das Naturerlebnis über Motorik beruht auf körperlicher Aktivität.<br />
Naturerlebnis mit allen Sinnen versucht, möglichst vielfältige Wahrnehmung zu<br />
ermöglichen. „Am geeignetsten <strong>zur</strong> Vermittlung eines nachhaltigen Naturerlebnisses ist<br />
natürlich eine Kombination aus allen drei Modulen (...)“ (Megerle 2003, S.271f.).<br />
Wie unter 3.3.1 Erlebnis ausgeführt, ist Erleben eine subjektive Kategorie, ein Erlebnis kann<br />
folglich nicht inszeniert werden. Eine Begegnung dagegen kann arrangiert werden, der<br />
Terminus Naturbegegnungspfad wäre daher im Grunde passender, hat aber weniger<br />
Marketingwirkung.<br />
Interpretationspfad: Ludwig (2005, S.37) gliedert neben den klassischen Kategorien den<br />
Interpretationspfad aus, der entlang einer Themenlinie eine Beziehung zwischen Besucher<br />
und Phänomen aufbaut. Nach meiner Einschätzung entspricht dieser jedoch je nach<br />
Aufmachung einem Lehr-, Lern- oder Erlebnispfad. Das Entscheidende an der<br />
Naturinterpretation ist die auf den Besucher zugeschnittene Deutung des Phänomens. Ein<br />
Themenweg kann nur eine fixierte Leitidee wiederspiegeln. Dabei kommen weder neue<br />
Techniken zum Einsatz, noch ist ein vierter Intensitätsgrad auszu<strong>machen</strong>, der eine eigene<br />
Kategorie rechtfertigen würde.<br />
Entdeckungspfad (Megerle 2003, S.7): Dieser Begriff deckt sich mit der Kategorie<br />
'Nummernpfad'.<br />
Sinnespfad: Um diesem Namen gerecht zu werden, muss ein Themenweg meines Erachtens<br />
überwiegend oder ausschließlich mit Sinnesstationen arbeiten.<br />
Dialogpfad: Das Bayrische Staatsministeriums für Landwirtschaft und Forsten (2004)<br />
versteht hierunter einen Pfad, der ausschließlich mit Klapptafeln arbeitet und eine<br />
Begleitbroschüre mit vertiefenden Informationen anbietet. Eine Klapptafel ist eine Form der<br />
Wissensvermittlung, die zunächst eigenes Nachdenken anregen soll, bevor die Information<br />
übermittelt wird. Ein solcher <strong>Weg</strong> ist in meinen Augen nichts anderes als ein Lernpfad, der<br />
sich zu Aktionselementen umgestalteter Tafeln bedient.<br />
Interaktionspfad: Diese Bezeichnung findet sich ebenfalls beim Bayrischen<br />
Staatsministeriums für Landwirtschaft und Forsten (2004). Als Beispiel wird der<br />
Naturerlebnispfad im Nationalpark Bayerischer Wald genannt. Prinzipiell ist ein<br />
Interaktionspfad zwar denkbar, die Bezeichnung dürfte aber aus den unter 3.3.2.12<br />
aufgeführten Gründen für keinen der momentan exstierenden Pfade zutreffen.<br />
Sonstige Begriffe: Naturpfad, Wandelpfad, Kunstpfad oder Wichtelpfad sind Begriffe, die<br />
auf die Thematik (Natur), die Aufmachung (Wichtel als fiktive Führer), das Medium (Kunst)<br />
oder die Intention (Wandel bewirken) einer lokalen Einrichtung hinweisen. Solche<br />
Konzeptionen bewegen sich innerhalb des aufgespannten Möglichkeitsraums und stellen<br />
keine neuartigen Kategorietypen dar.<br />
III. Die Medienkategorien<br />
Umsetzungsinstrumente, Mittel oder Medien sind die Träger der Information. Zur<br />
Umsetzung der Intensitätsstufen eignen sich verschiedene Medien jeweils unterschiedlich<br />
gut.<br />
59
60<br />
1) Informationsträger Text, Bild, Symbol<br />
Vorteile • viel auf einmal darstellbar<br />
Der methodische Baukasten<br />
• künstlerische Gestaltung (= Emotion, Ästhetik)<br />
• relativ preisgünstig<br />
• alle Intensitätsstufen umsetzbar<br />
• einfache Erfolgskontrolle: Meinungsabfrage, dabei aber Problem des Rücklaufs<br />
Nachteile • Gefahr der Überladung = Übermüdung, Aufnahmefähigkeit erlahmt<br />
• Gefahr der reinen Informationsweitergabe<br />
• Gefahr der Überforderung durch Fachwissen = Interesse erlahmt<br />
• Gefahr der einseitig rezeptiven Wissensvermittlung<br />
• Verknüpfung Information und Realität schwierig<br />
• künstlerische Gestaltung kann Wissensvermittlung behindern<br />
• Gefahr der Alibifunktion, einfache Art, sich Umweltimage zuzulegen<br />
Abhilfe • Zielgruppe beachten<br />
Text<br />
• Gestaltungsgrundsätze für Textmedien beachten<br />
• Aufgabenstellungen, Anleitung für Aktivität integrieren<br />
Die klassischen Textmedien Schild und Broschüre können bei allen drei Intensitätsstufen<br />
zum Einsatz kommen. Bei Lehrpfadkonzeptionen beschränken sie sich auf die Wiedergabe<br />
von Information, Lernpfadtexte stellen den Besucher vor zu lösende Aufgaben. Anregungen<br />
<strong>zur</strong> Naturerfahrung, für Spiele oder <strong>zur</strong> Erschaffung eines kleinen Kunstwerks, wie sie in<br />
Erlebnispfadkonzepten vorkommen, können ebenfalls über Texte gegeben werden. Über<br />
Gedichte, Zitate oder Erfahrungsberichte kann das Gefühl angesprochen, Lernleistungen<br />
über Arbeitsbögen abgefragt werden. Die Möglichkeiten einer Textinformation mögen<br />
beschränkter sein, als die von anderen Medien, dennoch liegen viele angebliche Nachteile<br />
des Textmediums nicht in ihm selbst begründet, sondern in einer schlechten Gestaltung. Dies<br />
gilt beispielsweise wenn der Bezug zum konkreten Phänomen oder Ort fehlt, der Textträger<br />
überladen wirkt, Fachsprache und Fachinformationen den Laien überfordern oder der Text<br />
sich auf Sachinformationen beschränkt.<br />
Bild<br />
Bilder werden seit Menschengedenken genutzt, um Sachverhalte zu vermitteln. Durch<br />
geistige Auseinandersetzung mit dem Bild wird die darin enthaltene Aussage abstrahiert und<br />
ein inneres Bild (= Vorstellungen) erarbeitet. Bilder können auch dazu dienen, Inhalte von<br />
Texten oder Erzählungen zu vertiefen. Zu diesem Zwecke sollen sie immer wieder<br />
angeschaut werden können, mit jeder Anschauung wird an das daran erarbeitete Wissen<br />
erinnert (www2.uni-jena.de/didaktik/did_02/philantrophen.htm). Bildelemente auf einer<br />
Tafel werden schon aus der Entfernung wahrgenommen. Sie können dazu einladen, den Text<br />
zu lesen. Über die künstlerische Gestaltung kann der Zugang zum Besucher erleichtert<br />
werden – sie kann allerdings die Wissensvermittlung auch behindern, z.B. wenn<br />
Schwerpunkte fehlen, über die Wissen 'hängen' bleibt, oder das Bild nicht mit dem<br />
Textinhalt übereinstimmt. Bildelemente sollen die Textaussage unterstreichen, sie mit einem<br />
Blick kenntlich <strong>machen</strong>, dem Betrachter eine Vorstellung geben oder eventuell einen<br />
verborgenen Vorgang veranschaulichen.
Der Möglichkeitsraum<br />
Symbol<br />
Über die Möglichkeit der Nutzung von Symbolen kann ein Bezug zum Alltag des Besuchers<br />
hergestellt werden.<br />
Symbole sind verschlüsselte Zeichen. Sie tarnen eine Aussage, die für Nicht-Eingeweihte<br />
daher unverständlich bleibt (Becker 2002, Vorwort). Symbole sind ausgesprochen<br />
mehrdeutig (Herder-Lexikon Symbole 2003,<br />
Einführung). Sie stehen für Getrenntes, das Kraft innerer<br />
Verbundenheit zusammen gehört. In ihnen werden<br />
verschiedene Wirklichkeiten verbunden. Die Ebene des<br />
sinnlich Erfahrbaren in Form des materiellen Symbols verweist auf eine über das Sinnliche<br />
hinausgehende Ebene der Bedeutung. An sich nicht Sichtbares, z.B. die Freundschaft, erhält<br />
durch das Symbol, z.B. den Ring, eine <strong>sichtbar</strong>e Gestalt (Kirchhoff 2000, S.25ff., Mayer-<br />
Tasch 2000, S.19ff.).<br />
Im mythisch-magischen Weltbild kam diese Bindung einer Identität gleich. Die Schlange<br />
bspw. war nicht mehr Sinnbild des Bösen, sie war selbst böse (Herder-Lexikon Symbole<br />
2003, Einführung)<br />
Heringer (2000, S.5) argumentiert, dass in der Symbolhaftigkeit von Natur ihr Wert als<br />
Psychotop für den Menschen liegt. Naturschutz sollte sich den Symbolgehalt und die<br />
Ausdrucksstärke der Natur für seine Öffentlichkeitsarbeit erschließen.<br />
a) Tafel (= Schilderpfad)<br />
Der Schilderpfad ist die älteste Form von Themenwegen und macht laut Ebers auch heute<br />
noch 70% aller Themenwege aus (Ebers et al. 1998, S.19). Entgegen der gängigen<br />
Vorstellung muss er aber keineswegs automatisch ein Lehrpfad im Sinne reiner<br />
Informationsweitergabe sein, sondern kann alle drei Intensitätsstufen umsetzen. Dazu seien<br />
an dieser Stelle einige Anregungen für einen kreativen Umgang mit Tafeln gegeben:<br />
Der Informationsgehalt einer Tafel muss keineswegs rein kognitiv ausgerichtet sein, sondern<br />
kann über eine künstlerische Gestaltung das Gefühl ansprechen und über<br />
Handlungsanweisungen zu Eigenaktivität auffordern. Tafeln müssen auch nicht auf 'Lesen'<br />
fixiert sein, sie können mit Relief, Fokus-Gucklöchern oder Mechaniken arbeiten und so zu<br />
Aktionselementen werden. Auch muss sich die Umrissgestaltung einer Tafel nicht auf das<br />
klassische Rechteck beschränken. Symbole, Silhouetten oder die natürliche Formgebung<br />
einer Baumscheibe bieten sich an.<br />
Es verwundert, dass der so beliebte Klappmechanismus bisher nur selten dazu genutzt<br />
wurde, um Tafeln platzsparender zu konzipieren. Einer schmalen stelenartigen Tafel, die erst<br />
durch Aufklappen den größten Teil ihrer Information freigibt, kann man schwerlich den weit<br />
verbreiteten Vorwurf <strong>machen</strong>, den Blick zu verstellen. Eine ähnliche Lösung wäre die 'Tafel<br />
mit Durchblick' oder im Falle der Eingangstafel gar die 'Tafel als Durchgang'. Das 'Die-<br />
Tafel-verstellt-den Blick-auf das Phänomen'-Argument kann auch über die Wahl einer<br />
pultartigen Konstruktion entschärft werden, die den zusätzlichen Vorteil hat, für Kinder und<br />
Erwachsene gleichermaßen gut einsehbar zu sein. Wird das Pult aufklappbar konstruiert,<br />
kann es Begleitbroschüren aufnehmen. Der Nachteil von Pulten liegt in ihrer hohen<br />
Wartungsintensität und im Verschleiß. Sie können nicht gut mit einer Überdachung vor der<br />
Witterung geschützt werden und werden zudem viel angefasst.<br />
61<br />
Symbol (griech. Symbállein) =<br />
zusammenwerfen, zusammenfügen<br />
(Kirchhoff 2000)
62<br />
Der methodische Baukasten<br />
Der Aufstellungsort einer Tafel muss mit großer Sensibilität gewählt werden. Ihre Wirkung<br />
in und auf die Umgebung ist genau zu testen, bevor sie unverrückbar fest steht. Weitere zu<br />
beachtende Faktoren bei der Nutzung von Tafeln sind die Wahl des Materials (z.B. Ebers et<br />
al. 1998; Lang & Stark 2000), die Art des Gestells, die Höhe (Kinder!) und eine sichere<br />
Aufstellungsweise. Aufrechte Tafeln können freistehend, als Reihe, Kiosk oder betretbarer<br />
Pavillon angeordnet werden.<br />
Vorteile • Vorteile aller Festinstallationen<br />
• vertraut, entspricht Erwartung<br />
• Fertigprodukt erspart Kosten individueller Konzeption<br />
• leicht zu installieren<br />
• Wartungsaufwand je nach Material unterschiedlich<br />
Nachteile • Nachteile aller Festinstallationen<br />
• Schilderwald<br />
• Fertigprodukte: Lehrpfad 'von der Stange', gleichförmig, austauschbar<br />
• verführt zu Lehrpfadkonzeption = rezeptive Wissensvermittlung<br />
• schnelle Überforderung, Übermüdung = geringer pädagogischer Erfolg<br />
• Kosten (Infotafel und Aufstellung je ca. 300 Euro, )<br />
• fraglich, ob verbal erfolgende Aufforderungen zu Aktivitäten befolgt werden<br />
Abhilfe • Phantasie bei Gestaltung; kann in allen 3 Intensitätsstufen konzipiert werden<br />
• Eigenleistung bei Trägerherstellung<br />
• Lehrtafeln in Verbindung mit Sitzgelegenheit aufstellen<br />
• Gestaltung mit Durchblick; Pulte;<br />
b) Informationsschrift<br />
Wird die Textinformation per Broschüre weitergegeben, führt der <strong>Weg</strong> zum Besucher<br />
hauptsächlich über die visuelle Aufnahme der Information. <strong>Den</strong>noch gibt es auch hier<br />
Möglichkeiten, den Informationsträger einzubeziehen. Ein Blatt Papier kann bspw. zum<br />
Fokusrohr gerollt werden, Papier lässt sich Falten, man kann es perforieren um z.B. eine<br />
Aktions-Postkarte herauszutrennen. Man kann Düfte oder Rätsellösungen freirubbeln lassen,<br />
Stifte integrierten um z.B. Baumborken ab<strong>zur</strong>eiben. Über gedruckte Medien können<br />
Sachinformation, Geschichten, Gedichte, Rätsel, Daumenkino, Spielideen, Bastelanleitung,<br />
Comic, Handlungsanweisungen, Bilder zum Ausmalen, Fotos, Graphiken und Arbeitsbögen<br />
angeboten werden. Nicht vergessen werden darf das leere Blatt, auf dem der Besucher alles<br />
Erdenkliche entstehen lassen kann. Neben klassischer Wissensabfrage können Kreativität<br />
und Phantasie gefördert werden. Der große Vorteil gegenüber Tafeln ist, dass relativ einfach<br />
auf unterschiedliche Zielgruppen, jahreszeitliche Aspekte, ausländische Besucher oder<br />
andere Variablen eingegangen werden kann, indem verschiedene Versionen erstellt werden.<br />
Außerdem lassen sich Änderungen leichter vornehmen.<br />
Vorteile • Nachdruck billiger als neue Tafeln/Stationen bauen zu müssen<br />
• Zielgruppenorientierung, Erwachsenen- und Kinderausführung<br />
• flexibel, z.B. jahreszeitliche oder Themenbroschüren<br />
• individuelle Konzeption<br />
• gut <strong>zur</strong> Nachrüstung von Schilderpfaden geeignet<br />
• leicht mehrsprachig zu gestalten<br />
• spricht Erwachsene gut an
Der Möglichkeitsraum<br />
Nachteile • häufiger Nachdruck<br />
• Kosten für individuelle Konzeption, kann nicht auf Vorgefertigtes <strong>zur</strong>ückgreifen<br />
• Besucher muss wissen, wo er Infoschrift bekommt, Aufwand der Beschaffung<br />
• Zugänglichkeit und Vorhandensein der Broschüre muss gewährleistet werden<br />
• Zielgruppe der Kinder dem Lesen eher abgeneigt<br />
• Abschreckung im Falle entgeltlicher Informationsschrift<br />
• fraglich, ob verbal erfolgende Aufforderungen zu Aktivitäten befolgt werden<br />
Abhilfe • Ausgefeilte Gestaltung<br />
• einfache Beschaffung, z.B. am <strong>Weg</strong>rand<br />
• kostenlose Abgabe<br />
Infoschrift zum Mitnehmen zum Ausleihen vor Ort verbleibend<br />
Vorteile • siehe Infoschrift<br />
generell<br />
• Information muss nicht<br />
sofort bzw. kann<br />
nachgelesen werden<br />
• Erinnerungsstück<br />
• Besucher fühlt sich im<br />
Besitz des Wissens<br />
Nachteile • Siehe Infoschrift<br />
generell<br />
• Broschüre bleibt<br />
liegen (Müll<br />
produziert)<br />
2) Informationsträger 'Erlebnis-Station'<br />
• siehe Infoschrift<br />
generell<br />
• Seltener Nachdruck<br />
• Siehe Infoschrift<br />
generell<br />
• kein<br />
Erinnerungsstück<br />
• kann abhanden<br />
kommen<br />
• benötigt<br />
Ausgabestelle<br />
• Abhängigkeit von<br />
Öffnungszeiten<br />
• siehe Infoschrift<br />
generell<br />
• Seltener Nachdruck<br />
• siehe Infoschrift<br />
generell<br />
• kein<br />
Erinnerungsstück<br />
• kann abhanden<br />
kommen<br />
63<br />
• muss wetterfest sein<br />
• benötigt Installation,<br />
in der sie verstaut<br />
werden kann<br />
(Skulptur, Pult)<br />
a) Gerätschaft (Spielgerät etc.)<br />
Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass dem zivilisierten Mensch Natur über<br />
Künstliches erlebbar gemacht wird. Es muss ein Gerät, eine Konstruktion, eine Installation<br />
zwischengeschaltet werden, damit er sich an sie herantraut. Es braucht erst einen Barfußpfad,<br />
damit er die Schuhe auszieht oder eine Fokussierstation, damit er genau hinsieht. Sich auf<br />
Elementares einzulassen, fällt schwer. Selbst Kinder spielen heute nicht mehr<br />
selbstverständlich im Matsch, auch wenn sie dürften. Folgende Stationstypen werden<br />
genutzt:
64<br />
Der methodische Baukasten<br />
Fokussierstation<br />
Sie soll die Beobachtungsgabe schärfen und eine bewusstere Wahrnehmung fördern, indem<br />
der Blick mit Hilfe von Rahmen, Röhren oder Ähnlichem auf eine Begebenheit gelenkt wird,<br />
die sonst vermutlich übersehen worden wäre.<br />
Kükelhaus-Erfahrungsstation<br />
„(...) spielend (...) erfahren, I. wie das Auge sieht, das Ohr hört, die Nase riecht, die Haut<br />
fühlt, die Finger tasten, der Fuß (ver-)steht, die Hand (be-)greift, das Gehirn denkt, die<br />
Lunge atmet, das Blut pulst, der Körper schwingt, und II. daß die Wahrung der Gesetze der<br />
eigenen Natur den Menschen befähigt, in den Erscheinungen der äußeren Natur die gleiche<br />
Gesetzlichkeit sowohl wahrzunehmen als auch zu wahren“ (Natur + Kunst e.V. 1999/2000,<br />
S. 128). Kükelhaus-Erfahrungsstationen haben zum Ziel, über die eigene Körpererfahrung<br />
zum Verständnis für die prinzipiellen Wirkkräfte in der Natur zu gelangen. Ein natürliches<br />
Phänomen wird isoliert, konzentriert und über ein Gerät erfahrbar gemacht. Dabei steht die<br />
sinnliche Wahrnehmung selbst im Mittelpunkt. Der Mensch lernt einerseits, wie seine Sinne<br />
und andererseits wie die physikalischen Kräfte, die auf seinen Leib einwirken, funktionieren.<br />
Es kann darüber hinaus eine gedankliche und emotionale Rückkopplung auf die äußere<br />
Natur erfolgen, indem die Erfahrungsstation mit entsprechenden Aufgaben oder<br />
gedanklichen Impulsen gekoppelt wird. Typische Beispiele sind Partnerschaukel,<br />
Balancierscheibe oder Summstein. Zum Teil finden sich Überschneidungen zu<br />
Bewegungsstationen.<br />
Bewegungsstationen<br />
Bewegungsstationen schulen das Körperempfinden, den Gleichgewichtssinn und die<br />
Motorik. Sie erfordern ein hohes Maß an Eigenaktivität, der körperliche Einsatz hält den<br />
Besucher wach und aufmerksam. Solche Stationen nutzen den Spaßfaktor und den<br />
emotionalen Mitnahmeeffekt, durch die Informationen besonders gut im Gedächtnis<br />
verankert werden (siehe 3.3.1 Lernen). Sie können auch ohne die Absicht der<br />
Informationsvermittlung eingesetzt werden, zum Austoben, als Abwechslung oder<br />
Ergänzung. Dies sollte aber maßvoll geschehen, ansonsten wird Natur zum Spielplatz.<br />
Bewegungsstationen, die Kooperation trainieren<br />
Dieser Typ Bewegungsstation initiiert die Interaktivität zwischen Themenwegbesuchern und<br />
fördert damit soziale Kompetenzen. Sie beruhen darauf, dass eine Leistung des Einzelnen<br />
nur durch Unterstützung anderer möglich ist. Eine typische Einrichtung dieser Art ist der<br />
Hochseilgarten, der aber professionelle Betreuung erfordert. Einfachere Elemente sind<br />
drehbarer Balancierbalken, Balancierscheibe oder die Partnerschaukel nach Kükelhaus.<br />
Bewegungsstationen, die Naturerfahrung vermitteln sollen<br />
Diese Stationen streben an, die körperliche Betätigung als Aufhänger für Sachwissen zu<br />
nutzen. Teilweise wird versucht, Bewegungsabläufe oder Situationen, in denen Tiere sich<br />
befinden, nachzuahmen. Dazu gehört zum Beispiel der Wackelsteg, der den schwankenden<br />
Ast des Eichhörnchens imitieren soll (Ebers et al. 1998, S. 131). Da es sich hierbei aber um<br />
sehr abstrakte Nachahmungen handelt, halte ich einen Einfühlungseffekt für eher<br />
unwahrscheinlich.
Der Möglichkeitsraum<br />
Stationen wie die Weitsprunggrube setzen darauf, die eigenen Fähigkeiten mit denen von<br />
Tieren zu messen. Es erfolgt eine gewisse Identifikation mit dem Tier, dessen Fähigkeiten<br />
gleichwertig mit den eigenen sind. Die Praxis zeigt aber, dass Zusatzinformationen, z.B. die<br />
zum Tier gehörige Fährte, nicht behalten werden (Ebers et al. 1998, S. 132). Es stellt sich die<br />
Frage, von welchem Wert das Wissen ist, soweit springen zu können, wie z.B. ein Marder...<br />
Sinnesstationen<br />
An Sinnesstationen wird die Aufmerksamkeit des Besuchers gezielt auf einen seiner Sinne<br />
gelenkt. Besonders häufig sind Taststationen, Duftorgeln, Barfußpfade oder Lauschstationen.<br />
Leider werden sie oft aus dem Kontext der unmittelbaren Umgebung genommen und auf<br />
sehr allgemeine Phänomene ausgerichtet. Das sollte vermieden werden – z.B. indem die<br />
Gerüche oder die Bodenstrukturen der Umgebung verwendet werden. Solche Installationen<br />
sind allgemein sehr wartungsintensiv, Fühlkästen müssen beispielsweise täglich bestückt und<br />
kontrolliert werden.<br />
Einfühlungsstationen<br />
Hierbei handelt es sich um Bauten, die den Besucher in die Lage von anderen Lebewesen<br />
versetzen bzw. ihm Einblicke in fremde Lebensräume geben sollen. Dazu gehören<br />
Nachbildungen von Tierbauen, Baumwipfelpfad, Höhlen, Anschnitte mit Glassscheiben und<br />
Unterwassertunnel.<br />
Rate-Stationen<br />
Die Antwort auf eine gestellte Frage ist hinter einem Klapp-, Schiebe- oder<br />
Drehmechanismus verborgen. Der Sinn der Station liegt also im Aufnehmen bzw.<br />
Überprüfen einer Sachinformation, wobei die Neugier als Lernmotivation genutzt wird. Die<br />
Station baut eine gewisse Spannung auf, man möchte wissen, ob man es richtig gewusst hat.<br />
Allerdings macht auch eine versteckte Lösung nicht neugierig, wenn die Frage nicht<br />
interessiert. In einer Gruppe kann gemeinsames Raten zu anregenden Diskussionen führen,<br />
die Station dient dann auch der Kommunikationsförderung. Diese Installationen werden<br />
meist fälschlicherweise als handlungsorientiert oder interaktiv bezeichnet (siehe S. X), bei<br />
der minimalen Anregung körperlicher Aktivität, die hier erfolgt, kann man m.E. auch nicht<br />
von einer Verstärkung des Lerneffekts durch Motorik reden. Es besteht zusätzlich die<br />
Gefahr, dass der Besucher gar nicht erst nachdenkt, sondern nach dem Lesen der Frage<br />
sofort die Mechanik betätigt. Solche Automatismen haben dann keinerlei Lerneffekt mehr.<br />
Mechanische Stationen ohne Ratespiel und Überraschungsstation<br />
Das Prinzip dieser Stationen ist es, die Überladung des Informationsträgers zu verhindern.<br />
Ein Mechanismus sorgt dafür, dass nicht alle Information auf einmal <strong>sichtbar</strong> ist, der<br />
Besucher steuert aktiv, welche Information er zu Gesicht bekommt (z.B. Drehscheibe Ebers<br />
et al. 1998, S.78f.). Auch diese Stationen werden fälschlicherweise als handlungsorientiert<br />
oder interaktiv bezeichnet und auch hier halte ich es für übertrieben, auf Grund der<br />
erforderlichen Aktivität von einer Verstärkung des Lerneffekts über Motorik auszugehen. Es<br />
können Überraschungseffekte eingebaut werden, bspw. wenn nach dem Aufklappen einer<br />
Vorrichtung ein Spiegel zum Vorschein kommt, der den Blick nach oben auf Baumkronen<br />
etc. lenken soll. Wie die Evaluation einer solchen Station bei Ebers zeigt, ergibt sich ein<br />
Problem bezüglich der Effektivität solcher Überraschungseffekte. Wenn Kinder angeben,<br />
65
66<br />
Der methodische Baukasten<br />
diese Station zu mögen, weil man mit den Spiegeln so schöne Lichteffekte <strong>machen</strong> kann,<br />
dann hat die Station ihr Ziel, z. B. die Aufmerksamkeit auf den Epiphyten Mistel zu lenken,<br />
nicht wirklich erreicht, auch wenn sie den Kindern in Erinnerung bleibt. Ähnliches gilt für<br />
die Überraschung der Erwachsenen: Keinen Spiegel erwartet zu haben ist eine andere<br />
Aussage, als keine Pflanze in der Krone eines Baums vermutet zu haben (Ebers et al. 1998,<br />
S. 102). Ohne ausführliche Textinformation bliebe die Überraschungsstation ineffektiv.<br />
Vorteile • Einfache Berücksichtung wirksamer didaktischer Methoden<br />
• wecken Neugier<br />
• <strong>machen</strong> Spaß<br />
• hinterlässt nachhaltigen Eindruck über ungewöhnliche Erfahrungen<br />
• in Kombination mit Wissensvermittlung sehr effektiv<br />
• <strong>zur</strong> Nachrüstung von Schilderpfaden geeignet<br />
• große Motivation für Kinder<br />
• geforderte Aktivität wird eher ausgeführt, als bei rein verbaler Aufforderung<br />
• schont das Naturobjekt<br />
Nachteile • Mittelbarkeit<br />
• hoher Verschleiß bei allen beweglichen oder viel angefassten Teilen<br />
• wartungsintensiv<br />
• Verletzungsgefahr<br />
• spaßbetonte Elemente lassen Bezug <strong>zur</strong> Natur übersehen, zieht Aufmerksamkeit<br />
von Natur ab<br />
• Störung des direkten Naturerlebens, kann Naturzugang blockieren oder lästig sein<br />
• Besucher können leicht überfordert werden<br />
• Vandalismus<br />
• hohe Anforderungen an Materialien<br />
• strenge technische Auflagen, TÜV<br />
Abhilfe • subtile Effekte, die nachträglich wirken<br />
• Transfer, Anstoß <strong>zur</strong> Reflexion<br />
b) Aufgabenstellung (z.B. Geräuschkarte, LandArt, Spiele etc.)<br />
Einfühlungsübungen<br />
Bei diesen Aufgaben geht es um die Erzeugung von Verständnis, worunter ich eine<br />
Mischung aus Gefühl und Verstand verstehe. Die Fähigkeit, Gefühle entwickeln zu können,<br />
ist Voraussetzung für diese Übungen und wird zugleich vertieft. Sinnliche Wahrnehmung<br />
und Emotionen dienen dabei im Wesentlichen dem Transport von Wissen. Sich in die Lage<br />
eines anderen Lebewesens – sei es eine andere Person oder eine andere Lebensform – zu<br />
versetzen, bedeutet, dessen Lebensumstände am eigenen Leib zu spüren oder zu versuchen,<br />
sie mental nachzuvollziehen. Das bedeutet nicht, zu wissen wie es ist, dieses Lebewesen zu<br />
sein. Es spricht einiges dafür, dass wir uns aus erkenntnis-theoretischen Gründen immer nur<br />
eine Vorstellung vom anderen Sein <strong>machen</strong> können, die außer durch die direkten Erfahrung<br />
auch von historisch geprägter Wahrnehmung und der soziokulturellen Lebenssituation des<br />
Betrachters beeinflusst ist (Wagner 1995, S.5). Sich in die Lage eines Anderen zu versetzen,<br />
ist eine hilfreiche Veranschaulichung von Funktionsweisen und eine Methode, um sich<br />
Verhaltensweisen zu erklären. Es verdeutlicht zudem die Andersartigkeit, angesichts derer<br />
man zu sich selbst finden kann. Um Klarheit zu erlangen, worin die Unterschiede zwischen<br />
dem Selbst und dem Anderen bestehen, muss zunächst das eigene Wesen erkannt werden. Im
Der Möglichkeitsraum<br />
Entdecken des anderen wurzelt schließlich auch Faszination. Ob es darüber hinaus<br />
Wirkungen geben kann, sei dahingestellt.<br />
Schöpferisches Handeln<br />
Kunst als Arbeitsmethode ist eine gute Möglichkeit, die konative Ebene (Ebene der<br />
Handlung) einzubinden. Sie übt Kreativität, Vorstellungskraft und Phantasie und weckt das<br />
ästhetische Empfinden. Sie kann gezielt eingesetzt werden, um die sinnliche Wahrnehmung<br />
zu schärfen, insbesondere das genaue Beobachten zu trainieren, z.B. indem Farbreihen gelegt<br />
werden. Genaues Beobachten und aktive Tätigkeit heben Sachverhalte auf die<br />
Bewusstseinsebene. Selbstverständlichkeiten werden bewusst wahrgenommen. Benutzt man<br />
beispielsweise Naturmaterialien, dann müssen diese hinsichtlich ihrer Beschaffenheit<br />
untersucht werden um herauszufinden, was man mit ihnen anstellen könnte. Die<br />
künstlerische Tätigkeit ist geeignet, dabei gewonnene Erkenntnisse fest im Bewusstsein zu<br />
verankern. Es kann zudem versucht werden, über Kunst ein Naturphänomen zu verbildlichen<br />
oder das eigene Verhältnis <strong>zur</strong> Landschaft darzustellen, auch dies erfordert geistige<br />
Auseinandersetzung mit Natur und stellt zugleich eine Beziehung zu ihr her. Kreative<br />
Tätigkeit bietet auch eine Möglichkeit, die eigenen Gefühle zu verarbeiten oder zum<br />
Ausdruck zu bringen (Knust 2004 S.12ff.). Aus der Erfahrung der Gestaltbarkeit von Natur<br />
und der Reflexion der Rolle des Gestalters kann die Übernahme von Verantwortung für das<br />
Gestaltete aber auch für das Ungestaltete erwachsen (Kalas 2005, S.157).<br />
a) LandArt<br />
LandArt ist Augenblicks-Kunst, die Schaffung vergänglicher Kunstwerke in der Natur mit<br />
den Mitteln der Natur. Das Wesentliche an Natur – der Wandel – wird im Kunstwerk<br />
gewürdigt und <strong>sichtbar</strong> gemacht. LandArt arbeitet wider den Drang, Monumente für die<br />
Ewigkeit zu errichten, bleibende Spuren zu hinterlassen und Natur dominieren zu wollen.<br />
Stattdessen geht es darum, Spuren verwehen, Dinge geschehen und der Natur ihren Lauf zu<br />
lassen.<br />
LandArt stimuliert Nachdenken über Vergänglichkeit, Sinn, Prozesshaftigkeit. Die<br />
Atmosphäre der Landschaft, die persönliche Stimmung, Wirkung und Eigenschaften des<br />
Materials, soziale Aspekte der Zusammenarbeit und spielerisch-schöpferische Eigentätigkeit<br />
verschmelzen (Kalas 2005, S.149). Da ein LandArt-Kunstwerk auf diese Weise mit der<br />
Landschaft korrespondiert, kann LandArt helfen, einer Landschaft näher zu kommen,<br />
Interesse an ihr zu wecken, sie mit anderen Augen zu sehen, Fragen aufzuwerfen und die<br />
Suche nach Antworten auslösen, die eigene Stellung im Lebens-Raum zu reflektieren und in<br />
diesem Sinne einen Beitrag <strong>zur</strong> ökologischen Bildung leisten (Kalas 2005, S.156f.).<br />
b) Mandala<br />
Mandala ist ein Wort aus dem Sanskrit. Es bedeutet 'Kreis' und steht für den Kosmos.<br />
Mandalas werden als Meditationshilfe verwendet. Um eine deutlich erkennbare Mitte<br />
werden Formen und Muster regelmäßig angeordnet. Bei dieser Tätigkeit soll die analytischabstrahierende<br />
linke mit der intuitiv-emotional ausgerichteten rechten Gehirnhälfte<br />
zusammen arbeiten. Diese harmonisierende Wirkung soll sich auch bei der reinen<br />
Betrachtung solcher Werke einstellen, sicher ist jedenfalls ihre ästhetische Wirkung (Knust<br />
67
68<br />
Der methodische Baukasten<br />
2004, S.40). Kreativität wird als Mittel <strong>zur</strong> Reflexion verwendet und zugleich als Kompetenz<br />
gefördert.<br />
Ein Mandala ist nicht für die Ewigkeit – das Fixieren der Bilder widerspricht dem Sinn.<br />
Beim Mandala geht es um Hingabe an eine Tätigkeit und Hinnahme deren Vergänglichkeit.<br />
Spiel<br />
Spiel ist der Ursprung der Kultur (Mitterbauer 1997, S.8). Im Spiel spiegelt sich die<br />
Gesellschaft, denn sie entwirft Spiele entsprechend ihrer Regeln (ebd. S.22). Während<br />
Konkurrenz- und Strategiespiele mit Kulturtechniken wie Mathematik oder Kriegskunst<br />
vertraut <strong>machen</strong>, entstanden in den 1970er Jahren aus der Ökologie- und Friedensbewegung<br />
heraus Kooperationsspiele und Spiele die Kreativität fördern (Mitterbauer 1997, S.8).<br />
Je nach Spielform übt das Spiel in unterschiedlichen Dingen. Es bereitet auf das<br />
Erwachsensein vor und lehrt die Bewältigung der Realität. Wer spielt, setzt sich mit sich<br />
selbst und seiner Umgebung auseinander und sammelt Erfahrungen. Beim Spielen kann der<br />
Ernstfall ohne ernste Konsequenzen erprobt werden. Es übt den Umgang mit Gefühlen, vor<br />
allem im Zusammenhang mit Erfolg bzw. Misserfolg. Spiel ist Aggressionskontrolle, dient<br />
der Triebbewältigung und der Entladung von Energien, die die Etikette im Alltag<br />
unterdrückt. Soziale Kompetenzen werden ebenso gefördert, wie geistige, körperliche und<br />
kreative Fähigkeiten (vgl. Mitterbauer 1997, S. 5, 7, 8, 11). Das Überprüfen von Spielregeln<br />
auf ihre Sinnhaftigkeit und das Einhalten sinnvoller Spielregeln übt Urteilskraft und<br />
Verbindlichkeit (Wucherer 2003).<br />
Spielerische Methoden unterstützen eine freudvolle, freundliche, angstfreie Atmosphäre, in<br />
der leicht gelernt werden kann. Spielen kann nur freiwillig geschehen. Die Pädagogik nutzt<br />
Spiele <strong>zur</strong> Wissensvermittlung (Quiz) oder um Verhaltensweisen zu etablieren. Außerdem<br />
<strong>zur</strong> Motivation, <strong>zur</strong> Förderung von Kooperation und ästhetischem und sinnlichem Erleben<br />
(Mitterbauer 1997, S.18). Eine Lernzielkontrolle ist schwierig, denn über das Spiel lassen<br />
sich Sachinformationen häufig nur indirekt über die Nachbereitung weitergeben. Das Spiel<br />
löst Reaktionen und Empfindungen aus, die Information transportieren. Diese Informationen<br />
können gezielt spielerisch aufgearbeitet werden – ohne Reflexion gehen sie aber verloren<br />
(Mitterbauer 1997, S.15).<br />
Die ursprünglichste Form der Spiele sind Effekt- oder Naturerfahrungsspiele, die auf<br />
Bewegung, den Einsatz der Sinne und den daraus resultierenden Effekten basieren. Diese<br />
Spiele sind Quelle elementarer Erfahrungen und haben sich in vielfältigen Variationen<br />
etabliert, z.B. dem Ringelspiel.<br />
Gestaltungs- und Konstruktionsspiele umfassen klassische technische (Baukasten) und<br />
künstlerisch kreative Spiele.<br />
Das Rollenspiel arbeitet mit Stereotypen. Über die Einfühlung in andere Persönlichkeiten,<br />
können deren Verhaltensweisen besser verstanden und berechenbar werden. Rollenspiele<br />
ermöglichen auch Selbsterfahrung, z.B. Aufklärung über imaginäre Wunscherfüllung (ich<br />
wäre gerne wie...). In Form von Planspielen können verschiedene Strategien <strong>zur</strong> Lösung<br />
eines Problems oder Interessenskonflikts durchgespielt werden.<br />
Regelspiele erfordern die Einhaltung von Spielregeln und Aneignung von spielbezogenem<br />
Wissen. Dazu gehören Brettspiele, Gesellschaftspiele, Kartenspiele und Computerspiele<br />
(Baurecht-Pranzl 1995, S.50f).
Der Möglichkeitsraum<br />
Themenwege können Spiele in der Regel nur anregen, ggf. auch Utensilien<br />
bereitstellen, während eine Begleitperson <strong>zur</strong> Umsetzung animieren kann.<br />
Zeichensetzung<br />
Zeichensetzungen (z.B. Steinsetzungen) eignen sich, um Ziele, Strategien oder Leitlinien zu<br />
allen Bevölkerungsteilen zu transportieren. Die Arbeit mit Sinnbildern spricht insbesondere<br />
die emotionale Ebene an und kann die Diskussion aus dem engen Kreis der Fachausschüsse<br />
und Insider herausheben. Sinnbilder und Zeichen in der Landschaft sind immer präsent, die<br />
Errichtung von land-marks kommt der Entstehung besonderer Orte gleich, die der<br />
Landschaft Charakter geben. Sie sollten als Ergebnis und Ausdruck einer breiten Diskussion<br />
und Mitarbeit der Bevölkerung in Konzeption und Umsetzung entstehen (Michor 2000,<br />
S.31ff).<br />
Vorteile • Keine Installation in der Landschaft, Ausnahme: Zeichensetzung<br />
• Unmittelbarkeit<br />
Nachteile • Hemmschwelle, <strong>machen</strong> die Leute es von alleine?<br />
Abhilfe • Betreuung<br />
3) Informationsträger Kunstobjekt (Skulptur, Bilder-Stele etc.) (= Kunstpfad)<br />
Kunst in der Natur sollte als Medium dienen, um sich mit der Natur auseinander zusetzen.<br />
Daher muss das Kunstwerk eindeutig Bezug auf die umgebende Natur nehmen. Das kann es<br />
sowohl über Korrespondenz als auch über Dissonanz tun. Es kann Naturphänomene<br />
künstlerisch darstellen, Umweltprobleme veranschaulichen oder das Verhältnis Kultur-Natur<br />
thematisieren.<br />
Es erfordert geistige Tätigkeit vom Besucher, den Zusammenhang von Kunst und Natur zu<br />
erfassen. Da Überforderung aber zu Desinteresse führt, muss sich der Abstraktionsgrad der<br />
Botschaft in Grenzen halten. Der große Vorteil der Kunst als Medium liegt in ihrer<br />
Ansprache der ästhetischen Wahrnehmung. Kunst trifft die emotionale Ebene.<br />
Vorteile • i.d.R. ohne Worte verständlich<br />
• symbolhafte Darstellungsweise, ähnlich wie bei einem '<strong>Den</strong>k-Mal'<br />
• 'was für's Auge', Ansprache der Ästheten<br />
Nachteile • besonders diebstahlgefährdet<br />
• kann von Natur ablenken<br />
Abhilfe • Konkreten Bezug von Kunstwerk zu Natur beachten<br />
4) Informationsträger Aktionskoffer oder Rucksack (= 'mobiler Pfad')<br />
Solche Aktionsformen sprechen den Forscherdrang und die Neugier der Besucher an. In der<br />
Regel sind sie sehr naturwissenschaftslastig, könnten aber auch auf kreative Tätigkeiten<br />
ausgerichtet werden (Malutensilien, Bastelsachen etc.)<br />
69
70<br />
Vorteile • Konzentration auf Aktion; stark handlungsorientiert, interaktiv<br />
• gut <strong>zur</strong> Nachrüstung älterer reiner Informations-Pfade einsetzbar<br />
Nachteile • Ausgabestelle nötig; Besucher an Öffnungszeiten gebunden<br />
• Verlust, Beschädigung, Diebstahl von Gerätschaften (Lupen etc.)<br />
Abhilfe • Betreuung<br />
Der methodische Baukasten<br />
5) Informationsträger Multimedia: Walkman, Computer, Homepage (= 'technisierter<br />
Pfad')<br />
„Allerdings kann das Lernen in und mit multimedialen, interaktiven, computergestützten<br />
Lernsystemen keineswegs den unmittelbaren Zugang <strong>zur</strong> Umwelt, die Erfahrung vor Ort<br />
ersetzen. Ein interaktives Lernmedium kann diese begleiten, kommentieren, als<br />
Reflexionsmedium genutzt werden, auch als Ort für die Entdeckung von komplexen<br />
Zusammenhängen, die sich jeder unmittelbaren sinnlichen Erfahrbarkeit verschließen.<br />
Multimediale Lernumgebungen sind demnach kein Ersatz, sondern eine wertvolle Ergänzung<br />
für andere Umweltbildungsaktivitäten, indem sie Angebote zu Themengebieten – wie z.B.<br />
zum Systemlernen – <strong>machen</strong> können, die für den kompetenten Umgang mit<br />
Umweltproblemen wichtig, aber anderen Lernformen nur schwer zugänglich sind“ (Döring-<br />
Seipel 2001, S.14). Computerprogramme können interaktiv und als offene Lernangebote<br />
gestaltet werden, d.h. der Lernende schafft sich die Struktur seines Lernprozesses selbst,<br />
indem er den <strong>Weg</strong> durch den Lernstoff und die Geschwindigkeit des Lernfortschritts<br />
eigenständig bestimmt (Döring-Seipel 2001, S.13). Die große Faszination, die<br />
Computerspiele auf Jugendliche ausüben, sollte genutzt werden.<br />
Vorteile • zeitgemäße Methode der Informationsvermittlung<br />
• Übung in sytemorientiertem <strong>Den</strong>ken; dient Wissensvermittlung<br />
• Natur wird nicht verbaut<br />
• Schlechtwetter-Variante (Computer)<br />
• Homepage erhöht Bekanntheitsgrad über Zufallsfunde in Suchmaschinen,<br />
Öffentlichkeitsarbeit, breites Publikum<br />
• Homepage sehr geringe Hemmschwelle; unverbindlicher Besuch<br />
• Handyfunktion kann Prozesssimulationen ins Gelände liefern<br />
Nachteile • Diebstahl, Beschädigung<br />
• immer mit gewissem Realitätsverlust verbunden<br />
• Walkman: Mensch wird durch Kopfhörer abgekapselt, eigene kleine Welt<br />
• an Ausgabestelle bzw. Informationszentrum gebunden<br />
• Computer: Im Innenbereich erfolgt kein echter Naturkontakt; Abstraktion<br />
Abhilfe • Betreuung<br />
6) Informationsträger Person ('betreuter Pfad')<br />
Die persönliche Betreuung ist allen anderen Medien überlegen (z.B. Beyrich 1998, S.10) und<br />
ein Themenweg kann die zwischen Natur und Besucher vermittelnden Fachleute daher nicht<br />
ersetzen (z.B. Ebers et al.1998, S.141). Über die Kombination mit einem naturpädagogischen<br />
Programm wird ein Themenweg zum 'betreuten Lehrpfad' (Hücker et al. 1998, S.45). Viele<br />
Menschen brauchen die Hilfe von erfahrenen PraktikerInnen um ihre<br />
Wahrnehmungsfähigkeit wieder zu erlangen (z.B. Beyrich 1998, S.12). Eine Begleitperson<br />
kann spontan reagieren, auf individuelle Wünsche eingehen, Sicherheit bei Aktivitäten
Der Möglichkeitsraum<br />
geben, jedes beliebige Stück Natur zum Erlebnisraum <strong>machen</strong> und bei Reflexion und<br />
Transfer helfen. Sie kann sehr viel mehr Fachwissen übermitteln und besser <strong>zur</strong><br />
Durchführung der Aufgaben animieren, als eine Textinformation. Je nach Schwerpunkt ist<br />
sie in der Lage, das Sinnliche, das Kreative oder das Sachliche in den Vordergrund zu<br />
stellen. Sie kann sich auch von den fest installierten <strong>Weg</strong>stationen lösen und neue Stationen<br />
erschließen.<br />
Interpretation<br />
„Interpretation ist ein Kommunikationsprozeß, der gefühlsmäßige und geistige<br />
Verbindungen zwischen den Interessen der Zuhörerschaft und den den Gegenständen<br />
innewohnenden Bedeutungen herstellt“ (www.interp.de/interpretation/definition/index.html).<br />
Bei der Interpretation werden Phänomene der Natur von einem Interpreten in eine für den<br />
Besucher verständliche Sprache übersetzt (www.interp.de/interpretation/grundlagen<br />
/index.html). Interpretation ist nicht dasselbe wie Information, der Besucher soll <strong>zur</strong><br />
selbständigen Auseinandersetzung mit dem Phänomen angeregt werden<br />
(www.interp.de/interpretation/geschichte/prinzipien.html). Sein persönliches Erleben steht<br />
im Mittelpunkt, der Interpret hilft bei der Auslegung des Erlebten, indem er nur die zum<br />
Verstehen der Situation notwendigen Fakten bereitstellt (www.interp.de/interpretation<br />
/grundlagen /leitidee.html). Mehr bei Trommer 1997, Ludwig 2005 oder www.interp.de .<br />
Vorteile • kann individuell auf Bedürfnisse des Publikums eingehen<br />
• kann Gegebenheiten vor Ort, Atmosphäre des Augenblicks etc. aufgreifen<br />
• kann <strong>zur</strong> Bedienung der Stationen motivieren oder fachkundliche Anleitungen geben<br />
• Interaktivität<br />
• kann spezielle Zusatzinformationen oder Erläuterungen liefern<br />
Nachteile • Begehung auf festgelegte Zeiten beschränkt<br />
• begrenzte Teilnehmerzahl<br />
• färbt die Situation durch ihre Sicht der Dinge und ihre persönliche Wirkung<br />
• Mittelbarkeit; Ver-Mittler, Interpret, Entertainer<br />
• erhöhter personeller, finanzieller, organisatorischer Aufwand<br />
IV) Die Präsenzkategorien<br />
Installationen im Gelände sind 'Hingucker'. Die Tatsache, dass sie die Aufmerksamkeit auf<br />
sich ziehen, hat ihnen aber auch den Vorwurf der 'Möblierung der Landschaft' eingetragen.<br />
Diese Bezeichnung wird häufig im Zusammenhang mit Schilderpfaden benutzt (z.B. Ebers et<br />
al. 1998, S.7), kann aber ebenso für jede andere Form fester Installation in der Landschaft<br />
gelten. Dem kann über ein unaufdringliches oder sehr 'organisches' Design der Installation<br />
entgegen gewirkt werden oder aber man lässt den Besucher ausschließlich von einer<br />
Begleitbroschüre leiten, die an mit Nummern gekennzeichneten Stellen Erläuterungen oder<br />
Aufgabenstellungen gibt. Ein solcher Nummernpfad hat den großen Nachteil, dass sich seine<br />
Stationen nicht selbst erklären. Die Nummer im Gelände wird bei einem nicht eingeweihten<br />
Besucher Verwunderung auslösen. Betreiber dieser Pfadtypen gehen davon aus, dass die<br />
beim Besucher erzeugte Aufmerksamkeit ausreicht, dem Phänomen selbst auf die Spur zu<br />
kommen, was dem Laien aber schwer fallen wird. Auch wird sich selbst der neugierig<br />
gewordene Besucher mit großer Wahrscheinlichkeit im Nachhinein nicht mehr um die<br />
erklärende Broschüre bemühen.<br />
71
72<br />
Der methodische Baukasten<br />
Auch fest installierte Stationen sind natürlich nicht davor gefeit, Unverständnis<br />
hervor<strong>zur</strong>ufen. Sofern sich die Handhabung nicht absolut selbstverständlich ergibt, müssen<br />
sie mit einer Kurzanleitung versehen werden. Weniger problematisch sind in diesem<br />
Zusammenhang Kunstobjekte – selbst wenn sich ein eventuell darin versteckter zusätzlicher<br />
Lerneffekt nicht jedem erschließt, können sie immer noch als ästhetisches Element an sich<br />
betrachtet werden. Generell müssen Installationen an Kinder- und Erwachsenengröße<br />
angepasst sein und deren unterschiedlichen Lernmodus berücksichtigen.<br />
Kategorie A: Informationsträger fest installiert ('Möblierter Pfad')<br />
Medien • Tafel<br />
• Infoschrift vor Ort verstaut<br />
• Skulptur/Objekt/Bilder-Stele<br />
• Spielgerät, Installation<br />
Vorteile • Hingucker<br />
• immer präsent<br />
• erklärt sich selbst<br />
• Anpassung an wechselnde Aspekte über flexible Systeme möglich<br />
• Abwechslung und Schwerpunktsetzung beim Spaziergang<br />
Nachteile • Möblierung der Landschaft, stört Naturgenuss<br />
• Ablenkung von Phänomenen<br />
• vandalismusgefährdet (Zerstörung, Beschmieren, Zerkratzen)<br />
• immer der Witterung ausgesetzt<br />
Abhilfe • unaufdringliches Design<br />
• gute Integration in die Landschaft<br />
• langlebige Materialien (Metall, Kunststoff, Eiche Douglasie, Akazie)<br />
• mechanischer Witterungsschutz (Dach)<br />
Kategorie B: Informationsträger 'am Mann' ('Nummernpfad')<br />
Medien • Begleittext<br />
• Walkman<br />
• Aktionskoffer/Rucksack<br />
• Person<br />
Vorteile • keine 'Möblierung', keine Landschaftsbeeinträchtigung<br />
• einfache Anpassung an wechselnde Aspekte<br />
• ggf. geringe Kosten & Sachaufwand<br />
• leicht erweiterbar<br />
• kaum vandalismusgefährdet<br />
• erfordert mehr Eigenaktivität<br />
Nachteile • Unverständnis bei nicht informierten Besuchern, erklärt sich nicht von allein<br />
• umständlich, Besucher muss sich Medium besorgen<br />
• Informationsmedien müssen verfügbar gehalten werden<br />
Abhilfe • Häufiger Hinweis zum Erhalt des Mediums<br />
• mehrere leicht zugängliche Institutionen, bei denen Infomedium erhältlich ist<br />
• Broschüren können in Kästen am <strong>Weg</strong> lagern
Der methodische Baukasten in praktischer Anwendung<br />
73<br />
Je üppiger die Pläne, umso verzwickter die Tat.<br />
Erich Kästner<br />
4. Der Drachenpfad – Erleben einer Landschaft im Umbruch<br />
4.1 Der methodische Baukasten in praktischer Anwendung<br />
In diesem Kapitel wird ein Konzept beschrieben, anhand dessen sich die Elemente des<br />
methodischen Baukastens konkret im NSG Lanken umsetzen lassen.<br />
4.1.1 Zielsetzungen, Konzeptionstyp, Grundsätze<br />
Beim Drachenpfad handelt es sich um einen Themenweg, der die Etablierung von<br />
sekundärer <strong>Wildnis</strong> (siehe 2.1 zum Phänomen der <strong>Wildnis</strong>) <strong>sichtbar</strong> und erlebbar macht.<br />
Daraus ergibt sich als übergreifendes Informationsziel (vgl. 3.1 Zielsetzungen Themenweg)<br />
die Veranschaulichung der Eigendynamik im sich selbst überlassenen NSG Lanken. Im<br />
Detail werden einzelne Naturphänomene, Prozesse aber auch Konfliktsituationen und<br />
Gründe für das Verwildern lassen vorgestellt.<br />
Dies soll dazu beitragen, dem Verwildern den Schrecken zu nehmen (siehe unten, Studie<br />
Bauer). Um ein generelles Abblocken der Informationsaufnahme zu vermeiden, werden<br />
künstlerische und den Besucher involvierende Methoden gewählt, auf eine belehrende<br />
Darstellung wird verzichtet.<br />
Es ergibt sich das Problem, dass Prozesse als das Wesentliche an <strong>Wildnis</strong> als solche nicht<br />
erfahrbar sind, man erlebt immer nur eine Momentaufnahme des Geschehens. Über<br />
Einblicke in Vergangenheit und vermutliche Zukunft wird versucht, diese<br />
Momentaufnahmen als Teil eines Prozesses verständlich zu <strong>machen</strong>. Die Darstellung der<br />
negativen Auswirkungen menschlicher Eingriffe soll zudem deren Rücknahme einsichtig<br />
<strong>machen</strong>. Da viele Besucher Lanken regelmäßig aufsuchen, besteht die Hoffnung, ihre<br />
Aufmerksamkeit für Veränderungen zu erhöhen, so dass sie im Laufe der Zeit die Prozesse<br />
selbstständig verfolgen werden.<br />
Da der Schutzstatus in Lanken bereits seit 50 Jahren besteht, werden vom Besucher keine<br />
neuen Verhaltensweisen verlangt, für die der Pfad werben müsste (z.B. <strong>Weg</strong>egebot). Dass es<br />
während oder nach dem Besuch des Pfades zum Überdenken und zu Änderungen im<br />
Verhalten von Besuchern kommt, ist nicht auszuschließen, kann aber auch nicht<br />
vorausgesetzt werden (vgl. 3.1 Zielsetzungen Themenweg). Dem Besucher wird erläutert,<br />
wie er einen aktiven Beitrag zum <strong>Wildnis</strong>schutz leisten kann.<br />
Die Kompetenzen, die im Zuge der angewandten didaktischen Methoden gefördert werden,<br />
variieren je nach Teilstrecke (siehe dort bzw. Tabelle Anhang 5.3).<br />
Der Themenweg kann gleichzeitig als ein Projekt der Öffentlichkeitsarbeit für die<br />
Eigentümerin des Gebietes genutzt werden. Er leistet daneben einen Beitrag <strong>zur</strong><br />
Regionalentwicklung (vgl. 3.1 Zielsetzungen Themenweg)<br />
Der Drachenpfad sucht in besonderem Maße die Auseinandersetzung mit dem<br />
Wertbewusstsein des Besuchers (vgl. 3.1 Zielsetzungen<br />
Themenweg). Er wirbt um Akzeptanz für das Schutzziel<br />
'<strong>Wildnis</strong>', versucht Vorurteile gegen das Verwildern<br />
abzubauen und dem Besucher den Wert verwildernder<br />
Landschaft näher zu bringen. Indem er gezielt darauf<br />
aufmerksam macht, dass Lanken verwildert, stellt er dem<br />
Besucher eine in Deutschland wenig bekannte Facette der<br />
*<br />
heimen bedeutet so viel wie<br />
zäunen, vgl. auch Heimat von<br />
heimod, zusammengesetzt aus<br />
heimen = zäunen und od = Gut,<br />
Besitz (Trommer 1992, S.50)
74<br />
Der Drachenpfad – Erleben einer Landschaft im Umbruch<br />
Natur vor. Dem Mitteleuropäer ist eine geordnete (gezähmte) Kulturlandschaft vertraut, eine<br />
Natur, die er sich 'eingeheimst' * hat.<br />
Vor den Augen des Drachenpfadbesuchers entsteht nun sekundär-relative <strong>Wildnis</strong> inmitten<br />
der Kulturlandschaft. Manchem mag das im doppelten Sinne unheimlich sein. Wer <strong>Wildnis</strong><br />
als etwas vom Menschen in den Griff zu Bekommendes ansieht, wird am Drachenpfad mit<br />
der Ansicht konfrontiert, dass der <strong>Wildnis</strong> als Urform von Natur Platz in unserer Landschaft<br />
eingeräumt werden und das Ungelenkte an ihr nicht bekämpft, sondern unterstützt werden<br />
muss. Der Besucher soll erkennen, dass Natur nicht nur als Kulturlandschaft einen Wert hat.<br />
Eine positive Einstellung zu <strong>Wildnis</strong> wird dadurch bestärkt, einer negativen Einstellung<br />
Reibungsfläche geboten.<br />
Eine Schweizer Studie (Bauer 2005) versucht zu klären, mit welchen Werthaltungen man<br />
dabei zu rechnen hat und welche Hintergründe jeweils zu diesen Einstellungen gegenüber<br />
<strong>Wildnis</strong>gebieten führen. Sie gliedert vier <strong>Wildnis</strong>-Verständnis-Typen aus, die ich an dieser<br />
Stelle in Kurzform wiedergebe.<br />
Naturverbundene Naturnutzer haben eine utilitaristische Sichtweise auf Natur. Es sind<br />
häufig Landbewohner, Personen, die auf dem Land aufgewachsen sind oder einen<br />
umweltbezogenen Beruf haben, Menschen also, deren Beziehung zu Natur im dauernden<br />
Umgang mit ihr begründet liegt. Die Natur, die ihnen vertraut ist und mit der sie sich eng<br />
verbunden fühlen, ist die Natur, die von ihnen geprägt wurde. <strong>Wildnis</strong> ist ein zu großer<br />
Gegensatz <strong>zur</strong> den Menschen ernährenden Kulturlandschaft und wird abgelehnt,<br />
Veränderungen oder Nutzungsverzicht, wie sie Verwildern mit sich bringen würde, sind<br />
unakzeptabel. Im Bezug auf Nutzung von <strong>Wildnis</strong>gebieten durch Besucher sprechen sich<br />
Naturnutzer für eine relativ starke Reglementierung aus, vermutlich übertragen sie dabei die<br />
gewohnten Verhaltensmaßregeln aus der Kulturlandschaft auf die ihnen kaum bekannte<br />
<strong>Wildnis</strong>.<br />
Anthropozentrische Naturbeeinflusser haben eine menschenzentrierte Sichtweise auf<br />
Natur. Es sind häufig Stadtbewohner oder Personen, die in der Stadt aufgewachsen sind, die<br />
also relativ wenig direkten Umgang mit Natur haben. Wie bei den naturverbundenen<br />
Naturnutzern ist Natur für sie den menschlichen Ansprüchen unterstellt, sie empfinden im<br />
Gegensatz zu diesen aber keine Verbundenheit mit ihr, denn ihr Verhältnis beruht auf<br />
Dominanz. Natur muss bezwungen werden, ob <strong>zur</strong> Nahrungsmittelproduktion oder in der<br />
Freizeit. Auch für sie ist die gestaltetet Landschaft das Idealbild von Natur. <strong>Wildnis</strong> und<br />
Verwildern werden abgelehnt, vermutliche, weil sie Kontrollverlust und Verselbständigung<br />
bedeuten. Im Bezug auf Nutzung von <strong>Wildnis</strong>gebieten durch Besucher sprechen sie sich<br />
weniger für Regeln aus, wahrscheinlich weil diese nach ihrem Verständnis das Prinzip der<br />
freien Nutzung von Natur beeinträchtigen.<br />
Distanzierte Natursympathisanten sind ebenfalls häufig Stadtbewohner oder Personen, die<br />
in der Stadt aufgewachsen sind und sie haben besonders wenig direkten Kontakt mit Natur.<br />
Ihr Verhältnis <strong>zur</strong> Natur könnte man als rational bezeichnen. Nutzen und Dominanz stehen<br />
im Hintergrund, aber es existiert auch keine emotionale Beziehung. Natur darf ihren Lauf<br />
nehmen, <strong>Wildnis</strong> und Verwildern werden daher positiv bewertet. Viele Natur- und<br />
Umweltschützer gehören zu dieser Gruppe. Hinsichtlich der Besuchernutzung von<br />
<strong>Wildnis</strong>gebieten plädieren sie für wenig Infrastruktur und Regeln, sie wollen <strong>Wildnis</strong> eher<br />
ungestaltet sehen.<br />
Naturliebhaber besitzen eine stark naturzentrierte Sichtweise, ihr Verhältnis <strong>zur</strong> Natur<br />
bezeichne ich als emotional. Auch sie leben zumeist in der Stadt oder sind dort<br />
aufgewachsen. Ein großer Teil von ihnen sind Natur- und Umweltschützer. Ihre starke<br />
Verbundenheit mit Natur beruht nicht auf einem utilitaristischen Verhältnis wie bei den<br />
naturverbundenen Naturnutzern, sondern auf einem Gefühl der Verantwortung für Natur.<br />
Daraus ergibt sich eine gewisse Diskrepanz – einerseits übt <strong>Wildnis</strong> eine starke Faszination<br />
auf sie aus und sie sind bereit, Naturphänomene zu akzeptieren, andererseits möchten sie<br />
schützend eingreifen und dabei auch Natur vor Natur bewahren. Sie sprechen sich für Regeln<br />
in <strong>Wildnis</strong>gebieten aus, es liegt nahe, dass sie damit den Schutz der Natur verbinden.
Der methodische Baukasten in praktischer Anwendung<br />
Offenbar findet die Ablehnung von <strong>Wildnis</strong>gebieten auf zwei Ebenen statt: Einerseits kann<br />
<strong>Wildnis</strong> als solche abgelehnt werden, andererseits stoßen die zum Schutz der <strong>Wildnis</strong><br />
eingeführten Regeln auf Missfallen bzw. existieren konträre Vorstellungen, was die<br />
Ausgestaltung von <strong>Wildnis</strong>gebieten für den Besucher betrifft. Bauer (2005) konnte hier eine<br />
deutliche Diskrepanz, zwischen den geäußerten Vorstellungen von <strong>Wildnis</strong>gebieten und den<br />
Wünschen hinsichtlich des eigenen Erlebens eines <strong>Wildnis</strong>gebietes feststellen. Würden die<br />
<strong>Wildnis</strong>gebiete den Wünschen entsprechend ausgestattet, wären es den Vorstellungen<br />
entsprechend keine solchen mehr, sondern konventionelle Naherholungsgebiete. Sie führt<br />
dies auf Wissensdefizite <strong>zur</strong>ück, ihrer Ansicht nach können sich die Leute mangels<br />
Erfahrung mit <strong>Wildnis</strong> nur die konventionelle Ausstattung von Naherholungsräumen<br />
vorstellen.<br />
Eine mögliche Strategie im <strong>Wildnis</strong>schutz liegt darin, auf die Einstellung des Besuchers<br />
einzuwirken.<br />
Bauer (2005, S.150) empfiehlt, auf die Typen zugeschnittene umweltpädagogische<br />
Maßnahmen anzubieten, die ihnen positive <strong>Wildnis</strong>erfahrungen ermöglichen. Dabei ist<br />
unbedingt darauf zu achten, dass der ungestaltete Charakter von <strong>Wildnis</strong> vermittelt wird.<br />
Naturnutzer und Natursympathisanten müssen von der Ungefährlichkeit von verwildernder<br />
Natur überzeugt werden, Naturbeeinflusser und Natursympathisanten benötigen<br />
Maßnahmen, die Faszination und Wohlgefühl steigern (ebd., S.151). Im Bezug auf Natur<br />
nutzenorientierte Menschen müssen Verwildernlassen als Rückschritt und Zumutung<br />
auffassen, es stellt ihre traditionellen Wertvorstellungen und Verhaltensgewohnheiten in<br />
Frage (Hermann & Schutkowski 1998, S.24). Dies betrifft den von Bauer ausgegliederten<br />
Typen Naturnutzer und Naturbeeinflusser. Beide besitzen eine Neigung <strong>zur</strong> ästhetischen<br />
Annäherung an Natur, empfinden aber vom Menschen gestaltete Kulturlandschaft als<br />
ästhetisches Ideal, weswegen sie für den ästhetischen Wert von <strong>Wildnis</strong> nur schwer<br />
zugänglich sein werden. Statt leicht erfassbarer Strukturen, Abgrenzbarkeit und Stetigkeit<br />
bietet diese Komplexität und Wandelbarkeit und steht dadurch entspannender Erholung<br />
entgegen (Hermann & Schutkowski 1998, S.20, 23). <strong>Wildnis</strong>stationen müssen versuchen,<br />
diese wahrnehmungspsychologische Hürde zu überwinden.<br />
Eine zweite Strategie konzentriert sich auf die Ausgestaltung der <strong>Wildnis</strong>gebiete, sie passt<br />
also die <strong>Wildnis</strong> an den Besucher an, während die vorherige Strategie den Besucher auf<br />
<strong>Wildnis</strong> aus<strong>zur</strong>ichten versucht. Bauer (2005) führt aus, dass <strong>Wildnis</strong>gebiete in Regionen mit<br />
hohem Anteil an <strong>Wildnis</strong>gegnern und in ländlichen Räumen (!) einen weniger wilden<br />
Eindruck <strong>machen</strong> sollten, d.h. breite, gepflegte <strong>Weg</strong>e, wenige Tiere, Infrastruktur wie<br />
Feuerstellen etc. vorweisen müssen. Die Nähe von Straßen oder anderen zivilisatorischen<br />
Einflüssen stört dort weniger.<br />
<strong>Wildnis</strong>gebiete für <strong>Wildnis</strong>befürworter bzw. in urbanen Räumen (!) dürfen wilder sein, dafür<br />
sollten sie von zivilisatorischen Einflüssen wie Straßenlärm aber auch anderen Besuchern (!)<br />
frei sein (Bauer 2005, S.153), was jedoch gerade in urbanen Räumen nicht möglich sein<br />
dürfte.<br />
Sie verweist auf die Möglichkeit der Zonierung von <strong>Wildnis</strong>gebieten in eine zugängliche<br />
Kernzone mit freier Naturentwicklung im Inneren und eine äußere infrastrukturell stärker<br />
erschlossene, gepflegte Zone mit weniger strengen Regeln (ebd. S.153). In dieser äußeren<br />
'kontrollierten und gestalteten <strong>Wildnis</strong>' müssen Sport und Freizeitaktivitäten erlaubt sein, die<br />
Infrastruktur sollte Feuerstellen, Mülleimer, Parkplätze, Bänke und Informationsysteme<br />
umfassen, was dem <strong>Wildnis</strong>gegner eine 'angstfreie <strong>Wildnis</strong>erfahrung' ermöglichen würde.<br />
Die äußere Zone dient zugleich der Abschirmung der bedeutend weniger gestalteten inneren<br />
Zone vor zivilisationsbedingten Störungen. Die Infrastruktur darf hier nur rudimentär sein<br />
und der Zugang muss mit strikten Verhaltensregeln verknüpft sein. Eine solche kaum<br />
gestaltete <strong>Wildnis</strong>zone würde die Bedürfnisse von anspruchsvollen <strong>Wildnis</strong>befürwortern<br />
befriedigen.<br />
75
76<br />
Der Drachenpfad – Erleben einer Landschaft im Umbruch<br />
Der Drachenpfad verfolgt die erste Strategie. Es handelt sich um einen ortspezifischen<br />
Naturerlebnispfad (besser: Naturbegegnungspfad, vgl. 3.4.2), wobei Natur als Erlebnis<br />
vermittelt, ansatzweise auch Erlebnis in der Natur ermöglicht wird (vgl. 3.3.2.1).<br />
Die Stationen sind so angelegt, dass sie die Aufmerksamkeit nicht von der Natur ab- sondern<br />
auf diese lenken. Die angesprochenen Phänomene sind Teil der umgebenden Natur.<br />
Als Themenweg ist er Selbstbedienungs- und Selbstbildungsangebot (siehe 3.3.1 Begriff<br />
Bildung). Er gründet auf den Gedanken der konstruktivistischen Lerntheorie und versucht,<br />
die sich daraus ergebenden didaktischen Konsequenzen zu berücksichtigen (vgl. 3.3.1<br />
Begriff Lernen). Welche didaktischen Methoden an welcher Stelle angewandt werden, wird<br />
in Tabelle Anhang 5.3 deutlich.<br />
Die Entscheidung für eine Umweltbildungsmaßnahme, die zugleich der Besucherlenkung<br />
dient, fiel auf Grund des vorhandenen Schutzgebietsstatus´ (vgl. 2.5<br />
Erschließungsproblematik). Das Konzept sieht vor, die ohnehin in Benutzung befindlichen<br />
Bereiche des NSG zu nutzen. Des Weiteren wird die Möglichkeit erwogen, einen<br />
zusätzlichen <strong>Weg</strong> anzulegen, der Einblicke in die empfindlichen Innenbereiche gewährt,<br />
ohne sie direkt zu durchlaufen.<br />
Der Drachenpfad orientiert sich an Naturpädagogik und Naturbildung (siehe 3.3.1), d.h. der<br />
Aufbau einer Beziehung zu Natur, Gespür und Verständnis sind gegenüber der Vermittlung<br />
von Sachkenntnis und technischen Problemlösungen prioritär. Eigenaktivität in<br />
verschiedenster Form spielt ebenfalls eine große Rolle.<br />
Von den Dimensionen der Naturerfahrung (vgl. 3.3.2.1) werden ästhetische, erkundende,<br />
erholungsbezogene und gestaltende Dimension direkt angesprochen, spielerischherausfordernde<br />
und die spirituelle Dimension können über eine Begleitperson eingeführt<br />
werden.<br />
Obwohl ein wichtiges Element das direkte Naturerleben ist, kann auf mediale Unterstützung<br />
nicht verzichtet werden. Ein aufmerksamer Spaziergänger kann zwar sehr wohl die<br />
Auswirkungen der Nutzungsaufgabe, die sich zwischenzeitlich etabliert haben, wahrnehmen.<br />
Ebenso gut können diese jedoch übersehen oder als Nachlässigkeit der Bewirtschafter<br />
aufgefasst werden. Sie müssen also für den Besucher aufbereitet werden.<br />
Hierzu wurde als Pädagogisches Arrangement (siehe 3.2.1 Grundsätze von Themenwegen)<br />
ein mehrstufiger Konzeptaufbau gewählt:<br />
Fünf Stufen der Erfahrung sorgen für einen Spannungsbogen (siehe 3.2. Grundsätze von<br />
Themenwegen). Bereits mit der als Tor gestalteten Eingangstafel wird versucht,<br />
Begeisterung zu wecken. An diese erste Phase der Einstimmung schließen Kennenlernen<br />
(Faszination), Einlassen (Annäherung), Entdecken (Ausprobieren, Herausfinden) sowie der<br />
Komplex Reflexion-Transfer-Identifikation (Verinnerlichen, Verarbeiten, Umsetzen) an.<br />
Drei <strong>Weg</strong>e der Naturbegegnung, Bildweg, Lehr-Reiche und Spielraum, bieten<br />
zielgruppenspezifische Formen der Auseinandersetzung mit Natur. Erlebnis und Erkenntnis<br />
wird dabei immer an den <strong>sichtbar</strong>en Phänomenen verankert, auf die mittels fest im Gelände<br />
installierter, zumeist künstlerisch gestalteter Stationen hingewiesen wird. Diese sind so<br />
gestaltet, dass der Besucher sie wahrnehmen kann, ohne sich genötigt zu fühlen, sich mit<br />
ihnen auseinander zu setzen. Es wurde Wert darauf gelegt, dass keine Phänomene vorgestellt<br />
werden, die in jedem Wald oder an jedem Baum gezeigt werden könnten (z.B.<br />
Photosynthese), sondern immer der konkrete Bezug zum verwildernden Wald hergestellt<br />
wird.<br />
Von den unter 2.4 dargelegten Argumenten für <strong>Wildnis</strong>schutz lassen sich direkt über die<br />
Geländestationen die persönlichkeitsbildenden Effekte vermitteln. Ob sie als solche erkannt<br />
werden, ist eine Frage der Reflexion des Besuchers. Er kann hier neben Kontrasterfahrungen,<br />
Demutserfahrungen und Selbsterfahrungen auch Körpererfahrungen, Einheitserfahrungen
Der methodische Baukasten in praktischer Anwendung<br />
und ästhetische Erfahrungen <strong>machen</strong>, außerdem sein Wissen erweitern, sich erholen oder<br />
seine Sinne schärfen.<br />
Der Bildweg stellt einen innovativen Lehrpfad dar, er arbeitet mit rezeptiver<br />
Wissensvermittlung über Bild und Text sowie der Möglichkeit, künstlerisch tätig zu werden.<br />
Der geistig-kontemplative Prozess des Naturerlebens steht im Vordergrund, Hauptzielgruppe<br />
dieses <strong>Weg</strong>abschnitts sind Erwachsene (siehe 4.4.3 Bildweg).<br />
Die Lehr-Reiche setzen auf Kunstwerke, Kombinationsaufgaben und Interpretation sowie<br />
kreative Tätigkeit, die sinnliche Wahrnehmung als Voraussetzung erfordert. Die Vermittlung<br />
von Hintergrundinformationen erfolgt rezeptiv über die Begleitbroschüre (s.<br />
Betreuungsebene Schrift). Dieser Teilabschnitt gehört in die Kategorie Lernpfad, wobei er<br />
Elemente nutzt, die Lehrpfad oder Erlebnispfad auch nutzen können. Beim Naturerleben<br />
steht ebenfalls der geistig-kontemplative Prozess im Vordergrund (siehe 4.4.4 Lehr-Reiche).<br />
Für Bildweg und Lehr-Reiche wurde auf aufwendige mechanische Installationen und<br />
Texttafeln verzichtet, stattdessen spielen Bilder eine entscheidende Rolle. Der Besucher<br />
kommt mit seiner persönlichen Vorstellung von Wald nach Lanken, die er hier entweder<br />
bestätigt oder kontrastiert findet. Ein verwildernder Wald ist ein Gegen-Bild zum Forst in<br />
der bäuerlichen Kulturlandschaft, die für viele Menschen auch heute noch das ästhetische<br />
Ideal darstellt (siehe Bauer 2005). Dem Besucher werden am Drachenweg sorgsam<br />
ausgewählte, vielfältige aber ungewohnte Bilder vor Augen geführt, in der Hoffnung, dass<br />
sich ihm deren ästhetischer Reiz erschließt, obwohl es sich um verwildernde Orte handelt.<br />
Der Besucher erhält Gelegenheit, die äußere Ansicht auf seine inneren Ansichten wirken zu<br />
lassen. Fachinformation tritt dezent in den Hintergrund, aufkommende Neugier kann aber<br />
über die Stationen befriedigt werden.<br />
Der Spielraum kommt einem als Erfahrungsraum angeordneten Erlebnispfad gleich. Über<br />
Sinnesstationen, Körpererfahrungsstationen und Stationen, die kreative Tätigkeit erfordern,<br />
wird die motorisch-sinnliche Dimension des Naturerlebens betont. Höhere<br />
Betreuungsebenen komplementieren ihn mittels zusätzlicher Spielanregungen (siehe 4.4.5<br />
Spielraum).<br />
Die drei Teilkonzepte sind so angelegt, dass sie sowohl einzeln, als auch im Gesamtkontext<br />
erschlossen werden können. Sie unterscheiden sich deutlich in der Art der Ansprache des<br />
Besuchers bzw. in der Art und Weise, wie der Besucher sich auf ihnen der Natur annähert.<br />
Ich habe mich damit bewusst gegen die Empfehlung in der Themenwegliteratur entschieden,<br />
möglichst keine gleich gestalteten Stationen nacheinander anzubieten (z.B. Ebers et al.<br />
1998), da eine Mischung der Stationstypen den Spannungsbogen des Bildweges zerstören<br />
würde. Ich halte eine solche Mischung nur dann für sinnvoll, wenn auf das Bildwegprinzip<br />
verzichtet wird.<br />
In seiner Gesamtheit ist der Drachenpfad äußerst komplex und umfangreich. Da aber davon<br />
ausgegangen werden kann, dass es sich bei den Besuchern überwiegend um häufig<br />
wiederkehrende Bewohner der Region handelt, besteht nicht die Notwendigkeit, den<br />
gesamten Pfad auf einmal zu absolvieren. Nach Wunsch kann sich auf eine Teilstrecke oder<br />
im Falle der Lehr-Reiche auch auf eine einzelne Station bis hin zu einer einzelnen<br />
Aufgabenstellung beschränkt werden.<br />
Die drei <strong>Weg</strong>e der Naturbegegnung treffen an einem gemeinsamen Kreuzungspunkt<br />
zusammen, hier kann sozusagen in eine andere Begegnungsform gewechselt werden. Über<br />
eine Zeichensetzung kann an dieser Stelle vom Besucher ein Bekenntnis zum Motto: 'Mut<br />
<strong>zur</strong> <strong>Wildnis</strong>' abgelegt werden. Damit leistet diese Station einen wichtigen Beitrag <strong>zur</strong> letzten<br />
Erfahrungsstufe Reflexion-Transfer-Identifikation.<br />
Vier Betreuungsebenen sorgen einerseits dafür, dass die Teilstrecken auch von den jeweils<br />
anderen Zielgruppen optimal genutzt werden können, denn es ist davon auszugehen, dass<br />
verschiedene Zielgruppen den <strong>Weg</strong> gemeinsam gehen werden.<br />
Andererseits ermöglichen sie der Hauptzielgruppe eine Vertiefung der Begegnung bzw. eine<br />
ihrer Aufnahmebereitschaft entsprechende Auseinandersetzung – vom Spaziergang mit<br />
77
78<br />
Der Drachenpfad – Erleben einer Landschaft im Umbruch<br />
kleinen künstlerischen Arrangements am <strong>Weg</strong>esrand über die Registrierung von Information<br />
bis hin <strong>zur</strong> geistigen und körperlichen Eigenaktivität.<br />
Über die höheren Betreuungsebenen (Schrift, Person, Internet) können weitere Werte von<br />
<strong>Wildnis</strong> bzw. Argumente für <strong>Wildnis</strong>schutz angesprochen werden: Gerechtigkeit und<br />
Glaubwürdigkeit, ökonomische und ökologische Werte, Transformationswert,<br />
moralisierende Wirkung und Eigenwert von <strong>Wildnis</strong>. Sie können aber auch im Alleingang<br />
durch das Gelände durch Reflexion aufgeworfen werden.<br />
Alleingang * : Alle Stationen, die als solche in der Landschaft<br />
zu erkennen sind, erklären sich bis zu einem gewissen Grad<br />
selbst. So wird verhindert, dass ein Besucher, der ohne<br />
erklärende Begleitbroschüre (Betreuungsebene Schrift)<br />
unterwegs ist, ratlos wird.<br />
*<br />
Alleingang bezieht sich auf das<br />
Fehlen von Begleitmedien,<br />
unabhängig davon, ob<br />
Besucher allein oder in der<br />
Gruppe unterwegs sind.<br />
Begleitschriften '<strong>Weg</strong>begleiter' und Kinderbuch: Von Umweltbildung und<br />
Öffentlichkeitsarbeit wird Zielgruppenorientierung verlangt, für eine Einrichtung, die mit<br />
einem breiten Spektrum an Besuchern rechnen muss, ist das eine schwierige Aufgabe,<br />
insbesondere, wenn sie mit fest installierten Stationen arbeitet. Texte lassen sich dagegen gut<br />
an eng gefasste Zielgruppen anpassen. Daher bietet es sich an, verschiedene Zielgruppen mit<br />
verschiedenen Begleitmaterialien auszustatten.<br />
Angedacht ist eine relativ sachlich gehaltene Informationsbroschüre (<strong>Weg</strong>begleiter) mit<br />
Erläuterungen und Hintergrundinformationen, die auf Jugendliche und Erwachsene<br />
zugeschnitten ist.<br />
Ein speziell auf Kinder ausgerichtetes Begleitbuch bietet neben der kindgerechten<br />
Aufarbeitung der Informationen zusätzliche Aufgaben und Spielanregungen (siehe 4.3.1.2).<br />
Person: Eine weitere Intensitätssteigerung wird über die Einbeziehung einer Begleitperson<br />
erreicht. Über sie kann jede Besuchergruppe und in ihr jedes Individuum gezielt<br />
angesprochen werden (siehe 4.3.2). Sie kann den Kenntnisstand der Besucher ebenso wie<br />
deren individuellen Wunsch nach Information berücksichtigen.<br />
Internet: Es bietet eine völlig andere Form der Auseinandersetzung, hier ist der Besucher<br />
anonym und erlebt den Ort virtuell. Per Handy kann vor Ort Kontakt <strong>zur</strong> Homepage<br />
hergestellt und Zusatzinformationen (z.B. animiertes Modell der Landschaftsentwicklung)<br />
abgerufen werden.<br />
Die Umsetzung des Grundsatzes Zielgruppenorientierung am Drachenpfad wurde<br />
ansatzweise bereits behandelt, dennoch eine kurze Zusammenfassung.<br />
Kinder sind Hauptzielgruppe des Teilkonzepts 'Spielraum', er spricht insbesondere Sinne und<br />
Motorik an. In den Gesamtweg werden Kinder durch die Betreuungsebene 'Kinderbuch'<br />
eingebunden, die ihnen eine kindgerechte Aufarbeitung der eigentlich für Ältere konzipierten<br />
Stationen ermöglicht. Außerdem lässt der Drachenpfad viel Raum für eigene Phantasie, es<br />
gibt viele Ansatzpunkte, sich Dinge auszudenken und kreativ tätig zu werden und schließlich<br />
ist der Strand zum Bauen, Graben und Gestalten ideal. In der Hauptsache für Jugendliche<br />
sind die Lehr-Reiche gedacht, während der Bildweg für Erwachsene konzipiert ist. Diese<br />
beiden Gruppen werden zusätzlich von der Broschüre '<strong>Weg</strong>begleiter' geleitet. Für alle<br />
Altersgruppen können speziell auf sie ausgerichtete Veranstaltungen angeboten werden (vgl.<br />
4.3.2.2).<br />
Im Hinblick auf die Lernstile nach Kolb werden insbesondere konkrete Erfahrungen und<br />
reflektiertes Beobachten gefördert. Auch die abstrakte Begriffsbildung findet Eingang, das<br />
aktive Experimentieren kann dagegen nur im Zusammenspiel mit einer Begleitperson oder<br />
im Rahmen eines Schulprojekts umgesetzt werden. Das bedeutet, dass der Drachenpfad<br />
besonders Divergierer fördert, aber auch Assimilierern entgegen kommt. Die Neigungen von<br />
Konvergierern und Akkomodierern werden im Spielraum und über höhere<br />
Betreuungsebenen angesprochen (vgl. 3.2.2.3 Lernstile nach Kolb).
Der methodische Baukasten in praktischer Anwendung<br />
Die vom Pfad angesprochenen Naturerfahrungstypen sind insbesondere der ästhetische und<br />
der ökologisch-erkundende Typus (vgl. 3.2.2.2 Naturerfahrungstypen nach Bögeholz).<br />
Der oben erläuterte Grundsatz Reflexion-Transfer-Identifikation (siehe 3.2.3<br />
Transferleistung) wird am Drachenpfad über Stationen umgesetzt, die konkret dem<br />
'Nachsinnen' gewidmet sind. Daneben wird in den Begleittexten bei allen Aufgaben dazu<br />
aufgefordert, die Ergebnisse bzw. Fotos davon an die <strong>Stiftung</strong> zu schicken. Zusätzlich wird<br />
um einen Erlebnisbericht gebeten, der als Geschichte, Gedicht, Bild, Theaterstück, Hörspiel<br />
oder in anderer Form verfasst sein kann und über die Erfahrungen am Drachenpfad berichten<br />
soll. Durch die entsprechende Aufbereitung setzt sich die Person noch einmal intensiv mit<br />
dem Erlebten auseinander und vertieft die Beziehung zum NSG Lanken. Alle Einsendungen<br />
werden in einer Internetgalerie veröffentlicht. Es ist auch ein Schaukasten vor Ort denkbar,<br />
indem Berichte direkt ausgestellt werden.<br />
Der Transfer des <strong>Wildnis</strong>gedankens in das eigene Lebensumfeld wird über höhere<br />
Betreuungsebenen angestrebt, z.B. Tipps in den Begleitbroschüren. Über eine Begleitperson<br />
kann ein Nachdenken darüber initiiert werden.<br />
Des Weiteren ist ein intensiver Einbezug der Bevölkerung vor Ort bei der Planung und<br />
Umsetzung des Drachenpfades angestrebt. Bereits jetzt ist eine deutliche Identifikation der<br />
Anwohner mit ihrem NSG Lanken als Ort der Naherholung zu verzeichnen. <strong>Den</strong>noch ist<br />
vermutlich vielen Besuchern nicht bewusst, dass sie mit dem verwildernden Lanken einer<br />
regionalen Besonderheit begegnen. Die aktive Teilnahme an der Ausgestaltung des<br />
Drachenpfadkonzepts soll tiefere Einblicke in die Hintergründe ermöglichen und dazu<br />
beitragen, dass die sich entwickelnde <strong>Wildnis</strong> Lankens im Regionalbewusstsein als<br />
Bereicherung für die Region angenommen werden kann. Eine solche Beteiligung am<br />
Entstehungsprozess wird auch einen verantwortungsvollen Umgang mit der Einrichtung<br />
selbst unterstützen.<br />
Die Meinung der Bürger einzuholen bietet sich z.B. bei der Entscheidung an, welche<br />
Variante des Drachenpfades umgesetzt werden soll.<br />
Bei der Auswertung von Wettbewerben, wie sie für die Gestaltung der Durchgangstafel<br />
ausgeschrieben werden könnten, wäre eine Mitentscheidung der Bevölkerung<br />
begrüßenswert.<br />
Die Gestaltung und Umsetzung einzelner Stationen, z.B. eines Barfußpfades oder<br />
Labyrinths, könnten einer Schulklasse oder einer Kindergartengruppe anvertraut werden<br />
oder im Rahmen eines Ferien-Workshops für Kinder der Region erfolgen. Schulen oder<br />
Kindergärten könnten auch die Wartung 'ihrer' Station übernehmen und für die Ausstattung<br />
der 'Infokästen' mit Broschüren sorgen.<br />
Aufwendigerer Art sind Schulprojekte, die die Entwicklung z.B. der Naturverjüngung, des<br />
Totholzanteils oder Naturschutz relevanter Waldstrukturen über mehrere Jahre verfolgen.<br />
Die Schüler lernen den Wald und seine Prozesse dabei intensiv kennen und helfen aktiv bei<br />
der wissenschaftlichen Aufarbeitung des Verwilderungsprozesses mit. Die Betreuung der<br />
Schüler könnten Studenten aber auch Forstbeamte übernehmen.<br />
Ebenfalls einen Beitrag <strong>zur</strong> Identifikation können Aktivitäten für die Bevölkerung leisten,<br />
dazu mehr unter 4.3.2.2 Veranstaltungen. Die Zusammenarbeit zwischen der Eigentümerin<br />
Lankens und den Akteuren vor Ort würde von einer gemeinsamen Marketingstrategie für die<br />
Regionalentwicklung profitieren. <strong>Den</strong>kbar wäre z.B. ein Sommerticket, in dem die<br />
Dampferfahrt von Wieck nach Ludwigsburg, ein Gedeck Kaffee mit Kuchen, eine<br />
Schlossbesichtigung und das Kinderbegleitbuch zusammen erworben werden. Eine weitere<br />
Möglichkeit ist die Gestaltung einer Regionalseite in der Begleitbroschüre und auf der<br />
Homepage für Lanken. Wichtig ist die Vergabe eventueller Aufträge an Firmen und Künstler<br />
in der Region, wann immer dies möglich ist. Auch der Einbezug der Greifswalder<br />
Behindertenwerkstatt ist zu überlegen. An Regionale Umweltbildungsveranstalter sollte die<br />
79
80<br />
Der Drachenpfad – Erleben einer Landschaft im Umbruch<br />
Möglichkeit herangetragen werden, den Drachenpfad unentgeltlich für betreute Angebote zu<br />
nutzen.<br />
Für den Drachenpfad müssen Logo (Vorschlag siehe Abb. 5) und einheitliches<br />
Erscheinungsbild entwickelt werden (vgl. 3.2.5 Grundsatz Öffentlichkeitsarbeit). Sie werden<br />
am Pfad z.B. im Rahmen der <strong>Weg</strong>markierung sowie in den Begleitbroschüren zum Einsatz<br />
kommen. Da am <strong>Weg</strong> selbst auf Texttafeln verzichtet wird, sind die Standards der äußeren<br />
Form von Öffentlichkeitsarbeit im Wesentlichen für die<br />
Gestaltung der begleitenden Textmedien relevant, deren<br />
Entwurf innerhalb dieser Arbeit nicht mehr vorgelegt<br />
werden kann.<br />
Ein wichtiger Aspekt hinsichtlich Öffentlichkeitsarbeit am<br />
Drachenpfad ist die Möglichkeit, ihn innerhalb mehrerer<br />
Realisierungsstufen zeitlich nacheinander umzusetzen.<br />
Das lässt Raum für die Suche nach Sponsoren bzw.<br />
Drittmitteleinwerbung. Jede Fertigstellung eines neuen<br />
Elements kann als Anlass für ein kleines 'Event' genutzt werden, durch das sowohl die<br />
Lanken als auch die Eigentümerin und deren Ziele in der Öffentlichkeit in Erscheinung<br />
treten.<br />
Als Basis kann ein Nummernpfad (siehe 3.4.2) dienen, der sukzessive zum eigentlichen<br />
Konzept umgestaltet und ausgebaut wird. Die Begleitbroschüre erläutert die angedachten,<br />
noch nicht realisierten Stationen jeweils mit und wirbt um Spenden für deren Umsetzung.<br />
Entsprechend muss jede Neuauflage an den jeweiligen Stand der Dinge angepasst werden.<br />
Damit haben regelmäßige Besucher bzw. Anwohner Gelegenheit, am Entstehungsprozess<br />
des Gesamtkonzeptes teilzuhaben.<br />
4.2 Zusätzliche allgemeine Überlegungen<br />
4.2.1 Regionale Infrastruktur<br />
Die Einbindung in die regionale Infrastruktur entscheidet darüber, ob sich Lanken als Ort für<br />
die Anlage eines Themenweges überhaupt eignet. Die Erreichbarkeit ist gewährleistet.<br />
Lanken verfügt über eine Zufahrtsstrasse mit großem Besucherparkplatz, ein überregionaler<br />
Radweg kreuzt das NSG und ein Fahrgastschiff steuert den Anleger Ludwigsburg von April<br />
bis Oktober dreimal täglich an. Lanken ist in der Region ein beliebtes Naherholungsziel,<br />
insbesondere der nicht zum NSG gehörende Strand wird gern aufgesucht. Ferner existiert<br />
eine Gaststätte direkt am NSG sowie zwei Lokalitäten im nahen Ludwigsburg. Im dortigen<br />
Schloss finden im Jahresverlauf diverse kulturelle Veranstaltungen statt.<br />
Zumindest in den Sommermonaten stehen für Touristen einige Ferienwohnungen und<br />
Gästezimmer in den umgebenden Ortschaften sowie der Zeltplatz Loissin <strong>zur</strong> Verfügung.<br />
4.2.2 Infrastruktur am <strong>Weg</strong><br />
Abb. 5: Landeslogo Mecklenburg-<br />
Vorpommern (links) und Vorschlag<br />
für Lankenlogo (rechts)<br />
Ein Informationszentrum für das NSG Lanken ist nicht vorgesehen, dadurch scheiden<br />
Themenwegtypen, die auf dem Ausleihen von Utensilien beruhen, ebenso aus, wie Stationen,<br />
die eine tägliche Betreuung benötigen. Ehemals vorhandene öffentliche Toiletten wurden<br />
zwischenzeitlich abgebaut, was ein gewisses Problem darstellt. Die Gemeinde unterhält<br />
einige Mülleimer und Bänke im Gebiet, deren Zweckmäßigkeit überdacht werden sollte.<br />
Sitzgelegenheiten, die den Besucher in nicht verkehrsgesicherte Bereiche leiten, sollten<br />
dringend abgebaut werden (s. u.). Entlang des Drachenpfades aufgestellte Bänke sollten sich<br />
besser in das Gelände einfügen, als es die jetzigen Modelle tun, vorstellbar wären Holz- oder<br />
Steinarbeiten mit spezifisch auf Lanken zugeschnittenen Motiven, aber auch ein passend<br />
platzierter Baumstamm erfüllt den selben Zweck auf unauffälligere Weise. Es besteht eine<br />
gewisse Ablenkung vom Drachenpfad durch den Strand, der aber als offener
Zusätzliche allgemeine Überlegungen<br />
Gestaltungsraum bewusst einbezogen und somit mehr als Ergänzung denn als Konkurrenz<br />
aufgefasst wird.<br />
4.2.3 Gefahrenpotenzial<br />
Bei hohen Wasserständen können Gräben und Feuchtgebiete entlang des Drachenpfades eine<br />
potenzielle Gefahr für Kinder darstellen. Darauf sollte bei der Beschreibung der Strecke im<br />
Begleitheft hingewiesen werden, es können auch Warnschilder im Gelände aufgestellt<br />
werden. Ebenso empfiehlt sich ein allgemeiner Hinweis für die Benutzung der Spiel- und<br />
Klettergeräte im Spielraum, wie er sich auch an öffentlichen Spielplätzen findet. Hinweise<br />
auf die Möglichkeit von Zeckenbissen und Tipps für die Entfernung der Tiere sind ebenfalls<br />
hilfreich.<br />
Ein zentraler Aspekt bei öffentlichen Waldwegen ist die Verkehrssicherung. Potenzielle<br />
Gefahren müssen beiderseits des <strong>Weg</strong>es beseitigt werden. Diesbezüglich besteht die<br />
Verpflichtung, entsprechende Strecken 2mal jährlich zu begutachten. Eine Handreichung <strong>zur</strong><br />
Sicherung von Wanderwegen ist bei Europarc Deutschland erhältlich (Laux 2005,<br />
mündlich).<br />
Stege und Holzbohlenwege sollten <strong>zur</strong> Verminderung der Rutschgefahr mit Drahtgitter<br />
versehen werden.<br />
4.2.4 Vandalismus<br />
Während Lang & Stark (2000) glauben, dass eine ansprechende Gestaltung von Stationen<br />
Schutz vor Vandalismus biete, geht Schemel (1998, S.299) davon aus, dass eher eine<br />
gewisse Unfertigkeit der Dinge einen psychologischen Schutz vor mutwilliger Zerstörung<br />
mit sich bringe. Eine Vorstellung davon, womit gerechnet werden kann, gibt die Aufzählung<br />
der am Erlebnispfad Gut Ophoven entstandenen Schäden von Ebers (Ebers et al. 1998). Die<br />
Liste reicht von Diebstahl über anbrennen, abbrechen und zerkratzen bis <strong>zur</strong> völligen<br />
Zerstörung von Konstruktionen. Am Drachenpfad werden bewusst keine Installationen mit<br />
beweglichen Teilen eingesetzt. Die Stationen und Sitzgelegenheiten müssen jedoch<br />
diebstahlsicher im Boden verankert werden.<br />
4.2.5 Verbote bzw. Gebote<br />
Grundsätzlich ist es wünschenswert, sowohl auf Verbote als auch auf Gebote zu verzichten,<br />
da sie vom Besucher stets als eine gewisse Bevormundung empfunden werden. Die<br />
wichtigsten Verhaltensgrundsätze in NSGs dürften zumindest einem Großteil der<br />
Bevölkerung bekannt sein. Wichtig ist daher die zweckmäßige Platzierung von NSG-<br />
Schildern. Sollten Verhaltenshinweise dennoch notwendig erscheinen, sind unbedingt die<br />
Standards der Öffentlichkeitsarbeit zu beachten (siehe 3.2.5).<br />
In Lanken besteht die von Schemel (1998) vorgeschlagene Lockerung des <strong>Weg</strong>egebots in<br />
Schutzgebieten (siehe 2.5 Erschließung) bereits im Dünenkiefernwald. Von einer Änderung<br />
der Behandlungsrichtlinie, die die freie Begehbarkeit des Dünenkiefernwaldes beendet, kann<br />
mit Blick auf die Akzeptanzproblematik nur abgeraten werden. Sollte dies aus<br />
naturschutzfachlichen Gründen aber notwendig sein, muss dem eine wohldurchdachte<br />
Öffentlichkeitsarbeit vorangehen.<br />
Ich empfehle, zukünftig darauf hinzuweisen, dass nur die im Zusammenhang mit dem<br />
Drachenpfad markierten <strong>Weg</strong>e öffentlich sind und nur an diesen Verkehrssicherung<br />
stattfindet. Derzeit dürfte den Besuchern völlig unklar sein, dass auf den von ihnen benutzten<br />
Pfaden zum Teil nicht unerhebliche Gefahren durch Astbruch oder Baumfall bestehen.<br />
4.2.6 Konfliktpotenzial<br />
Es ist zu erwarten, dass die vom Drachenpfad vermittelte Wertvorstellung bezüglich des<br />
Verwilderns nur von wenigen Besuchern unmittelbar geteilt wird. Diese Auseinandersetzung<br />
wird vom Drachenpfad jedoch explizit gesucht. Konflikte können sich im Hinblick auf die<br />
81
82<br />
Der Drachenpfad – Erleben einer Landschaft im Umbruch<br />
angedachte Neuanlage eines <strong>Weg</strong>es im NSG ergeben. Da sowohl <strong>Weg</strong>egebot als auch<br />
Leinenpflicht für Hunde bereits jetzt gelten, sind hier keine zusätzlichen Probleme zu<br />
erwarten.<br />
4.2.7 Erfolgskontrolle / Evaluation<br />
Eine Ausarbeitung einer Evaluation für das Drachenpfadkonzept kann nicht geleistet werden.<br />
Um eine solche aber im Nachhinein zu ermöglichen, werden die Zielstellungen der<br />
Teilkonzepte und ggf. auch die der einzelnen Stationen dergestalt beschrieben, dass eine<br />
Überprüfung der Sollerfüllung möglich wird. Die Durchführung einer Evaluation könnte z.B.<br />
im Rahmen eines Projektpraktikums im Fach Landschaftsökonomie der Universität<br />
Greifswald stattfinden. Hinweise <strong>zur</strong> Durchführung von Evaluationen geben z.B. Ebers at al.<br />
(1998) und Megerle (2003), dort finden sich weitere Literaturhinweise.<br />
4.2.8 Behördliche Genehmigung und TÜV<br />
Im Falle der Neuanlage eines <strong>Weg</strong>es bedarf es auf Grund des Schutzstatus' einer<br />
behördlichen Befreiung von den Verboten der NSG-Verordnung (Ausnahmegenehmigung).<br />
Zu prüfen ist weiterhin, ob die Installation der vorgeschlagenen Stationen<br />
genehmigungspflichtig ist.<br />
Eventuelle Bauten (Stege und Bohlenwege, Brücken, Geländer, Türme) und Geräte <strong>machen</strong><br />
eine TÜV-Prüfung erforderlich.<br />
4.2.9 Versicherung<br />
Grundsätzlich sollte die Möglichkeit geprüft werden, teure Stationen gegen Diebstahl und<br />
Vandalismus versichern zu lassen. Insbesondere im Hinblick auf den Spielraum kann auch<br />
eine (Betriebs-) Haftpflichtversicherung in Erwägung gezogen werden.<br />
4.2.10 Kosten und Folgekosten<br />
Bei der Errichtung des Drachenpfades sowie dessen Unterhaltung ist mit Kosten in<br />
folgenden Bereichen zu rechnen:<br />
• Projektierung und Baubegleitung<br />
• <strong>Weg</strong> (Bau, Reparatur, Verkehrssicherung, Müllbeseitigung)<br />
• Stationen (Bau, Reinigung und Wartung)<br />
• Infrastruktur (Aufstellung, Reparatur von Bänken, <strong>Weg</strong>markierungen,<br />
Hinweisschildern etc.)<br />
• Broschüre, Textbuch (Druck, Verfügbarhaltung, Aktualisierung)<br />
• Homepagegestaltung / Pflege<br />
• Werbung & Vermarktung<br />
• Evaluation, Sonstiges<br />
Als Finanzierungspartner kommen sowohl öffentliche Institutionen (Gemeinde Loissin,<br />
Landkreis, Land Mecklenburg-Vorpommern, Tourismusverbände, staatliche<br />
Förderprogramme) als auch private Geldgeber (<strong>Stiftung</strong>en, Firmen, Privatpersonen) in Frage.<br />
Vielversprechend erscheint die Vergabe von Patenschaften für einzelne Stationen.<br />
Während eine externe Finanzierung für die Einrichtung des Pfades zumindest in Teilen<br />
realistisch erscheint, muss davon ausgegangen werden, dass für die Folgekosten<br />
überwiegend Eigenmittel bereitgestellt werden müssen.<br />
4.2.11 Werbung<br />
Im Interesse der <strong>Stiftung</strong> und der Regionalentwicklung wird angestrebt, ein möglichst breites<br />
Publikum anzuziehen. Dafür ist eine aktive Bewerbung des Drachenpfades erforderlich.<br />
Diese erfolgt beispielsweise über die breit gestreute Verteilung der Begleitschriften (siehe<br />
4.3.1 Betreuungsebene Schrift), andere <strong>Stiftung</strong>smedien und das Internet (siehe 4.3.3<br />
Betreuungsebene Internet). Darüber hinaus sollten alle sich anbietenden Ereignisse, wie z.B.
Zusätzliche allgemeine Überlegungen<br />
die Eröffnung eines neuen Teilabschnitts, zu intensiver Pressearbeit genutzt werden. Auch<br />
die Einbindung eines regionalen Umweltbildungsanbieters kann mit Werbung verknüpft<br />
werden.<br />
4.2.12 Strecke<br />
Die Streckenführung festzulegen bedeutet, zwischen Attraktivität, Störungsgrad,<br />
Bedürfnissen der Besucher und Kosten abzuwägen. Die Attraktivität hängt u.a. vom<br />
Routentyp ab. Allgemein gelten Rundwege als besucherfreundlicher als <strong>Weg</strong>strecken, bei<br />
denen der gleiche <strong>Weg</strong> zweimal gegangen werden muss (z.B. Ebers et al. 1998, S.38). Eine<br />
Kompromisslösung könnte eine Schleife bieten. Vom Hauptweg abführende Stichwege<br />
können Neugier wecken aber auch übersehen werden. Die Strecke muss möglichst viele<br />
naturkundlich bzw. historisch interessante Teile berühren, darf aber zugleich nicht durch<br />
besonders empfindliche Bereiche führen. Sensible Orte, wie z.B. Tierbauten, können<br />
allenfalls bei gelegentlichen Führungen einbezogen werden.<br />
Das Gelände sollte nicht extra umgestaltet werden müssen, der <strong>Weg</strong> muss sich in die<br />
Landschaft einpassen. Die Ausbauintensität eines <strong>Weg</strong>es verändert seine Wirkung. Breit<br />
ausgebaute <strong>Weg</strong>e erlauben ein bequemes Nebeneinanderhergehen und somit auch<br />
Unterhaltung, die von der Umgebung ablenkt. Sie kommen aus praktischen Gründen vor<br />
allem dann in Frage, wenn mit Kinderwagen oder Fahrrädern zu rechnen ist. Trampelpfade<br />
erhöhen Spannung und Konzentration, insbesondere wenn sie durch unübersichtliches<br />
Gelände führen. Sie sind aber nicht für jede Personengruppe geeignet. Entsprechend legen<br />
sie innerhalb eines Konzepts mit wechselnden <strong>Weg</strong>breiten die Zielgruppe fest. Bohlenwege<br />
können nicht nur in Feuchtgebieten sondern immer auch dann zum Einsatz kommen, wenn<br />
aus ökologischen oder psychologischen Gründen eine Distanz zwischen Besucher und<br />
Umgebung erzeugt werden soll. Sie eignen sich darüber hinaus, um Hindernisse, die nicht<br />
entfernt werden sollen, zu überbauen (Beispiel Seelensteig Bayrischer Wald). Unabhängig<br />
vom <strong>Weg</strong>typ stellt sich die Frage, ob ein Hindernis (z.B. umgestürzter Baum) entfernt oder<br />
integriert, bzw. ob die <strong>Weg</strong>führung jeweils angepasst wird.<br />
Lang & Stark (2000, S. 65) empfehlen für Themenwege eine Gesamtlänge zwischen 2 und 4<br />
km, wobei der erforderliche Zeitaufwand 3 Stunden nicht überschreiten sollte. Megerle<br />
(2003, S. 22ff., 290) gibt für Kinder eine Richtlinie von maximal 3 Kilometer <strong>Weg</strong>strecke<br />
und einen Stationsabstand von höchstens 300m an. Sie empfiehlt zwischen 8 und 16<br />
Stationen. Der Drachenpfad benutzt verschiedene Routentypen, die nach Wunsch zu einem<br />
Rundweg von ca. 3,5 km Gesamtlänge kombiniert werden können. Entlang der Strecke<br />
befinden sich 18 fest installierte Stationen. Die nähere Beschreibung erfolgt bei den<br />
Teilkonzepten (siehe 4.4).<br />
4.2.13 Kennzeichnung<br />
Die Strecke muss deutlich und gut <strong>sichtbar</strong> gekennzeichnet werden, wobei konzeptionelle<br />
Teilstrecken jeweils ein eignes Symbol benötigen. Üblicherweise werden kleine Schildchen<br />
an Bäumen oder Pfosten befestigt oder Bäume farbig markiert. Kindgerecht – aber nicht<br />
diebstahlsicher – ist eine Anbringung in Kniehöhe. Nachahmenswert sind Drehwegweiser,<br />
wie sie im Nationalpark Bayerischer Wald verwirklicht sind (Ebers et al. 1998, S. 114).<br />
Auch Stelen, Findlinge oder Kunstwerke können zum Einsatz kommen.<br />
An allen Zugängen müssen Übersichtstafeln oder Broschüren-Pulte aufgestellt sein, die<br />
Informationen <strong>zur</strong> Einrichtung geben und erläutern, wo sich der Besucher momentan<br />
befindet.<br />
4.2.14 Material<br />
Hinweise zu <strong>zur</strong> Anwendung kommenden Materialien bzw. Herstellernachweise sind bei<br />
Ebers et al. 1998, Lang & Stark 2000 oder bei Bayerisches Staatsministerium für<br />
Landwirtschaft und Forsten (2004) zu finden. Verständlicherweise wird versucht, Wert auf<br />
Langlebigkeit, Witterungsbeständigkeit, Haltbarkeit und Umweltverträglichkeit zu legen und<br />
83
84<br />
Der Drachenpfad – Erleben einer Landschaft im Umbruch<br />
dennoch relativ kostengünstig zu bleiben. Am Drachenpfad wird wann immer möglich<br />
versucht, auf die Materialien vor Ort <strong>zur</strong>ückzugreifen.<br />
4.2.15 Barrierefreiheit<br />
Ein rollstuhltauglicher Ausbau setzt eine starke Modifikation der Verhältnisse vor Ort voraus<br />
(Lang & Stark 2000, S. 98ff.; Megerle 2003, S.291), was sich mit der Vermittlung des<br />
<strong>Wildnis</strong>gedankens nur schwer vereinbaren lässt. Ein behindertengerechter Ausbau könnte<br />
allenfalls für die Lehr-Reiche entlang des Radweges in Erwägung gezogen werden.<br />
4.2.16 Leitfigur<br />
Eine Leitfigur begleitet den Besucher entlang des <strong>Weg</strong>es und führt ihn durch die Thematik.<br />
Als Sympathieträger weckt sie Interesse und stellt eine emotionale Verbindung her, wodurch<br />
die Aufnahme von Informationen erleichtert wird (siehe 3.3.1 Lernen). Insbesondere Kinder<br />
sind sehr empfänglich für anthropomorphisierte Figuren, denn sie entsprechen der<br />
subjektivierten Form des Naturkontakts, den sie auch von sich aus eingehen (Gebhard 1995,<br />
S.41f.).<br />
Während reale Lebewesen als Leitfigur einerseits gut geeignet sind, ökologische Fakten zu<br />
vermitteln, rufen sie andererseits beim Besucher den Wunsch hervor, diesem Lebewesen<br />
auch zu begegnen.<br />
In Lanken kommen keine Arten vor, die sich als spezielle <strong>Wildnis</strong>-Leitfigur eignen würden.<br />
Als grundsätzlicher Sympathieträger käme der Dachs in Frage, er ist jedoch relativ<br />
störungsempfindlich, weshalb es nicht ratsam ist, einen ständigen Besucherverkehr in seiner<br />
Nähe ein<strong>zur</strong>ichten. Er wäre für den Besucher somit nicht erlebbar. Für den Drachenpfad ist<br />
eine Leitfigur erforderlich, die das <strong>Wildnis</strong>prinzip Eigendynamik repräsentiert. Sie muss<br />
geeignet sein, das wechselnde Verhältnis des europäischen Menschen <strong>zur</strong> ungelenkten Natur<br />
zu visualisieren. Diese Anforderungen erfüllt das Fabelwesen Drachen, wie im Folgenden<br />
gezeigt wird.<br />
Die Figur des Drachen findet sich überall auf der Welt. Laut Zerling (2003, S.60, 63)<br />
kennzeichnet er „die Ambivalenz der ursprünglichen und ungezähmten Natur, den Rhythmus<br />
<strong>sichtbar</strong>er und un<strong>sichtbar</strong>er kosmischer Strömungen, der Jahreszeiten und des Mondes“ und<br />
„Macht und Kraft des unaufhörlichen Flusses der Lebenskraft; die zu überwindenden<br />
Widerstände gegen diesen unser ganzes Leben begleitenden und formenden Fluss [und] die<br />
Gegensätze als Motor aller Veränderungsprozesse“. Als Sohn von Sonne und Mond wird er<br />
als das älteste Wesen überhaupt beschrieben (Zerling 2003, S.60). Der Ouroborus – eine<br />
Schlange, die sich in den Schwanz beißt oder zwei Drachen, die nach ihren Schwänzen jagen<br />
– symbolisiert die sich ewig selbst belebenden und wieder zerstörenden Kräfte, die Lehre<br />
vom Werden und Vergehen. In der mittelalterlichen Alchemie beschreibt der Drachen das<br />
Flüchtige des Quecksilbers Mercurius (Zerling 2003, S.59ff.), also die Wandlungsfähigkeit.<br />
In den religiösen Erzählformen Mythos und Legende ist das vorweltliche Nichts, die<br />
mütterliche Urmaterie, oft ein Ungeheuer (Drache, Seeschlange), das im Urmeer haust und<br />
aus dem eine geistige Kraft in einem kämpferischen Akt die irdische Welt (Himmel und<br />
Erde) formt. Der sumerische Sturmgott Enil bzw. der amoritisch-babylonische Sonnengott<br />
Marduk ringt mit der Tiamat, der kanaanäische Baal bzw. der syrische Hadad besiegt die<br />
Schlange Lotan, der ägyptische Horus kämpft mit Seth (Zerling 2003, 59ff.; Drewermann<br />
1987, S. 397). Das Motiv wird in die christliche Schöpfungsgeschichte übernommen, der<br />
biblische Drache liegt als Urmeer vor jeder Schöpfung, über dem der Geist Gottes schwebt.<br />
Das vorweltliche Chaos in Form des Drachen wird verdammt in den Abgrund, lebt aber fort<br />
und bedroht als Prinzip des Satans die Schöpfung. Der rote 7köpfige Drache (7 Todsünden)<br />
bedroht die Jungfrau Maria, die das Kind (Jesu bzw. die Kirche) gebärt. Er ist das Symbol<br />
des Teufels und wird schließlich vom Erzengel <strong>Michael</strong> gestürzt (Becker 2002, S.57f.;<br />
Zerling 2003, S.59ff., Geheime Offenbarung des Johannes (12,3-20,10), Apokalypse). Der<br />
Kampf mit dem Drachen wiederholt sich jährlich, wenn er die Jungfrau Mutter Erde in Form
Zusätzliche allgemeine Überlegungen<br />
einer Überschwemmung (Regenzeit) oder durch Rückhalt des Wassers (Trockenzeit) bedroht<br />
(Drewermann 1987, S. 397).<br />
Die weltlichen Erzählformen Märchen und Sage bringen im Drachenkampf die Urfehde<br />
zwischen Gut und Böse, Hell und Dunkel, Bewusstem und Unbewusstem zum Ausdruck<br />
(Drewermann 1987, S.398). Der Drache ist Hüter von Schätzen, verborgenen Gärten,<br />
Gemächern von Jungfrauen oder geraubten Königstöchtern und verkörpert damit die<br />
Schwierigkeiten, die <strong>zur</strong> Erreichung eines hohen Ziels überwunden werden müssen (Becker<br />
2002, S.57f.; Drewermann 1987, S. 397)<br />
C.G. Jung deutet den Drachenkampf psychoanalytisch als Auseinandersetzung zwischen<br />
dem 'Ich' und den negativen Aspekten der Persönlichkeit sowie dem Widerstand gegen das<br />
Neue, Fremde, die Wandlung und Transformation, die uns daran hindern selbständig zu<br />
werden (Becker 2002, S.57f.; Zerling 2003, S.61). Für Freud ist die Drachentötung<br />
symbolische Darstellung des Ödipuskomplex. Dieser ist aber selbst nur ein Symbol für die<br />
Auseinandersetzung mit der eigenen Anima und dem Schatten, so dass der Drachenkampf<br />
die Auseinandersetzung mit der eigenen Triebhaftigkeit darstellt (Drewermann 1987, S.<br />
399).<br />
Während der Westen in der Drachenfigur das Destruktive des Chaos in den Vordergrund<br />
rückt und den Drachen selbst zum Bösen schlechthin macht, betont der Osten das Positive.<br />
In China und Japan ist er Glücksbringer und wehrt Dämonen ab. Als Vermittler zwischen<br />
den Prinzipien Yin (Leben spendendes Element Wasser) und Yang (Himmel, Lebensatem)<br />
ist er Symbol der Fruchtbarkeit (Becker 2002, S.57f.). Drache bzw. Schlange kennzeichnen<br />
höchste geistige Macht, übernatürliche Weisheit und Stärke. Sie steuern die Rythmen und<br />
Zyklen der Natur und sind Ursprung des Wandels (Zerling 2003, S.62). Die taoistische<br />
Philosophie verbindet mit Drachen Vollkommenheit, Erleuchtung, Weisheit und die geistige<br />
Essenz des Universums, es sind machtvolle geistige Wesenheiten (Becker 2002, S.57f.).<br />
Für den Themenweg in Lanken entstand die Figur des Drachen Darsinus. Als Fabelwesen<br />
hat er den Vorteil, dass niemand ernsthaft erwartet, ihm zu begegnen, während er der<br />
kindlichen Phantasie vielfältige Möglichkeiten eröffnen. Sein Name leitet sich ab von Portus<br />
Darsinus, der ersten urkundlich erwähnten Siedlung bei Lanken.<br />
Die Darstellungsweise des Drachens am Pfad erfolgt so, dass sein Symbolcharakter zum<br />
Ausdruck kommt und er nicht als verniedlichtes Maskottchen interpretiert werden kann. Das<br />
'Ungeheuer' Darsinus steht<br />
für die Ungeheuerlichkeit der<br />
<strong>Wildnis</strong>, er versinnbildlicht<br />
die Art und Intensität der<br />
menschlichen Einflussnahme<br />
auf die <strong>Wildnis</strong>dynamik, in<br />
deren Verlauf der Drache<br />
zum 'Opfer' wird. Dieses für<br />
den westlichen Kulturkreis<br />
untypische Drachenbild soll<br />
einen neuen Blickwinkel auf<br />
den Umgang mit<br />
eigendynamischen Prozessen<br />
Abb. 6: Vorschlag für die Leitfigur Darsinus<br />
eröffnen.<br />
85
86<br />
4.3 Betreuungsebenen<br />
Der Drachenpfad – Erleben einer Landschaft im Umbruch<br />
Die Betreuungsebenen entsprechen den Medien Schrift, Person und Internet des<br />
Möglichkeitsraumes (siehe 3.4.2). Sie ermöglichen ein tieferes Eindringen ins Thema für die<br />
jeweilige Hauptzielgruppe der Teilwegstrecken bzw. erschließen die Station für die übrigen<br />
Besucher.<br />
4.3.1 Betreuungsebene Schrift<br />
Die Erläuterung in schriftlicher Form wird als Broschüre '<strong>Weg</strong>begleiter' und als Kinderbuch<br />
angeboten. Sie verhelfen dem Besucher zu einer intensiveren Erschließung der jeweiligen<br />
Station. Damit die Texte nicht zu umfangreich werden, sollten neben Basisinformationen vor<br />
allem Fingerzeige zum selbständigen Entdecken und zum Nachdenken gegeben werden.<br />
Auflagen in Englisch, Schwedisch und Polnisch könnten perspektivisch für Lanken<br />
zweckmäßig werden.<br />
Die Begleitschriften müssen bei möglichst vielen Einrichtungen erhältlich sein. In Frage<br />
kommen neben dem Fahrgastschiff nach Ludwigsburg die ortsnahen Gaststätten, das Schloss<br />
Ludwigsburg und der Parkplatzwächter. Außerdem können sie über die Touristen-<br />
Information und den Tourismusverband in Greifswald sowie die <strong>Michael</strong>-<strong>Succow</strong>-<strong>Stiftung</strong><br />
direkt vertrieben werden. Das Prinzip des frankierten Rückumschlags ermöglicht dies ohne<br />
Zusatzkosten. Eine elektronische Version kann im Internet verfügbar sein. <strong>Den</strong><br />
'<strong>Weg</strong>begleiter' muss der Besucher auch in Pulten am Pfad vorfinden.<br />
4.3.1.1 '<strong>Weg</strong>begleiter'<br />
Die so bezeichnete Broschüre soll auf Jugendliche und Erwachsene zugeschnitten sein. Wird<br />
tatsächlich zunächst nur eine Basisversion des <strong>Weg</strong>es als Nummernpfad realisiert, ist sie die<br />
Hauptinformationsquelle. Sie muss in diesem Falle die angedachten Stationen als solche mit<br />
erläutern und um finanzielle Unterstützung für deren Umsetzung werben. Bei jeder<br />
Neuauflage muss der jeweilige Stand der Dinge beachtet werden. Der '<strong>Weg</strong>begleiter' soll<br />
kostenlos <strong>zur</strong> Verfügung stehen.<br />
Sein Stil soll eher sachlich, darf aber nicht zu fachspezifisch sein. Hier kommen die<br />
Standards der Öffentlichkeitsarbeit (siehe 3.2.5) zum Tragen. Es ist Wert auf eine<br />
abwechslungsreiche Gestaltung mit Zeichnungen, Anekdoten, Gedichten, Zitaten und<br />
dergleichen zu legen. Dass die Broschüre auch Aufgaben beinhaltet, die einen Stift<br />
erfordern, sollte gut <strong>sichtbar</strong> auf dem Deckblatt vermerkt werden. Es kann auch in Erwägung<br />
gezogen werden, Bleistifte mit <strong>Stiftung</strong>snamen, Logo und Internetadresse zusammen mit der<br />
Broschüre anzubieten.<br />
Inhaltlich muss zunächst Organisatorisches erläutert werden. Neben einem Lageplan von<br />
Lanken, den Anreise- und Parkmöglichkeiten muss eine Übersichtskarte die Orientierung<br />
ermöglichen. Außerdem sind Erläuterungen zu <strong>Weg</strong>länge und Teilstrecken,<br />
<strong>Weg</strong>markierungen, ungefährer Spaziergangs-Dauer, Stationszahl und Thema erforderlich.<br />
Zentrale Stationsinhalte müssen wiedergegeben sein. Ihr Sinngehalt muss erklärt,<br />
weiterführende Fragen angerissen und zusätzliche Aktivitäten können vorgeschlagen<br />
werden. Darsinus wird dem Besucher vorgestellt.<br />
Für jede Thematik werden Literaturtipps und Internetadressen angegeben. Zusätzlich<br />
könnten Hinweise auf andere <strong>Wildnis</strong>schutzgebiete in Deutschland als potenzielle<br />
Ausflugsziele enthalten sein.<br />
Der '<strong>Weg</strong>begleiter' weist zudem auf das Kinderbuch und seine Bezugsmöglichkeiten, die<br />
Internetseite und auf regelmäßig stattfindende Führungen hin.<br />
Sinnvoll erscheint die Einrichtung einer 'Regionalseite', auf der lokale und regionale Akteure<br />
mit Kontaktadressen, Öffnungszeiten etc. vorgestellt werden.
Betreuungsebenen<br />
Auch die <strong>Stiftung</strong> muss sich hier präsentieren und auf Spendenmöglichkeiten verweisen, ggf.<br />
mit einem heraustrennbaren Überweisungsträger. Daneben könnte eine an die <strong>Stiftung</strong><br />
adressierte Postkarte mit der Bitte um Feedback positioniert sein.<br />
4.3.1.2 Kinderbuch: Ein Begleiter durch Zeit und Raum für Kinder und ihre Eltern<br />
Auch im Kinderbuch müssen die organisatorischen Sachverhalte und der Verweis auf die<br />
anderen Betreuungsebenen integriert sein, wie sie bereits oben beim '<strong>Weg</strong>begleiter'<br />
aufgeführt wurden. Die <strong>Stiftung</strong> muss ebenfalls vorgestellt werden, die Regionalseite<br />
dagegen halte ich hier für unpassend.<br />
Da die Altersgruppe von 5-10 Jahren sehr empfänglich für märchenhaft-mythische<br />
Darstellungen ist, werden Kinder sich leicht mit Darsinus anfreunden können, der sie durch<br />
das Buch und durch das Gebiet führt. Die Grundidee für den Aufbau des Kinderbegleitbuchs<br />
ist allerdings unabhängig von der Art der Leitfigur, es könnte sich auch um eine Person oder<br />
ein real existierendes Tier handeln: Zwei Erzählebenen sind miteinander verschnitten, zum<br />
einen ein Märchen über die Figur und ihre Geschichte, die sich im Gebiet zugetragen hat.<br />
Diese Erzählung rankt sich um die Bildweg-Stationen und nimmt Leser und Zuhörer mit<br />
hinein in die Landschaftsgeschichte. Die Figur kommuniziert aus der Geschichte heraus mit<br />
dem Leser und erläutert die Aufgabenstellungen der Stationen.<br />
Diese Trennung von Erzählung über die Vergangenheit und Aktivität in der Gegenwart muss<br />
sich auch deutlich in der Aufmachung des Textes spiegeln, z.B. über den Schrifttyp, die<br />
Schriftfarbe bzw. die Nutzung von Rahmen oder Sprechblasen.<br />
Zudem wird das Kind aufgefordert, seine Erlebnisse festzuhalten und mit anderen Besuchern<br />
zu teilen, d.h. der <strong>Stiftung</strong> einen Erlebnisbericht in Form einer Zeichnung, eines Gedichts<br />
oder einer Geschichte zu zusenden. Dieser wird auf der Internetseite der Lanken<br />
veröffentlicht. Damit trägt diese Betreuungsebene in besonderem Maße zu Reflexion bei. Im<br />
Vergleich <strong>zur</strong> <strong>Weg</strong>begleiter-Broschüre erfolgt eine kindgerechtere Aufarbeitung der<br />
Einzelstationen und viele zusätzliche Anregungen, wie Spiele und Bastelanleitungen.<br />
In das Buch müssen ein loses Zeichenblatt und Farbstifte integriert sein, um die Bildweg<br />
Stationen nutzen zu können. Deswegen erfordert es eine durchdachte, aufwendige<br />
Gestaltung. <strong>Den</strong>kbar wäre eine feste Mappe, die zugebunden werden kann und neben dem<br />
Buchteil Gummizugschlaufen und Einstecklasche bietet. Hier darf nicht am 'falschen Ende'<br />
gespart werden, der Buchteil muss mit Faden- oder Ringbuchheftung integriert sein,<br />
Klebeheftungen sind für diesen Zweck nicht haltbar genug.<br />
Die Herstellung eines solchen Buchs ist mit hohen Kosten verbunden und es muss überlegt<br />
werden, zu welchen Konditionen es dem Besucher angeboten werden soll. Die Entrichtung<br />
eines geringen Obolus unterstreicht den qualitativen Wert des Buches. Andererseits schreckt<br />
eine Gebühr den Besucher eventuell ab. Alternativ sollte die Schrift als PDF-Datei im<br />
Internet erhältlich sein, der Besucher muss dann für Heftung, Zeichenbogen und Stifte selber<br />
sorgen.<br />
Die Umsetzung muss in professionelle Hände gegeben werden. Eventuell bietet sich für die<br />
Konzeption eine Zusammenarbeit mit dem Kunstinstitut der Universität Greifswald an.<br />
4.3.2 Betreuungsebene Person<br />
4.3.2.1 Umweltbildung<br />
Sinnvoll ist eine enge Zusammenarbeit mit regionalen Umweltbildungsveranstaltern, die den<br />
<strong>Weg</strong> nutzen, um auf die Ziele der <strong>Stiftung</strong> abgestimmte, zielgruppen- oder<br />
themenspezifische Führungen anbieten zu können (vgl. 3.4.2 Medium Person). Eine<br />
gegenseitige Vernetzung von Internetseiten verhilft zu gegenseitiger Werbung und<br />
Bekanntmachung und verbessert somit die Öffentlichkeitsarbeit. Es ist unbedingt darauf zu<br />
achten, dass die angebotenen Veranstaltungen nicht in ein 'Erlebnis mit Hilfe der Natur'<br />
abgleiten!<br />
87
88<br />
Der Drachenpfad – Erleben einer Landschaft im Umbruch<br />
Nachfolgend einige Möglichkeiten für derartige Umweltbildungsangebote (vgl. z.B. Kalff<br />
1993; Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz 1998; Seifert et al. 1999; Knust 2004;<br />
Bayerisches Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten 2004):<br />
• Führungen, die besonderen Wert auf atmosphärisches Erleben legen, z.B. in der<br />
Dämmerung (Dachse, Fledermäuse), bei Regen oder Nebel, Vogelstimmenexkursion<br />
am frühen Morgen oder Nachtwanderung (vgl. Wehde 2001)<br />
• Thematische Führungen, z.B. Tierspuren, essbare Pflanzen oder kulturhistorische<br />
Begebenheiten (letztere ggf. als szenische Darstellung durch Theatergruppen)<br />
• Führungen mit Schwerpunkt auf künstlerischer Gestaltung<br />
• Führungen mit Schwerpunkt auf der sinnlichen Wahrnehmung, z.B. Schütteldosen,<br />
Fühl- und Riechsäckchen, Geschmacksproben, Spiele bei denen der Sehsinn<br />
ausgeschaltet wird, Barfußweg, Geräuschkarte, Klettern<br />
• Altersorientierte Erlebnistage in der Landschaft, für Kinder z.B. Forschungsreise zu<br />
den Frühblühern oder Laubstreuzersetzern, für Erwachsene z.B.<br />
Landschaftswahrnehmung<br />
• mittel- bis langfristige Schulprojekte<br />
• an Lehrplan angelehnte Schulklassenführung (Zusammenarbeit mit Jugendherberge<br />
Greifswald)<br />
Schulprojekt 'Wald im Wandel'<br />
Die Schüler einer Klasse dokumentieren über mehrere Jahre die Waldentwicklung z.B. über<br />
eine Fotodokumentation und empirische Datenerfassung mit Auswertung bezüglich Arten,<br />
Verbiss, Alterszusammensetzung, Totholz, Biotopstruktur etc. Dadurch werden sie einerseits<br />
mit naturwissenschaftlichen Arbeitsweisen vertraut, andererseits erleben sie die Dynamik<br />
des Verwilderns mit. Ihre Ergebnisse können auf der Internetseite vorgestellt werden, diese<br />
Präsentation können die Jugendlichen selbst gestalten, was <strong>zur</strong> Einarbeitung in die<br />
Funktionsweise dieses Mediums dient, aber auch die Reflexion vertieft. Das Projekt wird an<br />
die nachfolgende Schülergeneration abgegeben, möglicherweise werden die Jüngeren schon<br />
ein Jahr lang von den Älteren betreut. Die Nachfolger müssen in jedem Fall über den Stand<br />
des Projekts informiert und eingewiesen werden. Auch dadurch müssen sich die<br />
Jugendlichen wieder mit ihrer Arbeit auseinandersetzen (vgl. Bayerisches Staatsministerium<br />
für Landwirtschaft und Forsten 2004).<br />
4.3.2.2 Lokale Veranstaltungen<br />
Nicht an Umweltbildungsunternehmen abzugeben, sondern von der <strong>Stiftung</strong> selbst zu<br />
organisieren wären bestimmte öffentlichkeitswirksame Rahmenveranstaltungen mit<br />
pädagogischem Hintergrund. Derartige Veranstaltungen stärken lokale Identifikation, als<br />
Mittel der Öffentlichkeitsarbeit können Beweggründe für bestimmte Maßnahmen über sie<br />
kommuniziert werden. Außerdem geben sie den Menschen vor Ort Gelegenheit, Kontakt<br />
aufzunehmen und sich persönlich zu informieren. Es wäre ratsam, dass <strong>Stiftung</strong>smitglieder<br />
anwesend sind. Lokale Akteure sind unbedingt einzubeziehen. Veranstaltungen werden<br />
selbstverständlich auf der Internetseite angekündigt.<br />
Auch hier folgen einige Vorschläge:<br />
• feierliche Pfad-Eröffnung bzw. Eröffnungsfeier für jede neue Station oder<br />
<strong>Weg</strong>abschnitt<br />
• Mitarbeit am Drachenfest, das regelmäßig vom Förderverein Ludwigsburg<br />
ausgerichtet wird<br />
• eigenes Lanken-Fest; Thematisierung der <strong>Stiftung</strong>s-Aktivitäten in Lanken,<br />
Spielangebote etc.<br />
• Workshops z.B. zu LandArt, Lochkamera (Camera obscura), Naturpädagogik<br />
• Baumpflanzung – bei jeder Veranstaltung einen Baum pflanzen, ergibt Altersreihe<br />
(z.B. Birkenallee <strong>zur</strong> Gaststätte)<br />
• Gestaltungswettbewerbe z.B. zu Sitzmöbeln, Eingangstafel, Menschenwerken
Betreuungsebenen<br />
• Erlebnistag für Sehende und Blinde<br />
• Meditationsveranstaltungen<br />
• Tag der Artenvielfalt<br />
• Fotowettbewerb<br />
• Freiluftvorträge / Filme z.B. bei Gaststätte mit gleichzeitiger Bewirtung<br />
• Jugendspiele: kindgemäßes Kräftemessen mit Wald und Wasser, Schatzsuche<br />
• Ballett, Theater, Lesungen zum Thema Wald bzw. Naturentwicklung, <strong>Wildnis</strong><br />
• Osterveranstaltung<br />
'Ach Du dickes Ei' – eine österliche Eiersuche der besonderen Art<br />
Es werden Nester mit Schokoeiern oder gefärbten Hühnereiern versteckt, darin befinden sich<br />
aber auch Modelle von Eiern hier lebender Vogelarten, darunter auch das dicke Ei des<br />
eingeschleusten Nandus! Jeder Teilnehmer darf ein Nest, das er entdeckt hat mitnehmen.<br />
Schokoladeneier und Hühnereier dürfen behalten werden, sie sind mit dem <strong>Stiftung</strong>slogo<br />
versehen (z.B. Kleine Anhänger am Schoko-Ei; Schablone beim Färben benutzen...). Nach<br />
der Suche kommen alle zusammen und die Modelleier werden genutzt, um die Vogelarten,<br />
ihre Lebensweisen und Gefährdungen vorzustellen. Die Erläuterungen können durch<br />
Vogelmodelle, Bilder und Vogelstimmenaufnahmen unterstützt werden. Dem Besucher wird<br />
vermittelt, wie er zum Schutz der Arten beitragen kann, z.B. über sein Verhalten im Freien,<br />
den Verzicht auf Insektizide im Garten, das Mähen zu bestimmten Zeitpunkten oder das<br />
Anbieten von Bruthilfen. Thematisiert werden können auch die Winterfütterung und die<br />
Einstellung <strong>zur</strong> Einführung fremder Arten in Ökosysteme – eben das dicke Ei des Nandu.<br />
Eingebunden werden sollten Verbände, Ornithologen oder das Zoologische Institut der<br />
Universität Greifswald.<br />
Erlebnistag für Blinde und Sehende<br />
Ein Sehender führt jeweils einen Blinden über den Bildweg, der Sehende könnte dabei<br />
barfuß laufen, damit auch er etwas Ungewöhnliches erlebt und außerdem langsam geht.<br />
Nachdem das Relief (siehe 4.4.3 Bildwegbeschreibung) ertastet wurde, liest der Sehende die<br />
Erläuterungen der Broschüre vor. Im Spielraum und am Strand könnten Spiele durchgeführt<br />
werden, die zum einen Blinde und Sehende integrieren, zum anderen ökologisches Wissen<br />
über Körpererfahrung vermitteln, z.B. blinde Barfußraupe, Purzelbaum bergauf, Ertasten von<br />
Rindenstrukturen oder das Amöbenspiel (Trommer 1991). Ein gemeinsames Picknick und<br />
gemeinsames Baden runden den Tag ab.<br />
Baustellenparty als Eröffnungsveranstaltung<br />
Baustellenschild: Baustelle Natur - 'Wir bauen die <strong>Wildnis</strong> der Zukunft für Sie'!<br />
Fertigstellung: Frühjahr 3175<br />
Bauherren: Fagus sylvatica, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Pinus<br />
sylvestris<br />
Beteiligte Firmen: Wind, Sonne, Wasser, heimische Pflanzen, Tiere<br />
Mit freundlicher Unterstützung der <strong>Michael</strong>-<strong>Succow</strong>-<strong>Stiftung</strong> zum Schutz der Natur<br />
4.3.3 Betreuungsebene Internet<br />
Lanken und der Drachenpfad brauchen eine eigene Homepage, die mit der Internetseite der<br />
<strong>Stiftung</strong> verlinkt oder dort integriert ist. Sie soll einerseits neugierig auf die Realität <strong>machen</strong><br />
und zum Besuch einladen, andererseits dem bereits in Lanken gewesenen Besucher<br />
Antworten auf dort aufgeworfene Fragen geben. Zu überlegen wäre die Einbindung so<br />
genannter WAP-Handys, die sich direkt vor Ort mit der Internetseite in Verbindung setzen<br />
und Zusatzinformationen abrufen können (vgl. Megerle 2003, S.7).<br />
89
90<br />
Der Drachenpfad – Erleben einer Landschaft im Umbruch<br />
Der Besucher kann einen virtuellen Rundgang absolvieren, Darsinus erläutert ihm den<br />
Bildweg und er kann sich an den Lehr-Reich-Aufgaben probieren. Die Spielraum-Stationen<br />
können über das Internet nur beschrieben, die Zusatzelemente wie Spiele und<br />
Bastelanleitungen aber können heruntergeladen werden.<br />
Der besondere Vorteil dieses Mediums liegt in der Möglichkeit, dynamische Prozesse über<br />
animierte Szenen <strong>sichtbar</strong> zu <strong>machen</strong>. Hier übertrifft die unpersönliche Erlebnisform das<br />
unmittelbare Erleben vor Ort. Trickfilme können Höftlandentwicklung, Dünenentstehung,<br />
Sukzession und Mosaik-Zyklen ablaufen lassen, am Bildweg können Personen in<br />
historischer Kleidung eingeblendet werden.<br />
Indem man den Besucher selbst Eingriffe durchführen lässt und deren wahrscheinliche<br />
Wirkungsweise darstellt, können verschiedene Prozessschutzformen bzw. auch andere<br />
mögliche Naturschutz- oder Nutzungsvarianten durchgespielt werden. Auf diese Weise<br />
lassen sich auch Konfliktsituationen (Grabenabdichtung, Entnahme gebietsfremder<br />
Baumarten, Wildbestandsreduzierung) thematisieren. Beim Besucher soll sich ein<br />
Problembewusstsein für den Umgang mit der Natur entwickeln, ohne dass ihm eine ideale<br />
Lösung präsentiert wird. Er soll im Gegenteil feststellen, dass es keine für alle Belange<br />
gleichermaßen ideale Lösung gibt und dass Werthaltungen eine entscheidende Rolle spielen<br />
(vgl. auch Borggräfe 1998, S. 57). Auch der Entstehungsprozess des Themenweges selbst<br />
kann hier dokumentiert werden.<br />
Die Internetseite ist zusätzlich Kommunikationsplattform. Hier kann der Besucher sich über<br />
kommende Veranstaltungen informieren, Presseberichte über vergangene Aktivitäten<br />
einsehen und sich selbst einbringen. Ein virtuelles Lankentagebuch dient der<br />
Veröffentlichung von Erlebnisberichten der Besucher, ein Gästebuch erlaubt Kritik.<br />
Die Homepage muss mit Seiten weiterer regionaler Akteure vernetzt werden, dazu gehören<br />
die Gemeinde Loissin, Tourismusanbieter, der Förderverein Ludwigsburg, die Universität<br />
Greifswald usw., außerdem natürlich die Umweltbildungsanbieter, die den <strong>Weg</strong> nutzen.<br />
4.4 Teilstrecken- und Stationsbeschreibung des Drachenpfades<br />
4.4.1 Eingangsstation<br />
Gestaltungsvorschlag: Eine als Durchgang gestaltete Übersichtstafel bietet unterschiedliche<br />
Durchlässe (bücken, quetschen, kriechen, klettern). Sie besteht aus einer mit einem<br />
Stahlgerüst unterlegten, umgedrehten Baumkrone. Diese wird im Laufe der Zeit zerfallen,<br />
<strong>zur</strong>ück bleibt das menschengemachte Gerüst, das dann gegebenenfalls von Kletterpflanzen<br />
umrankt werden kann. Das Stahlgerüst bietet Klettermöglichkeiten, außerdem ein<br />
Kooperationsspiel ('Spinnennetz' * ) und ist Halterung für die Übersichtstafel. Auf diese Weise<br />
wird eine ästhetische Ansprache mit Aktivität kombiniert.<br />
Symbolwert: Man muss sich durcharbeiten, um <strong>zur</strong><br />
Kernaussage zu gelangen.<br />
Zweck: a) Mentale Einstimmung. Einstieg (und<br />
gleichzeitig Abschluss). Die ungewohnte Umsetzung soll<br />
Interesse und Neugier wecken, Spannung erzeugen und<br />
fröhliche Stimmung aufkommen lassen. b) Annäherung<br />
an <strong>Wildnis</strong>gedanken. Die viermalige Wiederholung des<br />
Satzes 'Was heißt hier wild' mit jeweils unterschiedlicher<br />
Betonung soll <strong>zur</strong> Assoziation anregen:<br />
Was heißt hier wild? Was heißt hier wild? Was heißt hier<br />
wild? Was heißt hier wild?<br />
* Beim Spinnennetz sollen die<br />
Mitglieder einer Gruppe eine<br />
Konstruktion mit diversen<br />
Durchlässen passieren, ohne einen<br />
Durchgang doppelt zu benutzen und<br />
ohne die Konstruktion selbst zu<br />
berühren. Es muss gemeinsam<br />
überlegt werden, wer wo am Besten<br />
durchpasst, Personen müssen<br />
gehoben werden usw.
Teilstrecken- und Stationsbeschreibung des Drachenpfades<br />
Höhere Betreuungsebenen fordern konkret dazu auf, diese Frage mit auf den <strong>Weg</strong> zu<br />
nehmen und darauf zu achten, was Lanken von anderen Wäldern unterscheidet. Darüber<br />
hinaus leiten sie komplexere Assoziationsübungen<br />
an.<br />
Bestandteile der Übersichtstafel:<br />
• Karte mit Standort, <strong>Weg</strong>führung und<br />
Stationen, Erläuterung der Symbole<br />
• Angaben zu <strong>Weg</strong>länge und Dauer; evtl.<br />
Verbote / Gebote / Besucherverhalten<br />
• Kasten mit Broschüren<br />
• Nennung von Projektpartnern<br />
Abwägungen: Es ist zu prüfen, inwiefern eine<br />
solche Installation das Landschaftsbild stört Abb. 7: Vorschlag Eingangsstation<br />
oder bereichert.<br />
Der gewählte Standort befindet sich auf einem Grundstück im Eigentum der Gemeinde<br />
Loissin, es bedarf einer Aufstellungsgenehmigung. Besonders erfreulich wäre eine<br />
Beteiligung der Gemeinde an dieser Station.<br />
Die Mitentscheidung über das Aussehen im Rahmen eines Gestaltungswettbewerbs böte den<br />
Anwohnern Identifikationsmöglichkeit.<br />
4.4.2 Kreuzungspunkt<br />
Am Kreuzungspunkt endet der Bildweg und beginnen die Lehr-Reiche. Außerdem führt ein<br />
Abzweig zum Spielraum.<br />
Gestaltungsvorschlag: Ein Flechtzaun oder<br />
eine aus Holz geschichtete Schlangenlinie<br />
erzeugt durch Windungen verschieden große<br />
Ruheräume. Die Holzkonstruktion darf<br />
bewachsen (Prozess Zeit). Verfallende<br />
Abb. 8: Vorschlag Kreuzungspunkt<br />
Windungen werden durch Neuanbau ersetzt.<br />
An dieser Station muss ein Broschürenpult<br />
integriert sein.<br />
Zweck: Reflexion-Transfer-Identifikation<br />
Die Station bietet geschützte Plätze zum<br />
Nachdenken, Lesen und Pausieren. Wer dem<br />
Verwildern zustimmt, kann der Schlangenlinie<br />
einen Stock hinzufügen. Dadurch verändert sie<br />
sich ständig, was der Prozesshaftigkeit Rechnung trägt (Zeichensetzung).<br />
Höhere Betreuungsebenen greifen die Assoziationsaufgabe wieder auf: Was heißt hier wild?<br />
Was sagt man dazu, nachdem man den Bildweg erlebt hat? Diskussionen um Werte von<br />
<strong>Wildnis</strong> sind angestrebt.<br />
Zusätzlich können Hinweise <strong>zur</strong> Umsetzung des Naturschutzgedankens im Alltagsleben<br />
gegeben werden (Wildecke im Garten anlegen, Wildobst statt Thujahecke und Laub- statt<br />
Nadelbäume pflanzen, Teich und Insektenhotel anlegen, Schwalben und Wespen dulden,<br />
Nistkästen und Igelburg anlegen, Trockenmauer und Steinhaufen errichten oder ein paar<br />
Äpfel als Tiernahrung am Baum belassen). Spezieller auf <strong>Wildnis</strong> ausgerichtet werden kann<br />
die Mitarbeit in oder die finanzielle Unterstützung von Umweltgruppen. Bestimmtes<br />
Konsumverhalten, wie die Verwendung von Recyclingpapier, trägt ebenfalls zum<br />
<strong>Wildnis</strong>schutz bei.<br />
91
92<br />
Der Drachenpfad – Erleben einer Landschaft im Umbruch<br />
Abwägung: Auch hier muss, wie bei der Eingangstafel, zwischen sinnvoller Bereicherung<br />
des Themenweges und Störung durch ein ortsfremdes Objekt abgewogen werden.<br />
4.4.3 Bildweg – Die Geschichte des Drachens<br />
Quelle: Diese vom Schweizer Künstler Daniel Ambühl 1995 entwickelte Kunstform besteht<br />
aus einer Serie von Reliefplatten, die jede für sich eine Einzelszene darstellen.<br />
Zusammengenommen erzählen sie einen Entwicklungsverlauf. Der Teilnehmer absolviert<br />
den <strong>Weg</strong> mit einem Blatt Papier und Farbstiften. Er reibt die Reliefplatten nacheinander auf<br />
das Papier ab, so entsteht bereits bei der zweiten Platte ein drittes Bild, da zwei Einzelbilder<br />
übereinander liegen. Es werden immer nur gewisse Bildlinien des Reliefs übernommen, das<br />
letzte Bild vereint alle Darstellungen und ist selbst einmalig. Parallel wird der <strong>Weg</strong> von einer<br />
Erzählung begleitet, die die Einzelbilder aufgreift. Ambühls Methode, Kunst zu erleben,<br />
verschneidet die Ebenen Zeit und Ort, Bild und Sprache, Künstler und Betrachter. Der<br />
Teilnehmer wird zum Mitschöpfer seines persönlichen Werks (www.bildweg.ch).<br />
Kurzbeschreibung: Die Dauerinstallation einer Serie von fünf Reliefplatten, die jede für<br />
sich eine Einzelszene darstellen, erzählt zusammen genommen die Landschaftsgeschichte<br />
der Lanken. Während das heute Sichtbare nur eine Momentaufnahme sein kann, spiegelt das<br />
Relief keinen solchen Moment wieder, sondern fasst die wesentlichen Elemente der Epoche<br />
zusammen, die das heute <strong>sichtbar</strong>e Bild entscheidend geprägt haben. Eine Zeitangabe im<br />
Relief erlaubt die geschichtliche Einordnung, ansonsten arbeitet es nur mit bildhafter<br />
Darstellung. Nähere Erläuterungen geben die Begleitschriften. Erst in der Betreuungsebene<br />
'Kinderbuch' kommt der Mitmacheffekt der Originalidee zum Tragen, der die Installation für<br />
Kinder erschließt.<br />
Der Bildweg erzählt eine Geschichte, die nicht unterbrochen werden soll und keiner<br />
Zusatzelemente bedarf. Obwohl die ausgewählte Strecke eine Reihe von Ansatzpunkten für<br />
eine ökologisch orientierte Wissensvermittlung gibt, werden diese daher nicht aufgegriffen.<br />
Sie können im Rahmen von Sonderveranstaltungen erschlossen werden (siehe 4.4.6<br />
Wunderpunkte).<br />
Die Route wurde anhand von <strong>zur</strong> Landschaftsgenese passenden Blicken gewählt. So bietet<br />
der Bildweg auch unabhängig von den Stationen das Potenzial für einen<br />
abwechslungsreichen Spaziergang. Geländebedingt ist aber der Abstand der Stationen<br />
untereinander unterschiedlich und zwischen erster und zweiter Station besonders groß.<br />
Als Träger für die Reliefplatten werden gleich gestaltete Pultkonstruktionen aus Zement<br />
vorgeschlagen, in die die Platten eingelassen sind. Zu beachten sind Witterungsbeständigkeit<br />
und Diebstahlsicherung.<br />
Zielstellungen: Am Bildweg kann sich Wissen über die Landschaftsgenese angeeignet<br />
werden. Er möchte aber vor allem <strong>zur</strong> Reflexion über den Umgang des Menschen mit Natur<br />
und seinen Werthaltungen im Zusammenhang mit Natur anstoßen. Die Kompetenzen, die<br />
über diese Teilstrecke gefördert werden, liegen im Bereich der Deutung von Symbolen,<br />
Zeichen und Bildern. Bei der Interpretation der Szene ist auf kleinste Details zu achten. Zum<br />
Beispiel sagen der sich aus dem Bild wendende Mönch und die über das Wasser kommenden<br />
Schweden des dritten Reliefs aus, dass die Zeit der Mönche bereits vorbei war, als die<br />
Schwedenzeit begann.<br />
Hauptzielgruppe: Als Folge seiner künstlerisch-kontemplativen Ausrichtung spricht der<br />
Bildweg vorwiegend Erwachsene an, da es ihnen bei der Naturbegegnung auf Ruhe und<br />
Entspannung ankommt (Lang & Stark 2000, S.62). Sie fassen die Vermittlung von<br />
Information im Gegensatz zu Kindern und Jugendlichen seltener als lästig auf. Ratsam ist die<br />
Überprüfung, ob das Bildwegprinzip und ein solcherart unbefestigter Pfad für Blinde und<br />
geistig behinderte Menschen in Begleitung von nicht gehandicapten Personen geeignet ist.<br />
Entsprechend sollte eine Blindenschrift -Broschüre in Erwägung gezogen werden.
Teilstrecken- und Stationsbeschreibung des Drachenpfades<br />
Stufen der Erfahrung: Die Einstimmung erfolgt am Eingangstor, Einlassen, Kennenlernen<br />
und Entdecken entlang des <strong>Weg</strong>es. Die sich entfaltende Geschichte sorgt für den Aufbau<br />
eines Spannungsbogens. Reflexion, Transfer und Identifikation können bereits unterwegs<br />
einsetzen, kommen aber gezielt am Kreuzungspunkt <strong>zur</strong> Sprache und könnten sich über das<br />
erstellte Bild zu Hause fortsetzen. In den Begleitschriften wird der Besucher darüber hinaus<br />
<strong>zur</strong> Kommentierung des Themenweges bzw. <strong>zur</strong> Zusendung eines Erlebnisberichts<br />
aufgefordert.<br />
Betreuungsebenen<br />
Alleingang<br />
Für sich genommen stellen die Relieftafeln eine rein rezeptive Wissensvermittlung dar. Die<br />
Bilder erklären sich im Grunde von selbst. Jahreszahlen ermöglichen die geschichtliche<br />
Einordnung, Symbole werden genutzt um z.B. Baumarten darzustellen. Information wird<br />
hier über Interpretation erarbeitet. Die Bilder müssen mit möglichst wenig Vorwissen<br />
verstanden werden können. Da es innerhalb einer Gruppe von Besuchern <strong>zur</strong> Diskussion<br />
bezüglich des Sinngehalts der Bilder kommen könnte, ist es berechtigt, zu sagen, dass der<br />
Bildweg die Interaktivität fördern kann.<br />
<strong>Weg</strong>begleiter<br />
Er gibt eine sachlich gehaltene Beschreibung der Bilder und Symbolerklärung und vermittelt<br />
zusätzliches Wissen, das die bildhafte Darstellung sprengen würde. Zudem kann er das<br />
Thema Naturverständnis und Wertvorstellungen anschneiden (Reflexion) und bestimmte<br />
Verhaltensweisen thematisieren (Transfer), sowie weiterführende Literaturhinweise geben.<br />
Kinderbuch<br />
Das Begleitbuch für Kinder bettet die Landschaftsgeschichte in eine kindgerechte,<br />
märchenhafte Erzählung. Außerdem kommen hier Papier und Stifte zum Abpausen der<br />
Reliefplatten zum Einsatz. Über das Lesen oder Vorlesen des Märchens am Ort des<br />
Geschehens, die Leitfigur Darsinus und die Beschäftigung mit der Landschaft über das<br />
Kunstwerk, könnte sich eine gewisse Beziehung zum Ort aufbauen. Da das Ergebnis nach<br />
Hause mitgenommen und dort vermutlich anderen Menschen gezeigt werden wird, erfolgt<br />
auch im Nachhinein eine Beschäftigung damit, durch die es <strong>zur</strong> Reflexion über die<br />
Naturgeschichte sowie über Sinn und Notwendigkeit von Eingriffen in die Landschaft<br />
kommen kann.<br />
Person<br />
Eine Person könnte im Rahmen einer Veranstaltung in zeitgemäßen Kostümen mehr <strong>zur</strong><br />
jeweiligen Epoche erzählen oder Naturinterpretation betreiben. Sie ist besser als eine Schrift<br />
in der Lage, eine Reflexion über den menschlichen Umgang mit Darsinus anzustoßen.<br />
Internet<br />
Im Internet bietet sich ein animierter Ablauf der Landschaftsgenese an. Außerdem könnten<br />
Filmszenen in historischen Kostümen gezeigt werden.<br />
Abwägungen: Der Bildweg in der oben vorgeschlagenen Ausführung erfordert die<br />
Neuanlage eines <strong>Weg</strong>es in einem NSG. Dafür ist eine Genehmigung einzuholen.<br />
Die besonders störungsempfindlichen Bereiche werden von der Route nicht berührt, sie<br />
tangiert aber Teile des bisher unerschlossenen Kernbereichs. Die Meinungen darüber,<br />
inwieweit davon Beeinträchtigungen für das Gebiet zu erwarten sind, gehen auseinander.<br />
Während die einen befürchten, dass die Besucher Müll hinterlassen oder gar den<br />
Kernbereich abseits des <strong>Weg</strong>es aufsuchen und dort Störungen verursachen, gehen die<br />
93
94<br />
Der Drachenpfad – Erleben einer Landschaft im Umbruch<br />
anderen davon aus, dass es für ein Verlassen des <strong>Weg</strong>es größerer Attraktionen bedürfe, z.B.<br />
einen Tierbau, den man sich aus der Nähe betrachten möchte. Solche Anziehungspunkte sind<br />
aber nicht gegeben, zudem ist der betreffende Waldbereich im Frühjahr relativ feucht und im<br />
Sommer dicht mit Adlerfarn bewachsen, was einem 'Herumstreunen' entgegen wirken dürfte.<br />
Im Rahmen der derzeitigen Gesetzgebung wird mit der <strong>Weg</strong>anlage eine Verkehrsicherung<br />
notwendig. In Anbetracht der damit verbundenen Kosten und der Alteichen entlang der<br />
Strecke, die davon betroffen sein könnten, vermag dies in der Tat ein Grund für den Verzicht<br />
auf diesen Teil des Themenweges zu sein.<br />
Alternativen: Eine Aufarbeitung der Landschaftsgeschichte erfordert eine festgelegte<br />
Reihenfolge der Stationen, der Pfad kann daher nicht beliebig verlegt werden. Er ist<br />
allerdings auch als Ausstellung umsetzbar, an die Stelle der direkten Anschauungsobjekte<br />
könnten dann sehr große Fotos (Fototapete) treten. Im Rahmen einer ersten<br />
Nummernpfadkonzeption ist denkbar, die Reliefbilder zunächst nur als Abbildungen in der<br />
Broschüre zu zeigen und die Einzelstationen dann nach und nach zu errichten, so wie sich<br />
Sponsoren oder Paten finden.<br />
Eine stärkere Abwandlung der Originalidee wird erforderlich, wenn nicht der Urheber mit<br />
der Umsetzung beauftragt wird, da diese Kunstform zum geistigen Eigentum gezählt werden<br />
muss (siehe 4.4.4 Alternativvorschlag Lehr-Reiche).<br />
Strecke: (siehe Anhang 5.2 – Karte)<br />
Es handelt sich um die Neuanlage eines Pfades von ca. 900m Länge, der vom Parkplatz aus<br />
durch den Wald zum Fahrradweg führt. Dort hat er Anschluss an die übrigen Teilkonzepte.<br />
Er greift <strong>zur</strong>ück auf bereits bestehende Trampelpfade, Rückegassen und Wildwechsel. Die<br />
Strecke soll einen naturnahen Charakter erhalten, d.h. es ist kein fester Belag vorgesehen.<br />
Somit wird sie weder Kinderwagen noch Rollstuhl tauglich sein. Vier Gräben müssen<br />
überquert werden, zwei davon sind sehr flach, die beiden anderen etwas tiefer. Keiner davon<br />
führt Wasser, so dass keine Brücken o.ä. notwendig sind.<br />
Der Charakter des Waldes wird sich durch den stattfindenden Waldumbau stark ändern, es<br />
wird sich zeigen, ob die Stationen angepasst oder der weg verlegt werden muss.<br />
4.4.3.1 Bildwegstation 1: 'Höftlandentstehung' (10 000 – 5000 Jahre v.h.)<br />
Lage: Diese Station befindet sich auf einer noch zu erhöhenden Kuppe am Parkplatz, von<br />
der aus die Reffen- und Riegenstruktur des Strandwallsystems zu erkennen ist.<br />
Darstellung: Auf der Reliefplatte zu sehen sind die sich <strong>zur</strong>ückziehenden Gletscher im<br />
Norden, sich ausbildende Sandhaken, Strandwälle und der Strandsee. Der Mensch tritt als<br />
nacheiszeitlicher Jäger in Erscheinung. Als<br />
Symbol für unbeeinträchtige <strong>Wildnis</strong>dynamik<br />
wird der Drache frei am Himmel fliegend<br />
abgebildet.<br />
Hintergrundinformation (Begleitschriften<br />
und Internet): In stark komprimierter Form<br />
wird ein Abriss der Landschaftsgenese vom<br />
Ende der Eiszeit bis zum Erscheinen erster<br />
Menschen gegeben. Dabei wird auf<br />
Einzelereignisse, wie das Aussterben der<br />
Mammute, die Strandwall-, Dünen- und<br />
Strandseebildung und die Besiedlung durch<br />
Abb. 9: Vorschlag Bildwegstation 1<br />
Jäger und Sammler eingegangen.<br />
Klärungsbedarf: Die geplante Station befindet sich auf Gemeindeland, daher ist eine<br />
gesonderte Genehmigung des Eigentümers einzuholen. Darüber hinaus ist mit der Gemeinde<br />
eine landschaftsangepasste Umgestaltung des Trafohäuschens zu vereinbaren.
Teilstrecken- und Stationsbeschreibung des Drachenpfades<br />
Weiterer <strong>Weg</strong>verlauf: Auf dem <strong>Weg</strong> <strong>zur</strong> zweiten Station durchquert der Besucher zunächst<br />
einen lichten Eichenwald. Anschließend führt der Pfad durch eine Fläche mit Douglasien, in<br />
der die beginnende Entnahme der Nadelbäume zu sehen ist. Schließlich wird eine kleine<br />
Buchengruppe mit Blick auf einen Erlenwald erreicht.<br />
4.4.3.2 Bildwegstation 2: Strandseeverlandung, Bewaldung und früher Ackerbau (5000 –<br />
1000 Jahre v.h.)<br />
Lage: Die Station befindet sich auf einer Mineralbodenzunge, die mit älteren Buchen und<br />
Eichen bestanden ist, der Blick fällt in einen Erlenwald.<br />
Darstellung: Die Reliefplatte zeigt einen<br />
verlandenden Restsee im Wald. Baumsymbole<br />
deuten an, in welcher Reihenfolge die<br />
Bewaldung ablief. Ein kleines Feld am Rande<br />
steht für beginnenden Ackerbau.<br />
Ein kräftiger Darsinus befindet sich im Wald<br />
und symbolisiert so die nach wie vor<br />
dominierende Eigendynamik der Natur.<br />
Hintergrundinformation (Begleitschriften<br />
Abb. 10: Vorschlag Bildwegstation 2<br />
und Internet): Die näheren Erläuterungen<br />
betreffen die Verlandung des Strandsees, die<br />
fortschreitende Sukzession und die neolithische<br />
Revolution.<br />
<strong>Weg</strong>verlauf: Durch den Buchen-Eichen-Mischbestand führt der <strong>Weg</strong> bis <strong>zur</strong> dritten Station.<br />
4.4.3.3 Bildwegstation 3: Nutzung im Mittelalter (1000 – 300 Jahre v.h.)<br />
Lage: Durch einen ehemaligen Entwässerungsgraben getrennt, blickt der Besucher in einen<br />
lichten Alteichenbestand mit Hutewaldcharakter.<br />
Darstellung: Das Relief stellt verschiedene im Mittelalter verbreitete Waldnutzungsformen<br />
dar. Dazu gehören der Hutebetrieb, das<br />
Schneiteln und das Sammeln von Laubstreu.<br />
Um die wechselnden Eigentumsverhältnisse<br />
anzudeuten, sind eine verfallene wendische<br />
Siedlung, ein Mönch, der sich aus dem Bild<br />
begibt, der Bau des Ludwigsburger Schlosses<br />
und ein sich näherndes schwedisches Schiff zu<br />
sehen. Eine weniger aufwändige Variante wäre<br />
die Darstellung einer symbolischen Schlüsselübergabe<br />
vom Slawen zum Mönch, zum<br />
deutschen Adelsmann und zum schwedischen<br />
General.<br />
Darsinus ist – entsprechend der eingeschränkten Abb. 11: Vorschlag Bildwegstation 3<br />
Eigendynamik – an eine dicke Eiche mit Wurzelhöhle gekettet, wie ein Hofhund an die<br />
Hundehütte.<br />
Hintergrundinformation (Begleitschriften und Internet): Die Auswirkung der<br />
Nutzungsformen auf den Wald werden vertiefend erläutert, dabei wird insbesondere auf die<br />
Diskrepanz zwischen der Ästhetik der Waldbilder und der nicht nachhaltigen Landnutzung<br />
eingegangen.<br />
Zudem bietet sich an dieser Stelle die Erläuterung der Gründe für die Anlage der Gräben in<br />
der Vergangenheit und deren Rückbau in jüngster Zeit an.<br />
<strong>Weg</strong>verlauf: Dem Entwässerungsgraben folgend durchquert der Besucher einen dichten<br />
Jungbestand aus Birke und Eberesche und erreicht wenig später die vierte Station.<br />
95
96<br />
Der Drachenpfad – Erleben einer Landschaft im Umbruch<br />
4.4.3.4 Bildwegstation 4: Forstwirtschaft (200-50 Jahre v.h.)<br />
Lage: Die Station befindet sich inmitten einer gepflanzten<br />
Fichten-Douglasiengruppe.<br />
Darstellung: Die Reliefplatte zeigt verschiedene Methoden<br />
der geregelten Forstwirtschaft, wie Bodenbearbeitung und<br />
Nadelholzpflanzung.<br />
Der stark ausgezehrte Darsinus ist in einer vergitterten<br />
Bärengrube angekettet.<br />
Hintergrundinformation (Begleitschriften und Internet): Es<br />
erfolgt eine Darlegung der Geschichte der geregelten<br />
Forstwirtschaft und deren Auswirkung.<br />
<strong>Weg</strong>verlauf: Der <strong>Weg</strong> setzt sich entlang der Grenze<br />
zwischen Huteeichenwald und Fichten-Douglasien-Bestand<br />
bis zu einer größeren Einschlagfläche fort.<br />
4.4.3.5 Bildwegstation 5: Naturschutz (seit 50 Jahren)<br />
Abb. 12: Vorschlag Bildwegstation 4<br />
Lage: Diese letzte Bildwegstation lenkt den Blick des Besuchers auf eine Freifläche mit<br />
einzelnen Eichen mittleren Alters. An dieser Stelle wurde in jüngster Vergangenheit ein<br />
dichtes Sitkafichten-Stangenholz entfernt.<br />
Darstellung: Auf dem Relief sind die Impulsmaßnahmen des Naturschutzes abgebildet.<br />
Dazu gehört die Entnahme der Nadelbäume und die<br />
Schließung der Gräben.<br />
Der ausgezehrte Drache Darsinus ist befreit und stärkt sich<br />
an einer Futterstelle.<br />
Hintergrundinformation (Begleitschriften und Internet):<br />
Der Besucher erhält Informationen zu den Gründen für die<br />
Einrichtung des NSG Lanken, die Übernahme durch die<br />
<strong>Michael</strong>-<strong>Succow</strong>-<strong>Stiftung</strong> und zum Prozessschutzkonzept,<br />
das hier Anwendung findet.<br />
Nach dem Abpausen des fünften Reliefs hat der Besucher<br />
nun das Endbild auf seinem Blatt: die Zukunft, die nach<br />
dem heutigen Stand des ökologischen Wissens und unter<br />
der Voraussetzung, dass es zu keinem extremen<br />
Abb. 13: Vorschlag Bildwegstation 5<br />
Klimawandel kommt, in einem Buchenwald und darin<br />
enthaltenen Erlenbruch bestehen wird. Darsinus ist auf<br />
diesem letzten Bild frei und wieder bei Kräften.<br />
Auch zu diesem letzten Bild werden Hintergrundinformationen gegeben. Sie betreffen die<br />
Stellung der Buchenwälder in Europa und die Mosaik-Zyklus-Theorie. Außerdem können<br />
Szenarien im Falle massiver Klimaveränderungen (borealer Nadelwald oder Trockenwald)<br />
und Wertfragen im Bezug auf <strong>Wildnis</strong> angesprochen werden.<br />
<strong>Weg</strong>verlauf: Von der letzten Bildwegstation aus führt der Pfad zwischen Douglasien und<br />
Eichen hindurch zum Kreuzungspunkt am Hauptweg.<br />
4.4.4 Lehr-Reiche: <strong>Den</strong> Drachen spüren<br />
Kurzbeschreibung: Die Lehr-Reiche sollen dem Laien eine erste Annäherung an<br />
naturwissenschaftliche Ergebnisse der Naturraumkunde ermöglichen, ohne ihn mit<br />
Fachbegriffen oder Unmengen an Detailinformationen zu konfrontieren. Der Drachenpfad ist<br />
nicht für die universitäre Ausbildung konzipiert, sondern für Spaziergänger, deren
Teilstrecken- und Stationsbeschreibung des Drachenpfades<br />
Werthaltung im Bezug auf das Verwildern im Fokus steht. Wissensvermittlung ist dabei<br />
Transportmedium, nicht vordergründiges Ziel. Erst über eine Begleitperson soll das Niveau<br />
an Lehrpläne angepasst werden können, sofern die Zielgruppe dies wünscht. Für den<br />
Spaziergänger wurde eine gezielte Informationsauswahl entlang der Strecke getroffen, wobei<br />
längst nicht alle potenziell interessanten Phänomene angesprochen werden können (vgl.<br />
4.4.6 Wunderpunkte).<br />
Der Besucher kommt auf seinem <strong>Weg</strong> in die Reiche verschiedener Baumarten. Die sehr<br />
komplexe Thematik des Verwilderns wird an jeder Station in vier künstlerisch aufbereitete<br />
Teilaufgaben zerlegt. Der Besucher wird direkt einbezogen, indem er selbst kreativ tätig<br />
wird, interpretiert und Lösungen suchen muss, statt Antworten vorgegeben zu bekommen.<br />
In jedem Reich durchläuft er die Erfahrungsstufen Einlassen, Kennenlernen und Entdecken<br />
an je einem Objekt. 'Ankerplätze' markieren den Blick in das entsprechende Baum-Reich. An<br />
ihnen findet sich eine bildhafte Darstellung eines Drachenkampfs – also eine Allegorie für<br />
die das Verwildern bisher hemmende Einwirkung des Menschen. Daneben findet man in die<br />
Landschaft eingepasste, künstlerisch gestaltete Lernstationen, die 'Menschenwerke' und die<br />
'Tafel für den Durchblick', die auf Einzelbäume fokussiert. Der Besucher wird an die<br />
Phänomene herangeführt, die den Charakter des Ortes prägen. Er lernt die Hauptbaumarten<br />
kennen, die an den Standort jeweils am Besten angepasst sind und ihn dementsprechend<br />
wiederspiegeln. Die Konzentration auf Bäume begründet sich darin, dass sie das ganze Jahr<br />
über <strong>sichtbar</strong> und für den Laien unterscheidbar sind. Neben den ökologischen Eigenschaften<br />
dieser Baumarten wird deren Wirkungen auf ihre Umgebung angesprochen.<br />
Die Reihenfolge, in der die Lernobjekte der jeweiligen Station angesteuert werden, ist<br />
gleichgültig. So, wie die von ihnen übermittelten Inhalte Phänomen, Baum und Wirkung in<br />
der Realität über den Prozess verbunden sind, ergänzen sich die Erfahrungsstufen<br />
gegenseitig. Jede gibt Hinweise auf den Sinn der jeweils anderen. An jeder Lehr-Reich-<br />
Station geht es um Spüren ebenso wie um Aufspüren, genaues Beobachten ebenso wie<br />
Nachdenken (Ganzheitliches Lernen). Es werden Sinne und Verstand angesprochen,<br />
aufbauend auf selbst gemachten Erkenntnissen und mit Hilfe von Hinweisen und<br />
Vergleichen kann schrittweise mehr Information selbst erarbeitet werden (vernetztes<br />
<strong>Den</strong>ken). Insgesamt wird versucht, Phänomene aus mehreren Perspektiven zu beleuchten.<br />
Sinnlich und künstlerisch (kreative Schreibübung), symbolisch (Drachenkampf),<br />
wissenschaftlich (Menschenwerk und Aufgaben), ästhetisch (Aufmachung generell und<br />
Schreibübung) oder philosophisch (weiterführende Fragestellungen über Werte etc.). So<br />
können umfassende innere Bilder erstellt bzw. verschiedene Zugänge ermöglicht werden.<br />
Die Reihenfolge der Reiche wird vom Gelände vorgegeben, auch hier ist daher der<br />
Stationsabstand verschieden und auch diesmal zwischen erster und zweiter Station<br />
verhältnismäßig lang. An der letzten Station wird das Erarbeitete zusammengeführt. Sie ist<br />
zusätzlich der Reflexion und dem Transfer gewidmet.<br />
Quellen: Die Ankerplätze sind eine Ableitungen der so genannten Ankersteine aus der<br />
Gestaltungspraxis von Zen-Gärten. Fokussierende Elemente, z.B. Blickrohre, finden sich an<br />
diversen Themenwegen. Die Menschenwerke sind als als naturwissenschaftliche Hilfsmittel<br />
genutzte Kunstwerke zu verstehen.<br />
Alternativen: Im Falle einer stufenweisen Umsetzung des Themenweges empfiehlt es sich,<br />
zunächst die Ankerplätze zu realisieren. Fokussiertafeln und Menschenwerke können nach<br />
und nach zugefügt werden, ihre Inhalte lassen sich zunächst auch über die Begleitbroschüre<br />
transportieren.<br />
Alternativ könnte auf Menschenwerk und Tafel mit Durchblick verzichtet und stattdessen<br />
das Bildwegprinzip in abgewandelter Form <strong>zur</strong> Anwendung kommen. Am Ankerplatz als<br />
Ort der Ruhe und Landschaftsbetrachtung befindet sich zusätzlich ein dreiteiliges Bildrelief.<br />
Eine Abbildung in den Begleitmaterialien wird über das Abreiben des Reliefs ergänzt. Dabei<br />
übertragen sich Spuren der naturgeschichtlichen Vergangenheit, des menschlichen Einflusses<br />
97
98<br />
Der Drachenpfad – Erleben einer Landschaft im Umbruch<br />
und der vermutlichen Zukunft auf das momentan <strong>sichtbar</strong>e Bild, die Benutzung von drei<br />
Farben macht die zeitliche Dimension deutlich. Zum Beispiel übertragen sich an der<br />
Kiefernstation Umrisse von Düne, Kiefernwirtschaft und Buche. Die erforderlichen<br />
Hintergrundinformationen stellen die höheren Betreuungsebenen <strong>zur</strong> Verfügung.<br />
Die Vermittlung des Entwicklungsprozesses beschränkt sich bei dieser Variante auf den<br />
Einzelstandort. Es wird kein Gesamtprozess mehr verbildlicht, die Bildwegbilder werden<br />
nicht mehr übereinander gelegt. Das hat den Vorteil, dass das Originalkonzept damit so weit<br />
abgewandelt wird, dass mit der Umsetzung nicht mehr der Urheber beauftragt werden<br />
müsste. Entsprechend ist aber auch ein andere Bezeichnung zu wählen, da 'Bildweg' ein<br />
feststehender Begriff in der Kunstwelt ist.<br />
Eine schlichte Verlagerung der Bildweg-Stationen auf den Fahrradweg gestaltet sich<br />
schwierig, da das Gelände die passenden Waldbilder nicht in der notwendigen Reihenfolge<br />
'liefert'.<br />
Strecke: (siehe Anhang 5.2 – Karte)<br />
Die Lehr-Reiche nutzen den durch das Gebiet führenden Radweg als Hauptachse. Einige<br />
sind sehr nah am <strong>Weg</strong> gelegen, die anderen werden durch einen kurzen Stichweg mit<br />
Trampelpfadcharakter erschlossen. Es ist darauf zu achten, dass der sich interessierende<br />
Besucher vom Hauptweg herunter treten kann, damit es nicht zu Konflikten mit Radfahrern<br />
kommt. An der Kiefern-Station kann der <strong>Weg</strong> abgebrochen und über das Trampelpfadsystem<br />
des Dünenkiefernwaldes <strong>zur</strong>ückgegangen werden. Nach Absolvierung aller Lehr-Reiche<br />
stehen drei Rückwege offen: Ein Pfad entlang der Düne, der Strand oder der Radweg. Vom<br />
Kreuzungspunkt bis <strong>zur</strong> letzten Lehr-Reich-Station beträgt die Strecke ca. 1 km.<br />
Zielgruppe und weitere Betreuungsebenen: Im Vordergrund steht die Gruppe der<br />
Jugendlichen, aber auch Erwachsene können ihr Wissen und ihre Kombinationsgabe testen.<br />
Der '<strong>Weg</strong>begleiter' hilft, wenn die hinter dem Menschenwerk stehenden Fragestellungen<br />
nicht eigenständig erkannt werden. Kindern werden die Stationen über altersgerechte<br />
Aufgaben im Kinderbuch erschlossen. Eine Begleitperson oder das Internet kann<br />
weiterführende Aufgabenstellungen anregen.<br />
Zielstellungen: Die Lehr-Reiche vermitteln Wissen über die<br />
Prozesse und Standortfaktoren, die <strong>zur</strong> Ausprägung der<br />
Waldbilder * der Lanken geführt haben.<br />
Über die Zusammenführung des Erlernten an der letzten<br />
Station ergibt sich die typische Sukzessionsreihe<br />
* Waldbild ist hier analog zu<br />
Naturbild oder Landschaftsbild<br />
zu verstehen. Gemeint ist eine<br />
stimmungsvolle, ganzheitliche<br />
Wiedergabe eines<br />
Naturzusammenhangs<br />
(Trommer 1992, S.51).<br />
mitteleuropäischer Wälder (Systemorientierung). Die indirekt immer angesprochenen Fragen<br />
der Werthaltung, der Reflexion und des Transfers können über höhere Betreuungsebenen in<br />
den Vordergrund gerückt werden. An diesem Teilabschnitt besonders geförderte<br />
Kompetenzen sind Wahrnehmung und Kombinationsfähigkeit.<br />
Ankerplatz – Erfahrungsstufe Einlassen<br />
Die Ankerplätze befinden sich am Ende der Stichwege, über sie darf nicht wesentlich hinaus<br />
gegangen werden. Sie bestehen aus einer leicht erhöhten Holzplattform, in deren Mitte ein<br />
Stein so eingelassen ist, dass seine Oberfläche nur etwas über die Plattform hinausragt. Da<br />
Lanken eine ursprünglich steinfreie Landschaft ist, könnte auch eine Holzplatte oder eine<br />
Klapptafel benutzt werden. Sie zeigen in Form von Drachenkämpfen die jeweils hemmende<br />
Wirkung des Menschen auf die <strong>Wildnis</strong>dynamik.<br />
Der Ankerplatz ist eine Stelle, an der der Einzelne Gelegenheit <strong>zur</strong> Begegnung mit Natur<br />
haben soll – er muss eine entsprechend ruhige, entspannte Atmosphäre erzeugen und<br />
zusätzlich eine spielerische Anleitung für das Sich-Einlassen geben. Damit wird er zum
Teilstrecken- und Stationsbeschreibung des Drachenpfades<br />
'Trittstein' über den sich die Person dem Phänomen Verwildern eigenständig nähern kann.<br />
Während sie sich ästhetisch, künstlerisch und sinnlich mit dem aktuellen Waldbild<br />
auseinandersetzt, kann sie sich den Unterschied zwischen kultiviertem und verwilderndem<br />
Ort erschließen.<br />
Für eine kreativ-künstlerische Kontaktaufnahme gibt es vielfältige Möglichkeiten. Besonders<br />
geeignet sind meines Erachtens kreative Schreibübungen, da über sie einerseits die<br />
Wahrnehmungen von Nase, Ohr und Tastsinn festgehalten werden können und sie<br />
andererseits impulsiver sind als beispielsweise das Ausdenken eines Gedichts oder einer<br />
Liedstrophe. In einer sehr einfachen Variante wird ein Wort in Großbuchstaben senkrecht<br />
notiert und anschließend, beginnend mit jedem Buchstaben, waagerecht ein Wort gebildet,<br />
das Assoziationen zum Ort spiegelt. Im Idealfall entsteht dabei ein Satz. Weitere<br />
Möglichkeiten bestehen in der Anfertigung von Fotographien oder Zeichnungen. Für Kinder<br />
kann in Erwägung gezogen werden, eine im Kinderbuch abgedruckte begonnene Skizze des<br />
Landschaftsbildes fertig zeichnen zu lassen oder über die 'Verbinde-Punkt-zu-Punkt'-<br />
Methode ein vorgefertigtes Bild zu verändern, indem z.B. Elemente zugefügt werden, die<br />
sich mit zunehmendem Verwildern einstellen.<br />
Grundaufgabe ist immer, den Charakter des Ortes und die eigene Empfindung einzufangen.<br />
Wichtig ist, dass an allen Punkten immer die gleiche Form der Auseinandersetzung gewählt<br />
wird. Das erlaubt den späteren Vergleich, der die unterschiedlichen Qualitäten der<br />
verschiedenen Orte wiederspiegelt.<br />
Durch das Festhalten der subjektiven Wahrnehmung ist der Besucher direkt eingebunden. Es<br />
ist sein Waldbild, dessen objektive Hintergründe er aufklären kann, wenn er mag. Über den<br />
künstlerischen <strong>Weg</strong> wird die Sensibilisierung der Sinne unterstützt, denn um die<br />
atmosphärische Wirkung des Platzes einzufangen, ist es hilfreich, neben dem Sehsinn auch<br />
Gehör, Geruch und Tastsinn einzusetzen. Diese Form der Auseinandersetzung erfordert und<br />
fördert ästhetische Wahrnehmung, Kreativität und Phantasie.<br />
Die Veröffentlichung der zu verschiedenen Tages- und Jahreszeiten entstandenen Werke in<br />
einer Internetgalerie visualisiert die mannigfaltigen Stimmungen und dauernden<br />
Veränderungen in der Landschaft.<br />
Die Plattform kann auch als Liegefläche verwendet werden, von der aus man den Blick in<br />
die Baumkronen schweifen lässt. Sie kann als Ruhezone, Platz zum Verweilen und Ort der<br />
Reflexion dienen, der im Idealfall immer wieder aufgesucht wird.<br />
Im Alleingang ist der Ankerplatz Aussichts- und Ruhepunkt, da hier keine zusätzlichen<br />
Tafeln mit Informationen oder Aufgabenstellungen eingerichtet werden.<br />
Die Begleittexte erläutern die kreative Übung und bieten ggf. Platz, sie auszuführen.<br />
Eine Begleitperson kann die sinnliche Annäherung verstärken oder die Konzentration auf<br />
den Ort über Meditationsübungen steigern. Sie kann die Aufmerksamkeit gezielt auf etwas<br />
Bestimmtes lenken (z.B. die Lichtverhältnisse, Farben, Geräusche, Gerüche) oder eine<br />
philosophische Komponente einbringen, indem sie eine Diskussion um Werte der Landschaft<br />
anregt.<br />
Im 'Internet' wird der Platz über ein stimmungsvolles Bild mit Geräuschkulisse vorgestellt.<br />
Eine durch die Einsendungen von Besuchern zu vervollständigende Bildergalerie zeigt<br />
Eindrücke zu verschiedenen Jahreszeiten und Wetterlagen.<br />
Tafel mit Durchblick – Erfahrungsstufe Kennenlernen<br />
Die Tafel für den Durchblick ist eine Fokussierstation, die jeweils einen individuellen Baum<br />
in den Blickpunkt rückt. Unterhalb der Blickröhre befindet sich eine Kurzcharakterisierung<br />
des Baumes. Diese erfolgt nicht in Form eines naturwissenschaftlichen Steckbriefes, sondern<br />
als Wortspiel, das Schlüsselbegriffe aufgreift über die die ökologischen Eigenschaften der<br />
99
100<br />
Der Drachenpfad – Erleben einer Landschaft im Umbruch<br />
Baumart abgeleitet werden können. Anthropomorphe Bestandteile stellen dabei einen Bezug<br />
zum Alltag des Besuchers her. Es handelt sich somit um eine Interpretationsstation.<br />
Sie könnte als halbierter Baumstamm gestaltet sein, bei dem ein hohler Aststumpf in einer<br />
für Kinder gut zugänglichen Höhe das Fokussierrohr bildet.<br />
Im Alleingang muss der Spruch selbständig gedeutet werden.<br />
Der '<strong>Weg</strong>begleiter' hilft bei der Interpretation, indem er auf die benutzten Schlüsselbegriffe<br />
eingeht und Zusatzinformationen gibt.<br />
Das Kinderbuch erläutert ebenfalls den Tafelspruch, außerdem fordert es dazu auf, sich je<br />
nach Jahreszeit näher mit Blüte, Blatt, Frucht oder Borke der Baumart zu beschäftigen. Dies<br />
erfolgt an jeder Station nach gleichem Muster, damit zum Schluss für alle Bäume<br />
vergleichbares Wissen besteht. Es können z.B. Blätter gesammelt, gepresst und später ins<br />
Buch eingeklebt werden. Solchen Aufforderungen, die eine weitere Beschäftigung zu Hause<br />
beinhalten, schreibe ich ein großes Reflektionspotenzial zu. Baumborken werden betastet,<br />
genau betrachtet und ein passender Vergleich für sie gesucht, die Borke der Douglasie<br />
erinnert zum Beispiel an einen gehenden Hefeteig. Das Buch gibt zusätzliche Informationen<br />
z.B. <strong>zur</strong> Bestäubungsart, den Samen oder dem Wurzelsystem. Es kann auch<br />
Bastelanleitungen, Rezepte und Ähnliches enthalten.<br />
Die 'Person' unterstützt die Interpretation bzw. weiterführende Fragestellungen, z.B.<br />
Biotopstrukturen betreffend.<br />
Das 'Internet' könnte über Animationen, z.B. sprechende Bäume, unterhaltsame Hilfestellung<br />
und Zusatzinformationen bieten.<br />
Menschenwerk – Erfahrungsstufe Entdecken<br />
Das Menschenwerk ist an das Prinzips des selbstentdeckenden Lernens (siehe 3.3.2.4)<br />
angelehnt. Die Skulpturen sind <strong>Den</strong>k- und Rätselaufgaben in Kunstform, die darin<br />
'verpackte' Fragestellung wird absichtlich im Gelände nicht erläutert. Für den<br />
Uneingeweihten sind es lediglich Kunstwerke am <strong>Weg</strong>esrand. Um ihrem versteckten<br />
Informationsgehalt auf die Spur zu kommen, ist scharfe Beobachtung und geistige<br />
Eigenaktivität erforderlich, der Alleingang erfordert daher eine relativ große<br />
Kombinationsgabe. Erst die Begleitschriften oder eine Person geben – auf Zielgruppen<br />
zugeschnittene – Hinweise und können weiterführende Fragen aufwerfen (z.B.<br />
Nutzungskonflikte) bzw. bearbeiten (z.B. Rollenspiel). In Gruppen wird durch die<br />
gemeinsame Suche nach Aufgabe und Lösung Interaktivität angeregt.<br />
Hier bietet sich die Gelegenheit, die Bevölkerung an der Entstehung des Pfades teilhaben zu<br />
lassen, indem regionale Künstler die Menschenwerke direkt vor Ort fertigen und Besucher<br />
ihnen bei der Arbeit über die Schulter schauen können.<br />
Zusammenführung: In den Begleitschriften werden die Ergebnisse der Einzelstationen<br />
festgehalten – nach jeder Station muss sich dort zusammengefügt haben, welche Phänomene<br />
welchen Prozess an diesem Ort bewirken. An der letzten Station erfolgt die Erarbeitung des<br />
Zusammenhangs der Stationen untereinander.<br />
Abwägung: Die Stationen versuchen, sich in die Landschaft einzupassen, dennoch stellen<br />
sie selbstverständlich eine Möblierung der Landschaft dar. Dies könnte nur über einen<br />
konsequenten Nummernpfad vermieden werden, dessen pädagogische Wirkung aber deutlich<br />
geringer sein dürfte.<br />
Das generelle Problem, dass Übungen oder Spiele, zu denen nur schriftlich aufgefordert<br />
wird, nicht unbedingt umgesetzt werden, muss hingenommen werden, schließlich handelt es<br />
sich um ein freiwillig absolviertes Angebot.
Teilstrecken- und Stationsbeschreibung des Drachenpfades<br />
Die formelle Gleichgestaltung der Stationen, insbesondere die sich wiederholende<br />
Schreibübung, könnte von Jugendlichen als langweilig empfunden werden. Eine<br />
vorausgehende Evaluation sollte hier Klarheit verschaffen.<br />
4.4.4.1 Lehr-Reich-Station 1: Schattenreich von Buche und Douglasie<br />
Derzeit führt die Buche ein Schattendasein, doch sie wird ein schattiges Reich aufbauen,<br />
nachdem die Douglasie ins Geisterreich der Schatten eingegangen ist. Das<br />
Hauptinformationsziel dieser Station besteht darin, zu<br />
erläutern, dass sich die Buche auf diesem Standort<br />
durchsetzen wird. Als Schattbaumart und Humuskeimer<br />
findet sie ideale Wuchsbedingungen und unterdrückt<br />
lichtbedürftige Konkurrenten. Buchenwälder zeichnen sich<br />
durch zahlreiche Frühjahrsblüher und ansonsten geringen<br />
Unterwuchs aus. Neben der Bedeutung dieser Waldformation<br />
in Mitteleuropa muss deutlich werden, dass diese Wälder im<br />
Rahmen der Forstwirtschaft stark verändert wurden. Der<br />
Mensch verkürzte die Lebenszyklen der natürlich<br />
vorkommenden Baumarten, in extremen Fällen wandelte er<br />
Buchenwälder in Kunstforste aus Nadelbäumen um. So<br />
kommt auch die Douglasie in Lanken ausschließlich auf<br />
Grund wirtschaftlich motivierter Aktivitäten des Menschen<br />
vor. Sie wurde zu Beginn des 19.Jh. ihrer Schnellwüchsigkeit<br />
wegen eingeführt. Ihr Vorhandensein belastet jedoch unter<br />
Abb. 14:<br />
Vorschlag für Lehr-Reich-Station 1<br />
101<br />
anderem den Landschaftswasserhaushalt erheblich, so dass<br />
sie infolge der veränderten Zielstellung (Naturschutz) jetzt<br />
entnommen wird.<br />
Lage: Die erste Lehr-Reich-Station befindet sich in unmittelbarer Nähe des<br />
Kreuzungspunktes.<br />
Ankerplatz: Hier soll der Besucher die Mischung aus Laub- und Nadelbäumen erfassen und<br />
sich Schatten und Kühle bewusst <strong>machen</strong>. Die Darstellung des Drachenkampfes zeigt, wie<br />
der Mensch Darsinus mit Nadelreisig aus dem Wald vertreibt.<br />
Tafel mit Durchblick: Hier wird auf zwei Bäume fokussiert, ein Rohr nimmt eine große<br />
Douglasie, das andere eine kleine Buche in den Blick.<br />
Als Interpretationsspruch für die Douglasie wird vorgeschlagen: Die duftende Fremde will<br />
schnell nach oben und ist beim Förster dafür sehr beliebt.<br />
Für die Buche könnte er lauten: Ausdauernde Karrierefrau mit Ellenbogen, stellt alle<br />
anderen in den Schatten.<br />
Menschenwerk: Im Abstand von zunächst 5 Jahren werden kleine Weiserflächen<br />
eingerichtet, die über eine Brückenkonstruktion von oben einsehbar und miteinander<br />
verbunden sind. Der Besucher kann hier verschiedene Waldentwicklungsstadien verfolgen.<br />
Höhere Betreuungsebenen: In den Begleitschriften werden zusätzliche Informationen zu<br />
Aspekten wie Mosaikzyklus und Überlebensstrategien im Buchenwald, Wildproblematik,<br />
Wasserhaushalt, fremdländische Baumarten und Szenarien bei Klimaveränderungen<br />
gegeben. Aus dem Interpretationsspruch werden die Schlüsselbegriffe 'duftende Fremde',<br />
'schnell nach oben' und 'Förster' aufgegriffen. Neben der an jeder Station wiederkehrenden<br />
Jahreszeitenaufgabe (siehe oben) wird über die bereits erwähnte Punkt-zu-Punkt-Zeichnung<br />
im Kinderbuch der Nadel- in einen Laubwald umgewandelt. Eine Begleitperson kann<br />
darüber hinaus beispielsweise Lichtmessungen oder Meditationsübungen zu Licht und<br />
Schatten durchführen. Im Internet können Mosaik-Zyklus-Dynamik oder Szenarien zum<br />
Klimawandel in animierter Form ablaufen.
102<br />
Der Drachenpfad – Erleben einer Landschaft im Umbruch<br />
4.4.4.2 Lehr-Reich-Station 2: Pionierreich der Kiefer<br />
Eine zentrale Rolle bei der Entstehung des Kiefern-Reichs spielt der Wind, der Sand zu<br />
Dünen aufgeweht und Kiefernsamen herangetragen hat. Auch die bizarre Form der Bäume<br />
ist dem Wind geschuldet. An dieser Station wird deutlich, dass die Kiefer ihre eigene<br />
Ablösung vorbereitet. Als genügsamer<br />
Rohbodenkeimer findet sie zunächst ideale<br />
Bedingungen, verändert aber das Standortklima<br />
hinsichtlich der Wind-, Licht-, Wasser- und<br />
Bodenverhältnisse so stark, dass Eberesche,<br />
Eiche und Buche einwandern können. Diese<br />
natürliche Entwicklung wird in der<br />
Forstwirtschaft durch Förderung der Kiefer<br />
unterdrückt.<br />
Lage: Vom Hauptweg führt ein Trampelpfad<br />
über eine Düne, auf deren höchstem Punkt sich<br />
die Station befindet. Hier könnte zusätzlich ein<br />
Abb. 15: Vorschlag Lehr-Reich-Station 2<br />
Broschürenpult aufgestellt werden, da der<br />
Trampelpfad Anschluss an weitere <strong>Weg</strong>e hat, von denen aus ein Quereinstieg möglich ist.<br />
Ankerplatz: Der Besucher soll das Dünenrelief, die vom Wind geprägte Form der Kiefern<br />
und die sich einstellende Verjüngung von Laubbäumen wahrnehmen. Die Drachenszene<br />
zeigt Darsinus, in dessen Fußstapfen junge Laubbäume wachsen, sowie einen Menschen, der<br />
ihn mit Forstwerkzeugen bedroht.<br />
Tafel mit Durchblick: Sie lenkt den Blick auf eine besonders bizarre Kiefer. Der Vorschlag<br />
für den Interpretationsspruch lautet: Die Genügsame braucht nur den Wind, um<br />
Pionierleistungen zu vollbringen, doch Nutznießer sind Andere.<br />
Menschenwerk: Eine dreiteilige Installation verbildlicht die Wirkung der Kiefer auf den<br />
Standortfaktor Boden. In einem ersten Behältnis befindet sich nur Sand, im zweiten Behälter<br />
ist er mit Kiefernnadelstreu und in der dritten zusätzlich mit Laubstreu bedeckt. Je nach<br />
technischer Umsetzung kann ggf. die Pflanzung einer kleinen Kiefer und einer Eberesche im<br />
entsprechenden Behälter in Erwägung gezogen werden.<br />
Höhere Betreuungsebenen: Die Begleitschriften gehen auf weiterführende Fragen z.B. zu<br />
Pioniereigenschaften, Küstendynamik und Dünensukzession ein. Sie erläutern zu diesem<br />
Zweck die Schlüsselbegriffe 'genügsam', 'Wind', 'Pionierleistung' und 'Nutznießer'. Im<br />
Kinderbuch wird an dieser Stelle die Erstellung einer Geräuschkarte vorgeschlagen.<br />
Außerdem kann es Bastelanleitungen für Windspiele und Windräder geben. Eine angeleitete<br />
Meditation kann das Thema Wind oder Tugend des Loslassens beinhalten. Im Internet<br />
können Küstendynamik und Dünensukzession modellhaft veranschaulicht werden.<br />
4.4.4.3 Lehr-Reich-Station 3: Wasserreich der Erle<br />
Im Zentrum dieser Station steht die<br />
Sonderrolle des Erlenwaldes als nässebedingte<br />
Schlusswaldgesellschaft am Ende einer<br />
Seenverlandung. Die Erle ist die einzige<br />
mitteleuropäische Baumart, die langanhaltend<br />
hohe Wasserstände toleriert. Bei stärkeren<br />
Wasserstandsschwankungen bilden sich die<br />
für Erlenbruchwälder charakteristischen Bulte.<br />
Die bei hohen Wasserständen stattfindende<br />
Torfbildung trägt <strong>zur</strong><br />
Kohlendioxidspeicherung bei. Durch den<br />
Menschen verursachte Entwässerung führt zu<br />
Grundwasserabsenkung und in dessen Folge Abb. 16: Vorschlag Lehr-Reich-Station 3
Teilstrecken- und Stationsbeschreibung des Drachenpfades<br />
zu Torfmineralisierung und CO2-Freisetzung.<br />
Lage: Ein kurzer Stichweg führt <strong>zur</strong> zwischen zwei Entwässerungsgräben liegenden Station.<br />
Die hier zwischen Hauptweg und Erlenwald befindlichen Fichten sollten demnächst<br />
entnommen werden.<br />
Ankerplatz: An dieser Station soll Wasser als zentraler Standortfaktor begriffen werden.<br />
Die Drachenszene zeigt, wie ein Mensch dem sich suhlenden Darsinus das Wasser abgräbt.<br />
Tafel mit Durchblick: Der auf die Erle fokussierende Spruch könnte besagen: Sie hat nichts<br />
gegen nasse Füße und verwurzelt sich tief im Gedächtnis der Landschaft.<br />
Menschenwerk: Eine steinerne Wildschweinskulptur fungiert in einer anzulegenden Senke<br />
als 'Pegel'. Im Frühjahr steht es bis <strong>zur</strong> Nase im Wasser, im Sommer in einer feuchten Suhle<br />
und später im Trockenen. Das Wasser hinterlässt an der Skulptur Spuren, anhand derer der<br />
Besucher auf die Höhe der Frühjahrswasserstände schließen kann.<br />
Höhere Betreuungsebenen: Die Begleitschriften gehen auf die Schlüsselbegriffe 'nasse<br />
Füße', 'tief verwurzelt' und 'Gedächtnis der Landschaft' ein. Entsprechend werden<br />
Wasserkreislauf, Torfbildung, Kohlendioxidspeicherung und Klimaschutz thematisiert.<br />
Ausgehend von der Drachenkampfszene werden die Einrichtung und der Rückbau von<br />
Entwässerungssystemen sowie damit verbundene potenzielle Konflikte angesprochen. Eine<br />
Person kann dieses zu einer Diskussion über Impulsmaßnahmen weiterführen. Sie kann<br />
außerdem Rollenspiele zu Konfliktsituationen oder Meditationen zum Thema Wasser<br />
initiieren. Auf Kinder werden Gräben und Wasserlachen eine große Anziehungskraft<br />
ausüben. Dies durch Aufgabenstellungen zu forcieren (z.B. den Graben auf einem<br />
Baumstamm überqueren) könnte aus Haftungsgründen problematisch sein. Für theoretische<br />
Aufgaben werden Kinder an dieser Stelle aber vermutlich wenig Geduld aufbringen. Das<br />
Internet erlaubt eine sehr anschauliche Wiedergabe von Seenverlandung, Torfbildung sowie<br />
der Wirkungsweise von Entwässerung und Grabenabdichtung.<br />
4.4.4.4 Lehr-Reich-Station 4: Zwischenreich der Eiche<br />
An dieser Station muss klar werden, dass zwischen Kiefern-<br />
Pionierwald und Buchenwald ein Eichenstadium eingeschoben<br />
ist, weil Eichen im Gegensatz zu Buchen von<br />
Eichelhäher und Eichhörnchen relativ schnell verbreitet<br />
werden. Da sie zudem ein hohes Alter erreichen können,<br />
finden sich Eichen auch noch in jüngeren Buchenwäldern.<br />
Die Eiche ist eine Halbschattenbaumart, ihr Lichtbedarf <strong>zur</strong><br />
Keimung liegt zwischen dem von Kiefer und Buche. Sie<br />
profitiert von der Humusanreicherung durch die Kiefer und<br />
verändert ihrerseits die Humusqualität durch leichter<br />
zersetzbares Laub.<br />
Der Mensch hat Eichenwälder lange Zeit aus vielfältigen<br />
Gründen gefördert, Übernutzung führte aber vielerorts zu<br />
Waldzerstörung.<br />
Lage: Diese Lehr-Reich-Station befindet sich unmittelbar<br />
am Hauptweg an einer Gruppe aus sieben Eichen. Momentan<br />
versperren einige Fichten, die entnommen werden sollten,<br />
den Blick auf mehrere sehr imposante Huteeichen.<br />
Ankerplatz: Der Besucher soll an dieser Stelle die unterschiedliche Atmosphäre erleben, die<br />
von Nadel- und Laubwäldern ausgeht. Die Drachenkampfszene stellt Darsinus dar, der von<br />
Hausschweinen und Menschen mit Laubrechen und Sicheln umzingelt ist.<br />
Tafel mit Durchblick: Die Fokussiertafel lenkt den Blick auf eine der Huteeichen und<br />
könnte den Spruch tragen: Die Langlebige nimmt alles mit trotzigem Gleichmut, Hauptsache<br />
ihr Vogel ist am Werk.<br />
103<br />
Abb. 17:<br />
Vorschlag Lehr-Reich-Station 4
104<br />
Der Drachenpfad – Erleben einer Landschaft im Umbruch<br />
Menschenwerk: Eine aus einem Baumstamm und einem Maschengitter gearbeitete Säule in<br />
Form eines aufrecht sitzenden Drachens thematisiert die Laubzersetzung als wichtigen<br />
Prozess im Laubwald. Die Säule ist gefüllt mit Laub, wobei Kerben andeuten, in welchem<br />
Maße sich das Laub über die Jahre anreichern würde, wenn es keine Zersetzung gäbe.<br />
Höhere Betreuungsebenen: Die Begleitschriften erläutern die Schlüsselbegriffe 'langlebig',<br />
'Gleichmut' und 'Vogel' und geben vertiefende Informationen zu Stoffkreisläufen und<br />
historischen Waldnutzungsformen. Im Kinderbuch wird dazu animiert, eine<br />
Laubzersetzungsreihe anzufertigen. Begleitpersonen können Waldbodenuntersuchung und<br />
Meditationen zu Licht und Wärme anleiten oder über den Vergleich mit den beiden<br />
vorherigen Stationen die Zwischenstellung der Eiche betonen. Das Internet kann<br />
Stoffkreisläufe über Animationen besonders anschaulich darstellen.<br />
4.4.4.5 Lehr-Reich-Station 5: Gemeinschaftsreich von Esche, Ahorn, Eiche, Buche<br />
Diese Station soll erläutern, weshalb Ahorn und Esche hier der Buchenkonkurrenz<br />
standhalten. Bewegtes Sickerwasser sowie<br />
Stau- und Haftnässe im Boden führen am<br />
Rande der Grundmoränenplatte dazu, dass die<br />
Wuchsbedingungen für die Buche nicht mehr<br />
optimal sind und sich bei guter<br />
Nährstoffversorgung neben ihr weitere<br />
Baumarten etablieren können. Das Ergebnis ist<br />
eine vom Forstmann als Edellaubwald<br />
bezeichnete Mischung aus Esche, Ahorn,<br />
Eiche, Buche und anderen Laubbaumarten.<br />
Durch gezielte Entnahme der Buche fördert der<br />
Mensch im Wirtschaftswald häufig die übrigen<br />
Arten. Die wirtschaftliche Nutzung verkürzt<br />
Abb. 18: Vorschlag Lehr-Reich-Station 5<br />
zudem die Lebenszyklen im Laubwald,<br />
insbesondere die für Waldökosysteme wichtige Alt- und Totholzphase fehlt weitgehend.<br />
Lage: Die Station befindet sich am nordöstlichen Waldrand. Vom Hauptweg aus führt ein<br />
Stichweg an der Ackerkante entlang dorthin.<br />
Ankerplatz: Dem Besucher soll zum einen bewusst werden, dass hier verschiedene<br />
Laubbaumarten nebeneinander vorkommen. Zum anderen soll er die besondere Lage dieses<br />
Waldtyps zwischen der Grundmoräne und dem Erlenwald erkennen. Die<br />
Drachenkampfszene zeigt Darsinus im Wald auf einem Haufen Totholz sitzend, wobei<br />
Menschen ihm von allen Seiten das Holz unter den Füßen wegziehen.<br />
Tafel mit Durchblick: An dieser Station wird auf Esche und Ahorn fokussiert. Die<br />
Vorschläge für die zugehörigen Interpretationssprüche lauten:<br />
Ihre Exzellenz gibt sich <strong>zur</strong>ückhaltend, legt aber Wert auf einen gehaltvollen Tropfen.<br />
Der Harlekin versüßt den Herbst mit buntem Kleid und tausend kleinen Fliegern.<br />
Menschenwerk: Ein beschnitzter Totholzstamm wird mit der Zeit die vom Menschen<br />
gegebene Form verlieren und so symbolisieren, dass im verwildernden Wald die Spuren des<br />
Menschen verschwinden. Euro- oder Dollarzeichen im Schnitzwerk können deutlich<br />
<strong>machen</strong>, dass in Lanken zu Gunsten von <strong>Wildnis</strong>entwicklung bewusst auf Erlöse aus der<br />
Holznutzung verzichtet wird.<br />
Höhere Betreuungsebenen: Die Begleitschriften gehen vertiefend auf die Schlüsselbegriffe<br />
'Exzellenz', '<strong>zur</strong>ückhaltend', 'gehaltvoller Tropfen', Harlekin', versüßen' und 'Flieger' ein.<br />
Auch wird die Bedeutung von Alt- und Totholz für den Wald angesprochen. Dabei erläutern<br />
Zahlenbeispiele die Unterschiede zwischen ungenutzten und bewirtschafteten Wäldern. Das<br />
nicht verwertete Holz spiegelt zum erheblichen Teil den Preis wider, den die Eigentümerin<br />
für den Naturschutz zahlt. Im Kinderbuch besteht die Möglichkeit, in einer Bildvorlage über<br />
eine Punkt-zu-Punkt-Zeichnung den Totholzanteil zu erhöhen. Betreute Exkursionen greifen
Teilstrecken- und Stationsbeschreibung des Drachenpfades<br />
das Thema Destruenten und Totholzzersetzung auf. Vergänglichkeit, Werden und Vergehen<br />
bieten sich ebenso für eine Meditation oder philosophische Erörterungen an. Im Internet<br />
lassen sich beispielsweise Modelle der Waldentwicklung von der Jugend- bis <strong>zur</strong><br />
Zerfallsphase animieren.<br />
4.4.4.6 Lehr-Reich-Station 6: Vernetzung / Zusammenführung<br />
Die letzte Lehr-Reich-Station, die sich am bzw. in unmittelbarer Nähe des Strandes befindet,<br />
stellt einen Zusammenhang zwischen den vorherigen Stationen her. Dafür werden zwei<br />
Vorschläge unterbreitet. Ein Aussichtsturm in Gestalt einer sich um die Eichen windenden<br />
Treppe ermöglicht einen Überblick im doppelten Sinne: Drei Stockwerke stellen die<br />
verschiedenen Sukzessionsphasen (Kiefer,<br />
Eiche, Buche) dar, die nässebedingten<br />
Schlussgesellschaften (Erlenbruch und Eschen-<br />
Mischwald) sind als Abstecher von der<br />
Haupttreppe angelegt. Ganz oben findet sich<br />
eine Darstellung der aktuellen Vegetationskarte.<br />
Statt des aufwendigen Turmbaus könnte der<br />
benachbarte Strand als letzte Lehr-Reich-Station<br />
dienen. Die Fokussiertafel kann den Bodden als<br />
Ursprung der Lanken ins Visier nehmen. Auf<br />
einer pultartigen Tafel ist die aktuelle<br />
Vegetationskarte und ein Modell des<br />
Abb. 19: Vorschlag Lehr-Reich-Station 6<br />
Sukzessionsablaufes mit den nässebedingten<br />
Schlussgesellschaften als Seitenzweigen abgebildet, hinter Mechanismen sind die Namen der<br />
Baum-Reiche verborgen.<br />
Höhere Betreuungsebenen: Mit Hilfe der Begleitschriften kann der Besucher die<br />
Stimmungen der Einzelstationen vergleichen und nun abschließend seine Eindrücke, z.B. im<br />
Hinblick auf die Eingangsfrage 'Was heißt hier wild?' zusammenfassen. Dazu wird die<br />
kreative Schreibübung auf einen Satz pro Zeile ausgeweitet. Während sie an den vorherigen<br />
Stationen ortspezifische Ausgangsbegriffe nutzte (z.B. Pionierreich, Zwischenreich etc.),<br />
wird jetzt der Terminus 'Wildes Lanken' gewählt. Dies dient gleichzeitig der Reflexion.<br />
Daneben werden Anregungen gegeben, wie jeder im Alltag zum Schutz von <strong>Wildnis</strong><br />
beitragen kann. Eine Abschlussmeditation kann das Thema Vernetzung aufgreifen. Für<br />
Kinder bietet die Turmkonstruktion die Möglichkeit für kleine Kletterabenteuer<br />
(Hängebrücke, Kletternetz etc.), während am Strand ein kleines Kunstwerk aus Strandgut<br />
angefertigt werden kann. Das Internet kann ein anschauliches Gesamtmodell der<br />
voraussichtlichen Gebietsentwicklung in Lanken wiedergeben.<br />
4.4.5 Spielraum (siehe Anhang 5.2 – Karte)<br />
Kurzbeschreibung: Es wird vorgeschlagen, den Bereich des derzeitigen Spielplatzes in<br />
einen die Sinne und die Motorik anregenden Spielraum zu verwandeln, ohne daraus eine<br />
künstliche Erlebnislandschaft zu <strong>machen</strong>. In ihm werden gestalterische Aufgaben und die<br />
Körpererfahrung betonende Spielgeräte angesiedelt. Eine minimal gehaltene Kurzanleitung<br />
mit möglichst bildhaften Erläuterungen lässt die Stationen auch ohne Begleitheft<br />
verständlich sein. Der Strand als klassischer Aktionsraum kann ebenso mit einbezogen<br />
werden, wie Teile des Kieferndünenwaldes, der laut NSG-Behandlungsrichtlinie für die<br />
Erholung zugänglich sein soll. Damit wären die für Kinder eingeforderten Bereiche<br />
funktioneller Unbestimmtheit gegeben (siehe 3.2.2.1 Zielgruppe Kinder).<br />
Die Ergebnisse kindlicher Aktivitäten wie Sandburgen oder kleine Kunstwerke aus<br />
Waldmaterialien sind nicht von langer Dauer. Die Kinder legen Spuren, die von der Natur<br />
wieder verwischt werden. Über die Betrachtung der zerfallenden Werke wird ihnen die<br />
wirkende Kraft der Natur näher gebracht.<br />
Die Gaststätte dient dabei als zentraler Punkt, der ein Ausufern verhindern könnte.<br />
105
106<br />
Der Drachenpfad – Erleben einer Landschaft im Umbruch<br />
<strong>Den</strong> Eltern kommen besondere Aufgaben zu. Sie müssen dazu aufgefordert werden, der<br />
Phantasie ihrer Kinder freien Lauf zu lassen, ihren Kindern zuzuhören, wenn diese ihre<br />
Erfahrungen berichten wollen und ihnen Aktivitäten, wie das Klettern auf Bäume, zu<br />
gestatten. Außerdem können Erwachsene sich an Spielen beteiligen.<br />
Ein Schaukasten am Spielraum kann neben dem Internet als weitere Kommunikationsplattform<br />
dienen, über die Schulklassen und Kindergartengruppen ihre Erfahrungen für<br />
andere Besucher darstellen. Es entstünde eine sehr authentische kleine Wechsel-Ausstellung.<br />
Quelle: Der Spielraum lehnt sich an das 'Kükelhaus-Erfahrungsfeld' an.<br />
Alternative: Eine aufwendigere Variante besteht in einer Erlebniszone, die mittels<br />
Orientierungskarte in der Broschüre erschlossen werden kann. Sie nutzt den alten Spielplatz<br />
und das darum entstandene, dichte Netz aus Trampelpfaden. Es gibt keine festgelegte<br />
Reihenfolge der Stationen und keine <strong>Weg</strong>weiser, die zu ihnen führen. Der Standpunkt<br />
einiger Stationen ist genau angegeben, andere müssen anhand markanter Punkte oder<br />
Angaben wie Himmelsrichtungen oder Entfernung geortet und nach Entdeckung in die Karte<br />
eingetragen werden (Schulung des Orientierungssinns, Übung im Kartenlesen, Spaß,<br />
Spannung, Schatzsuche).<br />
Abwägung: Kükelhauserfahrungsgeräte sind teuer, zugleich ist die Gefahr von Vandalismus<br />
und Diebstahl groß. Sie heben sich deutlich von der Waldumgebung ab, was im Bereich des<br />
Spielplatzes m.E. aber kein Problem darstellt.<br />
Die Eigentumsverhältnisse der Spielplatzfläche sind noch zu klären.<br />
Hauptzielgruppe: Im Spielraum sollen vor allem Kinder und Jugendliche angesprochen<br />
werden, auch in Form von Kindergartengruppen oder Schulklassen. Er kommt ihrem<br />
Bewegungsdrang aber auch ihrem Gestaltungsbedürfnis entgegen.<br />
Zielstellungen: Der Spielraum dient der Selbsterfahrung. Naturphänomene werden mit dem<br />
Resonanzkörper 'Leib' selbst erspürt, die eigenen Fähigkeiten erkundet und gestärkt und<br />
dadurch <strong>zur</strong> Ausbildung der eigenen Identität beigetragen. Der Schwerpunkt der<br />
Installationen liegt auf Sensibilisierung der Sinne und Bewegung. Diese Stationen haben nur<br />
einen sehr losen Zusammenhang mit dem Thema Verwildern, über höhere Betreuungsebenen<br />
können aber <strong>Den</strong>kanstöße erfolgen. Die Partnerschaukel bietet beispielsweise einen<br />
praktischen Verweis auf das Prinzip der Kooperation in der Natur, wie es sich zwischen<br />
Eiche und Eichelhäher ausgebildet hat. Körpererfahrungen und Spaß dienen der<br />
Unterstützung des kognitiven Verstehens. Zusätzliche schöpferische Tätigkeiten fördern<br />
Phantasie und Kreativität, Spiele die Interaktivität.<br />
Betreuungsebenen: Stationen und Aufgabenstellungen des Spielraums erfordern ein großes<br />
Maß an Eigeninitiative. Der <strong>Weg</strong>begleiter kann Bedeutungshintergründe bzw. die<br />
physikalischen Gesetzmäßigkeiten hinter der Funktionsweise der Erfahrungsstationen <strong>zur</strong><br />
Sprache bringen, Bezüge zu Naturphänomenen herstellen und den Spielraum über<br />
Aufgabenstellungen für Jugendliche und Erwachsene interessant <strong>machen</strong>. Im Kinderbuch<br />
werden die Gruppenspiele Drachenschwanz (Kalff et al. 1997, S.153) und Barfußraupe<br />
(Trommer 1991, S.36ff.) vorgeschlagen und eine Anleitung zum Drachenbau gegeben.<br />
Neben Spielen, Problemlöseaufgaben und dem Anstoß weiterführender Fragen kann eine<br />
Person besonders gut das Prinzip der LandArt nutzen. Künstlerische Tätigkeit kann auch<br />
direkt mit naturwissenschaftlicher Erkenntnis verbunden werden, z.B. beim Legen von<br />
Farbpaletten und Farbreihen, indem die Hintergründe der <strong>sichtbar</strong>en Phänomene aufgedeckt<br />
werden. Auch hier sind die Überlegungen dahingehend zu führen, wie ein Bezug zum<br />
Verwildern hergestellt wird.
Teilstrecken- und Stationsbeschreibung des Drachenpfades<br />
Bei Verwendung eines Spiegels können besonders einprägsame Erfahrungen gesammelt<br />
werden. Eine Baumwipfelwanderung ohne den Boden zu verlassen (Seifert et al. 1999,<br />
S.50), ungewöhnliche Einsichten (Knust 2003, S.19) oder Experimente mit Lichtreflexen<br />
und Symmetrien (Knust 2003, S.19) verbinden naturwissenschaftliche Erkenntnisse mit<br />
großem Spaß.<br />
Im Internet können lediglich die Bastel- und Spielideen<br />
weitergegeben werden.<br />
4.4.5.1 Spielraum-Station: Labyrinth<br />
Vorgeschlagen wird ein so genannter Lebensbaum, der<br />
Grundtyp des Labyrinths. Es könnte von Schülern oder im<br />
Rahmen eines Workshops angelegt werden. Schwierigkeiten<br />
ergeben sich möglicherweise durch die Notwendigkeit, die<br />
Sandwälle zu fixieren.<br />
Neben dem üblichen Durchschreiten des Labyrinths können<br />
auch Laufwettkämpfe oder Ähnliches stattfinden.<br />
4.4.5.2 Spielraum-Station: Barfußweg<br />
Auch hier wird empfohlen, die Bevölkerung in Form von<br />
Schulklassen, Kindergartengruppen oder im Rahmen eines<br />
Ferienworkshops an der Gestaltung teilhaben zu lassen. Dabei<br />
sollten vor allem Materialien der unmittelbaren Umgebung<br />
(Steine, Muscheln, Sand, Kiefernnadeln, Kienäpfel, Laub etc.)<br />
verwendet werden.<br />
4.4.5.3 Spielraum-Station: Mandala<br />
Auf einem polierten Baumstumpf wird aus zuvor in der Umgebung gesammelten<br />
Naturmaterialien ein Mandala gelegt. Diese meditative Übung fordert zum Loslassen auf,<br />
denn das Werk wird dem Spiel der Natur überlassen. Der Prozess des Vergehens muss<br />
zugelassen werden.<br />
Die Begleitschriften regen an dieser Stelle <strong>zur</strong> Suche nach natürlichen Mandalas an, z.B.<br />
Früchten, Blüten oder dem dynamischen Mandala von Wellenkreisen, wenn man einen Stein<br />
ins Wasser wirft. Eine Person kann dieses weiterführen, indem sie das Zustandekommen und<br />
die Vergänglichkeit natürlicher Mandalas erläutert.<br />
4.4.5.4 Spielraum-Station: Kletterkiefer oder Holzhaufen<br />
Klettern fördert Gleichgewichtssinn und Motorik. Es wird jedoch nicht explizit zum Klettern<br />
aufgefordert, da möglicherweise nicht alle Eltern ihren Kindern dies erlauben. Eine<br />
geeignete Kiefer befindet sich etwas abseits vom Spielraum im Dünen-Kiefernwald.<br />
Alternativ kann im Spielraum ein Holz-Kletterhaufen installiert werden.<br />
4.4.5.5 Spielraum-Station: Kükelhaus-Erfahrungsstationen<br />
Aus den vielfältigen Möglichkeiten (z.B. Kükelhaus 2000a,b) werden drei Varianten<br />
vorgestellt, die für eine solche Freifläche besonders geeignet sind.<br />
107<br />
Abb. 20: Lebensbaum-Labyrinth<br />
(aus Candolini 1999)<br />
„Im Labyrinth verliert man sich<br />
nicht. Im Labyrinth findet man<br />
sich. Im Labyrinth begegnet<br />
man nicht dem Minotaurus. Im<br />
Labyrinth begegnet man sich<br />
selbst.“ (Gemeinnützige<br />
Gesellschaft für Natur+Kunst<br />
e.V. 1999/2000, S. 24).
108<br />
Summstein<br />
Der Drachenpfad – Erleben einer Landschaft im Umbruch<br />
Aus einer großen Steinstele ist eine Höhlung herausgearbeitet. In diese wird der Kopf<br />
gesteckt und die Vokale A, O oder U gesummt. Die Vibration der Stimme steigert sich zu<br />
einem Dröhnen und breitet sich über die Wirbelsäule auf den<br />
ganzen Körper aus. Das gesamte taktile System wird aktiviert.<br />
Partnerschaukel<br />
Abb. 21:<br />
Summstein nach Kükelhaus<br />
(Natur & Kunst e.V. 1999/2000)<br />
Abb. 23: Balancierscheibe<br />
(Kükelhaus 2000a)<br />
Bei der Partnerschaukel handelt es<br />
sich um zwei separate Schaukeln,<br />
die über ein Seilsystem so<br />
miteinander gekoppelt sind, dass<br />
Schaukeln nur in Kooperation<br />
möglich ist.<br />
Balancierscheibe<br />
Es soll versucht werden, eine<br />
beweglich gelagerte Scheibe ins Gleichgewicht zu bringen und<br />
in Drehung zu versetzen. Balancierscheiben sind für<br />
Einzelpersonen und Gruppen erhältlich.<br />
4.4.6 Wunderpunkte<br />
Diese Form der flexiblen Gestaltung eines Themenweges (Ebers<br />
et al. 1998) könnte genutzt werden, um die interessanten<br />
Phänomene, die nicht in die Lehr-Reiche und den Bildweg<br />
integriert werden konnten, dennoch zu erschließen. Für einen<br />
begrenzten Zeitraum werden sie über eine Zusatzbroschüre oder<br />
Extratafel im Gelände herausgehoben. Sie können auch im<br />
Rahmen einer thematischen Sonderveranstaltung über die<br />
Betreuungsebene Person vorgestellt werden.<br />
Hier nur einige wenige Anregungen:<br />
In einen kulturhistorischen Komplex können Kulturrelikte, wie die alte Waldkante,<br />
Grenzsteine, das Grabensystem und der Hutewald oder auch Nutzpflanzen wie Hasel und<br />
Wildapfel einbezogen werden. Dabei bietet der Wildapfel auch eine Reflexion über<br />
Kultivierung und Domestizierung, über Genressourcen, Transportwege und Normierung im<br />
Zeitalter der Globalisierung.<br />
Essbare Wildpflanzen ist eine weitere mögliche Thematik, die Hasel, Eberesche und<br />
Wildapfel aber auch Buche, Ahorn, diverse Kräuter und Pilze umfassen kann.<br />
Zitterpappel, Eberesche, Birke sowie der östliche Waldrand und der Strand können<br />
zusammen mit der Kiefer zum Thema Sukzession und Pionierpflanzen herangezogen<br />
werden.<br />
Nur so kann die enorme Bandbreite an Kombinationsmöglichkeiten einzelner Phänomene<br />
abgedeckt werden, ansonsten wird ein Schilderwald im Gelände oder ein Blätterwald in der<br />
Hand des Besuchers produziert.<br />
4.5 Abwägung und Empfehlung<br />
Abb. 22:<br />
Partnerschaukel (Kükelhaus 2000a)<br />
Für die Umsetzung des Themenweges ergeben sich insgesamt 26 Drachenpfad-<br />
Kombinationen, da für jeden Teilabschnitt zwei Alternativen vorgeschlagen wurden und<br />
außerdem auch Teilbereiche entfallen können.<br />
Die Anwendung der Kunstform 'Bildweg' im Bereich der Naturbildung ist meines Wissens<br />
ein Novum, sie sollte auch bei einer Reduzierung des Gesamtkonzepts realisiert werden.
Teilstrecken- und Stationsbeschreibung des Drachenpfades<br />
Ebenso wenig darf auf den Aspekt des Verwilderns verzichtet werden, der insbesondere in<br />
den Lehr-Reichen umgesetzt ist.<br />
Wie bei der Beschreibung des Bildweges ausgeführt (siehe 4.4.3), ist seine Realisierung mit<br />
erheblichen Eingriffen verbunden (<strong>Weg</strong>anlage, Verkehrssicherung). Sollte er aus diesen<br />
Gründen nicht umgesetzt werden, plädiere ich für eine Verschmelzung der Kunstform<br />
'Bildweg' mit dem Inhalt 'Verwildern', wie sie bereits als Alternative für die Lehr-Reiche<br />
vorgeschlagen wurde, bei gleichzeitigem Umbau des Spielplatzes zu einem vielseitigeren<br />
Spielraum.<br />
109
110<br />
5. Anhang<br />
5.1 Landschaftsgeschichte<br />
Anhang<br />
Das Naturschutzgebiet Lanken ist ca. 8km westlich von Lubmin an der Küste gelegen. Es<br />
gehört <strong>zur</strong> Landschaftseinheit 'Südlicher Greifswalder Bodden' des Naturraums<br />
'Mecklenburgische Jungmoränenlandschaft'. Damit befindet es sich im Bereich des östlichen<br />
Küstenklimas (Usedomklima). Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt 540-<br />
600mm, die durchschnittliche Jahrestemperatur 7,7°C.<br />
Die Grundlagen für die Entstehung Lankens legten die jüngsten Eisvorstöße im Pleistozän<br />
(Velgaster und Nordrügener Staffel) mit der Schaffung des Gletscherzungenbeckens, in dem<br />
später der Greifswalder Bodden entstand. Mit der Litorina Phase der Ostseeentwicklung (ca.<br />
8000 v.h.) begann die bis heute andauernde Formung Lankens durch holozäne<br />
Küstenausgleichsprozesse. An der Umbiegung der Küstenlinie von der Ost-West-Richtung<br />
des Greifswalder Boddens in die Südost-Nordwest- Richtung der Dänischen Wieck entstand<br />
ein so genanntes Hakenstrandwallsystem oder Höftland mit typischer dreieckiger<br />
Grundform. Es ist in Riegen (vermoorte Senken) und Reffen (landfest gewordene<br />
Strandwälle) gegliedert und entlang der Küstenlinie im Norden mit Dünen besetzt. Das<br />
Relief schwankt zwischen 0,5 und 4 m über NN (Weinitschke et al. 1980). Im Osten<br />
kennzeichnet oberflächlich anstehender verlehmter Geschiebemergel der Grundmoräne die<br />
ungefähre Lage der ehemaligen Küstenlinie, der sich das Strandwallsystem vorgelagert hat.<br />
Die zunächst südwestlich verlaufenden und dann südöstlich abbiegenden Strandwälle<br />
Abb. 24: Aktuelles Satellitenbild von Lanken und Umgebung (Google Earth 2006) (verändert)<br />
umschließen einen ehemals ca. 70 cm flachen, heute vollständig verlandeten Strandsee, auf<br />
den der Großteil der heutigen grundwasserbeeinflussten Standorte der Lanken<br />
<strong>zur</strong>ückzuführen ist (Brinkmann 2002). Am Strand wechseln Winderosions- und marine
Landschaftsgeschichte<br />
Abrasionsflächen mit Akkumulationsbereichen kleinräumig ab, die Küstenlinie ist nach wie<br />
vor in Bewegung (Weinitscke et al. 1980).<br />
Aus der Entstehungsgeschichte lassen sich die heutigen hydrologischen Verhältnisse und<br />
Bodenformen ableiten. Grundwasserspiegel und Freiwasserstand in den Riegen der Lanken<br />
werden einerseits vom Niederschlag, andererseits vom Wasserstand des Greifswalder<br />
Boddens bestimmt, der im Jahresgang zwischen -0,70 m und +1,50 m (max.+2,50 m) NN<br />
schwankt. Im Bereich des verlehmten Geschiebemergels finden sich zudem<br />
Stauwassereinflüsse. Das Bodensubstrat ist überwiegend basenarmer Sand. Lanken unterteilt<br />
sich in einen grundwasserfernen Dünenbereich mit Rankerstadien und einen<br />
grundwasserbeeinflussten Teil mit Anmoor- und Humus-Grundgleyen. Insbesondere auf den<br />
anhydromorphen Standorten ist Rohhumus die vorherrschende Humusform (Brinkmann<br />
2002)<br />
Die Entstehungsgeschichte der Lanken und hier insbesondere die Neulandbildung spiegelt<br />
sich in den Gebietsbezeichnungen wieder. 'Ludwigsburger Haken' und 'Darsimer Hövt' (auch<br />
'Dersemer Hoved' oder 'Darsimerhovet') verweisen ebenso darauf wie das ältere slawische<br />
Wort 'Lanken', das 'sumpfige Wiese' oder 'buschige Niederung' bedeutet. In einer anderen<br />
Deutung wird es mit 'Schwemmland', 'am Meerbusen gelegenes Land' oder 'an einer<br />
Krümmung gelegenes Land' gleichgesetzt (Brinkmann 2002).<br />
Hoved, Hövet und Haken wurden in der niedersächsischen Schiffersprache als Bezeichnung<br />
für ein Vorgebirge gebraucht (Berghaus 1868 nach Brinkmann 2002).<br />
'Darsim' leitet sich vermutlich vom böhmischen Stamm drs ab, von dem das Adjektiv drsny<br />
= rau, uneben abstammt. Es könnte aber auch auf eine Familie Dars <strong>zur</strong>ückgehen oder wegen<br />
seiner vorspringenden Lage auf die Halbinsel Darß Bezug nehmen (Pyl 1880/81 nach<br />
Brinkmann 2002).<br />
Im Pommerschen Platt der<br />
Einheimischen wird die Lanken auch<br />
'Lütt Busch' genannt, sie wird durch<br />
das 'Butenfeld' (Außenfeld) vom<br />
'Groot Busch', einem weiteren<br />
Waldgebiet, getrennt (Christel<br />
Schmidt, Förderverein Schloss<br />
Ludwigsburg, mündlich 25.10.05).<br />
Funde mit Schnur- und Ritztechnik<br />
belegen eine Besiedlung der Region<br />
seit der Steinzeit (Christel Schmidt,<br />
mündlich 25.10.05). Der wendische<br />
Ort 'Darsim' (heutiges Ludwigsburg)<br />
wird erstmalig 1184 als 'portus<br />
Darsinus' urkundlich erwähnt (Pyl<br />
1880/81 nach Brinkmann 2002). Fürst<br />
Jaromar I von Rügen gründet 1207<br />
das Zisterzienserkloster Eldena und<br />
schenkt ihm zum Unterhalt u.a. den<br />
Ort Darsim (Hasselbach &<br />
Hosengarten 1862 nach Brinkmann<br />
2002), zu dem das heutige Lanken<br />
damals gehörte und auf dem ein<br />
Eichenwald gestockt haben dürfte<br />
(Berghaus 1868 und Pyl 1880/81 nach<br />
Brinkmann 2002). Mit der Säkularisierung des Klosters fällt Darsim 1534 an das herzögliche<br />
Amt Eldena, wird 1535 von Herzog Philip I. übernommen und gelangt 1577 als Geschenk in<br />
den Besitz Hedwig Sophia von Braunschweigs. Sie benennt es nach ihrem Gemahl Herzog<br />
Ernst Ludwig in Ludwigsburg um und lässt das Schloss errichten. 1631 übernimmt Herzogin<br />
111<br />
Abb. 25: Lanken und Umgebung 1694 (Ausschnitt aus der<br />
Schwedischen Matrikelkarte, verändert)
112<br />
Anhang<br />
Anna von Croy das Gut, veräußert es aber 1650 an den schwedischen General Mühler von<br />
der Lühnen. 1694 wird das nun als 'Die Lang' bezeichnete zugehörige Gebiet im Rahmen der<br />
Schwedischen Landesaufnahme vom Landvermesser Peder Wising aufgenommen (Rubow-<br />
Kalähne 1960 nach Brinkmann 2002, siehe Abb. 24).<br />
Auffallend ist der breite Sandbereich, es existierte kein Dünenkiefernwald. Baumbestand ist<br />
nur für den heutigen Kernbereich des NSG angegeben. Er wird beschrieben als Bruch und<br />
Morast mit auch als Viehweide nutzbarem Laubholzbestand (Eiche, Erle, Birke, Espe,<br />
Weide) und einer Soltwisch (Salzwiese), die ebenfalls als Weideland genutzt worden sein<br />
dürfte.<br />
Somit kann die Nutzung als Waldweide seit dem 17.Jh als sicher gelten, wird aber<br />
vermutlich bereits lange vorher praktiziert worden sein. Der Einfluss dieser anthropogenen<br />
Nutzungsform ist immens. Die Ausbreitung von Quercus robur und die Ausbildung zweier<br />
Formen des Stieleichen-Birkenwaldes wurde gefördert (Nährstoffentzug, Lichtverhältnisse).<br />
1747 kauft Ernst von Horn Gut Ludwigsburg, 1776 wechselt es in den Besitz des<br />
schwedischen Oberleutnants Ernst Sebastian von Klinkowström und wird 1810 vom<br />
Kaufmann Johann Philip Hermann Weißenborn erworben. Im Besitz seiner Familie verbleibt<br />
das Gut bis nach dem 2. Weltkrieg.<br />
1835 wird 'Die Lanken' im Zusammenhang mit der Erstellung der Preußischen<br />
Urmesstischblätter erneut kartographisch aufgenommen (siehe Abb. 26). Neben zwei<br />
Entwässerungsgräben im Südosten ist<br />
auch eine als Streifen angelegte<br />
Aufforstung mit Nadelbäumen im<br />
westlichen Bereich verzeichnet.<br />
Zwischen 1880 und 1920 wurde der<br />
Dünenbereich im Norden mit Pinus<br />
sylvestris aufgeforstet (Brinkmann<br />
2002).<br />
Zu Beginn des 20. Jh. wurden die im<br />
Westen an den baumbestandenen<br />
Bereich anschließenden Flächen als<br />
Schafweide genutzt (Relikte: Juniperus<br />
communis) und im Bereich des<br />
Stieleichen-Birkenwaldes existierte<br />
eine Schweinekoppel (Christel<br />
Schmidt, mündlich 25.10.05).<br />
In den 1930er Jahren wurden<br />
gebietsfremde Baumarten gepflanzt,<br />
vor allem Pseudotsuga menziesii,<br />
Picea abies, Picea sitchensis und Alnus<br />
incana.<br />
Neben der forstwirtschaftlichen<br />
Nutzung gebrauchte man<br />
Wachholderholz zum Räuchern,<br />
Abb. 26: Lanken und Umgebung 1835 (Ausschnitt aus<br />
dem Preußischen Urmeßtischblatt, verändert)<br />
außerdem betrieben die Fischer einen<br />
Ausschank im Waldbereich hinter dem<br />
noch heute existierende Fischerhaus an der Südostkante der Lanken. Auch waren mit der<br />
Vermietung eines Zimmers an Sommerfrischler bereits erste Ansätze von Tourismus<br />
vorhanden (Christel Schmidt, mündlich 25.10.05).<br />
Nach dem 2.Weltkrieg wurde das Anwesen Ludwigsburg Eigentum der Gemeinde Loissin,<br />
während die Lanken in den Besitz des Volkes der DDR überging.<br />
Am 12.12.1957 erhielten 56,9 ha Waldfläche der Lanken den Status eines<br />
Naturschutzgebietes (NSG), überwiegend in der besonderen Ausprägung des Totalreservats.
Landschaftsgeschichte<br />
Grund war die „Erhaltung und Regeneration eines feuchten Stieleichen-Birkenwaldes an der<br />
Ostgrenze seiner Verbreitung sowie eines naturnahen Dünen-Kiefernwaldes“ (Weinitschke<br />
1980).<br />
Anfang der 1960er Jahre erfolgte der Bau einer Gaststätte im nordwestlichen Bereich der<br />
Lanken. Das Gebiet wurde stark von Tagestouristen frequentiert, man zog mit Decke und<br />
Picknickkorb am Wochende 'zum Lagern' in den Lankener Kiefernwald (Dr. Lebrecht<br />
Jeschke, mündlich Jan. 2006). Eine Fährverbindung von Wieck nach Ludwigsburg sorgte für<br />
gute Erreichbarkeit.<br />
1976/77 wurden von Süden groß dimensionierte Grünlandentwässerungsgräben bis an den<br />
Wald herangeführt, die den Grundwasserspiegel im Südteil des NSG beeinflussen. Sie<br />
entwässern über ein Schöpfwerk im Polder Ludwigsburg in die dänische Wiek.<br />
1990 ging Lanken in die Verwaltung der Treuhandgesellschaft bzw. deren<br />
Nachfolgeorganisation BVVG (Boden-Verwertungs- und Verwaltungs-GmbH) über und<br />
wurde durch die Landesforst Mecklenburg-Vorpommern betreut.<br />
1991 kaufte Familie Weissenborn das Schloss und zwei Nebengebäude <strong>zur</strong>ück, seit 1998<br />
wird es vom Förderverein 'Schloss und Gutshofanlage Ludwigsburg e.V.' genutzt und wieder<br />
aufgebaut.<br />
Das Schutzgebiet wurde 1993 durch den Einbau mehrerer Staue vom Entwässerungsnetz<br />
des Polders Ludwigburg getrennt, der Grundwasserspiegel konnte dadurch nicht<br />
angehoben werden. Die zwischenzeitlich von Unbekannten zerstörten Staue sind im<br />
Februar 2006 erneuert und ausgebaut worden. 1999 fand – entgegen der Bestimmung<br />
der NSG-Behandlungsrichtlinie – ein Einschlag von Eschen und alten Eichen statt.<br />
Das Schutzziel der Lanken orientiert sich mittlerweile an der geomorphologischen Form,<br />
dem Höftland (Erhalt und Entwicklung eines bewaldeten Höftlandes an der Südküste des<br />
Greifswalder Boddens mit Dünen und Strandwällen sowie einem davon eingeschlossenen<br />
Versumpfungsmoor – (Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommern 2003). Das erlaubt<br />
die eigendynamische Umwandlung der Vegetation.<br />
Das NSG befindet sich seit Ende 2003 im Besitz der <strong>Michael</strong>-<strong>Succow</strong>-<strong>Stiftung</strong> zum Schutz<br />
der Natur. Sie strebt an, mit dem NSG Lanken einen Beitrag zum Naturschutzziel<br />
'<strong>Wildnis</strong>erhalt' zu leisten. Da nunmehr seit 50 Jahren ehemals traditionell genutzter Wald<br />
weitgehend aus der Nutzung genommen ist, kann zumindest von einem potenziellen<br />
sekundären <strong>Wildnis</strong>gebiet gesprochen werden. Es ist bescheidener Bestandteil der<br />
nutzungsfreien Schutzgebietsflächen in Deutschland, die sich auf nur 0,51% der<br />
Landesfläche (<strong>Succow</strong> et al. 2001, S. 149) belaufen.<br />
Zur Stützung dieses Ziels wurde im Jahr 2004 begonnen die eigendynamische Entwicklung<br />
des Gebietes durch Impulsmaßnahmen zu unterstützen. Die <strong>Michael</strong>-<strong>Succow</strong>-<strong>Stiftung</strong> zum<br />
Schutz der Natur verfolgt damit einen Prozessschutz, der auf den Erhalt ökologischer<br />
Leistungen der Landschaft für den Menschen zielt (www.succow-stiftung.de).<br />
Im Falle von Lanken zielen die Impulsmaßnahmen auf die Stabilisierung des<br />
Landschaftswasserhaushaltes. Sowohl das vorhandene Grabensystem, als auch die<br />
Pflanzungen von Douglasie, Sitkafichte und Fichte haben zu dessen massiver<br />
Beeinträchtigung beigetragen. Der stark gesunkene Grundwasserspiegel führte <strong>zur</strong><br />
Torfzehrung im Bereich des Erlenbruchwaldes. Die Entnahme der nicht standortgerechten,<br />
gepflanzten Nadelholzbestände und die Abdichtung des Grabensystems sollen diese, der<br />
Funktionsfähigkeit des Ökosystems abträgliche, Entwicklung beenden. Eine vollständige<br />
Rückführung in ein System mit Torfakkumulation wird aber nicht möglich sein (Prof.<br />
<strong>Michael</strong> <strong>Succow</strong>, mündlich 9.12.2005). Darüber hinaus wird durch das NSG Lanken ein<br />
Lebensraum für bedrohte Vogelarten an der Ostsee gesichert.<br />
Um die Bedeutung von <strong>Wildnis</strong> in die Öffentlichkeit zu tragen, entstand die Idee, den<br />
Prozess des Verwilderns mittels eines Naturerlebnispfades erfahrbar zu <strong>machen</strong> und das<br />
NSG für die Umweltbildung zu erschließen. Auch soll es für eine wissenschaftliche<br />
113
114<br />
Anhang<br />
Begleitung der eigendynamischen Entwicklung genutzt werden, wofür insbesondere die nahe<br />
Universität Greifswald vielfältige Potenziale bietet. Letztlich nutzt die <strong>Michael</strong>-<strong>Succow</strong>-<br />
<strong>Stiftung</strong> das Gebiet damit für ihre Öffentlichkeitsarbeit.<br />
Die Lanken wird in hohem Maße von Menschen aus der Region als Naherholungsgebiet<br />
aufgesucht, wenngleich der Erholungsdruck im Vergleich zu DDR-Zeiten nachgelassen hat.<br />
Die zwischenzeitlich eingestellte Schiffsverbindung von und nach Greifswald ist<br />
mittlerweile wieder in Betrieb genommen worden. Heute beschränkt sich die intensivste<br />
Nutzung des Gebietes auf den unmittelbaren Strandbereich in der Nähe der Gaststätte. <strong>Den</strong><br />
Kiefernwald durchzieht ein nach Osten immer dünner werdendes Netz von Trampelpfaden.<br />
Dem heutigen Besucher Lankens bieten sich erstaunlich unterschiedliche Waldbilder. Auf<br />
der Düne im Nord-Westen durchquert er einen Kiefernwald der trotz forstlichen Ursprungs<br />
auf Grund der charakteristischen Wuchsformen sehr naturnah anmutet. Zudem weist er die<br />
typische Begleitflora auf. Es<br />
handelt sich um eine<br />
verarmte Ausbildung eines<br />
Krähenbeer-Kiefernwaldes,<br />
wärmeliebende Arten zeigen<br />
eine zusätzliche Saumausbildung<br />
an. Deutlich ist die<br />
Einwanderung von Büschen,<br />
Stiel-Eiche und Rot-Buche<br />
zu beobachten.<br />
Der südlich der Düne<br />
gelegene Bereich ist in<br />
auffälliger Weise unterteilt.<br />
Fichten und Douglasien<br />
dominieren den Westteil,<br />
dazwischen finden sich<br />
einzelne Huteeichen. Nach<br />
der Schutzgebietsverordnung<br />
sind die nicht heimischen<br />
Abb. 27:<br />
Nadelhölzer zu entnehmen.<br />
Vegetationskarte des NSG Lanken (Brinkmann 2002, verändert)<br />
Im inneren dominiert Birken-<br />
Stieleichenwald, der je nach Standort in einer trockenen und einer feuchten Ausprägung<br />
vorkommt. Die nässeren Bereiche werden von drei verschiedenen Erlengesellschaften<br />
eingenommen, Flattergras-Erlenwald auf geringmächtigen Flachmoortorfen, Frauenfarn-<br />
Erlenwald und kleinflächig auch Erlenbruch als Endstadium der Strandseeverlandung.<br />
Auf dem Geschiebelehmstreifen, der die Lanken im Osten abschließt ist ein Eschen-<br />
Buchenwald anzutreffen (detaillierte Vegetationsbeschreibung bei Brinkmann 2002).<br />
Zur Fauna liegen bislang keine offiziellen Untersuchungen vor. Bekannt ist jedoch, dass das<br />
Gebiet einen artenreichen Singvogelbestand (u.a. Schnäpper, Goldhähnchen, Sprosser,<br />
Kernbeißer, Eichelhäher) aufweist, sowie von Greifvögeln wie Mäusebussard, Habicht,<br />
Waldkauz und Seeadler aufgesucht wird. Es hat darüber hinaus wichtige Bedeutung als<br />
Zugvogelrastplatz (Rotdrossel, Erlenzeisig, Buchfink) und als Laichgebiet für Amphibien<br />
(z.B. Moorfrosch).
Karte Drachenpfad<br />
5.2 Karte Drachenpfad<br />
115
116<br />
5.3 Tabelle Praxisübersicht<br />
Anhang
Tabelle Praxisübersicht<br />
117
118<br />
Anhang
Zeichnungen<br />
5.4 Zeichnungen<br />
Abb. 7 (groß): Vorschlag Eingangsstation<br />
119
120<br />
Abb. 8 (groß): Vorschlag Kreuzungspunkt<br />
Anhang
Zeichnungen<br />
Abb. 9 (groß): Vorschlag Bildwegstation 1<br />
121
122<br />
Abb. 10 (groß): Vorschlag Bildwegstation 2<br />
Anhang
Zeichnungen<br />
Abb. 11 (groß): Vorschlag Bildwegstation 3<br />
123
124<br />
Abb. 12 (groß): Vorschlag Bildwegstation 4<br />
Anhang
Zeichnungen<br />
Abb. 13 (groß): Vorschlag Bildwegstation 5<br />
125
126<br />
Abb. 14 (groß): Vorschlag Lehr-Reich-Station 1<br />
Anhang
Zeichnungen<br />
Abb. 15 (groß): Vorschlag Lehr-Reich-Station 2<br />
127
128<br />
Abb. 16 (groß): Vorschlag Lehr-Reich-Station 3<br />
Anhang
Zeichnungen<br />
Abb. 17 (groß): Vorschlag Lehr-Reich-Station 4<br />
129
130<br />
Abb. 18 (groß): Vorschlag Lehr-Reich-Station 5<br />
Anhang
Zeichnungen<br />
Abb. 19 (groß): Vorschlag Lehr-Reich-Station 6<br />
131
132<br />
6. Literaturverzeichnis<br />
Literaturverzeichnis<br />
Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz (1998): Naturbegegnung im Wald und an der<br />
Hecke. Naturschutz im Unterricht (2), Schneverdingen<br />
Altschwager, Ina (1998): Darstellung des Naturerlebnispfades im Nationalpark Bayerischer<br />
Wald und erste Ergebnisse einer Erfolgskontrolle. In: Bayerische Akademie für<br />
Naturschutz und Landschafspflege (ANL) (Hrsg.): Lehr-, Lern- und Erlebnispfade im<br />
Naturschutz. Laufener Seminarbeiträge (7) S. 35-43<br />
Amesberger, Günter; Schörghuber, Karl; Sotzko, Volker (1995): Innere und Äußere Natur.<br />
Zum Naturverständnis bei Outdoor-Aktivitäten. In: Österreichische Gesellschaft für<br />
Natur- und Umweltschutz (Hrsg.): Gratwanderungen – Naturerleben und<br />
Erlebnispädagogik. Umwelterziehung (1), ARGE-Verlag, Wien S.19-23<br />
Bauer, Nicole (2005): Für und wider <strong>Wildnis</strong>. Soziale Dimensionen einer aktuellen<br />
gesellschaftlichen Debatte. Bristol-Schriftenreihe Band 15, Haupt-Verlag, Bern,<br />
Stuttgart, Wien<br />
Baumgartner, Christoph (2005): Umweltethik – Umwelthandeln. Ein Beitrag zu Lösung<br />
des Motivationsproblems. Mentis-Verlag, Paderborn<br />
Baurecht-Pranzl, Christine (1995): Hinein ins Spielvergnügen. In: Österreichische<br />
Gesellschaft für Natur- und Umweltschutz (Hrsg.): Umweltbewußt – und nun ...?<br />
Umwelterziehung (2), ARGE-Verlag, Wien S.50-52<br />
Bayerisches Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.) (2004):<br />
Forstliche Bildungsarbeit – Waldpädagogischer Leitfaden nicht nur für Förster.<br />
6.Auflage, München<br />
Becker, Udo (2002): Lexikon der Symbole. Herder Taschenbuch, 4. Auflage, Freiburg<br />
Beidernikl, Gerd (2001): Der Ruf der <strong>Wildnis</strong>. Zivilisationstherotische Aspekte outdoororientierter<br />
Erlebnispädagogik. Diplomarbeit an der Universität Graz, Institut für<br />
Soziologie.<br />
Beyrich, Claudia (1998): Erlebnisraum Natur: Umweltbildungsmedien vor Ort – Naturpfade<br />
und Naturerlebnisräume. In: Bayerische Akademie für Naturschutz und<br />
Landschafspflege (ANL) (Hrsg.): Lehr-, Lern- und Erlebnispfade im Naturschutz.<br />
Laufener Seminarbeiträge (7) S. 9-13<br />
Bibelriether, Hans (1998): Faszination <strong>Wildnis</strong> – Wissenschaftlich nicht faßbare Realität.<br />
In: Nationalpark (3) S. 4-9<br />
Blinkert, Baldo (1998): Aktionsräume von Kindern. In: Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.):<br />
Naturerfahrungsräume. Angewandte Landschaftsökologie (19), Bonn-Bad Godesberg<br />
S.103-114<br />
Borggräfe, Karsten (1998): Multimediasysteme als ein Element der spielerischen<br />
Informationsvermittlung am Beispiel des Erprobungs- und Entwicklungsvorhabens<br />
'Revitalisierung in der Ise-Niederung'. In: Bayerische Akademie für Naturschutz und<br />
Landschafspflege (ANL) (Hrsg.): Lehr-, Lern- und Erlebnispfade im Naturschutz.<br />
Laufener Seminarbeiträge (7) S. 55-59<br />
Brämer, Rainer (1998): Natur als Begriff – Versuch einer empirischen Vorklärung. In:<br />
Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Naturerfahrungsräume. Angewandte<br />
Landschaftsökologie (19), Bonn-Bad Godesberg S.71-90<br />
Brilling, Oskar; Kleber, Eduard W. (Hrsg.) (1999): Hand-Wörterbuch der Umweltbildung.<br />
Schneider-Verlag, Hohengehren<br />
Brinkmann, Christiane (2002): Landschaftsökologische Untersuchungen des NSG Lanken<br />
(Kreis Ost-Vorpommern). Unveröffentlichte Diplomarbeit am Institut für Botanik und<br />
Landschaftsökologie der Universität Greifswald
133<br />
Candolini, Gernot (1999): Labyrinthe – Ein Praxisbuch zum Malen, Bauen, Tanzen,<br />
Spielen, Meditieren und Feiern. Pattloch-Verlag, Augsburg<br />
De Haan, Gerhard; Kuckartz, Udo (1996): Umweltbewußtsein. <strong>Den</strong>ken und Handeln in<br />
Umweltkrisen. Westdeutscher Verlag, Opladen<br />
Döring-Seibel, Elke (2001): Neue <strong>Weg</strong>e in der Umweltbildung. Mulitmedia als Mittel zum<br />
Umwelt- und Systemlernen. In: Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz (Hrsg.):<br />
Umweltpsychologie – Motivation zum Handeln statt Missionierung. NNA Berichte<br />
(14/1), Schneverdingen S. 12-14<br />
Drewermann, Eugen (1987): Tiefenpsychologie und Exegese Band I: Die Wahrheit der<br />
Formen. Traum, Mythos, Märchen, Sage und Legende. 4. Auflage, Walter-Verlag, Olten,<br />
Freiburg im Breisgau<br />
Dudenredaktion (Hrsg.) (2004.): Duden. Die deutsche Rechtschreibung. 23. Auflage<br />
Dudenverlag, Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich<br />
Düwell, Marcus; Hübenthal, Christoph; Werner, Micha H. (2002): Handbuch Ethik. Verlag<br />
Metzler, Stuttgart, Weimar<br />
Ebers, Sybill; Laux, Lukas; Kochanek, Hans-Martin (1998): Vom Lehrpfad zum<br />
Erlebnispfad. Handbuch für Naturerlebnispfade. NZH-Verlag, Wetzlar<br />
Gebauer, <strong>Michael</strong>; Harada, Nobuyuki (2005): Wie Kinder die Natur erleben. Ergebnisse<br />
einer kulturvergleichenden Studie in Japan und Deutschland. In: Unterbrunner, U.;<br />
Forum Umweltbildung (Hrsg.): Naturerleben. Neues aus Forschung und Praxis <strong>zur</strong><br />
Naturerfahrung. Studienverlag, Innsbruck, Wien, Bozen S. 45-61<br />
Gebhard, Ulrich (1995): Aspekte kindlicher Naturbeziehung. In: Österreichische<br />
Gesellschaft für Natur- und Umweltschutz (Hrsg.): Umweltbewußt – und nun ...?<br />
Umwelterziehung (2), ARGE-Verlag, Wien S. 41-45<br />
Gebhard, Ulrich (2005): Natur, Atmosphäre und Erlebnis. Zur ästhetischen Dimension von<br />
Naturerlebnissen. In: Unterbrunner, U.; Forum Umweltbildung (Hrsg.): Naturerleben.<br />
Neues aus Forschung und Praxis <strong>zur</strong> Naturerfahrung. Studienverlag, Innsbruck, Wien,<br />
Bozen S. 23-42<br />
Gesetz zum Schutz der Natur und der Landschaft im Lande Mecklenburg – Vorpommern<br />
(LNatG M-V) Vom 22.10.2002 (GVOBl. 2003 S. 1) zuletzt geändert am 11.7.2005<br />
(GVOBl. M-V S. 326).<br />
Giesinger, Thomas (1995): Mit Psychologie die Umwelt gestalten? . In: Österreichische<br />
Gesellschaft für Natur- und Umweltschutz (Hrsg.): Umweltbewußt – und nun ...?<br />
Umwelterziehung (2), ARGE-Verlag, Wien S. 10-13<br />
Gorke, Martin (2006): Prozessschutz aus Sicht einer holistischen Ethik. In: Natur und Kultur<br />
7 (1): in Druck.<br />
Hampicke, Ulrich (1999): Von der Bedeutung der spontanen Aktivität der Natur – John<br />
Stuart Mill und der Umgang mit der <strong>Wildnis</strong>. In: Bayerische Akademie für Naturschutz<br />
und Landschaftspflege (ANL) (Hrsg.): Schön wild sollte es sein... Wertschätzung und<br />
ökonomische Bedeutung von <strong>Wildnis</strong>. Laufener Seminarbeiträge (2) S. 85-92<br />
Haubl, Rolf (1999): Angst vor der <strong>Wildnis</strong> – An den Grenzen der Zivilisation. In:<br />
Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL) (Hrsg.): Schön wild<br />
sollte es sein... Wertschätzung und ökonomische Bedeutung von <strong>Wildnis</strong>. Laufener<br />
Seminarbeiträge (2) S.47-56<br />
Heidenreich, Heinz-Georg (2005): Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung in den<br />
Naturparken des Landes Brandenburg. Dissertation; edocs.tuberlin.de/diss/2004/heidenreich_heinzgeorg.pdf<br />
Download: 29.4.2005<br />
Heiland, Stefan (2001): Naturverständnis und Umgang mit Natur. In: Bayerische Akademie<br />
für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL) (Hrsg.): Wir und die Natur –<br />
Naturverständnis im Strom der Zeit. Berichte der ANL (25) S. 5-17<br />
Herder-Lexikon (2003): Symbole. 9. Auflage, Herder, Freiburg
134<br />
Literaturverzeichnis<br />
Heringer, Josef (2000): Symbolwert der Natur für den Naturschutz nützen. In: Bayerische<br />
Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL) (Hrsg.): Natur – Welt der<br />
Sinnbilder. Laufener Seminarbeiträge (1) S. 5-6<br />
Herrmann, Bernd; Schutkowski, Holger (1998): Humanwissenschaftliche Annäherung an<br />
die Beziehung Mensch-Natur. In: Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.):<br />
Naturerfahrungsräume. Angewandte Landschaftsökologie (19), Bonn-Bad Godesberg S.<br />
13-29<br />
Hettinger, Ned; Throop, Bill (1999): Refocusing Ecocentrism. De-emphasizing Stability<br />
and Defending Wilderness. In: Environmental Ethics. Vol.21 S. 3-21<br />
Hilgers, Micha (1995): Schamanen oder 'Local Heros'?. In: Österreichische Gesellschaft für<br />
Natur- und Umweltschutz (Hrsg.): Fliessende Grenzen – die spirituelle Dimension.<br />
Umwelterziehung (3), ARGE-Verlag, Wien S. 19-22<br />
Hoppe, Jörg Reiner (1998): Bedeutung von Naturerfahrung für die psychologische<br />
Entwicklung von Kindern In: Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.):<br />
Naturerfahrungsräume. Angewandte Landschaftsökologie (19), Bonn-Bad Godesberg S.<br />
115-124<br />
Hücker, Pia; Schulz, Stefan; Lilitakis, Georg; Gouder, Dirk (1998): Naturerlebnisaktion<br />
„Naturgeheimnisse“. In: Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschafspflege<br />
(ANL) (Hrsg.): Lehr-, Lern- und Erlebnispfade im Naturschutz. Laufener<br />
Seminarbeiträge (7) S. 45-46<br />
Hüther, Gerald (2004): Die Bedeutung innerer und äußerer Bilder für die Strukturierung des<br />
kindlichen Gehirns. In: Hüther, G.; Köhler, H.; Kühlewind, G.; Schiffer, E.; Schiller, H.:<br />
Lernen. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart S. 55-77<br />
Jedicke, Eckhard (1999): Prozeßschutz-Definition und Ziele. In: Umweltstiftung WWF<br />
Deutschland (Hrsg.): Chaos Natur? Prozeßschutz in Großschutzgebieten. Tagungsbericht<br />
S. 8-19<br />
Jessel, Beate (1997): <strong>Wildnis</strong> als Kulturaufgabe? - Nur scheinbar ein Widerspruch! Zur<br />
Bedeutung des <strong>Wildnis</strong>gedanken für die Naturschutzarbeit. In: Bayerische Akademie für<br />
Naturschutz und Landschaftspflege (ANL) (Hrsg.): <strong>Wildnis</strong>-ein neues Leitbild?<br />
Möglichkeiten und Grenzen ungestörter Naturentwicklung für Mitteleuropa. Laufener<br />
Seminarbeiträge (1) S. 9-20<br />
Joosten, Johannes H. J. (1997): Landschaftsökologie und Naturschutz von Hochmooren:<br />
angewandte und theoretische Studien. Dissertation an der Ernst-Moritz-Arndt-<br />
Universität Greifswald, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät<br />
Kalas. Sybille (2005): Landart – Sensible Kreativität mit und in Natur. In: Unterbrunner, U.;<br />
Forum Umweltbildung (Hrsg.): Naturerleben. Neues aus Forschung und Praxis <strong>zur</strong><br />
Naturerfahrung. Studienverlag, Innsbruck, Wien, Bozen S. 149-162<br />
Kalff, <strong>Michael</strong>; Eisfeld, Jens-Gerrit; Bühring, Ursel; Filipski, Claudia; Held, Anke;<br />
Langholf, Henrik (1993): Handbuch <strong>zur</strong> Natur- und Umweltpädagogik. Theoretische<br />
Grundlegung und praktische Anleitungen für ein tieferes Mitweltverständnis. Günter<br />
Albert Ulmer Verlag, Tuningen<br />
Kellner-Rauch, Heike (2004): Impulse der Erlebnispädagogik für eine ökosystemische<br />
Heilpädagogik. Hausarbeit im Fach Erziehungswissenschaften (o. weiter Angaben).<br />
Dokument Nr. 35194 Wissensarchive Grin. Download: 3.7.2005<br />
KindSein e.V. (Hrsg.). Konzeption Kinderhaus am Mondsteinweg. http://www.bossebielefeld.de/Kinderhaus/selbstdarstellung/konzept/konzept.pdf<br />
Download: 5.7.2005<br />
Kirchhoff, Hermann (2000): Ursymbole. In: Bayerische Akademie für Naturschutz und<br />
Landschaftspflege (ANL) (Hrsg.): Natur – Welt der Sinnbilder. Laufener<br />
Seminarbeiträge (1) S.25-29<br />
Kleber, Eduard W. (1998): Position ökologischer Pädagogik <strong>zur</strong> Einrichtung von<br />
Naturerfahrungsräumen. In: Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Naturerfahrungsräume.<br />
Angewandte Landschaftsökologie (19), Bonn-Bad Godesberg S. 161-167
135<br />
Knust, Ingeborg (Hrsg.) (2004): Kunst in der Umweltbildung. Handreichungen für die<br />
pädagogische Praxis. NZH Verlag, Wetzlar<br />
Kowarik, Ingo (1999): Natürlichkeit, Naturnähe und Hemerobie als Bewertungskriterien. In:<br />
Konold, W.; Böcker, R.; Hampicke, U. (Hrsg.): Handbuch Naturschutz und<br />
Landschaftspflege. ecomed Verlag, Landsberg S. 1-18<br />
Kükelhaus, Hugo (2000a): Hören und Sehen in Tätigkeit, 7. unveränderte Auflage, Klett<br />
Verlag, Zug.<br />
Kükelhaus, Hugo (2000b): Fassen Fühlen Bilden. Organerfahrungen im Umgang mit<br />
Phänomenen. 7.Auflage. Gemeinnützige Forschungs- und Bildungsgesellschaft, Essen<br />
Küster, Hansjörg (1999): Zähmung und Domestizierung. Von der <strong>Wildnis</strong> <strong>zur</strong><br />
Kulturlandschaft. In: Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege<br />
(ANL) (Hrsg.): Schön wild sollte es sein... Wertschätzung und ökonomische Bedeutung<br />
von <strong>Wildnis</strong>. Laufener Seminarbeiträge (2) S. 35-41<br />
Lang, Christian; Stark, Werner (2000): Schritt für Schritt NaturErleben. Ein <strong>Weg</strong>weiser <strong>zur</strong><br />
Einrichtung moderner Lehrpfade und Erlebniswege. Forum Umweltbildung, Wien<br />
Leopold, Aldo (1992): Am Anfang war die Erde. Plädoyer <strong>zur</strong> Umwelt-Ethik.<br />
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt<br />
Liedtke, Max (1988): Unterricht und Naturerfahrung. Über die Bedingungen der<br />
Vermittlung von ökologischen Kenntnissen und Wertvorstellungen. In: Bayerische<br />
Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL) (Hrsg.): Berichte der ANL (12)<br />
S. 19-24<br />
Lindner, Willi; Leuthold, Margit (2005): Zwischen Begeisterung und 'Knochenarbeit'. Ein<br />
kritischer Blick auf die Aufgaben der NaturvermittlerInnen. In: Unterbrunner, U.; Forum<br />
Umweltbildung (Hrsg.): Naturerleben. Neues aus Forschung und Praxis <strong>zur</strong><br />
Naturerfahrung. Studienverlag, Innsbruck, Wien, Bozen S.121-132<br />
Lude, Armin (2005): Naturerfahrung und Umwelthandeln – Neue Ergebnisse aus<br />
Untersuchungen mit Jugendlichen. In: Unterbrunner, U.; Forum Umweltbildung (Hrsg.):<br />
Naturerleben. Neues aus Forschung und Praxis <strong>zur</strong> Naturerfahrung. Studienverlag,<br />
Innsbruck, Wien, Bozen S. 65-84<br />
Ludwig, Thorsten (2005): Grundkurs Natur- und Kulturinterpretation. Kurshandbuch.<br />
Bildungswerk Interpretation, Werleshausen. www.interp.de Download: 29.4.2005<br />
Mayer-Tasch, Peter C. (2000): Natur als Symbol. In: Bayerische Akademie für Naturschutz<br />
und Landschaftspflege (ANL) (Hrsg.): Natur – Welt der Sinnbilder. Laufener<br />
Seminarbeiträge (1) S.19-23<br />
Megerle, Heidi (2003): Naturerlebnispfade – neue Medien der Umweltbildung und des<br />
landschaftsbezogenen Tourismus? Bestandsanalyse, Evaluation und Entwicklung von<br />
Qualitätsstandards. Selbstverlag des Geographischen Instituts der Universität Tübingen,<br />
Heft 124<br />
Michor, Klaus (2000): Sinnbilder in der Landschaftsplanung. In: Bayerische Akademie für<br />
Naturschutz und Landschaftspflege (ANL) (Hrsg.): Natur – Welt der Sinnbilder.<br />
Laufener Seminarbeiträge (1) S.31-35<br />
Mitterbauer, Eva (1997): UmweltSpiele. ARGE Umwelterziehung, Wien<br />
Mitterbauer, Eva; Baurecht-Pranzl, Christine (1993): Umweltwirkstatt. Kreativ für und<br />
mit Natur. ARGE Umwelterziehung, Wien<br />
Natur + Kunst e.V. (Hrsg.) (1999/2000): Katalog zum Erfahrungsfeld Freudenberg.<br />
Nohl, Werner (1998): Naturaneignung und Naturaneignungsräume – Konzeptionelle<br />
Überlegungen <strong>zur</strong> Erweiterung des gegenwärtigen Naturschutzverständnisses. In:<br />
Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Naturerfahrungsräume. Angewandte<br />
Landschaftsökologie (19), Bonn-Bad Godesberg S.131-140<br />
Nutz, <strong>Michael</strong>a (2003): Lehr-, Lern- und Erlebnispfade <strong>zur</strong> Umweltbildung. Natur erkennen,<br />
erleben, erhalten. Reinhold Krämer Verlag, Hamburg
136<br />
Literaturverzeichnis<br />
Oberwemmer, Frank (1998): Möglichkeiten der Informationsvermittlung im Gelände durch<br />
Spieleinrichtungen am Beispiel des Otterzentrums Hankensbüttel. In: Bayerische<br />
Akademie für Naturschutz und Landschafspflege (ANL) (Hrsg.): Lehr-, Lern- und<br />
Erlebnispfade im Naturschutz. Laufener Seminarbeiträge (7) S. 15-19<br />
Piechocki, Reinhard; Wiersbinski, Norbert; Potthast, Thomas, Ott, Konrad (2004): Vilmer<br />
Thesen zum 'Prozessschutz'. In: Natur und Landschaft (79/2)<br />
Potthast, Thomas (2001): Funktionssicherung und/oder Aufbruch ins Ungewisse?<br />
Anmerkungen zum Prozeßschutz. In: Jax, K. (Hrsg.): Funktionsbegriff und Ungewißheit<br />
in der Ökologie. Theorie der Ökologie 1, Peter Lang, Frankfurt a.M. S. 65-81<br />
Prüter, Johannes; Wübbenhorst, Jann; Janssen, Johann; Wilde, Peter (2004): Frischer<br />
Wind in alter Heide. In: Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz (Hrsg.): Mitteilungen<br />
aus der NNA (1) S. 26-30<br />
Putensen, Stephan (2000): Chancen und Grenzen von Erlebnispädagogik als Methode<br />
sozialer Arbeit. Diplomarbeit an der Evtl. FH für Sozialpädagogik der Diakonieanstalt<br />
des Rauhen Hauses Hamburg, home.tiscalinet.de/putensen/diplom.doc Download:<br />
10.5.2005<br />
Schärli, Otto (2001): Werkstatt des Lebens – Durch die Sinne zum Sinn. 3. Auflage, AT-<br />
Verlag, Aarau<br />
Schemel, Hans-Joachim (1998): Das Konzept der Flächenkategorie 'Naturerfahrungsräume'<br />
und Grundlagen für die planerische Umsetzung. In: Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.):<br />
Naturerfahrungsräume. Angewandte Landschaftsökologie (19), Bonn-Bad Godesberg S.<br />
207-356<br />
Scherzinger, Wolfgang (1997): Tun oder Unterlassen? Aspekte des Prozeßschutzes und<br />
Bedeutung des 'Nichts-Tuns' im Naturschutz. In: Bayerische Akademie für Naturschutz<br />
und Landschaftspflege (ANL) (Hrsg.): <strong>Wildnis</strong> – ein neues Leitbild? Möglichkeiten und<br />
Grenzen ungestörter Naturentwicklung für Mitteleuropa. Laufener Seminarbeiträge (1)<br />
S.31-44<br />
Seifert, Manuela; Steiner, Regina; Tschapka, Johannes (1999): From Management to<br />
Mandala – Environmental Education in Europe. Wien<br />
Stremlow, Matthias; Sidler, Christian (2002): Schreibzüge durch die <strong>Wildnis</strong>.<br />
<strong>Wildnis</strong>vorstellungen in Literatur und Printmedien der Schweiz. Haupt-Verlag, Bern,<br />
Stuttgart, Wien<br />
Strohschneider, Renate (1998): Einführung in das Thema und Ergebnisse der Fachtagung<br />
In: Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschafspflege (ANL) (Hrsg.): Lehr-,<br />
Lern- und Erlebnispfade im Naturschutz. Laufener Seminarbeiträge (7) S. 6<br />
Sturm, Knut (1993): Prozeßschutz – ein Konzept für naturschutzgerechte Waldwirtschaft<br />
www.angewandte-waldoekologie.de/docs/prozesschutz.pdf Download: 31.03.2006<br />
<strong>Succow</strong>, <strong>Michael</strong>; Jeschke, Lebrecht; Knapp Hans Dieter (2001): Die Krise als Chance –<br />
Naturschutz in neuer Dimension. Findling Verlag, Neuenhagen<br />
Suchanek, Norbert (2001):Mythos <strong>Wildnis</strong>. Schmetterling Verlag, Stuttgart<br />
Taylor, Paul W. (1989): Respect for Nature – A Theory of Environmental Ethics. 2. Aufl.,<br />
Princeton, NJ.<br />
Thiel, Romy (2002): Die Phänomenologie des entdeckenden Lernen. Seminararbeit am<br />
Institut für Grundschulpädagogik an der Universität Potsdam. Dokument Nr. 6829<br />
Wissensarchive Grin. Download: 3.7.2005<br />
Trommer, Gerhard (1992): <strong>Wildnis</strong> – die pädagogische Herausforderung. Deutscher Studien<br />
Verlag, Weinheim<br />
Trommer, Gerhard (1997a): Wilderness, <strong>Wildnis</strong> oder Verwilderung – Was können und was<br />
sollen wir wollen? In: Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege<br />
(ANL) (Hrsg.): <strong>Wildnis</strong> – ein neues Leitbild? Möglichkeiten und Grenzen ungestörter<br />
Naturentwicklung für Mitteleuropa. Laufener Seminarbeiträge (1) S. 21-30
Trommer, Gerhard (Hrsg.) (1991): Natur wahrnehmen mit der Rucksackschule.<br />
Westermann Schulbuchverlag, Braunschweig<br />
Trommer, Gerhard; Noack, Reimund (1997b): Die Natur in der Umweltbildung. Deutscher<br />
Studienverlag, Weinheim<br />
Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommern (Hrsg.) (2003): Die Naturschutzgebiete<br />
in Mecklenburg-Vorpommern. Demmler Verlag<br />
137<br />
Unger, Sebastian (2003): Wilderness Management on Svalbard – Recent Concepts, Future<br />
Options and Social Consequences. Unveröffentlichte Diplomarbeit am Institut für<br />
Botanik und Landschaftsökologie der Universität Greifswald<br />
Wagner, Richard (1995): Zwischen Sonntagspredigt und Leib-Sinnlicher Revitalisierung.<br />
Spirituell-religiöse Lernimpulse in der Umwelterziehung. In: Österreichische<br />
Gesellschaft für Natur- und Umweltschutz (Hrsg.): Fliessende Grenzen – die spirituelle<br />
Dimension. Umwelterziehung (3), ARGE-Verlag, Wien S. 4-7<br />
Wehde, Volker (2001): Nachtwanderung ohne Licht (Exkursionsbeschreibung) In: Alfred<br />
Toepfer Akademie für Naturschutz (Hrsg.): Umweltpsychologie – Motivation zum<br />
Handeln statt Missionierung. NNA Berichte (14/1), Schneverdingen S. 73-76<br />
Weinitschke, Hugo (Hrsg.) (1980): Handbuch der Naturschutzgebiete der Deutschen<br />
Demokratischen Republik – Die Bezirke Rostock, Schwerin und Neubrandenburg. Bd.1,<br />
2. Auflage, Urania-Verlag Leipzig, Jena, Berlin<br />
Wessels, Julia: Naturpädagogik – Die Begegnung mit der Natur ermöglichen.<br />
www.kigaweb.de/ratgeber/paedagogik/ Download: 19.6.2005<br />
Westra, Laura (2001): From Aldo Leopold to the Wildlands Project: The Ethics of Integrity.<br />
In: Environmental ethics, Vol.23, S. 261-274<br />
Wilcox, B. A. (1984): In situ conservation of genetic resources: determinants of minimum<br />
area requirements. In: McNeely, J. A.; Miller, K. R. (Hrsg.): National Parks,<br />
conservation, and development: the role of protected areas in sustaining society.<br />
Smithsonian Institution Press, Washington D. C., USA. S. 639-647<br />
Wucherer, Sandra (2003): Naturerlebnis-Pädagogik. Unveröffentlichtes Manuskript der<br />
Firma 'Wildwärts', Anbieter für Natur Erleben, Oberscheuren 30, 53639 Königswinter<br />
Zerling, Clemens (2003): Lexikon der Tiersymbolik. Mythologie, Religion, Psychologie.,<br />
Kösel-Verlag, München<br />
Ziegenspeck, Jörg (1998): Erlebnis – Versuch einer Begriffsklärung aus<br />
erziehungswissenschaftlicher Sicht. In: Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.):<br />
Naturerfahrungsräume. Angewandte Landschaftsökologie (19), Bonn-Bad Godesberg<br />
S.141-152<br />
Ziegler, Ursula (2002): Prozessschutz vor dem Hintergrund der Ideengeschichte des<br />
Naturschutzes. Diplomarbeit an der Technischen Universität München, Lehrstuhl<br />
Landschaftsökologie<br />
Zucchi, Herbert (2002):<strong>Wildnis</strong> als Kulturaufgabe – ein Diskussionsbeitrag. In: Natur und<br />
Landschaft (77 9/10) S.373-178<br />
de.wikipedia.org/wiki/Bildung Zugriff: 2.7.2005<br />
de.wikipedia.org/wiki/Didaktik Zugriff: 2.7.2005<br />
de.wikipedia.org/wiki/Erlebnispaedagogik Zugriff: 2.7.2005<br />
de.wikipedia.org/wiki/Erziehung Zugriff: 2.7.2005<br />
de.wikipedia.org/wiki/Frontalunterricht Zugriff: 2.7.2005<br />
de.wikipedia.org/wiki/Handlungsorientierter_Unterricht Zugriff: 5.7.2005<br />
de.wikipedia.org/wiki/Interaktivitaet Zugriff: 2.7.2005<br />
de.wikipedia.org/wiki/Lehrpfad Zugriff: 2.7.2005<br />
de.wikipedia.org/wiki/Lernen Zugriff: 2.7.2005
138<br />
Literaturverzeichnis<br />
de.wikipedia.org/wiki/Lernstil Zugriff: 5.7.2005<br />
de.wikipedia.org/wiki/Paedaogik Zugriff: 2.7.2005<br />
de.wikipedia.org/wiki/Wahrnehmung Zugriff: 2.7.2005<br />
www.bildweg.ch Zugriff: 9.5.2005<br />
www.interp.de/ Zugriff: 1.5.2005<br />
www.interp.de/interpretation/definition/index.html Zugriff: 1.5.2005<br />
www.interp.de/interpretation/geschichte/prinzipien.html Zugriff: 1.5.2005<br />
www.interp.de/interpretation/grundlagen/index.html Zugriff: 1.5.2005<br />
www.interp.de/interpretation/grundlagen/leitidee.html Zugriff: 1.5.2005<br />
www.stangl-taller.at/ arbeitsblaetter/wissenschaftpaedagogik /ModelleBildungstheorie.shtml<br />
Zugriff: 25.6.2005<br />
www.stangl-taller.at/<br />
arbeitsblaetter/wissenschaftpaedagogik/ModellHandlungsorientiert.shtml Zugriff:<br />
25.6.2005<br />
www.stangl-taller.at/arbeitsblaetter/wissenschaftpaedagogik/ErzwissInhalte.shtml Zugriff:<br />
24.6.2005<br />
www.succow-stiftung.de Zugriff: 15.3.2005<br />
www2.uni-jena.de/didaktik/did_01/doppelt.htm Zugriff: 22.6.2005<br />
www2.uni-jena.de/didaktik/did_01/neunfrag.htm Zugriff: 22.6.2005<br />
www2.uni-jena.de/didaktik/did_02/philantrophen.htm Zugriff: 10.5.2005<br />
www2.uni-jena.de/didaktik/did_03/bruner.htm Zugriff: 10.5.2005<br />
www2.uni-jena.de/didaktik/did_03/implikation.htm Zugriff: 10.5.2005