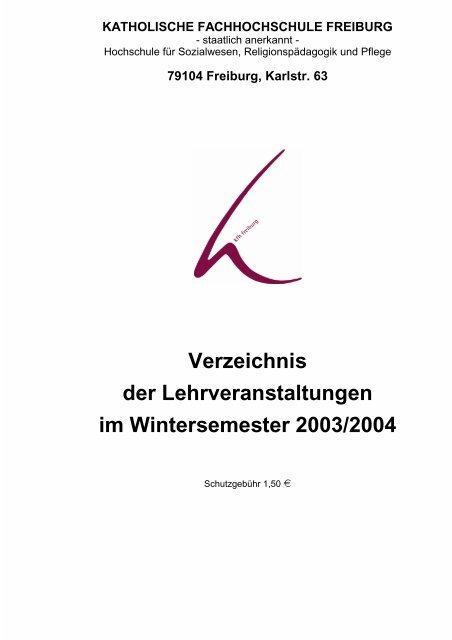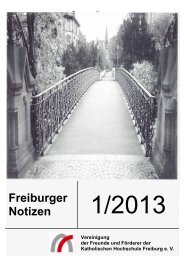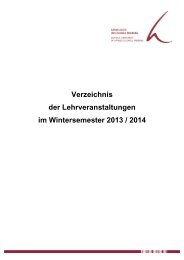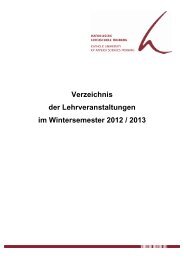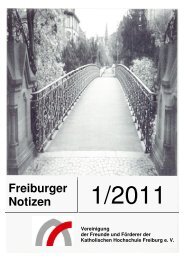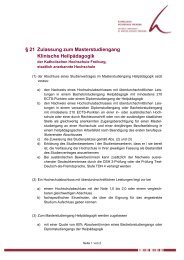Grundstudium - KH Freiburg
Grundstudium - KH Freiburg
Grundstudium - KH Freiburg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
KATHOLISCHE FACHHOCHSCHULE FREIBURG<br />
- staatlich anerkannt -<br />
Hochschule für Sozialwesen, Religionspädagogik und Pflege<br />
79104 <strong>Freiburg</strong>, Karlstr. 63<br />
Verzeichnis<br />
der Lehrveranstaltungen<br />
im Wintersemester 2003/2004<br />
Schutzgebühr 1,50 L
Herausgegeben vom Rektor<br />
der Katholischen Fachhochschule <strong>Freiburg</strong><br />
Prof. Dr. Christoph Steinebach<br />
79104 <strong>Freiburg</strong>, Karlstr. 63<br />
E-Mail: rektorat@kfh-freiburg.de<br />
http://www.kfh-freiburg.de<br />
Telefax: 0761/200 444<br />
0761/200 166 (Fachbereiche Soziale Arbeit/HP/RP/<br />
Pflege/Management)<br />
0761/200 478 (Studentensekretariat/Prüfungsamt)<br />
Telefon:<br />
Sekretariat Rektor................................... 0761/200476<br />
Sekretariat Prorektor..................................... 200491<br />
Sekretariat Prorektor und IAF .............................. 200736<br />
Sekretariat Verwaltungsdirektorin ........................... 200488<br />
Fachbereichssekretariat <strong>Grundstudium</strong> ...................... 200491<br />
Fachbereichssekretariat Soziale Arbeit ....................... 200483<br />
Fachbereichssekretariat Heilpädagogik ...................... 200260<br />
Fachbereichssekretariat Religionspädagogik .................. 200472<br />
Fachbereichssekretariat Pflege ............................. 200602<br />
Fachbereichssekretariat Management ....................... 200530<br />
Studienberatung ........................................ 200497<br />
Prüfungsamt .....................................200481, 200474<br />
Studentensekretariat ..................................... 200486<br />
EDV-Zentrum ....................................200591, 200162<br />
Stundenplan/Raumvergabe ............................... 200630<br />
Frauenbeauftragte ...................................... 200495<br />
BAföG-Förderung ....................................... 200662<br />
Kath. Hochschulgemeinde ................................ 200439<br />
Hausmeister ........................................... 200550<br />
Redaktion: Isabella Wehrle<br />
Redaktionsschluss: 02.06.2003<br />
Änderungen vorbehalten, Nachdruck nicht gestattet<br />
<strong>Freiburg</strong>, im September 2003
INHALTSVERZEICHNIS<br />
Die Katholische Fachhochschule <strong>Freiburg</strong> ......................... 4<br />
Allgemeine Informationen<br />
Terminplanung .............................................. 7<br />
Vertreter der Trägerschaft im Verwaltungsrat ....................... 9<br />
Selbstverwaltung der Kath. Fachhochschule .......................10<br />
Wichtige Anschriften und AnsprechpartnerInnen ....................24<br />
Lehrangebot<br />
GRUNDSTUDIUM :<br />
Soziale Arbeit ...............................................38<br />
Heilpädagogik ...............................................46<br />
Religionspädagogik ..........................................55<br />
Pflege und Therapiemanagement ................................60<br />
Angebote im Bereich Kultur- und Medienpädagogik ..................90<br />
Zusatzangebote .............................................98<br />
HAUPTSTUDIUM:<br />
Studiengang Sozialarbeit .....................................101<br />
Studiengang Sozialpädagogik .................................125<br />
Fachbereich Heilpädagogik Hauptstudium/Aufbaustudium ........154, 175<br />
Fachbereich Religionspädagogik ...............................197<br />
Angebote im Bereich Kultur- und Medienpädagogik .................213<br />
Fachbereich Pflege ..........................................227<br />
GRUND-und HAUPTSTUDIUM<br />
Theologische Zusatzausbildung(ThZ) ............................237<br />
Zusatzlehrprogramme........................................242<br />
Kooperationsveranstaltungen mit EFH <strong>Freiburg</strong> ....................250<br />
Sprachkurse ...............................................257<br />
Anschriftenverzeichnis<br />
Verzeichnis der hauptamtlichen Lehrkräfte........................262<br />
Verzeichnis der Lehrbeauftragten ...............................275<br />
Lageplan ..................................................288
Die Katholische Fachhochschule <strong>Freiburg</strong><br />
- staatlich anerkannt -<br />
Hochschule für Sozialwesen, Religionspädagogik und Pflege<br />
Catholic University of Applied Sciences<br />
Sieben Fachhochschulen mit Studiengängen des Sozialwesens gibt es in<br />
Baden-Württemberg. Gemessen an der Zahl der Studierenden ist die Katholische<br />
Fachhochschule <strong>Freiburg</strong> (KFH) unter ihnen die größte. Ca. 1000 Studentinnen<br />
und Studenten (und damit rund ein Drittel der an baden-württembergischen<br />
Fachhochschulen des Sozialwesens eingeschriebenen Studierenden)<br />
sind in den Studiengängen Sozialarbeit, Sozialpädagogik, Heilpädagogik,<br />
Religionspädagogik, Pflegemanagement und Pflegepädagogik der KFH immatrikuliert.<br />
Die Studiengänge Heilpädagogik, Katholische Religionspädagogik<br />
und Pflegepädagogik können in Baden-Württemberg nur an der KFH <strong>Freiburg</strong><br />
studiert werden. Darüber hinaus werden zwei Studiengänge mit neuen akademischen<br />
Abschlüssen angeboten: Bachelor “Therapiemanagement” (BA) und<br />
“Master of International Non-Profit Administration” (M.A.). 34 Professorinnen<br />
und Professoren und Fachschulrätinnen und Fachschulräte sowie 170 Lehrbeauftragte<br />
bilden den Lehrkörper, 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in<br />
der Verwaltung der Hochschule tätig.<br />
Die KFH wurde zum 1.10.1971 aus mehreren Vorgängereinrichtungen gebildet<br />
und steht damit in einer langjährigen Tradition der Katholischen Kirche im<br />
Bereich des Ausbildungswesens für soziale Berufe. Rechtsträger der Hochschule<br />
ist eine Gemeinnützige GmbH, deren Gesellschafter die Erzdiözese<br />
<strong>Freiburg</strong>, die Diözese Rottenburg-Stuttgart, der Deutsche Caritasverband e.V.<br />
sowie der Caritasverband für die Erzdiözese <strong>Freiburg</strong> e.V. und der Caritasverband<br />
der Diözese Rottenburg-Stuttgart e.V. sind.<br />
Das Land Baden-Württemberg teilt sich mit den genannten Rechtsträgern die<br />
Finanzierung der staatlich anerkannten Hochschule. Die Hochschule selbst<br />
vergibt Diplome in allen Studiengängen und verleiht den Absolventen der<br />
Studiengänge des Sozialwesens die staatliche Anerkennung als Sozialarbeiter/in,<br />
Sozialpädagoge/in, Heilpädagoge/in.<br />
Selbstverwaltung<br />
Im Rahmen ihrer Verfassung verwaltet sich die Fachhochschule durch ihre<br />
Organe (Rektor, Senat, Dekane, Fachbereichsräte) selbst. In den Kollegialorganen<br />
bestimmen die Studierenden durch gewählte Vertreterinnen und<br />
Vertreter mit, und auch an der Wahl des Rektors/der Rektorin und der Dekane/<br />
Dekaninnen sind die Studierenden über ihre gewählten Vertreterinnen und<br />
Vertreter beteiligt. Die Verfassung der KFH sieht vor, dass sich die Studierenden<br />
in einer verfassten Studentenschaft zusammenschließen.<br />
Zur Wahrnehmung der spezifischen Interessen der weiblichen Hochschulangehörigen<br />
hat der Senat eine Frauenbeauftragte der Fachhochschule<br />
gewählt.
Aufgaben<br />
Durch ihre Verfassung sind der KFH Aufgaben in der Lehre, Weiterbildung und<br />
Forschung gestellt:<br />
6 Zuvörderst soll die KFH ihren Studierenden eine praxisorientierte Ausbildung<br />
auf wissenschaftlicher Grundlage vermitteln. Das spezifische Profil der KFH<br />
als Hochschule in kirchlicher Trägerschaft kommt zum Ausdruck in qualifizierter<br />
anwendungsorientierter Lehre und dem Bemühen ihrer Mitglieder,<br />
dem Leben aus christlicher Verantwortung Gestalt zu geben und einen<br />
engagierten Dienst am Menschen und an der Gesellschaft zu leisten.<br />
6 Die Verfassung der KFH stellt der Hochschule aber auch die Aufgabe, durch<br />
Weiterbildung zur Qualifizierung sozialer, pflegerischer und religionspädagogischer<br />
Arbeit beizutragen und sich durch die Wahrnehmung von Aufgaben<br />
der Forschung und Entwicklung an der wissenschaftlichen Fundierung<br />
und Weiterentwicklung sozialer, pflegerischer und religionspädagogischer<br />
Arbeit zu beteiligen. Struktureller Ort für Forschung, Entwicklung und<br />
Weiterbildung ist das 1996 gegründete Institut für Angewandte Forschung,<br />
Entwicklung und Weiterbildung (IAF). Sowohl in der Fort- und Weiterbildung<br />
wie in der Forschung wird die Dienstleistungsfunktion der KFH für die Region<br />
und für die Träger sozialer, pflegerischer und religionspädagogischer Arbeit,<br />
verbunden mit der Rückkoppelung von Erfahrungswissen in die Hochschule,<br />
sichtbar.<br />
Vereinigungen im Hochschulbereich<br />
Die KFH ist Bestandteil des nationalen und internationalen Hochschulsystems.<br />
Sie gehört deshalb einer Reihe deutscher und internationaler Vereinigungen im<br />
Hochschulbereich an. Auf regionaler Ebene ist sie Mitglied des Studentenwerks<br />
<strong>Freiburg</strong>, auf Landesebene gehört sie der Fachhochschul-Rektorenkonferenz<br />
Baden-Württemberg (RKF) und der Arbeitsgemeinschaft der Rektoren und<br />
Dekane des Sozial- und Gesundheitswesens (ARDSG) an, auf nationaler<br />
Ebene ist sie Mitglied der Deutschen Hochschulrektorenkonferenz (HRK), der<br />
Bundeskonferenz der Rektoren und Präsidenten kirchlicher Fachhochschulen<br />
in der Bundesrepublik Deutschland (RKF), der Arbeitsgemeinschaft der Rektoren<br />
und Präsidenten Katholischer Fachhochschulen (ARKF), des Fachbereichstages<br />
Soziale Arbeit, des Fachbereichstages Heilpädagogik, der Dekanekonferenz<br />
der Fachbereiche Religionspädagogik an Kath. Fachhochschulen<br />
und der Dekanekonferenz der Fachbereiche Pflege an Kath. Fachhochschulen.<br />
Zur Förderung der internationalen Beziehungen im Hochschulbereich ist die<br />
KFH Mitglied der Konföderation der Fachhochschulen und Höheren Fachschulen<br />
des Sozialwesens in der Region Oberrhein/Confédération des Ecoles<br />
Superieures en Travail Social de la Regio (RECOS).<br />
Auslandskontakte<br />
Besondere Aufmerksamkeit widmet die KFH ihren internationalen Beziehungen.<br />
Das zusammenwachsende Europa, aber auch die Entwicklung im osteuropäischen<br />
Raum stellen für die soziale, pflegerische und religionspädagogische<br />
Arbeit und die darin tätigen Fachkräfte große Herausforderungen
dar. Die soziale und pflegerische Arbeit braucht zunehmend Fachleute mit<br />
Auslandserfahrung und mit Wissen über die sozialpolitischen und gesundheitspolitischen<br />
Systeme in anderen Ländern. Die KFH will die Angehörigen der<br />
Hochschule auf diese Anforderungen vorbereiten und hat dazu ein Netz von<br />
Auslandsbeziehungen auf- und ausgebaut, in dessen Rahmen Studentenaustausch<br />
(Auslandssemester), bi- und multinationale Seminare, Dozentenaustausch<br />
und kooperative Forschungsprojekte geplant und realisiert werden<br />
können.<br />
Seit 1990 ist die KFH am ERASMUS/SOKRATES-Programm der Europäischen<br />
Union beteiligt, seit 1998 am Interreg-Programm der EU. In Kooperation mit<br />
Partnerhochschulen bietet die KFH die Zusatzlehrprogramme “Europäische<br />
Soziale Arbeit/European Social Work” und “Regio-Akademie für Soziale Arbeit<br />
/ Regio-Pôle de formation sur le travail social” an.<br />
Öffentlichkeitsarbeit<br />
Um die Öffentlichkeit über ihre Arbeit und über das Leben an der Hochschule<br />
zu informieren, gibt die KFH das einmal im Semester erscheinende KFH-<br />
Magazin FOCUS heraus. Aktuelle Informationen können auch über die Website<br />
der KFH (www.kfh-freiburg.de) abgerufen werden.
TERMINPLANUNG WINTERSEMESTER 2003/2004<br />
Lehrveranstaltungen<br />
Beginn der Lehrveranstaltungen<br />
06.10.2003<br />
(Hauptstudium)<br />
Einführungswoche (<strong>Grundstudium</strong>) 06.10. - 10.10.2003<br />
Beginn der Lehrveranstaltungen<br />
13.10.2003<br />
(<strong>Grundstudium</strong>)<br />
Ende der Lehrveranstaltungen 30.01.2004<br />
Prüfungen<br />
Wiederholungsprüfungen<br />
30.09. - 02.10.2003<br />
vom Sommersemester 2003<br />
Klausurwoche 02.02. - 06.02.2004<br />
Wiederholungsprüfungen<br />
29.03. - 31.03.2004<br />
vom Wintersemester 2003/2004<br />
Weihnachtsferien 22.12.03 - 06.01.2004<br />
Rückmeldung für das<br />
19.01. - 29.01.2004<br />
Sommersemester 2004<br />
Terminplanung Sommersemester 2004<br />
Beginn der Lehrveranstaltungen 29.03.2004<br />
Pfingstpause 01.06. - 04.06.2004<br />
Ende der Lehrveranstaltungen 16.07.2004<br />
Rückmeldung für das<br />
Wintersemester 2004/2005<br />
05.07. - 16.07.2004<br />
Prüfungen 19.07. - 23.07.2004
STUDIENZEITEN IM FACHBEREICH PFLEGE<br />
UND THERAPIEMANAGEMENT<br />
Wintersemester 2003/2004<br />
1. Semester 06.10. - 24.10.2003 (3 Wochen)<br />
24.11. - 12.12.2003 (3 Wochen)<br />
19.01. - 31.01.2004 (2 Wochen)<br />
3. Semester 06.10. - 17.10.2003 (2 Wochen)<br />
17.11. - 05.12.2003 (3 Wochen)<br />
12.01. - 31.01.2004 (3 Wochen)<br />
5. Semester Studientage n.V.<br />
7. Semester 13.10. - 07.11.2003 (4 Wochen)<br />
08.12. - 19.12.2003 (2 Wochen)<br />
12.01. - 23.01.2004 (2 Wochen)<br />
Sommersemester 2004<br />
2. Semester 13.04. - 30.04.2004 (3 Wochen)<br />
01.06. - 18.06.2004 (3 Wochen)<br />
12.07. - 23.07.2004 (2 Wochen)<br />
4. Semester 29.03. - 08.04.2004 (2 Wochen)<br />
03.05. - 21.05.2004 (3 Wochen)<br />
28.06. - 16.07.2004 (3 Wochen)<br />
6. Semester 29.03. - 08.04.2004 (3 Wochen)<br />
03.05. - 21.05.2004 (3 Wochen)<br />
05.07. - 23.07.2004 (3 Wochen)<br />
8. Semester 13.04. - 07.05.2004 (4 Wochen)<br />
21.06. - 16.07.2004 (4 Wochen)<br />
Wintersemester 2004/2005<br />
4.10.2004 bis 28.01.2005
VERTRETER DER TRÄGERSCHAFT IM VERWALTUNGSRAT<br />
Appel, Bernhard Msgr., Direktor des Caritasverbandes für<br />
die Erzdiözese <strong>Freiburg</strong> e. V.<br />
Cremer, Prof. Dr. Georg Generalsekretär<br />
Deutscher Caritasverband e. V. <strong>Freiburg</strong><br />
Engler, Egon Direktor des<br />
Caritasverbandes <strong>Freiburg</strong>-Stadt e. V.<br />
Keck, Dr. Fridolin Domkapitular<br />
Erzbischöfliches Ordinariat <strong>Freiburg</strong><br />
Kraft, Martin Referatsleiter Büro Generalsekretariat<br />
Deutscher Caritasverband e.V. <strong>Freiburg</strong>,<br />
Geschäftsführer KFH <strong>Freiburg</strong> GGmbH<br />
Kreidler, Dr. Johannes Weihbischof<br />
Bischöfliches Ordinariat Rottenburg<br />
Lenninger, Dr. phil.<br />
Peter Franz<br />
Referatsleiter Berufliche Bildung<br />
Deutscher Caritasverband e. V. <strong>Freiburg</strong><br />
Metzger, Dieter Juristischer Sachbearbeiter<br />
Bischöfliches Ordinariat Rottenburg<br />
Schmid, Dr. Angelika Rechtsdirektorin<br />
Erzbischöfliches Ordinariat <strong>Freiburg</strong><br />
Schmitz-Elsen, Josef Vorsitzender des Verwaltungsrates<br />
Generalsekretär i. R.<br />
Tripp, Wolfgang Msgr., Diözesan-Caritasdirektor,<br />
Caritasverband der Diözese Rottenburg-<br />
Stuttgart e. V.<br />
Wunderlich, Theresia Abteilungsleiterin Soziales und Gesundheit<br />
Deutscher Caritasverband e. V. <strong>Freiburg</strong><br />
Zinnecker, Sigrid Bereichsleiterin Caritasverband für die<br />
Diözese Rottenburg-Stuttgart e. V.<br />
Beratende Mitglieder:<br />
Steinebach, Prof. Dr. Rektor KFH <strong>Freiburg</strong><br />
Christoph<br />
Thiele, Prof. Günter<br />
Kösler, Prof. Dr. Edgar<br />
Prorektor KFH <strong>Freiburg</strong><br />
Prorektor KFH <strong>Freiburg</strong>, Leiter des IAF
SELBSTVERWALTUNG DER KATH. FACHHOCHSCHULE<br />
Rektor Prof. Dr. Christoph Steinebach<br />
Karlstr. 63, Zi. 3405, Tel. 200 485<br />
Sprechzeiten: Mi 9.45 - 11.15 Uhr<br />
Sekretariat Barbara Herr<br />
Karlstr. 63, Zi. 3404 , Tel. 200 476<br />
E-Mail: rektorat@kfh-freiburg.de<br />
Sekretariat<br />
Internationale Beziehungen<br />
Prorektor<br />
und<br />
Senatsbeauftragter für das<br />
<strong>Grundstudium</strong><br />
Sekretariat<br />
<strong>Grundstudium</strong><br />
Sekretariat<br />
Qualitätsmanagement und<br />
Controlling<br />
Prorektor<br />
und Leiter des IAF<br />
Natascha Gimbel<br />
Karlstr. 63, Zi. 3311, Tel,. 200 530<br />
E-Mail: international@kfh-freiburg.de<br />
Prof. Günter Thiele<br />
Karlstr. 63, Zi. 3313, Tel. 200 490<br />
Sprechzeit: Mi 12.30 - 13.30 Uhr und n.V.<br />
Ilona Dvorak (vormittags)<br />
Karlstr. 63, Zi. 3312, Tel. 200 491<br />
E-Mail: grundstudium@kfh-freiburg.de<br />
Annette Scheydecker (nachmittags)<br />
Karlstr. 63, Zi. 3312, Tel. 200 491<br />
E-Mail: controlling@kfh-freiburg.de<br />
Prof. Dr. Edgar Kösler<br />
Karlstr. 63, Zi. 3409, Tel. 200 523<br />
Sprechzeiten: Mi 10.00 - 11.00 Uhr<br />
Sekretariat Heide Bronner-Benz<br />
Karlstr. 63, Zi. 3408 , Tel. 200 736<br />
E-Mail: iaf@kfh-freiburg.de
MITGLIEDER DES SENATS IM STUDIENJAHR 2002/2003<br />
(Bis zur Neuwahl im Oktober 2003)<br />
Prof. Dr. Christoph<br />
Steinebach<br />
Rektor<br />
Prof. Günter Thiele Prorektor<br />
Prof. Dr. Edgar Kösler Prorektor, Leiter des IAF<br />
Dekan FB Management<br />
Prof. Dr. Stephanie Bohlen Dekanin FB<br />
Soziale Arbeit<br />
Prof. Dr. Herbert Pielmaier Dekan FB HP<br />
Prof. Gerhard Rummel Dekan FB RP<br />
Prof. Dr. Burkhard Werner Dekan FB Pflege<br />
Prof. DDr. Gerhard Hammer Vertr. d. Professoren/-innen<br />
Prof. Dr. Karl-Heinz Menzen Vertr. d. Professoren/-innen<br />
Prof. Dr. Klaus Schilling Vertr. d. Professoren/-innen<br />
Prof. Dr. Hermann<br />
Brandenburg<br />
Vertr. d. Professoren/-innen<br />
FB SP<br />
FB HP<br />
FB RP<br />
FB Pflege<br />
Günther Grosser Vertr. d. Fachschulräte/-innen<br />
Prof. Wolfram Schlabach Vertreter der Lehrbeauftragten<br />
Matthias Linnenschmidt Vertr. d. Verwaltungsmitarbeiter/innen<br />
Petra Groß Verwaltungsdirektorin<br />
Ursula Otto Vertr. der Studierenden FB Soz.Arb.<br />
Sebastian Vogt Vertr. der Studierenden FB SP<br />
Astrid Heinrich Vertr. der Studierenden FB HP<br />
Maria Matt Vertr. der Studierenden FB RP<br />
Uta Holz Vertr. der Studierenden FB Pflege
FACHBEREICH SOZIALE ARBEIT<br />
Dekanin Prof. Dr. Stephanie Bohlen<br />
Karlstr. 63, Zi. 3316, Tel. 200 482<br />
E-Mail: bohlen@kfh-freiburg.de<br />
Sprechzeiten: Do 9.30 - 11.00 Uhr<br />
Prodekanin Prof. Katharina Megnet<br />
Karlstr. 63, Zi. 3214, Tel. 200 526<br />
E-Mail: megnet@kfh-freiburg.de<br />
Sprechzeiten: Di 10.30 -11.15 Uhr<br />
Studiengangsleiter<br />
Sozialarbeit<br />
Studiengangsleiter<br />
Sozialpädagogik<br />
Prof. Werner Nickolai<br />
Karlstr. 63, Zi. 3219<br />
E-Mail: nickolai@kfh-freiburg.de<br />
Sprechzeiten: siehe Aushang<br />
Prof. Gerhard Veith<br />
Karlstr. 63, Zi. 3219<br />
E-Mail: veith@kfh-freiburg.de<br />
Sprechzeiten: siehe Aushang<br />
Sekretariat Bettina Braun (vormittags)<br />
Karlstr. 63, Zi. 3315, Tel. 200 483<br />
E-Mail: braun@kfh-freiburg.de<br />
Sekretariat Irma Hanselmann (nachmittags)<br />
Karlstr. 63, Zi. 3315, Tel. 200 483<br />
E-Mail: hanselmann@kfh-freiburg.de<br />
Sekretariat Marianne Hopmeier (vormittags)<br />
Karlstr. 63, Zi. 3314, Tel. 200 517<br />
E-Mail: hopmeier@kfh-freiburg.de<br />
Praxisamt<br />
Soziale Arbeit<br />
Sozialarbeit<br />
Sozialpädagogik<br />
Prof. Dr. Cornelia Kricheldorff<br />
Karlstr. 63, Zi. 3115, Tel. 200 441<br />
Sprechzeiten: nach Rücksprache mit<br />
Sekretariat Praxisamt<br />
Prof. Dr. Jürgen Winkler<br />
Prof. Gerhard Veith<br />
Sekretariat Karola Bärmann (vormittags)<br />
Karlstr. 63, Zi. 3106, Tel. 200 169<br />
Sprechzeiten: Mo - Do 10.00-11.30 Uhr<br />
Fr 9.00-10.00 Uhr<br />
E-Mail: baermann@kfh-freiburg.de
Mitglieder im Fachbereichsrat des Fachbereiches Soziale Arbeit<br />
im Studienjahr 2003/2004<br />
Prof. Dr. Stephanie Bohlen<br />
Prof. Katharina Megnet<br />
Dekanin<br />
Prodekanin<br />
Prof. DDr. Michael N. Ebertz<br />
Prof. DDr. Winfried Effelsberg<br />
Prof. DDr. Gerhard Hammer<br />
Prof. Dr. Cornelia Kricheldorff<br />
Prof. Werner Nickolai<br />
Prof. Dr. Gerhard Oswald<br />
Prof. Dr. Engelbert Schinzler<br />
Prof. Dr. Jürgen Schwab<br />
Prof. DDr. Nikolaus Sidler<br />
Prof. Gerhard Veith<br />
Prof. Dr. Jürgen Winkler<br />
Fachschulrat Günther Grosser<br />
Fachschulrätin Annelore Möller<br />
Fachschulrätin Monika Renz<br />
Fachschulrat Karl-Georg Schönenborn<br />
Martin Hänsler<br />
André Paul Stöbener<br />
Alexander Hässler<br />
Matthias Locher<br />
Katharina Mennig<br />
Marcus Müller<br />
Thorsten Knuth Müller<br />
Ursula Otto<br />
Marion Staudhammer<br />
Verena Supper<br />
Lukas Trägner<br />
Bettina Braun /<br />
Marianne Hopmeier<br />
Vertreter der Lehrbeauftragten<br />
Vertreter der Lehrbeauftragten<br />
Vertreter der Studierenden<br />
Vertreter der Studierenden<br />
Vertreterin der Studierenden<br />
Vertreter der Studierenden<br />
Vertreter der Studierenden<br />
Vertreterin der Studierenden<br />
Vertreterin der Studierenden<br />
Vertreterin der Studierenden<br />
Vertreter der Studierenden<br />
Vertreterin der übrigen Mitarbeiter/innen
FACHBEREICH HEILPÄDAGOGIK<br />
Dekan Prof. Dr. Herbert Pielmaier<br />
Karlstr. 38, Zi. 2225, Tel. 200 268<br />
Sprechzeiten: Mo 11.30 - 13.00 Uhr<br />
und n. V.<br />
E-Mail: pielmaier@kfh-freiburg.de<br />
Prodekan Prof. Dr. Karl-Heinz Menzen<br />
Karlstr. 38, Zi. 2307, Tel. 200 261<br />
Sprechzeiten: Di 12.00 - 13.00 Uhr<br />
E-Mail: menzen@kfh-freiburg.de<br />
Sekretariat Else Dimmig-Hein<br />
Karlstr. 38, Zi. 2227, Tel. 200 260<br />
E-Mail: heilpaedagogik@kfh-freiburg.de<br />
Organisation und Vermittlung<br />
von Praktika<br />
Gabriele Weiss<br />
Karlstr. 38, Zi. 2308, Tel 200 495<br />
Sprechzeiten: Di 10.00 - 11.00 Uhr<br />
und n.V.<br />
E-Mail: weiss@kfh-freiburg.de<br />
FRAUENBEAUFTRAGTE<br />
Mitglieder im Fachbereichsrat des Fachbereiches Heilpädagogik<br />
im Studienjahr 2003/2004<br />
Prof. Dr. Herbert Pielmaier<br />
Prof. Dr. Karl-Heinz Menzen<br />
Prof. Dr. Friederike Berger-Sallawitz<br />
Prof. Reinhard Markowetz<br />
Prof. Traudel Simon<br />
Prof. Dr. Christoph Steinebach<br />
Fachschulrätin Gabriele Weiss<br />
Ullrich Böttinger<br />
Annette Geiger<br />
Kristina Licht<br />
Thorsten Merz<br />
Susanne Schnitter<br />
Dekan<br />
Prodekan<br />
Vertreter der Lehrbeauftragten<br />
Vertreterin der Lehrbeauftragten<br />
Vertreterin der Studierenden<br />
Vertreter der Studierenden<br />
Vertreterin der Studierenden<br />
Else Dimmig-Hein Vertreterin der übrigen Mitarbeiter/innen
FACHBEREICH RELIGIONSPÄDAGOGIK<br />
Dekan Prof. Gerhard Rummel<br />
Karlstr. 63, Zi. 3310, Tel. 200 471<br />
Sprechzeiten: Mi 11.30 - 12.15 Uhr<br />
Prodekan Prof. Dr. Klaus Schilling<br />
Karlstr. 63, Zi. 3210, Tel. 200 443<br />
Sprechzeiten: Mo 16.30 - 17.15 Uhr<br />
und n. V.<br />
Sekretariat Gabriele Linke<br />
Karlstr. 63, Zi. 3309, Tel. 200 472<br />
E-Mail:<br />
religionspaedagogik@kfh-freiburg.de<br />
Vermittlung und Organisation<br />
von Praktika<br />
Prof. Gerhard Rummel<br />
Karlstr. 38, Zi. 3310, Tel. 200 471<br />
Sprechzeiten: Mi 11.30 - 12.15 Uhr<br />
Mitglieder im Fachbereichsrat des Fachbereiches Religionspädagogik<br />
im Studienjahr 2003/2004<br />
Prof. Gerhard Rummel<br />
Prof. Dr. Klaus Schilling<br />
Dekan<br />
Prodekan<br />
Prof. Dr. Erika Heusler<br />
Prof. Dr. Sabine Pemsel-Maier<br />
Prof. Ernst A. Schmitz<br />
NN Vertr. der Lehrbeauftragten<br />
Bettina Derndinger<br />
Daniela Frey<br />
Kerstin Ploil<br />
Vertreterin der Studierenden<br />
Vertreterin der Studierenden<br />
Vertreterin der Studierenden<br />
Gabriele Linke Vertreterin der übrigen Mitarbeiter/innen
FACHBEREICH PFLEGE<br />
Dekan Prof. Dr. Burkhard Werner<br />
Karlstr. 63, Zi. 3308, Tel. 200 737<br />
E-Mail: werner@kfh-freiburg.de<br />
Sprechzeiten: Mo 13.00 - 14.00 Uhr<br />
und nach Vereinbarung<br />
Prodekan Prof. Dr. Hermann Brandenburg<br />
Karlstr. 63, Zi. 3124, Tel. 200 672<br />
E-Mail: brandenburg@kfh-freiburg.de<br />
Sprechzeiten: Di 13.00 - 14.00 Uhr in den<br />
Studienzeiten des Fachbereichs<br />
Fr 13.00 - 14.00 Uhr außerhalb<br />
der Präsenzzeiten<br />
und nach Vereinbarung<br />
Sekretariat Annette Scheydecker (vormittags)<br />
Claudia Kreutner (nachmittags)<br />
Karlstr. 63, Zi. 3307, Tel. 200 602,<br />
Fax 200 166<br />
E-Mail: pflege@kfh-freiburg.de<br />
Assistent im Fachbereich Wilhelm Gertsen<br />
Diplom-Pflegepädagoge (FH)<br />
Karlstr. 63, Zi. 3117, Tel. 200 669<br />
E-Mail: pflegeass@kfh-freiburg.de
Mitglieder im Fachbereichsrat des Fachbereiches Pflege<br />
im Studienjahr 2003/2004<br />
Prof. Dr. Burkhard Werner<br />
Prof. Dr. Hermann<br />
Brandenburg<br />
Prof. Dr. Edgar Kösler<br />
Prof. Dr. Brigitte Scherer<br />
Prof. Dr. Jochen Schmerfeld<br />
Prof. Günter Thiele<br />
Dekan<br />
Prodekan<br />
Prof. Dr. Thomas Klie in Angelegenheiten Gerontologischer Pflege<br />
mit beratender Stimme<br />
Birgit Sennenwald Etzel<br />
Bernd Haag<br />
Martina Bivort<br />
Jens Klebig<br />
Ulrike Schweizer<br />
Vertreterin der Lehrbeauftragten<br />
Vertreter der Lehrbeauftragten<br />
Vertreterin der Studierenden<br />
Vertreter der Studierenden<br />
Vertreterin der Studierenden<br />
Annette Scheydecker Vertreterin der übrigen Mitarbeiter/innen
FACHBEREICH MANAGEMENT<br />
Dekan Prof. Dr. Edgar Kösler<br />
Karlstr. 63, Zi. 3409, Tel. 200 523<br />
Sprechzeiten: Mi 10.00 - 11.00 Uhr<br />
Sekretariat Natascha Gimbel<br />
Karlstr. 63, Zi. 3311, Tel. 200 530<br />
E-Mail: management@kfh-freiburg.de<br />
Assistentin im Fachbereich Simone Hruschka,<br />
Bachelor of Science in Physiotherapy,<br />
Assistentin für den Studiengang<br />
Therapiemanagement,<br />
Karlstr. 63, Zi. 3118, Tel. 200 750<br />
E-Mail: management@kfh-freiburg.de<br />
Vermittlung und Organisation Prof. Dr. Edgar Kösler<br />
von Praktika<br />
Mitglieder im Fachbereichsrat des Fachbereiches Management<br />
Prof. Dr. Edgar Kösler Dekan<br />
Prof. Gerhard Rummel<br />
Prof. Dr. Brigitte Scherer<br />
Prof. Dr. Christoph Steinebach<br />
Prof. Günter Thiele<br />
Prof. Dr. Burkhard Werner<br />
Prof. Dr. Jürgen Winkler<br />
Gerhard Geckle<br />
Günter Tomberg<br />
Matthias Ehret<br />
Bärbel Gießler<br />
Djahan Salar<br />
Monika Schiffert<br />
Vertreter der Lehrbeauftragten<br />
Vertreter der Lehrbeauftragten<br />
Vertreter der Studierenden<br />
Vertreterin der Studierenden<br />
Vertreter der Studierenden<br />
Vertreterin der Studierenden<br />
Natascha Gimbel Vertreterin der übrigen Mitarbeiter/innen
INSTITUT FÜR ANGEWANDTE FORSCHUNG, ENTWICK-<br />
LUNG UND WEITERBILDUNG (IAF)<br />
Institutsleiter Prof. Dr. Edgar Kösler<br />
Karlstr. 63, Zi. 3409 , Tel. 200 523<br />
Sprechzeiten: Mi 10.00 - 11.00 Uhr<br />
Stellvertretender<br />
Institutsleiter<br />
Prof. Dr. Dr. Winfried Effelsberg<br />
Karlstr. 63, Zi. 3211, Tel. 200 158<br />
Sprechzeiten: Di 13.15 - 14.00 Uhr<br />
Sekretariat Heide Bronner-Benz<br />
Karlstr. 63, Zi. 3408 , Tel. 200 736<br />
E-Mail: iaf@kfh-freiburg.de<br />
Kommission für Forschung, Entwicklung u. Weiterbildung<br />
Prof. Dr. Edgar Kösler Institutsleiter<br />
Prof. Dr. Dr. Winfried<br />
Effelsberg<br />
stellvertretender Institutsleiter<br />
Heide Bronner-Benz<br />
Prof. Dr. Karl-Heinz Menzen<br />
Prof. Werner Nickolai<br />
Prof. Dr. Klaus Schilling<br />
Prof. Dr. Burkhard Werner<br />
Beirat des IAF<br />
Vertreterin der Mitarbeiter/-innen des IAF<br />
Lothar Böhler Direktor der Stiftungsverwaltung <strong>Freiburg</strong><br />
Beate Buchstor Pflegedirektorin Univ.klinikum <strong>Freiburg</strong><br />
Hans-Peter Burget DiCV <strong>Freiburg</strong><br />
Dr. Bernd Dallmann Wirtschaft und Touristik <strong>Freiburg</strong><br />
Bernd Hausmann Landeswohlfahrtsverband Baden<br />
Birgit Kremmers-Knick Fortbildungs-Akademie DCV<br />
Klaus Ritter Erzbischöfliches Seelsorgeamt <strong>Freiburg</strong><br />
Hansjörg Seeh Erster Bürgermeister Stadt <strong>Freiburg</strong> a.D.<br />
Wilfried Telkämper Carl Duisberg Gesellschaft<br />
Prof. Dr. Werner<br />
Tzscheetzsch<br />
Albert-Ludwigs-Universität <strong>Freiburg</strong><br />
Brigitte Zindstein Bischöfl. Ordinariat Rottenburg-Stuttgart<br />
Sigrid Zinnecker DiCV Rottenburg-Stuttgart
MITGLIEDER<br />
DES ZENTRALEN PRÜFUNGSAUSSCHUSSES<br />
Keller, Karlheinz Vorsitzender des Zentralen<br />
Prüfungsausschusses<br />
Prof. Dr. Steinebach,<br />
Christoph<br />
Rektor der KFH<br />
Stellvertretender Vorsitzender<br />
Prof. Thiele, Günter Prorektor der KFH,<br />
Prof. Dr. Kösler, Edgar Prorektor der KFH, Leiter des IAF<br />
Dekan FB Management<br />
Prof. Dr. Stephanie Bohlen Dekanin FB Soziale Arbeit<br />
Prof. Dr. Pielmaier, Herbert Dekan FB Heilpädagogik<br />
Prof. Gerhard Rummel Dekan FB Religionspädagogik<br />
Prof. Dr. Werner, Burkhard Dekan FB Pflege<br />
Linnenschmidt, Matthias Leiter des Prüfungsamtes<br />
Vorsitzende der Prüfungsausschüsse der Fachbereiche<br />
Adam, Hansjörg Prüfungsausschuss Soziale Arbeit<br />
Prüfungsausschuss Management<br />
Dr. Geitner, Horst Prüfungsausschuss Religionspädagogik<br />
Michaelis-Meier, Ingrid Prüfungsausschuss Heilpädagogik<br />
Dr. Hein, Hermann Prüfungsausschuss Pflege
VERWALTUNG<br />
Verwaltungsdirektorin Petra Groß<br />
Karlstr. 63, Zi. 3403, Tel. 200 492<br />
Sprechzeiten: Mo - Do 10.00-12.00 Uhr<br />
und n. V.<br />
Stundenplanung/<br />
Raumvergabe<br />
Isabella Wehrle<br />
Karlstr. 63, Zi. 3317, Tel. 200 630<br />
E-Mail: stundenplan@kfh-freiburg.de<br />
Sprechzeiten: tägl. 10.00 - 12.00 Uhr<br />
Sekretariat und Kasse Karin Woworsky<br />
Karlstr. 63, Zi. 3402, Tel. 200 488<br />
E-Mail:<br />
verwaltungsdirektion@kfh-freiburg.de<br />
Öffnungszeiten: tägl. 8.30 - 12.00 Uhr<br />
Buchhaltung Karin Rombach<br />
Karlstr. 63, Zi. 3407, Tel. 200 496<br />
E-Mail: buchhaltung@kfh-freiburg.de<br />
Sprechzeiten: Mo - Do 8.00-12.00 Uhr<br />
Bankverbindungen - Bank für Sozialwirtschaft, Karlsruhe<br />
BLZ 660 205 00 Konto Nr. 1 778 000<br />
- Postgiro Karlsruhe<br />
BLZ 660 100 75<br />
Kto Nr. 15 84 66 - 755<br />
EDV Zentrum<br />
Leiter der<br />
Betriebseinheit EDV<br />
Nikolaus Müller-Büchele<br />
Karlstr. 63, Zi. 3005, Tel.200 591<br />
Kay-Michael Schulze<br />
Karlstr. 63, Zi. 3006, Tel. 200 162<br />
EDV-Räume: Karlstr. 34, Zi. 1303,1304<br />
E-Mail: edv@kfh-freiburg.de
PRÜFUNGSAMT<br />
Leiter Matthias Linnenschmidt<br />
Karlstr.34, Zi. 1112 ,Tel. 200 497<br />
Sprechzeiten:<br />
Montag - Freitag 9.00 - 12.00 Uhr u. n. V.<br />
Sachbearbeitung Irmgard Smikalla<br />
Karlstr. 34, Zi. 1114 , Tel. 200 481<br />
Sprechzeiten:<br />
Montag 13.30 - 15.30 Uhr<br />
Dienstag - Donnerstag 10.00 - 11.30 Uhr<br />
Sachbearbeitung Brunhilde Schenk<br />
Karlstr. 34, Zi. 1114, Tel. 200 474<br />
Sprechzeiten:<br />
Montag 13.30 - 15.30 Uhr<br />
Dienstag - Donnerstag 10.00 - 11.30 Uhr<br />
Sachbearbeitung für den<br />
Fachbereich Pflege<br />
E-Mail: pruefungsamt@kfh-freiburg.de<br />
Annette Scheydecker<br />
Karlstr. 63, Zi. 3307, Tel. 200 602<br />
E-Mail:pflege@kfh-freiburg.de<br />
Sprechzeiten: Mo - Mi 8.30 - 11.30 Uhr<br />
Do - Fr 13.00 - 15.00 Uhr
STUDENTENSEKRETARIAT<br />
Leiter Matthias Linnenschmidt<br />
Karlstr. 34, Zi. 1112, Tel. 200 497<br />
Sprechzeiten:<br />
Montag - Freitag 9.00 - 12.00 Uhr u.n.V.<br />
Sachbearbeitung Roswitha Graf<br />
Maha Malky<br />
Karlstr.34, Zi. 1115, Tel. 200 486<br />
E-Mail:<br />
studentensekretariat@kfh-freiburg.de<br />
Sachbearbeitung<br />
für Bewerbungen<br />
Öffnungszeiten:<br />
Montag - Donnerstag 10.00 - 12.00 Uhr<br />
Montag und Donnerstag 13.30 - 15.30 Uhr<br />
Rosemarie Wehrle<br />
Karlstr. 34, Zi. 1116, Tel. 200 479<br />
E-Mail:<br />
bewerbungsbuero@kfh-freiburg.de<br />
Öffnungszeiten:<br />
Montag - Donnerstag 10.00 - 12.00 Uhr<br />
Essenmarken Das Mittagessen kann in der Kantine des<br />
DCV täglich in der Zeit von 11.30 - 13.30<br />
Uhr eingenommen werden.<br />
Die Essenmarken zum Preis von L 2,20<br />
sind im Studentensekretariat erhältlich von:<br />
Montag - Donnerstag 10.00 - 12.00 Uhr.<br />
Sie sind vom Wochentag unabhängig während<br />
der zwei aufgedruckten Wochen<br />
gültig.<br />
(Nähere Info im Studentensekretariat).
WICHTIGE ANSCHRIFTEN UND ANSPRECHPARTNER/<br />
ANSPRECHPARTNERINNEN<br />
Frauenbeauftragte:<br />
Gabriele Weiss, Dipl.Sozialpäd., Dipl.Heilpäd. / FH<br />
Stellvertretende Frauenbeauftragte:<br />
Prof. Dr. Sabine Pemsel-Maier<br />
Initiativen:<br />
Sonderlehrauftrag im Rahmen des Edith-Stein-Programms:<br />
Die Frauenbeauftragten der KFH initiieren und finanzieren im Rahmen des<br />
Edith-Stein-Programmes einen Sonderlehrauftrag, der Studentinnen aller<br />
Fachbereiche zur Verfügung steht und in dem regulär ein Schein oder<br />
Leistungsnachweis erworben werden kann. Er hat zum Ziel, junge<br />
Dozentinnen zu fördern. Gleichzeitig sollen auf diesem Weg<br />
frauenspezifische Fragestellungen thematisiert werden.<br />
Geschlechterforschung ("gender studies"):<br />
Die Geschlechterforschung, die Frauen- und Männerforschung umfasst,<br />
untersucht die soziale, kulturelle und historische Dimension (“gender”) von<br />
Mannsein und Frausein. Sie fragt nach bestehenden Rollenzuschreibungen<br />
und -erwartungen, nach Faktoren für die Konstitution weiblicher und<br />
männlicher Identität sowie nach dem Verhältnis der Geschlechter<br />
zueinander. Während die gender-studies in den Hochschulen der USA<br />
mittlerweile eine feste Institution darstellen, müssen sie sich in Deutschland<br />
erst noch etablieren. Die KFH hat das Ziel, sie in Form verschiedener<br />
Veranstaltungen in ihrem Lehrangebot zu verankern und weiter<br />
auszubauen.
BAföG-Förderung BAföGbeauftragter der FHS<br />
Prof. Günter Thiele<br />
Fachbereich Pflege<br />
Habsburgerstr. 97, Zi. 410, Tel. 200 662<br />
Sprechzeiten: Mi 12.30 - 13.30 Uhr<br />
und n.V.<br />
Darlehen/Stundung Vorsitzender des Förderungsausschusses<br />
und Beratung:<br />
Prof. Günter Thiele<br />
Fachbereich Pflege<br />
Habsburgerstr. 97, Zi. 410, Tel. 200 662<br />
Sprechzeiten: Mi 12.30 - 13.30 Uhr<br />
und n. V.<br />
Behindertenfragen Matthias Linnenschmidt<br />
Leiter des Studentensekretariates<br />
Karlstr. 34, Zi. 1112, Tel. 200 497<br />
Sprechzeiten: Mo - Fr 9.00-12.00 Uhr<br />
und n. V.<br />
Hausmeister Oliver Eck<br />
Thomas Luhr<br />
Tel. 200 550<br />
Bibliotheken<br />
Deutscher Caritasverband<br />
Karlstr. 40<br />
79104 <strong>Freiburg</strong><br />
Universität <strong>Freiburg</strong><br />
Werthmannplatz 2<br />
79098 <strong>Freiburg</strong><br />
Pädagogische Hochschule<br />
Kunzenweg 21<br />
79117 <strong>Freiburg</strong><br />
Stadtbibliothek <strong>Freiburg</strong><br />
Münsterplatz 17<br />
79098 <strong>Freiburg</strong><br />
Tel. 200 240<br />
Öffnungszeiten:<br />
Montag 9.30 bis 17.30 Uhr<br />
Dienstag bis Freitag 9.30 bis 16.30 Uhr<br />
Tel. 203 - 3918<br />
203 - 3940<br />
Tel. 682 - 0<br />
Tel. 201 - 2207
STUDENTENWERK FREIBURG<br />
Amt für<br />
Ausbildungsförderung<br />
Schreiberstr. 12 - 16<br />
79098 <strong>Freiburg</strong><br />
Tel. 0761 / 2101 - 347 (A - Jo)<br />
- 266 (Jp - Z)<br />
Weitere Leistungen:<br />
Die Katholische Fachhochschule <strong>Freiburg</strong> gehört zum Betreuungsbereich<br />
des Studentenwerks <strong>Freiburg</strong>. Folgende Einrichtungen stehen den Nutzern<br />
im Rahmen der Regelungen des Studentenwerks zur Verfügung: Mensen<br />
und Cafeterien, Darlehenskasse, Härtefonds für Zuschüsse, Diebstahl-,<br />
Haftpflicht- und Unfallversicherung, Wohnheime, Zimmervermittlung,<br />
Krabbelstuben, Psychotherapeutische Beratung, Sozialberatung,<br />
Rechtsberatung.<br />
ALLGEMEINER HOCHSCHULSPORT<br />
Allgemeiner Hochschulsport<br />
der <strong>Freiburg</strong>er Hochschulen<br />
Schwarzwaldstr. 175<br />
79117 <strong>Freiburg</strong><br />
Tel. 0761 / 203 4513<br />
Die KFH <strong>Freiburg</strong> hat mit der Universität <strong>Freiburg</strong> in einem Kooperationsvertrag<br />
über die Beteiligung am Hochschulsport der Albert-Ludwigs-<br />
Universität und der Pädagogischen Hochschule vereinbart, dass alle<br />
Angehörigen der KFH in der Regel kostenlos an den Angeboten des<br />
Allgemeinen Hochschulsports in <strong>Freiburg</strong> teilnehmen können. Derzeit werden<br />
über 60 Sportarten angeboten, wöchentlich nehmen zwischen 5000 und<br />
6000 Studierende und Bedienstete der <strong>Freiburg</strong>er Hochschulen am<br />
Hochschulsport teil. Eine Programm-Broschüre über die Angebote im<br />
Wintersemester 2003/2004 ist im Studentensekretariat der KFH erhältlich.<br />
Weitere Informationen: www.uni-freiburg.de/ifss/www/ifss.htm
HOCHSCHUL- UND BILDUNGSEINRICHTUNGEN<br />
Evangelische Fachhochschule<br />
Hochschule für Soziale Arbeit, Diakonie und Religionspädagogik<br />
Buggingerstr. 38<br />
79114 <strong>Freiburg</strong><br />
Tel. 47812-0<br />
Albert-Ludwigs-Universität<br />
Zentrale Studienberatungsstelle<br />
Sedanstr. 6<br />
79098 <strong>Freiburg</strong><br />
Tel. 203 - 4246<br />
Fax 203 - 4409<br />
Pädagogische Hochschule<br />
Kunzenweg 21<br />
79117 <strong>Freiburg</strong><br />
Tel. 682 - 0<br />
Staatliche Hochschule für Musik<br />
Schwarzwaldstr. 141<br />
79102 <strong>Freiburg</strong><br />
Tel. 31915 - 0
KATHOLISCHE HOCHSCHULGEMEINDE (<strong>KH</strong>G) AN DER<br />
KFH<br />
Karlstr. 38, 79104 <strong>Freiburg</strong>, Zi. 2131,<br />
Tel. 200-439, Fax 200-435, E-Mail: khg@kfh-freiburg.de<br />
Leiter der <strong>KH</strong>G Bernhard Huber<br />
Sprechzeiten: Mo 10.00-12.00 Uhr<br />
und n.V.<br />
<strong>KH</strong>G-Referentin Beate Jörg<br />
Sprechzeiten: Di 15.00-17.00 Uhr<br />
Mi 11.00-12.00 Uhr<br />
und n.V.<br />
Priester, <strong>KH</strong>G an der KFH N.N.<br />
Semester-EröffnungsgottesdienstSemester-Schlussgottesdienst<br />
Dienstag, 7. Oktober 2003, 12.00 Uhr,<br />
Aula 2000, anschließend Sektempfang<br />
Mittwoch, 4. Februar 2004, 18.00 Uhr,<br />
im » Raum « (Haus 2)<br />
Die Katholische Hochschulgemeinde möchte...<br />
... für Studierende Treffpunkte, Begegnungsräume und Räume der Geborgenheit<br />
in der zunehmenden Anonymität und Unübersichtlichkeit<br />
schaffen.<br />
... vielfältige Hilfe, Orientierung und Unterstützung geben.<br />
... Anstöße und Auseinandersetzungen zu wichtigen Fragen und Themen<br />
geben.<br />
... Kirche erlebbar machen, eine Lebensgestaltung aus dem Glauben<br />
anregen und begleiten sowie im Feiern von Gottesdiensten unserem<br />
Glauben einen zeitgemäßen und lebendigen Ausdruck geben.<br />
Dazu haben wir an der Fachhochschule die verschiedensten Räume und<br />
Angebote...<br />
... Das <strong>KH</strong>G-Café jeden Dienstag von 13.30 bis 15.00 Uhr im <strong>KH</strong>G-Raum<br />
(Haus 2),<br />
... Gottesdienst jeden Mittwoch um 7.30 Uhr im » Raum « (Haus 2,<br />
1.OG),<br />
... thematische Veranstaltungen, Gesprächskreise,<br />
Wochenenden,Fahrten
WEITERE FREIBURGER HOCHSCHULGEMEINDEN<br />
Kath. Hochschulgemeinde<br />
Littenweiler (PH)<br />
Reinhold-Schneider-Str. 37<br />
79117 <strong>Freiburg</strong><br />
Kath. Hochschulgemeinde<br />
Edith Stein (Uni)<br />
Lorettostr. 24<br />
79100 <strong>Freiburg</strong><br />
Evangelische<br />
Studentengemeinde<br />
Turnseestr. 16<br />
79102 <strong>Freiburg</strong><br />
Tel. 7674-241<br />
Tel. 70529-0<br />
Tel. 741 44
GEISTLICHE BEGLEITUNG<br />
für Studentinnen und Studenten des Fachbereichs Religionspädagogik<br />
(offen auch für die Studierenden der anderen Fachbereiche)<br />
Die geistliche Studienbegleitung ist eine Einrichtung der Erzdiözese <strong>Freiburg</strong> und der<br />
Diözese Rottenburg-Stuttgart.<br />
Sie trägt die Verantwortung für den spirituellen Teil der Ausbildung von angehenden<br />
Gemeindereferentinnen und Gemeindereferenten. Damit bildet sie neben dem theoretischen<br />
Teil, der durch die Lehrveranstaltungen der katholischen Fachhochschule sichergestellt wird,<br />
und dem berufspraktischen Teil in der Verantwortung der Bewerberkreise, die dritte Säule in<br />
der Ausbildung.<br />
Wir wollen Hilfestellung geben für ein Leben aus dem Glauben und bei der Gestaltung einer<br />
persönlichen Gottesbeziehung. Bei der Arbeit der geistlichen Studienbegleitung geht es nicht<br />
um die Vermittlung von Inhalten und Methoden, vielmehr geht es um Glaubenserfahrungen.<br />
Reife im Glauben und menschliche Reife sind eng miteinander verknüpft, und so ist es für<br />
einen Glaubensweg von Bedeutung, sich auch auf einen persönlichen Wachstumsprozess<br />
einzulassen. Das bedeutet, dass der einzelne Mensch im Mittelpunkt unserer Arbeit steht:<br />
der Einzelne vor Gott, der Einzelne in der Gemeinschaft (Gemeinschaft der Gläubigen;<br />
Kirche) und der Einzelne in Beziehung zu sich selbst.<br />
Die persönliche Gottesbeziehung und das Glaubensleben entspringen der Einmaligkeit und<br />
Einzigartigkeit jedes Menschen. Sich in diesem Bereich zu öffnen ist gewiss herausfordernd<br />
und fordert Vertrauen. Wer Hilfen auf diesem Weg sucht, muss sich diese in aller Freiheit<br />
suchen dürfen.<br />
Wir sind gerne bereit, mit Ihnen einen Weg zu gehen.<br />
Wir sind offen und bereit für geistliche Begleitung, führen Exerzitien und Besinnungstage<br />
durch, helfen aber auch bei der Suche nach geeigneten Wegbegleitern und geistlichen<br />
Angeboten.<br />
Ein Wort der hl. Theresia von Lisieux, in dem sie eine persönliche Erfahrung zum Ausdruck<br />
bringt, macht unser Anliegen mit Blick auf Ihre berufliche Zukunft deutlich:<br />
"Ich begriff, dass die Kirche ein Herz hat und dass dieses Herz von Liebe brennt. Ich<br />
erkannte, dass die Liebe allein die Glieder der Kirche in Tätigkeit setzt; und würde die Liebe<br />
erlöschen, so würden die Apostel das Evangelium nicht mehr verkünden, die Märtyrer sich<br />
weigern, ihr Blut zu vergießen.<br />
Ich begriff, dass die Liebe alle Berufungen in sich schließt, dass die Liebe alles ist, dass sie<br />
alle Zeiten und Orte umspannt, dass sie ewig ist. "<br />
Diese Liebe erkennen, für sich in Anspruch nehmen und wiederlieben - darum soll es gehen.<br />
Die geistliche Studienbegleitung wird geleitet von Sr. Erna Maria Zimmerer.<br />
Raum 3207, Karlstr. 63, Tel. 200 156.
BEWERBER/BEWERBERINNENKREIS<br />
FÜR GEMEINDEREFERENTEN/REFERENTINNEN<br />
Für Studierende des Fachbereiches Religionspädagogik<br />
Erzdiözese <strong>Freiburg</strong><br />
Leiter Richard Hilpert<br />
Ausbildungsleiter für<br />
Gemeindereferenten/innen<br />
Diözese Rottenburg-Stuttgart<br />
Büro:<br />
Niemensstr. 9<br />
79098 <strong>Freiburg</strong><br />
Tel. 20889815<br />
Fax 2921528<br />
E-Mail: bewerberkreis@hilpert-online.de<br />
Sprechzeiten: n. V.<br />
Mentorat für Gemeindereferenten/-referentinnen<br />
Leiterin Elisabeth Färber (Gemeindereferentin)<br />
Büro:<br />
Sprollstr. 20<br />
72108 Rottenburg<br />
Tel. 07472/169434<br />
E-Mail:efaerber@bo.drs.de<br />
Fax 07472/169589<br />
Feste Sprechzeiten im Wintersemester 2003/2004 werden durch Aushang<br />
bekanntgegeben.
VEREINIGUNG DER FREUNDE UND FÖRDERER DER<br />
KATHOLISCHEN FACHHOCHSCHULE FREIBURG e. V.<br />
Vorsitzender Prof. Dr. Sigmund Gastiger<br />
Kath. Fachhochschule<br />
Postfach<br />
Karlstr. 63<br />
79104 <strong>Freiburg</strong><br />
Tel. 200 535<br />
Ehemalige und Dozenten unserer Fachhochschule haben 1983 den Verein<br />
gegründet, um Kontakte zueinander aufrechtzuerhalten und die<br />
Zusammenarbeit zwischen Praxis und Ausbildungsstelle zu fördern. Eine<br />
eigene Publikation, die FREIBURGER NOTIZEN, informiert Mitglieder und<br />
Interessenten. Auch Studierende und Dozenten der Fachhochschule sind<br />
immer wieder zu gemeinsamen thematischen und festlichen Veranstaltungen<br />
oder Fortbildungen eingeladen.<br />
Die Förderung von Studierenden mit einem Förderpreis für besonders<br />
qualifizierte Diplomarbeiten ist ein besonderes Anliegen der Mitglieder.<br />
Hinweise zum Bewerberverfahren erhalten Sie im Studentensekretariat.<br />
FÖRDERKREIS DER FREIBURGER PFLEGESTUDIEN-<br />
GÄNGE e.V.<br />
Akademisierung ist ein anerkannter Weg zur Professionalisierung und<br />
Weiterentwicklung der Pflegeberufe. Dazu gehört unverzichtbar die<br />
Theorieentwicklung in den einschlägigen Wissenschaften. Diese ist auf<br />
intensiven Austausch mit der Praxis angewiesen.<br />
Die Förderung der Kommunikation zwischen Praxisfeldern und<br />
Fachhochschule ist daher ein wichtiges Aufgabenfeld. Dazu wurde im<br />
Oktober 1999 der Förderkreis der <strong>Freiburg</strong>er Pflegestudiengänge e.V.<br />
gegründet.<br />
Sein Anliegen ist die Beratung, Förderung und Unterstützung der<br />
Studierenden des Fachbereichs Pflege an der Katholischen Fachhochschule<br />
<strong>Freiburg</strong>. Gleichzeitig werden wissenschaftliche Projekte in der Pflege und<br />
ihren Bezugswissenschaften unterstützt.<br />
Ausführliche Informationen erhalten Sie unter folgender Adresse:<br />
Förderkreis der <strong>Freiburg</strong>er Pflegestudiengänge e.V.<br />
Katholische Fachhochschule <strong>Freiburg</strong><br />
Karlstr. 63<br />
79104 <strong>Freiburg</strong><br />
Tel.: (0761) 200-669<br />
Fax: (0761) 200-166
PSYCHOTHERAPEUTISCHE BERATUNG,<br />
EHE- UND FAMILIENBERATUNG<br />
Psychotherapeutische Beratungsstelle<br />
des Studentenwerks <strong>Freiburg</strong><br />
Schreiberstr. 12 Tel. 2101 - 269<br />
Schwierigkeiten mit dem Studium, Stress in Beziehungen, Ärger mit den Eltern - für<br />
alle, die ihre Probleme mal “loswerden” wollen, gibt es die Möglichkeit, sich an die<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Psychotherapeutischen Beratungsstelle zu<br />
wenden. Telefonische Anmeldung unter 2101 - 269.<br />
Sprechzeiten: Montag bis Freitag von 9.00 - 12.00 h und von 14.00 - 16.00 h.<br />
Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle Tel. 38689-20<br />
Träger: Katholisches Stadtdekanat <strong>Freiburg</strong><br />
Jacob-Burckhardt-Straße 13, 79098 <strong>Freiburg</strong><br />
Die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle ist ein Angebot<br />
für alle, - die einen Ausweg suchen aus persönlichen Schwierigkeiten, Ängsten,<br />
Selbstzweifeln und Konflikten<br />
- die sich in einer Krise befinden<br />
- die lernen möchten, mit sich und anderen besser umzugehen<br />
für Paare, - die mit Ärger und Enttäuschung fertig werden müssen,<br />
- deren Beziehung lieblos geworden ist<br />
- die sexuelle Schwierigkeiten haben<br />
- die lernen wollen, besser miteinander zu reden<br />
für Familien,- die sich in einer Ablösungskrise befinden.<br />
Für die Beratung steht ein Team von 12 Beratern/-innen zur Verfügung.<br />
Alle Berater/-innen verfügen über eine anerkannte mehrjährige Ausbildung zum Ehe-,<br />
Familien- und Lebensberater und über langjährige Erfahrung. Jede/r einzelne hat<br />
unterschiedliche Schwerpunkte und Qualifikationen, z. B. in<br />
Gesprächspsychotherapie, Gestalttherapie, Transaktionsanalyse, Psychodrama,<br />
Familientherapie und Gruppentherapie.<br />
Die Beratung findet in Einzel-, Paar- und Familiengesprächen statt. Außerdem werden<br />
Selbsterfahrungsgruppen angeboten.<br />
Um unnötiges Warten von Ratsuchenden zu vermeiden, ist vorherige telefonische<br />
Terminvereinbarung über das Sekretariat der Beratungsstelle (0761-38689-20, Mo -<br />
Fr 10.00 bis 12.00 Uhr und 15.00 bis 18.00 Uhr) notwendig.
KINDERBETREUUNG<br />
durch die Krabbelstube des<br />
IKS e. V.,Leitung Sabine Schanzenbach<br />
Karlstr. 38, Zi. 2129, Tel. 200 670<br />
Konzept/Finanzen<br />
Die Initiative Kinderbetreuung IKS e. V. bietet als Träger der freien Jugendhilfe<br />
und Modell des Landes seit Anfang der 90 er Jahre eine Kinderbetreuung an<br />
der Katholischen Fachhochschule an.<br />
Grundlage für die Entwicklung des Konzepts der Betreuung ist die Ausrichtung<br />
von Organisation und pädagogischer Arbeit an den Bedürfnissen der<br />
studierenden Eltern und ihren Kindern. Daher legt der IKS e. V. großen Wert<br />
auf die Mitarbeit der Eltern. Diese übernehmen bestimmte Aufgaben wie z. B.<br />
Putzen, Wäschepflege, Mitgestaltung von Festen und Spielplatz etc. .<br />
Außerdem kochen sie abwechselnd für die Vormittagskinder Essen.<br />
Die Krabbelstube nimmt bis jeweils 10 Kinder ( vormittags bevorzugt<br />
Studentenkinder) von 1 bis zu drei Jahren für halbe Tage auf. Die Mindestbetreuungszeit<br />
für Studierendenkinder beträgt drei Vormittage. Nachmittags<br />
kommen auch Kinder aus der Nachbarschaft. Die einmal zu Beginn des<br />
Semesters festgelegte Zeit gilt für das ganze Semester als Fixzeit und muss<br />
bezahlt werden. Die 10 Kinder werden derzeit von 3 ausgebildeten<br />
pädagogischen Fachkräften betreut.<br />
Die Höhe der Elternbeiträge pro Monat richtet sich nach dem<br />
Betreuungsumfang. Die Kosten pro Betreuungsstunde sinken mit steigender<br />
Stundenzahl. Der Höchstbetrag pro Monat liegt bei ca. L 150,- für Studierende.<br />
Öffnungszeiten<br />
Die Krabbelstube ist vormittags von 8.00-13.00 Uhr und nachmittags (außer<br />
Mittwoch) von 14.00-18.00 Uhr geöffnet. Da mittwochs Teamgespräche<br />
stattfinden, beginnt die Nachmittagsgruppe an diesen Tagen um 15.00 Uhr und<br />
endet um 18.00 Uhr.<br />
Um Weihnachten, Ostern und Pfingsten schließt die Krabbelstube zeitgleich<br />
mit der KFH. In den übrigen lehrveranstaltungsfreien Wochen bleibt sie bis auf<br />
ca. 4 Wochen im Sommer, in denen die Mitarbeiter Urlaub machen, geöffnet.<br />
Außerordentliche Schließzeiten werden rechtzeitig bekannt gegeben.
Anmeldung<br />
Eltern sollten ihre Kinder unbedingt so früh wie möglich zur Betreuung<br />
anmelden, Studienanfänger/innen also zugleich mit ihrer Immatrikulation im<br />
Sommer. Normalerweise werden die Kleinen - das ist für die pädagogisch<br />
verantwortliche Planung und Gestaltung der gestaffelten Eingewöhnungszeit<br />
sehr wichtig - Ende Juli für September/Oktober und Ende Februar für April<br />
eines jeden Jahres aufgenommen. Nur in Ausnahmefällen können spätere<br />
Anmeldungen berücksichtigt werden. Die Eingewöhnungszeit beginnt am 1.<br />
September bzw. am 1. März eine Jahres.<br />
Bitte richten Sie Ihren Aufnahmewunsch an die päd. Fachkräfte. Im Gespräch<br />
mit ihnen erhalten Sie alle benötigten Informationen. Die genauen<br />
Betreuungszeiten werden am Ende der zweiten Woche der Lehrveranstaltungszeit<br />
festgelegt, wenn die Eltern ihre Studien-/ Lehrveranstaltungspläne<br />
fertiggestellt haben.<br />
Bisher war es möglich, allen Studierenden zu den für sie wichtigen Zeiten eine<br />
Betreuung anzubieten. Eine Erfüllung aller Betreuungswünsche ist allerdings<br />
nicht immer zu garantieren. Für Notfälle konnte bisher immer eine Lösung<br />
gefunden werden. Kinder allein erziehender Eltern werden bevorzugt<br />
behandelt.<br />
Konto: IKS e. V. Kinderbetreuung, Öff. Sparkasse <strong>Freiburg</strong>,<br />
BLZ: 680 501 01, Kt. Nr. 204 68 28.<br />
Der Vorstand
- 36 -
- 37 -<br />
GRUNDSTUDIUM
- 38 -<br />
<strong>Grundstudium</strong> - Fachbereich Soziale Arbeit 1. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
A. Pflichtbereich<br />
Fachwissenschaft Soziale Arbeit<br />
Geschichten, Theorien und<br />
Konzepte der Sozialarbeit<br />
und der Sozialpädagogik<br />
3 Std. Vorlesung<br />
mit Übung<br />
Schwab<br />
Schwab<br />
Berufliches Handeln in der Sozialen Arbeit<br />
Berufsorientierendes Seminar<br />
(BOS)<br />
Fortsetzung im<br />
Sommersemester<br />
4 Std. Seminar<br />
Grosser<br />
Möller<br />
Nickolai<br />
Oswald/<br />
Höchner<br />
Hanselmann<br />
Renz<br />
Veith<br />
Müller<br />
Kricheldorff<br />
Becker<br />
Do 8.00 - 9.30<br />
Mi 8.00 - 8.45<br />
Aula<br />
1100<br />
2300<br />
Do 14.00 - 17.00 1203<br />
3302<br />
1204<br />
3201<br />
3204<br />
3303<br />
3101<br />
3104<br />
3202<br />
3304<br />
Das Seminar soll in theoretischen Angeboten und Gesprächen mit der Praxis eine erste Berufsorientierung<br />
vermitteln und auf das erste praktische Studiensemester vorbereiten.<br />
Am Beispiel typischer Arbeitsfelder und Arbeitsmethoden der Sozialen Arbeit werden Berufsrolle<br />
und Berufsvollzüge erarbeitet.<br />
Die Auseinandersetzung mit spezifischen Fragen des Berufsvollzugs, wie z. B. Berufsmotivation,<br />
persönliche Ressourcen und Wertorientierungen, Psychohygiene, berufliches Handeln in gesellschaftlichen<br />
Rahmenbedingungen, Supervision, mündet abschließend in Lernziele für das erste<br />
praktische Studiensemester.<br />
Die Teilnehmer/-innen erhalten zur Praxisstellensuche für das erste praktische Studiensemester<br />
(3.Sem.) eine Beratung durch die Seminardozenten und während des praktischen Studiensemesters<br />
eine fachlich Begleitung.
- 39 -<br />
<strong>Grundstudium</strong> - Fachbereich Soziale Arbeit 1. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Gesprächsführung<br />
Fortsetzung im<br />
Sommersemester<br />
2 Std. Seminar<br />
Fehrenbach<br />
Renz<br />
Schley<br />
Schley<br />
Weiß<br />
Sieß<br />
Sieß<br />
Imgraben<br />
Uihlein<br />
Kompakttermine:<br />
Fr 05. / Sa 06.12.03<br />
Fr 23. / Sa 24.01.04<br />
Fr jeweils ab 13.00<br />
Mo 11.30 - 13.00<br />
1.Treff Gruppe 1:<br />
Mo 13.10.2003<br />
11.30 - 13.00<br />
weitere Treffen als<br />
Kompakttermine n.V.<br />
1.Treff Gruppe 2:<br />
Mo 13.10.2003<br />
11.30 - 13.00<br />
weitere Treffen als<br />
Kompakttermine n.V.<br />
Mo 11.30 - 13.00<br />
Beginn: 27.10.2003<br />
+ Kompakttermin n.V.<br />
Mo 11.30 - 13.00<br />
Beginn: 13.10.2003<br />
Kompakttermine:<br />
12.11.03 / 03.12.03<br />
jeweils 14.00 -17.00<br />
Mi 9. 45 - 11.15<br />
Beginn: 15.10.2003<br />
Kompakttermine:<br />
26.11. / 10.12.03<br />
jeweils 14.00 - 17.00<br />
Mo 8.00 - 9.30<br />
Mo 11.30 - 13.00<br />
Beginn: 20.10.2003<br />
Kompakttermin:<br />
Mi 22.10.2003<br />
14.00 - 17.30 Uhr<br />
3101<br />
3203<br />
3101<br />
3101<br />
3102<br />
3202<br />
3202<br />
3202<br />
3202<br />
3102<br />
1206<br />
1206
- 40 -<br />
<strong>Grundstudium</strong> - Fachbereich Soziale Arbeit 1. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Ziel:<br />
6 Die Studierenden sind in der Lage, Haltung, Grundprinzipien und Vorgehensweise hilfreicher<br />
Gesprächsführung in Ansätzen zu praktizieren.<br />
Inhalte:<br />
6 Relevante Aspekte der Kommunikationstheorie, sowie Selbst- und Fremdwahrnehmung.<br />
6 Unterschiedliche Theorieansätze in der Gesprächsführung.<br />
6 Das helfende Gespräch: setting, contracting, das aktive Zuhören, fördernde und hindernde<br />
Interventionen<br />
Methoden:<br />
6 Seminargespräch, Referate, Übungen, Rollenspiel, theoretische Inputs<br />
Lehrveranstaltung:<br />
6 Teilnahmepflichtiges Seminar mit starkem Übungscharakter<br />
Humanwissenschaftliche Grundlagen der Sozialen Arbeit<br />
Erziehungswissenschaft<br />
2 Std. Vorlesung<br />
Schinzler Do 9.45 - 11.15 Aula<br />
1100<br />
Ziele: Auseinandersetzung mit Grundkategorien pädagogischen Denkens und Handelns: Ziele,<br />
Aufgaben und Funktionen der “Pädagogik” (Erziehung, Sozialisation, Bildung/Begriffs-, Inhalts- und<br />
Gegenstandsbestimmungen) auf dem Hintergrund gesellschaftlicher Bedingungen, Erwartungen<br />
und Not-Wendigkeiten. Soll/kann die “Pädagogik” norm- und sinngebende, personale und gesellschaftsbezogene<br />
Aufgaben in der sozial-kulturellen Wirklichkeit erfüllen ?<br />
Psychologie<br />
2 Std. Vorlesung<br />
Steinebach Mi 11.30 - 13.00 Aula<br />
1100<br />
Entwicklung erscheint mehr und mehr als ein vom Menschen selbst gestalteter Prozess. Vorhersagen<br />
zu Entwicklungsverläufen und gezielte Interventionen sind schwierig, ihre Gültigkeit und<br />
Wirkungen sind von vielen Faktoren abhängig. Multidimensionalität, Multidirektionalität, Multikausalität<br />
und Multifunktionalität werden zu theoretischen Leitbegriffen. Damit stehen nicht nur allgemeine<br />
Entwicklungsverläufe, sondern auch individuelle Entwicklungsprozesse im Brennpunkt der<br />
Aufmerksamkeit. Dies betrifft so unterschiedliche Fragen wie gesundes Altern, Entwicklungserleben,<br />
Krisen und kritische Lebensereignisse, Entwicklung in Partnerschaften, Familien und<br />
Teams.<br />
Soziologie<br />
2 Std. Vorlesung<br />
Sidler Do 11.30 - 13.00 Aula<br />
1100<br />
Inhalte: Auf der Basis der Klärung der Frage, was Soziologie sein kann, wird ein allgemeines<br />
Modell für das Bedenken und Besprechen sozialer Tatbestände entwickelt, das dazu befähigen<br />
soll, in den kommenden Semestern konkrete Fragen und Themen einer praxisorientierten Soziologie<br />
zu bearbeiten.<br />
Ziel dieser und aller künftigen soziologischen Lehrveranstaltungen: Eine verbesserte Fähigkeit der<br />
Studierenden, soziale Tatbestände differenziert wahrzunehmen, sie im Zusammenhang zu sehen<br />
und so sie erklären und verstehen zu können, was eine unverzichtbare Voraussetzung für verantwortliches<br />
Handeln im beruflichen und privaten Bereich ist.
- 41 -<br />
<strong>Grundstudium</strong> - Fachbereich Soziale Arbeit 1. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Sozialmedizin<br />
2 Std. Vorlesung<br />
Effelsberg Mo 9.45 - 11.15 Aula<br />
1100<br />
Sozialmedizin befasst sich mit Gesundheit, Krankheit und der Wechselwirkung mit gesellschaftlichen<br />
Faktoren. Die Vorlesung stellt wissenschaftliche Grundlagen und Ergebnisse des Faches vor<br />
und zeigt die praktische Anwendung exemplarisch an wichtigen Krankheitsbildern. Themen aus der<br />
Allgemeinen Sozialmedizin sind beispielsweise Epidemiologie, unser Gesundheitssystem, Prävention<br />
und Gesundheitsförderung, Behinderung und Rehabilitation und Herz-Kreislaufkrankheiten,<br />
Krebs und AIDS. Auf einem bio-psycho-sozialen Krankheitsverständnis aufbauend will die Vorlesung<br />
Handlungskompetenz vermitteln. Einzelne Themen werden mit Hilfe von Gästen aus der<br />
Praxis beispielhaft vertieft.<br />
Rechtliche, sozialpolitische und ökonomische Grundlagen<br />
der Sozialen Arbeit<br />
Recht<br />
2 Std. Vorlesung<br />
Gastiger Di 11.30 - 13.00 Aula<br />
1100<br />
Die Rechtsordnung wird aus allen das menschliche Zusammenleben ordnenden Geboten und<br />
Verboten gebildet. Man nennt dies das objektive Recht. Die Rechtsordnung ist Teil der Sozialordnung<br />
und damit abhängig von der jeweiligen Staatsform, vom jeweiligen politischen System und<br />
stabilisiert es auch. Gerade damit hat es auch Soziale Arbeit zu tun, wenn sie - als eigentliche<br />
Aufgabe - soziale Probleme lösen will und dabei ihre Klientel in das "System" integrieren oder<br />
reintegrieren hilft. Recht reduziert Komplexität, indem es ermöglicht, dass ein bestimmtes Verhalten<br />
erwartet, notfalls erzwungen werden kann.<br />
ISAG<br />
Sozial- und Gesellschaftspolitik<br />
2 Std. Vorlesung<br />
Hohm Di 9.45 - 11.15 Aula<br />
1100<br />
Folgende Themen sollen in der Vorlesung behandelt werden:<br />
“Was sind die Spezifika des deutschen Wohlfahrtstaates?”<br />
“Welches sind die zentralen Probleme seiner einkommens- und dienstleistungsorientierten Sozialpolitik<br />
bezüglich des Arbeitsmarktes, der Familien in Armut?”<br />
“Welche konkurrierenden Problemlösungsstrategien lassen sich beobachten?”<br />
“Wie werden diese von den politischen Entscheidern legitimiert?”<br />
“In welche Richtung transformieren sich der Wohlfahrtstaat und die Sozialpolitik?”
- 42 -<br />
<strong>Grundstudium</strong> - Fachbereich Soziale Arbeit 1. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
B. Wahlpflichtbereich<br />
Philosophische und theologische Grundlagen der Sozialen<br />
Arbeit<br />
Anthropologie und Ethik<br />
Der Mensch auf der Suche<br />
nach Sinn<br />
(max. 40 Tn)<br />
2 Std. Seminar<br />
Bohlen Fr 8.00 - 9.30 1206<br />
Menschen beurteilen ihre Handlungen und auch die Handlungen anderer darauf, ob sie sinnvoll<br />
sind oder nicht. Doch was kann unter dem Sinn einer Handlung überhaupt verstanden werden? Hat<br />
unser Handeln und unser Leben einen Sinn? Oder ist menschliches Leben absurdes Dasein? In<br />
der Lehrveranstaltung soll die Möglichkeit geboten werden, solchen Fragen im Gespräch nachzugehen.<br />
Dabei werden unterschiedliche philosophische und auch theologische Ansätze zur<br />
Beantwortung der Sinnfrage als Anregung fungieren. Die Lehrveranstaltung ist als eine Einführung<br />
in das Philosophieren konzipiert. Sie setzt keine philosophischen Kenntnisse, wohl aber die<br />
Bereitschaft zum Gespräch voraus.<br />
Anthropologische Grundla- Bohlen<br />
gen der Sozialen Arbeit<br />
(max. 40 Tn)<br />
2 St. Seminar<br />
Fr 9.45 - 11.15 1206<br />
Anhand unterschiedlicher philosophischer Texte wollen wir die Bedeutung des Kommunikationsgeschehens<br />
für das Menschsein thematisieren. In dem Kontext wird der Bezug von Ich und Du,<br />
Selbst und Anderem, Dasein und Mitsein, Individualität und Sozialität für uns von Interesse sein.<br />
Ziel der Lehrveranstaltung ist es, die genannten Begriffe im Gespräch zu klären, um dadurch ein<br />
philosophisch fundiertes Verständnis der anthropologischen Grundlagen Sozialer Arbeit zu<br />
ermöglichen.<br />
Philosophische<br />
Anthropologie<br />
(max. 40 Tn)<br />
2 Std. Seminar<br />
Kollhoff Mo 19.00 - 20.30 1207<br />
Durch die Lektüre verschiedener Texte von Platon bis zu Nietzsche soll ein Einblick in philosophische<br />
Denkweisen gegeben werden. Thematisch konzentriert sich die Seminararbeit auf die<br />
anthropologische Grundfrage: "Was ist der Mensch?"<br />
Eine Textsammlung kann zu Beginn des Semesters kopiert werden.
- 43 -<br />
<strong>Grundstudium</strong> - Fachbereich Soziale Arbeit 1. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Ist Gott gut?<br />
Überlegungen zur "Güte Gottes"<br />
angesichts der Zustände<br />
in der Welt<br />
(max. 40 Tn)<br />
2 Std. Seminar<br />
Uhde Fr 9.45 - 11.15 3202<br />
Das Problem der "Güte Gottes" in Anbetracht der großen Miss-Stände in der Welt ist eine schwere<br />
gedankliche Herausforderung für die Theologie, aber auch für die einzelne Glaubenserfahrung.<br />
Von Alters her haben daher religiöse Denker versucht, hier eine Antwort zu finden - und jeder, der<br />
in einer monotheistischen Religion lebt, muss Auskunft geben können, wie dieses Problem<br />
theoretisch und / oder praktisch zu lösen sei. Daher versucht die Vorlesung, einige der wichtigsten<br />
Standpunkte christlicher Theologie vorzustellen und diese in eine praxisbezogene Gegenwart zu<br />
übersetzen.<br />
Anthropologische und ethi- Hammer<br />
sche Grundlagen des sozialen<br />
Handelns<br />
(max. 40 Tn)<br />
2 Std. Seminar<br />
Mo 14.00 - 15.30 1206<br />
Wir gehen aus von der Erkenntnis, “dass in den meisten Persönlichkeitsmodellen implizit eine<br />
generelle philosophische Sicht des Menschen enthalten ist” (L.A. Pervin). Dem folgend behandeln<br />
wir im ersten Semester systematisch einige für die sozial- und heilpädagogische Arbeit relevante<br />
anthropologische und ethische Themen (Denken zwischen Wahrheit und Täuschung; Freiheit,<br />
Verantwortung und Schuld; Sinn und Glück; Sterben und Tod...). Die Wahl der Themen im zweiten<br />
Semester richtet sich nach den Interessen der TN (ausgedrückt in der Wahl des Themas der<br />
Hausarbeit); es wird erwartet, dass die TN die Ergebnisse ihrer Hausarbeit in das Seminar einbringen.<br />
In der Organisationsform wird ein Wechsel von Einzel-, Partner-, Kleingruppen- und<br />
Plenumsarbeit angestrebt.<br />
Kultur- und Medienpädagogik<br />
siehe “<strong>Grundstudium</strong>: Zusammenfassung der Angebote im Medienbereich”<br />
C. weitere Angebote<br />
siehe “Zusatzangebote” und “Sprachkurse”
- 44 -<br />
<strong>Grundstudium</strong> - Fachbereich Soziale Arbeit 3. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
A. Pflichtbereich<br />
Berufliches Handeln in der Sozialen Arbeit<br />
Begleitung des praktischen Studiensemesters:<br />
Studientage:<br />
Mo 27.10.2003<br />
Di 28.10.2003<br />
Do 08.01.2004<br />
Fr 09.01.2004<br />
Organisation:<br />
Herr Effelsberg<br />
Organisation:<br />
Frau Kricheldorff<br />
Praxisbegleitende Seminare an den Studientagen<br />
Becker / Grosser / Hanselmann / Kricheldorff / Möller / Müller / Nickolai /<br />
Oswald / Höchner / Renz / Veith<br />
Supervision NN<br />
C. Zusatzangebot<br />
Praxisanleitertreffen<br />
am:<br />
Freitag,05.12.2003,9.45 Uhr<br />
(vorläufiger Termin)<br />
Kricheldorff /<br />
Bohlen<br />
Praxisamt (Zimmer 3106, 1. OG, Haus 3)<br />
Leitung: Frau Prof. Dr. Kricheldorff<br />
Tel. 200 441<br />
Sekretariat: Frau Karola Bärmann<br />
Tel. 200 169<br />
Sprechzeiten: Mo - Do 10.00 - 11.30 Uhr<br />
Fr 9.00 - 10.00 Uhr<br />
3500
- 45 -<br />
<strong>Grundstudium</strong> - Fachbereich Soziale Arbeit 3. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Soziale Arbeit und Heilpädagogik<br />
Zusatzprogramm "Fachschule / Didaktik des Unterrichtens"<br />
- Schulpraktischer Teil -<br />
Anleitung durch<br />
Mentoren/Innen<br />
1 Std.<br />
Praxisberatung /<br />
Supervision<br />
Gruppe A 1 Std.<br />
Gruppe B 1 Std.<br />
Didaktisches<br />
Begleitseminar<br />
1 Std.<br />
Pohlmann / Kray / Scherer / Härpfer /<br />
Engelmann / Niedermeier / Lindner-Ziegler /<br />
Stehle / Wochner / Günther / Fischer / Sartorius<br />
Dierstein<br />
Dierstein<br />
Schinzler nach Vereinbarung<br />
In dieser Veranstaltung besteht Gelegenheit, die in der Praxis aufgetretenen Fragen und Probleme<br />
fachlicher Art zu bearbeiten.<br />
Beobachtung, Bewertung<br />
und Reflexion von<br />
Prüfungssituationen<br />
3 Std.<br />
Schinzler nach Vereinbarung
- 46 -<br />
<strong>Grundstudium</strong> - Fachbereich Heilpädagogik 1. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
A. Pflichtbereich<br />
Fachwissenschaft Heilpädagogik<br />
Einführung in die<br />
Heilpädagogik<br />
2 Std. Vorlesung<br />
+ 5 Teilnehmer EFH<br />
Kösler Mo 11.30 - 13.00 2200<br />
Die Veranstaltung liefert einen ersten systematischen Einblick in die Themen, Traditionen und<br />
aktuellen Trends der Heilpädagogik. In diesem Semester sollen insbesondere Praxiskonzepte,<br />
Kernbegriffe und Aufgaben der Heilpädagogik in der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung<br />
Gegenstand sein. Förderung, Beratung und Begleitung für Menschen mit geistiger Behinderung<br />
gelten als wesentliche Aufgaben der Heilpädagogik. Heilpädagogische Maßnahmen sollen<br />
fachlich differenziert und theoriegeleitet die Integration des Individuums in seine soziale Umwelt<br />
vorbereiten und sichern. Die entsprechenden Theorien, Modelle und Methoden werden diskutiert.<br />
Elemente beruflichen Handelns in der Heilpädagogik<br />
Verfahren der Heilpädagogischen Entwicklungsförderung<br />
Diagnostik in der Heilpädagogik<br />
I:<br />
Grundlagen<br />
2 St. Vorlesung<br />
Simon Mo 9.45 - 11.15 2300<br />
Die Vorlesung vermittelt grundlegende allgemeine Merkmale heilpädagogischer Diagnostik mit<br />
Strategien zu Anamnese, Exploration und Beobachtung. Neben einer Einführung in testtheoretische<br />
Grundkenntnisse und diagnostische Systeme werden Verfahren der Entwicklungsdiagnostik<br />
vorgestellt. Ein Schwerpunkt bildet dabei die Früherkennung von Behinderungen und Entwicklungsverzögerungen<br />
bei Kindern. In ergänzenden Fallarbeiten soll die Erstellung von Untersuchungsplänen<br />
geübt werden.<br />
Heilpädagogische Interventionsformen<br />
Heilpädagogische<br />
Entwicklungsförderung für<br />
Kinder und Jugendliche<br />
2 Std. Vorlesung<br />
Weiss Do 8.00 - 9.30 2300<br />
Heilpädagogische Entwicklungsförderung beinhaltet ein Spektrum systematischer Hilfsangebote für<br />
entwicklungsgestörte und geistig behinderte Kinder und Jugendliche. Studierende sollen befähigt<br />
werden, Entwicklungsstörungen und Behinderungen bei Kindern bzw. Jugendlichen zu erkennen,<br />
im diagnostischen Prozess differenziert einzuordnen, therapeutische Ziele zu formulieren und<br />
entsprechende adäquate heilpädagogische Interventionen zu planen und durchzuführen, sowie die<br />
Eltern und Bezugspersonen zu beraten und zu begleiten.
- 47 -<br />
<strong>Grundstudium</strong> - Fachbereich Heilpädagogik 1. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Kommunikation und<br />
Gesprächsführung<br />
2 Std. Vorlesung<br />
( mit Fachbereich Pflege)<br />
Kösler/<br />
Steinebach<br />
Kompaktseminar:<br />
Termin wird rechtzeitig<br />
durch Aushang<br />
bekannt gegeben<br />
Gesprächssituationen mit unterschiedlichen Intentionen im heilpädagogischen Arbeitsfeld verlangen<br />
unterschiedliches kommunikatives Verhalten. Diese Unterschiede sollen bearbeitet,<br />
situations- und zieladäquat reflektiert und in Arbeitsgruppen erprobt werden.<br />
Planung, Dokumentation,<br />
Evaluation, Präsentation<br />
heilpädagogischen Handelns<br />
- Wissenschaftliches Arbeiten<br />
2 Std.<br />
Vorlesung/Übung<br />
Reinhardt Mo 17.30 - 19.00 2300<br />
Ziele: Vermittlung der Techniken wissenschaftlichen Arbeitens und der Literaturrecherche.<br />
Inhalte: Formen einer wissenschaftlichen Arbeit: Referat, Hausarbeit, Diplomarbeit, Protokoll;<br />
Anlegen einer Gliederung, Zitieren, Fußnotenverwaltung, Anlegen eines Literaturverzeichnisses.<br />
Führung in der UB, Ausleihverfahren, Olix-Katalog.<br />
Humanwissenschaftliche Grundlagen der Heilpädagogik<br />
Pädagogische Grundlagen<br />
6 Allg. Pädagogik<br />
2 Std. Vorlesung<br />
Psychologische<br />
Grundlagen<br />
6 Entwicklungspsychologie<br />
2 Std. Vorlesung<br />
Schinzler Do 9.45 - 11.15 Aula<br />
1100<br />
Steinebach Mi 11.30 - 13.00 Aula<br />
1100<br />
Entwicklung erscheint mehr und mehr als ein vom Menschen selbst gestalteter Prozess. Vorhersagen<br />
zu Entwicklungsverläufen und gezielte Interventionen sind schwierig, ihre Gültigkeit und<br />
Wirkungen sind von vielen Faktoren abhängig. Multidimensionalität, Multidirektionalität, Multikausalität<br />
und Multifunktionalität werden zu theoretischen Leitbegriffen. Damit stehen nicht nur allgemeine<br />
Entwicklungsverläufe, sondern auch individuelle Entwicklungsprozesse im Brennpunkt der<br />
Aufmerksamkeit. Dies betrifft so unterschiedliche Fragen wie gesundes Altern, Entwicklungserleben,<br />
Krisen und kritische Lebensereignisse, Entwicklung in Partnerschaften, Familien und<br />
Teams.
- 48 -<br />
<strong>Grundstudium</strong> - Fachbereich Heilpädagogik 1. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Medizinische<br />
Grundlagen<br />
- Sozialmedizin<br />
2 Std. Vorlesung<br />
Fischer Do 16.30 - 18.00 2300<br />
Sozialmedizin befasst sich mit Gesundheit, Krankheit und deren Wechselwirkung mit gesellschaftlichen<br />
Faktoren. Die Vorlesung stellt wissenschaftliche Grundlagen und Ergebnisse vor und zeigt die<br />
praktische Anwendung exemplarisch an wichtigen Krankheitsbildern. Themen sind beispielsweise:<br />
Epidemiologie, unser Gesundheitssystem, Prävention und Gesundheitsförderung, Behinderung<br />
und Rehabilitation, Herz-Kreislaufkrankheiten, Krebs und AIDS. Auf einem bio-psycho-sozialen<br />
Krankheitsverständnis aufbauend will die Vorlesung Handlungskompetenz vermitteln.<br />
Rechtliche und sozialwissenschaftliche Grundlagen<br />
der Heilpädagogik<br />
Recht I:<br />
Einführung in das Recht<br />
der Sozialen Arbeit<br />
Strukturelle Grundlagen<br />
des Sozialen Rechts<br />
2 Std.<br />
Winkler Di 8.00 - 9.30 2200<br />
Die Veranstaltung Recht I führt in die rechtlichen Grundlagen der Sozialen Arbeit ein. Nach einer<br />
allgemeinen Einführung in die Bedeutung des Rechts, in die Fallbearbeitung, in das Rechtssystem<br />
der Bundesrepublik Deutschland sowie in die vertrags- und sachenrechtlichen Grundlagen werden<br />
folgende für die Heilpädagogik besonders bedeutsame Rechtsfragen erörtert: Haftung bei Aufsichtspflichtverletzung,<br />
Betreuung und zwangsweise Unterbringung von Menschen mit Behinderung.<br />
Soziologische<br />
Grundlagen<br />
2 Std. Vorlesung<br />
Heilpäd. + Religionspäd.<br />
Hohm Di 11.30 - 13.00 1206<br />
Die Soziologie gewinnt ihre Autonomie als Fachdisziplin der Wissenschaft dadurch, dass sie die<br />
Welt anhand der Differenz sozial/nichtsozial beobachtet und ihre theoretische Anschlussfähigkeit<br />
durch die nähere Betrachtung des Sozialen erreicht. Ihre Paradigmen lassen sich mithin als<br />
unterschiedliche Antworten auf die Frage interpretieren, wie Soziales im Unterschied zu Nichtsozialem<br />
in der Welt möglich wird uns sich dauerhaft reproduzieren kann. Ein soziologisches<br />
Paradigma - die Systemtheorie - wird im Zentrum der Vorlesung stehen. Für sie verweist das<br />
Soziale auf Kommunikation. Ihre Wiederholung auf soziale Systeme. Und ihre nichtsoziale Umwelt<br />
auf den Menschen. Welche Implikationen mit diesen Antworten für die soziologische Beobachtung<br />
der modernen Gesellschaft und des modernen Menschen verbunden sind, wird Generalthema der<br />
Vorlesung sein.<br />
Literatur: Hans-Jürgen Hohm: Soziale Systeme, Kommunikation, Mensch. Eine Einführung in<br />
soziologische Systemtheorie, Juventa Verlag, Weinheim/München 2000.
- 49 -<br />
<strong>Grundstudium</strong> - Fachbereich Heilpädagogik 1. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
B. Wahlpflichtbereich<br />
Elemente beruflichen Handelns in der Heilpädagogik<br />
Einführung in die<br />
Kunsttherapie /<br />
Gestaltungspädagogik<br />
2 Std. Vorlesung<br />
(mit Teilnehmern der EFH)<br />
Menzen Mi 18.00 - 21.00<br />
14-täglich<br />
Beginn: 22.10.2003<br />
05.11./19.11./03.12./<br />
17.12./07.01./14.01.<br />
Aula<br />
1100<br />
Die Einführungsveranstaltung "Kunsttherapie/Gestaltungspädagogik I" will in die verschiedenen<br />
Ansätze kunst- und gestaltungstherapeutischer Verfahren einführen<br />
Im Mittelpunkt der Vorlesung werden Projekte stehen, die im heil- und sozialpädagogischen sowie<br />
im sozialarbeiterischen Berufsfeld stattfanden. Wahrnehmungsgeschädigte, mental und altersverwirrte,<br />
verhaltensverunsicherte, d. h. selbstwert- und emotional gestörte, psychiatrisierte<br />
Menschen, - das sind Beispiele anhand deren kunst- und gestaltungspädagogische wie -therapeutische<br />
Maßnahmen gezeigt und theoretisch fundiert werden.<br />
Literatur: K.- H. Menzen: (Grundlagen der Kunsttherapie. UTB.München 2002.<br />
Alte Menschen mit<br />
Behinderung<br />
2 Std. Seminar<br />
( 8 Tn je Fachbereich<br />
Soziale Arbeit / Pflege /<br />
Heilpäd. / Religionspäd.)<br />
Brandenburg/<br />
Menzen<br />
Kompaktseminar:<br />
Do 19.02.2004<br />
10.00 - 18.00<br />
Fr 20.02.2004<br />
10.00 - 18.00<br />
Sa 21.02.2004<br />
9.00 - 12.00<br />
3301<br />
Im Zentrum des Seminars steht der Zusammenhang von Altern und Behinderung. Wir wollen den<br />
Versuch unternehmen, das Thema "Altern und Behinderung" aus der Perspektive verschiedener<br />
Wissenschaften zu beleuchten. Nach einer Klärung dessen, was man unter Altern verstehen kann,<br />
werden wir das Thema von zwei Seiten angehen: Einerseits geht es um die gesundheitliche,<br />
soziale und psychische Situation von Menschen, die lebenslang mit einer körperlichen oder<br />
geistigen Behinderung gelebt haben und jetzt alt geworden sind. Andererseits geht es um ältere<br />
Menschen, die aufgrund spezifischer gesundheitlicher Beeinträchtigung (z. B. Demenz) im hohen<br />
Alter in erheblichem Umfang in ihrer Selbständigkeit eingeschränkt und auf die Unterstützung und<br />
Hilfe von Angehörigen und Professionellen angewiesen sind. Welche spezifischen Anforderungen<br />
stellen sich an eine heilpädagogische und pflegerische Beratung und Versorgung dieser Menschen?<br />
Mit welchen Konzeptionen können die Berufsgruppen auf diese Herausforderungen<br />
reagieren?
- 50 -<br />
<strong>Grundstudium</strong> - Fachbereich Heilpädagogik 1. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
JEUX DRAMATIQUES<br />
im Heilpäd. Hort<br />
8 Tn<br />
(4 Tn KFH / 4 Tn EFH)<br />
2 Std. Seminar<br />
Weiss Vorbereitungstreffen<br />
an der KFH:<br />
Di 14.10.2003<br />
14.00 - 17.00<br />
2400<br />
Die Jeux Dramatiques - Ausdrucksspiel aus dem Erleben - sind eine pädagogische Methode,<br />
Geschichten, Bilderbücher, Märchen zu spielen, ohne Texte zu lernen oder Requisiten zu bauen.<br />
Gemeinsam mit Kindern im Grundschulalter erleben wir bekannte und unbekannte Geschichten<br />
oder erfinden unsere eigenen Spiel-Texte. Studierende haben die Möglichkeit, die Methode<br />
darüber hinaus in Reflexion und Planung theoretisch zu erfahren und sich Anwendungsmöglichkeiten<br />
in heil- und sozialpädagogischen Kinder- oder Erwachsenengruppen zu erarbeiten.<br />
Lit. u.a.: Weiss: Wenn die roten Katzen tanzen... <strong>Freiburg</strong> 1999<br />
JEUX DRAMATIQUES<br />
mit Erwachsenen - ein<br />
integratives Projekt<br />
8 Tn<br />
(4 Tn KFH / 4 Tn EFH)<br />
2 Std. Seminar<br />
Weiss Kompaktseminar:<br />
28. / 29.11.2003<br />
Vorbereitungstreffen<br />
an der KFH:<br />
Di 11.11.2003<br />
19.00 - 21.00 Uhr<br />
Di 18.11.2003<br />
19.00 - 21.00Uhr<br />
Nachbereitungstreff:<br />
nach Vereinbarung<br />
WFB<br />
Neuershausen<br />
2400<br />
2400<br />
Die Jeux Dramatiques (Ausdrucksspiel) sind eine Methode des freien Theaterspiels ohne eingeübte<br />
Rollen, ohne Auswendiglernen und ohne Proben. Als Spielvorlagen dienen Geschichten,<br />
Märchen, Bilderbücher, Gedichte u.ä., die wichtigsten Requisiten sind Tücher in allen Farben und<br />
Größen zum Verkleiden und Gestalten der Spielplätze. Im Vordergrund stehen das eigene Empfinden<br />
und die eigene Spielfreude, nicht das Erbringen von Leistungen. Wir werden gemeinsam ein<br />
integratives Wochenend-Projekt für Erwachsene mit geistiger Behinderung und für Studierende<br />
vorbereiten, erleben und reflektieren. Im Tun werden die methodischen Grundlagen erarbeitet und<br />
für die Zielgruppe spezifiziert.<br />
Die Teilnahme sowohl am Wochenende wie an den Vor- und Nachbereitungstreffen wird erwartet.<br />
Ort: WFB Neuershausen<br />
Lit. u.a.: Weiss, Gabriele: Wenn die roten Katzen tanzen... Jeux Dramatiques für sozial- und<br />
heilpädagogische Berufe. <strong>Freiburg</strong> 1999
- 51 -<br />
<strong>Grundstudium</strong> - Fachbereich Heilpädagogik 1. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Kunst- und gestaltungstherapeutische<br />
Arbeit in<br />
der Nachsorge mit altersverwirrten<br />
Menschen an<br />
der Neurologischen Klinik<br />
Elzach<br />
max. 4 Tn<br />
(2 Tn GS, 2 Tn HS)<br />
2 Std.<br />
Menzen Do 14.00 - 16.30<br />
Beginn: 16.10.2003<br />
2301<br />
Wir werden im wöchentlichen Abstand an zwei Nachmittagen alte und dementiell erkrankte<br />
Menschen an der Neurologischen Klinik Elzach betreuen. Die Teilnehmer der Veranstaltung<br />
werden jeweils an einem Nachmittag für ca. 4 Stunden in der Klinik 6 Patient/innen je Gruppe mit<br />
bildnerisch-ästhetischen Mitteln betreuen. Die Arbeit wird laufend supervidiert. Interessenten<br />
müssen also 1 Nachmittag und 1 Supervisionsstunde einplanen. Die Termine werden nach<br />
Vereinbarung gemacht.<br />
Philosophische und christlich-ethische Grundlagen der<br />
heilpädagogischen Arbeit<br />
Philosophisch-anthropologische, ethische und erkenntnistheoretische<br />
Grundlagen<br />
Der Mensch auf der Suche<br />
nach Sinn<br />
(max. 40 Tn)<br />
2 Std. Seminar<br />
Bohlen Fr 8.00 - 9.30 1206<br />
Menschen beurteilen ihre Handlungen und auch die Handlungen anderer darauf, ob sie sinnvoll<br />
sind oder nicht. Doch was kann unter dem Sinn einer Handlung überhaupt verstanden werden? Hat<br />
unser Handeln und unser Leben einen Sinn? Oder ist menschliches Leben absurdes Dasein? In<br />
der Lehrveranstaltung soll die Möglichkeit geboten werden, solchen Fragen im Gespräch nachzugehen.<br />
Dabei werden unterschiedliche philosophische und auch theologische Ansätze zur<br />
Beantwortung der Sinnfrage als Anregung fungieren. Die Lehrveranstaltung ist als eine Einführung<br />
in das Philosophieren konzipiert. Sie setzt keine philosophischen Kenntnisse, wohl aber die<br />
Bereitschaft zum Gespräch voraus.<br />
Anthropologische Grundla- Bohlen<br />
gen der Sozialen Arbeit<br />
(max. 40 Tn)<br />
2 St. Seminar<br />
Fr 9.45 - 11.15 1206
- 52 -<br />
<strong>Grundstudium</strong> - Fachbereich Heilpädagogik 1. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Anhand unterschiedlicher philosophischer Texte wollen wir die Bedeutung des Kommunikationsgeschehens<br />
für das Menschsein thematisieren. In dem Kontext wird der Bezug von Ich und Du,<br />
Selbst und Anderem, Dasein und Mitsein, Individualität und Sozialität für uns von Interesse sein.<br />
Ziel der Lehrveranstaltung ist es, die genannten Begriffe im Gespräch zu klären, um dadurch ein<br />
philosophisch fundiertes Verständnis der anthropologischen Grundlagen Sozialer Arbeit zu<br />
ermöglichen.<br />
Philosophische<br />
Anthropologie<br />
(max. 40 Tn)<br />
2 Std. Seminar<br />
Kollhoff Mo 19.00 - 20.30 1207<br />
Durch die Lektüre verschiedener Texte von Platon bis zu Nietzsche soll ein Einblick in philosophische<br />
Denkweisen gegeben werden. Thematisch konzentriert sich die Seminararbeit auf die<br />
anthropologische Grundfrage: "Was ist der Mensch?"<br />
Eine Textsammlung kann zu Beginn des Semesters kopiert werden.<br />
Ist Gott gut?<br />
Überlegungen zur "Güte Gottes"<br />
angesichts der Zustände<br />
in der Welt<br />
(max. 40 Tn)<br />
2 Std. Seminar<br />
Uhde Fr 9.45 - 11.15 3202<br />
Das Problem der "Güte Gottes" in Anbetracht der großen Miss-Stände in der Welt ist eine schwere<br />
gedankliche Herausforderung für die Theologie, aber auch für die einzelne Glaubenserfahrung.<br />
Von Alters her haben daher religiöse Denker versucht, hier eine Antwort zu finden - und jeder, der<br />
in einer monotheistischen Religion lebt, muss Auskunft geben können, wie dieses Problem<br />
theoretisch und / oder praktisch zu lösen sei. Daher versucht die Vorlesung, einige der wichtigsten<br />
Standpunkte christlicher Theologie vorzustellen und diese in eine praxisbezogene Gegenwart zu<br />
übersetzen.<br />
Anthropologische und ethi- Hammer<br />
sche Grundlagen des sozialen<br />
Handelns<br />
(max. 40 Tn)<br />
2 Std. Seminar<br />
Mo 14.00 - 15.30 1206<br />
Wir gehen aus von der Erkenntnis, “dass in den meisten Persönlichkeitsmodellen implizit eine<br />
generelle philosophische Sicht des Menschen enthalten ist” (L.A. Pervin). Dem folgend behandeln<br />
wir im ersten Semester systematisch einige für die sozial- und heilpädagogische Arbeit relevante<br />
anthropologische und ethische Themen (Denken zwischen Wahrheit und Täuschung; Freiheit,<br />
Verantwortung und Schuld; Sinn und Glück; Sterben und Tod...). Die Wahl der Themen im zweiten<br />
Semester richtet sich nach den Interessen der TN (ausgedrückt in der Wahl des Themas der<br />
Hausarbeit); es wird erwartet, dass die TN die Ergebnisse ihrer Hausarbeit in das Seminar einbringen.<br />
In der Organisationsform wird ein Wechsel von Einzel-, Partner-, Kleingruppen- und<br />
Plenumsarbeit angestrebt.
- 53 -<br />
<strong>Grundstudium</strong> - Fachbereich Heilpädagogik 1. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Kultur- und Medienpädagogik<br />
siehe “<strong>Grundstudium</strong>: Zusammenfassung der Angebote im Medienbereich”<br />
C. weitere Angebote<br />
siehe “Zusatzangebote” und “Sprachkurse”
- 54 -<br />
<strong>Grundstudium</strong> - Fachbereich Heilpädagogik 3. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Planung, Dokumentation,<br />
Evaluation, Präsentation<br />
heilpädagogischen Handelns<br />
2 Std.<br />
Huslisti /<br />
Ehrhart<br />
im Rahmen der<br />
Studientage:<br />
Beginn:<br />
20.10.2003, 9.00 Uhr<br />
Ende:<br />
24.10.2003, nach<br />
Vereinbarung<br />
Im letzten Jahrzehnt nahm die Bedeutung zu, das "Tun" im heilpädagogischen Handeln fundiert zu<br />
planen und zu dokumentieren. Unter dem steigenden Kostendruck der verschiedenen Leistungsträger<br />
im Sozial- und Gesundheitswesens sehen wir uns ferner dazu gezwungen, den Erfolg<br />
unserer Arbeit schriftlich darzulegen, auszuwerten und den entsprechenden Interessengruppen zu<br />
präsentieren. Gleichzeitig wird im Rahmen des Qualitätsmanagements der Versuch unternommen,<br />
bewertbare Standards als Kriterien für den Erfolg unserer Arbeit zu formulieren. Am Beispiel eines<br />
Wohnheims sowie einer ambulanten heilpädagogischen Praxis werden die Teilnehmer dieser<br />
Lehrveranstaltung einen praktischen Bezug zu diesem Themenkomplex erhalten.
- 55 -<br />
<strong>Grundstudium</strong> - Fachbereich Religionspädagogik 1. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
A. Pflichtbereich<br />
Humanwissenschaftliche Grundlagen<br />
Pädagogik<br />
Hauptfragen der<br />
Erziehungswissenschaft<br />
2 Std. Vorlesung<br />
Psychologie<br />
Entwicklungspsychologie<br />
2 Std. Vorlesung<br />
Schinzler Do 9.45 - 11.15 Aula<br />
1100<br />
Steinebach Mi 11.30 - 13.00 Aula<br />
1100<br />
Entwicklung erscheint mehr und mehr als ein vom Menschen selbst gestalteter Prozess. Vorhersagen<br />
zu Entwicklungsverläufen und gezielte Interventionen sind schwierig, ihre Gültigkeit und<br />
Wirkungen sind von vielen Faktoren abhängig. Multidimensionalität, Multidirektionalität, Multikausalität<br />
und Multifunktionalität werden zu theoretischen Leitbegriffen. Damit stehen nicht nur allgemeine<br />
Entwicklungsverläufe, sondern auch individuelle Entwicklungsprozesse im Brennpunkt der<br />
Aufmerksamkeit. Dies betrifft so unterschiedliche Fragen wie gesundes Altern, Entwicklungserleben,<br />
Krisen und kritische Lebensereignisse, Entwicklung in Partnerschaften, Familien und<br />
Teams.<br />
Soziologie<br />
2 Std. Vorlesung<br />
Hohm Di 11.30 - 13.00 1206<br />
Die Soziologie gewinnt ihre Autonomie als Fachdisziplin der Wissenschaft dadurch, dass sie die<br />
Welt anhand der Differenz sozial/nichtsozial beobachtet und ihre theoretische Anschlussfähigkeit<br />
durch die nähere Betrachtung des Sozialen erreicht. Ihre Paradigmen lassen sich mithin als<br />
unterschiedliche Antworten auf die Frage interpretieren, wie Soziales im Unterschied zu Nichtsozialem<br />
in der Welt möglich wird und sich dauerhaft reproduzieren kann. Ein soziologisches<br />
Paradigma- die Systemtheorie - wird im Zentrum der Vorlesung stehen. Für sie verweist das<br />
Soziale auf Kommunikation. Ihre Wiederholung auf soziale Systeme. Und ihre nichtsoziale Umwelt<br />
auf den Menschen. Welche Implikationen mit diesen Antworten für die soziologische Beobachtung<br />
der modernen Gesellschaft und des modernen Menschen verbunden sind, wird Generalthema der<br />
Vorlesung sein.<br />
Literatur: Hans-Jürgen Hohm: Soziale Systeme, Kommunikation, Mensch. Eine Einführung in<br />
soziologische Systemtheorie, Juventa Verlag, Weinheim/München 2000.<br />
Einführung in das wissenschaftliche<br />
Arbeiten<br />
1 Std. Übung<br />
Pemsel-<br />
Maier<br />
nach Vereinbarung<br />
Die Einführung will die Studierenden mit den nötigen Hilfsmitteln und dem Handwerkszeug für das<br />
wissenschaftliche Arbeiten vertraut machen: Grundregeln, Literaturrecherche, Zitation, Aufbau<br />
einer Hausarbeit etc. Dazu gehören auch mehrere Bibliotheksführungen. Die Veranstaltung findet<br />
nach Absprache in Blöcken statt.
- 56 -<br />
<strong>Grundstudium</strong> - Fachbereich Religionspädagogik 1. Semester<br />
Biblische und Historische Theologie<br />
Altes Testament<br />
Altes Testament I:<br />
Einführung in die Exegese<br />
des Alten Testaments<br />
2 Std. Vorlesung<br />
Heusler Mo 11.30 - 13.00 3301<br />
Die Heilige Schrift der Juden ist die Heilige Schrift Jesu von Nazareth. In einem langen, tausendjährigen<br />
Prozess, in der ständigen Reflexion Israels über sich selbst und über die Beziehung zu<br />
seinem Gott ist die biblische Überlieferung Schritt für Schritt gewachsen, bis sie ihre heutige<br />
Gestalt erreichte: die Bücher der Tora, die Prophetenbücher und die sogenannten Schriften.<br />
Anliegen der Vorlesung ist es, dieser Entstehungsgeschichte auf die Spur zu kommen, dabei die<br />
Grundzüge der Exegese zu vermitteln und einzuführen in alttestamentliche Theologie und Anthropologie.<br />
Neues Testament<br />
Neues Testament I:<br />
Einführung in die Exegese<br />
des Neuen Testaments<br />
2 Std. Vorlesung<br />
Heusler Do 8.00 - 9.30 3301<br />
Die Botschaft von der Auferstehung Jesu von den Toten ist die Mitte des Neuen Testaments. Im<br />
Licht der Auferstehung schreiben die neutestamentlichen Schriften die Geschichte Jesu und geben<br />
Zeugnis von Christus, dem Erlöser: die Evangelien, die Apostelgeschichte, die Briefe, die Apokalypse.<br />
Aufgabe der Bibelwissenschaft ist es, die einzelnen Entwürfe der Verkündigung herauszuarbeiten<br />
und aus ihrem jeweiligen geschichtlichen Kontext heraus zu interpretieren. Die Vorlesung<br />
will mit dem wissenschaftlichen Arbeiten am Neuen Testament und mit den exegetischen Methoden<br />
- vor allem der historisch-kritischen Methode - vertraut machen und in die urchristliche Überlieferung,<br />
in die Theologie und Christologie in ihrer unterschiedlichen Gestalt einführen.<br />
Kirchengeschichte<br />
Kirchengeschichte I:<br />
Alte Kirchengeschichte<br />
Von den Anfängen bis zum<br />
Mittelalter<br />
2 Std. Vorlesung<br />
Schmitz Do 11.30 - 13.00 3301<br />
Nach einer Einführung in das Fach und in die religiöse Situation des Mittelmeerraumes zur Zeit der<br />
Entstehung des Christentums vermittelt die Lehrveranstaltung in Grundzügen die geschichtliche<br />
Entwicklung der Kirche, ihrer Lehre, ihres Lebens und ihres Verhältnisses zum Staat.
- 57 -<br />
<strong>Grundstudium</strong> - Fachbereich Religionspädagogik 1. Semester<br />
Systematische Theologie<br />
Theologische Propädeutik<br />
Einführung in die<br />
Theologie:<br />
Einführung in das Studium<br />
der Religionspädagogik und<br />
in die Theologie<br />
2 Std. Vorlesung / Übung<br />
Schmitz Mi 9.45 - 11.15 3301<br />
Gegenstandsbereiche und Ziele:<br />
- Orientierung im religionspädagogischen Studium gewinnen<br />
- Theologie und den Kanon der theologischen Fächer verstehen lernen<br />
- Wichtige Theologen, theologische Fragestellungen und Richtungen der Theologie des 20.<br />
Jahrhunderts durch Referate und Diskussion erarbeiten.<br />
Dogmatik I:<br />
Einführung in die Aufgaben,<br />
Ziele und Arbeitsweisen der<br />
Dogmatik<br />
2 Std. Vorlesung<br />
Pemsel-Maier Di 8.00 - 9.30 3301<br />
Die Lehrveranstaltung gibt eine allgemeine Einführung in die Dogmatik. Im 1. Teil stellt sie die<br />
Frage nach Sinn, Ziel und Aufgabe der Dogmatik und reflektiert die Notwendigkeit des je "Neu-<br />
Sagens" von Glaubensaussagen. Im 2. Teil befasst sie sich mit den Dogmen im Sinne verpflichtender<br />
Glaubenslehren und beleuchtet ihre Entstehungsbedingungen und ihre Grenzen.<br />
Moraltheologie I:<br />
Einführung in die Moraltheologie<br />
2 Std. Vorlesung<br />
Schmitz Di 9.45 - 11.15 3302<br />
Im ersten Schritt geht es um eine Einführung in Begriff und Grundlagen der Ethik. Der zweite Teil<br />
behandelt human- und gesellschaftswissenschaftliche Erkenntnisse, die einer theologischen Ethik<br />
wichtige Einsichten für ihre Arbeit liefern. Im dritten Schritt ist das Verhältnis von Weltanschauung<br />
und Ethik zu reflektieren. Anschließend werden wichtige Elemente einer christlichen Ethik für heute<br />
erarbeitet.<br />
Praktische Theologie<br />
Grundkurs Pastoral<br />
Gottesdienstgestaltung<br />
1 Std. Seminar<br />
Höffner Mo 8.00 - 9.30<br />
14-täglich<br />
Beginn: 13.10.2003<br />
3301
- 58 -<br />
<strong>Grundstudium</strong> - Fachbereich Religionspädagogik 1. Semester<br />
Das II. Vatikanische Konzil (1963-65) bezeichnete im ersten Dokument (der Liturgiekonstitution) die<br />
Feiern des Glaubens, die Gottesdienste der Kirche, als Quelle und Gipfel allen Handelns der<br />
Kirche. Was ist überhaupt Liturgie, Gottesdienst? Welche gottesdienstlichen Feiern der Kirche gibt<br />
es? Wer ist Träger dieser Gottesdienste? Was ist bei deren Vorbereitung, Feier und Nachbereitung<br />
zu berücksichtigen? Welche Hilfestellungen geben uns hierfür die Liturgischen Bücher? Unter<br />
Berücksichtigung eigener gottesdienstlicher Erfahrungen wird die Veranstaltung im Sinne einer<br />
Fundamentalliturgik diesen Fragen nachgehen.<br />
Missionarische Prozesse<br />
(Grundlegungsphase<br />
1. Semester)<br />
Heidemanns Einführung:<br />
nach Vereinbarung<br />
Abschlusstag:<br />
Fr 09.01.2004<br />
09.00 - 12.00 Uhr<br />
14.00 - 17.00 Uhr<br />
3301<br />
Von missionarischer Kirche und Gemeinde zu sprechen ist wieder aktuell. Das Seminarangebot<br />
“Missionarische Prozesse” greift dies auf und möchte Gelegenheit geben, die missionarische<br />
Dimension der pastoralen Arbeit zu entdecken. Dabei sollen vor allem auch die kirchlich-theologischen<br />
Entwicklungen der Weltchristenheit betrachtet und in ihrer Bedeutung für die Suche nach<br />
der eigenen Identität von Christinnen und Christen gerade auch hierzulande wahrgenommen<br />
werden.<br />
Die “Missionarischen Prozesse” umfassen drei Abschnitte: 1) Grundlegungsphase “Missionstheologische<br />
Einführung”, 2) Vertiefungsphase “Erarbeitung von Beispielen missionarischer Praxis”<br />
und 3) Projektphase “Praktische Annäherung an spezifische Erfahrungsfelder” (fakultativ).<br />
In diesem ersten Abschnitt geht es zunächst um die Aneignung missionstheologischer Grundlagen<br />
(Missionsverständnis, Inkulturation, Kontextualität, missionarische Spiritualität etc.). Die Erarbeitung<br />
dieser Themenfelder ist die Voraussetzung, um in den sich anschließenden Phasen 2 und 3<br />
missionarische Prozesse in Kirche und Gesellschaft aufspüren, beschreiben und anzustoßen<br />
können. Im Mittelpunkt steht die Frage, wo und wie christlicher Glaube zur Erneuerung der Kirche<br />
beitragen.<br />
Die Grundlegungsphase beinhaltet die schriftliche Bearbeitung eines Studienbriefes, der auf einem<br />
Einführungstreffen ausgegeben und erläutert wird. Die Ergebnisse dieser Arbeitsphase werden auf<br />
einem Studientag am Endes des Semesters vorgestellt, der zugleich der Vorbereitung der Vertiefungsphase<br />
dient, in der besonders die Beschäftigung mit weltkirchlichen Handlungsfeldern in den<br />
Diözesen angestrebt wird.<br />
Religionspädagogik I<br />
Einführung in die<br />
Religionspädagogik<br />
2 Std. Vorlesung<br />
Schilling Mo 9.45 - 11.15 3201<br />
Es gilt, die unterschiedlichen Zielsetzungen von Religionsunterricht, wie sie in den vergangenen 30<br />
Jahren vertreten wurden, kennen zulernen. Dabei sollen jeweils Kritikpunkte und Bleibendes im<br />
Blick auf den heutigen Religionsunterricht erarbeitet werden. Am Beispiel der Montessoripädagogik<br />
wird ein reformpädagogischer Ansatz praktisch vorgestellt.<br />
Pastoralpraktikum<br />
TPS-Vorbereitung des<br />
Pastoralpraktikums<br />
Färber<br />
Hilpert<br />
Schilling<br />
Di 20.01.2004<br />
9.00 - 16.30<br />
2100<br />
3303
- 59 -<br />
<strong>Grundstudium</strong> - Fachbereich Religionspädagogik 1. Semester<br />
B. Wahlpflichtbereich<br />
Humanwissenschaftliche Grundlagen<br />
Religionsphilosophie I<br />
Anthropologie<br />
2 Std. Vorlesung<br />
Kollhof Do 17.30 - 19.00<br />
+ Kompakttermin:<br />
12. / 13.12.2003<br />
2110<br />
Anhand ideengeschichtlicher Stationen von Philosophie und Theologie soll der Kantischen Grundfrage<br />
“Was ist der Mensch?” nachgegangen werden.<br />
Im ersten Semester stehen dabei die Entwürfe von Platon, Aristoteles, Augustinus, Thomas von<br />
Aquin und der Renaissancephilosophie (G.Bruno) im Vordergrund.<br />
Im Kompaktseminar (12./13.12.2003) wollen wir uns mit Descartes, Spinoza und Hobbes beschäftigen.<br />
Kultur- und Medienpädagogik<br />
Liturgiemusikalische Ausbildung<br />
“Tageszeitenliturgie:<br />
Urgebet der Kirche in alter<br />
und neuer Form”<br />
2 Std. Seminar<br />
in Zusammenarbeit mit der<br />
Theol. Fakultät der<br />
Uni <strong>Freiburg</strong><br />
Kolberg<br />
Jeggle-Merz<br />
Mi 14.15 - 15.45<br />
Beginn: 15.10.2003<br />
Veranstaltungsort:<br />
Niemensstr. 9,<br />
79098 <strong>Freiburg</strong><br />
weitere Angebote siehe “<strong>Grundstudium</strong>: Zusammenfassung der Angebote im<br />
Medienbereich”<br />
Zusatzangebot<br />
Stimmbildung/Vorsingen<br />
in der Liturgie<br />
Einzelunterricht auf Anfrage<br />
C. weitere Angebote<br />
siehe “Zusatzangebote” und “Sprachkurse”<br />
Kolberg nach Vereinbarung
- 60 -<br />
Fachbereich Pflege - <strong>Grundstudium</strong> - 1. Semester<br />
Studiengang Pflegepädagogik<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Pflichtfächer<br />
Pflegetheorien und<br />
Modelle<br />
(parallel mit PM)<br />
3 Std.<br />
Brandenburg,<br />
Immenschuh<br />
Veranstaltungszeiten<br />
und -orte siehe Aushang<br />
des Fachbereichs Pflege<br />
In dieser Veranstaltung geht es um einen Einstieg in relevante Fragen der Pflegewissenschaft.<br />
Zu Beginn wird ein historischer Überblick gegeben, dann folgt eine grundsätzliche Klärung der<br />
Begriffe “Wissenschaft”, “Modell” und “Theorie”. Den Schwerpunkt bildet die Vorstellung ausgewählter<br />
Aufsätze (Henderson, Orem, Peplau, Rogers, Nightingale, Leininger) sowie deren<br />
kritische Diskussion. Ziel ist es, im Rahmen der Veranstaltung einen ersten Überblick über<br />
theoretische Ansätze in der Pflege zu gewinnen und Kriterien zu entwickeln, wie die entsprechenden<br />
theoretischen Ansätze beschrieben, analysiert, kritisiert und evaluiert werden können.<br />
Nachdem die Grundlagen gelegt sind, geht es am Ende der Veranstaltung um die Umsetzung<br />
der Pflegetheorien in die Praxis.<br />
Effektivität<br />
pflegerischen Handelns<br />
(parallel mit PM)<br />
2 Std.<br />
Immenschuh<br />
Pflegende sehen sich im Spannungsfeld von steigendem Kostendruck und veränderten Anforderungen<br />
an ihre Arbeit zunehmend mit der Frage konfrontiert, welche Handlungsweisen<br />
wirksam und bezahlbar sind. Hierfür bedarf es zum einen eines politischen und ethischen<br />
Entscheidungsrahmens, welche Pflege sich unsere Gesellschaft leisten will, zum anderen einer<br />
wissenschaftlichen Fundierung pflegerischen Handelns.<br />
Im Seminar findet über diese Frage eine Auseinandersetzung mit subjektiven Theorien und<br />
Erfahrungswissen (best practise) der Studierenden und eine Annäherung an pflegewissenschaftliches<br />
Denken (evidence based nursing) statt.<br />
Berufsbilder:<br />
Nationale/internationale<br />
Geschichte der Pflege<br />
und der Berufe der<br />
Pflege<br />
(parallel mit PM)<br />
2 Std.<br />
Müller
- 61 -<br />
Fachbereich Pflege - <strong>Grundstudium</strong> - 1. Semester<br />
Studiengang Pflegepädagogik<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Viele Bedingungen und Handlungsabläufe der Pflege, die heute wie selbstverständlich im<br />
Pflegealltag akzeptiert zu werden scheinen, haben ihre Vorgeschichte. Deren Entwicklung soll<br />
in diesem Veranstaltungsangebot bis zu den Anfängen der so genannten neuzeitlichen Krankenpflege<br />
zurückverfolgt werden. Es geht darum, ein grundlegendes Verständnis für die heutige<br />
Situation der Pflegeberufe zu erwerben. Mit einem vergleichenden Blick auf internationale<br />
Professionalisierungsprozesse der Pflege soll schließlich die Diskussion um hiesige aktuelle<br />
Entwicklungen unterstützt werden. Da das zu bearbeitende Themenspektrum sehr weitreichend<br />
zu bearbeiten wäre, aber aufgrund des zur Verfügung stehenden zeitlichen Rahmens nur<br />
übersichtsweise erfolgen kann, wird neben der chronologischen Abfolge ein Leitmotiv zu jeweils<br />
einer geschichtlichen Entwicklungsphase definiert und die Situation der Pflegeberufe an diesem<br />
Leitmotiv exemplarisch bearbeitet.<br />
Eine Literaturliste soll das Veranstaltungsangebot unterstützen, aber auch die eine oder den<br />
anderen Teilnehmer dazu motivieren, tiefgreifendes Textmaterial im Selbststudium zu erarbeiten.<br />
Pädagogik:<br />
Historische Pädagogik<br />
1 Std.<br />
Christliche<br />
Anthropologie<br />
2 Std.<br />
--------------- verschoben ins<br />
3. Semester!<br />
Bohlen<br />
Personalität als Grundbegriff theoretisch-philosophischer Anthropologie:<br />
Die Biotechnologie hat uns vor fundamentale Probleme gestellt. Darf man Menschen klonen?<br />
Soll man in Embryonenforschung investieren? Ist aktive Sterbehilfe ethisch zu rechtfertigen? Im<br />
Kontext all dieser Probleme stellt sich die Frage nach dem Menschen und seiner personalen<br />
Würde. Die Lehrveranstaltung will der Frage nachgehen, was unter der Würde einer Person<br />
überhaupt verstanden werden kann. Dazu sollen unterschiedliche philosophische und theologische<br />
Konzepte der Personalität des Menschen vorgestellt und auf ihre Bedeutung für eine<br />
ethische Stellungnahme zu den genannten Problemen befragt werden.<br />
Kommunikation:<br />
Gesprächsführung und<br />
kommunikative<br />
Kompetenz<br />
(parallel mit PM und TM)<br />
TRAINING, 2 Std.<br />
Wiss. Arbeiten:<br />
Einführung in wiss.<br />
Denken und Arbeiten<br />
(parallel mit PM und TM)<br />
1 Std.<br />
Scherer,<br />
Kösler<br />
Thiele<br />
BLOCKSEMINAR<br />
02. bis 05.12.2003<br />
Exkursion mit Zusatzkosten!
- 62 -<br />
Fachbereich Pflege - <strong>Grundstudium</strong> - 1. Semester<br />
Studiengang Pflegepädagogik<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Im Rahmen dieser Veranstaltung wird eine Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten<br />
vorgenommen. Ziel ist es, Studierende mit grundlegenden formalen, methodischen und inhaltlichen<br />
Aspekten schriftlicher Arbeiten vertraut zu machen. Darüber hinaus ist geplant, die wesentlichen<br />
Unterscheidungen zwischen Hausarbeiten, Referaten und Vorträgen zu erläutern und mit<br />
den Studierenden an Beispielen auszuprobieren.<br />
Erörtert werden: psychologische Aspekte, Techniken, Strukturen und Funktion der Formen<br />
wissenschaftlichen Arbeitens.<br />
Psychologie:<br />
Psychologische<br />
Richtungen und Schulen<br />
2 Std.<br />
Scherer<br />
Die Veranstaltung gibt einen Überblick über die wichtigen psychologischen Schulen: Von der<br />
Tiefenpsychologie mit ihren wichtigsten Vertretern (Freud, Adler, Jung) über die Verhaltenspsychologie<br />
(vor und nach der kognitiven Wende) bis zu den systemischen Psychologien. Es<br />
werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Theorie hinsichtlich psychologischer Grundannahmen<br />
(Psyche und Psychopathologie) herausgearbeitet.<br />
Soziologie: Einführung<br />
in soziologische<br />
Theorien/ Bezug zu<br />
Pflegewissenschaft<br />
(parallel mit PM und TM)<br />
2 Std.<br />
Werner<br />
Es werden die wichtigsten soziologischen Schulen und Grundlagentheorien (Durkheim, Weber,<br />
Symbolischer Interaktionismus, Ethnomethodologie, Strukturfunktionalismus, Systemtheorie,<br />
Kritische Theorie, Marxismus und historischer Materialismus) vorgestellt und diskutiert. Zusätzlich<br />
sollen sie, wo möglich, auf Zusammenhänge mit verschiedenen Pflegetheorien untersucht<br />
werden.<br />
Literatur:<br />
Schülein, J.A:, Brunner, K.-M., 1994, Soziologische Theorien - Eine Einführung für Amateure,<br />
Springer Verlag, Wien, New York<br />
(Literatur wird auszugsweise als Reader zur Verfügung gestellt)<br />
ISAG<br />
Gerontologie<br />
(parallel mit PM)<br />
2 Std.<br />
Brandenburg
- 63 -<br />
Fachbereich Pflege - <strong>Grundstudium</strong> - 1. Semester<br />
Studiengang Pflegepädagogik<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Zusatzfächer - freiwillig -<br />
Schreibwerkstatt<br />
(parallel mit PM und TM)<br />
2 Std.<br />
Stöbener Veranstaltungszeiten<br />
und -orte siehe Aushang<br />
des Fachbereichs Pflege<br />
Wie eine normale Werkstatt so braucht auch eine Schreibwerkstatt ihr besonderes Ambiente,<br />
ihre besonderen Werkzeuge sowie ihre spezifischen Methoden. Wir werden uns mit verschiedenen<br />
Schreibtechniken und kreativen Methoden den wissenschaftlichen Schreibaufgaben, wie<br />
zum Beispiel Hausarbeiten, Rezessionen, wissenschaftlichen Aufsätzen und Lehrgeschichten,<br />
vertraut machen. Die Studierenden erproben und erlernen in dieser Schreibwerkstatt die<br />
notwendigen Grundlagen, um den Anforderungen wissenschaftlichen Lesens und Schreibens<br />
gerecht werden zu können. In einem kollegialen und anregenden Ambiente sollen die Studierenden<br />
die Erfahrung machen, dass Freude das Ergebnis von Schreiben ist und nicht deren<br />
Voraussetzung.<br />
Vor allem: Lesen und Schreiben kann gelehrt und gelernt werden.<br />
ISAG<br />
Forum Soziale Altenarbeit<br />
in der Stadt <strong>Freiburg</strong><br />
und Umgebung<br />
(30 - 40 TN)<br />
Kricheldorff,<br />
Brandenburg<br />
Veranstaltungszeiten<br />
und - orte siehe Aushang zu<br />
Beginn des Semesters!<br />
Im Rahmen dieses regelmäßig stattfindenden Forums werden aktuelle Themen aus dem<br />
Berufsfeld der Sozialen Altenarbeit aufgegriffen. Nach einer inhaltlichen Einführung in das<br />
Thema wird dieses in einem intensiven Theorie-Praxis-Dialog vertieft und aus unterschiedlichen<br />
Blickwinkeln beleuchtet.<br />
Über die inhaltliche Schwerpunktsetzung und die genauen Themen sowie Termine im Wintersemester<br />
2003/04 wird über einen Plakataushang zu Beginn des Semesters informiert werden.<br />
Die einzelnen Veranstaltungen sind offen für alle Vertreter der Fachpraxis und interessierte<br />
Studierende aller Fachbereiche. Das Forum ist darüber hinaus auch eine Informationsplattform<br />
über Fort- und Weiterbildungsangebote, Tagungen und neue Literatur.
- 64 -<br />
Fachbereich Pflege - <strong>Grundstudium</strong> - 1. Semester<br />
Studiengang Pflegemanagement<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Pflichtfächer<br />
Pflegetheorien und<br />
Modelle<br />
(parallel mit PP)<br />
3 Std.<br />
Brandenburg,<br />
Immenschuh<br />
Veranstaltungszeiten<br />
und -orte siehe Aushang<br />
des Fachbereichs Pflege<br />
In dieser Veranstaltung geht es um einen Einstieg in relevante Fragen der Pflegewissenschaft.<br />
Zu Beginn wird ein historischer Überblick gegeben, dann folgt eine grundsätzliche<br />
Klärung der Begriffe “Wissenschaft”, “Modell” und “Theorie”. Den Schwerpunkt bildet die Vorstellung<br />
ausgewählter Aufsätze (Henderson, Orem, Peplau, Rogers, Nightingale, Leininger)<br />
sowie deren kritische Diskussion. Ziel ist es, im Rahmen der Veranstaltung einen ersten<br />
Überblick über theoretische Ansätze in der Pflege zu gewinnen und Kriterien zu entwickeln,<br />
wie die entsprechenden theoretischen Ansätze beschrieben, analysiert, kritisiert und evaluiert<br />
werden können. Nachdem die Grundlagen gelegt sind, geht es am Ende der Veranstaltung<br />
um die Umsetzung der Pflegetheorien in die Praxis.<br />
Effektivität<br />
pflegerischen Handelns<br />
(parallel mit PP)<br />
2 Std.<br />
Immenschuh<br />
Pflegende sehen sich im Spannungsfeld von steigendem Kostendruck und veränderten Anforderungen<br />
an ihre Arbeit zunehmend mit der Frage konfrontiert, welche Handlungsweisen<br />
wirksam und bezahlbar sind. Hierfür bedarf es zum einen eines politischen und ethischen<br />
Entscheidungsrahmens, welche Pflege sich unsere Gesellschaft leisten will, zum anderen einer<br />
wissenschaftlichen Fundierung pflegerischen Handelns.<br />
Im Seminar findet über diese Frage eine Auseinandersetzung mit subjektiven Theorien und<br />
Erfahrungswissen (best practise) der Studierenden und eine Annäherung an pflegewissenschaftliches<br />
Denken (evidence based nursing) statt.<br />
Berufsbilder: Nationale /<br />
Internationale Geschichte<br />
der Pflege und der<br />
Berufe der Pflege<br />
(parallel mit PP)<br />
2 Std.<br />
Müller
- 65 -<br />
Fachbereich Pflege - <strong>Grundstudium</strong> - 1. Semester<br />
Studiengang Pflegemanagement<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Viele Bedingungen und Handlungsabläufe der Pflege, die heute wie selbstverständlich im<br />
Pflegealltag akzeptiert zu werden scheinen, haben ihre Vorgeschichte. Deren Entwicklung soll<br />
in diesem Veranstaltungsangebot bis zu den Anfängen der so genannten neuzeitlichen Krankenpflege<br />
zurückverfolgt werden. Es geht darum, ein grundlegendes Verständnis für die heutige<br />
Situation der Pflegeberufe zu erwerben. Mit einem vergleichenden Blick auf internationale<br />
Professionalisierungsprozesse der Pflege soll schließlich die Diskussion um hiesige aktuelle<br />
Entwicklungen unterstützt werden. Da das zu bearbeitende Themenspektrum sehr weitreichend<br />
zu bearbeiten wäre, aber aufgrund des zur Verfügung stehenden zeitlichen Rahmens nur<br />
übersichtsweise erfolgen kann, wird neben der chronologischen Abfolge ein Leitmotiv zu jeweils<br />
einer geschichtlichen Entwicklungsphase definiert und die Situation der Pflegeberufe an diesem<br />
Leitmotiv exemplarisch bearbeitet.<br />
Eine Literaturliste soll das Veranstaltungsangebot unterstützen, aber auch die eine oder den<br />
anderen Teilnehmer dazu motivieren, tiefgreifendes Textmaterial im Selbststudium zu erarbeiten.<br />
Organisation des Pflegedienstes:Organisationsformen<br />
für stationäre<br />
und ambulante Pflege<br />
und Pflegesysteme<br />
3 Std.<br />
Etzel<br />
Folgende Schwerpunkte werden behandelt:<br />
6 Einführung in die Organisationstheorien und -strukturen<br />
6 Welche Pflegesysteme sind in welchem Behandlungs-/Pflegebereich (klinische stationäre/teilstationäre<br />
und ambulante Kranken-/Altenpflege) anwendbar?<br />
6 Welche Einflüsse haben welche Pflegesysteme auf die Qualität der Pflege?<br />
Literatur:<br />
Büssing, A. (Hrsg.), 1997, Von der funktionalen zur ganzheitlichen Pflege, Hogrefe-Verlag,<br />
Göttingen<br />
Rehmer, A., 1989, Organisationslehre, Einführung Verlag de Gruyter<br />
Scott, R.W., 1986, Grundlagen der Organisationstheorie, Campus Verlag, Frankfurt/Main<br />
Richter, D., 1998, Ganzheitliche Pflege - Trauen die Pflegenden sich zu viel zu?<br />
In: Pflege (11): 255-262<br />
Kommunikation:<br />
Gesprächsführung und<br />
kommunikative Kompetenz<br />
(Training)<br />
(parallel mit PP und TM)<br />
2 Std.<br />
Scherer,<br />
Kösler<br />
BLOCKSEMINAR<br />
20. bis 23.01.2004<br />
Exkursion mit Zusatzkosten!
- 66 -<br />
Fachbereich Pflege - <strong>Grundstudium</strong> - 1. Semester<br />
Studiengang Pflegemanagement<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Einführung in die Sozialpsychologie:<br />
Gruppe,<br />
Individuum, Interaktion<br />
(parallel mit TM)<br />
1 Std.<br />
Ökonomie: Grundlagen<br />
der Betriebswirtschaftslehre<br />
(parallel mit TM)<br />
2 Std.<br />
Wiss. Arbeiten:<br />
Einführung in wiss.<br />
Denken und Arbeiten<br />
(parallel mit PP und TM)<br />
1 Std.<br />
Scherer<br />
Thiele<br />
Thiele<br />
Im Rahmen dieser Veranstaltung wird eine Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten<br />
vorgenommen. Ziel ist es, Studierende mit grundlegenden formalen, methodischen und inhaltlichen<br />
Aspekten schriftlicher Arbeiten vertraut zu machen. Darüber hinaus ist geplant, die wesentlichen<br />
Unterscheidungen zwischen Hausarbeiten, Referaten und Vorträgen zu erläutern und mit<br />
den Studierenden an Beispielen auszuprobieren.<br />
Erörtert werden: psychologische Aspekte, Techniken, Strukturen und Funktion der Formen<br />
wissenschaftlichen Arbeitens.<br />
Soziologie: Einführung<br />
in soziologische<br />
Theorien/ Bezug zur<br />
Pflegewissenschaft<br />
(parallel mit PP und TM)<br />
2 Std.<br />
Werner
- 67 -<br />
Fachbereich Pflege - <strong>Grundstudium</strong> - 1. Semester<br />
Studiengang Pflegemanagement<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Es werden die wichtigsten soziologischen Schulen und Grundlagentheorien (Durkheim, Weber,<br />
Symbolischer Interaktionismus, Ethnomethodologie, Strukturfunktionalismus, Systemtheorie,<br />
Kritische Theorie, Marxismus und historischer Materialismus) vorgestellt und diskutiert. Zusätzlich<br />
sollen sie, wo möglich, auf Zusammenhänge mit verschiedenen Pflegetheorien untersucht<br />
werden.<br />
Literatur:<br />
Schülein, J.A:, Brunner, K.-M., 1994, Soziologische Theorien - Eine Einführung für Amateure,<br />
Springer Verlag, Wien, New York<br />
(Literatur wird auszugsweise als Reader zur Verfügung gestellt)<br />
Gerontologie<br />
(parallel mit PP)<br />
2 Std.<br />
Zusatzfächer - freiwillig -<br />
Schreibwerkstatt<br />
(parallel mit PP und TM)<br />
2 Std.<br />
Brandenburg<br />
Stöbener Veranstaltungszeiten<br />
und -orte siehe Aushang des<br />
Fachbereichs Pflege<br />
Wie eine normale Werkstatt so braucht auch eine Schreibwerkstatt ihr besonderes Ambiente,<br />
ihre besonderen Werkzeuge sowie ihre spezifischen Methoden. Wir werden uns mit verschiedenen<br />
Schreibtechniken und kreativen Methoden den wissenschaftlichen Schreibaufgaben,<br />
wie zum Beispiel Hausarbeiten, Rezessionen, wissenschaftlichen Aufsätzen und Lehrgeschichten,<br />
vertraut machen. Die Studierenden erproben und erlernen in dieser Schreibwerkstatt<br />
die notwendigen Grundlagen, um den Anforderungen wissenschaftlichen Lesens und<br />
Schreibens gerecht werden zu können. In einem kollegialen und anregenden Ambiente sollen<br />
die Studierenden die Erfahrung machen, dass Freude das Ergebnis von Schreiben ist und<br />
nicht deren Voraussetzung.<br />
Vor allem: Lesen und Schreiben kann gelehrt und gelernt werden.
- 68 -<br />
Fachbereich Pflege - <strong>Grundstudium</strong> - 1. Semester<br />
Studiengang Pflegemanagement<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
ISAG<br />
Forum Soziale Altenarbeit<br />
in der Stadt <strong>Freiburg</strong><br />
und Umgebung<br />
(30 - 40 TN)<br />
Kricheldorff,<br />
Brandenburg<br />
Veranstaltungszeiten<br />
und - orte siehe Aushang zu<br />
Beginn des Semesters!<br />
Im Rahmen dieses regelmäßig stattfindenden Forums werden aktuelle Themen aus dem<br />
Berufsfeld der Sozialen Altenarbeit aufgegriffen. Nach einer inhaltlichen Einführung in das<br />
Thema wird dieses in einem intensiven Theorie-Praxis-Dialog vertieft und aus unterschiedlichen<br />
Blickwinkeln beleuchtet.<br />
Über die inhaltliche Schwerpunktsetzung und die genauen Themen sowie Termine im Wintersemester<br />
2003/04 wird über einen Plakataushang zu Beginn des Semesters informiert werden.<br />
Die einzelnen Veranstaltungen sind offen für alle Vertreter der Fachpraxis und interessierte<br />
Studierende aller Fachbereiche. Das Forum ist darüber hinaus auch eine Informationsplattform<br />
über Fort- und Weiterbildungsangebote, Tagungen und neue Literatur.
- 69 -<br />
Fachbereich Pflege - <strong>Grundstudium</strong> - 1. Semester<br />
Studiengang Therapiemanagement<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Pflichtfächer<br />
Theorien und Modelle in<br />
den Gesundheitsfachberufen<br />
4 Std.<br />
Habermann,<br />
Hruschka<br />
Veranstaltungszeiten<br />
und -orte siehe Aushang<br />
des Fachbereichs Pflege!<br />
Die Diskussion über Modelle und Theorien als Bezugsrahmen der therapeutischen Berufe<br />
Physiotherapie und Ergotherapie basiert auf internationalen Entwicklungen. Auch in der deutschen<br />
Ergotherapie werden facheigene Modellentwicklungen angewandt; in der Physiotherapie<br />
gibt es erste Modellentwicklungen, die den Gegenstand des Berufs (seinen Inhalt) bestimmen<br />
sollen.<br />
In diesem zweigeteilten Seminar werden die Studierenden spezifische Modelle und Theorien<br />
der Gesundheitsfachberufe aus dem In- und Ausland erörtern. Vor dem Hintergrund der Bezugswissenschaften,<br />
wie z.B. Sozialwissenschaften, Medizin und Wissenschaftstheorie, soll<br />
die Bedeutung für die Anwendung in der beruflichen Praxis und für die Professionalisierung<br />
der therapeutischen Berufe bestimmt werden.<br />
Effektivität in den<br />
Gesundheitsfachberufen<br />
2 Std.<br />
Borchardt<br />
In diesem Seminar werden Methoden vorgestellt, welche das effektive Vorgehen in der therapeutischen<br />
Arbeit erleichtern. Die Studierenden setzen sich mit ihrem Erfahrungswissen auseinander<br />
und erweitern dieses in Bezug auf Evidenz basierte Therapie.<br />
Berufsbilder: Nationale /<br />
Internationale Geschichte<br />
der Gesundheitsfachberufe<br />
2 Std.<br />
Habermann,<br />
Hruschka<br />
Die Studierenden werden erfahren, wie die geschichtliche Entwicklung der Gesundheitsfachberufe<br />
national und international fortgeschrieben wird. Dazu wird auch die momentane<br />
Ausbildungs- und Studiensituation erläutert und vor dem Hintergrund der Entwicklung vergleichend<br />
diskutiert.<br />
Organisationsformen für<br />
stationäre und ambulante<br />
Rehadienste<br />
2 Std.<br />
Jäckel,<br />
und andere<br />
in Kooperation mit dem<br />
Hochrheininstitut Bad<br />
Säckingen
- 70 -<br />
Fachbereich Pflege - <strong>Grundstudium</strong> - 1. Semester<br />
Studiengang Therapiemanagement<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Die aktuellen Entwicklungen in der Rehabilitation, das Theoriemodell der Rehabilitation, die<br />
Bedeutung von Leitlinien in der Rehabilitation sowie die Vorstellung verschiedener Behandlungskonzepte<br />
(z.B. Psychosomatik, Mutter-Kind-Rehabilitation) bilden den Schwerpunkt des<br />
Theorieteils der Lehrveranstaltung.<br />
Der praktische Teil des Seminars wird von Therapeuten der Rheumaklinik und des Kurmittelhauses<br />
Bad Säckingen gestaltet. Ziel ist es, die Verzahnung des interdisziplinären Teams zu<br />
verdeutlichen. Die Organisation der stationären Rehabilitation sowie die entsprechenden<br />
sozialmedizinischen Aspekte werden mit der Vorstellung von Patienten veranschaulicht.<br />
Sozialpsychologie: Einführung:<br />
Gruppe,<br />
Individuum, Interaktion<br />
(parallel mit PM)<br />
2 Std.<br />
Kommunikation:<br />
Gesprächsführung und<br />
kommunikative<br />
Kompetenz (Training)<br />
(parallel mit PM und PP)<br />
2 Std.<br />
Ökonomie: Grundlagen<br />
der allgemeinen<br />
Betriebswirtschaftslehre<br />
(parallel mit PM)<br />
2 Std.<br />
Wissenschaftliches<br />
Arbeiten: Einführung<br />
(parallel mit PM und PP)<br />
1 Std.<br />
Scherer<br />
Scherer,<br />
Kösler<br />
Thiele<br />
Thiele<br />
BLOCKSEMINAR<br />
20. bis 23.01.2004<br />
Exkursion mit Zusatzkosten!<br />
Im Rahmen dieser Veranstaltung wird eine Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten<br />
vorgenommen. Ziel ist es, Studierende mit grundlegenden formalen, methodischen und inhaltlichen<br />
Aspekten schriftlicher Arbeiten vertraut zu machen. Darüber hinaus ist geplant, die wesentlichen<br />
Unterscheidungen zwischen Hausarbeiten, Referaten und Vorträgen zu erläutern und mit<br />
den Studierenden an Beispielen auszuprobieren.<br />
Erörtert werden: psychologische Aspekte, Techniken, Strukturen und Funktion der Formen<br />
wissenschaftlichen Arbeitens.
- 71 -<br />
Fachbereich Pflege - <strong>Grundstudium</strong> - 1. Semester<br />
Studiengang Therapiemanagement<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Soziologie: Einführung<br />
in soziologische Theorien<br />
/ Bezug zur<br />
Rehabilitationswissenschaft<br />
(parallel mit PM und PP)<br />
2 Std.<br />
Werner<br />
Es werden die wichtigsten soziologischen Schulen und Grundlagentheorien (Durkheim, Weber,<br />
Symbolischer Interaktionismus, Ethnomethodologie, Strukturfunktionalismus, Systemtheorie,<br />
Kritische Theorie, Marxismus und historischer Materialismus) vorgestellt und diskutiert. Zusätzlich<br />
sollen sie, wo möglich, auf Zusammenhänge mit verschiedenen Pflegetheorien untersucht<br />
werden.<br />
Literatur:<br />
Schülein, J.A:, Brunner, K.-M., 1994, Soziologische Theorien - Eine Einführung für Amateure,<br />
Springer Verlag, Wien, New York<br />
(Literatur wird auszugsweise als Reader zur Verfügung gestellt)<br />
Schreibwerkstatt<br />
(parallel mit PM und PP)<br />
2 Std.<br />
Stöbener<br />
Wie eine normale Werkstatt so braucht auch eine Schreibwerkstatt ihr besonderes Ambiente,<br />
ihre besonderen Werkzeuge sowie ihre spezifischen Methoden. Wir werden uns mit verschiedenen<br />
Schreibtechniken und kreativen Methoden den wissenschaftlichen Schreibaufgaben, wie<br />
zum Beispiel Hausarbeiten, Rezessionen, wissenschaftlichen Aufsätzen und Lehrgeschichten,<br />
vertraut machen. Die Studierenden erproben und erlernen in dieser Schreibwerkstatt die<br />
notwendigen Grundlagen, um den Anforderungen wissenschaftlichen Lesens und Schreibens<br />
gerecht werden zu können. In einem kollegialen und anregenden Ambiente sollen die Studierenden<br />
die Erfahrung machen, dass Freude das Ergebnis von Schreiben ist und nicht deren<br />
Voraussetzung.<br />
Vor allem: Lesen und Schreiben kann gelehrt und gelernt werden.
- 72 -<br />
Fachbereich Pflege - <strong>Grundstudium</strong> - 1. Semester<br />
Studiengang Therapiemanagement<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Zusatzfach - freiwillig -<br />
ISAG<br />
Forum Soziale Altenarbeit<br />
in der Stadt <strong>Freiburg</strong><br />
und Umgebung<br />
(30 - 40 TN)<br />
Kricheldorff,<br />
Brandenburg<br />
Veranstaltungszeiten<br />
und - orte siehe Aushang zu<br />
Beginn des Semesters!<br />
Im Rahmen dieses regelmäßig stattfindenden Forums werden aktuelle Themen aus dem<br />
Berufsfeld der Sozialen Altenarbeit aufgegriffen. Nach einer inhaltlichen Einführung in das<br />
Thema wird dieses in einem intensiven Theorie-Praxis-Dialog vertieft und aus unterschiedlichen<br />
Blickwinkeln beleuchtet.<br />
Über die inhaltliche Schwerpunktsetzung und die genauen Themen sowie Termine im Wintersemester<br />
2003/04 wird über einen Plakataushang zu Beginn des Semesters informiert werden.<br />
Die einzelnen Veranstaltungen sind offen für alle Vertreter der Fachpraxis und interessierte<br />
Studierende aller Fachbereiche. Das Forum ist darüber hinaus auch eine Informationsplattform<br />
über Fort- und Weiterbildungsangebote, Tagungen und neue Literatur.
- 73 -<br />
Fachbereich Pflege<br />
- <strong>Grundstudium</strong> - 3. Semester<br />
Studiengang Pflegemanagement<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Pflichtfächer<br />
Recht:<br />
Betriebsverfassung und<br />
Mitarbeiterrechte<br />
(parallel mit TM)<br />
2 Std.<br />
Bockstahler Veranstaltungszeiten<br />
und -orte siehe Aushang<br />
des Fachbereichs Pflege!<br />
In der Veranstaltung werden anhand der Rechtsprechung entnommener Fälle Grundzüge des<br />
“allgemeinen” Arbeitsrechts dargestellt. Folgende Themenbereiche werden dabei angesprochen:<br />
Bedeutung, Begriff, Regelungsgegenstände und Standort des Arbeitsrechts im Rechtssystem<br />
I. Arbeitsrechtliche Rechtsquellenlehre<br />
II. Arbeitnehmerbegriff und internationaler Geltungsbereich des deutschen Arbeitsrechts<br />
III. Einstellungsvorschreibende Maßnahmen, Stellenausschreibung und Anbahnung des<br />
Arbeitsverhältnisses (unter besonderer Berücksichtigung der Befristung des Arbeitsverhältnisses)<br />
IV. Pflichten von Arbeitnehmer und Arbeitgeber einschließlich Haftungsfragen<br />
V. Beendigung des Arbeitsverhältnisses.<br />
Auf diesen Inhalten aufbauend wird in den Veranstaltungen im Hauptstudium (8. Semester)<br />
das Arbeitsrecht des Öffentlichen Dienstes und das kirchliche Arbeitsrecht dargestellt werden.<br />
Wissenschaftliches<br />
Arbeiten:<br />
Lektüre und Redaktion<br />
wissenschaftlicher Texte<br />
(parallel mit PP)<br />
2 Std.<br />
Stöbener<br />
Das Seminar versteht sich als Fortsetzung der Veranstaltung im Sommersemester. Neben der<br />
Kompetenz, wissenschaftliche Texte bearbeiten zu können, geht es vertiefend auch darum,<br />
Techniken der Präsentation, Moderation und des Zeitmanagements zu erwerben.<br />
Psychologie:<br />
Psychologie des Alterns<br />
(parallel zu PP)<br />
2 Std.<br />
Brandenburg
- 74 -<br />
Fachbereich Pflege<br />
- <strong>Grundstudium</strong> - 3. Semester<br />
Studiengang Pflegemanagement<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Aufbauend auf der Einführung in die gerontologische Pflege (2. Semester) werden in dieser<br />
Veranstaltung vor allem psychogerontologische Aspekte vertieft. Der Schwerpunkt liegt auf<br />
Fragen nach der Kompetenz, der Auseinandersetzung mit Belastungssituationen (Coping) sowie<br />
der intellektuellen Leitungsfähigkeit (Intelligenz, Lernen, Gedächtnis). Es sollen sowohl die<br />
Möglichkeiten wie auch die Grenzen der psychischen Kompetenz alter Menschen diskutiert<br />
werden. Akzente liegen auf Fragen der Kompetenz im Alter und der Interventionsgerontologie.<br />
Berücksichtigung finden auch die aktuellen Debatten um die Zukunft der Heime und die Gewaltproblematik<br />
im Alter.<br />
ISAG<br />
Soziologie:<br />
Soziologie der<br />
Lebensalter<br />
(parallel mit PP)<br />
2 Std.<br />
Werner<br />
Thematische Schwerpunkte sind: Grundlagen der Demographie, Bevölkerungssoziologie, der<br />
Soziologie der verschiedenen Altersgruppen und der Familiensoziologie<br />
Literatur:<br />
Höpflinger, F., 1987, Bevölkerungssoziologie, Eine Einführung in bevölkerungs-soziologische<br />
Ansätze und demographische Prozesse, Juventa, Weinheim<br />
Backes, G.M., Clemens, W., 1998, Lebensphase Alter, Eine Einführung in die sozialwissenschaftliche<br />
Alternsforschung, Juventa, Weinheim<br />
(Literatur wird auszugsweise als Reader zur Verfügung gestellt)<br />
Kommunikation:<br />
Kommunikationswissenschaft<br />
und kommunikative<br />
Kompetenz<br />
(parallel mit PP und TM)<br />
Training, 2 Std.<br />
Pflegewissenschaft:<br />
Forschungsergebnisse<br />
aus der Pflegewissenschaft<br />
(parallel mit PP)<br />
2 Std.<br />
Kösler,<br />
Scherer<br />
Brandenburg,<br />
Immenschuh<br />
BLOCKSEMINAR<br />
02. bis 05.12.2003<br />
Exkursion mit Zusatzkosten!
- 75 -<br />
Fachbereich Pflege<br />
- <strong>Grundstudium</strong> - 3. Semester<br />
Studiengang Pflegemanagement<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Nach dem im 1. Semester die Pflegetheorien und Pflegemodelle ausführlich diskutiert und im 2.<br />
Semester wissenschaftstheoretische Grundlagen gelegt wurden, soll der Schwerpunkt im 3.<br />
Semester auf empirischen Ergebnissen der Pflegewissenschaft (mit Bezug zu Pflegemanagement<br />
und Pflegepädagogik) gelegt werden. Dies ist deswegen notwendig, um einen Überblick<br />
über relevante Forschungsergebnisse mit Bedeutung für Pflegepädagogik und Pflegemanagement<br />
zu erhalten. Möglichkeiten und Grenzen pflegerischer Intervention - seien sie pädagogisch<br />
oder durch das Management motiviert - sind ohne fundierte Kenntnisse des Forschungsstandes<br />
nicht adäquat einzuschätzen. Eine Auswahl relevanter Studien soll in diesem Seminar vorgestellt<br />
und kritisch diskutiert werden.<br />
Berufsbilder:<br />
Theorie des Professionalisierungsbegriffes<br />
(parallel mit PP)<br />
2 Std.<br />
Gertsen<br />
Die Entscheidung, Pflege zu studieren, könnte etwas zu tun haben mit den Bestrebungen, den<br />
Berufsstand zu professionalisieren. Sicherlich aber geht es auch darum, die eigene Professionalität<br />
zu erweitern. Dazu bedarf es unter anderem einer Auseinandersetzung mit dem Begriff der<br />
Profession.<br />
In diesem Seminar soll dies geschehen anhand der Beschäftigung mit Professionalisierungstheorien,<br />
die mit der Pflege zunächst so viel zu tun haben wie die Auseinandersetzung mit<br />
eigenen beruflichen Erfahrungen der Studierenden innerhalb dieses Seminars dies zulassen.<br />
Angestrebt wird, einen Standpunkt innerhalb der Professionalisierungsdebatte zu erarbeiten, der<br />
in den späteren Seminaren eine Grundlage für ein Verständnis der Professionalisierung der<br />
Pflege bietet.<br />
Sozialökonomie<br />
Wirtschaftsordnung und<br />
soziale Marktwirtschaft<br />
(parallel mit PP und TM)<br />
2 Std.<br />
Thiele<br />
In der Veranstaltung wird auf die makroökonomischen Grundlagen der Volkswirtschaft eingegangen.<br />
Themenbereiche sind:<br />
- Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung<br />
- Arbeitslosigkeit<br />
- Inflation<br />
- Konjunktur und Wachstum<br />
- Prinzipien und Ziele der Wirtschafts- und Sozialpolitik<br />
Literatur:<br />
Neubäumer, R., Hewel, B. (Hrsg.) (1998): Volkswirtschaftslehre, Wiesbaden<br />
Kromphardt, J. (1998): Arbeitslosigkeit und Inflation. Göttingen<br />
Zinn, K. G. (1994): Konjunktur und Wachstum. Aachen<br />
Müller, H. (1999): Angewandte Makroökonomik. München
- 76 -<br />
Fachbereich Pflege<br />
- <strong>Grundstudium</strong> - 3. Semester<br />
Studiengang Pflegemanagement<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Pflegewirtschaftslehre:<br />
Grundlagen der<br />
Betriebswirtschaftslehre<br />
(parallel mit TM)<br />
2 Std.<br />
Sozialpsychologie:<br />
Soziale Kompetenz<br />
(parallel mit TM)<br />
2 Std.<br />
EDV:<br />
Inferenzstatistik<br />
(parallel mit PP und TM)<br />
2 Std.<br />
Thiele<br />
----------------- verschoben ins<br />
4. Semester!<br />
Werner<br />
Thematische Schwerpunktsetzung: Einführung in Wahrscheinlichkeitsrechnung und computergestützte<br />
Statistikprogramme. Anwendung von hypothesentestenden statistischen Analyseverfahren.<br />
Literatur:<br />
Puhani, J. (1998): Statistik - Einführung mit praktischen Beispielen, 8. Auflage, Lexika-Verlag,<br />
Würzburg<br />
Munro, B.H., Batten Page, E. (1993): Statistical methods for health care research, Lippincott,<br />
Philadelphia<br />
(Literatur, auch zusätzliche, wird auszugsweise als Reader zur Verfügung gestellt.)<br />
Wahlpflichtfächer<br />
Schwerpunkt Gesundheitspflege:<br />
Organisation des<br />
Pflegedienstes:<br />
Gesundheitssysteme<br />
und Pflegeorganisation<br />
im internationalen<br />
Vergleich<br />
2 Std.<br />
Werner Veranstaltungszeiten<br />
und -orte siehe Aushang<br />
des Fachbereichs Pflege!
- 77 -<br />
Fachbereich Pflege<br />
- <strong>Grundstudium</strong> - 3. Semester<br />
Studiengang Pflegemanagement<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Thematische Schwerpunktbildung: Ausgehend von unterschiedlichen Gesundheitssystemen -<br />
v.a. in europäischen Ländern - soll die Integration und spezifische Rolle des Pflegedienstes in<br />
den verschiedenen Gesundheitssystemen analysiert werden.<br />
Literatur:<br />
Hohmann, J. (1998): Gesundheits-, Sozial- und Rehabilitationssysteme in Europa,<br />
Hans Huber Verlag, Bern<br />
(Literatur, auch zusätzliche, wird auszugsweise als Reader zur Verfügung gestellt)<br />
Organisationspsychologie:<br />
Leitungskompetenz und<br />
Mitarbeiterführung<br />
(parallel mit PP und TM)<br />
2 Std.<br />
Scherer<br />
In den Veranstaltungen werden die Theorie der Intervention in Organisationen (aus systemtheoretischer<br />
Sicht) angeboten. Während des gesamten Semesters wird die Planung und<br />
Steuerung von Interventionen in den eigenen Arbeitsbereich diskutiert, die Durchführung in der<br />
Hausarbeit dokumentiert.<br />
Schwerpunkt Gerontologische Pflege:<br />
Organisation des<br />
Pflegedienstes:<br />
Altenhilfesysteme und<br />
Organisation der Pflege<br />
im internationalen<br />
Vergleich<br />
2 Std.<br />
ISAG<br />
Organisationspsychologie:<br />
Leitungskompetenz und<br />
Mitarbeiterführung<br />
(Altenpflege)<br />
(parallel mit PP und TM)<br />
2 Std.<br />
Werner Veranstaltungszeiten<br />
und - orte siehe Aushang<br />
des Fachbereichs Pflege!<br />
Hennecke
- 78 -<br />
Fachbereich Pflege<br />
- <strong>Grundstudium</strong> - 3. Semester<br />
Studiengang Pflegemanagement<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Das richtige Personal an der richtigen Stelle fordert eine sensible und geplante Personalentwicklung<br />
und Personalauswahl.<br />
Assessmentcenter sind eine gute Methode, die Kompetenzen von Personen zielgenau transparent<br />
zu machen. Während eines zweitägigen Blockes werden Methoden und Hintergründe<br />
vorgestellt und am zweiten Tag ein Assessmentcenter simuliert.
- 79 -<br />
Fachbereich Pflege<br />
- <strong>Grundstudium</strong> - 3. Semester<br />
Studiengang Pflegemanagement<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Zusatzfach - freiwillig -<br />
ISAG<br />
Forum Soziale<br />
Altenarbeit in der Stadt<br />
<strong>Freiburg</strong> und Umgebung<br />
(30 - 40 TN)<br />
Kricheldorff,<br />
Brandenburg<br />
Veranstaltungszeiten<br />
und - orte siehe Aushang zu<br />
Beginn des Semesters!<br />
Im Rahmen dieses regelmäßig stattfindenden Forums werden aktuelle Themen aus dem<br />
Berufsfeld der Sozialen Altenarbeit aufgegriffen. Nach einer inhaltlichen Einführung in das<br />
Thema wird dieses in einem intensiven Theorie-Praxis-Dialog vertieft und aus<br />
unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet.<br />
Über die inhaltliche Schwerpunktsetzung und die genauen Themen sowie Termine im<br />
Wintersemester 2003/04 wird über einen Plakataushang zu Beginn des Semesters informiert<br />
werden.<br />
Die einzelnen Veranstaltungen sind offen für alle Vertreter der Fachpraxis und interessierte<br />
Studierende aller Fachbereiche. Das Forum ist darüber hinaus auch eine<br />
Informationsplattform über Fort- und Weiterbildungsangebote, Tagungen und neue Literatur.
- 80 -<br />
Fachbereich Management<br />
- <strong>Grundstudium</strong> - 3. Semester<br />
Studiengang Therapiemanagement<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Pflichtfächer<br />
Recht:<br />
Betriebsverfassung und<br />
Mitarbeiterrechte<br />
(parallel mit PM)<br />
2 Std.<br />
Bockstahler Veranstaltungszeiten<br />
und -orte siehe Aushang<br />
des Fachbereichs Pflege!<br />
In der Veranstaltung werden anhand der Rechtsprechung entnommener Fälle Grundzüge des<br />
“allgemeinen” Arbeitsrechts dargestellt. Folgende Themenbereiche werden dabei<br />
angesprochen:<br />
Bedeutung, Begriff, Regelungsgegenstände und Standort des Arbeitsrechts im Rechtssystem<br />
I. Arbeitsrechtliche Rechtsquellenlehre<br />
II. Arbeitnehmerbegriff und internationaler Geltungsbereich des deutschen Arbeitsrechts<br />
Einstellungsvorschreibende Maßnahmen, Stellenausschreibung und Anbahnung des<br />
Arbeitsverhältnisses (unter besonderer Berücksichtigung der Befristung des<br />
Arbeitsverhältnisses)<br />
Pflichten von Arbeitnehmer und Arbeitgeber einschließlich Haftungsfragen<br />
Beendigung des Arbeitsverhältnisses.<br />
Auf diesen Inhalten aufbauend wird in den Veranstaltungen im Hauptstudium (8. Semester)<br />
das Arbeitsrecht des Öffentlichen Dienstes und das kirchliche Arbeitsrecht dargestellt werden.<br />
Recht:<br />
Individualarbeitsrecht<br />
(parallel mit 7. Sem. PM)<br />
2 Std.<br />
Kommunikation:<br />
Kommunikationswissenschaft<br />
und<br />
kommunikative<br />
Kompetenz<br />
(parallel mit PP und PM)<br />
Training, 2 Std.<br />
Winkler<br />
Kösler,<br />
Scherer<br />
BLOCKSEMINAR<br />
02. bis 05.12.2003<br />
Exkursion mit Zusatzkosten!
- 81 -<br />
Fachbereich Management<br />
- <strong>Grundstudium</strong> - 3. Semester<br />
Studiengang Therapiemanagement<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Sozialökonomie<br />
Wirtschaftsordnung und<br />
soziale Marktwirtschaft<br />
(parallel mit PP und PM)<br />
2 Std.<br />
Thiele<br />
In der Veranstaltung wird auf die makroökonomischen Grundlagen der Volkswirtschaft<br />
eingegangen. Themenbereiche sind:<br />
- Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung<br />
- Arbeitslosigkeit<br />
- Inflation<br />
- Konjunktur und Wachstum<br />
- Prinzipien und Ziele der Wirtschafts- und Sozialpolitik<br />
Literatur:<br />
Neubäumer, R., Hewel, B. (Hrsg.) (1998): Volkswirtschaftslehre, Wiesbaden<br />
Kromphardt, J. (1998): Arbeitslosigkeit und Inflation. Göttingen<br />
Zinn, K. G. (1994): Konjunktur und Wachstum. Aachen<br />
Müller, H. (1999): Angewandte Makroökonomik. München<br />
Grundlagen der<br />
Betriebswirtschaftslehre<br />
(parallel mit PM)<br />
2 Std.<br />
Sozialpsychologie:<br />
Soziale Kompetenz<br />
(parallel mit PM)<br />
2 Std.<br />
EDV:<br />
Inferenzstatistik<br />
(parallel mit PP und PM)<br />
2 Std.<br />
Thiele<br />
----------------- verschoben ins<br />
4. Semester!<br />
Werner
- 82 -<br />
Fachbereich Management<br />
- <strong>Grundstudium</strong> - 3. Semester<br />
Studiengang Therapiemanagement<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Thematische Schwerpunktsetzung: Einführung in Wahrscheinlichkeitsrechnung und<br />
computergestützte Statistikprogramme. Anwendung von hypothesentestenden statistischen<br />
Analyseverfahren.<br />
Literatur:<br />
Puhani, J. (1998): Statistik - Einführung mit praktischen Beispielen, 8. Auflage, Lexika-Verlag,<br />
Würzburg<br />
Munro, B.H., Batten Page, E. (1993): Statistical methods for health care research, Lippincott,<br />
Philadelphia<br />
(Literatur, auch zusätzliche, wird auszugsweise als Reader zur Verfügung gestellt.)<br />
ISAG<br />
Organisationspsychologie:<br />
Leitungskompetenz und<br />
Personalentwicklung<br />
(parallel mit PP und PM)<br />
2 Std.<br />
Scherer,<br />
Hennecke<br />
Das richtige Personal an der richtigen Stelle fordert eine sensible und geplante<br />
Personalentwicklung und Personalauswahl.<br />
Assessmentcenter sind eine gute Methode, die Kompetenzen von Personen zielgenau<br />
transparent zu machen. Während eines zweitägigen Blockes werden Methoden und<br />
Hintergründe vorgestellt und am zweiten Tag ein Assessmentcenter simuliert.<br />
Rehabilitationswissenschaft:<br />
Forschungsergebnisse<br />
aus der<br />
Rehawissenschaft<br />
2 Std.<br />
Methodische Grundlagen<br />
der Rehabilitationsforschung<br />
2 Std.<br />
Rehabilitationswissenschaft:<br />
Diagnostik<br />
2 Std.<br />
Dozenten im Rahmen der Kooperation mit<br />
dem Hochrheininstitut Bad Säckingen<br />
Dozenten im Rahmen der Kooperation mit<br />
dem Hochrheininstitut Bad Säckingen<br />
Dozenten im Rahmen der Kooperation mit<br />
dem Hochrheininstitut Bad Säckingen<br />
(vorgezogen aus dem 4. Semester)
- 83 -<br />
Fachbereich Management<br />
- <strong>Grundstudium</strong> - 3. Semester<br />
Studiengang Therapiemanagement<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Berufsbilder: Theorien<br />
zum Professionalisierungsbegriff<br />
2 Std.<br />
Sozial- und Gesundheitspolitik:<br />
Gesundheitsreform<br />
(parallel mit 7. Sem. PM)<br />
2 Std.<br />
Zusatzfach - freiwillig -<br />
ISAG<br />
Forum Soziale<br />
Altenarbeit in der Stadt<br />
<strong>Freiburg</strong> und Umgebung<br />
(30 - 40 TN)<br />
Jehn<br />
Werner,<br />
Schulz-Nieswandt<br />
Kricheldorff,<br />
Brandenburg<br />
Veranstaltungszeiten<br />
und - orte siehe Aushang zu<br />
Beginn des Semesters!<br />
Im Rahmen dieses regelmäßig stattfindenden Forums werden aktuelle Themen aus dem<br />
Berufsfeld der Sozialen Altenarbeit aufgegriffen. Nach einer inhaltlichen Einführung in das<br />
Thema wird dieses in einem intensiven Theorie-Praxis-Dialog vertieft und aus<br />
unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet.<br />
Über die inhaltliche Schwerpunktsetzung und die genauen Themen sowie Termine im<br />
Wintersemester 2003/04 wird über einen Plakataushang zu Beginn des Semesters informiert<br />
werden.<br />
Die einzelnen Veranstaltungen sind offen für alle Vertreter der Fachpraxis und interessierte<br />
Studierende aller Fachbereiche. Das Forum ist darüber hinaus auch eine<br />
Informationsplattform über Fort- und Weiterbildungsangebote, Tagungen und neue Literatur.
- 84 -<br />
Fachbereich Pflege - <strong>Grundstudium</strong> - 3. Semester<br />
Studiengang Pflegepädagogik<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Pflichtbereich<br />
Wissenschaftliches<br />
Arbeiten:<br />
Lektüre und Redaktion<br />
wiss. Texte<br />
(parallel mit PM)<br />
2 Std.<br />
Stöbener Veranstaltungszeiten<br />
und -orte siehe Aushang<br />
des Fachbereichs Pflege!<br />
Das Seminar versteht sich als Fortsetzung der Veranstaltung im Sommersemester. Neben der<br />
Kompetenz, wissenschaftliche Texte bearbeiten zu können, geht es vertiefend auch darum,<br />
Techniken der Präsentation, Moderation und des Zeitmanagements zu erwerben.<br />
ISAG<br />
Psychologie:<br />
Psychologie des Alterns<br />
(parallel mit PM)<br />
2 Std.<br />
Brandenburg<br />
Aufbauend auf der Einführung in die gerontologische Pflege (2. Semester) werden in dieser<br />
Veranstaltung vor allem psychogerontologische Aspekte vertieft. Der Schwerpunkt liegt auf<br />
Fragen nach der Kompetenz, der Auseinandersetzung mit Belastungssituationen (Coping) sowie<br />
der intellektuellen Leitungsfähigkeit (Intelligenz, Lernen, Gedächtnis). Es sollen sowohl die<br />
Möglichkeiten wie auch die Grenzen der psychischen Kompetenz alter Menschen diskutiert<br />
werden. Akzente liegen auf Fragen der Kompetenz im Alter und der Interventionsgerontologie.<br />
Berücksichtigung finden auch die aktuellen Debatten um die Zukunft der Heime und die<br />
Gewaltproblematik im Alter.<br />
ISAG<br />
Soziologie:<br />
Soziologie der<br />
Lebensalter<br />
(parallel mit PM)<br />
2 Std.<br />
Werner<br />
Thematische Schwerpunkte sind: Grundlagen der Demographie, Bevölkerungssoziologie,<br />
Soziologie der verschiedenen Altersgruppen und der Familiensoziologie<br />
Literatur:<br />
Höpflinger, F., 1987, Bevölkerungssoziologie, Eine Einführung in bevölkerungs-soziologische<br />
Ansätze und demographische Prozesse, Juventa, Weinheim<br />
Backes, G.M., Clemens, W., 1998, Lebensphase Alter, Eine Einführung in die<br />
sozialwissenschaftliche Alternsforschung, Juventa, Weinheim<br />
(Literatur wird auszugsweise als Reader zur Verfügung gestellt)
- 85 -<br />
Fachbereich Pflege - <strong>Grundstudium</strong> - 3. Semester<br />
Studiengang Pflegepädagogik<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Kommunikation:<br />
Kommunikationswissenschaft<br />
und<br />
kommunikative<br />
Kompetenz<br />
(parallel mit PM und TM)<br />
2 Std.<br />
Pflegewissenschaft:<br />
Forschungsergebnisse<br />
aus der<br />
Pflegewissenschaft<br />
(parallel mit PM)<br />
2 Std.<br />
Kösler,<br />
Scherer<br />
Brandenburg,<br />
Immenschuh<br />
BLOCKSEMINAR<br />
02.-05.12.2003<br />
Exkursion mit Zusatzkosten!<br />
Nach dem im 1. Semester die Pflegetheorien und Pflegemodelle ausführlich diskutiert und im 2.<br />
Semester wissenschaftstheoretische Grundlagen gelegt wurden, soll der Schwerpunkt im 3.<br />
Semester auf empirischen Ergebnissen der Pflegewissenschaft (mit Bezug zu<br />
Pflegemanagement und Pflegepädagogik) gelegt werden. Dies ist deswegen notwendig, um<br />
einen Überblick über relevante Forschungsergebnisse mit Bedeutung für Pflegepädagogik und<br />
Pflegemanagement zu erhalten. Möglichkeiten und Grenzen pflegerischer Intervention - seien<br />
sie pädagogisch oder durch das Management motiviert - sind ohne fundierte Kenntnisse des<br />
Forschungsstandes nicht adäquat einzuschätzen. Eine Auswahl relevanter Studien soll in<br />
diesem Seminar vorgestellt und kritisch diskutiert werden.<br />
Berufsbilder:<br />
Theorie des<br />
Professionalisierungsbegriffes<br />
(parallel mit PM)<br />
2 Std.<br />
Gertsen<br />
Die Entscheidung, Pflege zu studieren, könnte etwas zu tun haben mit den Bestrebungen, den<br />
Berufsstand zu professionalisieren. Sicherlich aber geht es auch darum, die eigene<br />
Professionalität zu erweitern. Dazu bedarf es unter anderem einer Auseinandersetzung mit dem<br />
Begriff der Profession.<br />
In diesem Seminar soll dies geschehen anhand der Beschäftigung mit<br />
Professionalisierungstheorien, die mit der Pflege zunächst so viel zu tun haben wie die<br />
Auseinandersetzung mit eigenen beruflichen Erfahrungen der Studierenden innerhalb dieses<br />
Seminars dies zulassen. Angestrebt wird, einen Standpunkt innerhalb der<br />
Professionalisierungsdebatte zu erarbeiten, der in den späteren Seminaren eine Grundlage für<br />
ein Verständnis der Professionalisierung der Pflege bietet.
- 86 -<br />
Fachbereich Pflege - <strong>Grundstudium</strong> - 3. Semester<br />
Studiengang Pflegepädagogik<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Sozialökonomie<br />
Wirtschaftsordnung und<br />
soziale Marktwirtschaft<br />
(parallel mit PM und TM)<br />
2 Std.<br />
Thiele<br />
In der Veranstaltung wird auf die makroökonomischen Grundlagen der Volkswirtschaft<br />
eingegangen. Themenbereiche sind:<br />
- Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung<br />
- Arbeitslosigkeit<br />
- Inflation<br />
- Konjunktur und Wachstum<br />
- Prinzipien und Ziele der Wirtschafts- und Sozialpolitik<br />
Literatur:<br />
Neubäumer, R., Hewel, B.(Hrsg.) (1998): Volkswirtschaftslehre, Wiesbaden<br />
Kromphardt, J. (1998): Arbeitslosigkeit und Inflation. Göttingen<br />
Zinn, K. G. (1994): Konjunktur und Wachstum. Aachen<br />
Müller, H. (1999): Angewandte Makroökonomik. München<br />
EDV:<br />
Inferenzstatistik<br />
(parallel mit PM)<br />
2 Std.<br />
Werner<br />
Thematische Schwerpunktsetzung: Einführung in Wahrscheinlichkeitsrechnung und<br />
computergestützte Statistikprogramme. Anwendung von hypothesentestenden statistischen<br />
Analyseverfahren.<br />
Literatur:<br />
Puhani, J. (1998): Statistik - Einführung mit praktischen Beispielen,<br />
8. Auflage, Lexika-Verlag, Würzburg<br />
Munro, B.H., Batten Page, E. (1993): Statistical methods for health care research,<br />
Lippincott, Philadelphia<br />
(Literatur, auch zusätzliche, wird auszugsweise als Reader zur Verfügung gestellt)<br />
Pädagogik:<br />
Aktuelle Entwicklungen<br />
und Probleme<br />
2 Std.<br />
Gertsen<br />
Es geht um eine Erarbeitung des Paradigmas ‘Selbstorganisation’ in der Pädagogik und um<br />
seine Kritik vor dem Hintergrund von Bildungstheorien. Die wichtigsten Begriffe des<br />
Konstruktivismus sollen erarbeitet und in seine Denkweise eingeführt werden.<br />
Die Kritik setzt bei Defiziten dieser Theorie an und versucht eine Weiterentwicklung.
- 87 -<br />
Fachbereich Pflege - <strong>Grundstudium</strong> - 3. Semester<br />
Studiengang Pflegepädagogik<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Wahlpflichtfächer<br />
Schwerpunkt Gesundheitspflege:<br />
ISAG<br />
Organisationspsychologie:<br />
Leitungskompetenz und<br />
Mitarbeiterführung<br />
(parallel mit PM und TM)<br />
2 Std.<br />
Scherer Vorlesungszeiten<br />
und -orte siehe Aushang<br />
des Fachbereichs Pflege!<br />
In den Veranstaltungen werden die Theorie der Intervention in Organisationen (aus<br />
systemtheoretischer Sicht) angeboten. Während des gesamten Semesters wird die Planung<br />
und Steuerung von Interventionen in den eigenen Arbeitsbereich diskutiert, die Durchführung<br />
in der Hausarbeit dokumentiert.<br />
ISAG<br />
Didaktik:<br />
Theorien und Modelle<br />
der Didaktik<br />
2 Std.<br />
Behr,<br />
Friedeck,<br />
Haag<br />
Pflegende sehen sich im Spannungsfeld von steigendem Kostendruck und veränderten<br />
Anforderungen an ihre Arbeit zunehmend mit der Frage konfrontiert, welche Handlungsweisen<br />
wirksam und bezahlbar sind. Hierfür bedarf es zum einen eines politischen und ethischen<br />
Entscheidungsrahmens, welche Pflege sich unsere Gesellschaft leisten will, zum anderen einer<br />
wissenschaftlichen Fundierung pflegerischen Handelns.<br />
Im Seminar findet über diese Frage eine Auseinandersetzung mit subjektiven Theorien und<br />
Erfahrungswissen (best practise) der Studierenden und eine Annäherung an<br />
pflegewissenschaftliches Denken (evidence based nursing) statt.
- 88 -<br />
Fachbereich Pflege - <strong>Grundstudium</strong> - 3. Semester<br />
Studiengang Pflegepädagogik<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Schwerpunkt Gerontologische Pflege:<br />
ISAG<br />
Organisationspsychologie:<br />
Leitungskompetenz und<br />
Mitarbeiterführung<br />
(Altenpflege)<br />
(parallel mit PM)<br />
2 Std.<br />
Hennecke Veranstaltungszeiten<br />
und -orte siehe Aushang<br />
des Fachbereichs Pflege!<br />
Das richtige Personal an der richtigen Stelle fordert eine sensible und geplante<br />
Personalentwicklung und Personalauswahl.<br />
Assessmentcenter sind eine gute Methode, die Kompetenzen von Personen zielgenau<br />
transparent zu machen. Während eines zweitägigen Blockes werden Methoden und<br />
Hintergründe vorgestellt und am zweiten Tag ein Assessmentcenter simuliert.<br />
ISAG<br />
Didaktik:<br />
Theorien und Modelle<br />
der Didaktik<br />
(Altenpflege)<br />
2 Std.<br />
Behr,<br />
Friedeck,<br />
Haag<br />
Pflegende sehen sich im Spannungsfeld von steigendem Kostendruck und veränderten<br />
Anforderungen an ihre Arbeit zunehmend mit der Frage konfrontiert, welche Handlungsweisen<br />
wirksam und bezahlbar sind. Hierfür bedarf es zum einen eines politischen und ethischen<br />
Entscheidungsrahmens, welche Pflege sich unsere Gesellschaft leisten will, zum anderen einer<br />
wissenschaftlichen Fundierung pflegerischen Handelns.<br />
Im Seminar findet über diese Frage eine Auseinandersetzung mit subjektiven Theorien und<br />
Erfahrungswissen (best practise) der Studierenden und eine Annäherung an<br />
pflegewissenschaftliches Denken (evidence based nursing) statt.
- 89 -<br />
Fachbereich Pflege - <strong>Grundstudium</strong> - 3. Semester<br />
Studiengang Pflegepädagogik<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Zusatzfach - freiwillig -<br />
ISAG<br />
Forum Soziale<br />
Altenarbeit in der Stadt<br />
<strong>Freiburg</strong> und Umgebung<br />
(30 - 40 TN)<br />
Kricheldorff,<br />
Brandenburg<br />
Veranstaltungszeiten<br />
und - orte siehe Aushang zu<br />
Beginn des Semesters!<br />
Im Rahmen dieses regelmäßig stattfindenden Forums werden aktuelle Themen aus dem<br />
Berufsfeld der Sozialen Altenarbeit aufgegriffen. Nach einer inhaltlichen Einführung in das<br />
Thema wird dieses in einem intensiven Theorie-Praxis-Dialog vertieft und aus<br />
unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet.<br />
Über die inhaltliche Schwerpunktsetzung und die genauen Themen sowie Termine im<br />
Wintersemester 2003/04 wird über einen Plakataushang zu Beginn des Semesters informiert<br />
werden.<br />
Die einzelnen Veranstaltungen sind offen für alle Vertreter der Fachpraxis und interessierte<br />
Studierende aller Fachbereiche. Das Forum ist darüber hinaus auch eine<br />
Informationsplattform über Fort- und Weiterbildungsangebote, Tagungen und neue Literatur.
- 90 -<br />
<strong>Grundstudium</strong> - Alle Fachbereiche<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Wahlpflichtbereich<br />
Kultur- und Medienpädagogik<br />
Musik-, Bewegungs-, Spiel- und Sprachgestaltung<br />
Für Wochenend-Kompakteinheiten sind folgende Termine reserviert:<br />
14.-15.11. / 28.-29.11. / 19.-20.12.2003 / 09.-10.01.2004 / 16.-17.01.2004<br />
Vom kreativen Tanz zum<br />
Tanztheater<br />
(max. 16 Tn)<br />
2 Std. Seminar<br />
Megnet Di 14.00 - 17.00<br />
Beginn:<br />
25.11.2003<br />
weitere Termine:<br />
02.12.03 / 09.12.03<br />
16.12.03 / 13.01.04<br />
20.01.04 / 27.01.04<br />
Aula<br />
2000<br />
1306<br />
1308<br />
In diesem Seminar experimentieren wir mit den vielfältigen Wechselspielen, die sich durch die<br />
unterschiedlichen Verbindungen von Bewegung, Musik, Stimme und Objekte ergeben. Nach<br />
einstimmenden Übungen zur Sensibilisierung der Körperwahrnehmung und zur Erweiterung des<br />
eigenen tänzerischen Bewegungsrepertoires werden die gewählten Themen oder Impulse auf<br />
improvisatorischem Wege erkundet und in einem weiteren Schritt zu Tanztheaterformen<br />
weiterentwickelt und gestaltet.Die Reflexion der Gruppenergebnisse und -prozesse findet im<br />
Hinblick auf die Umsetzbarkeit mit verschiedenen Zielgruppen statt.<br />
Zirkuspädagogik<br />
(max. 18 Tn)<br />
2 Std. Seminar<br />
Rauchs Mi 15.00 - 18.00<br />
Beginn:<br />
15.10.2003<br />
(14-täglich)<br />
Aula<br />
2000<br />
Im Seminar werden theoretische Hintergründe und Zielsetzungen von Zirkuspädagogik beleuchtet.<br />
Außerdem werden die Einsatzmöglichkeiten von Zirkusarbeit in pädagogischen Arbeitsfeldern, die<br />
Arbeit mit unterschiedlichen Zielgruppen und die Rahmenbedingungen für zirkuspädagogische<br />
Arbeit thematisiert.<br />
Darüber hinaus sollen die TeilnehmerInnen eine praktische Einführung in Elemente der<br />
Zirkuspädagogik wie Jonglage, Artistik, Equilibristik, Clownerie erhalten und Ansätze für die<br />
Vermittlung von Zirkustechniken kennen lernen.<br />
Rhythmen in<br />
verschiedenen Kulturen<br />
(max. 16 Tn)<br />
2 Std. Seminar<br />
Kimmig Di 19.15 - 20.45<br />
Beginn:<br />
14.10.2003<br />
1308
- 91 -<br />
<strong>Grundstudium</strong> - Alle Fachbereiche<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Überall ist Rhythmus. Tag und Nacht, die Jahreszeiten, die Schaltung einer Verkehrsampel, der<br />
Herzschlag, der eigene Gang. Jeder Kulturkreis hat den natürlichen Rhythmus zu einer anderen<br />
rhythmischen Form weiterentwickelt. So entstanden die Musikkulturen Afrikas, Lateinamerikas,<br />
Indiens etc. In diesem Seminar werden wir, ausgehend von einfachen rhythmischen Übungen,<br />
einige der vielen Möglichkeiten, die Trommeln, Rasseln etc. bieten, im Zusammenhang der<br />
jeweiligen Herkunft praktisch erproben.<br />
Bausteine der Musik<br />
(max. 16 Tn)<br />
2 Std. Seminar<br />
Kimmig Di 17.30 - 19.00<br />
Beginn:<br />
14.10.2003<br />
1308<br />
Dieses Seminar ist für Studierende, die schon immer mal erfahren wollten, wie Musik funktioniert.<br />
Notenschrift, Tonleitern, Intervalle, Akkorde, Harmonien, Rhythmus etc., all die kleinen Bausteine,<br />
die zum Aufbau der Musik notwendig sind, werden vorgestellt und ihre Funktion innerhalb der<br />
Musik untersucht. Damit das kein trockenes Theorielernen wird, werden wir alles mit Instrumenten<br />
zum Klingen bringen.<br />
Musikalische Vorkenntnisse oder instrumentale Erfahrungen sind nicht erforderlich.<br />
Sport-Basics für Damen<br />
und Herren<br />
(max. 18 Tn)<br />
2 Std. Seminar<br />
Russo Mo 16.30 - 18.00 Uhr<br />
Beginn:<br />
13.10.2003<br />
Weiherhof<br />
Schule<br />
Sporttreiben macht Spaß!!! Unter diese Maxime soll dieses einsemestrige Seminar gestellt werden.<br />
Sportliches Handeln als (Er)lebenserfahrung, Sport und Bewegung als Sinnelemente einer<br />
dauerhaften Ausgeglichenheit. Kennen lernen von Sportarten und den dazugehörigen Regeln. Wie<br />
gestalte ich eine Bewegungsstunde? Was passiert in und mit meinem Körper bei kontinuierlichen<br />
sportlichen Belastungen?<br />
Grundlage für die zweisemestrige Veranstaltung im Hauptstudium "Sportpädagogik in der Praxis"!<br />
Geschichten erzählen und<br />
kreatives Schreiben<br />
(max. 17 Tn)<br />
2 Std. Seminar<br />
Megnet Di 14.00 - 17.00<br />
Beginn:<br />
14.10.2003<br />
weitere Termine:<br />
21.10.03 / 28.10.03<br />
04.12.03 / 11.12.03<br />
18.11.03<br />
Aula<br />
2000<br />
1306<br />
1308<br />
Geschichten erzählen gehört heute in unserer Kultur zu den Künsten, die durch die Konkurrenz der<br />
technischen Medien immer mehr vom Aussterben bedroht sind. Um diesem Prozess etwas<br />
entgegenzuwirken, werden wir - ausgehend von unterschiedlichen kreativen Ansätzen und<br />
Methoden - Geschichten erfinden, erzählen, variieren und gestalten. Die Gestaltungsprozesse<br />
beziehen sich zum einen auf die mündliche und schriftliche Präsentation, zum andern auch auf die<br />
Verbindung der Geschichten mit anderen ästhetischen Ausdrucksmitteln, wie z. B. Bild, Theater,<br />
Tanz und Musik. In der Reflexion der erarbeiteten Formen wird deutlich werden, dass gerade auch<br />
in der sozialen Arbeit das Erfinden, Erzählen und Hören von Geschichten eine Methode sein kann,<br />
mit der elementare Themen, Konflikte und Wünsche in kreativer Form zum Ausdruck gebracht<br />
werden können.
- 92 -<br />
<strong>Grundstudium</strong> - Alle Fachbereiche<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Computerspiele für Kinder<br />
und Jugendliche in der<br />
pädagogischen Praxis<br />
(max. 12 Tn)<br />
2 Std. Seminar<br />
Fierravanti Kompakttermine:<br />
Fr 14.11.2003<br />
14.00 - 20.00 Uhr<br />
Sa 15.11.2003<br />
10.00 - 18.00 Uhr<br />
Fr 28.11.2003<br />
14.00 - 20.00 Uhr<br />
Sa 29.11.2003<br />
10.00 - 18.00 Uhr<br />
Haus der<br />
Jugend<br />
Uhlandstr.<br />
2,<br />
<strong>Freiburg</strong><br />
Raum 31<br />
Computer- und Videospiele sind ein fester Bestandteil im Freizeitverhalten von Kindern und<br />
Jugendlichen. Die pädagogischen Fachkräfte in Kinder- und Jugendeinrichtungen sind daher nicht<br />
nur gefordert sich mit den “Neuen Medien” auseinander zusetzen, sondern diese in die<br />
pädagogische Arbeit einzubinden.<br />
Bei Computerspielen erschwert eine fast unüberschaubare Vielfalt die Konzipierung zielgerechter<br />
Angebote für Kinder und Jugendliche in der pädagogischen Praxis.<br />
Das Seminar soll einen Einblick in die Welt der Computerspiele vermitteln, die Möglichkeiten und<br />
die Grenzen für die pädagogische Arbeit aufzeigen und einen praktischen Bezug zu Spielen<br />
herstellen.<br />
Rhetorische<br />
Kommunikation<br />
(max. 14 Tn)<br />
2 Std. Seminar<br />
Obert Kompaktseminar:<br />
Fr 19.12.2003<br />
ab 13.00 Uhr<br />
Sa 20.12.2003<br />
ab 08.30 Uhr<br />
Fr 16.01.2004<br />
ab 13.00 Uhr<br />
Sa 17.01.2004<br />
ab 08.30 Uhr<br />
3101<br />
3101<br />
Suche keine Effekte zu erzielen, die nicht in Deinem Wesen liegen.<br />
Ein Podium ist eine unbarmherzige Sache - da steht der Mensch nackter als im Sonnenbad.<br />
Natürlichkeit und Echtheit in der Rede waren schon für Kurt Tucholsky Schlüsselworte. In seinen<br />
bekannten “Ratschlägen” an einen Vortragenden aus dem Jahre 1930 weist er darauf hin, dass<br />
gute Reden kurz und prägnant sein müssten.<br />
Nicht nur Politiker und Führungskräfte sollten die Ratschläge Tucholskys beherzigen. Auch gerade<br />
Berufseinsteiger sind durch Projektarbeit und flache Hierarchien immer wieder Situationen<br />
ausgesetzt, in denen sie andere Menschen mit ihren Ideen begeistern und von deren Inhalten<br />
überzeugen müssen. Dazu gehört die Kommunikationskompetenz, vor kleinen oder größeren<br />
Gruppen sicher auftreten und sprechen zu können.<br />
Ein Redner muss seine eigene Persönlichkeit erkennen und akzeptieren. Nur so kann er<br />
überzeugen und verstanden werden. Kein Mensch vermag über eine längere Zeit einfach nur eine<br />
Rolle zu spielen. Dazu ist Kommunikation mit ihren verbalen und non-verbalen Mitteln zu<br />
vielschichtig. Rhetorik dient dazu, Vertrauen zu übermitteln und ist keinesfalls dazu da,<br />
irgendwelche Kosmetik zu betreiben.<br />
Dieser Kurs ist ein Dienstleistungsangebot an die Studierenden, die in den theoretischen und<br />
praktischen Teilen dieser Übung eine Einführung in die Grundlagen kommunikativer Rhetorik und<br />
Gesprächsführung und deren Methoden bei der Kommunikation im täglichen Leben erfahren<br />
können.
- 93 -<br />
<strong>Grundstudium</strong> - Alle Fachbereiche<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Grundlagen des sozialen<br />
Spiels<br />
Aktions- und<br />
Interaktionsspiele unter<br />
spielpädagogischem Aspekt<br />
(max. 18 Tn)<br />
2 Std. Seminar<br />
Schlabach Kompakttermine:<br />
Fr 09.01.2004<br />
13.00 - 19.15 Uhr<br />
Sa 10.01.2004<br />
10.00 - 16.15 Uhr<br />
Mo 12.01.2004<br />
17.30 - 22.00 Uhr<br />
Di 13.01.2004<br />
17.30 - 22.00 Uhr<br />
Räume:<br />
3201 / 3202 / 3203 / 3204<br />
Lernziel: Neben dem Kennenlernen unterschiedlicher Spielformen werden spielpädagogische<br />
Grundsätze vermittelt.<br />
Inhalt: Unter spielpädagogischem Aspekt werden die verschiedensten Spielformen, die das Ich<br />
stärken und gruppenfähig machen, Gegenstand dieses Seminars sein. Darüber hinaus wird die<br />
Körpersprache als wichtiges Kommunikationsmittel und als Darstellungsmöglichkeit im personalen<br />
und gegenständlichen Spiel aufgezeigt. Über diese Spiel- und Darstellungsformen erlebt die<br />
Gruppe den Einzelnen in seiner Andersartigkeit und Individualität.<br />
Ein Weg in das<br />
“Darstellende Spiel”<br />
Inhaltliche und methodische<br />
Anregungen zu sozialen und<br />
darstellenden Spielformen<br />
(max. 18 Tn)<br />
2 Std. Seminar<br />
Schlabach Kompakttermine:<br />
Fr 16.01.2004<br />
13.00 - 19.15 Uhr<br />
Sa 17.01.2004<br />
10.00 - 16.15 Uhr<br />
Mo 19.01.2004<br />
17.30 - 22.00 Uhr<br />
Di 20.01.2004<br />
17.30 - 22.00 Uhr<br />
Räume:<br />
3201 / 3202 / 3203 / 3204<br />
Lernziel: Formen des Darstellenden Spiels kennen und vermitteln lernen.<br />
Inhalt: Unter sozialem Aspekt werden in diesem Seminar Möglichkeiten aufgezeigt, mit der Gruppe<br />
ins Spiel zu kommen. Dabei werden unterschiedliche Spielformen wie mimische Spiele,<br />
Interaktionsspiele und Aktionsspiele erlebbar gemacht. Über die körpersprachlichen<br />
Ausdrucksmöglichkeiten wird zu den verschiedensten Formen der Darstellung hingeführt.
- 94 -<br />
<strong>Grundstudium</strong> - Alle Fachbereiche<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Bibliodrama<br />
(18 Tn)<br />
2 Std. Seminar<br />
Schilling Kompakttermine:<br />
Fr 19.12.2003<br />
14.00 - 19.00 Uhr<br />
Sa 20.12.2003<br />
09.00 - 16.00 Uhr<br />
Fr 16.01.2004<br />
14.00 - 19.00 Uhr<br />
Sa 17.01.2004<br />
09.00 - 16.00 Uhr<br />
3301<br />
3303<br />
3301<br />
3303<br />
Bibliodrama ist der Versuch, biblische Texte mit allen Sinnen handelnd zu erfahren. Ziel ist es, die<br />
Texte so zu entschlüsseln, dass deren Bedeutung für die eigene Person erlebt wird. Mit<br />
unterschiedlichen bibliodramatischen Ansätzen werden wir dies praktisch erproben.<br />
Bildhaftes, plastisches Gestalten und Werken<br />
Für Wochenend-Kompakteinheiten sind folgende Termine reserviert:<br />
10.-11.10. / 17.-18.10. / 24.-25.10. / 07.-08.11.2003<br />
Werken (Einführung)<br />
(max. 24 Tn)<br />
2 Std. Seminar<br />
Cloidt 1. Treff:<br />
Mo 03.11.2003<br />
18.00 - 19.30 Uhr<br />
Kompakttermine:<br />
Fr 07.11.2003<br />
13.00 - 20.00 Uhr<br />
Sa 08.11.2003<br />
08.00 - 18.00 Uhr<br />
Di 11.11.2003<br />
18.30 - 20.00 Uhr<br />
Werkr.<br />
Werkr.<br />
Werkr.<br />
Dieses Seminar ermöglicht den Studierenden, die ohne “Werkerfahrung” sind, in verschiedenen<br />
Materialien, Techniken, Werkzeugen und Maschinen eigene Kenntnisse und Fertigkeiten zu<br />
sammeln. Die Arbeit, das Schaffen am Werkstück, führt über das Sammeln von Erfahrungen zur<br />
eigenen Erkenntnis sowie zur Vertiefung der Kreativität und wird somit einer Grundlage zur<br />
sozialen Arbeit (Ganzheitlichkeit, Verbalisierung und Interaktion).<br />
Arbeitsweise: Einzelarbeit, eigene Entscheidung zum Werkstück, Ausprobieren/Lernen, Reflexion<br />
(u.a. Umsetzungsmöglichkeiten in das Berufsfeld).
- 95 -<br />
<strong>Grundstudium</strong> - Alle Fachbereiche<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Material - Technik -<br />
Beziehung<br />
(max. 19 Tn)<br />
2 Std. Seminar<br />
Knaubert 1. Treff:<br />
Die 21.10.2003<br />
13.15 - 14.45 Uhr<br />
Kompaktseminar:<br />
Fr 24.10.2003<br />
13.00 - 20.30 Uhr<br />
Sa 25.10.2003<br />
09.00 - 18.00 Uhr<br />
Nachtreffen:<br />
Mi 05.11.2003<br />
16.30 - 21.00 Uhr<br />
jeweils<br />
Werkr.<br />
Ziel: Die Studierenden sollen den werkpädagogischen und werkdidaktischen Prozess erfahren. Mit<br />
Material (u. a. Holz, Seide, Ton) arbeiten, bedeutet einen Zusammenhang von Ideen/<br />
Gedanken und Handlungen herzustellen, um so u. a. auch zur Problemlösung beitragen zu können.<br />
Inhalt: Werkstück aussuchen - Entsprechendes Material nach Rücksprache besorgen - Notwendige<br />
Techniken anwenden - Maschinen und Werkzeuge kennen lernen - Werkstück herstellen -<br />
Oberflächenbehandlung - Reflexion<br />
Arbeitsweise: Entscheidung zum Werkstück, Einzelarbeit, Üben und Ausprobieren.<br />
Videopraxis -<br />
Grundlagenseminar<br />
(max. 14 Tn)<br />
2 Std. Seminar<br />
Schulz Grundlagen<br />
Videopraxis<br />
Mi 14.01.2004<br />
14.00 - 17.00 Uhr<br />
Mi 21.01.2004<br />
14.00 - 18.00 Uhr<br />
Liveaufzeichnungen:<br />
Mi 11.02.2004<br />
14.00 -19.00 Uhr<br />
Do 12.02.2004<br />
09.30 -18.00 Uhr<br />
Bitte beachten Sie,<br />
dass beide Termine<br />
am Anfang der<br />
Semesterferien liegen!<br />
Exkursion nach<br />
Vereinbarung<br />
3101<br />
3101<br />
Aula<br />
2000<br />
Aula<br />
2000
- 96 -<br />
<strong>Grundstudium</strong> - Alle Fachbereiche<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
In diesem praxisorientierten Seminar sollen die TeilnehmerInnen Grundlagen der Bildgestaltung,<br />
der Kameraführung und der Aufnahmetechnik im handelnden Umgang mit dem Medium Video<br />
erleben und sich dabei ihrer Wirkungsweisen bewusst werden.<br />
Anschließend wird das Gelernte bei der Liveaufzeichnung von Diskussionsrunden des Seminares<br />
Rhetorik / Moderation in die Praxis umgesetzt. Dabei werden die TeilnehmerInnen Einblicke in die<br />
professionelle Studioaufzeichnung mit mehreren Kameras erhalten. In diesem Zusammenhang ist<br />
außerdem eine Exkursion zur Aufzeichnung einer Sendung in ein Fernsehstudio geplant.<br />
Soziale Arbeit mit<br />
kreativen Medien<br />
(max. 17 Tn)<br />
2 St. Seminar<br />
Soziale Arbeit mit<br />
kreativen Medien<br />
(max. 17 Tn)<br />
2 Std. Seminar<br />
Schönenborn Di 13.30 - 15.00 U 1<br />
Schönenborn Di 15.15 - 16.45 U 1<br />
Es werden unterschiedliche kunstdidaktische Ansätze und Vorgehensweisen vermittelt und<br />
reflektiert. Method.-didaktische Fragestellungen werden im Hinblick auf die spätere Praxis<br />
untersucht.<br />
Methodisches Vorgehen: Aktives Ausprobieren, Reflektieren und Theorieteile.<br />
Puppenspiel im<br />
Sozialwesen<br />
(max. 17 Tn)<br />
2 Std. Seminar<br />
Schönenborn Kompaktseminar:<br />
Fr 17.10.2003<br />
13.00 - 20.00 Uhr<br />
Sa 18.10.2003<br />
9.00 - 18.00 Uhr<br />
Fr 24.10.2003<br />
13.00 - 19.30 Uhr<br />
Herstellen einer spielbaren Figur und die “Erweckung” dieser Figur zum “Leben”. Vorkenntnisse<br />
sind nicht erforderlich. Neben Herstellung und Spiel wird über die Anwendungsmöglichkeit in der<br />
späteren Praxis reflektiert.<br />
Methodisches Vorgehen: Mischform aus Projektunterricht und Lehrgang.<br />
Zukunft Multimedia-<br />
Chancen und Perspektiven<br />
für die pädagogische<br />
Arbeit<br />
(max. 14 Tn)<br />
2 Std. Seminar<br />
Kunz Kompaktseminar:<br />
Fr 17.10.2003<br />
Beginn: 13 Uhr<br />
Sa 18.10.2003<br />
Ende: 18.00 Uhr<br />
weiter Termine nach<br />
Absprache!<br />
U 1<br />
Ort<br />
siehe<br />
Text<br />
unten
- 97 -<br />
<strong>Grundstudium</strong> - Alle Fachbereiche<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Der Computer ist ein brauchbares Medium in der pädagogischen Arbeit, um unterschiedliche<br />
Zielgruppen zu erreichen, ihre Themen zu bearbeiten und mit ihnen kreative Produkte zu gestalten.<br />
Projekte und Anwendungsbeispiele aus der praktischen Arbeit werden vorgestellt und unter dem<br />
Focus “Gender” Zugangs- und Herangehensweisen von Mädchen und Jungen beleuchtet.<br />
Schwerpunkte des Seminars ist das Gestalten eigener medialer Produktionen z.B. Comics,<br />
Collagen oder einfache Websites zu selbst gewählten Themen.<br />
Veranstaltungsort: Wiss. Institut des Jugendhilfwerks <strong>Freiburg</strong> e.V. - Medienzentrum -<br />
Konradstr. 14, 79100 <strong>Freiburg</strong><br />
Bildhaftes, kreatives<br />
Arbeiten als Grundlage der<br />
“Beziehung”<br />
(max. 17 Tn)<br />
2 Std. Seminar<br />
Hänsler Di 18.30 - 20.00 U 1<br />
Dieses Seminar soll Ihnen am Beispiel des Bildhaft kreativen Arbeitens vermitteln, wie Sie anhand<br />
dieses ausgewählten Mediums in eine sinnvolle und authentische Beziehungsarbeit zu Menschen<br />
in der späteren Praxis der sozialen Arbeit kommen. Dabei soll im Rahmen dieses Seminars<br />
gegeben sein, Ihre eigenen kreativen Ideen einfließen lassen zu können.<br />
Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.<br />
Foto- und Labortechnik<br />
(max. 14 Tn)<br />
2 Std. Seminar<br />
Macziola Di 14.00 - 17.00<br />
14-täglich<br />
Beginn:<br />
14.10.2003<br />
Fotolabor<br />
und<br />
2110<br />
Die aufeinander folgenden Stufen des Negativ- und Positivprozesses sollen gemeinsam erarbeitet<br />
werden - Von den Überlegungen vor der Aufnahme bis zur eigenständigen Ausarbeitung im Labor<br />
mit dem Vergrößerungsgerät: Aufnahmetechnik, Auswahl, umweltverträgliche Handhabung und<br />
Entwicklung von SW-Negativ-Materialien; Grundlagen und Gestaltungsmöglichkeiten der<br />
Positivverarbeitung. Kleinbild-Spiegelreflex-Kamera Bedingung.<br />
Der richtige Drive ? Barth Mo 17.30 - 19.30 Werkr.<br />
Sucht wahrnehmen und<br />
und<br />
“SACHGERECHT” reagieren<br />
(max. 16 Tn)<br />
2 Std. Seminar<br />
1204<br />
In diesem Seminar rückt der suchtgefährdete und abhängige Jugendliche in den Mittelpunkt.<br />
Neben theoretischen Inhalten zum Thema Sucht werden Hilfestellungen für den Berufsalltag mit<br />
dem o.g. Personenkreis erarbeitet.<br />
Von den Teilnehmer/innen des Seminars wird die Aufarbeitung theoretischer Inhalte erwartet, um<br />
dann mit diesem Hintergrundwissen werktechnisch, gestalterisch arbeiten zu können. Anhand<br />
eines Suchtkonzeptes einer Jugendhilfeeinrichtung, das zunächst einmal die Basis für den<br />
theoretischen Teil der Seminararbeit darstellt, werden ganz konkrete Möglichkeiten für suchtkranke<br />
Jugendliche und junge Erwachsene vorgestellt.
- 98 -<br />
<strong>Grundstudium</strong> - Alle Fachbereiche<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Maskenbau und<br />
Maskenspiel<br />
(max. 16 Tn)<br />
2 Std. Seminar<br />
Megnet Kompaktseminar:<br />
Fr 09.01.2004<br />
14.00 - 20.00 Uhr<br />
Sa 10.01.2004<br />
10.00 - 17.00 Uhr<br />
Fr 16.01.2004<br />
14.00 - 20.00 Uhr<br />
Sa 17.01.2004<br />
10.00 - 17.00 Uhr<br />
1308<br />
1306<br />
1207<br />
Die Maske- auf das Gesicht geschminkt oder aus unterschiedlichen Materialien gearbeitet -<br />
begleitet den Menschen durch die kulturgeschichtliche Entwicklung bis in die Gegenwart. Nach<br />
einem einführenden Vortrag über Maskenkulte in verschiedenen Kulturen werden verschiedene<br />
Formen der Maskenherstellung kennen gelernt. Anschließend entscheiden sich die<br />
Gruppenmitglieder für die Herstellungsform einer eigenen Maske.<br />
Übungsphasen zu speziellen Spielformen mit Masken führen anschließend zur Entwicklung einer<br />
theatralen Präsentation in Kleingruppen.<br />
Zusatzangebote<br />
Für den Fachbereich Soziale Arbeit<br />
Übung zu Recht<br />
2 Std. Übung<br />
Gruppe A<br />
Gruppe B<br />
Wilde<br />
Wilde<br />
Di 17.30 - 19.00<br />
Mi 17.30 - 19.00<br />
3000<br />
3000<br />
Zur Lösung menschlicher Interessenkonflikte reicht ein reines "Gerechtigkeitsgefühl" nicht aus.<br />
Rechtsfrieden und eine Annäherung an das Ideal der Gerechtigkeit kann nur über die Anwendung<br />
eines entsprechenden "Handwerkzeuges" erreicht werden. Dieses Handwerkszeug ist das Recht.<br />
Im Wintersemester geht es um die Grundlagen für das Verständnis des bürgerlichen Rechts und<br />
der erfolgreichen Fall-Lösung. Die Aufarbeitung eines Falles ist nur dann zur Konfliktbewältigung<br />
geeignet, wenn sie die innere Struktur der gesetzlichen Vorschriften berücksichtigt und umsetzt.<br />
Man spricht deshalb auch vom "Aufbau der Fall-Lösung".<br />
Anhand von Fällen zu bestimmten grundsätzlichen Rechtsbereichen - Willenserklärung,<br />
Rechtsgeschäft, Geschäftsfähigkeit, Stellvertretung etc. - wird der Einstieg in das Bürgerliche<br />
Recht geübt und die Vorlesung zu Recht begleitet.<br />
Der Besuch der Übung ist eine maßgebliche Voraussetzung für das Gelingen der Klausur im<br />
Sommersemester.
- 99 -<br />
<strong>Grundstudium</strong> - Alle Fachbereiche<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Für die Fachbereiche Soziale Arbeit und Heilpädagogik<br />
Einführungsseminar<br />
in die "Regio-Akademie"<br />
(für alle Semester der<br />
Fachbereiche SozArb,<br />
SozPäd, HeilPäd und<br />
Studierende der<br />
EFH <strong>Freiburg</strong>)<br />
1 Std. Sem.<br />
Spiegelberg/<br />
Weiss<br />
Zeitangabe folgt rechzeitig<br />
durch Aushang!<br />
Das Projekt "Regio-Akademie für soziale Arbeit" ist ein Gemeinschaftsprojekt der in RECOS<br />
zusammengeschlossenen Ausbildungsstätten für Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Heilpädagogik<br />
in Mulhouse, Strasbourg, Basel sowie an der EFH <strong>Freiburg</strong>. Im Rahmen dieses Projekts besteht<br />
die Möglichkeit, über ein Zusatzlehrprogramm interkulturelle Kompetenzen zur<br />
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu erwerben. Über die erfolgreiche Teilnahme in diesem<br />
Programm wird am Ende ein Zertifikat in deutscher und französischer Sprache ausgestellt. -<br />
Themen des Einführungsseminars werden sein: Einführung in Anliegen und Struktur des<br />
Zusatzlehrprogramms; Ausbildungssysteme zu sozialen Berufen in den drei Ländern;<br />
sozialrelevante Aspekte zur Situation in der Regio; soziale Dienstleistungssysteme in Elsass,<br />
Nordschweiz und Südbaden; Grundstruktur der sozialen Sicherheit in den drei Ländern.<br />
Binationales Seminar:<br />
Soziale Arbeit mit jungen<br />
Menschen<br />
(Kooperationsveranstaltung<br />
mit den Escueles<br />
Universitaries de Treball<br />
Social i Educaciò Social an<br />
der Ramon Llull Universität<br />
Barcelona)<br />
2 Std.<br />
Sidler/NN Vorbereitungsseminar<br />
im Wintersemester<br />
2003/04 n.V.<br />
Seminar in <strong>Freiburg</strong>:<br />
07. - 14.02.2004<br />
Seminar in<br />
Barcelona::<br />
17. - 24.04.2004<br />
Das Seminar wendet sich an Studierende der Fachbereiche Sozialarbeit und Heilpädagogik, sowie<br />
der Studiengänge Sozialarbeit und Sozialpädagogik des Grund- und Hauptstudiums. Die<br />
Teilnehmerzahl ist auf je 17 Studierende aus <strong>Freiburg</strong> und Barcelona begrenzt.<br />
Von den Teilnehmern wird die aktive Teilnahme an allen Teilen des Seminars erwartet. Dazu zählt<br />
die Vorlage eines Arbeitspapiers zum Vorbereitungsseminar oder die Vorlage eines Referats zum<br />
Kompaktseminar in <strong>Freiburg</strong> sowie die Vorlage eines Protokolls über einen Praxisbesuch während<br />
des Kompaktseminars in <strong>Freiburg</strong> und Barcelona.<br />
Im Rahmen des Seminars können PL bzw. PVL nach den Bestimmungen der Fachbereiche zum<br />
Zusatzlehrprogramm Europäische Soziale Arbeit erbracht werden.<br />
Zusatzlehrprogramm<br />
“SPOSA”<br />
max. 10 Tn<br />
Schinzler Persönliche Anmeldung bei<br />
Herrn Dr. Schinzler bis spät.<br />
14.10.2003 erforderlich.
- 100 -<br />
<strong>Grundstudium</strong> - Alle Fachbereiche<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Zusatzlehrprogramm "Fachschule / Didaktik des Unterrichtens"<br />
Didaktik des<br />
Unterrichtens I<br />
2 Std.<br />
Für alle Fachbereiche:<br />
ISAG<br />
Forum<br />
Soziale Altenarbeit in der<br />
Stadt <strong>Freiburg</strong> und<br />
Umgebung<br />
(30 - 40 Tn)<br />
Schinzler Mi 8.00 - 9.30<br />
Kricheldorff/<br />
Brandenburg<br />
Persönliche Anmeldung<br />
bei Herrn<br />
Dr.Schinzler bis spät.<br />
14.10.2003 erforderlich.<br />
Termine und Themen:<br />
siehe Plakat zu Beginn des<br />
Semesters<br />
3302<br />
Im Rahmen dies regelmäßig stattfindenden Forums werden aktuelle Themen aus dem Berufsfeld<br />
der Sozialen Altenarbeit aufgegriffen. Nach einer inhaltlichen Einführung in das Thema wird dieses<br />
in einem intensiven Theorie-Praxis-Dialog vertieft und aus unterschiedlichen Blickwinkeln<br />
beleuchtet.<br />
Über die inhaltliche Schwerpunktsetzung und die genauen Themen sowie die Termine des<br />
Wintersemesters 2003/04, wird über einen Plakataushang zu Beginn des Semesters informiert<br />
werden. Die Veranstaltungen sind offen für alle Vertreter der Fachpraxis und interessierte<br />
Studierende aller Fachbereiche. Das Forum ist darüber hinaus auch eine Informationsplattform<br />
über Fort- und Weiterbildungsangebote, Tagungen und neue Literatur.
- 101 -<br />
STUDIENGANG<br />
SOZIALARBEIT
- 102 -<br />
Sozialarbeit 5. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
A. Pflichtbereich<br />
Berufliches Handeln in der Sozialen Arbeit<br />
Studienbegleitendes<br />
Praktikum<br />
Projekte<br />
4 Std.<br />
Supervision<br />
1 Std.<br />
Arbeitsformen und Methoden<br />
der Sozialen Arbeit:<br />
Sozialarbeit mit Einzelnen;<br />
systemisches Arbeiten im<br />
Kontext der Familie<br />
2 Std.<br />
Möller/<br />
Nickolai<br />
Mo 14.00 - 15.30 3000<br />
Die Vorlesung soll einen Überblick vermitteln über methodische Arbeitsansätze in Familien. Es<br />
geht um prozesshaftes Arbeiten mit Familien, unterstützende Angebote in Familien, wie z.B.<br />
sozialpädagogische Familienhilfe, lösungsorientierte Familienberatung und Arbeit mit Multiproblemfamilien.<br />
Neben der Geschichte der Einzelfallhilfe geht es um die Vermittlung spezifisch sozialarbeiterischer<br />
Herangehensweisen an Problemlagen einzelner Menschen. Es werden verschiedene<br />
Ansichten von Fachlichkeit - Lebensweltorientierung, Empowerment, Casemanagement,<br />
Netzwerkarbeit - dargestelllt. Darüber hinaus werden auch unterschiedliche Anwendungsbereiche<br />
der sozialen Einzelhilfe wie etwa Streetwork oder akzeptierende Sozialarbeit vorgestellt.<br />
Literatur: Pantucek, Peter: Lebensweltorientierte Individualhilfe, <strong>Freiburg</strong> 1998.<br />
Humanwissenschaftliche Grundlagen der Sozialen Arbeit<br />
Psychologische Theorien<br />
auffälligen Verhaltens<br />
2 Std.<br />
Oswald Mi 11.30 - 13.00 3000<br />
Diese Vorlesung erstreckt sich über zwei Semester. Im zweiten Teil der Vorlesung werden<br />
verhaltenstherapeutische Ansätze zum Verständnis und zur Behandlung abweichenden Verhaltens<br />
vorgestellt. Schließlich werden tiefenpsychologische und verhaltenstherapeutische Sicht als<br />
Systemaspekte verbunden.
- 103 -<br />
Sozialarbeit 5. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Sozialstruktur und soziale<br />
Probleme in Deutschland<br />
2 Std.<br />
Sidler Di 8.00 - 9.30 3000<br />
Die Vorlesung behandelt soziale Probleme im allgemeinen und abweichendes Verhalten<br />
(Kriminalität) und Armut im Besonderen.<br />
Rechtliche, sozialpolitische und ökonomische Grundlagen<br />
der Sozialen Arbeit<br />
Sozialrecht I:<br />
Sozialversicherungsrecht<br />
1 Std.<br />
Winkler Mi 9.45 - 11.15<br />
1. Semesterhälfte<br />
2 Std. wöchentlich<br />
Die Vorlesung Sozialrecht I führt die Veranstaltung aus dem Sommersemester fort und wird<br />
folgende Themen zum Inhalt haben: Recht der gesetzlichen Rentenversicherung (versicherter<br />
Personenkreis, Leistungen, Organisation und Finanzierung), Arbeitsförderungsrecht (versicherter<br />
Personenkreis, Leistungen einschließlich der Leistung an soziale Einrichtungen, Organisation<br />
und Finanzierung), Recht der sozialen Entschädigung unter besonderer Berücksichtigung der<br />
Kriminalopferentschädigung und Recht der sozialen Förderung unter besonderer<br />
Berücksichtigung der Familienförderung. Eine detaillierte Gliederung der Veranstaltung findet<br />
sich auf der Dozentenseite der Homepage des Fachbereichs Sozialarbeit der Fachhochschule.<br />
Literatur: Literaturhinweise werden zu Beginn der Veranstaltung gegeben.<br />
Sozialrecht II:<br />
Sozialhilferecht<br />
2 Std.<br />
3000<br />
Winkler Di 11.30 - 13.00 3000<br />
Die Vorlesung Sozialrecht II dient der Vermittlung von Grundkenntnissen im Sozialhilferecht.<br />
Folgende Themen werden in der Vorlesung angesprochen: Begriff, Regelungsgegenstände,<br />
historische Entwicklung und Ziele des Sozialhilferechts, Grundsätze des Sozialhilferechts,<br />
laufende Hilfe zum Lebensunterhalt, einmalige Hilfen zum Lebensunterhalt, Hilfen in besonderen<br />
Lebenslagen, Überleitung und gesetzlicher Übergang von Sozialhilfeansprüchen, Kostenerstattung<br />
sowie die Organisation der Sozialhilfe. Eine detaillierte Gliederung findet sich auf der<br />
Dozentenseite der Homepage des Fachbereichs Sozialarbeit der Fachhochschule.<br />
Literatur: Literaturhinweise werden zu Beginn der Veranstaltung gegeben.
- 104 -<br />
Sozialarbeit 5. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Verwaltungsrecht<br />
1 Std.<br />
Winkler Mi 9.45 - 11.15<br />
2. Semesterhälfte<br />
2 Std. wöchentlich<br />
Die Vorlesung Verwaltungsrecht dient der Vermittlung von Grundkenntnissen insbesondere des<br />
Sozialverwaltungsrechts. Folgende Themen werden in der Vorlesung angesprochen: Begriff,<br />
Regelungsgegenstände und Aufgaben des Verwaltungsrechts, Rechtsquellen des Verwaltungsrechts,<br />
Grundsätze des Verwaltungsrechts, Ablauf des Verwaltungsverfahrens, Verwaltungsakt,<br />
öffentlich-rechtlicher Vertrag. Eine detaillierte Gliederung findet sich auf der Dozentenseite der<br />
Homepage des Fachbereichs Sozialarbeit der Fachhochschule. Die Veranstaltung wird im 8.<br />
Semester fortgeführt.<br />
Literatur: Literaturhinweise werden zu Beginn der Veranstaltung gegeben.<br />
Familienrecht<br />
2 Std.<br />
3000<br />
Glenz Di 18.30 - 20.00 Aula<br />
1100<br />
Familienrecht ist für die soziale Praxis - vor allem für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - von<br />
großer Bedeutung. In der Veranstaltung “Familienrecht” werden die für Sozialarbeiter/innen und<br />
Sozialpädagog/innen wesentlichen Inhalte des Familienrechts anhand von Fällen vermittelt.<br />
Abstammung, Adoption, Unterhalt, elterliche Sorge, Umgangsrecht, Trennung und Scheidung,<br />
nichteheliche Lebensgemeinschaft und Vormundschaft / Betreuung.<br />
In der zweiten Semesterhälfte werden Grundzüge des Kinder- und Jugendhilferechts vermittelt.<br />
Kinder- und<br />
Jugendhilferecht<br />
- Jugendstrafrecht<br />
2 Std.<br />
Zier Mo 8.00 - 9.30 3000<br />
Die Vorlesung befasst sich mit der Stellung des Jugendlichen und Heranwachsenden im<br />
Strafverfahren. Den Schwerpunkt bilden hierbei die Reaktions - und Sanktionssysteme der<br />
Justiz, Vermeidungsstrategien, Aufgaben und Rollen der am Jugendstrafverfahren beteiligten<br />
Personen. Ergänzend hierzu werden Aufbau und Organisation der Jugendgerichte, Probleme<br />
der Untersuchungshaft und des Jugendstrafvollzugs besprochen. Die Vorlesung will die rechtlichen<br />
Inhalte praxisorientiert und unter Berücksichtigung der Aufgaben der Sozialarbeit darstellen.
- 105 -<br />
Sozialarbeit 5. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
B. Wahlpflichtbereich<br />
Berufliches Handeln in der Sozialen Arbeit<br />
Theorie-Praxis-Seminare<br />
Soziale Arbeit<br />
mit Familien<br />
4 Std.<br />
Möller Mi 9.00 - 12.00 3201<br />
Ein-Eltern-Familien, Stieffamilien, Adoptions- und Pflegefamilien, aber auch Familien mit einer<br />
speziellen Problematik wie Suchtverhalten, Gewaltproblematik und psychische Erkrankungen<br />
stehen im Mittelpunkt des Arbeitsansatzes. Entsprechende Institutionen bzw. methodische<br />
Ansätze werden vorgestellt.<br />
Literaturhinweise im Seminar.<br />
ISAG<br />
Angewandte Soziale<br />
Gerontologie<br />
4 Std.<br />
Kricheldorff Mi 9.00 - 12.00 3102<br />
Ziel: Kenntnis typischer Lebenslagen alternder Menschen und des professionellen Handelns im<br />
Arbeitsfeld. Inhalte des Seminars: - Auseinandersetzung mit den Lebensmöglichkeiten, aber<br />
auch mit typischen Krisen und Krankheiten im Alterungsprozess, - Überprüfung der eigenen<br />
Haltung zu Alter und Tod, - methodischer Aufbau einer beruflichen Unterstützungsstruktur und<br />
Kennenlernen anderer methodischer Verfahren im Bereich der Sozialarbeit und des bürgerschaftlichen<br />
Engagements, - Auseinandersetzung mit Organisationsstrukturen und rechtlichen<br />
sowie sozialpolitischen Rahmenbedingungen.<br />
Gemeinwesenorientierte<br />
Sozialarbeit<br />
4 Std.<br />
Grosser Mi 9.00 - 12.00 1203<br />
Im Seminar sollen sich die Teilnehmer/innen Grundlagen erarbeiten können für eine Zusammenarbeit<br />
mit Bürgern, die sich an der gemeinsamen Lösung ihrer Probleme und Anliegen beteiligen<br />
und Einfluss auf die Strukturen im Gemeinwesen nehmen wollen. Die Auseinandersetzung über<br />
Handlungsmodelle und Praxisbeispiele der Gemeinwesenarbeit soll den Teilnehmer/innen als<br />
Orientierung für die Entwicklung eines eigenen Handlungsentwurfs in ihrer Berufspraxis dienen.<br />
Gezieltes Handeln in Prozessen der GWA soll an typischen Rollen, Aufgaben und Methoden<br />
geklärt und in Projekten des studienbegleitenden Praktikums umgesetzt und reflektiert werden.<br />
Lernprozesse und Lernergebnisse werden gemeinsam evaluiert, und diese Evaluation dient<br />
damit zugleich einer weiteren Praxiserfahrung für die Gemeinwesenarbeit.
- 106 -<br />
Sozialarbeit 5. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Jugendsozialarbeit<br />
4 Std.<br />
Schwab Mi 9.00 - 12.00 3101<br />
Jugendsozialarbeit ist auf das unmittelbare soziale Umfeld, die Schule und den Beruf bezogene<br />
Hilfe für junge Menschen, die in besonderen sozialen Verhältnissen leben. Jugendsozialarbeit<br />
zielt auf mehr Chancengleichheit und darauf, dass die betroffenen jungen Menschen am<br />
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben der Gesellschaft teilhaben.<br />
Praktische Berufsfelder der Jugendsozialarbeit werden exemplarisch mit einem Kompetenzprofil<br />
als Sozialarbeiter diskutiert und vertieft.<br />
Soziale Arbeit<br />
mit straffälligen<br />
Menschen<br />
4 Std.<br />
Nickolai Mi 9.00 -12.00 1204<br />
Nachdem im 4. Semester ein Überblick über die Sozialen Dienste der Justiz und der Freien<br />
Straffälligenhilfe erfolgte, stehen in diesem Semester die Lebenslagen der straffällig Gewordenen<br />
im Vordergrund. Darüber hinaus sollen hier auch Themen ihren Platz haben, die von den<br />
Seminarteilnehmer/innen im Kontext kriminologischer- und kriminalpolitischer Fragestellungen<br />
gewünscht werden,<br />
Literatur: Nickolai, Werner / Kawamura, Gabriele / Krell, Wolfgang / Reindl, Richard (Hrsg.):<br />
Straffällig - Lebenslagen und Lebenshilfen. <strong>Freiburg</strong> 1996.<br />
Soziale Arbeit<br />
mit abhängigen Menschen<br />
4 Std.<br />
Kreis Mi 9.00 - 12.00 3203<br />
In Fortführung der erarbeiteten Inhalte des 4. Semesters schließen sich nun die konkreten<br />
Tätigkeitsfelder in der Arbeit mit abhängigen Menschen an. Es soll ein Überblick der einzelnen<br />
Arbeitsfelder gegeben werden sowohl durch die Seminararbeit als auch durch Praxisbesuche<br />
vor Ort. Die persönlichen Erfahrungen sollen erweitert werden durch die Auseinandersetzung mit<br />
und Diskussion von Praxisfällen. Persönliche Reflexion und Kompetenzerweiterung des beruflichen<br />
Selbstverständnisses stehen im Mittelpunkt.<br />
Gesprächsführung in der Sozialen Arbeit<br />
Beratung ist eine Kerntätigkeit Sozialer Arbeit in den unterschiedlichsten Arbeitsfeldern. In<br />
diesem Seminar lernen die Teilnehmer/innen, wie man Beratungsgespräche mit einzelnen<br />
führt. Ein Beratungskonzept wird vorgestellt und in Kleingruppen eingeübt. Das Konzept<br />
orientiert sich an der Lebenslage und am Prinzip ressourcenorientierter Sozialer Arbeit.<br />
Das Beratungsgespräch<br />
in der Sozialarbeit<br />
2 Std.<br />
Oswald Mo 11.30 - 13.00 3201
- 107 -<br />
Sozialarbeit 5. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Das Beratungsgespräch<br />
in der Sozialarbeit<br />
2 Std.<br />
Das Beratungsgespräch<br />
in der Sozialarbeit<br />
2 Std.<br />
Das Beratungsgespräch<br />
in der Sozialarbeit<br />
2 Std.<br />
Das Beratungsgespräch<br />
in der Sozialarbeit<br />
2 Std.<br />
Uihlein Mo 9.45 - 11.15<br />
14-tägl., ab 06.10.03<br />
+ Kompakt:<br />
Sa 11.10.03,<br />
9.00 - 17.00<br />
Zenner Kompaktseminar<br />
Fr 05.12.03,ab 13.30<br />
Sa 06.12.03<br />
Fr 12.12.03,ab 13.30<br />
Sa 13.12.03<br />
Schley 1.Treff:<br />
Mo 13.10.03,<br />
9.45 - 11.15 Uhr<br />
Kompaktseminar<br />
Fr 14.11.03,ab 14.00<br />
Sa 15.11.03,ab 9.00<br />
Fr 21.11.03,ab 14.00<br />
Sa 22.11.03,ab 9.00<br />
Klier Kompaktseminar<br />
Fr 07.11.2003,<br />
13.00 - 18.30 Uhr<br />
Sa 08.11.2003,<br />
9.00 - 16.00 Uhr<br />
Fr 14.11.2003,<br />
13.00 - 18.30 Uhr<br />
Sa 15.11.2003,<br />
9.00 - 16.00 Uhr<br />
3102<br />
3102<br />
3102<br />
3102<br />
3101<br />
3102<br />
3102<br />
3302<br />
3302
- 108 -<br />
Sozialarbeit 5. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Spezielle Arbeitsformen, Methoden und Techniken in der<br />
Sozialen Arbeit<br />
Berichterstattung und<br />
Gutachtenerstellung in<br />
der Sozialarbeit<br />
(max. 14 TN)<br />
2 Std.<br />
Lang teilweise Kompaktseminar<br />
1. Treffen:<br />
Di 07.10.2003,<br />
13.15 - 14.00 Uhr<br />
(Terminabsprache)<br />
Theoretische Einführung zu psychologischen, soziologischen, rechtlichen und anderen<br />
Variablen (z.B. Theorie der Beobachtung, Kommunikationsstrukturen, Funktion von Sprache),<br />
Klärung rechtlicher Grundlagen zur Berichterstattung als Vorlesung mit Kurzübungen, ca. 5<br />
Doppelstunden.<br />
Praktische Übungen zur Erschließung von Informationsquellen, Formen und Inhalten unterschiedlicher<br />
Berichte in Paar- und Kleingruppenarbeit anhand von Fällen als Blockveranstaltung(en).<br />
Ziel: Auseinandersetzung mit und kennen lernen von notwendigen Inhalten und Strukturen<br />
einfacher sowie differenzierter Berichte im Hinblick auf die praktischen Studiensemester.<br />
Kompetenzerwerb in der<br />
außerschulischen<br />
Jugendbildung<br />
2 Std.<br />
Nickolai/<br />
Schwab<br />
Das Seminar führt die Lehrveranstaltung vom 4. Semester fort.<br />
ISAG<br />
Berufliches Handeln in<br />
der Sozialen Arbeit auf<br />
der Basis biografischer<br />
Forschung<br />
2 Std.<br />
Methodische Arbeit mit<br />
Gruppen<br />
(max. 18 TN)<br />
2 Std.<br />
3201<br />
Do 11.30 - 13.00 1204<br />
Kricheldorff Do 11.30 - 13.00 3201<br />
Kirchgäßner Kompaktseminar<br />
1. Treffen s. Aushang
- 109 -<br />
Sozialarbeit 5. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Im Rahmen eines Kompaktseminars werden die Grundlagen in der Arbeit mit Gruppen (Entwicklung<br />
und Dynamik von Gruppen, Rollen in Gruppen, die Leitung von Gruppen, Arbeit an und<br />
in Konflikten, Konzepte) bearbeitet. Ergänzend dazu werden systemisches Denken und konstruktivistische<br />
Wahrnehmung in ihren Konsequenzen für die konkrete Arbeit mit Gruppen<br />
Thema sein.<br />
Die Veranstaltung ist weder als Vorlesung noch als herkömmliches Seminar gedacht. Vielmehr<br />
soll Lernen in der konkreten (Teilnehmer/innen -) Gruppe und vor dem Hintergrund eigener<br />
Gruppenerfahrungen stattfinden. Daher werden theoretische Abschnitte im Wechsel mit veranschaulichenden<br />
Übungen stehen. Ziel des Seminars ist, Grundlagen für eine Handlungskompetenz<br />
in der Arbeit mit Gruppen zu vermitteln.<br />
Verhandeln als Strategie<br />
und Methode in der<br />
Sozialarbeit<br />
2 Std.<br />
Grosser 1. Treff:<br />
Mi 08.10.2003,<br />
12.15 Uhr<br />
Kompaktseminar:<br />
Fr 17.10.2003<br />
Sa 18.10.2003<br />
und weiterer Termin<br />
n.V.<br />
Fragen: Wie erleben Sie Verhandlungssituationen in der Sozialarbeit, in Geschäftsbeziehungen<br />
oder im Privatleben? Bekommen Sie dabei Herzklopfen? - Im Seminar sollen die Teilnehmer/innen<br />
Verhandeln üben und verbessern lernen.<br />
Ziele des Seminars sind, den Teilnehmern Strategien und Methoden des Verhandelns zu<br />
vermitteln. Es soll die Teilnehmer/innen befähigen, zu überprüfen, wie sie verhandeln, und neue<br />
Ideen, Instrumente und neue Fertigkeiten für die Anwendung im eigenen beruflichen Bereich zu<br />
erwerben.<br />
Inhalte: Verhandlungssituationen in der eigenen Lebens- und Berufspraxis der Sozialarbeit;<br />
verschiedene Handlungskonzepte, ihre Strategien und Methoden; schwierige Verhandlungssituationen.<br />
Arbeitsformen: Verhandlungstraining mit unterschiedlichen Rollen und Aufgaben; Reflexion,<br />
Analyse von Verhandlungserfahrungen; Anregungen zur Theorie und Praxis, Tipps.<br />
Literaturangaben im Seminar<br />
Konzepte entwickeln -<br />
Projekte managen -<br />
Qualität sichern<br />
2 Std.<br />
1204<br />
3102<br />
Hilpert Mo 17.30 - 19.00 3301<br />
Die Teilnehmenden werden sich mit Markt- und Kundenorientierung am Beispiel ausgewählter<br />
Handlungsfelder der sozialen Arbeit kritisch auseinander setzen. Die Studierenden werden sich<br />
Methoden und Instrumente aneignen, Konzepte der sozialen Arbeit praxis- und bedarfsorientiert<br />
zu entwickeln. Ein Schwerpunkt des Seminars wird darin bestehen, Grundelemente von Projektarbeit<br />
kennen zu lernen und zu erproben. Daraus abgeleitet werden Bausteine eines Projektmanagements<br />
vorgestellt. Die Methode der Selbstevaluation und das Instrument der Zieleplanung<br />
als strategisches und operatives Planungsinstrument für soziale Arbeit werden an praktischen<br />
Beispielen erprobt.<br />
Methoden: Fallarbeit, Gruppenarbeit, Referate
- 110 -<br />
Sozialarbeit 5. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Lösungsorientierte<br />
Beratung<br />
2 Std.<br />
Möller Kompaktseminar:<br />
Fr 09.01.04,ab 14.00<br />
Sa 10.01.04,ab 9.00<br />
Grundlegendes Beratungskonzept:<br />
Lösungen werden verstanden als Veränderungen eines Teils eines Systems (z.B. Veränderungen<br />
von Wahrnehmungen, Gedanken, Gefühlen, Werterhaltungen, Lebensplänen, Verhaltensmustern);<br />
dies wiederum führt zu einer Rückwirkung, zu einer Neuorganisation des gesamten<br />
Systems.<br />
Es ist nicht wichtig, das Problem zu kennen, sondern es muss der Therapeutin klar sein, wie das<br />
Leben für die Klientin aussieht, wenn das Problem gelöst ist.<br />
Die Beratung soll den Blick auf alternative Verhaltensmöglichkeiten öffnen. In der Sichtweise der<br />
lösungsorientierten Beratung ist die Lösung eines Problems immer vorhanden. Es gibt verschiedene<br />
Perspektiven, eine Sache zu betrachten - die lösungsbeinhaltende Sichtweise muss<br />
von der Klientin nur noch entdeckt werden.<br />
Kommunalpolitik und<br />
kommunale Jugendpolitik<br />
2 Std.<br />
Wenzl Beginn:<br />
Mo 13.10.2003,<br />
17.30 - 20.30 Uhr<br />
(14-täglich)<br />
Exkursion:<br />
Do 13.11.2003,<br />
ab 15.00 Uhr<br />
Kommunalpolitik ist neben der Politik auf Landes- und Bundesebene für BürgerInnen eine<br />
relativ leicht zugängliche Ebene im politischen System. Hier kann politische Partizipation in<br />
konventioneller wie in unkonventioneller Weise gelernt, praktiziert und erfahren werden. Jugendpolitik<br />
umfasst auf alle Jugendliche bezogenen politischen Forderungen, Programme und<br />
Aktivitäten. Jugendpolitik hat die Funktion der öffentlichen Thematisierung von Problemen<br />
jugendlicher Gruppen, das Vertreter der Interesse von Mädchen und Jugen und die Erarbeitung<br />
von Lösungen. Somit stehen Kommunalpolitik und Jugendpolitik eng miteinander in Verbindung,<br />
da politische Entscheidungen auf kommunaler Ebene Einfluss auf das Lebensumfeld jungen<br />
Menschen hat.<br />
Schwerpunkte: Einführung in die kommunale Jugendpolitik - Gespräche mit engagierten<br />
Kommunal- und JugendpolitikerInnen - Besuch einer Sitzung des Jugendhilfeausschusses / des<br />
Gemeinderates der Stadt <strong>Freiburg</strong> - Diskussion mit jugendpolitischen Lobbyisten - Kommunalwahlen<br />
2004<br />
3302<br />
3101
- 111 -<br />
Sozialarbeit 5. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Interkulturelle Kompetenz<br />
(max. 18 TN)<br />
2 Std.<br />
Schramkowski<br />
1. Treffen:<br />
Do 09.10.2003,<br />
11.30 - 13.00 Uhr<br />
(weitere Terminvereinbarung<br />
im Seminar)<br />
Das Hauptziel des Seminars liegt in der Förderung interkultureller Kompetenzen der Studierenden<br />
der Sozialen Arbeit. Dabei ist interkulturelle Kompetenz zu verstehen als die Fähigkeit,<br />
eigene Werte und Sichtweisen reflektieren und sich in andere Denkmuster hineinversetzen zu<br />
können, ein Bewusstsein für die Relativität selbiger zu erlangen wie auch das Wissen um<br />
Migrationsprozesse und interkulturelle Arbeitsansätze. So soll es u.a. um folgende Themen<br />
gehen: Migration & Integration, Zuwanderungspolitik, der Kulturbegriff, interkulturelle Öffnung<br />
der sozialen Dienste, interkulturelle Netzwerke, Zweisprachigkeit, methodische Ansätze für<br />
interkulturelle Arbeit u.a. So soll zum einen theoretisches Hintergrundwissen vermittelt und<br />
zum anderen Übungen und Methoden aus Fortbildungen zur Förderung interkultureller Kompetenzen<br />
praktisch ausprobiert werden.<br />
Sozialraum und<br />
Stadtteilanalyse<br />
2 Std.<br />
Back Mo 17.30 - 19.00<br />
Beginn: 13.10.2003<br />
Hilfe zur Selbsthilfe kann professionelle Soziale Arbeit nur leisten, wenn sie die sozialen Netzwerke<br />
und das soziale Milieu ihrer Klienten kennt. Das gilt sowohl für die Einzelhilfe wie für die<br />
Gemeinwesenarbeit. Gerade die Gemeinwesenarbeit erlebt durch den aktuellen gesellschaftlichen<br />
Wandel eine Renaissance. In Wohnquartieren hat sie für den Aufbau neuer Sozialräume<br />
eine kommunikationsstiftende Funktion. Sie erforscht Meinungen, Stimmungen, Themen in der<br />
Nachbarschaft und versucht Menschen zu diesen Themen zusammen zu bringen. Gemeinsam<br />
mit ihnen entwickelt sie Lösungsstrategien bei Problemen. Dazu gehört die Analyse von Sozialräumen.<br />
In der Veranstaltung werden die Sozialraum- und Stadtteilanalyse, verschiedene Handlungsansätze,<br />
Methoden und Arbeitsweisen vorgestellt. Als theoretischer und praktischer Bezugsrahmen<br />
gilt der alltagsbezogene Sozialraum oder Lebensraum der Menschen.<br />
Die Praxisprojekte in den Neubaustadtteilen <strong>Freiburg</strong>-Rieselfeld, <strong>Freiburg</strong>-Vauban und <strong>Freiburg</strong>-<br />
Weingarten werden vorgestellt und Fragen zu den sozialen und politischen Strukturen reflektiert.<br />
In Schritten wird gelernt, eine Sozialraum- und Stadtteilanalyse zu erstellen.<br />
Literatur: Boulet/Kraus/Oelschlägel: Gemeinwesen als Arbeitsprinzip. Bielefeld 1980.<br />
Noack, Winfrid, Gemeinwesenarbeit: Ein Lehr- und Arbeitsbuch, <strong>Freiburg</strong> 1999.<br />
Weitere Literatur wird im Seminar genannt.<br />
1203<br />
3302
- 112 -<br />
Sozialarbeit 5. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Gestaltungspädagogik<br />
2 Std.<br />
Cloidt/<br />
Menzen/<br />
Schönenborn<br />
n. V.<br />
Ziel und Inhalt: Diese Veranstaltung soll einen Überblick über die praktisch-methodischen<br />
Anwendungen des Faches Gestaltungspädagogik/Kunstpädagogik/-therapie geben.<br />
Der theoretische Teil der Veranstaltung behandelt angesichts seines fächerübergreifenden<br />
Charakters die heilpädagogischen, sozialpädagogischen und sozialarbeiterischen wie die<br />
psychiatrisch-betreuenden Aspekte der praktisch-kunsttherapeutischen/-pädagogischen Arbeit.<br />
Die Veranstaltung will eine breite Übersicht der pädagogisch-betreuenden, bildnerisch-anleitenden<br />
und therapeutisch-intervenierenden Maßnahmen geben.<br />
Methodisches Vorgehen: Mit viel Anschauungsmaterial (Dias, Videos) werden die unterschiedlichen<br />
Ansätze der im wesentlichen pädagogisch orientierten Kunsttherapie skizziert und<br />
diskutiert.<br />
Der praktisch-pädagogische Teil will mit Hilfe unterschiedlicher bildnerischer und plastischformbarer<br />
Materialien und Techniken soziale Konflikte begreifbar machen. Wir werden praktisch<br />
wie theoretisch in den Umgang mit den Ausdrucksmitteln ästhetisch-bildnerisch-/plastischformbarer<br />
Art einführen.<br />
Methodisch/organisatorisches Vorgehen: Studierende wechseln wöchentlich zwischen den<br />
Angeboten von bildnerischen Materialien und Techniken und plastisch-formbaren Materialien<br />
und Techniken.<br />
Projektaufbau:<br />
Einsatz für den Sozialen<br />
Hilfsfond im Landkreis<br />
Emmendingen<br />
2 Std.<br />
Grosser/<br />
Sidler<br />
Fr 8.00 - 9.30 3202<br />
Die Katholische Fachhochschule <strong>Freiburg</strong> hat im Landkreis Emmendingen einen Projektauftrag<br />
übernommen. Studierende können in diesem Seminar sowohl theoretisch wie praktisch-methodisch<br />
lernen, wie man Projektarbeit in der Sozialen Arbeit leistet. Das Untersuchungsprojekt<br />
“Einsatz für den Sozialen Hilfsfond” läuft ein Jahr und ist in drei Phasen gegliedert:<br />
1. Die Untersuchung von Notfällen im Lebensalltag und die Grenzen von Hilfemöglichkeiten im<br />
beruflich organisierten Hilfesystem.<br />
2. Aktionen der Öffentlichkeitsarbeit zum Einsatz des Sozialen Hilfsfonds.<br />
3. Klärung von Kooperationen und Vermittlungsverfahren für den Einsatz des Sozialen Hilfsfonds.<br />
Die Studierenden können die Projektarbeit erlernen, vom Konzeptgedanken über Planungsaufgaben<br />
bis hin zur Durchführung von Interviews und der Auseinandersetzung mit unseren<br />
Hilfesystemen. Fahrtkosten nach Emmendingen werden übernommen. Teilnehmer/innen sollten<br />
sich für das Projekt engagieren.<br />
Kultur- und Medienpädagogik: siehe<br />
“Hauptstudium: Zusammenfassung der Angebote im Medienbereich”<br />
C. Zusatzangebote siehe 7. Semester Studiengang Sozialarbeit
- 113 -<br />
Sozialarbeit 7. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
A. Pflichtbereich<br />
Berufliches Handeln in der Sozialen Arbeit<br />
Fallseminar;<br />
interdisziplinär, schwerpunktbezogen<br />
2 Std.<br />
Möller /<br />
Winkler<br />
ISAG<br />
Kricheldorff /<br />
Tolles<br />
Grosser /<br />
Winkler<br />
Wenzl /<br />
Winkler<br />
Nickolai /<br />
Bukowski<br />
Kreis /<br />
Sidler<br />
Di 9.45 - 11.15 3101<br />
Di 9.45 - 11.15 3201<br />
Di 9.45 - 11.15 3102<br />
Mo 15.45 - 17.15 3101<br />
Di 9.45 - 11.15 1204<br />
n. V.<br />
Humanwissenschaftliche Grundlagen der Sozialen Arbeit<br />
Pädagogische<br />
Psychologie<br />
2 Std.<br />
Schmidt Fr 9.45 - 11.15 Aula<br />
1100<br />
Zunächst sollen grundlegende Themen (Beziehungsgestaltung und Lernen, Bedürfnisse des<br />
Kindes, Einfühlungsvermögen, Familieninteraktion, Selbstkonzept, Leistungsmotivation u.a.) der<br />
Pädagogischen Psychologie behandelt werden.<br />
In einem zweiten Teil werden wichtige pädagogische Handlungsmaximen im Alltag mit<br />
Kindern und Jugendlichen dargestellt und wie angehenden Eltern und Erziehern diese vermittelt<br />
werden können.<br />
Abschließend sollen Vorgehensweisen der Pädagogischen Psychologie im Umgang mit<br />
verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen dargestellt werden. Methoden der<br />
pädagogisch-psychologischen Diagnostik und daraus abgeleitete Hilfen für ängstliche oder<br />
aggressive Kinder und Jugendliche werden erläutert.
- 114 -<br />
Sozialarbeit 7. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Klinische Psychologie<br />
2 Std.<br />
Oswald Do 9.45 - 11.15 3000<br />
Im Rahmen des Systemmodells wird der Stellenwert psychotherapeutischer Methoden in der<br />
sozialen Einzelhilfe dargestellt. Behandelt werden: Systembild zu Lebenslagen; grundlegende<br />
Ansätze in der Psychotherapie; das integrative Modell von Grawe. Vergleich typisierter Rollenprofile<br />
der Sozialarbeiter/innen und der Psychotherapeut/innen; Abgrenzung von Beratung<br />
und Psychotherapie. Verhaltenstherapeutische Methoden; psychoanalytisch basierte Methoden;<br />
Sozialtherapie.<br />
Sozialarbeit in<br />
soziologischer Sicht<br />
1 Std. / (1.Sem.-Hälfte<br />
2 Std.)<br />
Sidler Do 8.00 - 9.30<br />
Beginn: 09.10.2003<br />
8 Termine in Folge<br />
Die Aufgabe dieser Vorlesung ist ganz einfach: die soziologische Rekonstruktion der politischen<br />
Konstitution der sozialen Probleme, deren Bearbeitung die Aufgabe der Sozialarbeitenden der<br />
Praxisstellen der praktischen Studiensemester der Studierenden darstellt.<br />
Rechtliche, sozialpolitische und ökonomische Grundlagen<br />
der Sozialen Arbeit<br />
Kinder- und Jugendhilferecht<br />
2 Std.<br />
3000<br />
Winkler Mo 9.45 - 11.15 3000<br />
Die Vorlesung "Kinder- und Jugendhilferecht" dient der Vertiefung der in der Praxis erworbenen<br />
Kenntnisse in diesem sozialrechtlichen Teilrechtsgebiet. Folgende Themen werden anhand<br />
aktueller, der Rechtsprechung entnommener Fälle erörtert: Allgemeine Grundsätze des Jugendhilferechts,<br />
Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz,<br />
Förderung der Erziehung in der Familie, Tageseinrichtungen und Tagespflege, Hilfen zur<br />
Erziehung, Inobhutnahme, Herausnahme des Kindes, Organisation der Kinder- und Jugendhilfe.
- 115 -<br />
Sozialarbeit 7. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Politische und ökonomische<br />
Bedingungen<br />
der Sozialen Arbeit<br />
2 Std.<br />
Hohm Di 14.00 - 15.30 1207<br />
Im Zentrum der Veranstaltung soll die Konsumgesellschaft als eine Form der heutigen Gesellschaftsbeschreibung<br />
stehen. Sie ist aus folgenden Gründen für die ökonomischen und politischen<br />
Bedingungen der Sozialarbeit interessant:<br />
1. zusammen mit Gesellschaftsbeschreibungen wie Erlebnis-, Spaß- und Freizeitgesellschaft<br />
verweist sie auf die wachsenden Verheißungen und Risiken jenseits der Arbeitsgesellschaft und<br />
der Erwerbsarbeit;<br />
2. sofern ihre Risiken die Form von überzogenen Konsumansprüchen und/oder kommunizierte<br />
Lifestyle-Erwartungen annehmen, führen sie nicht selten zu prekären sozialen Lagen (Überschuldung,<br />
Kaufsucht, conspicous consumption etc.) mit der Notwendigkeit des Hilfebedarfs<br />
durch Sozialarbeit;<br />
3. ihre Ambivalenz manifestiert sich besonders anhand der Subkulturen von Kindern und<br />
Jugendlichen, welche ihr entweder überkonform Tribut zollen (Yuppies, markenbewusste Kids)<br />
oder ihr als Wegwerfgesellschaft (Punks, Gothics) den Spiegel vorhalten bzw. ihre Folgeprobleme<br />
politisch attackieren (“Attac”);<br />
4. ihre Semantik der Kundenorientierung reduziert sich nicht mehr nur auf den Konsumsektor<br />
des Wirtschaftssystems, sondern erobert als Nachfolgesemantik des Hilfesuchenden und<br />
Klienten zunehmend die Organisationen der Sozialarbeit (Neues Steuerungsmodell) und ihre<br />
sozialen Dienstleistungen).<br />
Sozial- und Gesellschaftspolitik<br />
2 Std.<br />
Hohm Di 15.45 - 17.15 1207<br />
In der Veranstaltung soll die jüngere Entwicklung zum Wohlfahrtspluralismus bzw. Welfare-Mix<br />
der Sozial- und Gesellschaftspolitik anhand folgender Fragen thematisiert werden:<br />
1. Welche aktuellen Transformationen der Relation von Wohlfahrtsstaat, Wohlfahrtsverbänden,<br />
Laienorganisationen und gewinnorientierten Unternehmen lassen sich beobachten?<br />
2. Welche Implikationen haben die aktuellen Organisationsreformen der dienstleistungsorientierten<br />
Sozialpolitik (veränderte Rechtsformen, Neues Steuerungsmodell, Qualitätssicherung,<br />
reformulierte Corporate Identity, personenzentrierte Hilfe, Öffnung für gewinnorientierte Unternehmen)<br />
für die Erbringung sozialer Hilfe?<br />
3. Welchen Stellenwert haben die aktuellen Semantiken des aktivierenden Staates und der<br />
Zivilgesellschaft für bestimmte Entscheidungsbereiche (Sozialversicherung, Arbeitsmarkt,<br />
soziale Stadt etc.) der Sozialpolitik?
- 116 -<br />
Sozialarbeit 7. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
B. Wahlpflichtbereich<br />
Sozialarbeitswissenschaft<br />
Theorien und Konzepte zur Sozialarbeit<br />
Sexueller Missbrauch<br />
an Mädchen und Jungen<br />
(max. 20 TN)<br />
2 Std.<br />
Bremer Do 14.00 - 15.30 2110<br />
Das Seminar bietet die Möglichkeit, sich umfangreiche Kenntnisse zur Thematik des sexuellen<br />
Missbrauchs anzueignen. Näher beleuchtet werden die Täterstrategien, die Psychodynamik des<br />
sexuellen Missbrauchs, Signale des Kindes und die Auswirkungen im Kindes- und Erwachsenenalter.<br />
Es werden unterstützende und therapeutische Interventionsmöglichkeiten erarbeitet<br />
werden.<br />
Psychiatrie für Sozialarbeiter/innen<br />
2 Std.<br />
Effelsberg Di 11.30 - 13.00 3202<br />
Zunächst lernen wir anhand des didaktisch besonders guten Lehrbuches von Möller et al. die<br />
psychiatrische Terminologie, die Krankheitslehre und die allgemeine Psychopathologie kennen.<br />
Dann besprechen wir mit Referaten der Teilnehmer/innen die für Sozialarbeiter/innen<br />
wichtigsten psychiatrischen Krankheitsbilder. Besonderen Wert legen wir auf die Eigenarten<br />
der Interaktion mit psychisch Kranken (Kommunikation) und auf die im <strong>Grundstudium</strong> eingeführten<br />
Aspekte der Sozialpsychiatrie.<br />
Literatur: H.-J. Möller,G. Laux, A. Deister: Psychiatrie.<br />
Stuttgart: Hippokrates (Duale Reihe) 2. Aufl. 2001 (mit Video-CD-ROM).<br />
Entwicklungsstörungen<br />
und abweichendes Verhalten<br />
bei Kindern und<br />
Jugendlichen<br />
2 Std.<br />
Höchner Mo 14.00 - 15.30 3101<br />
Damit einzelne psychische Probleme und Störungen klar definiert und beschrieben werden<br />
können, wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine internationale Klassifikation<br />
der Krankheiten (ICD-10) erarbeitet. In den Kapiteln F8 und F9 werden wesentliche Charakteristika<br />
für Entwicklungsstörungen und Verhaltensabweichungen im Kindes- und Jugendalter<br />
angegeben. In dem Seminar werden anhand des ICD-10 typische Störungsbilder besprochen,<br />
Ursachen, aufrechterhaltende Bedingungen und das Zusammenspiel einzelner Faktoren geklärt,<br />
sowie Interventions- und Behandlungsmöglichkeiten vorgestellt, besonders auch im Hinblick auf<br />
Jugendhilfemaßnahmen nach dem KJHG. Durch die Bearbeitung von Beispielfällen in Kleingruppen<br />
kann der Praxisbezug für die soziale Arbeit vertieft werden.
- 117 -<br />
Sozialarbeit 7. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
ISAG<br />
Biografiearbeit in<br />
sozialen Arbeitsfeldern<br />
2 Std.<br />
Kricheldorff Di 11.30 - 13.00 3201<br />
Biografisches Lernen und Erinnerungsarbeit als Spurensuche nach verschütteten Lebenskräften,<br />
die Rekonstruktion von Sinnwelten vergangener Lebenszusammenhänge sowie das<br />
Herstellen von Zugehörigkeit sind mögliche Anliegen im Rahmen von Biografiearbeit. Das<br />
Konzept der Biografiearbeit ist nicht an die Soziale Arbeit mit bestimmten Zielgruppen<br />
geknüpft, sondern kann immer dann Anwendung finden, wenn es darum geht, sinnstiftende<br />
Orientierungs- und Selbstfindungsprozesse von Menschen beruflich zu begleiten, die sich neu<br />
positionieren oder neue Rollen finden müssen. Biografiearbeit kann mit Jugendlichen also<br />
ebenso sinnvoll sein, wie in der Sozialen Arbeit mit Menschen im mittleren oder höheren<br />
Erwachsenenalter. Das Konzept der Biografiearbeit wird im Rahmen des Seminars nicht nur<br />
theoretisch vermittelt, sondern es wird auch um die Auseinandersetzung mit der eigenen<br />
Biografie oder mit lebensgeschichtlichen Erfahrungen in der eigenen Herkunftsfamilie gehen.<br />
Binationales<br />
Projektseminar:<br />
Gemeinwesenarbeit auf<br />
der Basis des<br />
Empowermentansatzes<br />
in Sozialen<br />
Brennpunkten in<br />
Deutschland und<br />
Nikaragua im Vergleich<br />
(Kooperationsveranstaltung<br />
mit der Universidad<br />
Juan Pablo II, Universidad<br />
de Ciencias Sociales<br />
Aplicades - UCSA -<br />
Managua / Nikaragua)<br />
2 Std.<br />
Schwalb Vorbesprechung:<br />
Mi 08.10.2003,<br />
13.00 - 14.30 Uhr<br />
Vorbereitungsseminar:<br />
21.-23.11.2003<br />
Fr ab 14.00 Uhr bis<br />
So 13.00 Uhr<br />
Kompaktseminar I<br />
in Managua /<br />
Nikaragua:<br />
07.-17.02.2004<br />
Kompaktseminar II<br />
in <strong>Freiburg</strong>:<br />
15.-23.05.2004<br />
Auswertungsseminar:<br />
05.06.2004,<br />
9.00 -17.00 Uhr<br />
Das Seminar wird angeboten für Studierende ab dem 5. Semester der Studiengänge Sozialarbeit,<br />
Sozialpädagogik und Heilpädagogik und des Studienganges Promotores Sociales der UCSA<br />
Managua. Die Teilnehmer/innenzahl ist auf je 10 Studierende aus <strong>Freiburg</strong> und Managua begrenzt.<br />
Bei den Studierenden der KFH werden als Voraussetzung für die Teilnahme gute Kenntnisse<br />
der spanischen Sprache und die aktive Teilnahme an allen vier Teilen des Seminars<br />
erwartet. Dazu zählt bei jedem/r Teilnehmer/in die Vorlage eines Arbeitspapiers zum Vorbereitungsseminar,<br />
eines Protokolls zu einer Einheit des Kompaktseminars I in Managua, eines<br />
Referats zum Kompaktseminar II und eines Kurzberichts über die im Seminar gewonnenen<br />
Erkenntnisse und Erfahrungen.<br />
Voraussetzung für die Durchführung des Seminars ist eine Bezuschussung durch den DAAD; ein<br />
Antrag ist gestellt.<br />
3201<br />
3201
- 118 -<br />
Sozialarbeit 7. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Binationales Seminar:<br />
Soziale Arbeit mit<br />
jungen Menschen<br />
(Kooperationsveranstaltung<br />
mit den Escueles<br />
Universitàries de Treball<br />
Social i Educació Social<br />
an der Ramon Llull<br />
Universität Barcelona)<br />
2 Std.<br />
Sidler/<br />
NN<br />
Vorbereitungsseminar<br />
im<br />
Wintersemester<br />
2003/2004 n.V.<br />
Seminar in<br />
<strong>Freiburg</strong>:<br />
07. - 14.02.2004<br />
Seminar in<br />
Barcelona:<br />
17. - 24.04.2004<br />
Das Seminar wendet sich an Studierende der Fachbereiche Soziale Arbeit und Heilpädagogik<br />
sowie der Studiengänge Sozialarbeit und Sozialpädagogik des Grund- und Hauptstudiums. Die<br />
Teilnehmerzahl ist auf je 17 Studierende aus <strong>Freiburg</strong> und Barcelona begrenzt.<br />
Von den Teilnehmern wird die aktive Teilnahme an allen Teilen des Seminars erwartet. Dazu<br />
zählt die Vorlage eines Arbeitspapiers zum Vorbereitungsseminar oder die Vorlage eines<br />
Referats zum Kompaktseminar in <strong>Freiburg</strong> sowie die Vorlage eines Protokolls über einen<br />
Praxisbesuch während des Kompaktseminars in <strong>Freiburg</strong> und Barcelona.<br />
Im Rahmen des Seminars können PL bzw. PVL nach den Bestimmungen der Fachbereiche zum<br />
Zusatzlehrprogramm Europäische Soziale Arbeit erbracht werden.<br />
Sozialarbeit mit Fremden<br />
im Spannungsfeld<br />
von Anpassungserwartung<br />
und Ablehnung<br />
(max. 20 TN)<br />
(10 TN Studieng.<br />
Soz.arb.,<br />
10 TN “<br />
Soz.päd.)<br />
2 Std.<br />
Barwig Einführungssem.<br />
Fr 24.10.2003,<br />
14.00 - 19.00 Uhr<br />
Blockseminar in<br />
Stuttgart-Hohenheim<br />
vom<br />
01.12. - 05.12.2003<br />
(Kosten ca. L 67,–)<br />
- Migration von und nach Deutschland - Migrationsursachen - Migrantengruppen -<br />
Migrationspolitik - Integration / Assimilation / Akkommodation/ Enkulturation -<br />
Begriffserklärungen.<br />
- Rollenmuster und Wertewandel am Beispiel von Migrantenfamilien - Migrantinnen im<br />
sozialen Gefüge Stuttgarts - Bevölkerungsstruktur - soziale Infrastruktur -<br />
Partizipation - kommunale Ausländerpolitik.<br />
- Die ehemaligen “Gastarbeiter”: Einwanderer in Deutschland.<br />
- Grundzüge des Ausländerrechts - Fremdenfeindlichkeit und Einbürgerungserleichterungen,<br />
Zusammenhänge und Widersprüche - Hospitationen in Einrichtungen für Einwanderer.<br />
- Ausländische Flüchtlinge - Hospitationen in Einrichtungen der Asylarbeit.<br />
- (Spät-)Aussiedler, die ungeliebten Deutschen?<br />
- Migrationsfachdienste - eine Perspektive für die Zukunft.<br />
3302
- 119 -<br />
Sozialarbeit 7. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Corporate Citizenship -<br />
Kooperation Wirtschaft<br />
und Sozialarbeit<br />
(max. 16 TN)<br />
2 Std.<br />
Ferch Do 11.30 - 13.00 3101<br />
Aufgrund drastischer Einsparungen im sozialen Sektor wird es für soziale Einrichtungen und<br />
Träger zunehmend wichtiger selbst aktiv zu werden und Drittmittel zu akquirieren. Doch wie<br />
genau beschafft man sich Gelder von Spendern und Sponsoren? Kooperationen zwischen<br />
Wirtschaft und Sozialarbeit gewinnen dabei mehr und mehr an Bedeutung. Corporate Citizenship<br />
ist ein strategisches Handlungskonzept, wie Unternehmen und soziale Einrichtungen<br />
gemeinsam gesellschaftliche Aufgaben übernehmen.<br />
Das Seminar vermittelt neben den vielseitigen Kooperationsmöglichkeiten zwischen sozialen<br />
Einrichtungen und Unternehmen, Grundlagen über Spenden und Sozialsponsoring, Fundraising<br />
und Marketing für Non-Profit Organisationen. Zusammen mit den Studierenden werden praxisbezogene<br />
Konzepte erarbeitet, die auch gleich umgesetzt werden können.<br />
Schulsozialarbeit<br />
(max. 15 TN)<br />
2 Std.<br />
Strohmeier Di 17.30 - 19.00 3302<br />
Schulsozialarbeit, zwischen Jugendhilfe und Schule angesiedelt, ist ein Versuch, auf veränderte<br />
Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen einzugehen. Schwerpunkt dieser Veranstaltung ist<br />
das Kennenlernen von verschiedenen Arbeitsansätzen und ihren Begründungszusammenhängen.<br />
Verschiedene Einrichtungen sollen besucht werden.<br />
Berufliches Handeln in der Sozialen Arbeit<br />
Spezielle Arbeitsformen, Methoden und Techniken der<br />
Sozialen Arbeit<br />
Scheidungsmediation<br />
2 Std.<br />
Möller Mo 15.45 - 17.15 3201<br />
Mediation ist ein strukturiertes methodisches Angebot, um mit Konflikten im Scheidungsprozess<br />
konstruktiv umgehen zu können. Trennung und Scheidung sind Krisensituationen im Lebenszyklus<br />
einer Familie. Sie sind von Ängsten, Verunsicherungen und anderen Problemen begleitet.<br />
Um ihnen begegnen zu können, bedarf es in der Regel professioneller Hilfe und Unterstützung.<br />
In diesem Seminar geht es um die Vermittlung eines strukturierten Konfliktlösungsmodells. Es<br />
soll den Sozialarbeitern und anderen Mitarbeitern in psychosozialen Bereichen einen Arbeitsansatz<br />
vermitteln, um die Partner im Trennungs- und Scheidungsprozess zu selbstverantwortlichem<br />
Handeln anregen zu können.
- 120 -<br />
Sozialarbeit 7. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Lösungsorientierte<br />
Beratung<br />
2 Std.<br />
Gestaltungspädagogik<br />
2 Std.<br />
Verhandeln als Strategie<br />
und Methode in der<br />
Sozialarbeit<br />
2 Std.<br />
Konzepte entwickeln -<br />
Projekte managen -<br />
Qualität sichern<br />
2 Std.<br />
Projektaufbau:<br />
Einsatz für den Sozialen<br />
Hilfsfond im Landkreis<br />
Emmendingen<br />
2 Std.<br />
Sozialraum und<br />
Stadtteilanalyse<br />
2 Std.<br />
Interkulturelle<br />
Kompetenz<br />
2 Std.<br />
Möller Kompaktseminar:<br />
Fr 09.01.04,<br />
ab 14.00 Uhr<br />
Sa 10.01.2004,<br />
ab 9.00 Uhr<br />
Cloidt /<br />
Menzen /<br />
Schönenborn<br />
n.V.<br />
Grosser 1.Treff:<br />
Mi 08.10.2003,<br />
12.15 Uhr<br />
Kompaktseminar:<br />
Fr 17.10.2003<br />
Sa 18.10.2003<br />
und weiterer Termin<br />
n.V.<br />
3302<br />
1204<br />
3102<br />
Hilpert Mo 17.30 - 19.00 3301<br />
Grosser/<br />
Sidler<br />
Fr 8.00 - 9.30 3202<br />
Back Mo 17.30 - 19.00<br />
Beginn: 13.10.2003<br />
Schramkowski<br />
1. Treffen:<br />
Do 09.10.2003,<br />
11.30 - 13.00 Uhr<br />
(weitere Terminvereinbarung<br />
im Seminar)<br />
3302<br />
1203
- 121 -<br />
Sozialarbeit 7. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Kommunalpolitik<br />
und kommunale<br />
Jugendpoltik<br />
2 Std.<br />
Kommentierungen siehe 5. Semester<br />
“Für die Zukunft lernen”<br />
Evaluation der<br />
Gedenkstättenpädagogischen<br />
Projekte<br />
2 Std.<br />
Wenzl Mo 17.30 - 20.30<br />
(14-täglich)<br />
Beginn: 13.10.2003<br />
Nickolai/<br />
Sehrig<br />
3101<br />
Fr 11.30 - 13.00 1204<br />
Seit 1993 führt der Verein “Für die Zukunft lernen - Verein zur Erhaltung der Kinderbaracke<br />
Auschwitz-Birkenau e.V.” Gedenkstättenpädagogische Projekte in Auschwitz durch. Angesprochen<br />
werden insbesondere sozial benachteiligte Jugendliche. In diesem Seminar, das auf zwei<br />
Semester angelegt ist, soll zunächst recherchiert werden, ob in Deutschland ähnliche Projekte<br />
angeboten werden, mit dem Ziel, im Rahmen einer Tagung zu einem Erfahrungsaustausch zu<br />
kommen. In einem weiteren Schritt sollen dann Jugendliche, die in den vergangenen Jahren an<br />
einem Projekt beteiligt waren, interviewt werden.<br />
Psychosoziale<br />
Familienberatung<br />
2 Std.<br />
Oswald Mi 9.45 - 11.15 2110<br />
Das Seminar vermittelt Basiswissen und praktische Kompetenz für die psychosoziale Familienberatung.<br />
Das Beratungsmodell wird dargestellt und in Rollenspielen praktisch eingeübt. Die Teilnehmer<br />
lernen, familiäre Probleme systemisch zu erfassen, ihre eigene Position in der Familie einzuschätzen<br />
und ressourcenorientiert mit Familien zu arbeiten.
- 122 -<br />
Sozialarbeit 7. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Organisation und Management<br />
ISAG<br />
Organisation und Management<br />
in sozialen<br />
Diensten und Einrichtungen(Sozialmanagement)<br />
2 Std.<br />
Fehrenbacher<br />
/<br />
Spielmann<br />
Kompaktseminar:<br />
Fr 19.12.2003<br />
Sa 20.12.2003<br />
Fr 09.01.2004<br />
Sa 10.01.2004<br />
Fr jew. 13.00-18.00<br />
Sa jew. 9.00-18.00<br />
Ort:<br />
Caritasverband f.d.<br />
Erzdiözese Frbg.,<br />
Alois-Eckert-Str. 6,<br />
79111 <strong>Freiburg</strong><br />
Das Seminar befasst sich mit Konzepten der Organisation, des Managements und der Führung<br />
sozialer Institutionen. Nach einer Einführung in die Grundlagen geht es auf aktuelle Entwicklungen<br />
ein und vermittelt ihre Konsequenzen für die Führung sozialer Einrichtungen und die<br />
Organisation sozialer Dienstleistungen.<br />
Themen sind u.a.: Organisationsverständnis und -grundlagen, Organisationsmodelle, Leistung<br />
und Qualität in sozialen Organisationen, Grundlagen des Managements, Grundlagen des<br />
Führens und Leitens in sozialen Institutionen, Entwicklungslinien und Rahmenbedingungen.<br />
Vertieft werden folgende Aspekte: ausgewählte Managementkonzepte, Prozess- und Leistungsorganisation,<br />
Strategieentwicklung und Marketing, Organisationsentwicklung und Controlling,<br />
Arbeitsorganisation und Selbstmanagement.<br />
ISAG<br />
Organisation und<br />
Management in<br />
sozialen Diensten und<br />
Einrichtungen<br />
(max. 20 TN)<br />
2 Std.<br />
Böhler Kompaktseminar<br />
1. Treffen:<br />
Mo 10.11.2003,<br />
14.00 - 15.30 Uhr<br />
(weitere Terminvereinbarung<br />
im Seminar)<br />
Auf dem Hintergrund langjähriger Führungserfahrungen bei freien und öffentlichen Trägern<br />
befasst sich das Seminar mit Fragen des Managements, der Führung und Organisation von<br />
Trägern sozialer Dienste und Einrichtungen.<br />
Themen sind u.a. Transparenz sozialer und politischer Entscheidungsstrukturen, Organisation<br />
und Organisationskontrolle, Organisationsentwicklung, Rahmenbedingungen im sozialen<br />
Bereich, Marktentwicklungen, Europäisierung des Sozialen, Sponsoring, Managementgrundlagen.<br />
Information über das Stiftungswesen / Stiftungsmanagement / Stiftungsmarketing.<br />
3201
- 123 -<br />
Sozialarbeit 7. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Philosophische und theologische Grundlagen der<br />
Sozialen Arbeit<br />
Wertorientierungen in der Sozialen Arbeit<br />
Ethik in der Sozialen<br />
Arbeit<br />
2 Std.<br />
Bohlen Mo 11.30 - 13.00 2300<br />
Da Soziale Arbeit u. a. darin fundiert ist, dass Zustände in unserer Gesellschaft als problematisch<br />
bewertet werden, wird jede Reflexion auf die Praxis der Sozialen Arbeit mit einer Reflexion<br />
auf die Wertungen, die in ihrem Kontext geschehen, verbunden sein. Woran orientieren wir uns,<br />
sofern wir einen Sachverhalt als problematisch bewerten? Welche Interessen verfolgen wir in<br />
der Sozialen Arbeit?<br />
Die Frage nach den für menschliche Praxis fundierenden Interessen ist eine der Grundfragen<br />
der Ethik. Die Lehrveranstaltung will anhand konkreter Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit die<br />
ethischen Implikationen sozialarbeiterischer Praxis thematisieren. Ferner sollen Grundmuster<br />
ethischer Reflexion vorgestellt und mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen der Lehrveranstaltung<br />
eingeübt werden.<br />
Wertorientierung in<br />
pluraler Gesellschaft<br />
2 Std.<br />
Bohlen Do 11.30 - 13.00 3102<br />
Die Begriffe “Pluralisierung” und “Individualisierung” benennen nicht nur Grundtendenzen in<br />
unserer Gesellschaft. Sie fordern auch dazu auf, die Frage zu stellen, auf welcher Grundlage<br />
eine allgemeinverbindliche ethische Orientierung denn überhaupt noch möglich ist. In der<br />
Lehrveranstaltung sollen unterschiedliche Ansätze zur Beantwortung dieser Frage diskutiert<br />
werden, wobei die Begriffe der “Menschenwürde” und der “Personalität” als Leitfaden fungieren<br />
können. Ziel der Lehrveranstaltung ist es, die Bedeutung der genannten Begriffe für das Handeln<br />
in den unterschiedlichen Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit deutlich zu machen.<br />
Kultur- und Medienpädagogik: siehe<br />
“Hauptstudium: Zusammenfassung der Angebote im Medienbereich”
- 124 -<br />
Sozialarbeit 7. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
C. Zusatzangebote<br />
Einführungsseminar in<br />
die “Regio-Akademie”<br />
Spiegelberg/<br />
Weiss<br />
Zeit wird rechtzeitig<br />
durch Aushang<br />
bekannt gegeben !<br />
Das Projekt “Regio-Akademie für soziale Arbeit” ist ein Gemeinschaftsprojekt der in RECOS<br />
zusammengeschlossenen Ausbildungsstätten für Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Heilpädagogik<br />
in Mulhouse, Strasbourg, Basel sowie an der EFH <strong>Freiburg</strong>. Im Rahmen dieses Projekts<br />
besteht die Möglichkeit, über ein Zusatzlehrprogramm interkulturelle Kompetenzen zur grenzüberschreitenden<br />
Zusammenarbeit zu erwerben. Über die erfolgreiche Teilnahme in diesem<br />
Programm wird am Ende ein Zertifikat in deutscher und französischer Sprache ausgestellt. -<br />
Themen des Einführungsseminars werden sein: Einführung in Anliegen und Struktur des<br />
Zusatzlehrprogramms; Ausbildungssysteme zu sozialen Berufen in den drei Ländern; sozialrelevante<br />
Aspekte zur Situation in der Regio; soziale Dienstleistungssysteme in Elsass, Nordschweiz<br />
und Südbaden; Grundstruktur der sozialen Sicherheit in den drei Ländern.<br />
ISAG<br />
Forum Soziale Altenarbeit<br />
in der Stadt <strong>Freiburg</strong><br />
und Umgebung<br />
(30-40 TN)<br />
Kricheldorff/<br />
Brandenburg<br />
Termine und<br />
Themen:<br />
siehe Plakat zu Beginn<br />
des Semesters<br />
Im Rahmen dieses regelmäßig stattfindenden Forums werden aktuelle Themen aus dem<br />
Berufsfeld der Sozialen Altenarbeit aufgegriffen. Nach einer inhaltlichen Einführung in das<br />
Thema wird dieses in einem intensiven Theorie-Praxis-Dialog vertieft und aus unterschiedlichen<br />
Blickwinkeln beleuchtet. Über die inhaltliche Schwerpunktsetzung und die genauen Themen<br />
sowie die Termine des Wintersemesters 2003/04 wird über einen Plakataushang zu Beginn des<br />
Semesters informiert werden. Die Veranstaltungen sind offen für alle Vertreter der Fachpraxis<br />
und interessierte Studierenden aller Fachbereiche. Das Forum ist darüber hinaus auch eine<br />
Informationsplattform über Fort- und Weiterbildungsangebote, Tagungen und neue Literatur.
STUDIENGANG<br />
SOZIALPÄDAGOGIK
- 126 -<br />
Sozialpädagogik 5. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Pflichtfächer<br />
Fachwissenschaft Sozialpädagogik I<br />
Fortsetzung vom Sommersemester PL = Studienarbeit<br />
Sozialwissenschaftliche<br />
Forschungsmethoden<br />
1 Std.<br />
Gruppe 1<br />
Gruppe 2<br />
Stöbener<br />
Stöbener<br />
Mi 17.45 - 19.15<br />
(14-täglich)<br />
Mi 17.45 - 19.15<br />
(14-täglich)<br />
1. Termin<br />
(beide Gruppen):<br />
Mi 08.10.2003<br />
2200<br />
2200<br />
Aula<br />
3000<br />
In diesem Seminar wird eine Auswahl grundlegender qualitativer und quantitativer Methoden der<br />
Sozialwissenschaften besprochen, die im Hinblick auf den Forschungsprozess ausgewählt<br />
werden. Besonderer Wert wird auf solche Verfahren gelegt, die für das Verfassen der eigenen<br />
Diplomarbeit relevant sind. Im Seminar geht es um die Entwicklung einer Forschungsfrage, um<br />
die Entwicklung von Fragebögen, um die edv-technische Dateneingabe und Datenauswertung<br />
mit dem Statistikprogramm SPSS/PC und schließlich um die wissenschaftliche Aufarbeitung und<br />
Diskussion der gefundenen Ergebnisse.<br />
Berufliches Handeln in der sozialpädagogischen Arbeit<br />
Theorie und Praxis ausgewählter didaktischer Fragestellungen<br />
(max. 22 TN/Gruppe) PVL = Referat<br />
2 Std.<br />
Gruppe A Schwab Di 14.00 - 15.30<br />
Beginn: 14.10.03<br />
Teilblock:<br />
Di 13.01.2004,<br />
14.00 - 18.30 Uhr<br />
3102<br />
2100<br />
Sozialpädagogische Tätigkeit erfordert didaktische Grundkompetenzen. Ausgewählte Fragen und<br />
Projekte sollen in Form didaktischer Konzepte entwickelt und im Seminar getestet werden.<br />
Kommunikationstheoretische Erkenntnisse liefern Hinweise und Ansatzpunkte, um sozialpädagogische<br />
Institutionen, Zielgruppen und Themen zu erarbeiten. Die Ergebnisse werden als<br />
Präsentationen im Seminar diskutiert. Wesentliche Bestandteile sind mediendidaktische Überlegungen<br />
im Blick auf mögliche Zielgruppen einer Präsentation. (Einzel- und Gruppenarbeit,<br />
Medieneinsatz mit PC, Beamer, AV-Medien).
- 127 -<br />
Sozialpädagogik 5. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Gruppe B Meger Mo 8.15 - 11.15<br />
Beginn: 20.10.03<br />
(bis 15.12.03)<br />
3101<br />
Das Seminar vermittelt zunächst Grundlagen der Didaktik in der Erwachsenenbildung. Wir<br />
beschäftigten uns mit den Fragen: was ist didaktisches Handeln und in welchen sozialpädagogischen<br />
Arbeitszusammenhängen ist didaktisches Handeln eine notwendige Qualifizierung?<br />
Vertiefen werden wir folgende Themen:<br />
Was ist und wie geschieht Lernen? Lernstile/Lernmilieus<br />
Störungen, Blockaden...<br />
Neue Formen des Lernens/Motivation<br />
Didaktische Handlungsfelder<br />
Entwicklung von Handlungsschritten für eine Vermittlung von Lerninhalten in Gruppen und<br />
anderen sozialpädagogischen Zusammenhängen.<br />
Ziel des Seminars ist es, mit den Teilnehmer/innen eigene Ansätze für ein qualifiziertes, didaktisches<br />
Handeln in Gruppen, Teams und anderen Lernzusammenhängen zu erstellen.<br />
Gruppe C Scherer Mi 14.00 - 17.00<br />
Beginn: 8.10.2003<br />
weitere Termine:<br />
15.10./22.10./<br />
29.10./ 12.11./<br />
26.11./3.12./10.12./<br />
14.1./21.1.04<br />
3301<br />
Didaktische Planung trägt dazu bei verschiedene Hilfsmöglichkeiten zu erschließen und zielgerichtete<br />
Lernprozesse zu initiieren und zu koordinieren.<br />
Ausgehend von verschiedenen Erfahrungen der Studierenden in der Planung, Durchführung und<br />
Evaluation von Maßnahmen in unterschiedlichen sozialpädagogischen Handlungsfeldern sollen<br />
ausgewählte Fragestellungen bearbeitet bzw. reflektiert werden.
- 128 -<br />
Sozialpädagogik 5. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Rechtliche, sozialwissenschaftliche und ökonomische<br />
Grundlagen der Sozialpädagogik<br />
KJHG und Jugendstrafrecht<br />
(PL = Klausur)<br />
2 Std.<br />
Winkler<br />
(KJHG)/<br />
Janssen<br />
(Jugendstrafrecht)<br />
Mo 11.30 - 13.00<br />
1. Semesterhälfte<br />
wöchentlich<br />
Mo 18.30 - 20.00<br />
2. Semesterhälfte<br />
Termine:<br />
08.12./15.12.03/<br />
12.01./19.01./<br />
26.01.04<br />
3000<br />
Aula<br />
1100<br />
1. Teil: Kinder- und Jugendhilferecht (Dozent: Herr Winkler).<br />
Das Kinder- und Jugendhilferecht (KJHG) zählt zu den Rechtsmaterien, deren Kenntnis für<br />
Sozialpädagog/innen unverzichtbar sind. In der Veranstaltung werden Grundkenntnisse dieses<br />
sozialrechtlichen Teilrechtsgebietes vermittelt. Folgende Themen werden dabei angesprochen:<br />
Grundsätze, Organisation /Leistungen und andere Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe,<br />
Teilnehmerbeiträge, Kostenerstattung und Überleitung von Ansprüchen.<br />
2. Teil: Jugendstrafrecht (Dozent: Herr Janssen)<br />
Im zweiten Teil der Veranstaltung wird das Jugendgerichtsverfahren dargestellt werden.<br />
Verwaltungsrecht<br />
(PVL = Klausur (60 Min.)<br />
1 Std.<br />
Winkler Mo 11.30 - 13.00<br />
2. Semesterhälfte,<br />
wöchentlich<br />
3000<br />
Die Vorlesung Verwaltungsrecht dient der Vermittlung von Grundkenntnissen insbesondere des<br />
Sozialverwaltungsrechts. Folgende Themen werden in der Vorlesung angesprochen: Begriff,<br />
Regelungsgegenstände und Aufgaben des Verwaltungsrechts, Rechtsquellen des Verwaltungsrechts,<br />
Grundsätze des Verwaltungsrechts, Ablauf des Verwaltungsverfahrens, Verwaltungsakt,<br />
öffentlich-rechtlicher Vertrag. Eine detaillierte Gliederung findet sich auf der Dozentenseite der<br />
Homepage des Fachbereichs Sozialarbeit der Fachhochschule. Die Veranstaltung wird im 8.<br />
Semester fortgeführt.<br />
Literatur: Literaturhinweise werden zu Beginn der Veranstaltung gegeben.<br />
Lebenslauf und private<br />
Lebensformen<br />
(PVL = Klausur)<br />
2 Std.<br />
Sidler Mi 8.00 - 9.30 Aula<br />
1100<br />
Nach dem im <strong>Grundstudium</strong> erfolgten Versuch der Einübung soziologischen Wahrnehmens und<br />
Denkens überhaupt wird in der soziologischen Vorlesung dieses Semesters versucht, diese<br />
“neue” Weltsicht auf die für Sozialpädagogik sehr wichtigen, nicht nur persönlich-individuellen,<br />
sondern auch zuhöchst sozialen Tatbestände des Lebenslaufs und der lebensgeschichtlich<br />
bedeutsamen Gesellungsformen wie z.B. Ehe und Familie anzuwenden.
- 129 -<br />
Sozialpädagogik 5. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Wahlpflichtfächer<br />
Fachwissenschaft Sozialpädagogik II<br />
Fortsetzung vom Sommersemester<br />
Arbeit mit ausgewählten Zielgruppen I ÜPL = Klausur<br />
1. Erwachsene und<br />
Familien<br />
max. 22 TN<br />
2 Std.<br />
Hammer Do 9.45 - 11.15 3302<br />
Ausgehend von Fragen der Erwachsenensozialisation wendet sich das Seminar den Arbeitsfeldern<br />
und Zielgruppen sozialpädagogischer Erwachsenen- und Familienarbeit zu (speziell auch<br />
den Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie gem. §§ 16-18 KJHG). Integriert in<br />
die Bearbeitung einschlägiger Maßnahmen und Projekte werden die dafür notwendigen Arbeitsformen<br />
und Handlungsansätze thematisiert (Integration der Methoden).<br />
- Auf die einschlägige und aktuelle Literatur wird im Seminar hingewiesen.<br />
2. Vorschulische und<br />
nebenschulische<br />
Sozialisation<br />
max. 22 TN<br />
2 Std<br />
Schinzler Mo 8.00 - 9.30 3201<br />
ZIEL: Grundlegende Auseinandersetzung, Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten zu den<br />
Zielen, Aufgaben und Methoden der Einrichtungen und Berücksichtigung der aktuellen Situation!<br />
- Die Einbettung der Institutionen in den historischen und gesellschaftlichen Kontext, die zentralen<br />
Probleme, Möglichkeiten und Erfordernisse sollen erkannt und die Hauptaufgaben der<br />
Leistungsangebote erfasst werden. - Berücksichtigung der pädagogischen, psychischen,<br />
sozialen, rechtlichen, organisatorischen Grundlagen.<br />
INHALTE: - Feste, unabdingbare und variable Themen nach Absprache.<br />
METHODE: - Gruppenarbeit - Referate - Fachgespräche - Hospitation - Exkursionen.<br />
3. Kinder- und Jugendarbeit<br />
max. 22 TN<br />
2 Std.<br />
Schwab Do 9.45 - 11.15 3201<br />
Arbeitsfelder, Einrichtungen, Konzepte und Projekte der Kinder- und Jugendarbeit werden mit<br />
sozialpädagogischem Blick diskutiert. Das SGB VIII als gesetzliche Grundlage und Ergebnisse<br />
der Jugendforschung helfen konzeptionelle Ansätze zu diskutieren. Es geht u.a. um Aufgabenfelder,<br />
gezielte Förderung von Gruppen, Projektarbeit, Sozialraumorientierung und Formen<br />
direkter und indirekter Jugendarbeit. Berufliche Kompetenzen sollen exemplarisch geklärt und<br />
eingeübt werden.<br />
Literatur u.a.: Stegbauer/Schwab/Stegmann: Blinde Flecken traditioneller Jugendhilfe, Eine Shell<br />
Jugendstudie 1997, 2000, 2002.
- 130 -<br />
Sozialpädagogik 5. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Arbeit mit ausgewählten Zielgruppen II ÜPL = Klausur<br />
1. Arbeit mit suchtmittelabhängigen<br />
jungen<br />
Menschen<br />
max. 22 TN<br />
2 Std.<br />
Michel Mo 15.45 - 17.15<br />
Kompaktseminar:<br />
Fr 24./Sa 25.10.03<br />
Fr 21./Sa 22.11.03<br />
Fr jew. ab 13.00<br />
bis Sa 18.00 Uhr<br />
3202<br />
3202<br />
Das Seminar gibt einen Einblick in den Themenkomplex der Sucht und Suchtkrankenhilfe und<br />
bietet den Teilnehmer/innen die Möglichkeit sich in einen Teilbereich schwerpunktmäßig einzuarbeiten.<br />
Mögliche Themen sind:<br />
Stoffgebundene und stoffungebundene Formen der Sucht, Ursachen der Sucht, Suchtverlauf,<br />
Co-Abhängigkeit, Rückfall, Überblick zu Hilfsangeboten, Selbsthilfegruppen, Suchtprophylaxe,<br />
Substitution.<br />
2. Ressourcenorientiertes<br />
Arbeiten mit verhaltensauffälligen<br />
jungen<br />
Menschen und deren Bezugspersonen<br />
in Einrichtungen<br />
der Jugendhilfe<br />
max. 22 TN<br />
2 Std.<br />
Veith Mi 11.30 - 13.00 3202<br />
Zur Bewältigung ihrer Probleme und Schwierigkeiten entwickeln junge Menschen vielschichtige<br />
Strategien. In der Hilfe- und Erziehungsplanung stehen dabei eher Defizite und Problemlagen im<br />
Blickpunkt, die Ressourcen werden dabei oftmals weniger wahrgenommen. Der Ansatz des<br />
Positive Peer Culture (PPC) versucht durch eine konsequente Betrachtung der Ressourcen<br />
verhaltensauffälliger junger Menschen und deren Bezugspersonen Veränderungspotentiale zu<br />
entdecken und diese zu aktivieren. Inhalte: die Philosophie des PPC, ressourcenorientierte<br />
sozialpädagogische Diagnostik, Zielformulierung, Hilfeplanung, ressourcenorientierte Hilfen, z.B.<br />
Peer Group Counseling.<br />
3. Arbeit mit seelisch behinderten<br />
jungen<br />
Menschen<br />
max. 22 TN<br />
2 Std.<br />
Boll/<br />
Marqua<br />
Do 15.45 - 17.15 2110
- 131 -<br />
Sozialpädagogik 5. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Aufbauend auf den Kenntnissen des vorausgegangenen Semesters soll dieses Seminar die<br />
theoretischen Grundlagen für die Arbeit mit seelisch behinderten jungen Menschen festigen und<br />
vertiefen.<br />
An ausgewählten Beispielen werden spezifische Krankheitsbilder, ihre Behandlungs- und<br />
Therapiemöglichkeiten unter besonderer Berücksichtigung der praktischen Erfahrungen erarbeitet<br />
und diskutiert.<br />
Außerdem wird ein Überblick gegeben über die Fördermöglichkeiten und Angebote der Jugendhilfe<br />
für seelisch behinderte junge Menschen nach § 35 a des Kinder- und Jugendhilfegesetztes.<br />
Alle beschriebenen Arbeitsinhalte werden anhand von Fallbeispielen praxisnah vermittelt.<br />
Projektarbeit<br />
2/4 Std.<br />
Fortsetzung vom Sommersemester 2003 PL = Referat<br />
1. Projekt:<br />
Theaterpädagogische<br />
Angebote in <strong>Freiburg</strong><br />
max. 9 TN<br />
Megnet Di 11.30 - 13.00 1308<br />
In zunehmendem Maße finden unterschiedliche theaterpädagogische Methoden und<br />
Projektformen Eingang in die Soziale Arbeit.<br />
In der ersten Projektphase werden wir uns mit folgenden Fragen beschäftigen:<br />
- Was für theaterpädagogische Projekte und Angebote gibt es in <strong>Freiburg</strong> für unterschiedliche<br />
Zielgruppen und welche Konzepte, Methoden und Zielsetzungen sind in diesen Angeboten von<br />
Bedeutung.<br />
In der zweiten Projektphase werden wir uns mit der Entwicklung und Durchführung eines<br />
theaterpädagogischen Konzeptes für eine konkrete Zielgruppe beschäftigen.<br />
2. Projekt<br />
max. 9 TN<br />
Renz Mi 9.45 -11.15 3303<br />
Ziele: Im Rahmen der Projektarbeit sollen die Studierenden exemplarisch einen Ausschnitt des<br />
zukünftigen Berufsfeldes kennen lernen und sich aktiv mit der sozialen Wirklichkeit auseinander<br />
setzen. Gemeinsam wird ein Projekt entwickelt, durchgeführt, evaluiert und dokumentiert.<br />
3. Projekt:<br />
“ Ich möchte Teil einer<br />
Jugendbewegung sein!”<br />
Eine Reise durch die Welt<br />
der Jugend(sub)kulturen -<br />
in <strong>Freiburg</strong><br />
max. 9 TN<br />
Brandstetter Mi 9.45 - 11.15 3204
- 132 -<br />
Sozialpädagogik 5. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Was bedeutet Jugend? Was bedeutet “Jung-Sein” heute in der so genannten Risikogesellschaft?<br />
Gibt es die Jugend oder hat sie es überhaupt einmal gegeben und wenn ja, so hat sie sich in den<br />
letzten Jahrzehnten wohl endgültig in eine kaum mehr überschaubare Vielfalt von<br />
Jugendkulturen und subkulturellen Cliquen, Szenen und Gruppierungen aufgelöst. - Punks,<br />
Skins, Raver, Shater, Hip Hop oder Gothics, etc... -<br />
Was haben diese unterschiedlichen Stilgruppen gemein? Worin unterscheiden sie sich? Gibt es<br />
Zusammenhänge zwischen ihnen? - Natürlich, in der neueren Literatur werden sie alle unter dem<br />
Begriff “Jugendkulturen” zusammengefasst. Aber sind nicht auch oftmals Menschen über 25<br />
Jahre Teil einer solchen Szene? So stellt sich die Frage, welcher Umstand es zulässt diese<br />
Begrifflichkeit über alle Differenzen hinweg aufrechtzuerhalten?<br />
Worin liegt der Kern dieser jugend(sub)kulturellen Erscheinungen? Produzieren diese tatsächlich<br />
Kultur und wie verhalten sich diese im Spannungsfeld zwischen Unabhängigkeit, Rebellion,<br />
Konsum und Kommerz.<br />
In diesem Projekt sollen diese Fragen beantwortet werden. Zudem sollen verschiedene<br />
Jugend(sub)kulturen in und um <strong>Freiburg</strong> kennen gelernt werden und daraus Rückschlüsse für die<br />
Jugendarbeit gezogen werden.<br />
4. Projekt:<br />
Learning by doing<br />
max. 9 TN<br />
Schinzler Do 14.00 - 15.30<br />
2 Std. mit Dozent<br />
und<br />
Do 15.45 - 17.15<br />
2 Std. Studierende<br />
alleine<br />
3203<br />
3203<br />
Die Möglichkeiten und die Wirksamkeit eines projektorientierten Angebots sozialer Arbeit - im<br />
vor- und nebenschulischen Bereich und/oder im sportpädagogischen Feld - sollen erprobt,<br />
durchgeführt und evaluiert werden.<br />
Zentrale Elemente - Ziele, Methoden, Teilnehmerorientierung - der Projektarbeit sollen erfahren<br />
und überprüft werden<br />
ISAG<br />
5. Projekt:<br />
Altern - Hilfs- und<br />
Fördermaßnahmen für<br />
Sozial- und<br />
Heilpädagogen<br />
max. 9 TN<br />
Schönenborn<br />
(in Zusammenarbeit<br />
mit dem FB<br />
Heil- Päd.<br />
Menzen)<br />
Fortsetzung n. V. U 1<br />
Studierende, die mit alten und erkrankten, in der Folge behinderten Menschen arbeiten wollen,<br />
führen verantwortlich eine heilpädagogische Maßnahme als Projekt durch. Im ersten Teil der<br />
Veranstaltung werden in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Heilpädagogik die<br />
Lebenssituationen alter und erkrankter, in der Folge behinderter Menschen erarbeit. Wir werden<br />
Hypothesen und Ziele für die Arbeit mit diesen Menschen formulieren. Zwei Tage lang werden<br />
wir über Möglichkeiten der heil- und sozialpädagogischen Interventionen nachdenken und<br />
Formen der Biographie-, d.h. der Erinnerungsbild-Arbeit wie der alltäglichen Lebensbewältigung<br />
recherchieren.
- 133 -<br />
Sozialpädagogik 5. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
6. Projekt:<br />
Soziales<br />
Kompetenztraining<br />
max. 18 TN<br />
Veith/<br />
Hazubski<br />
Do 8.00 - 9.30 3201<br />
Ein erheblicher Anteil von Kindern und Jugendlichen entwickelt massive Verhaltensauffälligkeiten,<br />
darunter Störungen des Sozialverhaltens. Im Projekt werden empirisch erprobte<br />
Manuale zur Förderung sozialer Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen vorgestellt, auf ihre<br />
Praktikabilität für die methodische Arbeit im Heim überprüft und in adaptierter Form mit Kindern<br />
und Jugendlichen unter Anleitung durchgeführt.<br />
Berufliches Handeln in der sozialpädagogischen Arbeit<br />
Berufliches Handeln<br />
in Arbeitsfeldern der Sozialpädagogik<br />
Fortsetzung vom Sommersemester PL = mündl. Prüfung<br />
1. Systemisch-integrative<br />
Familienberatung<br />
max. 15 TN<br />
2 Std.<br />
Hammer Di 9.45 - 11.15 3202<br />
Themen des Seminars sind Systemtheorien, Einschätzungen von Systemen, Aufbau<br />
systemischer Interventionen, Durchführung einer Beratung, Bilanzierung u.a. Neben der<br />
Theorievermittlung (Impulsreferate und Texte) nehmen Fallarbeit und Simulation (Rollenspiel)<br />
einen breiten Raum ein. Die grundsätzliche Bereitschaft zur Mitarbeit in Familiensimulationen ist<br />
eine unerlässliche Voraussetzung der Teilnahme.<br />
ISAG<br />
2. Einführung in die<br />
Gestaltungspädagogik /<br />
Kunsttherapie<br />
max. 15 TN<br />
2 Std.<br />
Cloidt /<br />
Menzen /<br />
Schönenborn<br />
Fortsetzung n.V. U1
- 134 -<br />
Sozialpädagogik 5. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
ZIEL UND INHALT: Diese Veranstaltung soll einen Überblick über die praktisch-methodische<br />
Anwendung des Faches Gestaltungspädagogik/Kunstpädagogik/-therapie geben. - Der<br />
theoretische Teil der Veranstaltung behandelt angesichts seines fächerübergreifenden<br />
Charakters die heilpädagogischen, sozialpädagogischen und sozialarbeiterischen, wie die<br />
psychiatrisch-betreuenden Aspekte der praktisch- kunsttherapeutischen/-pädagogischen Arbeit. -<br />
Die Veranstaltung will eine breite Übersicht der pädagogisch-betreuenden, bildnerischanleitenden<br />
und therapeutisch-intervenierenden Maßnahmen geben.<br />
Methodisches Vorgehen:<br />
Mit viel Anschauungsmaterial (Dias, Videos) werden die unterschiedlichen Ansätze der im<br />
wesentlichen pädagogisch orientierten Kunsttherapie skizziert und diskutiert.<br />
Der praktisch-pädagogische Teil will mit Hilfe unterschiedlicher bildnerischer und plastischformbarer<br />
Materialien und Techniken soziale Konflikte begreifbar machen. Wir werden praktisch<br />
wie theoretisch in den Umgang mit Ausdrucksmitteln ästhetisch-bildnerisch/-plastisch-formbarer<br />
Art einführen.<br />
Methodisches/organisatorisches Vorgehen: Studierende wechseln wöchentlich zwischen<br />
Angeboten von bildnerischen Materialien und Techniken und plastisch-formbaren Materialien und<br />
Techniken.<br />
3. Interventionen in der<br />
Jugendhilfe<br />
max. 15 TN<br />
2 Std.<br />
Schwab Di 9.45 - 11.15 1206<br />
Lerntheoretische Grundlagen und ausgewählte Projekte der Jugendhilfe werden als<br />
Handlungskonzepte erarbeitet. Rollen und Aufgaben sozialpädagogischer Profis werden<br />
exemplarisch diskutiert. Das KJHG (SGB VIII) als gesetzliche Grundlage und die Sozialstruktur<br />
von Gruppen definieren Ansatzpunkte sozialpädagogischer Interventionen. Es geht um Personen<br />
und Gruppen, die einer besonderen Förderung bedürfen, um an den gesellschaftlichen<br />
Entwicklungen partizipieren zu können.<br />
Arbeitsformen sind Vortrag, Diskussion und Einsatz audiovisueller Medien.<br />
4. Verhaltensmodifikation<br />
max. 15 TN<br />
2 Std.<br />
Schmidt Fr 11.30 - 13.00 3202<br />
An ausgewählten Fällen der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie aus dem Praxisfeld<br />
Heimerziehung sollen die Studierenden in das methodische Arbeiten der Verhaltensmodifikation<br />
eingeführt werden. Dargestellt werden Methoden der Verhaltenstherapie und der Hypnotherapie,<br />
die Veränderungsimpulse geben für die drei Ebenen menschlichen Erlebens: Verhalten,<br />
Kognition und Emotion. Es sollen einzel- und gruppentherapeutische Vorgehensweisen vermittelt<br />
werden sowie die Einbeziehung der Bezugspersonen in die Verhaltensmodifikation. Im einzelnen<br />
sollen die folgenden Themenschwerpunkte behandelt werden: Soziale Unsicherheiten und<br />
Hemmungen, Angststörungen, Aggressive und delinquente Kinder und Jugendliche,<br />
Aufmerksamkeitsstörungen, Förderung des Sozialverhaltens bei Jugendlichen, Einnässen und<br />
Einkoten, Entspannungstechniken und posttraumatische Belastungsreaktionen.
- 135 -<br />
Sozialpädagogik 5. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Humanwissenschaftliche Grundlagen<br />
der Sozialpädagogik<br />
Psychopathologie PVL = Studienarbeit<br />
Eines der Angebote ist zu wählen.<br />
1. Ausgewählte Aspekte<br />
der Klinischen Psychologie<br />
für die sozialpädagogische<br />
Praxis<br />
Gemeinsames Angebot der<br />
Fachbereiche SozPäd und<br />
HeilPäd<br />
max. 25 TN<br />
20 TN SozPäd<br />
5 TN HeilPäd<br />
2 Std.<br />
Veith Mo 14.00 - 15.30<br />
Beginn: 13.10.03<br />
3202<br />
Wir beschäftigen uns in dieser Veranstaltung mit Epidemiologie, Diagnostik und Therapie<br />
ausgewählter Störungsbilder im Kindes- und Jugendalter, die im Arbeitsfeld der Sozialpädagogik<br />
von Bedeutung sind. Das Ziel der Veranstaltung ist es, diesbezügliche praxisrelevante psychologische<br />
und pädagogische Grundkenntnisse zu erarbeiten und damit zu einem sicheren<br />
professionellen Umgang sowohl mit den betroffenen Kindern/Jugendlichen und deren Eltern als<br />
auch mit anderen Berufsgruppen wie Ärzten und Psychologen zu gelangen.<br />
2. Ausgewählte Aspekte<br />
der Psychiatrie<br />
Gemeinsames Angebot der<br />
Fachbereiche SozPäd und<br />
HeilPäd<br />
max. 25 TN<br />
20 TN SozPäd<br />
5 TN HeilPäd<br />
2 Std.<br />
Effelsberg Do 11.30 - 13.00 3202<br />
Nach einer Einführung in die aktuelle Krankheitslehre stellen die Teilnehmer/innen wichtige<br />
psychiatrische Krankheitsbilder in Referaten dar, wobei der Schwerpunkt auf der medizinischen<br />
Sicht liegt. Wir orientieren uns an dem didaktisch besonders geeigneten Lehrbuch von Möller et<br />
al. Besonders vertiefen wir die in der Vorlesung “Sozialmedizin” eingeführten sozialpsychiatrischen<br />
Aspekte. Videos, Fallbeispiele, evtl. auch Exkursionen und Gastvorträge sollen einige<br />
Aspekte illustrieren. Wir stellen immer wieder aktuelle lokale und regionale Bezüge her.
- 136 -<br />
Sozialpädagogik 5. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
3. Musik(-therapie) in der<br />
Heilpädagogischen Arbeit<br />
mit geistigbehinderten<br />
Menschen<br />
Gemeinsames Angebot der<br />
Fachbereiche HeilPäd und<br />
SozPäd<br />
max. 12 TN<br />
8 TN HeilPäd<br />
4 TN SozPäd<br />
2 Std.<br />
Markowetz Do 9.45 - 11.30 2110<br />
Im Leben geistig behinderter Menschen spielt Musik eine große Bedeutung. Musik wird mit allen<br />
Sinnen wahrgenommen und wirkt therapeutisch. In vielerlei Hinsicht scheint sich das Sprichwort<br />
“mit Musik geht alles besser!” im pädagogischen wie therapeutischen Alltag zu bestätigen. Nicht<br />
zuletzt deshalb begegnet uns die Musik in allen heil- und sozialpädagogischen Handlungs- und<br />
Arbeitsfeldern. In dem Seminar geht es deshalb darum, sich dieser Zusammenhänge<br />
theoriegeleitet bewusst zu werden und die Musik als Lern- und Erfahrungsraum für Menschen mit<br />
geistiger Behinderung praktisch zu erfahren und didaktisch zu reflektieren.<br />
4. Zukunftskonferenzen -<br />
identitätsrelevanten<br />
Fragen und schwierigen<br />
Lebenssituationen<br />
behinderter Jugendlichen<br />
heilpädagogisch<br />
begegnen<br />
Gemeinsames Angebot der<br />
Fachbereiche HeilPäd und<br />
SozPäd<br />
max. 16 TN<br />
12 TN HeilPäd<br />
4 TN SozPäd<br />
2 Std.<br />
Markowetz Do 11.30 - 13.00 2110<br />
Auch aus behinderten Kindern werden Jugendliche. Sie kommen in die Pubertät und werden<br />
junge erwachsene Menschen. Die Anlässe, in denen sich behinderte Jugendliche ‘neu erleben’<br />
und ‘neu machen’ werden häufiger, komplexer und damit auch schwieriger. Bisweilen lösen sie<br />
ernsthafte Krisen mit sehr vielfältigen Problemen aus. Erschwerend kommt hinzu, dass in dieser<br />
Lebensphase sehr weitreichende, lebensbiographische Entscheidungen zu treffen sind. Sowohl<br />
Eltern als auch Experten möchten deshalb helfen und zur Bewältigung dieser schwierigen<br />
Lebenslage beitragen. Aus systemischer Sicht haben sich bei der interaktionistischen Lösung<br />
solcher Probleme sog. “Zukunfskonferenzen”, als eine moderne, trialogorientierte<br />
Interventionsform in der Pädagogik bewährt. In dem Seminar werden wir uns mit diesem Ansatz<br />
in Theorie und Praxis beschäftigen und interdisziplinäre über diese komplexe, nicht mittelbar<br />
wirksam werdende heilpädagogische Fördermaßnahme reflektieren.
- 137 -<br />
Sozialpädagogik 5. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
5. Direktive pädagogischtherapeutische<br />
Verfahren<br />
Gemeinsames Angebot der<br />
Fachbereiche HeilPäd und<br />
SozPäd<br />
max. 22 TN<br />
16 TN HeilPäd<br />
6 TN SozPäd<br />
2 Std.<br />
Pielmaier Do 11.30 - 13.00 2300<br />
Die Lehrveranstaltung dient dem Kennenlernen und Erproben direktiver Verfahren zur<br />
störungsspezifischen Arbeit mit emotional und verhaltensgestörten Kindern und Jugendlichen.<br />
Die Verfahren stammen überwiegend aus dem Bereich der Verhaltenstherapie und eignen sich<br />
im Ganzen oder in Teilen zur Kombination mit kindzentriertem, spieltherapeutischem Vorgehen.<br />
Unter anderem werden Trainingsverfahren für Kinder mit hyperkinetischem und oppositionellem<br />
Problemverhalten, Trainings mit Scheidungskindern, Adipositastrainings, Anti-Stress-Trainings<br />
unter die Lupe genommen und auf ihre Brauchbarkeit für Heil- und Sozialpädagogik hin<br />
überprüft. Die Arbeit im Seminar erfolgt in thematisch orientierten Kleingruppen. Die Bereitschaft<br />
zur aktiven Mitarbeit ist Voraussetzung für die Zulassung zum Seminar und die Erbringung einer<br />
Prüfungsleistung in Form einer Dokumentation.<br />
Grundkenntnisse in Verhaltenstherapie sind unabdingbar erforderlich.<br />
ISAG<br />
6. Alte Menschen mit<br />
Behinderung<br />
Gemeinsames Angebot der<br />
Fachbereiche HeilPäd und<br />
SozPäd<br />
max. 20 TN<br />
10 TN HeilPäd<br />
10 TN SozPäd<br />
2 Std.<br />
Brandenburg<br />
Menzen<br />
Kompaktseminar:<br />
Do 19.02.04,<br />
10.00 - 18.00<br />
Fr 20.02.04,<br />
10.00 - 18.00<br />
Sa 21.02.04,<br />
9.00 - 12.00<br />
3301<br />
Im Zentrum des Seminars steht der Zusammenhang von Altern und Behinderung. Wir wollen den<br />
Versuch unternehmen, das Thema “Altern und Behinderung” aus der Perspektive verschiedener<br />
Wissenschaften zu beleuchten. Nach einer Klärung dessen, was man unter Altern verstehen<br />
kann, werden wir das Thema von zwei Seiten angehen: Einerseits geht es um die<br />
gesundheitliche, soziale und psychische Situation von Menschen, die lebenslang mit einer<br />
körperlichen und geistigen Behinderung gelebt haben und jetzt alt geworden sind. Anderseits<br />
geht es um ältere Menschen, die aufgrund spezifischer gesundheitlicher Beeinträchtigung (z.B.<br />
Demenz) im hohen Alter in erheblichem Umfang in ihrer Selbständigkeit eingeschränkt und auf<br />
die Unterstützung und Hilfe von Angehörigen und Professionellen angewiesen sind. Welche<br />
spezifischen Anforderungen stellen sich an eine heilpädagogische und pflegerische Beratung<br />
und Versorgung dieser Menschen? Mit welchen Konzeptionen können die Berufsgruppen auf<br />
diese Herausforderung reagieren?
- 138 -<br />
Sozialpädagogik 5. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Wahlpflichtfächer:<br />
Musik-, Bewegungs- Spiel- und Sprachgestaltung;<br />
Bildhaftes, plastisches Gestalten und Werken<br />
siehe Hauptstudium:<br />
Angebote im Bereich Kultur- und Medienpädagogik<br />
Zusatzangebote (5. und 7. Semester):<br />
Sprachangebote: siehe “Sprachkurse”<br />
Einführungsseminar in<br />
die “Regio-Akademie”<br />
Spiegelberg/<br />
Weiss<br />
Zeit wird rechtzeitig<br />
durch Aushang<br />
bekannt gegeben !<br />
Das Projekt “Regio-Akademie für soziale Arbeit” ist ein Gemeinschaftsprojekt der in RECOS<br />
zusammengeschlossenen Ausbildungsstätten für Sozialarbeit, Sozialpädagogik und<br />
Heilpädagogik in Mulhouse, Strasbourg, Basel sowie an der EFH <strong>Freiburg</strong>. Im Rahmen dieses<br />
Projekts besteht die Möglichkeit, über ein Zusatzlehrprogramm interkulturelle Kompetenzen zur<br />
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu erwerben. Über die erfolgreiche Teilnahme in diesem<br />
Programm wird am Ende ein Zertifikat in deutscher und französischer Sprache ausgestellt. -<br />
Themen des Einführungsseminars werden sein: Einführung in Anliegen und Struktur des<br />
Zusatzlehrprogramms; Ausbildungssysteme zu sozialen Berufen in den drei Ländern;<br />
sozialrelevante Aspekte zur Situation in der Regio; soziale Dienstleistungssysteme in Elsass,<br />
Nordschweiz und Südbaden; Grundstruktur der sozialen Sicherheit in den drei Ländern.<br />
Binationales Seminar:<br />
Soziale Arbeit mit jungen<br />
Menschen<br />
(Kooperationsveranstaltung<br />
mit den Escueles<br />
Universitaries de Treball<br />
Social i Educació Social an<br />
der Ramon Llull Universität<br />
Barcelona)<br />
2 Std.<br />
Sidler/NN Vorbereitungsseminar<br />
im<br />
Wintersemester<br />
2003/04 n.V.<br />
Seminar in<br />
<strong>Freiburg</strong>:<br />
07. - 14.02.2004<br />
Seminar in<br />
Barcelona:<br />
17. - 24.04.2004
- 139 -<br />
Sozialpädagogik 5. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Das Seminar wendet sich an Studierende der Fachbereiche Soziale Arbeit und Heilpädagogik,<br />
sowie der Studiengänge Sozialarbeit und Sozialpädagogik des Grund- und Hauptstudiums. Die<br />
Teilnehmerzahl ist auf je 17 Studierende aus <strong>Freiburg</strong> und Barcelona begrenzt.<br />
Von den Teilnehmern wird die aktive Teilnahme an allen Teilen des Seminars erwartet. Dazu<br />
zählt die Vorlage eines Arbeitspapiers zum Vorbereitungsseminar oder die Vorlage eines<br />
Referats zum Kompaktseminar in <strong>Freiburg</strong> sowie die Vorlage eines Protokolls über einen<br />
Praxisbesuch während des Kompaktseminars in <strong>Freiburg</strong> und Barcelona.<br />
Im Rahmen des Seminars können PL bzw. PVL nach den Bestimmungen der Fachbereiche zum<br />
Zusatzlehrprogramm Europäische Soziale Arbeit erbracht werden.<br />
Binationales Projektseminar:<br />
Gemeinwesenarbeit auf<br />
der Basis des Empowermentansatzes<br />
in Sozialen<br />
Brennpunkten in<br />
Deutschland und<br />
Nikaragua im Vergleich<br />
Kooperationsveranstaltung<br />
mit der Universidad Juan<br />
Pablo II, Universidad de<br />
Ciencias Soziales<br />
Aplicadas - UCSA -<br />
Managua/Nikaragua<br />
Schwalb Vorbesprechung:<br />
08.10.2003,<br />
13.00-14.30<br />
Vorbereitungsseminar:<br />
21. - 23.11.2003,<br />
14.00-13.00<br />
Kompaktseminar I<br />
in Managua/Nikar.:<br />
07. - 17.02.2004<br />
Kompaktseminar II<br />
in <strong>Freiburg</strong>:<br />
15. - 23.05.2004<br />
Auswertungssem.:<br />
05.06.2004,<br />
9.00 - 17.00<br />
3201<br />
3201<br />
Das Seminar wird angeboten für Studierende ab dem 5. Semester (WS 2003/04) der<br />
Studiengänge Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Heilpädagogik der KFH <strong>Freiburg</strong> und des<br />
Studiengangs Promotores Sociales der UCSA Managua. Die Teilnehmer/innenzahl ist auf je 10<br />
Studierende aus <strong>Freiburg</strong> und Managua begrenzt. Bei den Studierenden der KFH werden als<br />
Voraussetzung für die Teilnahme gute Kenntnisse der spanischen Sprache und die aktive<br />
Teilnahme an allen vier Teilen des Seminars erwartet. Dazu zählt bei jedem/r Teilnehmer/in die<br />
Vorlage eines Arbeitspapiers zum Vorbereitungsseminar, eines Protokolls zu einer Einheit des<br />
Kompaktseminars I in Managua, eines Referats zum Kompaktseminar II und eines Kurzberichts<br />
über die im Seminar gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen.<br />
Voraussetzung für die Durchführung des Seminars ist eine Bezuschussung durch den DAAD; ein<br />
Antrag ist gestellt.<br />
An der Teilnahme interessierte Studierende werden gebeten, sich bis 01.08.2003 an Prof.<br />
H. Schwalb, E-Mail: hschwalb@web.de, zu wenden.
- 140 -<br />
Sozialpädagogik 5. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
ISAG<br />
Für alle Fachbereiche:<br />
Forum Soziale<br />
Altenarbeit in der Stadt<br />
<strong>Freiburg</strong> und Umgebung<br />
(30 - 40 Tn)<br />
Kricheldorff/<br />
Brandenburg<br />
Termine und<br />
Themen: siehe<br />
Plakat zu Beginn<br />
des Semesters<br />
Im Rahmen dies regelmäßig stattfindenden Forums werden aktuelle Themen aus dem Berufsfeld<br />
der Sozialen Altenarbeit aufgegriffen. Nach einer inhaltlichen Einführung in das Thema wird<br />
dieses in einem intensiven Theorie-Praxis-Dialog vertieft und aus unterschiedlichen Blickwinkeln<br />
beleuchtet.<br />
Über die inhaltliche Schwerpunktsetzung und die genauen Themen sowie die Termine des<br />
Wintersemesters 2003/04, wird über einen Plakataushang zu Beginn des Semesters informiert<br />
werden. Die Veranstaltungen sind offen für alle Vertreter der Fachpraxis und interessierte<br />
Studierende aller Fachbereiche. Das Forum ist darüber hinaus auch eine Informationsplattform<br />
über Fort- und Weiterbildungsangebote, Tagungen und neue Literatur.
- 141 -<br />
Sozialpädagogik 7. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Pflichtfächer<br />
Fachwissenschaft Sozialpädagogik<br />
- Praxisforschung - PVL = Referat<br />
Wissenschaftliches<br />
Arbeiten - Empirische<br />
Forschungstechniken<br />
4 Gruppen á 15 TN<br />
2 Std.<br />
Effelsberg<br />
Hammer<br />
Renz<br />
Schönenborn<br />
Mi 11.30 - 13.00<br />
Mi 11.30 - 13.00<br />
Mi 11.30 - 13.00<br />
n.V.<br />
Wir überlegen, was Wissenschaftlichkeit bedeutet, und grenzen sie gegen nichtwissenschaftliches<br />
Arbeiten ab. Wir untersuchen, wo und wie Wissenschaft betrieben wird (wissenschaftliche<br />
“Sub-Kultur”, Institutionen, Internationalität), welche Quellen sie verwendet (eigene Daten,<br />
Bücher, Zeitschriften, Datenbanken) und wie Wissenschaftler/innen kommunizieren (Gesellschaften,<br />
Zeitschriften, Kongresse). Wir lernen empirische Forschungsmethoden und<br />
Arbeitstechniken kennen, machen uns Gedanken über Zeitpläne und Durchführbarkeit,<br />
rechtliche (Datenschutz) und ethische Aspekte (Probanden-Aufklärung, Einwilligung). Wir<br />
reflektieren Sprachstile und lernen, wie man sich einfach und verständlich ausdrückt. Alle<br />
Teilnehmer/innen erarbeiten ein eigenes Konzept zu einer Arbeit nach eigenem Interesse,<br />
insbesondere als Vor-bereitung für die Diplomarbeit.<br />
Berufliches Handeln in der sozialpädagogischen Arbeit<br />
Praxisnachbereitung PVL = Bericht<br />
Gruppe A<br />
max. 15 TN<br />
1 Std.<br />
Dilger Di 15.00 - 17.15<br />
Folgende Termine:<br />
11.11./18.11./<br />
25.11./2.12./<br />
9.12. 2003<br />
Ersatztermin:<br />
16.12.2003<br />
“Was war gut in meinem Praktikum und wie kann es verstärkt oder ausgebaut werden, bzw.,<br />
was will ich verändern und welche Möglichkeiten stehen mir zur Verfügung?“<br />
Ressourcen- und handlungsorientiert werden wir in diesem Seminar sozialpädagogische<br />
Arbeitsan- und -einsätze innerhalb Ihres bereits geleisteten Praxissemesters reflektieren und so<br />
Lernprozesse entwickeln, die Wahrnehmungs- und Konfliktfähigkeit fördern..<br />
Gruppe B<br />
max 15 TN<br />
1 Std.<br />
Kaesehagen-<br />
Schwehn<br />
1. Treff:<br />
Di 14.10.2003,<br />
15.45 - 17.15 Uhr<br />
und<br />
Teilkompakt n.V.<br />
2110<br />
3302<br />
3303<br />
U1<br />
3201<br />
3201
- 142 -<br />
Sozialpädagogik 7. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Im Rückblick auf Ihre im Berufsfeld geleistete Arbeit während des Praxissemester werden wir im<br />
Rahmen des Seminars Ihre individuellen Eindrücke, Erfahrungen und Fragen reflektieren. Sie<br />
haben die Möglichkeit, innerhalb der Gruppe ihre Bewertungen und Einstellungen zu überprüfen<br />
und gegebenenfalls andere Perspektiven kennen zu lernen. Darüber hinaus geht es im Seminar<br />
um Fragen individueller Handlungsorientierung und gezielter fachlicher Weiterentwicklung im<br />
Hinblick auf den beruflichen Einstieg.<br />
Gruppe C<br />
max. 15 TN<br />
1 Std.<br />
Meier Kompaktseminar:<br />
Fr 10.10.03<br />
ab 14.00 Uhr<br />
Sa 11.10.03<br />
bis 18.00 Uhr<br />
Im Vordergrund dieser Lehrveranstaltung steht die eigene Erfahrung im Praxissemester. Es<br />
besteht die Möglichkeit, die gesammelten Erfahrungen des pädagogischen Alltags mit seinen<br />
mannigfachen Anforderungen zu reflektieren, gewonnene Erkenntnisse bewusst zu machen und<br />
das eigene pädagogische Handeln zu hinterfragen.<br />
Dies geschieht unter Berücksichtigung der Spezifikation der verschiedenen Einrichtungen, in<br />
denen die Teilnehmer/innen ihr Praxissemester verbracht haben, sowie im Kontext von<br />
Jugendamt, Eltern, Kind und Einrichtung mit ihren jeweiligen Wünschen, Erwartungen und<br />
Ressourcen, aber auch ihren Grenzen.<br />
Gruppe D<br />
max. 15 TN<br />
1 Std.<br />
Reichart Di 16.00 - 18.15<br />
Beginn: 14.10.03<br />
Was habe ich in meinem Praktikum erlebt/gelernt? Wie konnte ich mich mit dem mitgebrachten<br />
Wissen aus der Fachhochschule einbringen? In welchen Bereichen konnte ich erlernte<br />
Methoden einsetzen/praktizieren, was will ich noch verändern, was muss ich noch erlernen, um<br />
im Praxisfeld (und mir selbst) den Anforderungen standhalten zu können?<br />
Unter diesen Aspekten besteht die Möglichkeit eines intensiven Austauschens von allen<br />
Teilnehmer/innen untereinander im Rückblick auf das absolvierte Praktikum.<br />
3302<br />
3102
- 143 -<br />
Sozialpädagogik 7. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Rechtliche, sozialwissenschaftliche und ökonomische<br />
Grundlagen der Sozialpädagogik<br />
Sozial- und Arbeitsrecht<br />
(PL = Klausur)<br />
2 Std. Vorlesung<br />
Rynski Mi 8.00 - 9.30 Aula<br />
3000<br />
Schwerpunkt: Sozialhilferecht<br />
Die Vorlesung gibt eine grundlegende Übersicht über Sinn und Zweck sowie die Inhalte des<br />
Systems der Sozialen Sicherung in Deutschland:<br />
Versicherungen / Sozialversicherungen<br />
Versorgungsleistungen inkl. Familienlastenausgleich<br />
Fürsorge / Sozialhilfe (vertiefte Darstellung mit praktischen Fällen)<br />
Rechtsgrundlagen: SGB I - BSHG - SGB X und Verw.GO (auszugsweise).<br />
Politische Theorie<br />
(PVL = Klausur)<br />
2 Std. Vorlesung<br />
Jaser Mi 9.45 - 11.15 Aula<br />
1100<br />
Das 19. und 20. Jahrhundert werden nicht zu Unrecht als ein Zeitalter der Ideologien bezeichnet.<br />
Mit dem Zusammenbruch der kommunistischen Staaten in Osteuropa wurde hingegen für das<br />
21. Jahrhundert mit der Ausbreitung der demokratischen Systeme westlicher Prägung<br />
verschiedentlich ein ‘Ende der Geschichte’ prognostiziert. Die Vorlesung fragt, auch vor dem<br />
Hintergrund tiefgreifender wirtschaftlicher Wandlungsprozesse wie z.B. der industriellen<br />
Revolution, nach den Wurzeln unseres heutigen Staatsverständnisses. Dabei werden nicht nur<br />
für die Politikwissenschaft maßgebliche politische Philosophen seit Thomas Hobbes und John<br />
Locke behandelt, sondern es wird auch die Frage nach dem Wandel des Wesens und der<br />
Aufgaben des Staates seit dem 19. Jahrhundert gestellt.
- 144 -<br />
Sozialpädagogik 7. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Wahlpflichtfächer<br />
Fachwissenschaft Sozialpädagogik<br />
Spezifische Arbeitsfelder gestalten und ausfüllen PL = Referat<br />
Eines der Angebote ist zu wählen<br />
1. Sozialpädagogische<br />
Krisenbegleitung<br />
max. 15 TN<br />
3 Std<br />
Hammer Mo 9.45 - 12.00<br />
Beginn: 13.10.03<br />
Themen des Seminars: Vielfalt der Wendepunkte im Leben, Verlaufsmodelle unterschiedlicher<br />
Krisen, Möglichkeiten sozialpädagogischer Interventionsformen. Der Wechsel von Partner-,<br />
Kleingruppen- und Plenumsarbeit wird das Setting des Seminars prägen. Von den<br />
Teilnehmer/innen wird die Reflexion eigener Wendepunkte erwartet sowie die Bereitschaft, an<br />
der Simulation von Interventionsformen sich aktiv zu beteiligen. - Literaturliste und einschlägige<br />
Texte werden im Seminar ausgegeben und besprochen.<br />
2. (Teil-) stationäre Hilfen<br />
max. 15 TN<br />
3 Std<br />
Scheiwe Mo 9.45 - 12.00<br />
Beginn: 13.10.03<br />
Wir werden die erzieherische Hilfen zunächst in ihrer historischen Dimension und Entwicklung<br />
betrachten und diskutieren, welche strukturellen Veränderungen und inhaltlichen Reformen in<br />
den letzten Jahren vollzogen worden sind. Um das Aufgabengebiet der heutigen (teil-<br />
(stationären Erziehungshilfe zu begreifen, werden wir uns mit den Schwierigkeiten und<br />
Problemen der jungen Menschen und deren Familien auseinander setzen, die diese Hilfeform<br />
benötigen (Indikation). Weiterhin werden methodische Aspekte und Konzepte angesprochen<br />
(u.a. Sozialraumorien-tierung, Familienarbeit, Erziehungshilfe und Schule, intensive<br />
sozialpädagogische Einzelbe-treuung). Aspekte der aktuellen Qualitätsdebatte und der Neuen<br />
Steuerung werden berück-sichtigt.<br />
3. Gesprächsführung<br />
(Vertiefung)<br />
max. 15 TN<br />
3 Std.<br />
2110<br />
1204<br />
Renz Do 9.00 - 11.15 3303<br />
Hilfreiche Gespräche zu führen ist eine Grundlage professioneller sozialpädagogischer Arbeit<br />
mit Klientinnen und Klienten. - In dieser Lehrveranstaltung wird der eigene Kenntnisstand<br />
aktualisiert und auf Erlerntem aufgebaut. Mit Hilfe persönlicher konkreter Beispiele aus den<br />
praktischen Studiensemestern werden die Erfahrungen reflektiert und vertieft, vorhandenes<br />
Wissen erweitert sowie durch theoretische und praktische Inputs ergänzt.<br />
Voraussetzung ist die Bereitschaft, eigene Gesprächssituationen einzubringen und im Seminar<br />
reflektieren zu wollen. Gearbeitet wird mit Rollenspiel, Interaktionsübungen, Papieren,<br />
theoretischen Inputs, Videoaufzeichnungen und dem Seminargespräch.<br />
!! Jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin gebe bis zum 10.10.2003 schriftlich eine<br />
Gesprächssituation aus dem praktischen Studiensemester bei Frau Renz ab, die er/sie im<br />
Seminar reflektieren will !!
- 145 -<br />
Sozialpädagogik 7. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
4. Ethnomedizin:<br />
Kranke und Heilkunde<br />
aus fremden Kulturen<br />
max. 15 TN<br />
3 Std.<br />
Effelsberg Do 9.00 - 11.15 3202<br />
Krankheitsdefinitionen und Krankheitsverhalten werden von der Kultur geprägt. Wir lernen<br />
verschiedene Kulturbegriffe kennen, betrachten soziale Normen und rollen und das<br />
zugrundeliegende Menschenbild. Anhand von Beispielen aus fernen Ländern, aber auch an der<br />
Arbeit mit Migranten in Deutschland zeigen wir, wie sich dies auf Gesundheit und Krankheit<br />
auswirkt. Einzelne Themen, ausgewählt nach Erfahrungen und Interessen der Studierenden,<br />
besprechen wir in Referaten der Studierenden. Besonders achten wir auf Interaktion und<br />
Kommunikation und Anwendung auf die Soziale Arbeit.<br />
Gäste aus dem Institut für Völkerkunde/der Krankenpflegeschule der Universitätskliniken werden<br />
uns Migrantenarbeit aus ihrer Sicht und einige aktuelle Forschungsergebnisse schildern.<br />
Berufliches Handeln in der sozialpädagogischen Arbeit<br />
Führung und Leitung in<br />
sozialpädagogischen Institutionen PL = Referat (Ende WS)<br />
Eines der Angebote ist zu wählen<br />
(Fortsetzung im Sommersemester)<br />
1. Kommunikationskompetenz<br />
und Beratung<br />
max. 20 TN<br />
2 Std.<br />
Renz Do 11.30 - 13.00 2200<br />
Kommunikationskompetenz ist eine Grundlage professioneller sozialpädagogischer Arbeit mit<br />
Klient/innen, im Umgang mit Kolleg/innen und Mitarbeiter/innen.<br />
6 Aktualisieren des eigenen Kenntnisstandes, um auf Erlerntem aufbauen zu können<br />
6 Reflektieren konkreter Kommunikationserfahrungen aus dem praktischen Studiensemester,<br />
um die persönlichen Kommunikationskompetenz weiterzuentwickeln<br />
6 Teamleitung und Mitarbeiterführung als Anforderungen an berufliches Handeln<br />
6 Personalentwicklung als Führungsaufgabe<br />
Voraussetzungen:<br />
6 Bereitschaft zur Reflexion eigener Gesprächsbeispiele<br />
6 Teilnahme an Übungen und Rollenspielen
- 146 -<br />
Sozialpädagogik 7. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
2. Rhetorik und<br />
Moderation<br />
max. 14 TN<br />
2 Std.<br />
Obert Kompaktseminar:<br />
Teil 1: Fr 21.11.03<br />
ab 13.00 h und<br />
Sa 22.11.2003<br />
ab 8.30 h<br />
Teil 2: Fr 9.1.04<br />
ab 13.00 h und<br />
Sa 10.1.2004<br />
ab 8.30 h<br />
Folgeveranstaltung<br />
für Sommersemester<br />
2004 vorgezogen<br />
auf:<br />
Di 10.2.2004 bis<br />
Do 12.2.2004<br />
jew. 10.00-18.30 h<br />
Diskussion, Debatte und Moderation bilden die “Hohe Schule der Rhetorik”. Reden können wir<br />
bis aufs letzte I-Tüpfelchen wohl vorbereiten. Diskussionen und Debatten nicht. Wir sind hier in<br />
viel höherem Maße von unserem Partner abhängig. Wir müssen unsere Statements unmittelbar<br />
vor ihm und vor unserem Moderator “verantworten.”<br />
Es gibt viele glänzende Redner und hinreisende Debattierer, denen diese Begabung in die<br />
Wiege gelegt wurde. Aber auch sie arbeiten an sich und bereiten sich auf Verhandlungen,<br />
Debatten und Diskussionen sorgfältig vor, vor allem dann, wenn sie mit der zumeist schwierigen<br />
Aufgabe der Moderation und Diskussionsleitung betraut werden.<br />
Diese Veranstaltung präsentiert Techniken und bietet einen Erfahrungsaustausch auf dem<br />
Gebiet der Diskussion, Debatte und Moderation.<br />
HINWEIS:<br />
1. Die Folgeveranstaltung für das 8. Semester (Teil II) zu dieser Vorlesung und Übung findet im<br />
unmittelbaren Anschluss an das WS 2003/04 im Rahmen einer Blockveranstaltung mit<br />
praktischer Durchführung einer Diskussion/Moderation statt (Termin siehe oben!).<br />
Die Vorbereitungen zu dieser Blockveranstaltung werden im Teil I im WS 2003/04 präsentiert.<br />
TN an den Kursen im Wintersemester 2003/04 werden gebeten, diesen Folgetermin bei der<br />
Belegung dieses Kurses zu berücksichtigen.<br />
2. Dies gilt auf für die Studierenden des Video-Kurses von Christian Schulz, mit dem wir im<br />
Februar 2004 in unserem Rhetorik-/Moderationskurs eng zusammenarbeiten werden.<br />
3. Rhetorik und Moderation ist für 14 TN konzipiert.<br />
4. Eine Exkursion im WS 2003/04 ist für diesen Kurs vorgesehen. Die Teilnahme daran ist<br />
obligatorisch.<br />
3. Führen und Leiten in<br />
Organisationen des<br />
Sozialwesens<br />
max. 20 TN<br />
2 Std.<br />
Welter Do 15.45 - 17.15<br />
Beginn: 16.10.2003<br />
3101<br />
3101<br />
3101<br />
3102
- 147 -<br />
Sozialpädagogik 7. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Die erfolgreiche Gestaltung der Leitungsrolle setzt eine differenzierte Wahrnehmung eigener<br />
Handlungsstrategien voraus. Zwischen Rollenanforderungen und Selbstbild einen eigenen<br />
Führungsstil zu entwickeln, ist ein kontinuierlicher Lernprozess, der zu persönlichen<br />
Einstellungsänderungen führen kann oder soll. Der thematische Spannungsbogen verläuft von<br />
traditionellen Handlungsmodellen hin zum Veränderungsmanagement in sozialen<br />
Organisationen: Mitarbeiterführung, Personalentwicklung, intentionale Kommunikation,<br />
Konfliktmanagement und Kontextsteuerung sind für Leiten und Führen relevante<br />
Themenbereiche, die vor sozialpsychologischem und kommunikationstheoretischem Hintergrund<br />
behandelt werden.<br />
Humanwissenschaftliche Grundlagen der Sozialpädagogik<br />
Spezifische Aspekte der Pädagogischen<br />
Psychologie für Sozialpädagogik PVL = Klausur<br />
Eines der Angebote ist zu wählen<br />
1. Grundlagen und Praxis<br />
geschlechtsbewusster<br />
Pädagogik<br />
Jungen - Mädchenarbeit<br />
im Einfluss von Gendermainstreaming<br />
max. 20 TN<br />
2 Std.<br />
Adler/Steiner Teil 1:(Fr. Steiner)<br />
Kompakttermin:<br />
Fr 24.10.03<br />
13.00 bis 17.30<br />
Sa 25.10.03<br />
10.00 bis 17.30<br />
Teil 2: (Hr. Adler)<br />
Do 20.11. und<br />
Do 4.12.2003,<br />
jew. 9.45 -11.15<br />
Kompakttermin:<br />
Fr.19./Sa 20.12.03<br />
Nachtermin:<br />
Do 15.01.2004,<br />
9.45 -11.15<br />
Geschlechtsspezifische und geschlechtsbewusste Pädagogik hat in der Jugendhilfe zu mehr<br />
Verständnis sowohl unter Mädchen und Jungen selbst, als auch zwischen den Geschlechtern<br />
beigetragen. Mädchenarbeit gehört schon seit Jahrzehnten zum festen Bestandteil<br />
professioneller Jugendarbeit. Aus der geschlechtsbewussten Arbeit mit Jungen liegen<br />
mittlerweile etliche Ansätze und Praxiserfahrungen vor. Das Seminar besteht aus einem Block<br />
über Mädchen- und einem Block über Jungenarbeit. Sozialisation, die Rolle des/der<br />
Pädagogen/Pädagogin/innen, praktische Handlungsansätze, Sucht- und Gewaltprävention bei<br />
Mädchen und Jungen, sollen auf dem Hintergrund der Geschlechter-(Gender-)forschung in<br />
beiden Seminarteilen behandelt werden.<br />
3201<br />
3102<br />
3201<br />
3102
- 148 -<br />
Sozialpädagogik 7. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
2. Pädagogische<br />
Psychologie<br />
max. 20 TN<br />
2 Std.<br />
Blumenberg Mo 15.45 - 17.15<br />
Beginn: 13.10.03<br />
Pädagogische Psychologie ist kein fest umrissenes, eindeutig definiertes Theorie- und<br />
Handlungsfeld. In diesem Seminar sollen, im Sinne einer Verknüpfung, Beiträge der<br />
pädagogischen Psychologie zum Tätigkeitsfeld der Jugendhilfe aufgenommen und behandelt<br />
werden. Dabei sollen nach Absprache mit den Studierenden u.a. folgende exemplarische<br />
Themenschwerpunkte aufgenommen werden: Zum Grundverständnis von Bildung und<br />
Erziehung, gravierende Veränderungen des Aufwachsens in unserer Gesellschaft (vgl. 11.<br />
Jugendbericht), Beiträge einer pädagogischen Psychologie zur Diagnostik im Sinne des KJHG,<br />
Einflüsse der Verbreitung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien auf Bildung und<br />
Erziehung, zur Erreichbarkeit so genannter “nicht-erreichbarer” Jugendlicher und Konzepte der<br />
Qualitätsentwicklung bzw.-sicherung.<br />
3. Interkulturelle Arbeit:<br />
Arbeit mit Fremden<br />
max. 20 TN<br />
10 TN SozPäd<br />
10 TN SozArb<br />
2 Std.<br />
Barwig Einführungsseminar:<br />
Fr 24.10.2003<br />
14.00 - 19.00 Uhr<br />
Blockseminar in<br />
Stuttgart-<br />
Hohenheim:<br />
01.- 05.12.2003<br />
(Kosten L 67,-)<br />
- Migration von und nach Deutschland - Migrationsursachen - Migrantengruppen-<br />
Migrationspolitik - Integration/Assimilation/Akkomodation/Enkulturation - Begriffserklärungen -<br />
Rollenmuster und Wertewandel am Beispiel von Migrantenfamilien - Migrant/innen im sozialen<br />
Gefüge Stuttgarts - Bevölkerungsstruktur - soziale Infrastruktur - Partizipation<br />
- kommunale Integrationspolitik<br />
- die ehemaligen “Gastarbeiter”: Einwanderer in Deutschland<br />
- Grundlagen des Ausländerrechts - Fremdenfeindlichkeit und Einbürgerungserleichterungen,<br />
Zusammenhänge und Widersprüche - Hospitationen in Einrichtungen für Einwanderer<br />
- ausländische Flüchtlinge - Hospitationen in Einrichtungen der Asylarbeit<br />
- (Spät-)Aussiedler, die ungeliebten Deutschen?<br />
- Migrationsfachdienste - eine Perspektive für die Zukunft.<br />
4. Zuschauen hilft nicht -<br />
Verantwortung ist<br />
weltweit<br />
max. 20 TN<br />
Gemeinsames Angebot<br />
mit Fachbereich HeilPäd<br />
14 TN SozPäd<br />
6 TN HeilPäd<br />
2 Std.<br />
Veith/<br />
Mitarbeiter/innen<br />
von<br />
Caritas<br />
International<br />
Mo 16.30 - 19.30<br />
und n. V.<br />
1. Treff: 13.10.2003<br />
2300<br />
3102<br />
3102
- 149 -<br />
Sozialpädagogik 7. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Eine Schnittstelle schaffen zwischen Theorie und konkreter Sozialer Arbeit in Partnerländern von<br />
Caritas International. Dies ist das Anliegen, das in diesem Seminar zur Sprache kommen soll.<br />
Im Wintersemester wird die Situation von Kindern und Jugendlichen in Afrika im Mittelpunkt<br />
stehen, wobei die Themen “Kindersoldaten”, “Straßenkinder”, “Gewalt in Familien” von<br />
besonderer Bedeutung sein werden.<br />
Rechtliche, sozialwissenschaftliche und ökonomische Grundlagen<br />
der Sozialpädagogik<br />
Organisation und Management PL = St.Arb. (Ende WS)<br />
Eines der Angebote ist zu wählen<br />
(Fortsetzung im Sommersemester)<br />
1. Qualitätsentwicklung<br />
max. 20 TN<br />
2 Std.<br />
Fehrenbacher/<br />
Spielmann<br />
1. Termin<br />
(Teilkompakt):<br />
Fr 05.12.03,<br />
9.00 - 17.00<br />
weitere Termine n.V.<br />
und Kompakttermin<br />
in der vorlesungsfreien<br />
Zeit n.V.<br />
Qualitätsentwicklung und Qualitätsmanagement spielen in der Sozialen Arbeit eine mittlerweile<br />
bedeutende Rolle. Die Lehrveranstaltung will ausgehend von den gesellschaftlichen und sozioökonomischen<br />
Entwicklungen einerseits und von den gesetzlichen Anforderungen andererseits<br />
einen Überblick über die aktuelle Diskussion geben, Modelle und Systeme vorstellen und<br />
bearbeiten sowie am Beispiel der Kinder- und Jugendhilfe exemplarisch entwickeln.<br />
2. Grundzüge der<br />
Betriebswirtschaft für<br />
soziale Einrichtungen<br />
max. 20 TN<br />
2 Std.<br />
Müller, J./<br />
Müller, M./<br />
Immenschuh/<br />
Teuber<br />
Mo 15.45 - 17.15<br />
Beginn: 13.10.03<br />
Betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse werden für Sozialpädagog/innen nicht erst in<br />
Leitungsfunktionen wichtig. Auch wenn in sozialen Diensten keine Gewinne erzielt werden<br />
sollen, so müssen Aufwand und Erfolg in den Leistungen bei knapper werdenden Budgets<br />
gemanagt werden.<br />
Im Wintersemester werden nach einer allgemeinen Einführung Themen des Rechnungswesens<br />
(Buchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, Bilanzen), Controlling (Berichtswesen,<br />
strategisches und operatives Controlling, Kennzahlensysteme) und Marketing behandelt.<br />
Besonderen Wert wird auf die Anknüpfung der Inhalte an Praxisprobleme gelegt.<br />
Literatur: Knorr/Offer: Betriebswirtschaftslehre. Grundlagen für die Soziale Arbeit. Neuwied 1999<br />
(Luchterhand)<br />
3302<br />
2200
- 150 -<br />
Sozialpädagogik 7. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
3. Existenzgründung in<br />
der Sozialen Arbeit<br />
max. 20 TN<br />
2 Std.<br />
Ferch Do 9.45 - 11.15<br />
Beginn: 09.10.03<br />
Inhalt: Selbständig in der Sozialarbeit. Die interessanten und gefragten Stellen der<br />
Sozialarbeit/Sozialpädagogik werden weniger. Ein Ausweg daraus ist die Selbständigkeit. Doch<br />
wie funktioniert das? Das Seminar vermittelt neben den Möglichkeiten, sich als SP-ler/SA-ler<br />
selbständig zu machen die Grundlagen, wie der Schritt in die Selbständigkeit geplant und<br />
umgesetzt wird. Daneben werden die vielseitigen Kooperationsmöglichkeiten zwischen sozialen<br />
Einrichtungen und Unternehmen, Grundlagen über Spenden nd Sozialsponsoring, Fundraising<br />
und Marketing für Non-Profit Organisationen behandelt. Zusammen mit den Studierenden<br />
werden praxisbezogene Konzepte erarbeitet, die auch gleich umgesetzt werden können.<br />
4. Binationales Seminar:<br />
Soziale Arbeit mit jungen<br />
Menschen<br />
(Kooperationsveranstaltung<br />
mit den Escueles<br />
Universitaries de Treball<br />
Social i Educació Social an<br />
der Ramon Llull Universität<br />
Barcelona)<br />
2 Std.<br />
Sidler/NN Vorbereitungsseminar<br />
im<br />
Wintersemester<br />
2003/04 n.V.<br />
Kommentierung siehe unter Zusatzangebote 5. Semester !<br />
Seminar in <strong>Freiburg</strong>:<br />
07. - 14.02.2004<br />
Seminar in<br />
Barcelona:<br />
17. - 24.04.2004<br />
Philosophische und theologische Grundlagen der Sozialen Arbeit<br />
Wertorientierung und Berufsethik PL = Ref (Ende Sommer)<br />
Eines der Angebote ist zu wählen<br />
(Fortsetzung im Sommersemester)<br />
1. Ethik sozialpädagogischen<br />
Handelns<br />
max. 20 TN<br />
2 Std.<br />
3101<br />
Hammer Do 11.30 - 13.00 3302<br />
Themen des Seminars: Analyse ethischer Fragestellungen im professionellen Handeln, Muster<br />
ethischer Argumentation, ethische Grundlagen sozialer Berufe in ausgewählten Berufs-<br />
Codices... - Methodisches Vorgehen: Impulsreferate, Arbeit an einschlägigen Texten, Einüben<br />
ethischer Diskurse anhand von Fällen aus der Praxis. Der Wechsel von Partner-Kleingruppenund<br />
Plenumsarbeit wird das Setting des Seminars prägen. - Von den Teilnehmer/innen wird<br />
erwartet, die eigenen Erfahrungen im Hinblick auf ethisch relevante Fragestellungen zu<br />
reflektieren.
- 151 -<br />
Sozialpädagogik 7. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
2. Philosophie und<br />
Theologie in der sozialen<br />
Arbeit<br />
max. 20 TN<br />
2 Std.<br />
Kollhof Di 18.30 - 20.00<br />
Beginn: 14.10.2003<br />
Die Veranstaltung soll einzelne anthropologische und gesellschaftstheoretische Konzepte der<br />
Philosophie und Theologie näher bringen, die auf ihre Tragfähigkeit für soziales Handeln hin<br />
befragt werden sollen. Dabei soll insbesondere die Dialektik zwischen Theorie und Praxis<br />
ausgeleuchtet werden.<br />
3. Bioethik<br />
max. 20 TN<br />
2 Std.<br />
Clausen Di 11.00 - 13.00<br />
Beginn: 14.10.2003<br />
Die zentrale Frage der Bioethik, die sich als anwendungsbezogene Ethik auf den großen<br />
Bereich des Lebendigen erstreckt, lautet: “Wie wollen wir mit den Möglichkeiten umgehen, die<br />
uns Wissenschaft und Forschung in Biologie und Medizin neue eröffnen?”<br />
Dieses auf zwei Semester angelegte Seminar will sowohl in die Grundfragen dieser<br />
Bereichsethik einführen als auch die aktuellen Schwerpunkte der öffentlichen Diskussion<br />
aufgreifen. Dabei sollen medizinethische Fragen besondere Berücksichtigung finden.<br />
Im ersten Teil sollen neben einer Begriffserklärung grundlegende theoretische Ansätze und<br />
Konzeptionen vorgestellt sowie unterschiedliche Verständnisse von Zentralbegriffen wie z.B.<br />
Menschenbild und Menschenwürde thematisiert werden. um dann in einem zweiten Teil<br />
begründete ethische Einschätzungen zu den drängenden Fragen rund um den Anfang und das<br />
Ende des menschlichen Lebens vornehmen zu können. Fragen zu Embryonen- und<br />
Stammzellenforschung sowie Klonen werden dabei ebenso problematisiert werden wie<br />
Präimplantations-, Pränataldiagnostik und Schwangerschaftsabbruch. Außerdem werden<br />
Sterbe-hilfe, Palliativ- und Transplantationsmedizin auf dem Programm stehen.<br />
- Zusatzangebote: siehe 5. Semester<br />
- Musik-, Bewegungs- Spiel- und Sprachgestaltung und<br />
Bildhaftes, plastisches Gestalten und Werken:<br />
siehe Hauptstudium unter “Angebote im Bereich Kultur- und<br />
Medienpädagogik”<br />
3102<br />
3101
Kompaktveranstaltungen<br />
- 152 -<br />
1. Kompaktveranstaltungen dürfen nur in der Zeit von Freitag 13.00 Uhr bis<br />
Samstag 18.00 Uhr stattfinden.<br />
2. Termine für Kompaktveranstaltungen werden vom Fachbereichsrat<br />
beschlossen; die konkreten Termine der einzelnen Kompaktveranstaltungen<br />
sind dem Fachbereich rechtzeitig mitzuteilen und von diesem<br />
zu koordinieren.<br />
Studienfahrten/Exkursionen (Senat vom 05.07.1990)<br />
6 Studienfahrten können diese Bezeichnung nur tragen, wenn sie unter<br />
Beteiligung von Dozenten (hauptamtlich Lehrenden oder Lehrbeauftragten)<br />
durchgeführt werden. Nur unter dieser Voraussetzung ist auch eine<br />
Bezuschussung seitens der Fachhochschule möglich.<br />
6 Studienfahrten finden im <strong>Grundstudium</strong> ausschließlich, im Hauptstudium in<br />
der Regel in der vorlesungsfreien Zeit statt.
- 153 -
- 154 -<br />
FACHBEREICH<br />
HEILPÄDAGOGIK<br />
HAUPTSTUDIUM
- 155 -<br />
Fachbereich Heilpädagogik Hauptstudium 5. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
A. Pflichtbereich<br />
Heilpädagogik als Handlungswissenschaft<br />
Heilpädagogik<br />
Soziale Integration und<br />
berufliche Eingliederung<br />
TN EFH: 5<br />
1 Std.<br />
Markowetz Do 8.00 - 8.45 2200<br />
Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der<br />
Weltgesundheitsorganisation (WHO) betont sehr stark den gesellschaftlichen Kontext, in dem<br />
Menschen mit Behinderungen leben, sowie ihre Möglichkeiten zu aktiver und selbstbestimmter<br />
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Diese sozialintegrative Zielsetzung findet ihren Ausdruck<br />
im neunten Buch “Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen” unserer<br />
Sozialgesetzgebung (SGB IX). Das integrative Paradigma verändert nachhaltig auch das System<br />
der sozialen und beruflichen Rehabilitation. Am Beispiel der beruflichen Eingliederung von<br />
Menschen mit geistiger Behinderung werden Möglichkeiten und Grenzen dieser tiefgreifenden<br />
Reform aufgezeigt und die veränderten Anforderungen an die Heilpädagogik kritisch diskutiert.<br />
ISAG<br />
Heilpädagogik<br />
Förderung und Begleitung<br />
im Alter<br />
TN<br />
EFH: 5<br />
1 Std.<br />
Menzen Mi 11.30 - 13.00<br />
14-täglich<br />
Beginn: 15.10.2003<br />
Wir werden uns fragen: Was Altern bedeutet in anthropologischer, physiologischer,<br />
neurologischer Hinsicht; wie Behinderung im Alter sich je anders zu zeigen vermag, jedenfalls<br />
nicht immer erschwerend; wie die Rahmenbedingungen eines Heims, ob Pflege- oder<br />
Behinderteneinrichtung, die traumatisierende Belastung einer Heimeinweisung mildern können;<br />
wie psychische Belastungen im Alter sich zeigen; schließlich welche Fördermaßnahmen im<br />
behinderten Alterungsprozess angelegen sind.<br />
Kinder- und Jugendpsychiatrie<br />
I<br />
2 Std.<br />
Albermann Fr 8.15 - 12.15<br />
10.10./07.11./<br />
21.11./05.12./<br />
16.01./30.01. + n.V.<br />
2300<br />
2300
- 156 -<br />
Fachbereich Heilpädagogik Hauptstudium 5. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Die Vorlesung vermittelt einen Überblick über die Besonderheiten kinder- und<br />
jugendpsychiatrischer Krankheitsbilder. In Orientierung am multiaxialen Klassifikationsschema<br />
wird die Mehrdimensionalität psychischer Störungen beschrieben. Anhand anschaulicher<br />
Fallbeispiele werden wichtige und häufig in der Praxis anzutreffende psychische Störungen des<br />
Kindesalters besonders dargestellt und diagnostische und therapeutische Methoden beschrieben<br />
(u.a. Aufmerksamkeitsstörungen, Einkoten, Autismus, Störungen des Sozialverhaltens,<br />
Angststörungen). Darüber hinaus werden Störungen des Säuglings- und Kleinkindalters (u.a.<br />
Schlafstörungen, exzessives Schreien) besprochen. Neben verhaltensbiologischen Grundlagen<br />
werden psychische Störungen auch unter systemischen und familiendynamischen<br />
Gesichtspunkten betrachtet. In der interdisziplinären Zusammenarbeit verschiedener<br />
Fachbereiche bei der Behandlung seelisch kranker und behinderter Kinder und Jugendlicher<br />
wird die grundlegende Funktion der Heilpädagogik besprochen.<br />
Interventionsformen in der Heilpädagogik<br />
Heilpädagogische<br />
Maßnahmen:<br />
Förder- und<br />
Bildungsbereich<br />
- Fortsetzung aus dem<br />
Sommersemester 2003 -<br />
HPF<br />
HPE<br />
HPES<br />
Bernhardt<br />
Kleiner<br />
Weiss<br />
Böttinger<br />
Markowetz<br />
Geiger<br />
Menzen<br />
n.V. n.V.
- 157 -<br />
Fachbereich Heilpädagogik Hauptstudium 5. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
HPF:<br />
Studierende, die mit Kindern oder Jugendlichen arbeiten, führen verantwortlich eine<br />
Heilpädagogische Entwicklungsförderung durch. Dazu gehören Hypothesenbildung und<br />
Zielformulierung nach Eingangs- und Prozessdiagnostik, Planung, Durchführung,<br />
Dokumentation, Reflexion und theoretische Fundierung der heilpädagogischen Angebote,<br />
regelmäßige Gespräche mit Eltern, Bezugspersonen und beteiligten Fachkräften, die aktive<br />
Teilnahme an der wöchentlichen Praxisberatung in der Kleingruppe sowie die Erstellung des<br />
Zwischen- und Abschlussberichtes.<br />
HPE:<br />
Studierende, die mit geistig behinderten Erwachsenen arbeiten, führen verantwortlich eine<br />
heilpädagogische Maßnahme im Bereich der Erwachsenenbildung durch. Diese Maßnahme kann<br />
für Einzelne oder Gruppen in Form separater, zielgruppenorientierter oder integrativer Kurse oder<br />
Projekte organisiert sein. Neben der Erfassung individueller Bildungsbedürfnisse der Adressaten<br />
gehören die Planung, prozessbegleitende Diagnostik, Durchführung, Dokumentation und<br />
Reflexion der Maßnahme zu den Aufgaben der Studierenden. Hinzukommen Gespräche mit<br />
relevanten Bezugspersonen sowie die regelmäßige Praxisbegleitung in Kleingruppen.<br />
HPES*:<br />
Welche Bedürfnisse haben alte Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung und<br />
welche Folgen haben die altersbedingten Veränderungen bei Ihnen?<br />
Wie ist demzufolge das Betreuungssystem inhaltlich und strukturell zu gestalten mit dem Ziel<br />
einer hohen Lebensqualität?<br />
Welche Bedürfnisse haben alte Menschen mit dementiellen Störungen, und welche Folgen<br />
haben die altersbedingten Veränderungen bei ihnen?<br />
* Studierende, die an der HPES-Gruppe teilnehmen, müssen im Wahlpflichtbereich im Fach<br />
“Fördermaßnahmen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene” die Lehrveranstaltung<br />
“Altern - Hilfs- und Fördermaßnahmen für Sozial- und Heilpädagogen” belegen.<br />
Einführung in die<br />
heilpädagogische<br />
Spieltherapie<br />
2 Std.<br />
Hensel<br />
Simon<br />
Beginn:<br />
23.01.04, 9.00 Uhr<br />
Ende:<br />
25.01.04, 16.00 Uhr<br />
Mitte Dez. 03<br />
Anfang Feb. 04 n.V.<br />
Als Interventionsform in der Heilpädagogik basiert die Heilpädagogische Spieltherapie trotz<br />
fehlender eigenständiger Konzeption im wesentlichen auf dem Menschenbild der so genannten<br />
Humanistischen Psychologie und hier ist sie insbesondere dem personzentrierten Ansatz nach<br />
Carl Rogers verwandt. Ausgehend von der Grundannahme, dass jedem Menschen die<br />
notwendigen (Selbstheilungs)kräfte innewohnen, die er/sie braucht, um psychische und<br />
Entwicklungsstagnation zu überwinden, wird dem Kind ein sicherer und bewertungsfeier Spielund<br />
Beziehungsraum angeboten, in dem “korrigierende Beziehungserfahrungen” mit der<br />
Heilpädagogin machen kann. Dabei bestimmt das Kind Art und Tempo der eigenen<br />
Auseinandersetzung mit seinen Problemen und Blockaden. Die Spielbegleiterin “arbeitet” derweil<br />
“an sich” und versucht in akzeptierender, einfühlender und echter Weise mit dem Kind in seiner<br />
Sprache, in der Regel dem Spiel, zu kommunizieren.<br />
2300
- 158 -<br />
Fachbereich Heilpädagogik Hauptstudium 5. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Beratung in Familien<br />
2 Std.<br />
Pielmaier Di 9.45 - 12.45<br />
14-täglich<br />
Beginn: 14.10.2003<br />
Die Veranstaltung begann im Sommersemester 2003. Sie soll die Bedeutung der Arbeit mit<br />
Familien in der heilpädagogischen Arbeit hervorheben, Hintergrundinformationen dazu<br />
vermitteln und das eigene Repertoire an Interventionsformen in Bezug auf Eltern, Familien und<br />
Gruppen erweitern.<br />
Themenschwerpunkte: Merkmale des Beratungsprozesses; Familien in ihren Grundstrukturen<br />
und Variationen; Familiendynamik; Familie im Wandel; Familie und Gesellschaft, Überblick über<br />
familientherapeutische Methoden und Einübung spezieller Techniken; Familien im sozialen<br />
Netzwerk unter Einbeziehung sozialpolitischer und rechtlicher Gesichtspunkte; Sucht und<br />
Missbrauch in der Familie.<br />
Organisation, Leitung und interdisziplinäre<br />
Zusammenarbeit<br />
Beratung in sozialen<br />
Institutionen<br />
2 Std.<br />
Stempel Fr 8.15 -12.45<br />
Termine:<br />
17.10.<br />
31.10<br />
14.11.<br />
28.11.<br />
12.12.<br />
09.01.<br />
16.01.<br />
Sowohl die vorhandenen Organisationsstrukturen der zu beratenden Organisation, als auch die<br />
aktuelle Teamzusammensetzung und die daraus resultierenden Themen haben einen<br />
entscheidenden Einfluss auf die Beratungssituation und Supervision in “sozialen Institutionen”.<br />
Im Seminar wird es darum gehen, unterschiedliche Beratungskonzepte und Methoden kennenund<br />
anwenden zu lernen.<br />
Konfliktberatung, Teamentwicklung und Organisationsentwicklung als sich ergänzende<br />
Beratungsaspekte im beraterischen Alltag zu verstehen um im konkreten Fall entscheiden zu<br />
können, wann wende ich was an, um im “Sinne der Organisation” handeln und beraten zu<br />
können.<br />
Die geschieht mit einem konkreten Blick auf die vorhandenen Praxiserfahrung der<br />
Teilnehmenden die in Form von ausgearbeiteten Referaten mit Praxisübungen vorgestellt<br />
werden.<br />
Referatsthemen werden zu Beginn der Veranstaltungsreihe vergeben.<br />
Management in sozialen<br />
Institutionen I<br />
- Grundlagen<br />
2 Std.<br />
2300<br />
2300<br />
Scherer Mo 17.30 - 19.00 2200
- 159 -<br />
Fachbereich Heilpädagogik Hauptstudium 5. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Recht II<br />
KJHG und Recht der<br />
Sozialen Sicherung<br />
2 Std.<br />
Winkler Mi 8.00 - 9.30 2200<br />
Die Vorlesung dient der Vermittlung von Grundkenntnissen im Kinder- und Jugendhilferecht und<br />
im Recht der sozialen Sicherung. In der Veranstaltung wird einerseits ein Überblick über den<br />
berechtigten Personenkreis und die Leistungen der einzelnen Zweige der sozialen Sicherung<br />
gegeben. Andererseits werden für die Heilpädagogik besonders bedeutsamen Sozialleistungen<br />
vertieft dargestellt.<br />
Literaturhinweise werden zu Beginn der Veranstaltung gegeben.<br />
Recht III:<br />
Verwaltungsrecht<br />
1 Std.<br />
Winkler Mo 11.30 - 13.00<br />
2. Semesterhälfte<br />
wöchentlich<br />
Die Vorlesung Verwaltungsrecht dient der Vermittlung von Grundkenntnissen insbesondere des<br />
Sozialverwaltungsrechts. Folgende Themen werden in der Vorlesung angesprochen: Begriff,<br />
Regelungsgegenstände und Aufgaben des Verwaltungsrechts, Rechtsquellen des<br />
Verwaltungsrechts, Grundsätze des Verwaltungsrechts, Ablauf des Verwaltungsverfahrens,<br />
Verwaltungsakt, öffentlich-rechtlicher Vertrag. Eine detaillierte Gliederung findet sich<br />
auf der Dozentenseite der Homepage des Fachbereiches Sozialarbeit der Fachhochschule. Die<br />
Veranstaltung wird im 8. Semester fortgeführt.<br />
Literaturhinweise werden zu Beginn der Veranstaltung gegeben.<br />
3000
- 160 -<br />
Fachbereich Heilpädagogik Hauptstudium 5. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
B. Wahlpflichtbereich<br />
Interventionsformen in der Heilpädagogik<br />
Fördermaßnahmen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene<br />
Diese Fächer gelten wahlweise auch für die Rubrik<br />
HEILPÄDAGOGISCHE THEMEN UND ARBEITSFORMEN<br />
Aktuelle Themen und Arbeitsmethoden aus dem Theorie- und Praxisfeld<br />
der Heilpädagogik (vgl. Fußnote 3 auf Seite 38 der StudPO)<br />
Wahrnehmungsförderung II<br />
2 Std.<br />
Weiss Di 8.00 - 9.30<br />
+ n.V.<br />
Weitere Ansätze der Wahrnehmungsförderung werden theoretisch und praktisch dargestellt,<br />
kritisch reflektiert und auf ihre Anwendbarkeit in heilpädagogischen Arbeitsfeldern überprüft.<br />
Jeux Dramatiques<br />
mit Erwachsenen - ein<br />
integratives Projekt<br />
TN: 8<br />
EFH: 4<br />
2 Std.<br />
Weiss 28./29.11.2003<br />
Vorbereitungstreffen<br />
an der KFH:<br />
Di 11.11.<br />
“ 18.11<br />
19.00-21.00 h<br />
Nachbereitungstreff:<br />
n.V.<br />
2300<br />
WFB<br />
Neuershausen<br />
Die Jeux Dramatiques sind eine Methode des freien Theaterspiels ohne eingeübte Rollen, ohne<br />
Auswendiglernen und ohne Proben. Als Spielvorlagen dienen Geschichten, Märchen, Gedichte,<br />
Liedtexte etc. Die wichtigsten Requisiten sind Tücher in allen Farben und Größen zum<br />
Verkleiden und Gestalten der Spielplätze. Im Vordergrund stehen das eigene Empfinden und die<br />
eigene Spielfreude, nicht das Erbringen von Leistungen. Wir werden gemeinsam ein integratives<br />
Wochenend-Projekt für Erwachsene mit geistiger Behinderung und für Studierende vorbereiten,<br />
erleben und reflektieren. Im Tun werden die methodischen Grundlagen erarbeitet und für die<br />
Zielgruppe spezifiziert. Die Teilnahme sowohl am Wochenende wie an den Vor- und<br />
Nachbereitungstreffen wird erwartet.<br />
Lit. u.a.: Weiss, Gabriele: Wenn die roten Katzen tanzen... Jeux Dramatiques für sozial- und<br />
heilpädagogische Berufe. <strong>Freiburg</strong> 1999<br />
2400
- 161 -<br />
Fachbereich Heilpädagogik Hauptstudium 5. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Jeux Dramatiques<br />
im Heilpäd. Hort<br />
TN: 8<br />
EFH: 4<br />
2 Std.<br />
Weiss Vorbereitungstreffen<br />
an der KFH:<br />
Dienstag, 14.10.,<br />
14.00 - 17.00 Uhr<br />
Die Jeux Dramatiques - Ausdrucksspiel aus dem Erleben - sind eine pädagogische Methode,<br />
Geschichten, Bilderbücher, Märchen zu spielen, ohne Texte zu lernen oder Requisiten zu bauen.<br />
Gemeinsam mit Kindern im Grundschulalter erleben wir bekannte und unbekannte Geschichten<br />
oder erfinden unsere eigenen Spiel-Texte. Studierende haben die Möglichkeit, die pädagogische<br />
Methode darüber hinaus in Reflexion und Planung theoretisch zu erfahren und sich<br />
Anwendungsmöglichkeiten in heil- und sozialpädagogischen Kinder- oder Erwachsenengruppen<br />
zu erarbeiten.<br />
Lit. u.a.: Weiss: Wenn die roten Katzen tanzen... <strong>Freiburg</strong> 1999<br />
Kunst- und<br />
gestaltungstherapeutische<br />
Arbeit von altersverwirrten<br />
Menschen an der<br />
Neurologischen Klinik<br />
Elzach<br />
TN: 4 (2 GS/2 HS)<br />
2 Std.<br />
Menzen Do 14.00 - 16.30<br />
Beginn: 16.10.2003<br />
Das Projekt betreut an mehreren Nachmittagen altersverwirrte Menschen. Die bildnerischorientierte<br />
Arbeit mit unterschiedlichen Materialien will Erinnerungsarbeit sein, will zu mehr<br />
Aufmerksamkeits-, Konzentrations- und Assoziationsfähigkeit animieren. Das Projekt wird von<br />
den Ärzten, Neuropsychologen und Ergotherapeuten der Klinik evaluiert.<br />
ISAG<br />
Einführung in die<br />
Kunsttherapie/<br />
Gestaltungspädagogik<br />
TN<br />
EFH: 50<br />
2 Std.<br />
Menzen Mi 18.00 - 21.00<br />
14-täglich<br />
Beginn: 22.10.2003<br />
2400<br />
2301<br />
Aula<br />
1100
- 162 -<br />
Fachbereich Heilpädagogik Hauptstudium 5. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Die Einführungsveranstaltung “Kunsttherapie/Gestaltungspädagogik” will in die verschiedenen<br />
Ansätze kunst- und gestaltungstherapeutischer Verfahren einführen.<br />
Im Mittelpunkt der Vorlesung werden Projekte stehen, die im heil- und sozialpädagogischen<br />
sowie sozialarbeiterischen Berufsfeld stattfanden. Wahrnehmungsgeschädigte, mental und<br />
altersverwirrte, verhaltensverunsicherte, d.h. selbstwert- und emotional gestörte, psychiatrisierte<br />
Menschen, - das sind Beispiele anhand deren kunst- und gestaltungspädagogische wie -<br />
therapeutische Maßnahmen gezeigt und theoretisch fundiert werden.<br />
Literatur: K.-H. Menzen: (Grundlagen der Kunsttherapie. UTB. München 2002.<br />
Musik(-therapie) in der.<br />
heilpädagogischen Arbeit<br />
mit geistigbehinderten<br />
Menschen<br />
Gemeinsames Angebot der<br />
Fachbereiche SozPäd.<br />
und HeilPäd.<br />
TN 12 (8 HP/4 SP)<br />
2 Std.<br />
Markowetz Do 9.45 - 11.15 2110<br />
Im Leben geistig behinderter Menschen spielt Musik eine große Bedeutung. Musik wird mit allen<br />
Sinnen wahrgenommen und wirkt therapeutisch. In vielerlei Hinsicht scheint sich das Sprichwort:<br />
„mit Musik geht alles besser!“ im pädagogischen wie therapeutischen Alltag zu bestätigen. Nicht<br />
zuletzt deshalb begegnet uns die Musik in allen heil- und sozialpädagogischen Handlungs- und<br />
Arbeitsfeldern. In dem Seminar geht es deshalb darum, sich dieser Zusammenhänge<br />
theoriegeleitet bewußt zu werden und die Musik als Lern- und Erfahrungsraum für Menschen mit<br />
geistiger Behinderung praktisch zu erfahren und didaktisch zu reflektieren.<br />
Zukunftskonferenzen -<br />
identitätsrelevanten Fragen<br />
und schwierigen<br />
Lebenssituationen<br />
behinderter Jugendlichen<br />
heilpädagogisch begegnen<br />
Gemeinsames Angebot der<br />
Fachbereiche SozPäd.<br />
und HeilPäd.<br />
TN: 16 (12 HP/4 SP)<br />
2 Std.<br />
Markowetz Do 11.30 - 13.00 2110
- 163 -<br />
Fachbereich Heilpädagogik Hauptstudium 5. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Auch aus behinderten Kindern werden Jugendliche. Sie kommen in die Pubertät und werden<br />
junge erwachsene Menschen. Die Anlässe, in denen sich behinderte Jugendliche �neu erleben�<br />
und �neu machen� werden häufiger, komplexer und damit auch schwieriger. Bisweilen lösen sie<br />
ernsthafte Krisen mit sehr vielfältigen Problemen aus. Erschwerend kommt hinzu, dass in dieser<br />
Lebensphase sehr weitreichende, lebensbiographische Entscheidungen zu treffen sind. Sowohl<br />
Eltern als auch Experten möchten deshalb helfen und zur Bewältigung dieser schwierigen<br />
Lebenslage beitragen. Aus systemischer Sicht haben sich bei der interaktionistischen Lösung<br />
solcher Probleme sog. „Zukunftskonferenzen“, als eine moderne, trialogorientierte<br />
Interventionsform in der Pädagogik bewährt. In dem Seminar werden wir uns mit diesem Ansatz<br />
in Theorie und Praxis beschäftigen und interdisziplinär über diese komplexe, nicht mittelbar<br />
wirksam werdende heilpädagogische Fördermaßnahme reflektieren.<br />
Päd.-therapeutische Maßnahmen für Kinder und Jugendliche<br />
Direktive pädagogischtherapeutische<br />
Verfahren<br />
Gemeinsames Angebot der<br />
Fachbereiche SozPäd.<br />
und HeilPäd.<br />
TN: 24 (18 HP/6 SP)<br />
2 Std.<br />
Pielmaier Do 11.30 - 13.00 2300<br />
Die Lehrveranstaltung dient dem Kennenlernen und Erproben direktiver Verfahren zur<br />
störungsspezifischen Arbeit mit emotional und verhaltensgestörten Kindern und Jugendlichen.<br />
Die Verfahren stammen überwiegend aus dem Bereich der Verhaltenstherapie und eignen sich<br />
im Ganzen oder in Teilen zur Kombination mit kindzentriertem, spieltherapeutischem Vorgehen.<br />
Unter anderem werden Trainingsverfahren für Kinder mit hyperkinetischem und oppositionellem<br />
Problemverhalten, Trainings mit Scheidungskindern, Adipositastrainings, Anti-Stress-Trainings<br />
unter die Lupe genommen und auf ihre Brauchbarkeit für Heil- und Sozialpädagogik hin<br />
überprüft. Die Arbeit im Seminar erfolgt in thematisch orientierten Kleingruppen. Die Bereitschaft<br />
zur aktiven Mitarbeit ist Voraussetzung für die Zulassung zum Seminar und die Erbringung einer<br />
Prüfungsleistung in Form einer Dokumentation.<br />
Grundkenntnisse in Verhaltenstherapie sind unabdingbar erforderlich.<br />
Einführung in die<br />
Hypnotherapie für Kinder<br />
und Jugendliche<br />
TN: 16<br />
2 Std.<br />
Pielmaier Fr 21.11.,13.00 Uhr<br />
bis Sa 22.11.,<br />
18.00 Uhr<br />
Fr 05.12., 13.00 Uhr<br />
bis Sa 06.12.,<br />
18.00 Uhr<br />
2300<br />
2300
- 164 -<br />
Fachbereich Heilpädagogik Hauptstudium 5. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Auf dem Gebiet der Behandlung von verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen haben sich<br />
in den vergangenen 20 Jahren zunehmend hypnotherapeutische Verfahren etabliert, die sich<br />
durch alters- und entwicklungsangemessene Vorgehensweisen auszeichnen. Durch<br />
therapeutische Geschichten, Metaphern, szenische Darstellungen und Rituale werden die<br />
Entwicklungs- und Selbstheilungskräfte der Kinder und Jugendlichen aktiviert und günstige<br />
Voraussetzungen für Problembearbeitungen geschaffen.<br />
Die Veranstaltung dient dem Kennenlernen und Erproben von Behandlungsbausteinen aus der<br />
Hypnotherapie zur Anwendung in der heilpädagogischen Arbeit. Dabei werden vor allem<br />
einfache hypnotherapeutische Verfahren demonstriert und erläutert, die anschließend in<br />
Selbsterfahrung und Rollenspiel erprobt werden können.<br />
Therapeutische<br />
Geschichten<br />
TN: 12<br />
2 Std.<br />
Weiss Do 17.00 - 20.00<br />
Beginn:<br />
siehe Aushang<br />
Geschichten, Märchen und Metaphern - einfach im Aufbau, magisch in der Handlung und<br />
poetisch in der Form - spielen zunehmend eine wichtige Rolle in heilpädagogischen<br />
Arbeitsfeldern, sei es in der Therapie und Förderung mit Kindern wie auch in der Therapie und<br />
Beratung mit Jugendlichen und Erwachsenen.<br />
Wir werden Geschichten entdecken und kennen lernen, die sich für die therapeutische Arbeit mit<br />
Kindern und Erwachsenen eignen, wir werden unsere eigenen Geschichten schreiben und sie<br />
uns gegenseitig erzählen. Wir werden Aufbauformen für therapeutische Geschichten kennen<br />
lernen, uns mit Metaphern, Ziel und Ressourcenorientierung und Reframing beschäftigen.<br />
Daneben werden wir unterschiedliche Anwendungsformen in den verschiedenen therapeutischen<br />
Richtungen vergleichen und damit experimentieren, wie Geschichten möglicherweise in unsere<br />
heilpädagogischen Therapieprozesse integrierbar sind.<br />
Heilpädagogische Themen und Arbeitsformen<br />
Aktuelle Themen und Arbeitsmethoden aus dem Theorie-<br />
und Praxisfeld der Heilpädagogik<br />
ISAG<br />
Sterbe- und<br />
Trauerbegleitung<br />
Kooperation mit RP<br />
TN: ca. 23 (8 HP, 15 RP)<br />
2 Std.<br />
Heusler Mo 14.00 - 17.15<br />
1. Semesterhälfte<br />
2400<br />
3301
- 165 -<br />
Fachbereich Heilpädagogik Hauptstudium 5. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Es gehört zur Wirklichkeit des menschlichen Lebens, dass es begrenzt und endlich ist. Wie jedes<br />
Leben ist auch jedes Sterben einmalig, einzigartig und braucht von daher individuelle Achtung<br />
und Aufmerksamkeit. Dennoch macht es Sinn, grundlegende Einsichten der Sterbe- und<br />
Trauerbegleitung kennen zu lernen, um in einer höchst unsicheren Situation etwas mehr<br />
Sicherheit erfahren zu können.<br />
Welche Bedürfnisse haben Sterbende und ihre Angehörigen? Welche besonderen Themen kann<br />
das Sterben junger, alter, chronisch kranker, geistig behinderter Menschen mit sich bringen?<br />
Welche Hilfestellungen gibt es für die Helfenden? Welche besonderen Fragen stellt die<br />
Begegnung mit Abschiednehmen und Sterben an das eigene Leben? Das Seminar lädt die<br />
Studierenden der Religionspädagogik und der Heilpädagogik ein, sich mit diesen und weiteren<br />
Fragen zu beschäftigen und auseinanderzusetzen.<br />
Einführung in die<br />
Montessoripädagogik und<br />
ihre Umsetzung heute<br />
2 Std.<br />
Arndt Di 18.00 - 21.00<br />
+ n.V.<br />
Maria Montessori - Wer ist das<br />
Prinzipien ihrer Pädagogik<br />
Praxisorientiertes Arbeiten zum Bereich Kinderhaus und Schule (bis 12 Jahre)<br />
ISAG<br />
Alte Menschen mit<br />
Behinderung<br />
Kooperation mit<br />
Soz.Arb./Pflege/RP/SP<br />
TN: 30 (SP 10, HP 10<br />
2 Std.<br />
Menzen<br />
Brandenburg<br />
Kompaktseminar:<br />
Do 19.02.04,<br />
10.00 - 18.00 Uhr<br />
Fr 20.02.04,<br />
10.00 - 18.00 Uhr<br />
Sa 21.02.04,<br />
9.00 - 12.00 Uhr<br />
Im Zentrum des Seminars steht der Zusammenhang von Altern und Behinderung. Wir wollen den<br />
Versuch unternehmen, das Thema "Altern und Behinderung" aus der Perspektive verschiedener<br />
Wissenschaften zu beleuchten. Nach einer Klärung dessen, was man unter Altern verstehen<br />
kann, werden wir das Thema von zwei Seiten angehen: Einerseits geht es um die<br />
gesundheitliche, soziale und psychische Situation von Menschen, die lebenslang mit einer<br />
körperlichen oder geistigen Behinderung gelebt haben und jetzt alt geworden sind. Andererseits<br />
geht es um ältere Menschen, die aufgrund spezifischer gesundheitlicher Beeinträchtigung (z.B.<br />
Demenz) im hohen Alter in erheblichem Umfang in ihrer Selbständigkeit eingeschränkt und auf<br />
die Unterstützung und Hilfe von Angehörigen und Professionellen angewiesen sind. Welche<br />
spezifischen Anforderungen stellen sich an eine heilpädagogische und pflegerische Beratung<br />
und Versorgung dieser Menschen? Mit welchen Konzeptionen können die Berufsgruppen auf<br />
diese Herausforderungen reagieren?<br />
2300<br />
3301
- 166 -<br />
Fachbereich Heilpädagogik Hauptstudium 5. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Psychologie für<br />
Sozialpädagogik<br />
Zuschauen hilft nicht -<br />
Verantwortung ist weltweit<br />
Gemeinsames Angebot der<br />
Fachbereiche SozPäd.<br />
und HeilPäd.<br />
max. 20 TN<br />
14 TN SozPäd<br />
6 TN HeilPäd<br />
2 Std.<br />
Ausgewählte Aspekte der<br />
klinischen Psychologie für<br />
die sozialpädagogische<br />
Praxis<br />
Gemeinsames Angebot der<br />
Fachbereiche SozPäd.<br />
und HeilPäd.<br />
max. 25 TN<br />
20 TN SozPäd<br />
5 TN HeilPäd<br />
2 Std.<br />
Veith Mo 16.30 - 19.00<br />
und n. V.<br />
3102<br />
Veith Mo 14.00 - 15.30 3202<br />
Wir beschäftigen uns in dieser Veranstaltung mit Epidemiologie, Diagnostik und Therapie<br />
ausgewählter Störungsbilder im Kindes- und Jugendalter, die im Arbeitsfeld der Sozialpädagogik<br />
von Bedeutung sind. Das Ziel der Veranstaltung ist es, diesbezügliche praxisrelevante<br />
psychologische und pädagogische Grundkenntnisse zu erarbeiten und damit zu einem sicheren<br />
professionellen Umgang sowohl mit den betroffenen Kindern/Jugendlichen und deren Eltern als<br />
auch mit anderen Berufsgruppen wie Ärzten und Psychologen zu gelangen.<br />
Ausgewählte Aspekte der<br />
Psychiatrie<br />
Gemeinsames Angebot der<br />
Fachbereiche SozPäd.<br />
und HeilPäd.<br />
max. 25 TN<br />
20 TN SozPäd<br />
5 TN HeilPäd<br />
2 Std.<br />
Effelsberg Do 11.30 - 13.00 3202
- 167 -<br />
Fachbereich Heilpädagogik Hauptstudium 5. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Nach einer Einführung in die aktuelle Krankheitslehre stellen die Teilnehmer/innen wichtige<br />
psychiatrische Krankheitsbilder in Referaten dar, wobei der Schwerpunkt auf der medizinischen<br />
Sicht liegt. Wir orientieren uns an dem didaktisch besonders geeigneten Lehrbuch von Möller et<br />
al. Besonders vertiefen wir die in der Vorlesung “Sozialmedizin” eingeführten<br />
sozialpsychiatrischen Aspekte. Videos, evtl. auch Exkursionen und Gastvorträge sollen einige<br />
Aspekte beispielhaft illustrieren. Wir stellen immer wieder aktuelle lokale und regionale Bezüge<br />
her.<br />
Reha- und<br />
Behindertenrecht<br />
Klie Do 11.00 - 13.00<br />
Ort:<br />
EFH<br />
Bugginger Str. 38<br />
Das Rehabilitationsrecht beschäftigt sich mit Fragen der gesundheitlichen Prävention und der<br />
Rehabilitation nach eingetretener Krankheit: (fast) alle BürgerInnen der Bundesrepublik werden<br />
im Laufe ihres Lebens Rehabilitationsleistungen in Anspruch nehmen. Das Behindertenrecht<br />
hingegen bezieht sich auf die Gruppe gehandicapter Menschen, sei es durch körperliche,<br />
geistige oder seelische Behinderung. Sie sind in vielfältiger Weise in ihren Rechten auf dem<br />
Arbeitsmarkt, in der Schule, in Wohnungsfragen, v.a. aber auch im öffentlichen Leben bedroht.<br />
Auch und besonders sie sind Empfänger von Rehabilitationsleistungen, zumeist ihr Leben lang.<br />
In der Veranstaltung werden die Grundlagen des Rehabilitationsrechts erarbeitet, soweit sie für<br />
die Soziale Arbeit von Bedeutung sind. Die aktuellen Änderungen des SGB IX<br />
(Rehabilitationsrecht) werden in besonderer Weise gewürdigt. Auch wird das Rehabilitationsrecht<br />
in seiner problematischen Segmentierung und in seiner begrenzten Wirkungskraft kritisch<br />
analysiert. Im Behindertenrecht stehen Fragen des Schwerbehindertenrechts, des<br />
Nachteilsausgleichs und der Lasten bei Pflegebedürftigkeit im Vordergrund. Das Projekt<br />
„Antidiskriminierungsgesetz“ der rot-grünen Bundesregierung wird diskutiert und die Gesetze, die<br />
besondere Schutzvorkehrungen für Behinderte vorsehen, etwa das Heimgesetz und die<br />
Werkstättenverordnung, werden erörtert.<br />
Die Veranstaltung richtet sich in besonderer Weise an Studierende aus den Schwerpunkten<br />
Gesundheit und Behinderung.<br />
Betreuungsrecht und Recht<br />
der Psychiatrie<br />
Klie Mo 8.00 - 10.00<br />
Ort:<br />
EFH<br />
Bugginger Str. 38
- 168 -<br />
Fachbereich Heilpädagogik Hauptstudium 5. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
2003 ist das Europäische Jahr der Behinderten. Auf Europäischer Ebene wurden die<br />
Grundrechte von Menschen mit Behinderungen und psychisch Kranken ausformuliert: Ihre<br />
Würde gilt es zu schützen und herzustellen, ihre Selbstbestimmung zu sichern und die Soziale<br />
Teilhabe zu eröffnen. Das Betreuungsrecht in Deutschland verfolgt genau diese Ziele. Über 1<br />
Million Menschen stehen derzeit unter gesetzlicher Betreuung oder haben einen gesetzlichen<br />
Betreuer zur Seite, 3 Millionen könnten es sein. Die Dunkelziffer von Menschen mit geistiger<br />
Behinderung, den Psychisch Kranken, einigen Körperbehinderten und der großen Zahl von<br />
hochbetagten Menschen etwa mit Demenz sind vielfältig. Das Feld des Betreuungswesens ist ein<br />
pflichtrelevantes für die Berufe der Sozialen Arbeit, sei es mit der Arbeit mit Freiwilligen<br />
gesetzlichen Betreuern, in der Beratung aber auch als Berufsbetreuer. In verschiedensten<br />
Feldern der Sozialen Arbeit, sei es Gesundheitswesen, in der Psychiatrie in der Arbeit mit geistig<br />
Behinderten ist das Betreuungsrecht und das Recht der psychisch Kranken relevant und die<br />
Lehrveranstaltung bietet eine gründliche Einführung in das Betreuungsrecht. Es wird Praxis und<br />
Fallorientiert gearbeitet und die Teilnehmer des Seminars sollen die verschiedenen Akteure im<br />
Betreuungswesen: Vormundschaftsrichter, Rechtspfleger, Berufsbetreuer, Betreuungsvereine,<br />
ihre Arbeitsbedingungen und Vorgehensweisen kennen lernen.<br />
Forum Soziale Altenarbeit<br />
in der Stadt <strong>Freiburg</strong> und<br />
Umgebung<br />
TN: 30-40<br />
Kricheldorff/<br />
Brandenburg<br />
Termine und<br />
Themen: s. Plakat<br />
zu Beginn des<br />
Semesters<br />
Im Rahmen dies regelmäßig stattfindenden Forums werden aktuelle Themen aus dem Berufsfeld<br />
der Sozialen Altenarbeit aufgegriffen. Nach einer inhaltlichen Einführung in das Thema wird<br />
dieses in einem intensiven Theorie-Praxis-Dialog vertieft und aus unterschiedlichen Blickwinkeln<br />
beleuchtet.<br />
Über die inhaltliche Schwerpunktsetzung und die genauen Themen sowie die Termine des<br />
Wintersemesters 2003/04, wird über einen Plakataushang zu Beginn des Semesters informiert<br />
werden. Die Veranstaltungen sind offen für alle Vertreter der Fachpraxis und interessierte<br />
Studierende aller Fachbereiche. Das Forum ist darüber hinaus auch eine Informationsplattform<br />
über Fort- und Weiterbildungsangebote, Tagungen und neue Literatur.<br />
Binationales Seminar<br />
s. Fachbereich<br />
Sozialarbeit<br />
Kommentar:<br />
s. Fachbereich Sozialarbeit<br />
s.<br />
Fachbereich<br />
Sozialarbeit<br />
Vorbereitungsseminar/<br />
Vorbesprechung:<br />
s. Aushang<br />
s. Fachbereich<br />
Sozialarbeit
- 169 -<br />
Fachbereich Heilpädagogik Hauptstudium 5. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Einführungsseminar in die<br />
“Regio-Akademie”<br />
Spiegelberg/<br />
Weiss<br />
Zeit wird<br />
rechtzeitig durch<br />
Aushang bekannt<br />
gegeben !<br />
Das Projekt “Regio-Akademie für soziale Arbeit” ist ein Gemeinschaftsprojekt der in RECOS<br />
zusammengeschlossenen Ausbildungsstätten für Sozialarbeit, Sozialpädagogik und<br />
Heilpädagogik in Mulhouse, Strasbourg, Basel sowie an der EFH <strong>Freiburg</strong>. Im Rahmen dieses<br />
Projekts besteht die Möglichkeit, über ein Zusatzlehrprogramm interkulturelle Kompetenzen zur<br />
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu erwerben. Über die erfolgreiche Teilnahme in diesem<br />
Programm wird am Ende ein Zertifikat in deutscher und französischer Sprache ausgestellt. -<br />
Themen des Einführungsseminars werden sein: Einführung in Anliegen und Struktur des<br />
Zusatzlehrprogramms; Ausbildungssysteme zu sozialen Berufen in den drei Ländern;<br />
sozialrelevante Aspekte zur Situation in der Regio; soziale Dienst-leistungssysteme in Elsass,<br />
Nordschweiz und Südbaden; Grundstruktur der sozialen Sicherheit in den drei Ländern.<br />
Kultur- und Medienpädagogik<br />
Musik-, Bewegungs-, Spiel- und Sprachgestaltung und/oder<br />
Bildhaftes, plastisches Gestalten und Werken<br />
siehe:<br />
“Hauptstudium: Zusammenfassung der Angebote im Medienbereich”
- 170 -<br />
Fachbereich Heilpädagogik Hauptstudium 7. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
A. Pflichtbereich<br />
Heilpädagogik als Handlungswissenschaft<br />
Heilpädagogik<br />
- Heilpädagogik in der<br />
stationären Jugendhilfe<br />
2 Std.<br />
Blasel Beginn:<br />
14.11., 13.00 Uhr<br />
Ende:<br />
15.11., 18.00 Uhr<br />
Beginn:<br />
28.11., 13.00 Uhr<br />
Ende:<br />
29.11., 18.00 Uhr<br />
Grundprobleme und typische Konstellationen aus der Jugendhilfe werden in dieser<br />
Lehrveranstaltung vorgestellt und auf dem Hintergrund systemischer Theorien diskutiert.<br />
Stationäre und teilstationäre Jugendhilfe begegnet uns in komplexen Arbeitsfeldern, welche<br />
jeweils sorgfältig analysiert werden müssen. Qualifiziertes Fachwissen zu haben reicht in<br />
komplizierten Berufsfeldern alleine oft nicht aus. Therapeutische Ansätze, Hilfen,<br />
Beratungsstrategien oder Fördermaßnahmen in unübersichtlichen Kontexten erfolgreich<br />
einzusetzen, ist eine ganz andere, weitere Herausforderung. Vorgehensweisen werden<br />
erarbeitet und diskutiert, die helfen, sich im “Labyrinth der Jugendhilfe, nicht zu verlaufen”,<br />
sondern um dort heilpädagogisch erfolgreich zu arbeiten.<br />
Heilpädagogik<br />
- Arbeit mit mehrfach<br />
belasteten Familien<br />
1 Std.<br />
Danzeisen/<br />
Skorski-<br />
Spielmann<br />
23.01.04<br />
Beginn: 13.00 Uhr<br />
24.01.04<br />
Ende: 16.30 Uhr<br />
In der Arbeit mit “mehrfach belasteten Familien” ist es wichtig, mit der Familie realistische und<br />
erreichbare Entwicklungsziele zu erarbeiten und die dafür passenden und erforderlichen<br />
Unterstützungsmaßnahmen zu finden. Um die Familien für die Hilfsmöglichkeiten zu modifizieren<br />
und ihre Mitarbeit zu sichern, ist es notwendig, ihre Ressourcen zu erkennen und in den<br />
Vordergrund zu stellen. Dies ist für die pädagogisch-therapeutische Begleitung eine große<br />
Herausforderung und bedarf seitens der Fachkräfte einer besonderen Haltung, Vorgehensweise<br />
und intensiver Kooperation mit dem Netzwerk. Das Seminar wird sich mit diesen Themen<br />
anhand von Theorie, Fallbeispielen und praktischen Übungen befassen.<br />
Waltraud Danzeisen, Dipl.-Sozialarbeiterin/FH; Angelika Skorski-Spielmann, Dipl.-<br />
Heilpädagogin/FH<br />
Kinder- und Jugendpsychiatrie<br />
II<br />
2 Std.<br />
Simon<br />
u.a.<br />
2300<br />
2300<br />
2200<br />
Di 9.45 - 11.15 2200
- 171 -<br />
Fachbereich Heilpädagogik Hauptstudium 7. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Im Sinne eines “Kinder- und Jugendpsychiatrischen Bilderbuches” sollen ausgewählte<br />
Störungsbilder (z.B. Mutismus, Schulphobien, psychosomatische Erkrankungen im Kindes- und<br />
Jugendalter) anhand von Kasuistiken unter Einbezug systemischer und psychodynamischer<br />
Aspekte vertieft betrachtet werden. Niedergelassene Kinder- und Jugendpsychiater werden im<br />
Rahmen von Gastvorlesungen zu verschiedenen psychiatrischen Erkrankungen aus ihrer Arbeit<br />
berichten.<br />
Das Seminar dient der Vertiefung des in der Vorlesung Kinder- und Jugendpsychiatrie I<br />
erworbenen Wissens.<br />
Interventionsformen in der Heilpädagogik<br />
Heilpädagogische<br />
Maßnahmen:<br />
Pädagogischtherapeutischer<br />
Bereich<br />
Freudling<br />
Kratz-<br />
Bosbach<br />
Pielmaier<br />
Simon<br />
Skorski-<br />
Spielmann<br />
Stehle-<br />
Remer<br />
n.V. n.V.<br />
Die Studierenden führen verantwortlich eine Heilpädagogische Spieltherapie mit einem Kind in<br />
Verbindung mit Beratungsgesprächen mit dessen Bezugspersonen durch. Wöchentliche<br />
Praxisberatung in einer Kleingruppe ist integraler Bestandteil. Die Durchführung der Behandlung<br />
und Gespräche ist zu dokumentieren und zu reflektieren hinsichtlich der individuellen Kind- und<br />
Elternproblematiken mit Erklärungshypothesen, Zielformulierungen, pädagogischtherapeutischen<br />
Interventionen im Therapieprozess. Einbezogen sind Aspekte der<br />
klientzentrieren Selbsterfahrung.<br />
Organisation, Leitung und interdisziplinäre Zusammenarbeit<br />
Management in soz.<br />
Institutionen I<br />
Grundlagen<br />
2 Std.<br />
Management in soz.<br />
Institutionen II<br />
Personalentwicklung<br />
2 Std.<br />
Späth Fr 8.00-12.00<br />
Termine:<br />
10.10./17.10./31.10./<br />
21.11./05.12./19.12.<br />
Mahler Fr 8.00-12.45<br />
Termine:<br />
24.10./14.11./28.11./<br />
12.12./16.01.<br />
2200<br />
2200
- 172 -<br />
Fachbereich Heilpädagogik Hauptstudium 7. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
B. Wahlpflichtbereich<br />
Päd.-therapeutische Maßnahmen für Kinder und Jugendliche<br />
Diese Fächer gelten wahlweise auch für die Rubrik<br />
HEILPÄDAGOGISCHE THEMEN UND ARBEITSFORMEN<br />
Aktuelle Themen und Arbeitsmethoden aus dem Theorie- und<br />
Praxisfeld der Heilpädagogik (vgl. Fußnote 3 auf Seite 38 der<br />
StudPO)<br />
Direktive pädagogischtherapeutische<br />
Verfahren<br />
Gemeinsames Angebot<br />
der<br />
Fachbereiche HeilPäd und<br />
SozPäd<br />
TN: 24<br />
(18 HP, 6 SP)<br />
2 Std.<br />
Pielmaier Do 11.30 - 13.00 2300<br />
Die Lehrveranstaltung dient dem Kennenlernen und Erproben direktiver Verfahren zur<br />
störungsspezifischen Arbeit mit emotional und verhaltensgestörten Kindern und Jugendlichen.<br />
Die Verfahren stammen überwiegend aus dem Bereich der Verhaltenstherapie und eignen sich<br />
im Ganzen oder in Teilen zur Kombination mit kindzentriertem, spieltherapeutischem Vorgehen.<br />
Unter anderem werden Trainingsverfahren für Kinder mit hyperkinetischem und oppositionellem<br />
Problemverhalten, Trainings mit Scheidungskindern, Adipositastrainings, Anti-Stress-Trainings<br />
unter die Lupe genommen und auf ihre Brauchbarkeit für Heil- und Sozialpädagogik hin<br />
überprüft. Die Arbeit im Seminar erfolgt in thematisch orientierten Kleingruppen. Die Bereitschaft<br />
zur aktiven Mitarbeit ist Voraussetzung für die Zulassung zum Seminar und die Erbringung einer<br />
Prüfungsleistung in Form einer Dokumentation.<br />
Grundkenntnisse in Verhaltenstherapie sind unabdingbar erforderlich.<br />
Einführung in die<br />
Hypnotherapie für Kinder<br />
und Jugendliche<br />
TN: 16<br />
2 Std.<br />
Pielmaier Fr 21.11., 13.00 Uhr<br />
bis Sa. 22.11.,<br />
18.00 Uhr<br />
Fr 05.12., 13.00 Uhr<br />
bis Sa 06.12.,<br />
18.00 Uhr<br />
2300<br />
2300
- 173 -<br />
Fachbereich Heilpädagogik Hauptstudium 7. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Auf dem Gebiet der Behandlung von verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen haben sich<br />
in den vergangenen 20 Jahren zunehmend hypnotherapeutische Verfahren etabliert, die sich<br />
durch alters- und entwicklungsangemessene Vorgehensweisen auszeichnen. Durch<br />
therapeutische Geschichten, Metaphern, szenische Darstellungen und Rituale werden die<br />
Entwicklungs- und Selbstheilungskräfte der Kinder und Jugendlichen aktiviert und günstige<br />
Voraussetzungen für Problembearbeitungen geschaffen.<br />
Die Veranstaltung dient dem Kennenlernen und Erproben von Behandlungsbausteinen aus der<br />
Hypnotherapie zur Anwendung in der heilpädagogischen Arbeit. Dabei werden vor allem<br />
einfache hypnotherapeutische Verfahren demonstriert und erläutert, die anschließend in<br />
Selbsterfahrung und Rollenspiel erprobt werden können.<br />
Kinderpsychodrama<br />
TN : 12<br />
2 Std.<br />
Weiss Fr 17.10., 13.00 Uhr<br />
bis Sa 18.10.,<br />
18.00 Uhr<br />
Fr 24.10., 13.00 Uhr<br />
bis Sa 25.10.,<br />
18.00 Uhr<br />
Im Seminar werden wir Grundlagen des Kinderpsychodramas als gruppentherapeutische<br />
Methode theoretisch und praktisch kennen lernen. Im Verlauf des Semesters werden wir auch<br />
den Transfer einzelner methodischer Elemente in das einzeltherapeutische Konzept der<br />
Heilpädagogischen Spieltherapie erarbeiten.<br />
Das Seminar setzt die Bereitschaft zum aktiven Spielen und zur persönlichen Reflexion voraus,<br />
ebenso die Möglichkeit zur regelmäßigen Teilnahme.<br />
Therapeutische<br />
Geschichten<br />
TN: 12<br />
2 Std.<br />
Weiss Do 17.00 - 20.00<br />
Beginn:<br />
siehe Aushang<br />
Geschichten, Märchen und Metaphern - einfach im Aufbau, magisch in der Handlung und<br />
poetisch in der Form - spielen zunehmend eine wichtige Rolle in heilpädagogischen<br />
Arbeitsfeldern, sei es in der Therapie und Förderung mit Kindern wie auch in der Therapie und<br />
Beratung mit Jugendlichen und Erwachsenen.<br />
Wir werden Geschichten entdecken und kennen lernen, die sich für die therapeutische Arbeit mit<br />
Kindern und Erwachsenen eignen, wir werden unsere eigenen Geschichten schreiben und sie<br />
uns gegenseitig erzählen. Wir werden Aufbauformen für therapeutische Geschichten kennen<br />
lernen, uns mit Metaphern, Ziel und Ressourcenorientierung und Reframing beschäftigen.<br />
Daneben werden wir unterschiedliche Anwendungsformen in den verschiedenen<br />
therapeutischen Richtungen vergleichen und damit experimentieren, wie Geschichten<br />
möglicherweise in unsere heilpädagogischen Therapieprozesse integrierbar sind.<br />
2400<br />
2400<br />
2400
- 174 -<br />
Fachbereich Heilpädagogik Hauptstudium 7. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Heilpädagogische Themen und Arbeitsformen<br />
Aktuelle Themen und Arbeitsmethoden aus dem Theorie-<br />
und Praxisfeld der Heilpädagogik<br />
s. Angebote: 5. Semester<br />
Kultur- und Medienpädagogik<br />
Musik-, Bewegungs-, Spiel- und Sprachgestaltung und/oder<br />
Bildhaftes, plastisches Gestalten und Werken<br />
siehe:<br />
“Hauptstudium: Zusammenfassung der Angebote im Medienbereich”
- 175 -<br />
FACHBEREICH<br />
HEILPÄDAGOGIK<br />
AUFBAUSTUDIUM
- 176 -<br />
Fachbereich Heilpädagogik Aufbaustudium 2. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
A. Pflichtbereich<br />
Heilpädagogik als Handlungswissenschaft<br />
Heilpädagogik<br />
Soziale Integration und<br />
berufliche Eingliederung<br />
TN EFH: 5<br />
1 Std.<br />
Markowetz Do 8.00 - 8.45 2200<br />
Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der<br />
Weltgesundheitsorganisation (WHO) betont sehr stark den gesellschaftlichen Kontext, in dem<br />
Menschen mit Behinderungen leben, sowie ihre Möglichkeiten zu aktiver und selbstbestimmter<br />
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Diese sozialintegrative Zielsetzung findet ihren Ausdruck<br />
im neunten Buch “Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen” unserer<br />
Sozialgesetzgebung (SGB IX). Das integrative Paradigma verändert nachhaltig auch das System<br />
der sozialen und beruflichen Rehabilitation. Am Beispiel der beruflichen Eingliederung von<br />
Menschen mit geistiger Behinderung werden Möglichkeiten und Grenzen dieser tiefgreifenden<br />
Reform aufgezeigt und die veränderten Anforderungen an die Heilpädagogik kritisch diskutiert.<br />
ISAG<br />
Heilpädagogik<br />
Förderung und Begleitung<br />
im Alter<br />
TN<br />
EFH: 5<br />
1 Std.<br />
Menzen Mi 11.30 - 13.00<br />
14-täglich<br />
Beginn: 15.10.2003<br />
Wir werden uns fragen: Was Altern bedeutet in anthropologischer, physiologischer,<br />
neurologischer Hinsicht; wie Behinderung im Alter sich je anders zu zeigen vermag, jedenfalls<br />
nicht immer erschwerend; wie die Rahmenbedingungen eines Heims, ob Pflege- oder<br />
Behinderteneinrichtung, die traumatisierende Belastung einer Heimeinweisung mildern können;<br />
wie psychische Belastungen im Alter sich zeigen; schließlich welche Fördermaßnahmen im<br />
behinderten Alterungsprozess angelegen sind.<br />
Kinder- und Jugendpsychiatrie<br />
I<br />
2 Std.<br />
Albermann Fr 8.15-12.15<br />
Termine:<br />
10.10./07.11./21.11.<br />
05.12./16.01./30.01.<br />
+ n. V.<br />
2300<br />
2300
- 177 -<br />
Fachbereich Heilpädagogik Aufbaustudium 2. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Die Vorlesung vermittelt einen Überblick über die Besonderheiten kinder- und<br />
jugendpsychiatrischer Krankheitsbilder. In Orientierung am multiaxialen Klassifikationsschema<br />
wird die Mehrdimensionalität psychischer Störungen beschrieben. Anhand anschaulicher<br />
Fallbeispiele werden wichtige und häufig in der Praxis anzutreffende psychische Störungen des<br />
Kindesalters besonders dargestellt und diagnostische und therapeutische Methoden beschrieben<br />
(u.a. Aufmerksamkeitsstörungen, Einkoten, Autismus, Störungen des Sozialverhaltens,<br />
Angststörungen). Darüber hinaus werden Störungen des Säuglings- und Kleinkindalters (u.a.<br />
Schlafstörungen, exzessives Schreien) besprochen. Neben verhaltensbiologischen Grundlagen<br />
werden psychische Störungen auch unter systemischen und familiendynamischen<br />
Gesichtspunkten betrachtet. In der interdisziplinären Zusammenarbeit verschiedener<br />
Fachbereiche bei der Behandlung seelisch kranker und behinderter Kinder und Jugendlicher<br />
wird die grundlegende Funktion der Heilpädagogik besprochen.<br />
Interventionsformen in der Heilpädagogik<br />
Heilpädagogische<br />
Maßnahmen:<br />
Förder- und<br />
Bildungsbereich<br />
- Fortsetzung aus dem<br />
Sommersemester 2003 -<br />
HPF<br />
HPE<br />
HPES<br />
Bernhardt<br />
Kleiner<br />
Weiss<br />
Böttinger<br />
Markowetz<br />
Geiger<br />
Menzen<br />
n.V. n.V.
- 178 -<br />
Fachbereich Heilpädagogik Aufbaustudium 2. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
HPF:<br />
Studierende, die mit Kindern oder Jugendlichen arbeiten, führen verantwortlich eine<br />
Heilpädagogische Entwicklungsförderung durch. Dazu gehören Hypothesenbildung und<br />
Zielformulierung nach Eingangs- und Prozessdiagnostik, Planung, Durchführung,<br />
Dokumentation, Reflexion und theoretische Fundierung der heilpädagogischen Angebote,<br />
regelmäßige Gespräche mit Eltern, Bezugspersonen und beteiligten Fachkräften, die aktive<br />
Teilnahme an der wöchentlichen Praxisberatung in der Kleingruppe sowie die Erstellung des<br />
Zwischen- und Abschlussberichtes.<br />
HPE:<br />
Studierende, die mit geistig behinderten Erwachsenen arbeiten, führen verantwortlich eine<br />
heilpädagogische Maßnahme im Bereich der Erwachsenenbildung durch. Diese Maßnahme kann<br />
für Einzelne oder Gruppen in Form separater, zielgruppenorientierter oder integrativer Kurse oder<br />
Projekte organisiert sein. Neben der Erfassung individueller Bildungsbedürfnisse der Adressaten<br />
gehören die Planung, prozessbegleitende Diagnostik, Durchführung, Dokumentation und<br />
Reflexion der Maßnahme zu den Aufgaben der Studierenden. Hinzukommen Gespräche mit<br />
relevanten Bezugspersonen sowie die regelmäßige Praxisbegleitung in Kleingruppen.<br />
HPES*:<br />
Welche Bedürfnisse haben alte Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung und<br />
welche Folgen haben die altersbedingten Veränderungen bei Ihnen?<br />
Wie ist demzufolge das Betreuungssystem inhaltlich und strukturell zu gestalten mit dem Ziel<br />
einer hohen Lebensqualität?<br />
Welche Bedürfnisse haben alte Menschen mit dementiellen Störungen, und welche Folgen<br />
haben die altersbedingten Veränderungen bei ihnen?<br />
* Studierende, die an der HPES-Gruppe teilnehmen, müssen im Wahlpflichtbereich im Fach<br />
“Fördermaßnahmen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene” die Lehrveranstaltung<br />
“Altern - Hilfs- und Fördermaßnahmen für Sozial- und Heilpädagogen” belegen.<br />
Einführung in die<br />
heilpädagogische<br />
Spieltherapie<br />
2 Std.<br />
Hensel<br />
Simon<br />
Beginn:<br />
23.01.04, 9.00 Uhr<br />
Ende:<br />
25.01.04, 16.00 Uhr<br />
Mitte Dez. 03<br />
Anfang Feb. 04 n.V.<br />
Als Interventionsform in der Heilpädagogik basiert die Heilpädagogische Spieltherapie trotz<br />
fehlender eigenständiger Konzeption im wesentlichen auf dem Menschenbild der so genannten<br />
Humanistischen Psychologie und hier ist sie insbesondere dem personzentrierten Ansatz nach<br />
Carl Rogers verwandt. Ausgehend von der Grundannahme, dass jedem Menschen die<br />
notwendigen (Selbstheilungs)kräfte innewohnen, die er/sie braucht, um psychische und<br />
Entwicklungsstagnation zu überwinden, wird dem Kind ein sicherer und bewertungsfeier Spielund<br />
Beziehungsraum angeboten, in dem “korrigierende Beziehungserfahrungen” mit der<br />
Heilpädagogin machen kann. Dabei bestimmt das Kind Art und Tempo der eigenen<br />
Auseinandersetzung mit seinen Problemen und Blockaden. Die Spielbegleiterin “arbeitet” derweil<br />
“an sich” und versucht in akzeptierender, einfühlender und echter Weise mit dem Kind in seiner<br />
Sprache, in der Regel dem Spiel, zu kommunizieren.<br />
2300
- 179 -<br />
Fachbereich Heilpädagogik Aufbaustudium 2. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Beratung in Familien<br />
2 Std.<br />
Pielmaier Di 9.45 - 12.45<br />
14-täglich<br />
Beginn: 14.10.2003<br />
Die Veranstaltung begann im Sommersemester 2003. Sie soll die Bedeutung der Arbeit mit<br />
Familien in der heilpädagogischen Arbeit hervorheben, Hintergrundinformationen dazu<br />
vermitteln und das eigene Repertoire an Interventionsformen in Bezug auf Eltern, Familien und<br />
Gruppen erweitern.<br />
Themenschwerpunkte: Merkmale des Beratungsprozesses; Familien in ihren Grundstrukturen<br />
und Variationen; Familiendynamik; Familie im Wandel; Familie und Gesellschaft, Überblick über<br />
familientherapeutische Methoden und Einübung spezieller Techniken; Familien im sozialen<br />
Netzwerk unter Einbeziehung sozialpolitischer und rechtlicher Gesichtspunkte; Sucht und<br />
Missbrauch in der Familie.<br />
Organisation, Leitung und interdisziplinäre<br />
Zusammenarbeit<br />
Beratung in sozialen<br />
Institutionen<br />
2 Std.<br />
Stempel Fr 8.15 -12.45<br />
Termine:<br />
17.10./31.10./14.11.<br />
28.11./12.12./09.01.<br />
16.01.<br />
Sowohl die vorhandenen Organisationsstrukturen der zu beratenden Organisation, als auch die<br />
aktuelle Teamzusammensetzung und die daraus resultierenden Themen haben einen<br />
entscheidenden Einfluss auf die Beratungssituation und Supervision in “sozialen Institutionen”.<br />
Im Seminar wird es darum gehen, unterschiedliche Beratungskonzepte und Methoden kennenund<br />
anwenden zu lernen.<br />
Konfliktberatung, Teamentwicklung und Organisationsentwicklung als sich ergänzende<br />
Beratungsaspekte im beraterischen Alltag zu verstehen um im konkreten Fall entscheiden zu<br />
können, wann wende ich was an, um im “Sinne der Organisation” handeln und beraten zu<br />
können.<br />
Die geschieht mit einem konkreten Blick auf die vorhandenen Praxiserfahrung der<br />
Teilnehmenden die in Form von ausgearbeiteten Referaten mit Praxisübungen vorgestellt<br />
werden.<br />
Referatsthemen werden zu Beginn der Veranstaltungsreihe vergeben.<br />
Management in sozialen<br />
Institutionen I- Grundlagen<br />
2 Std.<br />
2300<br />
2300<br />
Scherer Mo 17.30 - 19.00 2200
- 180 -<br />
Fachbereich Heilpädagogik Aufbaustudium 2. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Recht II<br />
KJHG und Recht der<br />
Sozialen Sicherung<br />
2 Std.<br />
Winkler Mi 8.00 - 9.30 2200<br />
Die Vorlesung dient der Vermittlung von Grundkenntnissen im Kinder- und Jugendhilferecht und<br />
im Recht der sozialen Sicherung. In der Veranstaltung wird einerseits ein Überblick über den<br />
berechtigten Personenkreis und die Leistungen der einzelnen Zweige der sozialen Sicherung<br />
gegeben. Andererseits werden für die Heilpädagogik besonders bedeutsamen Sozialleistungen<br />
vertieft dargestellt.<br />
Literaturhinweise werden zu Beginn der Veranstaltung gegeben.<br />
Recht III:<br />
Verwaltungsrecht<br />
1 Std.<br />
Winkler Mo 11.30 - 13.00<br />
2. Semesterhälfte<br />
wöchentlich<br />
Die Vorlesung Verwaltungsrecht dient der Vermittlung von Grundkenntnissen insbesondere des<br />
Sozialverwaltungsrechts. Folgende Themen werden in der Vorlesung angesprochen: Begriff,<br />
Regelungsgegenstände und Aufgaben des Verwaltungsrechts, Rechtsquellen des<br />
Verwaltungsrechts, Grundsätze des Verwaltungsrechts, Ablauf des Verwaltungsverfahrens,<br />
Verwaltungsakt, öffentlich-rechtlicher Vertrag. Eine detaillierte Gliederung findet sich<br />
auf der Dozentenseite der Homepage des Fachbereiches Sozialarbeit der Fachhochschule. Die<br />
Veranstaltung wird im 8. Semester fortgeführt.<br />
Literaturhinweise werden zu Beginn der Veranstaltung gegeben.<br />
3000
- 181 -<br />
Fachbereich Heilpädagogik Aufbaustudium 2. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
B. Wahlpflichtbereich<br />
Interventionsformen in der Heilpädagogik<br />
Fördermaßnahmen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene<br />
Diese Fächer gelten wahlweise auch für die Rubrik<br />
HEILPÄDAGOGISCHE THEMEN UND ARBEITSFORMEN<br />
Aktuelle Themen und Arbeitsmethoden aus dem Theorie- und Praxisfeld<br />
der Heilpädagogik (vgl. Fußnote 3 auf Seite 86 der StudPO)<br />
Wahrnehmungsförderung II<br />
2 Std.<br />
Weiss Di 8.00 - 9.30<br />
+ n.V.<br />
Weitere Ansätze der Wahrnehmungsförderung werden theoretisch und praktisch dargestellt,<br />
kritisch reflektiert und auf ihre Anwendbarkeit in heilpädagogischen Arbeitsfeldern überprüft.<br />
Jeux Dramatiques<br />
mit Erwachsenen - ein<br />
integratives Projekt<br />
TN: 8<br />
EFH: 4<br />
2 Std.<br />
Weiss 28./29.11.03<br />
Vorbereitungstreffen<br />
an der KFH:<br />
Di 11.11.<br />
“ 18.11<br />
19.00-21.00 Uhr<br />
Nachbereitungstreff:<br />
n.V.<br />
Die Jeux Dramatiques sind eine Methode des freien Theaterspiels ohne eingeübte Rollen, ohne<br />
Auswendiglernen und ohne Proben. Als Spielvorlagen dienen Geschichten, Märchen, Gedichte,<br />
Liedtexte etc. Die wichtigsten Requisiten sind Tücher in allen Farben und Größen zum<br />
Verkleiden und Gestalten der Spielplätze. Im Vordergrund stehen das eigene Empfinden und die<br />
eigene Spielfreude, nicht das Erbringen von Leistungen. Wir werden gemeinsam ein integratives<br />
Wochenend-Projekt für Erwachsene mit geistiger Behinderung und für Studierende vorbereiten,<br />
erleben und reflektieren. Im Tun werden die methodischen Grundlagen erarbeitet und für die<br />
Zielgruppe spezifiziert. Die Teilnahme sowohl am Wochenende wie an den Vor- und<br />
Nachbereitungstreffen wird erwartet.<br />
Lit. u.a.: Weiss, Gabriele: Wenn die roten Katzen tanzen... Jeux Dramatiques für sozial- und<br />
heilpädagogische Berufe. <strong>Freiburg</strong> 1999<br />
2300<br />
2400
- 182 -<br />
Fachbereich Heilpädagogik Aufbaustudium 2. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Jeux Dramatiques<br />
im Heilpäd. Hort<br />
TN: 8<br />
EFH: 4<br />
2 Std.<br />
Weiss Vorbereitungstreffen<br />
an der KFH:<br />
Dienstag, 14.10.,<br />
14.00 - 17.00 Uhr<br />
Die Jeux Dramatiques - Ausdrucksspiel aus dem Erleben - sind eine pädagogische Methode,<br />
Geschichten, Bilderbücher, Märchen zu spielen, ohne Texte zu lernen oder Requisiten zu<br />
bauen.<br />
Gemeinsam mit Kindern im Grundschulalter erleben wir bekannte und unbekannte Geschichten<br />
oder erfinden unsere eigenen Spiel-Texte. Studierende haben die Möglichkeit, die pädagogische<br />
Methode darüber hinaus in Reflexion und Planung theoretisch zu erfahren und sich<br />
Anwendungsmöglichkeiten in heil- und sozialpädagogischen Kinder- oder Erwachsenengruppen<br />
zu erarbeiten.<br />
Lit. u.a.: Weiss: Wenn die roten Katzen tanzen... <strong>Freiburg</strong> 1999<br />
Kunst- und<br />
gestaltungstherapeutische<br />
Arbeit von altersverwirrten<br />
Menschen an der<br />
Neurologischen Klinik<br />
Elzach<br />
TN: 4 (2 GS/2 HS)<br />
2 Std.<br />
Menzen Do 14.00 - 16.30<br />
Beginn: 16.10.2003<br />
Das Projekt betreut an mehreren Nachmittagen altersverwirrte Menschen. Die bildnerischorientierte<br />
Arbeit mit unterschiedlichen Materialien will Erinnerungsarbeit sein, will zu mehr<br />
Aufmerksamkeits-, Konzentrations- und Assoziationsfähigkeit animieren. Das Projekt wird von<br />
den Ärzten, Neuropsychologen und Ergotherapeuten der Klinik evaluiert.<br />
ISAG<br />
Einführung in die<br />
Kunsttherapie/<br />
Gestaltungspädagogik<br />
TN<br />
EFH: 50<br />
2 Std.<br />
Menzen Mi 18.00 - 21.00<br />
14-täglich<br />
Beginn: 22.10.2003<br />
2400<br />
2301<br />
Aula<br />
1100
- 183 -<br />
Fachbereich Heilpädagogik Aufbaustudium 2. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Die Einführungsveranstaltung “Kunsttherapie/Gestaltungspädagogik” will in die verschiedenen<br />
Ansätze kunst- und gestaltungstherapeutischer Verfahren einführen.<br />
Im Mittelpunkt der Vorlesung werden Projekte stehen, die im heil- und sozialpädagogischen<br />
sowie sozialarbeiterischen Berufsfeld stattfanden. Wahrnehmungsgeschädigte, mental und<br />
altersverwirrte, verhaltensverunsicherte, d.h. selbstwert- und emotional gestörte, psychiatrisierte<br />
Menschen, - das sind Beispiele anhand deren kunst- und gestaltungspädagogische wie -<br />
therapeutische Maßnahmen gezeigt und theoretisch fundiert werden.<br />
Literatur: K.-H. Menzen: (Grundlagen der Kunsttherapie. UTB. München 2002.<br />
Musik(-therapie) in der.<br />
heilpädagogischen Arbeit<br />
mit geistigbehinderten<br />
Menschen<br />
Gemeinsames Angebot der<br />
Fachbereiche SozPäd.<br />
und HeilPäd.<br />
TN 12 (8 HP/4 SP)<br />
2 Std.<br />
Markowetz Do 9.45 - 11.15 2110<br />
Im Leben geistig behinderter Menschen spielt Musik eine große Bedeutung. Musik wird mit allen<br />
Sinnen wahrgenommen und wirkt therapeutisch. In vielerlei Hinsicht scheint sich das Sprichwort:<br />
„mit Musik geht alles besser!“ im pädagogischen wie therapeutischen Alltag zu bestätigen. Nicht<br />
zuletzt deshalb begegnet uns die Musik in allen heil- und sozialpädagogischen Handlungs- und<br />
Arbeitsfeldern. In dem Seminar geht es deshalb darum, sich dieser Zusammenhänge<br />
theoriegeleitet bewußt zu werden und die Musik als Lern- und Erfahrungsraum für Menschen mit<br />
geistiger Behinderung praktisch zu erfahren und didaktisch zu reflektieren.<br />
Zukunftskonferenzen -<br />
identitätsrelevanten Fragen<br />
und schwierigen<br />
Lebenssituationen<br />
behinderter Jugendlichen<br />
heilpädagogisch begegnen<br />
Gemeinsames Angebot der<br />
Fachbereiche SozPäd.<br />
und HeilPäd.<br />
TN: 16 (12 HP/4 SP)<br />
2 Std.<br />
Markowetz Do 11.30 - 13.00 2110
- 184 -<br />
Fachbereich Heilpädagogik Aufbaustudium 2. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Auch aus behinderten Kindern werden Jugendliche. Sie kommen in die Pubertät und werden<br />
junge erwachsene Menschen. Die Anlässe, in denen sich behinderte Jugendliche �neu erleben�<br />
und �neu machen� werden häufiger, komplexer und damit auch schwieriger. Bisweilen lösen sie<br />
ernsthafte Krisen mit sehr vielfältigen Problemen aus. Erschwerend kommt hinzu, dass in dieser<br />
Lebensphase sehr weitreichende, lebensbiographische Entscheidungen zu treffen sind. Sowohl<br />
Eltern als auch Experten möchten deshalb helfen und zur Bewältigung dieser schwierigen<br />
Lebenslage beitragen. Aus systemischer Sicht haben sich bei der interaktionistischen Lösung<br />
solcher Probleme sog. „Zukunftskonferenzen“, als eine moderne, trialogorientierte<br />
Interventionsform in der Pädagogik bewährt. In dem Seminar werden wir uns mit diesem Ansatz<br />
in Theorie und Praxis beschäftigen und interdisziplinär über diese komplexe, nicht mittelbar<br />
wirksam werdende heilpädagogische Fördermaßnahme reflektieren.<br />
Päd.-therapeutische Maßnahmen für Kinder und Jugendliche<br />
Diese Fächer gelten wahlweise auch für die Rubrik<br />
HEILPÄDAGOGISCHE THEMEN UND ARBEITSFORMEN<br />
Aktuelle Themen und Arbeitsmethoden aus dem Theorie- und Praxisfeld<br />
der Heilpädagogik (vgl. Fußnote 3 auf Seite 86 der StudPO)<br />
Direktive pädagogischtherapeutische<br />
Verfahren<br />
Gemeinsames Angebot der<br />
Fachbereiche SozPäd.<br />
und HeilPäd.<br />
TN: 24 (18 HP/6 SP)<br />
2 Std.<br />
Pielmaier Do 11.30 - 13.00 2300<br />
Die Lehrveranstaltung dient dem Kennenlernen und Erproben direktiver Verfahren zur<br />
störungsspezifischen Arbeit mit emotional und verhaltensgestörten Kindern und Jugendlichen.<br />
Die Verfahren stammen überwiegend aus dem Bereich der Verhaltenstherapie und eignen sich<br />
im Ganzen oder in Teilen zur Kombination mit kindzentriertem, spieltherapeutischem Vorgehen.<br />
Unter anderem werden Trainingsverfahren für Kinder mit hyperkinetischem und oppositionellem<br />
Problemverhalten, Trainings mit Scheidungskindern, Adipositastrainings, Anti-Stress-Trainings<br />
unter die Lupe genommen und auf ihre Brauchbarkeit für Heil- und Sozialpädagogik hin<br />
überprüft. Die Arbeit im Seminar erfolgt in thematisch orientierten Kleingruppen. Die Bereitschaft<br />
zur aktiven Mitarbeit ist Voraussetzung für die Zulassung zum Seminar und die Erbringung einer<br />
Prüfungsleistung in Form einer Dokumentation.<br />
Grundkenntnisse in Verhaltenstherapie sind unabdingbar erforderlich.
- 185 -<br />
Fachbereich Heilpädagogik Aufbaustudium 2. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Einführung in die<br />
Hypnotherapie für Kinder<br />
und Jugendliche<br />
TN: 16<br />
2 Std.<br />
Pielmaier Fr 21.11., 13.00 Uhr<br />
bis Sa 22.11.,<br />
18.00 Uhr<br />
...<br />
Fr 05.12., 13.00 Uhr<br />
bis Sa 06.12.,<br />
18.00 Uhr<br />
Auf dem Gebiet der Behandlung von verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen haben sich<br />
in den vergangenen 20 Jahren zunehmend hypnotherapeutische Verfahren etabliert, die sich<br />
durch alters- und entwicklungsangemessene Vorgehensweisen auszeichnen. Durch<br />
therapeutische Geschichten, Metaphern, szenische Darstellungen und Rituale werden die<br />
Entwicklungs- und Selbstheilungskräfte der Kinder und Jugendlichen aktiviert und günstige<br />
Voraussetzungen für Problembearbeitungen geschaffen.<br />
Die Veranstaltung dient dem Kennenlernen und Erproben von Behandlungsbausteinen aus der<br />
Hypnotherapie zur Anwendung in der heilpädagogischen Arbeit. Dabei werden vor allem<br />
einfache hypnotherapeutische Verfahren demonstriert und erläutert, die anschließend in<br />
Selbsterfahrung und Rollenspiel erprobt werden können.<br />
Therapeutische<br />
Geschichten<br />
TN: 12<br />
2 Std.<br />
Weiss Do 17.00 - 20.00<br />
Beginn:<br />
siehe Aushang<br />
Geschichten, Märchen und Metaphern - einfach im Aufbau, magisch in der Handlung und<br />
poetisch in der Form - spielen zunehmend eine wichtige Rolle in heilpädagogischen<br />
Arbeitsfeldern, sei es in der Therapie und Förderung mit Kindern wie auch in der Therapie und<br />
Beratung mit Jugendlichen und Erwachsenen.<br />
Wir werden Geschichten entdecken und kennen lernen, die sich für die therapeutische Arbeit mit<br />
Kindern und Erwachsenen eignen, wir werden unsere eigenen Geschichten schreiben und sie<br />
uns gegenseitig erzählen. Wir werden Aufbauformen für therapeutische Geschichten kennen<br />
lernen, uns mit Metaphern, Ziel und Ressourcenorientierung und Reframing beschäftigen.<br />
Daneben werden wir unterschiedliche Anwendungsformen in den verschiedenen therapeutischen<br />
Richtungen vergleichen und damit experimentieren, wie Geschichten möglicherweise in unsere<br />
heilpädagogischen Therapieprozesse integrierbar sind.<br />
2300<br />
2300<br />
2400
- 186 -<br />
Fachbereich Heilpädagogik Aufbaustudium 2. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Heilpädagogische Themen und Arbeitsformen<br />
Aktuelle Themen und Arbeitsmethoden aus dem Theorie-<br />
und Praxisfeld der Heilpädagogik<br />
ISAG<br />
Sterbe- und<br />
Trauerbegleitung<br />
Kooperation mit RP<br />
TN: ca. 23 (8 HP, 15 RP)<br />
2 Std.<br />
Heusler Mo 14.00 - 17.15<br />
1. Semesterhälfte<br />
Es gehört zur Wirklichkeit des menschlichen Lebens, dass es begrenzt und endlich ist. Wie jedes<br />
Leben ist auch jedes Sterben einmalig, einzigartig und braucht von daher individuelle Achtung<br />
und Aufmerksamkeit. Dennoch macht es Sinn, grundlegende Einsichten der Sterbe- und<br />
Trauerbegleitung kennen zu lernen, um in einer höchst unsicheren Situation etwas mehr<br />
Sicherheit erfahren zu können.<br />
Welche Bedürfnisse haben Sterbende und ihre Angehörigen? Welche besonderen Themen kann<br />
das Sterben junger, alter, chronisch kranker, geistig behinderter Menschen mit sich bringen?<br />
Welche Hilfestellungen gibt es für die Helfenden? Welche besonderen Fragen stellt die<br />
Begegnung mit Abschiednehmen und Sterben an das eigene Leben? Das Seminar lädt die<br />
Studierenden der Religionspädagogik und der Heilpädagogik ein, sich mit diesen und weiteren<br />
Fragen zu beschäftigen und auseinanderzusetzen.<br />
Einführung in die<br />
Montessoripädagogik und<br />
ihre Umsetzung heute<br />
2 Std.<br />
Arndt Di 18.00 - 21.00<br />
+ n.V.<br />
Maria Montessori - Wer it das<br />
Prinzipien ihrer Pädagogik<br />
Praxisorientiertes Arbeiten zum Bereich Kinderhaus und Schule (bis 12 Jahre)<br />
3301<br />
2300
- 187 -<br />
Fachbereich Heilpädagogik Aufbaustudium 2. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
ISAG<br />
Alte Menschen mit<br />
Behinderung<br />
Kooperation mit<br />
Soz.Arb./Pfleg/RP/SP<br />
TN: 30 (SP 10, HP 10<br />
2 Std.<br />
Menzen<br />
Brandenburg<br />
Kompaktseminar:<br />
Do 19.02.04,<br />
10.00 - 18.00 Uhr<br />
Fr 20.02.04,<br />
10.00 - 18.00 Uhr<br />
Sa 21.02.04,<br />
9.00 - 12.00 Uhr<br />
Im Zentrum des Seminars steht der Zusammenhang von Altern und Behinderung. Wir wollen den<br />
Versuch unternehmen, das Thema "Altern und Behinderung" aus der Perspektive verschiedener<br />
Wissenschaften zu beleuchten. Nach einer Klärung dessen, was man unter Altern verstehen<br />
kann, werden wir das Thema von zwei Seiten angehen: Einerseits geht es um die<br />
gesundheitliche, soziale und psychische Situation von Menschen, die lebenslang mit einer<br />
körperlichen oder geistigen Behinderung gelebt haben und jetzt alt geworden sind. Andererseits<br />
geht es um ältere Menschen, die aufgrund spezifischer gesundheitlicher Beeinträchtigung (z.B.<br />
Demenz) im hohen Alter in erheblichem Umfang in ihrer Selbständigkeit eingeschränkt und auf<br />
die Unterstützung und Hilfe von Angehörigen und Professionellen angewiesen sind. Welche<br />
spezifischen Anforderungen stellen sich an eine heilpädagogische und pflegerische Beratung<br />
und Versorgung dieser Menschen? Mit welchen Konzeptionen können die Berufsgruppen auf<br />
diese Herausforderungen reagieren?<br />
Psychologie für<br />
Sozialpädagogik<br />
Zuschauen hilft nicht -<br />
Verantwortung ist weltweit<br />
Gemeinsames Angebot der<br />
Fachbereiche SozPäd.<br />
und HeilPäd.<br />
max. 20 TN<br />
14 TN SozPäd<br />
6 TN HeilPäd<br />
2 Std.<br />
Veith Mo 16.30 - 19.00<br />
und n. V.<br />
3301<br />
3102
- 188 -<br />
Fachbereich Heilpädagogik Aufbaustudium 2. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Ausgewählte Aspekte der<br />
klinischen Psychologie für<br />
die sozialpädagogische<br />
Praxis<br />
Gemeinsames Angebot der<br />
Fachbereiche SozPäd.<br />
und HeilPäd.<br />
max. 25 TN<br />
20 TN SozPäd<br />
5 TN HeilPäd<br />
2 Std.<br />
Veith Mo 14.00 - 15.30 3202<br />
Wir beschäftigen uns in dieser Veranstaltung mit Epidemiologie, Diagnostik und Therapie<br />
ausgewählter Störungsbilder im Kindes- und Jugendalter, die im Arbeitsfeld der Sozialpädagogik<br />
von Bedeutung sind. Das Ziel der Veranstaltung ist es, diesbezügliche praxisrelevante<br />
psychologische und pädagogische Grundkenntnisse zu erarbeiten und damit zu einem sicheren<br />
professionellen Umgang sowohl mit den betroffenen Kindern/Jugendlichen und deren Eltern als<br />
auch mit anderen Berufsgruppen wie Ärzten und Psychologen zu gelangen.<br />
Ausgewählte Aspekte der<br />
Psychiatrie<br />
Gemeinsames Angebot der<br />
Fachbereiche SozPäd.<br />
und HeilPäd.<br />
max. 25 TN<br />
20 TN SozPäd<br />
5 TN HeilPäd<br />
2 Std.<br />
Effelsberg Do 11.30 - 13.00 3202<br />
Nach einer Einführung in die aktuelle Krankheitslehre stellen die Teilnehmer/innen wichtige<br />
psychiatrische Krankheitsbilder in Referaten dar, wobei der Schwerpunkt auf der medizinischen<br />
Sicht liegt. Wir orientieren uns an dem didaktisch besonders geeigneten Lehrbuch von Möller et<br />
al. Besonders vertiefen wir die in der Vorlesung “Sozialmedizin” eingeführten<br />
sozialpsychiatrischen Aspekte. Videos, evtl. auch Exkursionen und Gastvorträge sollen einige<br />
Aspekte beispielhaft illustrieren. Wir stellen immer wieder aktuelle lokale und regionale Bezüge<br />
her.
- 189 -<br />
Fachbereich Heilpädagogik Aufbaustudium 2. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Reha- und<br />
Behindertenrecht<br />
Klie Do 11.00 - 13.00<br />
Ort:<br />
EFH<br />
Bugginger Str. 38<br />
Das Rehabilitationsrecht beschäftigt sich mit Fragen der gesundheitlichen Prävention und der<br />
Rehabilitation nach eingetretener Krankheit: (fast) alle BürgerInnen der Bundesrepublik werden<br />
im Laufe ihres Lebens Rehabilitationsleistungen in Anspruch nehmen. Das Behindertenrecht<br />
hingegen bezieht sich auf die Gruppe gehandicapter Menschen, sei es durch körperliche,<br />
geistige oder seelische Behinderung. Sie sind in vielfältiger Weise in ihren Rechten auf dem<br />
Arbeitsmarkt, in der Schule, in Wohnungsfragen, v.a. aber auch im öffentlichen Leben bedroht.<br />
Auch und besonders sie sind Empfänger von Rehabilitationsleistungen, zumeist ihr Leben lang.<br />
In der Veranstaltung werden die Grundlagen des Rehabilitationsrechts erarbeitet, soweit sie für<br />
die Soziale Arbeit von Bedeutung sind. Die aktuellen Änderungen des SGB IX<br />
(Rehabilitationsrecht) werden in besonderer Weise gewürdigt. Auch wird das Rehabilitationsrecht<br />
in seiner problematischen Segmentierung und in seiner begrenzten Wirkungskraft kritisch<br />
analysiert. Im Behindertenrecht stehen Fragen des Schwerbehindertenrechts, des<br />
Nachteilsausgleichs und der Lasten bei Pflegebedürftigkeit im Vordergrund. Das Projekt<br />
„Antidiskriminierungsgesetz“ der rot-grünen Bundesregierung wird diskutiert und die Gesetze, die<br />
besondere Schutzvorkehrungen für Behinderte vorsehen, etwa das Heimgesetz und die<br />
Werkstättenverordnung, werden erörtert.<br />
Die Veranstaltung richtet sich in besonderer Weise an Studierende aus den Schwerpunkten<br />
Gesundheit und Behinderung.<br />
Betreuungsrecht und Recht<br />
der Psychiatrie<br />
Klie Mo 8.00 - 10.00<br />
Ort:<br />
EFH<br />
Bugginger Str. 38<br />
2003 ist das Europäische Jahr der Behinderten. Auf Europäischer Ebene wurden die<br />
Grundrechte von Menschen mit Behinderungen und psychisch Kranken ausformuliert: Ihre<br />
Würde gilt es zu schützen und herzustellen, ihre Selbstbestimmung zu sichern und die Soziale<br />
Teilhabe zu eröffnen. Das Betreuungsrecht in Deutschland verfolgt genau diese Ziele. Über 1<br />
Million Menschen stehen derzeit unter gesetzlicher Betreuung oder haben einen gesetzlichen<br />
Betreuer zur Seite, 3 Millionen könnten es sein. Die Dunkelziffer von Menschen mit geistiger<br />
Behinderung, den Psychisch Kranken, einigen Körperbehinderten und der großen Zahl von<br />
hochbetagten Menschen etwa mit Demenz sind vielfältig. Das Feld des Betreuungswesens ist ein<br />
pflichtrelevantes für die Berufe der Sozialen Arbeit, sei es mit der Arbeit mit Freiwilligen<br />
gesetzlichen Betreuern, in der Beratung aber auch als Berufsbetreuer. In verschiedensten<br />
Feldern der Sozialen Arbeit, sei es Gesundheitswesen, in der Psychiatrie in der Arbeit mit geistig<br />
Behinderten ist das Betreuungsrecht und das Recht der psychisch Kranken relevant und die<br />
Lehrveranstaltung bietet eine gründliche Einführung in das Betreuungsrecht. Es wird Praxis und<br />
Fallorientiert gearbeitet und die Teilnehmer des Seminars sollen die verschiedenen Akteure im<br />
Betreuungswesen: Vormundschaftsrichter, Rechtspfleger, Berufsbetreuer, Betreuungsvereine,
- 190 -<br />
Fachbereich Heilpädagogik Aufbaustudium 2. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Forum Soziale Altenarbeit<br />
in der Stadt <strong>Freiburg</strong> und<br />
Umgebung<br />
TN: 30-40<br />
Kricheldorff/<br />
Brandenburg<br />
Termine und<br />
Themen: s. Plakat<br />
zu Beginn des<br />
Semesters<br />
Im Rahmen dies regelmäßig stattfindenden Forums werden aktuelle Themen aus dem Berufsfeld<br />
der Sozialen Altenarbeit aufgegriffen. Nach einer inhaltlichen Einführung in das Thema wird<br />
dieses in einem intensiven Theorie-Praxis-Dialog vertieft und aus unterschiedlichen Blickwinkeln<br />
beleuchtet.<br />
Über die inhaltliche Schwerpunktsetzung und die genauen Themen sowie die Termine des<br />
Wintersemesters 2003/04, wird über einen Plakataushang zu Beginn des Semesters informiert<br />
werden. Die Veranstaltungen sind offen für alle Vertreter der Fachpraxis und interessierte<br />
Studierende aller Fachbereiche. Das Forum ist darüber hinaus auch eine Informationsplattform<br />
über Fort- und Weiterbildungsangebote, Tagungen und neue Literatur.<br />
Binationales Seminar<br />
s. Fachbereich<br />
Sozialarbeit<br />
Kommentar:<br />
s. Fachbereich Sozialarbeit<br />
Einführungsseminar in die<br />
“Regio-Akademie”<br />
s.<br />
Fachbereich<br />
Sozialarbeit<br />
Spiegelberg/<br />
Weiss<br />
Vorbereitungsseminar/<br />
Vorbesprechung:<br />
s. Aushang<br />
s. Fachbereich<br />
Sozialarbeit<br />
Zeit wird<br />
rechtzeitig durch<br />
Aushang bekannt<br />
gegeben !<br />
Das Projekt “Regio-Akademie für soziale Arbeit” ist ein Gemeinschaftsprojekt der in RECOS<br />
zusammengeschlossenen Ausbildungsstätten für Sozialarbeit, Sozialpädagogik und<br />
Heilpädagogik in Mulhouse, Strasbourg, Basel sowie an der EFH <strong>Freiburg</strong>. Im Rahmen dieses<br />
Projekts besteht die Möglichkeit, über ein Zusatzlehrprogramm interkulturelle Kompetenzen zur<br />
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu erwerben. Über die erfolgreiche Teilnahme in diesem<br />
Programm wird am Ende ein Zertifikat in deutscher und französischer Sprache ausgestellt. -<br />
Themen des Einführungsseminars werden sein: Einführung in Anliegen und Struktur des<br />
Zusatzlehrprogramms; Ausbildungssysteme zu sozialen Berufen in den drei Ländern;<br />
sozialrelevante Aspekte zur Situation in der Regio; soziale Dienst-leistungssysteme in Elsass,<br />
Nordschweiz und Südbaden; Grundstruktur der sozialen Sicherheit in den drei Ländern.
- 191 -<br />
Fachbereich Heilpädagogik Aufbaustudium 2. Semester<br />
Kultur- und Medienpädagogik<br />
Musik-, Bewegungs-, Spiel- und Sprachgestaltung und/oder<br />
Bildhaftes, plastisches Gestalten und Werken<br />
siehe:<br />
“Hauptstudium: Zusammenfassung der Angebote im Medienbereich”
- 192 -<br />
Fachbereich Heilpädagogik Aufbaustudium 4. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
A. Pflichtbereich<br />
Heilpädagogik als Handlungswissenschaft<br />
Heilpädagogik<br />
- Heilpädagogik in der<br />
stationären Jugendhilfe<br />
2 Std.<br />
Blasel Beginn:<br />
14.11., 13.00 Uhr<br />
Ende:<br />
15.11., 18.00 Uhr<br />
Beginn:<br />
28.11., 13.00 Uhr<br />
Ende:<br />
29.11., 18.00 Uhr<br />
Grundprobleme und typische Konstellationen aus der Jugendhilfe werden in dieser<br />
Lehrveranstaltung vorgestellt und auf dem Hintergrund systemischer Theorien diskutiert.<br />
Stationäre und teilstationäre Jugendhilfe begegnet uns in komplexen Arbeitsfeldern, welche<br />
jeweils sorgfältig analysiert werden müssen. Qualifiziertes Fachwissen zu haben reicht in<br />
komplizierten Berufsfeldern alleine oft nicht aus. Therapeutische Ansätze, Hilfen,<br />
Beratungsstrategien oder Fördermaßnahmen in unübersichtlichen Kontexten erfolgreich<br />
einzusetzen, ist eine ganz andere, weitere Herausforderung. Vorgehensweisen werden<br />
erarbeitet und diskutiert, die helfen, sich im “Labyrinth der Jugendhilfe, nicht zu verlaufen”,<br />
sondern um dort heilpädagogisch erfolgreich zu arbeiten.<br />
Heilpädagogik<br />
- Arbeit mit mehrfach<br />
belasteten Familien<br />
1 Std.<br />
Danzeisen/<br />
Skorski-<br />
Spielmann<br />
23.01.04<br />
Beginn: 13.00 Uhr<br />
24.01.04<br />
Ende: 16.30 Uhr<br />
In der Arbeit mit “mehrfach belasteten Familien” ist es wichtig, mit der Familie realistische und<br />
erreichbare Entwicklungsziele zu erarbeiten und die dafür passenden und erforderlichen<br />
Unterstützungsmaßnahmen zu finden. Um die Familien für die Hilfsmöglichkeiten zu modifizieren<br />
und ihre Mitarbeit zu sichern, ist es notwendig, ihre Ressourcen zu erkennen und in den<br />
Vordergrund zu stellen. Dies ist für die pädagogisch-therapeutische Begleitung eine große<br />
Herausforderung und bedarf seitens der Fachkräfte einer besonderen Haltung, Vorgehensweise<br />
und intensiver Kooperation mit dem Netzwerk. Das Seminar wird sich mit diesen Themen<br />
anhand von Theorie, Fallbeispielen und praktischen Übungen befassen.<br />
Waltraud Danzeisen, Dipl.-Sozialarbeiterin/FH; Angelika Skorski-Spielmann, Dipl.-<br />
Heilpädagogin/FH<br />
Kinder- und Jugendpsychiatrie<br />
II<br />
2 Std.<br />
Simon<br />
u.a.<br />
2300<br />
2300<br />
2200<br />
Di 9.45 - 11.15 2200
- 193 -<br />
Fachbereich Heilpädagogik Aufbaustudium 4. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Im Sinne eines “Kinder- und Jugendpsychiatrischen Bilderbuches” sollen ausgewählte<br />
Störungsbilder (z.B. Mutismus, Schulphobien, psychosomatische Erkrankungen im Kindes- und<br />
Jugendalter) anhand von Kasuistiken unter Einbezug systemischer und psychodynamischer<br />
Aspekte vertieft betrachtet werden. Niedergelassene Kinder- und Jugendpsychiater werden im<br />
Rahmen von Gastvorlesungen zu verschiedenen psychiatrischen Erkrankungen aus ihrer Arbeit<br />
berichten.<br />
Das Seminar dient der Vertiefung des in der Vorlesung Kinder- und Jugendpsychiatrie I<br />
erworbenen Wissens.<br />
Interventionsformen in der Heilpädagogik<br />
Heilpädagogische<br />
Maßnahmen:<br />
Pädagogischtherapeutischer<br />
Bereich<br />
Freudling<br />
Kratz-<br />
Bosbach<br />
Pielmaier<br />
Simon<br />
Skorski-<br />
Spielmann<br />
Stehle-<br />
Remer<br />
n.V. n.V.<br />
Die Studierenden führen verantwortlich eine Heilpädagogische Spieltherapie mit einem Kind in<br />
Verbindung mit Beratungsgesprächen mit dessen Bezugspersonen durch. Wöchentliche<br />
Praxisberatung in einer Kleingruppe ist integraler Bestandteil. Die Durchführung der Behandlung<br />
und Gespräche ist zu dokumentieren und zu reflektieren hinsichtlich der individuellen Kind- und<br />
Elternproblematiken mit Erklärungshypothesen, Zielformulierungen, pädagogischtherapeutischen<br />
Interventionen im Therapieprozess. Einbezogen sind Aspekte der<br />
klientzentrieren Selbsterfahrung.<br />
Organisation, Leitung und interdisziplinäre Zusammenarbeit<br />
Management in soz.<br />
Institutionen I<br />
Grundlagen<br />
2 Std.<br />
Management in soz.<br />
Institutionen II<br />
Personalentwicklung<br />
2 Std.<br />
Späth Fr 8.00-12.00<br />
Termine:<br />
10.10./17.10./31.10./<br />
21.11./05.12./19.12.<br />
Mahler Fr 8.00-12.45<br />
Termine:<br />
24.10./14.11./28.11./<br />
12.12./16.01.<br />
2200<br />
2200
- 194 -<br />
Fachbereich Heilpädagogik Aufbaustudium 4. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
B. Wahlpflichtbereich<br />
Päd.-therapeutische Maßnahmen für Kinder und Jugendliche<br />
Diese Fächer gelten wahlweise auch für die Rubrik<br />
HEILPÄDAGOGISCHE THEMEN UND ARBEITSFORMEN<br />
Aktuelle Themen und Arbeitsmethoden aus dem Theorie- und<br />
Praxisfeld der Heilpädagogik (vgl. Fußnote 3 auf Seite 86 der<br />
StudPO)<br />
Direktive pädagogischtherapeutische<br />
Verfahren<br />
Gemeinsames Angebot<br />
der<br />
Fachbereiche HeilPäd und<br />
SozPäd<br />
TN: 24<br />
(18 HP, 6 SP)<br />
2 Std.<br />
Pielmaier Do 11.30 - 13.00 2300<br />
Die Lehrveranstaltung dient dem Kennenlernen und Erproben direktiver Verfahren zur<br />
störungsspezifischen Arbeit mit emotional und verhaltensgestörten Kindern und Jugendlichen.<br />
Die Verfahren stammen überwiegend aus dem Bereich der Verhaltenstherapie und eignen sich<br />
im Ganzen oder in Teilen zur Kombination mit kindzentriertem, spieltherapeutischem Vorgehen.<br />
Unter anderem werden Trainingsverfahren für Kinder mit hyperkinetischem und oppositionellem<br />
Problemverhalten, Trainings mit Scheidungskindern, Adipositastrainings, Anti-Stress-Trainings<br />
unter die Lupe genommen und auf ihre Brauchbarkeit für Heil- und Sozialpädagogik hin<br />
überprüft. Die Arbeit im Seminar erfolgt in thematisch orientierten Kleingruppen. Die Bereitschaft<br />
zur aktiven Mitarbeit ist Voraussetzung für die Zulassung zum Seminar und die Erbringung einer<br />
Prüfungsleistung in Form einer Dokumentation.<br />
Grundkenntnisse in Verhaltenstherapie sind unabdingbar erforderlich.<br />
Einführung in die<br />
Hypnotherapie für Kinder<br />
und Jugendliche<br />
TN: 16<br />
2 Std.<br />
Pielmaier Fr 21.11., 13.00 Uhr<br />
bis Sa 22.11.,<br />
18.00 Uhr<br />
Fr 05.12., 13.00 Uhr<br />
bis Sa. 06.12.,<br />
18.00 Uhr<br />
2300<br />
2300
- 195 -<br />
Fachbereich Heilpädagogik Aufbaustudium 4. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Auf dem Gebiet der Behandlung von verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen haben sich<br />
in den vergangenen 20 Jahren zunehmend hypnotherapeutische Verfahren etabliert, die sich<br />
durch alters- und entwicklungsangemessene Vorgehensweisen auszeichnen. Durch<br />
therapeutische Geschichten, Metaphern, szenische Darstellungen und Rituale werden die<br />
Entwicklungs- und Selbstheilungskräfte der Kinder und Jugendlichen aktiviert und günstige<br />
Voraussetzungen für Problembearbeitungen geschaffen.<br />
Die Veranstaltung dient dem Kennenlernen und Erproben von Behandlungsbausteinen aus der<br />
Hypnotherapie zur Anwendung in der heilpädagogischen Arbeit. Dabei werden vor allem<br />
einfache hypnotherapeutische Verfahren demonstriert und erläutert, die anschließend in<br />
Selbsterfahrung und Rollenspiel erprobt werden können.<br />
Kinderpsychodrama<br />
TN : 12<br />
2 Std.<br />
Weiss Fr 17.10.03,<br />
Beginn:13.00 Uhr<br />
Sa 18.10.03,<br />
Ende 18.00 Uhr<br />
Fr 24.10.03,<br />
Beginn 13.00 Uhr<br />
Sa 25.10.03,<br />
Ende 18.00 Uhr<br />
Im Seminar werden wir Grundlagen des Kinderpsychodramas als gruppentherapeutische<br />
Methode theoretisch und praktisch kennen lernen. Im Verlauf des Semesters werden wir auch<br />
den Transfer einzelner methodischer Elemente in das einzeltherapeutische Konzept der<br />
Heilpädagogischen Spieltherapie erarbeiten.<br />
Das Seminar setzt die Bereitschaft zum aktiven Spielen und zur persönlichen Reflexion voraus,<br />
ebenso die Möglichkeit zur regelmäßigen Teilnahme.<br />
Therapeutische<br />
Geschichten<br />
TN: 12<br />
2 Std.<br />
Weiss Do 17.00 - 20.00<br />
Beginn:<br />
siehe Aushang<br />
2400<br />
2400<br />
2400
- 196 -<br />
Fachbereich Heilpädagogik Aufbaustudium 4. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Geschichten, Märchen und Metaphern - einfach im Aufbau, magisch in der Handlung und<br />
poetisch in der Form - spielen zunehmend eine wichtige Rolle in heilpädagogischen<br />
Arbeitsfeldern, sei es in der Therapie und Förderung mit Kindern wie auch in der Therapie und<br />
Beratung mit Jugendlichen und Erwachsenen.<br />
Wir werden Geschichten entdecken und kennen lernen, die sich für die therapeutische Arbeit mit<br />
Kindern und Erwachsenen eignen, wir werden unsere eigenen Geschichten schreiben und sie<br />
uns gegenseitig erzählen. Wir werden Aufbauformen für therapeutische Geschichten kennen<br />
lernen, uns mit Metaphern, Ziel und Ressourcenorientierung und Reframing beschäftigen.<br />
Daneben werden wir unterschiedliche Anwendungsformen in den verschiedenen<br />
therapeutischen Richtungen vergleichen und damit experimentieren, wie Geschichten<br />
möglicherweise in unsere heilpädagogischen Therapieprozesse integrierbar sind.<br />
Heilpädagogische Themen und Arbeitsformen<br />
Aktuelle Themen und Arbeitsmethoden aus dem Theorie-<br />
und Praxisfeld der Heilpädagogik<br />
s. Angebote: 2. Semester<br />
Kultur- und Medienpädagogik<br />
Musik-, Bewegungs-, Spiel- und Sprachgestaltung und/oder<br />
Bildhaftes, plastisches Gestalten und Werken<br />
siehe:<br />
“Hauptstudium: Zusammenfassung der Angebote im Medienbereich”
- 197 -<br />
FACHBEREICH<br />
RELIGIONSPÄDAGOGIK
- 198 -<br />
Fachbereich Religionspädagogik 3. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
A. Pflichtbereich<br />
Humanwissenschaftliche Grundlagen<br />
Religionsphilosophie II<br />
Religionskritik<br />
2 Std. Vorl.<br />
Bohlen Do 8.00 - 9.30 3302<br />
Der neuzeitlichen Religionskritik zufolge ist der Glaube nur eine Illusion. Derart stellt sie eine<br />
Herausforderung dar für jeden Menschen, der glaubt und mit anderen Glaubenserfahrungen<br />
reflektieren will. Die Veranstaltung möchte der Herausforderung durch die neuzeitliche Religionskritik<br />
dadurch begegenen, dass sie deren Argumentationsmuster ausarbeitet und ihre Bedeutung<br />
für eine vernünftig verantworteten Glauben kritisch erörtert. Sie möchte aber auch der Frage<br />
nachgehen, ob der Glaube in unserer Zeit, ohne grundsätzlich in Frage gestellt zu werden, zu<br />
“verdunsten” droht.<br />
Sonderpädagogik<br />
2 Std. Vorl./Üb.<br />
Kösler Di 8.00 - 9.30 3202<br />
In dieser Veranstaltung sollen zentrale sonderpädagogische Fragestellungen, die in religionspädagogischen<br />
Handlungsfeldern von Relevanz sind, bearbeitet werden: Was meint das Phänomen<br />
“Behinderung” ? Welche Werte leiten sonderpädagogisches Handeln ? Welche Handlungsfelder<br />
und Aufgaben ergeben sich an der Schnittstelle von Sonder- und Religionspädagogik ? Welche<br />
Konsequenzen entstehen hinsichtlich der didaktischen Ausgestaltung von spezifischen Handlungsfeldern?<br />
Biblische Theologie<br />
Altes Testament<br />
Altes Testament III:<br />
Weisheit und Poesie<br />
2 Std. Vorl.<br />
Heusler Do 9.45 - 11.15 3301<br />
Die weisheitliche und poetische Literatur des Alten Testaments bringt das Leben mit all seinen<br />
Facetten in Beziehung zu Gott. Die Weisheitsdichtung – das Buch der Sprichwörter, Ijob, Kohelet<br />
und schließlich das Buch der Weisheit – vermittelt mit ihren Fragen nach einem tragenden Grund<br />
und lebensmehrenden Zusammenhängen in der Welt ein lebensnahes theologisches Denken. Das<br />
Buch der Psalmen mit Lob und Dank, Bitte und Klage und das Hohelied zeugen von den vielfältigen<br />
Erfahrungen menschlichen Lebens. Anhand ausgewählter Texte eröffnet die Vorlesung einen<br />
Zugang zu den Themen und Anliegen dieser Schriften.
- 199 -<br />
Fachbereich Religionspädagogik 3. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Neues Testament<br />
Neues Testament III:<br />
Die Frage nach dem<br />
historischen Jesus<br />
2 Std. Vorl.<br />
Heusler Di 11.30 - 13.00 3301<br />
Zu den Grundfragen jeder Beschäftigung mit den Evangelientexten gehört das Interesse an der<br />
Person und der Botschaft Jesu von Nazareth. Was sind die mit der Rückfrage nach dem historischen<br />
Jesus verbundenen Herausforderungen? Und welche Möglichkeiten des Zugangs zur<br />
Geschichte Jesu bietet die neutestamentliche Exegese? Die Vorlesung gibt einen Überblick über<br />
die Forschungsgeschichte, führt ein in die Methoden und Kriterien einer Rückfrage nach dem<br />
historischen Jesus und versucht, entsprechend dem heutigen Stand der Forschung ein Bild vom<br />
Wirken und von der Verkündigung Jesu zu entwerfen.<br />
Systematische Theologie<br />
Fundamentaltheologie<br />
Fundamentaltheologie II<br />
wird im SoSe 2004 für<br />
4. und 8. Semester<br />
zusammen angeboten<br />
Dogmatik<br />
Dogmatik III:<br />
Christologie und<br />
Mariologie<br />
2 Std. Vorl.<br />
Pemsel-Maier Di 9.45 - 11.15 3301<br />
Im Mittelpunkt der Vorlesung steht die Person und theologische Bedeutung desjenigen, den wir als<br />
"Christus" bekennen. Ausgehend von der Frage nach dem historischen Jesus, nach der Thematisierung<br />
von Tod und Auferstehung, schlagen wir den Bogen zum verkündigten Christus. In diesem<br />
Zusammenhang gilt es auch, die Bedeutung der alten christologischen Dogmen zu erschließen.<br />
Am Schluss soll die theologische Bedeutung Marias zur Sprache kommen.
- 200 -<br />
Fachbereich Religionspädagogik 3. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Moraltheologie<br />
Moraltheologie II:<br />
Fundamentalmoral I<br />
Normen und Normkritik in<br />
der christlichen Ethik<br />
2 Std. Vorl.<br />
Schmitz Mi 11.30 - 13.00 3301<br />
Zur Klärung der in Bibel und Tradition verankerten Bedeutung von Norm und Gesetz für eine<br />
heutige christliche Ethik behandelt die Lehrveranstaltung insbesondere<br />
6 Entstehung, Fortentwicklung und zeitbezogene Bedeutung des biblischen Gesetzesverständnisses,<br />
6 das Ethos der Propheten,<br />
6 die jesuanische Gesetzeskritik und die hochethischen Weisungen der Bergpredigt,<br />
scholastisches und neuscholastisches Naturrechtsverständnis; Möglichkeiten und Grenzen<br />
naturrechtlichen Argumentierens.<br />
Praktische Theologie<br />
Pastoraltheologie<br />
Pastoraltheologie I:<br />
Allgemeine Pastoraltheologie<br />
Grundformen und Grundfunktionen<br />
von Gemeinden<br />
unter besonderer<br />
Berücksichtigung von größeren<br />
Räumen in der Seelsorge<br />
2 Std. Vorl.<br />
Rummel Mi 9.45 - 11.15 3302<br />
Die Frage “Was ist und wozu dient eine christliche Gemeinde ?” wird von verschiedenen Aspekten<br />
aus angegangen: Kirche und Gemeinde im NT, Entwicklung von Gemeindemodellen,<br />
Basisgemeinde-Bewegung, Konzepte der “Kooperativen Pastoral”. Insbesondere soll die Herausforderung<br />
durch die Institutionalisierung von Seelsorgeeinheiten mit Seelsorge- und Pastoralteams<br />
auf den verschiedenen Ebenen dargestellt und bearbeitet werden.<br />
Literatur:<br />
J. Müller (Hrsg.) Pfarrgemeinde für das 3. Jahrtausend, Augsburg 1993;<br />
P. M. Zulehner, Pastoraltheologie, Bd. 2, Gemeindepastoral, Düsseldorf 1990;<br />
A. Prior, Kirche als Gemeinschaft von Gemeinschaften, München 1994;<br />
Zur Pastoral der Gemeinde (= Schriftreihe des Erzbistums <strong>Freiburg</strong> Nr. 25), <strong>Freiburg</strong> 1996
- 201 -<br />
Fachbereich Religionspädagogik 3. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Liturgiewissenschaft<br />
Allgemeine Liturgiewissenschaft<br />
2 Std. Vorl.<br />
Höffner Mo 9.45 - 11.15<br />
Beginn: 06.10.2003<br />
3301<br />
Die Allgemeine Liturgiewissenschaft legt den Schwerpunkt zunächst auf die Feiern der Initiation,<br />
der Eingliederung in die Kirche, auf Taufe, Firmung und Eucharistie. Angelpunkte der Erörterung<br />
sind die Grundentscheidungen der Liturgiereform des II. Vatikanischen Konzils (1962-1965) und<br />
der auch uns gegebene Auftrag nach einer permanenten Reform der Feiern u. a. in der neuen<br />
pastoralen Situation der Seelsorgeeinheiten. Einer Auswahl aus den übrigen Sakramenten (Buße,<br />
Ordination, Trauung und Krankensalbung im Kontext der Krankensakramente) sowie den Feiern<br />
der Sakramentalien gibt Hilfestellung zum liturgietheologischen Verständnis und zur pastoralliturgischen<br />
Praxis unserer heutigen Gottesdienste.<br />
Pastoralpsychologie I<br />
Pastoralpsychologische<br />
Gesprächsführung (Teil 1)<br />
4 Std. Sem.<br />
Heusler Mo 14.00 - 17.15<br />
nur 2. Semesterhälfte<br />
3301<br />
Seelsorge wendet sich im Namen Jesu den Menschen zu. Sie geschieht wesentlich in Begegnung<br />
und Begleitung, im Zuhören und im Gespräch, im Unterstützen und Konfrontieren. Dazu brauchen<br />
Seelsorgerinnen und Seelsorger nicht nur eine tragfähige Spiritualität und ein Gespür für die<br />
eigene Identität, sondern auch Beziehungsfähigkeit und Einfühlungsvermögen, eine sensible<br />
Wahrnehmung und kommunikative Kompetenz.<br />
Die Lehrveranstaltung will die Fähigkeit fördern, helfende Gespräche bewusst zu gestalten. Neben<br />
dem Prozess des seelsorgerlichen Gesprächs und hilfreichen Methoden der Gesprächsführung<br />
steht vor allem auch die Person des Seelsorgers, der Seelsorgerin mit den eigenen Möglichkeiten<br />
und Grenzen im Mittelpunkt.<br />
Religionspädagogik II<br />
Methodik des<br />
Unterrichtens<br />
2 Std. Vorl. / Üb.<br />
Nowak Do 11.30 - 13.00 2100<br />
Religionsunterricht ist wesentlich geprägt von den Methoden, die dabei zum Zuge kommen. Dieses<br />
Seminar stellt ein Grundrepertoire an Methoden vor - verschiedene Sozialformen<br />
(z. B. Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit anleiten), verschiedene Sitzformen (z. B. Morgenkreis,<br />
Erzählkreis, Gruppentische), Beginn und Abschluss einer Stunde gestalten; Umgang mit Bildern<br />
(Folien) im Unterricht, Arbeit mit Texten, Erstellen von Arbeitsblättern, Tafelanschriebe u.a.m. - und<br />
bietet Möglichkeiten, sie selbst auszuprobieren und anzuwenden.
- 202 -<br />
Fachbereich Religionspädagogik 3. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Religionspädagogik III<br />
Symboldidaktik<br />
2 Std. Vorl. / Üb.<br />
Schilling Di 14.00 - 15.30<br />
Beginn: 14.10.2003<br />
3301<br />
Symbole begleiten unser ganzes Leben. Insbesondere sind sie aber auch die "Sprache der<br />
Religion".<br />
Die Lehrveranstaltung zielt einerseits eine theoretische Auseinandersetzung mit dem Themenbereich<br />
"Symbol" an. Sodann geht es darum, an unterschiedlichen Beispielen und mit unterschiedlichen<br />
Methoden gemeinsam Symbole zu erfahren.<br />
B. Wahlpflichtbereich<br />
Biblische Theologie<br />
Seminare<br />
Die Offenbarung des<br />
Johannes<br />
2 Std. Sem.<br />
Kooperation KFH/EFH<br />
Heusler Di 15.45 - 17.15<br />
Beginn: 14.10.2003<br />
3302<br />
Die Offenbarung des Johannes, das letzte Buch der Bibel, ist die einzige apokalyptische Schrift des<br />
Urchristentums, die in den neutestamentlichen Kanon aufgenommen worden ist. In einer Zeit<br />
großer Bedrängnis am Ende des ersten Jahrhunderts – zur Zeit des seine Gottheit propagierenden<br />
Kaisers Domitian – schreibt der Verfasser der Johannes-Apokalypse, „was in Kürze geschehen<br />
muss“ (Apk 1,1; 22,6): Nicht der römische Kaiser, sondern Gott wird seine Herrschaft endgültig<br />
durchsetzen – das Heil, das mit der Auferweckung Jesu von Nazareth bereits begonnen hat.<br />
Das Seminar führt ein in die Gedankenwelt der frühjüdischen Apokalyptik, vor deren Hintergrund<br />
die Offenbarung des Johannes zu verstehen und zu interpretieren ist, erschließt die Visionen und<br />
Auditionen des Sehers Johannes, ihre zunächst fremde Sprache und ihre geheimnisvollen Bilder,<br />
und fragt nach der Bedeutung ihrer theologischen und christologischen Aussagen für die Menschen<br />
damals und heute.
- 203 -<br />
Fachbereich Religionspädagogik 3. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Erstes Testament:<br />
Einführung in die Psalmen<br />
2 Std. Sem.<br />
Kooperation KFH/EFH<br />
Schwendemann<br />
Mo 11.00 - 13.00<br />
Beginn: 13.10.2003<br />
Ort:<br />
Evangelische Fachhochschule<br />
Bugginger Str. 38,<br />
<strong>Freiburg</strong><br />
In dieser einführenden Veranstaltungen zu poetischen Texten der hebräischen Bibel geht es in<br />
erster Linie um die tehillim - Sammlungen des Psalters. Einleitungsfragen, Stil, Aufbau, Gattungen<br />
und Formelemente der Psalmen sollen kennen gelernt werden, auch die doppelte Auslegung<br />
in Judentum und Christentum steht im Vordergrund. Zu einzelnen Gattungen werden<br />
exemplarisch Psalmen ausgelegt und interpretiert. Eine wesentliche Rolle sollen auch die so<br />
genannten Rache- und Feindpsalmen mit ihrer verheerenden Wirkungsgeschichte spielen.<br />
Die Veranstaltung ist für Studierende der Katholischen Fachhochschule <strong>Freiburg</strong> geöffnet.<br />
Praktische Theologie<br />
Pastorales Handeln<br />
Tradition ist nicht das Hüten<br />
von Asche, sondern das<br />
Weitergeben von Feuer.<br />
- Theologische Perspektiven<br />
einer zeitgemäßen Jugendpastoral.<br />
2 Std. Sem.<br />
Ritter Kompakttermine:<br />
Fr 10.10.2003<br />
14.00 - 18.00 Uhr<br />
Fr 24.10.2003<br />
9.00 - 19.00 Uhr<br />
Sa 25.10.2003<br />
9.00 - 18.00 Uhr<br />
3301<br />
3301<br />
Tradition - ein Begriff, der nicht zu jungen Menschen zu passen scheint. Aber er kann ein wichtiger<br />
Schlüsselbegriff sein, um zu verstehen, was eine zeitgemäße Jugendpastoral aus theologischen<br />
Gründen auszeichnet. Bei diesem Blockseminar geht es um die Frage, was "Weitergeben<br />
von Feuer" in der gegenwärtigen und der zukünftigen Jugendpastoral bedeutet. Dazu sind theologische<br />
Überlegungen ebenso notwendig, wie der Blick auf die aktuelle Situation Jugendlicher<br />
und die Erfahrungen in der Jugendpastoral.<br />
ISAG<br />
Trauer- und Sterbebegleitung<br />
4 Std. Sem.<br />
RP/HP; TN-Begrenzung<br />
Heusler Mo 14.00 - 17.15<br />
nur 1. Semesterhälfte<br />
3301
- 204 -<br />
Fachbereich Religionspädagogik 3. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Es gehört zur Wirklichkeit des menschlichen Lebens, dass es begrenzt und endlich ist. Wie jedes<br />
Leben ist auch jedes Sterben einmalig, einzigartig und braucht von daher individuelle Achtung und<br />
Aufmerksamkeit. Dennoch macht es Sinn, grundlegende Einsichten der Sterbe- und Trauerbegleitung<br />
kennen zu lernen, um in einer höchst unsicheren Situation etwas mehr Sicherheit<br />
erfahren zu können.<br />
Welche Bedürfnisse haben Sterbende und ihre Angehörigen? Welche besonderen Themen kann<br />
das Sterben junger, alter, chronisch kranker, geistig behinderter Menschen mit sich bringen?<br />
Welche Hilfestellungen gibt es für die Helfenden? Welche besonderen Fragen stellt die Begegnung<br />
mit Abschiednehmen und Sterben an das eigene Leben? Das Seminar lädt die Studierenden der<br />
Religionspädagogik und der Heilpädagogik ein, sich mit diesen und weiteren Fragen zu beschäftigen<br />
und auseinanderzusetzen.<br />
Alte Menschen mit<br />
Behinderung<br />
2 Std. Sem.<br />
RP/HP<br />
Menzen<br />
Brandenburg<br />
Kompakttermin:<br />
Do 19.02.04,<br />
10.00 - 18.00 Uhr<br />
Fr 20.02.04,<br />
10.00 - 18.00 Uhr<br />
Sa 21.02.04,<br />
9.00 - 12.00 Uhr<br />
3301<br />
Im Zentrum des Seminars steht der Zusammenhang von Altern und Behinderung. Wir wollen den<br />
Versuch unternehmen, das Thema "Altern und Behinderung" aus der Perspektive verschiedener<br />
Wissenschaften zu beleuchten. Nach einer Klärung dessen, was man unter Altern verstehen kann,<br />
werden wir das Thema von zwei Seiten angehen: Einerseits geht es um die gesundheitliche,<br />
soziale und psychische Situation von Menschen, die lebenslang mit einer körperlichen oder<br />
geistigen Behinderung gelebt haben und jetzt alt geworden sind. Andererseits geht es um ältere<br />
Menschen, die aufgrund spezifischer gesundheitlicher Beeinträchtigung (z.B. Demenz) im hohen<br />
Alter in erheblichem Umfang in ihrer Selbständigkeit eingeschränkt und auf die Unterstützung und<br />
Hilfe von Angehörigen und Professionellen angewiesen sind. Welche spezifischen Anforderungen<br />
stellen sich an eine heilpädagogische und pflegerische Beratung und Versorgung dieser Menschen?<br />
Mit welchen Konzeptionen können die Berufsgruppen auf diese Herausforderungen<br />
reagieren?<br />
Religionspädagogik V<br />
Religionsunterricht in der<br />
Primarstufe<br />
2 Std. Vorl.<br />
Schilling Kompakttermine:<br />
Fr 21./Sa 22.11.03<br />
Fr 05./Sa 06.12.03<br />
von Fr 14.00 Uhr<br />
bis Sa 18.00 Uhr<br />
3301<br />
3303<br />
Gerade in der Primarstufe sollte der Unterricht nicht verkopft und einseitig inhaltsorientiert sein. Die<br />
Grundschulpädagogik stellt heute ein großes Repertoire an Methoden zur Verfügung, mittels derer<br />
"über alle Sinne" gelernt werden kann. Gemeinsam werden wir uns solche Methoden im Blick auf<br />
den Religionsunterricht aneignen.
- 205 -<br />
Fachbereich Religionspädagogik 3. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Interdisziplinäre Projekte:<br />
Missionarische Prozesse<br />
Vertiefungsphase<br />
Müller Kompakttermin:<br />
Mo 20.10.2003<br />
Di 21.10.2003<br />
jew. 9.00 - 17.00 Uhr<br />
2100<br />
Im Mittelpunkt des ersten Studientages “Missionarische Prozesse” im WS 2001/2002 stand die<br />
Frage, wie heute die missionarische Dimension christlicher Existenz verstanden werden kann,<br />
wenn wir von unseren eigenen Glaubens- und Lebenserfahrungen ausgehen. Im zweiten Teil<br />
werden wir die begonnene Diskussion inhaltlich ausweiten und die in einschlägigen kirchlichen<br />
Dokumenten sowie von Christen in anderen kulturellen und gesellschaftlichen Kontexten entwickelten<br />
Perspektiven zum Verständnis missionarischen Handelns hinzuziehen. Weiter werden wir den<br />
Zusammenhang von Kontextanalyse, theologischer Reflexion und pastoralem Handeln aus<br />
missionstheologischer Sicht betrachten und uns mit aktuellen Initiativen zur Verständigung über<br />
den Missionsauftrag der Kirche in Deutschland beschäftigen.<br />
Kultur- und Medienpädagogik<br />
Liturgiemusikalische Aus- Kolberg<br />
bildung:<br />
Jeggle-Merz<br />
“Tagzeitenliturgie: Urgebet<br />
der Kirche in alter und neuer<br />
Form”<br />
2 Std. Seminar<br />
in Zusammenarbeit mit der<br />
Theol. Fakultät der Uni <strong>Freiburg</strong><br />
Mi 14.15 - 15.45<br />
Beginn: 15.10.2003<br />
Ort:<br />
Niemensstr. 9,<br />
79098 <strong>Freiburg</strong><br />
Weitere Angebote siehe:<br />
“Hauptstudium : Zusammenfassung der Angebote im Medienbereich”<br />
Zusatzangebot<br />
Stimmbildung/Vorsingen in<br />
der Liturgie<br />
Einzelunterricht auf Anfrage<br />
Kolberg n. V.
- 206 -<br />
Fachbereich Religionspädagogik 3. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Für alle Fachbereiche:<br />
ISAG<br />
Forum Soziale Altenarbeit in Kricheldorff/<br />
der Stadt <strong>Freiburg</strong> und Um- Brandenburg<br />
gebung<br />
(30-40 TN)<br />
Termine und Themen:<br />
siehe Plakat zu Beginn<br />
des Semesters<br />
Im Rahmen dieses regelmäßig stattfindenden Forums werden aktuelle Themen aus dem Berufsfeld<br />
der Sozialen Altenarbeit aufgegriffen. Nach einer inhaltlichen Einführung in das Thema wird dieses<br />
in einem intensiven Theorie-Praxis-Dialog vertieft und aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet.<br />
Über die inhaltliche Schwerpunktsetzung und die genauen Themen sowie die Termine des<br />
Wintersemesters 2003/2004, wird über einen Plakataushang zu Beginn des Semesters informiert<br />
werden. Die Veranstaltungen sind offen für alle Vertreter der Fachpraxis und interessierte Studierende<br />
aller Fachbereiche. Das Forum ist darüber hinaus auch eine Informationsplattform über Fortund<br />
Weiterbildungsangebote, Tagungen und neue Literatur.
- 207 -<br />
Fachbereich Religionspädagogik 5. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Studientage/-wochen Heusler<br />
Pemsel-Maier<br />
Rummel<br />
Schilling<br />
Schmitz<br />
Termine:<br />
01. - 03.09.2003<br />
27. - 31.10.2003<br />
12. - 16.01.2004
- 208 -<br />
Fachbereich Religionspädagogik 7. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
A. Pflichtbereich<br />
Humanwissenschaftliche Grundlagen<br />
Sonderpädagogik<br />
2 Std. Vorl./Üb.<br />
Kommentar siehe 3. Semester<br />
Biblische Theologie<br />
Neues Testament<br />
Neues Testament IV:<br />
Paulus<br />
2 Std. Vorl.<br />
Kösler Di 8.00 - 9.30 3202<br />
Heusler Di 9.45 - 11.15 2110<br />
Die Briefe des Paulus vermitteln ein lebendiges Bild von dem Auftrag des Völkerapostels, von<br />
seiner Leidenschaft für die Botschaft, die er zu verkünden hat, und von dem Verantwortungsbewusstsein<br />
für „seine“ Gemeinden. Ausgewählte Texte aus den paulinischen Briefen, dann aber<br />
auch aus der Apostelgeschichte und aus den Deuteropaulinen sollen mit dem Leben des Paulus<br />
und mit seinem Missionsweg, mit seiner Theologie, Soteriologie und Ekklesiologie vertraut machen.<br />
Systematische Theologie<br />
Fundamentaltheologie<br />
Fundamentaltheologie II<br />
wird im SoSe 04 für<br />
4. und 8. Sem. angeboten<br />
Moraltheologie<br />
Moraltheologie IV:<br />
Spezielle moraltheologische<br />
Fragestellungen<br />
2 Std. Vorl.<br />
Schmitz Mo 9.45 - 11.15 3302
- 209 -<br />
Fachbereich Religionspädagogik 7. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Bearbeitet werden die Themenbereiche:<br />
Toleranz und Religionsfreiheit (Verständnis, Geschichte, ökumenische und gesellschaftliche<br />
Bedeutung religiöser Toleranz),<br />
der Schwangerschaftsabbruch (Gesellschaftliche Rahmenbedingungen, Fragen um den Lebensbeginn,<br />
Indikationen, Schwangerschaftskonfliktberatung).<br />
Christliche Soziallehre<br />
Christliche Soziallehre II:<br />
Gesellschafts- und wirtschaftsethischeOrientierungen<br />
2 Std. Vorl.<br />
Schmitz Di 11.30 - 13.00 3302<br />
Die Vorlesung behandelt auf dem Hintergrund der philosophischen, kulturellen und ökonomischen<br />
Umbrüche der Neuzeit relevante gesellschaftstheoretische Konzeptionen und erörtert wirtschaftsethische<br />
Leitlinien für heute.<br />
Praktische Theologie<br />
Liturgiewissenschaft<br />
Spezielle Liturgiewissenschaft<br />
1 Std. Vorl.<br />
Höffner Mo 8.00 - 9.30<br />
14-täglich<br />
Beginn: 06.10.2003<br />
3301<br />
Im Anschluss an das Praktische Jahr in der Gemeinde steht in der speziellen Liturgiewissenschaft<br />
die Reflexion gottesdienstlicher Feiern im Mittelpunkt der Lehrveranstaltung. Die genaue inhaltliche<br />
Auswahl der Themenfelder wird gemeinsam in der ersten Stunde anhand folgender Fragestellungen<br />
festgelegt: Welche Feierformen bin ich begegnet ? Zu welchen Feierformen fehlen mir noch<br />
Informationen ? Welche Planung und Gestaltungshilfe gibt es im einzelnen ? Wie begründe ich<br />
liturgietheologisch Entscheidungen in der Pfarrei oder Seelsorgeeinheit bei Gottesdiensten mit<br />
Gruppierungen oder der ganzen Gemeinde ? (z. B. bei der Fragestellung: Sonntäglicher Wortgottesdienst<br />
ja oder nein ?).<br />
Praktika<br />
Studienbegleitende<br />
Praktika<br />
Schulpraktikum II Pemsel-Maier<br />
Rummel<br />
Schilling<br />
Fr 7.45 - 13.00<br />
Do 7.45 - 13.00<br />
Verschiedene Schulen
- 210 -<br />
Fachbereich Religionspädagogik 7. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
B. Wahlpflichtbereich<br />
Biblische Theologie<br />
Seminare<br />
Die Offenbarung des<br />
Johannes<br />
2 Std. Sem.<br />
Kooperation KFH/EFH<br />
Kommentar siehe 3. Semester<br />
Erstes Testament:<br />
Einführung in die Psalmen<br />
2 Std. Sem.<br />
Kooperation KFH/EFH<br />
Kommentar siehe 3. Semester<br />
Praktische Theologie<br />
Pastorales Handeln<br />
Angebote siehe 3. Sem.<br />
Pastoraltheologische<br />
Seminare<br />
ISAG<br />
Trauer- und Sterbebegleitung<br />
2 Std. Sem.<br />
Heusler Di 15.45 - 17.15<br />
Beginn: 14.10.2003<br />
Schwendemann<br />
Kommentar siehe 3. Semester unter Pastorales Handeln<br />
Mo 11.00 - 13.00<br />
Beginn: 13.10.2003<br />
Ort:<br />
Evangelische Fachhochschule<br />
Bugginger Str. 38,<br />
<strong>Freiburg</strong><br />
Heusler Mo 14.00 - 17.15<br />
nur 1. Semesterhälfte<br />
3302<br />
3301
- 211 -<br />
Fachbereich Religionspädagogik 7. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Pastoraltheologisches<br />
Projektstudium<br />
Diverse Projekte<br />
gemäß Antrag<br />
2 Std.<br />
Religionspädagogische<br />
Seminare<br />
Das Recht des Kindes auf<br />
Religion einlösen<br />
- Grundlagen und Methoden<br />
der religionspädagogischen<br />
Arbeit mit Kindern im Elementarbereich<br />
2 Std. Sem.<br />
Heusler<br />
Pemsel-Maier<br />
Rummel<br />
Schilling<br />
Schmitz<br />
n. V.<br />
Hugoth Mo 11.30 - 13.00 3302<br />
In diesem Seminar werden die Gründe und Motive für eine religiöse Erziehung von Kindern im<br />
Elementarbereich reflektiert, Methoden und Arbeitsweisen vorgestellt und die Rolle der in diesem<br />
Feld tätigen Akteure - Erzieherinnen, Lehrerinnen und Lehrer, Katecheten und Eltern - analysiert.<br />
Was geschieht eigentlich an religionspädagogischer Arbeit in den mehr als 20.000 kirchlichen<br />
Kindertageseinrichtungen? Auf welchen Grundlagen und mit welchen Methoden wird hier gearbeitet?<br />
Welche Formen der Kooperation mit den Eltern, der Schule, dem Pastoralteam der<br />
Kirchengemeinde haben sich etabliert? Wie sieht es mit der interreligiösen Erziehung von Kindern<br />
unterschiedlicher Religionszugehörigkeit aus? Das Seminar bietet religionspädagogische Grundlagenwissen<br />
und vermittelt Ansätze und Methoden der Praxis von religiöser Erziehung und Kinderpastoral.<br />
Kultur- und Medienpädagogik<br />
Liturgiemusikalische Aus- Kolberg<br />
bildung:<br />
Jeggle-Merz<br />
“Tagzeitenliturgie: Urgebet<br />
der Kirche in alter und neuer<br />
Form”<br />
2 Std. Seminar<br />
in Zusammenarbeit mit der<br />
Theol. Fakultät der Uni <strong>Freiburg</strong><br />
Mi 14.15 - 15.45<br />
Beginn: 15.10.2003<br />
Ort:<br />
Niemensstr. 9,<br />
79098 <strong>Freiburg</strong>
- 212 -<br />
Fachbereich Religionspädagogik 7. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Weitere Angebote siehe:<br />
“ Hauptstudium : Zusammenfassung der Angebote im Medienbereich”<br />
Zusatzangebote<br />
Stimmbildung/Vorsingen in<br />
der Liturgie<br />
Einzelunterricht auf Anfrage<br />
Für alle Fachbereiche:<br />
Kolberg n. V.<br />
ISAG<br />
Forum Soziale Altenarbeit in Kricheldorff/<br />
der Stadt <strong>Freiburg</strong> und Um- Brandenburg<br />
gebung<br />
(30-40 TN)<br />
Kommentar siehe 3. Semester<br />
Termine und Themen:<br />
siehe Plakat zu Beginn<br />
des Semesters
- 213 -<br />
KULTUR- UND<br />
MEDIENPÄDAGOGIK
- 214 -<br />
Hauptstudium - alle Fachbereiche<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Wahlpflichtfächer<br />
Musik-, Bewegungs-, Spiel- und Sprachgestaltung<br />
(5. und/oder 7. Semester)<br />
Eines der Angebote ist zu wählen<br />
Frau Megnet und Herr Schönenborn (beide Fachbereich Soziale Arbeit)<br />
sind die hauptamtlichen Ansprechpartner für diesen Bereich.<br />
Kompakttermine:<br />
Fr 17.11./Sa 18.11.2003<br />
Fr 07.11./Sa 08.11.2003<br />
Fr 12.12./Sa 13.12.2003<br />
Fr 16.01./Sa 17.01.2004<br />
1. Sportpädagogik in der<br />
Praxis unter besonderer<br />
Berücksichtigung<br />
pädagogischer und<br />
didaktischer Aspekte<br />
für Damen und Herren<br />
2 Std.<br />
Fortsetzung vom<br />
Sommersemester 2003<br />
(keine Neuaufnahme)<br />
Russo Fr 15.00 - 16.30<br />
Vorbesprechung n.V.<br />
Sporthalle<br />
St. UrsulaGymnasium<br />
In diesem Seminar sollen in Theorie und Praxis der Sinn und die Notwendigkeit von Bewegung<br />
und Bewegungserziehung als integrierter Teil einer ganzheitlichen Entwicklung von Kindern und<br />
Jugendlichen erfahren und diskutiert werden. "Bewegungserziehung" ist altersunabhängig<br />
geeignet für das gesamte Förder- und Lernprogramm, z.B. bei Ängstlichen, Retardierten, Aggressiven,<br />
Auffälligen und "Normalen". ZIELE: Stoffauswahl und Lehr-Lernmethodik unabhängig<br />
von schulischen und vereinsmäßigen Anforderungen. Kennenlernen und Erproben verschiedenster<br />
Übungs-, Spiel- und Bewegungssituationen mit und ohne Gerät zur grob-, fein- und sensomotorischen<br />
Bewegungsförderung; Übung, Spiel und Leistung unter entwicklungs-, geschlechtsund<br />
altersspezifischen Aspekten.<br />
aBesondere Berücksichtigung didaktischer Aspekte.
- 215 -<br />
Hauptstudium - alle Fachbereiche<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
2. Tanz in der sozialen<br />
und therapeutischen<br />
Arbeit<br />
2 Std.<br />
Fortsetzung vom<br />
Sommersemester 2003<br />
(keine Neuaufnahme)<br />
Megnet Do 14.00 - 17.00<br />
vom<br />
23.10. bis 11.12.03<br />
1306<br />
1308<br />
Aula<br />
2000<br />
In diesem zweisemestrigen Seminar werden wir tänzerische Ausdrucksformen entwickeln, die<br />
geeignet sind für Menschen ohne tänzerische Vorerfahrungen in sozialen und therapeutischen<br />
Arbeitsfeldern. Übungen zur Sensibilisierung der Körperwahrnehmung und zur Erweiterung des<br />
eigenen Bewegungsrepertoirs bilden den Beginn jeder Arbeitsphase. Ausgehend von<br />
verschiedenen Impulsen (alltäglichen Bewegungsmustern, der Stimme, Stimmbildern, Musik,<br />
Objekten usw.). Wir werden unterschiedliche tänzerische Gestaltungsformen entwickeln, die<br />
geprägt sind von Elementen des kreativen Tanzes, dem Ausdruckstanz und dem Tanztheater.<br />
Im Wintersemester werden wir uns mit unterschiedlichen tanzpädagogischen sowie<br />
tanztherapeutischen Richtungen im Hinblick auf die Entwicklung und Erprobung eigener Konzepte<br />
beschäftigen.<br />
3. Musikwerkstatt:<br />
Die Band, Songs,<br />
Rhythmen und Melodie<br />
2 Std.<br />
Fortsetzung vom<br />
Sommersemester 2003<br />
(keine Neuaufnahme)<br />
Kimmig Do 17.00 - 20.00<br />
14-tägl.<br />
1. Termin: 16.10.03<br />
1306<br />
1308<br />
Eine Band ist eine kompakte musikalische Einheit. Mehrere Musizierende bringen ihre Ideen,<br />
Wünsche, Vorgaben und Energien zusammen, um daraus Musik zu formen. Oft rankt sich die<br />
Musik um bekannte Bausteine: Songformen, Rhythmen und harmonische Modelle. Stilistische<br />
Wurzeln finden wir in der Rockmusik, im Jazz, im Blues. In diesem Seminar werden wir<br />
bestehende Modelle praktisch untersuchen und selbst Musik erfinden. Die Teilnehmer/innen sind<br />
aufgefordert, Wünsche, Ideen etc. einzubringen. Daraus werden wir Musik entstehen lassen.<br />
Musikalische Vorerfahrung ist von Vorteil.<br />
4. Kabarett:<br />
Vom Sujet zur Aufführung:<br />
praktische Erfahrungen von<br />
der Verwirklichung von<br />
Kabarett<br />
2 Std.<br />
Fortsetzung vom<br />
Sommersemester 2003<br />
(keine Neuaufnahme)<br />
Schlabach/<br />
Roppelt<br />
Kompaktseminar:<br />
Fr 17./Sa 18.10.03<br />
Fr 07./Sa 08.11.03<br />
Fr jew. 13-18.00 Uhr<br />
Sa jew. 10-15.00 Uhr<br />
weitere Termine:<br />
Mi 12.11./Do 13.11.<br />
jew. 13-20.00 Uhr<br />
3201<br />
3202<br />
3203<br />
3204<br />
Aula<br />
2000
- 216 -<br />
Hauptstudium - alle Fachbereiche<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
In diesem 2-semestrigen Projekt stehen zunächst Einzel- und Gruppenübungen zur Sprache und<br />
Körpersprache im Mittelpunkt. An Einzelbeispielen werden die unterschiedlichen<br />
Darstellungsformen des Kabaretts kennen gelernt und die eigenen Darstellungsfähigkeiten und<br />
-grenzen erfahrbar gemacht. Daran schließt die intensive Sujetsuche an in den Bereichen des<br />
sozialen Umfelds, Studiums und der gesellschaftlichen Verhältnisse. Die Hauptarbeitsphase ist<br />
ausgefüllt mit der Suche und Realisierung der kritischen Aussagen in der jeweils geeigneten<br />
kabarettistischen Form. Höhepunkt und Schluss dieses Projekts ist da Verbinden und<br />
Zusammenschnüren der Einzelnummern zu einem stimmenden Programm, das<br />
hochschulöffentlich zum Ende des Wintersemesters aufgeführt wird.<br />
5. Spielleitung in der<br />
Theaterpädagogik<br />
max. 17 TN<br />
2 Std.<br />
Megnet Mo 15.45 - 18.45<br />
Termine:<br />
17.11./24.11./01.12./<br />
08.12./15.12./12.01./<br />
19.01.<br />
Aula<br />
2000<br />
1306<br />
1308<br />
Theaterpädagogische Anleitung in der soziokulturellen Arbeit bewegt sich immer im<br />
Spannungsfeld zwischen kultureller Bildung und sozialer Gruppenarbeit. Deshalb sind zur<br />
Anleitung theatraler Gruppenprozesse vielfältigste methodisch-didaktische Kompetenzen<br />
erforderlich damit soziale und ästhetische Ziele mit unterschiedlichen Zielgruppen überhaupt<br />
erreicht werden können.<br />
In Form eines experimentellen Theaterlabors bietet das Seminar die Möglichkeit, unterschiedliche<br />
Anleitungskonzepte zu erproben und im Hinblick auf die Praxis zu reflektieren.<br />
Das Seminar richtet sich an Studierende, die bereits Theaterspielerfahrungen (Seminar, Jugendarbeit<br />
u.ä. gesammelt haben.<br />
6. Einführung in die<br />
Zirkuspädagogik für<br />
Kinder und Jugendliche<br />
max. 18 TN<br />
2 Std.<br />
Kälble Mo 15.45 - 18.45<br />
Termine:<br />
13.10./27.10./03.11./<br />
10.11.<br />
Teilkompakt:<br />
Fr 16./Sa 17.01.04<br />
Fr ab 13.00 Uhr bis<br />
Sa 18.00 Uhr<br />
Aula<br />
2000<br />
Zirkus - das heißt: Bälle und Keulen jonglieren, Menschenpyramiden bauen, Diabolo spielen, auf<br />
einem Einrad fahren, auf Scherben stehen und vieles mehr. Gerade für Kinder und Jugendliche<br />
bietet Zirkus die Möglichkeit, Neues kennen zu lernen, sich selbst zu erproben und die alten<br />
Gewissheiten, wie man kann oder nicht kann in Frage zu stellen. Dieses Seminar soll einen<br />
Einblick geben - ausgehend vom selber machen - , welche Möglichkeiten Zirkus in der Arbeit mit<br />
Kindern und Jugendlichen bietet.
- 217 -<br />
Hauptstudium - alle Fachbereiche<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
7. Musik in der sozialen<br />
und therapeutischen<br />
Arbeit<br />
max. 16 TN<br />
2 Std.<br />
Repetto Do 16.00 - 21.00<br />
an folgenden<br />
Terminen:<br />
16.10./23.10./30.10./<br />
6.11./13.11./20.11.03<br />
Ort<br />
siehe<br />
Text<br />
unten<br />
Musik ist ein Medium, das in der pädagogischen und therapeutischen Praxis gerade als<br />
nonverbales Kommunikationsmittel dazu verhelfen kann, neu in Kontakt zu kommen: in Kontakt<br />
mit sich selbst (Körper und Psyche), mit einem anderen Menschen und auch innerhalb einer<br />
Gruppe.<br />
Durch eigenes praktisches Tun und eigene Erfahrung im Umgang mit Musik soll ein Einblick<br />
ermöglicht werden in die Anwendung des Mediums in der musiktherapeutischen Praxis. Mit Hilfe<br />
der gemeinsamen Reflexion und ergänzender Beispiele aus Berufspraxis und Fachliteratur sollen<br />
dann Methoden und Ziele musikpädagogischen und therapeutischen Handelns erarbeitet und<br />
vermittelt werden.<br />
Schließlich ist beabsichtigt, einen Transfer der eigenen Erfahrungen herzustellen zu<br />
Arbeitsfeldern, welche die Student/innen interessieren. Ein wichtiges Anliegen des Seminars ist<br />
es, die eigenen, möglicherweise noch unentdeckten Ressourcen, Interessen und Neigungen<br />
dahingehend aufzufinden, wie und was jede/r Einzelne selbst in der Arbeit anwenden könnte.<br />
Musikalische Kenntnisse sind nicht erforderlich!<br />
Das Seminar wird als Teilblockveranstaltung im ZPE (Zentrum für Psychiatrie<br />
Emmendingen), Neubronnstr. 25, Emmendingen, stattfinden. (An der Pforte nach<br />
“Musiktherapie” fragen).<br />
8. Rhetorik<br />
max. 17 TN<br />
2 Std.<br />
Obert Kompakseminar:<br />
Fr 17./Sa 18.10.03<br />
Fr 07./Sa 08.11.03<br />
Fr ab 13.00 Uhr<br />
Sa ab 8.30 Uhr<br />
3101<br />
Bitte entnehmen Sie die Hinweise zu dieser Veranstaltung dem Kurs RHETORIK,<br />
Kompaktseminar beim GRUNDSTUDIUM !!<br />
9. Südamerikanische<br />
Literatur<br />
max. 23 TN<br />
2 Std.<br />
Gäng Do 14.00 - 15.30 2300<br />
Die Erzähltradition Südamerikas ist mit ihrem magisch-realistischen Stil bis heute der indianischen<br />
Tradition verpflichtet. Diesen Spuren soll nachgegangen werden, das Verhältnis der beiden<br />
Kulturen zueinander näher untersucht werden.
- 218 -<br />
Hauptstudium - alle Fachbereiche<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
10. Computermusik<br />
max. 16 TN<br />
2 Std.<br />
Busch Kompaktseminar:<br />
Fr 7.11./Sa 8.11.03<br />
Fr 12./Sa 13.12.03<br />
Fr ab 14.00 Uhr bis<br />
Sa 18.00 Uhr<br />
1206<br />
In dieser Veranstaltung soll das Medium Computer als Musikcomputer fungieren und sein Einsatz<br />
am Beispiel der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen theoretisch wie praktisch beleuchtet werden.<br />
Der Umgang mit entsprechenden Programmen sowie grundlegende Kenntnisse über<br />
“Computermusik” (z.B. Audio, MIDI oder Mixdown) werden den Teilnehmern näher gebracht. Auch<br />
soll der Bezug zur Sozialen Arbeit nicht fehlen, das Konzept der Medienkompetenz wird in diesem<br />
Zusammenhang erklärt und diskutiert. Ein Ziel des Seminars ist die Produktion eines eigenen<br />
Songs. Des Weiteren sollen Kenntnisse über den Einsatz eines Musikcomputers unter<br />
medienpädagogischen Gesichtspunkten erlangt werden. Die Interessen der Teilnehmer/innen<br />
werden berücksichtigt. Computergrundkenntnisse sind wünschenswert.<br />
11. Bewegungs- und<br />
Körperarbeit mit Kindern<br />
und Jugendlichen<br />
max. 18 TN<br />
2 Std.<br />
Schäfer,<br />
Annette<br />
Kompaktseminar:<br />
Fr 12./Sa 13.12.03<br />
Fr 16./Sa 17.01.04<br />
Fr 15-20.00 Uhr<br />
Sa 9-16.00 Uhr<br />
1308<br />
2400<br />
Wie lassen sich die beiden Medien Musik und Bewegung in verschiedenen Arbeitsfeldern<br />
einsetzen? Über das eigene Tun und Erfahren werden mögliche Ansätze, Inhalte, Methoden und<br />
Ziele der musik- und bewegungspädagogischen Arbeit kennen gelernt. In der gemeinsamen<br />
Reflexion stellen wir einen Transfer zur Berufspraxis her.<br />
Kreativer Einsatz von Stimme und Sprache, Kennenlernen und Spielen von erweitertem Orff- und<br />
Percussionsinstrumentarium, Spiele und Übungen zum Thema Körpererfahrung und<br />
Körperkontakt, Bewegungsausdruck und Tanzimprovisation, Rhythmusspiele, etc. werden Inhalte<br />
des Seminars sein.<br />
Musikalische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich!<br />
12. Einführung in die<br />
Meditation<br />
max. 20 TN<br />
2 Std.<br />
Schilling Mo 17.30 - 19.00<br />
Beginn: 13.10.2003<br />
«im<br />
Raum»<br />
In der Meditation geht es um Sammlung, Besinnung, Schweigen. Verstand und Gefühl sind<br />
gleichermaßen beteiligt. Dies ist auf unterschiedliche Weise möglich. Die Lehrveranstaltung bietet<br />
in entsprechenden Übungen einen Einblick in verschiedene Formen des Meditierens.
- 219 -<br />
Hauptstudium - alle Fachbereiche<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
13. “Sport für alle”<br />
Sport in der Lebenswelt<br />
sozial benachteiligter<br />
Kinder und Jugendlicher<br />
(in Zusammenarbeit mit der<br />
Badischen Sportjugend)<br />
10 TN aus allen Semester<br />
und Fachbereichen<br />
2 Std.<br />
Schinzler BundesleistungszentrumHerzogenhorn:<br />
24.-28.11.03<br />
Pers. Anmeldung bei<br />
Herrn Schinzler bis<br />
spätestens: 6.10.03<br />
In Zusammenarbeit mit der Badischen Sportjugend und der Evang. Fachhochschule <strong>Freiburg</strong> soll<br />
in diesem Lehrgang gezeigt werden, wie sozialschwachen Bevölkerungsgruppen der Zugang zu<br />
Sport, Spiel und Bewegung vermittelt und ermöglicht werden kann. Dabei gewinnen neben dem<br />
wettkampforientierten Sport zunehmend Abenteuer- und Erlebnissport an Bedeutung. Aufgezeigt<br />
wird die sinnvolle Zusammenarbeit bei Projekten und Aktionen der Sportorganisation mit<br />
verschiedenen sozialen Einrichtungen.<br />
Studierende des Zusatzlehrprogramms “SPOSA” haben Vorrang. - Eine entsprechende<br />
Prüfungsleistung kann erbracht werden. - Mitgliedschaft (aktiv/passiv) in einem Sportverein ist<br />
Voraussetzung. Die Badische Sportjugend erhebt Euro 25,00 als Teilnahmegebühr.
- 220 -<br />
Hauptstudium - alle Fachbereiche<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Bildhaftes, plastisches Gestalten und Werken<br />
(5. und/oder 7. Semester)<br />
Eines der Angebote ist zu wählen.<br />
Frau Megnet und Herr Schönenborn (beide Fachbereich Soziale Arbeit)<br />
sind die hauptamtlichen Ansprechpartner für diesen Bereich.<br />
Kompakttermine:<br />
Fr 14.11. /Sa 15.11.2003<br />
Fr 28.11. /Sa 29.11.2003<br />
Fr 23.01. /Sa 24.01.2004<br />
1. Erlebnispädagogik<br />
Ein pädagogischer<br />
Prozess<br />
max. 18 TN<br />
2 Std.<br />
Ernst 1. Termin:<br />
Fr 10.10.03,<br />
13.00 - 14.00 Uhr<br />
Kompakttermin:<br />
Exkursion<br />
Fr 28.11., ab 13.00<br />
bis<br />
Sa 29.11.03, 18.00<br />
weiterer Termin n.V.<br />
3201<br />
In diesem Seminar bietet sich den Teilnehmer/innen die Möglichkeit, die Theorien der<br />
Erlebnispädagogik in der Praxis kennen zu lernen. Mit verschiedenen Beispielen aus den<br />
Bereichen Teamkooperationsaufgaben bzw. Interaktionsspiele, Felsklettern mit Abseilübungen<br />
und der Anwendung von mobilen Seilelementen werden in diesem Zusammenspiel von Aktion<br />
und Reflexion die Möglichkeiten und Grenzen der Erlebnispädagogik sichtbar und spürbar.<br />
Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Erlebnispädagogik und die mögliche Umsetzung von<br />
pädagogischen Zielsetzungen in den pädagogischen Alltag. Vorkenntnisse oder sportliche<br />
Fähigkeiten sind nicht erforderlich.<br />
2. “Erleben allein genügt<br />
nicht”<br />
Erlebnispädagogik in der<br />
Sozialen Arbeit<br />
max. 18 TN<br />
2 Std.<br />
Mall Vorbesprechung:<br />
Do 06.11.03,<br />
14.00 - 15.30 Uhr<br />
Kompaktseminar:<br />
Exkursion<br />
Fr 14./Sa 15.11.03<br />
Fr 28./Sa 29.11.03<br />
jeweils<br />
Fr ab 13.00 Uhr bis<br />
Sa 18.00 Uhr<br />
3102
- 221 -<br />
Hauptstudium - alle Fachbereiche<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Dieses Seminar eröffnet den Teilnehmer/innen einen fundierten Einblick in die Geschichte und die<br />
aktuellen Entwicklungen in der Erlebnispädagogik. Erlebnispädagogische Lernfelder werden<br />
anhand praktischer Übungen erkundet und Fragestellungen nach Wirkungsweisen und<br />
pädagogischen Transfersituationen werden auf dem persönlichen ganzheitlichen<br />
Erfahrungshintergrund erörtert<br />
Das Seminar verzichtet bewusst auf den Einsatz erlebnispädagogischer Lernfelder die zwar<br />
wirkungsvoll sind, aber in der Praxis der sozialen Arbeit aufgrund des hohen Material- und<br />
Personalaufwandes - und somit der damit verbundenen hohen Kosten - nicht, oder nur selten zum<br />
Einsatz kommen.<br />
Erlebnispädagogische Angebote müssen sich den Gegebenheiten der Sozialen Einrichtungen vor<br />
Ort anpassen. Dazu zählt der flexible Einsatz erlebnispädagogischer Medien, der die vielfältigen<br />
Bedarfssituationen des Klientel berücksichtig und individuelle Handlungskonzepte zur Verfügung<br />
stellt.<br />
3. Technische Werkstatt<br />
max. 17 TN<br />
2 Std.<br />
Barth Do 17.30 - 21.30<br />
1. Termin: 16.10.03<br />
Weitere Termine:<br />
30.10./6.11./13.11./<br />
26.11./4.12.2003<br />
Werkraum<br />
Themenschwerpunkte: 1. Fahrradreparaturen, 2. Drechselkurs, 3. Maschinenkurs (Maschinen, die<br />
im Werkraum sind, 4. Sanitärinstallationen, 5. Fließen bearbeiten/verlegen, 6. Wartungsarbeiten/Pannenhilfe<br />
am Auto, 7. Einführung in die Hauselektrik (Lampen anschließen,<br />
Verlängerungskabel nachnehmen u.v.m.). Ziel der o. g. Arbeitsbereiche ist das praktische<br />
Erlernen handwerklicher Grundkenntnisse/Fertigkeiten, um diese dann bezogen auf eine<br />
Zielgruppe (Jugend-/Altenarbeit, Erwachsenenbildung) zur Anwendung zu bringen. Alle Inhalte<br />
der Lehrveranstaltung werden nach dem Prinzip “do it yourself” erlernt.<br />
4. Werken I<br />
max. 17 TN<br />
2 Std.<br />
Drobny 1. Treff:<br />
Do 6.11.03<br />
13.30 - 17.30 Uhr<br />
Kompakttermin:<br />
Fr 14./Sa 15.11.03<br />
jew. 13.00 - 18.00<br />
Nachbesprechg. n.V.<br />
1206<br />
Werkr.<br />
Thema: Holz, Glas, Mosaiktechnik<br />
Ziele/Inhalte: In den einzelnen Gruppen sollen die Studierenden Werkpädagogischen und<br />
werkdidaktischen Prozess erfahren. Grundkenntnisse in der Holzverarbeitung:<br />
Eckverbindungen, Materialkunde, Umgang mit Glas und Gestaltungstechniken, Mosaiktechnik<br />
mit Keramik und Glassteine . Und wie sind die einzelnen Materialien in welcher Zielgruppe<br />
einsetzbar. Im praktischen Teil werden die geplanten Werkstücke umgesetzt und die Arbeit<br />
reflektiert.
- 222 -<br />
Hauptstudium - alle Fachbereiche<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
5. Werken II<br />
max. 17 TN<br />
2 Std.<br />
Drobny 1. Treff:<br />
Do 6.11.03<br />
13.30 - 17.30<br />
Kompakttermin:<br />
Fr 28./Sa 29.11.03<br />
jew. 13.00 - 18.00<br />
Nachbesprechg. n.V.<br />
1206<br />
Werkr.<br />
Thema: Holz, Ton, Filz<br />
Ziele/Inhalt: In den einzelnen Gruppen sollen die Studierenden werkpädagogischen und<br />
werkdidaktischen Prozess erfahren. Grundkenntnisse in der Holzverarbeitung: Eckverbindungen,<br />
Materialkunde; was kann aus Ton und Filz noch hergestellt werden und wie sind die einzelnen<br />
Materialien in welcher Zielgruppe einsetzbar. Im praktischen Teil werden die geplanten<br />
Werkstücke umgesetzt und die Arbeit reflektiert. Und wie sind die einzelnen Materialien in welcher<br />
Zielgruppe einsetzbar.<br />
6. Werken mit ausgewählten<br />
Themen in der<br />
sozialen Arbeit<br />
max. 18 TN<br />
2 Std.<br />
Linnenschmidt<br />
Mo 15.45 - 17.15<br />
Beginn: 13.10.2003<br />
Werkr.<br />
Thematisch-handwerklicher Aspekt: Vom mechanischen Spielzeug zur bewegten Skulptur.<br />
Sozialer Aspekt: von der Einzel- zur Gruppenarbeit.<br />
Ressourcen-Aspekt: Bewegt vom Wind, vom Wasser und von der eigenen Idee.<br />
Zielgruppenaspekt: Für Studierende mit Spaß an der Verbindung von Mechanik und Kreativität.<br />
Pädagogischer und zielorientierter Aspekt: Die eigene Idee zur Konstruktion einer bewegten<br />
Skulptur im Rahmen einer Peergroup einbringen, modifizieren und verwirklichen.<br />
7. Bildhaft, kreatives<br />
Arbeiten in Sozialer<br />
Arbeit<br />
max. 18 TN<br />
2 Std.<br />
Hänsler Di 17.00 - 18.30<br />
Beginn: 14.10.2003<br />
Dieses Seminar soll Ihnen vermitteln, wie Sie durch bildhaft, kreatives Arbeiten Zugang zu<br />
Menschen in ausgewählten Feldern von Sozialer Arbeit kommen. Im weiteren sollen Sie darauf<br />
neugierig sein, wie es möglich ist, durch den Einsatz dieses Mediums Menschen in ihren<br />
Möglichkeiten und Fähigkeiten zu fördern und zu stärken. Anhand von Falldarstellungen aus der<br />
konkreten Praxis, flankiert durch Theorieteile, erlangen Sie Kenntnisse und Anregungen.<br />
Auch sollen Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie Sie durch den Einsatz dieses Mediums ihre<br />
eigene Kompetenz im praktischen Berufsfeld erweitern können. Im Rahmen dieses Seminars<br />
können Sie Ihre eigenen kreativen Ideen einfließen lassen, sowie verschiedene Techniken<br />
kennen lernen. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf aktivem Ausprobieren sowie der Reflexion Ihrer<br />
Erfahrungen. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.<br />
U 1
- 223 -<br />
Hauptstudium - alle Fachbereiche<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
8. Werken mit Zielgruppen<br />
max. 18 TN<br />
2 Std.<br />
Knaubert Vorbesprechung:<br />
Di 13.01.04,<br />
13.15 - 14.45<br />
Kompaktseminar:<br />
Fr 23.01.04,<br />
13.00 - 20.30<br />
Sa 24.01.04,<br />
9.00 - 18.00<br />
Nachtermin:<br />
Mi 28.01.04,<br />
16.30 - 21.00<br />
Werkr.<br />
Werkr.<br />
Werkr.<br />
Die TN haben die Möglichkeit, Erfahrungen mit der Bearbeitung verschiedener Materialien zu<br />
machen (Holz, Ton, Seide, eingeschränkt Metall und Stein) und Techniken kennen zu lernen<br />
diese - werkend-handwerklich - gestaltend zu verändern. Das Schaffen eines “Werkstückes”<br />
erfordert das Einlassen auf einen Prozess zur Lösung von Problemen, wie Auswahl, Planung und<br />
Handeln. Es sollen Erfahrungen vermittelt werden, Wege zu einer Zielgruppe zu öffnen und/oder<br />
mit dieser aktiv tätig zu werden. Miteinander Tun als pädagogische Hilfe wird reflektiert.<br />
9. Von der Idee zum Film<br />
- Videoprojektwerkstatt -<br />
max. 14 TN<br />
2 Std.<br />
Schulz Di 18.11.03,<br />
14.00 - 19.00<br />
Kompakttermin:<br />
Fr 28.11.03,<br />
13.00 - 18.00<br />
Sa 29.11.03,<br />
9.00 - 17.00<br />
Videoschnitt-Termin<br />
n.V. (ca. 5 Zeitstd.)<br />
3101<br />
3104<br />
3101<br />
3104<br />
Gemeinsam wollen wir uns in diesem Seminar auf den steinigen Weg von der ersten spontanen<br />
Idee zur Produktion eines Videokurzfilms machen. Wohin uns unsere Ideen führen ist offen. Eines<br />
ist allerdings sicher, Drehbucharbeit, Kameraführung, Schnitt und Präsentation gehören dazu.<br />
10. Schwarzweiß-<br />
Fotografie Fotolabor:<br />
Bildgestaltung<br />
max. 12 TN<br />
2 Std.<br />
Macziola Do 14.00 - 17.00<br />
14-täglich<br />
1. Termin: 16.10.03<br />
Fotolabor
- 224 -<br />
Hauptstudium - alle Fachbereiche<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Schrittweise vom spielerischen Umgang mit Licht und Schatten, dargestellt mittels Schwamm und<br />
Pinsel auf Fotopapier, von Fotogrammen und “goldenem Schnitt” zu Gestaltgesetzen wie “Figur<br />
und Grund” hin zu den Eingriffsmöglichkeiten, den Techniken, Formen und Verfahren der<br />
Gestaltung bei der Vergrößerung der Aufnahmen, mit der Möglichkeit der Entwicklung (und<br />
Vermittlung) einer eigenständigen Bildaussage und -sprache.<br />
Bedingung für eigene Aufnahmen während des Semesters:<br />
Kleinbild-Spiegelreflex-Kamera mit der Möglichkeit der Belichtungs-Korrektur.<br />
Tipp: Weitere Begleitmaterialien etc. im Internet unter www.fotokollegium.ch<br />
11. Gestalterische Medien<br />
in der Sozialen Arbeit<br />
max. 18 TN<br />
2 Std.<br />
Roth Do 13.00 - 16.00<br />
14-täglich<br />
Beginn: 16.10.2003<br />
Das Seminar möchte Sie einladen, Ihr kreatives Potential zu entdecken, zu erweitern und es in<br />
der Beziehungsarbeit zu nutzen. Anhand verschiedener Materialien werden wir unterschiedliche<br />
Wirkungsweisen erproben, reflektieren und mit theoretischem Hintergrund füllen.<br />
Eigene kreative Ideen sind willkommen, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.<br />
12. Kreatives Gestalten<br />
mit Papier<br />
max. 18 TN<br />
2 Std.<br />
Doll Do 18.00 - 21.00<br />
1. Termin: 9.10.03<br />
weitere Termine:<br />
16.10./23.10./30.10./<br />
6.11/13.11./20.11./<br />
27.11.2003<br />
Bei dieser LVA werden wir den Rohstoff Papier, welcher uns in Fülle als Altpapier zur Verfügung<br />
steht, für die pädagogische Praxis entdecken. Die dem Papier innewohnenden Eigenschaften und<br />
unzähligen kreativen Möglichkeiten der Gestaltung werden erlebnisorientiert erforscht. Mit hoher<br />
Sensibilität und Erlebnisfreude wird Altpapier verwandelt und neu gestaltet. Der Werkstoff “Papier”<br />
fasziniert durch die vielfältigen materialimmanenten Eigenschaften, welche bei den verschiedenen<br />
Zielgruppen prozessbegleitend nutzbar gemacht werden können. Für die pädagogischen<br />
Arbeitsbereiche werden methodisch-didaktische Schritte und pädagogische Ziele erarbeitet und<br />
eigene Themen künstlerisch gestaltend umgesetzt. Verschiedene Techniken der<br />
Papiergestaltung, vor allem die des Papierschöpfens und die des Schöpfenden Gestaltens sowie<br />
weiterführende Verarbeitunsmöglichkeiten werden in Einzel- und Kleingruppenarbeit vermittelt.<br />
Mitzubringen ist eine kleine Menge Altpapier und eine Plastiktüte.<br />
U 1<br />
U 1
- 225 -<br />
Hauptstudium - alle Fachbereiche<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
13. Kunst und Psychiatrie<br />
max. 18 TN<br />
2 Std.<br />
Effelsberg Mo 15.45 - 17.15 1206<br />
Wir beschäftigen uns mit dem Verhältnis der kranken Psyche zu Bildern. Wir betrachten Leben<br />
und Werk von bildnerisch tätigen psychisch Kranken und von psychisch kranken bildenden<br />
Künstlern (soweit man das trennen kann) aus der Perspektive der Kunstgeschichte und aus der<br />
Sicht der Psychiatrie. Wir befasse uns mit “Art Brut”, der Kunst von nicht ausgebildeten Künstlern<br />
aller Art. Neben dem theoretischen Studium nutzen wir solche Arbeiten als Anregung für eigene<br />
Darstellungen, setzen uns also aktiv damit auseinander.<br />
Nach einer Einführung in Kunstbetrachtung/Kunstgeschichte und in die Psychiatrie durch den<br />
Dozenten stellen die Studierenden in Präsentationen oder Gruppenarbeiten wichtige Themen zur<br />
Diskussion.
- 226 -<br />
FACHBEREICH<br />
PFLEGE
- 227 -<br />
Fachbereich Pflege - Hauptstudium<br />
5. Semester - praktisches Studiensemester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Pflichtbereich<br />
(parallel für beide Studiengänge)<br />
Supervision<br />
2 SWS<br />
Studientage<br />
2 SWS<br />
ausgewählte Supervisorinnen<br />
und Supervisoren<br />
Kösler,<br />
Scherer<br />
01.10. +<br />
02.10.2003<br />
26.01. +<br />
27.01.2004<br />
Das Thema der Studientage ist: Kann man aus Erfahrung lernen?<br />
Dabei wird die Selbstverständlichkeit dieser Alltagsrede ebenso kritisch betrachtet wie<br />
die pädagogischen Konzepte des Lernens aus Erfahrung
- 228 -<br />
Fachbereich Pflege - Hauptstudium - 7. Semester<br />
Studiengang Pflegemanagement<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Pflichtfächer<br />
Recht<br />
Individualarbeitsrecht<br />
(parallel mit 3. Sem TM)<br />
2 Std.<br />
Pflegewissenschaft:<br />
Kritische Analyse von<br />
Forschungsergebnissen<br />
in der Pflegewissenschaft<br />
(parallel mit PP)<br />
2 Std.<br />
Winkler Veranstaltungszeiten<br />
und -orte siehe Aushang<br />
des Fachbereichs Pflege!<br />
Reuschenbach<br />
Nähere Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie bei: http://www.pflege-wissenschaft.de/kfh/<br />
Organisationspsychologie:<br />
Teamleitung/ Topmanagement/<br />
Vernetzung<br />
2 Std.<br />
EDV: Informatik im<br />
Gesundheitswesen<br />
2 Std.<br />
Innerbetriebliche<br />
Fortbildung<br />
(parallel mit PP)<br />
2 Std.<br />
Scherer<br />
Schrader<br />
Sailer<br />
In der Veranstaltung geht es um die Kooperation von Managern und Pädagogen im Bereich von<br />
innerbetrieblicher Fortbildung und Personalentwicklung.<br />
Wie kann man sinnvolle Konzepte für innerbetriebliche Fortbildung entwickeln?<br />
Worum geht es da?<br />
Wie können Fachleute aus Management und Pädagogik zusammenarbeiten?
- 229 -<br />
Fachbereich Pflege - Hauptstudium - 7. Semester<br />
Studiengang Pflegemanagement<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Wahlpflichtfächer:<br />
Schwerpunkt Gesundheitspflege:<br />
Organisation des<br />
Pflegedienstes:<br />
Soziale Netzwerke<br />
(parallel mit PP)<br />
2 Std.<br />
Sozial- und Gesundheitspolitik:<br />
Gesundheits-<br />
Reform<br />
(parallel mit PP und<br />
3. Sem. TM)<br />
2 Std.<br />
Pflegewirtschaftslehre:<br />
Operatives Mangement<br />
für Non-Profit-Oragnisationen<br />
(gem. mit Studienschwerpunkt<br />
Gerontologische<br />
Pflege)<br />
2 Std.<br />
Werner Veranstaltungszeiten<br />
und -orte siehe Aushang<br />
des Fachbereichs Pflege!<br />
Werner<br />
Thiele<br />
Schwerpunkt Gerontologische Pflege<br />
Organisation des Pflegedienstes:<br />
Soziale Netzwerke<br />
(Altenhilfe und<br />
Altenpflege)<br />
2 Std.<br />
Werner Veranstaltungszeiten<br />
und -orte siehe Aushang<br />
des Fachbereichs Pflege!
- 230 -<br />
Fachbereich Pflege - Hauptstudium - 7. Semester<br />
Studiengang Pflegemanagement<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Ausgehend von den beiden sozialwissenschaftlichen Theorieansätzen “Soziales Netzwerk”<br />
und “Soziale Unterstützung” werden exemplarisch empirische Forschungen vorgestellt.<br />
Forschungsmethoden, -designs, -ergebnisse und deren Relevanz für Pflegeeinrichtungen und<br />
-dienste stehen im Mittelpunkt des Seminars. Die angeführten Themenbereiche werden<br />
schwerpunktmäßig auf die Zielgruppe älterer Menschen, auf die Altenpflege sowie auf die<br />
Einrichtungen und Dienste der ambulanten, teilstationären und vollstationären Altenpflege<br />
bezogen.<br />
Literatur:<br />
Netz, P., Steinkamp, G., Werner, B. (1996): Psychisch kranke ältere Menschen und ihre<br />
sozialen Netzwerke, Leske+Budrich, Opladen<br />
Zeitschift für Bevölkerungswissenschaft, Jg. 25, Heft 1, 2000: Die Pluralisierung von<br />
Lebensformen. In: Werner B., 1997, Demenz, Juventa, Weinheim<br />
(Literatur, auch zusätzliche, wird auszugsweise als Reader zur Verfügung gestellt.)<br />
ISAG<br />
Sozial- und<br />
Gesundheitspolitik:<br />
Pflegeversicherung<br />
(parallel mit PP)<br />
2 Std.<br />
ISAG<br />
Pflegewirtschaftslehre:<br />
Operatives Mangement<br />
für Non-Profit-<br />
Oragnisationen<br />
(gem. mit<br />
Studienschwerpunkt<br />
Gesundheitspflege)<br />
2 Std.<br />
Schulz-<br />
Nieswandt<br />
Thiele
- 231 -<br />
Fachbereich Pflege - Hauptstudium - 7. Semester<br />
Studiengang Pflegemanagement<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Zusatzfach - freiwillig -<br />
ISAG<br />
Forum Soziale<br />
Altenarbeit in der Stadt<br />
<strong>Freiburg</strong> und Umgebung<br />
(30 - 40 TN)<br />
Kricheldorff,<br />
Brandenburg<br />
Veranstaltungszeiten<br />
und - orte siehe Aushang<br />
zu Beginn des Semesters!<br />
Im Rahmen dieses regelmäßig stattfindenden Forums werden aktuelle Themen aus dem<br />
Berufsfeld der Sozialen Altenarbeit aufgegriffen. Nach einer inhaltlichen Einführung in das<br />
Thema wird dieses in einem intensiven Theorie-Praxis-Dialog vertieft und aus<br />
unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet.<br />
Über die inhaltliche Schwerpunktsetzung und die genauen Themen sowie Termine im<br />
Wintersemester 2003/04 wird über einen Plakataushang zu Beginn des Semesters informiert<br />
werden.<br />
Die einzelnen Veranstaltungen sind offen für alle Vertreter der Fachpraxis und interessierte<br />
Studierende aller Fachbereiche. Das Forum ist darüber hinaus auch eine<br />
Informationsplattform über Fort- und Weiterbildungsangebote, Tagungen und neue Literatur.
- 232 -<br />
Fachbereich Pflege - Hauptstudium - 7. Semester<br />
Studiengang Pflegepädagogik<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Pflichtfächer:<br />
Kommunikation:<br />
Rhetorische<br />
Kommunikation<br />
2 Std.<br />
Pflegewissenschaft:<br />
Kritische Analyse von<br />
Forschungsergebnissen<br />
in der<br />
Pflegewissenschaft<br />
(parallel mit PM)<br />
2 Std.<br />
N.N. Veranstaltungszeiten<br />
und -orte siehe Aushang<br />
des Fachbereichs Pflege!<br />
Reuschenbach<br />
Nähere Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie bei: http://www.pflege-wissenschaft.de/kfh/<br />
Recht:<br />
Arbeits- und Sozialrecht<br />
2 Std.<br />
Pädagogische<br />
Psychologie: Beratung<br />
2 Std.<br />
Jung<br />
------------ Verschoben ins<br />
8. Semester!<br />
Beratung wird als Teil von Pädagogik vorgestellt und diskutiert. Methodisch wird Beratung von<br />
Therapie einerseits und Lehren/Unterrichten andererseits abgegrenzt.<br />
Einzelne Beratungskonzepte werden erörtert und die Frage angesprochen, ob so etwas wie<br />
‘Beratungskompetenz’ ein sinnvolles Konstrukt ist, bzw. worin sie bestehen könnte.<br />
Schulorganisation:<br />
Organisation von<br />
Bildungseinrichtungen in<br />
den Pflegeberufen<br />
2 Std.<br />
Fritz
- 233 -<br />
Fachbereich Pflege - Hauptstudium - 7. Semester<br />
Studiengang Pflegepädagogik<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Didaktik:<br />
Betriebliche<br />
Bildungsarbeit im<br />
Gesundheitswesen<br />
2 Std.<br />
Innerbetriebliche<br />
Fortbildung<br />
(parallel mit PM)<br />
2 Std.<br />
alle<br />
Dozenten<br />
des<br />
FB Pflege<br />
Sailer<br />
Fließt in die Lehr-Lern-<br />
Forschungs- und<br />
Entwicklungsprojekte ein!<br />
In der Veranstaltung geht es um die Kooperation von Managern und Pädagogen im Bereich von<br />
innerbetrieblicher Fortbildung und Personalentwicklung.<br />
Wie kann man sinnvolle Konzepte für innerbetriebliche Fortbildung entwickeln?<br />
Worum geht es da?<br />
Wie können Fachleute aus Management und Pädagogik zusammen arbeiten?<br />
Wahlpflichtfächer:<br />
Schwerpunkt Gesundheitspflege:<br />
ISAG<br />
Organisation des<br />
Pflegedienstes:<br />
Soziale Netzwerke<br />
(gem. mit<br />
Studienschwerpunkt<br />
Gesundheitspflege)<br />
(parallel mit PM)<br />
2 Std.<br />
ISAG<br />
Sozial- und<br />
Gesundheitspolitik:<br />
Gesundheits-Reform<br />
(parallel mit PM)<br />
2 Std.<br />
Werner Veranstaltungszeiten<br />
und -orte siehe Aushang<br />
des Fachbereichs Pflege!<br />
Werner
- 234 -<br />
Fachbereich Pflege - Hauptstudium - 7. Semester<br />
Studiengang Pflegepädagogik<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Medienpädagogik<br />
(gem. mit Studienschwerpunkt<br />
Gerontologische Pflege)<br />
2 Std.<br />
Schwerpunkt Gerontologische Pflege:<br />
ISAG<br />
Organisation des<br />
Pflegedienstes:<br />
Soziale Netzwerke<br />
(Altenhilfe und<br />
Altenpflege)<br />
(gem. mit<br />
Studienschwerpunkt<br />
Gesundheitspflege)<br />
(parallel mit PM)<br />
2 Std.<br />
Strüber Nachzuholen aus<br />
dem 4. Semester!<br />
Werner<br />
Ausgehend von den beiden sozialwissenschaftlichen Theorieansätzen “Soziales Netzwerk” und<br />
“Soziale Unterstützung” werden exemplarisch empirische Forschungen vorgestellt.<br />
Forschungsmethoden, -designs, -ergebnisse und deren Relevanz für Pflegeeinrichtungen und -<br />
dienste stehen im Mittelpunkt des Seminars. Die angeführten Themenbereiche werden<br />
schwerpunktmäßig auf die Zielgruppe älterer Menschen, auf die Altenpflege sowie auf die<br />
Einrichtungen und Dienste der ambulanten, teilstationären und vollstationären Altenpflege<br />
bezogen.<br />
Literatur:<br />
Netz, P., Steinkamp, G., Werner, B. (1996): Psychisch kranke ältere Menschen und ihre sozialen<br />
Netzwerke, Leske+Budrich, Opladen<br />
Zeitschift für Bevölkerungswissenschaft, Jg. 25, Heft 1, 2000: Die Pluralisierung von<br />
Lebensformen. In: Werner B., 1997, Demenz, Juventa, Weinheim<br />
(Literatur, auch zusätzliche, wird auszugsweise als Reader zur Verfügung gestellt.)<br />
ISAG<br />
Sozial- und<br />
Gesundheitspolitik:<br />
Pflegeversicherung<br />
(parallel mit PM)<br />
2 Std.<br />
Schulz-Nieswandt
- 235 -<br />
Fachbereich Pflege - Hauptstudium - 7. Semester<br />
Studiengang Pflegepädagogik<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Medienpädagogik<br />
(gem. mit<br />
Studienschwerpunkt<br />
Gesundheitspflege)<br />
2 Std.<br />
Zusatzfach - freiwillig -<br />
ISAG<br />
Forum Soziale<br />
Altenarbeit in der Stadt<br />
<strong>Freiburg</strong> und Umgebung<br />
(30 - 40 TN)<br />
Strüber Nachzuholen aus dem<br />
4. Semester!<br />
Kricheldorff,<br />
Brandenburg<br />
Veranstaltungszeiten<br />
und - orte siehe Aushang zu<br />
Beginn des Semesters!<br />
Im Rahmen dieses regelmäßig stattfindenden Forums werden aktuelle Themen aus dem<br />
Berufsfeld der Sozialen Altenarbeit aufgegriffen. Nach einer inhaltlichen Einführung in das<br />
Thema wird dieses in einem intensiven Theorie-Praxis-Dialog vertieft und aus<br />
unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet.<br />
Über die inhaltliche Schwerpunktsetzung und die genauen Themen sowie Termine im<br />
Wintersemester 2003/04 wird über einen Plakataushang zu Beginn des Semesters informiert<br />
werden.<br />
Die einzelnen Veranstaltungen sind offen für alle Vertreter der Fachpraxis und interessierte<br />
Studierende aller Fachbereiche. Das Forum ist darüber hinaus auch eine Informationsplattform<br />
über Fort- und Weiterbildungsangebote, Tagungen und neue Literatur.
- 236 -
- 237 -<br />
THEOLOGISCHE<br />
ZUSATZAUSBILDUNG (ThZ)<br />
für Studierende der Fachbereiche Soz. Arb. / SP / HP<br />
Verantwortlich für die ThZ: Fachbereich Religionspädagogik<br />
Organisation und Betreuung für alle Semester:<br />
Herr Prof. Dr. Klaus Schilling
- 238 -<br />
Theologische Zusatzausbildung SozArb / SP / HP<br />
1. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Religionsphilosophie I<br />
Ist Gott gut?<br />
Überlegungen zur "Güte Gottes"<br />
angesichts der Zustände<br />
in der Welt<br />
2 Std. Vorl.<br />
Uhde Fr 9.45 - 11.15 3202<br />
Das Problem der "Güte Gottes" in Anbetracht der großen Miss-Stände in der Welt ist eine schwere<br />
gedankliche Herausforderung für die Theologie, aber auch für die einzelne Glaubenserfahrung.<br />
Von alters her haben daher religiöse Denker versucht, hier eine Antwort zu finden - und jeder, der<br />
in einer monotheistischen Religion lebt, muss Auskunft geben können, wie dieses Problem<br />
theoretisch und / oder praktisch zu lösen sei. Daher versucht die Vorlesung, einige der wichtigsten<br />
Standpunkte christlicher Theologie vorzustellen und diese in eine praxisbezogene Gegenwart zu<br />
übersetzen.<br />
Altes Testament<br />
2 Std. Vorl.<br />
Heusler Di 14.00 - 15.30 3302<br />
„Der Herr führte uns mit starker Hand und hoch erhobenem Arm, unter großem Schrecken, unter<br />
Zeichen und Wundern aus Ägypten, er brachte uns an diese Stätte und gab uns dieses Land, ein<br />
Land, in dem Milch und Honig fließen“ (Dtn 26,8f) – so lautet die zentrale Erfahrung Israels mit<br />
seinem Gott. Wer ist dieser Gott, den Israel durch die Jahrhunderte hindurch als den Rettenden<br />
und Befreienden bekennt? Von welchem Welt- und Menschenbild zeugen die alttestamentlichen<br />
Schriften? Welche Perspektiven eröffnet der biblische Gottesglaube den Menschen damals – und<br />
den Menschen von heute? Die Vorlesung zeichnet die Entstehungsgeschichte der alttestamentlichen<br />
Überlieferungen nach und bietet Anregungen an, diesen Fragen auf die Spur zu kommen.<br />
Dogmatik I<br />
Einführung in die<br />
Theologie<br />
2 Std. Vorl.<br />
Schilling Di 15.45 - 17.15<br />
Beginn: 14.10.2003<br />
3301<br />
In einem ersten Teil geht es darum, in die Begriffe Glaube und Offenbarung einzuführen, sowie<br />
einen Überblick über die einzelnen Disziplinen der Theologie und die Traktate der Dogmatik zu<br />
vermitteln. Der zweite Teil beschäftigt sich mit der theologischen Gotteslehre.
Theologische Zusatzausbildung SozArb / SP / HP<br />
5. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Christliche Ethik I<br />
Einführung in die christliche<br />
Ethik<br />
2 Std. Vorl.<br />
Schmitz Do 13.30 - 15.00 3301<br />
Philosophische, sozialwissenschaftliche und psychologische Reflexionen im ersten Teil der<br />
Lehrveranstaltung dienen der Grundlegung eines angemessenen Verständnisses von Ethik sowie<br />
deren Voraussetzungen (z. B. Handlungsfreiheit). Anschließend wird die neuzeitliche Problematik<br />
von Sinnoptionen sowie deren Bedeutung für die Ethik behandelt. Die Vorstellung fundamentaler<br />
Elemente einer heutigen christlichen Ethik ist auch als Antwortversuch auf die aufgeworfenen<br />
Fragen zu verstehen.<br />
Religionspädagogik II<br />
Religionspädagogische<br />
Konzepte<br />
2 Std. Vorl.<br />
Pemsel-Maier Do 15.15 - 16.45 3301<br />
Die Lehrveranstaltung führt ein in Theorie und Praxis des Religionsunterrichtes. Im ersten Teil<br />
werden verschiedene religionspädagogische Konzepte und didaktische Ansätze vorgestellt. Im<br />
Mittelpunkt des 2. Teils steht die konkrete Planung und Durchführung von Religionsstunden.
Theologische Zusatzausbildung SozArb / SP / HP<br />
7. Semester<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Christliche Ethik II<br />
3 Std. Vorl.<br />
Schmitz Mo 14.00 - 16.30 3302<br />
Behandelt werden die Themenbereiche:<br />
6 Biblische Grundlagen einer christlichen Ethik<br />
6 Gewissen und Gewissensbildung<br />
sowie je nach Präferenz der Teilnehmer/Teilnehmerinnen alternativ:<br />
6 Leitlinien und Prinzipien christlicher Sozialethik/Soziallehre<br />
6 Schwangerschaftsabbruch und Schwangerenkonfliktberatung<br />
Kolloquium zu den<br />
Prüfungen<br />
(Christliche Ethik,<br />
Religionspädagogik)<br />
1 Std.<br />
Aktuelle ethische Fragestellungen<br />
Aktuelle Probleme der Religionspädagogik<br />
Schmitz<br />
Pemsel-Maier<br />
n.V.<br />
n.V.<br />
Das Kolloquium dient der didaktischen Vertiefung; ebenso sollen Fragen und Probleme der<br />
Studierenden angesprochen werden, die diese aus ihrer Unterrichtserfahrung her mitbringen.<br />
Zugleich findet eine Vorbereitung auf die mündliche Prüfung statt.
- 241 -<br />
ZUSATZLEHRPROGRAMME
- 242 -<br />
ZUSATZLEHRPROGRAMME<br />
Theologische Zusatzausbildung (ThZ)<br />
Studentinnen und Studenten der Fachbereiche Soziale Arbeit und Heilpädagogik<br />
haben die Möglichkeit, im Verlauf ihres Studiums an der KFH die Lehrveranstaltungen<br />
der ThZ zu besuchen und nach erfolgreicher Beteiligung an<br />
den vorgesehenen Prüfungsverfahren ein Zeugnis zu erwerben.<br />
Die ThZ dient einerseits der persönlichen theologischen Auseinandersetzung<br />
mit dem christlichen Glauben und der religiösen Vertiefung, andererseits der<br />
Ergänzung der hauptberuflichen Qualifikation als Sozialarbeiter /Sozialarbeiterin,<br />
Sozialpädagoge/Sozialpädagogin, Heilpädagoge/Heilpädagogin für eine<br />
spätere Tätigkeit in sozialarbeiterischen, sozialpädagogischen und heilpädagogischen<br />
Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft, in denen auch religiöse<br />
Erziehung / Begleitung / Beratung wesentliche Aufgabenfelder sind.<br />
Kontaktperson: Prof. Dr. Klaus Schilling, Zi. 3210, Tel. 200 443,<br />
schilling@kfh-freiburg.de<br />
SPOSA<br />
Sportbezogene, lebensweltorientierte Soziale Arbeit mit sozial benachteiligten<br />
jungen Menschen<br />
Die Katholische Fachhochschule <strong>Freiburg</strong> führt in Kooperation mit der Sportschule<br />
Karlsruhe-Schöneck, der Badischen Sportjugend und den Projektträgern<br />
der Sportpraxis/Sportprojekte für Studierende der Fachbereiche Soziale<br />
Arbeit und Heilpädagogik das Zusatzlehrprogramm “SPOSA” durch.<br />
Die Voraussetzung für die Teilnahme am Zusatzlehrprogramm “SPOSA” ist die<br />
Mitgliedschaft in einem Sportfachverband; pro Studienjahr können bis zu sechs<br />
Teilnehmer/-innen am Programm teilnehmen. Spätestens zum Ende des<br />
Semesters, zu dem die Studentin/der Student sich für das Zusatzlehrprogramm<br />
“SPOSA” anmeldet, ist ein einmaliger Teilnehmerbeitrag von L 100,00 zu<br />
bezahlen.<br />
Nach erfolgreicher Absolvierung des Programms wird auf Antrag und bei<br />
Vorliegen aller Nachweise ein Zertifikat ausgestellt.<br />
Kontaktperson: Prof. Dr. Engelbert Schinzler, Zi. 3213, Tel. 200 484,<br />
schinzler@kfh-freiburg.de
- 243 -<br />
ZUSATZLEHRPROGRAMME<br />
Fachschule/Didaktik des Unterrichtens<br />
Das Zusatzlehrprogramm “Fachschule/Didaktik des Unterrichtens” ist eine<br />
fakultatives Programm der Katholischen Fachhochschule für Studierende aller<br />
Fachbereiche. Folgende Personengruppen können zugelassen werden:<br />
- Erzieher/innen nach Abschluss einer einschlägigen 3-jährigen Fachschulausbildung<br />
(einschließlich Anerkennungsjahr) sowie mindestens einem weiteren<br />
Jahr anschließender Berufserfahrung oder<br />
- Erzieher/innen, Heilpädagogen/innen, Jugend- und Heimerzieher/innen, die<br />
gemäß § 53, Abs. 7, Satz 1 des Fachhochschulgesetzes Baden-Württemberg<br />
die Zugangsvoraussetzungen für das Studium an der Fachhochschule<br />
erworben haben.<br />
Für das Zusatzlehrprogramm Fachschule/Didaktik des Unterrichtens ist der<br />
Fachbereich Soziale Arbeit zuständig. Als Teilnehmerzahl sind jährlich 10<br />
Plätze vorgesehen. Die Zulassung erfolgt durch einen besonderen Aufnahmeausschuss,<br />
der sich aus je einem Mitglied der beteiligten Fachbereiche zusammensetzt.<br />
Das Zusatzlehrprogramm besteht aus folgenden Fächern:<br />
- Methodik und Didaktik des Unterrichtens<br />
- Didaktisches Begleitseminar<br />
- schulpraktischer Einsatz mit Supervision und Anleitung<br />
- musische Lehrveranstaltungen<br />
Die erfolgreiche Teilnahme an den Lehrveranstaltungen des Zusatzlehrprogramms,<br />
am schulpraktischen Einsatz und an der abschließenden Prüfung wird<br />
durch ein Zertifikat bestätigt.<br />
Kontaktperson: Prof. Dr. Engelbert Schinzler, Zi. 3213, Tel. 200 484,<br />
schinzler@kfh-freiburg.de<br />
Sozial- und heilpädagogische Kunsttherapie<br />
Das Konzept basiert auf einer Verknüpfung von bildender Kunst/Werken,<br />
Verfahren/Methoden der Kunsttherapie und Therapie mit Medien. Die persönliche<br />
Lebensgeschichte wird als exemplarisches Lernfeld hinterfragt. In diesem<br />
Zusammenhang wird besonders an den Phänomenen innerer Bilder gearbeitet.<br />
Die Kunst steht in ihrer medialen und kommunikativen Dimension im Mittelpunkt.<br />
Sie dient in dieser Weiterbildung keinem Selbstzweck. Dass der eigene<br />
künstlerische Ausdruck gefördert werden kann, ist ein positiver Begleitumstand.<br />
Es wird in der Weiterbildung darauf ankommen, Belastungen und Krisen<br />
des eigenen Lebens in Bezug auf die scheinbar zur Verfügung stehenden
- 244 -<br />
ZUSATZLEHRPROGRAMME<br />
Erinnerungen künstlerisch umzusetzen. Der Austausch in einer Gruppe ermöglicht<br />
Wechselwirkungen zwischen erinnerten und ersehnten Lebensverhältnissen.<br />
Lehren und Lernen gründet sich auf kontinuierlicher biographischer<br />
Kommunikation.<br />
Die Lehrinhalte umfassen die Vermittlung und Erarbeitung kunsttherapeutischer<br />
Verfahren, künstlerischer Ausdruckprozesse und grundlegender therapeutischer<br />
Verfahren:<br />
- inhaltlich orientierte Bild-Analyse<br />
- problemorientierte Initiierung und Analyse von Bildern<br />
- Assoziation neuer Problemstellungen<br />
- erinnerndes Zeichnen, Malen und Werken<br />
- künstlerische Verfahren in Gruppen.<br />
Nach Abschluss der Weiterbildung kann auf der Grundlage von<br />
sozialarbeiterischen, sozial-, heil- und religionspädagogischen Grundberufen<br />
eine kunsttherapeutische Tätigkeit in sozialen und psychiatrischen Institutionen<br />
und Einrichtungen der Rehabilitation ausgeübt werden.<br />
Kontaktperson: Prof. Dr. Karl-Heinz Menzen, Zi. 2307, Tel. 200 261<br />
menzen@kfh-freiburg.de,<br />
Fachschulrat Karl-Georg Schönenborn, Zi. 3218, Tel. 200 514,<br />
schoenenborn@kfh-freiburg.de<br />
ISAG<br />
Interdisziplinärer Schwerpunkt Angewandte Gerontologie<br />
Mit dem Zusatzangebot des ISAG reagiert die KFH <strong>Freiburg</strong>, in Kooperation mit<br />
der EFH <strong>Freiburg</strong>, auf die mit dem demographischen Wandel verbundenen<br />
Herausforderungen und Veränderungen vieler Arbeitsfelder, in allen angebotenen<br />
Studienrichtungen. Studierende aller Fachbereiche haben die Möglichkeit,<br />
innerhalb ihres grundständigen Studiums im eigenen Fachbereich und zusätzlich<br />
in den Lehrveranstaltungen der anderen Fachbereiche sowie der EFH,<br />
Lehrveranstaltungen zu besuchen, die sich speziell mit Fragen des Alters und<br />
des Alterns beschäftigen, wenn diese für ISAG ausgewiesen und im Vorlesungsverzeichnis<br />
gekennzeichnet sind. Auf diesem Weg können sie sich nach<br />
einem individuellen Studienplan mit spezifischen Handlungsansätzen im Bereich<br />
der Angewandten Gerontologie vertraut machen und damit eine inhaltliche<br />
Schwerpunktsetzung in diesem Feld vornehmen. Sie erweitern damit ihre<br />
hauptberufliche Qualifikation um gerontologische Kenntnisse und Kompetenzen,<br />
die - vor dem Hintergrund des Altersstrukturwandels - in der Praxis immer<br />
stärker nachgefragt werden.
- 245 -<br />
ZUSATZLEHRPROGRAMME<br />
ISAG dient damit<br />
6 der grundlegenden Information über demographische Veränderungen in<br />
unserer Gesellschaft und dem damit verbundenen Wandel der Lebenslagen<br />
und Lebensstile alter Menschen<br />
6 dem Kennenlernen der gesundheitlichen, sozialen und psychischen Einflussfaktoren<br />
auf den Alternsprozess sowie der Möglichkeiten und Grenzen von<br />
Intervention<br />
6 der Vermittlung grundlegender Kompetenzen in folgenden beruflichen<br />
Handlungsfeldern der Arbeit mit alten Menschen:<br />
1. Diagnostik/ Beratung<br />
2. Freizeit/ Bildung/ Kultur,<br />
3. Planung/Vernetzung,<br />
4. Führung/Leitung<br />
Für die Zulassung zur Prüfung muss der erfolgreiche Besuch von Lehrveranstaltungen<br />
in den folgenden Modulen nachgewiesen werden:<br />
Einführungsveranstaltung<br />
Grundlagen der Gerontologie 2 SWS<br />
+<br />
Modul 1<br />
Soziale Gerontologie 4 SWS<br />
+<br />
Modul 2<br />
Gerontologische Pflege 4 SWS<br />
+<br />
Modul 3<br />
Interventionsgerontologie 4 SWS<br />
+<br />
Modul 4<br />
Ethisch-philosophische und religiöse Grundfragen der 4 SWS<br />
Arbeit mit alten Menschen<br />
+
- 246 -<br />
ZUSATZLEHRPROGRAMME<br />
Wahlpflichtbereich:<br />
Aus den folgenden vier Handlungsfeldern ist jeweils eine Veranstaltung zu<br />
belegen. Diese werden ebenfalls von allen Fachbereichen angeboten, im<br />
Vorlesungsverzeichnis speziell ausgewiesen und sind damit anrechenbar für<br />
das ISAG.<br />
Diagnostik, Beratung 2 SWS<br />
Freizeit, Bildung, Kultur 2 SWS<br />
Vernetzung, Planung 2 SWS<br />
Führung, Leitung 2 SWS<br />
Gesamtstundenzahl: 26 SWS<br />
Im Rahmen einer Informationsveranstaltung zu ISAG, zu Beginn des Wintersemesters<br />
2003/04, wird über das Studienprogramm und seine Zusammensetzung<br />
ausführlich informiert und eine kommentierte Zusammenstellung aller<br />
zugelassenen Lehrveranstaltungen angeboten.<br />
Kontaktpersonen: Prof. Dr. Cornelia Kricheldorff, Zi.-Nr. 3115<br />
Tel. 200/441; e-mail: kricheldorff@kfh-freiburg.de<br />
Prof. Dr. Hermann Brandenburg (FB Pflege)<br />
Tel. 200/672; e-mail: brandenburg@kfh-freiburg.de<br />
Regio-Akademie für Soziale Arbeit<br />
Regio-Pôle de formation sur le travail social<br />
Seit mehreren Jahren kooperieren die Ausbildungsstätten für Soziale<br />
Arbeit im Elsaß, in der Nordschweiz und in Südbaden in einer “Konföderation<br />
der Fachhochschulen und Höheren Fachschulen des Sozialwesens<br />
in der Regio/ Confédération des Ecoles Superieures en Travail<br />
Social de la Regio (RECOS)”.<br />
Folgende Ausbildungsstätten gehören RECOS an:<br />
- Institut Supérieur Social de Mulhouse<br />
- Centre de Formation d’Educateurs de Jeunes Enfants de Mulhouse<br />
- Ecole Supérieure en Travail Éducatif et Social de Strasbourg<br />
- Fachhochschule für Soziale Arbeit beider Basel<br />
- Evangelische Fachhochschule <strong>Freiburg</strong>,
- 247 -<br />
ZUSATZLEHRPROGRAMME<br />
- Hochschule für Soziale Arbeit, Religionspädagogik und Gemeindediakonie<br />
- Katholische Fachhochschule <strong>Freiburg</strong>, Hochschule für Sozialwesen,<br />
Religionspädagogik und Pflege<br />
Diese Ausbildungsstätten bieten seit dem Wintersemester 1997/98 für<br />
die Studierenden ihrer Sozialwesenstudiengänge ein gemeinsames<br />
Zusatzlehrprogramm “Regio-Akademie für Soziale Arbeit/Regio-Pôle de<br />
formation sur le travail social” an. Das Zusatzlehrprogramm bietet Studierenden<br />
der Fachhochschulen für Soziale Arbeit in Basel, <strong>Freiburg</strong>,<br />
Mulhouse und Straßburg die Möglichkeit<br />
- Kenntnisse politischer, wirtschaftlicher, sozialer und rechtlicher<br />
Gegebenheiten und Entwicklungen, soziale Problemstellungen<br />
und sozialpolitische sowie sozialarbeiterische/<br />
sozialpädagogische/heilpädagogische Lösungsansätze und Lösungen<br />
in Deutschland, Frankreich und in der Schweiz zu erwerben<br />
- Fähigkeiten der Analyse und des Vergleichs der verschiedenen<br />
nationalen und supranationalen Gegebenheiten zu entwickeln<br />
- Kenntnisse von Kultur und Sprache der europäischen Nachbarn<br />
weiter zu ent wickeln und<br />
- Fähigkeiten zum beruflichen Tätigwerden in Feldern, die die<br />
Grenzen des Nationalstaats überschreiten, zu erlernen.<br />
Das Zusatzlehrprogramm erstreckt sich über 3 Jahre. Innerhalb des Programms<br />
sind sieben Module vorgesehen.<br />
Kontaktperson: Prof. DDr. Gerhard Hammer, Zi. 3226, Tel. 200 520,<br />
hammer@kfh-freiburg.de<br />
Europäische Soziale Arbeit<br />
Die KFH <strong>Freiburg</strong> bietet in Kooperation mit der Libera Universita Maria<br />
SS. Assunta in Rom/Italien (LUMSA) und der Escola Universitaria de<br />
Treball Social an der Ramon Llull Universität Barcelona/Spanien für<br />
Studierende der Studiengänge Soziale Arbeit und Heilpädagogik ein<br />
Zusatzlehrprogramm Europäische Soziale Arbeit an.
- 248 -<br />
ZUSATZLEHRPROGRAMME<br />
Das Zusatzlehrprogramm Europäische Soziale Arbeit will interkulturelle<br />
Kompetenz vermitteln, insbesondere<br />
- die Kenntnis politischer, wirtschaftlicher, sozialer und rechtlicher<br />
Gegebenheiten, sozialer Problemstellungen und sozialpolitischer<br />
sowie sozialarbeiterischer Lösungsansätze und Lösungen in<br />
ausgewählten Ländern der Europäischen Union und in europäischen<br />
Zusammenhängen<br />
- die Fähigkeit der Analyse und des Vergleichs unterschiedlicher<br />
nationaler und supranationaler Gegebenheiten<br />
- die Fähigkeit, beruflich tätig zu werden in Feldern, die die engen<br />
Grenzen des Nationalstaates überschreiten<br />
- die Kenntnis von Kultur und Sprache eines europäischen Nachbarn<br />
Das Zusatzlehrprogramm umfasst die folgenden Module:<br />
- fachbezogene Sprachkurse an der KFH in Italienisch oder Spanisch<br />
im 1. bis 5.Semester und Intensivsprachkurs in Italien oder<br />
Spanien vor dem praktischen Studiensemester<br />
- binationales Seminar der KFH<br />
- zwei Seminare zu im europäischen Kontext relevanten Themen<br />
- Absolvierung eines praktischen Studiensemesters in Rom oder<br />
Barcelona<br />
- Diplomarbeit zu einem Thema aus dem Problemkreis des<br />
Zusatzlehrlehrprogramms<br />
- Hochschulabschlussprüfung, in der auch Themen im Kontext des<br />
Zusatzlehrprogramms in die Prüfung einbezogen wurden<br />
Kontaktperson: Prof. DDr. Nikolaus Sidler, Zi. 3110, Tel. 200 449,<br />
sidler@kfh-freiburg.de<br />
Weiterbildungsvertrag 2003 - 2006, Theaterpädagogische Grundausbildung<br />
zum Spielleiter / zur Spielleiterin<br />
Kontaktperson: Prof. Katharina Megnet, Zi. 3214, Tel. 200 526,<br />
megnet@kfh-freiburg.de
- 249 -<br />
Kooperationsveranstaltungen<br />
mit der<br />
Evangelischen Fachhochschule<br />
<strong>Freiburg</strong>
- 250 -<br />
Kooperationsveranstaltungen mit der EFH<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Einführung in die<br />
Heilpädagogik<br />
2 Std. Vorlesung<br />
+ 5 Teilnehmer EFH<br />
Kösler Mo 11.30 - 13.00 2200<br />
Die Veranstaltung liefert einen ersten systematischen Einblick in die Themen, Traditionen und<br />
aktuellen Trends der Heilpädagogik. In diesem Semester sollen insbesondere Praxiskonzepte,<br />
Kernbegriffe und Aufgaben der Heilpädagogik in der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung<br />
Gegenstand sein. Förderung, Beratung und Begleitung für Menschen mit geistiger<br />
Behinderung gelten als wesentliche Aufgaben der Heilpädagogik. Heilpädagogische Maßnahmen<br />
sollen fachlich differenziert und theoriegeleitet die Integration des Individuums in seine<br />
soziale Umwelt vorbereiten und sichern. Die entsprechenden Theorien, Modelle und Methoden<br />
werden diskutiert.<br />
Einführung in die<br />
Kunsttherapie /<br />
Gestaltungspädagogik<br />
2 Std. Vorlesung<br />
(mit Teilnehmern der EFH)<br />
Menzen Mi 18.00 - 21.00<br />
14-täglich<br />
Beginn: 22.10.03<br />
weitere Termine:<br />
5.11./19.11.03<br />
3.12./17.12.03<br />
7.1./14.1.04<br />
Die Einführungsveranstaltung "Kunsttherapie/Gestaltungspädagogik I" will in die verschiedenen<br />
Ansätze kunst- und gestaltungstherapeutischer Verfahren einführen<br />
Im Mittelpunkt der Vorlesung werden Projekte stehen, die im heil- und sozialpädagogischen<br />
sowie im sozialarbeiterischen Berufsfeld stattfanden. Wahrnehmungsgeschädigte, mental und<br />
altersverwirrte, verhaltensverunsicherte, d. h. selbstwert- und emotional gestörte, psychiatrisierte<br />
Menschen, - das sind Beispiele anhand deren kunst- und gestaltungspädagogische wie -<br />
therapeutische Maßnahmen gezeigt und theoretisch fundiert werden.<br />
Literatur: K.- H. Menzen: (Grundlagen der Kunsttherapie. UTB.München 2002.<br />
JEUX DRAMATIQUES<br />
im Heilpäd. Hort<br />
8 Tn<br />
(4 Tn KFH / 4 Tn EFH)<br />
2 Std. Seminar<br />
Weiss Vorbereitungstreffen<br />
an der KFH:<br />
Di 14.10.2003<br />
14.00 - 17.00<br />
Die Jeux Dramatiques - Ausdrucksspiel aus dem Erleben - sind eine pädagogische Methode,<br />
Geschichten, Bilderbücher, Märchen zu spielen, ohne Texte zu lernen oder Requisiten zu bauen.<br />
Gemeinsam mit Kindern im Grundschulalter erleben wir bekannte und unbekannte Geschichten<br />
oder erfinden unsere eigenen Spiel-Texte. Studierende haben die Möglichkeit, die Methode<br />
darüber hinaus in Reflexion und Planung theoretisch zu erfahren und sich Anwendungsmöglichkeiten<br />
in heil- und sozialpädagogischen Kinder- oder Erwachsenengruppen zu erarbeiten.<br />
Lit. u.a.: Weiss: Wenn die roten Katzen tanzen... <strong>Freiburg</strong> 1999<br />
Aula<br />
1100<br />
2400
- 251 -<br />
Kooperationsveranstaltungen mit der EFH<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
JEUX DRAMATIQUES<br />
mit Erwachsenen - ein<br />
integratives Projekt<br />
8 Tn<br />
(4 Tn KFH / 4 Tn EFH)<br />
2 Std. Seminar<br />
Weiss Kompaktseminar:<br />
28. / 29.11.2003<br />
Vorbereitungstreffen<br />
an der KFH:<br />
Di 11.11.2003<br />
19.00 - 21.00 Uhr<br />
Di 18.11.2003<br />
19.00 - 21.00Uhr<br />
Nachbereitungstreff:<br />
nach Vereinbarung<br />
WFB<br />
Neuershausen<br />
Die Jeux Dramatiques (Ausdrucksspiel) sind eine Methode des freien Theaterspiels ohne<br />
eingeübte Rollen, ohne Auswendiglernen und ohne Proben. Als Spielvorlagen dienen Geschichten,<br />
Märchen, Bilderbücher, Gedichte u.ä., die wichtigsten Requisiten sind Tücher in allen<br />
Farben und Größen zum Verkleiden und Gestalten der Spielplätze. Im Vordergrund stehen das<br />
eigene Empfinden und die eigene Spielfreude, nicht das Erbringen von Leistungen. Wir werden<br />
gemeinsam ein integratives Wochenend-Projekt für Erwachsene mit geistiger Behinderung und<br />
für Studierende vorbereiten, erleben und reflektieren. Im Tun werden die methodischen Grundlagen<br />
erarbeitet und für die Zielgruppe spezifiziert.<br />
Die Teilnahme sowohl am Wochenende wie an den Vor- und Nachbereitungstreffen wird<br />
erwartet. Ort: WFB Neuershausen<br />
Lit. u.a.: Weiss, Gabriele: Wenn die roten Katzen tanzen... Jeux Dramatiques für sozial- und<br />
heilpädagogische Berufe. <strong>Freiburg</strong> 1999<br />
Einführungsseminar<br />
in die "Regio-Akademie"<br />
(für alle Semester der<br />
Fachbereiche SozArb,<br />
SozPäd, HeilPäd und Studierende<br />
der<br />
EFH <strong>Freiburg</strong>)<br />
1 Std. Sem.<br />
Spiegelberg/<br />
Weiss<br />
Zeitangabe folgt rechzeitig<br />
durch Aushang!<br />
2400<br />
2400
- 252 -<br />
Kooperationsveranstaltungen mit der EFH<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Das Projekt "Regio-Akademie für soziale Arbeit" ist ein Gemeinschaftsprojekt der in RECOS<br />
zusammengeschlossenen Ausbildungsstätten für Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Heilpädagogik<br />
in Mulhouse, Strasbourg, Basel sowie an der EFH <strong>Freiburg</strong>. Im Rahmen dieses Projekts<br />
besteht die Möglichkeit, über ein Zusatzlehrprogramm interkulturelle Kompetenzen zur grenzüberschreitenden<br />
Zusammenarbeit zu erwerben. Über die erfolgreiche Teilnahme in diesem<br />
Programm wird am Ende ein Zertifikat in deutscher und französischer Sprache ausgestellt. -<br />
Themen des Einführungsseminars werden sein: Einführung in Anliegen und Struktur des<br />
Zusatzlehrprogramms; Ausbildungssysteme zu sozialen Berufen in den drei Ländern; sozialrelevante<br />
Aspekte zur Situation in der Regio; soziale Dienstleistungssysteme in Elsass, Nordschweiz<br />
und Südbaden; Grundstruktur der sozialen Sicherheit in den drei Ländern.<br />
Heilpädagogik<br />
Soziale Integration und<br />
berufliche Eingliederung<br />
TN EFH: 5<br />
1 Std.<br />
Markowetz Do 08.00 - 08.45 2200<br />
Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der<br />
Weltgesundheitsorganisation (WHO) betont sehr stark den gesellschaftlichen Kontext, in dem<br />
Menschen mit Behinderungen leben, sowie ihre Möglichkeiten zu aktiver und selbstbestimmter<br />
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Diese sozialintegrative Zielsetzung findet ihren Ausdruck<br />
im neunten Buch “Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen” unserer Sozialgesetzgebung<br />
(SGB IX). Das integrative Paradigma verändert nachhaltig auch das System der<br />
sozialen und beruflichen Rehabilitation. Am Beispiel der beruflichen Eingliederung von Menschen<br />
mit geistiger Behinderung werden Möglichkeiten und Grenzen dieser tiefgreifenden<br />
Reform aufgezeigt und die veränderten Anforderungen an die Heilpädagogik kritisch diskutiert.<br />
Heilpädagogik<br />
Förderung und Begleitung<br />
im Alter<br />
TN<br />
EFH: 5<br />
1 Std.<br />
Menzen Mi 11.30 - 13.00<br />
14-täglich<br />
Beg: 15.10.03<br />
Wir werden uns fragen: Was Altern bedeutet in anthropologischer, physiologischer, neurologischer<br />
Hinsicht; wie Behinderung im Alter sich je anders zu zeigen vermag, jedenfalls nicht<br />
immer erschwerend; wie die Rahmenbedingungen eines Heims, ob Pflege- oder Behinderteneinrichtung,<br />
die traumatisierende Belastung einer Heimeinweisung mildern können; wie psychische<br />
Belastungen im Alter sich zeigen; schließlich welche Fördermaßnahmen im behinderten<br />
Alterungsprozess angelegen sind.<br />
2300
- 253 -<br />
Kooperationsveranstaltungen mit der EFH<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Die Offenbarung des<br />
Johannes<br />
2 Std. Sem.<br />
Kooperation KFH/EFH<br />
Heusler Di 15.45 - 17.15<br />
Beg: 14.10.03<br />
Die Offenbarung des Johannes, das letzte Buch der Bibel, ist die einzige apokalyptische Schrift<br />
des Urchristentums, die in den neutestamentlichen Kanon aufgenommen worden ist. In einer<br />
Zeit großer Bedrängnis am Ende des ersten Jahrhunderts – zur Zeit des seine Gottheit propagierenden<br />
Kaisers Domitian – schreibt der Verfasser der Johannes-Apokalypse, „was in Kürze<br />
geschehen muss“ (Apk 1,1; 22,6): Nicht der römische Kaiser, sondern Gott wird seine Herrschaft<br />
endgültig durchsetzen – das Heil, das mit der Auferweckung Jesu von Nazareth bereits begonnen<br />
hat.<br />
Das Seminar führt ein in die Gedankenwelt der frühjüdischen Apokalyptik, vor deren Hintergrund<br />
die Offenbarung des Johannes zu verstehen und zu interpretieren ist, erschließt die Visionen<br />
und Auditionen des Sehers Johannes, ihre zunächst fremde Sprache und ihre geheimnisvollen<br />
Bilder, und fragt nach der Bedeutung ihrer theologischen und christologischen Aussagen für die<br />
Menschen damals und heute.<br />
Erstes Testament:<br />
Einführung in die Psalmen<br />
2 Std. Sem.<br />
Kooperation KFH/EFH<br />
Schwendemann<br />
Mo 11.00 - 13.00<br />
Beg: 13.10.03<br />
Ort:<br />
Evangelische Fachhochschule<br />
Bugginger Str. 38,<br />
<strong>Freiburg</strong><br />
In dieser einführenden Veranstaltungen zu poetischen Texten der hebräischen Bibel geht es<br />
in erster Linie um die tehillim - Sammlungen des Psalters. Einleitungsfragen, Stil, Aufbau,<br />
Gattungen und Formelemente der Psalmen sollen kennen gelernt werden, auch die doppelte<br />
Auslegung in Judentum und Christentum steht im Vordergrund. Zu einzelnen Gattungen werden<br />
exemplarisch Psalmen ausgelegt und interpretiert. Eine wesentliche Rolle sollen auch die<br />
so genannten Rache- und Feindpsalmen mit ihrer verheerenden Wirkungsgeschichte spielen.<br />
Die Veranstaltung ist für Studierende der Katholischen Fachhochschule <strong>Freiburg</strong> geöffnet.<br />
3302
- 254 -<br />
Kooperationsveranstaltungen mit der EFH<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Französisch<br />
(mit Themen aus der Sozialen<br />
Arbeit)<br />
in Kooperation mit EFH<br />
2 Std.Üb. je max. 15 Tn.<br />
- für Anfänger mit Vorkenntnissen<br />
- Cours de français pour<br />
travailleurs sociaux,<br />
niveau avancé<br />
- für Fortgeschrittene<br />
Pinto<br />
Pinto<br />
Pinto<br />
Di 18.00 - 19.30<br />
Mi 09.45 - 11.15<br />
Beg: 07./08.10.03<br />
Mo 18.00 - 19.30<br />
Beg: 06.10.03<br />
Di 19.30 - 21.00<br />
Beg: 07.10.03<br />
Le cours de français pour travailleurs sociaux - niveau avancé est un cours de langue pour les<br />
étudiantes de la Evang. Fachhochschule et de la Kath. Fachhochschule à Fribourg.<br />
Rafraichir ses connaissances de français, pouvoir se faire comprendre dans la vie de tous les<br />
jours ou au téléphone, mener une conversation plus ou moins difficile: tels sont les objectifs de<br />
ce cours. Le niveau de difficulté du cours sera adapté en fonction des besoins et des intérêts de<br />
la majorité du groupe.<br />
English for Social Work<br />
Professionals<br />
Advanced course<br />
(in Cooperation with Evangelische<br />
Fachhochschule<br />
<strong>Freiburg</strong>)<br />
2 Std. max.11 Tn. KFH<br />
S.<br />
Scharberth<br />
Mi 18.30 - 20.00<br />
Beg: 08.10.03<br />
3301<br />
2300<br />
2100<br />
3301<br />
EFH
- 255 -<br />
Kooperationsveranstaltungen mit der EFH<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
English for Social Work Professionals is a language course for Students of the Evangelische<br />
Fachhochschule and the Katholische Fachhochschule in <strong>Freiburg</strong>. It will help students build a<br />
professional vocabulary for study or work in English speaking countries or with English speaking<br />
clients or colleagues. It is designed to help attempt to bridge the gap between general secondary<br />
school English and professional English language skills (reading, writing and conversing)<br />
needed fo different professional purposes:<br />
- reading professional texts for study purposes<br />
- communicating with students and professionals during international exchange programs<br />
and/or conferences<br />
- competing for international scholarships<br />
- preparation for field placements in English speaking countries<br />
The seminar will include explanations and presentations by the instructur, role plays, translation<br />
exercises. Instruction is in American English; students should be able to read and speak<br />
conversational English, but fluency is not necessary. A certificate will be awarded upon successful<br />
completion of the course.<br />
Social Work<br />
Methodology<br />
Advanced course<br />
(in Cooperation with Evangelische<br />
Fachhochschule<br />
<strong>Freiburg</strong>)<br />
2 Std. max. 10 Tn KFH<br />
T. Rogers Di 16.00 - 18.00<br />
oder<br />
Do 16.00 - 18.00<br />
Beg: 07./09.10.03<br />
genaues Datum<br />
und Uhrzeit werden<br />
per Aushang bekannt<br />
gegeben<br />
The course consists of a combination of general and specific theoretical aspects which are<br />
intended to help students become more aware of the role of social work methodology in the past<br />
an in modern day social casework practice. In additon to an introduction and overview of<br />
theories and concepts dealing with social casework, a major focus of seminar activity will be on<br />
“learning by doing”: practical exercises, interview techniques and the reflection of role play<br />
experiences.<br />
The course also includes information about the history, development and practice of social work<br />
from the beginning of the 20 th up until the present date. The major emphasis of the seminar is<br />
however not on historical aspects, but rather on up to date, every day, practical aspects of<br />
dealing with social work clients in different practical work settings.<br />
EFH
- 256 -
- 257 -<br />
SPRACHKURSE<br />
für Studierende der Fachbereiche Soz. Arb. / SP / HP / RP<br />
für das Grund- und Hauptstudium
- 258 -<br />
Sprachkurse Grund- und Hauptstudium,<br />
Fachbereiche Soz.Arb. / SP / HP / RP<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Italienisch<br />
(mit Themen aus der<br />
Sozialen Arbeit)<br />
2 Std.Üb. je max. 20 Tn.<br />
- für Anfänger mit Vorkenntnissen<br />
- Italiano per operatori<br />
sociali<br />
Corso avanzato<br />
Carli<br />
Carli<br />
Mo 18.30 - 20.00<br />
Beg: 06.10.03<br />
Mi 17.15 - 18.45<br />
Beg: 08.10.03<br />
Il corso "Italiano per operatori sociali" é un corso di lingua per studenti della Katholische Fachhochschule<br />
di Friburgo. Intende fornire agli studenti un vocabolario tecnico per lo studio e<br />
l'esercizio della professione in Italia o per i colloqui con i clienti di madre lingua italiana.<br />
Si propone anche di esercitare la lettura di testi tecnici e di fornire le competenze linguistiche<br />
necessari per poter lavorare in Italia. Si eseguiranno anche traduzioni nelle due lingue.<br />
A conclusione del corso sará possibile ottenere un certificato.<br />
Spanisch<br />
(mit Themen aus der<br />
Sozialen Arbeit)<br />
2 Std.Üb. je max. 20 Tn.<br />
- für Anfänger mit Vorkenntnissen<br />
- Español para Trabajadores<br />
Sociales<br />
Curso avanzado<br />
Buesa<br />
Buesa<br />
Mo 18.30 - 20.00<br />
Beg: 06.10.03<br />
Mo 20.00 - 21.30<br />
Beg: 06.10.03<br />
Curso de español para estudiantes y profesionales de trabajo social que quieren hacer prácticas<br />
o trabajar en paises de habla hispana. El curso comprenderá:<br />
- lectura de textos con contenidos sociales referentes a España y Latinoamérica,<br />
- ejercicios de conversación y comunicatión<br />
- ejercicios de gramática.<br />
Seminario para participantes con conocimientos básicos de español (2 semestres).<br />
2110<br />
3203<br />
1206<br />
1206
- 259 -<br />
Sprachkurse Grund- und Hauptstudium,<br />
Fachbereiche Soz.Arb. / SP / HP / RP<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Französisch<br />
(mit Themen aus der<br />
Sozialen Arbeit)<br />
in Kooperation mit EFH<br />
2 Std.Üb. je max. 15 Tn.<br />
- für Anfänger mit Vorkenntnissen<br />
- Cours de français pour<br />
travailleurs sociaux,<br />
niveau avancé<br />
- für Fortgeschrittene<br />
Pinto<br />
Pinto<br />
Pinto<br />
Di 18.00 - 19.30<br />
Mi 09.45 - 11.15<br />
Beg: 07./08.10.03<br />
Mo 18.00 - 19.30<br />
Beg: 06.10.03<br />
Di 19.30 - 21.00<br />
Beg: 07.10.03<br />
Le cours de français pour travailleurs sociaux - niveau avancé est un cours de langue pour les<br />
étudiantes de la Evang. Fachhochschule et de la Kath. Fachhochschule à Fribourg.<br />
Rafraichir ses connaissances de français, pouvoir se faire comprendre dans la vie de tous les<br />
jours ou au téléphone, mener une conversation plus ou moins difficile: tels sont les objectifs de<br />
ce cours. Le niveau de difficulté du cours sera adapté en fonction des besoins et des intérêts de<br />
la majorité du groupe.<br />
English for Social Work<br />
Professionals<br />
Advanced course<br />
(in Cooperation with Evangelische<br />
Fachhochschule<br />
<strong>Freiburg</strong>)<br />
2 Std. max.11 Tn. KFH<br />
S. Scharberth<br />
Mi 18.30 - 20.00<br />
Beg: 08.10.03<br />
3301<br />
2300<br />
2100<br />
3301<br />
EFH
- 260 -<br />
Sprachkurse Grund- und Hauptstudium,<br />
Fachbereiche Soz.Arb. / SP / HP / RP<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
English for Social Work Professionals is a language course for Students of the Evangelische<br />
Fachhochschule and the Katholische Fachhochschule in <strong>Freiburg</strong>. It will help students build a<br />
professional vocabulary for study or work in English speaking countries or with English speaking<br />
clients or colleagues. It is designed to help attempt to bridge the gap between general secondary<br />
school English and professional English language skills (reading, writing and conversing)<br />
needed fo different professional purposes:<br />
- reading professional texts for study purposes<br />
- communicating with students and professionals during international exchange programs<br />
and/or conferences<br />
- competing for international scholarships<br />
- preparation for field placements in English speaking countries<br />
The seminar will include explanations and presentations by the instructur, role plays, translation<br />
exercises. Instruction is in American English; students should be able to read and speak<br />
conversational English, but fluency is not necessary. A certificate will be awarded upon successful<br />
completion of the course.<br />
Social Work<br />
Methodology<br />
Advanced course<br />
(in Cooperation with Evangelische<br />
Fachhochschule<br />
<strong>Freiburg</strong>)<br />
2 Std. max. 10 Tn KFH<br />
T. Rogers Di 16.00 - 18.00<br />
oder<br />
Do 16.00 - 18.00<br />
Beg: 07./09.10.03<br />
genaues Datum und<br />
Uhrzeit werden per<br />
Aushang bekannt<br />
gegeben<br />
The course consists of a combination of general and specific theoretical aspects which are<br />
intended to help students become more aware of the role of social work methodology in the past<br />
an in modern day social casework practice. In additon to an introduction and overview of<br />
theories and concepts dealing with social casework, a major focus of seminar activity will be on<br />
“learning by doing”: practical exercises, interview techniques and the reflection of role play<br />
experiences.<br />
The course also includes information about the history, development and practice of social work<br />
from the beginning of the 20 th up until the present date. The major emphasis of the seminar is<br />
however not on historical aspects, but rather on up to date, every day, practical aspects of<br />
dealing with social work clients in different practical work settings.<br />
EFH
- 261 -<br />
Sprachkurse Grund- und Hauptstudium,<br />
Fachbereiche Soz.Arb. / SP / HP / RP<br />
Fach Dozent Zeit Raum<br />
Portugiesisch<br />
(mit Themen aus der<br />
Sozialen Arbeit)<br />
2 Std. Übg.<br />
für Fortgeschrittene M. Moreas-<br />
Schulz<br />
Di 17.30 - 19.00<br />
Beg: 07.10.03<br />
Curso de Português para profissionais e estudantes de trabalho social é um curso de língua<br />
para estudanes da Katholische Fachhochschule em <strong>Freiburg</strong>. O curso compreenderá de<br />
leitura e interpretação de textos, exerc�cios de gramática e construção de vocabuario adequado<br />
para o estudo ou trabalho nos países de língua estrangeira.<br />
2110
- 262 -<br />
HAUPTAMTLICHE LEHRKRÄFTE<br />
IM WINTERSEMESTER 2003/2004<br />
FACHBEREICH SOZIALE ARBEIT<br />
Bohlen, Stephanie Dr. theol., Privatdozentin,<br />
Dipl. Theologin,<br />
Professorin für<br />
“Theologisch-philosophische Anthropologie unter<br />
besonderer Berücksichtigung von ethischen Fragen<br />
der angewandten Sozialwissenschaften”<br />
Ebertz,<br />
Michael N.<br />
DEKANIN<br />
Sprechstunden: Do 9.30 - 11.00 Uhr<br />
Zi. 3316, Tel. 200 482<br />
E-Mail: bohlen@kfh-freiburg.de<br />
Dr. rer. soc., Dr. theol., Privatdozent,<br />
Diplomsoziologe,<br />
Professor für "Sozialpolitik, Freie Wohlfahrtspflege,<br />
kirchliche Sozialarbeit"<br />
Sprechstunden: laut Aushang und n.V.,da im<br />
WS 03/04 im Fortbildungssemester,<br />
Zi. 3113, Tel. 200 560<br />
E-Mail:ebertz@kfh-freiburg.de<br />
Privatadresse: 79312 Emmendingen- Kollmarsreute<br />
Breisgaustr. 10<br />
Tel. 07641/570377<br />
Effelsberg, Winfried Dr. med., Dr. rer. nat., M.P.H.<br />
Professor für "Sozialmedizin"<br />
Sprechstunden: Di 13.15 - 14.00 Uhr und n.V.<br />
Zi. 3211, Tel. 200 158<br />
E-Mail:<br />
effelsberg@kfh-freiburg.de
- 263 -<br />
Grosser, Günther Diplom-Sozialarbeiter (FH),<br />
Fachschulrat,<br />
Dipl. Opbouwwerker,<br />
"Einführung in die Sozialarbeit",<br />
"Die Methoden der Gemeinwesenarbeit"<br />
Sprechstunden: Mo 10.00 - 12.00 Uhr<br />
Zi. 3111, Tel. 200 432<br />
E-Mail:<br />
grosser@kfh-freiburg.de<br />
Hammer, Gerhard Dr. phil., Dr. theol.,<br />
Diplompädagoge,<br />
Professor für "Philosophie und Pädagogik"<br />
Sprechstunden: Mo 15.30 - 16.30 Uhr und n.V.<br />
Zi. 3226, Tel. 200 520<br />
E-Mail:<br />
hammer@kfh-freiburg.de<br />
Kricheldorff,<br />
Cornelia<br />
Dr. phil.,<br />
Dipl.-Sozialpädagogin,<br />
Dipl. Sozialgerontologin,<br />
Professorin für<br />
“Soziale Arbeit mit Schwerpunkt Altern”<br />
Sprechstunden: Do 10.00 - 11.30 Uhr<br />
Zi. 3115, Tel. 200 441<br />
E-Mail:<br />
kricheldorff@kfh-freiburg.de<br />
Megnet, Katharina Professorin für<br />
"Musik-, Bewegungs- und Theaterpädagogik"<br />
Sprechstunden: Di 10.30 - 11.15 Uhr<br />
Zi. 3214 , Tel. 200 526<br />
E-Mail:<br />
megnet@kfh-freiburg.de<br />
Privatadresse: Tel. 292 13 40<br />
E-Mail:<br />
Katharina@megnet.de
- 264 -<br />
Möller, Annelore Sozialpädagogin (grad.),<br />
Fachschulrätin,<br />
Familientherapeutin,<br />
“Sozialarbeit und Familientherapie"<br />
Sprechstunden: Mi 13.00 - 14.00 Uhr,<br />
Zi. 3109, Tel. 200 431<br />
E-Mail:<br />
moeller@kfh-freiburg.de<br />
Nickolai, Werner Diplom-Sozialarbeiter (FH),<br />
Professor für<br />
" Soziale Arbeit mit Schwerpunkt Straffälligenhilfe"<br />
Studiengangsleiter Sozialarbeit<br />
Sprechstunden: Mi 13.15 - 14.15 Uhr<br />
Zi. 3112, Tel. 200 467<br />
E-Mail:<br />
nickolai@kfh-freiburg.de<br />
Privatadresse: 79206 Breisach<br />
Kupfertorplatz 1<br />
Tel. 07667/8700<br />
Oswald, Gerhard Dr. phil.,<br />
Dipl. Psychologe,<br />
Professor für "Psychologie"<br />
Sprechstunden: Do 11.30 - 12.30 Uhr und n.V.<br />
Zi. 3114, Tel. 200 473<br />
E-Mail:<br />
oswald@kfh-freiburg.de<br />
Renz, Monika Dipl. Sozialarbeiterin,<br />
Fachschulrätin,<br />
"Methoden in der Sozialpädagogik / Supervision"<br />
Sprechstunden: Mo 10.15 - 11.15 Uhr und n.V.<br />
Zi. 3217, Tel. 200 468<br />
E-Mail:renz@kfh-freiburg.de
Schinzler,<br />
Engelbert<br />
Schönenborn,<br />
Karl-Georg<br />
- 265 -<br />
Dr. rer. soc.,<br />
Professor für "Sozialpädagogik"<br />
Sprechstunden: Do 11.30 - 12.30 Uhr<br />
Zi. 3213, Tel. 200 484<br />
E-Mail:<br />
schinzler@kfh-freiburg.de<br />
Privatadresse: 79112 <strong>Freiburg</strong>-Munzingen<br />
Unteres Breitle 3<br />
Tel. 07664/5757<br />
Maler, Grafiker und Kunstpädagoge,<br />
Fachschulrat,<br />
“Kunstpädagogik und Bildhaftes Gestalten”<br />
Sprechstunden: Di 12.00 - 13.00 Uhr und n.V.<br />
Zi. 3218,Tel. 200 514<br />
E-Mail:<br />
schoenenborn@kfh-freiburg.de<br />
Privatadresse: 79183 Waldkirch<br />
Tannenweg 45<br />
Tel. 07681/24677<br />
Schwab, Jürgen Dr. phil.,<br />
Dipl. Pädagoge, Soziologe,<br />
Dipl. Sozialpädagoge,<br />
Professor für<br />
“Soziale Arbeit mit Schwerpunkt Jugend”<br />
Sprechstunden: Mi 12.15 - 13.00 Uhr und n.V.<br />
Zi. 3221, Tel. 200 489<br />
E-Mail:schwab@kfh-freiburg.de
- 266 -<br />
Sidler, Nikolaus Dr. phil., Dr. theol.,<br />
Diplomtheologe,<br />
Professor für "Soziologie"<br />
Sprechstunden: Mi 11.30 - 12.15 Uhr und n.V.<br />
Zi. 3110, Tel. 200 449<br />
E-Mail:sidler@kfh-freiburg.de<br />
Veith, Gerhard Dipl. Psychologe,<br />
Professor für “Psychologie”<br />
Studiengangsleiter Sozialpädagogik<br />
Sprechstunden: Mo 9.00 - 10.30 Uhr und n.V.<br />
Zi. 3212, Tel. 200 525<br />
E-Mail:veith@kfh-freiburg.de<br />
Winkler, Jürgen Dr. jur.,<br />
Professor für "Sozialrecht"<br />
Sprechstunden: Mi 12.00 - 14.00 Uhr und n.V.<br />
Zi. 3116, Tel. 200 446<br />
E-Mail:<br />
winkler@kfh-freiburg.de<br />
Privatadresse: 78467 Konstanz<br />
St.-Gebhard-Str. 20<br />
Tel. u. Fax 07531/52943<br />
Tel. 0171 571 5539<br />
E-Mail:<br />
juergen.winkler@01019freenet.de<br />
78120 Furtwangen<br />
Sonnhalde 46<br />
Tel. 07723/7978
FACHBEREICH HEILPÄDAGOGIK<br />
Berger-Sallawitz,<br />
Friederike<br />
Markowetz,<br />
Reinhard<br />
- 267 -<br />
Dr. med.,<br />
Dipl. Psychologin, Fachärztin für Kinderund<br />
Jugendpsychiatrie und Psychotherapie,<br />
Professorin für<br />
"Heilpädagogik mit dem Schwerpunkt<br />
heilpädagogisch-therapeutisches Arbeiten"<br />
Sprechstunden: s. Aushang<br />
Karlstr.38, Zi. 2210,<br />
Tel. 200 267<br />
E-Mail:<br />
berger-sallawitz@kfh-freiburg.de<br />
Privatadresse: 79211 Denzlingen<br />
Hauptstr. 25<br />
Tel. 07666/948066<br />
Dipl. Pädagoge,<br />
Professor für “Heilpädagogik”<br />
Sprechstunden: Do 13.30 - 14.30 Uhr<br />
Karlstr. 38, Zi. 2309,<br />
Tel. 200 124<br />
E-Mail:<br />
markowetz@kfh-freiburg.de<br />
Privatadresse: 68526 Ladenburg<br />
Fritz-Würzburger-Weg 7<br />
Tel./Fax 06203/3207<br />
E-Mail:<br />
R.Markowetz@t-online.de
- 268 -<br />
Menzen, Karl-Heinz Dr. phil., habil.,<br />
Dipl. Psychologe,<br />
Professor für<br />
“Pädagogik mit Schwerpunkt Altern und Behinderung<br />
unter Einbeziehung von Aspekten ästhetischer<br />
Bildung”<br />
Sprechstunden: Di 12.00 - 13.00Uhr<br />
Karlstr. 38, Zi. 2307,<br />
Tel. 200 261<br />
E-Mail:<br />
menzen@kfh-freiburg.de<br />
Privat: Tel. 07660/920550<br />
E-Mail:<br />
karl-heinz.menzen@t-online.de<br />
Pielmaier, Herbert Dr. phil.,<br />
Dipl. Psychologe,<br />
Professor für<br />
"Psychologie, Heilpädagogik und Praxisberatung"<br />
DEKAN<br />
Sprechstunden: Mo 11.30 - 13.00 Uhr und n.V.<br />
Karlstr.38, Zi. 2225,<br />
Tel. 200 268<br />
E-Mail:<br />
pielmaier@kfh-freiburg.de<br />
Simon, Traudel Dipl. Psychologin, Approbation als psychologische<br />
Psychotherapeutin, Psychoanalytikerin,<br />
Vertreterin einer Professur mit dem Schwerpunkt<br />
heilpäd.-therapeutisches Arbeiten<br />
Sprechstunden: Do 10.00 - 11.00 Uhr<br />
Karlstr. 38, Zi. 2310,<br />
Tel. 200 262<br />
E-Mail:<br />
simon-wundt@kfh-freiburg.de<br />
Zusätzliche Test- Do 9.00 - 10.00 Uhr<br />
sprechstunde:<br />
Privat: Tel. 07661/7337<br />
E-Mail:<br />
simon-wundt@t-online.de
Steinebach,<br />
Christoph<br />
- 269 -<br />
Dr. rer. soc.<br />
Dipl.Psychologe, Klin.Psych.,<br />
Supervisor BDP<br />
Professor für "Heilpädagogik / Rehabilitationspädagogik"<br />
REKTOR<br />
Sprechstunden: Mi 9.45 - 11.15 Uhr<br />
Karlstr. 63, Zi. 3405<br />
Tel. 200 485<br />
E-Mail:<br />
steinebach@kfh-freiburg.de<br />
Privatadresse: 79104 <strong>Freiburg</strong><br />
Weiherhofstr. 1<br />
Tel. 07533/1019<br />
Fax: 07533/1019<br />
E-Mail:<br />
Christoph.Steinebach@t-online.de<br />
Weiss, Gabriele Dipl.Sozialpädagogin/FH, Dipl.Heilpädagogin/FH<br />
Fachschulrätin,<br />
"Heilpädagogik, Methoden der Heilpädagogik<br />
und Praxisberatung"<br />
FRAUENBEAUFTRAGTE<br />
Sprechstunden: Di 10.00 - 11.00 Uhr und n.V.<br />
Karlstr.38, Zi. 2308,<br />
Tel. 200 495<br />
E-Mail:weiss@kfh-freiburg.de<br />
Tel./Fax 0761/507953<br />
E-Mail: GabiWeiss@aol.com
- 270 -<br />
FACHBEREICH RELIGIONSPÄDAGOGIK<br />
Heusler, Erika Dr. theol.,<br />
Professorin für<br />
“Biblische Theologie/Alt- und Neutestamentliche Exegese”<br />
Sprechstunden: Do 11.30 - 12.30 Uhr<br />
Zi. 3216, Tel. 200 493<br />
E-Mail:heusler@kfh-freiburg.de<br />
Privatadresse: 79369 Wyhl<br />
Am Hans-Peter-Acker 3<br />
Tel. 07642/926891<br />
Pemsel-Maier,<br />
Sabine<br />
Dr. theol.,<br />
Professorin für "Dogmatik und Religionspädagogik"<br />
STELLV. FRAUENBEAUFTRAGTE<br />
Sprechstunden: Di 11.30 - 12.15 Uhr und n.V.<br />
Zi. 3215 , Tel. 200 447<br />
E-Mail:<br />
pemsel-maier@kfh-freiburg.de<br />
Privatadresse: 79117 <strong>Freiburg</strong><br />
Alte Sägemühle 18<br />
Tel. 66549
- 271 -<br />
Rummel, Gerhard Dipl. Theologe,<br />
Professor für "Didaktik und Methodik des Religionsunterrichts,<br />
Pastoraltheologie"<br />
Vermittlung und Organisation der Praktika für alle<br />
Semester<br />
DEKAN<br />
Sprechstunden: Mi 11.30 - 12.15 Uhr<br />
Zi. 3310, Tel. 200 471<br />
E-Mail:<br />
rummel@kfh-freiburg.de<br />
Privatadresse: 79104 <strong>Freiburg</strong><br />
Rötebuckweg 63<br />
Tel. 54 524<br />
Schilling, Klaus Dr. theol.,<br />
Professor für “Religionspädagogik”<br />
Sprechstunden: Mo 16.30 - 17.15 Uhr und n.V.<br />
Zi. 3210, Tel. 200 443<br />
E-Mail:<br />
schilling@kfh-freiburg.de<br />
Privatadresse: 79199 Kirchzarten<br />
Römerweg 3<br />
Tel. 07661/3133<br />
Schmitz, Ernst A. Dipl. Theologe,<br />
Professor für "Moraltheologie und Christliche Gesellschaftslehre"<br />
Sprechstunden: Mo 11.30 - 12.15 Uhr<br />
Zi. 3209, Tel. 200 448<br />
E-Mail:<br />
schmitz@kfh-freiburg.de<br />
Privatadresse: 79263 Simonswald<br />
Oberer Herrenstein 3<br />
Tel. 07683/403
FACHBEREICH PFLEGE<br />
Brandenburg,<br />
Hermann<br />
- 272 -<br />
Dr. phil.,<br />
Professor für "Gerontologie und Pflegewissenschaft"<br />
Prodekan<br />
Sprechstunden: Di 13.00 - 14.00 Uhr in der<br />
Präsenzzeit des Fachbereichs<br />
Fr 13.00 - 14.00 Uhr außerhalb<br />
der Präsenzzeit<br />
Karlstr. 63, Zi. 3124,<br />
Tel. 200 672<br />
E-Mail:<br />
brandenburg@kfh-freiburg.de<br />
Privatadresse: Attentalstr. 13<br />
79252 Stegen<br />
07661/989673<br />
E-Mail:HBboxter@aol.com<br />
Kösler, Edgar Dr. paed., Dipl.Päd.,<br />
Professor für “Heilpädagogik und Praxisberatung”<br />
PROREKTOR<br />
LEITER DES INSTITUTS FÜR ANGEWANDTE<br />
FORSCHUNG, ENTWICKLUNG UND WEITERBIL-<br />
DUNG (IAF)<br />
Sprechstunden: Mi 10.00 - 11.00 Uhr<br />
Karlstr. 63, Zi. 3409<br />
Tel. 200 523<br />
E-Mail:koesler@kfh-freiburg.de<br />
Privatadresse: 79104 <strong>Freiburg</strong><br />
Leinhaldenweg 6<br />
Tel. 5561600<br />
Fax: 5561601<br />
E-Mail:<br />
edgar.koesler@t-online.de
- 273 -<br />
Scherer, Brigitte Dr. phil.,<br />
Professorin für<br />
“Leitung und Kommunikation”<br />
Schmerfeld,<br />
Jochen<br />
Studiengangsleiterin Pflegemanagement<br />
Sprechstunden: nach Vereinbarung,<br />
Karlstr. 63, Zi. 3121,<br />
Tel. 200 667<br />
E-Mail: scherer@kfh-freiburg.de<br />
Dr. phil.,<br />
Professor für<br />
"Pädagogik / Didaktik im Fachgebiet Pflege"<br />
Studiengangsleiter Pflegepädagogik<br />
Sprechstunden: Mi 10.00 - 11.00 Uhr<br />
Karlstr. 63, Zi. 3119,<br />
Tel. 200 660<br />
E-Mail:<br />
schmerfeld-j@kfh-freiburg.de<br />
Privatadresse: 79194 Gundelfingen<br />
Ginsterweg 12<br />
Tel. 0761/5950010<br />
Thiele, Günter Dipl. Ökonom,<br />
Professor für "Krankenhausbetriebslehre"<br />
PROREKTOR<br />
SENATSBEAUFTRAGTER FÜR BaföG<br />
Sprechstunden: Mi 12.30 - 13.30 Uhr und n.V.<br />
Karlstr. 63, Zi. 3313,<br />
Tel. 200 490<br />
E-Mail:thiele@kfh-freiburg.de<br />
Privatadresse: 79108 <strong>Freiburg</strong>-Hochdorf<br />
Mooswaldstr. 8 a<br />
Tel. 07665/932722
- 274 -<br />
Werner, Burkhard Dr. P.H.,<br />
Professor für<br />
"Organisation des Pflegedienstes im Gesundheitswesen"<br />
DEKAN<br />
Studiengangsleiter Therapiemanagement<br />
Sprechstunden: Mo 13.00 - 14.00 Uhr<br />
Karlstr. 63, Zi. 3308,<br />
Tel. 200 737<br />
E-Mail:werner@kfh-freiburg.de<br />
Privatadresse: 79194 Heuweiler<br />
Gundelfingerstr. 1<br />
Tel. 07666/610881<br />
Gertsen, Wilhelm Diplom-Pflegepädagoge (FH),<br />
Assistent im Fachbereich Pflege<br />
Karlstr. 63, Zi. 3117,<br />
Tel. 200 669<br />
E-Mail:<br />
pflegeass@kfh-freiburg.de<br />
HONORARPROFESSOR:<br />
Schlabach,<br />
Wolfram<br />
Professor,<br />
Spiel- u. Theaterpädagoge<br />
Privatadresse: 79283 Bollschweil<br />
Gartenweg 5<br />
Tel. 07633/5612
Adler, Frank<br />
Jugendpfleger<br />
79353 Bahlingen, Bühlstr. 50<br />
Aechter, Angelika<br />
79098 <strong>Freiburg</strong>, Rathausgasse 16<br />
Albermann, Dr. med. Kurt<br />
Facharzt Kinder-u. Jugendpsychiatrie<br />
79104 <strong>Freiburg</strong>, Meisenbergweg 8<br />
Aly, Annette<br />
Dipl. Sozialarbeiterin<br />
79100 <strong>Freiburg</strong>, Kybfelsenstr. 17 A<br />
Arndt, Marianne<br />
Lehrerin<br />
79106 <strong>Freiburg</strong>, Egonstr. 26<br />
Back, Clemens<br />
Dipl. Pädagoge / Dipl.-Sozialpädagoge<br />
79100 <strong>Freiburg</strong>, Gerda-Weiler-Str. 13<br />
Barth, Hermann<br />
Dipl. Sozialpädagoge, Werkstatt- u.<br />
Ausbildungsleiter<br />
79238 Ehrenkirchen, Niederdorfstr. 38<br />
Barwig, Klaus<br />
Akademiereferent/Akademie der Diöz.<br />
Rottenburg-Stuttgart<br />
79184 Stuttgart, Im Schellenkönig 61<br />
Becker, Dr. Dr. phil. Martin<br />
freiberuflicher Supervisor<br />
77654 Offenburg, Scheffelstr. 23<br />
Bernhardt, Elke<br />
Dipl.Heilpädagogin<br />
Blasel, Georg<br />
Dipl.Heilpädagoge<br />
69257 Wiesenbach, Dürerstr. 49<br />
Blumenberg, Dr. Franz-Jürgen<br />
Leiter des WI-JHW<br />
79104 <strong>Freiburg</strong>, Rosenau 4<br />
Bockstahler, Beate<br />
Referentin für Arbeitsrecht beim DCV,<br />
Rechtsanwältin<br />
79104 <strong>Freiburg</strong>, Karlstraße 40<br />
- 275 -<br />
LEHRBEAUFTRAGTE<br />
Tel.: 07663/860<br />
SP<br />
Tel.: 326 33<br />
Tel.: 0761/554483<br />
HP<br />
Tel.: 0761 / 29 00 54<br />
SozA<br />
Tel.: 67493<br />
HP<br />
Tel.: 4 57 04 98<br />
SozA<br />
Tel.: 07633/50443<br />
HP, RP, SoA, SozA<br />
Tel.: 0711/1640-730<br />
SozA, SP<br />
barwig@akademie-rs.de<br />
Tel.: 0781-39120<br />
Tel.: 07621/401040<br />
HP<br />
Tel.: 06223/48019<br />
HP<br />
Tel.: FR 32011<br />
SP<br />
Tel.: 0761/200-202<br />
Pfl, TM<br />
beate.bockstahler@caritas.de
- 276 -<br />
Böhler, Lothar A.<br />
Stiftungsdirektor<br />
79104 <strong>Freiburg</strong>, Deutschordensstraße 2<br />
Boll, Marianne<br />
Dipl. Psychologin, Leiterin der Jugendhilfe<br />
79104 <strong>Freiburg</strong>, Leinhaldenweg 21<br />
Bösterling-Schulte, Anneliese<br />
Dipl.Sozialarbeiterin<br />
79336 Herbolzheim 5, Schwarzwaldstr. 36<br />
Böttinger, Ullrich<br />
Dipl.Psychologe,Psychotherapeut,Supervisor<br />
BDP<br />
79312 Emmendingen, Gartenstr. 19<br />
Brandstetter, Stefan<br />
Dipl. Soz.Päd./Ausbildner in der Praxis<br />
79104 <strong>Freiburg</strong>, Haydnstr. 11<br />
Bremer, Carmen<br />
Gestalttherapeutin /Dipl.Sozialpädagogin<br />
79108 <strong>Freiburg</strong>, Reutebachgasse 35a<br />
Buesa, M.A. Pilar<br />
Lehrerin<br />
79100 <strong>Freiburg</strong>, Holbeinstraße 10<br />
Bukowski, Annette<br />
Doktorandin<br />
79183 Waldkirch, Sonnhalde 13<br />
Busch, Stephan<br />
Dipl. Soz. Päd.<br />
79227 Schallstadt, Steingasse 32<br />
Carli, Fausta<br />
Fremdsprachensekretärin<br />
79100 <strong>Freiburg</strong>, Holbeinstraße 12<br />
Clausen, Jens<br />
Wissenschaftl. Mitarbeiter<br />
79110 <strong>Freiburg</strong>, Elsässer Str. 2 m, Haus 1a<br />
Cloidt, Maria<br />
Dipl.Sozialarbeiterin<br />
79183 Waldkirch-Suggental, Rebackerweg 8<br />
Danzeisen, Waltraud<br />
Dipl.Sozialarbeiterin<br />
79312 Emmendingen, Käthe-Kollwitz-Str. 15<br />
Tel.: 0761/ 2108-110<br />
SozA<br />
Tel.: 0761/55 19 00<br />
SP<br />
Tel.: 07643 / 15 67<br />
SozA<br />
Tel.: 07641/54433<br />
HP<br />
Tel.: FR 555 700<br />
SP<br />
Tel.: d.: 7071191/pr.<br />
8975607<br />
SozA<br />
Tel.: 0761/407146<br />
IB<br />
Tel.: 07681/9949<br />
SozA<br />
Tel.: 07664/96 20 46<br />
SP<br />
stephan@elsola.de<br />
Tel.: 70 69 09<br />
IB<br />
Tel.: FR 270-7265<br />
SP<br />
clausen@sfa.ukl.uni-freiburg.de<br />
Tel.: 07681/7311<br />
HP, RP, SoA, SozA<br />
Tel.: 07641/1636<br />
HP
- 277 -<br />
Dieffenbach, Susanne<br />
Leiterin des Pflegecontrolling/Klinikum Ludwigshafen<br />
68723 Schwetzingen, Sternallee 39<br />
Dierstein, Ursula<br />
Realschullehrerin/Supervisorin<br />
79117 <strong>Freiburg</strong>, Fendrichstr. 10<br />
Dilger, Helga<br />
Dipl.Sozialpädagogin<br />
79098 <strong>Freiburg</strong>, Wilhelmstr. 30<br />
Döldissen, Stefan<br />
63064 Offenbach/Main, Senefeldstraße 47<br />
Doll, Christa<br />
Dipl.-Sozialpädagogin<br />
79249 Merzhausen, Im Großacker 8<br />
Drobny, Stephan<br />
Pädagogischer Mitarbeiter<br />
78628 Rottweil, Neutorstr. 7<br />
Engelmann, Cornelia<br />
Dipl. Pädagogin<br />
79100 <strong>Freiburg</strong>, Konradstr. 14<br />
Ernst, Gerhard<br />
Dipl.Sozialarbeiter, Dipl.Pädagoge<br />
79111 <strong>Freiburg</strong>, Im Glaser 30<br />
Etzel, Birgit<br />
Pflegedirektorin der Klinik für Tumorbiologie<br />
<strong>Freiburg</strong><br />
79102 <strong>Freiburg</strong>, Zasiusstraße 63<br />
Euschen, Herbert<br />
Selbst. Organisationsberater/Erwachsenenbildner<br />
79211 Denzlingen, Jahnstraße 16<br />
Fehrenbach, Philipp<br />
freiberufl.Supervisor u. Erwachsenenbildner<br />
79111 <strong>Freiburg</strong>, Malteserordenstr. 5<br />
Fehrenbacher, Roland<br />
Referatsleiter Jugendhilfe<br />
79215 Elzach, Blumenweg 22<br />
Ferch, Daniel<br />
Dipl. Soz. Arb.<br />
79283 Bollschweil, Hexentalstr. 11<br />
Fierravanti, Tilo<br />
Dipl.Sozialpädagoge<br />
79111 <strong>Freiburg</strong>, Neuntöterweg 21<br />
Tel.: 06202-272281<br />
Pfl<br />
sd@frankdieffenbach.de<br />
Tel.: und Fax: FR 78 631<br />
SoA<br />
Tel.: 381422<br />
SP<br />
Tel.:<br />
Pfl<br />
Tel.: 0761 / 40 45 57<br />
SozA<br />
christa@fam-doll.de<br />
Tel.: 07641-9494780<br />
SozA<br />
Tel.: FR 28 3535<br />
SoA<br />
Tel.: 0761/471305<br />
SozA<br />
Tel.: 0761/700 647<br />
Pfl<br />
Tel.: 07666/5100<br />
Pfl<br />
Tel.: 0761/473863<br />
SoA<br />
Tel.: 07682/7201<br />
SozA, SP<br />
Tel.: 07633/808861<br />
SozA, SP<br />
d.ferch@t-online.de<br />
Tel.: 0761/4765527<br />
HP, RP, SoA
- 278 -<br />
Fischer, Dr. Helmut<br />
Dipl.Päd.,Facharzt Kinder-u. Jugendpsychiatrie<br />
79117 <strong>Freiburg</strong>, Eichbergstr. 37<br />
Fischer, Thomas<br />
Dipl. Psychologe/wiss. Lehrkraft<br />
79102 <strong>Freiburg</strong>, Bürgerwehrstr. 24<br />
Frei, Anita<br />
Dipl.Sozialarbeiterin<br />
79108 Hochdorf, Bachwinkel 8<br />
Freudling, Sylvia<br />
79106 <strong>Freiburg</strong>, Guntramstr. 36<br />
Friedeck, Annette<br />
Berufsschullehrerin (für Pflegeberufe)<br />
79312 Emmendingen, Lammstraße 16<br />
Fritz, Klaus<br />
Diplom-Pflegepädagoge<br />
79114 <strong>Freiburg</strong>, Haierweg 2 d<br />
Gäng, Marianne<br />
Ass. des Lehramts<br />
79098 <strong>Freiburg</strong>, Gerberau 21<br />
Gastiger, Prof. Dr. Sigmund<br />
Jurist<br />
79232 March, Sonnhalde 4<br />
Geiger, Annette<br />
Dipl.Heilpädagogin<br />
79312 Emmendingen, Gartenstr. 19<br />
Geißner, Prof. Dr. Ursula<br />
freie Dozentin<br />
79274 St. Märgen, Wagensteigstraße 15<br />
Gertsen, Wilhelm<br />
Assistent im FB Pflege der KFH<br />
79104 <strong>Freiburg</strong>, Karlstraße 63<br />
Glenz, Beate<br />
Rechtsanwältin<br />
79102 <strong>Freiburg</strong>, Kartäuserstr. 136<br />
Goddar, Anke<br />
Kinder- und Jugendpsychotherapeutin<br />
79110 <strong>Freiburg</strong>, Edith-Stein-Str. 7<br />
Günther, Erich<br />
Sonderschullehrer<br />
79111 <strong>Freiburg</strong>, Tiengener Str. 2 a<br />
Tel.: 0761/66116<br />
HP<br />
Tel.: FR 70 93 34<br />
SoA<br />
Tel.: 07665-930921<br />
Pfl<br />
Tel.: 276467<br />
HP<br />
Tel.: 07641/1684<br />
Pfl<br />
annette.friedeck@bs.ch<br />
Tel.: 0761/<br />
Pfl<br />
Fritz.Alexandra-klaus@t-online<br />
Tel.: 26726<br />
SP<br />
Tel.: 07665-1777<br />
SoA<br />
Tel.: 07641/54433<br />
HP<br />
Tel.: 07669-530<br />
Pfl<br />
Tel.: 0761/200-669<br />
Pfl<br />
pflegeass@kfh-freiburg.de<br />
Tel.: 0761 / 3 70 49<br />
SozA<br />
Tel.: d: 07621 / 20 85<br />
SozA<br />
Tel.: FR 47 62 364<br />
SoA
Haag, Bernd<br />
Berufsschullehrer<br />
79336 Herbolzheim, Friedrichstraße 37<br />
- 279 -<br />
Haensler, Martin<br />
Dipl. Soz.Arb.<br />
79106 <strong>Freiburg</strong>, Hugstetterstr. 17<br />
Hanselmann, Roswitha<br />
Sozialarbeiterin<br />
79206 Breisach, Zeppelinstr. 7<br />
Härpfer, Evi<br />
Lehrerin/Gymnasiallehrerin<br />
79117 <strong>Freiburg</strong>, Am Hörchersberg 7<br />
Hartinger, Sabine<br />
93051 Regensburg, Niebelungenstr. 15<br />
Hazubski, Holger<br />
Dipl. Sozialpädagoge<br />
79312 Emmendingen, Kübelestr. 3<br />
Heidemanns, Katja<br />
Referentin im MWI Aachen<br />
52012 Aachen, Postfach 11 10<br />
Helmes, Almut<br />
79085 <strong>Freiburg</strong>, Engelbergerstraße 41<br />
Hennecke, Matthias<br />
Referatsleiter Altenhilfe, AWO, BV Hannover<br />
30455 Hannover, Köstingsdorfer 8<br />
Hensel, Thomas<br />
Dipl.Psychologe<br />
77654 Offenburg, Franz-Ludwig-Mercy-Str. 10<br />
Hilpert, Jochen<br />
Dipl.Sozialarbeiter, Stellv.Leiter d.Jugendhauses<br />
79211 Denzlingen, Burgvogteistr. 5<br />
Höchner, Johannes<br />
Dipl.Sozialarbeiter, Dipl. Päd.<br />
79100 <strong>Freiburg</strong>, Lorettostr. 44<br />
Höffner, Dr. Bernhard<br />
Wissenschaftlicher Assistent<br />
79104 <strong>Freiburg</strong>, Kartäuserstr. 137 b<br />
Hohm, Dr. Hans-Jürgen<br />
Dozent f. Soziologie, Politik<br />
55122 Mainz 1, Jakob-Steffan-Str. 14<br />
Hugoth, Matthias<br />
Wissenschaftlicher Referent im DCV<br />
79104 <strong>Freiburg</strong>, Burgunderstr. 26<br />
Tel.: 07643/6608<br />
Pfl<br />
bernd.haag@bs.ch<br />
Tel.: FR 292 4653<br />
HP, RP, SoA, SP<br />
Tel.: 07667-906560<br />
SoA<br />
Tel.: 65720<br />
SoA<br />
Tel.:<br />
TM<br />
Tel.: 07641/915 456<br />
SP<br />
Tel.: 0241/7507-312<br />
RP<br />
Tel.:<br />
TM<br />
Tel.: 0511/4952212<br />
Pfl, TM<br />
Mathias.Hennecke@bv-hannover.a<br />
Tel.: 0781/9480662<br />
HP<br />
Tel.: 07666/4431<br />
SozA<br />
Tel.: 407716<br />
SozA, SoA<br />
Tel.: 0761/65981<br />
RP<br />
Tel.: 06131-320359<br />
SozA, SoA, HP, RP<br />
Tel.: 0761/30701<br />
RP
Imgraben, Katharina<br />
Diplom-Sozialarbeiterin (FH)<br />
79227 Schallstadt, Steingasse 11b<br />
Immenschuh, Dr. cand. Ursula<br />
Dozentin<br />
79115 <strong>Freiburg</strong>, Staufener Straße 52<br />
Immenschuh, Martin<br />
Referent beim Caritasverb.<br />
79115 <strong>Freiburg</strong>, Staufener Str. 52<br />
Janssen, Jens<br />
Fachanwalt für Strafrecht<br />
79106 <strong>Freiburg</strong>, Lehener Str. 17 a<br />
Jaser, Dr. Dr. phil. /M.A. Alexander<br />
Lehrbeauftragter a.d. Uni <strong>Freiburg</strong><br />
79249 Merzhausen, Dorfstr. 41 a<br />
- 280 -<br />
Jehn, Peter<br />
79100 <strong>Freiburg</strong>, Günterstalstraße 84<br />
Jung, Kalle<br />
Abteilungsleiter Haus- und Grundstücksverwaltung<br />
der Univ.kliniken <strong>Freiburg</strong><br />
79114 <strong>Freiburg</strong>, Am Lindenwäldle 37<br />
Kaesehagen-Schwehn, Georg<br />
79104 <strong>Freiburg</strong>, Leinhaldenweg 21<br />
Kälble, Friedrich<br />
Leiter des Kinder- und Jugendtreffs<br />
79312 EM-Wasser, Basler Str. 8<br />
Kimmig, Harald<br />
Musiker/Musikpädag. Komponist<br />
79271 St. Peter, Spittelhofstr. 12<br />
Kirchgäßner, Ulrich<br />
Dipl.Pädagoge, Heimleitung<br />
79100 <strong>Freiburg</strong>, Georg-Elser-Str. 16<br />
Kleiner, Andreas<br />
Dipl.Heilpädagoge<br />
79585 Steinen, Hebelstr. 8/1<br />
Klie, Prof. Dr. Thomas<br />
Professor der Evang. Fachhochschule <strong>Freiburg</strong><br />
79114 <strong>Freiburg</strong>, Buggingerstraße 38<br />
Klier, Helga<br />
Sozialreferentin<br />
79199 Kirchzarten, Tarodunumweg 16<br />
Tel.: 07664/6411<br />
SoA<br />
Tel.: 0761/292 7544<br />
Pfl, TM<br />
Ursula.Immenschuh@epost.de<br />
Tel.: FR 292 7544<br />
SP<br />
Tel.:<br />
SP<br />
Tel.: 0761/281574<br />
SP<br />
AlexanderJaser@aol.com<br />
Tel.: 0761/77998<br />
TM<br />
Tel.: 0761/472384<br />
Pfl<br />
kalle.jung@uniklinik-freiburg.de<br />
Tel.: FR 580 837<br />
SP<br />
Tel.: 07641/955 677<br />
SP<br />
Fritz.kaelble@t-online.de<br />
Tel.: 07660/920621 (auch<br />
Fax)<br />
HP, RP, SoA, SP<br />
Tel.: 0761 / 7 51 65<br />
SozA<br />
Tel.: 07627/922292<br />
HP<br />
Tel.: 0761/47812-32<br />
Pfl<br />
Tel.: 07661/912545<br />
SozA
- 281 -<br />
Knaubert, Elisabeth<br />
Dipl. Soz.Arb., Werklehrerin i.soz. Bereich<br />
79100 <strong>Freiburg</strong>, Goethestr. 20<br />
Köhler, Bernd<br />
Dipl. Sozialarbeiter<br />
79111 <strong>Freiburg</strong>, Anna-Müller-Weg 17<br />
Kolberg, Barbara<br />
79098 <strong>Freiburg</strong>, Rathausgasse 3<br />
Kollhof, Rainer<br />
Fremdsprachenberater<br />
79102 <strong>Freiburg</strong>, Gresserstr. 13<br />
Kratz-Bosbach, Evelyn<br />
Dipl.Heilpädagogin<br />
79111 <strong>Freiburg</strong>, Freda-Wüsthoff-Weg 17<br />
Kray, Karin<br />
Grund-u.Hauptschullehrerin<br />
79199 Kirchzarten, Keltenring 3<br />
Kreis, Ulrike<br />
Dipl. Sozialarbeiterin / Familientherapeutin<br />
79379 Müllheim, Bismarckstr. 4<br />
Kunz, Carmen<br />
Medienpädag. Mitarbeiterin<br />
79106 <strong>Freiburg</strong>, Kreuzstr. 39<br />
Lang, Christoph<br />
Dipl. Sozialarbeiter, Jugendgerichtshelfer<br />
79100 <strong>Freiburg</strong>, Vauban-Allee 18<br />
Lehmann, Sigrid<br />
Dipl. Sozialarbeiterin<br />
79108 <strong>Freiburg</strong>-Hochdorf, Benzhauserstr. 15<br />
Lindner-Ziegler, Beatrix<br />
Schulleiterin<br />
88634 Herdwangen-Schönach, Panoramaweg 7<br />
Linnenschmidt, Matthias<br />
Leiter der studentischen Abteilung<br />
79104 <strong>Freiburg</strong>, Karlstr. 34<br />
Macziola, Ingmar<br />
Freier Photograph, Printer<br />
79111 <strong>Freiburg</strong>, Neuntöterweg 11<br />
Mahler, Bernd<br />
Dipl.Heilpädagoge<br />
79104 <strong>Freiburg</strong>, Johanniterstr. 5<br />
Tel.: FR 52862<br />
HP, RP, SoA, SP<br />
Tel.: 0761 / 47 45 93<br />
SozA<br />
Tel.: 0761/2852457<br />
RP<br />
Tel.: Tel. 275354<br />
SP, HP, SoA, RP<br />
Tel.: 506308<br />
HP<br />
Tel.: 07661-1255<br />
SoA<br />
Tel.: 07631/5785<br />
SozA<br />
Tel.: 0761/ 47 69 789<br />
HP, RP, SoA<br />
Tel.: 0761 / 28 86 54<br />
SozA<br />
Tel.: 07665 / 30 63<br />
SozA<br />
Tel.: 07552/936943<br />
SoA<br />
Tel.: FR 200-497<br />
SP<br />
linnenschmidt@kfh-freiburg.de<br />
Tel.: 4761503<br />
HP, RP, SoA, SozA<br />
Tel.: 281054<br />
HP
- 282 -<br />
Mall, Jürgen<br />
Dipl. Soz.Päd.<br />
79206 Breisach, Im Jugendwerk 15<br />
Marqua, Petra<br />
Dipl. Soz.Arb. - Erziehungsleitung<br />
79102 <strong>Freiburg</strong>, Dreikönigstr. 56<br />
Meger, Susanne<br />
Dipl. Pädag. und Kunsttherapeutin<br />
79112 <strong>Freiburg</strong>, Häge 2<br />
Meier, Raymund<br />
Dipl.Rel.Päd.,Dipl.Soz.Päd.<br />
79211 Denzlingen, Schwabenstr. 27<br />
Meinders, Frauke<br />
79085 <strong>Freiburg</strong>, Belfortstraße 16<br />
Michel, Stefan<br />
Sozialarbeiter<br />
79102 <strong>Freiburg</strong>, Schwarzwaldstr. 156<br />
Moraes-Schulz, Maria Aparecida<br />
Dipl.Pädagogin,Portugiesischlehrerin<br />
79108 <strong>Freiburg</strong>, In den Weihermatten 27<br />
Müller, Dr. Dr. phil. Elke<br />
freiberufliche Dozentin, Beratung in der Pflege<br />
und Pflegebildung<br />
69221 Dossenheim, Am Mantelbach 6<br />
Müller, Dr. Hadwig<br />
Referentin am Missionswissenschaftlichen Institut<br />
52012 Aachen, Postfach 11 10<br />
Müller, Hildegard<br />
Dipl.Sozialpädagogin<br />
79102 <strong>Freiburg</strong>, Zasiusstr. 65<br />
Müller, Jürgen<br />
Referent beim DiCV<br />
79115 <strong>Freiburg</strong>, Gutleutstr. 31<br />
Müller, Michael<br />
Referent Betriebswirtschaft und Sozialmarketing<br />
79117 <strong>Freiburg</strong>, Littenweilerstr. 36 b<br />
Müller, Ursula<br />
Dipl.-Sozialarbeiterin (FH)<br />
79183 Waldkirch, Schwarzwaldstr. 109<br />
Niedermeier, Tamara<br />
Dipl. Soz.Päd.<br />
77855 Achern, Bundesstr. 20<br />
Tel.: 07664/59467<br />
SP<br />
Tel.: 0761/70 20 43<br />
SP<br />
Tel.: 0761/37290<br />
SP, HP<br />
Tel.: 07666/5883<br />
SP<br />
Tel.:<br />
TM<br />
Tel.: FR 6129422<br />
SP<br />
Tel.: 0761/56232<br />
IB<br />
Tel.: 06221/869762<br />
Pfl<br />
elkemueller.pflewiss@t-online.de<br />
Tel.: 0241/7507238<br />
RP<br />
Tel.: 0761 / 7 07 93 82<br />
SozA<br />
Tel.: FR 488 2828<br />
SP<br />
Tel.: FR 640 386<br />
SP<br />
Tel.: 07681/24199<br />
SoA<br />
Tel.: 07841/681652<br />
SoA
- 283 -<br />
Nowak, Dr. Jutta<br />
Referentin für Grundschulen am Inst. f. RP<br />
79183 Waldkirch-Buchholz, Fohrenbühlstr. 7<br />
Obert, Wolfram<br />
Jurist<br />
79232 March-Buchheim, Dreisamstr. 25<br />
Oelhaf-Bollin, Doris<br />
Dipl.Sozialarbeiterin, Dipl. Pädagogin<br />
79112 <strong>Freiburg</strong>, Im Hubhof 8<br />
Pinto, Jean-Louis<br />
Dipl.Pädagoge, Lehrer<br />
79098 <strong>Freiburg</strong>, Wilhelmstraße 3a<br />
Pohlmann, Sonja<br />
Sonderschullehrerin<br />
79249 Merzhausen, Heimatstr. 1<br />
Rabenbauer-Müller, Monika<br />
selbständige Supervisorin und Beraterin,<br />
Profit-u.Non-Profit-Org<br />
79100 <strong>Freiburg</strong>, Beethovenstraße 2<br />
Rauchs, Willy<br />
Sozialpädagoge<br />
79115 <strong>Freiburg</strong>, Haslacher Str. 54<br />
Rech, Peter Wilhelm<br />
Professor, Uni Köln<br />
50354 Hürth-Efferen, St. Michaels-Kapelle,<br />
Hahnenstr.13<br />
Reichart, Johannes<br />
Sozialarbeiter<br />
79227 Schallstadt, Schulstr. 9 i<br />
Reinhardt, Klaus<br />
Lektor<br />
79104 <strong>Freiburg</strong>, Immentalstr. 9<br />
Repetto, Bärbel<br />
Musiktherapeutin<br />
79112 <strong>Freiburg</strong>, St. Elisabethenstr. 4 c<br />
Reuschenbach, Bernd<br />
69126 Heidelberg, Psychologisches Institut Universität<br />
Heidelberg<br />
Ritter, Klaus<br />
BDKJ-Bildungsreferent<br />
79108 <strong>Freiburg</strong>, Okenstr. 15<br />
Tel.: 07681/24213<br />
RP<br />
Tel.: 07665/41563<br />
HP, RP, SoA, SP, SozA<br />
Tel.: 07664 / 5 91 98<br />
SozA<br />
dob.Oelhaf@t-online.de<br />
Tel.: 0171/7559033<br />
IB<br />
Tel.: 0761/406 388<br />
SoA, SP<br />
Tel.: 0761 / 2 02 34 75<br />
SozA<br />
Tel.: 0761/4764134<br />
HP, RP, SoA<br />
Tel.: 02233/35785<br />
HP<br />
Tel.: 07664 - 590 343<br />
SP<br />
Tel.: 2022380<br />
HP<br />
Tel.: 07665/9938 917<br />
HP<br />
Tel.:<br />
Pfl<br />
Tel.: 5144-153<br />
RP<br />
klaus.ritter@seelsorgeamt-frei
Rixius, Angelika<br />
Dipl.Kunsttherapeutin<br />
79199 Kirchzarten, Neuhäuserstr. 70<br />
Roppelt, Christian<br />
Dipl. Soz.Päd.<br />
79106 <strong>Freiburg</strong>, Wentzinger Str. 62<br />
Roth, Cornelia<br />
Heilpädagogin<br />
79115 <strong>Freiburg</strong>, Eschholzstr. 80<br />
- 284 -<br />
Russo, Remo<br />
Dipl. Pädagoge<br />
79288 Gottenheim, Bahnhofstr. 8<br />
Rynski, Prof. Werner<br />
79194 Gundelfingen, Lärchenstr. 26<br />
Sailer, Marcel<br />
Leiter der Innerbetrieblichen Fortbildung,<br />
Univ.klinikum Ulm<br />
89610 Oberdischingen, Hintere Gasse 21<br />
Sartorius, Josef Adam<br />
79111 <strong>Freiburg</strong>, Heinrich-Finke-Str. 2<br />
Schäfer, Annette<br />
Musikpädagogin<br />
79872 Bernau, Im Moos 9<br />
Scheiwe, Norbert<br />
Rektor, Gesamtleiter<br />
79206 Breisach-Oberr., Im Jugendwerk 11<br />
Scherer, Sabine<br />
Lehrerin<br />
79102 <strong>Freiburg</strong>, Turnseestr. 39<br />
Schlabach, Prof. Wolfram<br />
Spiel- und Theaterpädagoge<br />
79283 Bollschweil, Gartenweg 5<br />
Schley, Kurt<br />
Dipl.Sozialarbeiter (FH)<br />
77652 Offenburg, Ringelgasse 4<br />
Schmidt, Lothar<br />
Dipl. Psychologe, Psychologischer<br />
Psychotherapeut<br />
78532 Tuttlingen, Leutenbergstr. 16<br />
Schrader, Prof. Dr. Ulrich<br />
Professor der Fachhochschule Frankfurt am Main<br />
61231 Bad Nauheim, Mühlgasse 33<br />
Tel.: 0761/696417<br />
/0761/69677<br />
HP<br />
Tel.: 0761/20 24 591<br />
SP<br />
chrizzlythebear@hotmail.com<br />
Tel.: 0761/4763086<br />
SP<br />
CORO11@gmx.de<br />
Tel.: 07665/942079<br />
HP, RP, SoA, SP<br />
Tel.: FR 581 161<br />
SP<br />
Tel.: 07305/23687<br />
Pfl<br />
marcel.sailer@medizin.uni-ulm.<br />
Tel.: 475939<br />
SoA<br />
Tel.: 07675/922294<br />
HP<br />
Tel.: 07664/409-201<br />
SP<br />
Tel.: FR 707 15 29<br />
SoA<br />
Tel.: 07633-5612<br />
HP, RP, SoA, SozA<br />
Tel.: 0781/9267860<br />
SoA, SozA<br />
Tel.: 07461/5609<br />
SP, SozA<br />
Tel.: 06032/700-910<br />
Pfl<br />
ulrich.schrader@uumail.de
Schramkowski, Barbara<br />
Dipl.Sozialpädagogin<br />
79115 <strong>Freiburg</strong>, Wiesneckstr. 3<br />
- 285 -<br />
Schulz, Christian<br />
Fachlehrer<br />
79268 Bötzingen, Mühlgasse 5<br />
Schulz, Jürgen<br />
Leiter Adaption und Betreutes Wohnen, Bezugstherapeut<br />
79111 <strong>Freiburg</strong>, Junkermattenweg 9<br />
Schulz-Nieswandt, Prof. Dr. Frank<br />
Universitäts-Professor in Köln<br />
53489 Sinzig, Koblenzer Straße 97<br />
Schwalb, Prof. Helmut<br />
79294 Sölden, Im Gaisbühl 1 b<br />
Sieß, Heidrun<br />
freiberuflich<br />
79102 <strong>Freiburg</strong>, Glareanstr. 4<br />
Skorski-Spielmann, Angelika<br />
Dipl. Heilpädagogin<br />
79100 <strong>Freiburg</strong>, Gerda-Weiler-Str. 14<br />
Sommer-Prosinger, Rafaela<br />
Dipl. Pädagogin und Supervisorin<br />
79102 <strong>Freiburg</strong>, Erwinstr. 31<br />
Späth, Bernhard<br />
Direktor<br />
79618 Rheinfelden, Hauptstr. 1<br />
Spielmann, Michael<br />
79183 Waldkirch, In der Bannweid 1 B<br />
Stehle, Heide<br />
Dozentin an der Fam.Pflegeschule<br />
79249 Merzhausen, Im Laimacker 24<br />
Stehle-Remer, Barbara<br />
Psychotherapeutin, Psychologin<br />
79102 <strong>Freiburg</strong>, Gresserstr. 9<br />
Steiner, Elisabeth<br />
Dipl. Soz.Arb.<br />
76229 Karlsruhe, Wiesenäckerweg 18<br />
Steinhoff, M.A. Kaspar<br />
Dozent für Erwachsenenbildung<br />
79104 <strong>Freiburg</strong>, Wintererstraße 49<br />
Tel.: 0761 / 5 57 56 46<br />
SozA<br />
Barbara.Schramkowski@gmx.de<br />
Tel.: 07663/6895<br />
HP, RP, SoA, SozA<br />
Tel.: 0761 / 27 45 29<br />
SozA<br />
Tel.: 02642/991773<br />
Pfl, TM<br />
schulz-nieswandt@t-online.de<br />
Tel.: 0761 / 40 71 02<br />
SozA<br />
hschwalb@web.de<br />
Tel.: 0761/71170<br />
SoA<br />
Tel.: 0761/4004700<br />
HP<br />
Tel.: 0761 / 7 52 99<br />
SozA<br />
Tel.: 07623/470218<br />
Tel.:<br />
SP<br />
Tel.: 406984<br />
SoA<br />
Tel.: 292270<br />
HP<br />
Tel.: 0721/695144<br />
SP<br />
Tel.: 0761/35941<br />
Pfl, TM
Stöbener, André<br />
Dipl.Soz.Arb.(FH), M.A.<br />
79106 <strong>Freiburg</strong>, Tennenbacherstr. 15<br />
- 286 -<br />
Strohmeier, Waltraud<br />
Sozialarbeiterin<br />
79117 <strong>Freiburg</strong>, Littenweilerstr. 15<br />
Strüber, Dipl.-Theologe (Uni) Lothar<br />
Leiter der Film- und Bildstelle der<br />
Erzdiözese <strong>Freiburg</strong><br />
79112 <strong>Freiburg</strong>-Opfingen, Probsteihof 14<br />
Teuber, Marianne<br />
Referentin Pflegekasse<br />
79114 <strong>Freiburg</strong>, Sudermannstr. 7<br />
Tolles, Karin<br />
Sozialarbeiterin<br />
79292 Pfaffenweiler, Weinstraße 94b<br />
Tschöpe, Gerhard<br />
Dipl.Sozialarbeiter,Dipl.Pädagoge<br />
79102 <strong>Freiburg</strong>, Kartäuserstr. 25<br />
Uhde, DDr. Bernhard<br />
Privat-Dozent / Theologische Fakultät<br />
Uni <strong>Freiburg</strong><br />
79098 <strong>Freiburg</strong>, c/o Reichert, Gerberau 6<br />
Uihlein, Maria<br />
79114 <strong>Freiburg</strong>, Sulzburger Str. 92<br />
Uschok, M.A. Andreas<br />
Krankenpfleger<br />
79194 Heuweiler, Wiesenweg 5a<br />
Weiß, Christoph<br />
Sozialarbeiter<br />
79106 <strong>Freiburg</strong>, Stühlingerstr. 9<br />
Welter, Joachim<br />
Dipl. Psychologe<br />
79359 Riegel, Robert-Meyer-Weg 20<br />
Wenzl, Udo<br />
Dipl.Sozialpädagoge<br />
79194 Gundelfingen, Waldackerweg 1<br />
West, Bodo<br />
Supervisor<br />
79114 <strong>Freiburg</strong>, Einsiedelnweg 4<br />
Wilde, Reinhard<br />
Rechtsanwalt<br />
79117 <strong>Freiburg</strong>, Im Etter 12<br />
Tel.: 200 551<br />
SP, Pfl, TM<br />
AP.Stoebener@t-online.de<br />
Tel.: 0761 / 67391<br />
SozA<br />
Tel.: 07664/59847<br />
Pfl<br />
Tel.:<br />
SP<br />
Tel.: 07664 / 6 02 35<br />
SozA<br />
Tel.: 0761 / 7 07 04 21<br />
SozA<br />
gerhardtschoepe@hotmail.com<br />
Tel.: 39019<br />
HP, SoA<br />
Tel.: 0761 / 445888<br />
SozA<br />
Tel.:<br />
Pfl<br />
Tel.: FR 3836689<br />
SoA<br />
Tel.: 07642/5898<br />
SP<br />
Tel.: 0761 / 55 40 75<br />
SozA<br />
Tel.: 0761 / 8 53 36<br />
SozA<br />
Tel.: 0761/ 65689<br />
SoA
- 287 -<br />
Wochner, Petra<br />
Lehrerin<br />
79110 <strong>Freiburg</strong>, Almendweg 4<br />
Zenner, Bettina<br />
Dipl.Sozialpädagogin<br />
79102 <strong>Freiburg</strong>, Kartäuserstr. 138<br />
Zier, Heinz<br />
Direktor des Amtsgerichts Staufen<br />
Zindorf, Ute<br />
Fachreferentin für BtG, Jugend und Familienhilfe<br />
79106 <strong>Freiburg</strong>, Gärtnerweg 4<br />
Tel.: FR 808046<br />
SoA<br />
Tel.: 0761 / 3 88 47 14<br />
SozA<br />
Tel.: 07633 / 95 00 12<br />
SozA<br />
Tel.: 0761 / 28 11 48<br />
SozA
â Karlstr. 34<br />
Studienberatung<br />
Studentensekretariat<br />
Prüfungsamt<br />
Aula 1100<br />
Werkraum<br />
Lehrräume 1203-1308<br />
EDV-Räume 1303, 1304<br />
ã Karlstr. 38<br />
Fachbereich Heilpädagogik<br />
Lehrräume 2100-2480<br />
Aula 2000<br />
Katholische Hochschulgemeinde<br />
Krabbelstube (IKS e.V.)<br />
ä Karlstr. 63<br />
Rektorat<br />
Prorektoren<br />
Verwaltung<br />
Institut für Angewandte Forschung,<br />
Entwicklung u. Weiterbildung (IAF)<br />
Fachbereich Soziale Arbeit<br />
Fachbereich Sozialpädagogik<br />
Fachbereich Religionspädagogik<br />
Fachbereich Pflege<br />
Fachbereich Management<br />
Lehrräume 3000-3304, U1, U2<br />
Konferenzräume 3500-3502<br />
Wölflinstraße<br />
LAGEPLAN<br />
Habsburgerstraße<br />
â ã<br />
ä<br />
æ<br />
Karlstraße<br />
ç<br />
æ Karlstr. 40<br />
Bibliothek<br />
Großer Sitzungssaal des<br />
DCV<br />
ç Karlstr. 40<br />
Deutscher<br />
Caritasverband (DCV)<br />
Kantine / Mensa