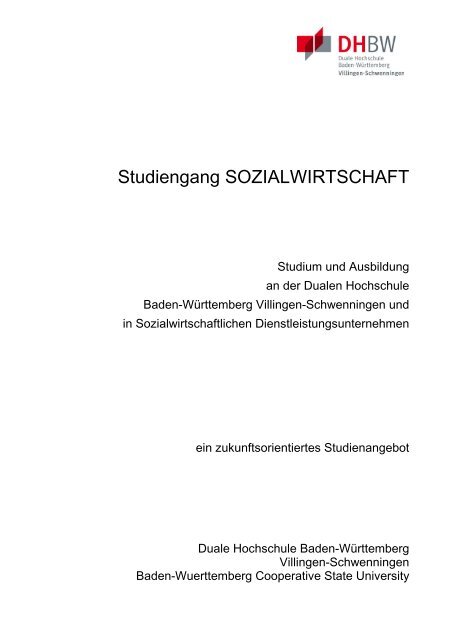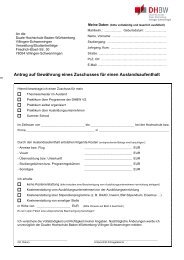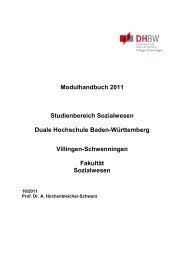Aufnahmeantrag - DHBW Villingen-Schwenningen
Aufnahmeantrag - DHBW Villingen-Schwenningen
Aufnahmeantrag - DHBW Villingen-Schwenningen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Studiengang SOZIALWIRTSCHAFT<br />
Studium und Ausbildung<br />
an der Dualen Hochschule<br />
Baden-Württemberg <strong>Villingen</strong>-<strong>Schwenningen</strong> und<br />
in Sozialwirtschaftlichen Dienstleistungsunternehmen<br />
ein zukunftsorientiertes Studienangebot<br />
Duale Hochschule Baden-Württemberg<br />
<strong>Villingen</strong>-<strong>Schwenningen</strong><br />
Baden-Wuerttemberg Cooperative State University
Zentrale:<br />
Duale Hochschule Baden-Württemberg<br />
<strong>Villingen</strong>-<strong>Schwenningen</strong><br />
Friedrich-Ebert-Straße 30<br />
78054 <strong>Villingen</strong>-<strong>Schwenningen</strong><br />
Telefon 07720 3906-0<br />
Telefax 07720 3906-119<br />
E-Mail info@dhbw-vs.de<br />
Internet www.dhbw-vs.de<br />
November 2009<br />
Verantwortlich für Konzeption und Inhalt:<br />
Prof. Helmut E. Becker<br />
2
SOZIALWIRTSCHAFT<br />
1. Kontakt 4<br />
2. Haupt- und nebenberufliche Dozentinnen und Dozenten 5<br />
3. Das Studium der Sozialwirtschaft 8<br />
3.1 Angebot und Erwartungen 8<br />
3.2 Besonderheiten eines Dualen Studiums an der Dualen Hochschule 10<br />
3.3 Der Bachelor-Abschluss 11<br />
3.4 Grundsätzliches zum Studienangebot Sozialwirtschaft 13<br />
3.5 Zum professionellen Verständnis der Sozialwirtschaft 15<br />
3.6 Ausbildungs- und Studienziele 16<br />
4. Struktur des Studiums und der Ausbildung 17<br />
5. Prüfungen und Leistungskontrollen 19<br />
6. Studien- und Prüfungsplan 20<br />
7. Studieninhalte in den Studienfächern 26<br />
8. Die Vertiefungen 29<br />
9. Praxisphasen in den Ausbildungseinrichtungen 30<br />
10. Eignung von Ausbildungseinrichtungen 33<br />
3
SOZIALWIRTSCHAFT<br />
1. Kontakt<br />
Duale Hochschule<br />
<strong>Villingen</strong>-<strong>Schwenningen</strong><br />
Studiengang Sozialwirtschaft<br />
Bürkstraße 1<br />
78056 <strong>Villingen</strong>-<strong>Schwenningen</strong><br />
Telefon 07720 39 06-311<br />
Telefax 07720 39 06-319<br />
Internet www.dhbw-vs.de<br />
Leiter des Studiengangs<br />
Prof. Helmut E. Becker<br />
Telefon 07720 39 06-312<br />
E-Mail helmut.becker@dhbw-vs.de<br />
Sekretariat<br />
Tanja Fischer<br />
Telefon 07720 3906-311<br />
E-Mail tanja.fischer@dhbw-vs.de<br />
Dozenten<br />
Prof. Michael Hauser<br />
Telefon 07720 3906-405<br />
E-Mail michael.hauser@dhbw-vs.de<br />
Prof. Dr. Gerald Schmola<br />
Telefon 07720 3906-305<br />
E-Mail gerald.schmola@dhbw-vs.de<br />
Prof. Dr. Bernd Sommer<br />
Telefon 07720 3906-309<br />
E-Mail bernd.sommer@dhbw-vs.de<br />
4
SOZIALWIRTSCHAFT<br />
2. Haupt- und nebenberufliche Dozentinnen und Dozenten<br />
Hauptberufliche Dozentinnen und Dozenten<br />
Prof. Helmut E. Becker Dipl.-Verwaltungswissenschaftler<br />
Dipl.-Sozialpädagoge (BA)<br />
Prof. Dr. Vera Döring Dipl.-Handelslehrerin<br />
Prof. Jürgen Grass Dipl.-Informatiker<br />
Prof. Michael Hauser Dipl.-Volkswirt<br />
Dipl.-Sozialpädagoge (BA)<br />
Prof. Dr. Anette Renz Dipl.-Kauffrau<br />
Dipl.-Betriebswirtin (FH)<br />
Prof. Dr. Gerald Schmola Dipl.-Gesundheitsökonom (Univ.)<br />
Prof. Dr. Ahron Schwerdt Dipl.-Kaufmann<br />
Prof. Dr. Bernd Sommer Dipl.-Pädagoge<br />
Prof. Dr. Lothar Wildmann Dipl.-Volkswirt<br />
5
SOZIALWIRTSCHAFT<br />
Nebenberufliche Dozentinnen und Dozenten<br />
Matthias Berg Jurist<br />
Ariane Beringer Dipl.-Sozialwirtin (BA)<br />
Martin Engelbrecht Dipl.-Kaufmann<br />
Ulrike Fassnacht Dipl.-Psychologin, Dipl.-Pädagogin<br />
Sonja Gaißmaier Dipl.-Sozialpädagogin (BA)<br />
Master of Arts Sozialmanagement<br />
Dietmar Gebert Dipl.-Sozialpädagoge (BA)<br />
Dipl.-Verwaltungswissenschaftler<br />
Ulrike Gfrörer Dipl.-Sozialpädagogin (FH)<br />
Sabine Giese-Zeller Dipl.-Sozialpädagogin (BA)<br />
Stefan Goller-Martin Dipl.-Sozialarbeiter (FH)<br />
Marianne Haardt Dipl.-Pädagogin<br />
Gisa Haas Philologin<br />
Christof Heusel Dipl.-Sozialpädagoge (BA)<br />
Alfred Klausmann Dipl.-Sozialpädagoge (FH)<br />
Helga Klier Dipl.-Sozialarbeiterin (FH)<br />
Bernhard Lauinger Dipl.-Verwaltungswissenschaftler<br />
Regine Leinweber Dipl.-Pflegewirtin (FH)<br />
Christian Lewedei Rechtsanwalt<br />
Manuela Lübben-<br />
Konstantinoff<br />
Kommunikationsassistentin /<br />
EDV-Trainerin<br />
Hermann Luz Dipl.-Verwaltungswirt (FH)<br />
Silvana Maier-Sommer Dipl.-Sozialpädagogin (FH)<br />
Hildegard Mantel Dipl.-Psychologin<br />
Dr. Markus Mayer Soziologe M. A.<br />
Gerhard Meder Dipl.-Psychologe<br />
Gabriele Möhrle Dipl.-Sozialwirtin (BA)<br />
Helmut Müller Dipl.-Kaufmann<br />
6
SOZIALWIRTSCHAFT<br />
Thomas Müller Dipl.-Sozialwirt (BA)<br />
Jürgen Muff Dipl.-Sozialpädagoge (BA)<br />
Thilo Naujoks Dipl.-Sozialarbeiter (FH), Betriebswirt<br />
Karin Pfeifer Supervisorin<br />
Rainer Pfeifer Dipl.-Verwaltungswirt (FH)<br />
Steffen Riegraf Dipl.-Sozialwirt (BA)<br />
Dr. Wolfgang Ruf-Ballauf Dr. med.<br />
Jochen Röckle Dipl.-Sozialpädagoge (BA)<br />
Martin Scheuer Dipl.-Verwaltungswirt (FH)<br />
Sven Schiffel Dipl.-Betriebswirt (BA)<br />
Dr. Markus Schoor Rechtsanwalt<br />
Siegmar Schröck Dipl.-Kaufmann<br />
Jürgen Schweizer Dipl.-Verwaltungswirt (FH)<br />
Jochen Stahl Diakon<br />
Prof. Irmgard Teske Dipl.-Psychologin<br />
Ute Villing Dipl.-Sozialpädagogin (BA), Supervisorin<br />
Martin Volz-Neidlinger Dipl.-Theologe, Supervisor<br />
Jochen Wallmann Dipl.-Sozialwirt (BA)<br />
7
SOZIALWIRTSCHAFT<br />
3. Das Studium der Sozialwirtschaft<br />
3.1 Angebot und Erwartungen<br />
Was bieten wir<br />
...unseren Ausbildungseinrichtungen?<br />
• Eine Ausbildung der Studierenden nach den neuesten Erkenntnissen aus<br />
Theorie und Praxis.<br />
• Hochmotivierte und engagierte Studierende bzw. Auszubildende, die mit zu-<br />
nehmender Studiendauer sich selbständig in das Unternehmen einbringen.<br />
• Eine enge Verzahnung zwischen Theorie und Praxis und die dadurch entstehende<br />
Chance, aktuelle Erkenntnisse aus Forschung und Lehre in die tägliche<br />
Betriebspraxis zu übertragen.<br />
• Im Zuge einer Personalentwicklungsmaßnahme den eigenen Führungsnachwuchs<br />
auszubilden und somit die Gewähr zu haben, bei Personalentscheidungen<br />
keine Fehlinvestition zu tätigen.<br />
…unseren Studierenden?<br />
• Ein interessantes, abwechslungsreiches Studium, das sich durch interdisziplinäre<br />
Studieninhalte (von der Psychologie bis zu Managementtechniken, von<br />
der Philosophie bis zur EDV) auszeichnet.<br />
• Eine kurze Studiendauer von drei Jahren mit einem qualifizierten Berufsabschluss.<br />
• Einen spannenden Wechsel zwischen den Erfahrungen in den Praxisphasen<br />
und den theoretischen Lehrinhalten.<br />
• Einen kompetenten und überaus engagierten Lehrkörper, der die eigenen Erfahrungen<br />
aus der Praxis in den Lehrveranstaltungen fundiert aufbereitet.<br />
• Kleine, überschaubare Teilnehmerzahlen in unseren Lehrveranstaltungen, die<br />
viele Möglichkeiten zur individuellen Entfaltung bieten.<br />
• Eine Ausbildungsvergütung durch die Ausbildungsbetriebe.<br />
• Gute Berufschancen mit Karrieremöglichkeiten.<br />
8
SOZIALWIRTSCHAFT<br />
Was erwarten wir<br />
...von unseren Dualen Partnern?<br />
• Eine fachkompetente, praxisbezogene Ausbildung unserer Studierenden<br />
in der Sozialarbeit / Sozialpädagogik und in der Betriebswirtschaftslehre, die<br />
sich in der Sozialwirtschaft zu einer Synthese vereint.<br />
• Eine Übereinstimmung mit unserer „Unternehmensphilosophie“, die geprägt<br />
ist von einem ausgewogenen Verständnis der Gewichtung von Sozialer Arbeit<br />
auf der einen und Betriebswirtschaftslehre auf der anderen Seite. Wir verstehen<br />
„Soziales“ und „Wirtschaft“ nicht als Gegensätze, sondern gehen davon<br />
aus, dass eine erfolgreiche Arbeit in Sozialwirtschaftlichen Dienstleistungsunternehmen<br />
nur noch gelingt, wenn beide Fachkompetenzen vorhanden sind.<br />
Das besondere Merkmal der Sozialwirte ist, dass sie beide Kompetenzen in<br />
sich vereinigen und sie somit zu einer Symbiose sozialen und wirtschaftlichen<br />
Handelns gelangen<br />
• Das Verständnis als Sozialwirtschaftliches Dienstleistungsunternehmen, das<br />
die Notwendigkeit erkannt hat, sich mit modernen Managementmethoden einem<br />
zunehmenden Konkurrenz- bzw. Erwartungsdruck der Kunden bzw. Bürger<br />
zu stellen.<br />
...von unseren Studierenden?<br />
Studienbewerber fragen immer wieder an, welche Voraussetzungen wir an sie stellen,<br />
damit sie der Ausbildung gerecht werden?<br />
• Hierauf gibt es (neben den formalrechtlichen Voraussetzungen der allgemeinen<br />
Hochschulreife bzw. der Fachhochschulreife und dem Vorliegen eines<br />
Ausbildungsvertrages mit einer geeigneten Ausbildungsstätte) eine relativ einfache<br />
Antwort: Interesse und Freude sowohl an der Sozialen Arbeit als auch<br />
an verwaltungstechnischen und betriebswirtschaftlichen Aufgabenstellungen.<br />
• Der angehende Sozialwirt sollte sich bewusst für den sozialen Bereich entscheiden,<br />
weil er sich in diesem Arbeitsfeld eine sinnhafte berufliche Tätigkeit<br />
verspricht. Ein besonderes soziales Engagement wird daher auch von uns<br />
vorausgesetzt.<br />
• Daneben erwarten wir eine hohe Leistungsbereitschaft. Die qualifizierte Ausbildung<br />
in einem zeitlich begrenzten Rahmen von 3 Jahren erfordert, dass die<br />
Studierenden bereit sind, sich stark zu engagieren und sich aktiv in den Lehrbetrieb<br />
einzubringen.<br />
9
SOZIALWIRTSCHAFT<br />
3.2 Besonderheiten eines Studiums an der Dualen Hochschule<br />
Das besondere Merkmal des Ausbildungssystems an der Dualen Hochschule ist die<br />
Verknüpfung von theoretischer Ausbildung an der Studienakademie mit der intensiven,<br />
systematischen und reflektierten praktischen Ausbildung in sechs Praxisphasen<br />
durch die Ausbildungsstätten. Dabei erwerben die Studierenden von Beginn an Erfahrungen<br />
in den Sozialwirtschaftlichen Dienstleistungsunternehmen, werden mit<br />
den institutionellen, gesellschaftspolitischen und ökonomischen Rahmenbedingungen<br />
sowie den verschiedenen Problemlagen der Klienten (Kunden) konfrontiert und<br />
gewinnen in zunehmend verantwortungsvoller Tätigkeit berufliche Handlungskompetenz<br />
und berufsrollenspezifisches Selbstverständnis.<br />
Von den Studierenden müssen frühzeitig Transferleistungen erbracht werden zwischen<br />
den in der Theorie erworbenen Kenntnissen in unterschiedlichen Fach- oder<br />
Sachgebieten und den Anforderungen der Praxis an berufliches Handeln der<br />
Sozialwirte.<br />
Mit dem exemplarischen Erwerb von beruflichen Fähigkeiten in einem Arbeitsfeld ist<br />
zugleich die Notwendigkeit verbunden, die eigene berufliche Kompetenz auf andere<br />
Arbeitsfelder übertragbar zu machen.<br />
Den zeitlichen Rahmen der Ausbildung bzw. des Studiums gibt ein relativ stark strukturiertes<br />
Curriculum mit hoher Semesterstundenzahl und Präsenzpflicht vor, wobei<br />
noch Raum bleiben muss für das Selbststudium. Die Ausbildung erfordert von den<br />
Studierenden ein hohes Maß an Flexibilität, Problembewusstsein und autonomer<br />
Handlungsfähigkeit. Gleichzeitig sind die Fähigkeit und die Bereitschaft gefragt, das<br />
eigene berufliche Handeln kritisch zu überprüfen und die eigenen Ziele und Vorgehensweisen<br />
mit den Zielen und Vorgehensweisen der Institution bzw. den Rahmenbedingungen,<br />
unter denen in Sozialwirtschaftlichen Dienstleistungsunternehmen gearbeitet<br />
wird, abzustimmen.<br />
Sozialwirtschaft wird erlernt unter den Bedingungen von Interdisziplinarität. Dies<br />
zwingt die Studierenden dazu, sich neben den Kernfächern Betriebswirtschaft und<br />
Sozialarbeit/Sozialpädagogik in die Denk- und Handlungsansätze anderer Fächer<br />
einzuarbeiten und den Anwendungsbezug herzustellen. Die Sozialwirtschaft selbst<br />
als Wissenschafts- und Handlungsansatz ist ständig im Fluss, so dass auch in Ausbildung<br />
und Studium weniger fertige Handlungskonzepte als vielmehr neue und<br />
mehrperspektivische Handlungsansätze gefragt sind.<br />
Die Duale Hochschule Baden-Württemberg vermittelt eine wissenschaftsbezogene<br />
und zugleich praxisorientierte berufliche Bildung. Sie erfüllt ihre Aufgabe durch das<br />
Zusammenwirken der Hochschule mit den beteiligten Kooperationspartnern. Dieses<br />
praxisintegrierte Konzept ist zentrales Bestimmungsmerkmal des Studiums:<br />
Der Lernort Theorie (Duale Hochschule) vermittelt die wissenschaftlichen (z. B. ökonomischen,<br />
soziologischen, psychologischen, rechtlichen, pädagogischen) sowie<br />
methodischen Grundlagen für eine qualifizierte Tätigkeit in der Sozialwirtschaft.<br />
10
SOZIALWIRTSCHAFT<br />
Der Lernort Praxis (ein Sozialwirtschaftliches Dienstleistungsunternehmen) ist Anwendungsort<br />
dieser grundlegenden Kenntnisse. Den Studierenden wird die Befähigung<br />
zu arbeitsfeldspezifischem Handeln durch die Anleitung, durch praxisbegleitende<br />
Information und Reflexion wie auch durch die Einübung in alltägliche Berufsvollzüge<br />
vermittelt.<br />
3.3 Der Bachelor-Abschluss<br />
Mit Beginn des Studienjahrgangs 2006 passte die Duale Hochschule Baden-<br />
Württemberg <strong>Villingen</strong>-<strong>Schwenningen</strong> ihre Studiengänge an die internationale Entwicklung<br />
(„Bologna-Prozess“) an. Als berufsqualifizierenden Abschluss erhalten die<br />
Absolventen den akademischen Grad „Bachelor of Arts“ im Studiengang Sozialwirtschaft..<br />
Ziel des „Bologna-Prozesses“ ist eine Harmonisierung der Studiengänge in der Europäischen<br />
Union. Der Bachelor-Abschluss ist mit einer Regelstudienzeit von 6 Semestern<br />
grundsätzlich der erste berufsqualifzierende Abschluss, dem dann ein Master-Studiengang<br />
folgen kann.<br />
Der Bachelor-Abschluss an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg <strong>Villingen</strong>-<br />
<strong>Schwenningen</strong> hat gegenüber einem Bachelor-Abschluss an einer Universität oder<br />
einer Fachhochschule den großen Vorteil, dass das Studium bereits ab dem 1. Semester<br />
einer berufsspezifischen Ausrichtung folgt. Die Studieninhalte an der <strong>DHBW</strong><br />
VS sind gezielt auf die Tätigkeiten in den jeweiligen Kooperationsunternehmen ausgerichtet.<br />
Gerade wenn der Bachelor-Abschluss zum Regelfall für den künftigen Berufsnachwuchs<br />
wird, ist es notwendig, die anspruchsvollen und für die Berufspraxis<br />
wichtigen Themen bereits in den Bachelor-Studiengang zu integrieren. Das kann nur<br />
die <strong>DHBW</strong> bieten.<br />
Neuerungen im Bachelor-Studiengang:<br />
• Neben Noten für das Bestehen von Leistungsnachweisen (insbesondere<br />
durch Klausuren, Projektarbeiten, Bachelor-Arbeiten) gibt es zusätzlich Credit<br />
Points (ECTS), die entsprechend des Leistungsumfangs vergeben werden.<br />
Ein ECTS-Punkt steht dabei für etwa 30 Arbeitsstunden.<br />
• An der Bachelor-Gesamtnote ist die Klassifikation des Studierenden erkennbar<br />
(die besten zehn Prozent eines Studiengangs erhalten die Note A, gefolgt<br />
von B bis E).<br />
• Die Studiengänge unterliegen der Akkreditierung durch unabhängige Agenturen,<br />
die neben dem internen Qualitätssicherungsprogramm für den hohen<br />
Standard der angebotenen Studieninhalte bürgt.<br />
Die Einführung von Bachelor-Studiengängen änderte somit weder etwas an der hohen<br />
Qualität des Studiums noch an der praxisorientierten Grundausrichtung der Dualen<br />
Hochschule. Die enge Verzahnung von Theorie und Praxis – das Erfolgsrezept<br />
der Dualen Hochschule – blieb in neuen Kleidern erhalten und sichert so den Ausbildungsbetrieben<br />
eine zielgerichtete, praxisorientierte Wissensvermittlung für ihre<br />
Nachwuchskräfte.<br />
11
Sozialwirtschaft – Studium und Ausbildung mit einer breiten Fachkompetenz<br />
12
Studium SOZIALWIRTSCHAFT<br />
3.4 Grundsätzliches zum Studienangebot Sozialwirtschaft<br />
• Soziale Einrichtungen und Dienste verstehen sich heute immer mehr als moderne<br />
Dienstleistungsunternehmen. Sie werden verstärkt nach Marktmechanismen organisiert.<br />
Die Bewertung von Leistungen und Effizienz steuert die Umverteilung<br />
der Geldmittel der sozialen Sicherungssysteme.<br />
• In ihnen werden die Schnittstellen zwischen einem effizienten wirtschaftlichen<br />
Handeln einerseits und dem sozialen Auftrag andererseits immer offenkundiger.<br />
In der Vergangenheit stellte man sich diesen Anforderungen dadurch, dass man<br />
die Betriebswirtschaft und die Soziale Arbeit in unterschiedlichen Organisationseinheiten<br />
institutionalisierte. Hierdurch entstanden und entstehen häufig hohe Koordinationsbedarfe.<br />
Die organisatorische Trennung ist jedoch in der Regel künstlich,<br />
da es sich um eine ganzheitliche Aufgabenstellung handelt.<br />
Zudem können sich viele (vor allem kleinere) Sozialwirtschaftliche Dienstleistungsunternehmen<br />
Fachkräfte sowohl aus dem Bereich „Wirtschaft“ als auch aus<br />
dem Bereich „Sozialwesen“ nicht leisten.<br />
• Wirtschaftliche Entscheidungen in der Sozialen Arbeit setzen voraus, dass eine<br />
gründliche, fachkompetente Kenntnis der Sozialen Arbeit vorhanden ist. Nur wer<br />
die zu erbringenden sozialen Dienstleistungen aus eigener Fach- und Erfahrungskompetenz<br />
kennt, ist in der Lage, fachgerechte Entscheidungen zu treffen.<br />
Die Soziale Arbeit wird ihrerseits immer mehr mit wirtschaftlichen Aufgabenstellungen<br />
konfrontiert, so dass eine gründliche, fachkompetente Kenntnis der Betriebswirtschaft<br />
auf unterschiedlichen Ebenen der Sozialen Arbeit notwendig wird.<br />
Auf diesem Hintergrund stellt sich zunehmend ein neues Anforderungsprofil. Wirtschaftliche<br />
und Soziale Fachkompetenz müssen auf den unterschiedlichsten Ebenen<br />
als Einheit vorhanden sein. Dies setzt ein neues Qualifikationsprofil voraus.<br />
Hierbei ist zu beachten, dass die Basis für eine gute Soziale Arbeit ein gesunder<br />
wirtschaftlicher Betrieb ist. Sozialwirtschaftliche Dienstleistungen müssen daher<br />
auf den Prüfstand eines effizienten und effektiven Handelns gestellt werden.<br />
● Das wirtschaftliche Handeln darf jedoch nicht Selbstzweck sein. Es ist ein zwingend<br />
notwendiges Mittel, um den sozialen Auftrag und daher die originären Unternehmensziele<br />
zu verwirklichen.<br />
13
Studium SOZIALWIRTSCHAFT<br />
Effizienz / Effektivität<br />
Marktmechanismen<br />
Sozialwirtschaft - die Zukunft in Sozialwirtschaftlichen Dienstleistungsunternehmen<br />
Wirtschaftliches Handeln<br />
Neues Qualifikationsprofil:<br />
Sozialwirtschaft<br />
Anforderungsprofil:<br />
Wirtschaftliche<br />
und Soziale<br />
Fachkompetenz<br />
Soziale<br />
Dienstleistungsunternehmen<br />
Behinderteneinrichtungen Wohlfahrtsverbände Soziale Vereine<br />
Zentren für Psychatrie Rettungsdienste Sozial- und Jugendämter<br />
Beschäftigungsinitiative<br />
n<br />
Soziale Wohnungsbauunternehmen Einrichtungen der Jugendhilfe<br />
Sozialstationen Krankenhäuser Kur- und Reha-Einrichtungen Altenpflegeheime<br />
14<br />
und, und, und...<br />
Sozialer Auftrag<br />
Leitbild / Vision<br />
Unternehmensziele
Studium SOZIALWIRTSCHAFT<br />
3.5 Zum professionellen Verständnis der Sozialwirtschaft<br />
• Zunächst ist festzuhalten, dass die grundständige Ausbildung als Sozialwirt immer<br />
noch relativ neu ist, so dass die angehenden Absolventen mit einem sich entwickelnden<br />
professionellen Selbstverständnis heranwachsen werden, das die Integration<br />
des sozialen und betriebswirtschaftlichen Denkens und Handelns beinhaltet.<br />
• Das professionelle Selbstverständnis des Sozialwirts ist ein Profil, das aus den<br />
beiden Studienbereichen „Sozialwesen“ und „Wirtschaft“ geprägt ist.<br />
Der Sozialwirt kennt die sozialstaatlichen Leistungsbereiche (Kinder- und Jugendhilfe,<br />
Behindertenhilfe, Hilfe für psychisch kranke Menschen, Altenhilfe usw.). Er<br />
kennt den gesetzlichen/normativen, gesellschaftlichen und fachlichen Rahmen der<br />
Sozialen Arbeit.<br />
Er kennt und wendet die professionellen Arbeitsmethoden Sozialer Arbeit an. Er<br />
ist informiert über die grundlegende Intention Sozialer Arbeit, individuelle und soziale<br />
Verhältnisse nach humanen, sozialstaatlichen und fachlichen Grundsätzen<br />
so gestalten zu helfen, dass die beteiligten „Kunden“ diese Prozesse als hilfreich<br />
und sinnvoll akzeptieren können. Er weiß um die Schwierigkeiten des Austarierens<br />
von Interessen und folgt der Handlungsstrategie, dass der konsensorientierte<br />
Dialog und die Entscheidungsfähigkeit von Arbeitsteams wichtige Grundlagen der<br />
Arbeit darstellen.<br />
● Der Sozialwirt kennt die ökonomischen Zusammenhänge unserer Gesellschaftsordnung.<br />
Er beherrscht breite Grundlagen über die Methoden und Inhalte der Betriebswirtschaftslehre.<br />
Hierbei findet eine Übertragung theoretischer Erkenntnisse auf<br />
praxisorientierte Aufgabenstellungen ebenso wie ein kennen lernen exemplarischer<br />
betrieblicher Aufgabenfelder statt. Die Methoden- und Sozialkompetenz wird<br />
gezielt entwickelt und gefördert.<br />
Er kennt die Anwendung der Methoden wissenschaftlichen Arbeitens und das<br />
theoretisch-systematische Denken in Zusammenhängen.<br />
● Durch die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen wird die Fähigkeit zum selbständigen<br />
Arbeiten und die Persönlichkeitsentwicklung gefördert. Fachkompetenz,<br />
Methodenkompetenz und Sozialkompetenz ermöglichen dem Sozialwirt Einsatzmöglichkeiten<br />
in den unterschiedlichsten Bereichen sozialer Dienstleistungsunternehmen.<br />
• Dieses Qualifikationsprofil befähigt den Sozialwirt, auch in Betrieben außerhalb<br />
Sozialwirtschaftlicher Dienstleistungsunternehmen tätig zu sein.<br />
15
Studium SOZIALWIRTSCHAFT<br />
3.6 Ausbildungs- und Studienziele<br />
Das formale Ziel besteht darin, in einem dreijährigen gestuften Ausbildungs- und<br />
Studiengang zum Bachelor of Arts in Sozialwirtschaft auszubilden.<br />
Der Studiengang an der Dualen Hochschule ist akkreditiert und hochschulrechtlich<br />
anerkannt. Der Zugang zu weiterführenden Masterstudiengängen ist offen.<br />
Die Sozialwirtschaft nimmt in Sozialwirtschaftlichen Dienstleistungsunternehmen eine<br />
zentrale Funktion ein und muss vielfältigen Anforderungen entsprechen, die sich<br />
aus den unterschiedlichsten Problemstellungen ergeben. Sie hat mannigfaltige Aufgaben<br />
zu erfüllen, entsprechend breit sind die Einsatzmöglichkeiten der Sozialwirte,<br />
und entsprechend differenziert ist das Angebot an Studienfächern und -inhalten an<br />
der Dualen Hochschule.<br />
Das Studien- und Ausbildungsangebot verfolgt daher folgende Richtziele:<br />
• Erwerb einer Grundqualifikation als Sozialwirt, die fachrichtungsübergreifend ist<br />
und eine breite Ausbildung für viele Arbeitsfelder einschließt. Damit wird der spätere<br />
Einsatz in allen Sozialwirtschaftlichen Dienstleistungsunternehmen ermöglicht<br />
und es werden Grundlagen gelegt für spätere berufliche Differenzierungen.<br />
• Erwerb einer Spezialqualifikation in dem gewählten Arbeitsfeld, die eine vertiefte<br />
Einarbeitung in die Praxis über insgesamt sechs Praxisphasen und eine fachrichtungsspezifische<br />
Theorieausbildung in den Theorie-Praxis-Seminaren und den<br />
Studienschwerpunkten einschließt.<br />
Übergreifendes Ziel des Studiums und der Ausbildung ist es, professionelle Handlungskompetenz<br />
zu vermitteln, die die Entwicklung und Beherrschung aller für die<br />
Berufsausübung entscheidenden oder wichtigen Fähigkeiten und Fertigkeiten umfasst.<br />
Die in der Theorie vermittelten Studieninhalte und die in der praktischen Ausbildung<br />
erlernten Ausbildungsinhalte münden ein in eine generelle professionelle Befähigung<br />
der Studierenden. Exemplarisch wird in einigen Arbeitsfeldern generelle berufliche<br />
Kompetenz erworben, die die Absolventen für einen beruflichen Einsatz in allen Sozialwirtschaftlichen<br />
Dienstleistungsunternehmen vorbereitet. So ist beispielsweise<br />
eine spätere berufliche Tätigkeit in einer Altenhilfeeinrichtung möglich, auch wenn<br />
man die praktische Ausbildung in einer Einrichtung für behinderte Menschen oder<br />
einer Sozialverwaltung durchlaufen hat.<br />
16
Studium SOZIALWIRTSCHAFT<br />
4. Struktur des Studiums und der Ausbildung<br />
17<br />
Halbjahr / Wochen<br />
I II III IV V VI I-VI<br />
Theorie an der Dualen Hochschule 12 12 12 12 12 12 72<br />
Praktische Ausbildung im sozialwirtschaft-<br />
lichen Bereich 1)<br />
Gesamtdauer in Wochen 26 26 26 26 26 26 156<br />
Termine der Studien- und Praxisphasen<br />
Jahrgang 2010<br />
14<br />
14<br />
Studienphasen<br />
12 Wochen<br />
14<br />
14<br />
14<br />
14<br />
84<br />
Praxisphasen 1)<br />
14 Wochen<br />
Jahrgang 2010<br />
1. Halbjahr 01.10.10 – 26.12.10 27.12.10 – 03.04.11<br />
2. Halbjahr 04.04.11 – 26.06.11 27.06.11 – 02.10.11<br />
3. Halbjahr 03.10.11 – 25.12.11 26.12.11 – 31.03.12<br />
4. Halbjahr 01.04.12 – 24.06.12 25.06.12 – 30.09.12<br />
5. Halbjahr 07.01.13 – 31.03.13 01.10.12 – 06.01.13<br />
6. Halbjahr 01.07.13 – 30.09.13 01.04.13 – 30.06.13<br />
Jahrgang 2011<br />
Studienphasen<br />
12 Wochen<br />
Praxisphasen 1)<br />
14 Wochen<br />
Jahrgang 2011<br />
1. Halbjahr 01.10.11 – 25.12.11 26.12.11 – 31.03.12<br />
2. Halbjahr 01.04.12 – 24.06.12 25.06.12 – 30.09.12<br />
3. Halbjahr 01.10.12 – 22.12.10 23.12.12 – 31.03.13<br />
4. Halbjahr 01.04.13 – 22.06.13 23.06.13 – 28.09.13<br />
5. Halbjahr 05.01.14 – 29.03.14 29.09.13 – 04.01.14<br />
6. Halbjahr 06.07.14 – 30.09.14 30.03.14 – 05.07.14<br />
1) Die Praxisphasen schließen die Urlaubszeiten mit ein. Die Praxisphasen der 4.<br />
und 5. Studienhalbjahre sind zu einer halbjährlichen Praxisphase zusammengelegt.
Studium SOZIALWIRTSCHAFT<br />
Abschlüsse<br />
Studium<br />
Eingangsvoraussetzungen<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
Bachelor of Arts<br />
Sozialwirt (B.A.)<br />
Sozialwirtin (B.A.)<br />
Praxis<br />
Praxis<br />
Praxis<br />
Praxis<br />
Praxis<br />
Praxis<br />
18<br />
Theorie<br />
Theorie<br />
Theorie<br />
Theorie<br />
Theorie<br />
Theorie<br />
Studien-<br />
halbjahre Phasen des Studiums<br />
Abitur<br />
(Hochschulreife, Fachhochschulreife)<br />
und Ausbildungsvertrag<br />
Beruf
Studium SOZIALWIRTSCHAFT<br />
5. Prüfungen und Leistungskontrollen<br />
Prüfungsleistungen im Studium werden als Sukzessiv-Prüfungsleistungen erbracht<br />
und über die sechs Theoriephasen hinweg als Modulprüfungen erbracht. Sie umfassen<br />
vor allem Studienarbeiten, Klausurarbeiten, Seminararbeiten, Reflexionsberichte,<br />
mündliche Prüfungen und die Bachelor-Arbeit.<br />
• Studienarbeit (S) mit einem Umfang von durchschnittlich 20 bis 25 Seiten. Die<br />
Studienarbeit soll die Fähigkeit zeigen, eine klar definierte Problemstellung wissenschaftlich<br />
selbständig zu bearbeiten. Sie ist zu dem von der DH festgelegten<br />
Termin abzugeben.<br />
• Klausurarbeit (K); die Vorgabezeit soll 120 Minuten nicht unter- und 180 Minuten<br />
nicht überschreiten.<br />
• Seminararbeit (SE) ist eine Prüfungsleistung in Form eines Vortrages und einer<br />
schriftlichen Ausarbeitung von i.d.R. 15 bis 20 Seiten. Der Vortrag soll 30 Minuten<br />
dauern. An den Vortrag schließt sich eine diskursive Auseinandersetzung mit der<br />
Thematik in der Gruppe an, die von den Vortragenden zu moderieren ist.<br />
• Reflexionsbericht (RB) als eine sozialwirtschaftliche, interdisziplinäre Bearbeitung<br />
eines praxisbezogenen Falles bzw. Projektes. Die Studierenden sollen an Hand<br />
des Falles nachweisen, dass sie eine interdisziplinäre Denk- und Arbeitsweise gelernt<br />
haben und an Aufgabenstellungen mit einer typischen sozialwirtschaftlichen<br />
Fachkompetenz heran gehen. Er soll i.d.R. 25 Schreibmaschinenseiten umfassen.<br />
• Die Bachelor-Arbeit (BA) soll zeigen, dass die Studierenden in der Lage sind, eine<br />
praxisbezogene Problemstellung selbständig unter Anwendung praktischer und<br />
wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden zu bearbeiten. Der Umfang der<br />
Bachelor-Arbeit soll 60 bis 80 Seiten betragen.<br />
• Mündliche Prüfung (MP); durch die mündliche Prüfung sollen die Studierenden<br />
nachweisen, dass sie die Zusammenhänge des Prüfungsgebiets erkennen, reflektieren<br />
und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen<br />
vermögen. Ferner soll festgestellt werden, ob sie über ein breites Grundlagenwissen<br />
verfügen. Die mündliche Prüfung dauert ca. 30 Minuten.<br />
• Testat (T); ein Testat wird ausgestellt, wenn Studierende ein Seminar ordnungsgemäß<br />
belegt, regelmäßig an den Veranstaltungen teilgenommen und den verlangten<br />
Anforderungen nachgekommen sind. Die Prüfungsleistung wird mit „bestanden“<br />
oder „nicht bestanden“ bewertet.<br />
• Präsentation (P); bei der Präsentation steht die Befähigung zur Vermittlung eines<br />
Themas in der Gruppe im Vordergrund. Die Prüfungsleistung wird mit „bestanden“<br />
oder „nicht bestanden“ bewertet.<br />
• Praxisbericht (PB); Praxisberichte sollen die Ergebnisse des angeleiteten Studiums<br />
zusammenfassend beschreiben. Die Prüfungsleistung wird mit „bestanden“<br />
oder „nicht bestanden“ bewertet.<br />
19
Studium SOZIALWIRTSCHAFT<br />
6. Studien- und Prüfungsplan<br />
Prüfungsteil Prüfungsleistungen / Präsenzstunden<br />
Lehrveranstaltung/Unit 1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem. 5. Sem. 6. Sem.<br />
Modul 1<br />
Sozialwirtschaft I – Einführung in<br />
sozialwirtschaftliches Denken und<br />
Grundlagen der Sozialwirtschaft<br />
(13 ECTS)<br />
S und<br />
K<br />
V: Einführung in die Sozialwirtschaft 30<br />
V/Ü: Einführung in sozialpädagogisches<br />
Denken und Grundlagen der<br />
Sozialen Arbeit<br />
S/Ü: Einführung in kommunikatives<br />
Handeln<br />
V/Ü: Einführung in betriebswirtschaftliches<br />
Denken und Grundlagen<br />
der BWL<br />
V/Ü: Einführung in wissenschaftliches<br />
Arbeiten<br />
Modul 2<br />
Recht I – Einführung in das juristische<br />
Denken und Grundlagen des<br />
Rechts (7 ECTS)<br />
V: Einführung in das Öffentliche<br />
Recht<br />
33<br />
21<br />
21<br />
18<br />
K<br />
18<br />
V: Einführung in das Private Recht 18<br />
V: Einführung in das Sozialgesetzbuch<br />
Modul 3<br />
Volkswirtschafslehre -<br />
Mikroökonomische Theorie und ökonomisches<br />
Denken (6 ECTS)<br />
18<br />
V: Einführung in die VWL 21<br />
V: Mikroökonomische Theorie 21<br />
Modul 4<br />
Soziologische und psychologische<br />
Grundlagen der Sozialwirtschaft<br />
(9 ECTS)<br />
V: Soziologische Grundlagen der<br />
Sozialwirtschaft I<br />
V: Soziologische Grundlagen der<br />
Sozialwirtschaft II – ausgewählte<br />
Themen<br />
V: Psychologische Grundlagen der<br />
Sozialwirtschaft I<br />
K<br />
18<br />
18<br />
20<br />
S oder<br />
SE<br />
15
Studium SOZIALWIRTSCHAFT<br />
Lehrveranstaltung / Unit 1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem. 5. Sem. 6. Sem.<br />
V: Psychologische Grundlagen der<br />
Sozialwirtschaft II - ausgewählte<br />
Themen<br />
V/Ü: Empirische Sozialforschung 21<br />
Modul 5<br />
Technik der Finanzbuchführung<br />
(5 ECTS)<br />
V/Ü: Rechnungswesen I 24<br />
V/Ü: Rechnungswesen II 24<br />
Modul 6<br />
Studien- und Praxisschwerpunkt<br />
(6 ECTS)<br />
S: Theorie-Praxis-Seminar I 12<br />
21<br />
39<br />
K<br />
PB<br />
S: Theorie-Praxis-Seminar II 12<br />
V: Arbeitsfelder der Sozialwirtschaft<br />
21<br />
S: Wahlpflichtseminar I 21<br />
S: Wahlpflichtseminar II 21<br />
Modul 7<br />
Recht II – Die Bücher des SGB<br />
(7 ECTS)<br />
V: SGB II 12<br />
V: SGB III 12<br />
V: SGB IV und V 12<br />
V: SGB VI 12<br />
V: SGB XI 12<br />
V: SGB XII 21<br />
Modul 8<br />
Informationstechnologie<br />
(4 ECTS)<br />
V/S: Grundlagen der<br />
Informationstechnologie<br />
V/S: Kommunikation und Netze 15<br />
Modul 9<br />
Sozialwirtschaft II – Vertiefung<br />
(5 ECTS)<br />
K<br />
30<br />
K<br />
K
Studium SOZIALWIRTSCHAFT<br />
Lehrveranstaltung / Unit 1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem. 5. Sem. 6. Sem.<br />
V/Ü: Sozialwirtschaft I – Die Merkmale<br />
der Sozialwirtschaft<br />
V/Ü: Sozialwirtschaft II – Sozialwirtschaftliches<br />
interdisziplinäres<br />
Denken<br />
Modul 10<br />
Methoden der Sozialen Arbeit<br />
(9 ECTS)<br />
Ü: Kommunikatives Handeln –<br />
Vertiefung<br />
V/Ü: Soziale Einzelfallhilfe I 18<br />
22<br />
18<br />
18<br />
S oder<br />
SE<br />
V/Ü: Soziale Einzelfallhilfe II 18<br />
V/Ü: Gruppenarbeit I 18<br />
V/Ü: Gruppenarbeit II 15<br />
Modul 11<br />
Kosten- und Leistungsrechnung<br />
(5 ECTS)<br />
V/Ü: Kosten- und Leistungsrechnung<br />
I<br />
V/Ü: Kosten- und Leistungsrechnung<br />
II<br />
Modul 12<br />
Berufsethik und professionelles<br />
Handeln (5 ECTS)<br />
S: Reflexionsseminar I 24<br />
S: Reflexionsseminar II 24<br />
Modul 13<br />
Kommunikation und Darstellung<br />
(4 ECTS)<br />
S/Ü: Präsentation 15<br />
S/Ü: Moderation 15<br />
Modul 14<br />
Methoden der Sozialen Arbeit II<br />
(6 ECTS)<br />
V: Gemeinwesenarbeit und Sozialraumorientierung<br />
V: Soziale Netzwerkarbeit und<br />
case management<br />
S/Ü: Wahlpflichtseminar 15<br />
21<br />
10<br />
K<br />
21<br />
T<br />
P<br />
21<br />
21<br />
K
Studium SOZIALWIRTSCHAFT<br />
Lehrveranstaltung / Unit 1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem. 5. Sem. 6. Sem.<br />
Modul 15<br />
Recht III – Vertiefung (6 ECTS)<br />
V: BGB – Vertiefung 21<br />
V: Handels- und Gesellschaftsrecht<br />
S: Wahlpflichtseminar Recht 21<br />
Modul 16<br />
Investition und Finanzierung<br />
(5 ECTS)<br />
V: Investition und Finanzierung I 21<br />
V: Investition und Finanzierung II 21<br />
Modul 17<br />
Management und Führung I<br />
(9 ECTS)<br />
V/Ü: Organisation 15<br />
S/Ü: Planungs- und Entscheidungstechniken<br />
V: Projekt- und Prozessmanagement<br />
V: Qualitätsmanagement I 18<br />
Ü: Qualitätsmanagement II 15<br />
Modul 18<br />
Sozialwirtschaft und Ethik<br />
(5 ECTS)<br />
S: Sozialwirtschaft und Ethik I 21<br />
S: Sozialwirtschaft und Ethik II 21<br />
Modul 19<br />
Studien- und Praxisschwerpunkt II<br />
(10 ECTS)<br />
S: Theorie-Praxis-Seminar III 12<br />
23<br />
21<br />
K<br />
21<br />
K<br />
K<br />
21<br />
S<br />
RB<br />
und<br />
MP<br />
S: Theorie-Praxis-Seminar IV 12<br />
S: Wahlpflichtseminar 21<br />
Modul 20<br />
Management und Führung II<br />
(7 ECTS)<br />
V: Unternehmensführung 27<br />
V: Mitarbeiterführung 21<br />
K
Studium SOZIALWIRTSCHAFT<br />
Lehrveranstaltung / Unit 1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem. 5. Sem. 6. Sem.<br />
V: Grundlagen der Personalwirtschaft<br />
Modul 21<br />
Bilanzierung (5 ECTS)<br />
V/Ü: Bilanzierung I 21<br />
V/Ü: Bilanzierung II 21<br />
Modul 22<br />
Marketing und Fundraising<br />
(5 ECTS)<br />
V: Marketing I 21<br />
V: Marketing II 21<br />
V/Ü: Fundraising und social<br />
Sponsoring<br />
Modul 23<br />
Das Unternehmen in der makroökonomischen<br />
und politischen<br />
Umwelt<br />
(5 ECTS)<br />
V: Makroökonomie 21<br />
V: Sozialwirtschaft und Politik 21<br />
S Wahlpflichtseminar 21<br />
Modul 24<br />
Theorie- und Praxisprojekte I<br />
(10 ECTS)<br />
S/Ü: Planspiel – Konzeption 40<br />
Modul 25<br />
Personal- und Organisationsentwicklung<br />
(9 ECTS)<br />
V: Personalwirtschaft I 24<br />
Ü: Personalwirtschaft II 21<br />
V: Arbeitspsychologie I 18<br />
V: Arbeitspsychologie II 21<br />
V: Organisationsentwicklung 18<br />
24<br />
21<br />
18<br />
K<br />
K<br />
K<br />
SE<br />
K
Studium SOZIALWIRTSCHAFT<br />
Lehrveranstaltung / Unit 1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem. 5. Sem. 6. Sem.<br />
Modul 26<br />
Arbeits- und Tarifrecht (5 ECTS)<br />
V: Arbeitsrecht I 15<br />
V: Arbeitsrecht II 15<br />
V: Tarifrecht 21<br />
Modul 27<br />
Controlling (5 ECTS)<br />
V: Controlling I 24<br />
V: Controlling II 21<br />
Modul 28<br />
Studien- und Praxisschwerpunkt III<br />
(10 ECTS)<br />
S: Theorie-Praxis-Seminar V 12<br />
S: Theorie-Praxis-Seminar VI 12<br />
S: Wahlpflichtseminar I 21<br />
S: Wahlpflichtseminar II 21<br />
S: Trainingsseminar I 10<br />
S: Trainingsseminar II 10<br />
Modul 29<br />
Praxisbezogene Fallarbeit und<br />
Interdisziplinäres Denken (6 ECTS)<br />
S: Fallseminar Soziale Arbeit und<br />
Sozialwirtschaft<br />
S: Fallseminar Recht und Sozialwirtschaft<br />
S: Wahlpflichtseminar 21<br />
Modul 30<br />
Theorie- und Praxisprojekte II<br />
(5 ECTS)<br />
S: Planspiel – Finanzierung 40<br />
Modul 31<br />
Bachelor-Arbeit (12 ECTS)<br />
25<br />
21<br />
K<br />
K<br />
MP<br />
K<br />
21<br />
SE<br />
BA
Studieninhalte SOZIALWIRTSCHAFT<br />
7. Studieninhalte in den Studienfächern<br />
Das interdisziplinäre Studium der Sozialwirtschaft setzt sich aus den Studienfächern<br />
Sozialarbeit/Sozialpädagogik, Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Recht, Psychologie,<br />
Soziologie, Philosophie, Sozialmedizin/Gesundheitswissenschaften und Informatik<br />
zusammen.<br />
Sozialarbeit/Sozialpädagogik<br />
Die meisten Sozialwirtschaftlichen Dienstleistungsunternehmen, die mit dem Studiengang<br />
Sozialwirtschaft zusammenarbeiten, sind in dem Arbeitsfeld der Sozialarbeit/Sozialpädagogik<br />
tätig. In der Regel handelt es sich hierbei um Hilfen für Menschen,<br />
die in „Not“ sind (z. B. Altenhilfe, Behindertenhilfe, Hilfe für psychisch kranke<br />
Menschen, Sozialhilfe, Jugendhilfe).<br />
In den Lehrveranstaltungen sollen die Studierenden den individuell helfenden und<br />
den gesellschaftlich-politischen Auftrag der Sozialarbeit erkennen und dabei eine<br />
eigene Positionsbestimmung vornehmen können. Ebenfalls soll ein umfassender<br />
Überblick über das differenzierte Arbeitsfeld der Sozialwirtschaft gegeben werden.<br />
Die Studierenden werden mit den wichtigsten Handlungsprinzipien sozialpädagogischer<br />
Methoden vertraut gemacht. Sie sollen befähigt werden, die Ausgangslagen<br />
in konkreten Hilfesituationen zu definieren, die im Einzelfall nötige Hilfe zu planen<br />
und den Verlauf eines Hilfeprozesses methodisch zu strukturieren und zu begleiten.<br />
Betriebswirtschaftslehre<br />
Das Interessenfeld der Betriebswirtschaftslehre sind die einzelnen Wirtschaftseinheiten<br />
„Betrieb“ bzw. „Unternehmung“, deren Strukturen und Prozesse. Die Betriebswirtschaftslehre<br />
gliedert sich als wissenschaftliche Disziplin traditionell in die „Allgemeine<br />
Betriebswirtschaftslehre“ und in die „Speziellen Betriebswirtschaftslehre“.<br />
Die „Allgemeine Betriebswirtschaftslehre“ beschränkt sich auf die Untersuchung von<br />
wirtschaftlichen Tatbeständen, die für alle Betriebe bzw. Unternehmen gleichermaßen<br />
Gültigkeit haben. Als betriebliche Hauptfunktionen sind die Bereiche Beschaffung,<br />
Produktion, Absatz sowie Finanzierung und Investition zu nennen.<br />
Die „Allgemeine Betriebswirtschaftslehre“ ist damit das Fundament, auf dem die<br />
„Spezielle Betriebswirtschaftslehre“ der Sozialwirtschaft aufbaut. Von übergeordneter<br />
Bedeutung sind dabei Fragen der Unternehmensführung mit den Bereichen Personal,<br />
Organisation, Planung und Kontrolle.<br />
Um für verantwortungsvolle Tätigkeiten in Sozialwirtschaftlichen Dienstleistungsunternehmen<br />
zu qualifizieren, werden im Rahmen der Betriebswirtschaftslehre folgende<br />
Fachgebiete schwerpunktmäßig vermittelt:<br />
• Fundierte Fachkenntnisse im Rechnungswesen (Buchführung, Bilanzierung,<br />
Bilanzpolitik und Bilanzanalyse)<br />
• Anwendungsorientierte Betriebswirtschaftslehre (Kostenrechnung, Finanzierung,<br />
Investitionsrechnung, Marketing, Organisation, Controlling)<br />
• Grundlagen des Steuerrechts<br />
• Konzepte und Methoden modernen Managements.<br />
26
Studieninhalte SOZIALWIRTSCHAFT<br />
Volkswirtschaftslehre<br />
Die klassische Volkswirtschaftslehre untergliedert sich in drei Teilgebiete, die aufeinander<br />
aufbauen. Zunächst untersucht die „Mikroökonomie“ das Verhalten der einzelnen<br />
Wirtschaftssubjekte (Haushalte und Unternehmen) unter bestimmten Rahmenbedingungen.<br />
Aufbauend auf diesen Aussagen widmet sich die „Makroökonomie“<br />
der Gesamtheit wirtschaftlicher Gruppen. Dabei wird untersucht, wie sich Entscheidungen<br />
von Unternehmen, Haushalten und Staat in ihrer Gesamtheit auf eine<br />
Volkswirtschaft auswirken.<br />
Das dritte Teilgebiet der Volkswirtschaftslehre ist die „Wirtschaftspolitik“. Sie kann als<br />
angewandte Mikro- und Makroökoomie definiert werden. Die Wirtschaftspolitik untersucht<br />
die Anforderungen an die wirtschaftliche Tätigkeit des Staates und deren mögliche<br />
Folgen, wie z. B. in der Finanz- und Sozialpolitik.<br />
Recht<br />
Das Recht bildet die Grundlage, an der sich zahlreiche sozialwirtschaftliche Aufgabenstellungen<br />
zu orientieren haben. Auf diese Weise lernen die Studierenden, Sachverhalte<br />
aus der Sichtweise des Juristen zu erfassen, in rechtliche Kategorien zu<br />
übertragen und mit gesetzlichen Bestimmungen zu arbeiten. Die Studierenden erfahren,<br />
dass Recht den Handlungsauftrag für sozialwirtschaftliche Arbeit festlegt und<br />
teilweise Grenzen definiert. Sie lernen, mit „Rechtskodifikationen“ und der rechtlichen<br />
„Subsumtionstechnik“ umzugehen (Orientierungswissen für den Umfang mit<br />
umfassenden Gesetzeswerken; Fähigkeit, abstrakte Normen auf konkrete Sachverhalte<br />
beziehen zu können).<br />
Psychologie<br />
Ein wesentliches Merkmal Sozialwirtschaftlicher Dienstleistungsunternehmen ist die<br />
Beschäftigung mit Menschen als MitarbeiterInnen sowie als Klienten/Kunden. Die<br />
Psychologie hilft uns, das Verhalten von Menschen zu verstehen, zu erklären und<br />
unter Umständen auch zu beeinflussen. Psychologie ist für die Sozialwirtschaft von<br />
grundlegender Bedeutung, da ohne genaue Kenntnis der funktionalen Zusammenhänge,<br />
die menschliches Verhalten bestimmen, es unmöglich ist, Menschen dazu zu<br />
verhelfen, ihr Erleben und Verhalten in einer für sie selbst und ihre Mitmenschen<br />
sinnvollen Weise zu steuern.<br />
Soziologie<br />
Die Studierenden sollen einen Einblick in soziologische Fragestellungen, Begriffe<br />
und Theorien gewinnen. Ihnen soll die Fähigkeit vermittelt werden, Situationen sozialwirtschaftlichen<br />
Handelns unter soziologischen Gesichtspunkten zu reflektieren. So<br />
werden Erkenntnisse über die Struktur, die Funktionen und Probleme der Familie in<br />
der modernen Gesellschaft gewonnen (Familiensoziologie). Ebenfalls wird das Lebensalter<br />
als eine der Grunddimensionen sozialer Strukturbildung und Ordnung thematisiert<br />
(Soziologie der Lebensalter).<br />
27
Studieninhalte SOZIALWIRTSCHAFT<br />
Die Studierenden lernen die Zusammenhänge zwischen sozialen Normierungen/Typisierungen/Sanktionierungen<br />
und abweichendem Verhalten verstehen (Soziologie<br />
abweichenden Verhaltens).<br />
Philosophie<br />
Die Studierenden sollen Grundbegriffe und Strukturen wissenschaftlicher Erkenntnisse<br />
kennen lernen und sich insbesondere mit der Bedeutung von Theorien für das<br />
praktische Handeln befassen. Im Mittelpunkt steht hierbei die „Ethik“. Es wird ein<br />
Überblick über ethisches Denken in der philosophischen Tradition gegeben. Die Studierenden<br />
lernen, ihre eigenen moralischen Überzeugungen weltanschaulich zu verorten,<br />
ethisch zu reflektieren und sie auf ihre berufliche Praxis zu beziehen. Ein besonderer<br />
Stellenwert kommt hierbei der Unternehmensethik zu.<br />
Sozialmedizin/Gesundheitswissenschaft<br />
Entsprechend ihrem Arbeitsfeld bzw. ihren Neigungen haben die Studierenden die<br />
Möglichkeit, in Wahlseminaren die sozialmedizinischen Grundlagen der einzelnen<br />
Arbeitsfelder zu erkennen.<br />
Die Studierenden können Grundkenntnisse über geistige und körperliche sowie über<br />
Mehrfachbehinderungen erwerben. Sie können die Möglichkeiten der medizinischen<br />
und sozialen Rehabilitation kennen lernen. Durch diese Kenntnisse werden sie Sicherheit<br />
im Umgang mit behinderten Menschen und ihren Angehörigen (Lehrveranstaltung<br />
„Behinderung und Rehabilitation“) erhalten.<br />
Die Studierenden können daneben Grundkenntnisse von verschiedenen Krankheitsbildern<br />
im Bereich des Erlebens und Verhaltens erwerben. Sie lernen verschiedene<br />
therapeutische Methoden kennen und sie machen sich mit dem angemessenen Umgang<br />
mit psychisch kranken Menschen vertraut (Lehrveranstaltung „Psychische Erkrankungen<br />
und Rehabilitation“).<br />
Insbesondere für Studierende, die im Bereich der Altenhilfe tätig sind, wird die Lehrveranstaltung<br />
„Alter und Rehabilitation“ angeboten. Darin werden u. a. Grundkenntnisse<br />
über Krankheitsformen und -verläufe im Alter vermittelt.<br />
Informatik<br />
Es werden sämtliche Grundkenntnisse vermittelt, die im beruflichen Arbeitsalltag<br />
notwendig sind. Ebenfalls werden Lehrveranstaltungen angeboten, in denen die Anwendungsorientierung<br />
der EDV im Vordergrund steht.<br />
Vertiefungsrichtung/Arbeitsfeld<br />
Daneben werden Lehrveranstaltungen speziell für das Arbeitsfeld (= Vertiefungsrichtung),<br />
das durch die Wahl des Ausbildungsbetriebes bestimmt wird, angeboten.<br />
Hierdurch können im Arbeitsfeld Spezialkenntnisse erworben und die spezifischen<br />
Bedürfnisse der Ausbildungsbetriebe berücksichtigt werden.<br />
28
Studieninhalte SOZIALWIRTSCHAFT<br />
8. Die Vertiefungen<br />
Die Studierenden der Sozialwirtschaft belegen bei 88 % (= 1604 Präsenzstunden)<br />
aller Lehrveranstaltungen (in Höhe von insgesamt 1823 Stunden) die gleichen Angebote.<br />
Damit werden -unabhängig vom Arbeitsfeld des Ausbildungsbetriebes- einheitliche<br />
sozialwirtschaftliche Fachkenntnisse vermittelt. Diese Ausbildung ermöglicht<br />
es den Absolventinnen und Absolventen, in allen Arbeitsfeldern der Sozialwirtschaft<br />
tätig sein zu können.<br />
Aktuell bestehen die Vertiefungen Altenhilfe, Behindertenhilfe, Klinikmanagement<br />
und Öffentliche Sozialverwaltung (Sozialamt, Jugendamt, Job Center). Weitere Vertiefungen<br />
sind entsprechend dem Bedarf geplant. Studierende, die keinem dieser<br />
Arbeitsfelder angehören, können sich ein Arbeitsfeld auswählen.<br />
Für die spezifischen Lehrangebote in den Vertiefungen sind insgesamt 219 Stunden<br />
(= 12 % aller Präsenzstunden) vorgesehen. Die 219 Stunden können unterteilt werden<br />
in<br />
• Theorie-Praxis-Seminare (12 Stunden pro Theoriephase) = 72 Stunden<br />
• Wahlpflichtseminare in den einzelnen Modulen = 147 Stunden.<br />
In den Theorie-Praxis-Seminaren wird neben den Grundlagen der jeweiligen Arbeitsfelder<br />
insbesondere eine enge Verzahnung zwischen Theorie und Praxis bzw. Praxis<br />
und Theorie angestrebt.<br />
Beispiele für Lehrangebote in den Wahlpflichtseminaren sind:<br />
Einführung in medizinische Grundlagen und in die Pflegewissenschaften, Behindertenpädagogik,<br />
Vertiefungen in SGB II, SGB V und VI, SGB VIII, SGB IX, SGB XII,<br />
Heimrecht, Betreuungsrecht, BGB-Vertiefung, Investition und Finanzierung - Vertiefung,<br />
Besonderheiten des Arbeitsfeldes im Rechnungswesen, der Kosten- und Leistungsrechnung,<br />
der Bilanzierung und der Finanzierung, Supervision, Europäisches<br />
Sozialrecht, Einführung in die Steuerlehre, Strafrecht usw.<br />
29
Studieninhalte SOZIALWIRTSCHAFT<br />
9. Praxisphasen in den Ausbildungseinrichtungen<br />
Vermittlung sozialwirtschaftlicher Praxisinhalte<br />
Sozialwirtschaft ist eine Synthese aus Sozialer Arbeit und Betriebswirtschaft.<br />
Dies muss auch in der praktischen Ausbildung zum Ausdruck kommen.<br />
Soweit und wo immer dies möglich ist, sollten die Studierenden daher von Beginn<br />
ihrer praktischen Ausbildung an mit Aufgaben- und Problemstellungen konfrontiert<br />
werden, die eine integrierte Denk- und Handlungsweise erfordern. Damit wird einem<br />
ganzheitlichen Ansatz und dem Selbstverständnis der Sozialwirtschaft als einer interdisziplinären<br />
Wissenschaft Rechnung getragen.<br />
Wichtig wird es hierbei sein, dass die Studierenden das sozialpädagogische Arbeitsfeld<br />
intensiv kennenlernen, da die Sozialwirtschaft davon ausgeht, dass fundierte<br />
Entscheidungen über soziale Sachverhalte nur in genauer Kenntnis des sozialen<br />
Aufgabenfeldes getroffen werden können.<br />
Dies setzt voraus, dass die Studierenden praktische Erfahrungen im Umgang mit<br />
dem Klientel machen bzw. (evtl. bereits vor Beginn der Ausbildung) gemacht haben.<br />
Sie sollen einen fachlich kompetenten und vertieften Einblick in die Lebenswelt des<br />
Klientels erhalten und die Anwendung sozialpädagogischer Methoden kennen lernen.<br />
Ebenfalls sollen die Studierenden in den betriebswirtschaftlichen und kaufmännischen<br />
Bereichen ihrer Ausbildungsstätten eingesetzt werden, um die in der Theorie<br />
vermittelten Lehrinhalte in der Praxis umzusetzen und zu erweitern. Hierbei sollen<br />
sie insbesondere mit Aufgabenstellungen konfrontiert werden, in denen soziale und<br />
wirtschaftliche Anforderungen aufeinander treffen.<br />
Rahmenplan für das angeleitete Studium in der Praxis<br />
Der Rahmenplan vermittelt Grundinhalte, die in den Ausbildungsplänen der Studienschwerpunkte<br />
wiederkehren, er dient als Orientierungshilfe und als Basis für den individuellen<br />
Praxisplan der Studierenden.<br />
Grundsätzlich muss dem Studierenden eine Anleitung zugeordnet werden, die für<br />
den Studierenden die Gesamtorganisation der Ausbildung übernimmt und als Bindeglied<br />
zur Dualen Hochschule fungiert.<br />
Die Anleitung kann die Aufgabe der konkreten Betreuung und Anleitung in einzelnen<br />
Praxisphasen an weitere (Unter-) Anleitungen delegieren. Grundsätzlich muss zu<br />
Beginn und zum Ende jeder Praxisphase ein Anleitungsgespräch geführt werden.<br />
Daneben wird empfohlen, zur Hälfte einer Praxisphase (bei Bedarf) ein weiteres Anleitungsgespräch<br />
zu vereinbaren. Zu Beginn einer Praxisphase ist die konkrete Planung<br />
der Praxisphase zu besprechen, Erwartungshaltungen sind zu klären. Am Ende<br />
der Praxisphase hat eine Evaluation der Anleitung, der Inhalte sowie der Arbeit des<br />
Studierenden zu erfolgen. Ebenfalls soll die nächste Praxisphase in groben Inhalten<br />
festgelegt werden.<br />
Ziel der Ausbildung muss es sein, dass die Studierenden – nachdem sie zu Beginn<br />
ihrer Ausbildung weitgehend unter Anleitung arbeiten – im Laufe der Ausbildung bei<br />
wachsender fachlicher und persönlicher Eigenkompetenz immer eigenverantwortlicher<br />
und selbständiger Aufgaben übernehmen können.<br />
30
Ausbildungsplan: 1. Praxisphase<br />
Praktische Ausbildung<br />
Kennen lernen des Unternehmens<br />
Kennen lernen der Klienten<br />
Kontakt zu Klienten<br />
(teilnehmende Beobachtung)<br />
Einführung in den praktischen Umgang mit Klienten<br />
(Erläuterung des sozialpädagogischen Handelns)<br />
Kennen lernen der Mitarbeiter und ihrer<br />
Funktionen (Zuständigkeiten)<br />
Kennen lernen des betrieblichen<br />
Rechnungswesens<br />
Ausführung von Buchungsvorgängen<br />
Ausbildungsplan: 2. Praxisphase<br />
Einübung in die Soziale Arbeit im Praxisfeld<br />
Einüben in die Methoden der Sozialen Arbeit<br />
- selbständige Erfüllung einfacher Aufgaben<br />
- Einführung in schwierige Aufgaben unter<br />
Anleitung<br />
Die Kosten- und Leistungsrechnung im<br />
Unternehmen<br />
Einüben der KLR in der Praxis<br />
31<br />
Praxisbegleitende Information u. Reflexion<br />
- Leitbild, Unternehmenskultur, Ziele,<br />
Geschichte<br />
- Organisationsstrukturen (Organigramm,<br />
Geschäftsverteilungen, Dienstanweisungen,<br />
Arbeitszeitregelungen)<br />
- Finanzierungsstrukturen<br />
- Gesetzlicher Handlungsauftrag<br />
- Informationen über besondere Merkmale<br />
der Klienten<br />
- Grundsätze für den Umgang mit Klienten<br />
- rechtliche Grundlagen und<br />
Dienstvorschriften (z. B. Hausordnung,<br />
Schweigepflicht, interne Dienst-<br />
Anweisungen), inhaltliche Zielsetzungen<br />
konzeptionelle Vorgaben<br />
- Vertraut werden mit beruflichen Alltagshandlungen<br />
- Informationen über die Professionen, die<br />
im Unternehmen tätig sind (z. B. Betriebswirte,<br />
Verwaltungswirte, Sozialpädagogen, Pflegefachkräfte<br />
usw.) und deren Aufgaben<br />
- Erläuterungen und Verordnungen, Vorschriften<br />
usw.<br />
- Erläuterung der angewandten Methoden der<br />
Sozialen Arbeit<br />
- Information und Reflexion der Handlungsvollzüge<br />
- Reflexion der Arbeit und der Stellung des Studierenden<br />
im Unternehmen sowie der Ausbildung<br />
- Ergänzende Informationen zur KLR
Ausbildungsplan: 3. Praxisphase<br />
Praktische Ausbildung<br />
Die Finanzierung des Unternehmens<br />
nach Möglichkeit: Teilnahme an Pflegesatzverhandlungen<br />
Das Qualitätsmanagement<br />
Mitarbeit beim QM-Beauftragten<br />
Die Organisation des Unternehmens<br />
Übernahme einer organisatorischen Aufgabenstellung<br />
Ausbildungsplan: 4. u. 5. Praxisphase<br />
Die Personalwirtschaft<br />
Prozesshaftes Einbeziehen in das<br />
Personalwesen<br />
Personalbedarfsplanung, Stellenausschreibung,<br />
Personalauswahl, Abschluss eines Arbeitsvertrages,<br />
Vergütung/Lohn<br />
Das Marketing<br />
Analyse der Kommunikations- und/oder Distributionspolitik<br />
des Unternehmens und/oder<br />
Fundraising und social sponsoring im Unternehmen<br />
Die pädagogische Konzeption des<br />
Unternehmens<br />
Der Jahresabschluss<br />
nach Möglichkeit: Beteiligung bei der Aufstellung<br />
des Jahresabschlusses bzw. des Haushaltsplanes<br />
Ausbildungsplan: 6. Praxisphase<br />
Führungsaufgaben im Unternehmen<br />
- Mitarbeit im Controlling<br />
- Assistenz der Unternehmensleitung<br />
oder Bereichsleitung<br />
32<br />
Praxisbegleitende Information und Reflexion<br />
- detaillierte Information über die Finanzierung<br />
des Unternehmens<br />
a) Finanzierung des laufenden Betriebs<br />
b) Investitionsfinanzierung<br />
- Information über das betriebliche QM-System<br />
- detaillierte Information über die Aufbau- und<br />
die Ablauforganisation<br />
- Erläuterung der Bedeutung der Personalwirtschaft<br />
im Unternehmen, aktuelle personalwirtschaftliche<br />
Aufgaben- und Problemstellungen,<br />
personalwirtschaftliche Konzeption<br />
- Vorstellung der Marketing-Konzeption<br />
- Information über die pädagogische Konzeption<br />
und (damit verbunden) Analyse der baulichen<br />
Konzeption<br />
- Information über die Bilanz und die Gewinn-<br />
und Verlustrechnung des Unternehmens bzw.<br />
die Haushaltsplanung<br />
- Information über Führungsaufgaben und den<br />
Alltag
10. Eignung von Ausbildungseinrichtungen<br />
Die Grundsätze für die Eignung von Ausbildungsstätten der Dualen Hochschule Baden-Württemberg<br />
sagen im Wesentlichen aus, dass<br />
• die in den Ausbildungsplänen des jeweiligen Studiengangs vorgeschriebenen<br />
Ausbildungsinhalte vermittelt werden müssen,<br />
• geeignetes Ausbildungspersonal vorhanden sein muss,<br />
• anhand des Ausbildungsplans ein konkreter Einsatzplan aufzustellen ist,<br />
• die Ausbildung planmäßig und vollständig durchgeführt werden muss.<br />
Der Ausbildungsvertrag regelt unter anderem die Ausbildungszeit, die Pflichten des<br />
Anstellungsträgers und des/der Auszubildenden sowie die Ausbildungsvergütung.<br />
Für letztere gelten die tariflichen Vergütungsregeln für Auszubildende in den jeweiligen<br />
Tarifbereichen. Im Studiengang Sozialwirtschaft sind mindestens die Vergütungen<br />
des Manteltarifvertrags für Auszubildende bei Bund und Ländern zugrunde zu<br />
legen. Soweit tarifliche Regelungen nicht bestehen, können im Einzelfall monatliche<br />
Ausbildungsvergütungen in Höhe von mindestens 70 % der Vergütungssätze des<br />
Ausbildungstarifvertrags für Auszubildende bei Bund und Ländern vereinbart werden<br />
(Beschluss des Kuratoriums der Berufsakademie Baden-Württemberg vom 12. April<br />
1989).<br />
Das Land Baden-Württemberg legt Mindestvergütungssätze fest. Diese sind auf der<br />
Homepage der Dualen Hochschule Baden-Württemberg <strong>Villingen</strong>-<strong>Schwenningen</strong><br />
veröffentlicht.<br />
www.dhbw-vs.de<br />
33
Partner der Dualen Hochschule<br />
Baden-Württemberg<br />
<strong>Villingen</strong>-<strong>Schwenningen</strong> e. V.<br />
Die Duale Hochschule Baden-Württemberg <strong>Villingen</strong>-<strong>Schwenningen</strong> ist in vielfältiger Weise auf die Unterstützung<br />
durch ihre Partner angewiesen. Hierfür wurde im Jahr 1983 der gemeinnützige Verein Partner<br />
der Dualen Hochschule Baden-Württemberg <strong>Villingen</strong>-<strong>Schwenningen</strong> e. V. („Partnerverein“) gegründet,<br />
der derzeit ca. 900 Mitglieder zählt.<br />
Werden auch Sie Mitglied in unserem Förderverein!<br />
Der Jahresbeitrag für Unternehmen/Institutionen beträgt derzeit 75,00 €, für natürliche Personen 15,00 €.<br />
Wir freuen uns selbstverständlich auch über eine Einzelspende, für die Sie umgehend eine Spendenbescheinigung<br />
erhalten.<br />
Der Partnerverein ist eine gemeinnützige Institution, in der sich<br />
• die Ausbildungsstätten,<br />
• Lehrbeauftragte und Professoren der Dualen Hochschule Baden-Württemberg<br />
<strong>Villingen</strong>-<strong>Schwenningen</strong>,<br />
• Absolventen und Studierende und<br />
• Freunde der Dualen Hochschule Baden-Württemberg <strong>Villingen</strong>-<strong>Schwenningen</strong><br />
engagieren, insbesondere um<br />
• für die Idee der Dualen Hochschule Baden-Württemberg <strong>Villingen</strong>-<strong>Schwenningen</strong> zu werben,<br />
• die Verbundenheit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg <strong>Villingen</strong>-<strong>Schwenningen</strong> mit ihren ehemaligen<br />
Studierenden, mit Dozenten, Freunden und Förderern zu pflegen,<br />
• die Lehrtätigkeit an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg <strong>Villingen</strong>-<strong>Schwenningen</strong>, ihre Studierenden<br />
und Absolventen zu fördern,<br />
• Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zu organisieren und durchzuführen,<br />
• Studierenden einen Auslandsaufenthalt zu ermöglichen.<br />
Als Mitglied des Partnervereins<br />
• werden Sie zu allen Campus Abenden (Vorträge über aktuelle Themen) eingeladen.<br />
Die Teilnahme ist kostenlos.<br />
• erhalten Sie Einladungen zu Veranstaltungen des Partnervereins.<br />
• erhalten Sie den quartalsweise erscheinenden „Blickpunkt“, um sich immer über die aktuellen Entwicklungen<br />
an Ihrer Dualen Hochschule Baden-Württemberg <strong>Villingen</strong>-<strong>Schwenningen</strong> auf dem Laufenden<br />
zu halten.<br />
• unterstützen Sie mit Ihrem Beitrag die aktuellen Studierenden und finanzieren Anschaffungen, die<br />
sonst nicht getätigt werden könnten.<br />
• halten Sie Kontakt zu uns und das ist uns wichtig.<br />
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann füllen Sie bitte den umseitigen Mitgliedsantrag aus und senden<br />
uns diesen zu. Für Fragen steht Ihnen selbstverständlich auch der Geschäftsführer des Vereins, Prof.<br />
Dr. Wolfgang Hirschberger, Tel. 07720 3906-140, E-Mail: wolfgang.hirschberger@dhbw-vs.de, gerne zur<br />
Verfügung. Weitere Informationen (z. B. die Satzung des Vereins) erhalten Sie unter<br />
www.dh-vs-partnerverein.de.<br />
34
-<br />
Partner der Dualen Hochschule<br />
Baden-Württemberg<br />
<strong>Villingen</strong>-<strong>Schwenningen</strong> e. V.<br />
Partner der Dualen Hochschule<br />
Baden-Württemberg<br />
<strong>Villingen</strong>-<strong>Schwenningen</strong> e. V. Fax-Nr. 07720 3906-119<br />
Friedrich-Ebert-Straße 30<br />
78054 <strong>Villingen</strong>-<strong>Schwenningen</strong><br />
<strong>Aufnahmeantrag</strong><br />
Natürliche Person<br />
Unternehmen / Institution<br />
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Verein Partner der Dualen Hochschule Baden-Württemberg<br />
<strong>Villingen</strong>-<strong>Schwenningen</strong> e. V. Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten zum Zwecke<br />
der Mitgliederverwaltung und des Beitragseinzuges elektronisch gespeichert werden.<br />
Name<br />
Unternehmen/Institution:<br />
Straße<br />
Telefon<br />
Für Absolventen der <strong>DHBW</strong> VS bzw. BA VS<br />
Studiengang<br />
Datum<br />
Abbuchungsermächtigung<br />
Vorname<br />
PLZ<br />
E-Mail<br />
Unterschrift<br />
35<br />
Ort<br />
geb. am<br />
Studienbeginn (Jahr)<br />
Ich ermächtige den Partner der Dualen Hochschule Baden-Württemberg <strong>Villingen</strong>-<strong>Schwenningen</strong> e. V.<br />
jederzeit widerruflich den Jahresbeitrag von meinem u. a. Konto abzubuchen.<br />
Kontonummer<br />
Bank/Spk.<br />
Datum<br />
BLZ<br />
Unterschrift