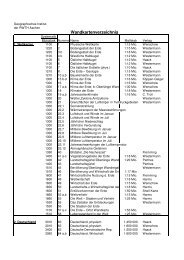Angewandte Geographie - Geographisches Institut der RWTH Aachen
Angewandte Geographie - Geographisches Institut der RWTH Aachen
Angewandte Geographie - Geographisches Institut der RWTH Aachen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
MODULHANDBUCH<br />
M.Sc.-Studiengang<br />
„<strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong>“<br />
<strong>Geographisches</strong> <strong>Institut</strong><br />
Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik<br />
Stand: 29. Mai 2008
Inhaltsverzeichnis<br />
I. Pflichtbereich <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> 3<br />
II. Wahlpflichtbereich <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> 6<br />
III. Wahlpflichtbereich Wirtschaftsgeographie im M.Sc.<br />
<strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> 11<br />
IV. Nebenfächer 15<br />
Abfallwirtschaft und Umwelttechnik 15<br />
Biologie 19<br />
Geologie I 21<br />
Geologie II 24<br />
Informatik 29<br />
Mathematik 36<br />
Rohstoffversorgung von Industrielän<strong>der</strong>n 42<br />
Siedlungswasser- und Siedlungsabfallwirtschaft I 46<br />
Siedlungswasser- und Siedlungsabfallwirtschaft II 54<br />
Stadtplanung 61<br />
Verkehrswesen und Raumplanung I 65<br />
Verkehrswesen und Raumplanung II 71<br />
Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsgeschichte 78<br />
<strong>Geographie</strong> (für 2-Fach B.A.) 81<br />
V. Wahlpflichtbereich Vertiefung 84<br />
Fernerkundung 84<br />
Geodäsie 85<br />
Management von Altlasten 87<br />
Qualitäts- und Wassermanagementsysteme 89<br />
Rechtswissenschaften 90<br />
Ressourcengeologie 91<br />
Spezielle Geoökologie: Boden und Wasser 93<br />
Umweltbiologie 95<br />
Umweltgeochemie 97<br />
Umweltmanagement 98<br />
Verwaltungsrecht und kommunales Management 100<br />
Wirtschaftswissenschaften (BWL) 101
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />
I. Pflichtbereich <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />
Geographische Methoden 3<br />
Modulbeauftragte: Prof. Dr. Chr. Schnei<strong>der</strong><br />
Dozenten: Wieger, Schnei<strong>der</strong>, weitere Mitarbeiter des Geographischen <strong>Institut</strong>s<br />
Studiengänge<br />
Angebot (Turnus) Dauer Studienjahr<br />
M.Sc.-Studiengang <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />
MSc-Studiengang Wirtschaftsgeographie<br />
jährlich<br />
1-2 Semester 1. Studienjahr<br />
Kategorie Erläuterung<br />
Veranstaltungen und a) Vorlesung/Übung: Geostatistik II<br />
Lehrformen<br />
b) Übung: GIS Vertiefung<br />
c) Übung: Karteninterpretation<br />
Voraussetzungen keine<br />
Lern-/<br />
a) Vorlesung/Übung Geostatistik II: Die Studierenden sollen spezielle statistische<br />
Qualifikationsziele Instrumentarien für quantitative Raumanalysen kennen lernen, <strong>der</strong>en Einsatz einen<br />
größeren Aufwand erfor<strong>der</strong>t als die einfachen, in den Grundkursen für Statistik behandelten<br />
Verfahren.<br />
b) Übung GIS Vertiefung: Es werden die Kenntnisse über GIS-Arbeitstechniken vertieft.<br />
Die Studierenden sollen in die Lage versetzt werden, komplexe digitale<br />
Raumanalysewerkzeuge einzusetzen.<br />
c) Übung Karteninterpretation: Die Studierenden erlernen die Technik <strong>der</strong> Interpretation<br />
geographischer Medien auf <strong>der</strong> Basis topographischer und thematischer Karten<br />
Deutschlands, Mitteleuropas und außereuropäischer Beispielräume. Dabei werden<br />
vor allem kulturgeographische, wirtschaftsgeographische und physisch-<br />
Inhalte<br />
geographische Inhalte zur regionalen <strong>Geographie</strong> Mitteleuropas vermittelt.<br />
a) Vorlesung/Übung Geostatistik II: komplexe statistische Analysen<br />
(exemplarisch) Literatur:<br />
BAHRENBERG & GIESE (1992): Statistische Methoden in <strong>der</strong> <strong>Geographie</strong> 2.<br />
VON STORCH & W. ZWIERS (1999): Statistical Analysis in Climate Research<br />
GRIFFITH & AMRHEIN (1997): Multivariate Statistical Analysis for Geographers<br />
b) Übung GIS Vertiefung: Vertiefen von GIS-Arbeitstechniken insbeson<strong>der</strong>e in Bezug<br />
auf Rasterdatenanalyse (Spatial-Analyst-Prozesse) und Netzwerkanalysen, Bearbeiten<br />
von Fernerkundungsdaten mit GIS-Werkzeugen<br />
Literatur:<br />
MACH, R. (2006): Visualisierung digitaler Gelände- und Landschaftsdaten. Berlin,<br />
Springer Verlag.<br />
HEYWOOD, I., CORNELIUS, S. & CARVER, S. (2006): An Introdution to Geographical Information<br />
Systems. Harlow, Pearson Education Ltd.<br />
c) Übung Karteninterpretation: Methoden <strong>der</strong> Karteninterpretation auf verschiedenen<br />
Maßstäben und aus verschiedenen Landschaften Deutschlands, Mitteleuropas sowie<br />
von Landschaftsräumen Außereuropas.<br />
<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 3
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />
Gruppengröße a) 40 b) 20 c) 20<br />
Kontaktzeit<br />
a) 30 h b) 30 h c) 30 h<br />
Summe: 90 h<br />
Selbststudium a) 90 h b) 60 h c) 30 h<br />
Summe: 180 h<br />
CP<br />
a) 4 b) 3 c) 2<br />
Kreditpunkte: 9 CP<br />
Voraussetzung für die a) Klausur (60 Minuten), die Zulassung zur Klausur erfolgt vorbehaltlich <strong>der</strong> regelmäßi-<br />
Vergabe von CP<br />
gen und erfolgreichen Bearbeitung von Übungsaufgaben<br />
b) Hausarbeit (Projektarbeit mit 4 Wochen Bearbeitungszeit), die Zulassung zur Teilmodulprüfung<br />
erfolgt vorbehaltlich <strong>der</strong> regelmäßigen Teilnahme an <strong>der</strong> Übung sowie<br />
<strong>der</strong> erfolgreichen Bearbeitung von Übungsaufgaben.<br />
c) Klausur (60 Minuten)<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet<br />
Regionale <strong>Geographie</strong> 2<br />
Modulbeauftragte: Prof. C. Pfaffenbach<br />
Dozenten: (Ggf. zusätzlich hauptamtlich Lehrende)<br />
Studiengänge<br />
Angebot (Turnus) Dauer<br />
M.Sc.-Studiengang <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />
M.Sc.-Studiengang Wirtschaftsgeographie<br />
jährlich<br />
1 Semester<br />
Kategorie Erläuterung<br />
Veranstaltungen und a) Großes Regionalpraktikum (Geo/WiGeo nach Wahl) (7 Tage)<br />
Lehrformen<br />
b) Regionalseminar<br />
Voraussetzungen keine<br />
Lern- /<br />
Qualifikationsziele<br />
Inhalte<br />
(exemplarisch)<br />
Studienjahr<br />
1. Studienjahr (SS)<br />
Ziel des Moduls ist es, die Studierenden an Hand eines Beispielraumes in die Arbeitsweisen<br />
und Bearbeitungsmethoden in <strong>der</strong> Regionalen <strong>Geographie</strong> unter stadtund<br />
/ o<strong>der</strong> physisch-geographischen Aspekten einzuführen. Nach Abschluss dieses<br />
Moduls sollen die Studierenden die Fähigkeit erworben haben, regionalwissenschaftliche<br />
Fragestellungen entsprechend <strong>der</strong> gewählten Vertiefungsmöglichkeit selbstständig<br />
unter Anwendung geeigneter Recherchetechniken (z. B. Recherche in Archiven, Regionalbibliotheken,<br />
Kartenstudium, Befragung) in einem für sie fremden Raum zu bearbeiten.<br />
Exkursion und Exkursionsseminar bilden dabei eine Einheit. Sie haben einen Teilraum<br />
innerhalb o<strong>der</strong> außerhalb Europas zum Thema, wobei im Blickpunkt Fragestellungen<br />
aus <strong>der</strong> gewählten Vertiefungsrichtung stehen. Im Seminar werden i. d. R. allgemeine<br />
Rahmenbedingungen des Raumes erarbeitet, während die Exkursion diese exemplarisch<br />
und am Anschauungsbeispiel vertieft. Das Exkursionsseminar o<strong>der</strong> Teile davon<br />
können in die Exkursion integriert werden, so dass je nach Gewichtung für die Bearbeitung<br />
im Gelände ein Zeitraum von bis zu 10 Tagen zur Verfügung stehen kann.<br />
a) Großes Regionalpraktikum: Regionalpraktikum mit Geländeanalyse, regionaler<br />
Recherche, Interviews u. ä. in einem je nach gewählter Vertiefungsrichtung nach<br />
physisch-geographischen, kulturgeographischen o<strong>der</strong> wirtschaftsgeographischen<br />
Gesichtspunkten abgegrenzten Raum.<br />
b) Regionalseminar als Grundlage und Vorbereitung zum Großen Regionalpraktikum:<br />
Erarbeitung <strong>der</strong> für das Exkursionsgebiet typischen Raumstrukturen an Hand von<br />
<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 4
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />
Gruppengröße 20<br />
Hausarbeiten und Referaten.<br />
Kontaktzeit<br />
a) 15 h b) 80 h<br />
Summe: 95 h<br />
Selbststudium a) 25 h b) 30 h<br />
Summe: 55 h<br />
CP<br />
a) und b) 5 CP<br />
Kreditpunkte: 5 CP<br />
Voraussetzung für die a) Protokoll: Aufarbeitung und Darstellung <strong>der</strong> Inhalte eines Abschnittes <strong>der</strong> Exkursi-<br />
Vergabe von CP<br />
on, Bearbeitungszeit: 4 Wochen,<br />
b) Hausarbeit (Bearbeitungszeit: 4 Wochen, Gewichtung 50 %) im Umfang von maximal<br />
20 Seiten sowie dazugehörige Präsentation (Referat, Dauer: 20 bis 40 Minuten,<br />
Gewichtung: 50 %) im Exkursionsseminar<br />
zu a) und b): je nach Untersuchungsraum und Seminargröße ist die Bearbeitung in<br />
Kleingruppen von bis zu 3 Studierenden möglich<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 5
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />
II. Wahlpflichtbereich Kern <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />
Landschaftssystemanalyse<br />
Modulbeauftragter: Prof. Dr. F. Lehmkuhl<br />
Dozenten: Prof. Dr. F. Lehmkuhl; Prof. Dr. H. Stanjek<br />
Studiengänge<br />
Angebot (Turnus) Dauer Studienjahr<br />
M.Sc. - Studiengang <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />
M. Sc. - Studiengang Wirtschaftsgeographie<br />
jährlich<br />
2 Semester 1. Studienjahr<br />
Kategorie Erläuterung<br />
Veranstaltungen und a) Vorlesung und Übung: Landschaftsgenese und quartäre Dynamik<br />
Lehrformen<br />
b) Vorlesung und Übung: Prozesse in Böden<br />
c) Gelände- und Laborpraktikum: Relief und Boden<br />
Voraussetzungen keine<br />
Lern-/<br />
Qualifikationsziele<br />
Ziel des Moduls ist es, den Studierenden eine Einführung in die grundlegenden Begriffe,<br />
Konzepte, Arbeitsweisen und Fragestellungen <strong>der</strong> Landschaftssystemanalyse (Relief,<br />
Vegetation, Klima, Hydrologie und Boden) zu vermitteln. Nach Abschluss dieses Moduls<br />
sind die Studierenden in <strong>der</strong> Lage, in unterschiedlichen Landschaftsregionen und auf<br />
verschiedenen Maßstabsebenen aktuelle angewandte Problemstellungen zu identifizieren.<br />
Sie haben die Fähigkeit erworben auf spezielle landschaftsökologische Problemstellungen<br />
hin zielgerichtet eine sinnvolle Beprobungs- und Analysestrategie zu entwickeln,<br />
die erworbenen Daten zu interpretieren und Lösungsvorschläge zu entwerfen.<br />
Inhalte<br />
a) Vorlesung/Übung: Landschaftsgenese und quartäre Dynamik: In <strong>der</strong> Vorlesung<br />
(exemplarisch)<br />
werden die Wirkungen von aktuellen, vorzeitlichen und zukünftigen Klimaverän<strong>der</strong>ungen<br />
im Quartär auf die verschiedenen Komponenten des Systems Landschaft<br />
dargestellt. Im 2. Teil <strong>der</strong> Vorlesung werden die daraus resultierende räumliche<br />
Verbreitung bodenbilden<strong>der</strong> Sedimente und Substrate <strong>der</strong> Erde und ihre Bedeutung<br />
für den wirtschaftenden Menschen abgeleitet.<br />
b) Vorlesung Prozesse in Böden: Ausgehend von den bodenbildenden Faktoren werden<br />
Prozesse <strong>der</strong> Bodengenese und Bodenentwicklung vorgestellt. Ferner werden<br />
physikalische und chemische Eigenschaften von oberflächennahen Substraten und<br />
Böden und ihre Bedeutung für die Georessource Boden vermittelt.<br />
c) Gelände und Laborpraktikum (Relief und Boden): Eine Vertiefung in die digitale<br />
Reliefanalyse ermöglicht die Darstellung <strong>der</strong> wechselseitigen Abhängigkeiten Relief<br />
– Sediment – Boden. Eine Verifizierung dieser Daten erfolgt im Gelände und Labor.<br />
Des weiteren werden anhand unterschiedlicher Bodentypen im Gelände die Bodenprofilansprache<br />
erlernt sowie die zielgerichtete Beprobung diskutiert und durchgeführt.<br />
Im Labor werden bodenkundliche Standardparameter analysiert und verschiedene<br />
Methoden für unterschiedliche Probentypen und Fragestellungen hinsichtlich<br />
Fehlerquellen und Anwendbarkeit verglichen.<br />
Gruppengröße a) und b) 50 c) 12<br />
Kontaktzeit<br />
a) 30 h b) 30 h c) 30 h<br />
Summe : 90 h<br />
Selbststudium a) 60 h b) 60 h c) 60 h<br />
Summe: 180 h<br />
CP<br />
a) 3 b) 3 c) 3<br />
CP: 9 CP<br />
Voraussetzung für die a) Klausur (60 Minuten) o<strong>der</strong> mündliche Prüfung (15 min)<br />
<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 6
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />
Vergabe von CP b) Klausur (45 Minuten)<br />
c) Protokoll (Bearbeitungszeit 4 Wochen) zum Geländepraktikum, Praktikumsbericht von<br />
ca. 20 Seiten je Gruppe (50%), Bewertung <strong>der</strong> praktischen Arbeit im Labor (50%)<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
<strong>Angewandte</strong> Klimatologie und Hydrologie<br />
Modulbeauftragter: Prof. Dr. C. Schnei<strong>der</strong><br />
Dozenten: Prof. Dr. C. Schnei<strong>der</strong>, Prof. Dr. H. Nacken, Dr. G. Ketzler<br />
Studiengänge<br />
Angebot (Turnus) Dauer Studienjahr<br />
M.Sc.-Studiengang <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />
M.Sc.-Studiengang Wirtschaftsgeographie<br />
jährlich<br />
1-2 Semester 1. Studienjahr<br />
Kategorie Erläuterung<br />
Veranstaltungen und a) Vorlesung und Übung: Klima <strong>der</strong> bodennahen Luftschicht (WS)<br />
Lehrformen<br />
b) Vorlesung und Übung: Wasserwirtschaft und Hydrologie I (WS)<br />
c) Praktikum Stadt- und Geländeklimatologie (SS)<br />
Voraussetzungen keine<br />
Lern-/<br />
a) Vorlesung Klima <strong>der</strong> bodennahen Luftschicht: Die Vorlesung vermittelt ein grund-<br />
Qualifikationsziele legendes Verständnis <strong>der</strong> Austauschbeziehungen von Impuls, Masse und Energie –<br />
insbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong> Energie- und Strahlungsbilanz - zwischen Atmosphäre und Oberfläche<br />
in Abhängigkeit <strong>der</strong> Schichtung <strong>der</strong> Luft und <strong>der</strong> Bodenbeschaffenheit. Die<br />
Bedeutung dieser Zusammenhänge für Mensch und Landschaft werden herausgearbeitet.<br />
Dabei werden auch regionale und synoptische Aspekte <strong>der</strong> <strong>Angewandte</strong>n<br />
Klimatologie thematisiert.<br />
b) Vorlesung und Übung: Wasserwirtschaft und Hydrologie: Die Studierenden sollen<br />
eine profunde Wissensbasis zu den Prozessabläufen des Wasserkreislaufes (Hydrologie)<br />
erhalten und die Zusammenhänge <strong>der</strong> qualitativen und quantitativen Wasserwirtschaft<br />
anhand von Anwendungsbeispielen erarbeiten. Dabei sollen die Studierenden<br />
lernen, eigenständig konkreten Aufgaben aus <strong>der</strong> Wasserwirtschaft zu lösen<br />
und ihr erarbeitetes Wissen im Rahmen des self-assement fortlaufend überprüfen.<br />
c) Praktikum Stadt- und Geländeklimatologie: Erarbeitung und Einübung spezieller Untersuchungsmethoden<br />
und Analysewerkzeuge für den Zustand <strong>der</strong> bodennahen Luft<br />
und die Energie- und Strahlungsbilanz <strong>der</strong> Grenzschicht im Zusammenhang mit angewandten<br />
Fragestellungen <strong>der</strong> Stadt- und Geländeklimatologie.<br />
Inhalte<br />
a) Vorlesung Klima <strong>der</strong> bodennahen Luftschicht:<br />
(exemplarisch) • Energie- und Strahlungsbilanz an natürlichen und künstlichen Oberflächen<br />
• Messung und Parametrisierung von Energieflussgrößen <strong>der</strong> bodennahen Luft,<br />
• Massenaustausche zwischen Atmosphäre und Bodenoberfläche<br />
• Regionale Aspekte <strong>der</strong> <strong>Angewandte</strong>n und synoptischen Klimatologie<br />
• Raumzeitliche Klimavariabilität<br />
Literatur:<br />
Geiger, R. (1961): Das Klima <strong>der</strong> bodennahen Luftschicht.<br />
Bendix, J. (2004): Geländeklimatologie.<br />
<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 7
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />
b) Vorlesung Wasserwirtschaft und Hydrologie I:<br />
• Aufbau und Funktionsweise des Wasserhaushaltes<br />
• Grundlagen <strong>der</strong> Teilkompartimente Nie<strong>der</strong>schlag, Verdunstung, Abfluss und Speicherung<br />
• Grundlagen <strong>der</strong> quantitativen und qualitativen Wasserwirtschaft<br />
• Grundlagen <strong>der</strong> Herleitung von Bemessungswerten in <strong>der</strong> Wasserwirtschaft (hydrologische<br />
Statistik)<br />
• Anwendungsbeispiele aus <strong>der</strong> Wasserwirtschaft (Ausweisung von Retentionsflächen,<br />
Hochwasserschadenspotenzial-Analysen, Erosionsmodellierung, Speicherwirtschaft,<br />
DV-Aufgaben in <strong>der</strong> Hydrologie)<br />
Literatur: Fachliteratur wird im LMS (Learning Management System) fortlaufend themenspezifisch<br />
aktualisiert.<br />
Gruppengröße<br />
c) Praktikum Stadt- und Geländeklimatologie: Durchführung von Messprogrammen zu<br />
angewandten Fragestellungen <strong>der</strong> Stadt- bzw. Geländeklimatologie in Anlehnung an<br />
die Inhalte aus a) und b); Analyse und Präsentation <strong>der</strong> erhobenen Datensätze<br />
Literatur:<br />
Bendix, J. (2004): Geländeklimatologie<br />
Fezer, F. (1995): Das Klima <strong>der</strong> Städte<br />
a) und b) variabel, c) 20<br />
Kontaktzeit<br />
a) 30 h b) 30 h c) 30 h<br />
Summe: 90 h<br />
Selbststudium a) 30 h b) 30 h c) 120 h<br />
Summe: 160 h<br />
CP<br />
a) 2 CP b) 2 CP c) 5 CP<br />
Kreditpunkte: 9 CP<br />
Voraussetzung für die a) Mündliche Prüfung (Dauer: ca. 20 Minuten); die regelmäßige Teilnahme an <strong>der</strong> Ü-<br />
Vergabe von CP bung zur Vorlesung sowie die erfolgreiche Bearbeitung von Hausübungen sind Voraussetzung<br />
für die Zulassung zur Teilmodulprüfung<br />
b) wöchentliche Hausarbeit und Klausur (Dauer: 60 Minuten)<br />
c) Praktikumsbericht (Bearbeitungszeit: 6 Wochen), Gruppenarbeit mit max. je 5 Studierenden<br />
möglich, maximaler Umfang: 20 Seiten je Studieren<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Studierendem<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 8
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />
<strong>Angewandte</strong> Stadtgeographie<br />
Modulbeauftragter: Prof. Dr. C. Pfaffenbach<br />
Dozenten: Prof. Dr. C. Pfaffenbach, Wiss. Mitarbeiter und Lehrbeauftragte<br />
Studiengang<br />
Angebot (Turnus) Dauer<br />
Studienjahr<br />
M.Sc.-Studiengang <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />
M.Sc.-Studiengang Wirtschaftsgeographie<br />
jährlich<br />
1-2 Semester 1. Studienjahr<br />
Kategorie Erläuterung<br />
Veranstaltungen und a) Übung: <strong>Angewandte</strong> Stadtgeographie<br />
Lehrformen<br />
b) Seminar: Sozialgeographie <strong>der</strong> Stadt<br />
c) Geländepraktikum: Stadtentwicklung<br />
Voraussetzungen keine<br />
Lern-/<br />
Ziel des Moduls ist es, spezielle Themenfel<strong>der</strong> <strong>der</strong> Stadtgeographie unter beson<strong>der</strong>er<br />
Qualifikationsziele Berücksichtigung des berufsorientierten Anwendungsbezugs zu vermitteln. Die Kombination<br />
von Übung, Seminar und Geländepraktikum garantiert aufgrund des hohen Anteils<br />
an eigenständigem Arbeiten in kleineren Gruppen die Realisierung einer praxisnahen<br />
Ausbildung.<br />
a) Übung: <strong>Angewandte</strong> Stadtgeographie: In <strong>der</strong> Übung werden die in geographischen<br />
Bachelorstudiengängen erlernten Fachkenntnisse weiter vertieft und eingeübt.<br />
Grundlage hierfür ist die Lektüre und intensive Diskussion von Spezialliteratur zu<br />
ausgewählten Themen <strong>der</strong> angewandten Stadtgeographie. Aufbauend werden ausgewählte<br />
Fragestellungen <strong>der</strong> Stadtentwicklung, Stadtpolitik, Stadtplanung etc. in<br />
Gruppenarbeit vor dem Hintergrund praxisbezogener Anwendungen bearbeitet.<br />
Lernziele sind entsprechend einerseits das Erlangen von vertieften Fachkenntnissen<br />
sowie an<strong>der</strong>erseits von praxisrelevanten methodischen Kenntnissen.<br />
b) Seminar: Sozialgeographie <strong>der</strong> Stadt: Das Seminar soll gewährleisten, dass mittels<br />
Abfassen komplexer Hausarbeiten zu speziellen Fragestellungen die Fähigkeit zum<br />
Erstellen von fundierten Berichten und Konzepten erlangt wird. Dies ist wesentlicher<br />
Bestandteil des späteren berufsbezogenen Arbeitens von Absolventen des Masterstudiengangs<br />
<strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong>. Weitere Qualifikationsziele bestehen darin,<br />
auch komplizierte Sachverhalte allgemeinverständlich in Form von medienunterstützten<br />
Präsentationen vermitteln zu können sowie unter Anleitung Mo<strong>der</strong>ationen<br />
und Diskussionsleitungen durchzuführen.<br />
c) Geländepraktikum: Stadtentwicklung: Das Geländepraktikum zielt darauf ab, komplexere<br />
Verfahren <strong>der</strong> Erhebung und Auswertung empirischer Daten zur Stadtentwicklung<br />
durchzuführen, um damit ausgewählte aktuelle Fragestellungen zu bearbeiten.<br />
Die Methoden sollen soweit eingeübt werden, dass auch umfangreiche empirische<br />
Untersuchungen nach Abschluss des Moduls selbstständig konzipiert und<br />
durchgeführt werden können.<br />
Inhalte<br />
(exemplarisch)<br />
a) Übung <strong>Angewandte</strong> Stadtgeographie: Die Lehrveranstaltung beinhaltet Themen <strong>der</strong><br />
angewandten Stadtgeographie, u. a. zu Leitbil<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Stadtentwicklung und ihrer<br />
Umsetzung, Praxisrelevanz und Steuerungsmöglichkeiten von Prozessen einer postindustriellen/postmo<strong>der</strong>nen<br />
Urbanisierung, Governance-Formen und -Konzepte auf<br />
verschiedenen Ebenen in Stadtregionen, Stadt- und Citymarketing, Quartiersmanagement,<br />
Revitalisierung von Brachflächen.<br />
b) Seminar Sozialgeographie <strong>der</strong> Stadt: Im Seminar wird das Spannungsfeld von Gesellschaft,<br />
Kultur, Wirtschaft und Politik im urbanen Zusammenhang und unter sozialgeographischen<br />
Gesichtspunkten thematisiert. Struktur- und akteursbezogene Ansätze<br />
sind dabei die zentralen Perspektiven. Exemplarische Themenfel<strong>der</strong>: Segregationsforschung<br />
und ihre Praxisrelevanz (demographische, soziale, ethnische Segregation),<br />
Lebensstile und Stadtentwicklung, demographischer Wandel/Migration und<br />
Stadtentwicklung, Wahrnehmung und Image von urbanen Räumen.<br />
<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 9
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />
Gruppengröße a) bis c) 20<br />
Kontaktzeit<br />
Selbststudium<br />
CP<br />
Voraussetzung für die<br />
Vergabe von CP<br />
c) Geländepraktikum: Stadtentwicklung: Eine komplexe Fragestellung <strong>der</strong> angewandten<br />
Stadtgeographie wird mittels qualitativer, quantitativer Methoden und/o<strong>der</strong> Diskursanalysen<br />
bearbeitet und die Ergebnisse öffentlich präsentiert.<br />
a) 30 h b) 30 h c) 30 h<br />
a) 60 h b) 60 h c) 60 h<br />
a) 3CP b) 3 CP c)3 CP<br />
Summe: 90 h<br />
Summe: 180 h<br />
Kreditpunkte: 9 CP<br />
a) Klausur (Dauer: 60 Minuten)<br />
b) Hausarbeit (Bearbeitungszeit: 6 Wochen, Umfang 20 Seiten, Gewichtung: 50%)<br />
und Referat (Dauer: 30 Minuten, Gewichtung 50%)<br />
Praktikumsbericht (Bearbeitungszeit: 4 Wochen), Gruppenarbeit mit max. je 4 Studierenden<br />
möglich, maximaler Umfang: 10 Seiten je Studieren<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Studierendem<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 10
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />
III. Wahlpflichtbereich Kern Wirtschaftsgeographie<br />
Modul: Industrie und Innovation; Wahlpflichtbereich Kern<br />
Modulbeauftragter: Prof. Dr. M. Fromhold-Eisebith<br />
Dozenten: (Ggf. zusätzlich hauptamtlich Lehrende)<br />
Studiengänge<br />
Angebot (Turnus) Dauer<br />
Studienjahr<br />
M. Sc. Wirtschaftsgeographie<br />
M. Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />
Jährlich<br />
1-2 Semester 1.-2. Studienjahr<br />
Kategorie Erläuterung<br />
Veranstaltungen und a) Vorlesung: Wissen, Innovation und neue Technologien in räumlicher Perspektive<br />
Lehrformen<br />
b) Seminar: zu Vorlesung a)<br />
c) Praktikum Industrie und Innovation<br />
Voraussetzungen Keine<br />
Lern-<br />
/Qualifikationsziele<br />
Die Studierenden sollen die Fähigkeit erwerben, die Bedeutsamkeit von Wissen, Innovativität<br />
und neuen Technologien für wirtschafts- bzw. industrieräumliche Entwicklungen<br />
beschreiben, erklären und bewerten zu können. Auf dieser Basis sollen aktuelle Zugänge<br />
zu diversen Fragestellungen einer <strong>Geographie</strong> <strong>der</strong> Innovation und Technologie behandelt<br />
werden. Begriffliche Grundlagen, Determinanten/ Einflussfaktoren, Messungsmöglichkeiten<br />
sowie konzeptionelle Erklärungsansätze werden im Zusammenhang mit<br />
branchen- und raumbezogenen Beispielen vorgestellt.<br />
Inhalte (exemplarisch) a) Vorlesung: Wissen, Innovation und neue Technologien in räumlicher Perspektive:<br />
Klärung grundlegen<strong>der</strong> Begriffe, Kategorisierungen von Wissen, Innovation und technologieorientierter<br />
Entwicklung. Bedeutung von Wissen und Innovativität für die Entwicklung<br />
technologieorientierter Branchen und Wirtschaftsräume; Relevanz räumlicher Nähe.<br />
Konzentrations- und Diffusionsprozesse im Raum. Innovationsdynamik, -zyklen und<br />
territoriale Innovationssysteme; Erklärungsansätze zu Struktur, Dynamik und Verflechtungsmustern<br />
technologieorientierter Wirtschaftsräume; Management und För<strong>der</strong>maßnahmen<br />
<strong>der</strong> technologie-/ innovationsorientierten Regionalentwicklung; Implikationen<br />
von Technologiepolitik.<br />
b) Seminar: zu Vorlesung a):<br />
Vertiefung und Konkretisierung von Inhalten <strong>der</strong> Vorlesung a) im Hinblick auf verschiedene<br />
anwendungsrelevante Prozess-, Konzept- und Politikfel<strong>der</strong>. Themenbezogene<br />
Ausarbeitung und Analyse ausgewählter Fallbeispiele. Präsentation <strong>der</strong> erarbeiteten<br />
Ergebnisse sowie Mo<strong>der</strong>ation/Leitung von Seminardiskussionen zu vorgegebenen<br />
Themen mit Praxisbezug.<br />
c) Praktikum Industrie und Innovation :<br />
Gestützt auf gemeinsame Workshop-Sitzungen und empirische Arbeiten im Gelände<br />
erfolgt die statistik- und empirie-gestützte Analyse räumlicher Innovationsprozesse bzw.<br />
des raumrelevanten Verhaltens von Akteuren <strong>der</strong> technologieorientierten Regionalentwicklung.<br />
Dabei Anwendung diverser Arbeitsmethoden <strong>der</strong> Projektarbeit (Konzeption,<br />
Durchführung und Auswertung) zu forschungs- und praxisrelevanten Fragestellungen<br />
im Bereich technologiebasierter Raumentwicklungen. Sammeln von Erkenntnissen /<br />
<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 11
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />
Erfahrungen im Umgang mit innovativen Unternehmen, Forschungseinrichtungen sowie<br />
an<strong>der</strong>en Akteuren.<br />
Gruppengröße a) 60 b) 20 c) 20<br />
Kontaktzeit<br />
a) 30 h b) 30 h c) 30 h<br />
Summe: 90 h<br />
Selbststudium a) 60 h b) 90 h c) 30 h<br />
Summe: 180 h<br />
CP<br />
a) 3 b) 4 c) 2<br />
Summe: 9 CP<br />
Voraussetzung für die a) Klausur (45 Min.)<br />
Vergabe von CP b) Hausarbeit (25 S.), Referat (45 Min.) (zählt zu je 50%)<br />
c) Praktikumsbericht (10-30 Seiten), ggf. einschließlich thematischer Karten und statistischer<br />
Analysen; Gruppenarbeit mit max. jeweils 3 Studierenden in einem Team<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Punkteverteilung gewichtet<br />
Modul: Dienstleistungen Handel, Finanzen, Immobilien, Kommunikation; Wahlpflichtbereich Kern<br />
Modulbeauftragter: Prof. Dr. P. Gräf<br />
Dozenten: (Ggf. zusätzlich hauptamtlich Lehrende)<br />
Studiengänge<br />
Angebot (Turnus) Dauer<br />
M. Sc. Wirtschaftsgeographie<br />
M. Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />
jährlich<br />
1-2 Semester<br />
Kategorie Erläuterung<br />
Veranstaltungen und a) Vorlesung: Strukturen und Strategien im Handel<br />
Lehrformen<br />
b) Vorlesung: Finanzdienste sowie Immobilienwirtschaft<br />
c) Übung: Diffusion <strong>der</strong> Kommunikation<br />
Voraussetzungen keine<br />
Lern-<br />
/Qualifikationsziele<br />
Studienjahr<br />
1.-2. Studienjahr<br />
Ziel des Moduls ist eine ergänzende Vertiefung <strong>der</strong> „Wirtschaftsgeographie <strong>der</strong> Dienstleistungen“<br />
im Bereich Handel, Finanzdienstleistungen, Immobilien-wirtschaft und kommunikative<br />
Dienstleistungen. Diese Vertiefung ist in Deutschland ein Alleinstellungsmerkmal<br />
unter den Angeboten M.Sc. „Wirtschaftsgeographie“ und hat sich bereits in<br />
den zurückliegenden Jahren als beson<strong>der</strong>s arbeitsmarktrelevante Spezialisierung erwiesen.<br />
Die Befassung mit <strong>der</strong> wesentlichen Literatur, die Anfertigung von thematisch eng umgrenzten<br />
Hausarbeiten sowie die Präsentation dieser Arbeiten sollen den Studierenden<br />
neben Fachwissen Sicherheit im Umgang mit Arbeitsmethoden vermitteln, die in den<br />
einzelnen Dienstleistungsbranchen beson<strong>der</strong>s gefragt sind.<br />
Inhalte a) Vorlesung Strukturen und Strategien im Handel:<br />
Die Vorlesung bietet grundlegende Einblicke und Zusammenhänge in Formen, Lebenszyklen,<br />
Standortstrategien und raumbezogene Wirkungen eines Strukturwandels im<br />
Handel. Metropolregionen und Mittelstädte sowie ländliche Räume sind die Betrachtungsebenen<br />
<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 12
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />
b) Vorlesung Finanzdienste sowie Immobilienwirtschaft:<br />
Die Vorlesung bietet Einblicke in vernetzte Systeme <strong>der</strong> Finanzdienstleister, in Diffusionsmuster<br />
von Bankentypen und in die Rolle von Finanzplätzen. Versicherungsdienstleister<br />
und die Wahl ihrer Verwaltungsstandorte sowie in den Wandel <strong>der</strong> Vertriebsformen<br />
für Versicherungspolicen. Der Teil Immobilienwirtschaft befasst sich mit<br />
den Dienstleitungsformen dieses Teilmarkts sowie den strukturellen Verän<strong>der</strong>ungen im<br />
Bereich <strong>der</strong> Büro- und Einzelhandelsimmobilien anhand von Beispielen aus EU-<br />
Län<strong>der</strong>n.<br />
c) Übung Diffusion <strong>der</strong> Kommunikation:<br />
Die Übung befasst sich mit Innovations- und Diffusionsprozessen sowohl <strong>der</strong> technikbasierten<br />
Individualkommunikation (u.a. Mobiltelefonie, WLAN; Internet; Location based<br />
services) als auch <strong>der</strong> Massenkommunikation (u.a. Tagespresse; Hörfunk/Fernsehen<br />
und Filmwirtschaft)<br />
Gruppengröße a) 60 b 60 c) 30<br />
Kontaktzeit<br />
a) 30h b) 30h c) 30h<br />
Summe: 90 h<br />
Selbststudium a) 60h b) 60h c) 60h<br />
Summe: 180 h<br />
CP<br />
a) 3 b) 3 c) 3<br />
Summe: 9 CP<br />
Voraussetzung für die a) Klausur (45 Minuten) zu den Themen <strong>der</strong> Vorlesungen<br />
Vergabe von CP b) Klausur ( 45 Minuten) zu den Themen <strong>der</strong> Vorlesungen<br />
c) Hausarbeit (15 Seiten) und Kurzpräsentation (Referat, 10 Minuten) (zählt zu je 50<br />
%)<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Punkteverteilung gewichtet<br />
Modul: Logistik und Verkehr; Wahlpflichtbereich Kern<br />
Modulbeauftragter: Prof. Dr. A. Wieger<br />
Dozenten: (Ggf. zusätzlich hauptamtlich Lehrende)<br />
Studiengänge<br />
Angebot (Turnus) Dauer<br />
M. Sc. Wirtschaftsgeographie<br />
M. Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />
jährlich<br />
1-2 Semester<br />
Kategorie Erläuterung<br />
Veranstaltungen und a) Vorlesung: Verkehrsgeographische Prozesse<br />
Lehrformen<br />
b) Seminar: Logistik<br />
c) Praktikum Verkehrswirtschaft<br />
Voraussetzungen keine<br />
Studienjahr<br />
1.-2. Studienjahr<br />
Lern-<br />
Die Studierenden sollen die Fähigkeit erwerben, verkehrsgeographische Prozesse zu<br />
/Qualifikationsziele analysieren, zu bewerten und in einen wirtschaftsgeographischen und raumordnerischen<br />
Zusammenhang zu stellen. Vertiefend sollen wesentliche Aspekte des Eisenbahnwesens<br />
und im Rahmen <strong>der</strong> an <strong>der</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong> gegebenen Möglichkeiten auch<br />
des Flug- und Kfz- Verkehrs und <strong>der</strong> dafür erfor<strong>der</strong>lichen Planung behandelt werden.<br />
Theoretisch entwickelte Analyseverfahren sind ebenso wichtig wie Erfahrungen mit<br />
praktischen Erhebungsmethoden und <strong>der</strong> verkehrsorientierten Planungskartographie.<br />
Inhalte (exemplarisch) a) Vorlesung Verkehrsgeographische Prozesse:<br />
<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 13
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />
Verän<strong>der</strong>ungen von Raumstrukturen durch verkehrsgeographische Prozesse. Einpassung<br />
von Verkehrssystemen in vorgegebene Raumstrukturen. Verknüpfung von Verkehrsplanung<br />
und Raumordnung. Raumbezogene Aspekte <strong>der</strong> Logistik und Verkehrslenkung.<br />
Telematik und Verkehrsleitsysteme. Wirtschaftsgeographische Hintergründe<br />
und Auswirkungen europäischer Verkehrs-Großprojekte. Ziele und Rahmenbedingungen<br />
grenzüberschreiten<strong>der</strong> Verkehrsplanung.<br />
b) Seminar: Logistik:<br />
Statistische Analyse und Prognostik von Güterbewegungen; die Bedeutung von Verkehrssystemen<br />
für die Entwicklung rohstoffbasierter und rohstoffabhängiger Wirtschaftsräume;<br />
die Bedeutung von Verkehrssystemen für die Entwicklung an<strong>der</strong>er Wirtschaftsräume.<br />
Konkurrenz und Ergänzung <strong>der</strong> verschiedenen Verkehrsträger. Planung von<br />
Systemen für den Transport und den Umschlag von Gütern.<br />
c) Praktikum Verkehrswirtschaft:<br />
Kennen lernen und Einüben von Arbeitsmethoden zu forschungs- und praxisrelevanten<br />
Fragestellungen. Ermittlung von Bedarfsstrukturen. Konzeption, Durchführung und<br />
Auswertung repräsentativer Befragungen <strong>der</strong> Benutzer von Verkehrsmitteln, Flughäfen<br />
und Bahnhöfen. Erstellung verkehrsbezogener Planungskarten. Optimierung von Fahrtrouten.<br />
Kennen lernen <strong>der</strong> Funktion und Organisation großer Logistikunternehmen.<br />
Gruppengröße a) 60 b) 30 c) 30<br />
Kontaktzeit:<br />
a) 30 h b) 30 h c) 30 h<br />
Summe:90 h<br />
Selbststudium: a) 60 h b) 90 h c) 30 h<br />
Summe: 180 h<br />
CP:<br />
a) 3 b) 4 c) 2<br />
Summe: 9 CP<br />
Voraussetzung für die a) Klausur (45 Min.)<br />
Vergabe von CP b) Hausarbeit (20 Seiten), Referat (45 Min.) (zählt zu je 50 %)<br />
c) Praktikumsbericht (30 Seiten), ggf. einschließlich thematischer Karten und statistischer<br />
Analysen; Gruppenarbeit mit max. jeweils 3 Studierenden in einem Team<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Punkteverteilung gewichtet<br />
<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 14
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />
IV. Nebenfächer<br />
Nebenfach: Abfallwirtschaft und Umwelttechnik<br />
Modul SWS CP Semester<br />
Umwelttechnik in <strong>der</strong> Rohstoffindustrie (NF) 6 10 1-4<br />
Kreislaufwirtschaft, Recycling und Altlastensanierung<br />
(NF)<br />
6 10 1-4<br />
Abfallbeseitigung und Deponietechnik (NF) 6 10 1-4<br />
Umwelttechnik in <strong>der</strong> Rohstoffindustrie (NF)<br />
Modulbeauftragter: Prof. Dr.- Ing. Christian Niemann-Delius<br />
Veranstaltungen a) Mineralische Rohstoffe und Nachhaltigkeit - Theorie und praktische Beispiele<br />
b) Tagebau, Umwelt und Wasser<br />
Lern-/<br />
Qualifikationsziele<br />
Inhalte<br />
(exemplarisch)<br />
Nach Beendigung dieses Moduls sollten die Studenten in <strong>der</strong> Lage sein, zu erkennen,<br />
in welchem Spannungsfeld Rohstoffunternehmen heutzutage am Markt operieren<br />
müssen. Dazu wird neben <strong>der</strong> Vermittlung von Fachwissen über aktuelle Anfor<strong>der</strong>ungen<br />
des Umweltschutzes an die Rohstoffgewinnung ein kritisches Bewusstsein in <strong>der</strong><br />
Frage des Umweltschutzes geschaffen. Die sich ergebenden Fragestellungen werden<br />
anhand konkreter Beispiele dargestellt und bearbeitet. Letztlich werden die Studierenden<br />
in die Diskussion um nachhaltige Entwicklung und die Bedeutung dieser gesellschaftspolitischen<br />
Aufgabe in <strong>der</strong> Rohstoffindustrie eingeführt und für Interdependenzen<br />
sensibilisiert.<br />
a) Mineralische Rohstoffe und Nachhaltigkeit- Theorie und praktische Beispiele:<br />
Grundlagen und Definitionen, Drei-Säulen-Modell, Indikatoren, sozioökonomische<br />
Belange <strong>der</strong> Rohstoffindustrie, Akteure, politische Aktionen, Stoffstrommanagement<br />
Literatur:<br />
International <strong>Institut</strong>e for Environment and Development (IIED) and World Business<br />
Council for Sustainable Development (WBCSD): Breaking new ground : the report of<br />
the Mining, Minerals, and Sustainable Development Project, Earthscan Publications<br />
Ltd, 120 Pentonville Road, London, N1 9JN, UKMai 2002.<br />
Organisation for economc do-operation and development (OECD): Policies to Enhance<br />
Sustainable Development, Paris, Frankreich, 2001<br />
LÁSZLÓ PINTÉR U.A. (2000): Capacity Building for Integrated Environmental Assessment<br />
and Reporting - Training Manual, Second Edition, -International <strong>Institut</strong>e for<br />
Sustainable Development (IISD) & United Nations Environment Programme (UNEP),<br />
Ecologistics International, Ltd., Canada.<br />
MARTA MIRANDA U.A. (2003): Mining and critical ecosystems: Mapping the Risks,<br />
World Resources <strong>Institut</strong>e, Washington D.C., USA.<br />
b) Tagebau, Umwelt und Wasser:<br />
Rekultivierung und Renaturierung; Eingriffsabschätzung, -min<strong>der</strong>ung und Kompen-<br />
<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 15
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />
sationsmaßnahmen; Umweltverträglichkeit und Raumbedeutsamkeit; Umsiedlungsproblematik;<br />
Sanierungsbergbau; interner und externer Wasserkreislauf von Rohstoffbetrieben;<br />
Staub- und Lärmemissionen;<br />
Literatur:<br />
KÖPPEL, J. U.A. (1998): Praxis <strong>der</strong> Eingriffsregelung, Verlag Ulmer.<br />
DINGETHAL, DR. F. U.A. (1981): Kiesgrube und Landschaft, Verlag Parey.<br />
PFLUG, W. (1998): Braunkohlentagebau und Rekultivierung, Verlag Springer.<br />
Gruppengröße<br />
Kontaktzeit<br />
a) 30 h b) 60 h<br />
Summe: 90 h<br />
Selbststudium a) 60 h b) 150 h<br />
Summe: 210 h<br />
Kreditpunkte (CP) a) 3 CP b) 7 CP<br />
Kreditpunkte: 10 CP<br />
Prüfungsleistungen Die Zulassung zu den Modulprüfungen erfolgt vorbehaltlich folgen<strong>der</strong> Leistungsnachweise:<br />
Anwesenheitspflicht bei b) (max. zwei Fehltermine pro Semester)<br />
a) schriftlichePrüfung (90 Minuten)<br />
b) mündliche Prüfung (30- 40 Minuten, Gewichtung 50 %) sowie mündliche<br />
Präsentation (Dauer 20 bis 30 Minuten, Gewichtung: 50 %)<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
Kreislaufwirtschaft, Recycling und Altlastensanierung (NF)<br />
Modulbeauftragter: Prof. Dr.- Ing. Thomas Pretz<br />
Veranstaltungen a) Einführung in die Kreislaufwirtschaft (V/Ü)<br />
b) Recycling für Geographen (V/Ü)<br />
c) In-Situ-Sicherung von Altlasten (V)<br />
Lern-/<br />
Ziel des Moduls ist es, eine Einführung in die technisch-wirtschaftlichen Grundlagen<br />
Qualifikationsziele <strong>der</strong> Kreislaufwirtschaft, des Recyclings und <strong>der</strong> Sanierung von Altlasten zu vermitteln.<br />
Darüber hinaus sollen die Studierenden ein Grundverständnis über technische Zusammenhänge,<br />
die Unterschiede von freien und verordneten Märkten und die Steuerungsfunktion<br />
<strong>der</strong> Gesetzgebung im Recycling und <strong>der</strong> Sanierung von Altlasten erwerben.<br />
Weiterhin sollen sie in die Lage versetzt werden, bereits erworbenes Wissen<br />
in eigenen Übungen zu vertiefen und gewonnene Ergebnisse komplexer technischwirtschaftlich-rechtlicher<br />
Sachverhalte einem Publikum zu präsentieren.<br />
Inhalte<br />
a) Einführung in die Kreislaufwirtschaft::<br />
(exemplarisch) Basierend auf <strong>der</strong> aktuellen Gesetzgebung werden Rückschlüsse auf Gewerbe, Industrie<br />
und Kommunen aufgezeigt und anhand praktischer Beispiele verschiedene<br />
Kreislaufwirtschaftsmaßnahmen dargestellt. Behandelt werden Kreisläufe folgen<strong>der</strong><br />
Industriebereiche: Auto, Elektronik, Chemie, Stahl, Papier, Mineral, Holz etc.<br />
Literatur:<br />
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz<br />
b) Recycling für Geographen:<br />
Zu ausgesuchten Themen des Recyclings (z.B. Bauabfälle, Schrotte, Papier, ölhaltige<br />
Betriebsmittel, Altöl etc.): Gesetzliche Grundlagen, Mengen Abfall und Primärrohstoffe,<br />
Rohstoffpreise und Recyclingkosten, Markt für Sekundärrohstoffe, Qualitätsanfor<strong>der</strong>ungen,<br />
technische Grundprinzipien, Beispiele für Recyclingverfahren; Praktische<br />
Übung zur Aufbereitung von Abfällen und Herstellung von Sekundärrohstoffen,<br />
<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 16
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />
Bewertung von Recyclingprozessen und <strong>der</strong>en Massen- und Qualitätsverlusten; Übung<br />
in Blockveranstaltung; Eigenständige Bearbeitung von Recyclingthemen in<br />
Gruppenarbeit mit mündlicher Präsentation <strong>der</strong> Arbeitsergebnisse.<br />
Literatur: Lose-Blatt Sammlung Müllhandbuch<br />
c) In-Situ-Sicherung von Altlasten:<br />
Definition von Altlasten, einschlägige Methoden und Verfahren zur Erkundung u.<br />
Sanierung von Altlasten, Oberflächenabdeckungen, Oberflächenabdichtungen,<br />
Dichtwände, Veranschaulichung durch Exkursion.<br />
Literatur:<br />
Zeitschrift Altlastensanierung<br />
Gruppengröße<br />
Kontaktzeit<br />
a) 30 h b) 30 h c) 30 h<br />
Summe: 90 h<br />
Selbststudium a) 60 h b) 90 h c) 60 h<br />
Summe: 210 h<br />
Kreditpunkte (CP) a) 3 CP b) 4 CP c) 3 CP<br />
Kreditpunkte: 10 CP<br />
Prüfungsleistungen a) Klausur (90 Minuten)<br />
Note<br />
b) Klausur (90 Minuten, Gewichtung: 50 %) und mündliche Präsentation (Dauer 30<br />
Minuten, Gewichtung: 50 %)<br />
c) mündliche Prüfung (Dauer 30 Minuten)<br />
Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
Abfallbeseitigung und Deponietechnik (NF)<br />
Modulbeauftragter: Prof. Dr.- Ing. Christian Niemann- Delius<br />
Veranstaltungen a) Planung, Bau und Betrieb übertägiger Deponien I (V) (WS)<br />
b) Planung, Bau und Betrieb übertägiger Deponien II (Ü) (SS)<br />
Lern-/<br />
Qualifikationsziele<br />
Inhalte<br />
(exemplarisch)<br />
Vermittlung von Fachwissen und Verknüpfung von Wissen aus verschiedenen Fachbereichen.<br />
Darüber hinaus wird beson<strong>der</strong>es Augenmerk auf die Ausbildung von<br />
Teamfähigkeit, Arbeiten in <strong>der</strong> Gruppe gelegt. Im Vor<strong>der</strong>grund dieses Moduls stehen<br />
weiterhin selbständiges Lernen und Informationsbeschaffung. Erzielte Ergebnisse<br />
müssen in verbalen Präsentation dargestellt werden.<br />
Die Qualifikationsziele <strong>der</strong> Veranstaltung liegen im Vermitteln und selbständigen Erarbeiten<br />
von Wissen als auch im Beson<strong>der</strong>en auf dem Gebiet <strong>der</strong> „Soft Skills“ Teamfähigkeit<br />
und Präsentation.<br />
a) Planung und Betrieb übertägiger Deponien I<br />
Rechtliche Grundlagen im Bereich Deponietechnik - Standortsuche für Deponien -<br />
Basisabdichtungen und Entwässerung - Organisation und Betrieb, Deponiemanagement<br />
- Oberflächenabdichtungssysteme und Entgasung - Kontrolle und<br />
Nachsorge - Beispielplanung einer Deponie - Exkursionen zu Deponien im In- und<br />
Ausland<br />
Literatur:<br />
Gesetz zur För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Kreislaufwirtschaft und Sicherung <strong>der</strong> umweltverträglichen<br />
Beseitigung von Abfällen (Krw-/ AbfG)<br />
Verordnung über die umweltverträgliche Ablagerung von Siedlungsabfällen (AbfAblV),<br />
Verordnung über Deponien und Lang zeitlager (DepV), Dritte Allgemeine Verwaltungsvorschrift<br />
zum Abfallgesetz (TASi)<br />
<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 17
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />
b) Planung und Betrieb übertägiger Deponien II<br />
Die Gesamtveranstaltung ist in mehrwöchige Themenblöcke aufgeteilt. Die einzelnen<br />
Themenbereiche werden nach einer Einführungs-/Grundlagenvorlesung an Hand von<br />
praxisnahen Beispielplanungen vertieft und einzelne Fragestellungen von den Kleingruppen<br />
bearbeitet und präsentiert. Die Einzelergebnisse werden am Ende in einer<br />
Dokumentation gebündelt, die dann einen Gesamtüberblick von Planung, Bau, Betrieb<br />
und Nachsorge eine Deponie darstellt.<br />
Literatur: BILITEWSKI, B. U.A. (2000): Abfallwirtschaft- Handbuch für Praxis und Lehre-<br />
Springer.<br />
Gruppengröße<br />
Kontaktzeit<br />
a) 30 h b) 60 h<br />
Summe: 90 h<br />
Selbststudium a) 60 h b) 150 h<br />
Summe: 210 h<br />
Kreditpunkte (CP) a) 3 CP b) 7 CP<br />
Kreditpunkte: 10 CP<br />
Prüfungsleistungen a) Klausur 120 Minuten; die Zulassung zur Prüfung erfolgt vorbehaltlich folgen<strong>der</strong><br />
Leistungsnachweise: Anwesenheitspflicht (max. zwei Fehltermine pro Semester)<br />
b) mündliche Präsentation (20 bis 40 Minuten, Gewichtung: 50 %) Projektarbeit: (90 h,<br />
Gewichtung 50%); die Zulassung zu den Prüfungen erfolgt vorbehaltlich folgen<strong>der</strong><br />
Leistungsnachweise: Anwesenheitspflicht (max. zwei Fehltermine pro Semester)<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 18
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />
Nebenfach Biologie<br />
Modul SWS CP Semester<br />
Biologie 1: Bau <strong>der</strong> Organismen 8 12 1-2<br />
Biologie 2: Physiologie 10 9 3-4<br />
Biologie 3: Ökologie 6 9 3-4<br />
Modul Biologie 1: Bau <strong>der</strong> Organismen<br />
Modulbeauftragter: Prof. A. Schäffer<br />
Beteiligte Lehrstühle/Dozenten: Bio1: Prof. Frentzen; Bio 2: Prof. Bräunig,<br />
Studiengänge<br />
Angebot (Turnus) Dauer Studienjahr<br />
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />
jährlich<br />
2 Semester 1. Studienjahr<br />
Kategorie Erläuterung<br />
Veranstaltungen und a) Vorlesung und praktische Übungen Bau <strong>der</strong> Organismen I (Tiere)<br />
Lehrformen<br />
b) Vorlesung und praktische Übungen Bau <strong>der</strong> Organismen II (Pflanzen)<br />
Voraussetzungen Keine<br />
Lern-/<br />
Qualifikationsziele<br />
Nach Abschluss dieses Moduls sollen die Studierenden einen Überblick über die<br />
Vielfalt <strong>der</strong> Lebewesen und einen Einblick in biologische Bauprinzipien erworben<br />
haben<br />
Inhalte<br />
Überblick über das Tier- und Pflanzenreich, ihre Evolution, Bau und Funktion ver-<br />
(exemplarisch) schiedener Gewebe- und Organsysteme<br />
Literatur (a, b): Campbell, Biologie (Spektrum Verlag)<br />
Gruppengröße max. 6 Studierende aus dem Studiengang MSc <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />
Kontaktzeit:<br />
a) 60 h b) 60 h<br />
Summe: 120 h<br />
Selbststudium: a) 120 h b) 120 h<br />
Summe: 240 h<br />
Kreditpunkte: a) 6 CP b) 6 CP<br />
Summe: 12 CP<br />
Voraussetzung für die a) und b): jeweils eine Klausur (Dauer: 60 Min., Gewichtung jeweils 50%); die Zulas-<br />
Vergabe von sung zur Modulteilprüfung erfolgt vorbehaltlich <strong>der</strong> erfolgreichen Erarbeitung von<br />
CP-Punkten<br />
Protokollen (keine Benotung) in den jeweiligen Übungen.<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Punkteverteilung gewichtet.<br />
Modul Biologie 2: Physiologie<br />
Modulbeauftragter: Prof. A. Schäffer<br />
Beteiligte Lehrstühle/Dozenten: Bio1: Prof. Wagner; Bio 3: Prof. Slusarenko;<br />
Studiengänge<br />
Angebot (Turnus) Dauer Studienjahr<br />
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />
jährlich<br />
2 Semester 2. Studienjahr<br />
Kategorie Erläuterung<br />
Veranstaltungen und a) Vorlesung Pflanzenphysiologie o<strong>der</strong> alternativ Tierphysiologie<br />
Lehrformen<br />
b) Praktische Übungen in Pflanzenphysiologie o<strong>der</strong> alternativ Tierphysiologie<br />
Voraussetzungen Modul Biologie 1<br />
Lern-/<br />
Nach Abschluss dieses Moduls sollen die Studierenden einen Überblick über die<br />
Qualifikationsziele enge Korrelation zwischen Struktur und Funktion von Organismen erworben haben.<br />
Inhalte Theoretische und praktische Kenntnisse über die Physiologie von Pflanzen bzw. Tie-<br />
<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 19
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />
(exemplarisch) ren auf subzellulärer, zellulärer und organismischer Ebene<br />
Literatur: (a, b): Campbell, Biologie (Spektrum Verlag)<br />
Gruppengröße max. 6 Studierende aus dem Studiengang MSc <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />
Kontaktzeit<br />
Selbststudium<br />
CP<br />
Voraussetzung für die<br />
Vergabe von<br />
CP-Punkten<br />
a) 60 h b) 90 h<br />
a) 60 h b) 60 h<br />
a) 4 CP b) 5 CP<br />
Summe: 150 h<br />
Summe: 120 h<br />
Summe: 9 CP<br />
Je eine Klausur zu den Inhalten von a) und b) (Dauer: je 60 Min.); die Zulassung zur<br />
Modulprüfung erfolgt vorbehaltlich <strong>der</strong> erfolgreichen Erarbeitung von Protokollen (keine<br />
Benotung) und einer erfolgreichen Kurzpräsentation in b) (keine Benotung).<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Punkteverteilung gewichtet.<br />
Modul Biologie 3: Ökologie<br />
Modulbeauftragter: Prof. A. Schäffer<br />
Beteiligte Lehrstühle/Dozenten: Bio1: Prof. Priefer, Dr. Jahnke; Bio V: Prof. Schäffer, Prof. Ratte, Dr. Roß-<br />
Nickoll<br />
Studiengänge<br />
Angebot (Turnus) Dauer Studienjahr<br />
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />
jährlich<br />
1 Semester 2. Studienjahr<br />
Kategorie Erläuterung<br />
Veranstaltungen und a) Vorlesung Einführung in die Ökologie<br />
Lehrformen<br />
b) Botanische und zoologische Bestimmungsübungen mit Exkursionen<br />
Voraussetzungen Modul Biologie 1<br />
Lern-/<br />
Nach Abschluss dieses Moduls sollen die Studierenden grundlegende Kenntnisse<br />
Qualifikationsziele auf dem Gebiet <strong>der</strong> Ökologie besitzen. Sie sollen in <strong>der</strong> Lage sein, durch genaues<br />
Beobachten und Protokollieren typische Pflanzen- und Tierarten zu bestimmen und<br />
ihren Lebensraum zu erfassen.<br />
Inhalte<br />
Autökologie von Organismen, Populationsdynamik, Biozönotik, Ökosystemkunde,<br />
(exemplarisch) Grundlagen <strong>der</strong> Pflanzen- und Tiermorphologie, Bestimmungsmethoden<br />
Literatur: (a, b): Campbell, Biologie (Spektrum Verlag)<br />
Gruppengröße max. 6 Studierende aus dem Studiengang MSc <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />
Kontaktzeit<br />
a) 30 h b) 60 h<br />
Summe: 90 h<br />
Selbststudium a) 90 h b) 90 h<br />
Summe: 180 h<br />
CP<br />
a) 4 CP b) 5 CP<br />
Summe: 9 CP<br />
Voraussetzung für die a) und b): jeweils eine Klausur (Dauer: 60 Min., Gewichtung: jeweils 50%); die Zulas-<br />
Vergabe von sung zur Modulprüfung erfolgt vorbehaltlich <strong>der</strong> erfolgreichen Erarbeitung von Proto-<br />
CP-Punkten<br />
kollen (keine Benotung) und einer erfolgreichen Kurzpräsentation (keine Benotung) in<br />
b).<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Punkteverteilung gewichtet.<br />
<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 20
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />
Nebenfach: Geologie I<br />
Modul SWS CP Semester<br />
System Erde für Nebenfächer (NF) 7 10 1-2<br />
Geologische Methoden für Nebenfächer (NF) 6 10 1-2<br />
Geländemethoden für Nebenfächer (NF) 6 10 2-4<br />
System Erde für Nebenfächer (NF)<br />
Modulbeauftragter: Prof. P. Kukla, Ph.D.<br />
Veranstaltungen a) Allgemeine Geologie (V)<br />
b) Erdgeschichte (V)<br />
c) Gesteinskunde (V/Ü)<br />
d) Geologische Exkursionen (2 Tage)<br />
Lern-/<br />
Ziel des Moduls ist es, den Studierenden eine Einführung in die a) grundlegenden<br />
Qualifikationsziele Fragestellungen, Begriffe, Konzepte und Arbeitsweisen <strong>der</strong> Geologie, b) in die Methoden<br />
zur Rekonstruktion <strong>der</strong> erdgeschichtlichen Vergangenheit unter beson<strong>der</strong>er<br />
Berücksichtigung <strong>der</strong> prinzipiellen, physikalisch bedingten Prozesse sowie <strong>der</strong> globalen<br />
Umweltverän<strong>der</strong>ungen und c) in die qualifizierte Ansprache von Gesteinen im<br />
Hörsaal und d) im Gelände, zu geben. Eine Einführung in mo<strong>der</strong>ne geowissenschaftliche<br />
Konzepte und Bezug zu angewandten Methoden wird hierbei ebenso vermittelt.<br />
Inhalte<br />
a) Allgemeine Geologie:<br />
(exemplarisch) Grundlagen des Erdaufbaus; Exogene Dynamik; Endogene Dynamik; Dynamik <strong>der</strong><br />
Lithosphäre; <strong>der</strong> Mensch im System Erde; Beispiele aus <strong>der</strong> Berufspraxis.<br />
Literatur:<br />
H. BAHLBURG & C. BREITKREUZ (2004): Grundlagen <strong>der</strong> Geologie. 403. Elsevier Verlag.<br />
ISBN: 382741394.<br />
b) Erdgeschichte:<br />
Methoden <strong>der</strong> Altersbestimmung (geologisch, physikalisch, chemisch); Methoden <strong>der</strong><br />
Paläogeographie; Biostratigraphie; Systeme <strong>der</strong> Erdgeschichte.<br />
Literatur:<br />
WALTER, R. (2003): Erdgeschichte – Die Entstehung <strong>der</strong> Kontinente und Ozeane. 325<br />
S., 5. Aufl., de Gruyter Berlin. ISBN 3-11-017697-1.<br />
c) Gesteinskunde:<br />
Erkennen unterschiedlichster Gesteinsarten anhand ihrer charakteristischen Merkmale;<br />
Klassifizierung unbekannter Gesteine aufgrund des Mineralbestandes sowie struktureller<br />
und textureller Kriterien.<br />
Literatur:<br />
FRY, N. (1991): The field description of Metamorphic Rocks.- 128 S., Wiley; New York.<br />
THORPE, R.S. & BROWN, G.C. (1991): The Field Description of Igneous Rocks.- 160 S.,<br />
Wiley; New York.<br />
<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 21
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />
Gruppengröße<br />
TUCKER, M.E. (1996): Sedimentary Rocks in the Field.- 162 S., Wiley, New York.<br />
d) Geologische Exkursionen:<br />
Erfassen unterschiedlicher geologischer Fragestellungen im Gelände, praktische<br />
methodische Arbeit (Aufschlussaufnahme, Gesteinsbestimmung, Bestimmung von<br />
Lagerungsverhältnissen), Verfassen eines Exkursionsberichts.<br />
Literatur: Skript<br />
Kontaktzeit<br />
a) 30 h b) 30 h c) 30 h d) 15 h<br />
Summe: 105 h<br />
Selbststudium a) 60 h b) 60 h c) 60 h d) 15 h<br />
Summe: 195 h<br />
Kreditpunkte (CP) a) 3 CP b) 3 CP c) 3 CP d) 1 CP<br />
Kreditpunkte: 10 CP<br />
Prüfungsleistungen a) Klausur 90 min<br />
b) Klausur 90 min<br />
c) Klausur 90 Minuten<br />
Note<br />
d) Exkursionsbericht (Bearbeitungsdauer: 2 Tage, max. 10 Seiten)<br />
Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
Geologische Methoden für Nebenfächer (NF)<br />
Modulbeauftragter: Prof. P. Kukla, Ph.D.<br />
Veranstaltungen a) Regionale Geologie (V)<br />
b) Geologische Arbeitsmethoden und Kartenkunde (V/Ü)<br />
Lern-/<br />
Vermittlung geowissenschaftlicher Arbeitsmethoden<br />
Qualifikationsziele<br />
Inhalte<br />
(exemplarisch)<br />
Gruppengröße<br />
Kontaktzeit<br />
Selbststudium<br />
Kreditpunkte (CP)<br />
Regionale Geologie:<br />
Verknüpft Lehrinhalte des Moduls System Erde für Nebenfächer durch Besprechung<br />
<strong>der</strong> geodynamischen Entwicklung <strong>der</strong> Krustenblöcke im Meso-/Känozoikum anhand<br />
ausgewählter Fallbeispiele (Nordsee, Zentraleuropäisches Becken, Mitteleuropäische<br />
Senkungszone, Pariser Becken, Golf von Mexiko).<br />
Literatur:<br />
WALTER, R. (1995): Geologie von Mitteleuropa, 566 S.<br />
ZIEGLER, P.A. (1990): Geological Atlas of Western & Central Europe. 2nd Ed., Shell<br />
Internat. Petrol. Maatsch., Geol. Soc. London (distr.)<br />
Geologische Arbeitsmethoden und Kartenkunde:<br />
Darstellung von Gesteinskörpern, Flächen und Linearen in geologischen Karten und<br />
Profilen; Bestimmung <strong>der</strong> Raumlage von Schichtflächen; Bohrlochkorrelationen und<br />
Mächtigkeitsermittlung aus Bohrlochdaten; Lagerstättenkonstruktionen.<br />
Literatur:<br />
POWELL, D. (1995): Interpretation geologischer Strukturen durch Karten.- 216 S.,<br />
Springer, Berlin.<br />
a) 30 h b) 60 h<br />
a) 60 h b) 150 h<br />
a) 3 CP b) 7 CP<br />
Summe: 90 h<br />
Summe: 210 h<br />
Kreditpunkte: 10 CP<br />
<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 22
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />
Prüfungsleistungen a) Klausur 90 Minuten<br />
b) Klausur 180 Minuten<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
Geländemethoden für Nebenfächer (NF)<br />
Modulbeauftragter: Prof. P. Kukla, Ph.D.<br />
Veranstaltungen a) Geländeübung: Geologischer Kartierkurs (12 Tage)<br />
b) Exkursion: Geologische Exkursionen (6 Tage)<br />
Lern-/<br />
Einführung in die Praxis geologischer Geländearbeiten<br />
Qualifikationsziele<br />
Inhalte<br />
(exemplarisch)<br />
Geologischer Kartierkurs:<br />
Orientierung im Gelände, Unterscheiden kartierbarer Gesteinseinheiten, Erstellen<br />
einer geologischen Karte, Erarbeiten von Säulen- und Querprofilen und Abfassung<br />
eines Berichtes, <strong>der</strong> die bei <strong>der</strong> Kartierung unterschiedenen lithologischen Einheiten<br />
beschreibt und <strong>der</strong>en Lagerungsverhältnisse erläutert und deutet.<br />
Literatur:<br />
MCCLAY, K.R. (1987): The Mapping of Geological Structures.- Geological Society of<br />
London Handbook Series, 161 S., Open University Press; Milton Keynes.<br />
Geologische Exkursionen:<br />
Erfassen unterschiedlicher geologischer Fragestellungen im Gelände, praktische<br />
methodische Arbeit (Aufschlussaufnahme, Gesteinsbestimmung, Bestimmung von<br />
Lagerungsverhältnissen), Verfassen eines Exkursionsberichts.<br />
Literatur:<br />
Skript zu den Exkursionen<br />
Gruppengröße<br />
Kontaktzeit<br />
a) 60 h b) 30 h<br />
Summe: 90 h<br />
Selbststudium a) 120 h b) 90 h<br />
Summe: 210 h<br />
Kreditpunkte (CP) a) 6 CP b) 4 CP<br />
Kreditpunkte: 10 CP<br />
Prüfungsleistungen a) Kartierbericht, min. 10 Seiten inkl. geologischer Karte (Bearbeitungszeit: 2 Wochen)<br />
b) Exkursionsberichte (Bearbeitungszeit: jeweils 2 Tage)<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 23
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />
Nebenfach Geologie II<br />
Modul SWS CP Semester<br />
Exogene und Endogene Dynamik 6 9 1-4<br />
Umweltgeologie 6 9 1-4<br />
Ressourcengeologie 6 6 1-4<br />
Geländemethoden II 3 6 1-4<br />
Modul: Exogene und Endogene Dynamik (DYN)<br />
Modulbeauftragter: Prof. Dr. J. Urai<br />
Dozenten: a) Stollhofen, b)Urai, c) Stollhofen<br />
Studiengänge<br />
Angebot (Turnus) Dauer<br />
Studienjahr<br />
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />
M.Sc. Wirtschaftsgeographie<br />
jährlich<br />
2 Semester 1./2. Studienjahr<br />
Kategorie Erläuterung<br />
Veranstaltungen und a) Vorlesung: Exogene Dynamik I<br />
Lehrformen<br />
b) Vorlesung: Endogene Dynamik I<br />
c) Vorlesung: Methoden <strong>der</strong> Sedimentologie<br />
Voraussetzungen Nebenfach Geologie I o<strong>der</strong> Wahlpflichtmodul W-GG<br />
Lern-/<br />
Ziel des Moduls ist es den Studierenden eine Vertiefung des Verständnisses endoge-<br />
Qualifikationsziele ner und exogener Prozesse zu geben. Dabei werden grundlegende Fragestellungen,<br />
Begriffe, Konzepte und Arbeitsweisen <strong>der</strong> Sedimentologie und Strukturgeologie/Tektonik<br />
behandelt. Eine Einführung in mo<strong>der</strong>ne geowissenschaftliche Konzepte<br />
und Bezug zu angewandten Methoden wird hierbei ebenso vermittelt.<br />
Inhalte<br />
a) Exogene Dynamik I:<br />
(exemplarisch) Herkunft sedimentärer Partikel, Massentransportprozesse, Physikal. Grundlagen des<br />
Sedimenttransports, Struktur von Sedimenten, Schichtungsgefüge, Mineralogische<br />
Zusammensetzung, Sedimentstrukturen, Deformationsstrukturen & Diagenese, Faziesarchitektur<br />
und –geometrie, Wüsten & Alluviale Fächer, Flüsse & Deltas, Seen &<br />
Gletscher, Strand & Schelf, Ozeane: Prozesse & Ablagerungen<br />
Literatur:<br />
Allen, P.A. (1997): Earth surface processes.- Blackwell<br />
Lee<strong>der</strong>, M.R. (1999): Sedimentology and sedimentary basins.- Blackwell.<br />
Reading, H.G. (1996): Sedimentary environments. Processes, facies and stratigraphy,<br />
3. Auflage.- Blackwell.<br />
b) Endogene Dynamik I: Strukturanalyse, Spannung, Verformung, Mechanische Eigenschaften<br />
von Geomaterialien, Falten, Störungen, Risse, Scherzonen, Schersinn-<br />
Indikatoren, Mantelkonvektion, Plattenbewegung, Dynamik von Tektonischen Prozessen.<br />
Rifts, Extensionstektonik, Passive Kontinentalrän<strong>der</strong>, Mittelozeanische Rücken,<br />
Blattverschiebungstekonik, Subduktionszonen, Akkretionskeile, Kontinentkollision.<br />
Magmatismus, Vulkanismus und Metamorphose an Plattenrän<strong>der</strong>n.<br />
Literatur:<br />
<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 24
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />
Ramsay, J. G. & Huber, M. I. (1983): The Techniques of mo<strong>der</strong>n Structural Geology.<br />
Volume 1: Strain Analysis. Academic Press, Inc., London.<br />
Ramsay, J. G. & Huber, M. I. (1987): The Techniques of mo<strong>der</strong>n structural Geology.<br />
Volume 2: Folds and Fractures. Academic Press, London.<br />
Cox, A. & Hart, B. R. (1986): Plate Tectonics - How It Works. Blackwell<br />
Scientific Publications<br />
Kearey, P. & Vine, F. J. (1990): Global Tectonics. Blackwell Science, Oxford.<br />
Gruppengröße<br />
c) Methoden <strong>der</strong> Sedimentologie: Geländeaufnahme & Auswertung, Beschreibung<br />
von Bohrprofilen, Darstsellung geologischer Körper, Vermessung von Säulen- &<br />
Querprofilen, Paläotransportanalyse, Fazies- und Sequenzanalyse, Stratigraphische<br />
Methoden, Seismische Stratigraphie, Geophysikalische Methoden, Korngrößen- und<br />
Partikelanalyse, Mineralseparation.<br />
Literatur:<br />
Emery, D. & Myers, K. (1996): Sequence Stratigraphy.- Oxford (Blackwell).<br />
Lindholm, R. (1987): A practical approach to sedimentology.- London (Allen & Unwin).<br />
Miall, A.D. (1996): The geology of fluvial deposits.- Stuttgart: (Springer).<br />
Müller, G. (1964): Methoden <strong>der</strong> Sedimentuntersuchung.- Stuttgart (Schweizerbart).<br />
Tucker, M. (1996): Methoden <strong>der</strong> Sedimentologie.- Stuttgart (Enke).<br />
unbegrenzt<br />
Kontaktzeit<br />
a) 30 h b) 30 h c) 30 h<br />
Summe: 90 h<br />
Selbststudium a) 60 h b) 60 h c) 60 h<br />
Summe: 180 h<br />
CP<br />
a) 3 CP b) 3 CP c) 3 CP<br />
Summe: 9 CP<br />
Voraussetzung für die a) Klausur (Dauer: 90 Min)<br />
Vergabe von CP b) Klausur (Dauer: 90 Min)<br />
c) Klausur (Dauer: 90 Min)<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
Modul: Umweltgeologie (UWG)<br />
Modulbeauftragter: Prof. Dr. R. Azzam<br />
Dozenten: a) N.N. Georisiken, b) N.N. Neotektonik, c) Azzam / Rüde<br />
Studiengänge<br />
Angebot (Turnus) Dauer Studienjahr<br />
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />
M.Sc. Wirtschaftsgeographie<br />
jährlich<br />
1 Semester 1./2. Studienjahr<br />
Kategorie Erläuterung<br />
Veranstaltungen und a) Vorlesung: Einführung in die Georisiken<br />
Lehrformen<br />
b) Vorlesung: Neotektonik<br />
c) Vorlesung: Ingenieur- und Hydrogeologie I (Einführung)<br />
Voraussetzungen Nebenfach Geologie I o<strong>der</strong> Wahlpflichtmodul W-GG<br />
Lern-/<br />
Das Modul gibt eine Einführung in die grundlegenden Fragestellungen, Begriffe, Kon-<br />
Qualifikationsziele zepte und Arbeitsweisen <strong>der</strong> Neotektonik und <strong>der</strong> Ingenieur- und Hydrogeologie. Die<br />
Studierenden sollten danach verstehen, welche geologischen Prozesse aktuelle die<br />
Erdoberfläche gestalten und welche Risiken davon für die Anthroposphäre ausgehen.<br />
Umgekehrt übt die Nutzung von Fels, Lockergestein und Grundwasser durch den<br />
<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 25
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />
Inhalte<br />
(exemplarisch)<br />
Menschen einen starken Ressourcendruck auf die Geosphäre aus. Es sollten grundlegenden<br />
Verfahren zur Quantifizierung von Einflussgrößen und Materialeigenschaften<br />
danach beherrscht werden.<br />
a) Einführung in die Georisiken: Qualitatives und quantitatives Verständnis <strong>der</strong> endogenen<br />
und exogenen Wechselwirkungsprozesse im System Erde. Grundlagen für<br />
Rekonstruktionen, Bilanzierungen und Vorhersagen sowie numerische Modelle von<br />
Massen- und Energietransport inklusive <strong>der</strong> Analyse von Unsicherheit. Georisiken I:<br />
Erdbeben und Vulkanausbrüche, Hangrutschungen, großräumige Absenkungen;<br />
Georisiken II: Quantitative Risikoanalyse;<br />
Literatur:<br />
Ernst, W.G (2000).: Earth Systems, Cambridge UP<br />
Holland, H.D., Petersen, U (1995): Living Dangerously: The Earth, its Resources and<br />
the Environment, 498 S., Princeton UP<br />
Reice, S.R. (2003): The silver lining: the benefits of natural disasters. Princeton UP.<br />
b) Neotektonik: Bewegungen und Kräfte in <strong>der</strong> oberen Erdkruste und an <strong>der</strong> Erdoberfläche,<br />
über viele Grössenordnungen in Länge und Zeit. Spannungen in <strong>der</strong> Erdkruste.<br />
Rezente Bewegungen (GPS, INSAR). Erdbeben, Vulkanismus, Kopplung zwischen<br />
Deformation, Erosion und Sedimentation.<br />
Literatur:<br />
Cosgrove, J. & Jones, M. (1991): Neotectonics and resources: Wiley & Sons.<br />
Summerfield, M.A. (2000): Geomorphology and global tectonics: Wiley&Sons.<br />
c) Ingenieur- und Hydrogeologie I: Grundlagen <strong>der</strong> Ingenieurgeologie <strong>der</strong> Festgesteine:<br />
Klassifikation von Festgesteinen, Darstellung von Trennflächen; Grundlagen <strong>der</strong><br />
Ingenieurgeologie <strong>der</strong> Lockergesteine: Klassifikation, Bestimmung <strong>der</strong> Zustandsgrenzen;<br />
Grundwasser als Ressource, Wasserkreislauf, Strömung im porösen Medium,Grundwasserleitertypen,<br />
Grundwasservorkommen.<br />
Literatur:<br />
Fetter, C.W. (2002): Applied Hydrogeology.<br />
Langguth, H. & Voigt, R. (2005): Hydrogeologische Methoden.<br />
Prinz, H. (1997): Abriß <strong>der</strong> Ingenieurgeologie, 3. Aufl, Enke Verlag<br />
Smoltczyk, U. (2003): Grundbau Taschenbuch.- Ernst & Sohn Verlag<br />
Gruppengröße 10 Studierende aus <strong>Geographie</strong> und Wirtschaftsgeographie<br />
Kontaktzeit<br />
a) 30 h b) 30 h c) 30 h<br />
Summe: 90 h<br />
Selbststudium a) 60 h b) 60 h c) 60 h<br />
Summe: 180 h<br />
CP<br />
a) 3 CP b) 3 CP c) 3 CP<br />
Summe: 9 CP<br />
Voraussetzung für die a) Klausur (Dauer: 90 Min)<br />
Vergabe von CP b) Klausur (Dauer: 90 Min)<br />
c) Klausur (Dauer: 90 Min)<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 26
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />
Modul: Ressourcengeologie (RG)<br />
Modulbeauftragter: Prof. Dr. M. Meyer<br />
Dozenten: a) Meyer, b) Littke<br />
Studiengänge<br />
Angebot (Turnus) Dauer<br />
Studienjahr<br />
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />
M.Sc. Wirtschaftsgeographie<br />
jährlich<br />
1 Semester 1./2.Studienjahr<br />
Kategorie Erläuterung<br />
Veranstaltungen und a) Vorlesung: Mineralische Lagerstätten I<br />
Lehrformen<br />
b) Vorlesung: Erdöl- und Erdgasgeologie I<br />
Voraussetzungen Nebenfach Geologie I o<strong>der</strong> Wahlpflichtmodul W-GG<br />
Lern-/<br />
a) Einführung in die Grundlagen <strong>der</strong> Lagerstättenlehre, Kenntnisse über Genesemo-<br />
Qualifikationsziele delle, Altersstellung und tektonischen Rahmen von Cu, Mo, W, Sn, Cr, Ni, Pb, Zn, Au,<br />
PGE, Fe und Bauxit Lagerstätten. Verwendung <strong>der</strong> Metallrohstoffe und <strong>der</strong>en Umwelteigenschaften<br />
b) Einführung in die Erdöl- und Kohlengeologie, Entwicklung von Prozessverständnis<br />
in Bezug auf die Ablagerung und Reaktivität von sedimentärem organischem Material<br />
Inhalte<br />
a) Mineralische Lagerstätten I: Vorräte, Ressourcen, Reserven, Prospektion, Explora-<br />
(exemplarisch) tion und Probennahme; Prozesse <strong>der</strong> liquidmagmatischen, pegmatitischen, hydrothermalen<br />
und supergenen Metallanreicherung; Physikochemie erzführen<strong>der</strong> Fluide,<br />
Fluid-Gesteinsreaktionen (hydrothermale Alteration); Genetische Modelle und Klassifikation<br />
von Erzlagerstätten;<br />
Literatur:<br />
Pohl, W.L. (2005): Mineralische und Energie-Rohstoffe. E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung,<br />
Stuttgart, 527 S.<br />
Gruppengröße<br />
b) Erdöl- und Erdgasgeologie I: Entstehung von Erdöl, Erdgas und Kohle aus pflanzlichem<br />
organischem Material in Sedimentgesteinen, Erdölmuttergesteine, Torfe als<br />
Vorläufer <strong>der</strong> Kohle, Klassifizierung von Erdöl, Erdgas und Kohle, erste Grundlagen<br />
und Methoden <strong>der</strong> Erdölgeochemie<br />
Literatur:<br />
Killops, S.D. & Killops, V.J. (1997): Einführung in die Organische Geochemie. Ferd.<br />
Enke Verlag, Stuttgart, 230 S.<br />
a) unbegrenzt b) unbegrenzt<br />
Kontaktzeit<br />
a) 30 h b) 30 h<br />
Summe: 60 h<br />
Selbststudium a) 60 h b) 60 h<br />
Summe: 120 h<br />
CP<br />
a) 3 CP b) 3 CP<br />
Summe: 6 CP<br />
Voraussetzung für die a) Klausur (Dauer: 60 Min)<br />
Vergabe von CP b) Klausur (Dauer: 60 Min)<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 27
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />
Modul: Geländemethoden II (GM-II)<br />
Modulbeauftragter: PD Dr. H. Stollhofen<br />
Dozenten: a) Stollhofen, b) Dozenten des Nebenfaches<br />
Studiengänge<br />
Angebot (Turnus) Dauer<br />
Studienjahr<br />
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />
M.Sc. Wirtschaftsgeographie<br />
jährlich<br />
1 Semester 1./2. Studienjahr<br />
Kategorie Erläuterung<br />
Veranstaltungen und a) Übung: Geländemethoden zur <strong>Angewandte</strong>n Sedimentologie (3 Tage)<br />
Lehrformen<br />
b) Exkursion: Geologische Exkursionen (5 Tage)<br />
Voraussetzungen Nebenfach Geologie I o<strong>der</strong> Wahlpflichtmodul W-GG<br />
Lern-/<br />
Einführung in die Faziesanalyse, selbstständige Anwendung sedimentologischer<br />
Qualifikationsziele Feldmethoden und die Darstellung sedimentologischer Körper im Raum.<br />
Inhalte<br />
a) Geländemethoden zur <strong>Angewandte</strong>n Sedimentologie: Faziesmodelle, Charakteris-<br />
(exemplarisch) tika und Erkennungsmerkmale klastischer Ablagerungsräume, Sedimentologische<br />
Profilaufnahme, Sedimentologische Feldmethoden<br />
Literatur:<br />
Lee<strong>der</strong>, M.R. (1999): Sedimentology and sedimentary basins.-Blackwell<br />
Reading, H.G. (1996): Sedimentary environments. Processes, facies and stratigraphy,<br />
3. Auflage.- Blackwell<br />
Reineck, H.E. & Singh, I.B. (1980): Depositional sedimentary environments.- Springer,<br />
Berlin<br />
Walker, R.G. & James, N.P. (1992): Facies models: response to sea-level change.-<br />
St. Johns (Geol. Assoc. Canada)<br />
b) Geologische Exkursionen: Erfassen unterschiedlicher geologischer Fragestellungen<br />
im Gelände, praktische methodische Arbeit (Aufschlussaufnahme, Gesteinsbestimmung,<br />
Bestimmung von Lagerungsverhältnissen), Verfassen eines Exkursionsberichts.<br />
Literatur: nach Absprache, abhängig vom Exkursionsziel<br />
Gruppengröße a) 15 b) 15<br />
Kontaktzeit<br />
a) 30 h b) 50 h<br />
Summe: 80 h<br />
Selbststudium a) 30 h b) 70 h<br />
Summe: 100 h<br />
CP<br />
a) 2 CP b) 4 CP<br />
Summe: 6 CP<br />
Voraussetzung für die a) Bericht zu den Profilaufnahmen (Bearbeitungszeit: 1 Woche)<br />
Vergabe von CP b) Exkursionsbericht (Bearbeitungszeit: 1 Woche, 1 Bericht je Exkursion<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 28
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />
Nebenfach: Informatik<br />
Module SWS CP Semester<br />
Programmierung (NF) 4 4 1<br />
Datenstrukturen und Algorithmen (NF) 3 4 2<br />
Grundzüge <strong>der</strong> Informatik (NF) 3 4 1<br />
Grundzüge <strong>der</strong> Softwareentwicklung (NF) 3 4 2<br />
Datenbanken und Informationssysteme (NF) 5 6 4<br />
Softwarepraktikum (NF) 4 8 3, 4<br />
Programmierung (IF-1) (NF)<br />
Modulbeauftragter: Prof. U. Schroe<strong>der</strong><br />
Veranstaltungen a) Programmierung (Service): Vorlesung mit begleiten<strong>der</strong> Übung<br />
Lern-/<br />
Qualifikationsziele<br />
Inhalte<br />
(exemplarisch)<br />
Erwerb <strong>der</strong> folgenden Kenntnisse und Fähigkeiten:<br />
- Kenntnis <strong>der</strong> wesentlichen Konzepte imperativer und objektorientierter Programmiersprachen<br />
sowie wichtiger Programmiertechniken in diesen Sprachen<br />
- Kenntnis grundlegen<strong>der</strong> Datenstrukturen und ihrer Realisierung<br />
- Fähigkeit zur selbständigen Entwicklung kleinerer Programme und ihrer Dokumentation<br />
unter Beachtung üblicher Programmierkonventionen<br />
- Kenntnis grundlegen<strong>der</strong> Beschreibungsformen für Programmiersprachen<br />
In <strong>der</strong> Vorlesung wird <strong>der</strong> systematische Entwurf von Java-Programmen als Vorbereitung<br />
auf die objekt-orientierte Software-Entwicklung erarbeitet. Darüber hinaus werden<br />
die begrifflichen Grundlagen von Programmiersprachen entwickelt.<br />
Themen:<br />
- Algorithmus und Programm<br />
- Syntax und Semantik<br />
- Einführung in objektorientiertes Modellieren und Programmieren, Objekte und<br />
Klassen<br />
- Imperative Elemente von Programmiersprachen<br />
- Variablen, Datentypen, Ausdrücke<br />
- Anweisungen<br />
- Schleifen und Fel<strong>der</strong><br />
- Methoden und Rekursion<br />
- Rekursive Datenstrukturen<br />
- Vererbung, Redefinition, Polymorphie und Dynamisches Binden<br />
Literatur:<br />
DOUGLAS B., MIKE PARR (2002): Java für Studenten, Pearson Studium.<br />
JUDUTH BISHOP (2001): Java lernen. 2. Aufl., Addison-Wesley.<br />
DAVID J. BARNES & MICHAEL KÖLLING (2003): Objects First with Java – A Practical<br />
Introduction using BlueJ, Prentice Hall / Pearson Education.<br />
KLAUS ECHTLE, MICHAEL GOEDICKE (2000): Lehrbuch <strong>der</strong> Programmierung mit Java.<br />
Dpunkt-Verlag.<br />
<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 29
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />
Gruppengröße<br />
Kontaktzeit<br />
a) 60 h<br />
Summe: 60 h<br />
Selbststudium a) 60 h<br />
Summe: 60 h<br />
Kreditpunkte (CP) a) 4 CP<br />
Kreditpunkte: 4 CP<br />
Prüfungsleistungen Klausur (90 Minuten); die Zulassung zur Modulprüfung erfolgt vorbehaltlich <strong>der</strong> regelmäßigen<br />
Abgabe <strong>der</strong> erfolgreich bearbeiteten Übungsaufgaben des Moduls und <strong>der</strong><br />
aktiven Mitarbeit in den Übungen<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
Datenstrukturen und Algorithmen (IF-2) (NF)<br />
Modulbeauftragter: Prof. T. Seidl<br />
Veranstaltungen a) Datenstrukturen und Algorithmen (Service): Vorlesung mit begleiten<strong>der</strong> Ü-<br />
Lern-/<br />
Qualifikationsziele<br />
Inhalte<br />
(exemplarisch)<br />
bung<br />
a) Erwerb <strong>der</strong> folgenden Kenntnisse und Fähigkeiten:<br />
- Kenntnis grundlegen<strong>der</strong> Entwurfsmethoden für Algorithmen<br />
- Verständnis <strong>der</strong> wesentlichen Komplexitätskategorien für Laufzeit und Speicherbedarf<br />
von Algorithmen sowie Beherrschung einfacher Methoden zur Analyse<br />
von Algorithmen<br />
- Kenntnis effizienter Algorithmen und Datenstrukturen für Standardprobleme (Suchen<br />
in Mengen, Sortieren, Graphenalg.)<br />
- Fähigkeit zur Auswahl und Kombination von Algorithmen und Datenstrukturen<br />
und <strong>der</strong>en Umsetzung in imperativen und objektorientierten Programmiersprachen<br />
Entwurf und Analyse von Algorithmen<br />
- Worst-Case-Analyse, asymptotische Komplexität („Oh-Notation“) und Komplexitätskategorien<br />
(z.B. exponentiell, polynomiell)<br />
- Algorithmische Paradigmen (z.B. Greedy, Divide-and-Conquer)<br />
- Algorithmen für Sortierprobleme<br />
- elementare Sortieralgorithmen (z.B. Insertionsort)<br />
- fortgeschrittene Sortierverfahren (Merge-, Quick-, Heapsort)<br />
- Schlüsselbasiertes Sortieren (z.B. Bucketsort)<br />
- Datenstrukturen zur Verwaltung von Mengen<br />
- Repräsentation von Mengen durch Bäume<br />
- Binäre Suchbäume<br />
- Balancierte Suchbäume, insbeson<strong>der</strong>e B- und R-Bäume<br />
- Priority Queues<br />
- Hashingverfahren<br />
- Graphen: Modellierung und Algorithmen<br />
- Graphmodelle und Anwendungen<br />
- Tiefensuche, Breitensuche<br />
- Bestimmung kürzester Wege<br />
- Berechnung minimaler Spannbäume<br />
Literatur:<br />
<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 30
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />
Gruppengröße<br />
T. CORMEN, C. LEISERSON, R. RIVEST, C. STEIN (2001): Introduction to Algorithms, MIT<br />
Press and McGraw-Hill.<br />
T. OTTMANN, P. WIDMAYER (2002): Algorithmen und Datenstrukturen, Spektrum Akademischer<br />
Verlag.<br />
R SEDGEWICK (2002): Algorithms in Java: Fundamentals, data structures, sorting<br />
searching, Addison-Wesley.<br />
H. NEY (1999): Algorithmen und Datenstrukturen, <strong>RWTH</strong>.<br />
Kontaktzeit<br />
a) 90 h<br />
Summe: 90 h<br />
Selbststudium a) 30 h<br />
Summe: 30 h<br />
Kreditpunkte (CP) a) 4 CP<br />
Kreditpunkte: 4 CP<br />
Prüfungsleistungen Klausur (90 Minuten); die Zulassung zur Modulprüfung erfolgt vorbehaltlich <strong>der</strong> regelmäßigen<br />
Abgabe <strong>der</strong> erfolgreich bearbeiteten Übungsaufgaben des Moduls und <strong>der</strong><br />
aktiven Mitarbeit in den Übungen<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
Grundzüge <strong>der</strong> Informatik (IF-3) (NF)<br />
Modulbeauftragter: Bischof, Freiling<br />
Veranstaltungen a) Vorlesung und Übung Grundzüge <strong>der</strong> Informatik<br />
Lern-/<br />
Qualifikationsziele<br />
Inhalte<br />
(exemplarisch)<br />
Erwerb <strong>der</strong> folgenden Kenntnisse und Fähigkeiten:<br />
- spezielles Wissen über Hintergrund, Bedienung und Möglichkeiten aktueller<br />
Computersysteme<br />
- Einführung in die prinzipielle Funktionsweise von Rechnern, Grundzüge und<br />
Konzepte von Betriebssystemen<br />
- konzeptionelles Wissen über die Benutzung mo<strong>der</strong>ner Rechnersysteme anhand<br />
<strong>der</strong> Befehlssprachen von Betriebssystemen<br />
- Umgang mit wichtigen Dienst- und Anwendungsprogrammen, Editoren, Textverarbeitungs-<br />
sowie Datenbanksysteme<br />
- mo<strong>der</strong>ne Netzwerkdienste<br />
- in Übungen: Betriebssysteme samt spezifischer Anwendungssoftware; Schwerpunkte:<br />
Anwendung von Befehls-Prozeduren, E-Mail, Umgang mit dem Internet,<br />
Interprozesskommunikation, Datenbanken<br />
- Was ist Informatik? (Informatik‚ Programmierung)<br />
- Grundlagen (u.a. Informations-/Zahlendarstellung, Anwendungsprogramme),<br />
- Rechnerstrukturen (u.a. Boolsche Algebra),<br />
- Betriebssysteme (am Beispiel von UNIX),<br />
- Rechnernetze (u.a. Protokolle und Netze, Netztechnologien),<br />
- Internet (u.a. Dienste im Internet, WWW),<br />
- Datenbanksysteme (u.a. SQL),<br />
- IT-Sicherheit<br />
Literatur:<br />
Folien und Skripte zur Vorlesung sowie z. B. folgende Bücher<br />
H. P. GUMM, M. SOMMER (2004): Einführung in die Informatik. Oldenbourg, München<br />
(6. Auflage).<br />
<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 31
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />
Gruppengröße<br />
Kontaktzeit<br />
a) 90 h<br />
Summe: 90 h<br />
Selbststudium a) 30 h<br />
Summe: 30 h<br />
Kreditpunkte (CP) a) 4 CP<br />
Kreditpunkte: 4 CP<br />
Prüfungsleistungen Klausur (90 Minuten); die Zulassung zur Modulprüfung erfolgt vorbehaltlich <strong>der</strong> regelmäßigen<br />
Abgabe <strong>der</strong> erfolgreich bearbeiteten Übungsaufgaben des Moduls und <strong>der</strong><br />
aktiven Mitarbeit in den Übungen<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
Grundzüge <strong>der</strong> Softwareentwicklung (IF-4) (NF)<br />
Modulbeauftragter: Prof. U. Naumann<br />
Veranstaltungen a) Grundzüge <strong>der</strong> Softwareentwicklung (Service): Vorlesung mit begleiten<strong>der</strong><br />
Lern-/<br />
Qualifikationsziele<br />
Inhalte<br />
(exemplarisch)<br />
Übung<br />
Lernziel <strong>der</strong> Vorlesung ist zum einen, den Softwareentwicklungs-Prozess sowie sein<br />
komplexes Produkt kennen zu lernen und zu charakterisieren. Zum an<strong>der</strong>en werden<br />
die Aktivitätenblöcke <strong>der</strong> Softwareentwicklung erörtert und Notationen für das Festhalten<br />
<strong>der</strong> Teilergebnisse sowie ihres Zusammenhangs eingeführt. Schließlich werden<br />
auch die Hauptklassen von Softwaresystemen skizziert.<br />
In den Übungen werden die angesprochenen Aspekte einzeln vertieft. Darüber hinaus<br />
ergeben die Resultate einiger Übungen ein größeres Beispiel. Schließlich tauchen<br />
Übungsaufgaben zu den Hauptklassen Transformationssysteme, Interaktive Systeme<br />
sowie eingebettete Systeme auf.<br />
- Einführung/Grundbegriffe: Motivation, Realität, Einordnung, Vision<br />
- Aktivitäten und Dokumente im Software-Lebenszyklus: Phasen, Arbeitsbereiche,<br />
Zusammenhang, Diskussion, Lebenszyklus-Modelle<br />
- Der Entwicklungs- und Wartungsprozess: Allg. Aspekte, Wartung, kritische Bereiche,<br />
Eigenschaften Programmsysteme, Modellierungsproblematik, Prinzipien <strong>der</strong><br />
Modellierung, Prozesse/Konfigurationen, Statik/Dynamik<br />
- Requirements Engineering: Klärung, Struktur des Prozesses, Glie<strong>der</strong>ung Ergebnisse,<br />
Anfor<strong>der</strong>ungs-Spezifikation: Ermittlung, Perspektiven, Probleme, Rollen,<br />
Zusammenhang <strong>der</strong> Ergebnisse<br />
- Anfor<strong>der</strong>ungsspezifikation und Notationen: Sprachen für das Requirements Engineering,<br />
Vorstellung einiger UML-Notationen, Probleme <strong>der</strong> Sprache/Methodik,<br />
kleine Fallstudie<br />
- Entwurf/Architekturerstellung Software-Architekturen: Begriffsklärung, Bedeutung,<br />
Entwurfsprozess und Ergebnisse<br />
- Notationen für Architekturen: Sprachen für Architekturen, UML: Ergänzungen,<br />
Modulare Ansätze, Verteilung und techn. Architekturen<br />
- Formale Spezifikation: Einordnung/Klassifikation, algebraische Spezifikation,<br />
Verhaltensspezifikation, operationale Spezifikation für Kernteile des Systems<br />
- Projektmanagement: Teilaspekte Gruppenmodelle, Aufwandsschätzverfahren,<br />
Konfigurationsverwaltung<br />
- Dokumentation: Übersicht, Benutzerdokumentation, Entwicklungsdokumentation,<br />
- Qualitätssicherung: Klassifikation und häufigste Arten, Formen menschlicher<br />
<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 32
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />
-<br />
Begutachtung, Allgemeines zu Test, Modul-/Teilsystem-, Integrations-, Abnahme-<br />
Test, Testplanung und Beendigung<br />
Wartung: Reverse-/Reengineering, Integration, Verteilung, Beispiele<br />
Literatur:<br />
H. BALZERT: ''Lehrbuch <strong>der</strong> Software-Technik 1'', Spektrum Akadem. Verlag<br />
C. GHEZZI, M. JAZAYERI, D. MANDRIOLI: ''Fundamentals of Software Engineering'',<br />
Prentice Hall<br />
H. LICHTER: ''Entwicklung und Umsetzung von Architektruprototypen für Anwendungssoftware''<br />
M. NAGL: ''Softwaretechnik: Methodisches Programmieren im Großen'', Springer I.<br />
Sommerville: ''Software-Engineering'', Addison-Wesley<br />
Gruppengröße<br />
Kontaktzeit<br />
a) 45 h<br />
Summe: 45 h<br />
Selbststudium a) 75 h<br />
Summe: 75 h<br />
Kreditpunkte (CP) a) 4 CP<br />
Kreditpunkte: 4 CP<br />
Prüfungsleistungen Klausur (90 Minuten); die Zulassung zur Modulprüfung erfolgt vorbehaltlich <strong>der</strong> regelmäßigen<br />
Abgabe <strong>der</strong> erfolgreich bearbeiteten Übungsaufgaben des Moduls und <strong>der</strong><br />
aktiven Mitarbeit in den Übungen<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
Datenbanken und Informationssysteme (IF5) (NF)<br />
Modulbeauftragter: Prof. M. Jarke<br />
Veranstaltungen a) Datenbanken und Informationssysteme: Vorlesung mit begleiten<strong>der</strong> Übung<br />
Lern-/<br />
Qualifikationsziele<br />
Inhalte<br />
(exemplarisch)<br />
- Grundverständnis <strong>der</strong> Rolle von Datenbanken und Informationssystemen<br />
- Gute Kenntnis und erste praktische Erfahrung mit dem relationalen Datenbankmodell,<br />
insbeson<strong>der</strong>e den relationalen Anfragesprachen (SQL) und ihren formalen<br />
Grundlagen<br />
- Grundkenntnisse <strong>der</strong> Vorgehensweise beim relationalen Datenbankentwurf,<br />
insbeson<strong>der</strong>e konzeptuelle Modellierung und Normalisierungstheorie<br />
- Verständnis <strong>der</strong> Grundprobleme und Ansätze <strong>der</strong> Datenbankimplementierung<br />
und Datenbankadministration (Architektur, Anfrageauswertung, Transaktionsmanagement)<br />
- Grundüberblick über objektorientierte, objektrelationale und semi-strukturierte<br />
Datenmodelle sowie über Entwurf betrieblicher Informationssysteme<br />
- Praktische Rechnererfahrung mit SQL, XML, ERP-Systemen<br />
- Aufgaben und Bedeutung von Informationssystemen<br />
- Relationale Datenbankmodelle<br />
- Relationale Anfragesprachen und ihre formalen Grundlagen<br />
- Entwurf relationaler Datenbanken (konzeptuelle Modellierung, Normalisierungstheorie)<br />
- Grundelemente relationaler Datenbankimplementierung (Architekturen, Anfrageverarbeitung,<br />
Transaktionsmanagement)<br />
- Überblick neuere Datenmodelle<br />
- objektorientierte / objektrelationale Datenbanken<br />
<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 33
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />
- Internet-Informationssysteme/ XML<br />
- Betriebliche Informationsmodellierung und ERP<br />
- Praktische Übungen im Datenbanklabor: SQL-Day, XML-Day, ERP-Day<br />
Literatur:<br />
ELMASRI R., NAVATHE S.B.: Fundamentals of Database Systems. Benjamin-<br />
Cummings.<br />
KEMPER, A., EICKER, A.: Datenbanksysteme – eine Einführung. Oldenbourg.<br />
VOSSEN G.: Datenmodelle, Datenbanksprachen und Datenbank-<br />
Managementsysteme. Addison-Wesley.<br />
Gruppengröße<br />
Kontaktzeit<br />
a) 120 h<br />
Summe: 120 h<br />
Selbststudium a) 60 h<br />
Summe: 60 h<br />
Kreditpunkte (CP) a) 6 CP<br />
Kreditpunkte: 6 CP<br />
Prüfungsleistungen Klausur (90 Minuten); die Zulassung zur Modulprüfung erfolgt vorbehaltlich <strong>der</strong> regelmäßigen<br />
Abgabe <strong>der</strong> erfolgreich bearbeiteten Übungsaufgaben des Moduls und <strong>der</strong><br />
aktiven Mitarbeit in den Übungen<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
Softwarepraktikum (IF-6) (NF)<br />
Modulbeauftragter: Prof. H. Lichter<br />
Veranstaltungen a) Softwarepraktikum<br />
Lern-/<br />
Der Schwerpunkt des Praktikums liegt darauf, den Teilnehmern fundierte Program-<br />
Qualifikationsziele mierkenntnisse zu vermitteln. Dies geschieht dadurch, dass ein größeres Programmsystem.<br />
Die Teilnehmer erlernen dazu intensiv die verwendete Programmiersprache<br />
und wissen, wie diese anzuwenden ist. Weiterhin erlernen sie den Umgang mit mo<strong>der</strong>nen<br />
Entwicklungswerkzeugen, die Dokumentation sowie die Präsentation <strong>der</strong><br />
erarbeiteten Ergebnisse. Um die Ergebnisse systematisch zu prüfen, führen die Teilnehmer<br />
Software-Inspektionen und Tests durch. Dadurch dass die Aufgaben in Kleingruppen<br />
bearbeitet werden, lernen die Teilnehmer sich in ein Team zu integrieren und<br />
gemeinsam Ergebnisse zu erarbeiten. Abstimmungs- und Präsentationssitzungen<br />
dienen dazu, die Präsentations- und Vortragstechnik zu verbessern.<br />
Inhalte<br />
- Fundierte Kenntnisse in einer Programmiersprache<br />
(exemplarisch) - Implementierung gemäß Programmierrichtlinien<br />
- Entwicklung und Durchführung von Software-Tests<br />
- Prüfung <strong>der</strong> erarbeiteten Ergebnisse durch Inspektionen<br />
- Systematische, strukturierte Dokumentation des Codes<br />
- Umgang mit einer mo<strong>der</strong>nen Entwicklungsumgebung<br />
- Präsentation <strong>der</strong> erarbeiteten Ergebnisse<br />
Literatur: in Abhängigkeit von <strong>der</strong> eingesetzten Programmiersprache<br />
Gruppengröße<br />
Kontaktzeit<br />
a) 120 h<br />
Summe: 120 h<br />
Selbststudium a) 120 h<br />
Summe: 120 h<br />
Kreditpunkte (CP) a) 8 CP<br />
Kreditpunkte: 8 CP<br />
Prüfungsleistungen Regelmäßige Lösung von Übungs- und Programmieraufgaben, aktive Übungsteil-<br />
<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 34
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />
nahme und schriftliche Prüfung(en) (90 Minuten)<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 35
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />
Nebenfach: Mathematik<br />
Module SWS CP Semester<br />
Höhere Mathematik I (NF) 6 8 1<br />
Höhere Mathematik II (NF) 6 8 2<br />
Höhere Mathematik III (NF) 6 8 3<br />
Höhere Mathematik IV* 4 4 4<br />
Einführung in die <strong>Angewandte</strong> Stochastik (NF) 3 6 2<br />
* <strong>der</strong> Besuch dieser Veranstaltung ist freiwillig und nicht Voraussetzung für das Nebenfach Mathematik.<br />
Höhere Mathematik I (HMA I) (NF)<br />
Modulbeauftragter: Prof. Dr. J. Bemelmans, Prof. Dr. M. Wiegner<br />
Veranstaltungen a) Höhere Mathematik I (V4/Ü2, Diskussionsrunden)<br />
Lern-/<br />
Qualifikationsziele<br />
Inhalte<br />
(exemplarisch)<br />
a) Höhere Mathematik I (V/Ü)<br />
Die Studierenden sollen:<br />
- das Verständnis für die grundlegenden mathematischen Prinzipien und<br />
Strukturkonzepte entwickeln,<br />
- die Grundbegriffe und –techniken sicher beherrschen und die Fähigkeit zum<br />
aktiven Umgang mit den Gegenständen <strong>der</strong> Lehrveranstaltungen erwerben,<br />
- die mathematische Arbeitsweise erlernen, mathematische Intuition entwickeln<br />
und <strong>der</strong>en Umsetzung anhand konkreter Probleme einüben,<br />
- durch Klausurtraining ein Gespür für den Umfang und Schwierigkeitsgrad einer<br />
schriftlichen Klausur sowie eine Einsicht in die gewünschte Lösungsdarstellung<br />
bekommen,<br />
- das Basiswissen und Fertigkeiten für das gesamte weitere Studium erwerben.<br />
a) Höhere Mathematik I (V/Ü)<br />
Zahlen: Addition und Multiplikation reeller Zahlen, Anordnungsaxiome, Vollständigkeitsaxiom,<br />
vollständige Induktion, Abstand und Betrag reeller Zahlen, einige elementare<br />
Ungleichungen; Reelle Funktionen, Grenzwert, Stetigkeit: Funktionen, Polynome<br />
und rationale Funktionen, Zahlenfolgen, Grenzwerte von Funktionen, Eigenschaften<br />
stetiger Funktionen, Unendliche Reihen, Potenzreihen; Vektorrechnung: Der Vektorraum<br />
Rn , Geometrie im Rn , Geometrische Eigenschaften <strong>der</strong> komplexen Zahlen; Lineare<br />
Algebra: Vektorräume, Lineare Abbildungen, Lineare Gleichungssysteme, Determinanten,<br />
Eigenwerte und Eigenvektoren, Symmetrische Matrizen, quadratische<br />
Formen, Hauptachsentransformation; Einführung in die Differentialrechnung: Ableitung<br />
und Differential, Berechnung von Ableitungen, Der Mittelwertsatz <strong>der</strong> Differentialrechnung<br />
Literatur:<br />
K. MEYBERG, P. VACHENAUER (2001): Höhere Mathematik 1 und 2. Berlin, 2001.<br />
<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 36
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />
K. BURG, H. HAF, R. WILLE (2006): Höhere Mathematik für Ingenieure, I (Analysis) und<br />
II (Lineare Algebra). 2006.<br />
BÄRWOLFF, G. (2006): Höhere Mathematik für Naturwissenschaftler und Ingenieure.<br />
Heidelberg, 2006.<br />
Gruppengröße<br />
Kontaktzeit<br />
a) 90 h<br />
Summe: 90 h<br />
Selbststudium a) 150 h<br />
Summe: 150 h<br />
Kreditpunkte (CP) a) 8 CP<br />
Kreditpunkte: 8 CP<br />
Prüfungsleistungen a) Klausur (90 min)<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
Höhere Mathematik II (NF)<br />
Modulbeauftragter: Prof. Dr. J. Bemelmans, Prof. Dr. M. Wiegner<br />
Veranstaltungen b) Höhere Mathematik II (V4/Ü2, Diskussionsrunden)<br />
Lern-/<br />
Qualifikationsziele<br />
Inhalte<br />
(exemplarisch)<br />
Gruppengröße<br />
Kontaktzeit<br />
Selbststudium<br />
Kreditpunkte (CP)<br />
b) Höhere Mathematik II (V/Ü)<br />
Die Studierenden sollen:<br />
- das Verständnis für einige grundlegende Prinzipien <strong>der</strong> Analysis, insbeson<strong>der</strong>e<br />
die (mehrdimensionale) Differential- und (eindimensionale) Integralrechnung<br />
sowie den Kompaktheitsbegriff entwickeln<br />
- die Grundbegriffe und –techniken sicher beherrschen und die Fähigkeit zum<br />
aktiven Umgang mit den Gegenständen <strong>der</strong> Lehrveranstaltung erwerben,<br />
- einfache physikalische Probleme durch Differentialgleichungen zu modellieren<br />
und durch Anwendung <strong>der</strong> Theorie zu behandeln,<br />
- durch Klausurtraining ein Gespür für den Umfang und Schwierigkeitsgrad einer<br />
schriftlichen Klausur sowie eine Einsicht in die gewünschte Lösungsdarstellung<br />
bekommen.<br />
b) Höhere Mathematik II (V/Ü)<br />
Das bestimmte Integral: Definition und grundlegende Eigenschaften, Kriterien für die<br />
Integrierbarkeit von Funktionen, Integralungleichungen und Mittelwertsätze; Hauptsätze<br />
<strong>der</strong> Differential- und Integralrechnung. Anwendungen: Erster und zweiter<br />
Hauptsatz, Partielle Integration und Substitutionsregel, das Unbestimmte Integral,<br />
Integration rationaler Funktionen, Taylorsche Reihe und Anwendungen, Einführung in<br />
die gewöhnlichen Differentialgleichungen, eine Anwendung auf lineare Differentialgleichungssysteme,<br />
weitere spezielle Differentialgleichungen erster Ordnung, Gewöhnliche<br />
Differentialgleichungen zweiter Ordnung (I), Uneigentliche Integrale; Funktionen<br />
mehrerer Verän<strong>der</strong>licher: Stetige Funktionen, Differentiation, Kurven in <strong>der</strong><br />
Ebene und im Raum, Ausbau <strong>der</strong> Differentialrechnung und Anwendungen<br />
Literatur:<br />
s. Modul Höhere Mathematik I<br />
b) 90 h<br />
b) 150 h<br />
b) 8 CP<br />
Summe: 90 h<br />
Summe: 150 h<br />
Kreditpunkte: 8 CP<br />
<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 37
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />
Prüfungsleistungen b) Klausur (90 min)<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
Höhere Mathematik III (NF)<br />
Modulbeauftragter: Prof. Dr. J. Bemelmans, Prof. Dr. M. Wiegner<br />
Veranstaltungen c) Höhere Mathematik III (V4/Ü2, Diskussionsrunden)<br />
Lern-/<br />
c) Höhere Mathematik III (V/Ü)<br />
Qualifikationsziele Die Studierenden sollen:<br />
- die Problematik <strong>der</strong> Volumenmessung und Integration in höheren Dimensionen<br />
kennen lernen und verstehen,<br />
- den praktischen Umgang mit mehrdimensionalen Integralen erlernen,<br />
- grundlegende Prinzipien <strong>der</strong> Vektoranalysis (Integralsätze von Gauß, Stokes)<br />
auf physikalische Fragestellungen anwenden,<br />
- grundlegende Konzepte <strong>der</strong> Wahrscheinlichkeitstheorie verstehen und anwenden<br />
lernen.<br />
Inhalte<br />
c) Höhere Mathematik III (V/Ü)<br />
(exemplarisch)<br />
Gruppengröße<br />
Funktionen mehrerer Verän<strong>der</strong>licher (Fortsetzung): Integration von Funktionen mehrerer<br />
Verän<strong>der</strong>licher, Uneigentliche Parameterintegrale; Integralsätze: Kurvenintegrale,<br />
Gaußscher Satz und 2. Hauptsatz für Kurvenintegrale in <strong>der</strong> Ebene, Transformationssatz<br />
für Gebietsintegrale, Der Satz über implizite Funktionen, Flächen in Parameterdarstellung.<br />
Oberflächenintegrale, Der Integralsatz von Gauß (im Raum), Der Integralsatz<br />
von Stokes; Gewöhnliche Differentialgleichungen (II): Exakte Differentialgleichungen,<br />
Rand- und Eigenwertaufgaben für gewöhnliche Differentialgleichungen<br />
zweiter Ordnung; Funktionsreihen, insbeson<strong>der</strong>e Fourier-Reihen: Einleitung, Gleichmäßige<br />
Konvergenz, Trigonometrische Polynome und trigonometrische Reihen, Der<br />
Hauptsatz über Fourier-Reihen; Grundbegriffe <strong>der</strong> Wahrscheinlichkeitsrechnung: Der<br />
Wahrscheinlichkeitsraum, Bedingte Wahrscheinlichkeit und stochastische Unabhängigkeit,<br />
Satz von <strong>der</strong> totalen Wahrscheinlichkeit und Bayessche Formel, Zufallsvariable<br />
und Verteilungsfunktionen, Erwartungswert, Varianz und Streuung, Tschebyschew-<br />
Ungleichung und schwaches Gesetz <strong>der</strong> großen Zahl, Der zentrale Grenzwertsatz<br />
Literatur:<br />
s. Modul Höhere Mathematik I<br />
K. MEYBERG, P. VACHENAUER (2001): Höhere Mathematik 1, 2. Berlin 2001.<br />
K. BURG, H. HAF, R. WILLE (2002): Höhere Mathematik für Ingenieure, III (Gewöhnliche<br />
Differentialgleichungen), IV (Vektoranalysis, Funktionentheorie), 2002.<br />
W. DAHMEN, A. REUSKEN (2006): Numerik für Ingenieure und Naturwissenschaftler,<br />
Berlin 2006.<br />
Kontaktzeit<br />
c) 90 h<br />
Summe: 90 h<br />
Selbststudium c) 150 h<br />
Summe: 150 h<br />
Kreditpunkte (CP) c) 8 CP<br />
Kreditpunkte: 8 CP<br />
Prüfungsleistungen c) Klausur (90 min)<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 38
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />
Höhere Mathematik IV (freiwillige Veranstaltung)<br />
Modulbeauftragter: Prof. Dr. J. Bemelmans, Prof. Dr. M. Wiegner<br />
Veranstaltungen d) Höhere Mathematik IV (V2/Ü2)<br />
Lern-/<br />
Qualifikationsziele<br />
Inhalte<br />
(exemplarisch)<br />
Gruppengröße<br />
Kontaktzeit<br />
Selbststudium<br />
Kreditpunkte (CP)<br />
d) Höhere Mathematik IV (V/Ü)<br />
Die Studierenden sollen:<br />
- wichtige Grundlagen für die theoretische Physik kennen lernen und mit den<br />
Begriffen umgehen können,<br />
- funktionstheoretische Methoden kennen lernen, soweit sie in <strong>der</strong> Theoretischen<br />
Elektrotechnik verwendet werden,<br />
- selbständig erkennen, welche mathematischen Methoden für praktische<br />
Probleme eingesetzt werden können,<br />
- grundlegende Prinzipien <strong>der</strong> Numerik erlernen; numerische Methoden kennen<br />
lernen und auf physikalische Fragestellungen anwenden.<br />
Numerische Mathematik:<br />
Die Studierenden sollen:<br />
- selbständig erkennen, welche mathematischen Methoden für praktische<br />
Probleme eingesetzt werden können,<br />
- grundlegende Prinzipien <strong>der</strong> Numerik erlernen; numerische Methoden kennen<br />
lernen und auf physikalische Fragestellungen anwenden.<br />
d) Höhere Mathematik IV (V/Ü)<br />
Funktionentheorie: Einleitung, Abbildungseigenschaften komplexer Funktionen, Differentiation<br />
komplexer Funktionen, Integralsatz und Integralformel von Cauchy, Analytische<br />
Funktion, Die Laurent-Entwicklung, Der Residuensatz, Untersuchung partieller<br />
Differentialgleichungen mit Methoden <strong>der</strong> Funktionentheorie; Die Fourier-<br />
Transformation:<br />
Einleitung, Lösung einer Dirichletschen Randwertaufgabe durch Fourier-Reihen, Die<br />
Fourier-Transformation. Lösung einer Dirichletschen Randwertaufgabe durch Fourier-<br />
Transformation, Eigenschaften <strong>der</strong> Fourier-Transformation, Das Fouriersche Integraltheorem;<br />
Die Laplace-Transformation: Grundlegende Eigenschaften, Einige Anwendungen<br />
<strong>der</strong> Laplace-Transformation<br />
Numerische Mathematik:<br />
Fehleranalyse: Kondition, Rundungsfehler, Stabilität, Lineare Gleichungssysteme,<br />
direkte Lösungsverfahren, Ausgleichsrechnung, Fehlerquadratmethode, Iterative<br />
Lösung von Gleichungssystemen, Interpolation mit Polynomen, Numerische Integration,<br />
Gewöhnliche Differentialgleichungen, Anfangswertprobleme, Berechnung von<br />
Eigenwerten und Eigenvektoren, Nichtlineare Ausgleichsrechnung.<br />
Literatur: s. Modul Höhere Mathematik III<br />
d) 60 h<br />
d) 60 h<br />
d) 4 CP<br />
Summe: 60 h<br />
Summe: 60 h<br />
Kreditpunkte: 4 CP<br />
<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 39
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />
Prüfungsleistungen d) Klausur (90 min)<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
Einführung in die <strong>Angewandte</strong> Stochastik (NF)<br />
Modulbeauftragter: Prof. Dr. U. Kamps, Prof. Dr. E. Cramer<br />
Veranstaltungen a) Einführung in die <strong>Angewandte</strong> Stochastik (V3/Ü1)<br />
Lern-/<br />
Qualifikationsziele<br />
Inhalte<br />
(exemplarisch)<br />
a) Einführung in die <strong>Angewandte</strong> Stochastik (V/Ü)<br />
• Entwicklung eines grundlegenden Verständnisses stochastischer Modelle zur<br />
Analyse zufallsabhängiger Vorgänge<br />
• Bildung einer Basis zur Auswahl und Anwendung geeigneter statistischer Verfahren<br />
in konkreten Situationen<br />
• Verständnis und Einüben <strong>der</strong> wesentlichen Begriffe und Argumentationen <strong>der</strong><br />
Stochastik<br />
• Erwerben von Fähigkeiten zum selbständigen Umgang mit den Inhalten <strong>der</strong><br />
Lehrveranstaltung<br />
- Sichere Beherrschung <strong>der</strong> grundlegenden Methoden <strong>der</strong> Stochastik<br />
a) Einführung in die <strong>Angewandte</strong> Stochastik (V/Ü)<br />
1. Einleitung<br />
2. Wahrscheinlichkeitsrechnung<br />
a. Wahrscheinlichkeitsräume<br />
i. Grundlagen <strong>der</strong> Wahrscheinlichkeitsrechnung (Mengentheoretische<br />
Grundlagen, Kolmogorov-Axiome, Laplace-Modell,<br />
Grundformeln <strong>der</strong> Kombinatorik)<br />
ii. Diskrete Wahrscheinlichkeitsmaße (Binomialverteilung, Poisson-Verteilung,<br />
Geometrische Verteilung, ...)<br />
iii. Eigenschaften von Wahrscheinlichkeitsmaßen<br />
iv. Bedingte Wahrscheinlichkeiten<br />
v. Stochastische Unabhängigkeit von Ereignissen<br />
vi. Wahrscheinlichkeitsmaße mit Riemann-Dichten (Exponential-,<br />
Weibull-, Gamma-, Normal- Rechteckverteilung, ...)<br />
b. Zufallsvariablen<br />
i. Zufallsvariablen und Wahrscheinlichkeitsmaße<br />
ii. Verteilungsdichte, Verteilungsfunktion und Quantilfunktion<br />
iii. Mehrdimensionale Zufallsariablen (gemeinsame Verteilung,<br />
mehrdimensionale Normalverteilung, Randverteilung, bedingte<br />
Verteilung, Produkträume)<br />
iv. Transformation von Zufallsvariablen (Dichtetransformationssatz,<br />
Faltung)<br />
v. Erwartungswerte, Varianz, Kovarianz und Korrelation<br />
vi. Erzeugende Funktionen und Laplace-Transformation<br />
vii. Bedingte Erwartungswerte<br />
3. Statistik<br />
a. Grundlegende Methoden <strong>der</strong> Beschreibenden Statistik<br />
i. Einführung und Grundbegriffe<br />
<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 40
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />
ii. Lage- und Streuungsmaße<br />
iii. Empirische Verteilungsfunktion<br />
iv. Klassierte Daten und Histogramm<br />
v. Zusammenhangsmaße<br />
vi. Regressionsanalyse<br />
b. Elementare Verfahren <strong>der</strong> Schließenden Statistik<br />
i. Problemstellungen <strong>der</strong> Schließenden Statistik<br />
ii. Parameterschätzungen: Erwartungstreue und Güte<br />
iii. Schätzung <strong>der</strong> Verteilungsfunktion<br />
iv. Maximum-Likelihood-Schätzung<br />
v. Konfidenzintervalle<br />
vi. Schätzungen bei Normalverteilung<br />
vii. Zentraler Grenzwertsatz<br />
viii. Lineare Regressionsmodelle<br />
ix. Elemente <strong>der</strong> Bayes-Statistik (Bayessche Entscheidungstheorie,<br />
Parameterschätzung)<br />
Literatur:<br />
STELAND, A. (2004): Mathematische Grundlagen <strong>der</strong> empirischen Forschung. Berlin,<br />
Heidelberg: Springer.<br />
CRAMER, E. & KAMPS, U. (2007): Grundlagen <strong>der</strong> Wahrscheinlichkeits-rechnung und<br />
Statistik (Ein Skript für Studierende <strong>der</strong> Informatik, <strong>der</strong> Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften).<br />
Heidelberg: Springer.<br />
CRAMER, E., KAMPS, U. (2006): Statistik griffbereit.<br />
Lehr- und Lernumgebung EMILeA-stat (http://emilea-stat.rwth-aachen.de).<br />
Weitere Literatur wird in <strong>der</strong> Vorlesung bekannt gegeben.<br />
Gruppengröße<br />
Kontaktzeit<br />
a) 60 h<br />
Summe: 60 h<br />
Selbststudium a) 120 h<br />
Summe: 120 h<br />
Kreditpunkte (CP) a) 6 CP<br />
Kreditpunkte: 6 CP<br />
Prüfungsleistungen a) Klausur (90 min)<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 41
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />
Nebenfach: Rohstoffversorgung in Industrielän<strong>der</strong>n<br />
Modul SWS CP Semester<br />
Metallversorgung (NF) 8 10 1-3<br />
Ressourcenmanagement (NF) 8 10 1-3<br />
Kreislaufwirtschaft, Recycling und Altlastensanierung<br />
(NF)<br />
8 10<br />
Metallversorgung (NF)<br />
Modulbeauftragter: Prof. Dr.- Ing. K. B. Friedrich<br />
Veranstaltungen a) Vorlesung: Einführung in die Metallurgie (V3)<br />
b) Übung: Einführung in die Metallurgie (Ü1)<br />
c) Vorlesung: Planung und Wirtschaftlichkeit von Anlagen (V2)<br />
d) Übung: Planung und Wirtschaftlichkeit von Anlagen (Ü2)<br />
Lern-/<br />
Qualifikationsziele<br />
Inhalte<br />
(exemplarisch)<br />
a)-d): Die vorherige Teilnahme am Modul „Ressourcenmanagement“ wird empfohlen.<br />
a) und b): Einführung in die Metallurgie (V/Ü)<br />
Dieses Modul soll Verständnis für technische Sachverhalte und für die Prozesskette<br />
ausgewählter Metalle vermitteln. Weiterhin werden berufliche Perspektiven in <strong>der</strong><br />
Metallindustrie aufgezeigt, die einer <strong>der</strong> bedeutendsten Wirtschaftszweige in Deutschland<br />
ist.<br />
c) und d): Planung und Wirtschaftlichkeit von Anlagen (V/Ü)<br />
Kenntnisse über den Ablauf von Produktidee bis Inbetriebnahme <strong>der</strong> dazu erfor<strong>der</strong>lichen<br />
Anlage. Fähigkeit zur Kostenermittlung und Angebotserstellung<br />
a) und b): Einführung in die Metallurgie (V/Ü)<br />
Es werden die Erzeugung, die Verarbeitung, die Eigenschaften und die Prozesse <strong>der</strong><br />
Märkte <strong>der</strong> Nichteisenmetalle Kupfer und Aluminium sowie Eisen und Stahl behandelt.<br />
Literatur:<br />
Vorlesungsunterlagen; Ullmann’s Encyclopedia of industrial chemistry (hier: Aluminium,<br />
Copper), VCH Verlagsgesellschaft, ISBN 3-527-20102-5<br />
c) und d): Planung und Wirtschaftlichkeit von Anlagen (V/Ü)<br />
Prozessdatenermittlung, Verfahrensentwicklung und Scale up/down, Projekt-planung,<br />
-steuerung, -organisation, Angebotskosten, Angebotskalkulation und Wirtschaftlichkeit,<br />
Standortstudie, Verfahrens- und Apparateauslegung<br />
Literatur:<br />
Vorlesungsunterlagen<br />
G. BERNECKER (2001), Planung und Bau verfahrenstechnischer Anlagen. Projektmanagement<br />
und Fachplanungsfunktionen, Springer, Heidelberg.<br />
Gruppengröße<br />
Kontaktzeit<br />
a) 45 h b) 15 h c) 30 h d) 30 h<br />
Summe: 120 h<br />
Selbststudium a) 75 h b) 15 h c) 45 h d) 45 h<br />
Summe: 180 h<br />
Kreditpunkte (CP) a) 4 CP b) 1 CP c) 2,5 CP d) 2,5 CP<br />
Kreditpunkte: 10 CP<br />
Prüfungsleistungen a), b): Klausur (90 min.); c), d): Klausur (90 min.)<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 42<br />
1-4
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Ressourcenmanagement<br />
Modulbeauftragter: Prof. Dr.- Ing. P. N. Martens<br />
Veranstaltungen a) Vorlesung/Übung: Mineralische Rohstoffwirtschaft und Ressourcen<br />
b) Vorlesung: Einführung in das Rohstoffingenieurwesen<br />
c) Vorlesung: Rohstoffindustriebetriebslehre und –projektfinanzierung<br />
d) Übung: Rohstoffindustriebetriebslehre und –projektfinanzierung<br />
Lern-/<br />
Qualifikationsziele<br />
Inhalte<br />
(exemplarisch)<br />
Die Studierenden sollen<br />
- einen Überblick über Größe und Bedeutung <strong>der</strong> Rohstoffindustrie erhalten und<br />
Entwicklungen auf dem Rohstoffsektor beurteilen können sowie Methoden des<br />
Aufsuchens und Bewertens von Ressourcen anwenden können.<br />
- die beson<strong>der</strong>en wirtschaftlichen Zusammenhänge in Rohstoffunternehmen verstehen<br />
(Kostenrechnung, Finanzierung von Rohstoffprojekten, Investitionen, Bilanzen)<br />
a) Vorlesung/Übung: Mineralische Rohstoffwirtschaft und Ressourcen<br />
Rohstoffindustrie- Einführung, Definitionen, Abgrenzungen Rohstoffe und Rohstoffwirtschaft<br />
(international, Deutschland) Prospektion, Exploration und Bewertung von<br />
Ressourcen, Nachhaltigkeitsaspekte in <strong>der</strong> Rohstoffgewinnung<br />
Literatur:<br />
UTHER, E.-U. (1982): Einführung in den Bergbau, Verlag Glückauf GmbH Essen.<br />
b) Vorlesung: Einführung in das Rohstoffingenieurwesen<br />
Einführung in die verschiedenen Arbeitsgebiete des Rohstoffingenieurs, Gewinnung<br />
über / unter Tage Maschinentechnik über / unter Tage, Maschinenwesen allg. Betriebsführung,<br />
Aufbereitungstechnik mineralische + sekundäre Rohstoffe, Rechtliche<br />
Aspekte<br />
c) und d) Rohstoffindustriebetriebslehre und –projektfinanzierung (V/Ü)<br />
Unter Berücksichtigung <strong>der</strong> Beson<strong>der</strong>heiten <strong>der</strong> Rohstoffindustrie:<br />
Unternehmensformen, Kostenrechnung, Finanzierung von Rohstoff-projekten, Investitionsrechnung<br />
in <strong>der</strong> Rohstoffindustrie<br />
Literatur:<br />
VON WAHL, S.: Bergwirtschaftslehre 1 - 3. Essen: Verlag Glückauf. N.N. Mine Estimation<br />
Cost Handbook<br />
Gruppengröße<br />
Kontaktzeit<br />
a) 45 h b) 15 h c) 30 h d) 30 h<br />
Summe: 120 h<br />
Selbststudium a) 75 h b) 15 h c) 45 h d) 45 h<br />
Summe: 180 h<br />
Kreditpunkte (CP) a) 4 CP b) 1 CP c) 2,5 CP d) 2,5 CP<br />
Kreditpunkte: 10 CP<br />
Prüfungsleistungen a,) mündliche Prüfung zu den Inhalten <strong>der</strong> Vorlesung (max. 30 min)<br />
b) Klausur (Dauer: 45 min)<br />
c, d) mündliche Prüfung zur Vorlesung und Übung (max. 30 min);<br />
die Zulassung zur Teilmodulprüfung erfolgt vorbehaltlich <strong>der</strong> regelmäßigen Teilnahme<br />
in den Vorlesungen und Übungen a) - d)<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
43
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Kreislaufwirtschaft, Recycling und Altlastensanierung (NF)<br />
Modulbeauftragter: Prof. Dr.- Ing. T. Pretz<br />
Veranstaltungen a) Vorlesung: Einführung in die Kreislaufwirtschaft<br />
b) Vorlesung: Recycling für Geographen<br />
c) Übung: Recycling für Geographen<br />
d) Vorlesung: In-Situ-Sicherung von Altlasten<br />
e) Übung: In-Situ-Sicherung von Altlasten<br />
Lern-/<br />
Ziel des Moduls ist es, eine Einführung in die technisch-wirtschaftlichen Grundlagen<br />
Qualifikationsziele <strong>der</strong> Kreislaufwirtschaft, des Recyclings und <strong>der</strong> Sanierung von Altlasten zu vermitteln.<br />
Darüber hinaus sollen die Studierenden ein Grundverständnis über technische Zusammenhänge,<br />
die Unterschiede von freien und verordneten Märkten und die Steuerungsfunktion<br />
<strong>der</strong> Gesetzgebung im Recycling und <strong>der</strong> Sanierung von Altlasten erwerben.<br />
Weiterhin sollen sie in die Lage versetzt werden, bereits erworbenes Wissen<br />
in eigenen Übungen zu vertiefen und gewonnene Ergebnisse komplexer technischwirtschaftlich-rechtlicher<br />
Sachverhalte einem Publikum zu präsentieren.<br />
Inhalte<br />
a) Vorlesung Einführung in die Kreislaufwirtschaft:<br />
(exemplarisch) Basierend auf <strong>der</strong> aktuellen Gesetzgebung werden Rückschlüsse auf Gewerbe, Industrie<br />
und Kommunen aufgezeigt und anhand praktischer Beispiele verschiedene<br />
Kreislaufwirtschaftsmaßnahmen dargestellt. Behandelt werden Kreisläufe folgen<strong>der</strong><br />
Industriebereiche: Auto, Elektronik, Chemie, Stahl, Papier, Mineral, Holz etc.<br />
Literatur:<br />
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz<br />
b) Vorlesung und Übung Recycling für Geographen:<br />
Zu ausgesuchten Themen des Recyclings (z.B. Bauabfälle, Schrotte, Papier, ölhaltige<br />
Betriebsmittel, Altöl etc.): Gesetzliche Grundlagen, Mengen Abfall und Primärrohstoffe,<br />
Rohstoffpreise und Recyclingkosten, Markt für Sekundärrohstoffe, Qualitätsanfor<strong>der</strong>ungen,<br />
technische Grundprinzipien, Beispiele für Recyclingverfahren; Praktische<br />
Übung zur Aufbereitung von Abfällen und Herstellung von Sekundärrohstoffen,<br />
Bewertung von Recyclingprozessen und <strong>der</strong>en Massen- und Qualitätsverlusten; Übung<br />
in Blockveranstaltung; Eigenständige Bearbeitung von Recyclingthemen in<br />
Gruppenarbeit mit mündlicher Präsentation <strong>der</strong> Arbeitsergebnisse<br />
Literatur:<br />
lose Blatt Sammlung Müllhandbuch<br />
c) Übung In-Situ-Sicherung von Altlasten:<br />
Definition von Altlasten, einschlägige Methoden und Verfahren zur Erkundung u.<br />
Sanierung von Altlasten, Oberflächenabdeckungen, Oberflächenabdichtungen,<br />
Dichtwände, Veranschaulichung durch Exkursion.<br />
Literatur: Zeitschrift Altlastensanierung<br />
Gruppengröße<br />
Kontaktzeit a) 30 h b) 15 h c) 15 h d) 15 h e) 15 h Summe: 120 h<br />
44
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Selbststudium a) 45 h b) 45 h c) 60 h d) 30 h e) 30 h Summe: 180 h<br />
Kreditpunkte (CP) a) 2,5 CP b) 2 CP c) 2,5 CP d) 1,5 CP e) 1,5 CP Kreditpunkte: 10 CP<br />
Prüfungsleistungen a) Klausur (90 Minuten)<br />
b) Klausur Prüfung (90 Minuten)<br />
c) mündliche Präsentation (30 Minuten)<br />
d) + e) mündliche Prüfung (30 Minuten)<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
45
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Nebenfach: Siedlungswasser- und Siedlungsabfallwirtschaft I<br />
Modul SWS CP Semester<br />
Siedlungswasser- und Siedlungsabfallwirtschaft 1 (SWW1)<br />
(NF)<br />
3 4 1<br />
Siedlungswasser- und Siedlungsabfallwirtschaft 2 (SWW2)<br />
(NF, WP)<br />
4 6 3<br />
Wasserversorgung und Wassergütewirtschaft (SWW3) (NF) 7 10 3<br />
Siedlungsabfallwirtschaft (SWW4) (NF) 8 10 3-4<br />
Siedlungswasser- und Siedlungsabfallwirtschaft (SWW1) (NF)<br />
Modulbeauftragter: Univ.-Prof. Dr.-Ing. J. Pinnekamp<br />
Veranstaltungen a) Einführung in die Siedlungswasserwirtschaft (V)<br />
b) Grundlagen <strong>der</strong> Siedlungswasserwirtschaft und Siedlungsabfallwirtschaft<br />
(V + Ü)<br />
Lern-/<br />
a) Einführung in die Siedlungswasserwirtschaft<br />
Qualifikationsziele - Befähigung zur Einordnung <strong>der</strong> Siedlungswasserwirtschaft in die Wasserwirtschaft<br />
- Grundkenntnisse über die Geschichte und Aufgaben <strong>der</strong> Siedlungswasserwirtschaft<br />
- Grundkenntnisse über Lebensgemeinschaften aquatischer Ökosysteme<br />
- Kenntnisse über die Auswirkungen und Folgen von Abwassereinleitungen in<br />
Gewässer<br />
- Kenntnisse über die Werkzeuge <strong>der</strong> Siedlungswasserwirtschaft<br />
Inhalte<br />
(exemplarisch)<br />
b) Grundlagen <strong>der</strong> Siedlungswasser - und Siedlungsabfall- wirtschaft<br />
- Verständnis <strong>der</strong> Zusammenhänge des Gesamtsystems <strong>der</strong> Siedlungswasserwirtschaft<br />
und Siedlungsabfallwirtschaft<br />
- Kenntnisse über rechtliche Vorgaben und administrative Strukturen <strong>der</strong> Wasser-,<br />
Abwasser- und Abfallwirtschaft<br />
- Naturwissenschaftliches und technisches Grundlagenwissen über die Prozesse<br />
<strong>der</strong> Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Abfallentsorgung<br />
- Grundkenntnisse über die Planung von Anlagen <strong>der</strong> Siedlungswasser- und Siedlungsabfallwirtschaft<br />
a) Einführung in die Siedlungswasserwirtschaft<br />
Siedlungswasserwirtschaft und<br />
- ihre Geschichte sowie ihre Aufgaben,<br />
- ihre internationale Dimension,<br />
- <strong>der</strong> Schutz <strong>der</strong> Gewässer,<br />
- Siedlungsabfallwirtschaft,<br />
- Ressourcen- und Energiemanagement,<br />
- ihre Werkzeuge: Planung, Bau, Modellierung, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen,<br />
- ihre Zukunftsaufgaben und Forschungsthemen.<br />
Literatur:<br />
46
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
selbstständige Auswahl, Vorlesungsumdrucke<br />
b) Grundlagen <strong>der</strong> Siedlungswasserwirtschaft und Siedlungsabfallwirtschaft<br />
- Der Kreislauf des Wassers (Gesamtwasserkreislauf, Kreislauf des Wassers in <strong>der</strong><br />
Siedlungswasserwirtschaft)<br />
- Grundlagen des Wasserrechts (international, national)<br />
- Grundlagen des Gewässerschutzes (Grundlagen <strong>der</strong> Limnologie, Gewässernutzungen<br />
und Gewässerbelastungen, Gewässergüteparameter)<br />
- Grundlagen <strong>der</strong> Wasserversorgung (Wasservorkommen, Wasserbedarf und<br />
Wassernutzung, Elemente <strong>der</strong> Wasserversorgung: Wassergewinnung, Wasseraufbereitung,<br />
Wasserför<strong>der</strong>ung, Wasserspeicherung und Wasserverteilung)<br />
- Abwassermengen und -zusammensetzung<br />
- Grundlagen <strong>der</strong> Siedlungsentwässerung (Zusammenhang zwischen Nie<strong>der</strong>schlag<br />
und Abfluss, Abflusskonzentration und Abflusstransport, Elemente <strong>der</strong><br />
Siedlungsentwässerung, Mischwasserbehandlung)<br />
- Grundlagen <strong>der</strong> Abwasserreinigung (Funktionsweise einer Kläranlage, Prozesse<br />
<strong>der</strong> Abwasserreinigung)<br />
- Grundlagen <strong>der</strong> Siedlungsabfallwirtschaft (Grundlagen des internationalen und<br />
nationalen Abfallrechts, Abfallaufkommen und Abfallzusammensetzung, Entsorgungswege<br />
von Abfällen)<br />
Literatur:<br />
selbstständige Auswahl, Vorlesungsumdrucke<br />
Gruppengröße<br />
Kontaktzeit<br />
a) 15 h b) 30 h<br />
Summe: 45 h<br />
Selbststudium a) 15 h b) 60 h<br />
Summe: 75 h<br />
Kreditpunkte (CP) a) 1 CP b) 3 CP<br />
Kreditpunkte: 4 CP<br />
Prüfungsleistungen a) und b) jeweils Klausur (60 Minuten)<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
Siedlungswasser- und Siedlungsabfallwirtschaft 2 (SWW2) (NF)<br />
Modulbeauftragter: Univ.-Prof. Dr.-Ing. J. Pinnekamp<br />
Veranstaltungen a) Siedlungsentwässerung (V + Ü)<br />
b) Abwasserreinigung (V + Ü)<br />
Lern-/<br />
Qualifikationsziele<br />
a) Siedlungsentwässerung<br />
- Kenntnisse über rechtliche Grundlagen und administrative Strukturen<br />
- Technisches Grundlagenwissen über die Prozesse <strong>der</strong> Abwasserableitung<br />
- Befähigung zur eigenständigen Bemessung von Abwasserkanälen, Kanalnetzen<br />
und an<strong>der</strong>en Bauwerken <strong>der</strong> Siedlungsentwässerung<br />
- Kenntnisse über Bau, Betrieb und Sanierung von Entwässerungsanlagen<br />
b) Abwasserreinigung<br />
- Technisches Grundlagenwissen über die Prozesse <strong>der</strong> Abwasserreinigung<br />
- Befähigung zur eigenständigen Bemessung und Planung von Bauwerken <strong>der</strong><br />
47
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Inhalte<br />
(exemplarisch)<br />
Abwasserreinigung<br />
- Grundkenntnisse über den Bau und Betrieb von Anlagen zur Abwasserreinigung<br />
a) Siedlungsentwässerung<br />
- Verfahren <strong>der</strong> Siedlungsentwässerung<br />
- Bemessung von Abwasserkanälen und -pumpwerken<br />
- Grundlagen <strong>der</strong> Schmutzfrachtberechnung<br />
- Grundlagen <strong>der</strong> Modellierung von Kanalnetzen<br />
- Regen- und Mischwasserbehandlung<br />
- Planung, Bau, Betrieb und Instandhaltung von Bauwerken <strong>der</strong> Abwasserableitung<br />
- Grundlagen <strong>der</strong> Organisation und Finanzierung <strong>der</strong> Abwasserwirtschaft<br />
Literatur:<br />
selbstständige Auswahl, Vorlesungsumdrucke<br />
b) Abwasserreinigung<br />
- Auslegung <strong>der</strong> Prozesse <strong>der</strong> Abwasserreinigung (physikalisch, chemisch, biologisch)<br />
- Bemessung <strong>der</strong> Bauwerke zur Abwasserreinigung<br />
- Bau und Betrieb von Anlagen zur Abwasserreinigung<br />
- Mess-, Steuer- und Regeltechnik auf Abwasserreinigungsanlagen<br />
- Behandlung und Entsorgung von Rückständen aus <strong>der</strong> Abwassereinigung<br />
Literatur:<br />
selbstständige Auswahl, Vorlesungsumdrucke<br />
Gruppengröße<br />
Kontaktzeit<br />
a) 30 h b) 30<br />
Summe: 630 h<br />
Selbststudium a) 60 h b) 60<br />
Summe: 120 h<br />
Kreditpunkte (CP) a) 3 CP b) 3 CP<br />
Kreditpunkte: 6 CP<br />
Prüfungsleistungen a) und b) Die Zulassung zur Prüfung in den Veranstaltungen erfolgt vorbehaltlich <strong>der</strong><br />
erfolgreichen Bearbeitung von Übungsaufgaben, jeweils eine Klausur (60 Minuten)<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
Wasserversorgung und Wassergütewirtschaft (SWW3) (NF)<br />
Modulbeauftragter: Univ.-Prof. Dr.-Ing. J. Pinnekamp<br />
Veranstaltungen a) Wasserversorgung 1 (V + Ü)<br />
b) Wasserversorgung 2 (V + Ü)<br />
c) Wassergütewirtschaft<br />
(1) Naturwissenschaftliche Grundlagen <strong>der</strong> Wassergütewirtschaft (V),<br />
(2) Grundlagen und Umsetzung <strong>der</strong> EU-WRRL (V),<br />
(3) Praktikum Gewässergütewirtschaft<br />
Lern-/<br />
Qualifikationsziele<br />
a) Wasserversorgung 1<br />
- Grundwissen bezüglich <strong>der</strong> Rechtsvorgaben für die Rohwasser- und Trinkwasserqualität<br />
in <strong>der</strong> Wasserversorgung<br />
- Technisches Wissen über die Prozesse in <strong>der</strong> Wasserversorgung und ihre Zusammenhänge<br />
bzw. Wechselwirkungen<br />
48
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Inhalte<br />
(exemplarisch)<br />
- Befähigung zur eigenständigen Bemessung und Planung von Anlagen zur Wassergewinnung<br />
und Wasserverteilung<br />
b) Wasserversorgung 2<br />
- • Vertieftes Wissen bezüglich <strong>der</strong> europäischen und nationalen Rechtsvorgaben<br />
für die Rohwasser- und Trinkwasserqualität in <strong>der</strong> Trinkwasserversorgung<br />
- Technisches Wissen über die Prozesse in <strong>der</strong> Wasseraufbereitung und ihre Zusammenhänge<br />
bzw. Wechselwirkungen<br />
- Befähigung zur eigenständigen Bemessung und Planung von Anlagen zur Wasseraufbereitung<br />
- Vertiefte Kenntnisse über Betrieb und Instandhaltung von Anlagen <strong>der</strong> Wasserversorgung<br />
(Instandhaltungsstrategien, Reduzierung von Wasserverlusten, etc.<br />
c) Wassergütewirtschaft<br />
(1) Naturwissenschaftliche Grundlagen <strong>der</strong> Wassergütewirtschaft:<br />
- Verständnis <strong>der</strong> Zusammenhänge <strong>der</strong> unterschiedlichen Bausteine <strong>der</strong> Wassergütewirtschaft<br />
- Verständnis naturwissenschaftlicher Grundlagen in <strong>der</strong> Wasserwirtschaft (Gewässer,<br />
Chemie und Biologie)<br />
- Vertieftes Verständnis <strong>der</strong> Limnologie<br />
(2) Grundlagen und Umsetzung <strong>der</strong> EU-WRRL:<br />
- Verständnis <strong>der</strong> Zusammenhänge <strong>der</strong> unterschiedlichen Bausteine <strong>der</strong> Wassergütewirtschaft<br />
- Kenntnisse <strong>der</strong> rechtlichen Grundlagen und <strong>der</strong> administrativen Strukturen in <strong>der</strong><br />
Wassergütewirtschaft<br />
- Kenntnis über Maßnahmen des Gewässerschutzes<br />
- Lösen konkreter wasserwirtschaftlicher Fragestellungen<br />
(3) Praktikum Gewässergütewirtschaft:<br />
- Kenntnisse über biologische und chemische Gewässergüteparameter und -<br />
modelle<br />
- Kenntnisse über Maßnahmen des Gewässerschutzes<br />
- Lösen konkreter wasserwirtschaftlicher Fragestellungen<br />
a) Wasserversorgung 1<br />
Rechtliche Grundlagen<br />
- Rechtliche und administrative Grundlagen <strong>der</strong> Wasserversorgung<br />
Wassergewinnung und -för<strong>der</strong>ung<br />
- Wasserqualität von Grundwasser und Oberflächenwasser<br />
- Wasserschutzzonen<br />
- Wasserhaushaltsgleichung, Wasserverbrauch und Wasserressourcen<br />
- Wassergewinnungsanlagen, Anlagen zur Grundwasseranreicherung, Bemessung<br />
von Wasserleitungen und Wasserpumpwerken<br />
Wasserspeicherung<br />
- Bauformen, Anordnung und Bemessung von Wasserspeichern<br />
49
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Wasserverteilung<br />
- Formen und Bemessung Wasserversorgungsnetzen<br />
Literatur:<br />
selbstständige Auswahl, Vorlesungsumdrucke<br />
b) Wasserversorgung 2<br />
Rechtliche Grundlagen<br />
- Rechtliche Vorschriften bezüglich <strong>der</strong> Trinkwasserqualität und Einordnung in den<br />
Gesamtkontext wasserwirtschaftlicher Rechtsvorschriften<br />
Wasseraufbereitung<br />
- Einführung<br />
- Einsatzbereiche verschiedener Aufbereitungsverfahren – unterteilt nach Rohwasserarten<br />
- Flockung und Fällung<br />
- Schnellfiltration, Sedimentation, Flotation, Filtration und Membranverfahren<br />
- Kohlensäure im Trinkwasser: Grundlagen des Kalk-Kohlensäure-Gleichgewichts<br />
(KKG)<br />
- Entsäuerung/Enthärtung/Entsalzung<br />
- Enteisenung und Entmanganung<br />
- Desinfektion<br />
Wassergütewirtschaft von Trinkwassertalsperren<br />
- Limnologische Grundlagen stehen<strong>der</strong> Gewässer<br />
- Einzugsgebietsmanagement<br />
- Bewirtschaftung von Talsperren<br />
- Aufbereitung von Rohwasser aus Talsperren<br />
- Gewässersanierung<br />
- Wasserspeicherung<br />
Betrieb und Instandhaltung<br />
- Instandhaltungsstrategien in <strong>der</strong> Wasserversorgung und ihre Umsetzung (insbeson<strong>der</strong>e<br />
Reduzierung von Wasserverlusten, EDV-Anwendungen in <strong>der</strong> Wasserversorgung<br />
etc.)<br />
Bearbeitung von Planungsaufgaben<br />
- Anwendung und Vertiefung <strong>der</strong> Vorlesungsinhalte durch eigenständige Bearbeitung<br />
von konkreten Planungsaufgaben in Gruppen<br />
Literatur:<br />
selbstständige Auswahl, Vorlesungsumdrucke<br />
c) Wassergütewirtschaft<br />
(1) Naturwissenschaftliche Grundlagen <strong>der</strong> Wassergütewirtschaft:<br />
- Stoffkreisläufe und -umsetzungen im Gewässer<br />
- Aussagekraft von Gewässergüteparametern in Fließgewässern<br />
- Schadstoff- und Nährstoffkonzentrationen und -frachten in Gewässern (punktuelle<br />
und diffuse Einträge)<br />
(2) Grundlagen und Umsetzung <strong>der</strong> EU-WRRL:<br />
50
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
- Rechtliche Vorschriften zur Gewässerbewirtschaftung und Einordnung in den<br />
Gesamtkontext wasserwirtschaftlicher Rechtsvorschriften<br />
- Bestandsaufnahme und Monitoring<br />
- Aufstellen von Maßnahmenprogrammen<br />
- Bewirtschaftungspläne<br />
(3) Praktikum Gewässergütewirtschaft:<br />
- Bestimmung von Leitorganismen und Berechnung des Saprobien-Index<br />
- Beurteilung <strong>der</strong> Gewässergüte<br />
- Maßnahmen zur Verbesserung <strong>der</strong> Gewässergüte<br />
- Praktische Übungen an Fallbeispielen aus <strong>der</strong> Praxis<br />
- Exkursionen<br />
Literatur:<br />
selbstständige Auswahl, Vorlesungsumdrucke<br />
Gruppengröße<br />
Kontaktzeit<br />
a) 30 h b) 45 h c) 45 h<br />
Summe: 120 h<br />
Selbststudium a) 60 h b) 75 h c) 45 h<br />
Summe: 180 h<br />
Kreditpunkte (CP) a) 3 CP b) 4 CP c) 3 CP<br />
Kreditpunkte: 10 CP<br />
Prüfungsleistungen a) Klausur (60 min)<br />
b) Klausur (60 min)<br />
c) Klausur (jeweils 30 min)<br />
Note<br />
die Zulassung zur Modulprüfung erfolgt vorbehaltlich <strong>der</strong> erfolgreichen Bearbeitung<br />
von Übungsaufgaben (a) - (b)<br />
Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
Siedlungsabfallwirtschaft (SSW4) (NF)<br />
Modulbeauftragter: Univ.-Prof. Dr.-Ing. J. Pinnekamp<br />
Veranstaltungen a) Siedlungsabfallwirtschaft (V + Ü)<br />
b) Klärschlammbehandlung und Klärschlammentsorgung (V +Ü)<br />
c) Projektarbeit Siedlungswasser- und Siedlungsabfallwirtschaft<br />
Lern-/<br />
Qualifikationsziele<br />
a) Siedlungsabfallwirtschaft<br />
- Technisches Grundlagenwissen über die Abfalllogistik, die Verfahren <strong>der</strong> Abfallbehandlung<br />
und Abfallentsorgung<br />
- Befähigung zur eigenständigen Bemessung und Planung von Systemen zur<br />
Wertstoff-, Reststoff- und Schadstoffsammlung<br />
- Grundlagenwissen über Bemessung, Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur<br />
Abfallbehandlung und Abfallentsorgung.<br />
b) Klärschlammbehandlung und Klärschlammentsorgung<br />
- Technisches Grundlagenwissen über die Prozesse <strong>der</strong> Klärschlammbehandlung<br />
und Klärschlammentsorgung<br />
- Befähigung zur eigenständigen Bemessung von Anlagenteilen zur Klärschlammbehandlung<br />
- Kenntnisse über die Entsorgungswege für Klärschlämme<br />
51
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Inhalte<br />
(exemplarisch)<br />
c) Projektarbeit Siedlungswasser- und Siedlungsabfallwirtschaft<br />
- Anwendung und Vertiefung des Wissens in den Fächern Siedlungsentwässerung,<br />
Abwasserreinigung, Klärschlammbehandlung und Klärschlammentsorgung durch<br />
eigenständige Bearbeitung von konkreten Planungsaufgaben in Gruppen<br />
- Vorstellung und Präsentation <strong>der</strong> erarbeiteten Ergebnisse<br />
a) Siedlungsabfallwirtschaft<br />
- rechtliche und administrative Grundlagen <strong>der</strong> Siedlungsabfallwirtschaft<br />
- Einteilung von Abfällen nach ihrer Gefährlichkeit<br />
- Strategien <strong>der</strong> Abfallentsorgung - Vermeidung, Verwertung, Beseitigung<br />
- Entsorgungslogistik<br />
- Verfahren <strong>der</strong> Abfallbehandlung (thermische, biologische, mechanische, Kombinationen)<br />
- Abfallablagerung - Randbedingungen und Multibarrienkonzept<br />
- Abfallwirtschaftskonzepte<br />
Literatur:<br />
selbstständige Auswahl, Vorlesungsumdrucke<br />
b) Klärschlammbehandlung und Klärschlammentsorgung<br />
- Arten, Mengen, Zusammensetzung und Eigenschaften von Schlämmen aus<br />
Abwasserreinigungsanlagen<br />
- Verfahren <strong>der</strong> Klärschlammstabilisierung (chemisch, thermisch, biologisch)<br />
- Klärschlammentseuchung<br />
- Klärschlammkonditionierung<br />
- Verfahren <strong>der</strong> Klärschlammentwässerung (Eindickung, masch. Schlammentwässerung,<br />
Trocknung)<br />
- Möglichkeiten <strong>der</strong> Klärschlammentsorgung: landwirtschaftlich, thermisch, industriell<br />
- Klärschlammbeseitigung<br />
- Energiebilanzen und Energiekonzepte<br />
Literatur:<br />
selbstständige Auswahl, Vorlesungsumdrucke<br />
c) Projektarbeit Siedlungswasser- und Siedlungsabfallwirtschaft<br />
- Bearbeitung von konkreten Aufgabenstellungen aus den folgenden Fachgebieten<br />
<strong>der</strong> Siedlungswasserwirtschaft: Siedlungsentwässerung, Abwasserreinigung,<br />
Klärschlammbehandlung und -entsorgung<br />
- Besichtigung von aufgabenrelevanten siedlungswasserwirtschaftlichen Bauwerken<br />
Literatur:<br />
selbstständige Auswahl, Vorlesungsumdrucke<br />
Gruppengröße<br />
Kontaktzeit a) 45 h b) 45 h c) 30 h Summe: 120 h<br />
52
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Selbststudium a) 75 h b) 45 h c) 60 h<br />
Summe: 180 h<br />
Kreditpunkte (CP) a) 4 CP b) 3 CP c) 3 CP<br />
Kreditpunkte: 10 CP<br />
Prüfungsleistungen a) Klausur (60 Minuten); Die Zulassung zur Prüfung in den Veranstaltungen erfolgt<br />
vorbehaltlich <strong>der</strong> erfolgreichen Bearbeitung von Übungsaufgaben,<br />
b) Klausur (60 Minuten)<br />
c) Schriftliche Ausarbeitung des Projektberichtes (Bearbeitungszeit: 30 h, Gewichtung:<br />
50%) und Präsentation <strong>der</strong> Projektergebnisse (Dauer ca. 20 bis 40 Minuten,<br />
Gewichtung: 50%)<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
53
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Nebenfach Siedlungswasserwirtschaft II<br />
Modul SWS CP Semester<br />
Organisation <strong>der</strong> Wasser- und Abfallwirtschaft 5 6 1/2<br />
Industrieabwasserbehandlung 3 3 1<br />
Chemie und Biologie 3 3 1<br />
Biologische Behandlung von Abfällen 4 4 2<br />
Planung von Abwasseranlagen 10 10 2/3<br />
Mathemathische Modelle in <strong>der</strong> SiWaWi 3 4 3<br />
Modul: Organisation <strong>der</strong> Wasser- und Abfallwirtschaft<br />
Modulbeauftragter: Prof. Dr.-Ing. Johannes Pinnekamp<br />
Beteiligte Lehrstühle/Dozenten: Prof. Dr.-Ing. Johannes Pinnekamp<br />
Dr.-Ing. Nelle (LA), Dipl.-Ing. Wille (LA), Dr.-Ing. Roos (LA)<br />
Studiengänge<br />
Angebot (Turnus) Dauer Studienjahr<br />
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />
jährlich<br />
2 Semester 1. Studienjahr<br />
Kategorie Erläuterung<br />
Veranstaltungen und a) Vorlesung: Organisation <strong>der</strong> Wassergütewirtschaft<br />
Lehrformen<br />
b) Vorlesung: Organisation <strong>der</strong> Abfallwirtschaft<br />
Voraussetzungen Siedlungswasser- und Siedlungsabfallwirtschaft 1 - 2<br />
Lern-/<br />
a) Kenntnisse über die Strukturen <strong>der</strong> Wasserwirtschaft Kenntnisse über öf-<br />
Qualifikationsziele<br />
fentlich-rechtliche und privatwirtschaftliche Organisationsformen<br />
und –modelle. Befähigung zur Bewertung unterschiedlicher Organisationsformen<br />
und <strong>der</strong>en Potenziale im konkreten Anwendungsfall.<br />
Kenntnisse zur Festlegung von Gebühren.<br />
b) Kenntnisse über die Strukturen <strong>der</strong> Abfallwirtschaft. Kenntnisse über öffentlich-rechtliche<br />
und privatwirtschaftliche Organisationsformen und –<br />
modelle. Befähigung zur Bewertung unterschiedlicher Organisationsformen<br />
und <strong>der</strong>en Potenziale im konkreten Anwendungsfall.<br />
Kenntnisse zur Festlegung von Gebühren. Kenntnisse über die Organisation<br />
und Überwachung <strong>der</strong> Entsorgung verschiedener Abfallfraktionen<br />
Inhalte<br />
a) Rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen: Strukturen in <strong>der</strong> Pra-<br />
(exemplarisch) xis, Verknüpfung <strong>der</strong> Akteure, hoheitliche Aufgaben, Wettbewerbsgesetz,<br />
VOL - VOB - VOF, Gemeindeordnung, Steuerpflicht, Kalkulatorische Kosten,<br />
Haushaltsplan, Gebühren und Beiträge. Öffentlich-rechtliche Organisationsformen:<br />
Regiebetrieb, Eigenbetrieb, Zweckverband, Eigengesellschaft,<br />
AöR. Privatwirtschaftliche Organisationsformen: Betriebsführungsmodell,<br />
Kooperationsmodell, Beistellungsmodell, Betreibermodell. Liberalisierung<br />
und Privatisierung <strong>der</strong> Wasserwirtschaft: Organisationsuntersuchungen,<br />
Ablauf von PPP-Ausschreibungen. Zukünftige Entwicklung des Wassermarktes.<br />
Finanzierung <strong>der</strong> Wasser- und Abwasserwirtschaft, technisches<br />
54
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Gruppengröße<br />
Kontaktzeit<br />
Selbststudium<br />
CP<br />
Voraussetzung für die<br />
Vergabe von<br />
CP-Punkten<br />
Controlling, Qualitäts- und Umweltmanagement-Systeme. Vergleich mit<br />
dem Ausland: Multi-Utility-Unternehmen, Global- Player, Europäisches<br />
Ausland, Konsequenzen für die deutsche Entwicklungspolitik.<br />
b) Rechtliche, technische, wirtschaftliche und administrative Rahmenbe<br />
dingungen <strong>der</strong> Abfallwirtschaft. Entsorgungsstrukturen und Organisationsformen<br />
in <strong>der</strong> Abfallwirtschaft Stoffstrommanagement. Überwachung<br />
und Nachweis <strong>der</strong> geordneten Entsorgung, behördliche<br />
Überwachungsstruktur. Son<strong>der</strong>abfallentsorgung: Aufbau und<br />
Organisation, län<strong>der</strong>spezifische Regelungen. Organisationsformen<br />
in <strong>der</strong> Abfallwirtschaft. Betriebliche Organisation: Aufbau- und Ablauforganisation,<br />
Entsorgungsfachbetrieb, Qualitäts- und Umweltmanagement.<br />
a) 45 h b) 30 h<br />
a) 30 h b) 15 h<br />
a) 4 CP b) 2 CP<br />
a) und b): jeweils eine Klausur (Dauer: 60 Min.)<br />
Summe: 75 h<br />
Summe: 45 h<br />
Summe: 6 CP<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Punkteverteilung gewichtet.<br />
Modul: Industrieabwasserbehandlung<br />
Modulbeauftragter: Prof. Dr. rer. nat. H. F. Schrö<strong>der</strong><br />
Beteiligte Lehrstühle/Dozenten: Prof. Dr. rer. nat. H. F. Schrö<strong>der</strong><br />
Studiengänge<br />
Angebot (Turnus) Dauer Studienjahr<br />
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />
jährlich<br />
1 Semester 1. Studienjahr<br />
Kategorie Erläuterung<br />
Veranstaltungen und a) Vorlesung: Industrieabwasserbehandlung<br />
Lehrformen b) Übung: Industrieabwasserbehandlung<br />
Voraussetzungen Siedlungswasser- und Siedlungsabfallwirtschaft 1 - 2<br />
Lern-/<br />
a)/b) Grundwissen über die Zusammensetzung und Untersuchung von Indust-<br />
Qualifikationsziele rieabwässern.<br />
Kenntnisse über die Bestimmung von Schadstoffen in Industrieabwässern<br />
Grundwissen über die zur Industrieabwasserbehandlung eingesetzten Verfahrenstechniken<br />
Inhalte<br />
a)/b) Einteilung <strong>der</strong> Industrieabwässer<br />
(exemplarisch)<br />
Gruppengröße<br />
Zusammensetzung ausgewählter Industrieabwässer<br />
Umweltrelevante Schadstoffe in Industrieabwässern und ihre Bestimmung<br />
Spezielle Verfahrentechniken zur Industrieabwasserreinigung (physikalisch,<br />
chemisch, biologisch)<br />
Behandlung und Entsorgung von Rückständen aus <strong>der</strong> Industrieabwassereinigung<br />
55
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Kontaktzeit<br />
a) 30 h b)15 h<br />
Summe: 45 h<br />
Selbststudium a) 15 h b) 15 h<br />
Summe: 30 h<br />
CP<br />
a)+ b) 3 CP<br />
Summe: 3 CP<br />
Voraussetzung für die<br />
Vergabe von<br />
CP-Punkten<br />
Klausur (Dauer: 90 min)<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Punkteverteilung gewichtet.<br />
Modul: Chemie und Biologie in <strong>der</strong> Siedlungswasser- und Siedlungsabfallwirtschaft<br />
Modulbeauftragter: Prof. Dr.-Ing. Johannes Pinnekamp<br />
Beteiligte Lehrstühle/Dozenten: Prof. Dr.-Ing. Johannes Pinnekamp<br />
Prof. Dr. rer. nat. H. F. Schrö<strong>der</strong><br />
Studiengänge<br />
Angebot (Turnus) Dauer Studienjahr<br />
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />
jährlich<br />
1 Semester 1. Studienjahr<br />
Kategorie Erläuterung<br />
Veranstaltungen und a) Vorlesungen Chemie und Biologie in <strong>der</strong> Siedlungswasserwirtschaft und<br />
Lehrformen<br />
Siedlungsabfallwirtschaft<br />
b) Praktikum Chemie und Biologie in <strong>der</strong> Siedlungswasserwirtschaft und<br />
Siedlungsabfallwirtschaft<br />
Voraussetzungen Siedlungswasser- und Siedlungsabfallwirtschaft 1 – 2<br />
Lern-/<br />
a)/b) Kenntnisse über die Grundlagen <strong>der</strong> Wasserchemie und Mikrobiologie<br />
Qualifikationsziele Verständnis für chemische und biologische Vorgänge bei <strong>der</strong> Trinkwasseraufbereitung,<br />
Abwasserreinigung und biologischen Abfallbehandlung<br />
Befähigung zur Bewertung von chemischen und biologischen Analyseergebnissen<br />
Inhalte<br />
Chemie:<br />
(exemplarisch) • Grundlagen <strong>der</strong> Chemie<br />
• Zusammensetzung von Wässern, Abwässern und festen Abfällen<br />
• Wasser-, Abwasser- und Abfallparameter<br />
• Untersuchungsmethoden<br />
Biologie:<br />
• Grundlagen <strong>der</strong> Mikrobiologie<br />
• Stoffwechsel <strong>der</strong> heterotrophen und autotrophen Organismen<br />
• Hygienische Aspekte <strong>der</strong> Abwasser- und Abfallwirtschaft<br />
• Untersuchungsmethoden<br />
Praktikum:<br />
• Laborpraktische Wasser-, Abwasser- und Abfalluntersuchungen<br />
• Mikroskopische Untersuchungen<br />
Bestimmung von Hygieneparametern<br />
Gruppengröße<br />
Kontaktzeit<br />
Selbststudium<br />
CP<br />
a) 45 h b)15 h<br />
a) 15 h b) 15 h<br />
a)+ b) 3 CP<br />
Summe: 60 h<br />
Summe: 30 h<br />
Summe: 3 CP<br />
56
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Voraussetzung für die a) Klausur (Dauer: 90 min)<br />
Vergabe von<br />
CP-Punkten<br />
b) Teilnahmenachweis<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Punkteverteilung gewichtet.<br />
Modul: Biologische Behandlung von Abfällen<br />
Modulbeauftragter: Prof. Dr.-Ing. Johannes Pinnekamp<br />
Beteiligte Lehrstühle/Dozenten: Prof. Dr.-Ing. Johannes Pinnekamp<br />
Studiengänge<br />
Angebot (Turnus) Dauer Studienjahr<br />
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />
jährlich<br />
1 Semester 1. Studienjahr<br />
Kategorie Erläuterung<br />
Veranstaltungen und a) Vorlesung: Biologische Behandlung von Abfällen<br />
Lehrformen<br />
b) Übung: Biologische Behandlung von Abfällen<br />
Voraussetzungen Siedlungswasser- und Siedlungsabfallwirtschaft 1 - 2<br />
Lern-/<br />
Grundwissen bezüglich <strong>der</strong> europäischen und nationalen Rechtsvorgaben für<br />
Qualifikationsziele die biologische Abfallbehandlung. Naturwissenschaftliches und technisches<br />
Wissen über die Prozesse <strong>der</strong> biologischen Abfallbehandlung. Bemessung<br />
biologischer Abfallbehandlungsanlagen. Betrieb von Anlagen zur biologischen<br />
Abfallbehandlung. Entstehung und Behandlung von Emissionen aus biologischen<br />
Abfallbehandlungsanlagen. Vermarktung von Produkten aus <strong>der</strong> biologischen<br />
Behandlung von Abfällen<br />
Inhalte<br />
Arten, Mengen und Zusammensetzung von biogenen Abfällen<br />
(exemplarisch) Rechtliche Grundlagen<br />
• Rechtliche Vorgaben für die biologische Abfallbehandlung, Verwertung<br />
und Ablagerung biologisch behandelter Abfälle<br />
• Einordnung in den Gesamtkontext des Umweltrechts<br />
Erfassung von Bioabfällen, Kompostierung<br />
• Naturwissenschaftliche und verfahrenstechnische Grundlagen<br />
• Bemessung und Betrieb von Kompostierungsanlagen<br />
• Kostenbetrachtung<br />
Vergärung<br />
• Naturwissenschaftliche und verfahrenstechnische Grundlagen<br />
• Bemessung und Betrieb von Vergärungsanlagen<br />
• Kostenbetrachtung<br />
Mechanisch-biologische Abfallbehandlung<br />
• Ziele <strong>der</strong> mechanisch-biologischen Abfallbehandlung<br />
• Verfahrenstechnik<br />
• Bemessung und Betrieb von Anlagen zur mechanisch-biologischen<br />
Abfallbehandlung<br />
Emissionen biologischer Behandlungsanlagen<br />
• Abluft und ihre Behandlung<br />
• Prozesswasseremissionen und -behandlung<br />
Vermarktung von Produkten aus <strong>der</strong> biologischen Abfallbehandlung<br />
57
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Gruppengröße<br />
• Anfor<strong>der</strong>ungen an Düngemittel<br />
• Wert- und Schadstoffe von Gärprodukten und Komposten<br />
Charakterisierung, Behandlung und Entsorgung landwirtschaftlicher Reststoffe<br />
Altholzverwertung und -vermarktung<br />
Verfahren zur Nährstoffrückgewinnung aus organischen Abfällen<br />
Kontaktzeit<br />
a) 30 h b)30 h<br />
Summe: 60 h<br />
Selbststudium a) 15 h b) 15 h<br />
Summe: 30 h<br />
CP<br />
a)+ b) 4 CP<br />
Summe: 4 CP<br />
Voraussetzung für die a) Klausur (Dauer: 120 min)<br />
Vergabe von<br />
CP-Punkten<br />
b) Semesterbegleitende Hausübung<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Punkteverteilung gewichtet.<br />
Modul: Planung von Abwasseranlagen<br />
Modulbeauftragter: Prof. Dr.-Ing. Johannes Pinnekamp<br />
Beteiligte Lehrstühle/Dozenten: Dr.-Ing. Markus Schrö<strong>der</strong> (LA)<br />
Prof. Dr.-Ing. Johannes Pinnekamp<br />
Studiengänge<br />
Angebot (Turnus) Dauer Studienjahr<br />
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />
jährlich<br />
1 Semester 1./2. Studienjahr<br />
Kategorie Erläuterung<br />
Veranstaltungen und a) Übung: Planung von Abwasseranlagen 1<br />
Lehrformen<br />
b) Übung: Planung von Abwasseranlagen 2<br />
Voraussetzungen Siedlungswasser- und Siedlungsabfallwirtschaft 1 – 2, 4<br />
Lern-/<br />
a) Kenntnisse über die Arbeitsweise von Ingenieurbüros<br />
Qualifikationsziele<br />
Grundwissen zur HOAI. Vertragswesen im Ingenieurbüro. Kenntnisse<br />
über die Erstellung eines Ingenieurangebotes. Eigenständige<br />
Lösung einer komplexen Planungsaufgabe aus <strong>der</strong> Siedlungswasserwirtschaft<br />
Fähigkeiten zur Führung von Gesprächen im Rahmen <strong>der</strong> Projektabwicklung<br />
b) Eigenständige Lösung einer komplexen Planungsaufgabe aus <strong>der</strong> Siedlungswasserwirtschaft.<br />
Kenntnisse über spezielle Aufgabenstellungen<br />
eines Ingenieurbüros (Energiemanagement, technische Varianten)<br />
Inhalte<br />
a) Rechtliche Rahmenbedingungen bei <strong>der</strong> Planung von Einrichtungen <strong>der</strong><br />
(exemplarisch) Abwasserentsorgung. Einführung in die ingenieurtechnische Planung von Abwasserentsorgungsprojekten.<br />
• Besuch eines Ingenieurbüros; Diskussionen mit Mitarbeitern über das<br />
Berufsbild; Erwartungen an den Beruf<br />
• Vorstellung eines Planungsobjektes<br />
• Besuch des Planungsgebietes und Vorstellung des Bauleitplanes<br />
• Erfassung von Grundlagendaten zur Anlagenbemessung und Abschät-<br />
58
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Gruppengröße<br />
Kontaktzeit<br />
Selbststudium<br />
CP<br />
Voraussetzung für die<br />
Vergabe von<br />
CP-Punkten<br />
zung <strong>der</strong> Anschlussgrößen<br />
• Arten <strong>der</strong> Kostenermittlung (Kostenschätzung, Kostenberechnung, Kostenfeststellung)<br />
• Erstellung eines Ingenieurangebotes für die Anlagenteile einer Abwasserreinigungsanlage<br />
unter Berücksichtigung <strong>der</strong> HOAI<br />
Planung einer Kläranlage<br />
b) Gesamtinfrastruktur <strong>der</strong> Abwasserentsorgung<br />
• Bemessung von Kanalnetzen, Diskussion weitergehen<strong>der</strong> ingenieurplanerischer<br />
Rahmenbedingungen, Erläuterung und Handhabung unterschiedlicher<br />
technischer Werkzeuge<br />
• Zustandserfassung von Kanälen an einem Praxisbeispiel<br />
• Planung von Regenbecken<br />
• Dynamische Kostenvergleichsrechnung bei <strong>der</strong> Abwasserentsorgung<br />
• Energiemanagement und Energieoptimierung auf Kläranlagen (Durchführung<br />
von Energieanalysen)<br />
• Einsatz von Präsentationsmedien; Vorbereitung und Durchführung einer<br />
fachgebundenen Präsentation<br />
Besichtigung einer Kläranlage und eines Kanalbauprojektes<br />
a) 75 h b) 75 h<br />
Summe: 150 h<br />
a) 15 h b) 15 h<br />
Summe: 30 h<br />
a) 5 CP b) 5 CP<br />
Summe: 10 CP<br />
a) Anwesenheitsnachweis<br />
mündliche Präsentation (30 %)<br />
Klausur (Dauer: 60 min) (70%)<br />
b) Anwesenheitsnachweis<br />
mündliche Präsentation (30%), Klausur (Dauer: 60 min) (70%)<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Punkteverteilung gewichtet.<br />
Modul: Mathematische Modelle in <strong>der</strong> Siedlungswasserwirtschaft<br />
Modulbeauftragter: Prof. Dr.-Ing. Johannes Pinnekamp<br />
Beteiligte Lehrstühle/Dozenten: Prof. Dr.-Ing. Johannes Pinnekamp<br />
Studiengänge<br />
Angebot (Turnus) Dauer Studienjahr<br />
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />
jährlich<br />
1 Semester 1./2. Studienjahr<br />
Kategorie Erläuterung<br />
Veranstaltungen und a) Vorlesung Mathematische Modelle in <strong>der</strong> Siedlungswasserwirtschaft<br />
Lehrformen b) Übung Mathematische Modelle in <strong>der</strong> Siedlungswasserwirtschaft<br />
Voraussetzungen Siedlungswasser- und Siedlungsabfallwirtschaft 1 – 3<br />
Lern-/<br />
Kenntnisse über Anwendungsbereiche von mathematischen Modellen in <strong>der</strong><br />
Qualifikationsziele Siedlungswasserwirtschaft. Grundwissen zu Inhalten und Unterschieden verschiedener<br />
Modellansätze. Verständnis <strong>der</strong> Zusammenhänge und Beeinflussungen<br />
zwischen Kanalnetz, Kläranlage und Gewässer. Modelltechnische<br />
59
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Inhalte<br />
(exemplarisch)<br />
Gruppengröße<br />
Umsetzung <strong>der</strong> Prozesse in <strong>der</strong> Abwasserableitung, Abwasserbehandlung und<br />
Gewässergütewirtschaft<br />
Grundlagen<br />
• Begriffe, Parameter, Modelltypen, Software-Tools<br />
• Integrierte Simulation<br />
Modelle in <strong>der</strong> Abwasserableitung<br />
• Verfahren, Modelle und Einsatzgebiete<br />
• Modellgrundlagen, Modellbegriffe, Modellaufbau<br />
• Hydrologische Modelle<br />
• Hydrodynamische Modellierung<br />
• Schmutzfrachtberechnungsmodelle<br />
• Kanalnetzsteuerung (Online-Simulation)<br />
Dynamische Simulation von Kläranlagen<br />
• Aufgaben und Anwendungsbereiche<br />
• Abgrenzung Simulation und Bemessung<br />
• Modellgrundlagen und Modellaufbau<br />
• Notwendige Vorarbeiten für eine Simulation, Parameterbestimmung<br />
• Durchführung und Interpretation von Simulationen<br />
• Online-Simulation<br />
Gewässergütemodelle<br />
• Begriffe, Parameter<br />
• Gewässergütemodelle<br />
Übungen<br />
• Anwendung von Kanalnetz-, Schmutzfrachtberechnungsprogrammen,<br />
Kläranlagensimulations- und Gewässergütemodellen<br />
Kontaktzeit<br />
a) 45 h b) 15 h<br />
Summe: 60 h<br />
Selbststudium a) 15 h b) 15 h<br />
Summe: 30 h<br />
CP<br />
a) + b) 4 CP<br />
Summe: 4 CP<br />
Voraussetzung für die<br />
Vergabe von<br />
CP-Punkten<br />
a) + b) Klausur (Dauer: 90 min)<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Punkteverteilung gewichtet.<br />
60
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Nebenfach: Stadtplanung<br />
Modul SWS CP Semester<br />
Handlungsfel<strong>der</strong> und Methoden <strong>der</strong> Stadtplanung (NF) 8 12 1-4<br />
Grundlagen <strong>der</strong> Stadtplanung (NF) 12 18 1-4<br />
Handlungsfel<strong>der</strong> und Methoden <strong>der</strong> Stadtplanung (NF)<br />
Modulbeauftragte: Prof. Dr. Klaus Selle, Prof. Kunibert Wachten<br />
Veranstaltungen Für den B.Sc. sind 4, für den M.Sc. 3 Lehrveranstaltungen aus einem Angebot zu<br />
wählen, das mindestens die unten stehenden Lehrveranstaltungen enthält. Die Lehrveranstaltungen<br />
werden als Seminare durchgeführt.<br />
Lern-/<br />
Qualifikationsziele<br />
Inhalte<br />
(exemplarisch)<br />
a) Stadt- und Regionalplanung: Die Verantwortung gibt einen Überblick über die<br />
wichtigsten Programme <strong>der</strong> Stadt- und Regionalplanung und zeigt Anwendungsfälle<br />
auf<br />
b) Stadterneuerung und Quartiersentwicklung: Vermittlung von Grundlagen <strong>der</strong><br />
Gestaltung städtischer Transformationsprozesse auf Quartiersebene<br />
c) Planungsrecht und Bauleitplanung: Die Veranstaltung führt in die Systematik<br />
des städtebaulichen Rechtsinstrumentariums ein und stellt an konkreten Fällen<br />
die Anwendungsbezüge her.<br />
d) Methoden <strong>der</strong> Prozessgestaltung und Projektentwicklung: Mit <strong>der</strong> Veranstaltung<br />
sollen den Studierenden Grundlagen und Fähigkeiten zur dialogischen Gestaltung<br />
von Prozessen <strong>der</strong> Planung und Entwicklung vermittelt werden.<br />
a) Stadt- und Regionalplanung: Sowohl klassische als auch aktuelle Strategien und<br />
Modelle <strong>der</strong> Stadt- und Regionalplanung werden an Praxisbeispielen dargestellt<br />
und unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Rahmenbedingungen diskutiert. Ein<br />
Schwerpunkt liegt auf <strong>der</strong> Betrachtung von Programmen im Rahmen <strong>der</strong> Städtebauför<strong>der</strong>ung<br />
auf Bundes- und Landesebene. In verschiedenen Maßstabsebenen<br />
von <strong>der</strong> Region bis zum Quartier werden Ansätze wie Stadtumbau Ost/West, Soziale<br />
Stadt, Ab in die Mitte, REGIONALE in NRW, Internationale Bauausstellungen<br />
o<strong>der</strong> Programme zur Stadtbaukultur vorgestellt und bewertet. An Beispielen<br />
aus <strong>der</strong> Planungspraxis wird das Verhältnis von formeller und informeller Planung<br />
unter planungstheoretischen Aspekten analysiert.<br />
Literatur:<br />
BRAAM, W. (1999): Stadtplanung. Neuwied.<br />
Akademie für Raumforschung und Landespflege (ARL) (2005): Handwörterbuch <strong>der</strong><br />
Raumordnung. Hannover.<br />
SIEVERT, T. (1998): Zwischenstadt. Wiesbaden.<br />
ALBERS, G. (1992): Stadtplanung: Eine praxisorientierte Einführung.<br />
b) Stadterneuerung und Quartiersentwicklung: Auseinan<strong>der</strong>setzung mit den aktuellen<br />
Rahmenbedingungen <strong>der</strong> Stadtentwicklung in unterschiedlichen Teilräumen,<br />
Darstellung <strong>der</strong> Auswirkung auf die Quartiersebene. Darstellung und Analyse aktueller<br />
Politik- und Planungsprogramme (EU, Bund, Län<strong>der</strong>); Entwicklung von Kri-<br />
61
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
terien und Anwendung auf die Analyse eines Planungsfalles<br />
Literatur:<br />
MÜLLER U.A. (HG., 2003): Stadtentwicklung rückwärts. Dortmund.<br />
SELLE (2005): Stadtentwicklung ohne Wachstum, in: Ders.: Planen. Steuern. Entwickeln.<br />
Dortmund, S. 153 ff.<br />
c) Planungsrecht und Bauleitplanung: Die wesentlichen Grundbegriffe aus dem<br />
Baugesetzbuch, <strong>der</strong> Baunutzungsverordnung und <strong>der</strong> Planzeichenverordnung<br />
sowie ihre Umsetzung in Bauleitpläne (Flächennutzungsplan, Bebauungsplan,<br />
vorhabenbezogener Bebauungsplan). Das Verhältnis zwischen <strong>der</strong> örtlichen Gemeinschaft<br />
(Kommune) und dem Einzelnen, die Abwägung als wesentliches Instrument<br />
zum Ausgleich verschiedener Interessen.<br />
Literatur:<br />
Das Baugesetzbuch (2004)<br />
KUSCHNERUS, U. (2004): Der sachgerechte Bebauungsplan. Bonn.<br />
KUSCHNERUS, U. (2001): Das zulässige Bauvorhaben. Bonn.<br />
SCHMIDT-EICHSTAEDT, G. (1998): Städtebaurecht. Stuttgart.<br />
LOEWE, L./MÜLLER-BÜSCHING, F.–W. (2002): Landesbauordnung Nordrhein-<br />
Westfalen. Düsseldorf.<br />
FICKERT, H. C. /FIESELER, H. (2002): Der Umweltschutz im Städtebau.<br />
Port, N./Runkel, P. (1998): Baurecht für die kommunale Praxis. Berlin.<br />
d) Methoden <strong>der</strong> Prozessgestaltung und Projektentwicklung: Drei Fragenbereiche<br />
werden einführend behandelt: Warum Kommunikation bei Planung und Entwicklung?<br />
Wer ist beteiligt? Welche Inhalte sind Gegenstand <strong>der</strong> Kommunikation?<br />
Vor diesem Hintergrund soll dann anhand von konkreten Beispielen und praktischen<br />
Übungen die Gestaltung <strong>der</strong> Kommunikation analysiert und erprobt werden.<br />
Literatur:<br />
SELLE (2005): Planen. Steuern. Entwickeln. [Kap. 10, 14 und 15], Dortmund, S. 385<br />
ff./ 491 ff;<br />
RÖSENER/SELLE (2005): Kommunikation gestalten. Dortmund.<br />
Gruppengröße<br />
Kontaktzeit<br />
a) 30 h b) 30 h c) 30 h d) 30 h<br />
Summe: 120 h<br />
Selbststudium a) 60 h b) 60 h c) 60 h d) 60 h<br />
Summe: 240 h<br />
Kreditpunkte (CP) a) 3 CP b) 3 CP c) 3 CP d) 3 CP<br />
Kreditpunkte: 12 CP<br />
Prüfungsleistungen (a - d) jeweils Referat und Präsentation; (Bearbeitungszeit: jeweils 1 Woche, Präsentationszeit:<br />
20 Minuten)<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
62
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Grundlagen <strong>der</strong> Stadtplanung (SP 1) (NF)<br />
Modulbeauftragte: Prof. Dr. K. Selle, Prof. Dr. K. Wachten<br />
Veranstaltungen a) Vorlesung: Handlungsfel<strong>der</strong> <strong>der</strong> Stadtplanung<br />
b) Übung: StadtProjekt<br />
Lern-/<br />
a) Handlungsfel<strong>der</strong> <strong>der</strong> Stadtplanung (V)<br />
Qualifikationsziele Mit <strong>der</strong> Veranstaltung sollen den Studierenden Grundlagen <strong>der</strong> Stadt- und Landschaftsplanung<br />
vermittelt werden, die sie in die Lage versetzen, sich analytisch und<br />
konzeptionell mit konkreten Praxis-Aufgaben auseinan<strong>der</strong>zusetzen. Zugleich gilt es,<br />
Anregungen zur vertieften Auseinan<strong>der</strong>setzung mit Fragen des Städtebaus, <strong>der</strong><br />
Stadtentwicklung und Landschaftsarchitektur (z.B. in einem Master-Studium) zu geben.<br />
Inhalte<br />
(exemplarisch)<br />
b) StadtProjekt (Ü)<br />
Auseinan<strong>der</strong>setzung mit einer praxisbezogenen Aufgabenstellung <strong>der</strong> Stadt- und<br />
Landschaftsplanung<br />
a) Handlungsfel<strong>der</strong> <strong>der</strong> Stadtplanung (V)<br />
Folgende Aspekte sind zu behandeln:<br />
- Stadt-Qualitäten: Woran orientiert sich die Stadtplanung?<br />
- Nutzerperspektiven: Was ergibt sich daraus für Analyse und Konzeption?<br />
- Stadt-Akteure: Wer wirkt an <strong>der</strong> Stadtentwicklung mit?<br />
- Stadt- Bausteine: Offene Räume, Baufel<strong>der</strong><br />
- Stadt gestalten/Städtische Nutzungen: Wohnen & Wohngebiete, Wohnungsmarkt,<br />
Gewerbe/Einkaufen, Freizeit, Erholung, Tourismus, gemischte Nutzungen<br />
- Handlungsfel<strong>der</strong> <strong>der</strong> Stadtplanung (Überblick)<br />
- Stadt entwickeln – Prozesse gestalten: Mit welchen Instrumenten? Von <strong>der</strong> Analyse<br />
zum Konzept; Vom Konzept zur Realität; Prozesse (kommunikativ) gestalten<br />
Literatur:<br />
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (Hg.): Stadtentwicklung und Städtebau<br />
in Deutschland. Ein Überblick. Berichte Bd. 5. Bonn 2000<br />
WACHTEN, K. (HG.) (1996): Wandel ohne Wachstum. StadtBau-Kultur im 21. Jahrhun<strong>der</strong>t.<br />
Braunschweig, Vieweg-Verlag.<br />
Topos. European Landscape Magazine: Heft 28: Impulse durch Freiräume. September<br />
1999 und Heft 39: Öffentlicher Freiraum. Juni 2002. München, Callway Verlag<br />
HUMPERT, K. (1997): Einführung in den Städtebau. Stuttgart, Berlin, Köln, Kohlhammer.<br />
RAITH, E. (2000): Stadtmorphologie. Annäherungen, Umsetzungen, Aussichten. Wien,<br />
Springer Verlag.<br />
SELLE, K. (HG.) (2000): Vom „sparsamen Umgang“ zur „nachhaltigen Entwicklung“.<br />
Programme, Positionen und Projekte. 2. Auflage Dortmund<br />
SELLE, K. (HG.) (2003): Was ist los mit den öffentlichen Räumen? Dortmund (2. erweiterte<br />
Auflage)<br />
SELLE, K. (2005): Planen. Steuern. Entwickeln. Kap. 4 und 5<br />
63
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
b) Stadtprojekt (Ü)<br />
Insbeson<strong>der</strong>e drei Phasen stadtplanerischer Arbeit sollen erfahren und Zu b): Auseinan<strong>der</strong>setzung<br />
mit einer praxisbezogenen Aufgabenstellung <strong>der</strong> Stadt- und Landschaftsplanung<br />
erprobt werden:<br />
- Analyse: Auseinan<strong>der</strong>setzung mit dem Raum, seinen Entwicklungsbedingungen<br />
und den im Raum wirkenden Akteuren (Stakehol<strong>der</strong>)<br />
- Konzept: Entwicklung von thematischen und räumlichen Konzepten auf verschiedenen<br />
Maßstabsstufen<br />
- Durcharbeitung und Vertiefung: Städtebaulicher Entwurf, Berücksichtigung von<br />
Nutzer- und Nutzungsaspekten, Auseinan<strong>der</strong>setzung mit Fragen <strong>der</strong> Prozessgestaltung<br />
und <strong>der</strong> Umsetzung<br />
Literatur:<br />
HENRY BEIERLORZER, JOACHIM BOLL, KARL GANSER (HG.) (1999): Siedlungskultur.<br />
Neue und alte Gartenstädte im Ruhrgebiet. Braunschweig, Vieweg.<br />
ARIANE BISCHAFF, KLAUS SELLE, HEIDI SINNING (2005): Informieren, Beteiligen, Kooperieren.<br />
4. Völlig überarbeitete Auflage. Dortmund<br />
FALTIN • SCHEUVENS • WACHTEN (1997): Städtebauliche Wettbewerbe in Nordrhein-<br />
Westfalen. För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Planungs- und Baukultur. Im Auftrag des Ministeriums für<br />
Stadtentwicklung, Kultur und Sport des Landes NRW, Düsseldorf<br />
FLAGGE, I. UND PESCH, F. (HG.) (2004): Stadt und Wirtschaft. Darmstadt, Verlag Das<br />
Beispiel.<br />
GUNßER, C. (2003): Stadtquartiere. Neue Architektur für das Leben in <strong>der</strong> Stadt. Stuttgart/München,<br />
DVA.<br />
WACHTEN, K. (1999): Siedlungsbau an integrierten Standorten. in: Topos. European<br />
Landscape Magazine: Heft 26, S. 91 ff. März 1999. München, Callway.<br />
Wüstenrot Stiftung (Hg.) (2000) Umnutzungen im Bestand. Neue Zwecke für alte<br />
Gebäude. Stuttgart/Zürich, Karl Krämer Verlag.<br />
Gruppengröße<br />
Kontaktzeit<br />
a) 60 h b) 120 h<br />
Summe: 180 h<br />
Selbststudium a) 120 h b) 240 h<br />
Summe: 360 h<br />
Kreditpunkte (CP) a) 6 CP b) 12 CP<br />
Kreditpunkte: 18 CP<br />
Prüfungsleistungen a) und b): Übungsergebnisse (Hausarbeit, 4 Wochen Bearbeitungszeit, Gewichtung:<br />
67%) und mündliche Präsentation (20 Min., Gewichtung: 33%)<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
64
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Nebenfach: Verkehrswesen und Raumplanung I<br />
Modul SWS CP Semester<br />
Planungsmethodik (NF) 4 5 1-2<br />
Grundlagen <strong>der</strong> Verkehrsplanung (NF) 4 7 1-4<br />
Grundlagen <strong>der</strong> Stadt- und Regionalplanung (NF) 6 8 1-4<br />
Verkehrswesen und Raumplanung: Wahlpflichtfach 1<br />
(NF)<br />
Verkehrswesen und Raumplanung: Wahlpflichtfach 2<br />
(NF)<br />
4 5<br />
4 5<br />
Planungsmethodik (VW-RP-1) (NF)<br />
Modulbeauftragter: N.N. (Lehrstuhl Stadtbauwesen und Stadtverkehr)<br />
Veranstaltungen a) Planungsmethodik (V)<br />
b) Planungsmethodik (Ü)<br />
Lern-/<br />
Ziel des Moduls ist es, Abläufe von Planungsverfahren darzustellen und ausgewählte<br />
Qualifikationsziele quantitative Methoden im Bereich <strong>der</strong> Stadt- und Verkehrsplanung vorzustellen und<br />
anhand praktischer Übungen zu vertiefen.<br />
Nach Abschluss dieses Moduls sollen die Studierenden die Fähigkeit erworben haben,<br />
diese Methoden anwenden und beurteilen zu können, speziell im Zusammenhang<br />
mit städtebaulichen Projekten, <strong>der</strong> Dimensionierung von Projekten <strong>der</strong> sozialen<br />
Infrastruktur, den Grundlagen verkehrlicher Bedienungssysteme sowie <strong>der</strong> Dimensionierung<br />
verkehrlicher Anlagen als auch <strong>der</strong> Verkehrsflusssimulation.<br />
Im Rahmen von praktischen Übungsaufgaben aus unterschiedlichem planerischen<br />
Kontext werden die methodischen Grundlagen vertieft.<br />
Inhalte<br />
(exemplarisch)<br />
a) Planungsmethodik (V):<br />
Die Vorlesung führt allgemein in Planungsprozesse und Arbeitsprozesse ein. Fachliche<br />
Vertiefungen erfolgen in den Bereichen Nachfrageabschätzung im Bereich <strong>der</strong><br />
Raum- und Verkehrsplanung, in Grundlagen verkehrlicher Bedienungssysteme, <strong>der</strong><br />
Dimensionierung von Knotenpunkten, <strong>der</strong> Verkehrsflusssimulation, <strong>der</strong> Wirkungssimulation<br />
sowie Bewertungsverfahren.<br />
Literatur:<br />
Umdruck Planungsmethodik<br />
b) Planungsmethodik (Ü):<br />
Vertiefung <strong>der</strong> Vorlesungsinhalte anhand konkreter Aufgabenstellungen<br />
Literatur:<br />
Umdruck Planungsmethodik<br />
Gruppengröße<br />
Kontaktzeit<br />
a) 45 h b) 15 h<br />
Summe: 60 h<br />
Selbststudium a) 75 h b) 15 h<br />
Summe: 90 h<br />
Kreditpunkte (CP) a) 4 CP b) 1 CP<br />
Kreditpunkte: 5 CP<br />
Prüfungsleistungen a) und b) eine Klausur (120 Minuten)<br />
1-4<br />
1-4<br />
65
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
Grundlagen <strong>der</strong> Verkehrsplanung (Modul VW-RP-2) (NF)<br />
Modulbeauftragter: N.N. (Stadtbauwesen und Stadtverkehr)<br />
Veranstaltungen a) Grundlagen <strong>der</strong> Verkehrsplanung (V)<br />
b) Grundlagen <strong>der</strong> Verkehrsplanung, dabei selbstständige Bearbeitung einer<br />
Aufgabenstellung zu Grundlagen <strong>der</strong> Verkehrsplanung (Hausübung)<br />
Lern-/<br />
Ziel des Moduls ist es, die Grundlagen <strong>der</strong> städtischen und regionalen Verkehrspla-<br />
Qualifikationsziele nung, <strong>der</strong> Verkehrssteuerung, des Verkehrsmanagements sowie des Entwurfs, Baus<br />
und Betriebs von Verkehrsanlagen zu vermitteln.<br />
Die Studierenden erwerben Kenntnisse über die Grundlagen des Entwurfs und des<br />
Betriebes verkehrlicher Anlagen für alle Verkehrsarten und ihre Verknüpfungen sowie<br />
über die relevanten Richtlinien und Regelwerke. Es wird <strong>der</strong> theoretische Hintergrund<br />
<strong>der</strong> städtischen Verkehrstechnik erläutert, die Anwendung von Strategien <strong>der</strong> Verkehrslenkung<br />
bzw. Verkehrssteuerung sowie die Bemessung entsprechen<strong>der</strong> Anlagen.<br />
Die Systematik und Anwendbarkeit <strong>der</strong> verschiedenen Erhebungsverfahren wird behandelt,<br />
da sie als empirische Grundlagen für Bemessungen und Prognosen dienen.<br />
Es werden die verschiedenen Typen von Verkehrsberechnungsmodellen vorgestellt,<br />
ihre Typisierung, die Anwendungsbereiche, <strong>der</strong> theoretische Hintergrund, <strong>der</strong> Modellaufbau<br />
sowie die Funktionsweise. Speziell wird <strong>der</strong> sog. "4-Stufen-Algorithmus"<br />
vorgestellt, auf dem die meisten Verkehrsberechnungsmodelle basieren.<br />
Die Auswirkungen des Verkehrs sind ebenso ein Thema wie Bewertungs- und Beurteilungsverfahren<br />
zur Abwägung von Planungen und Wirkungen. Diese Verfahren<br />
werden typisiert, und es werden ihre Anwendungsbereiche, Aussagekraft und Übertragbarkeit<br />
dargestellt.<br />
Inhalte<br />
a) Grundlagen <strong>der</strong> Verkehrsplanung (V):<br />
(exemplarisch) Die Vorlesung behandelt folgende Schwerpunkte:<br />
- Wechselwirkungen zwischen Siedlungsstrukturen und Verkehrsentstehung bzw.<br />
Verkehrsabläufen<br />
- Verkehrsursachen / Entstehung von Verkehr<br />
- Datengrundlagen, Erhebungen, Messungen<br />
- modellgestützte Abbildung des Verkehrs / Verkehrsprognosen<br />
- Planung, Bau und Betrieb verkehrlicher Anlagen (motorisierter Individualverkehr,<br />
nichtmotorisierter Verkehr, straßengebundener öffentlicher Personennahverkehr,<br />
...)<br />
- Lenkung und Steuerung von Verkehr<br />
- Verkehrsinformation/-organisation (Mobilitätsmanagement).<br />
Literatur:<br />
Umdruck „Grundlagen <strong>der</strong> Verkehrsplanung“<br />
b) Grundlagen <strong>der</strong> Verkehrsplanung (Ü):<br />
In <strong>der</strong> Übung werden die theoretischen Grundlagen <strong>der</strong> Vorlesung in Berechnungs-<br />
66
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
beispielen praktisch umgesetzt. Daneben ist eine vorgegebene verkehrstechnische /<br />
verkehrsplanerische Aufgabenstellung selbstständig zu bearbeiten. Die Übung ist als<br />
semesterbegleitende Übung konzipiert und wird mit einem Kolloquium abgeschlossen.<br />
Literatur:<br />
Umdruck „Grundlagen <strong>der</strong> Verkehrsplanung“<br />
Gruppengröße<br />
Kontaktzeit<br />
a) 30 h b) 30 h<br />
Summe: 60 h<br />
Selbststudium a) 90 h b) 90 h<br />
Summe: 180 h<br />
Kreditpunkte (CP) a) 4 CP b) 4 CP<br />
Kreditpunkte: 8CP<br />
Prüfungsleistungen a) und b): eine Klausur (60 Minuten); Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung<br />
ist die erfolgreiche selbstständige Bearbeitung <strong>der</strong> Hausübung sowie ein Kolloquium<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
Grundlagen <strong>der</strong> Stadt- und Regionalplanung (Modul VW-RP-3) (NF)<br />
Modulbeauftragter: N.N. (Lehrstuhl Stadtbauwesen und Stadtverkehr)<br />
Veranstaltungen a) Grundlagen <strong>der</strong> Stadt- und Regionalplanung (V)<br />
b) Entwurfsübung zu Grundlagen <strong>der</strong> Stadt- und Regionalplanung (Ü)<br />
Lern-/<br />
Qualifikationsziele<br />
Inhalte<br />
(exemplarisch)<br />
Ziel des Moduls ist es, die inhaltlichen, technischen, methodischen und rechtlichen<br />
Grundlagen sowie Entwurfs- und Berechnungsmethoden des Städtebaus, <strong>der</strong> Stadtplanung<br />
und <strong>der</strong> Erschließungsplanung zu vermitteln.<br />
Nach Abschluss dieses Moduls sollen die Studierenden die Fähigkeit erworben haben,<br />
die Zusammenhänge des Planungssystems <strong>der</strong> Bundesrepublik Deutschland zu<br />
verstehen und in den europäischen Kontext zu stellen, die grundlegenden Methoden,<br />
Verfahren und Instrumente <strong>der</strong> räumlichen Planung zu verstehen und anwenden zu<br />
können, den Planungsablauf, die Arbeitsschritte und das Instrumentarium <strong>der</strong> Bauleitplanung<br />
zu beherrschen, Nutzungs-, Erschließungs- und Bebauungssysteme zu<br />
entwerfen und zu beurteilen und in Rechtspläne umzusetzen sowie städtebauliche<br />
Qualitäten beurteilen zu können.<br />
Sie haben dabei grundlegende Arbeitstechniken <strong>der</strong> grafischen Datenverarbeitung<br />
kennen gelernt und sind in <strong>der</strong> Lage, diese selbstständig im Rahmen eigener kleiner<br />
Entwürfe einzusetzen.<br />
a) Grundlagen <strong>der</strong> Stadt- und Regionalplanung (V):<br />
Im Rahmen <strong>der</strong> Vorlesung werden die rechtlichen Grundlagen, Verfahren und Planungsabläufe<br />
in <strong>der</strong> Raumordnung und Landesplanung sowie in <strong>der</strong> Stadt- und Regionalplanung<br />
dargestellt. Die Grundzüge <strong>der</strong> Planungsprozesse, Dimensionierungsgrundlagen<br />
für Stadtplanung sowie für die soziale und technische Infrastrukturplanung,<br />
Wirkungsanalysen und Risikoabschätzungen sowie die räumlichen Entwicklung<br />
sind weitere Bestandteile <strong>der</strong> Vorlesung. Die Vorlesung vermittelt methodische Grundlagen<br />
<strong>der</strong> Planung und erläutert <strong>der</strong>en praktische Anwendung.<br />
Literatur:<br />
Umdruck „Grundlagen <strong>der</strong> Stadt- und Regionalplanung“<br />
67
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
b) Grundlagen <strong>der</strong> Stadt- und Regionalplanung (Ü):<br />
Vertiefung <strong>der</strong> Inhalte <strong>der</strong> Vorlesung sowie Vertiefung des Entwurfsprozesses. Eigenständiger<br />
Entwurf eines beispielhaften Baugebietes, Berechnung städtebaulicher<br />
Kennwerte und Umsetzung in einen Rechtsplan<br />
Literatur:<br />
Umdruck „Grundlagen <strong>der</strong> Stadt- und Regionalplanung“<br />
Gruppengröße<br />
Kontaktzeit<br />
a) 30 h b) 30 h<br />
Summe: 60 h<br />
Selbststudium a) 60 h b) 90 h<br />
Summe: 150h<br />
Kreditpunkte (CP) a) 3 CP b) 4 CP c)<br />
Kreditpunkte: 7 CP<br />
Prüfungsleistungen a) und b): eine Klausur (60 Minuten); Voraussetzung zur Zulassung zur Modulprüfung<br />
ist die erfolgreiche selbstständige Bearbeitung einer vorgegebenen Entwurfsaufgabe<br />
(Hausübung) und einer Kurzpräsentation<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
Verkehrswesen und Raumplanung Wahlpflichtfach 1 (Modul VW-RP-4) (NF)<br />
(zu wählen ist 1 aus den 5 u.g. Wahlpflichtfächern, sofern nicht in Wahlpflichtfach 2 gewählt)<br />
Modulbeauftragter: N.N. (Lehrstuhl Stadtbauwesen und Stadtverkehr)<br />
und jeweilige Professoren <strong>der</strong> Wahlpflichtfächer<br />
Veranstaltungen a) Vorlesungen zu Wahlpflichtfach 1<br />
b) Übungen zu Wahlpflichtfach 1<br />
Lern-/<br />
Ziel <strong>der</strong> Wahlpflichtmodule ist die Vermittlung weiteren Grundlagenwissens aus Fach-<br />
Qualifikationsziele gebieten des Bauingenieurwesens, die dem Fach Stadtbauwesen und Stadtverkehr<br />
fachlich sehr nahe stehen. Den Studierenden soll hiermit neben <strong>der</strong> Vermittlung einer<br />
breiteren Wissensbasis auch die Möglichkeit einer fachlichen Akzentuierung <strong>der</strong> Studieninhalte<br />
nach eigenen Vorstellungen gegeben werden.<br />
Inhalte<br />
a) Vorlesungen:<br />
(exemplarisch) Lehrinhalte nach <strong>der</strong> Studienordnung für den Diplomstudiengang Bauingenieurwesen<br />
(Wahlpflichtfach 1)<br />
b) Übung zu den Wahlpflichtfächern:<br />
Vertiefung <strong>der</strong> Vorlesungsinhalte anhand konkreter Aufgabenstellungen (Wahlpflichtfach<br />
1)<br />
WAHLPFLICHTFÄCHER:<br />
- Schienenbahnwesen (Lehrstuhl für Schienenbahnwesen und Verkehrswirtschaft)<br />
- Verkehrswirtschaft (Lehrstuhl für Schienenbahnwesen und Verkehrswirtschaft)<br />
- Straßenplanung I (Lehrstuhl für Straßenwesen, Erd- und Tunnelbau)<br />
- Flughafenwesen (Lehr- und Forschungsgebiet Flughafenwesen und Luftverkehr)<br />
- Siedlungswasserwirtschaft und -abfallwirtschaft I (Lehrstuhl für Siedlungswasserwirtschaft<br />
und Siedlungsabfallwirtschaft)<br />
- Immobilienprojekte und Unternehmensstrategien (Lehrstuhl für Baubetrieb-<br />
Projektmanagement)<br />
68
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Literatur:<br />
Je nach Wahlpflichtfach variabel<br />
Gruppengröße<br />
Kontaktzeit<br />
a) 30 h b) 30 h<br />
Summe: 60 h<br />
Selbststudium a) 75 h b) 15 h<br />
Summe: 90 h<br />
Kreditpunkte (CP) a) 3,5 CP b) 1,5 CP<br />
Kreditpunkte: 5 CP<br />
Prüfungsleistungen a) und b) eine Klausur (90 Minuten) zu Vorlesungen und Übungen <strong>der</strong> jeweiligen<br />
Wahlpflichtfächer; Voraussetzung zur Zulassung zur Modulprüfung ist ggf. nach<br />
Vorgabe <strong>der</strong> für das Fach verantwortlichen Lehrstühle die erfolgreiche Teilnahme<br />
an <strong>der</strong> Übung des jeweiligen Wahlpflichtfaches.<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
Verkehrswesen und Raumplanung Wahlpflichtfach 2 (Modul VW-RP-5) (NF)<br />
(zu wählen ist 1 aus den u.g. 5 Wahlpflichtfächern, sofern nicht in Wahlpflichtfach 1 gewählt)<br />
Modulbeauftragter: N.N. (Lehrstuhl Stadtbauwesen und Stadtverkehr)<br />
und jeweilige Professoren <strong>der</strong> Wahlpflichtfächer<br />
Veranstaltungen a) Vorlesungen zu Wahlpflichtfach 2<br />
b) Übungen zu Wahlpflichtfach 2<br />
Lern-/<br />
Ziel <strong>der</strong> Wahlpflichtmodule ist die Vermittlung weiteren Grundlagenwissens aus Fach-<br />
Qualifikationsziele gebieten des Bauingenieurwesens, die dem Fach Stadtbauwesen und Stadtverkehr<br />
fachlich sehr nahe stehen. Den Studierenden soll hiermit neben <strong>der</strong> Vermittlung einer<br />
breiteren Wissensbasis auch die Möglichkeit einer fachlichen Akzentuierung <strong>der</strong> Studieninhalte<br />
nach eigenen Vorstellungen gegeben werden.<br />
Inhalte<br />
a) Vorlesungen:<br />
(exemplarisch)<br />
Gruppengröße<br />
Lehrinhalte nach <strong>der</strong> jetzt gültigen Studienordnung für den Diplomstudiengang Bauingenieurwesen<br />
(Wahlpflichtfach 2)<br />
b) Übung zu den Wahlpflichtfächern:<br />
Vertiefung <strong>der</strong> Vorlesungsinhalte anhand konkreter Aufgabenstellungen (Wahlpflichtfach<br />
2)<br />
WAHLPFLICHTFÄCHER:<br />
- Schienenbahnwesen (Lehrstuhl für Schienenbahnwesen und Verkehrswirtschaft)<br />
- Verkehrswirtschaft (Lehrstuhl für Schienenbahnwesen und Verkehrswirtschaft)<br />
- Straßenplanung I (Lehrstuhl für Straßenwesen, Erd- und Tunnelbau)<br />
- Flughafenwesen (Lehr- und Forschungsgebiet Flughafenwesen und Luftverkehr)<br />
- Siedlungswasserwirtschaft und -abfallwirtschaft I (Lehrstuhl für Siedlungswasserwirtschaft<br />
und Siedlungsabfallwirtschaft)<br />
- Immobilienprojekte und Unternehmensstrategien (Lehrstuhl für Baubetrieb-<br />
Projektmanagement)<br />
Literatur: Umdrucke <strong>der</strong> jeweiligen Lehrstühle<br />
Kontaktzeit<br />
a) 30 h b) 30 h<br />
Summe: 60 h<br />
Selbststudium a) 75 h b) 15 h<br />
Summe: 90 h<br />
Kreditpunkte (CP) a) 3,5 CP b) 1,5 CP<br />
Kreditpunkte: 5 CP<br />
Prüfungsleistungen a) und b) eine Klausur (90 Minuten) zu Vorlesungen und Übungen <strong>der</strong> jeweiligen<br />
69
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Wahlpflichtfächer; Voraussetzung zur Zulassung zur Modulprüfung ist ggf. nach<br />
Vorgabe <strong>der</strong> für das Fach verantwortlichen Lehrstühle die erfolgreiche Teilnahme<br />
an <strong>der</strong> Übung des jeweiligen Wahlpflichtfaches.<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
70
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Nebenfach Verkehrswesen und Raumplanung II<br />
Modul SWS CP Semester<br />
Methodik <strong>der</strong> Stadt- und Regionalplanung 7 10 1-2<br />
Methoden <strong>der</strong> Verkehrsplanung 5 8 1-2<br />
Kommunale Infrastrukturplanung 5 7 3-4<br />
Verkehrsstädtebauliche Projektentwicklung und -<br />
realisierung<br />
4 5 3-4<br />
Modul: Methodik <strong>der</strong> Stadt- und Regionalplanung (Modul SR-2, Pflichtmodul)<br />
Modulbeauftragter: Prof. Vallée<br />
Studiengang<br />
Angebot (Turnus) Dauer Studienjahr<br />
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />
M.Sc. Wirtschaftsgeographie<br />
jährlich<br />
1 Semester (WS) 1. Studienjahr<br />
Kategorie Erläuterung<br />
Veranstaltungen und a) Vorlesung: Methodik <strong>der</strong> Stadt- und Regionalplanung<br />
Lehrformen<br />
b) Übung: Methodik zur Stadt- und Regionalplanung<br />
c) Vertiefungsentwurf zur Methodik <strong>der</strong> Stadt- und Regionalplanung<br />
d) Städtebau und Verkehrsseminar<br />
Voraussetzungen SR-1<br />
Lern-/<br />
Das Modul vertieft die Planung, die Dimensionierung, den Entwurf, die Beurteilung und<br />
Qualifikationsziele Bewertung sowie das Management städtischer und regionaler Siedlungs- und Infrastruktursysteme<br />
in Rückkopplung zu ökonomischen, sozialen und ökologischen Auswirkungen.<br />
Nach Abschluss dieses Moduls sollen die Studierenden die Fähigkeit erworben haben,<br />
Wirkgrößen und Handlungsmöglichkeiten im Gesamtzusammenhang städtischer und<br />
regionaler Planung einzuordnen und das Gesamtsystem räumlicher Entwicklung sinnvoll<br />
optimieren zu können. Hinzu kommt die adäquate Darstellung <strong>der</strong> Inhalte in wissenschaftlichen<br />
Texten und fachbezogenen Präsentationen.<br />
Inhalte<br />
a) Vorlesung Methodik <strong>der</strong> Stadt- und Regionalplanung:<br />
(exemplarisch) Es werden sowohl Methoden für einzelne Teilbereiche (z.B. Bevölkerungs-, Haushaltsprognosen<br />
und Siedlungsflächenprognosen, Beurteilungs- und Abwägungsverfahren im<br />
Umweltbereich) als auch die Wechselwirkungen zwischen unterschiedlichen räumlichen<br />
Planungsebenen (Raumordnung, Landes- und Regionalplanung, Stadtentwicklung) und<br />
fachlichen Bereichen (Siedlungsentwicklung, Verkehr, Umwelt) angesprochen. Die Veranstaltung<br />
deckt somit den gesamten Bereich <strong>der</strong> Planung und Koordination städtischer<br />
und regionaler Siedlungs-, Infrastruktur, Umwelt- und Verkehrssysteme, ergänzt durch<br />
aktuelle Entwicklungstendenzen und Forschungsergebnisse, ab.<br />
b) Übung Methodik <strong>der</strong> Stadt- und Regionalplanung:<br />
Das methodische Instrumentarium, die technischen und fachlichen Rahmenbedingungen,<br />
die rechtlichen, organisatorischen und finanziellen Umsetzungsmöglichkeiten sowie<br />
die zu erwartenden Wirkungen für relevante Aufgaben <strong>der</strong> Stadt- und Regionalplanung<br />
werden an praxisrelevanten Beispielen vermittelt und vertieft.<br />
c) Vertiefungsentwurf:<br />
71
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Gruppengröße<br />
Kontaktzeit<br />
Selbststudium<br />
CP<br />
Voraussetzung für die<br />
Vergabe von CP<br />
Eigenständige Erstellung eines vertiefenden Entwurfs<br />
d) Städtebau- und Verkehrsseminar:<br />
Anhand eines aktuellen Themas aus dem Themenbereich Städtebau/Stadtplanung/Stadtverkehr<br />
wird eine Seminararbeit angefertigt. Diese Arbeit wird in<br />
einem Vortrag mit Diskussion im Rahmen des Seminars vorgestellt.<br />
a) 30 b) 30 c) 4 d) 1<br />
a) 30 h b) 30 h c) 30 h d) 15 h<br />
a) 90 h b) 15 h c) 45 h d) 45 h<br />
a) 4 CP b) 1,5 CP c) 2,5 CP d) 2,0 CP<br />
Summe: 105 h<br />
Summe: 195 h<br />
Kreditpunkte: 10,0 CP<br />
a) bis c) Klausur (bis 90 Minuten) über die Inhalte <strong>der</strong> Vorlesung und Übung Methodik<br />
<strong>der</strong> Stadt- und Regionalplanung; Voraussetzung zur Zulassung zur Modulprüfung ist die<br />
erfolgreiche selbstständige Bearbeitung einer vorgegebenen Entwurfsaufgabe (Hausübung)<br />
und einer Kurzpräsentation sowie die Anfertigung <strong>der</strong> unter d) beschriebenen<br />
Hausarbeit und Kurzpräsentation (Referat)<br />
Note Die Modulnote entspricht <strong>der</strong> Klausurnote.<br />
Modul: Methoden <strong>der</strong> Verkehrsplanung (Modul V-2, Pflichtmodul)<br />
Modulbeauftragter: Prof. Vallée<br />
Studiengang<br />
Angebot (Turnus) Dauer Studienjahr<br />
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />
M.Sc. Wirtschaftsgeographie<br />
jährlich<br />
1 Semester (SS) 1. Studienjahr<br />
Kategorie Erläuterung<br />
Veranstaltungen und a) Vorlesung: Methodik <strong>der</strong> Verkehrsplanung<br />
Lehrformen<br />
b) EDV-gestützte Übung zu Methodik <strong>der</strong> Verkehrsplanung<br />
c) Vorlesung: Verkehrsmanagement und Verkehrssteuerung<br />
Voraussetzungen V-1 (Grundlagen <strong>der</strong> Verkehrsplanung)<br />
Lern-/<br />
Im Modul „Methodik <strong>der</strong> Verkehrsplanung“ werden aufbauend auf dem Modul „Grundla-<br />
Qualifikationsziele gen <strong>der</strong> Verkehrsplanung“ die Wechselwirkungen von Raum-/Siedlungsentwicklung und<br />
<strong>der</strong> Verkehrsentwicklung vertieft dargestellt. Dabei werden Ressourcenbeanspruchung,<br />
Sozialsystem und Wirtschaftssystem in die Betrachtung einbezogen. Es werden vertiefende<br />
Sachkenntnisse und methodische Grundlagen <strong>der</strong> sozialen, ökonomischen und<br />
ökologischen Auswirkungen von Siedlungen, Verkehrsanlagen und Verkehrsabläufen<br />
vermittelt. Aus <strong>der</strong> Kenntnis <strong>der</strong> Grundlagen und <strong>der</strong> methodischen Vorgehensweise<br />
heraus werden Handlungsansätze zur Gestaltung von Verkehrssystemen, Verkehrsnetzen,<br />
Verkehrsanlagen und des Verkehrssystemmanagements dargestellt. Die Methoden<br />
einer umweltverträglichen verkehrsmittelsystemübergreifenden Verkehrsplanung, <strong>der</strong><br />
Beurteilung und Abwägung von Handlungsalternativen und die EDV-gestützte Abschätzung<br />
<strong>der</strong> sozialen, ökonomischen und ökologischen Auswirkungen werden durch exemplarische<br />
Anwendungen erlernt.<br />
Die in "Grundlagen <strong>der</strong> Verkehrsplanung" vermittelten Kenntnisse zur Dimensionierung<br />
und zum Betrieb von Verkehrsanlagen werden in <strong>der</strong> Vorlesung „Verkehrsmanagement<br />
und Verkehrssteuerung“ erweitert und vertieft. Ein Schwerpunkt liegt hierbei – neben<br />
<strong>der</strong> Vermittlung von Bemessungs- und Steuerungsverfahren maßgeben<strong>der</strong> technischer<br />
72
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Inhalte<br />
(exemplarisch)<br />
Regelwerke – in <strong>der</strong> ausführlichen Darstellung <strong>der</strong> theoretischen Grundlagen zur Beschreibung<br />
des Straßenverkehrsablaufs. Hieraus abgeleitet werden verschiedene Methoden<br />
und Lösungsansätze zur Simulation des Verkehrs aufgezeigt, mit <strong>der</strong>en Hilfe<br />
Erkenntnisse über Verkehrszustände gewonnen werden können, die durch Messung<br />
und Beobachtung nur schwierig o<strong>der</strong> überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Ein weiterer<br />
Schwerpunkt wird in <strong>der</strong> Darstellung von Verkehrssystemmanagement (VSM)-Aufgaben<br />
und -Maßnahmen gesetzt. Unter <strong>der</strong> Zielsetzung, für das Gesamtverkehrssystem die<br />
Kapazitätsreserven zu mobilisieren, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, die Umweltbelastungen<br />
zu reduzieren und die Wirtschaftlichkeit zu verbessern, werden sowohl Handlungsmöglichkeiten<br />
als auch die Wirkungszusammenhänge verschiedener Maßnahmen<br />
aufgezeigt.<br />
Neben <strong>der</strong> verkehrssystemübergreifenden ("intermodalen") Betrachtung wird auf die<br />
jeweils verkehrsmittelspezifischen Beson<strong>der</strong>heiten (MIV, ÖPNV) eingegangen. Es werden<br />
Steuerungs- und Lenkungsstrategien einschließlich notwendiger Informationsgrundlagen,<br />
Informationsflüsse, Optimierungskriterien und Optimierungsverfahren erläutert.<br />
a) Vorlesung Methodik <strong>der</strong> Verkehrsplanung:<br />
Die Vorlesung behandelt folgende Schwerpunkte:<br />
− Prozess <strong>der</strong> Verkehrsplanung, Verkehrsentwicklungsplanung<br />
− Verkehrsursachen, Wirkungszusammenhänge<br />
− Wechselwirkungen Siedlung / Standortmuster und Verkehr<br />
− Erhebungen / Daten<br />
− Modelle, Prognosen, Szenarien<br />
− Verkehrserzeugung<br />
− Theorie <strong>der</strong> Nutzenmaximierungsmodelle<br />
− Verkehrsverteilung<br />
− Modal Split / Verkehrsaufteilung<br />
− Routensuche und Umlegung<br />
− Verkehrsflusssimulation<br />
− Wirkungsermittlung<br />
− Beurteilung, Abwägung und Auswahl<br />
b) EDV-gestützte Übung zu Methoden <strong>der</strong> Verkehrsplanung:<br />
Inhalt <strong>der</strong> Übung ist (in Anlehnung an Teile einer städtischen Verkehrsentwicklungsplanung)<br />
die modellmäßige Prognose des Verkehrsaufkommens und die Berechnung von<br />
relevanten Verkehrskenngrößen (z.B. Modal-Split, Belastungen im Verkehrsnetz) auf<br />
<strong>der</strong> Basis verän<strong>der</strong>ter räumlicher Nutzungen. In <strong>der</strong> Übung werden die theoretischen<br />
Grundlagen <strong>der</strong> Vorlesung in Berechnungsbeispielen praktisch umgesetzt.<br />
Der Einsatz EDV-gestützter Hilfsmittel für den Teilbereich <strong>der</strong> Abschätzung <strong>der</strong> Verkehrsabläufe<br />
und <strong>der</strong> Berechnungen <strong>der</strong> Auswirkungen an einzelnen Knoten auf den<br />
Strecken eines Verkehrsnetzes und in einem Gesamtverkehrsnetz ist Teil <strong>der</strong> Ausbildung<br />
und basiert auf <strong>der</strong> modellmäßigen Abbildung <strong>der</strong> komplexen Ursache-Wirkungs-<br />
Zusammenhänge (Wechselwirkungen) zwischen <strong>der</strong> Raum-/Siedlungsstruktur, dem<br />
73
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Gruppengröße<br />
Kontaktzeit<br />
Selbststudium<br />
Kreditpunkte<br />
Voraussetzung für die<br />
Vergabe von CP<br />
Note<br />
Verkehrsverhalten <strong>der</strong> Menschen und den Verkehrssystemangeboten.<br />
Die Übung zur Methodik <strong>der</strong> Verkehrsplanung ist als semesterbegleitende Gruppenübung<br />
konzipiert und wird mit einer Präsentation und Diskussion <strong>der</strong> Übungsarbeit abgeschlossen.<br />
c) Vorlesung Verkehrsmanagement und Verkehrssteuerung:<br />
Die Vorlesung behandelt folgende Schwerpunkte:<br />
− Theoretische Grundlagen; Simulation<br />
− Wahrscheinlichkeitsverteilungen einer Zufallsgröße<br />
− Steuerungsverfahren; Grüne Welle<br />
− Lichtsignalanlagen: Son<strong>der</strong>aspekte<br />
− Verkehrssystem-Management (VSM): Grundlagen, statische Informationssysteme<br />
− Verkehrssystem-Management (VSM): Maßnahmen im MIV<br />
− Verkehrssystem-Management (VSM): Maßnahmen im ÖPNV<br />
− Verkehrssicherheit<br />
a) 100 b) max. 15 c) 100<br />
a) 30 h b) 30 h c) 15 h<br />
a) 110 h b) 5 h c) 50 h<br />
a) 4,7 CP b) 1,2 CP c) 2,2 CP<br />
Summe: 75 h<br />
Summe: 165 h<br />
Kreditpunkte: 8,0 CP<br />
a) bis c) Klausur (60-90 Minuten) über die Inhalte <strong>der</strong> Vorlesungen und Übung;<br />
Voraussetzung zur Zulassung zur Modulprüfung ist die erfolgreiche Teilnahme<br />
an <strong>der</strong> Übung Methodik <strong>der</strong> Verkehrsplanung<br />
Die Modulnote entspricht <strong>der</strong> Klausurnote.<br />
Modul: Kommunale Infrastrukturplanung (Modul KIP, Pflichtmodul)<br />
Modulbeauftragter: Prof. Vallée<br />
Studiengang<br />
Angebot (Turnus) Dauer Studienjahr<br />
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />
M.Sc. Wirtschaftsgeographie<br />
jährlich<br />
2 Semester 2. Studienjahr<br />
Kategorie Erläuterung<br />
Veranstaltungen und a) Vorlesung: Kommunale Infrastrukturplanung I (WS)<br />
Lehrformen<br />
b) Vorlesung: Kommunale Infrastrukturplanung II (SS)<br />
Voraussetzungen SR-2<br />
Lern-/<br />
Ziel des Moduls ist es, die Rahmenbedingungen und Methoden <strong>der</strong> kommunalen Infra-<br />
Qualifikationsziele strukturplanung und <strong>der</strong> Stadtentwicklung zu vermitteln und anhand von Beispielen<br />
praxisnah umzusetzen.<br />
Nach Abschluss dieses Moduls sollen die Studierenden die notwendigen rechtlichen<br />
und organisatorischen Rahmenbedingungen, die Finanzierungsmöglichkeiten und die<br />
technische Realisierung von kommunaler Infrastruktur (Verkehr, Städtebau, Tiefbau,<br />
Ver- und Entsorgung) beherrschen. Sie werden dazu die Kommunale Organisation und<br />
Abläufe, den Aufbau und die Arbeitsweise <strong>der</strong> Verwaltung kennen lernen. Die Finanzierung<br />
kommunaler Infrastrukturmaßnahmen, die Vergabe von Aufträgen, Realisierung<br />
74
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Inhalte<br />
(exemplarisch)<br />
Gruppengröße<br />
von Infrastrukturprojekten sowie Erhaltungs- und Erneuerungsstrategien sind weitere<br />
Schwerpunkte.<br />
Die quantitativen und qualitativen Datengrundlagen stellen eine grundlegende Basis bei<br />
<strong>der</strong> Planung und Erhaltung kommunaler Infrastruktur dar. Daher werden die in diesem<br />
Zusammenhang relevanten statistischen Methoden wie Wahrscheinlichkeitsverteilungen;<br />
Test- und Schätzverfahren, multivariate statistische Verfahren, Korrelation und<br />
Regression, Varianzanalyse und Clusteranalyse vorgestellt. Für den Bereich <strong>der</strong> empirischen<br />
Sozialforschung werden Objektbereiche, Skalen, Gütekriterien und Erhebungsinstrumente/<br />
Erhebungsmethoden vertieft.<br />
Die Projektentwicklung und das Projektmanagement von städtebaulichen Projekten ist<br />
ein weiterer Schwerpunkt, bei dem Berechnungsverfahren für Renditeermittlung von<br />
Immobilienprojekte, die Projektentwicklung in Public-Private-Partnerships sowie die<br />
Erschließung und Bebauung von Wohngebieten im Kostenvergleich im Mittelpunkt stehen.<br />
a) Vorlesung Kommunale Infrastrukturplanung I:<br />
Die Vorlesung stellt die wesentlichen Grundlagen <strong>der</strong> kommunalen Infrastrukturplanung<br />
(Gesetzliche Rahmenbedingungen, Organisation und Abläufe und Verfahren) sowie<br />
anhand praktischer Beispiele das Zusammenspiel von Planung, Abstimmung, Finanzierung,<br />
För<strong>der</strong>ung, Vergabe und Realisierung von kommunalen Infrastruktureinrichtungen<br />
dar. Schwerpunkte sind Organisation und Abläufe in <strong>der</strong> öffentlichen Verwaltung. Ein<br />
weiterer Schwerpunkt sind wichtige statistische Verfahren, die in <strong>der</strong> Infrastrukturplanung<br />
angewandt werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Anwendungsgebieten zu<br />
Haushaltsstrukturen und realisiertem Verkehrsverhalten. Dazu werden Verfahren <strong>der</strong><br />
Korrelations- und Regressionsrechnung, <strong>der</strong> Varianzanalyse und <strong>der</strong> Clusteranalyse<br />
theoretisch und anhand von Beispielen näher erläutert.<br />
b) Vorlesung Kommunale Infrastrukturplanung II: Die Veranstaltung umfasst im ersten<br />
Block einen Vorlesungsteil und Teile mit Übungscharakter zu Methoden empirischer<br />
Sozialforschung. Zunächst werden die theoretischen Grundlagen vermittelt, die für die<br />
Konzeption, Durchführung und Auswertung empirischer Studien benötigt werden. Für<br />
eine ausgewählte aktuelle Fragestellung wird ein vollständiges Erhebungskonzept einschließlich<br />
<strong>der</strong> Erhebungsinstrumente erarbeitet. Die Erhebungen werden von den Studierenden<br />
durchgeführt und ausgewertet. Die Ergebnisse werden abschließend präsentiert<br />
und in einem kurzen Bericht zusammengefasst.<br />
In einem zweiten Block wird die Zusammenarbeit von verschiedenen Akteuren zur Entwicklung<br />
von Baugebieten und Einzelimmobilien betrachtet. Dazu werden Grundlagen<br />
und Methoden <strong>der</strong> Projektentwicklung und des Projektmanagements vorgestellt. Weitere<br />
Inhalte sind Grundlagen und Anwendungsmöglichkeiten von Planungsinformationssystemen<br />
und GIS-Systemen in <strong>der</strong> Stadt- und Verkehrsplanung.<br />
a) 30 b) 30<br />
Kontaktzeit<br />
a) 45 h b) 30 h<br />
Summe: 75 h<br />
Selbststudium a) 70 h b) 65 h<br />
Summe: 135 h<br />
CP<br />
a) 3,8 CP b) 3,2 CP<br />
Kreditpunkte: 7,0 CP<br />
Voraussetzung für die a) und b) Klausur (bis 90 Minuten) zu Vorlesungen und Übungen „Kommunale Infra-<br />
Vergabe von CP strukturplanung“ Voraussetzung zur Zulassung zur Modulprüfung ist die erfolgreiche<br />
selbstständige Bearbeitung einer vorgegeben Erhebungsaufgabe (Hausübung) und<br />
einer Kurzpräsentation<br />
Note Die Modulnote entspricht <strong>der</strong> Klausurnote.<br />
75
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Modul: Verkehrsstädtebauliche Projektentwicklung und -realisierung<br />
Modulbeauftragter: Prof. Vallée<br />
Studiengang<br />
Angebot (Turnus) Dauer Studienjahr<br />
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />
M.Sc. Wirtschaftsgeographie<br />
jährlich<br />
1-2 Semester 2. Studienjahr<br />
Kategorie Erläuterung<br />
Veranstaltungen und a) Vorlesung: Verkehrsstädtebauliche Projektentwicklung und -realisierung<br />
Lehrformen<br />
b) Übung: Verkehrsstädtebauliche Projektentwicklung und –realisierung<br />
c) Projekt: Verkehrsstädtebauliche Projektentwicklung und –realisierung<br />
Voraussetzungen PM (Planungsmethodik), V (Verkehrsplanung) 1/2, SR (Stadt- und Regionalplanung)<br />
1/2,<br />
Lern-/<br />
Ziel des Wahlpflichtmoduls ist die Ergänzung, integrierte Anwendung und Überlagerung<br />
Qualifikationsziele des erlernten Wissens aus den Bereichen Stadt- und Regional sowie Verkehrsplanung.<br />
Durch einen konkreten Projektbezug erfolgt dies in einem praxisnahen Kontext.<br />
Nach Abschluss dieses Moduls sollen die Studierenden die Fähigkeit erworben haben,<br />
den Gesamtzusammenhang projektbezogener Planung einzuordnen, diese selbständig<br />
im Rahmen einer Gruppenarbeit zu koordinieren und durchzuführen sowie sinnvoll optimieren<br />
zu können. Hinzu kommt die adäquate Darstellung <strong>der</strong> Inhalte in fachbezogenen<br />
Präsentationen.<br />
Inhalte<br />
(exemplarisch)<br />
a) Vorlesung:<br />
Die Vorlesung vermittelt spezifische Grundlagen zu verkehrsstädtebaulichen Projekten<br />
und Planungsprozessen mit folgenden Schwerpunkten:<br />
o Akteure und Abläufe in verkehrsstädtebaulichen Projekten<br />
o Entwurfsvarianten und Ausführungspläne für verkehrsstädtebauliche<br />
Projekte<br />
o Realisierung von baulichen Anlagen<br />
o Qualitätssicherung und Wirkungsanalyse<br />
o Kommunikation im Planungsprozess<br />
b) Übung:<br />
Im Rahmen <strong>der</strong> Übung werden relevante Bestandteile vertieft, insbeson<strong>der</strong>e sind dies:<br />
o Einsatz von CAD- und GIS-Systemen in <strong>der</strong> Planung und im Entwurf<br />
o Sicherheitsanalysen<br />
o Qualitätssicherung und Wirkungsanalyse<br />
c) Projektarbeit<br />
Im Rahmen <strong>der</strong> eigenständigen Projektarbeit soll eine integrative Entwurfsbearbeitung<br />
und grafische Umsetzung erfolgen sowie begleitende Konzepte <strong>der</strong> Öffentlichkeitsbeteiligung<br />
erstellt werden. Dies umfasst:<br />
o Verkehrliche und städtebauliche Analysen<br />
o Anfertigung von Entwurfsvarianten für verkehrsstädtebauliche Projekte<br />
o Umsetzung mit Hilfe von CAD- und GIS-Systemen<br />
o Erstellung von Kommunikationskonzepten und Umsetzung mit Hilfe verschiedener<br />
Medien<br />
76
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Gruppengröße a) 30 b) 30 c) 30<br />
Kontaktzeit<br />
a) 15 h b) 30 h c) 0 h<br />
Summe: 45 h<br />
Selbststudium a) 5 h b) 35 h c) 65 h<br />
Summe: 105 h<br />
CP<br />
a) 0,7 CP b) 2,2 CP c) 2,2 CP<br />
Kreditpunkte: 5<br />
Voraussetzung für die<br />
Vergabe von Kreditpunkten<br />
a), b), c) mündliche Prüfung (bis 20 Minuten) und benotete Projektarbeit<br />
Note Die Modulnote setzt sich zu 50% aus <strong>der</strong> benoteten Projektarbeit und zu 50% aus <strong>der</strong><br />
mündlichen Prüfung zusammen<br />
77
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Nebenfach: Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsgeschichte<br />
Module - Nebenfach SWS CP Semester<br />
Basismodul Mikro- und Makroökonomie (NF) 8 14 1-2<br />
Basismodul Wirtschaftsgeschichte (NF) 4 8 1-4<br />
Vertiefungsmodul Volkswirtschaftslehre (NF) 4 8 3-4<br />
Mikro- und Makroökonomie (VWL-1) (NF)<br />
Modulbeauftragte: Prof. Dr. Feess, Prof. Dr. Harms<br />
Veranstaltungen a) Vorlesung: Mikroökonomie<br />
b) Übung: Mikroökonomie<br />
c) Vorlesung: Makroökonomie<br />
d) Übung Makroökonomie<br />
Lern-/<br />
Ziel dieses Moduls ist es, in grundlegende mikro- und makroökonomische Denkwei-<br />
Qualifikationsziele sen und Modelle einzuführen. Ein beson<strong>der</strong>er Schwerpunkt liegt dabei auf <strong>der</strong> Anwendung<br />
ökonomischer Konzepte auf aktuelle wirtschaftspolitische Fragen - etwa zu<br />
den Konsequenzen von Deregulierung und Privatisierung o<strong>der</strong> zur Rolle <strong>der</strong> Geldpolitik<br />
im Kontext <strong>der</strong> Europäischen Währungsunion.<br />
Nach Abschluss <strong>der</strong> Studieneinheit sind die Studierenden in <strong>der</strong> Lage, ein ökonomisches<br />
Thema inhaltlich und mit einfachen formalen Methoden selbstständig zu bearbeiten.<br />
Die Studierenden können den Unterschied zwischen verschiedenen methodischen<br />
Ansätzen erläutern und auf die verschiedenen Lehrinhalte anwenden. Darüber<br />
hinaus sind sie fähig, die Konsequenzen eines verän<strong>der</strong>ten makroökonomischen<br />
Umfelds für einzelwirtschaftlich relevante Größen abzuschätzen, und kennen das<br />
Instrumentarium, das gesamtwirtschaftlich orientierten Analysen und Prognosen<br />
zugrunde liegt.<br />
Inhalte<br />
a) Vorlesung Mikroökonomie: Die Vorlesung umfasst nach einer kurzen Einfüh-<br />
(exemplarisch)<br />
rung in die Haushalts- und Unternehmenstheorie die wesentlichen Theorien über<br />
die Marktformen vollständiger Konkurrenz, des Monopols und des Oligopols. Die<br />
unterschiedlichen Marktformen und Modelle werden dabei im Rahmen einer allgemeinen<br />
theoriegeschichtlichen Einführung erörtert. Das didaktische Konzept<br />
innerhalb <strong>der</strong> Vorlesungen beruht auf <strong>der</strong> Kombination von Modellen und Fallstudien.<br />
Ferner werden die Studierenden mit Entscheidungssituationen konfrontiert,<br />
die sie selbständig lösen und die in <strong>der</strong> Vorlesung anschließend diskutiert werden.<br />
b) Übung Mikroökonomie: Vertiefung <strong>der</strong> Inhalte <strong>der</strong> Vorlesung Mikroökonomie<br />
anhand konkreter Aufgabenstellungen<br />
Literatur:<br />
FEESS, E. (2004): Mikroökonomie: Eine spieltheoretisch- und anwendungsorientierte<br />
Einführung. Marburg.<br />
c) Vorlesung Makroökonomie: Zunächst werden unter Einbeziehung internationaler<br />
Wirtschaftsbeziehungen – aufbauend auf den Zusammenhängen und den Daten<br />
<strong>der</strong> Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen sowie <strong>der</strong> Analyse individueller<br />
Entscheidungen und <strong>der</strong> Interaktionen auf Güter-, Arbeits- und Finanzmärkten –<br />
78
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Gruppengröße<br />
gesamtwirtschaftliche Phänomene wie Wachstum und Arbeitslosigkeit sowie <strong>der</strong>en<br />
wirtschaftspolitische Implikationen behandelt. Betrachtet werden anschließend<br />
die Auswirkungen von Geld- und Fiskalpolitik in geschlossenen und offenen<br />
Volkswirtschaften, die Funktionsweise mo<strong>der</strong>ner geldpolitischer <strong>Institut</strong>ionen, die<br />
Ursachen und Konsequenzen von Inflation, und die Rolle von Erwartungen für die<br />
kurz- und mittelfristigen Effekte staatlicher Interventionen.<br />
d) Übung Makroökonomie: Vertiefung <strong>der</strong> Inhalte <strong>der</strong> Vorlesung Makroökonomie<br />
anhand konkreter Aufgabenstellungen<br />
Literatur:<br />
BURDA, M. UND C. WYPLOSZ (2005): Macroeconomics: A European Text. Oxford.<br />
MANKIW, N. G. (2002): Macroeconomics. New York.<br />
Kontaktzeit<br />
a) 30 h b) 30 h c) 30 h d) 30 h<br />
Summe: 120 h<br />
Selbststudium a) 60 h b) 90 h c) 60 h d) 90 h<br />
Summe: 300 h<br />
Kreditpunkte (CP) a) 3 CP b) 4 CP c) 3 CP d) 4 CP<br />
Kreditpunkte: 14 CP<br />
Prüfungsleistungen a) und b) Klausur (60 Minuten) zu Vorlesung und Übung Mikroökonomie<br />
c) und d) Klausur (60 Minuten) zu Vorlesung und Übung Makroökonomie<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
Wirtschaftsgeschichte (VWL-2) (NF)<br />
Modulbeauftragter: Prof. Dr. Thomes<br />
Veranstaltungen a) Vorlesung: „Grundzüge <strong>der</strong> vorindustriellen Wirtschafts- und Sozialgeschichte<br />
Europas“ (exemplarisches Veranstaltungsthema)<br />
Lern-/<br />
b) Vorlesung: „Von <strong>der</strong> Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft“ (exemplarisches<br />
Veranstaltungsthema)<br />
Ziel des Moduls ist es, in die sozialökonomischen Strukturen einer Epoche einzufüh-<br />
Qualifikationsziele ren und die angewandten Methoden vorzustellen.<br />
Nach Abschluss <strong>der</strong> Studieneinheit haben die Studierenden wirtschafts- und sozialhistorisches<br />
Überblickswissen über eine bestimmte Epoche erworben und können dieses<br />
reflektierend mündlich und schriftlich wie<strong>der</strong>geben.<br />
Sie verfügen über eine Wissensgrundlage, um aktuelle sozialökonomische Fragestellungen<br />
kritisch zu diskutieren.<br />
Sie sind mit den Grundzügen wirtschafts- und sozialhistorischer Perspektive vertraut<br />
und kennen die wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Methodenvielfalt des Faches.<br />
Inhalte<br />
Die Vorlesungen entfalten ein Thema auf hohem wissenschaftlichem Niveau und im<br />
(exemplarisch)<br />
Gruppengröße<br />
Gesamtzusammenhang<br />
Kontaktzeit<br />
a) 30 h b) 30 h<br />
Summe: 60 h<br />
Selbststudium a) 90 h b) 90 h<br />
Summe: 180 h<br />
Kreditpunkte (CP) a) 4 CP b) 4 CP<br />
Kreditpunkte: 8 CP<br />
Prüfungsleistungen a) und b) eine Klausur über beide Vorlesungen (60 Minuten).<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
79
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Volkswirtschaftslehre (VWL-3) (NF)<br />
Modulbeauftragter: Prof. Dr. Feess<br />
(ggfs. an<strong>der</strong>e hauptamtlich Lehrende)<br />
Veranstaltungen a) Vorlesung<br />
b) Übung<br />
Exemplarische Vorlesungsbezeichnungen: Umweltökonomie, <strong>Angewandte</strong> Wirtschaftspolitik<br />
Lern-/<br />
Ziel dieses Moduls ist es, die methodischen Kenntnisse aus den Basismodulen „Mik-<br />
Qualifikationsziele roökonomie“ und „Makroökonomie“ zu vertiefen und auf aktuelle Fragestellungen<br />
anzuwenden.<br />
Nach Abschluss <strong>der</strong> Studieneinheit sind die Studierenden in <strong>der</strong> Lage, wirtschaftspolitische<br />
Themen selbständig zu bearbeiten. Die Studierenden sind in <strong>der</strong> Lage, unterschiedliche<br />
Kriterien zur Beurteilung wirtschaftspolitischer Instrumente auf aktuelle<br />
wirtschaftspolitische Fragen und Konzepte anzuwenden.<br />
Inhalte<br />
Umweltpolitische Instrumente; Wettbewerbs- und Regulierungspolitik, Beschäfti-<br />
(exemplarisch)<br />
Gruppengröße<br />
gungs- und Arbeitsmarktpolitik, Innovations- und Technologiepolitik sowie Strukturund<br />
Regionalpolitik<br />
Literatur: je nach Vorlesungsthema variabel<br />
Kontaktzeit<br />
a) 30 h b) 30 h<br />
Summe: 60 h<br />
Selbststudium a) 90 h b) 90 h<br />
Summe: 180 h<br />
Kreditpunkte (CP) a) 4 CP b) 4 CP<br />
Kreditpunkte: 8 CP<br />
Prüfungsleistungen a) und b) Klausur (60 Minuten) zu Vorlesung und Übung.<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
80
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Nebenfach <strong>Geographie</strong> (2-Fach BA)<br />
Modul SWS CP Semester<br />
Geographische Methoden 8 18 1/2<br />
Projektmodul Vertiefung 5,3 10 1<br />
Aufbaumodul 4 7/8 1<br />
Modul: Geographische Methoden 1B/2<br />
Modulbeauftragter: Prof. Dr. A. Wieger/H. Espeter<br />
Studiengänge<br />
Angebot (Turnus) Dauer Studienjahr<br />
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />
jährlich<br />
1 Semester 1./2. Studienjahr<br />
Kategorie Erläuterung<br />
Veranstaltungen und a) Geostatistik (V+Ü)<br />
Lehrformen b) Räumliche Planung (V)<br />
c) GIS (Seminar)<br />
Voraussetzungen keine<br />
Lern-/<br />
Ziel des Moduls ist es, den Studierenden eine allgemeine Einführung in die quantitati-<br />
Qualifikationsziele ven Arbeitsmethoden <strong>der</strong> <strong>Geographie</strong> zu geben. Nach Abschluss dieses Moduls sollen<br />
die Studierenden die Fähigkeit erworben haben, einfache Aufgabenstellungen aus<br />
<strong>der</strong> Gesamtdisziplin <strong>Geographie</strong> im räumlichen Zusammenhang zu erkennen.<br />
Im einführenden Proseminar steht das Kennen lernen grundlegen<strong>der</strong> geographischer<br />
Arbeitsmethoden, <strong>der</strong> Teildisziplinen und des Methodenspektrums <strong>der</strong> <strong>Geographie</strong> als<br />
Ganzes im Vor<strong>der</strong>grund. Die begleitenden Geländetage dienen dem Zweck, die Studierenden<br />
zur genauen Beobachtung <strong>der</strong> den speziellen Raum betreffenden Fragestellungen<br />
anzuleiten und dadurch die Entwicklung des fachlichen Urteilsvermögens<br />
zu för<strong>der</strong>n. In <strong>der</strong> einführenden Vorlesung in Statistik steht die Vermittlung grundlegen<strong>der</strong><br />
Kenntnisse <strong>der</strong> Statistik im Vor<strong>der</strong>grund. Diese werden im Rahmen <strong>der</strong> damit<br />
verknüpften Übung vertieft und durch angewandte Aufgabenstellungen aus dem Bereich<br />
<strong>der</strong> Datenverarbeitung (Arbeiten im CIP-Pool) ergänzt.<br />
Inhalte<br />
a) Die Vorlesung zeigt, wie Verfahren <strong>der</strong> mathematischen Statistik bei quantitativen<br />
(exemplarisch)<br />
Raumanalysen angewandt werden. Sie behandelt die Aufbereitung und Interpretation<br />
geographisch relevanter Daten mit Hilfe <strong>der</strong> deskriptiven Statistik, Methoden<br />
<strong>der</strong> Erhebung und Beurteilung von Stichproben, die Anwendung <strong>der</strong> Wahrscheinlichkeitsrechnung<br />
auf geographische Fragestellungen, die Test- und Schätzstatistik<br />
sowie die Regressions- und Korrelationsanalyse.<br />
b) In <strong>der</strong> Vorlesung werden die wissenschaftlichen Grundlagen, die Leitvorstellungen<br />
und die gesetzlichen Rahmenbedingungen für raum- und flächenbezogene Planungen<br />
sowie die daraus hervorgehenden Tätigkeiten zu ihrer Verwirklichung behandelt.<br />
Sie befasst sich sowohl mit <strong>der</strong> Raumordnung des Bundes als auch mit planerischen<br />
Zielen, Aufgaben und Maßnahmen <strong>der</strong> Län<strong>der</strong>, <strong>der</strong> Planungsregionen und Gemeinden<br />
sowie mit grenzüberschreiten<strong>der</strong> Planung. Vorgestellt werden planerische<br />
Schutzmaßnahmen, Planungen, die sich in einer Umgestaltung <strong>der</strong> Kulturlandschaft<br />
81
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Gruppengröße<br />
Kontaktzeit<br />
Selbststudium<br />
CP<br />
Voraussetzung für die<br />
Vergabe von<br />
CP-Punkten<br />
ausdrücken, sowie Wirtschaftsför<strong>der</strong>ungsmaßnahmen mit einem regionalen Bezug.<br />
c) Kennen lernen und praktische Anwendung von GIS-Arbeitstechniken (Arbeiten im<br />
CIP-Pool) an Beispielen.<br />
a) 60 h b) 30 h c) 30h<br />
Summe: 120 h<br />
a) 210 h b) 90 h c) 120h<br />
Summe: 420 h<br />
a) 9 CP b) 4 CP c) 5 CP<br />
Summe: 18 CP<br />
a) Klausur (90 min)<br />
b) Klausur (45 min)<br />
c) Haus-/Projektarbeit (4 Wochen Bearbeitungszeit)<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Punkteverteilung gewichtet.<br />
Modul: Projektmodul Vertiefung<br />
Modulbeauftragter:Dr. G. Ketzler<br />
Studiengänge<br />
Angebot (Turnus) Dauer Studienjahr<br />
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />
jährlich<br />
1 Semester 1./2. Studienjahr<br />
Kategorie Erläuterung<br />
Veranstaltungen und a) Empirische Methoden<br />
Lehrformen<br />
ODER<br />
b) Projektstudie<br />
Voraussetzungen keine<br />
Lern-/<br />
Ziel des Moduls ist es, den Studierenden vertiefte Kenntnisse und Erfahrungen bei<br />
Qualifikationsziele <strong>der</strong> Anwendung von empirischen Untersuchungsmethoden in einem Teilbereich <strong>der</strong><br />
<strong>Geographie</strong> nach Wahl zu vermitteln. Sie sollen dabei einen Querschnitt grundlegen<strong>der</strong><br />
Arbeitstechniken in diesem Teilbereich näher kennen lernen und an Fallbespielen<br />
anwenden; im Rahmen eines thematisch begrenzten Projekts werden die Kenntnisse<br />
erweitert und um Erfahrungen zur Projektorganisation ergänzt.<br />
Nach Abschluss dieses Moduls sollen die Studierenden die Fähigkeit erworben haben,<br />
im Bereich <strong>der</strong> gewählten Vertiefungsrichtung eigene empirische Untersuchungen<br />
auf Basis bekannter Methoden zu entwerfen und durchzuführen.<br />
Inhalte<br />
a) Empirische Methoden:<br />
(exemplarisch)<br />
Gruppengröße<br />
Theoretische Einführung in ausgewählte empirische Methoden eines Teilbereichs <strong>der</strong><br />
<strong>Geographie</strong> (Physische o<strong>der</strong> Bevölkerungs-/Stadt- o<strong>der</strong> Wirtschaftsgeographie),<br />
Durchführung von kleinen Untersuchungen unter Anleitung als konkrete Anwendungsbeispiele,<br />
Dokumentation und Auswertung <strong>der</strong> Ergebnisse<br />
b) Projektstudie:<br />
Einführung in die fachliche Aufgabenstellung und die spezielle empirische Methodik<br />
eines thematisch eng begrenzten Projektthemas in dem gewählten Teilbereich <strong>der</strong><br />
<strong>Geographie</strong> (wie oben), Erstellen eines Projektplans, selbständige Durchführung <strong>der</strong><br />
empirischen Untersuchungen, Anfertigen eines Projektberichts.<br />
Kontaktzeit<br />
a) 50 h b) 30 h<br />
Summe: 80 h<br />
Selbststudium a) 100 h b) 120 h<br />
Summe: 220 h<br />
82
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
CP a) 5 CP b) 5 CP Summe: 10 CP<br />
Voraussetzung für die a) Hausarbeit Gelände-/Standortpraktikum (Bearbeitungszeit: 8 Wochen)<br />
Vergabe von b) Ergebnisbericht (Hausarbeit, Bearbeitungszeit: 8 Wochen, Gewichtung 50%) und<br />
CP-Punkten Kurzpräsentation (30-50 Minuten, Gewichtung: 50%), Gruppenarbeiten mit max. je 5<br />
Studierenden sind möglich<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Punkteverteilung gewichtet.<br />
Modul: Aufbaumodul (o<strong>der</strong> wahlweise: Wahlpflichtbereich Vertiefung)<br />
Modulbeauftragter: Dr. G. Ketzler<br />
Studiengänge<br />
Angebot (Turnus) Dauer Studienjahr<br />
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />
jährlich<br />
1 Semester 1./2. Studienjahr<br />
Kategorie Erläuterung<br />
Veranstaltungen und a) Vertiefende Vorlesung nach Wahl<br />
Lehrformen b) Hauptseminar<br />
ODER<br />
c) Wahlpflichtbereich Vertiefung<br />
Voraussetzungen Keine<br />
Lern-/<br />
Ziel des Moduls ist es, den Studierenden die grundlegenden fachspezifischen Kennt-<br />
Qualifikationsziele nisse und Arbeitsweisen im Bereich <strong>der</strong> angewandten <strong>Geographie</strong> je nach Wahl des<br />
Schwerpunktes zu vermitteln. Der Stoff <strong>der</strong> Vorlesungen behandelt Themenkomplexe<br />
die exemplarisch dazu geeignet sind, ein weiterführendes Verständnis für die Arbeitsweisen<br />
und Problemstellungen <strong>der</strong> <strong>Angewandte</strong>n <strong>Geographie</strong> in den Fel<strong>der</strong>n<br />
Physische <strong>Geographie</strong> und Wirtschaftsgeographie zu vermitteln.<br />
Im Hauptseminar werden ausgewählte Themen auf <strong>der</strong> Basis studentischer Vorträge<br />
erarbeitet und ausgeführt. Nach Abschluss dieses Moduls sollen die Studierenden die<br />
Fähigkeit erworben haben, spezielle Fragestellungen in den behandelten Vertiefungsrichtungen<br />
selbständig zu erarbeiten und entsprechende Problemlösungen zu formulieren.<br />
Inhalte<br />
a) Fragenkomplexe und Zusammenhänge <strong>der</strong> regionalen, angewandten, physischen,<br />
(exemplarisch)<br />
Gruppengröße<br />
Wirtschafts- o<strong>der</strong> Anthropogeographie.<br />
b) Spezielle Themen <strong>der</strong> gewählten Vertiefungsrichtung<br />
Kontaktzeit<br />
a) 30 h b) 30 h o<strong>der</strong> c)<br />
Summe: 60 h<br />
Selbststudium a) 60 h b) 90 h o<strong>der</strong> c)<br />
Summe: 150 h<br />
CP<br />
a) 3 CP b) 4 CP o<strong>der</strong> c) 8 CP Summe: 7 CP/ 8 CP<br />
Voraussetzung für die a) Klausur (60 min)<br />
Vergabe von b) Hausarbeit (15 Seiten) und Kurzpräsentation (Referat, 15 Minuten)<br />
CP-Punkten<br />
o<strong>der</strong><br />
c) Je nach Wahl<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Punkteverteilung gewichtet.<br />
83
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
V. Wahlpflichtbereich Vertiefung<br />
Fernerkundung<br />
Modulbeauftragter: Prof. Dr. F. Lehmkuhl<br />
Dozenten: Lehmkuhl, Schnei<strong>der</strong>, Römer und Lehrauftrag<br />
Studiengänge<br />
Angebot (Turnus) Dauer<br />
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />
jährlich<br />
2 Semester<br />
Kategorie Erläuterung<br />
Veranstaltungen und a) Vorlesung und Übung: Fernerkundung (WS)<br />
Lehrformen<br />
b) Übung: <strong>Angewandte</strong> digitale Fernerkundung (WS)<br />
c) Übung: Landschaftsinterpretation (SS)<br />
Voraussetzungen keine<br />
Lern-/<br />
Qualifikationsziele<br />
Studienjahr<br />
1./2. Studienjahr<br />
a) Grundlegen<strong>der</strong> Überblick über Methoden und Anwendungsbereiche <strong>der</strong> Fernerkundung;<br />
Analyse komplexer geographischer Räume mit Hilfe digitaler und analoger<br />
Satellitenbil<strong>der</strong><br />
b) Praktische und eigenständige Bearbeitung typischer Fragestellungen in <strong>der</strong> digitalen<br />
Fernerkundung.<br />
c) Landschaftsinterpretation ausgewählter geographischer Räume.<br />
Inhalte<br />
a) Satellitenbildauswertung und Interpretation. Es werden Methoden, Techniken und<br />
(exemplarisch)<br />
Interpretationsbeispiele sowie Anwendungsmöglichkeiten von analogen und digitalen<br />
Satellitenbil<strong>der</strong>n vorgestellt.<br />
b) Grundlagen und Struktur digitaler Fernerkundungsdaten, Georeferenzierung, visuelle<br />
und automatische Klassifikationsverfahren.<br />
c) Kartographische Umsetzung <strong>der</strong> Landschaftsinterpretation ausgewählter Räume.<br />
Literatur zu a) bis c):<br />
LILLESAND, T.M AND R.W. KIEFER (2006): Remote Sensing and Image Interpretation,<br />
ALBERTZ, J. (2007): Einführung in die Fernerkundung. WBG.<br />
Gruppengröße a) 16 b) 16 c) 16<br />
Kontaktzeit<br />
a) 30 h b) 30 h c) 15 h<br />
Summe: 60 h<br />
Selbststudium a) 60 h b) 60 h c) 45 h<br />
Summe: 180 h<br />
CP<br />
a) 3 CP b) 3 CP c) 2 CP<br />
Kreditpunkte: 8 CP<br />
Voraussetzung für die a) Kurzpräsentation (15-20 Minuten)<br />
Vergabe von CP b) Projektarbeit (Bearbeitungszeit: 3 Wochen)<br />
c) Kurzpräsentation (15-20 Minuten)<br />
Note<br />
Die Zulassung zur Modulprüfung erfolgt vorbehaltlich <strong>der</strong> erfolgreichen Bearbeitung von<br />
Übungsaufgaben in a) und c).<br />
Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
84
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Geodäsie<br />
Modulbeauftragter: Prof. Dr. Benning<br />
Dozenten: Benning, Schwermann<br />
Studiengänge<br />
Angebot (Turnus) Dauer Studienjahr<br />
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />
jährlich<br />
2 Semester 1./2. Studienjahr<br />
Kategorie Erläuterung<br />
Veranstaltungen und a) Vorlesung und Übung: Photogrammetrie<br />
Lehrformen<br />
b) Übung: Einführung in CAD<br />
Voraussetzungen keine<br />
Lern-/<br />
a)<br />
Qualifikationsziele • Kenntnisse über die zweckmäßigen Einsatzgebiete <strong>der</strong> Photogrammetrie<br />
als berührungsloses Messverfahren<br />
• Praktische Befähigung zur fachgerechten Herstellung von Messaufnahmen<br />
und <strong>der</strong>en Auswertung<br />
•<br />
b)<br />
Beurteilungsvermögen zur erzielbaren Genauigkeit und zu Zeit- und Kostenaufwand<br />
von photogrammetrischen Messungen<br />
• Grundverständnis des computergestützten Zeichnens<br />
• Beurteilung <strong>der</strong> Vor- und Nachteile von CAD<br />
• Fähigkeit zur Einschätzung des Zeitaufwandes<br />
• Fertigkeiten zum selbständigen Anfertigen von einfachen 2D- und 3D-<br />
Zeichnungen<br />
Inhalte<br />
a)<br />
(exemplarisch) • Mathemathische und physikalische Grundlagen <strong>der</strong> Bildmessung mit analogen<br />
und digitalen Bil<strong>der</strong>n<br />
• Projektive Bildentzerrung als Verfahren <strong>der</strong> Einbildauswertung<br />
• Photogrammetrische Bildorientierung<br />
• Verfahrensschritte <strong>der</strong> Mehrbildauswertung<br />
• Stereophotogrammetrie<br />
• Integrierte Verwendung von Laserscannerdaten<br />
• Aspekte <strong>der</strong> Aufnahmetechnik<br />
• Anwendungsgebiete <strong>der</strong> Photogrammetrie im Bauwesen<br />
Inhalte<br />
(exemplarisch)<br />
b)<br />
• Grundlagen von CAD<br />
• Erstellen, Verän<strong>der</strong>n und Löschen von Basiselementen (Primitiven) in 2D-<br />
Zeichnungen<br />
• Einrichtung und Benutzung von komplexen Elementgruppen (Zellen) und <strong>der</strong>en<br />
Verwaltung in Zellbibliotheken<br />
• Erstellung von Flächenelementen; Schraffieren und Bemustern von Zeichnungen<br />
• Wesen und Benutzung von Referenzzeichnungen<br />
• Bemaßung von linearen und kreisförmigen Zeichenobjekten<br />
• Grundlagen <strong>der</strong> Erstellung von 3D-Zeichnungen; Arbeiten im dreidimensionalen<br />
85
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Gruppengröße<br />
Zeichenraum<br />
• Erstellung und Manipulation von Primitiven in 3D-Zeichnungen<br />
• Referenzzeichnungen und Zellbibliotheken in Verbindung mit 3D-Konstruktionen<br />
• Konstruktion von B-Spline-Kurven und -Flächen<br />
• Erstellung von rotationssymmetrischen Körpern<br />
• Eigenschaften und Benutzung von lokalen Hilfskoordinatensystemen<br />
• Ableitung von Schnitt- und an<strong>der</strong>en zweidimensionalen Zeichnungen aus 3D-<br />
Modellen<br />
• Visualisierungsfunktionen im Zusammenhang mit 3D-Konstruktionen<br />
• Ausgabe von technischen Zeichnungen in vorgegebenen Maßstäben (Plotten)<br />
Literatur zu a) K.Kraus: Photogrammetrie, Band 1 und 2, ISBN<br />
3110177080,3427786536.<br />
Literatur zu b) Kuhr/Merr: Microstation V8 Seminar, ISBN 3-519-25045-4.<br />
a) b) je max. 40<br />
Kontaktzeit<br />
a) 60 h b) 30 h<br />
Summe: 90 h<br />
Selbststudium<br />
a) 90 h b) 60 h<br />
Summe: 150 h<br />
CP<br />
a) 5 CP b) 3 CP<br />
Kreditpunkte: 8 CP<br />
Voraussetzung für die a) Klausur 120 min<br />
Vergabe von CP b) mündliche Prüfung (Dauer: 30 min)<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
86
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Management von Altlasten<br />
Modulbeauftragter: Prof. Dr. Niemann-Delius<br />
Dozenten: a) und b) Dipl.-Geol. Michael Blesken c) Prof. Dr. Azzam<br />
Studiengänge<br />
Angebot (Turnus) Dauer Studienjahr<br />
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />
jährlich<br />
1 Semester 1./2. Studienjahr<br />
Kategorie Erläuterung<br />
Veranstaltungen und a) In-situ-Sicherung von Altlasten (SS)<br />
Lehrformen<br />
b) Exkursion zur In-situ-Sicherung von Altlasten (SS)<br />
c) Vorlesung: Altlastenerkundung und –sanierung (SS)<br />
Voraussetzungen keine<br />
Lern-/<br />
Die Studierenden werden in die Altlastenproblematik eingeführt und lernen die gängigen<br />
Qualifikationsziele Erkundungs- und Sanierungsverfahren kennen. Ziel des Moduls ist es einen umfassenden<br />
Einblick in aktuelle Fragestellungen und normative Vorgaben <strong>der</strong> Altlastensanierung<br />
zu geben. Darüber hinaus sollen die Studierenden zur selbstständigen Bearbeitung und<br />
Entwicklung von Lösungsstrategien anhand praxisnaher Sanierungsfällen angeleitet<br />
werden. Weiterhin werden zusätzlich die Teamfähigkeit und die Präsentation komplexer<br />
wissenschaftlicher Fragestellungen geför<strong>der</strong>t.<br />
Inhalte<br />
a) In-Situ-Sicherung von Altlasten<br />
(exemplarisch)<br />
Definition von Altlasten, einschlägige Methoden und Verfahren zur Erkundung u.<br />
Sanierung von Altlasten, Oberflächenabdeckungen, Oberflächenabdichtungen,<br />
Dichtwände, Veranschaulichung durch Exkursion<br />
Literatur:<br />
Zeitschriften Altlastenspektrum, Altlastensanierung, Terratech und Geotechnik, Unterlagen<br />
des Landesumweltamtes<br />
b) Exkursion zur Altlastensanierung<br />
Inhaltliche Vorbereitung <strong>der</strong> Befahrung einer zu untersuchenden Altlast,<br />
Befahrung und Datenaufnahme vor Ort, Abgleich <strong>der</strong> selbstständig in<br />
Gruppen entwickelten Sanierungsvorschläge mit tatsächlich durchgeführten<br />
Maßnahmen, Präsentation <strong>der</strong> Ergebnisse<br />
Literatur:<br />
Zeitschriften Altlastensanierung, Terratech und Geotechnik, Ausschreibungsunterlagen,<br />
Unterlagen des Landesumweltamtes<br />
c) Altlastenerkundung und -sanierung<br />
Definitionen, Rechtliche Grundlagen, Ursachen und Auswirkungen, Übertragung<br />
von Schadstoffen, Mechanismen <strong>der</strong> Schadstoffausbreitung, Arbeitsschutz,<br />
Gefahrenstoffe u. Gefährdungsfaktoren<br />
Erkundung: Probennahme, allgemeine Klassifikationswerte, Erkundungsverfahren<br />
von Altlasten<br />
Sanierung: Sanierungsuntersuchungen, Sanierung und Sanierungskontrolle,<br />
Sanierungsverfahren, Dekontaminationsverfahren,<br />
87
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Natural Attenuation, Revitalisierung, Beispiel Standorttypen<br />
Gruppengröße<br />
Literatur:<br />
Lang, G. & Knödel, K. (2003): Handbuch zur Erkundung des Untergrundes von Deponien<br />
und Altlasten, Band 8: Erkundungspraxis. - Springer<br />
Neumaier, H. & Weber, H.H. (1996): Altlasten. – Springer<br />
Weber, H.H., Neumaier, H. (1996): Altlasten: Erkunden – Bewerten – Sanieren. - Springer<br />
a) 20 b) 15 c) unbegrenzt<br />
Kontaktzeit<br />
a) 30 h; b) 20 h c) 30 h<br />
Summe: 70 h<br />
Selbststudium a) 60 h; b) 40 h c) 60 h<br />
Summe: 170 h<br />
CP<br />
a) 3 CP b) 2 CP c) 3 CP<br />
Summe: 8 CP<br />
Voraussetzung für die a) Klausur (60-90 Minuten)<br />
Vergabe von CP b) mündliche Präsentation (20-40 Minuten)<br />
c) Klausur (60-90 Minuten)<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
88
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Modul: Qualitäts- und Wassermanagementsysteme<br />
Modulbeauftragte: Prof. Dr. F. Lehmkuhl<br />
Dozenten: Diverse Lehrbeauftragte<br />
Studiengänge<br />
Angebot (Turnus) Dauer Studienjahr<br />
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />
jährlich<br />
1 Semester 1. o<strong>der</strong> 2. Studienjahr<br />
Kategorie Erläuterung<br />
Veranstaltungen und a) Seminar: Qualitätsmanagementsysteme (Werner-Korall) (WS)<br />
Lehrformen<br />
b) Seminar: Umweltmanagementsysteme (Werner-Korall) (SS)<br />
c) Seminar: Water and Water management in the Catchment of the River Maas (in englisch)<br />
(Hendrix)<br />
Voraussetzungen keine<br />
Lern-/<br />
Qualifikationsziele<br />
Das Seminar vermittelt einen praxisbezogenen Einstiegs in den Aufbau und Anwendung<br />
von Managementsystemen nach internationalen Standards. Die Studierenden sollen<br />
verschiedene praktische Aufgabenfel<strong>der</strong> des kommunalen Managements, die aus geographischer<br />
Perspektive beson<strong>der</strong>s bedeutsam sind, kennen lernen. Die Kenntnisse<br />
werden anhand eines integrierten Wassermanagementkonzepts am Beispiel <strong>der</strong> Maas<br />
vertieft.<br />
Inhalte (exemplarisch) a) und b) Qualitäts- und Umweltmanagementsysteme<br />
Aufbau virtueller Organisationen nach ISO 9001 und ISO 14001 sowie Darstellung relevanter<br />
Aspekte eines gelebten Qualitäts- und Umweltmanagementsystems<br />
c) Water and Water management in the Catchment of the River Maas<br />
Geophysical and hydrological characteristics of the catchment, the groundwatersystem<br />
in relation to the surfacewater, the relation between regional waters and riversystem<br />
water quality and water quantity, monitoring and measurements, functions and planning,<br />
and the EU Water Framework Directive<br />
Gruppengröße a) 15, b) 15<br />
Kontaktzeit<br />
Selbststudium<br />
CP<br />
Voraussetzung für die<br />
Vergabe von CP<br />
a) 15 h b) 15 h c) 30<br />
a) 45 h b) 45 h c) 90<br />
a) 2 b) 2 c) 4<br />
Summe: 60 h<br />
Summe: 180 h<br />
Ges.-Summe: 240 h<br />
Summe: 8 CP<br />
a) Präsentation eines zu erstellenden Qualitätsmanagementplans (15-20 min)<br />
b) Präsentation eines zu erstellenden Umweltmanagementplans (15-20 min)<br />
c) Writing a brief report (size one A4) of one of the lectures blocks and a list of ten terms<br />
to be translated from English to German, both to be submitted in English two months<br />
after the date of the lecture block, attending a one day field excursion to the River Maas<br />
zu a) und b) Gruppenarbeit mit max. je 2 Studierenden möglich<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet<br />
89
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Rechtswissenschaften<br />
Modulbeauftragter: Prof. Dr. Frenz; RA Müggenborg<br />
Studiengänge<br />
Angebot (Turnus) Dauer<br />
Studienjahr<br />
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />
jährlich<br />
2 Semester<br />
a) WS<br />
b) SS; zuerst b)<br />
1./2. Studienjahr<br />
Kategorie Erläuterung<br />
Veranstaltungen und Lehr- a) Vorlesung und Übung: Genehmigungs- und Umweltrecht I<br />
formen<br />
b) Vorlesung und Übung: Öffentliches Recht und Europarecht<br />
Voraussetzungen keine<br />
Lern-/<br />
a) Darstellung und Erarbeitung <strong>der</strong> Grundlagen des Genehmigungs- und Umwelt-<br />
Qualifikationsziele<br />
rechts mit Praxisbeispielen. Anlagenzulassung und Zivilrecht<br />
b) Darstellung <strong>der</strong> maßgeblichen Rechtsgrundlagen aus dem öffentlichen und dem<br />
Europarecht mit praktischen Beispielen; Beteiligung an <strong>der</strong> Lösung von Fällen<br />
Inhalte<br />
a) Vorlesung/ Übung Genehmigungs- und Umweltrecht I:<br />
(exemplarisch)<br />
Anlagengenehmigungsrecht einschl. UVP und Planfeststellungsverfahren, Bergrecht<br />
einschl. Spätfolgenverantwortung, Wasserhaltung, Europäisches und nationales Umweltrecht,<br />
Gewässer-, Natur- und Immissionsschutzrecht; Emissionshandelsrecht,<br />
Umweltzivilrecht<br />
b) Vorlesung/ Übung Öffentliches Recht und Europarecht:<br />
Normenpyramide, Bedeutung und Einfluss des Europarechts, Grenzüberschreitende<br />
Arbeitsmöglichkeiten,Staatsrecht, insbeson<strong>der</strong>e Grund-rechte: Eigentums- und Berufsfreiheit<br />
gegen staatliche Eingriffe, Verwaltungs-recht, v.a. Formen Verwaltungshandeln,<br />
Verwaltungsverfahren, Falllösungen durch Studierende; Rollenspiele in<br />
Form von geleiteten Diskussionen und Abläufen etwa im Rahmen <strong>der</strong> Antragstellung<br />
o<strong>der</strong> des Planfeststellungs- verfahrens, Vorbereitung <strong>der</strong> in <strong>der</strong> Übung behandelten<br />
Fälle und Lösung durch Studierende; Kurzvorträge zu praxisrelevanten Themenstellungen<br />
in <strong>der</strong> Vorlesung.<br />
Literatur:<br />
Frenz (1999): Umweltrecht für Ingenieure.<br />
Frenz (1999): Zivilrecht für Ingenieure.<br />
Frenz (1997): Europäisches Umweltrecht.<br />
Kremer & Neuhaus (2001): Bergrecht.<br />
Frenz (2004): Öffentliches Recht. 2. Auflage.<br />
Gruppengröße a) b) 120<br />
Kontaktzeit<br />
a) 60 h b) 30 h<br />
Summe: 90 h<br />
Selbststudium<br />
a) 90 h b) 60 h<br />
Summe: 150 h<br />
CP<br />
a) 5 CP b) 3 CP<br />
Kreditpunkte: 8 CP<br />
Voraussetzung für die<br />
Vergabe von CP<br />
a) und b) Klausur (90 Min.) zu den Inhalten <strong>der</strong> Vorlesungen und Übungen<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
90
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Modul: Ressourcengeologie (Wahlpflichtmodul Vertiefung)<br />
Modulbeauftragter: Prof. Dr. M. Meyer<br />
Dozenten: a) Meyer, b) Meyer / Kukla, c) Rüde<br />
Studiengänge<br />
Angebot (Turnus) Dauer Studienjahr<br />
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />
jährlich<br />
2 Semester 1./2. Studienjahr<br />
Kategorie Erläuterung<br />
Veranstaltungen und a) Metallrohstoffe und Umwelt (V)<br />
Lehrformen<br />
b) Economics of Mineral and Petroleum Resources (V1Ü1, in englischer Sprache)<br />
c) Grundwasserrisikenmanagement (V)<br />
Voraussetzungen Nebenfach Geologie I o<strong>der</strong> Wahlpflichtmodul W-GG<br />
Lern-/<br />
a) Deskriptive Modelle des umweltrelevanten Stoffumsatzes infolge <strong>der</strong> Bildung und<br />
Qualifikationsziele Nutzung von Lagerstätten <strong>der</strong> Metallrohstoffe. Nachhaltige Nutzung nichterneuerbarer<br />
Ressourcen, Umweltmodelle von Erzlagerstätten.<br />
b) The course teaches how to use economic prinpipals in geological decission making<br />
and to apply basic resource economics in target selection and exploration. It aims at<br />
combining geologic factors with basic economic concepts; commodity prices; cost<br />
categories, cut-off, grade; present value of ore deposit; net present value; ore body<br />
delineation; geometric ore body analysis; grade-tonnage estimation, structure of the<br />
mining industry.<br />
c) Die Studierenden sollen nach diesem Modul Kenntnisse über Grundwasser als<br />
knappes Gut besitzen. Dies umfasst sowohl natürliche als auch anthropogene Situation,<br />
in denen sehr geringe Grundwasserressourcen o<strong>der</strong> solche von sehr schlechter<br />
Qualität, vorliegen. Zudem werden Qualifikationen zur Beurteilung als auch zum<br />
Risikomanagement erworben werden, insbeson<strong>der</strong>e zur Vulnerabilitätsanalyse.<br />
Inhalte<br />
a) Metallrohstoffe und Umwelt:<br />
(exemplarisch)<br />
Ressourcen und Reserven, statische Reichweite, Hubbert Zyklus, Elementverteilung<br />
in <strong>der</strong> Erdkruste, geochemische Anomalien, deskriptive Lagerstättenmodelle,<br />
Nachhaltigkeit, wirtschaftliche Bedeutung, Wertstoff/Reststoff-<br />
Verhältniss, ökologischer Rucksack, Stoffumsatz <strong>der</strong> Hydrothermalsysteme<br />
am Meeresboden, Grubenwasserversauerung.<br />
b) Economics of Mineral and Petroleum Resources:<br />
Geologic processes and the formation of mineral deposits; importance and<br />
availability of mineral resources to society; geology and economics; supply<br />
and demand; cartels: natural (Pt, Co) vs artificial (Cu, diamonds); recyling<br />
and substitution; ore grade; cut-off grade, by-products; commodity prices;<br />
mineralogic form; size and shape of deposits; ore reserve classification,<br />
cashflows & profitability (DCF method) in petroleum projects; sensitivity/ optimisation/ranking;<br />
cashin/unit costs/breakeven prizes/tariffs; fiscal terms<br />
and systems; probability/sensitivities/decision theory; exploration economics;<br />
contract management;, Value Of Information (VOI), Net present value<br />
("NPV") calculations; cash flow for an oil and gas project, the difference between<br />
cash flow and profit; case histories.<br />
Literatur:<br />
91
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Gruppengröße<br />
Evans, A.M.: Introduction to Mineral Exploration, Backwell Science; Marjoribanks, R.:<br />
Geological Methods in Mineral Exploration and Mining, Chapman & Hall; Gravel, J. &<br />
Matysek, P.: Quality Control in Mineral Exploration, Association of Exploration Geochemists;<br />
Kessler, S.E.: Mineral Resources, Economics and the Environment, Macmillan.<br />
c) Grundwasserrisikenmanagement:<br />
Bewirtschaftung begrenzter Grundwasservorkommen, Grundwasserversalzung, Risiken<br />
im Karst, GwVulnerabilitäts- und GwRisikenkarten als Steuerungsinstrumente,<br />
Trendindizierung<br />
a) b) c) 10<br />
Kontaktzeit<br />
a) 30 h b) 30 h c) 30 h<br />
Summe: 90 h<br />
Selbststudium a) 60 h b) 60 h c) 60 h<br />
Summe: 180 h<br />
CP<br />
a) 3 CP b) 3 CP c) 3 CP<br />
Kreditpunkte: 9 CP<br />
Voraussetzung für die a) Klausur (90 Min.)<br />
Vergabe von CP b) Klausur (90 Min.)<br />
c) Klausur (90 Min.)<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
92
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Spezielle Geoökologie: Boden und Wasser<br />
Modulbeauftragter: Prof. Dr. F. Lehmkuhl<br />
Dozenten: a) Lehmkuhl/Vigener b) Kasteel c) Rüde<br />
Studiengänge<br />
Angebot (Turnus) Dauer Studienjahr<br />
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />
jährlich<br />
2 Semester 1./2. Studienjahr<br />
Kategorie Erläuterung<br />
Veranstaltungen und a) Geoökolgisches Geländepraktikum mit Vorbereitungsseminar<br />
Lehrformen<br />
b) Vorlesung mit Übungen: Wasserfluss und Stofftransport in Boden (SS)<br />
c) Vorlesung mit Übung: Stofffluss in <strong>der</strong> ungesättigten Zone (WS)<br />
Voraussetzungen keine<br />
Lern-/<br />
a) Die Studierenden erwerben die Kompetenz selbstständig ein Messprogramm aufzu-<br />
Qualifikationsziele bauen und zu unterhalten, um die biotischen und abiotischen Zusammenhänge von<br />
Fliessgewässern zu erfassen.<br />
b) Die Studierenden erwerben die Kompetenz, um die grundlegenden Konzepte zum<br />
(un)gesättigten Wasserfluss, Wärme- und Stofftransport in Böden zu quantifizieren und<br />
an realistischen Fallbeispielen anzuwenden.<br />
c) Die Studierenden erwerben die Kompetenz die Verlagerung diffuser Stoffeinträge in<br />
<strong>der</strong> Bodenzone zum Grundwasser und zum Vorfluter hin wissenschaftlich zu bearbeiten<br />
und z.B. im Sinne einer Sickerwasserprognose nach Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung<br />
beurteilen zu können.<br />
Inhalte<br />
a) Geoökologisches Geländepraktikum:<br />
(exemplarisch) Konzepte verschiedener Gewässergüteindices und des Saprobienindex, Grundlagen<br />
<strong>der</strong> Hydrologie, Abflussmessungen, Anorganische Nährstoff-analyse im Labor, Nährstoffkreisläufe,<br />
riparisches System, ganzheitliche Betrachtung von Fliessgewässereinzugsgebieten,<br />
integrativer Ansatz<br />
b) Wasserfluss und Stofftransport in Boden:<br />
Mathematische Konzepte des (un)gesättigten Wasserflusses (Darcy- und Richardsgleichung),<br />
Wärmetransport (Fouriergleichung) und Stofftransports (Konvektions-<br />
Dispersionsgleichung), Potentialtheorie, hydraulische Eigenschaften, Hysterese, thermische<br />
Bodeneigenschaften, Abbau, Sorption, Prinzipien von gängigen Messverfahren.<br />
c) Stofffluss in <strong>der</strong> Ungesättigten Zone:<br />
Diffuse Stoffeinträge, Mathematische Konzepte des ungesättigten Stofftransportes,<br />
Kolloidvermittelter Transport, Bedeutung des präferentiellen Fliessens, Sickerwasserprognose;<br />
Gruppengröße<br />
Literatur: Gunkel (1996): Renaturierung kleiner Fliessgewässer. Jury, Gardner, and<br />
Gardner (1991): Soil Physics, Burt, Heathwaite. Trudgill (1993): Nitrate: Processes,<br />
Patterns, and Management. Corwin, D.L., Loague, K. & Ellsworth, T.R. (1999): Assessment<br />
of non-point source pollution in the vadose zone. Selker, J.S. (1999): Vadose<br />
zone processes.<br />
a) 15 in 3 Gruppen á 5 b) 10-15 c) 10<br />
Kontaktzeit a) 30 h b) 30 h c) 30 h Summe: 90 h<br />
93
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Selbststudium a) 60 h b) 45 h c) 45 h<br />
Summe: 150 h<br />
CP<br />
a) 3 CP b) 2,5 CP c) 2,5 CP<br />
Kreditpunkte: 8 CP<br />
Voraussetzung für die a) Praktikumsbericht von ca. 20 Seiten je Gruppe, Bewertung <strong>der</strong> praktischen Arbeit im<br />
Vergabe von CP Labor<br />
b) Klausur (90 Minuten)<br />
c) Klausur (90 Minuten)<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
94
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Umweltbiologie<br />
Modulbeauftragter: Prof. A. Schäffer<br />
Beteiligte Lehrstühle/Dozenten: Bio I: Prof. Priefer, Dr. Jahnke; Bio V: Prof. Schäffer, Prof. Hollert, Prof.<br />
Ratte, Dr. Roß-Nickoll, Dr. Schmidt<br />
Studiengänge<br />
Angebot (Turnus) Dauer Studienjahr<br />
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />
jährlich<br />
2 Semester 1./2. Studienjahr<br />
Kategorie Erläuterung<br />
Veranstaltungen und a) Einführung in die Bodenökologie (V)<br />
Lehrformen<br />
b) Einführung in die Ökotoxikologie und Ökochemie (V)<br />
c) Methoden <strong>der</strong> Bodenökologie, Ökotoxikologie und Ökochemie (Ü)<br />
Voraussetzungen Allgemeine Grundkenntnisse in Ökologie (empfohlen wird z.B. die Vorlesung Ökologie,<br />
Biologie 3, o<strong>der</strong> das Kapitel „Ökologie und Verhalten“ aus Campbell, Biologie,<br />
Spektrum Verlag).<br />
Lern-/<br />
Die Studierenden sollten Kenntnisse und Methoden erlernen, Umweltchemikalien in<br />
Qualifikationsziele verschiedenen Matrizes und <strong>der</strong>en ökotoxische Effekte auf Organismen, Populationen<br />
und Ökosysteme zu analysieren und zu bewerten. Insbeson<strong>der</strong>e soll <strong>der</strong> "Boden“ als<br />
komplexes Ökosystem kennen gelernt und Einblicke in die vielfältigen biotischen und<br />
abiotischen Wechselwirkungen gewonnen werden. Im Übungsteil werden Methoden<br />
vermittelt, biotische und abiotische Bodenparameter zu erfassen. Außerdem werden<br />
Studierende mit wichtigen Methoden <strong>der</strong> Umweltanalytik und des Biotesting vertraut<br />
gemacht.<br />
Inhalte<br />
a) Bodenökologie<br />
(exemplarisch)<br />
Bodenkundliche Grundlagen, Bodenflora und –fauna, Nahrungsetze, Energetik<br />
b) Ökotoxikologie und Ökochemie<br />
Bioverfügbarkeit, Bioakkumulation, Effektendpunkte für Organismen, Populationen<br />
und Biozönosen, Ermittlung von Dosis-Wirkungsbeziehungen<br />
und Effektschwellen, Zusammenwirkung multipler Stressoren<br />
c) Methoden <strong>der</strong> Bodenökologie, Ökotoxikologie und Ökochemie<br />
Eigenschaften. Funktion und Prozesse von Umweltmatrices (Boden,<br />
Pflanze, Wasser, Atmosphäre), Verhalten und Nachweis von organischen<br />
und anorganischen Spurenstoffen<br />
Literatur: Gisi, Bodenökologie; Fent, Ökotoxikologie; Bliefert, Umweltchemie; Baird,<br />
Environmental Chemistry<br />
Gruppengröße max. 6 Studierende aus dem Studiengang M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />
Kontaktzeit<br />
a) 30 h b) 30 h c) 45 h<br />
Summe: 105 h<br />
Selbststudium: a) 45 h b) 45 h c) 45 h<br />
Summe: 135 h<br />
Kreditpunkte: a) 2,5 CP b) 2,5 CP c) 3 CP<br />
Summe: 8 CP:<br />
Voraussetzung für die Die einzelnen Teile a) – c) werden durch eine gemeinsame Klausur (120 min, Ge-<br />
Vergabe von wichtung je 1/3 für a, b, c) geprüft.<br />
CP-Punkten<br />
Die Zulassung zur Modulprüfung erfolgt vorbehaltlich von Protokollen und Kurzpräsentationen<br />
des Lehrstoffes in den Übungen (c); diese Leistungen werden nicht beno-<br />
95
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
tet, müssen jedoch mindestens ausreichende Qualität aufweisen.<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
96
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Umweltgeochemie (E-UG)<br />
Modulbeauftragter: Prof. Dr. R. Littke<br />
Dozenten: a) Schwarzbauer, b) Kramm, c) Rüde<br />
Studiengänge<br />
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />
Kategorie Erläuterung<br />
Angebot (Turnus)<br />
jährlich<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
Studienjahr<br />
2. Studienjahr<br />
Veranstaltungen und a) Organische Geochemie (V)<br />
Lehrformen<br />
b) Anorganische Geochemie (V)<br />
c) Einführung in die Hydrochemie mit Laborübungen (V + Ü) (WS)<br />
Voraussetzungen Nebenfach Geologie I o<strong>der</strong> Wahlpflichtmodul W-GG<br />
Lern-/<br />
a) + b) Einführende Kenntnisvermittlung zur Chemie <strong>der</strong> Geosphäre. Qualitative und<br />
Qualifikationsziele quantitative organisch-/anorganisch-chemische Zusammensetzung <strong>der</strong> unbelebten<br />
Materie sowie wichtige Transformationsprozesse.<br />
c) Die Studierenden sollten die wichtigsten hydrochemischen Prozesse verstehen, um<br />
hydrochemische Daten zu interpretieren. Sie beherrschen die Probenahme von Grundwässern<br />
und sind mit einfachen Plausibilitätskontrollen vertraut.<br />
Inhalte<br />
a) Organische Geochemie<br />
(exemplarisch)<br />
Einführung in die Organische Chemie geowissenschaftlich relevanter Verbindungen:<br />
Nomenklatur, physiko-chemische Eigenschaften, Reaktionstypen,<br />
Diagenetische Prozesse, Markereigenschaften.<br />
b) Anorganische Geochemie<br />
Aufbau <strong>der</strong> Materie, Nukleosynthese, Sonnensystem, chem. Aufbau <strong>der</strong> Erde,<br />
Prozesse <strong>der</strong> Stoffdifferenzierung, Verteilungsprinzipien <strong>der</strong> chemischen<br />
Elemente, Geochemische Zyklen, fluide und feste Phasen, Stabilität von<br />
Mineralen, thermodynamische Grundlagen.<br />
c) Einführung in die Hydrochemie mit Laborübungen:<br />
Grundlegende hydrochemische Prozesse (Kalk-Kohlensäure-System, Metallkomplexe,<br />
Redoxreaktionen, Sorption, Kolloide); Probenahme-techniken,<br />
Datenaufbereitung, hydrogeochemische Typisierung, Bestim-mung <strong>der</strong><br />
Hauptionen in Wässern (Laborübung)<br />
Gruppengröße a) b) c) 5<br />
Kontaktzeit<br />
a) 30 h b) 30 h c) 30 h<br />
Summe: 90 h<br />
Selbststudium a) 60 h b) 60 h c) 60 h<br />
Summe: 180 h<br />
CP<br />
a) 3 CP b) 3 CP c) 3 CP<br />
Kreditpunkte: 9 CP<br />
Voraussetzung für die a) Klausur (60 Min.)<br />
Vergabe von CP b) Klausur (60 Min.)<br />
Note<br />
c) Hausarbeit (Bericht zu Laborübungen) Umfang: max. 5000 Worte, Bearbeitungszeit:<br />
4 Wochen<br />
Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
97
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Umweltmanagement (Wahlpflichtbereich Vertiefung)<br />
Modulbeauftragter: Prof. Dr.–Ing. Peter Doetsch<br />
Dozenten: Prof. Dr.-Ing. Peter Doetsch, wissenschaftliche Mitarbeiter, Lehrbeauftragte<br />
Studiengänge<br />
Angebot (Turnus) Dauer Studienjahr<br />
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />
jährlich<br />
2 Semester 1./ 2. Studienjahr<br />
Kategorie Erläuterung<br />
Veranstaltungen und a) Grundlagen des Umweltmanagements (V + Ü)<br />
Lehrformen<br />
b) Methoden des Umweltmanagements (V + Ü)<br />
c) Planspiel „Umweltmanagement“ (S)<br />
Voraussetzungen keine<br />
Lern-/<br />
Ziel des Moduls ist es, die elementaren Grundlagen und Methoden des öffentlichen und<br />
Qualifikationsziele betrieblichen Umwelt- resp. Nachhaltigkeitsmanagements, die normativen Anfor<strong>der</strong>ungen<br />
sowie Kenntnisse über Aufbau, Inhalt und Ziele <strong>der</strong> wichtigsten Umweltmanagementsysteme<br />
zu vermitteln und sie an ausgewählten Beispielen zu erproben.<br />
Die Studierenden erwerben vertiefte Kenntnisse <strong>der</strong> wissenschaftlichen Grundlagen des<br />
öffentlichen und betrieblichen Umweltmanagements und <strong>der</strong> zugehörigen Instrumente/Methoden<br />
sowie die Kompetenz, die Umweltrelevanz öffentlicher und betrieblicher<br />
Entscheidungen sachkundig zu beurteilen, Umweltauswirkungen zu kommunizieren und<br />
ihre Minimierung durch strukturierte Managementsysteme umzusetzen.<br />
Das Modul vermittelt neben <strong>der</strong> Fachkompetenz (50%) und <strong>der</strong> Methoden-/ Systemkompetenz<br />
(40%) auch die erfor<strong>der</strong>liche Sozialkompetenz (10%).<br />
Inhalte<br />
a) Grundlagen des Umweltmanagements<br />
(exemplarisch)<br />
Überblick europäisches und nationales Umweltrecht (Bund, Län<strong>der</strong>), Nachhaltigkeitsleitbild/<br />
-indikatoren, Umweltqualitätsziele, Entwicklung des Umweltmanagements,<br />
regionales Stoffstrom- und Flächenmanagement, betriebliches Stoffstrommanagement,<br />
Umwelt-Auditing ( EMAS, DIN EN ISO 14001 ff.), Umweltbetriebsprüfung,<br />
Umwelterklärung, Umweltleistungsbewertung, Prinzipien <strong>der</strong> Ökobilanzierung,<br />
Grundlagen zum Aufbau und zur Implementierung von Umweltmanagementsystemen,<br />
Zertifizierung<br />
b) Methoden des Umweltmanagements<br />
Bewertung von Umweltwirkungen (Grundlagen und Methoden <strong>der</strong> formal-rationalen<br />
Bewertung, ökologische Buchhaltung, Technikfolgenabschätzung, Chemikalienbewertung<br />
nach EU Technical Guidance Document, Methoden zur Quantifizierung <strong>der</strong><br />
Umweltrelevanz von Emissionen und Immissionen), Ökobilanzierung (ABC-Analyse,<br />
Emissionsgrenzwertmethode, Ökofaktoren, VNCI-Modell etc.), Stoffflussanalyse, Life-Cycle-Assessment,<br />
Umweltkennzahlen, Umweltkostenrechnung, Öko-Controlling<br />
c) Planspiel „Umweltmanagement“<br />
EDV-Werkzeuge (Umberto, Gabi, Gemis), Datenbanken (ecoinvent, Netzwerk Lebenszyklusdaten),<br />
Analyse beispielhafter Umweltmanagementsysteme, Diskussion<br />
mit Umweltbeauftragten ausgewählter Unternehmen, Auswertung aktueller Fachartikel,<br />
Organisation und Durchführung des Planspiels für das Bauunternehmen „Musterbau“<br />
Gruppengröße a) 30 b) 30 c) 30<br />
98
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Kontaktzeit<br />
a) 30 h b) 30 h c) 20 h<br />
Summe: 80 h<br />
Selbststudium a) 60 h b) 60 h c) 40 h<br />
Summe: 160 h<br />
CP<br />
a) 3 CP b) 3 CP c) 2 CP<br />
Kreditpunkte: 8 CP<br />
Voraussetzung für die a) und b) Klausur (90 Minuten) zu Vorlesung und Übung<br />
Vergabe von CP c) Präsentationen (Dauer: 20 Min.) und Teilnahme am Kolloquium<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
99
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Modul: Verwaltungsrecht und kommunales Management<br />
Modulbeauftragte: Prof. Dr. M. Fromhold-Eisebith<br />
Dozenten: Diverse Lehrbeauftragte<br />
Studiengänge<br />
Angebot (Turnus) Dauer Studienjahr<br />
M. Sc. Wirtschaftsgeographie<br />
zweijährlich 2 Semester 1. o<strong>der</strong> 2. Studienjahr<br />
Kategorie Erläuterung<br />
Veranstaltungen und a) Vorlesung: Allgemeines und beson<strong>der</strong>es Verwaltungsrecht<br />
Lehrformen<br />
b) Übung: Kommunales und regionales Gewerbeflächenmanagement<br />
c) Geländepraktikum: Verwaltungsrecht und kommunales Management<br />
Voraussetzungen Keine<br />
Lern-/<br />
Es werden Kenntnisse zu diversen rechtlichen und planerischen Aspekten des kommu-<br />
Qualifikationsziele nalen Managements vermittelt, mit Blick auf berufsrelevante Kompetenzen. Die Studierenden<br />
sollen die Grundlagen und diverse Anwendungsfragen des Verwaltungsrechts<br />
kennen lernen, dazu verschiedene praktische Aufgabenfel<strong>der</strong> des kommunalen Managements,<br />
die aus geographischer Perspektive beson<strong>der</strong>s bedeutsam sind.<br />
Inhalte (exemplarisch) a) Vorlesung Allgemeines und beson<strong>der</strong>es Verwaltungsrecht:<br />
Grundlegen<strong>der</strong> Aufbau, Elemente und Anwendungsfragen des Verwaltungsrechts werden<br />
von einem erfahrenen Experten aus <strong>der</strong> Praxis (Lehrbeauftragter) vorgestellt und<br />
mit den Studierenden diskutiert, mit Erörterung diverser Beispielfälle aus <strong>der</strong> Kommunalverwaltung.<br />
b) Übung: Kommunales und regionales Gewerbeflächenmanagement<br />
Ziele, Potenziale und Probleme des Gewerbeflächenmanagements werden durch einen<br />
Experten aus <strong>der</strong> Praxis (Lehrbeauftrager) erläutert, mit Vorstellung diverser Fallstudien<br />
aus <strong>der</strong> Praxis. Klassifikationen von Gewerbeflächen sowie Aspekte <strong>der</strong> Wie<strong>der</strong>- bzw.<br />
Nachnutzbarkeit werden thematisiert, dabei insb. <strong>der</strong> Problemfall kontaminierter Flächen<br />
mit Notwendigkeit des Flächenrecyclings.<br />
c) Geländepraktikum: Verwaltungsrecht und kommunales Management<br />
Für zwei Tage erleben Studierende (im Sinne eines ‚Mini-Praktikums’) den<br />
Alltag des Kommunalmanagements vor Ort und beobachten die dabei relevanten<br />
Rahmenbedingungen, Erfor<strong>der</strong>nisse und Herausfor<strong>der</strong>ungen kommunaler<br />
Managementaufgaben.<br />
Gruppengröße a) 60, b) 20, c) 20,<br />
Kontaktzeit<br />
a) 30 h b) 30 h c) 20 h<br />
Summe: 80 h<br />
Selbststudium a) 60 h b) 60 h c) 40 h<br />
Summe: 160 h<br />
Ges.-Summe: 240 h<br />
CP<br />
a) 3 b) 3 c) 2<br />
Summe: 8 CP<br />
Voraussetzung für die a) Mündliche Prüfung (15 Minuten p. Person; ggf. Gruppenprüfung)<br />
Vergabe von CP b) Mündliche Prüfung (15 Minuten p. Person; ggf. Gruppenprüfung)<br />
c) Protokoll des Geländepraktikums (6-8 Seiten) (Bearbeitungszeit: 4 Wochen)<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet<br />
100
Modulhandbuch M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Wirtschaftswissenschaften (Wahlpflichtbereich Vertiefung)<br />
Modulbeauftragter: Prof. Dr. M. Brettel<br />
Studiengang<br />
Angebot (Turnus) Dauer Studienjahr<br />
M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />
jährlich<br />
1 Semester 1./2. Studienjahr<br />
a)/b): WS c)/d): WS<br />
Kategorie Erläuterung<br />
Veranstaltungen und a) Gründungs- und Wachstumsmanagement (GWM) (V)<br />
Lehrformen<br />
b) Gründungs- und Wachstumsmanagement (GWM) (Ü)<br />
c) Grundzüge <strong>der</strong> Wirtschaftswissenschaften (GDW) (V)<br />
d) Grundzüge <strong>der</strong> Wirtschaftswissenschaften (GDW) (Ü)<br />
Voraussetzungen keine<br />
Lern-/<br />
Die Veranstaltung ist auf spätere Berufsanfor<strong>der</strong>ungen von Ingenieuren und Naturwis-<br />
Qualifikationsziele senschaftlern ausgerichtet und hat zum Ziel, ein Verständnis für wirtschaftswissenschaftliche<br />
Zusammenhänge zu schaffen. Zudem sollen die Teilnehmer nach Abschluss<br />
<strong>der</strong> Veranstaltung selbständig einen Business-Plan anfertigen können. Damit verbunden<br />
ist die betriebswirtschaftliche Durchdringung gründungs- und wachstumsrelevanter<br />
Aspekte einer Unternehmung.<br />
Inhalte<br />
a) Gründungs- und Wachstumsmanagement<br />
(exemplarisch) In <strong>der</strong> Vorlesung werden Gründungstheorien und Wachstumsmodelle diskutiert und<br />
somit Eindrücke vermittelt, welchen Herausfor<strong>der</strong>ungen junge Unternehmen ausgesetzt<br />
sind.<br />
b) Gründungs- und Wachstumsmanagement<br />
In <strong>der</strong> Übung erlernen die Studenten die Ausarbeitung eines Business Plans<br />
c) und d) Grundzüge <strong>der</strong> Wirtschaftswissenschaften<br />
Einführung in Aspekte <strong>der</strong> Volkswirtschaftslehre (Konsum, Individuum, Märkte, Staat…)<br />
und <strong>der</strong> Betriebswirtschaftslehre (General Management, Investition und Finanzierung,<br />
Controlling und Rechnungswesen, Marketing, Logistik…)<br />
Gruppengröße a) 30 b) 30 c) 60-80 d) 60-80<br />
Kontaktzeit<br />
a) 30 h b) 30 h c) 30 h d) 30 h<br />
Summe: 120 h<br />
Selbststudium a) 60 h b) 60 h c) 60 h d) 60 h<br />
Summe: 240 h<br />
CP<br />
a) 3 CP b) 3 CP c) 3 CP d) 3 CP<br />
CP: 12<br />
Voraussetzung für die a) und b) Vortrag eines Elevator Pitches, Erstellung eines Business Plans, mündliche<br />
Vergabe von CP Prüfung (Dauer 60 Minuten)<br />
c) und d) Klausur (Dauer 90 Minuten)<br />
Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />
101