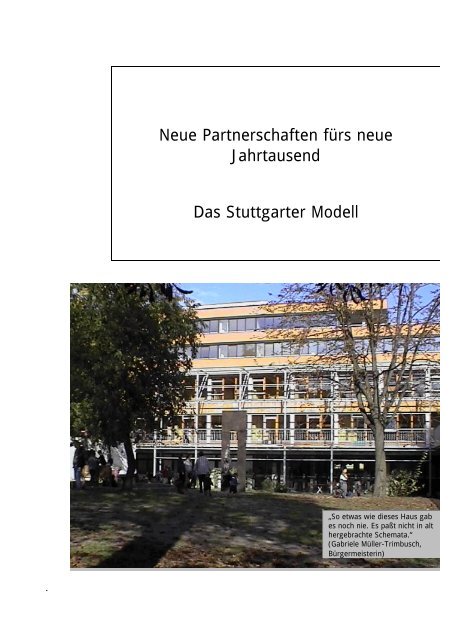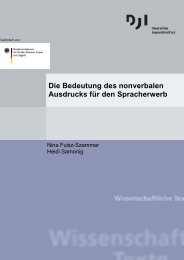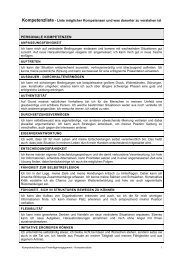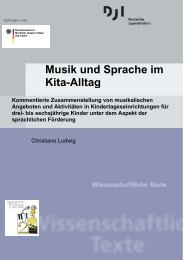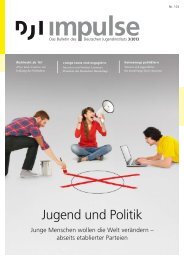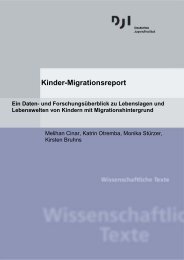Neue Partnerschaften fürs neue Jahrtausend-Das Stuttgarter Modell
Neue Partnerschaften fürs neue Jahrtausend-Das Stuttgarter Modell
Neue Partnerschaften fürs neue Jahrtausend-Das Stuttgarter Modell
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
.<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong><br />
<strong>Jahrtausend</strong><br />
<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />
„So etwas wie dieses Haus gab<br />
es noch nie. Es paßt nicht in alt<br />
hergebrachte Schemata.“<br />
(Gabriele Müller-Trimbusch,<br />
Bürgermeisterin)
Diese Dokumentation beruht auf Interviews, die Anfang Oktober 2001 mit allen Gruppierungen,<br />
die an der Planung des Generationenhaus West beteiligt waren, durchgeführt wurden.<br />
Insgesamt wurden 26 Gespräche geführt. Die Interviews wurden in Auftrag gegeben von<br />
GROOTS (Grassroots Organisations Organising Together in Sisterhood), einer weltweiten<br />
Organisation von Frauen-Selbsthilfeorganisationen, bei der die deutschen Mütterzentren<br />
Gründungsmitglied sind.<br />
Finanziert wurde die Dokumentation aus Mitteln der Ford Foundation, des Eltern Kind Zentrums<br />
(EKIZ) und des Mütterzentren Internationalen Netzwerks (MINE).<br />
Die Interviews wurden durchgeführt von:<br />
* Suranjana Gupta, SSP, Bombay, Indien<br />
* Monika Jaeckel, Deutsches Jugendinstitut (DJI), München<br />
Wir bedanken uns bei unseren Gesprächspartnern:<br />
* Edgar Kurz, Rudolf Schmid und Herman Schmid Stiftung<br />
* Gabriele Müller-Trimbusch, Bürgermeisterin für Soziales, Jugend und Gesundheit<br />
* Sven Kohlhoff, Architekt<br />
* Christine Heizmann-Kerres, Alexander Hoffmann, Hochbauamt<br />
* Isolde Bartel, Jugendamt, Bau- und Bauunterhaltung,<br />
* Michaela Bolland, Jugendhilfe Planung,<br />
* Brigitte Gramlich, Jugendamt, Bestellwesen<br />
* Sigrid Eppstein, Stephanie Braunstein, Ganztagesstätte für Kinder<br />
* Sonja Rudolphi, Luca Siermann, Ulrike Einsfeld, Elternbeirat Ganztagesstätte für Kinder<br />
* Heidi Menge, Bereichsleiterin Kindertagesstätten<br />
* Elke Arenskrieger, Felizitas Keller, Iris Kauffeld-Donhausen, Andrea Laux, Daniela Rapp,<br />
Antje Reiferscheidt, EKIZ<br />
* Alfred Schöffend, Freie Altenarbeit<br />
* Barbara Steiner, Wohlfahrtswerk<br />
* Suzanne Thoni, Koordinatorin für betreutes Wohnen<br />
* Ute Kinn, Dieter Brosig, Agenda Büro, Carl Duisberg Gesellschaft<br />
* Brigitte Preuß, Allianz Versicherungen, Personalabteilung<br />
* Christa van Winsen, Organisationsberatung, Prozeßbegleitung<br />
Veröffentlicht anläßlich der festlichen Eröffnung des Generationenhaus West am 1. Februar 2002<br />
Deutscher Text: Monika Jaeckel<br />
Englischer Text: Suranjana Gupta<br />
Photos und Layout: Marieke van Geldermalsen<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />
1sten Februar 2002. Seite 2 von 43
Gliederung:<br />
I. EINLEITUNG 4<br />
Warum ein Mehrgenerationenhaus? 4<br />
Entstehungsgeschichte 6<br />
Warum diese Dokumentation? 7<br />
II. DIE VISION 9<br />
III. ZU PARTNERN WERDEN 13<br />
Hindernisse und Barrieren 15<br />
Erfolgsrezepte 16<br />
Wenn unterschiedliche Kulturen aufeinander treffen 19<br />
Was war anders? 21<br />
IV. DAS HAUS -<br />
INNENSICHTEN UND AUßENSICHTEN 23<br />
V. INNOVATIONEN 30<br />
VI. EMPFEHLUNGEN 35<br />
Perspektiven im Haus 35<br />
Bedingungen der Übertragbarkeit 37<br />
Empfehlungen für die Politik 40<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />
1sten Februar 2002. Seite 3 von 43
I. EINLEITUNG<br />
Warum ein Mehrgenerationenhaus?<br />
<strong>Das</strong> Generationenhaus West in der Ludwigstrasse in Stuttgart ist<br />
einzig in seiner Art. Hier ist es gelungen auf einen historischen sozialund<br />
familienpolitischen Bedarf zu antworten und Zukunftskonzepte,<br />
von denen allerorts viel die Rede ist, in tatsächliche Praxis<br />
umzusetzen.<br />
<strong>Das</strong> Generationenhaus West ist ein generationsübergreifendes<br />
Nachbarschaftszentrum, oder, um es in den Worten der Beteiligten<br />
auszudrücken, „eine blühende Oase der Menschlichkeit im Stadtteil“, in<br />
dem sich jung und alt, (und alles dazwischen), Familien und Alleinstehende,<br />
Institution und Selbsthilfe, BürgerInnen und Politik,<br />
BewohnerInnen und Verwaltung, Professionelle und PraxisexpertInnen<br />
sowie Einheimische und Zugewanderte begegnen und gemeinsam die<br />
Lebensbedingungen des Stadtteils gestalten.<br />
<strong>Das</strong> Haus wurde von der Rudolf<br />
und Herman Schmid Stiftung mit<br />
Euro 11 Millionen gestiftet und<br />
wird gemeinschaftlich betrieben<br />
von der städtischen Ganztagesstätte<br />
für Kinder, von dem Altenpflegedienst<br />
„Freie Altenarbeit“,<br />
von dem Altenhilfeträger „Wohlfahrtswerk“<br />
und der Selbsthilfegruppe<br />
„Eltern-Kind-Zentrum“. 1<br />
„Die Stiftung hat uns viel Freiraum<br />
gegeben und es ermöglicht,<br />
innovative Wege in der<br />
Verwaltung zu gehen und weitestgehende<br />
Bürgerbeteiligung<br />
zu praktizieren. So viel Spielraum<br />
ist im Alltagsgeschäft<br />
normalerweise nicht gegeben.“<br />
(Michaela Bolland, Jugendhilfeplanung)<br />
1 Zu Beginn des Projektes war auch der Eigenbetrieb Leben und Wohnen beteiligt,<br />
der innovative Konzepte von betreutem Wohnen im Alter für Migranten einbrachte.<br />
Hier hat es einen Trägerwechsel gegeben. Seit April 2001 betreibt das<br />
Wohlfahrtswerk die Vermittlung der Altenwohnungen.<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />
1sten Februar 2002. Seite 4 von 43<br />
„Mit dem genrationsübergreifenden<br />
Haus West in der Ludwigstrasse<br />
soll das, was in der<br />
Moderne auseinander dividiert<br />
wurde, wieder zusammengefügt<br />
werden. Es spricht für das Ausmaß<br />
des Problems, daß man<br />
das, was eigentlich das Normale<br />
sein sollte, in der heutigen Zeit<br />
als innovatives <strong>Modell</strong> bezeichnen<br />
muß.“ (Bürgermeisterin<br />
Gabriele Müller-Trimbusch)
„Wenn man gesunde Nachbarschaften<br />
will, dann muß man<br />
den Bürgern und Bürgerinnen<br />
mehr Beteiligungschancen und<br />
Mitspracherechte eröffnen. Dann<br />
muß man die Selbsthilfe ernst<br />
nehmen. <strong>Das</strong> hat die Stadt verstanden.<br />
Deswegen sind wir ins<br />
Boot geholt worden.“ (Elke<br />
Ahrenskrieger, Ekiz)<br />
Es beherbergt auf 5 Stockwerken und einer Gesamtfläche von 6000 qm<br />
eine städtische Kindertagesstätte für 120 Kinder, eine flexible Kleinkindbetreuung<br />
mit Platzsharing, 10 Altenwohnungen, eine Großküche<br />
für die Kindertagesstätten des Stadtteils, ein Nachbarschaftscafé mit<br />
offener Kinderbetreuung, ein Second Hand Laden, eine Altenpflegeservice<br />
Agentur und großzügige Gemeinschaftsflächen, die auch für<br />
die Nachbarschaft geöffnet sind. Hierzu gehören ein traumhafter<br />
Garten und Kinderspielplatz, eine luxeriöse Dachterrasse, sowie Veranstaltungs-<br />
Hobby- und Gymnastikräume.<br />
Die Lebensqualität in den Städten wird zunehmend beklagt, vor allem<br />
von Familien mit Kindern, von Jugendlichen und von alten Menschen.<br />
In den bundesdeutschen Großstädten leben nur noch in ca. einem<br />
Viertel aller Haushalte Kinder und der Trend zur Stadtflucht von<br />
Familien setzt sich fort. Eingeschränkte Mobilitätschancen für Kinder,<br />
Gefährdung der Sicherheit in anonymen Nachbarschaften, die<br />
Ausdünnung familienentlastender Infrastruktur und das Fehlen<br />
sozialer Nachbarschaften zählen zu den Gründen, die Familien<br />
veranlassen, an den Stadtrand oder ganz aus der Stadt<br />
herauszuziehen.<br />
Die in der Stadtplanung im letzten Jahrhundert durchgesetzte<br />
Entmischung der Schlüsselfunktionen menschlicher Siedlungen in<br />
Wohnen, Versorgen, Arbeiten, Freizeit, Handel und Verkehr hat zu<br />
einer Ausdünnung der sozialen Verflechtungen und der sozialen<br />
Lebensdichte in den Wohnbereichen geführt und den familialen<br />
Binnenraum in den Städten zunehmend auf den engsten Raum der<br />
eigenen vier Wände eingeschränkt.<br />
Der öffentliche Raum als Ort zum Verweilen und Ort der Begegnung<br />
ist zunehmend ausgehöhlt, Priorität hat der rollende Verkehr, der alle<br />
anderen Funktionen auf engstem Raum zusammendrängt und<br />
voneinander abkoppelt. Isolation und Einsamkeit, überforderte<br />
Nachbarschaften und sozial gefährdete Stadtteile sind Folgen, für die<br />
zunehmend Gegenstrategien gesucht werden.<br />
<strong>Das</strong> Verständnis von Stadtplanung hat sich in der Folge zunehmend<br />
erweitert. Darunter wird nicht mehr vor allem eine Politik für die<br />
bebaute Umgebung und für effiziente Wirtschafts- und Verkehrssysteme<br />
verstanden, sondern es kommt zunehmend auch die Dimension<br />
der sozialen Infrastruktur und des sozialen Nahraums in den Blick.<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />
1sten Februar 2002. Seite 5 von 43
Entstehungsgeschichte<br />
Bei der Entstehung des Generationenhaus West kamen mehrere<br />
glückliche Umstände zusammen. Die Gebrüder Schmid vermachten<br />
ihr Vermögen der Stadt Stuttgart für Projekte im Bereich der<br />
Familien- und Altenarbeit. Die Testamentsvollstrecker trafen auf eine<br />
engagierte Bürgermeisterin mit weitsichtigen sozialen Visionen. Die<br />
städtische Kindertagesstätte in der Ludwigstrasse befand sich in<br />
einem Abrißhaus. Die Sanierung war überfällig. Jugendhilfeplanung<br />
suchte nach Möglichkeiten bei einer Neugestaltung, die großzügige<br />
Freifläche des Kita Grundstückes für den überaus dicht besiedelten<br />
Stadtteil zu erhalten. Der <strong>Stuttgarter</strong> Westen besaß zwei<br />
familienpolitische „Schätze“: das Familienselbsthilfeprojekt Eltern-<br />
Kind-Zentrum, erstes Mütterzentrum in Baden Württemberg, UN<br />
Preisträger und Inbegriff lebendiger Nachbarschaftskultur, das aus<br />
allen Nähten platzte, und den Verein Freie Altenarbeit, einen<br />
innovativen Träger ganzheitlicher Altenpflege.<br />
Als die Stadt Stuttgart sich entschloß, diese Akteure zusammenzubringen,<br />
und die Stadtverwaltung sich auf einen partizipativen<br />
Planungsprozeß einließ, war das Projekt geboren. Als dann noch ein<br />
renommierter <strong>Stuttgarter</strong> Architekt mit viel Sensibilität für soziale<br />
Fragen und ein Sponsor aus der freien Wirtschaft für eine Moderation<br />
des partizipativen Planungsprozesses gewonnen werden konnten,<br />
waren die Bestandteile eines Erfolgrezeptes beisammen.<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />
1sten Februar 2002. Seite 6 von 43<br />
„Die Mütterzentren verbreiten<br />
sich ja inzwischen über die<br />
ganze Welt. Überall da, wo traditionelle<br />
Familien- und Verwandtschaftsnetzwerkeausgehöhlt<br />
wurden, sei es durch<br />
Aids in Afrika oder durch Krieg<br />
wie in Bosnien oder durch den<br />
Sozialismus wie in Bulgarien und<br />
der Tschechischen Republik,<br />
stoßen Mütterzentren auf großes<br />
Interesse. Sie stellen <strong>neue</strong> Gemeinschaften<br />
her, so etwas wie<br />
Ersatzfamilien in der Nachbarschaft.“<br />
(Andrea Laux, Ekiz)<br />
„Wenn man sich wie wir um<br />
Lebensversicherungen kümmert,<br />
dann ist das Interesse an den<br />
verschiedenen Möglichkeiten,<br />
wie Menschen im Alter betreut<br />
und versorgt werden können,<br />
von Haus aus gegeben. Generationsübergreifende<br />
<strong>Modell</strong>e halten<br />
wir auf diesem Gebiet für<br />
zukunftsweisend. Und so waren<br />
wir auch daran interessiert, als<br />
Partner für das <strong>neue</strong> Haus in der<br />
Ludwigstrasse einzusteigen.“<br />
(Brigitte Preuß, Allianz<br />
Versicherungen)
Warum diese Dokumentation?<br />
Diese Dokumentation ist eine Festschrift zur feierlichen Eröffnung des<br />
Generationenhaus West und ein Ausdruck davon, das dieses<br />
„<strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong>“ bereits auf internationales Interesse gestoßen ist.<br />
Die Dokumentation wurde von dem Internationalen Netzwerk von<br />
Frauenselbsthilfe Gruppen, GROOTS, in Auftrag gegeben und mit<br />
Mitteln der Ford Foundation, sowie von EKIZ und dem Internationalen<br />
Netzwerk der Mütterzentren (MINE) finanziert.<br />
Dieses Haus ist eine sozialpolitische und stadtplanerische Innovation<br />
und ein Grund zum Feiern. Dahinter steht ein 3 Jahre langer -<br />
durchaus mühsamer - Prozeß, in dem gesellschaftlich sehr unterschiedliche<br />
Akteure, zwischen denen es strukturell viel Trennendes<br />
gibt, sich „zusammengerauft“ haben und zu echten Partnern<br />
geworden sind. Erfolge lassen sich besser feiern, wenn man weiß,<br />
was sie ermöglicht hat und sie lassen sich auch besser wiederholen<br />
und übertragen, wenn man ihre Bestandteile kennt.<br />
<strong>Das</strong> Ziel dieser Dokumentation ist es daher einen ungewöhnlich<br />
partizipativen Planungs- und Partnerschaftsprozeß zu dokumentieren,<br />
in dem unterschiedliche Kulturen aufeinandergetroffen sind und zu<br />
einem konstruktiven Miteinander gefunden haben. Es geht sowohl<br />
darum die Konflikte, Mißverständnisse, Hindernisse und strukturellen<br />
Barrieren aufzuzeigen, die dabei überwunden werden mußten, als<br />
auch die Aspekte zu definieren, die den Prozeß positiv gestaltet<br />
haben. Die Dokumentation soll dazu dienen, ein Instrument der<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />
1sten Februar 2002. Seite 7 von 43
Übertragbarkeit zu schaffen, das von anderen Trägern und anderen<br />
Gemeinden genutzt werden kann, um ähnliche Partizipationsprozesse<br />
und <strong>neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> zu entwickeln. Was kann man aus den<br />
<strong>Stuttgarter</strong> Erfahrungen darüber lernen, was es braucht, damit<br />
<strong>Partnerschaften</strong> zwischen Akteuren aus unterschiedlichen Sektoren<br />
gelingen und welche Empfehlungen, können für Planungsprozesse<br />
generell daraus gezogen werden?<br />
Schließlich geht es auch darum, den mutigen und durchhaltewilligen<br />
„Pionieren“ aus den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, die<br />
diesen Prozeß getragen haben, ein kleines Denkmal zu setzen. Denn<br />
die Erfahrung zeigt, wie schnell das Bewußtsein davon, was einzelne<br />
engagierte Menschen für das Gemeinwohl leisten, in der Öffentlichkeit<br />
verloren geht.<br />
„Internationale Erfahrungen zeigen, daß von Frauenbasisgruppen<br />
weltweit wichtige Impulse für eine positive Stadtentwicklung ausgehen.<br />
Wir waren sehr inspiriert von den Erzählungen des Mütterzentrums<br />
über die <strong>neue</strong> Partnerschaftskultur, die in Stuttgart in der<br />
Planung des <strong>neue</strong>n Hauses in der Ludwigstrasse entwickelt wurde.<br />
Wir waren neugierig darauf, mehr darüber zu erfahren, was es<br />
braucht, um Frauen- und Nachbarschaftsgruppen an der Entwicklung<br />
ihres Stadtteils stärker zu beteiligen und mehr Gewicht in<br />
kommunalpolitische Prozesse zu verschaffen. Es hat uns sehr<br />
interessiert, welche unterschiedlichen Beiträge Mütter und<br />
Professionelle in diesen Prozeß einbringen und wie die<br />
Zusammenarbeit das Endresultat verbessert hat.<br />
Wir werden die <strong>Stuttgarter</strong> Erfahrungen an unsere internationalen<br />
Netzwerke weitergeben, damit Vertreter der öffentlichen Verwaltung,<br />
der Kommunalpolitik, und der Selbsthilfe aus anderen Ländern sowie<br />
internationale Organisationen wie die Vereinigten Nationen und die<br />
Weltbank daraus lernen können. <strong>Das</strong> internationale Interesse daran<br />
wächst, Initiativen und „Best Practices“ zu vervielfältigen, denen es<br />
gelingt, Frauengruppen vor Ort in kommunalpolitische<br />
Entscheidungsprozesse einzubeziehen.“ (Sandy Schilen, GROOTS)<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />
1sten Februar 2002. Seite 8 von 43
Stichworte aus der<br />
Prozeßbegleitung:<br />
II. DIE VISION<br />
Strategien urbaner Revitalisierung betonen zunehmend die Notwendigkeit<br />
von Investitionen in soziale Ressourcen, in den sozialen<br />
Zusammenhalt und in die Nachbarschaftsqualität menschlicher<br />
Siedlungen. Die Aktivierung von Bewohnern, die Initiierung von<br />
Stadtteilkultur und eine partizipative Kommunalpolitik sind Wege zur<br />
Verbesserung der sozialen Integrationskraft von Nachbarschaften, die<br />
in Programmen wie der „Agenda 21“ oder der „Sozialen Stadt“<br />
vorgeschlagen werden.<br />
<strong>Das</strong> Generationenhaus West<br />
ist entstanden, weil die<br />
beteiligten Akteure diese<br />
Vision teilen und zum Teil<br />
auch bereits leben. Und weil<br />
sie gemeinsam, jede an ihrem<br />
Ort und in ihrer Funktion<br />
damit ernst gemacht haben,<br />
diese Vision umzusetzen.<br />
Inmitten des oft schwierigen<br />
Aushandlungsprozesses und<br />
der vielen Klippen, die es zu<br />
umschiffen gab haben die<br />
Beteiligten alle Kurs gehalten,<br />
so daß die Vision im Laufe des<br />
Planungsprozesses nicht<br />
abgeschwächt, sondern im<br />
Gegenteil klarere Konturen<br />
erhielt und den gemeinsamen<br />
Prozeß tragen konnte.<br />
In unserem Haus<br />
gehen ein und aus:<br />
Mitarbeiter/-innen Kinder Väter Mütter, Kinder<br />
(volzeit – Teilzeit) Eltern mit Kindern aus dem stadtteil<br />
Hausmeister/-in Alleinerziehende Nachbarn<br />
Küchenpersonal Honorarmütter Senioren aus Stadtteil<br />
Frei Arbeiter/-innen Mütterzentrumfrauen Publikum<br />
Garten- und Arbeitsgemeinschaften Gäste<br />
Bauunterhaltung Akademieteilnehmende Festgesellschaften<br />
Reinigungsleute Migrant/-innen Polit-Prominenz<br />
Lieferanten Bewohner/-innen Menschen ohne Geld<br />
Praktikant/-innen Senioren Menschen mit Handicap<br />
Behinderte Menschen<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />
1sten Februar 2002. Seite 9 von 43
Von Seiten der Bauherrin war als Ziel formuliert, ein multifunktionales<br />
Haus zu schaffen für unterschiedliche Gruppen und Generationen. Ein<br />
wichtiger Teil dieser Vision betraf auch die Frage des Wohnens im<br />
Alter und der Integration von Bürgern ausländischer Herkunft. Die<br />
Altenwohnungen im obersten Stockwerk sind speziell mit diesen<br />
Anliegen konzipiert.<br />
„Kinder, Jugendliche, Eltern und alte Menschen sollen hier miteinander<br />
kommunizieren und voneinander lernen können. Darüber<br />
hinaus ist aber auch ein Haus erwünscht, das sich gegenüber<br />
Initiativen, Vereinen, Institutionen und Familien aus dem Stadtbezirk<br />
Stuttgart-West öffnet.“ (Bürgermeisterin)<br />
Die beteiligten Gruppen formulierten ihre Vision im laufe der<br />
Interviews in unterschiedlicher Weise.<br />
„Es geht uns um Selbständigkeit und Selbstbestimmung im Alter für<br />
Bewohner und Senioren im Stadtteil, es sollen Wohnformen<br />
entstehen, die der Vereinsamung im Alter entgegenwirken und<br />
kulturelle Begegnungen fördern. <strong>Das</strong> Zentrum soll zur Lebensfreude<br />
und Lebensqualität zwischen jung and alt beitragen. Es könnte<br />
vielleicht schwierig werden die Idee einer Gemeinschaftsküche zu<br />
verkaufen, aber man vergißt oft nur zu schnell wie einsam alte<br />
Menschen werden können und wie wichtig es ist, daß sie in<br />
Gemeinschaft bleiben. Vielleicht wird dieses Haus unsere<br />
Vorstellungen von betreutem Wohnen völlig umkrempeln.“<br />
(Wohlfahrtswerk)<br />
„Die Haltung und das Menschenbild aller im Haus soll in der von<br />
Freundlichkeit und Offenheit geprägten Atmosphäre spürbar werden.<br />
Es ist ein Ort für alle Lebenslagen. Wir bieten den Rahmen für<br />
Begegnungen, für aktives Miteinander und bürgerschaftliches<br />
Engagement. <strong>Das</strong> Haus wird Anlaufstelle und wichtiger Knotenpunkt<br />
im Stadtteil Stuttgart-West, ein florierender und lebendiger Betrieb,<br />
ein Ort der Kooperation innerhalb des Hauses und im Stadtteil. Jeder<br />
soll sich willkommen fühlen.“ (EKIZ)<br />
„In diesem Haus können wir unsere Vorstellungen von einer<br />
qualitativen Kinderbetreuung wirklich realisieren, mit vielen kreativen<br />
und Bewegungsangeboten. Wir können Baumhäuser bauen,<br />
Kinderkonferenzen veranstalten, die Möglichkeiten sind unbegrenzt.<br />
Die eingebaute Begegnung zwischen den Generationen eröffnet ganz<br />
<strong>neue</strong> Perspektiven “. (Kindertagesstätte)<br />
„<strong>Das</strong> wichtigste an diesem Haus ist die Hilfe zur Selbsthilfe, daß<br />
Menschen hier lernen können, sich selbst zu helfen.“ (Jugendamt)<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />
1sten Februar 2002. Seite 10 von 43<br />
„Im <strong>neue</strong>n Haus werden wir<br />
richtig loslegen können mit unseren<br />
Träumen und Visionen.<br />
Wir wollen ein Haus werden, in<br />
dem ökologisch angebaute Produkte<br />
verwertet werden, in dem<br />
die regionalen Produzenten<br />
unterstützt werden, das erste<br />
öffentliche Haus, in dem ökologisch<br />
geputzt wird. Es sollen<br />
Bewußtseinsprozesse zu Umweltfragen<br />
von hier ausgehen.<br />
Es sollen auch Entlastungen für<br />
Familien und Alte im Stadtteil<br />
geschaffen werden, ein Wäscheund<br />
Bügel-Service, Einkaufsdienste,<br />
Transportfahrten. Leute<br />
sollen zum Verwöhnen her<br />
kommen können.“ (Andrea<br />
Laux, EKIZ)<br />
„Es hat einige Zeit gedauert, bis<br />
ich wirklich von diesem Projekt<br />
überzeugt war. Die regelmäßigen<br />
Teamtreffen waren sehr<br />
wichtig für mich, dort habe ich<br />
die Visionen der verschiedenen<br />
beteiligten Partner kennengelernt,<br />
vom Architekten, von der<br />
Bürgermeisterin, von der<br />
Planungsabteilung, von den<br />
Mütterzentren. <strong>Das</strong> hat mich<br />
beeindruckt und inspiriert und<br />
nach einer Weile war ich im<br />
Boot. Jetzt stehe ich vollkommen<br />
dahinter und arbeite nach<br />
Kräften mit, daß unsere Vision<br />
Wirklichkeit wird.“ (Sigrid<br />
Eppstein, Kindertagesstätte)
„Wir sehen unsere Aufgabe vor<br />
allem darin, daß das Haus eine<br />
gute Atmosphäre hat, daß es<br />
familiär ist, offen und entspannend,<br />
ein Ort, wo man ermutigt<br />
wird, über sich hinaus wachsen<br />
kann, aber auch wo man Unterstützung<br />
erfährt und getragen<br />
wird. Es soll zu einer sicheren<br />
Nachbarschaft beitragen, wo es<br />
keine Gewalt und auch keine<br />
psychische Erschöpfung und<br />
Überforderung gibt. Kranke und<br />
Behinderte sollen einen würdevollen<br />
Platz und <strong>neue</strong> Chancen<br />
erhalten. Jeder soll die Möglichkeit<br />
haben, nach eigenem<br />
Tempo weiterzukommen.“<br />
(Andrea Laux, EKIZ)<br />
„<strong>Das</strong> Haus soll Offenheit transportieren, und Transparenz. Es soll<br />
nicht alles hinter geschlossenen Türen und geschlossenen Vorhängen<br />
stattfinden, sondern es soll zum mitmachen und mit dabei sein<br />
anregen. Es ist so konzipiert, daß man sich gegenseitig wahrnimmt<br />
und sich begegnet. Was Architektur dazu beitragen kann, um<br />
Kooperation und Gemeinschaft zu stiften, ist hier versucht worden.“<br />
(Architekt)<br />
„Dieses Mehrgenerationenhaus wird eine <strong>neue</strong> Art von Familienleben<br />
schaffen. Wir versuchen hier unsere Themen aus der Isolation<br />
herauszubringen und hier gemeinsam zu gestalten. Nicht nur für<br />
alleinerziehende Mütter ist es wichtig, sich mit anderen austauschen<br />
zu können und Unterstützung zu finden. Hier kann man auftanken,<br />
aufblühen und Talente entdecken, die verschüttet lagen. Wenn ich<br />
allein mit meinen Kindern daheim geblieben wäre, hätte ich nie die<br />
Motivation gehabt, mich so für die Gemeinschaft einzusetzen, wie ich<br />
es hier tue. Ich hätte auch gar nicht so viele Ideen und Projekte<br />
entwickeln können.“ (EKIZ)<br />
„Alte Menschen sind aus unserem öffentlichen Leben zunehmend<br />
ausgeschlossen und in unserer Kultur gibt es keinen selbstverständlichen<br />
Umgang mehr mit ihnen. Ein Haus wie dieses wird dazu beitragen<br />
können, das Image von alten Menschen zu verändern. Sie werden oft<br />
nur noch als bedürftig wahrgenommen, als fragil, als bitter, als Leute,<br />
denen alles zu viel ist und die sich immer beschweren. Aber es gibt bei<br />
ihnen - wie bei allen Menschen - viele Seiten und es ist gut, wenn Kinder<br />
wie Erwachsene die Gelegenheit erhalten, alte Menschen von allen<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />
1sten Februar 2002. Seite 11 von 43
Seiten zu sehen. Im <strong>neue</strong>n Haus können wir alle wieder lernen, mit einander<br />
umzugehen.“ (Freie Altenarbeit)<br />
„Dieses Haus könnte demonstrieren, wie Nachbarschaftlichkeit sein<br />
kann. Es gibt ja kaum noch intakte Nachbarschaften. Dies könnte eine<br />
Gelegenheit sein, daß sich das in unserem Viertel wieder entwickelt.“<br />
(Besucherin im Café Ludwigslust)<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />
1sten Februar 2002. Seite 12 von 43
„Kein Architekt kann und sei er<br />
noch so genial den Konsultationsprozeß<br />
vorwegnehmen und<br />
es besser wissen als die Nutzer,<br />
was für sie am Besten ist. Die<br />
beste Qualität entsteht immer,<br />
wenn die Nutzer direkt beteiligt<br />
werden.“ (Sven Kohlhoff, Architekt)<br />
„Die Verwaltung spricht eine andere<br />
Sprache als die Nutzer, die<br />
die „Amtssprache“ oft nicht verstehen.<br />
Hier braucht es eine Vermittlung,<br />
jemand die in beiden<br />
Welten zu hause ist und übersetzen<br />
und vermitteln kann. Es<br />
erfordert aber auch die Bereitschaft<br />
aller Beteiligten auf Kommunikationsprobleme<br />
zu achten<br />
und darüber zu reflektieren, was<br />
dabei der eigene Anteil sein könnte<br />
und wie man selber zu einer<br />
besseren Kommunikation und<br />
Kooperation beitragen könnte.“<br />
(Isolde Bartel, Jugendamt)<br />
III. ZU PARTNERN WERDEN<br />
<strong>Partnerschaften</strong> fallen nicht vom Himmel, sie sind in der Politik wie im<br />
richtigen Leben das Ergebnis intensiver Kommunikations- und<br />
Aushandlungsprozesse. In diesem Kapitel soll der Prozeß<br />
nachgezeichnet werden, durch den <strong>Partnerschaften</strong> entstanden sind,<br />
unter den am Haus beteiligten Gruppen untereinander, sowie<br />
zwischen ihnen und der öffentlichen Verwaltung. Dieser Prozeß spielte<br />
sich in mehreren Stufen ab.<br />
Entscheidend war der Beschluß der Stadt, das Generationenhaus<br />
West von Anfang an unter Beteiligung der Nutzer partizipativ zu<br />
planen. Dies ist ungewöhnlich. Die Beteiligung der Bürger an<br />
Bauprojekten wird in der Regel zu einem Zeitpunkt eingeplant, zu<br />
dem der Architekt schon ausgewählt und ein Grunddesign des<br />
Gebäudes bereits erstellt ist. Die Bürger können sagen, ob dieser<br />
Entwurf ihren Bedürfnissen entspricht oder nicht und Modifikationen<br />
anbringen. Grundentscheidungen jedoch wie die Frage wieviel<br />
Quadratmeter für welche Funktion zur Verfügung stehen sollen, sind<br />
meist ohne Beteiligung der Bürger bereits gefallen und werden in der<br />
Regel auch nicht mehr revidiert.<br />
Beim Bau des Generationenhaus West wurden alle Nutzer 2 , bereits in der<br />
Programphase beteiligt. Sie suchten den Architekten mit aus und fällten<br />
vor allem gemeinsam die Entscheidungen über die Aufteilung der<br />
Quadratmeter und die Raumnutzung im Haus. Anders wäre eines der<br />
innovativsten Entscheidungen des Generationenhaus West, die<br />
gemeinsame Nutzung der Gemeinschaftsflächen durch alle Nutzer,<br />
wahrscheinlich nicht zustande gekommen. Dieser Planungsprozeß fand<br />
durch regelmäßige Jour-fixe Treffen aller Beteiligten statt, in denen die<br />
relevanten Entscheidungen ausdiskutiert und gemeinsam gefällt wurden.<br />
Parallel zu diesen Planungstreffen wurde ein gemeinsamer Prozeß<br />
unter den Hausnutzern initiiert, in dem sie klärten, welche Ziele sie<br />
an das Generationenhaus knüpften und wie sie gemeinsam das<br />
Haus führen und nutzen wollten. Dieser Prozeß wurde von einer<br />
professionellen Prozeßbegleitung moderiert und trug entscheidend<br />
dazu bei, daß die beteiligten Gruppen sich besser kennenlernten und<br />
zusammengewachsen sind. Am Ende dieses Prozesses haben sich<br />
alle Gruppen auf eine gemeinsame Rahmenkonzeption einigen<br />
können.<br />
2 Anfängliche Stolpersteine gab es als nur die Erzieherinnen der<br />
Ganztageseinrichtung für Kinder und nicht auch die Elternvertreter am<br />
Planungsprozeß miteinbezogen werden sollten. Dies wurde aber revidiert.<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />
1sten Februar 2002. Seite 13 von 43
Die Planungsprozesse wurden begleitet von intensiven Diskussionen<br />
und Auseinandersetzungen in den Gruppierungen selber. Sowohl mit<br />
den Erzieherinnen und Eltern der Kindertagesstätte als auch unter<br />
den Aktiven des Eltern Kind Zentrums wurden regelmäßige<br />
Informations- und Diskussionsveranstaltungen zu den verschiedenen<br />
Phasen des Planungsprozesses plenar veranstaltet.<br />
Der gemeinsame Planungsprozeß und das Zusammenfinden als Partner<br />
ist gelungen. Mit dem Generationenhaus West identifizieren sich alle<br />
beteiligten Akteure in hohem Maße. Es gab jedoch viele strukturelle<br />
Barrieren zu überwinden, bis dies geglückt ist. Es galt das Machtgefälle,<br />
das unter den unterschiedlichen Partnern bestand, auszugleichen. Es<br />
galt alle Beteiligten soweit zu „professionalisieren“, daß sie die<br />
Planungsprozesse verstehen konnten, sowohl vom bautechnischen als<br />
auch vom verwaltungstechnischen her. Es galt die politischen<br />
Rahmenbedingungen transparent und nachvollziehbar zu machen.<br />
Alle Partner, die interviewt<br />
wurden, schilderten den Prozeß<br />
anfangs als sehr mühsam und<br />
von Mißver-ständnissen und<br />
Mißtrauen geprägt. Jeder versuchte<br />
die eigenen Inte-ressen<br />
zu wahren und sah in den<br />
anderen einen potentielle<br />
Kontrahenten. Es bedurfte<br />
intensiver KommunikationsundAuseinandersetzungsprozesse<br />
bis hieraus Partner<br />
wurden, die ein gemeinsames<br />
Ziel hatten, sich als Teil eines<br />
kooperativen Gesamtprozesses<br />
wahr-nahmen und sich mit dem<br />
ganzen Haus identifizierten.<br />
Zum positiven hat sich der Prozeß gewendet als in der Prozeßbegleitung<br />
der Focus auf die gemeinsamen Werte und Visionen<br />
gelenkt wurde, und man feststellte, daß man von den Werten und<br />
Zielen her gar nicht so weit voneinander entfernt war wie man<br />
angenommen hatte. Eine große Rolle spielte auch, daß alle Beteiligten<br />
im Planungsprozeß das gleiche Sagen hatten und konsensual<br />
entschieden wurde.<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />
1sten Februar 2002. Seite 14 von 43<br />
„Irgend jemand ist zwischendrin<br />
immer geschwind geschockt und<br />
entsetzt. Mal ist es die eine<br />
Seite, mal die andere. Aber<br />
diese Schocks sind wichtig, sie<br />
sind genau das, was angesprochen<br />
werden muß, um sich zu<br />
verständigen und zu einer<br />
Kooperation zu kommen.“<br />
(Christa Van Winsen, Prozeßbegleitung)<br />
„Nicht beteiligt werden, nicht<br />
informiert werden, und ein<br />
eklatanter Mangel an Wertschätzung<br />
sind häufige Erfahrungen<br />
bei Selbsthilfegruppen. <strong>Das</strong> geht<br />
mit viel Frust und Verletzungen<br />
einher. Es ist daher sehr wichtig<br />
eine öffentliche Anerkennungskultur<br />
zu schaffen, in der sehr<br />
sichtbar gemacht wird, was<br />
diese Gruppen gesellschaftlich<br />
beitragen, und welche Kompetenzen<br />
sie mit an den Tisch<br />
bringen.“ (Christa van Winsen,<br />
Prozeßbegleitung)
„Für mich war es wichtig zu bemerken,<br />
wenn einer der Beteiligten<br />
sich zurückzog und nicht<br />
mehr kommunizierte. Meine<br />
Aufgabe war es dies anzusprechen<br />
und herauszufinden, was<br />
geschehen war, wo das Problem<br />
lag.“ (Christa van Winsen,<br />
Prozeßbegleitung)<br />
„Mir war es ein Anliegen dem<br />
EKIZ eine Finanzsituation zu geben,<br />
die sie aus dieser Kampfstellung<br />
herausholt, ihnen einen<br />
Finanzhaushalt zuzuteilen, die<br />
sie gleichstellt mit den städtischen<br />
Begegnungsstellen. Man<br />
bindet sonst zu viele Ressourcen<br />
des Projekts daran, nur das<br />
eigene Überleben zu sichern.<br />
<strong>Das</strong> ist dann ein Dauerkonflikt,<br />
das ist nicht sinnvoll.“ (Michaela<br />
Bolland, Jugendhilfeplanung)<br />
Hindernisse und Barrieren<br />
Die Hindernisse und Barrieren, die während der dreijährigen Planung<br />
des Generationenhaus West bearbeitet und überwunden wurden,<br />
schildern die Beteiligten in ihren eigenen Worten wie folgt:<br />
„<strong>Das</strong> Mißtrauen gegenüber dem Jugendamt war sehr hoch. Es gab<br />
Phasen da hatten wir das Gefühl, wir lassen das, das hat keinen Sinn.<br />
<strong>Das</strong> kann nicht klappen. Wie können Gruppen zusammen ein Haus<br />
betreiben, wenn sie so mißtrauisch gegeneinander sind! Jede Gruppe<br />
fühlte sich ein wenig als die Besseren. Die einen, weil sie sich als<br />
Professionelle identifizierten, die anderen, weil sie sich als die<br />
wirkliche Basis fühlten. Am Anfang gab es einiges an<br />
unterschwelligem Gerangel, wessen Meinung und Expertise mehr<br />
zähle. Die Verwaltung hatte z.B. das Gefühl: „Wir haben das Know<br />
How und müssen Bestimmungen korrekt erfüllen, also muß es<br />
eigentlich nach uns gehen“. Die Praxis hatte eher das Gefühl: „Wir<br />
sind jahrelang nicht öffentlich anerkannt worden, jetzt sind wir da,<br />
und wir sind toll, jetzt müßt ihr uns anerkennen, nur durch uns kann<br />
es richtig laufen.“ Auch gab es Konkurrenzen bei der Frage der<br />
Erziehungskompetenzen zwischen professionellen Erzieherinnen und<br />
Müttern.<br />
Es war ein längerer Prozeß, bis alle lernten, sich untereinander<br />
wertzuschätzen und jede Meinung zu respektieren. Es war ein<br />
komplizierter Lernprozeß, Kontroversen zu tolerieren, in Konflikten<br />
stabil zu bleiben und Kompromisse schließen zu lernen. <strong>Das</strong><br />
interessante ist, daß es am Ende doch geklappt hat, aber es war ein<br />
enormer Kraftakt unter allen Beteiligten.“ (Jugendhilfeplanung)<br />
„Es war schwierig die verschiedenen Gruppen in einen wirklich<br />
kooperativen Prozeß zu bringen. Es gab viele Empfindlichkeiten und<br />
viel Mißtrauen. Dies spiegelt aber auch ein strukturelles Problem<br />
wider: wie schafft man eine gleichwertige Partnerschaft unter<br />
ungleichen Partnern, wenn die Bedingungen unter denen die<br />
verschiedenen Partner antreten, so unterschiedlich sind? Die<br />
Unterschiede müssen auf den Tisch gebracht und transparent<br />
gemacht werden, sonst führen sie zu Mißstimmungen und zu<br />
Kämpfen im Untergrund. Z.B. einige Partner beteiligten sich an dem<br />
Planungsprozeß als Teil ihrer bezahlten Arbeit, für andere war es<br />
Ehrenamt.“ (Prozeßbegleitung)<br />
„Wenn man auf Dauer Bürgerbeteiligung will, dann braucht es<br />
Strukturen, die eine solche Beteiligung und Partnerschaft auf Dauer<br />
stellen. Dann muß das auch eine finanzielle Basis haben.<br />
Bürgerbeteiligung für eine Spielstraße oder für Verkehrsberuhigung an<br />
einer Straßenkreuzung als einzelne Projekte ist etwas anderes als<br />
wenn man wie hier eine Beteiligung auf Dauer anstrebt, sozusagen<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />
1sten Februar 2002. Seite 15 von 43
eine strukturelle Aufgabe an die Bürger delegiert. <strong>Das</strong> geht dann nicht<br />
ohne Bezuschußung. Die dürfen nicht finanziell ungesichert sein und<br />
Existenzängste haben. <strong>Das</strong> überfordert die Selbsthilfe, und auch die<br />
anderen Partner und den Prozeß als Ganzes. <strong>Das</strong> macht es für alle<br />
schwierig, wenn strukturell keine Gleichwertigkeit da ist. <strong>Das</strong> war in<br />
diesem Fall ein Problem, daß das lange Zeit nicht klar war.Wir haben<br />
einen gleichberechtigten Aushandlungsprozeß erwartet, obwohl die<br />
Partner ungleich waren. <strong>Das</strong> war ein Dauerkonflikt, der sich durch den<br />
ganzen Prozeß durchzog. Bürgerschaftliches Engagement geht nicht<br />
ohne finanzielle Förderung, man kann die Selbsthilfe nicht als Partner<br />
ins Boot holen ohne sie auch finanziell gleichzustellen.“<br />
(Jugendhilfeplanung)<br />
Erfolgsrezepte<br />
Die Faktoren, die entscheidend zum Erfolg des Planungsprozesses<br />
beigetragen haben, werden von den Beteiligten folgendermaßen<br />
beschrieben:<br />
„Dieser Prozeß wurde getragen von Personen, die nicht bereit waren,<br />
die Anfangsvision wieder zu verlassen, trotzdem es zwischendurch<br />
auch gnadenlos werden konnte. Im Laufe des Prozesses mußten die<br />
Beteiligten aber auch lernen, Kompromisse zu schließen und daß es<br />
bestimmte Punkte gibt, die sind fix. Wichtig war es Raum und Zeit zu<br />
lassen für einen Entwicklungsprozeß der Beteiligten, für ein<br />
Zusammenwachsen der Personen, die das dann umsetzen müssen.“<br />
(Jugendamt)<br />
„Wir hatten einen hervorragenden Architekten, der in der Lage war,<br />
genau hinzuhören und ungewöhnliche und kreative Lösungen<br />
beizubringen. Er hat die Nutzer und ihre Beiträge und Ideen wirklich<br />
ernst genommen. Er hat ganze Tage im Kindergarten und im Zentrum<br />
verbracht, um zu verstehen, wie der Alltag bei uns läuft. Jedes mal<br />
wenn wir dachten, jetzt wird es zu teuer, oder jetzt stoßen wir an<br />
Grenzen und unumstößliche Vorschriften war er zusammen mit den<br />
städtischen Planungspartnern in der Lage eine kreative und flexible<br />
Lösung zu finden, die immer noch ins Konzept paßte, ja oft die<br />
Grundvision sogar noch viel besser transportierte.“ (EKIZ)<br />
„Wir haben uns auf das Mitplanen gut vorbereitet. Als klar war, daß es<br />
einen Neubau geben würde und wir bei der Planung einbezogen sein<br />
sollten, haben wir Studienfahrten unternommen zu innovativen<br />
Projekten in der Region, um Inspirationen und Ideen zu sammeln. Wir<br />
haben dann zusammen mit Elternschaft, Erzieherinnen und<br />
Kindergartenleitung einen Katalog zusammengestellt, was im <strong>neue</strong>n<br />
Haus alles umgesetzt werden sollte.“ (Elternvertreter Kindertagesstätte)<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />
1sten Februar 2002. Seite 16 von 43<br />
„Wir haben gelernt besser einzuschätzen,<br />
daß die Ämter in<br />
Hierarchien und Sachzwänge<br />
eingebunden sind und die Partner,<br />
mit denen man es zu tun<br />
hat, nicht frei entscheiden können,<br />
und ihre eigenen Kämpfe<br />
auszutragen haben, um Innovationen<br />
durchzusetzen. Vorher<br />
haben wir oft gedacht, warum<br />
sind sie bloß so inflexibel?“<br />
(Felizitas Keller, EKIZ)
„Die Atmosphäre bei den<br />
Planungstreffen ist entscheidend.<br />
Wenn alle gleichberechtigt<br />
sind und wenn sich alle wohl<br />
fühlen, wenn man „dumme Fragen“<br />
stellen kann und es keine<br />
Hierarchie am Tisch gibt, kann<br />
Kreativität entstehen. <strong>Das</strong>selbe<br />
Instrument kann völlig stumpf<br />
werden, wenn es nur pro forma<br />
angewandt wird und nicht wirklich<br />
beteiligt.“ (Sven Kohlhoff,<br />
Architekt)<br />
„Wir haben viel mit Demonstrationsmethoden und Demonstrationsmaterial<br />
gearbeitet. Es ist wichtig, daß die Nutzer uns Planer und<br />
Architekten verstehen, nur dann können sie wirklich Partner sein und<br />
ihre Ideen und ihre Kompetenz beitragen. Hier muß man sich<br />
bemühen und sich auch Zeit lassen. Wir haben Sitzungen gemacht, in<br />
denen wir die Nutzer gebeten haben, mental durch das Haus zu<br />
gehen und sich vorzustellen, wie das, was zur Debatte stand,<br />
umgesetzt ausschauen würde. Wir haben vor Ort Planungstreffen<br />
veranstaltet, an Ort und Stelle lassen sich Dinge besser<br />
veranschaulichen und erklären als auf dem Papier. Wir haben<br />
Demonstrationsmodelle gebastelt. Die best funktionierenden Häuser<br />
sind die, an denen die Nutzer sich wirklich beteiligt haben. Dann<br />
haben sie das Gefühl, dies ist unser Haus, wir haben es geplant, wir<br />
haben es gebaut.“ (Hochbauamt)<br />
„In der Prozeßbegleitung haben wir intensiv daran gearbeitet, wie die<br />
einzelnen Gruppen die Arbeit im Haus und die Kooperation<br />
miteinander gestalten könnten. Es galt sich mit sich selbst und mit<br />
den anderen gut bekannt zu machen. Die Beteiligten haben sich in<br />
ihren Stärken und Schwächen einander vorgestellt und sind in einen<br />
Dialog darüber getreten was passieren muß, damit Stärken zum<br />
Tragen kommen und Schwächen im gemeinsamen Prozeß nicht<br />
destruktiv wirken. Man entwickelt gemeinsam persönliche<br />
Gebrauchsanweisungen und Spielregeln des Umgangs miteinander.<br />
Man entwickelt ein anderes Verständnis füreinander, es werden<br />
Sympathien geweckt und man weiß wie man den anderen behandeln<br />
muß, wenn Schwächen oder wunde Punkte berührt werden. <strong>Das</strong> hilft<br />
kritische Situationen durchzustehen.“ (Prozeßbegleitung)<br />
„Wir haben uns kennengelernt,<br />
wie jeder Dinge angeht, was<br />
jedem wichtig ist. Am Anfang<br />
waren wir vorsichtig, was wir<br />
herausgelassen haben, jetzt ist<br />
eine Vertrauensatmosphäre und<br />
ein entspanntes Umgehen miteinander<br />
da. Nach 3 Jahre<br />
langem Coaching sind wir<br />
Freunde geworden. (Stephanie<br />
Braunstein, Kindertagesstätte)<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />
1sten Februar 2002. Seite 17 von 43
„ Die Stadt Stuttgart hat mit vielen verschiedenen Firmen Verträge<br />
abgeschlossen, so daß wir sehr flexible sind und durchaus in der Lage<br />
auf unterschiedliche Wünsche und Bedürfnisse einzugehen. Wir haben<br />
z.B. Spielzeuge finden können, die multifunktional sind, die in<br />
verschiedener Art und Weise benutzt werden können und die<br />
Kreativität und Phantasie von Kinder sehr anregen können. Wir sind<br />
uns immer einig geworden.“ (Jugendamt).<br />
„Wir haben im Laufe der Verhandlungen die Kompetenzen und die<br />
spezifischen Beiträge jedes Partners kennen und respektieren gelernt.<br />
Vor allem hat man gelernt das Ganze als ein System zu verstehen. So<br />
lernten wir alle nach Lösungen zu suchen, wenn es zwischen<br />
einzelnen Parteien Kontroversen gab und dies nicht nur den<br />
Kontrahenten zu überlassen. Mit der Zeit lernten wir in Lösungen zu<br />
denken und uns untereinander kooperativ zu verhalten. Mittlerweile<br />
sind wir wie ein Organismus zusammengewachsen. Wenn für einen<br />
Partner etwas nicht paßt, dann betrifft das uns alle, denn wenn einer<br />
im Haus unzufrieden ist, dann wirkt sich das auf die ganze<br />
Atmosphäre aus. Und gerade die Kinder spüren so etwas sehr schnell<br />
und leiden darunter. Wir müssen immer dafür sorgen, daß dieses<br />
Haus für alle Beteiligte gut funktioniert.“ (Kindertagesstätte)<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />
1sten Februar 2002. Seite 18 von 43<br />
„Es war ein Abenteuer. Wir<br />
haben gemeinsam den Weg erfunden,<br />
während wir ihn gegangen<br />
sind. Die Stadt hätte ohne<br />
so einen Prozeß sicher später für<br />
alle Fehler zahlen müssen. Jetzt<br />
sind wir alle begeistert vom Ergebnis<br />
und bereit, es zu verteidigen.“<br />
(Andrea Laux, EKIZ)
„Als normale Frau an der Basis<br />
hat man nicht den Überblick,<br />
wie die Verwaltung arbeitet,<br />
man weiß nicht wer was entscheidet,<br />
hat keine Insiderinformationen<br />
wie Entscheidungsund<br />
Kommunikationswege in der<br />
Politik laufen. <strong>Das</strong> war für uns<br />
oft sehr verwirrend und hat zu<br />
großen Unsicherheiten beigetragen.<br />
Wir wußten oft nicht woran<br />
wir waren.“ (Daniela Rapp, Ekiz)<br />
„Sprache ist ein Knackpunkt. Es<br />
muß jemand da sein, der die<br />
Sprache ausgleicht. Und der<br />
auch darauf achtet, daß man<br />
dann auch zusammen <strong>neue</strong><br />
Wörter sucht, die für alle<br />
gehen.“ (Christa Van Winsen,<br />
Prozeßbegleitung)<br />
Wenn unterschiedliche Kulturen aufeinander treffen<br />
Die verschiedenen Partner, die beim Planungsprozeß des Generationenhaus<br />
West beteiligt waren, kommen aus unterschiedlichen<br />
Kulturen. <strong>Das</strong> löste viele Mißverständnisse und Irritationen bei allen<br />
Beteiligten aus und es bedurfte eines ausgiebigen Verständigungsund<br />
Annäherungsprozesses bis dies als Chance statt als Störung<br />
empfunden werden konnte und den Planungsprozeß bereicherte. In<br />
der Wirtschaft hat man Erfahrung damit, und weiß, daß bei<br />
Firmenfusionen jede Firma ihre eigene Betriebskultur mitbringt und es<br />
wichtig ist bewußt darauf einzugehen und Wege zu finden, wie aus<br />
unterschiedlichen Kulturen eine gemeinsame Einheit werden kann.<br />
Angestellte der Stadt sind eingebunden in ein hierarchisches<br />
Verwaltungssystem mit vielen Regulationen und Vorschriften, die sich<br />
von außen nicht unmittelbar erschließen. Hier spielen neben<br />
Sachzwängen auch oft politische Vorgaben und Erwägungen eine<br />
Rolle, die für einen Außenstehenden oft nicht transparent sind.<br />
Familienselbsthilfe Gruppen agieren demgegenüber in einem freieren<br />
Rahmen. Ihre Stärke liegt oft in ihren Improvisationstalenten und<br />
ihrer Fähigkeit ad hoc auf Möglichkeiten und Notwendigkeiten zu<br />
reagieren. Sie beziehen ihre Kraft aus einer hohen Eigenmotivation<br />
und Identifikation mit ihren Anliegen, und entwickeln daraus eine<br />
Einsatzbereitschaft, die vor Wochenenden und Feierabenden nicht<br />
halt macht, was eine an vorgegebenen Arbeitsstunden orientierte<br />
professionelle Kultur unter Druck bringen kann.<br />
Aus der Eingebundenheit in so verschiedenen Alltagskulturen entwickeln<br />
sich auch unterschiedliche Mentalitäten, ein unterschiedlicher<br />
Sprachgebrauch und unterschiedliche Arten und Weisen, Dinge anzugehen.<br />
Wenn man immer innerhalb der eigenen Kultur bleibt, fällt<br />
dies oft nicht einmal besonders auf, wenn sich Kulturen jedoch wie in<br />
diesem Fall mischen, prallen diese Unterschiede oft gewaltig aneinander<br />
und müssen wahrgenommen, reflektiert und bewußt<br />
ausbalanciert werden mit ausgehandelten<br />
Kommunikations- Informations- und Sprachregelungen,<br />
mit einer Prozeßbegleitung, mit dem<br />
Transparentmachen der Rahmenbedingungen<br />
und der Entscheidungsstrukturen und mit Verfahrensweisen<br />
und Vereinbarungen, die für alle<br />
Angst- und Streßfreiheit herstellen.<br />
„Am Anfang habe ich das gar nicht gemerkt, daß<br />
bei solchen Verwaltungen so viele Strömungen da<br />
sind, die muß man erst erkennen. Da spielt die<br />
Partei eine Rolle, da arbeiten die verschiedenen<br />
Ämter manchmal nebeneinander her, da sind so<br />
viele Dinge verknüpft, da gibt es Animositäten und<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />
1sten Februar 2002. Seite 19 von 43
Eitelkeiten. Da war es oft nicht einfach, immer wieder die Spur<br />
reinzukriegen. Da mußten wir manchmal auch eingreifen.“<br />
(Testamentsvollstrecker)<br />
„In der Verwaltung gibt es vorgegebene und komplizierte Entscheidungsstrukturen.<br />
Diejenigen mit denen wir es zu tun hatten<br />
konnten oft gar nicht entscheiden. Zum Beispiel als es darum ging<br />
den Vertrag für unsere Räume zu unterzeichnen wurde eine<br />
Hierarchieperson geschickt, die mit dem Ganzen noch gar nichts zu<br />
tun gehabt hatte und keine Ahnung hatte, um was für ein Projekt es<br />
sich bei uns eigentlich handelte. Er hatte die ganzen Diskussionen<br />
nicht mitbekommen und wollte alles standardmäßig abwickeln, was<br />
aber in unserem Fall gar nicht ging. Ich habe daraus gelernt, daß man<br />
immer gleich mit den obersten Chargen verhandeln muß.“ (EKIZ)<br />
„<strong>Das</strong> war einer der großen Herausforderungen der Zusammenarbeit.<br />
Auf der einen Seite die kommunalen Einrichtungen, die ohnehin auch<br />
Probleme haben gegenüber der Spitze und gegenüber dem<br />
Gemeinderat, und ständig um Geld kämpfen müssen und mit viel zu<br />
knappen Ressourcen auskommen müssen. Auf der anderen Seite die<br />
Mütterzentren, die erst recht Verwalterin der Not sind, häufig<br />
weggestellt wurden, und einen fast übermenschlichen Kampf<br />
anstellen müssen, um ein bißchen von dem abzukriegen, was die<br />
Kommune zu verteilen hat. <strong>Das</strong> prallte aufeinander, das mußte gelöst<br />
werden, wie man mit diesem Spagat umgeht.“ (Prozeßbegleitung)<br />
„Du bist in einer anderen Welt und das schüchtert dich auch erst mal<br />
ein. Du wirst ja auch nicht unbedingt als gleichberechtigt behandelt. Also<br />
sind wir das nächste mal zu fünft erschienen, um uns sicher genug zu<br />
fühlen, uns wirklich zu beteiligen. <strong>Das</strong> wurde als sehr ungewöhnlich<br />
empfunden und paßte gar nicht in die Kultur. Aber wir können doch nur<br />
wirklich gleichberechtigte Partner sein, wenn wir uns auch sicher genug<br />
fühlen, um unsere Meinung zu äußern.“ (EKIZ)<br />
„Die EKIZ Frauen dachten anders, was sehr erfrischend war. Sie<br />
gingen die Dinge mehr pragmatisch und lösungsorientiert an, ohne<br />
sich durch Gedanken an irgendwelche Regularien oder komplizierte<br />
Prozedere einengen und einschränken zu lassen. Sie hinterfragten die<br />
Vorschriften und suchten nach Wegen, Dinge anders zu machen. Sie<br />
sind gewohnt, Dinge selbst in die Hand zu nehmen. <strong>Das</strong> hat die<br />
anderen Partner oft irritiert und verunsichert.“ (Prozeßbegleitung)<br />
„Es gab einen Strukturkonflikt, der oft für unterschwellige Spannungen<br />
sorgte, das ist der Unterschied zwischen Selbsthilfe und<br />
bezahltem professionellem Personal. Die einen sind mit Leib und<br />
Seele dabei und bereit über die Grenzen eines 8 Stunden Tages<br />
hinaus Zeit und Energie zu investieren. Die anderen wollten eher<br />
darauf achten, daß das Ganze im Rahmen ihrer bezahlten Arbeitszeit<br />
blieb.“ (Elternvertreter Kindertagesstätte)<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />
1sten Februar 2002. Seite 20 von 43<br />
„<strong>Das</strong> Jugendamt hat eine Hierarchie<br />
und hat auch Macht. <strong>Das</strong><br />
EKIZ sind Leute ohne Rangunterschiede,<br />
da gibt es keine<br />
ein, zwei oder drei Stern Generäle.<br />
Die haben auch kein Geld<br />
zu verteilen.“ (Sven Kohlhoff,<br />
Architekt)<br />
„Wir schauen die Dinge ganzheitlicher<br />
an, nicht so professionalisiert<br />
und spezialisiert. In der<br />
Verwaltung hat jede eine spezielle<br />
Zuständigkeit aus deren<br />
Perspektive alles gesehen wird.<br />
Wir denken immer an alle<br />
Aspekte auf einmal, Gesundheit,<br />
Geld, Zukunft, Vergangenheit,<br />
Fehler, Nachbarn, Kinder, Familie.<br />
<strong>Das</strong> brachten wir alles mit in<br />
den Prozeß ein.“ (Andrea Laux,<br />
EKIZ)
„Die einzigen, die nach dem Bau<br />
des Hauses eine Beschwerde<br />
vorgebracht haben, waren die<br />
Reinemachefrauen. Und die<br />
hatten wir im Planungsprozeß<br />
auch vergessen mit<br />
einzubeziehen.“ (Sven Kohlhoff,<br />
Architekt)<br />
„Die Mütterzentren sind unkomplizierter im Umsetzen, wenn sie z.B.<br />
sagen, man macht eine <strong>neue</strong> Kinderbetreuungsgruppe auf, dann kriegen<br />
sie das relativ schnell, ganz handfest und oft auch kostengünstiger hin.<br />
Die klassischen Trägerstrukturen sind oft komplizierter. Da gibt es einen<br />
Personalschlüssel, es muß eine Hauswirtschaftlerin sein, die kocht. Die<br />
Mütterzentren irritiert das nur, die nehmen die Frau, die kochen kann<br />
oder will. Und wie übersetzt man das dann in Förderstrukturen, wenn<br />
die Stadt sagt, ihr müßt eine Hauswirtschaftlerin nehmen, das sind die<br />
Richtlinien. Da kommen die Welten aufeinander, die Mütter, die einfach<br />
handeln, und die klassischen Verwaltungs- und Förderstrukturen, die<br />
Standards festgeklopft haben, die oft als Hemmnisse wirken. <strong>Das</strong><br />
auszuhandeln ist dann die Kunst.“ (Jugendhilfeplanung)<br />
Was war anders?<br />
Was haben die verschiedenen Partner zum Planungsprozeß beigetragen?<br />
Was war durch den partizipativen Konsultationsprozeß<br />
anders? Alle Beteiligte bestätigen, daß die Einbeziehung der Nutzer<br />
eine größere Kreativität und eine größere Nähe zum Bedarf in die<br />
Planung gebracht hat. Hier wurde nicht vom grünen Tisch aus<br />
geplant, sondern Wert gelegt auf die Kompetenzen aus der Praxis,<br />
auf die Erfahrungen des Alltags, die in Verwaltungshandeln übersetzt<br />
wurden. In diesem Prozeß waren die Beiträge aller Partner wichtig.<br />
Unkonventionelle Ideen und Visionen konnten zu Innovationen<br />
werden, weil sie von Partnern unterstützt wurden, die in der Lage<br />
waren, sie in das Dickicht administrativer Regulativen einzuflechten<br />
und die wußten, wie sie für Politik und Verwaltung aufzubereiten<br />
waren.<br />
Zukünftige Nutzer bringen erhöhte Aufmerksamkeit und ein größeres<br />
Achten auf die Details in einen Bauplanungsprozeß ein, denn sie<br />
werden die gebauten Räume bewohnen. Sie planen für ihren eigenen<br />
Bedarf, für ihre eigene Zukunft und nicht in Vertretung für andere.<br />
Vor allem auf die Frage der Gestaltung des Eingangsbereichs, der<br />
Küche und der Kindergartenräume haben die Nutzer starken Einfluß<br />
genommen.<br />
„<strong>Das</strong> Eltern Kind Zentrum brachte viel Erfahrung für den Aspekt der<br />
Herstellung von Nachbarschaftlichkeit und der Beteiligung der<br />
BewohnerInnen des Viertels ein. Ihnen lag die Offenheit des Hauses<br />
und eine einladende Atmosphäre besonders am Herzen. Für sie war<br />
es wichtig, daß das Haus Wärme ausstrahlt.“ (Architekt)<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />
1sten Februar 2002. Seite 21 von 43
„<strong>Das</strong> Haus sollte attraktiv sein und dazu einladen, einfach<br />
hereinzuspazieren. Es sollte beim Eingang gleich ein menschlicher<br />
Kontakt da sein und keine anonymen Hinweistafel. Daher waren wir<br />
gleich begeistert über die Idee einer Espresso Bar im Foyer, die von<br />
draußen sichtbar ist und einladend und offen wirkt. So daß man das<br />
Gefühl hat, man kann einfach vorbeischauen, ohne zuvor Mitglied zu<br />
werden. Auch die Frage der Küche war uns sehr wichtig. Wir wollten<br />
nicht nur eine professionelle Küche, die möglichst effektiv und rationell<br />
Einrichtungen mit hoher Abnehmerzahl versorgt. Wir wollten im Haus<br />
eine Atmosphäre wie in einem öffentlichen Wohnzimmer, da gehört<br />
auch eine Küche dazu, die familiär arbeitet. Wir waren es auch, die<br />
bemerkt haben, daß die Abgase aus der Garage direkt dahin geleitet<br />
wurden, wo die kleinen Kinder in den Garten hinausgehen.“ (EKIZ)<br />
„Durch die Beteiligung der Selbsthilfe kamen Mechanismen rein, die<br />
sich die Kommunen so gern auf die Fahnen schreiben, Bürgernähe,<br />
Verringerung der Wege, nicht lineares Denken. Die<br />
Mütterzentrumsfrauen können synchron arbeiten, das sind sehr<br />
wertvolle Kompetenzen. Auch brachten sie viel Pioniergeist mit. In der<br />
Verwaltung gibt es ja oft Angst vor dem <strong>Neue</strong>n, weil das wieder mit<br />
viel Arbeit verbunden ist, <strong>neue</strong> Strukturen durchzusetzen. Da waren<br />
die Anstöße von den Frauen sehr wichtig. Es ist wichtig daß es in so<br />
einem Prozeß welche gibt mit Pioniergeist. Auch viel von dem, was<br />
jetzt unter Vereinbarkeit von Beruf und Leben diskutiert wird wie<br />
Sinnhaftigkeit, Gesundheit und Wellness, das kam aus dieser Ecke.<br />
<strong>Das</strong> sind wichtige Ressourcen.“ (Prozeßbegleitung)<br />
„Wir wollten im Kindergartenbereich mehrere kleine Räume statt zwei<br />
offene, um mit den Kindern in jedem Raum unterschiedliche<br />
Aktivitäten unternehmen zu können. Auch war das erst geplante<br />
Möbiliar nicht die richtige Höhe für Kinder“ (Kindertagesstätte)<br />
„Die Kompetenzen der Frauen werden von der Öffentlichkeit und von<br />
der öffentlichen Verwaltung ja durchaus abgefragt. Sie werden ganz<br />
selbstverständlich in Anspruch genommen, aber nicht im selben Maße<br />
gewürdigt. Diese Kompetenzen müssen auf die<br />
gleiche Fahne geschrieben werden, da wo Profis<br />
schon immer ihre Kompetenzen stehen haben. Nach<br />
diesem Prozeß ist es wirklich nicht mehr zu<br />
übersehen, welche wertvollen und kompetenten<br />
Partner die Stadt im Eltern-Kind-Zentrum hat. Sie<br />
haben viel Erfahrung, sind motiviert und stellen<br />
Kontinuität her. Sie bringen eine sehr solide Basis<br />
ein. Dies muß sichtbar gemacht werden. Bei<br />
Gruppen, die nicht genügend wahrgenommen oder<br />
ausgegrenzt worden sind, braucht es auch heilende<br />
Rituale der Wertschätzung.“ (Prozeßbegleitung)<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />
1sten Februar 2002. Seite 22 von 43<br />
„Es ist in diesem Haus eben<br />
nicht so, daß man reinkommt<br />
und an den Gesichtern schon<br />
ablesen kann: „sprich mich ja<br />
nicht an.“ Hier fühlt man sich<br />
wirklich willkommen und wahrgenommen.“(Stadtteilbewohner)
„Man wird nie wirklich generationsübergreifend<br />
arbeiten<br />
können, wenn man das segregierte<br />
Bauen nicht aufgibt und<br />
Räume nicht multifunktional<br />
genutzt werden.“ (Michaela<br />
Bolland, Jugendhilfeplanung)<br />
IV. DAS HAUS -<br />
INNENSICHTEN UND AUßENSICHTEN<br />
In den ersten Monaten zeigte sich das Generationenhaus West bereits<br />
als lebendiges Begegnungszentrum, das vielfältig genutzt wird und<br />
eine besondere Atmosphäre ausstrahlt. <strong>Das</strong> Konzept und seine<br />
Umsetzung durch den partizipativen Planungsprozeß hat sich <strong>fürs</strong><br />
Erste bestätigt, die Umsetzung einer sozialen Vision in Architektur<br />
scheint gelungen. Die Interaktion der verschiedenen Nutzer<br />
miteinander und mit den räumlichen Möglichkeiten wurde von allen<br />
Seiten als sehr positiv beschrieben.<br />
<strong>Das</strong> Haus beherbergt architektonisch<br />
viele innovative Ideen, die zum Teil erst<br />
im Laufe der gemeinsamen Planung sich<br />
herausgeschält haben. Daß der<br />
Kindergarten im 1. Stock untergebracht<br />
wurde, um das Erdgeschoß für die<br />
offenen Bereiche, wie das Café oder die<br />
gemeinsamen Veranstaltungsräume<br />
nutzen zu können war ungewöhnlich.<br />
Daß der Kinderbereich durch eine Rampe<br />
dennoch direkt mit dem Garten und dem<br />
Foyer verbunden ist bezieht ihn voll ins<br />
Gemeinschaftsleben ein.<br />
Daß alle Gruppenräume wie das Café, der Gymnastikraum, der<br />
Werkraum, der Garten, gemeinschaftlich genutzt werden schafft viel<br />
Begegnungsfläche für die verschiedenen Gruppen im Haus. Die<br />
Architektur ist offen gestaltet, keine störenden Säulen behindern den<br />
freien Blick durchs Haus, die Räume sind transparent, selbst vom<br />
Waschraum aus hat man Einblicke in andere Bereiche des Hauses.<br />
Begegnungen im Haus laufen nicht über eine wie auch immer<br />
gestaltete „Pädagogik“, sondern über den Alltag, über das<br />
Hauswirtschaftliche und die gemeinsamen Funktionsräume. Der<br />
warme Mittagstisch, oder Dienstleistungen wie ein Wäscheservice<br />
oder eine mobile Hausmeisterei bringen die Generationen in Kontakt<br />
miteinander, die Bewohner der Altenwohnungen werden bei Festen<br />
und kulturellen Veranstaltungen des Hauses miteinbezogen, sie<br />
können aber auch eigene Fähigkeiten und Talente miteinbringen.<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />
1sten Februar 2002. Seite 23 von 43
Es braucht viel Kommunikation, um die vielen Begegnungs- und<br />
Gestaltungsmöglichkeiten des Hauses auszuschöpfen und positiv zu<br />
gestalten. Begegnung und Kooperation ist sozusagen mit ins Haus<br />
eingebaut. Die übliche Trennung in Programme und Angebote für<br />
spezifische Zielgruppen, für Kinder, für Jugendliche, für Alte ist im<br />
Generationenhaus überwunden. Dieses Haus ist Kinderhaus,<br />
Jugendzentrum, Café, Ladenzeile, Altenservicecenter, Arbeitsplatz<br />
und Mütter- und Nachbarschaftszentrum in einem und gleichzeitig<br />
keines von alledem. Es stellt das Wiederzusammenfügen aller Teile zu<br />
einem Ganzen dar, die Rückkehr des Lebens in die Öffentlichkeit.<br />
„Vor allem das Foyer in der offenen Gestaltung, nicht abgegrenzt und<br />
einladend, wo man gleich auf Menschen trifft und nicht auf einen<br />
Schilderwald ist gelungen. Hierauf hatten wir ja besonders Wert<br />
gelegt. Es spielt sich wirklich ein reges Leben um die Espresso Bar ab.<br />
Am Anfang konnte ich mir das gar nicht vorstellen, was das heißen<br />
sollte: „die Straße ins Haus hineinverlängern“. Aber jetzt wo der Vater<br />
in der früh sein Kind auf dem Fahrrad die Rampe hoch in den<br />
Kindergarten fährt oder nachmittags die Mütter mit den Kinderwagen<br />
die Rampe herunterkommen, wenn das ältere Kind abgeholt wird und<br />
das Jüngere noch schläft. Oder die Kinder noch im Foyer zusammen<br />
spielen, während Mama an der Theke noch einen Schwatz hält. Jetzt<br />
erlebe ich wie genial dieser Eingangsbereich gestaltet ist.“ (EKIZ)<br />
„Es ist leichter an der Espressobar schnell noch einen Kaffee zu bestellen<br />
als ins Café zu gehen. Denn eigentlich will man ja wenn man die Kinder<br />
abgeholt hat, nach hause. Aber ich habe festgestellt, daß man dann oft<br />
doch in ein Gespräch verwickelt wird und ziemlich lange noch bleibt. Die<br />
Kinder haben ja attraktive Spielgeräte im Eingangsbereich, die sie auch<br />
ziemlich lange bei Laune halten. So erfährt man, was alles im haus läuft<br />
und lernt die anderen Leute kennen.“ (Kita Mutter)<br />
„Die einzelnen Räume sind so gebaut, daß sie nach allen Seiten zu<br />
öffnen sind. Die Kinder können hinausgehen in den Flur, in den<br />
Garten, hinauf auf die Galerie oder in die zwei Räume, die<br />
anschließen. In unserem alten Gebäude gab es nur den Hof und den<br />
Flur. Wenn das Wetter schlecht war sind alle in der Pause in den Flur<br />
raus und es gab einen Höllenlärm. Jetzt, wenn ich durch das Haus<br />
gehe, ist es ruhig, einige Kinder spielen im Flur, andere in den<br />
Zimmern oder auf der Galerie oder im Garten. Es gibt nicht diesen<br />
massiven Ansturm von 120 Kindern auf eine Schlag auf eine Fläche.<br />
<strong>Das</strong> hat viel Ruhe in die Arbeit gebracht.“ (Kindertagesstätte)<br />
„<strong>Das</strong> Haus ist ja sehr offen gebaut. Man kann von der Straße durch<br />
das Café bis durch in den Garten schauen. <strong>Das</strong> macht natürlich<br />
neugierig. So bin ich eines Tages auch einfach hineingegangen, habe<br />
eine Tasse Kaffee getrunken und mir erzählen lassen, was es hier<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />
1sten Februar 2002. Seite 24 von 43<br />
„So ein Haus mit so viel Offenheit<br />
kann nur funktionieren,<br />
wenn alle sich verantwortlich<br />
fühlen für alle. Wenn alle, die<br />
sich im Haus bewegen, ein Auge<br />
auf die Kinder haben und mit<br />
aufpassen. Eigentlich sollte das<br />
ja in der Nachbarschaft eine<br />
Selbstverständlichkeit sein, aber<br />
das ist verloren gegangen. <strong>Das</strong><br />
ist die Haltung, die durch dieses<br />
Haus wieder eingeübt wird.“<br />
(Andrea Laux, EKIZ)<br />
„<strong>Das</strong> Haus wirkt sehr offen.<br />
Selbst die Wände lassen noch<br />
viel Raum zur Selbstdarstellung<br />
und zur Gestaltung. <strong>Das</strong><br />
inspiriert, sich was einfallen zu<br />
lassen, eigene Ideen mit<br />
einzubringen.“ (Café Besucher)
„Wir können so viel voneinander<br />
lernen, die Art wie das EKIZ<br />
Kinderbetreuung macht ist anders.<br />
Ich finde das sehr inspirierend.<br />
Es werden viele Gedanken<br />
und Tips ausgetauscht zwischen<br />
unseren Erzieherinnen und den<br />
Betreuerinnen im offenen<br />
Kinderprogram. Vielleicht ergibt<br />
sich aus dem wie die Dinge sich<br />
in diesem Haus entwickeln eine<br />
ganz <strong>neue</strong> Pädagogik.“ (Sigrid<br />
Eppstein, Kindertagesstätte)<br />
alles gibt. Besonders beeindruckt hat mich, daß wir von der<br />
Nachbarschaft diese Räume auch nutzen können. <strong>Das</strong> konnte ich am<br />
Anfang gar nicht glauben, der Garten, die Werkräume, die<br />
Dachterasse, das ist wirklich alles auch für uns? (Stadtteilbewohnerin)<br />
„Die Kinder haben sich sehr schnell mit den <strong>neue</strong>n Möglichkeiten<br />
zurechtgefunden. In den ersten Tagen waren sie noch schüchtern und<br />
haben sich nicht viel im Haus bewegt, aber das war rasch vorbei und es<br />
war erstaunlich, wie schnell sie alles ausprobiert haben und sich im Haus<br />
auskannten. Sie haben sich ganz selbstverständlich ihren Raum genommen<br />
und bewegen sich sehr souverän im Haus. Sie sagen sehr deutlich,<br />
welchen Raum sie jetzt nutzen und wo sie als nächstes spielen wollen.<br />
Sie mischen sich auch problemlos mit den anderen Kindern im Haus. Es<br />
sind eher die Eltern, die noch Eingewöhnungsprobleme haben. Vor allem<br />
gibt es bei so großer Offenheit Ängste um die Sicherheit der Kinder. Da<br />
müssen wir auch noch dran arbeiten.“ (Kindertagesstätte)<br />
„<strong>Das</strong> Café ist das Herz, das Zentrum des Hauses. Hier kommt alles<br />
zusammen. Daher ist es besonders wichtig, daß die Mütter, die die<br />
Espresso Bar und das Café betreiben ihre Gastgeberrolle verstehen, daß<br />
wir immer noch ein Mütterzentrum sind und nicht ein normales Café.<br />
Daß es drum geht, Menschen willkommen zu heißen, auf sie zuzugehen<br />
und herauszuhören, was sie im Haus suchen oder erwarten. Es gilt sie<br />
aktiv anzusprechen und einzubeziehen, herauszufinden, was sie gut<br />
können und wie sie zum Leben im Haus beitragen könnten. Wir haben<br />
mit den Caféfrauen regelmäßige Teamtreffen, wo wir dies besprechen,<br />
wo wir uns darüber austauschen, wie wir das Leben im Haus<br />
wahrnehmen, und was vor allem in diesem Kernbereich verbessert<br />
werden könnte.“ (EKIZ)<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />
1sten Februar 2002. Seite 25 von 43
„Ich habe mir angewöhnt, meine Bürotür immer offen zu lassen. Es ist<br />
so ein lebendiges Treiben, es riecht nach Kaffee, es ist schön das Gefühl<br />
zu haben ein Teil davon zu sein. Obwohl das Haus so groß ist, begegnet<br />
man überall Menschen.“ (Freie Altenarbeit)<br />
„Die ersten Tage waren sehr ungewohnt, daß man sozusagen auf dem<br />
eigenen Terrain andere traf, die man nicht kannte, für die es aber auch<br />
ihr Haus war. Man traf sich im Foyer, in den Toiletten, im Garten. Man<br />
teilte sich die Räume und die Spielgeräte mit anderen. Wir haben in der<br />
ersten Zeit viele Teambesprechungen gehabt, um darüber zu sprechen,<br />
wie man damit umgeht.“ (Kindertagesstätte)<br />
„Am Anfang war jede Gruppe doch sehr bedacht, sich im<br />
Haus eigene Flächen zu schaffen. Es gab Diskussionen den<br />
Garten in verschiedene Nutzungsbereiche für die<br />
verschiedenen Gruppen abzuzäunen, jeder wollte seinen<br />
eigenen Gruppenraum, man wollte sich von den anderen<br />
abgrenzen können. Jetzt sind wir so zusammengewachsen,<br />
daß solche Gedanken eher fremd erscheinen. Es ist eine<br />
freundschaftliche Atmosphäre im Haus entstanden und ein<br />
Wir-Gefühl und jeder fühlt sich heimisch im ganzen Haus.<br />
Und es ist einfach wunderbar, daß der Garten so eine schöne<br />
Freifläche zum Spielen bietet. Im ganzen Stadtteil gibt es so<br />
etwas nicht. Für die Kinder ist das Haus großartig, denn es<br />
erweitert ihre Möglichkeiten enorm, soziale Kontakte und<br />
Erfahrungen zu machen.“ (Kita Elternvertreter)<br />
„Die Grundvision von einem gemeinschaftlichen Leben im<br />
Haus hat den ursprünglichen Entwurf geleitet, daß es aber bis<br />
ins Detail so gelungen ist und wirklich lebt, das liegt am<br />
gemeinschaftlichen Planungsprozeß. Die Beratung mit den<br />
Nutzern hat vieles erst stimmig gemacht. Allein das<br />
Erdgeschoß haben wir so etwa 20 mal komplett umgestaltet.<br />
Ich habe in diesem Prozeß unglaublich viel dazu gelernt. Für<br />
meine Professionalität möchte ich so einen Prozeß nicht<br />
missen. Vor allem aber haben die Benutzer durch die Planung<br />
sich das Haus schon zu eigen gemacht. <strong>Das</strong> kann man im<br />
Nachhinein nie so gut hinkriegen, daß ein Gebäude<br />
angenommen wird und die Nutzer sich damit identifizieren.<br />
Daß es hier gelungen ist und die verschiedenen Beteiligten<br />
als eine Gemeinschaft das Haus bezogen haben, liegt an dem<br />
intensiven Planungsprozeß, der voraus gegangen war.“<br />
(Architekt)<br />
„In diesem Haus kann man nicht für sich leben. Wenn wir mit unseren<br />
Kindern in den Gymnastikraum gehen, kommen wir durch das Foyer<br />
durch und kommen an allen anderen vorbei. Es gibt viel Glas im Haus.<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />
1sten Februar 2002. Seite 26 von 43
Stichworte aus der Prozeßbegleitung: Man kann in die Räume hineinsehen, ohne<br />
Mit dem Haus und den darin ein und aus<br />
gehenden Menschen verbundene Werte<br />
Arteitsgruppe “Angebote und Atmosphäre”<br />
! ! ! ❁ ❁ ❁<br />
- Menschlichkeit<br />
- Offenheit für alle Lebenslagen<br />
- Netzwerk mit dem Ziel: Sicher und Lebenswerter Stadtteil<br />
- Partnerschaftliches Miteinander – <strong>Partnerschaften</strong><br />
- Ein Ort der Nachhaltigkeit – Ressourcenorientierung<br />
- Anlaufstelle, wichtiger Knotenpunkt im Stadtteil<br />
- Selbstorganisation<br />
- Professionalität und Prävention<br />
- Emotionalen Rahmen schaffen: heilend, Sorgen<br />
+ Nöte erkennend<br />
- Kraftspendende Bedingungen für alle<br />
„Dieses Haus unterscheidet sich<br />
von anderen. Hier passiert alles<br />
mit Herz. <strong>Das</strong> macht es so<br />
besonders.“ (Edgar Kurz,<br />
Gebrüder Schmid Stiftung)<br />
hineingehen zu müssen. Ich kann jetzt<br />
viel besser abschätzen, wann es günstig<br />
ist, in einen Gruppenraum zu gehen, ohne<br />
einen Prozeß zu stören. Die Transparenz<br />
funktioniert auch für die Eltern. Die Räume<br />
erschließen sich von selbst, sie können<br />
sehen, was wo läuft. Sie sind viel näher<br />
dran am Geschehen und es gibt viel mehr<br />
Kontakt- und Begeg-nungsfläche. Die<br />
Offenheit des Gebäudes wirkt sich auch auf<br />
die Haltung im Haus aus, man ist offener<br />
für Kontakt und Gespräche, man geht<br />
offener aufeinander zu. Schon nach einigen<br />
Monaten kann ich feststellen, daß es mehr<br />
Kontakt und Kommunikation mit den Eltern<br />
gibt.“ (Kindertagesstätte)<br />
„Es ist immer gut alte Menschen mit Kindern zusammenzubringen,<br />
das wirkt erfrischend auf alte Menschen und bringt ihnen oft viel<br />
Lebensfreude. In einem Haus wie dieses fühlen sie sich nicht<br />
abgeschoben in ein Altenghetto. Wenn man mit alten Menschen in ein<br />
öffentliches Café geht, dann ist das oft sehr anstrengend. Sie sind<br />
nicht so schnell oder etwas verwirrt und bemerken dann die<br />
ungeduldigen Blicke der Bedienung oder der anderen Gäste. In einem<br />
Haus wie diesem ist die Atmosphäre anders, gibt es mehr Toleranz<br />
und Verständnis für Menschen, die ein wenig mehr Zeit brauchen. Wir<br />
sehen unsere Rolle darin hier dabei zu helfen, einen sicheren Umgang<br />
miteinander zu lernen. Wenn ein alter Mensch mal verwirrt durch die<br />
Räume läuft, daß dann Kinder und Erwachsene wissen, wie mit<br />
solchen Situationen umzugehen ist. Berührungsängste und -<br />
unsicherheiten können abgebaut werden, indem man die Bedürfnisse<br />
kennen und verstehen und die Situationen einzuschätzen lernt.<br />
Gut ist hier auch, daß die alten Menschen selber wählen können, wie<br />
nah ran sie gehen wollen. Sie können den Kindern im Garten aus<br />
sicherem Abstand im Café zuschauen, oder sie können hinaus in den<br />
Garten gehen und den Kindern direkt begegnen. Es ist nämlich durchaus<br />
nicht immer so, daß alte Menschen den direkten Kontakt mit Kindern<br />
möchten. Viele genießen es auch mehr von der Seitenlinie her und aus<br />
sicherem Abstand teilzunehmen. Die Möglichkeiten sich entweder mitten<br />
hinein zu begeben oder mit etwas Distanz dabei zu sein sind hier<br />
gegeben. Hier ist auch nichts inszeniert. Die Kinder kommen nicht zu<br />
Besuch, singen ein Lied und alle sollen gerührt sein, sondern die alten<br />
Menschen sind Teil des Alltags und der täglichen Situationen. Viele<br />
haben ja auch sehr interessante Leben gelebt, haben spannende Reisen<br />
unternommen und haben viel zu bieten.“ (Freie Altenarbeit)<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />
1sten Februar 2002. Seite 27 von 43
„Ich habe viel von den anderen gelernt, vom Architekten wie man<br />
Ideen kreativ und innovativ umsetzt, von EKIZ wie man eine offene,<br />
familiäre und herzliche Atmosphäre herstellt, von der Verwaltung was<br />
geht und was nicht geht, von der Freien Altenarbeit, wie man mit<br />
alten Menschen umgeht. Ich habe jetzt Ideen, wie wir Begegnungen<br />
mit den Alten in unser Kindergartenprogram einbauen können. Aber<br />
wir müssen warten, bis sie da sind. Bis jetzt sind noch keine<br />
eingezogen.“ (Kindertagesstätte)<br />
Die Nachbarschaft<br />
In der kurzen Zeit, in der es besteht, ist das Generationenhaus West<br />
gut von der Nachbarschaft angenommen worden. Der Ansturm am<br />
Tag der offenen Tür war überwältigend, und auch im Alltag wird es<br />
von StadteilbewohnerInnen gerne genutzt, sowohl um die vielen<br />
Angebote in Anspruch zu nehmen, als auch um selber Ideen und<br />
Unterstützung einzubringen. Auch ohne viel Öffentlichkeitsarbeit hat<br />
es sich im Viertel schon herumgesprochen, daß es für alle offen ist<br />
und daß man sich dort willkommen und wohl fühlen kann.<br />
Die Veranstaltungsräume werden von Eltern und Nachbarn für private<br />
Feste am Wochenende gebucht sowie von Vereinen für Seminare und<br />
Treffen genutzt.<br />
Ganz von alleine entwickelt es sich zu einer Art Tauschbörse, so z.B.<br />
wenn eine Nachbarin, die direkt angrenzend wohnt hereinkommt und<br />
den Vorschlag macht, daß jemand von Haus ihr die Blumen gießt,<br />
wenn sie - was oft der Fall ist - verreist, daß sie im Gegenzug ein<br />
Ferienkind mal mit auf Reisen nimmt.<br />
„Gerade viele ältere Menschen aus der<br />
Nachbarschaft sind gekommen und<br />
fragen, was dieses Haus ist und wie es<br />
funktioniert. Sie sind überrascht, daß sie<br />
den Garten nutzen dürfen, daß es keine<br />
Mitgliedsbeiträge gibt, daß das Haus<br />
allen offen steht. Auch Frauen aus der<br />
Nachbarschaft kommen, um im Garten<br />
oder im Café zu sitzen während ihre<br />
Kinder spielen. Diese Offenheit scheint<br />
viele auch zu inspirieren selber etwas<br />
beizutragen. Sie kommen vorbei und<br />
spenden uns Äpfel aus dem Garten oder<br />
fragen, ob sie sonstwie aushelfen<br />
können. Neulich kam eine Frau herein<br />
und meinte, sie würde sich das schon<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />
1sten Februar 2002. Seite 28 von 43<br />
„Man kann nicht nur ins Haus<br />
hineinschauen, man kann auch<br />
von innen hinaus auf den<br />
Stadtteil schauen. <strong>Das</strong> gibt ein<br />
viel größeres Gefühl zur<br />
Nachbarschaft dazuzugehören.“<br />
(Sigrid Eppstein,<br />
Kindertagesstätte)
eine Weile anschauen. Die Pflanzen hier im Haus bekämen nicht<br />
genügend Aufmerksamkeit. Darum würde sie sich jetzt kümmern. Jetzt<br />
ist sie für unsere ganze Blumendekoration zuständig. Viele sagen<br />
einfach: Schön habt ihr es hier und wie wunderbar, daß ich hier<br />
mitmachen kann.“ (EKIZ)<br />
„Es war der richtige Rahmen für uns, unser Jahrestreffen in diesem<br />
Haus abzuhalten. Hier wurde ja auch so etwas wie Frieden gestiftet,<br />
zwischen den unterschiedlichen Nutzern und zwischen den Bürgern<br />
und der Stadt. Da fühlen wir uns mit unseren Anliegen doch gleich<br />
richtig aufgehoben.“ (Irische Friedensfrauen)<br />
„Auch die Kinder aus dem Stadtteil haben die<br />
Möglichkeiten des Hauses bereits entdeckt. Es<br />
gibt eine ganze Clique von Schulkindern, die<br />
sich hier nach der Schule treffen, hier Mittag<br />
essen und die vielen Möglichkeiten des Hauses<br />
nutzen. Meine Söhne kommen hier auch her<br />
und haben wieder Freunde aus dem Stadtteil<br />
wiedergetroffen, die sie aus den Augen<br />
verloren hatten, als sie die Schule gewechselt<br />
hatten. Im alten Zentrum hatten wir nicht viele<br />
Schulkinder, denn die Räumlichkeiten waren<br />
zu klein. Hier spielen sie im Garten oder<br />
spielen Billard oder toben sich im<br />
Gymnastikraum aus. Es macht ihnen sogar<br />
Spaß, eine Weile mit den kleineren Kindern zu<br />
spielen, und diese sind natürlich begeistert von<br />
der Aufmerksamkeit der „Großen“.<br />
Den Mädchen gefällt es, daß sie hier so<br />
unterschiedliche Menschen kennenlernen können. Wenn ausländischer<br />
Besuch da ist, sind sie z.B. ganz wild darauf, ihre Englischkenntnisse<br />
auszuprobieren.“ (EKIZ)<br />
„Es gibt ja schon lange die Bürgerhäuser und Nachbarschaftszentren<br />
als Projekte der Gemeinwesenarbeit mit Stadtteilbezug. Aber die sind<br />
ganz anders als dieses Haus. Dort treffen sich verschiedene Clubs und<br />
Vereine, aber es gibt keine Kinder, niemand wohnt in diesen Häusern<br />
und es gibt nicht den offenen Bereich und die offenen Angebote wie<br />
hier. Sie werden nicht in denselben Maße<br />
<strong>Das</strong> Haus strahlt eine ganz<br />
andere Kultur aus. Daß den<br />
Räumen Namen gegeben<br />
wurden wie „Mond und Sterne“<br />
oder „Blitz und Donner“, oder<br />
daß es einen Friedensraum gibt,<br />
wo gibt es so etwas in einem<br />
öffentlichen Gebäude?“ (Sven<br />
Kohlhoff, Architekt)<br />
von der Nachbar- schaft im Alltag genutzt<br />
wie das Genera-tionenhaus West.“<br />
(Jugendhilfeplanung)<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />
1sten Februar 2002. Seite 29 von 43
V. INNOVATIONEN<br />
Der Europarat formuliert als Kriterien innovativer Politik<br />
in den Städten: Die Investition in Humanressourcen,<br />
sektorenübergreifende Ansätze, nachbarschaftsorientierte<br />
Bottom-Up Strategien, die Einbeziehung<br />
sozial marginalisierter Gruppen, sowie <strong>Partnerschaften</strong><br />
zwischen der öffentlichen Administration, der<br />
ortsansässigen Wirtschaft und Selbsthilfe- und<br />
Bürgerorganisationen. <strong>Das</strong> Generationenhaus West<br />
erfüllt alle diese Kriterien.<br />
An diesem Projekt läßt sich demonstrieren welche<br />
Innovationen geschehen müssen, um solchen Zielen und<br />
solcher Programmatik gerecht werden zu können:<br />
1) <strong>Neue</strong> Mitspieler erfordern <strong>neue</strong> Spielregeln<br />
Bürgerbeteiligung und bürgerschaftliches Engagement hat Auswirkungen<br />
auf die kommunale Machtverteilung und das Selbstverständnis<br />
von Verwaltung. Neben der freien Marktwirtschaft und der öffentlich<br />
staatlichen Wohlfahrt kommt ein dritter Akteur hinzu, die zivile<br />
Gesellschaft, die einzubeziehen <strong>neue</strong> Verfahrensweisen erfordert.<br />
Neben den gewählten KommunalpolitikerInnen und der von ihnen<br />
eingesetzten Administration entsteht ein Element direkter Demokratie<br />
und direkter Beteiligung von Bürgern, die weder gewählt noch Angestellte<br />
der Stadt sind.<br />
Bürgerorganisationen und Selbsthilfeinitiativen antworten in der Regel<br />
auf Lücken sozialstaatlicher Politik und übernehmen damit häufig<br />
auch Aufgaben, die zum Aufgabenfeld öffentlicher Wohlfahrtspolitik<br />
gehören. Ihre größere Nähe zum Bedarf und ihre unbürokratische<br />
Strukturen lassen sie in manchen Bereichen als geeignetere Träger<br />
kommunaler Dienstleistungen erscheinen. Dies gilt vor allem überall<br />
dort, wo familienähnliche Strukturen eine höhere Qualität versprechen<br />
als institutionelle Strukturen, was z.B. bei der Frage der Altenpflege<br />
eher der Fall zu sein scheint. Anders als kommerzielle Dienstleistungsangebote<br />
brauchen Selbsthilfegruppen jedoch öffentliche<br />
Unterstützung, um solche Aufgaben kontinuierlich und verläßlich erbringen<br />
zu können. Diese Unterstützung darf nicht an Bedingungen<br />
und Regulationen gebunden werden, die den Selbsthilfecharakter und<br />
damit die eigentliche Qualität ihrer Arbeit wieder zunichte machen<br />
droht.<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />
1sten Februar 2002. Seite 30 von 43<br />
„Hier hatte die kleine Stimme<br />
dasselbe Gewicht wie die große<br />
Stimme“ (Sven Kohlhoff,<br />
Architekt)
„Es war ungewohnt für die<br />
Stadt, das Eltern-Kind-Zentrum<br />
als Selbsthilfeeinrichtung in derselben<br />
Weise zu fördern wie die<br />
Einrichtungen, die unter ihrer<br />
eigenen Trägerschaft stehen.<br />
Anders wäre aber dieses Haus<br />
nicht zu realisieren gewesen. Ein<br />
Auto kann nicht fahren ohne<br />
Benzin, ein Projekt kann nicht<br />
leben wenn neben den Investivkosten<br />
nicht auch für die laufenden<br />
Kosten gesorgt ist.“<br />
(Edgar Kurz, Gebrüder Schmid<br />
Stiftung)<br />
„Dann haben wir beschlossen,<br />
beim Jour Fixe unsere Sprache<br />
nicht zu verändern. Wir haben<br />
einfach unsere Fragen gestellt,<br />
so wie wir sie auch am Küchentisch<br />
stellen würden. Für uns<br />
war es wichtig, daß man bei den<br />
Treffen normal reden kann.“<br />
(Andrea Laux, EKIZ)<br />
Ein Beispiel betrifft die Frage der Honorierung von Leistungen, die<br />
nicht auf professioneller Basis und nicht von Professionellen erbracht<br />
werden. Traditionell gilt, daß öffentliche Leistungen nur bezahlt werden,<br />
wenn sie auf professionelle Kompetenz beruhen. Im Falle von<br />
Leistungen, die von Selbsthilfegruppen ausgehen, beruht die Qualität<br />
ihrer Dienste auf Alltagserfahrungen, emotionaler Involviertheit und<br />
persönlicher Motivation und auf Qualifikationen und Kompetenzen,<br />
die nicht im Ausbildungssystem, sondern im Alltag und in der Praxis<br />
erworben werden.<br />
Eine Stärkung und gleichwertige Beteiligung der Zivilgesellschaft erfordert<br />
vom System finanzielle Mittel an Akteure zu verteilen, die<br />
außerhalb des Systems agieren und sich nicht in die herkömmlichen<br />
Regulativen, Hierarchien und das Kontrollsystem der öffentlichen<br />
Administration ohne Qualitätsverluste einbinden lassen. Ein solches<br />
Wagnis muß eingegangen werden, sollen Innovationen wie das<br />
Generationenhaus West entstehen.<br />
2) Frauen verändern Politik<br />
Dies gilt verstärkt, wenn es darum geht, politisch und sozial bislang<br />
ausgeschlossene Gruppen in kommunale Entscheidungsprozesse einzubeziehen,<br />
denn für viele dieser Gruppen, stellen die institutionellen,<br />
partei- und formal demokratischen Beteiligungsverfahren zu große<br />
Zugangshürden dar. In der frauenpolitischen Diskussion kommt vor<br />
allem international zunehmend in den Blick, daß direktere kommunalpolitische<br />
Beteiligungsformen es ermöglichen, stärker vom Alltagswissen<br />
von Frauen zu profitieren.<br />
Eine größere Beteiligung von Frauen in der Politik erfordert eine Veränderung<br />
politischer Verfahrensweisen und der politischen Infrastruktur.<br />
Eine der Hauptbarrieren für die Teilnahme von Frauen an öffentlichen<br />
Entscheidungsprozessen liegt in der Tatsache, daß es in unserer Kultur<br />
eine riesige Kluft zwischen öffentlich und privat gibt und Politik<br />
sich weitgehend vom Alltagsleben abkoppelt, dem Frauen sich jedoch<br />
stärker verpflichtet fühlen. Eklatantes Beispiel ist der Mangel an<br />
Kinderbetreuung als selbstverständlicher Teil der angebotenen Infrastruktur<br />
bei politischen Beteiligungsprozessen.<br />
Wenn Frauen ihre Familien und ihren sozialen Nahraum nicht<br />
hintenan stellen müssen, um Politik zu machen, und wenn die politische<br />
Kultur ihren Alltagsprioritäten und ihrer ganzheitlichen Angehensweise<br />
Raum gibt, sind Frauen auch in größeren Zahlen in politischen<br />
Entscheidungsbildungsprozessen zu finden.<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />
1sten Februar 2002. Seite 31 von 43
<strong>Das</strong> Beispiel der Mütterzentren, die sich in Deutschland und darüber<br />
hinaus in atemberaubender Geschwindigkeit verbreitet haben, und in<br />
vielen Gemeinden zu einer kommunalpolitischen Größe geworden<br />
sind, die nicht mehr wegzudenken ist, zeigt das frauenpolitische<br />
Potential, das aktivierbar ist, wenn man die Bedingungen von Politik<br />
an die Lebensentwürfe von Frauen anpaßt. 3<br />
<strong>Das</strong> Generationenhaus West ist ein Beispiel dafür, wie die Qualität<br />
urbaner Infrastruktur verbessert werden kann, wenn man<br />
Frauenbasisgruppen wie die Mütterzentren als gleichberechtigte<br />
Partner in kommunale Planungs- und Entscheidungsstrukturen<br />
einbezieht. Die hohe öffentliche Sichtbarkeit des Generationenhaus<br />
West ist eine Plattform, die die Leistungen von Frauen für das<br />
Funktionieren von Nachbarschaften auch sichtbar und öffentlich<br />
werden läßt.<br />
3) Öffentliche Räume zum Verweilen<br />
Um eine größere Aktivierung von Bürgern und Bewohnern zu erreichen<br />
muß großzügiger und sozial bewußter mit dem öffentlichen<br />
Raum umgegangen werden. In der Regel werden bei Kosteneinsparungen<br />
als erstes die Gemeinschaftsräume eingespart.<br />
3 Siehe hierzu die Broschüre: Habitat an die Basis, Schriftenreihe des Mütterforums<br />
Baden-Wuerttemberg, 1999<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />
1sten Februar 2002. Seite 32 von 43<br />
„Innovativ bauen, das geht nur<br />
wenn man einen Freiraum hat.<br />
Eine soziale Vision mit Leben<br />
erfüllen, das geht nur wenn man<br />
nicht sagt, pro Kopf stehen nur<br />
so und so viele Quadratmeter<br />
zur Verfügung, die Zimmer dürfen<br />
nur so und so groß sein,<br />
Fenster dürfen nur so und so<br />
viele sein. Hier hatten wir einen<br />
wirklich guten Architekten, der<br />
das verstanden hat. Der nicht<br />
nur ein Gebäude erstellt hat,<br />
sondern eine Vision verfolgt<br />
hat.“ (Edgar Kurz, Gebrüder<br />
Schmid Stiftung)
„Was ich in diesem Prozeß gelernt<br />
habe, ist daß man nicht an<br />
einer Ecke etwas <strong>Neue</strong>s haben<br />
kann, ohne daß es sich auch auf<br />
andere Felder auswirkt. Ein offenes<br />
Haus funktioniert nicht<br />
ohne Selbstverwaltung, und<br />
Selbstverwaltung erfordert andere<br />
öffentliche Verwaltungsstrukturen<br />
und andere Förderrichtlinien.<br />
Man kann nicht sagen,<br />
man will soziale Innovation,<br />
aber ansonsten soll sich<br />
nichts verändern.“ (Sigrid<br />
Eppstein, Kindertagesstätte)<br />
„Eine Netzwerkstruktur erfordert<br />
gegenüber der hierarchischen<br />
Organisationsstruktur mehr<br />
Selbstverantwortung und partnerschaftliche<br />
Kooperation und<br />
weniger hierarchische Kontrolle.<br />
Dort wo es gelungen ist, das<br />
sind die stabilsten und erfolgreichsten<br />
Unternehmen. <strong>Das</strong> ist<br />
häufig noch Zukunftsmusik, aber<br />
hier ist es schon Gegenwart.“<br />
(Christa van Winsen, Prozeßbegleitung)<br />
Bürgerschaftliches Engagement läßt sich ohne offene öffentliche<br />
Treffpunkte im Stadtteil und ohne Gemeinschaftsräume in Wohnanlagen<br />
und Einrichtungen nicht erreichen. Ein wichtiger Faktor, der den<br />
gemeinschaftsstifenden Erfolg des Generationenhaus West ausmacht,<br />
ist der großzügige Umgang mit Raum, sowohl in den Außen- wie in<br />
den Innenflächen. Wenn Menschen jenseits von Kommerz oder<br />
Privatsphäre nicht zusammenkommen und sich begegnen können,<br />
wenn Räume sich nicht eignen zu Kommunikation und zum Verweilen<br />
läßt sich das soziale Tuch nicht weben, das die Grundlage lebendiger<br />
und gesunder Nachbarschaften ausmacht.<br />
4) Soziale Freiräume<br />
Auch mit sozialen Räumen muß großzügiger umgegangen werden,<br />
wenn Innovationen entstehen sollen. Bei den Planungen zu diesem<br />
Projekt war ein wichtiger Faktor, daß ein Freiraum zugestanden<br />
wurde, in dem die Beteiligten ihre Kommunikationsstrukturen und ihre<br />
Ideen in Ruhe entwickeln konnten, ohne jeden einzelnen Schritt<br />
rückmelden und legitimieren zu müssen.<br />
Dies trifft auch auf das Führen des fertigen Hauses zu. Mit hierarchischen<br />
Strukturen und engmaschigen Kontrollsystemen ist die soziale<br />
Qualität der Kommunikationsstrukturen, auf die es bei generationenübergreifenden<br />
sozialen Systemen primär ankommt, nicht herzustellen.<br />
Hier braucht es auch innovatives Management.<br />
<strong>Das</strong> Generationenhaus West wird von allen am Haus beteiligten<br />
Gruppen gemeinsam selbst verwaltet. Es gibt keinen Leiter oder Leiterin<br />
im Haus, sondern ein Leitungsteam. Dies stellt einen ähnlich<br />
intensiven Kommunikations- und Auseinandersetzungsprozeß auf<br />
Dauer, wie es den Planungsprozeß geprägt hat. Und es ermöglicht<br />
sektorübergreifende Kooperationen und <strong>Partnerschaften</strong>, wie sie zwar<br />
oft in der Programatik als wünschenswert genannt, aber selten real<br />
umgesetzt werden. In der Regel „gehören“ Projekte einer Institution<br />
oder einem Träger, z.B. einem Wohlfahrtsverband, der Kirche oder<br />
der Stadt. Dieses Haus gehört mehreren unterschiedlichen Gruppen<br />
einschließlich der Nachbarschaft. Durch die Selbstverwaltung sind<br />
ständige Abstimmungs- und Aushandlungsprozesse strukturell eingebaut,<br />
die es braucht, damit alle gleichermaßen sich mit den Zielen des<br />
Hauses identifizieren und partnerschaftlich zu seinem Erfolg beitragen.<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />
1sten Februar 2002. Seite 33 von 43
5) Sektorenübergreifende <strong>Partnerschaften</strong><br />
Große Institutionen und Verwaltungen mit großen Bürokratien tun<br />
sich bekanntlich etwas schwerer mit Veränderungen. Es zeigt sich oft<br />
als dem Prozeß sozialer Innovation dienlich, wenn Akteure von außen<br />
beteiligt werden, ein Grund warum in modernen sozialpolitischen<br />
Konzeptionen so viel Wert auf sektorenübergreifende Kooperationen<br />
gelegt wird.<br />
Der dritte Sektor wird eine zunehmend wichtige Rolle bei der Finanzierung<br />
sozialer Innovationen spielen, denn wir haben es jetzt mit<br />
einer Generationen von Erben zu tun, die über große Finanzvolumen<br />
verfügen. Private Stiftungen werden ein größeres Gewicht bekommen,<br />
die öffentliche Hand an Entscheidungs- und Definitionsmacht<br />
verlieren.<br />
<strong>Das</strong> Generationenhaus West hat inhaltlich sehr davon profitiert, daß<br />
es auf einer Partnerschaft aufbaute, in der mehrere Akteure beteiligt<br />
waren und das Sagen hatten.<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />
1sten Februar 2002. Seite 34 von 43<br />
„Man muß außenstehende<br />
Gruppierungen einbeziehen.<br />
Stiftungen und die Selbsthilfe<br />
zusammenzubringen - das wirkt<br />
dann wie Zauberei.“ (Gabriele<br />
Müller-Trimbusch, Bürgermeisterin)
„Es ist wichtig, daß sich alle bewußt<br />
sind, daß dieses Haus ein<br />
Geschenk ist, daß uns allen gegeben<br />
wurde und womit alle<br />
verantwortungsbewußt umgehen<br />
sollten.“ (Christine Heizmann-Kerres,<br />
Hochbauamt)<br />
VI. EMPFEHLUNGEN<br />
Perspektiven im Haus<br />
Mit der Eröffnung des Generationenhaus West ist der Prozess nicht zu<br />
Ende, sondern fängt erst an. Die Instrumente, die für den Erfolg der<br />
Planungsphase wichtig waren, bleiben weiterhin für die Praxis im<br />
Haus wichtig. In der tagtäglichen Praxis muß weiterhin viel Raum sein<br />
für vertrauensbildende Maßnahmen und Kommunikation, für Partnerschafts-<br />
und Teambildung, für Lernprozesse und Veränderung, damit<br />
diejenigen, die die Vision umsetzen und das Haus mit Leben füllen<br />
weiterhin sich finden und weiterentwickeln können. Es handelt sich<br />
hier um eine lernende Organisation, für die Flexibilität und Entwicklungsraum<br />
gegeben und für die begleitende Unterstützungssysteme<br />
entwickelt werden müssen, damit die Kultur im Haus positiv bleiben<br />
kann, Geben und Nehmen für alle gut ausbalanciert werden und jeder<br />
Partner für die eingebrachten Kompetenzen, Leistungen und Beiträge<br />
angemessene Wertschätzung findet.<br />
Mit dem Generationenhaus West ist mit großzügigen privaten<br />
Mitteln und mit viel Know How aus Praxis, Profession, Verwaltung<br />
und Politik eine Vision und ein großzügiger Bau gesetzt worden,<br />
der Raum für Entwicklung läßt. Vieles muß in der Praxis erst<br />
wachsen, dafür muß Raum und Zeit gelassen werden.<br />
Folgende Maßnahmen werden empfohlen:<br />
* Regelmäßige Jour Fixe Termine unter allen Beteiligten im Haus<br />
* Weiterführung der Prozeßbegleitung und Beratung des Leitungsteams<br />
* Regelmäßige Reflektionsmöglichkeiten außerhalb des Alltagsgeschäfts<br />
(Klausuren, Seminare)<br />
* Schulungen in Teamfähigkeit<br />
* Supervisionsangebote und Coaching für die einzelnen Teammitglieder<br />
* Dokumentation der ersten Jahre im Haus<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />
1sten Februar 2002. Seite 35 von 43
„Für das Team wäre es gut, wenn sie regelmäßige Evaluationsrunden<br />
einplanten um Bilanz zu ziehen. Sind wir noch bei unseren Zielen?<br />
Was ist kritikfähig und verbesserungswürdig? Was läuft gut und sollte<br />
in die Zukunft transportiert werden: auf der persönlichen Ebene, auf<br />
der Ebene des Programms und der Angebote im Haus und strukturell.<br />
Sprechen wir noch dieselbe Sprache, gibt es unterschiedliche Kulturen<br />
zu übersetzen und zu überbrücken, gibt es Mißverständnisse auszuräumen,<br />
müssen wir <strong>neue</strong> Kommunikations- und Umgangsregeln<br />
entwickeln? Man kann auch Teamhygiene dazu sagen. Genauso wie<br />
man eine Putzfrau braucht, damit es draußen sauber ist, braucht man<br />
etwas, daß es intern sauber bleibt. Daß sich da nichts anstaut, daß<br />
sich da nicht Schutt auf die Seelen legt, wie Mehltau, daß sich kein<br />
Mobbing etabliert. Es ist aber auch wichtig, daß die Beteiligten sich<br />
klar machen, sie können jetzt aus der Fülle heraus agieren. Sie können<br />
selbstbewußt und in Ruhe an die Dinge rangehen wo weiterer<br />
Lernbedarf ist.“ (Prozeßbegleitung)<br />
„Es wird wichtig sein, weiterhin Zugang zu einer Prozeßbegleitung zu<br />
haben. In städtischen System kann man mittel für Supervision und<br />
Prozeßmoderation beantragen, wenn es Probleme gibt und etwas<br />
bereits schief gelaufen ist. Und individuelles Coaching gibt es nur auf<br />
der Ebene von Amtsleitern. Wir sollten im Haus jedoch eine Struktur<br />
haben, die regelmäßige Reflektion und kontinuierliches Problemlösungsverhalten<br />
stimuliert. Sinnvoll wäre es auch, den Prozeß im<br />
Haus zu dokumentieren, so daß wir davon lernen können.“ (Kindertagesstätte)<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />
1sten Februar 2002. Seite 36 von 43<br />
„Als Wirtschaftsunternehmen ist<br />
uns die Bedeutung bekannt, die<br />
bei einem Prozeß mit so unterschiedlichen<br />
Planungspartnern<br />
einer Prozeßbegleitung zukommt.<br />
(Brigitte Preuß, Allianz<br />
Versicherungen)
„Wenn die einen im System sind<br />
und die anderen kommen von<br />
Außen, da gibt es einfach viele<br />
Reibungsflächen. <strong>Das</strong> ist ein<br />
strukturelles Problem, das aber<br />
oft an den Individuen festgemacht<br />
wird. <strong>Das</strong> heißt dann die<br />
einen sind zu mißtrauisch oder<br />
unrealistisch oder zu dünnhäutig.<br />
Bzw. die anderen sind zu<br />
stur, feindlich oder phantasielos.<br />
Da wird oft nicht inhaltlich diskutiert,<br />
sondern über lauter Persönlichkeitsmerkmale.<br />
Da reibt<br />
man sich an Personen auf, anstatt<br />
die strukturellen Widersprüche<br />
anzugehen.“ (Andrea<br />
Laux, EKIZ)<br />
„<strong>Das</strong> Haus bietet jetzt unendliche Möglichkeiten. Wir können Essen an<br />
die Schulen rundum anbieten, auch an alte Leute im Stadtteil, oder<br />
auch einen Mittagstisch für die Büros ringsrum. Wir können im Prinzip<br />
alle Gruppen des Stadtteils ins Haus einbinden, auch die Jugendlichen<br />
integrieren. Wir können den Garten und die Dachterasse in blühende<br />
Oasen urbaner Gastlichkeit und interkultureller Begegnung verwandeln,<br />
wir können den Generationenvertrag neu interpretieren, auf der<br />
Basis von Nachbarschaft und gegenseitigen Hilfsleistungen. <strong>Das</strong> alles<br />
kann jetzt Schritt für Schritt wachsen und gedeihen.“(EKIZ)<br />
Bedingungen der Übertragbarkeit<br />
Beim Zustandekommen des Generationenhaus West sind einige<br />
glückliche Umstände zusammengekommen. <strong>Das</strong> macht das Haus jedoch<br />
nicht zu einem einmaligen „Glücksfall“, der sich anderswo nicht<br />
wiederholen läßt. Aus den Elementen, die den Erfolg des Projekts<br />
ausmachten und aus den Empfehlungen der Beteiligten, was man<br />
noch verbessern könnte, lassen sich Möglichkeiten zur Replikation und<br />
Bedingungen der Übertragbarkeit zusammenstellen für Interessierte<br />
aus anderen Gemeinden oder Stadtteilen, die vom „<strong>Stuttgarter</strong><br />
<strong>Modell</strong>“ lernen und Ähnliches auch bei sich umsetzen wollen.<br />
Innovationsprojekte wie dieses brauchen die Beteiligung starker und<br />
hochmotivierter Persönlichkeiten und engagierter Visionäre die jedoch<br />
in ihren individuellen Handlungsfähigkeiten unterstützt werden müssen.<br />
Wenn Gruppierungen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen<br />
Bereichen, die keine Erfahrungen der Zusammenarbeit haben,<br />
zusammenkommen und eine Partnerschaft eingehen, sind Konflikte<br />
und Mißverständnisse strukturell eingebaut. Damit diese einerseits als<br />
strukturelle erkannt und nicht persönlich genommen oder an Persönlichkeitsmerkmalen<br />
der einzelen Beteiligten festgemacht werden, und<br />
andererseits die einzelnen Beteiligten die Fähigkeiten entwickeln den<br />
dabei unumgänglichen Streß auszuhalten und durchzustehen, braucht<br />
es strukturelle Prozeßunterstützung in Form von Zeit, professionelle<br />
Moderation, Reflektionsfreiräumen und individuellen Coachingangeboten.<br />
Der Wille zur Innovation muß auf oberster Ebene vorhanden sein. Die<br />
beteiligten Partner müssen jeweils mit denjenigen zu tun haben, die<br />
in den jeweiligen Bereichen tatsächliche Entscheidungsbefugnisse<br />
haben. Gleichzeitig müssen die mittleren und unteren Ebenen ins<br />
Innovationsgeschehen einbezogen und eingewiesen sein.<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />
1sten Februar 2002. Seite 37 von 43
Es muß viel Zeit für die Annäherung der Beteiligten und für die Herstellung<br />
von Transparenz eingeplant werden. Es müssen offene<br />
Kommunikationsstrukturen ermöglicht und gefördert werden, in<br />
denen sowohl Vorbehalte und Ängste offen auf den Tisch gelegt werden<br />
können, wie an den gemeinsamen Zielen und Visionen gearbeitet<br />
werden kann. Partner sollten es für sich klar haben und es auch<br />
kommunizieren können, wo sie Gemeinsamkeiten und wo sie Unterschiede<br />
sehen, wie weit jede Partei gehen kann und will, und wo für<br />
die einzelnen die Grenzen gesetzt sind.<br />
Folgende Checkliste wird zur Beachtung empfohlen:<br />
• Alle Beteiligte von Anfang an am Planungsprozeß gleichberechtigt<br />
einbinden, niemanden vergessen oder ausschließen.<br />
• Partizipative Planungen dürfen keine pro Forma Veranstaltungen<br />
sein, sondern wirkliche Entscheidungen beinhalten.<br />
• Rahmenbedingungen und politische Intentionen offenlegen. Keine<br />
heimlichen Lehrpläne, versteckten Strategien, unklare Bedingungen,<br />
unbekannte Vorhaben.<br />
• Hierarchische Strukturen außen vor lassen. Planungstreffen<br />
kooperativ und konsensual gestalten, keine einschüchternden<br />
Rituale, keine Denkverbote. Keine Dominanz einer Kultur oder<br />
eines Sprachgebrauchs. Entspanntes Arbeitsklima, das Kreativität<br />
fördert.<br />
• Bei sektorenübergreifenden <strong>Partnerschaften</strong> viel Zeit für einen intensiven<br />
Kennenlern- und Annäherungsprozeß der unterschiedlichen<br />
Partner lassen und einplanen.<br />
• Finanzielle Planungssicherheit gewährleisten.<br />
• Kommunikationsspielregeln, Umgangsformen und Verfahrensweisen,<br />
Sprachgebrauch und Sprachregelungen ansprechen, aushandeln<br />
und vereinbaren.<br />
• Gleicher Zugang aller Beteiligten zu Informationen, Transparenz<br />
des Informationsflusses.<br />
• Supervision, Coaching und Prozeßbegleitung erweisen sich als<br />
struktureller Teil von Bürgerbeteiligung. Finanzmittel dafür einplanen.<br />
• „Kulturelle Übersetzer“, die sich in den verschiedenen Alltagskulturen<br />
und „corporate identities“ auskennen und vermitteln und übersetzen<br />
können einbinden. Diese müssen von allen anerkannt und<br />
akzeptiert werden.<br />
• Strukturelle Ungleichheiten wie unterschiedliche zeitliche und<br />
finanzielle Ressourcen der beteiligten Partner offenlegen und<br />
ausgleichen.<br />
• Verwaltungsangestellte für den Umgang mit Bürgern und Selbsthilfegruppen<br />
vorbereiten und fachbilden.<br />
• Beiträge der Beteiligten sichtbar anerkennen und wertschätzen,<br />
Erfolge gemeinsam feiern.<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />
1sten Februar 2002. Seite 38 von 43<br />
„Man muß bei so einem Prozeß<br />
vergessen in welcher Partei man<br />
ist und in welcher Abteilung der<br />
Verwaltung man steht. Um zu<br />
einer wirklichen sachlichen Kooperation<br />
zu kommen, muß man<br />
sich der Sache unterwerfen.“<br />
(Edgar Kurz, Gebrüder Schmid<br />
Stiftung)<br />
„Daß wohlfahrtsstaatliche Aufgaben<br />
ehrenamtlich geliefert<br />
werden sollen, das ist eine<br />
Milchmädchenrechnung. Selbsthilfe<br />
ist nicht automatisch<br />
Ehrenamt. <strong>Das</strong> ist eine Motivationsfrage,<br />
man tut es für sich<br />
und den nächsten, für die eigene<br />
Vision, die eigenen Werte.<br />
<strong>Das</strong> ist aber nicht mit Ehrenamt<br />
gleichzusetzen. <strong>Das</strong> sind<br />
Präventionsleistungen. <strong>Das</strong> erspart<br />
der Stadt viele Probleme<br />
und viele Kosten. <strong>Das</strong> kann man<br />
nicht zum Nulltarif erwarten.“<br />
(Christa van Winsen, Prozeßbegleitung)
Zusammenfassend einige Ratschläge in den Worten der Beteiligten:<br />
„Innovationen müssen von oben gewollt sein. Aber sie lassen sich<br />
nicht durchsetzen, wenn das mittlere Management und die Verwaltungsangestellten,<br />
die sie umsetzen müssen nicht sorgfältig informiert<br />
und eingestimmt werden. Sie müssen die Ziele kennen und wissen,<br />
was auf sie zukommt und was von ihnen erwartet wird. Daß die Dinge<br />
anders laufen müssen als üblich und daß sie größere Spielräume zulassen<br />
dürfen, daß Vorschriften flexibel und kreativ ausgelegt werden<br />
müssen.“ (Prozeßbegleitung)<br />
„Die Prozeßbegleitung war wichtig. Es braucht eine Begleitung und<br />
Steuerung, um die strukturellen Probleme und Konflikte immer wieder<br />
zum Thema zu machen. <strong>Das</strong> können die Beteiligten nicht alleine. Dies<br />
darf von der Verwaltung nicht unterschätzt werden, da muß Zeit und<br />
Mittel dafür eingeplant werden. Es müssen strukturelle Bedingungen<br />
hergestellt werden, unter denen Konflikte auch da sein und ausgehandelt<br />
werden können, ohne daß es die Effektivität und den<br />
Zeitrahmen der Planung sprengt, und die Motivation der Beteiligten<br />
schwächt. Mit Mißverständnissen, Gerüchteküchen und Mißtrauen<br />
muß man bei so einem Prozeß rechnen. Es müssen Strukturen vorhanden<br />
sein, sie zu klären und aufzulösen. Es muß auch eine<br />
Planungssicherheit gewährleistet werden, daß das Projekt nicht durch<br />
irgendwelche Änderungen in der Stadt oder dem Gemeinderat gefährdet<br />
ist.“ (Jugendhilfeplanung)<br />
„<strong>Das</strong> nächste Mal sollte man eine klarere Projektstruktur vorgeben<br />
und die Zuständigkeiten zwischen Nutzern, Verwaltung, Politik,<br />
Vermittler und Stifter nachvollziehbar abklären. Wer spielt welche<br />
Rolle und bestimmt über was und welche Spielräume ergeben sich<br />
daraus, was ist der zeitliche Rahmen für Entscheidungen und bis<br />
wann müssen sie getroffen sein. Man könnte so etwas mit einem Diagram<br />
festhalten und vorgeben. Es sollte auch mehr schriftlich festgehalten<br />
werden, Protokolle machen, Vereinbarungen treffen, Regeltermine<br />
festlegen. Lieber einen Termin umsonst, als daß man sich<br />
erst wieder trifft, wenn was in Busch ist.<br />
Auf der anderen Seite muß man, wenn man Laien beteiligt, auch dafür<br />
sorgen, daß sie dieselben Möglichkeiten haben, sich als gleichberechtigte<br />
Partner einzubringen. Dazu gehört z.B auch Ressourcen einzuplanen,<br />
daß sie sich als Gruppe finden und konsolidieren können.<br />
Die Verwaltung bietet ihren Angestellten und ihren Einrichtungen<br />
Supervision und Teambegleitung an. Selbsthilfegruppen brauchen so<br />
etwas auch, daß sie mal eine Klausurtagung veranstalten können und<br />
ihre Positionen klären und unter sich auch ausgären können. Sie<br />
brauchen die Möglichkeit als Gruppe an ihren Zielen zu arbeiten. <strong>Das</strong><br />
muß man zur Verfügung stellen.“ (Jugendhilfeplanung)<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />
1sten Februar 2002. Seite 39 von 43
Empfehlungen für die Politik<br />
Bürgernähe und generationenübergreifende Ansätze können nicht als<br />
einzelne, isolierte Projekte realisiert werden, sondern müssen eingebettet<br />
sein in eine Politik, die mit diesen Zielen kongruent ist. Betroffenenbeteiligung,<br />
lernende Organisationen, Förderung von Selbsthilfegruppen<br />
erfordern von der Kommune ein stückweit aus ihren<br />
bürokratischen Strukturen auszusteigen und Raum für Selbstbestimmung<br />
und Entwicklungen an der Basis zuzulassen. Sie erfordern eine<br />
andere Art von Organisationsentwicklung und andere Förderkriterien.<br />
Es braucht andere Denk- und Handlungsmuster der Verwaltung und<br />
unterstützende Fortbildung und Supervision im wechselseitigen Umgang<br />
von Bürgerselbstorganisationen und Verwaltung. Ressourcen<br />
müssen umgeleitet, Prioritäten und Investitionen neu definiert werden.<br />
Auch bei dieser Umstrukturierung selbst ist es sinnvoll einen<br />
partizipativen Ansatz zu verfolgen und die Betroffenen zu Beteiligten zu<br />
machen, sowie sektorenübergreifende <strong>Partnerschaften</strong> einzubeziehen.<br />
Folgende Eckpunkte können dabei Orientierungshilfen abgeben:<br />
* Bürgerpartizipation als allgemeines Prinzip kommunaler Planung<br />
* Entbürokratisierung der Administration<br />
* Förderrichtlinien und Verwaltungsvorschriften, die Selbstverwaltung,<br />
vernetzte Organisationsstrukturen und Basisbeteiligung zulassen<br />
* Fortbildungen für die Verwaltung im Umgang mit Selbsthilfegruppen,<br />
sowie Fortbildungen von Selbsthilfegruppen im Umgang mit<br />
der Verwaltung.<br />
Zum Schluß einige Empfehlungen im Wortlaut:<br />
„Wenn der Erfolg dieses Hauses gefeiert wird und sich alle damit<br />
identifizieren, sollte klar gemacht werden, daß es nicht einfach vom<br />
Himmel gefallen ist. Da sind die Nutzer von Anfang an in den Planungsprozeß<br />
miteinbezogen worden. Daraus muß man die Konsequenzen<br />
ziehen und das woanders auch machen. Nicht daß es heißt,<br />
das ist jetzt unser Erfolgsobjekt, aber ansonsten machen wir weiter<br />
wie bisher, dann ist es nicht wirklich eine Innovation, sondern ein<br />
Aushängeschild. Ganz im Gegenteil, dieses Projekt muß auf andere<br />
Bereiche der Stadt ausstrahlen und eine Kette von Reformen und<br />
weiteren Innovationen nach sich ziehen.“ (EKIZ)<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />
1sten Februar 2002. Seite 40 von 43<br />
„Wenn man es mit anderen<br />
Häusern im selben Maßstab vergleicht,<br />
dann hält dieses Projekt<br />
durchaus einen Kostenvergleich<br />
aus. <strong>Das</strong> zeigt, Innovationen<br />
müssen nicht unbedingt teurer<br />
sein, wichtig ist der Freiraum im<br />
Planungsprozeß.“ (Christine<br />
Heizmann-Kerres, Hochbauamt)<br />
„Durch den intensiven Kommunikationsprozeß<br />
aller war es bei<br />
der Möblierung möglich, nach<br />
dem wirklichen Bedarf und den<br />
unterschiedlichen Aktivitäten im<br />
Haus vorzugehen und nicht<br />
einfach nach Schema F allen<br />
Beteiligten dieselben Mittel zuzuweisen.<br />
<strong>Das</strong> war ein sehr<br />
harmonischer Prozeß und wäre<br />
nicht möglich gewesen, wenn es<br />
strikte Regeln gegeben hätte,<br />
die nach abstrakten Prinzipien<br />
und nicht nach den Gegebenheiten<br />
vor Ort ausgerichtet<br />
sind.“ (Brigitte Gramlich,<br />
Jugendamt)
„Wenn bei jedem Bauvorhaben,<br />
gleichwohl ob es sich um ein<br />
privates oder ein öffentliches<br />
Projekt handelt, die Nutzer einbezogen<br />
wären, sähen unsere<br />
Städte anders aus.“ (Alexander<br />
Hoffmann, Hochbauamt)<br />
„Unter Professionellen gibt es oft Widerstände gegenüber einer<br />
Bürgerbeteiligung an Planungs- und Entscheidungsprozessen. Die<br />
Kollegen fühlen sich abgewertet: Wieso sollen die Bürger das Sagen<br />
haben, das ist doch unser Beruf. Was sie oft dabei jedoch vergessen<br />
ist daß auch professionelles Handeln erklärt, begründet und transparent<br />
gemacht werden muß. Wenn man beteiligen will, muß man<br />
sein Handeln auch übersetzen und erläutern. Daß bedeutet nicht, daß<br />
professionelles Know How und Erfahrung nichts mehr gilt, aber man<br />
muß gute Gründe haben und sie auch erklären und nachvollziehbar<br />
machen können dafür, die Dinge so und nicht anders entscheiden zu<br />
wollen. <strong>Das</strong> ist ungewohnt für die Verwaltung. Viele Konflikte in Beteiligungsprozessen<br />
entstehen dadurch, daß Dinge einfach gesetzt und<br />
nicht erklärt werden. Hier muß die Verwaltung lernen mehr zu erläutern<br />
und sich auch mal eines Besseren belehren zu lassen. Denn die<br />
Praxis hat auch Erfahrungen und Know How und von ihnen kann man<br />
auch lernen.“ (Jugendhilfe)<br />
„Wir begleiten ja auch Firmenteams in großen Projekten. Es ist absolut<br />
notwendig, die Leute, die in diesem Prozeß beteiligt sind, zu<br />
coachen. <strong>Das</strong> sind alles Persönlichkeiten, aber die haben natürlich<br />
auch ihre Schwächen. Hier muß man auch individuell unterstützen,<br />
denn an den Personen hängt es ja oft auch letztlich, wenn der Prozeß<br />
gelingen soll. Solche dynamischen und extrovertierten Persönlichkeiten,<br />
die man für so ein Hochleistungsteam in so einem Projekt unbedingt<br />
braucht, die müssen immer wieder auch als Person rangenommen<br />
und gestärkt werden, daß sie auch für sich Platz finden und<br />
durchatmen können.“ (Prozeßbegleitung)<br />
„Da hätte die Stadt in ihren Abteilungen ja schon mal signalisieren<br />
können, hier entsteht ein tolles <strong>neue</strong>s Projekt, seit mal für die offen.<br />
So aber haben wir um jede Mark, jedes Büro und jeden Vertrag<br />
kämpfen müssen. <strong>Das</strong> war so frustrierend und einschränkend, daß<br />
alles erkämpft werden mußte. Oft haben die erst mal dicht gemacht<br />
und es hat erst mal lange Verhandlungen gebraucht. Ich habe oft<br />
gedacht, die Verwaltungsvorschriften, die passen einfach nicht zu<br />
diesem Haus. Daran muß dann auch intern gearbeitet werden, das<br />
kann man nicht alles uns außenstehenden überlassen.“ (EKIZ)<br />
„<strong>Das</strong> eigenverantwortlich in Selbstorganisation arbeitende Generationenzentrum<br />
ist auf die ideelle, personelle und finanzielle Unterstützung<br />
durch Dritte angewiesen. <strong>Das</strong> Angebot der verschiedenen Träger<br />
und Aktiven richtet sich an alle Generationen und Menschen in den<br />
verschiedensten Lebenslagen - gerade auch sozial Schwache und<br />
Menschen aus gesellschaftlich randständigen Gruppen.<br />
Dies schließt einen kostendeckenden oder gar gewinnbringenden Betrieb<br />
nach aller Erfahrung aus. Insofern ist eine materielle und emo-<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />
1sten Februar 2002. Seite 41 von 43
tionale Rahmung notwendig, durch städtische Zuschüsse sowie durch<br />
bürgerschaftlich engagierte MitbürgerInnen.“ (Konzeptpapier)<br />
„Es heißt ja von allen Seiten, dieses Projekt ist nur gelungen, weil<br />
man durch den Stifter einen Freiraum hatte von städtischen Reglements<br />
und Vorgaben. Da müßte doch die Stadt jetzt auch ein Interesse<br />
daran haben, von diesem Erfolg zu lernen und ihre Reglements<br />
so zu verändern, daß alle Planungen so erfolgreich verlaufen wie<br />
diese. Denn sie arbeiten ja mit Steuermitteln, und es wäre ja gut,<br />
wenn alle ihre Projekte so gelingen. Aus der Qualität dieses Projekts<br />
sollte die Stadt Konsequenzen ziehen für ihre eigenen Amtsstrukturen<br />
und für zukünftige Entscheidungsprozesse.“ (EKIZ)<br />
„Im Grunde müßte ein völlig <strong>neue</strong>r „interkultureller“ Fortbildungszweig<br />
entwickelt werden an der Schnittstelle zwischen Selbsthilfe und<br />
Administration. Damit die Verwaltung lernt, wie die Selbsthilfe denkt,<br />
in welche Fettnäpfen man im Umgang mit ihr treten kann und wie<br />
man echte partizipative Prozesse fördert. Umgekehrt müßten Selbsthilfegruppen<br />
ein Training darin bekommen, unter welchen Bedingungen<br />
die Administration arbeitet, warum sie so denken und handeln,<br />
wie sie es tun, und wie man Bürgeranliegen so formuliert und vermittelt,<br />
daß sie in Verwaltungshandeln transportiert werden können.<br />
Wir könnten so ein Fortbildungsinstitut aufmachen, da wäre sicher<br />
Bedarf. (EKIZ)<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />
1sten Februar 2002. Seite 42 von 43<br />
„Ein partizipativer Planungsprozeß<br />
ist zeitaufwendig, aber die<br />
Resultate sind überzeugend.<br />
Gremienarbeit und politische<br />
Ausschüsse sind auch zeitaufwendig.“<br />
(Gabriele Müller-Trimbusch,<br />
Bürgermeisterin)
„Dieses Haus mag vielleicht<br />
nicht allen professionellen Standards<br />
entsprechen. Viel wird<br />
hier auch improvisiert. Es ist<br />
gerade das Nicht Perfekte, daß<br />
die Stimmung so entspannt und<br />
fröhlich sein läßt. Dieselbe Art<br />
von Freude, das von einem<br />
selbstgemachten Geschenk ausgeht<br />
gegenüber einem Geschenk,<br />
daß im Kaufhaus gekauft<br />
wurde.“ (Edgar Kurz,<br />
Gebrüder Schmid Stiftung)<br />
„Man muß nur dafür sorgen, daß<br />
die Menschen sich das Gebäude<br />
selber anschauen. Es hat noch<br />
keinen gegeben, der Fuß in das<br />
Haus gesetzt hat ohne begeistert<br />
zu sein.“ (Gabriele Müller-<br />
Trimbusch, Búrgermeisterin)<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />
1sten Februar 2002. Seite 43 von 43