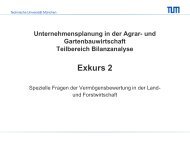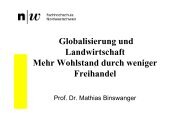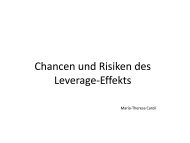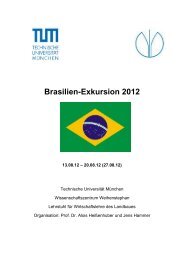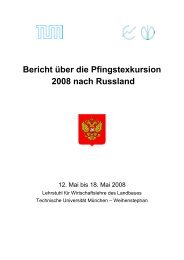Exkursionsbericht - Lehrstuhl für Wirtschaftslehre des Landbaues
Exkursionsbericht - Lehrstuhl für Wirtschaftslehre des Landbaues
Exkursionsbericht - Lehrstuhl für Wirtschaftslehre des Landbaues
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Pfingstexkursion 2012<br />
Italien<br />
28. Mai bis 01. Juni 2012<br />
Technische Universität München – Weihenstephan<br />
<strong>Lehrstuhl</strong> <strong>für</strong> <strong>Wirtschaftslehre</strong> <strong>des</strong> Landbaus<br />
Organisation der Exkursion: Prof. Dr. Alois Heißenhuber
Inhaltsverzeichnis<br />
Inhaltsverzeichnis 2<br />
Abbildungsverzeichnis 5<br />
Tabellenverzeichnis 6<br />
Programm 7<br />
Route in Italien 8<br />
Teilnehmerliste 9<br />
1. Allgemeine Informationen über Italien 11<br />
1.1 Wirtschaft 12<br />
1.2 Landwirtschaft Südtirol 14<br />
2. Finanzkrise der EU unter besonderer Berücksichtigung Italiens 15<br />
3. Landwirtschaft in Italien 17<br />
3.1 Allgemeine Informationen 17<br />
3.2 Pflanzenbau 19<br />
3.3 Tierhaltung 19<br />
4. Die Landwirtschaft der Emilia Romagna 20<br />
5. Betrieb Grana Padano Familie Nordera 22<br />
5.1 Milchvieh 22<br />
5.2 Forellenzucht 23<br />
5.3 Kaninchenmast 24<br />
6. Die Stadt Parma 25<br />
7. Antica Corte Pallavicina, Restaurant Al Cavallino Bianco 27<br />
8. Käserei „Parmigiano Reggiano“ 29<br />
9. Besichtigung Betrieb Torre<br />
(Parmigiano Reggiano Produktion) 32<br />
10. Stadtführung Verona 34<br />
10.1 Daten und Fakten 34<br />
10.2 Geschichtliches 34<br />
10.3 Geographische Lage 34<br />
10.4 Sehenswürdigkeiten 35<br />
2
11. Besichtigung Schweinebetrieb Aldo Montolli 37<br />
11.1 Allgemeines 37<br />
11.2 Fütterung 38<br />
11.3 Maststall 38<br />
11.4 Sauenanlage mit angeschlossener Ferkelaufzucht 38<br />
12. Geschichte Südtirols 40<br />
12.1 Urgeschichte 40<br />
12.2 Tirol im 14. Jahrhundert 40<br />
12.3 Eroberung durch Bayern und Zeit <strong>des</strong> Andreas Hofer 41<br />
12.4 Zeit <strong>des</strong> ersten Weltkriegs 42<br />
12.5 Südtirol im zweiten Weltkrieg 42<br />
12.6 Erringen der Autonomie 42<br />
13. Tourismus in Südtirol 43<br />
14. Die Landwirtschaft in Südtirol 45<br />
14.1 Flächenverteilung Südtirols 45<br />
14.2 Geschichte der Landwirtschaft in Südtirol 45<br />
14.3 Landwirtschaft heute. 46<br />
14.4 Obstbau 46<br />
14.5 Weinbau 47<br />
14.6 Milchwirtschaft 48<br />
15. Besichtigung Weinkellerei Tramin 49<br />
15.1 Überblick über die Landwirtschaft in Südtirol 49<br />
15.2 Kellerei Tramin 49<br />
15.3 Jahreskreis <strong>des</strong> Weinbaues 50<br />
15.4 Führung durch den Betrieb 51<br />
15.5 Weinverkostung 51<br />
16. Die Stadt Bozen 53<br />
17. Freie Universität Bozen 56<br />
17.1 Landwirtschaft in Südtirol (Vortrag <strong>des</strong> Vizedirektors<br />
<strong>des</strong> Südtiroler Bauernbun<strong>des</strong> SBB, Ulrich Höllrigl) 57<br />
17.1.1 Geschichte 57<br />
17.1.2 Die Landwirtschaft in Südtirol nach<br />
3
dem zweiten Weltkrieg bis heute 58<br />
17.1.3 Herausforderungen <strong>für</strong> die Zukunft 58<br />
17.2 Obstbauwirtschaft in Südtirol (Dr. Wolfgang Drahorad) 59<br />
18. Betriebsbesichtigung Obsthof Troidner 61<br />
19. Versuchszentrum Laimburg 65<br />
19.1 Geschichte 65<br />
19.2 Allgemeines zum Versuchszentrum 65<br />
19.3 Apfelanbau 66<br />
19.4 Sortenprüfung 67<br />
19.5 Clubsorten 67<br />
19.6 Lagerung 68<br />
20. Felsenkeller Laimburg - Weinverkostung 69<br />
20.1 Weißweine 70<br />
20.2 Rotweine 71<br />
21. Obstgenossenschaft Cafa Meran 73<br />
21.1 Eckdaten 73<br />
21.2 Produktionsablauf 73<br />
21.3 Abrechnung und Vermarktung 74<br />
22. Betriebsbesichtigung Pflegerhof – Kräuterhof 75<br />
22.1 Allgemeines über den Pflegerhof 75<br />
22.1.1 Betriebsstruktur 75<br />
22.1.2 Philosophie 76<br />
22.2 Anbau der Kräuter 76<br />
22.2.1 Ausstattung 76<br />
22.2.2 Kräuter 76<br />
22.2.3 Vorgehensweise beim Anbau 77<br />
22.2.4 Ernte und Konservierung 77<br />
22.2.5 Verarbeitung und Verkauf der Produkte 78<br />
4
Abbildungsverzeichnis<br />
Abbildung 1: Route in Italien 8<br />
Abbildung 2: Karte Italien 13<br />
Abbildung 3: Parmigiano Reggiano und Parmaschinken 26<br />
Abbildung 4: Dom und Baptisterium von Parma 26<br />
Abbildung 5: Käseherstellung 29<br />
Abbildung 6: Käsereifung 30<br />
Abbildung 7: Andreas Hofer 41<br />
Abbildung 8: Übernachtungen und Ankünfte in Südtirol 44<br />
Abbildung 9: Obstbau 46<br />
Abbildung 10: Weinbau 47<br />
Abbildung 11: Milchwirtschaft 48<br />
Abbildung 12: Panoramabild Bozen und Brennerautobahn 53<br />
Abbildung 13: Bozen und Dolomiten 54<br />
Abbildung 14: Dom Maria Himmelfahrt in Bozen 54<br />
Abbildung 15: Hofladen Troidner 64<br />
Abbildung 16: Versuchszentrum Laimburg 65<br />
Abbildung 17: Clubsorten Südtirol 67<br />
Abbildung 18: Lagerschäden an Äpfel 68<br />
Abbildung 19: Logo Versuchszentrum Laimburg 68<br />
Abbildung 20: Felsenkeller Laimburg 69<br />
Abbildung 21: Kräuterhof Pfleger 79<br />
Abbildung 22: Zitronenbaum als Thermometer 79<br />
5
Tabellenverzeichnis<br />
Tabelle 1: BIP Italien 14<br />
Tabelle 2: Landnutzung in Italien 17<br />
Tabelle 3: Betriebsstruktur 2007 18<br />
Tabelle 4: Produktion ausgewählter Früchte 18<br />
Tabelle 5: Studiengänge im Bereich Agrarwissenschaften 56<br />
6
Programm<br />
Tag Zeitplan Details<br />
Mo<br />
28.05.12<br />
Di<br />
29.05.12<br />
Mi<br />
30.05.12<br />
Do<br />
31.05.12<br />
Fr<br />
01.06.12<br />
6.30 Uhr Abfahrt am Parkplatz an der Sauwiese in Freising<br />
12.30 Uhr Mittagessen<br />
14:00-16:00 Uhr Milchviehbetrieb F.lli Nordera e Figli<br />
17:30 -21:00 Uhr Antica Corte Pallavicina<br />
Restaurant Al Cavallino Bianco<br />
Besichtigung: Parmaschinken, Black-Pig<br />
mit anschließendem Essen<br />
Übernachtung Verona (Sud Point)<br />
7:00 Uhr Abfahrt<br />
8:15 Uhr Molkereibesichtigung - Parmigiano Reggiano<br />
12:00 - 13:30 Uhr Betriebsbesichtigung- Milchvieh - Parmigiano<br />
Reggiano<br />
13:00 - 14:30 Uhr Mittagessen<br />
14.30 - 16:00 Uhr Besichtigung von Parma<br />
17:30 - 20:00 Uhr Stadtführung Verona<br />
anschließend Aben<strong>des</strong>sen in Verona<br />
Übernachtung Verona (Sud Point)<br />
8:30 Uhr Abfahrt<br />
9:30- 12:00 Uhr Betriebsbesichtigung von Montolli Aldo<br />
(Schweinebetrieb)<br />
12:30- 14:00 Uhr Mittagessen<br />
16:00 - 18:00 Uhr Kellereibesichtigung mit Weinverkostung<br />
Kellerei Tramin (SBB Obmann Leo Tiefenthaler)<br />
Übernachtung Bozen Rentschner Hof<br />
9:00 Uhr Abfahrt<br />
9:30 -12:00 Uhr Uni Bozen, Führung und Vortrag mit Herrn Prof.<br />
Schamel<br />
12:00 - 13:30 Uhr Mittagessen<br />
14:00 - 15:00 Uhr Obsthof Kohl-Troidner<br />
16:30- 18:00 Uhr Besichtigung Versuchszentrum Laimburg<br />
18:00- 20:30 Uhr Führung und Merende mit Weinverkostung<br />
im Felsenkeller mit Lan<strong>des</strong>hauptmann Durnwalder<br />
21:00 Uhr Tschurtschkeller Auer<br />
Übernachtung Bozen Rentschner Hof<br />
9:30 Uhr Abfahrt<br />
10:00 - 11:30 Uhr Obstgenossenschaft Cafa Meran<br />
12:00 - 13:15 Uhr Mittagessen<br />
14:00 - 15:00 Uhr Pflegerhof Kräuteranbau, Kastelruth<br />
15:00 Uhr Rückfahrt. Ankunft in FS etwa 20:00 Uhr<br />
7
Route in Italien<br />
B: Milchviehbetrieb F..lli Nordera e Figli<br />
C: Antica Corte Pallavicina<br />
D: Verona<br />
E: Parma<br />
F: Verona<br />
G: Tramin (Kellerei)<br />
H: Bozen<br />
I: Versuchszentrum Laimburg<br />
J: OG Cafa Meran<br />
K: Pflegerhof, Kastelruth<br />
8
Teilnehmerliste<br />
Name Vorname<br />
1 Altenburger Christian<br />
2 Aumann Roswitha<br />
3 Bauer Simon<br />
4 Bauerdick Josef<br />
5 Bilgeri Anna<br />
6 Böhm Monika<br />
7 Braun Patricia<br />
8 Braun Sascha<br />
9 Brunlehner Eva-Maria<br />
10 Caroli Maria-Theresa<br />
11 Dehoff Andrea<br />
12 Gehling Martina<br />
13 Göschl Barbara<br />
14 Hagl Georg<br />
15 Harrer Markus<br />
16 Heimsoeth Jana<br />
17 Heinze Claudia<br />
18 Henne Kilian<br />
19 Höcherl Susanne<br />
20 Hofbauer Maximilian<br />
21 Hoffmann Dominik<br />
22 Kappauf Katharina<br />
23 Klarer Max<br />
24 Koller Regina<br />
25 Kotschenreuther Martin<br />
9
26 Landwehr Maximiliane<br />
27 Lang Toni<br />
28 Lederer Elisabeth<br />
29 Lenz Johannes<br />
30 Metz Christian<br />
31 Mittelberger Cilli<br />
32 Obermaier Sabine<br />
33 Petershammer Silke<br />
34 Raddatz Mirco<br />
35 Ries Elke<br />
36 Schütz Stefan<br />
37 Seiler Sarah<br />
38 Sojer Dominik<br />
39 Stäbler Rupert<br />
40 Steindl Matthias<br />
41 Überacker Johannes<br />
43 Vandieken Hubert<br />
43 Vinzent Beat<br />
44 Weber Anne<br />
45 Wenig Johannes<br />
46 Wenninger Ludwig<br />
47 Wohlschläger Melanie<br />
Begleitpersonen<br />
48 Dr. Paulicks Brigitte<br />
49 Culiuc Nicoleta<br />
50 Prof. Dr. Heißenhuber Alois<br />
51 Lechner Hermann<br />
10
1. Allgemeine Informationen über Italien<br />
Das Land besteht zu ca. 80% aus Bergen und Hügeln. Umgeben wird Italien von gut<br />
8000 Kilometern Küste, die völlig unterschiedlich ist: einerseits flach und sandig, aber<br />
auch steinig und steil. Der äußerste Norden Italiens gehört zu den Alpen und wird unter<br />
anderem durch den Brenner-Pass mit Österreich und durch den Gotthard (Tunnel und<br />
Passstraße) mit der Schweiz verbunden. Zu den längsten Flüssen zählen neben dem<br />
Po und dem Arno auch die Etsch und der Tiber. Die bekanntesten und auch größten<br />
Seen sind der Lago di Garda oder Bènaco, der Lago di Como und der Lago Maggiore<br />
in Norditalien, sowie der Lago di Bolsena und der Lago Trasimeno nördlich von Rom.<br />
Seit Mitte der 1940er Jahre ist Italien eine parlamentarische Republik. Ferner ist Italien<br />
Mitglied in einigen Organisationen. So gehört das Land seit Ende der 1940er Jahre der<br />
NATO an, ist seit Mitte der 1950er Jahre Mitglied der Vereinten Nationen und zudem<br />
noch Gründungsmitglied der Europäischen Union sowie ein G-8 Mitglied. Italien ist in<br />
20 eigenständige Regionen aufgeteilt, von der jede eine eigene Regierung hat. Neben<br />
der staatlichen Amtssprache Italienisch werden in Trentino-Südtirol Deutsch und<br />
Ladinisch, in Friaul-Julisch Venetien auch Slowenisch gesprochen. Im Aostatal spricht<br />
man Französisch. Aber auch verschiedene andere Sprachen, wie zum Beispiel<br />
Albanisch, Franko-Provenzalisch, Furlan, Griechisch, Katalanisch, Sardisch und einige<br />
so genannte Dialektsprachen genießen einen Schutz durch die Verfassung.<br />
Die Lan<strong>des</strong>hauptstadt Rom liegt in der Region Latium in der Mitte <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> und ist<br />
nach Mailand und Neapel die drittgrößte Stadt mit ca. 4 Millionen Einwohnern. Die<br />
„Ewige Stadt“ wurde der Sage nach von Romulus im Jahre 753 vor Christus gegründet<br />
und ist seit dem Ende <strong>des</strong> Kirchenstaates um 1870 die Hauptstadt <strong>des</strong> neuen Italien.<br />
Mitten in Rom befindet sich der eigenständige Vatikanstaat. Der Sitz <strong>des</strong> Papstes ist<br />
allerdings <strong>für</strong> die Öffentlichkeit nicht zugänglich.<br />
Von großer wirtschaftlicher Bedeutung ist der Weinanbau in Italien, denn das Land ist<br />
weltweit bekannt <strong>für</strong> seine qualitativ hochwertigen Weine. Die wirtschaftliche und<br />
industrielle Lage in Italien ist zwischen Nord und Süd sehr unterschiedlich. Während im<br />
Norden <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> große Industriebetriebe ansässig sind, ist der Süden Italiens eher<br />
von landwirtschaftlichen Betrieben geprägt.<br />
Seit der Antike spielt Italien eine sehr große Rolle, wenn man über Kunst und Kultur<br />
spricht. Viele namhafte Maler und Bildhauer wie Leonardo da Vinci, Michelangelo und<br />
11
Giotto stammen aus Italien. Bauwerke wie das Colosseum in Rom, der schiefe Turm<br />
von Pisa und die Lagunenstadt Venedig sind nur einige Highlights.<br />
Auch in sportlicher Hinsicht ist Italien weltweit bekannt. Viele berühmte Fußballvereine<br />
wie Juventus Turin, Inter Mailand oder der AS Rom sorgen immer wieder <strong>für</strong><br />
Schlagzeilen. Außerdem rangiert Italien hinter Brasilien mit vier Fußball-<br />
Weltmeistertiteln. Italien ist auch eine motorsportbegeisterte Nation. Sportarten wie die<br />
Formel-1 und der Motorradsport sind sehr weit verbreitet und erfreuen sich immer<br />
größerer Beliebtheit. Aber auch der Radsport kommt hier nicht zu kurz. Fahrer wie<br />
Giacomo Agostini, Felice Gimondi, Marco Pantani und Mario Cipollini dürften<br />
hinreichend bekannt sein. Jährlich veranstaltet das Land den Giro d’Italia; nach der<br />
Tour de France das zweitwichtigstes Radrennen der Welt.<br />
Der Exportschlager der Italiener ist jedoch die italienische Küche. Italien bietet vom<br />
Norden bis zum Süden <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> eine immense Vielfalt an kulinarischen Gerichten<br />
und gilt nicht nur unter Kennern als die beste Küche <strong>des</strong> Abendlan<strong>des</strong>. Italiener haben<br />
auch aufgrund ihrer Ernährung eine der höchsten Lebenserwartungen weltweit.<br />
Wirklich wegen der Ernährung? Außerdem sorgt das <strong>für</strong> viele Menschen immer noch<br />
existierende Dolce Vita (Lebensweise) <strong>für</strong> einen ausgeglichenen Lebensstil.<br />
1.1 Wirtschaft<br />
Die Industrie, der Tourismus und die Landwirtschaft sind die drei Standbeine der<br />
italienischen Wirtschaft. Viele Produkte Italiens sind weltberühmt und Firmennamen<br />
wie Fiat oder Benetton stehen <strong>für</strong> das Label "Made in Italy". Über die Hälfte der Fläche<br />
Italiens wird <strong>für</strong> die Agrarwirtschaft genutzt. Allen voran der Obstanbau mit Oliven,<br />
Äpfeln, Orangen oder Datteln bis hin zu Feldfrüchten wie Tomaten, Artischocken,<br />
Rüben oder Mais ist <strong>für</strong> das Bruttosozialprodukt bedeutend. Das Sonnenland im Süden<br />
Europas rangiert ebenso bei der Herstellung und beim Export von Wein in alle Welt<br />
ganz vorn. Aber auch der Käse ist berühmt: Gorgonzola, Pecorino und Parmesan sind<br />
erfolgreiche Exportschlager.<br />
Ein großes Problem Italiens stellt das starke Gefälle <strong>des</strong> Nordens zum Süden dar, in<br />
dem die Zahl der Arbeitssuchenden dreifach so groß ist. Inwieweit die organisierte<br />
Kriminalität bzw. die Mafia mitmischt, kann nur geraten werden. Industrielles Zentrum<br />
ist dagegen Mailand und die Umgebung. Viele Italiener erhoffen sich dort Arbeit in den<br />
vielen kleinen und mittelständigen Betrieben oder im Tourismus.<br />
12
Erst spät wurden große staatliche Konzerne z.B. in den Bereichen Telekommunikation,<br />
Stahl, Elektronik oder Luftfahrt privatisiert. Man erhofft sich dadurch mehr Wettbewerb<br />
und mehr Innovation, auch im Vergleich zu den anderen EU-Ländern. Nennenswerte<br />
Bodenschätze sind Erdgas und Petroleum. Da aber auch in Italien der Staat und die<br />
Städte verschuldet sind, lässt ein deutliches Wirtschaftswachstum noch auf sich<br />
warten.<br />
13
1.2 Landwirtschaft Südtirol<br />
Die Landwirtschaft beschäftigt 7,8 % der Südtiroler Erwerbsbevölkerung (2005). Im<br />
Etsch- und Eisacktal dominiert der Anbau von Äpfeln und Wein, während im Pustertal,<br />
Wipptal und anderen Seitentälern die Milchwirtschaft überwiegt.<br />
Die Apfelproduktion nimmt einen hohen Stellenwert innerhalb der Landwirtschaft ein.<br />
Südtirols Landwirte produzieren auf 18.000 ha rund 10 % der in der EU angebauten<br />
Äpfel beziehungsweise 2 % der Weltproduktion.<br />
Neben dem Apfelanbau hat auch der Weinbau eine lange Tradition in Südtirol. Die<br />
bedeutendsten Sorten sind Vernatsch und Weißburgunder. Besonders in den letzten<br />
20 Jahren hat sich Südtirol als eine der besten Weißweinregionen Italiens einen<br />
Namen gemacht. Dabei steht Südtirol besonders <strong>für</strong> trockene und fruchtige<br />
Weißweine. Südtirol gehört mit ungefähr 5100 ha zu den kleinsten italienischen<br />
Weinbauregionen (weniger als ein Prozent der Gesamtfläche), ist aber durch den<br />
hohen Anteil an Qualitätsweinen überaus erfolgreich.<br />
Der Südtiroler Bauernbund (SBB) vertritt den Bauernstand in wirtschaftlicher, sozialer,<br />
kultureller und politischer Hinsicht und versucht, ihn zu stärken und zu festigen. Er<br />
vertritt den Stand und die eigenen Mitglieder gegenüber Behörden, Gewerkschaften<br />
und wirtschaftlichen Organisationen. Gegründet wurde er 1904 als Tiroler Bauernbund<br />
und wurde nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut und zu SBB umbenannt.<br />
Deutschland Bayern Italien Südtirol<br />
BIP (mio €) 2.476.800 429.900 1.556.029 17.059<br />
BIP pro Kopf (€) 30.300 34 397 25.700 34.193<br />
Fläche (in km²) 357.108 70.552 301.338 7.400<br />
Einwohner (in Mio.) 82,2 12,5 60,6 0,5<br />
Bevölkerungsdichte<br />
(pro km²)<br />
Landwirtschaftliche<br />
Nutzfläche (in ha)<br />
229 178 201,2 68,6<br />
17 Mio. 3,1 Mio. 12,4 Mio. 272.000<br />
Ø – Betriebsgröße (ha) 45 26 11 2<br />
14
2. Finanzkrise der EU unter besonderer<br />
Berücksichtigung Italiens<br />
Monika Böhm<br />
Die Finanzkrise der EU, auch als Staatsschuldenkrise im Euroraum bezeichnet,<br />
entstand aus den Verschuldungskrisen einiger Mitgliedsstaaten der Eurozone. Diese<br />
können ihren Zahlungsverpflichtungen aus ihrer Verschuldung ohne Unterstützung<br />
Dritter nicht mehr nachkommen. Beginn dieser Krise war im Zeitraum Oktober 2009 bis<br />
April 2010. In diesem Zeitraum hat Griechenland nach einer neuen Regierungsbildung<br />
das tatsächliche Ausmaß seiner bisher verschleierten Haushaltsdefizite und seines<br />
Schuldenstan<strong>des</strong> offengelegt. Nach Griechenland waren auch Irland und Portugal von<br />
der Finanzkrise betroffen. Ebenso haben Italien und Spanien Probleme, am<br />
Kapitalmarkt Kredite aufzunehmen und werden daher genauso zu den Krisenstaaten<br />
gezählt. Die italienische Staatsverschuldung ist nach Griechenland die zweithöchste im<br />
Euroraum und betrug 2010 119% <strong>des</strong> BIP, was fast doppelt so hoch ist wie vereinbart.<br />
Festgestellt wurde das „excessiv deficit“ Italiens am 2. Dezember 2009 von der<br />
Europäischen Kommission. Daraufhin beschloss das italienische Parlament Ende Mai<br />
2010 ein Sparpaket in Höhe von 24 Milliarden Euro. Mit diesem Sparpaket sollte die<br />
jährliche Neuverschuldung bis 2014 unter die Grenze von 3% <strong>des</strong> BIP gesenkt werden.<br />
Weiterhin billigte das italienische Parlament im September 2011 zusätzliche<br />
Sparmaßnahmen. Dazu gehörten unter anderem weitere Einsparungen von 54<br />
Milliarden Euro, sowie eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um einen Prozentpunkt auf<br />
21% und eine Schuldenbremse nach deutschen Vorbild, die 2014 in Kraft treten soll.<br />
Ziel ist es, einen ausgeglichenen Haushalt bis 2013 zu erreichen. Am 16. November<br />
2011 wurde nun Mario Monti neuer Ministerpräsident sowie Wirtschafts- und<br />
Finanzminister Italiens. Dieser brachte noch im Dezember 2011 ein erstes<br />
Reformpaket durch: „Salva Italia“, zu Deutsch „Rette Italien“. In den letzten Wochen<br />
von 2011 erhielt man mittels Auktion neue 10-jährige Staatsanleihen mit einem Zins<br />
von 6,98%, was im Vergleich zur vorangegangenen Auktion im November um 0,58%<br />
billiger war. Und auch bei dreijährigen Anleihen ist der Zins erheblich gefallen, von<br />
7,89% auf 5,62%. Im Vergleich muss beispielsweise Deutschland vielfach gar keine<br />
Zinsen zahlen. Insgesamt brauchte Italien 2012 440 Milliarden Euro um alte Kredite<br />
abzulösen, Zinsen zu zahlen und Haushaltslücken zu schließen.<br />
15
Als Gründe der Finanzkrise Italiens können die politische Agonie, der Schuldenberg,<br />
das Sparpaket und die lahmende Konjunktur genannt werden.<br />
Mit politischer Agonie ist der Politikstil Berlusconis gemeint. Dieser war durch seine<br />
Unberechenbarkeit nicht gerade vertrauensfördernd an den Finanzmärkten.<br />
Unberechenbar war er, weil er heute etwas ankündigt, es morgen doch wieder<br />
zurückzog und es schlussendlich dann doch umsetzte. Als Beispiel lässt sich das lange<br />
Hin und Her über das italienische Sparpaket nennen. Dabei kam es zum Streit mit dem<br />
damaligen Finanzminister Tremonti, was zu Unruhe führte. Außerdem war das Volk<br />
unzufrieden mit der Politik <strong>des</strong> Regierungschefs und wehrte sich gegen die<br />
Sparmaßnahmen mit Protesten in Rom.<br />
Ein weiterer Grund der Finanzkrise ist der hohe Schuldenberg Italiens. Dieser ergab<br />
sich aus den hohen Verbindlichkeiten Italiens; zudem liegt die Gesamtverschuldung<br />
schon seit Jahren über der Wirtschaftsleistung <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong>.<br />
Auch die Sparpakete werden als Grund aufgeführt. Neben den oben genannten<br />
Sparmaßnahmen wurde zusätzlich beschlossen, dass bei einem Einkommen über<br />
300.000€ eine Solidaritätsabgabe von 3% geleistet und das Rentenalter der Frauen<br />
angehoben werden soll. Außerdem sollen Energiekonzerne mit einer Sonderabgabe<br />
zur Haushaltskonsolidierung beitragen. Ein wichtiger Punkt ist noch die schärfere<br />
Verfolgung von Steuerhinterziehern. Auch wenn diese Sparmaßnahmen durchaus<br />
nötig sind, stellt sich die Frage, ob man damit nicht die Konjunktur noch weiter abwürgt.<br />
Diese zusätzlichen Belastungen senken den Konsum und Italien läuft damit Gefahr,<br />
dass sich die Lage noch verschärfen könnte.<br />
Als letzter Grund ist die lahmende Konjunktur Italiens zu nennen. Italien hat schon seit<br />
Jahren ein chronisches Wachstumsproblem, was auch als ein Ergebnis der jahrelang<br />
verschleppten Strukturreformen in der Ära Berlusconi gesehen werden kann. Vor allem<br />
die Wettbewerbsfähigkeit hat darunter stark gelitten. Eine massive Schattenwirtschaft<br />
war ebenso die Folge. Allein 2009 schrumpfte die Wirtschaft um 5%. Somit steht Italien<br />
um einiges schlechter da, als andere große EU-Volkswirtschaften wie Deutschland und<br />
Frankreich.<br />
16
3. Landwirtschaft in Italien<br />
Matthias Steindl, Susanne Höcherl<br />
3.1 Allgemeine Informationen<br />
Die Landwirtschaft Italiens stellt immer noch einen bedeutenden Sektor der<br />
italienischen Volkswirtschaft dar. Die Erwerbstätigen in diesem Bereich haben mit 3,8%<br />
zwar nur einen geringen Anteil an der Gesamtheit der Beschäftigten, vergleicht man<br />
dies jedoch mit den 1,6% der Arbeitnehmer, die in der deutschen Landwirtschaft in<br />
2009 tätig waren, so zeigt sich hier die größere Bedeutung, die der Landwirtschaft in<br />
Italien zukommt. Im Jahr 2008 wurden durch die Landwirtschaft 2% <strong>des</strong> BIP erzeugt,<br />
wohingegen in Deutschland dieser Anteil bei lediglich 0,76% lag. Dieser Vergleich zeigt<br />
die relative Bedeutung der Landwirtschaft Italiens auf. Gemessen am absoluten<br />
Produktionswert zu Herstellungspreisen ist die Landwirtschaft Deutschlands mit 52<br />
Mrd. € jedoch noch leistungsfähiger als die Landwirtschaft Italiens mit 47 Mrd. €,<br />
jeweils im Jahr 2009. Zum Teil liegt das an der landwirtschaftlich genutzten Fläche: laut<br />
FAO wird von den 29 Mio. ha Landfläche nur etwa ein Drittel bewirtschaftet.<br />
Landnutzung in Italien<br />
Jahr 1995 2000 2005 2007 2009<br />
% der<br />
Gesamtfläche<br />
landwirtschaft-<br />
lich genutzt<br />
52,1 53,2 50,1 47,2 31,5<br />
bewaldet 30,3 32,1 33,9 34,6<br />
Ein weiterer Grund <strong>für</strong> die geringere Produktion Italiens könnte die Tatsache sein, dass<br />
49% der genutzten Fläche als benachteiligt oder Berggebiet gelten. So kommen ca.<br />
40% der landwirtschaftlichen Produkte aus der Poebene, auch als Kornkammer Italiens<br />
bezeichnet, da sie sich auf Grund der guten Böden, <strong>des</strong> flachen Gelän<strong>des</strong> und der<br />
Bewässerungsmöglichkeit hervorragend <strong>für</strong> die Landwirtschaft eignet. Nach Süden hin<br />
nimmt die Produktivität ab, das heiße Klima und das eher unwegsame Gelände spielen<br />
hier mit eine wichtige Rolle.<br />
17
Die folgende Tabelle zur Betriebsstruktur liefert u. a. Hinweise darauf, warum in Italien<br />
mehr Menschen in der Landwirtschaft tätig sind als in Deutschland.<br />
Betriebsstruktur 2007<br />
Betriebsgröße<br />
[ha]<br />
Betriebe in<br />
1000<br />
über 50 20 - 50 5 - 20 bis 5<br />
EU 27 698,11 804,31 2553,16 9644,82<br />
DE 85,36 81,94 119,62 83,57<br />
I 40,01 83,42 325,31 1230,70<br />
Die Statistik aus dem Jahr 2007 zeigt, dass Italien einen sehr hohen Anteil an<br />
Betrieben kleiner 5 ha aufweist, was 12,7% an der Gesamtheit dieser Betriebe in<br />
Europa ausmacht. Weiterhin liegt Italien mit 1,67 Mio. Betrieben insgesamt an dritter<br />
Stelle in Europa. Nur in Rumänien und Polen gibt es noch mehr. Der Unterschied<br />
zwischen großen und kleinen Betrieben in Italien ist vor Allem zwischen Südtirol und<br />
der Poebene deutlich und hat auch eine Auswirkung auf die Interessensvertretung der<br />
Landwirte. Es existiert kein einheitlicher Verband wie der BBV, sondern einer <strong>für</strong> die<br />
kleinen und ein anderer <strong>für</strong> die großen Betriebe.<br />
Auf Grund anderer klimatischer und geographischer Gegebenheiten unterscheiden<br />
sich die produzierten Güter und damit auch deren Mengen erheblich von der<br />
deutschen Landwirtschaft.<br />
Produktion ausgewählter Feldfrüchte<br />
Produkt Getreide Zuckerrüben Soja Gemüse Obst<br />
Produktionsfläche<br />
(1000 ha)<br />
DE 6500 383,6 0 107 47,7<br />
I 3143 60,6 165 487 428,6<br />
Italien ist beispielsweise auf Zucker- und Getreideimporte angewiesen, wohingegen z.<br />
B. 30% <strong>des</strong> nach Deutschland importierten Frischobsts aus Italien stammen.<br />
18
3.2 Pflanzenbau<br />
Der Obstanbau ist <strong>für</strong> Italien sehr bedeutsam. Im Vordergrund stehen dabei: Äpfel,<br />
Orangen, Feigen und Datteln. Aber auch Tomaten und Kartoffeln zählen als wichtige<br />
Agrarprodukte.<br />
Vor allem Weizen, Mais und Reis, aber auch Zuckerrüben, Obst- und Gemüse wird<br />
auf den Ackerflächen Norditaliens angebaut. Apfelsinen- und Zitronenbäume findet<br />
man hingegen in den Küstenregionen von Sizilien, Kalabrien, Kampanien und<br />
Sardinien, weil sie auf ein warmes, maritimes Klima und gut bewässerte Böden<br />
angewiesen sind. Sehr charakteristisch <strong>für</strong> das Landschaftsbild Italiens sind<br />
Ölbaumkulturen. So werden Oliven und Olivenöl hauptsächlich in Sizilien, Kalabrien<br />
und Apulien produziert. Italien gehört, was die Produktion von Olivenöl betrifft, weltweit<br />
zu den führenden Nationen und nimmt sogar den 2. Platz ein, gleich hinter Spanien.<br />
Auch der Weinbau ist in Italien weit verbreitet. Er nimmt eine Anbaufläche von mehr als<br />
908.000 ha ein. Nach Frankreich ist Italien sogar der zweitgrößte Produzent auf der<br />
Welt. So werden jährlich über 60 Mio. Hektoliter Wein hergestellt.<br />
3.3 Tierhaltung<br />
Neben dem Ackerbau nimmt die Rinderzucht und die Zucht von Schafen und<br />
Schweinen eine bedeutende Rolle ein. Die Emilia Romagna im Norden Italiens gilt als<br />
Zentrum <strong>für</strong> die Schweinezucht im Lande. So werden große Teile <strong>des</strong> Fleisches zu<br />
Wursterzeugnissen verarbeitet und anschließend exportiert.<br />
Die größte Bedeutung hat jedoch in Norditalien die Rinderzucht. Hier im Norden findet<br />
man auch die meisten Molkereien. Die Milchwirtschaft ermöglicht eine Herstellung von<br />
etwa 50 verschiedenen Käsesorten, zu denen auch der bekannte Parmesan oder<br />
Gorgonzola zählen.<br />
Nach Süden hin nimmt die Zahl von Rindern und Schweinen eher ab. Hier werden v.a.<br />
Ziegen und Schafe extensiv gehalten, da es hier zu trocken ist <strong>für</strong> ergiebige<br />
Weideflächen.<br />
19
4. Die Landwirtschaft der Emilia Romagna<br />
Sarah Seiler, Stefan Schütz<br />
Die Landwirtschaft der Emilia Romagna zeichnet sich durch die Erzeugung,<br />
Verarbeitung sowie Herstellung traditioneller Lebensmittel mit geografischer<br />
Ursprungsbezeichnung aus. Weltweit bekannt ist neben dem Parmaschinken<br />
(Prosciutto di Parma), der Parmesankäse (Parmigiano-Reggiano) oder der Balsamico-<br />
Essig (Aceto Balsamico Tradizionale di Modena). Trotz dieser Bekanntheit trägt die<br />
Landwirtschaft der Region nur mit 2,4% zu einem eher unbedeutend Teil <strong>des</strong> BIPs bei.<br />
5,5% der Bewohner <strong>des</strong> ländlichen Raumes sind in der Landwirtschaft beschäftigt.<br />
60% der Fläche werden landwirtschaftlich genutzt, davon 77,6% als Ackerland (ca. 1<br />
Mio. ha), 13,6% <strong>für</strong> Dauerkulturen und 8,7% als Dauergrünland. Die durchschnittliche<br />
Betriebsgröße beträgt 13,6 ha (Italien: 6,7 ha, EU 16 ha).<br />
Einige der größten Hersteller landwirtschaftlicher Maschinen, wie Goldoni und Landini,<br />
sowie der auch in Deutschland bekannte Nudelproduzent Barilla sind hier ansässig.<br />
Die Biobranche ist ein aufstrebender Zweig, auch in der Emilia-Romagna. 2010 gab es<br />
1700 Biobetriebe, die 7,2% der Fläche ökologisch bewirtschafteten. Dies sind 2,5% der<br />
landwirtschaftlichen Betriebe in der Region. Außerdem waren 2010 über 400 Betriebe<br />
in der Umstellung. Dies zeigt die große Dynamik der Branche.<br />
Die Region wird unterteilt in neun verschiedene Provinzen. Im Norden wird die Region<br />
durch den Fluss Po begrenzt. Es schließt sich die besonders fruchtbare Poebene an,<br />
die ein sehr hohes Ertragsniveau ermöglicht. Hier wird eines der höchsten Verhältnisse<br />
von Aussaat und Ernte in Italien erreicht. Im Süden werden alle Provinzen, mit<br />
Ausnahme der Provinz Ferrara, vom Apennin durchzogen. Das Bergland nimmt ein<br />
Anteil von 25 % an der Gesamtfläche der Emilia Romagna ein. Die Provinz Rimini hat<br />
Anschluss an das Adriatische Meer. Hier spielt daher die Fischerei eine Rolle. Das<br />
gemäßigte Klima (700mm, 13°C) ermöglicht den Anbau verschiedenster Kulturen. Die<br />
geografischen Besonderheiten haben jedoch Auswirkungen auf die Auswahl an<br />
regional hergestellten landwirtschaftlichen Produkten. Die typischen Feldfrüchte sind<br />
Getreide (vor allem Weizen und Mais), Obst (Pfirsiche, Birnen, Äpfeln, Aprikosen,<br />
Pflaumen und Kirschen), sowie Gemüse (Fenchel, Tomaten, Salat, Rüben, Rettich,<br />
Karotten, Kartoffeln, Zucchini, Kürbis, Paprika, Gurken und viele andere). Wein wird<br />
auf bis zu 800 Meter Höhe auf über 55.000 ha angebaut. Die vorherrschenden<br />
Rebsorten sind Albana, Sangiovese und Trebbiano. Die daraus resultierenden Weine<br />
20
sind in der Regel leicht und einfach. International bekannt ist der Lambrusco, ein leicht<br />
schäumender Wein und der berühmte Balsamico-Essig, der aus weißen Weintrauben<br />
gewonnenen wird.<br />
Die Viehwirtschaft hat sich stark in die Richtung Schweine- und Rinderzucht entwickelt.<br />
Die Zucht <strong>des</strong> „Mora Romagnola“-Schweins, auch „Black Pig“, hat die Region in der<br />
Vergangenheit stark geprägt. Es wurde in den Tälern und Hügeln <strong>des</strong> romagnolen<br />
Apennin gehalten, spielt aber heute mit nur 1500 Exemplaren eine unbedeutende<br />
Rolle. Die Produktion der Rassen Large White, Landrance und Duroc ist bedeutender,<br />
da nur aus ihnen der Parmaschinken hergestellt wird.<br />
21
5. Betrieb Grana Padano Familie Nordera<br />
Dominik Hoffmann, Beat Vinzent<br />
Empfangen wurden wir nach einem kurzen Zwischenstopp in Verona von einem<br />
örtlichen Bauernverbandsfunktionär und der Betriebsleiterin. Der Betrieb befindet sich<br />
in der Nähe von Verona, einer sehr landwirtschaftlich geprägten Region. Von Ackerbau<br />
über Milchvieh bis Obst und Weinbau sind alle Kulturen vertreten. Bewirtschaftet wird<br />
der Betrieb als größerer Familienbetrieb mit fünf Fremd-AK <strong>für</strong> alle Betriebsbereiche.<br />
Der 1920 gegründete Betrieb wird heute in der dritten Generation geführt und stützt<br />
sich auf drei Standbeine.<br />
5.1 Milchvieh<br />
Der Milchviehbereich ist der arbeits- und kostenintensivste aber zugleich einträglichste<br />
Betriebszweig. Zum Bestand zählen 850 HF Tiere, wovon 400 , mit einer<br />
Jahresdurchschnittsleistung von 10100kg Milch, in der Laktation stehen. Bei zwei<br />
Melkzeiten täglich ergeben sich so ca. 12,5 t Milch pro Tag. 180 Kühe können in dem<br />
2007 errichteten Melkkarussel pro Stunde gemolken werden. Die Milch wird an Parma<br />
Latte geliefert, die größte Molkerei Italiens. Der Milchpreis liegt aktuell bei 38 Cent und<br />
wird alle 3 Monate neu verhandelt.<br />
Lan<strong>des</strong>weit liegt die Nutzungsdauer von Milchkühen laut Aussage <strong>des</strong><br />
Herdenmanagers bei 1,2 Laktationen pro Kuh, den dieser Betrieb mit 2,8 deutlich<br />
übertrifft. Als Hauptgrund <strong>für</strong> die niedrige Nutzungsdauer wurden<br />
Fruchtbarkeitsprobleme genannt. Die Erstbelegung erfolgt mit 17 Monaten. Die Kälber<br />
werden 2 Monate in Einzelboxen gehalten und bekommen die ersten 100 Tage Milch.<br />
Zusätzlich werden den jungen Kälbern zur besseren Entwicklung <strong>des</strong> Magen-<br />
Darmtraktes schon früh Baumwollsamen gefüttert, die durch ihre pelzige Schale einen<br />
hohen Rohfasergehalt aufweisen. Interessant zu erwähnen scheint noch, dass das<br />
Jungvieh im Herbst auch aus Gründen der Arbeitswirtschaft <strong>für</strong> einige Zeit auf die<br />
Weide kommt.<br />
Die Kühe sind in 3 Gruppen nach Leistungsklassen unterteilt, wobei die Fütterung über<br />
die täglich zugeteilte Futtermenge, nicht über die Futterzusammensetzung an die<br />
Milchleistung angepasst wird. Den <strong>für</strong> die Tierleistung widrigen hohen<br />
22
Sommertemperaturen wird durch eine Drosselung der Milchleistung durch geringere<br />
Futtervorlage sowie möglichst wenige Abkalbungen im Sommer Rechnung getragen.<br />
Die Betriebsinhaber haben vor, in Zukunft die Anzahl der Melkungen auf täglich drei zu<br />
erhöhen und noch 200 - 300 Kühe mehr zu halten . Dementsprechend soll auch die<br />
Betriebsfläche wachsen, die momentan 130 ha umfasst. Auf 100 ha wird Silomais<br />
(Ertragsniveau bis zu 60t FM/ha), auf dem Rest Luzerne und Heu produziert. Wegen<br />
<strong>des</strong> hohen Wirtschaftsdüngeranfalls und der schon heute damit verbundenen<br />
Nitratproblematik ist außerdem die Errichtung einer Biogasanlage geplant, die mit der<br />
anfallenden Rindergülle betrieben werden soll, was die hohen Ausbringungsmengen<br />
an Nitrat vermindern könnte. Eine Zupacht von Flächen ist bei einem Pachtniveau von<br />
derzeit ca. 200 – 300 €/ha kaum eine Lösung. Die Gesetzgebung bezüglich<br />
Höchstmengen an ausgebrachten Wirtschaftsdüngern und Sperrfristen sind den<br />
deutschen Regelungen sehr ähnlich. Zudem würde eine Biogasanlage die nach<br />
Angaben der Betriebsleiterin oft auftretende Geruchsproblematik und die damit<br />
verbundenen Anwohnerbeschwerden lösen. Wie in Deutschland existieren auch in<br />
Italien Förderprogramme <strong>für</strong> derartige Projekte (Vergütung zurzeit 20 Cent/KWh),<br />
deren Finanzierung in Zukunft allerdings als unsicher gilt.<br />
Auf Nachfrage teilte der Vertreter <strong>des</strong> Bauernverban<strong>des</strong> mit, dass trotz <strong>des</strong> hohen<br />
Maisanteils in der Fruchtfolge bei den meisten Betrieben Maiszünsler und<br />
Maiswurzelbohrer heute noch keine ernstzunehmenden Bedrohungen darstellen.<br />
Grüne Gentechnik wird vom Bauerverband nach Aussage <strong>des</strong> Verbandvertreters<br />
abgelehnt. Begründet wurde dies mit einer Zunahme der Gleichheit und<br />
Auswechselbarkeit von Lebensmitteln, die mit dem Gedanken einer hohen Qualität und<br />
Individualität der landwirtschaftlich erzeugten Produkte nicht einhergehe. Wirklich offen<br />
wollte sich zu diesem Thema aber niemand der Beteiligten äußern.<br />
5.2 Forellenzucht<br />
Das zweite Standbein der Familie bildet die Forellenzucht. Die Fische werden 14<br />
Monate lang in 13 - 16°C kaltem Wasser gemästet, wobei die Becken in einen<br />
vorhandenen Bach eingefügt wurden und nicht über eine zusätzliche Klärung verfügen.<br />
Während die Jungforellen früher noch zugekauft wurden, werden heute in jedem Jahr 1<br />
Mio. Eier zur Brut herangezogen, von denen am Ende 92% eingesetzt werden. Der<br />
tägliche Arbeitsaufwand besteht nur aus der Kontrolle und dem Füttern, sodass in<br />
diesem Betriebszweig eine AK arbeitet. Das Futter setzt sich überwiegend aus Soja<br />
23
und Fischmehl zusammen. Das Mastendgewicht der Forellen beträgt 300 - 400<br />
Gramm, wo<strong>für</strong> Preise von 2,30 €/kg Lebendgewicht gezahlt werden. Da es im Sommer<br />
in der Region um Verona oft hohe Temperaturen von über 30°C hat und die Forellen<br />
dann eventuell unter Sauerstoffmangel leiden könnten, wird das Wasser bei Bedarf zur<br />
O2-Anreicherung umgewälzt.<br />
5.3 Kaninchenmast<br />
Zum Abschluss warfen wir noch einen kurzen Blick in die betriebseigene<br />
Kaninchenmast, die den dritten Betriebszweig darstellt. 1,5 AK sind hier seit 1996 mit<br />
der Betreuung von 1500 Häsinnen betraut, die alle 49 Tage Nachwuchs zur Welt<br />
bringen. Die Wurfgröße beträgt etwa 7 - 10 Tiere, wobei die Würfe aufgrund der<br />
ausgeprägten Rangfolge und der damit verbundenen Gefahr von Kannibalismus<br />
möglichst bis zum Ende der Mast als Gruppe zusammenbleiben sollten., Vermarktet<br />
werden die Kaninchen lebend nach einer Mastdauer von 85 - 90 Tagen mit 2,5 kg<br />
Endgewicht. Die Erlöse betragen derzeit ca. 1,85 €/kg und werden jede Woche neu mit<br />
den Abnehmern ausgehandelt. Hier bestehen Partnerschaften mit großen<br />
fleischverarbeitenden Betrieben in der Region wie z.B. Aya und Veronesi. Bei der<br />
Rasse setzt der Betrieb auf französische Abstammungen, da diese unter anderem eine<br />
hohe Fruchtbarkeit aufweisen. Die Besamung der Kaninchen erfolgt künstlich, die<br />
Aufnahmeraten liegen im Schnitt bei 85 %.<br />
Zusammenfassend war der Betrieb ein sehr eindrucksvolles Beispiel <strong>für</strong> einen<br />
innovativen und stark vom Wachstum geprägten landwirtschaftlichen Betrieb, der<br />
größtenteils aber immer noch von einer Familie bewirtschaftet wird.<br />
24
6. Die Stadt Parma<br />
Roswitha Aumann<br />
Parma ist eine Großstadt mit 186.690 Einwohnern in der südwestlichen Poebene. Sie<br />
liegt in der Region Emilia Romagna und grenzt im Norden an die Lombardei und<br />
Venetien, im Westen und Süden an die Berge <strong>des</strong> toskanisch-romagnolischen<br />
Appennins und im Osten an die Adria.<br />
Die Po-Ebene ist ein etwa 50.000 km² großes, fruchtbares Tiefland, benannt nach dem<br />
größten Fluss Italiens, dem Po. Sie entstand seit dem Tertiär durch Sedimentation der<br />
Alpenflüsse in die vorgelagerte geologische Senke, die abwechselnd Festland bzw.<br />
Flachmeer war.<br />
Die Stadtgeschichte Parmas geht bis auf die Etrusker zurück: der römische Konsul<br />
Marcus Lepidus gründete die Stadt im Jahre 184 v. Chr am rechten Ufer <strong>des</strong> Flusses<br />
“Parma”.<br />
Heute ist Parma, neben Mailand, Bologna, Turin, Genua und Venedig, ein führen<strong>des</strong><br />
Wirtschaftszentrum Norditaliens, mit Schwerpunkt in der Lebensmittelindustrie.<br />
International tätige Unternehmen wie Barilla oder Parmalat haben ihren Sitz in Parma.<br />
Dies ist bereits ein Hinweis da<strong>für</strong>, wie gut die Region <strong>für</strong> die Landwirtschaft geeignet<br />
ist: Wegen der sehr fruchtbaren Böden in der Po-Ebene und dem eher kontinental<br />
geprägten Klima ist die Gegend prä<strong>des</strong>tiniert <strong>für</strong> Viehhaltung und Ackerbau. Besonders<br />
etabliert haben sich der Anbau von Mais, Weizen, Zuckerrüben und auch Wein. Früher<br />
wurde auch Reis angebaut, weshalb das Risotto eines der lan<strong>des</strong>typischen Gerichte<br />
Norditaliens ist.<br />
Die wohl bekanntesten Produkte aus Parma sind der Parmesankäse „Parmigiano<br />
Reggiano“ und der Parmaschinken,bei<strong>des</strong> Erzeugnisse mit geschützter<br />
Ursprungsbezeichnung. Dies bedeutet, dass die besonderen Merkmale und die<br />
Verbundenheit mit dem Ursprungsgebiet durch ein System von EU-Vorschriften<br />
garantiert werden, wodurch sowohl Verbraucher als auch Hersteller geschützt werden.<br />
25
So darf der Käse das Kennzeichen<br />
„Parmigiano Reggiano“ nur dann tragen,<br />
wenn er am Ursprungsort hergestellt und<br />
weiterverarbeitet wurde und die strengen<br />
Vorgaben bezüglich Herstellung,<br />
Ausgangsmaterialien und Kennzeichnung<br />
erfüllt.<br />
Die Milch <strong>für</strong> den Parmigiano Reggiano darf<br />
beispielsweise nur von Kühen stammen, die<br />
ausschließlich mit Gras und Grasprodukten<br />
gefüttert wurden. Futtermittel wie Silage und<br />
fermentiertes Futter, sowie Futtermittel tierischen Ursprungs und bestimmte<br />
Nebenprodukte der Lebensmittelindustrie sind untersagt.<br />
Auch die Herstellung von Parmaschinken unterliegt strengen Regeln. Beispielsweise<br />
dürfen die Schweine, deren Fleisch <strong>für</strong> die Herstellung verwendet wird, nur aus 11<br />
festgesetzten Regionen Nord- und Mittelitalien stammen, müssen min<strong>des</strong>tens 9<br />
Monate alt sein und dürfen nicht weniger als 145 Kilo wiegen.<br />
Des Weiteren hat die 2002 gegründete „Europäische Behörde <strong>für</strong><br />
Lebensmittelsicherheit“ (EFSA) ihren Sitz in Parma. Ihre Aufgabe ist es, über<br />
bestehende und neu auftretende Risiken in Zusammenhang mit der Lebensmittelkette<br />
zu informieren und wissenschaftliche Beratung anzubieten. Dabei deckt die Arbeit der<br />
Behörde alle Themen ab, die direkte oder indirekte Auswirkungen auf die Lebensmittel-<br />
und Futtermittelsicherheit haben, einschließlich Tier- und Pflanzengesundheit. Die<br />
EFSA hilft effektive und zeitnahe Risikomanagemententscheidungen zu treffen, und<br />
berät bei der Zulassung geregelter Stoffe wie Pestiziden oder<br />
Lebensmittelzusatzstoffen.<br />
Natürlich hat Parma auch kulturell und kunstgeschichtlich einiges zu bieten. Der im<br />
Dom und Baptisterium von Parma<br />
26<br />
Parmigiano Reggiano und Parmaschinken<br />
11.Jahrhundert erbaute Dom „Santa Maria<br />
Assunta“ mit dem achteckigen Baptisterium,<br />
das 985 gegründete Kloster „San Giovanni<br />
Evangelista“ und der Palazzo della Pilotta sind<br />
nur Beispiele aus der großen Anzahl an<br />
Sehenswürdigkeiten.
7. Antica Corte Pallavicina, Restaurant Al<br />
Cavallino Bianco<br />
Martin Kotschenreuther, Patricia Braun<br />
Am ersten Tag waren wir bei den Brüdern Spigaroli zu Besuch, die bekannt <strong>für</strong> die<br />
Herstellung <strong>des</strong> Culatello-Schinkens sind. Bei diesem Schinken handelt es sich nicht<br />
um Parma-Schinken, da sich die Herstellung maßgeblich unterscheidet, wie Massimo<br />
Spigaroli betonte. Für den Culatello werden nur die oberen Hinterviertel von Schweinen<br />
der alten Rasse „Mora Romagnola“ (Black Pig) verwendet, welche zuvor zwei Jahr in<br />
Freilandhaltung auf der Basis von Mais, Eicheln und Kastanien auf ca. 250 Kilogramm<br />
gemästet wurden.<br />
Haut und Fett werden nach der Schlachtung entfernt sowie der Schinken entbeint. Der<br />
zwischen 15 und 20 Kilogramm schwere Schinken wird dann mit Pfeffer, Salz und<br />
Knoblauch sowie dem rotem Fortana-Wein einmassiert. Danach wird der Culatello-<br />
Schinken in eine durchlöcherte Schweineblase eingenäht. Dadurch erlangt der<br />
Schinken sein typisch birnenförmiges Aussehen.<br />
Die komplette Verarbeitung darf nur in den Monaten Oktober bis Februar erfolgen.<br />
Grund hier<strong>für</strong> ist das feuchte Klima der Po-Ebene, welches <strong>für</strong> die hohe Qualität<br />
notwendig ist. 15 bis 18 Monate Trocknung und Reifung im Hause Spigaroli sind dann<br />
bei geöffnetem Fenster <strong>des</strong> Kellers nötig. Durch die Bildung von Edelschimmel erhält<br />
der Schinken seinen typischen Geschmack. Da<strong>für</strong> ist jedoch, wie bereits<br />
angesprochen, das Klima der Po-Ebene nötig. Während der Reife verliert der Schinken<br />
mehr als 50 Prozent seines Gewichts. Somit bleiben nach der Reife nur noch sechs<br />
Kilogramm feinster Schinken übrig. Das Kilogramm kostet jedoch min<strong>des</strong>tens 60 Euro.<br />
Von der Herstellung und der Qualität <strong>des</strong> Schinkens konnten wir uns im Keller <strong>des</strong><br />
Antica Corte Pallavicina persönlich überzeugen. Nachdem wir uns zwischen den<br />
schätzungsweise 5000-6000 Schinken, die von den Decken <strong>des</strong> Kellers herunter<br />
hingen, hindurch geschlängelt hatten, war <strong>für</strong> unsere Gruppe bereits eine Schinken-<br />
Verköstigung mit hauseigenem Fortana-Wein und Salami hergerichtet.<br />
Neben den Schweinen werden auch noch Kühe sowie Geflügel bei den Brüdern<br />
Spigaroli gehalten. Der hergestellte Schinken wird kaum exportiert, da auf eine<br />
regionale Vermarktung bei den Brüdern Spigaroli sehr viel Wert gelegt wird. Da<strong>für</strong><br />
stehen auch die zwei von ihnen betriebenen Restaurants zur Verfügung.<br />
27
Wir konnten abschließend noch im Restaurant Al Cavallino Bianco die hauseigenen<br />
Köstlichkeiten bei einem Aben<strong>des</strong>sen probieren, bevor es wieder zur Übernachtung<br />
nach Verona ging.<br />
28
8. Käserei „Parmigiano Reggiano“<br />
Maximiliane Landwehr, Anna Bilgeri<br />
Am zweiten Exkursionstag besuchten wir die Produktionsstätte <strong>des</strong> bekannten Käses<br />
„Parmigiano Reggiano“. Diese Spezialität ist fest mit dem Gebiet seines Ursprungs,<br />
„zona d´origine“, verbunden. Die Milch <strong>für</strong> dieses Produkt wird in den Provinzen<br />
Modena, Reggio-Emilia, Parma und Bologna produziert, ebenso wird der Rohstoff in<br />
diesen Gebieten verarbeitet. Nur Milch von Kühen, die nach strengen Vorschriften<br />
gefüttert werden, darf zur Herstellung verwendet werden. So dürfen die Tiere weder mit<br />
Silage noch mit anderem vergorenem Futter gefüttert werden. Bestimmte Futtermitteln<br />
aus der Lebensmittelindustrie und Futtermittel tierischen Ursprungssind verboten. Da<br />
die Kühe ausschließlich Futtermittel in Form von Heu und Kraftfutter aufnehmen, erhält<br />
der Käse seine typische Struktur und seinen milden Geschmack. In der Käserei wird<br />
die Milch von ca. 270.000 Kühen verarbeitet. Parmigiano Reggiano wird ohne Zugabe<br />
von Zusatzstoffen ausschließlich aus Rohmilch hergestellt. Im Folgenden werden die<br />
einzelnen Schritte der Produktherstellung näher erläutert.<br />
Die Abendmilch wird über Nacht im Aufrahmbecken gelagert. Von dort wird sie am<br />
nächsten Morgen, teilentrahmt, mit der rohen Vollmilch <strong>des</strong> Morgens in Kupferkesseln<br />
(der Betrieb besitzt 18 Kessel) vermischt. Der anfallende Rahm wird verkauft oder<br />
teilweise zur Butterherstellung verwendet. Nach dem Erwärmen der Milch wird diese<br />
mit sogenannten Säureweckern, einer Kultur von natürlichen Milchfermenten, die man<br />
Käser teilen den Kesselinhalt in zwei gleich große<br />
Stücke<br />
29<br />
aus der Restmolke der Herstellung<br />
vom Vortag erhält, versetzt.<br />
Anschließend wird Lab zugegeben<br />
und somit die Gerinnung der Milch<br />
eingeleitet. Die geronnene Milch<br />
wird mit dem „Spino“ (=Käseharfe)<br />
in kleine Körnchen zerkleinert. Im<br />
nächsten Schritt wird der<br />
Kesselinhalt 10 min auf 55 °C<br />
erwärmt. Hierbei wird dem eben<br />
gewonnenen Bruch Wasser<br />
entzogen. Darauf folgt eine einstündige Ruhephase in der sich aus den Körnchen eine
homogene Masse bildet. Die entstandene Käsemasse wird in einem Leintuch per<br />
Hand zu einem kompakten Stück geformt. Als Nebenprodukt entsteht Molke, die <strong>für</strong><br />
die Käseherstellung <strong>des</strong> nächsten Tages verwendet oder an Schweine verfüttert wird.<br />
Die Käser heben die Masse nun aus dem Kessel und schneiden sie in zwei gleich<br />
große Stücke. Aus einem Kupferkessel, der 120 Liter fasst, entstehen also nur zwei<br />
Käselaibe. Diese werden dann <strong>für</strong> zwei bis drei Tage in spezielle Formen „fascera“<br />
gegeben, durch die dieser Käse auch seine typische Form erhält. Bevor der Käse<br />
weiter bearbeitet wird, erhält er seine speziellen Ursprungsmakierungen. Danach wird<br />
auf dem gesamten Umfang <strong>des</strong> Käses der gepunktet Schriftzug „Parmigiano<br />
Reggiano“ eingeprägt und die Registrierungsnummer der Molkerei und das Jahr der<br />
Herstellung wiedergegeben. Außerdem wird auf der Oberseite eine Kaseinplakette<br />
angebracht. Mithilfe dieser Kennzeichnung kann jeder einzelne Laib identifiziert<br />
In diesen Regalen findet die<br />
Reifung statt<br />
30<br />
werden. Anschließend wird der Käse 20 Tage in eine<br />
definierte Salzlake getaucht. Dabei wird das Salz<br />
absorbiert, was <strong>für</strong> den Geschmack <strong>des</strong> Käseteiges<br />
und <strong>für</strong> die lange Reifung entscheidend ist. Das Salz<br />
benötigt min<strong>des</strong>tens acht Monate, bis es auch in den<br />
Kern <strong>des</strong> Käselaibes eingedrungen ist. An diesen<br />
Schritt schließt die Reifung an. Die Laibe werden in<br />
Holzregale geschichtet, dort werden „junge Laibe“<br />
ca. alle fünf Tage und „alte Laibe“ ca. alle 14 Tage<br />
mit Hilfe einer speziellen Maschine gebürstet und<br />
anschließend gewendet. Durch diesen Arbeitsschritt<br />
wird eine Schimmelbildung verhindert. Die Reifezeit<br />
dauert bis zu 24 Monate und länger. Während dieser<br />
Zeit verfeinern sich dich die Aromen und der Käse<br />
erhält seine typische Struktur. Nach Beendigung der Min<strong>des</strong>treifezeit (12 Monate) wird<br />
jeder Laib einer Expertise unterzogen. Hierbei werden das Äußere <strong>des</strong> Käses, seine<br />
Struktur und die Beschaffenheit <strong>des</strong> Käseteiges bewertet. Die Prüfer beklopfen den<br />
Käse mit einem Hämmerchen und erkennen am Klang die Qualitätsstufen <strong>des</strong><br />
Parmesans. Werden die Kriterien erfüllt, erhält der Laib das Gütesiegel in Form eines<br />
Brandsiegels. Dies trägt den ovalen Schriftzug „Parmigiano- Reggiano Consorzio<br />
Tutela“ und das Jahr der Herstellung. Käselaibe, die Fehler aufweisen, bekommen eine<br />
Markierung in Form von Rillen, die den ganzen Laib umziehen. Diese werden
aussortiert und z.B. zu Reibekäse verarbeitet. Nach der Führung durch die Käserei<br />
gab es noch eine Parmesanverkostung.<br />
31
9. Besichtigung Betrieb Torre (Parmigiano<br />
Reggiano Produktion)<br />
Sascha Braun, Dominik Sojer<br />
Am Dienstagvormittag, 29.05.2012, besichtigten wir den Milchviehbetrieb der Familie<br />
Torre in der Region Parma. Der Betrieb hält 270 Tiere der Rasse Holstein-Friesian; die<br />
Betriebsfläche beträgt 50 Hektar. Die 100 Milchkühe werden in 5 Boxen zu je 20 Tieren<br />
getrennt gehalten, die in 5 Leistungsgruppen eingeteilt sind. Der Liegebereich war als<br />
Tiefstreubox ausgelegt, von wo aus die Tiere in den Laufhof gehen können, der<br />
planbefestigt ist und in den Fütterungsbereich übergeht; der planbefestigte<br />
Betonboden wird mit Schiebeentmistung abgeräumt.<br />
Der Juniorchef <strong>des</strong> Betriebes klärte uns über die Futterration auf. Parmesan ist ein<br />
Heumilchkäse, es darf also weder Gras- noch Maissilage verfüttert werden. Deshalb<br />
wird ausschließlich Luzerneheu und Heu aus Dauergrünland ad libitum verfüttert,<br />
zusätzlich zu den 10kg Kraftfutter, bestehend aus Mais, Getreide, Mineralfutter und<br />
Sojaschrot. Die Milchleistung der Tiere liegt im Durchschnitt bei 30kg und maximal bei<br />
50kg pro Tag, daraus ergibt sich eine Jahresleistung von 9.000 bis 10.000 Liter,<br />
welche in einem Doppel-5er-Fischgrätenmelkstand ermolken wird. Die Laktationsdauer<br />
beträgt 300 Tage, 4 bis 5 Laktationen lang. Die Milch wird zweimal täglich warm<br />
abgeholt und in der Molkerei direkt weiterverarbeitet. Der Eiweißgehalt der Milch liegt<br />
bei 3,5% bis 3,7%. Der Fettgehalt sollte nicht über 4,0% steigen, da es sonst Abzüge<br />
durch die Molkerei gibt.<br />
Auf den 50 Hektar Grund, der teilweise gepachtet ist, stand zum Großteil<br />
Dauergrünland. Auf der restlichen Fläche wurde Luzerne zum Heuen <strong>für</strong> 4 bis 5 Jahre<br />
angebaut und im Anschluss <strong>für</strong> 1 bis 2 Jahre Weizen oder anderes Getreide. Das<br />
Luzerneheu wies eine außerordentlich gute Qualität auf, da es mit speziellen<br />
Maschinen gewendet wird. Das Stroh zum Einstreuen wird teilweise auf dem eigenen<br />
Betrieb erzeugt und teilweise <strong>für</strong> 11 Euro je 100kg zugekauft. Durch den vielen<br />
anfallenden Mist erspart sich der Betriebsleiter organischen Dünger, den er sonst<br />
kaufen müsste. In diesem Sommer wurde auch Luzerneheu <strong>für</strong> 13 Euro je 100kg<br />
zugekauft, das allerdings eine wesentlich schlechtere Qualität hatte, da es nur aus<br />
Stielen bestand.<br />
32
Am Ende erklärte uns der Seniorchef seine Zuchtstrategie. Bei den 30% künstlichen<br />
Besamungen wird hauptsächlich auf Spitzensamen von kanadischen Bullen gesetzt,<br />
um die Genetik aufzubessern. Die restlichen 70% der Kühe werden vom eigenen<br />
Bullen im Natursprung gedeckt, der nur 2 Jahre am Hof bleibt, um Inzucht zu<br />
vermeiden. (Der Seniorchef betonte, dass sie als Italiener besonders auf den Spaß der<br />
Kühe und so längere Nutzung setzen und <strong>des</strong>halb den Bullen bevorzugen!) Die<br />
männlichen Kälber werden nach zwei Wochen <strong>für</strong> 60 – 70 Euro verkauft.<br />
Der Milchpreis betrug 2010 78 Cent pro Liter Milch und wird 2012 voraussichtlich auf<br />
60 Cent sinken. Allerdings wird der Preis nicht direkt ausgezahlt, sondern errechnet<br />
sich aus den Verkaufspreisen <strong>des</strong> fertigen Parmesans. Deshalb bekommen die<br />
Landwirte erst ca. 18 Monate später ihr Geld. Mit 50 ct/l Milch Produktionskosten<br />
ergeben sich mit 10 Cent Gewinn ähnliche Margen wie bei uns in Bayern.<br />
33
10. Stadtführung Verona<br />
Jana Heimsoeth, Mirco Raddatz<br />
10.1 Daten und Fakten<br />
Die Stadt Verona ist Hauptstadt der Provinz Verona und liegt an der Etsch in der<br />
Region Venetien. Mit rund 264.000 Einwohnern und ihren zahlreichen<br />
Sehenswürdigkeiten ist Verona einer der Hauptanziehungspunkte <strong>für</strong> den Tourismus in<br />
Norditalien. Die Region ist eine der wirtschaftlich stärksten <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> und neben dem<br />
Fremdenverkehr hauptsächlich bekannt <strong>für</strong> Textil- und Lebensmittelindustrie sowie die<br />
Landwirtschaft. Die Altstadt von Verona wurde im Jahr 2000 von der UNESCO zum<br />
Weltkulturerbe erklärt. Je<strong>des</strong> Jahr besuchen etwa 7 Mio. Touristen die Stadt.<br />
10.2 Geschichtliches<br />
Die Wurzeln Veronas reichen zurück bis in die vorchristliche Zeit. Als Kolonie <strong>des</strong><br />
römischen Reiches entwickelte es sich zur größeren Stadt. In dieser Zeit entstand auch<br />
das noch heute genutzte Amphitheater. Im 12. Jahrhundert wurde Verona mit eigenen<br />
Stadtrechten selbstständig. Im Mittelalter während der Herrschaft der Scaliger wird<br />
Verona zu einem Zentrum der Kunst und Kultur. Ab 1387 gehörte es zu Mailand und<br />
fiel 1405 an die Republik Venetien. In dieser Zeit erlebte es eine kulturelle Blüte, in der<br />
viele der zahlreichen noch heute erhaltenen Baudenkmäler entstanden. Nach dieser<br />
Zeit gelangte es 1797 unter österreichische Herrschaft, bevor es 1866 an das<br />
Königreich Italien fiel.<br />
10.3 Geographische Lage<br />
Verona liegt wenige Kilometer entfernt vom Gardasee, dem größten See Italiens und<br />
einem beliebten Urlaubsziel. Nördlich Veronas erhebt sich die Dolomitenkette mit ihren<br />
bis zu über 3.300 Meter hohen Gipfeln. Im Süden erstreckt sich die weitläufige Po-<br />
Ebene von der Adriaküste bis an die Schweizer Grenze. Durch Verona fließt die Etsch<br />
(ital. Adige), die in den Ötztaler Alpen entspringt und am nördlichen Ende <strong>des</strong> Po-<br />
Deltas in die Adria mündet. In den vergangenen Jahrhunderten konnte Verona von<br />
seiner Lage im Zentrum <strong>des</strong> Dreiecks der bedeutenden Handelsstädte Venedig,<br />
Mailand und Bologna profitieren. Heute profitiert es neben seiner eigenen touristischen<br />
34
Anziehungskraft von seiner Lage im industriellen Zentrum Italiens und der räumlichen<br />
Nähe zu einigen der beliebtesten Urlaubsziele Europas.<br />
10.4 Sehenswürdigkeiten<br />
Eines der Wahrzeichen der Stadt ist das gut erhaltene und noch heute genutzte<br />
römische Amphitheater (Arena di Verona), gelegen an der Piazza Bra. Errichtet wurde<br />
es um 30 n. Chr., zur gleichen Zeit wie das Kolosseum in Rom, vor den Toren <strong>des</strong><br />
damaligen Verona. Heute ist es sowohl das drittgrößte als auch das besterhaltene<br />
Amphitheater der Welt. Bei einem Erdbeben im Jahre 1117 wurden Teile der<br />
Außenfassade zerstört. Genutzt wurde die Arena anfangs zu Wettkämpfen,<br />
Hinrichtungen sowie Stierkämpfen, die unter Napoleon verboten wurden, fasste etwa<br />
30.000 Zuschauer und gab damit mehr Menschen Platz, als Verona Einwohner hatte.<br />
Dies ist vermutlich auf die große Zahl an durchreisenden Legionären zurückzuführen.<br />
Erst ab 1913 wurde die Arena wieder regelmäßig <strong>für</strong> Aufführungen genutzt. Damals<br />
wurde zu Ehren von Giuseppe Verdi anlässlich <strong>des</strong>sen 100. Geburtstags die Oper Aida<br />
aufgeführt. Aufgrund der hervorragenden Akustik finden noch heute neben anderen<br />
Veranstaltungen jährlich die Opernfestspiele von Verona statt. Daneben werden aber<br />
auch Rock- und Popkonzerte veranstaltet. Das Bauwerk bietet heute 22.000<br />
Zuschauern Platz. Im Winter wird die Bühne abgebaut und dadurch der ursprüngliche<br />
Kampfplatz sichtbar. Die Piazza Bra umgibt die Arena und ist mit seinen zahllosen<br />
Restaurants einer der beliebtesten Plätze Veronas.<br />
Das nach dem Amphitheater am besten erhaltene römische Monument ist das<br />
dreigeschossige Stadttor Porta dei Borsari. Das aus Kalkstein bestehende Bauwerk<br />
öffnete die Stadtmauer zur Römerstraße Via Postumia hin. Diese führte über eine<br />
Länge von etwa 450 Kilometern von Genua über den Apennin, Piacenza, Cremona,<br />
Verona, Vicenza bis nach Aquileia und war eine bedeutende Handelsstraße. Errichtet<br />
wurde die Porta dei Borsari im 1. Jh. n. Chr. und im Jahr 265 durch den römischen<br />
Kaiser Gallienus restauriert. Ihr Name ist auf die Zöllner <strong>des</strong> alten Verona, die Bursari,<br />
zurückzuführen, die an den Stadtgrenzen Steuern erhoben. Heute ist nur noch die<br />
Außenfassade <strong>des</strong> Tores erhalten.<br />
Architektonisch herausragend ist das zwischen 1354 und 1376 im gotischen Stil<br />
errichtete Castelvecchio (dt. Alte Festung). Es besteht aus vier Hauptgebäuden im<br />
Inneren und sieben Wachtürmen. Umgeben war es von einem inzwischen<br />
trockengelegten Wassergraben der aus der Etsch gespeist wurde. Veronas damaliger<br />
35
Regent Cangrande II. della Scala (1332-1359) errichtete es als Festung und Residenz<br />
zur Abschreckung seiner mächtigen Nachbarn in Venedig. Das Castelvecchio wurde<br />
über die Jahrhunderte von den jeweiligen Machthabern mehrfach verändert, diente<br />
unter der Österreichischen Herrschaft als Kaserne und beherbergt heute ein Museum.<br />
Vom Castelvecchio aus führte die Ponte Scaligero (dt. Skaligerbrücke) nach Norden<br />
über die Etsch aus der Stadt hinaus. Die Brücke soll von der Herrscherfamilie Scala<br />
erbaut worden sein, um sich im Falle eines Volksaufstan<strong>des</strong> sicheres Geleit aus<br />
Verona zu sichern. Die Brücke ist insgesamt 133 Meter lang und wurde so robust<br />
gebaut, dass sie fünf Jahrhunderte lang unbeschadet überstand. Zur damaligen Zeit<br />
war sie die längste Segmentbogenbrücke der Welt. Im Zweiten Weltkrieg wurde sie<br />
1945 wurde sie beim Rückzug der deutschen Wehrmacht aus Italien weitgehend<br />
zerstört, aber wenige Jahre später fast originalgetreu wieder aufgebaut.<br />
Das gleiche Schicksal ereilte die weiter östlich gelegene antike Ponte Pietra (dt.<br />
Steinbrücke) die jedoch schon um 100 v. Chr. erbaut worden sein soll. Auch sie wurde<br />
1957 aus dem Originalmaterial wiederaufgebaut.<br />
Weitere touristische Attraktionen sind einige Bauwerke, die sich auf das in Verona<br />
spielende Shakespeare-Drama Romeo und Julia beziehen sollen. Nahe der Piazza<br />
delle Erbe befindet sich ein mittelalterlicher Skaligerbau, der das Elternhaus der Figur<br />
Julia darstellen soll. Der im Innenhof <strong>des</strong> Anwesens befindliche berühmte Balkon<br />
wurde angeblich im Nachhinein angebaut. Dort gibt es auch eine Statue von Julia,<br />
deren Berührung angeblich Glück in der Liebe bringen soll. Auch das angebliche<br />
Anwesen der Familie Romeos findet sich in der Stadt. Für die Romanfiguren gibt es<br />
keine historischen Vorbilder. Das Anwesen gehörte tatsächlich einer Familie Capuleti.<br />
36
11. Besichtigung Schweinebetrieb Aldo Montolli<br />
Kilian Henne, Hubert Vandieken<br />
An unseren dritten Exkursionstag stand am Vormittag die Besichtigung <strong>des</strong><br />
Schweinebetriebs von Adlo Montolli in der Nähe von Mantova auf dem Programm.<br />
Direkt nach der Ankunft wurden wir mit Parmesan, Parmaschinken, Wein und Saft<br />
empfangen, und es bot sich <strong>für</strong> uns die Gelegenheit, in lockerer Atmosphäre etwas<br />
mehr über den seit 1978 existierenden Betreib zu erfahren.<br />
11.1 Allgemeines<br />
So erklärte uns der Betriebsleiter, dass der Betrieb jährlich zwischen 32.000 und<br />
33.000 Mastschweine, einer Hybridkreuzung aus Schweinen holländischen Ursprungs<br />
mit klassischen italienischen Rassen, erzeugt und diese dann im Alter von 9 Monaten<br />
mit einem Lebendgewicht von 170 bis 175 Kilogramm verkauft. Die lange Mastzeit ist<br />
notwendig, weil das Fleisch zur Herstellung von Rohschinken verwendet wird und<br />
dieser eine Reifezeit von 18 Monaten benötigt. Eine Reifung von solch langer Dauer ist<br />
nur dann möglich, wenn im Fett ein ausreichend großer Anteil an gesättigten<br />
Fettsäuren vorhanden ist, was nur bei min<strong>des</strong>tens 9 Monate alten Schweinen der Fall<br />
sei.<br />
.<br />
Der Betrieb besitzt insgesamt 1.400 Zuchtsauen an mehreren Standorten. Die<br />
Aufzucht der Ferkel ab 5 Kilogramm ist in Vertragsbetriebe in der Umgebung<br />
ausgelagert, die Mast ab 30 Kilogramm bis zum Verkauf an den Schlachthof findet<br />
wieder in den eigenen Stallungen statt. Der Preis <strong>für</strong> 1 kg Fleisch liegt momentan bei<br />
1,26 Euro plus Mehrwertsteuer (21%), was derzeitig ein ziemlich schlechter Preis ist.<br />
Der Betrieb bearbeitet 300 Hektar Ackerfläche im Umkreis von 50 Kilometern, auf<br />
denen Weizen und hauptsachlich Mais angebaut wird.Insgesamt werden 16<br />
Angestellte beschäftigt, die vor allem im Stall tätig sind, aber auch bei der Feldarbeit<br />
helfen und sämtliche Tiertransporte zwischen den Standorten übernehmen.<br />
Der Betrieb ist trotz seiner Größe in der Bevölkerung akzeptiert und hat keine<br />
Probleme bei der Gülleausbringung, da er über ausreichend Fläche verfügt.<br />
37
Außerdem ist der Betrieb Mitglied bei der Tourismusaktion „Agritourismo“, was in etwa<br />
mit dem deutschen „Urlaub auf dem Bauernhof“ vergleichbar ist.<br />
11.2 Fütterung<br />
Gefüttert werden Maiskornsilage, Soja, Milchpulver und Proteinzusatzfutter, jedoch<br />
keine Abfallstoffe aus der Lebensmittelproduktion, da deren Einsatz verboten ist. Die<br />
Genossenschaft überprüft die Inhaltsstoffe durch Kontrollen. Nur unter Verwendung<br />
dieser erlaubten Futterkomponenten darf das Fleisch später bei der Produktion von<br />
Parmaschinken benutzt werden, was eine geschützte Ursprungsbezeichnung der EU<br />
ist. Bei der Fütterung wird zunächst Maissilage mit Milchpulver vermischt, dann wird<br />
das Gemisch mit Soja und Kraftfutter versetzt. Die Fütterung erfolgt zweimal täglich,<br />
eine Sensorfütterung gibt es somit nicht. An heißen Tagen wird zusätzlich Wasser<br />
gegeben, das mit Milchpulver versetzt sind. Während der Fütterung erfolgt parallel die<br />
Tierkontrolle durch die Mitarbeiter.<br />
11.3 Maststall<br />
Nachdem wir uns einen kurzen Überblick über das Betriebsgeschehen verschaffen<br />
konnten, zogen wir uns Einweg-Schutzanzüge über, bevor wir einen Maststall mit<br />
1.300 Mastschweinen besichtigten. Je 10 bis 13 Schweine befinden sich in einer<br />
Bucht. Die Ferkel werden nach dem Absetzen und auch zur Aufstallung in die Mast<br />
nach Größe sortiert. Eine aktive Lüftung gibt es nicht in den Mastställen. Die Luft<br />
gelangt durch den First in den Stall und durch die Fenster und Türen wieder nach<br />
draußen. Die Fensteröffnungen sind über Klappen verstellbar. Bei besonders großer<br />
Hitze werden zusätzlich noch Beregnungsanlagen im Stall eingeschaltet.<br />
Auf vielen Dächern <strong>des</strong> Betriebes sind Photovoltaikmodule installiert; der dort<br />
gewonnene Strom wird teilweise selbst verbraucht.<br />
11.4 Sauenanlage mit angeschlossener Ferkelaufzucht<br />
Nach der Besichtigung der Hauptstelle fuhren wir vom Hauptstandort zur Sauenanlage<br />
mit angeschlossener Ferkelaufzucht, wo wir den Deck- und Wartestall sowie den<br />
Abferkelstall zu sehen bekamen. Der Betrieb arbeitet im Wochenrhythmus, so erfolgt<br />
38
das Abferkeln am Donnerstag, Freitag und Samstag. Rund 70 Sauen ferkeln pro<br />
Woche ab, dies ergibt etwa 800 Ferkel wöchentlich. Diese Ferkel werden ab dem 4.-5.<br />
Lebenstag mit Prestarter versorgt. Sofort nach dem Abferkeln wird Milchaustauscher<br />
angeboten. Die Ferkel werden prophylaktisch gegen Influenza, Circovirus, Parvovirus<br />
und Mycoplasen geimpft.<br />
Der Betrieb erzeugt die Nachzucht nicht selbst, sondern kauft bei 35 %<br />
Remontierungsrate pro Monat etwa 50 weibliche Zuchtläufer mit 7 kg Gewicht zu.<br />
Diese werden in einem separaten Stall aufgezogen. Dem Betriebsleiter zufolge gebe<br />
es trotz <strong>des</strong> Zukaufs keine Probleme mit eingeschleppten Krankheiten.<br />
Die Gruppenhaltung <strong>für</strong> tragende Sauen, welche ab 2013 verpflichtend ist, soll im<br />
bereits genehmigten Neubau umgesetzt werden. Bislang sind Deck- und Wartestall<br />
nicht getrennt, die Sauen werden durchgehend im Kastenstand gehalten. Die dadurch<br />
deutlich verminderte Bewegungsmöglichkeit der Tiere kann man kritisch betrachten.<br />
Deswegen muss der Betrieb auch viele Sauen aufgrund schlechter Fundamente oder<br />
einer hohen Umrauscherquote von 15 % aussortieren. Vor den Sauen befinden sich<br />
Ebergänge zur Stimulation <strong>für</strong> die künstliche Belegung. Das Sperma hier<strong>für</strong> wird durch<br />
eigene Eber selbst produziert.<br />
Eine Sau erreicht angeblich etwa acht bis neun Abferkelungen bei 2,43 Würfen/Jahr.<br />
Die Richtigkeit dieser Angaben ist allerdings sowohl angesichts der hohen<br />
Remontierungsrate als auch einer Güstzeit von 10 Tagen anzuzweifeln. Rund 25-26<br />
Ferkel werden pro Sau und Jahr abgesetzt. Ihr stehen im Abferkelstall 2,5 m 2 zur<br />
Verfügung.<br />
Zu schaffen machten dem Betrieb vor längerer Zeit Mikroplasmen, aktuell gibt es<br />
Probleme mit BLS.<br />
Die Stalltechnik <strong>des</strong> Betriebes wurde bisher alle 5 bis 10 Jahre aktualisiert.<br />
39
12. Geschichte Südtirols<br />
Elisabeth Lederer, Elke Ries<br />
12.1 Urgeschichte<br />
Vor 24tausend Jahren lag das Gebiet <strong>des</strong> heutigen Südtirols unter einer hohen<br />
Eisdecke. Die Klimaerwärmung ließ diese dann auf neuzeitliche Ausmaße schmelzen<br />
und prägte somit die Vegetation und Fauna Südtirols. Etwa 5000 vor Christus<br />
entstanden die ersten ständig bewohnten Siedlungen, in denen auch Ötzi, sicherlich<br />
einer der weltbekanntesten Südtiroler, lebte.<br />
12.2 Tirol im 14. Jahrhundert<br />
Das Land Tirol entstand durch eine Übergabe der Grafschaften um den Brenner an die<br />
Bischöfe von Brixen und Trient. Nach dem Tod Karls <strong>des</strong> Großen und den damaligen<br />
Teilungsverträgen lagen das heutige Nord- und Südtirol innerhalb der Grenzen <strong>des</strong><br />
deutschen Königreiches. Das Kerngebiet <strong>des</strong> heutigen Tirols gehörte jedoch zu<br />
Bayern.<br />
Südtirol wurde schon immer vom Einfluss der Kunst, dem geistig-kulturellem Leben der<br />
Maler, Mönche und Minnesänger <strong>des</strong> Mittelalters geprägt.<br />
Im 14. und 15. Jahrhundert entwickelte sich in Tirol die erste und älteste Demokratie<br />
auf dem europäischen Festland. Die Tiroler hatten eine Selbstständigkeit innerhalb<br />
Österreichs und ein Mitspracherecht der Bevölkerung bei der Regierung <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong>.<br />
In dieser Zeit kam es auch im Land zu einer Wirtschaftsblüte und zu Aufschwüngen in<br />
der Landwirtschaft, dem Bergbau, der Industrie und den Verkehrswegen. Dadurch galt<br />
Tirol als Schatzkammer <strong>des</strong> Hauses Österreich.<br />
40
12.3 Eroberung durch Bayern und Zeit <strong>des</strong> Andreas<br />
Hofer<br />
Anfang <strong>des</strong> Jahres 1809 wurde Tirol zuerst von Bayern erobert, aber bereits im<br />
<strong>des</strong>selben Jahres sofort wieder von der Österreichern zurückerobert.<br />
Aus dieser Zeit stammen auch die ersten Aufzeichnungen über Andreas Hofer.<br />
Abb. 1: Gemälde „Andreas Hofer“ von Franz von Defregger<br />
Der heutige (süd)tiroler Nationalheld Andreas Hofer war Kommandant der Schützen in<br />
Sterzing und wurde zum Oberkommandant der Aufstände während der Bauernkriege<br />
und Gründer der Kriegspartei gegen Frankreich. Da er der Meinung war, dass<br />
Napoleon kein Recht hatte, den Krieg in Tirol während <strong>des</strong> offiziellen<br />
Waffenstillstan<strong>des</strong> dennoch fortzusetzen, schaffte er es die Tiroler von der Besetzung<br />
Frankreichs zu lösen und die zivile Verwaltung zu übernehmen. Hofer holte sich<br />
Berater aus allen Ständen um die Lan<strong>des</strong>verwaltung wieder notdürftig in Gang zu<br />
setzten. Nach dem Friedensschluss von Schönbrunn hatte Hofer allerdings keine<br />
Rückendeckung mehr aus den eigenen Reihen, da diese mit seinen Auffassungen und<br />
Handlungen überfordert waren. Daher flüchtete er in die Berge, womit das Ende seiner<br />
Ära – und nach einem Verrat auch das Ende seines Lebens besiegelt war. Am 20.<br />
Februar 1810 wurde Andreas Hofer in der norditalienischen Stadt Mantua nach kurzer<br />
Gerichtsverhandlung durch ein Erschießungskommando hingerichtet.<br />
1814 wurde Tirol nach langem Hin und Her wieder österreichisch. Mit dem ersten<br />
Tourismus entsteht 1890 ein neuer Wirtschaftszweig. Meran entwickelte sich schon in<br />
dieser Zeit zum Kurort, was den Standort Tirol auch wirtschaftlich verbesserte.<br />
41
12.4 Zeit <strong>des</strong> ersten Weltkriegs<br />
Allerdings ging auch der 1.Weltkrieg nicht spurlos an Tirol vorbei. Viele Gebäude und<br />
Kirchen wurden zerstört und die Zukunft Südtirols war ungewiss. Südtirol wurde vom<br />
einen Tag auf den anderen von Italien einvernommen und litt unter der Einführung der<br />
Lira als neuer Währung wirtschaftliche Not. Städte und Straßennamen wurde auf<br />
Italienisch umbenannt und auch Familiennamen mussten zwangsmäßig geändert<br />
werden, da es sonst zu Verfolgungen durch die neue Regierung kam. Außerdem<br />
wurde in allen Schulen Italienisch als Unterrichtssprache eingeführt und der<br />
Deutschunterricht verboten. Das Land sollte somit seine nationale Identität verlieren,<br />
was natürlich zu Unmut und Widerstand führte.<br />
12.5 Südtirol im zweiten Weltkrieg<br />
Auch der 2.Weltkrieg hatte gravierende Folgen <strong>für</strong> Südtirol: Deutsche Truppen rückten<br />
über den Brenner vor und so begann die Herrschaft <strong>des</strong> Hackenkreuzes auch in<br />
Südtirol. Die ersten Opfer <strong>des</strong> neuen Regimes waren wenige Juden aus Meran, was<br />
jedoch von der Bevölkerung nicht groß realisiert wurde. Psychisch Kranke und geistig<br />
Behinderte wurden über den Brenner in Krankenhäuser geschickt zur Euthanasie.<br />
Circa 230 Südtiroler wurden verhaftet und in eine alte Schlossruine von Schloss<br />
Sigmundskron in ein Konzentrationslager gebracht. Als einziger aktiver Widerstand<br />
gegen die SS war der Andreas-Hofer-Bund zu verzeichnen.<br />
1945 kam es zur Brennerschlacht durch die amerikanischen Truppen, wodurch Hitler<br />
geschlagen wurde und die Alliierten das Land besetzten. Als das Kriegsende kurz<br />
bevorstand, übergaben die deutschen Militärbehörden am 3. Mai 1945 die<br />
Verwaltungsgeschäfte, wodurch die Zukunft Südtirols wieder einmal ungewiss war.<br />
12.6 Erringen der Autonomie<br />
Bis 1972 erfolgte der Wiederaufbau <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> und Südtirol erkämpfte sich nach<br />
langem Ringen endlich die Autonomie der Provinz Bozen. 1992 gab die italienische<br />
Regierung bekannt, dass das seinerzeit in Paris beschlossene Südtirolpaket nun<br />
komplett realisiert sei und Südtirol nun eine weitgehende Autonomie besitzt. Dadurch<br />
war der Weg zu einer der wohlhabenderen Regionen in Europa frei.<br />
42
13. Tourismus in Südtirol<br />
Josef Bauerdick, Melanie Wohlschläger<br />
Südtirol ist heute die nördlichste Provinz Italiens mit der Hauptstadt Bozen. Mehr als<br />
2/3 der Region sind deutschsprachig. Der Begriff Tourismus ist seit den 1980er Jahren<br />
gebräuchlich, bis dahin wurden der Wirtschaftszweig und dieses<br />
Gesellschaftsphänomen als Fremdenverkehr bezeichnet. Sowohl Tourismus als auch<br />
Fremdenverkehr stellen einen Überbegriff <strong>für</strong> Reisen, die Reisebranche, das<br />
Gastgewerbe und die Freizeitwirtschaft dar.<br />
Die Entwicklung <strong>des</strong> Tourismus setzte bereits in der ersten Hälfte <strong>des</strong> 19. Jahrhunderts<br />
ein und hatte seinen Ursprung im Raum Meran um das Jahr 1830, als Kuraufenthalte<br />
<strong>für</strong> den damaligen Adel <strong>des</strong> Habsburger-Reiches aufkamen. Südtirol war<br />
insbesondere wegen der guten Luft und dem mildem Klima beliebt. Meran entwickelte<br />
sich von einer „Kuhstadt“ zu einer „Kurstadt“. Als Kaiserin Elisabeth dann 1870 ihren<br />
Feriensitz in das Südtiroler Schloss Trautmannsdorff verlegte, setzte ein bis heute<br />
ungebrochener Reisestrom ein. Die touristische Erschließung begann mit dem<br />
Eisenbahnbau und der Eröffnung der Brennerbahn im Jahr 1867, die den Boom <strong>des</strong><br />
ganzjährigen Tourismus im Durchgangsland Tirol auslöste.<br />
Doch dann brachen <strong>für</strong> den Tourismus ungünstige Zeiten an. Zunächst vollzog sich ein<br />
Wandel <strong>des</strong> Tourismus von der südlichsten Destination der Donau-Monarchie zur<br />
nördlichsten Destination Italiens während <strong>des</strong> ersten Weltkriegs. Zwar entwickelte sich<br />
ein gewisser Massentourismus der 20er und 30er Jahre aufgrund politischer<br />
Maßnahmen nach dem ersten Weltkrieg, die Bewohner Südtirols wurden jedoch erst<br />
nach dem zweiten Weltkrieg mit einbezogen. Im allgemeinen wirtschaftlichen<br />
Aufschwung Europas erholte sich auch der Südtiroler Fremdenverkehr wieder. In den<br />
50er und 60er Jahren begann sich eine Erschließung der ländlichen Regionen zu<br />
entwickeln, da es v. a. deutsche Touristen von den Städten wie Meran und Bozen auf<br />
das Land zog. Hauptsächlich auf landwirtschaftlichen Betrieben wurde beispielsweise<br />
in Fremdenzimmer investiert.<br />
1979 wurde dann ein Stopp von weiteren Bauinvestitionen verordnet, welcher die<br />
Verschiebung von 1-2 Sterne Hotels zu 3-5 Sterne Betrieben nach sich zog. Das<br />
Angebot verschob sich von Quantität zu Qualität. Seit dem Jahr 2000 halten sich<br />
gastgewerbliche und nichtgastgewerbliche Beherbergungsbetriebe die Waage. Der<br />
43
Begriff nichtgastgewerblich beinhaltet sowohl Campingplätze, als auch den Urlaub auf<br />
dem Bauernhof.<br />
2007 lag die Zahl der Übernachtungen bei 27 Millionen, 2010 bei 28 Millionen. Dabei<br />
stieg die Zahl der Besucher an, während die Übernachtungszahlen nahezu konstant<br />
bleiben. Dies lässt sich auf die Zunahme der Kurzurlaube zurückführen. Im<br />
Fremdenverkehr sind ca. 30.000 Personen beschäftigt, dies entspricht 12% aller<br />
Beschäftigten. 58% der Beschäftigten sind hierbei Frauen. Insgesamt gibt es in Südtirol<br />
ca. 10.000 Beherbergungsbetriebe, diese bieten den Touristen etwa 214.000 Betten<br />
an. Den stärksten Übernachtungsanstieg verbuchen die deutschen Gäste. Besonders<br />
auffallend ist aber der kontinuierliche Übernachtungsanstieg der Gäste aus den<br />
„Nischenmärkten“ Schweiz, Polen und Russland.<br />
Zusammenfassend ist anzumerken, dass der Tourismus eine zentrale Rolle in der<br />
Wirtschaft <strong>des</strong> rohstoffarmen Lan<strong>des</strong> spielt. Besonders die Tallagen und die<br />
Wintersportzentren haben sich in den letzten 100 Jahren zu florierenden<br />
Fremdenverkehrszentren entwickelt. Einst wegen der Kurorte und <strong>des</strong> milden Klimas<br />
stark besucht, wurde Südtirol in den letzten Jahrzehnten zunehmend von Wintersport<br />
und sommerlichem Erlebnisurlaub geprägt.<br />
Entwicklung Wachstum Übernachtungen und Anzahl Ankünfte<br />
44
14. Die Landwirtschaft in Südtirol<br />
Überacker Johannes, Wenninger Ludwig<br />
14.1 Flächenverteilung Südtirols<br />
Die Fläche Südtirols umfasst insgesamt 740 Tausend Hektar, wobei lediglich 36%<br />
davon, also knapp 270 Tausend Hektar landwirtschaftlich genutzt werden. Ähnlich ist<br />
es bei der Nutzung der Waldfläche, die rund 40% (290 Tausend ha) der Gesamtfläche<br />
beträgt. Der Prozentsatz an Landfläche, der aufgrund <strong>des</strong> extremen Reliefs, seien es<br />
extreme Hanglagen oder sogar unbegrünte Felsen, nicht genutzt werden kann, liegt bei<br />
22,5%, also bei ca. 165 Tausend Hektar.<br />
14.2 Geschichte der Landwirtschaft in Südtirol<br />
Schon zu Zeiten von Andreas Hofer, einem Freiheitskämpfer gegen die bayerische und<br />
französische Besetzung Tirols, waren der Weinbau und die Viehzucht die wichtigsten<br />
Standbeine der Südtiroler Landwirtschaft. Der arbeitsintensivere Getreideanbau fand<br />
überwiegend in tieferen Lagen statt.<br />
1859-1890 kam es zu einer Krise in der Landwirtschaft. Als Gründe hier<strong>für</strong> sind unter<br />
anderem die Industrialisierung, das Fehlen von Ausbildungsstätten im Agrarsektor,<br />
Naturkatastrophen, beispielsweise die Überschwemmung <strong>des</strong> Etschtales 1882, die<br />
teilweise hohe Verschuldung der Höfe und das Fehlen einer Interessensvertretung der<br />
Bauern zu nennen. Infolge<strong>des</strong>sen gingen die Zahlen der in der Landwirtschaft<br />
Beschäftigten seit 1890 bis heute kontinuierlich zurück. Waren 1890 noch 65% der<br />
Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig, waren es im Jahr 2006 lediglich noch 6,6 %<br />
(rund 15.000 Erwerbstätige).<br />
Um diesem Rücklauf entgegenzuwirken kam es mehr und mehr zur Gründung<br />
landwirtschaftlicher Genossenschaften, was eine Rationalisierung der Landwirtschaft<br />
zur Folge hatte. So entstand 1904 der Tiroler Bauernbund. Durch diesen erhoffte man<br />
sich mehr Durchschlagskraft auf politischer Ebene. Auch wurde zunehmend auf eine<br />
verbesserte Aus- und Weiterbildung der Landwirte geachtet, was die Produktivität im<br />
Agrarsektor auf eine höhere Stufe setzen sollte.<br />
45
Nach dem zweiten Weltkrieg entstand nicht nur der Südtiroler Bauernbund (SBB), der<br />
bis heute die Interessenvertretung der Südtiroler Bauern in wirtschaftlicher, politischer,<br />
sozialer und kultureller Hinsicht ist. Auch die Modernisierung, die Spezialisierung und<br />
eine umsichtige Lan<strong>des</strong>politik verhinderten das Bauernsterben nach der Krise.<br />
14.3 Landwirtschaft heute<br />
Etwa 6,6% der südtiroler Erwerbsbevölkerung ist heute noch ausschließlich in der<br />
Landwirtschaft tätig. Insgesamt existieren einschließlich Nebenerwerbslandwirten noch<br />
über 25 Tausend Landwirtschaftsbetriebe, wobei die Durchschnittsfläche pro Betrieb<br />
nur bei ca. 2 Hektar liegt.<br />
Neben der Milchwirtschaft im Pustertal und im Wipptal sind auch Weinbau und der<br />
Anbau von Äpfeln vor allem im Etsch- und Eisacktal von großer Bedeutung <strong>für</strong> die<br />
Region.<br />
14.4 Obstbau<br />
Auf einer Fläche von knapp 18.700 Hekrar produzieren rund 7.000 Bauern Obst. Von<br />
der gesamten Obstanbaufläche dienen ca. 99,8% dem Anbau von Äpfeln, wodurch im<br />
Jahre 2007 980 Tausend Tonnen Äpfel produziert wurden.<br />
Die Restanbaufläche verteilt sich auf Birnen (Eintausend Tonnen) und Kirschen, wobei<br />
dieser Prozentsatz relativ gering ist. Südtirol hat einen Anteil von 45,7% an der<br />
nationalen, rund 11 Prozent an der europäischen und rund 2 Prozent an der weltweiten<br />
Apfelproduktion.<br />
46
14.5 Weinbau<br />
Auch der Anbau von Wein ist essentiell <strong>für</strong> die Region. So wurden im Jahr 2007 auf<br />
einer Rebfläche von 5.256 Hektar von knapp 4.000 Bauern ungefähr 350 tausend<br />
Hektoliter Wein produziert. Aufgrund der durchschnittlichen Rebfläche pro Betrieb von<br />
nur einem Hektar produziert Südtirol zwar nicht die größte Menge an Wein, davon ist<br />
jedoch der Anteil an Qualitätswein umso größer. Bedeutende Weinsorten sind unter<br />
anderem Vernatsch (Rotwein) und Weißburgunder (Weisswein), die nach Italien,<br />
Deutschland, England, aber auch in die USA exportiert werden.<br />
47
14.6 Milchwirtschaft<br />
Als drittes Standbein der Südtiroler Landwirtschaft gilt die Milchwirtschaft. Im Jahr 2006<br />
wurden an die Molkereien und Sennereigenossenschaften knapp 400 Tausend Tonnen<br />
Milch angeliefert und verarbeitet. Ungefähr 22Tausend Tonnen wurden als Frischmilch,<br />
24 Tausend Tonnen als UHT-Milch, 3 Tausend Tonnen als Butter, 16Tausend<br />
Tonnenals Käse, und 90 Tausend Tonnenals Joghurt verarbeitet.<br />
In Südtirol werden 3 Prozent der italienischen Gesamtproduktion an Milch erzeugt.<br />
Dies bedeutet, dass ca. 2/3 der in Südtirol erzeugten Milch oder der daraus<br />
gewonnenen Produkte außer Lan<strong>des</strong> auf den Markt gebracht werden müssen. Die<br />
durchschnittliche Anlieferungsmenge pro Molkereimitglied betrug 2006 rund 61 Tonnen<br />
Milch im Jahr, der durchschnittliche Auszahlungspreis lag bei 0,3773 Euro je<br />
Kilogramm Milch.<br />
Neben diesen drei Standbeinen der Südtiroler Landwirtschaft kommt dem Tourismus<br />
eine immer größere Bedeutung zugute. So stieg in den letzten Jahren die Zahl der<br />
eingetragenen Beherbergungsbetriebe <strong>für</strong> „Urlaub auf dem Bauernhof“ auf knapp 2600<br />
an.<br />
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Landwirtschaft Südtirols eine<br />
Berglandwirtschaft mit enormer Vielfalt auf kleinstem Raum ist, die relativ stabil, zum<br />
einen in der Anzahl der Betriebe, zum anderen hinsichtlich der bewirtschafteten Fläche<br />
ist. Sie ist innovativ und ausbaufähig, genossenschaftlich stark organisiert und dadurch<br />
wirtschaftlich bedeutend.<br />
48
15. Besichtigung Weinkellerei Tramin<br />
Maximilian Hofbauer, Rupert Stäbler<br />
15.1 Überblick über die Landwirtschaft in Südtirol<br />
Am Anfang unserer Besichtigungstour durch Südtirol besuchten wir die Weinkellerei<br />
Tramin. Nachdem wir die herrliche Aussicht aus den Empfangsräumen der Kellerei<br />
über die Weinberge, bis hin zum Kalterer See bewundert hatten, gab uns Herr Leo<br />
Tiefenthal, Obmann <strong>des</strong> Südtiroler Bauernbun<strong>des</strong>, einen Überblick über die<br />
Landwirtschaft in Südtirol: Südtirol ist ein verhältnismäßig kleines Land mit ca. 500.000<br />
Einwohnern. Von der Lan<strong>des</strong>fläche sind nur 60 % grundsätzlich landwirtschaftlich<br />
nutzbar, der Rest der Fläche ist Hochgebirge etc. Hauptstandbeine der Landwirtschaft<br />
sind Viehhaltung, Obstbau (15.000 ha) und Weinbau (5.300 ha). Große Teile <strong>des</strong><br />
Weinbaugebietes befinden sich südlich von Bozen, wie eben auch um den Ort Tramin.<br />
Für fachliche Fragen und Neuerungen steht den Landwirten ein „Beratungsring“ mit<br />
Beratern <strong>für</strong> Wein- und Obstbau zur Verfügung. Mit Dr. Luis Durnwalder als<br />
Lan<strong>des</strong>hauptmann, der selbst aus der Landwirtschaft stammt, ist stets ein guter Draht<br />
der Landwirtschaft zur Politik gesichert. Vertreten wird der Bauernstand durch den<br />
Südtiroler Bauernbund (gegründet 1904) mit 21.000 Mitgliedern. Er kümmert sich um<br />
alle Belange der Landwirtschaft, von der Organisation von Erntehelfern bis hin zu<br />
Förderanträgen etc.<br />
15.2 Kellerei Tramin<br />
Der Weinbau ist eine bedeutende Säule der südtiroler Landwirtschaft. Nach der<br />
Weinkrise in den 70er und 80er Jahren aufgrund <strong>des</strong> Glykol-Skandals gingen die<br />
südtiroler Weinbauern einen neuen Weg: Qualität vor Quantität. So wird heute auf<br />
gleicher Fläche nur mehr die halbe Menge an Wein produziert - aber da<strong>für</strong> von<br />
erlesener Qualität. Zur Reduktion der Erntemenge ist es nötig, ungefähr die Hälfte der<br />
Gehänge manuell von den Weinstöcken zu entfernen um die Qualität der Trauben zu<br />
erhöhen Im gleichen Zug können die Aufwandmengen an Dünger, Pflanzenschutz und<br />
Bewässerung verringert werden. Auch hat sich in neuerer Zeit das Anbauspektrum von<br />
80% Rotwein und 20% Weißwein hin zu jeweils 50% Rot- und 50% Weißwein<br />
verschoben. Mit Weißwein können nämlich die klimatischen Bedingungen Südtirols mit<br />
einem starken Temperaturgefälle von kalten Nachttemperaturen und warmen<br />
49
Tagestemperaturen zur Erzeugung eines aromatischen und doch angenehm herben<br />
Weißweins von hoher Qualität ausgenutzt werden können. Ziel ist es, mit aromatischen<br />
Sorten wie Sauvignon, Müller Thurgau und Gewürztraminer sich schrittweise den<br />
italienischen Markt zu erarbeiten. Ein wichtiges Standbein ist hierbei der<br />
Gewürztraminer, der auf 20% der Gesamtweinbaufläche angebaut wird.<br />
Die Kellerei selbst ist eine Genossenschaft mit 270 Mitgliedern, die bei einer<br />
durchschnittlichen Anbaufläche von 0,8 ha zusammen 230 ha bewirtschaften. Vorteil<br />
dieser kleinstrukturierten Betriebe ist, dass <strong>für</strong> Terminarbeiten im Weinberg, wie z.B.<br />
die kurzfristig wetterabhängig innerhalb von wenigen Tagen zu erledigende Ernte,<br />
innerhalb kürzester Zeit große Mengen an Arbeitskräften aus dem familiären Umfeld<br />
mobilisiert werden können.<br />
Von den 250 ha Fläche werden jährlich ca. 22.000 dt Weintrauben von Hand geerntet,<br />
was ca. 60-70 hl pro Hektar entspricht.<br />
Auf den Flächen der Mitglieder werden an Weißweinen Gewürztraminer, Ruländer,<br />
Weißburgunder, Sauvignon und Müller-Thurgau, an Rotweinen Vernatsch, Lagrein<br />
(bei<strong>des</strong> autochthone Südtiroler Sorten), Blauburgunder und Rosenmuskateller<br />
angebaut.<br />
Die Bezahlung der Mitglieder erfolgt nach der Erntemenge, aber auch der<br />
Zuckergehalt, die Qualität <strong>des</strong> Weines und die Lage <strong>des</strong> Weingartens werden<br />
berücksichtigt.<br />
Die Vermarktung der erzeugten Weine erfolgt zu 80% in „Gesamt-Italien“, davon etwa<br />
jeweils die Hälfte in Südtirol und in „Rest-Italien“. Von den 20-25%, die exportiert<br />
werden, geht circa die Hälfte nach Deutschland. Absatzwege sind vor allem<br />
Restaurants, Hotels und der Fachhandel, es werden ca. 2000 Kunden beliefert.<br />
15.3 Jahreskreis <strong>des</strong> Weinbaues<br />
Nach dem Rebschnitt im Winter beginnt im Mai die Traubenblüte, so dass im Juni die<br />
ersten grünen Beeren erscheinen. Ab August setzt dann die Aromabildung ein. Nach<br />
der Prüfung und Empfehlung eines Erntetermins durch die Kellerei <strong>für</strong> die jeweiligen<br />
Weingärten beginnen die Weinbauern im September mit der Weinlese. Die Trauben<br />
werden schonend in Kisten verpackt und sofort zur Kellerei geliefert, wo sie - nach<br />
einzelnen Weinlagen getrennt - am selben Tag noch gepresst werden. Vor dem<br />
Pressen erfolgt - mittlerweile voll automatisiert - eine Sortierung der Trauben. Eine<br />
Besonderheit an der Weinpresse ist, dass diese während <strong>des</strong> Pressvorganges mit N2<br />
50
geflutet wird, um ein vorzeitiges Gären <strong>des</strong> Traubensaftes außerhalb <strong>des</strong> Fasses zu<br />
verhindern. Aufgabe <strong>des</strong> Kellermeisters Willi Stürz ist hierbei, die verschiedenen<br />
Trauben zu sortieren, sodass sie innerhalb weniger Stunden weiterverarbeitet werden<br />
können.<br />
15.4 Führung durch den Betrieb<br />
Nachdem wir so unsere theoretischen Kenntnisse bezüglich <strong>des</strong> Weinbaues erweitert<br />
hatten, führte uns Herr Geier durch die beeindruckenden Räumlichkeiten der<br />
Weinverarbeitung, von der Presse bis hin zu den Lagerkellern. Der Architekt <strong>des</strong><br />
Gebäu<strong>des</strong>, Werner Tscholl, orientierte sich bei der Gestaltung <strong>des</strong> Gebäu<strong>des</strong>, welches<br />
Anfang 2010 eingeweiht wurde, an der Gestalt der Weinrebe und setzte dies im<br />
Außen- und im Innenbereich der Kellerei eindrucksvoll um. Besonders imponierend<br />
waren hier die Lagerbehälter vom kleinen Eichenfass über Eichenfässer in<br />
Zimmergröße bis hin zu großen Tanks aus Edelstahl oder Beton. Je nach Wahl <strong>des</strong><br />
Fasses hat dies unterschiedliche Auswirkungen auf den Geschmack <strong>des</strong> Weines.<br />
Holzfässer geben noch Geschmacksstoffe an den Wein ab, während die anderen<br />
Materialien sich bezüglich <strong>des</strong> Geschmackes vollkommen neutral verhalten. Zu der<br />
Kellerei gehört auch eine Abfüllanlage, welche bis zu 5000 Flaschen in der Stunde<br />
befüllt, sodass ein jährliches Abfüllvolumen von 1,8 MiIlionen Flaschen erreicht werden<br />
kann.<br />
15.5 Weinverkostung<br />
An diese Besichtigung schloss sich selbstverständlich noch eine Verkostung der Weine<br />
<strong>des</strong> Hauses an. Während wir den Blick über Weinberge und Kalterer See<br />
bewunderten, durften wir, nach Erklärung der richtigen Techniken <strong>des</strong> Wein-Trinkens<br />
und Beurteilens, von Weißburgunder, Gewürztraminer und Lagrein kosten. Wichtig ist<br />
es hierbei, den Wein mit allen Sinnen wahrzunehmen und zu beurteilen. Zunächst<br />
beginnen wir mit den beiden Weißweinen:<br />
Der Weißburgunder präsentiert sich den Augen kristallklar, vital und hat eine reine<br />
Form mit sehr guter Konsistenz. Der Geruch ist fruchtig und von mittlerer Intensität.<br />
Der hierauf gereichte Gewürztraminer ist kristallklar und von goldgelber Farbe, mit der<br />
Nase nimmt man einen intensiven und komplexen Geruch von würzigen Blumen und<br />
Früchten wahr. Geschmacklich nimmt man kaum Gerbstoffe wahr, allerdings spürt man<br />
eine sog. „Scheinwärme“ am Gaumen, die auf einen Alkoholgehalt von 13-14%<br />
51
hinweist. Nach dem Schlucken bleibt ein langer Abgang. Somit handelt es sich um<br />
einen harmonischen und gerade schon trinkreifen Wein, der aber auch gut noch<br />
mehrere Jahre gelagert werden darf.<br />
Lagrein ist eine Rotweinsorte, die im Eichenfass reift. Die Farbe ist ziegelrot und von<br />
leicht violettem Reflex. Man nimmt einen Geruch von Waldbeere und Zwetschge wahr.<br />
Die typischer Weise vorhandenen Gerbstoffe wirken leicht adstringierend im Gaumen.<br />
Insgesamt präsentiert sich Lagrein als Wein mit ausgeprägtem Charakter.<br />
Nach dieser Verkostung setzten wir fröhlich unsere Fahrt zu unserer Unterkunft in<br />
Bozen, dem Hotel Rentschner Hof, fort.<br />
52
16. Stadt Bozen<br />
Maria Theresa Caroli, Johannes Lenz<br />
Bozen, auch Bolzano<br />
(italienisch), Bulsan oder<br />
Balsan (ladinisch), Poutsn<br />
(südtirolerisch) sowie<br />
Bauzanum (lateinisch)<br />
genannt, ist die<br />
Lan<strong>des</strong>hauptstadt<br />
Südtirols. In dieser<br />
autonomen Provinz in<br />
Bozen Panoramabild mit der Brennerautobahn<br />
Italien sitzt sowohl die Südtiroler Lan<strong>des</strong>regierung als auch der Südtiroler Landtag.<br />
Bozen ist seit 1964 der Bischofssitz der Diözese Bozen-Brixen und seit 1998 mit der<br />
Freien Universität Bozen (FUB) Universitätsstadt. Die enge Altstadt Bozens ist<br />
mittelalterlich geprägt. Sehenswert sind die vielen prächtigen Bürgerhäuser und<br />
Laubengänge (17./18. Jahrhundert) der Stadt. Klöster und Burgen tragen zur<br />
historischen Bausubstanz bei, so z. B. die romanisch-gotische Kathedrale (13.-15. Jh.).<br />
Auch das Franziskanerkloster aus dem 14. Jahrhundert und einige Stadthäuser aus<br />
der Barockzeit sind sehenswert. Den neueren Stadtteil Bozens kennzeichnet die<br />
Architektur <strong>des</strong> 20. Jahrhunderts. Die Industriegebiete liegen im Süden und Südwesten<br />
der Stadt.<br />
Bozen gilt als eine der größten urbanen Zentren im Alpenbogen und auf Grund ihrer<br />
Bikulturalität als wichtigster Begegnungsort der österreichisch-deutschen und der<br />
italienischen Kultur und Wirtschaft. Dr. Luigi Spagnolli von der demokratischen Partei<br />
(italienisch Partio Democratico, abgekürzt PD) ist bis voraussichtlich 2015 der<br />
amtierende Bürgermeister. Im Jahre 2009 wurde die Stadt zur Alpenstadt <strong>des</strong> Jahres.<br />
Bozen hatte im Jahr 2010 insgesamt 104.029 Einwohner, die in fünf Stadtteilen<br />
wohnen und die die Sprachen Deutsch (zu 26,3%), Italienisch (zu 73 %) und<br />
Ladinisch(zu 0,7%) sprechen. Die Stadtteile sind Zentrum-Bozner Boden-Rentsch,<br />
Oberau-Haslach, Gries-Qirein und die jüngeren Stadtteile Europa-Neustift und Don<br />
Bosco. Von der gesamten Bevölkerung lebten im Jahre 2008 schon 12,5%<br />
ausländische Staatsbürger in Bozen. Bozen besitzt zahlreiche Schulen, wie die<br />
Wolfgang-von-Goethe-Schule, das Humanistische Gymnasium „Walther von der<br />
53
Vogelweide“, das Franziskanergymnasium u. a. Neben der Universität beherbergt<br />
Bozen auch die nach der früheren Lan<strong>des</strong><strong>für</strong>stin Claudia dé Medici benannte<br />
Lan<strong>des</strong>fachhochschule <strong>für</strong> Gesundheitsberufe Claudiana. Desweiteren gibt es die<br />
Europäische Akademie EURAC und eine parauniversitäre Forschungseinrichtung mit<br />
Schwerpunkt Sprachminderheiten und Umwelt. Die ZeLIG, eine dreisprachige Schule<br />
<strong>für</strong> Dokumentarfilm, Fernsehen und Neue Medien ist weltbekannt. 2005 wurde Bozen<br />
zur Guggenmusik Hauptstadt Europas ernannt und im Juli 2005 wurde die 47.<br />
Europeade, eines der größten europäischen Trachten- und Folklorespektaktel,<br />
ausgetragen.<br />
Geografisch gesehen liegt Bozen nahe der<br />
Dolomiten an der Vereinigung zweier<br />
Alpentransversalen, der oberen Etschtal-<br />
und der Eisacktalfurche, die zum Reschen<br />
beziehungsweise Brenner führen und<br />
damit die Stadt seit jeher in den Mittelpunkt<br />
eines überregionalen Wegenetzes rücken.<br />
In der Stadt mündet die Talfer in die<br />
Eisack, die wiederum südlich der Stadt in<br />
die Etsch fließt. Aus diesem Grund wird die<br />
Stadt auch als Talferstadt bezeichnet. Die<br />
historische Stadt bestand nur aus der<br />
heutigen zwischen Talfer und Eisack bzw.<br />
zwischen Zollstange und Wangergasse<br />
gelegenen Altstadt. Trotz dieser<br />
räumlichen Beengung wohnten 1910<br />
schon etwa 45% der Bozner Bevölkerung<br />
im Altstadtbereich.<br />
Bozen Panoramabild mit den Dolomiten<br />
Dom Maria Himmelfahrt in Bozen<br />
In den Jahren zwischen 1170 und 1195 wurde die spätere Stadt Bozen als Markt mit<br />
einer Gasse und einem Platz errichtet. Bereits 1159 existierte ein Pfarrer, der <strong>für</strong> seine<br />
Tätigkeit die 1180 errichtete Marienkirche nutzte, die später vom heutigen Dom Maria<br />
Himmelfahrt abgelöst wurde. Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Stadt dann<br />
mehrmals unter anderem durch die bischöfliche Neustadt, Wangersche Vorstadt u.a.<br />
erweitert. In Bozen gab es auch immer wieder mehrere Jahrmärkte bzw. Messen, und<br />
54
so gewährte auch die Lan<strong>des</strong><strong>für</strong>stin Claudia dé Medici im Jahre 1635 das Bozner<br />
Merkantilmagistrat (Handelsgericht). Die Industrialisierung Südtirols ging von Bozen<br />
aus, wo 1848 die Baumwollspinnerei gegründet wurde. In der Landgemeinde<br />
Zwölfmalgreien entstanden vor der Eingemeindung (1911) weitere wichtige Bauwerke,<br />
wie der Bahnhof Bozen-Gries (1859), das E-Werk Kardaun (1901) sowie die Kohlerer<br />
Bahn (1908). Sowohl im Kurort Gries, also auch in Bahnhofsnähe entstanden mehrere<br />
Hotels, wie das heute noch bestehende Parkhotel Laurin (1910). Hier hatte der<br />
Tourismus anfangs seinen Schwerpunkt . Obwohl der Fremdenverkehr <strong>für</strong> Bozen sehr<br />
bedeutend ist, ist die Industrie <strong>für</strong> die Stadt immer noch der größte Wirtschaftsfaktor.<br />
Bozen selbst ist vor Meran mit 35.000, Brixen mit 20.000 und Bruneck mit 10.700 der<br />
größte Beschäftigtenstandort Südtirols. Zudem gehört Bozen zu den größten<br />
Weinbaugebieten Südtirols. Die Weine werden vor allem in St. Magdalena, Guntschna<br />
und Gries produziert und dann in der Kellerei Bozen gekeltert. 2004 wurde der Bau <strong>des</strong><br />
ersten größeren Einkaufszentrums in der Stadt endgültig abgewehrt. Die Südtiroler<br />
Raumordnung hemmt die Zersiedelung durch große Märkte und fördert somit den<br />
Einzelhandel. Die internationale Messe Bozen, mit Messegelände, Kongresszentrum<br />
und Messehotel, befindet sich im Süden von Bozen.<br />
Durch die Brennerautobahn A22 ist die Stadt sowohl nach Süden als auch nach<br />
Norden an das europäische Autobahnnetz angebunden. Bozen hat auch einen<br />
Flughafen, und mit Hilfe der Brennerbahn kann man Innsbruck, München, Mailand,<br />
Venedig und Rom direkt erreichen. Eine Straßenbahn existierte von 1909 bis 1948.<br />
Heute gibt es noch drei Seilbahnen, die Kohlerer Bahn, Seilbahn Jenesien und die<br />
Ritter Seilbahn, die zwei Gemeinden und eine Fraktion von Bozen mit der Stadt<br />
verbinden. Der innerstädtische öffentliche Verkehr wird heute zumeist mit<br />
methangasbetriebenen Bussen abgewickelt. Für den privaten Verkehr ist die Altstadt<br />
gesperrt. Die zweibahnigen Fahrradstreifen mit Mittelstreifen und Gegenverkehr<br />
können als Markenzeichen gelten. Der Fahrradanteil liegt bis jetzt bei 30 Prozent.<br />
Hohe Kosten verhindern den Bau einer Straßenbahn, die den andauernden<br />
Pendlerstau beseitigen sollte.<br />
55
17. Freie Universität Bozen<br />
Martina Gehling, Toni Lang<br />
Die Freie Universität Bozen (FUB) ist eine relative kleine und noch recht junge<br />
Universität. Sie wurde 1997 gegründet und befindet sich auf der zentralen Piazza<br />
Universitá in Bozen. Zur Zeit studieren dort über 3.500 Studenten aus 60<br />
verschiedenen Ländern.<br />
Die Lehre umfasst die 5 Fakultäten Natur und Technik, Wirtschaftswissenschaften,<br />
Design und Kunst, Informatik sowie Bildungswissenschaften an den drei Standorten<br />
Bozen, Brixen (Bildungswissenschaften) und Bruneck (Wirtschaftswissenschaften).<br />
Neben der fachlichen Ausbildung wird an der Universität Bozen auch auf die<br />
Sprachausbildung der Studierenden Wert gelegt. Die Kurse werden auf Deutsch,<br />
Englisch und Italienisch jeweils im selben Umfang abgehalten. Für die Zulassung zum<br />
Studium sind daher Sprachkenntnisse auf B2 Niveau nach CEFR in min<strong>des</strong>tens zwei<br />
der drei Sprachen Voraussetzung. Nach dem Studium sollte der Absolvent in einer der<br />
ersten beiden Sprachen das Niveau C1, in der anderen B2+ und in der dritten<br />
min<strong>des</strong>tens B2 erreicht haben. Die besondere Betonung der Dreisprachigkeit und der<br />
Sprachausbildung der Studenten machen die Universität Bozen einzigartig.<br />
Im Rahmen <strong>des</strong> Master-Studiengangs “Environmental Management of Mountain<br />
Areas” gibt es Kooperationen mit den Universitäten in Trento und Innsbruck. Außerdem<br />
werden Partnerschaften mit vielen Universitäten innerhalb und außserhalb Europas<br />
unterhalten, wodurch der internationale Austausch der Studierenden zusätzlich<br />
gefördert wird.<br />
Die Studiengänge der Fachrichtung Agrarwissenschaften waren bis 2007 an der<br />
Fakultät <strong>für</strong> Wirtschaftswissenschaften angesiedelt, mit starker Betonung der<br />
wirtschaftlichen Fächer. 2007 wurde dann die Fakultät <strong>für</strong> Natur und Technik<br />
gegründet, an welcher zur Zeit insgesamt 219 Studenten unter anderem<br />
Agrarwissenschaften studieren.<br />
Angebotene Studiengänge im Fachbereich Agrarwissenschaften<br />
Bachelor Agricultural Science and Technology<br />
Master Fruit Science<br />
Promotionsstudium Management of Mountain Environment<br />
56
Neben den Bachelor- und Master-Studiengängen gibt es noch ein relativ verschultes<br />
Promotionsstudium mit nur 10 – 12 Plätzen pro Jahr.<br />
Für das Studium an der Universität Bozen fallen jährlich 1286,50 EUR<br />
Studiengebühren an. Bewerbungsschluss ist am 20. August.<br />
17.1 Landwirtschaft in Südtirol (Vortrag <strong>des</strong><br />
Vizedirektors <strong>des</strong> Südtiroler Bauernbun<strong>des</strong>, Ulrich<br />
Höllrigl)<br />
17.1.1 Geschichte<br />
Bis zur Krise 1870/80 war die Landwirtschaft Südtirols geprägt von Weinbau<br />
und Viehzucht, aber auch von arbeitsintensivem Getreideanbau. In den Jahren<br />
1870 bis 1880 kam es unter anderem durch eine Überschwemmung durch die<br />
Etsch zur landwirtschaftlichen Krise, im Zuge derer es z.B. zu schweren<br />
Maikäferplagen kam. Die Krise führte zur Revolution der Landwirtschaft. Es<br />
wurde vor allem in die Ausbildung im landwirtschaftlichen Bereich investiert. Im<br />
Zuge <strong>des</strong>sen wurden zum Beispiel 1874 die Landwirtschafts-Fachschule San<br />
Michele als erste Landwirtschaftsschule Tirols und im Jahre 1875 die<br />
Landwirtschaftsschule in Rotholz gegründet. Ab 1880 wurde das System der<br />
Kredit- und Vermarktungsgenossenschaften eingeführt. Bis zum heutigen Tag<br />
werden im Bereich Milchwirtschaft rund 98%, im Obstbau 95% und im Weinbau<br />
70% über Genossenschaften vermarktet.<br />
1904 wurde der Südtiroler Bauernbund (SBB) gegründet. Dieser fungiert bis<br />
heute als Interessensvertretung und teilweise auch Dienstleister der Bauern<br />
Südtirols.<br />
Nach dem ersten Weltkrieg wurde Südtirol 1918 dem Staat Italien<br />
zugesprochen, wodurch es zum Verbot <strong>des</strong> SBB und der Genossenschaften<br />
kam. Ausserdem wurden gezielt italienische Bauern in Südtirol angesiedelt und<br />
im Zuge der battaglia del grano Autarkie der Landwirtschaft angestrebt.<br />
57
17.1.2 Die Landwirtschaft in Südtirol nach dem zweiten<br />
Weltkrieg bis heute<br />
Die Entwicklung der Südtiroler Landwirtschaft seit dem zweiten Weltkrieg war durch<br />
Modernisierung und Spezialisierung der Betriebe gekennzeichnet. Dabei kam es<br />
allerdings nicht wie in vielen anderen Ländern zur Flurbereinigung, weshalb die Anzahl<br />
der Betriebe stabil blieb. Auch heute noch zeichnet sich die Region durch besonders<br />
viele kleine Betriebe aus, welche allerdings fast als übermechanisiert angesehen<br />
werden können. Zwischen 2000 und 2007 nahm die Zahl der landwirtschaftlichen<br />
Betriebe in Südtirol nur um 10,7% ab, in Deutschland dagegen um über 20%. Die bis<br />
ins 19. Jahrhundert vorherrschende Diversität der Betriebsstrukturen wurde im Laufe<br />
<strong>des</strong> 20. Jahrhunderts durch zunehmend spezialisierte Betriebe verdrängt. Es<br />
herrschen die drei großen Bereiche Obstbau (vor allem Apfelanbau), Milchwirtschaft<br />
und Weinbau vor. Heute trägt die Landwirtschaft in Südtirol mit ca. 700 Mio. EUR 5-6%<br />
zum BIP <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> bei. Dieser relativ hohe Anteil wird durch die große Vielfalt der<br />
Berglandwirtschaft auf kleinem Raum, die hohe Stabilität der Betriebszahlen und der<br />
bewirtschafteten Fläche, sowie <strong>des</strong> Genossenschaftswesens mit Mitbestimmungsrecht<br />
der Bauern erreicht.<br />
Durch die sinkenden Milchpreise und die gleichzeitig steigenden Produktionskosten<br />
wird zur Zeit das Standbein “Urlaub auf dem Bauernhof” in der Region immer<br />
bedeutsamer. Damit soll die Zahl der Betriebe weiterhin gering gehalten und die<br />
familiäre Struktur der Landwirtschaft aufrechterhalten werden.<br />
17.1.3 Herausforderungen <strong>für</strong> die Zukunft<br />
In der Zukunft wird die Produktion erneuerbarer Energien auch in Südtirol ein immer<br />
wichtigerer Bestandteil der Landwirtschaft werden. Dabei ist dort vor allem die<br />
Produktion von Hackschnitzeln aus Waldwirtschaft bedeutend. Der Anbau von<br />
Energiepflanzen auf dem Feld z.B. zur Gewinnung von Biogas hat in Südtirol einen<br />
vergleichsweise niedrigen Stellenwert.<br />
Außerdem werden auch regionale Kreisläufe an Bedeutung gewinnen, welche zum<br />
Beispiel durch lokale Vermarktung unterstützt und gestärkt werden.<br />
58
Alles in allem ist Südtirol ein gelungenes Beispiel da<strong>für</strong>, dass auch die Beibehaltung<br />
und Förderung kleinbetrieblicher Strukturen und eine besondere Betonung und<br />
Wertschätzung der Landwirtschaft zu einer erfolgreichen Wirtschaft führen können.<br />
17.2 Obstbauwirtschaft in Südtirol (Dr. Wolfgang<br />
Drahorad)<br />
Als wichtigste Säule der Südtiroler Landwirtschaft wurde im Rahmen <strong>des</strong> Besuchs an<br />
der Uni Bozen noch die Obstbauwirtschaft vorgestellt. Vor allem die Apfelproduktion<br />
hat hierbei einen besonderen Stellenwert.<br />
Die klimatischen Ausgangsbedingungen in der Region sind von kontinentalem<br />
trockenem Klima mit Schnee im Winter und warmen trockenen Sommern geprägt.<br />
Daher ist vor allem im Sommer Bewässerung nötig. Diese wird in Form der<br />
wassersparenden Tröpfchenbewässerung realisiert. Im Frühjahr findet dagegen die<br />
sogenannte Frostberegnung als Schutz gegen Erfrieren der Pflanzen bei<br />
Kälteeinbrüchen Anwendung. Dabei wird die bei der Eisbildung frei werdende<br />
Gefrierwärme ausgenutzt um die Pflanzen vor den niedrigen Temperaturen zu<br />
schützen.<br />
Pflanzenschutz wird in Südtirol nach dem Schadschwellen-Prinzip betrieben. Dabei<br />
wird je nach Schädlingsbefall gezielt mit Pflanzenschutzmittel behandelt. Mit Hilfe von<br />
Pheromonfallen werden Insekten eingefangen und gezählt woraufhin die entsprechend<br />
notwendige Maßnahme durchgeführt wird. Außerdem steht die Schonung und<br />
Förderung von Nützlingen, z.B. durch Bereitstellung von Überwinterungsmöglichkeiten,<br />
im Vordergrund.<br />
Die Obstmade wird mit Hilfe der Verwirrtechnik bekämpft. Dabei werden hohen<br />
Konzentrationen an Pheromonen im Feld ausgebracht, welche die Paarfindung der<br />
Tiere erschweren und deren Vermehrung behindern. Mit dieser Technik spart man bis<br />
zu 80% der Behandlungen mit Pflanzenschutzmitteln ein.<br />
Insgesamt werden jährlich ca. 15 Behandlungen zum Zweck <strong>des</strong> Pflanzenschutzes<br />
durchgeführt, darunter u.a. 8-10 Behandlungen mit Fungiziden gegen Schorf und<br />
Mehltau und 2-3 Behandlungen mit Insektiziden.<br />
Neben dem Schädlingsbefall stellen auch die fast jährlichen Schäden durch<br />
Hagelschlag die Südtiroler Obstbauern vor Herausforderungen. Zum Schutz der<br />
Obstbäume werden Hagelnetze angebracht, welche gleichzeitig auch physiologische<br />
Wirkungen wie ein verstärktes Wachstum und eine geringere Farbausbildung nach sich<br />
59
ziehen. Per Gesetz ist aus Gründen <strong>des</strong> Landschaftsschutzes allerdings nur das<br />
Anbringen von schwarzen oder dunkelgrauen Netzen erlaubt.<br />
60
18. Betriebsbesichtigung Obsthof Troidner<br />
Barbara Göschl, Katharina Kappauf,<br />
Der Obsthof Troidner wird von der Familie Kohl bewirtschaftet und liegt auf dem Ritten<br />
in der Fraktion Unterinn. Auf 900 Metern über Meereshöhe werden seit ca. 20 Jahren<br />
verschiedenste Apfelsorten angebaut. Davor wurden die Flächen als Wiesen, Äcker<br />
und <strong>für</strong> die Viehhaltung genutzt, da früher der Erwerbs-Apfelanbau nur bis max. 750<br />
Meter über Meereshöhe durchgeführt wurde. Nun hat der Betrieb 6 ha Apfelbäume mit<br />
durchschnittlich 3000 bis 4000 Bäumen pro ha und 2 ha Wein. Die gesamte Weinernte<br />
wird an eine Genossenschaft geliefert.<br />
Auf dem hochgelegenen Betrieb werden verschiedene Apfelsorten angebaut. Jedoch<br />
hat sich der Betrieb Kohl auf besondere Apfelsorten spezialisiert. Darunter fallen<br />
Sorten wie Pinova und Jonagold, die als „nicht mehr modern“ gelten und daher <strong>für</strong> den<br />
Markt uninteressant geworden sind. Daneben sind aber auch Sorten, die im Anbau<br />
stark rückläufig sind, zu finden, wie die Sorte Elstar. Die Sorte Grafensteiner, die<br />
ebenfalls von Familie Kohl angebaut wird, ist eine alte Liebhabersorte, die<br />
Schwierigkeiten bereitet im Anbau und der Lagerung. Die alte Sorte Rubinette findet<br />
man in Südtirol nur noch auf dem Troidnerhof; sie eignet sich hervorragend <strong>für</strong> die<br />
Saftproduktion. Die Trends, welche Sorten gerade modern sind, werden durch den<br />
Großhandel vorgegeben, in dem er nur bestimmte Sorten listet und dadurch den Preis<br />
bestimmt.<br />
Die Bäume sind generell kleinwüchsig mit einer schwachwüchsigen Unterlage, auf die<br />
die gewünschten Edelsorten gepfropft sind. Sie werden als schlanke Spindeln gepflegt,<br />
was den Vorteil bietet, dass vom Boden aus gearbeitet werden kann und maximal eine<br />
kleine Erhöhung benötigt wird. Durch das schlanke Wachstum gelangt sehr viel Licht,<br />
Sonne und Luft in das Bauminnere und die Bildung von Schattenfrüchten verhindert,<br />
welche weniger Geschmack und Farbe beinhalten. Der Nachteil eines kleinen Baumes<br />
ist, dass er zeitlebens ein Gerüst bzw. Halteeinrichtung benötigt. Zudem ist<br />
Bewässerung notwendig, da auch das Wurzelsystem geringer ausgebildet ist und der<br />
Baum so nicht gegen Trockenheit geschützt ist. Aus diesem Grund ist eine<br />
Tropfenbewässerung eingerichtet worden. Dadurch ist eine optimale und sehr<br />
sparsame Verteilung <strong>des</strong> Wassers möglich (2 Liter pro Baum und Tag).<br />
Das Wasser wird auch zur Stickstoffdüngung verwendet (= Fertilisation). Die Düngung<br />
erfolgt lediglich sechs Wochen im Frühjahr, einmal wöchentlich vor, während und kurz<br />
61
nach der Blüte. Es werden nie große Gaben gegeben, damit es zu keiner<br />
Auswaschung kommt. Zudem werden Phosphor, Magnesium und Kalium gedüngt. Als<br />
organischer Dünger wird Stallmist händisch ausgebracht. Diesen erhält der Betrieb im<br />
Tausch gegen Apfeltrester als Viehfutter.<br />
Die Geräte <strong>des</strong> Pflanzenschutzes sind auf die ‚Hecke’ abgestimmt, dadurch gibt es<br />
keine Verluste. Gras zwischen den Baumreihen wird weitgehend beibehalten um<br />
Erosion zu vermeiden. Oft wird nur jede zweite Reihe gemulcht, damit die darin<br />
enthaltenen Nützlinge bzw. Schädlinge nach Entzug ihrer Lebensgrundlage nicht die<br />
Bäume besiedeln.<br />
Die Ernteausdünnung erfolgt Mitte Juni, da zu dieser Zeit klar ist, welche Anzahl an<br />
Äpfeln der Baum voll ausbilden möchte. Dabei werden überzählige Früchte per Hand<br />
oder mithilfe von chemischen Ausdünnungsmittel entfernt. Dadurch erreichen die<br />
restlichen Früchte eine optimale Größe und noch wichtiger den vollen Geschmack.<br />
Andernfalls würden sich die Inhaltsstoffe auf mehrere Früchte aufteilen. Auch der<br />
Baum wird dadurch entlastet und bildet <strong>für</strong> das darauffolgende Jahr ausreichend<br />
Blütenanlagen. So wird ein gleichmäßiger Ertrag über die Jahre erlangt und die<br />
Früchte bilden einen optimalen Geschmack aus. Bemerkenswert ist, dass schon 5%<br />
der Vollblüte <strong>für</strong> eine spätere Vollernte ausreichen.<br />
Zum Schutz der Früchte werden <strong>für</strong> zwei Hektar Hagelschutznetze verwendet. Dies<br />
war vor allem wichtig, als der Betrieb die Äpfel noch als Tafelware vermarktete.<br />
Nachteilig ist dabei, dass die Produktionskosten steigen und Mäuse sich zunehmend<br />
ausbreiten. Für Vögel sind diese Netze kein Problem. Sie werden nach der Ernte<br />
zusammengebunden und erst nach abgeschlossener Blüte wieder aufgespannt, damit<br />
die Insekten und der Wind während der Bestäubung nicht behindert werden.<br />
Die Ernte erfolgt im August per Hand in mehreren Pflückdurchgängen. Im Schnitt<br />
werden 150 AKh pro Hektar in 3 – 4 Durchgängen benötigt. In dieser Zeit werden acht<br />
Arbeitskräfte auf dem Hof beschäftigt. Während <strong>des</strong> restlichen Jahres sind es 2 – 4<br />
Arbeitskräfte.<br />
Im Jahr 2004 wurde mit der Apfelsaftproduktion im kleinen Rahmen begonnen. Der<br />
Verkauf erfolgte bereits über Direktvermarktung. 2009 kam es zu einer Erweiterung,<br />
und die Produktion wurde in zwei verschiedene Bereiche der ehemaligen Scheune<br />
aufgeteilt. Im oberen Raum werden die Äpfel (es werden nur gepflückte Äpfel und kein<br />
Fallobst verwendet) zunächst im Wasserbad gewaschen um sie von Staub zu befreien<br />
und daraufhin in einer Mühle zu Brei zermahlen. Dieser Brei fällt auf eine<br />
Einbahnpresse, welche zu Walzen führt, die den Saft herauspressen. Dieser wird dann<br />
62
über Nacht in einem Tank gelagert, damit sich die groben Anteile absetzen. Ist die<br />
Naturtrübung optimal, wird der Saft in den unteren Raum zum Abfüllen weitergeleitet,<br />
wenn nicht wird noch eine Zentrifuge dazwischen geschaltet. Im unteren Raum der<br />
Scheune wird der Saft am nächsten Tag pasteurisiert. Dies geschieht, indem der Saft<br />
<strong>für</strong> 25 Sekunden auf 80 °C erhitzt wird. Danach wird er ausschließlich in neue Flaschen<br />
abgefüllt. Der komplette Verarbeitungsvorgang erfolgt getrennt <strong>für</strong> jede Sorte.<br />
Damit die Maschinen besser ausgelastet sind, wird neben den eigenen Äpfeln (450 t<br />
Äpfel) auch <strong>für</strong> Privatpersonen Apfelsaft (300 t Äpfel) hergestellt.<br />
Im Dunkellager, das ca. 1500 m³ umfasst, werden die abgefüllten Flaschen dann<br />
temperaturneutral gelagert. Das Etikett wird aus Gründen der Zeitersparnis während<br />
der Erntezeit erst im Laufe <strong>des</strong> Jahres aufgebracht.<br />
Herr Kohl hat <strong>für</strong> sein hervorragen<strong>des</strong> Marketing 2011 den Marketing-Award<br />
gewonnen. Über das aufwändige Marketing werden die Säfte im höheren<br />
Preissegment vermarktet. Dabei gibt es Premiumsäfte, Gourmet Plus oder die<br />
klassische Linie. Eine Flasche sortenreiner Premiumsaft mit 0,75 Liter Inhalt kostet<br />
2,90€. Der Markt <strong>für</strong> diese Säfte ist in Südtirol relativ klein. Vorrangig gehen die Säfte<br />
nach Deutschland, Norditalien, Tschechien, Ukraine und Slowakei. Dort werden sie<br />
hauptsächlich in Großstädten verkauft.<br />
63
Regal im Hofladen mit verschiedensten Saftsorten<br />
Nach der Betriebsführung wurde im Verkaufsraum eine Saftverkostung durchgeführt.<br />
Jeder durfte den Saft der Sorte Jonagold und der Sorte Elstar probieren. Danach gab<br />
es auch noch die Gourmet Plus Variante mit Marille zum Verkosten. Es wurde deutlich,<br />
dass es sich hierbei um qualitativ sehr hochwertige Säfte handelt und so mancher<br />
staunte auch über den unterschiedlichen Geschmack, den die verschiedenen<br />
Apfelsorten hervorbringen können. Überzeugt von dem Geschmack und der Qualität<br />
kaufte nach der Verkostung ein Großteil der Exkursionsteilnehmer Produkte im<br />
Genussladen auf dem Troidner Hof.<br />
64
19. Versuchszentrum Laimburg<br />
Claudia Heinze, Eva-Maria Brunlehner<br />
19.1 Geschichte<br />
Im Jahr 1968 wurden die ersten Versuchsanlagen angelegt, und die offizielle Gründung<br />
<strong>des</strong> Versuchszentrums fand 1975 nach dem Lan<strong>des</strong>gesetz Nr. 53 vom 3. November<br />
statt.<br />
Bereits 1978 wurde das Versuchszentrum durch den Neubau der Hofstelle Mair am<br />
Hof in Dietenheim/Bruneck und die Übernahme <strong>des</strong> Außenbetriebes Seeburg erweitert.<br />
Das Agrikulturchemie Labor nahm 1979 seine Arbeit auf.<br />
Die Staatsgüter ONC-Höfe in Freiberg/Meran und der Ölleitenhof am Kalterer See<br />
wurden 1980 <strong>für</strong> Versuche im Obst- und Weinbau übernommen.<br />
Ein wichtiger Punkt in der Geschichte <strong>des</strong> Versuchszentrums Laimburg war der Bau<br />
<strong>des</strong> Felsenkellers von 1989 bis 1990; die Kellerei wurde bereits 1993 erweitert und<br />
2003/2004 nochmals ausgebaut.<br />
Versuchszentrum Laimburg<br />
19.2 Allgemeines zum Versuchszentrum<br />
65<br />
Die Gärten von Schloss<br />
Trauttmansdorff wurden ab<br />
1994 errichtet und 2001 <strong>für</strong><br />
Besucher geöffnet.<br />
Bedeutsam waren die<br />
Aufnahme der Arbeit am<br />
Molekularbiologischen Labor<br />
und der Beginn <strong>des</strong> Aufbaus<br />
der Genbank im Jahr 2002.<br />
In der Genbank werden alle<br />
Arten von Apfelsorten<br />
aufbewahrt (i.M. 150<br />
Genprofile).<br />
Das Versuchszentrum Laimburg wurde gegründet um praxisorientiert zu forschen und<br />
um die Südtiroler Landwirtschaft auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu gestalten.Derzeit<br />
arbeiten 200 Mitarbeiter plus 200 Saisonarbeitskräfte am Versuchszentrum. Die
Forschungsgebäude und die landwirtschaftlichen Flächen befinden sich in<br />
Lan<strong>des</strong>besitz und sämtliche Erzeugnisse werden auf herkömmlichem Weg vermarktet.<br />
Die landwirtschaftlichen Flächen befinden sich im Pustertal, im Vinschgau und in der<br />
Gegend rund um Brixen. Davon sind rund 160 Hektar Obstbau, 45 Hektar Weinbau<br />
und 15 Hektar Grünland. Der Obstbau findet auf Flächen statt, die auf 200 bis 800<br />
Metern Meereshöhe liegen. Die Grünlandbewirtschaftung erstreckt sich bis auf eine<br />
Höhe von 1800 Metern; die Almwirtschaft geht darüber hinaus.<br />
Am Versuchszentrum Laimburg befinden sich verschiedene Einrichtungen wie<br />
beispielsweise ein Bodenlabor oder auch ein Weinlabor.<br />
Hier werden in der Pflanzenschutz-Abteilung Mittel- und Verträglichkeitsprüfungen<br />
sowie Blatt- und Rückstandsuntersuchungen durchgeführt.<br />
Die Aufgabenschwerpunkte im Obstbau sind die Sortenprüfungen und die darauf<br />
basierenden Sortenempfehlungen. Im Weinbau werden verschiedene Anbauformen<br />
überprüft, dadurch können produktionstechnische Hinweise an die Landwirte<br />
weitergegeben werden. Die Analysen werden zu 60 Prozent im Auftrag der Winzer<br />
durchgeführt. Weitere Aufgaben <strong>des</strong> Weinbaulabors sind: Vergleich verschiedener<br />
Weinbehandlungsmittel, Studien hinsichtlich aktueller Weinkrankheiten und<br />
Durchführung von Reifetests <strong>für</strong> Keltertrauben. Insgesamt werden in der Kellerei<br />
jährlich 200.000 Flaschen Rot- und Weißwein abgefüllt und vermarktet.<br />
Auf dem Gelände <strong>des</strong> Versuchszentrums Laimburg ist die Fachschule <strong>für</strong> Ost-, Garten-<br />
und Weinbau angegliedert. Trotz der eigenständigen Verwaltung findet hier ein reger<br />
Austausch beispielsweise durch Projekte statt.<br />
Interessant zu erwähnen ist das Projekt „Originale“ in Zusammenarbeit mit der<br />
Universität Bozen. Ziel der Zusammenarbeit ist die Förderung regionaler Obst-,<br />
Fleisch- und Milchprodukte.<br />
19.3 Apfelanbau<br />
Durchschnittlich werden auf den Versuchsflächen 50 Tonnen pro Hektar geerntet; die<br />
frühesten Sorten bereits Mitte August. Danach kommen die Äpfel in die Sortieranlage<br />
und werden anschließend im eigenen Lagerhaus eingelagert. Die beliebtesten Sorten<br />
sind „Golden Delicious“, „Gala“ und „Red Delicious“. Die Preise liegen je nach Sorte<br />
zwischen 25 und 70 Eurocent pro Kilogramm.<br />
66
19.4 Sortenprüfung<br />
Die wechselnden Anforderungen <strong>des</strong> Marktes verlangen eine laufende Anpassung <strong>des</strong><br />
Apfelsortiments, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. In der Sortenprüfung<br />
werden <strong>des</strong>halb interessante Neuzüchtungen aus aller Welt auf ihre Eignung <strong>für</strong> das<br />
Südtiroler Anbaugebiet getestet. Geachtet wird dabei auf Fruchtqualität und günstige<br />
Baumeigenschaften.<br />
Durch eine eigene Züchtung sollen angepasste Sorten entwickelt werden, die in ihren<br />
Fruchteigenschaften den Anforderungen <strong>des</strong> Konsumenten entsprechen. Ein<br />
besonderes Augenmerk wird dabei auch auf die Resistenz gegenüber Schaderregern<br />
gelegt.<br />
Die Konservierung und Vorvermehrung von Apfelsorten garantiert dem<br />
Baumschulwesen und letzten En<strong>des</strong> dem Obstbauern kontrolliertes Pflanzmaterial.<br />
19.5 Clubsorten<br />
Clubsorten in Südtirol<br />
Sorten sind im Testanbau.<br />
67<br />
Unter Clubsorten versteht man<br />
Sorten, die exklusiv vermarktet<br />
werden. Der Clubinhaber übernimmt<br />
hierbei alle Aufgaben. Will ein<br />
Landwirt eine Clubsorte anbauen, so<br />
muss er eine Lizenzgebühr<br />
entrichten; da<strong>für</strong> werden Clubsorten<br />
auch zu höheren Preisen vermarktet.<br />
Die wohl wichtigsten Clubsorten sind<br />
„Cripps Pink“ und „Rosy Glow“. Sie<br />
werden unter dem Markennamen<br />
„Pink Lady®“ verkauft.<br />
Im Bioanbau ist bisher nur die Sorte „Evelina“ zugelassen.<br />
Bisher wurden 40.000 Sämlinge gepflanzt ; 5
19.6 Lagerung<br />
Die Erntefrische von Obst und Gemüse soll durch eine optimale Lagerung über einen<br />
möglichst langen Zeitraum hinweg erhalten bleiben. Dem Konsumenten stehen somit<br />
Lagerschäden an Äpfeln<br />
Lagerschäden vor.<br />
68<br />
Früchte länger in hochwertiger Qualität zur<br />
Verfügung, und es kann auf die saisonal<br />
bedingte Nachfrage <strong>des</strong> Marktes flexibel<br />
reagiert werden. Die Frische der geernteten<br />
Früchte wird mittels Anwendung<br />
konsumentenfreundlicher und<br />
umweltschonender Lagerverfahren erhalten.<br />
Angewandt wird bei der Lagerung die „ultra-<br />
low-oxygen-Methode“. Hierbei wird der<br />
Stoffwechsel <strong>des</strong> Apfels soweit verlangsamt,<br />
dass er sich praktisch in einer Art Winterschlaf<br />
befindet. Der Lagerraum wird dazu mit<br />
Stickstoff aufgefüllt; der Sauerstoffgehalt wird<br />
streng reguliert und liegt lediglich zwischen<br />
1,2 und 1,4 Prozent. Sind die Äpfel innen braun oder<br />
haben ein eher glasiges Fruchtfleisch, so liegen<br />
Logo <strong>des</strong> Versuchszentrums Laimburg
20. Felsenkeller Laimburg mit Weinverkostung<br />
Silke Petershammer, Regina Koller<br />
Im Felsenkeller<br />
Am Donnerstagabend hatten wir die Ehre, den Lan<strong>des</strong>hauptmann Luis Durnwalder im<br />
Felsenkeller besuchen zu dürfen. Dieser Felsenkeller wurde vor circa 18 Jahren in den<br />
Felsen eingefräst. Die Kosten beliefen sich dabei auf etwa 162 Euro pro m².<br />
In den Räumen können bis zu 86.000 Weinflaschen Platz zur Lagerung finden; derzeit<br />
lagern um die 18.000 Flaschen in diesem Keller. Es gibt einen eigenen<br />
Verkostungsraum, da der Lan<strong>des</strong>hauptmann immer wieder betont, landwirtschaftliche<br />
Produkte seien Botschafter <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong>. Herr Durnwalder empfängt in diesem Keller<br />
seine Gäste, zu denen bereits der österreichische Bun<strong>des</strong>kanzler, Kommissare,<br />
Olympiasieger und jetzt wir, die Studenten der TU München, zählen. Der<br />
Verkostungsraum wurde mit einer Harzschicht verkleidet, um der Bildung von<br />
Kondensationswasser an der Decke vorzubeugen. Der Felsenkeller ist laut Herrn<br />
Durnwalder der Verwaltungssitz der landwirtschaftlichen Kulturgründe Südtirols.<br />
Zuständig sei die Verwaltung <strong>für</strong> ca. 13.000 Sozialwohnungen, <strong>für</strong> eine Forstwirtschaft<br />
mit ca. 12.000 ha Fläche und eine Landwirtschaft, die ungefähr 450 ha<br />
landwirtschaftliche Kulturgründe, 180 ha Obst, 50 ha Wein und 5 ha Gemüse<br />
beinhaltet.<br />
Bei seiner Ansprache betonte Herr Durnwalder die Bedeutung Südtirols in der<br />
Apfelproduktion. Jeder 10. Apfel in Europa werde in Südtirol produziert. Die Hälfte der<br />
Äpfel gehen in den Export nach Deutschland. Wichtig, aber auch problematisch sei<br />
dabei die Lagerung der Äpfel. Eine wichtige Aufgabe der Laimburg<br />
69
ist es <strong>des</strong>halb, die Forschung voran zu treiben. Gelte es doch, die verschiedenen<br />
Sorten mit deren jeweiligen Standorteigenschaften, die Düngung oder auch das<br />
richtige Zuschneiden von den Bäumen zu verbessern.<br />
Auch in Südtirol gäbe es einen zeitlichen Wandel. Hatte man früher beispielsweise<br />
1.500 große Bäume, jetzt hat man 4.500 kleine Bäume. Immerhin sind 50 % der Fläche<br />
Südtirols ausschließlich Wald, der nicht nur zur Holzgewinnung, also<br />
Biomasseproduktion dient, sondern auch eine wichtige Rolle bei der<br />
Landschaftsgestaltung, der Erholung und der Landschaftssicherheit hat und dies nicht<br />
zuletzt wegen den jährlich 6 Millionen Touristen.<br />
Der Weinbau ist in Südtirol auch außerordentlich wichtig. Laut Herrn Durnwalder sei<br />
dies nicht nur der Wein selbst, sondern auch dort wo der Wein angebaut wird, da hier<br />
ein anderes Klima, andere Sitten, andere Gebräuche und andere Kulturen zu finden<br />
sind. Aus diesem Grund erscheine Herrn Durnwalder der Felsenkeller auch der<br />
passende Ort <strong>für</strong> politische Verhandlungen. Trotz alledem versucht man in Südtirol<br />
Qualität statt Quantität vorherrschen zu lassen. Der Südtiroler Wein mache zwar nur<br />
0,8 % am gesamten italienischen Wein aus, aber 14 % der Auszeichnungen gingen an<br />
eben diese besonderen Weine.<br />
Die Weine werden in Holzfässer gelagert, da das Holz den Charakter <strong>des</strong> Weines<br />
unterstreichen solle. Die Fässer werden 6 – 8 Jahre <strong>für</strong> die Reifung <strong>des</strong> Weines<br />
verwendet und dann ausgewechselt. Die Weine werden alle 3, 5 und 10 Jahre<br />
verkostet, um zu wissen, wann derer geschmacklicher Höhepunkt erreicht ist. Für<br />
diese Verkostung werden auch Vergleichsweine aus aller Welt im Felsenkeller<br />
gelagert.<br />
Nach der sehr fesselnden und informativen Rede <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong>hauptmanns ging es zur<br />
gemütlichen Weinprobe über. Alle Weine haben ihre Namen aus der nordischen<br />
Sagenwelt. Folgende Weine durften wir kosten:<br />
20.1 Weißweine<br />
Südtiroler Weißburgunder „Rayèt“ DOC<br />
(Rayèt = Strahlenstein mit Zauberkraft)<br />
Die Farbe ist ein strahlen<strong>des</strong> Gelb mit zartem Grün. Flüchtige Blütenaromen und<br />
Apfelduft können wahrgenommen werden. Die Säure hat eine tragende Struktur. Der<br />
Körper ist gut gebaut und zeigt Fülle und Nachhaltigkeit; trocken.<br />
70
Südtiroler Sauvignon „Oyèll“ DOC<br />
(Oyèll= kluge Herrin der Dolomiten)<br />
Die Farbe ist ein helles Strohgelb mit grünlichen Reflexen. Das<br />
Aroma ist ausgeprägt und markant nach Holunderblüten, Feigenmilch und<br />
Johannisbeeren. Ein mineralisch-salziger Wein. Gut strukturiert mit anregender Säure;<br />
trocken.<br />
Bis in die 90er Jahre wurde in Südtirol vermehrt Rotwein produziert.<br />
Jetzt werden 53 – 55 % Weißweine hergestellt.<br />
Südtiroler Gewürztraminer „Elyònd“ DOC<br />
(Elyònd = mutige Bergprinzessin mit goldenem Haar)<br />
Die Farbe ist ein kräftiges Goldgelb. Rosen, Lavendel und Zuckerfeigen prägen das<br />
Duftbild. Die angenehm begleitende Säure vermittelt Eleganz und Finesse. Opulent<br />
und ausgewogen; trocken.<br />
20.2 Rotweine<br />
Südtiroler Blauburgunder Riserva „Selyèt“ DOC<br />
(Selyèt = Glück bringende Wunderblume, die Welten offenbart)<br />
Die Farbe ist ein Dunkelrubin bis Purpurrot. Sein primäres Aroma erinnert an Maul- und<br />
Brombeeren. Extrakt, Herbe und Säure stehen mit den eingebundenen Aromen <strong>des</strong><br />
Eichenholzfasses im Gleichklang.<br />
71
Südtiroler Cabernet Sauvignon Riserva „Sass Roà” DOC<br />
(Sass Roà = glühend roter, magischer Stein im bleichen Fels)<br />
Die Farbe ist ein Dunkelpurpur mit granatroten Reflexen. Das Bukett ein Hauch<br />
von schwarzer Johannisbeere und Melisse, begleitet von den Lohestoffen der<br />
Eiche. Groß in seiner Struktur, reich an Gerbstoffen und lang anhaltend;<br />
trocken.<br />
Südtiroler Lagrein Riserva „Barbagòl“ DOC<br />
(Barbagòl = Hexenmeister, der die Sinne verzaubert)<br />
Die Farbe ist ein funkeln<strong>des</strong> Granatrot. Im Bukett sind Kirsche und Eichenholz<br />
angedeutet und bestens eingebunden. Weich beim Eintritt, kompakt und kräftig<br />
im Mittelbereich. Lang anhaltend und mit feiner körniger Herbe im Abgang;<br />
trocken.<br />
72
21. Obstgenossenschaft Cafa Meran<br />
Johannes Wenig, Markus Harrer<br />
21.1 Eckdaten<br />
Der Qualitätsleiter der Obstgenossenschaft Cafa Meran lieferte uns einen Einblick in<br />
die Abwicklung der verschiedenen Produktions- und Verarbeitungsphasen. Die<br />
Mitgliederzahl beträgt 349, von denen rund 1000 Hektar Anbaufläche stammen. 2011<br />
betrug die Anlieferungsmenge exakt 58.730,668 Tonnen Äpfel von 15 verschiedenen<br />
Sorten. Die beiden mengenmäßig bedeutendsten Sorten stellten dabei der Golden<br />
Delicious mit 48% und der Red Delicious mit 20% dar.<br />
21.2 Produktionsablauf<br />
Nach der Ernte im Herbst erfolgt eine optische Eingangskontrolle und Qualitätsprüfung.<br />
Dabei werden die Apfelkisten, die etwa 240 kg fassen, mit einem Barcode versehen,<br />
der die Rückverfolgbarkeit gewährleistet.<br />
Die Einlagerung in Kühlzellen läuft unter anderem mit Sauerstoffentzug ab. Das<br />
Verfahren heißt dynamische CA-Lagerung (DCA=Dynamic Controlled Atmosphere).<br />
Der Sauerstoffgehalt beträgt 0,3 bis 0,4 Prozent, um die Qualität der Früchte zu<br />
erhalten. Außerdem wird die Luftfeuchtigkeit auf 95% angehoben, sodass keine<br />
Schrumpfungserscheinungen auftreten.<br />
Eine weitere Methode Äpfel langfristig einzulagern, besteht in der Verwendung <strong>des</strong><br />
pulverförmigen MCP (Methylcyclopropen), einem Ethylenblocker. MCP ist nicht<br />
deklarationspflichtig, da keine Rückstände in den Früchten nachgewiesen werden<br />
konnten. Ethylen bewirkt bei Äpfeln das Voranschreiten <strong>des</strong> Reifeprozesses. Wird<br />
MCP eingesetzt, wird dieser nahezu vollständig zum Erliegen gebracht. Deshalb erfolgt<br />
die Anwendung mit MCP in der sogenannten ‚Smart Fresh‘ Qualitätssicherung zu<br />
einem genau definierten Zeitpunkt , um den genauen Reifegrad <strong>für</strong> die Auslieferung in<br />
den Handel festzulegen. In der Obstgenossenschaft dominiert jedoch die CA-<br />
Lagerung.<br />
Nach min<strong>des</strong>tens 5 bis 6 Monaten findet die Entnahme aus den Kühlzellen statt, die<br />
den ersten Schritt in Richtung Verkauf einleitet. Bei der vollautomatischen Sortierung<br />
mit Hilfe von Kameras auf bis zu 40 Qualitätsmerkmale, wie zum Beispiel Farbe und<br />
Größe, werden die Äpfel in drei Verkaufskategorien eingeteilt. Die erste Kategorie<br />
73
stellen Tafeläpfel dar. Äpfel mit kleinen Defekten wandern in die zweite Kategorie, die<br />
beispielsweise Discounter aufgrund <strong>des</strong> günstigeren Preises abnehmen. Äpfel, die<br />
große Defekte wie Hagelschäden aufweisen, und Fallobst gelangen als dritte Kategorie<br />
zur Verwertung in der Industrie. Diese stellt daraus Apfelsaft oder Obstbrände her. 70<br />
Kisten werden pro Stunde einsortiert. Der gesamte Transportweg läuft im Wasserbad<br />
ab, so dass die Äpfel vor Druckstellen bewahrt werden.<br />
21.3 Abrechnung und Vermarktung<br />
Ein Beratungsring informiert Landwirte über den rechtzeitigen Erntetermin. Kriterien<br />
hier<strong>für</strong> sind die Größe und die Farbe. Optimale Größen liegen zwischen 70 und 85<br />
Millimetern Durchmesser. Generell gilt: je mehr Äpfel der ersten Kategorie angeliefert<br />
werden, <strong>des</strong>to höher sind die Auszahlungsraten an die Obstbauern, die je nach<br />
Qualität im Durchschnitt bei 32 Cent pro kg liegen. In November erhalten die Betriebe<br />
zunächst eine kleine Anzahlung. Im Anschluss erfolgt alle drei Monate eine weitere<br />
Auszahlung. Die Endabrechnung über die erhaltene Menge wird erst ein Jahr nach der<br />
Ernte erledigt.<br />
Auslieferungen betreffen in Deutschland die Großkunden Edeka, Rewe, Lidl, Aldi und<br />
Tengelmann. Externe Gutachter stellen sicher, dass die qualitativ hochwertige Ware<br />
auch in den Regalen der Supermärkte ankommt. Qualitätsmängel haben Rücknahmen<br />
oder Preissenkungen zur Folge. In Italien verbleibt circa die Hälfte. Weitere Abnehmer<br />
sind Norwegen, Schweden, England und Spanien, aber es finden auch Exporte in<br />
Länder außerhalb der EU, wie Libyen und Ägypten, statt. Konsumenten in Nordafrika<br />
bevorzugen glänzende und knackig rote Äpfel. Auf diese Wünsche geht die<br />
Obstgenossenschaft mit speziellen Linien ein, die gewachst werden, um einerseits die<br />
Haltbarkeit auch bei höheren Temperaturen, andererseits das optisch gewünschte<br />
Erscheinungsbild zu gewährleisten.<br />
Doch auch innerhalb von Länders stellen Verbraucher unterschiedliche<br />
Qualitätsansprüche an Äpfel. Deutschland spaltet sich im Hinblick auf den Golden<br />
Delicious beispielsweise in Nord und Süd: der Norden verlangt grüne und kleine<br />
Früchte, wohingegen im Süden gelbliche und große Äpfel stärker nachgefragt werden.<br />
74
22. Betriebsbesichtigung Pflegerhof – Kräuterhof<br />
Andrea Dehoff, Anne Weber<br />
22.1 Allgemeines über den Pflegerhof<br />
Nach einer abenteuerreichen Busfahrt durch unwegsames Berggelände, mussten wir den<br />
restlichen Weg zu dem abgelegenen Kräuterhof „Pflegerhof“ der Familie Mulcher schließlich<br />
zu Fuß bestreiten.<br />
22.1.1 Betriebsstruktur<br />
Seit 1980 wird der in St. Oswald-Gemeinde Kastelruth gelegene Hof auf 800 m üNN<br />
biologisch bewirtschaftet. Als Urlauber aus dem Norden Deutschlands auf den<br />
Pflegerhof kamen, brachten sie die Idee eines Kräuterhofes mit. 1982 setzte die<br />
Familie neben anderen Betrieben dieser Region die Idee in die Tat um und<br />
bewirtschaftete zunächst 100 m 2 ,auf denen 10-15 Kräutersorten angebaut wurden.<br />
Unter Anleitung einer Gärtnerin aus der Familie und Seminarbesuchen seitens der<br />
anderen Familienmitglieder wurde mit Hilfe von weiteren Mitarbeitern, u.a. auch<br />
Studenten und Praktikanten, die Anbaufläche auf 2ha ausgeweitet. Auf dieser Fläche<br />
werden mittlerweile 80 verschiedene Kräutersorten und 500 verschiedene<br />
Kräuterjungpflanzen gezogen. Insgesamt gehören zum Betrieb 17ha wovon 5ha mit<br />
Kräutern bewirtschaftet werden.<br />
Der Anbau der Kräuter erfolgt auf Lehmböden, die ausgehoben und mit Sand<br />
vermischt werden, da die Kräuter auf diesen Böden besser wachsen. An wenigen<br />
Stellen der Felder befinden sich noch natürliche Sandböden.<br />
Trotz der hohen Lage wird der Anbau nicht nach Höhenlagen strukturiert. Neben den<br />
am Hof gezogenen Pflanzen werden auch Wildblumen verarbeitet, die zur Produktion<br />
von beispielsweise Sirup verwendet werden. Das Sammeln der Wildblumen<br />
erfordert jedoch einen sehr hohen Zeitaufwand.<br />
Die Hochsaison im Kräuteranbau ist von April bis Juni. Im November und Dezember<br />
findet das Verpacken der Mischungen, die Vorbereitungen <strong>für</strong> den Verkauf und die<br />
Reinigung der Felder statt.<br />
75
22.1.2 Philosophie<br />
Die Philosophie <strong>des</strong> Betriebes wird von dem Motto „Von Samen bis zum Endprodukt“<br />
getragen.<br />
Alle Pflanzen stammen aus eigener Nachzucht, wodurch die Gesundheit der Pflanzen<br />
der Erfahrung nach besser ist und Krankheitsausfälle verringert werden können. Der<br />
Pflegerhof ist ein anerkannter Biobetrieb, der mit dem Südtiroler Qualitätssiegel „Roter<br />
Hahn“ ausgezeichnet wurde. Die Leitung <strong>des</strong> Hofes folgt dem Grundsatz der<br />
Nachhaltigkeit und <strong>des</strong> umsichtigen Umgangs mit den zur Verfügung stehenden<br />
Rohstoffen. Problematisch könnte der Spritzmitteleinsatz der Nachbarn sein, da die<br />
eigenen Kräuter Spritzmittel aufnehmen könnten und somit kontaminiert wären. Bisher<br />
konnten jedoch keine Rückstände in den Kräutern nachgewiesen werden.<br />
22.2 Anbau der Kräuter<br />
22.2.1 Ausstattung<br />
Die Anzucht der Kräuter wird in 2 verschiedenen Gewächshäusern durchgeführt. Eines<br />
der Häuser wird im Winter mit einer Temperatur von 10°C -15°C beheizt, das andere<br />
ist ein doppelschichtiges Kalthaus, <strong>des</strong>sen Zwischenschicht erst ab einer<br />
Außentemperatur von minus sechs Grad Celsius beheizt wird. Dieses Haus dient dazu,<br />
die Pflanzen wetterfest zu machen und auf die natürlichen Bedingungen auf dem Feld<br />
vorzubereiten. Als Temperaturindikator dient ein Zitronenbaum, der sensibel auf<br />
Temperaturschwankungen reagiert.<br />
22.2.2 Kräuter<br />
Angebaut werden momentan 10 verschiedene Minze-Arten, die in<br />
Teemischungen Verwendung finden. Desweiteren sind zahlreiche Melisse-<br />
Sorten zu finden, die nur alle zwei Jahre angebaut werden. Zitronenmelisse<br />
beispielsweise ist mehrjährig.<br />
Genauere Informationen und die gesamte Produktpalette ist auf der Homepage<br />
<strong>des</strong> Pflegerhofs unter www.pflegerhof.com zu finden.<br />
76
22.2.3 Vorgehensweise beim Anbau<br />
Die Anzucht der Kräuter beginnt im Januar im beheizten Gewächshaus. Als Saatgut<br />
werden sowohl Samen aus eigener Zucht sowie Wildsamen verwendet. Die<br />
Auspflanzung der Wildpflanzen findet im Frühjahr statt.<br />
Früher wurde noch am Steilhang angebaut; aufgrund hoher Auswaschungen und der<br />
erschwerten Bearbeitung erfolgte aber eine Umstrukturierung auf Terrassenanbau.<br />
Angebaut werden die Pflanzen im Reihensystem, d.h. pro Reihe eine Kräuterart. Durch<br />
den Anbau in Mischkulturen profitieren die Pflanzen voneinander und beeinflussen sich<br />
positiv, was natürlich gute Kenntnisse hinsichtlich der Verträglichkeit und<br />
Unverträglichkeit verschiedener Pflanzen erfordert. Die Wege zwischen den einzelnen<br />
Reihen werden mit Hackschnitzeln aufgeschüttet, die einen festen Untergrund <strong>für</strong> den<br />
Transporter und die zahlreichen Besucher bildet, die auf Führungen den Pflegerhof<br />
besichtigen.<br />
Alle Felder werden von Hand gejätet, Schädlingsbekämpfung wird keine durchgeführt,<br />
da es sich um einen Biobetrieb handelt. Bisher hatte die Familie keine Probleme mit<br />
dieser Art der Bewirtschaftung.<br />
Gedüngt wird maximal dreimal jährlich mit Rhizinusschrot, dem Pressrückstand aus<br />
der Ölgewinnung, das aus Ungarn bezogen wird. Dieses ist in der Biobranche ein<br />
anerkannter Dünger, der sowohl im Gewächshaus als auch auf dem Feld ausgebracht<br />
wird. Hierbei ist jedoch genau auf die ausgebrachte Menge zu achten, da es bei zu<br />
hoher Düngung zu einer negativen Beeinflussung <strong>des</strong> Aromas kommt.<br />
Die Bewässerung der Flächen wird hauptsächlich über eine Genossenschaft geregelt.<br />
Hierbei steht jedem Betrieb ein begrenzter Zeitraum zur Verfügung, in dem Wasser<br />
bezogen werden kann. Da die von der Genossenschaft zur Verfügung gestellte<br />
Wassermenge jedoch nicht ausreicht, wird über eine betriebseigene Quelle zusätzlich<br />
Wasser bezogen.<br />
22.2.4 Ernte und Konservierung<br />
Als 1982 mit dem Kräuteranbau begonnen wurde, waren aufgrund der geringen<br />
Anbaufläche noch drei Schnitte mit der Sichel möglich. Einen großen Nachteil dieser<br />
Erntemethode stellte jedoch der mechanische Druck auf die Kräuter dar, der auf den<br />
einzelnen Pflanzen viele Druckstellen hinterließ und durch den das gewünschte<br />
Ernteergebnis häufig nicht erzielt wurde.<br />
77
Heute sind die Flächen <strong>für</strong> eine Ernte von Hand zu groß und es gibt schonendere<br />
Ernteverfahren. So wird eine Maschine eingesetzt, die eigentlich <strong>für</strong> den Schnitt von<br />
Stecklingen konstruiert ist. Das Gerät wird jeweils über eine Kräuterreihe gefahren,<br />
wobei ein Messbalken an der Maschinenunterseite die Pflanze abschneidet. Durch ein<br />
Gebläse wird das Schnittgut in einen Sack geblasen ohne dass es zu Quetschungen<br />
<strong>des</strong> empfindlichen Materials kommt. Obwohl die Erntemaschine sehr<br />
pflanzenfreundlich arbeitet, müssen vereinzelt Kräuter noch von Hand geerntet<br />
werden, wie beispielsweise die Ringelblume und die<br />
Malve. Bei der Kamille kommt die Kammernte zum Einsatz.<br />
Nach der Ernte werden die Kräuter in der Entfeuchtungsanlage bei 10-12°C<br />
entfeuchtet. Die Schubladen, in denen die Kräuter in der Maschine liegen, sind<br />
durchlöchert, wodurch die aufsteigende warme Luft die Feuchtigkeit der Pflanzen nach<br />
außen transportieren kann. Dieses Verfahren stellt eine wesentlich schonendere<br />
Möglichkeit der Trocknung dar als ein Warmlufttrockner, der früher eingesetzt wurde.<br />
Der Trocknungsvorgang dauert jetzt zwar länger, da<strong>für</strong> ist er sehr pflanzenschonend,<br />
bietet durch das Schubladensystem eine lockere Trocknung und die Kräuterfarbe bleibt<br />
besser erhalten. In der letzten Stunde der Trocknungsphase wird die Temperatur auf<br />
29°C erhöht, damit sich die Stängel der Pflanzen beim sogenannten „rebbeln“ leichter<br />
lösen lassen. Als Hilfsmittel dient eine Gebläsemaschine, die Stängel, Blätter und<br />
Staub voneinander trennt. Anschließend werden die getrockneten Kräuter eingefroren,<br />
um Eier, Larven und Insekten, die sich auf den Pflanzen befunden haben, abzutöten.<br />
Das Abfüllen <strong>des</strong> getrockneten Materials erfolgt manuell, da unerwünschte<br />
Bestandteile, wie eben die abgetöteten Insekten o.ä. bei einem maschinellen Abfüllen<br />
nicht ausselektiert werden können.<br />
22.2.5Verarbeitung und Verkauf der Produkte<br />
Neben Brotaufstrichen, Sirup, Kräuterkissen und -bädern werden hauptsächlich<br />
Kräuter sowie Kräuter- und Teemischungen aus eigener Produktion angeboten.<br />
Desweiteren können Jungpflanzen und Saatgut der jeweiligen Kräuter erworben<br />
werden. Kosmetika wie Cremes, die die Kräuter <strong>des</strong> Hofes beinhalten, müssen aus<br />
Gründen von Hygienegesetzen von einem externen Labor in Padua hergestellt werden.<br />
Im Laden ist ein Heft erwerblich, in dem die gesamte Produktpalette mit Bildern und<br />
der Beschreibung je<strong>des</strong> Krautes, sowohl was die Botanik als auch die Wirkung und<br />
Anwendung betrifft, zusammengefasst ist. Die Verpackungen der einzelnen Produkte<br />
sind mit sehr viel Liebe zum Detail gestaltet und folgen einer gemeinsamen<br />
78
Marketinglinie. Zum einen soll die Verpackung die Qualität der Kräuter bewahren und<br />
somit nicht viel Licht einlassen, zum anderen möchte der Verbraucher auf einen Blick<br />
sehen, was er kauft. Auf speziellen Wunsch, ist die Zustellung der Ware auch per Post<br />
möglich. Der Verkauf der Produkte findet zu 50% im Hofladen und zu 50% auf<br />
Bauernmärkten, in Feinkostläden und an Restaurants statt. Auf dem Bauernmarkt wird<br />
jedoch nur eine geringe Produktauswahl angeboten, um die Kunden, die gesteigertes<br />
Interesse am Angebot haben, auf einen Besuch auf dem Hof zu animieren<br />
Schild am Hofeingang<br />
Danke<br />
Abschließend bedanke ich mich nochmals ganz herzlich bei den jeweiligen<br />
Gastgebern auf unserer Exkursion, die sich <strong>für</strong> uns viel Zeit genommen haben<br />
und uns auf alle Fragen bereitwillig antworteten. Ganz herzlich bedanke ich<br />
mich auch beim Lan<strong>des</strong>hauptmann Luis Durnwalder <strong>für</strong> das besondere Erlebnis<br />
eines Empfangs im Felsenkeller. Ein Dankeschön schließlich an die<br />
Studierenden <strong>für</strong> die engagierte Teilnahme, die Anfertigung der Protokolle und<br />
die überaus hilfreiche Mitwirkung bei der Organisation.<br />
Heißenhuber<br />
Zitronenbaum als Thermometer<br />
79