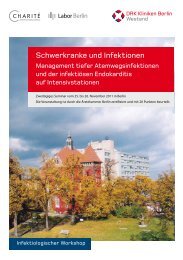D 1250 - DRK Kliniken Berlin
D 1250 - DRK Kliniken Berlin
D 1250 - DRK Kliniken Berlin
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Implementierung von klinischen<br />
Behandlungspfaden:<br />
Das Krankenhaus vor neuen<br />
organisatorischen Herausforderungen<br />
Gunhild Leppin M. A. und Thomas Rosenthal, Diplom-Sozialökonom<br />
1 Einleitung 1-3<br />
2 Behandlungspfade – Zum<br />
Konzept 4-7<br />
3 Behandlungspfade – Zu den<br />
organisatorischen Herausforderungen<br />
8-26<br />
3.1 Herausforderungen für die<br />
Organisationsstruktur im<br />
Krankenhaus 10-17<br />
3.1.1 Vom funktionalen zum prozessorientierten<br />
Betrieb 11, 12<br />
3.1.2 Vom Pflegeprozess zum<br />
Behandlungsprozess 13-16<br />
3.1.3 Von der patientenbezogenen<br />
zur fallbezogenen Betreuung 17<br />
3.2 Herausforderungen für die<br />
Unternehmenskultur im<br />
Krankenhaus 18-26<br />
3.2.1 Der Behandlungspfad erfordert<br />
eine berufsgruppenübergreifende<br />
Kooperation 19-24<br />
Kooperation 22<br />
Pflegefachkräfte 12, 14-16, 23, 34, 38<br />
1 Einleitung<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Rn. Rn.<br />
Schlagwortübersicht<br />
D <strong>1250</strong><br />
3.2.2 Der Behandlungspfad erfordert<br />
einen kontinuierlichen<br />
Verbesserungsprozess 25, 26<br />
4 Behandlungspfade – Zu<br />
den organisatorischen<br />
Gestaltungsmaßnahmen 27-39<br />
4.1 Klärung der Rahmenbedingungen<br />
29, 30<br />
4.2 Bereitstellung der<br />
Ressourcen 31<br />
4.3 Einbeziehung der<br />
Mitarbeiter 32-34<br />
4.4 Fundierter Einsatz von<br />
Kommunikation 35, 36<br />
4.5 Konstruktiver Umgang mit<br />
Widerstand 37-39<br />
5 Zusammenfassung 40, 41<br />
Literatur<br />
Rn. Rn.<br />
Prozessverantwortliche 12<br />
Verbesserungsprozess 26<br />
Spätestens seit dem Jahr 2004 erfolgt die Finanzierung der allgemeinen<br />
vollstationären und teilstationären Krankenhausleistungen über ein<br />
„durchgängiges, leistungsorientiertes und pauschalierendes Vergü-<br />
MH Pflege, 7. Aktualisierung März 2006 (Leppin/Rosenthal) 1<br />
1
D<strong>1250</strong> Implementierung von klinischen Behandlungspfaden<br />
tungssystem“ 1) auf Grundlage der Diagnosis Related Groups (DRGs). 2)<br />
Die Vergütung orientiert sich nicht mehr an der Verweildauer im<br />
Krankenhaus, sondern bezieht sich auf die „komplette konservative,<br />
interventionelle oder operative Gesamtbehandlung eines Krankheitsbildes.“<br />
3) Vor diesem Hintergrund erscheint die Einführung von klinischen<br />
Behandlungspfaden dringend geboten.<br />
2 Derzeit liegt der Schwerpunkt der fachlichen Diskussion bei der Entwicklung<br />
von Behandlungspfaden; die mit der Implementierung klinischer<br />
Behandlungspfade verbundenen organisatorischen Herausforderungen<br />
werden hingegen kaum thematisiert. Es wird folgende These<br />
vertreten: Die erfolgreiche und nachhaltige Implementierung von<br />
Behandlungspfaden setzt eine prozessorientierte Organisation voraus.<br />
Der Behandlungspfad bildet den Kernprozess des Krankenhauses, um<br />
den sich alle anderen Prozesse ranken. Es wird bei der Einführung von<br />
Behandlungspfaden offensichtlich zu wenig berücksichtigt, dass Krankenhäuser<br />
nach wie vor noch funktional und berufsständisch organisiert<br />
sind (traditionelle Organisationsstruktur und Unternehmenskultur)<br />
und daher eine Arbeitsorganisation auf der Grundlage von<br />
Behandlungspfaden systemfremd ist.<br />
3 Im Folgenden werden – neben einigen grundlegenden Anmerkungen<br />
zu den Behandlungspfaden (Kapitel 2) – die organisatorischen Herausforderungen<br />
aufgezeigt, die mit der Implementierung von klinischen<br />
Behandlungspfaden einhergehen (Kapitel 3). Es wird dargestellt, dass<br />
eine nachhaltige Einführung von Behandlungspfaden zu einem tiefgreifenden<br />
organisatorischen Wandel führen muss; dieser Veränderungsprozess<br />
ist nur erfolgreich zu bewältigen, wenn er von entsprechenden<br />
Maßnahmen seitens des Managements flankiert wird (Kapitel 4).<br />
2 Behandlungspfade – Zum Konzept<br />
4 Der Begriff „Behandlungspfad“ lässt sich folgendermaßen definieren:<br />
„Ein klinischer Behandlungspfad ist der im Behandlungsteam selbst<br />
gefundene berufsgruppen- und institutionenübergreifende Konsens<br />
1 Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der<br />
Krankenhauspflegesätze – Krankenhausfinanzierungsgesetz 2005: § 17 b Absatz 1<br />
Satz 1.<br />
2 Vgl. Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung<br />
der Krankenhauspflegesätze – Krankenhausfinanzierungsgesetz 2005: § 17 b<br />
Absatz2Satz1.<br />
3 Roeder, N. u. a.: Frischer Wind mit klinischen Behandlungspfaden (I): Instrumente<br />
zur Verbesserung der Organisation klinischer Prozesse, in: das Krankenhaus 95/1<br />
2003, S. 20.<br />
2
Implementierung von klinischen Behandlungspfaden D <strong>1250</strong><br />
für die beste Durchführung der gesamten stationären Behandlung<br />
unter Wahrung festgelegter Behandlungsqualität sowie unter Berücksichtigung<br />
der notwendigen und verfügbaren Ressourcen, ebenso<br />
unter Festlegung der Aufgaben sowie der Durchführungs- und Ergebnisverantwortlichkeiten.<br />
Der klinische Behandlungspfad steuert den<br />
Behandlungsprozess; gleichzeitig ist er das behandlungsbegleitende<br />
Dokumentationsinstrument und erlaubt die Kommentierung von<br />
Normabweichungen zum Zwecke fortgesetzter Evaluation und Ver-<br />
besserung.“ 4)<br />
4 Roeder, N. u. a.: Frischer Wind mit klinischen Behandlungspfaden (I): Instrumente<br />
zur Verbesserung der Organisation klinischer Prozesse, in: das Krankenhaus 95/1<br />
2003, S. 21 f.<br />
Durch Behandlungspfade werden die Kosten, die Erlöse<br />
und die Qualität transparent. Die Unternehmensleitung kann die Leistungsprozesse<br />
des Krankenhauses strategisch planen und operativ<br />
steuern.<br />
Seit der Umstellung auf eine DRG-basierende Krankenhausfinanzierung<br />
gibt es einen festen Preis pro DRG – ohne Beachtung der im<br />
Krankenhaus tatsächlich angefallenen Kosten und weitestgehend<br />
unabhängig von der Verweildauer des Patienten. „Da die Erlösmöglichkeiten<br />
somit fixiert sind, bleibt dem Krankenhaus zur Steuerung<br />
von Gewinn und Verlust lediglich die Einflussnahme auf die Kosten<br />
der Behandlung.“ 5) Eine Planung, Steuerung sowie Kontrolle der personellen<br />
bzw. materiellen Ressourcen und Kosten ist jedoch nur möglich,<br />
wenn Leistungsprozesse mittels Behandlungspfaden standardisiert<br />
werden. 6)<br />
Mit der inhaltlichen und zeitlichen Standardisierung der diagnostischen,<br />
therapeutischen und pflegerischen Maßnahmen, von der Aufnahme<br />
bis zur Entlassung, wird die Effizienz7) bei gleichzeitiger Kostenreduzierung8)<br />
gesteigert. Des Weiteren kann die Behandlungsqualität<br />
anhand der Überprüfung von Abweichungen vom Behandlungspfad<br />
auf ihre Ursachen hin gesteuert werden. Behandlungspfade sind<br />
daher als Managementinstrument sowohl zur Steuerung der Wirtschaftlichkeit<br />
des Krankenhauses als auch zur Qualitätssicherung und<br />
-verbesserung von außerordentlicher Bedeutung.<br />
5 Küttner, T. / Wiese, M. / Roeder, N.: Klinische Behandlungspfade (Teil 1): Hohe Qualität<br />
zu niedrigen Kosten – ein unlösbarer Zielkonflikt?, in: Pflegezeitschrift 58/3<br />
2005, S. 176.<br />
6 Eine Standardisierung durch Behandlungspfade bietet sich insbesondere für planbare<br />
und häufige bzw. kostenintensive Krankheitsfälle an.<br />
7 Als Beispiel sei die Optimierung der Verweildauer genannt.<br />
8 Es können z. B. nicht medizinisch notwendige Doppeluntersuchungen vermieden<br />
werden.<br />
MH Pflege, 7. Aktualisierung März 2006 (Leppin/Rosenthal) 3<br />
5<br />
6
D<strong>1250</strong> Implementierung von klinischen Behandlungspfaden<br />
7 Um so mehr erstaunen die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage<br />
des Deutschen Krankenhausinstitutes zwischen Mai und September<br />
2003: In 10 % der Krankenhäuser sind „schon“ Behandlungspfade entwickelt<br />
worden; 73 % der Krankenhäuser beabsichtigen Behandlungspfade<br />
zu entwickeln. 9) Es scheint dies – kurz vor der Umstellung auf<br />
eine pauschalierende fallbezogene Vergütung der Krankenhausleistungen<br />
– eine sehr zögerliche Reaktion zu sein; sowohl was die Bedeutung<br />
des Behandlungspfads als Managementinstrument angeht, als auch<br />
was die zeitintensiven organisatorischen Veränderungsprozesse anbelangt,<br />
die mit der Implementierung der Pfade verbunden sind.<br />
3 Behandlungspfade – Zu den<br />
organisatorischen Herausforderungen<br />
8 Die mit der Einführung von klinischen Behandlungspfaden verbundenen<br />
organisatorischen Herausforderungen für Krankenhäuser (Abbildung<br />
1) beziehen sich einerseits auf die Organisationsstruktur<br />
(Abschnitt 3.1) und andererseits auf die Unternehmenskultur<br />
(Abschnitt 3.2).<br />
Impementierung<br />
Organisationsstruktur<br />
Vom funktionalen zum<br />
prozessorientierten Betrieb<br />
berufsgruppenübergreifende<br />
Kooperation<br />
Krankenhaus<br />
Von Pflegeprozess<br />
zum Behandlungsprozess<br />
Behandlungspfade<br />
Von der patientenbezogenen<br />
zur fallbezogenen<br />
Betreuung<br />
kontinuierlicher<br />
Verbesserungsprozess<br />
Unternehmenskultur<br />
9 Abb. 1: Implementierung von Behandlungspfaden – Herausforderungen für<br />
das Krankenhaus<br />
9 Vgl. Deutsches Krankenhausinstitut e. V.: Krankenhaus-Barometer. Umfrage 2003,<br />
Internet: www.dkgev.de [Datum des Aufrufs: 11. 08. 2005], S. 22.<br />
4
Implementierung von klinischen Behandlungspfaden D <strong>1250</strong><br />
3.1 Herausforderungen für die<br />
Organisationsstruktur im Krankenhaus<br />
Die interne Organisation vieler deutscher Krankenhäuser basiert nach<br />
wie vor auf fachabteilungsbezogenen und berufsständischen Strukturen.<br />
Die Implementierung von Behandlungspfaden führt daher zu<br />
„Prozessinseln, für die jeweils unterschiedliche Personen zuständig<br />
sind. Je mehr Abteilungen eine Prozesskette durchläuft und je tiefer die<br />
Abteilungsorganisation gegliedert ist, desto häufiger sind Prozess- und<br />
Verantwortungsbrüche sowie Schnittstellen anzutreffen, die einen<br />
hohen Koordinations- und Kontrollaufwand erfordern sowie die<br />
Ergebnisqualität und die Produktivität mindern.“ 10) Die Behandlungspfade<br />
werden deshalb als systemfremd wahrgenommen.<br />
3.1.1 Vom funktionalen zum prozessorientierten Betrieb<br />
Die Krankenhausorganisation ist weitestgehend von der Aufbauorganisation<br />
(d. h. der Zuordnung der gebildeten Stellen in einem Unternehmensorganigramm)<br />
und der Ablauforganisation bestimmt (d. h. die<br />
Anordnung der Arbeitsplätze sowie die Art der Verrichtungen der<br />
Tätigkeiten und die Arbeitsfolge). In einer funktionalen und gleichzeitig<br />
Hierarchie betonten Krankenhausorganisation wird die Zuständigkeit<br />
in der Ablauforganisation formal bestimmt durch die Aufbauorganisation,<br />
die berufsständischen Interessen und die Zugehörigkeit zu<br />
einer bestimmten Gruppe (z. B. Team, Funktionseinheit).<br />
In einer prozessorientierten Organisation hingegen steht der reibungslose<br />
und patientenorientierte Behandlungsablauf im Vordergrund:<br />
„“Wer“ kann „was“ im Dienst der patientenorientierten Versorgung<br />
am besten und Ressourcen schonend leisten, was muss die Organisation<br />
bereithalten, um diese Leistungsprozesse zu unterstützen?“ 11) Dies<br />
erfordert eine hohe Kooperationsbereitschaft und -fähigkeit von allen<br />
an der Behandlung des Patienten beteiligten Mitarbeitern – fachabteilungs-,<br />
berufsgruppen- und hierarchieübergreifend. Behandlungspfade<br />
bieten hierfür eine sinnvolle Basis. Allerdings sollte es Prozessverantwortliche<br />
geben, damit die Prozess- und Verantwortungsbrüche vermieden<br />
und die Schnittstellen gemanagt werden können. Nur so kann<br />
der Behandlungspfad für den einzelnen Patienten realisiert werden.<br />
10 Greiling, M.: Prozessbrüche vermeiden. Das Krankenhaus der Zukunft ist prozessorientiert,<br />
prozessstrukturiert und workflowbasiert, in: Krankenhaus Umschau 73/<br />
10 2004, S. 879.<br />
11 Dahlgaard, K. / Stratmeyer, P.: Kooperatives Prozessmanagement im Krankenhaus,<br />
in: das Krankenhaus 96/8 2004, S. 639.<br />
MH Pflege, 7. Aktualisierung März 2006 (Leppin/Rosenthal) 5<br />
10<br />
11<br />
12
D<strong>1250</strong> Implementierung von klinischen Behandlungspfaden<br />
Für diese Aufgabe sind Pflegefachkräfte mit ihrer spezifischen Prozesserfahrung<br />
geradezu prädestiniert.<br />
3.1.2 Vom Pflegeprozess zum Behandlungsprozess<br />
13 Behandlungspfade12) bilden die Kernprozesse des Krankenhauses.<br />
DieseProzessemüssenvon der Aufnahme bis zur Entlassung gemanagt<br />
werden – einschließlich einer Überleitung in eine andere Institution.<br />
Im Hinblick auf eine optimale quantitative und qualitative Ressourcennutzung<br />
sollten sich die Ärzte „auf ihre Kernaufgaben in der<br />
Planung und Durchführung von Diagnostik und Therapie konzentrieren.<br />
Angrenzende Managementaufgaben, die eine Prozesskenntnis<br />
voraussetzen, jedoch keine medizinische Ausbildung erfordern, können<br />
von anders qualifizierten, zeitlich besser verfügbaren und nicht<br />
zuletzt kostengünstigeren Mitarbeitern übernommen werden.“ 13)<br />
14 Hier bieten sich die Pflegefachkräfte geradezu an:<br />
– Pflegefachkräfte haben längst auf einer Station die Steuerung der<br />
Behandlungsprozesse „ihrer“ Patienten und das Belegungsmanagement<br />
für die Station – soweit es ohne offizielle Befugnisse geht –<br />
übernommen.<br />
– Pflegefachkräfte haben Schnittstellen zu allen Berufsgruppen, die am<br />
Behandlungsprozess des Patienten beteiligt sind (z. B. Physiotherapie,<br />
Funktionsbereiche, Küche, Verwaltung), und können damit den klinischen<br />
Behandlungspfad von der Aufnahme bis zur Entlassung (einschließlich<br />
der nicht medizinischen Sekundärprozesse) unter Berücksichtigung<br />
der Bedürfnisse des Patienten optimal gestalten.<br />
– Pflegefachkräfte sind medizinisch ausreichend qualifiziert, um zu<br />
erkennen, wann der bisher vorgesehene Behandlungspfad für einen<br />
bestimmten Patienten durch den behandelnden Arzt erneut überprüft<br />
und ggf. korrigiert werden muss. 14)<br />
– Pflegefachkräfte sind über vierundzwanzig Stunden mit dem Patienten<br />
in Kontakt und gewährleisten damit eine Kontinuität, welche<br />
die bestmögliche Patientenbetreuung und -orientierung garantiert.<br />
12 In diesem Kontext beziehen sich die Behandlungspfade auf die standardisierten<br />
Behandlungspfade. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass die Prozessverantwortung<br />
in einem nächsten Schritt auch auf individuelle Einzelfälle abgestimmte<br />
Behandlungspfade Bezug nehmen kann.<br />
13 Dahlgaard, K. / Stratmeyer, P.: Kooperatives Prozessmanagement im Krankenhaus,<br />
in: das Krankenhaus 96/8 2004, S. 638.<br />
14 Gerade dieser Aspekt zeigt auf, dass die Steuerung der Behandlungspfade nur von<br />
Pflegefachkräften und nicht – was derzeit auch diskutiert wird – von Arzthelferinnenübernommenwerdenkann;vgl.dazuSchmitz-Rixen,<br />
T.: Behandlungspfade –<br />
ein Weg aus der Krise der Krankenhäuser?, in: Hessisches Ärzteblatt 8/2003, S. 392.<br />
6
Implementierung von klinischen Behandlungspfaden D <strong>1250</strong><br />
Entschiede man sich für dieses Verfahren, so würden die Pflegefachkräfte<br />
die Prozessverantwortung für die „Realisation (Veranlassen,<br />
Disponieren, Einwirken, Organisieren)“ 15) und in Teilen auch für die<br />
Kontrolle übernehmen. Die Ärzte würden die Fachverantwortung tragen,<br />
das Behandlungsziel festlegen und die Entscheidung für einen<br />
bestimmten Behandlungspfad treffen. Anhand des jeweiligen medizinischen<br />
Sollzustandes des Patienten im Behandlungsverlauf gleicht der<br />
Arzt zudem ab, ob die Behandlung im Rahmen des Behandlungspfades<br />
fortgesetzt werden kann oder angepasst werden muss.<br />
Die Übernahme der Prozessverantwortung durch Pflegefachkräfte<br />
setzt jedoch voraus, dass diese die notwendigen Befugnisse erhält, um<br />
auf den jeweiligen Prozess einwirken zu können. 16) Das Konzept des<br />
Case Managements als eine inhaltliche Weiterführung des Prozessgedankens<br />
für Behandlungspfade bietet sich hierfür als Instrument an.<br />
3.1.3 Von der patientenbezogenen zur fallbezogenen<br />
Betreuung<br />
Im deutschen Sprachraum wird der Begriff „Case Management“ sehr<br />
unterschiedlich definiert. In der Regel handelt es sich – ob einrichtungsbezogen<br />
oder sektorenübergreifend – um ein Fallmanagement<br />
von bestimmten Krankheitsbildern. „Das Case-Management ist [] notwendig,<br />
um auffällige und die Abläufe deutlich störende Probleme<br />
innerhalb eines sorgfältig geplanten, berufsgruppenübergreifenden<br />
Einsatz-, Zeit- und Kostenrahmens gezielt in den Griff zu bekommen.<br />
Auf das aktive Zusammenwirken von Personal, Systemen und Organisationen<br />
wird dabei besonderer Wert gelegt.“ 17) Neben der auf Patienten<br />
bezogenen Prozessverantwortung – im Sinne eines „one face to the<br />
customer“ – ist daher die fallbezogene Evaluation unter verschiedenen<br />
Aspekten von Bedeutung. Dazu zählen die jeweilige Fallauswertung<br />
unter Kosten- und Erlösgesichtspunkten, einschließlich der Fallkodierung,<br />
die Auswertung des organisatorischen Ablaufes einschließlich<br />
des Entlassungsmanagements und die Auswertung der eventuellen<br />
Beschwerden des Patienten.<br />
15 Dahlgaard, K. / Stratmeyer, P.: Kooperatives Prozessmanagement im Krankenhaus,<br />
in: das Krankenhaus 96/8 2004, S. 638.<br />
16 Vgl. Dahlgaard, K. / Stratmeyer, P.: Kooperationsanforderungen an Pflege und Medizin<br />
im Krankenhaus der Zukunft, in: das Krankenhaus 95/2 2003, S. 134.<br />
17 Gratias, R.: Case-Management. Den Patienten zielgerichtet durch den Leistungsprozess<br />
führen. Ziele, Funktionen und Aufgaben eines pflegerisch gestützten Case-<br />
Managements, in: Die Schwester/Der Pfleger 43/4 2004, S. 289.<br />
MH Pflege, 7. Aktualisierung März 2006 (Leppin/Rosenthal) 7<br />
15<br />
16<br />
17
D<strong>1250</strong> Implementierung von klinischen Behandlungspfaden<br />
3.2 Herausforderungen für die<br />
Unternehmenskultur im Krankenhaus<br />
18 Die Einführung der Behandlungspfade und der damit verbundene<br />
Wandel hin zu einer prozessorientierten Organisation kommt einem<br />
Paradigmenwechsel gleich. Dieser kann nur gelingen, wenn sich parallel<br />
die Unternehmenskultur verändert; denn „zu einer Kultur gehört<br />
die Art und Weise, wie bestimmte Dinge und Angelegenheiten gesehen<br />
und behandelt werden.“ 18) Insbesondere zwischen Ärzten und<br />
Pflegenden hatte sich eine Kultur herausgebildet, die von stereotypen<br />
Verhaltensmustern geprägt ist. Im Folgenden wird aufgezeigt, dass<br />
eine nachhaltige Implementierung von Behandlungspfaden nur gelingen<br />
kann, wenn sich das traditionelle Rollenverständnis von Ärzten<br />
und Pflegenden entsprechend verändert.<br />
3.2.1 Der Behandlungspfad erfordert eine<br />
berufsgruppenübergreifende Kooperation<br />
19 In der Krankenhausorganisation habendieBerufsgruppenderÄrzte<br />
und der Pflegenden ihre jeweils eigene (Sub-)Kultur entwickelt,<br />
geprägt vom jeweiligen standesorientierten Berufsverständnis. Zum<br />
Teil ergänzen sich beide, aber sie werden auch genutzt und „dies<br />
höchst effektiv, um sich voneinander abzugrenzen und die eigene Profession<br />
kenntlich und wichtig zu machen.“ 19)<br />
20 Die medizinische Versorgung bestimmt den Zweck des Krankenhauses.<br />
20) Damit sehen sich die Ärzte als die „eigentlichen Taktgeber“ 21) .In<br />
der ärztlichen Wahrnehmung verantworten sie den Behandlungsprozess,<br />
insbesondere nach dem Grundsatz der Therapiefreiheit. „Kooperationen<br />
im Sinne einer ernst gemeinten Beteiligung anderer Berufs-<br />
18 Rosenthal, T. / Wagner, E.: Organisationsentwicklung und Projektmanagement im<br />
Gesundheitswesen. Grundlagen – Methoden – Fallstudien, Heidelberg 2004, S. 92.<br />
19 Rosenthal, T. / Wagner, E.: Organisationsentwicklung und Projektmanagement im<br />
Gesundheitswesen. Grundlagen – Methoden – Fallstudien, Heidelberg 2004, S. 93.<br />
20 Krankenhäuser sind „Einrichtungen, in denen durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistung<br />
Krankheiten, Leiden oder Körperschäden festgestellt, geheilt oder gelindert<br />
werden sollen oder Geburtshilfe geleistet wird und in denen die zu versorgenden<br />
Personen untergebracht und verpflegt werden können“; Gesetz zur wirtschaftlichen<br />
Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze<br />
– Krankenhausfinanzierungsgesetz 2005: § 2 Nr. 1.<br />
21 Dahlgaard, K. / Stratmeyer, P.: Kooperationsanforderungen an Pflege und Medizin im<br />
Krankenhaus der Zukunft, in: das Krankenhaus 95/2 2003, S. 131.<br />
8
Implementierung von klinischen Behandlungspfaden D <strong>1250</strong><br />
gruppen an patientenbezogenen Entscheidungen“ 22) sind dabei nicht<br />
vorgesehen. Der Blick auf den Patienten wird von medizinischen<br />
Aspekten dominiert.<br />
Die Pflegenden konnten demgegenüber in den letzten zwanzig Jahren<br />
ihre unselbständige Rolle als „Hilfskraft des Arztes“ immer weniger<br />
akzeptieren – verstärkt durch Erfahrungen, vielfach vom „guten Willen“<br />
des Arztes abhängig zu sein. Im Rahmen ihrer Professionalisierungsbestrebungen<br />
hat die Pflege deshalb eigenständige Aufgaben wie<br />
z. B. den Pflegeprozess23) entwickelt. Trotz Berücksichtigung von Diagnose<br />
und Behandlung steht er jedoch losgelöst und unabhängig<br />
neben der medizinischen Versorgung. Im Zuge der Definition von<br />
eigenständigen Aufgaben hat eine deutliche Abgrenzung gegenüber<br />
denärztlichenTätigkeitenstattgefunden. Viele delegierbare medizinische<br />
Aufgaben (wie z. B. Blutentnahmen) werden daher aus berufspolitischen<br />
Gründen abgelehnt.<br />
Die Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Pflegenden in nicht prozessorientierten<br />
Organisationen ist daher formal in Bezug auf die fachliche<br />
Weisungsbefugnis der Ärzte gegenüber den Pflegenden<br />
beschränkt. Eine weitergehende Kooperation existiert höchstens<br />
„zusammengehalten durch ein Netz von Routinen, Einzelabsprachen,<br />
Weisungen, formalen und informellen Kompetenzen, Aushandlungsprozessen<br />
und Kompensationsmaßnahmen.“ 24) Diese Form der Kooperation<br />
lässt einen patientenbezogenen und effizienten Behandlungsprozess<br />
nicht zu.<br />
Die Implementierung von Behandlungspfaden in diesen berufsständischen<br />
(Sub-)Kulturen stellt neue Anforderungen an die Kooperationsbeziehungen<br />
zwischen Ärzten und Pflegenden. Beide Berufsgruppen25) müssen sich als ein Behandlungsteam verstehen. Entscheidend für das<br />
Gelingen ist dabei die „funktionale, komplementäre Arbeitsteilung auf<br />
der Grundlage eines gemeinsamen Verständnisses von patientenorientiertem<br />
Handeln mit klaren Absprachen und verbindlichen Regelun-<br />
22 Dahlgaard, K. / Stratmeyer, P.: Kooperationsanforderungen an Pflege und Medizin im<br />
Krankenhaus der Zukunft, in: das Krankenhaus 95/2 2003, S. 131.<br />
23 Der Pflegeprozess ist ein Regelkreis bestehend aus Informationssammlung, Erkennen<br />
von Ressourcen bzw. Pflegeproblemen, Festlegen der Pflegeziele, Planung der<br />
Pflegemaßnahmen, Durchführung der geplanten Maßnahmen sowie Überprüfung<br />
der Wirksamkeit der Maßnahmen.<br />
24 Dahlgaard, K. / Stratmeyer, P.: Kooperationsanforderungen an Pflege und Medizin im<br />
Krankenhaus der Zukunft, in: das Krankenhaus 95/2 2003, S. 132.<br />
25 Auch wenn hier nur auf die Berufsgruppe der Ärzte und die der Pflegenden Bezug<br />
genommen wird, gelten diese Aussagen natürlich auch für alle anderen Berufsgruppen,<br />
die den Patienten medizinisch, pflegerisch oder therapeutisch betreuen.<br />
MH Pflege, 7. Aktualisierung März 2006 (Leppin/Rosenthal) 9<br />
21<br />
22<br />
23
D<strong>1250</strong> Implementierung von klinischen Behandlungspfaden<br />
gen.“ 26) Beiden Berufsgruppen wird abverlangt, ihr einseitiges berufsständisches<br />
Denken zu verlassen und den gesundheits- und gesellschaftspolitischen<br />
Erfordernissen anzupassen. Hinweis: Behandlungspfade<br />
sind kein Eingriff in die ärztliche Therapiefreiheit, sondern stellen<br />
transparent die Handlungsroutine des Arztes dar. Mit der Übernahme<br />
von medizinischen Aufgaben27) würden die Pflegefachkräfte<br />
aktiv zu einer Reduzierung der Schnittstellen beitragen.<br />
24 Somit wäre die Anwendung der Behandlungspfade in Hinblick auf die<br />
Optimierung der personellen Ressourcen – qualitativ, quantitativ und<br />
kostenmäßig – sowie in Hinblick auf die Qualität der Patientenversorgung<br />
nicht nur ein gemeinsames Anliegen der Ärzte bzw. der Pflege<br />
sondernauchihreHandlungsgrundlage.<br />
3.2.2 Der Behandlungspfad erfordert einen<br />
kontinuierlichen Verbesserungsprozess<br />
25 Der Behandlungspfad ermöglicht es, nicht gewollte Abweichungen zu<br />
erkennen, deren Ursachen zu analysieren, Verbesserungspotential zu<br />
identifizieren und entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Mit Hilfe<br />
des Pfades lässt sich zu jedem Behandlungszeitpunkt überprüfen, ob es<br />
bei der medizinischen Behandlung oder im zeitlichen Prozessablauf zu<br />
unerwarteten und unerwünschten Abweichungen gekommen ist. Falls<br />
notwendig, kann dann im Interesse des Patienten zeitnah interveniert<br />
werden. Des Weiteren kann eine Varianzanalyse auch rückwirkend<br />
erfolgen, indem der Ist-Pfad mit dem Soll-Verlauf abgeglichen wird.<br />
26 Den Behandlungspfad als Instrument im kontinuierlichen Verbesserungsprozess<br />
zu begreifen, setzt jedoch einen offenen und selbstkritischen<br />
Umgang mit den Abweichungen und ihren Ursachen voraus<br />
(Fehlerkultur). „Der Aufbau einer Fehlerkultur, welcher die Fehlerhaftigkeit<br />
menschlichen Handelns akzeptiert, einen Fehler auch als<br />
Chance zur Verbesserung begreift und durch geeignete Strategien effiziente<br />
Fehlerprävention ermöglicht“ 28) , ist notwendig und muss als<br />
weitere gewünschte (Sub-)Kultur im Unternehmen existieren. Damit<br />
ist der Behandlungspfad – trotz seiner Festschreibung – gleichzeitig ein<br />
äußerst dynamisches Instrument der Qualitätssicherung und -verbesserung<br />
sowie des Risk Managements.<br />
26 Dahlgaard, K. / Stratmeyer, P.: Kooperatives Prozessmanagement im Krankenhaus,<br />
in: das Krankenhaus 96/8 2004, S. 636.<br />
27 Vgl. Gaede, K.: Starke Schwestern, in: kma 1/2005, S. 38 ff.<br />
28 Meilwes, M.: Aspekte zu Risiken aus der Sicht der Health Professionals. Was können<br />
wirvonanderenlernen?,in:Holzer,E.u.a.(Hrsg.):Patientensicherheit.Leitfaden<br />
für den Umgang mit Risiken im Gesundheitswesen, Wien 2005, S. 31.<br />
10
Implementierung von klinischen Behandlungspfaden D <strong>1250</strong><br />
4 Behandlungspfade – Zu den organisatorischen<br />
Gestaltungsmaßnahmen<br />
Die Implementierung von Behandlungspfaden ist eine strategische<br />
Entscheidung des Krankenhausmanagements; damit verbunden sind<br />
erhebliche Herausforderungen hinsichtlich der Organisationsstruktur<br />
und Unternehmenskultur eines Krankenhauses als komplexe Organisationen.<br />
Bei Veränderungen reagieren diese sozial geprägten Gebilde<br />
oftmals recht eigensinnig und entfalten häufigeinestarkekonservative<br />
Eigendynamik, d. h. das Festhalten am Althergebrachten steht einer<br />
strategischen Neuausrichtung diametral entgegen. Methoden und<br />
Instrumente des Veränderungsmanagements müssen daher bewusst<br />
ausgewählt und eingesetzt werden, um die Organisationsstruktur und<br />
deren Unternehmenskultur Schritt für Schritt an die strategische<br />
(Neu-)Ausrichtung anzupassen. Insgesamt können fünf Gestaltungsmaßnahmen<br />
benannt werden (Abbildung 2).<br />
Klärung der<br />
Rahmenbedingungen<br />
K r a n k e n h a u s<br />
Bereitstellung der<br />
Ressourcen<br />
I m p l e m e n t i e r u n g Behandlungspfade<br />
Fundierter Einsatz von<br />
Kommunikation<br />
Einbeziehung der<br />
Mitarbeiter<br />
Konstruktiver Umgang mit<br />
Widerstand<br />
Abb. 2: Implementierung von Behandlungspfaden – Gestaltungsmaßnahmen<br />
für das Krankenhaus<br />
MH Pflege, 7. Aktualisierung März 2006 (Leppin/Rosenthal) 11<br />
27<br />
28
D<strong>1250</strong> Implementierung von klinischen Behandlungspfaden<br />
4.1 Klärung der Rahmenbedingungen<br />
29 Eine wichtige Voraussetzung für die krankenhausweite Implementierung<br />
von Behandlungspfaden ist ein einheitliches Verständnis zum<br />
Thema „Behandlungspfade im Unternehmen“. Die Unternehmensführung<br />
muss daher grundsätzliche Anforderungen an einen Behandlungspfad<br />
festlegen. Dazu gehören z. B. eine interdisziplinäre Ausrichtung<br />
und eine am Patienten bzw. am Behandlungsprozess orientierte<br />
Organisation der Behandlung.<br />
30 Die Entwicklung und Implementierung von Behandlungspfaden muss<br />
fachabteilungsübergreifend organisiert und gesteuert werden. Die Entwicklung<br />
einschließlich der Implementierung von Behandlungspfaden<br />
muss als unternehmensweites Projekt organisiert werden, um die Aktivitäten<br />
der verschiedenen Fachabteilungen sinnvoll zu verzahnen. Hierbei<br />
kann es zweckmäßig sein, eine Steuerungsgruppe (mit Koordinationsfunktion)<br />
bzw. eine Lenkungsgruppe (mit Entscheidungsbefugnissen)<br />
einzusetzen. Es muss geklärt werden, in welcher Reihenfolge, mit welcher<br />
Zeitplanung (einschließlich einer Fortschrittskontrolle) Behandlungspfade<br />
für welche Krankheitsfälle entwickelt und eingeführt sein sollen.<br />
4.2 Bereitstellung der Ressourcen<br />
31 Entwicklung sowie Implementierung von Behandlungspfaden binden<br />
erheblich Ressourcen. Es sind die personellen Voraussetzungen zu<br />
schaffen, damit die Freistellung zur Teilnahme an den Arbeitsgruppen<br />
(„Entwicklung von Behandlungspfaden“) sichergestellt werden kann,<br />
ohne dass es zu einer Arbeitsmehrbelastung der Arbeitsgruppenmitglieder<br />
bzw. der Kollegen im Arbeitsalltag kommt. Auch das notwendige<br />
Know-how muss zur Verfügung stehen; entweder in Form interner<br />
bzw. externer Beratung oder durch die Möglichkeit für Arbeitsgruppenmitglieder<br />
sich die notwendigen Kompetenzen aneignen zu<br />
können. Von großer Bedeutung ist auch die Bereitstellung der notwendigen<br />
Sachmittel als Voraussetzung für eine erfolgreiche Implementierung<br />
von Behandlungspfaden (z. B. Dokumentationssystem).<br />
4.3 Einbeziehung der Mitarbeiter<br />
32 Die Mitarbeiter sind ein entscheidender Erfolgsfaktor für die nachhaltige<br />
Implementierung von Behandlungspfaden. Durch sie wird der<br />
Behandlungspfad für den Patienten erst erlebbar. Durch die Einbeziehung<br />
der betroffenen Mitarbeiter ist es möglich, praxisgerechte – und<br />
damit im Arbeitsalltag akzeptierte – Lösungen zu finden. Trotzdem<br />
12
Implementierung von klinischen Behandlungspfaden D <strong>1250</strong><br />
stehen diesem organisatorischen Wandel „arbeitende Menschen gegenüber,<br />
deren Veränderungswillen und Veränderungstempo nicht<br />
zwangsläufig den aktuellen Erfordernissen entsprechen müssen.“ 29)<br />
Deshalb müssen die Führungskräfte als Multiplikatoren frühzeitig in<br />
den Veränderungsprozess einbezogen und von dem Vorhaben überzeugt<br />
werden. Diese wiederum müssen die Erwartungen, die in diesem<br />
Zusammenhang an ihre Mitarbeiter gestelltwerden,kommunizieren<br />
und die Entwicklung und Implementierung von Behandlungspfaden<br />
vorbildhaft unterstützen. 30) Entscheidend für die erfolgreiche Einführung<br />
von Behandlungspfaden ist die Auswahl der richtigen Schlüsselpersonen,<br />
die den Veränderungsprozess vorantreiben können – z. B.<br />
im Hinblick auf die Koordination und Steuerung des Projektes. Wichtigste<br />
Voraussetzung dafür wiederum ist die Akzeptanz gegenüber<br />
den Behandlungspfaden bei den Mitarbeitern.<br />
Viele Mitarbeiter stehen vor neuen Anforderungen (z. B. die Pflegefachkräfte<br />
als Prozessverantwortliche). Hier sollten frühzeitig Schulungen<br />
zur Vorbereitung auf die neuen Aufgaben angeboten werden.<br />
Grundsätzlich müssen die Mitarbeiter im Veränderungsprozess von<br />
Führungskräften als auch von Projektverantwortlichen aktiv begleitet<br />
werden. Hier sind die Instrumente der Mitarbeiterführung und der<br />
Personalentwicklung bewusst einzusetzen.<br />
4.4 Fundierter Einsatz von Kommunikation<br />
Einen entscheidenden Faktor, die Mitarbeiter „ins Boot zu holen“, stellen<br />
die rechtzeitige Information über Entwicklung und Implementierung<br />
der Behandlungspfade sowie die Kommunikation über diese Thematik<br />
dar. Hier sollten alle dem Unternehmen zur Verfügung stehenden<br />
Informations- und Kommunikationsmittel (z. B. Mitarbeiterzeitung,<br />
Intranet, Betriebsversammlung, Besprechung oder Teamsitzung)<br />
intensiv genutzt werden, um möglichst viele Mitarbeiter zu erreichen.<br />
Von besonderer Bedeutung ist die verbale Form der Kommunikation,<br />
um auf Fragen und Bedenken von Mitarbeitern sofort eingehen zu<br />
können. Gleichzeitig wird sich die Informations- und KommunikationskulturdurchdieArbeitmitBehandlungspfaden<br />
verändern (müssen).<br />
Information und Kommunikation richten sich zukünftig an den<br />
Prozessen aus und finden berufsübergreifend und interdisziplinär<br />
29 Hensen, P. u. a.: Veränderungsmanagement im DRG-Zeitalter: Anpassungsprozesse<br />
müssen integrativ bewältigt werden, in: das Krankenhaus 96/2 2004, S. 88.<br />
30 Hensen, P. u. a.: Veränderungsmanagement im DRG-Zeitalter: Anpassungsprozesse<br />
müssen integrativ bewältigt werden, in: das Krankenhaus 96/2 2004, 88 f.<br />
MH Pflege, 7. Aktualisierung März 2006 (Leppin/Rosenthal) 13<br />
33<br />
34<br />
35<br />
36
D<strong>1250</strong> Implementierung von klinischen Behandlungspfaden<br />
statt. Die Kommunikationspartner verstehensichalsgleichberechtigte<br />
Mitglieder eines patientenbezogenen Behandlungsteams.<br />
4.5 Konstruktiver Umgang mit Widerstand<br />
37 Doch selbst wenn die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche<br />
Einführung klinischer Behandlungspfade geschaffen wurden, wird<br />
sich ein Teil der Mitarbeiter den Veränderungen widersetzen. Das<br />
Bewusstsein dafür und ein konstruktiver Umgang mit diesem Widerstand<br />
sind wichtige Bausteine im Veränderungsmanagement.<br />
38 Oftmals handelt es sich beim Widerstand gegenüber organisatorischen<br />
Veränderungen um eine diffuse Ablehnung, um nicht unmittelbar<br />
nachvollziehbare Bedenken oder um ein Unterlaufen durch passives<br />
Verhalten. 31)<br />
Für das Auflösen des Widerstandes ist es entscheidend,<br />
die tatsächlichen Ursachen zu ergründen und auf diese angemessen zu<br />
reagieren. Ein häufig genannter Grund, der gegen die Implementierung<br />
von Behandlungspfaden spricht, ist aus Sicht der Ärzte die Einengung<br />
ihrer Therapiefreiheit. Pflegefachkräfte wiederum könnten sich<br />
durchdieneuenAufgabenderProzessverantwortungfürdenBehandlungspfad<br />
überfordert fühlen. Doch auchvieleandereUrsachenkönnen<br />
zu aktivem oder passivem Widerstand führen (z. B. Wissenslükken,<br />
Besitzstandswahrung oder Angst vor Veränderung). Auch (zu)<br />
theoretische Lösungsansätze provozieren Widerstand. Gerade deshalb<br />
sollten Mitarbeiter in die Gestaltung der Veränderungen einbezogen<br />
werden, damit praxisgerechte Lösungen entwickelt werden können.<br />
39 Widerstand, auf den nicht professionell reagiert wird, bindet unnötig<br />
Ressourcen. Deshalb muss Widerstand ernst genommen werden. Es<br />
müssen die eigentlichen Ursachen erkannt und behoben werden. Nur<br />
dann wird die Implementierung der Behandlungspfade nachhaltig sein<br />
und den gewünschten Effekt haben.<br />
5 Zusammenfassung<br />
40 Die Krankenhäuser werden zeitnah unweigerlich Behandlungspfade<br />
einführen müssen. Dies wird deren Organisationsstruktur und Unternehmenskultur<br />
tiefgreifend verändern. Aber trotz des Wandels hin zu<br />
einer prozessorientierten Organisation erweist sich die traditionellen<br />
Organisationsstruktur und Unternehmenskultur vieler Krankenhausbetriebe<br />
als starr und überaus langlebig. Doch es sind auch andere<br />
31 Vgl. Doppler, K. / Lauterburg, C.: Change Management. Den Unternehmenswandel<br />
gestalten, Frankfurt a. M., New York 2002, S. 323.<br />
14
Implementierung von klinischen Behandlungspfaden D <strong>1250</strong><br />
bzw. ergänzende Veränderungen der Krankenhausorganisation vorstellbar.<br />
Eine Alternative wäre: Viele Krankenhäuser bilden Zentren<br />
(z. B. ein Brust- oder Gefäßzentrum) oder führen Care Manager ein, die<br />
die Betreuung der Patienten von der Aufnahme bis zur Entlassung<br />
fachabteilungsübergreifend übernehmen. 32)<br />
Entscheidend für eine erfolgreiche Einführung von Behandlungspfaden<br />
ist jedoch nicht die Entwicklung der Behandlungspfade selbst<br />
(auch wenn dies eine berufsübergreifende und interdisziplinäre<br />
Zusammenarbeit voraussetzt), sondern die flankierenden Maßnahmen,<br />
um den damit verbundenen Organisationswandel möglich zu machen.<br />
FürdieKrankenhäuseristjetztderZeitpunktgekommen,durchprofessionell<br />
gestaltete Reorganisationsprozesse die Nachhaltigkeit und<br />
Zukunftstauglichkeit zu sichern.<br />
Literatur<br />
Dahlgaard, K./Stratmeyer, P.: Kooperationsanforderungen an Pflege und<br />
Medizin im Krankenhaus der Zukunft, in: das Krankenhaus 95/2<br />
2003.<br />
Dahlgaard, K./Stratmeyer, P.: Kooperatives Prozessmanagement im<br />
Krankenhaus, in: das Krankenhaus 96/8 2004.<br />
Deutsches Krankenhausinstitut e. V.: Krankenhaus-Barometer. Umfrage<br />
2003, Internet: www.dkgev.de [Datum des Aufrufs: 11. 08. 2005].<br />
Doppler, K./Lauterburg, C.: Change Management. Den Unternehmenswandel<br />
gestalten, Frankfurt a. M., New York 2002.<br />
Gaede, K.: Starke Schwestern, in: kma 1/2005.<br />
Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur<br />
Regelung der Krankenhauspflegesätze – Krankenhausfinanzierungsgesetz,<br />
Internet: www.bmgs.bund.de [Datum des Aufrufs: 21. 07. 2005].<br />
Gratias, R.: Case-Management. Den Patienten zielgerichtet durch den<br />
Leistungsprozess führen. Ziele, Funktionen und Aufgaben eines<br />
pflegerisch gestützten Case-Managements, in: Die Schwester/Der<br />
Pfleger 43/4 2004.<br />
Greiling, M.: Prozessbrüche vermeiden. Das Krankenhaus der Zukunft<br />
ist prozessorientiert, prozessstrukturiert und workflowbasiert, in:<br />
Krankenhaus Umschau 73/10 2004.<br />
Hensen, P. u. a.: Veränderungsmanagement im DRG-Zeitalter: Anpassungsprozesse<br />
müssen integrativ bewältigt werden, in: das Krankenhaus<br />
96/2 2004.<br />
32 Vgl. dazu Zietemann, F.: Clinical Pathways. Viele Pfade führen nach Rom, in: Klinikmanagement<br />
Aktuell 3/2004, S. 57.<br />
MH Pflege, 7. Aktualisierung März 2006 (Leppin/Rosenthal) 15<br />
41
D<strong>1250</strong> Implementierung von klinischen Behandlungspfaden<br />
Küttner, T./Wiese, M. / Roeder, N.: Klinische Behandlungspfade (Teil 1):<br />
Hohe Qualität zu niedrigen Kosten – ein unlösbarer Zielkonflikt?, in:<br />
Pflegezeitschrift 58/3 2005.<br />
Meilwes, M.: Aspekte zu Risiken aus der Sicht der Health Professionals.<br />
Was können wir von anderen lernen?, in: Holzer, E. u. a. (Hrsg.):<br />
Patientensicherheit. Leitfaden für den Umgang mit Risiken im<br />
Gesundheitswesen, Wien 2005.<br />
Roeder, N. u. a.: Frischer Wind mit klinischen Behandlungspfaden (I):<br />
Instrumente zur Verbesserung der Organisation klinischer Prozesse,<br />
in: das Krankenhaus 95/1 2003.<br />
Rosenthal, T./Wagner, E.: Organisationsentwicklung und Projektmanagement<br />
im Gesundheitswesen. Grundlagen – Methoden – Fallstudien,<br />
Heidelberg 2004.<br />
Schmitz-Rixen, T.: Behandlungspfade – ein Weg aus der Krise der Krankenhäuser?,<br />
in: Hessisches Ärzteblatt 8/2003.<br />
Zietemann, F.: Clinical Pathways. Viele Pfade führen nach Rom, in: Klinikmanagement<br />
Aktuell 3/2004.<br />
16