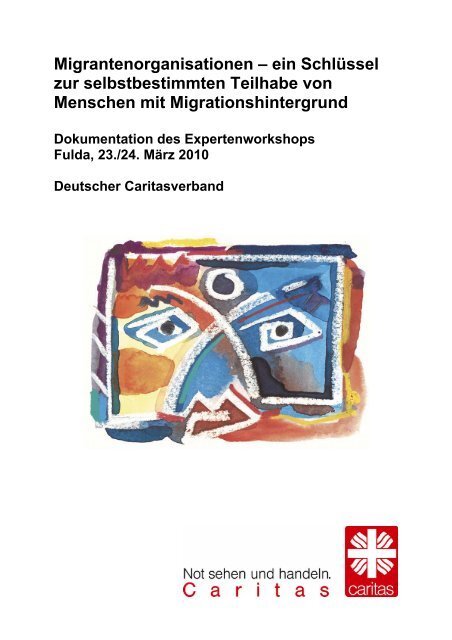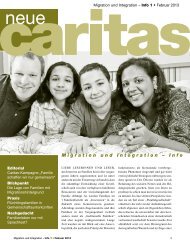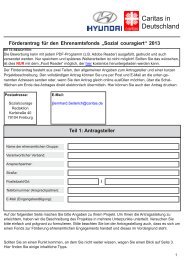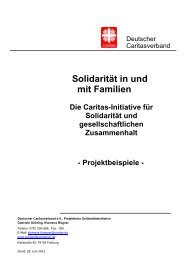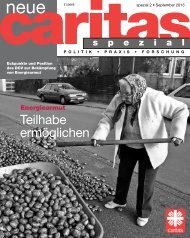Umsetzung der Projektziele - Caritas
Umsetzung der Projektziele - Caritas
Umsetzung der Projektziele - Caritas
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Migrantenorganisationen – ein Schlüssel<br />
zur selbstbestimmten Teilhabe von<br />
Menschen mit Migrationshintergrund<br />
Dokumentation des Expertenworkshops<br />
Fulda, 23./24. März 2010<br />
Deutscher <strong>Caritas</strong>verband
Migrantenorganisationen – ein Schlüssel zur<br />
selbstbestimmten Teilhabe von Menschen<br />
mit Migrationshintergrund<br />
Expertenworkshop<br />
23./24. März 2010, Hotel Bachmühle in Fulda<br />
Dokumentation
Migrantenorganisationen – ein Schlüssel zur<br />
selbstbestimmten Teilhabe von Menschen mit<br />
Migrationshintergrund<br />
Expertenworkshop<br />
23./24. März 2010, Hotel Bachmühle in Fulda<br />
Dokumentation<br />
Redaktion: Thomas Leipp<br />
Technische Redaktion: Katharina Bischof<br />
Herausgeber: Deutscher <strong>Caritas</strong>verband e.V.<br />
Abteilung Soziales und Gesundheit<br />
Referat Migration und Integration<br />
Freiburg, August 2010
Inhalt<br />
1. Vorwort ..........................................................................................................................5<br />
2. Teil I ................................................................................................................................6<br />
2.1 Eröffnung des Expertenworkshops des Deutschen <strong>Caritas</strong>verbandes<br />
„Migrantenorganisationen – ein Schlüssel zur selbstbestimmten Teilhabe von<br />
Menschen mit Migrationshintergrund“ (Roberto Alborino) ......................................6<br />
2.2 Migrantenselbstorganisation: Formen, Aktivitäten, Potenziale und Wege des<br />
Empowerments (Prof. Dr. Sabine Jungk) …………..…….......................................9<br />
2.3 Migrantenselbstorganisationen – Herausfor<strong>der</strong>ungen für Politik und<br />
Zivilgesellschaft (Dr. Claudia Martini) ...................................................................22<br />
2.4 Migrantenorganisationen in <strong>der</strong> Integrationsför<strong>der</strong>ung – Erfahrungen und<br />
Empfehlungen (Romy Bartels)..............................................................................27<br />
2.5 Potenziale und Grenzen <strong>der</strong> Migrantenorganisationen in <strong>der</strong> Integrationsarbeit<br />
(Kenan Küçük)......................................................................................................39<br />
2.6 Empowerment von Migrantenorganisationen – Zusammenarbeit zwischen<br />
Wohlfahrtsverbänden und Migrantenorganisationen gestalten (Vicente Riesgo).41<br />
2.7 Migrantenorganisationen – Bekanntheit, Nutzung, Erwartungen. Ergebnisse<br />
aus <strong>der</strong> Sinus Migranten-Milieu®-Studie (Thomas Leipp) ....................................42<br />
3. Teil II .............................................................................................................................58<br />
3.1 Präsentation Modellprojekte .................................................................................58<br />
3.1.1 PAKT – anpacken – zupacken. Mentoring für einen interkulturellen<br />
Migrantinnenverein (Manuela Pintus) .......................................................58<br />
3.1.2 Interkulturelle Öffnung – professionelles und ehrenamtliches<br />
Engagement vor Ort verbinden (Dorothee Hüllen) ...................................69<br />
3.2 Zusammenfassung <strong>der</strong> Diskussionspunkte ..........................................................75<br />
4. Anhang .........................................................................................................................77
1. Vorwort<br />
In <strong>der</strong> aktuellen Integrationsdebatte wird Migrantenorganisationen eine große Aufmerksamkeit<br />
geschenkt. Sie werden als wichtige Experten für die Bedarfe von Menschen mit Migrationshintergrund,<br />
als Brückenbauer und Vermittler sowie als unverzichtbare Akteure <strong>der</strong> Integrationsarbeit<br />
beschrieben. In zahlreichen För<strong>der</strong>programmen wird <strong>der</strong> Fokus auf eine verstärkte<br />
Zusammenarbeit zwischen etablierten Trägern und Migrantenorganisationen o<strong>der</strong> auf<br />
die Professionalisierung <strong>der</strong> Selbstorganisationen von Menschen mit Migrationshintergrund<br />
gelegt.<br />
Für den Deutschen <strong>Caritas</strong>verband ist es seit langem ein wichtiges Anliegen, Migrantenorganisationen<br />
und ausländische Vereinigungen zu för<strong>der</strong>n und zu unterstützen. Ziel war und<br />
ist die Stärkung <strong>der</strong> selbstbestimmten Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund.<br />
Aktuell stellt sich jedoch die Frage, wie die verbandliche <strong>Caritas</strong> mit <strong>der</strong> wachsenden Bedeutung<br />
<strong>der</strong> Migrantenorganisationen umgehen soll. Denn die Zusammenarbeit mit den Selbstorganisationen<br />
von Menschen mit Migrationshintergrund rührt an das Selbstverständnis als<br />
Wohlfahrtsverband in seiner Rolle als Solidaritätsstifter, Anwalt und Dienstleister.<br />
An diesem Punkt setzte <strong>der</strong> Expertenworkshop „Migrantenorganisationen – ein Schlüssel zur<br />
selbstbestimmten Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund“ an. In einem ersten<br />
Teil hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, mit Vertreterinnen und Vertretern <strong>der</strong> Wissenschaft,<br />
Politik und Migrantenorganisationen ins Gespräch zu kommen. In einem zweiten<br />
Teil waren die Mitarbeitenden <strong>der</strong> <strong>Caritas</strong> bzw. katholischen Einrichtungen dazu eingeladen,<br />
die grundlegenden Fragestellungen zur Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen zu<br />
diskutieren, Erfahrungen auszutauschen und neue Perspektiven zu entwickeln. Um dabei<br />
auch einen Einblick in die Praxis zu erhalten, wurden zudem die beiden Modellprojekte <strong>der</strong><br />
<strong>Caritas</strong>, die <strong>der</strong>zeit im Rahmen des För<strong>der</strong>programms „Verstärkte Partizipation von Migrantenorganisationen“<br />
des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge geför<strong>der</strong>t werden, dargestellt.<br />
Da gerade vor Ort die Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen konkret gestaltet<br />
und durchgeführt wird, richtete sich <strong>der</strong> Expertenworkshop vor allem an Mitarbeitende aus<br />
den Ortscaritasverbänden.<br />
Der Expertenworkshop ist Teil des Projektes „Migrantenorganisationen ein Schlüssel zur<br />
selbstbestimmten Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund – Beitrag <strong>der</strong> <strong>Caritas</strong>“.<br />
Seine Ergebnisse fließen in die Arbeit des Projektes, das im Oktober 2009 startete und eine<br />
Laufzeit von eineinhalb Jahren hat, ein.<br />
Freiburg, August 2010<br />
Roberto Alborino Thomas Leipp<br />
Referatsleiter Referent<br />
Referat Migration und Integration Referat Migration und Integration<br />
Deutscher <strong>Caritas</strong>verband e.V. Deutscher <strong>Caritas</strong>verband e.V.<br />
5
Alborino: Eröffnung des Expertenworkshops<br />
_________________________________________________________________________________<br />
2. Teil I<br />
2.1 Eröffnung des Expertenworkshops des Deutschen <strong>Caritas</strong>verbandes „Migrantenorganisationen<br />
– ein Schlüssel zur selbstbestimmten Teilhabe von Menschen<br />
mit Migrationshintergrund“<br />
Roberto Alborino, Leiter des Referats Migration und Integration im Deutschen <strong>Caritas</strong>verband<br />
Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
ich möchte Sie sehr herzlich zum Expertenworkshop „Migrantenorganisationen – ein Schlüssel<br />
zur selbstbestimmten Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund“ des Deutschen<br />
<strong>Caritas</strong>verbandes hier in Fulda begrüßen.<br />
Wie Sie wissen, wird in <strong>der</strong> aktuellen Integrationsdebatte den Migrantenorganisationen eine<br />
große Aufmerksamkeit geschenkt. Sie werden als wichtige Experten für die Bedarfe von<br />
Menschen mit Migrationshintergrund, als Brückenbauer und Vermittler zwischen <strong>der</strong> Aufnahme-<br />
und Zuwan<strong>der</strong>ungsgesellschaft sowie als unverzichtbare Akteure <strong>der</strong> Integrationsarbeit<br />
beschrieben. Auch in zahlreichen För<strong>der</strong>programmen auf Bundes-, Landes und kommunaler<br />
Ebene wird <strong>der</strong> Fokus auf eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen etablierten Trägern<br />
und Migrantenorganisationen o<strong>der</strong> auf die Professionalisierung <strong>der</strong> Selbstorganisationen<br />
von Menschen mit Migrationshintergrund gelegt.<br />
Beson<strong>der</strong>s deutlich wurde die gewachsene Bedeutung von Migrantenorganisationen, vor<br />
allem auch durch ihre Beteiligung an <strong>der</strong> Entwicklung des Nationalen Integrationsplans <strong>der</strong><br />
Bundesregierung. Darin sind drei zentrale Empfehlungen bzw. Selbstverpflichtungen festgehalten:<br />
1. Als ein Ziel wird benannt die Einbeziehung von Migrantenorganisationen in die Erarbeitung<br />
von kommunalen- und Landesintegrationsplänen.<br />
2. Der Bund hat zugesagt, dass er fachliche Hilfe für Migrantenorganisationen als Träger<br />
von Projekten anbieten und hierfür auch die Bildung von Netzwerken von Migrantenorganisationen<br />
unterstützen werde.<br />
3. Das Bundesamt hat sich verpflichtet, Migrantenorganisationen in die Entwicklung des<br />
bundesweiten Integrationsprogramms einzubeziehen.<br />
Für den Deutschen <strong>Caritas</strong>verband ist es seit langem ein wichtiges Anliegen gewesen,<br />
Migrantenorganisationen und ausländische Vereinigungen in ihren Selbsthilfepotentialen, als<br />
gleichberechtigte Partner sowie als eigenständige Akteure im Integrationsgeschehen zu<br />
stärken. Bereits in den 1950er Jahren zählte nicht nur die Beratung und Betreuung <strong>der</strong> ausländischen<br />
Arbeitskräfte zu den Aufgaben <strong>der</strong> muttersprachlichen Gemeinden und dem Auslän<strong>der</strong>sozialdienst<br />
<strong>der</strong> <strong>Caritas</strong>, son<strong>der</strong>n auch <strong>der</strong> Auf- und Ausbau von Selbstorganisationen.<br />
Viele Vereinigungen und Gruppierungen sind aus den muttersprachlichen Gemeinden hervorgegangen<br />
o<strong>der</strong> sind in enger Zusammenarbeit mit dem Auslän<strong>der</strong>sozialdienst entstanden.<br />
Ich freue mich deshalb ganz beson<strong>der</strong>s, Monsignore Wolfgang Miehle, Nationaldirektor<br />
für die Auslän<strong>der</strong>seelsorge bei <strong>der</strong> Deutschen Bischofskonferenz, begrüßen zu dürfen. Diese<br />
wegweisende Haltung <strong>der</strong> <strong>Caritas</strong> wurde in den Folgejahren immer wie<strong>der</strong> aufgegriffen. So<br />
wird beispielsweise in einer Orientierungshilfe für den Auslän<strong>der</strong>sozialdienst zur „Zusammenarbeit<br />
<strong>der</strong> <strong>Caritas</strong> mit Auslän<strong>der</strong>vereinigungen“ aus dem Jahr 1990 hingewiesen:<br />
„Nach mehr als dreißigjähriger Erfahrungen in <strong>der</strong> Auslän<strong>der</strong>arbeit und auch mit<br />
Auslän<strong>der</strong>vereinigungen hält <strong>der</strong> Deutsche <strong>Caritas</strong>verband es heute für beson<strong>der</strong>s<br />
dringend geboten, auf den beson<strong>der</strong>en Arbeitsschwerpunkt ,Befähigung <strong>der</strong><br />
6
Alborino: Eröffnung des Expertenworkshops<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Auslän<strong>der</strong> zur Bildung eigener Organisationen mit eigenen Strukturen’ … erneut<br />
hinzuweisen […] Er möchte zu einer Intensivierung <strong>der</strong> Arbeit ermutigen.“ 1<br />
Der Deutsche <strong>Caritas</strong>verband sieht seine Position durch die aktuellen Diskussionen zur Rolle<br />
und Funktion von Migrantenorganisationen im Integrationsprozess gestärkt. Ein zentrales<br />
Anliegen ist es dabei, das Zusammenleben zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund<br />
zu gestalten und zu för<strong>der</strong>n. Wichtige Merkmale einer gelungenen Integration sind<br />
gegenseitige Anerkennung, Partizipation, Gleichberechtigung und Chancengleichheit. Da ein<br />
großer Teil <strong>der</strong> Menschen mit Migrationshintergrund immer noch keinen gleichberechtigten<br />
Zugang zu gesellschaftlich, politisch und wirtschaftlich relevanten Bereichen hat, setzt sich<br />
die verbandliche <strong>Caritas</strong> auch heute aktiv für die Erweiterung ihrer Partizipationsmöglichkeiten<br />
ein. Ein wichtiges Element dieser Unterstützungsleistungen ist demnach die Unterstützung<br />
und För<strong>der</strong>ung ihrer Selbstorganisation. Denn damit kann im Sinne von Empowerment<br />
ein Prozess hin zu einer verstärkten Autonomie, Selbstbestimmung und Interessenvertretung<br />
von Personen mit Migrationshintergrund unterstützt werden. Und in diesem Sinne haben wir<br />
unseren Workshop auch benannt: Migrantenorganisationen als Schlüssel zur selbstbestimmten<br />
Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund!<br />
Gleichwohl muss kritisch darauf hingewiesen werden, dass die zielgerichtete Unterstützung<br />
und För<strong>der</strong>ung von Migrantenorganisationen innerhalb des Verbandes nicht immer unumstritten<br />
ist. Mancherorts lässt sich auch eine gewisse Unsicherheit über die konkrete Ausgestaltung<br />
<strong>der</strong> Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen feststellen. Dies liegt sicherlich<br />
auch daran, dass sich mit dem Begriff „Migrantenorganisationen“ eine Vielzahl an sehr unterschiedlichen<br />
Organisationen, Gruppierungen und Vereinigungen zusammenfassen lässt.<br />
Diese Unterschiede beziehen sich sowohl auf die jeweiligen Zielsetzungen, Aktivitäten, Organisationsstrukturen<br />
als auch auf die religiöse bzw. politische Ausrichtung o<strong>der</strong> den Grad<br />
<strong>der</strong> Professionalisierung. Dies hat zur Folge, dass bei <strong>der</strong> Unterstützung und För<strong>der</strong>ung von<br />
Migrantenorganisationen durchaus eine Differenzierung vorgenommen werden kann. Die<br />
Frage, mit welchen Selbstorganisationen und in welcher Form eine Zusammenarbeit angestrebt<br />
und durchgeführt wird, ist dann wie<strong>der</strong>um sehr eng mit den eigenen Vorstellungen und<br />
Zielsetzungen <strong>der</strong> Gestaltung <strong>der</strong> Gesellschaft und des Sozialraums verbunden.<br />
Ich möchte dazu noch einen weiteren kritischen Punkt anmerken: durch die starke Fokussierung<br />
auf die Migrantenorganisationen im Integrationsdiskurs und in För<strong>der</strong>programmen<br />
könnte die Gefahr bestehen, dass eine Erwartungshaltung hinsichtlich <strong>der</strong> Leistungsfähigkeit<br />
von Migrantenorganisationen aufgebaut wird, <strong>der</strong> viele Migrantenorganisationen nicht entsprechen<br />
können o<strong>der</strong> wollen. Sehr viele Gruppierungen und Vereinigungen haben nur begrenzte<br />
infrastrukturelle, finanzielle und personelle Ressourcen, die allermeisten sind nicht<br />
an übergeordnete Bundes- bzw. Dachverbände angeschlossen. Aber gerade vor Ort haben<br />
sie vielfach einen verbesserten Zugang und Blick auf die eigene Community bzw. einzelne<br />
Gruppen von Menschen mit Migrationshintergrund. Und gerade dort gilt es zu beachten,<br />
dass Unterstützungsleistungen – z. B. die Bereitstellung von Räumlichkeiten, Qualifizierungsprogramme<br />
zur Professionalisierung o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Aufbau von hauptamtlichen Strukturen –<br />
in ein übergeordnetes Konzept zur För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Selbstorganisationen eingebettet sind.<br />
Ansonsten bleiben einzelne För<strong>der</strong>ungsmaßnahmen ein Strohfeuer, eine partnerschaftliche<br />
und auf gleicher Augenhöhe angesetzte Zusammenarbeit wird erschwert, die Nachhaltigkeit<br />
ist nicht gesichert.<br />
Genau an diesem Punkt setzt <strong>der</strong> heute und morgen stattfindende Expertenworkshop an.<br />
Das übergeordnete Ziel <strong>der</strong> Veranstaltung ist es, einen innerverbandlichen Diskussionsprozess<br />
zur Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen anzustoßen bzw. weiterzuführen.<br />
1 Stellungnahme des Zentralrats des Deutschen <strong>Caritas</strong>verbandes vom 11.10.1989: Zusammenarbeit <strong>der</strong> <strong>Caritas</strong><br />
mit Auslän<strong>der</strong>vereinigungen – Eine Orientierungshilfe für den Auslän<strong>der</strong>sozialdienst. In: <strong>Caritas</strong>, H. 3, Jg. 91,<br />
März 1990 (Son<strong>der</strong>druck). S. 136-142, hier S. 136f.<br />
7
Alborino: Eröffnung des Expertenworkshops<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Dazu sollen die grundlegenden Fragestellungen zur Zusammenarbeit mit den Selbstorganisationen<br />
von Menschen mit Migrationshintergrund diskutiert, bisherige Erfahrungen ausgetauscht<br />
und neue Perspektiven entwickelt werden.<br />
Der Expertenworkshop ist Teil des Projektes „Migrantenorganisationen ein Schlüssel zur<br />
selbstbestimmten Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund – Beitrag <strong>der</strong> <strong>Caritas</strong>“.<br />
Es soll erkunden und ausloten, welche Formen <strong>der</strong> Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen<br />
in den Orts-<strong>Caritas</strong>verbänden bereits bestehen und in welchen Bereichen eine verstärkte<br />
Zusammenarbeit notwendig und sinnvoll ist. Zentral ist dabei die Frage, wie bestehende<br />
Kooperationen ausgebaut und neue Kooperationen initiiert werden können. Das Ergebnis<br />
des Projekts soll eine Handreichung zum Themenfeld Migrantenorganisationen sein.<br />
Das Projekt wird in <strong>der</strong> Zentrale des Deutschen <strong>Caritas</strong>verbandes durchgeführt und hat eine<br />
Laufzeit von eineinhalb Jahren. Beginn war <strong>der</strong> 1. Oktober 2009.<br />
Ein erstes Ergebnis des Projektes ist eine Orientierungshilfe für den Fachdienst Migration<br />
und Integration zur Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen. Sie kann als erste Standortbestimmung<br />
zur Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen angesehen werden und<br />
enthält Anregungen und Hilfestellungen für die praktische Arbeit mit den Selbstorganisationen<br />
<strong>der</strong> Menschen mit Migrationshintergrund. Die Orientierungshilfe finden Sie übrigens<br />
auch in Ihren Tagungsmappen.<br />
Meine sehr geehrten Damen und Herren, für die Zielsetzung <strong>der</strong> Veranstaltung war es uns<br />
wichtig, ausgewiesene und erfahrene Fachleute für den Themenbereich Migrantenorganisationen<br />
zu gewinnen. Und ich denke, dass unsere Veranstaltung zu Recht die Bezeichnung<br />
Experten-Workshop hat.<br />
Zum einen konnten wir Experten aus den Bereichen Wissenschaft, Politik und Selbstorganisationen<br />
für uns gewinnen. Ganz beson<strong>der</strong>s möchte ich in diesem Zusammenhang Frau<br />
Prof. Dr. Sabine Jungk von <strong>der</strong> Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin sowie Frau<br />
Dr. Claudia Martini vom Arbeitsstab <strong>der</strong> Beauftragten <strong>der</strong> Bundesregierung für Migration,<br />
Flüchtlinge und Integration begrüßen. Des Weiteren freut es mich außerordentlich, dass Herr<br />
Kenan Küçük, Sprecher des Forums für Migrantinnen und Migranten im Paritätischen Wohlfahrtsverband<br />
und Geschäftsführer des Multikulturellen Forums sowie Herr Vicente Riesgo,<br />
Fachberater des Bundes <strong>der</strong> Spanischen Elternvereine und Vorsitzen<strong>der</strong> <strong>der</strong> Spanischen<br />
Weiterbildungsakademie heute den Weg zu uns gefunden haben.<br />
Zum an<strong>der</strong>en sind aber auch Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen aus den Diözesan- und<br />
Ortscaritasverbänden, aus den Fachverbänden und <strong>der</strong> Kirche, Experten für die Belange von<br />
Menschen mit Migrationshintergrund bzw. <strong>der</strong>en Organisationen. Denn Sie haben in Ihrer<br />
praktischen Arbeit den direkten und vielfältigen Kontakt mit den Vereinigungen und Organisationen.<br />
Sie wissen, welche Bedeutung diese vor Ort für den Sozialraum haben und wie<br />
sich eine Zusammenarbeit mit ihnen gestalten lässt.<br />
Ich freue mich auf sehr spannende Vorträge und Diskussionen. Vielen Dank!<br />
8
Jungk: Migrantenselbstorganisation: Formen, Aktivitäten, Potenziale und Wege des Empowerments<br />
________________________________________________________________________________<br />
2.2 Migrantenselbstorganisation: Formen, Aktivitäten, Potenziale und Wege des<br />
Empowerments<br />
Prof. Dr. Sabine Jungk, Arbeitsbereich Interkulturelle Bildung und Erziehung an <strong>der</strong> Katholischen<br />
Hochschule für Sozialwesen Berlin<br />
Einleitung<br />
Dass die <strong>Caritas</strong> einen Expertenworkshop zum Thema „Migrantenselbstorganisationen“<br />
gestaltet, zeigt einen Verständigungsbedarf, <strong>der</strong> nicht nur theoretischer Natur ist.<br />
Die Forschung, die wissenschaftliche und öffentliche Debatte über Migrantenselbstorganisationen<br />
war zwar in Deutschland immer ausgesprochen randständig, aber hat immerhin eine<br />
ca. 20-jährige Tradition. Im Vor<strong>der</strong>grund stand dabei überwiegend eine integrationspolitische<br />
Fragestellung, nämlich ob Migrantenselbstorganisationen eher eine Segregation <strong>der</strong> Zugewan<strong>der</strong>ten,<br />
die Verfestigung von integrations- und aufstiegsbehin<strong>der</strong>nden Strukturen beför<strong>der</strong>n<br />
o<strong>der</strong> ob sie eine wertvolle Brücke zur Aufnahmegesellschaft bilden. Das ist auch heute<br />
noch das vorherrschende Erkenntnisinteresse.<br />
Aber es hat sich doch einiges bewegt. Erstens kann man seit ca. zehn Jahren eine verstärkte<br />
Beschäftigung, geradezu einen Trend in <strong>der</strong> Thematisierung von Migrantenselbstorganisationen<br />
feststellen (z. B. Koopmans/Statham 1998; MASSKS 1999; Schwenken 2000; Thränhardt<br />
2000; Enquete-Kommission 2002; Jungk 2001, 2003, 2005; MGSFF 2004; Huth 2004;<br />
Hunger 2004; Klein et al. 2004; Weiss/Thränhardt 2005; Halm/Sauer 2005; Latorre Pallares/Zitzelsberger<br />
2006; Stadt Pa<strong>der</strong>born 2007). Zweitens hat sich <strong>der</strong> Fokus, unter dem<br />
Migrantenselbstorganisationen beforscht werden, doch etwas erweitert – etwa um demokratietheoretische<br />
und zivilgesellschaftliche Perspektiven. Darauf werde ich noch zu sprechen<br />
kommen. Drittens verfügen wir inzwischen über – zwar immer noch zu wenige – empirische<br />
Forschungen über Migrantenselbstorganisationen, die sie als soziale Organisationen real in<br />
den Blick nehmen und den Dialog mit den Organisationen aufnehmen. Das ist etwas an<strong>der</strong>es<br />
als ein Forschungsinteresse, in dem ethnische Vereinigungen lediglich als Artefakte aufscheinen<br />
und als „Indikator des Assimilationsgrades einer ethnischen Gruppe“ abstrakt gesetzt<br />
werden. Viertens haben sich integrationspolitische Zielformulierungen verän<strong>der</strong>t; die<br />
Politik setzt stärker auf Dialog und Partizipation von Migrantinnen und Migranten bei den<br />
Integrationsanstrengungen. Dadurch sind Migrantinnen und Migranten, und dabei häufig<br />
VertreterInnen ihrer Organisationen, „aufgestiegen“ zu GesprächspartnerInnen und BeraterInnen,<br />
z. B. beim ersten Integrationsgipfel 2006, beim Nationalen Integrationsplan und -<br />
programm, bei <strong>der</strong> Islamkonferenz, auch z. B. bei <strong>der</strong> Entwicklung von Integrationsplänen in<br />
Kommunen.<br />
Entsprechend wird bei diversen För<strong>der</strong>programmen – wie <strong>der</strong> „Sozialen Stadt“ o<strong>der</strong> bei Projekten<br />
gegen Rechtsextremismus und für „Vielfalt“ – o<strong>der</strong> bei <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung des Bundesamts<br />
für Migration und Flüchtlinge für die gemeinwesenorientierten Integrationsprojekte – die Unterstützung<br />
von Selbstorganisationen propagiert, eine Kooperation mit den Interessenvertretungen<br />
von ethnischen Min<strong>der</strong>heiten verlangt und honoriert.<br />
Um also den Bogen zurück zu meinem einleitenden Satz zu schlagen: Ihre Verständigung<br />
hier und heute ist nicht theoretischer Natur, son<strong>der</strong>n steht im Zusammenhang mit einem<br />
praktischen Interesse <strong>der</strong> Ausgestaltung neuer Arbeitsansätze im Bereich Migration und Integration.<br />
Noch vor zehn Jahren bedeutete es eher einen mutigen Schritt, sich für die För<strong>der</strong>ung von<br />
Migrantenselbstorganisationen einzusetzen. Das Beispiel Nordrhein-Westfalen zeigt, dass<br />
ein solcher Schritt einer sorgfältigen Absicherung bedurfte. So wurde die dort 1997 erstmals<br />
9
Jungk: Migrantenselbstorganisation: Formen, Aktivitäten, Potenziale und Wege des Empowerments<br />
________________________________________________________________________________<br />
eingerichtete Landes-För<strong>der</strong>ung für Migrantenselbstorganisationen zu Beginn auf zwei Jahre<br />
begrenzt und durch eine wissenschaftliche Studie ihres Selbsthilfe- und Integrationspotenzials<br />
(MASSKS 1999) sowie eine Evaluation (ebd.) <strong>der</strong> geför<strong>der</strong>ten Projekte begleitet, um Informationen<br />
und Erfahrungen zu sammeln. Erst die positiven Ergebnisse dieser Studien führten<br />
schließlich dazu, dass das För<strong>der</strong>programm in eine För<strong>der</strong>richtlinie umgewandelt wurde.<br />
Und obgleich, wie gerade kurz skizziert, sich die Öffnung zu Migrantenorganisationen vielerorts<br />
abzeichnet, beginnt erst jetzt richtig, wenn auch immer noch zögerlich, <strong>der</strong> Weg, Erfahrungen<br />
in <strong>der</strong> „Kooperation auf Augenhöhe“ zu sammeln.<br />
Allerdings hatten die Organisationen auf kommunaler o<strong>der</strong> sozialräumlicher Ebene hier immer<br />
schon einen Vorsprung und ich nehme stark an, dass in diesem Kreis schon viele Erfahrungen<br />
mit Migrantenselbstorganisationen vorhanden sind.<br />
Zur – hoffentlich hilfreichen – Unterstützung Ihrer Positionsfindung und als Anregungen für<br />
Ihre Arbeit werde ich zunächst (1) einen Überblick über Migrantenselbstorganisationen und<br />
ihre Aktivitäten geben, (2) die Rolle und Funktion von Migrantenselbstorganisationen thematisieren,<br />
die sie im Integrationsprozess, in <strong>der</strong> Zivilgesellschaft und demokratietheoretisch<br />
einnehmen, (3) Bedingungen und Voraussetzungen für Empowerment von Migrantenselbstorganisationen<br />
benennen und (4) Herausfor<strong>der</strong>ungen für die Kooperation/Zusammenarbeit<br />
<strong>der</strong> <strong>Caritas</strong> als Wohlfahrtsverband mit Migrantenselbstorganisationen, beson<strong>der</strong>s<br />
im Sozialraum, geben.<br />
1. Migrantenselbstorganisationen: Formen, Aktivitäten, Dynamik<br />
Zur Bedeutung – quantitativ: In älteren Studien <strong>der</strong> 1980er und 1990er Jahre schwankten die<br />
Angaben über die Mitgliedschaft von Migrantinnen und Migranten in einer Eigenorganisation<br />
zwischen einem Fünftel bis einem Drittel <strong>der</strong> ausländischen Bevölkerung. Die neue Studie<br />
von Sinus Sociovision – von <strong>der</strong> Sie heute noch hören werden – ermittelte 2008, dass 22<br />
Prozent <strong>der</strong> Menschen mit Migrationshintergrund „aktives o<strong>der</strong> passives Mitglied von Migrantenselbstorganisation“<br />
sind, 16 % sind aktiv. 1<br />
Quelle: http://www.caritas.de/57946.html<br />
1 Thränhardt/Dieregsweiler errechneten, dass 17 % aller in Nordrhein-Westfalen lebenden Migrantinnen und<br />
Migranten Mitglied einer Selbstorganisation sind. Sie verweisen darauf, dass <strong>der</strong> tatsächliche Anteil „deutlich<br />
darüber“ liege, da sich die Angabe auf die gesamte Wohnbevölkerung, also auch Kin<strong>der</strong> bezieht (MASSKS<br />
1999, S. 32). Des Weiteren verweisen sie auf eine Untersuchung von Krummacher/Waltz (1996), die in den<br />
1980er Jahren einen Organisationsgrad von 20 bis 30 % ermittelten. Während <strong>der</strong> Freiwilligensurvey keine aktualisierte<br />
Berechnung erlaubt, hat Sinus Sociovision 2008 die genannten alten Daten mit 22 % aktiver o<strong>der</strong><br />
passiver Mitgliedschaft bestätigt.<br />
10
Jungk: Migrantenselbstorganisation: Formen, Aktivitäten, Potenziale und Wege des Empowerments<br />
________________________________________________________________________________<br />
In ihrer Bekanntheit liegen Migrantenselbstorganisationen zwar hinter denen <strong>der</strong> verschiedenen<br />
sozialen Dienste in unterschiedlicher Trägerschaft. Aber bezüglich <strong>der</strong> Nutzungsdaten<br />
liegen Migrantenselbstorganisationen meist über denen sozialer Dienste. Dies weist schon<br />
auf einen qualitativen Unterschied hin: Migrantenselbstorganisationen sind nicht nur für soziale<br />
Notlagen wichtig, sie sind mehr als Organisationen <strong>der</strong> Sozialen Arbeit.<br />
Damit wären wir bei <strong>der</strong> Beschreibung <strong>der</strong> äußerst heterogenen Landschaft <strong>der</strong> Migrantenselbstorganisationen.<br />
Das Bundeszentralregister (wiewohl nicht vollständig, Hunger 2005, S.<br />
223) vermeldet 2004 ca. 16.000 Vereine von Zugewan<strong>der</strong>ten in den alten Bundeslän<strong>der</strong>n<br />
und nur zwölf in den neuen Bundeslän<strong>der</strong>n (Kindelberger 2005, S. 164). Sezgin/Tuncer-<br />
Zengingül (2009) haben 3.480 Migrantenselbstorganisationen in 75 kreisfreien Städten erfasst<br />
– ich kann zurzeit diese Differenz nicht aufklären, da eine weiterführende Veröffentlichung<br />
(Pries/Sezgin 2010) erst für 2010 annonciert ist. Die Dichte <strong>der</strong> Migrantenorganisationen<br />
ist in NRW und Hessen am größten, die höchste Pro-Kopf-Dichte aber gibt es in<br />
Schleswig-Holstein (Sezgin/Tuncer-Zengingül 2009).<br />
Zunächst einige impressionistische Eindrücke von <strong>der</strong> Vielgestaltigkeit <strong>der</strong> Migrantenselbstorganisationen:<br />
Das Spektrum reicht von kleinen Initiativgruppen, z. B. von alleinerziehenden<br />
Frauen, die sich im „Wohnzimmer“ treffen über ethnische Vereine, die über eigene<br />
Räume verfügen, häufig ethnisch homogen sind, vielleicht über kleinere Projektgel<strong>der</strong> verfügen<br />
und auch sozialarbeiterische Angebote o<strong>der</strong> Deutschkurse u. ä. durchführen. Es gibt<br />
Zentren, häufig multikulturelle Organisationen (wie z. B. das Multikulturelle Forum Lünen,<br />
das Herr Küçük leitet), die oft aus binationalen Vereinen hervorgegangen und mittlerweile<br />
professionelle Träger von Sozialer Arbeit sind und es gibt einige wenige Dachvereine, die<br />
ihrerseits öffentliche Gel<strong>der</strong> an im Land verteilte Ortsvereine weitergeben.<br />
Seit Mitte <strong>der</strong> 1980er Jahre – so wies bereits eine Studie 1999 aus und ich kann es aus neueren<br />
Projektzusammenhängen bestätigen – ist eine zunehmende Orientierung <strong>der</strong> Vereine<br />
auf die Herausfor<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> bundesdeutschen Gesellschaft zu beobachten. Und zwar<br />
unabhängig davon, ob es sich um Zusammenschlüsse <strong>der</strong> ersten, zweiten o<strong>der</strong> dritten Einwan<strong>der</strong>ergeneration<br />
handelt (MASSKS 1999, S. 59 und S. 115). Nur noch wenige Organisationen<br />
arbeiten ausschließlich herkunftslandbezogen, Mischformen zwischen beiden Orientierungen<br />
sind aber bei über <strong>der</strong> Hälfte üblich (ebd.). 2 Hunger (2005, S. 226) hat für das Jahr<br />
2001 ermittelt, dass nur noch 61,9 % aller Vereinsneugründungen, an denen Auslän<strong>der</strong> beteiligt<br />
waren, herkunftshomogene Zusammenschlüsse sind, während es noch Ende <strong>der</strong><br />
1980er Jahre fast 90 % waren.<br />
Für eine etwas strukturiertere Charakterisierung beziehe ich mich im Folgenden auf Uwe<br />
Hunger (2005, S. 224). Er hat anhand des Bundesauslän<strong>der</strong>vereinsregisters (Zentralregister)<br />
eine statistisch repräsentative Zahl von fast 5.700 Vereinen detailliert untersucht.<br />
Interessant ist zunächst <strong>der</strong> Blick auf die Gründungswellen ausländischer Vereine in<br />
Deutschland: Zwei Drittel wurden seit 1990 gegründet, aber <strong>der</strong> Anteil von Auslän<strong>der</strong>n an <strong>der</strong><br />
Wohnbevölkerung stieg zwischen 1989 und 1995 bis 2003 lediglich von 7,7 % auf rund 9 %,<br />
um 2007 auf 8,2 % zu sinken (BAMF 2008, S. 3f.) 3 . Mit an<strong>der</strong>en Worten: Der Trend zur<br />
Gründung von Selbstorganisationen wächst stärker, als sich allein über die wachsende Zahl<br />
<strong>der</strong> ausländischen Bevölkerung erklären ließe.<br />
2 Weiter ist zu beobachten, dass Vereine neben <strong>der</strong> Auseinan<strong>der</strong>setzung mit politischen Vorgängen im Herkunftsland<br />
zum Träger humanitärer Hilfe dort werden, wie das große Engagement von türkischen Organisationen<br />
nach dem Erdbeben in <strong>der</strong> Türkei 1999 zeigt.<br />
3 Hier sind die Statistiken kongruent, sie weisen lediglich Personen ohne deutschen Pass aus – weshalb ich hier<br />
sowie folgend an Stellen mit gleichem Dilemma – von „Auslän<strong>der</strong>innen und Auslän<strong>der</strong>n“ spreche. Aussiedler<br />
und Eingebürgerte werden nicht erfasst und sind entsprechend in den genannten Zahlen nicht enthalten.<br />
11
Jungk: Migrantenselbstorganisation: Formen, Aktivitäten, Potenziale und Wege des Empowerments<br />
________________________________________________________________________________<br />
Gründungen ausländischer Vereine in Deutschland *<br />
Zeit Häufigkeit Prozent<br />
bis 1959 9 0,2<br />
1960er Jahre 54 1,0<br />
1970er Jahre 163 2,9<br />
1980er Jahre 1.903 33,5<br />
ab 1990 3.548 62,5<br />
Gesamt 5.677 100<br />
* repräsentative Auswahl aus ca. 16.000 erfassten Vereinen des Bundesauslän<strong>der</strong>vereinsregisters,<br />
Hunger 2005, S. 224.<br />
Die Aktivitätenstruktur von Migrantenselbstorganisationen entspricht grosso modo <strong>der</strong> Struktur<br />
deutscher Vereine (BMFSFJ 2005). „Den dominierenden Typus ausländischer Vereine<br />
bilden (...) Kultur- und Begegnungsvereine, gefolgt von religiösen Vereinen. Weiter spielen<br />
Sportvereine, soziale Vereine (wie Gesundheitsvereine o<strong>der</strong> ähnliche) und Freizeitvereine<br />
eine bedeutende Rolle. Politische Vereine sowie Flüchtlings- beziehungsweise humanitäre<br />
Vereine machen je circa fünf Prozent aus. Unter den Vereinen, die für spezielle Gruppen<br />
(Eltern, Senioren, Frauen, bestimmte Berufe etc.) gegründet wurden, haben Elternvereine<br />
mit insgesamt 4,6 % den größten Stellenwert. Auffallend ist, dass spezielle ausländische<br />
Jugendvereine kaum eine Rolle spielen“ (Hunger 2005, S. 232). Diese Schwerpunkte „Kultur-<br />
und Begegnungsvereine“ sieht Hunger (2008, S. 12) auch bei den Neugründungen bestätigt;<br />
Sezgin/Tuncer-Zengingül (2009) sehen ebenfalls die Funktionen „Identität“ und „Integration“<br />
im Vor<strong>der</strong>grund.<br />
Laut Sinus Sociovision nennen 22 % <strong>der</strong> befragten Migrantinnen und Migranten als Erwartung<br />
an Migrantenorganisationen, „mit Landsleuten zusammenkommen“, 18 % „<strong>der</strong> Familie<br />
den Kontakt zur Kultur des Herkunftslandes ermöglichen“, 16 % „Anschluss an die Kultur<br />
meines Herkunftslandes halten“: Anliegen, die in Zeiten <strong>der</strong> Globalisierung, in denen viele<br />
die Frage beschäftigt, wie Vielfalt bei wachsendem Angleichungsdruck erhalten werden<br />
kann, m. E. auf größeres Verständnis stoßen als noch vor 30 Jahren, als „Anschluss an die<br />
Herkunftskultur“ doch eher antiquiert o<strong>der</strong> gar als Anzeichen von Abschottung galten. Es<br />
irritiert, dass die von Sinus Sociovision ermittelten Erwartungen überwiegend als „private“ zu<br />
kennzeichnen sind, dass Motive wie politische Einflussnahme und Interessenvertretung, Unterstützung<br />
bei <strong>der</strong> Erziehung <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> etc. völlig fehlen. Fehlt damit doch auch ein ganz<br />
großer Bereich <strong>der</strong> soziokulturellen Arbeit <strong>der</strong> Vereine, die z. B. auf die schulische För<strong>der</strong>ung<br />
von Kin<strong>der</strong>n gerichtet ist.<br />
12
Jungk: Migrantenselbstorganisation: Formen, Aktivitäten, Potenziale und Wege des Empowerments<br />
________________________________________________________________________________<br />
Verfolgt man die Aktivitäten von IDA e.V. (Projekt: Kooperation und Netzwerkarbeit för<strong>der</strong>n:<br />
Ein Verzeichnis von Vereinen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund - "VJM VZ", s. u.),<br />
so kann man eine neue Entwicklung von Jugendvereinen annehmen (entgegen <strong>der</strong> Diagnose<br />
von Hunger 2005, S. 232). Auch eine Tagung in Loccum (15.-17.5.2009: Coole Muslime?<br />
Muslimische Jugend in Deutschland) sieht hier einen Trend und hat 2009 eine veritable Anzahl<br />
von in Migrantenselbstorganisationen engagierten Jugendlichen eingeladen 4 .<br />
Haupttätigkeitsbereich von Migrantenvereinen, repräsentative Auswahl von ca.<br />
1/3 <strong>der</strong> im Bundesauslän<strong>der</strong>vereinsregisters erfassten Vereine<br />
Haupttätigkeitsbereich Häufigkeit Prozent<br />
Brauchtumspflege 958 18,9<br />
Informationsveranstaltungen 621 12,2<br />
Gottesdienst/Religionsunterricht 599 11,8<br />
Sportveranstaltungen 565 11,1<br />
Freizeitgestaltung 406 8,0<br />
Interkulturelle Begegnung 296 5,8<br />
Hilfe für das Heimatland 272 5,4<br />
Interessenvertretung nach außen 215 4,2<br />
Beratungsdienste 205 4,0<br />
Öffentlichkeitsarbeit 185 3,6<br />
Soziale Hilfe 162 3,2<br />
Schülerhilfe 161 3,2<br />
Sprachkurse Muttersprache 144 2,8<br />
Infrastrukturelle Unterstützung 132 2,6<br />
Kontaktpflege und Vernetzung 105 2,1<br />
Sprachkurs Deutsch 34 0,7<br />
Keine Angabe möglich 14 0,3<br />
Gesamt 5.074 100<br />
Quelle: Hunger 2005, S. 233 (Tätigkeiten entsprechen Sozialer Arbeit, politische Partizipation,<br />
Hervorhebungen durch Autorin)<br />
4 Laut Tagungsprogramm: MJD; Life Makers, Bonn; Bündnis <strong>der</strong> Islamischen Gemeinden im Norden, Hamburg;<br />
Jugend und Mädchen, DITIB Köln; Milli Görüş; Inssan, Berlin; Islamischer Jugendbund, Hamburg; ufuq.de, Berlin;<br />
Freihafen, Hamburg.<br />
13
Jungk: Migrantenselbstorganisation: Formen, Aktivitäten, Potenziale und Wege des Empowerments<br />
________________________________________________________________________________<br />
Hunger hat diese Aktionsschwerpunkte <strong>der</strong> Vereine aus <strong>der</strong> Analyse <strong>der</strong> Satzungen ermittelt<br />
und sich dabei um die Identifikation eines Hauptschwerpunkts bemüht. Die Realität von<br />
Migrantenselbstorganisationen stellt sich gegenüber dieser Dokumentenanalyse vielschichtiger<br />
dar. Arbeit und Angebotsstruktur entwickeln sich entlang bestimmter Bedürfnisse und <strong>der</strong><br />
Möglichkeiten, sie durch in <strong>der</strong> Organisation vorhandene Fähigkeiten zu befriedigen. Aspekte<br />
<strong>der</strong> Kulturarbeit, <strong>der</strong> Begegnung und Bildung, <strong>der</strong> Beratung (Sozial- o<strong>der</strong> Rentenberatung)<br />
und Betreuung (von Schulkin<strong>der</strong>n, Müttern o<strong>der</strong> Senioren), gesundheitsbezogene Angebote<br />
und politische Aktivitäten stehen häufig nebeneinan<strong>der</strong> o<strong>der</strong> wechseln sich im Verlauf <strong>der</strong><br />
Zeit ab.<br />
Migrantenselbstorganisationen entwickeln Aktivitäten entlang <strong>der</strong> Bedürfnisse, Interessen<br />
und Fähigkeiten ihrer Mitglie<strong>der</strong> (zumeist) multifunktional und dynamisch im Verlauf des Prozesses<br />
<strong>der</strong> Einwan<strong>der</strong>ung und <strong>der</strong> gesellschaftlichen Entwicklung.<br />
2. Rolle und Funktion von Migrantenselbstorganisation<br />
Der schon klassische Begriff für die zentrale integrationspolitische Leistung von Migrantenselbstorganisationen<br />
lautet: „Integration durch Binnenintegration“ (Elwert 1982). Migrantenorganisationen<br />
tragen, und hier zitiere ich den Bericht <strong>der</strong> Enquete-Kommission <strong>der</strong> Bundesregierung<br />
zur Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements, „zur Bildung von sozialem<br />
Kapital bei, da soziale Kompetenzen trainiert, gesellschaftliche Bezüge für Min<strong>der</strong>heiteninteressen<br />
hergestellt und Aktivitäten mobilisiert werden, die für den individuellen Integrationsprozess<br />
för<strong>der</strong>lich sind“ (2002, S. 221). Mit an<strong>der</strong>en Worten: Durch Zusammenhalt und Unterstützung<br />
in <strong>der</strong> eigenen ethnischen Gruppe erhalten Zugewan<strong>der</strong>te erst jene Sicherheit<br />
und Orientierung, die es ihnen ermöglicht, sich gegenüber <strong>der</strong> Aufnahmegesellschaft zu öffnen.<br />
Das möchte ich mit Blick auf die Entwicklungsdynamik auf Seiten <strong>der</strong> Migrantinnen und<br />
Migranten beschreiben: Kettenmigration und ethnische Strukturen als typische Kennzeichen<br />
von Einwan<strong>der</strong>ungsgesellschaften führen zu Formen <strong>der</strong> Selbsthilfe, die in <strong>der</strong> Lebenswelt<br />
verankert sind. 5 In zunächst eher informellen Kreisen findet sich Rat in vielen unbekannten<br />
Lebenssituationen. Diese gegenseitige Hilfe ist durch psychologische und physische Nähe,<br />
durch Vertrautheit gekennzeichnet. Hier werden Sicherheit und Vertrauen erwartet und vermittelt.<br />
Die existenzielle Bedeutung von eigenethnischen Gruppen in allen Migrationsprozessen<br />
erklärt sich auch über ein Muster, das Leon und Rebeca Grinberg beschrieben haben,<br />
zwei Psychoanalytiker, die selber die Erfahrung des Exils gemacht haben. „Die Verwundbarkeit<br />
des Neuankömmlings ist wie die des Neugeborenen sehr groß“, so dass ein starkes<br />
„Bedürfnis nach einer vertrauten Figur, die die Ängste und Befürchtungen des Immigranten<br />
angesichts des Neuen und Unbekannten aufwiegt beziehungsweise neutralisiert“ (1990,<br />
S. 86f, zit. nach Matterei 2005, S. 186) entsteht. Es geht also um das Gefühl des Angenommenseins<br />
und Wohlbefindens, darum, keine Ausgrenzung und Gefühle <strong>der</strong> sozialen Scham<br />
zu erfahren, die lebensweltliche Selbsthilfe zu garantieren scheint. Zugleich aber, auch das<br />
soll nicht ausgeblendet werden, kompensieren Personen und zugängliche Strukturen <strong>der</strong><br />
eigenen Community die Unkenntnis über Strukturen <strong>der</strong> Aufnahmegesellschaft.<br />
Am Beispiel von Frauen in <strong>der</strong> Migration illustriert: Bei den lokalen Frauenorganisationen, die<br />
Latorre Pallares et al. (2006, S. 34 ff) untersuchten, liegen die Motive „Überwindung <strong>der</strong><br />
häuslichen Isolation“, Ausgrenzungserfahrungen im privaten wie institutionellen Umfeld und<br />
die positive Erfahrung, Frei-Räume und Frei-Zeit von familiären Kontexten mit an<strong>der</strong>en Frauen<br />
gestalten zu können, weit vorne. Die Bildungsarbeit reicht von niedrigschwelligen gesundheitlichen<br />
Aufklärungs- über Alphabetisierungs- bis zu berufsbezogenen Deutschkursen<br />
5 Vgl. auch die Unterscheidung zwischen lebensweltlich orientierten Vereinen, vor allem auf lokaler Ebene, und<br />
gesellschaftspolitischen Assoziationen, zumeist Dachverbände, die Rauer (2004, S. 212 f.) vornimmt.<br />
14
Jungk: Migrantenselbstorganisation: Formen, Aktivitäten, Potenziale und Wege des Empowerments<br />
________________________________________________________________________________<br />
und Elternbildungsangeboten. Selbstorganisationen von Migrantinnen, so die Autorinnen,<br />
bringen „durch Selfempowerment die Frauen dazu (…), Exklusionsmechanismen zu überwinden<br />
und somit mehrheitsgesellschaftliche Dominanzverhältnisse zu durchbrechen“ (ebd.,<br />
S. 44). Die „Vermittlung von Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein“ (ebd., S. 46) ist deshalb<br />
ein wichtiges Ziel, das offensichtlich beson<strong>der</strong>s gut gemeinsam mit ähnlich von <strong>der</strong><br />
Migrationssituation betroffenen Frauen erreicht werden kann.<br />
Schwenken 6 weist darauf hin, dass zwischen den aktiven Trägerinnen – vor allem Migrantinnen<br />
mit einem relativ gesicherten Aufenthaltstitel sowie Frauen, die schon vor <strong>der</strong> Migration<br />
in politische Kontexte eingebunden waren – und den Nutzerinnen zu unterscheiden ist 7 . Mittlerweile<br />
kennen wir auch genügend Frauen, die sich z. B. als Elternbegleiterinnen engagieren<br />
und keinerlei Berührungsängste mit Institutionen des Aufnahmelandes haben. Generell<br />
ist also eine sukzessive Partizipation an Strukturen <strong>der</strong> Aufnahmegesellschaft nicht ausgeschlossen,<br />
son<strong>der</strong>n Erfahrungen in Eigenorganisationen können sie beför<strong>der</strong>n – den migrationsunspezifischen<br />
Willen <strong>der</strong> Subjekte, sich überhaupt in „anonymere“ Organisationen zu<br />
begeben, vorausgesetzt.<br />
Zwischenresümee<br />
Als Stärken und Potenziale von Migrantenselbstorganisationen im Sinne <strong>der</strong> Sozialen Arbeit<br />
kann also festgehalten werden: Sie sind ein „Aktivposten“, Menschen sind freiwillig engagiert.<br />
Ihre Vereinigungen, gleich welchen Rechtsstatus sie haben, sind von lebensweltlicher<br />
Nähe, Ganzheitlichkeit und Niedrigschwelligkeit gekennzeichnet. Sie leben vom gegenseitigen<br />
Vertrauen, von <strong>der</strong> dichten Kommunikation in <strong>der</strong> community und sind dadurch zugänglich<br />
und bekannt. Muttersprachliche Kompetenz spielt dort eine weitere Rolle, wo Menschen<br />
die lingua franca Deutsch noch nicht (ausreichend) zur Verfügung steht. Migrantenselbstorganisationen<br />
sind deshalb auch längst in <strong>der</strong> sogenannten Mehrheitsgesellschaft als Brückenbauer<br />
und Vermittler anerkannt; sie verfügen über praktisches Know-how in für Zuwan<strong>der</strong>er<br />
existentiellen Fragen. Sie sind aber mehr als „Clearingstellen“ im Vorfeld <strong>der</strong> professionellen<br />
sozialen Dienste. Sie haben teilweise hohe Fachkompetenz und eine hohe<br />
Spezialisierung, z. B. in <strong>der</strong> psycho-sozialen Beratung und in <strong>der</strong> Flüchtlingsarbeit; Arbeitsfel<strong>der</strong>,<br />
in denen häufig gut ausgebildete Menschen mit Migrationshintergrund auch hauptamtlich<br />
tätig sind.<br />
Damit komme ich zu einer neueren Entwicklungsdynamik, <strong>der</strong>en Beginn ich in den 1980er<br />
Jahren sehe, die m. E. aber zunehmend kennzeichnend für Migrantenselbstorganisationen<br />
wird. Auf Seiten <strong>der</strong> Migrantinnen und Migranten geht <strong>der</strong> Wunsch nach Engagement,<br />
Selbsthilfe und (politischer) Eigenvertretung häufig Hand in Hand. Sie möchten eine eigene<br />
Organisation, eine gewisse Selbständigkeit erlangen. Damit verbindet sich <strong>der</strong> Wille nach<br />
eigener Gestaltung, eigenständiger Interessenpolitik und Lobbyarbeit, aber auch nach Schaffung<br />
eigener Arbeitsplätze, gerade auch bei gut, zumeist akademisch Qualifizierten, die keinen<br />
Zugang zum ersten Arbeitsmarkt erlangt haben. Und zwar durchaus in Verbindung mit<br />
dem Anspruch, eigene Methoden und Konzepte zu entwickeln.<br />
6 Die Erhebung von Schwenken (2000) stützt sich auf Analysen von Zeitschriften v. a. <strong>der</strong> Frauenbewegung, so<br />
dass davon ausgegangen werden kann, dass exponiertere, publizistisch tätige Organisationen („gesellschaftspolitische<br />
Assoziationen“), häufig mit feministischem Hintergrund erfasst wurden.<br />
7 Dies ist kein exklusives Merkmal von Migrantinnenorganisationen: In <strong>der</strong> Mikroanalyse eines türkischen Arbeitervereins<br />
zeigt Daniela Schmidt (2003), dass die Vereinsaktiven ein Selbstverständnis als politische Person<br />
auszeichnet. Diese aus dem Herkunftsland mitgebrachte biografische Prägung führt auch in Deutschland zum<br />
Engagement. Dabei liegt es nahe, sich für die eigene Gruppe einzusetzen, <strong>der</strong>en Probleme und Benachteiligungen<br />
offensichtlich sind.<br />
15
Jungk: Migrantenselbstorganisation: Formen, Aktivitäten, Potenziale und Wege des Empowerments<br />
________________________________________________________________________________<br />
Politisch ist auch das Anliegen, in selbstbestimmter Weise Bedarfe zu definieren, die von <strong>der</strong><br />
Mehrheitsgesellschaft nicht gesehen und befriedigt werden o<strong>der</strong> gegen Diskriminierung als<br />
eigener Anwalt tätig zu werden. Vereine <strong>der</strong> Migrantinnen und Migranten wirken hier als ethnische<br />
Öffentlichkeit, in <strong>der</strong> Meinungen gebildet werden – nicht zuletzt ist es diese demokratietheoretisch<br />
ausgewiesene Funktion, die die Teilnahme von Vereinen und Verbänden <strong>der</strong><br />
Min<strong>der</strong>heiten beim Integrationsgipfel und ähnlichen Diskussionsforen legitimiert.<br />
3. Bedingungen und Voraussetzungen für ein Empowerment von Migrantenorganisationen<br />
Die bisherige Analyse hat an einigen Punkten schon erkennen lassen, dass auch Barrieren<br />
<strong>der</strong> Aufnahmegesellschaft die Eigenaktivitäten von Migrantinnen und Migranten stimulieren.<br />
Die Entwicklungsdynamik ist historisch durchaus durch mangelnde Angebote <strong>der</strong> Aufnahmegesellschaft<br />
gekennzeichnet: Die bekanntlich zu späte und schwache Reaktion auf die Einwan<strong>der</strong>ungssituation,<br />
das fehlende Problembewusstsein, fehlende Konzepte und mangelhafte<br />
Zugänglichkeit von Lebenswelt, Gesellschaft, Organisationen und sozialen Dienstleistungen.<br />
Fehlende Anerkennung und Partizipationsmöglichkeiten sind auch heute noch zu<br />
beklagen; unter dem Stichwort interkulturelle Öffnung gibt es die Fülle <strong>der</strong> Defizite o<strong>der</strong>, positiv<br />
gesprochen, <strong>der</strong> Herausfor<strong>der</strong>ungen nachzulesen. Dazu gehört auch zwingend <strong>der</strong> Punkt:<br />
Kooperation mit Migrantenorganisation.<br />
Für mich ist eine <strong>der</strong> entscheidenden Bedingungen <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung von Migrantenorganisationen<br />
ihr offensiver Einbezug in die relevanten Strukturen <strong>der</strong> Information, Kooperation, des<br />
sozialräumlichen Netzwerkens – hingegen tue ich mich mit dem Begriff des „Empowerments“<br />
von Migrantenorganisationen schwer. Hier klingt erneut etwas Paternalistisches an: jemand,<br />
z. B. eine Ortsgruppe eines Wohlfahrtsverbands, „ermächtigt“ eine Migrantenorganisation.<br />
Empowerment ist aber Selbstermächtigung – und wie dies in den Organisationen geschieht,<br />
habe ich sowohl für die Nutzerinnen als auch unter dem Stichwort „neuere Entwicklungen“<br />
versucht deutlich zu machen.<br />
Wir haben relativ wenig Aussagen aus Migrantenorganisationen über ihre Erwartungen gegenüber<br />
<strong>der</strong> Aufnahmegesellschaft o<strong>der</strong> ihren Institutionen. Hier besteht weiterer Forschungsbedarf<br />
(das BAMF hat gerade eine Expertise zu Tandem-Kooperationsmodellen in<br />
Auftrag gegeben), aber auch in <strong>der</strong> Kooperationspraxis wird man mehr über die Notwendigkeiten<br />
zur Stärkung von Migrantenorganisationen erfahren.<br />
Aber einige Punkte sind bekannt (vgl. Freiwilligensurvey 2005, S. 401 f; Halm/Sauer 2005, S.<br />
169). Neben <strong>der</strong> For<strong>der</strong>ung nach direkter finanzieller För<strong>der</strong>ung werden wie<strong>der</strong>holt drei Aspekte<br />
genannt: <strong>der</strong> Wunsch nach Anerkennung ihrer Arbeit, nach Weiterbildungsmaßnahmen<br />
und fachlicher Unterstützung sowie nach Möglichkeiten <strong>der</strong> beruflichen Verwertung etwa<br />
durch Anerkennung des Engagements als Praktikum. Hier sind also Anfor<strong>der</strong>ungen benannt,<br />
denen Wohlfahrtsverbände versuchen könnten gerecht zu werden.<br />
Gemeinsame Projekte können zur Qualifizierung von Migrantenselbstorganisationen beitragen.<br />
Sie können z. B. die Potenziale im Sinne <strong>der</strong> Organisationsentwicklung stärken (Cakir/Jungk<br />
2004; Jungk 2005, 2006; MASGF 2007; Grünhage-Monetti 2006) o<strong>der</strong> einzelne<br />
Fachkompetenzen wie Bildungs- und Arbeitsmarktberatung (Pro Qualifizierung o. J.) för<strong>der</strong>n.<br />
Entscheidend ist darüber hinaus, dass Vernetzungen <strong>der</strong> Organisationen untereinan<strong>der</strong> und<br />
mit an<strong>der</strong>en migrations- und integrationspolitischen Akteuren ermöglicht werden. Eingebettet<br />
in einen Beziehungs- und Arbeitszusammenhang, erreichen relevante Informationen Migrantenselbstorganisationen<br />
besser, machen den Nutzen plausibel und reduzieren Schwellenängste.<br />
16
Jungk: Migrantenselbstorganisation: Formen, Aktivitäten, Potenziale und Wege des Empowerments<br />
________________________________________________________________________________<br />
4. Herausfor<strong>der</strong>ungen in <strong>der</strong> Kooperation zwischen Wohlfahrtsverbänden und<br />
Migrantenselbstorganisationen<br />
Nur kurz möchte ich die normativen Grundlagen skizzieren, die eine Kooperation von Wohlfahrtsverbänden<br />
und Migrantenorganisationen nahe legen:<br />
a) In zivilgesellschaftlicher und demokratietheoretischer Perspektive lassen sich Migrantenselbstorganisationen<br />
als Teil Sozialer Bewegungen, als Aktionsform „von unten“ interpretieren.<br />
Migrantenorganisationen sind Ausdruck <strong>der</strong> Pluralität von Bedürfnissen, Interessen und<br />
Zugehörigkeiten und ein legitimer Ausweis lebendiger, politisch-partizipativer Demokratie.<br />
„Im zivilgesellschaftlichen Kontext kommt gerade den kleinen Vereinigungen und Initiativen,<br />
die Raum für die plurale Identität des Einzelnen und gesellschaftliche Selbstorganisationsprozesse<br />
bieten, ein beson<strong>der</strong>er Stellenwert zu, da hier Solidarität als Steuerungsmechanismus<br />
aufgrund <strong>der</strong> vergleichsweise kleinen Gruppen am stärksten ausgeprägt ist“ (Priller/Zimmer<br />
2004, S.105).<br />
Selbstorganisation und Solidarität: Im Werteverständnis können Wohlfahrtsverbände nicht<br />
an<strong>der</strong>s, als zivilgesellschaftliche Strukturen zu begrüßen.<br />
b) Migrantenorganisationen, das habe ich im ersten Teil dargestellt, wirken im Sinne <strong>der</strong> sozialen<br />
Selbsthilfe.<br />
Empowerment ist in <strong>der</strong> Sozialen Arbeit ein zentrales Ziel: die Gewinnung von Kontrolle und<br />
die Ermöglichung <strong>der</strong> Gestaltung <strong>der</strong> eigenen Lebensumstände durch die Betroffenen selbst.<br />
Insofern müssen Wohlfahrtsverbände das Selbsthilfe-Engagement begrüßen und ausloten,<br />
in welchem Verhältnis sie dazu mit ihren professionellen o<strong>der</strong> auch ehrenamtlichen Aktivitäten<br />
stehen. Hier hieße die Aufgabe von Wohlfahrtsverbänden in <strong>der</strong> Positionsbestimmung:<br />
Erwächst uns eine Konkurrenz o<strong>der</strong> ein wertvoller Kooperationspartner? Das haben sie in<br />
<strong>der</strong> Vergangenheit getan und werden es prozessbezogen weiter fortsetzen. Es stellt sich<br />
also keine an<strong>der</strong>e Aufgabe in Bezug auf die Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen<br />
als in Bezug auf an<strong>der</strong>e Organisationen <strong>der</strong> Selbsthilfe auch.<br />
Für Wohlfahrtsverbände steht diese Positionsklärung zudem im Kontext mit verbands- und<br />
gesellschaftspolitischen, d.h. wohlfahrtsstaatlichen Fragen: Wo wird durch Stärkung von<br />
Bürgerengagement, Ehrenamt und Selbsthilfestrukturen in Migrantenorganisationen eine<br />
neoliberale Politik, <strong>der</strong> „schlanke Staat“ und die Deregulierung beför<strong>der</strong>t in einem Ausmaß,<br />
das sie nicht tragen wollen?<br />
Inwieweit es Vereinen und Netzwerken von Migrantinnen und Migranten gelingt, ihr soziales<br />
Kapital und ihr spezielles Know-how in Interaktionen mit <strong>der</strong> deutschen Umgebung einzusetzen,<br />
ist nicht nur von ihnen zu beeinflussen. Ob und in welchem Umfang sich die Brücken-<br />
Funktion <strong>der</strong> Eigenorganisationen realisieren kann o<strong>der</strong> wie durch Kooperation und Netzwerke<br />
die spezifischen Potenziale von Eigenorganisationen eingebunden werden können, hängt<br />
ebenso von <strong>der</strong> Bereitschaft <strong>der</strong> deutschen Institutionen ab, dieses Potenzial anzuerkennen<br />
und zu för<strong>der</strong>n.<br />
Für die Gestaltung einer Zuwan<strong>der</strong>ungsgesellschaft, die auf Partizipation und Aktivierung<br />
von Migrantinnen und Migranten setzt, ist die Anerkennung, För<strong>der</strong>ung und Kooperation mit<br />
ihren Eigenorganisationen unverzichtbar. Hier bündeln sich zivilgesellschaftliche und selbsthilfebezogene<br />
Ressourcen mit hohem Potenzial für gesamtgesellschaftliche Öffnungsprozesse.<br />
Hervorzuheben ist auch die Bedeutung <strong>der</strong> Organisationen für die Weiterentwicklung<br />
demokratischer Kultur und Gremien, sei es durch Mobilisierung für Auslän<strong>der</strong>beirats- o<strong>der</strong><br />
Integrationsratswahlen o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>e Formen <strong>der</strong> Interessensartikulation. Wie bereits dargestellt,<br />
sind die Potenziale von Migrantenselbstorganisationen in den letzten Jahren deutlich<br />
17
Jungk: Migrantenselbstorganisation: Formen, Aktivitäten, Potenziale und Wege des Empowerments<br />
________________________________________________________________________________<br />
gestiegen, ihre Arbeitsbereiche haben sich ständig erweitert und: Sie liegen vor allem im<br />
sozialen Bereich. Damit sind sie eigentlich gute Partner für Wohlfahrtsverbände und Kommunen.<br />
Ihre Potenziale können sich nur im Zusammenspiel mit Institutionen <strong>der</strong> Mehrheitsgesellschaft<br />
voll entfalten. Hier kann die Ausrichtung <strong>der</strong> bundesgeför<strong>der</strong>ten gemeinwesenorientierten<br />
Integrationsprojekte, die gefor<strong>der</strong>te Tandemkonstruktion, eine wichtige Rolle<br />
spielen.<br />
Trotzdem gestalten sich Kooperationen nicht leicht. Unterschiedliche Professionalitätsniveaus,<br />
aber auch ungeklärte Erwartungen o<strong>der</strong> Ziele stellen sich als Hin<strong>der</strong>nis heraus. So<br />
wird oft beklagt, dass Migrantenselbstorganisationen als Partner häufig zu schwach sind, um<br />
effektiv in bestimmten Projekten mitarbeiten zu können. Vor allem ehrenamtlich arbeitende<br />
Organisationen können manchmal die gestiegenen Anfor<strong>der</strong>ungen an die Qualität <strong>der</strong> Arbeit<br />
nicht erfüllen und verfügen nicht über die dafür nötigen Qualifikationen. Ihnen fehlen Zeit und<br />
Geld, aber auch Wissen und Fähigkeiten, sich in komplexe Planungen einzubringen. An<strong>der</strong>e<br />
bringen zwar hohe fachliche Kompetenz mit (gerade auch im psychosozialen Bereich), geraten<br />
aber an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit, wenn finanzielle Mittel für Infrastruktur und<br />
Personal fehlen.<br />
Man kann aber auch beobachten, dass viele Organisationen <strong>der</strong> so genannten Mehrheitsgesellschaft<br />
nicht wissen, wie sie die Beteiligung von Migrantenselbstorganisationen erreichen<br />
können. Hier fehlt es an Erfahrung und Know-how, auch, weil zu den Beschäftigten „deutscher“<br />
Organisationen kaum Migrantinnen und Migranten gehören. Das Informations- und<br />
Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e.V. (IDA e.V.; www.idaev.de) hat 2009 im<br />
Rahmen eines vom Bundesministerium des Innern (BMI) geför<strong>der</strong>ten Projekts VJM VZ (Verzeichnis<br />
von Vereinen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund) – gerade auch wegen<br />
<strong>der</strong> fehlenden Kenntnisse über Migrantenorganisationen im Sozialraum und um Kooperationen<br />
und Vernetzung zu för<strong>der</strong>n – rund 270 Vereine von Jugendlichen mit Migrationshintergrund<br />
recherchiert, die allen Interessierten als Online-Datenbank zur Verfügung stehen.<br />
Offene Ohren bei Kooperationspartnern vor Ort reichen nicht aus. Wenn es ernst gemeint ist<br />
mit <strong>der</strong> Partizipation von Migrantinnen und Migranten und ihren Organisationen, müssen<br />
ihnen Beteiligungen, z. B. an Bildungsveranstaltungen, Projekten und Finanzierungen, ermöglicht<br />
und angeboten werden. Auf diese Weise können sie auch „wachsen“, personell,<br />
bezogen auf die Infrastruktur und Qualifikationen. Die Auffor<strong>der</strong>ung zur gleichberechtigten<br />
Mitwirkung bleibt ein Lippenbekenntnis, wenn nicht <strong>der</strong> strukturelle Nachteil <strong>der</strong> Migrantenselbstorganisationen<br />
gesehen und Abhilfe geschaffen wird.<br />
Wohlfahrtsverbände können an positiven Traditionen anknüpfen und sollten diese in Hinblick<br />
auf die neuen Projektanfor<strong>der</strong>ungen überprüfen. Neu zu entwickeln sind:<br />
� neue Netzwerke, eine neue Systematik des Zugehens, <strong>der</strong> Identifikation von geeigneten<br />
Migrantenselbstorganisationen, z. B. auch in Hinblick auf passende Arbeitsschwerpunkte,<br />
Ziele und Adressaten, denn: Netzwerke bedürfen eines Anlasses, einer<br />
gemeinsamen Basisintention, eines erwartbaren, durch „Tausch“ realisierten<br />
Mehrwerts und eines Beziehungspotenzials (Jungk 1994);<br />
� ein neuer Blick auf Potenziale und (fachliche) Fähigkeiten und ein Abwägen, welche<br />
„Option auf die Zukunft“ eingegangen wird, sodass eine ggf. aktuell geringere Leistungskraft<br />
<strong>der</strong> Migrantenorganisationen aufgewogen wird;<br />
� eine neue Definition <strong>der</strong> Aufgaben- und Ressourcenverteilung, als grundsätzliche<br />
Selbstdefinition und in konkreten Projekten;<br />
� neue Formen <strong>der</strong> Aushandlung und Gestaltung von Arbeitsprozessen.<br />
18
Jungk: Migrantenselbstorganisation: Formen, Aktivitäten, Potenziale und Wege des Empowerments<br />
________________________________________________________________________________<br />
Perspektiven<br />
Ich halte den offensiven Dialog und die direkte wie indirekte För<strong>der</strong>ung von Migrantenselbstorganisationen<br />
für den besten und im demokratischen Gemeinwesen alternativlosen<br />
Weg, Ausschluss und (Selbst-)Separierung zu vermeiden. Denn: „Gesellschaftlicher Wandel<br />
kann am gründlichsten durchgesetzt werden, wenn er in sozialen Gemeinschaften verankert<br />
wird und Kommunikations-Ketten geschaffen werden, die eine weitgehende und umfassende<br />
Ausstrahlung haben“ (Thränhardt/Weiss 2005, S. 39). Je mehr das deutlich sichtbare Engagement<br />
gewürdigt wird – und durch Anerkennung illegitimes in legitimes soziales und symbolisches<br />
Kapital verwandelt wird (Bourdieu) – und die Vereine selbst in die vielfältigen Handlungsfel<strong>der</strong><br />
vor Ort produktiv einbezogen werden, desto mehr werden sich Brücken zwischen<br />
Min<strong>der</strong>heit und Mehrheit aufbauen.<br />
Literatur<br />
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) (2008): Auslän<strong>der</strong>zahlen 2007. Nürnberg<br />
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (Hg.) (2005): Freiwilliges<br />
Engagement in Deutschland 1999 – 2004. Ergebnisse <strong>der</strong> repräsentativen Tren<strong>der</strong>hebung<br />
zu Ehrenamt, Freiwilligenarbeit und bürgerschaftlichem Engagement. Vorgelegt von<br />
TNS Infratest Sozialforschung/Gensicke, Thomas/Picot, Sibylle/Geiss, Sabine. München.<br />
Internetpublikation: http://bmfsfj.de/bmfsfj/generator/RedaktionBMFSFJ/Arbeitsgruppen/Pdf-<br />
Anlagen/freiwilligen-survey-langfassung,property=pdf,bereich=,sprache=de,rwb=true.pdf<br />
(Abruf 20.02.2008)<br />
Cakir, Sedat/Jungk, Sabine (2004): SternStunden. Management-Handbuch für Zuwan<strong>der</strong>er-<br />
Vereine. Essen<br />
Enquete-Kommission „Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements“ des Deutschen Bundestags<br />
(2002): Bericht. Bürgerschaftliches Engagement: auf dem Weg in eine zukunftsfähige<br />
Bürgergesellschaft. Opladen<br />
Grünhage-Monetti, Matilde (Hg.) (2006): Interkulturelle Kompetenz in <strong>der</strong> Zuwan<strong>der</strong>ungsgesellschaft.<br />
Fortbildungskonzepte für kommunale Verwaltungen und Migrantenselbstorganisation.<br />
Bielefeld<br />
Halm, Dirk/Sauer, Martina (2004): Freiwilliges Engagement von Türkinnen und Türken in<br />
Deutschland. Projekt <strong>der</strong> Stiftung Zentrum für Türkeistudien im Auftrag des Bundesministeriums<br />
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Internetpublikation:<br />
http://www.bmfsfj.de/Publikationen/engagementstudie-zft/ (Abruf 12.06.2008)<br />
Hunger, Uwe (2004): Wie können Migrantenselbstorganisationen den Integrationsprozess<br />
betreuen? Wissenschaftliches Gutachten im Auftrag des Sachverständigenrates für Zuwan<strong>der</strong>ung<br />
und Integration des Bundesministeriums des Innern <strong>der</strong> Bundesrepublik Deutschland.<br />
Münster/Osnabrück. Internetpublikation:<br />
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Migration/Downloads/Expertisen/exp-hungerzuwan<strong>der</strong>ungsrat,templated=raw,property=publicationFile.pdf/exp-hungerzuwan<strong>der</strong>ungsrat.pdf<br />
(Abruf 14.06.2006)<br />
Hunger, Uwe (2005): Auslän<strong>der</strong>vereine in Deutschland. Eine Gesamterfassung auf <strong>der</strong> Basis<br />
des Bundesauslän<strong>der</strong>vereinsregisters. In: Weiss, Karin/Thränhardt, Dietrich (Hg.): SelbstHilfe.<br />
Wie Migranten Netzwerke knüpfen und soziales Kapital schaffen, Freiburg i. Br., S. 211-<br />
244.<br />
19
Jungk: Migrantenselbstorganisation: Formen, Aktivitäten, Potenziale und Wege des Empowerments<br />
________________________________________________________________________________<br />
Huth, Susanne (2004): Partizipation durch bürgerschaftliches Engagement in Migrantenselbstorganisationen,<br />
INBAS-Sozialforschung GmbH. Internetpublikation:<br />
http://www.inbas-sozialforschung.de/download/2004-02_huth_partizipation_engagement.pdf<br />
(Abruf 30.06.2006)<br />
Jungk, Sabine (1994): Kooperation und Vernetzung. Strukturwandel als Kompetenzanfor<strong>der</strong>ung.<br />
In: Hagedorn, Friedrich/Jungk, Sabine/Lohmann, Mechthild/Meyer, Heinz H. (Hg.): An<strong>der</strong>s<br />
arbeiten in Bildung und Kultur, Kooperation und Vernetzung als soziales Kapital. Weinheim<br />
und Basel, S. 61-76.<br />
Jungk, Sabine (2001): Soziale Selbsthilfe und politische Interessenvertretung in Organisationen<br />
von Migrantinnen und Migranten – Politische Rahmenbedingungen, Forschungslage,<br />
Weiterbildungsbedarf. In: Informationszentrum Sozialwissenschaften und Landeszentrum für<br />
Zuwan<strong>der</strong>ung NRW (Hg.): Migration und ethnische Min<strong>der</strong>heiten. Sozialwissenschaftlicher<br />
Fachinformationsdienst. Band 1, S. 7-15.<br />
Jungk, Sabine (2003): Politische und soziale Partizipation von Migrantinnen und Migranten<br />
und ihren Selbstorganisationen – Beiträge zu Mitwirkungsmöglichkeiten, Inanspruchnahme<br />
und Chancen in Deutschland. In: Navend – Zentrum für kurdische Studien e.V. (Hg.): Politische<br />
und soziale Partizipation von MigrantInnen. Navend-Schriftenreihe Band 12, Bonn, S.<br />
49-66.<br />
Jungk, Sabine (2005): Selbsthilfe-För<strong>der</strong>ung in Nordrhein-Westfalen. In: Weiss, Karin/Thränhardt,<br />
Dietrich (Hg.): SelbstHilfe. Wie Migranten Netzwerke knüpfen und soziales<br />
Kapital schaffen, Freiburg i. Br., S. 135-155.<br />
Jungk, Sabine (2006): Erfahrungen aus Fortbildungen für Migrantenselbstorganisation. In:<br />
Grünhage-Monetti, Matilde (Hg.): Interkulturelle Kompetenz in <strong>der</strong> Zuwan<strong>der</strong>ungsgesellschaft.<br />
Fortbildungskonzepte für kommunale Verwaltungen und Migrantenselbstorganisation.<br />
Bielefeld, 94-103.<br />
Kindelberger, Hala (2005): Selbsthilfe und Auslän<strong>der</strong>beiräte in den neuen Bundeslän<strong>der</strong>n, in:<br />
Weiss, Karin/Thränhardt, Dietrich (Hg.): SelbstHilfe. Wie Migranten Netzwerke knüpfen und<br />
soziales Kapital schaffen, Freiburg i. Br., S. 135-155.<br />
Klein, Ansgar/Kern, Kristine/Geißel, Brigitte/Berger, Maria (Hg.) (2004): Zivilgesellschaft und<br />
Sozialkapital. Herausfor<strong>der</strong>ungen politischer und sozialer Integration. Wiesbaden.<br />
Koopmans, Ruud/Statham, Paul (1998): Challenging the Liberal Nation-State? Postnationalism,<br />
Multiculturalism and the Collective Claims-Making of Migrants and Ethnic Minorities in<br />
Britain and Germany. Berlin.<br />
Krummacher, Michael (2004): Hohe Erwartungen nicht erfüllt. Bürgerbeteiligung und Aktivierung<br />
in <strong>der</strong> Programmumsetzung „Soziale Stadt“, in: Neue Praxis, November.<br />
Latorre Pallares, Patricia/Zitzelsberger, Olga (2006): Selbstorganisationen von Migrantinnen<br />
– ihre Bedeutung für die Partizipation in <strong>der</strong> Einwan<strong>der</strong>ungsgesellschaft. Abschlussbericht<br />
für das Ministerium Wissenschaft und Kunst. Darmstadt. Internetpublikation:<br />
http://www.frauennrw.de/docs/handbuch/Latorre-in-Handbuch-Demografischer-Wandel.pdf<br />
(Abruf 21.07.2008)<br />
20
Jungk: Migrantenselbstorganisation: Formen, Aktivitäten, Potenziale und Wege des Empowerments<br />
________________________________________________________________________________<br />
MASGF – Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie Brandenburg (2007): Das<br />
Projekt „KOMMIT“ – Kompetenzen von Migrantinnen und Migranten stärken. Internetpublikation:<br />
http://www.masgf.brandenburg.de/cms/detail.php?gsid=bb2.c.422163.de&_siteid=19<br />
(Abruf 30.06.2008)<br />
MASSKS – Ministerium für Arbeit, Soziales, Stadtentwicklung, Kultur und Sport NRW (Hg.)<br />
(1999): Selbstorganisationen von Migrantinnen und Migranten in NRW. Wissenschaftliche<br />
Bestandsaufnahme. Düsseldorf.<br />
Matterei, Norma (2005): Zwischen sozialer Kompensation und emanzipatorischer Perspektive:<br />
Selbsthilfe-För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Stadt München. In: Weiss, Karin/Thränhardt, Dietrich (Hg.):<br />
SelbstHilfe. Wie Migranten Netzwerke knüpfen und soziales Kapital schaffen, Freiburg i. Br.,<br />
S. 135-155.<br />
MGSFF – Ministerium für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie des Landes Nordrhein-<br />
Westfalen (Hg.) (2004): Zuwan<strong>der</strong>ung und Integration in Nordrhein-Westfalen. 3. Bericht <strong>der</strong><br />
Landesregierung. Düsseldorf.<br />
Pries, Ludger/Sezgin, Zeynep (Hg.) (2010): Jenseits von Identität und Integration – Grenzen<br />
überspannende Migrantenselbstorganisationen. Wiesbaden.<br />
Priller, Eckhardt/Zimmer, Annette (2004): Zwischen „Markt“ und „Mission“. In: Gosewinkel,<br />
Dieter/Rucht, Dieter/van den Daele, Wolfgang/Kocka, Jürgen (Hg.): Zivilgesellschaft – national<br />
und transnational. WZB-Jahrbuch 2003. Berlin, S. 105-127.<br />
Pro Qualifizierung – Teilprojekt Ostwestfalen-Lippe: Internetpublikation:<br />
http://www.proqua.de/publikation._aWQ9NDU0MA_.html (Abruf 15.09.2007)<br />
Puskeppeleit, Jürgen/Thränhardt, Dietrich (1990): Vom betreuten Auslän<strong>der</strong> zum gleichberechtigten<br />
Bürger. Perspektiven <strong>der</strong> Beratung und Sozialarbeit, <strong>der</strong> Selbsthilfe und <strong>der</strong> Artikulation<br />
und <strong>der</strong> Organisation und Integration <strong>der</strong> eingewan<strong>der</strong>ten Auslän<strong>der</strong> aus den Anwerbestaaten<br />
in <strong>der</strong> Bundesrepublik Deutschland. Freiburg.<br />
Schwenken, Helena (2004): Migrantinnenorganisationen: Zur Selbstorganisierung von<br />
Migrantinnen. In: Becker, Ruth/Kortendieck, Beate (Hg.): Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung.<br />
Theorie, Methoden, Empirie. Wiesbaden, 698-703.<br />
Sezgin, Zeynap/Tuncer-Zengingül, Tülay: Grenzüberschreitende Migrantenselbstorganisationen<br />
– Herausfor<strong>der</strong>ungen und Chancen im 21. Jahrhun<strong>der</strong>t, in: BBE-Newsletter 7/2009.<br />
Sinus Sociovision (2007): Die Milieus <strong>der</strong> Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland.<br />
Internetpublikation: http://www.sinus-sociovision.de (Abruf 12.02.2008)<br />
Stadt Pa<strong>der</strong>born (Hg.) (2007): Selbstorganisation und bürgerschaftliches Engagement von<br />
Migranten in <strong>der</strong> Stadt Pa<strong>der</strong>born. Eine empirische Studie zur Bildung von Sozialkapital. Pa<strong>der</strong>born.<br />
Internetpublikation: www.pa<strong>der</strong>born.de/integration (Abruf 12.09.2007)<br />
Thränhardt, Dietrich (2000): Einwan<strong>der</strong>erkulturen und soziales Kapital. Eine komparative<br />
Analyse. In: Thränhardt, Dietrich/Hunger, Uwe (Hg.): Einwan<strong>der</strong>er-Netzwerke und ihre Integrationsqualität<br />
in Deutschland und Israel. Münster, S. 15-52.<br />
Weiss, Karin/Thränhardt, Dietrich (Hg.) (2005): SelbstHilfe. Wie Migranten Netzwerke knüpfen<br />
und soziales Kapital schaffen. Freiburg.<br />
21
Martini: Migrantenselbstorganisationen – Herausfor<strong>der</strong>ungen für Politik und Zivilgesellschaft<br />
_________________________________________________________________________<br />
2.3 Migrantenselbstorganisationen – Herausfor<strong>der</strong>ungen für Politik und Zivilgesellschaft<br />
Dr. Claudia Martini, Arbeitsstab <strong>der</strong> Beauftragten <strong>der</strong> Bundesregierung für Migration,<br />
Flüchtlinge und Integration<br />
Migrantenorganisationen in <strong>der</strong> Auslän<strong>der</strong>- und Integrationspolitik<br />
In <strong>der</strong> Auslän<strong>der</strong>- und Integrationspolitik in Deutschland sind Migrantenselbstorganisationen<br />
o<strong>der</strong> Migrantenorganisationen, auch Auslän<strong>der</strong>-, herkunftsorientierte o<strong>der</strong> ethnische Vereine<br />
genannt, recht unterschiedlich wahrgenommen worden.<br />
Seit Beginn <strong>der</strong> Phase <strong>der</strong> Auslän<strong>der</strong>politik zur Zeit <strong>der</strong> Anwerbung ausländischer Arbeitnehmer<br />
müssen sich die sogenannten Auslän<strong>der</strong>vereine im Auslän<strong>der</strong>zentralregister registrieren<br />
lassen. 1 Dies betrifft bis heute alle Vereine, <strong>der</strong>en Leitung o<strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong> sämtlich<br />
o<strong>der</strong> überwiegend ausländische Staatsangehörige sind. Sie werden im Auslän<strong>der</strong>vereinsregister<br />
registriert (§ 14 Vereinsgesetz, Abs. 1). Seit <strong>der</strong> Än<strong>der</strong>ung des Vereinsgesetzes im<br />
Jahr 2001 werden ausschließlich Vereine von Drittstaatsangehörigen registriert. Die Gesamtzahl<br />
<strong>der</strong> registrierten ausländischen Vereine ist infolge dessen von 16.000 auf ca.<br />
13.000 ausländische Vereine zurückgegangen. 2 Gemäß Art. 9 Abs. 1 GG „haben alle Deutschen<br />
das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden.“ Ein Auslän<strong>der</strong>verein war und ist<br />
damit einem Nicht-Auslän<strong>der</strong>verein nicht gleichgestellt. Auslän<strong>der</strong>vereine wurden wegen<br />
ihrer tatsächlichen o<strong>der</strong> angenommenen Verbindungen zu den Herkunftslän<strong>der</strong>n oft als folkloristische<br />
Freizeitgruppe, als politische Stimme <strong>der</strong> Herkunftslän<strong>der</strong> o<strong>der</strong> als <strong>der</strong> Segregation<br />
för<strong>der</strong>lich betrachtet. Ihre bereits zu Beginn <strong>der</strong> Gastarbeiterzuwan<strong>der</strong>ung umfängliche<br />
Beratungsarbeit, die <strong>der</strong> Integration <strong>der</strong> Neuzuwan<strong>der</strong>er diente, wurde öffentlich kaum wahrgenommen.<br />
Ein deutlicher Entwicklungsschritt wurde mit dem Bericht <strong>der</strong> unabhängigen Kommission<br />
Zuwan<strong>der</strong>ung (2001) vollzogen. Der Bericht befasste sich mit <strong>der</strong> Frage, ob eigenethnische<br />
Vereine zur „Abkapselung“ von <strong>der</strong> Mehrheitsgesellschaft führten o<strong>der</strong> eine Voraussetzung<br />
für die gleichberechtigte Teilhabe seien. Die eigenethnischen Vereine wurden einerseits als<br />
Mittel zur Verbesserung <strong>der</strong> Lebenszufriedenheit und sozialen Anerkennung insbeson<strong>der</strong>e<br />
für Erstzuwan<strong>der</strong>er bewertet. Gleichzeitig wurde auf die Gefahr des Rückzugs durch diese<br />
Organisationsform hingewiesen. Dem Engagement von Zuwan<strong>der</strong>ern in deutschen Vereinen<br />
wurde ein hohes Integrationspotenzial zugeschrieben.<br />
Einen Schritt weiter ging <strong>der</strong> Sachverständigenrat Integration drei Jahre später (2004). Er<br />
maß Migrantenselbstorganisationen ein „hohes Integrationspotenzial“ zu. Dieses liege unter<br />
an<strong>der</strong>em in <strong>der</strong> Vermittlung integrationspolitischer Ziele und Strategien in die Eigengruppen<br />
hinein. Die Sachverständigen empfahlen daher: „Vertreter von Migrantenselbstorganisationen<br />
sowie <strong>der</strong> Auslän<strong>der</strong>beiräte sollten als Diskussions- und Gestaltungspartner kontinuierlich<br />
in den politischen Prozess eingebunden werden.“ Auch die Entwicklung von Migrantenorganisationen<br />
hin zu aufnahmelandbezogenen Interessengruppen von Migranten <strong>der</strong> zweiten<br />
und dritten Generation unterschiedlicher Herkunft wurde in <strong>der</strong> Kommission<br />
wahrgenommen.<br />
1<br />
Vgl. Jagusch, Birgit: Rechtliche Grundlagen für Auslän<strong>der</strong>vereine; Newsletter des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches<br />
Engagement, 22/2008.<br />
2<br />
Vgl. Hunger, Uwe: Auslän<strong>der</strong>vereine in Deutschland: Eine Gesamterfassung auf <strong>der</strong> Basis des Bundesauslän<strong>der</strong>vereinsregisters.<br />
In: Weiss, Karin/Thränhardt, Dietrich (Hg.): SelbstHilfe. Wie Migranten Netzwerke knüpfen<br />
und soziales Kapital schaffen, Freiburg i.Br. 2005, S. 221-244.<br />
22
Martini: Migrantenselbstorganisationen – Herausfor<strong>der</strong>ungen für Politik und Zivilgesellschaft<br />
_________________________________________________________________________<br />
Der erste Integrationsgipfel 2006 ließ <strong>der</strong> grundsätzlichen Anerkennung des Integrationspotentials<br />
von Migrantenorganisationen Taten folgen. Migrantenorganisationen wurden erstmals<br />
gleichberechtigt mit an<strong>der</strong>en zivilgesellschaftlichen Akteuren an <strong>der</strong> Weiterentwicklung<br />
<strong>der</strong> Integrationspolitik <strong>der</strong> Bundesregierung beteiligt. Län<strong>der</strong> und insbeson<strong>der</strong>e Kommunen<br />
hatten bereits langjährige Erfahrungen mit Auslän<strong>der</strong>- und Integrationsräten o<strong>der</strong> –beiräten.<br />
Für die Bundesregierung war die aktive Mitwirkung von Migrantenorganisationen bei <strong>der</strong><br />
Erstellung und Fortschreibung des Nationalen Integrationsplans eine neue und sehr gewinnbringende<br />
Erfahrung. Insgesamt rund 20 Migrantenorganisationen – meist bundesweit tätige<br />
Dachverbände - sowie knapp 10 Selbstorganisationen aus dem unternehmerischen Bereich<br />
nahmen an den integrationspolitischen Gremien wie den Integrationsgipfeln, regelmäßigen<br />
Dialogforen, auch zu konkreten Anliegen <strong>der</strong> Organisationen wie Einbürgerung, Anerkennung<br />
von Abschlüssen etc. teil. Erstmalig hat eine Gruppe überregionaler Migrantendachverbände<br />
eine Stellungnahme in einen Bericht <strong>der</strong> Bundesregierung eingebracht und sich mit<br />
umfangreichen Selbstverpflichtungen am Gelingen des Integrationsplans beteiligt. Die wichtige<br />
Rolle von Migrantenorganisationen im Integrationsprozess ist damit auf allen politischen<br />
Ebenen anerkannt. In <strong>der</strong> Folge hat die Nachfrage nach <strong>der</strong> Mitwirkung von Migrantenorganisationen<br />
in Beratungsgremien des Sports, <strong>der</strong> Kultur, des bürgerschaftlichen Engagements<br />
und vieler an<strong>der</strong>er gesellschaftlicher Bereiche stark zugenommen.<br />
Auch von Seiten <strong>der</strong> beteiligten Migrantenorganisationen wird ihre Beteiligung als Fortschritt<br />
bewertet. Ihre Rolle im Prozess des Nationalen Integrationsplans beschrieben sie folgen<strong>der</strong>maßen:<br />
„Ihre Meinung war gefragt und ihre speziellen Anliegen wurden aufgegriffen. Die<br />
Migrantenorganisationen partizipierten als gleichberechtigter und gleichwertiger Partner in<br />
den Gremien. Der Prozess des Dialogs funktionierte gut, verlangte allerdings einen sehr hohen<br />
Kosten- und Zeitaufwand für die Organisationen“ (1. Fortschrittsbericht zur <strong>Umsetzung</strong><br />
des Nationalen Integrationsplans S. 212)<br />
Migrantenorganisationen in <strong>der</strong> Praxis<br />
Dass Migrantenorganisationen in <strong>der</strong> Praxis von Beginn <strong>der</strong> Zuwan<strong>der</strong>ung an eine wichtige<br />
und zumeist integrative Rolle spielten, ist bereits erwähnt worden. Auslän<strong>der</strong>vereine, oft gemeinsam<br />
mit Wohlfahrtsverbänden, Gewerkschaften, Kirchen und an<strong>der</strong>en etablierten Organisationen,<br />
setzen sich für die Belange von Zuwan<strong>der</strong>ern ein, bieten Beratung und Unterstützung<br />
in allen Belangen <strong>der</strong> Zuwan<strong>der</strong>er an. Sie vertreten neben <strong>der</strong> praktischen Integrationsarbeit<br />
auch die gesellschafts-politischen Anliegen von Zuwan<strong>der</strong>ern. Dies hat sich in den<br />
Kommunen, also bei <strong>der</strong> Integration vor Ort, frühzeitig in Form von Kooperationen mit öffentlichen<br />
Stellen, Mitwirkung in Beiräten und Bereitstellung von För<strong>der</strong>mitteln für lokale Vereine<br />
nie<strong>der</strong>geschlagen.<br />
Vicente Riesgo vom Bundesverband <strong>der</strong> Spanischen Elternvereine beschreibt die Rolle von<br />
Migrantenorganisationen daher zutreffend als sowohl „prospektiv“ als auch „generativ“. Das<br />
heißt, sie greifen vielfach Themen und Probleme früher auf als Gesellschaft und Politik und<br />
sie tragen dazu bei, diese Themen zum Gegenstand gesellschaftlicher Auseinan<strong>der</strong>setzung<br />
und politischen Handelns zu machen. Die Integration <strong>der</strong> zugewan<strong>der</strong>ten Bevölkerung wäre<br />
in den ersten Jahrzehnten <strong>der</strong> Einwan<strong>der</strong>ung ohne Selbstvertretungen von Zuwan<strong>der</strong>ern und<br />
ohne <strong>der</strong>en Kooperationspartner denkbar schlechter verlaufen.<br />
Die Anzahl von Migrantenorganisationen in Deutschland ist unbekannt. Im Auslän<strong>der</strong>zentralregister<br />
werden unter den Vereinen mit überwiegend ausländischer Mitgliedschaft bzw. ausländischem<br />
Vorstand inzwischen nur diejenigen <strong>der</strong> Drittstaater festgehalten. 2001 waren<br />
dort 16.000 ausländische Vereine registriert. Eine Vollerhebung von Migrantenorganisationen<br />
in Nordrhein-Westfalen ermittelte über 2.200 Organisationen. In Anbetracht <strong>der</strong> Vielfalt<br />
23
Martini: Migrantenselbstorganisationen – Herausfor<strong>der</strong>ungen für Politik und Zivilgesellschaft<br />
_________________________________________________________________________<br />
hinsichtlich Größe, Ausrichtung, Aktivitätsgrad, Vernetzung mit an<strong>der</strong>en Organisationen etc.<br />
können Zahlenangaben nur sehr begrenzt Auskunft geben. Auf Bundesebene hat die<br />
Staatsministerin und Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration regelmäßig mit<br />
mindestens 20 Dachverbänden verschiedener Herkunftsgemeinden sowie herkunftsunabhängigen<br />
Dachverbänden zu tun. Auf Landesebene wie<strong>der</strong>um sind neben den Unterglie<strong>der</strong>ungen<br />
<strong>der</strong> bundesweiten Dachverbände auch regionale Organisationen aktiv. In den Kommunen<br />
gibt es große Unterschiede zwischen denjenigen mit sehr aktiven Migrantenorganisationen<br />
und Kommunen, in denen das Vereinsleben von Migranten praktisch nur auf dem Papier<br />
besteht. Hinzu kommt die große Zahl interkultureller Initiativen, in denen Migrantinnen<br />
und Migranten ebenfalls stark repräsentiert sind. In München beispielsweise wurden über<br />
100 interkulturelle Initiativen gezählt.<br />
Migrantenorganisationen werden zahlreiche Qualitäten zugeschrieben, die sie zu wichtigen<br />
Beteiligten bei <strong>der</strong> Integration machen. Sie gelten als Experten in eigener Sache, als Brücken<br />
in die Gemeinschaften <strong>der</strong> Zugewan<strong>der</strong>ten, als erster Ansprechpartner für Neuzuwan<strong>der</strong>er<br />
und auch als Katalysatoren für die interkulturelle Öffnung vorhandener Einrichtungen.<br />
Ihre Angebote gelten als passgenau und erreichen oft Gruppen, die von allgemeinen Integrations-<br />
und Beteiligungsangeboten nicht angesprochen werden. Für aktive Migrantinnen und<br />
Migranten stellt die Beteiligung ihrer Organisationen auch eine Anerkennung ihrer gesellschaftlichen<br />
und integrativen Leistungen dar. Nicht zuletzt transportieren Migrantenorganisationen<br />
gesellschaftliche und politische Themen aus <strong>der</strong> Mehrheitsgesellschaft in die Migrantengemeinschaften<br />
hinein und beteiligen diese damit an gesellschaftlichen Entwicklungen.<br />
Heutige und zukünftige Rolle von Migrantenorganisationen<br />
Betrachtet man Migrantenorganisationen aus <strong>der</strong> Sicht <strong>der</strong> Engagementforschung, müssen<br />
sie als Teil <strong>der</strong> deutschen Bürgergesellschaft beschrieben werden. Denn Engagement heißt,<br />
dass sich Personen zusammenschließen, die ein Interesse o<strong>der</strong> ein Anliegen teilen und dieses<br />
gemeinsam bearbeiten wollen. Damit ist auch die Grundlage für ihre gleichberechtigte<br />
Position in <strong>der</strong> gesellschaftlichen und politischen Mitwirkung gelegt. Dass dies einer Entwicklung<br />
vom sogenannten Auslän<strong>der</strong>verein zur Migrantenorganisation bedarf, ist oben bereits<br />
beschrieben worden.<br />
In einem Steuerungsmodell <strong>der</strong> politischen Integration von Migrantenorganisationen lässt<br />
sich diese Entwicklung in Form von acht Beteiligungsmustern von Migrantinnen bzw. Migranten<br />
und Migrantenorganisationen beschreiben 1 : Steuerungsobjekt – Infogeber – Bittsteller –<br />
Mithersteller – Berater – Anfor<strong>der</strong>er – Entschei<strong>der</strong> im eingeschränkten Wirkungskreis –<br />
gleichberechtigter Partner.<br />
Diese Beteiligungsformen können in verschiedenen Bereichen gleichzeitig existieren; sie<br />
können aber auch als Prozess gesehen werden. Im ersten Stadium als „Steuerungsobjekt“<br />
dominieren die staatlichen Akteure, sie entscheiden allein über die Verteilung öffentlicher<br />
Güter; als „Mithersteller“ sind Migrantenorganisationen in <strong>der</strong> Rolle, die von staatlicher Seite<br />
definierten Güter in ihren Gemeinschaften umzusetzen; dann geht die Entwicklung <strong>der</strong> Entscheidungsfindung<br />
weiter bis zur partnerschaftlichen Interaktion, bei <strong>der</strong> Migrantinnen und<br />
Migranten und ihre Organisationen eine fest definierte Entscheidungsmacht innehaben<br />
(„Machtteilung“). Das Modell bezieht sich auf freiwillige staatliche Leistungen, d.h. nicht auf<br />
Bereiche wie beispielsweise die Gesetzgebung, für die allein Parlamente und Regierungen<br />
verantwortlich sein können – beratende Kooperationsformen kommen hier selbstverständlich<br />
auch zum Tragen. Es beschreibt sehr treffend eine Entwicklung, die Migrantenorganisationen<br />
auch in Deutschland durchlaufen haben.<br />
1<br />
Dr. Scott Stock Gissendanner, Georg-August-Universität Göttingen: Ein Steuerungsmodell <strong>der</strong> politischen Integration<br />
von Migrantenorganisationen.<br />
24
Martini: Migrantenselbstorganisationen – Herausfor<strong>der</strong>ungen für Politik und Zivilgesellschaft<br />
_________________________________________________________________________<br />
Cemalettin Özer ermittelte in seiner Studie zu „Interkulturellen Dialogaktivitäten zwischen<br />
Migrantenselbstorganisationen und Organisationen <strong>der</strong> Mehrheitsbevölkerung in Ostwestfalen-Lippe“<br />
(2008) ähnliche Beteiligungsformen:<br />
� MSO als Informationsvermittler<br />
� MSO als Interessenvertreter<br />
� MSO als Expertengremium<br />
� MSO als Kooperationspartner<br />
� MSO als anerkannter Träger für Integrationsprojekte<br />
Im Allgemeinen vereinen Migrantenorganisationen mehrere <strong>der</strong> o. g. Muster in ihren Aktivitäten.<br />
Eine Entwicklung entsprechend <strong>der</strong> oben genannten Steuerungsmodelle ist auch bei Migrantenorganisationen<br />
auf Bundesebene in Deutschland nachvollziehbar. Sie stehen heute in <strong>der</strong><br />
zweiten Hälfte <strong>der</strong> Entwicklungslinie. Denn sie sind Mithersteller von Integration, z. B. als<br />
Projektträger; sie werden als Berater angefragt; sie sind in <strong>der</strong> Position, selbst Mittel und<br />
Dialog an- bzw. einzufor<strong>der</strong>n; sie entscheiden in einem eingeschränkten Wirkungskreis wie<br />
in Integrationsräten und an<strong>der</strong>en Gremien mit und sie sind in einigen Bereichen gleichberechtigte<br />
Partner in Beratungsgremien geworden wie zum Beispiel in Projekten zu Freiwilligendiensten,<br />
in <strong>der</strong> Erstellung und Weiterentwicklung des Nationalen Integrationsplans sowie<br />
des Integrationsprogramms. Die Position als gleichberechtigter Partner kann nur dann<br />
zufriedenstellend ausgefüllt werden, wenn gleiche Beteiligungsvoraussetzungen bestehen,<br />
d.h. auch Kenntnisse, Qualifikationen und Mittel vorhanden sind, um die eigenen Kompetenzen<br />
wirksam einzubringen. Die Migrantenorganisationen, die am Nationalen Integrationsplan<br />
mitgewirkt haben, formulieren dies folgen<strong>der</strong>maßen:<br />
„Eine staatliche Politik, die sich das teilhabe- und integrationsför<strong>der</strong>nde Potential <strong>der</strong> MSOs<br />
zu Nutze machen möchte, muss diesen Organisationen die Möglichkeit eröffnen, eine aktive<br />
Rolle in <strong>der</strong> Integrationspolitik ihrer neuen Wahlheimat zu spielen.“ 1<br />
Herausfor<strong>der</strong>ung für Politik und Zivilgesellschaft: Partnerschaftliche Beteiligung ermöglichen<br />
In <strong>der</strong> vergangenen Legislatur haben sich staatliche Stellen und zivilgesellschaftliche Organisationen<br />
mit <strong>der</strong> Frage befasst, wie Migrantenorganisationen ihre Rolle als bürgerschaftlicher<br />
Akteur und als Akteur in <strong>der</strong> Integrationspolitik stärken können. Zu nennen sind neben<br />
dem oben genannten Nationalen Integrationsplan und dem Ersten Fortschrittsbericht das<br />
vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge entwickelte Integrationsprogramm und die entsprechenden<br />
Maßnahmen zur För<strong>der</strong>ung von Migrantenorganisationen sowie Initiativen <strong>der</strong><br />
interkulturellen Öffnung von Freiwilligendiensten durch das Bundesministerium für Familie,<br />
Senioren, Frauen und Jugend. Im zivilgesellschaftlichen Bereich haben das Bundesnetzwerk<br />
bürgerschaftliches Engagement, die Stiftung Bürger für Bürger, Wohlfahrtsverbände und<br />
weitere Organisationen des bürgerschaftlichen und freiwilligen Engagements an <strong>der</strong> Formulierung<br />
von Grundlagen und <strong>der</strong> Erprobung von Praxismodellen mitgewirkt.<br />
1<br />
1. Fortschrittsbericht zur <strong>Umsetzung</strong> des Nationalen Integrationsplans, 2008: Stellungnahme <strong>der</strong> Migrantenorganisationen,<br />
S. 213.<br />
25
Martini: Migrantenselbstorganisationen – Herausfor<strong>der</strong>ungen für Politik und Zivilgesellschaft<br />
_________________________________________________________________________<br />
Die Vorschläge für die Stärkung und Professionalisierung von Migrantenorganisationen lassen<br />
sich in vier Punkten zusammenfassen:<br />
1. Ausbau <strong>der</strong> Infrastruktur: Bislang beruht das Engagement von Migrantenorganisationen<br />
im Vergleich zu nicht migrantischen Organisationen weitaus häufiger auf ehrenamtlichem<br />
Engagement. Es mangelt an hauptamtlichen Strukturen. Migrantenorganisationen<br />
benötigen aber ebenso wie nicht migrantische Organisationen eine hauptamtliche<br />
Infrastruktur, um sich zu qualifizieren, ihre Engagementfel<strong>der</strong> zu verbreitern<br />
und weitere ehrenamtlich Engagierte zu gewinnen.<br />
2. Einen Prozess <strong>der</strong> Qualifizierung einleiten: Qualifizierungsinitiativen sind auf verschiedenen<br />
Ebenen notwendig. Diese reichen von Fortbildungen für Vereinsgründung,<br />
Vereinsfinanzen und Pressearbeit bis hin zu langfristigen Qualifizierungsprozessen,<br />
zum Beispiel als Träger und Einsatzstelle im Bereich <strong>der</strong> Freiwilligendienste.<br />
3. Beteiligung an Netzwerken, Beiräten und Gremien: Die Beteiligung von Migrantenorganisationen<br />
an Diskursen und Entscheidungen zur Integrationspolitik im weiteren<br />
Sinne dient <strong>der</strong> fachlichen Qualifizierung und dem berechtigten Anliegen, Bevölkerungsgruppen<br />
mit Migrationshintergrund auch unabhängig von ihrem Wahlrecht an<br />
politischen Entscheidungen mitwirken zu lassen.<br />
4. Abbau von Barrieren durch interkulturelle Öffnung bestehen<strong>der</strong> Strukturen systematisch<br />
verfolgen: Bei <strong>der</strong> interkulturellen Öffnung von Maßnahmen wird zum Beispiel<br />
<strong>der</strong> Kreis <strong>der</strong> potentiellen Projektträger in den entsprechenden Richtlinien erweitert<br />
o<strong>der</strong> es werden gezielte Fortbildungen für Migrantenorganisationen angeboten. Ein<br />
vielerorts bewährtes Instrument ist die Tandempartnerschaft, die gleichberechtigte<br />
Partizipation und Qualifizierung vereint sowie ein Katalysator für die interkulturelle<br />
Öffnung in etablierten Einrichtungen ist.<br />
Im Koalitionsvertrag für die 17. Legislaturperiode hat die Bundesregierung festgelegt, den<br />
Dialog zwischen Staat und Gesellschaft, insbeson<strong>der</strong>e den Migrantinnen und Migranten, in<br />
institutionalisierter Form fortzusetzen und das bürgerschaftliche Engagement von Migrantinnen<br />
und Migranten weiter zu för<strong>der</strong>n und zu stärken, insbeson<strong>der</strong>e über den Ausbau <strong>der</strong><br />
Jugendfreiwilligendienste. Auch viele zivilgesellschaftlichen Organisationen werden ihre Kooperation<br />
mit Migrantenorganisationen erweitern. Migrantenorganisationen werden sich weiter<br />
qualifizieren und ihre Aktivitäten erweitern. Die Stimme von Migrantenorganisationen sowie<br />
ihre aktive und tragende Rolle bei <strong>der</strong> Integration werden an Bedeutung gewinnen.<br />
26
Bartels: Migrantenorganisationen in <strong>der</strong> Integrationsför<strong>der</strong>ung – Erfahrungen und Empfehlungen<br />
_________________________________________________________________________________<br />
2.4 Migrantenorganisationen in <strong>der</strong> Integrationsför<strong>der</strong>ung – Erfahrungen und Empfehlungen<br />
1<br />
Romy Bartels, Leiterin des Referats Grundsatzangelegenheiten in <strong>der</strong> Integrationsför<strong>der</strong>ung<br />
im BAMF<br />
Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
ich bedanke mich sehr für die Einladung zu diesem Expertenworkshop. Ich freue mich, dass<br />
<strong>der</strong> DCV das Thema Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen für so wichtig einstuft,<br />
dass ein eigenes Projekt eingerichtet wurde, um einen innerverbandlichen Diskussionsprozess<br />
zu diesem gesellschaftspolitisch bedeutsamen Thema anzustoßen. Gleichzeitig fühle<br />
ich mich geehrt, dass Sie das Bundesamt als Experten für dieses Thema ansehen und eingeladen<br />
haben, Ihnen einen Impuls für Ihren internen Konzeptions- und Orientierungsprozess<br />
geben zu dürfen.<br />
Zunächst möchte ich mich kurz vorstellen: Mein Name ist Romy Bartels, ich leite das Referat<br />
Grundsatzangelegenheiten <strong>der</strong> Integrationsför<strong>der</strong>ung im Bundesamt für Migration und<br />
Flüchtlinge in Nürnberg.<br />
Meinen Vortrag möchte ich wie folgt glie<strong>der</strong>n:<br />
I. Stellenwert <strong>der</strong> Migrantenorganisationen in <strong>der</strong> För<strong>der</strong>politik des Bundesamtes<br />
II. Vorschläge im Rahmen des Integrationsprogramms zur För<strong>der</strong>ung von Migrantenorganisationen<br />
III. För<strong>der</strong>ung von Migrantenorganisationen: Erfahrungen und Herausfor<strong>der</strong>ungen<br />
IV. Erste Erfahrungen aus den Modellprojekten zur verstärkten Partizipation von<br />
Migrantenorganisationen<br />
V. Empfehlungen an die Wohlfahrtsverbände.<br />
I. Kurze Einführung in die Integrationsför<strong>der</strong>ung des Bundesamtes und Stellenwert<br />
<strong>der</strong> Migrantenorganisationen in <strong>der</strong> För<strong>der</strong>politik des Bundesamtes<br />
Das Bundesamt ist seit 2003 neben den Themen Migration und Flüchtlingsschutz nunmehr<br />
auch für verschiedene Aufgaben im Bereich <strong>der</strong> Integration zuständig. Mit Inkrafttreten des<br />
Zuwan<strong>der</strong>ungsgesetzes am 1. Januar 2005 wurde eine systematische Integrationspolitik mit<br />
einem bundesweit einheitlichen Erstför<strong>der</strong>angebot für Neuzuwan<strong>der</strong>er eingeführt. Dazu zählen<br />
insbeson<strong>der</strong>e die Steuerung und Koordinierung <strong>der</strong> Integrationskurse und <strong>der</strong> Migrationsberatung<br />
für erwachsene Zuwan<strong>der</strong>er. Ergänzt werden diese beiden Integrationsangebote<br />
durch Projekte zur sozialen und gesellschaftlichen Einglie<strong>der</strong>ung von Zuwan<strong>der</strong>innen und<br />
Zuwan<strong>der</strong>ern.<br />
Integration ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, zu <strong>der</strong>en Erfolg <strong>der</strong> Staat auf verschiedenen<br />
Ebenen beiträgt. Ziel <strong>der</strong> Integrationsför<strong>der</strong>ung sind das friedliche Miteinan<strong>der</strong> von<br />
Migranten und Einheimischen und die Stärkung des sozialen Zusammenhalts in <strong>der</strong> Gesellschaft.<br />
In Deutschland leben <strong>der</strong>zeit 15,6 Mio. Menschen mit Migrationshintergrund, dies<br />
sind etwa 19 % <strong>der</strong> Gesamtbevölkerung. Durch den demographischen Wandel ist in den<br />
kommenden Jahren mit einem weiteren Anstieg dieser Quote zu rechnen. Diese Menschen<br />
sollen alle Chancen auf eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen<br />
und politischen Zusammenleben unter Respektierung gesellschaftlicher Vielfalt haben. Die<br />
kulturelle Vielfalt anzuerkennen, Vielfalt als Chance zu begreifen und gleichzeitig den Zu-<br />
1<br />
Romy Bartels konnte aus Krankheitsgründen nicht an <strong>der</strong> Veranstaltung teilnehmen, hat aber ihren Vortrag für<br />
die Dokumentation zur Verfügung gestellt.<br />
27
Bartels: Migrantenorganisationen in <strong>der</strong> Integrationsför<strong>der</strong>ung – Erfahrungen und Empfehlungen<br />
_________________________________________________________________________________<br />
sammenhalt <strong>der</strong> Gesellschaft zu sichern, ist eine herausragende Aufgabe für Politik und Gesellschaft.<br />
Die Integration neu zugewan<strong>der</strong>ter wie auch <strong>der</strong> zum Teil bereits länger hier leben<strong>der</strong> Menschen<br />
mit Migrationshintergrund ist eine langfristige Herausfor<strong>der</strong>ung und Aufgabe für Staat<br />
und Gesellschaft. Für ein gutes Miteinan<strong>der</strong> ist ein gemeinsamer Gestaltungswillen und die<br />
Bereitschaft aller, für die Gesellschaft Verantwortung zu übernehmen, notwendig.<br />
Migrantenorganisationen sind Foren <strong>der</strong> Selbstorganisation und gesellschaftlichen Beteiligung.<br />
Sie können als Teil <strong>der</strong> Zivilgesellschaft einen wichtigen Beitrag zur Integration leisten.<br />
Migrantenorganisationen engagieren sich in vielfältiger Weise und zwar hauptsächlich ehrenamtlich<br />
für die För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Integration: in Migrantenorganisationen werden Menschen<br />
mit Migrationshintergrund aktiv und können ihre Kompetenzen einbringen. Sie kennen die<br />
Bedarfe von Menschen mit Migrationshintergrund und schließen mit ihren Angeboten häufig<br />
Lücken in <strong>der</strong> Integrationsarbeit. Sie haben meist einen guten Zugang zu Gruppen, die von<br />
an<strong>der</strong>en Integrationsangeboten schlechter erreicht werden.<br />
Es hat sich ein Perspektivwechsel im Umgang mit Migrantenorganisationen vollzogen. Früher<br />
wurden Migranten beraten und betreut und waren nur Zielgruppe von Integrationsmaßnahmen.<br />
Heutzutage möchten sich Migranten verstärkt organisieren und auch selbst Integrationsmaßnahmen<br />
für Migranten durchführen. Sie sind damit nicht nur Empfänger, son<strong>der</strong>n<br />
auch Gestalter von Integrationsangeboten. Der Handlungsansatz in <strong>der</strong> Integrationsför<strong>der</strong>ung<br />
richtet sich damit stärker auf den Gesichtspunkt <strong>der</strong> gesellschaftlichen Teilhabe. Übergeordnetes<br />
Ziel ist die gleichberechtigte Teilhabe von Migranten und ihren Organisationen in<br />
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.<br />
Dem entsprechend wird die Rolle von Migrantenorganisationen heute an<strong>der</strong>s wahrgenommen,<br />
nämlich stärker als Brückenbauer und unverzichtbare Akteure in <strong>der</strong> Integrationsarbeit<br />
vor Ort. Sie werden zunehmend als Experten für eine bedarfsgerechte Ausrichtung <strong>der</strong> Integrationspolitik<br />
und -för<strong>der</strong>ung wahrgenommen und mit einbezogen. Die aktive Mitgestaltung<br />
<strong>der</strong> Integrationsarbeit durch Migrantenorganisationen führt damit zu einem Mehrwert für unsere<br />
Gesellschaft.<br />
Wen meinen wir, wenn wir von Migrantenorganisationen sprechen?<br />
In Deutschland gibt es eine große Vielfalt von Organisationen, in denen sich Menschen mit<br />
Migrationshintergrund zusammenschließen. „Die“ Migrantenorganisation gibt es ebenso wenig<br />
wie „die“ Migrantin o<strong>der</strong> „den“ Migranten. Zu beachten ist, dass mit Blick auf Aufgaben<br />
und Ziele, Zusammensetzung <strong>der</strong> Vereinsmitglie<strong>der</strong> und Organisationsgrad starke Unterschiede<br />
zwischen den Organisationen auffallen, es gibt kulturelle, religiöse und politische<br />
Vereine, die nur eine Zuwan<strong>der</strong>ergruppe repräsentieren o<strong>der</strong> aber interkulturell zusammengesetzt<br />
sind, Migrantinnen- und Vertriebenenorganisationen, Bildungsträger (wie die AEF).<br />
Neben unzähligen kleineren lokal agierenden Migrantenorganisationen, die nur zum Teil in<br />
einem Wohlfahrtsverband organisiert sind (dem DPWV) gibt es eine kleine Zahl an bundesweit<br />
agierenden Dachverbänden (z. B. TGD, Alevitische Gemeinde in Deutschland).<br />
Die im Rahmen des bundesweiten Integrationsprogramms entwickelten Empfehlungen richten<br />
sich an Organisationen, die überwiegend von Zugewan<strong>der</strong>ten gegründet wurden, <strong>der</strong>en<br />
Mitglie<strong>der</strong> überwiegend Migranten sind und die sich nachweislich in <strong>der</strong> Integrationsarbeit<br />
engagieren und nach außen in die Gesellschaft wirken.<br />
28
Bartels: Migrantenorganisationen in <strong>der</strong> Integrationsför<strong>der</strong>ung – Erfahrungen und Empfehlungen<br />
_________________________________________________________________________________<br />
II. Vorschläge im Rahmen des Integrationsprogramms zur För<strong>der</strong>ung von Migrantenorganisationen<br />
Die Entwicklung des bundesweiten Integrationsprogramms ist ein Auftrag aus § 45 AufenthG<br />
und als langfristiger Prozess <strong>der</strong> Qualitätsentwicklung <strong>der</strong> Integrationsför<strong>der</strong>ung angelegt.<br />
Dieser Auftrag wurde dem BAMF vom Bundesministerium des Innern übertragen. Der Auftrag<br />
besteht darin, die bestehenden Integrationsangebote von Bund, Län<strong>der</strong>n, Kommunen<br />
und privaten Trägern festzustellen und Empfehlungen zur Weiterentwicklung vorzulegen.<br />
U.a. sollen gemeinsame Ziele für die Integrationsför<strong>der</strong>ung in verschiedenen Bereichen entwickelt<br />
werden. Im Rahmen des bundesweiten Integrationsprogramms sollen ganz konkrete,<br />
praxisbezogene Vorschläge zur Verbesserung <strong>der</strong> Integration entwickelt werden.<br />
Was haben wir getan? – Situationsanalyse<br />
Im Austausch mit Experten aus Politik, Verwaltung, Praxis <strong>der</strong> Integrationsför<strong>der</strong>ung und<br />
Wissenschaft wurden unter <strong>der</strong> Fe<strong>der</strong>führung des BAMF die drängenden Handlungsbedarfe<br />
in den Handlungsfel<strong>der</strong>n sprachliche Integration, Bildung und Integration, berufliche Integration<br />
und gesellschaftliche Integration ermittelt und konkrete Empfehlungen und Strategien<br />
entwickelt.<br />
Als Ergebnis wurden praxisbezogene Vorschläge zu konkreten Fragestellungen erarbeitet.<br />
Die Empfehlungen betreffen nicht nur das BAMF, son<strong>der</strong>n richten sich an Bund, Län<strong>der</strong>,<br />
Kommunen, Verbände, freie Träger, Migrantenorganisationen, Forschungseinrichtungen und<br />
viele an<strong>der</strong>e Akteure.<br />
Ein Schwerpunktthema im bundesweiten Integrationsprogramm im Handlungsfeld gesellschaftliche<br />
Integration ist die Stärkung von Migrantenorganisationen als Akteure <strong>der</strong> Integrationsför<strong>der</strong>ung.<br />
Bei <strong>der</strong> Entwicklung <strong>der</strong> Empfehlungen wurden viele Vertreter <strong>der</strong> Migrantenorganisationen<br />
eingebunden und Erfahrungen einiger Län<strong>der</strong> und Kommunen einbezogen.<br />
In diesem Zusammenhang sind zwei Aspekte beson<strong>der</strong>s wichtig:<br />
1. Zum einen ist die Integration von Zuwan<strong>der</strong>ern im Sinn <strong>der</strong> Schaffung gleicher Teilhabechancen<br />
an Bildung – Arbeit – gesellschaftlicher Mitgestaltung eine Aufgabe des<br />
Staates und <strong>der</strong> Gesellschaft. Migrantenorganisationen können diese Aufgabe unterstützen,<br />
aber nicht übernehmen.<br />
2. Migrantenorganisationen sind bei aller Vielfalt überwiegend ehrenamtlich organisiert.<br />
Integrationsför<strong>der</strong>ndes, bürgerschaftliches Engagement von Migrantenorganisationen<br />
und an<strong>der</strong>en Gruppen leistet einen wichtigen Beitrag für ein gelingendes Zusammenleben<br />
von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Es kann und soll aber professionelle<br />
Sozialarbeit nicht ersetzen. Vielmehr geht es um die Nutzung und För<strong>der</strong>ung<br />
komplementärer Strukturen und Kompetenzen.<br />
Empfehlungen des bundesweiten Integrationsprogramms<br />
Derzeit gibt es keine systematische und gleichberechtigte Einbeziehung und Nutzung <strong>der</strong><br />
vielfältigen Kompetenzen <strong>der</strong> Migrantenorganisationen in die Gestaltung <strong>der</strong> Integrationsarbeit.<br />
Eine systematische För<strong>der</strong>ung von Migrantenorganisationen als Akteure und insbeson<strong>der</strong>e<br />
Träger <strong>der</strong> Integrationsför<strong>der</strong>ung geschieht bisher nur punktuell.<br />
Einzelne Län<strong>der</strong> (bspw. Nordrhein-Westfalen, Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt) haben<br />
För<strong>der</strong>programme gezielt zur Unterstützung von Migrantenorganisationen und zur För<strong>der</strong>ung<br />
<strong>der</strong> Zusammenarbeit zwischen etablierten Trägern (wie den Wohlfahrtsverbänden) und<br />
29
Bartels: Migrantenorganisationen in <strong>der</strong> Integrationsför<strong>der</strong>ung – Erfahrungen und Empfehlungen<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Migrantenorganisationen mit ersten guten Kooperationsbeispielen. Darauf muss jetzt aufgebaut<br />
werden.<br />
Rahmenbedingungen vieler Migrantenorganisationen<br />
Da Migrantenorganisationen hauptsächlich ehrenamtlich Integrationsarbeit leisten, stoßen<br />
sie oft an ihre Grenzen, sie sind meist kaum über Netzwerke und För<strong>der</strong>möglichkeiten informiert.<br />
Insbeson<strong>der</strong>e darf man Migrantenorganisationen nicht überfor<strong>der</strong>n o<strong>der</strong> erwarten,<br />
dass sie genauso leistungsfähig sind wie bspw. die vergleichsweise großen Wohlfahrtsverbände.<br />
Man muss sich die schwierigen Rahmenbedingungen vieler Migrantenorganisationen<br />
vor Augen halten:<br />
� Die meisten Migrantenorganisationen sind ehrenamtlich engagiert und verfügen nicht<br />
o<strong>der</strong> kaum über hauptamtliche Strukturen.<br />
� Kleinere, rein ehrenamtlich arbeitende Migrantenorganisationen verfügen nicht über<br />
die Personalressourcen, längerfristig in Netzwerken mitzuarbeiten, während <strong>der</strong> regulären<br />
Arbeitszeit an Sitzungen und Besprechungen teilzunehmen o<strong>der</strong> sich an <strong>der</strong><br />
Erarbeitung von kommunalen Integrationskonzepten zu beteiligen.<br />
� Ehrenamtlich Engagierte sind meist keine ausgebildeten Sozialarbeiter, ehrenamtliche<br />
Arbeit soll und kann professionelle Sozialarbeit nicht ersetzen.<br />
� Häufig fehlen Erfahrungen und spezifische Fachkenntnisse in Vereinsführung und<br />
Vereinsrecht sowie Projektmanagement und Öffentlichkeitsarbeit.<br />
Die Empfehlungen des Integrationsprogramms sollen konkrete Vorschläge unterbreiten, wie<br />
dies verän<strong>der</strong>t werden kann. Dabei hat sich unser Blick beson<strong>der</strong>s auf folgende vier Bereiche<br />
gerichtet:<br />
� Auf- und Ausbau tragfähiger Strukturen für die Integrationsarbeit von Migrantenorganisationen,<br />
� Ausbau <strong>der</strong> Weiterbildungsangebote,<br />
� För<strong>der</strong>ung des bürgerschaftlichen Engagement in und durch Migrantenorganisationen,<br />
� positive Effekte <strong>der</strong> interkulturellen Öffnung <strong>der</strong> Gesellschaft für Migrantenorganisationen.<br />
In verschiedenen Gesprächen mit Vertretern von Migrantenorganisationen, Verbänden, Län<strong>der</strong>n,<br />
Kommunen, Einrichtungen und Forschung wurden die Ist-Situation, Handlungsbedarfe<br />
und För<strong>der</strong>modelle diskutiert. Es wurden umfangreiche Empfehlungen und praxisorientierte<br />
<strong>Umsetzung</strong>shinweise zusammengestellt. Dabei wurden konkrete Schritte vorgeschlagen, um<br />
die Arbeit <strong>der</strong> Migrantenorganisationen zu unterstützen, ihnen ein langfristiges Engagement<br />
in <strong>der</strong> Integrationsför<strong>der</strong>ung zu ermöglichen und damit auch ihre Kompetenzen und Ressourcen<br />
gezielt zu nutzen.<br />
Einige <strong>der</strong> Ideen, die in den Empfehlungen ausgeführt werden:<br />
Strukturaufbau <strong>der</strong> Migrantenorganisationen<br />
Diskutiert wurden Möglichkeiten, um die Partizipation von Migrantenorganisationen an För<strong>der</strong>strukturen<br />
zu erleichtern. Dabei müssen die unterschiedlichen Unterstützungsbedarfe<br />
gesehen werden: Viele ehrenamtlich aufgestellte Migrantenorganisationen benötigen zuvör<strong>der</strong>st<br />
eine Grundausstattungsför<strong>der</strong>ung (bspw. Geschäftsräume, technische Ausstattung wie<br />
PC, Schreibtisch). Daneben benötigen Migrantenorganisationen auch eine infrastrukturelle<br />
För<strong>der</strong>ung (z. B. eine minimale Regelfinanzierung von Personal- und Sachkosten).<br />
30
Bartels: Migrantenorganisationen in <strong>der</strong> Integrationsför<strong>der</strong>ung – Erfahrungen und Empfehlungen<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Im Fokus war darüber hinaus die Frage, wie die Beteiligung von Migrantenorganisationen an<br />
<strong>der</strong> Projektför<strong>der</strong>ung gestärkt werden kann. Diskutiert wurden dabei z. B. Lösungen für den<br />
vom Zuwendungsgeber meist gefor<strong>der</strong>ten Eigenmittelanteil: z. B. durch Anrechnung ehrenamtlicher<br />
Arbeit auf den finanziellen Eigenanteil <strong>der</strong> Migrantenorganisationen. Hinterfragt<br />
wurde beispielsweise auch, ob auf die von einigen För<strong>der</strong>programmen gefor<strong>der</strong>te bundesweite<br />
Tätigkeit des Antragstellers verzichtet werden kann, damit auch lokal agierende<br />
Migrantenorganisationen (bzw. grundsätzlich kleine lokale Organisationen) in den Genuss<br />
einer För<strong>der</strong>ung gelangen können.<br />
Ausbau <strong>der</strong> Weiterbildungsangebote<br />
Ein weiteres wichtiges Thema war die Frage nach einem Ausbau <strong>der</strong> Weiterbildungsmaßnahmen<br />
für Migrantenorganisationen. Aus Sicht <strong>der</strong> beteiligten Experten sind folgende Aspekte<br />
in diesem Zusammenhang beson<strong>der</strong>s wichtig:<br />
� Entwicklung von Qualifizierungs-/Weiterbildungsangeboten für Migrantenorganisationen;<br />
� das Beratungsangebot für Migrantenorganisationen sollte ausgedehnt werden;<br />
� Informationsfluss über För<strong>der</strong>mittel verbessern;<br />
� Kooperation zwischen etablierten Trägern <strong>der</strong> Integrationsför<strong>der</strong>ung, z. B. Wohlfahrtsverbänden<br />
o<strong>der</strong> Einrichtungen <strong>der</strong> Engagementför<strong>der</strong>ung und Migrantenorganisationen;<br />
� stärkere Vernetzung zwischen etablierten Trägern und Migrantenorganisationen;<br />
� Einbeziehung von Migrantenorganisationen in die bestehenden Integrationsnetzwerke<br />
vor Ort und in die Entwicklung von Integrationskonzepten.<br />
Interkulturelle Öffnung<br />
Angesprochen wurden auch Möglichkeiten, die bereits bestehenden Aktivitäten zur interkulturellen<br />
Öffnung auf Seiten <strong>der</strong> Verwaltung, bei bestehenden Einrichtungen und Angebote zu<br />
stärken und eine engere Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen hierbei zu unterstützen.<br />
Eine partnerschaftliche und mitgestaltende Kooperation zwischen Migrantenorganisationen<br />
und öffentlichen und privaten Einrichtungen und Verbänden (z. B. Wohlfahrtsverbände,<br />
Bildungsträger) kann <strong>der</strong>en interkulturelle Öffnung nachhaltig stärken.<br />
Ausblick<br />
Die Empfehlungen des bundesweiten Integrationsprogramms sollen mit den zuständigen<br />
Ressorts abgestimmt und im Anschluss veröffentlicht werden. Einzelne Themen werden<br />
dann weiter vertieft und <strong>Umsetzung</strong>sprozesse angestoßen, z. B. in Form von Modellprojekten.<br />
Das Integrationsprogramm zeigt sich damit als Prozess und nicht nur als eine Publikation.<br />
31
Bartels: Migrantenorganisationen in <strong>der</strong> Integrationsför<strong>der</strong>ung – Erfahrungen und Empfehlungen<br />
_________________________________________________________________________________<br />
III. För<strong>der</strong>ung von Migrantenorganisationen: Erfahrungen und Herausfor<strong>der</strong>ungen<br />
Das Bundesamt för<strong>der</strong>t flankierend zu den gesetzlichen Integrationsangeboten Projekte zur<br />
sozialen und gesellschaftlichen Einglie<strong>der</strong>ung von jugendlichen und erwachsenen Zuwan<strong>der</strong>ern<br />
mit dauerhafter Bleibeperspektive.<br />
Gemeinsame För<strong>der</strong>richtlinien von BMI und BMFSFJ<br />
Grundlage sind die am 1. März 2010 in Kraft getretenen För<strong>der</strong>richtlinien für Maßnahmen zur<br />
gesellschaftlichen und sozialen Integration von Zuwan<strong>der</strong>ern. För<strong>der</strong>fähig sind sowohl Maßnahmen<br />
zur sozialen und gesellschaftlichen Integration von Neuzuwan<strong>der</strong>ern als auch Maßnahmen<br />
<strong>der</strong> nachholenden Integration. Die Mitwirkung von Migrantenorganisationen wird<br />
in den neuen För<strong>der</strong>richtlinien erstmals ausdrücklich hervorgehoben.<br />
Ziele <strong>der</strong> Projektför<strong>der</strong>ung sind<br />
� Stärkung <strong>der</strong> Kompetenzen <strong>der</strong> Zuwan<strong>der</strong>er (insbeson<strong>der</strong>e soziale Kompetenzen und<br />
Erziehungskompetenz <strong>der</strong> Eltern);<br />
� Verbesserung <strong>der</strong> gesellschaftlichen Teilhabe <strong>der</strong> Zuwan<strong>der</strong>er (z. B. durch Stärkung<br />
des bürgerschaftlichen Engagements und gleichberechtigte Teilhabe von Mädchen<br />
und Frauen mit Migrationshintergrund);<br />
� För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> gegenseitigen Akzeptanz von Zuwan<strong>der</strong>ern und Einheimischen (und<br />
damit eine Verbesserung des Zusammenlebens vor Ort);<br />
� Stärkung <strong>der</strong> Teilhabe von Migrantenorganisationen.<br />
Die Projektför<strong>der</strong>ung konzentriert sich auf innovative, gemeinwesen- und ressourcenorientierte<br />
Integrationsmaßnahmen, in denen an die mitgebrachten Talente, Kompetenzen und<br />
Qualifikationen <strong>der</strong> jugendlichen Zuwan<strong>der</strong>er angeknüpft wird, um <strong>der</strong>en Selbstwertgefühl<br />
und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu steigern (Hilfe zur Selbsthilfe, Empowerment).<br />
In Zusammenarbeit mit zahlreichen Verbänden, Vereinen, Stiftungen, Initiativen sowie<br />
Behörden auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene werden bundesweit jährlich rund<br />
400 bis 450 Projekte durchgeführt. Dafür werden im Jahr 2010 Bundesmittel in Höhe von<br />
rund 21 Mio. € zur Verfügung gestellt.<br />
Erfahrungen und Herausfor<strong>der</strong>ungen aus <strong>der</strong> Projektför<strong>der</strong>ung<br />
Die Projekte wurden bisher von den Wohlfahrtsverbänden und zahlreichen Verbänden und<br />
Vereinen, Vertriebenenorganisationen und Kommunen durchgeführt. Eine systematische und<br />
gleichberechtigte Einbeziehung und Nutzung <strong>der</strong> Kompetenzen von Migrantenorganisationen<br />
in die Gestaltung von Integrationsangeboten sowie eine systematische För<strong>der</strong>ung von<br />
Migrantenorganisationen als Akteure <strong>der</strong> Integrationsför<strong>der</strong>ung hat bisher nur punktuell stattgefunden.<br />
So sind die Migrantenorganisationen im Rahmen <strong>der</strong> Projektför<strong>der</strong>ung bislang nur<br />
in geringem Umfang eigenständige Projektträger. In 2008 konnten von 400 vom Bundesamt<br />
geför<strong>der</strong>ten Projekten lediglich 33 Projekte (8 %) von Migrantenorganisationen durchgeführt<br />
werden.<br />
Damit sich dies än<strong>der</strong>t, hat das Bundesamt am 31.10.2008 eine vielfach beachtete Informationsveranstaltung<br />
für Migrantenorganisationen durchgeführt, an <strong>der</strong> über 120 Vertreter <strong>der</strong><br />
verschiedensten Migrantenorganisationen teilgenommen haben. Im För<strong>der</strong>jahr 2009 gingen<br />
über 10 % <strong>der</strong> zur Projektför<strong>der</strong>ung zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel an Migrantenorganisationen.<br />
Im Rahmen <strong>der</strong> Projektauswahl 2009 konnte <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> bewilligten<br />
Neuanträge von Migrantenorganisationen nahezu verdreifacht werden.<br />
32
Bartels: Migrantenorganisationen in <strong>der</strong> Integrationsför<strong>der</strong>ung – Erfahrungen und Empfehlungen<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Im Rahmen von Beratungsgespräche mit Verbänden, Vereinen und Migrantenorganisationen<br />
haben wir eine Vielzahl an unterschiedlichen Erkenntnissen gewinnen können.<br />
Kompetenzen von Migrantenorganisationen<br />
Die Migrantenorganisationen sind eine wichtige Interessenvertretung für Menschen mit<br />
Migrationshintergrund und leisten vielfältige Integrationsarbeit vor Ort. Migrantenorganisationen<br />
bringen eine Reihe von Kompetenzen mit:<br />
� Sie kennen die Bedarfe von Migranten.<br />
� Sie haben häufig besseren Zugang zu verschiedenen Migrantengruppen.<br />
� Vertreter <strong>der</strong> Migrantenorganisationen können ihre sprachlichen und (inter-) kulturellen<br />
Kompetenzen im Kontakt mit Migranten einbringen und damit als Brückenbauer<br />
agieren.<br />
� Migrantenorganisationen genießen das Vertrauen und den Respekt von Migranten.<br />
� Das Engagement von Migrantenorganisationen (etwa im Bildungsbereich) kann in erheblichem<br />
Umfang zu mehr Partizipation beitragen.<br />
Bedarfe von Migrantenorganisationen<br />
Die Erfahrungen zeigen, dass, um sich beteiligen zu können o<strong>der</strong> entsprechende Projekte<br />
durchzuführen, viele Migrantenorganisationen spezifische Qualifizierungsangebote benötigen,<br />
da sie meist ehrenamtlich tätig sind und kaum über hauptamtliche Strukturen verfügen.<br />
Sie benötigen insbeson<strong>der</strong>e:<br />
� Organisationsberatung und Entwicklungsbegleitung, die konkret am Entwicklungsstand<br />
und den Bedürfnissen <strong>der</strong> jeweiligen Organisation anknüpfen;<br />
� mehr fachliche Beratung und Fortbildung (insbeson<strong>der</strong>e Vereinsrecht, Vereinsmanagement);<br />
� aufeinan<strong>der</strong> abgestimmte, bezahlbare und auf die Bedürfnisse <strong>der</strong> Migrantenorganisationen<br />
ausgerichtete Weiterbildungsangebote;<br />
� Möglichkeiten zum bundesweiten Austausch;<br />
� besseren Zugang zu För<strong>der</strong>mitteln und<br />
� mehr gesellschaftliche Anerkennung.<br />
<strong>Umsetzung</strong> <strong>der</strong> Empfehlungen im Rahmen <strong>der</strong> Projektför<strong>der</strong>ung<br />
Das Bundesamt hat bereits viele <strong>der</strong> im Integrationsprogramm entwickelten und oben exemplarisch<br />
dargestellten Empfehlungen zur Stärkung von Migrantenorganisationen umgesetzt,<br />
insbeson<strong>der</strong>e im Rahmen <strong>der</strong> eigenen Projektför<strong>der</strong>ung:<br />
� Die Projektför<strong>der</strong>ung hat ihre För<strong>der</strong>kriterien stärker interkulturell geöffnet. Migrantenorganisationen<br />
werden zukünftig insbeson<strong>der</strong>e durch folgende Ansätze stärker geför<strong>der</strong>t:<br />
o Die neue För<strong>der</strong>richtlinie sieht erstmals ausdrücklich eine umfassende Mitwirkung<br />
von Migrantenorganisationen an <strong>der</strong> Integrationsför<strong>der</strong>ung vor.<br />
o Das Bundesamt hat verstärkt Migrantenorganisationen mit <strong>der</strong> Durchführung<br />
gemeinwesenorientierter Projekte beauftragt, <strong>der</strong> Projektanteil wurde bei neuen<br />
Projekten verdreifacht. Diese Projekte erfor<strong>der</strong>n zum Teil eine erhöhte Beratungstätigkeit<br />
und enge Begleitung durch das Bundesamt, insbeson<strong>der</strong>e<br />
durch die Regionalkoordinatoren vor Ort. Beratung ist aber auch bei <strong>der</strong> Projektabwicklung<br />
wie z. B. <strong>der</strong> Abrechnung im Rahmen <strong>der</strong> Verwendungsnachweise<br />
nötig.<br />
33
Bartels: Migrantenorganisationen in <strong>der</strong> Integrationsför<strong>der</strong>ung – Erfahrungen und Empfehlungen<br />
_________________________________________________________________________________<br />
o Zugleich wird vermehrt Beratung für Migrantenorganisationen zur Projektkonzeption<br />
und Antragstellung angeboten, z. B. über die Regionalkoordinatoren<br />
aber auch über die För<strong>der</strong>referate in <strong>der</strong> Zentrale des Bundesamtes.<br />
o Verstärkte För<strong>der</strong>ung von Weiterbildungsmaßnahmen für Migrantenorganisationen<br />
wie etwa Multiplikatorenschulungen und inhaltliche und organisationenbezogene<br />
Qualifizierungsmaßnahmen.<br />
o Eine fachliche und wissenschaftliche Begleitung/Evaluation ist z. B. im Rahmen<br />
<strong>der</strong> 15 Modellprojekte zur verstärkten Partizipation von MO-Projekten<br />
vorgesehen.<br />
� Das Bundesamt wird seine Zusammenarbeit und Unterstützung von Migrantenorganisationen<br />
in 2010 weiter ausbauen. Am 7. Mai 2010 findet im Bundesamt eine zweite<br />
Tagung mit Migrantenorganisationen unter dem Motto „Kompetenzen nutzen –<br />
Migrantenorganisationen stärken“ statt. Im Gegensatz zu dem Treffen im Jahr 2008,<br />
das von Vorträgen dominiert war, steht diesmal <strong>der</strong> Arbeitscharakter im Vor<strong>der</strong>grund.<br />
Neben Informationen zu den Fortschritten seit <strong>der</strong> letzten Veranstaltung sowie einem<br />
Impulsreferat besteht die Gelegenheit, sich im Rahmen des sog. World-Café ausführlich<br />
zu den Themenkomplexen<br />
o Kooperationsprojekte mit Migrantenorganisationen – Erfahrungen mit Tandems<br />
o Elternbildung in und mit Migrantenorganisationen<br />
o Interkulturelle Öffnung von Migrantenorganisationen, Verbänden und Verwaltung<br />
zu äußern. Ergebnisse werden zum Abschluss <strong>der</strong> Konferenz präsentiert und besprochen.<br />
IV. Modellprojekte zur verstärkten Partizipation von Migrantenorganisationen<br />
Anschließend möchte ich Ihnen erläutern, warum wir 15 Modellprojekte zur verstärkten Partizipation<br />
von Migrantenorganisationen för<strong>der</strong>n und welche Ziele wir damit verfolgen.<br />
Das Bundesamt hat im September 2009 ein Interessenbekundungsverfahren durchgeführt.<br />
Dabei sollten aus einer möglichst großen Anzahl an Projektideen unterschiedliche Handlungsansätze<br />
und Themenfel<strong>der</strong> identifiziert werden, in denen verschiedene Kooperationsmöglichkeiten<br />
zwischen unterschiedlichen Trägern vom Tandem- bis zum Mentoringprojekt<br />
erprobt werden können. Die verschiedenen Formen <strong>der</strong> Zusammenarbeit sollten sowohl auf<br />
bundesweiter als auch auf lokaler Ebene erfolgen. Die zweijährige Modellphase erfolgt mit<br />
fachlicher Begleitung durch zwei Experten und wird durch verschiedene Veranstaltungen und<br />
Workshops unterstützt. Am Ende soll eine Dokumentation die Erfahrungen und Handlungsempfehlungen<br />
aus diesen Kooperationsprojekten festhalten.<br />
Ziele <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Modellprojekte sind<br />
1. Potenziale und Professionalität von Migrantenorganisationen stärken (Migrantenorganisationen<br />
sollen als Brückenbauer und Experten für eine bedarfsgerechte Ausrichtung<br />
<strong>der</strong> Integrationsför<strong>der</strong>ung verstärkt in die Integrationsarbeit vor Ort einbezogen<br />
werden. Erfahrene Träger sollen ihre vielfältigen Erfahrungen, Fachkenntnisse und<br />
Kontakte/Vernetzung einbringen);<br />
2. Verbesserung <strong>der</strong> Integrationsarbeit vor Ort durch stärkere Vernetzung (Durch Zusammenarbeit<br />
mit Migrantenorganisationen können neue Zielgruppen erreicht werden;<br />
Migrantenorganisationen sollen in die Integrationsnetze vor Ort verstärkt mit<br />
einbezogen werden);<br />
3. Beitrag zur interkulturellen Öffnung bei<strong>der</strong> Träger (Durch die Zusammenarbeit sollen<br />
die interkulturelle Kompetenz und das gegenseitige Verständnis verbessert werden).<br />
34
Bartels: Migrantenorganisationen in <strong>der</strong> Integrationsför<strong>der</strong>ung – Erfahrungen und Empfehlungen<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Die Modellprojekte sollen sich in folgenden Handlungsfel<strong>der</strong>n bewegen:<br />
� Ausbau interkultureller Kompetenz<br />
� Aktivierung von Jugendlichen<br />
� stärkere Teilhabe im Stadtteil/freiwilliges Engagement<br />
� Stärkung <strong>der</strong> Erziehungskompetenz.<br />
Im Rahmen <strong>der</strong> Ausschreibung sind drei verschiedene Kooperationsmöglichkeiten vorgesehen:<br />
1. Tandempartnerschaft<br />
Bei einer Tandempartnerschaft arbeiten zwei Träger (Wohlfahrtsverband und Migrantenorganisation)<br />
zusammen, um ein Projekt zu beantragen (möglichst bereits gemeinsame Konzepterstellung)<br />
und durchzuführen. Beide Partner bringen unterschiedliche Stärken und fachliche<br />
Kompetenzen ein und können voneinan<strong>der</strong> lernen. Wie jede Partnerschaft funktioniert<br />
sie nur dann gut, wenn beide Seiten davon profitieren.<br />
Tandems bedürfen einer Vielzahl von Absprachen:<br />
� Wer stellt den Antrag, wird Zuwendungsempfänger und rechnet das Projekt gegenüber<br />
dem Zuwendungsgeber ab?<br />
� Wer ist verantwortlich und hält letztendlich den „Kopf“ hin?<br />
� Wer macht was im Projekt?<br />
� Was bedeutet „gleiche Augenhöhe“ für das Projekt und wie wird diese tatsächlich<br />
umgesetzt, damit sich keiner benachteiligt fühlt?<br />
� Wie sieht <strong>der</strong> Finanzierungsplan aus? Wer erhält was?<br />
� Wie viel Personal bei welchem Träger muss eingestellt werden?<br />
Wichtig ist dabei gegenseitiges Vertrauen. Vertrauen heißt, auch dem Kooperationspartner<br />
etwas zuzutrauen. Offenheit gegenüber neuen Ideen, Arbeitsformen und Handlungsperspektiven<br />
und Wertschätzung, um auf gleicher Augenhöhe arbeiten zu können, sind erfor<strong>der</strong>lich.<br />
Der Vorteil <strong>der</strong> Tandems liegt darin, dass in <strong>der</strong> projektbezogenen Zusammenarbeit die fachlichen<br />
Kompetenzen bei<strong>der</strong> Partner miteinan<strong>der</strong> gebündelt und effektiv eingesetzt werden<br />
können. Bei <strong>der</strong> Finanzierung sollte berücksichtigt werden, dass in einem Tandemprojekt<br />
zwei Träger tätig sind und dementsprechend ein höherer Zuwendungsbedarf besteht. Tandemprojekte<br />
kommen hauptsächlich in Betracht, wenn die MO bereits über Projekterfahrung<br />
und (geringe) hauptamtliche Strukturen o<strong>der</strong> zumindest gut ausgebaute ehrenamtliche Strukturen<br />
verfügt.<br />
2. Kooperationspartnerschaft<br />
Im Unterschied zur Tandempartnerschaft bezeichnet Kooperation eine losere Form <strong>der</strong> Zusammenarbeit,<br />
bei <strong>der</strong> die Beteiligten selbstständig bleiben. Auch auf dieser Ebene bietet<br />
Kooperation mit Migrantenorganisationen vielfältige Möglichkeiten, die eigene Projektarbeit<br />
zu stärken und Synergien zu nutzen. Kooperationsformen können sein:<br />
� Die Zusammenarbeit erfolgt nur während <strong>der</strong> inhaltlichen Vorarbeiten (indem beispielsweise<br />
die Erfahrungen des jeweiligen an<strong>der</strong>en Trägers in das Konzept aufgenommen<br />
werden), die <strong>Umsetzung</strong> erfolgt dann nur durch einen Träger, auf den sich<br />
beide Seiten geeinigt haben.<br />
� Die Zusammenarbeit erfolgt nur hinsichtlich einer Zielgruppe, zu <strong>der</strong>en Erreichung<br />
beispielsweise eine Migrantenorganisation (zeitweise) mit eingebunden wird und hierfür<br />
ein Honorar/Vergütung für ehrenamtliche Tätigkeiten erhält.<br />
35
Bartels: Migrantenorganisationen in <strong>der</strong> Integrationsför<strong>der</strong>ung – Erfahrungen und Empfehlungen<br />
_________________________________________________________________________________<br />
� Eine weitere Kooperationsmöglichkeit wäre, dass ein etablierter Träger eine Migrantenorganisation<br />
hinsichtlich Antragstellung und Abrechnung/Nachweis unterstützt,<br />
aber die inhaltliche Durchführung <strong>der</strong> Migrantenorganisation überlässt.<br />
Kooperationen sind einfacher zu vereinbaren und durchzuführen, haben aber den Nachteil,<br />
dass Migrantenorganisationen sich häufig ausgenutzt fühlen, da sie an <strong>der</strong> bewilligten Summe<br />
kaum teilhaben und ihre Leistung kostenfrei zur Verfügung stellen (müssen).<br />
3. Mentoring<br />
Ein solches Projekt dient <strong>der</strong> Professionalisierung und Entwicklungsbegleitung <strong>der</strong> MO. Hier<br />
ist die Unterstützung durch den erfahrenen Träger Schwerpunkt <strong>der</strong> Projektdurchführung.<br />
Ziel eines solchen Mentoringprojektes kann z. B. <strong>der</strong> Aufbau von Strukturen bei <strong>der</strong> MO o<strong>der</strong><br />
die Gründung eines rechtsfähigen Vereins sein.<br />
Allgemein zur Zusammenarbeit:<br />
Wir legen Wert darauf, dass Migrantenorganisationen von Anfang an in die Erstellung von<br />
Integrationskonzepten einbezogen werden, um aktiv mitgestalten zu können und nicht lediglich<br />
Objekt <strong>der</strong> Maßnahmen zu sein. Durch die Mitwirkung beim Projekt erfahren die Migrantenorganisationen<br />
eine Stärkung:<br />
� Sie können sich mit ihren Kompetenzen, ihren Erfahrungen, ihren Zugangsmöglichkeiten<br />
in die Projektarbeit einbringen.<br />
� Sie lernen, wie Anträge formuliert werden müssen und welche Möglichkeiten es für<br />
eine För<strong>der</strong>ung gibt.<br />
� Sie lernen die Ansprechpartner in den Behörden vor Ort kennen.<br />
� Sie werden vom Integrationsnetzwerk, in dem sie (evtl. gemeinsam mit einem etablierten<br />
Träger) das Projekt vorstellen, als ernstzunehmen<strong>der</strong> Partner wahrgenommen.<br />
� Sie werden mit ihrer Arbeit in <strong>der</strong> Öffentlichkeit wahrgenommen.<br />
� Hierdurch wird es für sie einfacher, Gel<strong>der</strong> zu akquirieren (z. B. Kommunen, Sparkassen,<br />
Rotary Club und sonstige Sponsoren)<br />
� Sie lernen, wie Projekte gegenüber dem Zuwendungsgeber abzurechnen sind und<br />
erfahren Anerkennung.<br />
� Im Rahmen <strong>der</strong> Projektför<strong>der</strong>ung können sie damit auch die Struktur ihrer Organisation<br />
stärken und verstärkt Mitglie<strong>der</strong> für die ehrenamtliche Tätigkeit werben.<br />
Welche Migrantenorganisationen kommen für eine Zusammenarbeit in Betracht?<br />
Wichtig ist uns im Rahmen <strong>der</strong> Projektför<strong>der</strong>ung insbeson<strong>der</strong>e mit Migrantenorganisationen<br />
zusammenzuarbeiten, die sich interkulturell geöffnet haben und möglichst nicht nur eine<br />
Ethnie vertreten, um einer möglichen Zersplitterung <strong>der</strong> Integrationsarbeit vorzubeugen. Allerdings<br />
kann es auch Sinn machen, mit einer Migrantenorganisation, die nur eine Ethnie<br />
vertritt, zusammenzuarbeiten, um gerade diese Zielgruppe (beispielsweise Muslime) besser<br />
zu erreichen (z. B. in Moscheen).<br />
Auswahlkriterien<br />
Die Ausschreibung des Bundesamtes ist erfreulicherweise auf eine sehr große Resonanz<br />
gestoßen. Insgesamt gingen über 200 Projektideen und –skizzen ein. Diese wurden in einer<br />
großen Übersicht erfasst und nach verschiedenen Kriterien bewertet.<br />
36
Bartels: Migrantenorganisationen in <strong>der</strong> Integrationsför<strong>der</strong>ung – Erfahrungen und Empfehlungen<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Das Bundesamt hat <strong>der</strong> Beurteilung <strong>der</strong> eingereichten Interessenbekundungen u. a. folgende<br />
Kriterien zugrunde gelegt:<br />
� För<strong>der</strong>fähigkeit: Nur ein grundsätzlich för<strong>der</strong>fähiges Projekt kann für die För<strong>der</strong>ung im<br />
Rahmen <strong>der</strong> ausgeschriebenen Modellprojekte ausgewählt werden.<br />
� Art <strong>der</strong> geplanten Zusammenarbeit: Eine <strong>der</strong> drei vorgegebenen Kooperationsformen<br />
muss gewählt werden. Am höchsten wurde bewertet, wenn die Träger eine Tandempartnerschaft<br />
anstreben, bei <strong>der</strong> sie zusammen ein Projekt beantragen, um es anschließend<br />
gemeinsam umzusetzen. Die Partner bringen während <strong>der</strong> gesamten Projektlaufzeit<br />
unterschiedliche Stärken und fachliche Kompetenzen ein und können<br />
voneinan<strong>der</strong> lernen.<br />
� Art <strong>der</strong> Migrantenorganisation: Wichtig ist, dass insbeson<strong>der</strong>e mit Migrantenorganisationen<br />
zusammengearbeitet werden soll, die sich interkulturell geöffnet haben. Ebenfalls<br />
wirkt es sich positiv aus, wenn es sich um eine landes- o<strong>der</strong> bundesweit tätige<br />
o<strong>der</strong> eine spezifische Migrantenorganisation wie eine Frauen- o<strong>der</strong> Jugendmigrantenorganisation<br />
handelt.<br />
� Art des etablierten Trägers: Bevorzugt werden Träger, die bereits gewisse Erfahrung<br />
in <strong>der</strong> Migrationsarbeit haben, möglichst interkulturell geöffnet sind und die auch bereit<br />
sind zu einer offenen interkulturellen Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen.<br />
Das Auswahlverfahren wurde Ende November 2009 abgeschlossen, und alle 15 Modellprojekte<br />
haben noch im Dezember den Bewilligungsbescheid erhalten. Alle Projekte werden eng<br />
fachlich wissenschaftlich begleitet durch Frau Dr. Beer und Herrn Dr. Ernst und durch die<br />
Regionalkoordinatoren des Bundesamtes mindestens einmal besucht.<br />
V. Empfehlungen an die Wohlfahrtsverbände<br />
Zusammenfassend möchte ich die anwesenden Vertreter <strong>der</strong> <strong>Caritas</strong> zu einer verstärkten<br />
Kooperation mit Migrantenorganisationen aufrufen. Es gibt wie soeben dargestellt vielfältige<br />
Möglichkeiten <strong>der</strong> Zusammenarbeit zwischen Wohlfahrtsverbänden und Migrantenorganisationen.<br />
Dabei ist zu beachten, dass beide Seiten lernen müssen, mit einem strukturellen Ungleichgewicht<br />
umzugehen:<br />
Wohlfahrtsverbände sind große, bundesweit agierende Organisationen, die über eine gesicherte<br />
Grundfinanzierung und eine mächtige Struktur mit vielen hauptamtlichen Mitarbeitern<br />
verfügen. Da diese meist seit vielen Jahren in <strong>der</strong> Integrationsarbeit tätig sind und entsprechende<br />
Schulungsmöglichkeiten haben bzw. finanzieren können, verfügen sie über ein umfassendes<br />
Know-how auf diesem Gebiet. Zudem haben die Wohlfahrtsverbände sehr gute<br />
politische wie auch außerpolitische Kontakte sowohl auf Bundes- als auch auf Landes- und<br />
Ortsebene und sind überall aufgrund ihrer umfassenden Öffentlichkeitsarbeit sehr bekannt<br />
und anerkannt.<br />
Migrantenorganisationen sind dagegen häufig nur auf örtlicher Ebene aktiv und verfügen<br />
aufgrund ihrer überwiegend ehrenamtlichen und ortsgebundenen Struktur kaum über hauptamtliche<br />
Mitarbeiter. In <strong>der</strong> Öffentlichkeit sind Migrantenorganisationen bis auf wenige Ausnahmen<br />
kaum bekannt und verfügen über wenig politische Kontakte.<br />
Überlegungen zum Auffangen des strukturellen Ungleichgewichts<br />
Das strukturelle Ungleichgewicht von etablierten Trägern und Migrantenorganisationen kann<br />
ein Problem für eine Partnerschaft sein. Hierüber müssen sich beide Partner im Klaren sein<br />
und vor Beginn einer Partnerschaft (ob Tandemprojekt o<strong>der</strong> losere Kooperation) offen sprechen.<br />
Wenn eine Migrantenorganisation eine Partnerschaft mit einem etablierten Träger eingeht,<br />
hat sie insbeson<strong>der</strong>e auch das Interesse, ihre Strukturen zu verbessern und hierauf<br />
sollte sich <strong>der</strong> etablierte Träger auch einlassen, denn er profitiert umgekehrt von den guten<br />
Zugangsmöglichkeiten <strong>der</strong> Migrantenorganisation. Häufig wird es notwendig sein, dass die<br />
37
Bartels: Migrantenorganisationen in <strong>der</strong> Integrationsför<strong>der</strong>ung – Erfahrungen und Empfehlungen<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Beantragung und die Abrechnung des Projekts aufgrund <strong>der</strong> vorhandenen Strukturen über<br />
den etablierten Träger erfolgt. Aber es macht auch durchaus Sinn, zur Stärkung <strong>der</strong> Strukturen<br />
dies <strong>der</strong> Migrantenorganisation zu überlassen und sie hierbei entsprechend zu unterstützen.<br />
Aufgrund ihrer meist ehrenamtlichen Struktur sind Migrantenorganisationen kaum in <strong>der</strong> Lage<br />
einen höheren Eigenmittelanteil einzubringen. Das Bundesamt nimmt darauf Rücksicht.<br />
Dies bedeutet keine Ungleichbehandlung <strong>der</strong> etablierten Träger, vielmehr ist <strong>der</strong> Eigenmittelanteil<br />
nach den Vorgaben <strong>der</strong> BHO in jedem Einzelfall individuell zu prüfen und hängt von<br />
<strong>der</strong> finanziellen Ausstattung <strong>der</strong> jeweiligen Organisation ab.<br />
Wichtig ist, dass Migrantenorganisationen von Anfang an in die Erstellung von Integrationskonzepten<br />
einbezogen werden, um aktiv mitgestalten zu können.<br />
Fazit:<br />
Ziel des Bundesamtes ist, Migrantenorganisationen künftig verstärkt und in angemessenem<br />
Umfang an <strong>der</strong> Projektför<strong>der</strong>ung zu beteiligen. Die Wohlfahrtsverbände sollten die verstärkte<br />
Berücksichtigung von Migrantenorganisationen als Chance begreifen und diese soweit wie<br />
möglich in die Projekte, die sie beantragen und durchführen, einbeziehen.<br />
Durch ihre beson<strong>der</strong>en Zugangsmöglichkeiten können Migrantenorganisationen helfen, neue<br />
Zuwan<strong>der</strong>ergruppen für die Wohlfahrtsverbände zu erschließen. Migrantenorganisationen<br />
können als Brückenbauer und Experten für die Bedarfe <strong>der</strong> Zuwan<strong>der</strong>er dazu beitragen, Zuwan<strong>der</strong>er<br />
schneller und besser zu erreichen, da sie <strong>der</strong>en Hintergründe und Interessen besser<br />
kennen. Sie können die Zuwan<strong>der</strong>er dort aufsuchen, wo sie sich aufhalten (z. B. in Moscheen)<br />
und finden einen besseren/einfacheren Zugang zu ihnen. Durch ihre umfassenden<br />
Erfahrungen im ehrenamtlichen Bereich, gelingt es ihnen besser, Zuwan<strong>der</strong>er für die ehrenamtliche<br />
Mitarbeit zu gewinnen.<br />
Die Wohlfahrtsverbände sollten Migrantenorganisationen daher nicht als Konkurrenz ansehen,<br />
son<strong>der</strong>n als Belebung <strong>der</strong> Integrationsarbeit und gleichwertige Partner. Migrantenorganisationen<br />
können gerade in Zusammenarbeit mit einem in <strong>der</strong> Integrationsarbeit erfahrenen<br />
Wohlfahrtsverband einen wesentlichen Beitrag zur Optimierung <strong>der</strong> Integrationsarbeit leisten.<br />
Auch wenn es nicht sofort zu einer Tandempartnerschaft kommt, sollten zumindest feste<br />
Kooperationen mit Migrantenorganisationen angestrebt werden.<br />
Migrantenorganisationen können einen Beitrag zur interkulturellen Öffnung von Wohlfahrtsverbänden,<br />
Vereinen und Einrichtungen leisten. Entscheidend ist, dass <strong>der</strong> Dialog „auf Augenhöhe“<br />
stattfindet.<br />
38
Küçük: Potenziale und Grenzen <strong>der</strong> Migrantenorganisationen in <strong>der</strong> Integrationsarbeit<br />
_________________________________________________________________________________<br />
2.5 Potenziale und Grenzen <strong>der</strong> Migrantenorganisationen in <strong>der</strong> Integrationsarbeit<br />
Kenan Küçük, Geschäftsführer Multikulturelles Forum e.V. und Sprecher des Forums<br />
<strong>der</strong> Migrantinnen und Migranten im Paritätischen<br />
Potenziale <strong>der</strong> Migrantenorganisationen<br />
� Migrantenorganisationen leisten einen wichtigen Beitrag zur Integration und sollten<br />
geför<strong>der</strong>t und gestärkt werden.<br />
� Beitrag <strong>der</strong> Migrantenorganisationen:<br />
o Mittlerfunktion<br />
o Interessenvertretung<br />
o Identitätsstärkung<br />
o Pflege des kulturellen Kapitals<br />
o Stärkung sozialer Kompetenzen<br />
o Präventions- und Dienstleistungsaufgaben<br />
o Aufbau von Netzwerken<br />
o Selbsthilfe<br />
o Ansprechpartner für Verwaltung und Politik<br />
� Migrantenorganisationen sind in zweierlei Hinsicht wichtig für die Integration: Zum einen<br />
können Migrant(inn)en, die sich häufig politisch nicht beteiligen können, sich<br />
durch dieses Engagement in die Gesellschaft einbringen. Sie werden aktiv und ihre<br />
Kompetenzen werden sichtbar und nutzbar. Zum an<strong>der</strong>en führt dieses Engagement<br />
zu einer gemeinsamen Bewältigung von Problemen, die auch eine gegenseitige Akzeptanz<br />
ermöglicht.<br />
� Migrantenorganisationen tragen zur interkulturellen Öffnung von Einrichtungen und<br />
Behörden bei, mit denen sie kooperieren; sie sensibilisieren für die Notwendigkeit <strong>der</strong><br />
gleichberechtigten Teilhabe.<br />
� Die Zahl <strong>der</strong> Migrantenorganisationen zeigt zweierlei: Zum einen macht sie deutlich,<br />
dass Defizite in den Betreuungsangeboten deutscher Wohlfahrtsverbände und an<strong>der</strong>er<br />
Organisationen die Gründung vielfältiger Migrantenorganisationen notwendig gemacht<br />
haben. Zum an<strong>der</strong>en macht sie deutlich: Migranten engagieren sich – aber<br />
an<strong>der</strong>s!<br />
Grenzen <strong>der</strong> Migrantenorganisationen<br />
� Migrantenorganisationen können staatliches Handeln nicht ersetzen; sie können Aufgaben<br />
<strong>der</strong> Integration nicht alleine erfüllen. Bereiche wie Bildungs-, Arbeitsmarkt- und<br />
Sozialpolitik bilden staatliche und gesamtgesellschaftliche Aufgaben, die nicht ganz<br />
o<strong>der</strong> teilweise von Migrantenorganisationen übernommen werden können. Sie können<br />
diese Bereiche jedoch durch aktive Teilhabe mitgestalten.<br />
� Viele Migrantenorganisationen arbeiten auf ehrenamtlicher Basis. Sie sind häufig<br />
nicht professionalisiert, haben noch keine klaren Strukturen, erhalten nur wenig För<strong>der</strong>ung<br />
und sind häufig nicht in <strong>der</strong> Lage, bürokratische Hürden zu überwinden. Sie<br />
sollten in <strong>der</strong> Weiterbildung ihrer aktiven Mitglie<strong>der</strong> unterstützt werden.<br />
Kooperation mit Migrantenorganisationen – aber wie?<br />
� Menschen mit Migrationshintergrund sollten nicht immer als Zielgruppe von Integrationspolitik<br />
behandelt werden. Sie sind Mitglie<strong>der</strong> dieser Gesellschaft und sollten als<br />
eigenständige Akteure auf gleicher Augenhöhe behandelt werden.<br />
39
Küçük: Potenziale und Grenzen <strong>der</strong> Migrantenorganisationen in <strong>der</strong> Integrationsarbeit<br />
_________________________________________________________________________________<br />
� Migrantenorganisationen ermöglichen, dass man nicht über „die Migranten“ redet und<br />
entscheidet, son<strong>der</strong>n gemeinsam mit ihnen. Hierfür muss ihnen jedoch auch das entsprechende<br />
Forum gegeben werden. Integration muss als beidseitiger Prozess verstanden<br />
werden, in dem auch Vertreter bestehen<strong>der</strong> Strukturen bereit sind, diesen<br />
Wandel zu vollziehen.<br />
40
Riesgo: Empowerment von Migrantenorganisationen<br />
_________________________________________________________________________________<br />
2.6 Empowerment von Migrantenorganisationen – Zusammenarbeit zwischen Wohlfahrtsverbänden<br />
und Migrantenorganisationen gestalten<br />
Vicente Riesgo, Fachberater des Bundes <strong>der</strong> Spanischen Elternvereine und Vorsitzen<strong>der</strong><br />
<strong>der</strong> Spanischen Weiterbildungsakademie<br />
1. Grundvoraussetzungen für eine auf Empowerment ausgerichtete Zusammenarbeit<br />
<strong>der</strong> Wohlfahrtsverbände mit Migrantenorganisationen:<br />
� Wissen und verinnerlichte Überzeugung, dass Migrantenorganisationen Stärken<br />
haben, sehr wichtige Funktionen im Migrationsprozess erfüllen und eine überwiegend<br />
positive Rolle bei <strong>der</strong> Integration spielen (können)<br />
� (Selbst)kritische Reflexion <strong>der</strong> Wohlfahrtsverbände über ihre langjährige Einstellung<br />
zu Migrantenorganisationen (Misstrauen, Geringschätzung, Defizitansatz ↔ Empowerment)<br />
2. Funktionen <strong>der</strong> Migrantenorganisationen im Migrationsprozess:<br />
� Erfahrung von Selbsthilfe, kollektiver Solidarität und Organisationsfähigkeit<br />
� Brücke zwischen Herkunfts- und Zielgesellschaft (Integration statt Assimilation und<br />
Verdrängung)<br />
� Anker und Ruhepunkte im multikulturellen Leben<br />
� Selbstbestimmte Ergreifung des Wortes (Bedürfnisse, Interessen, Wünsche artikulieren/Handlungsstrategien<br />
entwickeln)<br />
3. Kriterien zur Gestaltung erfolgreicher Zusammenarbeit zwischen Wohlfahrtsverbänden<br />
und Migrantenorganisationen:<br />
� Zusammenarbeit soll langfristig, strukturell und nachhaltig angestrebt und konzipiert<br />
werden<br />
� Wohlfahrtsverbände ermöglichen den Migrantenorganisationen ihre eigene Bedarfsanalyse<br />
zu machen und nehmen diese Ernst<br />
� Wohlfahrtsverbände und Migrantenorganisationen wirken zusammen und gleichberechtigt<br />
an <strong>der</strong> Planung, Durchführung und Auswertung <strong>der</strong> gemeinsam durchgeführten<br />
Maßnahmen<br />
� Wohlfahrtsverbände respektieren die Autonomie <strong>der</strong> Migrantenorganisationen<br />
� Wohlfahrtsverbände entwickeln neue, kooperative, offene Formen <strong>der</strong> Zusammenarbeit<br />
� Wohlfahrtsverbände för<strong>der</strong>n alles, was Migrantenorganisationen besser als sie<br />
selbst leisten können statt es selber tun zu wollen<br />
� Wohlfahrtsverbände erwarten nicht von Migrantenorganisationen, was diese nicht<br />
leisten können (Symmetrie – Asymmetrie)<br />
4. Was Zusammenarbeit scheitern lässt:<br />
� Wenn Migrantenorganisationen “zum Zugang zur Zielgruppe” missbraucht werden<br />
� Wenn Migrantenorganisationen als Lieferanten von Teilnehmer für Maßnahmen betrachtet<br />
werden<br />
� Wenn Migrantenorganisationen als Unterabteilungen o<strong>der</strong> Nebenstellen angesehen<br />
werden o<strong>der</strong> das Organigramm wichtiger ist als die Ziele<br />
� Wenn von Migrantenorganisationen immer nur ehrenamtliche Arbeit erwartet wird.<br />
41
Leipp: Migrantenorganisationen – Bekanntheit, Nutzung, Erwartungen<br />
_________________________________________________________________________________<br />
2.7 Migrantenorganisationen – Bekanntheit, Nutzung, Erwartungen. Ergebnisse aus<br />
<strong>der</strong> Sinus Migranten-Milieu®-Studie<br />
Thomas Leipp, Referent im Referat Migration und Integration, Deutscher <strong>Caritas</strong>verband<br />
Migrantenorganisationen - Bekanntheit, Nutzung, Erwartungen.<br />
Ergebnisse aus <strong>der</strong> Sinus Migranten-Milieu ® -Studie<br />
Expertenworkshop des Deutschen <strong>Caritas</strong>verbandes<br />
Migrantenorganisationen als Schlüssel zur selbstbestimmten Teilhabe von<br />
Menschen mit Migrationshintergrund<br />
23. März 2010, Fulda<br />
Thomas Leipp<br />
1. Hintergrund zur Studie und allgemeine Ergebnisse<br />
2. Bekanntheit und Nutzung von Migrantenorganisationen<br />
3. Erwartungen an Migrantenorganisationen<br />
4. Aktivitäten in „deutschen“ Organisationen<br />
5. Zusammenfassung <strong>der</strong> Ergebnisse<br />
1<br />
2<br />
42
Leipp: Migrantenorganisationen – Bekanntheit, Nutzung, Erwartungen<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Zwischen 2006-2008 Durchführung einer Studie des Sinus-<br />
Instituts zur Erfassung unterschiedlicher Lebenswelten von<br />
Menschen mit Migrationshintergrund<br />
� 1. Phase 2006-2007: qualitative ethnographische Leitstudie<br />
→ über 100 Tiefeninterviews<br />
� 2. Phase 2008: Quantifizierung<br />
→ Befragung von 2.072 Personen mit Migrationshintergrund ab<br />
14 Jahren<br />
� Stichprobe ist empirische gesichert und repräsentativ für<br />
definierte Grundgesamtheit<br />
� Studie repräsentiert 17,4 % <strong>der</strong> Wohnbevölkerung<br />
Deutschlands = 11,3 Mio. Menschen<br />
Das DCV-Fragenprogramm<br />
– 4 Hauptthemen –<br />
� Soziale Dienste und Einrichtungen<br />
– Bekanntheit, Inanspruchnahme, Wichtigkeit<br />
� Migrantenorganisationen<br />
– Bekanntheit, Nutzung, Erwartungen<br />
� Einstellungen zur Einbürgerung<br />
– Status, Einbürgerungsabsicht, Vor- und Nachteile<br />
� Heiratsverhalten<br />
– Ethnische Homogenität <strong>der</strong> Partner, Heiratsalter,<br />
Einfluss <strong>der</strong> Familie auf die Eheschließung<br />
3<br />
4<br />
43
Leipp: Migrantenorganisationen – Bekanntheit, Nutzung, Erwartungen<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Milieus werden als „real existierende Teilkulturen in unserer<br />
Gesellschaft mit gemeinsamen Sinn- und Kommunikationszusammenhängen<br />
in ihrer Alltagswelt“ verstanden.<br />
Es handelt sich dabei um eine Gruppe Gleichgesinnter mit<br />
ähnlichen:<br />
� Grund- und Wertorientierungen<br />
� Lebensstil<br />
� sozialen Lage<br />
� Lebensziel und Zukunftserwartung<br />
Die Migranten-Milieus in Deutschland 2008<br />
Milieu-Segmente nach © Sinus Sociovision<br />
hoch 1<br />
mittel 2<br />
niedrig 3<br />
Bürgerliche<br />
Migranten-Milieus<br />
A3<br />
Religiösverwurzeltes<br />
Milieu<br />
7%<br />
Soziale AI<br />
Lage<br />
Vormo<strong>der</strong>ne<br />
Tradition<br />
Konservativreligiös,<br />
strenge, rigide<br />
Grund- Wertvorstellungen,<br />
orientierung kulturelle Enklave<br />
Tradition<br />
AB12<br />
Statusorientiertes<br />
Milieu<br />
12%<br />
AB3<br />
Traditionelles<br />
Arbeitermilieu<br />
16%<br />
AII<br />
Ethnische Tradition<br />
Pflicht- und Akzeptanzwerte,<br />
materielle Sicherheit,<br />
traditionelle Moral<br />
Traditionsverwurzelte<br />
Migranten-Milieus<br />
B12<br />
Intellektuellkosmopolitisches<br />
Milieu<br />
11%<br />
B23<br />
Adaptives<br />
Bürgerliches Milieu<br />
16%<br />
B3<br />
Entwurzeltes<br />
Milieu<br />
9%<br />
BI<br />
Konsum-Materialismus<br />
Status, Besitz, Konsum,<br />
Aufstiegsorientierung,<br />
soziale Akzeptanz und<br />
Anpassung<br />
Mo<strong>der</strong>nisierung<br />
BII<br />
Individualisierung<br />
Selbstverwirklichung,<br />
Leistung, Genuss,<br />
bi-kulturelle Ambivalenz<br />
und Kulturkritik<br />
Ambitionierte<br />
Migranten-Milieus<br />
BC2<br />
Multikulturelles<br />
Performermilieu<br />
13%<br />
BC3<br />
Hedonistischsubkulturelles<br />
Milieu<br />
15%<br />
5<br />
© Sinus Sociovision 2008<br />
C<br />
Multi-Optionalität<br />
Postmo<strong>der</strong>nes Werte-<br />
Patchwork, Sinnsuche,<br />
multikulturelle<br />
Identifikation<br />
Neuidentifikation<br />
Prekäre<br />
Migranten-Milieus<br />
6<br />
44
Leipp: Migrantenorganisationen – Bekanntheit, Nutzung, Erwartungen<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Die Migranten-Milieus in Deutschland<br />
Bürgerliche Migranten-Milieus<br />
Traditionsverwurzelte Migranten-<br />
Milieus<br />
� Sinus A3 Religiös- verwurzeltes Milieu (7%)<br />
� Vormo<strong>der</strong>nes, sozial und kulturell isoliertes Milieu, verhaftet<br />
in den patriarchalischen und religiösen Traditionen <strong>der</strong><br />
Herkunftsregion<br />
� Sinus AB3 Traditionelles Arbeitermilieu (16%)<br />
� Traditionelles Blue Collar Milieu <strong>der</strong> Arbeitsmigranten und<br />
Spätaussiedler, das nach materieller Sicherheit für sich und<br />
seine Kin<strong>der</strong> strebt<br />
Kurzcharakteristik<br />
© Sinus Sociovision<br />
Ambitionierte Migranten-Milieus<br />
� Sinus B23 Adaptives Bürgerliches Milieu (16%)<br />
� Sinus BC2 Multikulturelles Performermilieu (13%)<br />
� Die pragmatische mo<strong>der</strong>ne Mitte <strong>der</strong> Migrantenpopulation, � Junges, leistungsorientiertes Milieu mit bi-kulturellem<br />
die nach sozialer Integration und einem harmonischen Leben Selbstverständnis, das sich mit dem westlichen Lebensstil<br />
in gesicherten Verhältnissen strebt<br />
� Sinus AB12 Statusorientiertes Milieu (12%)<br />
identifiziert und nach beruflichem Erfolg und intensivem<br />
Leben strebt<br />
� Klassisches Aufsteiger-Milieu, das durch Leistung und<br />
� Sinus B12 Intellektuell-kosmopolitisches Milieu (11%)<br />
Zielstrebigkeit materiellen Wohlstand und soziale<br />
� Aufgeklärtes, global denkendes Bildungsmilieu mit einer<br />
Anerkennung erreichen will<br />
weltoffenen, multikulturellen Grundhaltung und vielfältigen<br />
intellektuellen Interessen<br />
Prekäre Migranten-Milieus<br />
� Sinus B3 Entwurzeltes Milieu (9%)<br />
� Sozial und kulturell entwurzeltes Milieu, das Problemfreiheit<br />
und Heimat / Identität sucht und nach Geld, Ansehen und<br />
Konsum strebt<br />
� Sinus BC3 Hedonistisch-subkulturelles Milieu (15%)<br />
� Unangepasstes Jugendmilieu mit defizitärer Identität und<br />
Perspektive, das Spaß haben will und sich den Erwartungen<br />
<strong>der</strong> Mehrheitsgesellschaft verweigert<br />
Milieu-Untersuchung zeigt:<br />
� Differenziertes und facettenreiches Bild <strong>der</strong> Milieulandschaft<br />
� 8 Migranten-Milieus mit unterschiedl. Lebensauffassung und<br />
Lebensweise sind identifizier- und beschreibbar = MmM sind<br />
keine homogene Gruppe<br />
� Integrationsdiskurs in Deutschland ist sehr stark auf<br />
Defizitperspektive verengt. Unterschätzung von:<br />
a) Ressourcen an kulturellem Kapital von MmM<br />
b) ihrer Anpassungsleistungen<br />
c) ihrer Etablierung in <strong>der</strong> Mitte <strong>der</strong> Gesellschaft<br />
8<br />
7<br />
45
Leipp: Migrantenorganisationen – Bekanntheit, Nutzung, Erwartungen<br />
_________________________________________________________________________________<br />
� Migranten-Milieus unterscheiden sich weniger nach ethnischer<br />
Herkunft und sozialer Lage; viel eher nach Wertvorstellungen,<br />
Lebensstilen und ästh. Vorlieben<br />
� Gemeinsame lebensweltliche Muster bei MmM aus<br />
unterschiedlichen Herkunftskulturen:<br />
a) Menschen des gleichen Milieus mit unterschiedlichem Migrationshintergrund<br />
verbindet mehr miteinan<strong>der</strong> als mit dem Rest ihrer Landsleute<br />
aus an<strong>der</strong>en Milieus.<br />
b) Man kann nicht von <strong>der</strong> Herkunftskultur auf das Milieu schließen. Und man<br />
kann auch nicht vom Milieu auf die Herkunftskultur schließen.<br />
c) Ethnische Zugehörigkeit und Religion beeinflussen die Alltagskultur, sind<br />
aber kaum milieuprägend und auf Dauer nicht identitätsstiftend.<br />
Die Migranten-Milieus im Vergleich<br />
Migrationshintergrund: Erkennbare Schwerpunkte<br />
hoch 1<br />
mittel 2<br />
niedrig 3<br />
Türkei<br />
A3<br />
Religiösverwurzeltes<br />
Milieu<br />
Soziale AI<br />
Lage<br />
Vormo<strong>der</strong>ne<br />
Tradition<br />
Konservativreligiös,<br />
strenge, rigide<br />
Grund- Wertvorstellungen,<br />
orientierung kulturelle Enklave<br />
Tradition<br />
AB12<br />
Statusorientiertes<br />
Milieu<br />
Südeuropa<br />
AB3<br />
Traditionelles<br />
Arbeitermilieu<br />
AII<br />
Ethnische Tradition<br />
Pflicht- und Akzeptanzwerte,<br />
materielle Sicherheit,<br />
traditionelle Moral<br />
An<strong>der</strong>es EU-Land<br />
Polen<br />
Ex-Sowjetunion<br />
B3<br />
Entwurzeltes<br />
Milieu<br />
Ex-Jugoslawien<br />
BI<br />
Konsum-Materialismus<br />
Status, Besitz, Konsum,<br />
Aufstiegsorientierung,<br />
soziale Akzeptanz und<br />
Anpassung<br />
B12 Amerika<br />
Intellektuellkosmopolitisches<br />
Milieu Ex-Jugoslawien<br />
B23<br />
Adaptives<br />
Bürgerliches Milieu<br />
Mo<strong>der</strong>nisierung<br />
Afrika<br />
BII<br />
Individualisierung<br />
Selbstverwirklichung,<br />
Leistung, Genuss,<br />
bi-kulturelle Ambivalenz<br />
und Kulturkritik<br />
Türkei<br />
BC3<br />
Hedonistischsubkulturelles<br />
Milieu<br />
9<br />
© Sinus Sociovision<br />
BC2<br />
Multikulturelles<br />
Performermilieu<br />
An<strong>der</strong>es Land<br />
in Osteuropa<br />
© Sinus Sociovision 2008<br />
C<br />
Multi-Optionalität<br />
Postmo<strong>der</strong>nes Werte-<br />
Patchwork, Sinnsuche,<br />
multikulturelle<br />
Identifikation<br />
Neuidentifikation<br />
10<br />
46
Leipp: Migrantenorganisationen – Bekanntheit, Nutzung, Erwartungen<br />
_________________________________________________________________________________<br />
1. Hintergrund zur Studie und allgemeine Ergebnisse<br />
2. Bekanntheit und Nutzung von Migrantenorganisationen<br />
3. Erwartungen an Migrantenorganisationen<br />
4. Aktivitäten in „deutschen“ Organisationen<br />
5. Zusammenfassung <strong>der</strong> Ergebnisse<br />
Gesamtergebnisse:<br />
� Fast alle <strong>der</strong> Befragten kennen eine <strong>der</strong> aufgeführten<br />
Migrantenorganisationen<br />
� Die Hälfte <strong>der</strong> Menschen mit Migrationshintergrund haben<br />
solche Organisationen schon einmal genutzt<br />
� Lediglich 16 % <strong>der</strong> Befragten sind in den<br />
Migrantenorganisationen selbst aktiv<br />
11<br />
12<br />
47
Leipp: Migrantenorganisationen – Bekanntheit, Nutzung, Erwartungen<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Migrantenorganisationen:<br />
Bekanntheit, Nutzung und aktive Beteiligung<br />
Organisationen * Davon<br />
gehört<br />
Schon<br />
genutzt<br />
Selbst<br />
aktiv<br />
• Religiöse Vereinigung, Kirchengemeinde,<br />
ausländische Mission, Moschee etc. 58% 21% 7%<br />
• Kulturverein einer o<strong>der</strong> mehrerer<br />
Nationalitäten 49% 15% 4%<br />
• Ethnischer Sportverein 46% 12% 4%<br />
• Interessenvertretung einer<br />
Migrantengruppe 39% 9% 1%<br />
• Heimatverein 36% 7% 1%<br />
• Elternverein 32% 7% 1%<br />
• polit. Organisation 25% 3% 1%<br />
• Interkulturelle Organisation / Verein 21% 5% 2%<br />
• Nationalitätenübergreifende Interessenvertretung<br />
/ Dachverband 19% 2% 0%<br />
• Landsmannschaft 17% 3% 1%<br />
Nutzung von Migrantenorganisationen<br />
– Zielgruppenspezifische Beson<strong>der</strong>heiten –<br />
Überdurchschnittliche Nutzer von<br />
Migrantenorganisationen:<br />
• Ältere ab 60 Jahren 59%<br />
• Personen mit einfacher<br />
Schulbildung 57%<br />
• Menschen aus <strong>der</strong> Türkei 72%<br />
• Befragte mit muslimischer<br />
Religionszugehörigkeit 71%<br />
� Durchschnitt 50%<br />
Basis: Alle Befragte, N = 2.072 Personen<br />
* Listenvorgabe<br />
Basis: Alle Befragte, N = 2.072<br />
Personen<br />
Von diesen werden überdurchschnittlich<br />
häufig genutzt:<br />
religiöse Vereinigungen, Kulturvereine und<br />
ethnische Sportvereine<br />
48
Leipp: Migrantenorganisationen – Bekanntheit, Nutzung, Erwartungen<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Nutzung von Migrantenorganisationen<br />
Durchschnitt über alle Organisationstypen *<br />
hoch 1 B12<br />
Intellektuell-<br />
mittel 2<br />
niedrig 3<br />
Soziale<br />
Lage<br />
A3<br />
Religiösverwurzeltes<br />
Milieu<br />
67%<br />
AI<br />
Vormo<strong>der</strong>ne<br />
Tradition<br />
Konservativreligiös,<br />
strenge, rigide<br />
Grund- Wertvorstellungen,<br />
orientierung kulturelle Enklave<br />
= stark überrepräsentiert<br />
Indexwert ≥ 126<br />
Tradition<br />
61%<br />
= überrepräsentiert<br />
Indexwert 116 - 125<br />
AB12<br />
Statusorientiertes<br />
Milieu<br />
51%<br />
AB3<br />
Traditionelles<br />
Arbeitermilieu<br />
AII<br />
Ethnische Tradition<br />
Pflicht- und Akzeptanzwerte,<br />
materielle Sicherheit,<br />
traditionelle Moral<br />
B3<br />
Entwurzeltes<br />
Milieu<br />
54%<br />
BI<br />
Konsum-Materialismus<br />
Status, Besitz, Konsum,<br />
Aufstiegsorientierung,<br />
soziale Akzeptanz und<br />
Anpassung<br />
= durchschnittlich<br />
Indexwert 85 -115<br />
kosmopolitisches<br />
Milieu<br />
45%<br />
46%<br />
B23<br />
Adaptives<br />
Bürgerliches Milieu<br />
Mo<strong>der</strong>nisierung<br />
BII<br />
Individualisierung<br />
Selbstverwirklichung,<br />
Leistung, Genuss,<br />
bi-kulturelle Ambivalenz<br />
und Kulturkritik<br />
= unterrepräsentiert<br />
Indexwert 75 - 84<br />
BC2<br />
Multikulturelles<br />
Performermilieu<br />
37%<br />
BC3<br />
Hedonistischsubkulturelles<br />
Milieu<br />
47%<br />
© Sinus Sociovision 2008<br />
C<br />
Multi-Optionalität<br />
Postmo<strong>der</strong>nes Werte-<br />
Patchwork, Sinnsuche,<br />
multikulturelle<br />
Identifikation<br />
Neuidentifikation<br />
= stark unterrepräsentiert<br />
Indexwert ≤ 74<br />
Nutzung von Migrantenorganisationen<br />
Religiöse Vereinigungen *<br />
hoch 1 B12<br />
Intellektuell-<br />
mittel 2<br />
niedrig 3<br />
Soziale<br />
Lage<br />
A3<br />
Religiösverwurzeltes<br />
Milieu<br />
49%<br />
AI<br />
Vormo<strong>der</strong>ne<br />
Tradition<br />
Konservativreligiös,<br />
strenge, rigide<br />
Grund- Wertvorstellungen,<br />
orientierung kulturelle Enklave<br />
= stark überrepräsentiert<br />
Indexwert ≥ 126<br />
Tradition<br />
28%<br />
= überrepräsentiert<br />
Indexwert 116 - 125<br />
AB12<br />
Statusorientiertes<br />
Milieu<br />
22%<br />
AB3<br />
Traditionelles<br />
Arbeitermilieu<br />
AII<br />
Ethnische Tradition<br />
Pflicht- und Akzeptanzwerte,<br />
materielle Sicherheit,<br />
traditionelle Moral<br />
B3<br />
Entwurzeltes<br />
Milieu<br />
20%<br />
BI<br />
Konsum-Materialismus<br />
Status, Besitz, Konsum,<br />
Aufstiegsorientierung,<br />
soziale Akzeptanz und<br />
Anpassung<br />
= durchschnittlich<br />
Indexwert 85 -115<br />
kosmopolitisches<br />
Milieu<br />
19%<br />
15%<br />
B23<br />
Adaptives<br />
Bürgerliches Milieu<br />
Mo<strong>der</strong>nisierung<br />
BII<br />
Individualisierung<br />
Selbstverwirklichung,<br />
Leistung, Genuss,<br />
bi-kulturelle Ambivalenz<br />
und Kulturkritik<br />
= unterrepräsentiert<br />
Indexwert 75 - 84<br />
BC2<br />
Multikulturelles<br />
Performermilieu<br />
11%<br />
BC3<br />
Hedonistischsubkulturelles<br />
Milieu<br />
17%<br />
© Sinus Sociovision 2008<br />
C<br />
Multi-Optionalität<br />
Postmo<strong>der</strong>nes Werte-<br />
Patchwork, Sinnsuche,<br />
multikulturelle<br />
Identifikation<br />
Neuidentifikation<br />
= stark unterrepräsentiert<br />
Indexwert ≤ 74<br />
Ø = 50%<br />
* Listenvorgabe<br />
Basis:<br />
Alle Befragte,<br />
N = 2.072<br />
Ø = 21%<br />
* Listenvorgabe<br />
Basis:<br />
Alle Befragte,<br />
N = 2.072<br />
49
Leipp: Migrantenorganisationen – Bekanntheit, Nutzung, Erwartungen<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Nutzung von Migrantenorganisationen<br />
Kulturvereine *<br />
hoch 1 B12<br />
Intellektuell-<br />
mittel 2<br />
niedrig 3<br />
Soziale<br />
Lage<br />
A3<br />
Religiösverwurzeltes<br />
Milieu<br />
23%<br />
AI<br />
Vormo<strong>der</strong>ne<br />
Tradition<br />
Konservativreligiös,<br />
strenge, rigide<br />
Grund- Wertvorstellungen,<br />
orientierung kulturelle Enklave<br />
= stark überrepräsentiert<br />
Indexwert ≥ 126<br />
Tradition<br />
16%<br />
= überrepräsentiert<br />
Indexwert 116 - 125<br />
AB12<br />
Statusorientiertes<br />
Milieu<br />
19%<br />
AB3<br />
Traditionelles<br />
Arbeitermilieu<br />
AII<br />
Ethnische Tradition<br />
Pflicht- und Akzeptanzwerte,<br />
materielle Sicherheit,<br />
traditionelle Moral<br />
B3<br />
Entwurzeltes<br />
Milieu<br />
19%<br />
BI<br />
Konsum-Materialismus<br />
Status, Besitz, Konsum,<br />
Aufstiegsorientierung,<br />
soziale Akzeptanz und<br />
Anpassung<br />
= durchschnittlich<br />
Indexwert 85 -115<br />
kosmopolitisches<br />
Milieu<br />
12%<br />
15%<br />
B23<br />
Adaptives<br />
Bürgerliches Milieu<br />
Mo<strong>der</strong>nisierung<br />
BII<br />
Individualisierung<br />
Selbstverwirklichung,<br />
Leistung, Genuss,<br />
bi-kulturelle Ambivalenz<br />
und Kulturkritik<br />
= unterrepräsentiert<br />
Indexwert 75 - 84<br />
BC2<br />
Multikulturelles<br />
Performermilieu<br />
9%<br />
BC3<br />
Hedonistischsubkulturelles<br />
Milieu<br />
14%<br />
© Sinus Sociovision 2008<br />
C<br />
Multi-Optionalität<br />
Postmo<strong>der</strong>nes Werte-<br />
Patchwork, Sinnsuche,<br />
multikulturelle<br />
Identifikation<br />
Neuidentifikation<br />
= stark unterrepräsentiert<br />
Indexwert ≤ 74<br />
Nutzung von Migrantenorganisationen<br />
Ethnische Sportvereine *<br />
hoch 1 B12<br />
Intellektuell-<br />
mittel 2<br />
niedrig 3<br />
Soziale<br />
Lage<br />
A3<br />
Religiösverwurzeltes<br />
Milieu<br />
16%<br />
AI<br />
Vormo<strong>der</strong>ne<br />
Tradition<br />
Konservativreligiös,<br />
strenge, rigide<br />
Grund- Wertvorstellungen,<br />
orientierung kulturelle Enklave<br />
= stark überrepräsentiert<br />
Indexwert ≥ 126<br />
Tradition<br />
11%<br />
= überrepräsentiert<br />
Indexwert 116 - 125<br />
AB12<br />
Statusorientiertes<br />
Milieu<br />
14%<br />
AB3<br />
Traditionelles<br />
Arbeitermilieu<br />
AII<br />
Ethnische Tradition<br />
Pflicht- und Akzeptanzwerte,<br />
materielle Sicherheit,<br />
traditionelle Moral<br />
B3<br />
Entwurzeltes<br />
Milieu<br />
18%<br />
BI<br />
Konsum-Materialismus<br />
Status, Besitz, Konsum,<br />
Aufstiegsorientierung,<br />
soziale Akzeptanz und<br />
Anpassung<br />
= durchschnittlich<br />
Indexwert 85 -115<br />
kosmopolitisches<br />
Milieu<br />
10%<br />
6%<br />
B23<br />
Adaptives<br />
Bürgerliches Milieu<br />
Mo<strong>der</strong>nisierung<br />
BII<br />
Individualisierung<br />
Selbstverwirklichung,<br />
Leistung, Genuss,<br />
bi-kulturelle Ambivalenz<br />
und Kulturkritik<br />
= unterrepräsentiert<br />
Indexwert 75 - 84<br />
BC2<br />
Multikulturelles<br />
Performermilieu<br />
10%<br />
BC3<br />
Hedonistischsubkulturelles<br />
Milieu<br />
13%<br />
© Sinus Sociovision 2008<br />
C<br />
Multi-Optionalität<br />
Postmo<strong>der</strong>nes Werte-<br />
Patchwork, Sinnsuche,<br />
multikulturelle<br />
Identifikation<br />
Neuidentifikation<br />
= stark unterrepräsentiert<br />
Indexwert ≤ 74<br />
Ø = 15%<br />
* Listenvorgabe<br />
Basis:<br />
Alle Befragte,<br />
N = 2.072<br />
Ø = 12%<br />
* Listenvorgabe<br />
Basis:<br />
Alle Befragte,<br />
N = 2.072<br />
50
Leipp: Migrantenorganisationen – Bekanntheit, Nutzung, Erwartungen<br />
_________________________________________________________________________________<br />
1. Hintergrund zur Studie und allgemeine Ergebnisse<br />
2. Bekanntheit und Nutzung von Migrantenorganisationen<br />
3. Erwartungen an Migrantenorganisationen<br />
4. Aktivitäten in „deutschen“ Organisationen<br />
5. Zusammenfassung <strong>der</strong> Ergebnisse<br />
Wichtige Ergebnisse:<br />
� Hauptsächliches Motiv für die Inanspruchnahme o<strong>der</strong> die<br />
aktive Beteiligung ist die Möglichkeit…<br />
a) zur Begegnung mit Menschen aus eigener Herkunftskultur<br />
b) zur Pflege <strong>der</strong> Sprache und Kultur des Herkunftslandes<br />
c) soziale Kontakte zu haben<br />
� Daneben spielt die Hoffnung auf praktische Hilfen eine<br />
wichtige Rolle:<br />
a) direkte Unterstützungsleistungen (z.B. finanzielle Hilfen, Unterstützung bei<br />
Wohnungssuche)<br />
b) Dienstleistungsangebote (z.B. Bildungsangebote)<br />
19<br />
20<br />
51
Leipp: Migrantenorganisationen – Bekanntheit, Nutzung, Erwartungen<br />
_________________________________________________________________________________<br />
� Im Vergleich dazu ist die Möglichkeit zur politischen<br />
Interessensvertretung nachrangig:<br />
a) Interessen als Zugewan<strong>der</strong>te(r) vertreten<br />
b) Interessen meiner ethnischer Gruppe bzw. meines Herkunftslandes<br />
vertreten<br />
� Möglichkeit zur Religionsausübung wird ambivalent<br />
eingeschätzt:<br />
für religiöse MmM sehr wichtig; für nicht-religiöse MmM unwichtig<br />
Erwartungen an Migrantenorganisationen<br />
Soziale Kontakte und Sprache/Kultur Herkunftsland<br />
Ich habe die Erwartung an solche<br />
Organisationen / Vereine …<br />
… dass ich mit Landsleuten zusammenkommen<br />
kann<br />
… dass ich Menschen treffe, mit denen<br />
ich meine Freizeit verbringen kann<br />
… dass meine Familie / meine Kin<strong>der</strong><br />
Kontakt zur Kultur und Sprache<br />
meines Herkunftslandes bekommen<br />
… dass ich meine Religion ausüben<br />
kann<br />
… dass ich Anschluss an die Kultur und<br />
Sprache meines Herkunftslandes<br />
halten kann<br />
Basis: Alle Befragte, N = 2.072 Personen<br />
"Sehr wichtig"<br />
ältere Menschen<br />
21<br />
Beson<strong>der</strong>s wichtig für Personen:<br />
Personen mit einfacher Schulbildung<br />
Menschen aus <strong>der</strong> Türkei<br />
Befragte mit muslimischer<br />
Religionszugehörigkeit<br />
52
Leipp: Migrantenorganisationen – Bekanntheit, Nutzung, Erwartungen<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Erwartungen an Migrantenorganisationen<br />
… dass ich mit Landsleuten zusammenkommen kann *<br />
hoch 1 B12<br />
Intellektuell-<br />
mittel 2<br />
niedrig 3<br />
Soziale<br />
Lage<br />
A3<br />
Religiösverwurzeltes<br />
Milieu<br />
47%<br />
AI<br />
Vormo<strong>der</strong>ne<br />
Tradition<br />
Konservativreligiös,<br />
strenge, rigide<br />
Grund- Wertvorstellungen,<br />
orientierung kulturelle Enklave<br />
= stark überrepräsentiert<br />
Indexwert ≥ 126<br />
Tradition<br />
23%<br />
= überrepräsentiert<br />
Indexwert 116 - 125<br />
AB12<br />
Statusorientiertes<br />
Milieu<br />
27%<br />
AB3<br />
Traditionelles<br />
Arbeitermilieu<br />
AII<br />
Ethnische Tradition<br />
Pflicht- und Akzeptanzwerte,<br />
materielle Sicherheit,<br />
traditionelle Moral<br />
B3<br />
Entwurzeltes<br />
Milieu<br />
29%<br />
BI<br />
Konsum-Materialismus<br />
Status, Besitz, Konsum,<br />
Aufstiegsorientierung,<br />
soziale Akzeptanz und<br />
Anpassung<br />
= durchschnittlich<br />
Indexwert 85 -115<br />
kosmopolitisches<br />
Milieu<br />
16%<br />
17%<br />
B23<br />
Adaptives<br />
Bürgerliches Milieu<br />
Mo<strong>der</strong>nisierung<br />
BII<br />
Individualisierung<br />
Selbstverwirklichung,<br />
Leistung, Genuss,<br />
bi-kulturelle Ambivalenz<br />
und Kulturkritik<br />
= unterrepräsentiert<br />
Indexwert 75 - 84<br />
BC2<br />
Multikulturelles<br />
Performermilieu<br />
11%<br />
BC3<br />
Hedonistischsubkulturelles<br />
Milieu<br />
19%<br />
© Sinus Sociovision 2008<br />
C<br />
Multi-Optionalität<br />
Postmo<strong>der</strong>nes Werte-<br />
Patchwork, Sinnsuche,<br />
multikulturelle<br />
Identifikation<br />
Neuidentifikation<br />
= stark unterrepräsentiert<br />
Indexwert ≤ 74<br />
Erwartungen an Migrantenorganisationen<br />
Politische Interessensvertretung<br />
Ich habe die Erwartung an solche<br />
Organisationen / Vereine …<br />
… dass ich meine Interessen als<br />
Zugewan<strong>der</strong>te(r) in Deutschland<br />
wirkungsvoll vertreten kann<br />
… dass ich Informationen über die<br />
aktuelle Situation in meinem<br />
Herkunftsland bekomme<br />
… dass ich die Interessen meiner<br />
Landsleute in Deutschland vertreten<br />
kann<br />
… dass ich mich auch als Zuwan<strong>der</strong>er<br />
politisch engagieren kann<br />
… dass ich die Interessen meines<br />
Herkunftslandes in Deutschland<br />
vertreten kann<br />
Basis: Alle Befragte, N = 2.072 Personen<br />
"Sehr wichtig"<br />
Ø = 22%<br />
* Listenvorgabe<br />
Basis:<br />
Alle Befragte,<br />
N = 2.072<br />
Beson<strong>der</strong>s wichtig für Personen:<br />
� ab 60 Jahren, mit einfacher Schulbildung<br />
� aus <strong>der</strong> Türkei<br />
� mit muslimischer Religionszugehörigkeit<br />
� mit einfacher Schulbildung<br />
� aus <strong>der</strong> Türkei, aus an<strong>der</strong>en osteuropäischen<br />
Län<strong>der</strong>n (ohne ehemalige Sowjetunion und Polen)<br />
� mit muslimischer o<strong>der</strong> orthodoxer Religionszugehörigkeit<br />
� mit Menschen einfacher aus Schulbildung <strong>der</strong> Türkei<br />
� aus <strong>der</strong> Türkei, aus an<strong>der</strong>en osteuropäischen<br />
Län<strong>der</strong>n Befragte mit muslimischer<br />
� mit muslimischer Religionszugehörigkeit<br />
Religionszugehörigkeit<br />
� ab 60 Jahren<br />
� aus <strong>der</strong> Türkei, aus an<strong>der</strong>en osteuropäischen<br />
Län<strong>der</strong>n, aus Südeuropa<br />
� mit muslimischer Religionszugehörigkeit<br />
� ab 60 Jahren, mit einfacher Schulbildung<br />
� aus <strong>der</strong> Türkei, aus an<strong>der</strong>en osteuropäischen<br />
Län<strong>der</strong>n<br />
� mit muslimischer o<strong>der</strong> orthodoxer Religionszugehörigkeit<br />
53
Leipp: Migrantenorganisationen – Bekanntheit, Nutzung, Erwartungen<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Erwartungen an Migrantenorganisationen<br />
...dass ich mich auch als Zuwan<strong>der</strong>er politisch engagieren kann *<br />
hoch 1 B12<br />
Intellektuell-<br />
mittel 2<br />
niedrig 3<br />
Soziale<br />
Lage<br />
A3<br />
Religiösverwurzeltes<br />
Milieu<br />
10%<br />
AI<br />
Vormo<strong>der</strong>ne<br />
Tradition<br />
Konservativreligiös,<br />
strenge, rigide<br />
Grund- Wertvorstellungen,<br />
orientierung kulturelle Enklave<br />
= stark überrepräsentiert<br />
Indexwert ≥ 126<br />
Tradition<br />
12%<br />
= überrepräsentiert<br />
Indexwert 116 - 125<br />
AB12<br />
Statusorientiertes<br />
Milieu<br />
18%<br />
AB3<br />
Traditionelles<br />
Arbeitermilieu<br />
AII<br />
Ethnische Tradition<br />
Pflicht- und Akzeptanzwerte,<br />
materielle Sicherheit,<br />
traditionelle Moral<br />
B3<br />
Entwurzeltes<br />
Milieu<br />
9%<br />
BI<br />
Konsum-Materialismus<br />
Status, Besitz, Konsum,<br />
Aufstiegsorientierung,<br />
soziale Akzeptanz und<br />
Anpassung<br />
= durchschnittlich<br />
Indexwert 85 -115<br />
kosmopolitisches<br />
Milieu<br />
6%<br />
13%<br />
B23<br />
Adaptives<br />
Bürgerliches Milieu<br />
Mo<strong>der</strong>nisierung<br />
BII<br />
Individualisierung<br />
Selbstverwirklichung,<br />
Leistung, Genuss,<br />
bi-kulturelle Ambivalenz<br />
und Kulturkritik<br />
= unterrepräsentiert<br />
Indexwert 75 - 84<br />
BC2<br />
Multikulturelles<br />
Performermilieu<br />
6%<br />
BC3<br />
Hedonistischsubkulturelles<br />
Milieu<br />
11%<br />
© Sinus Sociovision 2008<br />
C<br />
Multi-Optionalität<br />
Postmo<strong>der</strong>nes Werte-<br />
Patchwork, Sinnsuche,<br />
multikulturelle<br />
Identifikation<br />
Neuidentifikation<br />
= stark unterrepräsentiert<br />
Indexwert ≤ 74<br />
1. Hintergrund zur Studie und allgemeine Ergebnisse<br />
2. Bekanntheit und Nutzung von Migrantenorganisationen<br />
3. Erwartungen an Migrantenorganisationen<br />
4. Aktivitäten in „deutschen“ Organisationen<br />
5. Zusammenfassung <strong>der</strong> Ergebnisse<br />
Ø = 11%<br />
* Listenvorgabe<br />
Basis:<br />
Alle Befragte,<br />
N = 2.072<br />
26<br />
54
Leipp: Migrantenorganisationen – Bekanntheit, Nutzung, Erwartungen<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Engagement in „deutschen“<br />
Organisationen zum Vergleich<br />
"Sind Sie selbst aktiv in<br />
Organisationen o<strong>der</strong> Vereinen,<br />
die von Deutschen getragen werden?"<br />
Aktiv<br />
Basis: Alle Befragte, N = 2.072 Personen<br />
18% 82% Ja 12% 70%<br />
"Würden Sie gerne dort<br />
mitmachen?"<br />
Selbst aktiv in dt. Organisationen<br />
o<strong>der</strong> Vereinen (18%)<br />
Nicht aktiv in dt. Organisationen<br />
o<strong>der</strong> Vereinen (82%)<br />
davon:<br />
Würde gerne mitmachen<br />
(12%)<br />
Möchte nicht mitmachen<br />
(70%)<br />
Aktivität in deutschen Organ./Vereinen *<br />
"Bin selbst aktiv"<br />
hoch 1 B12<br />
Intellektuell-<br />
mittel 2<br />
niedrig 3<br />
Soziale<br />
Lage<br />
A3<br />
Religiösverwurzeltes<br />
Milieu<br />
7%<br />
AI<br />
Vormo<strong>der</strong>ne<br />
Tradition<br />
Konservativreligiös,<br />
strenge, rigide<br />
Grund- Wertvorstellungen,<br />
orientierung kulturelle Enklave<br />
= stark überrepräsentiert<br />
Indexwert ≥ 126<br />
Tradition<br />
8%<br />
= überrepräsentiert<br />
Indexwert 116 - 125<br />
AB12<br />
Statusorientiertes<br />
Milieu<br />
18%<br />
AB3<br />
Traditionelles<br />
Arbeitermilieu<br />
AII<br />
Ethnische Tradition<br />
Pflicht- und Akzeptanzwerte,<br />
materielle Sicherheit,<br />
traditionelle Moral<br />
B3<br />
Entwurzeltes<br />
Milieu<br />
5%<br />
BI<br />
Konsum-Materialismus<br />
Status, Besitz, Konsum,<br />
Aufstiegsorientierung,<br />
soziale Akzeptanz und<br />
Anpassung<br />
= durchschnittlich<br />
Indexwert 85 -115<br />
kosmopolitisches<br />
Milieu<br />
16%<br />
33%<br />
B23<br />
Adaptives<br />
Bürgerliches Milieu<br />
Mo<strong>der</strong>nisierung<br />
BII<br />
Individualisierung<br />
Selbstverwirklichung,<br />
Leistung, Genuss,<br />
bi-kulturelle Ambivalenz<br />
und Kulturkritik<br />
= unterrepräsentiert<br />
Indexwert 75 - 84<br />
BC2<br />
Multikulturelles<br />
Performermilieu<br />
28%<br />
BC3<br />
Hedonistischsubkulturelles<br />
Milieu<br />
21%<br />
© Sinus Sociovision 2008<br />
C<br />
Multi-Optionalität<br />
Postmo<strong>der</strong>nes Werte-<br />
Patchwork, Sinnsuche,<br />
multikulturelle<br />
Identifikation<br />
Neuidentifikation<br />
= stark unterrepräsentiert<br />
Indexwert ≤ 74<br />
27<br />
Ø = 18%<br />
* Organisationen /<br />
Vereine, die von<br />
Deutschen getragen<br />
werden<br />
Basis:<br />
Alle Befragte,<br />
N = 2.072<br />
55
Leipp: Migrantenorganisationen – Bekanntheit, Nutzung, Erwartungen<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Gründe gegen eine Beteiligung an deutschen<br />
Organisationen / Vereinen<br />
� Ich habe dafür keine Zeit<br />
� Ich kenne dort niemanden<br />
� Es gibt hier am Ort keine solche<br />
Organisation, die meinen Interessen<br />
entspricht<br />
� Die Mitgliedsgebühr bzw. an<strong>der</strong>e<br />
finanzielle Aufwendungen sind mir zu<br />
hoch<br />
� Ich glaube nicht, dass ich als Zuwan<strong>der</strong>er<br />
dort Anschluss finden kann<br />
� Ich befürchte, dass ich als<br />
Zuwan<strong>der</strong>er ausgegrenzt werde<br />
� Ich kann dafür nicht genug Deutsch<br />
� Als Zuwan<strong>der</strong>er habe ich keine Möglichkeit,<br />
in einem deutschen Verein<br />
meinen Interessen nachzugehen<br />
Basis: Migranten, die nicht in deutschen Organisationen o<strong>der</strong> Vereinen aktiv sind, N = 1.709 Personen<br />
Soziale Distanz<br />
Ausgrenzung<br />
1. Hintergrund zur Studie und allgemeine Ergebnisse<br />
2. Bekanntheit und Nutzung von Migrantenorganisationen<br />
3. Erwartungen an Migrantenorganisationen<br />
4. Aktivitäten in „deutschen“ Organisationen<br />
5. Zusammenfassung <strong>der</strong> Ergebnisse<br />
30<br />
56
Leipp: Migrantenorganisationen – Bekanntheit, Nutzung, Erwartungen<br />
_________________________________________________________________________________<br />
� (Relativ) geringes Engagement – geringe Repräsentativität<br />
� Fokussierte Nutzung bzw. Engagement –<br />
Zugangsschwierigkeiten<br />
� Fokussierte Nutzung bzw. Engagement –<br />
Zugangsmöglichkeiten<br />
� Soziale Kontakte statt politische Interessensvertretung<br />
� Engagement in deutschen Organisationen (auch) för<strong>der</strong>n<br />
Migrantenorganisationen - Bekanntheit, Nutzung, Erwartungen.<br />
Ergebnisse aus <strong>der</strong> Sinus Migranten-Milieu®-Studie<br />
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!<br />
31<br />
32<br />
57
Pintus: PAKT – anpacken – zupacken<br />
_________________________________________________________________________________<br />
3. Teil II<br />
3.1 Präsentation Modellprojekte<br />
3.1.1 PAKT – anpacken – zupacken. Mentoring für einen interkulturellen Migrantinnenverein<br />
Manuela Pintus, <strong>Caritas</strong>verband Wiesbaden-Rheingau-Taunus e.V.<br />
BAMF Bundesmodellprojekt<br />
PAKT – anpacken – zupacken –<br />
Mentoring für einen interkulturellen Migrantinnenverein<br />
Migrantenorganisationen-Expertenworkshop des DCV, 23./24. März 2010 in Fulda - Manuela Pintus<br />
Bundesmodellprojekt PAKT<br />
Maßnahmeträger: <strong>Caritas</strong>verband Wiesbaden-Rheingau-Taunus e.V.<br />
Projektpartner: MigraMundi e.V.<br />
Projektlaufzeit: 15.12.2009 bis 14.12.2011<br />
Projektort: Wiesbaden<br />
Projektleiterin: Manuela Pintus<br />
Mitarbeiterinnen: Ayṣegül Güler, Özlem Ṣenay<br />
Migrantenorganisationen-Expertenworkshop des DCV, 23./24. März 2010 in Fulda - Manuela Pintus<br />
1<br />
2<br />
58
Pintus: PAKT – anpacken – zupacken<br />
_________________________________________________________________________________<br />
MigraMundi e.V.<br />
- Gemeinnütziger Verein<br />
- Am 8.12.2009 gegründet<br />
- 13 Gründungsmitglie<strong>der</strong><br />
- Derzeit Frauen aus: Afghanistan,<br />
Dominikanische Republik, Irak,<br />
Kasachstan, Kolumbien, Kroatien, Kuba,<br />
Marokko, Peru, Russland, Türkei<br />
- Kulturell, religiös, ethnisch und politisch<br />
unabhängig<br />
Migrantenorganisationen-Expertenworkshop des DCV, 23./24. März 2010 in Fulda - Manuela Pintus<br />
MigraMundi e.V.<br />
Jugendhilfe<br />
Erziehung und<br />
Bildung<br />
Umwelt und<br />
Naturschutz<br />
Völkerverständigung<br />
MigraMundi e.V.<br />
Partizipation von<br />
Min<strong>der</strong>heiten<br />
Migrantenorganisationen-Expertenworkshop des DCV, 23./24. März 2010 in Fulda - Manuela Pintus<br />
gegenseitige<br />
Akzeptanz<br />
Abbau von<br />
Fremdenfeindlichkeit<br />
För<strong>der</strong>ung des<br />
Demokratieverständnisses<br />
3<br />
4<br />
59
Pintus: PAKT – anpacken – zupacken<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Ausgangssituation<br />
31,5 % Menschen mit Migrationshintergrund in Wiesbaden<br />
- 45,7 % Ortsteil Amöneburg<br />
- 69,9 % Ortsteil Siedlung Sauerland<br />
- 64,4 % Ortsteil Schelmengraben<br />
- 58,0 % Ortsteil Klarenthal Nord<br />
Migrantenorganisationen-Expertenworkshop des DCV, 23./24. März 2010 in Fulda - Manuela Pintus<br />
Ausgangssituation<br />
Ca. 90 Migrantenvereine in Wiesbaden<br />
- Kulturell, religiös, ethnisch und/o<strong>der</strong> politisch geprägt<br />
- Überwiegend von Männern dominiert<br />
- Gering ausgeprägte Professionalität<br />
- Keine hauptamtlichen Strukturen<br />
Migrantenorganisationen-Expertenworkshop des DCV, 23./24. März 2010 in Fulda - Manuela Pintus<br />
5<br />
6<br />
60
Pintus: PAKT – anpacken – zupacken<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Zielgruppe<br />
- Als Vereinsmitglie<strong>der</strong> Frauen mit Migrationshintergrund<br />
unterschiedlicher kultureller, ethnischer und/o<strong>der</strong><br />
religiöser Zugehörigkeit<br />
- Wiesbadener Bevölkerung mit und ohne<br />
Migrationshintergrund<br />
- Gremien, Soziale Einrichtungen und Institutionen<br />
Migrantenorganisationen-Expertenworkshop des DCV, 23./24. März 2010 in Fulda - Manuela Pintus<br />
<strong>Projektziele</strong><br />
Hauptziele:<br />
- Etablierung eines kulturell, religiös, ethnisch und<br />
politisch unabhängigen Migrantinnenvereins<br />
- Vernetzung mit sozialen Einrichtungen, Institutionen und<br />
fachspezifischen Gremien<br />
Migrantenorganisationen-Expertenworkshop des DCV, 23./24. März 2010 in Fulda - Manuela Pintus<br />
7<br />
8<br />
61
Pintus: PAKT – anpacken – zupacken<br />
_________________________________________________________________________________<br />
<strong>Projektziele</strong><br />
Unterziele:<br />
1. Vereinsmitglie<strong>der</strong> sind qualifiziert<br />
2. Vereinsstrukturen sind organisiert<br />
3. Verein ist in wichtigen kommunalen Gremien vertreten<br />
4. Verein ist kommunal bekannt<br />
5. Tandemprojekt zw. <strong>Caritas</strong> und Verein wird durchgeführt<br />
6. Verein ist anerkannter Projektträger<br />
Migrantenorganisationen-Expertenworkshop des DCV, 23./24. März 2010 in Fulda - Manuela Pintus<br />
<strong>Umsetzung</strong> <strong>der</strong> <strong>Projektziele</strong><br />
1. Vereinsmitglie<strong>der</strong> sind qualifiziert<br />
- 12 ganztägige Schulungen finden statt<br />
- Themen und Inhalte werden von den Migrantinnen mitbestimmt<br />
- Mindestens 12 Teilnehmerinnen nehmen an den Schulungen teil<br />
Migrantenorganisationen-Expertenworkshop des DCV, 23./24. März 2010 in Fulda - Manuela Pintus<br />
9<br />
10<br />
62
Pintus: PAKT – anpacken – zupacken<br />
_________________________________________________________________________________<br />
<strong>Umsetzung</strong> <strong>der</strong> <strong>Projektziele</strong><br />
2. Vereinsstrukturen sind organisiert<br />
- Vorstand ist gewählt<br />
- Zuständigkeiten sind geklärt<br />
- Leitbild, Ziele und Handlungsfel<strong>der</strong> sind definiert<br />
- Vorstandssitzungen finden statt<br />
- Mitglie<strong>der</strong>versammlungen finden statt<br />
- Vereinstreffen finden statt<br />
Migrantenorganisationen-Expertenworkshop des DCV, 23./24. März 2010 in Fulda - Manuela Pintus<br />
<strong>Umsetzung</strong> <strong>der</strong> <strong>Projektziele</strong><br />
3. Verein ist in wichtigen kommunalen Gremien vertreten<br />
- Vereinsmitglie<strong>der</strong> nehmen an Stadtteilkonferenzen teil<br />
- Verein ist den entsprechen Ortbeiräten bekannt<br />
- Verein stellt sich als Liste beim Auslän<strong>der</strong>beirat auf<br />
- Verein ist bei den relevanten parlamentarischen Ausschüssen<br />
bekannt<br />
Migrantenorganisationen-Expertenworkshop des DCV, 23./24. März 2010 in Fulda - Manuela Pintus<br />
11<br />
12<br />
63
Pintus: PAKT – anpacken – zupacken<br />
_________________________________________________________________________________<br />
<strong>Umsetzung</strong> <strong>der</strong> <strong>Projektziele</strong><br />
4. Verein ist kommunal bekannt<br />
- In <strong>der</strong> örtlichen Presse wurde über den Verein berichtet<br />
- Flyer wurde erstellt und verteilt<br />
- Internetseite wurde erstellt<br />
- Gespräche mit diversen Vereinen, sozialen Einrichtungen haben<br />
stattgefunden<br />
- Der Verein hat sich bei öffentlichen Veranstaltungen stadtweit <strong>der</strong><br />
Bevölkerung vorgestellt (z.B. Stand beim Internationalen<br />
Sommerfest des Auslän<strong>der</strong>beirats)<br />
Migrantenorganisationen-Expertenworkshop des DCV, 23./24. März 2010 in Fulda - Manuela Pintus<br />
<strong>Umsetzung</strong> <strong>der</strong> <strong>Projektziele</strong><br />
5. Tandemprojekt zw. <strong>Caritas</strong> und Verein wird durchgeführt<br />
- Erarbeitung des Themas und des Handlungsfeldes<br />
- Erstellung <strong>der</strong> Projektkonzeption<br />
- Projektbeantragung<br />
- Projektdurchführung<br />
- Projektabrechnung<br />
Migrantenorganisationen-Expertenworkshop des DCV, 23./24. März 2010 in Fulda - Manuela Pintus<br />
13<br />
14<br />
64
Pintus: PAKT – anpacken – zupacken<br />
_________________________________________________________________________________<br />
<strong>Umsetzung</strong> <strong>der</strong> <strong>Projektziele</strong><br />
6. Verein ist anerkannter Projektträger<br />
Verein ist mit MO‘s, sozialen Einrichtungen, Institutionen<br />
und fachspezifischen Gremien vernetzt.<br />
Der Verein führt eigene Projekte und Kooperationsprojekte<br />
durch.<br />
Migrantenorganisationen-Expertenworkshop des DCV, 23./24. März 2010 in Fulda - Manuela Pintus<br />
Schulungen Block A<br />
Praktisches Handwerkszeug, um einen Verein<br />
professionell führen und Projektanträge stellen zu<br />
können.<br />
Einige Beispiele:<br />
- Vereinsführung und -verwaltung<br />
- Projektmanagement<br />
- Zeitmanagement<br />
- Kommunikationstraining und Rhetorik<br />
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />
Migrantenorganisationen-Expertenworkshop des DCV, 23./24. März 2010 in Fulda - Manuela Pintus<br />
15<br />
16<br />
65
Pintus: PAKT – anpacken – zupacken<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Schulungen Block B<br />
Auseinan<strong>der</strong>setzung mit migrationsspezifischen Themen, die<br />
interkulturelle Prozesse einleiten und bewusst machen.<br />
Einige Beispiele:<br />
- Psychogenese <strong>der</strong> Migration<br />
- Biographiearbeit, Trauma und Trauer in <strong>der</strong> Migration<br />
- Soziales Lernen, Gruppendynamik, Konformitätsdruck<br />
- Vorurteile, Stigma, Diskriminierung<br />
- Bi-kulturelle Identität, Werte und Normen, Konfliktbewältigung<br />
Migrantenorganisationen-Expertenworkshop des DCV, 23./24. März 2010 in Fulda - Manuela Pintus<br />
Hospitationen bei <strong>der</strong> <strong>Caritas</strong><br />
Zum Beispiel in folgenden Bereichen:<br />
- Personalverwaltung<br />
- Buchhaltung<br />
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />
- Administration<br />
- Familien-, Drogen-, Schuldnerberatung<br />
Migrantenorganisationen-Expertenworkshop des DCV, 23./24. März 2010 in Fulda - Manuela Pintus<br />
17<br />
18<br />
66
Pintus: PAKT – anpacken – zupacken<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Nachhaltigkeit<br />
Am Ende des Projektes wird <strong>der</strong> Verein professioneller<br />
Ansprechpartner sowohl für kommunale Institutionen und<br />
Einrichtungen als auch für Menschen mit und ohne<br />
Migrationshintergrund sein.<br />
Migrantenorganisationen-Expertenworkshop des DCV, 23./24. März 2010 in Fulda - Manuela Pintus<br />
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!<br />
Migrantenorganisationen-Expertenworkshop des DCV, 23./24. März 2010 in Fulda - Manuela Pintus<br />
19<br />
20<br />
67
Pintus: PAKT – anpacken – zupacken<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Fabel vom Fuchs und dem Storch<br />
Vor langer Zeit hat einmal ein Fuchs einen Storch zum Abendessen<br />
eingeladen. Er bot dem Storch ein köstliches Mahl auf einem flachen<br />
Teller an. Lei<strong>der</strong> konnte <strong>der</strong> Gast des Fuchses nichts essen, denn <strong>der</strong><br />
Storch hatte Schwierigkeiten mit seinem langen Schnabel die Stücke von<br />
dem flachen Teller aufzupicken.<br />
Nachdem <strong>der</strong> Fuchs den Storch besucht hatte, ging auch er hungrig nach<br />
Hause. Der Fuchs hatte große Schwierigkeiten mit seiner Schnauze in die<br />
Kanne zu gelangen, in <strong>der</strong> <strong>der</strong> Storch sein Abendessen anbot.<br />
Nach Jean de la Fontaine<br />
Migrantenorganisationen-Expertenworkshop des DCV, 23./24. März 2010 in Fulda - Manuela Pintus<br />
21<br />
68
Hüllen: Interkulturelle Öffnung<br />
_________________________________________________________________________________<br />
3.1.2 Interkulturelle Öffnung – professionelles und ehrenamtliches Engagement vor<br />
Ort verbinden<br />
Dorothee Hüllen, <strong>Caritas</strong>-Sozialdienste e.V. Mülheim an <strong>der</strong> Ruhr<br />
Interkulturelle Öffnung des<br />
<strong>Caritas</strong>- Sozialdienste e. V.<br />
Mülheim an <strong>der</strong> Ruhr<br />
Interkulturelle Öffnung<br />
Ausgangssituation:<br />
• Flüchtlingsberatung, Integrationsagentur<br />
• 20 Jahre Integrationsrat<br />
• Kontaktpflege zu Migrantenorganisationen<br />
• psychologischen Sprechstunde für<br />
türkische und binationale Paare<br />
• interkulturelles Kompetenz-Coaching <strong>der</strong><br />
MitarbeiterInnen verschiedener Fachdienste<br />
69
Hüllen: Interkulturelle Öffnung<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Interkulturelle Öffnung<br />
=> Sensibilisierung und Qualifizierung <strong>der</strong> gesamten<br />
Organisation <strong>der</strong> Regeldienste<br />
Ziele:<br />
• KollegInnen mit Zuwan<strong>der</strong>ungsgeschichte bereichern die<br />
Teams<br />
• Mehr Menschen mit Zuwan<strong>der</strong>ungsgeschichte nehmen<br />
die Angebote wahr<br />
• Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen hat sich<br />
entwickelt<br />
• Interkulturelles Profil wirkt nach innen und außen<br />
Interkulturelle Öffnung<br />
Personal- und<br />
Organisationsentwicklungsprozess:<br />
• Bestandsaufnahme durch Interviews in<br />
Fachdiensten<br />
• MitarbeiterInnen gestalten gemeinsam den Weg<br />
–Weltcafé<br />
– Dialog-Frühstück<br />
– Coaching und Beratung<br />
• MitarbeiterInnen bilden sich interkulturell fort<br />
70
Hüllen: Interkulturelle Öffnung<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Interkulturelle Öffnung<br />
Erste konkrete Ergebnisse<br />
• Interkulturelle Leitlinien<br />
• Landkarte <strong>der</strong> Sprachen und Kulturen<br />
• Konzeptentwicklung im offenen Ganztag<br />
• Elterncafé <strong>der</strong> Schwangerschaftsberatung<br />
• Neue Angebote in <strong>der</strong> Integrationsagentur:<br />
Frauenkochen, Frauenfrühstück, Expertenbesuche<br />
• Mitarbeit in regionalen Integrationsnetzwerken<br />
• Tandem-Projekt „Verstärkte Partizipation von<br />
Migrantenorganisationen“<br />
Interkulturelle Öffnung<br />
– professionelles und<br />
ehrenamtliches Engagement vor<br />
Ort verbinden<br />
71
Hüllen: Interkulturelle Öffnung<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Ziele des Tandem-Projektes<br />
• Stärkung des Engagements für und von Familien mit<br />
Zuwan<strong>der</strong>ungsgeschichte<br />
• Qualifizierung von Migrantinnen zu ‚interkulturellen<br />
Gesundheitsmediatorinnen’<br />
• Einbindung von Migrantinnen in städtische und karitative<br />
Dienste<br />
• För<strong>der</strong>ung von Kooperationen zwischen ehrenamtlich<br />
und professionell Tätigen<br />
• interkulturelle Qualifizierung, Begleitung für<br />
Ehrenamtliche<br />
Struktur des Projektes<br />
Jan<br />
Febr<br />
ab<br />
März<br />
<strong>Caritas</strong>-<br />
Sozialdienste e.V.<br />
Ehrenamtliche<br />
Interkulturelle Öffnungprofessionelles<br />
und ehrenamtliches<br />
Engagement vor Ort verbinden<br />
Kennen lernen<br />
T a n d e m<br />
Vorbereitung<br />
Tandemcafé<br />
2010<br />
2011<br />
Multikultureller<br />
Familienverein<br />
„fitte Mütter“<br />
Austauschen Zusammenarbeiten<br />
72
Hüllen: Interkulturelle Öffnung<br />
_________________________________________________________________________________<br />
ab<br />
April<br />
Ende<br />
Aug.<br />
Sept.’10<br />
-<br />
Sept.‘11<br />
Begleitung<br />
Ehrenamtliche<br />
Umgang mit<br />
Unpünktlichkeit<br />
Unterschiedliche<br />
Leistungsniveaus<br />
Einsatz von Medien<br />
Spracherwerb<br />
Sprachentwicklung<br />
T<br />
a<br />
n<br />
d<br />
e<br />
m<br />
Qualifizierung<br />
20 Frauen<br />
Interkulturelle Gesundheitsmediatorinnen<br />
Aufbauqualifizierung<br />
„fitte Mütter“<br />
Gruppenleitung<br />
Persönlichkeitsstärkung<br />
Entwicklung des Kindes<br />
Neue Technologien<br />
Praktikum<br />
Gesundheitsamt<br />
10x3<br />
10x3<br />
Zertifikat: „Interkulturelle<br />
Gesundheitsmediatorinnen“<br />
Erste Erfahrungen<br />
- 7 Fundamente für eine gute Zusammenarbeit<br />
• Von Anfang an gemeinsam<br />
• konkrete, smarte Ziele<br />
• gemeinsames Leitbild (Werte/Haltung)<br />
• Potenziale, Ressourcen <strong>der</strong> Partner<br />
• Gleichwertigkeit nach außen tragen<br />
• regelmäßige Planungstreffen auf Augenhöhe<br />
• Kontinuierliches Reflektieren <strong>der</strong> gemeinsamen Arbeit<br />
73
Hüllen: Interkulturelle Öffnung<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Zukunftsvisionen<br />
• Verbindungen und Kontakte<br />
– Erfolgreiche Kooperationen bestehen langfristig<br />
– Immer wie<strong>der</strong> neue Kooperationen entstehen<br />
• Netzwerk mit vielen Migrantenorganisationen<br />
• Multikultureller Beirat <strong>der</strong> <strong>Caritas</strong> Sozialdienste<br />
• Einbezug von Migrantenorganisationen in den<br />
Offenen-Ganztag<br />
74
Zusammenfassung <strong>der</strong> Diskussionspunkte<br />
_________________________________________________________________________________<br />
3.2 Zusammenfassung <strong>der</strong> Diskussionspunkte<br />
Im Rahmen eines World-Cafés, in Arbeitsgruppen sowie in Gesprächsrunden diskutierten die<br />
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Expertenworkshops die Grundlagen <strong>der</strong> Zusammenarbeit<br />
zwischen <strong>Caritas</strong> und Migrantenorganisationen, die konkrete <strong>Umsetzung</strong> <strong>der</strong> Zusammenarbeit<br />
in <strong>der</strong> Praxis und formulierten Handlungsempfehlungen für die <strong>Caritas</strong>. Im Folgenden<br />
werden die unterschiedlichen Aspekte dieser Diskussionen zusammenfassend dargestellt.<br />
Die grundsätzliche Motivation <strong>der</strong> <strong>Caritas</strong>, sich für Menschen mit Migrationshintergrund und<br />
ihren Selbstorganisationen einzusetzen, bezieht sich auf das Leitbild des Verbandes. Demnach<br />
setzt sich die <strong>Caritas</strong> für verbesserte Teilhabechancen von benachteiligten Gruppen in<br />
<strong>der</strong> Gesellschaft ein. Die Gestaltung des Zusammenlebens zwischen Menschen mit und ohne<br />
Migrationshintergrund kann allerdings – darauf wurde in den Diskussionen hingewiesen –<br />
nur gelingen, wenn sich auch Menschen mit Zuwan<strong>der</strong>ungsgeschichte in die Integrationsarbeit<br />
einbringen. Dabei können die Angebote <strong>der</strong> Wohlfahrtsverbände durch solche von<br />
Migrantenorganisationen ergänzt o<strong>der</strong> aber gemeinsam neue Formen von Angeboten entwickelt<br />
werden. Gerade die anwaltschaftliche Funktion <strong>der</strong> <strong>Caritas</strong> verpflichtet dazu, Migrantenorganisationen<br />
als gleichwertige Partner wahrzunehmen, auf sie zuzugehen und von ihnen<br />
zu lernen.<br />
Die Zielsetzung einer Zusammenarbeit zwischen den Diensten und Einrichtungen <strong>der</strong> <strong>Caritas</strong><br />
und Migrantenorganisationen liegt darin, noch besser die Bedarfe <strong>der</strong> Menschen mit<br />
Migrationshintergrund kennenzulernen sowie Themen <strong>der</strong> Integrationsarbeit in ethnische<br />
Gruppen vermitteln zu können. Weitere Ziele einer Kooperation sind die Erschließung <strong>der</strong><br />
Potentiale und Ressourcen <strong>der</strong> Migrantenorganisationen, die För<strong>der</strong>ung des Bürgerschaftliche<br />
Engagements bei Migranten sowie die Einbindung von Migrantenorganisationen in<br />
kommunale Gremien und Netzwerke.<br />
Darüber hinaus diskutierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch die Frage, worin die<br />
Chancen in <strong>der</strong> Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen liegen. Dabei wurde auf <strong>der</strong><br />
einen Seite betont, dass durch die spezifischen Kompetenzen und Erfahrungen auf beiden<br />
Seiten Synergieeffekte in <strong>der</strong> Integrationsarbeit hergestellt werden können. Auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en<br />
Seite wurde darauf verwiesen, dass durch die Zusammenarbeit die interkulturelle Öffnung<br />
des Wohlfahrtsverbandes vorangebracht und <strong>der</strong> Zugang zu Migrantengruppen verbessert<br />
werden kann.<br />
Bei <strong>der</strong> Frage nach den Risiken in <strong>der</strong> Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen wurde<br />
darauf hingewiesen, dass diese vermehrt Träger von Integrationsmaßnahmen und somit<br />
Konkurrenten für die Wohlfahrtsverbände werden. Des Weiteren wurde kritisch angemerkt,<br />
dass durch die Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen evtl. nicht unterstützenswerte<br />
Selbstorganisationen geför<strong>der</strong>t werden. Ein zusätzliches Risiko in <strong>der</strong> Zusammenarbeit mit<br />
Selbstorganisationen von Migranten liegt darin, dass Migrantenorganisationen als Lieferanten<br />
von Teilnehmern für Angebote <strong>der</strong> <strong>Caritas</strong> „ausgenutzt“ werden könnten. Gleichzeit besteht<br />
aber auch die Gefahr, dass Dienste und Einrichtungen <strong>der</strong> <strong>Caritas</strong> in <strong>der</strong> Kooperation<br />
auf die Durchführung von Verwaltungsaufgaben reduziert werden.<br />
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sprachen auch über die Frage, unter welchen Umständen<br />
eine Zusammenarbeit zwischen <strong>der</strong> <strong>Caritas</strong> und Migrantenorganisationen erfolgreich<br />
initiiert und durchgeführt werden kann. Bei <strong>der</strong> Initiierung kann <strong>der</strong> Zugang zu Migrantenorganisationen<br />
über Key-Persons sehr hilfreich sein. Für die Durchführung <strong>der</strong> Zusammenarbeit<br />
ist zentral, dass sich beide Seiten nicht als Konkurrenten, son<strong>der</strong>n als Partner ansehen.<br />
Auch gut qualifizierte und professionell arbeitende Migrantenorganisationen können wichtige<br />
Partner in <strong>der</strong> Integrationsarbeit sein und bleiben. Wichtig ist zudem, Ängste und Vorbehalte<br />
auf beiden Seiten (z. B. hinsichtlich islamisch-fundamentalistische Tendenzen bei Migrante-<br />
75
Zusammenfassung <strong>der</strong> Diskussionspunkte<br />
_________________________________________________________________________________<br />
norganisation o<strong>der</strong> aber katholischer Missionierungsabsichten bei <strong>der</strong> <strong>Caritas</strong>) abzubauen<br />
bzw. zu klären. Ein weiteres entscheidendes Kriterium für eine erfolgreiche Zusammenarbeit<br />
ist, dass sich beide Seiten „auf Augenhöhe“ begegnen. Dazu gehören folgende Aspekte:<br />
- Klärung und Absprache <strong>der</strong> jeweiligen Kompetenzen, Ressourcen und Aufgaben,<br />
- Offenheit und Transparenz <strong>der</strong> jeweiligen Ziele und Aktivitäten,<br />
- respektvoller Umgang,<br />
- Wünsche, Vorstellungen und Bedarfe <strong>der</strong> Migrantenorganisationen berücksichtigen,<br />
- Gefühlslagen und Emotionen auf beiden Seiten ernst nehmen,<br />
- Anerkennen, dass Zusammenarbeit auf Augenhöhe anstrengend sein sowie einen<br />
hohen persönlichen und zeitlichen Einsatz erfor<strong>der</strong>n kann,<br />
- Aspekte <strong>der</strong> Zusammenarbeit „auf Augenhöhe“ tatsächlich verinnerlichen; dadurch<br />
entsteht „Herzenshöhe“.<br />
Als eine Handlungsempfehlung formulierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass die<br />
verbandliche <strong>Caritas</strong> ihr Selbstverständnis und ihre Rolle in <strong>der</strong> Integrationsarbeit zukünftig<br />
stärker hinterfragen soll. Es gilt anzuerkennen, dass Migrantenorganisationen eine noch größere<br />
Rolle im Gemeinwesen spielen werden. Dieser Prozess sollte durch eine konsequente<br />
<strong>Umsetzung</strong> des Empowerments von Migrantenorganisationen unterstützt werden. Dazu ist<br />
es notwendig, mit ihnen neue Partnerschaften aufzubauen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang<br />
auch, die interkulturelle Öffnung des Verbandes weiter voranzubringen und die<br />
Zusammenarbeit mit Migrantenorganisation im gesamten Verband stärker zu thematisieren.<br />
Dies könnte durch einen gesamtverbandlichen Kongress o<strong>der</strong> durch die Etablierung von<br />
Plattformen für den innerverbandlichen Dialog zum Themenbereich umgesetzt werden.<br />
Gleichzeitig könnten auch Kompetenzzentren als Ansprechpartner für Migrantenorganisationen<br />
in einzelnen Regionen o<strong>der</strong> Diözesen aufgebaut werden. Zuletzt wurde aber auch darauf<br />
hingewiesen, dass die Grenzen und Möglichkeiten eines katholischen Wohlfahrtsverbandes<br />
in <strong>der</strong> Zusammenarbeit mit Migrantenorganisation weiter diskutiert werden sollte. Auch<br />
wurde betont, dass gerade durch eine enge Zusammenarbeit mit den muttersprachlichen<br />
Gemeinden <strong>der</strong> Katholischen Kirche Menschen mit Migrationshintergrund sehr gut angesprochen<br />
und erreicht werden können.<br />
76
4. Anhang<br />
1. Flyer Expertenworkshop<br />
2. Teilnehmerliste<br />
77
Expertenworkshop des<br />
Deutschen <strong>Caritas</strong>verbandes<br />
Migrantenorganisationen – ein Schlüssel zur<br />
selbstbestimmten Teilhabe von Menschen<br />
mit Migrationshintergrund<br />
23./24. März 2010, Fulda (Hotel Bachmühle)<br />
In <strong>der</strong> aktuellen Integrationsdebatte wird den<br />
Migrantenorganisationen eine große Aufmerksamkeit<br />
geschenkt. Sie werden als wichtige<br />
Experten für die Bedarfe von Menschen mit<br />
Migrationshintergrund, als Brückenbauer und<br />
Vermittler sowie als unverzichtbare Akteure <strong>der</strong><br />
Integrationsarbeit beschrieben. In zahlreichen<br />
För<strong>der</strong>programmen wird <strong>der</strong> Fokus auf eine<br />
verstärkte Zusammenarbeit zwischen etablierten<br />
Trägern und Migrantenorganisationen o<strong>der</strong><br />
auf die Professionalisierung <strong>der</strong> Selbstorganisationen<br />
von Menschen mit Migrationshintergrund<br />
gelegt.<br />
Für den Deutschen <strong>Caritas</strong>verband ist es seit<br />
langem ein wichtiges Anliegen, Migrantenorganisationen<br />
und ausländische Vereinigungen zu<br />
för<strong>der</strong>n und zu unterstützen. Ziel war und ist die<br />
Stärkung <strong>der</strong> selbstbestimmten Teilhabe von<br />
Menschen mit Migrationshintergrund. Aktuell<br />
stellt sich jedoch die Frage, wie die verbandliche<br />
<strong>Caritas</strong> mit <strong>der</strong> wachsenden Bedeutung <strong>der</strong><br />
Migrantenorganisationen umgehen soll. Denn<br />
die Zusammenarbeit mit den Selbstorganisationen<br />
von Menschen mit Migrationshintergrund<br />
rührt an das Selbstverständnis als Wohlfahrtsverband<br />
in seiner Rolle als Solidaritätsstifter,<br />
Anwalt und Dienstleister.<br />
An diesem Punkt setzt <strong>der</strong> Expertenworkshop<br />
„Migrantenorganisationen – ein Schlüssel zur<br />
selbstbestimmten Teilhabe von Menschen mit<br />
Migrationshintergrund“ an. In einem ersten Teil<br />
haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, mit<br />
Vertreterinnen und Vertretern <strong>der</strong> Wissenschaft,<br />
Politik und Migrantenorganisationen ins Gespräch<br />
zu kommen. In einem zweiten Teil sind<br />
die Mitarbeitenden <strong>der</strong> <strong>Caritas</strong> bzw. katholischer<br />
Einrichtungen dazu eingeladen, die grundlegenden<br />
Fragestellungen zur Zusammenarbeit<br />
mit Migrantenorganisationen zu diskutieren,<br />
Erfahrungen auszutauschen und neue Perspektiven<br />
zu entwickeln. Da gerade vor Ort die Zusammenarbeit<br />
mit Migrantenorganisationen<br />
konkret gestaltet und durchgeführt wird, richtet<br />
sich <strong>der</strong> Expertenworkshop vor allem an Mitarbeitende<br />
aus den Ortscaritasverbänden.<br />
Der Expertenworkshop ist Teil des Projektes<br />
„Migrantenorganisationen ein Schlüssel zur<br />
selbstbestimmten Teilhabe von Menschen mit<br />
Migrationshintergrund – Beitrag <strong>der</strong> <strong>Caritas</strong>“.<br />
Seine Ergebnisse fließen in die Arbeit des Projektes,<br />
das im Oktober 2009 startete und eine<br />
Laufzeit von eineinhalb Jahren hat, ein.<br />
Ansprechpartner DCV<br />
Thomas Leipp, Tel.: 0761/200-361,<br />
E-Mail: Thomas.Leipp@caritas.de<br />
Tagungsort<br />
Hotel-Restaurant-Bachmühle<br />
Künzeller Str. 133<br />
36043 Fulda<br />
http://www.bachmuehle.de<br />
Anfahrt<br />
Informationen zur Anreise finden Sie unter:<br />
http://www.bachmuehle.de/pages/anfahrt.htm<br />
23. März 2010<br />
Programm<br />
Tagesmo<strong>der</strong>ation: Thomas Leipp<br />
Teil I<br />
11:00 Eröffnung des Expertenworkshops<br />
Roberto Alborino, Leiter des Referats<br />
Migration und Integration im Deutschen<br />
<strong>Caritas</strong>verband<br />
11:15 Vortrag: Migrantenorganisationen als<br />
Akteure im Sozialraum – Wege des<br />
Empowerments und <strong>der</strong> Kooperation<br />
Prof. Dr. Sabine Jungk, Arbeitsbereich<br />
Interkulturelle Bildung und Erziehung an<br />
<strong>der</strong> Katholischen Hochschule für Sozialwesen<br />
Berlin<br />
12:30 Mittagessen<br />
13.30 Vortrag: Migrantenorganisationen –<br />
Herausfor<strong>der</strong>ungen für Politik und Zivilgesellschaft<br />
Dr. Claudia Martini, Arbeitsstab <strong>der</strong> Beauftragten<br />
<strong>der</strong> Bundesregierung für Migration,<br />
Flüchtlinge und Integration<br />
14:15 Vortrag: Migrantenorganisationen in<br />
<strong>der</strong> Integrationsför<strong>der</strong>ung – Erfahrungen<br />
und Empfehlungen<br />
Romy Bartels, Leiterin des Referats<br />
Grundsatzangelegenheiten in <strong>der</strong> Integrationsför<strong>der</strong>ung<br />
im BAMF<br />
15:00 Kaffee und Kuchen
15:30 Statements aus Migrantenorganisationen<br />
Potentiale und Grenzen <strong>der</strong> Migrantenorganisationen<br />
in <strong>der</strong> Integrationsarbeit<br />
Kenan Kücük, Multikulturelles Forum<br />
e.V. und Sprecher des Forums <strong>der</strong> Migrantinnen<br />
und Migranten im Paritätischen<br />
Empowerment von Migrantenorganisationen<br />
– Zusammenarbeit zwischen<br />
Wohlfahrtsverbänden und<br />
Migrantenorganisationen gestalten<br />
Vicente Riesgo, Fachberater des Bundes<br />
<strong>der</strong> Spanischen Elternvereine und<br />
Vorsitzen<strong>der</strong> <strong>der</strong> Spanischen Weiterbildungsakademie<br />
16:30 Vortrag: Migrantenorganisationen –<br />
Bekanntheit, Nutzung, Erwartungen.<br />
Ergebnisse aus <strong>der</strong> Sinus Migranten-<br />
Milieu®-Studie<br />
Thomas Leipp, Referent im Referat Migration<br />
und Integration, Deutscher <strong>Caritas</strong>verband<br />
17:00 Pause<br />
Teil II<br />
17:15 World Café: Grundlagen <strong>der</strong> Zusammenarbeit<br />
zwischen <strong>Caritas</strong> und Migrantenorganisationen<br />
Thementisch 1: Ziele und Themengebiete<br />
<strong>der</strong> Zusammenarbeit<br />
Thementisch 2: Motivation zur Zusammenarbeit<br />
aus Sicht <strong>der</strong> Migrantenorganisationen<br />
Thementisch 3: Chancen und Risiken<br />
<strong>der</strong> Zusammenarbeit<br />
Thementisch 4: Zusammenarbeit „auf<br />
Augenhöhe“ gestalten<br />
18:45 Ende des Programms<br />
19:00 Abendessen<br />
24. März 2010<br />
Tagesmo<strong>der</strong>ation: Thomas Leipp<br />
09:00 Arbeitsgruppen: <strong>Umsetzung</strong> <strong>der</strong> Zusammenarbeit<br />
in die Praxis<br />
AG 1: Kriterien einer erfolgreichen Zusammenarbeit<br />
– Sicherung <strong>der</strong> Nachhaltigkeit<br />
in <strong>der</strong> Zusammenarbeit<br />
Input: Modellprojekt „PAKT – anpacken<br />
– zupacken. Mentoring für einen interkulturellen<br />
Migrantinnenverein“; Manuela<br />
Pintus, <strong>Caritas</strong>verband Wiesbaden-<br />
Rheingau-Taunus e.V.<br />
AG 2: Wünschenswerte und erfolgreiche<br />
Formen <strong>der</strong> Zusammenarbeit<br />
Input: Modellprojekt „Interkulturelle Öffnung<br />
– professionelles und ehrenamtliches<br />
Engagement vor Ort verbinden“;<br />
Dorothee Hüllen, <strong>Caritas</strong>-Sozialdienste<br />
e.V. Mülheim an <strong>der</strong> Ruhr<br />
11:00 Kaffeepause<br />
11:30 Kurzstatements: Ergebnisse aus den<br />
Arbeitsgruppen<br />
Diskussion im Plenum<br />
12:30 Mittagessen<br />
13:00 Ende <strong>der</strong> Veranstaltung<br />
Herausgegeben von<br />
Deutscher <strong>Caritas</strong>verband e.V.<br />
Referat Migration und Integration<br />
Postfach 4 20, 79004 Freiburg<br />
Telefon: +49 (0)761 200-361<br />
Telefax: +49 (0)761 200-211<br />
E-Mail: Thomas.Leipp@caritas.de<br />
Internet: www.caritas.de
Herausgegeben von<br />
Deutscher <strong>Caritas</strong>verband e.V.<br />
Referat Migration und Integration<br />
Postfach 4 20, 79004 Freiburg<br />
Karlstraße 40, 79104 Freiburg<br />
Telefon: 0761 200-361<br />
Telefax: 0761 200-211<br />
(08/2010)<br />
E-Mail: Thomas.Leipp@caritas.de<br />
Internet: www.caritas.de