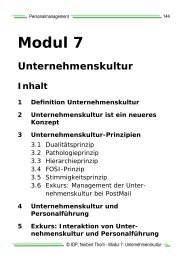Vollversion - Institut für Organisation und Personal - Universität Bern
Vollversion - Institut für Organisation und Personal - Universität Bern
Vollversion - Institut für Organisation und Personal - Universität Bern
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Unternehmensanalyse in öffentlichen Betrieben<br />
Konzeptionelle Gr<strong>und</strong>lagen – Fallstudie in der Pferdeklinik<br />
der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong> – Gestaltungsempfehlungen<br />
Lizentiatsarbeit eingereicht der<br />
Wirtschafts- <strong>und</strong> Sozialwissenschaftlichen Fakultät<br />
der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong><br />
Betreuender Professor: Prof. Dr. Norbert Thom<br />
Betreuender Assistent: Renato C. Müller, lic. rer. pol.<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Organisation</strong> <strong>und</strong> <strong>Personal</strong><br />
Engehaldenstrasse 4<br />
CH-3012 <strong>Bern</strong><br />
von:<br />
Denise Kuonen<br />
aus Termen (Wallis)<br />
Matr.-Nr.: 00-104-364<br />
Termerstrasse 24<br />
3912 Termen<br />
<strong>Bern</strong>, 24. September 2004
Vorwort<br />
Vorwort<br />
Während den letzten sechs Monaten, in denen ich die vorliegende Lizentiatsarbeit verfasste,<br />
konnte ich viele wertvolle Erfahrungen, sowohl in fachlicher als auch in persönlicher Hin-<br />
sicht, sammeln. Es ist mein Anliegen, der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong> eine Unterneh-<br />
mensanalyse bzw. eine Analyse der vorhandenen Problemfelder <strong>und</strong> wertvolle Ansatzpunkte<br />
<strong>für</strong> Verbesserungsmöglichkeiten zu liefern. Mit der Abgabe dieser Lizentiatsarbeit beende ich<br />
mein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong> <strong>und</strong> blicke gleichzeitig auf<br />
einen bedeutenden <strong>und</strong> ausserordentlich lehrreichen Lebensabschnitt.<br />
An dieser Stelle möchte ich allen Personen herzlich danken, die mich beim Schreiben der Li-<br />
zentiatsarbeit unterstützt haben. Ein grosses Dankeschön gilt meinem Praxispartner, Herrn<br />
Hanspeter Meier, Dispatcher der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong>, der mich während der Li-<br />
zentiatsarbeit betreut <strong>und</strong> mir jederzeit bei Fragen zur Verfügung stand. Weiter danke ich al-<br />
len Mitarbeitenden der Pferdeklinik, insbesondere dem Hilfspersonal <strong>und</strong> den Interviewpart-<br />
nern <strong>für</strong> das mir entgegengebrachte Vertrauen <strong>und</strong> die Bereitschaft, während den Interviews<br />
auf meine Fragen einzugehen. Mein spezieller Dank gilt auch Herrn Prof. Dr. Norbert Thom<br />
<strong>und</strong> meinem Assistenten Herrn Renato C. Müller, lic. rer. pol., <strong>für</strong> die Betreuung im Verlaufe<br />
der Arbeit.<br />
Grosser Dank gebührt meiner Familie <strong>und</strong> meinem Fre<strong>und</strong>eskreis <strong>für</strong> die Unterstützung, die<br />
sie mir während meiner gesamten Studienzeit bis hin zum Abschluss des Studiums gegeben<br />
haben. Besten Dank auch an Frau Daniela Kuonen <strong>und</strong> Herr Dr. Josef Kuonen <strong>für</strong> das Korrek-<br />
turlesen meiner Arbeit.<br />
Im Folgenden werden zur Vereinfachung <strong>und</strong> aus Gründen der besseren Lesbarkeit wenn<br />
möglich geschlechtsneutrale Begriffe verwendet. In einigen Fällen tritt nur die maskuline<br />
Form auf, wobei selbstverständlich immer Frauen <strong>und</strong> Männer angesprochen sind. So reprä-<br />
sentieren Ausdrücke wie Assistenten, Wärter etc. folglich beide Geschlechter gleichermassen.<br />
<strong>Bern</strong>, 24. September 2004 Denise Kuonen<br />
Denise Kuonen Seite I
Inhaltsverzeichnis<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Vorwort___________________________________________________________________ I<br />
Inhaltsverzeichnis __________________________________________________________II<br />
Abbildungsverzeichnis______________________________________________________ VI<br />
Tabellenverzeichnis _______________________________________________________ VII<br />
Anhangverzeichnis _______________________________________________________VIII<br />
Abkürzungsverzeichnis _____________________________________________________ IX<br />
Teil 1: EINFÜHRUNG ____________________________________________________ 1<br />
1 Einleitung_____________________________________________________________ 1<br />
1.1 Ausgangslage, Problemstellung <strong>und</strong> Abgrenzung des Gegenstandes ________ 1<br />
1.2 Stand der Forschung _______________________________________________ 3<br />
1.3 Ziele der Arbeit____________________________________________________ 5<br />
1.4 Methodische Vorgehensweise ________________________________________ 6<br />
1.5 Aufbau der Arbeit _________________________________________________ 7<br />
Teil 2: KONZEPTIONELLE ERKENNTNISSE________________________________ 9<br />
2 Gr<strong>und</strong>lagen ___________________________________________________________ 9<br />
2.1 Betrieb bzw. Unternehmen __________________________________________ 9<br />
2.1.1 Einführung <strong>und</strong> Definition __________________________________________ 9<br />
2.1.2 Bestimmungsfaktoren_____________________________________________ 11<br />
2.1.3 Öffentlicher Betrieb bzw. Unternehmen ______________________________ 12<br />
2.1.3.1 Definition __________________________________________________ 12<br />
2.1.3.2 Abgrenzung zu privaten Unternehmungen_________________________ 14<br />
2.1.3.3 Abgrenzung zur „öffentlichen Verwaltung“________________________ 15<br />
2.2 Unternehmensanalyse _____________________________________________ 16<br />
2.2.1 Einführung <strong>und</strong> Definition _________________________________________ 16<br />
Denise Kuonen Seite II
Inhaltsverzeichnis<br />
2.2.1.1 Betriebsanalyse______________________________________________ 16<br />
2.2.1.2 <strong>Organisation</strong>sanalyse _________________________________________ 18<br />
2.2.1.3 Unternehmensanalyse_________________________________________ 18<br />
2.2.1.3.1 Analysefelder der globalen Umwelt____________________________ 20<br />
2.2.1.3.2 Analysefelder der aufgabenspezifischen Umwelt _________________ 21<br />
2.2.1.3.3 Analysefelder des Unternehmens ______________________________ 21<br />
2.2.2 Zweck der Unternehmensanalyse____________________________________ 23<br />
2.2.3 Daten als Hilfsmittel______________________________________________ 24<br />
2.2.3.1 Phasen der Datenermittlung ____________________________________ 24<br />
2.2.3.2 Methoden der Datenerhebung __________________________________ 25<br />
2.2.4 Methoden der Unternehmensanalyse _________________________________ 30<br />
2.2.4.1 Stärken-/Schwächenanalyse ____________________________________ 31<br />
2.2.4.2 Wertvorstellungsanalyse_______________________________________ 34<br />
2.3 Pferdeklinik bzw. Spital____________________________________________ 36<br />
2.3.1 Begriffliche Einführung ___________________________________________ 36<br />
2.3.2 Spital__________________________________________________________ 36<br />
2.3.2.1 Spital als Dienstleistungsbetrieb_________________________________ 36<br />
2.3.2.2 Personelle <strong>und</strong> organisatorische Merkmale eines Spitals______________ 37<br />
2.4 Weitere Definitionen_______________________________________________ 38<br />
2.4.1 Interne Kommunikation ___________________________________________ 38<br />
2.4.2 Prozesse _______________________________________________________ 39<br />
3 Konzeptioneller Bezugsrahmen __________________________________________ 41<br />
3.1 Bedingungsgrössen ________________________________________________ 42<br />
3.1.1 Ausserbetriebliche Bedingungsgrössen _______________________________ 44<br />
3.1.1.1 Generelle Bedingungsgrössen __________________________________ 44<br />
3.1.1.1.1 Ökonomische Rahmenbedingungen____________________________ 44<br />
3.1.1.1.2 Politisch-rechtliche Rahmenbedingungen _______________________ 45<br />
3.1.1.1.3 Technologische Rahmenbedingungen __________________________ 46<br />
3.1.1.1.4 Sozio-kulturelle Rahmenbedingungen __________________________ 47<br />
3.1.1.1.5 Physisch-ökologische Rahmenbedingungen _____________________ 48<br />
3.1.1.2 Aufgabenspezifische Bedingungsgrössen _________________________ 48<br />
3.1.1.2.1 Branche__________________________________________________ 48<br />
Denise Kuonen Seite III
Inhaltsverzeichnis<br />
3.1.1.2.2 Öffentlicher Auftrag ________________________________________ 51<br />
3.1.2 Innerbetriebliche Bedingungsgrössen_________________________________ 52<br />
3.1.2.1 Betriebliche Bedingungsgrössen ________________________________ 52<br />
3.1.2.2 Personelle Bedingungsgrössen __________________________________ 53<br />
3.2 Aktionsparameter_________________________________________________ 54<br />
3.2.1 Mittelbare Aktionsparameter _______________________________________ 54<br />
3.2.2 Unmittelbare Aktionsparameter _____________________________________ 55<br />
3.3 Effektivitäts- <strong>und</strong> Effizienzkonzept __________________________________ 56<br />
Teil 3: FALLSTUDIE ____________________________________________________ 57<br />
4 Studiendesign – Einzelfallanalyse ________________________________________ 57<br />
4.1 Festlegung der Forschungsfragestellung ______________________________ 58<br />
4.2 Auswahl der Untersuchungseinheit (Falldefinition) _____________________ 59<br />
4.3 Bestimmung der Forschungsstrategie <strong>und</strong> der Forschungsmethoden ______ 60<br />
4.4 Vorbereitung der Datenerhebung____________________________________ 62<br />
4.5 Datenerhebung ___________________________________________________ 63<br />
4.6 Aufbereitung der Daten ____________________________________________ 63<br />
4.7 Auswertung der Daten <strong>und</strong> Interpretation ____________________________ 64<br />
4.8 Verfassen der Fallstudie____________________________________________ 65<br />
4.9 Nachbearbeitung__________________________________________________ 65<br />
4.10 Beurteilung des eigenen methodischen Vorgehens ______________________ 65<br />
5 Unternehmensanalyse der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong>___________________ 67<br />
5.1 Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong> ___________________________________ 67<br />
5.1.1 Rahmenstruktur _________________________________________________ 67<br />
5.1.2 Leistungsangebot ________________________________________________ 70<br />
5.1.3 Wichtige Kennzahlen _____________________________________________ 70<br />
5.1.4 Rahmenbedingungen _____________________________________________ 72<br />
5.1.4.1 Ausserbetriebliche Bedingungsgrössen ___________________________ 72<br />
Denise Kuonen Seite IV
Inhaltsverzeichnis<br />
5.1.4.2 Innerbetriebliche Bedingungsgrössen_____________________________ 75<br />
5.2 Unternehmensanalyse der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong> ____________ 76<br />
5.2.1 Problemstellung _________________________________________________ 76<br />
5.2.2 Spezifische Ausgangslage _________________________________________ 77<br />
5.2.2.1 Einleitung __________________________________________________ 77<br />
5.2.2.2 Allgemeine Situation _________________________________________ 77<br />
5.2.2.3 Interne Kommunikation _______________________________________ 79<br />
5.2.2.4 Dienste <strong>und</strong> Arbeitsprozesse ___________________________________ 81<br />
5.2.2.4.1 Pflegedienst <strong>und</strong> Arbeitsprozesse der Wärter_____________________ 81<br />
5.2.2.4.2 Hilfsdienst <strong>und</strong> Arbeitsprozesse der OPS-Gehilfen ________________ 88<br />
5.2.2.4.3 Situation r<strong>und</strong> um die Arbeitsprozesse__________________________ 90<br />
5.2.3 Bereiche mit Handlungsbedarf ______________________________________ 93<br />
5.2.4 Beschreibung <strong>und</strong> Bewertung von Verbesserungsansätzen ________________ 94<br />
Teil 4: SCHLUSSFOLGERUNGEN ________________________________________ 95<br />
6 Gestaltungsempfehlungen_______________________________________________ 95<br />
6.1 Allgemeine Gestaltungsempfehlungen ________________________________ 95<br />
6.2 Gestaltungsempfehlungen <strong>für</strong> die Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong>_______ 96<br />
6.2.1 Gestaltungsempfehlungen zur allgemeinen Situation ____________________ 97<br />
6.2.2 Gestaltungsempfehlungen zur internen Kommunikation_________________ 100<br />
6.2.3 Gestaltungsempfehlungen zu den Prozessen bzw. den Abläufen___________ 101<br />
7 Schlussbetrachtungen _________________________________________________ 107<br />
7.1 Überprüfung des konzeptionellen Bezugsrahmens _____________________ 107<br />
7.2 Fazit <strong>und</strong> Ausblick _______________________________________________ 108<br />
7.3 Kritische Würdigung _____________________________________________ 108<br />
Anhang_________________________________________________________________ 110<br />
Literaturverzeichnis_______________________________________________________ 118<br />
Selbstständigkeitserklärung ________________________________________________ 127<br />
Denise Kuonen Seite V
Abbildungsverzeichnis<br />
Abbildungsverzeichnis<br />
Abbildung 1: Aufbau der Lizentiatsarbeit ________________________________________ 8<br />
Abbildung 2: Finanzstruktur verschiedener Betriebstypen __________________________ 14<br />
Abbildung 3: Selbstbestimmungsrad von Betrieben _______________________________ 15<br />
Abbildung 4: Formen der Betriebsanalyse _______________________________________ 17<br />
Abbildung 5: Felder der strategischen Analyse ___________________________________ 19<br />
Abbildung 6: Phasen einer empirischen Untersuchung _____________________________ 24<br />
Abbildung 7: Gr<strong>und</strong>formen der Datenerfassung __________________________________ 27<br />
Abbildung 8: Zuteilung der Analysemethoden zu den Strategieprozessen ______________ 30<br />
Abbildung 9: Die Schritte der Stärken-/Schwächenanalyse__________________________ 32<br />
Abbildung 10: Stärken-Schwächenprofil ________________________________________ 33<br />
Abbildung 11: Schritte zur Analyse <strong>und</strong> Harmonisierung der Wertvorstellungen im<br />
Unternehmen__________________________________________________ 35<br />
Abbildung 12: Formen der Unternehmenskommunikation mit ihren Instrumenten _______ 38<br />
Abbildung 13: Konzeptioneller Bezugsrahmen ___________________________________ 42<br />
Abbildung 14: Der Staat als Linse im Zürcher Ansatz______________________________ 43<br />
Abbildung 15: Branchenstruktur öffentlicher Betriebe _____________________________ 50<br />
Abbildung 16: Vorgehensheuristik zur Erarbeitung von Fallstudien___________________ 58<br />
Abbildung 17: Überblick über das Departement <strong>für</strong> klinische Veterinärmedizin _________ 68<br />
Abbildung 18: Organigramm der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong>___________________ 69<br />
Abbildung 19: Anzahl behandelter Pferde seit 1994 _______________________________ 71<br />
Abbildung 20: Dienstplan der Wärter im 8-Wochenturnus __________________________ 82<br />
Denise Kuonen Seite VI
Tabellenverzeichnis<br />
Tabellenverzeichnis<br />
Tabelle 1: Öffentliche Betriebe aufgeteilt nach Branchen ______________________ 48<br />
Tabelle 2: Fragen bzw. Antworten zum Untersuchungsgegenstand ______________ 64<br />
Denise Kuonen Seite VII
Anhangverzeichnis<br />
Anhangverzeichnis<br />
Interviewleitfaden_________________________________________________________ 110<br />
Denise Kuonen Seite VIII
Abkürzungsverzeichnis<br />
Abkürzungsverzeichnis<br />
AG Aktiengesellschaft<br />
AHV Alters- <strong>und</strong> Hinterlassenenversicherung<br />
Art. Artikel<br />
Bd. Band<br />
BIP Bruttoinlandsprodukt<br />
bspw. beispielsweise<br />
BV B<strong>und</strong>esverfassung<br />
bzgl. bezüglich<br />
bzw. beziehungsweise<br />
ca. circa<br />
d. h. das heisst<br />
Dr. Doktor<br />
etc. et cetera<br />
EU Europäische Union<br />
evtl. eventuell<br />
exkl. exklusive<br />
Exp. Experiment<br />
f. folgende<br />
ff. fortfolgende<br />
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung<br />
Hrsg. Herausgeber<br />
hrsg. herausgegeben<br />
i. d. R. in der Regel<br />
inkl. inklusive<br />
IOP <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Organisation</strong> <strong>und</strong> <strong>Personal</strong><br />
Jg. Jahrgang<br />
KTQ ® Kooperation <strong>für</strong> Transparenz <strong>und</strong> Qualität im Krankenhaus<br />
lic. licentiatus/licentiata<br />
Matr.-Nr. Matrikelnummer<br />
Mrd. Milliarden<br />
M&A Mergers & Acquisitions<br />
Nr. Nummer<br />
Denise Kuonen Seite IX
Abkürzungsverzeichnis<br />
OPS- Operations-<br />
OR Obligationenrecht<br />
Prof. Professor<br />
rer. pol. rerum politicarum<br />
S. Seite<br />
Sp. Spalte<br />
St. Sankt<br />
u. a. <strong>und</strong> andere/unter anderem<br />
u. a. m. <strong>und</strong> andere mehr<br />
usw. <strong>und</strong> so weiter<br />
TPA Tiermedizinische Praxisassistentin<br />
TQM Total Quality Management<br />
v. von<br />
v. a. vor allem<br />
vgl. vergleiche<br />
z. B. zum Beispiel<br />
zfo Zeitschrift Führung <strong>und</strong> <strong>Organisation</strong><br />
ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch<br />
z. T. zum Teil<br />
Denise Kuonen Seite X
Einleitung<br />
Teil 1: EINFÜHRUNG<br />
1 Einleitung<br />
1.1 Ausgangslage, Problemstellung <strong>und</strong> Abgren-<br />
zung des Gegenstandes<br />
Wenn ein Unternehmen spürt oder erkennt, dass sich der Betrieb unbefriedigend entwickelt<br />
<strong>und</strong> verschiedene Probleme auftreten, greift es gemäss Prosch (2000: I f.) oft auf analytische<br />
Instrumente zurück. Die Verantwortlichen sehen sich häufig nicht in der Lage, die Ursachen<br />
festzustellen <strong>und</strong> eine Lösung der mässigen Entwicklungen zu finden. Deshalb werden Analy-<br />
sen von <strong>Organisation</strong>en meist im Vorfeld notwendiger Entscheidungen durchgeführt. Die<br />
Gründe da<strong>für</strong> können vielfältig sein. „Sie sind Ausdruck ungelöster Aufgaben oder Problem-<br />
situationen, die von dem Unternehmen bisher (noch) nicht oder zumindest nicht in ihrer gan-<br />
zen Schärfe erkannt worden sind. Es zeigen sich Symptome, <strong>für</strong> deren Ursachenerforschung<br />
eine <strong>Organisation</strong>sanalyse erforderlich wird.“ (Prosch 2000: II). Eine <strong>Organisation</strong>s- bzw. Un-<br />
ternehmensanalyse ist laut Prosch bspw. in folgenden Situationen sinnvoll:<br />
• Bei akuten Problemen.<br />
• Bei andauernden, ungelösten Problemfeldern.<br />
• Bei wirtschaftlichen Verlusten.<br />
• Bei offensichtlicher Verschlechterung des Arbeitsklimas.<br />
• Beim Nachlassen der Leistungsqualität.<br />
• Bei gravierenden Markteinbrüchen.<br />
Andauernde Probleme <strong>und</strong> eine offensichtliche Verschlechterung des Arbeitsklimas sind u. a.<br />
Gründe da<strong>für</strong>, dass sich Herr Hanspeter Meier, Dispatcher der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong><br />
<strong>Bern</strong>, an das <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Organisation</strong> <strong>und</strong> <strong>Personal</strong> (IOP) der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong> gewandt hat<br />
mit der Bitte, die wichtigsten organisatorischen <strong>und</strong> personellen Belange der Pferdeklinik de-<br />
tailliert zu analysieren. Es sind im Laufe der Zeit verschiedene personelle <strong>und</strong> finanzielle<br />
Probleme aufgetreten, welche die tägliche Arbeit erschweren bzw. deren Qualität beeinträch-<br />
tigen. Es bestehen u. a. folgende Probleme:<br />
Denise Kuonen Seite 1
Einleitung<br />
• Der Arbeitsaufwand <strong>für</strong> die „Patienten“ (Pferde) ist in den letzten Jahren stark gestie-<br />
gen. Die zur Verfügung stehenden personellen <strong>und</strong> finanziellen Ressourcen (diese sind<br />
wie bei vielen öffentlichen Unternehmungen vom Kanton <strong>Bern</strong> vorgegeben) sind jedoch<br />
gesunken. Folge davon sind Überst<strong>und</strong>en <strong>und</strong> Arbeitsüberlastung. Darunter leidet die<br />
Qualität der Arbeit. Daneben ist die Belastung des akademischen <strong>Personal</strong>s wegen einer<br />
Studienreform <strong>und</strong> der Zusammenlegung mit der Zürcher Fakultät (VetSuisse) grösser<br />
denn je. Zudem gibt es Probleme bei den Prozessabläufen.<br />
• Die Pferdepfleger (Wärter) <strong>und</strong> die Operationsgehilfen (OPS-Gehilfen) sind <strong>für</strong> folgen-<br />
de Arbeiten zuständig: Ställe ausmisten, Pferde putzen <strong>und</strong> füttern, bei Untersuchungen<br />
<strong>und</strong> Behandlungen helfen, Operationen vorbereiten <strong>und</strong> assistieren, Operationsräume<br />
<strong>und</strong> Instrumente bereitstellen <strong>und</strong> reinigen, Medikamente bestellen <strong>und</strong> kontrollieren<br />
usw. Da die Pferdeklinik gemäss Vorschriften des Kantons <strong>Bern</strong> die Anzahl der Be-<br />
schäftigten auf einem Minimum hält, führt dies oft zu Engpässen, da die Arbeiten mit<br />
den zur Verfügung stehenden Personen nicht in zufrieden stellender Qualität erledigt<br />
werden können.<br />
• Die interne Kommunikation ist unbefriedigend. Das <strong>Personal</strong> wird schlecht oder über-<br />
haupt nicht informiert. Es wird allgemein wenig kommuniziert.<br />
• Unter der schlechten Kommunikationssituation leidet das Arbeitsklima. Die Mitarbei-<br />
tenden sprechen wenig miteinander. Fre<strong>und</strong>schaften innerhalb des Betriebes sind rar. Es<br />
gibt auch Feindseligkeiten zwischen Mitarbeitenden.<br />
Die Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong> bildet das Untersuchungsfeld der Fallstudie. Da der<br />
Begriff „Unternehmensanalyse“ sehr umfassend ist, würde es den Rahmen dieser Arbeit<br />
sprengen, alle Aspekte der Analyse in der Fallstudie zu berücksichtigen. Deshalb wurde mit<br />
Herrn Meier vereinbart, nur einige, <strong>für</strong> die Pferdeklinik wichtige Punkte anzuschauen: die<br />
<strong>Personal</strong>situation, die Arbeitsabläufe <strong>und</strong> die interne Kommunikation. Es würde ebenfalls zu<br />
weit führen, den gesamten Betrieb der Pferdeklinik zu analysieren. Aus diesem Gr<strong>und</strong> wurde<br />
mit Herrn Meier abgemacht, nur die Situation des Hilfspersonals (Wärter <strong>und</strong> OPS-Gehilfen)<br />
zu untersuchen (vgl. Kapitel 5.2). Zum Hilfspersonal gehören die folgenden Personen:<br />
• Bigler Fritz: OPS- Helfer <strong>und</strong> Radiologe, Sattlerei, zu 100 % angestellt.<br />
• Brändli Hansruedi: OPS-Helfer, zu 100 % angestellt.<br />
• Karlen Hansruedi: OPS-Helfer <strong>und</strong> Hufschmied, zu 100 % angestellt.<br />
• Nef Vreni: OPS-Helferin <strong>und</strong> Apotheke, zu 100 % angestellt.<br />
• Gäumann Fritz: Wärter, zu 100 % angestellt.<br />
Denise Kuonen Seite 2
Einleitung<br />
• Glauser Robert: Chefwärter, zu 100 % angestellt.<br />
• Kindler Peter: Wärter <strong>und</strong> Hufschmied, zu 100 % angestellt.<br />
• Meerstetter Martin: Wärter, zu 100 % angestellt.<br />
• Schick Ernst: Wärter, zu 50 % angestellt.<br />
• Schmutz Susanne: Wärterin (Aushilfe), zu 50 % angestellt.<br />
• Stucki Kurt: Wärter <strong>und</strong> Metzger, zu 100 % angestellt.<br />
• Baumgartner Rudolf: Wärter, zu 100 % angestellt ab September 2004.<br />
• Immeli Alexandra: Tiermedizinische Praxisassistentin (TPA), angestellt ab Au-<br />
gust 2004.<br />
Da die Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong> ein öffentlicher Betrieb ist, werden dessen Ressour-<br />
cen von der öffentlichen Hand bestimmt. So kann die Pferdeklinik bspw. nicht selber ent-<br />
scheiden, wie viele Personen angestellt werden sollen.<br />
Im Rahmen dieser Lizentiatsarbeit geht es darum, die vorhandenen Problemfelder des Hilfs-<br />
personals zu eruieren <strong>und</strong> anschliessend Lösungen zur Verbesserung der bestehenden Ver-<br />
hältnisse in Form von Gestaltungsempfehlungen vorzuschlagen. Dabei werden Gestaltungs-<br />
empfehlungen sowohl spezifisch <strong>für</strong> die Pferdeklinik als auch <strong>für</strong> die Allgemeinheit (öffentli-<br />
che Betriebe) formuliert (vgl. Kapitel 6).<br />
1.2 Stand der Forschung<br />
<strong>Organisation</strong>en sind in unserem täglichen Leben allgegenwärtig wie nie zuvor. Dies äussert<br />
sich an der Bedeutung von <strong>Institut</strong>ionen wie Schulen, <strong>Universität</strong>en, Ämtern, Vereinen, Par-<br />
teien <strong>und</strong> nicht zuletzt Unternehmen. Dieser Einfluss setzte vor allem durch die Industrialisie-<br />
rung ein (vgl. Prosch 2000: 2 f.). Die Bedeutung von Unternehmen war vor 300 oder 400 Jah-<br />
ren noch relativ gering. Der Tagesablauf der damals lebenden Menschen wurde kaum durch<br />
die Präsenz von <strong>Organisation</strong>en beeinflusst. „Eine zunehmende gesellschaftliche Differenzie-<br />
rung, Arbeitsteilung <strong>und</strong> Leistungsorientierung sorgte <strong>für</strong> die große Verbreitung des Phäno-<br />
mens <strong>Organisation</strong>. Anfang des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts war dieser Prozess in den Industriegesell-<br />
schaften so weit fortgeschritten, dass <strong>Organisation</strong>en längst den Lebensbereich aller Men-<br />
schen beeinflussten.“ (Prosch 2000: 2).<br />
Denise Kuonen Seite 3
Einleitung<br />
Erst ab dem Zeitpunkt des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts begann die Wissenschaft, sich mit <strong>Organisation</strong>en<br />
auseinander zu setzen. Als einer der Gründerväter der Soziologie, Max Weber, anfing, mo-<br />
derne Bürokratien zu untersuchen, setzte er damit Massstäbe <strong>für</strong> künftige Forschungstätigkei-<br />
ten. Angesichts der Bedeutung von <strong>Organisation</strong>en <strong>für</strong> moderne Gesellschaften dauerte es<br />
aber erstaunlich lange, bis sich die Wissenschaftler mit diesem Forschungsgegenstand be-<br />
schäftigten <strong>und</strong> ihn etablierten.<br />
Als wichtiger Forschungszweig der Wirtschaftswissenschaften, Soziologie <strong>und</strong> Psychologie<br />
setzte sich die Untersuchung von Unternehmen bzw. <strong>Organisation</strong>en erst nach dem Zweiten<br />
Weltkrieg durch. In den sechziger Jahren war ihre Stellung als eigenständige Fachdisziplin<br />
noch nicht gesichert. Als Begriffe wie „<strong>Organisation</strong>sentwicklung“ <strong>und</strong> „<strong>Organisation</strong>sanaly-<br />
se“ längst verwendet wurden, ging man noch sehr vorsichtig mit Bezeichnungen wie „Organi-<br />
sationspsychologie“ oder „<strong>Organisation</strong>ssoziologie“ um (vgl. Prosch 2000: 2 f.). So definierte<br />
Mayntz (1963: 148) in ihrem einflussreichen Buch „Soziologie der <strong>Organisation</strong>“ den Begriff<br />
„<strong>Organisation</strong>ssoziologie“ noch folgendermassen: „Die soziologische Behandlung der Orga-<br />
nisation beansprucht nicht den Rang einer speziellen Soziologie.“ Heute ist die Erforschung<br />
von <strong>Organisation</strong>en bzw. Unternehmen ein interdisziplinäres Gebiet, das aus der Sicht ver-<br />
schiedenster Fachrichtungen wie bspw. den Wirtschaftswissenschaften, der Soziologie <strong>und</strong><br />
der Psychologie bearbeitet wird (vgl. Prosch 2000: 3).<br />
Die Untersuchung von Unternehmen ist besonders im heutigen Zeitalter von Mergers & Ac-<br />
quisitions (M&A) aktuell. Sie nimmt dabei einen grossen Stellenwert ein, da Managementent-<br />
scheide, z. B. im Rahmen des Verkaufs von Unternehmen, häufig auf den Ergebnissen einer<br />
Unternehmensanalyse basieren. Das Thema Unternehmensanalyse ist auch im Zusammen-<br />
hang mit Basel II aktuell (vgl. Simgen-Weber/Schmitz 2003: 19 ff.). Hier kann eine umfas-<br />
sende Unternehmensanalyse als Möglichkeit des jeweiligen Unternehmens zur Einflussnahme<br />
auf das eigene Unternehmens-Rating genutzt werden. Die betreffende Literatur ist u. a. durch<br />
die Aktualität des Themas umfassend. Es existiert auch eine relativ grosse Zahl an Publikatio-<br />
nen in Fachzeitschriften über Unternehmensanalysen (vgl. Pfohl/Krings/Betz 1996, Schwan-<br />
der 1996, Bruns/Knab/Hagspiel 1999 etc.).<br />
Der eine Teil der Literatur befasst sich mit Unternehmensanalysen vorwiegend im Zusam-<br />
menhang mit der strategischen Planung von Unternehmen (vgl. Grünig/Kühn 2000, Lombri-<br />
ser/Abplanalp 2004 usw.), während sich der andere Teil vorwiegend mit der Bewertung von<br />
Denise Kuonen Seite 4
Einleitung<br />
Unternehmen <strong>und</strong> finanziellen Kennzahlen befasst (vgl. Tschandl 1996, Born 2003, Dieter-<br />
le/Abplanalp 1990, Schnettler 1958 usw.). Letztere Werke finden aber keinen bzw. nur einen<br />
geringen Einbezug in die vorliegende Arbeit, da in der Fallstudie dieser Lizentiatsarbeit die<br />
finanzielle Situation nicht bzw. nur am Rande erwähnt wird (vgl. Kapitel 2.2).<br />
Die Forschung befasst sich stark mit der (v. a. strategischen) Analyse von Unternehmen. Zu<br />
nennen ist hier bspw. das <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Betriebswirtschaft der <strong>Universität</strong> St. Gallen, welches<br />
momentan Projekte dazu durchführt („Strategy Process“, „International Corporate Strategy“<br />
etc.). Das <strong>Institut</strong> hat in den vergangenen Jahren intensive Forschungsarbeiten betrieben, die<br />
gezeigt haben, dass eine grosse Herausforderung darin liegt, die komplexe Entwicklungsdy-<br />
namik von Unternehmen in ihren Umfeldern besser zu verstehen.<br />
Ferner ist das <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Organisation</strong> <strong>und</strong> <strong>Personal</strong> (IOP) der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong> zu erwähnen.<br />
Hier wird zum Thema öffentliche Betriebe ebenfalls viel geforscht <strong>und</strong> publiziert. Zu nennen<br />
ist u. a. die Dissertation mit dem Titel „Zusammenschlüsse öffentlicher Unternehmen. Koope-<br />
rationen <strong>und</strong> Fusionen im Spitalsektor“ von Herrn Dr. Jürg Lutz.<br />
Zu Unternehmensanalyse in öffentlichen Betrieben wie z. B. in Spitälern <strong>und</strong> Kliniken ist we-<br />
nig in der Literatur zu finden. Morra (1996) befasst sich kurz mit der Unternehmensanalyse<br />
im Zusammenhang mit der strategischen Planung eines Krankenhauses.<br />
1.3 Ziele der Arbeit<br />
Ziel der Arbeit ist es, einerseits die theoretischen Begriffe, Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Konzepte zur Un-<br />
ternehmensanalyse darzustellen. Andererseits sollen die theoretischen Ansätze anhand einer<br />
Fallstudie bei der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong> überprüft <strong>und</strong> eine Unternehmensanalyse<br />
in Teilbereichen der Pferdeklinik durchgeführt werden. Dabei werden die theoretischen<br />
Gr<strong>und</strong>lagen zu den Problemfeldern in der Pferdeklinik erarbeitet sowie Prozesse des Hilfsper-<br />
sonals analysiert <strong>und</strong> durch qualitative <strong>und</strong> informelle Interviews die aktuelle Situation <strong>und</strong><br />
die Bedürfnisse ermittelt. Auf der Gr<strong>und</strong>lage informeller Gespräche mit Personen der Pferde-<br />
klinik der <strong>Universität</strong> Zürich <strong>und</strong> eines Besuchs der Pferdeklinik in Zürich soll eine Fremd-<br />
perspektive einfliessen, um Vergleichsmöglichkeiten <strong>und</strong> Anregungen zu Verbesserungen zu<br />
erhalten. Ein Vergleich mit der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> Zürich ist gemäss Herrn Meier<br />
bzgl. der Zusammenlegung der Fakultäten (VetSuisse) sinnvoll. Zudem ist diese Pferdeklinik<br />
anders organisiert <strong>und</strong> der Betrieb scheint besser abzulaufen.<br />
Denise Kuonen Seite 5
Einleitung<br />
Aus diesen Untersuchungen sollen anschliessend Änderungen in Form von Gestaltungsemp-<br />
fehlungen formuliert werden, damit die bestehenden Probleme gelöst <strong>und</strong> die anfallenden Ar-<br />
beiten in Zukunft wieder effizient erledigt werden können.<br />
Daraus lassen sich folgende Ziele zusammenfassen:<br />
• Definition wichtiger Begriffe <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>lagen zu Unternehmensanalyse.<br />
• Entwicklung eines Bezugsrahmens <strong>für</strong> öffentliche Betriebe zur Identifizierung von Ak-<br />
tionsparametern, Ziel- <strong>und</strong> Bedingungsgrössen.<br />
• Analyse entsprechender Teilbereiche der Pferdeklinik.<br />
• Ableitung von Gestaltungsempfehlungen sowohl <strong>für</strong> die Allgemeinheit (öffentliche Be-<br />
triebe) als auch <strong>für</strong> die Pferdeklinik.<br />
1.4 Methodische Vorgehensweise<br />
Die Arbeit besteht aus vier Teilen. Nach dem ersten einführenden Teil folgt der zweite, theo-<br />
retische Teil, der deskriptiv <strong>und</strong> analytisch anhand der bestehenden Literatur wichtige Begrif-<br />
fe <strong>und</strong> Konzepte zu Unternehmensanalyse beschreibt. Dabei wurden sowohl wissenschaftli-<br />
che Bücher, Fachzeitschriften, Diplomarbeiten <strong>und</strong> Dissertationen gesichtet, als auch Recher-<br />
chen im Internet <strong>und</strong> in Datenbanken durchgeführt. Die Literaturanalyse beschränkt sich auf<br />
den deutschsprachigen Raum, da es sonst den Rahmen der vorliegenden Lizentiatsarbeit<br />
sprengen würde.<br />
Im dritten Teil werden in einer Fallstudie bei der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong> die beste-<br />
henden Verhältnisse <strong>und</strong> die entsprechenden Problemfelder des Hilfspersonals eruiert. Da<strong>für</strong><br />
wurden die Arbeitsprozesse während eines mehrtägigen Besuchs beobachtet <strong>und</strong> detailliert<br />
analysiert. Zudem wurden problemzentrierte (anhand eines Leitfadens) <strong>und</strong> informelle Inter-<br />
views mit einer Auswahl von Betroffenen des Hilfspersonals geführt. Die problemzentrierten<br />
Interviews wurden zuerst protokolliert, dann interpretiert <strong>und</strong> anschliessend zusammenge-<br />
fasst. Hinzu kamen weitere informelle Gespräche mit Assistenten der Pferdeklinik <strong>Bern</strong>. Es<br />
wurden – wie weiter oben bereits erwähnt – während eines Besuchs der Pferdeklinik der Uni-<br />
versität Zürich ebenfalls informelle Gespräche mit dem <strong>Personal</strong> dieser Klinik u. a. mit dem<br />
Obertierpfleger der Grosstiere, Herrn Hans Oesch, geführt.<br />
Das Ziel der Fallstudie ist es, die im theoretischen Teil besprochenen Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Kon-<br />
zepte in die Praxis umzusetzen <strong>und</strong> zu überprüfen. Dabei orientiert sich die Verfasserin an der<br />
Denise Kuonen Seite 6
Einleitung<br />
von Zaugg (2002b: 19) entwickelten neunstufigen Vorgehensheuristik zur Erarbeitung von<br />
Fallstudien, welche eine Hilfe bei der Suche nach relevanten Einflussgrössen <strong>und</strong> der Inter-<br />
pretation von Zusammenhängen darstellen soll.<br />
Im vierten Teil werden anhand dieser Resultate Änderungen in Form von Gestaltungsempfeh-<br />
lungen formuliert. Anschliessend folgt eine Schlussbetrachtung der wichtigsten Punkte, in der<br />
u. a. der konzeptionelle Bezugsrahmen auf seine Praktikabilität hin überprüft wird.<br />
1.5 Aufbau der Arbeit<br />
Die vorliegende Lizentiatsarbeit ist in vier Teile gegliedert <strong>und</strong> besteht aus sieben Kapiteln.<br />
Nach dem ersten einleitenden Teil (Kapitel 1), der die Ausgangslage, Problemstellung <strong>und</strong><br />
Abgrenzung des Gegenstandes, den Stand der Forschung, die Zielsetzungen, die methodische<br />
Vorgehensweise <strong>und</strong> den Aufbau der Arbeit beinhaltet, folgt der zweite Teil, in dem die kon-<br />
zeptionellen Erkenntnisse (Kapitel 2) wiedergegeben werden. Dabei werden zuerst wichtige<br />
Begriffe <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>lagen zu den Themen Betrieb bzw. Unternehmen, Unternehmensanalyse<br />
<strong>und</strong> Pferdeklinik bzw. Spital definiert <strong>und</strong> Abgrenzungen vorgenommen. Anschliessend folgt<br />
im dritten Kapitel die Darstellung des konzeptionellen Bezugsrahmens, der die Komplexität<br />
des Themas strukturiert.<br />
Im dritten Teil wird eine Fallstudie vorgestellt, die in Zusammenarbeit mit der Pferdeklinik<br />
der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong> als Praxispartner verfasst wurde. Zuerst folgt die Beschreibung des Stu-<br />
diendesigns im vierten Kapitel. Das fünfte Kapitel beinhaltet die Analyse der Pferdeklinik der<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong>.<br />
Im vierten Teil werden Schlussfolgerungen präsentiert. Dabei werden im sechsten Kapitel zu-<br />
nächst allgemeine <strong>und</strong> an den Praxispartner gerichtete spezifische Handlungsempfehlungen<br />
gegeben. Im siebten <strong>und</strong> letzten Kapitel folgen die Überprüfung des im dritten Kapitel erstell-<br />
ten Bezugsrahmens auf seine Brauchbarkeit hin, ein Fazit <strong>und</strong> ein Ausblick. Den Abschluss<br />
der Lizentiatsarbeit bildet eine kritische Würdigung der geleisteten Arbeit.<br />
Denise Kuonen Seite 7
Einleitung<br />
TEIL 1: EINFÜHRUNG<br />
• Einleitung (Kapitel 1)<br />
TEIL 2: KONZEPTIONELLE ERKENNTNISSE<br />
• Gr<strong>und</strong>lagen (Kapitel 2)<br />
• Konzeptioneller Bezugsrahmen (Kapitel 3)<br />
TEIL 3: FALLSTUDIE<br />
• Studiendesign (Kapitel 4)<br />
• Unternehmensanalyse der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong> (Kapitel 5)<br />
TEIL 4: SCHLUSSFOLGERUNGEN<br />
• Gestaltungsempfehlungen (Kapitel 6)<br />
• Schlussfolgerungen (Kapitel 7)<br />
Abbildung 1: Aufbau der Lizentiatsarbeit (eigene Darstellung).<br />
Denise Kuonen Seite 8
Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Teil 2: KONZEPTIONELLE ERKENNTNISSE<br />
2 Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Im Folgenden sollen die wichtigsten in der vorliegenden Lizentiatsarbeit verwendeten Begrif-<br />
fe definiert werden: „Betrieb“ bzw. „Unternehmen“, „Unternehmensanalyse“ <strong>und</strong> „Pferdekli-<br />
nik“ sowie die beiden Begriffe „Interne Kommunikation“ <strong>und</strong> „Prozess“, da in der Fallstudie<br />
u. a. die interne Kommunikation <strong>und</strong> die Prozessabläufe genauer untersucht werden.<br />
2.1 Betrieb bzw. Unternehmen<br />
2.1.1 Einführung <strong>und</strong> Definition<br />
Der Begriff „Betrieb“ kommt von „betreiben“ <strong>und</strong> meint „[…] jede Form der Zusammenar-<br />
beit von Menschen, die gemeinsam ein <strong>für</strong> sie wichtiges Ziel zu erreichen beabsichtigen, wo-<br />
bei persönliche Motive zunächst ausscheiden. In der Wirtschaftspraxis ist ein Betrieb definiert<br />
als eine planvoll organisierte Einrichtung zur Erstellung von Leistung zur Bedarfsdeckung<br />
<strong>und</strong> zur Leistungsverwertung.“ (Albert 1997: 355). Gemäss Thommen (1996: 32) dienen Be-<br />
triebe primär der Fremdbedarfsdeckung, d. h. sie leiten ihren Bedarf aus den Bedürfnissen der<br />
privaten Haushalte, also von Kollektivbedürfnissen, ab <strong>und</strong> werden deshalb auch Produk-<br />
tionswirtschaften genannt.<br />
Die betriebliche Leistung erfolgt durch Kombination der Produktionsfaktoren Arbeit, Werk-<br />
stoffe <strong>und</strong> Betriebsmittel (vgl. Albert 1997: 357). „Als Produktionsfaktoren bezeichnet man<br />
in der Betriebswirtschaftslehre alle Elemente, die im betrieblichen Leistungserstellungs- <strong>und</strong><br />
Leistungsverwertungsprozess miteinander kombiniert werden.“ (Thommen 1996: 31). Unter<br />
dem Begriff „Werkstoffe“ fasst Wöhe alle Güter zusammen, „[…] aus denen durch Umfor-<br />
mung, Substanzänderung oder Einbau neue Fertigprodukte hergestellt werden.“ (Wöhe 2002:<br />
262). Dies sind u. a. Roh-, Hilfs- <strong>und</strong> Betriebsstoffe, ferner alle Güter, die als fertige Bestand-<br />
teile in ein Produkt eingebaut werden wie bspw. Lichtanlagen <strong>und</strong> Armaturen der Automobil-<br />
produktion. Maschinen, Werkzeuge, Gebäude, Verkehrsmittel usw. zählt man zu den Be-<br />
Denise Kuonen Seite 9
Gr<strong>und</strong>lagen<br />
triebsmitteln. Dazu „[…] gehört die gesamte technische Apparatur, deren sich der Betrieb zur<br />
Durchführung des Betriebsprozesses bedient.“ (Wöhe 2002: 256).<br />
„Sieht man den Betrieb zusammen mit seinem rechtlich-finanziellen Rahmen, so spricht man<br />
von einem Unternehmen.“ (Albert 1997: 357). Die Begriffe „Betrieb“ <strong>und</strong> „Unternehmung“<br />
werden in den Medien sowie in der Wirtschaftspraxis weitgehend synonym gebraucht (vgl.<br />
Knolmayer 2004: 23), wobei umgangssprachlich der Begriff „Unternehmung“ häufiger bei<br />
privaten, der Begriff „Betrieb“ häufiger bei öffentlichen Unternehmungen gebraucht wird<br />
(vgl. Thommen 1996: 32). In der Folge werden die beiden Begriffe „Unternehmen“ <strong>und</strong> „Be-<br />
trieb“ synonym verwendet. In Anlehnung an neuere Definitionen bezeichnet Thommen (1996:<br />
51) die Unternehmung als ein offenes, dynamisches, komplexes, autonomes, marktgerichtetes<br />
produktives, soziales System. „Damit wollen wir zum Ausdruck bringen, dass die Unterneh-<br />
mung<br />
• ein soziales System ist, in welchem Menschen als Individuen oder in Gruppen tätig sind<br />
<strong>und</strong> das Verhalten der Unternehmung wesentlich beeinflussen,<br />
• durch Kombination der Produktionsfaktoren produktive Leistungen erstellt,<br />
• als offenes System mit ihrer Umwelt dauernd Austauschprozesse durchführt <strong>und</strong> durch<br />
vielfältige Beziehungen mit ihrer Umwelt verb<strong>und</strong>en ist,<br />
• sich laufend ändern muss, um sich neuen Entwicklungen anzupassen oder diese selber<br />
zu beeinflussen (dynamisches System),<br />
• aus vielen einzelnen Elementen besteht, deren Kombination zu einem Ganzen ein sehr<br />
komplexes System von Strukturen <strong>und</strong> Abläufen ergibt,<br />
• autonom ihre Ziele bestimmen kann, auch wenn dabei – gerade in einer sozialen<br />
Marktwirtschaft – gewisse Einschränkungen durch den Staat (Gesetze) als Rahmenbe-<br />
dingungen zu beachten sind,<br />
• sämtliche Anstrengungen letztlich auf die Bedürfnisse des Marktes ausrichten muss<br />
(marktgerechtes System).“<br />
Wie sich schon aus der Länge des Zitates zeigt, ist diese Definition der Unternehmung sehr<br />
umfassend. Die Verfasserin wird sich in der vorliegenden Lizentiatsarbeit auf diese Definition<br />
beziehen.<br />
Denise Kuonen Seite 10
Gr<strong>und</strong>lagen<br />
2.1.2 Bestimmungsfaktoren<br />
Betriebe bzw. Unternehmen finden sich sowohl in einer freien Marktwirtschaft als auch in ei-<br />
ner zentral geführten Planwirtschaft. Deshalb können sie nach Gutenberg (1976: 457 ff.)<br />
durch systemindifferente <strong>und</strong> systembezogene Merkmale charakterisiert werden. Gutenberg<br />
nennt folgende systemindifferente Merkmale:<br />
• Kombination der Produktionsfaktoren: In jedem Betrieb müssen Produktionsfakto-<br />
ren wie Inputgüter <strong>und</strong> menschliche Arbeit miteinander kombiniert werden, um eine<br />
Leistung (Output) zu erbringen.<br />
• Diese Kombination erfolgt nach dem ökonomischen Prinzip: Für längere Zeit versucht<br />
jeder Betrieb nach diesem Prinzip aufgr<strong>und</strong> der Knappheit der Güter zu handeln. Dieses<br />
Prinzip kommt in drei Ausprägungen vor: Prinzip der Outputmaximierung (mit ei-<br />
nem gegebenen Input soll ein möglichst hoher Output erzielt werden), Prinzip der In-<br />
putminimierung (ein vorgegebener Output soll mit einem möglichst kleinen Input an<br />
Produktionsfaktoren realisiert werden), Prinzip des optimalen Input-Outputverhält-<br />
nisses (Input <strong>und</strong> Output sollen so aufeinander abgestimmt werden, dass das ökonomi-<br />
sche Problem nach den festgelegten Kriterien optimal gelöst wird).<br />
• Jeder Betrieb sollte versuchen, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Dieses<br />
Prinzip heisst Prinzip des finanziellen Gleichgewichts.<br />
Diese systemindifferenten Merkmale haben gemäss Gutenberg <strong>für</strong> alle Wirtschaftssysteme<br />
Gültigkeit. Betriebe in Marktwirtschaften zeichnen sich durch folgende systembezogenen<br />
Merkmale aus:<br />
• Autonomieprinzip: Für den Betrieb in der Marktwirtschaft ist charakteristisch, dass er<br />
seine Entscheidungen eigenständig treffen kann. Dieses Prinzip beinhaltet die Nutzung<br />
von Marktchancen, aber auch die Gefahr von Risiken des Misslingens, die ohne Hilfe<br />
des Staates getragen werden müssen.<br />
• Erwerbswirtschaftliches Prinzip: Dieses Prinzip fordert, dass ein Unternehmen lang-<br />
fristig einen möglichst hohen Gewinn auf dem eingesetzten Kapital erzielen sollte.<br />
• Prinzip des Privateigentums: Dieses Prinzip besagt, dass den Eigenkapitalgebern das<br />
Privateigentum an den Produktionsmitteln zukommt. Daraus leitet sich der Anspruch<br />
der Eigenkapitalgeber auf Alleinbestimmung, d. h. auf die mittelbare <strong>und</strong> unmittelbare<br />
Geschäftsführung, ab.<br />
Denise Kuonen Seite 11
Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Dagegen zeichnen sich Betriebe der Zentral- <strong>und</strong> Planwirtschaften durch folgende systembe-<br />
zogenen Merkmale aus:<br />
• Organprinzip: Gemäss diesem Prinzip sind die öffentlichen Betriebe ausführende Or-<br />
gane des Staates. Die Pläne eines Betriebes können deshalb nicht auf den Markt ausge-<br />
richtet werden, sondern werden aufgr<strong>und</strong> eines zentralen Volkswirtschaftsplanes hin-<br />
sichtlich Menge, Qualität <strong>und</strong> Zeit festgelegt.<br />
• Prinzip der Planerfüllung: Die öffentlichen Betriebe richten ihr Handeln auf die Erfül-<br />
lung des von den staatlichen Planungsstellen vorgegebenen Planes aus.<br />
• Prinzip des Gemeineigentums: An die Stelle des Privateigentums tritt das Gemeinei-<br />
gentum. Es besteht folglich ein gesellschaftlicher Anspruch auf Mitbestimmung.<br />
Gemäss Thommen (1996: 32 ff.) ist zu beachten, dass in einem marktwirtschaftlichen System<br />
staatliche Betriebe vorhanden sind, die ähnliche Charakteristika wie die planwirtschaftlichen<br />
Betriebe aufweisen, <strong>und</strong> umgekehrt gibt es in zentralwirtschaftlich geführten Ländern Betrie-<br />
be, die viele Gemeinsamkeiten mit (markwirtschaftlichen) Unternehmungen haben.<br />
2.1.3 Öffentlicher Betrieb bzw. Unternehmen<br />
2.1.3.1 Definition<br />
Neben den privaten Betrieben, die primär Gewinn- <strong>und</strong> Wachstumsziele verfolgen, gibt es die<br />
öffentlichen, deren Ziele sich auch auf übergeordnete, öffentliche Interessen beziehen (vgl.<br />
Redli 1984: 197). Die staatlichen Betriebe in Marktwirtschaften werden Staatsbetriebe oder<br />
öffentliche Betriebe genannt <strong>und</strong> sind somit Bestandteil einer sozialen Marktwirtschaft, ge-<br />
nauso wie die Privaten. Denn ihnen fallen v. a. Aufgaben zu, die durch die Privatwirtschaft<br />
nicht rentabel oder nur mit sozial unerwünschten Nebeneffekten erfüllt werden können. Die<br />
öffentlichen Betriebe sind gemäss Thommen (1996: 33 f.) in folgenden Bereichen tätig:<br />
• Ver- <strong>und</strong> Entsorgungswirtschaft (Elektrizität, Gas, Wasser, Kehricht).<br />
• Verkehrswirtschaft (Bahn, Schifffahrt, Strasse).<br />
• Kreditwirtschaft (Nationalbank, Kantonalbanken).<br />
• Versicherungswirtschaft (Sozialversicherung, AHV).<br />
• Informationswirtschaft (Radio, Fernsehen).<br />
• Kommunikationswirtschaft (Post, Telefon).<br />
Denise Kuonen Seite 12
Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Daneben finden sich aber auch <strong>Institut</strong>ionen der öffentlichen Hand wie Theater, Museen,<br />
Schulen, <strong>Universität</strong>en, Schwimmbäder, Sportanlagen, Krankenhäuser, Heime, Armee, Ge-<br />
fängnisse etc. All diesen <strong>Institut</strong>ionen ist gemeinsam, dass sie die Kosten nicht oder nur teil-<br />
weise durch die selbst erwirtschafteten Erträge decken können <strong>und</strong> somit durch Steuergelder<br />
finanziert werden müssen.<br />
Die öffentliche Hand hat einen bestimmenden Einfluss auf die Geschäftspolitik der öffentli-<br />
chen Unternehmen. Die öffentliche Hand „beherrscht“ die öffentlichen Unternehmen sozusa-<br />
gen. Bei den gemischtwirtschaftlichen Betrieben kommt dem Staat nur eine mitbestimmende<br />
Rolle zu (vgl. Vogel 2000: 36). Daraus leitet sich folgende Definition <strong>für</strong> öffentliche Betriebe<br />
ab: „Ein öffentlicher Betrieb („ein öffentliches Unternehmen“) ist eine Einzelwirtschaft,<br />
deren Eigenkapital- oder Ausstattung mit Sachgütern, <strong>Personal</strong>- <strong>und</strong> Finanzmitteln ganz oder<br />
teilweise, direkt oder indirekt von einer oder mehreren öffentlich-rechtlichen Körperschaften<br />
aufgebracht worden ist <strong>und</strong> deren erstellte Güter <strong>und</strong> Dienstleistungen marktgängig sind.“<br />
(Brede 2001: 26). Unter einer Einzelwirtschaft wird dabei eine Wirtschaftseinheit bezeichnet,<br />
die relativ selbstständig über knappe Ressourcen verfügen kann (vgl. Brede 2001: 26).<br />
Öffentliche Unternehmen wirken i. d. R. binnenstaatlich, d. h. als nationale öffentliche Unter-<br />
nehmen. Sie können aber z. T. auch Exporte vornehmen als Industriebeteiligungen, Ausland-<br />
töchter haben oder sogar auf einer Mischung von in- <strong>und</strong> ausländischen Anteilseignern beru-<br />
hen. Besonders im letzten Fall liegen internationale öffentliche Unternehmen vor (vgl. Chmie-<br />
lewicz 1989: 1095).<br />
Gemäss Himmelmann (1992: 26) unterscheiden sich öffentliche Betriebe u. a. bzgl. folgender<br />
Merkmale:<br />
• Geschichtliche Herkunft <strong>und</strong> historische Gründe ihrer Entstehung.<br />
• Trägerschaft (B<strong>und</strong>, Kantone, Gemeinden, Gemeindeverbände).<br />
• Rechtsform (öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich).<br />
• Marktform (Tätigkeit in einem Monopol- oder im Wettbewerbssektor).<br />
• Beteiligungsverhältnis (Anteilsbesitz der öffentlichen sowie der privaten Träger).<br />
• Branchen (z. B. Elektrizitätsversorgung, Nahverkehr, Ges<strong>und</strong>heitswesen). Tabelle 1<br />
(vgl. Kapitel 3.1.1.2.1) zeigt eine Übersicht über die nach Branchen aufgeteilten öffent-<br />
lichen Unternehmen.<br />
Denise Kuonen Seite 13
Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Es stellt sich die Frage, wann ein Betrieb als öffentlich bezeichnet wird. Damit ist ein zweifa-<br />
ches Abgrenzungsproblem verb<strong>und</strong>en (vgl. Brede 2001: 25). Öffentliche Betriebe können ei-<br />
nerseits von privaten Unternehmen, andererseits von der öffentlichen Verwaltung abgegrenzt<br />
werden.<br />
2.1.3.2 Abgrenzung zu privaten Unternehmungen<br />
Die Abgrenzung der öffentlichen Betriebe zu den privaten ist in der Praxis oft schwierig. „Die<br />
Unterscheidung zwischen öffentlichen <strong>und</strong> privaten Unternehmen erfolgt anhand der Eigen-<br />
tümerschaft.“ (Lutz 2004: 28). Es herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass Unternehmen<br />
als öffentlich bezeichnet werden, wenn sie sich im Eigentum der öffentlichen Hand befinden<br />
(vgl. Brede 2001: 26, Eichhorn 2002: 599, Thommen 1996: 32, Stein 1998: 47 etc.). Je nach<br />
Umfang der öffentlichen Eigentümerschaft gibt es unterschiedliche Bezeichnungen <strong>für</strong> öffent-<br />
liche Unternehmungen (vgl. Abbildung 2).<br />
Anteil der<br />
Markt- an<br />
den Erfolgs-<br />
einnahmen [%]<br />
100<br />
Private Unter- Gemischtwirt- Öffentliche<br />
nehmung schaftliche Unternehmung<br />
Unternehmung<br />
Öffentliche<br />
Verwaltung<br />
0 Anteil des Staates am Eigenkapital [%] 100<br />
Abbildung 2: Finanzstruktur verschiedener Betriebstypen (Chmielewicz 1989: 1093).<br />
„Ist ein Unternehmen vollständig im Eigentum der öffentlichen Hand, so handelt es sich um<br />
ein rein öffentliches Unternehmen. Sind mehrere Gemeinwesen beteiligt, liegt ein gemischtöf-<br />
fentliches Unternehmen vor. Ein gemischtes Eigentum öffentlicher <strong>und</strong> privater Träger führt<br />
zu einem gemischtwirtschaftlichen Unternehmen. Ohne öffentliche Beteiligung handelt es<br />
sich um ein rein privatwirtschaftliches Unternehmen (nicht öffentliches Unternehmen).“ (Lutz<br />
2004: 28).<br />
Weitere Kriterien, die dabei helfen, die öffentlichen von den privaten Betrieben abzugrenzen,<br />
sind folgende (vgl. Thommen 1996: 32 f.):<br />
• Rechtliche Gr<strong>und</strong>lagen: Öffentliche Betriebe unterstehen dem öffentlichen Recht<br />
(Verwaltungsrecht <strong>für</strong> B<strong>und</strong>, Kantone <strong>und</strong> Gemeinden, Rechtserlasse etc.), private Be-<br />
triebe dem Privatrecht (OR, ZGB).<br />
Denise Kuonen Seite 14
Gr<strong>und</strong>lagen<br />
• Der Grad der Selbstbestimmung zeigt, ob die Unternehmung alle wichtigen Entschei-<br />
dungen selber treffen kann oder ob sie in ihrer Entscheidungsfreiheit durch die öffentli-<br />
che Hand eingeschränkt ist. Die unterschiedlichen Ausprägungen sind nachfolgend in<br />
Abbildung 3 ersichtlich.<br />
100 %<br />
Grad der Selbstbestimmung<br />
0 %<br />
Abbildung 3: Selbstbestimmungsrad von Betrieben (Thommen 1996: 33).<br />
öffentlicher Betrieb Mischformen privater Betrieb<br />
2.1.3.3 Abgrenzung zur „öffentlichen Verwaltung“<br />
Ein weiteres Abgrenzungskriterium <strong>für</strong> öffentliche Betriebe ist die „[…] ausreichende Aus-<br />
stattung mit marktmäßig wenigstens partiell reproduzierbarem Eigenkapital, die sich in der fi-<br />
nanzwirtschaftlichen Sonderstellung <strong>und</strong> rechnerischen Trennung vom Muttergemeinwesen<br />
niederschlägt.“ (Eichhorn 1986: 15 f.). Dieses Kriterium, mit dem die Abgrenzung zur öffent-<br />
lichen Verwaltung erfolgt, ist einerseits durch die Marktgängigkeit der Güter <strong>und</strong> Dienstleis-<br />
tungen, andererseits durch die Eigenkapitalausstattung gekennzeichnet (vgl. Lutz 2004: 31).<br />
Unter einer Verwaltung versteht Brede (2001: 17) „[…] eine Einzelwirtschaft, deren Ausstat-<br />
tung mit Sachgütern, <strong>Personal</strong>- <strong>und</strong> Finanzmitteln von einer oder mehreren öffentlich-<br />
rechtlichen Körperschaften aufgebracht worden ist <strong>und</strong> deren erstellte Güter oder Dienstleis-<br />
tungen nicht marktgängig sind.“ Die Marktgängigkeit von Gütern <strong>und</strong> Dienstleistungen wird<br />
in der Ökonomie anhand der beiden Kriterien Ausschliessbarkeit, d. h. dass es möglich ist,<br />
Menschen von der Inanspruchnahme eines Gutes oder einer Dienstleistung auszuschliessen,<br />
<strong>und</strong> Rivalität im Konsum, d. h. der Konsum einer Person schränkt die Menge, die den anderen<br />
Konsumenten zur Verfügung steht, ein (vgl. Varian 1994: 417). Wenn sich Güter <strong>und</strong> Dienst-<br />
leistungen durch Nichtrivalität im Konsum auszeichnen (z. B. Beleuchtung von Strassen in<br />
einer Stadt), findet sich kein Unternehmen, das bereit wäre, dieses Produkt zu vermarkten.<br />
Die Bereitstellung dieses Gutes fällt somit in den Aufgabenbereich der öffentlichen Verwal-<br />
tung, da sie die Möglichkeit hat, die Kosten durch Abgaben zu decken (vgl. Jenni 2002: 28).<br />
Ferner hat die öffentliche Hand Interesse daran, meritorische Güter <strong>und</strong> Dienstleistungen an-<br />
zubieten. Kennzeichen meritorischer Güter ist, dass sie in einem grösseren Umfang angeboten<br />
Denise Kuonen Seite 15
Gr<strong>und</strong>lagen<br />
werden müssen, als dass sie der Markt aufgr<strong>und</strong> der Nachfrage durch die Konsumenten be-<br />
reitstellt. Es findet folglich ein Engriff des Staates statt. „Obwohl es sich bei diesen Gütern<br />
um private Güter handelt, werden sie auf Gr<strong>und</strong> von Entscheidungen der Politik <strong>und</strong> des<br />
Staates als würdig angesehen, öffentlich bereitgestellt oder limitiert zu werden.“ (Lutz 2004:<br />
32 ff.). Als Beispiel sei der Personennahverkehr erwähnt. Bliebe es den Entscheidungen pri-<br />
vater Anbieter allein überlassen, welches Angebot an Verkehrsleistungen unterbreitet würde<br />
oder wie dieses Verkehrsangebot im Einzelnen aussähe, ist leicht vorstellbar, dass nur rentab-<br />
le Strecken zu den Stosszeiten bedient würden (vgl. Brede 2001: 14). Meritorische Güter <strong>und</strong><br />
Dienstleistungen stellen folglich einen Gr<strong>und</strong> <strong>für</strong> die Existenz öffentlicher Unternehmen dar<br />
(vgl. Jenni 2002: 28).<br />
2.2 Unternehmensanalyse<br />
2.2.1 Einführung <strong>und</strong> Definition<br />
In der Literatur werden neben dem Begriff „Unternehmensanalyse“ auch die zwei Begriffe<br />
„<strong>Organisation</strong>s-“ <strong>und</strong> „Betriebsanalyse“ verwendet. Um die Bedeutung der Begriffe aufzuzei-<br />
gen, wird nachfolgend neben der Definition des Begriffs „Unternehmensanalyse“ auch eine<br />
Definition zu „<strong>Organisation</strong>s-“ <strong>und</strong> zu „Betriebsanalyse“ formuliert.<br />
2.2.1.1 Betriebsanalyse<br />
Schnettler (1958: 6 ff.) unterscheidet nach der Art des Vorgehens folgende Formen der Be-<br />
triebsanalyse: „Erstens Betriebsanalysen, die sich vorwiegend mit verbalen Äußerungen be-<br />
gnügen <strong>und</strong> keine ziffernmäßigen Ergebnisse bringen, <strong>und</strong> zweitens Betriebsanalysen, die in<br />
erster Linie zahlenmässig fassbare Größen verwenden.“ Er bezeichnet die erste Methode als<br />
„verbale Methode“ <strong>und</strong> die zweite Methode als „rechnerische“.<br />
Denise Kuonen Seite 16
Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Untersuchung der Kosten<br />
<strong>und</strong> Erträge<br />
Verbale Methode<br />
Messung von Grössen, die sich auf<br />
einen einheitlichen, geschlossenen<br />
„Ber eich“ beziehen. Aus diesem „Bereich“<br />
werden bestimmte Teilerscheinungen bzw.<br />
Vorgänge herausgegriffen <strong>und</strong> analysiert.<br />
Formen der Betriebsanalyse<br />
Analyse von Grössen<br />
der Bilanz<br />
Rechnerische Methode<br />
Messung von Teilgrössen<br />
bzw. Teilvorgängen z. B. der Kapazität einer<br />
Maschine, der Kosten pro Stück, u. a. m.<br />
Messung der Durchlaufsbzw.<br />
Umschlagsgeschwindigkeit<br />
Messung von Wirtschaftlichkeit,<br />
Produktivität <strong>und</strong><br />
Rentabilität<br />
Abbildung 4: Formen der Betriebsanalyse (eigene Darstellung in Anlehnung an Schnettler 1958: 8).<br />
Die verbale Methode findet dann Verwendung, wenn das Objekt der Analyse zahlenmässig<br />
nicht oder nur sehr schwer fassbar ist wie z. B. bei der Untersuchung der <strong>Organisation</strong> eines<br />
Betriebes, seines <strong>Personal</strong>wesens <strong>und</strong> seiner Struktur oder seiner Verbindungen mit der Um-<br />
welt usw. Bei der rechnerischen Methode wird weiter unterschieden „[…] zwischen Analy-<br />
sen, die im Anschluß an die Geschäfts- <strong>und</strong> Betriebsbuchhaltung durchgeführt werden, <strong>und</strong><br />
Analysen, die in der Form von Sonderrechnungen abgewickelt werden.“ (Schnettler 1958: 7).<br />
Es handelt sich hierbei vorwiegend um die Zerlegung bzw. Aufgliederung betrieblicher Grös-<br />
sen wie z. B. die Untersuchung der Kosten <strong>und</strong> Erträge eines Unternehmens oder die Analyse<br />
von Grössen der Bilanz etc. Der Begriff „Betriebsanalyse“ bezieht sich <strong>für</strong> Schnettler (1958:<br />
2) „[…] nicht nur auf die Zerlegung bzw. Aufgliederung von betrieblichen Größen. Hinzu-<br />
kommen muß die anschließende Einordnung der Ergebnisse in größere Zusammenhänge. Me-<br />
thodisch gesehen wird dabei von der Wirkung auf die Ursache zurückgegangen.“<br />
Meist wird der Begriff „Betriebsanalyse“ in der Literatur im Zusammenhang mit der Bewer-<br />
tung von Unternehmen <strong>und</strong> der Untersuchung der finanziellen Kennzahlen (Bilanz, Kosten,<br />
Erträge etc.) gebraucht. Im Rahmen dieser Arbeit wurde mit Herrn Meier vereinbart, die fi-<br />
nanzielle Situation der Pferdeklinik nicht bzw. nur am Rande zu berücksichtigen. Somit be-<br />
zieht sich die folgende Lizentiatsarbeit vor allem auf die von Schnettler genannte „verbale“<br />
Form der Analyse von Unternehmen.<br />
Denise Kuonen Seite 17
Gr<strong>und</strong>lagen<br />
2.2.1.2 <strong>Organisation</strong>sanalyse<br />
In Anlehnung an Thom/Wenger (2002: 17) versteht man unter einer <strong>Organisation</strong> im instituti-<br />
onalen Sinn ein zielgerichtetes soziales System mit beständigen Grenzen zur Umwelt, in dem<br />
die Aktivitäten der Mitglieder nach einem bestimmten Muster aufgeteilt <strong>und</strong> durch Koordina-<br />
tion dauerhaft auf das verfolgte Ziel ausgerichtet werden. Eine <strong>Organisation</strong> ist folglich eine<br />
Unternehmung wie eine <strong>Universität</strong>, ein Krankenhaus, Parteien usw.<br />
Prosch (2000: 25) verwendet vorwiegend den Begriff „<strong>Organisation</strong>sanalyse“ <strong>und</strong> definiert<br />
ihn wie folgt: „<strong>Organisation</strong>sanalyse ist die Erfassung von wesentlichen Einflüssen, Merkma-<br />
len, Auswirkungen von <strong>Organisation</strong>en <strong>und</strong> <strong>Organisation</strong>sstrukturen.“ Er spricht davon, dass<br />
eine <strong>Organisation</strong>sanalyse einem besseren Verständnis von Abläufen, Prozessen, Gegebenhei-<br />
ten <strong>und</strong> Ergebnissen in <strong>und</strong> um <strong>Organisation</strong>en dient. Zudem betont er, dass die Verbindung<br />
von theoretischer F<strong>und</strong>ierung <strong>und</strong> praktischer Verwendbarkeit absolut möglich ist <strong>und</strong> zu<br />
günstigen Ergebnissen führt (vgl. Prosch 2000: 21). Um die Bedeutung des genauen Ist-<br />
Zustandes hervorzuheben, wird die Definition von Acker herangezogen. Bei Acker (1966: 9)<br />
setzt sich der Begriff „<strong>Organisation</strong>sanalyse“ aus der Aufnahme <strong>und</strong> der genauen Aufführung<br />
des Ist-Zustandes, seiner kritischen Überprüfung auf Schwächen <strong>und</strong> Fehlern sowie aus der<br />
Entwicklung <strong>und</strong> Beurteilung von alternativen Lösungen zusammen. Für Acker ist ohne eine<br />
Aufnahme <strong>und</strong> genaue Darstellung des Ist-Zustandes keine fruchtbare <strong>Organisation</strong>sanalyse<br />
möglich. Deshalb soll die Erfassung des Ist-Zustandes in den Untersuchungsgegenstand ein-<br />
bezogen werden.<br />
2.2.1.3 Unternehmensanalyse<br />
Der Begriff „Unternehmensanalyse“ taucht in der Literatur v. a. im Zusammenhang mit der<br />
strategischen Analyse eines Unternehmens auf (bspw. vgl. Aeberhard 1996, Grünig/Kühn<br />
2000, Lombriser/Abplanalp 2004 oder Ulrich/Fluri 1992). Die strategische Analyse ist ein<br />
zentraler Schritt im Prozess der strategischen Planung (vgl. Kreilkamp 1987: 563). Aeberhard<br />
(1996: 39 f.) versteht „[…] unter strategischer Analyse:<br />
• Einen wesentlichen Schritt im Prozess der strategischen Planung,<br />
• dessen Hauptaufgabe in der systematischen Suche <strong>und</strong> Diagnose von Stärken <strong>und</strong><br />
Schwächen im Unternehmen sowie von günstigen <strong>und</strong> ungünstigen Entwicklungen in<br />
seiner Umwelt liegt,<br />
Denise Kuonen Seite 18
Gr<strong>und</strong>lagen<br />
• mit dem Zweck, die gegenwärtige Ausgangslage mit ihren Chancen <strong>und</strong> Risiken aufzu-<br />
zeigen <strong>und</strong> daraus die zukünftigen Möglichkeiten des Unternehmens abzuleiten.“<br />
Der Hauptzweck der strategischen Analyse besteht folglich im Aufzeigen der gegenwärtigen<br />
Ausgangslage mit ihren Chancen <strong>und</strong> Risiken <strong>und</strong> der daraus abgeleiteten Möglichkeiten des<br />
Unternehmens in der Zukunft. Die strategische Analyse wird in der Literatur meist sehr ähn-<br />
lich aufgeteilt (vgl. Kreilkamp 1987, Steinmann/Schreyögg 1993 etc.). In Anlehnung an<br />
Aeberhard (1996: 54) sieht die Zerlegung der Gesamtanalyse in Analysefelder folgendermas-<br />
sen aus:<br />
Umweltanalyse<br />
Globale Umwelt Aufgabenspezifische<br />
Umwelt<br />
Gesellschaft <strong>und</strong><br />
Kultur<br />
Technologie<br />
Politik <strong>und</strong><br />
Recht<br />
Ökonomie<br />
Markt<br />
Ökologie Branche<br />
Unternehmensanalyse<br />
Analysefeld Unternehmen<br />
Günstige <strong>und</strong> Stärken <strong>und</strong><br />
ungünstige Schwächen des<br />
Umweltentwicklungen<br />
Unternehmens<br />
Unternehmens-<br />
spezifische Chancen <strong>und</strong><br />
Risiken<br />
Abbildung 5: Felder der strategischen Analyse (eigene Darstellung in Anlehnung an Aeberhard 1996: 54).<br />
Denise Kuonen Seite 19
Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Die Unternehmensanalyse ist folglich neben dem Analysefeld globale Umwelt <strong>und</strong> dem Ana-<br />
lysefeld aufgabenspezifische Umwelt ein Teil der strategischen Analyse. Es bestimmen zwei<br />
Faktoren das strategische Verhalten eines Unternehmens: einerseits die relevante Umwelt, die<br />
dem Unternehmen mit ihren Chancen <strong>und</strong> Risiken den Handlungsrahmen vorgibt; anderer-<br />
seits die Ressourcen, Fähigkeiten <strong>und</strong> Kernkompetenzen des Unternehmens. Denn diese<br />
bestimmen, welche Position das Unternehmen innerhalb dieses Rahmens tatsächlich ein-<br />
nimmt (Lombriser/Abplanalp 2004: 141). Nachfolgend werden neben dem Analysefeld Un-<br />
ternehmen auch die Felder globale Umwelt <strong>und</strong> aufgabenspezifische Umwelt kurz beschrie-<br />
ben.<br />
2.2.1.3.1 Analysefelder der globalen Umwelt<br />
Bei der Analyse der globalen Umwelt geht es darum, die <strong>für</strong> die Unternehmung relevanten<br />
Entwicklungen im weiteren Umfeld zu erfassen. Die globale Umwelt wird in der Literatur<br />
ähnlich gestaltet (vgl. Aeberhard 1996: 46, Grünig/Kühn 2000: 141, Kreilkamp 1987: 70 ff.<br />
etc.). In Anlehnung an Aeberhard (1996: 46) wird die globale Umwelt wie folgt strukturiert:<br />
• Ökonomische Umwelt: Sie umfasst diejenigen Einflussfaktoren, die <strong>für</strong> die gesamt-<br />
wirtschaftliche Entwicklung von Bedeutung sind wie bspw. die Konjunktur, der rele-<br />
vante Zinssatz, die aktuellen Wechselkurse, die Einkommensentwicklung <strong>und</strong> Einkom-<br />
mensverwendung etc.<br />
• Sozio-kulturelle Umwelt: Im Zentrum der sozio-kulturellen Umwelt stehen die gesell-<br />
schaftlichen Werte <strong>und</strong> Einstellungen, ferner die demographischen Merkmale eines<br />
geographischen Raumes.<br />
• Technologische Umwelt: Die technologische Umwelt beinhaltet die Betrachtung neuer<br />
Produkt- <strong>und</strong> Verfahrenstechnologien, mit denen das Unternehmen Schritt halten muss,<br />
wenn es konkurrenzfähig bleiben will.<br />
• Politisch-rechtliche Umwelt: Die politisch-rechtliche Umwelt beinhaltet Einflussfakto-<br />
ren wie politische Unruhen, staatliche Gesetzgebungen <strong>für</strong> den nationalen Bereich, des<br />
Weiteren internationale Gesetze wie z. B. EU-Richtlinien, Gatt-Abkommen etc. Solche<br />
staatlichen Aktivitäten sind <strong>für</strong> ein Unternehmen bindend.<br />
• Ökologische Umwelt: Gegenstand der ökologischen Umwelt ist die Berücksichtigung<br />
ökologischer Belange wie z. B. Überlegungen im Zusammenhang mit dem Umwelt-<br />
schutz. Die ökologische Umwelt bietet aber auch Gelegenheiten <strong>für</strong> die Entwicklung<br />
neuer Produkte <strong>und</strong> Produktionsverfahren.<br />
Denise Kuonen Seite 20
Gr<strong>und</strong>lagen<br />
2.2.1.3.2 Analysefelder der aufgabenspezifischen Umwelt<br />
Die aufgabenspezifische Umwelt umfasst diejenigen Einflussfaktoren, mit denen das Unter-<br />
nehmen interagieren muss, um seine Aufgaben zu erfüllen. In Anlehnung an Aeberhard<br />
(1996: 49 ff.) wird die aufgabenspezifische Umwelt folgendermassen strukturiert:<br />
• Markt: Im Mittelpunkt bei der Betrachtung des Marktes steht der Abnehmer. Es sind in<br />
erster Linie nachfrageorientierte Aspekte wie z. B. die Analyse der K<strong>und</strong>enbedürfnisse,<br />
die Kaufkriterien usw., denen sich die Marktanalyse widmet. Es interessieren aber auch<br />
quantitative Daten wie das Marktvolumen, das Marktpotenzial, der eigene Marktanteil,<br />
die Stellung im Marktlebenszyklus etc.<br />
• Branche: In Anlehnung an Porter (1999: 35) wird unter Branche eine Gruppe von Un-<br />
ternehmen verstanden, die ähnliche Produkte <strong>und</strong> Leistungen anbieten <strong>und</strong> deshalb in<br />
direkter Konkurrenz zueinander stehen. Gegenstand der Branchenanalyse sind die Bran-<br />
chenstrukturanalyse, die brancheninterne Strukturanalyse <strong>und</strong> die Konkurrenzanalyse.<br />
Hier sind insbesondere produkt- bzw. angebotsorientierte Aspekte von Interesse.<br />
2.2.1.3.3 Analysefelder des Unternehmens<br />
Mit einer umfassenden Unternehmensanalyse, in die alle Ressourcen, Funktionsbereiche <strong>und</strong><br />
Aspekte einer Unternehmung einzubeziehen sind, sollen die eigenen Stärken <strong>und</strong> Schwächen<br />
(Leistungspotenziale) erkannt werden (vgl. Ulrich/Fluri 1992: 117 ff.). Mit der Unterneh-<br />
mensanalyse werden Zusammenhänge <strong>und</strong> Abhängigkeiten im Unternehmen <strong>und</strong> mit externen<br />
Faktoren erforscht <strong>und</strong> dargestellt. Somit darf das Unternehmen nicht isoliert von seiner Um-<br />
welt betrachtet werden (vgl. Aeberhard 1996: 52). Um Aussagen über Stärken <strong>und</strong> Schwä-<br />
chen eines Unternehmens ableiten zu können, werden stets auch umweltbezogene Ver-<br />
gleichsmassstäbe wie z. B. die Potenziale der wichtigsten Konkurrenten benötigt (vgl. Kreil-<br />
kamp 1987: 232 ff.).<br />
Wie bei den anderen Analysefeldern gibt es auch beim Analysefeld des eigenen Unterneh-<br />
mens unterschiedliche Dekompositionen, die sich aber z. T. sehr ähnlich sind. Die Unterneh-<br />
mensanalyse nach Ulrich/Fluri (1992: 118) beinhaltet die folgenden Bereiche:<br />
• Bisherige Unternehmenspolitik: Hier steht die Frage nach den bestehenden klaren<br />
Zielsetzungen <strong>und</strong> Verhaltensgr<strong>und</strong>sätzen, nach denen gelebt wird <strong>und</strong> die der Unter-<br />
nehmenssituation angemessen sind, im Zentrum.<br />
• <strong>Organisation</strong> <strong>und</strong> Leitung der Unternehmung: Bei der <strong>Organisation</strong> <strong>und</strong> Leitung der<br />
Unternehmung interessiert die <strong>Organisation</strong>sstruktur, die <strong>Organisation</strong>skultur, die vor-<br />
Denise Kuonen Seite 21
Gr<strong>und</strong>lagen<br />
handenen Informationssysteme, die Leitungskräfte, die Prozesse bei Entscheidungen<br />
<strong>und</strong> der Stand der Planung <strong>und</strong> Kontrolle.<br />
• <strong>Personal</strong>: Beim <strong>Personal</strong> wird die Belegschaft analysiert in Bezug auf ihre Qualifikati-<br />
on <strong>und</strong> die Altersstruktur. Ebenfalls wird das <strong>Personal</strong> auf vorhandene Nachwuchspo-<br />
tenziale untersucht. Zuletzt interessiert das Verhältnis der Mitarbeitenden untereinander,<br />
d. h. es wird das Betriebsklima genauer untersucht.<br />
• Marketing: Gegenstand der Untersuchung in Bezug auf das Marketing ist die Markt-<br />
stellung, die Marktleistung sowie die Marktbearbeitung <strong>und</strong> die Distribution.<br />
• Forschung <strong>und</strong> Entwicklung: Dieser Bereich beinhaltet die Betrachtung der For-<br />
schungsaufwendungen, -qualität <strong>und</strong> -organisation.<br />
• Produktion <strong>und</strong> Beschaffung: Bei der Analyse der Produktion <strong>und</strong> Beschaffung sollen<br />
hauptsächlich die Produktionsanlagen, die Produktionsplanung <strong>und</strong> -steuerung betrach-<br />
tet werden. Ebenfalls im Zentrum der Betrachtung stehen die Flexibilität, die Reserven<br />
<strong>und</strong> die Versorgungsanlagen in Bezug auf wichtige Rohstoffe <strong>und</strong> Zwischenprodukte.<br />
Die Analyse der Produktion ist v. a. auch im Zusammenhang mit der globalen (techno-<br />
logischen) Umwelt (Verfahrenstechnologien) relevant.<br />
• Finanzsituation: Die Betrachtung der Finanzsituation ist besonders <strong>für</strong> die Eigentümer<br />
(Shareholder) interessant. Untersucht werden die Vermögens- <strong>und</strong> Kapitalstruktur, die<br />
Liquidität (Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens) <strong>und</strong> das Finanzierungspotenzial.<br />
• Kosten- <strong>und</strong> Ertragssituation: Gegenstand der Analyse der Kosten- <strong>und</strong> Ertragssitua-<br />
tion ist die Deckungsbeitragsanalyse.<br />
Ein solcher Vorschlag zur Dekomposition des Analysefelds Unternehmen ist gemäss<br />
Aeberhard (1996: 52) meist funktionsbereichsorientiert. Diese Dekomposition ist <strong>für</strong> die stra-<br />
tegische Analyse im Zusammenhang mit der Stäken-/Schwächenanalyse sinnvoll. Um den<br />
Blick <strong>für</strong> eine ganzheitliche Betrachtung des Unternehmens nicht zu verlieren, sollte aller-<br />
dings eine solche Unterteilung fallspezifisch vorgenommen werden.<br />
Beim Analysefeld des Unternehmens bezieht sich die Verfasserin auf die Unterteilung nach<br />
Ulrich/Fluri (1992: 118), da hier alle relevanten Aspekte eines Unternehmens berücksichtigt<br />
werden. In der Fallstudie wird – wie bereits erwähnt – nicht die ganze Pferdeklinik unter-<br />
sucht. Die Analyse beschränkt sich auf die allgemeine Situation (Betriebsklima), die interne<br />
Kommunikation <strong>und</strong> die Prozesse des Hilfspersonals (vgl. Kapitel 1.1). Dies betrifft folglich<br />
Denise Kuonen Seite 22
Gr<strong>und</strong>lagen<br />
die von Ulrich/Fluri genannte Untersuchung der <strong>Organisation</strong> <strong>und</strong> Leitung der Unternehmung<br />
sowie des <strong>Personal</strong>s.<br />
Die Verfasserin wird sich in der vorliegenden Arbeit auf den Begriff „Unternehmensanalyse“<br />
beziehen, da hier die Analyse ein umfassendes Bild der Unternehmung mit ihren wesentlichen<br />
Komponenten, ihren Stärken <strong>und</strong> Schwächen <strong>und</strong> mit all ihren Beziehungen zur Umwelt, zu<br />
K<strong>und</strong>en, zu Mitarbeitenden, zu Lieferanten etc. liefert.<br />
2.2.2 Zweck der Unternehmensanalyse<br />
Die Unternehmensanalyse ist – wie bereits erwähnt wurde – ein Teil der strategischen Analy-<br />
se, deren Hauptzweck im Aufzeigen der gegenwärtigen Ausgangslage einer Unternehmung<br />
mit ihren Chancen <strong>und</strong> Risiken <strong>und</strong> der daraus abgeleiteten zukünftigen Möglichkeiten be-<br />
steht. „Durch das Relativieren der Stärken <strong>und</strong> Schwächen mit den günstigsten <strong>und</strong> ungüns-<br />
tigsten Entwicklungen in der relevanten Umwelt lassen sich dann die unternehmensspezifi-<br />
schen Chancen <strong>und</strong> Risiken <strong>und</strong> damit der Ausgangspunkt der Strategieentwicklung ermit-<br />
teln.“ (Aeberhard 1996: 53). Hauptaufgabe der Unternehmensanalyse ist neben der Ermittlung<br />
der Stärken <strong>und</strong> Schwächen des Unternehmens in Bezug auf die relevanten Markt- <strong>und</strong> Bran-<br />
chenbedingungen die Suche nach den wettbewerbsrelevanten Ressourcen <strong>und</strong> Fähigkeiten.<br />
Als Ressourcen werden alle Elemente bezeichnet, die ein Unternehmen als Input dem Produk-<br />
tionsprozess zuführt (vgl. Lombriser/Abplanalp 2004: 141 f.). Die Unternehmensanalyse ist<br />
folglich Gr<strong>und</strong>lage <strong>für</strong> weit reichende Entscheidungen des Managements wie z. B. im Rah-<br />
men der strategischen Planung oder auch im Wege des Verkaufs von Unternehmen.<br />
In erster Linie dient die Unternehmensanalyse folglich internen Zwecken, u. a. der Strategie-<br />
entwicklung. Dabei stehen die Interessen der Kapitalbesitzer, der Unternehmensführung <strong>und</strong><br />
der Mitarbeitenden im Vordergr<strong>und</strong>. Der Kapitalbesitzer interessiert sich v. a. an der Erhal-<br />
tung seines Vermögens. Die Leitung eines Unternehmens will Unterlagen zur Beurteilung der<br />
Betriebsgebarung, der Kapitalstruktur, unterschiedlicher Verfahrensarten, <strong>für</strong> Budgetrechnun-<br />
gen, <strong>für</strong> die betriebliche Preispolitik etc. haben. Der Arbeiter will wissen, ob sein Arbeitsplatz<br />
weiterhin gesichert ist <strong>und</strong> ob er <strong>für</strong> seine Arbeit auch in Zukunft entschädigt wird. Die Ana-<br />
lyse eines Betriebes dient aber auch externen Zwecken, so bspw. der öffentlichen Hand, die<br />
Interesse an exakten betrieblichen Unterlagen hat, damit z. B. Gesetzesentwürfe, staatliche<br />
Massnahmen usw. besser beurteilt werden können (vgl. Schnettler 1958: 5).<br />
Denise Kuonen Seite 23
Gr<strong>und</strong>lagen<br />
2.2.3 Daten als Hilfsmittel<br />
Wie bereits erwähnt wurde, gehört es zum eigentlichen Kern einer Unternehmensanalyse, de-<br />
taillierte Informationen über z. B. den Ablauf der betrieblichen Prozesse, über die Möglichkeit<br />
von Verfahrensänderungen, über die Wirkung von Strukturen der Unternehmung etc. zu ge-<br />
winnen. In vielen Fällen ist es notwendig, vorliegendes Wissen zusammenzufassen, zu ordnen<br />
<strong>und</strong> auszuwerten. In anderen Fällen jedoch ist dies nicht ausreichend <strong>und</strong> zusätzliche Informa-<br />
tionen sind nötig, um Wissenslücken zu schliessen. Oftmals ist es aber nicht einfach, an die<br />
gewünschten Informationen heranzukommen, denn die Informationsgewinnung ist mit viel<br />
personellem, zeitlichem <strong>und</strong> finanziellem Aufwand verb<strong>und</strong>en. Aus diesem Gr<strong>und</strong> ist eine ge-<br />
schickte Vorgehensweise bei der Informationssammlung wichtig (vgl. Prosch 2000: 83).<br />
Nachfolgend werden die wichtigsten Phasen <strong>und</strong> Methoden der Datenermittlung <strong>und</strong><br />
-verarbeitung kurz dargestellt.<br />
2.2.3.1 Phasen der Datenermittlung<br />
In Anlehnung an Diekmann (2004: 162 ff.) werden nachfolgend fünf Phasen der Datener-<br />
mittlung dargestellt <strong>und</strong> beschrieben:<br />
2. Planung <strong>und</strong><br />
Vorbereitung der<br />
Erhebung<br />
1. Formulierung <strong>und</strong><br />
Präzisierung des Forschungsproblems<br />
3. Datenerhebung<br />
4. Datenauswertung<br />
Abbildung 6: Phasen einer empirischen Untersuchung (eigene Darstellung).<br />
5. Berichterstattung<br />
Denise Kuonen Seite 24
Gr<strong>und</strong>lagen<br />
• Phase 1: Der Ablauf der Gewinnung von Informationen beginnt mit der Benennung des<br />
Problems (Thematik), zu dem Informationen gesucht werden.<br />
• Phase 2: Anschliessend folgt die Planung <strong>und</strong> Vorbereitung der Erhebung, bei der es<br />
darum geht, die konkrete Thematik (die auftretenden Begriffe) in messbaren Grössen zu<br />
definieren <strong>und</strong> zu operationalisieren, d. h. einer Messung zugänglich machen. Zur Mes-<br />
sung der Einzeldimensionen bieten sich verschiedene Mess- <strong>und</strong> Skalierungsmethoden<br />
an. Dies ist ein sehr wichtiger Schritt, da mit ihm festgelegt wird, was genau gemessen<br />
werden soll (z. B. wer soll über was befragt werden). Ebenfalls folgt in dieser Phase die<br />
Konstruktion des Erhebungsinstrumentes (bei einer Befragung ist dies z. B. der Frage-<br />
bogen).<br />
• Phase 3: Anschliessend wird das Forschungsdesign festgelegt. Die Designentscheidun-<br />
gen beziehen sich auf folgende Bereiche: Frage nach der Untersuchungsebene (Kollek-<br />
tive oder Individuen als Untersuchungseinheiten), zeitlicher Aspekt der Datenerhebung<br />
(Querschnitt- <strong>und</strong> Längsschnitterhebung) etc. Ferner wird die Stichprobe nach Grösse<br />
<strong>und</strong> Typ (Zufallsstichprobe, Quotensample <strong>und</strong> „willkürliche“ Stichproben) bestimmt.<br />
Den Abschluss der dritten Phase bildet der „Vortest“ des Erhebungsinstrumentes (Pre-<br />
test), um das Erhebungsinstrument entsprechend zu überarbeiten, falls im Pretest Prob-<br />
leme auftreten.<br />
• Phase 4: Erst hier werden die eigentlichen Informationen gewonnen (eigentliche „Feld-<br />
arbeit“). Denn meistens stehen nach einer Datenerhebung die Erkenntnisse ja nicht di-<br />
rekt zur Verfügung, sondern müssen zuerst aus den Daten ermittelt <strong>und</strong> abgeleitet wer-<br />
den. Wenn bspw. eine nicht umfangreiche Befragung der Mitarbeitenden durchgeführt<br />
werden soll, helfen z. T. einfache Schätz- <strong>und</strong> Auszählungsverfahren bei der Auswer-<br />
tung der Daten. Insbesondere bei grösseren Datenmengen sind computerunterstützte sta-<br />
tistische Verfahren anzuwenden. Diekmann (2004: 169) unterscheidet vier Erhebungs-<br />
methoden, die im Kapitel 2.2.3.2 vorgestellt werden.<br />
• Phase 5: Den Abschluss der Datenermittlung bildet die Phase der Verwendung der neu-<br />
en Informationen, d. h. die Festhaltung der empirischen Resultate in einem Forschungs-<br />
bericht. Hier zeigt es sich, ob die erhobenen Daten wirklich relevant <strong>und</strong> praktisch ver-<br />
wendbar sind.<br />
2.2.3.2 Methoden der Datenerhebung<br />
Bei den Erhebungsverfahren der Sozialforschung wird zwischen der Primärforschung (Pri-<br />
märerhebung) <strong>und</strong> der Sek<strong>und</strong>ärforschung unterschieden. Die Primärforschung wird auch<br />
Denise Kuonen Seite 25
Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Feldforschung <strong>und</strong> die Sek<strong>und</strong>ärforschung Schreibtischforschung genannt (vgl. Zaugg 2002a:<br />
23). Bei der Sek<strong>und</strong>ärforschung (Dokumenten- <strong>und</strong> Literaturstudium) handelt es sich um eine<br />
Zweit- oder Neuauswertung von Datenmengen (vgl. Zaugg 2002b: 26). Bei der Analyse von<br />
Dokumenten geht es darum, Material zu erschliessen, das nicht erst vom Forscher durch die<br />
Datenerhebung geschaffen werden muss. Sie zeichnet sich durch die Vielfalt des Materials<br />
aus. Einen entscheidenden Stellenwert hat dabei die qualitative Interpretation des Dokuments<br />
(vgl. Mayring 2002: 47). Allerdings kommt die Dokumentenanalyse eher selten zum Einsatz.<br />
Das liegt u. a. daran, dass sie zum klassischen Feld der qualitativ-interpretativen Analyse ge-<br />
hört. D. h., dass menschliches Denken, Fühlen <strong>und</strong> Handeln in den Dokumenten zum Aus-<br />
druck kommen sollte, so dass sie interpretierbar sind. Die grosse Vielzahl an vorhandenem<br />
Material erweist sich bei der Dokumentenanalyse als Vorteil. Bei der Dokumentenanalyse<br />
wird Material untersucht, das bei klassischen Untersuchungsmethoden wie bspw. einem Test<br />
oder einem Beobachtungsverfahren wegfallen würde (vgl. Greiner 2001: 85). Ein weiterer<br />
Vorteil der Dokumentenanalyse ist, „ […] dass das Material, die Daten, bereits fertig sind,<br />
nicht eigens hervorgebracht, erfragt, ertestet werden müssen. Die Daten unterliegen damit<br />
weniger den Fehlerquellen der Datenerhebung; nur bei der Auswahl der Dokumente, nicht<br />
aber bei der Erhebung spielt die Subjektivität des Forschers herein.“ (Mayring 2002: 47).<br />
Abbildung 7 zeigt stellt die zentralen Erhebungsmethoden der Primärforschung im Überblick<br />
dar. Es ist zu beachten, dass die Hauptformen <strong>und</strong> deren Arten bzw. Unterformen ebenfalls<br />
miteinander in Kombination auftreten können.<br />
Denise Kuonen Seite 26
Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Erhebungsverfahren der Primärforschung<br />
Beobachtung Befragung Experiment<br />
strukturiert<br />
unstrukturiert<br />
verdeckt<br />
offen<br />
aktiv teilnehmend<br />
passiv teilnehmend<br />
Feldbeobachtung<br />
Laborbeobachtung<br />
Selbstbeobachtung<br />
Fremdbeobachtung<br />
schriftlich<br />
mündlich<br />
telefonisch<br />
elektronisch<br />
voll standardisiert<br />
teilstandardisiert<br />
nicht standardisiert<br />
Einzelperson<br />
Gruppenbefragung<br />
Feldexperiment<br />
Laborexperiment<br />
Simultanes Exp.<br />
Sukzessives Exp.<br />
Simultan<br />
Planspiel<br />
Abbildung 7: Gr<strong>und</strong>formen der Datenerfassung (eigene Darstellung in Anlehnung an Zaugg 2002a: 24).<br />
Beobachtungen sind das „[…] systematische Erfassen, Festhalten <strong>und</strong> Deuten sinnlich<br />
wahrnehmbaren Verhaltens zum Zeitpunkt seines Geschehens.“ (Atteslander 1995: 87). „Ist<br />
von der Erhebungsmethode der Beobachtung in der Sozialforschung die Rede, so wird darun-<br />
ter jedoch spezifischer die direkte Beobachtung menschlicher Handlungen, sprachlicher<br />
Äußerungen, nonverbaler Reaktionen (Mimik, Gestik, Körpersprache) <strong>und</strong> anderer sozialer<br />
Merkmale (Kleidung, Symbole, Gebräuche, Wohnformen usw.) verstanden.“ (Diekmann<br />
2004: 456). Je nach Untersuchungsgegenstand <strong>und</strong> Untersuchungszielen werden unterschied-<br />
liche Methoden der Beobachtung eingesetzt. Diekmann (2004: 469 ff.) unterscheidet die<br />
Feldbeobachtung (findet in natürlicher Umgebung statt), die Laborbeobachtung (findet in ei-<br />
ner künstlich geschaffenen Umgebung statt), Fremdbeobachtung (Beobachtung fremden Ver-<br />
haltens) <strong>und</strong> die Selbstbeobachtung (Beobachtung des eigenen Verhaltens). Ferner gilt es,<br />
zwischen strukturierten <strong>und</strong> unstrukturierten, passiv oder aktiv teilnehmenden (vgl. Fried-<br />
richs/Lüdtke 1973: 60) <strong>und</strong> verdeckten oder offenen Beobachtungsformen zu unterscheiden<br />
Denise Kuonen Seite 27
Gr<strong>und</strong>lagen<br />
(vgl. Atteslander 1995: 104 ff.). Die Dimension Strukturiertheit bezieht sich gemäss Atteslan-<br />
der (1995: 104) auf den Prozess der Wahrnehmung <strong>und</strong> den der Aufzeichnung, die beide im<br />
Beobachtungsprozess in den Extremfällen strukturiert bzw. unstrukturiert sein können. Der<br />
strukturierten Beobachtung liegt ein vorher erstelltes Beobachtungsschema zugr<strong>und</strong>e. Bei der<br />
unstrukturierten Beobachtung wird kein strukturiertes Schema verwendet. Das Beobachtungs-<br />
schema gibt an, was wie zu beobachten ist <strong>und</strong> definiert die Zahl <strong>und</strong> Art der Beobachtungs-<br />
einheiten, deren besonderen Dimensionen <strong>und</strong> gibt Beispiele <strong>für</strong> die zu beobachtende Sprache<br />
(vgl. Friedrich/Lüdtke 1973: 60). Die Dimensionen aktiv <strong>und</strong> passiv teilnehmend beziehen<br />
sich auf den Partizipationsgrad des Beobachters (vgl. Atteslander 1995: 112 f.). Passiv teil-<br />
nehmend bedeutet, dass sich der Beobachter auf seine Rolle als forschender Beobachter be-<br />
schränken kann <strong>und</strong> wenig bis überhaupt nicht an den zu untersuchenden Interaktionen teil-<br />
nimmt. Der aktive Beobachter nimmt an der Lebenswelt der Untersuchungspersonen teil, d. h.<br />
er übernimmt eine Teilnehmerrolle im Feld. „Die Dimension Offenheit bezieht sich auf die<br />
Transparenz der Beobachtungssituation <strong>für</strong> die Beobachteten <strong>und</strong> kann zwischen verdeckt<br />
<strong>und</strong> offen variieren […].“ (Atteslander 1995: 109). Bei einer verdeckten Beobachtung wissen<br />
die Beobachteten im Gegensatz zur offenen nicht, daß sie beobachtet werden.<br />
Bei den Befragungen reicht die Bandbreite von einer Volksbefragung bis hin zum Interview<br />
eines einzelnen Experten. Anhand der Kriterien Standardisierung, Durchführungsform, Ziel-<br />
gruppe <strong>und</strong> Stichprobe lässt sich die Befragung unterscheiden. In Anlehnung an Zaugg<br />
(2002a: 24) werden im Folgenden einige Befragungsformen kurz vorgestellt, die häufig zur<br />
Anwendung gelangen:<br />
• Postalische Befragung: Diese Befragungsform wird mittels schriftlichen Fragebogen<br />
durchgeführt <strong>und</strong> ist hoch standardisiert. Sie richtet sich an Einzelpersonen. Die Stich-<br />
probe ist gross (vgl. Zaugg 2002a: 24). Der Aufwand <strong>und</strong> die Kosten der schriftlichen<br />
Befragung sind im Allgemeinen geringer als bei persönlichen <strong>und</strong> telefonischen Inter-<br />
views. Ferner haben die Merkmale <strong>und</strong> das Verhalten von Interviewern keinen Einfluss<br />
auf die Befragten (vgl. Diekmann 2004: 439).<br />
• Telefonische Befragung: Bei der telefonischen Befragung, deren Zielgruppe v. a. Ein-<br />
zelpersonen sind, ist die Standardisierung hoch. Die Grösse der Stichprobe ist mittel bis<br />
gross <strong>und</strong> die Durchführungsform ist mündlich (vgl. Zaugg 2002a: 24). In der Schweiz<br />
werden heute r<strong>und</strong> zwei Drittel aller Befragungen am Telefon durchgeführt. Der Trend<br />
zum Telefoninterview ist hauptsächlich durch technologische Entwicklungen <strong>und</strong> deren<br />
Verbreitung bedingt (vgl. Diekmann 2004: 429).<br />
Denise Kuonen Seite 28
Gr<strong>und</strong>lagen<br />
• Expertenbefragungen werden mittels narrativen oder problemzentrierten Interviews<br />
unter Verwendung eines Interviewleitfadens mit Einzelpersonen durchgeführt. Die Ex-<br />
pertenbefragung ist eine mündlich Befragungsform, deren Standardisierung gering ist.<br />
Die Stichprobe ist klein (vgl. Zaugg 1996: 252 ff.). Die Merkmale <strong>und</strong> das Verhalten<br />
des Interviewers haben hier im Gegensatz zur schriftlichen Befragung einen grossen<br />
Einfluss auf die interviewte Person.<br />
Das Experiment versteht Zimmermann (1972: 37) „[…] als eine wiederholbare Beobachtung<br />
unter kontrollierten Bedingungen, wobei eine (oder mehrere) unabhängige Variable(n) derar-<br />
tig manipuliert wird, daß eine Überprüfungsmöglichkeit der zugr<strong>und</strong>e liegenden Hypothese<br />
(der Behauptung eines Kausalzusammenhanges) in unterschiedlichen Situationen gegeben<br />
ist.“ Zimmermann (1972: 38) spricht auch von einer besonderen Form der Untersuchungspla-<br />
nung, die durch Stimulus <strong>und</strong> Faktorenkontrolle gekennzeichnet ist. Gemäss Mayring (2002:<br />
59) versucht das Experiment, „[…] durch einen kontrollierten, gegenstandsadäquaten Eingriff<br />
in den Untersuchungsbereich unter möglichst natürlichen Bedingungen Veränderungen her-<br />
vorzubringen, die Rückschlüsse auf dessen Struktur zulassen.“ Zu den bekanntesten Experi-<br />
menten zählen die von Mayo <strong>und</strong> Röthlisberger durchgeführten Hawthorne Experimente (vgl.<br />
Roethlisberger/Dickson 1939), die den Übergang vom Scientific Management zur Human Re-<br />
lations Bewegung markieren (vgl. Zaugg 2002a: 25).<br />
Es gibt verschiedene Arten von Experimenten. Feldexperimente z. B. finden als experimen-<br />
telle Untersuchungen in natürlicher Umgebung statt (vgl. Diekmann 2004: 523), im Gegenzug<br />
zu den Laborexperimenten, die in künstlich geschaffenen Situationen unter weitgehend kon-<br />
trollierbaren Bedingungen stattfinden (vgl. Zimmermann 1972: 48 ff.). Ferner gibt es simul-<br />
tane <strong>und</strong> sukzessive Experimente. Der Unterschied zwischen diesen beiden Experimenten be-<br />
steht darin, dass im ersten Fall Gruppen (zwei oder mehr) gleichzeitig untersucht werden <strong>und</strong><br />
im zweiten Fall mit einer Gruppe mehrmals zu verschiedenen Zeitpunkten experimentiert<br />
wird (vgl. Zaugg 2002a: 25 f.). Um Verhaltensmuster von Einzelpersonen oder Gremien zu<br />
ermitteln, eignen sich die Simulation <strong>und</strong> das Planspiel. Sie ermöglichen die Abbildung rela-<br />
tiv komplexer Modelle. Das Experiment wird in den Sozialwissenschaften im Vergleich zu<br />
anderen Erhebungsmethoden jedoch selten eingesetzt (vgl. Zaugg 2002a: 26).<br />
Denise Kuonen Seite 29
Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Abschliessend ist zu erwähnen, dass bei der Wahl der Methoden der Datenerhebung deren<br />
Anwendungsbedingungen sowie deren Stärken <strong>und</strong> Schwächen zu beachten sind (vgl. Zaugg<br />
2002b: 26).<br />
2.2.4 Methoden der Unternehmensanalyse<br />
Es existiert eine grosse Zahl unterschiedlich spezifischer <strong>und</strong> sich teilweise inhaltlich über-<br />
schneidender Analysemethoden, die sich oftmals zur Bewältigung mehr oder weniger eng ab-<br />
gegrenzter Analyseaufgaben eignen. Eine weitere Schwierigkeit bei den Methoden ist der<br />
Umstand, dass sich <strong>für</strong> die gleiche oder ähnliche Analysemethode unterschiedliche Bezeich-<br />
nungen finden. So gleicht in der Praxis z. B. die Stärken- <strong>und</strong> Schwächenanalyse stark der<br />
Konkurrenzanalyse, denn bei beiden Methoden geht es darum, durch einen Vergleich mit der<br />
Konkurrenz eigene Stärken <strong>und</strong> Schwächen zu lokalisieren. Solche Schwierigkeiten führen<br />
dazu, dass die Vermittlung eines Überblicks über die verschiedenen Methoden nicht unprob-<br />
lematisch ist (vgl. Grünig/Kühn 2000: 144 f.). Abbildung 8 gibt einen Überblick über die vor-<br />
handenen Methoden der Unternehmensanalyse:<br />
Analysefeld<br />
Prozessschritte<br />
Schritt 1:<br />
Strategische<br />
Analyse<br />
Schritt 2:<br />
Erarbeitung der<br />
Gesamtunternehmensstrategie<br />
Schritt 3:<br />
Erarbeitung der<br />
Geschäftsstrategien<br />
Unternehmen<br />
Wertvorstellungsanalyse<br />
Stärken- <strong>und</strong><br />
Schwächenanalyse<br />
Portfolioanalyse<br />
nach Boston-<br />
Consulting Group<br />
oder nach<br />
General Electrics <strong>und</strong><br />
McKinsey<br />
Wertkettenanalyse<br />
Ressourcenanalyse<br />
Abbildung 8: Zuteilung der Analysemethoden zu den Strategieprozessen (eigene Darstellung in Anlehnung an<br />
Grünig/Kühn 2000: 151).<br />
Denise Kuonen Seite 30
Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Da es in der Fallstudie nicht darum geht, eine vollständige strategische Planung <strong>für</strong> die Pfer-<br />
deklinik durchzuführen, sondern um Informationen über die Ist-Situation beim Hilfspersonal<br />
zu erhalten <strong>und</strong> die vorhandenen Probleme zu eruieren, wird es als geeignet erachtet, nachfol-<br />
gend „nur“ die beiden Methoden Stärken-/ <strong>und</strong> Schwächenanalyse <strong>und</strong> die Wertvorstellungs-<br />
analyse detailliert vorzustellen, da diese Methoden einen Gr<strong>und</strong>stock an Informationen über<br />
ein Unternehmen liefern. Denn beim Schritt 1 (der strategischen Analyse) in Abbildung 8<br />
kommen v. a. Methoden zum Einsatz, die Fakten erfassen <strong>und</strong> strukturieren. Analysetools, die<br />
Chancen <strong>und</strong> Gefahren diagnostizieren <strong>und</strong> strategische Optionen identifizieren, sind dagegen<br />
schwergewichtig bei den Schritten 2 (der Erarbeitung einer Gesamtunternehmensstrategie)<br />
<strong>und</strong> 3 (bei der Erarbeitung von Geschäftstrategien) einzusetzen (vgl. Grünig/Kühn 2000: 151<br />
f.), was nicht Gegenstand der Fallstudie ist.<br />
2.2.4.1 Stärken-/Schwächenanalyse<br />
In der Literatur wird zur strategischen Analyse des Unternehmens im Allgemeinen überein-<br />
stimmend die Stärken-/Schwächenanalyse vorgeschlagen (vgl. Kreilkamp 1987: 237, Schrey-<br />
ögg 1984: 111, Ulrich/Fluri 1992: 117 f.).<br />
Unter einer Stärken-/Schwächenanalyse versteht man dabei die Ermittlung <strong>und</strong> Bewertung der<br />
unternehmensinternen Potenziale wie Ressourcen <strong>und</strong> Fähigkeiten eines Unternehmens im<br />
Vergleich zu seinen wichtigsten Konkurrenten (vgl. Aeberhard 1996: 172). „Auf diese Weise<br />
soll aufgedeckt werden, wo die F<strong>und</strong>amente <strong>für</strong> die künftigen Strategien liegen <strong>und</strong> welche<br />
Lücken entweder zu umgehen oder zu füllen sind.“ (Grünig/Kühn 2000: 164).<br />
In Anlehnung an Grünig/Kühn (2000: 164 ff.) wird die Stärken- <strong>und</strong> Schwächenanalyse in<br />
fünf Schritten vorgeschlagen (siehe Abbildung 9):<br />
Denise Kuonen Seite 31
Gr<strong>und</strong>lagen<br />
3. Bestimmung der in den Vergleich<br />
einzubeziehenden Konkurrenten.<br />
2. Auswahl der Bewertungskriterien,<br />
die strategische Relevanz aufweisen.<br />
1. Festlegen der Bereiche, <strong>für</strong> die ein<br />
Stärken-/Schwächenprofil erstellt werden soll.<br />
5. Vergleich <strong>und</strong> Identifikation<br />
der Leistungsdifferenzen.<br />
4. Beschaffung der benötigten Daten.<br />
Abbildung 9: Die Schritte der Stärken-/Schwächenanalyse (eigene Darstellung).<br />
Schritt 1: Zunächst ist festzulegen, <strong>für</strong> welche Bereiche des Unternehmens überhaupt ein<br />
Stärken-/Schwächenprofil zu erstellen ist.<br />
Schritt 2: Anschliessend werden in Schritt 2 die Bewertungskriterien ausgewählt, anhand de-<br />
ren das Unternehmen bzw. Bereiche des Unternehmens bewertet werden. Die Bewertungskri-<br />
terien sollten nicht nur <strong>für</strong> die Gegenwart relevant sein, sondern auch <strong>für</strong> die Zukunft<br />
(vgl. Kreilkamp 1987: 234 f.). Die Bestimmung der Bewertungskriterien wird gemäss Grü-<br />
nig/Kühn (2000: 164) als das zentrale Problem der Stärken-/Schwächenanalyse in der Litera-<br />
tur angesehen. Bewertungskriterien werden nach den Kategorien der Erfolgspotenziale unter-<br />
teilt: z. B. ist die Marktstellung (Marktanteil, Firmenimage usw.), das Angebot (Service, Qua-<br />
lität der Produkte <strong>und</strong> Dienstleistungen etc.) <strong>und</strong> die Ressourcen (Standorte, Anlagen <strong>und</strong> Ein-<br />
richtungen, Managementkompetenz etc.) ein Erfolgspotenzial. Abbildung 10 zeigt ein Formu-<br />
lar zur Durchführung einer Stärken-/Schwächenanalyse:<br />
Denise Kuonen Seite 32
Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Kriterien<br />
Marktstellung<br />
• Marktanteil<br />
• Marktanteilsveränderung<br />
• Firmenimage<br />
• Rentabilität<br />
Angebotsmerkmale<br />
• Sortimentsbreite<br />
• Sortimentstiefe<br />
• Qualität der Produkte <strong>und</strong> Leistungen<br />
• Preis<br />
• Service<br />
• Lieferbereitschaft<br />
Ressourcenmerkmale<br />
• Standorte<br />
• Anlagen <strong>und</strong> Einrichtungen<br />
• Finanzkraft<br />
• Strukturen <strong>und</strong> Abläufe<br />
• Patente <strong>und</strong> Lizenzen<br />
• Firmenname <strong>und</strong> Marken<br />
• Marketing <strong>und</strong> Verkaufskompetenz<br />
• Produktions- <strong>und</strong> Beschaffungskompetenz<br />
• Forschungs- <strong>und</strong> Entwicklungskompetenz/Innovationspotenzial<br />
• Qualitäts- <strong>und</strong> Kostenkompetenz<br />
• Managementkompetenz<br />
• Flexibilität <strong>und</strong> Wandlungsfähigkeit<br />
Bewertung<br />
1 = sehr schwach 3 = schwach 5 = mittel 7 = gut 9 = sehr gut<br />
Abbildung 10: Stärken-Schwächenprofil (Grünig/Kühn 2000: 165).<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Schritt 3: Der dritte Schritt befasst sich mit der Konkurrenz, die in den Vergleich einbezogen<br />
wird. Denn der Wettbewerbsvergleich ist zentraler Vergleichsstab der Bewertung interner Po-<br />
tenziale, d. h. der Vergleich der eigenen Ressourcen <strong>und</strong> Fähigkeiten mit den Potenzialen des<br />
oder der wichtigsten Konkurrenten (vgl. Pümpin 1992: 92).<br />
Schritt 4: Der vierte Schritt beinhaltet die Beschaffung der relevanten Daten über die eigene<br />
Unternehmung. Die benötigten Informationen zu den zu analysierenden Merkmalsausprägun-<br />
gen sind meist im Unternehmen vorhanden wie z. B. das betriebliche Rechnungswesen (vgl.<br />
Aeberhard 1996: 173) oder das Wissen der Mitarbeitenden, Dokumente <strong>und</strong> Datenbanken<br />
(vgl. Grünig/Kühn 2000: 166). Andere Potenzialbereiche wie z. B. die <strong>Organisation</strong>, die Qua-<br />
lität der Marktleistungen oder das Leistungspotenzial der Mitarbeitenden lassen sich dagegen<br />
nur mit Hilfe von qualitativen Bewertungen durch bspw. Führungskräfte oder externe Berater<br />
erfassen (vgl. Hörschgen u. a. 1993: 30). Nachdem die Daten über die eigene Unternehmung<br />
Denise Kuonen Seite 33
Gr<strong>und</strong>lagen<br />
beschaffen worden sind, wird eine Bestandesaufnahme der vorhandenen Potenziale der Kon-<br />
kurrenz vorgenommen.<br />
Schritt 5: Im letzten Schritt erfolgen schliesslich der Vergleich mit der Konkurrenz <strong>und</strong> die<br />
Identifikation der Leistungsdifferenzen.<br />
Die Frage, ob zuerst erkannte Schwächen eliminiert oder eigene Stärken ausgebaut werden<br />
sollen, ist gemäss Schwander (1996: 20 f.) theoretisch klar zu beantworten. Denn es ist dort<br />
anzusetzen, wo mit den verfügbaren Ressourcen rasch der grösste Nutzen erzielt werden<br />
kann. Die praktischen Erfahrungen zeigen, dass die sorgfältige Analyse der Stärken <strong>und</strong><br />
Schwächen des eigenen Unternehmens zum einen durch abgeleitete Sofortmassnahmen der<br />
Firma einen praktischen Nutzen bringt. Zum anderen können die ausgelösten Diskussionen<br />
z. B. innerhalb der Unternehmensführung als Ideenbörse <strong>und</strong> Vorarbeiten <strong>für</strong> die anschlies-<br />
sende Formulierung des Unternehmensleitbildes nutzbar gemacht werden.<br />
Gemäss Grünig/Kühn (2000: 168) wird die Stärken-/Schwächenanalyse sehr häufig einge-<br />
setzt, denn sie erlaubt es, mit begrenztem Aufwand ein Gesamtbild bezüglich der eigenen Po-<br />
sition zu schaffen.<br />
2.2.4.2 Wertvorstellungsanalyse<br />
Die Gr<strong>und</strong>einstellungen <strong>und</strong> Werte der obersten Leitungsorgane eines Unternehmens sind ein<br />
wichtiges Element in der strategischen Analyse bzw. der strategischen Planung, denn strategi-<br />
sche Entscheidungen lassen sich selten allein aufgr<strong>und</strong> ökonomischer Kriterien treffen (vgl.<br />
Kreikebaum 1991: 39). Die Analyse der Wertvorstellungen im eigenen Unternehmen hat folg-<br />
lich zur Aufgabe, die gr<strong>und</strong>legenden Werte der an den strategischen Entscheidungen beteilig-<br />
ten Personen zu erfassen <strong>und</strong> offen zu legen. Sie bildet die Gr<strong>und</strong>lage <strong>für</strong> die Harmonisierung<br />
abweichender Werte im Führungskreise (vgl. Aeberhard 1996: 198).<br />
Zur Analyse <strong>und</strong> Harmonisierung der Wertvorstellungen im eigenen Unternehmen empfiehlt<br />
sich ein Vorgehen in drei Schritten (vgl. Ulrich 1978: 52 ff., Aeberhard 1996: 199, Grü-<br />
nig/Kühn 2000: 169):<br />
Denise Kuonen Seite 34
Gr<strong>und</strong>lagen<br />
1. Identifikation der strategie-<br />
bestimmenden Leitungsorganen<br />
2. Ausfüllen des Formulars der<br />
Mitglieder der Leitungsorgane<br />
3. Vergleich, Diskussion <strong>und</strong><br />
eventuelle Harmonisierung<br />
der Wertvorstellungsprofile<br />
Abbildung 11: Schritte zur Analyse <strong>und</strong> Harmonisierung der Wertvorstellungen im Unternehmen (eigene Dar-<br />
stellung).<br />
Schritt 1: Zunächst werden die Leitungsorgane bestimmt, die direkt in der strategischen Pla-<br />
nung involviert sind. Je nach Eigentumsverhältnisse, juristischer Struktur, Unternehmensgrös-<br />
se etc. werden die Wertvorstellungen unterschiedlicher Personen erfasst. In jedem Fall sollten<br />
jedoch die Eigentümer sowie Personen des Verwaltungs- <strong>und</strong> Betriebsrates in den Kreis der<br />
Anspruchsgruppen einbezogen werden.<br />
Schritt 2: Darauf erfolgt die Erfassung der Wertvorstellungsprofile der Personen, die in der<br />
Analyse berücksichtigt werden. Die Erfassung der Wertvorstellungen kann schriftlich oder<br />
mündlich durchgeführt werden (vgl. Grünig/Kühn 2000: 199).<br />
Schritt 3: Abschliessend werden die unterschiedlichen Wertvorstellungsprofile miteinander<br />
verglichen. Falls Differenzen auftreten, sind diese auszudiskutieren. Ziel dieser Diskussion<br />
ist, die Wertvorstellungen im Führungskreise genügend zu harmonisieren. Bleiben die Wert-<br />
vorstellungsprofile extrem verschieden, so deutet das auf vorhandene Konfliktpotenziale hin.<br />
Eine einheitliche Führung erscheint unter solchen Voraussetzungen schwierig bzw. nicht<br />
möglich (vgl. Aeberhard 1996: 200). Falls keine genügende Harmonisierung zu Stande<br />
kommt, muss durch die Führungsspitze festgelegt werden, welche Werthaltung <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>zie-<br />
le die Rahmenbedingungen <strong>für</strong> die Erarbeitung der neuen Strategien bilden sollen (vgl. Grü-<br />
nig/Kühn 2000: 171).<br />
Gemäss Aeberhard (1996: 202) erweist sich die Analyse der Wertvorstellungen in der Berufs-<br />
praxis v. a. <strong>für</strong> die Abschätzung des Handlungsspielraums bei der Strategieentwicklung, <strong>für</strong><br />
die Erarbeitung von Unternehmensleitbildern <strong>und</strong> <strong>für</strong> die Diagnose von Unternehmenskultu-<br />
Denise Kuonen Seite 35
Gr<strong>und</strong>lagen<br />
ren wichtig. Aus methodischer Sicht gibt es <strong>für</strong> die Analyse der Wertvorstellungen kaum An-<br />
wendungsbeschränkungen.<br />
2.3 Pferdeklinik bzw. Spital<br />
2.3.1 Begriffliche Einführung<br />
Aufgr<strong>und</strong> der mangelnden spezifischen Literatur über Pferde- bzw. Tierkliniken lehnt sich die<br />
Verfasserin bei dieser Definition an den Begriff „Spital“ bzw. „Krankenhaus“ als öffentlicher<br />
Betrieb. Nach Ansicht der Verfasserin ist das Spital sehr ähnlich organisiert wie eine Tierkli-<br />
nik. In einer Pferdeklinik herrschen ähnliche Abläufe wie in einem Spital, ausser, dass die Pa-<br />
tienten keine Menschen, sondern Tiere bzw. Pferde sind.<br />
2.3.2 Spital<br />
2.3.2.1 Spital als Dienstleistungsbetrieb<br />
Das Krankenhaus ist eine Einrichtung, in der kranke Menschen untersucht <strong>und</strong> medizinisch<br />
behandelt werden. Es wird auch Klinik, Klinikum, Hospital oder Spital genannt <strong>und</strong> nach der<br />
Art der betrieblichen Leistungen der Gruppe der Dienstleistungsbetriebe zugeordnet. Inner-<br />
halb dieser Gruppe handelt es sich beim Krankenhaus um einen so genannten k<strong>und</strong>enpräsenz-<br />
bedingten Dienstleitungsbetrieb, weil die Erstellung <strong>und</strong> Inanspruchnahme der Leistung die<br />
Anwesenheit des K<strong>und</strong>en erfordert (vgl. Eichhorn 1987: 7). Einerseits muss der Erstellungs-<br />
prozess auf die Bedürfnisse des Patienten ausgerichtet werden wie z. B. durch die Raum-<br />
gestaltung, <strong>und</strong> andererseits ist die Produktion der Leistung von der Mitleistung des Patienten<br />
abhängig (vgl. Etienne 2000: 145 f.). „Dies führt dazu, dass die Spitalleistungen nicht von den<br />
Patientenleistungen getrennt werden können, denn nur wenn sich der Patient aktiv beteiligt,<br />
kann der Ges<strong>und</strong>heitsprozess erfolgreich sein. Das wirkt sich erschwerend auf die Mess- <strong>und</strong><br />
Vergleichbarkeit der Dienstleistungen aus.“ (Marchon 2002: 68). Die Leistung eines Spitals<br />
bzw. eines Krankenhauses kann entsprechend der Definition einer Leistung weder gelagert<br />
noch transportiert werden. Deshalb muss die Leistung am Ort selbst <strong>und</strong> zurzeit der Nachfra-<br />
ge produziert werden (vgl. Morra 1996: 29 f). Spitalleistungen „[..] besitzen eine zentrale Be-<br />
deutung innerhalb der Ges<strong>und</strong>heitsversorgung der Bevölkerung <strong>und</strong> gehören daher zur öffent-<br />
lichen Infrastruktur, <strong>für</strong> die der Staat zu sorgen hat.“ (Morra 1996: 31). Die meisten Spitäler<br />
sind deshalb auch öffentliche oder gemeinwirtschaftliche Betriebe.<br />
Denise Kuonen Seite 36
Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Ferner zeichnen sich die Dienstleistungen eines Spitals durch eine geringe Angebotselastizität<br />
aus: „Bei kurzfristiger Änderung der Nachfrage erfolgt die Kapazitätsanpassung erst mit gros-<br />
ser Verzögerung. Die Notwendigkeit, qualifizierte Fachkräfte <strong>für</strong> die Leistungserbringung im<br />
Krankenhaus einsetzen zu müssen, rauben dem Krankenhaus die Möglichkeit zur flexiblen<br />
Gestaltung der Leistungskapazität im kurzfristigen Bereich.“ (Morra 1996: 30). Hinzu kommt,<br />
dass die Krankenhausleistung als meritorisches Gut (vgl. Kapitel 2.1.3.3) bezeichnet wird.<br />
Folglich findet ein Staatseingriff statt, da aus „übergeordneten“ Gründen die meritorischen<br />
Güter in einem grösseren Umfang angeboten werden müssen als sie der Markt bereitstellt<br />
(vgl. Morra 1996: 30 f.).<br />
2.3.2.2 Personelle <strong>und</strong> organisatorische Merkmale eines Spitals<br />
Es gibt eine Vielzahl an personellen <strong>und</strong> organisatorischen Merkmalen, die die <strong>Institut</strong>ion<br />
„Spital“ auszeichnen. Spezifische Ausbildungen prägen die verschiedenen Berufsgruppen, die<br />
in einem Spital vorhanden sind (vgl. Marchon 2002: 69). Zu den verschiedenen Berufsgrup-<br />
pen gehört einerseits die Ärzteschaft, zu denen auch diejenigen Personen gehören, die ein me-<br />
dizinisches Hochschulstudium abgeschlossen haben, andererseits die Pflege <strong>und</strong> die Verwal-<br />
tung. Die Pflegeberufe beinhalten die Krankenschwestern bzw. die Krankenpfleger. Dem Be-<br />
reich Verwaltung werden neben dem administrativen <strong>Personal</strong> wie bspw. die Buchhaltung<br />
<strong>und</strong> das Rechnungswesen auch jene Mitarbeitende zugeordnet, die den optimalen Ablauf im<br />
Spital garantieren. Dies sind u. a. der technische Dienst, die Küche <strong>und</strong> die Raumpflege.<br />
Je leistungsfähiger ein Spital ist, desto höher ist der Grad der Arbeitsteilung. Insbesondere<br />
trifft dies auf die Ärzteschaft zu, deren Weiterbildungsordnung immer differenziertere Aus-<br />
bildungsnormen vorsieht. Diese Entwicklung führt v. a. kleinere Betriebe, die bisher auf „All-<br />
ro<strong>und</strong>-Können“ angewiesen waren, in existenzielle Bedrängnis (vgl. Albert 1997: 359).<br />
Eine organisatorische Besonderheit sind ferner die Arbeitszeiten, die aufgr<strong>und</strong> des reibungslo-<br />
sen Ablaufs des Betriebes während 24 St<strong>und</strong>en pro Tag <strong>und</strong> 365 Tagen im Jahr hervorgehen.<br />
Dieser Schichtbetrieb stellt grosse Anforderungen an das <strong>Personal</strong>. Eine weitere Anforderung<br />
stellt die heute erforderliche multipersonal-arbeitsteilige <strong>Organisation</strong> im Krankenhaus dar,<br />
sowohl in Hinblick auf die technisch-organisatorische Betriebsführung als auch auf die Füh-<br />
rung der im Krankenhaus beschäftigten Menschen (vgl. Albert 1997: 359).<br />
Denise Kuonen Seite 37
Gr<strong>und</strong>lagen<br />
2.4 Weitere Definitionen<br />
2.4.1 Interne Kommunikation<br />
Ein weiterer wichtiger Begriff, den es zu erklären gilt, ist die interne Kommunikation. Zur<br />
Bezeichnung von Kommunikationsvorgängen in Unternehmen existieren in der Theorie un-<br />
terschiedliche Begriffe. Meier (2002: 17) nennt u. a. die betriebliche Kommunikation, die or-<br />
ganisationale Kommunikation, die Mitarbeiterkommunikation, die Betriebskommunikation,<br />
die innerbetriebliche Kommunikation etc. „Kommunikation“ ist folglich zu einem Begriff mit<br />
einer weitgehenden Bedeutung geworden. Meist wird damit der Austausch von Informationen<br />
zwischen mindestens zwei Personen verstanden (vgl. Heise 2000: 14). In dieser Arbeit bezieht<br />
sich Kommunikation auf die zwischenmenschliche Kommunikation, d. h. Kommunikation<br />
zwischen Mensch <strong>und</strong> Mensch <strong>und</strong> nicht zwischen z. B. Mensch <strong>und</strong> Maschine.<br />
„Unternehmenskommunikation bezeichnet die Gesamtheit aller Kommunikationsinstrumente<br />
<strong>und</strong> -maßnahmen eines Unternehmens, die eingesetzt werden, um das Unternehmen <strong>und</strong> seine<br />
Leistungen bei relevanten Zielgruppen darzustellen.“ (Meier 2002: 16). Abbildung 12 stellt<br />
die beiden Formen der Unternehmenskommunikation im Überblick dar.<br />
UNTERNEHMENSKOMMUNIKATION<br />
INTERNE KOMMUNIKATION EXTERNE KOMMUNIKATON<br />
• Mitarbeiterzeitschrift. • Public Relations.<br />
• Internet/Intranet. • Klassische Werbung.<br />
• Veranstaltungen. • Verkaufsförderung.<br />
• Eventkommunikation. • Direktmarketing.<br />
• Schwarzes Brett. • Messe.<br />
• Gespräche. • Sponsoring.<br />
• usw. • usw.<br />
Abbildung 12: Formen der Unternehmenskommunikation mit ihren Instrumenten (eigene Darstellung).<br />
Unternehmenskommunikation beinhaltet sowohl die externe als auch die interne Kommunika-<br />
tion. Von externer Kommunikation spricht man, wenn ein Unternehmen mit der Aussenwelt<br />
Denise Kuonen Seite 38
Gr<strong>und</strong>lagen<br />
beispielsweise mit der Öffentlichkeit, der Presse oder mit dem Aktionariat kommuniziert. Die<br />
klassische Werbung, Public Relations, Verkaufsförderung, Direktmarketing, Eventkommuni-<br />
kation, Messekommunikation <strong>und</strong> Sponsoring gehören zu den verschiedenen Instrumenten<br />
der externen Kommunikation (vgl. Pasquier 2004: 1).<br />
Findet auf der anderen Seite Kommunikation im Unternehmen statt, wird von der internen<br />
Kommunikation gesprochen. Unter interner Unternehmenskommunikation versteht Heise<br />
(2000: 6) „[…] der zwischen den Mitgliedern einer <strong>Organisation</strong> stattfindende Prozess der In-<br />
formationsübermittlung sowie die Herstellung von Verbindung zwischen Individuen, Ermög-<br />
lichen von Interaktion <strong>und</strong> Koordination <strong>und</strong> somit die Steuerung eines Netzes ineinandergrei-<br />
fender Verhaltensaktivitäten.“ Die interne Kommunikation ist folglich ein Instrument, das<br />
mittels klar definierter, regelmässiger oder nach Bedarf eingesetzter <strong>und</strong> kontrollierter Medien<br />
die Vermittlung von Information sowie Führung des Dialoges zwischen der Unternehmenslei-<br />
tung <strong>und</strong> den Mitarbeitenden sicherstellt. Zu den Medien der internen Kommunikation gehö-<br />
ren die Mitarbeiterzeitschrift, das „Schwarze Brett“, elektronische Medien, Versammlungen,<br />
Konferenzen, Gespräche, Informationstafeln usw. (vgl. Klöfer 1999: 24 ff.). Um die überge-<br />
ordneten Ziele der Unternehmenskommunikation zu erreichen, müssen sich die Instrumente<br />
der internen <strong>und</strong> der externen Kommunikation ergänzen <strong>und</strong> aufeinander abgestimmt werden<br />
(vgl. Stettler/Falk 1997: 455).<br />
Störungen der internen Kommunikation sind nach Meier (2002: 58 ff.) neben Verunsiche-<br />
rung, Identifikationsverlust <strong>und</strong> destruktivem Verhalten bei den Mitarbeitenden u. a. tarnen-<br />
des Sprachverhalten (sprachliche Verschleierung <strong>und</strong> sprachliche Überheblichkeitsstrategien)<br />
<strong>und</strong> sprachliches Mobbing.<br />
2.4.2 Prozesse<br />
In der Literatur gibt es unterschiedliche Auffassungen von Unternehmensprozessen (vgl. Pi-<br />
cot/Franck 1996: 14). Die wesentliche Gemeinsamkeit der unterschiedlichen Definitionen<br />
bringt folgendes Zitat zum Ausdruck: „Wir definieren einen Unternehmensprozeß als Bündel<br />
von Aktivitäten, <strong>für</strong> das ein oder mehrere unterschiedliche Inputs benötigt werden <strong>und</strong> das <strong>für</strong><br />
den K<strong>und</strong>en ein Ergebnis von Wert erzeugt. […] Die Übergabe der bestellten Ware an den<br />
K<strong>und</strong>en stellt die Wertschöpfung dieses Prozesses dar.“ (Hammer/Champy 1994: 52). Somit<br />
ist die Orientierung am K<strong>und</strong>ennutzen die gemeinsame Basis der Definitionsversuche von<br />
Denise Kuonen Seite 39
Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Prozessen. „Prozesse sind demnach Tätigkeitsfolgen, die K<strong>und</strong>enwert schaffen.“ (Pi-<br />
cot/Franck 1996: 14).<br />
Zudem ist der von Michael Hammer <strong>und</strong> James Champy geprägte Begriff „Business Process<br />
Reengineering“ zu erwähnen. Darunter verstehen sie „f<strong>und</strong>amentales Überdenken <strong>und</strong> radika-<br />
les Redesign von Unternehmen oder wesentlichen Unternehmensprozessen. Das Resultat sind<br />
Verbesserungen um Größenordnungen in entscheidenden, heute wichtigen <strong>und</strong> meßbaren<br />
Leistungsgrößen in den Bereichen Kosten, Qualität, Service <strong>und</strong> Zeit.“ (Hammer/Champy<br />
1994: 48). Es geht darum, altbekannte Vorgehensweisen aufzugeben <strong>und</strong> die Arbeit, die in<br />
den Produkten oder Dienstleistungen eines Unternehmens steckt, aus einem neuen Blickwin-<br />
kel zu betrachten <strong>und</strong> dem K<strong>und</strong>en einen neuen Wert zu bieten (vgl. Hammer/Champy 1994:<br />
47).<br />
Denise Kuonen Seite 40
Konzeptioneller Bezugsrahmen<br />
3 Konzeptioneller Bezugsrahmen<br />
Die vorliegende Arbeit soll Faktoren aufzeigen, die den Erfolg eines öffentlichen Betriebes<br />
beeinflussen. Zu diesem Zweck wird ein Bezugsrahmen aufgestellt <strong>und</strong> beschrieben. Beim<br />
Bezugsrahmen handelt es sich um Begriffs- <strong>und</strong> Hypothesenschemata, die „[…] auf die Be-<br />
schreibung <strong>und</strong> Erklärung realer Phänomene […]“ (Grochla 1978: 62) ausgerichtet sind. Sie<br />
„[..] erleichtern die Formulierung von Problemdefinitionen, die Zerlegung umfassender Prob-<br />
leme in einfachere Teilprobleme <strong>und</strong> die Entwicklung entsprechender Lösungsansätze.“<br />
(Zaugg 2002a: 5). Aufgabe des Bezugsrahmens ist es, die zahlreichen Elemente, die ein öf-<br />
fentliches Unternehmen beeinflussen, zu beschreiben <strong>und</strong> zu erklären <strong>und</strong> das komplexe Zu-<br />
sammenspiel dieser Elemente zu systematisieren.<br />
In den darauf folgenden Abschnitten werden die Elemente eines konzeptionellen Bezugsrah-<br />
mens der erfolgreichen Führung von öffentlichen Betrieben im Detail vorgestellt. Dabei gilt<br />
die Unternehmensanalyse als Hilfsmittel, um ein Unternehmen erfolgreich führen zu können.<br />
Wie bereits im Kapitel 2.2 erwähnt, wird mittels einer Unternehmensanalyse u. a. die momen-<br />
tane Situation des Unternehmens dargestellt. Mit den Methoden der Unternehmensanalyse<br />
werden Schwächen aufgedeckt <strong>und</strong> Anregungen auf Verbesserungen gegeben wie etwa durch<br />
eine Stärken-/Schwächenanalyse oder eine Konkurrenzanalyse (vgl. Grünig/Kühn 2000: 164).<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich korrespondiert ein solcher Bezugsrahmen mit den Verhältnissen privater Un-<br />
ternehmen. Allerdings bedürfen einzelne Elemente einer Anpassung an die Situation öffentli-<br />
cher Unternehmen. Einleitend wird in Abbildung 13 der konzeptionelle Bezugsrahmen visua-<br />
lisiert.<br />
Denise Kuonen Seite 41
Konzeptioneller Bezugsrahmen<br />
Generelle Bedingungsgrössen<br />
• Ökonomische Rahmenbedingungen.<br />
• Politisch-rechtliche Rahmenbedingungen.<br />
• Technologische Rahmenbedingungen.<br />
• Sozio-kulturelle Rahmenbedingungen.<br />
• Physisch-ökologische Rahmenbedingungen.<br />
Betriebliche<br />
Bedingungsgrössen<br />
• Angebot.<br />
• Standort.<br />
• Rechtsform.<br />
• Unternehmensgrösse.<br />
• Finanzkraft.<br />
• Technologieausstattung.<br />
Ausserbetriebliche Bedingungsgrössen<br />
Unternehmensziele<br />
Mittelbare Aktionsparameter<br />
Strategie<br />
Struktur Kultur<br />
Abbildung 13: Konzeptioneller Bezugsrahmen (eigene Darstellung).<br />
3.1 Bedingungsgrössen<br />
Aufgabenspezifische Bedingungsgrössen<br />
Erfolgreiche Führung von öffentlichen Betrieben<br />
Unmittelbare Aktionsparameter<br />
Unternehmensanalyse<br />
Branche<br />
• Rivalitätsdruck.<br />
• K<strong>und</strong>en.<br />
• Lieferanten.<br />
• Substitutionspotenziale.<br />
• Regulierung.<br />
• Finanzierung.<br />
Effektivität- <strong>und</strong> Effizienzkonzept<br />
Öffentlicher Auftrag<br />
• Vorgaben.<br />
• Gebietskörperschaften.<br />
• Politik/Parteien.<br />
• <strong>Personal</strong>verbände.<br />
• Öffentlichkeit.<br />
• Medien.<br />
Personelle<br />
Bedingungsgrössen<br />
• Mitarbeitende.<br />
• Unternehmensleitung.<br />
• Trägerkörperschaft.<br />
• Eigentümerversammlung.<br />
• Verwaltungs-<br />
/Betriebsrat.<br />
Der Handlungsspielraum eines Unternehmens ist in jeder Situation durch verschiedene Be-<br />
dingungsgrössen in unterschiedlichem Masse eingeschränkt (vgl. Kubicek/Thom 1976: 3977<br />
ff.). Die Bedingungsgrössen lassen sich unterteilen in ausserbetriebliche (vgl. Kapitel 3.1.1)<br />
<strong>und</strong> innerbetriebliche (vgl. Kapitel 3.1.2) Rahmenbedingungen. Bei der Bestimmung der Be-<br />
Denise Kuonen Seite 42
Konzeptioneller Bezugsrahmen<br />
dingungsgrössen öffentlicher Betriebe muss insbesondere der Staat in den Fokus der Betrach-<br />
tung genommen werden (vgl. Abbildung 14), da er bei den öffentlichen Betrieben im Gegen-<br />
satz zu den privaten Unternehmen eine viel zentralere Rolle spielt. Denn die öffentliche Hand<br />
steht in unmittelbarer Beziehung mit den öffentlichen <strong>Institut</strong>ionen, da sie ja meist auch Ei-<br />
gentümerin bzw. Miteigentümerin <strong>und</strong> Kapitalgeberin ist (vgl. Kapitel 2.1.3.2).<br />
Abbildung 14: Der Staat als Linse im Zürcher Ansatz (Jenni 2002: 39).<br />
Die Abbildung 14 bezieht sich auf den Zürcher Ansatz. Dieser vermag die unternehmerische<br />
Umwelt mit ihren vielfältigen Interaktionen durch eine Linsenbetrachtung relativ einfach <strong>und</strong><br />
doch umfassend zu überblicken (vgl. Jenni 2002: 24). In den folgenden Abschnitten werden<br />
die vielfältigen Bedingungsgrössen öffentlicher Betriebe beschrieben. Auf die Unternehmens-<br />
analyse als Mittel der Unternehmensleitung, den Betrieb „besser“ (strategisch) planen <strong>und</strong><br />
führen zu können, wird insbesondere bei den innerbetrieblichen Bedingungsgrössen Bezug<br />
genommen. Die Unternehmensanalyse betrachtet insbesondere die Umwelt innerhalb des Un-<br />
ternehmens <strong>und</strong> nicht dessen globale Umwelt, deren Vorgaben u. a. die ausserbetrieblichen<br />
Bedingungsgrössen eines öffentlichen Unternehmens darstellen.<br />
Denise Kuonen Seite 43
Konzeptioneller Bezugsrahmen<br />
3.1.1 Ausserbetriebliche Bedingungsgrössen<br />
Ausserbetriebliche Bedingungsgrössen sind <strong>für</strong> ein Unternehmen kurz- <strong>und</strong> mittelfristig kaum<br />
beeinflussbar. Die ausserbetrieblichen Rahmenbedingungen werden unterteilt in generelle<br />
(vgl. Kapitel 3.1.1.1) <strong>und</strong> aufgabenspezifische (vgl. Kapitel 3.1.1.2) Bedingungsgrössen.<br />
3.1.1.1 Generelle Bedingungsgrössen<br />
Die generellen Bedingungsgrössen gelten <strong>für</strong> eine grössere Anzahl von Unternehmen mit un-<br />
terschiedlichen Sachzielen in einem bestimmten geographischen Raum, in der vorliegenden<br />
Arbeit der Schweiz (vgl. Kubicek/Thom 1976: Sp. 3988). Es wird eine weitere Unterteilung<br />
der generellen Bedingungsgrössen vorgenommen (vgl. Zaugg 2002a: 7), auf die im Folgen-<br />
den eingegangen wird:<br />
• Ökonomische Rahmenbedingungen (z. B. Konjunktur, Arbeitsmarkt).<br />
• Politisch-rechtliche Rahmenbedingungen (z. B. Rechtssystem, politisches System).<br />
• Technologische Rahmenbedingungen (z. B. Produkt- <strong>und</strong> Verfahrensinnovationen, neue<br />
Informations- <strong>und</strong> Kommunikationstechnologien).<br />
• Sozio-kulturelle Rahmenbedingungen (z. B. Wertewandel, demographische Struktur).<br />
• Physisch-ökologische Rahmenbedingungen (z. B. Infrastruktur, Umweltsituation).<br />
3.1.1.1.1 Ökonomische Rahmenbedingungen<br />
Eine wichtige Einflussgrösse auf öffentliche Betriebe ist die öffentliche Hand. Diese ist durch<br />
die Rezession der 1990er Jahre sowie durch die schwache aktuelle Konjunktur finanziell stark<br />
belastet (vgl. Lutz 2004: 170). Die ausgeprägten Defizite der letzten Jahre führten zu einem<br />
spektakulären Anstieg der öffentlichen Verschuldung, die sich binnen eines Jahrzehnts ver-<br />
doppelte. Sie betrug 2002 insgesamt 234,8 Mrd. Franken oder 54,5 % des BIP. Es trugen alle<br />
drei Gebietskörperschaften (B<strong>und</strong>, Kanton, Gemeinde) zur Verschuldung bei, am stärksten je-<br />
doch der B<strong>und</strong> (vgl. Eidgenössisches Finanzdepartement 2004).<br />
„Die Ansprüche an die öffentliche Hand <strong>und</strong> deren Wahrnehmung <strong>und</strong> Erfüllung öffentlicher<br />
Aufgaben sind in den letzten Jahren stetig gewachsen. B<strong>und</strong>, Kantone <strong>und</strong> Gemeinden stossen<br />
an ihre Leistungsgrenzen <strong>und</strong> die Bereitschaft <strong>für</strong> neue Formen der Aufgabenerfüllung wächst<br />
(vgl. Steiner 2002: 245).“ (Lutz 2004: 171). Die Erfüllung der Aufgaben öffentlicher Unter-<br />
nehmen steht dadurch zur Diskussion. Die genaue Analyse eines Unternehmens kann deshalb<br />
z. B. zur Klärung der Aufgaben eines öffentlichen Betriebs in Erwägung gezogen werden.<br />
Denise Kuonen Seite 44
Konzeptioneller Bezugsrahmen<br />
In Spitäler äussern sich die ökonomischen Rahmenbedingungen u. a. dadurch, dass sie durch<br />
Sparmassnahmen der öffentlichen Hand mit kleineren bzw. gekürzten Budgets auskommen<br />
müssen. Folge davon können gestrichene Stellen sein, um <strong>Personal</strong>punkte <strong>und</strong> dadurch Kos-<br />
ten einzusparen.<br />
3.1.1.1.2 Politisch-rechtliche Rahmenbedingungen<br />
Der Niedergang des Kommunismus zu Beginn der 1990er Jahre führte einerseits zur Öffnung<br />
zahlreicher neuer Märkte im Osten Europas sowie in Asien, andererseits zum Wettbewerb<br />
zwischen verschiedenen Wirtschaftsräumen. Dadurch schliessen sich in Europa auch immer<br />
mehr Länder der Europäischen Union (EU) an. Diese strebt eine freie Wirtschaftsordnung <strong>und</strong><br />
eine offene Marktwirtschaft an. Die Folge davon sind Liberalisierungen in Sektoren, in denen<br />
zahlreiche öffentliche Unternehmen tätig sind. Obwohl die Schweiz nicht Mitglied der EU ist,<br />
muss sie dennoch die Entwicklungen ihres grössten Wirtschafts- <strong>und</strong> Handelspartners berück-<br />
sichtigen, wenn sie wettbewerbsfähig bleiben will (vgl. Lutz 2004: 171 f.).<br />
Für öffentliche Unternehmen in der Schweiz sind u. a. die folgenden Elemente in Bezug auf<br />
die politisch-rechtliche Umwelt von Bedeutung (vgl. Jenni 2002: 40):<br />
• Der staatliche Aufbau der Schweiz: Dieser kennzeichnet sich durch die drei Ebenen<br />
B<strong>und</strong>, Kantone <strong>und</strong> Gemeinden aus. Die Schweiz ist gemäss Thom/Ritz (2000: 49) von<br />
einem ausgeprägt föderalistischen <strong>und</strong> (konsens-) demokratischen Staatssystem geprägt.<br />
Entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip, welches bezogen auf öffentliche Unternehmen<br />
besagt, dass öffentliche Aufgaben gr<strong>und</strong>sätzlich auf der untersten Ebene der Gebiets-<br />
körperschaft (B<strong>und</strong>-Kanton-Gemeinde) zu erfüllen sind (vgl. Vogel 2000: 27), werden<br />
dem B<strong>und</strong> nur Aufgaben übertragen, die die Kantone nicht in der Lage sind zu erfüllen.<br />
Zu den rechtlichen <strong>und</strong> faktischen Monopolbereichen des B<strong>und</strong>es gehören bspw. die<br />
Luftfahrt (Art. 87 BV), die Eisenbahnen (Art. 87 BV), das Post- <strong>und</strong> Fernmeldewesen<br />
(Art. 92 BV) sowie der Betrieb von Radio- <strong>und</strong> Fernsehanstalten (Art. 93 BV) (vgl.<br />
Jenni 2002: 41). Es zeigen sich allerdings Tendenzen zu einer Verlagerung der Aufga-<br />
ben von Kantonen zum B<strong>und</strong>, bspw. in den Bereichen der Verkehrs-, Agrar-, Steuer-,<br />
Sozial- <strong>und</strong> Bildungspolitik, was durch die zunehmende Globalisierung <strong>und</strong> Vereinheit-<br />
lichung des Rechts über die Grenzen hinaus zu erklären ist. Dies ist aus Sicht der öffent-<br />
lichen Betriebe von Bedeutung, da die Kantone über alle direktdemokratischen Instru-<br />
mente verfügen: das Referendum, die Initiative, die Abstimmung über wichtige Ge-<br />
Denise Kuonen Seite 45
Konzeptioneller Bezugsrahmen<br />
schäfte sowie über die Volkswahl nicht nur des Parlaments, sondern auch der Regierung<br />
etc. (vgl. Sigg 1996: 14 f.).<br />
• Öffentliche Unternehmen haben sich an gesetzliche Rahmenbedingungen zu halten<br />
wie bspw. das Wettbewerbsrecht, das öffentliche Baurecht <strong>und</strong> das Abgaberecht.<br />
Öffentliche Abgaben z. B. sind Geldleistungen, die der öffentlichen Hand zur Deckung<br />
ihres Finanzbedarfs dienen. Der Staat darf aber nur innerhalb gewisser Grenzen Abga-<br />
ben erheben. Diese Begrenzung ist aus der Sicht der öffentlichen Unternehmen von be-<br />
sonderer Bedeutung, denn sie hat Rahmen setzenden Charakter <strong>für</strong> die öffentlichen Un-<br />
ternehmen (vgl. Brede 2001: 9).<br />
• Die Rechtsformen öffentlicher Betriebe: In der Schweiz haben die öffentlichen Un-<br />
ternehmen die freie Wahl zwischen öffentlich-rechtlichen <strong>und</strong> privatrechtlichen Organi-<br />
sationsformen. Da Unternehmungen begriffsdefinitorisch mit einer gewissen Autono-<br />
mie ausgestattet sein müssen, kommt <strong>für</strong> öffentlich-rechtliche Unternehmungen nur eine<br />
aus der Zentralverwaltung ausgegliederte <strong>Organisation</strong>sform in Betracht. Im Speziellen<br />
handelt es sich um die Rechtsformen der selbstständigen <strong>und</strong> unselbstständigen Anstal-<br />
ten sowie der öffentlich-rechtlichen Körperschaften. Zu den selbstständigen Anstalten<br />
gehören die öffentlich-rechtlichen Anstalten, welche eine eigene Rechtspersönlichkeit<br />
besitzen im Gegensatz zu den unselbstständigen. Diese verfügen über keine eigene<br />
Rechtspersönlichkeit. Ebenfalls stehen der öffentlichen Hand auch alle Rechtsformen<br />
zur Verfügung, welche die privatwirtschaftlichen Unternehmen zur Auswahl haben, so<br />
bspw. die Aktiengesellschaft (AG), die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH),<br />
die Genossenschaft sowie die einfache Gesellschaft, der Verein <strong>und</strong> die Stiftung. Jede<br />
Form hat ihre Vor- <strong>und</strong> Nachteile. Für ein öffentliches Unternehmen ergeben sich folg-<br />
lich je nach Rechtsform unterschiedliche Bedingungsfaktoren. So birgt z. B. die un-<br />
selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt einige Nachteile wie die grosse Abhängig-<br />
keit von der Zentralverwaltung, die Gefahr von politischer Einflussnahme, der Zwang<br />
zur Einhaltung des Budgets etc. (vgl. Jenni 2002: 44 f.).<br />
3.1.1.1.3 Technologische Rahmenbedingungen<br />
Die Entwicklung der Technologie, insbesondere der Informations- <strong>und</strong> Telekommunikations-<br />
technologie ist ein wichtiger Einflussfaktor <strong>für</strong> ein Unternehmen. Sowohl private als auch öf-<br />
fentliche Betriebe sehen sich immer stärker mit diesem steten technologischen Wandel kon-<br />
frontiert. Häufig werden alte Technologien durch Innovationen abgelöst <strong>und</strong> ersetzt. Es kann<br />
davon ausgegangen werden, dass mit zunehmender Technologisierung auch die Anforderun-<br />
Denise Kuonen Seite 46
Konzeptioneller Bezugsrahmen<br />
gen an die Mitarbeitenden <strong>und</strong> die Unternehmen steigen (vgl. Moser 2002: 39). Technische<br />
Veränderungen haben insbesondere in Unternehmen, die im medizinischen Bereich tätig sind,<br />
einen grossen Einfluss auf den Geschäftsgang. Durch Innovationen <strong>und</strong> Verbesserungen in<br />
der Technologie <strong>und</strong> in den Verfahrensmethoden kann ein Unternehmen erhebliche Wettbe-<br />
werbsvorteile erlangen, indem z. B. durch neue Maschinen Prozesse <strong>und</strong> Vorgehensweisen<br />
optimiert bzw. neu gestaltet werden (verbesserte Methoden bei der Durchführung von Opera-<br />
tionen).<br />
Ferner werden den technologischen Rahmenbedingungen Informations- <strong>und</strong> Kommunikati-<br />
onstechnologien zugeordnet, welche die administrative Tätigkeit unterstützen. Hier zu nennen<br />
ist die Einführung von E-Mails, welche die Kommunikations- <strong>und</strong> Informationstätigkeit in ei-<br />
nem Unternehmen stark vereinfacht hat. Die Unternehmensleitung kann z. B. durch wöchent-<br />
liche E-Mails die Belegschaft über kurz- <strong>und</strong> mittelfristige Vorgänge <strong>und</strong> Zielsetzungen des<br />
Tagesgeschäftes orientieren (vgl. Meier 2002: 49).<br />
3.1.1.1.4 Sozio-kulturelle Rahmenbedingungen<br />
Der Einfluss der soziokulturellen Rahmenbedingungen auf öffentliche Betriebe wird mass-<br />
geblich durch die Einstellungen in der Bevölkerung, die häufig durch entsprechende mediale<br />
Berichterstattung verstärkt oder akzentuiert wird, geprägt (vgl. Lutz 2001: 174). Ein öffentli-<br />
ches Unternehmen wird ferner durch den Wertewandel in der Gesellschaft <strong>und</strong> das Image des<br />
Berufs als „Beamter“ beeinflusst. Gemäss Friedli (2002: 52 f.) betrifft der Wertewandel das<br />
gesellschaftliche Wertesystem, „[…] welches die Gesamtheit der Werthaltungen der Indivi-<br />
duen einer Gesellschaft umfasst. Verschiedene Autoren zeigen auf, dass in den letzten Jahren<br />
eine spürbare Änderung im Wertesystem stattgef<strong>und</strong>en hat. Als gemeinsamer Nenner der er-<br />
folgten Interpretationsversuche gilt, dass in den westlichen Industriegesellschaften ein Wan-<br />
del in der Einstellung zur Arbeit stattgef<strong>und</strong>en hat (z. B. steigende Bedeutung der Freizeit, be-<br />
rufliche Arbeit wird neu interpretiert).“<br />
Das Image des Beamtentums in der Öffentlichkeit stellt einen wichtigen Faktor bzgl. der Be-<br />
rufswahl dar. „Wer in ein Arbeitsverhältnis zum Staat tritt, gilt in den Augen des «Mannes<br />
von der Strasse» als Beamter oder Beamtin.“ (Richli 1996: 21). Zur Beamtenschaft zählen die<br />
Beamten der öffentlichen Verwaltungen <strong>und</strong> die der öffentlichen Unternehmen (vgl. Pippke<br />
1989: 86). Folglich hat der Staat da<strong>für</strong> zu sorgen, dass dieser Beruf auch in Zukunft attraktiv<br />
bleibt, damit es nicht zu einem Beamtenmangel kommt.<br />
Denise Kuonen Seite 47
Konzeptioneller Bezugsrahmen<br />
3.1.1.1.5 Physisch-ökologische Rahmenbedingungen<br />
Die physisch-ökologischen Rahmenbedingungen sind geprägt durch die Umweltsituation, die<br />
Infrastruktur etc. (vgl. Zaugg 2002a: 7). In der Schweiz sind die Mobilitätsvoraussetzungen<br />
aufgr<strong>und</strong> der sehr guten infrastrukturellen Erschliessung beinahe aller Landesteile gegeben<br />
(vgl. Zaugg 1996: 84 f.). Die Schweiz weist vorteilhafte Bedingungen in Bezug auf die tägli-<br />
che, dauerhafte oder vorübergehende Verschiebung vom bisherigen Arbeits- bzw. Wohnort an<br />
einen anderen Ort auf (vgl. Lutz 2004: 174).<br />
3.1.1.2 Aufgabenspezifische Bedingungsgrössen<br />
Die aufgabenspezifischen Rahmenbedingungen umfassen diejenigen Faktoren, „[…] mit de-<br />
nen eine Unternehmung zur Erreichung ihrer Sachziele interagiert, interagieren kann oder<br />
aufgr<strong>und</strong> verbindlicher Vorschriften interagieren muß.“ (Kubicek/Thom 1976: Sp. 3992).<br />
Nachfolgend werden die aufgabenspezifischen Bedingungsgrössen der Branche (Kapitel<br />
3.1.1.2.1) <strong>und</strong> des öffentlichen Auftrags (Kapitel 3.1.1.2.2) erläutert.<br />
3.1.1.2.1 Branche<br />
Die öffentlichen Betriebe lassen sich – wie in Kapitel 2.1.3.1 bereits erwähnt – u. a. anhand<br />
der Branche unterscheiden (vgl. Tabelle 1):<br />
Branche: Beispiele:<br />
Verkehrsbetriebe Schweizerische B<strong>und</strong>esbahnen (SBB), Personennahverkehr,<br />
Flughafenunternehmen, Fährbetriebe<br />
Betriebe des Post- <strong>und</strong> Telekommunikationswe- Die Schweizerische Post, Swisscom AG<br />
sens<br />
Kreditinstitute Sparkassen, Nationalbank, Kantonalbanken<br />
Versorgungsbetriebe Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Fernwärmeversorgung,<br />
Wasserversorgung, Vorratslager<br />
Entsorgungsbetriebe Müllabfuhr, Mülldeponien, Müllverbrennungsanlagen,<br />
Recycling-Anlagen, Abwasserbetriebe<br />
Krankenhäuser <strong>und</strong> Sozialeinrichtungen Krankenhäuser, Sanatorien, Kureinrichtungen, Rehabilitationskliniken,<br />
Alters- <strong>und</strong> Pflegeheime<br />
Bildungseinrichtungen Schulen, Hochschulen, Forschungsanstalten, Bibliotheken,<br />
Zoologische Gärten, Botanische Gärten<br />
Kulturbetriebe Theater, Opernhäuser, Orchester, Museen, Kinos,<br />
R<strong>und</strong>funkanstalten<br />
Industriebetriebe Ruag Suisse AG<br />
Land- <strong>und</strong> forstwirtschaftliche Betriebe Molkereien, Forstbetriebe, Gärtnereien<br />
Sonstiges Versicherungen, Versuchs- <strong>und</strong> Prüfanstalten, Sportstätten,<br />
Spielbanken, Lotteriegesellschaften, Schlachthöfe,<br />
Hotels<br />
Tabelle 1: Öffentliche Betriebe aufgeteilt nach Branchen (eigene Darstellung in Anlehnung an Brede 2001: 33).<br />
Denise Kuonen Seite 48
Konzeptioneller Bezugsrahmen<br />
Analog der Kategorisierung der generellen Bedingungsgrössen erweist sich auch eine Struktu-<br />
rierung des Wettbewerbsumfeldes öffentlicher Betriebe als zweckmässig, um einen Überblick<br />
über die relevanten Einflussgrössen aufzuzeigen (vgl. Lutz 2004: 175 ff.). Porter (1999: 33<br />
ff.) hat dabei eine Methode entwickelt, anhand derer die verschiedenen Faktoren <strong>und</strong> Akteure<br />
innerhalb einer Branche strukturiert werden. Bei der Methode handelt es sich um die Bran-<br />
chenstrukturanalyse, die in starkem Masse sowohl die Spielregeln des Wettbewerbs als auch<br />
die Strategien, die dem Unternehmen potenziell zur Verfügung stehen, beeinflusst. Porter<br />
(1999: 34 ff.) nennt folgende Triebkräfte des Branchenwettbewerbs:<br />
• Wettbewerbsintensität: Alle fünf nachfolgende Wettbewerbs- bzw. Triebkräfte<br />
bestimmen die Wettbewerbsintensität <strong>und</strong> die Rentabilität der Branche.<br />
• Rivalität unter den bestehenden Wettbewerbern in Form von Positionskämpfen, d. h. in<br />
Form von Taktiken wie Preiswettbewerb, Einführung neuer Produkte, verbesserter Ser-<br />
vice etc.<br />
• Markteintritt potenzieller neuer Konkurrenten, d. h. die Bedrohung der bestehenden<br />
Wettbewerber der Branche durch neue potenzielle Konkurrenz. Die Gefahr des<br />
Markteintritts hängt von den existierenden Eintrittsbarrieren (z. B. Betriebsgrössener-<br />
sparnisse, Produktdifferenzierung etc.) sowie den absehbaren Reaktionen der etablierten<br />
Wettbewerber ab. Sind die Barrieren hoch, so ist die Gefahr des Eintritts gering.<br />
• Verhandlungsstärke von Lieferanten, indem sie damit drohen, die Preise zu erhöhen<br />
oder die Qualität zu senken. Dadurch kann die Rentabilität der Branche gesenkt werden.<br />
• Verhandlungsstärke der Abnehmer, die mit der Branche „konkurrieren“, indem sie<br />
die Preise drücken, höhere Qualität oder bessere Leistung verlangen <strong>und</strong> Wettbewerber<br />
gegeneinander ausspielen – alles auf Kosten der Rentabilität der Branche.<br />
• Bedrohung der bestehenden Wettbewerber durch Ersatzprodukte <strong>und</strong> -dienste. Diese<br />
begrenzen das Gewinnpotenzial einer Branche, indem sie eine Obergrenze <strong>für</strong> die Preise<br />
setzen, welche die Unternehmen verlangen können, ohne ihre Gewinne zu gefährden.<br />
Da dieser Ansatz primär eine wettbewerbsorientierte Perspektive beinhaltet, sind die Ein-<br />
flussgrössen <strong>für</strong> öffentliche Unternehmen um Elemente zu erweitern, damit der spezifischen<br />
Stellung öffentlicher Unternehmen Rechnung getragen wird (vgl. Abbildung 15).<br />
Denise Kuonen Seite 49
Konzeptioneller Bezugsrahmen<br />
Substitutionspotenziale<br />
Branchenwettbewerb/<br />
Rivalitätsdruck<br />
Abbildung 15: Branchenstruktur öffentlicher Betriebe (eigene Darstellung in Anlehnung an Lutz 2004: 176).<br />
Öffentliche Betriebe sind auf öffentliche Finanzierungsbeiträge angewiesen, da sie oft ihren<br />
Auftrag nicht kostendeckend erfüllen können. Daraus entsteht unter den öffentlichen Unter-<br />
nehmen ein Wettbewerb um solche Finanzierungsbeiträge. Durch die knappen Finanzen der<br />
öffentlichen Hand wird dieser noch zusätzlich akzentuiert. In Bezug auf ein öffentliches Un-<br />
ternehmen wie ein Spital bzw. Krankenhaus wird gemäss Experten der Finanznotstand der öf-<br />
fentlichen Hand auf die Krankenhausindustrie einen zunehmenden Kostendruck ausüben. Da-<br />
bei hat das Krankenhaus in Zukunft eine hohe medizinische Versorgungsqualität bei tenden-<br />
ziell gleich bleibenden bzw. sinkenden Kosten sicherzustellen (vgl. Morra 1996: 75 f.). „Öf-<br />
fentliche Unternehmen sind zudem in Branchen tätig, in denen Regulierungen häufig einen<br />
erhöhten Stellenwert einnehmen […]. Zu erwähnen sind bspw. die Regulierungen von Netz-<br />
strukturen mittels Monopolen oder die planwirtschaftliche Steuerung der Krankenhausversor-<br />
gung mittels Spitallisten.“ (Lutz 2004: 176). B<strong>und</strong> <strong>und</strong> Kantone treten als Regulierungsbe-<br />
hörde auf, indem sie <strong>für</strong> die Gestaltung der Rahmenbedingungen einzelner Branchen zustän-<br />
dig sind.<br />
Lieferanten<br />
Regulierung<br />
Finanzierung<br />
K<strong>und</strong>en/Abnehmer<br />
Der Wettbewerb innerhalb der Branche führt zu einem Rivalitätsdruck der darin tätigen Un-<br />
ternehmen. Dieser Rivalitätsdruck wurde durch verschiedene Entwicklungen in einer Branche<br />
wie z. B. durch Liberalisierungen, die dazu beigetragen haben, dass öffentliche Unternehmen<br />
ihre teilweise protegierten Branchen <strong>und</strong> Gebiete verloren haben, erhöht. Dadurch können<br />
u. a. neue Konkurrenten tätig werden oder die öffentlichen Betriebe können selber in geöffne-<br />
te Märkte eintreten. Häufig ist Substitution die einzige Möglichkeit, um in einen Markt ein-<br />
zusteigen, da in Branchen öffentlicher Unternehmen das Angebot oft reguliert ist. „Alle Un-<br />
Denise Kuonen Seite 50
Konzeptioneller Bezugsrahmen<br />
ternehmen einer Branche konkurrieren (im weiteren Sinne) mit Branchen, die Ersatzprodukte<br />
(Substitute) herstellen.“ (Porter 1999: 56). Gemäss Morra (1996: 62 f.) sind zurzeit Entwick-<br />
lungen in der Ges<strong>und</strong>heitspolitik erkennbar, die auf eine klare Substitutionsgefährdung durch<br />
ambulante Anbieter hindeuten. Das bedeutet, dass ambulante, vor- <strong>und</strong> nachstationäre Be-<br />
handlungen den absoluten Vorrang geniessen, da der ambulante Anbieter durch viel tiefere<br />
Gemeinkosten die gleichen Ges<strong>und</strong>heitsleistungen günstiger anbieten kann.<br />
Um im Wettbewerb bestehen zu können, müssen die öffentlichen Unternehmen ihr Leistungs-<br />
angebot an den Bedürfnissen der K<strong>und</strong>en ausrichten. „Da bei öffentlichen Unternehmen die<br />
Kernleistungen im öffentlichen Auftrag definiert sind, können Differenzierungen oftmals nur<br />
über Zusatzleistungen, indirekte Produktpolitik <strong>und</strong> technologische Entwicklungen erfolgen<br />
[…].“ (Lutz 2004: 177). Bei einem öffentlichen Unternehmen wie einem Spital sehen die Be-<br />
dürfnisse der K<strong>und</strong>en bzw. der Patienten so aus, dass sie einen hohen Stellenwert auf eine<br />
möglichst individuelle Behandlung des Ges<strong>und</strong>heitsproblems legen. Gleichfalls erwartet der<br />
Patient eine angemessene, nach seinen Ansprüchen ausgerichtete Versorgung im Bereich der<br />
Unterkunft <strong>und</strong> Beherbergung. Dieser steigende Kostendruck <strong>für</strong> das Krankenhaus wird<br />
gleichzeitig von einer zunehmenden Preissensitivität der Patienten begleitet (vgl. Morra 1996:<br />
79).<br />
Ebenfalls haben die Lieferanten einen Einfluss auf ein öffentliches Unternehmen. „Lieferan-<br />
ten können ihre Verhandlungsstärke ausspielen, indem sie damit drohen, die Preise zu erhö-<br />
hen oder die Qualität zu senken. Mächtige Lieferanten können dadurch die Rentabilität von<br />
Branchen drücken, die nicht in der Lage sind, Kostensteigerungen in ihren eigenen Preisen<br />
weiterzugeben.“ (Porter 1999: 61).<br />
3.1.1.2.2 Öffentlicher Auftrag<br />
Der öffentliche Auftrag stellt eine aufgabenspezifische Bedingungsgrösse dar <strong>und</strong> beinhaltet<br />
als Vorgaben neben dem Unternehmensgegenstand das Gr<strong>und</strong>anliegen, die Zielkonzeption<br />
sowie weitere Nebenbedingungen der Leistungserfüllung. Das öffentliche Unternehmen erhält<br />
folglich durch den öffentlichen Auftrag seine Legitimation. Es widerspiegeln sich im öffentli-<br />
chen Auftrag die Interessen der Trägerschaft <strong>und</strong> der diversen Anspruchsgruppen am öffentli-<br />
chen Unternehmen. Das bedeutet, dass das öffentliche Unternehmen von den Interessen der<br />
Gebietskörperschaften, der politischen Parteien, der <strong>Personal</strong>verbände <strong>und</strong> Gewerkschaften,<br />
der Öffentlichkeit sowie der Medien beeinflusst wird. Diese einzelnen Interessengruppen<br />
Denise Kuonen Seite 51
Konzeptioneller Bezugsrahmen<br />
betreiben aktive Interessenwahrung, wenn Veränderungen das öffentliche Unternehmen<br />
betreffen: Die Trägerkörperschaft verfolgt die Sicherung ihrer Interessen als Eigentümer, die<br />
Gebietskörperschaften erstreben die Gewährleistung der Versorgungssicherheit <strong>und</strong> die Per-<br />
sonalverbände verlangen Garantie <strong>für</strong> die Sicherung von Arbeitsplätzen der Arbeitnehmer<br />
(vgl. Lutz 2004: 179 ff.). Eine Veränderung könnte z. B. die Entscheidung <strong>für</strong> einen Unter-<br />
nehmenszusammenschluss sein, die aufgr<strong>und</strong> eingehender Analysen (bspw. einer strategi-<br />
schen <strong>und</strong> finanziellen Analyse des Unternehmens) <strong>und</strong> Bewertungen getroffen wurden.<br />
3.1.2 Innerbetriebliche Bedingungsgrössen<br />
Bei den innerbetrieblichen Bedingungsgrössen handelt es sich um Ressourcen, über die das<br />
Unternehmen selbstständig disponieren kann. Die innerbetrieblichen Bedingungsgrössen, die<br />
in betriebliche <strong>und</strong> personelle Ressourcen bzw. Merkmale unterteilt werden, müssen von ei-<br />
nem Unternehmen kurzfristig als gegeben betrachtet werden. Bei einer Unternehmensanalyse<br />
spielen v. a. die innerbetrieblichen Bedingungsgrössen eine wichtige Rolle, da sie sich auf das<br />
Innere eines Unternehmens beziehen <strong>und</strong> durch eine Unternehmensanalyse detailliert betrach-<br />
tet <strong>und</strong> untersucht werden. Die innerbetrieblichen Bedingungsgrössen lassen sich in betriebli-<br />
che <strong>und</strong> personelle Bedingungsgrössen aufteilen, die nachfolgend erläutert werden.<br />
3.1.2.1 Betriebliche Bedingungsgrössen<br />
Zu den betrieblichen Bedingungsgrössen eines öffentlichen Unternehmens gehören (vgl. Lutz<br />
2004: 181 f.):<br />
• Angebot: Der öffentliche Auftrag spezifiziert die zu erbringenden Kernleistungen eines<br />
öffentlichen Unternehmens <strong>und</strong> somit dessen Angebot.<br />
• Rechtsform bzw. „Typ“ des öffentlichen Unternehmens: In der Schweiz haben die<br />
öffentlichen Unternehmen die freie Wahl zwischen öffentlich-rechtlichen wie die<br />
selbstständige <strong>und</strong> unselbstständige Anstalt <strong>und</strong> privatrechtlichen <strong>Organisation</strong>sformen<br />
wie die Aktiengesellschaft (AG), die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH),<br />
die Genossenschaft sowie die einfache Gesellschaft, der Verein <strong>und</strong> die Stiftung (vgl.<br />
Kapitel 3.1.1.1.2).<br />
• <strong>Organisation</strong>sstruktur.<br />
• Unternehmensgrösse: Um gewisse Leistungen erbringen zu können, erfordert dies<br />
vom Unternehmen eine bestimmte Grösse. Ein öffentliches Unternehmen wie bspw. ein<br />
Denise Kuonen Seite 52
Konzeptioneller Bezugsrahmen<br />
Spital sollte pro Jahr eine entsprechende Anzahl an Patienten behandeln, damit sowohl<br />
die Anlagen als auch das <strong>Personal</strong> einen vernünftigen Auslastungsgrad aufweisen.<br />
• Technologieausstattung: In welchem Ausmass die Technologieausstattung eine Rolle<br />
spielt, hängt davon ab, wie technologieabhängig die Branche ist, in der ein öffentliches<br />
Unternehmen tätig ist.<br />
• Finanzkraft: Die Finanzkraft des Unternehmens bzw. der Trägerschaft hat einen Ein-<br />
fluss auf die Entscheidungen, die das öffentliche Unternehmen z. B. im Rahmen einer<br />
strategischen Planung zu treffen hat.<br />
• Standort: Oft erhalten öffentliche Unternehmen den Auftrag, in einem gewissen Gebiet<br />
die Versorgung mit einer bestimmten Leistung sicherzustellen. Solche Auflagen erfor-<br />
dern zweckmässig verteilte Standorte.<br />
• Weitere Ressourcen, die einen direkten oder indirekten Einfluss auf das Unternehmen<br />
haben.<br />
Durch die Unternehmensanalyse lassen sich z. B. Schwächen in der <strong>Organisation</strong>s- <strong>und</strong> An-<br />
gebotsstruktur aufdecken oder es zeichnen sich andere Bereiche mit Handlungsbedarf ab. Ei-<br />
ne Unternehmensanalyse kann z. B. dabei hilfreich sein, einen Mangel an Ausstattung mit<br />
Technologie aufzuzeigen.<br />
3.1.2.2 Personelle Bedingungsgrössen<br />
„Zu den personellen Bedingungsgrössen werden alle Aktionsträger gezählt, welche das Han-<br />
deln öffentlicher Unternehmen [...] bestimmen oder zumindest einen legitimierten Einfluss<br />
darauf haben.“ (Lutz 2004: 183 f.). Lutz zählt zu den Aktionsträgern die Trägerkörperschaft,<br />
die Eigentümerversammlung, der Verwaltungs- bzw. Betriebsrat, die Unternehmensleitung<br />
sowie die Mitarbeitenden. Bei letzteren kommt der berufliche, soziale <strong>und</strong> politische Hinter-<br />
gr<strong>und</strong>, deren persönlichen Ziele, Erwartungen <strong>und</strong> Einstellungen, Wertvorstellungen <strong>und</strong> Mo-<br />
tivationen <strong>und</strong> die Belegschaftsstruktur sowie Barrieren des Wissens, Könnens, Wollens <strong>und</strong><br />
Wagens als weitere personelle Bedingungsgrössen hinzu. „Sie beinhalten sowohl eindeutig<br />
ersichtliche Aspekte als auch verborgene Seiten der Mitarbeitenden.“ (Salzgeber 2001: 27).<br />
Bei einem Klinikbetrieb hat die Qualität der Führungskräfte <strong>und</strong> der Mitarbeitenden einen be-<br />
deutenden Einfluss auf den Erfolg eines Unternehmens. Gemäss Morra (1996: 207) besitzen<br />
Ärzte eine besondere Funktion, da sie nicht nur <strong>für</strong> den Patientenfluss <strong>und</strong> <strong>für</strong> medizinische<br />
Fragen verantwortlich sind, sondern auch die Produktivität <strong>und</strong> Wirtschaftlichkeit der Leis-<br />
tungserstellungsprozesse durch ihre Entscheide steuern. Kompetente Führungskräfte schaffen<br />
Denise Kuonen Seite 53
Konzeptioneller Bezugsrahmen<br />
ein gutes Arbeitsklima <strong>und</strong> motivieren die Mitarbeitenden zu Höchstleistungen, was die rela-<br />
tive Wettbewerbsposition eines Spitals verbessert. So haben auch Elemente in Bezug auf die<br />
Führung bzw. den Führungsstil einen Einfluss wie bspw. das Führungsverhalten der Vorge-<br />
setzten, deren Delegationsbereitschaft etc. Bei der Unternehmensleitung kommen Machtstruk-<br />
turen <strong>und</strong> vorhandene Barrieren zwischen den Hierarchiestufen als weitere Bedingungsgrös-<br />
sen hinzu. Hierarchiestufen sind häufig in einem Unternehmen wie einem Spital anzutreffen<br />
(Gärtner 1997: 131). Ferner stellt auch das Verhältnis der Mitarbeitenden untereinander einen<br />
Einflussfaktor dar (z. B. Bereitschaft, um Informationen weiterzuleiten, die den Arbeitsablauf<br />
erleichtern).<br />
3.2 Aktionsparameter<br />
Die Aktionsparameter können je nach Wirkungshorizont <strong>und</strong> Entscheidsituation in mittelbare<br />
<strong>und</strong> unmittelbare Handlungsgrössen unterteilt werden (vgl. Lutz 2004: 168 f.). Die mittelba-<br />
ren Handlungsgrössen sind eher langfristig angelegt <strong>und</strong> wirken oft indirekt, wohingegen die<br />
unmittelbaren Handlungsgrössen direkt zur Zielerreichung beitragen (vgl. Zaugg 2002a: 8).<br />
Es handelt sich bei den unmittelbaren Handlungsgrössen um „[…] konkrete Gestaltungsent-<br />
scheide <strong>und</strong> -handlungen von Unternehmen, die zur Gestaltung von Strategie, Struktur <strong>und</strong><br />
Kultur beitragen.“ (Lutz 2004: 169). Während mittelbare Aktionsparameter eher auf der stra-<br />
tegischen Ebene angesiedelt werden, handelt es sich bei den unmittelbaren Aktionsparametern<br />
um Handlungsgrössen auf operativer Ebene (vgl. Zaugg 1996: 94). Im nachfolgenden Kapitel<br />
3.2.1 wird auf die mittelbaren Aktionsparameter eingegangen. Eine Beschreibung der unmit-<br />
telbaren Aktionsparameter enthält der darauf folgende Abschnitt 3.2.2.<br />
3.2.1 Mittelbare Aktionsparameter<br />
Die Leitung eines öffentlichen Unternehmens kann die mittelbaren Aktionsparameter nur in-<br />
direkt beeinflussen. Es handelt sich hier um die drei Parameter Strategie, Struktur <strong>und</strong> Kul-<br />
tur, welche langfristig angelegt sind. Wenn ein Unternehmen wichtige Entscheide, z. B. im<br />
Rahmen einer strategischen Planung, zu treffen hat, dann hat dies einerseits strategische,<br />
strukturelle <strong>und</strong> kulturelle Auswirkungen auf das Unternehmen. Andererseits bilden Strategie,<br />
Struktur <strong>und</strong> Kultur auch die Rahmenbedingungen <strong>für</strong> solche Entscheide (vgl. Lutz 2004:<br />
187). Folglich kann eine Unternehmensanalyse <strong>und</strong> ihre Entscheidungen Einfluss haben auf<br />
die Strategie, die Struktur <strong>und</strong> die Kultur <strong>und</strong> umgekehrt. Diese drei Parameter dürfen nicht<br />
isoliert voneinander betrachtet werden.<br />
Denise Kuonen Seite 54
Konzeptioneller Bezugsrahmen<br />
Die Struktur umfasst gemäss Grochla (1995: 1 ff.) einerseits die Aufbau- (Rahmen- <strong>und</strong> De-<br />
tailstruktur) <strong>und</strong> Ablauforganisation (Prozesse), anderseits die organisatorische Gestaltung.<br />
Veränderungen der Aufbau- <strong>und</strong> Ablauforganisation eines Unternehmens haben Auswirkun-<br />
gen auf unterschiedliche Faktoren wie z. B. die Rechtsform, den öffentlichen Auftrag, die Be-<br />
urteilung der Sachzielerreichung etc. (vgl. Lutz 2004: 187). Solche organisatorischen Verän-<br />
derungen bedingen eine Änderung der Strategie. Es müssen neue Wege der Aufgabenerfül-<br />
lung gef<strong>und</strong>en werden. Folglich müssen die Strukturen <strong>und</strong> die Prozesse an die neue Strategie<br />
angepasst werden (vgl. Salzgeber 2001: 28). Grünig/Kühn (2000: 41) definieren Strategien<br />
„[...] als langfristige Vorgaben zum Aufbau <strong>und</strong> zur Erhaltung von Erfolgspotentialen<br />
(attraktiven Wettbewerbspositionen <strong>und</strong> Wettbewerbsvorteilen), die <strong>für</strong> den Erfolg der<br />
Unternehmung als Ganzes oder den Erfolg wesentlicher Geschäfte von ausschlaggeben-<br />
der Bedeutung sind.“ Gemäss Simon (2002: 33) hängen Strategie <strong>und</strong> Kultur enger zusam-<br />
men, als man glaubt. „Das eine läßt sich ohne das andere nicht ändern. […] Strategie be-<br />
stimmt Kultur, Kultur bestimmt Strategie." (Simon 2002: 33). Kulturen passen sich folglich<br />
an veränderte Gegebenheiten an. „Kultur ist das von den Mitarbeitern anerkannte Werte- <strong>und</strong><br />
Normensystem eines Unternehmens.“ (Simon 2002: 33). Öffentliche Betriebe verfügen ten-<br />
denziell über starre <strong>und</strong> bewahrende Kulturen (vgl. Lutz 2004: 187). Eine solche Kultur hat<br />
Einfluss auf Entscheide. Es können aufgr<strong>und</strong> der bewahrenden Kultur Widerstände auftreten,<br />
wenn bspw. Änderungen im Unternehmen vorgenommen werden müssen. „Strategie, Struktur<br />
<strong>und</strong> Kultur dienen als Gestaltungsfelder zur Lösung von Anpassungsnotwendigkeiten an ge-<br />
änderte Bedingungen <strong>und</strong> zur Aufrechterhaltung der Leistungs- <strong>und</strong> Funktionsfähigkeit […]“<br />
(Salzgeber 2001: 28) eines öffentlichen Unternehmens.<br />
3.2.2 Unmittelbare Aktionsparameter<br />
Wie weiter oben bereits erwähnt wurde, beschreiben die unmittelbaren Aktionsparameter<br />
Handlungsgrössen auf operativer Ebene. Der gezielte Einsatz der unmittelbaren Aktionspara-<br />
meter wirkt sich schnell positiv aus auf eine erfolgreiche Führung eines öffentlichen Betrie-<br />
bes, wobei die Unternehmensanalyse ein Instrument ist, um den Betrieb erfolgreich zu führen.<br />
Folglich wird die Ausgestaltung der Unternehmensanalyse in der vorliegenden Arbeit als un-<br />
mittelbarer Aktionsparameter betrachtet.<br />
Denise Kuonen Seite 55
Konzeptioneller Bezugsrahmen<br />
3.3 Effektivitäts- <strong>und</strong> Effizienzkonzept<br />
Ausgehend von den übergeordneten Zielen des Unternehmens stellt sich <strong>für</strong> betriebswirt-<br />
schaftliche Handlungsfelder die Frage, wie sie zur Erreichung der Unternehmungsziele bei-<br />
tragen können (vgl. Zaugg 1996: 120 ff.). Sie formulieren Sachziele, die dann in Formalzielen<br />
(= Effizienzkriterien) konkretisiert <strong>und</strong> in Effizienzindikatoren operationalisiert werden. „Sie<br />
erlauben dadurch die Evaluation der zur Erreichung der Sach- <strong>und</strong> Formalziele eingesetzten<br />
Massnahmen.“ (Zaugg 2002a: 7 f.). Die beiden Dimensionen der Effektivität <strong>und</strong> der Effi-<br />
zienz werden wie folgt definiert: „Effektivität wird mit doing the right things umschrieben.“<br />
(Thom/Wenger 2002: 24). D. h. die richtigen Dinge zu tun, steht im Vordergr<strong>und</strong>. „Effizienz<br />
heisst demgegenüber doing the things right.“ (Thom/Wenger 2002: 24). Es geht vereinfacht<br />
gesagt darum, die Dinge richtig zu tun. „Effizienzindikatoren können in Form von Kennzah-<br />
len oder Checklisten formuliert werden. Ein umfassendes Effizienzkonzept darf sich aber<br />
nicht ausschliesslich auf die ökonomisch-technische Zieldimension beschränken, sondern<br />
muss auch eine individual-soziale, eine flexibilitätsorientierte, eine physisch-ökologische <strong>und</strong><br />
eine ethische Dimension beinhalten.“ (Zaugg 2002a: 8). Bei einem Effektivitäts- <strong>und</strong> Effi-<br />
zienzkonzept soll ein Konzept entwickelt werden, um eine Aussage darüber zu machen, ob<br />
ein öffentliches Unternehmen erfolgreich ist oder nicht. Dabei wird Effektivität als Massgrös-<br />
se <strong>für</strong> die Zielerreichung, Effizienz als diejenige <strong>für</strong> die Wirtschaftlichkeit verstanden.<br />
Bei öffentlichen Unternehmen steht die Erfüllung des öffentlichen Auftrages <strong>und</strong> der darin<br />
festgehaltenen Ziele im Mittelpunkt. Zielerreichung <strong>und</strong> Effektivität sind daher die zentralen<br />
Orientierungsgrössen <strong>für</strong> das Handeln (vgl. Lutz 2004: 188). „Öffentliche Unternehmen ha-<br />
ben den Auftrag, Nutzen zu stiften <strong>und</strong> dabei gleichzeitig ihre Funktionstüchtigkeit durch Er-<br />
haltung der unternehmerischen Substanz sicherzustellen. Dies bedingt, dass unternehmeri-<br />
sches Handeln auch effizient zu erfolgen hat. Insgesamt kann <strong>für</strong> ein Effektivitäts- <strong>und</strong> Effi-<br />
zienzkonzept öffentlicher Unternehmen festgehalten werden, dass „[…] Effektivität die um-<br />
fassende Handlungsstrategie zur Leistungserzielung bedarfswirtschaftlicher Einzelwirtschaf-<br />
ten [ist], welche die Rahmenbedingungen <strong>für</strong> effizientes Handeln determiniert.“ (Stein 1998:<br />
76).“ (Lutz 2004: 188 f.). Die Verfasserin verzichtet in dieser Arbeit auf die Erstellung eines<br />
Effektivitäts- <strong>und</strong> Effizienzkonzeptes, da dies den Rahmen dieser Lizentiatsarbeit sprengen<br />
würde.<br />
Denise Kuonen Seite 56
Studiendesign - Einzelfallanalyse<br />
Teil 3: FALLSTUDIE<br />
4 Studiendesign – Einzelfallanalyse<br />
In den folgenden Abschnitten wird das in der Fallstudie verwendete Studiendesign, welches<br />
die Forschungsmethode, das Datenerhebungsverfahren, die Datenaufbereitung <strong>und</strong> die Daten-<br />
auswertung beinhaltet, erläutert. Bei einer Fallstudie handelt es sich um die Darstellung einer<br />
Situation aus der betrieblichen Praxis oder dem Alltagsleben, die aufgr<strong>und</strong> bestimmter Tatsa-<br />
chen, Ansichten <strong>und</strong> Meinungen dargestellt wird. In einem bestimmten Umgang werden ab-<br />
hängig von der mit der Fallstudie festgelegten Zielsetzung zum Fall gehörende Voraussetzun-<br />
gen <strong>und</strong> Rahmenbedingungen geschildert (vgl. Kaiser 1983: 20 f.). Fallstudien sind als For-<br />
schungsdesign gemäss Zaugg (2002b: 3) insbesondere dann geeignet, wenn es eine grosse<br />
Zahl von Variablen bei einer kleinen Zahl von Untersuchungseinheiten zu analysieren gilt <strong>und</strong><br />
der Kontext eine wichtige Rolle spielt.<br />
Den Untersuchungsgegenstand einer Einzelfallanalyse können einzelne Personen oder Indivi-<br />
duen, die zusammen eine Einheit formen (z. B. Gruppe, <strong>Organisation</strong>en, <strong>Institut</strong>ionen, Unter-<br />
nehmen, etc.) bilden (vgl. Schnell/Hill/Esser 1993: 264). Die Einzelfallanalyse ist gemäss<br />
Mayring (2002: 42) eine Methode der qualitativen Sozialforschung <strong>und</strong> will sich „[…] wäh-<br />
rend des gesamten Analyseprozesses den Rückgriff auf den Fall seiner Ganzheit <strong>und</strong> Kom-<br />
plexität erhalten, um so zu genaueren <strong>und</strong> tief greifenderen Ergebnissen zu gelangen.“ Ferner<br />
geht es darum, die Zusammenhänge der Funktions- <strong>und</strong> Lebensbereiche in der Ganzheit der<br />
Person <strong>und</strong> der historische, lebensgeschichtliche Hintergr<strong>und</strong> zu betonen. Dabei stellen Fall-<br />
studien „[…] eine entscheidende Hilfe dar bei der Suche nach relevanten Einflussfaktoren <strong>und</strong><br />
bei der Interpretation von Zusammenhängen.“ (Mayring 2002: 42). Fallstudien haben in der<br />
Soziologie oft geholfen, <strong>Institut</strong>ionen genauer zu analysieren, da sie die Innenschicht, das<br />
Handlungsverständnis unterhalb der Regeln institutioneller Strukturen freigelegt haben (May-<br />
ring 2002: 44). Das Ziel dieser Fallstudie ist es, die Umsetzungen der in den Kapiteln 2 <strong>und</strong> 3<br />
besprochenen Zusammenhänge in der Praxis zu analysieren.<br />
Bei der Bearbeitung der Fallstudie ist die Verfasserin nach der von Zaugg (2002b: 19 ff.)<br />
entwickelten neunstufigen Vorgehensheuristik zur Erarbeitung von Fallstudien vorgegangen,<br />
Denise Kuonen Seite 57
Studiendesign – Einzelfallanalyse<br />
die nachfolgend erläutert wird. Die Verwendung einer Vorgehensheuristik zur Erarbeitung<br />
von Fallstudien ist gemäss Zaugg vor dem Hintergr<strong>und</strong> der Forderung nach intersubjektiver<br />
Nachvollziehbarkeit <strong>und</strong> gewissenhafter Dokumentation nützlich. In Abbildung 16 sind die<br />
neun Prozessschritte <strong>und</strong> die wichtigsten Vor- <strong>und</strong> Rückkopplungen dargestellt.<br />
1. Festlegung der Forschungsfragestellung<br />
2. Auswahl der Untersuchungseinheit<br />
(Falldefinition)<br />
3. Bestimmung der Forschungsstrategie <strong>und</strong> der<br />
Forschungsmethoden<br />
4. Vorbereitung der Datenerhebung<br />
5. Datenerhebung<br />
6. Aufbereitung der Daten<br />
7. Auswertung der Daten <strong>und</strong> Interpretation<br />
8. Verfassen der Fallstudie<br />
9. Nachbearbeitung<br />
Abbildung 16: Vorgehensheuristik zur Erarbeitung von Fallstudien (Zaugg 2002b: 19).<br />
4.1 Festlegung der Forschungsfragestellung<br />
Die Festlegung einer spezifischen Forschungsfragenstellung hat gemäss Zaugg (2002b: 20)<br />
weit reichende Konsequenzen <strong>für</strong> die Bestimmung der Forschungsstrategie <strong>und</strong> <strong>für</strong> die Wahl<br />
der Forschungsmethoden, die determinieren, auf welche Art <strong>und</strong> Weise die Daten aufbereitet<br />
werden müssen. Folgende Forschungsfragen sollen mit dieser Fallstudie beantwortet werden:<br />
• Was <strong>für</strong> Probleme hinsichtlich der allgemeinen Situation sind beim Hilfspersonal der<br />
Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong> vorhanden?<br />
• Was <strong>für</strong> Problemfelder hinsichtlich der internen Kommunikation sind beim Hilfsperso-<br />
nal der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong> vorhanden?<br />
Denise Kuonen Seite 58
Studiendesign – Einzelfallanalyse<br />
• Was <strong>für</strong> Probleme hinsichtlich der Prozesse sind beim Hilfspersonal der Pferdeklinik<br />
der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong> vorhanden?<br />
• Wie könnten diese Probleme gelöst werden?<br />
• Was <strong>für</strong> (weitere) Einflussfaktoren auf die Pferdeklinik als öffentlicher Betrieb sind<br />
vorhanden?<br />
• Was <strong>für</strong> Faktoren beeinflussen eine Unternehmensanalyse in einem öffentlichen Be-<br />
trieb?<br />
Das Schwergewicht liegt insbesondere bei den ersten vier Fragen, da diese im Gegensatz zu<br />
den letzten zwei Fragen die Abgrenzung des Untersuchungsgegenstandes (Kapitel 1.1) be-<br />
rücksichtigen <strong>und</strong> die Situation des Hilfspersonals betrachten. Im Rahmen der Fallstudie wer-<br />
den die allgemeine Situation, die interne Kommunikation <strong>und</strong> die Prozesse innerhalb des<br />
Hilfspersonals detailliert dargestellt <strong>und</strong> analysiert. Die Pferdeklinik bzw. das Hilfspersonal<br />
bildet folglich den Untersuchungsgegenstand der Fallstudie. Aufgr<strong>und</strong> dieser Analyse sollen<br />
Gestaltungsempfehlungen formuliert <strong>und</strong> die Richtigkeit des Bezugsrahmens überprüft wer-<br />
den. Die Fallstudie richtet sich an die Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong>, da ihre spezifische<br />
Situation (Situation des Hilfspersonals) dargestellt wird. Zum Zielpublikum gehören aber<br />
auch andere öffentliche Betriebe sowie allgemein Interessierte.<br />
4.2 Auswahl der Untersuchungseinheit (Falldefini-<br />
tion)<br />
Die Verfasserin hat dieses Lizentiatsthema, das vom IOP <strong>für</strong> die Teilnehmenden des Kollo-<br />
quiums des Wintersemesters 2003/04 zur Auswahl stand, aufgr<strong>und</strong> des Interesses an Tieren<br />
<strong>und</strong> des frühen Bezugs zur Landwirtschaft durch den elterlichen Alpakazucht-Betrieb ausge-<br />
wählt. Die Analyse der Pferdeklinik war sehr interessant <strong>und</strong> vielseitig, insbesondere auch<br />
dadurch, dass es sich bei der Pferdeklinik nicht um ein privates, sondern um ein öffentliches<br />
Unternehmen handelt. Die Zusammenarbeit mit Herrn Meier als Praxispartner der Pferdekli-<br />
nik gestaltete sich sehr gut. Die Verfasserin konnte problemlos Einsicht nehmen in die benö-<br />
tigten Dokumente <strong>und</strong> Unterlagen. Zudem stand ihr sowohl Herr Meier <strong>und</strong> als auch das<br />
Hilfspersonal der Pferdeklinik jederzeit hilfs- <strong>und</strong> auskunftsbereit zur Verfügung.<br />
Denise Kuonen Seite 59
Studiendesign – Einzelfallanalyse<br />
4.3 Bestimmung der Forschungsstrategie <strong>und</strong> der<br />
Forschungsmethoden<br />
Gemäss Zaugg (2002b: 25) können bei der Erarbeitung einer Fallstudie verschiedene Strate-<br />
gien der explorativen Forschung (sachlich-analytische, empirische <strong>und</strong> formal-analytische)<br />
angewandt werden. Bei der Erarbeitung dieser Fallstudie wurde eine sachlich-analytische For-<br />
schungsstrategie gewählt, da sie auf die Durchdringung komplexer Zusammenhänge <strong>und</strong> die<br />
Erarbeitung von Handlungsgr<strong>und</strong>lagen ausgerichtet ist (vgl. Grochla 1978: 72). Ferner dient<br />
sie der laufenden Präzisierung <strong>und</strong> Ergänzung der Elemente des Bezugsrahmens, ohne sie je-<br />
doch empirisch zu überprüfen. Die sachlich-analytische Forschungsstrategie basiert auf einem<br />
kontinuierlichen Denkprozess, der von bekannten Variablen ausgeht, diese abwechselnd prä-<br />
zisiert <strong>und</strong> erweitert, um anschliessend zu neuen Variablen <strong>und</strong> Annahmen über Wirkungszu-<br />
sammenhänge zu kommen, die wiederum präzisiert <strong>und</strong> erweitert werden usw. (vgl. Zaugg<br />
2002b: 15). Bei der zugr<strong>und</strong>e liegenden Lizentiatsarbeit wurden verschiedene Formen der Da-<br />
tenerhebung miteinander kombiniert, um eine ganzheitliche Erfassung des Untersuchungsge-<br />
genstandes zu gewährleisten <strong>und</strong> den verschiedenen Dimensionen der Problemstellung ge-<br />
recht zu werden. Folglich kamen zunächst die Beobachtung <strong>und</strong> die Befragung als Methoden<br />
der Primärerhebung <strong>und</strong> die Dokumentenanalyse als Methode der Sek<strong>und</strong>ärerhebung zum<br />
Einsatz. Die Beobachtungen lassen sich in verschiedene „Arten“ unterteilen (vgl. Kapitel<br />
2.2.3.2). Im Rahmen von Fallstudien ist strukturierten <strong>und</strong> offenen Beobachtungen gegenüber<br />
unstrukturierten <strong>und</strong> verdeckten Formen den Vorzug zu geben, da eine Strukturierung grösse-<br />
re Ergiebigkeit verspricht <strong>und</strong> eine verdeckte Beobachtung dem Aufbau einer Vertrauensbe-<br />
ziehung entgegensteht (vgl. Zaugg 2002b: 26). Die Verfasserin hat während ihrer mehrtägigen<br />
Besuche in der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong> die Situation beim Hilfspersonal offen<br />
beobachtet. Systematische Betriebsr<strong>und</strong>gänge dienten u. a. der Ermittlung des Betriebsklimas,<br />
um dadurch die Situation des Hilfspersonals nachzuvollziehen <strong>und</strong> vorhandene Problemfelder<br />
zu eruieren.<br />
Bei der Befragung einiger Mitarbeitenden der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong> wurde das<br />
problemzentrierte Interview angewandt. Das problemzentrierte Interview ist eine qualitative<br />
Methode der Befragung (vgl. Diekmann 2004: 443 ff.). Es geht darum, die befragte Person<br />
möglichst frei zu Wort kommen zu lassen <strong>und</strong> so einem offenen Gespräch nahe zu kommen.<br />
Im Zentrum stehen Aspekte einer bestimmten Problemstellung, welche die interviewende Per-<br />
son in den Interviewleitfaden (vgl. Kapitel 4.4) einfliessen lässt <strong>und</strong> auf die sie während des<br />
Denise Kuonen Seite 60
Studiendesign – Einzelfallanalyse<br />
Gesprächs immer wieder zurückkommt. Den Nachteilen dieser Methode, die im z. T. erhebli-<br />
chen Aufwand bei der Aufbereitung der Daten, deren Auswertung sowie in den Anforderun-<br />
gen an den Interviewenden liegen, sind die wesentlichen Vorteile gegenüberzustellen. Die<br />
Vorteile des problemzentrierten Interviews als Erhebungstechnik sind die Flexibilität <strong>und</strong> die<br />
Fokussierung (vgl. Zaugg 2002b: 27). Hinzu kommt die Standardisierung durch den Leitfa-<br />
den. „Denn diese Standardisierung erleichtert die Vergleichbarkeit mehrerer Interviews. Das<br />
Material aus vielen Gesprächen kann auf die jeweiligen Leitfadenfragen bezogen werden <strong>und</strong><br />
so sehr leicht ausgewertet werden.“ (Mayring 2002: 70). Wie oben bereits erwähnt wurde, ist<br />
die Offenheit beim problemzentrierten Interview von Bedeutung. So kann direkt während des<br />
Interviews überprüft werden, ob der Befragte die Frage überhaupt richtig verstanden hat. Die<br />
Interviewten können ihre subjektive Perspektive <strong>und</strong> ihre Deutungen offen legen <strong>und</strong> selber<br />
Zusammenhänge im Interview entwickeln <strong>und</strong> formulieren. Ebenfalls von Bedeutung ist die<br />
Vertrauensbasis zwischen Interviewer <strong>und</strong> Befragten, denn der „[..] Interviewte soll sich ernst<br />
genommen <strong>und</strong> nicht ausgehorcht fühlen.“ (Mayring 2002: 69). Wenn es gelingt, eine mög-<br />
lichst offene Beziehung während des Interviews aufzubauen, profitiert auch der Befragte von<br />
der Erforschung der Problemstellung <strong>und</strong> antwortet deshalb i. d. R. ehrlicher, reflektierter, ge-<br />
nauer <strong>und</strong> offener (vgl. Mayring 2002: 69).<br />
Es wurden sechs problemzentrierte Interviews geführt. Die Auswahl der Interviewpartner<br />
wurde so getroffen, dass vom Hilfspersonal mindestens ein Wärter <strong>und</strong> ein OPS-Gehilfe be-<br />
fragt wurden, so dass alle „Ausprägungen“ der Tätigkeiten des Hilfspersonals abgedeckt wur-<br />
den <strong>und</strong> eine „inhaltliche“ Repräsentativität der Befragung gegeben ist. Bei der (bewussten)<br />
Auswahl der zu befragenden Personen ging es darum, das Aussagenspektrum abzubilden. Da<br />
die Anzahl der Wärter-Stellen grösser ist als diejenige der OPS-Gehilfen, wurden mehr Wär-<br />
ter als OPS-Gehilfen befragt, nämlich vier Wärter <strong>und</strong> zwei OPS-Gehilfen. Aufgr<strong>und</strong> der<br />
Gewährleistung der Anonymität <strong>und</strong> der Gefahr des Rückschlusses auf die Person wird hier<br />
auf die Nennung der Namen der Interviewpartner verzichtet.<br />
Neben den problemzentrierten Interviews wurden auch informelle Gespräche mit anderen<br />
Mitarbeitenden der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong>, u. a. mit der Assistentin Frau Britta<br />
Lippold, da sie sich in der Vergangenheit <strong>für</strong> die Position des Hilfspersonals eingesetzt hat,<br />
<strong>und</strong> mit Herrn Hans Oesch, Obertierpfleger der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> Zürich, geführt.<br />
Das Gespräch mit Herrn Oesch wurde mit einem Besuch der Zürcher Pferdeklinik verb<strong>und</strong>en,<br />
um einen Einblick in deren <strong>Organisation</strong> <strong>und</strong> dadurch eine Vergleichsmöglichkeit zu erhalten.<br />
Denise Kuonen Seite 61
Studiendesign – Einzelfallanalyse<br />
Neben den beiden Methoden der Primärforschung wurde auch eine Dokumentenanalyse<br />
durchgeführt, jedoch in kleinem Rahmen. Als Dokumente galten in diesem Zusammenhang<br />
unterschiedliche Sitzungsprotokolle, Protokolle der Mitarbeitergespräche, Pflichtenhefte etc.<br />
Mit der Untersuchung dieser Dokumente wurde die aktuelle Situation beim Hilfspersonal<br />
nachvollzogen.<br />
4.4 Vorbereitung der Datenerhebung<br />
Vier Wochen nach dem Beginn der Lizentiatsarbeit wurde mit Herrn Meier als Praxispartner<br />
der Pferdeklinik Kontakt aufgenommen, um ein erstes Gespräch zu führen. Dabei wurde u. a.<br />
der Untersuchungsgegenstand der Fallstudie besprochen. Um den Betrieb <strong>und</strong> die Personen<br />
der Pferdeklinik – hauptsächlich das Hilfspersonal – kennen zu lernen, besuchte die Verfasse-<br />
rin ca. fünf Wochen nach Beginn der sechsmonatigen Arbeitsdauer die Klinik während zwei<br />
Tagen. Darauf wurde mit Herrn Meier besprochen, welche Personen des Hilfspersonals bei<br />
den Interviews befragt werden sollen. Die Verfasserin erstellte anschliessend einen Interview-<br />
leitfaden (vgl. Atteslander 1995: 193 ff.), der auch von Herrn Meier gelesen wurde, um allfäl-<br />
lige Änderungswünsche aufzunehmen. Der Interviewleitfaden (siehe Anhang) bzw. die Ge-<br />
spräche bestehen hauptsächlich aus den drei folgenden Teilen (vgl. Mayring 2002: 69 f.):<br />
• Sondierungsfragen: Sie dienen zum Einstieg in eine Thematik <strong>und</strong> nehmen dem Be-<br />
fragten die Befangenheit. Mit den Sondierungsfragen soll eruiert werden, ob das Thema<br />
<strong>für</strong> den Einzelnen überhaupt wichtig ist <strong>und</strong> welche subjektive Bedeutung der Untersu-<br />
chungsgegenstand <strong>für</strong> ihn besitzt.<br />
• Leitfragen: Diese Fragen sind auf das zentrale Untersuchungsthema ausgerichtet. Sie<br />
entsprechen denjenigen Themenaspekten, die als wesentlichste Fragestellungen im In-<br />
terviewleitfaden festgehalten sind.<br />
• Ad-hoc-Fragen: Diese Fragen sind diejenigen Themenaspekte, die im Leitfaden nicht<br />
verzeichnet sind. Sie sind <strong>für</strong> die Themenstellung <strong>und</strong> die Erhaltung des Gesprächsfa-<br />
dens bedeutsam.<br />
Die problemzentrierten Interviews wurden auf Tonband aufgenommen, die nach der Bearbei-<br />
tung <strong>und</strong> Auswertung der Interviews wieder gelöscht wurden. Bei den problemzentrierten In-<br />
terviews ging es darum, den Ist-Zustand festzuhalten sowie die vorhandenen Probleme des<br />
Hilfspersonals zu eruieren <strong>und</strong> deren Bedürfnisse zu ermitteln. Bei der Formulierung der Fra-<br />
gen (Leitfragen) konzentrierte sich die Verfasserin auf die drei zentralen Problemstellungen:<br />
allgemeine Situation, interne Kommunikation <strong>und</strong> Prozesse/Abläufe. Danach wurde die Do-<br />
Denise Kuonen Seite 62
Studiendesign – Einzelfallanalyse<br />
kumentenanalyse vorbereitet, bei der die Verfasserin Einsicht in interne Dokumente der Pfer-<br />
deklinik nahm. Parallel zu den Interviews folgten informelle Gespräche mit anderen Mitarbei-<br />
tenden der Pferdeklinik. Nach der Durchführung der problemzentrierten Interviews <strong>und</strong> der<br />
Dokumentenanalyse folgte ein dreitägiger Besuch der Pferdeklinik. Während diesen Tagen<br />
beobachtete die Verfasserin insbesondere die Tätigkeiten <strong>und</strong> Ablaufprozesse der Wärter <strong>und</strong><br />
der OPS-Gehilfen während des Tages-, Nacht- <strong>und</strong> Wochenenddienstes. Viereinhalb Monate<br />
nach Beginn der Lizentiatsarbeit nahm die Verfasserin Kontakt auf mit der Pferdeklinik der<br />
<strong>Universität</strong> Zürich, um ein informelles Gespräch mit Herrn Oesch zu führen <strong>und</strong> Einblick in<br />
diesen Betrieb <strong>und</strong> dessen <strong>Organisation</strong> zu nehmen.<br />
4.5 Datenerhebung<br />
Die Datenerhebung durch die problemzentrierten Interviews sowie durch die mehrtägigen Be-<br />
suche der Pferdeklinik wurde zeitlich auf ca. zwei Wochen konzentriert. Diese zeitliche Kon-<br />
zentration der Erhebung weist folgenden Vorteil auf: „Findet die Datenerhebung in einem en-<br />
gen Zeitfenster statt, gelten <strong>für</strong> alle Befragten oder Interviewten die gleichen generellen Rah-<br />
menbedingungen. Zieht sich eine Erhebung über einen längeren Zeitraum hinweg, verändert<br />
sich der Untersuchungsgegenstand, was die Auswertung <strong>und</strong> Interpretation der Daten er-<br />
schwert.“ (Zaugg 2002b: 32). Während den Untersuchungen in der Pferdeklinik erstellte die<br />
Verfasserin so genannte „Forschungs- oder Feldnotizen“, d. h. es wurden Ereignisse eines<br />
Forschungstages notiert. Forschungsnotizen enthalten jene Informationen, die nicht mittels<br />
spezifischer Forschungsmethoden wie Interviews, Befragungen etc. gewonnen werden. Bei<br />
diesen Eintragungen kann es sich auch um Beobachtungen, Überlegungen, Intuitionen, Ideen,<br />
Anpassungen in der Methodik, erste Interpretationen, Quellen <strong>für</strong> Zusatzinformationen oder<br />
spontane Hinweise der Praxispartner handeln (vgl. Zaugg 2002b: 32).<br />
4.6 Aufbereitung der Daten<br />
Die Aussagen der problemzentrierten Interviews wurden bei der Aufbereitung der Daten zu-<br />
nächst verdichtet. Dabei wurden sie auf ein eigens entwickeltes Konzept übertragen. Bei die-<br />
sem Konzept ging es darum, festzulegen, mit welchen Fragen bzw. Antworten der Untersu-<br />
chungsgegenstand dann auch tatsächlich beschrieben werden kann. Die Untersuchung erfolgte<br />
getrennt nach den drei Hauptbereichen allgemeine Situation, interne Kommunikation <strong>und</strong><br />
Prozesse/Abläufe. Die Tabelle 2 zeigt, welche Fragen bzw. welche Antworten wo berücksich-<br />
tigt wurden:<br />
Denise Kuonen Seite 63
Studiendesign – Einzelfallanalyse<br />
Allgemeine Situation<br />
Einstieg<br />
Zufriedenheit mit Betriebsklima<br />
Verhältnis zwischen den Mitarbeitenden<br />
Probleme, Gründe <strong>für</strong> Unzufriedenheit, Lösungen<br />
Interne Kommunikation<br />
Kommunikationssituation<br />
Informationsweitergabe<br />
Beeinträchtigte Arbeitsqualität<br />
Eingesetzte Instrumente<br />
Probleme, Lösungen,<br />
Prozesse<br />
Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortlichkeiten<br />
Dokumentationen, Beschreibungen der Abläufe<br />
Stellvertretungsregelungen<br />
Ferien<br />
Arbeitsprozesse<br />
Nachtdienst<br />
Wochenenddienste<br />
Tagesdienst<br />
Arbeitsbelastung<br />
Probleme, Lösungen<br />
Gehalt<br />
Anforderungen, Ausbildung,<br />
Fragen bzw. Antworten (Nr.)<br />
1, 2<br />
3, 4, 10<br />
5, 6, 7, 8, 9<br />
11, 12, 13<br />
Fragen bzw. Antworten (Nr.)<br />
14, 15, 16, 19<br />
17, 20, 21<br />
18<br />
22<br />
23, 24<br />
Fragen bzw. Antworten (Nr.)<br />
25, 26, 27, 32<br />
28, 54<br />
29, 30<br />
31<br />
33, 34<br />
35, 36, 41, 42<br />
37, 38, 43, 44<br />
39, 40<br />
45, 46, 47<br />
48, 49<br />
50, 51<br />
52, 53, 55<br />
Tabelle 2: Fragen bzw. Antworten zum Untersuchungsgegenstand (eigene Darstellung).<br />
Anschliessend erfolgte die Zusammenfassung der Ergebnisse mittels eines Protokolls. Ein zu-<br />
sammenfassendes Protokoll ist dann sinnvoll, „[…] wenn man vorwiegend an der inhaltlich-<br />
thematischen Seite des Materials interessiert ist […].“ (Mayring 2002: 97). Der konkrete<br />
Sprachkontext, die Interview- oder Diskussionssituation geht dabei verloren (vgl. Mayring<br />
2002: 97). Die Ergebnisse der Dokumentenanalyse, welche als relevant erachtet wurden, sind<br />
nach Themenbereich (allgemeine Situation, interne Kommunikation <strong>und</strong> Prozesse/Abläufe)<br />
abgelegt worden. Die aufgr<strong>und</strong> der Beobachtungen erzielten Ergebnisse wurden ebenfalls pro-<br />
tokolliert <strong>und</strong> auf ihre Relevanz hin geprüft.<br />
4.7 Auswertung der Daten <strong>und</strong> Interpretation<br />
Nach der Aufbereitung wurden die Daten nach den in Kapitel 4.1 formulierten Forschungs-<br />
fragenstellungen <strong>und</strong> Zielen ausgewertet (vgl. Tabelle 2 in Kapitel 4.6). Ferner gilt zu erwäh-<br />
nen, dass das Material durch Zusammenfassen so reduziert wurde, dass die wesentlichen In-<br />
halte erhalten blieben.<br />
Denise Kuonen Seite 64
Studiendesign – Einzelfallanalyse<br />
4.8 Verfassen der Fallstudie<br />
Die Fallstudie umfasst nach Zaugg (2002b: 37) gr<strong>und</strong>sätzlich zwei Teile, einen methodischen<br />
<strong>und</strong> einen inhaltlichen. Neben diesen beiden gibt es Fallstudien, die in der Schulung zum Ein-<br />
satz kommen <strong>und</strong> die dann um einen didaktischen Teil zu ergänzen sind. Da die in Kapitel 5<br />
folgende Fallstudie nicht in der Lehre eingesetzt wird, verzichtet die Verfasserin auf die Er-<br />
klärung bzw. Aufbereitung des didaktischen Teils der Fallstudie <strong>und</strong> verweist <strong>für</strong> weitere de-<br />
taillierte Informationen hierzu auf die Literatur (vgl. Zaugg 2002b: 36 ff.). „Im methodischen<br />
Teil beschreiben die Forschenden, wie sie die in der Fallstudie verarbeiteten Informationen<br />
gewonnen <strong>und</strong> ausgewertet haben.“ (Zaugg 2002b: 39). Die Erläuterung des methodischen<br />
Teils, der die zentrale Forschungsfragestellung <strong>und</strong> die Ziele der Fallstudie (Kapitel 4.1), die<br />
Auswahl der Untersuchungseinheit (Kapitel 4.2), die Forschungsstrategie <strong>und</strong> die -methoden<br />
(Kapitel 4.3) usw. beinhaltet, folgt in diesem Kapitel. Der inhaltliche Teil der Fallstudie findet<br />
sich in Kapitel 5. Dabei geht es um einen generellen Abschnitt, welcher aus der Beschreibung<br />
des Untersuchungsgegenstandes (Vorstellung des Unternehmens im Firmenporträt) besteht,<br />
<strong>und</strong> einen problemspezifischen Abschnitt, der sich mit der spezifischen Fragestellung der<br />
Fallstudie, der Unternehmensanalyse der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong>, befasst. Nach dem<br />
Verfassen der Fallstudie wurden die Resultate gemeinsam mit dem Praxispartner besprochen<br />
<strong>und</strong> wo nötig ergänzt.<br />
4.9 Nachbearbeitung<br />
Der letzte Schritt der von Zaugg (2002b: 37 ff.) entwickelten neunstufigen Vorgehensheuris-<br />
tik zur Erarbeitung von Fallstudien befasst sich mit der zu einem späteren Zeitpunkt folgen-<br />
den Nachbearbeitung. Hier gilt es abzuklären, in welcher Form die Fallstudie zu verbreiten<br />
ist. Diese hängt von den Eigentumsrechten, der Qualität der Ausarbeitung, der Aktualität der<br />
behandelten Problemstellung sowie den Interessen der Forschenden <strong>und</strong> der Praxispartner ab.<br />
Entsprechend der Form der Verbreitung bzw. den Anforderungen des Mediums muss die<br />
Fallstudie überarbeitet werden.<br />
4.10 Beurteilung des eigenen methodischen Vorge-<br />
hens<br />
Das von Zaugg (2002b: 19 ff.) vorgeschlagene Vorgehen ist nach Ansicht der Verfasserin <strong>für</strong><br />
die Erarbeitung dieser Fallstudie geeignet. Die problemzentrierten Interviews <strong>und</strong> die ver-<br />
Denise Kuonen Seite 65
Studiendesign – Einzelfallanalyse<br />
schiedenen informellen Gespräche <strong>und</strong> Besuche der <strong>Bern</strong>er Pferdeklinik halfen, den Ablauf<br />
des Betriebs zu verstehen <strong>und</strong> die vorhandenen Probleme beim Hilfspersonal zu eruieren. Ins-<br />
besondere der Besuch der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> Zürich hat dazu beigetragen, Verbesse-<br />
rungen <strong>und</strong> Anregungen <strong>für</strong> Lösungsvorschläge <strong>für</strong> die <strong>Bern</strong>er Pferdeklinik zu erhalten.<br />
Denise Kuonen Seite 66
Unternehmensanalyse der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong><br />
5 Unternehmensanalyse der Pferdeklinik der<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong><br />
In einem ersten Teil wird die Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong> vorgestellt. Anschliessend<br />
folgt im zweiten Teil die Analyse der Pferdeklinik.<br />
5.1 Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong><br />
5.1.1 Rahmenstruktur<br />
Die Pferdeklinik gehört neben der Nutztierklinik (Schweine <strong>und</strong> Wiederkäuer) <strong>und</strong> der Klein-<br />
tierklinik zum Departement <strong>für</strong> klinische Veterinärmedizin. Die Pferdeklinik hat zwei Abtei-<br />
lungen: einerseits die Abteilung „Innere Medizin“, anderseits die Abteilung „Chirurgie“. Das<br />
Hilfspersonal, auf deren Situation unter Kapitel 5.2 eingegangen wird, arbeitet mit diesen bei-<br />
den Abteilungen zusammen bzw. hilft bei den medizinischen <strong>und</strong> chirurgischen Untersuchun-<br />
gen, Behandlungen <strong>und</strong> Operationen mit. Organisatorisch sind sie jedoch nicht diesen beiden<br />
Abteilungen angegliedert, sondern bilden den Bereich „Übriges <strong>Personal</strong>“, unter der Leitung<br />
von Herrn Meier. Die Pferdeklinik arbeitet ferner sehr eng mit den überbetrieblichen Abtei-<br />
lungen „Bildgebende Verfahren“ (Diagnostik) <strong>und</strong> „Anästhesiologie“ zusammen. Weitere<br />
Abteilungen sind die klinische Neurologie, die Pathophysiologie <strong>und</strong> das klinische Labor, die<br />
Dermatologie, die klinische Immunologie, die Fortpflanzung <strong>und</strong> die klinische Forschung<br />
(vgl. Abbildung 17).<br />
Denise Kuonen Seite 67
Unternehmensanalyse der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong><br />
Kleintierklinik<br />
Departement <strong>für</strong> klinische<br />
Veterinärmedizin<br />
Nutztierklinik<br />
Innere Medizin Chirurgie<br />
Überbetriebliche Abteilungen:<br />
• Bildgebende Verfahren.<br />
• Anästhesiologie.<br />
• Klinische Neurologie.<br />
• Pathophysiologie.<br />
• Klinisches Labor.<br />
• Dermatologie.<br />
• Klinische Immunologie.<br />
• Fortpflanzung.<br />
• Klinische Forschung.<br />
Pferdeklinik<br />
Übriges <strong>Personal</strong><br />
Abbildung 17: Überblick über das Departement <strong>für</strong> klinische Veterinärmedizin (eigene Darstellung).<br />
Aufgr<strong>und</strong> des Projektes VetSuisse steht die Veterinärmedizinische Fakultät in den nächsten<br />
Jahren vor grossen Herausforderungen. Denn bei dem im Januar 2003 in die Realisierungs-<br />
phase eingetretenen Projekt geht es darum, die beiden Veterinärmedizinischen Fakultäten der<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong> <strong>und</strong> Zürich zu einer Fakultät mit zwei Standorten zusammen zu schliessen.<br />
Die endgültige organisationsrechtliche Zusammenführung unter einheitlicher Trägerschaft ist<br />
spätestens auf den Beginn des akademischen Jahres 2005 geplant. Bis dahin bleiben beide Fa-<br />
kultäten als eigenständige organisationsrechtliche Einheiten bestehen. Aufgr<strong>und</strong> dieser Um-<br />
strukturierungen gibt es weder von der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong> noch von der Fakul-<br />
tät ein „offizielles“ Organigramm. Deshalb erstellt die Verfasserin nachfolgend ein Organi-<br />
gramm, welches einen Überblick über die Pferdeklinik geben soll:<br />
Denise Kuonen Seite 68
Unternehmensanalyse der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong><br />
Resident**<br />
Frau Imhof<br />
Innere Medizin<br />
Herr Prof. Straub<br />
Oberassistent<br />
Herr Gerber<br />
Intern***<br />
Frau Florin<br />
* ab September 2004<br />
Dienstleistung Pferdeklinik<br />
Herr Prof. Ueltschi<br />
Resident**<br />
Frau Studer<br />
Intern***<br />
Frau Bieri<br />
Chirurgie<br />
Herren Brehm <strong>und</strong> Deiss<br />
Oberassistent<br />
50 % vakant<br />
Resident**<br />
Frau Lippold<br />
Intern***<br />
Herr Koch<br />
Oberassistent<br />
50 % vakant<br />
Resident**<br />
Frau Werren<br />
** Die „Residents“ spezialisieren sich während drei Jahren in der von ihnen<br />
gewünschten Abteilung.<br />
*** Die „Interns“ (Internship) rotieren zwischen den jeweiligen Abteilungen.<br />
Diese Ausbildung nach dem Studium der Veterinärmedizin dauert ein Jahr.<br />
Abbildung 18: Organigramm der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong> (eigene Darstellung).<br />
Dispatcher<br />
Herr Meier<br />
Übriges <strong>Personal</strong><br />
Herr Meier<br />
Sekretariat<br />
Frau Lamy<br />
TPA<br />
Frau Immeli<br />
OPS-Pfleger<br />
Herr Bigler<br />
Sattlerei<br />
Herr Brändli<br />
Herr Karlen<br />
Schmiede<br />
Frau Nef<br />
Apotheke<br />
Wärter<br />
Herr Glauser<br />
Herr Baumgartner*<br />
Herr<br />
Gäumann<br />
Herr Kindler<br />
Schmiede<br />
Herr<br />
Meerstetter<br />
Herr Schick<br />
(50 %)<br />
Frau Schmutz<br />
(50 %)<br />
Herr Stucki<br />
Denise Kuonen Seite 69
Unternehmensanalyse der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong><br />
5.1.2 Leistungsangebot<br />
Das Ziel der Veterinärmedizinischen Fakultät<br />
sowie auch der Pferdeklinik ist hauptsächlich<br />
die Ausbildung von qualifizierten Tierärzten. Neben der Lehre (Gr<strong>und</strong>ausbildung, Fort- <strong>und</strong><br />
Weiterbildung) hat insbesondere in diesem Jahrh<strong>und</strong>ert die wissenschaftliche Forschung zu-<br />
genommen. Über die Aufgaben <strong>und</strong> die Lehr- <strong>und</strong> Forschungsgebiete geben die Aufzählun-<br />
gen der <strong>Institut</strong>e <strong>und</strong> der Kliniken einen Überblick: <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Tieranatomie, <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Para-<br />
sitologie der Veterinärmedizinischen <strong>und</strong> der Medizinischen Fakultät, <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Veterinär-<br />
Virologie, <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Tierpathologie, <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Veterinärbakteriologie, <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Tierneu-<br />
rologie, Veterinär-pharmakologisches <strong>Institut</strong> <strong>und</strong> das <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Genetik, Ernährung <strong>und</strong><br />
Haltung von Haustieren, des Weiteren die Kleintierklinik, die Nutztierklinik (Wiederkäuer-<br />
<strong>und</strong> Schweineklinik) <strong>und</strong> die Pferdeklinik.<br />
Als Dienstleistungsbetrieb erfüllt die Pferdeklinik<br />
der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong> neben der Ausbildung<br />
von<br />
qualifizierten Tierärzten wichtige Aufgaben <strong>und</strong> Beraterfunktionen im Dienst der Land-<br />
wirtschaft. In der Pferdeklinik werden im Jahr durchschnittlich etwa 1820 Pferde betreut. Sie<br />
werden in erster Linie <strong>für</strong> Untersuchungen <strong>und</strong> Operationen eingeliefert. In letzterem Fall<br />
kommt i. d. R. noch eine Nachbehandlung dazu. Ein grosser Teil der „Patienten“ bleibt hospi-<br />
talisiert <strong>und</strong> wird folglich stationär behandelt. Der kleinere Teil der Pferde wird konsultato-<br />
risch behandelt, d. h. sie werden während des Tagesbetriebes hindurch untersucht, verlassen<br />
aber nach der Behandlung die Klinik wieder. Das Angebot der Pferdeklinik umfasst folgende<br />
Dienstleistungen: Untersuchungen durchführen, Diagnosen stellen, Beratung der Pferdebesit-<br />
zer <strong>und</strong> der Tierärzteschaft, Behandlung <strong>und</strong> Pflege der Tiere, Gutachten erstellen etc. Zusätz-<br />
lich zum normalen Tagesklinikbetrieb wird der Notfalldienst während 365 Tagen im Jahr <strong>und</strong><br />
während 24 St<strong>und</strong>en pro Tag gewährleistet.<br />
5.1.3 Wichtige Kennzahlen<br />
In der untenstehenden Abbildung sind Kennzahlen<br />
über die in der Pferdeklinik behandelten<br />
Tiere (Pferde, Ponys, Maultiere, Esel <strong>und</strong> andere) aufgelistet:<br />
Denise Kuonen Seite 70
Unternehmensanalyse der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong><br />
Anzahl behandelter Pferde<br />
2000<br />
1950<br />
1900<br />
1850<br />
1800<br />
1750<br />
1700<br />
1650<br />
1600<br />
1550<br />
1500<br />
1450<br />
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003<br />
Jahr<br />
Abbildung 19: Anzahl behandelter Pferde seit 1994 (eigene Darstellung).<br />
Wie aus der Abbildung 19 ersichtlich ist, liegt der Durchschnitt der pro Jahr untersuchten<br />
Pferde bei r<strong>und</strong> 1820. Aus der internen Statistik der Pferdeklinik geht hervor, dass der Anteil<br />
an chirurgisch behandelten Tieren höher ist als der internistische Anteil (derjenige Anteil, der<br />
durch die Abteilung „Innere Medizin“ behandelt wird). Die durchschnittliche Aufenthaltsdau-<br />
er eines Pferdes in der Klinik beträgt r<strong>und</strong> 8.4 Tage.<br />
Die Entwicklung beim Hilfspersonals sieht folgendermassen aus: Bei den Wärtern handelte es<br />
sich bis 1992 um neun Vollzeitstellen. Zu diesem Zeitpunkt wechselte einer der Wärter, Herr<br />
Brändli, zu den OPS-Gehilfen. Seine Wärter-Stelle wurde nicht ersetzt. Im Jahr 2001 wurde<br />
eine weitere Wärter-Stelle nicht mehr ersetzt. Gemäss Herrn Meier wurden die <strong>Personal</strong>punk-<br />
te dieser Stelle an die Abteilung „Bildgebende Verfahren“ verschoben. Im April 2004 ist ein<br />
weiterer Wärter ausgetreten, dessen Stelle wurde jedoch erst ab September 2004 ersetzt. Bei<br />
den OPS-Gehilfen, die bis 2002 zu fünft waren, ist eine Stelle gestrichen <strong>und</strong> deren Aufgaben<br />
zusätzlich an Frau Nef übertragen worden. Die <strong>Personal</strong>punkte dieser Stelle wurden aufgr<strong>und</strong><br />
von Sparmassnahmen gestrichen. Folglich handelt es sich nun beim Hilfspersonal um vier<br />
OPS-Gehilfen <strong>und</strong> sechs Wärter, die zu 100 % angestellt sind <strong>und</strong> zwei, die zu 50 % ange-<br />
stellt sind (die 100 %-Stelle von Herrn Schick wurde aufgr<strong>und</strong> seiner ges<strong>und</strong>heitlichen Prob-<br />
leme zerlegt in zwei à 50 %).<br />
Denise Kuonen Seite 71
Unternehmensanalyse der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong><br />
Ein Vergleich mit der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> Zürich, in der 16 Pferdepfleger, davon drei<br />
à 50 % <strong>und</strong> einer à 80 %, zwei Praktikanten <strong>für</strong> den Tagesdienst <strong>und</strong> sieben Studierende <strong>für</strong><br />
den Spätdienst angestellt sind, zeigt folgendes: In Zürich wurden im Jahr 2003 r<strong>und</strong> 2300 Tie-<br />
re behandelt. Dies bedeutet, dass in Zürich weniger Tiere durch einen Pferdepfleger (alle<br />
Pfleger sind auch OPS-Gehilfen) zu pflegen sind als in <strong>Bern</strong>, nämlich 142 Tiere pro Pferde-<br />
pfleger (inkl. Praktikanten, exkl. Studierende). In <strong>Bern</strong> pflegt das Hilfspersonal 166 Tiere pro<br />
Person (sieben 100 %-Wärter-Stellen <strong>und</strong> vier OPS-Gehilfen) im Jahr. Die Pfleger in der Kli-<br />
nik in Zürich sind auch <strong>für</strong> weniger Boxen „verantwortlich“, nämlich pro Pferdepfleger drei<br />
der insgesamt 43 Boxen. Dies ist ebenfalls weniger als in der <strong>Bern</strong>er Klinik, in der acht Boxen<br />
pro Wärter zu „betreuen“ sind. Die Wärter in <strong>Bern</strong> sind insgesamt <strong>für</strong> 49 Boxen verantwort-<br />
lich, wobei die Boxen der neuen Ställe (Reservestall eins <strong>und</strong> zwei), die im September 2004<br />
eröffnet worden sind, mitgezählt wurden.<br />
5.1.4 Rahmenbedingungen<br />
Da sich der Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit auf die Situation des Hilfsper-<br />
sonals bezieht <strong>und</strong> nur indirekt auf die gesamte Pferdeklinik, werden nachfolgend Bedingun-<br />
gen formuliert, die vorwiegend Einfluss auf das Hilfspersonal der Pferdeklinik haben. Neben<br />
den Bedingungsgrössen, die bereits im dritten Kapitel „Bezugsrahmen“ formuliert wurden,<br />
werden die Rahmenbedingungen <strong>für</strong> das Hilfspersonal bzw. die Pferdeklinik der <strong>Universität</strong><br />
<strong>Bern</strong> spezifiziert.<br />
5.1.4.1 Ausserbetriebliche Bedingungsgrössen<br />
Im Folgenden wird zunächst auf die generellen <strong>und</strong> dann auf die aufgabenspezifischen Bedin-<br />
gungsgrössen eingegangen. Die generellen Bedingungsgrössen <strong>für</strong> die Pferdeklinik lassen<br />
sich folgendermassen beschreiben:<br />
• Ökonomische Rahmenbedingungen: Die ökonomischen Rahmenbedingungen äussern<br />
sich insbesondere dadurch, dass die Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong> ihre finanziellen<br />
Mittel von der öffentlichen Hand vorgegeben erhält. Folglich muss die Pferdeklinik<br />
durch Sparmassnahmen der öffentlichen Hand mit kleineren bzw. gekürzten Budgets<br />
auskommen. Dementsprechend muss die Pferdeklinik selbst organisieren, wie das Bud-<br />
get einzuhalten ist. Folge davon können bspw. gestrichene Stellen sein, um <strong>Personal</strong>-<br />
punkte <strong>und</strong> dadurch Kosten einzusparen, was Auswirkungen auf die Situation des<br />
Hilfspersonals hat.<br />
Denise Kuonen Seite 72
Unternehmensanalyse der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong><br />
• Politisch-rechtliche Rahmenbedingungen: Die politisch-rechtlichen Rahmenbedin-<br />
gungen der Pferdeklinik entsprechen denjenigen des Kapitels 3.1.1.1.2.<br />
• Technologische Rahmenbedingungen: Innovationen <strong>und</strong> Verbesserungen in der<br />
Technologie <strong>und</strong> in den Verfahrensmethoden können in einem Unternehmen wie der<br />
Pferdeklinik zu erheblichen Veränderungen in den Prozessen <strong>und</strong> Vorgehensweisen<br />
führen (bspw. neue Maschinen <strong>und</strong> dadurch verbesserte Methoden, um Operationen<br />
durchzuführen). Veränderungen in den technologischen Rahmenbedingungen haben<br />
folglich einen grossen Einfluss auf das Hilfspersonal. Auch die Informations- <strong>und</strong> Kom-<br />
munikationstechnologien beeinflussen den Tagesablauf des Hilfspersonals: Einige Per-<br />
sonen des Hilfspersonals werden bspw. per E-Mail über kurz- <strong>und</strong> mittelfristige Vor-<br />
gänge schnell informiert.<br />
• Sozio-kulturelle Rahmenbedingungen: Die sozio-kulturellen Rahmenbedingungen<br />
der Pferdeklinik sind durch die Einstellung in der Bevölkerung gegenüber der Tierhal-<br />
tung geprägt. Je positiver die Gr<strong>und</strong>haltung zu Tieren in der Bevölkerung ist <strong>und</strong> je<br />
mehr Tiere dadurch in der Bevölkerung gehalten werden, desto grösser wird auch die<br />
Nachfrage nach medizinischen Dienstleistungen sein, was sich folglich auch auf die Tä-<br />
tigkeit des Hilfspersonals auswirkt. Gemäss Morra (1996: 205 f.) korreliert der Umsatz<br />
einer Klinik stark mit deren Akzeptanz bei der Bevölkerung. Folglich ist anzunehmen,<br />
dass sich der Erfolg der Pferdeklinik auch positiv auf Situation des Hilfspersonals aus-<br />
wirkt (z. B. stehen mehr finanzielle Mittel <strong>für</strong> Aus- <strong>und</strong> Weiterbildungen zur Verfü-<br />
gung). Es gilt daher, die allgemeine Einstellung der Bevölkerung gegenüber der eigenen<br />
Klinik positiv zu beeinflussen.<br />
Eine weitere sozio-kulturelle Rahmenbedingung, welche sich jedoch in erster Linie auf<br />
die Pferdeklinik als eine öffentliche <strong>Institut</strong>ion wie eine <strong>Universität</strong> bezieht <strong>und</strong> nur in-<br />
direkt auf das Hilfspersonal, ist die Einstellung in der Bevölkerung zu einer akademi-<br />
schen Ausbildung. Es ist anzunehmen, dass sich die positive Einstellung der Gesell-<br />
schaft auf die Attraktivität der Wahl eines Veterinärmedizin-Studiums auswirkt. Da die<br />
Wärter z. T. auch in der Lehre eingesetzt werden (z. B. Hilfe bei der Ausbildung im<br />
Umgang mit den Pferden), hat dies folglich auch (indirekt) Auswirkungen auf das<br />
Hilfspersonal.<br />
• Physisch-ökologische Rahmenbedingungen: Wie bereits erwähnt, weist die Schweiz<br />
vorteilhafte Bedingungen in Bezug auf die tägliche, dauerhafte oder vorübergehende<br />
Verschiebung vom bisherigen Arbeits- bzw. Wohnort an einen anderen Ort auf (vgl.<br />
Denise Kuonen Seite 73
Unternehmensanalyse der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong><br />
Kapitel 3.1.1.1.5). Gute Mobilitätsvoraussetzungen sind besonders <strong>für</strong> die OPS-<br />
Gehilfen wichtig, da sie Pikettdienst leisten, während dem sie rechtzeitig innert weniger<br />
Minuten in der Pferdeklinik eintreffen müssen, wenn sie z. B. aufgr<strong>und</strong> eines Notfalles<br />
gerufen werden. Eine gute Mobilität ist hier relevant, um den Notfallbetrieb optimal<br />
aufrechterhalten zu können. Wie bereits erwähnt wurde, arbeiten die Wärter <strong>und</strong> die<br />
OPS-Gehilfen im Durchschnitt seit vielen Jahren in der Pferdeklinik. Folglich ist anzu-<br />
nehmen, dass die Mobilitätsbereitschaft des Hilfspersonals gering ist, da sie davon aus-<br />
gehen, dass ihre Stellen langfristig gesichert sind. Diese Haltung wird durch die geringe<br />
Wettbewerbsintensität, in der sich die <strong>Universität</strong> befindet <strong>und</strong> durch die Schwierigkei-<br />
ten bei der Suche nach geeigneten Personen <strong>für</strong> das Hilfspersonal (z. B. kompetente<br />
Aushilfen) bestärkt.<br />
Bei der Darstellung der aufgabenspezifischen Bedingungsgrössen wird auf die Branche ein-<br />
gegangen. Für die Darstellung des öffentlichen Auftrages als Einflussgrösse wird auf das<br />
Kapitel 3.1.1.2.2 verwiesen.<br />
Die Pferdeklinik gehört einerseits als <strong>Universität</strong>sbetrieb zur Branche der Bildungseinrichtun-<br />
gen, andererseits als Tierklinik zur derjenigen der Krankenhäuser (vgl. Tabelle 1). Die Bran-<br />
che wirkt sich insofern auf das Hilfspersonal aus, als dass der Finanznotstand der öffentlichen<br />
Hand einen zunehmenden Kostendruck auf die Pferdeklinik ausüben wird <strong>und</strong> die Pferdekli-<br />
nik dadurch in Zukunft eine hohe medizinische Versorgungsqualität sicherzustellen hat bei<br />
tendenziell gleich bleibenden bzw. sinkenden Kosten (vgl. Kapitel 3.1.1.2.1). Wenn z. B.<br />
Sparmassnahmen der öffentlichen Hand sinkende <strong>Personal</strong>kosten <strong>und</strong> dadurch gestrichene<br />
bzw. nicht ersetzte Stellen in der Pferdeklinik erfordern, hat dies Einfluss auf die Situation des<br />
Hilfspersonals.<br />
Ebenfalls prägt die K<strong>und</strong>enorientierung als Triebkraft des Branchenwettbewerbs das Hilfsper-<br />
sonal, wobei die Besitzer der Pferde den K<strong>und</strong>en entsprechen. Denn die Besitzer sind u. a. an<br />
einer nach den neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen folgenden Therapie <strong>für</strong> ihre Pferde<br />
interessiert, was sich folglich auf die Art <strong>und</strong> Weise der Behandlungen <strong>und</strong> Untersuchungen<br />
der „Patienten“ (künftig aufwändiger werdende Untersuchungs- <strong>und</strong> Behandlungsmethoden<br />
etc.) <strong>und</strong> dadurch auch auf das Hilfspersonal, welches bei den klinischen Tätigkeiten mithilft,<br />
auswirkt. Als weitere Einflussgrösse auf die klinischen Arbeiten des Hilfspersonals kommt<br />
Denise Kuonen Seite 74
Unternehmensanalyse der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong><br />
die Bedrohung durch Ersatzprodukte <strong>und</strong> -dienste (bspw. neue Erkenntnisse bzgl. Operati-<br />
onsmethoden) hinzu.<br />
Auf die anderen Triebkräfte des Branchenwettbewerbs wird nicht weiter eingegangen, da sie<br />
sich hauptsächlich auf die Pferdeklinik <strong>und</strong> nicht so sehr auf das Hilfspersonal auswirken. Die<br />
unter dem Kapitel 3.1.1.2.1 aufgeführten Bedingungsgrössen treffen gr<strong>und</strong>sätzlich auf eine<br />
<strong>Institut</strong>ion wie die Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> zu. Jedoch sollte die wettbewerbsorientierte<br />
Perspektive abgeschwächt werden, da die sich der Wettbewerb nicht so „stark“ auf die Pfer-<br />
deklinik als Dienstleistungsunternehmen auswirkt wie bei anderen Unternehmen, die z. B. in<br />
der Produktion von Gütern tätig sind.<br />
5.1.4.2 Innerbetriebliche Bedingungsgrössen<br />
Bei den betrieblichen Bedingungsgrössen (vgl. Kapitel 3.1.2.1) gilt zu erwähnen, dass v. a.<br />
das Angebot (Dienstleistung) auf das Hilfspersonal einen Einfluss hat. Da die Dienstleistun-<br />
gen der Pferdeklinik (Untersuchungen, Behandlungen, Operationen etc.) durch ihre Ausstat-<br />
tung an Technologie geprägt sind <strong>und</strong> gemäss dem Kapitel 5.1.4.1 das Hilfspersonal durch die<br />
technologischen Rahmenbedingungen beeinflusst ist, hat folglich die Gestaltung der Dienst-<br />
leistungen auch Auswirkungen auf die Tätigkeit des Hilfspersonals, welches bei der klini-<br />
schen Arbeit bekanntlich mithilft. Ebenfalls zu erwähnen ist die Unternehmensgrösse als<br />
Rahmenbedingung, denn ein öffentliches Unternehmen wie die Pferdeklinik sollte pro Jahr<br />
eine entsprechende Anzahl an „Patienten“ aufweisen, damit sowohl die Anlagen als auch das<br />
<strong>Personal</strong> vernünftig ausgelastet sind.<br />
Einen grossen Einfluss auf ein erfolgreiches Wirtschaften der Pferdeklinik haben insbesonde-<br />
re die personellen Bedingungsgrössen. Bei einem Klinikbetrieb hat die Qualität der Füh-<br />
rungskräfte <strong>und</strong> der Mitarbeitenden einen bedeutenden Einfluss auf den Erfolg des Unterneh-<br />
mens. Gemäss Morra (1996: 207) besitzen Ärzte eine besondere Funktion, da sie nicht nur <strong>für</strong><br />
medizinische Fragen verantwortlich sind, sondern auch die Produktivität <strong>und</strong> Wirtschaftlich-<br />
keit der Leistungserstellungsprozesse durch ihre Entscheide steuern. Kompetente Führungs-<br />
kräfte schaffen ein gutes Arbeitsklima <strong>und</strong> motivieren die Mitarbeitenden zu Höchstleistun-<br />
gen, was die relative Wettbewerbsposition des Betriebs verbessert. Die personellen Bedin-<br />
gungsgrössen beeinflussen auch das Hilfspersonal. Sowohl die Wärter als auch die OPS-<br />
Gehilfen sind durch das Führungsverhalten <strong>und</strong> die Entscheidungen der Leitung der Pferde-<br />
klinik beeinflusst.<br />
Denise Kuonen Seite 75
Unternehmensanalyse der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong><br />
In der Fallstudie (Kapitel 5) wird neben der herrschenden Kommunikationspolitik in der Pfer-<br />
deklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong> auch die allgemeine <strong>Personal</strong>situation untersucht. Daher ist v. a.<br />
den personellen Rahmenbedingungen Aufmerksamkeit zu schenken.<br />
Abschliessend ist zu erwähnen, dass sich die Rahmenbedingungen <strong>für</strong> eine öffentliche Institu-<br />
tion wie eine Klinik ständig ändern: sowohl der Kostendruck der Leistungseinkäufer (Staat,<br />
Krankenkassen) <strong>und</strong> -empfänger („Patienten“), der Substitutionsdruck durch andere Leis-<br />
tungsanbieter, der Leistungsdruck durch Inputfaktoren (Mitarbeitende <strong>und</strong> der medizinische<br />
Fortschritt), als auch der Veränderungsdruck durch neue Markteintritte (neue Anbieter <strong>und</strong><br />
dadurch erhöhte Angebotskapazitäten) sowie der Rivalitätsdruck durch die Marktreife (lang-<br />
sames Marktwachstum <strong>und</strong> somit stärkerer Wettbewerb) führen dazu, dass strukturelle An-<br />
passungen <strong>und</strong> Konzentrationsprozesse im Ges<strong>und</strong>heitswesen ausgelöst werden (vgl. Morra<br />
1996: 57 ff.). Solche Änderungen <strong>für</strong> die Pferdeklinik wirken sich folglich auch auf das Hilfs-<br />
personal aus.<br />
5.2 Unternehmensanalyse der Pferdeklinik der<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong><br />
5.2.1 Problemstellung<br />
Die Problemstellung wurde bereits im Kapitel 1.1 dargelegt. Sie besteht insbesondere in der<br />
allgemeinen Unzufriedenheit des Hilfspersonals über die herrschenden Arbeitsbedingungen in<br />
der Pferdeklinik, v. a. über den <strong>Personal</strong>mangel. Die Analyse der Pferdeklinik bzw. der Berei-<br />
che allgemeine Situation, Arbeitsprozesse <strong>und</strong> interne Kommunikation beim Hilfspersonal der<br />
Pferdeklinik bildet den Gegenstand der vorliegenden Fallstudie. Aufgr<strong>und</strong> der problemzent-<br />
rierten Interviews sollen die aktuelle Situation <strong>und</strong> die Bedürfnisse des Hilfspersonals ermit-<br />
telt werden. Anschliessend werden darauf Änderungen in Form von Gestaltungsempfehlun-<br />
gen formuliert, damit die bestehende Situation verbessert <strong>und</strong> die anfallenden Arbeiten in Zu-<br />
kunft wieder effizient erledigt werden können. Ferner soll dem Leser anhand dieses Fallbei-<br />
spiels die Unternehmensanalyse in einem öffentlichen Betrieb vorgestellt werden.<br />
Denise Kuonen Seite 76
Unternehmensanalyse der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong><br />
5.2.2 Spezifische Ausgangslage<br />
Die spezifische Ausgangslage wird anhand der Gespräche <strong>und</strong> der Beobachtungen, die die<br />
Verfasserin in der Pferdeklinik während ihrer mehrmaligen Besuche gemacht hat <strong>und</strong> der<br />
Auswertung der Interviews, dargestellt. Da die Analyse in der Pferdeklinik während der Mo-<br />
nate Juni <strong>und</strong> Juli 2004 gemacht wurde, beziehen sich die Resultate der Untersuchungen so-<br />
wie die Gestaltungsempfehlungen (Kapitel 6.2) auf die Situation bevor Herr Baumgartner an-<br />
gestellt wurde. D. h., es handelte sich beim Hilfspersonal um vier OPS-Gehilfen, fünf Wärter<br />
mit einem Arbeitspensum von je 100 %, die gemäss des Dienstplanes (Turnus) arbeiteten, <strong>und</strong><br />
zwei Wärter mit einem Arbeitspensum von je 50 %, die nicht im Turnus arbeiteten.<br />
5.2.2.1 Einleitung<br />
In der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong> werden – wie oben bereits erwähnt – im Jahr durch-<br />
schnittlich 1820 Tiere <strong>für</strong> Untersuchungen <strong>und</strong> Operationen eingeliefert. Da ein Grossteil der<br />
behandelten Pferde hospitalisiert bleibt, fallen neben der Untersuchung, der Operation <strong>und</strong> ei-<br />
ner eventuellen Nachbehandlung auch noch die Pflege der Pferde sowie die Fütterung <strong>und</strong> das<br />
Misten an. Gelegentlich sind auch Schmiede- <strong>und</strong> gewisse Unterhaltsarbeiten im Stall zu erle-<br />
digen. Für diese Arbeiten <strong>und</strong> die Mithilfe bei den medizinischen Tätigkeiten sind Wärter an-<br />
gestellt. Für die Arbeiten r<strong>und</strong> um Operationen wie Medikamente auffüllen, OPS-Raum vor-<br />
bereiten, Instrumente bereitstellen etc. sind die OPS-Gehilfen zuständig.<br />
Während Jahren handelte es sich beim Hilfspersonal um neun Wärter <strong>und</strong> fünf OPS-Gehilfen.<br />
Inzwischen sank deren Zahl auf fünf Vollzeitstellen <strong>und</strong> zwei 50 %-Stellen bei den Wärtern<br />
<strong>und</strong> auf vier bei den OPS-Gehilfen, wo<strong>für</strong> Sparmassnahmen wie auch Umstrukturierungen<br />
verantwortlich sind. Bei diesem Bestand kann die Arbeit insofern erledigt werden, als dass die<br />
Ansprüche an die Qualität der Arbeit verringert wurden. Bei einem solchen <strong>Personal</strong>bestand<br />
werden nun massive Engpässe konstatiert.<br />
5.2.2.2 Allgemeine Situation<br />
Die meisten der befragten Mitarbeitenden arbeiten seit über zehn Jahren in der Pferdeklinik.<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich macht der Mehrheit der Befragten die Arbeit an sich Spass, da sie sehr selbst-<br />
ständig arbeiten können. Jedoch sind sie mit dem Umfeld nicht mehr vollständig zufrieden.<br />
Alle Interviewpartner sind der Meinung, dass sich das Betriebsklima in den letzten Jahren<br />
stark verschlechtert hat. Hauptgründe sehen sie zum einen darin, dass es keine Führung des<br />
Denise Kuonen Seite 77
Unternehmensanalyse der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong><br />
Betriebes mehr gibt, zum anderen, dass sich die allgemeine Situation aufgr<strong>und</strong> des <strong>Personal</strong>-<br />
mangels <strong>und</strong> der häufigen Präsenzzeiten in der Pferdeklinik verschlechtert hat, was die An-<br />
spannung jedes einzelnen fördert. Letzteres wird bei den Wärtern v. a. durch die zu leistenden<br />
Wochenendendienste verstärkt. Dies ist neben dem <strong>Personal</strong>mangel eines der Hauptprobleme<br />
der Wärter. Da die Wärter nur noch fünf Personen sind, die in den Dienstplan einbezogen<br />
werden können, häufen sich die zu leistenden Nacht- <strong>und</strong> Wochenenddienste: Die Wärter<br />
müssen aufgr<strong>und</strong> des <strong>Personal</strong>mangels <strong>und</strong> des 5-Wochenturnus (vgl. Kapitel 5.2.2.4.1) an<br />
drei aufeinander folgenden Wochenenden von fünf arbeiten. Darunter leiden die Familien <strong>und</strong><br />
die Fre<strong>und</strong>schaften stark. Es häufen sich auch die Nachtdienste, nämlich ein Nachtdienst (an<br />
sieben aufeinander folgenden Nächten) pro fünf Wochen (im Vergleich zu früher arbeiteten<br />
sie einen Nachtdienst pro acht Wochen). Zudem ist es schwierig geworden, Ferien zu neh-<br />
men. Alle befragten Wärter sind der Meinung, dass sie nicht problemlos ihre Ferien beziehen<br />
können, da sie immer auf den Turnus <strong>und</strong> den Dienst ihrer Kollegen achten müssen. Es ist so-<br />
gar vorgekommen, dass einzelne Wärter in ihren Ferien während eines Wochenendes ein-<br />
springen mussten, um den reibungslosen Ablauf in der Pferdeklinik aufrechterhalten zu kön-<br />
nen. Mit nur fünf Personen im Turnus gibt es kaum noch Möglichkeiten zum Verschieben<br />
<strong>und</strong> Abtauschen der Dienste untereinander. Besonders in der Ferienzeit von Juni bis Oktober<br />
wird es schwierig, Dienste zu tauschen, um bspw. Überzeit zu kompensieren, da immer je-<br />
mand abwesend ist. Ähnlich sieht die Situation bei den OPS-Gehilfen aus, die aufgr<strong>und</strong> der<br />
reduzierten Anzahl an OPS-Gehilfen ca. jeden dritten Tag Pikettdienst während der Nacht<br />
leisten müssen. Wenn sie in der Nacht z. B. gegen 3.00 Uhr gerufen werden, um bei einem<br />
notfallmässig zu operierenden Tier zu assistieren <strong>und</strong> diese Operation sich bis in die Morgen-<br />
st<strong>und</strong>en des folgenden Tages hinzieht, dann müssen die OPS-Gehilfen gleichwohl am selben<br />
Tag um 7.45 Uhr zur Arbeit erscheinen <strong>und</strong> haben erst wieder um 17.45 Uhr Feierabend. Dies<br />
geht besonders bei zwei der vier OPS-Gehilfen, die über 60 Jahre alt sind, nicht spurlos vor-<br />
bei. Wenn entweder ein OPS-Gehilfe oder ein Wärter krank werden würde, insbesondere<br />
während der Zeit von Juni bis Oktober, dann „sind wir am Anschlag“ so Interviewpartner 4.<br />
Zusätzlich gilt zu erwähnen, dass alle ausser einem Wärter über ges<strong>und</strong>heitliche Probleme<br />
klagen. Wenn ein Wärter oder ein OPS-Gehilfe <strong>für</strong> längere Zeit z. B. aufgr<strong>und</strong> einer Operati-<br />
on ausfällt, ist es sehr schwierig, eine geeignete Aushilfe zu finden. Oft werden das Know-<br />
how <strong>und</strong> die Risiken, die mit der Arbeit mit Pferden verb<strong>und</strong>en sind, unterschätzt <strong>und</strong> es ge-<br />
schehen leicht Unfälle.<br />
Denise Kuonen Seite 78
Unternehmensanalyse der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong><br />
Alle der Befragten finden, dass sowohl unter den Wärtern wie auch unter den OPS-Gehilfen<br />
kaum Fre<strong>und</strong>schaften bestehen. Interviewpartner 5 findet, dass jeder nur noch <strong>für</strong> sich schaut.<br />
Von Mobbing könne man jedoch nicht sprechen. Besonders, wenn es darum geht, Dienste<br />
miteinander zu tauschen, könne man es sich nicht erlauben, einen anderen zu attackieren ge-<br />
mäss Interviewpartner 2. Interviewpartner 4 meint, dass das Verhältnis unter den Mitarbeiten-<br />
den nicht extrem unkollegial sei, aber es könnte kollegialer sein.<br />
Das Verhältnis zu den Vorgesetzten (Herren Ueltschi, Meier, Deiss, Brehm <strong>und</strong> Glauser) wird<br />
von der Mehrheit der Wärter <strong>und</strong> von allen OPS-Gehilfen als gut eingestuft. Alle Befragten<br />
fühlen sich jedoch durch K<strong>und</strong>tun ihrer Probleme beim Leiter der Pferdeklinik nicht ernst ge-<br />
nommen, da sich bisher an der bestehenden Situation nichts geändert hat. Sie sehen in ihm<br />
keine Ansprechperson, die sich <strong>für</strong> ihre Anliegen <strong>und</strong> Probleme einsetzt. Dementsprechend<br />
fehlt eine Führung, die durchgreift <strong>und</strong> die Leute zusammenruft, um über aktuelle Probleme<br />
zu sprechen. „Ein Vorbild von oben fehlt“, so Interviewpartner 5. Ebenfalls fördere der Leiter<br />
der Pferdeklinik mit seinem Verhalten gemäss Interviewpartner 3 die Motivation der Mitar-<br />
beitenden nicht. „Er ist nicht der Mann, der mit dem <strong>Personal</strong> über Probleme diskutiert. Er<br />
wird als Radiologe sehr anerkannt, aber nicht als Chef der Pferdeklinik“, sagt Interviewpart-<br />
ner 5.<br />
5.2.2.3 Interne Kommunikation<br />
Die Kommunikation unter dem Hilfspersonal wird von vier der sechs Befragten als gut be-<br />
zeichnet. „Es wird auch über private Angelegenheiten gesprochen“, so Interviewpartner 6.<br />
Zwei der Interviewten sind der Meinung, dass nur das Nötigste miteinander gesprochen wird.<br />
Was die Kommunikation mit den Vorgesetzten (Herr Ueltschi, Herr Meier) betrifft, gibt es<br />
viele Unzufriedenheiten. Sowohl die Wärter als auch die OPS-Gehilfen wünschten sich be-<br />
reits mehrfach in der Vergangenheit regelmässige Sitzungen, bei denen u. a. die Oberassisten-<br />
ten, die Assistenten, Herr Ueltschi, Herr Meier <strong>und</strong> das Hilfspersonal anwesend sein sollten,<br />
um über die aktuellen Geschehnisse, Probleme <strong>und</strong> Anliegen zu sprechen. Diese Sitzungen<br />
fanden wenige Male statt, wurden aber dann gestrichen. Die Wärter haben diesen Wunsch<br />
mehrmals geäussert, sowohl bei Herrn Meier als auch bei Herrn Ueltschi, „[…] aber gesche-<br />
hen ist nichts“, sagt Interviewpartner 3. Alle Befragten finden die (v. a. zwischenmenschliche)<br />
Kommunikation mit der Führung <strong>und</strong> die Information über die allgemeinen Belange der Pfer-<br />
deklinik ungenügend. So wird das Hilfspersonal z. B. über neue Mitarbeitende <strong>und</strong> deren An-<br />
stellung weder durch Herrn Meier noch durch Herrn Ueltschi ausreichend informiert. Neue<br />
Denise Kuonen Seite 79
Unternehmensanalyse der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong><br />
Assistenten, Praktikanten, Aushilfen etc. werden dem <strong>Personal</strong> oft nicht vorgestellt. „Über<br />
Änderungen in der Klinik werden wir häufig durch Drittpersonen oder durch kursierende Ge-<br />
rüchte informiert. Die Kommunikation von oben ist gleich null“, meint Interviewpartner 2.<br />
Spezifisches, die Tätigkeit des Hilfspersonals direkt betreffend, wird ausreichend kommuni-<br />
ziert. Diesbezüglich sind sich alle sechs Befragten einig. Oft holen sich die Diensthabenden<br />
die benötigten Informationen direkt bei den Assistenten oder bei den Oberassistenten. Die<br />
Qualität der Arbeit leidet nur teilweise durch mangelnde spezifische Kommunikation <strong>und</strong> In-<br />
formation. Bei den Wärtern zeigt sich dies insbesondere dann, wenn sie sich bei den Assisten-<br />
ten selber informieren müssen bspw. über die Spezialfütterung eines Tieres, weil die Assisten-<br />
ten ungenaue oder keine Angaben darüber gemacht haben (keine Schilder über die Spezialfüt-<br />
terung eines Pferdes, die an der Box befestigt sein sollten). Die Qualität der Arbeit ist insofern<br />
beeinträchtigt, als dass die Wärter durch das Nachfragen bei den Assistenten bei ihrer Tätig-<br />
keit noch mehr zeitlich eingeschränkt werden. Bei den OPS-Gehilfen zeigt sich die beein-<br />
trächtigte Arbeitsqualität durch bspw. ungenügende Kommunikation mit den Oberassistenten<br />
<strong>und</strong> Assistenten bei fehlenden Anweisungen über die Instrumente, die <strong>für</strong> eine bestimmte<br />
Operation gebraucht werden <strong>und</strong> welche die OPS-Gehilfen dann während der Operation holen<br />
müssen.<br />
Ferner sind sich die Befragten ebenfalls darüber einig, dass die Informationsweitergabe beim<br />
Dienstwechsel zufrieden stellend funktioniert. Wenn sich etwas Wichtiges während der Nacht<br />
oder während des Tages ereignet hat, schreiben sich die Wärter Zettel, die sich auf den Tisch<br />
im Aufenthaltsraum legen, damit der nachfolgende Wärter darüber Bescheid weiss (z. B.<br />
wenn ein Tier bei der Fütterung speziell behandelt werden muss). Wenn etwas Besonderes in<br />
der Nacht geschieht, informiert der OPS-Helfende, der am Vorabend Pikettdienst leisten<br />
musste, die anderen am darauf folgenden Tag.<br />
In der Pferdeklinik werden u. a. folgende Instrumente der internen Kommunikation einge-<br />
setzt: Informationstafeln, Anschlagbrett, Betriebsausflüge <strong>und</strong> -feste. Bei den Ausflügen <strong>und</strong><br />
Feiern nehmen jedoch häufig wenig Personen teil, da die letzten Feste kurzfristig oder<br />
schlecht organisiert waren oder zuletzt überhaupt nicht stattgef<strong>und</strong>en haben (z. B. wurde die<br />
Weihnachtsfeier 2003 abgesagt). Diesbezüglich gibt es auch Reibereien unter dem Hilfsper-<br />
sonal, wenn es darum geht abzuklären, wer Dienst leisten muss an dem jeweiligen Tag <strong>und</strong><br />
wer am Fest teilnehmen kann. Des Weiteren werden einmal pro Jahr Mitarbeitergespräche ge-<br />
Denise Kuonen Seite 80
Unternehmensanalyse der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong><br />
führt. Mit den OPS-Gehilfen führen die Herren Brehm <strong>und</strong> Deiss diese Gespräche. Dies funk-<br />
tioniert gemäss der Befragten gut. Mit den Wärtern führt Herr Meier die Mitarbeitergesprä-<br />
che. Die Mehrheit der Befragten fühlt sich jedoch dabei nicht ernst genommen <strong>und</strong> glaubt<br />
nicht daran, dass – wie weiter oben bereits erwähnt wurde – durch K<strong>und</strong>tun ihrer Anliegen<br />
etwas an der bestehenden Situation geändert wird, da sie schon in der Vergangenheit auf<br />
Missstände hingewiesen haben, jedoch auf kein Gehör (v. a. seitens der Klinikleitung) gestos-<br />
sen sind. Nur wenige Personen des Hilfspersonals verfügen über ein E-Mail-Konto. Folglich<br />
wird dieses Instrument der internen Kommunikation zwar genutzt, jedoch nur sehr wenig.<br />
5.2.2.4 Dienste <strong>und</strong> Arbeitsprozesse<br />
Zuerst werden die verschiedenen Dienste <strong>und</strong> Arbeitsprozesse der Wärter, dann die der OPS-<br />
Gehilfen beschrieben. Anschliessend folgt die Darstellung der vorhandenen Probleme bei den<br />
Abläufen anhand der Auswertung der problemzentrierten Interviews <strong>und</strong> der Beobachtungen,<br />
die die Verfasserin während des Besuchs in der Pferdeklinik gemacht hat.<br />
5.2.2.4.1 Pflegedienst <strong>und</strong> Arbeitsprozesse der Wärter<br />
Pflegedienst:<br />
Der Pflegedienst der Wärter ist aufgeteilt in Tages-, Spät-, Nacht- <strong>und</strong> Wochenenddienst. Die<br />
unterschiedlichen Dienste sind im Dienstplan (Turnus) abgebildet:<br />
Denise Kuonen Seite 81
Unternehmensanalyse der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong><br />
Montag<br />
Dienstag<br />
Mittwoch<br />
Donnerstag<br />
Freitag<br />
Samstag<br />
Sonnstag<br />
Woche 1 2 3 4 5 6 7 8<br />
St<strong>und</strong>en 49 37.5 33 39 49.5 36 46 46<br />
Vormittag<br />
Nachmittag<br />
7<br />
frei<br />
4.75<br />
3.5<br />
5.25<br />
4.5<br />
frei<br />
4.75<br />
3.5<br />
4.75<br />
3.5<br />
4.75<br />
3.5<br />
Vormittag<br />
Nachmittag<br />
7<br />
frei<br />
4.75<br />
3.5<br />
5.25<br />
4.5<br />
4.75<br />
3.5<br />
4.75<br />
3.5<br />
4.75<br />
3.5<br />
4.75<br />
3.5<br />
Vormittag<br />
Nachmittag<br />
7<br />
frei<br />
4.75<br />
3.5<br />
5.25<br />
4.5<br />
4.75<br />
3.5<br />
4.75<br />
1.75<br />
4.75<br />
3.5<br />
4.75<br />
3.5<br />
Vormittag<br />
Nachmittag<br />
7 4.75<br />
3.5<br />
4.75<br />
3.5<br />
5.25<br />
4.5<br />
4.75<br />
3.5<br />
frei<br />
4.75<br />
3.5<br />
4.75<br />
3.5<br />
Vormittag<br />
Nachmittag<br />
7 5.25<br />
4.5<br />
frei frei<br />
4.75<br />
3.5<br />
4.75<br />
3.5<br />
4.75<br />
3.5<br />
4.75<br />
3.5<br />
Vormittag<br />
Nachmittag<br />
7 5.25<br />
4.5<br />
frei frei<br />
4.75<br />
3.5<br />
4.75<br />
frei<br />
4.75<br />
frei<br />
4.75<br />
frei<br />
Vormittag<br />
Nachmittag<br />
7 5.25<br />
4.5<br />
frei frei<br />
4.75<br />
3.5<br />
frei frei frei<br />
Die erste Woche ist der Nachtdienst.<br />
Die zweite Woche entspricht dem Sonntags-Spätdienst.<br />
Die dritte Woche wird Kompensationsdienst genannt.<br />
Die vierte Woche ist der Spätdienst mit dem grossen Wochenende.<br />
Die fünfte Woche entpricht dem normalen Sonntagsdienst.<br />
Die sechste Woche ist der Kompensationsdienst.<br />
Die siebte Woche heisst normaler Dienst.<br />
Die achte Woche heisst normaler Dienst.<br />
Abbildung 20: Dienstplan der Wärter im 8-Wochenturnus (eigene Darstellung).<br />
Der Dienst eines Wärters beginnt in der Woche 1 <strong>und</strong> hört in der Woche 5 auf. Danach be-<br />
ginnt er wieder in der Woche 1 <strong>und</strong> fährt nicht mit dem Dienst der Woche 6 weiter, da es nur<br />
fünf Wärter sind, die in diesen Turnus einbezogen werden können, nämlich: Herr Gäumann,<br />
Herr Glauser, Herr Kindler, Herr Meerstetter <strong>und</strong> Herr Stucki. Herr Schick wird nicht mehr in<br />
den Turnus einbezogen, da er aufgr<strong>und</strong> ges<strong>und</strong>heitlicher Probleme nicht mehr als 50 % arbei-<br />
ten darf (ärztliches Zeugnis). Er arbeitet folglich nur noch morgens (Montag bis Freitag). Frau<br />
Schmutz arbeitet die anderen 50 % (jeweils am Nachmittag von Montag bis Freitag) <strong>und</strong> ist<br />
neben der Pferdeklinik zu weiteren 50 % in der Nutztierklinik angestellt, wodurch sie auch<br />
nicht in den Turnus einbezogen werden kann. Somit sind es – wie bereits erwähnt – nur fünf<br />
Personen, die in diesem Turnus arbeiten <strong>und</strong> die Nacht- <strong>und</strong> Wochenenddienst leisten können.<br />
Dementsprechend ist die Zahl der zu arbeitenden Wochenenden sehr hoch. Die Wärter arbei-<br />
Denise Kuonen Seite 82
Unternehmensanalyse der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong><br />
ten an drei aufeinander folgenden Wochenenden von fünf: das erste in der Woche 5, das zwei-<br />
te in der Woche 1 während der Nacht <strong>und</strong> das dritte in der Woche 2. Dies ist u. a. einer der<br />
Hauptgründe der Unzufriedenheit der Wärter. Denn durch die häufigen Wochenenddienste<br />
leiden die Familien <strong>und</strong> es ist schwierig, Fre<strong>und</strong>schaften zu pflegen.<br />
Die verschiedenen Dienste werden nachfolgend beschrieben:<br />
• Tagesdienst: Die tägliche Arbeitszeit dauert von 6.45 Uhr bis 11.30 Uhr <strong>und</strong> von 13.30<br />
Uhr bis 17.00 Uhr. Meistens sind zwischen drei <strong>und</strong> vier Wärter anwesend. Benötigter<br />
Pflegedienst bei allfälligen Notfällen über Mittag wird von den Wärtern, die über Mittag<br />
in der Klinik bleiben, betreut, wobei dies nicht klar geregelt ist. Arbeitet ein Wärter län-<br />
ger als bis zu diesen Zeiten, wird die zusätzlich gearbeitete Zeit als Überzeit aufge-<br />
schrieben <strong>und</strong> kann später kompensiert werden.<br />
• Spätdienst: Ein Wärter, der dem Spätdienst zugeteilt ist, arbeitet zusätzlich neben der<br />
gearbeiteten Zeit des Tagesdienstes noch von 11.30 Uhr bis 12.00 Uhr <strong>und</strong> von 17.00<br />
Uhr bis 18.00 Uhr. Arbeitet der Wärter länger, wird die zuviel gearbeitete Zeit als Über-<br />
zeit aufgeschrieben <strong>und</strong> kann später kompensiert werden.<br />
• Nachtdienst (Notfalldienst): Der Nachtdienst wird an sieben aufeinander folgenden<br />
Nächten geleistet. Der Nachtdienst dauert von 18.00 Uhr bis am nächsten Morgen um<br />
6.00 Uhr. Während der Zeit von 22.00 Uhr bis 3.00 Uhr kann der Wärter schlafen.<br />
Wenn es während dieser Zeit einen Notfall gibt, hilft der Wärter <strong>und</strong> kann diese Stun-<br />
den aufschreiben, die später kompensiert werden können.<br />
• Wochenenddienst: Am Wochenende wird der Pflegedienst in der Pferdeklinik tagsüber<br />
durch zwei Wärter abgedeckt, die gemäss des Tagesdienstes arbeiten. Einer davon leis-<br />
tet zusätzlich den Spätdienst. Ab 18.00 Uhr übernimmt dann wieder der Nachtwärter<br />
den Dienst.<br />
Arbeitsprozesse:<br />
Zuerst werden die Arbeitsprozesse des Tagesdienstes <strong>und</strong> des Spätdienstes beschrieben. An-<br />
schliessend folgen die Abläufe während der Nacht (Nachtdienst) <strong>und</strong> am Wochenende (Wo-<br />
chenenddienst):<br />
Tages- <strong>und</strong> Spätdienst:<br />
Die Wärter des Tagesdienstes <strong>und</strong> derjenige Wärter, der dem Spätdienst zugeteilt ist, treffen<br />
sich um 6.45 Uhr vor dem Aufenthaltsraum. Beim Tagesdienst unter der Woche sind meist<br />
Denise Kuonen Seite 83
Unternehmensanalyse der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong><br />
vier Wärter anwesend. Die Wärter teilen sich auf die Ställe auf, um die Boxen zu misten. Ei-<br />
ner der Wärter (meistens derjenige, dem Stall Nr. 3 zugeteilt worden ist) bereitet vor dem<br />
Misten noch das Futter vor <strong>und</strong> füttert danach alle Tiere. Dieser ist während des ganzen Tages<br />
<strong>für</strong> die Fütterung verantwortlich. Wenn er mit der Fütterung fertig ist, beginnt auch er, seinen<br />
zugewiesenen Stall (Stall Nr. 3) zu putzen <strong>und</strong> sich um die Pferde zu kümmern. Beim Misten<br />
werden die Kotäpfel <strong>und</strong> die nasse Einstreue entfernt <strong>und</strong> auf einem Mistwagen gesammelt.<br />
Dann verteilt der Wärter neue Einstreue (Stroh, Tierwohl oder Anipelli) in der Box <strong>und</strong> gibt<br />
dem Tier frisches Heu <strong>und</strong> Wasser. Gleichzeitig wird die Temperatur jedes Pferdes gemessen<br />
<strong>und</strong> in der Liste, die an der jeweiligen Box befestigt ist, eingetragen, damit die Assistenten<br />
diese Information bei ihrer Visite mit den Oberassistenten <strong>und</strong> den Professoren um 8.00 Uhr<br />
einsehen können. Dann wird jedes Tier geputzt. Bei grosser Arbeitslast, z. B. wenn ein Notfall<br />
eintrifft, reicht es oftmals nicht, jedes Tier gründlich zu pflegen. Beim Putzen des Tieres<br />
kratzt der Wärter den Dreck aus den Hufen <strong>und</strong> bürstet das Fell. Dann wischt der Wärter den<br />
Flur des Stalles. Sind die Mistwagen (sie befinden sich in jedem Stall) nach dem Misten voll,<br />
werden sie entleert. Aufgr<strong>und</strong> des Abnehmers existieren da<strong>für</strong> zwei Misthaufen: einer <strong>für</strong> den<br />
Strohmist (Stroh <strong>und</strong> Anipelli, beides Einstreue aus Stroh) <strong>und</strong> der andere <strong>für</strong> den Tierwohl-<br />
mist (Einstreue aus Holz). In einigen Ställen gibt es einen kleinen Untersuchungsraum. Dieser<br />
wird morgens ebenfalls gründlich mit Wasser <strong>und</strong> Desinfektionsmittel gereinigt. Wenn ein<br />
Wärter früher fertig ist, hilft er dem anderen beim Misten. Nach dem Misten treffen sich die<br />
Wärter im Aufenthaltsraum <strong>und</strong> machen eine Pause bis 9.00 Uhr. Die Wärter teilen sich dann<br />
auf die Abteilungen der Inneren Medizin bzw. der Chirurgie auf, d. h. sie helfen während des<br />
Tages der jeweiligen Abteilung bei der klinischen Arbeit. Um 9.00 Uhr kommen die Assisten-<br />
ten <strong>und</strong> Oberassistenten <strong>und</strong> die Professoren der jeweiligen Abteilungen von der morgendli-<br />
chen Visite zurück, während der sie den Tagesplan (beinhaltet die zu untersuchenden Pferde)<br />
erstellt haben. Die Wärter warten auf die Assistenten <strong>und</strong> ihre Anweisungen. Um sich auf den<br />
Tag vorzubereiten, orientiert sich jeder Wärter an den Tafeln, die in der Halle der Chirurgie<br />
befestigt sind. Auf denen steht geschrieben, was <strong>für</strong> Operationen <strong>und</strong> Untersuchungen zu wel-<br />
cher Zeit anstehen. Jeder Wärter erhält anschliessend den Auftrag, ein bestimmtes Tier aus<br />
der Box zu holen, um es von den Oberassistenten <strong>und</strong> Assistenten untersuchen zu lassen.<br />
Innere Medizin:<br />
Wenn ein Pferd durch einen Assistenten der Inneren Medizin untersucht wird, muss der Wär-<br />
ter das Tier während der Untersuchung <strong>und</strong> Behandlung, z. B. bei Koliken, halten <strong>und</strong> gege-<br />
benenfalls beruhigen.<br />
Denise Kuonen Seite 84
Unternehmensanalyse der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong><br />
Chirurgie:<br />
Die Chirurgen führen v. a. Operationen oder Szintigraphien mit der Radiologie bzw. der Ab-<br />
teilung „Bildgebende Verfahren“ (dabei wird ein radioaktives Mittel in den Körper gegeben,<br />
um u. a. erhöhte Aktivität zu erkennen) durch <strong>und</strong> untersuchen ein Tier z. B. auf gebrochene<br />
Knochen, auf Lahmheit etc. Der Wärter hilft bei der medizinischen Behandlung ebenfalls mit.<br />
Wenn ein Tier operiert oder szintigraphiert werden soll <strong>und</strong> deswegen eine Narkose erhält,<br />
hilft der Wärter beim Legen des Tieres auf den Operationstisch (vgl. Prozesse bei OPS-<br />
Gehilfen). Bis das Tier <strong>für</strong> die Operation bereit liegt, dauert es ca. 30-40 Minuten. Während<br />
dieser Zeit „fehlt“ der Wärter, um den anderen Oberassistenten oder Assistenten bei der Un-<br />
tersuchung der Pferde zur Verfügung zu stehen. Während der Operation ist der Wärter nicht<br />
anwesend. Der Wärter kommt erst wieder zurück, um das Tier vom Operationstisch in den<br />
Aufwachraum zu bringen. Beim Aufwachen ist neben dem Wärter (oder einem OPS-<br />
Gehilfen) ein Anästhesist anwesend.<br />
Nach der Untersuchung bringt der Wärter das Tier wieder zurück in die Box <strong>und</strong> hilft an-<br />
schliessend bei der weiteren Behandlung des nächsten Patienten. Wenn keine Operationen<br />
<strong>und</strong> Untersuchungen anstehen, kann der Wärter anderen Tätigkeiten nachgehen, die sonst oft<br />
zu kurz kommen wie z. B. den Hof wischen, die Boxen gründlich reinigen, die Tiere bürsten<br />
<strong>und</strong> putzen, die Strohvorräte in den Ställen auffüllen etc. Ab <strong>und</strong> zu erk<strong>und</strong>igt sich der Wärter<br />
bei den Assistenten <strong>und</strong> den anderen Wärtern, ob sie Hilfe benötigen oder er wird von ihnen<br />
selbst gerufen. Wenn ein Notfall eintrifft, wird als erstes der Notfall behandelt. Die anderen<br />
anstehenden Arbeiten können – wenn überhaupt – erst nach dem Notfall erledigt werden.<br />
Um 11.00 Uhr werden die Tiere wieder gefüttert. Jeder Wärter läuft vor 11.30 Uhr nochmals<br />
durch die Boxen, um die Kotäpfel herauszunehmen. Um 11.30 Uhr gehen die Wärter in die<br />
Mittagspause ausser demjenigen, der Spätdienst hat. Dieser bleibt nämlich bis um 12.00 Uhr<br />
(oder noch länger) da <strong>und</strong> hilft, wenn z. B. Notfälle eintreffen.<br />
Um 13.30 Uhr beginnt die Arbeit wieder. Die Wärter misten die Boxen <strong>und</strong> geben frisches<br />
Heu zum Fressen. Ab 14.00 Uhr helfen die Wärter erneut den Assistenten bei der Arbeit.<br />
Meistens werden am Nachmittag auch einige Pferde beschlagen. Dabei muss ein Wärter dem<br />
Hufschmied helfen, um die Beine hoch zu heben <strong>und</strong> das Tier zu halten. Aus Sicherheits- <strong>und</strong><br />
Ges<strong>und</strong>heitsgründen beschlägt ein Hufschmied das Tier nicht alleine, sondern immer in An-<br />
wesenheit eines Wärters. Für das Beschlagen eines Tieres braucht der Hufschmied zwischen<br />
Denise Kuonen Seite 85
Unternehmensanalyse der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong><br />
90 <strong>und</strong> 120 Minuten, je nach Spezialbeschlag. Während dieser Zeit „fehlt“ der helfende Wär-<br />
ter wiederum, um den Assistenten zur Verfügung zu stehen. Engpässe entstehen dann, wenn<br />
z. B. zur selben Zeit ein anderes Tier operiert <strong>und</strong> da<strong>für</strong> narkotisiert werden muss, da von den<br />
vier Wärtern, die z. B. am Nachmittag Dienst haben, einer bis zwei folglich mit Hufenbe-<br />
schlagen beschäftigt sind, einer beim Ablegen des zu operierenden Tieres behilflich ist <strong>und</strong><br />
der vierte gleichzeitig den Assistenten der beiden Abteilungen zur Verfügung stehen sollte.<br />
Ungefähr gegen 16.00 Uhr wird wieder das Futter zubereitet <strong>und</strong> verteilt. Um 16.30 Uhr<br />
durchlaufen die Wärter dann zum letzten Mal die Ställe, um nasses Stroh <strong>und</strong> Kotäpfel aus<br />
den Boxen zu entfernen. Dann wischt jeder Wärter noch seinen Stall, damit dieser sauber dem<br />
Nachtwärter überlassen werden kann. Anschliessend verlässt er die Klinik. Derjenige, der <strong>für</strong><br />
den Spätdienst eingeteilt ist, bleibt noch bis 18.00 Uhr da. Er mistet <strong>und</strong> hilft den Assistenten,<br />
wenn z. B. ein Notfall eintrifft usw. Um 18.00 Uhr beginnt der Nachtwärter mit seinem<br />
Dienst.<br />
Es ist zu erwähnen, dass nicht jeder Tag gleich abläuft. Jedes Tier ist aus einem anderen<br />
Gr<strong>und</strong> in der Klinik <strong>und</strong> reagiert in einem ihm fremden Umfeld (<strong>und</strong> unter Schmerzen) an-<br />
ders. Zudem kann immer ein Notfall dazwischen kommen, der den ganzen Tagesablauf ändert<br />
bzw. durcheinander bringt.<br />
Nachtdienst:<br />
Der Nachtdienst dauert an sieben aufeinander folgenden Tagen. Der Nachtwärter beginnt je-<br />
weils um 18.00 Uhr seinen Dienst. Als erstes erk<strong>und</strong>igt er sich bei den Dienst habenden As-<br />
sistenten, was sich während des Tages ereignet hat <strong>und</strong> ob bereits Notfälle angemeldet sind<br />
<strong>für</strong> den Abend. Anschliessend beginnt er mit dem Stalldurchgang (misten, putzen der Tiere<br />
etc.). Wenn der Wärter gerufen wird, z. B. um einen Notfall zu behandeln, stoppt er mit der<br />
Stallarbeit <strong>und</strong> hilft dem entsprechenden Assistenten bei der Untersuchung des Pferdes. Wenn<br />
ein Tier operiert werden muss, ist der Wärter bis zum Niederlegen des Pferdes auf den Opera-<br />
tionstisch anwesend. Ebenfalls beim Aufwachen des Tieres, gleich wie während des Tages-<br />
dienstes. Danach kann sich der Wärter wieder den Stallarbeiten widmen. Der Wärter arbeitet<br />
bis um 22.00 Uhr. Danach schläft er im Zimmer des Aufenthaltsraumes der Wärter bis 3.00<br />
Uhr, d. h., wenn keine Notfälle eintreffen. Schlafen ist jedoch häufig nicht möglich, u. a. auf-<br />
gr<strong>und</strong> des Lärmes der Kolikpatienten, die ihre Boxen neben dem Aufenthaltsraum der Wärter<br />
haben. Oft wird der Wärter auch wegen des technischen Alarms geweckt. Wenn dieser Alarm<br />
Denise Kuonen Seite 86
Unternehmensanalyse der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong><br />
losgeht, muss der Wärter die entsprechenden Personen alarmieren <strong>und</strong> das Klingeln des<br />
Alarms ausschalten. Um 3.00 Uhr beginnt der Wärter wieder mit der Stallarbeit <strong>und</strong> arbeitet<br />
bis um 6.00 Uhr. Danach geht er nach Hause. Die Zeit, die der Wärter zwischen 22.00 Uhr<br />
<strong>und</strong> 3.00 Uhr arbeitet, kann er als Überzeit aufschreiben lassen. Jedoch nur diejenige Zeit, die<br />
durch das Eintreffen eines Notfalles gearbeitet wird (z. B. bei einer Operation). Für die Zeit,<br />
die der Wärter aufgr<strong>und</strong> des läutenden technischen Alarms oder des Nachschauens nach ei-<br />
nem unruhigen Pferd arbeitet, wird er nicht entschädigt. Der Ablauf des Nachtdienstes am<br />
Wochenende ist identisch wie der Nachtdienst während der Woche.<br />
Der Notfalldienst verlangt neben den Anforderungen <strong>für</strong> die normale Arbeit auch ein Ver-<br />
ständnis <strong>für</strong> tiermedizinische Belange <strong>und</strong> eine hohe Kompetenz <strong>für</strong> Hilfeleistungen. Da die<br />
Personen während der Nacht neben dem Dienst habenden Assistenten alleine sind, müssen sie<br />
auch Arbeiten erledigen, die sie während des Tages nicht gewöhnt sind zu machen. Ferner<br />
müssen Personen im Notfalldienst erkennen, wenn mit einem Pferd etwas nicht in Ordnung<br />
ist. Sie müssen Ausnahmesituationen gewachsen sein (z. B. Euthanasie eines tobenden Pfer-<br />
des). Aushilfen bzw. Ersatzleute leisten <strong>für</strong> gewöhnlich keinen Nachtdienst aufgr<strong>und</strong> der<br />
mangelnden Kompetenz. Der Nachtdienst wird folglich nur von den fünf Wärtern geleistet,<br />
die in den Turnus einbezogen werden.<br />
Wochenenddienst:<br />
Der Wochenenddienst während des Tages läuft identisch ab wie der Tagesdienst, ausser, dass<br />
der Dienst mit nur zwei Wärtern geleistet wird. Beide Wärter beginnen morgens die Ställe<br />
auszumisten. Da sie nur zu zweit sind, dauert dies länger als während der Woche. Einer der<br />
beiden füttert die Tiere. Wenn keine Notfälle eintreffen <strong>und</strong> wenn auch nicht so viele Pferde<br />
stationär behandelt werden müssen, kann die Arbeit mit zwei Wärtern gut geleistet werden.<br />
Oftmals reicht es jedoch nicht, um die Pferde auch noch gründlich zu putzen <strong>und</strong> die Ställe<br />
sauber zu misten. Dies ist dann <strong>für</strong> das Erscheinungsbild eines <strong>Universität</strong>sspitals nicht för-<br />
derlich. Besonders am Wochenende: Die Besitzer besuchen am Wochenende oft ihr Pferd <strong>und</strong><br />
möchten einen sauberen Stall <strong>und</strong> ein geputztes Tier vorfinden.<br />
Früher, als im 8-Wochenturnus gearbeitet wurde (mindestens acht Wärter, die im Turnus ein-<br />
bezogen werden konnten), waren am Samstag insgesamt fünf Wärter anwesend, von denen<br />
zwei den ganzen Tag <strong>und</strong> drei nur am Morgen arbeiteten, <strong>und</strong> am Sonntag zwei Wärter (siehe<br />
Dienstplan). Inzwischen wurde die Anzahl der am Samstag Dienst habenden Personen auf<br />
Denise Kuonen Seite 87
Unternehmensanalyse der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong><br />
zwei Wärter, die den ganzen Tag arbeiten, reduziert. Wenn noch weniger als zwei Wärter pro<br />
Wochenende arbeiten würden, würde dies bedeuten, dass der betreffende Pfleger bestenfalls<br />
nur noch die Stallarbeiten erledigen könnte. Die anderen Arbeiten (Untersuchungen, Notfälle<br />
etc.) müssten dann von den Assistenten selber gemacht werden, die jedoch auch bereits ausge-<br />
lastet sind.<br />
5.2.2.4.2 Hilfsdienst <strong>und</strong> Arbeitsprozesse der OPS-Gehilfen<br />
Hilfsdienst:<br />
Der OPS-Dienst ist eingeteilt in Tages-, Nacht- <strong>und</strong> Wochenenddienst. Die verschiedenen<br />
Dienste werden nachfolgend beschrieben:<br />
• Tagesdienst: Die tägliche Arbeitszeit (Montag bis Freitag) dauert von 7.45 Uhr bis<br />
12.00 Uhr <strong>und</strong> von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr. Alle vier OPS-Gehilfen sind anwesend.<br />
• Nachtdienst (Notfalldienst): Der Nachtdienst wird von einem der OPS-Gehilfen als<br />
Pikettdienst geleistet. Nachdem der OPS-Gehilfe während des Tages hindurch bis 17.45<br />
Uhr gearbeitet hat, kann er nach Hause gehen, muss jedoch abrufbar sein <strong>und</strong> innerhalb<br />
von ca. 20 Minuten in der Pferdeklinik eintreffen, wenn es einen Notfall gibt, der ope-<br />
riert werden muss. Die Zeit, die der OPS-Gehilfe <strong>für</strong> den Notfall arbeitet, kann er als<br />
Überzeit aufschreiben <strong>und</strong> später kompensieren. Der OPS-Helfer erhält <strong>für</strong> den Pikett-<br />
dienst 30 Franken pro Nacht, auch wenn es keine Notfälle <strong>und</strong> Operationen gibt <strong>und</strong> die<br />
Person folglich zu Hause bleiben darf. Diejenige Person, die Pikettdienst <strong>für</strong> die kom-<br />
mende Nacht leistet, ist auch <strong>für</strong> den Notfalldienst über Mittag (12.00-14.00 Uhr) ver-<br />
antwortlich.<br />
• Wochenenddienst: Eine Person der OPS-Gehilfen arbeitet am Samstag von 7.45 Uhr<br />
bis 12.00 Uhr. Danach kann sie nach Hause gehen, leistet aber bis am Montag um 7.45<br />
Uhr Pikettdienst. Für diesen Pikettdienst werden die OPS-Gehilfen ebenfalls bezahlt.<br />
Wenn sie während des Pikettdienstes in die Klinik gerufen werden um zu helfen, kön-<br />
nen sie diese gearbeitete Zeit als Überzeit aufschreiben <strong>und</strong> später kompensieren.<br />
Arbeitsprozesse:<br />
Jeder der OPS-Gehilfen führt neben den allgemeinen OPS-Aufgaben noch andere Arbeiten<br />
aus: Herr Bigler hilft v. a. in der Radiologie <strong>und</strong> macht nebenbei noch Sattlereiarbeiten, Herr<br />
Brändli bildet neue Mitarbeitende im Bereich der Operationen aus, Herr Karlen ist nebenbei<br />
<strong>für</strong> die Wäsche (Operationskleider, Tücher etc.) zuständig <strong>und</strong> arbeitet auch als Hufschmied<br />
<strong>und</strong> Frau Nef ist zuständig <strong>für</strong> die Apotheke. Im Folgenden werden die Arbeitsprozesse einer<br />
Denise Kuonen Seite 88
Unternehmensanalyse der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong><br />
OPS-Helferin (Frau Nef) beschrieben, da sie – wie bereits erwähnt – neben der Tätigkeit als<br />
OPS-Gehilfin auch noch die Apotheke betreut. Da die OPS-Gehilfen während des Tages von<br />
Montag bis Freitag arbeiten <strong>und</strong> die restliche Zeit in Form eines Pikettdienstes leisten, be-<br />
schränkt sich nachfolgende Beschreibung der Arbeitsprozesse auf die des Tagesdienstes.<br />
Denn die Vorgänge während einer Operation bei einem Notfall in der Nacht oder am Wo-<br />
chenende sind dieselben wie diejenigen während des Tagesdienstes (ausser, dass insgesamt<br />
weniger <strong>Personal</strong> anwesend ist).<br />
Die Arbeit beginnt um 7.45 Uhr. Die OPS-Helferin schaut als erstes nach, ob Medikamente<br />
<strong>und</strong> Instrumente (Spritzen, Kanülen, Katheter etc.) in der so genannten „kleinen Apotheke“<br />
(im Stall Nr. 3) <strong>und</strong> in der Apotheke im Operationsraum fehlen <strong>und</strong> nachzufüllen sind. Sie<br />
kontrolliert die vorhandenen Medikamente auf ihr Verfalldatum. Anschliessend holt sie die<br />
entsprechenden Medikamente <strong>und</strong> Instrumente aus dem Apotheke-Lagerraum. Wenn dort<br />
Medikamente <strong>und</strong> Instrumente fehlen, bestellt sie diese nach. Anschliessend reinigt <strong>und</strong> steri-<br />
lisiert sie die Instrumente, die während einer Operation in der vorhergehenden Nacht ge-<br />
braucht wurden. Sie schaut dann an der Tafel nach, was <strong>für</strong> Operationen <strong>und</strong> Untersuchungen<br />
anstehen <strong>und</strong> erk<strong>und</strong>igt sich beim jeweiligen Assistenten oder Oberassistenten, wie die Opera-<br />
tion gewünscht wird bzw. wie der OPS-Raum auszusehen hat. Danach wird der OPS-Raum<br />
entsprechend hergerichtet. Dies beinhaltet folgendes: Instrumente <strong>und</strong> Medikamente bereitle-<br />
gen, Operationstisch richten, Maschinen bereitstellen etc. Wenn diese Arbeiten erledigt sind,<br />
können die OPS-Wärter eine kurze Pause machen. Um 9.00 Uhr starten dann meistens die<br />
Operationen. Dabei wird das Tier von einem Wärter aus dem Stall geholt, gewogen <strong>und</strong> in der<br />
Chirurgiehalle auf die Operation vorbereitet (Hufen abdecken, Schweif befestigen etc.). Da-<br />
nach kommt der Anästhesist <strong>und</strong> spritzt ein Beruhigungsmittel. Während das Mittel zu wirken<br />
beginnt, wird das Tier in den Operationsraum gebracht <strong>und</strong> an den Operationstisch geb<strong>und</strong>en.<br />
Der Vorgang, bis das Tier auf dem Tisch liegt, ist ein sehr aufwändiger, bei dem zwischen 6<br />
<strong>und</strong> 8 Personen anwesend sind: ein bis zwei Wärter, die das Tier an den Tisch binden, ein bis<br />
zwei OPS-Gehilfen, die das Tier mit Tüchern einpacken, ein bis zwei Narkoseärzte, die die<br />
Narkose setzen <strong>und</strong> überwachen <strong>und</strong> schliesslich die Oberassistenten oder die Assistenten,<br />
welche die Operation durchführen. Die Wärter verlassen anschliessend wieder den OPS-<br />
Raum. Sobald das Tier schläft, zieht sich die OPS-Gehilfin spezielle Kleider <strong>für</strong> die Operation<br />
an <strong>und</strong> hilft dem operierenden Oberassistenten oder Assistenten beim Einkleiden. Danach<br />
kann die Operation beginnen. Während der Operation reicht die OPS-Helferin die Instrumen-<br />
te, holt die Medikamente etc. Nach der Operation wird der Raum geputzt, die Instrumente<br />
Denise Kuonen Seite 89
Unternehmensanalyse der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong><br />
gewaschen <strong>und</strong> sterilisiert <strong>und</strong> der Operationsraum auf die nächste Operation vorbereitet. Von<br />
12.00 Uhr bis 14.00 Uhr ist Mittagspause. Morgens finden meistens Szintigraphien statt <strong>und</strong><br />
am Nachmittag Operationen, die nach 14.00 Uhr beginnen. Um 17.45 Uhr ist die Arbeit fertig<br />
<strong>und</strong> der OPS-Helfende kann nach Hause gehen (sofern kein Notfall da ist <strong>und</strong> die Person nicht<br />
<strong>für</strong> den Nacht-Pikettdienst eingeteilt ist).<br />
5.2.2.4.3 Situation r<strong>und</strong> um die Arbeitsprozesse<br />
Arbeitsprozesse:<br />
Es gibt Arbeitsprozesse, die mehrheitlich problemlos ablaufen. Dies sind v. a. die Stallarbei-<br />
ten bei den Wärtern <strong>und</strong> die Operationen bei den OPS-Gehilfen. Wenn die klinische Arbeit<br />
um 9.00 Uhr beginnt, gibt es jedoch vermehrt Störungen bei den Abläufen. Störungen treten<br />
v. a. in Form von langen Wartezeiten auf, z. B. Warten bis die Assistenten die klinische Ar-<br />
beit beginnen oder wenn auf Ergebnisse des Labors gewartet werden muss. Oftmals sind diese<br />
Umstände auf die schlechte <strong>Organisation</strong> der Assistenten zurückzuführen. Die Assistenten<br />
sind z. B. morgens häufig verspätet <strong>und</strong> treffen erst nach 9.00 Uhr in den Klinikhallen ein.<br />
Dort müssen dann die Wärter <strong>und</strong> z. T. auch die OPS-Gehilfen auf sie warten. Diese Situation<br />
konnte die Verfasserin während des Besuches vom 22. Juli 2004 in der Pferdeklinik auch sel-<br />
ber beobachten: Auf der Tafel in der Chirurgiehalle stand eine Operation geschrieben, die <strong>für</strong><br />
9.00 Uhr angesagt war. Gegen 9.10 Uhr kam einer der Anästhesisten vorbei <strong>und</strong> teilte mit,<br />
dass die Operation wohl erst später beginnen könne, da die Assistenten der Chirurgie <strong>und</strong> der<br />
Inneren Medizin noch in der Fortbildung (jeweils dienstags <strong>und</strong> donnerstags morgens bis 9.00<br />
Uhr) seien. Da die anstehenden Operationen des Tages immer am Vorabend an die Tafel ge-<br />
schrieben werden, hätten die Assistenten die Operation also auch etwas später ansagen kön-<br />
nen, da sie wussten, dass sie am nächsten Morgen eine Fortbildung haben <strong>und</strong> diese i. d. R.<br />
länger als bis 9.00 Uhr dauert. Ca. um 9.20 Uhr kamen dann die ersten Personen aus der Fort-<br />
bildung zurück. Hätten die Wärter <strong>und</strong> die OPS-Gehilfen vorher gewusst, dass die Assistenten<br />
erst um 9.20 Uhr kommen werden, hätten sie sich während dieser Zeit einer anderen Tätigkeit<br />
anstatt sinnlosem Warten widmen können.<br />
Ebenfalls muss das Hilfspersonal bei Telefonaten der Assistenten warten. Die Untersuchung<br />
eines Tieres wird dann unterbrochen, weil der behandelnde Assistent ans Telefon gerufen<br />
wird. Dieser Umstand ist jedoch oft auch auf die mangelnde Auskunftsbereitschaft der Sekre-<br />
tärinnen zurückzuführen, die auch dann Telefonate durchstellen, die nicht Notfälle betreffen.<br />
Denise Kuonen Seite 90
Unternehmensanalyse der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong><br />
Eigentlich sollten keine Telefonate vor 11.00 Uhr durchgestellt werden, ausser es handelt sich<br />
um einen Notfall.<br />
Warten aufgr<strong>und</strong> der Behandlung selbst (z. B. warten bis das gespritzte Mittel wirkt) wird je-<br />
doch von keinem der Befragten als eigentliche Störung an sich empf<strong>und</strong>en. Solches „Warten“<br />
gehört zum Betrieb. Ebenfalls werden Notfälle von allen Befragten als zum Betrieb gehörende<br />
„Störungen“ angegeben. Die Notfälle unterbrechen zwar die laufenden Arbeiten, aber sie ge-<br />
hören zu einem Spitalbetrieb <strong>und</strong> haben Vorrang in der Behandlung gegenüber den laufenden<br />
Untersuchungen. Die Arbeit im Zusammenhang mit Notfällen <strong>und</strong> mit nicht vorhersehbaren<br />
Situationen (z. B. sich plötzlich verschlechternder Zustand eines Pferdes vor der Operation, so<br />
dass auf Besserung gewartet werden muss, um es zu operieren) erfordert von allen Personen<br />
viel Flexibilität, da der Betrieb manchmal nicht so abläuft wie geplant.<br />
Überzeit:<br />
Ein weiteres Problem ist die hohe Anzahl Überst<strong>und</strong>en. Die Überst<strong>und</strong>en konnten z. T. im<br />
Verlaufe des Vorjahres nicht kompensiert werden <strong>und</strong> kamen folglich zu den Überst<strong>und</strong>en des<br />
laufenden Jahres hinzu. Besonders während des Sommers (von Juni bis Oktober) ist es <strong>für</strong> das<br />
Hilfspersonal schwierig, diese Überst<strong>und</strong>en zu kompensieren, da sie aufgr<strong>und</strong> des reduzierten<br />
<strong>Personal</strong>s (Ferienabwesenheiten) nicht auch noch frei nehmen können. Die Überzeit bei den<br />
Wärtern ergibt sich nicht so sehr aus der zuviel gearbeiteten Zeit an einem Tag, sondern<br />
hauptsächlich aus den Tagen, die sie nicht kompensieren können (bspw. in den Ferien). Pro 5-<br />
Wochenturnus (nach fünf Wochen) macht jeder Wärter automatisch 1.5 Tage Überzeit. Diese<br />
Überzeit entsteht dadurch, dass den Wärtern aufgr<strong>und</strong> des zuvor in der Woche 5 (vgl. Dienst-<br />
plan der Wärter Kapitel 5.2.2.4.1) gearbeiteten Wochenendes eigentlich der Mittwochnach-<br />
mittag <strong>und</strong> der Donnerstag der 6. Woche zustehen würden. Diese Zeit können sie aber nicht<br />
kompensieren, da die Wärter nach der Woche 5 wieder mit dem Nachtdienst der Woche 1 be-<br />
ginnen müssen, da sie nur zu fünft sind <strong>und</strong> folglich die Wochen 6-8 des Dienstplanes durch<br />
die reduzierte Anzahl an Mitarbeitenden wegfallen. Ebenfalls machen die Wärter automatisch<br />
Überzeit, wenn sie Ferien beziehen. Da es die Wochen 7 <strong>und</strong> 8 des Dienstplanes nicht mehr<br />
gibt, in denen die Wärter früher problemlos Ferien nehmen konnten ohne Überzeit zu machen,<br />
müssen die Wärter während den Wochen 1-5 Ferien nehmen. Dadurch machen sie automa-<br />
tisch Überzeit. Wenn z. B. ein Wärter in der dritten Woche in die Ferien geht, erhält er 1.5<br />
Tage als Überzeit geschrieben. So summieren sich die Überst<strong>und</strong>en. Es muss damit gerechnet<br />
werden, dass pro Wärter im Jahr etwa über 100 Überst<strong>und</strong>en akkumuliert werden, was pro<br />
Denise Kuonen Seite 91
Unternehmensanalyse der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong><br />
Wärter ungefähr 2.5 <strong>und</strong> insgesamt 17.5 Wochen entspricht. Beim OPS-<strong>Personal</strong>, das eben-<br />
falls Überst<strong>und</strong>en in dieser Höhe aufweist, entstehen die Überst<strong>und</strong>en insbesondere aufgr<strong>und</strong><br />
der gearbeiteten Zeit während der häufig zu leistenden Pikettdienste (jede dritte Nacht).<br />
Stellvertretungsregeln:<br />
Es gibt keine Stellvertretungsregelungen. Wenn einer fehlt, wird die Arbeit durch die anderen<br />
Kollegen erledigt. Der Ausfall eines Mitarbeitenden führt zu Engpässen, insbesondere in der<br />
Ferienzeit. Oftmals reicht es dann nicht, die Arbeit des anderen nebenbei auch noch zu erledi-<br />
gen oder die eigene Arbeit qualitativ zufrieden stellend auszuführen.<br />
Dienst über Mittag bei den Wärtern:<br />
Die Wärter arbeiten – wie bereits erwähnt wurde – bis 11.30 Uhr, ausser demjenigen, der den<br />
Spätdienst leistet. Dieser hat erst um 12.00 Uhr Mittagspause. Oft werden die Wärter, welche<br />
zum Essen über Mittag in der Pferdeklinik bleiben, gerufen, um bspw. bei einem Notfall oder<br />
einer länger dauernden Operation zu helfen. Einer der Wärter stellt sich dann „freiwillig“ zur<br />
Verfügung, um zu helfen. Es ist jedoch nicht geregelt, wer dies tun muss. Der ungeregelte<br />
Mittagsdienst führt bei der Mehrheit der Wärter zu Unzufriedenheit. Die Wärter, die über Mit-<br />
tag in der Klinik bleiben <strong>und</strong> dann z. B. von einem Assistenten geholt werden, leisten sozusa-<br />
gen einen Pikettdienst, der weder geregelt noch separat bezahlt, sondern als Überzeit aufge-<br />
schrieben wird.<br />
Stellenbeschreibungen/Pflichtenhefte:<br />
Es gibt nur <strong>für</strong> wenige Stellen des Hilfspersonals Pflichtenhefte <strong>und</strong> wenn sie existieren, sind<br />
sie oft nicht mehr aktuell. Alle übrigen Leistungsanforderungen beruhen auf ungeschriebenen<br />
„Erwartungshaltungen“. Ein Teil der Befragten ist jedoch nicht mehr bereit, solche Aufgaben<br />
„zusätzlich“ zu leisten. Diese Haltung wird ausserdem durch Entscheide der Leitung der Pfer-<br />
deklinik wie bspw. das Streichen von Vergünstigungen auf Einkaufspreise <strong>für</strong> das gesamte<br />
<strong>Personal</strong> der Pferdeklinik, bestärkt.<br />
Neue Mitarbeitende:<br />
Neue Mitarbeitende werden durch „learning by doing“ eingelernt, d. h. nicht durch Einfüh-<br />
rungskurse oder durch schriftliches Material zum Lernen, sondern durch Mitlaufen <strong>und</strong> Zu-<br />
schauen bei einem Wärter, meist bei Herrn Glauser, <strong>und</strong> bei einem OPS-Helfenden, meist bei<br />
Herrn Brändli. Es dauert sehr lange, bis ein neuer Mitarbeitender so eingelernt ist, dass er<br />
Denise Kuonen Seite 92
Unternehmensanalyse der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong><br />
auch Nachtdienst bzw. Notfalldienst leisten kann. Deshalb können auch keine Aushilfen in-<br />
nert kurzer Zeit eingelernt werden, um die Wärter <strong>und</strong> OPS-Gehilfen zu entlasten.<br />
Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung:<br />
Möglichkeiten zur Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung sind insbesondere bei den Wärtern nicht vorhan-<br />
den <strong>und</strong> aufgr<strong>und</strong> der <strong>Personal</strong>situation auch nicht gut möglich. Denn bei Aus- oder Weiter-<br />
bildungen, die einen reduzierten Beschäftigungsgrad von 80 % erfordern würden, könnte<br />
durch den herrschenden <strong>Personal</strong>mangel nicht noch eine Person zusätzlich regelmässig fehlen.<br />
Zudem müsste geklärt werden, ob überhaupt finanzielle Mittel seitens der Pferdeklinik auf-<br />
gr<strong>und</strong> der Sparmassnahmen da<strong>für</strong> vorhanden sind. Für die OPS-Gehilfen sind Weiterbil-<br />
dungsmöglichkeiten vorhanden, die vom <strong>Personal</strong> auch genutzt werden. Ausbildungen sind<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich möglich, wenn sie langfristig nicht eine regelmässige Abwesenheit während den<br />
Arbeitszeiten erfordern. Die Förderung der Mitarbeitenden hält sich folglich in bescheidenem<br />
Rahmen.<br />
5.2.3 Bereiche mit Handlungsbedarf<br />
Aufgr<strong>und</strong> der problemzentrierten Interviews mit dem Hilfspersonal <strong>und</strong> geführter Gespräche<br />
mit dem <strong>Personal</strong> der Pferdeklinik können folgende Bereiche (insbesondere der Organisati-<br />
ons- <strong>und</strong> <strong>Personal</strong>politikbereich) genannt werden, bei denen ein Handlungsbedarf vorliegt:<br />
• Schlechtes Betriebsklima, fehlende Motivation.<br />
• Zu wenig <strong>Personal</strong>, dadurch viele Überst<strong>und</strong>en <strong>und</strong> viele Wochenenddienste.<br />
• Probleme beim Kompensieren der Überzeit.<br />
• Fehlende Ferienregelung.<br />
• Fehlende Führung: Führungsaufgaben werden von Professoren übernommen, die über<br />
keine betriebswirtschaftlichen Kenntnisse <strong>und</strong> Führungserfahrung verfügen.<br />
• Kein geregelter Notfalldienst über Mittag bei den Wärtern.<br />
• Ungleich bezahlter Pikettdienst des Hilfspersonals in der Nacht.<br />
• Wenig bis keine Aus- <strong>und</strong> Weiterbildungsmöglichkeiten.<br />
• Mangelnde Kommunikation.<br />
• Keine ausreichende Information.<br />
• Keine Pflichtenhefte, keine Stellenbeschreibungen.<br />
• Lange Wartezeiten, oft aufgr<strong>und</strong> der schlechten <strong>Organisation</strong> der Assistenten (Unpünkt-<br />
lichkeit).<br />
Denise Kuonen Seite 93
Unternehmensanalyse der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong><br />
• Kein Organigramm.<br />
5.2.4 Beschreibung <strong>und</strong> Bewertung von Verbesserungsan-<br />
sätzen<br />
Eine genaue Beschreibung <strong>und</strong> Bewertung von möglichen Verbesserungsansätzen dieser Be-<br />
reiche wird im folgenden sechsten Kapitel vorgenommen.<br />
Denise Kuonen Seite 94
Gestaltungsempfehlungen<br />
Teil 4: SCHLUSSFOLGERUNGEN<br />
6 Gestaltungsempfehlungen<br />
In diesem Kapitel folgen zunächst allgemeine Gestaltungsempfehlungen. Anschliessend wer-<br />
den konkrete, an den Praxispartner bzw. an die Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong> gerichtete<br />
Handlungsempfehlungen formuliert.<br />
6.1 Allgemeine Gestaltungsempfehlungen<br />
Nachfolgend werden vier allgemeine Gestaltungsempfehlungen formuliert.<br />
Gestaltungsempfehlung 1: Informieren der Belegschaft über die Analyse<br />
Die Unternehmensleitung bzw. die <strong>für</strong> die Analyse verantwortlichen Personen des zu untersu-<br />
chenden Unternehmens sollten ihre Belegschaft über das Vorhaben, den Betrieb zu analysie-<br />
ren, entsprechend informieren <strong>und</strong> den Mitarbeitenden gegebenenfalls die analysierende Per-<br />
son bzw. Personen – insbesondere wenn die Unternehmensanalyse nicht von betriebsinternen<br />
Personen gemacht wird – vorstellen. Dies ist u. a. <strong>für</strong> die Vertrauensgewinnung der Beleg-<br />
schaft <strong>und</strong> eine erhöhte aktive Teilnahme in Hinblick auf eine eventuelle Datenerhebung mit-<br />
tels schriftlichen oder persönlichen Befragungen wichtig. Um eine offene Informations- <strong>und</strong><br />
Kommunikationspolitik zu betreiben, sind auch Informationsveranstaltungen denkbar, in de-<br />
nen über den Stand der Analyse bzw. deren Ergebnisse <strong>und</strong> Folgen informiert wird. Insbeson-<br />
dere bei einem öffentlichen Unternehmen ist zu prüfen, welche Interessengruppen – wenn<br />
überhaupt – informiert werden sollen (vgl. Kapitel 3.1.1.2.2).<br />
Gestaltungsempfehlung 2: Ansprechperson<br />
Um eine Unternehmensanalyse in einem Betrieb erfolgreich durchführen zu können, sollten<br />
den analysierenden Personen eine kompetente Ansprechperson von Seiten des zu analysieren-<br />
den Unternehmens zur Verfügung gestellt werden, die über umfassende Informationen verfügt<br />
<strong>und</strong> entsprechend informieren kann.<br />
Denise Kuonen Seite 95
Gestaltungsempfehlungen<br />
Gestaltungsempfehlung 3: Dokumente<br />
Ebenfalls sollten in dem zu untersuchenden Betrieb relevante Dokumente <strong>und</strong> interne Unter-<br />
lagen wie Sitzungsprotokolle, Mitarbeitergespräche etc. sorgfältig abgelegt werden, damit die<br />
Personen, welche die Unternehmensanalyse durchführen, bei Bedarf in diese Unterlagen Ein-<br />
sicht nehmen <strong>und</strong> sie auswerten können. Falls bei der Unternehmensanalyse auch die finan-<br />
zielle Situation des Unternehmens von Interesse ist, sollten die finanziellen Kennzahlen des<br />
Unternehmens, nachdem sie auf ihre Relevanz <strong>und</strong> Vollständigkeit hin überprüft worden sind,<br />
den Analysierenden <strong>für</strong> die weitere Bearbeitung <strong>und</strong> Auswertung zur Verfügung stehen.<br />
Gestaltungsempfehlung 4: Datenerhebung<br />
Falls bei der Unternehmensanalyse Daten bspw. mittels Befragungen erhoben werden, sollten<br />
die zu befragenden Personen bzw. das <strong>Personal</strong> rechtzeitig gefragt werden, ob sie sich z. B.<br />
<strong>für</strong> ein persönliches Gespräch in Form eines Interviews bereit erklären würden. Ebenfalls soll-<br />
ten die Befragten darüber informiert werden, wie die Interviews durchgeführt werden <strong>und</strong> in<br />
welcher Form ihre Aussagen weiterverwendet werden (eventuell Gewährleistung der Anony-<br />
mität). Bei schriftlichen Erhebungen sollten die zu befragenden Personen auch frühzeitig über<br />
die Befragung informiert werden, um u. a. auch deren Bereitschaft zur aktiven Teilnahme<br />
(<strong>und</strong> dadurch evtl. die Rücklaufquote bei schriftlichen Fragebogen) zu erhöhen.<br />
6.2 Gestaltungsempfehlungen <strong>für</strong> die Pferdeklinik<br />
der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong><br />
Die Handlungsempfehlungen <strong>für</strong> die Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong> sind auf die allgemeine<br />
Situation, die interne Kommunikation <strong>und</strong> die Prozesse bzw. Abläufe des Hilfspersonals ge-<br />
richtet. Wie mit Herrn Meier zu Beginn der sechsmonatigen Arbeitsphase vereinbart wurde,<br />
soll die finanzielle Situation der Pferdeklinik nur am Rande betrachtet werden. So gilt zu er-<br />
wähnen, dass bei einigen Gestaltungsempfehlungen zuerst überprüft werden müsste, ob sie<br />
aus finanzieller Sicht überhaupt möglich sind (bspw. Gestaltungsempfehlungen 1, 11, 15 <strong>und</strong><br />
17).<br />
Denise Kuonen Seite 96
Gestaltungsempfehlungen<br />
6.2.1 Gestaltungsempfehlungen zur allgemeinen Situation<br />
Gestaltungsempfehlung 1: Einstellen neuer Mitarbeitenden<br />
Der Meinung aller befragten Interviewpartner nach fehlt es an <strong>Personal</strong>, sowohl bei den Wär-<br />
tern als auch bei den OPS-Gehilfen. Insbesondere sind die Arbeitsbedingungen des häufigen<br />
Nacht- bzw. Wochenenddienstes in der Form nicht länger zu tragen. Der Verfasserin ist wäh-<br />
rend den mehrtägigen Besuche in der Pferdeklinik aufgefallen, dass die Arbeiten mit dem zur<br />
Verfügung stehenden <strong>Personal</strong> zwar erledigt werden, aber dass die Ansprüche an die Qualität<br />
der Arbeit v. a. bei den Wärtern gesenkt werden mussten (schnelles Misten <strong>und</strong> ungenaues<br />
oder gar kein Putzen der Pferde, seltenes Wischen des Hofes etc.). Unter dem <strong>Personal</strong>mangel<br />
leidet u. a. auch die Instandhaltung der Ställe.<br />
Die grosse Zahl an Überst<strong>und</strong>en <strong>und</strong> die Schwierigkeiten beim Kompensieren der Überstun-<br />
den <strong>und</strong> beim Beziehen von Ferien zeigen ebenfalls den Mangel an <strong>Personal</strong> auf. Besonders,<br />
seit die neuen Ställe (Reservestall eins <strong>und</strong> zwei) eröffnet wurden, wird es mit der vorhande-<br />
nen Anzahl an Wärtern schwierig, die Arbeiten zufrieden stellend zu erledigen. Beim Reser-<br />
vestall eins gilt zu erwähnen, dass dort drei Absonderungsboxen gebaut wurden <strong>für</strong> Tiere mit<br />
ansteckenden Krankheiten. Wenn nun ein Wärter Tiere in den Absonderungsboxen zu pflegen<br />
hat, müssen vor dem Betreten einer neuen Box sämtliche Kleider <strong>und</strong> Schuhe gewechselt<br />
bzw. einen Overall angezogen werden. Folglich dauern die Stallarbeiten beim Reservestall<br />
eins länger als bei den anderen Ställen (dadurch „fehlt“ dann dieser Wärter bei den anderen<br />
Stall- <strong>und</strong> Klinikarbeiten <strong>und</strong> Engpässe sind die Folge), womit wiederum deutlich wird, dass<br />
das <strong>Personal</strong> an Wärtern knapp ist. Ebenfalls ist zu berücksichtigen, dass gleichzeitig mit der<br />
Abnahme der Zahl der Wärter <strong>und</strong> der OPS-Gehilfen der Anfall an klinischer Arbeit zuge-<br />
nommen hat, da immer aufwändiger untersucht <strong>und</strong> behandelt wird. Da das <strong>Personal</strong> auch bei<br />
den OPS-Gehilfen reduziert wurde, werden oft Wärter gerufen, um die Engpässe zu überwin-<br />
den – dadurch „fehlen“ dann die Wärter, um bei den Untersuchungen <strong>und</strong> den Stallabreiten zu<br />
helfen. Zudem gilt zu erwähnen, dass gewisse Aufgaben nicht allen zugemutet werden kön-<br />
nen (z. B. Arthroskopie). Dies alles soll deutlich machen, dass ein Mangel an Hilfspersonal<br />
besteht. Bei den Wärtern könnte die unzufriedene Situation durch mindestens sieben Wärter,<br />
die in den Turnus einzubeziehen sind, entschärft werden. Bei den OPS-Gehilfen würde eine<br />
fünfte Person mehr im OPS-Team genügen, damit die Arbeit wieder in gewünschter Qualität<br />
<strong>und</strong> zur eigenen Zufriedenheit erledigt werden könnte. Da die Pferdeklinik jedoch ihr Budget<br />
Denise Kuonen Seite 97
Gestaltungsempfehlungen<br />
<strong>und</strong> so auch die finanziellen Mittel <strong>für</strong> neue Stellen vom Staat vorgegeben erhält, <strong>und</strong> die<br />
Pferdeklinik dadurch nicht selber neues <strong>Personal</strong> nach Bedarf einstellen kann, sollte folglich<br />
die Leitung der Pferdeklinik vermehrt um <strong>Personal</strong>punkte <strong>für</strong> das Hilfspersonal kämpfen <strong>und</strong><br />
auf die vorhandenen Probleme <strong>und</strong> die dringenden Anliegen aufmerksam machen, sowohl bei<br />
der Leitung des Departements als auch bei der Regierung bzw. der kantonalen Behörde. Eben-<br />
falls müsste überprüft werden, ob die grosse Anzahl der Überst<strong>und</strong>en den arbeitsrechtlichen<br />
Reglementen (Bestimmungen) entsprechen.<br />
Gestaltungsempfehlung 2: Frühpensionierung oder Umteilung von Herrn Ernst<br />
Schick<br />
Fast alle Wärter sind ges<strong>und</strong>heitlich angeschlagen, insbesondere jedoch Herr Schick, der auf-<br />
gr<strong>und</strong> eines Nierenleidens nur noch zu 50 % arbeiten darf (ärztliches Zeugnis). Herr Schick,<br />
der 62 Jahre alt ist, kommt folglich <strong>für</strong> schwere <strong>und</strong> anspruchsvolle Arbeiten nicht mehr in<br />
Frage. Wie bereits erwähnt wurde, arbeitet Herr Schick immer morgens <strong>und</strong> wird dadurch<br />
nicht in den Wärterzyklus einbezogen, d. h. er leistet weder Nacht- noch Wochenenddienste.<br />
Um die Pfleger jedoch zu entlasten, so dass sie insbesondere weniger häufig Wochenend-<br />
dienste leisten müssen, sollte eine zusätzliche Person, die in den Wärterzyklus einbezogen<br />
wird, angestellt werden. Da dies zurzeit aufgr<strong>und</strong> der Sparmassnahmen nicht möglich ist,<br />
sollte Herr Schick aufgr<strong>und</strong> seiner angeschlagenen Ges<strong>und</strong>heit frühpensioniert oder in eine<br />
körperlich weniger anspruchsvolle Tätigkeit (z. B. in der Gärtnerei der <strong>Universität</strong>) umgeteilt<br />
werden. Mit seinen freigewordenen <strong>Personal</strong>punkten sollte entweder die Anstellung von Frau<br />
Schmutz auf 100 % aufgestockt oder eine neue Person als Wärter angestellt werden.<br />
Gestaltungsempfehlung 3: Pflichtenhefte bzw. Stellenbeschreibungen<br />
Wie bereits unter dem Kapitel 5.2.2.4.3 erwähnt wurde, gibt es nur <strong>für</strong> wenige Stellen des<br />
Hilfspersonals Pflichtenhefte <strong>und</strong> Stellenbeschreibungen. Alle übrigen Leistungsanforderun-<br />
gen beruhen auf ungeschriebenen „Erwartungshaltungen“. Es sollte jedoch <strong>für</strong> jede Person ein<br />
aktuelles Pflichtenheft erstellt werden, in welchem u. a. eine genaue Beschreibung der Aufga-<br />
ben, Kompetenzen <strong>und</strong> Verantwortlichkeiten der einzelnen Person enthalten ist. Ebenfalls<br />
sollte die Ernennung nur eines Vorgesetzten (bisher mehrere) beinhaltet sein.<br />
Denise Kuonen Seite 98
Gestaltungsempfehlungen<br />
Gestaltungsempfehlung 4: Führung<br />
Wie bereits erwähnt wurde, war die mangelnde oder schlechte Führung bei allen Interviewten<br />
ein Problem. Die Führung bzw. die Art <strong>und</strong> Weise, wie geführt wird, muss geändert werden.<br />
Die Führungspersonen, insbesondere der Leiter der Pferdeklinik, sollen ihre Mitarbeitenden<br />
fördern <strong>und</strong> motivieren. Ferner sollte sich die leitende Person Zeit <strong>für</strong> die Mitarbeitenden<br />
nehmen, um mit ihnen u. a. über aktuelle Probleme zu sprechen. Die Mitarbeitenden müssen<br />
ernst genommen werden. Die Führungsperson sollte dabei als Vorbild <strong>für</strong> seine Belegschaft<br />
eine Ansprechperson <strong>für</strong> die Mitarbeitenden sein <strong>und</strong> sich <strong>für</strong> sie einsetzen. Hinzu kommt das<br />
Fördern der Disziplin bzw. das härtere Durchgreifen beim akademischen <strong>Personal</strong> in Hinblick<br />
auf die Pünktlichkeit (v. a. bei Arbeitsbeginn um 9.00 Uhr) <strong>und</strong> Ordnung (besseres Aufräu-<br />
men <strong>und</strong> Putzen der Instrumente etc.). Des Weiteren ist es angebracht, persönliche Schwierig-<br />
keiten <strong>und</strong> Uneinigkeiten („Filz“) zwischen den Führungspersonen nicht offen bzw. vor den<br />
Mitarbeitenden auszutragen. Die verantwortlichen Personen haben sich im Bereich Führung<br />
konsequent weiterzubilden.<br />
Gestaltungsempfehlung 5: Unterrichten in betriebswirtschaftlichen Kenntnissen<br />
Der Verantwortliche <strong>für</strong> das Hilfspersonal führt jährlich Mitarbeitergespräche durch. Er ist<br />
folglich – wie auch andere Personen des akademischen <strong>Personal</strong>s (z. B. Professoren der Pfer-<br />
deklinik) – nebenamtlich <strong>für</strong> Aufgaben zuständig, die qualifizierte betriebswirtschaftliche<br />
Kenntnisse erfordern über Führung, <strong>Personal</strong>wesen, Marketing, Informatik etc. I. d. R. haben<br />
diese Personen wenig oder überhaupt keine „gelernten“ betriebswirtschaftlichen Kenntnisse.<br />
Folglich sollten Personen, die mit solchen betriebswirtschaftlichen Aufgaben beauftragt wer-<br />
den, auch entsprechend „professionell“ unterrichtet, geschult werden.<br />
Gestaltungsempfehlung 6: Ausstatten der Stelle von Herrn Hanspeter Meier mit<br />
mehr Kompetenzen<br />
Wie bereits erwähnt, ist Herr Hanspeter Meier seit gut eineinhalb Jahren <strong>für</strong> das Hilfspersonal<br />
zuständig. Seine Weisungsbefugnis ist jedoch stark eingeschränkt. So darf er u. a. keine Sit-<br />
zungen einberufen <strong>und</strong> z. T. auch nicht an internen Sitzungen teilnehmen, keine Briefe<br />
schreiben etc. Um sich <strong>für</strong> das Hilfspersonal entsprechend einsetzen <strong>und</strong> um überhaupt etwas<br />
bewirken zu können (z. B. bei der Departements- <strong>und</strong> <strong>Universität</strong>sleitung), sollte Herr Meiers<br />
Denise Kuonen Seite 99
Gestaltungsempfehlungen<br />
Stelle als <strong>Personal</strong>verantwortlicher mit mehr Weisungsbefugnissen ausgestattet werden. Dies<br />
ist hauptsächlich im Zusammenhang mit der Verbesserung der Kommunikationssituation (vgl.<br />
Gestaltungsempfehlung 7) relevant.<br />
6.2.2 Gestaltungsempfehlungen zur internen Kommunika-<br />
tion<br />
Gestaltungsempfehlung 7: Regelmässige Sitzungen, mehr Information<br />
Um die interne Kommunikation in der Pferdeklinik v. a. in Bezug auf das Hilfspersonal zu<br />
verbessern, sollen regelmässige Sitzungen (z. B. monatlich) stattfinden, in denen sich der<br />
Dispatcher Herr Meier, die Wärter, die OPS-Gehilfen <strong>und</strong> gegebenenfalls auch die Leitung<br />
der Pferdeklinik mit den Assistenten treffen. Ebenfalls sollten nach Bedarf wöchentlich Sit-<br />
zungen stattfinden, jedoch in kleinerem Rahmen z. B. ohne die Oberassistenten <strong>und</strong> die Assis-<br />
tenten. Die Sitzungen sollten sich auf allgemeine Informationen, aktuelle Geschehnisse, be-<br />
sondere Erfahrungen, entstandene Probleme, patientenbezogene Besonderheiten, in Zukunft<br />
anfallende Aufgaben etc. beziehen.<br />
Gestaltungsempfehlung 8: E-Mail <strong>für</strong>s Hilfspersonal<br />
Nicht alle Personen des Hilfspersonals verfügen über ein E-Mailkonto. Es ist insbesondere bei<br />
den Wärtern sinnvoll, ein E-Mailkonto einzurichten, damit Informationen direkt an alle Wär-<br />
ter gehen <strong>und</strong> nicht nur an Herrn Glauser, den Chefwärter, der die restlichen Wärter dann wei-<br />
ter informieren soll. Für Herrn Glauser wäre es auch einfacher, mittels E-Mail die Personen<br />
zu informieren. Denn die Wärter arbeiten ja in einem Turnus <strong>und</strong> sind folglich nicht alle wäh-<br />
rend desselben Tages in der Pferdeklinik, um informiert werden zu können. Mitteilungen per<br />
E-Mail sind auch persönlicher als das Anschlagbrett. E-Mail als Kommunikationsmittel wür-<br />
de auch den Informationsfluss beim Dienstwechsel erleichtern.<br />
Gestaltungsempfehlung 9: Vorstellen der neu angestellten Personen<br />
Neu angestellte Personen sollten dem <strong>Personal</strong> vorgestellt werden, damit z. B. der Name, die<br />
Zuständigkeit <strong>und</strong> die voraussichtliche Anstellungsdauer (bei Aushilfen) etc. bekannt sind.<br />
Dies sollte entweder von Herrn Meier als Zuständiger <strong>für</strong> das Hilfspersonal oder vom Chef<br />
Denise Kuonen Seite 100
Gestaltungsempfehlungen<br />
bzw. einem der Oberassistenten der jeweiligen Abteilung, welche die neue Person einstellt,<br />
durchgeführt werden.<br />
Gestaltungsempfehlung 10: Betriebsausflüge, Weihnachtsfeiern, Abschiedsfeste<br />
Betriebausflüge, Weihnachtsfeiern, Abschiedsfeste etc. sollten rechtzeitig geplant <strong>und</strong> organi-<br />
siert werden, so dass alle wissen, wann eine Feier bzw. ein Ausflug stattfindet <strong>und</strong> wer daran<br />
teilnehmen darf/kann. Um Konflikte zu vermeiden bzgl. der an einer Feier teilnehmenden <strong>und</strong><br />
der den Dienst in der Klinik aufrechterhaltenden Personen, sollte bspw. eine Liste geführt<br />
werden, die festhält, wer in der Vergangenheit während einer Feier arbeiten musste <strong>und</strong> wer<br />
an einem Fest teilnahm, damit es bei einer nächsten Feier nicht wieder dieselbe Person trifft,<br />
die arbeiten muss bzw. nicht mit den anderen feiern kann.<br />
6.2.3 Gestaltungsempfehlungen zu den Prozessen bzw. den<br />
Abläufen<br />
Gestaltungsempfehlung 11: Verwendung von Holzgranulat als Boxen-Einstreue<br />
In der Vergangenheit wurde viel darüber diskutiert (zwischen den Wärtern, Herren Meier <strong>und</strong><br />
Ueltschi usw.), ob das arbeitsaufwendige Stroh als Einstreue in den Boxen ersetzt werden<br />
sollte durch eine weniger aufwendige Einstreue wie bspw. durch Tierwohl. Denn <strong>für</strong> das Mis-<br />
ten einer Box, in welcher Stroh als Einstreue verwendet wird, braucht man länger als <strong>für</strong> eine<br />
Box mit Tierwohl. Tierwohl wird aus Holz hergestellt <strong>und</strong> ist besonders bei Lungenpatienten<br />
geeignet, da die Staubentwicklung durch Tierwohl geringer ist als durch Stroh. Argumente<br />
gegen das Tierwohl waren neben der Klärung der Mist-Abnehmerfrage die Nachteile, dass<br />
Stroh <strong>für</strong> das Wohl des Tieres u. a. in Bezug auf dessen Beschäftigung während des Klinik-<br />
aufenthaltes (Pferde spielen mit den Strohhalmen) <strong>und</strong> <strong>für</strong> das Wohl der Patienten mit offenen<br />
W<strong>und</strong>en besser geeignet ist als Tierwohl. Nach Abwägen der Vor- <strong>und</strong> Nachteile kam man<br />
zum Entschluss, Stroh bzw. Anipelli (gewürfeltes Stroh) in den meisten Boxen einzustreuen<br />
<strong>und</strong> nur in einzelnen wenigen Boxen Tierwohl zu verwenden.<br />
Wenn man – wie in der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> Zürich – Holzspäne bzw. Holzgranulat<br />
als Einstreue in den Boxen verwenden würde, könnte die Arbeit der Wärter wesentlich er-<br />
leichtert werden. Insbesondere an Wochenenden, wenn nur zwei Wärter anwesend sind, wür-<br />
Denise Kuonen Seite 101
Gestaltungsempfehlungen<br />
de Holzgranulat den (v. a. zeitlichen) Aufwand bei den Stallarbeiten mindern. Die Holzgranu-<br />
lat-Einstreue ist besser zu misten als Stroh, da man die Kotäpfel einfach raussieben <strong>und</strong> die<br />
feuchten Stellen komplett entfernen kann. Somit ist die gesamte Box trockener als bei Stroh.<br />
Die Wärter könnten die Mistarbeit schneller erledigen <strong>und</strong> hätten mehr Zeit <strong>für</strong> andere Arbei-<br />
ten (z. B. gründliches Putzen der Pferde, was besonders während des Wochenendes, wenn die<br />
Besitzer ihre Tiere besuchen kommen, <strong>für</strong> das Erscheinungsbild der Pferdeklinik wichtig ist),<br />
die sonst u. a. aufgr<strong>und</strong> des reduzierten <strong>Personal</strong>s <strong>und</strong> des Zeitdrucks zu kurz kommen. Zwar<br />
kann sich das Pferd mit dem Holzgranulat nicht so beschäftigen wie mit den Strohhalmen,<br />
aber die Pferde sind ja i. d. R. auch nur <strong>für</strong> kurze Zeit in der Klinik, wodurch sie durch diesen<br />
Nachteil keine schweren Folgen zu tragen hätten. Die Verwendung von Holzgranulat scheint<br />
in der Zürcher Pferdeklinik zudem bestens zu passen. Es ist folglich intensiv darüber zu dis-<br />
kutieren bzw. zu prüfen, ob die jetzige Einstreue durch eine andere wie bspw. Holzgranulat zu<br />
ersetzen ist.<br />
Gestaltungsempfehlung 12: Minimieren von Wartezeiten<br />
Die Abläufe des Hilfspersonals können optimiert werden, indem die langen <strong>und</strong> oftmals sinn-<br />
losen Wartezeiten verkürzt werden. Insbesondere das morgendliche Warten auf das Eintreffen<br />
der Oberassistenten <strong>und</strong> Assistenten sollte reduziert werden, um mit der klinischen Arbeit<br />
pünktlich beginnen zu können. Dies sollte durch bessere Disziplin <strong>und</strong> härteres Durchgreifen<br />
des Leiters der Pferdeklinik bei Unpünktlichkeit seiner Mitarbeitenden erreicht werden. Eben-<br />
falls sollten die Sekretärinnen dazu gebracht werden, sich an die Vorgaben zu halten <strong>und</strong> Te-<br />
lefonate nicht vor 11.00 Uhr (ausser Telefonate betreffend Notfälle) an die Assistenten durch-<br />
zustellen. Zudem sollten sie zu mehr Selbstständigkeit in Bezug auf die Auskunftsbereitschaft<br />
<strong>und</strong> -fähigkeit angehalten werden.<br />
Gestaltungsempfehlung 13: Regeln des Dienstes der Wärter über Mittag<br />
Wie unter Kapitel 5.2.2.4.3 erwähnt, ist der Dienst der Wärter über Mittag nicht geregelt.<br />
Folglich sollte bestimmt werden, welche Person über Mittag zu rufen ist, wenn ein Notfall<br />
eintrifft oder eine Operation länger dauert. Dies könnte bspw. diejenige Person sein, die <strong>für</strong><br />
den Spätdienst eingeteilt ist. Diese Person würde dann bis 12.00 Uhr arbeiten <strong>und</strong> über Mittag<br />
eine Art „Pikettdienst“ leisten, der folglich auch entsprechend zu entlöhnen ist, da die Person<br />
ja zum Essen nicht nach Hause gehen kann. Wenn dies aus Kostengründen nicht möglich sein<br />
sollte, wird auf Gestaltungsempfehlung 14 verwiesen.<br />
Denise Kuonen Seite 102
Gestaltungsempfehlungen<br />
Gestaltungsempfehlung 14: Änderung des Spätdienstes der Wärter<br />
Wie in Kapitel 5.2.2.4.1 bereits besprochen, arbeitet der Wärter im Spätdienst die normalen<br />
Zeiten des Tagesdienstes <strong>und</strong> zusätzlich von 11.30 Uhr bis 12.00 Uhr <strong>und</strong> von 17.00 Uhr bis<br />
18.00 Uhr. Um die Problematik des Dienstes über Mittag bei den Wärtern zu beheben, sollte<br />
entweder der vorangehende Lösungsvorschlag 13 vollzogen oder der Dienstplan umstruktu-<br />
riert werden. Da<strong>für</strong> gibt es verschiedene Möglichkeiten. Z. B. könnte der Spätdienst in eine<br />
Art „Schichtbetrieb“ geändert werden. Diese Änderungen hätten natürlich auch Auswirkun-<br />
gen auf den restlichen Dienstplan, der folglich entsprechend angepasst werden müsste (da die<br />
Erstellung eines neuen Dienstplanes, der zuerst während einer Probezeit eingeführt werden<br />
sollte, sehr komplex ist <strong>und</strong> spezifische Kenntnisse verlangt, verzichtet hier die Verfasserin<br />
auf die Erstellung eines neuen Dienstplanes). Der Schichtbetrieb könnte dann so aussehen,<br />
dass der Wärter morgens später mit der Arbeit beginnt, z. B. um 7.45 Uhr, <strong>und</strong> bis 13.15 Uhr<br />
arbeitet. Dann nimmt er die Arbeit um 14.45 Uhr wieder auf <strong>und</strong> bleibt bis 18.00 Uhr. Dieser<br />
Spätdienst dauert eine St<strong>und</strong>e weniger als der jetzige. Diese Zeit könnte jedoch durch den<br />
neuen Nachtdienst (vgl. Gestaltungsempfehlung 16) kompensiert werden.<br />
Gestaltungsempfehlung 15: Gleich bezahlter Pikettdienst in der Nacht<br />
Die Wärter fühlen sich benachteiligt in Bezug auf die Entlöhnung der OPS-Gehilfen während<br />
des Nachtdienstes im Vergleich zu ihnen. Wie bereits erwähnt, erhalten die OPS-Gehilfen <strong>für</strong><br />
den Nacht-Pikettdienst 30 Franken, können aber wenn kein Notfall dazwischen kommt, zu<br />
Hause übernachten <strong>und</strong> die <strong>für</strong> den Notfall gearbeitete Zeit als Überzeit aufschreiben. Der<br />
Nachtwärter, der zwar zwischen 22.00 Uhr <strong>und</strong> 3.00 Uhr schlafen kann (häufig jedoch ist<br />
schlafen kaum möglich u. a. aufgr<strong>und</strong> der Kolikpatienten), jedoch aufstehen muss, wenn u. a.<br />
der Alarm des technischen Dienstes läutet, wird nicht entschädigt. Dies sollte geändert wer-<br />
den, da die Nachtwärter auch einen „Pikettdienst“ leisten, da sie schliesslich zum Schlafen<br />
nicht nach Hause gehen können.<br />
Gestaltungsempfehlung 16: Änderung des Nachtdienstes der Wärter<br />
Eine weitere Möglichkeit, um vorangehendes Problem zu beheben, ist der spätere Beginn des<br />
Nachtdienstes <strong>und</strong> zwar um 22.00 Uhr. Der Nachtwärter würde folglich seine Arbeit um<br />
22.00 Uhr beginnen <strong>und</strong> bis am nächsten Morgen um 6.00 Uhr arbeiten. Der Nachtwärter ar-<br />
beitet dann acht St<strong>und</strong>en, d. h. eine St<strong>und</strong>e mehr als beim jetzigen Nachtdienst. Diese Zeit<br />
Denise Kuonen Seite 103
Gestaltungsempfehlungen<br />
könnte durch den geänderten Spätdienst (Gestaltungsvorschlag 14) kompensiert werden. Um<br />
die bisherige Zeit von 18.00 Uhr bis 22.00 Uhr zu überbrücken, wird auf nachfolgenden Ges-<br />
taltungsvorschlag 17 verwiesen.<br />
Gestaltungsempfehlung 17: Studierende einsetzen<br />
Um den Nachtdienst der Wärter um 22.00 Uhr ansetzen zu können, könnten z. B. Studierende<br />
eingesetzt werden, die während der Zeit von 18.00 Uhr bis 22.00 Uhr arbeiten. Die Pferdekli-<br />
nik der <strong>Universität</strong> Zürich hat da<strong>für</strong> insgesamt sieben Studierende angestellt, die jeweils wäh-<br />
rend eines Tages in der Woche den Spätdienst leisten. Sie beginnen zu arbeiten, wenn der Ta-<br />
gesdienst nach Hause geht <strong>und</strong> enden mit der Arbeit, wenn der Nachtwärter mit seinem Dienst<br />
anfängt. Auch hier ist den Studierenden genügend Zeit <strong>für</strong> die Einarbeitung zu geben, da die<br />
Tätigkeiten (Know-how) <strong>und</strong> die möglichen Risiken oft unterschätzt werden. Die Studieren-<br />
den sollten gemäss kantonaler Verordnung entsprechend entlöhnt werden. Es sollte folglich<br />
bei der Leitung der Pferdeklinik bzw. des Departements der Antrag <strong>für</strong> die Einstellung von<br />
Studierenden gestellt werden. Der grosse Vorteil besteht darin, dass gut ausgebildete Arbeits-<br />
kräfte zu tieferen Kosten angestellt werden können. Auf der anderen Seite ist es auch <strong>für</strong> die<br />
Studierenden eine Chance, vermehrt Erfahrungen in der Praxis zu sammeln.<br />
Gestaltungsempfehlung 18: Mitarbeiterpool der Wärter <strong>und</strong> OPS-Gehilfen<br />
Eine weitere Gestaltungsempfehlung ist die Zusammenlegung des OPS- <strong>und</strong> des Wärter-<br />
<strong>Personal</strong>s wie in der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> Zürich. Alle Wärter sollten während ca. zwei<br />
Monaten die häufigsten (Standard-) Operationen wie bspw. Kolikoperationen erlernen, damit<br />
sie diese Operationen v. a. während des Wochenend- <strong>und</strong> Nachtdienstes beherrschen. Die Per-<br />
sonen, die bis jetzt OPS-Gehilfen waren, erlernen ebenfalls die Abläufe der Wärtertätigkeiten.<br />
Dabei sind das jeweilige Know-how <strong>und</strong> die bei einer neuen, noch (mehr oder weniger) unbe-<br />
kannten Arbeit vorhandenen Risiken jedoch nicht zu unterschätzen. Es soll genügend Zeit <strong>für</strong><br />
die Erlernung der neuen Tätigkeiten eingeräumt werden.<br />
Während des Tages sollte aus diesem Pool ein Operationsteam von ca. drei bis vier Personen<br />
gebildet <strong>und</strong> durchnummeriert werden. Nr. 1 assistiert während der ersten Operation, Nr. 2<br />
hilft dabei, das Pferd nieder zu legen <strong>und</strong> ist auch beim Aufwachen anwesend. Während der<br />
Operation hilft Nr. 2 bei den klinischen Untersuchungen <strong>und</strong> den Stallarbeiten mit wie Nr. 3<br />
<strong>und</strong> Nr. 4. Bei der zweiten Operation ist es dann umgekehrt: Nr. 1 hilft beim Legen des Pfer-<br />
Denise Kuonen Seite 104
Gestaltungsempfehlungen<br />
des <strong>und</strong> Nr. 2 assistiert während der Operation. Anschliessend kommt Nr. 3, um die dritte<br />
Operation zu assistieren <strong>und</strong> Nr. 4 hilft beim Niederlegen des Tieres usw. Ab <strong>und</strong> zu sollten<br />
die anderen Pferdepfleger bzw. Wärter auch wieder während Operationen dabei sein, um de-<br />
ren Handlungsabläufe etc. aufzufrischen. Durch diese Variante gestaltet sich die Arbeit ab-<br />
wechslungsreicher <strong>und</strong> die Nacht- <strong>und</strong> Wochenenddienste fallen weniger häufig an.<br />
Gestaltungsempfehlung 19: Operationsordner erstellen<br />
Es sollte ein Ordner erstellt werden, in dem das <strong>für</strong> die jeweilige Operation benötigte Material<br />
(Instrumente, Medikamente etc.) abgebildet wird. Wenn z. B. in der Nacht ein Notfall eintrifft<br />
<strong>und</strong> eine Operation vorgenommen werden muss, dann kann diejenige Person, welche bei der<br />
Operation hilft, im Ordner nachschauen, was alles an Material benötigt wird. Dies wäre insbe-<br />
sondere dann sinnvoll, wenn vorangehender Gestaltungsvorschlag 18 umgesetzt wird. Ein<br />
solcher Ordner wäre <strong>für</strong> diejenigen, die nicht zum OPS-Team während des Tagesdienstes ge-<br />
hören <strong>und</strong> die folglich nicht täglich mit den Instrumenten arbeiten, eine Hilfe.<br />
Gestaltungsempfehlung 20: Mitarbeiterpool der Pferde- mit der Nutztierklinik<br />
Während des Nachtdienstes arbeiten ein Nachtwärter in der Pferdeklinik <strong>und</strong> einer in der<br />
Nutztierklinik. Diese beiden Dienste sollten zusammengelegt werden. Es würde sich ein Pool<br />
der Mitarbeitenden der Pferde- <strong>und</strong> der Nutztierklinik bilden, die sich den Nachtdienst teilen.<br />
Sowohl die Wärter der Pferde- als auch der Nutztierklinik sollten eine entsprechende Ausbil-<br />
dung im jeweils <strong>für</strong> sie neuen Tätigkeitsgebiet erhalten. Dadurch würde sich die Arbeit ab-<br />
wechslungsreicher gestalten <strong>und</strong> die Pfleger müssten nicht so häufig Nacht- <strong>und</strong> Wochenend-<br />
dienste leisten.<br />
Gestaltungsempfehlung 21: Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung<br />
Es ist wünschenswert, <strong>für</strong> die Wärter <strong>und</strong> <strong>für</strong> die OPS-Gehilfen Möglichkeiten zur Aus- <strong>und</strong><br />
Weiterbildung u. a. in Form von ein- bis zweitägigen Kursen anzubieten. Insbesondere Kurse<br />
zum Auffrischen von bestehendem oder Aneignen von neuem Wissen in Zusammenhang mit<br />
der Fütterung <strong>und</strong> Haltung der Tiere, dem Longieren sowie dem Umgang mit (neuen) Instru-<br />
menten etc. Da aufgr<strong>und</strong> der <strong>Personal</strong>situation (<strong>Personal</strong>mangel) Ausbildungen, die eine re-<br />
gelmässige Abwesenheit einzelner Mitarbeitenden erfordern würden, kaum möglich sind,<br />
Denise Kuonen Seite 105
Gestaltungsempfehlungen<br />
sollten intern Alternativen zur Erweiterung der Kompetenzen <strong>und</strong> Fähigkeiten gesucht <strong>und</strong><br />
ermöglicht werden.<br />
Denise Kuonen Seite 106
Schlussbetrachtungen<br />
7 Schlussbetrachtungen<br />
7.1 Überprüfung des konzeptionellen Bezugs-<br />
rahmens<br />
Im zweiten Kapitel dieser Arbeit wurden theoretische <strong>und</strong> konzeptionelle Gr<strong>und</strong>lagen mittels<br />
einer Literaturanalyse entworfen <strong>und</strong> in einem Bezugsrahmen (Kapitel 3) dargestellt, dessen<br />
Aufgabe es ist, die zahlreichen Elemente, welche ein öffentliches Unternehmen beeinflussen,<br />
zu beschreiben <strong>und</strong> zu erklären <strong>und</strong> das komplexe Zusammenspiel verschiedener Elemente zu<br />
systematisieren. Dabei gilt die Unternehmensanalyse als ein Instrument des Managements,<br />
um den Betrieb optimal zu führen. Dieser Bezugsrahmen soll im Folgenden auf seine Prakti-<br />
kabilität hin überprüft werden.<br />
Besonders die Vorgaben des Staates haben sich bei der Überprüfung des Bezugsrahmens als<br />
wichtige Rahmenbedingung <strong>für</strong> öffentliche Betriebe herausgestellt. So hat auch die Pferdekli-<br />
nik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong> viele Vorschriften <strong>und</strong> Vorgaben der öffentlichen Hand einzuhalten,<br />
v. a., was die finanzielle Situation <strong>und</strong> dadurch auch notwendige Sparmassnahmen (beim Per-<br />
sonal) betrifft.<br />
Bei der Überprüfung des Bezugsrahmens hat sich ferner gezeigt, dass insbesondere die Be-<br />
schreibung der ausserbetrieblichen <strong>und</strong> der betrieblichen Bedingungsgrössen zutreffend ist.<br />
Die personellen Rahmenbedingungen stellen bei der Durchführung einer erfolgreichen Unter-<br />
nehmensanalyse eine wichtige Einflussgrösse dar. Die Verfasserin hat bei den problemzent-<br />
rierten Interviews mit Mitarbeitenden des Hilfspersonals gesehen, wie wichtig es ist, eine<br />
Vertrauensbasis zu den Interviewten aufzubauen, damit von ihnen ehrliche Antworten geäus-<br />
sert werden, so dass ein der Wirklichkeit entsprechendes Bild des Unternehmens geliefert<br />
werden kann. Dies ist auch <strong>für</strong> die weitere Verwendung der Ergebnisse der Unternehmensana-<br />
lyse von grosser Bedeutung, da eine Unternehmensanalyse meist Konsequenzen nach sich<br />
zieht. So wird sich auch erst in Zukunft zeigen, ob sich die Situation in der Pferdeklinik der<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong> mit Hilfe dieser Unternehmensanalyse <strong>und</strong> der daraus abgeleiteten Gestal-<br />
tungsempfehlungen verbessert, so dass die im Rahmen der Lizentiatsarbeit untersuchte Ziel-<br />
gruppe (das Hilfspersonal) mit den Arbeitsbedingungen etc. wieder zufrieden ist.<br />
Denise Kuonen Seite 107
Schlussbetrachtungen<br />
7.2 Fazit <strong>und</strong> Ausblick<br />
Es kann auch in Zukunft davon ausgegangen werden, dass die Unternehmensanalyse ein<br />
wichtiges Instrument ist, um einen Betrieb erfolgreich zu analysieren <strong>und</strong> zu steuern. Die Un-<br />
ternehmensanalyse gewinnt insbesondere in der heutigen Wirtschaftslage an Bedeutung, in<br />
der viele Betriebe Kosten senken <strong>und</strong> Einsparungen machen müssen, um erfolgreich weiter<br />
bestehen zu können. Dabei hilft die Analyse, die aktuelle Situation zu widerspiegeln <strong>und</strong><br />
Schwächen bzw. potenzielle Bereiche mit Handlungsbedarf aufzuzeigen. Ferner spielt die Un-<br />
ternehmensanalyse im Zusammenhang mit der strategischen Analyse <strong>und</strong> Planung eine wich-<br />
tige Rolle. Angesichts der Tatsache, dass sich Unternehmen auch künftig strategisch neu aus-<br />
richten werden <strong>und</strong> folglich ihr Unternehmen analysieren (lassen), ist davon auszugehen, dass<br />
eine umfassende Unternehmensanalyse in Zukunft noch vermehrt zum Einsatz gelangen wird.<br />
Die vorliegende Arbeit zeigt, dass die Unternehmensanalyse ein wichtiger <strong>und</strong> nicht zu unter-<br />
schätzender Erfolgsfaktor <strong>für</strong> einen Betrieb ist.<br />
7.3 Kritische Würdigung<br />
R<strong>und</strong> sechs Monate befasste sich die Verfasserin mit dem Thema „Unternehmensanalyse in<br />
öffentlichen Betrieben. Konzeptionelle Gr<strong>und</strong>lagen – Fallstudie in der Pferdeklinik der Uni-<br />
versität <strong>Bern</strong> – Gestaltungsempfehlungen.“ Das Erarbeiten der Lizentiatsarbeit verlief gr<strong>und</strong>-<br />
sätzlich positiv <strong>und</strong> war eine lehrreiche Erfahrung. Es war sehr anregend, in ein öffentliches<br />
Unternehmen wie die Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong> Einblick zu nehmen, dessen <strong>Personal</strong><br />
kennen zu lernen, dessen Abläufe zu verstehen <strong>und</strong> die vorhandenen Probleme zu analysieren.<br />
Ebenfalls interessant gestalteten sich die verschiedenen Gespräche mit dem <strong>Personal</strong> der Pfer-<br />
deklinik, insbesondere die Gespräche mit dem Hilfspersonal in Form von problemzentriert ge-<br />
führten Interviews. Die verschiedenen Dialoge <strong>und</strong> Betrachtungsweisen halfen der Verfasse-<br />
rin, den Untersuchungsgegenstandes ganzheitlich zu erfassen <strong>und</strong> den verschiedenen Dimen-<br />
sionen der Problemstellung gerecht zu werden.<br />
Die formulierten Gestaltungsempfehlungen basieren auf der Analyse der Pferdeklinik <strong>und</strong> den<br />
Ergebnissen der geführten Interviews <strong>und</strong> Gespräche. Es wäre nun sehr interessant zu wissen,<br />
welche Gestaltungsempfehlungen von der Leitung der Pferdeklinik umgesetzt werden <strong>und</strong> zu<br />
erfahren, ob sie dazu beitragen, die Situation in der Pferdeklinik zu verbessern <strong>und</strong> die Zu-<br />
friedenheit, v. a. die des Hilfspersonals, zu erhöhen. Ebenfalls wäre es interessant zu erfahren,<br />
Denise Kuonen Seite 108
Schlussbetrachtungen<br />
welche allfälligen künftigen Änderungen notwendig sind, die im Zusammenhang mit dem<br />
Projekt VetSuisse auftreten.<br />
Denise Kuonen Seite 109
Anhang<br />
Anhang<br />
INTERVIEWLEITFADEN<br />
1. Begrüssung <strong>und</strong> Einleitung<br />
1.1 Einleitung<br />
Zuerst einmal möchte ich Ihnen danken, dass Sie sich Zeit nehmen <strong>für</strong> dieses Gespräch. Mein<br />
Name ist Denise Kuonen <strong>und</strong> ich studiere an der <strong>Universität</strong> Betriebswirtschaftslehre. Zurzeit<br />
verfasse ich meine Abschlussarbeit am <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Organisation</strong> <strong>und</strong> <strong>Personal</strong>. Diese Ab-<br />
schlussarbeit mache ich in Zusammenarbeit mit der Pferdeklinik der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong> über<br />
das Thema Unternehmensanalyse in öffentlichen Betrieben. Anhand einiger problemzentrier-<br />
ten Interviews möchte ich untersuchen, was die vorhandenen Probleme beim Hilfspersonal<br />
(dazu gehören die Wärter <strong>und</strong> die OPS-Gehilfen) in Bezug auf die allgemeine Situation, die<br />
interne Kommunikation <strong>und</strong> die Prozesse/Abläufe sind. Aus diesem Gr<strong>und</strong> habe ich Sie ange-<br />
fragt, mit mir dieses Interview durchzuführen.<br />
1.2 Ziel des Interviews<br />
Das Ziel dieses Interviews ist, Erkenntnisse über die vorhandenen Probleme beim Hilfsperso-<br />
nal <strong>und</strong> über deren individuellen Bedürfnisse sowie Verbesserungsvorschläge aus ihrer Sicht<br />
zu gewinnen. Nur so können effektive Gestaltungsempfehlungen formuliert <strong>und</strong> notwendige<br />
Massnahmen eingeleitet werden.<br />
1.3 Dauer des Gesprächs<br />
Das Gespräch dauert r<strong>und</strong> 90 Minuten.<br />
1.4 Anonymität<br />
Ich werde dieses Interview im Sinne eines Gesprächs führen. Ich halte mich dabei an einen<br />
Gesprächsleitfaden, welcher aber nur die grobe Struktur des Gespräches vorgibt. So können<br />
Sie sich offen äussern.<br />
Ich garantiere Ihnen absolute Diskretion im Umgang mit Ihren Äusserungen. Niemand ausser<br />
mir wird Einblick in das Protokoll unseres Gespräches haben. Es werden nur Gesamtergeb-<br />
Denise Kuonen Seite 110
Anhang<br />
nisse in meiner Lizentiatsarbeit weitergegeben, woraus keine Rückschlüsse auf die Befragten<br />
möglich sind.<br />
Wenn Sie einverstanden sind, werde ich das Interview auf Tonband aufnehmen. Das Ge-<br />
spräch kann so ungestört ablaufen <strong>und</strong> es erleichtert mir die nachträgliche Bearbeitung we-<br />
sentlich. Die Aufnahme wird selbstverständlich anschliessend gelöscht. Sind Sie damit ein-<br />
verstanden? Haben Sie bis dahin irgendwelche Fragen? Wenn es Ihnen recht ist, schalte ich<br />
nun das Tonband ein <strong>und</strong> beginne mit dem Interview (falls nicht einverstanden, wird das Ge-<br />
spräch laufend schriftlich protokolliert).<br />
2. Fragen<br />
Die Kernfragen sind in fetter Schrift dargestellt. Diese Fragen sollten wenn möglich allen Ge-<br />
sprächspartnerinnen <strong>und</strong> Gesprächspartnern gestellt werden. Die Zusatzfragen innerhalb der<br />
Kernfragen können je nach Verlauf eingebracht werden. Sie dienen der Vertiefung <strong>und</strong> allfäl-<br />
liger Präzisierung der Kernfragen. Sie werden gestellt, wenn die Gesprächspartnerin oder der<br />
Gesprächspartner beim Antworten Mühe bek<strong>und</strong>et oder sich nicht von selbst ausführlich äus-<br />
sert.<br />
EINSTIEG<br />
1. Wie lange arbeiten Sie schon in der Pferdeklinik?<br />
2. Können Sie kurz Ihr Tätigkeitsfeld vorstellen?<br />
� Als was arbeiten Sie?<br />
� Was sind Ihre Aufgaben?<br />
ALLGEMEINE SITUATION BEIM HILFSPERSONAL<br />
3. Arbeiten Sie gerne in der Pferdeklinik?<br />
� Macht Ihnen die Arbeit Spass?<br />
4. Sind Sie mit dem Betriebsklima zufrieden?<br />
� Sind Unzufriedenheiten vorhanden?<br />
5. Wer ist Ihr Vorgesetzter?<br />
6. Wie ist das Verhältnis des Hilfspersonals zum Vorgesetzten?<br />
Denise Kuonen Seite 111
Anhang<br />
7. Wie beschreiben Sie das Arbeitsverhältnis der Kolleginnen <strong>und</strong> Kollegen unter-<br />
einander?<br />
� Wie ist der Umgang zwischen den Arbeitskolleginnen <strong>und</strong> -kollegen?<br />
� Kameradschaftlich? Fre<strong>und</strong>schaftlich?<br />
� Konkurrenzdenken? Mobbing?<br />
� Sind Spannungen vorhanden? Falls<br />
ja, was wird getan, um sie zu lösen?<br />
8. Wie<br />
ist Ihr Verhältnis zu den Arbeitskolleginnen <strong>und</strong> -kollegen?<br />
� Wie gehen Sie mit Ihren Kolleginnen <strong>und</strong> Kollegen um?<br />
9. Bestehen<br />
Fre<strong>und</strong>schaften ausserhalb der Arbeit?<br />
10. Sind Ihrer Meinung nach Ihre Kolleginnen <strong>und</strong> Kollegen<br />
motiviert zu arbeiten?<br />
11. In der Pferdeklinik sind verschiedene Problemfelder vorhanden. Eines davon ist<br />
u. a. die allgemeine unbefriedigende Situation bei den Wärtern <strong>und</strong> OPS-<br />
Gehilfen. Was sind Ihrer Meinung nach die Hauptgründe der Unzufriedenheit<br />
des Hilfspersonals?<br />
12. Was <strong>für</strong> Probleme existieren?<br />
� In Bezug auf das Betriebsklima?<br />
� In Bezug auf die Arbeitskollegen/ Kolleginnen?<br />
13. Was sollte diesbezüglich wie geändert werden, damit<br />
der Betrieb besser funktio-<br />
niert <strong>und</strong> die Mitarbeitenden wieder zufrieden sind?<br />
� Wie könnte man die Situation verbessern?<br />
INTERNE KOMMUNIKATION<br />
14.<br />
Wie sieht die allgemeine Kommunikationssituation in der Pferdeklinik aus?<br />
� Wird viel <strong>und</strong> oft miteinander gesprochen?<br />
� Oder nur das Nötigste?<br />
15. Werden Sie über das allgemeine Geschehen in der Pferdeklinik informiert?<br />
� Z. B. neu angestellte Mitarbeitende?<br />
� Z. B. Mitarbeitende, die kündigen/denen<br />
gekündigt wird?<br />
� Z. B. bei neuen Bauvorhaben?<br />
� Falls ja, sind diese Informationen<br />
Ihrer Meinung nach ausreichend?<br />
Denise Kuonen Seite 112
Anhang<br />
16. Werden Ihnen <strong>für</strong> Ihre Tätigkeit spezifische Informationen kommuniziert?<br />
� Z. B. zu „Patienten“?<br />
� Z. B. über Medikamente?<br />
� Z. B. Dienstplanänderungen?<br />
� Z. B. Ferienabwesenheiten?<br />
� Falls ja, sind diese Informationen ausreichend?<br />
17. Wie sieht die Informationsweitergabe beim Dienstwechsel aus?<br />
18. Ist die Qualität Ihrer Arbeit durch ungenügende Informationsvermittlung bzw.<br />
Kommunikation beeinträchtigt?<br />
19. Sind mehr Kommunikation <strong>und</strong> Information wünschenswert?<br />
� Falls ja, was <strong>für</strong> Informationen?<br />
� Falls ja, mit wem ist mehr Kommunikation wünschenswert?<br />
20. Wer informiert Sie?<br />
� Vorgesetzter?<br />
� Kolleginnen <strong>und</strong> Kollegen?<br />
� Sekretärin?<br />
21. An wen geben Sie Informationen weiter?<br />
� Wen haben Sie zu informieren?<br />
� Was <strong>für</strong> Informationen sind das?<br />
22. Um mit den Mitarbeitenden zu kommunizieren bzw. um sie zu informieren, gibt<br />
es in der Theorie eine Vielzahl von Instrumenten der internen Kommunikation<br />
wie bspw. Informationsveranstaltungen, regelmässige Sitzungen, Gespräche,<br />
Mitarbeiterzeitung, Betriebsausflüge, Intranet/Internet etc. Wie wird in der<br />
Pferdeklinik kommuniziert bzw. welche Instrumente werden eingesetzt?<br />
23. Was <strong>für</strong> (weitere) Probleme hinsichtlich der Kommunikation innerhalb der<br />
Pferdeklinik sind vorhanden?<br />
24. Was sollte diesbezüglich Ihrer Meinung nach geändert werden?<br />
� Z. B. regelmässige Sitzungen? Gespräche?<br />
Denise Kuonen Seite 113
Anhang<br />
ORGANISATION UND ARBEITSABLÄUFE (PROZESSE)<br />
25. Gibt es <strong>für</strong> das Hilfspersonal Unsicherheiten hinsichtlich der Aufgabenvertei-<br />
lung?<br />
� Z. B. ungeeignete Aufgabenzuordnung?<br />
26. Haben Sie bei der Erledigung Ihrer Arbeit genügend Kompetenzen oder existie-<br />
ren Unsicherheiten bezüglich der Kompetenzverteilung?<br />
� Falls ja, in welchem Umfang?<br />
27. Wird Ihnen bei der Erledigung Ihrer Arbeit genügend Verantwortung einge-<br />
räumt?<br />
28. Gibt es in der Pferdeklinik Stellenbeschreibungen <strong>und</strong> Dokumentationen der Ar-<br />
beitsabläufe?<br />
� Falls ja, werden sie eingesetzt? Im Wesentlichen beachtet?<br />
� Falls ja, steuern sie die Unternehmensabläufe optimal?<br />
� Falls nein, sind diese wünschenswert (z. B. beim Einarbeiten neuer Mitarbei-<br />
tenden)?<br />
29. Gibt es klare Stellvertretungsregeln?<br />
� Bei Krankheit? Ferienabwesenheit?<br />
� Unerwarteter Ausfall?<br />
30. Treten Schwierigkeiten auf, wenn Mitarbeitende ausfallen z. B. im Rahmen von<br />
Ferien?<br />
� Was <strong>für</strong> Schwierigkeiten? Beim Ausfall welcher Personen?<br />
31. Können Sie problemlos die Ihnen zustehenden Ferientage beziehen?<br />
� Falls nein, was <strong>für</strong> Probleme gibt es (bspw. selber eine Stellvertretung organi-<br />
sieren)?<br />
32. Wie würden Sie die Stellung Ihres Vorgesetzten beschreiben? (evt. Varianten<br />
Vorlesen)<br />
� Unersetzlich, sehr stark mit Arbeit überlastet?<br />
� Auch <strong>für</strong> kurze Zeit schwer zu ersetzen <strong>und</strong> stark belastet?<br />
� Für 2-3 Wochen ersetzbar, aber langfristig aufgr<strong>und</strong> seiner Erfahrungen <strong>und</strong><br />
Kontakte sehr wichtig?<br />
� Die Aufgaben des Vorgesetzten könnten auch von einem Vertreter wahrge-<br />
nommen werden?<br />
� Das Unternehmen würde auch ohne ihn problemlos funktionieren?<br />
Denise Kuonen Seite 114
Anhang<br />
33. Gibt es im Betrieb sinnvolle, effiziente <strong>und</strong> weitgehend störungsfreie Arbeitspro-<br />
zesse?<br />
� Welche Prozesse laufen problemlos ab?<br />
34. Gibt es Prozesse, die nicht problemlos ablaufen?<br />
� Z. B. langes Warten (durch technische Probleme, Notfälle etc.)?<br />
� Z.B. durch andere Mitarbeitende (durchgestellte Telefonate der Sekretärin<br />
etc.)?<br />
� Falls ja, was <strong>für</strong> Prozesse?<br />
� Was <strong>für</strong> Störungen sind vorhanden?<br />
35. Wie viele Nacht- bzw. Notfalldienste leisten Sie pro Monat?<br />
36. Finden Sie die Anzahl Nachtdienste pro Monat zumutbar?<br />
� Falls nicht, an wie vielen Nacht- bzw. Notfalldiensten wären Sie maximal be-<br />
reit, zu arbeiten?<br />
37. Und an wie vielen Wochenenden pro Monat arbeiten Sie?<br />
38. Finden Sie die Anzahl Wochenenddienste pro Monat zumutbar?<br />
� Falls nicht, an wie vielen Wochenenden wären Sie maximal bereit zu abreiten?<br />
39. Wie viele Leute des Hilfspersonals arbeiten während der Woche hindurch pro<br />
Tag in der Klinik?<br />
40. Sind dies genügend Personen? Wird die Arbeit mit dieser Anzahl an <strong>Personal</strong> zu-<br />
frieden stellend erledigt?<br />
� Falls ja, könnte die Arbeit auch mit weniger <strong>Personal</strong> erledigt werden?<br />
� Falls nein, wie viele Personen wären wünschenswert?<br />
41. Wie viele Personen des Hilfspersonals arbeiten während des Nacht- bzw. Notfall-<br />
dienstes?<br />
42. Sind dies genügend Personen, um die Arbeit zu erledigen?<br />
� Falls ja, könnte die Arbeit auch mit weniger <strong>Personal</strong> erledigt werden?<br />
� Falls nein, wie viele Personen wären wünschenswert?<br />
43. Wie viele Personen des Hilfspersonals arbeiten am Wochenende?<br />
44. Sind dies Ihrer Meinung nach genügend Personen?<br />
� Falls ja, könnte die Arbeit auch mit weniger <strong>Personal</strong> erledigt werden?<br />
� Falls nein, wie viele Personen wären wünschenswert?<br />
45. Sind Sie mit der Arbeit überlastet?<br />
� Falls ja, wann (während des Nacht- bzw. Notfalldienstes, am Tag etc.)?<br />
� Falls ja, wie könnte man Ihrer Meinung nach dieses Problem lösen?<br />
Denise Kuonen Seite 115
Anhang<br />
46. Machen Sie Überst<strong>und</strong>en?<br />
47. Falls ja, wie viele St<strong>und</strong>en ungefähr pro Monat?<br />
� Wird Ihnen die Überzeit ausbezahlt?<br />
� Oder können Sie diese Zeit kompensieren?<br />
� Gibt es Probleme beim Kompensieren der Überzeit?<br />
48. Was <strong>für</strong> (weitere) Probleme existieren in Bezug auf den Arbeitsablauf?<br />
� Arbeitszyklus?<br />
� Arbeitsbedingungen?<br />
49. Wie könnte man diese Probleme Ihrer Meinung nach lösen?<br />
50. Sind Sie mit dem Gehalt zufrieden?<br />
� Werden Sie angemessen entlöhnt?<br />
51. Gibt es „Ungleichheiten“ (oder „Ungerechtigkeiten“) in Bezug auf die Entlöh-<br />
nung?<br />
� Z. B. beim Nachtdienst oder beim Wochenenddienst im Vergleich zum Tages-<br />
dienst?<br />
� Z. B während des Dienstes auf Abruf (im Vergleich zu den OPS-Gehilfen bzw.<br />
Pferdepflegern)?<br />
52. Was <strong>für</strong> Qualifikationen <strong>und</strong> Anforderungen muss man als Wärter bzw. als OPS-<br />
Gehilfe mitbringen?<br />
� Kraft bei körperlichen Anstrengungen?<br />
� Allgemeines Wissen über Pferde?<br />
� Spezifische Pferdekenntnisse (wie Krankheiten)? Vertrautheit mit dem Tier?<br />
� „psychische“ Anforderungen (bspw. beim Töten <strong>und</strong> Entsorgen von Tieren)?<br />
53. Wie werden neue Mitarbeitende eingelernt?<br />
� Learning by doing?<br />
� Anhand von Einführungskursen? Falls nein, wären diese wünschenswert?<br />
54. Gibt es Beschreibungen der Abläufe in Form von z. B. Dokumenten <strong>für</strong> die neuen<br />
Mitarbeitenden?<br />
� Falls nein, wären diese wünschenswert?<br />
55. Gibt es Aus- <strong>und</strong> Weiterbildungsmöglichkeiten <strong>für</strong> das Hilfspersonal? Sind Defi-<br />
zite vorhanden?<br />
� Falls ja, was <strong>für</strong> welche?<br />
� Falls nein, sind Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung wünschenswert? In welchem Rah-<br />
men?<br />
Denise Kuonen Seite 116
Anhang<br />
SCHLUSS<br />
56. Gibt es aus Ihrer Sicht noch einen Aspekt im Zusammenhang mit den vorhande-<br />
nen Problemfeldern in der Pferdeklinik, den wir im Gespräch nicht behandelt<br />
haben, den Sie aber noch gerne diskutiert hätten?<br />
PERSÖNLICHE ANGABEN<br />
Name:<br />
Vorname:<br />
Wir sind am Ende unseres Interviews angekommen. Ich bedanke mich <strong>für</strong> dieses<br />
aufschlussreiche Gespräch!<br />
Denise Kuonen Seite 117
Literaturverzeichnis<br />
Literaturverzeichnis<br />
Acker, Heinrich B. (1966)<br />
<strong>Organisation</strong>sanalyse. Verfahren <strong>und</strong> Techniken praktischer <strong>Organisation</strong>sarbeit, 5.<br />
Auflage, Baden-Baden/Bad Homburg vor der Höhe 1966<br />
Aeberhard, Kurt (1996)<br />
Strategische Analyse. Empfehlungen zum Vorgehen <strong>und</strong> zu sinnvollen Methodenkom-<br />
binationen, <strong>Bern</strong> u. a. 1996<br />
Albert, Franz-Werner (1997)<br />
Betriebsleitung – eine ärztliche Aufgabe. In: Klinikmanagement. Erfolgsstrategien <strong>für</strong><br />
die Zukunft, hrsg. v. Eduard Zwierlein, München/Wien/Baltimore 1997, S. 355-368<br />
Atteslander, Peter (1995)<br />
Methoden der empirischen Sozialforschung, 8. Auflage, Berlin/New York 1995<br />
Born, Karl (2003)<br />
Unternehmensanalyse <strong>und</strong> Unternehmensbewertung, 2. aktualisierte <strong>und</strong> erweiterte Auf-<br />
lage, Stuttgart 2003<br />
Brede, Helmut (2001)<br />
Gr<strong>und</strong>züge der Öffentlichen Betriebswirtschaftslehre, München/Wien 2001<br />
Bruns, Gerhard/Knab, Barbara/Hagspiel, Daniel (1999)<br />
Unternehmensanalyse mit System. In: <strong>Personal</strong>wirtschaft, Jg. 26 1999, Nr. 4, S. 61-65<br />
Chmielewicz, Klaus (1989)<br />
Öffentliche Unternehmen. In: Handwörterbuch der Öffentlichen Betriebswirtschaft,<br />
hrsg. v. Klaus Chmielewicz <strong>und</strong> Peter Eichhorn, Stuttgart 1989, Sp. 1093-1105<br />
Diekmann, Andreas (2004)<br />
Empirische Sozialforschung. Gr<strong>und</strong>lagen, Methoden, Anwendungen, 11. Auflage, Rein-<br />
bek bei Hamburg 2004<br />
Denise Kuonen Seite 118
Literaturverzeichnis<br />
Dieterle, Robert/Abplanalp, Franz (1990)<br />
Kostenrechnung. Der Zusammenhang zwischen Buchhaltung, Betriebsabrechnung,<br />
Kalkulation, Betriebsanalyse, 2. überarbeitete Auflage, <strong>Bern</strong>/Stuttgart 1990<br />
Eichhorn, Peter (1986)<br />
Begriff, Bedeutung <strong>und</strong> Besonderheiten der öffentlichen Wirtschaft <strong>und</strong> Gemeinwirt-<br />
schaft. In: Die Unternehmen der öffentlichen Wirtschaft in der B<strong>und</strong>esrepublik<br />
Deutschland, ein Handbuch, hrsg. v. Helmut Brede u. a., Baden-Baden 1986, S. 13-29<br />
Eichhorn, Peter (2002)<br />
Öffentliches Unternehmen. In: Verwaltungslexikon, 3. Auflage, hrsg. v. Peter Eichhorn<br />
u. a., Baden-Baden 2002, S. 754-757<br />
Eichhorn, Siegfried (1987)<br />
Krankenhausbetriebslehre – Theorie <strong>und</strong> Praxis der Krankenhausleistungsrechnung,<br />
Bd. 3, Köln 1987<br />
Eidgenössisches Finanzdepartement (2004)<br />
Leicht positiver Rechnungsabschluss <strong>für</strong> die öffentlichen Gemeinwesen im Jahr 2002.<br />
[Online] URL: http://www.efd.admin.ch/d/dok/medien/medienmitteilun-<br />
gen/2004/08/rechnungsabschluss.htm, 23. August 2004<br />
Etienne, Michèle (2000)<br />
Total Quality Management (TQM) im Spital. Empfehlungen zur erfolgreichen Gestal-<br />
tung, <strong>Bern</strong>/Stuttgart/Wien 2000<br />
Friedli, Vera (2002)<br />
Die betriebliche Karriereplanung. Konzeptionelle Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> empirische Studien<br />
aus der Unternehmensperspektive, <strong>Bern</strong>/Stuttgart/Wien 2002<br />
Friedrichs, Jürgen/Lüdtke, Hartmut (1973)<br />
Teilnehmende Beobachtung. Einführung in die sozialwissenschaftliche Feldforschung,<br />
2. überarbeitete <strong>und</strong> erweiterte Auflage, Weinheim/Basel 1973<br />
Gärtner, Heribert W. (1997)<br />
Das Krankenhaus als System. In: Klinikmanagement. Erfolgsstrategien <strong>für</strong> die Zukunft,<br />
hrsg. v. Eduard Zwierlein, München/Wien/Baltimore 1997, S. 119-138<br />
Denise Kuonen Seite 119
Literaturverzeichnis<br />
Greiner, Gabriela (2001)<br />
Unternehmenskultur als kritischer Erfolgsfaktor bei Integrationsprozessen in Spitälern.<br />
Konzeptionelle Gr<strong>und</strong>lagen – Fallstudie – Gestaltungsempfehlungen, Lizentiatsarbeit<br />
am <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Organisation</strong> <strong>und</strong> <strong>Personal</strong> der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong>, <strong>Bern</strong> 2001<br />
Grochla, Erwin (1978)<br />
Einführung in die <strong>Organisation</strong>stheorie, Stuttgart 1978<br />
Grochla, Erwin (1995)<br />
Gr<strong>und</strong>lagen der organisatorischen Gestaltung, Stuttgart 1995<br />
Grünig, Rudolf/Kühn, Richard (2000)<br />
Methodik der strategischen Planung. Ein prozessorientierter Ansatz <strong>für</strong> Strategiepla-<br />
nungsprojekte, 2. Auflage, <strong>Bern</strong>/Stuttgart/Wien 2000<br />
Gutenberg, Erich (1976)<br />
Gr<strong>und</strong>lagen der Betriebswirtschaftslehre, Bd. 2: Der Absatz, 15. neubearbeitete <strong>und</strong> er-<br />
weiterte Auflage, Berlin u. a. 1976<br />
Hammer, Michael/Champy, James (1994)<br />
Business Reengineering. Die Radikalkur <strong>für</strong> das Unternehmen, Frankfurt am Main 1994<br />
Heise, Norman (2000)<br />
Kommunikation im Unternehmen. Interne Unternehmenskommunikation als gr<strong>und</strong>le-<br />
gender Bestandteil der <strong>Organisation</strong>sentwicklung, Frankfurt 2000<br />
Himmelmann, Gerhard (1992)<br />
Öffentliche Unternehmen im Strukturwandel. In: Beiträge zur Theorie öffentlicher Un-<br />
ternehmen, hrsg. v. Peter Friedrich, Baden-Baden 1992, S. 10-19<br />
Hörschgen, Hans u. a. (1993)<br />
Marketing-Strategien. Konzepte zur Strategienbildung im Marketing, 2. überarbeitete<br />
<strong>und</strong> erweiterte Auflage, Ludwigsburg 1993<br />
Jenni, André (2002)<br />
Unterschiede im Management öffentlicher <strong>und</strong> privater Unternehmen. Literaturanalyse,<br />
Lizentiatsarbeit am <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Organisation</strong> <strong>und</strong> <strong>Personal</strong> der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong>, <strong>Bern</strong><br />
2002<br />
Denise Kuonen Seite 120
Literaturverzeichnis<br />
Kaiser, Franz-Josef (Hrsg.) (1983)<br />
Die Fallstudie. Theorie <strong>und</strong> Praxis der Fallstudiendidaktik, Bad Heilbrunn 1983<br />
Klöfer, Franz (Hrsg.) (1999)<br />
Erfolgreich durch interne Kommunikation Mitarbeiter informieren, motivieren, aktivie-<br />
ren, Neuwied/Kriftel 1999<br />
Knolmayer, Gerhard (2004)<br />
BWL II: Methoden der Betriebswirtschaftslehre, Skriptum zur Vorlesung des Sommer-<br />
semesters 2004 an der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong>, <strong>Bern</strong> 2004<br />
Kreikebaum, Hartmut (1991)<br />
Strategische Unternehmensplanung, Stuttgart/Berlin/Köln 1991<br />
Kreilkamp, Edgar (1987)<br />
Strategisches Management <strong>und</strong> Marketing. Markt- <strong>und</strong> Wettbewerbsanalyse, strategi-<br />
sche Frühaufklärung, Portfolio-Management, Berlin/New York 1987<br />
Kubicek, Herbert/Thom, Norbert (1976)<br />
Umsystem, betriebliches. In: Handwörterbuch der Betriebswirtschaft, 4. völlig neu ges-<br />
taltete Auflage, hrsg. v. Erwin Grochla <strong>und</strong> Waldemar Wittmann, Stuttgart 1976,<br />
Sp. 3977-4017<br />
Lombriser, Roman/Abplanalp, Peter A. (2004)<br />
Strategisches Management. Visionen entwickeln, Strategien umsetzen, Erfolgspotenzia-<br />
le aufbauen, 3. vollständig überarbeitete <strong>und</strong> erweiterte Auflage, Zürich 2004<br />
Lutz, Jürg (2004)<br />
Zusammenschlüsse öffentlicher Unternehmen. Kooperationen <strong>und</strong> Fusionen im Spital-<br />
sektor, <strong>Bern</strong>/Stuttgart/Wien 2004<br />
Marchon, Nicole (2002)<br />
Total Quality Management im Spital. Konzeptionelle Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> die Umsetzung in<br />
einer psychiatrischen Klinik anhand des KTQ ® -Modells, Lizentiatsarbeit am <strong>Institut</strong> <strong>für</strong><br />
<strong>Organisation</strong> <strong>und</strong> <strong>Personal</strong> der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong>, <strong>Bern</strong> 2002<br />
Mayntz, Renate (1963)<br />
Soziologie der <strong>Organisation</strong>, Reinbek 1963<br />
Denise Kuonen Seite 121
Literaturverzeichnis<br />
Mayring, Philipp (2002)<br />
Einführung in die qualitative Sozialforschung. Ein Anleitung zu qualitativem Denken,<br />
5. überarbeitete <strong>und</strong> neu ausgestattete Auflage, Weinheim/Basel 2002<br />
Meier, Philip (2002)<br />
Kommunikation im Unternehmen. Von der Hauszeitung bis zum Intranet, Zürich 2002<br />
Morra, Francesco (1996)<br />
Wirkungsorientiertes Krankenhausmanagement. Ein Führungshandbuch, <strong>Bern</strong>/Stutt-<br />
gart/Wien 1996<br />
Moser, Fritz (2002)<br />
Wirksamkeit von Outdoor-Trainings in der Managemententwicklung: Konzeptionelle<br />
Gr<strong>und</strong>lagen – Evaluation des Nutzens – Gestaltungsempfehlungen, Lizentiatsarbeit am<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Organisation</strong> <strong>und</strong> <strong>Personal</strong> der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong>, <strong>Bern</strong> 2002<br />
Müller, Renato C. (2003)<br />
<strong>Personal</strong>management in Maturitätsschulen. Konzeptionelle Gr<strong>und</strong>lagen – Fallstudie –<br />
Gestaltungsempfehlungen, Lizentiatsarbeit am <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Organisation</strong> <strong>und</strong> <strong>Personal</strong><br />
der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong>, <strong>Bern</strong> 2003<br />
Pasquier, Martial (2004)<br />
Unternehmens- <strong>und</strong> Marketingkommunikation (Kommunikationsinstrumente). [Online]<br />
URL: http://www.imu.unibe.ch/rk/downloads/ukomm/kapitel6_2.pdf, 16. Juni 2004<br />
Pfohl, Hans-Christian/Krings, Michael/Betz, Germar (1996)<br />
Techniken der prozessorientierten <strong>Organisation</strong>sanalyse. In: Zeitschrift Führung <strong>und</strong><br />
<strong>Organisation</strong> (zfo), Jg. 65. 1996, Nr. 4, S. 246-251<br />
Picot, Arnold/Franck, Egon (1996)<br />
Prozessorganisation. Eine Bewertung der neuen Ansätze aus Sicht der <strong>Organisation</strong>sleh-<br />
re. In: Prozessmanagement <strong>und</strong> Reengineering. Die Praxis im deutschsprachigen Raum,<br />
hrsg. von Michael Nippa <strong>und</strong> Arnold Picot, Frankfurt/New York 1996<br />
Pippke, Wolfgang (1989)<br />
Berufsbeamtentum. In: Handwörterbuch der Öffentlichen Betriebswirtschaft, hrsg. v.<br />
Chmielewicz Klaus <strong>und</strong> Peter Eichhorn, Stuttgart 1989, Sp. 86-93<br />
Denise Kuonen Seite 122
Literaturverzeichnis<br />
Porter, Michael E. (1999)<br />
Wettbewerbsstrategie. Methoden zur Analyse von Branchen <strong>und</strong> Konkurrenten, 10.<br />
durchgesehene <strong>und</strong> erweiterte Auflage, Frankfurt/New York 1999<br />
Prosch, <strong>Bern</strong>hard (2000)<br />
Praktische <strong>Organisation</strong>sanalyse. Ein Arbeitsbuch <strong>für</strong> Berater <strong>und</strong> Führende, Leonberg<br />
2000<br />
Pümpin, Cuno B. (1992)<br />
Strategische Erfolgspositionen. Methodik der dynamischen strategischen Unterneh-<br />
mensführung, <strong>Bern</strong>/Stuttgart 1992<br />
Redli, Markus (1984)<br />
Unternehmerische Führung öffentlicher Betriebe. In: Zur Zukunft von Staat <strong>und</strong> Wirt-<br />
schaft in der Schweiz, Festschrift <strong>für</strong> B<strong>und</strong>esrat Dr. Kurt Furgler zum 60. Geburtstag,<br />
hrsg. v. Otto K. Kaufmann, Arnold Koller <strong>und</strong> Alois Riklin, Zürich/Köln 1984,<br />
S. 197-203<br />
Richli, Paul (1996)<br />
Öffentliches Dienstrecht im Zeichen des New Public Management, <strong>Bern</strong> 1996<br />
Roethlisberger, Fritz J./Dickson, William J. (1939)<br />
Management and the Worker. An Account of a Research Program Conducted by the<br />
Western Electric Company, Hawthorne Works, Chicago 1939<br />
Salzgeber, Réanne (2001)<br />
Erfolgsfaktoren des Projektmanagements bei der Durchführung von Fusionen in der<br />
B<strong>und</strong>esverwaltung, Lizentiatsarbeit am <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Organisation</strong> <strong>und</strong> <strong>Personal</strong> der Uni-<br />
versität <strong>Bern</strong>, <strong>Bern</strong> 2001<br />
Schnell, Rainer/Hill, Paul B./Esser, Elke (1993)<br />
Methoden der empirischen Sozialforschung, 4. Auflage, München/Wien/Oldenbourg<br />
1993<br />
Schnettler, Albert (1958)<br />
Betriebsanalyse, Stuttgart 1958<br />
Denise Kuonen Seite 123
Literaturverzeichnis<br />
Schreyögg, Georg (1984)<br />
Unternehmensstrategie. Gr<strong>und</strong>fragen einer Theorie strategischer Unternehmensführung,<br />
Berlin/New York 1984<br />
Schwander, Pirmin (1996)<br />
Von der Unternehmensanalyse zum Erfolg. In: Der Organisator, Jg. 78 1996, Nr. 10,<br />
S. 19-21<br />
Sigg, Oswald (1996)<br />
Die politische Schweiz, Zürich 1996<br />
Simgen-Weber, Barbara/Schmitz, Jürgen (2003)<br />
Ratingvorbereitung auf Basel II (Kennzahlen <strong>und</strong> Frühwarnsysteme bereiten den Weg).<br />
[Online] URL: http://www.codex.ch/ch/pdf2003/aktuell1-03.pdf, 16. Juni 2004<br />
Simon, Hermann (2002)<br />
Strategie <strong>und</strong> Unternehmenskultur. In: Unternehmenskultur <strong>und</strong> Strategie. Herausforde-<br />
rungen im globalen Wettbewerb, hrsg. v. Hermann Simon, Frankfurt am Main 2002,<br />
S. 33-38<br />
Stein, Friedrich A. (1998)<br />
Realtypologie der Management-Leistung öffentlicher Unternehmen, Baden-Baden 1998<br />
Steiner, Reto (2002)<br />
Interkommunale Zusammenarbeit <strong>und</strong> Gemeindezusammenschlüsse in der Schweiz.<br />
Erklärungsansätze, Umsetzungsmöglichkeiten <strong>und</strong> Erfolgsaussichten, <strong>Bern</strong>/Stutt-<br />
gart/Wien 2002<br />
Steinmann, Horst/Schreyögg, Georg (1993)<br />
Management: Gr<strong>und</strong>lagen der Unternehmensführung. Konzepte – Funktionen – Fallstu-<br />
dien, Wiesbaden 1993<br />
Stettler, Frank/Falk, Juliane (1997)<br />
Unternehmenskommunikation. Ein zentraler Erfolgsfaktor <strong>für</strong> Ges<strong>und</strong>heitseinrichtun-<br />
gen. In: Klinikmanagement. Erfolgsstrategien <strong>für</strong> die Zukunft, hrsg. von Eduard Zwier-<br />
lein, München/Wien/Baltimore 1997, S. 455-467<br />
Denise Kuonen Seite 124
Literaturverzeichnis<br />
Thom, Norbert/Ritz, Adrian (2000)<br />
Public Management, Wiesbaden 2000<br />
Thom, Norbert/Wenger, Andreas P. (2002)<br />
Die effiziente <strong>Organisation</strong>. Bewertung <strong>und</strong> Auswahl von <strong>Organisation</strong>sformen,<br />
Glattbrugg 2002<br />
Thommen, Jean-Paul (1996)<br />
Betriebswirtschaftslehre, Bd. 1: Unternehmung <strong>und</strong> Umwelt, Marketing, Material- <strong>und</strong><br />
Produktionswirtschaft, 4. Auflage, Zürich 1996<br />
Tschandl, Gerhard (1996)<br />
Betriebsanalysen. Praxisnahes Arbeitshandbuch <strong>für</strong> Unternehmer, Wirtschaftsberater<br />
<strong>und</strong> Controller, Wien 1996<br />
Ulrich, Hans (1978)<br />
Unternehmungspolitik, <strong>Bern</strong>/Stuttgart 1978<br />
Ulrich, Peter/Fluri, Edgar (1992)<br />
Management. Eine konzentrierte Einführung, 6. überarbeitete <strong>und</strong> ergänzte Auflage,<br />
<strong>Bern</strong>/Stuttgart 1992<br />
Varian, Hal R. (1994)<br />
Mikroökonomie, 3. Auflage, München/Wien 1994<br />
Vogel, Stefan (2000)<br />
Der Staat als Marktteilnehmer, Zürich 2000<br />
Wöhe, Günter (2002)<br />
Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 21. neubearbeitete Auflage,<br />
München 2002<br />
Zaugg, Robert J. (1996)<br />
Integrierte <strong>Personal</strong>bedarfsdeckung. Ausgewählte Gestaltungsempfehlungen zur Ge-<br />
winnung ganzheitlicher <strong>Personal</strong>potentiale, <strong>Bern</strong> 1996<br />
Zaugg, Robert J. (2002a)<br />
Bezugsrahmen als Heuristik der explorativen Forschung. Gr<strong>und</strong>lagen – Bezugsrahmen<br />
– Forschungsstrategien – Forschungsmethoden, <strong>Bern</strong> 2002<br />
Denise Kuonen Seite 125
Literaturverzeichnis<br />
Zaugg, Robert J. (2002b)<br />
Fallstudien als Forschungsdesign der Betriebswirtschaftslehre. Anleitung zur Erarbei-<br />
tung von Fallstudien, <strong>Bern</strong> 2002<br />
Zimmermann, Ekkart (1972)<br />
Das Experiment in den Sozialwissenschaften, Stuttgart 1972<br />
Denise Kuonen Seite 126
Selbstständigkeitserklärung<br />
Selbstständigkeitserklärung<br />
Ich erkläre hiermit, dass ich diese Arbeit selbstständig verfasst <strong>und</strong> keine anderen als die an-<br />
gegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäss aus Quellen<br />
entnommen wurden, habe ich als solche kenntlich gemacht. Mir ist bekannt, dass andernfalls<br />
der Senat gemäss dem Gesetz über die <strong>Universität</strong> zum Entzug des auf Gr<strong>und</strong> dieser Arbeit<br />
verliehenen Titels berechtigt ist.<br />
<strong>Bern</strong>, 24. September 2004 Denise Kuonen<br />
Denise Kuonen Seite 127