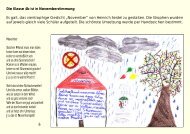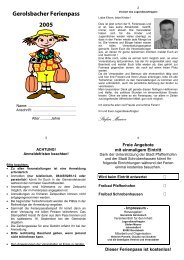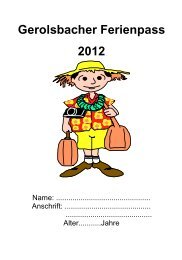Revierkurier - Neu!
Revierkurier - Neu!
Revierkurier - Neu!
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
B 47654 Ausgabe Nr. 2 • September 2004<br />
Liebe Jägerinnen und Jäger,<br />
verehrte Freunde der Jagd,<br />
noch nie musste sich die Jagd so vielen<br />
unnötigen Änderungsplänen von<br />
Seiten der Politik erwehren wie in der<br />
letzten Zeit. Leider bleibt bei diesen<br />
Plänen der Sachverstand meist auf der<br />
Strecke. Wir müssen aufpassen, dass<br />
bei all den geplanten Reformen nicht<br />
Bewährtes zerschlagen wird. Besseres<br />
ist aber nicht in Sicht!<br />
Das reicht von der beabsichtigten<br />
Änderung oder vielleicht sogar Abschaffung<br />
des Bundesjagdgesetzes<br />
zugunsten eigener Ländergesetze, und<br />
geht weiter über die ungewisse <strong>Neu</strong>ansiedelung<br />
der Unteren Jagdbehörden<br />
Bayerns bis zur Privatisierung der<br />
Jägerprüfung und der Abschaffung der<br />
Pfl ichthegeschau.<br />
Zu allen Punkten hat der Landesjagdverband<br />
Position bezogen. Bitte<br />
„munitionieren“ Sie sich nur mit unseren<br />
Argumenten, wenn Sie in nächster<br />
Zeit mit Mandatsträgern, Medienvertretern<br />
und interessierten Mitbürgern<br />
ins Gespräch kommen sollten. Bedenken<br />
Sie: Die entscheidenden Weichen<br />
für die Zukunft der Jagd werden in den<br />
nächsten Monaten gestellt.<br />
Mit Waidmannsheil<br />
Prof. Dr. Jürgen Vocke, Präsident<br />
des Landesjagdverbandes Bayern<br />
<strong>Revierkurier</strong><br />
Herausgeber: Landesjagdverband Bayern e.V.<br />
Vorverfahren bei Wild- und Jagdschaden<br />
Nicht gleich zum Kadi<br />
Schäden in Wald und Feld durch jagdbares Wild oder durch die<br />
Jagdausübung selbst führen immer wieder zu Streit. Oft erschweren<br />
hohe Ersatzforderungen eine schnelle Schadensregulierung. Dank des<br />
Vorverfahrens brauchen die Beteiligten nicht gleich zum Kadi zu laufen.<br />
Wie dies nach den letzten Rechtsänderungen funktioniert, zeigt<br />
Dr. Paul Leonhardt, Leitender Ministerialrat a. D.<br />
Laut Jagdgesetz muss in Wild- und<br />
Jagdschadenssachen vor anderen<br />
Schritten ein Feststellungsverfahren<br />
(Vorverfahren) von der zuständigen<br />
Gemeinde durchgeführt werden. Damit<br />
will man die Streitigkeit zwischen<br />
den Beteiligten schnell und kostensparend<br />
beilegen und so auch die ordentlichen<br />
Gerichte entlasten.<br />
Wild- und Jagdschäden auf landwirtschaftlich<br />
genutzten Grundstücken<br />
hat der Ersatzberechtigte binnen einer<br />
Woche, nachdem er von dem Schaden<br />
Kenntnis erhalten hat oder bei Beachtung<br />
gehöriger Sorgfalt erhalten hätte,<br />
bei der zuständigen Gemeinde schriftlich<br />
anzumelden. Bei Schäden an forstwirtschaftlich<br />
genutzten Grundstücken<br />
genügt es, wenn zwei Mal im Jahr,<br />
zum 1. Mai und 1. Oktober, gemeldet<br />
wird. Es reicht, wenn unter Angabe<br />
des Ortes das Vorliegen eines Wildoder<br />
Jagdschadens behauptet und<br />
Schadensersatz gefordert wird. Die<br />
Anmeldefrist ist keine Verjährungs-,<br />
sondern eine Ausschlussfrist, das heißt,<br />
der Anspruch erlischt grundsätzlich,<br />
wenn er nicht rechtzeitig angemeldet<br />
worden ist.<br />
Das Vorverfahren umfasst insbesondere<br />
die Prüfung der örtlichen Zuständigkeit<br />
und der ordnungsgemäßen<br />
Anmeldung, die Ermittlung der Scha-<br />
densursache und des Schadensumfangs<br />
– gegebenenfalls durch Ortsbesichtigung<br />
und Anhörung von Zeugen<br />
und Sachverständigen (Wildschadensschätzer)<br />
– und die Feststellung des<br />
Ersatzpfl ichtigen sowie die Aufnahme<br />
vollstreckungsfähiger Anerkenntnisse<br />
oder Vergleiche oder den Erlass eines<br />
Vorbescheids.<br />
Feststellungstermin ansetzen<br />
Ist ein Schaden angemeldet, hat die<br />
Gemeinde unverzüglich einen Schätzungstermin<br />
am Schadensort anzuberaumen,<br />
bei dem auf eine gütliche<br />
Einigung der Beteiligten hinzuwirken<br />
ist. Dazu sind der Geschädigte und alle<br />
Ersatzpfl ichtigen, die nach §§ 29, 30<br />
und 33 BJagdG in Anspruch genommen<br />
werden können, mit dem Hinweis<br />
zu laden, dass im Fall des Nichterscheinens<br />
mit der Ermittlung dennoch<br />
begonnen werden kann. In einem<br />
Gemeindejagdrevier ist stets auch der<br />
Jagdvorsteher der Jagdgenossenschaft<br />
zu laden.<br />
Jeder Beteiligte kann bei diesem<br />
Termin beantragen, dass bei landwirtschaftlich<br />
genutzten Grundstücken<br />
der Schaden erst zu einem späteren,<br />
kurz vor der Ernte abzuhaltenden Termin<br />
festgestellt werden soll. Diesem
Antrag hat die Gemeinde stattzugeben,<br />
sofern nicht bereits feststeht, dass<br />
für den vollständigen Verlust der Ernte<br />
Ersatz zu leisten ist. Wird dem Antrag<br />
stattgegeben, so ist der Schaden soweit<br />
zu ermitteln, als dies möglich und zur<br />
endgültigen Feststellung notwendig ist.<br />
Kommt im Termin eine gütliche<br />
Einigung zustande, hat die Gemeinde<br />
darüber eine Niederschrift aufzunehmen,<br />
die von allen Beteiligten zu unterzeichnen<br />
ist. Darin sind – neben Art und<br />
Umfang des entstandenen Wild- oder<br />
Jagdschadens – der Ersatzberechtigte,<br />
der Ersatzpfl ichtige und die Höhe des<br />
Schadensersatzes „sowie die vereinbarte<br />
Kostentragung“ anzugeben.<br />
Vorbescheid bei Nichteinigung<br />
Einigt man sich nicht und wird<br />
auch kein Vertagungsantrag gestellt,<br />
hat die Gemeinde unverzüglich einen<br />
Wildschadensschätzer beizuziehen,<br />
der in einem schriftlichen Gutachten<br />
den Schaden festhält. Auf dieser<br />
Grundlage erlässt die Gemeinde den<br />
schriftlichen Vorbescheid, der den Ersatzberechtigten,<br />
den Ersatzpfl ichtigen<br />
sowie die Höhe des Schadensersatzes<br />
feststellt „und eine Bestimmung über<br />
die Kostentragung“ enthalten muss.<br />
In der Begründung hat die Gemeinde<br />
auch Art und Umfang des Schadens<br />
festzuhalten. Vier Wochen nach seiner<br />
Zustellung an den Ersatzpfl ichtigen ist<br />
der Vorbescheid vollstreckbar, sofern<br />
nicht innerhalb dieser Frist Klage vor<br />
dem ordentlichen Gericht erhoben<br />
worden ist.<br />
Regelung der Kostentragung<br />
Der Hinweis in § 26 Abs. 3 Satz 1<br />
und in § 27 Abs. 3 Satz 1 AVBayJG, dass<br />
die gütliche Einigung beziehungsweise<br />
der Vorbescheid eine Bestimmung über<br />
die Kostentragung enthalten muss,<br />
ist rein verfahrensrechtlicher Natur. Er<br />
enthält weder eine verwaltungskostenrechtliche<br />
Regelung noch regelt er<br />
materiell-rechtlich die Kostenverteilung<br />
dem Inhalt nach im Verhältnis der<br />
Beteiligten. Art. 47 Abs. 2 BayJG enthält<br />
zwar eine Ermächtigung für das<br />
Staatministerium für Landwirtschaft<br />
und Forsten, die Kostentragung, das<br />
heißt die Verteilung der Kosten des<br />
Vorverfahrens auf die Beteiligten im<br />
Verordnungsweg zu regeln. Entsprechende<br />
Vorschriften, auf die sich die<br />
Entscheidung über die Kostentragung<br />
im Vorbescheid stützen könnte, sind<br />
aber bislang nicht erlassen. Die Gemeinde<br />
ist somit bei der Entscheidung<br />
über die Kostentragung im Vorbescheid<br />
2 <strong>Revierkurier</strong> 2/2004<br />
an keine festen Regeln gebunden. Sie<br />
kann in Anlehnung an die in §§ 91 und<br />
92 ZPO enthaltenen Grundsätze dem<br />
im Streit um die Hauptsache ganz oder<br />
teilweise Unterlegenen im selben Maß<br />
auch ganz oder teilweise die Kosten des<br />
Verfahrens auferlegen.<br />
Statt einer analogen Anwendung<br />
der §§ 91, 92 ZPO kann sich die Gemeinde<br />
bei ihrer Entscheidung über die<br />
Kostentragung an den Grundsätzen des<br />
früheren Gesetzes über das Verfahren<br />
in Wild- und Jagdschadenssachen vom<br />
12.08.1953 (BayBS IV S. 575) orientieren:<br />
Danach tragen die Beteiligten die<br />
ihnen erwachsenen Kosten einschließlich<br />
etwaiger Anwaltskosten selbst. Die<br />
übrigen Kosten sind im Vorbescheid<br />
grundsätzlich dem Ersatzpfl ichtigen<br />
aufzuerlegen. Der Einsatzberechtigte ist<br />
jedoch an diesen Kosten angemessen<br />
zu beteiligen, soweit er für die Entstehung<br />
des Schadens mitverantwortlich<br />
ist oder soweit er sie durch sein Säumnis<br />
oder eine dem Zweck nicht entsprechende<br />
Rechtsverfolgung verursacht<br />
hat. Gegenstand der Vereinbarung<br />
oder Entscheidung über die Kostentragung<br />
sind somit im Wesentlichen nur<br />
die Verwaltungskosten der Gemeinde<br />
(Gebühren und Auslagen, insbesondere<br />
Entschädigung des Wildschadensschätzers<br />
nach § 24 Abs. 2 AVBayJG i. V. mit<br />
Art. 85 VwVfG).<br />
Ohne eigene Regelung keine<br />
Kostenerhebung<br />
Die Erhebung von Verwaltungskosten<br />
(Gebühren, Auslagen) für<br />
Amtshandlungen im Rahmen des<br />
Vorverfahrens bestimmt sich, da das<br />
BayJG weder selbst einschlägige verwaltungskostenrechtliche<br />
Vorschriften<br />
noch eine gesetzliche Ermächtigung<br />
für eine entsprechende Sonderregelung<br />
in der AVBayJG enthält, allein nach<br />
Art. 20 KG. Will also eine Gemeinde<br />
hier Kosten erheben, muss sie auf der<br />
Grundlage des Art. 20 Abs. 1 KG zuvor<br />
die notwendige Regelung durch Erlass<br />
einer Satzung über die Erhebung von<br />
Verwaltungskosten für Amtshandlungen<br />
im eigenen Wirkungskreis mit einem<br />
entsprechenden Kostenverzeichnis<br />
schaffen (s. Bek. des Staatministeriums<br />
des Innern über die Erhebung von<br />
Verwaltungskosten für Amtshandlungen<br />
im eigenen Wirkungskreis der<br />
Gemeinden und Gemeindeverbände<br />
vom 20.01.1999, AllMBl S. 135, geänd.<br />
durch IMBek vom 21.1.2002 AllMBl<br />
S. 116). Ohne entsprechende Rechtsgrundlage<br />
(Kostensatzung) kann die<br />
Gemeinde die ihr aus der Durchführung<br />
des Vorverfahrens entstehenden Kosten<br />
somit nicht erheben.<br />
Das Vorverfahren ist kein Antragsverfahren<br />
im Sinne des Kostenrechts.<br />
Folglich kann die Gemeinde, selbst<br />
wenn sie die Rechtsgrundlage zur Erhebung<br />
von Verwaltungskosten geschaffen<br />
hat, vom Ersatzberechtigten, der<br />
den Schaden bei ihr anmeldet, keinen<br />
Kostenvorschuss fordern; eine von Art.<br />
14 Abs. 1 KG abweichende gesetzliche<br />
Sonderregelung kennt das BayJG nicht.<br />
Kostenschuldner kann jeder sein<br />
Hat die Gemeinde durch Erlass einer<br />
Kostensatzung die rechtlichen Voraussetzungen<br />
für die Erhebung von Kosten<br />
für Amtshandlungen im Rahmen des<br />
Vorverfahrens geschaffen, ergibt sich<br />
der Kostenschuldner aus Art. 20 Abs.<br />
3 i.V. mit Art. 2 KG. Danach ist zur<br />
Zahlung der Kosten verpfl ichtet, wer<br />
die Amtshandlung veranlasst hat, also<br />
der Schadensanmeldende. In streitentscheidenden<br />
Verfahren ist nach Art.<br />
2 Abs. 1 Satz 3 KG neben dem Veranlasser<br />
auch Kostenschuldner, wem die<br />
Kosten auferlegt werden. Dabei macht<br />
es keinen Unterschied, ob das Verfahren<br />
mit der Niederschrift über die gütliche<br />
Einigung oder, wenn eine solche nicht<br />
erreicht worden ist, mit dem Erlass eines<br />
Vorbescheids abgeschlossen wird.<br />
Im Rahmen ihres Selbstverwaltungsrechts<br />
entscheidet die Gemeinde, welche<br />
Amtshandlungen kostenpfl ichtig<br />
sind, wie insbesondere auch darüber,<br />
ob das Verfahren gebührenfrei ist,<br />
wenn eine gütliche Einigung zustande<br />
gekommen ist. Für Gebührenfreiheit<br />
in diesem Fall spricht, dass dadurch<br />
womöglich ein gewisser Anreiz zur gütlichen<br />
Einigung geschaffen wird.<br />
● Literatur:<br />
Leonhardt: Jagdrecht Kommentar;<br />
Leonhardt – Bauer – Schätzler:<br />
Handbuch zur Schadensabwicklung<br />
mit Berechnungsgrundlagen und<br />
Tabellen. Beide erschienen im Verlag<br />
Wolters Kluwer Deutschland GmbH<br />
Schriftenreihe des<br />
Landesjagdverbandes<br />
Bayern,<br />
Band 3: „JagdrechtseminarWildschadensersatz“,<br />
Fachtagung<br />
des Landesjagdverbandes<br />
Preis 7,20 €.<br />
Band 1 – 11 schriftlich zu bestellen bei<br />
der BJV-Geschäftsstelle, Hohenlindner<br />
Str. 12, 85622 Feldkirchen, Fax: 089/<br />
990234-35, E-mail: info@jagd-bayern.de
Jäger und E.ON Bayern helfen Wildtieren<br />
<strong>Neu</strong>er Lebensraum in<br />
alten Trafohäuschen<br />
Der Landesjagdverband Bayern (BJV) und die Wildland Gesellschaft haben<br />
sich mit dem Energieversorgungsunternehmen E.ON Bayern zusammengetan,<br />
um ausrangierte Trafohäuschen zu Wohn- und Brutstätten<br />
umzufunktionieren. Damit wollen die Projektpartner mit Hilfe der örtlichen<br />
BJV-Kreisgruppen bayernweit Fledermäuse und andere bedrohte<br />
Tierarten unterstützen.<br />
Nicht nur bei der Fledermaus,<br />
sondern auch bei vielen anderen<br />
gebäudebewohnenden Tieren herrscht<br />
akute Wohnungsnot. Wo für Menschen<br />
neue Behausungen entstehen,<br />
verschwinden Schlupfwinkel und<br />
Nistgelegenheiten für Höhlen- und<br />
Halbhöhlenbrüter. Bei Renovierungen<br />
von alten Höfen, Kirchtürmen, Ställen<br />
und Scheunen wird Holz durch Beton<br />
ersetzt, Ritzen und Fugen werden zugemauert.<br />
Trotzdem könnten Großes Mausohr,<br />
Hausrotschwanz und Schleiereule bald<br />
wieder unter einem Dach wohnen –<br />
unter dem Dach eines Trafohäuschens.<br />
Ausgediente Trafostationen für<br />
bedrohte Tierarten umzubauen, ist<br />
das Ziel der Zusammenarbeit von BJV,<br />
Wildland Gesellschaft, und der E.ON<br />
Bayern.<br />
Dabei übernimmt die Wildland<br />
Gesellschaft die Grundstücke mit den<br />
Trafoturmstationen, die E.ON nicht<br />
mehr in Betrieb hat. Voraussetzung<br />
ist, dass sich die Häuschen in einem<br />
„guten baulichen Zustand“ befi nden.<br />
Auch die Lage kann entscheidend sein<br />
– steht ein umgebautes Häuschen zum<br />
Beispiel auf freiem Feld, kann es eine<br />
karge Landschaft ohne Hecken, Gräben<br />
oder Gehölze bereichern und sie<br />
für Fledermäuse oder andere bedrohte<br />
Tierarten interessant machen.<br />
Ist das Gelände um das Häuschen<br />
herum geeignet und sind die Jäger der<br />
örtlichen BJV-Kreisgruppen bereit, das<br />
Projekt tatkräftig zu unterstützen, kann<br />
der Umbau zum „Fledermaushotel“<br />
beginnen.<br />
Die Außenwände mit Holzbrettern<br />
beschlagen und die Fenster mit<br />
Fensterläden versehen, sind nur zwei<br />
Möglichkeiten, um sowohl für Fledermäuse,<br />
als auch für Eulen, Greifvögel<br />
und höhlenbrütende Singvögel Brut-<br />
und Unterschlupfmöglichkeiten zu<br />
schaffen. Bohrt man im oberen Bereich<br />
ein Einfl ugloch, können Fledermäuse<br />
im Dachstuhl ihre Wochenstuben einrichten.<br />
Zusätzlich können die Jäger selbstgebaute<br />
Nistkästen auch für Singvögel<br />
oder Schleiereule aufhängen sowie<br />
Jäger haben dieses alte Trafohäuschen (links) zum „Fledermaushotel“ (rechts) umgebaut.<br />
Nisthilfen für beispielsweise den Weißstorch<br />
auf den Dächern anbringen.<br />
Auch für Untermieter ist Platz: Ist<br />
das „Untergeschoss“ entsprechend<br />
ausgestattet, kriechen Schlangen, Eidechsen<br />
und Frösche in Ritzen, Fugen<br />
und Verschläge. Außerdem können<br />
auch für Wespen, Hornissen und andere<br />
Insekten Brutplätze entstehen. Im<br />
Innenraum kann zum Beispiel der Igel<br />
ein warmes Zuhause für die Wintermonate<br />
fi nden.<br />
Ein weiterer positiver Nebeneffekt:<br />
Die bewohnten „Fledermaushotels“<br />
sind sichtbare Öffentlichkeitsarbeit.<br />
Sie wirken nicht nur auf Tiere, sondern<br />
auch auf Menschen sympathisch. Um<br />
Spaziergänger über die neuen Tierbehausungen<br />
zu informieren, ist auch<br />
daran gedacht, Infotafeln aufzustellen.<br />
Zu erkennen sind die umfunktionierten<br />
Trafostationen in Zukunft<br />
außerdem an den Logos<br />
der beteiligten Organisationen.<br />
Bevor es mit dem Umbau losgeht,<br />
erhalten die Kreisgruppen einen Leitfaden,<br />
aus dem sie entnehmen können,<br />
welche Möglichkeiten sie umsetzen<br />
müssen, um gezielt bestimmte Arten<br />
zu unterstützen – je nach räumlicher<br />
Besonderheit ihres Trafohäuschens.<br />
Das erste „Fledermaushotel“ wurde<br />
bereits letztes Jahr in Bad Feilnbach<br />
in Oberbayern eingeweiht. In Kürze<br />
macht sich die BJV-Kreisgruppe Rosenheim<br />
unter der Leitung von Werner<br />
Zwingmann ans Werk und baut eine<br />
Trafostation in Brannenburg um.<br />
Im Laufe der Zeit wird die E.ON weitere<br />
Stationen über ganz Bayern verteilt<br />
ausmustern.<br />
Naturliebhaber können sich also<br />
freuen, wenn im nächsten Jahr viele<br />
Tiere ihre neuen Behausungen aus Jägerhand<br />
beziehen. SG<br />
<strong>Revierkurier</strong> 2/2004 3
Salmonelleninfektion<br />
4 <strong>Revierkurier</strong> 2/2004<br />
Dunkelziffer bei Wildtieren<br />
Eine der weltweit häufi gsten Ursachen für bakterielle Darminfektionen sind die Erreger der Salmonellose.<br />
Auch in Deutschland gehen immer wieder Meldungen über Erkrankungen und Todesfälle infolge von<br />
Salmonelleninfektionen durch die Presse. Nicht nur der Mensch oder Haus- und Nutztiere können<br />
durch Salmonellen krank werden. Auch unsere Wildtiere sind dagegen nicht gefeit, wie Dr. Odward Geisel,<br />
Fachtierarzt für Pathologie, berichtet.<br />
Die klassischen menschenspezifi -<br />
schen Salmonellosen sind Typhus<br />
und Paratyphus. Sie gehören allerdings<br />
nicht zu den hier zu beschreibenden<br />
Anthropozoonosen. Diese sind Infektionskrankheiten,<br />
die von Tieren auf den<br />
Menschen und umgekehrt übertragen<br />
werden und immer wieder in den Medien<br />
auftauchen.<br />
Die Erreger sind weltweit verbreitet.<br />
Es handelt sich um Keime, die zu<br />
der großen Gruppe der hauptsächlich<br />
im Darm lebenden Bakterien gehören.<br />
Der Mensch infi ziert sich in den<br />
meisten Fällen durch den Verzehr von<br />
Lebensmitteln, die mit den Erregern<br />
durchsetzt oder oberfl ächlich behaftet<br />
sind. Ob sich daraus eine Erkrankung<br />
entwickelt, hängt von der Menge der<br />
Eigenschaften der<br />
Salmonellen<br />
Vorkommen<br />
• Mensch, Haus- und Wildtiere<br />
(Warm- und Kaltblüter)<br />
• Ausscheidungen von Menschen<br />
und Tieren<br />
• Nahrungsmittel tierischer Herkunft<br />
• Futtermittel<br />
• Schlachtabfälle<br />
• Abwasser<br />
Temperatureinfl uss<br />
• Rasante Vermehrung der Bakterien<br />
bei 30 bis 40°C,<br />
• Abtötung durch Erhitzen ab 75°C<br />
in wenigen Minuten.<br />
• Bakterientoxine werden teilweise<br />
erst ab 200°C unschädlich<br />
Überlebenszeit<br />
• in Gefrierschrank-Fleisch > 1 Jahr<br />
• in Gülle, Dung > 9 Monate<br />
• nach Klärschlammdüngung auf<br />
Boden und Pfl anzen > 5 Monate<br />
• in Fischmehl > 1 Jahr<br />
• in Voll-Eipulver mehrere Jahre<br />
Beim Federwild, namentlich bei Wassergefl ügel wie Stockente und anderen Entenarten,<br />
wurden häufi g Salmonellen nachgewiesen.<br />
aufgenommenen Erreger und von der<br />
Abwehrfähigkeit des Immunsystems<br />
ab. Vorherrschend ist eine Erkrankung<br />
des Darmes, die etwa einen bis fünf<br />
Tage nach der Infektion auftritt.<br />
Im Wesentlichen erkranken Menschen,<br />
wenn sie infi ziertes Fleisch oder<br />
infi zierte Eier zu sich genommen haben.<br />
Vereinzelt stecken sie sich auch über<br />
Ausscheidungen infi zierter Menschen<br />
oder Haustiere an. Hierbei spielen die<br />
sogenannten latenten – stummen – Infektionen<br />
von Rindern, Schweinen und<br />
Gefl ügel eine wesentliche Rolle, weniger<br />
das Fleisch von eindeutig kranken<br />
Tieren, das kaum dem Verzehr durch<br />
den Menschen zugeführt wird. Auch<br />
eine Infektion durch Wildbret ist möglich,<br />
und zwar vor allem deshalb, weil<br />
bei der Art der Zubereitung die Bakterien<br />
oft nicht abgetötet werden.<br />
Bei der sogenannten stummen Infektion,<br />
die bei circa 30 Prozent der<br />
infi zierten Personen auftritt, ist eine<br />
Dauerausscheidung der Keime oder<br />
eine Ausheilung möglich. Bei 70 Prozent<br />
der Erkrankten treten allerdings<br />
Symptome auf wie Leibschmerzen,<br />
Durchfall, Erbrechen, Fieber, Kreislaufstörungen,<br />
möglicherweise Sepsis. In<br />
seltenen Fällen, vor allem bei Kranken,<br />
Kindern oder alten Menschen, führt<br />
die Erkrankung sogar zum Tod.<br />
Auch andere Keime als<br />
Krankheitsursache<br />
Eine erhebliche Dunkelziffer besteht<br />
hinsichtlich möglicher Infektionen<br />
durch Salmonellen im Wildbret. Um<br />
sicher zu gehen, dass es sich bei akuter<br />
Erkrankung nach dem Verspeisen<br />
von zum Beispiel Wildgerichten um<br />
eine Salmonelleninfektion handelt, ist<br />
eine bakteriologische Untersuchung<br />
des Stuhls nötig. Ansonsten können<br />
durchaus andere Keime als Krankheitsursache<br />
in Betracht kommen. Im<br />
Foto: H. Lehmann
Foto: Institut f. Tierpathologie d. Uni München<br />
Schrifttum ist eine Reihe von Wildtieren<br />
erwähnt, bei denen der Nachweis<br />
von Salmonellen geführt worden ist<br />
(siehe folgender Kasten).<br />
Ein besonderes Problem stellt eine<br />
Salmonelleninfektion in Gattern, in Fasanerien<br />
oder Volieren dar. Auch wenn<br />
die erkrankten Tiere verendet sind und<br />
Berichte über den<br />
Nachweis von Salmonellen<br />
bei Wildtieren<br />
• Schalenwild: Rotwild, Damwild,<br />
Rehwild, Schwarzwild<br />
• Raubtiere: u.a. Fuchs und Nerz<br />
(auch Farmtiere), Dachs<br />
• Hasenartige: Hase, Kaninchen<br />
• Nagetiere: u.a. Maus, Ratte, Nutria<br />
(auch Farmtiere)<br />
• Insektenesser: Igel, Fledermaus<br />
• Federwild: u.a. Auerwild, Birkwild,<br />
Rebhuhn, Fasan, Wachtel,<br />
Taube, Ente<br />
• Fische: u.a. Karpfen, Hecht<br />
• Reptilien, Amphibien: u.a.<br />
Schlange, Frosch<br />
Aufgebrochene Gelenkentzündung durch<br />
Salmonellen am Flügel einer Haustaube.<br />
Säugetiere:<br />
• Appetitmangel<br />
• struppiges Haarkleid<br />
• durch Losung verschmutzter<br />
Weidlochbereich und Hinterläufe<br />
• Durchfall mit wässriger bis breiiger,<br />
teilweise blutiger Losung<br />
• Abmagerung, Schwäche,<br />
Verwerfen (Abort)<br />
unschädlich beseitigt werden, bleibt<br />
ein erhöhtes Gefahrenpotential durch<br />
jene Tiere erhalten, die scheinbar gesund<br />
geblieben sind, aber als Ausscheider<br />
der Bakterien eine Infektionsquelle<br />
für die übrigen, besonders für abwehrgeschwächte<br />
Tiere bleiben.<br />
Vorbeugung und Behandlung von<br />
Infektionen frei lebender Wildtiere<br />
sind problematisch, weil die Dosierung<br />
von Medikamenten nicht überwacht<br />
werden kann. Bei einer Infektion von<br />
Gattertieren kann der Einsatz von Antibiotika<br />
versucht werden. Allerdings<br />
besteht infolge der Behaftung des Bodens<br />
und der Äsung mit salmonellenhaltiger<br />
Losung ständig die Gefahr der<br />
Infektion weiterer Tiere. Ferner muss<br />
stets mit der Möglichkeit gerechnet<br />
werden, dass unzureichend behandelte<br />
Tiere zu Dauerausscheidern und<br />
die Keime gegen Antibiotika resistent<br />
werden. Eine Sanierung des Gatters<br />
gelingt am besten, wenn es geräumt<br />
und über ein Jahr freigehalten wird.<br />
Gleiches gilt auch für die Haltung von<br />
Federwild. Hierbei wird empfohlen,<br />
dass Bruteier nur aus salmonellenfreien<br />
Beständen bezogen werden. Alle<br />
Einrichtungen und Gerätschaften sind<br />
gründlich zu desinfi zieren, bevor man<br />
mit dem <strong>Neu</strong>aufbau des Bestandes<br />
beginnt. Eine Reinfektion durch Mäuse,<br />
Igel und andere Tiere ist aber auch<br />
dann noch denkbar.<br />
Bei Verdacht Wildbret<br />
unbedingt untersuchen<br />
Besteht bei einem Wildtier auf<br />
Grund des Verhaltens, der Krankheitserscheinungen<br />
oder – beim Aufbrechen<br />
– der Organbefunde der Verdacht auf<br />
eine Salmonelleninfektion, muss das<br />
Wildbret auf jeden Fall untersucht<br />
werden, bevor es zum Verzehr in den<br />
Verkehr gebracht wird. Generell ist<br />
Krankheitserscheinungen bei Wildtieren<br />
Federwild:<br />
• Appetitmangel<br />
• gesträubtes Gefi eder<br />
• herabhängende Flügel, Mattigkeit<br />
• verklebte Kloake<br />
• Durchfall mit Ausscheidung von<br />
viel Harnsäure (weiße Kükenruhr)<br />
• Haltungs- und Bewegungsstörungen<br />
infolge Hirnschädigungen<br />
Durchfall beim Wild kann Anzeichen für<br />
eine Salmonelleninfektion sein.<br />
bei allen sogenannten bedenklichen<br />
Merkmalen, wie sie in der Fleischhygiene-Verordnung<br />
aufgeführt sind (siehe<br />
Kasten unten), ein amtlicher Tierarzt<br />
zwingend hinzu zu ziehen, es sei<br />
denn, wirtschaftliche Gründe sprechen<br />
gegen diese kostenpfl ichtige Untersuchung.<br />
Entscheidet man sich aufgrund<br />
ökonomischer Überlegungen, darauf<br />
zu verzichten, müssen Tierkörper und<br />
Organe unschädlich beseitigt werden.<br />
In diesen Fällen darf das verdächtige<br />
Stück Wild nicht auf den Luderplatz<br />
gebracht werden, sondern muss in<br />
der Tierkörperbeseitigungsanstalt unschädlich<br />
entsorgt werden. Es ist stets<br />
zu bedenken, dass der Jäger einerseits<br />
gegenüber dem Verbraucher der Produkthaftung<br />
unterliegt und andererseits<br />
wie jeder andere Bürger auch verpfl<br />
ichtet ist, Boden- und Grundwasser<br />
vor schädlichen Einfl üssen zu schützen<br />
– in diesem Falle vor Krankheitserregern.<br />
Organbefunde:<br />
• Magen-Darm-Entzündung, teilweise<br />
katarrhisch, teilweise mit<br />
Geschwürbildung<br />
• Lymphknotenschwellung, vor<br />
allem an den Bauchorganen<br />
• Leberschwellung, Milzschwellung,<br />
Nierenschwellung (bei<br />
chronischem Verlauf mit kleinen<br />
weißen Herden<br />
• Gelenkschwellung<br />
• Lungenentzündung<br />
<strong>Revierkurier</strong> 2/2004 5<br />
Foto: M. Migos
Grundsätze zur Bewegungsjagd<br />
1. Ziele der Bewegungsjagd<br />
• Bewegungsjagden sind eine wirkungsvolle<br />
Jagdmethode zur<br />
- Anpassung von Wildbeständen an<br />
ihren Lebensraum,<br />
- zur Steuerung der Raumnutzung<br />
von Wildbeständen,<br />
- zur Herstellung und Erhaltung<br />
wildbiologisch richtiger Sozialstrukturen<br />
und Lebensmöglichkeiten<br />
- und zur Vermeidung des Jagddruckes<br />
und der Wildschäden.<br />
• Bewegungsjagden tragen in besonderer<br />
Weise den veränderten<br />
Waldstrukturen Rechnung und<br />
bieten eine gute Möglichkeit, durch<br />
gemeinsames Jagen Jagdkultur zu<br />
leben.<br />
• Bewegungsjagden sind Teil eines<br />
Jagdkonzeptes, in dem die örtlichen<br />
Verhältnisse, sowie die Interessen<br />
von Grundeigentümern und Öffentlichkeit<br />
berücksichtigt sind.<br />
• Der Erfolg der Jagd soll sich messen<br />
an der Höhe und der Zusammensetzung<br />
der Strecke.<br />
• Langfristig soll die Bewegungsjagd<br />
eine ausgewogene Sozialstruktur<br />
der Wildbestände und die Rückkehr<br />
zu artgerechten Verhalten fördern<br />
und die Wildschäden senken.<br />
2. Konfl iktvermeidung und<br />
Organisation<br />
• Die Planung und Organisation der<br />
Bewegungsjagd muss so ausgerichtet<br />
sein, dass nach allem Ermessen<br />
ein Überjagen der Hunde in benachbarte<br />
Reviere ausgeschlossen<br />
werden kann.<br />
• Wird im Bereich von Reviergrenzen<br />
mit Hunden gejagt, sind Reviernachbarn<br />
zu verständigen. Die<br />
kleinräumige Jagd ausschließlich auf<br />
Schwarzwild ist keine Bewegungsjagd<br />
in diesem Sinne.<br />
• Bewegungsjagden sollen ab Oktober<br />
und nicht nach Jahresende,<br />
sowie nicht bei hoher Schneelage<br />
und/oder Harsch stattfi nden.<br />
6 <strong>Revierkurier</strong> 2/2004<br />
Richtig drücken<br />
Drück- oder Treibjagden oder ganz allgemein Bewegungsjagden werden – vor allem vor dem Hintergrund der<br />
explosiv gestiegenen Schwarzwildbestände – immer wichtiger. Sie erfordern eine besonders sorgfältige Planung<br />
und Organisation. Die folgenden Grundsätze können jedem Jagdleiter für das Vorbereiten und Durchführen<br />
einer erfolgreichen Bewegungsjagd dienen. Sie wurden im Rahmen einer Expertentagung mit Vertretern<br />
des Landesjagdverbandes Bayern und der Bayerischen Staatsforstverwaltung erarbeitet.<br />
• Bewegungsjagden müssen rechtzeitig<br />
vor der Dunkelheit beendet<br />
werden.<br />
• Die Freigabe von Wild zum Abschuss<br />
und die Kontrolle der Strecke<br />
durch den Jagdleiter muss die<br />
Sozialstruktur des Wildes und die<br />
Erfordernisse des Tierschutzes berücksichtigen.<br />
3. Hunde<br />
• Grundsätzlich alle Jagdhunde, die<br />
- gegenüber Mensch und Artgenossen<br />
verträglich sind,<br />
- spurlaut bzw. fährtenlaut jagen,<br />
- wesensfest,<br />
- wildscharf sind und nicht anschneiden,<br />
- und einen ausgeprägten Orientierungssinn<br />
haben,<br />
können auf Bewegungsjagden<br />
eingesetzt werden.<br />
• Art und Anzahl der eingesetzten<br />
Hunde richten sich nach den wild-<br />
und revierspezifi schen Verhältnissen.<br />
• Es sollen nur erfahrene und eingejagte<br />
Hunde eingesetzt werden, die<br />
während des Treibens einzeln jagen.<br />
Meuten, die gesundes Wild fangen,<br />
werden nicht eingesetzt.<br />
• Für Kontroll- und Nachsuchen müssen<br />
qualifi zierte Nachsuchegespan-<br />
ne in ausreichender Zahl bereit<br />
stehen.<br />
• Nachsuchen und damit verbundene<br />
Maßnahmen sind nur von den von<br />
der Jagdleitung beauftragten Personen<br />
durchzuführen. Zur Planung des<br />
Hundeeinsatzes gehören auch Vorkehrungen<br />
zur Sicherheit, tierärztlichen<br />
Versorgung und Versicherung<br />
der Hunde.<br />
• Es sollen nur erfahrene, orts- oder<br />
kartenkundige Treiber und Hundeführer<br />
nach Maßgabe der VSG<br />
eingesetzt werden.<br />
4. Tierschutz<br />
• Bei der Schussabgabe sind Gesichtspunkte<br />
des Tierschutzes und<br />
der Wildbrethygiene zu beachten.<br />
Bewegtes Wild stellt hohe Anforderungen<br />
an die Schießfertigkeit<br />
der Jäger, daher sind Schüsse zu<br />
unterlassen, die keine hinreichende<br />
Treffsicherheit erwarten lassen.<br />
• Ziel ist die Erhaltung der Sozialstruktur<br />
des Wildtierverbandes.<br />
• Vom Muttertier noch abhängige<br />
Jungtiere sind vor dem Muttertier<br />
zu erlegen (z.B. beim Rotwild ist das<br />
Kalb während der ganzen Jagdzeit<br />
abhängig).<br />
• Keine Hetzjagd (§19 BJG).<br />
Foto: M. Breuer
5. Wildbrethygiene<br />
• Schlechte Schüsse führen zur Entwertung<br />
des Wildbrets.<br />
• Fachgerechtes und rechtzeitiges<br />
Aufbrechen, vorschriftsmäßiges<br />
Auskühlen, Transportieren und<br />
Lagern sind sicherzustellen.<br />
6. Sicherheitskonzept<br />
Die Sicherheit hat bei der Planung, Organisation<br />
und Durchführung oberste<br />
Priorität! Dem Jagdleiter fällt hierbei<br />
die zentrale Verantwortung zu:<br />
• Auswahl und Abgrenzung des Jagdgebietes.<br />
Jede erkennbare Gefährdung<br />
Dritter ist dabei auszuschließen<br />
(Straßen, Siedlungen usw.).<br />
Die notwendige Schießfertigkeit<br />
zu erlernen und zu erhalten ist<br />
gar nicht so einfach. Zum einen sind<br />
Schießanlagen, die ein Training mit<br />
großkalibrigen Waffen auf laufende<br />
Scheiben ermöglichen, keineswegs<br />
häufi g. Zum anderen ist das Trainieren<br />
in nur einer einzelnen Disziplin, etwa<br />
„Laufender Keiler von rechts nach<br />
links“, auch nicht optimal.<br />
Aber einmal oder natürlich besser<br />
mehrmals im Jahr auf den „Laufenden<br />
Keiler“ mit der eigenen vertrauten<br />
Waffe zu schießen, ist mindestens ein<br />
Anfang. Aber noch viel mehr Möglichkeiten<br />
zu Schießübungen auf bewegtes<br />
Wild gibt es zum Beispiel auf der Graf-<br />
Stauffenberg-Schießanlage im schwäbischen<br />
Amerdingen. Dort können<br />
sogar Tageskurse belegt werden, wie<br />
sie das Jagdversandhaus Frankonia<br />
anbietet. Die Schützen haben zudem<br />
die Möglichkeit, verschiedene gängige<br />
Waffenmodelle von Frankonia unter<br />
Praxisbedingungen zu testen. So lernen<br />
sie die Vorteile und Unterschiede<br />
der Drückjagdwaffen mit entsprechender<br />
Optik kennen und schonen ihre<br />
eigene Waffe – bei 100 Schuss am<br />
Tag zu empfehlen. Die Munition für<br />
die Testwaffen kann am Schießstand<br />
günstig erworben werden. Außerdem<br />
bekommen die Teilnehmer viele nützliche<br />
Tipps aus der jagdlichen Praxis von<br />
einem professionellen Berufsjäger.<br />
Auf drei aufeinander aufbauenden<br />
• Rettungskette (vorbeugende Maßnahmen:<br />
Arzt, Tierarzt)<br />
• Auswahl der Schützenstände (Unfallverhütungsvorschriften,Bewuchs)<br />
• Auswahl der Schützen (Ausbildung,<br />
Training, Verantwortungsbewusstsein)<br />
• Sicherheitsbelehrung (Stand, Beginn<br />
u. Ende, Gefahrenbereich, Ahndung<br />
von Verstößen).<br />
• Sicherheitsrelevante Ausrüstung<br />
und Maßnahmen (Warnweste,<br />
Hutband, Halsband, Straßensperrungen,<br />
moderne Kommunikationsmittel).<br />
• Kontrolle des Sicherheitskonzeptes.<br />
Schießtraining auf bewegte Ziele<br />
Achtung, annehmender Keiler!<br />
Das sichere Erlegen von ziehendem oder gar fl üchtendem Wild verlangt den Teilnehmern an einer<br />
Bewegungsjagd einiges ab. Um die nötige Schießfertigkeit zu erlangen, ist jede Menge Training erforderlich.<br />
Auch erfahrene Schützen sollten immer wieder auf einem Bewegungsschießstand üben und an<br />
speziellen Lehrgängen teilnehmen.<br />
Parcours können die Teilnehmer trainieren<br />
bis die Läufe fast glühen. Nach<br />
dem Warmschießen auf der Trainingsbahn,<br />
wo angestrichen und stehend<br />
freihändig auf drei 50 Meter entfernte<br />
Wildscheiben ohne langes Zielen geübt<br />
wird, geht es auf die Reaktionsbahn.<br />
Hier sind eine gehende und eine<br />
kommende Sauscheibe auf einem fahrbaren<br />
Rahmen postiert, der sich erst<br />
entfernt und dann wieder hereingefahren<br />
wird. Dabei müssen fünf Schuss<br />
auf die gehende und fünf Schuss auf<br />
die kommende Sau abgegeben werden.<br />
Als Trefferfl äche gilt lediglich eine<br />
faustgroße „Blesse“. Dann wird es<br />
schwieriger: Über eine Duellfunktion<br />
wird die Scheibe im Sekundentakt vor-<br />
und zurückgeklappt. Nun müssen die<br />
Schüsse genau in der kurzen Zeit fallen,<br />
in der die Sau in Vollansicht erscheint.<br />
Eine gute Übung, um im Rhythmus von<br />
Schießen und Repetieren die kontrollierte<br />
und punktgenaue Schussabgabe<br />
unter Zeitdruck zu lernen.<br />
Nach dieser soliden Grundausbildung<br />
wagen sich die meisten Teilnehmer<br />
an den Bewegungsparcours mit<br />
je drei Klappscheiben und Laufenden<br />
Keilern. Laufende Keiler von links und<br />
rechts, plötzlich auftauchende Rehe<br />
hinten, Sauen vorne und ein zu allem<br />
Überfl uss plötzlich annehmender<br />
Keiler halten die Schützen auf Trab.<br />
Die Klappscheiben fallen übrigens<br />
nur, wenn der Schuss in der tödlichen<br />
7. Schießfertigkeit (siehe auch unten)<br />
• Hohe Schießfertigkeit ist die Voraussetzung<br />
für die verantwortungsvolle<br />
Jagd, unter Achtung des Tieres als<br />
Mitgeschöpf.<br />
• Hierfür sind diszipliniertes Schießen<br />
und Sicherheit beim Ansprechen<br />
erforderlich. Diese geforderten<br />
Eigenschaften sind durch Aus-<br />
und ständige Fortbildung bzw.<br />
Training eigenverantwortlich zu<br />
gewährleisten.<br />
• Der Jagdleiter sollte durch entsprechende<br />
Vor- und Nachbereitung auf<br />
die Schießfertigkeit und Disziplin der<br />
Teilnehmer Einfl uss nehmen.<br />
●<br />
Trefferzone sitzt, ansonsten heißt es<br />
weiterschießen. Die Auswertung der<br />
Schussserien erfolgt ultraschallgestützt<br />
am Monitor, so dass jeder Teilnehmer<br />
sein jeweiliges Resultat begutachten<br />
kann.<br />
Eine weitere Möglichkeit, Schießen<br />
auf bewegte Ziele zu üben, bieten<br />
Schießkinos mit Laserstrahl aus der eigenen<br />
Waffe. Ein großer Vorteil dieser<br />
Kinos liegt darin, dass Sicherheitsaspekte<br />
wie Kugelfang mitberücksichtigt<br />
werden können.<br />
Egal wie – Schießtraining soll auch<br />
Spaß machen. Und das tut es meist<br />
gemeinsam mit Jagdfreunden in der<br />
Gruppe. Wer als Jagdherr seine Gäste<br />
vor der winterlichen Jagd zu einem<br />
Schießnachmittag einlädt, handelt deshalb<br />
sicher in deren Sinne. Viele Schießstandbetreiber<br />
kommen derartigen<br />
Wünschen gewiss gerne entgegen.<br />
BJV-Schießausschuss<br />
Anmeldung und weitere Informationen<br />
zum Lehrgang im Internet<br />
unter www.frankonia.de<br />
Kosten: Je nach Gruppengröße 60<br />
- 150 € je Schütze, zzgl. Munition.<br />
Adresse Schießanlage:<br />
Graf-Stauffenberg-Schießanlage<br />
Landesjagdschule Amerdingen<br />
Witzlesweg 11, 86735 Amerdingen<br />
Tel.: 09089/1555<br />
<strong>Revierkurier</strong> 2/2004 7
Jagdrecht in der Praxis<br />
Verkehrssicherheit bei Drück-<br />
oder Treibjagden – wer haftet?<br />
Der Veranstalter einer Drück- oder<br />
Treibjagd beziehungsweise der Jagdleiter<br />
ist nicht verpfl ichtet, durch Jagdpersonal<br />
oder sonstige Schützen das<br />
Drückjagdgebiet gegen Straßen oder<br />
in der Nähe gelegene Siedlungsgebiete<br />
abzuschirmen (OLG Celle, Beschluss<br />
vom 17.2.2003 – 9U 12 / 03;).<br />
Allerdings hat er die Drückjagd so<br />
zu organisieren, dass die Treiben nicht<br />
direkt auf Straßen oder Siedlungen<br />
zugeführt werden. Ansonsten muss<br />
ständig damit gerechnet werden, dass<br />
fl üchtiges Wild auf die Straße oder in<br />
die Siedlung läuft.<br />
In diesem Fall kann<br />
es sein, dass der Jagdleiter<br />
unter Umständen<br />
haftet. Auch wenn eine<br />
konkrete Gefahr durch<br />
ein verstörtes, ausbrechendes<br />
Tier bereits erkennbar<br />
ist, und dieses<br />
Tier durch einen risikolosen<br />
Abschuss leicht<br />
hätte erlegt werden<br />
können, ist der Jagdleiter<br />
haftbar zu machen.<br />
Nicht haftbar zu machen<br />
ist der Jagdleiter<br />
im Rahmen seiner Verkehrssicherungspfl<br />
icht allerdings dann, wenn zum<br />
Beispiel, wie vorgekommen, ein aufgescheuchtes<br />
Wildschwein in einem zwei<br />
Kilometer entfernten Wohngebiet in<br />
ein Wohnhaus durch eine geschlossene<br />
Terrassentür springt und dort Schaden<br />
anrichtet (LG Lüneburg, Urt. vom<br />
29.11.02 – 4 O 201 / 02;).<br />
Der Veranstalter einer Drück- oder<br />
Treibjagd ist auch dann nicht zum Schadensersatz<br />
verpfl ichtet, wenn aufgrund<br />
von Schüssen Pferde eines nahe gelegenen<br />
Reiterhofs auf der Weide unruhig<br />
werden und sich verletzen. Allerdings<br />
muss der Jagdleiter den Inhaber des<br />
Reiterhofs rechtzeitig über die Durchführung<br />
dieser Jagd informiert haben,<br />
so dass dieser Zeit hat, die Pferde in den<br />
Stall zu bringen (AG Coesfeld, Urt. vom<br />
3.7.2002 – Az: 6 C 27 / 2002;).<br />
Impressum:<br />
Herausgeber: Landesjagdverband Bayern e.V. · Hohenlindner Straße 12 · 85622 Feldkirchen · Telefon 089 / 99 02 34 0 · Fax 089 / 99 02 34 37,<br />
Internet: www.jagd-bayern.de, E-mail: dr.reddemann@jagd-bayern.de<br />
Präsident des Landesjagdverbandes Bayern: Prof. Dr. Jürgen Vocke, MdL<br />
Verantwortlich für den Inhalt: Dr. Joachim Reddemann, BJV-Hauptgeschäftsführer • Redaktion: Stephanie Geißendörfer, Günter Heinz Mahr (Leitung)<br />
Layout: Doris Dröge • Bezugspreis im Mitgliedsbeitrag enthalten.<br />
8 <strong>Revierkurier</strong> 2/2004<br />
Hat er dies nicht getan und die Jagd<br />
wird so durchgeführt, dass in unmittelbarer<br />
Nähe der Koppel geschossen<br />
wird und die Jagdhunde kreuz und<br />
quer über die Koppel das Wild hetzen,<br />
kann eine Verletzung der Verkehrssicherungs-<br />
und Sorgfaltspfl icht des<br />
Jagdveranstalters gegeben sein.<br />
So hat zum Beispiel das Landgericht<br />
Düsseldorf (Urteil vom 25.1.2002,<br />
– Az: 3 O 442 / 98) entschieden, dass<br />
der Jagdveranstalter in diesem Fall für<br />
den Schocktod eines Pferdes haftbar<br />
gemacht werden kann.<br />
Bei einem Wildunfall, der unabhän-<br />
gig von einer Jagd passiert, haftet der<br />
Revierinhaber grundsätzlich nicht als<br />
Tierhalter gemäß § 833 BGB. Allein die<br />
Tatsache, dass zum Beispiel das Reh<br />
dem Jagdrecht unterliegt, begründet<br />
keine Tierhaltereigenschaft des Revierinhabers.<br />
Das Wildtier ist grundsätzlich<br />
herrenlos, so dass eine Haftung des<br />
Revierinhabers insoweit ausscheidet<br />
(AG Celle, Urteil vom 12.2.2003 – 15<br />
C 17 / 03 ).<br />
Dies gilt beispielsweise auch für die<br />
Tierarztkosten, die der unfallbeteiligte<br />
PKW-Fahrer aufwendet, wenn er das<br />
angefahrene Wildtier aufnimmt und<br />
bei einem Tierarzt behandeln lässt.<br />
Auch dafür haftet der Revierinhaber<br />
nicht. ●<br />
Barbara Frank, Rechtsanwältin,<br />
Vorsitzende des BJV-Rechtsausschusses<br />
Foto: H. Pieper<br />
Warnschilder bei<br />
Gesellschaftsjagden<br />
Auf Antrag der Regierung von Unterfranken<br />
hat das Bayerische Staatsministerium<br />
des Innern das Zusatzschild<br />
„Treibjagd“ zugelassen. Es ist bei<br />
allen Arten von Gesellschaftsjagden<br />
zweckmäßig, sollte aber mit einer<br />
Geschwindigkeitsbegrenzung – zum<br />
Beispiel 30 km/h – verbunden werden,<br />
um sicherzustellen, dass Autofahrer ihre<br />
Geschwindigkeit der Gefahrensituation<br />
ausreichend anpassen.<br />
Ob und inwieweit das Aufstellen<br />
von Warnschildern notwendig ist,<br />
kann nur der verantwortliche Jagdleiter<br />
beurteilen. Von Seiten der Straßenverkehrsbehörden<br />
sollte den Anträgen<br />
entsprochen werden, wenn glaubhaft<br />
und nachvollziehbar dargestellt wird,<br />
dass jagdorganisatorische Gegenmaßnahmen<br />
nicht möglich beziehungsweise<br />
nicht ausreichend sind. Auch eine<br />
Straßensperrung durch die Straßenverkehrsbehörden<br />
kommt in Frage.<br />
Eine Vorbereitungszeit von 14 Tagen<br />
dürfte in der Regel zumutbar sein, im<br />
Einzelfall kommen in der Jagdpraxis<br />
wetterbedingt aber kurzfristige Änderungen<br />
in Betracht. Daher sollte eine<br />
möglichst fl exible Handhabung angestrebt<br />
werden. BStMLF<br />
Kein generelles Jagdverbot<br />
auf öffentlichen<br />
Straßen<br />
Die Jagdausübung auf öffentlichen<br />
Straßen – zum Beispiel während einer<br />
Treibjagd – ist in Bayern nicht generell<br />
verboten. Ob sie erlaubt und möglich<br />
ist, muss statt dessen im Einzelfall<br />
geprüft werden. So gilt zum Beispiel<br />
für Bundesautobahnen und Kraftfahrstraßen<br />
gemäß §18 Abs. 9 Straßenverkehrsordnung<br />
ein Betretungsverbot<br />
für Fußgänger, das jede Jagdhandlung<br />
hier unmöglich macht.<br />
Im Übrigen unterbrechen öffentliche<br />
Straßen nicht den Zusammenhang<br />
eines Jagdbezirks. Die Trassenfl ächen<br />
sind auch keine befriedeten Bezirke.<br />
Dies verlangt also nach Überprüfung<br />
im Einzelfall. BStMLF