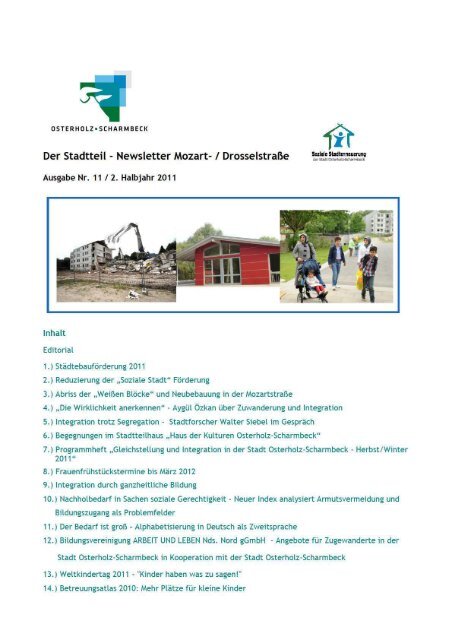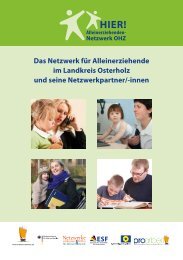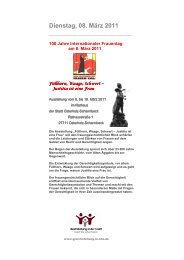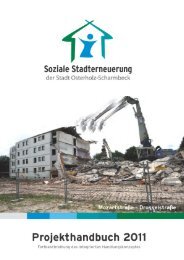Stadtteil-Newsletter-Nr-11-Schrift-1web - Haus der Kulturen in OHZ
Stadtteil-Newsletter-Nr-11-Schrift-1web - Haus der Kulturen in OHZ
Stadtteil-Newsletter-Nr-11-Schrift-1web - Haus der Kulturen in OHZ
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
15.) Kontroverse Debatte über geplante E<strong>in</strong>führung e<strong>in</strong>es Betreuungsgeldes<br />
16.) Bessere Kitas statt Betreuungsgeld<br />
17.) Ganztagsbetreuung von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n ab drei Jahren <strong>in</strong> Kitas: Nie<strong>der</strong>sachsen liegt mit e<strong>in</strong>er Quote von<br />
gut 16 Prozent bundesweit <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schlussgruppe<br />
18.) Grün-Rot <strong>in</strong> BADEN-WÜRTTEMBERG baut nicht auf Bildungshäuser<br />
19.) Sprachför<strong>der</strong>kompetenz <strong>in</strong> Nie<strong>der</strong>sachsens K<strong>in</strong><strong>der</strong>tagese<strong>in</strong>richtungen wird gestärkt<br />
20.) Erfolg auf ganzer L<strong>in</strong>ie – JFMK bestätigt Vorschlag <strong>der</strong> BAG-BEK e.V. zur Berufsbezeichnung<br />
„K<strong>in</strong>dheitspädagog<strong>in</strong>/K<strong>in</strong>dheitspädagoge“<br />
21.) Integration durch Bildung (<strong>in</strong> <strong>der</strong> Schule)<br />
22.) För<strong>der</strong>programm Inklusion durch Enkulturation – LINES <strong>in</strong> Osterholz-Scharmbeck<br />
23.) Bildungs- und Teilhabepaket: Schulbedarf beantragen - F<strong>in</strong>anzielle Unterstützung für Schulbedarf<br />
24.) K<strong>in</strong><strong>der</strong>zuschlag und Leistungen für Bildung und Teilhabe - Familienleistung K<strong>in</strong><strong>der</strong>zuschlag<br />
25.) Run<strong>der</strong> Tisch zur Umsetzung des Bildungspakets<br />
26.) Bundesfreiwilligendienst: die Fakten<br />
27.) neXTvote: Wie glücklich s<strong>in</strong>d junge Menschen <strong>in</strong> ihrem Wohnort?<br />
28.) Schule <strong>der</strong> Zukunft: e<strong>in</strong> ganzer Tag mit guten Angeboten<br />
29.) För<strong>der</strong>schulen: Sprungbrett o<strong>der</strong> Sackgasse?<br />
30.) BIBB - Hauptausschuss verabschiedet Leitl<strong>in</strong>ien zur Verbesserung des Übergangs Schule - Beruf<br />
31.) BIBB - Ausbildungsstellenmarkt: Zahl <strong>der</strong> Jugendlichen im Übergangsbereich geht stark zurück<br />
32.) Initiative JUGEND STÄRKEN<br />
33.) Neues Modellprogramm JUGEND STÄRKEN: Aktiv <strong>in</strong> <strong>der</strong> Region<br />
34.) Präventionsarbeit – Negative Schlagzeilen schaden e<strong>in</strong>er Imageverbesserung<br />
35.) „Engagement macht stark“- Woche des bürgerschaftlichen Engagements 20<strong>11</strong><br />
36.) Gymnasiasten beim Ehrenamt vorn - "Programme für soziales Engagement stärker auf<br />
Hauptschüler ausrichten"<br />
37.) Sorge um politische Bildung<br />
38.) Internetpatenschaften - Patenschaft für Internetneul<strong>in</strong>ge<br />
39.) Übersicht: Ständige Angebote <strong>in</strong> <strong>der</strong> Sozialen Stadterneuerung<br />
40.) Wettbewerb „Deutscher Schulpreis 2012<br />
41.) Urteile<br />
------------------------------------------------<br />
Editorial<br />
Durch diesen <strong>Newsletter</strong> möchte ich Ihnen im Editorial etwas Nachdenkliches an die Hand geben,<br />
denn: „Je<strong>der</strong> Mensch will ankommen.“<br />
Zu lesen war zur Ausschreibung zum Literaturwettbewerb <strong>der</strong> <strong>in</strong> diesem Jahr 8. Bonner Buchmesse<br />
Migration:<br />
Der Literaturwettbewerb ANGEKOMMEN gibt beson<strong>der</strong>s Menschen mit Migrationserfahrung die Möglichkeit,<br />
ihre Erlebnisse, Erfahrungen, Zukunftsvisionen und Fiktionen literarisch zu bearbeiten und<br />
e<strong>in</strong>er breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Zugleich wird damit h<strong>in</strong>terfragt, ob wir als Gesellschaft mit<br />
<strong>der</strong> Zuwan<strong>der</strong>ung angekommen s<strong>in</strong>d.<br />
2
Der Mensch wan<strong>der</strong>t, um e<strong>in</strong>e neue Heimat zu suchen. Die Gründe s<strong>in</strong>d so unterschiedlich wie die<br />
Menschen und ihre Erfahrungen. Viele von ihnen können sich nur schwer von dem lösen, was sie h<strong>in</strong>ter<br />
sich gelassen haben. Aber auch das Neue, das ihnen überall begegnet, muss verarbeitet werden.<br />
Der Mensch, <strong>der</strong> zwischen den Lebenswelten wan<strong>der</strong>t, ist neugierig auf das kommende Neue, voller<br />
Hoffnung, er ist Teil e<strong>in</strong>er Suchbewegung nach dem, was trägt, was verb<strong>in</strong>det, was Heimat schafft<br />
und Zugehörigkeit gibt, er ist ausgesetzt <strong>der</strong> Beschleunigung, dem Wi<strong>der</strong>spruch, dem Gezerre, <strong>der</strong><br />
Unsicherheit.<br />
Je<strong>der</strong> Mensch will ankommen, im Leben o<strong>der</strong> m<strong>in</strong>destens im Überleben, <strong>in</strong> <strong>der</strong> Familie und im Kreis<br />
<strong>der</strong> Gleichges<strong>in</strong>nten, im Beruf und geme<strong>in</strong>samen Schaffen, im Meistern des eigenen Weges, im Spurenh<strong>in</strong>terlassen<br />
und Zeichensetzen und im Verän<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Spielregeln des Alltags, im Anerkennen und<br />
Anerkannt se<strong>in</strong>.<br />
Der Mensch als Wan<strong>der</strong>n<strong>der</strong> versucht, sowohl die Ereignisse <strong>der</strong> Vergangenheit zu verarbeiten, als<br />
auch das Neue, was ihm überall begegnet, zu <strong>in</strong>terpretieren und zu bewältigen.<br />
In beiden Fällen kann Literatur helfen – als Ventil ebenso wie als Brücke zwischen Menschen und <strong>Kulturen</strong>.<br />
Die <strong>Schrift</strong>steller s<strong>in</strong>d dabei Sprachrohre <strong>der</strong>er, die selber auf <strong>der</strong> Suche nach e<strong>in</strong>em Zuhause<br />
s<strong>in</strong>d. www.migrapolis.de<br />
Zurück <strong>in</strong> <strong>der</strong> Realität werden wir durch die Medien mit Auswüchsen von nicht geahnter Brutalität <strong>in</strong><br />
europäischen Län<strong>der</strong>n konfrontriert. Dazu das Deutsche Forum für Krim<strong>in</strong>alprävention:<br />
E<strong>in</strong> Ausnahmefall <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em friedlichen Land. E<strong>in</strong> wahrsche<strong>in</strong>lich e<strong>in</strong>zelner Täter, <strong>der</strong> hasserfüllt, ohne<br />
Mitgefühl und –leid gehandelt hat. Für den Hass gab es Ste<strong>in</strong>brüche unmenschlicher Ideologien, die<br />
das Verbrechen begründen sollen. Der Mangel an Empathie hängt mit den fehlenden B<strong>in</strong>dungen zu<br />
an<strong>der</strong>en Menschen zusammen. Warum konnte er ke<strong>in</strong>e Beziehungen e<strong>in</strong>gehen? Wie ist es dazu gekommen?<br />
Die Schreckenstaten am 22. Juli <strong>in</strong> Oslo s<strong>in</strong>d schockierend. Die Folgen haben Ursachen. Wie<strong>der</strong>um<br />
stellen sich <strong>der</strong> Gesellschaft, den Medien, den politisch Verantwortlichen und den Sicherheitsbehörden<br />
- auch neue - Fragen nach dem Warum. Die Antworten müssen Folgen haben. Welche? „Der<br />
Schrei“, das bekannteste Motiv des norwegischen Malers Edvard Munch drückt mutlose Verzweiflung<br />
aus. Die Norweger antworten jetzt mutig, <strong>in</strong> dem sie ihren gesellschaftlichen Zusammenhalt mitmenschlich<br />
demonstrieren.<br />
Achtsamkeit, Füre<strong>in</strong>an<strong>der</strong> Sorge tragen, niemanden im Abseits stehen lassen… und Angebote, die<br />
soziale Fähigkeiten bereits im K<strong>in</strong>desalter stärken sowie im Jugendalter stabilisieren: Selbst <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Gruppe respektierende Resonanz f<strong>in</strong>den und den an<strong>der</strong>en <strong>in</strong> <strong>der</strong> Geme<strong>in</strong>schaft zugewandt se<strong>in</strong>. Der<br />
Weg, e<strong>in</strong>e Kultur <strong>der</strong> gegenseitigen Achtung und Fairness weiter zu entwickeln, muss fortgesetzt<br />
werden.<br />
Und nun Gewaltausbrüche <strong>in</strong> London, Manchester, Liverpool und Birm<strong>in</strong>gham – Fragen zur Dynamik<br />
<strong>der</strong> Gewalt, wie man sie unterbrechen kann, zu den Ursachen. Zudem die Botschaft, die Probleme<br />
mit <strong>der</strong> „vollen Härte des Gesetzes“ lösen zu wollen. Die Jugendgewalt <strong>in</strong> Großbritannien zeigt e<strong>in</strong>dr<strong>in</strong>glich,<br />
dass Gewalt und Krim<strong>in</strong>alität <strong>in</strong> diesem Ausmaß und <strong>in</strong> dieser Ausprägung Folgen gesellschaftlicher<br />
Fehlentwicklungen (Makroebene) s<strong>in</strong>d, die marg<strong>in</strong>alisierte Jugendlicher perspektivlos<br />
machen (Mikroebene) und nach e<strong>in</strong>em entzündenden Anlass (Aktualgenese) zu eruptiver kollektiver<br />
Gewalt und Gesetzeslosigkeit führen. Aus ihrer Sichtweise haben die <strong>in</strong> Banden lebenden K<strong>in</strong><strong>der</strong> und<br />
Jugendlichen nichts mehr zu verlieren.<br />
Gesellschaftliche Integration und Teilhabechancen für alle Gruppen s<strong>in</strong>d wichtige - auch krim<strong>in</strong>alpolitische<br />
– Zielsetzungen und Teil e<strong>in</strong>er präventiven Strategie, die die Mehrzahl <strong>der</strong> politischen Handlungsfel<strong>der</strong><br />
e<strong>in</strong>zubeziehen hat. www.krim<strong>in</strong>alpraevention.de<br />
Ihre<br />
Kar<strong>in</strong> Wilke<br />
3
___________________________________________________________________________________<br />
1.) Städtebauför<strong>der</strong>ung 20<strong>11</strong><br />
www.bmvbs.de<br />
_______________________________________________________________________________________<br />
Die Städtebauför<strong>der</strong>ung des Bundes ist e<strong>in</strong>es <strong>der</strong> wichtigsten Instrumente zur För<strong>der</strong>ung von nachhaltiger<br />
Stadtentwicklung. Der Bund stellt Län<strong>der</strong>n und Geme<strong>in</strong>den im Programmjahr 20<strong>11</strong> 455 Mio. Euro<br />
für Stadtentwicklungsvorhaben zur Verfügung.<br />
Die Städtebauför<strong>der</strong>ung trägt dazu bei, die Ziele e<strong>in</strong>er sozial, wirtschaftlich und ökologisch ausgewogenen<br />
Stadtentwicklungs- und Stadterneuerungspolitik zu konkretisieren. Das örtliche Baugewerbe<br />
und das Handwerk profitieren nachhaltig von den Investitionen, welche mit Hilfe des Bundes <strong>in</strong> den<br />
aktuell rund 3.600 Gebieten <strong>der</strong> Städtebauför<strong>der</strong>ung getätigt werden. Folgende Bund-Län<strong>der</strong>-<br />
Programme <strong>der</strong> Städtebauför<strong>der</strong>ung stehen zur Verfügung:<br />
"Stadtumbau" für die Anpassung an den demographischen und strukturellen Wandel <strong>in</strong> Ost (rund 83<br />
Millionen Euro) und West (rund 75 Millionen Euro),<br />
"Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" für die Innenentwicklung (rund 90 Millionen Euro),<br />
"Soziale Stadt" für <strong>in</strong>tegrativ-offene Ansätze <strong>in</strong> benachteiligten Quartieren und sozialen Brennpunkten<br />
(rund 28,5 Millionen Euro),<br />
"Städtebaulicher Denkmalschutz" für den Erhalt historischer Stadtkerne und Stadtquartiere <strong>in</strong> Ost<br />
(rund 62 Millionen Euro) und West (rund 30 Millionen Euro),<br />
"Kle<strong>in</strong>ere Städte und Geme<strong>in</strong>den" zur Sicherung <strong>der</strong> Dase<strong>in</strong>svorsorge <strong>in</strong> ländlichen o<strong>der</strong> dünn besiedelten<br />
Räumen (rund 35 Millionen Euro)<br />
"Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen" <strong>in</strong> Ost und West (je rund 25 Millionen Euro).<br />
Quelle: BMVBS<br />
__________________________________________________________________________________________________________________<br />
2.) Reduzierung <strong>der</strong> „Soziale Stadt“ För<strong>der</strong>ung<br />
______________________________________________________________________________<br />
Das Städtebauför<strong>der</strong>ungsprogramm "<strong>Stadtteil</strong>e mit beson<strong>der</strong>em<br />
Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt" des Bundesm<strong>in</strong>isteriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung<br />
(BMVBS) und <strong>der</strong> Län<strong>der</strong> wurde im Jahr 1999 mit dem Ziel e<strong>in</strong>gerichtet, benachteiligte <strong>Stadtteil</strong>e<br />
städtebaulich aufzuwerten und die Lebensbed<strong>in</strong>gungen und -chancen <strong>der</strong> dort lebenden Bewohner<br />
umfassend zu verbessern. Die Soziale Stadt startete im Jahr 1999 mit 161 <strong>Stadtteil</strong>en <strong>in</strong> 124 Geme<strong>in</strong>den;<br />
mit Stand 2009 s<strong>in</strong>d es 571 Gebiete <strong>in</strong> 355 Geme<strong>in</strong>den.<br />
Das Programm Soziale Stadt wird auf Bundesebene durch das Bundes<strong>in</strong>stitut für Bau-, Stadt- und<br />
Raumforschung (BBSR) fachlich-wissenschaftlich betreut. Die Umsetzung erfolgt durch Län<strong>der</strong> und<br />
Kommunen.<br />
Bis e<strong>in</strong>schließlich 2009 haben Bund, Län<strong>der</strong> und Kommunen rund 2,7 Milliarden Euro für rund 570 Programmgebiete<br />
<strong>in</strong> 355 Städten und Geme<strong>in</strong>den bereitgestellt. Dabei f<strong>in</strong>anziert <strong>der</strong> Bund e<strong>in</strong> Drittel des<br />
Gesamtprogramms durch F<strong>in</strong>anzhilfen nach Artikel 104b Grundgesetz. Län<strong>der</strong> und Kommunen tragen<br />
zusammen zwei Drittel.<br />
4
Für das <strong>Haus</strong>haltsjahr 2010 wurden für das Städtebauför<strong>der</strong>ungsprogramm „Soziale Stadt“ Bundesf<strong>in</strong>anzhilfen<br />
<strong>in</strong> Höhe von rund 95 Millionen Euro bewilligt. Hiervon konnten 44,9 Millionen Euro für Modellvorhaben<br />
zu sozial-<strong>in</strong>tegrativen För<strong>der</strong>zwecken e<strong>in</strong>gesetzt werden. Zusammen mit den Komplementärmitteln<br />
<strong>der</strong> Län<strong>der</strong> und Kommunen stand damit e<strong>in</strong> Programmvolumen 2010 <strong>in</strong> Höhe von etwa<br />
285 Millionen Euro für die „Soziale Stadt“ zur Verfügung.<br />
Für das Programmjahr 20<strong>11</strong> s<strong>in</strong>d die Bundesmittel auf 28,5 Millionen Euro gekürzt worden.<br />
Zur Höhe <strong>der</strong> im Jahre 2012 zur Verfügung stehenden Mittel ist bis noch ke<strong>in</strong>e abschließende Aussage<br />
zu treffen. Es steht zu befürchten, dass <strong>der</strong> Bund nach <strong>der</strong> deutlichen Reduzierung für 20<strong>11</strong> die Mittel<br />
im folgenden Jahr erneut weiter zurückfahren wird.<br />
Die kommunalen Spitzenverbände haben dies mehrfach auf verschiedenen Ebenen kritisiert und appellieren<br />
außerdem an die Landesregierung, auch für den Fall e<strong>in</strong>er Reduzierung von Bundesmitteln<br />
die Städtebauför<strong>der</strong>ung mit Landesmitteln m<strong>in</strong>destens <strong>in</strong> <strong>der</strong> bisherigen Höhe weiter zu unterstützen.<br />
Bündnis für e<strong>in</strong>e Soziale Stadt www.buendnis-soziale-stadt.de<br />
Die für das Jahr 20<strong>11</strong> von <strong>der</strong> Regierungskoalition beschlossene<br />
radikale Kürzung des Programms "Soziale Stadt" beseitigt<br />
dessen bedeutungsvollen strategischen Ansatz. Kernanliegen<br />
und Erfolgsgarantie des Programms, nämlich die Verknüpfung<br />
baulich-<strong>in</strong>vestiver und sozialer Maßnahmen, werden nicht mehr<br />
zugelassen. Das bedeutet faktisch das Aus für das "Soziale" im<br />
Programm "Soziale Stadt".<br />
Die Auslober des Bündnisses for<strong>der</strong>n alle, die sich für sozialen Frieden und solidarischen Zusammenhalt<br />
<strong>in</strong> den Wohn- und Stadtquartieren Deutschlands engagieren, zur Fortsetzung <strong>der</strong> erfolgreichen<br />
<strong>in</strong>tegrierten Stadtentwicklungspolitik auf <strong>der</strong> Grundlage <strong>der</strong> Städtebauför<strong>der</strong>ung auf.<br />
Erstunterzeichner des Gründungsaufrufs des "Bündnis für e<strong>in</strong>e Soziale Stadt" am 13. Januar 20<strong>11</strong> <strong>in</strong><br />
Berl<strong>in</strong> waren: Deutscher Städtetag, GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen,<br />
AWO Arbeiterwohlfahrt Bundesverband, vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung,<br />
Scha<strong>der</strong>-Stiftung, Deutscher Mieterbund.<br />
Dem „Bündnis für e<strong>in</strong>e Soziale Stadt“ hat sich die Stadt Osterholz-Scharmbeck angeschlossen.<br />
Städtebauför<strong>der</strong>ung: Anträge <strong>der</strong> Opposition<br />
Die E<strong>in</strong>schnitte im Bereich <strong>der</strong> Städtebauför<strong>der</strong>ung und <strong>der</strong> Sozialen Stadt seitens <strong>der</strong> Bundesregierung<br />
s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>nerhalb und außerhalb des Parlaments vielstimmiger Kritik ausgesetzt. Am 28. Juni 20<strong>11</strong><br />
hat die Konferenz <strong>der</strong> für Städtebau, Bau- und Wohnungswesen zuständigen M<strong>in</strong>ister und Senatoren<br />
<strong>der</strong> Län<strong>der</strong> (ARGEBAU) die Bundesregierung e<strong>in</strong>stimmig dazu aufgefor<strong>der</strong>t, die Mittel ab 2012 wie<strong>der</strong><br />
deutlich anzuheben sowie die Län<strong>der</strong> künftig <strong>in</strong> die F<strong>in</strong>anzplanungen frühzeitig e<strong>in</strong>zubeziehen, um<br />
Planungssicherheit zu erhalten.<br />
Die Fraktion DIE LINKE hat diese For<strong>der</strong>ungen als Gegenstand e<strong>in</strong>es Entschlussantrages <strong>in</strong> den Bundestag<br />
e<strong>in</strong>gebracht. In e<strong>in</strong>em geme<strong>in</strong>samen Entschlussantrag <strong>der</strong> SPD-Fraktion und <strong>der</strong> Fraktion<br />
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN geht es umfassend um die Instrumentarien <strong>der</strong> Städtebauför<strong>der</strong>ung, um<br />
<strong>der</strong>en Fortschreibung und Weiterentwicklung <strong>in</strong> den nächsten Jahren. Dabei geht es auch um e<strong>in</strong>e<br />
grundsätzliche bessere F<strong>in</strong>anzausstattung <strong>der</strong> Kommunen und Städte.<br />
Quelle: Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement<br />
5
___________________________________________________________________________________<br />
3.) Abriss <strong>der</strong> „Weißen Blöcke“ und Neubebauung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Mozartstraße<br />
_______________________________________________________________________________________<br />
Im Wege <strong>der</strong> Zwangsversteigerung konnte die<br />
Stadtentwicklungsgesellschaft Osterholz-<br />
Scharmbeck – STEG am 09.02.2010 <strong>in</strong>sgesamt<br />
191 <strong>der</strong> 199 Wohnungen <strong>in</strong> den acht „Weißen<br />
Blöcken“ <strong>der</strong> Mozartstraße sowie 71 <strong>der</strong><br />
<strong>in</strong>sgesamt 75 Garagen ersteigern. Die STEG<br />
hatte den Zuschlag für e<strong>in</strong>e „gute Million<br />
Euro“ bekommen. Die STEG erzielte, die<br />
restlichen acht Wohnungen und vier Garagen<br />
zum Verkehrswert von je 5.000 Euro zu erwerben.<br />
Sodann wurde e<strong>in</strong> Abrisskonzept für die<br />
<strong>in</strong>solventen „Weißen Blöcke“ erstellt und die<br />
Ausschreibung <strong>der</strong> Abrissarbeiten<br />
vorgenommen, so dass mittlerweile mit den<br />
Abbrucharbeiten begonnen werden konnte.<br />
Die Beseitigung <strong>der</strong> acht 'Weißen Blöcke' wird<br />
zuzüglich <strong>der</strong> erfor<strong>der</strong>lichen Erdarbeiten rund<br />
950.000 Euro kosten.<br />
Nach dem vollendeten Abriss soll e<strong>in</strong>e kle<strong>in</strong>teilige<br />
Wohnbebauung realisiert werden.<br />
Neue Straßen werden angelegt und etwa 45<br />
Baugrundstücke für E<strong>in</strong>familien- und Zweifamilienhäuser<br />
sollen entstehen. Beabsichtigt<br />
ist, das Wohngebiet <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> nächsten<br />
zwei bis drei Jahre zu entwickeln und so e<strong>in</strong>e<br />
Aufwertung des Gebietes zu erzielen.<br />
Die neu entstehenden Grundstücke sollen zwischen 450 und 600 qm groß se<strong>in</strong>, für Doppelhäuser s<strong>in</strong>d<br />
je <strong>Haus</strong>hälfte etwa 200 bis 350 qm vorgesehen. Der Quadratmeterpreis steht noch nicht fest. Zunächst<br />
muss e<strong>in</strong> Gutachterausschuss die Bodenrichtwerte <strong>in</strong> dem Quartier festlegen. Das wird bis Ende<br />
20<strong>11</strong> geschehen.<br />
Als erster Bauabschnitt soll im zweiten Quartal<br />
2012 e<strong>in</strong>e erste Erschließungsstraße als<br />
Baustraße nebst Schmutz- und Regenwasserkanal<br />
angelegt werden, um die Grundstücke<br />
im östlichen Bereich des neu entstehenden<br />
Wohngebietes zugänglich zu machen. Das<br />
s<strong>in</strong>d 14 Grundstücke für E<strong>in</strong>zelhäuser sowie 3<br />
Grundstücke für Doppelhäuser. Die<br />
Ausschreibung für den Straßenbau erfolgt<br />
Anfang 2012. Parallel dazu wird die<br />
Stadtentwicklungsgesellschaft – STEG mit <strong>der</strong><br />
Vermarktung <strong>der</strong> Grundstücke beg<strong>in</strong>nen.<br />
Die weitere Erschließung des Neubaugebietes hängt von <strong>der</strong> Nachfrage ab. Ziel ist es, alle Baugrundstücke<br />
<strong>in</strong> den nächsten zwei bis drei Jahren zu veräußern. Die STEG wird die Baugrundstücke<br />
ohne B<strong>in</strong>dung an e<strong>in</strong>en Bauträger anbieten. Je<strong>der</strong> Bauherr kann selbst entscheiden, von welchem<br />
6
Unternehmen er sich se<strong>in</strong>e Immobilie errichten lässt. Bauträger haben überdies die Möglichkeit,<br />
Baugrundstücke zu erwerben und dann selbst weiterzuvermarkten.<br />
_______________________________________________________________________________________<br />
4.) „Die Wirklichkeit anerkennen“<br />
Aygül Özkan über Zuwan<strong>der</strong>ung und Integration<br />
www.goethe.de<br />
Hans-Mart<strong>in</strong> Schönherr-Mann<br />
_____________________________________________________________<br />
Seit 2010 ist Aygül Özkan M<strong>in</strong>ister<strong>in</strong> für Soziales, Frauen, Familie,<br />
Gesundheit und Integration <strong>in</strong> Nie<strong>der</strong>sachsen. Goethe.de sprach mit<br />
<strong>der</strong> ersten türkischstämmigen M<strong>in</strong>ister<strong>in</strong> <strong>in</strong> Deutschland über die Ziele <strong>der</strong> Integrationspolitik und<br />
die Notwendigkeit von Zuwan<strong>der</strong>ung <strong>in</strong> <strong>der</strong> alternden Gesellschaft.<br />
Frau M<strong>in</strong>ister<strong>in</strong> Özkan, wie sehen Sie die faktische Situation <strong>der</strong> Integration <strong>in</strong> Deutschland, speziell<br />
auch vor dem H<strong>in</strong>tergrund <strong>der</strong> Sarraz<strong>in</strong>-Debatte, die nicht nur hierzulande, son<strong>der</strong>n auch im Ausland<br />
auf erstaunliche Resonanz gestoßen ist?<br />
Es ist wichtig, dass wir <strong>in</strong> ruhiger und sachlicher Atmosphäre über Verb<strong>in</strong>dendes und über Trennendes,<br />
über Positives und Negatives sprechen. Mir geht es nicht darum, Ängste und Sorgen e<strong>in</strong>fach „vom<br />
Tisch zu wischen“. Aber wir dürfen bei aller wichtigen und notwendigen Kritik nicht vergessen, dass<br />
es durchaus auch große Erfolge <strong>in</strong> <strong>der</strong> Integrationspolitik gibt.<br />
Insbeson<strong>der</strong>e die Menschen, die <strong>in</strong> <strong>der</strong> ersten Generation zu uns gekommen s<strong>in</strong>d, haben seitdem viel<br />
für dieses Land geleistet. Wir sorgen nun dafür, dass die vierte, fünfte und sechste Generation daran<br />
anknüpfen kann. Die Entwicklung <strong>der</strong> letzten Jahre zeigt: Die Integration schreitet voran, die Sprachkenntnisse<br />
bessern sich, Migrant<strong>in</strong>nen und Migranten übernehmen zunehmend Verantwortung <strong>in</strong> Wirtschaft,<br />
Politik und Gesellschaft.<br />
Vielfalt ist immer besser als E<strong>in</strong>falt<br />
Wie stehen Sie zu <strong>der</strong> Debatte um Multikulturalität o<strong>der</strong> Leitkultur?<br />
Ich denke nicht <strong>in</strong> solchen Begriffen. Wichtig ist, dass wir die Wirklichkeit<br />
anerkennen: Wir haben Zuwan<strong>der</strong>er <strong>in</strong> unserem Land – und wir werden<br />
angesichts des demografischen Wandels weitere Zuwan<strong>der</strong>ung<br />
brauchen. Diese Menschen s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>e Chance für unser Land.<br />
7
Hat die Zuwan<strong>der</strong>ung zu e<strong>in</strong>er Vielfalt geführt, die Deutschland bereichert?<br />
In Deutschland geborene und zugewan<strong>der</strong>te Menschen s<strong>in</strong>d nicht Rivalen, son<strong>der</strong>n Partner im<br />
Deutschland <strong>der</strong> Zukunft. Von dieser Vielfalt werden wir alle profitieren. Versöhnende Vielfalt ist<br />
immer besser als E<strong>in</strong>falt.<br />
O<strong>der</strong> haben sich gefährliche Parallelgesellschaften gebildet?<br />
Es geht um e<strong>in</strong> generelles Problem, e<strong>in</strong>e gesamte Schicht, zu <strong>der</strong> nicht nur Türken o<strong>der</strong> Araber gehören,<br />
son<strong>der</strong>n auch Deutsche. Für diese Schicht müssen wir etwas tun. Die K<strong>in</strong><strong>der</strong> dürfen nicht <strong>in</strong> sogenannte<br />
„Hartz-IV-Karrieren“ abgleiten.<br />
Niemand muss se<strong>in</strong>e Wurzeln verleugnen<br />
In welche Richtung sollte e<strong>in</strong>e gel<strong>in</strong>gende Integrationspolitik <strong>in</strong>tensiviert werden?<br />
Wir haben zwei Aufgaben. Erstens müssen wir die hier lebenden jungen Menschen<br />
mit Zuwan<strong>der</strong>ungsh<strong>in</strong>tergrund <strong>in</strong> Arbeit und Ausbildung <strong>in</strong>tegrieren und ihnen e<strong>in</strong>e<br />
Perspektive bieten. Zweitens ist – angesichts e<strong>in</strong>er älter werdenden Gesellschaft –<br />
e<strong>in</strong>e gezielte Zuwan<strong>der</strong>ung an Arbeitskräften für bestimmte Branchen und<br />
Bereiche s<strong>in</strong>nvoll. Integration kann durch staatliche Hilfen unterstützt werden,<br />
aber sie ist e<strong>in</strong> Prozess, <strong>der</strong> im Kle<strong>in</strong>en stattf<strong>in</strong>det, im Alltag: K<strong>in</strong><strong>der</strong>gärten,<br />
Schulen, Arbeitsplätze und Vere<strong>in</strong>e s<strong>in</strong>d Orte, wo unsere Gesellschaft zusammenwächst.<br />
Könnte dabei <strong>in</strong>des nicht auch e<strong>in</strong>e Art Assimilation drohen?<br />
Vor allem soll sich je<strong>der</strong>, <strong>der</strong> <strong>in</strong> Deutschland lebt, auch mit unserem Land identifizieren. Deshalb<br />
muss er ja nicht se<strong>in</strong>e Wurzeln verleugnen.<br />
Quelle: Goethe Institut<br />
___________________________________________________________________________________________<br />
5.) Integration trotz Segregation -<br />
Stadtforscher Walter Siebel im Gespräch<br />
(Professor an <strong>der</strong> Universität Oldenburg, Mitglied für Städtebau und<br />
Landesplanung sowie Träger des Schumacher- und des Scha<strong>der</strong>preies)<br />
www.goethe.de<br />
Roland Detsch – Februar 20<strong>11</strong><br />
____________________________________________________________<br />
Integration statt Segregation, so lautet das landläufige Rezept, um Deutschlands Rolle als E<strong>in</strong>wan<strong>der</strong>ungsland<br />
gerecht zu werden. Politisches Experimentierfeld ist dabei <strong>der</strong> urbane Raum.<br />
Der Stadtforscher Walter Siebel plädiert für Integration trotz Segregation als Alternative.<br />
Herr Professor Siebel, <strong>der</strong> Multikulturalismus, wie er lange Zeit als Ideal e<strong>in</strong>er sich gegenseitig befruchtenden<br />
multiethnischen Gesellschaft gepriesen wurde, hat sich spätestens zu Beg<strong>in</strong>n des 21.<br />
Jahrhun<strong>der</strong>ts als Wunschvorstellung erwiesen. Dennoch ist er <strong>in</strong> den Großstädten als Merkmal von<br />
Urbanität längst soziale Realität und unumkehrbar geworden. Kann e<strong>in</strong> friedliches Zusammenleben<br />
auf so engem Raum überhaupt möglich se<strong>in</strong>, wenn man sich fremd ist o<strong>der</strong> gar fe<strong>in</strong>dselig gegenüber<br />
steht?<br />
Mo<strong>der</strong>ne Gesellschaften werden nicht nur durch Homogenität <strong>in</strong>tegriert son<strong>der</strong>n ebenso durch ihre<br />
Fähigkeit, Differenz gar nicht zur Kenntnis zu nehmen. In Städten funktioniert das ähnlich wie auf<br />
Märkten, <strong>in</strong> <strong>der</strong> Demokratie o<strong>der</strong> im Rechtsstaat, wo es um Waren, Qualifikationen o<strong>der</strong> Geld geht,<br />
beziehungsweise die Teilhabe ohne Ansehen <strong>der</strong> Person unabhängig von Hautfarbe, Bildung o<strong>der</strong> politischen<br />
Überzeugungen läuft. Im öffentlichen Raum begegnen sich dort auch E<strong>in</strong>heimische e<strong>in</strong>an<strong>der</strong><br />
als Fremde.<br />
8
Fremdheit wird eben nicht erst durch Migration importiert. Mo<strong>der</strong>ne Städte produzieren aus sich heraus<br />
e<strong>in</strong>e Vielzahl von Milieus, die e<strong>in</strong>an<strong>der</strong> fremd s<strong>in</strong>d. Die Angehörigen bestimmter Jugendkulturen<br />
dürften dem deutschen Arbeiter frem<strong>der</strong> se<strong>in</strong> als se<strong>in</strong> türkischer Kollege. Deshalb hat sich <strong>in</strong> den<br />
Städten vor aller Zuwan<strong>der</strong>ung e<strong>in</strong>e urbane Mentalität entwickelt, die e<strong>in</strong>e zwanglose und konfliktfreie<br />
Koexistenz von Fremden ermöglicht. Der Soziologe Georg Simmel hat diese Mentalität mit den<br />
Begriffen Reserviertheit, Blasiertheit, Gleichgültigkeit und Intellektualität umschrieben. Der Städter<br />
wappnet sich gegen die beunruhigenden Erfahrungen <strong>der</strong> alltäglichen Fremdheit mit Distanz.<br />
Vertraute Heimat <strong>in</strong> <strong>der</strong> Fremde<br />
Erfahrungsgemäß zieht es vor allem Neuankömml<strong>in</strong>ge <strong>in</strong> <strong>Stadtteil</strong>e, wo<br />
sie Landsleute und vertraute Milieus antreffen. Oft ist das schlicht e<strong>in</strong>e<br />
Frage <strong>der</strong> F<strong>in</strong>anzen, etwa wenn es um bezahlbare Mieten geht, weshalb<br />
dort auch häufig e<strong>in</strong>heimische soziale Randgruppen beheimatet s<strong>in</strong>d.<br />
Birgt das nicht die Gefahr von unbeherrschbaren Rangordnungskonflikten?<br />
Die Konzentration von Zuwan<strong>der</strong>ern <strong>in</strong> bestimmten Vierteln, wo sie<br />
Ihresgleichen f<strong>in</strong>den, ist e<strong>in</strong> Phänomen aller E<strong>in</strong>wan<strong>der</strong>ungsstädte. Auch<br />
die Deutschen s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> Amerika zunächst e<strong>in</strong>mal nach „German Town“<br />
gezogen. Ethnische Kolonien fungieren als Brückenköpfe vertrauter Heimat <strong>in</strong> <strong>der</strong> Fremde, wo <strong>der</strong><br />
Neuankömml<strong>in</strong>g zunächst e<strong>in</strong>mal Unterkunft, Orientierung und Arbeitsmöglichkeiten f<strong>in</strong>det, aber<br />
auch Hilfe, Schutz vor Isolation und Unterstützung <strong>in</strong> psychischen Krisen, die so oft mit Migration<br />
verbunden s<strong>in</strong>d. Aber Sie weisen zu recht darauf h<strong>in</strong>, dass die meisten Migranten, die nach Deutschland<br />
kommen – <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schweiz ist das ganz an<strong>der</strong>s –, arm s<strong>in</strong>d und deshalb <strong>in</strong> Wohngebieten unterkommen,<br />
wo sie <strong>in</strong> <strong>der</strong> Nachbarschaft nicht auf grün-alternative Multikulti-Begeisterte treffen, son<strong>der</strong>n<br />
auf die deutschen Opfer des Strukturwandels. Verlierer suchen Sündenböcke und dazu eignen<br />
sich Zuwan<strong>der</strong>er hervorragend. Also s<strong>in</strong>d diese „überfor<strong>der</strong>ten Nachbarschaften“ oft Orte gegenseitiger<br />
aggressiver Abgrenzung.<br />
Mischen o<strong>der</strong> Trennen, das ist die Frage, wenn es um die Regulierung heterogener Stadtgesellschaften<br />
geht. „Integration trotz Segregation“ lautet die überraschende Empfehlung, mit <strong>der</strong> Sie sie beantwortet<br />
haben. Bedeutet das nicht Ghetto?<br />
Die Konzentration bestimmter sozialer Gruppen <strong>in</strong> bestimmten Quartieren ist e<strong>in</strong> universelles Phänomen.<br />
Indem sie die täglichen Reibungen und Ärgernisse zwischen Gruppen mit unterschiedlichen Lebensweisen<br />
verr<strong>in</strong>gert, dient räumliche Distanz durch Segregation nicht zuletzt <strong>der</strong> Konfliktvermeidung.<br />
Ethnische Kolonien erfüllen durchaus positive Funktionen im Prozess <strong>der</strong> Integration. Sie bieten<br />
e<strong>in</strong>en Schutz- und Übergangsraum, von dem aus die neue Gesellschaft allmählich kennengelernt werden<br />
kann. Das Wichtigste ist, dass Segregation freiwillig und nicht gezwungenermaßen durch Diskrim<strong>in</strong>ierung,<br />
Wohnungspolitik o<strong>der</strong> Marktmechanismen zustande kommt. Das muss die oberste Maxime<br />
städtischer Integrationspolitik se<strong>in</strong>.<br />
Die Kultur <strong>der</strong> Stadt ist e<strong>in</strong>e Kultur <strong>der</strong> Differenz<br />
Wohnquartiere als Auffangstationen für Neuankömml<strong>in</strong>ge, die als Brücken zwischen<br />
alter und neuer Heimat auf dem Weg zur Integration dienen – das kl<strong>in</strong>gt<br />
gut. Aber kann man verh<strong>in</strong><strong>der</strong>n, dass sie am Ende zu abgeschotteten Exklaven <strong>der</strong><br />
Heimat o<strong>der</strong> gar zu Refugien zur Kultivierung von Parallelgesellschaften mutieren?<br />
E<strong>in</strong>wan<strong>der</strong>ungsquartiere s<strong>in</strong>d immer auch <strong>in</strong> Gefahr, zu Fallen zu werden, wenn<br />
sich die Migranten – häufig nach gescheiterten Integrationsversuchen – <strong>in</strong> e<strong>in</strong><br />
enges und erstarrtes Herkunftsmilieu zurückziehen. Erste und wichtigste<br />
Voraussetzung, das zu vermeiden, wäre für die Funktionsfähigkeit von Markt, Demokratie, Recht und<br />
Stadt zu sorgen. Wären sie entsprechend ihrer Funktionslogik pr<strong>in</strong>zipiell offene Systeme, wäre nicht<br />
mehr viel geson<strong>der</strong>te Politik zur Integration von Zuwan<strong>der</strong>ern nötig.<br />
„Multikulti“ ist ja zum politischen Kampfbegriff geworden. Ist Multikulturalismus im positiven S<strong>in</strong>ne<br />
tatsächlich e<strong>in</strong> für alle Mal gescheitert, wie man immer wie<strong>der</strong> hört?<br />
9
Es kommt darauf an, was man darunter versteht. Natürlich gibt es e<strong>in</strong>e Leitkultur, an die sich anpassen<br />
muss, wer hier sozial und beruflich erfolgreich se<strong>in</strong> will. Jenseits davon ist kulturelle Differenz<br />
aber geradezu e<strong>in</strong> Ferment dynamischer Gesellschaften. Begegnungen mit dem An<strong>der</strong>sartigen und<br />
überraschende Erfahrungen, wie sie <strong>der</strong> öffentliche Raum <strong>der</strong> Stadt vermittelt, können ebenso wie<br />
die Konfrontation mit neuen Argumenten e<strong>in</strong>gefahrene Rout<strong>in</strong>en und Denkweisen aufbrechen. Sie<br />
s<strong>in</strong>d verunsichernd, und Verunsicherung kann zu Abgrenzung aber auch zu Reflexion von Selbstverständlichkeiten<br />
führen. Das ist wie<strong>der</strong>um Voraussetzung für kulturellen Wandel. Was das Stadtleben<br />
so anstrengend macht – die Nähe des Fremden –, ist somit e<strong>in</strong>e entscheidende Bed<strong>in</strong>gung für die Produktivität<br />
<strong>der</strong> Stadt. Die Kultur <strong>der</strong> Stadt ist e<strong>in</strong>e Kultur <strong>der</strong> Differenz, und eben deshalb s<strong>in</strong>d Städte<br />
kreative Orte.<br />
Quelle: Goethe Institut<br />
_______________________________________________________________________________________<br />
6.) Begegnungen im <strong>Stadtteil</strong>haus „<strong>Haus</strong> <strong>der</strong> <strong>Kulturen</strong> Osterholz-Scharmbeck“<br />
_______________________________________________________________________________________<br />
Seit <strong>der</strong> Eröffnung des neuen <strong>Stadtteil</strong>hauses<br />
„<strong>Haus</strong> <strong>der</strong> <strong>Kulturen</strong> Osterholz-Scharmbeck“<br />
am Quartiersplatz an <strong>der</strong> Mozartstraße im<br />
Oktober 2010 ermöglicht das Begegnungszentrum<br />
als „Ort <strong>der</strong> Kommunikation &<br />
Integration“ vielfältige Begegnungen<br />
zwischen zugewan<strong>der</strong>ten und deutschen Familien/Frauen,<br />
die die offenen<br />
<strong>in</strong>terkulturellen Angebote sowie die<br />
Bildungs- und Beratungsangebote mit<br />
Unterstützungen im Alltag nutzen.<br />
Osterfest im <strong>Stadtteil</strong> 20<strong>11</strong><br />
Zu den vielfältigen Angeboten zählen u.a.:<br />
Hilfen zur Integration für Zugewan<strong>der</strong>te,<br />
Unterstützung beim E<strong>in</strong>bürgerungsverfahren,<br />
Deutschsprachkurse für Migrant<strong>in</strong>nen<br />
„Deutsch sprechen, lesen & schreiben“, die<br />
„DabeiSe<strong>in</strong>!“ Servicestelle, Erziehungs- und<br />
Familienberatung, <strong>der</strong> Familienservice „Elterncafe´“,<br />
<strong>der</strong> Offene Müttertreff und <strong>der</strong><br />
Treff für Alle<strong>in</strong>erziehende, das<br />
Frauenfrühstück, die S<strong>in</strong>gende Kochgruppe,<br />
die Offene Nähgruppe, <strong>der</strong> Thailändischer<br />
Frauentreff, Frauengymnastik sowie die<br />
Kultur- und Literatur-Werkstatt.<br />
Frauenfrühstück im <strong>Haus</strong> <strong>der</strong> <strong>Kulturen</strong><br />
10
Neben Vorträgen zu aktuellen Themen zählen zu den Sem<strong>in</strong>arangeboten <strong>in</strong> 20<strong>11</strong> e<strong>in</strong> Kommunikations-<br />
Workshop „Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg – Worte s<strong>in</strong>d Fenster o<strong>der</strong><br />
Mauern“ mit Frau Petra Pfitzner sowie <strong>der</strong> Kurs „Neue Perspektiven für Frauen“ mit Frau Evelyn<br />
Fromme.<br />
Sommerfest im <strong>Stadtteil</strong> 20<strong>11</strong><br />
_______________________________________________________________________________________<br />
7.) Programmheft „Gleichstellung und Integration <strong>in</strong> <strong>der</strong> Stadt<br />
Osterholz-Scharmbeck - Herbst/W<strong>in</strong>ter 20<strong>11</strong>“<br />
________________________________________________________<br />
Weitere Informationen zu den Sem<strong>in</strong>aren/Kursen können im<br />
Programmheft „Gleichstellung und Integration <strong>in</strong> <strong>der</strong> Stadt<br />
Osterholz-Scharmbeck“ – Angebote Herbst/W<strong>in</strong>ter 20<strong>11</strong> bezogen<br />
werden, das unter www.sozialestadt-netzwerk-ohz.de zum<br />
Herunterladen zur Verfügung steht.<br />
Zudem liegt das Programmheft im Rathaus <strong>der</strong> Stadt Osterholz-<br />
Scharmbeck (Informationsstelle, Bürgerbüro, Gleichstellungsbüro)<br />
für Sie aus.<br />
<strong>11</strong>
________________________________________________________________________________________________<br />
8.) Frauenfrühstücksterm<strong>in</strong>e bis März 2012:<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
Datum<br />
Freitag,<br />
19.08.20<strong>11</strong><br />
Freitag,<br />
02.09.20<strong>11</strong><br />
Freitag,<br />
07.10.20<strong>11</strong><br />
Freitag,<br />
04.<strong>11</strong>.20<strong>11</strong><br />
Freitag,<br />
02.12.20<strong>11</strong><br />
Freitag,<br />
13.01.2012<br />
Freitag,<br />
03.02.2012<br />
Freitag,<br />
10.03.20<strong>11</strong><br />
Name<br />
Frauenfrühstück im <strong>Stadtteil</strong>haus<br />
"<strong>Haus</strong> <strong>der</strong> <strong>Kulturen</strong> Osterholz-Scharmbeck"<br />
2. Halbjahr 20<strong>11</strong> und Ausblick 2012<br />
Gleichstellungsbeauftragte<br />
Kar<strong>in</strong> Wilke<br />
und Kandidat<strong>in</strong>nen für die<br />
Kommunalwahl 20<strong>11</strong><br />
Birgit Lemme<br />
Birgit Busch<br />
Marion Guerian<br />
Monika Mörsch<br />
Gleichstellungsbeauftragte<br />
Kar<strong>in</strong> Wilke<br />
Breitl<strong>in</strong>g, Sab<strong>in</strong>e<br />
Gleichstellungsbeauftragte<br />
Kar<strong>in</strong> Wilke<br />
Institution<br />
Stadt Osterholz-Scharmbeck<br />
Bremer Mediationswerkstatt<br />
Dorfhelfer<strong>in</strong>nen-Station<br />
Hambergen<br />
PARADIGMA Coach<strong>in</strong>g & Consult<strong>in</strong>g<br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong>hospiz Jona <strong>in</strong> Bremen<br />
-Friedehorst<br />
Stadt Osterholz-Scharmbeck<br />
Vitalstoffberater<strong>in</strong><br />
Stadt Osterholz-Scharmbeck<br />
12<br />
Vortrag<br />
Eröffnung <strong>der</strong> Wan<strong>der</strong>ausstellung<br />
"Mütter des<br />
Grundgesetzes"<br />
Führung durch die Ausstellung<br />
und Vorstellung<br />
<strong>der</strong> Kandidat<strong>in</strong>nen<br />
"Frauen <strong>in</strong> die Räte"<br />
Die Dorfhelfer<strong>in</strong>nenstation<br />
Hambergen<br />
Wertschätzende Kommunikation<br />
Das K<strong>in</strong><strong>der</strong>hospiz Jona <strong>in</strong><br />
Bremen -Friedehorst<br />
Ausstellung "Bewegte Lebenswege"<br />
Schönheit von <strong>in</strong>nen<br />
Internationaler Frauentag<br />
2012
Das Frauenfrühstück im <strong>Stadtteil</strong><br />
13
___________________________________________________________________________________<br />
9.) Integration durch ganzheitliche Bildung<br />
Die Bildungsbeteiligung von Migrant<strong>in</strong>nen und Migranten<br />
und ihre Bildungserfolge bedürfen unserer beson<strong>der</strong>en<br />
Aufmerksamkeit und - wo nötig - För<strong>der</strong>ung. Denn Bildung<br />
ist für ihre Integration <strong>in</strong> unsere Gesellschaft von<br />
herausragen<strong>der</strong> Bedeutung. Den K<strong>in</strong><strong>der</strong>n und<br />
Jugendlichen gilt dabei die beson<strong>der</strong>e Aufmerksamkeit,<br />
denn sie stellen bei den unter 25-Jährigen <strong>in</strong>zwischen<br />
mehr als e<strong>in</strong> Viertel <strong>der</strong> Altersgruppe. In den<br />
Ballungszentren <strong>der</strong> alten Bundeslän<strong>der</strong> kommen sogar bis zu 40 Prozent <strong>der</strong> Jugendlichen aus<br />
Zuwan<strong>der</strong>erfamilien.<br />
Die Verbesserung <strong>der</strong> Bildungschancen, Bildungsbeteiligung und Bildungserfolge <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e von<br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong>n und Jugendlichen mit Migrationsh<strong>in</strong>tergrund ist e<strong>in</strong>e <strong>der</strong> zentralen Herausfor<strong>der</strong>ungen für<br />
unser Bildungssystem.<br />
Die Bundesregierung ist entschlossen, sich dieser Herausfor<strong>der</strong>ung zu stellen. Dies kommt bereits <strong>in</strong><br />
<strong>der</strong> geme<strong>in</strong>samen Dresdner Erklärung "Qualifizierungs<strong>in</strong>itiative für Deutschland" <strong>der</strong> Bundeskanzler<strong>in</strong><br />
und <strong>der</strong> M<strong>in</strong>isterpräsidenten <strong>der</strong> Län<strong>der</strong> aus dem Jahr 2008 und im Nationalen Integrationsplan aus<br />
dem Jahr 2007 sowie dem Ersten Fortschrittsbericht dazu zum Ausdruck.<br />
Der Bund wird se<strong>in</strong>e Ausgaben für Bildung und Forschung bis 2013 um <strong>in</strong>sgesamt 12 Milliarden Euro<br />
erhöhen. Im Bildungsbereich werden die zusätzlichen Mittel gezielt an den Stellen e<strong>in</strong>gesetzt, die<br />
über e<strong>in</strong> Gel<strong>in</strong>gen des Bildungswegs entscheiden. So wird das BMBF neue Maßnahmen von beson<strong>der</strong>er<br />
Bedeutung für Jugendliche und junge Erwachsene mit Migrationsh<strong>in</strong>tergrund auflegen und se<strong>in</strong>e bewährten<br />
Maßnahmen fortschreiben bzw. weiterentwickeln.<br />
E<strong>in</strong> Großteil <strong>der</strong> För<strong>der</strong>maßnahmen richtet sich nicht ausschließlich an Personen mit Migrationsh<strong>in</strong>tergrund.<br />
Vielmehr können alle K<strong>in</strong><strong>der</strong> und Jugendliche mit beson<strong>der</strong>em Unterstützungsbedarf daran<br />
teilhaben. K<strong>in</strong><strong>der</strong> und Jugendliche mit Migrationsh<strong>in</strong>tergrund können von diesen Maßnahmen häufig <strong>in</strong><br />
beson<strong>der</strong>em Maße profitieren, da sie <strong>in</strong> den jeweiligen Zielgruppen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Regel stark vertreten s<strong>in</strong>d.<br />
E<strong>in</strong> Schwerpunkt <strong>der</strong> Projekte und För<strong>der</strong>programme des BMBF liegt im Bereich <strong>der</strong> Beruflichen Bildung.<br />
Darüber h<strong>in</strong>aus s<strong>in</strong>d zur Integration von Migrant<strong>in</strong>nen und Migranten sowie zur Sicherung des Fachkräftebedarfs<br />
verbesserte Möglichkeiten <strong>der</strong> Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsabschlüssen<br />
und beruflichen Qualifikationen notwendig. Die Bundesregierung hat e<strong>in</strong>en Gesetzentwurf<br />
(sog. Anerkennungsgesetz) beschlossen, <strong>der</strong> e<strong>in</strong>en Rechtsanspruch - unabhängig von Herkunft und<br />
Staatsangehörigkeit - auf e<strong>in</strong> Bewertungsverfahren enthält. Dieses Verfahren soll schnell und transparent<br />
klären, <strong>in</strong> welchem Maße im Ausland erworbene Qualifikationen deutschen Ausbildungen vergleichbar<br />
s<strong>in</strong>d.<br />
Quelle: Bundesm<strong>in</strong>isterium für Bildung und Forschung<br />
_______________________________________________________________________________________<br />
10.) Nachholbedarf <strong>in</strong> Sachen soziale Gerechtigkeit<br />
Neuer Index analysiert Armutsvermeidung und<br />
Bildungszugang als Problemfel<strong>der</strong><br />
www.bertelsmann-stiftung.de<br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong>armut ist auch für Deutschland e<strong>in</strong> Problem<br />
Patrick Clark, Getty Images<br />
______________________________________________<br />
Im Vergleich mit 31 OECD-Staaten liegt Deutschland<br />
mit Platz 15 lediglich im Mittelfeld. Das zeigt e<strong>in</strong>e<br />
aktuelle Studie <strong>der</strong> Bertelsmann Stiftung. Unter die<br />
14
Lupe genommen wurden die Politikfel<strong>der</strong> Armutsvermeidung, Bildungszugang, Arbeitsmarkt, sozialer<br />
Zusammenhalt und Gleichheit sowie Generationengerechtigkeit. Angeführt wird <strong>der</strong> Gerechtigkeits<strong>in</strong>dex<br />
von den nordeuropäischen Staaten Island, Schweden, Dänemark, Norwegen<br />
und F<strong>in</strong>nland. Schlusslicht ist die Türkei.<br />
Defizite für Deutschland sieht die Bertelsmann Stiftung <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e <strong>in</strong> den Fel<strong>der</strong>n Armutsvermeidung,<br />
Bildung und Arbeitsmarkt. "In e<strong>in</strong>er zukunftsfähigen Sozialen Marktwirtschaft dürfen wir uns<br />
nicht damit zufrieden geben, dass rund jedes neunte K<strong>in</strong>d <strong>in</strong> armen Verhältnissen aufwächst, Bildungschancen<br />
stark von sozialer Herkunft abhängen und vergleichsweise viele Menschen dauerhaft<br />
vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen bleiben", sagte Gunter Thielen, Vorstandsvorsitzen<strong>der</strong> <strong>der</strong> Bertelsmann<br />
Stiftung, bei <strong>der</strong> Vorstellung <strong>der</strong> Studie. Der <strong>in</strong>ternationale Vergleich zeige e<strong>in</strong>deutig: Soziale<br />
Gerechtigkeit und marktwirtschaftliche Leistungsfähigkeit müssten sich ke<strong>in</strong>eswegs gegenseitig ausschließen.<br />
Dies belegten <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e die nordeuropäischen Län<strong>der</strong>.<br />
E<strong>in</strong>kommensarmut hat <strong>in</strong> Deutschland <strong>in</strong> den vergangenen zwei Jahrzehnten zugenommen. Besorgniserregend<br />
ist dabei das Phänomen <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>armut. Rund jedes neunte K<strong>in</strong>d lebt unterhalb <strong>der</strong> Armutsgrenze.<br />
Daher mangelt es vielerorts bereits an den Grundvoraussetzungen sozialer Gerechtigkeit,<br />
denn unter den Bed<strong>in</strong>gungen von Armut s<strong>in</strong>d soziale Teilhabe und e<strong>in</strong> selbstbestimmtes Leben<br />
kaum möglich.<br />
Zum Vergleich: In Dänemark, das neben Schweden und Norwegen die ger<strong>in</strong>gsten Armutsquoten im<br />
OECD-weiten Vergleich aufweist, s<strong>in</strong>d lediglich 2,7 Prozent <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong> von Armut betroffen. Selbst<br />
Ungarn (Rang 8) und Tschechien (Rang 13) liegen noch vor Deutschland (Rang 14).<br />
Trotz verbesserter PISA-Ergebnisse deutscher Schüler<strong>in</strong>nen und Schüler - das deutsche Bildungssystem<br />
hat unter dem Aspekt <strong>der</strong> sozialen Gerechtigkeit weiterh<strong>in</strong> Defizite. Hier rangiert Deutschland im<br />
OECD-Vergleich mit Platz 22 nur im unteren Mittelfeld. Der Bildungserfolg von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n und Jugendlichen<br />
hängt stark mit ihrem jeweiligen sozioökonomischen H<strong>in</strong>tergrund zusammen. Die Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit,<br />
dass K<strong>in</strong><strong>der</strong> aus e<strong>in</strong>em sozial schwachen Umfeld durch Bildung befähigt werden, am gesellschaftlichen<br />
Wohlstand teilzuhaben, ist <strong>in</strong> Deutschland ger<strong>in</strong>ger als <strong>in</strong> vielen an<strong>der</strong>en OECD-Staaten.<br />
Die Investitionen <strong>in</strong> frühk<strong>in</strong>dliche Bildung, e<strong>in</strong>es <strong>der</strong> Schlüsselfel<strong>der</strong> zur Gewährleistung gleicher Lebenschancen,<br />
s<strong>in</strong>d zudem noch stark ausbaufähig.<br />
Die weltweite Wirtschaftskrise ist <strong>in</strong> Deutschland am Arbeitsmarkt trotz <strong>der</strong> starken Exportabhängigkeit<br />
<strong>der</strong> <strong>in</strong>ländischen Wirtschaft deutlich weniger spürbar als <strong>in</strong> an<strong>der</strong>en Län<strong>der</strong>n. Doch unter dem<br />
Gesichtspunkt soziale Gerechtigkeit gibt es durchaus noch Schattenseiten. So bleibt e<strong>in</strong>igen gesellschaftlichen<br />
Gruppen - wie Langzeitarbeitslosen und Ger<strong>in</strong>gqualifizierten - auch weiterh<strong>in</strong> <strong>der</strong> Zugang<br />
zu Beschäftigung massiv erschwert. H<strong>in</strong>sichtlich <strong>der</strong> Vermeidung von Langzeitarbeitslosigkeit liegt<br />
Deutschland im OECD-Vergleich sogar auf dem vorletzten Platz.<br />
Auch beim Aspekt sozialer Zusammenhalt und Gleichheit bestehen Defizite. Die Ungleichverteilung<br />
<strong>der</strong> E<strong>in</strong>kommen <strong>in</strong> Deutschland hat <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> letzten zwei Jahrzehnte so stark zugenommen wie<br />
<strong>in</strong> kaum e<strong>in</strong>em an<strong>der</strong>en OECD-Mitgliedsland. Mit Blick auf den Zusammenhalt e<strong>in</strong>er Gesellschaft ist<br />
e<strong>in</strong>e solche Polarisierungstendenz bedenklich. Bei Fragen <strong>der</strong> Gleichbehandlung und <strong>der</strong> Vermeidung<br />
von Diskrim<strong>in</strong>ierungen herrschen <strong>in</strong> Deutschland zwar hohe rechtliche Standards. Doch gibt es <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Praxis durchaus Fälle von Diskrim<strong>in</strong>ierung, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e h<strong>in</strong>sichtlich des Alters, des Geschlechts<br />
und von Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ungen. Auch bei <strong>der</strong> Integration von Zuwan<strong>der</strong>ern erhält Deutschland nur mäßige<br />
Noten; Zuwan<strong>der</strong>ung wird häufig mehr als Risiko denn als Chance betrachtet.<br />
Das Pr<strong>in</strong>zip <strong>der</strong> Generationengerechtigkeit ist <strong>in</strong> Deutschland h<strong>in</strong>gegen vergleichsweise gut verwirklicht.<br />
Die Verankerung e<strong>in</strong>er Schuldenbremse im Grundgesetz ist positiv zu werten, und auch im Bereich<br />
Umweltpolitik und Ressourcenschonung erhält Deutschland gute Noten. Dieses Ergebnis sollte<br />
jedoch nicht darüber h<strong>in</strong>wegtäuschen, dass auch weiterh<strong>in</strong> umweltpolitischer Handlungsbedarf besteht,<br />
<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e im H<strong>in</strong>blick auf e<strong>in</strong>en verbesserten Klimaschutz und die För<strong>der</strong>ung erneuerbarer<br />
Energien. Steigerungsfähig s<strong>in</strong>d auch die öffentlichen Ausgaben für Forschung und Entwicklung, die<br />
maßgeblich über die Innovationsfähigkeit e<strong>in</strong>es Landes und damit auch über dessen Wohlstand entscheiden.<br />
Quelle: Bertelsmann-Stiftung<br />
15
_______________________________________________________________________________________<br />
<strong>11</strong>.) Der Bedarf ist groß – Alphabetisierung <strong>in</strong> Deutsch als Zweit-<br />
sprache<br />
www.goethe.de<br />
Christoph Brammertz<br />
___________________________________________________________<br />
Zugewan<strong>der</strong>te Analphabeten haben früher selten den Weg <strong>in</strong> den<br />
Deutschunterricht gefunden. Die deutsche Sprache haben sie, wenn überhaupt, ungesteuert und<br />
mündlich erworben. Das hat sich seit <strong>der</strong> Reform des Zuwan<strong>der</strong>ungsrechts geän<strong>der</strong>t.<br />
Seit 2005 s<strong>in</strong>d Alt- und Neuzuwan<strong>der</strong>er verpflichtet, an staatlich f<strong>in</strong>anzierten Deutschkursen teilzunehmen.<br />
Die damals e<strong>in</strong>geführten 600-stündigen Integrationskurse wurden jedoch nicht allen gerecht.<br />
Spezielle Kursarten wurden geschaffen – darunter auch Kurse mit e<strong>in</strong>em Umfang von bis zu<br />
1.200 Stunden für Zuwan<strong>der</strong>er mit Alphabetisierungsbedarf.<br />
Krieg verh<strong>in</strong><strong>der</strong>te den Schulbesuch<br />
Wie groß unter den Zuwan<strong>der</strong>ern <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong>er ist, die e<strong>in</strong>en solchen Alphabetisierungsbedarf haben,<br />
erfasst ke<strong>in</strong>e Statistik. Dass ihr Anteil nicht unerheblich ist, zeigt die Tatsache, dass im Jahr<br />
2010 <strong>in</strong> den ersten drei Quartalen 13,9 Prozent aller Integrationskursteilnehmer <strong>in</strong> sogenannten Alphakursen<br />
saßen. Seit 2005 haben <strong>in</strong>sgesamt 65.645 Menschen daran teilgenommen. Der tatsächliche<br />
Bedarf dürfte noch größer se<strong>in</strong>: Weil nicht überall Alphakurse zur Verfügung stehen, landen immer<br />
wie<strong>der</strong> Menschen mit Alphabetisierungsbedarf <strong>in</strong> den allgeme<strong>in</strong>en Kursen.<br />
Gemäß dem Integrationspanel, e<strong>in</strong>er vom Bundesamt für Migration und<br />
Flüchtl<strong>in</strong>ge (BAMF) beauftragten Erhebung, s<strong>in</strong>d 37 Prozent <strong>der</strong> Alphakurs-<br />
Teilnehmer primäre Analphabeten. Diese Menschen haben <strong>in</strong> ihrer Heimat<br />
ke<strong>in</strong>e Schule besucht, haben also auch <strong>in</strong> ihrer Muttersprache nie Lesen<br />
und Schreiben gelernt. Die Gründe dafür s<strong>in</strong>d unter an<strong>der</strong>em Kriege und<br />
Unruhen, ebenso wie K<strong>in</strong><strong>der</strong>arbeit und gesellschaftliche Traditionen. Vor<br />
allem Mädchen werden <strong>in</strong> vielen Län<strong>der</strong>n oft nicht zur Schule geschickt.<br />
Der Kurs als Chance<br />
Folglich s<strong>in</strong>d fast zwei Drittel <strong>der</strong> Teilnehmenden weiblich. Viele dieser Frauen leben schon seit Jahrzehnten<br />
<strong>in</strong> Deutschland, kommen aber erst <strong>in</strong> die Kurse, wenn die K<strong>in</strong><strong>der</strong> aus dem <strong>Haus</strong> s<strong>in</strong>d. „Diese<br />
Teilnehmer<strong>in</strong>nen s<strong>in</strong>d sehr motiviert“, berichtet Alexis Feldmeier von <strong>der</strong> Uni Bielefeld aus se<strong>in</strong>er<br />
Erfahrung als Kursleiter. „Sie nehmen den Kurs als Chance wahr, vielleicht zum ersten Mal etwas für<br />
sich persönlich zu erreichen.“<br />
Auch, wer <strong>in</strong> <strong>der</strong> Heimat die Schule für kurze Zeit besuchen konnte, beherrscht die <strong>Schrift</strong>sprache<br />
häufig nicht gut genug, um sie im Alltag wirklich nutzen zu können. 42 Prozent <strong>der</strong> Teilnehmenden<br />
zählen zur Gruppe <strong>der</strong> funktionalen Analphabeten. Feldmeier weist darauf h<strong>in</strong>, dass es didaktischmethodisch<br />
und auch lernpsychologisch e<strong>in</strong>facher und richtiger wäre, diese Teilnehmer zunächst <strong>in</strong><br />
<strong>der</strong> Muttersprache zu alphabetisieren. Das geschieht seit <strong>der</strong> E<strong>in</strong>führung <strong>der</strong> Integrationskurse aber<br />
kaum noch. Die DaF-Professor<strong>in</strong>nen Heike Roll und Karen Schramm sprechen sogar von e<strong>in</strong>em „Rückfall<br />
zu monol<strong>in</strong>gualen deutschen Alphabetisierungsangeboten, <strong>der</strong> das offizielle Bekenntnis <strong>der</strong> Bundesrepublik<br />
zur europäischen Mehrsprachigkeit konterkariert“.<br />
Ke<strong>in</strong>er Alphabetisierung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Muttersprache bedürfen weitere 21 Prozent<br />
<strong>der</strong> Teilnehmer. Die sogenannten Zweitschriftlerner haben über längere<br />
Zeit die Schule besucht, haben dort jedoch e<strong>in</strong> nicht-late<strong>in</strong>ischen <strong>Schrift</strong>system<br />
wie Arabisch erlernt. Daher sitzen <strong>in</strong> den Kursen völlig lernungewohnte<br />
Menschen ohne „Stifterfahrung“ neben Menschen, die <strong>in</strong> ihrer<br />
Heimat acht o<strong>der</strong> neun Jahre zur Schule gegangen s<strong>in</strong>d.<br />
16
Phonologische Bewusstheit schaffen<br />
Nicht nur diese heterogene Zusammensetzung <strong>der</strong> Kurse stellt die Lehrkräfte vor große Herausfor<strong>der</strong>ungen.<br />
Denn Alphabetisierung spielt <strong>in</strong> <strong>der</strong> herkömmlichen Deutsch-als-Zweitsprache-Didaktik kaum<br />
e<strong>in</strong>e Rolle. „Man verfolgt ja e<strong>in</strong> ganz an<strong>der</strong>es Ziel, nämlich Lesen- und Schreibenlernen. Dieses Ziel<br />
wird im DaZ-Unterricht nicht verfolgt“, sagt Alexis Feldmeier. Feldmeier hat im Auftrag des BAMF das<br />
Konzept für e<strong>in</strong>en bundesweiten Alphabetisierungskurs verfasst, das seit 2009 den Alphakursen als<br />
Grundlage dient.<br />
Am Beispiel des Ausspracheunterrichts beschreibt er die beson<strong>der</strong>en Herausfor<strong>der</strong>ungen für die Lehrkräfte:<br />
„Im Alphakurs ist es <strong>in</strong> den ersten 400 bis 500 Stunden das A und O phonologische Bewusstheit<br />
zu entwickeln, also die Fähigkeit e<strong>in</strong>en Anlaut o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>en Reim zu erkennen und auf Silbenebene e<strong>in</strong><br />
Wort zu segmentieren, etwa ‚Mar-me-la-de‘ sagen zu können. Diese Fähigkeiten werden im DaZ-<br />
Bereich vorausgesetzt und s<strong>in</strong>d ke<strong>in</strong> Gegenstand des Ausspracheunterrichts.“<br />
Lehrwerke s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> Vorbereitung<br />
Verschiedene E<strong>in</strong>richtungen wie das Leipziger Her<strong>der</strong>-Institut bieten Alphabetisierungsfortbildungen<br />
an. Seit Beg<strong>in</strong>n des Jahres 20<strong>11</strong> müssen DaZ-<br />
Lehrkräfte die Gebühren von 750 Euro allerd<strong>in</strong>gs meist selbst aufbr<strong>in</strong>gen;<br />
angesichts <strong>der</strong> ger<strong>in</strong>gen Honorare <strong>in</strong> <strong>der</strong> Erwachsenenbildung können sich<br />
das viele nicht leisten. Deshalb ist fraglich, ob die Kurse überall weiter<br />
stattf<strong>in</strong>den können.<br />
Nicht nur das methodische Wissen mussten und müssen sich Lehrkräfte oft<br />
<strong>in</strong> Eigenregie aneignen, auch bei den Lehrmaterialien war <strong>in</strong> <strong>der</strong> Vergangenheit Improvisationstalent<br />
gefragt. Doch hier ist Abhilfe <strong>in</strong> Sicht: Mehrere große Lehrbuchverlage br<strong>in</strong>gen 20<strong>11</strong> Lehrwerke für<br />
die Alphabetisierungskurse auf den Markt. Gut ausgebildetes Lehrpersonal und maßgeschnei<strong>der</strong>te<br />
Materialien än<strong>der</strong>n allerd<strong>in</strong>gs nichts daran, dass die Lernenden maximal das Sprachniveau A2 des Europäischen<br />
Referenzrahmens erreichen, mehr ist <strong>in</strong> 1.200 Stunden nicht zu schaffen. Feldmeier kritisiert:<br />
„Die Teilnehmer werden nicht so weit geför<strong>der</strong>t, dass sie die Bed<strong>in</strong>gungen für die E<strong>in</strong>bürgerung<br />
erfüllen können.“ Voraussetzung für die E<strong>in</strong>bürgerung ist <strong>der</strong> Nachweis des Sprachniveaus B1.<br />
Quelle: Goethe Institut<br />
________________________________________________________________________<br />
12.) Bildungsvere<strong>in</strong>igung ARBEIT UND LEBEN Nds. Nord gGmbH -<br />
Angebote für Zugewan<strong>der</strong>te <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Stadt Osterholz-Scharmbeck <strong>in</strong><br />
Kooperation mit <strong>der</strong> Stadt Osterholz-<br />
Scharmbeck<br />
________________________________<br />
Im Jahr 2010 wurde zwischen <strong>der</strong> Stadt<br />
Osterholz und <strong>der</strong> Bildungsvere<strong>in</strong>igung<br />
ARBEIT UND LEBEN Nds. Nord gGmbH<br />
vere<strong>in</strong>bart, neue Angebote für<br />
Zugewan<strong>der</strong>te <strong>in</strong> Osterholz-Scharmbeck zu<br />
organisieren.<br />
Hierzu gehören u. a. Beratungen für<br />
Menschen mit Migrationsh<strong>in</strong>tergrund sowie<br />
Deutschkurse für Frauen. Die Beratungen und Deutschkurse f<strong>in</strong>den statt <strong>in</strong> dem <strong>Stadtteil</strong>büro <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Drosselstraße sowie im <strong>Stadtteil</strong>haus „<strong>Haus</strong> <strong>der</strong> <strong>Kulturen</strong> Osterholz-Scharmbeck“ an <strong>der</strong> Mozartstraße<br />
– <strong>in</strong> <strong>Stadtteil</strong>en, <strong>in</strong> denen sehr viele Menschen mit Migrationsh<strong>in</strong>tergrund leben.<br />
17
An den im Rahmen des<br />
För<strong>der</strong>programms STÄRKEN vor Ort<br />
stattf<strong>in</strong>denden Deutschkursen<br />
nehmen Frauen u. a. aus <strong>der</strong><br />
Türkei, aus Syrien und Afghanistan<br />
teil. In dem ABC-Kurs s<strong>in</strong>d<br />
<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e Frauen, die nie die<br />
Möglichkeit gehabt haben – auch<br />
nicht <strong>in</strong> ihren Heimatlän<strong>der</strong>n – e<strong>in</strong>e<br />
Schule zu besuchen. Der 2. Kurs<br />
wendet sich an Frauen, die<br />
meistens schon e<strong>in</strong>e<br />
abgeschlossene Ausbildung <strong>in</strong><br />
ihrem Heimatland absolviert<br />
haben. Für diese Gruppe ist <strong>der</strong><br />
Ausbau <strong>der</strong> Sprachkenntnisse<br />
notwendig, um anschließend ihre<br />
berufliche Zukunft aufzubauen. In beiden Kursen wird versucht, neben <strong>der</strong> Vermittlung von Sprache,<br />
immer wie<strong>der</strong> e<strong>in</strong>zugehen auf Alltagssituationen <strong>in</strong> Deutschland, um den Integrationsprozess zu beschleunigen.<br />
Darüber h<strong>in</strong>aus werden Themen wie Beruf, Kommunikation, Sitten und Gebräuche behandelt.<br />
In beiden Kursen ist e<strong>in</strong> E<strong>in</strong>stieg je<strong>der</strong>zeit möglich.<br />
Diese Angebote werden unterstützt durch e<strong>in</strong> umfassendes Beratungsangebot, das von Wohnungssuche,<br />
<strong>Haus</strong>aufgabenhilfe für K<strong>in</strong><strong>der</strong> und Anträge aller Art an Ämter, z. B. Bildungspaket, Wohngeld,<br />
HartzIV sowie K<strong>in</strong><strong>der</strong>geldzuschuss reicht. Dabei wird <strong>in</strong> Abstimmung mit <strong>der</strong> Stadt Osterholz auch mit<br />
an<strong>der</strong>en zuständigen Stellen zusammengearbeitet. Aus dieser <strong>in</strong>tensiven Zusammenarbeit mit Migranten<br />
<strong>in</strong> Abstimmung mit <strong>der</strong> Stadt Osterholz konnten auch an<strong>der</strong>e Bildungsaktivitäten entwickelt werden,<br />
z. B. e<strong>in</strong> Englischkurs mit Migranten.<br />
Durch das Beratungsangebot können die Bildungsangebote kräftig unterstützt werden. Die Verzahnung<br />
von Beratungs- und Bildungsangeboten wird sehr gut angenommen und trägt zur Integration <strong>der</strong><br />
Frauen bei. Hieraus entwickeln sich auch weitere Angebote für Frauen, so z. B. E<strong>in</strong>zelvorträge <strong>in</strong><br />
Verb<strong>in</strong>dung mit e<strong>in</strong>em Frauenfrühstück.<br />
___________________________________________________________________________________<br />
13.) Weltk<strong>in</strong><strong>der</strong>tag 20<strong>11</strong><br />
"K<strong>in</strong><strong>der</strong> haben was zu sagen!"<br />
______________________________________________________________<br />
"K<strong>in</strong><strong>der</strong> haben was zu sagen!" – so lautet das diesjährige Motto des Deutschen<br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong>hilfswerkes und UNICEF zum Weltk<strong>in</strong><strong>der</strong>tag am 20. September. Mit dem<br />
Slogan möchten die K<strong>in</strong><strong>der</strong>rechtsorganisationen das Recht aller K<strong>in</strong><strong>der</strong> auf Beteiligung<br />
stärken.<br />
"K<strong>in</strong><strong>der</strong> haben e<strong>in</strong> Recht darauf, dass wir Ihnen zuhören. Und wir sollten ihnen mehr Möglichkeiten<br />
geben, sich zu beteiligen – bei allen Entscheidungen, die sie betreffen. Das fängt bei <strong>der</strong> Gestaltung<br />
von Spielplätzen an und hört bei <strong>der</strong> Schülermitverwaltung noch lange nicht auf", sagte Anne Lütkes,<br />
Vorstandsmitglied von UNICEF Deutschland und dem Deutschen K<strong>in</strong><strong>der</strong>hilfswerk.<br />
Zum Weltk<strong>in</strong><strong>der</strong>tag wird es unter dem geme<strong>in</strong>samen Motto bundesweit vielfältige Aktionen geben.<br />
Bereits am Sonntag vor dem Weltk<strong>in</strong><strong>der</strong>tag, am 18. September 20<strong>11</strong>, f<strong>in</strong>den die beiden größten K<strong>in</strong><strong>der</strong>feste<br />
<strong>in</strong> Deutschland statt. Dazu erwarten UNICEF und das Deutsche K<strong>in</strong><strong>der</strong>hilfswerk wie<strong>der</strong> jeweils<br />
rund 100.000 Besucher <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> auf dem Potsdamer Platz und <strong>in</strong> Köln im Rhe<strong>in</strong>garten.<br />
18
Der kle<strong>in</strong>e Pr<strong>in</strong>z www.karl-rauch-verlag.de<br />
In Zusammenarbeit mit <strong>der</strong> Drehbühne Berl<strong>in</strong> hat <strong>der</strong> Karl Rauch Verlag, Düsseldorf<br />
ergänzend zur Hörbuch-CD „Der kle<strong>in</strong>e Pr<strong>in</strong>z“, e<strong>in</strong>em Klassiker <strong>der</strong> Weltliteratur von<br />
Anto<strong>in</strong>e de Sa<strong>in</strong>t-Exupéry, auch e<strong>in</strong>e DVD zugunsten von UNICEF produziert.<br />
Mit dem Erlös <strong>der</strong> DVD wird das UNICEF-Projekt „Sauberes<br />
Wasser und bessere Hygiene“ im Sudan geför<strong>der</strong>t. Mitwirkende s<strong>in</strong>d<br />
namhafte Interpreten wie Bruno Ganz, Horst Krause, Florian Lukas,<br />
Dieter Mann, Michael Mendl und Arm<strong>in</strong> Rohde als Planetenbewohner.<br />
Buch, Hörbuch-CD und DVD „Der kle<strong>in</strong>e Pr<strong>in</strong>z“ s<strong>in</strong>d ab 20.09.20<strong>11</strong> auch<br />
im <strong>Stadtteil</strong>haus „<strong>Haus</strong> <strong>der</strong> <strong>Kulturen</strong> Osterholz-Scharmbeck“ erhältlich.<br />
_______________________________________________________________________________________<br />
14.) Betreuungsatlas 2010: Mehr Plätze für kle<strong>in</strong>e K<strong>in</strong><strong>der</strong><br />
www.dji.de<br />
___________________________________________________________<br />
In Deutschland bestehen erhebliche regionale Disparitäten im Angebot und Niveau <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>tagesbetreuung.<br />
Sie schaffen für K<strong>in</strong><strong>der</strong> nicht nur unterschiedliche Zugänge zu frühk<strong>in</strong>dlicher Bildung, son<strong>der</strong>n<br />
für <strong>der</strong>en Eltern auch günstigere o<strong>der</strong> ungünstigere Voraussetzungen, um Familie und Erwerbstätigkeit<br />
zu vere<strong>in</strong>baren.<br />
Nicht zuletzt im Zuge des gegenwärtigen Ausbauprozesses <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>tagesbetreuung für unter Dreijährige<br />
erhalten diese Unterschiede verstärkte Beachtung. Denn das 2008 verabschiedete K<strong>in</strong><strong>der</strong>för<strong>der</strong>ungsgesetz<br />
(KiföG) sieht ab August 2013 e<strong>in</strong>en Rechtsanspruch auf e<strong>in</strong>en Betreuungsplatz für K<strong>in</strong><strong>der</strong><br />
ab dem vollendeten ersten Lebensjahr vor.<br />
Ende Mai wurde <strong>der</strong> zweite Zwischenbericht über den Stand des Ausbaus für das Jahr 2010 vorgelegt.<br />
Demnach wurden im März 2010 deutschlandweit 472.157 unter Dreijährige <strong>in</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>tagese<strong>in</strong>richtungen<br />
o<strong>der</strong> durch Tagespflegepersonen betreut. Das entspricht e<strong>in</strong>er Betreuungsquote von 23,1 Prozent.<br />
Der vom DJI erstellte Betreuungsatlas 2010, <strong>der</strong> Anfang Juni <strong>der</strong> Öffentlichkeit präsentiert wird, versteht<br />
sich als Ergänzung zum zweiten KiFöG-Bericht. Wie schon <strong>der</strong> Betreuungsatlas 2008 zeigt er die<br />
aktuelle Inanspruchnahme von K<strong>in</strong><strong>der</strong>tagese<strong>in</strong>richtungen sowie relevante Qualitätsmerkmale <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
hoch auflösenden regionalen Perspektive auf <strong>der</strong> Grundlage von Daten <strong>der</strong> amtlichen Statistik.<br />
Quelle: Deutsches Jugend<strong>in</strong>stitut<br />
___________________________________________________________________________________<br />
15.) Kontroverse Debatte über geplante E<strong>in</strong>führung e<strong>in</strong>es<br />
Betreuungsgeldes<br />
www.bmfsfj.de<br />
www.zukunftsforum.de<br />
___________________________________________________________________________________<br />
Der Bundestagsausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend diskutierte am 4. Juli 20<strong>11</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
öffentlichen Anhörung die geplante E<strong>in</strong>führung e<strong>in</strong>es Betreuungsgeldes für Eltern, die ihre K<strong>in</strong><strong>der</strong><br />
nicht <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e K<strong>in</strong><strong>der</strong>betreuungse<strong>in</strong>richtung geben. Opposition, Verbände und Gewerkschaften kritisie-<br />
19
en das Vorhaben deutlich. Sie for<strong>der</strong>n von <strong>der</strong> Bundesregierung, auf das Betreuungsgeld zugunsten<br />
frühk<strong>in</strong>dlicher Betreuungsangebote zu verzichten.<br />
Ab 2013 sollen Eltern von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n unter drei Jahren, die ihre K<strong>in</strong><strong>der</strong> zuhause betreuen, statt sie <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>e K<strong>in</strong><strong>der</strong>tagese<strong>in</strong>richtung zu geben, e<strong>in</strong> Betreuungsgeld <strong>in</strong> Höhe von 150 Euro erhalten. Die Fraktion<br />
Bündnis 90/Die Grünen hat demgegenüber e<strong>in</strong>en Gesetzentwurf vorgelegt, <strong>der</strong> e<strong>in</strong>en verstärkten<br />
Ausbau <strong>der</strong> frühk<strong>in</strong>dlichen Erziehung <strong>in</strong> Betreuungse<strong>in</strong>richtungen vorsieht. Die SPD-Fraktion for<strong>der</strong>t<br />
von <strong>der</strong> Bundesregierung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Antrag ebenfalls, auf das Betreuungsgeld zu verzichten und stattdessen<br />
den Ausbau frühk<strong>in</strong>dlicher Betreuungsangebote zu för<strong>der</strong>n.<br />
Ute Sacksofsky, Professor<strong>in</strong> für Öffentliches Recht und Rechtsvergleich an <strong>der</strong> Johann Wolfgang Goethe-Universität<br />
<strong>in</strong> Frankfurt am Mai, kritisierte während <strong>der</strong> Anhörung das Betreuungsgeld als nicht<br />
verfassungskonform, da somit e<strong>in</strong>e bestimmte Familien- und Erziehungsform an<strong>der</strong>en gegenüber bevorzugt<br />
würde. Außerdem zementiere es die Rollenverteilung zwischen Frauen und Männern, da überwiegend<br />
Mütter die Betreuung kle<strong>in</strong>er K<strong>in</strong><strong>der</strong> übernähmen.<br />
Weiterh<strong>in</strong> sahen die geladenen Expert<strong>in</strong>nen und Experten die Gefahr, dass Altersarmut von Frauen<br />
mit dem Betreuungsgeld verschärft werde, wenn Frauen <strong>in</strong> schlecht bezahlten Berufen o<strong>der</strong> Frauen <strong>in</strong><br />
Teilzeit ganz aus dem Berufsleben aussteigen, um ihre K<strong>in</strong><strong>der</strong> zu <strong>Haus</strong>e zu erziehen. Der Wie<strong>der</strong>e<strong>in</strong>stieg<br />
<strong>in</strong>s Berufsleben werde dadurch erschwert.<br />
Der thür<strong>in</strong>gische Landtagsabgeordnete Klaus Zeh (CDU) berichtete dagegen, Thür<strong>in</strong>gen habe mit se<strong>in</strong>em<br />
Erziehungsgeld, e<strong>in</strong>er Entsprechung zum Betreuungsgeld, sehr gute Erfahrungen gemacht. Es<br />
habe nicht festgestellt werden können, dass Familien deswegen ihre K<strong>in</strong><strong>der</strong> aus Betreuungse<strong>in</strong>richtungen<br />
abgemeldet hätten.<br />
Maria Steuer vom Familien e.V. begrüßte die E<strong>in</strong>führung e<strong>in</strong>es Betreuungsgeldes und sprach sich<br />
deutlich gegen die Fremdbetreuung und für die Betreuung von Kle<strong>in</strong>k<strong>in</strong><strong>der</strong>n <strong>in</strong> <strong>der</strong> eigenen Familie<br />
aus. Die K<strong>in</strong><strong>der</strong> seien <strong>in</strong> Betreuungse<strong>in</strong>richtungen deutlich höherem Stress ausgesetzt als <strong>in</strong> <strong>der</strong> Familie.<br />
Quelle: Bundesm<strong>in</strong>isterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend / Bundestag<br />
___________________________________________________________________________________<br />
16.) Bessere Kitas statt Betreuungsgeld<br />
________________________________________<br />
Klare Worte: Für den weiteren und nachhaltigen Ausbau <strong>der</strong><br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong>tagese<strong>in</strong>richtungen hat sich die Bundesvere<strong>in</strong>igung<br />
<strong>der</strong> Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) ausgesprochen.<br />
Jedes K<strong>in</strong>d soll e<strong>in</strong>e Chance haben, sich zu entwickeln und<br />
die bestmögliche Bildung zu erhalten. Dabei plädiert die<br />
BDA für e<strong>in</strong>en Ausbau <strong>der</strong> Infrastruktur statt e<strong>in</strong>er Erhöhung von K<strong>in</strong><strong>der</strong>geld, K<strong>in</strong><strong>der</strong>freibetrag o<strong>der</strong><br />
gar e<strong>in</strong>es neuen Betreuungsgeldes. Qualitätssicherung habe Vorrang vor Kostenfreiheit.<br />
Dieses Ziel will die BDA mit e<strong>in</strong>em 8-Punkte-Katalog erreichen, den sie am 19.07.20<strong>11</strong> <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> vorstellte.<br />
Gute Bildungssysteme, hieß es dort, zeichneten sich im <strong>in</strong>ternationalen Vergleich dadurch<br />
aus, dass die För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong> weit vor <strong>der</strong> Schule beg<strong>in</strong>ne. Der <strong>in</strong> Deutschland beson<strong>der</strong>s enge<br />
Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg müsse vor allem durch e<strong>in</strong>e frühe För<strong>der</strong>ung<br />
weiter entkoppelt werden.<br />
Obwohl darüber mittlerweile <strong>in</strong> Politik und Gesellschaft Konsens bestehe, sei angesichts knapper öffentlicher<br />
Kassen zu beobachten, dass über dem quantitativen Aufbau <strong>der</strong> Betreuung - vor allem für<br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong> unter drei Jahren - <strong>der</strong> qualitative Ausbau zu Bildungse<strong>in</strong>richtungen vernachlässigt werde.<br />
In e<strong>in</strong>em 8-Punkte-Katalog hat die BDA nun konkrete For<strong>der</strong>ungen formuliert. Dazu gehört die Vermittlung<br />
von Sprachkompetenz ebenso wie <strong>der</strong> erste Umgang <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong> mit mathematischen Größen,<br />
Mengen und Relationen sowie Erfahrungen mit Phänomenen <strong>der</strong> Natur und Technik im forschenden<br />
20
Experimentieren. Die Kultusm<strong>in</strong>ister hätten die Aufgabe, bundesweit geme<strong>in</strong>same und verb<strong>in</strong>dliche<br />
Bildungsstandards zu vere<strong>in</strong>baren und umzusetzen.<br />
Außerdem seien an den gewachsenen Aufgaben <strong>der</strong> Frühpädagogen auch die Aus- und Fortbildung<br />
sowie die Bewertung und Bezahlung ihrer Arbeit zu orientieren. Statt K<strong>in</strong><strong>der</strong>geld o<strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>freibetrag<br />
zu erhöhen o<strong>der</strong> gar das neue Betreuungsgeld e<strong>in</strong>zuführen sollten die Mittel <strong>in</strong> den Ausbau <strong>der</strong><br />
Infrastruktur gesteckt werden.<br />
Quelle: Bundesvere<strong>in</strong>igung deutscher Arbeitgeberverbände<br />
_______________________________________________________________________________________<br />
17.) Ganztagsbetreuung von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n ab drei Jahren <strong>in</strong> Kitas:<br />
Nie<strong>der</strong>sachsen liegt mit e<strong>in</strong>er Quote von gut 16<br />
Prozent bundesweit <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schlussgruppe<br />
Bertelsmann Stiftung legt „Län<strong>der</strong>monitor frühk<strong>in</strong>dliche Bildungssysteme<br />
20<strong>11</strong>“ vor<br />
www.laen<strong>der</strong>-monitor.de<br />
_______________________________________________________________________________________<br />
In Nie<strong>der</strong>sachsen besuchten im März 2010 nur gut 16 Prozent aller Kita-K<strong>in</strong><strong>der</strong> ab drei Jahren e<strong>in</strong>e<br />
Ganztagse<strong>in</strong>richtung (mehr als sieben Stunden täglich). Deutschlandweit liegt Nie<strong>der</strong>sachsen mit dieser<br />
Quote <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schlussgruppe. In den Jahren zwischen 2007 und 2010 konnte Nie<strong>der</strong>sachsen e<strong>in</strong>e<br />
Steigerung des Anteils dieser K<strong>in</strong><strong>der</strong> <strong>in</strong> Ganztagsbetreuung verbuchen: von gut <strong>11</strong> Prozent auf gut 16<br />
Prozent. Das geht aus den aktuellen Daten des Län<strong>der</strong>monitors Frühk<strong>in</strong>dliche Bildungssysteme 20<strong>11</strong><br />
(www.laen<strong>der</strong>monitor.de) <strong>der</strong> Bertelsmann Stiftung hervor.<br />
Die Mehrzahl <strong>der</strong> nie<strong>der</strong>sächsischen Kita-K<strong>in</strong><strong>der</strong> ab drei Jahren – über 63 Prozent – nutzt e<strong>in</strong>e vertraglich<br />
vere<strong>in</strong>barte Betreuungszeit von bis zu 5 Stunden täglich. Der Halbtagsk<strong>in</strong><strong>der</strong>garten ist damit die<br />
am häufigsten genutzte Betreuungsform. Jedes fünfte K<strong>in</strong>d dieser Altersgruppe <strong>in</strong> Kitas besucht die<br />
Kita täglich 5 bis zu 7 Stunden.<br />
Positiv fällt auf, dass <strong>in</strong> Nie<strong>der</strong>sachsen mehr K<strong>in</strong><strong>der</strong> ab drei Jahren mit Migrationsh<strong>in</strong>tergrund (23 Prozent)<br />
e<strong>in</strong>e Ganztagsbetreuung nutzen als K<strong>in</strong><strong>der</strong> ohne Migrationsh<strong>in</strong>tergrund (14,2 Prozent). Damit<br />
kommt Nie<strong>der</strong>sachsen <strong>der</strong> For<strong>der</strong>ung zahlreicher Experten aus Wissenschaft und Politik nach, dass<br />
beson<strong>der</strong>s K<strong>in</strong><strong>der</strong> mit Migrationsh<strong>in</strong>tergrund ganztags geför<strong>der</strong>t werden sollten – die ganztägige<br />
Betreuung biete mehr Zeit für frühe Bildung und den Erwerb <strong>der</strong> deutschen Sprache.<br />
Längere „Bildungszeit“ <strong>in</strong> Kitas eröffnet bessere Chancen um Bildungsungleichheiten abzubauen.<br />
Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach längeren Betreuungszeiten, weil immer mehr Mütter mit jüngeren<br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong>n längere Erwerbszeiten realisieren möchten.<br />
Wie viele Ganztagsangebote tatsächlich gebraucht werden, muss <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e vor Ort bestimmt werden.<br />
Bildungs- und sozialpolitisch wird gefor<strong>der</strong>t, m<strong>in</strong>destens 50 Prozent <strong>der</strong> Kitaplätze als Ganztagsplätze<br />
anzubieten (12. K<strong>in</strong><strong>der</strong>- und Jugendbericht). „Wir brauchen e<strong>in</strong>en bundesweiten Rechtsanspruch<br />
auf e<strong>in</strong>en Ganztagsplatz für jedes K<strong>in</strong>d - und zwar unabhängig von <strong>der</strong> Erwerbs- o<strong>der</strong> Ausbildungssituation<br />
<strong>der</strong> Eltern“, for<strong>der</strong>t das für Bildung zuständige Vorstandsmitglied <strong>der</strong> Bertelsmann<br />
Stiftung, Dr. Jörg Dräger.<br />
In Deutschland gibt es zwischen den 16 Bundeslän<strong>der</strong>n enorme Unterschiede bei den Ganztagsangeboten<br />
<strong>in</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>tagese<strong>in</strong>richtungen für die über Dreijährigen. In <strong>der</strong> Spitzengruppe bei den Ganztagsangeboten<br />
für die über Dreijährigen liegen mit Quoten über 50 Prozent die ostdeutschen Bundeslän<strong>der</strong><br />
Thür<strong>in</strong>gen (90,7 Prozent), Sachsen (81,4 Prozent), Sachsen-Anhalt (61,5 Prozent), Mecklenburg-<br />
Vorpommern (60,1 Prozent), Brandenburg (57,1 Prozent) sowie Berl<strong>in</strong> (59,1 Prozent). In allen westdeutschen<br />
Bundeslän<strong>der</strong>n s<strong>in</strong>d weniger als 50 Prozent <strong>der</strong> Kita-K<strong>in</strong><strong>der</strong> ab 3 Jahren <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Ganztagsbetreuung.<br />
Im Mittelfeld liegen dabei Hamburg (42,4 Prozent), Hessen (40,2 Prozent), Nordrhe<strong>in</strong>-<br />
Westfalen (36,6 Prozent) sowie Rhe<strong>in</strong>land-Pfalz (35,2 Prozent). Gut e<strong>in</strong> Viertel dieser Altersgruppe <strong>in</strong><br />
21
Kitas nutzt im Saarland (27,3 Prozent), Bayern (25,7 Prozent) sowie Bremen (25,4 Prozent) e<strong>in</strong>e<br />
Ganztagsbetreuung. In <strong>der</strong> Schlussgruppe liegen Schleswig-Holste<strong>in</strong> (18,4 Prozent), Nie<strong>der</strong>sachsen<br />
(16,2 Prozent) sowie Baden-Württemberg (13,6 Prozent).<br />
Grundlage <strong>der</strong> Auswertungen s<strong>in</strong>d Daten <strong>der</strong> Statistischen Ämter des Bundes und <strong>der</strong> Län<strong>der</strong> aus <strong>der</strong><br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong>- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2010. Die Berechnungen hat <strong>der</strong> Forschungsverbund<br />
DJI/TU Dortmund durchgeführt. Der Län<strong>der</strong>monitor 20<strong>11</strong> ermöglicht e<strong>in</strong>en Gesamtüberblick zur frühk<strong>in</strong>dlichen<br />
Bildung <strong>in</strong> Deutschland.<br />
Quelle: Bertelsmann-Stiftung<br />
_______________________________________________________________________________________<br />
18.) Grün-Rot <strong>in</strong> BADEN-WÜRTTEMBERG baut nicht auf Bildungshäuser<br />
___________________________________________________________________________________<br />
In BADEN-WÜRTTEMBERG stoppt Grün-Rot den Ausbau <strong>der</strong> Bildungshäuser für Drei- bis Zehnjährige.<br />
Zunächst müssten <strong>der</strong> Orientierungsplan für K<strong>in</strong><strong>der</strong>gärten flächendeckend verb<strong>in</strong>dlich umgesetzt und<br />
Ganztags- und För<strong>der</strong>angebote an Grundschulen gestärkt werden, sagte Kultusstaatssekretär Frank<br />
Mentrup (SPD) im Landtag <strong>in</strong> Stuttgart.<br />
"Wenn wir weiterh<strong>in</strong> auf Bildungshäuser setzen, schaffen wir nicht gleiche Startchancen für alle." In<br />
den Bildungshäusern werden K<strong>in</strong><strong>der</strong>gärten und Grundschule eng verzahnt.<br />
Schwarz-Gelb wollte die Bildungshäuser flächendeckend e<strong>in</strong>führen. Deshalb mahnte <strong>der</strong> CDU-<br />
Bildungsexperte Georg Wacker Grün-Rot, den Grundkonsens aller Fraktionen über die frühk<strong>in</strong>dliche<br />
Bildung zu erhalten. Erste Erkenntnisse über die Bildungshäuser zeigten, dass das Interesse <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong><br />
am Lesen und Schreiben früher geweckt und <strong>der</strong>en Sozialkompetenz gestärkt werde.<br />
Für die FDP-Fraktion wies <strong>der</strong> Abgeordnete Timm Kern darauf h<strong>in</strong>, dass Erzieher, Lehrer und Eltern<br />
den Bildungshäuser gute Noten erteilten: "Sie setzen sich dem Verdacht aus, e<strong>in</strong> erfolgreiches Projekt<br />
nur deshalb nicht fortsetzen zu wollen, weil es e<strong>in</strong>e christlich-liberale Regierung <strong>in</strong>s Leben gerufen<br />
hat."<br />
Mentrup stelle die Frage nach dem Kosten-Nutzen-Verhältnis: Die Summe von 7,5 Millionen Euro im<br />
Jahr für bislang nur 200 Standorte bei 8000 K<strong>in</strong><strong>der</strong>gärten und 2500 Grundschulen könne wirksamer<br />
e<strong>in</strong>gesetzt werden. Der von <strong>der</strong> Vorgängerregierung angestrebte landesweite Ausbau hätte 90 Millionen<br />
Euro gekostet. Mit neun Millionen Euro könnten 180 Lehrerstellen geschaffen werden, um für den<br />
reibungslosen Übergang von K<strong>in</strong><strong>der</strong>garten zu Grundschule zu sorgen. "Der flächendeckende Ausbau<br />
des Bildungshauses hat nicht funktioniert", urteilte die Grünen-Abgeordnete Sandra Boser.<br />
Quelle: Deutsche Presse-Agentur GmbH - dpa-Dossier Bildung Forschung 29/18.07.20<strong>11</strong><br />
___________________________________________________________________________________<br />
19.) Sprachför<strong>der</strong>kompetenz <strong>in</strong> Nie<strong>der</strong>sachsens K<strong>in</strong><strong>der</strong>tagese<strong>in</strong>richtungen wird gestärkt<br />
___________________________________________________________________________________<br />
Wussten Sie, dass die Vere<strong>in</strong>ten Nationen den 21. Februar als Internationalen Tag <strong>der</strong> Muttersprache<br />
ausgerufen haben? Der Welttag er<strong>in</strong>nert an die Bedeutung des Kulturgutes Sprache. Er<br />
soll die Sprachenvielfalt und den Gebrauch <strong>der</strong> Muttersprache för<strong>der</strong>n und das Bewusstse<strong>in</strong> für<br />
sprachliche und kulturelle Traditionen stärken. Die Sprachenvielfalt entscheidet über Integration<br />
und Bildungserfolg. K<strong>in</strong><strong>der</strong> mit Migrationsh<strong>in</strong>tergrund.<br />
Das Nie<strong>der</strong>sächsische Kultusm<strong>in</strong>isterium, die kommunalen Spitzenverbände, die Landesarbeitsgeme<strong>in</strong>schaft<br />
<strong>der</strong> freien Wohlfahrtspflege, Kirchen und Eltern<strong>in</strong>itiativen haben sich im Juni 20<strong>11</strong> auf trägerübergreifende<br />
Handlungsempfehlungen für Sprachbildung und Sprachför<strong>der</strong>ung <strong>in</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>tagese<strong>in</strong>-<br />
22
ichtungen verständigt. Sie wurden als Ergänzung zum "Orientierungsplan für Bildung und Erziehung<br />
im Elementarbereich nie<strong>der</strong>sächsischer Tagese<strong>in</strong>richtungen für K<strong>in</strong><strong>der</strong>" unterzeichnet.<br />
Das Nie<strong>der</strong>sächsische Kultusm<strong>in</strong>isterium f<strong>in</strong>anziert die Sprachför<strong>der</strong>ung <strong>in</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>tagese<strong>in</strong>richtungen<br />
seit 2006 jedes Jahr mit sechs Millionen Euro. Die diesen Zuwendungen zugrundeliegende Richtl<strong>in</strong>ie<br />
wurde zum 1. Juni 20<strong>11</strong> novelliert. Landesmittel können nun genutzt werden, um regionale Sprachför<strong>der</strong>konzepte<br />
auf <strong>der</strong> Grundlage <strong>der</strong> neuen Handlungsempfehlungen zu erarbeiten und Fachkräfte<br />
für ihre Umsetzung zu qualifizieren.<br />
Die "Handlungsempfehlungen Sprachbildung und Sprachför<strong>der</strong>ung" zum Orientierungsplan führen aus,<br />
wie die Begleitung des frühk<strong>in</strong>dlichen Spracherwerbs im pädagogischen Alltag verankert und bei <strong>der</strong><br />
Gestaltung aller Bildungs- und Lernsituationen mitgedacht werden soll. Das den Handlungsempfehlungen<br />
zugrunde liegende Bildungsverständnis gilt nach Auffassung des Kultusm<strong>in</strong>isteriums nicht nur<br />
für den Elementarbereich, son<strong>der</strong>n ist gleichzeitig auch Ausgangspunkt für durchgängige Sprachför<strong>der</strong>konzepte<br />
von Krippe und K<strong>in</strong><strong>der</strong>garten über die Grundschule bis h<strong>in</strong> zur Sekundarstufe I.<br />
Quelle: Nie<strong>der</strong>sächsisches Kultusm<strong>in</strong>isterium<br />
______________________________________________________________________________________<br />
20.) Erfolg auf ganzer L<strong>in</strong>ie – JFMK bestätigt Vorschlag <strong>der</strong> BAG-BEK e.V. zur Berufsbezeich-<br />
nung „K<strong>in</strong>dheitspädagog<strong>in</strong>/K<strong>in</strong>dheitspädagoge“<br />
Prof. Dr. Ralf Ha<strong>der</strong>le<strong>in</strong>, Vorsitzen<strong>der</strong> <strong>der</strong> BAG-BEK e.V.<br />
_______________________________________________________<br />
Nach langem R<strong>in</strong>gen um die Frage e<strong>in</strong>er Berufsbezeichnung<br />
für akademisch ausgebildetes Fachpersonal für K<strong>in</strong><strong>der</strong>tagese<strong>in</strong>richtungen<br />
hat die JFMK e<strong>in</strong>e neue Berufsbezeichnung<br />
den Län<strong>der</strong>n empfohlen: „staatlich anerkannte<br />
K<strong>in</strong>dheitspädagog<strong>in</strong> / staatlich anerkannter K<strong>in</strong>dheitspädagoge“.<br />
„Diese Berufsbezeichnung ist Ausdruck e<strong>in</strong>er Fachlichkeit, die dem Fachkräftegebot <strong>in</strong> <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>-<br />
und Jugendhilfe entspricht“, so die JFMK. Damit folgt die JFMK dem Vorschlag <strong>der</strong> BAG-BEK e.V., die<br />
nach <strong>in</strong>tensiver Diskussion diesen Begriff als den e<strong>in</strong>zig für diesen Bereich s<strong>in</strong>nvollen und nützlichen<br />
proklamiert hatte.<br />
Die Län<strong>der</strong> s<strong>in</strong>d nun aufgefor<strong>der</strong>t zeitnah die Möglichkeiten zur Verleihung <strong>der</strong> Berufsbezeichnung<br />
über die Studiengänge umzusetzen. Die Studiengänge müssen vorab prüfen, ob die Inhalte dem im<br />
Dezember 2010 verabschiedeten Orientierungsrahmen <strong>der</strong> JFMK entsprechen.<br />
Die BAG-BEK e.V. freut sich, dass dieser seit <strong>der</strong> Entstehung <strong>der</strong> Studiengänge im Jahr 2004 von <strong>der</strong><br />
BAG-BEK e.V. e<strong>in</strong>gefor<strong>der</strong>te Schritt nun erfolgt ist. Damit wird auch umso mehr verdeutlicht, dass die<br />
Absolvent<strong>in</strong>nen und Absolventen e<strong>in</strong>e eigenständige Qualifikation erreicht haben. Diese Qualifikationen<br />
tragen wesentlich zu den Professionalisierungsumsetzungen <strong>in</strong> den K<strong>in</strong><strong>der</strong>tagese<strong>in</strong>richtungen bei.<br />
Träger haben nun noch deutlicher die Chance, die nächsten Schritte h<strong>in</strong> zu multiprofessionellen<br />
Teams <strong>in</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>tagese<strong>in</strong>richtungen umzusetzen. Damit können die unterschiedlichen Qualifikationen<br />
<strong>der</strong> Mitarbeiter<strong>in</strong>nen und Mitarbeiter für die Bildung, Erziehung und Betreuung von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n im S<strong>in</strong>ne<br />
des K<strong>in</strong><strong>der</strong>wohles optimiert e<strong>in</strong>gesetzt werden. Darüber h<strong>in</strong>aus s<strong>in</strong>d die Tarifparteien aufgefor<strong>der</strong>t,<br />
die mit <strong>der</strong> neuen Berufsgruppe e<strong>in</strong>hergehenden Qualifikationen entsprechend e<strong>in</strong>zugruppieren.<br />
Die BAG-BEK e.V. vertritt über 250 aktive Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten Bereichen <strong>der</strong><br />
Pädagogik <strong>der</strong> K<strong>in</strong>dheit. Dies s<strong>in</strong>d sowohl Erzieher<strong>in</strong>nen und Erzieher, Absolvent<strong>in</strong>nen und Absolventen<br />
aus den e<strong>in</strong>schlägigen Studiengängen, wie auch Professor<strong>in</strong>nen und Professoren, Wissenschaftler<strong>in</strong>nen<br />
und Wissenschaftlern, ebenso Fort- und Weiterbildungskräften, ebenso Fachschullehrer<strong>in</strong>nen<br />
und –lehrer, ebenso E<strong>in</strong>zelpersönlichkeiten aus politischen Gremien, Parteien und Gewerkschaften,<br />
wie auch Träger und an<strong>der</strong>e Interessierende.<br />
23
Unser geme<strong>in</strong>sames Ziel ist die ständige Weiterentwicklung <strong>der</strong> Professionalisierung <strong>der</strong> pädagogischen<br />
Fachkräfte <strong>in</strong> diesem Berufsfeld und die Vernetzung <strong>der</strong> Aktivitäten verschiedenster Institutionen,<br />
Akteure und Akteur<strong>in</strong>nen im Bereich <strong>der</strong> Bildung und Erziehung <strong>in</strong> <strong>der</strong> K<strong>in</strong>dheit <strong>in</strong> Deutschland.<br />
Quelle: Bundesarbeitsgeme<strong>in</strong>schaft Bildung und Erziehung <strong>in</strong> <strong>der</strong> K<strong>in</strong>dheit<br />
___________________________________________________________________________________________<br />
21.) Integration durch Bildung (<strong>in</strong> <strong>der</strong> Schule)<br />
www.goethe.de<br />
Dr. Ingrid Gogol<strong>in</strong><br />
______________________________________________________<br />
Bildung gehört zu den öffentlichen Gütern, zu denen e<strong>in</strong>e mo<strong>der</strong>ne demokratische Gesellschaft<br />
allen ihren Mitglie<strong>der</strong>n bestmöglichen Zugang ermöglichen muss – das jedenfalls ist <strong>der</strong> S<strong>in</strong>n e<strong>in</strong>es<br />
öffentlichen allgeme<strong>in</strong>bildenden Schulsystems.<br />
Integration bedeutet, dass den Menschen, die <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Gesellschaft leben, die Möglichkeit <strong>der</strong> Teilhabe<br />
an öffentlichen Gütern nicht aufgrund <strong>in</strong>dividueller Merkmale o<strong>der</strong> den Zufällen <strong>der</strong> Herkunft systematisch<br />
verwehrt wird.<br />
Selbstverständlich kann e<strong>in</strong> noch so gut funktionierendes Schulsystem nicht die trennenden Unterschiede<br />
völlig beseitigen, die nach Herkunft o<strong>der</strong> nach <strong>in</strong>dividuellen Merkmalen zwischen den Menschen<br />
bestehen. Die Zugehörigkeit zu e<strong>in</strong>er sozialen Klasse beispielsweise ist e<strong>in</strong>e sehr stabile Angelegenheit,<br />
und es gel<strong>in</strong>gt – auch im <strong>in</strong>ternationalen Vergleich – kaum e<strong>in</strong>em Schulsystem, an <strong>der</strong> engen<br />
Beziehung zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolgschancen durchgreifend etwas zu verän<strong>der</strong>n.<br />
Die Perspektive e<strong>in</strong>er Integration durch Bildung kann sich deshalb, realistischerweise, nur auf ger<strong>in</strong>ge<br />
Spielräume beziehen, die <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Schulsystem bestehen. Aber diese Spielräume gibt es. Sie liegen<br />
vor allem <strong>in</strong> <strong>der</strong> besseren Gestaltung des Unterrichts und e<strong>in</strong>es Schulklimas, <strong>in</strong> dem sich alle an Bildung<br />
Beteiligten – Lehrer, Schüler, Eltern – anerkannt, wertgeschätzt und zu guten Leistungen herausgefor<strong>der</strong>t<br />
fühlen. Diese bestehenden Spielräume gilt es zu nutzen.<br />
Internationaler Vergleich<br />
Die <strong>in</strong>ternationalen Schulleistungsvergleichsstudien wie IGLU und PISA haben zutage geför<strong>der</strong>t, dass<br />
das deutsche Schulsystem nicht beson<strong>der</strong>s gut aufgestellt ist, was das Ausnutzen des bestehenden<br />
Spielraums anbelangt. Hier s<strong>in</strong>d die Abhängigkeiten zwischen sozialer<br />
Herkunft und den Chancen auf hohe Leistungen beson<strong>der</strong>s eng. Dies wird<br />
bei den Schüler<strong>in</strong>nen und Schülern aus Familien mit Migrationsh<strong>in</strong>tergrund<br />
beson<strong>der</strong>s deutlich. Ihre Chancen, e<strong>in</strong>e gute Lesekompetenz<br />
o<strong>der</strong> hohe mathematische und naturwissenschaftliche Kenntnisse zu erreichen,<br />
s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> Deutschland viel ger<strong>in</strong>ger als <strong>in</strong> an<strong>der</strong>en Staaten mit e<strong>in</strong>er<br />
vergleichbaren Schülerschaft.<br />
Beson<strong>der</strong>s alarmierend s<strong>in</strong>d die Ergebnisse <strong>der</strong> PISA-Studien, die nun seit<br />
e<strong>in</strong>em Jahrzehnt durchgeführt werden. Zwar hat die letzte Studie PISA<br />
2009 e<strong>in</strong>en sehr leichten Trend <strong>der</strong> Besserung – <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e im H<strong>in</strong>blick auf die Lesekompetenz –<br />
festgestellt. Nach wie vor aber s<strong>in</strong>d die Leistungsunterschiede zwischen Jugendlichen mit und ohne<br />
Migrationsh<strong>in</strong>tergrund <strong>in</strong> Deutschland deutlich größer als <strong>in</strong> Staaten mit vergleichbarer Zuwan<strong>der</strong>ung.<br />
Beson<strong>der</strong>s hoch s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> auch die Zusammenhänge zwischen <strong>der</strong> sozialen Herkunft, <strong>der</strong> Bildungsnähe<br />
<strong>der</strong> Familien und den Chancen auf Bildungserfolg. Die jüngste PISA-Studie zeigt, dass sich <strong>in</strong> dieser<br />
H<strong>in</strong>sicht die Lage über das letzte Jahrzehnt nicht verbessert hat.<br />
In e<strong>in</strong>er im Auftrag <strong>der</strong> OECD durchgeführten <strong>in</strong>ternationalen Vergleichsstudie Where Immigrant Students<br />
Succeed, <strong>der</strong> die Daten von PISA 2006 zugrunde lagen, zeigte sich, dass Schüler<strong>in</strong>nen und Schüler<br />
aus Migrantenfamilien, die <strong>in</strong> Deutschland geboren und aufgewachsen s<strong>in</strong>d, schlechtere Leistungschancen<br />
besitzen als diejenigen, die selbst hierher zugewan<strong>der</strong>t s<strong>in</strong>d (die sogenannte „erste Genera-<br />
24
tion“). Dies wi<strong>der</strong>spricht den Erfahrungen und Erwartungen: Normalerweise s<strong>in</strong>d die Bildungschancen<br />
von Menschen umso höher, je länger sie im Land <strong>der</strong> Zuwan<strong>der</strong>ung leben. In Deutschland ist es zum<strong>in</strong>dest<br />
für diejenigen an<strong>der</strong>s, die aus weniger bildungsnahen Familien kommen.<br />
Für diese Ergebnisse gibt es viele Gründe. Etliche davon, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e die sozial und ökonomisch<br />
bed<strong>in</strong>gten, kann e<strong>in</strong> Bildungssystem nicht beseitigen. In <strong>der</strong> 2009er PISA-Studie wird darauf h<strong>in</strong>gewiesen,<br />
dass Bildungsferne <strong>der</strong> Familien und sozio-ökonomische Lage nicht ausreichen, die Bildungsnachteile<br />
<strong>der</strong> Migranten zu erklären. Ebenso wenig kann es an mangeln<strong>der</strong> Motivation <strong>der</strong> Familien<br />
liegen – im Gegenteil: viele Studien zeigen, dass Migranten hoch motiviert s<strong>in</strong>d und sich beste<br />
Bildungskarrieren für ihre K<strong>in</strong><strong>der</strong> wünschen. Zu vermuten ist, dass mangelnde Wertschätzung<br />
und Akzeptanz von Migrant<strong>in</strong>nen und Migranten <strong>in</strong> Deutschland dazu beitragen, dass diese weniger<br />
erfolgreich im deutschen Bildungssystem s<strong>in</strong>d als ihre nichtmigrierten Mitschüler<strong>in</strong>nen und<br />
Mitschüler.<br />
Die <strong>in</strong>ternationalen Studien zeigen, dass die Län<strong>der</strong> sehr unterschiedlich erfolgreich dabei s<strong>in</strong>d, die<br />
zugewan<strong>der</strong>ten Schüler<strong>in</strong>nen und Schüler bildungserfolgreich zu machen. E<strong>in</strong> Blick über Grenzen – <strong>in</strong><br />
Län<strong>der</strong>, denen Integration durch Bildung besser gel<strong>in</strong>gt – kann dabei helfen, Schwachpunkte im deutschen<br />
Bildungssystem zu entdecken, damit auch hier die Handlungsspielräume so gut wie möglich<br />
genutzt werden.<br />
Beispiel England: E<strong>in</strong> hohes Maß an Integration durch Bildung (Verweis auf Editorial…)<br />
In Großbritannien gehören heute etwa 22 Prozent <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong> im Primarbereich<br />
und etwa 18 Prozent <strong>der</strong> Jugendlichen <strong>in</strong> Sekundarschulen e<strong>in</strong>er zugewan<strong>der</strong>ten<br />
M<strong>in</strong><strong>der</strong>heit an.<br />
Das Bildungssystem <strong>in</strong> Großbritannien ist regional organisiert, aufgeteilt <strong>in</strong><br />
die Regionen England, Irland, Schottland und Wales. Es ist also ähnlich wie<br />
<strong>in</strong> Deutschland, wo Bildung „Län<strong>der</strong>sache“ ist. Beson<strong>der</strong>s lohnt es sich,<br />
nach England zu schauen, denn dort ist e<strong>in</strong> hohes Maß an Integration durch<br />
Bildung erreicht. Die Leistungschancen s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> deutlich ger<strong>in</strong>gerem Maße<br />
als <strong>in</strong> Deutschland vom sozioökonomischen Status des Elternhauses und<br />
von <strong>der</strong> Herkunft aus e<strong>in</strong>er Migrantenfamilie abhängig.<br />
Was ist das Geheimnis des englischen Schulsystems? Wie kommt es, dass Integration dort augensche<strong>in</strong>lich<br />
besser gel<strong>in</strong>gt als hier? Gewiss gibt es mehr als e<strong>in</strong>e Ursache. Aber es ist höchstwahrsche<strong>in</strong>lich,<br />
dass dafür e<strong>in</strong>e traditionell <strong>in</strong>klusive Politik mitverantwortlich ist. An<strong>der</strong>s als die Bundesrepublik<br />
Deutschland, hat Großbritannien – und beson<strong>der</strong>s England – seit Beg<strong>in</strong>n <strong>der</strong> Zuwan<strong>der</strong>ung nach dem<br />
Zweiten Weltkrieg e<strong>in</strong>e klare Integrations- und Inklusionspolitik betrieben. Es gibt viele Anzeichen<br />
dafür – etwa die bereits sehr früh und umfassend e<strong>in</strong>geführte Antidiskrim<strong>in</strong>ierungsgesetzgebung. Aber<br />
auch e<strong>in</strong>e Bildungsreformpolitik gehört dazu, <strong>der</strong>en generelles Ziel <strong>der</strong> Abbau von sozialer Ungleichheit<br />
und von regionalen Unterschieden <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schulqualität ist.<br />
Umfassende bildungspolitische Strategie<br />
E<strong>in</strong> gewichtiger Teil dieser Strategie trägt die Überschrift Ethnic m<strong>in</strong>ority achievement. Die Aktivitäten<br />
stehen unter dem Motto „The secret of education lies <strong>in</strong> respect<strong>in</strong>g the pupil“ – das Geheimnis<br />
<strong>der</strong> Erziehung liegt <strong>in</strong> <strong>der</strong> Anerkennung des Schülers. Hier kommt schon <strong>der</strong> Wille zum Ausdruck, e<strong>in</strong><br />
Klima <strong>der</strong> Anerkennung <strong>in</strong> den Schulen zu schaffen. Es ist erwiesen, dass Ermutigung, Lob und Anerkennung<br />
wichtige Voraussetzungen dafür s<strong>in</strong>d, K<strong>in</strong><strong>der</strong>n zu guten Leistungen zu verhelfen. In Deutschland<br />
hat man <strong>in</strong> dieser H<strong>in</strong>sicht noch viel zu lernen. Diejenigen, <strong>der</strong>en Leistung (o<strong>der</strong> Verhalten) zu<br />
wünschen übrig lässt, müssen nicht <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Lerngeme<strong>in</strong>schaft <strong>in</strong>tegriert werden, son<strong>der</strong>n man kann<br />
sie abschieben: durch Sitzenbleiben; durch die Verweisung an e<strong>in</strong>e niedriger angesehene Schulform –<br />
bis h<strong>in</strong> zur Son<strong>der</strong>schule. Untersuchungen zum deutschen Bildungssystem zeigen, dass solche Mechanismen<br />
bei K<strong>in</strong><strong>der</strong>n und Jugendlichen aus Migrantenfamilien überproportional häufig zum Zuge kommen,<br />
und zwar durchaus auch dann, wenn objektive Faktoren – zum Beispiel die Leistungen – dies gar<br />
nicht nahelegen.<br />
Praktische Maßnahmen<br />
E<strong>in</strong>e Reihe von praktischen Maßnahmen flankiert die bildungspolitische Strategie <strong>in</strong> England. E<strong>in</strong> Beispiel<br />
dafür s<strong>in</strong>d die <strong>in</strong> vielen Kommunen etablierten Ethnic M<strong>in</strong>ority Achievement Services (EMAS):<br />
kommunale Zentren, <strong>in</strong> denen Material und Fachkräfte bereitstehen, um die Schulen und an<strong>der</strong>e In-<br />
25
stitutionen bei ihren Integrationsaufgaben zu unterstützen. Dazu zählen Dolmetscherdienste, die<br />
auch per Telefon <strong>in</strong> Anspruch genommen werden können – beispielsweise bei Elternbesuchen. E<strong>in</strong><br />
an<strong>der</strong>es Beispiel s<strong>in</strong>d „bil<strong>in</strong>gual assistants“: geschulte Personen, die von Schulen angefor<strong>der</strong>t werden<br />
können, wenn e<strong>in</strong>zelne K<strong>in</strong><strong>der</strong> o<strong>der</strong> Gruppen beson<strong>der</strong>e Hilfe im Unterricht brauchen. Viele EMAS<br />
bieten Qualifizierungsmaßnahmen an, die genau auf die Bedürfnisse <strong>der</strong> Schulen <strong>in</strong> ihrer Region zugeschnitten<br />
s<strong>in</strong>d.<br />
Integration durch Bildung <strong>in</strong> Deutschland<br />
Da <strong>in</strong> Deutschland über Jahrzehnte das Diktum vorherrschte, ke<strong>in</strong> E<strong>in</strong>wan<strong>der</strong>ungsland zu se<strong>in</strong>, wurden<br />
viele Chancen <strong>der</strong> Etablierung e<strong>in</strong>er ähnlich vorausschauenden, systematischen Integrationsstrategie<br />
verpasst. Der Historiker Klaus Bade beschreibt es dementsprechend als Auftrag –<br />
nicht nur im Bildungsbereich –, e<strong>in</strong>e „nachholende Integrationspolitik“ zu entwickeln.<br />
Sie kann sich nicht nur an Neuzuwan<strong>der</strong>nde richten, son<strong>der</strong>n sie muss <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e<br />
diejenigen <strong>in</strong> den Blick nehmen, die schon lange hier leben, aber den<br />
Schlüssel zu gesellschaftlicher Teilhabe nicht <strong>in</strong> die Hand bekommen haben.<br />
Erst seit wenigen Jahren wird hier öffentlich anerkannt, dass die Integration <strong>der</strong><br />
Zuwan<strong>der</strong>nden e<strong>in</strong>e Daueraufgabe ist; und noch immer ist diese Anerkennung fragil<br />
– sie wird durchaus nicht von allen gesellschaftlichen Gruppen geteilt. Dennoch<br />
gibt es positive <strong>in</strong>tegrationspolitische Aktivitäten, die sich auch auf die Chancen<br />
des Bildungssystems auswirken können, zur Integration beizutragen. 2007 wurde <strong>der</strong> Nationale Integrationsplan<br />
<strong>der</strong> Bundesregierung vorgelegt; ihm folgten mehrere Integrationskonzepte, die auch den<br />
Bildungsbereich betreffen. Damit wurde – erstmals <strong>in</strong> <strong>der</strong> mehr als fünfzigjährigen Zuwan<strong>der</strong>ungsgeschichte<br />
<strong>der</strong> Bundesrepublik Deutschland – <strong>der</strong> Versuch zu e<strong>in</strong>er koord<strong>in</strong>ierten und systematischen<br />
Integrationsanstrengung e<strong>in</strong>genommen, an <strong>der</strong> sich alle relevanten politischen Handlungsbereiche<br />
und gesellschaftlichen Gruppen beteiligen sollen. Es wurden Selbstverpflichtungen vere<strong>in</strong>bart, die<br />
sowohl Politik und öffentliche Verwaltungen e<strong>in</strong>gegangen s<strong>in</strong>d als auch Instanzen <strong>der</strong> Zivilgesellschaft:<br />
von Arbeitgeberverbänden bis zum Zuwan<strong>der</strong>ervere<strong>in</strong>. Der Integrationsplan ist nach wie vor<br />
lesenswert. Realisiert s<strong>in</strong>d die guten Vorsätze, die <strong>in</strong> dem Plan gefasst wurden, ke<strong>in</strong>eswegs; das ist<br />
umso mehr e<strong>in</strong> Grund, immer wie<strong>der</strong> an ihn zu er<strong>in</strong>nern.<br />
Vision e<strong>in</strong>er koord<strong>in</strong>ierten und systematischen Integrationsanstrengung<br />
E<strong>in</strong> bedeutendes Kapitel dieses Plans gilt dem Handlungsfeld <strong>der</strong> Bildung und Ausbildung;<br />
es ist überschrieben mit „Gute Bildung sichern, Ausbildungschancen erhöhen“.<br />
Hier<strong>in</strong> ist das Leitziel formuliert: „Menschen mit Migrationsh<strong>in</strong>tergrund<br />
s<strong>in</strong>d mit allen Kräften <strong>in</strong> Bildung, Ausbildung und Arbeitsmarkt zu <strong>in</strong>tegrieren,<br />
ke<strong>in</strong>em K<strong>in</strong>d und Jugendlichen dürfen wegen se<strong>in</strong>es aufenthaltsrechtlichen Status<br />
Bildungschancen verweigert werden.“ E<strong>in</strong>e Bestandsaufnahme, die bei <strong>der</strong> Entwicklung<br />
des Nationalen Integrationsplans vorgenommen wurde, hat etliche<br />
Schwachstellen aufgedeckt. Dazu gehört, dass man sich bis dato kaum auf Integration<br />
als Daueraufgabe e<strong>in</strong>gestellt hat. Viele Maßnahmen wurden allzu kurzfristig<br />
etabliert. Es bestand lange Zeit die Illusion, dass e<strong>in</strong> K<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>mal – zum Beispiel<br />
am Anfang e<strong>in</strong>er Schulkarriere – beson<strong>der</strong>e För<strong>der</strong>ung braucht, danach aber behandelt werden könne<br />
wie e<strong>in</strong> K<strong>in</strong>d aus e<strong>in</strong>er nicht e<strong>in</strong>gewan<strong>der</strong>ten Familie. Dies aber wi<strong>der</strong>spricht allen Forschungsergebnissen<br />
und praktischen Erfahrungen. Wenn K<strong>in</strong><strong>der</strong> aus Migrantenfamilien <strong>in</strong> zwei o<strong>der</strong> mehr Sprachen<br />
leben, was bei sehr vielen <strong>der</strong> Fall ist, so muss dies über e<strong>in</strong>e lange Zeit <strong>der</strong> Bildungskarriere h<strong>in</strong>weg<br />
systematisch beim Lehren berücksichtigt werden.<br />
Mehrsprachigkeit stärker berücksichtigen<br />
Forschungsergebnisse zeigen, dass mit vier bis sechs Jahren <strong>der</strong> beson<strong>der</strong>en Beachtung<br />
von Zweisprachigkeit gerechnet werden muss, damit e<strong>in</strong> K<strong>in</strong>d beim Lernen<br />
ke<strong>in</strong>e Nachteile erleidet. E<strong>in</strong>e an<strong>der</strong>e Schwachstelle für die Integration <strong>in</strong> das<br />
hiesige Bildungssystem ist, dass die K<strong>in</strong><strong>der</strong> nicht früh genug e<strong>in</strong>e För<strong>der</strong>ung erhalten.<br />
Beson<strong>der</strong>s günstig für die spätere Bildungskarriere ist es, wenn spätestens<br />
mit dem vierten Lebensjahr e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>stitutionelle För<strong>der</strong>ung e<strong>in</strong>setzt. Allerd<strong>in</strong>gs<br />
reicht es ke<strong>in</strong>eswegs aus, dass K<strong>in</strong><strong>der</strong> <strong>in</strong> Bildungse<strong>in</strong>richtungen s<strong>in</strong>d – Vorteile ergeben<br />
sich dadurch nur, wenn sie e<strong>in</strong> Angebot von hoher Qualität erhalten. Und<br />
26
hier besteht e<strong>in</strong> Problem: Bislang s<strong>in</strong>d pädagogische Fachkräfte und Lehrkräfte ke<strong>in</strong>eswegs <strong>in</strong> genügendem<br />
Maß für die Aufgabe qualifiziert, K<strong>in</strong><strong>der</strong> mit Migrationsh<strong>in</strong>tergrund erfolgreich zu för<strong>der</strong>n.<br />
Um diese Lage zu verbessern, haben die Bundeslän<strong>der</strong> damit begonnen, Qualifizierungsangebote zum<br />
besseren Umgehen mit sprachlicher Heterogenität und Mehrsprachigkeit <strong>in</strong> <strong>der</strong> Aus- und Weiterbildung<br />
von pädagogischem Personal zu etablieren. Solche Angebote gibt es sowohl für Lehrkräfte als<br />
auch für an<strong>der</strong>e pädagogische Fachkräfte. E<strong>in</strong>e Prüfung ihrer Qualität und Wirksamkeit steht allerd<strong>in</strong>gs<br />
noch aus.<br />
Sowohl für vorschulische E<strong>in</strong>richtungen als auch für die Schule ist die Entwicklung und Erprobung<br />
neuer Sprachbildungskonzepte im Gange, mit denen die Deutschkenntnisse <strong>der</strong> Schüler<strong>in</strong>nen und<br />
Schüler mit Migrationsh<strong>in</strong>tergrund besser geför<strong>der</strong>t werden können und <strong>in</strong> denen gleichzeitig Mehrsprachigkeit<br />
als e<strong>in</strong> positives Potenzial anerkannt und genutzt wird.<br />
Qualifizierungsoffensive<br />
E<strong>in</strong> für Deutschland neuer Zugang dabei ist, dass die Lehrer<strong>in</strong>nen und<br />
Lehrer aller Fächer dabei <strong>in</strong> die Pflicht genommen werden sollen, nicht<br />
nur die Sprachlehrer. Dieser Weg, dass Sprache <strong>in</strong> allen Fächern gelehrt<br />
wird, hat sich an<strong>der</strong>swo – etwa <strong>in</strong> England – längst bewährt. Allerd<strong>in</strong>gs<br />
erfor<strong>der</strong>t auch dies zunächst e<strong>in</strong>e Qualifizierungsoffensive, denn für die<br />
Aufgabe <strong>der</strong> Sprachbildung s<strong>in</strong>d Lehrkräfte an<strong>der</strong>er Fächer ke<strong>in</strong>eswegs<br />
ausgebildet. Dies haben auch die Kultusm<strong>in</strong>ister <strong>der</strong> Län<strong>der</strong> so gesehen.<br />
Sie haben sich deshalb selbst dazu verpflichtet, Ausbildungs- und Fortbildungsmaßnahmen<br />
vorzusehen, die es künftig allen Lehrkräften ermöglichen wird, ihren Sprachbildungsauftrag<br />
wahrzunehmen.<br />
Auch das Pr<strong>in</strong>zip <strong>der</strong> Achtung und Anerkennung kommt <strong>in</strong> den Selbstverpflichtungen <strong>der</strong> Konferenz<br />
<strong>der</strong> Kultusm<strong>in</strong>ister <strong>der</strong> Län<strong>der</strong> zum Ausdruck. Sie haben sich dazu bekannt, dass neben dem Erwerb<br />
<strong>der</strong> deutschen Sprache die Mehrsprachigkeit für alle K<strong>in</strong><strong>der</strong> und Jugendlichen von großer Bedeutung<br />
ist. Hierbei s<strong>in</strong>d auch die Herkunfts- o<strong>der</strong> Familiensprachen <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong> und Jugendlichen mit Migrationsh<strong>in</strong>tergrund<br />
e<strong>in</strong>geschlossen. Es sollen Maßnahmen identifiziert werden, mit denen das Pr<strong>in</strong>zip <strong>der</strong><br />
Mehrsprachigkeit im Schulalltag angemessen verankert werden kann.<br />
Wenn solche Absichten <strong>in</strong> die Tat umgesetzt werden, besteht berechtigte Aussicht darauf, dass auch<br />
das deutsche Bildungssystem künftig besser als <strong>in</strong> <strong>der</strong> Vergangenheit zur Integration durch Bildung<br />
beiträgt.<br />
Quelle: Goethe Institut<br />
___________________________________________________________________________________<br />
22.) För<strong>der</strong>programm Inklusion durch Enkulturation – <strong>in</strong> Osterholz-Scharmbeck<br />
______________________________________________________________________________<br />
E<strong>in</strong> wesentliches Ziel von LINES II ist die Erhöhung <strong>der</strong> Lern- und Ausbildungsfähigkeit von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n und<br />
Jugendlichen (und ihren Eltern) mit Migrationsh<strong>in</strong>tergrund o<strong>der</strong> aus bildungsfernen Bevölkerungsgruppen<br />
zu Aus-, Fort- und Weiterbildung sowohl <strong>der</strong> Zielgruppen selbst als auch <strong>der</strong> Zielgruppen im<br />
Bereich <strong>der</strong> Erziehungs-, Betreuungs- und Lehrpersonals erhöht werden.<br />
Die vier zentralen Arbeitsbereiche von LINES II s<strong>in</strong>d: Campus für lebenslanges Lernen, Lernhaus im<br />
Campus, Kompetenzzentrum Dialog <strong>in</strong> Buschhausen und Elternarbeit und Ehrenamt.<br />
Das LINES II Projekt verfolgt die Weiterentwicklung und den nachhaltigen Ausbau des Inklusionsnetzwerkes<br />
mit allen beteiligten Akteuren <strong>in</strong> <strong>der</strong> Stadt Osterholz-Scharmbeck. Der bisherige Ansatz zur<br />
Entwicklung, Erprobung und Evaluierung von Fortblidungs- und Qualifizierungsmodulen für die Fort-<br />
und Weiterbildung von Lehr-, Betreuungs- und pädagogischem Personal wird<br />
fortgeführt und durch e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>same Qualifizierung von Eltern und pädagogischem Personal sowie<br />
von Lehr- und Betreuungspersonal ergänzt. Inhouseschulungen und mobile Beratungsmodule mit festen<br />
Beratungs- und Sprechzeiten auch an <strong>der</strong> Neuen Schule am CAMPUS runden das Projekt LINES II<br />
27
mit <strong>der</strong> Qualifizierung von ElternlotsInnen und mit <strong>der</strong> Fortführung <strong>der</strong> Fortbildungsreihe FachberaterIn<br />
Inklusion (vhs) ab.<br />
Durch das Kompetenzzentrum Dialog an <strong>der</strong> Grundschule Buschhausen werden Unterstützungsangebote<br />
für K<strong>in</strong><strong>der</strong> mit Entwicklungsprozessen und ihre Eltern direkt <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> Schule angeboten. Die<br />
Grundschule Buschhausen arbeitet deshalb eng mit Therapeuten und sozialpädagogischen Fachkräften<br />
zusammen, die regelmäßig Sprechstunden <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schule anbieten und <strong>in</strong> Klassen o<strong>der</strong> Gruppen<br />
hospitieren.<br />
Der Campus für lebenslanges Lernen soll geme<strong>in</strong>sam mit den beteiligten Schulen und Bildungsträgern<br />
zu e<strong>in</strong>em von allen Bevölkerungsgruppen genutzten Bildungsort entwickelt werden. Da die Campusentwicklung<br />
und die Weiterentwicklung <strong>der</strong> gesamten kommunalen Bildungslandschaft nur <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
geme<strong>in</strong>sam getragenen Gestaltungsprozess gel<strong>in</strong>gen können, wird e<strong>in</strong> <strong>in</strong>haltliches Konzept für den<br />
Campus geme<strong>in</strong>sam mit den beteiligten E<strong>in</strong>richtungen entwickelt. Die Stadt strebt als e<strong>in</strong> Ergebnis<br />
dieses Prozesses die Schaffung e<strong>in</strong>er geme<strong>in</strong>samen Koord<strong>in</strong>ationsstelle zur Planung und zum Anstoßen<br />
neuer Kooperationsvorhaben, dem E<strong>in</strong>werben dafür notwendiger Projektmittel und zum Raummanagement<br />
an.<br />
Um das neue Medienzentrum auf dem Campus zu e<strong>in</strong>em praxisorientierten Kompetenzzentrum für<br />
Schulen und K<strong>in</strong><strong>der</strong>gärten weiterzuentwickeln und se<strong>in</strong>e medienpädagogischen Angebote auszuweiten,<br />
s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> 20<strong>11</strong> geme<strong>in</strong>sam mit dem Europäischen Institut für Innovation e.V. und <strong>der</strong> Volkshochschule<br />
beim nie<strong>der</strong>sächsischen Kultusm<strong>in</strong>isterium Mittel für e<strong>in</strong> <strong>in</strong>ternationales Projekt "E-<br />
Inclusion" beantragt worden.<br />
E<strong>in</strong>e LINES III Umsetzung ab September 2012 bef<strong>in</strong>det sich h<strong>in</strong>sichtlich e<strong>in</strong>er Antragstellung aus dem<br />
Landesprogramm „Inklusion durch Enkulturation“ <strong>in</strong> <strong>der</strong> Planung.<br />
Richtfest für das neue Medienzentrum im Campus war am 05.07.20<strong>11</strong>. Nach dem bevorstehenden<br />
Abriss des alten Realschulgebäudes soll das Domizil des „Lernhauses im Campus“ für rd. 600 SchülerInnen<br />
<strong>der</strong> 5. bis 10. Klasse im ersten Quartal 2013 bezugsfertig se<strong>in</strong>.<br />
___________________________________________________________________________________________<br />
23.) Bildungs- und Teilhabepaket: Schulbedarf beantragen<br />
F<strong>in</strong>anzielle Unterstützung für Schulbedarf<br />
_______________________________________________________________<br />
Wer die Leistung für se<strong>in</strong>e K<strong>in</strong><strong>der</strong> rechtzeitig zum Schuljahresbeg<strong>in</strong>n<br />
(im August) 20<strong>11</strong> erhalten möchte, sollte sich an die zuständigen Stellen für die Bildungs- und Teilhabeleistungen<br />
wenden und dort e<strong>in</strong>en schriftlichen Antrag für den Schulbedarf stellen. Eltern, die den<br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong>zuschlag o<strong>der</strong> Wohngeld beziehen, erhalten für jedes anspruchsberechtigte K<strong>in</strong>d 100 Euro jährlich<br />
für den Schulbedarf: 70 Euro am 1. August und 30 Euro am 1. Februar.<br />
Der Betrag dient Eltern dazu, zum Beispiel Schreib- o<strong>der</strong> Rechenmaterial sowie Mal- o<strong>der</strong> Bastelutensilien<br />
zum Schuljahresbeg<strong>in</strong>n sowie zum Beg<strong>in</strong>n des zweiten Schulhalbjahres für den Unterricht anschaffen<br />
zu können. Diese Leistung ist Teil des Bildungs- und Teilhabepakets, das zum 1. Januar 20<strong>11</strong><br />
e<strong>in</strong>geführt wurde und auch für anspruchsberechtigte K<strong>in</strong><strong>der</strong> im SGB II gilt.<br />
Leistungen für Bildung und Teilhabe ab 1. Januar 20<strong>11</strong><br />
Seit dem 1. Januar 20<strong>11</strong> stehen den Empfängern von K<strong>in</strong><strong>der</strong>zuschlag zukünftig neben <strong>der</strong> Geldleistung<br />
von unverän<strong>der</strong>t maximal 140 Euro auch sieben Leistungen zur Bildung und Teilhabe zu:<br />
• e<strong>in</strong>tägige Schul- und Kitaausflüge (tatsächliche Kosten)<br />
• mehrtägige Klassen- und Kitafahrten (tatsächliche Kosten)<br />
• den persönlichen Schulbedarf (<strong>in</strong>sgesamt 100 Euro jährlich)<br />
• die Beför<strong>der</strong>ung von Schüler<strong>in</strong>nen und Schülern zur Schule (tatsächliche Kosten)<br />
• Lernför<strong>der</strong>ungen (tatsächliche Kosten)<br />
28
• die Teilnahme an e<strong>in</strong>er geme<strong>in</strong>schaftlichen Mittagsverpflegung <strong>in</strong> Schule o<strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>tagese<strong>in</strong>richtungen<br />
(Zuschuss)<br />
• die Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben <strong>in</strong> <strong>der</strong> Geme<strong>in</strong>schaft (wie im Sportvere<strong>in</strong><br />
o<strong>der</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Musikschule <strong>in</strong> Höhe von 10 Euro monatlich).<br />
Das Bildungs- und Teilhabepaket besteht aus Geld- und Sachleistungen. Mit den Sachleistungen wird<br />
sichergestellt, dass diese Leistungen die K<strong>in</strong><strong>der</strong> und Jugendlichen im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>dividuellen För<strong>der</strong>ung<br />
auch erreichen. Die e<strong>in</strong>heitliche Abwicklung aus e<strong>in</strong>er Hand durch die kommunalen Träger sichert<br />
e<strong>in</strong>e zielgenaue und bürgernahe Umsetzung vor Ort und gewährleistet e<strong>in</strong>e effiziente Verwaltung<br />
ohne bürokratische Hürden.<br />
Informationen zum Bildungs- und Teilhabepaket mit den entsprechenden Antragsformularen erhalten<br />
Sie auch im <strong>Haus</strong> <strong>der</strong> <strong>Kulturen</strong>.<br />
Quelle: Die Bundesregierung<br />
___________________________________________________________________________________________<br />
24.) K<strong>in</strong><strong>der</strong>zuschlag und Leistungen für Bildung und<br />
Teilhabe - Familienleistung K<strong>in</strong><strong>der</strong>zuschlag<br />
_______________________________________________________<br />
Der K<strong>in</strong><strong>der</strong>zuschlag ist e<strong>in</strong>e Familienleistung, die Familien im<br />
Niedrige<strong>in</strong>kommensbereich spürbar entlastet und mit <strong>der</strong><br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong>armut von unter 25 Jahre alten K<strong>in</strong><strong>der</strong>n bekämpft<br />
werden soll. Viele erwerbstätige Eltern brauchen den K<strong>in</strong><strong>der</strong>zuschlag als zusätzliche f<strong>in</strong>anzielle Unterstützung,<br />
weil ihr E<strong>in</strong>kommen nicht ausreicht, um auch den Unterhalt ihrer K<strong>in</strong><strong>der</strong> ausreichend zu<br />
sichern.<br />
Mit dem K<strong>in</strong><strong>der</strong>zuschlag wird die Bereitschaft von Eltern, für ihren eigenen Lebensunterhalt aktiv zu<br />
sorgen, honoriert. Und dass <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>zuschlag wirkt und beliebt ist, zeigt auch die jüngste Evaluation.<br />
Laut dieser Umfrage s<strong>in</strong>d mit dem K<strong>in</strong><strong>der</strong>zuschlag 82 Prozent <strong>der</strong> Berechtigten zufrieden. Fast<br />
genau so viele Befragte (81 Prozent) sprechen von e<strong>in</strong>er verbesserten E<strong>in</strong>kommenssituation durch den<br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong>zuschlag, <strong>der</strong> <strong>der</strong>zeit rund 300 000 K<strong>in</strong><strong>der</strong> und ihre Eltern erreicht. Vor allem aber Familien mit<br />
mehreren K<strong>in</strong><strong>der</strong>n profitieren von dieser Leistung.<br />
Der K<strong>in</strong><strong>der</strong>zuschlag beträgt monatlich bis zu 140 Euro je K<strong>in</strong>d und wird an Eltern für das <strong>in</strong> ihrem<br />
<strong>Haus</strong>halt lebende K<strong>in</strong>d gezahlt, wenn sie mit ihrem E<strong>in</strong>kommen zwar den eigenen Bedarf decken können,<br />
nicht aber den ihrer K<strong>in</strong><strong>der</strong>.<br />
Weitere Voraussetzungen für den Anspruch auf K<strong>in</strong><strong>der</strong>zuschlag s<strong>in</strong>d, dass die Eltern für das K<strong>in</strong>d K<strong>in</strong><strong>der</strong>geld<br />
beziehen, das E<strong>in</strong>kommen <strong>der</strong> Eltern die M<strong>in</strong>deste<strong>in</strong>kommensgrenze von 900 Euro brutto für<br />
Paare und 600 Euro brutto für Alle<strong>in</strong>erziehende erreicht, mit dem E<strong>in</strong>kommen die Höchste<strong>in</strong>kommensgrenze<br />
nicht überschritten wird und durch den K<strong>in</strong><strong>der</strong>zuschlag Hilfebedürftigkeit im S<strong>in</strong>ne des<br />
SGB II vermieden wird.<br />
Quelle: Die Bundesregierung<br />
___________________________________________________________________________________<br />
25.) Run<strong>der</strong> Tisch zur Umsetzung des Bildungspakets www.familien-mit-zukunft.de<br />
___________________________________________________________________________________<br />
Der Runde Tisch zur Umsetzung des Bildungspakets mit Vertreter<strong>in</strong>nen und Vertretern von Bund, Län<strong>der</strong>n<br />
und Kommunen tagte im Juni 20<strong>11</strong> erneut. Seit dem letzten Treffen im April war nach Umfragen<br />
<strong>der</strong> kommunalen Spitzenverbände die Antragsquote für Leistungen aus dem Bildungspaket von zehn<br />
auf rund 30 Prozent <strong>der</strong> antragsberechtigten Familien gestiegen.<br />
Das Bundesarbeitsm<strong>in</strong>isterium will Schwierigkeiten bei <strong>der</strong> Umsetzung genauer untersuchen und Eltern<br />
gezielter ansprechen: E<strong>in</strong>e Analyse <strong>der</strong> großen Differenzen bei den Antragsquoten <strong>der</strong> Kommu-<br />
29
nen soll erfolgreiche Konzepte sichtbar machen. E<strong>in</strong>e wissenschaftliche Untersuchung <strong>der</strong> Zielgruppen<br />
des Bildungspakets soll e<strong>in</strong>e gezieltere Ansprache ermöglichen. Neben Kitas, Vere<strong>in</strong>en und Schulen<br />
sollen auch Jobcenter als Verbreitungswege genutzt werden.<br />
Der Deutsche Städtetag hatte <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Umfrage <strong>in</strong> rund 100 Städten ermittelt, dass mittlerweile rund<br />
27 Prozent <strong>der</strong> Leistungsberechtigten Anträge gestellt haben, so Hauptgeschäftsführer Dr. Stephan<br />
Articus. Die Situation <strong>in</strong> den Städten ist danach sehr unterschiedlich. In etwa 20 Prozent <strong>der</strong> befragten<br />
Städte haben bereits über 40 Prozent <strong>der</strong> Eltern Anträge gestellt, <strong>in</strong> rund 30 Prozent <strong>der</strong> Städte<br />
liegen die Antragszahlen zwischen 20 und 30 Prozent, <strong>in</strong> ca. 25 Prozent <strong>der</strong> Städte zwischen 10 und<br />
20 Prozent. Am stärksten werde <strong>der</strong> Zuschuss zur Mittagsverpflegung nachgefragt, gefolgt von Ausflügen<br />
und Klassenfahrten. Die Lernför<strong>der</strong>ung werde bisher mit 5 Prozent noch wenig nachgefragt.<br />
Quelle: BAMF<br />
Ob e<strong>in</strong> unters AsylbLG fallendes K<strong>in</strong>d Leistungen für Schulhefte usw. erhält, hängt <strong>der</strong>zeit davon ab,<br />
<strong>in</strong> welchem Bundesland und welchem Landkreis es lebt. Z.B. bewilligen Nie<strong>der</strong>sachsen und Rhe<strong>in</strong>land-Pfalz<br />
das Bildungspaket für Asylbewerberk<strong>in</strong>d ausschließlich nur als Sachleistung.<br />
www.fluechtl<strong>in</strong>gsrat-berl<strong>in</strong>.de<br />
Dazu vertritt Georg Classen vom Flüchtl<strong>in</strong>gsrat Berl<strong>in</strong> die Auffassung, dass die Ausglie<strong>der</strong>ung des<br />
"Bildungspakets" aus den Regelbedarfssätzen für K<strong>in</strong><strong>der</strong> <strong>der</strong> Bundesregierung im Ergebnis wie bereits<br />
bei ALG2 dabei helfen wird, die AsylbLG-Leistungssätze für K<strong>in</strong><strong>der</strong> niedriger zu berechnen. Nur e<strong>in</strong>es<br />
an <strong>der</strong> anstehenden Reform des AsylbLG sche<strong>in</strong>t klar zu se<strong>in</strong>: das Bildungspaket für K<strong>in</strong><strong>der</strong> kommt <strong>in</strong>s<br />
AsylbLG. Die Mehrzahl <strong>der</strong> Län<strong>der</strong> und Kommunen stellen schon jetzt nach § 6 AsylbLG Geld- und<br />
Sachleistungen des Bildungspakets auch <strong>in</strong> den ersten vier Jahren des Leistungsbezugs bereit. Auch<br />
das BMAS legt dies nahe. Problematisch ist dabei, dass Flüchtl<strong>in</strong>ge, Bildungse<strong>in</strong>richtungen und Behörden<br />
- wie bei deutschen K<strong>in</strong><strong>der</strong>n - von <strong>der</strong> Antragsbearbeitung überfor<strong>der</strong>t s<strong>in</strong>d.<br />
___________________________________________________________________________________<br />
26.) Bundesfreiwilligendienst: die Fakten<br />
www.bundesfreiwilligendienst.de<br />
___________________________________________________________________________________<br />
Seit dem 1. Juli kann sich je<strong>der</strong> im neuen Bundesfreiwilligendienst engagieren – egal ob alt o<strong>der</strong><br />
jung, Frau o<strong>der</strong> Mann. Direkt <strong>in</strong>formieren können Sie sich unter<br />
www.bundesfreiwilligendienst.de .<br />
Der Bundesfreiwilligendienst (BFD) ist e<strong>in</strong> engagementpolitisches Projekt. Er soll <strong>der</strong> Nährboden für<br />
e<strong>in</strong>e neue Kultur <strong>der</strong> Freiwilligkeit <strong>in</strong> Deutschland se<strong>in</strong> und möglichst vielen Menschen e<strong>in</strong>en Dienst<br />
für die Allgeme<strong>in</strong>heit ermöglichen. Daher ist er offen für Jung und Alt, für Männer und Frauen - <strong>in</strong><br />
zahlreichen E<strong>in</strong>satzbereichen. Dabei baut <strong>der</strong> Bundesfreiwilligendienst auf Strukturen auf, die sich<br />
bewährt haben.<br />
Freiwillig Dienst tun können Interessent<strong>in</strong>nen und Interessenten <strong>in</strong> zahlreichen<br />
geme<strong>in</strong>wohlorientierten E<strong>in</strong>richtungen. Für die Tätigkeit benötigen sie ke<strong>in</strong>e<br />
fachliche Ausbildung, denn man übernimmt Aufgaben, die über die sogenannten<br />
Kernleistungen <strong>der</strong> E<strong>in</strong>satzstellen h<strong>in</strong>ausgehen. Das s<strong>in</strong>d oft praktische Hilfstätigkeiten,<br />
<strong>in</strong> denen menschliche Beziehungen im Vor<strong>der</strong>grund stehen. E<strong>in</strong>satzbeispiele<br />
s<strong>in</strong>d K<strong>in</strong><strong>der</strong>- und Jugendhilfe, Jugendarbeit, Wohlfahrts-, Gesundheits- und<br />
Altenpflege und Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>tenhilfe. Umwelt- und Naturschutz, Sport, Integration,<br />
Kultur- und Denkmalpflege zählen genauso dazu wie <strong>der</strong> Bildungsbereich, <strong>der</strong><br />
Zivil- und Katastrophenschutz.<br />
30
Wer die Schule abgeschlossen hat, kann mitmachen: egal ob Jung o<strong>der</strong> Alt, ob Mann o<strong>der</strong> Frau. Der<br />
BFD dauert <strong>in</strong> <strong>der</strong> Regel zwölf Monate, m<strong>in</strong>destens aber sechs und höchstens 18, <strong>in</strong> Ausnahmefällen<br />
bis zu 24 Monate. Der Dienst ist grundsätzlich e<strong>in</strong> Vollzeitdienst. Wenn die Freiwilligen älter als 27<br />
Jahre s<strong>in</strong>d, ist auch Teilzeit von m<strong>in</strong>destens 20 Wochenstunden möglich.<br />
Der neue Bundesfreiwilligendienst soll geme<strong>in</strong>sam mit dem Ausbau <strong>der</strong><br />
etablierten Jugendfreiwilligendienste FSJ und FÖJ den Nährboden für e<strong>in</strong>e<br />
neue Kultur <strong>der</strong> Freiwilligkeit <strong>in</strong> Deutschland bieten.“<br />
Dr. Krist<strong>in</strong>a Schrö<strong>der</strong>, Bundesm<strong>in</strong>ister<strong>in</strong> für Familie, Senioren, Frauen und Jugend<br />
Mit dem Bundesfreiwilligendienst will die Bundesregierung rund 35.000 Männern<br />
und Frauen pro Jahr die Möglichkeit bieten, sich für an<strong>der</strong>e e<strong>in</strong>zusetzen. Damit<br />
erfährt auch das eigene Leben e<strong>in</strong>e Bereicherung. Zum ersten Mal steht jetzt<br />
auf Bundesebene e<strong>in</strong> attraktives Angebot auch für ältere Menschen bereit, die sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Freiwilligendienst<br />
engagieren wollen.<br />
Gleichzeitig werden die Möglichkeiten des Engagements für jüngere Freiwillige ausgeweitet. Der<br />
Bundesfreiwilligendienst tritt mit dem Wegfall des Zivildienstes ab dem 1. Juli 20<strong>11</strong> neben das Freiwillige<br />
Soziale und das Freiwillige Ökologische Jahr (FSJ und FÖJ). Alle Dienste werden dabei weitgehend<br />
gleich ausgestattet, geme<strong>in</strong>sam durchgeführt und verwaltet.<br />
Kopplungsmodell BFD und FSJ<br />
Quelle: Matthias Sommer Leistet seit 1. Juli<br />
Bundesfreiwilligendienst: Gabriele Petersen<br />
Alle Freiwilligen s<strong>in</strong>d gesetzlich sozialversichert. Die E<strong>in</strong>satzstellen<br />
entscheiden, wie hoch das Taschengeld ausfällt. Die<br />
Höchstgrenze liegt bei 330,00 Euro. Die Eltern <strong>der</strong> Freiwilligen<br />
erhalten, wenn die Voraussetzungen hierfür erfüllt s<strong>in</strong>d, K<strong>in</strong><strong>der</strong>geld.<br />
Quelle: Die Bundesregierung<br />
Das Bundesfamilienm<strong>in</strong>isterium hat e<strong>in</strong>e Kopplung zwischen dem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) und<br />
dem neuen Bundesfreiwilligendienst (BFD) angekündigt. Demnach sollen 3 FSJ-Plätze nur dann genehmigt<br />
werden, wenn gleichzeitig auch 2 BFD-Plätze besetzt werden.<br />
H<strong>in</strong>tergrund ist das schleppende Interesse am BFD und die damit verbundende Gefahr, die auf Dauer<br />
vorgesehenen Mittel nicht halten zu können. Große Anbieter von Plätzen für FSJ und BFD wie die<br />
AWO und das Deutsche Rote Kreuz lehnen diese Pläne ab. Auch aus den Bundeslän<strong>der</strong>n werden die<br />
Pläne teilweise massiv abgelehnt. E<strong>in</strong>igkeit herrscht <strong>in</strong> den verschiedenen Erklärungen dar<strong>in</strong>, dass<br />
<strong>der</strong> BFD e<strong>in</strong>e Chance für mehr freiwillige s Engagement bietet.<br />
Quelle: Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement<br />
___________________________________________________________________________________<br />
27.) neXTvote: Wie glücklich s<strong>in</strong>d junge Menschen <strong>in</strong> ihrem Wohnort?<br />
Björn Bertram<br />
www.ljr.de<br />
Anlässlich <strong>der</strong> Kommunalwahl am <strong>11</strong>.09.20<strong>11</strong> startete <strong>der</strong> Landesjugendr<strong>in</strong>g<br />
Nie<strong>der</strong>sachsen e.V. (LJR) am 01.07.20<strong>11</strong> den<br />
„glüXtest”, mit dessen Hilfe junge Menschen aus ganz Nie<strong>der</strong>sachsen<br />
onl<strong>in</strong>e die Jugendfreundlichkeit ihrer Kommune bewerten<br />
können.<br />
31
___________________________________________________________________________________<br />
Vom Schwimmbad, über Freizeite<strong>in</strong>richtungen und die För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Jugendarbeit bis h<strong>in</strong> zu Nahverkehr<br />
und Schule – kommunalpolitische Entscheidungen haben e<strong>in</strong>en großen E<strong>in</strong>fluss auf die Lebenswelt<br />
junger Menschen”, so Jens Risse, Vorstandssprecher des LJR, und weiter: „mit dem »glüXtest«<br />
wollen wir junge Menschen dazu ermuntern, sich mit Kommunalpolitik ause<strong>in</strong>an<strong>der</strong>zusetzen und<br />
zugleich herausf<strong>in</strong>den, wie jugendfreundlich die e<strong>in</strong>zelnen Kommunen s<strong>in</strong>d.” Dazu dient e<strong>in</strong>e Onl<strong>in</strong>e-<br />
Umfrage, die bis zum Wahltag auf www.neXTvote.de durchgespielt werden kann. In den Tagen vor<br />
<strong>der</strong> Kommunalwahl werden dann landesweit <strong>in</strong> vielen Städten Veranstaltungen von Jugendverbänden<br />
und Jugendr<strong>in</strong>gen stattf<strong>in</strong>den, <strong>in</strong> denen diese Ergebnisse mit den Kandidat-<strong>in</strong>n-en <strong>der</strong> Parteien diskutiert<br />
werden.<br />
Die zur Wahl stehenden Parteien s<strong>in</strong>d außerdem aufgefor<strong>der</strong>t, sich im Rahmen <strong>der</strong> „glüXprüfung” auf<br />
neXTvote.de zu jugendpolitischen Fragestellungen zu positionieren, so dass sich die Wähler<strong>in</strong>nen und<br />
Wähler dann auf <strong>der</strong> Webseite über die Ziele <strong>der</strong> verschiedenen Parteien <strong>in</strong>formieren und onl<strong>in</strong>e den<br />
Kontakt zu den Parteien suchen können.<br />
Die nie<strong>der</strong>sächsische Sozialm<strong>in</strong>ister<strong>in</strong> Aygül Özkan, <strong>der</strong>en M<strong>in</strong>isterium die neXTvote-Kampagne för<strong>der</strong>t,<br />
unterstrich anlässlich <strong>der</strong> Präsentation <strong>der</strong> Kampagne: „neXTvote baut e<strong>in</strong>e Brücke zwischen<br />
jungen Menschen und Politik. Die Aktion motiviert die Jugendlichen, sich mit ihrer Umgebung aktiv<br />
ause<strong>in</strong>an<strong>der</strong>zusetzen und Lob und Kritik offen zu äußern. Es ist wichtig, Jugendliche für Politik zu<br />
begeistern und ihnen die Chance zu bieten, sich zu beteiligen.” Auch für Schulen sei die Kampagne<br />
e<strong>in</strong>e gute Möglichkeit, um im Unterricht die Kommunalwahl zum Thema zu machen.<br />
Auf <strong>der</strong> Webseite www.neXTvote.de gibt es neben dem glüXtest und <strong>der</strong> glüXprüfung auch jugendgerechte<br />
Informationen rund um die Kommunalwahl sowie Methodenvorschläge, wie die Kommunalwahl<br />
im Unterricht und <strong>in</strong> <strong>der</strong> Jugendarbeit jugendgerecht aufgegriffen werden kann.<br />
Quelle: Landesjugendr<strong>in</strong>g Nie<strong>der</strong>sachsen e.V.<br />
_______________________________________________________________________________________<br />
2 8 . ) S c h u l e d e r Z u k u n f t : e i n g a n z e r T a g m i t g u t e n A n g e b o t e n<br />
www.dji.de www.projekt-steg.de<br />
_______________________________________________________________________________________<br />
Die Ganztagsschule hält mittlerweile E<strong>in</strong>zug <strong>in</strong> das deutsche Bildungssystem – <strong>in</strong> ganz unterschiedlichem<br />
Tempo und <strong>in</strong> verschiedensten Ausprägungen. Die Angebote und <strong>der</strong>en Nutzung variieren erheblich<br />
und s<strong>in</strong>d abhängig vom Engagement des jeweiligen Bundeslandes, <strong>der</strong> Kommune, <strong>der</strong> e<strong>in</strong>zelnen<br />
Schulleitungen und nicht zuletzt <strong>der</strong> außerschulischen Kooperationspartner wie zum Beispiel <strong>der</strong> Jugendhilfe.<br />
So reicht die Palette von e<strong>in</strong>zelnen unverb<strong>in</strong>dlichen Nachmittagsangeboten bis h<strong>in</strong> zu flächendeckenden<br />
Grundschulen mit gebundenen Ganztagsangeboten. Vielerorts ist jedoch mit Wi<strong>der</strong>ständen<br />
o<strong>der</strong> widrigen Umständen zu kämpfen. Sowohl das Lehrpersonal als auch Schüler<strong>in</strong>nen und<br />
Schüler diskutieren kontrovers und viele s<strong>in</strong>d unentschieden, ob sie nun zu den Befürwortern o<strong>der</strong><br />
Gegnern gehören. Für die meisten Eltern h<strong>in</strong>gegen verläuft die Entwicklung entschieden zu langsam.<br />
Rund zwei Drittel von ihnen sprechen sich laut e<strong>in</strong>er Erhebung <strong>der</strong> Bertelsmann Stiftung für Ganztagsangebote<br />
an den Schulen aus.<br />
Die Ganztagsschule gilt <strong>in</strong> dreierlei H<strong>in</strong>sicht als Hoffnungsträger<strong>in</strong>:<br />
1. mit Blick auf die Vere<strong>in</strong>barkeit von Familie und Beruf als umfassen<strong>der</strong>e Bildungs- und<br />
Betreuungsform gegenüber <strong>der</strong> Halbtagsschule;<br />
32
2. wegen ihrer potenziell zielgenaueren und <strong>in</strong>dividuelleren För<strong>der</strong>ungsmöglichkeiten für Schüler<strong>in</strong>nen<br />
und Schüler, von denen man sich u.a. e<strong>in</strong> Plus an Chancengerechtigkeit im Bildungssystem<br />
verspricht;<br />
3. weil durch neue Akteure und Kooperationspartner <strong>in</strong> <strong>der</strong> Institution Schule auch außerunterrichtliche<br />
Lernformen und Bildungs<strong>in</strong>halte verwirklicht werden können.<br />
Sollen diese Hoffnungen Realität werden, müssen nach Ansicht des Deutschen Jugend<strong>in</strong>stituts<br />
bestimmte Voraussetzungen erfüllt se<strong>in</strong>:<br />
1. Ganztagsschulen benötigen e<strong>in</strong> übergreifendes <strong>in</strong>haltliches Konzept.<br />
2. Ganztagsschulen müssen Bildung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em erweiterten, umfassenden S<strong>in</strong>ne <strong>in</strong>s Blickfeld rücken<br />
und gewährleisten.<br />
3. Ganztagsschulen müssen Potenziale für alle K<strong>in</strong><strong>der</strong> und Jugendlichen nutzbar machen, um<br />
herkunftsbed<strong>in</strong>gte Benachteiligungen abzubauen.<br />
4. Ganztagsschulen müssen e<strong>in</strong>e bessere Vernetzung mit Familien und außerschulischen Akteuren<br />
anstreben.<br />
5. Ganztagsschulen müssen mit entsprechenden personellen und f<strong>in</strong>anziellen Mitteln ausgestattet<br />
se<strong>in</strong>, da Ziele e<strong>in</strong>er zukunftstauglichen Ganztagsschule zum Nulltarif nicht erreicht werden<br />
können.<br />
Im H<strong>in</strong>blick auf die oben formulierten Erwartungen an die Ganztagsschule <strong>in</strong> Deutschland werden im<br />
Folgenden die Ergebnisse von diversen Forschungsprojekten des Deutschen Jugend<strong>in</strong>stituts bzw. von<br />
Studien vorgestellt, an denen das Institut maßgeblich beteiligt ist.<br />
1. Entlastung o<strong>der</strong> Belastung: welche Auswirkungen hat die Ganztagsschule auf das Familienleben?<br />
Aus sozialpolitischer Perspektive ist die For<strong>der</strong>ung nach <strong>der</strong> besseren Vere<strong>in</strong>barkeit von Familie und<br />
Beruf e<strong>in</strong> zentraler Grund für den Ausbau <strong>der</strong> Ganztagsschulen. Kritiker befürchten h<strong>in</strong>gegen, dass<br />
sich <strong>der</strong> ganztägige Schulbesuch negativ auf das Familienleben auswirken könne.<br />
Bundesweite Studie wi<strong>der</strong>legt Befürchtung negativer Auswirkungen auf Familie<br />
Aktuelle Auswertungen <strong>der</strong> Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen 2005 bis 2010 (StEG)<br />
zeigen tendenziell positive Auswirkungen auf das Familienleben. In erster L<strong>in</strong>ie ermöglicht demnach<br />
die ganztägige Betreuung <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong> den Eltern, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e mehr Müttern o<strong>der</strong> alle<strong>in</strong>erziehenden<br />
Eltern, e<strong>in</strong>er eigenen Erwerbstätigkeit nachzugehen. Laut <strong>der</strong> dritten StEG-Erhebung aus dem Jahre<br />
2009 nehmen rund 80 Prozent <strong>der</strong> Grundschulk<strong>in</strong><strong>der</strong> Ganztagsangebote wahr, wenn die Mutter Vollzeit<br />
arbeitet (67 Prozent bei Teilzeit; 50 Prozent bei stundenweiser o<strong>der</strong> ke<strong>in</strong>er Erwerbstätigkeit). In<br />
<strong>der</strong> Sekundarstufe I verliert <strong>der</strong> Betreuungsaspekt an Bedeutung, da die K<strong>in</strong><strong>der</strong> dann selbstständiger<br />
werden.<br />
Zusätzlich zur Eröffnung e<strong>in</strong>er möglichen Doppelerwerbstätigkeit empf<strong>in</strong>den die meisten Eltern die<br />
verlässliche ganztägige Betreuung ihrer K<strong>in</strong><strong>der</strong> als große Entlastung. Dies ist <strong>in</strong> <strong>der</strong> vollgebundenen,<br />
also verpflichtenden Ganztagsschule noch stärker <strong>der</strong> Fall als bei teilgebundenen o<strong>der</strong> offenen Organisationsformen.<br />
So berichtet etwa die Hälfte <strong>der</strong> Befragten von Entlastungen bei <strong>der</strong> elterlichen<br />
<strong>Haus</strong>aufgabenbetreuung. Auch <strong>in</strong> Bezug auf erzieherische Probleme fühlen sich im Durchschnitt <strong>der</strong><br />
drei StEG-Wellen mehr als 20 Prozent <strong>der</strong> Familien entlastet.<br />
Diese Entlastung bietet vermutlich e<strong>in</strong>e Erklärung für e<strong>in</strong>e tendenziell positive Wirkung von Ganztagsschulen<br />
auf das Familienklima. Von Verbesserungen im Eltern-K<strong>in</strong>d-Verhältnis berichten vornehmlich<br />
Mütter (zu 12,8 Prozent) und Väter (zu 8,8 Prozent), <strong>der</strong>en K<strong>in</strong><strong>der</strong> 4 bis 5 Tage pro Woche Ganztagsangebote<br />
nutzen. Ähnlich stellt sich die E<strong>in</strong>schätzung aus Sicht <strong>der</strong> Schüler<strong>in</strong>nen und Schüler dar.<br />
Auf die Gestaltung des Familienlebens wirkt sich laut StEG <strong>der</strong> Ganztagsschulbesuch nur bed<strong>in</strong>gt aus:<br />
Geme<strong>in</strong>same Aktivitäten wie Mahlzeiten, Gespräche, Fernsehen, Ausflüge o<strong>der</strong> Zusammensitzen s<strong>in</strong>d<br />
nach E<strong>in</strong>schätzung <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong> unverän<strong>der</strong>t. Zwar nehmen die geme<strong>in</strong>samen Aktivitäten über die Zeit<br />
h<strong>in</strong>weg <strong>in</strong>sgesamt etwas ab – dies hängt jedoch eher mit dem steigenden Alter <strong>der</strong> Jugendlichen zu-<br />
33
sammen und gilt für sämtliche Befragte gleichermaßen, unabhängig von <strong>der</strong> Nutzung von Ganztagsangeboten.<br />
Damit bestätigen sich laut StEG die Befürchtungen, e<strong>in</strong>e ganztägige Betreuung wirke sich<br />
negativ auf das Familienleben aus, nicht.<br />
Langjährige positive Erfahrungen <strong>in</strong> NRW<br />
Dass die bessere Vere<strong>in</strong>barkeit von Familie und Beruf <strong>der</strong> Bereich ist, <strong>in</strong> dem Eltern – Mütter stärker<br />
als Väter – am stärksten vom Ganztag profitieren, bestätigt e<strong>in</strong> Projekt des Forschungsverbundes<br />
DJI/TU Dortmund <strong>in</strong> Kooperation mit drei weiteren Instituten durchgeführt: dem Institut für soziale<br />
Arbeit e.V. (Münster), dem Sozialpädagogischen Institut <strong>der</strong> FH Köln und <strong>der</strong> Universität Wuppertal.<br />
Mit <strong>der</strong> E<strong>in</strong>führung <strong>der</strong> offenen Ganztagsschule im Primarbereich <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen (NRW) im<br />
Jahr 2003 hat die damalige Landesregierung die wissenschaftliche Begleitung dieses Angebots <strong>in</strong> Auftrag<br />
gegeben. Seit 2003 wurden drei Teilstudien durchgeführt: die Pilotstudie (2003-2005), die<br />
Hauptstudie (2005-2007) und zuletzt die Vertiefungsstudie (2007-2009). Nach <strong>der</strong> anfänglichen Konzentration<br />
auf den Primarbereich wird <strong>der</strong> Ausbau von Ganztagsschulen <strong>in</strong> allen Schulformen <strong>der</strong> Sekundarstufe<br />
I vorangetrieben, seit 2010 ebenfalls begleitet durch das Projekt Bildungsberichterstattung<br />
Ganztagsschule NRW.<br />
Nach Angaben des M<strong>in</strong>isteriums für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen aus<br />
dem Jahr 2010 besuchen im bevölkerungsreichsten Bundesland <strong>in</strong>zwischen bereits 27 Prozent <strong>der</strong><br />
Schüler<strong>in</strong>nen und Schüler im Primarbereich e<strong>in</strong>e offene Ganztagsschule mit Unterricht am Vormittag<br />
und <strong>Haus</strong>aufgabenbetreuung und Freizeitangeboten am Nachmittag. Im bundesweiten Vergleich<br />
nimmt Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen damit e<strong>in</strong>e Son<strong>der</strong>stellung e<strong>in</strong>, da die meisten an<strong>der</strong>en Bundeslän<strong>der</strong> den<br />
Ausbauschwerpunkt auf Haupt-, Gesamt- und/o<strong>der</strong> Realschulen legen o<strong>der</strong> alle Schulstufen gleichermaßen<br />
e<strong>in</strong>beziehen. Im Jahr 2008 nutzte <strong>in</strong>sgesamt jede vierte Schüler<strong>in</strong> und je<strong>der</strong> vierte Schüler die<br />
Angebote e<strong>in</strong>er Ganztagsschule. In Bayern waren es laut Bildungsbericht 2010 gerade fünf Prozent<br />
aller Schüler<strong>in</strong>nen und Schüler.<br />
Die NRW-Studie kommt zu ähnlichen Ergebnissen wie die die StEG-Untersuchung: Die befragten Eltern<br />
profitieren hauptsächlich <strong>in</strong> Bezug auf ihre Berufstätigkeit, wenn ihr K<strong>in</strong>d ganztägig <strong>in</strong> die Schule<br />
geht. Für 93 Prozent <strong>der</strong> Mütter und 90 Prozent <strong>der</strong> Väter bildet <strong>der</strong> Ganztag e<strong>in</strong>en wichtigen Faktor,<br />
um berufstätig zu se<strong>in</strong> o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>e Arbeit zu suchen. Zugleich schätzen viele Mütter (75 Prozent) und<br />
Väter (72 Prozent) die Ganztagsangebote, da sie dadurch länger arbeiten gehen können.<br />
Neben <strong>der</strong> arbeitsmarktpolitischen Dimension profitieren die Eltern, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e die Mütter, vor<br />
allem von <strong>der</strong> <strong>Haus</strong>aufgabenbetreuung: Angesichts des Streitpotenzials und <strong>der</strong> zeitlichen Belastung,<br />
die die Erledigung <strong>der</strong> <strong>Haus</strong>aufgaben für die Familie darstellt, empf<strong>in</strong>den 73 Prozent <strong>der</strong> Mütter durch<br />
<strong>der</strong>en Verlagerung <strong>in</strong> den Schultag e<strong>in</strong>e Entlastung. Dies trifft auch auf 63 Prozent <strong>der</strong> Väter zu. E<strong>in</strong>e<br />
Unterstützung bei erzieherischen Problemen vermerken 38 Prozent <strong>der</strong> Mütter und 31 Prozent <strong>der</strong><br />
Väter <strong>in</strong> <strong>der</strong> Befragung.<br />
Mögliche Doppelbelastung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Umbruchphase vermeiden<br />
Ergänzend zu diesen zahlreichen positiven H<strong>in</strong>weisen auf die Entlastungsfunktion <strong>der</strong> Ganztagsschulen<br />
für die Eltern hat e<strong>in</strong> DJI-Projekt <strong>in</strong> qualitativen Interviews die (zeitlichen) Auswirkungen des<br />
längeren Schultages auf die Jugendlichen selbst vertiefend untersucht.<br />
Die DJI-Studie Bildungsprozesse zwischen Familie und Ganztagsschule befragte u.a. 16 Jugendliche<br />
im Alter zwischen 12 und 16 Jahren, die e<strong>in</strong> offenes o<strong>der</strong> gebundenes Ganztagsangebot <strong>der</strong> Realschule<br />
o<strong>der</strong> des Gymnasiums besuchen. Deren Antworten machen deutlich, dass die Freizeitangebote<br />
<strong>der</strong> Ganztagsschule von den Jugendlichen <strong>der</strong> Mittelschicht offenbar (noch) nicht als gleichberechtigte<br />
Freizeitaktivitäten neben den außerschulischen Hobbys anerkannt werden. Daraus entwickelt sich<br />
e<strong>in</strong>e Verdopplung von <strong>in</strong>stitutionellen Freizeitangeboten im Wochenalltag, wenn die Schüler<strong>in</strong>nen und<br />
Schüler nach <strong>der</strong> Ganztagsschule z.B. noch diversen Vere<strong>in</strong>saktivitäten nachgehen.<br />
Die Onl<strong>in</strong>e-Tagebucherhebung im Rahmen <strong>der</strong> DJI-Studie zeigt beispielsweise für den Bereich Sport,<br />
dass die wöchentlichen Aktivitäten <strong>der</strong> untersuchten Jungen etwa zehn Stunden und die <strong>der</strong> Mädchen<br />
sechs bis sieben Stunden umfassen. Damit liegt <strong>der</strong> Umfang ihrer Freizeitsportaktivitäten im bundesweiten<br />
Durchschnitt. D.h. viele Jugendliche stehen vor <strong>der</strong> Herausfor<strong>der</strong>ung, nachmittägliche Sportangebote<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> Schule und privat organisierte Aktivitäten zu vere<strong>in</strong>baren.<br />
Die Untersuchungsergebnisse deuten an, dass weniger die verlängerten Schulzeiten als belastend<br />
erlebt werden, son<strong>der</strong>n mehr noch die Koord<strong>in</strong>ation <strong>der</strong> außerschulischen Freizeitaktivitäten, die im<br />
34
Vere<strong>in</strong>sbereich nicht selten von den Eltern angeregt und unterstützt werden. Damit Freizeit nicht<br />
zum Stress wird, entwickeln manche Ganztagsschüler<strong>in</strong>nen und -schüler Strategien, den Schul- und<br />
Freizeitkontext zu verknüpfen. Das Ganztagsangebot kann diese Verknüpfung erleichtern, wenn es<br />
Schule gel<strong>in</strong>gt, sich als attraktiver Ort im Freizeitalltag <strong>der</strong> Jugendlichen zu etablieren. Dazu könnte<br />
die Öffnung <strong>der</strong> Schule für Freunde und Freund<strong>in</strong>nen, für die Freizeitpraxis ihrer Schüler<strong>in</strong>nen und<br />
Schüler und e<strong>in</strong>e stärkere Kooperation mit außerschulischen Anbietern för<strong>der</strong>lich se<strong>in</strong>.<br />
2. Potenzial <strong>der</strong> <strong>in</strong>dividuellen För<strong>der</strong>ung noch nicht ausgeschöpft<br />
Der wichtigste Grund für Eltern, ihre K<strong>in</strong><strong>der</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Ganztagsschule anzumelden, ist nach allen vorliegenden<br />
Studien die zuverlässige Sicherung <strong>der</strong> Betreuungsfrage und die damit e<strong>in</strong>hergehende verbesserte<br />
Vere<strong>in</strong>barkeit von Familie und Beruf. Laut <strong>der</strong> Untersuchungen zur Primarstufe <strong>in</strong> NRW nennen<br />
Eltern an zweiter Stelle <strong>der</strong> Anmeldegründe die soziale E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong> sowie die s<strong>in</strong>nvolle<br />
Freizeitgestaltung. Zunehmend an Bedeutung gew<strong>in</strong>nt des weiteren die Idee e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>dividuelleren<br />
För<strong>der</strong>ung, die sich e<strong>in</strong>ige Eltern vom Ganztag versprechen, sei es durch Projekte, die Kreativität,<br />
musische Fähigkeiten o<strong>der</strong> handwerkliche Fertigkeiten ausbilden o<strong>der</strong> Arbeitsgruppen, bei denen<br />
soziale o<strong>der</strong> kognitive Kompetenzen im Vor<strong>der</strong>grund stehen.<br />
För<strong>der</strong>erwartungen <strong>der</strong> Eltern sehr unterschiedlich<br />
Die Erwartungen, die Eltern an den Ganztagsschulbetrieb richten, differieren dabei stark. Aufgrund<br />
<strong>der</strong> Elternbefragung 2008 unterscheidet die NRW-Studie vier Kategorien des För<strong>der</strong>verständnisses:<br />
• Abbau schulischer Defizite;<br />
• Unterstützung <strong>der</strong> Stärken und Begabungen des K<strong>in</strong>des;<br />
• allseitige För<strong>der</strong>ung;<br />
• Verbesserung <strong>der</strong> Grundlagen und Voraussetzungen für Schulbesuch, Lernfähigkeit und<br />
Umgang mit an<strong>der</strong>en K<strong>in</strong><strong>der</strong>n.<br />
Insbeson<strong>der</strong>e Eltern mit Migrationsh<strong>in</strong>tergrund sowie Eltern mit niedrigem sozialem Status erwarten<br />
vom Ganztag e<strong>in</strong>e För<strong>der</strong>ung <strong>in</strong> Bezug auf schulisches Lernen. An<strong>der</strong>e, zumeist sozial gut situierte<br />
Eltern wünschen, dass ihre K<strong>in</strong><strong>der</strong> im Ganztag außerhalb des Unterrichts ke<strong>in</strong>e schulbezogene För<strong>der</strong>ung<br />
mehr erfahren, son<strong>der</strong>n Zeit zum Spielen haben. E<strong>in</strong>ige Eltern mit höherem Sozialstatus erhoffen<br />
sich vom Ganztag e<strong>in</strong>e För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Stärken, Interessen und Begabungen ihrer K<strong>in</strong><strong>der</strong>. In e<strong>in</strong>em<br />
die ersten beiden Positionen übergreifenden Verständnis wird unter För<strong>der</strong>n das Erkennen und die<br />
längerfristige Unterstützung aller Potenziale sowie Schwierigkeiten jedes e<strong>in</strong>zelnen K<strong>in</strong>des verstanden<br />
und vom Ganztag auch erwartet. Auch hier f<strong>in</strong>den sich vor allem Eltern mit höherem Sozialstatus.<br />
Gewünscht wird e<strong>in</strong>e allseitige, ganzheitliche För<strong>der</strong>ung, die die Entwicklung personaler, sozialer,<br />
kultureller und praktischer Kompetenzen <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong> umfasst. E<strong>in</strong>e För<strong>der</strong>ung alltäglicher Kompetenzen<br />
und Umgangsformen sowie <strong>der</strong> Grundlagen und Voraussetzungen des Lernens und <strong>der</strong> Teilnahme<br />
an Schule und Ganztag erwarten <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e Eltern mit niedrigem Sozialstatus.<br />
Wie gut diese vielfältigen Erwartungen <strong>der</strong> Eltern an den Ganztagsschulbetrieb umgesetzt werden,<br />
hat die bundesweite Ganztagsschulstudie StEG untersucht: beispielsweise anhand <strong>der</strong> Entwicklung<br />
von Sozialverhalten und Schulleistungen <strong>der</strong> Jugendlichen <strong>in</strong> den ganztägigen Schulen <strong>der</strong> Sekundarstufe<br />
I. Ihr Fazit: Der an Ganztagsschulen vorf<strong>in</strong>dbare Alltag bietet die Chance zu positiven Verän<strong>der</strong>ungen<br />
bei den Schüler<strong>in</strong>nen und Schülern, während negative Auswirkungen nicht gefunden wurden.<br />
Der Besuch des Ganztags wirkt sich <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e dann positiv aus, wenn er dauerhaft und regelmäßig<br />
erfolgt und zudem die Qualität <strong>der</strong> Angebote hoch ist.<br />
Positive Auswirkungen auf Sozialverhalten<br />
In Bezug auf aggressives Verhalten <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schule sowie auf störendes Verhalten im Unterricht zeigen<br />
die Schüler<strong>in</strong>nen und Schüler, die zu m<strong>in</strong>destens zwei Messzeitpunkten am Ganztag teilgenommen<br />
haben, e<strong>in</strong>e positivere Entwicklung als die Jugendlichen, die den Ganztag gar nicht o<strong>der</strong> nur sporadisch<br />
genutzt haben. Darüber h<strong>in</strong>aus för<strong>der</strong>t e<strong>in</strong>e höhere Qualität <strong>der</strong> Angebote die aktive, soziale<br />
Verantwortungsübernahme, für die sich durch die re<strong>in</strong>e Teilnahme am Ganztag ke<strong>in</strong> Effekt zeigen<br />
lässt. Positive Effekte <strong>der</strong> Angebotsqualität zeigen sich beson<strong>der</strong>s bei den jüngeren Schüler<strong>in</strong>nen und<br />
Schülern im Zeitraum von <strong>der</strong> 5. bis zur 7. Klassenstufe. Beson<strong>der</strong>s wirksam s<strong>in</strong>d offensichtlich gute<br />
Partizipationsmöglichkeiten: Je stärker die Jugendlichen bei Planung und Inhalten <strong>der</strong> Angebote mitbestimmen<br />
können, desto häufiger unterstützen sie beispielsweise nach eigenen Angaben auch ihre<br />
35
Mitschüler<strong>in</strong>nen und Mitschüler o<strong>der</strong> engagieren sich, um Konflikte gewaltfrei zu lösen. Beson<strong>der</strong>s<br />
positive Wirkungen <strong>der</strong> Angebotsqualität auf die soziale Verantwortungsübernahme f<strong>in</strong>det StEG für<br />
Schüler<strong>in</strong>nen und Schüler mit Migrationsh<strong>in</strong>tergrund.<br />
Verbesserte Schulleistungen nicht automatisch gegeben<br />
Über das Sozialverhalten h<strong>in</strong>aus liefert StEG Befunde dazu, <strong>in</strong>wiefern die Ganztagsschule die Schulleistungen<br />
<strong>der</strong> Schüler<strong>in</strong>nen und Schüler för<strong>der</strong>n kann. An<strong>der</strong>s als <strong>in</strong> expliziten Schulleistungsstudien<br />
wie PISA wurden <strong>in</strong> diesem Punkt allerd<strong>in</strong>gs ke<strong>in</strong>e Testleistungen erhoben. Stattdessen gaben die<br />
Schüler<strong>in</strong>nen und Schüler ihre Zeugnisnoten <strong>in</strong> Deutsch, Mathematik und <strong>der</strong> ersten Fremdsprache an.<br />
Hatten sich <strong>in</strong> den Daten aus den ersten beiden Erhebungswellen noch leicht positive Effekte <strong>der</strong><br />
Ganztagsteilnahme auf die Entwicklung <strong>der</strong> Noten <strong>in</strong> Deutsch und Mathematik gezeigt, so wirkt sich<br />
die bloße Teilnahme langfristig nicht mehr aus. Der ursprünglich festgestellte Vorteil <strong>der</strong> Ganztagsschüler<strong>in</strong>nen<br />
und -schüler gegenüber den nicht teilnehmenden Jugendlichen ist also nicht nachhaltig<br />
und könnte beispielsweise auch durch die Übergangssituation nach <strong>der</strong> Grundschule mit bed<strong>in</strong>gt se<strong>in</strong>.<br />
Auch für Jugendliche aus niedrigeren sozialen Schichten o<strong>der</strong> mit Migrationsh<strong>in</strong>tergrund lässt sich<br />
über vier Jahre h<strong>in</strong>weg ke<strong>in</strong> Effekt <strong>der</strong> re<strong>in</strong>en Ganztagsschulteilnahme auf ihre Schulleistungen nachweisen<br />
– es liegt <strong>in</strong> dieser H<strong>in</strong>sicht also ke<strong>in</strong> kompensatorischer Effekt für bildungsbenachteiligte<br />
Schülergruppen vor.<br />
Bei Beachtung weiterer Faktoren ergeben sich jedoch durchaus H<strong>in</strong>weise auf e<strong>in</strong>e positive Wirkung<br />
des Ganztags. So werden die Noten über den gesamten Befragungszeitraum zwar im Durchschnitt bei<br />
allen Jugendlichen schlechter – Unterschiede <strong>in</strong> <strong>der</strong> Entwicklung zeigen sich aber bei detaillierter<br />
Betrachtung <strong>der</strong> Schüler<strong>in</strong>nen und Schüler, die zu m<strong>in</strong>destens zwei Messzeitpunkten am Ganztag teilgenommen<br />
haben. Bei ihnen spielt die Intensität <strong>der</strong> Teilnahme e<strong>in</strong>e Rolle: Die Noten <strong>in</strong> Deutsch, <strong>der</strong><br />
ersten Fremdsprache und tendenziell auch <strong>in</strong> Mathematik entwickeln sich bei jenen Jugendlichen<br />
weniger negativ, die m<strong>in</strong>destens dreimal pro Woche Ganztagsangebote nutzen.<br />
Auch die Qualität <strong>der</strong> Angebote hat e<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>fluss: Wenn die Schüler<strong>in</strong>nen und Schüler die Angebote<br />
als gut strukturiert wahrnehmen, sich kognitiv herausgefor<strong>der</strong>t fühlen und sich aktiv beteiligen können,<br />
dann entwickeln sich ihre Noten besser als die <strong>der</strong> Jugendlichen, die die Angebotsqualität weniger<br />
gut beurteilen. Dieser positive Befund zeigt sich sowohl für Deutsch und Mathematik als auch im<br />
Durchschnitt über die Noten <strong>in</strong> den drei Kernfächern. E<strong>in</strong> för<strong>der</strong>licher E<strong>in</strong>fluss auf die Mathematiknote<br />
lässt sich darüber h<strong>in</strong>aus für e<strong>in</strong> weiteres Qualitätsmerkmal nachweisen, die positive Schüler-<br />
Betreuer-Beziehung.<br />
Ebenso ist <strong>der</strong> E<strong>in</strong>satz <strong>in</strong>dividualisieren<strong>der</strong> Lehrformen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schule mit <strong>der</strong> Entwicklung <strong>der</strong> Schulleistungen<br />
verknüpft. Unabhängig von <strong>der</strong> Organisationsform <strong>der</strong> Schule zeigt StEG: In Schulen, <strong>in</strong><br />
denen die Lehrkräfte angeben, dass sie im Unterricht verstärkt differenzieren, entwickeln sich die<br />
Mathematiknoten vergleichsweise positiv. Von diesem Effekt profitieren grundsätzlich alle Schüler<strong>in</strong>nen<br />
und Schüler an <strong>der</strong> Schule – <strong>in</strong> beson<strong>der</strong>em Maß aber jene, die an Ganztagsangeboten teilnehmen.<br />
Im Ergebnis reduziert <strong>der</strong> Besuch e<strong>in</strong>er vollgebundenen Ganztagsschule das Risiko, <strong>in</strong> <strong>der</strong> Sekundarstufe<br />
I e<strong>in</strong>e Klasse wie<strong>der</strong>holen zu müssen. Derselbe Effekt kann sich auch für Schüler<strong>in</strong>nen und Schüler<br />
an offenen und teilgebundenen Ganztagsschulen ergeben – Voraussetzung ist <strong>in</strong> beiden Fällen ihre<br />
regelmäßige Teilnahme an den Angeboten.<br />
Handicap <strong>der</strong> Herkunft ausgleichen<br />
Wie StEG herausgefunden hat, ist die Wirkung <strong>der</strong> Angebote vor allem im H<strong>in</strong>blick auf die sozial ausgleichende<br />
Funktion von Ganztagsschule <strong>in</strong>teressant, da sich e<strong>in</strong> beson<strong>der</strong>er Effekt für Schüler<strong>in</strong>nen<br />
und Schüler mit Migrationsh<strong>in</strong>tergrund zeigt: Sie s<strong>in</strong>d die e<strong>in</strong>zige Gruppe, bei <strong>der</strong> sich e<strong>in</strong>e hohe Qualität<br />
des Angebots – also e<strong>in</strong>e strukturierte Lernumgebung mit effektiver Zeitnutzung – positiv auf die<br />
Entwicklung <strong>der</strong> Noten <strong>in</strong> den drei Kernfächern auswirkt. Diese Wirkung lässt sich von <strong>der</strong> 5. bis zur 9.<br />
Klasse nachweisen. Beson<strong>der</strong>s stark ist sie von <strong>der</strong> 5. bis zur 7. Klassenstufe.<br />
E<strong>in</strong>e qualitative Studie des DJI mit dem Titel Die soziale Konstruktion <strong>der</strong> <strong>Haus</strong>aufgabensituation<br />
ist <strong>der</strong> Frage nachgegangen, <strong>in</strong>wieweit die pädagogische Gestaltung <strong>der</strong> <strong>Haus</strong>aufgabenbetreuung im<br />
Ganztag e<strong>in</strong>en Beitrag zu e<strong>in</strong>em Abbau herkunftsbed<strong>in</strong>gter Bildungsbenachteiligung leisten kann.<br />
Quantitativ steht dieses Angebot an <strong>der</strong> Spitze <strong>der</strong> im Ganztag realisierten Möglichkeiten. E<strong>in</strong>erseits<br />
trägt sie nach Angaben <strong>der</strong> Eltern allgeme<strong>in</strong> zur Entlastung und Besserung des Familienklimas bei.<br />
36
An<strong>der</strong>erseits bietet sie K<strong>in</strong><strong>der</strong>n die Gelegenheit, sich unabhängig vom Elternhaus <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er unterstützenden<br />
Umgebung mit den schulischen Aufgaben ause<strong>in</strong>an<strong>der</strong> zu setzen.<br />
Im Rahmen <strong>der</strong> qualitativen Studie wurden drei unterschiedliche Gestaltungsformen <strong>der</strong> <strong>Haus</strong>aufgabenstellung<br />
<strong>in</strong> Ganztagsschulen ausgewählt. Die Untersuchungen fanden <strong>in</strong> <strong>der</strong> vierten und nochmalig<br />
nach dem Schulwechsel <strong>in</strong> <strong>der</strong> fünften Klasse statt. Die Ergebnisse weisen darauf h<strong>in</strong>, dass Ganztagsschulen<br />
bildungsbenachteiligte Schüler<strong>in</strong>nen und Schüler bei den <strong>Haus</strong>aufgaben durchaus unterstützen<br />
können, wenn die Kont<strong>in</strong>uität <strong>der</strong> pädagogischen Gestaltungsformen <strong>der</strong> <strong>Haus</strong>aufgabenbetreuung<br />
gewährleistet ist; hier kommt es durch den Übergang von <strong>der</strong> Grund- <strong>in</strong> die weiterführende Schule<br />
aber häufig zu e<strong>in</strong>em Bruch, etwa <strong>in</strong> <strong>der</strong> Form, dass e<strong>in</strong>e Integration von selbstständigen Übungsphasen<br />
<strong>in</strong> den Unterrichtsablauf („Stillarbeit“) durch e<strong>in</strong>e konventionelle Vergabepraxis zu <strong>Haus</strong>e zu erledigen<strong>der</strong><br />
Aufgaben <strong>in</strong> <strong>der</strong> weiterführenden Schule abgelöst wird.<br />
3. Angebotsvielfalt durch Kooperationspartner<br />
Ganztagsschule bedeutet <strong>in</strong> <strong>der</strong> Regel nicht, dass den ganzen Tag unterrichtet wird. Vielmehr wird<br />
<strong>der</strong> herkömmliche schulische Alltag erweitert um Angebote wie <strong>Haus</strong>aufgabenbetreuung und För<strong>der</strong>ung,<br />
fächerübergreifendes Lernen und Projektarbeit sowie Freizeitangebote. E<strong>in</strong> solch umfassendes<br />
Programm kann und muss nicht nur alle<strong>in</strong> von Lehrkräften organisiert werden. Denn <strong>der</strong> dritte große<br />
Vorteil <strong>der</strong> ganztägigen Angebote besteht <strong>in</strong> <strong>der</strong> Möglichkeit <strong>der</strong> Schaffung e<strong>in</strong>er „Allianz des Aufwachsens“,<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> laut DJI-Direktor Prof. Dr. Thomas Rauschenbach bislang getrennte Zuständigkeiten<br />
und Verantwortlichkeiten zusammengeführt werden können. Neben den Lehrer<strong>in</strong>nen und Lehrern<br />
arbeiten dann Eltern und zahlreiche im Geme<strong>in</strong>wesen tätige Institutionen als mögliche Akteure im<br />
Bildungsprozess von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n und Jugendlichen stärker als bisher zusammen.<br />
Schule wird zum umfassenden Lern- und Bildungsraum<br />
Kooperationspartner können beispielsweise Sportvere<strong>in</strong>e, Musikschulen, E<strong>in</strong>richtungen <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>-<br />
und Jugendhilfe, Betriebe, Kirchen, aber auch kompetente E<strong>in</strong>zelpersonen wie Kunstschaffende, ältere<br />
Schüler<strong>in</strong>nen und Schüler, Senior<strong>in</strong>nen und Senioren o<strong>der</strong> auch Eltern se<strong>in</strong>. Die Beteiligung von<br />
(Fach)Kräften an<strong>der</strong>er Wissens- und Erfahrungsbereiche bietet den Schulen die Möglichkeit, Angebote<br />
zu unterbreiten, die im traditionellen Halbtagsmodell kaum aus eigener Kraft bereitgestellt werden<br />
können. E<strong>in</strong>e beson<strong>der</strong>e Rolle bei <strong>der</strong> Bereitstellung zusätzlicher Angebote kommt dabei den E<strong>in</strong>richtungen<br />
<strong>der</strong> Jugendhilfe zu, die die Schule <strong>in</strong> unterschiedlichen Handlungsfel<strong>der</strong>n unterstützen können.<br />
Gerade die Ganztagsschule bietet e<strong>in</strong>en geeigneten Rahmen, die Kompetenzen außerschulischer<br />
Partner für die Weiterentwicklung pädagogischer Konzepte im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>er breiteren För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong><br />
Schüler<strong>in</strong>nen und Schüler zu nutzen. Für die Realisierung konkreter Kooperationsprojekte haben sich<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> Praxis vertragliche Regelungen mit klaren Vere<strong>in</strong>barungen über die Ziele, personellen Zuständigkeiten,<br />
Verfahrensregeln, Überprüfungskriterien etc. als nützlich erwiesen. Rahmenvere<strong>in</strong>barungen,<br />
die e<strong>in</strong>zelne Bundeslän<strong>der</strong> mit e<strong>in</strong>schlägigen Institutionen o<strong>der</strong> Trägern für unterschiedliche<br />
Schwerpunkte abgeschlossen haben, bieten e<strong>in</strong>e hilfreiche Orientierung zur Fundierung schulischer<br />
Kooperationspraxis.<br />
Entwicklung <strong>der</strong> Angebotsvielfalt<br />
Bereits im Jahr 2007 zeigten die StEG-Daten, dass externe Partner generell für die Entwicklung von<br />
Ganztagsschulen e<strong>in</strong>e große Rolle spielen. Über den gesamten Erhebungszeitraum nahm ihre Bedeutung<br />
kont<strong>in</strong>uierlich zu: Der Anteil <strong>der</strong> Schulen, die mit außerschulischen Partnern zusammenarbeiten,<br />
stieg deutlich von 72 Prozent auf 83 Prozent. Nach wie vor s<strong>in</strong>d es vor allem die K<strong>in</strong><strong>der</strong>- und Jugendhilfe<br />
und Sportvere<strong>in</strong>e, die vorrangig Ganztagsangebote durchführen.<br />
Auch unabhängig von außerschulischen Kooperationspartnern haben sowohl die Grund- als auch die<br />
Sekundarstufenschulen ihren Ganztag <strong>in</strong> den ersten zwei Jahren <strong>der</strong> StEG-Studie unter dem Gesichtspunkt<br />
<strong>der</strong> Angebotsbreite ausgebaut. Die Grundschulen halten dieses Niveau bis <strong>in</strong>s Jahr 2009; für die<br />
Schulen <strong>der</strong> Sekundarstufe I fallen die Werte allerd<strong>in</strong>gs bis zur dritten Erhebung auf das Ausgangsniveau<br />
von 2005 zurück.<br />
Relativ viele Grundschulen haben im Rahmen des Ganztags beispielsweise Angebote neu e<strong>in</strong>geführt,<br />
<strong>in</strong> denen mathematische Themen behandelt und vertieft werden: Im Jahr 2005 boten 35 Prozent <strong>der</strong><br />
Schulen entsprechende fachnahe Veranstaltungen an, <strong>in</strong> <strong>der</strong> dritten Erhebungswelle 2009 waren es 61<br />
Prozent. Die Zahl <strong>der</strong> Grundschulen mit naturwissenschaftlichen Angeboten stieg zwischen 2005 und<br />
2009 um 15 Prozentpunkte, bei den handwerklich-hauswirtschaftlichen Angeboten beträgt <strong>der</strong> Zu-<br />
37
wachs 19, bei Angeboten im Bereich des sozialen Lernens 18 und bei beaufsichtigten, frei zu gestaltenden<br />
Zeiten waren es 19 Prozentpunkte.<br />
An Schulen <strong>der</strong> Sekundarstufe I ergibt sich <strong>der</strong> größte Zuwachs im Untersuchungszeitraum mit 15 Prozentpunkten<br />
ebenfalls bei den mathematischen Nachmittagsangeboten. Darüber h<strong>in</strong>aus nehmen <strong>11</strong><br />
Prozent <strong>der</strong> Schulen beaufsichtigte, frei zu gestaltende Zeiten neu <strong>in</strong> ihr Angebot auf. Dem steht e<strong>in</strong><br />
Rückgang bei an<strong>der</strong>en Ganztagselementen zwischen 2007 und 2009 gegenüber. Hier schlägt sich eventuell<br />
die Tatsache nie<strong>der</strong>, dass Schüler<strong>in</strong>nen und Schüler <strong>der</strong> Sekundarstufe I eher fächerübergreifende<br />
als Fach- und För<strong>der</strong>angebote <strong>in</strong> Anspruch nehmen. So werden beispielsweise bei 10 Prozent<br />
<strong>der</strong> Schulen „spezifische För<strong>der</strong>maßnahmen“ nicht mehr genannt. Außerdem geben <strong>in</strong> <strong>der</strong> dritten<br />
Erhebung weniger Schulen als 2007 an, naturwissenschaftliche Angebote bereitzustellen – hier fällt<br />
<strong>der</strong> Wert um 12 Prozentpunkte, bei den fremdsprachlichen Angeboten um 16. Auch fachbezogene<br />
Angebote <strong>in</strong> Deutsch, Angebote zu Formen des sozialen Lernens sowie <strong>in</strong>terkulturelle Angebote werden<br />
2009 von weniger Schulen als Teil ihres Programms im Ganztagsbetrieb genannt als 2007.<br />
Lehrkräfte, Fachkräfte und Ehrenamtliche im Verbund<br />
E<strong>in</strong> vielfältiges Angebot alle<strong>in</strong> reicht jedoch nicht aus: Die Qualität <strong>der</strong> pädagogischen Prozesse <strong>in</strong><br />
den e<strong>in</strong>zelnen Angeboten ist ebenso entscheidend für die Wirksamkeit des Ganztags wie die <strong>in</strong>haltliche<br />
und organisatorische Kooperation <strong>der</strong> Lehrkräfte und des weiteren pädagogisch tätigen Personals.<br />
Denn im Ganztagsbetrieb s<strong>in</strong>d zahlreiche Mitarbeiter<strong>in</strong>nen und Mitarbeiter tätig, die nicht als Lehrkräfte<br />
angestellt s<strong>in</strong>d. Diese Gruppe ist sehr heterogen, sowohl im H<strong>in</strong>blick auf ihre Qualifikationen<br />
als auch h<strong>in</strong>sichtlich des Umfangs und <strong>der</strong> Art <strong>der</strong> Beschäftigung. Grundsätzlich zeigt StEG: Während<br />
im Primarbereich vorwiegend Erzieher/<strong>in</strong>nen das Personal stellen, wächst im Sekundarbereich I die<br />
berufsstrukturelle Vielfalt <strong>in</strong>nerhalb dieser Gruppe mit <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> Mitwirkenden am Ganztag.<br />
Laut StEG-Daten besteht mehr als die Hälfte des weiteren pädagogisch tätigen Personals aus Fachkräften<br />
mit e<strong>in</strong>em pädagogischen Berufsabschluss: Der Anteil des pädagogisch qualifizierten Personals<br />
betrug <strong>in</strong> <strong>der</strong> ersten Welle 54 Prozent und erhöhte sich bis zur letzten Erhebung deutlich auf 61 Prozent.<br />
E<strong>in</strong>e ähnliche Entwicklung ergibt sich zwischen 2005 und 2009 beim Beschäftigungsstatus des weiteren<br />
pädagogisch tätigen Personals: So erhöhte sich <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> hauptberuflich beschäftigen Mitarbeiter<strong>in</strong>nen<br />
und Mitarbeiter von 55 auf gut 61 Prozent, während <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> überwiegend nebenberuflich<br />
o<strong>der</strong> ehrenamtlich an den Schulen engagierten Gruppe entsprechend von 45 auf knapp 39<br />
Prozent sank.<br />
Im Primarbereich s<strong>in</strong>d neben den Lehrkräften im Schnitt 73 Prozent professionelle Fachkräfte im E<strong>in</strong>satz,<br />
<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e Erzieher<strong>in</strong>nen und Erzieher (3. Welle 2009). Der Anteil nebenberuflich (17 Prozent)<br />
sowie ehrenamtlich tätiger Kräfte (9 Prozent) ist dagegen vergleichsweise ger<strong>in</strong>g.<br />
An den Schulen <strong>der</strong> Sekundarstufe ist die Anzahl <strong>der</strong> Mitarbeiter<strong>in</strong>nen und Mitarbeiter, die am Ganztag<br />
mitwirken, nicht nur <strong>in</strong>sgesamt wesentlich ger<strong>in</strong>ger – dort s<strong>in</strong>d auch weitaus mehr nebenberuflich<br />
und ehrenamtlich engagierte Personen am Ganztag beteiligt. 2009 waren es 43 Prozent. Dem gegenüber<br />
stehen mit knapp 43 Prozent etwa gleich viele nebenberufliche Kräfte sowie 14 Prozent ehrenamtlich<br />
Engagierte. Auch <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> Personen, die e<strong>in</strong>e pädagogische Berufsqualifikation erworben<br />
haben, liegt <strong>in</strong> <strong>der</strong> Sekundarstufe mit rund 50 Prozent wesentlich niedriger als <strong>in</strong> <strong>der</strong> Primarstufe<br />
(rund 74 Prozent).<br />
Diese Zusammensetzung ist unter an<strong>der</strong>em dadurch bed<strong>in</strong>gt, dass viele Län<strong>der</strong> <strong>in</strong> ihren Vorgaben für<br />
den Ganztag e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>haltliche Ergänzung <strong>der</strong> Angebote durch außerschulische Fachkräfte, Eltern o<strong>der</strong><br />
ehrenamtliche Mitarbeiter<strong>in</strong>nen und Mitarbeiter explizit vorsehen.<br />
Der Kooperation zwischen Lehr- und Fachkräften wird <strong>in</strong>sgesamt zwar e<strong>in</strong> hoher Stellenwert zugesprochen.<br />
Zu bemängeln ist jedoch, dass nach den Angaben des pädagogisch tätigen Personals die<br />
Intensität <strong>der</strong> Zusammenarbeit aller am Ganztag beteiligten Personalgruppen <strong>in</strong>sgesamt relativ ger<strong>in</strong>g<br />
ist. Der StEG-Vergleich von Ist- und Soll-Werten zeigt, dass ke<strong>in</strong>e <strong>der</strong> untersuchten Kooperationsaktivitäten<br />
das gewünschte Ausmaß auch nur annäherungsweise erreicht. Obwohl sich die Werte gegenüber<br />
2005 bei e<strong>in</strong>igen <strong>der</strong> Aktivitäten erhöht haben (z. B. bei den schriftlichen Rückmeldungen über<br />
e<strong>in</strong>zelne K<strong>in</strong><strong>der</strong>, bei <strong>der</strong> geme<strong>in</strong>samen Durchführung von Elterngesprächen und beim Austausch <strong>in</strong><br />
Lehrerkonferenzen) muss das Ausmaß <strong>der</strong> Kooperation alles <strong>in</strong> allem als eher niedrig veranschlagt<br />
werden.<br />
38
Schule als Teil e<strong>in</strong>es Bildungsnetzwerks<br />
Die Ausgestaltung des Ganztagsschulbetriebs ist von vielen verschiedenen lokalen, personalen und<br />
f<strong>in</strong>anziellen Gegebenheiten vor Ort abhängig. Die Etablierung sogenannter lokaler Bildungslandschaften<br />
soll gewährleisten, dass die Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebote auf die konkreten<br />
Lebenslagen <strong>der</strong> Bevölkerung vor Ort zugeschnitten s<strong>in</strong>d. Für viele Kommunen <strong>in</strong> Deutschland haben<br />
sich die Ganztagsschulen als <strong>der</strong> zentrale Ansatzpunkt herauskristallisiert, um lokale Bildungslandschaften<br />
zu schaffen. Die Ganztagsschule wird damit zum Anliegen <strong>der</strong> sogenannten staatlichkommunalen<br />
Verantwortungsgeme<strong>in</strong>schaft, ohne dass dadurch die Zuständigkeit <strong>der</strong> sich <strong>in</strong> diesen<br />
breiten Unterstützungs- und Gestaltungskontext e<strong>in</strong>br<strong>in</strong>genden Schulleitung tangiert würde. So kann<br />
<strong>der</strong> gesamte lokale Raum im Idealfall zu e<strong>in</strong>er anregenden Lern- und Lebensumgebung umgestaltet<br />
werden, vor allem auch um die Bildungschancen sozial benachteiligter K<strong>in</strong><strong>der</strong> zu verbessern.<br />
Das DJI hat dazu im Verbund zwei Forschungsprojekte durchgeführt: Lokale Bildungslandschaften <strong>in</strong><br />
Kooperation von Ganztagsschule und Jugendhilfe und Lokale Bildungslandschaften <strong>in</strong> Kooperation<br />
von Jugendhilfe und Schule. Dabei wurden Fallstudien <strong>in</strong> bundesweit sechs Modellregionen<br />
durchgeführt. Die Umwandlung des Halbtagsschulsystems h<strong>in</strong> zu e<strong>in</strong>em Ganztagsschulsystem ersche<strong>in</strong>t<br />
allen Beteiligten <strong>in</strong> den untersuchten Modellregionen als alternativlos. Sehr rege wird dort<br />
allerd<strong>in</strong>gs über konkrete Gestaltungsfragen diskutiert.<br />
Die Ergebnisse <strong>der</strong> beiden Untersuchungen zeigen, dass es <strong>in</strong> den Modellregionen durchaus zu e<strong>in</strong>em<br />
tragfähigen fachpolitischen Konsens im H<strong>in</strong>blick auf die Zielstellung e<strong>in</strong>er nicht mehr nur anlassbezogenen<br />
und punktuell bleibenden, son<strong>der</strong>n systematischen und nachhaltigen Vernetzung von Schule<br />
und Partnern kommt. Allerd<strong>in</strong>gs hängt die Verständigung stark von den zwischenmenschlichen Beziehungen<br />
ab. Die <strong>in</strong> den untersuchten Bildungslandschaften durchaus vorangeschrittenen Prozesse <strong>der</strong><br />
Öffnung von Schulen und <strong>der</strong> schulbezogenen Orientierung von Jugendhilfe tragen <strong>der</strong>zeit jedoch<br />
noch nicht erkennbar zu e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>stitutions- und e<strong>in</strong>richtungsübergreifenden Zusammenarbeit von<br />
Lehr- und Fachkräften <strong>in</strong> multiprofessionellen Teams bei.<br />
Lokale Bildungslandschaften s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em theoretisch wie empirisch anspruchsvollen S<strong>in</strong>ne noch ke<strong>in</strong>e<br />
„Beteiligungslandschaften“, <strong>in</strong> denen K<strong>in</strong><strong>der</strong>n, Jugendlichen und Eltern e<strong>in</strong>e verstärkte Mitsprache<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> Schule und auch bei kommunalen Planungsprozessen ermöglicht wird. Auch die durch die angestrebte<br />
Verknüpfung vielfältiger Lernorte und Bildungssett<strong>in</strong>gs vermuteten Potenziale zur Umsetzung<br />
e<strong>in</strong>es breiten Bildungsverständnisses bei Anregung <strong>in</strong>formeller Lernprozesse, die sich <strong>in</strong> <strong>der</strong> Formel<br />
des Übergangs von Ganztagsschule zur lokal vernetzten Ganztagsbildung zusammenfassen lässt,<br />
kommt vor Ort erst langsam <strong>in</strong> Gang.<br />
Die vorliegenden Ergebnisse machen zudem deutlich, dass es für die lokale Gestaltung des von den<br />
Jugend- und Kultusm<strong>in</strong>isterkonferenzen <strong>der</strong> Län<strong>der</strong> schon im Jahr 2004 e<strong>in</strong>hellig gefor<strong>der</strong>ten „Gesamtzusammenhang<br />
von Bildung, Erziehung und Betreuung“ mit dem wichtigen Element Ganztagsschule<br />
ke<strong>in</strong>e strukturellen Patentlösungen gibt, son<strong>der</strong>n jede Region auf <strong>der</strong> Basis <strong>der</strong> oben erwähnten<br />
breiten fachpolitischen Konsensbildung und e<strong>in</strong>er häufig scharfen Kritik im H<strong>in</strong>blick auf Ressourcenausstattung<br />
und den landes- wie bundespolitisch gesetzten Rahmenbed<strong>in</strong>gungen ihre eigenen Wege<br />
und Lösungen f<strong>in</strong>den muss.<br />
Quelle: Deutsches Jugend<strong>in</strong>stitut<br />
_______________________________________________________________________________________<br />
29.) För<strong>der</strong>schulen: Sprungbrett o<strong>der</strong> Sackgasse?<br />
www.dji.de<br />
_______________________________________________________________________________________<br />
Die deutschen Son<strong>der</strong>- und För<strong>der</strong>schulen sowie alle an<strong>der</strong>en E<strong>in</strong>rich-<br />
E<strong>in</strong>richtungen für K<strong>in</strong><strong>der</strong> und Jugendliche mit Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ungen stehen<br />
vor e<strong>in</strong>em großen Umbruch. Da 2009 auch <strong>in</strong> Deutschland die<br />
Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>tenrechtskonvention <strong>der</strong> Vere<strong>in</strong>ten Nationen <strong>in</strong> Kraft<br />
getreten ist, haben nun alle K<strong>in</strong><strong>der</strong> und Jugendlichen mit e<strong>in</strong>em<br />
Handicap o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>er Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung das Recht, geme<strong>in</strong>sam mit<br />
Gleichaltrigen unterrichtet zu werden (Inklusion). Gegenwärtig<br />
39
esuchen aber noch über 80 Prozent dieser K<strong>in</strong><strong>der</strong> und Jugendlichen <strong>in</strong> Deutschland beson<strong>der</strong>e Schulen.<br />
Zum Vergleich: In <strong>der</strong> EU besuchen 70 Prozent <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong> mit Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung e<strong>in</strong>e ganz normale<br />
Schule.<br />
Das Für und Wi<strong>der</strong> dieser "Ausson<strong>der</strong>ung" ist unter Expert<strong>in</strong>nen und Experten seit vielen Jahren ebenso<br />
umstritten wie <strong>in</strong> <strong>der</strong> Öffentlichkeit.<br />
Der UN-Beschluss zur Inklusion betrifft auch K<strong>in</strong><strong>der</strong>, die wegen e<strong>in</strong>er Lernschwäche o<strong>der</strong> sozialer Auffälligkeiten<br />
zur Gruppe mit beson<strong>der</strong>em För<strong>der</strong>bedarf gehören und entsprechende Schulen besuchen.<br />
77 Prozent aller För<strong>der</strong>schüler und -schüler<strong>in</strong>nen verlassen diese <strong>der</strong>zeit ohne e<strong>in</strong>en Hauptschul-<br />
Abschluss. E<strong>in</strong>e große Gruppe, die noch viel zu wenig im Blickfeld von Bildungspolitik und Bildungsforschung<br />
steht.<br />
Das Deutsche Jugend<strong>in</strong>stitut, das seit e<strong>in</strong>igen Jahren <strong>in</strong> bundesweiten DJI-Übergangspanel o<strong>der</strong> auch<br />
regionalen Studien Regionales Übergangsmanagement untersucht, wie die Übergänge sozial benachteiligter<br />
Jugendlicher von <strong>der</strong> Schule <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Ausbildung o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>en Beruf verlaufen, hat dabei<br />
auch Informationen zur Gruppe <strong>der</strong> För<strong>der</strong>schüler und För<strong>der</strong>schüler<strong>in</strong>nen erhoben.<br />
Studie: Stuttgarter Haupt- und För<strong>der</strong>schüler/<strong>in</strong>nen auf dem Weg von <strong>der</strong> Schule <strong>in</strong> die Berufsausbildung<br />
Über e<strong>in</strong>en Zeitraum von drei Jahren hat das Deutsche Jugend<strong>in</strong>stitut im Auftrag <strong>der</strong> Landeshauptstadt<br />
Stuttgart die Bildungs- und Ausbildungswege von Absolvent/<strong>in</strong>n/en <strong>der</strong> Stuttgarter Haupt- und<br />
För<strong>der</strong>schulen untersucht. Ausgehend von <strong>der</strong> neunten Klasse (im Frühjahr 2007) bis zum dritten Übergangsjahr<br />
(im November 2009) wurden über 600 Jugendliche <strong>in</strong>sgesamt vier Mal befragt.<br />
Studie: Verbesserung <strong>der</strong> beruflichen Integration von AbsolventInnen von För<strong>der</strong>schulen<br />
Für diese Studie führte das DJI im Auftrag <strong>der</strong> Aktion Mensch, <strong>der</strong> Robert-Bosch-Stiftung und <strong>der</strong> Max-<br />
Traeger-Stiftung qualitative Interviews mit För<strong>der</strong>schülern und -schüler<strong>in</strong>nen, <strong>der</strong>en Eltern, Schulleitungen<br />
und Personal <strong>der</strong> Arbeitsagentur mit dem Ziel, Faktoren zu identifizieren, die diesen Jugendlichen<br />
Zugang zu Formen von Erwerbsarbeit eröffnen, die ihren Wünschen und Potenzialen gerecht<br />
werden.<br />
Es ist geplant, dass die Gruppe <strong>der</strong> För<strong>der</strong>schüler/<strong>in</strong>nen im nächsten Nationalen Bildungsbericht, an<br />
dessen Erstellung das DJI maßgeblich beteiligt ist, noch stärker Berücksichtigung f<strong>in</strong>det. Insbeson<strong>der</strong>e<br />
sollen die <strong>in</strong>dividuellen Leistungsvoraussetzungen und sozioökonomischen Lebensumstände <strong>der</strong> För<strong>der</strong>schüler/<strong>in</strong>nen<br />
nach Nationalität und Geschlecht genauer untersucht werden.<br />
Außerdem erarbeitet <strong>der</strong>zeit das Konsortialprojekt NEPS (National Educational Panel Study/Nationales<br />
Bildungspanel) unter Mitwirkung des DJI die Grundlagen für die Erhebung genauerer<br />
Daten - unter E<strong>in</strong>beziehung <strong>der</strong> Gruppe <strong>der</strong> För<strong>der</strong>schüler/<strong>in</strong>nen - <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Multi-Kohorten-<br />
Längsschnittstudie mit dem Schwerpunkt Kompetenzmessung, anhand <strong>der</strong>er Bildungschancen und<br />
Bildungsübergänge <strong>in</strong> Deutschland e<strong>in</strong>gehen<strong>der</strong> untersucht werden können.<br />
Im Folgenden f<strong>in</strong>den sich e<strong>in</strong>ige ausgewählte Daten und Fakten rund um das Thema För<strong>der</strong>schulen im<br />
Überblick:<br />
Was heißt Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung?<br />
In Anlehnung an aktuelle <strong>in</strong>ternationale Begriffsdef<strong>in</strong>itionen werden Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ungen und Bee<strong>in</strong>trächtigungen<br />
<strong>in</strong> Deutschland heute nicht mehr ausschließlich als <strong>in</strong> <strong>der</strong> Person begründete Defizite betrachtet.<br />
Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ungen s<strong>in</strong>d dieser Sichtweise zufolge immer auch als e<strong>in</strong> Interaktionsprodukt zwischen<br />
dem Individuum und se<strong>in</strong>er Umwelt zu verstehen.<br />
Als beh<strong>in</strong><strong>der</strong>te Menschen im S<strong>in</strong>ne <strong>der</strong> Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>tenrechtskonvention gelten alle, die auf Grund von<br />
Wechselwirkungen zwischen <strong>in</strong>dividuellen Bee<strong>in</strong>trächtigungen und strukturellen Aspekten an <strong>der</strong> vollen<br />
gesellschaftlichen Teilhabe geh<strong>in</strong><strong>der</strong>t werden. Darunter fallen auch Menschen mit e<strong>in</strong>er sogenannten<br />
„Lernbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung“.<br />
Was ist e<strong>in</strong>e Lernbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung?<br />
Lernen und Lehren stehen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em engen wechselseitigen Zusammenhang. Daher ist die Lernbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung<br />
auch <strong>in</strong> diesem Verhältnis zue<strong>in</strong>an<strong>der</strong> zu sehen. Lernbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung ist demzufolge ke<strong>in</strong> stati-<br />
40
sches Wesensmerkmal o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>e genetische Bee<strong>in</strong>trächtigung e<strong>in</strong>es K<strong>in</strong>des o<strong>der</strong> Jugendlichen, son<strong>der</strong>n<br />
sie entwickelt sich - unter bestimmten Belastungen - <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em dynamischen sozialen Prozess.<br />
Während <strong>in</strong> <strong>der</strong> defizitorientierten Sichtweise häufig gesundheitliche Belastungen sowie e<strong>in</strong> bildungsfernes<br />
und anregungsarmes familiäres Milieu als primär verantwortlich für die Entstehung e<strong>in</strong>er Lernbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung<br />
gesehen werden, wird <strong>in</strong> <strong>der</strong> prozessorientierten Sichtweise die Wechselwirkung verschiedener<br />
Belastungsfaktoren betont. Zu diesen Belastungen gehören im Wesentlichen drei Faktorengruppen<br />
(Weiß 2004):<br />
• Entwicklungs- und lernerschwerende biologische Faktoren<br />
• Entwicklungs- und lernerschwerende Umwelte<strong>in</strong>flüsse<br />
• ungünstige schulische Lehr-/Lernbed<strong>in</strong>gungen.<br />
Welche För<strong>der</strong>bedarfe gibt es?<br />
Bei <strong>der</strong> son<strong>der</strong>pädagogischen För<strong>der</strong>ung wird unterschieden zwischen K<strong>in</strong><strong>der</strong>n und Jugendlichen<br />
• mit e<strong>in</strong>er S<strong>in</strong>nesschädigung<br />
• mit e<strong>in</strong>er körperlichen Bee<strong>in</strong>trächtigung<br />
• mit e<strong>in</strong>er geistigen Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung<br />
• mit Lern- und Sprachstörungen<br />
• mit beson<strong>der</strong>en emotionalen und sozialen Problemen.<br />
Wer stellt den För<strong>der</strong>bedarf fest?<br />
In <strong>der</strong> Regel wird e<strong>in</strong> son<strong>der</strong>pädagogischer För<strong>der</strong>bedarf auf Anregung e<strong>in</strong>er K<strong>in</strong><strong>der</strong>tagese<strong>in</strong>richtung<br />
o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>er Regelschule – meist e<strong>in</strong>er Grund- o<strong>der</strong> Hauptschule – festgestellt. Nach ersten Überprüfungen<br />
durch Beratungslehrer/<strong>in</strong>nen, Schulpsycholog/<strong>in</strong>nen o<strong>der</strong> För<strong>der</strong>lehrkräfte erfolgt e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>schätzung<br />
durch e<strong>in</strong>e mediz<strong>in</strong>ische E<strong>in</strong>richtung o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>en mobilen son<strong>der</strong>pädagogischen Dienst bzw. <strong>in</strong><br />
sogenannten Frühdiagnosezentren.<br />
Diese umfasst neben Gesprächen mit Erzieher<strong>in</strong>nen und Erziehern o<strong>der</strong> Lehrkräften, Eltern und K<strong>in</strong><strong>der</strong>n<br />
diverse standardisierte Testverfahren, <strong>der</strong>en Ergebnisse <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em abschließenden son<strong>der</strong>pädagogischen<br />
Gutachten festgehalten werden.<br />
Fachleute s<strong>in</strong>d sich darüber e<strong>in</strong>ig, dass es nicht e<strong>in</strong>fach ist, den Begriff <strong>der</strong> Lernbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung <strong>in</strong>haltlich<br />
klar zu fassen und von an<strong>der</strong>en Begriffen wie z.B. Schulleistungsschwäche, Lernversagen o<strong>der</strong><br />
Lernstörungen abzugrenzen und e<strong>in</strong>e Lernbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung mit <strong>der</strong> Konsequenz e<strong>in</strong>er Überweisung <strong>der</strong><br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong> und Jugendlichen an För<strong>der</strong>schulen zu diagnostizieren.<br />
Welche För<strong>der</strong>schwerpunkte bieten die Son<strong>der</strong>- und För<strong>der</strong>schulen an?<br />
Je nach diagnostiziertem För<strong>der</strong>bedarf wird e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>richtung mit e<strong>in</strong>er entsprechenden Spezialisierung<br />
vorgeschlagen. För<strong>der</strong>schwerpunkte gibt es zu den Bereichen:<br />
Sehen, Hören, Lernen, Sprache, geistige Entwicklung, körperliche und motorische Entwicklung sowie<br />
emotionale und soziale Entwicklung. Daneben gibt es E<strong>in</strong>richtungen, die für den Unterricht kranker<br />
Schüler<strong>in</strong>nen und Schüler zuständig s<strong>in</strong>d.<br />
Wie viele Schüler/<strong>in</strong>nen haben e<strong>in</strong>en beson<strong>der</strong>en För<strong>der</strong>bedarf?<br />
In Deutschland haben nahezu e<strong>in</strong>e halbe Million Schüler/<strong>in</strong>nen e<strong>in</strong>en diagnostizierten son<strong>der</strong>pädagogischen<br />
För<strong>der</strong>bedarf (2007/08). Davon besuchen etwa 400.000 K<strong>in</strong><strong>der</strong> und Jugendliche spezielle,<br />
eigens auf ihren För<strong>der</strong>bedarf zugeschnittene För<strong>der</strong>schulen. Weitere 85.000 von ihnen lernen mit<br />
Gleichaltrigen an Regelschulen im geme<strong>in</strong>samen Unterricht (Inklusion).<br />
Wie groß s<strong>in</strong>d die e<strong>in</strong>zelnen För<strong>der</strong>gruppen?<br />
Fast die Hälfte <strong>der</strong> För<strong>der</strong>schüler/<strong>in</strong>nen wird gegenwärtig im Schwerpunkt Lernen unterrichtet. Im<br />
Jahr 2006 waren es laut Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>tenbericht 2009 rund 190.000 (47%) junge Menschen . Der zweitgrößte<br />
För<strong>der</strong>schwerpunkt Sprache wird von knapp e<strong>in</strong>em Zehntel (9%) aller För<strong>der</strong>schüler/<strong>in</strong>nen besucht.<br />
E<strong>in</strong>e weitere große Gruppe hat als Unterrichtsschwerpunkt die emotionale und soziale Entwicklung<br />
(10%). D.h. etwa zwei Drittel <strong>der</strong> Jugendlichen, die e<strong>in</strong>e Son<strong>der</strong>schule besuchen, haben<br />
ke<strong>in</strong>e o<strong>der</strong> nur e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>gfügige, organisch bed<strong>in</strong>gte Bee<strong>in</strong>trächtigung.<br />
41
Schüler<strong>in</strong>nen und Schüler <strong>in</strong> För<strong>der</strong>schulen und För<strong>der</strong>schulbesuchsquote nach För<strong>der</strong>schwerpunkten<br />
2006<br />
Quelle: KMK/Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>tenbericht 2009, S. 35<br />
Nimmt die Zahl <strong>der</strong> För<strong>der</strong>schüler/<strong>in</strong>nen zu?<br />
Die För<strong>der</strong>schulbesuchsquote ist zwischen 1998 und 2006 von 4,4 auf 4,8 Prozent gestiegen. Der Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>tenbericht<br />
<strong>der</strong> Bundesregierung von 2009 besagt, dass von den <strong>in</strong>sgesamt 484.300 Schüler<strong>in</strong>nen<br />
und Schülern mit son<strong>der</strong>pädagogischem För<strong>der</strong>bedarf im Jahr 2006 <strong>in</strong> Deutschland rund 408.100 (84%)<br />
<strong>in</strong> För<strong>der</strong>schulen unterrichtet wurden. Trotz e<strong>in</strong>er zunehmenden Tendenz, Jugendliche mit son<strong>der</strong>pädagogischem<br />
För<strong>der</strong>bedarf auch <strong>in</strong> allgeme<strong>in</strong>en Schulen zu unterrichten, ist <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> Schüler/<strong>in</strong>nen<br />
an För<strong>der</strong>schulen im Verhältnis zur Gesamtzahl <strong>der</strong> Schüler/<strong>in</strong>nen bis 2004 gestiegen und<br />
lange Zeit stabil geblieben. Der nationale Bildungsbericht 2010 meldet e<strong>in</strong>en weiteren leichten Anstieg<br />
des För<strong>der</strong>schulbesuchs. Dazu habe beigetragen, dass die Schüler/<strong>in</strong>nen immer früher auf För<strong>der</strong>schulen<br />
überwiesen werden und sich dadurch die durchschnittliche Zeit des För<strong>der</strong>schulbesuchs<br />
verlängert hat.<br />
För<strong>der</strong>schulbesuchsquote von Schüler<strong>in</strong>nen und Schülern im Alter von 7, 10 und 13 Jahren 1995<br />
bis 2008<br />
(<strong>in</strong> %)<br />
Quelle:<br />
Nationaler Bildungsbericht 2010, S. 250<br />
Gibt es regionale Unterschiede?<br />
Die e<strong>in</strong>zelnen Bundeslän<strong>der</strong> unterscheiden sich sehr stark h<strong>in</strong>sichtlich <strong>der</strong> son<strong>der</strong>pädagogischen För<strong>der</strong>quoten<br />
und des Anteils <strong>der</strong> Schüler/<strong>in</strong>nen mit För<strong>der</strong>bedarf, die <strong>in</strong>klusiv unterrichtet werden. Zum<br />
Beispiel besuchen <strong>in</strong> Rhe<strong>in</strong>land-Pfalz 4,3 Prozent aller vollzeitschulpflichtigen K<strong>in</strong><strong>der</strong> und Jugendlichen<br />
e<strong>in</strong>e För<strong>der</strong>schule, während es <strong>in</strong> Mecklenburg-Vorpommern <strong>11</strong>,7 Prozent s<strong>in</strong>d.<br />
Verteilung <strong>der</strong> Anteile<br />
von Schüler/<strong>in</strong>ne/n mit<br />
son<strong>der</strong>pädagogischem<br />
För<strong>der</strong>bedarf auf die<br />
Bundeslän<strong>der</strong> im Jahr<br />
2008 (<strong>in</strong> Prozent)<br />
Quelle: DJI Bullet<strong>in</strong> 2/2010<br />
S. 21 / Nationaler<br />
Bildungsbericht 2010<br />
42
Wie viele K<strong>in</strong><strong>der</strong> wechseln von <strong>der</strong> För<strong>der</strong>schule <strong>in</strong> die Regelschule?<br />
Im Bundesdurchschnitt werden 84,3 Prozent <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong> mit För<strong>der</strong>bedarf an separaten För<strong>der</strong>schulen<br />
unterrichtet. Zum Schuljahr 2007/08 <strong>in</strong> Deutschland wurden <strong>in</strong>sgesamt 93.000 Schüler/<strong>in</strong>nen neu <strong>in</strong><br />
För<strong>der</strong>schulen aufgenommen: knapp 18.000 durch E<strong>in</strong>schulungen <strong>in</strong> die erste Klasse und <strong>der</strong> weitaus<br />
größere Teil mit etwa 75.000 durch Überweisungen aus den allgeme<strong>in</strong>en Schulen. Nur e<strong>in</strong>em Bruchteil<br />
von ihnen gel<strong>in</strong>gt <strong>der</strong> Sprung zurück auf e<strong>in</strong>e allgeme<strong>in</strong>e Schule. Im Jahr 2007/2008 waren es nur<br />
etwa 9.300 Schüler/<strong>in</strong>nen, die aus den För<strong>der</strong>schulen <strong>in</strong> allgeme<strong>in</strong>e Schulen wechselten.<br />
Aus welchen Familien stammen die För<strong>der</strong>schüler/<strong>in</strong>nen?<br />
Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Schülerschaft an För<strong>der</strong>schulen nach sozialer Lage und Nationalität und<br />
Geschlecht zeigt im Vergleich zu den allgeme<strong>in</strong>bildenden Schulen charakteristische Abweichungen.<br />
Nur 37 Prozent <strong>der</strong> För<strong>der</strong>schüler/<strong>in</strong>nen s<strong>in</strong>d weiblich. Im För<strong>der</strong>schwerpunkt Sprache beträgt <strong>der</strong><br />
Mädchenanteil nur 30 Prozent, bei den emotionalen und sozialen Entwicklungsstörungen sogar nur 14<br />
Prozent.<br />
Der Bildungsstand <strong>der</strong> Eltern von För<strong>der</strong>schüler/<strong>in</strong>nen ist im Schnitt relativ niedrig. Mehr als die Hälfte<br />
<strong>der</strong> Eltern hat höchstens e<strong>in</strong>en Hauptschulabschluss (52%); an allgeme<strong>in</strong>bildenden Schulen liegt<br />
diese Quote bei 27 Prozent. E<strong>in</strong> Drittel <strong>der</strong> Familienbezugspersonen ist nicht erwerbstätig (34%). E<strong>in</strong>e<br />
Erwerbssituation, die nur 12 Prozent <strong>der</strong> Schüler/<strong>in</strong>nen an allgeme<strong>in</strong>bildenden Schulen betrifft.<br />
Seit Beg<strong>in</strong>n <strong>der</strong> 1990er Jahre hat sich <strong>der</strong> Auslän<strong>der</strong>anteil an Son<strong>der</strong>schulen und För<strong>der</strong>schulen drastisch<br />
erhöht. Bei e<strong>in</strong>em Anteil von knapp 10 Prozent an <strong>der</strong> Gesamtschülerschaft liegt <strong>der</strong> Anteil ausländischer<br />
Schüler/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> den För<strong>der</strong>schulen bei 16 Prozent und im beson<strong>der</strong>en För<strong>der</strong>bereich Lernen<br />
bei 19 Prozent. Ausländische Schüler/<strong>in</strong>nen s<strong>in</strong>d damit an dieser Schulart deutlich überrepräsentiert.<br />
E<strong>in</strong> differenzierter Blick zeigt laut Nationalem Bildungsbericht 2010 jedoch deutliche Unterschiede je<br />
nach Herkunftsland. K<strong>in</strong><strong>der</strong> mit albanischem o<strong>der</strong> libanesischem Migrationsh<strong>in</strong>tergrund weisen zum<br />
Beispiel För<strong>der</strong>schulbesuchsquoten von 13 Prozent und mehr auf. An<strong>der</strong>e Nationalitäten (z.B. Vietnam,<br />
Ukra<strong>in</strong>e, Polen und Iran) liegen unter den Quoten <strong>der</strong> deutschen Schülerschaft. Der Anteil <strong>der</strong><br />
ausländischen K<strong>in</strong><strong>der</strong> aus Griechenland, Italien und <strong>der</strong> Türkei bleibt seit Jahren bei ca. 6 bis 8 Prozent<br />
konstant, obwohl diese überwiegend <strong>in</strong> Deutschland aufgewachsen s<strong>in</strong>d.<br />
Unterschiede des För<strong>der</strong>schulbesuchs nach Geschlecht, sozialer Lage und Nationalität<br />
För<strong>der</strong>schulbesuchsquote* 1995<br />
bis 2008 nach ausgewählten<br />
Nationalitäten (<strong>in</strong> %)<br />
Quelle: Nationaler<br />
Bildungsbericht S. 254<br />
Wie viele Schüler/<strong>in</strong>nen<br />
verlassen die För<strong>der</strong>schulen<br />
mit e<strong>in</strong>em Abschluss?<br />
2008 haben am Ende <strong>der</strong><br />
Pflichtschulzeit drei Viertel<br />
(77%) <strong>der</strong> För<strong>der</strong>schüler/<strong>in</strong>nen<br />
die Schule ohne<br />
Hauptschulabschluss verlassen.<br />
Damit stellen sie – und nicht<br />
etwa die Hauptschulbesucher<strong>in</strong>nen – die größte Gruppe (55%) aller Schüler/<strong>in</strong>nen ohne Hauptschulabschluss<br />
(mit Ausnahme von Berl<strong>in</strong>). Da die För<strong>der</strong>schulen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Mehrzahl ke<strong>in</strong>e Hauptschulabschlüsse<br />
vergeben dürfen, erhalten die meisten Absolvent/<strong>in</strong>n/en von För<strong>der</strong>schulen am Ende <strong>der</strong> Schulzeit<br />
e<strong>in</strong> spezifisches Abschlusszertifikat für den jeweiligen För<strong>der</strong>schwerpunkt.<br />
43
Wie viele För<strong>der</strong>schulen gibt es <strong>in</strong> Deutschland?<br />
Derzeit gibt es <strong>in</strong> Deutschland 3.302 För<strong>der</strong>schulen, an denen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes<br />
im Schuljahr 2009/10 <strong>in</strong>sgesamt 72.975 voll- und teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte tätig waren.<br />
Was kostet die geson<strong>der</strong>te För<strong>der</strong>ung?<br />
Die Bundeslän<strong>der</strong> geben pro Jahr 2,6 Milliarden Euro für die Beschulung von rund 400.000 Schüler/<strong>in</strong>nen<br />
durch zusätzliche Lehrkräfte an För<strong>der</strong>schulen aus. Ca. 800 Millionen Euro entfallen davon<br />
auf die rund 180.000 Schüler/<strong>in</strong>nen mit dem För<strong>der</strong>schwerpunkt Lernen. Die übrigen 1,8 Milliarden<br />
Euro gehen <strong>in</strong> die För<strong>der</strong>ung von 221.000 K<strong>in</strong><strong>der</strong>n und Jugendlichen mit an<strong>der</strong>en För<strong>der</strong>schwerpunkten.<br />
Insgesamt entstehen 2,6 Milliarden Euro Mehrausgaben – zusätzlich zu den Kosten, die diese K<strong>in</strong><strong>der</strong><br />
ohne son<strong>der</strong>pädagogische För<strong>der</strong>ung <strong>in</strong> allgeme<strong>in</strong>en Schulen verursacht hätten.<br />
Wie hat sich das Son<strong>der</strong>schulwesen <strong>in</strong> Deutschland entwickelt?<br />
Die Son<strong>der</strong>beschulung <strong>in</strong> Deutschland wurde im 19. Jahrhun<strong>der</strong>t <strong>in</strong> Form von Hilfsklassen e<strong>in</strong>geführt<br />
und hat sich <strong>in</strong> den 1960er Jahren als separate Schulform bundesweit etabliert und ausdifferenziert.<br />
Seit den 1970er Jahren ist das Son<strong>der</strong>schulwesen <strong>in</strong> Deutschland <strong>in</strong> zehn verschiedene Schulformen<br />
geordnet. Die Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Bezeichnung von „Hilfsschule“ über „Son<strong>der</strong>schule“ bis zur aktuellen<br />
Bezeichnung „För<strong>der</strong>schule“ verweist auf e<strong>in</strong>e Entwicklung <strong>der</strong> dah<strong>in</strong>ter stehenden Schulkonzepte.<br />
Was for<strong>der</strong>t die Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>tenrechtskonvention <strong>der</strong> Vere<strong>in</strong>ten Nationen?<br />
Wie schon die vorangegangene Weltkonferenz 1994 zu den Rechten von Menschen mit Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ungen<br />
for<strong>der</strong>t die Weltkonferenz <strong>der</strong> UNESCO 2009 <strong>in</strong> ihrer Resolution die Entwicklung e<strong>in</strong>es <strong>in</strong>klusiven Bildungssystems<br />
<strong>in</strong> jedem Land <strong>der</strong> Welt.<br />
Die Vertragsstaaten sollen sicherstellen, dass Menschen mit Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ungen nicht aufgrund e<strong>in</strong>er Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung<br />
vom allgeme<strong>in</strong>en Bildungssystem ausgeschlossen werden. Innerhalb des allgeme<strong>in</strong>en Bildungssystems<br />
sollen angemessene Vorkehrungen getroffen und die notwendige Unterstützung gewährleistet<br />
werden, um e<strong>in</strong>e erfolgreiche Bildung zu erleichtern und e<strong>in</strong>e qualitativ gleichwertige<br />
Bildung für beh<strong>in</strong><strong>der</strong>te und nichtbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>te Menschen sicherzustellen.<br />
Grundlage <strong>der</strong> UN-Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>tenrechtskonvention ist die Würde des Menschen. Der „Defizit-Ansatz“,<br />
<strong>der</strong> bisher das Verständnis von Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung prägte, wird <strong>in</strong> <strong>der</strong> UN-Konvention durch e<strong>in</strong>en „Diversity-Ansatz“<br />
ersetzt: Diese Sichtweise be<strong>in</strong>haltet die Wertschätzung <strong>der</strong> <strong>in</strong>dividuellen Beson<strong>der</strong>heit<br />
jedes Menschen und sieht Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung im Kontext von sozialen Bed<strong>in</strong>gungen.<br />
Im Unterschied zum Integrationsansatz, bei dem mitschw<strong>in</strong>gt, dass auf e<strong>in</strong>en vorausgegangenen gesellschaftlichen<br />
Ausschluss e<strong>in</strong>e Anpassungsleistung erfolgt, geht Inklusion von <strong>der</strong> grundsätzlichen<br />
Verschiedenheit aller Menschen aus - bei gleichzeitig geltendem Recht für alle ohne Ausnahme, am<br />
Leben <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gesellschaft teilzunehmen und es mitzugestalten.<br />
Wie ist die Rechtslage <strong>in</strong> Deutschland?<br />
Niemand darf wegen se<strong>in</strong>er Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung benachteiligt werden. So steht es <strong>in</strong> Artikel 3 des Grundgesetzes<br />
<strong>der</strong> Bundesrepublik Deutschland. Darüber h<strong>in</strong>aus ist seit dem 26. März 2009 die UN-Konvention<br />
zur Inklusiven Bildung auch verb<strong>in</strong>dliche Rechtsgrundlage <strong>in</strong> Deutschland.<br />
Wie steht es mit Umsetzung <strong>der</strong> UN-Resolution?<br />
Der Umsetzung des UN-Beschlusses zur <strong>in</strong>klusiven Bildung ist <strong>in</strong> den e<strong>in</strong>zelnen Bundeslän<strong>der</strong>n unterschiedlich<br />
weit gediehen. E<strong>in</strong>ige haben schon e<strong>in</strong> gutes Stück des Weges zurückgelegt. An<strong>der</strong>e h<strong>in</strong>gegen<br />
stehen noch am Anfang des Verän<strong>der</strong>ungsprozesses. Beispielsweise besuchten von den Schüler<strong>in</strong>nen<br />
und Schülern mit För<strong>der</strong>bedarf <strong>in</strong> Bremen 44,9 Prozent den geme<strong>in</strong>samen Unterricht, <strong>in</strong> Nie<strong>der</strong>sachsen<br />
aber lediglich 4,7 Prozent. Im Bundesdurchschnitt s<strong>in</strong>d es 15,7 Prozent.<br />
Insgesamt ist laut Nationalem Bildungsbericht 2010 aber ke<strong>in</strong>e Senkung <strong>der</strong> För<strong>der</strong>schulbesuchsquote<br />
zugunsten e<strong>in</strong>er För<strong>der</strong>ung <strong>in</strong> sonstigen allgeme<strong>in</strong>bildenden Schulen beobachtbar. Im Vergleich mit<br />
den an<strong>der</strong>en EU-Staaten hat Deutschland die höchste För<strong>der</strong>quote von Schüler<strong>in</strong>nen und Schülern, die<br />
<strong>in</strong> separaten För<strong>der</strong>schulen unterrichtet werden.<br />
Quelle: Deutsches Jugend<strong>in</strong>stitut<br />
44
_______________________________________________________________________________________<br />
30.) BIBB - Hauptausschuss verabschiedet Leitl<strong>in</strong>ien zur<br />
Verbesserung des Übergangs Schule - Beruf<br />
www.bibb.de<br />
Leitl<strong>in</strong>ien aufrufbar unter www.sozialestadt-netzwerk-ohz.de<br />
/ (Weiter-) Bildung<br />
_______________________________________________________________________________________<br />
Der Hauptausschuss des Bundes<strong>in</strong>stituts für Berufsbildung (BIBB) hat auf se<strong>in</strong>er Sitzung am 17. Juni<br />
20<strong>11</strong> <strong>in</strong> Bonn e<strong>in</strong>stimmig "Leitl<strong>in</strong>ien zur Verbesserung des Übergangs Schule - Beruf" verabschiedet.<br />
Dar<strong>in</strong> spricht sich das auch als "Parlament <strong>der</strong> Berufsbildung" bezeichnete BIBB-Gremium dafür aus,<br />
"die Ressourcen und Talente aller Jugendlichen <strong>in</strong> den Blick zu nehmen und junge Menschen <strong>in</strong>dividuell<br />
besser zu för<strong>der</strong>n".<br />
Um den direkten Übergang von <strong>der</strong> Schule <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e betriebliche Ausbildung zu stärken, müssten "konsistente<br />
und transparente Wege" geschaffen werden. Ziel sei es, "alle jungen Menschen zu e<strong>in</strong>er vollqualifizierenden<br />
Berufsausbildung und e<strong>in</strong>em Berufsabschluss zu führen".<br />
Bund und Län<strong>der</strong> werden aufgefor<strong>der</strong>t, die Angebotsvielfalt am Übergang Schule-Berufsausbildung zu<br />
reduzieren, zu bündeln und besser aufe<strong>in</strong>an<strong>der</strong> abzustimmen sowie <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e s<strong>in</strong>nvolle Struktur vor Ort<br />
unter E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung <strong>der</strong> verschiedenen Akteure <strong>in</strong> regionale Netzwerke e<strong>in</strong>zuglie<strong>der</strong>n.<br />
Aus Sicht des BIBB-Hauptausschusses sollte das Übergangsmanagement an folgenden Leitl<strong>in</strong>ien ausgerichtet<br />
werden:<br />
• frühzeitige Vorbereitung, fundierte Berufsorientierung<br />
• <strong>in</strong>dividuelle För<strong>der</strong>ung sowie Beratung und Begleitung <strong>der</strong> Jugendlichen<br />
• Nähe zur Berufs- und Betriebspraxis, E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung <strong>der</strong> Wirtschaft und <strong>der</strong> betrieblichen Praxis<br />
• regionale Koord<strong>in</strong>ierung und Steuerung sowie die Rolle <strong>der</strong> Akteure<br />
• Transparenz und Anschlussfähigkeit<br />
• Evaluierung <strong>der</strong> Programme und Maßnahmen<br />
Der BIBB-Hauptausschuss hat die gesetzliche Aufgabe, die Bundesregierung <strong>in</strong> grundsätzlichen Fragen<br />
<strong>der</strong> Berufsbildung zu beraten. Dem Ausschuss gehören zu gleichen Teilen Vertreter und Vertreter<strong>in</strong>nen<br />
<strong>der</strong> Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände sowie <strong>der</strong> Bundeslän<strong>der</strong> und <strong>der</strong> Bundesregierung<br />
an.<br />
Quelle: Bundes<strong>in</strong>stitut für Berufsbildung<br />
______________________________________________________________________________<br />
31.) BIBB - Ausbildungsstellenmarkt: Zahl <strong>der</strong> Jugendlichen im Übergangsbereich geht stark<br />
zurück www.bibb.de<br />
______________________________________________________________________________<br />
Die Zahl <strong>der</strong> Jugendlichen, die nach Verlassen <strong>der</strong> allgeme<strong>in</strong>bildenden Schule bei <strong>der</strong> Suche nach<br />
e<strong>in</strong>er Ausbildungsstelle zunächst erfolglos bleiben, ist stark rückläufig. Mündeten 2005 noch mehr als<br />
417.600 Jugendliche <strong>in</strong> das so genannte "Übergangssystem" e<strong>in</strong>, so waren dies 2010 nach Berechnungen<br />
<strong>der</strong> "<strong>in</strong>tegrierten Ausbildungsberichterstattung" (iABE) "nur" noch rund 323.700 (-22,5 %). Prof.<br />
Dr. Friedrich Hubert Esser, Präsident des Bundes<strong>in</strong>stituts für Berufsbildung (BIBB), begrüßt diese<br />
45
Entwicklung, mahnt jedoch zugleich mit Blick auf das am 1. August beg<strong>in</strong>nende neue Ausbildungsjahr:<br />
"Wenn diese Zahl weiter s<strong>in</strong>ken soll, muss die Wirtschaft im Zuge <strong>der</strong> <strong>in</strong> Kürze beg<strong>in</strong>nenden Nachvermittlungsaktion<br />
alles daran setzen, dass die noch offenen Ausbildungsstellen besetzt werden. Dabei<br />
müssen alle Potenziale genutzt werden. Ausbildungswillige und ausbildungsfähige Jugendliche gehören<br />
nicht <strong>in</strong> ,Warteschleifen' des Übergangs, son<strong>der</strong>n müssen gerade mit Blick auf die demografische<br />
Entwicklung für den betrieblichen Fachkräftebedarf <strong>der</strong> Zukunft qualifiziert werden."<br />
Bund und Län<strong>der</strong> for<strong>der</strong>te <strong>der</strong> BIBB-Präsident auf, bei <strong>der</strong> dr<strong>in</strong>gend gebotenen Verbesserung des Übergangsmanagements<br />
"an e<strong>in</strong>em Strang zu ziehen". Ziel müsse es se<strong>in</strong>, den bestehenden För<strong>der</strong>dschungel<br />
zu lichten. "Die unüberschaubare Vielfalt <strong>der</strong> Angebote muss reduziert und auf die Jugendlichen<br />
konzentriert werden, für die die Maßnahmen des Übergangsmanagements auch s<strong>in</strong>nvoll s<strong>in</strong>d."<br />
Der "Bildungsketten"-Ansatz <strong>der</strong> Bundesregierung sei <strong>der</strong> richtige Weg, <strong>der</strong> aber von Bund und Län<strong>der</strong>n<br />
geme<strong>in</strong>sam "nachhaltig <strong>in</strong> die Fläche getragen werden müsse", so Präsident Esser.<br />
Die <strong>in</strong> Westdeutschland durch doppelte Abiturjahrgänge und die Aussetzung <strong>der</strong> Wehrpflicht entstehenden<br />
Bewerberspitzen müssen nach Auffassung des BIBB-Präsidenten dr<strong>in</strong>gend für die Rekrutierung<br />
von zukünftigen Fach- und Führungskräften <strong>in</strong> den Betrieben genutzt werden. "Jugendlichen, aber<br />
auch den Eltern, empfehle ich, sich über die bestehenden Möglichkeiten breit zu <strong>in</strong>formieren. Die<br />
duale Berufsausbildung bietet gerade auch für Abiturienten attraktive Alternativen zu e<strong>in</strong>em Studium",<br />
wirbt <strong>der</strong> BIBB-Präsident. Hierfür sei es aber erfor<strong>der</strong>lich, dass die Betriebe die Zahl <strong>der</strong> Ausbildungsplatzangebote<br />
auf e<strong>in</strong>em hohen Niveau hielten. Sonst drohe e<strong>in</strong> Verdrängungswettbewerb zu<br />
Lasten <strong>der</strong> weniger qualifizierten Schüler. Dass man sich aber auf dem "richtigen Weg" bef<strong>in</strong>de, zeigten<br />
auch die neuesten Daten <strong>der</strong> Bundesagentur für Arbeit (BA), wonach die Zahl <strong>der</strong> betrieblichen<br />
Ausbildungsplatzangebote im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 40.000 gestiegen ist.<br />
Quelle: Bundes<strong>in</strong>stitut für Berufsbildung<br />
Nie<strong>der</strong>sächsischer Industrie- und Handelskammertag beklagt fehlende Ausbildungsreife<br />
Die Befürchtung, es könne wegen des doppelten Abitur-Jahrgangs durch e<strong>in</strong>en Andrang von Abiturienten<br />
auf e<strong>in</strong>e betriebliche Ausbildung zu e<strong>in</strong>em Verdrängungseffekt für Haupt-, Real- und Berufsfachschulabsolventen<br />
kommen, hat sich bisher nicht bewahrheitet. Nach Angaben des Nie<strong>der</strong>sächsischen<br />
Industrie- und Handelskammertages (NIHK) ist im laufenden Jahr <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> Auszubildenden<br />
mit Hochschulreife nicht e<strong>in</strong>mal um zwei Prozent gestiegen.<br />
E<strong>in</strong>e Umfrage unter mehr als 1000 Betrieben ergab aber, dass es fehlende Ausbildungsreife und mangelnde<br />
Berufsorientierung bei den Bewerbern vielen Unternehmen erschwere, ihre Ausbildungsplätze<br />
zu besetzen. Wegen <strong>der</strong> positiven wirtschaftlichen Entwicklung wollen drei von vier Unternehmen<br />
mehr o<strong>der</strong> gleich viele Ausbildungsplätze bereitstellen; nahezu 23% <strong>der</strong> Firmen beklagten aber, dass<br />
sie 2010 nicht alle Ausbildungsplätze besetzen konnten.<br />
Mit fast 80% werde mangelnde Ausbildungsreife <strong>der</strong> Bewerber als größtes Ausbildungsh<strong>in</strong><strong>der</strong>nis<br />
genannt, stellte <strong>der</strong> NIHK fest. Beklagt wurden vor allem unzureichendes mündliches und schriftliches<br />
Ausdrucksvermögen (56%), fehlende Rechenfertigkeiten (52%), mangelnde Diszipl<strong>in</strong> (49%) und<br />
nicht ausreichende Leistungsbereitschaft und Motivation (48%) sowie zu unklare Berufsvorstellungen.<br />
Der NIHK for<strong>der</strong>te Land und Kommunen auf, offensiv Partnerschaften zwischen Schulen und Wirtschaft<br />
sowie kommunalen E<strong>in</strong>richtungen zu unterstützen, um die Situation auf dem Arbeitsmarkt zu<br />
verbessern und dem Fachkräftemangel <strong>in</strong> vielen Branchen entgegenzuwirken. Ziel müsse es se<strong>in</strong>,<br />
Schüler frühzeitig auf das Berufsleben vorzubereiten. Insbeson<strong>der</strong>e die neue Oberschule müsse sich<br />
an dem politischen Ziel e<strong>in</strong>er vorbildlichen Berufsorientierung messen lassen, heißt es.<br />
Quelle: Nie<strong>der</strong>sächsische Industrie und Handelskammer<br />
46
Im Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit haben sich die Arbeiterwohlfahrt (AWO), die Bundesarbeitsgeme<strong>in</strong>schaft<br />
Evangelische Jugendsozialarbeit (BAG EJSA) und die Bundesarbeitsgeme<strong>in</strong>schaft<br />
Katholische Jugendsozialarbeit (BAG KJS), die Bundesarbeitsgeme<strong>in</strong>schaft örtlich regionaler Träger<br />
<strong>der</strong> Jugendsozialarbeit (BAG ÖRT), DER PARITÄTISCHE Gesamtverband (DER PARITÄTISCHE), das<br />
Deutsche Rote Kreuz (DRK) und <strong>der</strong> Internationale Bund (IB) zusammengeschlossen, um die gesellschaftliche<br />
und politische Teilhabe von benachteiligten Jugendlichen zu verbe ssern.<br />
Weitere Informationen unter http://www.jugendsozialarbeit.de/288<br />
Quelle: Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement<br />
Die Initiative JUGEND STÄRKEN setzt sich zusammen aus den vier Programmen des Europäischen Sozialfonds<br />
(ESF):<br />
• Schulverweigerung - Die 2. Chance<br />
• Kompetenzagenturen<br />
• STÄRKEN vor Ort<br />
• den aus Bundesmitteln f<strong>in</strong>anzierten Jugendmigrationsdiensten.<br />
Schulverweigerung - Die 2. Chance<br />
Das Programm "Schulverweigerung - Die 2. Chance" hat das Ziel, Jugendliche,<br />
die den Schulbesuch verweigern, wie<strong>der</strong> <strong>in</strong> die Schulen e<strong>in</strong>zuglie<strong>der</strong>n<br />
und ihre Chancen auf e<strong>in</strong>en Abschluss zu erhöhen. An rund<br />
200 Projektstandorten stehen bundesweit feste Ansprechpartner<strong>in</strong>nen<br />
und -partner für die Jugendlichen zur Verfügung. Zusammen mit ihnen,<br />
ihren Eltern und Lehrkräften werden <strong>in</strong>dividuelle För<strong>der</strong>pläne<br />
entwickelt, die passgenau auf die persönliche Lebenssituation <strong>der</strong> Mädchen und Jungen zugeschnitten<br />
s<strong>in</strong>d.<br />
Kompetenzagenturen (auch: Kompetenzagentur im Landkreis Osterholz/ Tagungshaus Bredbeck<br />
bis 31.08.20<strong>11</strong>)<br />
Kompetenzagenturen unterstützen benachteiligte Jugendliche beim<br />
Übergang von <strong>der</strong> Schule <strong>in</strong> den Beruf. Individuelle Beratungs- und<br />
Qualifizierungsangebote erleichtern die soziale Integration und<br />
erhöhen die Chancen auf e<strong>in</strong>en Ausbildungs- und Arbeitsplatz.<br />
Bundesweit wurden ca. 200 Kompetenzagenturen als Anlaufstellen<br />
geschaffen, <strong>der</strong>en Arbeit mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds<br />
(ESF) unterstützt wird.<br />
STÄRKEN vor Ort (auch: STÄRKEN vor Ort <strong>in</strong> <strong>der</strong> Stadt Osterholz-Scharmbeck / Mozart-, Drosselstraße<br />
und Am Voßberg bis 31.12.20<strong>11</strong>)<br />
Mit STÄRKEN vor Ort werden Kle<strong>in</strong>stprojekte <strong>in</strong> benachteiligten<br />
<strong>Stadtteil</strong>en und strukturschwachen Regionen geför<strong>der</strong>t, die soziale<br />
Infrastrukturen aufbauen und dadurch benachteiligte Jugendliche bei<br />
<strong>der</strong> sozialen, schulischen und beruflichen Integration unterstützen.<br />
Damit trägt das Programm nachhaltig zur Verbesserung <strong>der</strong> lokalen Integrations- und Beschäftigungssituation<br />
bei. Auch Frauen, die <strong>in</strong> das Berufsleben e<strong>in</strong>steigen o<strong>der</strong> nach e<strong>in</strong>er familienbed<strong>in</strong>gten Pause<br />
wie<strong>der</strong> <strong>in</strong>s Erwerbsleben zurückkehren möchten, profitieren von STÄRKEN vor Ort.<br />
In dem För<strong>der</strong>zeitraum von Januar 2009 bis Dezember 20<strong>11</strong> werden bundesweit 280 För<strong>der</strong>gebiete <strong>in</strong><br />
203 Kommunen und Landkreisen durch STÄRKEN vor Ort geför<strong>der</strong>t. F<strong>in</strong>anziert wird STÄRKEN vor Ort<br />
aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF); gesteuert wird das Programm durch das Bundesm<strong>in</strong>isterium<br />
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.<br />
48
Aus dem För<strong>der</strong>programm STÄRKEN vor Ort steht für den Zeitraum von März 2009 bis Dezember 20<strong>11</strong><br />
e<strong>in</strong> För<strong>der</strong>volumen <strong>in</strong> Höhe von fast 99 Mio. Euro zur Verfügung.<br />
Für das För<strong>der</strong>gebiet „Mozart- /<br />
Drosselstraße und Am Voßberg“ wurde <strong>der</strong><br />
Stadt Osterholz-Scharmbeck für 2009 bis<br />
20<strong>11</strong> e<strong>in</strong>e För<strong>der</strong>summe <strong>in</strong> Höhe von<br />
<strong>in</strong>sgesamt 300.000 Euro <strong>in</strong> Aussicht<br />
gestellt. Die pro För<strong>der</strong>jahr mögliche<br />
För<strong>der</strong>summe <strong>in</strong> Höhe von 100.000 Euro<br />
wurde jährlich durch die Fortschreibung<br />
des Lokalen Aktionsplans neu beantragt<br />
wurden.<br />
In <strong>der</strong> För<strong>der</strong>periode von Januar bis<br />
Dezember 20<strong>11</strong> wurden 100.000 Euro zur<br />
Unsetzung von momentan 15<br />
Mikroprojekten bewilligt, die im<br />
Dezember 20<strong>11</strong> beendet se<strong>in</strong> werden. Die<br />
jährliche Projektevaluation wird<br />
bundesweit von <strong>der</strong> STÄRKEN vor Ort Servicestelle <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> koord<strong>in</strong>iert.<br />
Das <strong>in</strong> den <strong>in</strong>sgesamt 14 Mikroprojekten <strong>in</strong> 2010 Erreichte wurde am <strong>11</strong>. Februar 20<strong>11</strong> während <strong>der</strong><br />
„STÄRKEN vor Ort Informationsveranstaltung“ mit <strong>der</strong> Vorstellung <strong>der</strong> „STÄRKEN vor Ort Dokumentation<br />
2010“ und <strong>der</strong> Eröffnung <strong>der</strong> Ausstellung <strong>der</strong> Bundesarbeitsgeme<strong>in</strong>schaft Katholische<br />
Jugendsozialarbeit (BAG KJS) e.V. im Foyer des Osterholz-Scharmbecker Rathauses vorgestellt.<br />
Am 23. Juni 20<strong>11</strong> wurde die Ausstellung “an<strong>der</strong>s? - cool!“ über die Lebenssituation von zugewan<strong>der</strong>ten<br />
Jugendlichen <strong>in</strong> Deutschland im <strong>Stadtteil</strong>haus „<strong>Haus</strong> <strong>der</strong> <strong>Kulturen</strong> Osterholz-Scharmbeck“ eröffnet,<br />
die von den Jugendmigrationsdiensten konzipiert wurde.<br />
Weitere Informationen über das För<strong>der</strong>programm STÄRKEN vor Ort stehen www.osterholzscharmbeck.de<br />
, unter www.sozialestadt-netzwerk-ohz.de , unter www.staerken-vor-ort.de sowie<br />
unter www.jugend-staerken.de zur Verfügung.<br />
49
Im Rahmen von STÄRKEN vor Ort wurden <strong>in</strong> <strong>der</strong> Stadt Osterholz-Scharmbeck <strong>in</strong> 20<strong>11</strong> Schüler<strong>in</strong>nen<br />
und Schüler aus den 7. und 8. Klassen <strong>der</strong> Haupt- und Realschule und des Gymnasiums zu „Streitschlichtern“<br />
an Schulen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Stadt<br />
ausgebildet. Im Projektverlauf habe sie<br />
das neue Internetportal<br />
www.streitschlichter-ohz.de geschaffen.<br />
Die teilnehmenden Jugendlichen<br />
absolvierten erfolgreich e<strong>in</strong>e<br />
Jugendgruppenleiterausbildung<br />
50<br />
Die offizielle Zertifizierung <strong>der</strong><br />
ausgebildeten StreitschlichterInnen erfolgte<br />
am 20.05.20<strong>11</strong> im <strong>Stadtteil</strong>haus „<strong>Haus</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>Kulturen</strong> Osterholz-Scharmbeck“.<br />
Jugendmigrationsdienste<br />
Junge Menschen mit Migrationsh<strong>in</strong>tergrund brauchen häufig beson<strong>der</strong>e Unterstützung,<br />
um sich <strong>in</strong> <strong>der</strong> neuen Heimat zurechtzuf<strong>in</strong>den o<strong>der</strong> aus ihrer<br />
isolierten Lage herauszukommen. Zahlen belegen, dass sie sowohl <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Schule als auch auf dem Ausbildungsmarkt nicht die gleichen Chancen haben<br />
wie e<strong>in</strong>heimische Jugendliche. Damit diese jungen Menschen auf ihrem Integrationsweg effizienter<br />
unterstützt werden, erhalten sie <strong>in</strong> den bundesweit mehr als 420 Jugendmigrationsdiensten fachkundige<br />
Begleitung mit <strong>in</strong>dividuellen För<strong>der</strong>plänen und E<strong>in</strong>zelberatung. Die Arbeit <strong>in</strong> den Jugendmigrationsdiensten<br />
wird regelmäßig den aktuellen Entwicklungen und Bedürfnissen angepasst.<br />
_______________________________________________________________________________________<br />
33.) Neues Modellprogramm JUGEND STÄRKEN: Aktiv <strong>in</strong> <strong>der</strong> Region<br />
www.jugend-staerken.de<br />
_______________________________________________________________________________________<br />
Das neue Modellprogramm „Aktiv <strong>in</strong> <strong>der</strong> Region“ ist Bestandteil <strong>der</strong> Initiative JUGEND STÄRKEN, mit<br />
<strong>der</strong> das Bundesm<strong>in</strong>isterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend e<strong>in</strong> deutliches Zeichen für e<strong>in</strong>e<br />
starke Jugendpolitik und e<strong>in</strong>e bessere Integration junger Menschen <strong>in</strong> Deutschland setzt.
Das Modellprogramm JUGEND STÄRKEN: Aktiv <strong>in</strong> <strong>der</strong> Region hat <strong>in</strong> <strong>der</strong> aktuellen ESF–För<strong>der</strong>periode<br />
(2007–2013) e<strong>in</strong>e Laufzeit vom 01. Oktober 2010 bis zum 31. Dezember 2013 und ist mit e<strong>in</strong>em Mittelvolumen<br />
von rund 17 Millionen Euro ausgestattet.<br />
Ziel des Modellprogramms ist es, <strong>in</strong> Fortentwicklung <strong>der</strong> Initiative JUGEND STÄRKEN und ihrer Programme<br />
- Jugendmigrationsdienste, Schulverweigerung – Die 2. Chance, Kompetenzagenturen und<br />
STÄRKEN vor Ort- kommunale Strukturen für die Anliegen <strong>der</strong> Jugendhilfe zu stärken. E<strong>in</strong>e För<strong>der</strong>ung<br />
erfolgt deshalb nur dort, wo es bereits Standorte <strong>der</strong> Initiative JUGEND STÄRKEN gibt, die aber noch<br />
ke<strong>in</strong>e lückenlose und durchgängige För<strong>der</strong>ung für benachteiligte junge Menschen anbieten.<br />
„JUGEND STÄRKEN: Aktiv <strong>in</strong> <strong>der</strong> Region“ erprobt <strong>in</strong> 35 Modellkommunen, <strong>in</strong> <strong>der</strong>en Wirkungskreis<br />
Standorte <strong>der</strong> Initiative JUGEND STÄRKEN gibt (<strong>in</strong> Nie<strong>der</strong>sachsen: Landkreis Diepholz, Landkreis Gött<strong>in</strong>gen,<br />
Landkreis Osnabrück, Landkreis Soltau-Fall<strong>in</strong>gbostel), e<strong>in</strong> durchgängiges, lückenloses und<br />
passgenaues För<strong>der</strong>system für benachteiligte junge Menschen am Übergang von <strong>der</strong> Schule <strong>in</strong> Ausbildung<br />
und Beschäftigung.<br />
In den ausgewählten Modellstandorten soll erprobt werden, welche Rahmenbed<strong>in</strong>gungen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Kommune<br />
gegeben se<strong>in</strong> müssen, um die kommunale Jugendpolitik rund um § 13 Jugendsozialarbeit (SGB<br />
VIII) nachhaltig zu stärken. Die Kommunen werden dabei unterstützt, die Verantwortung für die Koord<strong>in</strong>ierung<br />
und Vernetzung zwischen allen Beteiligten und Angeboten am Übergang von <strong>der</strong> Schule <strong>in</strong><br />
die Ausbildung wie<strong>der</strong> stärker wahrzunehmen. Aus diesem Grund wird das Programm <strong>in</strong> Verantwortung<br />
<strong>der</strong> öffentlichen Jugendhilfe umgesetzt.<br />
In den ausgewählten Städten und Landkreisen soll für die Zielgruppe <strong>der</strong> nicht (mehr) erreichten Jugendlichen<br />
e<strong>in</strong> passgenaues und möglichst lückenloses För<strong>der</strong>system vor Ort am Übergang von <strong>der</strong><br />
Schule <strong>in</strong> Ausbildung und Beschäftigung geschaffen werden, um e<strong>in</strong> „Verlorengehen“ <strong>der</strong> Jugendlichen<br />
zu verh<strong>in</strong><strong>der</strong>n.<br />
Unter zentraler Verantwortung <strong>der</strong> ausgewählten Modellkommunen sollen fehlende Angebote für die<br />
jungen Menschen identifiziert und entwickelt werden. Dies kann z.B. e<strong>in</strong> Angebot <strong>der</strong> Initiative<br />
JUGEND STÄRKEN se<strong>in</strong>, aber auch an<strong>der</strong>e, langfristige und eigenständige Angebote, die <strong>der</strong> Intention<br />
des Modellprogramms - beson<strong>der</strong>s benachteiligte Jugendliche <strong>in</strong>dividuell zu unterstützen - gerecht<br />
werden. Für die notwendige rechtskreisübergreifende Verzahnung zwischen Schule, Jugendamt, Jobcenter,<br />
Arbeitsagentur und weiteren Akteuren haben die Jugendämter geeignete und vor allem verb<strong>in</strong>dliche<br />
Strukturen und Rahmenbed<strong>in</strong>gungen zu schaffen.<br />
Die neu aufgebauten Angebote für die Jugendlichen sollen nach Auslaufen <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung im S<strong>in</strong>ne <strong>der</strong><br />
Nachhaltigkeit möglichst <strong>in</strong> Verantwortung <strong>der</strong> Kommune weitergeführt werden.<br />
Quelle: JUGEND stärken<br />
_______________________________________________________________________________________<br />
34.) Präventionsarbeit – Negative Schlagzeilen schaden e<strong>in</strong>er Imageverbesserung -<br />
Familienfest <strong>in</strong> <strong>der</strong> Drosselstraße<br />
___________________________________________<br />
Es erfolgte e<strong>in</strong>e sehr positive Berichterstattung<br />
über das am 25.06.20<strong>11</strong> von <strong>der</strong> städtischen<br />
Jugendarbeit organisierte „Familienfest <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Drosselstraße“ – gepaart mit sehr negativen<br />
Schlagzeilen basierend auf e<strong>in</strong>er laut Medien<br />
„Massenschlägerei“ nach dem Familienfest wegen<br />
Konflikten unter zugewan<strong>der</strong>ten Familien.<br />
Dass es sich dabei um e<strong>in</strong>en Konflikt unter zwei<br />
Familien handelte, haben die Medien erst später berichtet.<br />
51
Zur Konfliktbewältigung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Drosselstraße<br />
wurde durch das Bundesamt für Migration und<br />
Flüchtl<strong>in</strong>ge das Kooperationsprojekt des<br />
Präventionsrates <strong>der</strong> Stadt Osterholz-Scharmbeck<br />
und des Forums Ziviler Friedensdienst<br />
„Integration för<strong>der</strong>n – Gesellschaftlicher<br />
Zusammenhalt stärken. Kommunale<br />
Konfliktberatung“ für den Zeitraum vom<br />
15.12.20<strong>11</strong> bis 14.12.20<strong>11</strong> mit Mitteln aus dem<br />
Europäischen Integrationsfonds (EIF)<br />
aufgegriffen.<br />
E<strong>in</strong>e externe Evaluation h<strong>in</strong>sichtlich <strong>der</strong> Wirksamkeit sozial-<strong>in</strong>tegrativer Maßnahmen und zur Herausstellung,<br />
welche Projekte krim<strong>in</strong>al-präventiv bedeutend s<strong>in</strong>d, soll zu e<strong>in</strong>er möglichst ganzheitlichen<br />
und auf Dauer angelegten Wirkung führen. In 20<strong>11</strong> durchgeführte Workshops werden vom krim<strong>in</strong>alpsychologischen<br />
Dienst Hannover begleitet.<br />
Projekt-Workshop<br />
25.08.20<strong>11</strong><br />
52
Jugendgewalt - Härtere Strafen lösen Probleme nicht<br />
Psychologen for<strong>der</strong>n mehr Prävention und e<strong>in</strong>en kritischen Blick auf unsere Gesellschaft<br />
Nach den Unruhen <strong>in</strong> London und an<strong>der</strong>en Städten reagierte die britische Regierung mit Härte. Politik<br />
und Justiz setzen auf die abschreckende Wirkung rasch verhängter unverhältnismäßig langer<br />
Haftstrafen. Juristen kritisieren bereits die Unverhältnismäßigkeit <strong>der</strong> Strafen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>igen Fällen und<br />
sehen e<strong>in</strong>e Welle von Berufungsverfahren auf die britische Justiz zukommen. Auch <strong>der</strong><br />
Berufsverband Deutscher Psycholog<strong>in</strong>nen und Psychologen (BDP) warnt vor <strong>der</strong> durchaus nicht auf<br />
britische Bürger beschränkten Illusion, <strong>der</strong> Jugendgewalt durch härtere Bestrafungen Herr zu werden.<br />
Fälle, <strong>in</strong> denen Jugendliche exzessiv gegen Menschen und Sachen vorgehen – e<strong>in</strong>er davon wird gerade<br />
<strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> vier Monate nach <strong>der</strong> Tat auf e<strong>in</strong>em U-Bahnhof, begleitet von großer Medienaufmerksamkeit<br />
verhandelt – rufen jedes Mal Befürworter härterer Strafen auf den Plan und mobilisieren<br />
Kritiker e<strong>in</strong>er angeblichen Kuschelpädagogik. Bei dem Ruf nach härterer Bestrafung wird völlig übersehen,<br />
dass frühe Strafmündigkeit und harte Strafen dort, wo sie seit Jahren praktiziert werden, zu<br />
ke<strong>in</strong>em Erfolg geführt haben. Nun ist <strong>in</strong> Großbritannien, wo K<strong>in</strong><strong>der</strong> bereits mit 10 Jahren strafmündig<br />
s<strong>in</strong>d, die Gewalt beson<strong>der</strong>s eskaliert. "Wer sich durch zehn Jahre Haftstrafe nicht abschrecken lässt,<br />
den bee<strong>in</strong>drucken auch 15 Jahre nicht", so Dr. Anja Kannegießer, Vorstandsmitglied <strong>der</strong> Sektion<br />
Rechtspsychologie im BDP.<br />
Sicher sei dagegen, dass präventive Maßnahmen wirken, die bereits im Vorschulalter e<strong>in</strong>setzen sollten.<br />
Sicher sei auch die positive Wirkung evaluierter sozialer Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gsprogramme und Antiaggressivitätskurse.<br />
Zudem müsse, so Kannegießer, im Jugendstrafvollzug durch sozialtherapeutische Konzepte<br />
stärker auf e<strong>in</strong>e künftige Sozial- und Legalbewährung h<strong>in</strong>gearbeitet werden. Der Gesellschaft<br />
helfe das auf lange Sicht mehr. Statt die Verantwortung für junge Gewalttäter an die Gerichte abzugeben,<br />
sollte sie als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstanden werden. Verme<strong>in</strong>tlich e<strong>in</strong>fache<br />
Lösungen würden nicht den gewünschten Erfolg erzielen.<br />
"Während Strafen häufig Kränkung, Hass, Trotz und Unsicherheit erzeugen und mehrheitlich kaum<br />
abschrecken, bestehe das Ziel von Erziehung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er positiven Hilfestellung zur Entwicklung von<br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong>n und Jugendlichen, so Elisabeth Noeske aus dem Vorstand <strong>der</strong> Sektion Kl<strong>in</strong>ische Psychologie<br />
im BDP. Strafe alle<strong>in</strong> dagegen könne zwar zu vorübergehen<strong>der</strong> Anpassung führen, nicht jedoch zur<br />
Selbstregulation im Prozess des Erwachsenenwerdens. Sie bewirkt, so Noeske, ke<strong>in</strong>e wirklichen Verhaltensän<strong>der</strong>ung<br />
und erschwert eher e<strong>in</strong>en positiven Entwicklungsprozess, statt ihn zu för<strong>der</strong>n. E<strong>in</strong>e<br />
Null-Toleranz-Politik verän<strong>der</strong>e schließlich nicht die Gesellschaft, verh<strong>in</strong><strong>der</strong>e nicht ihren Zerfall und<br />
ignoriere vor allem die eigentlichen Ursachen für Fehlentwicklungen wie Armut, mangelnde Bildung<br />
und Ausson<strong>der</strong>ung unter e<strong>in</strong>er größer werdenden Zahl von Jugendlichen. Nötig sei stattdessen Konfliktbearbeitung<br />
durch e<strong>in</strong>fühlende, gleichzeitig Grenzen setzende Beziehungsarbeit. Jugendliche<br />
sollten Chancen erhalten, sich <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gesellschaft und bei <strong>der</strong> Bearbeitung ihrer Konflikte aktiv zu<br />
erfahren.<br />
Quelle: Berufsverband Deutscher Psycholog<strong>in</strong>nen und Psychologen (BDP)<br />
___________________________________________________________________________________________<br />
35.) „Engagement macht stark“- Woche des<br />
bürgerschaftlichen Engagements 20<strong>11</strong><br />
www.engagement-macht-stark.de<br />
___________________________________________________________________________________________<br />
Vom 16. bis 25. September 20<strong>11</strong> veranstaltet das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement -<br />
BBE die Woche des bürgerschaftlichen Engagements. Seit sieben Jahren ist die Aktionswoche die<br />
53
größte bundesweite Freiwilligenoffensive, die mit dem Motto »Engagement macht stark!« wirbt und<br />
die Arbeit von vielen Millionen Engagierten würdigt.<br />
Seit 2004 organisiert das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement - BBE die bundesweite<br />
Woche des bürgerschaftlichen Engagements, bei <strong>der</strong> sich mittlerweile mehr als 5500 Initiativen,<br />
Vere<strong>in</strong>e, Verbände, Stiftungen, staatliche Institutionen und Unternehmen aktiv beteiligt haben. Ziel<br />
ist es, bürgerschaftliches Engagement <strong>in</strong> all se<strong>in</strong>er Vielfalt und <strong>in</strong> se<strong>in</strong>en unterschiedlichen Formen<br />
öffentlich sichtbar und erfahrbar zu machen. Weitere Anliegen s<strong>in</strong>d, die wichtige Rolle des bürgerschaftlichen<br />
Engagements bei <strong>der</strong> Lösung gesellschaftlicher Probleme sichtbar zu machen und konkrete<br />
Vorschläge für e<strong>in</strong>e engagementför<strong>der</strong>nde Politik aufzuzeigen. Schirmherr <strong>der</strong> diesjährigen<br />
Aktionswoche - sie wird vom Bundesfamilienm<strong>in</strong>isterium geför<strong>der</strong>t - ist Bundespräsident Christian<br />
Wulff. Engagementbotschafter s<strong>in</strong>d wie im letzten Jahr Schauspieler<strong>in</strong> Ulrike Folkerts und Musiker<br />
Peter Maffay.<br />
Während <strong>der</strong> Kampagne wird durch <strong>in</strong>haltliche Schwerpunktsetzungen die Vielfalt des Engagements<br />
hervorgehoben. Die bundesweite Woche bietet Beteiligungsgelegenheiten für potentielle Partner und<br />
Raum für temporäre strategische Allianzen, die allen Mitwirkenden nützen.<br />
Für 20<strong>11</strong> werden außerdem vier spezielle Thementage vorbereitet: Inklusion, Bürgerstiftungen, Europa<br />
und Unternehmensengagement. Zu jedem Thementag s<strong>in</strong>d mit m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>er Partnerorganisation<br />
geme<strong>in</strong>same Aktivitäten im H<strong>in</strong>blick auf öffentlichkeitswirksame Maßnahmen geplant.<br />
Im Rahmen <strong>der</strong> Woche des bürgerschaftlichen Engagements vom 16. bis 25.09.20<strong>11</strong> wird durch e<strong>in</strong>en<br />
„Tag <strong>der</strong> offenen Tür im <strong>Stadtteil</strong>haus „<strong>Haus</strong> <strong>der</strong> <strong>Kulturen</strong> Osterholz-Scharmbeck“ Interessierten<br />
am 22.09.20<strong>11</strong> von 16.00 bis 18.00 Uhr die Gelegenheit gegeben, die vielschichtigen Angebote<br />
kennenzulernen:<br />
• Hilfen zur Integration für Zugewan<strong>der</strong>te<br />
• Unterstützung beim E<strong>in</strong>bürgerungsverfahren<br />
• Deutsch sprechen, lesen & schreiben<br />
• N@tcafe´ für Arbeitssuchende<br />
• „Gebrauchtes-Nützliches-Preiswertes“<br />
• Mittagstisch für BewohnerInnen<br />
• „DabeiSe<strong>in</strong>!“ Servicestelle<br />
• Erziehungs- und Familienberatung<br />
• Familienservice „Elterncafe´“<br />
• Offener Müttertreff<br />
• Treff für Alle<strong>in</strong>erziehende<br />
• Frauenfrühstück<br />
• Jugendtreff „S<strong>in</strong>gen und Musizieren“<br />
• Offener <strong>Stadtteil</strong>treff<br />
• S<strong>in</strong>gende Kochgruppe<br />
• Offene Nähgruppe<br />
• Thailändischer Frauentreff<br />
• Frauengymnastik<br />
• Kultur- und Literatur-Werkstatt<br />
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr<br />
Tel. 04791 / 17353 und 04791 / 8079728<br />
54
_______________________________________________________________________________________<br />
36.) Gymnasiasten beim Ehrenamt vorn -<br />
"Programme für soziales Engagement stärker auf Hauptschüler ausrichten"<br />
_______________________________________________________________________________________<br />
Fast die Hälfte <strong>der</strong> Jugendlichen <strong>in</strong> Deutschland hat sich im vergangenen Jahr ehrenamtlich engagiert.<br />
Dabei zeigen sich allerd<strong>in</strong>gs gravierende Unterschiede zwischen den Bildungsschichten mit zum<br />
Teil problematischen Folgen. Dies belegt e<strong>in</strong>e repräsentative Studie <strong>der</strong> Universität Würzburg.<br />
Prof. He<strong>in</strong>z Re<strong>in</strong><strong>der</strong>s - Bild: Robert Emmerich<br />
Sie organisieren K<strong>in</strong><strong>der</strong>gottesdienste, gehen zur Jugendfeuerwehr o<strong>der</strong> leiten<br />
Pfadf<strong>in</strong><strong>der</strong>gruppen: 44,9 Prozent aller 14- bis 15-Jährigen <strong>in</strong> Deutschland<br />
haben sich im vergangenen Jahr ehrenamtlich engagiert. Das s<strong>in</strong>d<br />
deutlich mehr, als bislang angenommen wurde. Im Durchschnitt war je<strong>der</strong><br />
von ihnen 22 Stunden im Monat aktiv – und das <strong>in</strong> <strong>der</strong> Regel über e<strong>in</strong>en<br />
längeren Zeitraum h<strong>in</strong>weg: Die Hälfte <strong>der</strong> Jugendlichen ist länger als e<strong>in</strong><br />
Jahr dabei. Allerd<strong>in</strong>gs ist ehrenamtliches Engagement nicht gleich verteilt:<br />
Während sich bei Gymnasiasten je<strong>der</strong> Zweite engagiert (50,5 Prozent), ist unter Hauptschülern nur<br />
je<strong>der</strong> dritte Befragte sozial aktiv. Dieses zwiespältige Bild zeichnen die Ergebnisse <strong>der</strong> aktuellen Studie<br />
zu "Jugend. Engagement. Politische Sozialisation." <strong>der</strong> Universität Würzburg.<br />
Soziales Engagement för<strong>der</strong>t demokratisches Bewusstse<strong>in</strong><br />
"Der Unterschied zwischen Gymnasiasten und Hauptschülern lässt sich <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie mit e<strong>in</strong>er größeren<br />
Nähe zum Ehrenamt bei bildungsnahen Familien erklären", erläutert <strong>der</strong> Leiter <strong>der</strong> Studie, Professor<br />
He<strong>in</strong>z Re<strong>in</strong><strong>der</strong>s, den Befund. Problematisch f<strong>in</strong>det Re<strong>in</strong><strong>der</strong>s dies Ergebnis vor allem aus zwei<br />
Gründen. Zum e<strong>in</strong>en: "Wie können zeigen, dass mit sozialem Engagement das Selbstwertgefühl<br />
steigt", so <strong>der</strong> Bildungsforscher. Und somit seien Hauptschüler auch <strong>in</strong> diesem Punkt wie<strong>der</strong> e<strong>in</strong>mal<br />
h<strong>in</strong>ten dran.<br />
Zum zweiten: "Wer sich ehrenamtlich engagiert, ist auch zu demokratischem Handeln bereit", so<br />
Re<strong>in</strong><strong>der</strong>s. Im Vergleich zu Jugendlichen, die ke<strong>in</strong>em Ehrenamt nachgehen, berichten ehrenamtlich<br />
Engagierte sehr viel häufiger, dass sie als Erwachsene bei Landtags- o<strong>der</strong> Bundestagswahlen ihre<br />
Stimme abgeben werden. 63,1 Prozent wollen sich an Landtagswahlen beteiligen, ehrenamtlich nicht<br />
Aktive h<strong>in</strong>gegen nur zu 51 Prozent. Bei Bundestagswahlen beträgt diese Differenz zwischen Engagierten<br />
und Nicht-Engagierten immerh<strong>in</strong> noch zehn Prozentpunkte (69,4 im Vergleich zu 59,4 Prozent).<br />
Dazu passt, dass Jugendliche, die sich <strong>in</strong> ihrer Freizeit für soziale Belange betätigen, sich eher als<br />
"gesellschaftliche Gestalter" erleben. Drei Viertel von ihnen haben das Gefühl, durch ihre Freizeitbeschäftigung<br />
etwas S<strong>in</strong>nvolles zu machen, woh<strong>in</strong>gegen nur etwa e<strong>in</strong> Viertel <strong>der</strong> Nicht- Engagierten<br />
ihrer Freizeit s<strong>in</strong>nvolle Seiten abgew<strong>in</strong>nen können. Knapp e<strong>in</strong> Viertel <strong>der</strong> Engagierten ist überdies <strong>der</strong><br />
Ansicht, <strong>in</strong> <strong>der</strong> Freizeit die Gesellschaft im Kle<strong>in</strong>en verän<strong>der</strong>n zu können. Nur sechs Prozent <strong>der</strong><br />
Nicht- Engagierten teilen diese Ansicht.<br />
Türöffner zur Gesellschaft – vor allem für Gymnasiasten<br />
"Ehrenamt ist bereits bei Jugendlichen e<strong>in</strong> zentraler Zugang zur Gesellschaft", resümiert Re<strong>in</strong><strong>der</strong>s die<br />
Ergebnisse und ergänzt: "Da werden die Hauptschuljugendlichen auch bei diesem Zugang e<strong>in</strong> weiteres<br />
Mal abgehängt." E<strong>in</strong>e Entwicklung, die er bedauert, schließlich för<strong>der</strong>e e<strong>in</strong> Ehrenamt die positive<br />
Entwicklung im Jugendalter.<br />
Re<strong>in</strong><strong>der</strong>s for<strong>der</strong>t daher, Programme für soziales Engagement viel stärker auf diese Zielgruppe auszurichten.<br />
Denn wie die Studie zeige, suchen Hauptschüler deutlich seltener eigenständig e<strong>in</strong> Engagement<br />
als Gymnasiasten. Sie lassen sich eher über Freunde motivieren.<br />
55
Was sie dann noch benötigen, ist e<strong>in</strong> möglichst konkretes Projekt. Und <strong>in</strong>teressant muss es se<strong>in</strong> – das<br />
zum<strong>in</strong>dest wünschen sich 45,4 Prozent <strong>der</strong> Jugendlichen aus Hauptschulen. An<strong>der</strong>s die Gymnasiasten:<br />
Von denen legt nur je<strong>der</strong> Dritte Wert darauf, sich für e<strong>in</strong> "<strong>in</strong>teressantes Projekt" zu engagieren.<br />
Bei Gymnasiasten steht h<strong>in</strong>gegen <strong>der</strong> Spaß ganz oben; den wünschen sich immerh<strong>in</strong> 43,6 Prozent für<br />
ihr Engagement. Im Unterschied zu Hauptschülern, unter denen nur 38 Prozent Wert auf diesen Aspekt<br />
legen. Hauptschüler wollen – wenn sie sich schon ehrenamtlich engagieren – gerne etwas für das<br />
Leben lernen (36,5 Prozent); Gymnasiasten ist dieser Punkt nicht so wichtig – er spielt nur für 24,9<br />
Prozent von ihnen e<strong>in</strong>e Rolle.<br />
Schulen und Verbände besser vernetzen<br />
Bleibt noch die Frage, was Organisationen tun müssen, die Jugendliche als ehrenamtliche Helfer gew<strong>in</strong>nen<br />
wollen. Über ihre Werbung schaffen es karitative Organisationen jedenfalls so gut wie gar<br />
nicht. Gerade e<strong>in</strong>mal je<strong>der</strong> zehnte Befragte gab an, se<strong>in</strong> Engagement wegen solch´ e<strong>in</strong>er Werbung<br />
begonnen zu haben.<br />
E<strong>in</strong>e Schlüsselstellung nehmen h<strong>in</strong>gegen Schulen e<strong>in</strong>. Neben den Freunden (15,5 Prozent) und den<br />
Eltern (13,1 Prozent) bahnen sie den meisten Jugendlichen (21,8 Prozent) den E<strong>in</strong>tritt <strong>in</strong> die Welt des<br />
Ehrenamts, sei es durch die schulische Mitbestimmung o<strong>der</strong> durch <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schule durchgeführte soziale<br />
Projekte. Deshalb mache es S<strong>in</strong>n, Schulen und benachbarte Vere<strong>in</strong>e o<strong>der</strong> Verbände auch <strong>in</strong> Fragen<br />
des sozialen Engagements sehr viel enger zu vernetzen, glaubt Re<strong>in</strong><strong>der</strong>s. "Idealerweise s<strong>in</strong>d <strong>der</strong> Klassenlehrer<br />
und <strong>der</strong> Leiter <strong>der</strong> Jugendfeuerwehr e<strong>in</strong> und dieselbe Person, und falls nicht, sollten sie<br />
schnellstens mite<strong>in</strong>an<strong>der</strong> reden", so Re<strong>in</strong><strong>der</strong>s.<br />
Die e<strong>in</strong>en im Kriegsgebiet - die an<strong>der</strong>en im Ehrenamt<br />
Über die konkreten Befunde <strong>der</strong> Studie h<strong>in</strong>aus rechnet <strong>der</strong> Würzburger Bildungsforscher mit e<strong>in</strong>em<br />
weiteren Effekt, <strong>der</strong> sich <strong>in</strong> den Daten andeute. Durch den Wegfall <strong>der</strong> Wehrpflicht würden vermutlich<br />
vor allem höher gebildete Jugendliche sich nach <strong>der</strong> Schule für e<strong>in</strong> Freiwilligenjahr entscheiden,<br />
woh<strong>in</strong>gegen die f<strong>in</strong>anziellen Anreize <strong>der</strong> Bundeswehr eher Jugendliche mit ger<strong>in</strong>ger Bildung locken<br />
werden. "Die sozial Schwachen werden dann häufiger ihr Leben <strong>in</strong> Kriegsgebieten riskieren, e<strong>in</strong>e Situation,<br />
die aus an<strong>der</strong>en Län<strong>der</strong>n wie den USA bereits bekannt ist".<br />
Umso wichtiger sei es, Hauptschuljugendliche für soziales Engagement zu begeistern. Denn <strong>in</strong>ternationale<br />
Studien zeigen laut Re<strong>in</strong><strong>der</strong>s, dass soziales Engagement im Jugendalter <strong>in</strong> hohem Maße auch<br />
ehrenamtliche Tätigkeiten als Erwachsener vorhersagt.<br />
Die Studie<br />
2.408 Jugendliche im Alter zwischen 14 und 15 Jahren haben die Bildungsforscher im Zeitraum von<br />
Oktober 2010 bis Januar 20<strong>11</strong> für ihre Studie befragt. 84,6 Prozent von ihnen s<strong>in</strong>d deutscher Herkunft.<br />
Die Stichprobe umfasst jeweils zur Hälfte Mädchen (46,9 Prozent) und Jungen (53,1 Prozent).<br />
E<strong>in</strong> Großteil <strong>der</strong> Befragten s<strong>in</strong>d Schüler an Gymnasien (48,1 Prozent); die Realschule besuchen 26,3<br />
Prozent; Hauptschüler stellen e<strong>in</strong>en Anteil von 20,4 Prozent. Die meisten Jugendlichen besuchten<br />
zum Befragungszeitpunkt die 8. bis 10. Klasse (96 Prozent).<br />
Quelle: Universität Würzburg<br />
_______________________________________________________________________________________<br />
37.) Sorge um politische Bildung www.boell.de<br />
__________________________________________________________<br />
Die Vorsitzenden <strong>der</strong> politischen Stiftungen haben dem für die politische<br />
Bildung verantwortlichen Bundes<strong>in</strong>nenm<strong>in</strong>ister Dr. Hans-Peter<br />
Friedrich <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> im Juli 20<strong>11</strong> e<strong>in</strong> Positionspapier zur Politischen<br />
Bildung überreicht, <strong>in</strong> dem sie argumentieren, dass ihre<br />
56
Bildungsarbeit wichtig für die Demokratie <strong>in</strong> Deutschland sei. Derzeit gehe <strong>der</strong> offensichtliche Vertrauensverlust<br />
<strong>in</strong> die Politik e<strong>in</strong>her mit e<strong>in</strong>em abnehmenden Kenntnisstand vieler Menschen über die<br />
Funktionsweise e<strong>in</strong>es demokratischen Systems, warnen die Stiftungen.<br />
Aufgrund ihrer beson<strong>der</strong>en Verantwortung, durch politische Bildung e<strong>in</strong>en Beitrag zur Stärkung und<br />
Weiterentwicklung <strong>der</strong> Demokratie <strong>in</strong> Deutschland zu leisten, haben die Stiftungen (Konrad-<br />
Adenauer-Stiftung, Friedrich-Ebert-Stiftung, Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit, He<strong>in</strong>rich-<br />
Böll-Stiftung, Hanns-Seidel-Stiftung, Rosa-Luxemburg-Stiftung) <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er geme<strong>in</strong>samen Erklärung e<strong>in</strong>e<br />
aktuelle Standortbestimmung zu Zielen, Aufgaben und Grundsätzen <strong>der</strong> Politischen Bildung vorgenommen.<br />
Demokratie sei die e<strong>in</strong>zig freiheitliche Staatsform, damit aber auch e<strong>in</strong>e anspruchsvolle Staatsform.<br />
Aus diesem Grunde müsse sie von je<strong>der</strong> Generation neu erlernt und e<strong>in</strong>geübt werden. Der offensichtliche<br />
Vertrauensverlust <strong>in</strong> die Politik und ihre Institutionen gehe e<strong>in</strong>her mit e<strong>in</strong>em abnehmenden<br />
Kenntnisstand vieler Menschen über die Funktionsweise e<strong>in</strong>es demokratischen Systems. Beides gefährde<br />
auf Dauer die notwendige Teilhabe und verantwortliche politische Mitgestaltung des Geme<strong>in</strong>wesens<br />
durch die Bürger<strong>in</strong>nen und Bürger. Politische Beteiligung setzte also Politische Bildung voraus.<br />
Politische Bildung, so die Stiftungen weiter, müsse nachhaltig angelegt se<strong>in</strong>. Aus e<strong>in</strong>em historischen<br />
Bewusstse<strong>in</strong> heraus solle sie zur Zukunftsgestaltung motivieren und sich <strong>der</strong> aktuellen Themenfel<strong>der</strong><br />
annehmen. Um gerade auch junge Menschen für Politik zu motivieren, nehme sie die Entwicklungen<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> digitalen Welt auf und mo<strong>der</strong>nisiere sich dabei stetig. Ziel <strong>der</strong> Bildungsarbeit <strong>der</strong> Politischen<br />
Stiftungen sei es, den Bürger<strong>in</strong>nen und Bürgern basierend auf den politischen Strömungen <strong>in</strong> Deutschland<br />
Werte und Orientierungsrahmen anzubieten, Grundlagenwissen über politische Themen, über<br />
Entscheidungsverläufe aber auch politisches Rüstzeug zu vermitteln und sie vor allem zur Übernahme<br />
von gesellschaftspolitischer Verantwortung zu befähigen und zu ermutigen.<br />
Dabei gehen die Politischen Stiftungen von e<strong>in</strong>em umfassenden Bildungsbegriff aus: Die berufliche<br />
Aus- und Weiterbildung und die die politische Bildung seien seitens des Staates gleichermaßen zu<br />
för<strong>der</strong>n. Denn e<strong>in</strong>e Demokratie brauche politisch gebildete Bürger<strong>in</strong>nen und Bürger!<br />
Quelle: Böll-Stiftung<br />
_______________________________________________________________________________________<br />
38.) Internetpatenschaften - Patenschaft für Internetneul<strong>in</strong>ge<br />
Zugang zu www.<strong>in</strong>ternet.<strong>in</strong>fo.de auch über www.sozialestadt-netzwerkohz.de<br />
möglich!<br />
______________________________________________________<br />
Noch immer abgehängt: Rund 25 Prozent <strong>der</strong> Deutschen nutzen we<strong>der</strong><br />
beruflich noch privat das Internet.<br />
Natürlich kann man das Ergebnis des (N)ONLINER Atlas 20<strong>11</strong>, Deutschlands größter Studie zur Internetnutzung,<br />
auch positiv ausdrücken: Drei Viertel <strong>der</strong> Deutschen über 14 Jahren s<strong>in</strong>d onl<strong>in</strong>e. Die<br />
Kehrseite ist, dass für knapp 18 Millionen Menschen das Internet immer noch ke<strong>in</strong> selbstverständliches<br />
Medium ist. Sie nutzen das Word Wide Web we<strong>der</strong> beruflich noch privat und s<strong>in</strong>d von den digitalen<br />
Chancen, die das Internet bietet, ausgeschlossen.<br />
57
Bildungsstudie:<br />
Digitale Medien <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schule<br />
Obwohl das vergangene Jahrzehnt auch als digitales Jahrzehnt <strong>in</strong> die<br />
Geschichte e<strong>in</strong>gehen kann, werden digitale Medien im Unterricht noch<br />
immer nicht durchgängig e<strong>in</strong>gesetzt. Bed<strong>in</strong>gt durch den Fö<strong>der</strong>alismus tut<br />
sich das deutsche Bildungssystem schwer, e<strong>in</strong> e<strong>in</strong>heitliches Konzept<br />
aufzustellen, um diese Situation zu än<strong>der</strong>n. Die D21-Bildungsstudie<br />
„Digitale Medien <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schule“ stellt e<strong>in</strong>e Bestandsaufnahme <strong>der</strong> aktuellen IT-Ausstattung und -<br />
Nutzung <strong>in</strong>nerhalb des deutschen Schulsystems dar und zeigt dabei deutlich, <strong>in</strong> welchen Bereichen<br />
beson<strong>der</strong>er Nachholbedarf herrscht.<br />
Für viele kaum vorstellbar, aber e<strong>in</strong>em Teil <strong>der</strong> Bevölkerung ist es nicht möglich, e<strong>in</strong>fache Informationen<br />
wie Fahrpläne, K<strong>in</strong>o- und Theaterprogramme, günstige Händlerangebote über das Internet zu<br />
f<strong>in</strong>den o<strong>der</strong> per E-Mail Kontakt zu Freunden und Verwandten aufzunehmen. Beson<strong>der</strong>s betroffen s<strong>in</strong>d<br />
ältere Menschen, die nicht mehr berufstätig s<strong>in</strong>d und über e<strong>in</strong> ger<strong>in</strong>ges E<strong>in</strong>kommen verfügen.<br />
Ehrenamtliches Engagement als Internet-Pat<strong>in</strong> und Internet-Pate eröffnet e<strong>in</strong>en neuen und unkomplizierten<br />
Weg zur Internetnutzung. Mit dem Programm "Internet-Pat<strong>in</strong>nen und -Paten: Erfahrung teilen"<br />
<strong>der</strong> Initiative "Internet erfahren" des Bundesm<strong>in</strong>isteriums für Wirtschaft und Technologie ermutigt<br />
und unterstützt das Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V. Netzerfahrene dabei,<br />
e<strong>in</strong>e Internet-Patenschaft zu übernehmen und zu gestalten.<br />
Mitmachen kann je<strong>der</strong>, <strong>der</strong> Spaß am Internet hat und sich gerne für an<strong>der</strong>e<br />
engagiert. Interessierte erhalten e<strong>in</strong> umfangreiches Informationspaket zur<br />
Gestaltung ihrer Internet-Patenschaft und können e<strong>in</strong>en Onl<strong>in</strong>e-Lernraum<br />
mit Lerne<strong>in</strong>heiten und praktischen Übungen nutzen:<br />
www.<strong>in</strong>ternetpaten.<strong>in</strong>fo/lernraum .<br />
Weitere Informationen zum Internet-Patenprogramm unter:<br />
www.<strong>in</strong>ternetpaten.<strong>in</strong>fo .<br />
Die gesamte Studie (N)ONLINER Atlas 20<strong>11</strong> <strong>der</strong> Initiative D21 ist zum Herunterladen hier zu f<strong>in</strong>den:<br />
www.nonl<strong>in</strong>er-atlas.de<br />
Internet-Pat<strong>in</strong> werden! Internet-Pate werden!<br />
Sie haben Spaß am Internet? Sie engagieren sich gern für an<strong>der</strong>e? Dann br<strong>in</strong>gen Sie diese Leidenschaften<br />
doch zusammen und werden <strong>in</strong> unserem Programm aktiv. Jede und je<strong>der</strong> kann mitmachen.<br />
Sie haben Interesse? Wir unterstützen Sie gerne mit unseren Angeboten auf diesen Internetseiten mit<br />
Erfahrungsberichten von Internet-Pat<strong>in</strong>nen und -Paten <strong>in</strong> >Onl<strong>in</strong>e-Tagebüchern, mit unseren Lernangeboten<br />
im >Lernraum, mit Tipps und H<strong>in</strong>weisen <strong>in</strong> unserem >Leitfaden zur Internet-Patenschaft<br />
und weiteren >Materialien und >Surftipps . Ihren Internetneul<strong>in</strong>g f<strong>in</strong>den Sie sicher <strong>in</strong> Ihrem privaten<br />
o<strong>der</strong> beruflichen Umfeld. So geht's!<br />
www.<strong>in</strong>ternetpaten.<strong>in</strong>fo.de<br />
58
_______________________________________________________________________________________<br />
39.) Übersicht: Ständige Angebote <strong>in</strong> <strong>der</strong> Sozialen Stadterneuerung<br />
___________________________________________________________________________________<br />
Angebote „<strong>Stadtteil</strong>arbeit“ ab August 20<strong>11</strong><br />
*) <strong>Stadtteil</strong>haus „<strong>Haus</strong> <strong>der</strong> <strong>Kulturen</strong> Osterholz-Scharmbeck“ *) <strong>Stadtteil</strong>büro <strong>in</strong> <strong>der</strong> Drosselstraße 7 *) an<strong>der</strong>e Standorte<br />
ANGEBOTE<br />
Sprechzeiten des « Soziale Stadt »<br />
Sanierungsträgers BauBeCon<br />
> <strong>Stadtteil</strong>büro Drosselstraße<br />
N@tcafe´- Gohar Cirak<br />
> <strong>Stadtteil</strong>haus – <strong>Haus</strong> <strong>der</strong> <strong>Kulturen</strong><br />
Frauenfrühstück - Brigitte Schikulski<br />
> <strong>Stadtteil</strong>haus – <strong>Haus</strong> <strong>der</strong> <strong>Kulturen</strong><br />
Hilfen zur Integration von Zugewan<strong>der</strong>ten<br />
- Brigitte Schikulski<br />
> <strong>Stadtteil</strong>haus, <strong>Stadtteil</strong>büro<br />
Deutschsprachkurs<br />
- Valent<strong>in</strong>a Skorobogatow<br />
> <strong>Stadtteil</strong>haus, <strong>Stadtteil</strong>büro<br />
Erziehungs- &Familienberatung<br />
„Erziehung & Entwicklung von<br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong>n“ - Birgit Friedrichs / SOS-<br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong>drof e.V.<br />
> <strong>Stadtteil</strong>haus – <strong>Haus</strong> <strong>der</strong> <strong>Kulturen</strong><br />
Elterncafe´ des Familienservice<br />
- Susanne Kampmann<br />
> <strong>Stadtteil</strong>haus – <strong>Haus</strong> <strong>der</strong> <strong>Kulturen</strong><br />
Offener Müttertreff - Gohar Cirak<br />
> <strong>Stadtteil</strong>haus – <strong>Haus</strong> <strong>der</strong> <strong>Kulturen</strong><br />
Mittagstisch für BewohnerInnen<br />
> <strong>Stadtteil</strong>haus – <strong>Haus</strong> <strong>der</strong> <strong>Kulturen</strong><br />
Anmeldungen im <strong>Stadtteil</strong>haus<br />
MONTAG<br />
14.30 – 17.30<br />
<strong>Stadtteil</strong>büro<br />
8.00 – 14.15<br />
10.30 - 12.30<br />
ab 04. April<br />
20<strong>11</strong><br />
je. 1. Montag<br />
12.00 – 12.45<br />
DIENSTAG<br />
8.00 – 14.15<br />
9.00 – <strong>11</strong>.30<br />
<strong>Stadtteil</strong>haus –<br />
<strong>Haus</strong> <strong>der</strong> <strong>Kulturen</strong><br />
9.00 - <strong>11</strong>.15<br />
<strong>Stadtteil</strong>haus –<br />
<strong>Haus</strong> <strong>der</strong> <strong>Kulturen</strong><br />
12.00 – 12.45<br />
59<br />
MITTWOCH<br />
8.00 – 14.15<br />
9.00 – <strong>11</strong>.30<br />
<strong>Stadtteil</strong>büro<br />
9.00 - <strong>11</strong>.15<br />
<strong>Stadtteil</strong>büro<br />
10.00 –<br />
<strong>11</strong>.30<br />
je. 1. u. 3.<br />
Mittw.<br />
10.00 –<br />
12.00<br />
je. 2. u. 4.<br />
Mittw.<br />
12.00 –<br />
12.45<br />
DONNERSTAG<br />
8.00 – 14.15<br />
10.00 – 12.30<br />
<strong>Stadtteil</strong>haus –<br />
<strong>Haus</strong> <strong>der</strong> <strong>Kulturen</strong><br />
10.00 - 12.15<br />
<strong>Stadtteil</strong>haus –<br />
<strong>Haus</strong> <strong>der</strong> <strong>Kulturen</strong><br />
12.00 – 12.45<br />
FREITAG<br />
10.00 –<br />
12.00<br />
Frauenfrühstück<br />
nach<br />
Ankündigung<br />
1 x im<br />
Monat<br />
9.00 –<br />
<strong>11</strong>.30<br />
<strong>Stadtteil</strong>büro<br />
9.00 -<br />
<strong>11</strong>.15<br />
<strong>Stadtteil</strong>büro<br />
SA. / SO.
Mittagstisch für SchülerInnen<br />
> <strong>Stadtteil</strong>haus – <strong>Haus</strong> <strong>der</strong> <strong>Kulturen</strong><br />
Anmeldungen Beethovenschule<br />
Offener <strong>Stadtteil</strong>treff – N<strong>in</strong>a Dick<br />
> <strong>Stadtteil</strong>haus – <strong>Haus</strong> <strong>der</strong> <strong>Kulturen</strong><br />
Die S<strong>in</strong>gende Kochgruppe<br />
- N<strong>in</strong>a Dick<br />
> <strong>Stadtteil</strong>haus – <strong>Haus</strong> <strong>der</strong> <strong>Kulturen</strong><br />
Frauen-Gymnastikgruppe<br />
- Krist<strong>in</strong>a Karich<br />
> <strong>Stadtteil</strong>haus – <strong>Haus</strong> <strong>der</strong> <strong>Kulturen</strong><br />
Jugendtreff - "Jugend musiziert"<br />
- N<strong>in</strong>a Dick, Svetoslav Krasnov<br />
> <strong>Stadtteil</strong>haus – <strong>Haus</strong> <strong>der</strong> <strong>Kulturen</strong><br />
Englischsprachkurs für Migrant<strong>in</strong>nen<br />
- Olga Zhemchuzh<strong>in</strong>a, Bildungsvere<strong>in</strong>igung<br />
Arbeit & Leben<br />
> <strong>Stadtteil</strong>haus - <strong>Haus</strong> <strong>der</strong> <strong>Kulturen</strong><br />
Treff für Alle<strong>in</strong>erziehende mit<br />
(beh<strong>in</strong><strong>der</strong>tem) K<strong>in</strong>d<br />
- Brigitte Schikulski<br />
> <strong>Stadtteil</strong>haus – <strong>Haus</strong> <strong>der</strong> <strong>Kulturen</strong><br />
Offene <strong>Stadtteil</strong>bibliothek<br />
mit versch. Ansprechpartnern<br />
> <strong>Stadtteil</strong>haus – <strong>Haus</strong> <strong>der</strong> <strong>Kulturen</strong><br />
Literatur- und Kulturwerkstatt<br />
mit <strong>der</strong> Nähgruppe - Lilia Mohr<br />
> <strong>Stadtteil</strong>haus – <strong>Haus</strong> <strong>der</strong> <strong>Kulturen</strong><br />
„Mütter-Kochgruppe – We are<br />
Family“ - Familienservice- Angebot<br />
– Katr<strong>in</strong> Speer u. Maike Buchala<br />
> <strong>Stadtteil</strong>haus – <strong>Haus</strong> <strong>der</strong> <strong>Kulturen</strong><br />
Thailändische Frauengruppe<br />
- Paveena Preckel & Rablana Ernst<br />
> <strong>Stadtteil</strong>haus – <strong>Haus</strong> <strong>der</strong> <strong>Kulturen</strong><br />
Dom<strong>in</strong>o-Projekt <strong>der</strong> SOS-<br />
Beratungsstelle für Migrant<strong>in</strong>nen<br />
– Frau Adziz<br />
> Geme<strong>in</strong>dehaus St. Willehadi<br />
Jugendtreff „<strong>Haus</strong> Mozartstraße<br />
- Streetworker, Ralf Sußner<br />
- 12rounds, Daniela Haak<br />
> Geme<strong>in</strong>schaftshaus Mozartstraße<br />
Fahrradwerkstatt<br />
- Waldemar Dau, Alexan<strong>der</strong> Karsten,<br />
Stefan Karsten<br />
> Garage <strong>in</strong> <strong>der</strong> Mozartstraße<br />
*) Än<strong>der</strong>ungen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Zeit s<strong>in</strong>d noch<br />
möglich<br />
13.00 – 13.45<br />
12.00 – 15.00<br />
14.00 - 16.00<br />
8.00 - 16.00<br />
BoxGym Am<br />
Pumpelberg<br />
18.00 - 19.30<br />
13.00 – 13.45<br />
12.00 – 18.00<br />
8.00 - 16.00<br />
15.00 – 18.00<br />
15.30 – 17.30<br />
Term<strong>in</strong>e Sept. /<br />
Okt. werden<br />
noch bekannt<br />
gegeben<br />
15.00 – 18.00<br />
je. 2. und 4.<br />
Dienstag<br />
18.30 - 20.3 0<br />
9.00 – <strong>11</strong>.00<br />
gerade Woche<br />
16.00 – 18.00<br />
ungerade Woche<br />
60<br />
13.00 –<br />
13.45<br />
12.00 –<br />
18.00<br />
14.00 –<br />
18.00<br />
16.30 -<br />
18.00<br />
8.00 – 16.00<br />
<strong>11</strong>.00 –<br />
15.00<br />
16.00 –<br />
18.00<br />
9.00 – <strong>11</strong>.00<br />
gerade Woche<br />
16.00 –<br />
18.00<br />
ungerade<br />
Woche<br />
13.00 – 13.45<br />
12.00 – 18.00<br />
15.00 - 17.00<br />
17.30 - 18.00<br />
8.00 – 16.00<br />
<strong>11</strong>.00 - 14.00<br />
16.00 – 18.00<br />
9.00 – <strong>11</strong>.00<br />
gerade Woche<br />
16.00 – 18.00<br />
ungerade<br />
Woche<br />
10.00 –<br />
14.00<br />
14.00 -<br />
16.00<br />
10.00 -<br />
16.00<br />
10.00 -<br />
14.00<br />
18.00 -<br />
20.00
___________________________________________________________________________________________<br />
40.) Wettbewerb: Deutscher Schulpreis 2012 - Dem Lernen Flügel verleihen!<br />
____________________________________________________________________<br />
Der Deutsche Schulpreis zeichnet diejenigen Schulen aus, die für Lernen begeistern und zu Orten des<br />
Staunens werden; Schulen, die Kreativität freisetzen, Lust an Leistungen entstehen lassen, Lebensfreude<br />
und Lebensmut stärken und zu Fairness und Verantwortung erziehen. Gesucht werden Schulen,<br />
die mit ihren Ideen und Konzepten öffentlich und bundesweit Vorbil<strong>der</strong> für Schulentwicklung <strong>in</strong><br />
Deutschland se<strong>in</strong> wollen.<br />
Beteiligen können sich alle Schulen aus Deutschland; berufliche Schulen können sich bewerben, wenn<br />
sie allgeme<strong>in</strong>bildende Abschlüsse vergeben und als Vollzeitschule organisiert s<strong>in</strong>d. Der Deutsche<br />
Schulpreis ist mit 100.000 Euro ausgestattet. Vier weitere Schulen erhalten Preise <strong>in</strong> Höhe von jeweils<br />
25.000 Euro. Zusätzlich wird <strong>der</strong> „Preis <strong>der</strong> Jury“ verliehen, <strong>der</strong> ebenfalls mit 25.000 Euro dotiert<br />
ist. Alle weiteren nom<strong>in</strong>ierten Schulen erhalten Anerkennungspreise <strong>in</strong> Höhe von je 2.000 Euro.<br />
Die Regionalteams unterstützen <strong>in</strong>teressierte Schulen im Bewerbungsprozess<br />
www.schulpreis.bosch-stiftung.de<br />
____________________________________________________________________<br />
41.) Urteile<br />
________________________________________________________________________<br />
Urteil zur Lernmittelfreiheit erstreckt sich auch auf Kopien<br />
Öffentliche Schulen können von Eltern und Schülern ke<strong>in</strong> Kopiergeld verlangen. "Die <strong>in</strong> <strong>der</strong> Sächsischen<br />
Verfassung garantierte Lernmittelfreiheit erstreckt sich auch auf Kopien aus Schul- und Arbeitsbüchern<br />
sowie Lern- und Übungsheften. Die Schulen s<strong>in</strong>d verpflichtet, Schülern diese Kopien unentgeltlich zur<br />
Verfügung zu stellen", gab das Verwaltungsgericht Dresden am 6. Juli bekannt. E<strong>in</strong> entsprechendes Urteil<br />
fiel bereits am 30. Juni.<br />
Die Geme<strong>in</strong>de Königswartha hatte gegen die Mutter dreier Schüler geklagt, die ihre Rechnungen über<br />
Kopierkosten nicht bezahlt hatte. Die Geme<strong>in</strong>de sah die Lernmittelfreiheit auf die "notwendigen Schulbücher"<br />
beschränkt. Die Richter folgten dieser Auffassung nicht und def<strong>in</strong>ierten Lernmittel viel weiter. Auch<br />
für den Unterricht benötigte Werkstoffe, Taschenrechner o<strong>der</strong> Musik<strong>in</strong>strumente gehörten dazu. (Az: 5 K<br />
1790/08) Quelle: dpa-Dossier Bildung Forschung <strong>Nr</strong>. 30/20<strong>11</strong><br />
Urteil zu Hartz IV-E<strong>in</strong> Euro-Jobs: Nachträglich voller Lohn<br />
Zahlreiche E<strong>in</strong>-Euro-Jobber können von ihrer Hartz IV-Behörde e<strong>in</strong>e satte Nachzahlung für Jobs ab<br />
2008 verlangen. Voraussetzung: Es handelte sich nicht wie vorgeschrieben um zusätzliche Arbeit und<br />
die Betroffenen haben Wi<strong>der</strong>spruch e<strong>in</strong>gelegt und geklagt. Laut Bundesrechnungshof gilt das für etwa<br />
die Hälfte aller E<strong>in</strong>-Euro-Jobs.<br />
Herausgeber:<br />
Stadt Osterholz-Scharmbeck<br />
Gleichstellung und Integration<br />
Kar<strong>in</strong> Wilke<br />
Rathausstraße 1, 277<strong>11</strong> Osterholz-Scharmbeck<br />
Tel.: 04791 / 17353, Fax.: 04791 / 1744353<br />
Mail: wilke@osterholz-scharmbeck.de<br />
Internet : www.osterholz-scharmbeck.de<br />
www.sozialestadt-netzwerk-ohz.de<br />
-----------------------------------------------------------<br />
61