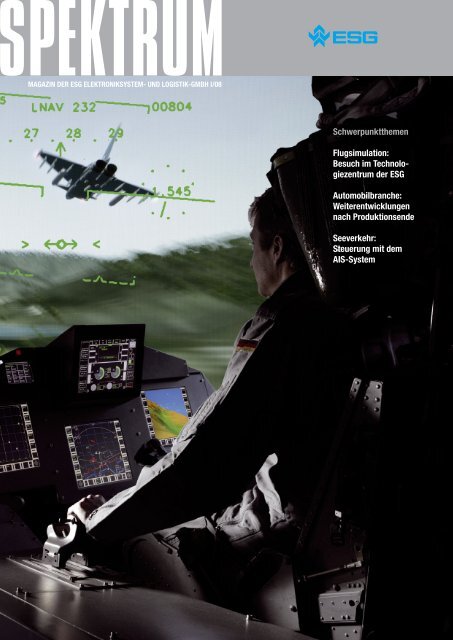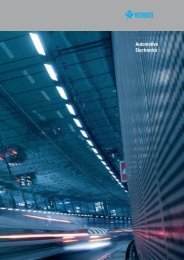Schwerpunktthemen Flugsimulation: Besuch im Technolo ... - ESG
Schwerpunktthemen Flugsimulation: Besuch im Technolo ... - ESG
Schwerpunktthemen Flugsimulation: Besuch im Technolo ... - ESG
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
MAGAZIN DER <strong>ESG</strong> ELEKTRONIKSYSTEM- UND LOGISTIK-GMBH I/08<br />
<strong>Schwerpunktthemen</strong><br />
<strong>Flugs<strong>im</strong>ulation</strong>:<br />
<strong>Besuch</strong> <strong>im</strong> <strong>Technolo</strong>giezentrum<br />
der <strong>ESG</strong><br />
Automobilbranche:<br />
Weiterentwicklungen<br />
nach Produktionsende<br />
Seeverkehr:<br />
Steuerung mit dem<br />
AIS-System
2 & 3 SPEKTRUM I/08<br />
Die Informationstechnologie- und<br />
Telekommunikationsbranche ist ein<br />
bedeutender Wirtschaftsfaktor. In<br />
unserem Land erwirtschaften rund<br />
750.000 Menschen einen Umsatz<br />
von geschätzten 134 Milliarden Euro<br />
– Tendenz steigend.<br />
Die Branche ist dabei in Deutschland<br />
besonders stark von kleinen<br />
und mittelständischen Unternehmen<br />
geprägt: Neun von zehn ITK-Firmen<br />
kommen aus den Reihen dieser<br />
KMUs. Sie sind ein Motor für Innovationen<br />
und bilden eine Brücke zwischen<br />
Wissenschaft und den Erfordernissen<br />
des Marktes. Das Bundesforschungsministerium hat die herausragende Bedeutung<br />
der KMUs zum Anlass genommen, in einer Hightech-Offensive sowohl den<br />
ITK-Markt als auch den Mittelstand besonders zu fördern.<br />
Unter den Themen, denen das Ministerium besondere Zukunftschancen<br />
einräumt, stehen an den ersten vier Stellen ausgesprochene Kompetenzthemen<br />
der <strong>ESG</strong>: Eingebettete Systeme, IT-Sicherheit, Fragen der Mensch-Maschine-Schnittstellen<br />
sowie „s<strong>im</strong>ulierte Realität“. Zu all diesen Punkten konnten Sie<br />
in den letzten Jahren regelmäßig Beiträge in unserer Unternehmenszeitschrift<br />
lesen. Dem Thema S<strong>im</strong>ulation haben wir die aktuelle Titelgeschichte gewidmet.<br />
Die <strong>ESG</strong> ist für die Zukunft also gut aufgestellt und wir haben uns für das<br />
laufende Jahr viel vorgenommen: Zusammen mit unseren Tochterunternehmen<br />
werden wir erstmals die Marke von 200 Millionen Euro Umsatz <strong>im</strong> Jahr erreichen<br />
und dabei so viele Mitarbeiter beschäftigen wie nie zuvor. Schon jetzt arbeiten<br />
über 1200 Menschen bei der <strong>ESG</strong>-Gruppe an ihren Standorten in Deutschland,<br />
Frankreich und den USA.<br />
Wir kommen also dem Ziel, „führendes international operierendes System-<br />
und Softwarehaus für Entwicklungs- und Serviceprozesse softwareintensiver,<br />
komplexer, technologisch hochwertiger und sicherheitsrelevanter Produkte“ (wie<br />
es in der Mission der <strong>ESG</strong> an zentraler Stelle heißt), ein ganzes Stück näher. Auch<br />
eine aktuelle Studie bescheinigt der <strong>ESG</strong> dabei, auf dem richtigen Weg zu sein. In<br />
der Untersuchung „Corporate Foresight <strong>im</strong> Mittelstand“, von der Z_punkt GmbH<br />
kürzlich mit Unterstützung des Bundesforschungsministeriums durchgeführt,<br />
heißt es, unser Unternehmen zeichne sich durch eine hohe Kunden- und Innovationsorientierung<br />
aus und verfüge über eine beispielhafte Zukunftsstrategie zur<br />
Definition künftiger Trends und Themen (vgl. Meldung auf Seite 13).<br />
Die aktuelle Ausgabe des Magazins Spektrum stellt Ihnen wieder einige dieser<br />
Zukunftsthemen vor. Ich wünsche Ihnen bei der Lektüre viel Vergnügen.<br />
Gerhard Schempp,<br />
<strong>im</strong> März 2008<br />
INHALTSVERZEICHNIS<br />
3 ............................................<br />
6 ............................................<br />
7 ............................................<br />
8 ............................................<br />
10 ..........................................<br />
12..........................................<br />
15..........................................<br />
IMPRESSUM<br />
Herausgeber<br />
Verantwortlich für den Inhalt<br />
Mitarbeiter dieser Ausgabe<br />
Gestaltung<br />
Druck<br />
Auflage<br />
Fotos<br />
Experte für <strong>Flugs<strong>im</strong>ulation</strong><br />
Das <strong>ESG</strong>-<strong>Technolo</strong>giezentrum zählt dank<br />
vernetzter S<strong>im</strong>ulationslösungen zu den<br />
modernsten seiner Art.<br />
Missionserfüllung <strong>im</strong> Team<br />
Ein <strong>Technolo</strong>gievorhaben untersucht den<br />
koordinierten Einsatz bemannter und<br />
unbemannter Flugobjekte.<br />
Impulse für die „EOP-Phase“<br />
Warum <strong>im</strong> Automobilbau auch nach<br />
dem Produktionsende eines Modells<br />
weiterentwickelt werden muss.<br />
Kollisionen auf See verhindern<br />
„AIS – Deutsche Küste“ wird die Sicherheit<br />
und das Flottenmanagement <strong>im</strong><br />
Schiffsverkehr deutlich verbessern.<br />
„Die Vision verwirklicht sich.“<br />
Ein Jahr nach ihrer Gründung hat sich<br />
die <strong>ESG</strong> Consulting GmbH gut am Markt<br />
etabliert.<br />
Kurzmeldungen<br />
Neuigkeiten aus dem Unternehmensverbund<br />
<strong>ESG</strong> International<br />
English Summary<br />
<strong>ESG</strong> Elektroniksystem- und Logistik-GmbH<br />
Livry-Gargan-Straße 6, 82256 Fürstenfeldbruck<br />
Tel. +49 (89) 9216 2850, www.esg.de<br />
Jörg Riedle (jr), Unternehmenskommunikation<br />
Manuela Dreger (md), Friedrich Eitelberg (fe),<br />
Thomas Schön (ts), Dr. Sonja Sulzmaier (ss),<br />
Mathias Huber, <strong>ESG</strong>-Grafik-Abteilung<br />
F-Media Druck GmhH, Kirchhe<strong>im</strong>/He<strong>im</strong>stetten<br />
2800<br />
Alle Abbildungen © <strong>ESG</strong>, wenn nicht anders<br />
angegeben. Umschlagbild: <strong>ESG</strong>-Archiv
Experte für <strong>Flugs<strong>im</strong>ulation</strong><br />
In ihrem <strong>Technolo</strong>giezentrum<br />
verfügt<br />
die <strong>ESG</strong> über eine<br />
deutschlandweit<br />
einmalige S<strong>im</strong>ulationslandschaft<br />
Angeblich bestand der erste Flugs<strong>im</strong>ulator<br />
aus Orgelteilen: Ende der<br />
1920er Jahre baute der damals<br />
25-jährige Mechaniker Edwin Link in<br />
der Musikinstrumentenfabrik seines<br />
Vaters <strong>im</strong> US-Bundesstaat New York<br />
eine Maschine, mit der Piloten die Bedienung<br />
von Flugzeugen üben konnten.<br />
Der erste „Link-Trainer“ bestand<br />
aus einem Cockpitnachbau, der auf<br />
einer beweglichen Plattform vor einer<br />
Kinoleinwand gelagert war. Er war<br />
auf drei Achsen beweglich und konnte<br />
Vibrationen übertragen, für das echte<br />
Fluggefühl sollte ein Ventilator sorgen,<br />
der vor dem Aufbau stand und „Gegenwind“<br />
erzeugte.<br />
Rund 80 Jahre sind seither vergangen.<br />
Aus den ersten einfachen<br />
Aufbauten sind längst hochkomplexe<br />
Systeme geworden, ohne die in der<br />
Im <strong>Technolo</strong>giezentrum der <strong>ESG</strong>: S<strong>im</strong>ulator für eine künftige<br />
Boden-Kontroll-Station zur Steuerung unbemannter Flugobjekte.<br />
militärischen und zivilen Luftfahrt<br />
nichts mehr geht. Ob zur kostengünstigen<br />
und zeitsparenden Entwicklung<br />
neuer System und Funktionalitäten,<br />
zur Ausbildung von Piloten und<br />
technisch-logistischem Personal oder<br />
zu Trainingszwecken – die Nutzungsmöglichkeiten<br />
für S<strong>im</strong>ulatoren sind<br />
vielfältig.<br />
Seit über zwei Jahrzehnten entwickelt<br />
und betreibt die <strong>ESG</strong> S<strong>im</strong>ulatoren<br />
für den Luftfahrtbereich. Im<br />
neuen <strong>Technolo</strong>giezentrum in der<br />
Fürstenfeldbrucker Firmenzentrale<br />
ist ein eindrucksvoller Querschnitt<br />
verschiedener S<strong>im</strong>ulatoren zu sehen.<br />
Auf über tausend Quadratmetern Fläche<br />
können zurzeit unter anderem die<br />
Hubschrauber CH-53 und TIGER sowie<br />
die Flugzeuge TORNADO, EURO-<br />
FIGHTER und ein Transportflugzeug<br />
„geflogen“ werden. An diesen Systemen<br />
finden beispielsweise Testreihen<br />
zur Mensch-Maschine-Schnittstelle<br />
und Funktionen eines intelligenten<br />
Unterstützungssystems für den Piloten,<br />
quasi eines elektronischen Co-<br />
Piloten, statt. Außerdem werden Versuche<br />
zur Verbundoperation eines<br />
unbemannten, mit Sensoren ausgestatteten<br />
Luftfahrzeugs mit einem<br />
Hubschrauber durchgeführt. Und am<br />
CH-53-S<strong>im</strong>ulator testen die Experten<br />
der <strong>ESG</strong> zusammen mit Piloten der<br />
Bundeswehr, die bereits Erfahrungen<br />
mit Staublandungen gemacht haben,<br />
zurzeit neuartige Sensoren und Anzeigekomponenten<br />
zur Unterstützung der<br />
Crew bei schwierigen Landungen.<br />
Die meisten Aufbauten wurden<br />
bereits in der alten Firmenzentrale in<br />
München intensiv genutzt. Der Um-
4 & 5 SPEKTRUM I/08<br />
zug des Unternehmens nach Fürstenfeldbruck<br />
Ende 2007 eröffnete der<br />
<strong>ESG</strong> nun die Möglichkeit, die einzelnen<br />
S<strong>im</strong>ulatoren in ein hochmodernes<br />
High-Tech-Umfeld zu integrieren. Entstanden<br />
ist dabei eine einmalige S<strong>im</strong>ulationslandschaft,<br />
die zu den modernsten<br />
in ganz Deutschland gehört.<br />
Für die Hubschraubers<strong>im</strong>ulation<br />
wurde zum Beispiel ein völlig<br />
neues Sichtsystem installiert. Es ermöglicht<br />
den Piloten einen fast natürlichen<br />
Sehbereich – S<strong>im</strong>ulatorflüge<br />
können dadurch deutlich realistischer<br />
als bisher durchgeführt werden. Die<br />
Cockpitaufbauten stehen <strong>im</strong> Zentrum<br />
einer Projektionsleinwand mit sieben<br />
Metern Durchmesser, die einen Sehbereich<br />
von 240 Grad horizontal und<br />
von 70 Grad in der Vertikale (davon<br />
45 Grad nach unten) bietet. Um für<br />
den vier Meter hohen Halbdom genug<br />
Platz zu haben, wurde speziell ein<br />
Technikraum mit doppelter Raumhöhe<br />
gebaut.<br />
Insgesamt sieben Projektoren erzeugen<br />
ein sehr realistisches Bild<br />
der Flugumgebung ohne erkennbare<br />
Übergänge. Beliebige Witterungsverhältnisse<br />
mit Nebel, Wolken, Regen<br />
oder Schnee sowie tageszeitabhängige<br />
Lichtverhältnisse können dargestellt<br />
werden. Zu diesem realistischen<br />
Eindruck tragen auch die hoch detaillierten<br />
Datenbasen bei, die seit mehr<br />
als zehn Jahren von der <strong>ESG</strong> erstellt<br />
werden. Diese Datenbasen beruhen<br />
auf Geländedaten und werden auf die<br />
spezifischen Erfordernisse einer s<strong>im</strong>ulierten<br />
Mission zugeschnitten.<br />
Damit nicht nur ein einziger Cockpits<strong>im</strong>ulator<br />
von der Domprojektion<br />
profitiert, hat die <strong>ESG</strong> <strong>im</strong> Zuge des<br />
Neubaus ein so genanntes „Roll-On-<br />
Roll-Off-Konzept“ realisiert. Verschiedene<br />
S<strong>im</strong>ulatoren wurden als bewegliche<br />
Aufbauten konzipiert. Sie können<br />
innerhalb von nur zwei Stunden <strong>im</strong><br />
Dom platziert werden. Hierzu wurde<br />
eine standardisierte Schnittstelle ge-<br />
Ein Hubschrauber CH-53 wirbelt bei der Landung in Afghanistan eine<br />
große Staubwolke auf. Experten der <strong>ESG</strong> arbeiten daran, Situationen wie<br />
diese künftig sicherer zu machen. Foto: 2007 Bundeswehr/PRZ Kunduz<br />
schaffen, über die Cockpits mit dem<br />
Sichtsystem und der zugehörigen Bedien-<br />
und Kontrollstation verbunden<br />
werden.<br />
Das modulare Konzept der S<strong>im</strong>ulationslandschaft<br />
<strong>im</strong> <strong>Technolo</strong>giezentrum<br />
geht noch einen Schritt weiter.<br />
Die Anlagen der <strong>ESG</strong> sind nicht als<br />
Insellösungen konzipiert, sondern miteinander<br />
vernetzt. So können komplexere<br />
Untersuchungen, die taktische<br />
Szenarien mit mehreren Hubschrauber-<br />
oder Flugzeugtypen voraussetzen,<br />
bei der <strong>ESG</strong> erfolgen. Die S<strong>im</strong>ulationsumgebung<br />
erlaubt verbundene<br />
Operationen und Spezialeinsätze und<br />
deckt damit einen wesentlichen Teil<br />
von Einsätzen der Vernetzten Operationsführung<br />
ab.<br />
Zusätzlich ist auch eine externe<br />
Vernetzung möglich: So nahmen<br />
mehrere S<strong>im</strong>ulatoren der <strong>ESG</strong>, etwa<br />
für den Hubschrauber TIGER und für<br />
den EUROFIGHTER, an der Übung<br />
VIRTEL 2007 teil. Ende November<br />
2007 wurden dabei über ein S<strong>im</strong>ulationsnetzwerk,<br />
das rund 50 Teilnehmer<br />
in ganz Deutschland umfasste,<br />
komplexe militärische Missionen mit<br />
Einsätzen zu Wasser, zu Lande und<br />
in der Luft s<strong>im</strong>uliert. Zur Kopplung<br />
realer Systeme mit den S<strong>im</strong>ulatoren<br />
und zur Kopplung von Führungsinformations-<br />
und S<strong>im</strong>ulationssystemen<br />
untereinander steuerte die <strong>ESG</strong><br />
ihre Softwarekomponenten „C2S<strong>im</strong>-<br />
Proxy“ und „MIP“ bei. Außerdem<br />
wurden das Führungsinformationssystem<br />
von Landstreitkräften HEROS<br />
2/1, 2. Los und das Tactical Command<br />
System TCS eingebunden. Mit<br />
Hilfe zweier Videokonferenzanlagen<br />
wurden Livebilder der Cockpits aus<br />
der <strong>ESG</strong>-Zentrale in Fürstenfeldbruck<br />
an die Übungszentrale in der<br />
Welfenkaserne Landsberg am Lech<br />
gesendet.<br />
Auch das S<strong>im</strong>ulationsframework<br />
AbiDem war bei VIRTEL 2007 dabei.<br />
Es ermöglicht die S<strong>im</strong>ulation Ver-
netzter Operationsführung in einem<br />
streitkräftegemeinsamen und multinationalen<br />
Verbund – mit s<strong>im</strong>ulierten<br />
Plattformen und s<strong>im</strong>ulierten<br />
Führungssystemen auf unterschiedlichen<br />
Ebenen. Zum Einsatz kam es<br />
bisher vor allem bei s<strong>im</strong>ulierten gemeinsamen<br />
Einsätzen zwischen Luftwaffe,<br />
Heer und Marine in einem gemeinsamen<br />
Szenario an der Küste.<br />
AbiDem wurde in der <strong>ESG</strong>-Betriebsstätte<br />
Wilhelmshaven realisiert.<br />
Selbstverständlich funktioniert auch<br />
hier ein problemloses Zusammenspiel<br />
mit den S<strong>im</strong>ulatoren in Fürstenfeldbruck.<br />
Der Pilot hier sieht sich in<br />
seinem Hubschraubercockpit in der<br />
S<strong>im</strong>ulationslandschaft von AbiDem –<br />
und in der S<strong>im</strong>ulationslandschaft des<br />
AbiDem taucht beispielsweise der<br />
Hubschrauber TIGER als ein eigenständiges<br />
Objekt auf, welches vom<br />
<strong>Technolo</strong>giezentrum in Fürstenfeldbruck<br />
aus in die S<strong>im</strong>ulation in Wilhelmshaven<br />
eingreift. Dies funktioniert<br />
über Standardverbindungen.<br />
Die S<strong>im</strong>ulatoren sind auch in das<br />
Netzwerk des Missionsausrüstungsträgers<br />
(MAT) der <strong>ESG</strong> eingebunden. Der<br />
MAT ist ein fliegender Versuchsträger,<br />
mit dem Hubschrauberkomponenten<br />
bereits in der Entwicklungsphase unter<br />
operationellen Bedingungen getes-<br />
tet werden können. Das System hat<br />
große Bedeutung in Hinblick auf die<br />
Einführung neuer Helikopter sowie<br />
bei der Avionikmodernisierung eingeführter<br />
Hubschrauber.<br />
Der „Original-MAT“ ist ein Versuchshubschrauber<br />
und wird von der<br />
Wehrtechnischen Dienststelle 61 in<br />
Manching betrieben. Er verfügt über<br />
zwei völlig getrennte Elektroniksysteme<br />
– ein „Versuchssystem“ und ein<br />
„Sicherheitssystem“. Im Versuchssystem<br />
können Komponenten getestet<br />
werden, die noch nicht für den Betrieb<br />
in Luftfahrzeugen zugelassen sind,<br />
denn das Sicherheitssystem gestattet<br />
es jederzeit, einzugreifen und den<br />
Hubschrauber sicher zu fliegen.<br />
Es gibt aber noch einen zweiten<br />
MAT – einen Testaufbau, der <strong>im</strong> <strong>ESG</strong>-<br />
S<strong>im</strong>ulationszentrum steht. Er ist eine<br />
exakte Kopie des MAT, die allerdings<br />
flugunfähig ist. Dieses so genannte<br />
Test-Rig dient der Vorbereitung von<br />
Flugkampagnen <strong>im</strong> Labor. Die Funktionsweise<br />
von Sensoren und ihre Einbindung<br />
in die Avionik können damit<br />
bereits umfassend vorbereitet wer-<br />
den, bevor die Erprobungsflüge starten.<br />
Durch die Einbindung in die S<strong>im</strong>ulationslandschaft<br />
der <strong>ESG</strong> ist auch<br />
hier ein Zusammenspiel mit anderen<br />
S<strong>im</strong>ulatoren möglich.<br />
Erste Aufgaben des MAT waren<br />
Tests zur Überprüfung von Modellen<br />
der Bundeswehr zu Vorhersagen von<br />
Sichtreichweiten mit Wärmebildgeräten.<br />
Derzeit entwickeln Bundeswehr<br />
und Industrie mit Hilfe des MAT Lösungen<br />
für eine sensorgestützte Landehilfe<br />
von Hubschraubern. Damit soll<br />
ein drängendes Problem gelöst werden,<br />
das besonders bei Auslandseinsätzen<br />
auftritt: Wenn Helikopter auf<br />
unbefestigtem Gelände aufsetzen<br />
müssen, wirbelt der Rotor nämlich<br />
meist so viel Staub oder Schnee auf,<br />
dass die letzten Meter quasi <strong>im</strong> Blindflug<br />
stattfinden. Fachleute sprechen<br />
hier von Brown-Out- oder White-Out-<br />
Bedingungen. Aufgrund der Brisanz<br />
des Themas misst der General Flugsicherheit<br />
der sensorgestützten Landehilfe<br />
eine hohe Bedeutung zu. Die<br />
Arbeiten laufen schon seit Sommer<br />
letzten Jahres.<br />
Bevor die ersten echten Testflüge<br />
mit dem MAT <strong>im</strong> April 2008<br />
starteten, waren in der <strong>ESG</strong> bereits<br />
umfangreiche Vorarbeiten erledigt<br />
worden: So wurden beispielsweise<br />
verschiedene Sensoren und die Darstellung<br />
der Daten auf den Displays<br />
der Hubschraubers, die so genannte<br />
Mensch-Maschine-Schnittstelle, getestet.<br />
Mit Hilfe von Radarsensoren<br />
soll die Besatzung auch bei stark<br />
eingeschränkter Sicht wesentliche<br />
Informationen über den Flugzustand<br />
des Helikopters erhalten. Unterstützend<br />
werden bei geeigneten Sichtbedingungen<br />
TV-, Wärmebild- und<br />
Restlichtkameras zur Überwachung<br />
des Bereichs unter dem Rumpf eingesetzt.<br />
Im Test ist auch ein hochgenauer<br />
Radar-Entfernungsmesser<br />
mit geringem Öffnungswinkel. Anders<br />
als die meisten gebräuchlichen<br />
Modelle liefert er auch bei schlechter<br />
Sicht oder Verunreinigungen der Luft<br />
brauchbare Messwerte. Dazu wurden<br />
auch Untersuchungen in einer Staubkammer<br />
durchgeführt.<br />
Erste Ergebnisse aus den Laboruntersuchungen<br />
stehen schon fest:<br />
Es wurde ein Stand-alone-System<br />
konzipiert, das kurzfristig in die Hubschrauber<br />
CH-53 eingerüstet werden<br />
kann. jr<br />
Flugs<strong>im</strong>ulatoren<br />
auf Messen<br />
Der Missionsausrüstungsträger ist Ausstellungsstück am Stand der<br />
WTD 61 (D165) auf der Messe Aerospace Testing Expo in München<br />
(15.-17.4.2008). Die Veranstaltung gilt als die weltweit führende Messe<br />
für die Themenschwerpunkte Design, Test, Auswertung, Fertigung und<br />
Qualitätsmanagement <strong>im</strong> Luftfahrtbereich. Auf ihr werden wesentliche Anwendungen<br />
für die Zivil- und Militärluftfahrt-, Weltraum- und Satellitenindustrie<br />
und für den Verteidigungsbereich vorgestellt.<br />
Nur einen Monat später, vom 27. Mai bis zum 1. Juni 2008, präsentiert<br />
das Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung (BWB) den MAT als<br />
zentrales Ausstellungsstück seines Standes auf der ILA 2008. Die Internationale<br />
Luft- und Raumfahrtausstellung, die in diesem Jahr unter dem<br />
Namen „Berlin Air Show“ firmiert, hat für 2008 die Ausrüstungs- und Zulieferindustrie<br />
zu einem Schwerpunkt gemacht. Die Messe wird vom Bundesverband<br />
der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V. (BDLI) veranstaltet<br />
und bildet alle zwei Jahre die Luft- und Raumfahrt umfassend <strong>im</strong><br />
Rahmen einer internationalen Fach-, Konferenz- und Publikumsmesse ab.<br />
An der letzten ILA beteiligten sich 1014 Aussteller aus 42 Ländern; rund<br />
150.000 Fachbesucher informierten sich auf dem Messegelände am Berliner<br />
Flughafen Schönefeld.<br />
Auf der diesjährigen „Berlin Air Show“ – hier ein Bild von 2006 –<br />
wird auch die <strong>ESG</strong> vertreten sein. Foto: ILA
6 & 7 SPEKTRUM I/08<br />
Kooperative Missions-<br />
erfüllung <strong>im</strong> Team<br />
Ein <strong>Technolo</strong>gievorhaben untersucht den koordinierten<br />
Einsatz bemannter und unbemannter Flugobjekte.<br />
Seit zwölf Stunden sind leichte Bodentruppen<br />
am Munitionsdepot stationiert.<br />
Ihr Auftrag ist es, das Depot<br />
vor Übergriffen militanter Gruppen zu<br />
schützen. Das Gelände wird durch<br />
Kampfhubschrauber vom Typ TIGER<br />
weiträumig überwacht. Heeresflieger<br />
übernehmen den Transport und die<br />
Versorgung der Truppen und unterstützen<br />
die Einsatzkräfte vor Ort. Denn<br />
es wird noch 36 Stunden dauern, bis<br />
stärkere Verbände zur dauerhaften Sicherung<br />
eintreffen…<br />
Ein fiktives Szenario – in Zeiten einer<br />
Bundeswehr <strong>im</strong> weltweiten Einsatz<br />
allerdings durchaus realistisch. Eine<br />
besondere Bedeutung kommt hier<br />
den Heeresfliegern zu: Ihre Aufgabe<br />
ist es, die Bodentruppen sicher zum<br />
Depot zu bringen, zu versorgen und<br />
durch Kampfhubschrauber zu unterstützen.<br />
Ein wichtiges Ziel ist dabei die<br />
Reduzierung der Bedrohungslage. Un-<br />
bemannte Luftfahrzeuge (Unmanned<br />
Aerial Vehicles, UAVs), die <strong>im</strong> Team<br />
mit den Hubschraubern operieren,<br />
können hierbei einen bedeutenden<br />
Beitrag leisten. Die UAVs können beispielsweise<br />
bereits vor dem Eintreffen<br />
der Bodentruppen das Gebiet aufklären<br />
und überwachen oder die TIGER-<br />
Hubschrauber mit wichtigen zusätzlichen<br />
Informationen versorgen – ohne<br />
dass Menschen dabei in Gefahr geraten.<br />
Man spricht in diesem Fall von<br />
einem „Manned Unmanned Teaming“<br />
(MUM-T).<br />
Den Bedarf der Heeresflieger an<br />
solcher und weiterer Unterstützung<br />
zu identifizieren und Lösungsmöglichkeiten<br />
sowie deren Realisierbarkeit<br />
aufzuzeigen, ist aktuelle Aufgabe<br />
der <strong>ESG</strong> <strong>im</strong> Rahmen des <strong>Technolo</strong>gievorhabens<br />
MUM-T. Hierfür wurde<br />
<strong>im</strong> vergangenen Jahr gemeinsam mit<br />
den Heeresfliegern eine Wissenserhe-<br />
Unbemannte Luftfahrzeuge wie die Aufklärungsdrohne Luna können Hubschrauberbesatzungen mit wichtigen<br />
Informationen versorgen. Foto: 2006 Bundeswehr/Modes<br />
bung durchgeführt. Das Ziel dieser<br />
das Gesamtsystem in vier Ansichten<br />
gliedert. Damit kann der Entwicklungsprozess<br />
in allen erforderlichen Detailebenen<br />
analysiert und festgelegt werden.<br />
Die „NATO All Views“ beschreiben<br />
allgemeine Daten, wie Projektdauer<br />
oder beteiligte Personen. Hier finden<br />
sich auch ein Glossar und später die<br />
Ergebnisse der Formalisierung. Die<br />
„NATO Operational Views“ dienen der<br />
Abbildung der operationellen Vorgänge.<br />
Die „NATO System Views“ bilden<br />
das Gesamtsystem besonders <strong>im</strong> Hin-<br />
Erhebung war, die aktuellen Einsätze blick auf relevante Schnittstellen ab,<br />
der Heeresflieger unter Heraus- und auf die <strong>Technolo</strong>gien, welche für<br />
stellung der operationellen Anforde- die Realisierung des Systems benötigt<br />
rungen, ihrer Aktivitäten, deren Ein- werden, konzentrieren sich die „NATO<br />
flussgrößen und mögliche Lösungs- Technical Views“.<br />
strategien sowie Fähigkeitslücken zu Jede dieser Ansichten besteht aus<br />
identifizieren.<br />
mehreren Detailebenen. Zum Beispiel<br />
Neben dieser Aufgabe galt es fol- stellt die „operationelle Aktivitätengendes<br />
zu klären: Wie kann das ge- Sicht“ dar, „was“ in einem betrachwonnene<br />
Wissen so formalisiert werteten Szenario passiert, während die<br />
den, dass es <strong>im</strong> Verlauf des Projekts „operationelle Knoten-Sicht“ das „wo“<br />
und darüber hinaus opt<strong>im</strong>al genutzt behandelt. Zwischen den einzelnen<br />
werden kann? Welche Unterstüt- Sichten bestehen Abhängigkeiten, so<br />
zungsmöglichkeiten gibt es, um ein so dass die Darstellung und Entwicklung<br />
komplexes Projekt in all seinen Pha- des Systems als iterativer Vorgang opsen<br />
von der Anforderungsanalyse über t<strong>im</strong>al verfolgt werden kann.<br />
Systementwurf und -entwicklung bis Aus den Ergebnissen der Wis-<br />
N-CORE zur Evaluation ist bei in Militärs Flugversuchen, und Unternehmen optisenserhebung auf der ganzen und Welt der Formalisierung<br />
in Gebrauch.<br />
mal durchzuführen?<br />
mit dem „NATO Architecture Frame-<br />
Eine Lösung hierfür bietet das Sywork“ konnten dann konkrete Anforstem-Engineering-Werkzeug<br />
„NATO derungen und notwendige Fähigkeiten<br />
Architecture Framework“ (NAF), das und Funktionalitäten an einen Verbund<br />
aus bemannten und unbemannten<br />
Luftfahrzeugen abgeleitet werden.<br />
Diese wurden abschließend in einem<br />
so genannten „Concept of Operations“<br />
zusammengefasst. Beispielsweise betrachtete<br />
die <strong>ESG</strong> schwerpunktmäßig<br />
die Landung der TIGER-Hubschrauber<br />
<strong>im</strong> Einsatzgebiet. Hier spielen unter<br />
anderem Fragen wie das Einnehmen<br />
der Landeformation oder die Identifizierung<br />
des Absetzpunktes eine<br />
Rolle. Für die Identifikation des Absetzpunktes<br />
kann zum Beispiel eine<br />
abgesetzte UAV-Sensorplattform vorab<br />
Zusatzinformationen – etwa über<br />
unbekannte Hindernisse – liefern, die<br />
die Landung maßgeblich beeinflussen<br />
können. Auf Basis dieser Informationen<br />
könnte zum Beispiel der Absetzpunkt<br />
verlegt werden.<br />
Das Vorhaben MUM-T hat eine<br />
Laufzeit von Juli 2007 bis November<br />
2010 und wird von der <strong>ESG</strong> in Kooperation<br />
mit der Universität der Bundeswehr,<br />
der FGAN und dem DLR durchgeführt.<br />
ts
Impulse zur Neuausrichtung<br />
der „EOP-Phase“<br />
Auch nach Produktionsendemüssen<br />
Automodelle<br />
künftig intensiv<br />
betreut werden.<br />
Früher war für die Automobilhersteller<br />
die Sache klar: Mit dem Ende der<br />
Produktion eines Automodells endeten<br />
auch alle Entwicklungsarbeiten an<br />
dem Typ. Künftig wird sich das ändern:<br />
Die einzelnen Modelle werden die Hersteller<br />
noch jahrelang beschäftigen,<br />
nachdem der letzte Wagen das Band<br />
verlassen hat, sagt der Leiter Projekt-<br />
und Integrationssteuerung E/E<br />
<strong>im</strong> <strong>ESG</strong>-Geschäftsbereich Automotive,<br />
Tobias Spann. Im Spektrum-Gespräch<br />
erläutert er, warum.<br />
Herr Spann, Sie sprechen von einer<br />
„End-of-Production-Herausforderung“.<br />
Was meinen Sie damit?<br />
In der Automobilindustrie ist ein Produktionszyklus<br />
von sieben Jahren üblich.<br />
Das heißt, dass eine Modellreihe<br />
normalerweise über diesen Zeitraum<br />
produziert wird, bevor sie durch das<br />
Nachfolgemodell ersetzt wird. Nach<br />
diesem Ende der Produktion („End of<br />
Production“/EOP) garantieren die Hersteller<br />
für weitere 15 Jahre die Versorgbarkeit.<br />
Während dieser Phase<br />
bekommt der Kunde weiterhin alle Ersatzteile.<br />
Über die Organisation dieser<br />
Zeitspanne vom EOP bis zum so genannten<br />
„End of delivery obligation“<br />
müssen sich die Automobilhersteller<br />
künftig verstärkt Gedanken machen.<br />
Für die Hersteller ist die „delivery<br />
obligation“ aber doch nichts<br />
Neues?<br />
Das ist richtig. Es haben sich aber die<br />
Rahmenbedingungen geändert. Bisher<br />
konnte ein Hersteller die Lieferzusage<br />
leicht garantieren. Nach dem<br />
EOP eines Modells wurden entweder<br />
alle relevanten Ersatzteile in den vo-<br />
raussichtlich benötigten Stückzahlen<br />
eingelagert und über die nächsten 15<br />
Jahre ausgegeben oder es wurden<br />
best<strong>im</strong>mte Ersatzteile einfach weiter<br />
produziert. Beide Möglichkeiten scheiden<br />
heute aus.<br />
Wieso?<br />
Weil der Elektronikanteil <strong>im</strong> Automobil<br />
in den letzten Jahren sehr stark angestiegen<br />
ist. In Premiumfahrzeugen<br />
sind heute um die 80 miteinander vernetzte<br />
Steuergeräte eingebaut – mit<br />
einem hohen Software-Anteil. Wir wissen,<br />
dass es beispielsweise bei Flash-<br />
Bausteinen schon nach wenigen Jahren<br />
zu Datenverlusten kommen kann,<br />
wenn sie „unbestromt“ lagern. Eine<br />
Lagerhaltung als Lösung wird dadurch<br />
stark erschwert. Und eine weitere Produktion<br />
der „alten“ Komponenten ist<br />
aufgrund zu erwartender Änderungen<br />
von Gleichsteuergeräten finanziell<br />
nicht sinnvoll.<br />
Was bedeuten diese Begriffe?<br />
Der Begriff Gleichsteuergeräte bezeichnet<br />
Komponenten, die in mehreren<br />
Modellreihen eines Herstellers<br />
identisch verwendet werden. Wenn<br />
Modell A die EOP erreicht hat, wird<br />
das Bauteil vielleicht noch einige<br />
Jahre in Modell B verbaut. Wenn nun<br />
Änderungen am Bauteil stattfinden,<br />
steht es Modell A nur noch in der modifizierten<br />
Fassung zur Verfügung.<br />
Als zusätzlicher Faktor kommt hinzu,<br />
dass die Elektronik- und Mikroelektronikbranche<br />
mit anderen Innovationszyklen<br />
als die Automobilhersteller<br />
rechnet. Wer die Entwicklung etwa<br />
von Speichermedien oder Prozessoren<br />
betrachtet, kann nicht davon<br />
ausgehen, dass ein heute verwendetes<br />
Teil genau so noch in 10 oder<br />
15 Jahren hergestellt wird.<br />
Die Folge ist, dass die Werkstätten<br />
künftig schon nach kurzer Zeit nicht<br />
mehr das identisch gleiche Bauteil<br />
zur Verfügung haben werden, sondern<br />
auf Nachfolgekomponenten zurückgreifen<br />
müssen.<br />
Tobias Spann<br />
Warum ist dies problematisch?<br />
Änderungen an Geräten finden natürlich<br />
auch während der Produktionsphase<br />
statt – je nach Automobilhersteller<br />
mehrere hundert pro Jahr. Man macht<br />
das, um Fehler zu beheben oder um mit<br />
technischen Weiterentwicklungen in<br />
anderen Branchen, etwa in der mobilen<br />
Kommunikation, Schritt halten zu können.<br />
Für diese Änderungen gibt es aber<br />
einen sehr strengen Prüfungsprozess.<br />
Bis ein geändertes Bauteil tatsächlich<br />
eingebaut wird, durchläuft es eine<br />
mehrmonatige Testphase. Dabei wird<br />
vor allem geprüft, ob die neuen Teile<br />
mit dem Gesamtsystem kompatibel<br />
sind. Aufgrund des hohen Vernetzungsgrades<br />
kann eine Änderung an einem<br />
Bauteil nämlich gravierende Folgen haben<br />
– bis zum Ausfall des gesamten<br />
Elektroniksystems. Einen solchen Prüfungsprozess<br />
gibt es nach dem EOP<br />
bisher nicht. Das neue Bauteil müsste<br />
also ungeprüft in das alte Modell eingebaut<br />
werden – mit allen Risiken und<br />
möglichen Nebenwirkungen.<br />
Wo sehen Sie Ansätze für<br />
Lösungen?<br />
Die Automobilhersteller haben das<br />
Problem mittlerweile erkannt. Es führt<br />
kein Weg daran vorbei, die etablierten<br />
Kompatibilitätsprozesse aus der Produktionsphase<br />
bis zum „End of delivery<br />
obligation“ zu übernehmen. Anders<br />
als bisher wird EOP nicht mehr bedeuten,<br />
dass tatsächlich alle Arbeiten<br />
eingestellt werden. Künftig müssen<br />
auch an Modellen, die seit über einem<br />
Jahrzehnt nicht mehr hergestellt werden,<br />
Entwicklungsarbeiten und Tests<br />
durchgeführt werden.<br />
Die <strong>ESG</strong> bietet den Automobilherstellern<br />
Unterstützung bei der<br />
Bewältigung dieser Herausforderungen.<br />
Was zeichnet das Unternehmen<br />
aus?<br />
Als ausgewiesener Experte für Systemverifikation<br />
und als unabhängige<br />
Beraterfirma kann die <strong>ESG</strong> wichtige<br />
Impulse zur Neuausrichtung der EOP-<br />
Phase bieten. Wir analysieren die<br />
bisherigen Prozesse, erstellen Kosten-Nutzen-Analysen<br />
und empfehlen<br />
Maßnahmen. Natürlich können wir <strong>im</strong><br />
letzten Schritt auch die komplette Prozesskette<br />
in Eigenregie bedienen, quasi<br />
als Gesamtfahrzeugverantwortung<br />
von der Entwicklung über Änderungsmanagement<br />
und Absicherung bis hin<br />
zum Datenhandling, zum Beispiel für<br />
Werkstätten. Dabei kommen uns unsere<br />
langjährigen Erfahrungen <strong>im</strong> Änderungs-,<br />
Integrations- und Qualitätsmanagement,<br />
be<strong>im</strong> Softwarehandling<br />
und in der Systementwicklung zugute.<br />
Herr Spann, vielen Dank für dieses<br />
Gespräch.
8 & 9 SPEKTRUM I/08<br />
Kollisionen auf See verhindern<br />
„AIS – Deutsche Küste“ wird die Sicherheit<br />
und das Flottenmanagement <strong>im</strong> Schiffsverkehr<br />
deutlich verbessern.<br />
Der Schiffsverkehr an den deutschen<br />
Küsten hat in den vergangenen Jahren<br />
stark zugenommen. So ist beispielsweise<br />
der Verkehr auf der Ostsee entsprechend<br />
dem Wirtschaftswachstum<br />
<strong>im</strong> Baltikum und in Russland seit 1990<br />
enorm gestiegen. Eine sehr hohe Verkehrsdichte<br />
herrscht unter anderem<br />
<strong>im</strong> Umfeld der Zufahrten zum Nord-<br />
Ostsee-Kanal oder in der Lübecker<br />
und Kieler Bucht. In der Nordsee sind<br />
die Einfahrtsbereiche der Überseehäfen<br />
Emden, Wilhelmshaven, Bremerhaven<br />
und Hamburg besonder stark<br />
befahren. Darüber hinaus gibt es an<br />
der deutschen Küste Seegebiete, die<br />
aufgrund der morphologischen und<br />
hydrologischen Randbedingungen be-<br />
sondere Gefahren für die Schifffahrt<br />
aufweisen – zum Beispiel Meerengen<br />
wie der Fehmarnbelt.<br />
Für die Verkehrsüberwachung der<br />
deutschen Seegebiete ist die Wasser-<br />
und Schifffahrtsverwaltung des<br />
Bundes (WSV) verantwortlich. Sieben<br />
Direktionen und 39 Wasser- und<br />
Schifffahrtsämter sorgen dafür, dass<br />
die Verkehrsströme sicher geleitet<br />
werden – bei steigendem Verkehrsaufkommen<br />
eine <strong>im</strong>mer größere Herausforderung.<br />
Die Regelung und Überwachung<br />
des Schiffsverkehrs erfolgt unter anderem<br />
durch die Beobachtung des<br />
Verkehrs. Die dafür notwendigen Anlagen<br />
werden <strong>im</strong> „System Marit<strong>im</strong>e<br />
Küstengebiete mit hohem Verkehrsaufkommen werden<br />
durch das AIS-System deutlich sicherer. Foto: fotolia/Chan<br />
Verkehrstechnik“ (SMV) zusammengefasst.<br />
Um dem steigenden Anspruch<br />
begegnen zu können, baut das WSV<br />
derzeit eine neue <strong>Technolo</strong>gie auf, mit<br />
der Verkehrsströme besser und effizienter<br />
als bisher überwacht und gesteuert<br />
werden können: ein automatisches<br />
Schiffsidentifizierungssystem.<br />
Das „Automatic Identification System“<br />
(AIS) wird die Steuerung des Schiffsverkehrs<br />
erleichtern und die Sicherheit<br />
auf See erhöhen. „AIS – Deutsche Küste“<br />
ist ein Baustein des Systems Marit<strong>im</strong>e<br />
Verkehrstechnik.<br />
Mit AIS identifizieren sich Schiffe<br />
auf der ganzen Welt mithilfe entsprechender<br />
Bordgeräte und geben unter<br />
anderem ihre Position, ihren Kurs, die<br />
Geschwindigkeit, das Ziel, Informationen<br />
über ihre Ladung sowie weitere<br />
Daten bekannt. AIS dient der Vermeidung<br />
von Kollisionen auf See, dem automatischen<br />
Informationsaustausch<br />
zwischen Schiffen untereinander und<br />
mit den Verkehrszentralen an der Küste<br />
als ergänzendes Mittel zur marit<strong>im</strong>en<br />
Verkehrssicherung.<br />
Hauptauftragnehmer für das gesamte<br />
Vorhaben ist die <strong>ESG</strong>. Das<br />
Unternehmen verfügt mit seiner Betriebsstätte<br />
in Wilhelmshaven über<br />
einen Arm, der sich schwerpunktmäßig<br />
Dienstleistungen und Lösungen<br />
für das marit<strong>im</strong>e Umfeld widmet.<br />
Nach der Realisierung des deutschen<br />
Gateways für die Helsinki-Kommission<br />
(HELCOM) zur Übermittlung von<br />
Schiffsdaten <strong>im</strong> Jahr 2005 ist die <strong>ESG</strong><br />
mit dem Projekt „AIS – Deutsche Küste“<br />
ein weiteres Mal für ein wichtiges<br />
Vorhaben der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung<br />
verantwortlich.<br />
Die <strong>ESG</strong> wird während der nächsten<br />
Jahre die gesamte notwendige<br />
Software entwickeln, diese integrieren<br />
und das Komplettsystem in<br />
den Betrieb überführen – inklusive
der Schulung des Bedienpersonals<br />
und der Dokumentation. Zusätzlich<br />
wird in der Wilhelmshavener <strong>ESG</strong>-<br />
Niederlassung ein Test- und Referenzsystem<br />
aufgebaut, mit dem die<br />
Funktionalitäten des echten AIS-<br />
Systems überprüft werden können.<br />
Für ein funktionierendes deutsches<br />
AIS-System müssen verschiedene<br />
Hardwarekomponenten, zum Beispiel<br />
Antennen, in zusammen 31 Außenstationen<br />
entlang der gesamten deutschen<br />
Küsten installiert werden. Bei<br />
der Beschaffung dieser Hardware und<br />
ihrer Einrüstung arbeitet die <strong>ESG</strong> mit<br />
verschiedenen Unternehmen zusammen.<br />
Wie aber werden die AIS-Daten<br />
genutzt werden? Der Schiffsverkehr<br />
an den deutschen Küsten ist nicht<br />
gleichmäßig verteilt. Es gibt Seegebiete<br />
mit hoher, mittlerer und geringer<br />
Verkehrsdichte.<br />
In den Seegebieten mit hoher<br />
Verkehrsdichte wird die Nutzung der<br />
AIS-Daten die bereits vorhandenen<br />
Mittel zur marit<strong>im</strong>en Verkehrssicherung<br />
sinnvoll ergänzen. Neben der<br />
bewährten Radarüberwachung des<br />
Verkehrs wird hier zukünftig die AIS-<br />
<strong>Technolo</strong>gie dazu beitragen, die Genauigkeit<br />
der in den Verkehrszentralen<br />
abgebildeten Verkehrslage zu erhöhen.<br />
Mit den jederzeit verfügbaren<br />
Daten über die Fahrzeuge und ihre<br />
aktuellen Kurse und Geschwindigkeiten<br />
erhalten die Verkehrszentralen<br />
ein effektives zusätzliches Instrumentarium<br />
für die kontinuierliche Überwachung<br />
des Verkehrgeschehens in den<br />
Revieren.<br />
In den Seegebieten mit mittlerer<br />
Verkehrsdichte, die auch aufgrund<br />
ihrer Küstenferne bislang in der Regel<br />
keiner Überwachung mittels Radar<br />
unterlagen, eröffnet die AIS-<strong>Technolo</strong>gie<br />
in Verbindung mit der elektronischen<br />
Seekarte ECDIS (Electronic<br />
Chart Display and Information System)<br />
eine neue Qualität der Verkehrs-<br />
überwachung. Mit der Darstellung der<br />
empfangenen AIS-Daten können die<br />
Schiffe auf gefährliche Situationen<br />
hingewiesen werden. Dies kann in<br />
sinnvoller Kombination aus manueller<br />
Überwachung und der Generierung<br />
von automatischen Alarmen, zum Beispiel<br />
bei Abweichungen der Schiffe<br />
von üblichen Sollkursen, rechtzeitig<br />
erfolgen. Insbesondere in sensibleren<br />
Seegebieten wie der Kadetrinne nördlich<br />
von Rostock, einem der schwierigsten<br />
und gefährlichsten Gewässer<br />
der Ostsee, wird damit die Prävention<br />
Der große Leuchtturm auf Borkum ist einer von 31 Standorten, die mit der AIS-<br />
Hardware ausgerüstet werden. Foto: fotolia/Richter<br />
Wie funktioniert AIS?<br />
Über spezielle UKW-Sender und Empfänger werden Daten zwischen<br />
Seefahrzeugen und den Verkehrszentralen automatisch in kurzen<br />
Zeitabständen ausgetauscht. Das Verfahren hierzu ist weltweit<br />
standardisiert und funktioniert auf allen Weltmeeren, so dass sich auch<br />
Fahrzeuge, die mit AIS-Bordgeräten verschiedener Hersteller ausgerüstet<br />
sind, gegenseitig ”sehen“ können. AIS ermöglicht zudem den Blick über<br />
Hindernisse und ergänzt damit die Radarbilddarstellung. Abhängig von<br />
der Antennenhöhe hat eine AIS-Station eine Reichweite von 20 bis 30<br />
Seemeilen, also bis zu 55 Kilometer.<br />
AIS unterstützt die Schiffsführung und die Verkehrszentralen an der Küste<br />
durch den automatischen Austausch von Informationen über die Position<br />
und die Bewegung der Schiffe. Informationen stehen dabei schneller als<br />
bisher zur Verfügung und sind präziser. An Bord der Schiffe können die<br />
AIS-Daten zusammen mit den Radarinformationen dargestellt werden, in<br />
den Verkehrszentralen an der Küste werden die AIS-Daten genutzt, um ein<br />
übersichtliches Bild der Verkehrssitution zu erzeugen.<br />
Mit der zunehmenden Verbreitung von AIS können Havariefälle eher<br />
vermieden werden, so dass sich die Verkehrssicherheit insgesamt deutlich<br />
verbessern wird. Gleichzeitig bedeutet dieser Sicherheitsgewinn einen<br />
entscheidenden Beitrag zum Schutz der Meeresumwelt.<br />
Quelle: Bundesverkehrsministerium<br />
von Havarien und Kollisionen deutlich<br />
verbessert.<br />
Aus den übrigen Seegebieten, in<br />
denen nur wenig Verkehr herrscht<br />
oder überwiegend Fischer- und Sportboote<br />
unterwegs sind, werden die AIS-<br />
Daten gebietsweise ebenfalls <strong>im</strong> Wege<br />
der automatischen Überwachung der<br />
Verkehre genutzt. Sofern eine automatische<br />
Überwachung aufgrund der<br />
geographischen Verhältnisse (beispielsweise<br />
in Wattgebieten mit ständig<br />
wechselnden Kursen) faktisch<br />
nicht möglich ist, stellt der Empfang<br />
der AIS-Daten jedoch sicher, dass<br />
sich die Verkehrszentrale in besonderen<br />
Fällen sofort über die Lage vor Ort<br />
informieren und gezielt Maßnahmen<br />
einleiten kann.<br />
AUFSTELLORTE AIS-DIENST<br />
Die Verkehrszentralen werden zudem<br />
in der Lage sein, mit Hilfe der<br />
AIS-<strong>Technolo</strong>gie kurze Nachrichten<br />
entweder an ein best<strong>im</strong>mtes Schiff,<br />
alle Schiffe oder an die Schiffe in<br />
einem best<strong>im</strong>mten Gebiet zu senden.<br />
Somit können jederzeit Navigationswarnungen,<br />
Informationen über<br />
Verkehrsregelungen oder hafenbezogene<br />
Informationen an die Schifffahrt<br />
weitergeleitet werden. Die AIS-<br />
<strong>Technolo</strong>gie trägt somit dazu bei, den<br />
Schiffsverkehr nicht nur auf hoher<br />
See sicherer zu gestalten, sondern sie<br />
wird auch in sensibleren küstennahen<br />
Seegebieten sowie in den Zufahrten<br />
zu den Häfen für die Sicherheit und<br />
Leichtigkeit des Verkehrs wesentliche<br />
Impulse setzen. fe/jr
10 & 11 SPEKTRUM I/08<br />
„Die Vision der <strong>ESG</strong> Consulting<br />
GmbH verwirklicht sich.“<br />
Ein Jahr nach<br />
seiner Gründung<br />
hat sich der <strong>ESG</strong>-<br />
Beratungsarm gut<br />
am Markt etabliert.<br />
Unternehmensberatung mit Schwer-<br />
punkt Prozessberatung – das ist die<br />
Kernkompetenz der <strong>ESG</strong> Consulting<br />
GmbH. Das einhundertprozentige<br />
Tochterunternehmen der <strong>ESG</strong> wurde<br />
am 1. März 2007 gegründet. Das<br />
Unternehmen hat es sich zum Ziel<br />
gesetzt, in der Beratung eine Brücke<br />
zwischen Strategie und <strong>Technolo</strong>gie<br />
zu schlagen.<br />
„Wir begleiten strategische Veränderungen<br />
durch entsprechende Entwicklungs-<br />
und Wachstumsstrategien<br />
und unterstützen den Kunden durch<br />
die bewährte Methoden-, Prozess-<br />
und Branchenkompetenz der <strong>ESG</strong><br />
<strong>im</strong> Prozess- und Qualitätsmanagement.“<br />
So hatte Dr. Marianne Janik,<br />
Geschäftsführerin der <strong>ESG</strong> Consulting<br />
GmbH, Anfang 2007 die Ausrichtung<br />
des neuen Beratungsunternehmens<br />
umschrieben. Ein Jahr später sprach<br />
Spektrum erneut mit ihr – über den<br />
Einstieg in neue Märkte, die Positionierung<br />
der <strong>ESG</strong> Consulting GmbH <strong>im</strong><br />
Wettbewerb und das Zusammenspiel<br />
mit dem Mutterkonzern. Das Interview<br />
führte Jörg Riedle.<br />
die Kunden bei strategischen Veränderungen,<br />
Prozessopt<strong>im</strong>ierungen und<br />
dem <strong>Technolo</strong>gie- und Prozessmanagement<br />
zu unterstützen, gut ankommt.<br />
Wir haben dafür sehr viele positive<br />
Reaktionen bekommen. Für uns<br />
war dies wichtig, weil es zeigt, dass<br />
wir richtig aufgestellt sind.<br />
Wo sehen Sie derzeit die Schwerpunkte<br />
des Unternehmens?<br />
Im Augenblick haben wir einen Fokus<br />
auf das Geschäft mit zivilen Behörden<br />
gesetzt. Hier konnten wir bereits mehrere<br />
große Aufträge gewinnen. Aber<br />
auch das Thema Health Care hat sich<br />
sehr gut entwickelt. Wir haben uns<br />
dort mit einem Schwerpunkt, nämlich<br />
Beratungsleistungen für Krankenhäuser<br />
und für das Gesundheitsministerium,<br />
gut positioniert. Mir liegt das<br />
Thema sehr am Herzen, weil wir damit<br />
zeigen können, dass sich die Vision<br />
der <strong>ESG</strong> Consulting GmbH verwirklicht,<br />
auch neue Märkte, die bisher<br />
nicht von der <strong>ESG</strong>-Gruppe bedient<br />
wurden, zu gewinnen.<br />
In der Hightech-Branche setzen<br />
wir derzeit vor allem auf Kunden, die<br />
sicherheitsrelevante Lösungen und<br />
Produkte anbieten. Hier profitieren wir<br />
natürlich von der jahrzehntelangen Erfahrung<br />
der <strong>ESG</strong>-Gruppe in diesem<br />
Umfeld.<br />
Frau Dr. Janik, die <strong>ESG</strong> Consulting<br />
GmbH ist vor gut einem Jahr<br />
gestartet. Wo steht das Unternehmen<br />
heute?<br />
Wir hatten uns für das erste Jahr<br />
das Ziel gesetzt, in drei ausgewählten<br />
Branchen, nämlich dem Public<br />
Sector, dem Bereich Health Care und<br />
der Hightech-Industrie, Fuß zu fassen<br />
und erste Kunden zu gewinnen. Dies<br />
ist sehr gut gelungen. Dabei hat sich<br />
auch gezeigt, dass unsere Botschaft, Dr. Marianne Janik<br />
Sie haben es gerade angesprochen:<br />
Als einhundertprozentiges<br />
Tochterunternehmen ist die <strong>ESG</strong><br />
Consulting GmbH integraler Bestandteil<br />
der Leistungskette des<br />
Mutterkonzerns. Was bedeutet<br />
dies für Ihre Kunden?<br />
Zum einen profitiert der Kunde von<br />
der Beratungskompetenz, die es<br />
<strong>im</strong>mer schon in der <strong>ESG</strong> gab und<br />
gibt. Ich möchte dabei besonders<br />
auf die Neutralität der <strong>ESG</strong>-Gruppe<br />
in Hardwarefragen hinweisen – ein<br />
Markenzeichen, das für Unabhängigkeit<br />
in der Beratung steht. Im öffentlichen<br />
Umfeld kann die <strong>ESG</strong> auf<br />
sehr viel Erfahrung zurückgreifen.<br />
Zusätzlich bekommt der Kunde eine<br />
erweiterte Leistung – vor allem, was<br />
konzeptionelle Aufgaben abseits der<br />
technischen Umsetzung betrifft.<br />
Besonders wichtig für unsere<br />
Kunden ist sicher, dass beide Unternehmen<br />
– die <strong>ESG</strong> und ihr Beratungsarm<br />
– sehr eng miteinander<br />
verzahnt sind. Zu best<strong>im</strong>mten technologischen<br />
Fragestellungen können<br />
wir jederzeit Kollegen aus der<br />
<strong>ESG</strong> in unsere Projekte integrieren.<br />
Der Kunde hat dann einen max<strong>im</strong>alen<br />
Nutzen, da er sowohl die fachlich-technische<br />
Perspektive als auch<br />
die neutrale Beratungsleistung bekommt.<br />
Was waren denn die Hauptgründe<br />
für die Ausgliederung einer Beratungstochter<br />
vor einem Jahr?<br />
Bei der Entscheidung, die <strong>ESG</strong> Consulting<br />
GmbH als Tochter der <strong>ESG</strong> zu<br />
gründen, spielte vor allem die Überlegung<br />
eine Rolle, uns klarer als bisher<br />
in Richtung Prozessberatung zu<br />
positionieren. Die <strong>ESG</strong> selbst bedient<br />
aufgrund ihrer strategischen Ausrichtung<br />
das Thema Unternehmensberatung<br />
nur am Rande. Eine zweite<br />
Überlegung war, dass es sicher sinnvoll<br />
ist, die bereits vorhandene Beratungskompetenz<br />
in einem neuen Pool<br />
zu bündeln.<br />
In Deutschland gibt es etwa 14.000<br />
Unternehmen, die Beratungsleistungen<br />
anbieten. Wie positioniert<br />
sich die <strong>ESG</strong> Consulting GmbH auf<br />
diesem hart umkämpften Markt?<br />
In der Tat ist die Konkurrenz sehr groß,<br />
aber bei der von Ihnen genannten Anzahl<br />
sind es in der Mehrzahl doch Einzelunternehmer<br />
und -kämpfer, die einzelne<br />
Nischen bedienen.<br />
Wir haben von Anfang an darauf gesetzt,<br />
dass Beratungsgeschäft vor<br />
allem „Personengeschäft“ ist. Themen<br />
wie die Teamzusammensetzung und<br />
-fähigkeit spielen eine große Rolle. Für<br />
die Kunden ist dieser Faktor letztendlich<br />
mit ausschlaggebend: Man merkt<br />
das daran, wie Beratungsleistungen<br />
ausgeschrieben und angefordert werden.<br />
Dabei wird mehr und mehr auf<br />
die Persönlichkeiten, ihre Verfügbarkeit<br />
und Berufserfahrung geachtet.<br />
Daher kümmern wir uns bei der<br />
Auswahl der Personen, die für die <strong>ESG</strong><br />
Consulting GmbH arbeiten, sehr stark<br />
um ausgeprägte Sozialkompetenzen.<br />
Außerdem müssen unsere Mitarbeiter<br />
zur Unternehmenskultur der <strong>ESG</strong> passen.<br />
Unsere Leute bringen viel Erfahrung<br />
mit – manchmal in der Unternehmensberatung<br />
selbst, meist aber vor<br />
allem in den entsprechenden Märkten.<br />
Für unsere Kunden bedeutet dies eine<br />
hohe Umsetzungsorientierung der Berater.
Erfahrene Beraterpersönlichkeiten sind ein Markenzeichen der <strong>ESG</strong> Consulting GmbH.<br />
Gerade das Thema Umsetzungsorientierung<br />
ist bei den meisten Unternehmensberatungen<br />
noch unterentwickelt.<br />
Hier sind wir – auch gegenüber<br />
unseren großen Mitbewerbern – durch<br />
die Einbindung in die <strong>ESG</strong>-Gruppe klar<br />
<strong>im</strong> Vorteil.<br />
Können Sie Beispiele nennen, wo<br />
es durch diese Positionierung der<br />
<strong>ESG</strong> Consulting GmbH gelungen<br />
ist, Kunden zu überzeugen?<br />
Dazu fallen mir auf Anhieb zwei große<br />
Projekte ein. Beide haben einen siebenstelligen<br />
Umfang und werden uns über<br />
die nächsten Jahre hinweg begleiten.<br />
Das eine ist ein Rahmenvertrag,<br />
den wir mit sehr unterschiedlichen Projekten<br />
ausfüllen. Wir unterstützen unterschiedlichste<br />
Bundesbehörden dabei,<br />
<strong>Technolo</strong>gie- und Projektmanagementkompetenz<br />
auszubauen. Dabei bringen<br />
wir nicht nur theoretisch-konzeptionell<br />
Modelle zu Papier, sondern haben auch<br />
eine begleitende Rolle – bis hin zu Themen,<br />
die neuartige Geschäftsmodelle<br />
in der Zusammenarbeit von Behörden<br />
betreffen. Dies geht weit über eine<br />
klassische Beratung zu den Themen<br />
<strong>Technolo</strong>gie<strong>im</strong>plementierung, Controlling<br />
oder Projektmanagement hinaus.<br />
Der zweite Auftrag betrifft die<br />
Begleitung eines sehr großen Forschungsprojektes.<br />
Auftraggeber ist ein<br />
Forschungsinstitut. Wir nehmen hier<br />
nicht nur methodisch Einfluss, sondern<br />
begleiten das Forschungsvorhaben<br />
sehr stark inhaltlich. Dabei beraten wir<br />
auch zum Thema Qualität, berücksichtigen<br />
die Implementierung von <strong>Technolo</strong>gien<br />
und erstellen internationale<br />
Benchmarks. Auch hier ist unsere Rolle<br />
also nicht nur beratend, sondern sehr<br />
stark begleitend.<br />
Wie steht die <strong>ESG</strong> Consulting GmbH<br />
zum Thema Partnerschaften?<br />
Wir haben uns ein so genanntes<br />
„multi firm consulting“ auf die Fahne<br />
geschrieben, also die Zusammenarbeit<br />
mit anderen Beratungsunternehmen.<br />
Dies ist in der Branche<br />
bisher eher unüblich und findet eigentlich<br />
nur statt, wenn Zwänge von<br />
Kundenseite dies erfordern.<br />
Wir hingegen behaupten, dass<br />
jedes kleinere Beratungsunternehmen<br />
auf Partner angewiesen ist. Also<br />
hat sich die <strong>ESG</strong> Consulting GmbH<br />
zu best<strong>im</strong>mten Themen oder für<br />
die Arbeit in best<strong>im</strong>mten geo-<br />
graphischen Regionen Partner ausgewählt,<br />
die das Unternehmen<br />
durch Spezialkompetenzen verstärken.<br />
Unser Ziel ist es, etwa ein<br />
Fünftel unseres Umsatzes mit Partnern<br />
zu realisieren – wobei die <strong>ESG</strong><br />
selbst natürlich unser „preferred<br />
partner“ ist.<br />
Das erste Jahr <strong>ESG</strong> Consulting<br />
GmbH ist vorbei. Was sind Ihre Ziele<br />
für die kommenden Jahre?<br />
Kurzfristig wollen wir neben dem Behördengeschäft<br />
das industrielle Geschäft<br />
<strong>im</strong> Hightech-Sektor stärker ausbauen.<br />
Dabei möchten wir vor allem in<br />
Branchen vorstoßen, die bisher noch<br />
nicht auf unserer Landkarte waren. Ein<br />
Beispiel kann hier die zivile Logistik<br />
sein. Längerfristig wollen wir vor allem<br />
in dem für uns relativ neuen Markt<br />
Health Care weiter wachsen und den<br />
Sprung schaffen, auch unsere Muttergesellschaft<br />
<strong>ESG</strong> in diesen Markt mitzunehmen<br />
Frau Dr. Janik, vielen Dank für das<br />
Gespräch.
12 & 13 SPEKTRUM I/08<br />
+ + K U R Z M E L D U N G E N + +<br />
ServiceXpert unterstützt<br />
Testautomatisierung bei MAN<br />
Die ServiceXpert GmbH, ein einhundertprozentiges Tochterunternehmen der<br />
<strong>ESG</strong>-Gruppe, unterstützt die MAN AG be<strong>im</strong> Test vernetzter Steuergeräte. Der<br />
Lkw-Hersteller führt dazu das System Labcar-Automation V3.1 der ETAS<br />
Group an seinen Prüfständen ein. Damit kann MAN jetzt komfortabel die<br />
Wechselwirkungen verschiedener Steuergeräte in einem komplexen System<br />
analysieren.<br />
Im Rahmen eines Pilotprojekts zwischen MAN, ETAS und ServiceXpert wurden<br />
die Hardware-in-the-Loop-Prüfstände auf den neuesten Stand der Testautomatisierung<br />
gebracht. Die <strong>ESG</strong>-Tochter übernahm dabei die Rolle des Systemintegrators.<br />
Das Unternehmen integrierte unter anderem zwei Werkzeuge<br />
von Drittanbietern, mit denen die Einträge der Steuergeräte-Diagnosespeicher<br />
ausgelesen und ausgewertet werden. Ferdinand Stocker, Geschäftsführer von<br />
ServiceXpert, betonte die gute Zusammenarbeit zwischen den drei beteiligten<br />
Unternehmen: „Die Zusammenarbeit von MAN als Anwender mit klar definierten<br />
Anforderungen, ETAS als Toolhersteller und ServiceXpert als Systemintegrator<br />
zeigt exemplarisch, wie innerhalb von kurzer Zeit eine komplexe<br />
und moderne Automatisierungslösung effizient umgesetzt werden kann.“<br />
Nachfolge in Repräsentanz Berlin<br />
Frank Kleinkauf wird zur Jahresmitte neuer Leiter der Berliner <strong>ESG</strong>-Repräsentanz.<br />
Er folgt auf Jochen Dietrich, der in Ruhestand geht. Der 56-jährige<br />
Kleinkauf ist bereits seit 1. Januar 2008 bei der <strong>ESG</strong> und bereitet sich auf seine<br />
neue Aufgabe vor.<br />
Frank Kleinkauf ist Diplom-Ingenieur<br />
der Nachrichtentechnik und kann<br />
auf mehr als 30 Berufsjahre in der<br />
ITK-Branche zurückblicken. Stationen<br />
seines Berufslebens waren unter anderem<br />
die Siemens AG, das Bundesministerium<br />
der Verteidigung, die<br />
NATO-C3-Agentur in Brüssel sowie<br />
die Berliner Sietec GmbH. Von 1988<br />
bis 1991 war Frank Kleinkauf schon<br />
einmal bei der <strong>ESG</strong> beschäftigt; er leitete<br />
damals die Brüsseler Firmenrepräsentanz.<br />
Frank Kleinkauf<br />
Informationen zum Thema RFID<br />
Der „Radio Frequency Identification“-<strong>Technolo</strong>gie RFID wird ein großes Potenzial<br />
bescheinigt. Bis zum Jahr 2010 wird der von der <strong>Technolo</strong>gie beeinflusste Anteil<br />
an der Bruttowertschöpfung rund 62 Milliarden Euro betragen, schätzt das<br />
Bundeswirtschaftsministerium. Die neuesten Entwicklungen rund um RFID werden<br />
auf der 7. Transponder Roadshow vorgestellt. An vier Terminen präsentieren<br />
17 Partnerunternehmen, darunter die <strong>ESG</strong>, in vier Städten neue Lösungen. Nach<br />
München und Berlin wird die Informationsveranstaltung am 15. April 2008 in<br />
Zürich und am 17. Juni 2008 in Mainz zu Gast sein.<br />
Am 24. Januar stellte Rainer Barthel, Leiter der <strong>ESG</strong>-Geschäftseinheit Transport<br />
und Verkehr, auf der Transponder Roadshow in München das <strong>ESG</strong>-Projekt<br />
be<strong>im</strong> Kunden Schenker Deutschland GmbH vor. Der Konzern überwacht und<br />
steuert mehr als 3500 Wechselbrücken durch den Einsatz der berührungslosen<br />
Funketiketten. Barthel zeigte außerdem auf, wie RFID in der Produktion, in der<br />
Logistik, <strong>im</strong> Dienstleistungssektor und <strong>im</strong> Pharmabereich Abläufe opt<strong>im</strong>ieren<br />
und Prozesskosten senken kann.<br />
Einsätze psychisch meistern,<br />
Traumatisierungen verhindern<br />
Auf großes Interesse stieß die <strong>ESG</strong>-Lösung CHARLY be<strong>im</strong> Forum der Deutschen<br />
Gesellschaft für Wehrtechnik (DWT) vom 22. bis 23. Januar 2008 in der<br />
Stadthalle Bonn-Bad Godesberg. Das Thema „Ausbildung in der Bundeswehr“<br />
war geprägt von der Tatsache, dass sich die Bundeswehr nach dem Ende des<br />
Kalten Krieges von einer Ausbildungsarmee zu einer Armee <strong>im</strong> Einsatz gewandelt<br />
hat – dies wird die künftige Ausbildung der Streitkräfte nachhaltig<br />
prägen.<br />
Benjamin Wittekind, Leiter Marketing des <strong>ESG</strong>-Geschäftsbereichs IT-Systemintegration<br />
Militär/Behörden, sprach auf der DWT-Veranstaltung zum Thema<br />
„Psychosoziale Unterstützung mit CHARLY – eine interaktive S<strong>im</strong>ulationsplattform“.<br />
Das System n<strong>im</strong>mt sich der „Herausforderung berufsbedingte Traumatisierung“<br />
an, auf die unter anderem der Wehrbeauftragte des Bundestags in<br />
seinem aktuellen Jahresbericht besonders hingewiesen hat.<br />
Bundeswehr und Einsatzkräfte werden heute in der Regel <strong>im</strong> Vorfeld von<br />
Auslandsmissionen oder möglichen Krisen durch einen Psychologen auf die<br />
Gefahren der Traumatisierung sowie auf die Möglichkeit einer sekundären,<br />
unmittelbar nachsorgenden Betreuung hingewiesen. Im Krisenfall soll durch<br />
Gespräche und die Nachbereitung von Einsätzen psychosoziale Unterstützung<br />
geleistet werden. Schwere Traumatisierungen kommen in die Nachsorge,<br />
wo unter anderem Gesprächskreise helfen sollen. Dabei ist eine schwere<br />
Traumatisierung nicht nur für die Betroffenen eine enorme, oft lebenslange,<br />
Belastung; eine Berufsunfähigkeit von Einsatzkräften bindet Ressourcen und<br />
verursacht erhebliche volkswirtschaftliche Kosten.<br />
Die <strong>ESG</strong> setzt mit ihrem System CHARLY daher auf die pr<strong>im</strong>äre Prävention.<br />
Eine hochinteraktive mult<strong>im</strong>ediale E-Learning-Plattform soll die bestehenden<br />
Unterrichtseinheiten massiv ergänzen und die psychosoziale Belastbarkeit der<br />
Einsatzkräfte – und damit die Handlungsfähigkeit in akuten Belastungssituationen<br />
– erhöhen. CHARLY will die Einsatzkräfte systematisch desensibilisieren,<br />
Akzeptanz für die eigenen Grenzen schaffen und bei Führungskräften Verständnis<br />
für berufsbedingte Traumatisierungen, den so genannten posttraumatischen<br />
Belastungsstörungen, erzeugen.<br />
Kodifizierungslösung<br />
N-CORE NG für Malaysia<br />
Das <strong>ESG</strong>-System N-CORE NG wird jetzt auch in Südostasien eingesetzt. Die<br />
Central Management Catalogue Agency (CMCA), die für die Streitkräfte von<br />
Malaysia als Dienstleister <strong>im</strong> Bereich Katalogisierung tätig ist, setzt die Lösung<br />
zur Kodifizierung militärischen Materials seit Anfang dieses Jahres ein. Ein entsprechender<br />
Vertrag wurde Ende Januar in der <strong>ESG</strong>-Zentrale in Fürstenfeldbruck<br />
unterschrieben.<br />
Die Softwarelösung N-CORE NG dient der Erfassung, Bereitstellung<br />
und Veröffentlichung von Materialinformationen über Versorgungsartikel,<br />
die von NATO-Staaten, NATO-Agenturen (NAMSA) und assoziierten Staaten<br />
verwendet werden. Mit ihrer Hilfe lassen sich die Materialidentifikationsdaten<br />
zum gesamten Materialbestand der NATO dezentral pflegen – von Waffensystemen,<br />
Fahrzeugen oder Maschinen bis hin zu Möbeln oder Kleidungs-<br />
stücken. Das Verteidigungsbündnis mit seinen 26 Mitgliedsstaaten kann so<br />
zu jedem Zeitpunkt einen genauen Überblick über das verwendete Material<br />
bekommen.<br />
Derzeit ist N-CORE bei den Katalogisierungsbehörden der Türkei, Griechenlands,<br />
Dänemarks, Sloweniens, Ungarns, Österreichs, Deutschlands, Rumäniens,<br />
Omans und der Niederlande eingeführt. Auch Firmen, die Katalogisierungsdienstleistungen<br />
erbringen, nutzen das <strong>ESG</strong>-Tool, neben der malayischen<br />
Firma CMCA unter anderem Unternehmen in Ungarn und Brasilien.
++ KURZMELDUNGEN ++<br />
„Corporate Foresight“:<br />
Ausgezeichnete Zukunftsstrategie<br />
Eine hohe Kunden- und Innovationsorientierung und eine strukturierte Zukunftsstrategie<br />
zur Definition künftiger Trends und Themen sind Markenzeichen der<br />
<strong>ESG</strong> Elektroniksystem- und Logistik-GmbH. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie<br />
„Corporate Foresight <strong>im</strong> Mittelstand“ der Z_punkt GmbH. Die vom Bundesministerium<br />
für Bildung und Forschung geförderte Untersuchung analysiert die<br />
Zukunftschancen ausgewählter Unternehmen.<br />
Die Analysten der Z_punkt GmbH erteilen der <strong>ESG</strong> dabei Bestnoten: Um künftige<br />
Trends frühzeitig zu erkennen, führe die <strong>ESG</strong> umfangreiche Markt- und Umfeldanalysen<br />
durch. Strategische Entscheidungen fallen „nicht intuitiv, sondern<br />
auf Basis des Orientierungswissens“ aus strukturierten Prozessen, heißt es in<br />
der Studie. Wichtige Standbeine des strategischen Zukunftsprozesses sind ein<br />
systematisches Trendscouting und <strong>Technolo</strong>giemanagement, in dem zukünftige<br />
Märkte und <strong>Technolo</strong>gien untersucht werden. Die gewonnenen Informationen<br />
werden in einem speziellen Wissensmanagementsystem gebündelt und aufbereitet.<br />
„Die durch Foresight gewonnenen und <strong>im</strong> Wissensmanagement aufbereiteten<br />
Informationen fließen in den jährlich stattfindenden Strategieprozess ein.“<br />
Der Vorsitzende der <strong>ESG</strong>-Geschäftsführung, Gerhard Schempp, bezeichnete<br />
den systematischen Prozess der Zukunftsgestaltung als eine zentrale Aufgabe<br />
des gesamten Management-Teams. Die Studie von Z_punkt dokumentiere, dass<br />
sich die <strong>ESG</strong> mit ihren Strategie- und Innovationsprozessen gut aufgestellt hat,<br />
um auch künftig zu wachsen und dem Anspruch als <strong>Technolo</strong>gieführer gerecht<br />
zu werden.<br />
Automobilelektronik in Asien<br />
Der „Silicon Sea Belt“ ist eine Hightech-Region der Halbleiterbranche, die sich<br />
von Südkorea bis Singapur erstreckt. Unter Beteiligung der <strong>ESG</strong> fand vom 25.<br />
bis 26. Februar 2008 in Fukuoka (Japan) der „Silicon Sea Belt Summit 2008“<br />
statt. Als einer von drei Keynotespeakern stellte der Leiter der <strong>ESG</strong>-Business<br />
Area Automotive, Wolfgang Sczygiol, technologische Entwicklungen <strong>im</strong> Bereich<br />
der Automobilelektrik und -elektronik in Europa vor. Dabei konnten interessante<br />
Kontakte zu Forschungseinrichtungen, etwa dem Japan Automobile Research<br />
Institute oder der Technischen Universität <strong>im</strong> chinesischen Dalian, geknüpft werden.<br />
Im Verlauf der Konferenz wurde deutlich, dass sich die Halbleiterindustrie<br />
und die Softwarehersteller in Asien sehr gut abst<strong>im</strong>men und insbesondere in Taiwan,<br />
Hongkong und Korea eine ausgeprägte Community vorhanden ist, die sich<br />
mit Fragen der E/E <strong>im</strong> Automobil beschäftigt.<br />
Musterbetreuer für Luftfahrtgeräte<br />
Die Zulassungsurkunde der <strong>ESG</strong> als „Luftfahrtbetrieb für Luftfahrzeuge/Luftfahrtgerät<br />
der Bundeswehr” ist vom Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung (BWB)<br />
umfangreich erweitert worden. Damit ist das Unternehmen offiziell berechtigt, die<br />
so genannte Musterbetreuung an Geräten der funktionellen Ausrüstung und an der<br />
Flugelektronik für die eingeführten Waffensysteme der Bundeswehr zu übernehmen.<br />
Die Zulassung belegt auch die Kompetenz der <strong>ESG</strong> bei der Abwicklung von Entwicklungsvorhaben<br />
sowie bei Logistikleistungen.<br />
Grund für die Erweiterung der Zulassung sind Zusammenarbeitsverträge, welche<br />
die <strong>ESG</strong> mit einer großen Anzahl an Herstellerfirmen abgeschlossen hat. Darin wurde<br />
vereinbart, dass die technisch-logistischen und entwicklungstechnischen Betreuungsleistungen<br />
gemäß dem gültigen Betreuungskonzept der Bundeswehr erbracht<br />
werden. In ihrem Abschlussbericht konnten die Prüfer des BWB feststellen, „dass die<br />
zur Musterbetreuung erforderlichen Systemkenntnisse für die [betreffenden] Geräte<br />
aufgrund einer jahrelangen Produktbeobachtung und durchgeführter Analysen ausreichend<br />
vorhanden ist.<br />
Neue Wege in der Entwicklung<br />
von Flugzeugen<br />
Wie kann die Entwicklung künftiger Flugzeuge effizienter als bisher gestaltet werden?<br />
Die <strong>ESG</strong> entwickelt dazu gemeinsam mit der PACE GmbH einen so genannten<br />
GAAD-Demonstrator, der bei der Entwicklung künftiger Airbus-Modelle eingesetzt<br />
werden soll. GAAD bedeutet „Generic Aircraft Architecture Design“.<br />
Das GAAD-Konzept bietet Antworten auf verschiedene Herausforderungen<br />
der Luftfahrtindustrie, etwa was neue Entwicklungsmethoden für Flugzeugarchitekturen<br />
und die Avionik betrifft. Um die Interoperabilität von Methoden und<br />
Werkzeugen sicherzustellen, ist eine einheitliche Plattform notwendig; auf ihr<br />
werden alle Entwicklungsprozesse verwaltet. Dadurch soll künftig stärker als bisher<br />
sichergestellt werden, dass Flugzeuge unter opt<strong>im</strong>alen Gesichtspunkten gestaltet<br />
werden. „Gut“ ist ein Flugzeugdesign dann, wenn verschiedene wichtige<br />
Kriterien, etwa Sicherheit, Gewicht und Kosten, gleichzeitig beachtet werden.<br />
Training für Marineflieger<br />
Mit einem „Cockpit Procedure Trainer“ (CPT) unterstützt die <strong>ESG</strong> die deutschen<br />
Marineflieger. Der S<strong>im</strong>ulator, der zurzeit in der Unternehmenszentrale in Fürstenfeldbruck<br />
entwickelt wird, bildet das Cockpit des Hubschraubers SeaLynx MK-88A,<br />
der auf den Fregatten der Bundeswehr eingesetzt wird, exakt nach. Piloten der<br />
Bundeswehr können damit künftig Einsätze bereits am Boden trainieren und den<br />
Umgang mit der Flugelektronik üben.<br />
Grund für die Entwicklung des CPT ist die Modernisierung der bestehenden<br />
SeaLynx-Hubschrauber während der nächsten Jahre. Diese werden derzeit<br />
mit einer neuen Flugelektronik – und damit auch mit neuen Anzeige- und<br />
Bedienelementen – ausgestattet. Zentraler Ausbildungsinhalt des neuen S<strong>im</strong>ulators<br />
wird daher der Umgang mit den neuen Komponenten sein. Die <strong>ESG</strong><br />
wird dazu das Cockpit mit allen Bedienelementen nachbilden. Statt mit Knöpfen<br />
oder Schiebereglern wie <strong>im</strong> Original-Hubschrauber wird der CPT allerdings über<br />
Touchscreens gesteuert.<br />
Zusätzlich zu dieser Cockpit-Variante, die den Piloten ein sehr realistisches<br />
Abbild des echten Hubschraubers vermittelt, entwickelt die <strong>ESG</strong> auch eine Laptop-Variante<br />
des CPT. Damit können an verschiedenen Standorten einfachere<br />
Abläufe und Szenarien geübt werden.<br />
Der neue CPT wird den bisherigen Trainingss<strong>im</strong>ulator der deutschen Marine,<br />
der sich in den Niederlanden befindet, ersetzen. Er wird direkt be<strong>im</strong> Marinefliegergeschwader<br />
3 in Nordholz aufgestellt. Über das besonders abgesicherte<br />
Bundeswehrnetz, eine Art militärisches Internet, kann der S<strong>im</strong>ulator von der <strong>ESG</strong>-<br />
Zentrale in Fürstenfeldbruck gesteuert und gewartet werden.<br />
Touchscreens mit fotorealistisch nachgebildeten Bedienelementen werden <strong>im</strong><br />
CPT das reale SeaLynx-Cockpit ersetzen.
14 & 15 SPEKTRUM I/08<br />
+ + K U R Z M E L D U N G E N + +<br />
Hightech-Ortungssysteme<br />
für Trailerortung<br />
Die <strong>ESG</strong> realisiert derzeit für die Kögel Fahrzeugwerke GmbH ein Hightech-<br />
System zur Fahrzeugortung am Standort Burtenbach (Landkreis Günzburg).<br />
Mittels hardwareunabhängiger Systemlösungen können künftig die exakten Positionen<br />
der Anhänger auf dem Werksgelände geortet und die Transporte dieser<br />
Trailer opt<strong>im</strong>iert werden. Kögel ist einer der führenden Hersteller für die Entwicklung<br />
und Serienproduktion von Sattelanhängern für den Gütertransport.<br />
Jeder LKW-Anhänger besitzt eine 17-stellige Fahrgestellnummer, welche in<br />
Form eines Barcodes auf das jeweilige Fahrgestell aufgebracht ist. Das Hightech-<br />
Ortungssystem der <strong>ESG</strong> ermöglicht es, die Barcodes der Trailer mittels moderner<br />
Handhelds zu scannen. Zeitgleich zum Barcodescan werden die GPS-Koordinaten<br />
der Auflieger ermittelt. Die zur Verfügung stehenden Geoinformationen werden<br />
dann via GPRS-Datenübertragung an das internetbasierte Portal SuCES-Telematics<br />
transferiert. Diese Software-Telematiklösung ist eine variabel nutzbare,<br />
modular ausbaubare Komplettlösung zur Steuerung, Überwachung und Verwaltung<br />
logistischer Prozesse.<br />
Im Falle von Kögel kann SuCES-Telematics sogar mehrfach eingesetzt werden.<br />
Zum einen visualisiert das Software-Portal die aktuellen Positionen der<br />
Trailer, was zu einer Reduzierung des Such- und Dispositionsaufwandes für<br />
die Mitarbeiter führt. Zum anderen wird SuCES-Telematics auch aktiv zur Auftragsbearbeitung<br />
genutzt. Zusätzlich überträgt das führende Dispositionssystem<br />
sämtliche relevanten Trailerinformationen an das <strong>ESG</strong>-Portal. Mittels SuCES-Telematics<br />
werden danach die Position und die Fahrgestellnummer über die auszuliefernden<br />
Trailer an die zuständigen Mitarbeiter transferiert. Auf Basis dieser<br />
<strong>Technolo</strong>gie findet der Mitarbeiter den gesuchten Trailer sofort und kann ihn umgehend<br />
in den Auslieferungsbereich verbringen.<br />
Reduzierte Suchzeiten, opt<strong>im</strong>ierte Ressourcenauslastung und Imagegewinn<br />
sind die pr<strong>im</strong>ären Vorteile, die sich mit der Einführung des Hightech-Ortungs-<br />
systems erzielen lassen. Dank der umfassenden Softwarelösung SuCES-Telematics<br />
ist eine Anpassung und Erweiterung des Konzeptes auf andere Standorte<br />
jederzeit und ohne großen Aufwand möglich. Als Basis hierfür dienen die geocodierten<br />
Karten der einzelnen Werke und die der externen Stellflächen.<br />
Fürstenfeldbruck:<br />
<strong>Besuch</strong>e in der <strong>ESG</strong>-Zentrale<br />
Informationsbesuche aus der Politik und von hochrangigen Vertretern der Bundeswehr<br />
in der Firmenzentrale in Fürstenfeldbruck standen in den ersten Monaten<br />
des Jahres 2008 auf dem Programm.<br />
Der bayerische Staatsminister für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Dr.<br />
Thomas Goppel, kam am Rosenmontag, den 4. Februar 2008, in die <strong>ESG</strong> und<br />
informierte sich über die Leistungen des Unternehmens. Im Rahmen seines <strong>Besuch</strong>es<br />
wurde auch das <strong>Technolo</strong>giezentrum besichtigt. Für Goppel war die Visite<br />
ein He<strong>im</strong>spiel: Der Minister vertritt den St<strong>im</strong>mkreis Landsberg am Lech/Fürstenfeldbruck-West,<br />
der auch die Stadt Fürstenfeldbruck umfasst, <strong>im</strong> bayerischen<br />
Landtag.<br />
Der Unterabteilungsleiter Rü VI (Ausrüstung Luft) <strong>im</strong> Bundesverteidigungsministerium,<br />
Ministerialdirigent Klaus Heyer, besuchte das Unternehmen am 27.<br />
Februar. Schwerpunkte des gemeinsamen <strong>Besuch</strong>es mit dem Direktor der Wehrtechnischen<br />
Dienststelle für Luftfahrzeuge – Musterprüfwesen für Luftfahrtgerät<br />
der Bundeswehr (WTD 61), Walter Storz, waren unter anderem die technischlogistische<br />
Betreuung des Transportflugzeuges A400M und des Seefernaufklärers<br />
P3-C Orion.<br />
Bereits am 31. Januar hatte sich der Befehlshaber des Wehrbereichskommandos<br />
III, Generalmajor Johann Oppitz, über anstehende militärische Projekte<br />
der <strong>ESG</strong> informiert.<br />
Die <strong>ESG</strong>-Geschäftsführer Gerhard Schempp (l.) und Götz Graichen (r.) freuten<br />
sich über den <strong>Besuch</strong> von Staatsminister Dr. Thomas Goppel.<br />
Ministerialdirigent Heyer (M.) und DirektorWTD Storz (2.v.r.) waren Ende Februar<br />
zu Gast in der <strong>ESG</strong>-Zentrale.<br />
Der Leiter des Geschäftsbereichs Luftfahrzeuge, Christoph Weber (r.), erläuterte<br />
General Oppitz (M.) neue Projekte <strong>im</strong> Hubschrauber- und Flugzeugumfeld.
ENGLISH SUMMARY<br />
Flight s<strong>im</strong>ulation experts<br />
Supposedly, the first flight s<strong>im</strong>ulator was<br />
built out of parts of an organ. At the end<br />
of the 1920s, 25-year-old mechanic Edward<br />
Link built a machine in his father’s<br />
musical instrument workshop in New<br />
York State that allowed pilots to practice<br />
flying airplanes. Since he first built the<br />
s<strong>im</strong>ple “Link Trainer”, highly complex<br />
systems have been developed that are<br />
now indispensable in military and civil<br />
aviation. Today, flight s<strong>im</strong>ulators serve as<br />
cost and t<strong>im</strong>e saving tools in the development<br />
of new systems and functions.<br />
They are also used to train pilots and<br />
technical or logistics employees, as well<br />
as for further training – flight s<strong>im</strong>ulators<br />
serve a wide variety of purposes.<br />
For over two decades, <strong>ESG</strong> has developed<br />
and operated s<strong>im</strong>ulators for<br />
the aviation sector. An <strong>im</strong>pressive array<br />
of s<strong>im</strong>ulators is on display at the<br />
company’s technology centre, which is<br />
among the most modern in Germany.<br />
Testing human-machine interfaces and<br />
intelligent support functions for pilots, for<br />
example, is conducted here. In addition,<br />
the centre conducts tests on combined<br />
operations involving a helicopter and<br />
an unmanned sensor-equipped aircraft.<br />
With the CH-53 s<strong>im</strong>ulator, <strong>ESG</strong> experts<br />
are currently testing new types of sensors<br />
and display components that a<strong>im</strong> to<br />
support flight crews with difficult landing<br />
operations. These tests are being<br />
conducted with Bundeswehr pilots who<br />
already have experience with brownout<br />
landings.<br />
<strong>ESG</strong> systems are not designed to work in<br />
isolation. Rather, they are part of a network<br />
that can carry out complex analyses<br />
requiring tactical scenarios involving<br />
several types of helicopters or aircraft.<br />
The s<strong>im</strong>ulation environment enables joint<br />
operations and special deployments and<br />
therefore covers most network-centric<br />
warfare missions. Furthermore, external<br />
networking is also possible: In 2007,<br />
several <strong>ESG</strong> s<strong>im</strong>ulators participated in<br />
VIRTEL exercises. At the end of November<br />
2007, a s<strong>im</strong>ulation network that<br />
included about 50 participants across<br />
Germany s<strong>im</strong>ulated complex military<br />
missions on water, land and in the air.<br />
<strong>ESG</strong>’s s<strong>im</strong>ulation expertise can be observed<br />
up close at the Berlin Air Show<br />
(ILA) from May 27 to June 1, 2008.<br />
<strong>ESG</strong>’s presence will comprise a booth in<br />
Hall 7 and an exhibit in the pavilion of the<br />
Federal Office of Defence <strong>Technolo</strong>gy<br />
and Procurement.<br />
Completing missions as a team<br />
In recent years, the German Bundeswehr<br />
has taken part in military missions<br />
worldwide. As a result, the army<br />
air corps has become particularly <strong>im</strong>portant.<br />
Its role is to ensure that ground<br />
troops are safely transported from one<br />
place to another, to provide them with<br />
adequate supplies and support them<br />
with combat helicopters. One of their<br />
most <strong>im</strong>portant objectives is to min<strong>im</strong>ize<br />
risk. Unmanned aerial vehicles<br />
(UAVs), operating together with helicopters,<br />
can make an <strong>im</strong>portant contribution.<br />
For instance, UAVs can reconnoitre<br />
and monitor the territory before ground<br />
troops arrive. They can also provide<br />
TIGER helicopters with <strong>im</strong>portant additional<br />
information without putting people<br />
in danger. This process is known as<br />
“Manned–Unmanned Teaming (MUM<br />
T)”. In the context of the MUM-T technology<br />
project, <strong>ESG</strong> has now set out to<br />
identify the army air corps needs for<br />
this and other types of support, and<br />
to present possible solutions and their<br />
feasibility. For this reason, the company<br />
jointly conducted a knowledge survey<br />
over the past year with the army air<br />
corps. The a<strong>im</strong> of this survey was to<br />
examine the air corps current missions<br />
in order to identify operational requirements,<br />
activities related to these missions,<br />
their <strong>im</strong>pact, possible approaches<br />
to solving problems and capability<br />
gaps.<br />
Impulses for the “EOP phase”<br />
In the past, automotive manufacturers<br />
had a s<strong>im</strong>pler mandate: Once a car was<br />
produced, development work on the<br />
model was considered over. According<br />
to Tobias Spann, head of project and<br />
integration management E/E in <strong>ESG</strong>’s<br />
automotive division, this is expected<br />
to change in the future as individual<br />
models continue to occupy carmakers’<br />
agendas long after the last of its type<br />
has left the assembly line.<br />
Following the end of production (EOP),<br />
carmakers today must guarantee that<br />
all spare parts be available to customers<br />
for a period of 15 years. And OEMs<br />
are finding it increasingly difficult to<br />
keep this promise, says Spann. This is<br />
because the share of electronic parts in<br />
cars has grown dramatically in recent<br />
years. In the case of Flash components,<br />
data loss can occur within a few years<br />
after being stored without power. OEMs<br />
cannot then s<strong>im</strong>ply produce a stock<br />
supply that can be stored for 15 years.<br />
Increasingly short IT innovation cycles<br />
also pose a challenge: within a short<br />
t<strong>im</strong>e, the parts available are no longer<br />
identical to those originally used as<br />
these are replaced by newer components.<br />
Spann says that until now, there has not<br />
been a post-EOP process to test whether<br />
these new components are compatible<br />
with the car. “As a proven system<br />
verification expert and as an independent<br />
consulting firm, <strong>ESG</strong> can provide<br />
<strong>im</strong>portant <strong>im</strong>petus to set the EOP phase<br />
on a new course. We assess the processes<br />
thus far employed, conduct cost/<br />
benefit analyses and recommend appropriate<br />
measures. Of course, in a final<br />
step, we can also assume full responsibility<br />
for the entire process chain, which<br />
means we are in charge of the entire<br />
vehicle, from the development phase,<br />
modification management and verification,<br />
through to data handling for the<br />
shop floor, for instance.<br />
Preventing collisions at sea<br />
In recent years, ship traffic on Germany’s<br />
coasts has increased substantially. Traffic<br />
on the Baltic Sea has risen sharply,<br />
for example, in keeping with economic<br />
growth in Russia and the Baltic states.<br />
Sea route surveillance has accordingly<br />
become an increasingly complex task.<br />
To successfully cope with increasing<br />
demand, Germany’s Federal Water<br />
and Shipping Administration (WSW) is<br />
currently setting up the Automatic Identification<br />
System (AIS). This new technology<br />
allows ships around the world<br />
to identify themselves with the help of<br />
onboard devices that provide information<br />
on their position, course, speed,<br />
destination, cargo and other data. As<br />
an additional tool to ensure marit<strong>im</strong>e<br />
traffic safety, AIS also serves to prevent<br />
collisions at sea, enabling ships to exchange<br />
information with one another<br />
and with coastal ship traffic control<br />
centres.<br />
<strong>ESG</strong> is the pr<strong>im</strong>e contractor for the entire<br />
project. With its facility in Wilhelmshaven,<br />
the company has a unit that<br />
focuses exclusively on services for the<br />
marit<strong>im</strong>e sector. Following the completion,<br />
in 2005, of the German gateway to<br />
transmit ship data in conjunction with<br />
the Helsinki Commission (HELCOM),<br />
the “AIS - German Coast” project marks<br />
the second t<strong>im</strong>e that <strong>ESG</strong> is responsible<br />
for a major project of the WSV.<br />
Over the next few years, <strong>ESG</strong> will develop<br />
all of the required software, integrate<br />
it into the full system and initiate<br />
the system’s operations. This process<br />
will include training system operators<br />
and providing documentation. In addition,<br />
the company will build a full testing<br />
and reference system to verify the functionality<br />
of the actual AIS system.<br />
“The vision is becoming reality”<br />
<strong>ESG</strong> Consulting GmbH’s core competency<br />
lies in management consulting<br />
with a special focus on process consulting.<br />
The company, which was founded<br />
on March 1, 2007, is a wholly owned<br />
subsidiary of <strong>ESG</strong>. Its a<strong>im</strong> is to provide<br />
consulting services that build a bridge<br />
between strategy and technology. Dr.<br />
Marianne Janik, Director of <strong>ESG</strong> Consulting<br />
GmbH, comments on how <strong>ESG</strong>’s<br />
consulting arm has fared so far, as it<br />
celebrates its one-year anniversary.<br />
According to Janik, the company has<br />
achieved its objective of gaining a strong<br />
foothold in the public sector as well as<br />
in the healthcare and high-tech industries.<br />
This proves that <strong>ESG</strong> Consulting<br />
GmbH’s vision to enter new markets<br />
that the <strong>ESG</strong> Group did not serve in the<br />
past, is becoming reality.<br />
In particular, customers are benefiting<br />
from the close relationship between<br />
<strong>ESG</strong> and its consulting subsidiary, Janik<br />
says. <strong>ESG</strong> employees can be integrated<br />
into the subsidiary’s project at any t<strong>im</strong>e<br />
should their technological expertise be<br />
required. Customers gain max<strong>im</strong>um<br />
benefit from the fact that they can call<br />
on both the specialist technological approach<br />
and neutral consulting services.<br />
From the very beginning, <strong>ESG</strong> Consulting<br />
GmbH was based on the idea that<br />
consulting is a “people business”. Topics<br />
such as team building and the ability<br />
to work as part of a team therefore play<br />
an <strong>im</strong>portant role. For customers, this is<br />
a decisive factor, as is clearly evident in<br />
how requests for consulting services are<br />
formulated and what is being sought. In<br />
an increasing number of cases, personality,<br />
availability and professional experience<br />
are critical factors.<br />
According to Janik, the company a<strong>im</strong>s<br />
to expand its industrial business in the<br />
high-tech sector in the coming years. In<br />
so doing, the company a<strong>im</strong>s to acquire<br />
customers in sectors such as commercial<br />
logistics or healthcare that have so<br />
far not appeared on the map of <strong>ESG</strong>’s<br />
activities.
TURNING SYSTEM EXPERTISE INTO VALUE WWW.<strong>ESG</strong>.DE