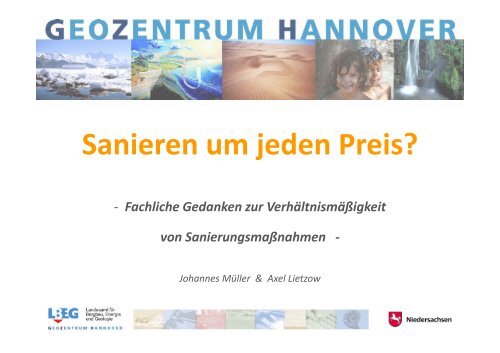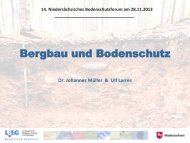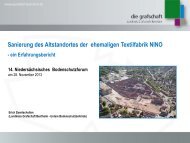Sanieren um jeden Preis? Fachliche Gedankenansätze zur ... - NGS
Sanieren um jeden Preis? Fachliche Gedankenansätze zur ... - NGS
Sanieren um jeden Preis? Fachliche Gedankenansätze zur ... - NGS
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Sanieren</strong> <strong>um</strong> <strong>jeden</strong> <strong>Preis</strong>?<br />
‐ <strong>Fachliche</strong> Gedanken <strong>zur</strong> Verhältnismäßigkeit<br />
von Sanierungsmaßnahmen ‐<br />
Johannes Müller & Axel Lietzow
Was erwartet Sie?<br />
(1) Vorbemerkungen<br />
(2) Grundlagen<br />
(3) Kriterien der Verhältnismäßigkeitsprüfung<br />
(4) schematisierter Ablauf einer Verhältnismäßigkeitsprüfung<br />
(5) Kernaussagen
Vorbemerkungen<br />
• Behörden haben Ermessen bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung.<br />
• Maßstab für die Ermessensausübung ergibt sich aus § 10 Absatz 1 BBodSchG<br />
und § 40 VwVfG.: Wenn die Behörde Ermessen hat, dann muss sie dieses<br />
entsprechend dem Zweck der Ermächtigung ausüben und die gesetzlichen<br />
Grenzen des Ermessens einhalten.<br />
• Verhältnismäßigkeitsprüfungen haben fachliche und juristische Aspekte<br />
• <strong>Gedankenansätze</strong> dieses Beitrags sind Teil eines laufenden Diskussions‐<br />
prozesses über die „Berücksichtigung der natürlichen Schadstoffminderung<br />
im Sinne eines MNA‐Konzeptes bei der Verhältnismäßigkeitsbetrachtung“<br />
im Gesprächskreis „MNA“ des LABO‐Altlastenausschusses (ALA)
<strong>Fachliche</strong> Grundlagen<br />
• Grundlage der Verhältnismäßigkeitsprüfung ist die Sanierungsuntersuchung<br />
o BBodSchV Anh. 3:<br />
„Mit Sanierungsuntersuchungen bei Altlasten sind die <strong>zur</strong> Erfüllung der Pflichten nach<br />
§ 4 Abs. 3 des Bundes‐Bodenschutzgesetzes geeigneten, erforderlichen und<br />
angemessenen (verhältnismäßigen) Maßnahmen zu ermitteln. Die hierfür in Betracht<br />
kommenden Maßnahmen sind unter Berücksichtigung von Maßnahmenkombinationen<br />
und von erforderlichen Begleitmaßnahmen darzustellen.“<br />
� Variantenvergleich<br />
� Pilotversuche<br />
• Pflichtiger schlägt eine Maßnahme oder Maßnahmenkombination vor,<br />
die er für sich als verhältnismäßig ansieht.<br />
Die abschließende Prüfung der Verhältnismäßigkeit und die Entscheidung ob es sich<br />
dabei <strong>um</strong> die vorzugswürdige Maßnahme handelt, ist der zust. Behörde vorbehalten.
Kriterien der Verhältnismäßigkeitsprüfung<br />
(1) Geeignetheit<br />
Geeignet sind diejenigen Maßnahmen, die erwarten lassen, dass das<br />
Sanierungsziel erreicht werden kann.<br />
(2) Erforderlichkeit<br />
Erforderlich ist diejenige unter den geeigneten Maßnahmen,<br />
die den Pflichtigen und die Allgemeinheit am geringsten belastet.<br />
Belastungen für den Pflichtigen und die Allgemeinheit (u.a. Umwelt) können als Aufwand zusammengefasst<br />
werden. Eine als erforderlich einzustufende Maßnahme verursacht also den geringsten Aufwand z<strong>um</strong><br />
Erreichen des Sanierungsziels. Sie stellt damit das „mildeste Mittel“ dar.<br />
(3) Angemessenheit<br />
Angemessen ist eine Maßnahme, wenn der mit ihr verbundene Aufwand in<br />
einem vernünftigen Verhältnis z<strong>um</strong> angestrebten Erfolg steht.<br />
„Die wirtschaftliche<br />
Praxis oder<br />
Leistungsfähigkeit<br />
Theorie?<br />
des Pflichtigen ist<br />
kein Beurteilungskriteri<strong>um</strong> bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung“
Verhältnismäßigkeitsprüfung � Sanierungsziel<br />
„Die Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen<br />
wird am Sanierungsziel gemessen“<br />
� d. h. vor der Verhältnismäßigkeitsprüfung muss das Sanierungsziel<br />
formuliert werden.<br />
Da die Grundlagen für die Verhältnismäßigkeitsprüfung mit der<br />
Sanierungsuntersuchung gelegt werden, muss das Sanierungsziel damit<br />
vor Beginn der Sanierungsuntersuchungen formuliert werden.<br />
Praxis oder Theorie?<br />
� Die Formulierung von Sanierungszielen wird nicht von der<br />
Leistungsfähigkeit eines Sanierungsverfahrens bestimmt,<br />
bevor die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme geprüft wurde.
Wie legt man ein Sanierungsziel fest?<br />
• Gemäß § 4 Absatz 3 BBodSchG sind Boden und Altlasten sowie durch schädliche<br />
Bodenveränderungen oder Altlasten verursachte Verunreinigungen von Gewässern so zu sanieren,<br />
dass dauerhaft keine Gefahren, erheblichen Nachteile oder erheblichen Belästigungen für den<br />
Einzelnen oder die Allgemeinheit entstehen.<br />
• Das Sanierungsziel ist demnach darauf aus<strong>zur</strong>ichten, Gefahren von betroffenen Schutzgütern<br />
abzuwehren. Es beschreibt verbal den am Standort anzustrebenden und noch tolerierbaren<br />
Zustand nach einer Sanierung. Dieser muss unterhalb der Schwelle liegen, ab der die Behörde nach<br />
§10 Absatz 1 BBodSchG eine Verpflichtung <strong>zur</strong> Durchführung von Sanierungsmaßnahmen sehen<br />
würde (Maßnahmenschwelle).<br />
• Bei der Maßnahmenschwelle handelt es sich somit <strong>um</strong> einen standortspezifischen Zustand<br />
(Konzentration, Fracht, Ausmaß), ab dem die Behörde im Ergebnis des Entschließungsermessens<br />
Sanierungsbedarf sieht. Dieser Zustand muss hinsichtlich der Schadstoffkonzentration nicht<br />
zwangsläufig mit der Gefahrenschwelle gleichgesetzt werden.<br />
• Bei der Festlegung von Sanierungszielen sind die materiellen Vorgaben des einschlägigen<br />
Fachrechtes (Bodenschutzrecht, Wasserrecht und ggf. weitere fachrechtliche Vorgaben) zu<br />
beachten.
Gefahrenschwelle � Maßnahmenschwelle<br />
Ermessensspielra<strong>um</strong> bei der Entscheidung über Art und Ausmaß<br />
von Sanierungsmaßnahmen (Auswahlermessen)<br />
Ermessensspielra<strong>um</strong> bei der<br />
Entscheidung über ein Sanierungserfordernis<br />
(Entschließungsermessen)<br />
„Gefahrenschwelle“ = GFS –Werte (Prüfwerte)<br />
Entwurf aus ALA‐GK MNA <strong>zur</strong> Verhältnismäßigkeitsprüfung bei MNA<br />
Gefahrenschwelle im Grundwasser = Geringfügigkeitsschwellenwert (LAWA, 2004)<br />
� Prüfwert, bei dessen Überschreitung über ein Sanierungserfordernis entschieden wird
Gefahrenschwelle / Schadensschwelle / Maßnahmenschwelle
Rahmenbedingungen für das Sanierungsziel<br />
• Gegebenheiten des Standorts und seiner Umgebung<br />
• Charakteristik des Schadensbildes<br />
• Bedeutung des Grundwasservorkommens<br />
• Hintergrundbeschaffenheit des Grundwassers<br />
• Weitere betroffene Schutzgüter und relevante Wirkungspfade<br />
• Bestehende oder planungsrechtlich zulässige Nutzungen<br />
• Zeitliche Aspekte<br />
z. B. im Hinblick auf die Ausbreitung des Schadens oder auf möglicherweise zukünftig betroffene<br />
Nutzungen<br />
• . . .
Wie legt man ein Sanierungsziel fest?<br />
Ein Sanierungsziel kann durch allgemeine Forderungen<br />
verbal beschrieben werden. Z.B.:<br />
• Wiederherstellung der uneingeschränkten Nutzbarkeit und<br />
ökologischen Funktion des Grundwassers<br />
• Wiederherstellung von Bodenfunktionen<br />
• Vermeidung bzw. Reduzierung der Nachlieferung und<br />
Ausbreitung von Schadstoffen<br />
• Schutz weiterer Schutz‐ und Rechtsgüter<br />
• . . .
Geht es auch etwas konkreter? � SanierungszielWERT<br />
SanierungszielWERTE konkretisieren das Sanierungsziel<br />
Sanierungszielwerte sollten messbar sein und damit die Kontrolle<br />
und Beurteilung des Sanierungserfolges ermöglichen.<br />
Messbar werden Sanierungszielwerte durch Bestimmtheitskriterien<br />
WAS muss WO und WANN erreicht werden?
Eigenschaften von Sanierungszielwerten<br />
• WAS muss erreicht werden<br />
(stoffliche Anforderungen: Reduktion von Konzentrationen und /<br />
oder Frachten)<br />
• WO muss das „WAS“ erreicht werden (rä<strong>um</strong>liche Anforderungen)<br />
Ra<strong>um</strong>bezug z. B. durch<br />
‐ Sanierungszonen,<br />
‐ Kontrollebenen, Fließquerschnitte, Messpunkte<br />
‐ Begrenzung der Schadstofffahne<br />
• WANN muss es dort erreicht werden (zeitliche Anforderungen)<br />
zu berücksichtigen:<br />
‐ Ausbreitungsverhalten der Schadstoffe<br />
‐ aktuelle oder geplante Nutzungen<br />
‐ sonstigen Standortgegebenheiten<br />
o Häufigkeit und zeitliche Abstände von Kontrollmessungen vereinbaren<br />
o Bei lang laufenden Sanierungsmaßnahmen Zwischenziele festlegen.
Kriterien der Verhältnismäßigkeitsprüfung<br />
(1) Geeignetheit<br />
Geeignet sind diejenigen Maßnahmen, die erwarten lassen, dass das<br />
Sanierungsziel erreicht werden kann.<br />
(2) Erforderlichkeit<br />
Erforderlich ist diejenige unter den geeigneten Maßnahmen,<br />
Die Eignung die den Pflichtigen einer Maßnahme und die muss Allgemeinheit im Zuge der am Sanierungsuntersuchung<br />
geringsten belastet.<br />
dargestellt werden:<br />
(3) Angemessenheit<br />
• Pilotversuche Angemessen ist eine Maßnahme, wenn der mit ihr verbundene Aufwand in<br />
• Variantenvergleiche<br />
einem vernünftigen Verhältnis z<strong>um</strong> angestrebten Erfolg steht.<br />
• (Bundesweite) Referenzen<br />
• Erfahrungen<br />
• Vergleichsfälle
Kriterien der Verhältnismäßigkeitsprüfung<br />
(1) Geeignetheit<br />
Geeignet sind diejenigen Maßnahmen, die erwarten lassen, dass das<br />
Sanierungsziel erreicht werden kann.<br />
(2) Erforderlichkeit<br />
Erforderlich ist diejenige unter den geeigneten Maßnahmen,<br />
die den Pflichtigen und die Allgemeinheit am geringsten belastet.<br />
(3) Angemessenheit<br />
Angemessen ist eine Maßnahme, wenn der mit ihr verbundene Aufwand in<br />
einem vernünftigen Verhältnis z<strong>um</strong> angestrebten Erfolg steht.
Verhältnismäßigkeitsprüfung Erforderlichkeit<br />
(1) Erforderlichkeit<br />
Erforderlich ist diejenige unter den geeigneten Maßnahmen, die den<br />
Pflichtigen und die Allgemeinheit am geringsten belastet.<br />
Belastungen für den Pflichtigen und die Allgemeinheit (u.a. Umwelt) können als Aufwand<br />
zusammengefasst werden. Eine als erforderlich einzustufende Maßnahme verursacht also den geringsten<br />
Aufwand z<strong>um</strong> Erreichen des Sanierungsziels. Sie stellt damit das „mildeste Mittel“ dar.<br />
Aufwand einer Maßnahme<br />
• Kosten<br />
� Direkte Kosten<br />
o Investitions‐, Betriebs‐ und Erhaltungskosten, Kosten in €/kg Schadstoffaustrag<br />
o Kosten für die Nachsorge<br />
� Indirekte Kosten: z. B. für Produktionsausfall, Nutzungsausfall<br />
• Negative Auswirkungen (Beeinträchtigung direkt Betroffener, der Allgemeinheit und der Umwelt )<br />
o Grundwasserabsenkung<br />
o Emissionen (z. B. Lärm, Erschütterungen, Geruch, Staub, gesundheits‐ und <strong>um</strong>weltgefährdende Stoffe,<br />
entsorgungspflichtige Abfälle und Abwässer)<br />
o Ressourcenverbrauch (z.B. Energie, Chemikalien, Grundwasser)<br />
o Infrastrukturelle Einschränkungen (z. B. Verkehrs‐ , Nutzungseinschränkungen)<br />
o Flächeninanspruchnahme
Kriterien der Verhältnismäßigkeitsprüfung<br />
(1) Geeignetheit<br />
Geeignet sind diejenigen Maßnahmen, die erwarten lassen, dass das<br />
Sanierungsziel erreicht werden kann.<br />
(2) Erforderlichkeit<br />
Erforderlich ist diejenige unter den geeigneten Maßnahmen,<br />
die den Pflichtigen und die Allgemeinheit am geringsten belastet.<br />
(3) Angemessenheit<br />
Angemessen ist eine Maßnahme, wenn der mit ihr verbundene Aufwand in<br />
einem vernünftigen Verhältnis z<strong>um</strong> angestrebten Erfolg steht.
Verhältnismäßigkeitsprüfung Angemessenheit<br />
(1) Angemessenheit<br />
Angemessen ist eine Maßnahme, wenn der mit ihr verbundene Aufwand in<br />
einem vernünftigen Verhältnis z<strong>um</strong> angestrebten Erfolg steht.<br />
• Die Beurteilung der Angemessenheit ist in hohem Maße eine Einzelfallentscheidung<br />
• Wann ist ein Verhältnis vernünftig?<br />
Abstrakt kann ein Verhältnis dann als vernünftig bezeichnet werden, wenn die Rechte und Interessen der<br />
Allgemeinheit und des Pflichtigen nachvollziehbar in einem ausgewogenen Verhältnis berücksichtigt werden<br />
sowie Aufwand und Erfolg in einem Verhältnis stehen, welches sich aus Beobachtungen und Erfahrungen von<br />
vergleichbaren Sachverhalten / Vorgängen (Kennzahlenvergleich) herleiten lässt.<br />
• Wie „wertvoll“ ist der Sanierungserfolg, wie schlimm ist der Schaden?<br />
In den Abwägungsprozess einzubeziehen und dem in Rede stehenden Aufwand gegenüberzustellen sind<br />
insbesondere die konkrete Gefahrensituation und Nutzungen sowie deren Bedeutung<br />
• Kann man Angemessenheit „messbar“ darstellen?<br />
Die quantitative Abwägung des Sanierungserfolgs gegenüber einem quantifizierten Aufwand ist in der Praxis<br />
nicht etabliert, schon gar nicht normiert.<br />
Es existieren derzeit keine Orientierungsgrößen, ab welchem Quotienten (Aufwand zu Erfolg) ein solches<br />
„quantifiziertes“ Verhältnis angemessen wäre.<br />
Weder lässt sich der Aufwand (Kosten und negative Auswirkungen auf den Pflichtigen und die Allgemeinheit) in<br />
Gänze beziffern, noch der Erfolg einer Sanierung in einer quantitativ vergleichbaren Einheit, im optimalen Falle<br />
in Euro, darstellen.
Verhältnismäßigkeitsprüfung Angemessenheit<br />
Gedanken <strong>zur</strong> Quantifizierung der Angemessenheit<br />
• Kann man dem potenziell aufgrund der Schadstoffmenge kontaminierbaren<br />
Grundwassers einen monetären Wert zuweisen?<br />
• Werden die maximalen Sanierungskosten durch die potenziell erforderlichen<br />
Aufbereitungskosten im Falle einer Nutzung des kontaminierten<br />
Grundwassers begrenzt?
Verhältnismäßigkeitsprüfung Angemessenheit<br />
• Ausgangsgedanke:<br />
Wie viel m³ Grundwasser können durch die vorhandene, i. d. R. aber mit großen Unsicherheiten<br />
abgeschätzte, freisetzbare Schadstoffmenge geschädigt werden, d.h. wie viel m³ Grundwasser<br />
haben nach einem Kontakt mit der Schadstoffquelle eine Schadstoffkonzentration oberhalb der<br />
Gefahrenschwelle (GFS‐Wert) und wären demnach nicht mehr uneingeschränkt (für den<br />
menschlichen Gebrauch) nutzbar bzw. ökologisch in einwandfreiem Zustand.<br />
Bsp.<br />
• 100 kg emittierbare/freisetzbare LHKW können bei einem GFS‐Wert von 20 µg/L<br />
5 Mio m³ Wasser verunreinigen.<br />
• Bei einem Wassergewinnungspreis von 1,‐‐ €/m³, dieser könnte ggf. sogar<br />
regionalspezifisch ermittelt werden, „dürfte“ eine Sanierung maximal bis zu 5 Mio €<br />
kosten, bevor sie den „Wert“ des potentiell kontaminierbaren Wassers übersteigt.<br />
• Bedeutet dies andererseits, dass Sanierungskosten von 50.000,‐‐ €/kg Schadstoff<br />
angemessen wären?<br />
Alternativ:<br />
Wie teuer ist es 5 Mio m³ Grundwasser nach einer potentiellen Förderung so<br />
aufzubereiten, dass anschließend die Konzentration < GFS ist<br />
� Höhe der Sicherheitsleistung?
Verhältnismäßigkeitsprüfung Angemessenheit<br />
Gedanken <strong>zur</strong> Quantifizierung der Angemessenheit<br />
• Kann man dem potenziell aufgrund der Schadstoffmenge kontaminierbaren<br />
Grundwassers einen monetären Wert zuweisen?<br />
• Werden die maximalen Sanierungskosten durch die potenziell erforderlichen<br />
Aufbereitungskosten im Falle einer Nutzung des kontaminierten<br />
Grundwassers begrenzt?<br />
Beide Ansätze eignen sich nicht abschließend, den gesamten Aufwand (Kosten und<br />
negative Auswirkungen auf den Pflichtigen und die Allgemeinheit) zu erfassen und dem<br />
angestrebten Erfolg (Erreichen des Sanierungsziels) quantitativ gegenüber zu stellen.<br />
Der Wert des Erfolgs im Sinne einer Wiederherstellung der uneingeschränkten Nutzbarkeit<br />
und ökologischen Funktion des Grundwassers, einer Wiederherstellung von<br />
Bodenfunktionen sowie der Schutz weiterer Schutz‐ und Rechtsgüter kann quantitativ<br />
nicht bewertet werden.<br />
� Gewichtete Bewertungsmatrix
Sanierungserfordernis als Ergebnis<br />
des Entschließungsermessens<br />
Sanierungsziel mit<br />
Sanierungszielwerten festlegen<br />
Was / Wo / Wann<br />
Sanierungsuntersuchung<br />
Maßnahme A<br />
Maßnahme B<br />
Maßnahme C<br />
Maßnahme X<br />
Geeig<br />
‐net?<br />
Verhältnismäßigkeitsprüfung von Maßnahmen<br />
Ja<br />
Maßnahme A<br />
Maßnahme B<br />
Maßnahme X<br />
Nein, keine der Maßnahmen<br />
ist geeignet<br />
schematisierter Prüfungsablauf<br />
<strong>zur</strong> Verhältnismäßigkeit<br />
Erfor‐<br />
derlich?<br />
Maßnahme X<br />
Ange‐<br />
messen?<br />
Ja<br />
Maßnahme<br />
durchführen<br />
Nein: wenn Maßnahmen auch<br />
nach Zielwertanpassung<br />
unverhältnismäßig<br />
Sanierungszielwerte anpassen Schutz‐ und Beschränkungs‐<br />
maßnahmen<br />
Nein
Kernaussagen 1/2<br />
• „Die Verhältnismäßigkeitsprüfung von Sanierungsmaßnahmen setzt die Formulierung<br />
von Sanierungszielen voraus.“<br />
• „Sanierungsziele sollten durch Sanierungszielwerte konkretisiert werden, mit denen<br />
festgelegt wird WAS, WO und bis WANN erreicht werden muss.“<br />
• „Sanierungsziele und Sanierungszielwerte sollten „im optimalen Fall“ im Bereich der<br />
Gefahrenschwelle bzw. Schadensschwelle liegen.“<br />
• „Sanierungszielwerte können bis <strong>zur</strong> Maßnahmenschwelle angepasst werden, wenn<br />
Sanierungsmaßnahmen mit dem Sanierungsziel „Gefahrenschwelle bzw.<br />
Schadensschwelle “ unverhältnismäßig sind.“<br />
• „Kann der bis <strong>zur</strong> Maßnahmenschwelle angepasste Sanierungszielwert mit<br />
Sanierungsmaßnahmen nicht erreicht werden, sind Sanierungsmaßnahmen bis <strong>zur</strong><br />
Grenze der Verhältnismäßigkeit trotzdem durchzuführen. Zusätzlich werden Schutz‐<br />
und Beschränkungsmaßnahmen erforderlich. Es ist von einer dauerhaften<br />
Überwachung auszugehen, so lange, wie die zuständige Behörde den verbliebenen<br />
Grundwasserschaden als überwachungsbedürftig einstuft.
Kernaussagen 2/2<br />
• „Bei komplexen Schäden kann die Aufteilung in Sanierungszonen mit jeweiligen<br />
Sanierungszielwerten und Verhältnismäßigkeitsprüfungen ratsam sein.“<br />
• „Während die Geeignetheit und Erforderlichkeit von Maßnahmen fachlich<br />
vergleichsweise sehr gut beurteilt werden kann, ist die Beurteilung der<br />
Angemessenheit einer Maßnahme, d. h. die Abwägung des vernünftigen Verhältnisses<br />
von Aufwand zu angestrebtem Erfolg, sehr schwierig.“<br />
• „Eine quantitative Gegenüberstellung von Aufwand zu angestrebtem Erfolg ist derzeit<br />
nicht möglich, da der Aufwand nur für die direkt mit den Maßnahmen verbundenen<br />
Kosten monetär zu ermitteln ist, während die übrigen negativen Auswirkungen auf<br />
den Pflichtigen und die Allgemeinheit sowie der angestrebte Erfolg nicht in gleicher<br />
Weise zu bewerten sind. Eine verbal‐arg<strong>um</strong>entative Abwägung, ggf. in Verbindung mit<br />
einer gewichteten Bewertungsmatrix, erscheint derzeit als einzige Möglichkeit, die<br />
Angemessenheit zu beurteilen.“
<strong>Sanieren</strong> <strong>um</strong> <strong>jeden</strong> <strong>Preis</strong>?<br />
‐ <strong>Fachliche</strong> Gedanken <strong>zur</strong> Verhältnismäßigkeit<br />
von Sanierungsmaßnahmen ‐<br />
Johannes Müller & Axel Lietzow