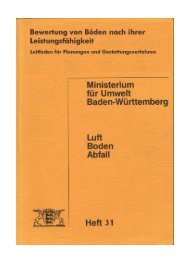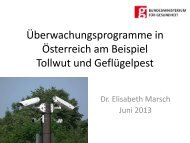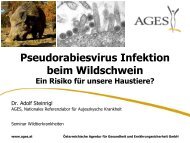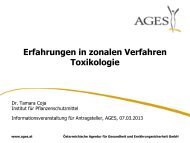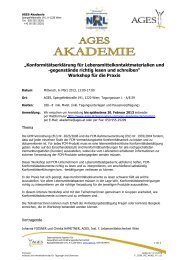Machbarkeitsstudie zur Auslobung „gentechnikfrei“ und ... - AGES
Machbarkeitsstudie zur Auslobung „gentechnikfrei“ und ... - AGES
Machbarkeitsstudie zur Auslobung „gentechnikfrei“ und ... - AGES
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Machbarkeitsstudie</strong><br />
<strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong><br />
Vermeidung von GVO bei Lebensmittel aus<br />
tierischer Erzeugung<br />
Eine Studie<br />
der österreichischen Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
Im Auftrag von:<br />
<strong>und</strong><br />
der Universität für Bodenkultur Wien, Departement für Wirtschafts- <strong>und</strong><br />
Sozialwissenschaften, Institut für Marketing & Innovation<br />
Wien, November 2005<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
Spargelfeldstraße 191, A-1226 Wien; www.ages.at
Eigentümer, Herausgeber <strong>und</strong> Verleger:<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
Für den Gesamtinhalt verantwortlich:<br />
Dr. Bernhard Url<br />
Für den Inhalt der Kapitel 6 <strong>und</strong> 9 verantwortlich:<br />
Univ.Ass. Dipl.-Ing. Dr. Siegfried Pöchtrager<br />
ISBN: 3-200-00475-4
„<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong><br />
<strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei<br />
Lebensmittel aus tierischer Erzeugung“<br />
Projektleitung <strong>AGES</strong><br />
Leopold Girsch<br />
Interne Projektkoordination : Dipl.-Ing. Natascha Balarezo<br />
Projektteam<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit<br />
Institut für Saatgut:<br />
Institut für Futtermittel:<br />
Institut für Lebensmitteluntersuchung Wien:<br />
Bereich Risikobewertung:<br />
Institut für Bienenk<strong>und</strong>e:<br />
Kompetenzzentrum Biochemie:<br />
Universität für Bodenkultur Wien<br />
Dipl.-Ing. Natascha Balarezo<br />
Dipl.-Ing. Christine Kargl<br />
Dipl.-Ing. Mag. Veronika Kolar<br />
Dipl.-Ing. Thomas Kickinger<br />
Univ.-Doz. Dipl.-Ing. Dr. Herbert Würzner<br />
Dipl.-Ing. Rainer Bernhart<br />
Dipl.-Ing. Klaus Riediger<br />
Dr. Roland Grossgut<br />
Mag. Daniela Hofstädter<br />
Dr. Rudolf Moosbeckhofer<br />
Dr. Hermann Hoertner<br />
Mag. Rupert Hochegger<br />
Departement für Wirtschafts- <strong>und</strong> Sozialwissenschaften, Institut für Marketing &<br />
Innovation:<br />
Univ.Ass. Dipl.-Ing. Dr. Siegfried Pöchtrager<br />
Ing. Josef Penzinger, Stefan Großauer<br />
Evaluierung durch A.o.Univ. Prof. Dr. Ludwig Maurer
Danksagung<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Danksagung<br />
Dank ergeht an die gesamte österreichische Mischfutterindustrie <strong>und</strong> -gewerbe <strong>und</strong> an die Großhändler für<br />
landwirtschaftliche Produkte <strong>und</strong> Rohstoffe für die außerordentlich kooperative Beteiligung an der<br />
Fragebogenbeantwortung.<br />
Dank für die fachliche Beratung <strong>und</strong> Mitwirkung bei der Erstellung der Rationen geht an:<br />
Dipl. Ing. Franz Tiefenthaller, LK OÖ, Ing. Hannes Priller, LK OÖ, Ing. Franz Strasser, LK OÖ, Dipl. Ing. Karl Wurm,<br />
LK Stmk, Ing. Rudolf Schmied, LK Stmk, Dipl. Ing. Günther Wiedner, LK NÖ, Dipl. Ing. Karl Feichtinger, St.<br />
Andrä/Lavanttal, Ing. Friedrich Riedl, Eggendorf, NÖ <strong>und</strong> an Ing. Max Gala, Schlierbach, OÖ.<br />
Dank geht an Frau Dr. Angela Busch, Grenzach-Wyhlen, in Deutschland für Ihre Informationen <strong>und</strong> Ausführungen<br />
über gentechnisch hergestellte Zusatzstoffe <strong>und</strong> Aminosäuren.<br />
Nicht zuletzt möchten wir allen Futtermittelfirmen <strong>und</strong> -händlern für Ihre bereitwilligen Auskünfte <strong>und</strong> Informationen<br />
danken.<br />
Wir danken Frau Mag. Siedler (Imkerschule Kärnten) <strong>und</strong> Prof. Dr. Bienefeld (Bieneninstitut Hohen Neuendorf, BRD)<br />
für die Überlassung von Daten, die sie im Rahmen ihrer Honig-Pollenanalysen gewonnen haben, sowie Dr. Peter<br />
Wiedner (LUA Kärnten), Dr. Christian Wurm <strong>und</strong> Vertretern des österreichischen Honig- <strong>und</strong> Bienenfuttemittelhandels<br />
für die Einbringung wertvoller Anregungen, Informationen <strong>und</strong> Kommentare.<br />
Wir danken Frau Dipl. Ing. Sonja Schantl, BMLFUW, für die aktuellen Informationen betreffend die<br />
Förderungsvorgaben für den Anbau von Eiweißalternativen zu Sojabohne - in der EU <strong>und</strong> in Österreich.<br />
Es ist uns bewusst, dass, gerade wenn es um branchen/firmeninterne Informationen geht, viel gegenseitiges<br />
Vertrauen notwendig ist. Darum danken wir Herrn Direktor Johannes Kapeller, Obmann Verband der<br />
Futtermittelindustrie Österreich, Dipl.-Ing. Walter Emathinger <strong>und</strong> Dipl.-Ing. Gunter Haydinger, Fixkraft Enns, GF<br />
Herbert Lugitsch <strong>und</strong> Ing. Franz Knittelfelder, Futtermühle Lugitsch Feldbach, Dipl.-Ing. Peter Messner, Unser<br />
Lagerhaus Warenhandels Ges.m.b.H Klagenfurt, GF Josef Falch, Landw. Genossenschaft f. d. Bez. Landeck, Dipl.-Ing.<br />
Stefan Pickl, Rauch Futter Hall in Tirol, Dipl.-Ing. Johann Schlederer, Verband landwirtschaftlicher<br />
Veredelungsproduzenten, Dipl.-Ing. Andreas Geisler, Tirol Milch Innsbruck, Dipl.-Ing. Thomas Parkfrieder, Geflügel<br />
GmbH. Schlierbach, Dipl.-Ing. Herbert Dullnig, Dipl.-Ing. Manfred Steringer, <strong>und</strong> Dipl.-Ing. Felix Hissek, Raiffeisen<br />
Ware Austria Wien, Dipl.-Ing. Karl Schneider, Börse für Landwirtschaftliche Produkte Wien, Dr. Fritz Gattermayer,<br />
Agrana Zucker GmbH Wien, <strong>und</strong> Mag. Hubert Huber, Agrar- <strong>und</strong> Forstrechts-Abteilung Linz für die <strong>zur</strong><br />
Verfügungstellung wichtiger Informationen <strong>und</strong> Vermittlung wichtiger Kontakte.<br />
Seitens der Südtiroler Verwaltung <strong>und</strong> Wirtschaft wurde uns ein tiefer Einblick in deren Sichtweise der GVO-freien<br />
Produktion vermittelt, wofür wir uns bei Dr. Albert Wurzer, Autonome Provinz Bozen-Südtirol, Franz Blaas,<br />
Bergbauernberatung Bozen-Südtirol, Dr. Annemarie Kaser, Sennereiverband Südtirol, Dr. Alessandro Fugatti,<br />
Tierärztlicher Dienst Südtirol, Karin Brugger, Consortium Südtiroler Speck bedanke<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite I von XI
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Resümee<br />
Mit der in der EU <strong>und</strong> in Österreich geltenden Verpflichtung der Beimengung von Biotreibstoffen werden bis<br />
2007/2008 proteinhältige Substitute in einer Menge <strong>zur</strong> Verfügung stehen, mit der potenziell etwa 40 % der<br />
Sojaextraktionsschrotimporte nach Österreich ersetzt werden können.<br />
Bewertung der Verfügbarkeit:<br />
- gemäß EU-Verordnung (1829/2003) für nicht als GVO deklarationspflichtige Futtermittel<br />
Die Verfügbarkeit von nicht als GVO deklarationspflichtigen Rohstoffen <strong>zur</strong> Futtermittelerzeugung auf der Gr<strong>und</strong>lage<br />
der EU-Verordnung (1829/2003) ist für den österreichischen Bedarf derzeit, sowie auch in der kurz- <strong>und</strong><br />
mittelfristigen Zukunft gegeben.<br />
- nach den Bedingungen des österreichischen Codex für die <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong><br />
Es werden mittelfristig proteinhältige Substitute für Sojaextraktionsschrot <strong>und</strong> Sojabohnen aus österreichischer <strong>und</strong><br />
europäischer Erzeugung verfügbar sein, die auch die Forderungen des österreichischen Codex <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong><br />
<strong>„gentechnikfrei“</strong> erfüllen.<br />
Anmerkungen:<br />
In einer wettbewerbsfähigen, die ernährungsphysiologischen Erfordernisse berücksichtigenden Tierernährung ist der<br />
Ersatz von SES durch Substitute in der Schweine- Geflügel- <strong>und</strong> Putenhaltung jedenfalls nur eingeschränkt möglich.<br />
Weiters kann derzeit die mittel- <strong>und</strong> längerfristige Entwicklung auf den Rohstoffmärkten nicht prognostiziert werden,<br />
ob <strong>und</strong> zu welchen Kosten „gentechnikfreie“ Rohstoffmengen für den österreichischen Bedarf tatsächlich verfügbar<br />
sind.<br />
b.) Zusatzstoffe (Vitamine, Aminosäuren, Enzyme <strong>und</strong> Mikroorganismen)<br />
- gemäß EU-Verordnung (1829/2003) für nicht als GVO deklarationspflichtige Futtermittel<br />
Die Verfügbarkeit von nicht als GVO deklarationspflichtigen Zusatzstoffen <strong>zur</strong> Futtermittelerzeugung auf der<br />
Gr<strong>und</strong>lage der EU-Verordnung (1829/2003) liegt vor.<br />
- nach den Bedingungen des österreichischen Codex für die <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong><br />
Die Verfügbarkeit der in der Fütterung von Schwein, Geflügel <strong>und</strong> Pute unverzichtbaren Futterzusatzstoffe nach den<br />
Anforderungen des österreichischen Codex <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> ist nicht gegeben.<br />
Anmerkungen:<br />
Der österreichische Codex <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> bestimmt zum Unterschied von der EU-Verordnung, dass<br />
Zusatzstoffe nicht mit gentechnisch veränderten Mikroorganismen (GVM) hergestellt werden dürfen. Die Zusatzstoffe<br />
Vitamin B2 <strong>und</strong> B12 <strong>und</strong> die Aminosäuren Lysin, Tryptophan <strong>und</strong> Threonin sind bereits derzeit nur aus Erzeugung mit<br />
GVM verfügbar. Der Trend zum Einsatz von GVM ist auch bei den anderen Vitaminen, bei Aminosäuren <strong>und</strong> Enzymen<br />
vorliegend, sodass deren zukünftige Verfügbarkeit ohne Einsatz von GVM NICHT gewährleistet ist.<br />
In einer wettbewerbsfähigen Tierernährung ist der Einsatz von Futterzusatzstoffen <strong>zur</strong> Vermeidung von<br />
Mangelerscheinungen, v.a. bei Monogastriern (Schwein, Geflügel, Pute), unverzichtbar. Der Einsatz von Vitaminen ist<br />
bei Monogastriern generell erforderlich. Die Aminosäureergänzung ist beim Einsatz von SES-Substituten aus<br />
heimischer oder europäischer Erzeugung unverzichtbar.<br />
3. Machbarkeit des Futtermitteleinsatzes unter Berücksichtigung ernährungsphysiologischer Anforderungen<br />
- gemäß EU-Verordnung (1829/2003) für nicht als GVO deklarationspflichtige Futtermittel<br />
Die Machbarkeit liegt unter Berücksichtigung ernährungsphysiologischer Anforderungen für alle Produktionszweige<br />
(Milchvieh, Mastrind, Schwein, Legehenne, Masthuhn <strong>und</strong> Pute) beim Einsatz von nicht deklarationspflichtigem<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite III von XI
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Resümee<br />
Futtermittel gemäß der EU-Verordnung derzeit, kurz- <strong>und</strong> mittelfristig vor. Betreffend den Einsatz von SES-<br />
Substituten gelten die oben genannten ernährungsphysiologischen Einschränkungen.<br />
- nach den Bedingungen des österreichischen Codex für die <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong><br />
Die Machbarkeit ist für die <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> bei Milchvieh <strong>und</strong> Mastrind gegeben.<br />
Die Machbarkeit ist für die <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> für die Produktionszweige Schwein, Legehenne, Masthuhn <strong>und</strong><br />
Pute nicht gegeben.<br />
4. Potenzieller GVO-Transfer in der Honigproduktion <strong>und</strong> bei Bienenprodukten<br />
Bienenprodukte – insbesondere naturbelassener, nicht gefilterter Honig – enthalten Blütenpollen. Der Gehalt an<br />
Pollen im Honig liegt üblicherweise deutlich unter den Kennzeichnungsschwellenwerten nach der EU-Verordnung<br />
(1829/2003).<br />
5. Strategien <strong>zur</strong> Vermeidung einer GVO-Verunreinigung im Futtermittel <strong>und</strong> Anforderungen an ein effektives <strong>und</strong><br />
effizientes Monitoring- <strong>und</strong> Überwachungssystem <strong>zur</strong> Sicherstellung der Anforderungen für die <strong>Auslobung</strong><br />
<strong>„gentechnikfrei“</strong> nach den Bedingungen des österreichischen Codex oder die Sicherstellung der Anforderungen für<br />
nicht als GVO deklarationspflichtige Futtermittel gemäß EU-Verordnung (1829/2003):<br />
Nachfolgend wird nur dann auf eine differenzierte Darstellung der Anforderungen für die <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong><br />
nach den Bedingungen des österreichischen Codex oder der Anforderungen für nicht als GVO deklarationspflichtige<br />
Futtermittel gemäß EU-Verordnung (1829/2003) eingegangen sofern dies erforderlich ist. Der besseren Lesbarkeit<br />
wegen wird daher der Begriff <strong>„gentechnikfrei“</strong> stellvertretend auch für nicht als GVO deklarationspflichtige Rohstoffe,<br />
Zusatzstoffe <strong>und</strong> Futtermittel gemäß EU-Verordnung (1829/2003) verwendet.<br />
Ausgangspunkt für die Erzeugung „gentechnikfreier“ Futtermittel müssen „gentechnikfreie“ Roh- <strong>und</strong> Zusatzstoffe<br />
sein.<br />
Zur Sicherstellung der Einhaltung der Anforderungen <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> bedarf es eines<br />
Eigenkontrollsystems der beteiligten Unternehmen <strong>und</strong> eines externen Monitoringsystems <strong>zur</strong> Evaluierung der<br />
gesetzten Maßnahmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette.<br />
In Futtermittelwerken mit gleichzeitiger Verarbeitung von „gentechnikfreien“ <strong>und</strong> konventionellen Produkten<br />
gewährleisten nur getrennte <strong>und</strong> geschlossene Produktionsprozesse die Einhaltung der Anforderungen an<br />
„gentechnikfreie“ Futtermittel.<br />
Es ist festzuhalten, dass auch in den landwirtschaftlichen Betrieben, getrennte <strong>und</strong> geschlossene Produktionsprozesse<br />
für den Einsatz von „gentechnikfreien“ <strong>und</strong> konventionellen Futtermittel sicherzustellen sind.<br />
Werden konventionelle GVO-hältige Futtermittel im landwirtschaftlichen Betrieb eingesetzt (zweites<br />
Betriebsstandbein, z.B. Schweine oder Geflügelmast), muss der betreffende Landwirt sämtliche Futtermittel klar<br />
kennzeichnen <strong>und</strong> separat lagern, bearbeiten <strong>und</strong> anwenden.<br />
„Gentechnikfreiheit“ bei Futtermittel muss auch durch entsprechende Untersuchungen garantiert werden. Zu diesem<br />
Zweck ist ein risikobasierter Probenplan entlang der gesamten Wertschöpfungskette anzuwenden. Hierbei sollte<br />
zwischen standardisierter Probeziehung bei jeder Liefereinheit <strong>und</strong> Stichprobenziehung unterschieden werden. Die<br />
standardisierte Beprobung jeder Lieferung ist vor allem bei der Übernahme am Flaschenhals der<br />
Wertschöpfungskette, z. B. dem Überseehafen, zu fordern.<br />
Die Reinigung der verwendeten Transportmittel, Lager-, Be- <strong>und</strong> Verarbeitungseinrichtungen ist bei der<br />
„gentechnikfreien“ Produktion von besonderer Bedeutung. Die Sauberkeit sollte durch ein Kontrollsystem<br />
sichergestellt werden.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite IV von XI
Feasibility study on “GMO-free” claims and the avoidance of GMOs in food<br />
Resume<br />
labelling as genetically modified is limited to a small number of countries of origin, primarily on the American<br />
continent.<br />
A trend calculation reveals that, in the long term, a restricted availability of feed raw materials that do not require<br />
labelling as genetically modified, primarily of soybeans and maize, is to be expected. While the share of “GM<br />
soybeans” amounted to 50 per cent of worldwide cultivation in 2003, this share is expected to climb to as much as<br />
almost 70 per cent by 2008.<br />
Due to the biofuel blend obligation that applies in the EU and thus in Austria, protein substitutes will be available by<br />
2007/2008 in a quantity that will have the potential to replace aro<strong>und</strong> 40 per cent of the soybean extraction meal<br />
imports to Austria.<br />
Availability assessment:<br />
- in accordance with EU Directive (1829/2003) for feed that does not require labelling as genetically modified<br />
Raw materials for animal feed production which do not require labelling as genetically modified in accordance with<br />
the EU Directive (1829/2003) are currently available for Austrian requirements and will continue to be available in the<br />
short- and medium-term future<br />
- in accordance with the provisions of the Austrian Codex on “GMO-free” labelling<br />
In the medium term, protein substitutes for soybean extraction meal and soybeans produced in Austria and Europe<br />
will be available that also comply with the requirements of the Austrian Codex Alimentarius on “GMO-free” labelling.<br />
Notes:<br />
In a competitive animal diet that takes into account the animals’ nutritional requirements, the replacement of SEM<br />
with substitutes in pig, poultry and turkey farming is only possible to a limited extent.<br />
Additionally, no forecast can be given for the medium- and long-term development on the raw material markets as to<br />
whether or not and at what prices “GMO-free” raw material quantities will actually be available for Austria’s<br />
requirements.<br />
b.) Additives (vitamins, amino acids, enzymes and micro-organisms)<br />
- in accordance with EU Directive (1829/2003) for animal feed that does not require labelling as genetically modified<br />
Additives for animal feed production which do not require labelling as genetically modified in accordance with the EU<br />
Directive (1829/2003) are available.<br />
- in accordance with the provisions of the Austrian Codex Alimentarius on “GMO-free” labelling<br />
There is no availability of such animal feed additives that are absolutely essential for feeding pigs, poultry and<br />
turkeys in accordance with the requirements of the Austrian Codex Alimentarius on “GMO-Free” labelling.<br />
Notes:<br />
Unlike the EU Directive, the Austrian Codex Alimentarius on “GMO-free” labelling determines that additives must not<br />
be produced with genetically modified micro-organisms (GMM). Yet already now the additives Vitamin B2 and B12<br />
and the amino acids lysine, tryptophane and threonine are only available produced with GMM. The trend towards use<br />
of GMM is also noticeable in other vitamins, amino acids and enzymes, which means that their future availability<br />
without the use of GMM is NOT guaranteed.<br />
In a competitive animal diet, the use of animal feed additives to avoid deficiency symptoms, primarily with regard to<br />
monogastric animals (pigs, poultry, turkeys) is absolutely essential. The use of vitamins for monogastric animals is<br />
generally required. When employing SEM substitutes from domestic or European production amino acid<br />
supplementation is absolutely essential.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite VIII von XI
3. Feasibility of the use of feeds taking nutritional requirements into account<br />
Feasibility study on “GMO-free” claims and the avoidance of GMOs in food<br />
Resume<br />
- according to EU Directive (1829/2003) for animal feed that does not require labelling as genetically modified<br />
Taking into account the nutritional requirements for all production industries (dairy cattle, beef cattle, pigs, layers,<br />
chickens for fattening and turkeys), the use of animal feed that does not require labelling as genetically modified in<br />
accordance with the EU Directive is possible at present and in the short- and medium-term future. With regard to the<br />
use of SEM substitutes, the aforementioned nutritional restrictions apply.<br />
- in accordance with the Austrian Codex Alimentarius on “GMO-free” labelling<br />
In dairy cattle and beef cattle, feasibility with regard to “GMO-free” labelling is possible.<br />
In the production industries pigs, layers, chickens for fattening and turkey, feasibility with regard to “GMO-free”<br />
labelling is not possible.<br />
4. Potential GMO transfer in honey production and bee products<br />
Bee products – specifically natural, unfiltered honey – contain flower pollen. The content of pollen in honey is usually<br />
noticeably below the labelling threshold levels in accordance with the EU Directive (1829/2003).<br />
5. Strategies to avoid GMO contamination in animal feed and requirements for an effective and efficient monitoring<br />
and surveillance system to ensure the observance of the requirements for “GMO-free” labelling in accordance with<br />
the provisions of the Austrian Codex Alimentarius or the requirements for the animal feeds that do not require<br />
labelling as genetically modified in accordance with the EU Directive (1829/2003):<br />
In the following, a differentiated presentation of the requirements for “GMO-free” labelling in accordance with the<br />
provisions laid down in the Austrian Codex Alimentarius or the requirements for animal feed that does not require<br />
labelling as genetically modified in accordance with EU Directive (1829/2003) will not be provided unless it is<br />
necessary. To make it easier to read, the term “GMO-free” is also used for raw materials, additives and feeding stuffs<br />
that do not require labelling as genetically modified in accordance with EU Directive (1829/2003).<br />
The starting point for producing “GMO-free” feeding stuffs must be “GMO-free” raw materials and additives.<br />
To ensure that the requirements for “GMO-free” labelling are observed, the companies involved will need an internal<br />
monitoring system while an external monitoring system will be required to evaluate the measures taken along the<br />
entire value chain.<br />
In animal feed factories in which “GMO-free” and conventional products are processed at the same time, only<br />
segregated and closed production processes are capable of ensuring that the requirements of “GMO-free” animal<br />
feed are met.<br />
It must be stated that also in agricultural operations, segregated and closed production processes for the use of<br />
“GMO-free” and conventional feeding stuffs must be ensured.<br />
If conventional feeding stuffs containing GMOs are used in agricultural operations (as a second business pillar, e.g.<br />
pigs or chickens for fattening), such a farmer must mark all feeding stuffs clearly and store, process and use them<br />
separately.<br />
The “freedom from genetic engineering“ in animal feed must also be guaranteed by adequate testing. For this<br />
purpose, a risk-based sampling plan along the entire value chain is to be applied. In this respect, one should<br />
distinguish between standardised sampling carried out for each delivery unit and random sampling. Standardised<br />
sampling performed with each delivery is to be demanded primarily when goods are accepted at a bottleneck of the<br />
value chain, e.g. at a transatlantic port.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite IX von XI
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
1. Einleitung <strong>und</strong> Aufgabenstellung - L. GIRSCH, Bereich Landwirtschaft, <strong>AGES</strong>.............................................5<br />
2. Rechtsnormen <strong>und</strong> Systeme <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>und</strong>/oder Kennzeichnung als <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong><br />
„GVO-frei“ bei Futter- <strong>und</strong> Lebensmitteln - N. BALAREZO, Institut für Saatgut, V. KOLAR, Institut für Futtermittel ,<br />
R. BERNHART <strong>und</strong> K. RIEDIGER, Institut für Lebensmitteluntersuchung Wien, <strong>AGES</strong>.....................................................7<br />
2.1. Verbindliche Rechtsgr<strong>und</strong>lagen............................................................................................ 7<br />
2.1.1. Saatgut <strong>und</strong> Landwirtschaft ............................................................................................ 7<br />
2.1.1.1. International .......................................................................................................... 7<br />
2.1.1.2. Europäische Union.................................................................................................. 7<br />
2.1.1.3. National................................................................................................................. 9<br />
2.1.2. Futtermittel.................................................................................................................... 9<br />
2.1.2.1. International .......................................................................................................... 9<br />
2.1.2.2. Europäische Union.................................................................................................. 9<br />
2.1.2.3. National............................................................................................................... 10<br />
2.1.3. Lebensmittel ................................................................................................................ 10<br />
2.1.3.1. International ........................................................................................................ 10<br />
2.1.3.2. National............................................................................................................... 12<br />
2.2. Weltweiter Codex (Codex Alimentarius) sowie der Österreichische Codex (Codex Alimentarius<br />
Austriacus), insbesondere Codex-Richtlinie <strong>zur</strong> Definition der „Gentechnikfreiheit“ .................... 13<br />
2.2.1. Saatgut <strong>und</strong> landwirtschaftliche Produktionsgr<strong>und</strong>lagen.................................................. 13<br />
2.2.2. Futtermittel.................................................................................................................. 14<br />
2.2.3. Lebensmittel ................................................................................................................ 16<br />
2.2.3.1. Codex Alimentarius- weltweiter Codex ................................................................... 16<br />
2.2.3.2. Codex Alimentarius Austriacus – Österreichisches Lebensmittelbuch....................... 17<br />
2.3. Private Gütesiegelprogramme (Beispiele dazu) ................................................................... 18<br />
2.3.1. In Österreich................................................................................................................ 18<br />
2.3.2. Beispiele für Gütesiegelprogramme im benachbarten Ausland ......................................... 18<br />
3. Abschätzung der Verfügbarkeit <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Futter- <strong>und</strong> Lebensmittel <strong>zur</strong><br />
<strong>Auslobung</strong> <strong>und</strong>/oder Kennzeichnung <strong>„gentechnikfrei“</strong> oder „GVO-frei“ aufgr<strong>und</strong> der Anbau- <strong>und</strong><br />
Marktsituation von GVO in der landwirtschaftlichen Erzeugung – N. BALAREZO <strong>und</strong> CH. KARGL, Institut für<br />
Saatgut, <strong>AGES</strong> ................................................................................................................................................21<br />
3.1. Anbau landwirtschaftlicher Kulturen <strong>zur</strong> Futtermittel- <strong>und</strong> Lebensmittelerzeugung unter<br />
besonderer Berücksichtigung von GV-Kulturen – aktuell <strong>und</strong> zukünftig ............................... 22<br />
3.1.1. Die Hauptproduzenten weltweit <strong>und</strong> auf EU-Ebene ......................................................... 22<br />
3.1.2. Anbau <strong>und</strong> Produktion in Österreich inklusive potentielle Sojabohnen-Substitute .............. 29<br />
3.1.2.1. Pflanzenbauliche Aspekte des Anbaus von Eiweißpflanzen....................................... 30<br />
3.1.2.2. Aspekte der Förderung von Eiweißpflanzen in der EU <strong>und</strong> in Österreich ................... 30<br />
3.1.2.3. Umsetzung der EU-Biokraftstoffrichtlinie <strong>und</strong> deren Einfluss auf das Aufkommen von<br />
Eiweißfuttermittel ................................................................................................. 31<br />
3.1.2.4. Perspektive für die Substitution von Sojabohnen in der Fütterung in Österreich........ 33<br />
3.2. Aktueller Stand <strong>und</strong> Perspektiven der GVO-Anwendung in der Landwirtschaft ...................... 35<br />
3.2.1. Der Stand der Anträge auf Freisetzungen von GVO <strong>und</strong> GV-Sorten gemäß Sortenzulassungsverfahren.....................................................................................................................<br />
35<br />
3.2.1.1. Freisetzung von GVO ............................................................................................ 35<br />
3.2.1.2. Aktueller Stand von Sortenzulassungen (gemäß Saatgutrecht in der EU) von<br />
gentechnisch veränderten Pflanzensorten <strong>und</strong> im Sortenzulassungsverfahren<br />
stehenden gentechnisch veränderten Sorten......................................................... 37<br />
3.2.2. Die Verbreitung von GVO in der landwirtschaftlichen Produktion <strong>und</strong> deren Bedeutung für<br />
eine potentielle Verfügbarkeit von „GVO-freien“ oder „gentechnikfreien“ Produkten.......... 38<br />
3.3. Handels- <strong>und</strong> Marktsituation landwirtschaftlicher Ernteprodukte <strong>zur</strong> Futtermittel- <strong>und</strong><br />
Lebensmittelerzeugung unter besonderer Berücksichtigung von GV-Kulturen ....................... 46<br />
3.3.1. Handelsdaten............................................................................................................... 46<br />
3.3.1.1. Sojabohnen (Glycine max) <strong>und</strong> Sojaextraktionsschrot (SES).................................... 46<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 1 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
3.3.1.2. Mais (Zea mays), Maisschrot <strong>und</strong> Maisverarbeitungsprodukte.................................. 49<br />
3.3.1.3. Raps (Brassica napus) <strong>und</strong> Rübsen (Brassica rapa), Rapsextraktionsschrot .............. 51<br />
3.3.2. Gentechnikstatus der Rohstoffe <strong>und</strong> Trennung der Warenströme durch IP-Systeme ......... 53<br />
3.4. Bewertung der Verfügbarkeit von „GVO-freien“ oder „gentechnikfreien“ Ernteprodukten aus<br />
der landwirtschaftlichen Erzeugung in Europa <strong>und</strong> in Österreich....................................................... 55<br />
4. Abschätzung der Verfügbarkeit von Futtermittel <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> „GVO-frei“ oder <strong>„gentechnikfrei“</strong> -<br />
V. KOLAR <strong>und</strong> TH. KICKINGER, Institut für Futtermittel, <strong>AGES</strong> ...........................................................................60<br />
4.1. Verbreitung von GVO in der Futtermittelherstellung, Einschätzung der zukünftigen<br />
Entwicklung, Aspekte der Verfügbarkeit <strong>und</strong> Optionen <strong>zur</strong> Versorgungssicherheit in der<br />
Futtermittelerzeugung <strong>und</strong> –anwendung............................................................................ 60<br />
4.1.1. Futtermittelausgangserzeugnisse, Rohstoffe aus landwirtschaftlicher Erzeugung .............. 60<br />
4.1.2. Zusatzstoffe <strong>und</strong> Aminosäuren ...................................................................................... 70<br />
4.1.2.1. Mangelerscheinungen von Vitamin B2 <strong>und</strong> B12 bei Monogastriern ........................... 72<br />
4.1.2.2. Mangelerscheinungen durch fehlende Aminosäuren (AS) ........................................ 74<br />
4.2. Einsatz von Substituten von Sojaextraktionsschrot (SES) in der Fütterung............................ 77<br />
4.2.1. Gegenüberstellung des Rohproteinwertes <strong>und</strong> des Aminosäuremusters von Soja 44 <strong>und</strong> Soja<br />
48 zu alternativen Eiweißträgern ................................................................................... 81<br />
4.2.2. Einsatzempfehlungen für alternative, eiweißreiche pflanzliche Futtermittel ....................... 83<br />
4.2.3. Verwertung von DDGS <strong>und</strong> Rapskuchen aus der Biokraftstofferzeugung .......................... 83<br />
4.2.4. Monetäre Betrachtung <strong>und</strong> Aspekte der Verfügbarkeit der Substitute............................... 86<br />
4.3. Zwischenresümee aus Ernährungsphysiologie, Verfügbarkeit <strong>und</strong> gesetzlichen<br />
Rahmenbedingungen........................................................................................................ 88<br />
5. Probenahme <strong>und</strong> Analytik im Zusammenhang mit GVO – H. HÖRTNER <strong>und</strong> R. HOCHEGGER, CC Biochemie, V.<br />
KOLAR, Institut für Futtermittel, G. WUNDERLICH, Institut für Saatgut, <strong>AGES</strong> ............................................................94<br />
5.1. Methodik der Probenahme ................................................................................................ 94<br />
5.1.1. Saatgut........................................................................................................................ 94<br />
5.1.2. Futtermittelausgangserzeugnisse <strong>und</strong> Rohstoffe ............................................................. 95<br />
5.1.3. Futtermittel.................................................................................................................. 96<br />
5.1.3.1. Amtliche Probenahme im Rahmen der Kontrolle nach dem Futtermittelgesetz .......... 96<br />
5.1.3.2. Eigenprobenahme bzw. amtliche Probenahme auf Auftrag ...................................... 97<br />
5.1.4. Lebensmittel ................................................................................................................ 97<br />
5.2. Prinzipien, Methodik <strong>und</strong> Limitationen der GVO-Analytik inklusive Probenvorbereitung im Labor<br />
98<br />
5.2.1. Methodik der GVO-Analytik ........................................................................................... 99<br />
5.2.2. Untersuchungsschema................................................................................................ 100<br />
5.2.3. Limitationen <strong>und</strong> Herausforderungen der GVO-Analytik................................................. 101<br />
5.2.4. Lösungsansätze <strong>zur</strong> Bewältigung der Herausforderungen in der GVO-Analytik ................ 102<br />
6. Betrachtungen zu einem effektiven <strong>und</strong> effizienten Monitoring- <strong>und</strong> Überwachungssystem für die<br />
Sicherstellung der Anforderungen eines Qualitätsprogrammes - S. PÖCHTRAGER, S. GROßAUER, Institut für<br />
Marketing & Innovation, BOKU...................................................................................................................... 103<br />
6.1. Allgemeines ................................................................................................................... 103<br />
6.2. Orte <strong>und</strong> Quellen der Verunreinigung .............................................................................. 104<br />
6.3. Monitoring auf den einzelnen Stufen des Produktionsprozesses......................................... 110<br />
6.3.1. Monitoring in der landwirtschaftlichen Produktion von Rohstoffen.................................. 112<br />
6.3.2. Monitoring bei der Sammelstelle, Transport <strong>und</strong> Zwischenlagerstelle ............................. 112<br />
6.3.3. Monitoring beim Futtermittelwerk................................................................................ 116<br />
6.3.4. Monitoring beim Selbstmischer mit <strong>und</strong> ohne eigener Futterroh- <strong>und</strong> Zusatzstoffe.......... 117<br />
6.3.5. Monitoring beim Landwirt mit Eierproduktion ............................................................... 118<br />
6.3.6. Monitoring beim Landwirt mit Geflügelmast ................................................................. 120<br />
6.3.7. Monitoring beim Landwirt mit Schweinemast................................................................ 120<br />
6.3.8. Monitoring beim Landwirt mit Milchproduktion ............................................................. 122<br />
6.3.9. Monitoring beim Landwirt mit Rindermast .................................................................... 123<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 2 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
6.4. Übergeordnete Maßnahmen bei allen Stufen .................................................................... 124<br />
7. Betrachtungen des landwirtschaftlichen Produktenhandels <strong>und</strong> der Futtermittelwirtschaft<br />
betreffend die Kostenbelastung für <strong>Auslobung</strong> „GVO-frei“ oder <strong>„gentechnikfrei“</strong> mit einem<br />
Qualitätsprogramm – V. KOLAR <strong>und</strong> TH. KICKINGER, Institut für Futtermittel, <strong>AGES</strong>............................................ 130<br />
8. Auswahl von „gentechnikfreien“ oder „GVO-freien“ Futterrationen <strong>zur</strong> Betrachtung der<br />
Verfügbarkeit <strong>und</strong> der Berechnung der Differenzkosten zu als GVO gekennzeichneten Futterrationen -<br />
V. KOLAR <strong>und</strong> TH. KICKINGER, Institut für Futtermittel, <strong>AGES</strong>................................................................................ 135<br />
9. Differenzkosten bei der Erzeugung von tierischen Lebensmitteln bei Einsatz von<br />
„gentechnikfreien“ oder „GVO-freien“ Futterrationen im Vergleich zu als GVO gekennzeichneten<br />
Futterrationen sowie Kostenbetrachtung für tierische Lebensmittel in Österreich - S. PÖCHTRAGER, J.<br />
PENZINGER, Institut für Marketing & Innovation, BOKU...................................................................................... 140<br />
9.1. Kosten der Lebensmittel- <strong>und</strong> Futtermittelwirtschaft betreffend die Vermeidung von GVO in<br />
Österreich................................................................................................................................... 140<br />
9.1.1. Was nicht berücksichtigt wurde................................................................................... 141<br />
9.1.2. Durchschnittliche Produktionsmengen je Betrieb .......................................................... 143<br />
9.1.3. Futterdifferenzkosten.................................................................................................. 143<br />
9.1.3.1. Berechnungsgr<strong>und</strong>lagen ..................................................................................... 143<br />
9.1.3.2. Durchführung der Kostenberechnungen............................................................... 145<br />
9.1.3.3. Ergebnisse <strong>und</strong> Interpretation der Futterdifferenzkosten (Mehr- <strong>und</strong> Minderkosten) 148<br />
9.1.3.3.1. Milcherzeugung:............................................................................................. 148<br />
9.1.3.3.2. Rindermast: ................................................................................................... 152<br />
9.1.3.3.3. Schweinemast:............................................................................................... 155<br />
9.1.3.3.4. Legehennenhaltung:....................................................................................... 160<br />
9.1.3.3.5. Hühnermast ................................................................................................... 166<br />
9.1.3.3.6. Putenmast ..................................................................................................... 169<br />
9.1.4. Kontrollkosten ............................................................................................................ 172<br />
9.1.4.1. Durchführung der Anfrage an österreichische Bio-Kontrollstellen ........................... 172<br />
9.1.4.2. Kontrollumfang .................................................................................................. 173<br />
9.1.4.3. Preise <strong>und</strong> Kosten je Einheit (Tier bzw. kg Fleisch, kg Milch, Ei) ............................ 173<br />
9.1.4.4. Interpretation .................................................................................................... 176<br />
9.1.5. Mögliche weitere Kriterien für die Umsetzung eines Qualitätsprogrammes „GVO-frei“ oder<br />
“gentechnikfrei“.......................................................................................................... 176<br />
9.1.5.1. Hofmischung oder Fertigfutterzukauf................................................................... 176<br />
9.1.5.2. Verteilung der Tierbestände nach B<strong>und</strong>esländern ................................................. 177<br />
10. Zeitrahmen bis <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> von „GVO-Freiheit“ oder „Gentechnikfreiheit“ – V. KOLAR <strong>und</strong> TH.<br />
KICKINGER, Institut für Futtermittel, <strong>AGES</strong> ........................................................................................................ 187<br />
10.1. Großhandel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen <strong>und</strong> Rohstoffen, landwirtschaftlicher<br />
Produktenhandel ............................................................................................................ 187<br />
10.2. Futtermittelindustrie ....................................................................................................... 187<br />
10.3. Landwirtschaftliche Erzeugung tierischer Produkte............................................................ 190<br />
10.4. Erzeugung von tierischen Lebensmittel (Be- <strong>und</strong> Verarbeitung) <strong>und</strong> Lebensmittelhandel..... 190<br />
11. Literaturrecherche <strong>zur</strong> aktuellen Datenlage bezüglich GVO-Transfer <strong>und</strong> potentielle GVO-<br />
Verunreinigungsquellen über Futtermittel ............................................................................................. 193<br />
11.1. Die mechanischen Verunreinigungsquellen über Futtermittel - V. KOLAR <strong>und</strong> TH. KICKINGER,<br />
Institut für Futtermittel, <strong>AGES</strong> ......................................................................................... 193<br />
11.2. GVO-Transfer in tierische Lebensmittel (Milch, Fleisch, Eier) – R. GROSSGUT <strong>und</strong> D.<br />
HOFSTÄDTER, Bereich Risikobewertung, <strong>AGES</strong> .................................................................... 200<br />
11.2.1. Zusammenfassung der Fütterungsversuche.............................................................. 200<br />
11.2.2. Gentransfer............................................................................................................ 201<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 3 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
11.3. Potentieller GVO-Transfer in der Honigproduktion <strong>und</strong> bei Bienenprodukten –<br />
R. MOOSBECKHOFER, Institut für Bienenk<strong>und</strong>e, <strong>AGES</strong> ........................................................... 215<br />
11.3.1. Gesetzliche Gr<strong>und</strong>lagen für Bienen- <strong>und</strong> Bienenprodukte .......................................... 215<br />
11.3.2. Nahrungsquellen <strong>und</strong> –bedürfnisse der Honigbiene .................................................. 216<br />
11.3.3. Bienenprodukte...................................................................................................... 217<br />
11.3.4. Bienenflugweiten.................................................................................................... 220<br />
11.3.5. Trachtquellen......................................................................................................... 221<br />
11.3.6. mögliche Quellen für GVO-Eintrag bzw. GVO-Einwirkung .......................................... 223<br />
11.3.7. Künftige Verfügbarkeit von ..................................................................................... 226<br />
11.3.8. Einfluss von GVO-Verunreinigungen in Bienenprodukten auf die Vermarktung im Inland...<br />
228<br />
11.3.9. Einfluss auf Vermarktung im Ausland....................................................................... 229<br />
11.3.10. Zusatzkosten für GVO-Analysen bei Honig <strong>und</strong> anderen Bienenprodukten .................. 229<br />
11.3.11. Erforderliche Maßnahmen <strong>zur</strong> Erhaltung der „GVO-Freiheit“ von Bienenprodukten von der<br />
Gewinnung über die Verarbeitung bis <strong>zur</strong> Abfüllung .................................................. 229<br />
11.3.12. Abschätzung der möglichen Folgen der <strong>Auslobung</strong> bestimmter Honige als <strong>„gentechnikfrei“</strong><br />
auf den österreichischen Honigmarkt ....................................................................... 230<br />
11.3.13. Einschätzung der Machbarkeit für eine <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> bei Bienenprodukten,<br />
insbesondere Honig ................................................................................................ 230<br />
12. Zusammenfassung............................................................................................................................ 235<br />
13. Literaturverzeichnis.......................................................................................................................... 254<br />
Tabellenverzeichnis ................................................................................................................................. 267<br />
Abbildungsverzeichnis ............................................................................................................................. 270<br />
Abkürzungsverzeichnis ............................................................................................................................ 272<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 4 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 1: Einleitung <strong>und</strong> Aufgabenstellung<br />
1. Einleitung <strong>und</strong> Aufgabenstellung - L. GIRSCH, Bereich Landwirtschaft, <strong>AGES</strong><br />
Einleitend werden die in der Studie angewandten Begriffe bzw. Definitionen vorgestellt:<br />
„Gentechnikfrei“ :<br />
Definition gemäß Codex Alimentarius Austriacus siehe<br />
http://www.bmgf.gv.at/cms/site/attachments/8/0/5/CH0264/CMS1085747609216/codex-rl.pdf<br />
„GVO-frei“:<br />
Der Begriff „GVO-frei“ wird in der Studie für nicht kennzeichnungspflichtige Lebensmittel <strong>und</strong> Futtermittel gemäß der<br />
Bestimmungen der VO (EG) 1829/2003 über genetisch veränderte Lebensmittel <strong>und</strong> Futtermittel verwendet.<br />
Darüber hinaus wird der Begriff „GVO-frei“ in der Studie im Zusammenhang mit Lebensmitteln aus tierischer<br />
Erzeugung (Milch, Eier, Fleisch) dann angewandt, wenn nicht kennzeichnungspflichtige Futtermittel gemäß der<br />
Bestimmungen der VO (EG) 1829/2003 in der Tierernährung eingesetzt werden.<br />
Zum Anwendungsbereich der VO (EG) 1829/2003 hat der Ständige Ausschuss Lebensmittelkette <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
folgende Klarstellung getroffen, siehe<br />
http://europa.eu.int/comm/food/committees/regulatory/modif_genet/summary240904_en.pdf<br />
(Punkt 1).<br />
Im Zuge der aktuellen Diskussionen über die Möglichkeit bzw. Machbarkeit der Erzeugung <strong>und</strong> <strong>Auslobung</strong><br />
„gentechnikfreier“ oder „GVO-freier“ tierischer Lebensmittel in einem Qualitätsprogramm in Österreich, beauftragten<br />
das B<strong>und</strong>esministerium für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Frauen (BMGF), das B<strong>und</strong>esministerium für Wirtschaft <strong>und</strong> Arbeit<br />
(BMWA) <strong>und</strong> die AMA Marketing GesmbH (AMA) die Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong><br />
Ernährungssicherheit (<strong>AGES</strong>) mit der Durchführung <strong>und</strong> Hauptkoordination einer <strong>Machbarkeitsstudie</strong>. Die Studie wird<br />
in Zusammenarbeit mit den fachlichen Kompetenzen der Universität für Bodenkultur, Univ.Ass. Dipl.-Ing. Dr.<br />
Siegfried Pöchtrager, erstellt <strong>und</strong> durch Herrn Univ. Prof. Dr. Ludwig Maurer einer laufenden Evaluierung<br />
unterzogen.<br />
Die Studie ist auf Lebensmittel aus tierischer Erzeugung <strong>und</strong> ausschließlich auf den konventionellen Bereich der<br />
Landwirtschaft beschränkt. Dabei wird auf die Umsetzbarkeit in den wichtigsten Produktionsbereichen Rind- <strong>und</strong><br />
Schweinefleisch, Eier, Geflügel- <strong>und</strong> Putenfleisch sowie Milch, inklusive jeweils der ersten Verarbeitungsstufe, Bezug<br />
genommen.<br />
Besondere Beachtung wird dem Einsatz „gentechnikfreier“ oder „GVO-freier“ Futtermittel geschenkt.<br />
Die Machbarkeit wird auf der Gr<strong>und</strong>lage der Vorgaben <strong>und</strong> Definition der österreichischen Codex-Richtlinie für die<br />
<strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> einerseits <strong>und</strong> der Anforderungen der EU-Verordnung 1829/2003 betreffend die nicht<br />
erforderliche Kennzeichnung von Futter- <strong>und</strong> Lebensmitteln als GVO andererseits, eingeschätzt.<br />
Im Zuge der Abschätzung der Machbarkeit wird auch eine Analyse der Voraussetzungen für Vermeidungsstrategien<br />
einer GVO-Verunreinigung in den Produktionsprozessen durchgeführt.<br />
Die Studie bearbeitet weiters Fragen des „Täuschungsschutzes“ im Zusammenhang mit der Kennzeichnung <strong>und</strong> Aus-<br />
lobung von „Gentechnikfreiheit“ gemäß der Definition der österreichischen Codex-Richtlinie <strong>und</strong> der Verwendung<br />
nicht kennzeichnungspflichtiger Futtermittel gemäß der EU-Verordnung 1829/2003 <strong>zur</strong> Erzeugung tierischer<br />
Lebensmittel.<br />
Der wissenschaftlich basierten Studie liegt eine ausführliche Recherche der bezugnehmenden aktuellen<br />
österreichischen <strong>und</strong> internationalen wissenschaftlichen Arbeiten <strong>und</strong> Publikationen zugr<strong>und</strong>e. Besondere Beachtung<br />
wird dabei den zuletzt publizierten umfangreichen bezugnehmenden Arbeiten in Österreich gewidmet.<br />
Folgende Themengebiete wurden in der <strong>Machbarkeitsstudie</strong> bearbeitet:<br />
1. Literaturrecherche <strong>und</strong> Darstellung der Datenlage zum unmittelbaren GVO-Transfer in tierische Lebensmittel<br />
(Milch, Fleisch <strong>und</strong> Eier). In die Literaturrecherche wurden auch „mechanische“ GVO-<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 5 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 1: Einleitung <strong>und</strong> Aufgabenstellung<br />
Verunreinigungsquellen, insbesondere über GVO-Futtermittel, einbezogen. Die Literaturrecherche <strong>und</strong><br />
Darstellung der Datenlage beinhaltet auch potentielle Verunreinigungsquellen durch GVO in Honig <strong>und</strong><br />
Imkereiprodukten.<br />
2. Der derzeitige Anbau <strong>und</strong> Handel sowie eine mittelfristige Einschätzung von Anbau, Handel sowie<br />
Verfügbarkeit von „gentechnikfreien“ oder „GVO-freien“ Rohstoffen <strong>und</strong> Futtermittelausgangserzeugnissen<br />
inkl. der Berücksichtigung möglicher Substitute für Sojabohnen <strong>und</strong>/oder Sojaextraktionsschrot <strong>zur</strong><br />
Futtermittelerzeugung in Österreich.<br />
3. Betrachtung von Optionen <strong>zur</strong> Verfügbarkeit von „gentechnikfreien“ oder „GVO-freien“ Rohstoffen <strong>und</strong><br />
Futtermittelausgangserzeugnissen inkl. der Berücksichtigung möglicher Substitute für Sojabohnen <strong>und</strong>/oder<br />
Sojaextraktionsschrot <strong>zur</strong> Futtermittelerzeugung auch im Hinblick auf einen längerfristigen Zeitraum (> 5<br />
Jahre) in Österreich.<br />
4. Die integrative Betrachtung der bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen sowie der technisch-<br />
/(ernährungs-) physiologischen <strong>und</strong> ökonomischen Faktoren (in den Produktionsprozessen) zu allen<br />
Themengebieten.<br />
5. Neben der Analyse der Verbreitung von GVO in der Erzeugung von Rohstoffen wurden auch die aktuelle <strong>und</strong><br />
eine mittelfristige Abschätzung der Verbreitung von GVO in Hilfs- <strong>und</strong> Zusatzstoffen bzw. in sämtlichen<br />
Futtermittelausgangserzeugnissen in der Futtermittelherstellung in Österreich vorgenommen. Soweit gem.<br />
der österreichischen Codexrichtlinie erforderlich, wurde insbesondere der GVM-Einsatz in den<br />
Erzeugungsprozessen für Zusatzstoffe berücksichtigt.<br />
6. Die Analyse eines effektiven <strong>und</strong> effizienten Monitoring- <strong>und</strong> Überwachungssystems für die Sicherstellung<br />
der Anforderungen eines Qualitätsprogrammes einschließlich der Betrachtung der internen <strong>und</strong> externen<br />
Monitoring- <strong>und</strong> Überwachungssystematik sowie der eingesetzten Vorsorgemaßnahmen <strong>zur</strong> Sicherung einer<br />
„gentechnikfreien“ oder „GVO-freier“ Produktionskette bzw. „gentechnikfreier“ oder „GVO-freier“<br />
Produktionsprozesse waren Bestandteil der Studie. Dabei ist festzuhalten, dass eine umfassende <strong>und</strong><br />
statistisch abgesicherte Risikobewertung im Hinblick auf die Rohstoffe, Zusatz- <strong>und</strong> Hilfsstoffe im Kontext v.<br />
a. mit der Quantifizierung von Kriterien in einem Monitoring- <strong>und</strong> Überwachungssystem einer<br />
weitreichenderen Analyse nach Festlegung konkreter qualitativer <strong>und</strong> quantitativer Kriterien für das<br />
Qualitätsprogramm bedarf.<br />
7. Zentraler Bestandteil der Studie war die Strategie <strong>und</strong> Einschätzung der Lebensmittel- <strong>und</strong><br />
Futtermittelwirtschaft betreffend die Vermeidung von GVO in der Futtermittelerzeugung <strong>und</strong> der Produktion<br />
<strong>und</strong> <strong>Auslobung</strong> von <strong>„gentechnikfrei“</strong> oder „GVO-frei“ für Lebensmittel aus tierischer Erzeugung in Österreich<br />
<strong>und</strong> auf Exportmärkten. Die Abschätzung des Zeitrahmens für die Einführung eines Qualitätsprogrammes<br />
<strong>und</strong> der Umstellung in den verschiedenen Produktionsbereichen, insbesondere in der Futtermittelwirtschaft,<br />
bis <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> der „Gentechnikfreiheit“ oder „GVO-Freiheit“ für Lebensmittel aus tierischer Erzeugung, ist<br />
Gegenstand der Studie.<br />
8. Ebenso zentraler Bestandteil der Studie ist die qualifizierte Abschätzung der möglichen Mehrkosten, welche<br />
der Landwirtschaft, Futter- <strong>und</strong> Lebensmittelerzeugung in den verschiedenen Produktionsprozessen für die<br />
Vermeidung von GVO <strong>und</strong> GVO-Verunreinigungen für die Einführung eines Qualitätsprogrammes <strong>zur</strong><br />
<strong>Auslobung</strong> von <strong>„gentechnikfrei“</strong> oder „GVO-frei“ für Lebensmittel aus tierischer Erzeugung erwachsen.<br />
Diese Analyse wird einerseits auf der Basis der Mindestanforderungen gemäß der EU-Verordnung 1829/2003<br />
für nicht kennzeichnungspflichtige Futtermittel <strong>und</strong> andererseits unter Berücksichtigung der österreichischen<br />
Codex-Richtlinie <strong>zur</strong> Definition der „Gentechnikfreiheit“ durchgeführt.<br />
Anzumerken ist, dass sämtliche Betrachtungen unter der Voraussetzung gelten, dass das potentielle<br />
Qualitätsprogramm eine Markdurchdringung von zumindest 20 % in Österreich erfährt. Weder Betrachtungen<br />
auf einzelbetrieblicher Ebene, noch solche im Hinblick auf den Biolandbau sind Gegenstand der Stud<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 6 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 2: Rechtsnormen<br />
2. Rechtsnormen <strong>und</strong> Systeme <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>und</strong>/oder Kennzeichnung als<br />
<strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> „GVO-frei“ bei Futter- <strong>und</strong> Lebensmitteln - N. BALAREZO,<br />
Institut für Saatgut, V. KOLAR, Institut für Futtermittel , R. BERNHART <strong>und</strong> K. RIEDIGER, Institut für<br />
Lebensmitteluntersuchung Wien, <strong>AGES</strong><br />
2.1. Verbindliche Rechtsgr<strong>und</strong>lagen<br />
Nachfolgend wird ein Auszug der wichtigsten Rechtsnormen betreffend der Thematik der Studie international, in der<br />
EU <strong>und</strong> in Österreich dargestellt.<br />
2.1.1. Saatgut <strong>und</strong> Landwirtschaft<br />
2.1.1.1. International<br />
Verfahren <strong>und</strong> Methoden für den internationalen Saatgutverkehr im Kontext mit GVO werden v.a. durch<br />
• die ISTA (Probenahme <strong>und</strong> Untersuchungsmethoden)<br />
• die OECD (Zertifizierung, Kennzeichnung) <strong>und</strong><br />
• das Cartagena Protokoll (Biologische Sicherheit, Biodiversität) bestimmt.<br />
Die ISTA (International Seed Testing Association) befasst sich mit der Festlegung eines performance-orientierten<br />
Verfahrens <strong>zur</strong> Untersuchung von GVO ohne die Methode selbst konkret festzulegen. In „Proficiency tests“ werden<br />
die Anwendung <strong>und</strong> Erfüllung der Performance-Kriterien in den Mitgliedslaboratorien bewertet. Diesbezüglich wurde<br />
eine Task Force eingerichtet <strong>und</strong> die definitive Aufnahme der Verfahren in die ISTA-Regeln für den kommenden<br />
ISTA-Kongreß geplant. (Anmerkung: Die betreffenden Saatgut-Laboratorien der <strong>AGES</strong> sind ISTA-akkreditiert <strong>und</strong> nahmen an den<br />
ISTA-Proficiency tests betreffend GVO-Nachweis <strong>und</strong> Quantifizierung bei Mais <strong>und</strong> Sojabohne erfolgreich teil.)<br />
Die OECD (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT) definiert Vorraussetzungen, denen Saatgut<br />
genügen muss, um für den internationalen Handel geeignet zu sein. In den OECD-Saatgutschemata sind derzeit<br />
weder Regelungen <strong>zur</strong> allgemein gültigen Identifizierung von GV-Sorten in der „List of Varieties Eligible for Seed<br />
Certification“, der sog. OECD-Sortenliste, aufgewiesen, noch sind Grenzwerte oder Schwellenwerte für GVO-<br />
Verunreinigungen explizit definiert. Es bestehen keine Regelungen bezüglich Kennzeichnung von GV-Sorten am<br />
OECD-Saatgutetikett.<br />
Das wichtigste internationale Völkerrechtsabkommen, das Bestimmungen über den internationalen Verkehr von<br />
GVO’s beinhaltet ist das „Protokoll von Cartagena über die biologische Sicherheit zum Übereinkommen über die<br />
biologische Vielfalt“ vom Jahr 2000 (CARTAGENA PROTOCOL, 2000). In dem Beschluss 2002/628/EG hat die Europäische<br />
Gemeinschaft dieses Protokoll genehmigt. Es bezieht sich auf alle lebenden veränderten Organismen <strong>und</strong> behandelt<br />
Sicherheitsregelungen für deren Verbringung, Durchfuhr, Handhabung <strong>und</strong> Verwendung. Im sog. Advanced Informed<br />
Agreement ist ein Genehmigungsverfahren für den Import von GVO zugr<strong>und</strong>e gelegt. Es besteht aus einer<br />
Notifizierung des geplanten Imports, einer auf wissenschaftlichen Gr<strong>und</strong>sätzen beruhenden Risikobewertung <strong>und</strong><br />
einer Entscheidung für oder gegen die grenzüberschreitende Verbringung des GVO. Konkrete Grenzwert- oder<br />
Schwellenwerte sind nicht genannt. Für die EU wichtige Handelspartner von landwirtschaftlichen Kulturen in der<br />
Futtermittel- <strong>und</strong> Lebensmittelerzeugung, u.a. die USA <strong>und</strong> Kanada (siehe Kapitel 3.3), haben das Cartagena-<br />
Protokoll nicht ratifiziert. In Brasilien ist es in 2004 in Kraft getreten. Die Verordnung (EG) Nr. 1946/2003 über<br />
grenzüberschreitende Verbringungen genetisch veränderter Organismen stellt die Anwendung der Bestimmungen des<br />
Protokolls durch die europäische Gemeinschaft sicher.<br />
2.1.1.2. Europäische Union<br />
Das EU-Recht betreffend GVO im Kontext von Saatgut <strong>und</strong> Pflanzensorten weist zwar nicht in dem Ausmaß wie die<br />
Bestimmungen der OECD Lücken auf, ist aber im Hinblick auf Grenz- <strong>und</strong> oder Schwellenwerte für GVO-<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 7 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 2: Rechtsnormen<br />
Verunreinigungen im Saatgut einerseits <strong>und</strong> im Hinblick auf die Verwendung von GVO-Saatgut (Koexistenz)<br />
andererseits nicht kohärent zu vergleichbaren Bestimmungen für Futtermittel <strong>und</strong> Lebensmittel. Die rechtlichen<br />
Rahmenbedingungen in Österreich sind zum Unterschied zum bezughabenden EU-Recht umfassend <strong>und</strong> lückenlos.<br />
siehe Abbildung 2-1.<br />
Abbildung 2-1: Die Rechtslage in der EU <strong>und</strong> in Österreich bezüglich GVO im Bereich Saatgut <strong>und</strong> Landwirtschaft<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 8 von 272
2.1.1.3. National<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 2: Rechtsnormen<br />
Die Rechtsgr<strong>und</strong>lagen betreffend Gentechnik in der Landwirtschaft lassen derzeit wie in Abbildung 2-1 dargestellt den<br />
Anbau von GVO-Sorten <strong>und</strong> Saatgut in Österreich nicht zu. Auch in einer zumindest mittelfristigen Perspektive (siehe<br />
dazu die „Empfehlungen für eine nationale Strategie <strong>zur</strong> Koexistenz“ auf der Homepage des Lebensministeriums) ist<br />
nicht mit einem Anbau von GVO in Österreich zu rechnen. GVO-freie pflanzliche Rohstoffe <strong>und</strong><br />
Futtermittelausgangserzeugnisse aus österreichischer Erzeugung liegen damit für eine durchaus angemessene<br />
Planungs- <strong>und</strong> Umsetzungsphase eines Qualitätsprogrammes „GVO-frei“ für tierische Lebensmittel vor. Die Kosten<br />
eines QM-Systems sowie der externen Monitoring- <strong>und</strong> Überwachungsmaßnahmen können, sofern ausschließlich<br />
österreichische Rohstoffe eingesetzt werden minimiert werden. Eine substantielle Versorgungslücke aus<br />
österreichischer Erzeugung besteht sowohl in Qualität <strong>und</strong> Quantität nur bei eiweißhältigen Rohstoffen <strong>und</strong><br />
Futtermitteln, wird von den Futtermittel-Zusatzstoffen abgesehen (siehe dazu auch nachfolgende Kapitel).<br />
2.1.2. Futtermittel<br />
2.1.2.1. International<br />
Für Futtermittel bestehen unmittelbar keine internationalen Rechtsnormen. Die Bestimmung <strong>zur</strong> biologischen<br />
Sicherheit <strong>und</strong> Biodiversität aus dem Cartagena Protokoll sind natürlich auch für die pflanzlichen Rohstoffe <strong>und</strong> daher<br />
auch für die Futtermittelerzeugung <strong>und</strong> den internationalen Handel mit Futtermittel, insbesondere Einzelfuttermittel,<br />
relevant.<br />
2.1.2.2. Europäische Union<br />
Innerhalb der Europäischen Gemeinschaft sind für die Festlegung des GVO-Status von Futtermitteln zwei<br />
Verordnungen relevant, VO (EG) 1829/2003 <strong>und</strong> VO (EG) 1830/2003. Sie regeln die Zulassung, Kennzeichnung <strong>und</strong><br />
Rückverfolgbarkeit von gentechnisch veränderten Organismen. Die VO (EG) 641/2004 regelt die Durchführungs-<br />
bestimmungen <strong>zur</strong> VO (EG) 1829/2003 hinsichtlich der Zulassung neuer genetisch veränderter Lebensmittel <strong>und</strong><br />
Futtermittel, der Meldung bestehender Erzeugnisse <strong>und</strong> des zufälligen oder technisch unvermeidbaren<br />
Vorhandenseins genetisch veränderten Materials, zu dem die Risikobewertung befürwortend ausgefallen ist.<br />
Die Liste der zugelassenen GVO in der EU ändert sich kontinuierlich <strong>und</strong> muss laufend aktualisiert werden. In der<br />
vorliegenden Studie wird auf den Stand von 12. September 2005 Bezug genommen. Als Beispiel für diese<br />
kontinuierliche Änderung sei angeführt, dass erst am 10.8.2005 das „GVO-Maiskonstrukt“ MON 863 als Futtermittel<br />
zugelassen wurde, jedoch mit der Einschränkung, dass erst bei einer Zulassung von MON 863 als Lebensmittel, die<br />
Futtermittelzulassung in Kraft tritt.<br />
Nach VO (EG) 1829/2003 sind jene Futtermittel als gentechnisch verändert zu kennzeichnen, bei denen der<br />
Schwellenwert von 0,9% für in der EU zugelassene GVO für zufällige, technisch unvermeidbare Verunreinigungen mit<br />
GVO überschritten wird. Ist das GVO in der EU noch nicht zugelassen, liegt aber eine Freigabe der Unbedenklichkeit<br />
für die tierische <strong>und</strong> menschliche Ernährung durch die EFSA vor, gilt ein Schwellenwert von 0,5 %. Für in der EU<br />
nicht zugelassene GVO gilt das Nicht-Vorhandensein bzw. -0-. Es gibt kein Anwendungsverbot für Aminosäuren <strong>und</strong><br />
Extraktionsschrote wie z.B. in der Bio-VO (EWG) 2092/91 i. d. g. F. Alle nach VO (EG) 1831/2003 zugelassenen<br />
Zusatzstoffe einschließlich Mikroorganismen, Vitamine, Enzyme <strong>und</strong> Aromastoffe dürfen verwendet werden.<br />
Da die Einordnung von Futterzusatzstoffen, die mit Hilfe von gentechnisch veränderten Mikroorganismen (= GVM)<br />
hergestellt werden, vorerst nicht klar war, hat die EU Kommission in ihrem Sitzungsprotokoll vom 23.9.2004<br />
festgestellt, dass Zusatzstoffe wie Vitamine, Enzyme <strong>und</strong> Aminosäuren, die mit GVM hergestellt werden, aber unter<br />
anderem keine GVO-DNA im Endprodukt enthalten, nicht in den Anwendungsbereich der VO (EG) 1829/2003 fallen<br />
<strong>und</strong> daher nicht als GVO gekennzeichnet werden müssen. Es gilt für Zusatzstoffe wie für Futtermittel-<br />
Ausgangserzeugnisse der Schwellenwert 0,9% für in der EU zugelassene GVO für die Kennzeichnung.<br />
Anlassbezogen hat die Kommission unter anderem mit der Entscheidung 2005/317/EG Dringlichkeitsmaßnahmen<br />
hinsichtlich des nicht zugelassenen „Bt 10“ in Maiserzeugnissen erlassen. Diese Regelungen betreffen unter anderem<br />
auch Importe aus Drittländern.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 9 von 272
2.1.2.3. National<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 2: Rechtsnormen<br />
Futtermittelgesetz 1999 i.d.g.F. <strong>und</strong> Futtermittelverordnung 2000 i.d.g.F.<br />
Im Futtermittelgesetz <strong>und</strong> der dazugehörenden Verordnung werden alle derzeit geltenden EU-Vorschriften, die<br />
Futtermittel <strong>und</strong> Futterzusatzstoffe betreffen, umgesetzt. In der Verordnung wird betreffend Zulassung <strong>und</strong><br />
Kennzeichnung von GVO bzw. Futtermitteln, die aus GVO hergestellt wurden, auf die VO (EG) 1829/2003 verwiesen.<br />
Zusätzlich finden die 45. Verordnung aus dem Jahre 1997 (Verbot des „GVO-Maiskonstrukts“ BT 176), die 175.<br />
Verordnung aus dem Jahre 1999 (Verbot des „GVO-Maiskonstrukts“ MON 810), die 120. Verordnung aus dem Jahre<br />
2000 (Verbot des „GVO-Maiskonstrukts“ T 25) <strong>und</strong> weiterführend die Futtermittel-GVO-Schwellenwert-Verordnung<br />
aus dem Jahre 2001, welche die Inverkehrbringung bzw. die Verarbeitung von „beschränkt verkehrsfähigen GVO`s“<br />
regelt, ihre Verwendung. Die „GVO-Maiskonstrukte“ BT 176, MON 810 <strong>und</strong> T 25 sind zwar in der EU für den Einsatz<br />
in Futtermittel zugelassen, aufgr<strong>und</strong> der oben erwähnten nationalen Verbotsverordnungen jedoch nur beschränkt<br />
verkehrsfähig <strong>und</strong> folglich laut Futtermittel-GVO-Schwellenwertverordnung in Österreich nur bei einem GVO-Anteil<br />
der nicht über 1 % liegt, in Verkehr zu bringen.<br />
Abbildung 2-2: Die Rechtslage in der EU <strong>und</strong> in Österreich bezüglich GVO im Bereich Futtermittel<br />
2.1.3. Lebensmittel<br />
2.1.3.1. International<br />
Wie bei Futtermittel gelten auch für Lebensmittel auf internationaler Ebene keine verbindlichen Rechtsnormen. Die<br />
Bestimmung <strong>zur</strong> biologischen Sicherheit <strong>und</strong> Biodiversität aus dem Cartagena Protokoll sind natürlich auch für die<br />
pflanzlichen Rohstoffe <strong>und</strong> daher auch für die Lebensmittelerzeugung relevant.<br />
Europäische Union (Siehe auch 2.1.3.2).<br />
Die Europäische Union hat im November 2003 zwei Verordnungen über genetisch veränderte Lebens- <strong>und</strong><br />
Futtermittel (VO 1829/2003) sowie über die Rückverfolgbarkeit <strong>und</strong> Kennzeichnung von GVOs <strong>und</strong> daraus<br />
hergestellten Lebens- <strong>und</strong> Futtermitteln (VO 1830/2003) veröffentlicht. Sie sehen ein einheitliches<br />
Gemeinschaftssystem für die Rückverfolgung von GVO vor, führen die Kennzeichnungspflicht für gentechnisch<br />
veränderte Lebensmittel <strong>und</strong> legen ein gestrafftes Zulassungsverfahren für GVO in Lebens- <strong>und</strong> Futtermitteln sowie<br />
für die absichtliche Freisetzung von GVO fest. Die Vorschläge zielen darauf ab, einen strikten Rechtsrahmen zu<br />
schaffen <strong>und</strong> bestehende Gesetzeslücken zu schließen. Mit den neuen Bestimmungen werden insbesondere die<br />
Verordnungen (EG) Nr. 1139/98, 49/2000 <strong>und</strong> 50/2000 sowie die Kennzeichnungs- <strong>und</strong> Zulassungsvorschriften in der<br />
Novel Food Verordnung (EG) Nr. 258/97 aufgehoben bzw. geändert.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 10 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 2: Rechtsnormen<br />
Seit dem 18. April 2004 sind alle Lebensmittel kennzeichnungspflichtig, die GVO enthalten, daraus bestehen oder<br />
daraus hergestellt wurden. Die neuen Kennzeichnungsvorschriften unterscheiden sich gr<strong>und</strong>sätzlich von den<br />
vorherigen <strong>und</strong> erweitern die Information der Verbraucher/innen. Die Kennzeichnungspflicht gilt unabhängig davon,<br />
ob die genetische Veränderung im Endprodukt nachweisbar ist. Das bisher in der Novel Food VO (EG) 258/97<br />
geltende Nachweisprinzip wird aufgegeben <strong>und</strong> durch ein umfassendes Anwendungsprinzip ersetzt, das die gesamte<br />
Produktionskette berücksichtigt.<br />
Die Verordnung (EG) 1829/2003 ist anzuwenden auf:<br />
• <strong>zur</strong> Verwendung als Lebensmittel <strong>und</strong> Futtermittel bestimmte GVO (z.B. GV-Mais, GV-Soja)<br />
• Lebensmittel <strong>und</strong> Futtermittel, die GVO enthalten oder aus solchen bestehen (z.B. Fertigprodukte mit<br />
Lezithin aus GV-Soja)<br />
• Lebensmittel <strong>und</strong> Futtermittel, die aus GVO hergestellt sind oder Zutaten enthalten, die aus GVO hergestellt<br />
werden (aber keine GVO mehr enthalten): z.B. Rapsöl aus GV-Raps, Lezithin aus GV-Sojabohnen<br />
Nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung fallen:<br />
• Zusatzstoffe <strong>und</strong> Aromen, die mit Hilfe von GVO hergestellt worden sind.<br />
• Enzyme, sofern sie als technologischer Hilfsstoff (keine technologische Wirkung im Endprodukt) verwendet<br />
werden.<br />
• Produkte von mit GVO-Futtermitteln gefütterten Tieren (z.B. Milch oder Fleisch von einer mit GVO-Futter<br />
gefütterten Kuh).<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich gilt das Prinzip, dass die GVO-Verunreinigung zufällig <strong>und</strong> technisch unvermeidbar ist.<br />
Kennzeichnungsschwellenwerte gelten jedenfalls wenn die GVO-Verunreinigung:<br />
a) 0,9 % für in der EU zugelassene GVO,<br />
b) 0,5 % für in der EU nicht zugelassene GVO bei Vorliegen einer positiven Risikobewertung beträgt (ist<br />
Grenzwert).<br />
c) Es gilt -0- für in der EU nicht zugelassene GVO<br />
Die Regelung bezüglich Punkt b) ist mit 3 Jahren nach Inkrafttreten der Verordnung befristet (Artikel 47 der VO (EG)<br />
1829/2003). Der Schwellenwert bezieht sich auf die einzelne Lebensmittelzutat oder das Lebensmittel, sofern es auf<br />
einer einzigen Zutat besteht. Unter Zutaten sind alle Bestandteile eines zusammengesetzten Lebensmittels zu<br />
verstehen die selbst Lebensmittel sind.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 11 von 272
2.1.3.2. National<br />
siehe Abbildung 2-3.<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 2: Rechtsnormen<br />
Abbildung 2-3: Die Rechtslage in der EU <strong>und</strong> in Österreich bezüglich GVO im Bereich tierischer Lebensmittel<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 12 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 2: Rechtsnormen<br />
2.2. Weltweiter Codex (Codex Alimentarius) sowie der Österreichische Codex (Codex<br />
Alimentarius Austriacus), insbesondere Codex-Richtlinie <strong>zur</strong> Definition der<br />
„Gentechnikfreiheit“<br />
Der weltweite Codex (Codex Alimentarius) hat lediglich bei Lebensmittel Bedeutung (siehe 2.2.3.1).<br />
2.2.1. Saatgut <strong>und</strong> landwirtschaftliche Produktionsgr<strong>und</strong>lagen<br />
Lebensmittel inkl. Nahrungsergänzungsmittel im Sinne der österreichischen Codex-Richtlinie für „gentechnikfreie“<br />
Lebensmittel werden ohne Verwendung von GVO <strong>und</strong> GVO-Derivaten hergestellt, wobei diese Definition der<br />
„Gentechnikfreiheit“ sich im Bereich Saatgut <strong>und</strong> Landwirtschaft u.a. auf Saatgut <strong>und</strong> vegetatives<br />
Vermehrungsmaterial, sowie auf die verwendeten Betriebsmittel wie Pflanzenschutzmittel, Düngemittel <strong>und</strong><br />
Bodenverbesserer bezieht. Demnach:<br />
• dürfen Saatgut <strong>und</strong> vegetatives Vermehrungsmaterial keine GVO sein<br />
• müssen Düngemittel <strong>und</strong> Bodenverbesserer ohne Verwendung von GVO <strong>und</strong> GVO-Derivaten hergestellt werden<br />
– außer, wenn sie nachweislich in Gentechnik-freier Qualität nicht ausreichend verfügbar sind<br />
• dürfen Pflanzenschutzmittel weder aus GVO bestehen, noch solche enthalten oder aus oder durch solche<br />
hergestellt oder gewonnen werden (betrifft den Wirkstoff).<br />
Für die Betriebsmittel sind im österreichischen Codex keine Grenzwerte für zufällige <strong>und</strong> unvermeidbare<br />
Verunreinigungen mit GVO festgelegt.<br />
Für Saatgut gilt gemäß §3(1) Saatgut-Gentechnik-Verordnung demnach kein Vorhandensein bei der<br />
Erstuntersuchung <strong>und</strong> ein Toleranzwert von 0,1% in der Nachuntersuchung (siehe Kapitel 2.1.1.3).<br />
Die derzeitige Rechtslage für die Vollziehung des Düngemittelgesetzes <strong>und</strong> der Düngemittelüberwachung stellt sich<br />
derart dar, dass gemäß §2(5) Düngemittelverordnung 2004 gentechnikrechtliche Bestimmungen von der<br />
Düngemittelverordnung unberührt bleiben. Der Einsatz von in der EU zugelassenen GVO’s in Produkten, die durch<br />
das Düngemittelgesetz normiert werden, bedarf keiner weiteren Zulassung. Bei Produkten, für die auf Gr<strong>und</strong> nicht<br />
geregelter Ausgangsstoffe einer Zulassung nach §9a Düngemittelgesetz notwendig ist, wird bei allen Produkten bei<br />
der Zulassung auf die gentechnikrechtlichen Bestimmungen hingewiesen bzw. im Bescheid ausdrücklich darauf<br />
verwiesen, dass die düngemittelrechtliche Zulassung nicht die Prüfung nach den gentechnikrechtlichen<br />
Bestimmungen beinhaltet.<br />
Die Genehmigung des Inverkehrsbringens von Pflanzenschutzmitteln, die aus genetisch veränderten Organismen<br />
bestehen oder solche enthalten - sofern deren Freisetzung gemäß RL 90/220/EG (aufgehoben durch RL 2001/18/EG)<br />
genehmigt wurde – ist in der Richtlinie 91/414/EWG geregelt. Das Pflanzenschutzmittelgesetz 1997 setzt diese<br />
Richtlinie in nationales Recht um.<br />
Gemäß § 58(8) Gentechnikgesetz ersetzt die Zulassung gemäß § 8 Pflanzenschutzmittelgesetz 1997 die im Rahmen<br />
ihres Geltungsumfanges nach diesem B<strong>und</strong>esgesetz erforderliche Genehmigung zum Inverkehrbringen von<br />
Pflanzenschutzmitteln, die GVO enthalten oder aus solchen bestehen. Der Einsatz in der EU zugelassener GVO’s in<br />
Produkten, die unter dem Pflanzenschutzmittelgesetz fallen, bedarf in Österreich keiner weiteren Zulassung.<br />
Eine <strong>Auslobung</strong> der Gentechnikfreiheit nach Codex setzt somit die Gentechnikfreiheit der in der landwirtschaftlichen<br />
Produktion verwendeten Betriebsmittel inkl. Saat- <strong>und</strong> Pflanzgut voraus. Bei Saat- <strong>und</strong> Pflanzgut ist die<br />
Gentechnikfreiheit in Österreich in der Saatgut-Gentechnik-Verordnung (2001) i.d.g.F. definiert <strong>und</strong> wird mittels<br />
Monitoring überwacht. Bei den Betriebsmitteln wie Pflanzenschutzmittel, Düngemittel <strong>und</strong> Bodenverbesserer<br />
hingegen ist die Überprüfung insbesondere der Herstellungsprozesse, ob diese ohne GVO erfolgten, nicht durch<br />
internationale Bestimmungen <strong>und</strong> Äquivalenzen sichergestellt. Für die Überprüfung der Produktionsprozesse von<br />
landwirtschaftlichen Produkten wie Sojabohne, Mais <strong>und</strong> Raps gibt es in Drittländern keine vergleichbare<br />
Rechtsgr<strong>und</strong>lage. Die bekannten <strong>und</strong> angebotenen IP-Programme z.B. aus Brasilien bieten bei Sojabohne jedenfalls<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 13 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 2: Rechtsnormen<br />
nicht die Gewährleistung von vergleichbaren Anforderungen für die GVO-Freiheit von Betriebsmitteln in der<br />
landwirtschaftlichen Erzeugung an. Auch in der EU bestehen keine vergleichbaren Rechtsnormen. Wird davon<br />
ausgegangen, dass durchaus auch im Ausland hergestellte Betriebsmittel, abgesehen von Saat- <strong>und</strong> Pflanzgut, in<br />
ihren Produktionsprozessen kaum überprüfbar sind, erscheint die Anwendung dieser Standards für die<br />
Kennzeichnung von EU- <strong>und</strong> Drittlandserzeugnissen nicht kohärent. Überlegungen <strong>zur</strong> Herstellung vergleichbarer<br />
Paritäten in der landwirtschaftlichen Erzeugung erscheinen in den Bestimmungen des Codex <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> von<br />
Gentechnikfreiheit von Produkten angemessen.<br />
2.2.2. Futtermittel<br />
Im Gegensatz <strong>zur</strong> VO (EG) 1829/2003 ist im Codex kein Kennzeichnungs-Schwellenwert für zufällige <strong>und</strong><br />
unvermeidbare Verunreinigungen mit GVO festgesetzt. Daher ist es schlüssig <strong>und</strong> üblich, für diese Verunreinigungen<br />
in Futtermitteln zumindest das Schwellenwertregime aus der VO (EG) 1829/2003 (0,9 % bzw. 0.5 %)<br />
heranzuziehen. Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zum Biolandbau ist, dass laut Codex Extraktionsschrote<br />
erlaubt sind. Der Höchstanteil für gentechnikfreie Sojaextraktionsschrote (SES) im Futter ist bei Pflanzenfressern bei<br />
10%, bei anderen Tieren 20%, bezogen auf die Trockenmasse. Basis für diese Beschränkung ist die Verwendung von<br />
Betriebsmitteln (z.B. Düngemittel, Pflanzenschutzmittel) beim Anbau von Sojabohne, die nicht der Codex-Richtlinie<br />
entsprechen.<br />
Eine Überschreitung dieses Grenzwertes von 10% bzw. 20% im Futter darf jedoch dann vorgenommen werden,<br />
wenn gentechnikfreier SES aus Hard IP (Identity Preservation) Programmen verwendet wird (vgl. BMGF, 2005).<br />
Aminosäuren, Vitamine, Enzyme <strong>und</strong> andere Zusatzstoffe, die durch Fermentation aus gentechnisch veränderten<br />
Mikroorganismen in einem geschlossenen Kreislauf hergestellt werden, dürfen laut Codex nicht verwendet werden.<br />
Alle nach VO (EG) 1831/2003 als Futterzusatzstoffe zugelassen Mikroorganismen (Probiotika) dürfen laut Codex<br />
eingesetzt werden, da nur gentechnisch unveränderte Mikroorganismen als Futterzusatzstoffe zugelassen sind <strong>und</strong><br />
zum Einsatz kommen.<br />
Weitere Auflagen des Codex sind, dass Schweine <strong>und</strong> Mastgeflügel von der Geburt an bis <strong>zur</strong> Schlachtung,<br />
Legehennen mindestens 6 Wochen lang, Mastrinder <strong>und</strong> Equiden mindestens 12 Monate bzw. drei Viertel ihres<br />
Lebens <strong>und</strong> Milchrinder mindestens 2 Wochen mit der Codex-Richtlinie entsprechenden Futtermitteln gefüttert<br />
werden müssen, damit die tierischen Erzeugnisse als <strong>„gentechnikfrei“</strong> bezeichnet werden können (vgl. BMGF, 2004).<br />
Nachstehend sind die Rahmenbedingungen von der VO (EG) 1829/2003 <strong>und</strong> Codex für „GVO-freie“ oder<br />
„gentechnikfreie“ Futtermittelausgangserzeugnisse <strong>und</strong> Futtermittelzusatzstoffe gegenübergestellt:<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 14 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 2: Rechtsnormen<br />
Tabelle 2-1: Zusammenfassung der verschiedenen gesetzlichen Rahmenbedingungen für „gentechnikfreie“ oder<br />
„GVO-freie“ Futtermittel-Ausgangserzeugnisse <strong>und</strong> Futtermittelzusatzstoffe<br />
Bereich<br />
GVO-Schwellenwert<br />
Sojabohne<br />
Mais<br />
Raps<br />
Bereich<br />
Methionin<br />
Lysin<br />
Threonin<br />
Tryptophan<br />
VO (EG)1829/2003<br />
0,9 % für in der EU zugelassene<br />
GVO<br />
bzw. 0,5% für von der EFSA<br />
freigegebene GVO<br />
0 für nicht zugelassene GVO<br />
Keine Mengenbegrenzung für<br />
gentechnikfreie Sojaprodukte aus<br />
Nicht-GVO-Sojabohne unter<br />
Einhaltung der<br />
Schwellenwerteregelungen<br />
VO (EG)1829/2003<br />
Ja** (Anwendung zulässig)<br />
Ja (Anwendung zulässig)<br />
Ja (Anwendung zulässig)<br />
Ja (Anwendung zulässig)<br />
Vitamine Ja (Anwendung zulässig)<br />
Kein Zertifikat erforderlich,<br />
üblicherweise kein GVO im<br />
Endprodukt<br />
Enzyme Ja (Anwendung zulässig)<br />
Kein Zertifikat erforderlich,<br />
üblicherweise kein GVO im<br />
Endprodukt<br />
Mikroorganismen (Probiotika) Ja (Anwendung zulässig)<br />
Nach RL 70/524 bzw. 1831/2003<br />
sind nur genetisch unveränderte<br />
Mikroorganismen zugelassen.<br />
Gesetzliche Rahmenbedingungen<br />
Österreichischer Codex für die <strong>Auslobung</strong><br />
„Gentechnikfrei“<br />
Codex legt keine Schwellenwerte explizit fest.<br />
Gesetzliche Mindestanforderung ist die<br />
Schwellenwertregelung der VO(EG) 1829/2003.<br />
Bei <strong>„gentechnikfrei“</strong> Soja (SOFT IP)<br />
Mengenbeschränkung<br />
von bis max. 10% bzw. 20 % in der Futterration.<br />
Bei <strong>„gentechnikfrei“</strong> Soja (HARD IP) gibt es<br />
keine Mengenbegrenzung.<br />
Gesetzliche Rahmenbedingungen<br />
Österreichischer Codex für die <strong>Auslobung</strong><br />
„Gentechnikfrei“<br />
Ja ** (Anwendung zulässig)<br />
nein*<br />
nein*<br />
nein*<br />
Nein, wenn mit GVM***<br />
hergestellt<br />
Ja, nur wenn ohne GVM*** hergestellt <strong>und</strong> mit<br />
Herstellungszertifikat. (Anwendung zulässig)<br />
Ja, nur wenn ohne GVM hergestellt <strong>und</strong> mit<br />
Herstellungszertifikat. (Anwendung zulässig)<br />
Nein, wenn mit GVM***<br />
Hergestellt.<br />
Ja (Anwendung zulässig)<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Nach RL 70/524 bzw. 1831/2003 sind nur genetisch<br />
unveränderte Mikroorganismen zugelassen.<br />
Schweine Von Geburt an bis <strong>zur</strong> Schlachtung<br />
Mastgeflügel Von Geburt an bis <strong>zur</strong> Schlachtung<br />
Legehennen mind. 6 Wochen lang<br />
Mastrind inkl. Fleischnutzung<br />
von Milchrind<br />
mind. 12 Monate, bzw. ¾ des Lebens<br />
Milchrind mind. 2 Wochen lang<br />
Equiden<br />
*ja, wenn ohne GVM hergestellt, Nachweis-Zertifikat<br />
mind. 12 Monate, bzw. ¾ des Lebens<br />
**Methionin wird noch zu 100% synthetisch-technisch hergestellt.<br />
*** GVM – genetisch veränderte Mikroorganismen, aus denen Vitamine, Enzyme, AS fermentiert werden.<br />
Seite 15 von 272
2.2.3. Lebensmittel<br />
2.2.3.1. Codex Alimentarius- weltweiter Codex<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 2: Rechtsnormen<br />
Der Codex Alimentarius ist eine gemeinsame Einrichtung der Ernährungs- <strong>und</strong> Landwirtschaftsorganisation (FAO) <strong>und</strong><br />
der Weltges<strong>und</strong>heitsorganisation (WHO) der Vereinten Nationen (UNO). Ziel <strong>und</strong> Aufgabe dieser Institution ist es, die<br />
Ges<strong>und</strong>heit der VerbraucherInnen zu schützen <strong>und</strong> faire Handelspraktiken im internationalen Handel mit Lebens-<br />
mitteln sicherzustellen. Dazu werden international anerkannte Standards für Lebensmittel in einheitlicher Form her-<br />
ausgegeben. Die einzelnen Codex-Komitees <strong>und</strong> Task Forces decken thematisch sowohl horizontale Bereiche wie z.B.<br />
Lebensmittelkennzeichnung, Analyse- <strong>und</strong> Probenahmeverfahren oder Lebensmittelhygiene als auch vertikale (pro-<br />
duktspezifische) Bereiche wie Fisch <strong>und</strong> Fischprodukte, Milch <strong>und</strong> Milchprodukte, frisches Obst <strong>und</strong> Gemüse etc. ab.<br />
Die Codex-Standards haben zwar keinen verbindlichen Charakter <strong>und</strong> stellen lediglich Empfehlungen für die<br />
Beschaffenheit von Lebensmitteln dar. Sie dienen aber insbesondere den Entwicklungsländern als Richtschnur für<br />
ihre nationalen lebensmittelrechtlichen Regelungen. Ihre besondere Bedeutung haben die vom Codex Alimentarius<br />
geschaffenen Normen durch zwei Handelsübereinkommen im Rahmen der Welthandelsorganisation (WTO) erlangt.<br />
Es handelt sich dabei um das Übereinkommen über die Anwendung von ges<strong>und</strong>heitspolizeilichen <strong>und</strong><br />
pflanzenschutzrechtlichen Maßnahmen (SPS-Übereinkommen) <strong>und</strong> das Übereinkommen über technische<br />
Handelshemmnisse (TBT-Übereinkommen). Demgemäß gelten die Codexstandards als Referenz für die<br />
Verkehrsfähigkeit von Lebensmitteln im internationalen Handel <strong>und</strong> spielen damit in den WTO-<br />
Streitbeilegungsverfahren bei Handelskonflikten eine entscheidende Rolle.<br />
(Quelle: http://www.bmgf.gv.at/cms/site/detail.htm?thema=CH0131&doc=CMS1056641057751)<br />
Die Codex Alimentarius Kommission konnte bei ihrer 26. Sitzung vom 30. Juni bis 7. Juli 2003 in Rom folgende<br />
Dokumente verabschieden: Gr<strong>und</strong>sätze für die Risikoanalyse gentechnisch veränderter Lebensmittel, die Richtlinie für<br />
die Durchführung der Sicherheitsbewertung von Lebensmitteln aus gentechnisch veränderten Pflanzen <strong>und</strong> die<br />
Richtlinie für die Durchführung der Sicherheitsbewertung von Lebensmitteln aus gentechnisch veränderten<br />
Mikroorganismen.<br />
Die Richtlinien regeln die Sicherheitsbewertung vor der Vermarktung, die Rückverfolgbarkeit von Produkten für den<br />
Fall von Rückholaktionen <strong>und</strong> das Monitoring nach der Vermarktung. Der Geltungsbereich umfasst gentechnisch<br />
veränderte Pflanzen, wie Mais, Soja oder Kartoffel, sowie Lebensmittel <strong>und</strong> Getränke aus gentechnisch veränderten<br />
Mikroorganismen, einschließlich Käse, Joghurt <strong>und</strong> Bier. Bestimmungen für die Bewertung der Allergenität sollen die<br />
Abschätzung ermöglichen, ob ein Produkt unerwartete Allergien bei Verbrauchern auslösen könnte. Diese Frage zählt<br />
zu den größten Herausforderungen für die Risikoanalyse gentechnisch veränderter Lebensmittel.<br />
Mit der Definition des Begriffs „modern biotechnology“ knüpfen die Richtlinien am Cartagena Protokoll über die<br />
Biologische Sicherheit der Konvention über die Biologische Vielfalt an. Gegenstand dieses Protokolls sind Risiken für<br />
die Umwelt. Eine Neuerung der Richtlinien ist die Einführung des Begriffs „conventional counterpart“. Das ist insofern<br />
bedeutsam, als die Richtlinien einen Vergleich zwischen gentechnisch veränderten Lebensmitteln <strong>und</strong> konventionellen<br />
Lebensmitteln vorschreiben. Dieser Vergleich soll dazu dienen, Ähnlichkeiten <strong>und</strong> Unterschiede festzustellen. Das<br />
Konzept der substantiellen Äquivalenz von Lebensmitteln ist ein Teil der Sicherheitsbewertung, aber es stellt keine<br />
Sicherheitsbewertung an sich dar.<br />
Die Qualität <strong>und</strong> Quantität von Daten <strong>und</strong> Informationen, die der Sicherheitsbewertung zu Gr<strong>und</strong>e liegen, sollten dem<br />
bei Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Zeitschriften üblichen „peer review“ – Prozess standhalten.<br />
Monitoring <strong>und</strong> Rückverfolgbarkeit sind Teile des Risikomanagements. Beim Monitoring nach der Vermarktung geht<br />
es darum, die Schlussfolgerungen der Sicherheitsbewertung betreffend die Ges<strong>und</strong>heit der Verbraucher zu<br />
überprüfen <strong>und</strong> mögliche Änderungen bei der Aufnahme von Nährstoffen zu überwachen. Die Rückverfolgbarkeit von<br />
Produkten unterstützt das Monitoring <strong>und</strong> erleichtert Rückholaktionen, wenn ein Risiko für die menschliche<br />
Ges<strong>und</strong>heit festgestellt wird. Die Richtlinien nennen die Kennzeichnung von Lebensmitteln als eine weitere<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 16 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 2: Rechtsnormen<br />
Maßnahme des Risikomanagements. Die Richtlinien enthalten Überlegungen zum Umgang mit Unsicherheiten, die in<br />
der Risikoabschätzung festgestellt wurden, <strong>und</strong> schließen Vorsorgemaßnahmen nicht aus.<br />
[Die Risikokommunikation] sollte in allen Phasen der Risikoabschätzung <strong>und</strong> des Risikomanagements stattfinden. Im<br />
Idealfall ist Risikokommunikation ein interaktiver Prozess aller Interessensgruppen, einschließlich Verwaltung,<br />
Industrie, Wissenschaft, Medien <strong>und</strong> Verbraucher. Insbesondere sollten Bewertungsberichte <strong>und</strong> andere Dokumente,<br />
die für die behördliche Entscheidung relevant sind, öffentlich zugänglich sein. Gleichzeitig muss die Vertraulichkeit<br />
bestimmter Informationen gewahrt bleiben. Gr<strong>und</strong>sätzlich gilt, je mehr Interessensgruppen eingeb<strong>und</strong>en sind, umso<br />
besser kann eine Risikoanalyse sein. Nicht immer sind diese Ziele einfach zu erreichen. Sie sind jedoch die<br />
Voraussetzung für die öffentliche Akzeptanz von Entscheidungen.<br />
Die Ungleichbehandlung von gentechnisch veränderten <strong>und</strong> konventionellen Lebensmitteln könnte <strong>zur</strong> Irreführung<br />
von Verbrauchern führen <strong>und</strong> ist zu vermeiden. Mögliche Risiken dürfen nicht aufgebauscht werden <strong>und</strong> zu treffende<br />
Maßnahmen müssen verhältnismäßig sein. Unterschiedliche Maßnahmen, die das gleiche Schutzniveau<br />
gewährleisten, sind als gleichwertige politische Optionen anzusehen. Die Verschärfung von Zulassungs-<br />
bestimmungen betreffend das „product design“ könnte Verwendungsbeschränkungen („end of pipe“- Ansatz) obsolet<br />
machen. Ein Beispiel dafür ist der Verzicht auf Markergene, die Resistenz gegenüber bestimmten Antibiotika<br />
vermitteln.<br />
Mögliche Lenkungseffekte, zum Beispiel durch die Kennzeichnung von Lebensmitteln, müssen genau bedacht<br />
werden. Die Verzerrung des Wettbewerbs ist nicht gerechtfertigt. Bereits seit 1999 gibt es Codex Richtlinien für<br />
Lebensmittel aus biologischer Landwirtschaft, die ausdrücklich die Produktionsweise ohne Einsatz der Gentechnik<br />
vorschreiben. Diese Richtlinien wurden 2001 um Bestimmungen für die Tierhaltung <strong>und</strong> für Tierprodukte ergänzt.<br />
Dadurch hat die Codex Alimentarius Kommission die Möglichkeit der gentechnikfreien Produktion von Lebensmitteln<br />
in Übereinstimmung mit den Regeln der WTO geschaffen.<br />
(Quelle: http://www.bmgf.gv.at/cms/site/detail.htm?thema=CH0131&doc=CMS1069940261164)<br />
2.2.3.2. Codex Alimentarius Austriacus – Österreichisches Lebensmittelbuch<br />
Der Codex beschreibt die allgemeine Verkehrsauffassung <strong>zur</strong> Beschaffenheit von Lebensmitteln. Dabei kommt ihm<br />
weder Gesetzes- noch Verordnungskraft zu. Er hat die rechtliche Bedeutung eines "objektivierten<br />
Sachverständigengutachtens". Gemäß § 51 LMG 1975 dient der Codex <strong>zur</strong> Verlautbarung von: Sachbezeichnungen,<br />
Begriffsbestimmungen, Untersuchungsmethoden <strong>und</strong> Beurteilungsgr<strong>und</strong>sätzen. Die Veröffentlichung erfolgt in Form<br />
von Erlässen des B<strong>und</strong>esministeriums für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Frauen (BMGF).<br />
Codex-Richtlinie <strong>zur</strong> Definition der "Gentechnikfreiheit"<br />
Diese Richtlinie hat zum Ziel, eine der derzeitigen Verbrauchererwartung gerecht werdende Beschreibung des<br />
Herstellungsverfahrens für als solche gekennzeichnete Lebensmittel zu geben. Sie gilt sinngemäß auch für andere<br />
Bezeichnungen (§ 8 lit f LMG), die darauf hinweisen, dass ein Lebensmittel ohne Verwendung von GVO (genetisch<br />
veränderte/r Organismus/men) <strong>und</strong> GVO-Derivaten hergestellt wurde, wie "ohne Gentechnik" oder "ohne<br />
Verwendung von Gentechnik". Als "gentechnikfrei" können Lebensmittel inklusive Nahrungsergänzungsmittel<br />
bezeichnet werden, die ohne Verwendung von genetisch veränderten Organismen im Sinne des § 4 GTG oder GVO-<br />
Derivaten hergestellt sind.(Quelle:<br />
http://www.bmgf.gv.at/cms/site/attachments/8/0/5/CH0264/CMS1085747609216/codex-rl.pdf,<br />
http://dielebensmittel.at/Dokumente/schwerpunktthemen/gentfrei.pdf)<br />
Anzumerken ist, dass der Codex wie bei Futtermitteln keinen Kennzeichnungsschwellenwert für zufällige <strong>und</strong><br />
unvermeidbare GVO Verunreinigungen festlegt.<br />
Honig <strong>und</strong> Bienenprodukte:<br />
Die gesetzlichen Regelungen bezüglich Honig <strong>und</strong> Bienenprodukten sind im Spezialkapitel 11.3 dargestellt.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 17 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 2: Rechtsnormen<br />
2.3. Private Gütesiegelprogramme (Beispiele dazu)<br />
Es gibt eine Fülle unterschiedlicher Gütesiegelprogramme, welche Produkte <strong>und</strong> Lebensmittel als <strong>„gentechnikfrei“</strong><br />
oder „GVO-frei“ oder vergleichbar kennzeichnen. Es wird nur ein Auszug an Gütesiegelprogrammen angeführt.<br />
Zudem wird ausschließlich auf Gütesiegelprogramme Bezug genommen, die Lebensmittel tierischer Herkunft wie<br />
Milch, Fleisch <strong>und</strong> Eier betreffen.<br />
2.3.1. In Österreich<br />
Laut ARGE GENTECHNIK-FREI (2005) werden derzeit folgende private Gütesiegel in Österreich für Lebensmittel tierischer<br />
Herkunft gelistet <strong>und</strong> ausgelobt bzw. sind in der Planungs- oder Umsetzungsphase.<br />
Milch <strong>und</strong> Molkereiprodukte:<br />
• Tirolmilch - <strong>Auslobung</strong> der Gentechnikfreiheit nach Codex<br />
• Kärntner Milch - <strong>Auslobung</strong> der Gentechnikfreiheit in Umsetzung*<br />
• NÖM - <strong>Auslobung</strong> der Gentechnikfreiheit nach Codex*<br />
* laut Pressemeldungen vom 27.7.2005<br />
Fleisch, Geflügel, Eier:<br />
• Geflügelhof Schlierbach (OÖ)* - <strong>Auslobung</strong> der Gentechnikfreiheit nach Codex<br />
• Toni´s Freilandeier (Stmk): - <strong>Auslobung</strong> der Gentechnikfreiheit nach Codex<br />
• Sennhof Frischei (Vlbg): - <strong>Auslobung</strong> der Gentechnikfreiheit nach Codex<br />
* ehemals „Nestei“<br />
2.3.2. Beispiele für Gütesiegelprogramme im benachbarten Ausland<br />
• Suisse Garantie (CH)<br />
• Brimi (IT)<br />
• Wiesenhofgruppe (D)<br />
Das Suisse Garantie Gütesiegel wird für Lebensmittel mit Schweizer Ursprung vergeben <strong>und</strong> garantiert, dass<br />
pflanzliche Nahrungsmittel aus dem Anbau von gentechnisch nicht veränderten Pflanzen stammen. Weiters umfasst<br />
die Garantie, dass tierische Produkte von gentechnisch nicht veränderten Tieren stammen, die nicht mit<br />
gentechnisch hergestellten Futtermitteln gefüttert wurden. Das Suisse Garantie Gütesiegel gilt für alle<br />
landwirtschaftlichen Nutztierarten <strong>und</strong> der Einsatz von SES („GVO-freier“ SES) ist ohne Mengenbeschränkung in der<br />
Ration erlaubt. Der Schwellenwert für unvermeidbare <strong>und</strong> zufällige Verunreinigungen im Mischfutter lag bis vor<br />
kurzem bei 3% für Mischfuttermittel (für Futtermittelausgangserzeugnisse 2%). Eine Angleichung an das EU Recht<br />
nach VO(EG)1829/2003 mit 0,9% für Mischfutter <strong>und</strong> Futtermittelausgangserzeugnisse ist seit 1.3.2005 in Kraft<br />
getreten(SUISSE GARANTIE, 2005).<br />
Zusatzstoffe <strong>und</strong> Aminosäuren aus gentechnisch veränderten Mikroorganismen werden toleriert, sofern sie aus einem<br />
geschlossenen Produktionskreislauf stammen.<br />
Das Südtiroler Gütesiegel BRIMI (Brixner Milch) basiert auf dem Südtiroler Landesgesetz vom 22.1.2002<br />
(Kennzeichnung gentechnikfreier Produkte, 2001) <strong>und</strong> der Durchführungsverordnung über die Kennzeichnung von<br />
gentechnikfreien Produkten, 2001. Es wird für Milch <strong>und</strong> Milchprodukte aus dem Südtiroler Raum vergeben.<br />
Gentechnikfreier SES unterliegt keiner mengenmäßigen Beschränkung in der Ration <strong>und</strong> der maximale Grenzwert<br />
bzw. Schwellenwert für zufällige <strong>und</strong> unvermeidbare Verunreinigungen liegt bei 0,9%. Sämtliche Zusatzstoffe <strong>und</strong><br />
Vitamine aus GVM können, sofern sie die Bestimmungen der VO (EG) 1829/2003 erfüllen, angewendet werden. Laut<br />
Sennereiverband Südtirol fallen jene Lebens- <strong>und</strong> Futtermittel (Zutaten, Aromen <strong>und</strong> Vitamine eingeschlossen) nicht<br />
unter die Regelung der VO (EG) 1829/2003, welche mittels Fermentation durch GVO produziert werden, wenn diese<br />
im Endprodukt nicht mehr enthalten sind (vgl. SENNEREIVERBAND SÜDTIROL, 2005).<br />
Die Deutsche Wiesenhofgruppe vergibt das Gütesiegel für Mastgeflügel (Huhn, Pute <strong>und</strong> Ente) unter Verwendung<br />
von nachweislich gentechnisch nicht verändertem SES. Im Gegensatz zu den zuvor beschriebenen Gütesiegeln gibt<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 18 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 2: Rechtsnormen<br />
es hier zwei Grenzwerte. Prinzipiell gilt der Schwellenwert der VO (EG) 1829/2003 mit 0,9 % bzw. 0,5 %, die Firma<br />
arbeitet jedoch mit einem internen Schwellenwert von generell 0,5 %. Ab Überschreitung dieses Wertes wird der SES<br />
nicht mehr <strong>zur</strong> Produktion verwendet.<br />
SES ist mengenmäßig in der Ration nicht beschränkt.<br />
Zusatzstoffe (Vitamine, Aromen) <strong>und</strong> Aminosäuren aus gentechnisch veränderten Mikroorganismen können<br />
verwendet werden, wenn sie aus einem geschlossenen Produktionssystem stammen, <strong>und</strong> außerdem nicht gemäß der<br />
Regelung von VO (EG) 1829/2003 kennzeichnungspflichtig sind, das heißt, wenn sie wohl mit GVO hergestellt<br />
werden, aber im Endprodukt keine DNA <strong>und</strong> andere Konstrukte des veränderten Mikroorganismus nachweisbar sind,<br />
entspricht dies dem Gütesiegelprogramm (vgl. WIESENHOFGRUPPE, 2005).<br />
Zusammenfassend kann zu den Gütesiegelprogrammen festgestellt werden:<br />
Im Gegensatz zu den österreichischen privaten Gütesiegeln betreffend der <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong>, die sich<br />
derzeit alle nach den Rahmenbedingungen des Codex Alimentarius richten, bauen die drei Garantien für die<br />
angeführten Gütesiegel in den Nachbarstaaten gr<strong>und</strong>sätzlich auf die VO (EG) 1829/2003 auf. Gr<strong>und</strong>sätzlich wird in<br />
beiden Optionen der Einsatz von GVO in Futtermittel ausgeschlossen. Besondere Bedeutung bekommt aufgr<strong>und</strong> der<br />
Importabhängigkeit in der EU, die zentrale Auflage des Einsatzes von gentechnisch nicht verändertem SES zu. Beim<br />
Grenzwert/Schwellenwert für zufällige <strong>und</strong> unvermeidbare Verunreinigungen gibt es Unterschiede, wie etwa 0,9%*<br />
bzw. 0,5%* bei der Wiesenhofgruppe in Deutschland, 0,9%* bei der BRIMI in Südtirol oder 3% bzw. 2%<br />
(Anmerkung: seit 1.3.2005 gilt 0,9%) bei der SUISSE GARANTIE in der Schweiz. Bei den Beispielen für Gütesiegel im<br />
Ausland liegen keinerlei mengenmäßige Beschränkungen von gentechnikfreiem SES (egal ob aus Soft IP oder Hard IP<br />
Programmen) vor. Weiters gelten die Bestimmungen der VO (EG) 1829/2003, wonach kein Verbot für Zusatzstoffe<br />
<strong>und</strong> Aminosäuren, die aus gentechnisch veränderten Mikroorganismen hergestellt wurden bzw. aus geschlossenen<br />
Kreisläufen stammen, sofern kein GVO nachweisbar ist. Zum Unterschied dazu haben aktuell die österreichischen<br />
Gütesiegelprogramme die Codex-Richtlinie <strong>zur</strong> Definition von „Gentechnikfrei“ als Gr<strong>und</strong>lage <strong>und</strong> weichen damit<br />
substanziell von den Gütesiegelprogrammen im benachbarten Ausland ab.<br />
* für in der EU zugelassene GVO<br />
In Tabelle 2-2 wurden die wichtigsten rechtlichen Rahmenbedingungen der österreichischen <strong>und</strong> ausländischen<br />
Gütesiegelprogramme zusammenfassend gegenübergestellt.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 19 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 2: Rechtsnormen<br />
Tabelle 2-2: Zusammenfassung der wichtigsten vertraglichen Rahmenbedingungen von österreichischen<br />
<strong>und</strong> einigen ausländischen Gütesiegelprogrammen<br />
Unternehmen Grenze für<br />
„GVO-freier“ Begrenzung von Zusatzstoffe u. Aminosäuren<br />
Gütesiegel Verunreinigungen SES*<br />
SES*,<br />
aus GVM (geschlossener<br />
mit zugelassenen<br />
GVO<br />
erlaubt<br />
in % der Ration Kreislauf) erlaubt<br />
Benachbartes Ausland:<br />
Suisse Garantie (3% für Mischfutter Ja<br />
Nein Ja<br />
(CH)<br />
2% für Futtermittelausgangsrzeugnisse)<br />
0,9% seit 1.3.2005<br />
in Kraft<br />
wenn nicht<br />
deklarationspflichtig<br />
Brimi (IT)<br />
Brixner Milch<br />
0,9%***<br />
Ja Nein Ja,<br />
wenn nicht<br />
deklarationspflichtig nach<br />
VO (EG) 1829/2003<br />
Wiesenhof (D) 0,9% (Kontrolle)***<br />
+<br />
Ja Nein Ja<br />
Österreich:<br />
0,5% (Zielgröße)<br />
wenn nicht<br />
deklarationspflichtig nach<br />
VO (EG) 1829/2003<br />
-Tirolmilch 0,9%***<br />
Ja<br />
Ja, wenn SES nicht Nein<br />
-Kärntnermilch**<br />
aus Hard-IP stammt<br />
-NÖM<br />
zusätzliche<br />
zusätzliche mit max. 10% für<br />
-Tonis Freilandeier Anforderungen in der Anforderungen Pflanzenfresser, 20 %<br />
-Nestei<br />
landw. Erzeugung in der landw. für andere Tiere<br />
-Sennhof-Frischei betreffend Saatgut, Erzeugung<br />
Pflanzenschutz- <strong>und</strong> betreffend Nein, keine<br />
Düngemittel<br />
Saatgut, Begrenzung für SES<br />
Pflanzenschutz- aus Hard IP<br />
nach Codex<br />
<strong>und</strong> Düngemittel Programmen<br />
(Stand: 7.4.2004)<br />
* SES: Sojaextraktionsschrot (SES)<br />
** Die Einführung eines Qualitätsprogrammes <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> wird geplant.<br />
*** nach VO(EG) 1829/2003<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 20 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 3: Verfügbarkeit von GVO – Anbau <strong>und</strong> Marktsituation<br />
3. Abschätzung der Verfügbarkeit <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Futter-<br />
<strong>und</strong> Lebensmittel <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>und</strong>/oder Kennzeichnung <strong>„gentechnikfrei“</strong><br />
oder „GVO-frei“ aufgr<strong>und</strong> der Anbau- <strong>und</strong> Marktsituation von GVO in der<br />
landwirtschaftlichen Erzeugung – N. BALAREZO <strong>und</strong> CH. KARGL, Institut für Saatgut, <strong>AGES</strong><br />
Futtermittel <strong>und</strong> Lebensmittel stehen am Ende einer langen Produktionskette. Ein Teil der pflanzlichen Rohstoffe, die<br />
in der Futtermittel- <strong>und</strong> Lebensmittelproduktion eingesetzt werden, stammen von Pflanzen aus Ländern mit<br />
großflächigem Anbau von transgenen Sorten. In diesem Kapitel wird zunächst beleuchtet:<br />
• in welchem Ausmaß die wichtigsten rohstoffliefernden Pflanzen aktuell produziert werden <strong>und</strong> wenn ein GVO-<br />
Anbau zutrifft, in welchem Ausmaß dieser stattfindet. Weiters erfolgt eine Abschätzung des zukünftigen Anbaus.<br />
• welches Potential dem Anbau von Substituten vor allem für Sojabohnen bzw. hochwertige Protein-Futtermittel -<br />
d.h. von „GVO-freien“ Pflanzenarten in Österreich zukommt bzw. hinzukommen könnte. Damit wird die Option<br />
einer potentiellen Substitution von Sojabohnen bzw. von SES geprüft, wenn die Verfügbarkeit nicht oder nicht in<br />
ausreichendem Maße garantiert werden kann.<br />
• der Ist-Stand der erteilten Zulassungen von GVO <strong>und</strong> der Anträge im Zulassungsverfahren, womit die zukünftige<br />
Auswahl von Substituten mitbestimmt werden kann<br />
• aus welcher Herkunft die pflanzlichen Rohstoffe für die Futtermittelerzeugung in Österreich stammen <strong>und</strong><br />
welcher Behandlung sie im internationalen Handel unterliegen. Insbesondere welche Qualitätsmanagement-/<br />
QS-Maßnahmen betreffend „Gentechnikfreiheit“ oder „GVO-Freiheit“ gesetzt werden (Art der Zertifizierung).<br />
Ziel ist es, die Verfügbarkeit von „GVO-freien“ oder „gentechnikfreien“ landwirtschaftlichen Produkten in Europa <strong>und</strong><br />
in Österreich zu bewerten. Die Faktensammlung soll als Basis dienen, die Möglichkeit des Ausschlusses <strong>und</strong> der<br />
Vermeidung von GVO in der Futtermittel- <strong>und</strong> Lebensmittelherstellung zu einem späteren Zeitpunkt einzuschätzen.<br />
Die Verfügbarkeit <strong>und</strong> Machbarkeit sowie die Kosten eines risikobasierten Überwachungs- <strong>und</strong> Monitoring- sowie<br />
Eigenkontrollsystem in der landwirtschaftlichen Erzeugung werden maßgeblich durch die rechtlichen<br />
Rahmenbedingungen <strong>zur</strong> Koexistenz, durch die botanische Art, die Agrarstruktur, die Verfügbarkeit von GVO-freiem<br />
Saatgut, den Kulturartenanteil <strong>und</strong> den GVO-Anteil bei der bezughabenden Kulturart sowie die Interaktion<br />
Umweltbedingungen zu Kulturpflanze (Persistenz <strong>und</strong> Durchwuchs, Gentransfer zu Wild- <strong>und</strong> Ruderalpflanzen) etc.<br />
bestimmt (siehe dazu <strong>AGES</strong>-Studie „Die Produktion von Saatgut in abgegrenzten Erzeugungsprozessen <strong>zur</strong><br />
Vermeidung einer Verunreinigung mit gentechnisch veränderten Organismen im Kontext mit der Koexistenz von<br />
konventioneller Landwirtschaft mit oder ohne GVO <strong>und</strong> ökologischer Landwirtschaft“, GIRSCH et al., 2004).<br />
Konkrete <strong>und</strong> rechtlich verbindliche Koexistenzbestimmungen in Drittländern sind im Hinblick auf die Einhaltung eines<br />
definierten Schwellenwerteregimes in den bedeutenden GVO-anbauenden Ländern nicht oder nur unter bestimmten<br />
Bedingungen vorliegend. Zumeist sind in diesen Ländern die Beziehungen der GVO- <strong>und</strong> Nicht-GVO-Landwirtschaft<br />
durch das Privatrecht bestimmt. Privatrechtliche Zertifizierungssysteme regeln die Mindestanforderungen an die<br />
landwirtschaftliche Produktion für "GVO-freie" Produkte.<br />
In Abhängigkeit der Koexistenzmaßnahmen in der landwirtschaftlichen Erzeugung in bestimmten Ländern <strong>und</strong><br />
Regionen ist ein dem Risiko, insbesondere einer systematischen GVO-Verunreingung, angepaßtes Monitoring- <strong>und</strong><br />
Eigenkontrollsystem bei der Erntegutübernahme ein<strong>zur</strong>ichten, sodaß eine "Segregation" von Erntegut mit<br />
verschiedenem GVO-Status erfolgt. In der Regel beziehen private Zertifizierungssysteme bereits die<br />
landwirtschaftliche Erzeugung beginnend von der Auswahl von Saatgut <strong>und</strong> Feldern in ihr Qualitätssystem mit ein.<br />
Dies, um entsprechende Gewähr der Erfüllung der vorgegebenen qualitativen <strong>und</strong> quantitativen Kriterien <strong>und</strong><br />
Vorgaben sicherzustellen. Es kann aktuell <strong>und</strong> mittelfristig mit gesicherter Gewähr davon ausgegangen werden, dass<br />
von der österreichischen Landwirtschaft erzeugtes Erntegut "GVO-frei" oder <strong>„gentechnikfrei“</strong> ist (siehe dazu<br />
„Empfehlungen für eine nationale Strategie <strong>zur</strong> Koexistenz“).<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 21 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 3: Verfügbarkeit von GVO – Anbau <strong>und</strong> Marktsituation<br />
3.1. Anbau landwirtschaftlicher Kulturen <strong>zur</strong> Futtermittel- <strong>und</strong> Lebensmittelerzeugung<br />
unter besonderer Berücksichtigung von GV-Kulturen – aktuell <strong>und</strong> zukünftig<br />
Die Erzeugung <strong>und</strong> der Anbau einzelner Kulturarten wird weltweit, innerhalb Europas <strong>und</strong> im Speziellen in Österreich<br />
dargestellt. In Österreich wird insbesondere das Potential des Anbaus von Eiweißpflanzen als Substitute betrachtet.<br />
Weiters wird auf die Produktion von Pflanzen für die Treibstofferzeugung <strong>und</strong> die daraus anfallenden eiweißhaltigen<br />
Nebenprodukte zum Einsatz als Futtermittel <strong>und</strong> als Substitut für Sojabohnen <strong>und</strong> SES eingegangen. Ausgangspunkt<br />
der Betrachtungen ist, dass aktuell <strong>und</strong> auch absehbar genügend „GVO-freie“ oder „gentechnikfreie“ stärkehältige<br />
Futtermittel wie Getreide <strong>und</strong> Mais in Österreich verfügbar sind, sodass die besondere Betrachtung der<br />
Eiweißkomponenten gerechtfertigt ist.<br />
3.1.1. Die Hauptproduzenten weltweit <strong>und</strong> auf EU-Ebene<br />
• Sojabohnen (Glycine max)<br />
Die Hauptproduzenten von Sojabohnen sind die USA, Brasilien <strong>und</strong> Argentinien (siehe Tabelle 3-1). Zusammen<br />
erzeugen diese drei Länder 82% der Weltsojabohnenproduktion.<br />
Tabelle 3-1: Sojabohnenproduktion - weltweit<br />
Anbauland Produktion Sojabohne<br />
in 2004/2005 [Mio. t]<br />
EU-25 0,8<br />
Indien 7,0<br />
Rest 15,5<br />
China 17,5<br />
Argentinien 39,0<br />
Brasilien 64,5<br />
USA 84,6<br />
Welt 228,9<br />
Quelle: TOEPFER INTERNATIONAL 2004<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Soja-Produktion in 2004/2005<br />
Brasilien<br />
28,2%<br />
USA<br />
37,0%<br />
Argentinien<br />
17,0%<br />
EU-25<br />
0,3%<br />
Indien<br />
3,1%<br />
Rest<br />
6,8%<br />
China<br />
7,6%<br />
Aus agronomischen Gründen <strong>und</strong> aus vertraglichen Verpflichtungen ist der Sojabohnenanbau in Europa kaum von<br />
Bedeutung (siehe Tabelle 3-2). Die wichtigsten Anbauländer sind Italien, Serbien <strong>und</strong> Montenegro, Rumänien,<br />
Frankreich <strong>und</strong> Kroatien. Der Sojabohnenanbau war in den letzten Jahren in den „alten“ 15 EU-Mitgliedstaaten stabil<br />
bis rückläufig, während es zu einer bedeutsamen Ausdehnung der Anbaufläche in den neuen Mitgliedstaaten (v.a.<br />
Ungarn) <strong>und</strong> anderen europäischen Ländern (Rumänien, Kroatien, Serbien <strong>und</strong> Montenegro) gekommen ist.<br />
Tabelle 3-2: Sojabohnenanbau <strong>und</strong> -produktion – Europa<br />
Abbildung 3-1: Sojabohnenproduktion – weltweit, Quelle TOEPFER<br />
INTERNATIONAL 2004, Darstellung <strong>AGES</strong><br />
Fläche in ha Produktion in t<br />
Anbauland 1998 2004 1998 2004<br />
Österreich 20.031,00 14.000,00 50.457,00 37.000,00<br />
Ungarn 23.702,00 30.000,00 49.564,00 50.000,00<br />
Kroatien 34.015,00 50.000,00 77.458,00 110.000,00<br />
Frankreich 111.826,00 60.000,00 284.000,00 152.000,00<br />
Rumänien 144.300,00 120.500,00 200.820,00 269.171,00<br />
Serbien <strong>und</strong> Montenegro 82.409,00 144.000,00 159.933,00 287.834,00<br />
Italien 351.235,00 145.500,00 1.230.720,00 487.000,00<br />
EU-15 491.013,00 222.400,00 1.581.501,00 681.200,00<br />
EU-25 518.283,00 268.765,00 1.636.983,00 759.800,00<br />
Quelle: FAOSTAT 2004<br />
Seite 22 von 272
Tabelle 3-3 : Mittelfristige Entwicklung der<br />
Sojabohnenproduktion<br />
Anbauland<br />
Produktionssteigerung<br />
2005-2008 [%]<br />
EU-15 11<br />
USA 5<br />
Argentinien 8<br />
China -<br />
Brasilien -<br />
Welt -<br />
Quelle: Berechnungen durch <strong>AGES</strong> nach OECD OUTLOOK<br />
2004<br />
Die weltweite Produktion von Sojabohnen steigt bis<br />
2015 mit einer Zuwachsrate von 2,3% p.a. (BRUINSMA<br />
• Mais (Zea mays)<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 3: Verfügbarkeit von GVO – Anbau <strong>und</strong> Marktsituation<br />
Mais-Produktion in 2004/2005<br />
USA<br />
44%<br />
China<br />
18%<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
et al., 2003). Die voraussichtlichen Produktions-<br />
steigerungen bis 2008 sind in Tabelle 3-3 angezeigt.<br />
Die Sojabohnenproduktion wird in Zukunft<br />
geografisch konzentriert bleiben <strong>und</strong> sich auf die USA,<br />
Brasilien <strong>und</strong> Argentinien fokussieren, wobei die<br />
Steigerung sowohl auf Flächensteigerung als auch auf<br />
Ertragssteigerung <strong>zur</strong>ückzuführen sein wird. In den<br />
USA soll jedoch die Fläche von Ölsaaten allgemein auf<br />
dem Niveau von 2003/2004 bleiben (EC DG-AGRI,<br />
2004). Die OECD prognostiziert eine Steigerung der<br />
Anbauflächen <strong>und</strong> der Produktionsmengen in Europa<br />
(allerdings auf der Basis eines sehr geringen<br />
Ausgangsniveaus).<br />
Die USA sind in der weltweiten Produktion von Mais die Spitzenreiter mit aktuell 295 Mio. t, weit dahinter liegen<br />
China <strong>und</strong> die EU 25 (siehe Abbildung 3-2 <strong>und</strong> Tabelle 3-4). USA, China, EU, Argentinien, Brasilien <strong>und</strong> Mexiko<br />
zusammen erzeugen ca. 81% der weltweit produzierten Maismenge (siehe Abbildung 3-2).<br />
Tabelle 3-4: Maisproduktion - weltweit<br />
Anbauland<br />
Produktion Mais<br />
2004/2005 [Mio. t]<br />
Kanada 9<br />
Südafrika 9<br />
Rumänien 13<br />
Argentinien 16<br />
Mexiko 20<br />
Brasilien 43<br />
EU-25 52<br />
Rest 105<br />
China 122<br />
USA<br />
Quelle: TOEPFER INTERNATIONAL 2004<br />
295<br />
KanadaSüdafrika<br />
1% 1%<br />
Rumänien<br />
2%<br />
Rest<br />
15%<br />
Argentinien<br />
2%<br />
Mexiko<br />
3%<br />
Brasilien<br />
In Europa ist der Haupt-Maisproduzent Frankreich, gefolgt von Rumänien, Italien, Ungarn, Spanien <strong>und</strong> Deutschland<br />
(siehe Tabelle 3-5).<br />
EU-25<br />
8%<br />
Abbildung 3-2: Maisproduktion – weltweit, Quelle TOEPFER<br />
INTERNATIONAL 2004, Darstellung <strong>AGES</strong><br />
6%<br />
Seite 23 von 272
Tabelle 3-5: Maisanbau <strong>und</strong> -produktion - Europa<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 3: Verfügbarkeit von GVO – Anbau <strong>und</strong> Marktsituation<br />
Fläche in ha Produktion in t<br />
Anbauland 1998 2004 1998 2004<br />
Deutschland 341.029,00 540.000,00 2.781.464,00 4.062.000,00<br />
Spanien 459.100,00 480.300,00 4.349.100,00 4.567.800,00<br />
Ungarn 1.022.548,00 1.200.000,00 6.143.270,00 8.500.000,00<br />
Italien 968.799,00 1.190.000,00 9.030.860,00 11.320.000,00<br />
Rumänien 3.085.000,00 3.000.000,00 8.623.370,00 13.231.030,00<br />
Frankreich 1.799.000,00 1.796.000,00 15.206.000,00 15.743.000,00<br />
EU-15 4.186.432,00 4.646.650,00 36.435.901,00 41.129.600,00<br />
EU-25 5.462.141,00 6.535.873,00 43.995.898,00 53.475.530,00<br />
Quelle: FAOSTAT 2004<br />
Tabelle 3-6: Mittelfristige Entwicklung der<br />
Maisproduktion<br />
Anbauland<br />
Produktionssteigerung<br />
2005-2008 [%]<br />
Kanada 4<br />
EU-15 7<br />
Mexiko 3<br />
Argentinien 6<br />
China -<br />
Brasilien -<br />
Welt -<br />
Quelle: Berechnungen durch <strong>AGES</strong> nach OECD<br />
OUTLOOK 2004<br />
• Raps (Brassica napus) <strong>und</strong> Rübsen (Brassica rapa)<br />
Die von der OECD prognostizierten<br />
Produktionssteigerungen für Mais in einem<br />
Raps-Produktion in 2004/2005<br />
EU-25<br />
33%<br />
China<br />
28%<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
mittelfristigen Zeitraum fallen geringer aus als für<br />
Sojabohne. Für die EU-15 z.B. geht man von einer<br />
Steigerung der Produktionsmenge von 7% zwischen<br />
2005 <strong>und</strong> 2008 aus (siehe Tabelle 3-6). Mittelfristig<br />
soll die Maisproduktion in der EU-25 sich auf 51 Mio. t<br />
einpendeln, wobei ca. 10,5 Mio. t zukünftig in den<br />
neuen Mitgliedstaaten produziert werden (EC DG-<br />
AGRI, 2004).<br />
Die drei größten Rapsproduzenten weltweit sind die EU-25, gefolgt von China <strong>und</strong> Kanada (siehe Tabelle 3-7).<br />
Zusammen erzeugen diese 3 Länder 78% der Weltrapsproduktion (siehe Abbildung 3-3).<br />
Tabelle 3-7: Rapsproduktion – weltweit<br />
Anbauland<br />
Produktion Raps in<br />
2004/2005 [Mio. t]<br />
Australien 1,5<br />
Rest 1,7<br />
Indien 5,8<br />
Kanada 7,0<br />
China 12<br />
EU-25 14,3<br />
Welt 42,3<br />
Quelle: TOEPFER INTERNATIONAL 2004<br />
Australien<br />
4%<br />
Rest<br />
4%<br />
Kanada<br />
17%<br />
Indien<br />
14%<br />
Abbildung 3-3: Rapsproduktion – weltweit, Quelle TOEPFER<br />
INTERNATIONAL 2004, Darstellung <strong>AGES</strong><br />
Seite 24 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 3: Verfügbarkeit von GVO – Anbau <strong>und</strong> Marktsituation<br />
Die größten Rapsproduzenten in Europa sind Deutschland, Frankreich <strong>und</strong> das Vereinigte Königreich, gefolgt von den<br />
neuen Mitgliedsstaaten Polen <strong>und</strong> Tschechien (siehe Tabelle 3-8).<br />
Tabelle 3-8: Rapsanbau <strong>und</strong> -produktion in Europa<br />
Anbauland Fläche in ha Produktion in t<br />
1998 2004 1998 2004<br />
Tschechien 264.310,00 259.460,00 680.216,00 910.388,00<br />
Polen 465.995,00 500.000,00 1.099.084,00 1.292.329,00<br />
Vereinigtes Königreich 534.000,00 557.000,00 1.567.000,00 1.612.000,00<br />
Frankreich 1.145.000,00 1.117.000,00 3.734.000,00 3.961.000,00<br />
Deutschland 1.007.225,00 1.279.000,00 3.387.928,00 5.250.000,00<br />
EU-15 3.093.259,00 3.311.505,00 9.559.745,00 11.745.990,00<br />
EU-25 3.984.566,00 4.418.944,00 11.587.906,00 14.671.407,00<br />
Quelle: FAOSTAT 2004<br />
Tabelle 3-9: Mittelfristige Entwicklung der<br />
Rapsproduktion<br />
Anbauland<br />
Produktionssteigerung<br />
2005-2008 [%]<br />
Australien 4<br />
Kanada 6<br />
EU-15 9<br />
China -<br />
Welt -<br />
Quelle: Berechnungen durch <strong>AGES</strong> nach OECD OUTLOOK 2004<br />
• Weizen (Triticum ssp. insbesondere T. aestivum)<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Die weltweite Produktion von Raps steigt bis 2015 mit<br />
einer Zuwachsrate von 2,4% p.a. (BRUINSMA et al.,<br />
2003). Die OECD prognostiziert eine Steigerung der<br />
Rapsproduktion bis zum Jahr 2008 von 9% allein in<br />
der EU-15 (siehe Tabelle 3-9).<br />
Wichtige Anbauländer weltweit sind China, Indien, USA <strong>und</strong> Russland (Tabelle 3-10 <strong>und</strong> Abbildung 3-4). Das Europa<br />
der 25 produziert mehr als ein Fünftel des Weizens weltweit. Die Weizenproduktion in Europa konzentriert sich stark<br />
auf Frankreich <strong>und</strong> Deutschland. Die „alten“ EU 15 Mitgliedstaaten produzierten im Jahre 2004 knapp mehr als 4/5<br />
der europäischen Produktion (siehe Tabelle 3-11).<br />
Tabelle 3-10: Weizenproduktion - weltweit<br />
Anbauland Produktion Weizen in<br />
2004/2005 [Mio. t]<br />
Argentinien 15<br />
Türkei 18<br />
Ukraine 18<br />
Australien 24<br />
Kanada 25<br />
Russland 44<br />
USA 59<br />
Indien 72<br />
China 90<br />
Rest 117<br />
EU-25 134<br />
Welt 616<br />
Quelle: TOEPFER INTERNATIONAL 2004<br />
Weizen-Produktion in 2004/2005<br />
Rest<br />
19%<br />
EU-25<br />
21%<br />
Argentinien<br />
2%<br />
China<br />
15%<br />
Türkei<br />
3% Ukraine Australien<br />
3% 4%<br />
Kanada<br />
4%<br />
Indien<br />
12%<br />
Russland<br />
7%<br />
USA<br />
10%<br />
Abbildung 3-4: Weizenproduktion – weltweit, Quelle TOEPFER<br />
INTERNATIONAL 2004, Darstellung <strong>AGES</strong><br />
Seite 25 von 272
Tabelle 3-11: Weizenanbau <strong>und</strong> -produktion in Europa<br />
Quelle: Berechnungen durch <strong>AGES</strong> nach OECD OUTLOOK 2004<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 3: Verfügbarkeit von GVO – Anbau <strong>und</strong> Marktsituation<br />
Fläche in ha Produktion in t<br />
Anbauland 1998 2004 1998 2004<br />
Ungarn 1.183.540,00 1.173.000,00 4.898.634,00 6.020.000,00<br />
Spanien 1.912.560,00 2.179.000,00 5.436.300,00 7.175.000,00<br />
Italien 2.327.950,00 2.300.000,00 8.338.301,00 8.000.000,00<br />
Polen 2.631.319,00 2.600.000,00 9.536.576,00 9.450.486,00<br />
Vereinigtes Königreich 2.045.000,00 1.991.000,00 15.449.000,00 15.706.000,00<br />
Deutschland 2.802.455,00 3.101.000,00 20.187.492,00 25.346.000,00<br />
Frankreich 5.234.000,00 5.231.000,00 39.809.000,00 39.641.000,00<br />
EU - 15 17.250.990,00 17.913.437,00 103.744.136,00 111.981.300,00<br />
EU - 25 22.805.285,00 23.563.698,00 123.705.294,00 135.972.040,00<br />
Quelle: FAOSTAT 2004<br />
Tabelle 3-12: Mittelfristige Entwicklung der<br />
Weizenproduktion<br />
Anbauland<br />
Produktionssteigerung<br />
2005-2008 [%]<br />
Australien 11<br />
Kanada 1<br />
EU-15 4<br />
Türkei 5<br />
USA 2<br />
Argentinien 10<br />
China 2<br />
Russland 3<br />
Welt 4<br />
• Gerste (Hordeum vulgare)<br />
Die weltweite Weizenproduktion wird zukünftig<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
rascher steigen als in den neunziger Jahren, vor allem<br />
in den Transformations- <strong>und</strong> Entwicklungsländern.<br />
Wie in den letzten Jahrzehnten wird die<br />
Produktionssteigerung eher auf Ertragssteigerung<br />
<strong>zur</strong>ückzuführen sein, da die Anbaufläche nur moderat<br />
ansteigen wird (EC DG-AGRI, 2004). Mittelfristig<br />
werden laut OECD sowohl in der EU-15 als auch<br />
weltweit Zuwachsraten in der Größenordnung von 4%<br />
vorausgesagt (siehe Tabelle 3-12).<br />
R<strong>und</strong> 40% der weltweiten Gerstenproduktion fällt auf die EU-25. Russland, Kanada, Ukraine, Türkei <strong>und</strong> Australien<br />
sind weitere wichtige Erzeugerländer (siehe Tabelle 3-13 <strong>und</strong> Abbildung 3-5).<br />
Tabelle 3-13: Gerstenproduktion - weltweit<br />
Anbauland<br />
Produktion Gerste in<br />
2004/2005 [Mio. t]<br />
China 3,5<br />
USA 6,1<br />
Türkei 7,1<br />
Australien 7,6<br />
Ukraine 11,2<br />
Kanada 13<br />
Russland 18,5<br />
Rest 24,6<br />
EU-25 60,7<br />
Welt 152,3<br />
Quelle: TOEPFER INTERNATIONAL 2004<br />
Gersten-Produktion in 2004/2005<br />
EU-25<br />
40%<br />
Rest<br />
16%<br />
China<br />
2%<br />
USA<br />
4%<br />
Türkei<br />
5%<br />
Australien<br />
5%<br />
Russland<br />
12%<br />
Ukraine<br />
7%<br />
Kanada<br />
9%<br />
Abbildung 3-5: Gerstenproduktion - weltweit, Quelle: TOEPFER<br />
INTERNATIONAL 2004, Darstellung <strong>AGES</strong><br />
Seite 26 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 3: Verfügbarkeit von GVO – Anbau <strong>und</strong> Marktsituation<br />
In der EU sind die großen Gerste-Anbauländer (> 1 Mio. ha Anbaufläche) Spanien, Deutschland, Frankreich, Polen<br />
<strong>und</strong> das Vereinigte Königreich (siehe Tabelle 3-14). Gegenüber anderen Getreidearten hat Gerste mittelfristig<br />
gesehen schlechtere Marktaussichten, was sich beispielsweise in einer geringeren Wettbewerbsfähigkeit zugunsten<br />
von Weizen <strong>und</strong> Mais in der Tierfütterung ausdrücken wird (EC DG-AGRI, 2004). Die Gerstenproduktion wird die<br />
nächsten Jahre in Europa vermutlich stagnieren (siehe Tabelle 3-15).<br />
Tabelle 3-14: Gerstenanbau <strong>und</strong> -produktion in Europa<br />
Fläche in ha Produktion in t<br />
Anbauland 1998 2004 1998 2004<br />
Vereinigtes Königreich 1.253.000,00 1.006.000,00 6.623.000,00 5.860.000,00<br />
Polen 1.137.556,00 1.090.000,00 3.611.680,00 3.476.514,00<br />
Frankreich 1.631.000,00 1.626.000,00 10.591.000,00 10.999.000,00<br />
Deutschland 2.180.849,00 2.236.000,00 12.512.262,00 12.967.000,00<br />
Spanien 3.535.200,00 3.177.000,00 10.895.300,00 10.583.200,00<br />
EU - 15 11.373.007,00 10.639.739,00 51.794.670,00 52.089.420,00<br />
EU - 25 14.506.871,00 13.409.074,00 61.102.445,00 61.748.814,00<br />
Quelle: FAOSTAT 2004<br />
Tabelle 3-15: Mittelfristige Entwicklung der<br />
Gerstenproduktion<br />
Anbauland<br />
Produktionssteigerung<br />
2005-2008 [% ]<br />
USA 5<br />
Australien 1<br />
Kanada 6<br />
Russland 3<br />
EU-25 0<br />
Welt -<br />
Quelle: Berechnungen durch <strong>AGES</strong> nach<br />
OECD OUTLOOK 2004<br />
Von den weiteren landwirtschaftlich erzeugten Rohstoffen bzw. Futtermittelausgangsprodukten seien neben den<br />
bereits erwähnten Kulturpflanzenarten die maßgeblichen Eiweißlieferanten Futter-/Körnererbse, Ackerbohne <strong>und</strong><br />
Lupine genannt. Nur der Erbse kommt mit einer Erzeugung von 5,25 Mio. t 1998 <strong>und</strong> 3,03 Mio. t 2004 eine gewisse<br />
Bedeutung zu (siehe Tabelle 3-17). Im Vergleich mit den Getreidearten sind diese Produktionsmengen allerdings<br />
vergleichsweise gering (
• Kartoffel (Solanum tuberosum)<br />
Tabelle 3-16: Kartoffelanbau <strong>und</strong> –produktion in Europa<br />
Fläche in ha Produktion in t<br />
Anbauland 1998 2004 1998 2004<br />
Tschechien 72.625,00 43.481,00 1.519.768,00 1.076.165,00<br />
Dänemark 36.000,00 41.000,00 1.455.960,00 1.412.175,00<br />
Litauen 136.300,00 110.000,00 1.849.000,00 1.600.000,00<br />
Italien 90.134,00 81.000,00 2.194.020,00 2.000.000,00<br />
Belgien 0,00 65.000,00 0,00 3.029.900,00<br />
Frankreich 164.000,00 160.000,00 6.053.000,00 6.900.000,00<br />
Deutschland 297.267,00 295.000,00 11.711.720,00 12.991.076,00<br />
EU - 15 1.313.224,00 1.267.409,00 43.689.513,00 47.387.551,00<br />
EU - 25 2.949.040,00 2.366.050,00 73.491.649,00 67.426.116,00<br />
Quelle: FAOSTAT 2004<br />
• Futtererbse, Körnererbse (Pisum sativum)<br />
Tabelle 3-17: Futtererbsenanbau <strong>und</strong> –produktion in Europa<br />
Fläche in ha Produktion in t<br />
Anbauland 1998 2004 1998 2004<br />
Ungarn 53.860,00 25.000,00 130.937,00 35.000,00<br />
Tschechien 50.979,00 21.000,00 121.789,00 45.000,00<br />
Österreich 26.280,00 42.000,00 83.710,00 104.000,00<br />
Dänemark 106.000,00 26.500,00 385.757,00 110.000,00<br />
Spanien 48.700,00 132.800,00 63.200,00 181.200,00<br />
Vereinigtes<br />
Königreich 102.200,00 73.500,00 324.000,00 288.000,00<br />
Deutschland 168.861,00 131.000,00 589.378,00 370.000,00<br />
Frankreich 605.160,00 357.000,00 3.224.728,00 1.674.000,00<br />
EU – 15 1.120.586,00 809.880,00 4.794.856,00 2.865.500,00<br />
EU – 25 1.334.548,00 909.213,00 5.252.886,00 3.031.700,00<br />
Quelle: FAOSTAT 2004<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 3: Verfügbarkeit von GVO – Anbau <strong>und</strong> Marktsituation<br />
• Ackerbohne (Vicia faba)<br />
Tabelle 3-18: Ackerbohnenanbau <strong>und</strong> –produktion in Europa<br />
Fläche in ha* Produktion in t**<br />
Anbauland 1998 2003 1998 2004<br />
Polen - N - - N - - N - 33.000,00<br />
Spanien 9.000,00 43.000,00 12.000,00 52.000,00<br />
Deutschland 27.000,00 19.000,00 92.000,00 60.000,00<br />
Italien 45.000,00 50.000,00 71.000,00 65.000,00<br />
Frankreich 13.000,00 81.000,00 39.000,00 270.000,00<br />
Vereinigtes Königreich 111.000,00 171.000,00 73.000,00 627.000,00<br />
EU-15 227.000,00 373.000,00 717.000,00 1.103.000,00<br />
EU-25 - N - - N - - N - 1.147.000,00<br />
Quelle: * PROLEA 2004, ** TOEPFER INTERNATIONAL 2004<br />
• Lupine (Lupinus ssp.)<br />
Tabelle 3-19: Lupinenanbau <strong>und</strong> –produktion in Europa<br />
Fläche in ha Produktion in t<br />
Anbauland 1998 2004 1998 2004<br />
Ungarn 1.926,00 350,00 1.459,00 300,00<br />
Griechenland 100,00 500,00 100,00 500,00<br />
Litauen 4.000,00 1.800,00 1.800,00 1.900,00<br />
Italien 3.000,00 3.500,00 4.700,00 5.000,00<br />
Polen 12.595,00 9.000,00 26.450,00 11.000,00<br />
Spanien 14.100,00 16.200,00 10.600,00 11.500,00<br />
Vereinigtes Königreich* - N - 4.600,00 - N - 12.650,00<br />
Frankreich 3.125,00 9.000,00 9.858,00 23.000,00<br />
Deutschland** - N - 35.775,00 - N - - N --<br />
EU - 15 - N - - N - - N - - N -<br />
EU - 25 - N - - N - - N - - N -<br />
Quelle: FAOSTAT 2004<br />
*Daten von 2003, Quelle: EUROSTAT 2004<br />
**EUROSTAT 2004<br />
Seite 28 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 3: Verfügbarkeit von GVO – Anbau <strong>und</strong> Marktsituation<br />
3.1.2. Anbau <strong>und</strong> Produktion in Österreich inklusive potentielle Sojabohnen-Substitute<br />
In Österreich wurden im Jahr 2004 82.136 ha Ölfrüchte angebaut, davon 17.864 ha Sojabohne, 35.284 ha Raps <strong>und</strong><br />
28.988 ha Sonnenblume. Die Anbaufläche von Sojabohne stieg 2004 um 16% im Vergleich zum Vorjahr, über die<br />
letzten Jahre betrachtet ist jedoch keine deutliche Tendenz zu erkennen. Anders bei den Erträgen, die seit 2001<br />
kontinuierlich gestiegen sind (+ 4,4 dt/ha). Die Anbaufläche von Winterraps ist seit 2001 rückläufig, der Ertrag <strong>und</strong><br />
die Erntemengen lagen aber aufgr<strong>und</strong> der günstigen Witterung 2004 deutlich über dem Durchschnitt der letzten<br />
Produktionsjahre. Die Anbaufläche von Sonnenblumen ist seit 2001 kontinuierlich gestiegen (+ 8.659 ha).<br />
Das Jahr 2004 war auch für Körnererbsen ein gutes Ertragsjahr, ansonsten schwankten bei Ackerbohne <strong>und</strong><br />
Körnererbse die Flächen <strong>und</strong> die Erträge in den letzten Jahren wenig.<br />
Zusammen machen die Öl- <strong>und</strong> Eiweißpflanzen, die speziell als Alternative zu Sojabohne in Frage kommen, also<br />
Raps, Ackerbohne, Erbse, Sonnenblume <strong>und</strong> Lupine, nur 7 bis 8% der Ackerfläche Österreichs aus. Die<br />
Produktionsmengen sind allerdings im Vergleich zu den Getreidearten geringer. Der Verbrauch bzw. der Markt für<br />
Körnerleguminosen hat in Österreich, ähnlich wie Anbau <strong>und</strong> Erzeugung, eine geringe Bedeutung.<br />
Die Tabelle 3-20 gibt Auskunft über Anbauflächen, Erntemengen <strong>und</strong> Erträge einiger für Futtermittelzwecke<br />
relevanter Kulturarten.<br />
Tabelle 3-20: Anbau- <strong>und</strong> Produktionsdaten ausgesuchter Kulturarten für Futtermittelzwecken<br />
Kulturart<br />
Anbaufläche<br />
2004<br />
[ha]<br />
Flächenänderung im<br />
Vergleich zu 2003<br />
[%]<br />
Produktion<br />
2004<br />
[t]<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Ertrag<br />
2004<br />
[dt/ha]<br />
Ø-Ertrag<br />
2001-2004<br />
[dt/ha]<br />
Ackerbohne 2.835 -18 7.764 27,4 26,8<br />
Körnererbse 39.320 -7 122.128 31,1 26,4<br />
Süßlupine 203 3 608 30,0 -<br />
Sommerraps <strong>und</strong><br />
Rübsen 276 -58 603 21,9 17,8<br />
Winterraps <strong>zur</strong><br />
Ölgewinnung 35.008 -19 120.212 34,3 25,4<br />
Sonnenblume 28.988 13 77.925 26,9 26,7<br />
Sojabohne 17.864 16 44.824 25,1 24,1<br />
Zuckerrübe 45.099 4 2.842.165 630,2 627,5<br />
Weizen 290.174 7 1.718.825 59,2 51,3<br />
Gerste 191.333 -10 1.006.742 52,6 45,9<br />
Körnermais 178.702 3 1.653.746 92,5 90,1<br />
Kartoffel 21.925 4 693.054 316,1 296,4<br />
Quelle: STATISTIK AUSTRIA 2003 <strong>und</strong> 2004, EUROSTAT 2004, Berechnungen durch <strong>AGES</strong><br />
Die Versorgungsbilanz 2002/2003 für Ölsaaten zeigt, dass 73% der inländisch erzeugten Sojabohnen für<br />
Futterzwecke verwendet werden (siehe Tabelle 3-21). Der Versorgungsgrad von 96% entsteht weiters durch die<br />
zusätzliche Verwendung für Saat-<strong>und</strong> Nahrungszwecke <strong>und</strong> durch Verluste.<br />
In derselben Referenzperiode wurden bei den Hülsenfrüchten (Erbsen, Ackerbohnen, Lupine <strong>und</strong> andere) 87% der<br />
inländischen Erzeugung für Futterzwecke verwendet (siehe Tabelle 3-21). Der Selbstversorgungsgrad mit<br />
Hülsenfrüchten lag bei knappen 100%. Daraus lässt sich primär ableiten, dass ohne Ausdehnung der Anbauflächen<br />
kein Potential für den Ersatz von ausländischer Sojabohne durch inländische Sojabohne oder Hülsenfrüchte aus<br />
österreichischer Produktion besteht. Bei den Kulturarten Raps <strong>und</strong> Sonnenblumen ist es noch weniger der Fall, da die<br />
Selbstversorgungsgrade bei 88% resp. 48% lagen.<br />
Seite 29 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 3: Verfügbarkeit von GVO – Anbau <strong>und</strong> Marktsituation<br />
Tabelle 3-21: Versorgungsbilanzen 2002/2003, Hülsenfrüchte <strong>und</strong> Ölfrüchte<br />
Bilanzposten 2002/2003<br />
Hülsenfrüchte<br />
Raps <strong>und</strong><br />
Rübsen<br />
Sonnenblumenkerne<br />
Sojabohnen<br />
Erzeugung [t] 107.416 128.647 58.476 35.329<br />
Anfangsbestand - 17.000 25.000 -<br />
Endbestand - 15.000 -<br />
Einfuhr 5.574 61.414 121.197 22.658<br />
Ausfuhr 5.255 60.072 68.466 21.098<br />
Inlandsverwendung [t] 107.735 146.989 121.207 36.889<br />
Saat 8.466 176 142 1.237<br />
Futter 93.060 618 10.736 26.015<br />
Verarbeitung - 141.706 106.575 -<br />
Lebensmittel 2.987 - 2.000 8.577<br />
Verluste 3.222 4.489 1.754 1.060<br />
Selbstversorgungsgrad [%] 100 88 48 96<br />
Quelle: nach BMLFUW 2004<br />
Die zusätzliche Produktion, die theoretisch nötig ist, um ausländische Sojabohnen bzw. Sojaextraktionsschrot zu<br />
substituieren, kann einerseits durch Ausdehnung der Ackerfläche von heimischen Substituten <strong>und</strong> andererseits durch<br />
den Einsatz von Nebenprodukten der Bioethanolerzeugung (v.a. aus Getreideüberschüssen) erzielt werden.<br />
Betrachtet man die Versorgungsbilanz für Getreide aus dem Jahr 2003/2004 wird laut Statistik Austria in Bezug auf<br />
Weichweizen (Triticum aestivum) ein Selbstversorgungsgrad innerhalb Österreichs von 126% erreicht, was eine gute<br />
Ausgangssituation für eine potentielle Substitution darstellt.<br />
3.1.2.1. Pflanzenbauliche Aspekte des Anbaus von Eiweißpflanzen<br />
Von der pflanzenbaulichen Seite betrachtet sind die Gründe für die geringe Bedeutung des Anbaus von<br />
Hülsenfrüchten in Österreich u.a.:<br />
• die vergleichsweise (mit Getreide) geringe Ertragshöhe <strong>und</strong> die Ertragsschwankungen sowie das<br />
Schaderregerauftreten, v.a. für Erbsen, Ackerbohne <strong>und</strong> Lupine<br />
• durch geringe Züchtungsfortschritte im Vergleich zu den Getreidearten <strong>und</strong> Mais fallen die jährlichen<br />
Ertragszuwächse bescheiden aus<br />
• die weiten Fruchtfolgen, die einzuhalten sind (Erbse, Ackerbohne <strong>und</strong> Lupine: 4 – 6 Jahre Anbaupause)<br />
Weiters sind die vom Handel <strong>und</strong> Mischfutterwerken gewünschten großen Partien von einheitlicher Qualität für ein<br />
kontinuierliches Produktangebot kaum verfügbar. Der Einsatz erfolgt daher entweder am landwirtschaftlichen Betrieb<br />
oder auf örtlicher Produktionsebene.<br />
3.1.2.2. Aspekte der Förderung von Eiweißpflanzen in der EU <strong>und</strong> in Österreich<br />
In dem 2001 von der Europäischen Kommission vorgelegten „Bericht über das Angebot an Eiweißpflanzen <strong>zur</strong><br />
Deckung des zusätzlichen Bedarfs an pflanzlichen Protein für die Futtermittelherstellung“, wurde eine Reihe von<br />
Schlüsseloptionen <strong>zur</strong> Förderung des Anbaus von Eiweißpflanzen in der EU geprüft. Als Hauptnachteil der Förderung<br />
der Produktion von Eiweißpflanzen durch Erhöhung der kulturspezifischen Beihilfe wurde damals die begrenzte<br />
Effizienz angeführt, d.h. die relativ hohen Kosten <strong>und</strong> die sehr bescheidene Steigerung des Eiweißangebots<br />
(EUROPÄISCHE KOMMISSION, 2001).<br />
Für die Eiweißpflanzen Erbse, Ackerbohne <strong>und</strong> Süßlupine können ab dem Jahr 2005 Ausgleichszahlungen im Rahmen<br />
der Einheitlichen Betriebsprämie sowie eine (zusätzliche) „Prämie für Eiweißpflanzen“ beantragt werden. Die<br />
Rechtsgr<strong>und</strong>lagen für die einheitliche Betriebsprämie <strong>und</strong> die gekoppelte Flächenzahlung sind in den Verordnungen<br />
VO (EG) Nr. 1782/2003 <strong>und</strong> VO (EG) Nr. 1973/2004 festgelegt. Die Eiweißpflanzen-Prämie von z.Z. 55,57 €/ha wird<br />
im Rahmen einer EU-weiten Garantiehöchstfläche von 1,4 Mio. ha gewährt. Im Jahr 2004, ein Jahr vor Inkrafttreten<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 30 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 3: Verfügbarkeit von GVO – Anbau <strong>und</strong> Marktsituation<br />
der Betriebsprämienregelung, wurde EU-weit für 1.251.239,91 ha die Eiweißprämie beantragt. Die garantierte<br />
Höchstfläche wurde somit nicht erreicht. Im Falle einer Überschreitung der Garantiehöchstfläche werden im<br />
betreffenden Jahr die Flächenprämien jedes Betriebsinhabers entsprechend gekürzt.<br />
Für eine Reihe von Pflanzen, darunter die Ölpflanzen Raps <strong>und</strong> Rübsen, Sonnenblume <strong>und</strong> Sojabohne, können ab<br />
dem Jahr 2005 eine Ausgleichszahlung im Rahmen der Einheitlichen Betriebsprämie sowie eine (zusätzliche) „Beihilfe<br />
für Energiepflanzen“ beantragt werden. Die wesentlichen Rechtsgr<strong>und</strong>lagen sind u.a. dieselben wie für die<br />
Eiweißpflanzen. Diese Beihilfe darf nicht für nachwachsende Rohstoffe auf stillgelegten Flächen beantragt werden.<br />
Vorraussetzung ist die Verwendung der angebauten Pflanzen für die Herstellung von Biokraftstoffen oder von Energie<br />
aus Biomasse. Die Beihilfe beträgt z.Z. 45 €/ha <strong>und</strong> wird EU-weit für eine Garantiehöchstfläche von 1,5 Mio. ha<br />
gewährt. Bei Überschreitung dieser Höchstfläche wird ähnlich wie bei Eiweißpflanzen verfahren.<br />
Beschränkungen über den Anbau von Ölsaaten gibt es nur durch das Blair House Abkommen [das zwischen USA <strong>und</strong><br />
EU 2003 beschlossen wurde (93/355/EWG)] (BMLFUW, 2005). Davon betroffen ist die Produktion von Ölsaaten für<br />
Nicht-Nahrungsmittel-Zwecke auf Stilllegungsflächen. Die Nebenerzeugnisse dieser Ölsaaten, die zu Lebens- oder<br />
Futtermittelzwecke verwendet werden, sind auf 1 Mio. Tonnen Sojamehläquivalent beschränkt. Bei<br />
Überschreitung sind die entsprechenden Mengen – auf der Gr<strong>und</strong>lage eines von der Europäischen Kommission<br />
festgesetzten Kürzungssatzes – einer anderen Verwertung als der Nahrungs- <strong>und</strong> Futtermittelschiene zuzuführen.<br />
Diese EU-weite Begrenzung wurde bis dato noch nicht überschritten (BMLFUW, 2005).<br />
National wird der Anbau von Ölsaaten <strong>und</strong> Eiweißpflanzen darüber hinaus im Rahmen des „Österreichischen<br />
Programms <strong>zur</strong> Förderung einer umweltgerechten, extensiv <strong>und</strong> den natürlichen Lebensraum schützenden<br />
Landwirtschaft“ ÖPUL 2000, gefördert.<br />
Die obligatorische Flächenstilllegung ist mit der GAP-Reform aufrecht geblieben, allerdings gibt es keinen EU-<br />
einheitlichen Stilllegungssatz mehr. Im Rahmen der neuen Betriebsprämienregelung werden die Zahlungsansprüche<br />
bei Stilllegung aufgr<strong>und</strong> der 2000-2002 obligatorisch stillzulegenden Flächen <strong>und</strong> der entsprechenden<br />
Direktzahlungen ermittelt. Die gesamte Brachefläche Österreichs betrug im Durchschnittszeitraum ca. 108.000 ha;<br />
die obligatorische Flächenstilllegung betrug, dem Stilllegungssatz in diesem Zeitraum von 10% entsprechend, im<br />
Durchschnitt der vergangenen Jahre ca. 70.000 ha. Unter Berücksichtigung einer durchschnittlich fünfjährigen<br />
Fruchtfolge ergibt sich ein maximales Potential für einen zusätzlichen Anbau – ohne Verdrängung anderer<br />
Kulturarten – von Öl- <strong>und</strong> Eiweißpflanzen für die ausschließliche Erzeugung nachwachsender Rohstoffe auf<br />
Stilllegungsfläche von ca. 18.000 ha. Berücksichtigt man die Tatsache, dass stillgelegte Flächen ohnehin schlecht zu<br />
bewirtschaften sind <strong>und</strong> dass Standort-Ansprüche der jeweiligen Kulturarten zu wesentlichen Einschränkungen<br />
führen, ergibt sich ein noch geringeres Flächenpotential.<br />
Österreich ist in den Diskussionen <strong>zur</strong> Agenda 2000 immer wieder für eine Erhöhung der Ölsaaten- <strong>und</strong> der<br />
Eiweißpflanzenprämie eingetreten. Aus handelspolitischen <strong>und</strong> budgetären Gründen konnte allerdings nur der im<br />
Beschluss <strong>zur</strong> Agenda 2000 festgelegte Kompromiss verabschiedet werden (BMLFUW, 2001).<br />
Die Halbzeitbewertung der Agenda 2000 führte 2003 zu einer gr<strong>und</strong>legenden Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik.<br />
Die neue EU-Agrarreform <strong>und</strong> die damit verb<strong>und</strong>ene komplette Einbindung der Kulturpflanzenförderung in die<br />
einheitliche Betriebsprämie sind seit 1. Januar 2005 in Kraft. Eine seriöse Schätzung über das zukünftige<br />
Anbauverhalten bei Eiweißpflanzen <strong>und</strong> Sojabohne kann aufgr<strong>und</strong> der 2005 erstmaligen Umsetzung der GAP-Reform<br />
nicht gemacht werden (BMLFUW, 2005).<br />
3.1.2.3. Umsetzung der EU-Biokraftstoffrichtlinie <strong>und</strong> deren Einfluss auf das Aufkommen von Eiweißfuttermittel<br />
Am 8. Mai 2003 wurde die EU-„Richtlinie <strong>zur</strong> Förderung der Verwendung von Bio-Kraftstoffen oder anderen<br />
erneuerbaren Kraftstoffen im Verkehrssektor“ verabschiedet (RL 2003/30/EG). Sie besagt, dass bis 31. Dezember<br />
2005 ein Anteil von 2 % der Kraftstoffe aus dem Verkehrssektor, gemessen am Energiegehalt, aus Biokraftstoffen<br />
bestehen soll. Bis 2008 soll ein Anteil von 5,75 % erreicht sein. Diese Ziele sind lediglich Soll-Bestimmungen <strong>und</strong> bei<br />
Nicht-Erreichen nicht einklagbar.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 31 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 3: Verfügbarkeit von GVO – Anbau <strong>und</strong> Marktsituation<br />
In Österreich wurde am 4. November 2004 die Biokraftstoffrichtlinie im Rahmen der Novelle der Kraftstoffverordnung<br />
in nationales Recht umgesetzt (ÄNDERUNG DER KRAFTSTOFFVERORDNUNG, 2004). Jene Stellen, die Treibstoffe in Verkehr<br />
bringen, sind dazu verpflichtet, ab 1. Oktober 2005 2,5% der gesamten in Verkehr gebrachten Energiemenge durch<br />
Biotreibstoffe zu ersetzen. Ab 2007 erhöht sich der Prozentsatz auf 4,3%, 2008 ist das Richtlinienziel von 5,75% zu<br />
erreichen.<br />
Unter Biotreibstoffe versteht man Treibstoffe, die aus Biomasse hergestellt wurden. Die wichtigsten sind <strong>zur</strong>zeit<br />
Biodiesel, Bioethanol, Biogas <strong>und</strong> reines Pflanzenöl. Biodiesel hat in den letzten Jahren in Österreich an Popularität<br />
stark zugenommen, während Bioethanol bisher unbekannt war. Im Zuge der Umsetzung der Biokraftstoffrichtlinie<br />
werden jedoch beide stark an Bedeutung zunehmen. Durch die entsprechende Verwertung der Nebenprodukte der<br />
Biokraftstoffproduktion besteht für Österreich die Möglichkeit, die Importe von Eiweißfuttermitteln deutlich zu senken<br />
<strong>und</strong> seine Selbstversorgung zu steigern. Anzuführen ist, dass es sich dabei um ein zusätzliches Angebot von<br />
Eiweißfuttermitteln aus der Überschussverwertung handelt.<br />
• Biodiesel<br />
Als Rohstoff für die Herstellung von Biodiesel wird in Österreich v.a. Raps herangezogen. Als Nebenprodukt der<br />
Biodieselproduktion fallen Presskuchen oder Extraktionsschrote an. Es ist damit zu rechnen, dass in den nächsten<br />
Jahren der Bedarf an Raps für die Biotreibstoffproduktion stark ansteigen wird – von 1991 bis 2002 ist die Biodiesel-<br />
Produktion in Österreich um durchschnittlich ca. 1870 t/Jahr gestiegen (basierend auf den Daten von KRAMMER UND<br />
PRANKL, 2003). Die derzeitige Produktionskapazität von Biodiesel in Österreich beträgt etwas mehr als 110.000 t pro<br />
Jahr (SALCHENEGGER, 2004). In Enns ist derzeit eine Anlage in Bau, die etwa 100.000 t Biodiesel aus Rapsöl pro Jahr<br />
erzeugen wird <strong>und</strong> bis Sommer 2006 in Betrieb gehen soll. Für die beschlossene Produktion sind […] pro Jahr 80.000<br />
bis 100.000 ha Rapsanbaufläche notwendig […], weshalb Rapsimporte notwendig sein werden (OOE BAUERNBUND,<br />
2005). Das österreichische Produktionsniveau im Jahr 2004 lag bei ca. 35.000 ha Anbaufläche (vergleiche Kapitel<br />
3.1.2). Im Vergleich dazu fand die seit 1990 maximale in Österreich angebaute Rapsfläche ihren Höchstwert im Jahre<br />
1995 mit 89.400 ha (BMLF, 1996). Eine Ausdehnung der österreichischen Rapsflächen ist pflanzenbaulich durchaus<br />
möglich.<br />
• Bioethanol<br />
Potentielle Rohstoffe für die Bioethanolproduktion in Österreich sind:<br />
- Zuckerhaltige Rohstoffe: v.a. Zuckerrübe<br />
- Stärkehaltige Rohstoffe: v.a. Weizen, Roggen, Triticale, Mais <strong>und</strong> Kartoffeln<br />
- Zellulosehaltige Rohstoffe: Verschiedene Gräser (Miscanthus, Rutenhirse, Rohrglanzgras, etc…)<br />
Die Ethanolgewinnung aus zellulosehaltigen Rohstoffen bedarf technischer Weiterentwicklungen <strong>und</strong><br />
Verbesserungen. Als Nebenprodukt der Bioethanolproduktion fällt die eiweißreiche Schlempe an, die entweder in<br />
Biogasanlagen vergoren wird oder nass bzw. getrocknet (Distillers Dried Grain with Solubles, kurz „DDGS“) verfüttert<br />
wird. In Österreich wird eine Bioethanolanlage mit einer Jahreskapazität von 200.000 m³ errichtet. Der erzeugte<br />
Bioethanol soll den österreichischen Bedarf decken. Als Nebenprodukt fallen 170.000 t Eiweißfuttermittel an (vgl.<br />
BAUERNZEITUNG vom 19.05.2005).<br />
SALCHENEGGERs (2004) Prognose der benötigten Biokraftstoffmengen unter Annahme einer Zielerreichung nur über<br />
Biodiesel <strong>und</strong> Bioethanol geht von folgenden Zahlen aus:<br />
Tabelle 3-22: Prognose der benötigten Biokraftstoffmengen auf Basis einer Umsetzung der Ziele entsprechend der<br />
Kraftstoffverordnung<br />
Jahr<br />
Angestrebte<br />
Prozentsätze<br />
Biodiesel [t] Bioethanol [t]<br />
2005 2,5% 220.900 -<br />
2007 4,3% 317.500 120.200<br />
2008<br />
Quelle: SALCHENEGGER 2004<br />
5,75% 481.900 150.000<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 32 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 3: Verfügbarkeit von GVO – Anbau <strong>und</strong> Marktsituation<br />
Rein theoretisch ergibt sich daraus folgender, durchschnittlicher Anfall von Nebenprodukten (bei Erreichung der<br />
4,3%- bzw. 5,75%-Ziele), die für die Futtermittelindustrie Verwendung finden könnten:<br />
Tabelle 3-23: Prognose des Anfalls von Nebenprodukten der Biodiesel- <strong>und</strong> Bioethanolproduktion auf Basis einer<br />
Umsetzung der Ziele entsprechend der Kraftstoffverordnung<br />
Jahr<br />
Rapspresskuchenanfall aus<br />
Biodieselproduktion<br />
[t]<br />
DDGS-Anfall aus<br />
Bioethanolproduktion<br />
[t]<br />
2007 524.000 ca. 150.000<br />
2008 795.000 ca. 190.000<br />
Quelle: Berechnungen durch <strong>AGES</strong>.<br />
Basis: Ethanoldichte: 0,794 kg/l. Ausbeute: 1l Bioethanol ergibt ca. 1kg Distillers Dried Grain with Solubles aus Weizen/Triticale<br />
1t Biodiesel ergibt ca. 1,65 t Raps-Presskuchen (TAUPP, unveröffentlicht).<br />
Die erste österreichische Bioethanolanlage, die Mitte 2007 ihren Betrieb aufnehmen soll, soll jährlich ca. 170.000 t<br />
Eiweißfuttermittel aus Mais, Weizen <strong>und</strong> Zuckerrübe liefern. Damit soll der österreichische Bedarf an Ethanol bei<br />
einer Zumischungsrate von 5.75% in etwa gedeckt werden. Für Mitte 2006 ist eine Produktion von ca. 210.000 t<br />
Biodiesel zu erwarten, die in etwa 340.000 t Eiweißfuttermittel aus Raps als Koppelprodukt liefern wird.<br />
Es ist zu beachten, dass entgegen der vereinfachenden Annahme auch andere Biokraftstoffe/erneuerbare Kraftstoffe<br />
zum Zuge kommen könnten, wie z.B. Biomethan. Aus welchen Kulturarten die Nebenprodukte der<br />
Biotreibstofferzeugung stammen werden, <strong>und</strong> wie die Verfügbarkeitsproblematik bei den Flächen gelöst wird, kann<br />
noch nicht vorausgesagt werden. Festzuhalten ist, dass die Ethanolerträge bei der Verwertung von Zuckerrüben<br />
deutlich höher sind als bei der Verwertung von Mais oder Weizen. Derzeit bestehen Überschüsse in den<br />
österreichischen Versorgungsbilanzen nur für Getreide (Weizen).<br />
Sollten in Zukunft die Ziele der Kraftstoffverordnung zum Teil durch österreichische Eigenproduktion erreicht werden,<br />
so ergeben sich durch die hohen Mengen an Koppelprodukten der Biokraftstofferzeugung beachtliche Potenziale <strong>zur</strong><br />
Deckung des Eiweißbedarfes durch einheimische Substitute.<br />
3.1.2.4. Perspektive für die Substitution von Sojabohnen in der Fütterung in Österreich<br />
Die Tabelle 3-24 gibt einen Überblick über die derzeit (Stand 2004) aus österreichischer landwirtschaftlicher<br />
Erzeugung eingesetzte pflanzliche Rohstoffe bzw. Futtermittelausgangserzeugnisse. Die derzeit nach Österreich<br />
importierte Menge von ca. 600.000 t SES (Statistik Austria, 2005) entspricht einer Rohproteinmenge (46%<br />
Rohproteingehalt) von ca. 276.000 t. Aktuell verfüttert werden ca. 110.000 t Rohprotein aus Substituten, ca. 40%<br />
der Sojaproteinimporte. Damit ergibt sich ein Gesamtbedarf an Rohprotein (exkl. des anteiligen Getreideproteins) von<br />
386.000 t.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 33 von 272
Tabelle 3-24: Aufkommen von Rohprotein in Österreich (2004)<br />
Futtermittel/<br />
Futtermittelausgangserzeugnisse<br />
(Substitute)<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 3: Verfügbarkeit von GVO – Anbau <strong>und</strong> Marktsituation<br />
Ø-Rohproteingehalt<br />
[%]<br />
Substitutmenge<br />
2004<br />
[t]<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Rohproteinmenge<br />
2004<br />
[t]<br />
Ackerbohnen 25 8.000 2.000<br />
Körnererbsen 20 120.000 24.000<br />
Süßlupine 34 600 204<br />
Rapsschrot bzw. –kuchen 32-35 100.000 32.000-35.000<br />
Sonnenblumen 36 75.000 27.000<br />
Sojabohnen (ganz oder erhitzt) 35-40 26.000 9.100-10.400<br />
Kartoffeleiweiß 84 3.000 2.520<br />
Kürbiskernkuchen 59 4.000-6.000 2.360-3.540<br />
Maiskleber 60 11.000 6.600<br />
Maikleberfutter 18 50.000 9.000<br />
Trockenschlempe 31 3.250-6.500 1.007-2.015<br />
Summe - - 115.791-122.279<br />
Quelle: Schätzungen anhand von Daten aus STATISTIK AUSTRIA 2003 <strong>und</strong> 2004, EUROSTAT 2004 <strong>und</strong> persönliche<br />
Mitteilungen der Ölmühle Bruck (Bunge)/Leitha, des Statistisches Zentralamtes, der Agrana, der LK Steiermark <strong>und</strong><br />
der Brennerei Starrein.<br />
Es ist nicht zu erwarten, dass der Anbau von Körnerleguminosen die nächsten Jahre bedeutend zunehmen wird.<br />
Sollte in Zukunft das höchste Anbau-Niveau der letzten Jahre seit 1990 erreicht werden, so ergeben sich im Vergleich<br />
zu 2004 auch nur ca. 19.000 t zusätzlich verfügbares Rohprotein. Diese Menge entspricht nur knapp 7% des<br />
importierten Sojaproteins.<br />
Es ergibt sich nunmehr die Frage, welcher Anteil des importierten Sojaproteins durch Substitute aus<br />
landwirtschaftlicher Erzeugung in Österreich ersetzt werden kann.<br />
Durch den Ausbau der Biodiesel- <strong>und</strong> Bioethanolproduktion wären kurzfristig (ab 2008) zusätzliche 163.000 t<br />
Rohprotein laut derzeitiger Anlagenplanung verfügbar. Die heimische Eiweißlücke würde sich somit mengenmäßig<br />
deutlich verringern, jedoch sind je nach Tierart Einsatzgrenzen zu berücksichtigen (s. Kapitel 4.2.2., Tabelle 4-16).<br />
Raps, Mais, Getreide, <strong>und</strong> Zuckerrübe werden die Hauptkulturen <strong>und</strong> Endprodukte sein, welche für die<br />
Biospriterzeugung eingesetzt werden. Das Risiko einer GVO-Verunreinigung der Eiweiß-Nebenprodukte aus<br />
europäischer Erzeugung liegt aktuell beim Einsatz von Mais am höchsten, da schon GV-Sorten zum Anbau auf dem<br />
europäischen Markt sind. Raps ist Selbstbefruchter mit einer hohen Fremdbefruchtungsrate <strong>und</strong> zählt zu den<br />
Kulturarten, für die in der aktuellen Struktur der österreichischen Landwirtschaft die Einrichtung von geschlossenen<br />
Anbaugebieten <strong>und</strong> Regionen sowie die Umsetzung geschlossener Produktionsprozesse zum Schutz vor GVO-<br />
Verunreinigungen unerlässlich ist. Die Vermeidung einer Verunreinigung mit GVO ist bei den selbstbefruchtenden<br />
Getreidearten (Weizen, Gerste, Hafer) <strong>und</strong> bei der Sojabohne durchaus beherrschbar. Eine absehbare Zulassung von<br />
GV-Rapsorten würde das Potenzial zum Schließen der heimischen Eiweißlücke, besonders durch die<br />
Biodieselproduktion sehr in Frage stellen. Da der Großteil des Rapses, der in der Biodieselproduktion Verwendung<br />
findet, importiert werden muss, ist jedoch qualitätsmäßig eine „GVO-Freiheit“ nicht gesichert (siehe Kapitel 3.2).<br />
Ackerbohnen, Körnererbsen <strong>und</strong> Lupinen können dagegen auch in Zukunft mit hoher Wahrscheinlichkeit als „GVO-<br />
frei“ angesehen werden.<br />
Seite 34 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 3: Verfügbarkeit von GVO – Anbau <strong>und</strong> Marktsituation<br />
3.2. Aktueller Stand <strong>und</strong> Perspektiven der GVO-Anwendung in der Landwirtschaft<br />
Der Stand der erteilten Zulassungen von GVO <strong>und</strong> der Anträge im Zulassungsverfahren gemäß Gentechnikrecht der<br />
EU – v.a. bestimmt durch die Richtlinie des Rates 2001/18/EG über die absichtliche Freisetzung von genetisch<br />
veränderten Organismen in die Umwelt (ersetzt die Richtlinie des Rates 90/220/EG) sowie die Verordnung EG<br />
1829/2003 <strong>und</strong> deren Umsetzung in den Mitgliedstaaten dient der Abschätzung des Ist-Zustandes. Weiters wird eine<br />
Abschätzung vorgenommen, bei welchen Kulturarten in Zukunft der Anbau von GVO wahrscheinlich sein wird. Damit<br />
wird die strategische Auswahl von Substituten für Sojaimporte maßgeblich bestimmt werden.<br />
Die aktuelle Verbreitung von GVO wird im folgenden Kapitel 3.2.2 dargestellt. Wenn möglich, wurde der Stand der<br />
Verbreitung von GVO im Jahr 2004 erhoben. Fehlende Zahlenangaben bedeuten jedoch nicht, dass der Anbau von<br />
GV-Pflanzen eingestellt wurde.<br />
3.2.1. Der Stand der Anträge auf Freisetzungen von GVO <strong>und</strong> GV-Sorten gemäß Sortenzulassungsverfahren<br />
3.2.1.1. Freisetzung von GVO<br />
Freisetzung bedeutet eine Ausbringung eines gentechnisch veränderten Organismus in die Umwelt. Eine Freisetzung<br />
liegt dann vor, wenn ein GVO absichtlich <strong>und</strong> zwar außerhalb eines geschlossenen Systems - wie Gewächshaus,<br />
Laboratorium oder einer Produktionsanlage - in die Umwelt ausgebracht wird (BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND<br />
FORSCHUNG - DEUTSCHLAND 2005).<br />
In der folgenden Tabelle sind Freisetzungsanträge gelistet, die in Ländern in Europa bis Dezember 2004 gestellt<br />
wurden. Über den Status der Anträge gibt die Tabelle keine Information.<br />
Tabelle 3-25: Freisetzungsanträge der<br />
Länder Europas bis Dezember 2004<br />
Mitgliedsstaat Anzahl Anträge<br />
Frankreich 551<br />
Italien 292<br />
Spanien 274<br />
Großbritannien 235<br />
Deutschland 146<br />
Niederlande 146<br />
Belgien 133<br />
Schweden 77<br />
Daenemark 40<br />
Finnland 26<br />
Griechenland 18<br />
Portugal 12<br />
Irland 5<br />
Österreich 3<br />
Island 1<br />
Norwegen 1<br />
Polen 1<br />
SUMME 1961<br />
Quelle: nach BUNDESMINISTERIUM FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ,<br />
ERNÄHRUNG UND LANDWIRTSCHAFT - DEUTSCHLAND 2005<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 35 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 3: Verfügbarkeit von GVO – Anbau <strong>und</strong> Marktsituation<br />
Tabelle 3-26: Anzahl der gestellten Freisetzungsanträge: Auswahl einiger Kulturen unterteilt in Eigenschaften<br />
wichtigste<br />
Kulturen total<br />
Herbizid-<br />
Resistenz<br />
Metabolismus-<br />
Veränderungen<br />
Insekten-<br />
Resistenz<br />
männliche<br />
Sterilität<br />
Virus-<br />
Resistenz<br />
Pilz-<br />
Resistenz<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Bakterien-<br />
Resistenz<br />
Nematoden-<br />
Resistenz<br />
Seite 36 von 272<br />
nur<br />
Markergene<br />
Mais 530 478 34 270 30 4 5 1 0 2<br />
Raps 365 289 65 3 120 0 31 1 0 4<br />
Zuckerrübe 286 261 15 0 2 56 4 1 0 0<br />
Kartoffel 233 18 145 21 1 28 27 15 6 5<br />
Weizen/Gerste 35 25 17 0 2 0 7 0 0 5<br />
Sojabohne 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Quelle: nach BUNDESMINISTERIUM FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ, ERNÄHRUNG UND LANDWIRTSCHAFT – DEUTSCHLAND 2005<br />
Laut der deutschen Biologischen B<strong>und</strong>esanstalt für Land- <strong>und</strong> Forstwirtschaft werden in der EU Freisetzungsanträge<br />
überwiegend bei der Kulturart Mais (530) gestellt. Für Raps wurden 365, für Zuckerrübe 286 <strong>und</strong> für Kartoffel 233<br />
der gesamten Freisetzungsanträge gestellt (siehe Tabelle 3-26). Die Anzahl der Sojabohnenfreisetzungsanträge liegt<br />
bei nur 17, <strong>zur</strong>ückzuführen auf die Tatsache, dass die Sojabohne in Europa nicht zu den Hauptanbaukulturen zählt.<br />
Bis zum Dezember 2004 wurden 1.961 Anträge auf Freisetzungen in der EU gestellt.<br />
Abbildung 3-6 zeigt die Verteilung auf gewünschte Eigenschaften. Die meisten Freisetzungsanträge wiesen das<br />
Merkmal Herbizid-Resistenz auf, in erster Linie wiederum bei den Kulturen Mais, Raps <strong>und</strong> der Zuckerrübe. Für<br />
Erbsen wurden bis Dezember 2004 drei Anträge auf Freisetzungen gestellt, zwei davon in Deutschland <strong>und</strong> einer in<br />
Großbritannien.<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
nur Markergene<br />
4<br />
Nematoden-Resistenz<br />
Eigenschaften der Freisetzungsanträge in %<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 3: Verfügbarkeit von GVO – Anbau <strong>und</strong> Marktsituation<br />
EU-Umweltminister in allen 3 Fällen gegen eine von der Europäischen Kommission geforderte Aufhebung der<br />
Importverbote (vgl. ÖSTERREICHISCHE BAUERNZEITUNG, 30. Juni 2005).<br />
Bisher wurden keine Anträge (Stand Juli 2005) bis zum Verfahrensschritt der Inverkehrbringung von GV-Produkten<br />
weder für die Verarbeitung noch für den Anbau bei Getreidearten (außer Mais) <strong>und</strong> großsamigen Leguminosen<br />
durchgesetzt.<br />
Zusätzlichen zu den Verfahren für die Zulassung <strong>zur</strong> Inverkehrbringung, insbesondere für den Anbau nach dem EU-<br />
Gentechnikrecht, müssen die Sorten der wichtigsten Kulturpflanzenarten in Europa ein Zulassungsverfahren nach<br />
dem Saatgutrecht durchlaufen. Nur Saatgut von Pflanzenarten, welche in einer der beiden „Gemeinsamen<br />
Sortenkataloge“ für landwirtschaftliche Pflanzenarten EU-Rats-Richtlinie 2002/53/EG <strong>und</strong> Gemüsearten 2002/55/EG<br />
eingetragen sind, dürfen in den EU-Mitgliedstaaten in Verkehr gebracht werden. Eine im EU-Recht definierte<br />
Ausnahme gibt es für Versuchssaatgut von im Sortenzulassungsprozess stehenden Pflanzensorten.<br />
3.2.1.2. Aktueller Stand von Sortenzulassungen (gemäß Saatgutrecht in der EU) von gentechnisch veränderten<br />
Pflanzensorten <strong>und</strong> im Sortenzulassungsverfahren stehenden gentechnisch veränderten Sorten<br />
Österreichischer Sortenkatalog:<br />
Das System der Zulassung von Pflanzensorten der wichtigsten Kulturpflanzenarten ist in Österreich im Saatgutgesetz<br />
1997, 4.Teil „Sortenordnung“ geregelt. Dieser Teil dient der Umsetzung der Richtlinie 2002/53/EG des Rates vom 13.<br />
Juni 2002 für einen gemeinsamen Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflanzenarten sowie analog der Richtlinie<br />
2002/55/EG über einen gemeinsame Sortenkatalog für Gemüsearten. In Österreich ist das B<strong>und</strong>esamt für<br />
Ernährungssicherheit (BAES) für die Sortenzulassung zuständig. Die Dauer des Zulassungsverfahrens umfasst eine 2<br />
bis 3 jährige Wert- <strong>und</strong> Registerprüfung. Bei positiver Bewertung wird die Sorte in die österreichische Sortenliste <strong>und</strong><br />
den bezughabenden EU-Sortenkatalog eingetragen. Das Saatgut dieser Sorte darf laut §2 des Saatgutgesetzes 1997<br />
somit erzeugt, anerkannt <strong>und</strong> in Österreich <strong>und</strong> der gesamten EU nach Notifizierung <strong>und</strong> Eintragung im<br />
gemeinsamen Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflanzenarten in Verkehr gebracht werden.<br />
In Österreich sind derzeit keine gentechnisch veränderten Sorten zugelassen, <strong>und</strong> es gibt auch keine Anträge auf<br />
Zulassung für GV-Pflanzensorten.<br />
An dieser Stelle soll nochmals auf die inzwischen auf EU-Ebene akzeptierten österreichischen Verbotsverordnungen,<br />
die Konstrukte MON810, T25 <strong>und</strong> Bt176 betreffend (siehe Kapitel 2.1.1.3), hingewiesen werden.<br />
Der gemeinsame Sortenkatalog der Europäischen Union:<br />
Der gemeinsame Sortenkatalog der EU wird auf der Gr<strong>und</strong>lage der nationalen Kataloge der Mitgliedstaaten der<br />
Europäischen Union erstellt. Die Eintragung in den gemeinsamen Sortenkatalog erfolgt nach Notifikation (=Meldung)<br />
der Sorten <strong>und</strong> Publikation im Amtsblatt der EG.<br />
Saat- <strong>und</strong> Pflanzgut jeder in diesem Katalog gelisteten Sorte darf in der Europäischen Union frei gehandelt werden,<br />
außer es wird von den Schutzklauseln gemäß RL 2001/18/EG oder RL 2002/53/EG Gebrauch gemacht.<br />
Mit Stand Juni 2005 werden seit 08.09.2004 17 Maissorten mit dem Konstrukt MON810 (Insektenresistenz) im<br />
gemeinsamen Sortenkatalog der EU für landwirtschaftliche Pflanzenarten geführt. Dabei handelt es sich um sechs<br />
französische <strong>und</strong> elf spanische Maissorten. Somit sind diese für den Verkauf <strong>und</strong> Anbau zugelassen. In Österreich<br />
gelten die Verbotsverordnungen (siehe Kapitel 2.1.1.3).<br />
Mit Stand September 2005 werden seit 28.07.2005 14, bereits in nationalen Sortenkatalogen gelisteten, GV-<br />
Maissorten mit dem Konstrukt MON810 zum gemeinsamen Sortenkatalog der EU für landwirtschaftliche Pflanzenarten<br />
notifiziert. Saatgut dieser Sorten ist in der EU erst mit dem Tag der Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen<br />
Union <strong>zur</strong> Inverkehrbringung zulässig. Nach der RL 2002/53/EG des Rates vom 13. Juni 2002 müssen GV-Sorten im<br />
Sortenkatalog klar <strong>und</strong> eindeutig als solche gekennzeichnet werden.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 37 von 272
Neuregelung bezüglich Versuchssaatgut<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 3: Verfügbarkeit von GVO – Anbau <strong>und</strong> Marktsituation<br />
Im Dezember 2004 trat eine Neuregelung bezüglich Versuchssaatgut von noch nicht in einem der Sortenkataloge<br />
gelisteten Sorten gemäß der Entscheidung der Kommission 2004/842/EG vom 1. Dezember 2004 in Kraft. Inhalt<br />
dieser Neuregelung sind Durchführungsbestimmungen, nach denen die Mitgliedstaaten das Inverkehrbringen von<br />
Saatgut von noch nicht in einem der Sortenkataloge gelisteten Sorten genehmigen können, wenn die Aufnahme in<br />
einen der einzelstaatlichen Sortenkataloge für landwirtschaftliche Pflanzenarten oder Gemüsearten beantragt wurde.<br />
Dies bedeutet, dass das BAES oder eine in einem EU Mitgliedstaat zuständige Behörde Saatgut einer Sorte als<br />
Versuchssaatgut für die beantragten EU Staaten in einer bestimmten Menge (abhängig von der Kulturart <strong>und</strong><br />
Gesamtanbaufläche der betreffenden Kulturart im jeweiligen Mitgliedstaat) genehmigen kann. Zusätzlich herrscht<br />
Informationspflicht der zuständigen Behörden sowie die Möglichkeit einer Untersagung durch einen der betroffenen<br />
Mitgliedstaaten. Diese Regelung gilt auch für Sorten/Prüfstämme, welche gentechnisch verändert wurden. Der<br />
aktuelle Stand der Genehmigungen in der EU betreffend Saatgut von GV-Sorten ist auf der Homepage der<br />
Österreichischen Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit (<strong>AGES</strong>) unter www.ages.at zu finden.<br />
Für 6 GV-Prüfstämme bzw. GV-Sorten liegt eine Genehmigung <strong>zur</strong> Inverkehrbringung als Versuchssaatgut in<br />
Deutschland vor. Für 5 weitere GV-Prüfstämme bzw. GV-Sorten liegen Anträge für eine Genehmigung für eine<br />
Inverkehrbringung in Spanien <strong>und</strong> für einen weiteren GV-Prüfstamm bzw. eine GV-Sorte liegt ein Antrag für Spanien<br />
<strong>und</strong> Frankreich vor. Davon betroffen sind bis jetzt Maissorten, die das Konstrukt MON 810 enthalten. Für Saatgut,<br />
welches in Österreich in Verkehr gebracht wird, gelten die Saatgut-Gentechnikverordnung sowie alle GVO-relevanten<br />
österreichischen Bestimmungen (Verbotsverordnungen, siehe oben <strong>und</strong> Kapitel 2.1.1.3). Ist der GVO Status nicht<br />
eindeutig geklärt, ist eine Inverkehrbringung in der EU <strong>und</strong> im Besonderen in Österreich folglich unzulässig.<br />
Im Zuge der umfassenden Monitorings- <strong>und</strong> Überwachungsmaßnahmen betreffend der potentiellen<br />
Inverkehrbringung von GV-Saatgut <strong>und</strong> GVO-verunreinigtem Saatgut in Österreich (siehe dazu auch<br />
Monitoringberichte unter www.ages.at) wurde in den vergangenen Jahren kein Saatgut von GV-Sorten <strong>und</strong> keine<br />
Überschreitungen des zulässigen Toleranzwertes von 0,1% GVO-Verunreinigung im Saatgut in Österreich festgestellt.<br />
3.2.2. Die Verbreitung von GVO in der landwirtschaftlichen Produktion <strong>und</strong> deren Bedeutung für eine<br />
potentielle Verfügbarkeit von „GVO-freien“ oder „gentechnikfreien“ Produkten<br />
2004 wurden 5% der Weltanbauflächen mit transgenen Sorten bepflanzt (JAMES, 2004). Dabei handelt es sich<br />
hauptsächlich um Sojabohne, Mais, Baumwolle <strong>und</strong> Raps. Im Folgenden wird die aktuelle Anbausituation von GV-<br />
Kulturen vorgestellt, die in der Futter- <strong>und</strong> Lebensmittelerzeugung von Bedeutung sind. Dabei wird nur der<br />
kommerzielle Anbau erhoben, <strong>und</strong> der Anbau für Freisetzungsversuchszwecke außer Acht gelassen. Kulturspezifisch<br />
wurden jene Länder dargestellt, in denen bereits GVO-Anbau erfolgt. Eine Differenzierung der Anbauflächen bzw.<br />
Produktionsmengen der übrigen Länder ohne GVO-Anbau wurde nicht abgebildet. Aus diesen Ländern sind vorläufig<br />
keine GV-Erzeugnisse oder auch Handelsströme nach Österreich zu erwarten, deshalb wurden die Anbauflächen bzw.<br />
die Produktionsmengen in einer Summe mit der Bezeichnung „Rest der Welt“ zusammengefasst. Auf die Erfüllung der<br />
Anforderungen betreffend „Gentechnikfreiheit“ wird nur insofern eingegangen als diese auch explizit bestätigt<br />
werden kann.<br />
• Sojabohne (Glycine max)<br />
Die Sojabohne ist mit einer Anbaufläche von 83,46 Mio. ha im Jahr 2003 <strong>und</strong> mit ca. 91,6 Mio. ha im Anbaujahr<br />
2004 weltweit eine der wirtschaftlich bedeutendsten Kulturpflanzen (vergleiche Tabelle 3-27 <strong>und</strong> Tabelle 3-28). Sie<br />
wird aufgr<strong>und</strong> ihres hohen Gehaltes an hochwertigen Ölen <strong>und</strong> Proteinen sowohl in der Lebensmittel- als auch<br />
Futtermittelindustrie sowie im technischen Bereich vielseitig genutzt. Produkte aus Sojabohne sind schätzungsweise<br />
in 30.000 Lebensmitteln enthalten. Sojaextraktionsschrot, SES, ist der wichtigste Eiweißlieferant in der Tierfütterung<br />
(AMERICAN SOYBEAN ASSOCIATION et al., 2001).<br />
Die ersten transgenen Sojabohnensorten, die in größerem Maße für die Inverkehrbringung bestimmt waren, sind<br />
1996 in den USA <strong>und</strong> Argentinien angebaut worden. Damals betrug der Flächenanteil GVO <strong>zur</strong> Gesamtanbaufläche<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 38 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 3: Verfügbarkeit von GVO – Anbau <strong>und</strong> Marktsituation<br />
Sojabohne lediglich 1,6% resp. 0,8% (EC DG AGRI, 2000). Seitdem sind diese Flächenanteile kontinuierlich<br />
gestiegen. Die Tabelle 3-27 stellt die Datenlage des Jahres 2003 dar.<br />
Tabelle 3-27: Die Verbreitung von GV-Sojabohne im Jahr 2003<br />
Anbauland<br />
Anbaufläche<br />
Sojabohne [1.000<br />
ha]<br />
Anbaufläche<br />
GV-Sojabohne<br />
[1.000 ha]<br />
Flächenanteil<br />
GV-Sojabohne<br />
[%]<br />
Produktion<br />
Sojabohne [t]<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Produktion<br />
GV - Sojabohne<br />
[t]<br />
Anteil an der<br />
weltweiten<br />
Produktion von<br />
GV-Sojabohne<br />
[%]<br />
Brasilien 18.469,40 3.000,00 16 51.482.300,00 8.362.312,80 8,58<br />
Mexiko 63,79 15,00 24 75.686,00 17.796,75 0,02<br />
Südafrika 49,10 15,00 31 148.000,00 45.213,85 0,05<br />
Kanada 1.046,60 580,00 55 2.262.900,00 1.254.043,57 1,29<br />
Rumänien 122,22 70,00 57 224.908,00 128.809,07 0,13<br />
Uruguay 78,90 60,00 76 183.000,00 139.163,50 0,14<br />
USA 29.267,60 24.300,00 83 66.777.820,00 55.443.597,22 56,85<br />
Argentinien 13.800,00 12.740,00 92 34.800.000,00 32.126.956,52 32,94<br />
EU-15 251,42 0,00 0 618.195,00 0,00 0,00<br />
EU-25 300,29 0,00 0 692.423,00 0,00 0,00<br />
Rest 20.263,00 -N- -N- 32.566.346,00 -N- -N-<br />
Welt 83.460,90 41.400,00 50 189.213.383,00 97.517.893,27 100<br />
Quelle: FAOSTAT 2004, TRANSGEN WISSENSCHAFTSKOMMUNIKATION, JAMES 2003, Berechnungen durch <strong>AGES</strong>.<br />
Tabelle 3-27 zeigt, dass, ausgenommen in Brasilien, GV- Sojabohne in den Hauptanbauländern die 50%-Marke z.T.<br />
deutlich überschritten hat.<br />
Die weltweite Sojabohnenanbaufläche <strong>und</strong> auch jene für GV-Sojabohnen ähnelt für 2004 jener von 2003. Eine<br />
Steigerung des GVO-Anbaus in Brasilien, dem zweitgrößten Sojabohnenerzeugerland weltweit, ist feststellbar. Die<br />
Entwicklungen gerade in diesem für die Kontraktierung <strong>und</strong> Zertifizierung von „GVO-freien“ Sojabohnen so wichtigem<br />
Land werden entscheidend für die weitere Verfügbarkeit von „GVO-freien“ Sojabohnenprodukten in Europa sein.<br />
Wenngleich die theoretisch verfügbaren „GVO-freien“ Sojabohnenmengen in den USA, Paraguay, Kanada, ja selbst<br />
Argentinien im Vergleich zum Bedarf an SES für die Fütterung in Österreich vielfach gegeben scheinen, wird das<br />
Angebot an „GVO-freien“ Sojabohnenprodukten (auch z.B. von Sojalezithin) letztlich durch die Nachfrage am Markt<br />
bestimmt werden. Der Bedarf <strong>und</strong> Einsatz von Produkten aus „GVO-freier“ Sojabohne in der Lebensmittelindustrie,<br />
insbesondere Lecithin, bestimmt inzwischen maßgeblich die Produktionsprozesse, so dass Gesamtanbieter an GVO-<br />
freien Produkten (Sojamühlen in den Erzeugerländern, v.a. in Brasilien) ein zertifiziertes Produktpaket aus „GVO-<br />
freier“ Sojabohnenproduktion am Markt anbieten. Damit wird auch das Angebot <strong>und</strong> die Verfügbarkeit sowie der<br />
Reinheitsgrad von SES mitbestimmt.<br />
Seite 39 von 272
Argentinien<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 3: Verfügbarkeit von GVO – Anbau <strong>und</strong> Marktsituation<br />
Sojabohnen-Anbau: Flächenanteil GVO im Jahr 2003<br />
USA<br />
Uruguay<br />
Rumänien<br />
Kanada<br />
Südafrika<br />
Mexiko<br />
Brasilien<br />
0 20 40 60 80 100<br />
Quelle: JAMES 2003 <strong>und</strong> TRANSGEN WISSENSCHAFTSKOMMUNIKATION, Darstellung durch <strong>AGES</strong><br />
Abbildung 3-7: Die Flächenanteile von GV-Sojabohne im Jahr 2003<br />
Abbildung 3-8 geht klar hervor, dass die USA <strong>und</strong> Argentinien hinsichtlich der Produktion von gentechnisch<br />
veränderter Sojabohne eine dominierende Stellung einnehmen. Im Jahr 2003 machten sie 99% der weltweiten GV-<br />
Sojabohnen-Produktion aus.<br />
Anteil GVO-Fläche an der Gesamt-Sojabohnen-Fläche des Landes [%]<br />
Aufteilung der weltweiten Produktion von gentechnisch<br />
veränderten Sojabohnen im Jahr 2003<br />
Rest<br />
< 0,5%<br />
USA<br />
57%<br />
Kanada<br />
< 1,5% Brasilien<br />
9%<br />
Argentinien<br />
33%<br />
Quelle: FAOSTAT 2004, TRANSGEN WISSENSCHAFTSKOMMUNIKATION, JAMES 2003, Berechnungen durch <strong>AGES</strong>, Darstellung durch <strong>AGES</strong>.<br />
Abbildung 3-8: Aufteilung der weltweiten Produktion von gentechnisch veränderten Sojabohnen im Jahr 2003<br />
Die Datenlage für das Jahr 2004 ist noch unvollständig, wird aber nachstehend, soweit verfügbar, dargestellt.<br />
Jedenfalls ist ein weiterer Anstieg des GVO-Anteils im Sojabohnenanbau ersichtlich (siehe Tabelle 3-28 <strong>und</strong> Abbildung<br />
3-9). Während sich der Anteil von GV-Sojabohne an der Gesamtanbaufläche von Sojabohne in den USA gegenüber<br />
2003 nur geringfügig veränderte, stieg dieser in Argentinien, Brasilien, Paraguay <strong>und</strong> Rumänien mehr oder weniger<br />
deutlich an. Die Vereinigten Staaten, die Sojabohnen-Hauptproduzenten weltweit, bauten auf 85% der Sojabohnen-<br />
Gesamtanbaufläche GV-Sojabohnen an. In Argentinien, dem drittgrößten Sojabohnenproduzenten, wurden 2004<br />
98% der gesamten Sojabohnenanbaufläche mit GV-Sojabohne bebaut. Brasilien, wo der Anbau von GV-Sojabohne<br />
offiziell erst seit der Anbausaison 2003/2004 genehmigt ist, dehnte seine GV-Sojabohnenanbaufläche um 2/3, also<br />
auf 5 Mio. ha aus. In Paraguay machten 2004 bereits 60% der Gesamtanbaufläche für Sojabohne GV-Sojabohne aus.<br />
In der EG werden de Facto keine GV- Sojabohnen erzeugt. Der Anbau von GV-Sojabohnen in Europa beschränkte<br />
sich 2004 auf Rumänien mit einer Fläche von ca. 100.000 ha. Weltweit stieg der Anbau von GV-Sojabohne von 2003<br />
auf 2004 um 17% auf ca. 53% der weltweiten Gesamt-Sojabohnenanbaufläche an.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 40 von 272
Tabelle 3-28: Die Verbreitung von GV-Sojabohne im Jahr 2004<br />
Anbauland<br />
Anbaufläche<br />
Sojabohne<br />
[1.000 ha]<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 3: Verfügbarkeit von GVO – Anbau <strong>und</strong> Marktsituation<br />
Anbaufläche<br />
GV-Sojabohne<br />
[1.000 ha]<br />
Flächenanteil<br />
GV-<br />
Sojabohne<br />
[%]<br />
Produktion<br />
Sojabohne<br />
[t]<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Produktion<br />
GV - Sojabohne [t]<br />
Brasilien 23.000,00 5.000,00 22 49.205.268,00 10.825.158,96<br />
Mexiko 63,79 - N - - N - 75.686,00 - N -<br />
Südafrika 140,00 70,00 50 207.585,00 103.792,50<br />
Kanada 1.204,70 - N - - N - 2.919.600,00 - N -<br />
Rumänien 120,50 100,00 83 269.171,00 223.378,42<br />
Uruguay 240,00 - N - - N - 480.000,00 - N -<br />
USA 29.943,01 25.451,56 85 85.740.952,00 72.879.809,20<br />
Argentinien 14.750,00 14.500,00 98 32.000.000,00 31.360.000,00<br />
Paraguay 2.000,00 1.200,00 60 3.800.000,00 2.280.000,00<br />
EU-15 222,40 0,00 0 681.200,00 0,00<br />
EU-25 268,77 0,00 0 759.800,00 0,00<br />
Rest 19.880,07 - N - - N - 30.951.463,00 - N -<br />
Welt 91.610,83 48.400,00 53 206.409.525,00 - N -<br />
Quelle: FAOSTAT 2004, TRANSGEN WISSENSCHAFTSKOMMUNIKATION, JAMES 2004, USDA 2004, Berechnungen durch <strong>AGES</strong>.<br />
Argentinien<br />
Uruguay<br />
Kanada<br />
Mexiko<br />
Paraguay<br />
Sojabohnen-Anbau: Flächenanteil GVO im Jahr 2004<br />
0 20 40 60 80 100<br />
Anteil GVO-Fläche an der Gesamt-Sojabohnen-Fläche des Landes [%]<br />
Quelle: TRANSGEN WISSENSCHAFTSKOMMUNIKATION, JAMES 2004, USDA 2004, Berechnungen durch <strong>AGES</strong><br />
Abbildung 3-9: Die Flächenanteile von GV-Sojabohne im Jahr 2004<br />
Wie oben schon erwähnt, ist eine Steigerung des GVO-Anbaus in Brasilien, dem zweitgrößten Sojabohnen<br />
erzeugenden Land weltweit, feststellbar. Diese Entwicklungen, gerade in diesem für die Kontraktierung <strong>und</strong><br />
Zertifizierung von „GVO-freien“ Sojabohnen so wichtigem Land, werden entscheidend für die weitere Verfügbarkeit<br />
von „GVO-freien“ Sojabohnenprodukten in Europa sein. Wenngleich die theoretisch verfügbare „GVO-freie“<br />
Sojabohnenmenge in den USA, Paraguay, Kanada, ja selbst Argentinien, im Vergleich zum Bedarf an SES für die<br />
Fütterung in Österreich nach wie vor vielfach gegeben scheint, ergeben sich nicht zuletzt auch durch das<br />
Inkrafttreten der EG (VO) 1829/2003 in der EU <strong>und</strong> die Bedingungen zum Schwellenwertregime für Lebens- <strong>und</strong><br />
Futtermittel Produktspezifikationen (insbesondere ab April 2004 mit Inkrafttreten der EG-Rechtsnormen), sofern nicht<br />
als GVO gekennzeichnet wird. Wie oben dargestellt ergeben sich diesbezüglich bereits Auswirkungen auf das Angebot<br />
<strong>und</strong> die Produktionsprozesse für die Zertifizierung von „GVO-freien“ Sojaprodukten.<br />
Seite 41 von 272
• Mais (Zea mays)<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 3: Verfügbarkeit von GVO – Anbau <strong>und</strong> Marktsituation<br />
Mais wurde im Jahr 2003 auf ca. 143,4 Mio. ha <strong>und</strong> im Jahr 2004 auf ca. 145 Mio. ha weltweit angebaut <strong>und</strong><br />
übersteigt in den Produktionsmengen andere Getreidearten wie Weizen oder Reis (siehe Tabelle 3-29 <strong>und</strong> Tabelle<br />
3-30). In Nordamerika gehen etwa 80% <strong>und</strong> in Europa ca. 60% der Maisernte in die Futtermittelherstellung. Ein<br />
geringer Teil wird als Lebensmittel direkt verzehrt. Weltweit werden drei Viertel des für Lebensmittel produzierten<br />
Maises für die Stärkeerzeugung eingesetzt, in Europa ist es gut die Hälfte. Durch die Verarbeitungsprodukte Stärke<br />
oder die zahlreichen Stärkeverzuckerungsprodukte kommt Mais eine immense Bedeutung in der<br />
Lebensmittelverarbeitung zu (NOWACK HEIMGARTNER <strong>und</strong> OEHEN, 2003).<br />
Der erste Anbau von gentechnisch verändertem Mais fand 1996 mit 0,3 Mio. ha in den USA <strong>und</strong> 0,001 Mio. ha in<br />
Kanada statt. Der Flächenanteil GV-Mais <strong>zur</strong> Gesamtanbaufläche von Mais betrug in diesen Ländern damals 1% resp.<br />
0,1% (EC DG AGRI, 2000). Die Tabelle 3-29 <strong>und</strong> Abbildung 3-10 zeigen die Situation vom Jahr 2003.<br />
Tabelle 3-29: Die Verbreitung von GV-Mais im Jahr 2003<br />
Anbauland<br />
Anbaufläche<br />
Mais [1.000 ha]<br />
Anbaufläche<br />
GV-Mais<br />
[1.000 ha]<br />
Flächenanteil<br />
GV-Mais [%]<br />
Produktion<br />
Mais [t]<br />
Produktion<br />
GV - Mais [t]<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Anteil an der<br />
weltweiten<br />
Produktion<br />
von<br />
GV-Mais [%]<br />
EU-15 4.432,81 32,00 0,72 33.856.212,00 291.579,66 0,25<br />
EU-25 6.113,53 32,00 0,52 41.551.846,00 291.579,66 0,25<br />
Honduras 342,00 2,00 1 501.859,00 2.934,85 0,00<br />
Philippinen 2.485,00 23,00 1 4.478.173,00 41.447,88 0,04<br />
Spanien 472,00 32,00 7 4.300.800,00 291.579,66 0,25<br />
Südafrika 3.350,00 340,00 10 9.714.254,00 985.924,29 0,83<br />
USA 28.789,24 12.800,00 44 256.904.560,00 114.222.479,23 96,53<br />
Argentinien 2.322,86 1.100,00 47 472.700,00 223.849,34 0,19<br />
Kanada 1.226,10 620,00 51 4.478.173,00 2.264.470,48 1,91<br />
Rest 98.292,14 -N- -N- 317.662.075,00 -N- -N-<br />
Welt 143.392,87 15.500,00 11 640.064.440,00 118.324.265,39 100,00<br />
Quelle: FAOSTAT 2004, TRANSGEN WISSENSCHAFTSKOMMUNIKATION, JAMES 2003, Berechnungen durch <strong>AGES</strong><br />
Wie schon beim Anbau von Sojabohne sind es die Länder in Nord- <strong>und</strong> Südamerika, die überwiegend den GVO-<br />
Anbau bei Mais tragen. Anders als bei Sojabohne besteht beim Fremdbefruchter Mais ein erhöhtes Risiko eines<br />
biologisch bedingten Gentransfers zwischen GVO- <strong>und</strong> Nicht-GVO-Maisfeldern, sodass GVO-Verunreinigungen nicht<br />
nur durch mechanische Verunreinigung in den verschiedenen Produktionsprozessen entstehen. Es ergibt sich eine<br />
Akkumulierung des Gentransfers beginnend von der Pflanzenzüchtung über die Generationen der Saatgutproduktion<br />
bis hin zum Maiskonsumanbau.<br />
(siehe dazu auch „Die Produktion von Saatgut in abgegrenzten Erzeugungsprozessen <strong>zur</strong> Vermeidung einer<br />
Verunreinigung mit Gentechnisch Veränderten Organismen im Kontext mit der Koexistenz von konventioneller<br />
Landwirtschaft mit oder ohne GVO <strong>und</strong> ökologischer Landwirtschaft“, GIRSCH et al., 2004.)<br />
Seite 42 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 3: Verfügbarkeit von GVO – Anbau <strong>und</strong> Marktsituation<br />
Gerade Nebenprodukte aus der Bioethanolerzeugung, wie Maisexpeller aus den USA <strong>und</strong> den anderen Ländern mit<br />
exzessivem GVO-Anbau, weisen ein erhöhtes Risiko einer GVO-Verunreinigung auf <strong>und</strong> scheiden damit sehr<br />
wahrscheinlich als „GVO-freies“ oder „gentechnikfreies“ Eiweißsubsubstitut für SES aus.<br />
Kanada<br />
Argentinien<br />
USA<br />
Südafrika<br />
Spanien<br />
Philippinen<br />
Honduras<br />
EU-25<br />
EU-15<br />
Maisanbau: Flächenanteil GVO im Jahr 2003<br />
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00<br />
Anteil GVO-Fläche an der Gesamt-Mais-Fläche des Landes/der Region [%]<br />
Quelle: TRANSGEN WISSENSCHAFTSKOMMUNIKATION, JAMES 2003, Darstellung durch <strong>AGES</strong><br />
Abbildung 3-10: Die Flächenanteile von GV-Mais im Jahr 2003<br />
Die dominierende Stellung der USA als Hauptproduzent von GV-Mais weltweit kommt in Abbildung 3-11 deutlich zum<br />
Ausdruck. Wenngleich auch in den USA der GVO-Anteil an der Gesamtanbaufläche bei Mais (45% für 2004) deutlich<br />
hinter dem GVO-Anteil bei Sojabohne (85% für 2004) <strong>zur</strong>ückliegt.<br />
Aufteilung der weltweiten Produktion von<br />
gentechnisch verändertem Mais im Jahr 2003<br />
USA<br />
97%<br />
Quelle: FAOSTAT 2004, TRANSGEN WISSENSCHAFTSKOMMUNIKATION, JAMES 2003, Berechnungen<br />
durch <strong>AGES</strong>, Darstellung durch <strong>AGES</strong>.<br />
Abbildung 3-11: Aufteilung der weltweiten Produktion von genetisch verändertem Mais im Jahr 2003<br />
Inzwischen werden weltweit ca. 19 Mio. ha transgener Mais angebaut. Mit ca. 13 Mio. ha sind die USA, der größte<br />
Maisproduzent, auch hinsichtlich des GV-Mais-Anbaus an erster Stelle (siehe Tabelle 3-30). Festzuhalten ist, dass in<br />
Argentinien oder Kanada im Verhältnis <strong>zur</strong> jeweiligen Gesamtanbaufläche mehr GV-Mais angebaut wird als in den<br />
USA. Mais ist die einzige Kulturart, die in Europa außerhalb von Freisetzungsversuchen angebaut wird. In Spanien<br />
wurde 2004 auf 58.000 ha (entspricht 12% der Mais-Gesamtanbaufläche) GV-Mais angebaut. In Deutschland <strong>und</strong><br />
Frankreich sowie anderen EU-Mitgliedstaaten findet der Anbau von GV-Mais nur auf kleinen Flächen im Rahmen von<br />
Versuchs- <strong>und</strong> Erprobungsanbau statt.<br />
Rest<br />
< 1%<br />
Südafrika<br />
< 1%<br />
Canada<br />
2%<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 43 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 3: Verfügbarkeit von GVO – Anbau <strong>und</strong> Marktsituation<br />
Derzeit sind ausschließlich bei Mais GV-Pflanzensorten <strong>und</strong> damit Saatgut für den Anbau in der EU zugelassen. Es<br />
ergibt sich damit bei Mais auch aus der Erzeugung bestimmter Länder in Europa ein steigendes <strong>und</strong> potentielles<br />
Risiko einer GVO-Verunreinigung von Futtermais <strong>und</strong> Nebenprodukten aus der Bioethanolerzeugung.<br />
Tabelle 3-30: Die Verbreitung von GV-Mais im Jahr 2004<br />
Anbauland<br />
Kanada<br />
Argentinien<br />
USA<br />
Südafrika<br />
Spanien<br />
Philippinen<br />
Honduras<br />
EU-25<br />
EU-15<br />
Anbaufläche<br />
Mais [1.000 ha]<br />
Anbaufläche<br />
GV-Mais [1.000 ha]<br />
Flächenanteil<br />
GV-Mais [%]<br />
Maisanbau: Flächenanteil GVO im Jahr 2004<br />
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00<br />
Anteil GVO-Fläche an der Gesamt-Mais-Fläche des Landes/der Region [%]<br />
Produktion<br />
Mais [t]<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Produktion<br />
GV - Mais [t]<br />
EU-15 4.646,65 58,00 1,25 41.129.600,00 513.384,22<br />
EU-25 6.535,87 58,00 0,89 53.475.530,00 474.547,28<br />
Honduras 342,00 - N - - N - 514.152,00 - N -<br />
Philippinen 2.550,00 52,00 2 5.000.000,00 101.960,78<br />
Spanien 480,30 58,00 12 4.567.800,00 548.136,00<br />
Südafrika 2.600,00 400,00 15 8.311.000,00 1.246.650,00<br />
USA 29.668,23 13.350,70 45 298.233.088,00 134.204.889,60<br />
Argentinien 3.000,00 1.700,00 55 13.000.000,00 7.150.000,00<br />
Kanada 1.062,50 - N - - N - 8.064.300,00 - N -<br />
Rest 98.903,68 - N - - N - - N - - N -<br />
Welt 145.142,58 19.300,00 - N - 705.293.226,00 - N -<br />
Quelle: FAOSTAT 2004, JAMES 2004, USDA, TRANSGEN WISSENSCHAFTSKOMMUNIKATION, Berechnungen durch <strong>AGES</strong><br />
Im Vergleich zu 2003 ist 2004 die weltweite GV-Maisanbaufläche um ca. 25% gestiegen. Das Auftreten eines<br />
weltweit nicht zugelassenem GVO bei Mais (Bt 10) v.a. in den USA <strong>und</strong> auch von Exporten von mit diesem Konstrukt<br />
verunreinigtem Mais <strong>und</strong> Maisprodukten nach Europa, macht das Erfordernis der Bezugnahme (v.a. von<br />
Drittlandsimporten, siehe auch Star Link - Problematik) zum gesamten Grenz- <strong>und</strong> Schwellenwerteregime für<br />
Lebensmittel- <strong>und</strong> Futtermittel der EU (inkl. der Untersuchung auf in der EU nicht zugelassener GVO) als eine<br />
absolute Mindestanforderung, deutlich (siehe dazu auch Kapitel 2).<br />
Quelle: TRANSGEN WISSENSCHAFTSKOMMUNIKATION, JAMES 2004, Darstellung durch <strong>AGES</strong><br />
Abbildung 3-12: Die Flächenanteile von GV-Mais im Jahr 2004<br />
Der Anbau von GV-Mais nahm in den USA von 2003 auf 2004 kaum zu. Eine relativ hohe Zuwachsrate weist<br />
hingegen Argentinien auf. Argentinien weist sowohl bei Sojabohne als auch Mais die höchsten GV-Anteile an der<br />
Anbaufläche auf (siehe Abbildung 3-12). Maiskleber (ein potentielles SES-Substitut), insbesondere aus der<br />
Ethanolproduktion, aus Argentinien aber auch den USA <strong>und</strong> Kanada erscheint aufgr<strong>und</strong> der vorliegenden<br />
Produktionsverhältnisse in diesen Ländern als „GVO-frei“ oder <strong>„gentechnikfrei“</strong> weitestgehend auszuscheiden. Zudem<br />
ist bei Mais als fremdbefruchtende botanische Art im Unterschied <strong>zur</strong> Sojabohne (strenger Selbstbefruchter) eine<br />
Verunreinigung durch Gentransfer viel wahrscheinlicher (siehe GIRSCH et al., 2004).<br />
Seite 44 von 272
• Raps (Brassica napus)<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 3: Verfügbarkeit von GVO – Anbau <strong>und</strong> Marktsituation<br />
Raps wurde weltweit im Jahr 2003 auf ca. 23 Mio. ha <strong>und</strong> im Jahr 2004 auf ca. 26. Mio. ha angebaut. Der erste<br />
Anbau von gentechnisch verändertem Raps fand ebenfalls im Jahre 1996 statt, mit 0,01 Mio. ha in den USA auf 5%<br />
<strong>und</strong> 0,10 Mio. ha in Kanada auf 3% der Raps-Anbaufläche (EC DG AGRI, 2000). Die Tabelle 3-31 zeigt die Datenlage<br />
vom Jahr 2003. Die Weltproduktion von GV-Raps teilten sich im Jahre 2003 die beiden Länder Kanada mit ca. 90%<br />
<strong>und</strong> die USA mit ca. 10%.<br />
Tabelle 3-31: Die Verbreitung von GV-Raps im Jahr 2003<br />
Anbauland<br />
Anbaufläche<br />
Raps<br />
[1.000 ha]<br />
Anbaufläche<br />
GV-Raps [1.000<br />
ha]<br />
Flächenanteil<br />
GV-Raps<br />
[%]<br />
Produktion<br />
Raps<br />
[t]<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Produktion<br />
GV - Raps<br />
[t]<br />
Anteil an der<br />
weltweiten<br />
Produktion<br />
von<br />
GV-Raps<br />
[%]<br />
Kanada 4.689,20 3.200,00 68 6.669.200,00 4.551.189,97 89,75<br />
USA 528,00 400,00 76 686.470,00 520.053,03 10,25<br />
EU-15 3.197,08 0,00 0 9.492.321,00 0,00 0<br />
EU-25 4.136,51 0,00 0 11.056.194,00 0,00 0<br />
Rest 13.762,48 -N- -N- 18.185.965,00 -N- -N-<br />
Welt 23.116,20 3.600,00 16 36.597.829,00 5.071.243,00 100,00<br />
Quelle: FAOSTAT 2004, TRANSGEN WISSENSCHAFTSKOMMUNIKATION, JAMES 2003, Berechnungen durch <strong>AGES</strong><br />
Auch im Jahr 2004 ist Kanada Haupt-Anbauland für transgenen Raps mit ca. 3,8 Mio. ha auf 77% der Raps-<br />
Anbaufläche (siehe Tabelle 3-32).<br />
Weltweit stieg die GV-Rapsanbaufläche von 2003 auf 2004 um ca. 20% an.<br />
Tabelle 3-32: Die Verbreitung von GV-Raps im Jahr 2004<br />
Anbauland<br />
Anbaufläche<br />
Raps [1.000 ha]<br />
Anbaufläche<br />
GV-Raps<br />
[1.000 ha]<br />
Flächenanteil<br />
GV-Raps<br />
[%]<br />
Produktion<br />
Raps<br />
[t]<br />
Produktion<br />
GV - Raps<br />
[t]<br />
Kanada 4.939,00 3.803,03 77 7.001.100,00 5.390.847,00<br />
USA 341,31 - N - - N - 572.350,00 - N -<br />
EU-15 3.311,51 0 0 11.745.990,00 0<br />
EU-25 4.418,94 0 0 14.671.407,00 0<br />
Rest 16.530,39 - N - - N - 21.409.306,00 - N -<br />
Welt 26.229,64 4.300,00 16 43.654.163,00 7.156.517,29<br />
Quelle: FAOSTAT 2004, TRANSGEN WISSENSCHAFTSKOMMUNIKATION, JAMES 2004, Berechnungen durch <strong>AGES</strong><br />
Rapsextraktionsschrot bzw. Rapsexpeller aus der Rapsölerzeugung, insbesondere Biodieselerzeugung, sind<br />
bedeutende <strong>und</strong> potentielle Sojaproteinsubstitute. Raps <strong>und</strong> Rübsen sind zwar botanisch gesehen Selbstbefruchter,<br />
weisen aber eine hohe Fremdbefruchtungsrate auf. Der potentielle Gentransfer im Anbau übersteigt deutlich jenen<br />
bei Mais, sodass bereits eher geringe GVO-Anteile am Anbau zu einer GVO-Verunreinigung der gesamten Produktion<br />
in einer Region führen können. Es ist daher eher unwahrscheinlich, dass bei den hohen Anteilen von GV-Raps in<br />
Kanada <strong>und</strong> den USA „GVO-freier“ Extraktionsschrot bzw. Rapsexpeller aus diesen Ländern verfügbar ist.<br />
Voraussetzung für eine weitestreichend „GVO-freie“ landwirtschaftliche Erzeugung wäre ausreichend große<br />
geschlossene <strong>und</strong> GVO-freie Anbaugebiete über einen langen Zeitraum (siehe GIRSCH et al., 2004).<br />
Derzeit wird in der EU GV-Raps nicht einmal in Sortenversuchen gemäß dem EU-Saatgutrecht angebaut, wenngleich<br />
eine sehr hohe Anzahl von Freisetzungsanträgen (siehe Tabelle 3-26) in der EU vorliegt. Es erscheint kurz- bis<br />
mittelfristig nicht mit der Zulassung von GV-Rapssorten zu rechnen zu sein, so dass Rapsextraktionsschrot bzw. –<br />
expeller aus europäischer Erzeugung in „GVO-freien“ Futterrationen Bestand hat. Kommt es aber zu einem<br />
großflächigen GVO-Anbau von Raps in der EU wird as auf Gr<strong>und</strong> des massiven Druckes eines Gentransfers <strong>und</strong> damit<br />
Seite 45 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 3: Verfügbarkeit von GVO – Anbau <strong>und</strong> Marktsituation<br />
einer GVO-Verunreinigung zum weitreichenden Ausfall als Sojabohnensubstitut kommen. Dies ist vor allem in Hinblick<br />
auf den bevorstehenden Bedarf an Biodiesel, wozu Rapsöl sehr geeignet ist (siehe Kapitel 3.1.2.3), zu betrachten.<br />
Die Flächenstrukturen in weiten Teilen Europas setzen für eine weitestreichend „GVO-freie“ landwirtschaftliche<br />
Erzeugung von Raps ausreichend große geschlossene <strong>und</strong> GVO-freie Anbaugebiete über einen langen Zeitraum<br />
voraus. Besondere Beachtung kommt dabei einer weitestreichend „GVO-freien“ Saatgutproduktion zu.<br />
Weitere Kulturpflanzen:<br />
Von der detaillierteren Betrachtung weiterer Kulturpflanzen, wie Getreidearten, Kartoffel, Zuckerrübe <strong>und</strong> auch den<br />
Großsamigen Leguminosen wird abgesehen, da entweder aktuell kein GVO-Anbau in größerem Ausmaß vorliegt, oder<br />
der Welthandel mit Rohstoffen bzw. Futtermittelausgangserzeugnissen keine substantiellen Dimensionen aufweist.<br />
3.3. Handels- <strong>und</strong> Marktsituation landwirtschaftlicher Ernteprodukte <strong>zur</strong> Futtermittel-<br />
<strong>und</strong> Lebensmittelerzeugung unter besonderer Berücksichtigung von GV-Kulturen<br />
3.3.1. Handelsdaten<br />
Die Landwirtschaft Europas verfügt auf Gr<strong>und</strong> klimatischer <strong>und</strong> agronomischer Bedingungen sowie auf der Basis von<br />
Handelsverträgen nicht über die erforderlichen Kapazitäten, um den Agrar- <strong>und</strong> Ernährungssektor ausreichend mit<br />
pflanzlichen Erzeugnissen <strong>zur</strong> Futtermittel- <strong>und</strong> Lebensmittelherstellung, sowohl hinsichtlich Quantität als auch<br />
Qualität, zu versorgen. Die EU tritt am Weltmarkt besonders als Importeur von Öl- <strong>und</strong> Eiweißsaaten auf.<br />
Jährlich importieren die Länder der EU 15 an die 40 Mio. t Getreide, Ölsaaten <strong>und</strong> eiweißhältige Rohstoffe. Besonders<br />
die europäische Futtermittelindustrie ist auf den Import von eiweißhaltigen Futterrohstoffen wie Sojabohne <strong>und</strong><br />
Sojaextraktionsschrot (SES) aus den Hauptanbauländern Nord- <strong>und</strong> Südamerikas angewiesen. In diesen Ländern<br />
liegt der Anteil von GV - Sorten bei Sojabohne, Mais <strong>und</strong> Raps inzwischen bei über 20 bis deutlich über 90% (siehe<br />
oben <strong>und</strong> vgl. SCHUMACHER et al.).<br />
Um die Herkunft der auf dem österreichischen Markt verfügbaren Agrarrohstoffe darstellen zu können, werden<br />
zusätzlich <strong>zur</strong> Anbaustruktur Österreichs auch die Importmengen an Sojabohne, Mais <strong>und</strong> Raps in die EU15 <strong>und</strong> nach<br />
Österreich von 1999 bis 2003 <strong>und</strong> soweit verfügbar 2004 dargestellt.<br />
Besonderes Augenmerk wird auf jene Herkunftsländer gelegt, in denen der Anbau von GV- Sorten zugelassen ist, in<br />
größerem Ausmaß betrieben wird, <strong>und</strong> deren Erntegut oder bereits verarbeitete Produkte am europäischen <strong>und</strong><br />
österreichischen Markt einen bedeutenden Anteil einnehmen.<br />
Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass auf Gr<strong>und</strong> der Schwierigkeit <strong>und</strong> Komplexität der Datenerfassung am<br />
Binnenmarkt eine Unvollständigkeit der Daten nicht <strong>zur</strong> Gänze auszuschließen ist. Sofern die Statistiken nicht<br />
vollständig verfügbar sind, wird auf eine Gesamtbetrachtung der EU-25 verzichtet. Es ist aus der Anbaustruktur <strong>und</strong><br />
der Nord- Süderstreckung nicht zu erwarten, dass die Verhältnisse maßgeblich von denen der EU 15 abweichen.<br />
3.3.1.1. Sojabohnen (Glycine max) <strong>und</strong> Sojaextraktionsschrot (SES)<br />
• Globale Situation – Importe der EU 15<br />
Die Ölmühlenindustrie der EU ist weltweit der wichtigste Anbieter von Veredelungsprodukten aus Öl- <strong>und</strong><br />
Eiweißsaaten. Der Großteil der verarbeiteten Sojabohnen wird in der Tierfütterung eingesetzt. Auf die<br />
Lebensmittelindustrie entfällt ein vergleichsweise geringer Anteil der Sojabohnenproduktion.<br />
Auch SES wird in sehr großen Mengen importiert. In die EU15 wurden laut FAO (2004) im Jahr 2003 ca. 19,37 Mio. t<br />
SES verbracht. Dies entspricht einer Menge von ca. 24,2 Mio. t Sojabohnenäquivalenten. Eine Betrachtung der<br />
Entwicklung des Imports von Sojabohnen <strong>und</strong> SES der letzten fünf Jahre zeigt deutlich steigende Tendenz. Der<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 46 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 3: Verfügbarkeit von GVO – Anbau <strong>und</strong> Marktsituation<br />
Eigenversorgungsgrad der EU15 bezogen auf Sojabohnen lag 1999 bei etwa ca. 12% <strong>und</strong> bezogen auf SES bei 6%<br />
(nach AMERICAN SOYBEAN ASSOCIATION et al., 2001).<br />
Tabelle 3-33 zeigt die Mengen an Sojabohnen <strong>und</strong> SES, die in den letzten 5 Jahren in die EU 15 eingeführt wurden.<br />
Es erfolgte eine Umrechnung des SES in Sojabohnenäquivalente um die importierten Mengen an SES mit den<br />
Produktionsmengen von Sojabohnen <strong>und</strong> damit die vergleichbaren Anbauflächen in Beziehung bringen zu können.<br />
Im Durchschnitt handelt es sich um eine Gesamtmenge von ca. 37,8 Mio. Tonnen Sojabohnenäquivalente, welche<br />
jährlich in die EU 15 importiert werden (siehe Tabelle 3-33).<br />
Tabelle 3-33: Gesamtimport in die EU 15 von Sojabohnen <strong>und</strong> Sojaextraktionsschrot (umgerechnet in<br />
Sojabohnenäquivalente) in den Jahren 1999 bis 2003<br />
Sojaextraktionsschrot in<br />
Summe Sojabohnen <strong>und</strong><br />
Sojaextraktionsschrot in<br />
Sojabohnen Sojaextraktionsschrot Sojabohnenäquivalente * Sojabohnenäquivalente<br />
Jahr [t] [t] [t] [t]<br />
1999 14 666 808 15 211 157 19 013 946 33 680 754<br />
2000 14 462 753 14 852 075 18 565 094 33 027 847<br />
2001 18 251 279 17 235 953 21 544 941 39 796 220<br />
2002 18 007 735 18 567 007 23 208 759 41 216 494<br />
2003 17 272 182 19 368 022 24 210 028 41 482 210<br />
QUELLE: EUROSTAT 2004, FAO 2004, Berechnung durch <strong>AGES</strong><br />
* Umrechnung von Sojaextraktionsschrot auf Sojabohnenäquivalente durch <strong>AGES</strong>; Umrechnungsfaktor 1: 0,8<br />
(100%Bohnen ergeben 20% Öl <strong>und</strong> 80% Schrot laut Verband deutscher Ölmühlen, persönliche Mitteilung).<br />
Es zeigt sich eine Steigerung der Importmengen im angegebenen Bezugszeitraum. Tabelle 3-34 beinhaltet die von<br />
den EU 15 importierten Mengen an Sojabohnen <strong>und</strong> SES aus Ländern mit GVO-Anbau. Detaillierte Daten bezüglich<br />
der Importmengen an SES umgerechnet in Sojabohnenäquivalente stehen von den drei Sojabohnen-<br />
hauptproduzenten Argentinien, Brasilien <strong>und</strong> USA <strong>zur</strong> Verfügung, was im Jahr 2003 99% der Weltproduktion an<br />
Sojabohnen ausmachte (vergleiche Kapitel 3.2.2). Hauptexporteur in die EU 15 war zuletzt Brasilien gefolgt von<br />
Argentinien <strong>und</strong> den USA.<br />
Eine Gegenüberstellung von Tabelle 3-33 <strong>und</strong> Tabelle 3-34 bringt zum Ausdruck, dass ca. 95% aller in die EU 15<br />
importierten Sojabohnenäquivalente aus Brasilien, den USA <strong>und</strong> Argentinien stammen.<br />
Tabelle 3-34: Der Import von Sojabohnen <strong>und</strong> SES der EU 15 von 1999 bis 2003 aus den drei GVO-<br />
Hauptanbauländern<br />
Sojabohnen<br />
Argentinien Brasilien USA<br />
Sojaextraktionsschrot<br />
in<br />
Sojabohnenäquivalente<br />
* Sojabohnen<br />
Sojaextraktionsschrot<br />
in<br />
Sojabohnenäquivalent<br />
* Sojabohnen<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Sojaextraktionsschrot<br />
in<br />
Sojabohnenäquivalente<br />
*<br />
Summe<br />
Sojabohnen<br />
<strong>und</strong><br />
Sojaextraktions-<br />
schrot in<br />
Sojabohnen-<br />
äquivalente<br />
Jahr [t] [t] [t] [t] [t] [t] [t]<br />
1999 960 502 9 282 500 6 105 756 7 352 500 6 491 506 558 750 30 751 515<br />
2000 381 482 9 580 000 6 372 400 8 457 500 6 917 264 228 750 31 937 396<br />
2001 693 314 9 863 750 9 855 034 10 441 250 6 657 256 661 250 38 171 855<br />
2002 1 197 776 12 011 250 9 178 200 10 563 750 7 008 243 336 250 40 295 469<br />
2003 310 206 12 787 500 9 736 287 11 053 750 5 784 236 58 750 39 730 729<br />
Quelle: EUROSTAT 2004, TOEPFER 2005, Berechnung durch <strong>AGES</strong><br />
* Umrechnung von Sojaextraktionsschrot auf Sojabohnenäquivalente durch <strong>AGES</strong>; Umrechnungsfaktor 1: 0,8 (100%<br />
Bohnen ergeben 20% Öl <strong>und</strong> 80% Schrot laut Verband deutscher Ölmühlen, persönliche Mitteilung).<br />
Recherchen bezüglich Importmengen an Sojabohnen aus weiteren Ländern mit GVO-Anbau, wie Kanada, Rumänien,<br />
Uruguay <strong>und</strong> Südafrika, zeigten, dass deren Anteil am Sojabohnenimport sich auf weniger als 3% am Gesamtimport<br />
Seite 47 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 3: Verfügbarkeit von GVO – Anbau <strong>und</strong> Marktsituation<br />
beläuft <strong>und</strong> somit in dieser Darstellung vernachlässigt wurde. Dies auch deshalb, da diese Länder ebenfalls in<br />
bedeutendem Maße GV-Sojabohnen anbauen.<br />
Brasilien produzierte offiziell bis 2003 „GV–freie“ Sojabohnen. GV- Saatgut aus Argentinien <strong>und</strong> Paraguay resultierte<br />
in einem illegalen GVO - Anbau mit dem Effekt, dass die brasilianische Regierung im Juni 2003 den Verkauf von<br />
illegal produziertem GV-Saatgut, beschränkt auf das Jahr 2004, erlaubte. Auch 2005 wird der Anbau von GV-<br />
Sojabohnen über einen vorläufigen Erlass geregelt, der folglich vom Parlament unterzeichnet wurde <strong>und</strong> im Jänner<br />
2005 in Kraft getreten ist. Dieser Erlass besagt, dass GV-Sojabohnen der Ernte 2005 bis Ende Juli 2006 vermarktet<br />
werden dürfen.<br />
Eine wichtige Bedeutung kommt der vom brasilianischen Senat verabschiedeten „Biosafety Gesetzgebung“ zu, welche<br />
dem Parlament <strong>zur</strong> Beratung <strong>und</strong> Unterzeichnung vorliegt, <strong>und</strong> die eine dauerhafte Genehmigung der Regelung eines<br />
Anbaus <strong>und</strong> der Vermarktung von GV-Sojabohnen zum Inhalt hat (TOEPFER 2005). Die Konsequenz dieser<br />
Entscheidung demonstriert ein explosionsartiger GV-Sojabohnenanbau in Brasilien im Vegetationsjahr 2004/2005<br />
Internationale Agrarhändler schätzen ihn auf 45% (TRANSGEN WISSENSCHAFTSKOMMUNIKATION, 2004).<br />
Informationen seitens des brasilianischen Unternehmens Cert ID Certificadora Ltda. zufolge wurden durch „Cert ID“ 4<br />
Mio. Tonnen „NON-GMO“ SES aus der Erntesaison 2005 zertifiziert <strong>und</strong> weitere 1,9 Mio. Tonnen SES sind innerhalb<br />
weniger Wochen zusätzlich zu den 4 Mio. Tonnen noch zertifizierbar. Die Zertifizierung durch Cert ID „NON-GMO“<br />
beinhaltet eine Toleranzgrenze von 0,1% GV-Gehalt. Somit wären ca. 6 Mio. Tonnen Sojaextraktionsschrot als „NON-<br />
GMO“ zertifiziert durch Cert ID verfügbar. Zusätzlich zu diesem enormen Volumen können nach Angaben aus<br />
brasilianischen Kreisen weitere 5 Mio. Tonnen an „NON-GMO“ Sojabohnen verfügbar gemacht werden. Allein 14<br />
Ölmühlen aus Brasilien sind in der Lage mehr als 25% des europäischen Bedarfs zu decken. Unter Angabe dieser<br />
Fakten bringt die Geschäftsführung dieses Unternehmens das Potential der brasilianischen Landwirtschaft zertifizierte<br />
„Nicht-GVO“ Rohware zu produzieren zum Ausdruck. Cert ID Certificadora Ltda., 2005 führt aus: „Die Annahme, dass<br />
nicht ausreichend „GVO-freier“ SES für eine nachhaltige Tierfutterproduktion zu Verfügung steht, wird somit<br />
widerlegt.“<br />
Auch andere Unternehmen bieten „GVO-freien“ SES aus verschiedenen Herkünften an. Anzumerken ist dabei die<br />
Strategie, ein „GVO-freies“ Paket an Produkten (insbesondere Öl <strong>und</strong> Lecithin) anzubieten. Die Nachfrage nach „GVO-<br />
freiem“ Öl <strong>und</strong> Lecithin für die Lebensmittelindustrie bestimmt somit das Angebot an „GVO-freiem“ SES mit.<br />
Aufgr<strong>und</strong> des prognostizierten, allerdings mäßigen Zuwachses in der Ölsaatenproduktion in der EU wird der<br />
Importbedarf an Ölsaaten <strong>und</strong> pflanzlichen Eiweißprodukten sich kaum ändern (EC DG-AGRI, 2004).<br />
• Österreichische Situation<br />
Österreich importierte im Durchschnitt zwischen 1999 <strong>und</strong> 2003 ca. 670.000 t Sojabohnenäquivalente einerseits über<br />
Direktverträge mit Brasilien, USA <strong>und</strong> Argentinien andererseits durch Transfer über EU – Mitgliedstaaten.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 48 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 3: Verfügbarkeit von GVO – Anbau <strong>und</strong> Marktsituation<br />
Tabelle 3-35 zeigt die importierten Mengen an Sojabohnen <strong>und</strong> SES zwischen den Jahren 1999 <strong>und</strong> 2003. Es erfolgte<br />
eine Umrechnung des SES in Sojabohnenäquivalente.<br />
Tabelle 3-35: Import an Sojabohnen <strong>und</strong> Sojaextraktionsschrot (SES) nach Österreich von 1999 bis 2003<br />
Sojaextraktions- Sojaextraktionsschrot in<br />
Summe<br />
Sojabohnen <strong>und</strong><br />
Sojaextraktionsschrot in<br />
Sojabohnen schrot Sojabohnenäquivalente * Sojabohnenäquivalente<br />
Jahr [t] [t] [t] [t]<br />
1999 13 953 473 650 592 063 606 016<br />
2000 13 214 475 094 593 868 607 082<br />
2001 30 423 515 822 644 778 675 201<br />
2002 22 349 569 086 711 358 733 707<br />
2003 18 189 577 156 721 445 739 634<br />
Quelle: FAOSTAT 2004, Berechnung durch <strong>AGES</strong><br />
* Umrechnung von Sojaextraktionsschrot auf Sojabohnenäquivalente durch <strong>AGES</strong>; Umrechnungsfaktor 1: 0,8<br />
(100%Bohnen ergeben 20% Öl <strong>und</strong> 80% Schrot**)<br />
** Verband deutscher Ölmühlen, persönliche Mitteilung<br />
Eine Betrachtung der von Österreich importierten Mengen an Sojabohnen <strong>und</strong> SES aus den EU 15 <strong>und</strong> den am 1.Mai<br />
2004 neu beigetretenen 10 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (=N10) zeigt, dass nur ein geringer Anteil<br />
aus/über die N10 importiert wurde.<br />
Die Abhängigkeit bezüglich Sojabohnen <strong>und</strong> Sojaextraktionsschrot von Drittländern außerhalb Europas ist in<br />
Anbetracht der europäischen Produktion, im Vergleich zum europäischen Bedarf, unumstritten.<br />
Innerhalb Europas sind für Österreich die Hauptlieferanten für Sojaextraktionsschrot die Ölmühlen Deutschlands,<br />
Italiens, der Niederlande <strong>und</strong> Belgiens.<br />
3.3.1.2. Mais (Zea mays), Maisschrot <strong>und</strong> Maisverarbeitungsprodukte<br />
• Globale Situation – Import der EU 15<br />
Die Europäische Union hat seit 1994 jährlich etwa zwei bis vier Mill. t Mais aus Drittländern bezogen (UHLMANN 2003),<br />
allerdings auch Mais exportiert. Europa deckt seinen Bedarf an Mais durch Eigenproduktion (TRANSGEN WISSENSCHAFTS-<br />
KOMMUNIKATION, 2005).<br />
In den Jahren 1999 bis 2003 wurden in den EU 15 im Durchschnitt 38,4 Mio. t Mais auf 4,36 Mio. ha Fläche<br />
produziert (FAOSTAT, 2005). Die Rolle der Importe aus Drittländern ist entsprechend gering, vor allem im Vergleich <strong>zur</strong><br />
Anbau- <strong>und</strong> Handelssituation bei der Sojabohne.<br />
Abbildung 3-13 zeigt die vier Maishauptexporteure in die EU 15 von 1998 bis 2003. Die höchste Anzahl der Importe<br />
kommt jährlich aus Argentinien; Importe aus den USA zeigen stark fallende Tendenz, aus Brasilien <strong>und</strong> Ungarn<br />
(inzwischen Teil der EU) hingegen steigende Tendenz. Der Hauptexporteur für die EU15 war im Jahr 2003 eindeutig<br />
Argentinien mit 45%. Dies entspricht einer Menge von etwa 2 Mio. Tonnen Mais.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 49 von 272
tsd T<br />
2 500<br />
2 000<br />
1 500<br />
1 000<br />
500<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 3: Verfügbarkeit von GVO – Anbau <strong>und</strong> Marktsituation<br />
Maishauptexporteure in die EU 15 von<br />
1998 bis 2003<br />
0<br />
1998 1999 2000 2001 2002 2003<br />
Jahr<br />
Argentinien USA<br />
Ungarn Brasilien<br />
Quelle: EUROSTAT 2005, Darstellung durch <strong>AGES</strong><br />
Abbildung 3-13: Maisimport der EU 15 von 1998 bis 2003<br />
Stattdessen lieferte Argentinien das Gros der Bezüge, da dieses Land nur solche gentechnisch veränderten<br />
Maissorten für den Verkehr zugelassen hat, die auch eine Zulassung in der EU besaßen (UHLMANN, 2003). Im Steigen<br />
befinden sich die Importe <strong>und</strong> Verbringungen aus den inzwischen neuen EU-Mitgliedstaaten oder Kandidatenländern<br />
in Zentraleuropa <strong>und</strong> Südeuropa. Mit dem Beitritt der 10 neuen Mitgliedsstaaten in die Europäische Union im Mai<br />
2004 kam es zu einer weiteren Steigerung der Eigenversorgung innerhalb Europas. In Tabelle 3-36 sind die<br />
Maisimporte der EU 15 aus Ländern mit GVO – Anbau dargestellt.<br />
Tabelle 3-36: Maisimport (inklusive Saatgut) der EU 15 aus Ländern mit GVO - Anbau von 1998 bis 2003<br />
Argentinien USA Kanada Südafrika Philippinen Summe<br />
Jahr [t] [t] [t] [t] [t] [t]<br />
1999 2 031 876 62 170 4 350 2 495 7 2 100 898<br />
2000 2 239 585 74 842 3 553 1 105 0 2 319 085<br />
2001 1 358 302 51 100 1 907 1 543 3 1 412 854<br />
2002 1 410 355 59 183 880 1 765 0 1 472 182<br />
2003 1 949 205 38 888 1 149 1 482 1 1 990 725<br />
Quelle: EUROSTAT 2004, Darstellung durch <strong>AGES</strong><br />
Im Jahr 2003 wurden ca. 2 Mio. Tonnen Mais aus Ländern mit GVO-Anbau in die EU exportiert. Dies entspricht etwa<br />
50% des Gesamtimports von ca. 4,3 Mio. t (siehe Tabelle 3-36 <strong>und</strong> Tabelle 3-37). Die verbleibenden 50% der<br />
Importe aus Ländern aktuell ohne bedeutenden GVO-Anbau stammen hauptsächlich aus Brasilien, Ungarn, Kroatien,<br />
Paraguay, Peru <strong>und</strong> inzwischen mit vermehrtem GVO-Anbau aus der Ukraine. Die von den EU 15 importierten<br />
Mengen an Maisschrot spielen mengenmäßig keine sonderlich bedeutende Rolle. In Tabelle 3-37 sind die<br />
importierten Mengen an Mais <strong>und</strong> Maisschrot der von 1998 bis 2003 dargestellt.<br />
Tabelle 3-37: Maisimport in die EU 15 von 1998 bis 2003<br />
Einheit 1999 2000 2001 2002 2003<br />
Mais [t] 2 649 738 2 872 122 2 469 641 2 814 214 4 348 680<br />
Maisschrot [t] 132 814 52 845 64 005 31 926 10 230<br />
Quelle: FAOSTAT 2004<br />
• Österreichische Situation<br />
In Österreich wurden im Jahr 2003 ca. 1,45 Mio. t Mais auf etwa 173.300 ha produziert. Im Vergleich dazu erscheint<br />
eine importierte Menge von 200.000 t im Jahr 2003 gering (FAOSTAT, 2004). In den letzten 5 Jahren wurden<br />
zwischen 65.000 t (1999) bis 265.000 t (2002) Mais nach Österreich verbracht (FAO, 2004).<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Der Rückgang der aus den USA bezogenen<br />
Mengen dürfte auf die Zulassung von<br />
gentechnisch verändertern Maissorten in<br />
der zweiten Hälfte der 90er Jahre<br />
<strong>zur</strong>ückzuführen sein.<br />
Die EU minimierte den Maisimport aus den<br />
USA im Jahr 2003 auf nur etwa 1%<br />
(entspricht ca. 40.000 t) der<br />
Gesamtimportmenge aus Drittländern<br />
(siehe Tabelle 3-36 <strong>und</strong> Tabelle 3-37).<br />
Seite 50 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 3: Verfügbarkeit von GVO – Anbau <strong>und</strong> Marktsituation<br />
Abbildung 3-14 zeigt die Einfuhrmengen an Mais (inklusive Saatgut) - differenziert nach Herkunftsländern innerhalb<br />
Europas. An dieser Stelle sei erwähnt, dass kaum Direktverbringungen aus Drittländern nach Österreich getätigt<br />
werden. Anzumerken ist, dass auf die Exportmengen aufgr<strong>und</strong> fehlender Relevanz im Kontext nicht näher<br />
eingegangen wird. Die Mengen, die aus bzw. über die der EU beigetreten 10 neuen Mitgliedsstaaten (N10) <strong>und</strong> der<br />
Mengen, die aus bzw. über die EU 15 eingeführt wurden, sind in Abbildung 3-14 dargestellt.<br />
Jahr<br />
2003<br />
2002<br />
2001<br />
2000<br />
1999<br />
Maisimport nach Österreich aus EU15 <strong>und</strong><br />
EU25 von 1999 bis 2003<br />
36<br />
50<br />
51<br />
42<br />
61<br />
21<br />
33<br />
25<br />
88<br />
186<br />
0 50 100 150 200 250<br />
tsd t<br />
Quelle: EUROSTAT 2004, Darstellung durch <strong>AGES</strong><br />
EU15 N10<br />
Abbildung 3-14: Maisimport (inklusive Saatgut) nach Österreich zwischen 1999 bis 2003 aus/über die Länder der<br />
EU<br />
3.3.1.3. Raps (Brassica napus) <strong>und</strong> Rübsen (Brassica rapa), Rapsextraktionsschrot<br />
• Globale Situation - Importe der EU 15<br />
In den EU 15 wurden in den letzten fünf Jahren im Durchschnitt 9,67 Mio. t Raps produziert. Stellt man dieser<br />
beachtlichen Menge die Importmenge von 245.000 t Raps gegenüber, wird die Unabhängigkeit der EU 15 von<br />
Drittländern in Bezug auf den Rohstoff Raps deutlich. Zum Ausdruck kommt diese Kapazität Europas in jährlich stark<br />
schwankenden Importmengen. Zusätzlich bevorzugten die Ölmühlen Raps aus inländischer Erzeugung, da sie davon<br />
ausgehen konnten, dass diese Herkünfte frei von gentechnisch veränderten Sorten sein würden. Die europäischen<br />
Ölmühlen versprachen sich dadurch eine leichtere Vermarktung ihrer Produkte, wenn sie gentechnikfreie Rohstoffe<br />
einsetzten (UHLMANN, 2003). In Tabelle 3-38 werden die von Europa importierten Mengen an Rapssaat aus der<br />
ganzen Welt <strong>und</strong> die Mengen aus den Ländern Kanada <strong>und</strong> USA dargestellt, da in diesen Ländern GV-Rapssorten<br />
angebaut werden. Der Rapssaatimport aus Drittländern in die EU 15 ist in den vergangenen Jahren deutlich<br />
<strong>zur</strong>ückgegangen. So liegt der Import von ca. 3.900 t aus Ländern, die GV – Raps (Kanada <strong>und</strong> USA) anbauen, im<br />
Jahr 2003 nur bei etwa 1,4 % der Gesamtimportmenge von 270.000 t in die EU 15 (siehe Tabelle 3-39). Es sei<br />
darauf verwiesen, dass die angeführten Mengen sich hier auf Rapssaat beziehen. Es liegen keine Daten über die<br />
Herkunft der EU 15 Mengen an Rapsschrot vor.<br />
Tabelle 3-38: Raps-/Rübsen-saatimport der EU 15<br />
Kanada USA Übrige Länder SUMME<br />
Jahr [t] [t] [t] [t]<br />
1999 10 370 1 406 1 027 912 1 039 687<br />
2000 1 703 1 836 490 838 193<br />
2001 2 483 8 1 202 962 1 205 453<br />
2002 2 431 645 644 909 647 985<br />
2003 3 887 4 265 309 269 200<br />
Quelle: EUROSTAT 2004, FAOSTAT 2004, Berechnung durch <strong>AGES</strong><br />
Wie in Tabelle 3-38 dargestellt, unterliegt der Rapssaatimport Europas starken Schwankungen. So wurden im Jahr<br />
2001 ca. 1,2 Mio. t <strong>und</strong> im Jahr 2003 nur 270. 000 t Rapssaat von den Ländern der EU 15 importiert. Neben den<br />
Schwankungen in Bezug auf die Importmengen, variieren auch die Bezugsländer sehr stark (siehe<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 51 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 3: Verfügbarkeit von GVO – Anbau <strong>und</strong> Marktsituation<br />
Abbildung 3-15). Besonders die Länder Osteuropas <strong>und</strong> Australien ersetzten in den letzten Jahren Kanada <strong>und</strong> USA<br />
als Hauptbezugsländer.<br />
in tsd. t<br />
Hauptexporteure an Raps-/Rübsensaat in die EU 15<br />
zwischen 1999 <strong>und</strong> 2003<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
1999 2000 2001 2002 2003<br />
Jahr<br />
Tschech.Republik Australien Ungarn<br />
Russland Polen Litauen<br />
USA<br />
Quelle: EUROSTAT 2004, Darstellung durch <strong>AGES</strong><br />
Abbildung 3-15: Raps-/Rübsen-saatimport der EU15 von 1999 bis 2003<br />
Zusätzlich zu den in Tabelle 3-38 angeführten Mengen an Rapssaat wurden folgende in Tabelle 3-39 angeführte<br />
Mengen an Rapsschrot - umgerechnet in Rapssaatäquivalente –von den EU 15 importiert. Im Durchschnitt handelt<br />
es sich zwischen 1999 <strong>und</strong> 2003 um ca. 1,8 Mio. t Rapssaatäquivalente.<br />
Tabelle 3-39: Raps-/Rübsenimport in die EU 15 von 1999 bis 2003<br />
Umrechnung in<br />
Summe<br />
Rapssaat <strong>und</strong><br />
Rapssaat Rapsschrot Rapssaatäquivalente * Rapssaatäquivalente<br />
Jahr [t] [t] [t] [t]<br />
1999 1 039 624 614 165 1 058 905 2 098 529<br />
2000 838 194 846 940 1 460 241 2 298 435<br />
2001 1 211 606 527 259 909 067 2 120 673<br />
2002 647 800 492 627 849 357 1 497 157<br />
2003 269 198 407 503 702 591 971 789<br />
Quelle: FAOSTAT 2004, Berechnung durch <strong>AGES</strong><br />
* Umrechnung des Rapsschrotes auf Rapssaatäquivalente durch <strong>AGES</strong>; 100% Saat ergeben 58% Schrot <strong>und</strong> 42% Öl laut einer<br />
persönlichen Mitteilung durch die Ölmühle Bruck<br />
• Österreichische Situation<br />
Der Selbstversorgungsgrad an Raps in Österreich lag laut Versorgungsbilanz 2002/2003 bei 88% (siehe Kapitel<br />
3.1.2). Der Bedarf <strong>und</strong> die Abhängigkeit Österreichs von Verbringungen aus dem Ausland sind sehr gering.<br />
Abbildung 3-15 zeigt die Mengen an Rapssaat <strong>und</strong> Rapsschrot, die in den Jahren 1999 bis 2003 nach Österreich<br />
gebracht wurden. Seit 1999 zeigt sich eine Zunahme der Importe von Rapsschrot. Durchschnittlich werden etwa<br />
66.000 t Rapsschrot jährlich im angegebenen Bezugszeitraum importiert.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 52 von 272
Jahr<br />
2003<br />
2002<br />
2001<br />
2000<br />
1999<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 3: Verfügbarkeit von GVO – Anbau <strong>und</strong> Marktsituation<br />
Rapssaat- <strong>und</strong> Rapsschrotimport nach<br />
Österreich von 1999 bis 2003<br />
17<br />
15<br />
13<br />
37<br />
34<br />
29<br />
60<br />
64<br />
72<br />
108<br />
0 50 100 150<br />
Rapsschrot in tsd t Rapssaat in tsd t<br />
QUELLE: FAOSTAT 2005, DARSTELLUNG DURCH <strong>AGES</strong><br />
Abbildung 3-16: Rapsimport von 1999 bis 2003 nach Österreich<br />
Raps- bzw. Rübsensaatimporte nach Österreich sollten mit der Inbetriebnahme einer geplanten Biodieselerzeugung<br />
deutlich zunehmen bzw. sich zumindest verdoppeln. Der anfallende Expeller ist zweifelsohne ein hochwertiges<br />
Sojabohnensubstitut in der Futtermittelerzeugung. Kurz bis mittelfristig ist der Anbau von GV-Raps bzw. GV-Rübsen<br />
in Europa unwahrscheinlich, sodass von einem „GVO-freien“ Substitut ausgegangen werden kann. Werden jedoch<br />
GV-Raps- <strong>und</strong> GV-Rübsensorten zugelassen, ist auf Gr<strong>und</strong> der Blühbiologie von Raps/Rübsen, der hohen Persistenz,<br />
sowie der Auskreuzung auf Wild- <strong>und</strong> Ruderalpflanzen in wenigen Anbaujahren eine maßgebliche GVO<br />
Verunreinigung bei eher geringem GVO-Anteil in der Anbaufläche zu erwarten. Es ist zumindest eine Situation<br />
vergleichbar mit Kanada <strong>und</strong> den USA zu erwarten, sodass „GVO-freier“ Expeller de facto nicht verfügbar sein wird.<br />
3.3.2. Gentechnikstatus der Rohstoffe <strong>und</strong> Trennung der Warenströme durch IP-Systeme<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich werden 2 Wege der Warenstrom-Trennung unterschieden. Das erste Verfahren ist die Segregation, das<br />
zweite die so genannte Identity-Preservation- Verfahren (IP) (AMERICAN SOYBEAN ASSOCIATION ET AL., 2001).<br />
Segregation bezieht sich auf ein System des Rohmaterial Managements, welches eine Trennung von einer Ladung zu<br />
einer anderen erlaubt. Segregation ist ein Versuch, getrennte Märkte für unterschiedliche Produkte oder einen neuen<br />
Markt für ein neues spezifisches Produkt zu kreieren <strong>und</strong> zu etablieren (EC DG-AGRI, 2000).<br />
Das System der IP geht über eine Trennung der Ware hinaus. IP ist ein System der landwirtschaftlichen Erzeugung,<br />
des Handels <strong>und</strong> der Verarbeitung, welches die Identifikation der Herkunft <strong>und</strong>/oder die Beschaffenheit des Materials<br />
erlaubt (EC DG-AGRI, 2000).<br />
IP-Systeme haben zum Ziel, die Option einer Wahl zwischen gentechnisch veränderten <strong>und</strong> nicht gentechnisch<br />
veränderten Produkten zu ermöglichen. Dies kann erreicht werden, indem die Beschaffenheit <strong>und</strong> Identität des<br />
Ernteguts bzw. Produktes, vom Saatgut bis zum Enderzeugnis belegt <strong>und</strong> sichergestellt wird. Die Nachvollziehbarkeit<br />
der verschiedenen Produktionsschritte ist somit gegeben, <strong>und</strong> es ist bekannt ob ein Produkt GV – frei erzeugt wurde.<br />
Als gängiges Beispiel für eine unter IP erwachsene Pflanzen unter Vertrag ist die Produktion von Zertifiziertem<br />
Saatgut (EC DG-AGRI, 2000).<br />
IP ist ein System der landwirtschaftlichen Erzeugung, der Bearbeitung <strong>und</strong> des Handels mit Ernteprodukten. Die<br />
Kenntnis der Identität der Quelle oder des Ursprungs der Produktionsmittel, vor allem des Saatgutes erlaubt die<br />
Bestimmung des GVO-Status vom Beginn der Produktion. Aus den Anforderungen <strong>und</strong> Zielsetzungen des IP-Systems<br />
resultiert ein Vertragsanbau für die Produktion von Kulturpflanzen mit gewünschten Qualitätsmerkmalen (bestimmte<br />
Inhaltsstoffe, Art der Produktion etc).<br />
Voraussetzungen für ein IP liegen einerseits in den biologischen Systemen <strong>und</strong> den technischen Möglichkeiten<br />
Kontrollen (Monitoring) durchzuführen. Risikobasierte Monitoring- <strong>und</strong> Untersuchungspläne sind ein wichtiges<br />
Element bei IP. Es wird die Voraussetzung, die technische Möglichkeit geschaffen, Proben auf eine „konservierte“<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 53 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 3: Verfügbarkeit von GVO – Anbau <strong>und</strong> Marktsituation<br />
Identität zu untersuchen (EC DG-AGRI, 2000). Weiters ist die Einrichtung von Toleranzgrenzen notwendig, da eine<br />
Forderung von absoluter Reinheit der Erzeugnisse in biologischen Systemen kaum erzielbar ist <strong>und</strong> in der Regel mit<br />
einer maßgeblichen Kostensteigerung verb<strong>und</strong>en wäre. Das Prinzip, einen Toleranzwert (Schwellenwert) für<br />
Standards in Bezug auf die Reinheit zu fixieren, ist ein alteingeführtes Merkmal für IP-Systeme (EC DG-AGRI, 2000).<br />
IP-Systeme werden unterteilt in a) „Hard Identity Preservation“ mit einer Kontrolle vom Saatgut bis zum Endprodukt<br />
<strong>und</strong> einer daraus resultierenden Rückverfolgbarkeit der Charge bzw. Partie bis zum Landwirt, <strong>und</strong> b) „Soft Identity<br />
Preservation“ mit einer reduzierten Prozessvorgabe <strong>und</strong> Überwachungsintensität. Bei Hard-IP erfolgt ein Monitoring<br />
(Prüfungen) vom Anbau bis zum Endprodukt. Als Beispiel wäre hier der Anbau von Sojabohnen für die Tofu-<br />
Produktion zu nennen, die in den USA erzeugt <strong>und</strong> nach Japan exportiert werden (AMERICAN SOYBEAN ASSOCIATION et<br />
al., 2001).<br />
Bei Soft-IP Verfahren beginnt üblicherweise die Warenflusskontrolle erst bei der Warenübernahme (Übernahme des<br />
Ernteguts) z.B. bei Beladen der Seeschiffe <strong>und</strong> in weiterer Folge beim Transport <strong>und</strong> nicht bereits vor dem Anbau<br />
beim Saatgut <strong>und</strong> der landwirtschaftlichen Erzeugung.<br />
IP-Systeme können entsprechende Mehrkosten auf Gr<strong>und</strong> möglicher zusätzlicher Aufwendungen betreffend Logistik<br />
in Produktion, Lagerung, Transport, Reinigung <strong>und</strong> Organisation <strong>und</strong> vor allem Monitoringkosten <strong>zur</strong> Evaluierung der<br />
Zielerreichung mit sich bringen.<br />
Im großflächigen Anbau von Kulturen v.a. in den USA, Kanada, Argentinien <strong>und</strong> Brasilien liefern IP-Systeme auch in<br />
Koexistenz zwischen GVO-Kulturen <strong>und</strong> Nicht-GVO-Kulturen in diesen Ländern ein hohes Maß an Sicherheit einen<br />
bestimmten, vertragsmäßig vereinbarten GVO-Status der Warenlieferung zu gewährleisten. Auf Gr<strong>und</strong> der<br />
biologischen Gegebenheiten ist bei der Sojabohne der Gentransfer weitestgehend auf mechanische Verunreinigungen<br />
beschränkt, sodass geschlossene Produktionsprozesse ausreichen, um ein hohes Maß an Sicherheit für „GVO-<br />
Freiheit“ zu erzielen. Die Zusatzkosten sind damit ebenfalls eher mäßig, wird von den möglichen Kostenvorteilen <strong>und</strong><br />
Ertragszunahmen beim Anbau <strong>und</strong> den landwirtschaftlichen Erzeugungsprozessen von GV-Sojabohnen abgesehen<br />
(v.a. Unkrautbekämpfung, Bodenbearbeitung).<br />
Nach dem Einsatz von GVO bei Sojabohnen in breiterem Umfang ab 1996 wurden ab 2001 IP-Systeme für „GVO-<br />
freie“ Produktion angeboten. Besonders zu beachten ist für die Erzeugung von „GVO-freier“ Ware zusätzlich zu den<br />
Anforderungen im primären Sektor der Landwirtschaft die Trennung <strong>und</strong> Einrichtung getrennter Produktionsketten<br />
<strong>und</strong> Produktionsprozesse in allen Transport- <strong>und</strong> Verarbeitungsstufen v.a. in den Ölmühlen <strong>und</strong> der<br />
Futtermittelerzeugung.<br />
Beim Mais- <strong>und</strong> Raps-/Rübsenanbau fordern die IP-Systeme vor allem auf Gr<strong>und</strong> der biologischen Gegebenheiten des<br />
Risikos eines Gentransfers erhebliche Zusatzmaßnahmen <strong>und</strong> Anforderungen an eine „GVO-freie“ landwirtschaftliche<br />
Erzeugung. Auch sind die Monitoringkosten <strong>zur</strong> Evaluierung des Systems erheblich höher. Die Höhe von Schwellen-<br />
bzw. Grenzwerten für GV-Verunreinigung bei Mais bzw. Raps-/Rübsen beeinflusst in deutlich höherem Maße die<br />
Kosten des IP-Systems als bei Sojabohnen. Diese Betrachtung ist insofern von Relevanz, da der mögliche Einsatz von<br />
Substituten für das Sojaprotein, welches in erheblichem Maße aus Raps-/Rübsen <strong>und</strong> Maisexpellern stammt,<br />
zukünftig eine große Rolle spielen könnte.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 54 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 3: Verfügbarkeit von GVO – Anbau <strong>und</strong> Marktsituation<br />
3.4. Bewertung der Verfügbarkeit von „GVO-freien“ oder „gentechnikfreien“<br />
Ernteprodukten aus der landwirtschaftlichen Erzeugung in Europa <strong>und</strong> in Österreich<br />
Anzumerken ist, dass nur dann auf „gentechnikfreie“ Produkte Bezug genommen wird, wenn dazu entsprechende<br />
Daten, welche die Anforderungen an <strong>„gentechnikfrei“</strong> berücksichtigen, verfügbar sind.<br />
Wie aus der Abbildung 3-17 zu entnehmen ist, findet der GV-Sojabohnenanbau fast ausschließlich in Argentinien, den<br />
USA <strong>und</strong> Brasilien statt. Diese Länder sind allerdings gleichzeitig die Hauptproduktionsländer von Sojabohnen mit<br />
einem Anteil von 97% Prozent an der globalen Sojabohnenanbaufläche.<br />
Fläche [Mio ha]<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
Anbaufläche von GV-Sojabohnen<br />
Bisherige Entwicklung 1997-2004<br />
0<br />
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004<br />
Rest<br />
Brasilien<br />
Argentinien<br />
USA<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
In der Bewertung der Verfügbarkeit<br />
wurden nur die in Abbildung 3-17<br />
aufgelisteten Länder betrachtet, da<br />
keine Handelsdaten zu den übrigen GV-<br />
Soja-Anbauländern aus sicherer Quelle<br />
zu beziehen sind. Diese Tatsache kann<br />
aber außer Acht gelassen werden, da<br />
über 90% der Sojabohnen, <strong>und</strong> über<br />
99% des Sojaextraktionsschrots, welche<br />
die EU-15 importierten, aus diesen 3<br />
Hauptanbau- <strong>und</strong><br />
Hauptverarbeitungsländern stammen.<br />
Quelle: TRANSGEN WISSENSCHAFTSKOMMUNIKATION, Darstellung durch <strong>AGES</strong><br />
Abbildung 3-17: Die Entwicklung des weltweiten GVO-Sojabohnenanbaus von 1997 bis 2004<br />
Tabelle 3-40 stellt eine Gegenüberstellung der Importe von Sojabohnen <strong>und</strong> an SES in die EU im Jahr 2003 dar. Um<br />
mit einer Gesamtmenge zu rechnen, wurden die Mengen an SES zu Mengen an Sojabohnenäquivalenten<br />
umgerechnet.<br />
Import in die EU-15 gegliedert nach Herkunft Theoretisch verfügbare Menge<br />
Sojabohnen<br />
Sojaextraktionsschrot<br />
in<br />
Sojabohnenäquivalenten*<br />
Sojabohnen<br />
<strong>und</strong><br />
Sojaextraktionsschrot<br />
in Sojabohnenäquivalenten*<br />
Anteil<br />
“GVO-freie“<br />
Sojabohnenproduktion<br />
Tabelle 3-40: Theoretisch verfügbare Menge an „GVO-freiem“ Sojabohnen<br />
„GVO-freier“<br />
Sojabohnen-<br />
äquivalente-<br />
Import in die<br />
EU-15<br />
Quelle: Berechnung durch <strong>AGES</strong> anhand von Daten aus FAO, Toepfer, Eurostat <strong>und</strong> Transgen<br />
*Umrechnung von Sojaextraktionsschrot auf Sojabohnenäquivalent durch <strong>AGES</strong>; Umrechnungsfaktor 1:0,8 (100% Bohnen ergeben<br />
20% Öl <strong>und</strong> 80% Schrot laut persönliche Mitteilung vom Verband deutscher Ölmühlen)<br />
Umgerechnet wurden im Jahr 2003 ca. 40 Mio. t Sojabohnenäquivalente in die EU-15 importiert, davon 95% aus<br />
Argentinien, Brasilien <strong>und</strong> USA. Durch die GVO-Flächenanteile in den jeweiligen Anbauländern lassen sich<br />
„GVO-freie“<br />
Sojabohnen-<br />
äquivalente<br />
im jeweiligen<br />
Erzeugungsland<br />
[1000 t] [1000 t] [1000 t] [%] [1000 t] [1000 t]<br />
Herkunft 2003 2003 2003 2003 2003 2003<br />
Argentinien 310 12 788 13 098 8 1 048 2 673<br />
Brasilien 9 736 11 054 20 790 84 17 464 43 120<br />
USA 5 784 59 5 843 17 993 11 334<br />
Welt 17 272 24 194 41 466 50 20 733 95 356<br />
theoretische Produktionsmengen für „GVO-freie“ Sojabohnen errechnen. Im Jahr 2003 waren theoretisch über 95<br />
Mio. t „GVO-freie“ Sojabohnenäquivalente auf Gr<strong>und</strong> der Anbaustatistiken verfügbar. Diese Menge entspricht 2,3-mal<br />
Seite 55 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 3: Verfügbarkeit von GVO – Anbau <strong>und</strong> Marktsituation<br />
die Menge an Soja, die die EU-15 im selben Jahr an Sojabohnenäquivalente importierte. Österreich importierte laut<br />
FAO im Jahr 2003 18.189 t Sojabohnen <strong>und</strong> 577.156 t SES (gleichzusetzen mit 721.445 t Sojabohnenäquivalenten).<br />
Dies ergibt eine Gesamtsumme von 739.634 t (sieheTabelle 3-35). Diese Menge Sojabohnenäquivalent, die<br />
Österreich im Jahr 2003 importierte, entsprach ca. einen halben Prozentpunkt der theoretischen, weltweiten<br />
Produktionsmenge an „GVO-freien“ Sojabohnen im selben Jahr. Diese Darstellung beschreibt wohl nur die<br />
theoretische Verfügbarkeit. Die tatsächliche Verfügbarkeit am Markt ist durch Vermengung von GVO- <strong>und</strong> NICHT-<br />
GVO-Sojabohnen deutlich geringer. Initiativen von Unternehmen <strong>und</strong> Zertifizierungsstellen (siehe auch Punkt<br />
3.3.1.1.) zeigen allerdings, dass in Anbetracht des Marktes für „GVO-freies“ Lecithin <strong>und</strong> Öl wie auch die Nachfrage<br />
nach „GVO-freiem“ SES auch erhebliche Mengen an „GVO-freiem“ SES verfügbar gemacht werden können.<br />
Einem linearen Trend folgend werden mittelfristig die Anbauflächen für GV-Sojabohnen nach wie vor stärker steigen<br />
als die Gesamt-Anbaufläche (siehe Abbildung 3-18). Die Entwicklungsprognose der Anbaufläche von Sojabohnen bis<br />
2008 stützt sich auf die von der FAO prognostizierte Produktionssteigerung von 2,3% p.a. Für die Prognose der<br />
Entwicklung der Anbaufläche von GV-Sojabohnen bis 2008 wurde eine lineare Steigerung angenommen.<br />
Voraussichtlich sind im Jahr 2008 nur mehr ca. 31% der weltweit angebauten Sojabohnen „GVO-frei“(2003 waren es<br />
noch ca. 50%).<br />
Die verfügbaren Flächen <strong>und</strong> Mengen mit Nicht-GVO-Sojabohnen sind, im Vergleich zum Bedarf, für Österreich nach<br />
wie vor gegeben. Allerdings ist bei Fortsetzung des dargestellten Trends eine Verengung des Angebotes an „GVO-<br />
freien“ Sojabohnenprodukten längerfristig (> 5 Jahre) zu erwarten, ergibt sich aufgr<strong>und</strong> von Marktgegebenheiten in<br />
der Zwischenzeit nicht eine signifikante Trendwende. Auf der Basis der vorliegenden Daten ergibt sich wohl eine<br />
Einengung der Verfügbarkeit von GVO-freien Sojabohnen auf wenige Herkunftsländer.<br />
In Abschätzung des Wachstums der GV-Sojabohnenproduktion auf Basis der vergangenen Jahre, ergibt sich für 2008<br />
theoretisch eine Sojabohnenproduktion ohne Verwendung von GV-Sorten von geschätzten 88 Mio. t. Die Deckung<br />
des Bedarfs von Österreich ist theoretisch erzielbar. Unter Bedachtnahme der 2007 verfügbaren „GVO-freien“<br />
Eiweißsubstitute aus der Biospriterzeugung sinkt übrigens der theoretische Anteil des Bedarfs Österreichs an der<br />
weltweiten Sojabohnengesamtproduktion auf unter einem halben Prozentpunkt - um in den nächsten Jahren gemäß<br />
vorliegendem Trend wieder anzusteigen.<br />
Es ist daher gemäß der Datenlage die Verfügbarkeit von „GVO-freiem“ Protein aus Sojabohnen <strong>und</strong>/oder Substituten<br />
theoretisch – <strong>und</strong> soweit die aktuellen Datenangaben von Unternehmen zuverlässig sind – auch in der praktischen<br />
Umsetzung gewährleistet. Dieser Umstand sagt allerdings nichts über die möglichen Produktpreise aus. Es ist<br />
allerdings anzunehmen, dass gerade die Nebenprodukte aus der Biospriterzeugung betreffend den Kosten im<br />
Vergleich zu den eingesetzten Rohstoffen (Getreide, Mais, Zuckerrüben) zu betrachten sind. Davon unberührt sind<br />
allerdings die Marktpreise zu betrachten. Hierzu fällt auf, dass die Nebenprodukte aus der Biospriterzeugung bisher<br />
ähnliche Preisentwicklungen wie Sojaextraktionsschrot durchlaufen. Besondere Sensibilität erhält die Betrachtung der<br />
Marktpreise im Vergleich zu Produkt- bzw. Rohstoffkosten insofern, als die Rohstoffe für die Biospriterzeugung aus<br />
der Landwirtschaft kommen <strong>und</strong> die Nebenprodukte bzw. Sojabohnensubstitute wiederum in der Fütterung in der<br />
Landwirtschaft Verwendung finden. Jedenfalls gibt die Datenlage eine theoretische <strong>und</strong> technische Verfügbarkeit<br />
einer „GVO-freien“ Eiweißkomponente in der Futterration (aus „GVO-freiem“ Sojaextraktionsschrot <strong>und</strong>/oder aus<br />
Substituten) wieder. Die Vertrags- <strong>und</strong> Marktsituation im Kontext mit der Preisgestaltung für „GVO-freie“ Rohstoffe<br />
<strong>und</strong> Futtermittelausgangserzeugnisse einerseits <strong>und</strong> die Marktsituation <strong>und</strong> Preisgestaltung für Lebensmittel tierischer<br />
Herkunft (Fleisch, Milch, Eier) <strong>und</strong> die Akzeptanz durch die Konsumenten andererseits, werden allerdings die<br />
Machbarkeit des Einsatzes einer „GVO-freien“ Fütterung <strong>und</strong> eines erfolgreichen Qualitätsprogrammes bestimmen.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 56 von 272
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
Anbaufläche von Sojabohnen<br />
Schätzung der mittelfristigen Entwicklung 1997-2008<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 3: Verfügbarkeit von GVO – Anbau <strong>und</strong> Marktsituation<br />
relative<br />
Anbaufläche<br />
Sojabohnen<br />
insgesamt<br />
relative<br />
Anbaufläche<br />
GVO-<br />
Sojabohnen<br />
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008<br />
Quelle: Darstellung durch <strong>AGES</strong> nach TRANSGEN<br />
WISSENSCHAFTSKOMMUNIKATION <strong>und</strong> FAOSTAT 2004<br />
Abbildung 3-18: Schätzung der mittelfristigen Entwicklung der<br />
Anbauflächen von (GV-)Sojabohnen, weltweit<br />
Jahr<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Anbaufläche<br />
Sojabohne<br />
[Mio. ha]<br />
Anbaufläche<br />
GV-Sojabohne<br />
[Mio. ha]<br />
1997 66,95 5,00<br />
1998 70,97 14,54<br />
1999 72,11 22,66<br />
2000 74,40 29,13<br />
2001 76,83 38,97<br />
2002 78,85 41,85<br />
2003 83,46 40,92<br />
2004 91,61 46,45<br />
2005 93,72 56,16<br />
2006 95,87 60,36<br />
2007 98,08 64,59<br />
2008 100,33 68,93<br />
Quelle: Berechnungen durch <strong>AGES</strong> auf Basis von<br />
OECD OUTLOOK 2004 TRANSGEN WISSENSCHAFTS-<br />
KOMMUNIKATION <strong>und</strong> FAOSTAT 2004<br />
Tabelle 3-41: Schätzung der mittelfristigen<br />
Entwicklung der Anbauflächen von (GV-) Sojabohnen,<br />
weltweit<br />
Seite 57 von 272
Zusammenfassung:<br />
• Anbau<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 3: Verfügbarkeit von GVO – Anbau <strong>und</strong> Marktsituation<br />
Sojabohne wird weltweit auf 91 Mio. ha angebaut. Führende Produzenten sind die USA, gefolgt von Brasilien <strong>und</strong><br />
Argentinien. Europa ist in der Sojabohnenproduktion unbedeutend. Jedoch ist in den neuen Mitgliedstaaten der<br />
Sojabohnenanbau steigend. Mittelfristig soll die Sojabohnenproduktion in der EU-15 um 11% steigen. Mais wird<br />
weltweit auf 145 Mio. ha angebaut. Die USA sind führend im Anbau von Mais, 8% der Weltproduktion wird in der EU-<br />
25 erzeugt. Mittelfristig soll die Maisproduktion in der EU-15 um 7% steigen. Raps wird weltweit auf 26 Mio. ha<br />
angebaut. Die EU-25 produziert ein Drittel der Weltproduktion, mittelfristig soll die Produktion um 9% steigen.<br />
Die geringe Erzeugung von Eiweißpflanzen ist in Europa auf wenige Länder konzentriert: Frankreich, das Vereinigte<br />
Königreich <strong>und</strong> Deutschland. Österreich baut derzeit auf 8% seiner Ackerfläche Öl- <strong>und</strong> Eiweißpflanzen an, die als<br />
Alternative zu Sojabohnen verwendet werden können bzw. bereits Verwendung finden. Die zuletzt festgelegt<br />
Zumischungsverpflichtung von „Biotreibstoff“ in Benzin <strong>und</strong> Diesel in der EU führt zwangsweise zu einer neuen<br />
Situation am Proteinmarkt für Futtermittel. Raps, Mais, Getreide, <strong>und</strong> Zuckerrübe werden die Hauptkulturen <strong>und</strong><br />
Endprodukte sein, welche für die Biosprit- <strong>und</strong> Biodieselerzeugung eingesetzt werden. Das Risiko einer GVO-<br />
Verunreinigung der Eiweiß-Nebenprodukte aus europäischer Erzeugung liegt aktuell beim Einsatz von Mais am<br />
höchsten, da schon GV-Sorten zum Anbau auf dem europäischen Markt sind. Raps ist Selbstbefruchter mit hoher<br />
Fremdbefruchtungsrate <strong>und</strong> zählt zu den Kulturarten, für die in der aktuellen Struktur der österreichischen<br />
Landwirtschaft die Einrichtung von geschlossenen Anbaugebieten <strong>und</strong> Regionen sowie die Umsetzung geschlossener<br />
Produktionsprozesse zum Schutz vor GVO-Verunreinigungen unerlässlich ist. Die Vermeidung einer Verunreinigung<br />
mit GVO ist bei den selbstbefruchtenden Getreidearten (Weizen, Gerste, Hafer) <strong>und</strong> bei der Sojabohne durchaus<br />
beherrschbar. Eine absehbare Zulassung von GV-Rapssorten würde das Potenzial zum Schließen der heimischen<br />
Eiweißlücke, besonders durch die Biodieselproduktion sehr in Frage stellen. Die Präsenz von Substituten in der EU<br />
<strong>und</strong> in Österreich eröffnet die Möglichkeit, die Abhängigkeit von Sojabohnenimporten zu reduzieren. Künftige<br />
Entwicklungen auf diesem Sektor werden letztlich Einfluss auf den Preis „GVO-freier“ Eiweißprodukte in der<br />
Futtermittelerzeugung haben. Es wird zu analysieren sein, inwiefern der Proteinträger Sojabohne durch andere<br />
pflanzliche Ernte- <strong>und</strong> Handelsprodukte substituierbar ist.<br />
• Gentechnisch veränderte Pflanzen<br />
Bereits 5% der Weltanbauflächen werden mit transgenen Sorten bepflanzt. Am schnellsten dehnten sich von 2003<br />
auf 2004 die Anbauflächen von GV-Mais (+25%) aus, gefolgt von GV-Raps (+20%) <strong>und</strong> GV-Sojabohne (+17%).<br />
Sojabohne nimmt im Vergleich zu anderen GV-Pflanzen eine Sonderstellung ein, da transgene Sojabohne mit 53%<br />
der weltweiten Sojabohnen-Anbaufläche <strong>und</strong> 60% der weltweiten GVO-Anbaufläche bei weitem den größten Anteil<br />
einnimmt. Während in Argentinien <strong>und</strong> in den USA hauptsächlich GV-Sojabohne angebaut wird, beträgt der<br />
Flächenanteil von GV-Sojabohne in Brasilien 22%.<br />
Die USA erzeugen 97% der Weltproduktion an GV-Mais. Mais ist die einzige GV-Pflanze, die in der EU-25 für<br />
kommerzielle Zwecke angebaut wird.<br />
Transgener Raps konnte sich nur in den USA <strong>und</strong> v.a. in Kanada etablieren.<br />
• Internationaler Handel<br />
Da die europäische Landwirtschaft auf Gr<strong>und</strong> klimatischer <strong>und</strong> agronomischer Bedingungen nicht über die<br />
Kapazitäten verfügt, die Lebens- <strong>und</strong> Futtermittelindustrie ausreichend mit pflanzlichen Rohstoffen <strong>und</strong> Erzeugnissen<br />
zu versorgen, ist es unumgänglich die Warenströme insbesondere die Importe nach Europa, das weltweit den<br />
Hauptimporteur an landwirtschaftlichen Produkten stellt, zu analysieren.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 58 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 3: Verfügbarkeit von GVO – Anbau <strong>und</strong> Marktsituation<br />
Die Importmengen der Kulturen Sojabohne, Mais <strong>und</strong> Raps werden dargestellt. Besonders bei der Sojabohne zeigt<br />
sich, dass eine sehr starke Abhängigkeit von Ländern mit GVO-Anbau besteht. Ein Gesamtimport von über 41 Mio. t<br />
Sojabohnenäquivalent im Jahr 2003 drückt dies deutlich aus. Diese Importmenge steht eine Sojabohnenproduktion<br />
der EU 15 von 0,6 Mio. t im Jahr 2003 gegenüber. Hauptexporteure zählen zu den weltweit größten Produzenten,<br />
wie Brasilien, Argentinien <strong>und</strong> Kanada.<br />
Die Maisimportmenge von ca. 4,4 Mio. t steht einer europäischen Produktion von 33,9 Mio. t im Jahr 2003<br />
gegenüber. Die Hauptexporteure sind die USA, Argentinien, Brasilien <strong>und</strong> Ungarn.<br />
Raps wird in solchen Mengen produziert, dass ausreichende Ware am europäischen Markt aus europäischer<br />
Produktion verfügbar ist. Dies spiegelt sich in verhältnismäßig geringen Einfuhren wieder. In der EU 15 wurden im<br />
Jahr 2003 9,5 Mio. t Raps produziert <strong>und</strong> nur 0,7 Mio. t Rapssaat <strong>und</strong> Rapsschrot importiert.<br />
• Identity Preservation<br />
Dieses Verfahren wird seit 2001 angeboten. Bei dem Verfahren der Identity Preservation wird die Identität des<br />
Erntegutes vom Saatgut bis hin zum Enderzeugnis belegt. Um eine „GVO-Freiheit“ des Produktes gewährleisten zu<br />
können, müssen alle Produktionsschritte innerhalb einer Produktionskette kontrolliert werden <strong>und</strong> nachvollziehbar<br />
sein.<br />
Innerhalb dieses Produktionsverfahrens gibt es verschiedene Systeme, die je nach Kontrollintensität in „Hard IP“ <strong>und</strong><br />
„Soft IP“ unterteilt werden. Als Beispiel einer „Soft IP“ wäre der Beginn der Kontrolle des Warenflusses erst bei<br />
Transportbeginn z.B. bei Beladen der Seesschiffe zu nennen. Die Begriffe „Hard IP“ <strong>und</strong> „Soft IP“ ergeben allerdings<br />
keine eindeutig definierten Systeme. Es bedarf daher einer Fall- zu Fall-Analyse was darunter letztlich zu verstehen<br />
ist.<br />
• Verfügbarkeit<br />
Voraussichtlich sind im Jahr 2008 nur mehr ca. 31% der weltweit angebauten Sojabohnen „GVO-frei“. Im Jahr 2003<br />
– als auf 50% der weltweiten Anbaufläche GV-Sojabohnen angebaut worden waren - entsprach die von der EU-15<br />
jährlich importierte Menge an Sojabohnenäquivalent etwa 43% der theoretischen, weltweiten Produktionsmenge an<br />
„GVO-freier“ Sojabohne. Für Österreich betrug diese Menge ca. 0,50%. Die nicht für die GVO-Erzeugung verfügbare<br />
Fläche <strong>und</strong> Mengen sind im Vergleich zum österreichischen Bedarf nach wie vor gegeben <strong>und</strong> werden es mittelfristig<br />
auch bleiben. Die Verfügbarkeit von „GVO-freiem“ SES auf dem Weltmarkt ist letztendlich abhängig von der<br />
Einhaltung der für die „GVO-freie“ Erzeugung zusätzlichen Anforderungen im primären Sektor sowie von der<br />
Entwicklung <strong>und</strong> Erhaltung einer Produktionskette für „GVO-freie“ Waren in der Futtermittel- <strong>und</strong><br />
Lebensmittelindustrie.<br />
Anzumerken ist, dass keine Daten vorliegen, die die Verfügbarkeit von Sojabohnen oder anderen Rohstoffen (über<br />
die Erzeugung in Österreich hinaus), welche den Anforderungen an „Gentechnikfreiheit“ genügen, bestätigen.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 59 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 4: Verfügbarkeit Futtermittel<br />
4. Abschätzung der Verfügbarkeit von Futtermittel <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> „GVOfrei“<br />
oder <strong>„gentechnikfrei“</strong> - V. KOLAR <strong>und</strong> TH. KICKINGER, Institut für Futtermittel, <strong>AGES</strong><br />
4.1. Verbreitung von GVO in der Futtermittelherstellung, Einschätzung der<br />
zukünftigen Entwicklung, Aspekte der Verfügbarkeit <strong>und</strong> Optionen <strong>zur</strong><br />
Versorgungssicherheit in der Futtermittelerzeugung <strong>und</strong> –anwendung<br />
4.1.1. Futtermittelausgangserzeugnisse, Rohstoffe aus landwirtschaftlicher Erzeugung<br />
Die österreichische Mischfutterindustrie produziert jährlich zirka 1.124.000 Tonnen Mischfutter (vgl. AGT, 2003).<br />
Davon entfallen ca. 35% auf den Geflügelsektor, 29% auf den Rindersektor <strong>und</strong> 19% auf den Schweinesektor. Der<br />
Rest entfällt auf Pferde- <strong>und</strong> Heimtierfutter. Die Menge an hofeigenen Futtermitteln (Selbstmischer) wird auf zirka<br />
2,6 bis 3,3 Millionen Tonnen pro Jahr geschätzt.<br />
Dies ergibt für Österreich insgesamt eine Futtermenge (Mischfutter, zusätzlich zum Rauhfutter) aus industrieller <strong>und</strong><br />
hofeigener Produktion von ca. 4 Millionen Tonnen pro Jahr.<br />
Die Produktionsmenge von heimischer Sojabohne beträgt ca. 44.000 t pro Jahr. 26.000 t davon werden in der<br />
Futtermittelindustrie verarbeitet.<br />
Als „GVO-Futtermittel“ in der EU zugelassen sind folgende Mais-, Raps- <strong>und</strong> Sojakonstrukte, welche jedoch aufgr<strong>und</strong><br />
nationaler Verbotsregelungen unterschiedlichen Einschränkungen unterliegen (siehe Kapitel 2.1.2.3.):<br />
Mais:<br />
• „Gentechnisch veränderter“ Mais (Zea Mays L.) mit der kombinierten Veränderung der Insektizidwirkung des<br />
BT-Endotoxin-Gens <strong>und</strong> erhöhter Toleranz gegenüber dem Herbizid-Gulfosinatammonium (BT 176);<br />
Spezifischer Erkennungsmarker: SYN-EV176-9<br />
• „Gentechnisch veränderter“ Mais (Zea Mays L.), Linie Mon 810; �Spezifischer Erkennungsmarker: MON-<br />
ØØ81Ø-6“<br />
• „Gentechnisch veränderter“ Mais (Zea Mais L.), T 25; Spezifischer Erkennungsmarker: ACS-ZMØØ3-2“<br />
• „Gentechnisch veränderter“ Mais (Zea Mays L.), Linie Bt-11; Spezifischer Erkennungsmarker: SYN-<br />
BTØ11-1<br />
• „Gentechnisch veränderter“ Mais mit Glyphosat Toleranz (Zea Mays L.), Linie NK 603; Spezifischer<br />
Erkennungsmarker: MON-ØØ603-6<br />
Raps:<br />
• Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1, RF1; Spezifischer Erkennungsmarker: ACS-BNØØ1-4, ACS-<br />
BNØØ4-7, ACSBNØØ4-7xACS-BNØØ1-4<br />
• Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1, RF2; Spezifischer Erkennungsmarker: ACS-BNØØ2-5, ACS-<br />
BNØØ4-7, ACSBNØØ4-7xACS-BNØØ2-5<br />
• Brassica napus L. ssp. oleifera; Spezifischer Erkennungsmarker: ACS-BNØØ7-1<br />
• Brassica napus L. GT 73; Spezifischer Erkennungsmarker: MON-ØØØ73-7<br />
Soja:<br />
• Glycine max. L. mit erhöhter Verträglichkeit des Herbizids Glyphosat; Spezifischer Erkennungsmarker:<br />
MON-Ø4Ø32-6<br />
Um die Eiweißversorgung unserer Nutztiere sicherstellen zu können, wird Sojaextraktionsschrot (SES) aus dem<br />
Ausland importiert, hauptsächlich aus Brasilien, USA <strong>und</strong> Argentinien, einerseits direkt, andererseits <strong>und</strong> bisher<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 60 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 4: Verfügbarkeit Futtermittel<br />
überwiegend über andere EU-Mitgliedstaaten (siehe Kapitel 3). Im Jahr 2003 wurde eine Menge von zirka 600.000 t<br />
SES nach Österreich importiert. Der durchschnittliche Import der letzten Jahre liegt etwa bei 550.000 t SES <strong>und</strong><br />
entspricht etwa auch dem durchschnittlichen Verbrauch an SES pro Jahr in Österreich (siehe Kapitel 3).<br />
Die importierte SES-Gesamtmenge gelangt zu etwa ¾ in Futter für Monogastrier (Schwein, Geflügel), die Restmenge<br />
geht in die Wiederkäuerfütterung <strong>und</strong> sonstiges Futter.<br />
Ungefähr die Hälfte des importierten SES wird von der Mischfutterindustrie verarbeitet, die andere Hälfte wird von<br />
den Tierhaltern im Agrarhandel gekauft <strong>und</strong> in hofeigenen Mischungen verarbeitet, dies vor allem <strong>zur</strong> Schweine- <strong>und</strong><br />
Rinderfütterung. In der Geflügelproduktion sind Hofmischer eher seltener anzutreffen.<br />
Zirka 95% des importierten SES stammen aus gentechnisch veränderter Produktion, nur 5% davon sind „GVO-freier"<br />
SES. Im Zuge zweier Fragebogenaktionen an Mischfutterhersteller bzw. an Großhändler ergab sich, dass aktuell ca.<br />
30.000 t (2004: 28.939 t) „GVO frei“ deklarierter SES in Österreich für Futtermittel verwendet wird.<br />
Wie Tabelle 4-1 <strong>und</strong> Abbildung 4-1 zeigen, geben bereits 60 Prozent der befragten Mischfutterproduzenten an,<br />
teilweise „GVO-freien“ SES <strong>zur</strong> Herstellung von „GVO freiem“ Futter zu verwenden, 34 % verwenden keinen „GVO-<br />
freien“ SES <strong>und</strong> 6% enthielten sich der Antwort.<br />
Laut unseren Recherchen stammt „GVO-freier“ SES zumeist aus Brasilien <strong>und</strong> wird von dort entweder direkt als SES<br />
importiert oder als Sojabohne in einer deutschen Ölmühle zu SES verarbeitet.<br />
„GVO-freier“ SES, das heißt eigentlich nicht kennzeichnungspflichtiger SES, wird derzeit in Österreich in zwei<br />
Reinheitsstufen bzw. Qualitätsstufen angeboten. Und zwar in den Kategorien 0,9% <strong>und</strong> 0,1% GVO für zufällige <strong>und</strong><br />
technisch unvermeidbare Verunreinigungen, sowie in Hard-IP <strong>und</strong> Soft-IP Qualität.<br />
„GVO-freier“ SES mit 0,1 % bis 0,9% Verunreinigungen wurde bis vor kurzem nur von einem Händler in Österreich<br />
angeboten.<br />
Anzumerken ist, dass wie im Kapitel 3 ausgeführt keine Daten vorliegen, die die Verfügbarkeit von Sojabohnen oder<br />
anderen Rohstoffen (über die Erzeugung in Österreich hinaus), welche den Anforderungen an „Gentechnikfreiheit“<br />
genügen, bestätigen.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 61 von 272
Tabelle 4-1: Fragebogen-Verwenden Sie “GVO-freien“ SES?<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 4: Verfügbarkeit Futtermittel<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Häufigkeit Prozent<br />
keine Angabe 2 6,3<br />
0,9 % „GVO verunreinigten“ SES 13 40,6<br />
0,1 % „GVO verunreinigten“ SES 4 12,5<br />
0,1 <strong>und</strong> 0,9 % „GVO verunreinigten“ SES 2 6,3<br />
Nein 11 34,4<br />
Gesamt 32 100<br />
Prozent<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
34<br />
nein<br />
41<br />
0,9 % GVO<br />
13<br />
0,1 % GVO<br />
6<br />
0,1 <strong>und</strong> 0,9 % GVO<br />
6<br />
keine Angabe<br />
Abbildung 4-1: Fragebogen-Verwenden Sie „GVO-freien“ SES?<br />
Anmerkungen <strong>zur</strong> Verfügbarkeit <strong>und</strong> Versorgungssicherheit:<br />
Die Verfügbarkeit von „gentechnikfreien“ Rohstoffen, insbesondere von „GVO-freiem“ SES, für die<br />
Futtermittelherstellung ist eine theoretische Frage, da aktuell überwiegend, nämlich zu 95 % als GVO<br />
gekennzeichneter SES, verwendet wird. „GVO-freier“ SES ist zwar derzeit am Weltmarkt vorhanden, doch erst die<br />
praktische Nachfrage kann die wirkliche Verfügbarkeit <strong>und</strong> vor allem den Preis ergeben.<br />
Im Kalenderjahr 2003 wurden 605.327 Tonnen SES nach Österreich importiert (Statistik Austria). Im Zeitraum von<br />
1.7.2003 -1.7.2004 wurde laut Statistik Austria eine Menge von 538.165 Tonnen SES eingeführt. Für das Jahr 2004<br />
wurden im Zeitraum Jänner-Dezember 490.183,70 t an SES importiert. Von den erwähnten Mengen sind ca. 5%<br />
„GVO-freier“ SES <strong>und</strong> ca. 95% entfallen auf als GVO gekennzeichneten SES.<br />
Fragebogenauswertung zu Sojabohnen <strong>und</strong> SES:<br />
Nachfragen beim bis vor kurzem einzigen österreichischen Importeur, der zuletzt nach eigenen Aussagen etwa<br />
20.000 t „GVO-freien“ SES eingeführt hat, ergaben, dass dieser sich zutraut, auch größere Mengen direkt aus<br />
Brasilien aufzutreiben <strong>und</strong> liefern zu können. Diese Aussage wurde bis vor kurzem von anderen österreichischen<br />
Landesproduktenhändlern aus mehreren Gründen sehr kritisch betrachtet. Die Hälfte (drei) der heimischen<br />
Großhändler für landwirtschaftliche Produkte <strong>und</strong> Rohstoffe könnte jedoch jeweils zwischen 10.000 <strong>und</strong> 50.000 t<br />
„GVO-freien“ SES umschlagen, einer sogar über 100.000 t, wie die folgenden Abbildungen veranschaulichen. Im<br />
persönlichen Gespräch wurde versichert, dass das Auftreiben dieser Mengen <strong>zur</strong> Zeit noch problemlos funktionieren<br />
würde <strong>und</strong> sollte es vom Markt gefordert werden, die angegebenen Tonnagen noch überboten werden könnten.<br />
Seite 62 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 4: Verfügbarkeit Futtermittel<br />
Tabelle 4-2: Fragebogen-Welche Höchstmenge an „GVO-freiem“ SES können Sie umschlagen?<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Häufigkeit Prozent<br />
bis 10.000 t SES 2 33,3<br />
von 10.001 t bis zu 50.000 t SES 3 50<br />
über 100.000 t SES 1 16,7<br />
Gesamt 6 100<br />
Prozent<br />
6 0<br />
5 0<br />
4 0<br />
3 0<br />
2 0<br />
1 0<br />
0<br />
3 3<br />
b is 1 0 . 0 0 0 t<br />
5 0<br />
1 0 .0 0 1 b is 5 0 . 0 0 0 t<br />
1 7<br />
ü b e r 1 0 0 . 0 0 0 t<br />
Abbildung 4-2: Fragebogen-Welche Höchstmenge an „GVO-<br />
freiem“ SES können Sie umschlagen?<br />
Den Recherchen nach gibt es innerhalb Europas noch drei weitere Quellen, wo brasilianischer SES in „GVO freier“<br />
Qualität verfügbar ist.<br />
Eine Ölmühle in Deutschland importierte bisher „GVO freie“ Sojabohnen aus Brasilien <strong>und</strong> verarbeitet diese von Mai<br />
bis Oktober. Die Kapazität dieser Ölmühle liegt bei 1.000-1.500 Tonnen pro Tag, d.h. pro Saison stehen maximal<br />
270.000 Tonnen <strong>zur</strong> Verfügung. Dies entspricht weniger als der Hälfte des österreichischen Bedarfes, ungeachtet<br />
dessen, dass Österreich nicht als einziger K<strong>und</strong>e beliefert wird <strong>und</strong> eine Kontinuität über das ganze Jahr hier nicht<br />
gegeben ist.<br />
Zwei weitere Werke in Deutschland bieten seit 2004 „GVO-freien“ SES in größeren Mengen <strong>und</strong> diese auch in „HARD<br />
IP Qualität“ an. Beide Werke führen über den an der Weser gelegenen Hafen Brake in Norddeutschland größere<br />
Mengen an SES ein <strong>und</strong> beziehen direkt über eine brasilianische Agrargenossenschaft (Cooperative), die laut eigenen<br />
Angaben ganz Mitteleuropa mit „GVO-freiem“ SES versorgen könnte. Das erste Werk gab an, eine Menge von 2<br />
Millionen Tonnen SES in „Hard IP Qualität“ übers Jahr verteilt liefern zu können. Das zweite Werk wollte derzeit noch<br />
keine offiziellen Angaben <strong>zur</strong> Menge machen, der österreichische Bedarf von 550.000 - 600.000 Tonnen pro Jahr<br />
könnte jedoch ohne Probleme gedeckt werden. Inwieweit diese schriftlichen Angaben (per e-Mail) tatsächlich<br />
eingehalten würden, kann an dieser Stelle nicht beurteilt werden. Es wird aber die in Kapitel 3 angeführte<br />
theoretische <strong>und</strong> technische Verfügbarkeit bestätigt.<br />
Die „Hard IP Ware“ wird vom Anbau über jede Stufe des Transportes nach Deutschland bis ins Lager kontrolliert. Die<br />
Ware ist entweder versichert oder der brasilianische Lieferant verpflichtet sich vertraglich <strong>zur</strong> Neulieferung, sollte der<br />
Schwellenwert von 0,9% überschritten werden. Proben werden bereits beim Abschwimmen des Schiffes aus dem<br />
brasilianischen Hafen <strong>und</strong> vor dem Löschen der Ladung in Deutschland durch eine unabhängige Prüfstelle gezogen.<br />
Ein repräsentatives Muster wird an eine anerkannte Untersuchungsstelle in Deutschland geschickt. Das Ergebnis wird<br />
ca. 8-10 Tage nach dem Abschwimmen schriftlich bekannt gegeben, sodass bereits vor Eintreffen des Schiffes im<br />
Hafen bekannt ist, ob der SES „GVO-frei“ (unter 0,9%) ist oder nicht. Die gesamte Lieferung erfolgt kontinuierlich<br />
über das ganze Jahr, im Gegensatz <strong>zur</strong> oben erwähnten Ölmühle, die nur auf eine bestimmte Saison <strong>und</strong> auch in der<br />
Menge beschränkt ist. Der Weitertransport vom deutschen Hafen nach Österreich kann durch Binnenschiffe (über die<br />
Seite 63 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 4: Verfügbarkeit Futtermittel<br />
Weser, Mittellandkanal, Rhein, Main, Main-/Donaukanal <strong>und</strong> die Donau), aber auch über LKW oder die Eisenbahn<br />
erfolgen.<br />
Ein besonderes Augenmerk müsste darauf gelegt werden, dass vor <strong>und</strong> während der Schiffsentladung keine<br />
Vermischung mit konventionellem SES stattfinden kann. Eine Problematik der Binnenschifffahrt soll an dieser Stelle<br />
nicht unerwähnt bleiben. Erfahrungen haben gezeigt, dass es besonders in den Wintermonaten auf der zugefrorenen<br />
Donau (von Dezember bis Februar) zu Transportproblemen kommen kann. Bei Schwierigkeiten würde sich der<br />
Versorgungsengpass für „GVO-freien“ SES im unverhältnismäßigen Ausmaß verstärken, da hier nicht wie beim als<br />
GVO gekennzeichneten SES rasch auf andere Lieferquellen <strong>zur</strong>ückgegriffen werden kann.<br />
Ist die Ware laut Untersuchungsergebnis „GVO-frei“, müsste der SES auch in eigenen Lagerzellen gelagert werden.<br />
Ein Problem, welches vom österreichischen SES-Handel mehrfach angesprochen wurde, ist eine etwaige Verteuerung<br />
aufgr<strong>und</strong> einer erhöhten Nachfrage <strong>und</strong> der Abhängigkeit von nur wenigen Anbietern. Kapitel 8 behandelt diese<br />
Thematik genauer. Aber auch die Haftungsfrage bei Überschreitung des Verunreinigungsgrenz(-schwellen)wertes<br />
wird als großes Problem bei der Umsetzung von „GVO-Freiheit“ oder „Gentechnikfreiheit“ in der Fütterung gesehen.<br />
Versicherungen werden vom Großhandel als unfinanzierbar eingeschätzt, sollten alle österreichischen Händler eine<br />
diesbezügliche Versicherung abschließen wollen. Weiters ist die Umsetzung der Kleinlogistik zu den Landwirten, im<br />
Falle von Hofmischern, noch nicht geklärt. Es können zwar große Mengen an „GVO-freiem“ SES nach Österreich<br />
geliefert werden, die Versorgung <strong>und</strong> Gewährleistung der „GVO-freien“ Lieferungen an die einzelnen Landwirte gilt es<br />
jedoch nachweislich abzusichern. Es ist zu bedenken, dass der österreichische Landwirt gewohnt ist, SES vom<br />
nächstgelegenen „Lagerhaus/Landesproduktenhandel“ zu erwerben. Um dieses Problem zu erörtern, bedarf es einer<br />
weiteren Betrachtung der Kleinlogistik, welche den Rahmen der hier vorliegenden Arbeit sprengen würde.<br />
Garantien <strong>zur</strong> Versorgungssicherheit über einen längerfristigen Zeitraum (mehr als drei Jahre) werden von den<br />
Befragten nicht abgegeben, da gewisse Entwicklungen (Anbausituation, Nachfrage,…) nicht vorausgesagt werden<br />
können. Die Auswertung des Fragebogens an den landwirtschaftlichen Großhandel ergab, dass lediglich ein<br />
Unternehmen <strong>und</strong> somit knapp 17 % die Versorgungssicherheit über 3 Jahre hinaus garantiert sieht.<br />
Tabelle 4-3: Fragebogen-Wie lange kann „GVO-freie“ SES-Menge garantiert werden?<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Häufigkeit Prozent<br />
dieses Jahr 4 66,7<br />
die nächsten 1 bis 2 Jahre 1 16,7<br />
über 3 Jahre 1 16,7<br />
Gesamt 6 100<br />
Seite 64 von 272
Prozent<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
67<br />
dieses Jahr<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 4: Verfügbarkeit Futtermittel<br />
nächsten 1 bis 2 J.<br />
über 3 Jahre<br />
Abbildung 4-3: Fragebogen - Wie lange kann „GVO-freie“ SES-<br />
Menge garantiert werden?<br />
17<br />
17<br />
In der folgenden Kreuztabelle ist veranschaulicht, dass jener Betrieb, welcher sich zutraut über 100.000 t „GVO-<br />
freien“ SES im Jahr aufzutreiben, auch die Versorgungssicherheit langfristig (über 3 Jahre) gegeben sieht. Über 1 bis<br />
2 Jahre kann von einem Unternehmen eine Menge von 10.000 bis 50.000 t garantiert werden.<br />
Tabelle 4-4: Fragebogen - Wie lange kann „GVO-freie“ SES-Menge oder mögliche Höchstmenge an „GVO-frei“ SES<br />
(Kreuztabelle) garantiert werden<br />
Kreuztabelle<br />
Wie lange kann<br />
„GVO-freie“<br />
SES-Menge<br />
Garantiert werden? nächsten 1<br />
bis 2 Jahre<br />
Mögliche Höchstmenge an „GVO-freiem“ SES<br />
bis 10.000 t<br />
10.0001 bis über<br />
50.000 t 100.000 t<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Gesamt<br />
dieses Jahr 2 2 4<br />
1 1<br />
über 3 Jahre 1 1<br />
Gesamt 2 3 1 6<br />
Die Mischfutterproduzenten betrachten zwar mit angemessener Skepsis die Produktion von „GVO-freiem“ Futter, laut<br />
Fragebogen gaben aber 78% (= 25 von 32 Betrieben) an, bereits „GVO freies“ Futter, d.h. nicht<br />
kennzeichnungspflichtiges Futter, zu produzieren. Es muss jedoch angemerkt werden, dass von Seiten der Befragten,<br />
auch Mineralfutter (keine Eiweißkomponenten enthalten), mit der Annahme <strong>„gentechnikfrei“</strong> hergestellte<br />
Aminosäuren <strong>und</strong> Vitamine zu besitzen, unter „GVO-freies“ Futter gezählt wurde. Dass eine Verunreinigung von 0,9<br />
% bzw. 0, 5 % nicht überschritten wird, obwohl keine zweite Produktionsschiene <strong>zur</strong> Verfügung steht, wurde, wie<br />
das Ergebnis zeigt, von den Befragten ebenfalls angenommen (vgl. MODER et al. 2004). Diese Einschätzung der<br />
Mischfutterindustrie führte sicherlich auch zu dem hohen Anteil an „Ja-Antworten“ bei dieser Frage.<br />
Seite 65 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 4: Verfügbarkeit Futtermittel<br />
Tabelle 4-5: Fragebogen-Produzieren Sie „GVO-freies“ Futter?<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Häufigkeit Prozent<br />
keine Angabe 1 3,1<br />
ja 25 78,1<br />
nein 6 18,8<br />
Gesamt 32 100<br />
Prozent<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Keine Angabe<br />
Abbildung 4-4: Fragebogen - Produzieren Sie „GVO-freies“ Futter?<br />
78<br />
ja<br />
19<br />
nein<br />
Nur 19 %, der Futtermittelhersteller führen an, dass sie derzeit kein „GVO-freies“ Futter produzieren, wie die obige<br />
Abbildung darstellt.<br />
Fragebogenauswertung zu Futtermittelausgangserzeugnissen bzw. Rohstoffen:<br />
Mais, Raps <strong>und</strong> Sonnenblumen:<br />
Mais, Raps/Rübsen <strong>und</strong> Sonnenblumen österreichischer Herkunft können derzeit als „GVO-frei“ angesehen werden.<br />
Das gleiche gilt für Raps/Rübsen <strong>und</strong> Sonnenblumen, sofern diese Importe bzw. Verbringung aus EU-Staaten kommt.<br />
Raps-/Rübsenexpeller aus den USA <strong>und</strong> Kanada, sowie Maisexpeller aus USA, Kanada oder Argentinien sind mit<br />
hoher Wahrscheinlichkeit mit GVO in höherem Maße verunreinigt (siehe auch Kapitel 3). Wie die Handelsströme in<br />
Kapitel 3 zeigen, ist allerdings die Wahrscheinlichkeit einer substantiellen Einschleppung über Importe bei diesen<br />
landwirtschaftlichen Produkten als eher gering anzusehen.<br />
In den folgenden Abbildungen wird dargestellt, welche zusätzlichen Mengen an Rapsprodukten bzw.<br />
Sonnenblumenextraktionsschrot pro Jahr in Österreich benötigt werden bzw. eingesetzt werden könnten.<br />
Seite 66 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 4: Verfügbarkeit Futtermittel<br />
Tabelle 4-6: Fragebogen - Welche Menge an zusätzlichem Rapsschrot können Sie pro Jahr auftreiben?<br />
Häufigkeit Prozent<br />
bis 5.000 t 2 33,3<br />
von 5.001 t bis zu 20.000 t 3 50<br />
von 20.001 t bis zu 50.000 t 1 16,7<br />
Gesamt 6 100<br />
Prozent<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
3 3<br />
b is 5 .0 00 t<br />
5 .00 1 bis 2 0. 0 0 0 t<br />
2 0 .00 1 bis 5 0 .0 0 0 t<br />
Abbildung 4-5: Fragebogen-Welche Menge an zusätzlichem<br />
Rapsschrot können Sie pro Jahr auftreiben?<br />
5 0<br />
1 7<br />
2 der 6 größten landwirtschaftlichen Großhändler nehmen an, dass Sie zusätzlich bis zu 5.000 t an Rapsschrot oder<br />
Rapskuchen pro Jahr auftreiben können <strong>und</strong> 3 Händler halten eine erweiterte Versorgung um 5.001 bis 20.000 t für<br />
möglich. Ein Betrieb schätzt zusätzlich 20.001 bis 50.000 t pro Jahr an Rapsschrot oder Rapskuchen umschlagen zu<br />
können.<br />
Tabelle 4-7: Fragebogen-Welche Menge an zusätzlichem Sonnenblumenschrot können Sie pro Jahr<br />
auftreiben?<br />
Häufigkeit Prozent<br />
bis 5.000 t 2 50<br />
von 5.001 t bis zu 20.000 t 3 33,3<br />
von 20.001 t bis zu 50.000 t 1 16,7<br />
Gesamt 6 100<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 67 von 272
Prozent<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
50<br />
bis 5.000 t<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 4: Verfügbarkeit Futtermittel<br />
5.001 bis 20.000 t<br />
20.001 bis 50.000 t<br />
Abbildung 4-6: Fragebogen-Welche Menge an<br />
zusätzlichem Sonnenblumenschrot können Sie pro Jahr auftreiben?<br />
33<br />
17<br />
50 % des Großhandels für landwirtschaftliche Produkte <strong>und</strong> Rohstoffe (das sind 3 von 6 Großhändlern) teilen die<br />
Meinung, dass sie zusätzlich bis zu 5.000 t an Sonnenblumenschrot auftreiben können <strong>und</strong> ebenfalls 2 Händler halten<br />
eine erweiterte Versorgung um 5.001 bis 20.000 t für möglich. Ein Betrieb schätzt zusätzlich 20.001 bis 50.000 t an<br />
Sonnenblumenschrot besorgen zu können.<br />
In Tabelle 4-8 werden die Ergebnisse aus der Umfrage an den Großhandel mit landwirtschaftlichen Produkten <strong>und</strong><br />
Rohstoffen in Österreich <strong>und</strong> Deutschland zusammengefasst. Nach diesen Aussagen könnte theoretisch der gesamte<br />
SES-Bedarf für Österreich in „GVO- freier“ Qualität gedeckt werden. Die Fragebogenergebnisse decken sich mit der<br />
Datenlage betreffend der theoretischen Verfügbarkeit von SES gemäß globaler Erzeugung <strong>und</strong> globalem<br />
Handelsvolumen.<br />
Im Laufe der Recherchen hat sich die Betrachtung des Agrarhandels <strong>und</strong> der Mischfutterindustrie zu „GVO-freien“<br />
Futtermittelausgangserzeugnissen sicherlich verändert. Während anfänglich noch die Meinung vorherrschend war,<br />
dass es unmöglich sei, den österreichischen Bedarf an SES in „GVO-freier“ Qualität aufzutreiben, brachten<br />
Informationen aus seriösen Quellen die Erkenntnis, dass sehr wohl Möglichkeiten <strong>zur</strong> Beschaffung vorhanden sind.<br />
Die Bereitschaft sich mit diesem Thema intensiver auseinanderzusetzen ist im Laufe der Bearbeitung dieser Studie<br />
<strong>und</strong> der dahingehenden Kontakte mit den Wirtschaftsbeteiligten spürbar gestiegen.<br />
Die Erhebungen <strong>zur</strong> Studie selbst, die parallel <strong>zur</strong> Studie laufenden Aktivitäten <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> von tierischen<br />
Lebensmitteln als „Gentechnikfrei“ <strong>und</strong> die Aktivitäten von Marktbeteiligten, insbesondere Anbietern von zertifizierten<br />
„GVO-freien“ Sojaprodukten, dürften zu einer intensiven Auseinandersetzung mit der Thematik beigetragen haben.<br />
Das Erfordernis der Auseinandersetzung mit Eiweißsubstituten als Nebenprodukte der mit einem rechtlichen Rahmen<br />
vorgegebenen Bio-Spriterzeugung in Europa in den nächsten 3 bis 4 Jahren stellt zweifelsohne eine Herausforderung<br />
<strong>und</strong> auch eine Chance für die Futtermittelwirtschaft <strong>und</strong> Tierernährung in Europa dar, „GVO-freie“ Rohstoffe<br />
verfügbar zu haben <strong>und</strong> die Abhängigkeit von SES-Importen zu vermindern.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 68 von 272
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 4: Verfügbarkeit Futtermittel<br />
Tabelle 4-8: Zusammenfassung <strong>zur</strong> Fragebogenauswertung betreffend Verfügbarkeit, des Zeitraumes für die Beschaffung, der Qualität <strong>und</strong> der potentiellen Preisanpassungen<br />
bei Sojaextraktionsschrot (SES) (Stand 28.4.2005)<br />
Produktionsstufe,<br />
Wirtschaftsbeteiligte<br />
1) Futtermittelhändler *<br />
(Österreich)<br />
2.) Ölmühle *<br />
(Deutschland)<br />
3) Kraftfutterwerk *<br />
(Deutschland)<br />
4) Landesproduktenhändler *<br />
(Deutschland)<br />
Ursprungsland des SES<br />
Direkt aus Brasilien<br />
Brasilianische Sojabohne wird in<br />
Deutschland zu SES verarbeitet<br />
Brasilien<br />
Brasilianische Sojabohne wird in<br />
Deutschland zu SES verarbeitet<br />
Direkt aus Brasilien<br />
Direkt aus Brasilien<br />
SES-Kapazität pro Jahr in t<br />
Unbegrenzte Menge<br />
(100.000-300.000 t pro Jahr)<br />
begrenzte Menge <strong>und</strong> begrenzter<br />
Zeitraum<br />
begrenzte Menge<br />
<strong>und</strong> begrenzter Zeitraum<br />
1000-1500 t /Tag x 180 Tage<br />
(Saison) =<br />
max. 270.000 t/ Saison<br />
60.000t sofort<br />
(bis 2006)<br />
ca. 2 Millionen t pro Jahr<br />
Längerfristig durch Kontrakte mit<br />
Genossenschaften in Brasilien<br />
gemeinsam mit drei anderen dt.<br />
Unternehmen<br />
gesamte Jahr über <strong>und</strong><br />
„unbegrenzte“ Menge<br />
Gesamtmenge wird derzeit<br />
nicht gerne offiziell bekannt<br />
gegeben,<br />
aber >>600.000t/Jahr**<br />
Zeitraum für die<br />
Beschaffung des SES<br />
30 Tage per Schiff über<br />
Rotterdam<br />
ganzes Jahr verfügbar<br />
nur von Mai bis Oktober <strong>und</strong><br />
nur eine<br />
begrenzte Menge<br />
verfügbar<br />
nur von Mai bis Oktober <strong>und</strong><br />
eine<br />
begrenzte Menge<br />
nur ein Teil davon für Ö<br />
verfügbar<br />
30 Tage per Schiff<br />
18 Tage Brasilien-Europa<br />
(Brake)<br />
+ 12 Tage Weser Hafen bis<br />
nach Österreich<br />
Ca. 21 Tage per Schiff<br />
1 Monat Lieferzeit<br />
Brasilien –Deutschland (Brake)<br />
Qualität des SES<br />
HARD IP WARE<br />
Preisangaben zu<br />
„GVO-freiem“ SES<br />
8 % Aufpreis<br />
Deckelung bis 20 € pro<br />
Tonne vorstellbar<br />
SOFT IP WARE 8 € Aufpreis pro Tonne<br />
(~3%)<br />
HARD IP WARE 5-8 € Aufpreis pro Tonne<br />
(~2-3%)<br />
HARD IP WARE<br />
* Anonymisierte Angabe <strong>zur</strong> Fragebogenauswertung ** 600.000 t SES: entspricht etwa der österreichischen Importmenge 2003<br />
Hard IP:<br />
15-20 €/t Aufpreis<br />
Seite 69 von 272
4.1.2. Zusatzstoffe <strong>und</strong> Aminosäuren<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 4: Verfügbarkeit Futtermittel<br />
Beim Ersatz von Sojaextraktionsschrot (SES) durch andere Eiweißpflanzen ist aus der Sicht der Tierernährung eine<br />
Ergänzung mit Aminosäuren <strong>zur</strong> Abdeckung des Bedarfes bei monogastrischen Tieren (Schwein <strong>und</strong> Geflügel) immer<br />
zu berücksichtigen. Eine physiologisch angemessene Fütterung unter wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist ohne<br />
diese Zusätze in der konventionellen Geflügelwirtschaft <strong>und</strong> Schweineproduktion <strong>und</strong>enkbar.<br />
Zusatzstoffe wie Vitamine, Enzyme <strong>und</strong> Aminosäuren gehören in der konventionellen Tierernährung, unabhängig<br />
davon, ob die Futtermittel industriell oder am Bauernhof hergestellt werden, zu unentbehrlichen <strong>und</strong> essentiellen<br />
Baustoffen. Die meisten dieser Zusatzstoffe müssen nach Österreich importiert werden.<br />
Ein Teil der Zusatzstoffe wird derzeit noch über die chemische Synthese hergestellt. Ein bestimmter Anteil wird aber<br />
bereits mit Hilfe biotechnologischer Verfahren produziert, wobei auch gentechnisch veränderte Mikroorganismen <strong>zur</strong><br />
Verwendung kommen können. In diesem Zusammenhang wird auf den Begriff „Weiße Biotechnologie“, welche in<br />
Zukunft einen immer größer werdenden Teil der Zusatzstoffproduktion ausmachen wird, verwiesen. Sie findet im<br />
Gegensatz <strong>zur</strong> „Grünen Gentechnik“ in einem geschlossenen System statt. Im Endprodukt ist weder DNA noch<br />
anderes Material vom genveränderten Organismus nachweisbar. Dieser Begriff soll genau wie die Bezeichnungen<br />
„rote“ <strong>und</strong> „grüne“ Biotechnologie lediglich als eine grobe Orientierungshilfe für ihre Einsatzgebiete dienen. In diesem<br />
Sinne bezieht sich die „Weiße Biotechnologie“ auf den Einsatz biotechnischer Verfahren in der Industrie.<br />
Die „Weiße Biotechnologie“ stellt einen kontrollierten Einsatz von biotechnologischen Verfahren in geschlossenen<br />
industriellen Anlagen dar. Für die Arbeit in geschlossenen Systemen der Labors <strong>und</strong> Industrieanlagen gelten schon<br />
seit vielen Jahren sehr hohe Sicherheitsstandards gemäß EU- <strong>und</strong> österreichischem Gentechnikrecht.<br />
Ohne eine Wertung vornehmen zu wollen sei KÜNAST (2005) zitiert, wonach Vorteile dieses Verfahrens ein erheblicher<br />
Beitrag <strong>zur</strong> Ressourcenschonung, Reduktion der Umweltbelastung vieler Herstellungsprozesse wie Leder, Textil <strong>und</strong><br />
Papier, industrielle Produktion neuer Stoffe <strong>und</strong> die nachhaltige Verbesserung existierender Produktionsverfahren,<br />
Nutzung nachwachsender Rohstoffe, Kreislaufoptimierung <strong>und</strong> die Beschränkung auf ein geschlossenes System, sind.<br />
Zu den bekanntesten Produkten der „Weißen Biotechnologie“ gehören Feinchemikalien, Vitamine, Pharmazeutika<br />
(z.B. Antibiotika), Pestizide, Polymere, Treibstoffe (Biokraftstoffe), Futtermittelzusatzstoffe, Hilfsstoffe für<br />
verarbeitende Industrien wie Enzyme (z.B. Waschmittel) sowie für die Textil- <strong>und</strong> Papierverarbeitung.<br />
Nach Einschätzungen von Experten werden folgende für die Fütterung relevante Zusatzstoffe bereits in sehr großem<br />
Umfang bzw. teilweise sogar gänzlich über die „weiße Biotechnologie“ bzw. „Gentechnik“ hergestellt: Vitamin B2 <strong>und</strong><br />
B12, Vitamin C, die Aminosäuren Lysin, Threonin <strong>und</strong> Tryptophan, sowie Zitronensäure <strong>und</strong> Enzyme wie Phytase.<br />
Während die Aminosäure Methionin noch ausschließlich synthetisch-technisch aus Acrolein, Blausäure <strong>und</strong><br />
Methylmerkaptan ohne Einsatz von gentechnisch veränderten Mikroorganismen produziert wird, werden die<br />
essentiellen Aminosäuren Lysin, Threonin <strong>und</strong> Tryptophan schon zu über 95% aus GVM (genetisch veränderte<br />
Mikroorganismen) durch Biofermentation hergestellt. Die Rohstoffversorgung für die Methioninherstellung ist bis<br />
2010 gesichert.<br />
Alle derzeit als Probiotika zugelassenen Mikroorganismen sind „GVO-frei“ (nicht gentechnisch verändert) <strong>und</strong> können<br />
sowohl nach VO(EG) 1829/2003, als auch nach Codex ohne zusätzliche Kennzeichnung in Verkehr gebracht werden.<br />
Obige Aussagen beziehen sich auf die derzeitige Situation <strong>und</strong> letzten Stand der Technik, eine längerfristige<br />
Voraussage über 5 Jahre kann zum derzeitigen Zeitpunkt nur relativ schwer gemacht werden. Die Entwicklung der<br />
Produktion von Futterzusatzstoffen wie Vitamine, Enzyme <strong>und</strong> Aminosäuren scheint mit der Begründung von KÜNAST<br />
(2005) in Richtung Biofermentation aus GVM, wo technisch möglich, zu gehen (siehe oben).<br />
Lysin spielt ganz besonders in der Schweinefütterung eine große Rolle, da es hier die erstlimitierende Aminosäure<br />
darstellt. Ohne Lysin-Zusatz ist beim Schwein in der konventionellen Tierhaltungspraxis mit einschneidenden<br />
wirtschaftlichen Einbußen im Wachstum <strong>und</strong> Fleischansatz zu rechnen (siehe Kapitel 4.1.2.2. Mangelerscheinungen<br />
von Aminosäuren).<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 70 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 4: Verfügbarkeit Futtermittel<br />
Tabelle 4-9: Übersicht über importierte Aminosäuremengen nach Österreich <strong>und</strong> derzeitiger Anteil von<br />
„mit“ <strong>und</strong> „ohne GVM“ in den Produktionsprozessen<br />
Aminosäuren<br />
Methionin<br />
Lysin<br />
Threonin<br />
Tryptophan<br />
Menge in Tonnen /Jahr<br />
(importiert)<br />
2004: ca. 1300 t<br />
2003: 906 t<br />
2002: 1370 t<br />
2001: 1380 t<br />
2004: 4808 t<br />
2003: 4960 t<br />
2002: 4900 t<br />
2004: ca. 400 t<br />
2003: ca. 400 t<br />
2003: ca. 400 t<br />
2004: ca. 15-20 t<br />
2003: ca. 15-20 t<br />
2002: ca. 15-20 t<br />
Quelle: Statistisches Zentralamt <strong>und</strong> persönliche Auskünfte der Industrie<br />
Herstellung ohne GVM<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
in %<br />
(geschätzt)<br />
100%<br />
0-5%<br />
„gentechnikfreie“ Produktion<br />
kann nicht mehr garantiert<br />
werden*<br />
0-5%<br />
„gentechnikfreie“ Produktion<br />
kann nicht mehr garantiert<br />
werden*<br />
0-5%<br />
„gentechnikfreie“ Produktion<br />
kann nicht mehr garantiert<br />
werden*<br />
Herstellung mit GVM<br />
in %<br />
(geschätzt)<br />
0%<br />
95-100%<br />
95-100%<br />
95-100%<br />
* Garantien mittels Zertifikaten aus Drittländern, welche nicht bzw. kaum überprüfbar sind, wurden nicht<br />
berücksichtigt.<br />
Bei der Versorgung mit Vitaminen gibt es bei Vitamin B2 <strong>und</strong> B12 schon jetzt einen ernsthaften Versorgungsengpass<br />
für die Anforderungen des Codex <strong>und</strong> für den Biolandbau. Laut DATENBANK INFOXGEN wurde für 2005 nur noch von<br />
einem Händler in Österreich ein Zertifikat für gentechnikfreie Herstellung für Vitamin B2 vorgelegt, jedoch ohne<br />
Mengenangabe. Aus den aktuellen Recherchen, im Zuge dieser Studie, wird derzeit kein Vitamin B2 mehr über<br />
chemische Synthese hergestellt. Daher muss angenommen werden, dass es sich um sehr geringe Mengen oder<br />
Restbestände handelt, die im Biolandbau zum Einsatz kommen. Genauere Angaben zu Menge <strong>und</strong> Herkunft oder<br />
schriftliche Stellungnahmen von den Herstellern selbst waren dazu nicht zu erhalten. Die Angaben über „ohne GVM“<br />
hergestelltes Vitamin B12 waren sehr unterschiedlich <strong>und</strong> teils widersprüchlich. Auch die Problematik hinsichtlich von<br />
Zertifikaten bestimmter Ursprungsländer, wo eine Überprüfung der Herstellungsprozesse nicht oder kaum möglich ist,<br />
soll hier angesprochen werden <strong>und</strong> wurde bereits in einer anderen Studie erwähnt (vgl. BROLL, 2004, 42). Derartige<br />
Zertifikate bzw. Zusicherungserklärungen können nur formal geprüft werden. Mittels gängiger Analytik kann der<br />
durch Ultrafiltration entfernte gentechnisch veränderte Mikroorganismus im Endprodukt nicht mehr nachgewiesen<br />
werden. Ohne definitive Angaben zu den modifizierten Stellen an der DNA kann auch ein genveränderter<br />
Mikroorganismus nicht als solcher erkannt werden.<br />
Für Vitamin C (Ascorbinsäure) gibt es derzeit noch keinen Versorgungsengpass für den Codex <strong>und</strong> Biolandbau,<br />
obwohl bereits ein beträchtlicher Anteil (geschätzte 50%) durch Biofermentation hergestellt wird, zwar ohne GVO,<br />
aber mit Substraten, die aus GVO hergestellt wurden (vgl. BROLL, 2004, 34).<br />
Die in Österreich hergestellte Menge Zitronensäure beträgt im Schnitt 160.000 Tonnen pro Jahr. Weder der<br />
eingesetzte Mikroorganismus noch die dazu verwendeten Rohstoffe sind gentechnisch verändert. Zitronensäure,<br />
hergestellt ohne GVM, ist somit in ausreichender Menge vorhanden.<br />
Seite 71 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 4: Verfügbarkeit Futtermittel<br />
Tabelle 4-10: Geschätzter Vitaminbedarf in Tonnen pro Jahr für den gesamten Tierernährungsbereich<br />
in Österreich<br />
Vitamine<br />
<strong>und</strong> vitaminähnliche Substanzen<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Menge in Tonnen<br />
Vitamin A 500 ca. 40-80 t<br />
Vitamin B1 (Thiamin) 7 t<br />
Vitamin B2, 80% (Riboflavin, Lactoflavin) 13-15 t<br />
Vitamin B3 (Niacin) 80 t<br />
Vitamin B5 98% (Calciumpanthothenat) 30-32 t<br />
Vitamin B6 98% (Pyridoxin) 10-13 t<br />
Vitamin B12, 0,1% (Cobalamin) 57-60 t<br />
Vitamin C (Ascorbinsäure) 60 t<br />
Vitamin D3 500 (Calciferol) 7-10 t<br />
Vitamin E 50 (Tocopherol) 800-1000 t<br />
Vitamin H 2% (Biotin) 11-15 t<br />
Vitamin K1 5% 50-75 kg (Kilogramm)<br />
Vitamin K3 50MSB 7 t<br />
Folsäure 2,5 t<br />
Cholinchlorid, 50%, 60% 1300 t<br />
Betain 15 t<br />
Eine Versorgungssicherheit mit den Vitaminen B2 <strong>und</strong> B12, ohne Einsatz von GVM, ist aufgr<strong>und</strong> des festgestellten<br />
Bedarfs in Tabelle 4-10 <strong>und</strong> der dargestellten Situation in Tabelle 4-11 nicht gegeben.<br />
Mit welchen Auswirkungen auf die Nutztierproduktion beim Fehlen/Mangel obiger Stoffe im Futter zu rechnen ist,<br />
wird im nächsten Unterkapitel bearbeitet.<br />
4.1.2.1. Mangelerscheinungen von Vitamin B2 <strong>und</strong> B12 bei Monogastriern<br />
• Vitamin B 2 (Riboflavin, Lactoflavin)<br />
Während beim Wiederkäuer keine Versorgungsprobleme für Vitamin B2 bekannt sind, sind für Geflügel <strong>und</strong> Schwein<br />
Zusätze von Vitamin B2 notwendig, da diese kein Vitamin B2 synthetisieren können. Bei wachsenden Hühnern ist die<br />
Verwertung der enteral gebildeten B-Vitamine <strong>zur</strong> Deckung des Bedarfs nur in geringem Maße möglich (vgl. Heider,<br />
1992, 492).<br />
Für Geflügel werden folgende Mangelerscheinungen in der Literatur angegeben:<br />
• trockene Haut <strong>und</strong> Farbverlust des Gefieders<br />
• Fettlebersyndrom<br />
• Lähmungserscheinungen durch degenerative Veränderungen an die Extremitäten versorgende Nervenfasern<br />
Seite 72 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 4: Verfügbarkeit Futtermittel<br />
• Wachstumsstörungen <strong>und</strong> verkürzte Gliedmaßen (Mikromelie)<br />
• Erhöhte Embryonensterblichkeit<br />
• Verminderung der Legeleistung bis Sistieren der Legetätigkeit<br />
Weitere unspezifische Symptome als Folge von Vitamin B2-Mangel sind Leistungsrückgang <strong>und</strong> eine Verschlechterung<br />
der Futterverwertung sowie eine typische „Faustbildung der Zehen“ durch Zehenverkrümmungen(vgl. Heider, 1992,<br />
423ff; vgl. Leeson, et al., 1979 b; Tabelle 57.15, vgl. Leeson, et al. , 1979 a;).<br />
Tabelle 4-11: Einschätzung der derzeitigen Situation, der mittelfristigen <strong>und</strong> langfristigen Verfügbarkeit<br />
von Vitaminen, die chemisch-synthetisch oder aus GVM hergestellt werden:<br />
Vitamine<br />
Vitamin A<br />
Vitamin B1<br />
Thiamin<br />
Vitamin B2<br />
Riboflavin, Lactoflavin<br />
Vitamin B6<br />
Pyridoxin<br />
Vitamin B12<br />
Cobalamin<br />
Vitamin C<br />
Ascorbinsäure<br />
Verfügbarkeit von Vitaminen ohne Anwendung von GVM<br />
derzeit/ kurzfristig<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
mittelfristig<br />
langfristig<br />
Chem-synth Tendenz zu GVM Tendenz zu GVM<br />
Chem-synth Tendenz zu GVM Tendenz zu GVM<br />
Fast <strong>zur</strong> Gänze<br />
mit GVM hergestellt<br />
Mit GVM<br />
Mit GVM<br />
Chem-synth Tendenz zu GVM Tendenz zu GVM<br />
Zum Großteil<br />
mit GVM*<br />
chem-synth.<br />
Nährlösung stammt<br />
aus nicht gesicherter<br />
Herkunft*<br />
Mit GVM<br />
Mit GVM<br />
Tendenz zu GVM Tendenz zu GVM<br />
Vitamin D2 Chem synth Tendenz zu GVM Tendenz zu GVM<br />
Vitamin D3 (Calciferol) Chem synth Tendenz zu GVM Tendenz zu GVM<br />
Vitamin E (Tocopherol) Chem synth Tendenz zu GVM Tendenz zu GVM<br />
Vitamin K1 Chem synth Tendenz zu GVM Tendenz zu GVM<br />
Vitamin K3 Chem synth Tendenz zu GVM Tendenz zu GVM<br />
Beta Carotin Chem synth Tendenz zu GVM Tendenz zu GVM<br />
Betain Chem synth Tendenz zu GVM Tendenz zu GVM<br />
Vitamin H (Biotin) Chem synth Tendenz zu GVM Tendenz zu GVM<br />
Calcium-Panthothenat Chem synth Tendenz zu GVM Tendenz zu GVM<br />
Cholinchlorid Chem synth Tendenz zu GVM Tendenz zu GVM<br />
Folsäure Chem synth Tendenz zu GVM Tendenz zu GVM<br />
Inosit Chem synth Tendenz zu GVM Tendenz zu GVM<br />
L-Carnitin Chem synth Tendenz zu GVM Tendenz zu GVM<br />
Nicotinsäure Chem synth Tendenz zu GVM Tendenz zu GVM<br />
Nicotinsäureamid Chem synth Tendenz zu GVM Tendenz zu GVM<br />
p-Aminobenzoesäure Chem synth Tendenz zu GVM Tendenz zu GVM<br />
Taurin Chem synth Tendenz zu GVM Tendenz zu GVM<br />
*Hier waren nur sehr unterschiedliche, bedeckte oder teils auch widersprüchliche Angaben oder<br />
Auskünfte durch Lieferanten <strong>und</strong>/oder Hersteller bezüglich gentechnikfreie Herstellung zu erhalten.<br />
Beim Schwein führt Vitamin B2-Mangel zu Leistungsminderungen, wie etwa schlechterer Futterverwertung <strong>und</strong><br />
geringeren Tagesgewichtszunahmen, Hautveränderungen, Sehstörungen <strong>und</strong> nervösen Erscheinungen. Länger<br />
Seite 73 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 4: Verfügbarkeit Futtermittel<br />
anhaltender, erheblicher Vitamin B2-Mangel führt bei Sauen zum Ausbleiben der Rausche, bei tragenden Tieren zu<br />
Mumifikationen der Föten <strong>und</strong> Totgeburten (Eich, 1985, 269).<br />
Da ohne GVM hergestelltes Vitamin B2 nicht mehr produziert wird, wäre es vom wirtschaftlichen <strong>und</strong> auch<br />
tierschützerischen Standpunkt aus in der konventionellen Tierhaltung nicht zu verantworten, Geflügel- oder<br />
Schweinerationen ohne Vitamin B2-Zusatz herzustellen. Während trockene Haut <strong>und</strong> Farbverlust des Gefieders von<br />
nebensächlicher Bedeutung sind, müssen das Fettlebersyndrom, Lähmungen <strong>und</strong> Faustbildungen der Zehen als<br />
hochgradig pathogen angesehen werden. Sehstörungen wurden ebenfalls beobachtet.<br />
Sehstörungen, Lähmungserscheinungen <strong>und</strong> Zehenmissbildungen führen früher oder später zu partieller oder<br />
vollständiger Immobilität mit allen damit verb<strong>und</strong>enen dramatischen Folgen.<br />
• Vitamin B 12 (Cobalamin)<br />
Allgemein typische Mangelerscheinungen von Vitamin B12 zeigen sich in allgemeinen Wachstumshemmungen,<br />
perniziöser Anämie (Blutarmut), funikulärer Myelose (Nervenschädigungen), Schädigungen der Schleimhäute,<br />
Folsäuremangel, Hautschäden (z.B. beim Ferkel struppiges Fell), vergrößerten, unreifen Erythrocyten <strong>und</strong> in einer<br />
gestörten DNA-Synthese in der Zelle.<br />
Heider (1992) berichtet beim Geflügel von gehemmter Embryonalentwicklung, Wachstumshemmungen vor allem in<br />
Phasen schnellen Körperwachstums, Mikromelie (Gliedmaßenverkürzungen), Lebernekrosen <strong>und</strong> Degeneration der<br />
Muskulatur.<br />
Beim Schwein verursacht ein Vitamin B12-Mangel zusätzlich einen gestörten Eiweißansatz <strong>und</strong> ein eingeschränktes<br />
Wachstum. Es treten Störungen bei der Bildung von roten Blutkörperchen auf, weiters auch Durchfall <strong>und</strong> Erbrechen.<br />
Graues Haarkleid <strong>und</strong> Entzündungen der Haut sind weitere Folgen des Vitamin B12-Mangels (Eich, 1985, 271).<br />
4.1.2.2. Mangelerscheinungen durch fehlende Aminosäuren (AS)<br />
Das Wachstum des Organismus setzt immer eine Eiweißsynthese voraus. Die dazu benötigten essentiellen <strong>und</strong> nicht<br />
essentiellen Aminosäuren werden hierbei entsprechend ihrer genetisch festgelegten Sequenz aneinander gereiht.<br />
Wird bei der Verlängerung der Eiweißkette eine AS benötigt, die am Ort der Synthese nicht vorhanden ist, kommt die<br />
Eiweißsynthese zunächst zum Stillstand. Handelt es sich dabei um eine nicht essentielle AS, kann der Körper diese<br />
über die Eigensynthese <strong>zur</strong> Verfügung stellen. Fehlt jedoch eine essentielle AS, „limitiert“ diese AS die<br />
Proteinsynthese.<br />
Die limitierende Aminosäure muss also über das Futter in ausreichender Menge <strong>zur</strong> Verfügung gestellt werden. Bei<br />
Bedarfsermittlung unterteilt man genauer in erst-, zweit- <strong>und</strong> nächstlimitierende AS. In Rationen für Geflügel sind im<br />
Allgemeinen die schwefelhältigen AS Methionin <strong>und</strong> Cystein erstlimitierend, in Rationen für Schweine das Lysin. Ein<br />
ausreichender Gehalt an diesen AS im Futter entscheidet also darüber, ob auch die anderen AS in effizienter Weise<br />
<strong>zur</strong> Eiweißsynthese (=Muskelansatz, Wachstum, Gewichtszunahme) verwertet werden.<br />
Dieses Prinzip wird durch das „Liebig´sche Faß“ illustriert, wobei der Füllungsgrad des Fasses das<br />
Proteinsynthesevermögen des Tieres darstellt. Die kürzeste Daube „limitiert“ das Fassungsvermögen des Fasses.<br />
Durch Verlängerung der kürzesten Daube steigt das Fassungsvermögen bis <strong>zur</strong> Höhe der ursprünglich<br />
„zweitlimitierenden“ Daube. Der wichtigste Faktor für die Ausnützung des Futterproteins für eine bestimmte Leistung<br />
ist die Ausgewogenheit der in ihm enthaltenen AS im Vergleich zum physiologischen Bedarf (Häffner et al.,1998,<br />
20f). Dies bedeutet, dass eine physiologisch ausgeglichene Tierernährung in der konventionellen Tierhaltung, unter<br />
wirtschaftlichen <strong>und</strong> zumutbaren Bedingungen, auf eine Zugabe von essentiellen Aminosäuren in der Ration<br />
angewiesen ist.<br />
Mittlerweile werden L-Lysin, L-Threonin <strong>und</strong> auch L-Tryptophan für die Futterindustrie nahezu vollständig über<br />
Biofermentation hergestellt.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 74 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 4: Verfügbarkeit Futtermittel<br />
Die moderne Biotechnologie eröffnet neue Zugänge für weitere Verbesserungen im Produktionsprozess von bereits<br />
vorhandenen Aminosäuren, <strong>und</strong> die Herstellung von weiteren AS, die für die Tierernährung essentiell sind. Sämtliche<br />
im Handel verfügbaren Aminosäuren <strong>und</strong> ihre Analoge sind durch die Richtlinie des Rates 82/471 EWG, weitere<br />
Änderungen dieser Richtlinie <strong>und</strong> neuerdings auch durch die VO (EG) 1831/2003 geregelt (vgl. Pack et al.,<br />
2002,16ff).<br />
Lysin stellt beim Schwein die erstlimitierende Aminosäure dar <strong>und</strong> hat somit direkten Einfluss auf das Wachstum.<br />
Der Gehalt muss gemäß Futtermittelverordnung in Allein- <strong>und</strong> Ergänzungsfuttermitteln für Schweine obligatorisch<br />
beim Inverkehrbringen angegeben werden (außer bei Melasse- <strong>und</strong> Mineralergänzungsfuttermittel). Ein Mangel an<br />
Lysin kann durch Erhöhung der pflanzlichen, eiweißreichen Futtermittel in der Ration ausgeglichen werden. Höhere<br />
Proteinanteile in der Ration beeinträchtigen die Futterverwertung <strong>und</strong> erzeugen mehr Gülle, die ihrerseits wiederum<br />
eine Umweltbelastung darstellt. Die gezielte Beimischung von Aminosäuren ins Futter stellt neben der Ökonomie<br />
einen wichtigen Faktor für die Tierges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ökologie dar (geringere Stickstoffausscheidung).<br />
Methionin ist beim Geflügel die erstlimitierende Aminosäure <strong>und</strong> sein Gehalt muss auf allen Allein- <strong>und</strong><br />
Ergänzungsfuttermitteln für Geflügel verpflichtend angegeben werden, sobald das Futtermittel in Verkehr gesetzt<br />
wird. Im Hinblick auf GVO spielt Methionin zwar keine Rolle, da es derzeit <strong>und</strong> auch in den nächsten 6-7 Jahren<br />
gemäß Angaben in der Recherche ausschließlich chemisch-synthetisch hergestellt wird.<br />
Threonin spielt für das Wachstum, den Harnsäurestoffwechsel <strong>und</strong> für das Immunsystem, den Proteinstoffwechsel<br />
<strong>und</strong> bei Enzym- <strong>und</strong> Hormonbildung eine wichtige Rolle. Threonin-Mangel führt zu Leberverfettung,<br />
Ermüdungserscheinungen, Appetitlosigkeit <strong>und</strong> Gewichtsverlust.<br />
Mangelerscheinungen treten jedoch bei ausreichender Eiweißversorgung nur äußerst selten auf. In der Tierernährung<br />
wird Threonin vor allem im Schweine- <strong>und</strong> Putenbereich eingesetzt, <strong>zur</strong> Zeit jedoch nur in geringen Mengen, da<br />
aufgr<strong>und</strong> der hohen Kosten <strong>und</strong> des relativ hohen nativen Gehalts in den Eiweißpflanzen, der Einsatz vielen<br />
Landwirten wirtschaftlich nicht rentabel erscheint.<br />
Tryptophan ist ein Baustein bei der Proteinsynthese <strong>und</strong> für den Leberstoffwechsel, <strong>und</strong> kann in Niacin übergeführt<br />
werden. Niacinmängel treten erst bei Tryptophan armer Ernährung auf <strong>und</strong> es zeigen sich Symptome wie Haut- <strong>und</strong><br />
Schleimhautveränderungen, sowie auch nervale Störungen. Bei maisreichen Rationen, die in Österreich sehr<br />
gebräuchlich sind, kann Tryptophan ins Minimum geraten. Mangelerscheinungen treten jedoch auch bei Tryptophan<br />
nur äußerst selten auf.<br />
Bei abschließender Betrachtung der Versorgung bestimmter Zusatzstoffe (Vitamin B2 <strong>und</strong> B12) <strong>und</strong> Aminosäuren<br />
(Lysin, Threonin, Tryptophan) stellt sich die Sachlage so dar, dass die Anforderungen des Codex hinsichtlich der<br />
„GVO-Freiheit“ in den Herstellungsprozessen, das heißt ohne GVM, nicht oder kaum erfüllt werden. Für die Spezies<br />
Schweine <strong>und</strong> Geflügel in der konventionellen Tierernährung <strong>und</strong> Tierhaltung ist der Zusatz dieser Vitamine <strong>und</strong><br />
Aminosäuren als unbedingt notwendig zu erachten.<br />
Während sich die Problematik insbesondere bei den Vitaminen B 2 <strong>und</strong> B 12 generell bei Monogastriern stellt, erhält<br />
die Frage der Aminosäurenergänzung vor allem beim Einsatz von Sojabohnensubstituten einen besonderen<br />
Stellenwert.<br />
Der Einsatz von Nebenprodukten der Biospriterzeugung (Raps-, Rübsen-, Mais-, Getreideexpeller) erfordert jedenfalls<br />
den angemessenen Einsatz von Aminosäuren als Zusatzstoffe <strong>zur</strong> Futterration bei Monogastriern in der<br />
konventionellen Tierhaltung.<br />
Beim Rind könnten die Anforderungen des Codex hinsichtlich Zusatzstoffe erfüllt werden, da Wiederkäuer nicht auf<br />
die Zufuhr dieser Zusatzstoffe angewiesen sind. Der Einsatz von Vitamin B2 <strong>und</strong> B12 sowie Aminosäuren ist beim<br />
Rind nicht zwingend erforderlich.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 75 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 4: Verfügbarkeit Futtermittel<br />
Tabelle 4-12: Abschätzung der derzeitigen, mittelfristigen <strong>und</strong> langfristigen Verfügbarkeit von „GVO-freien“<br />
Rohstoffen oder Futtermittel-Ausgangserzeugnissen (v.a. SES, Mais, Raps) in Österreich<br />
Futtermittel-<br />
Ausgangserzeugnisse<br />
Derzeit bis<br />
kurzfristig<br />
SES, Sojabohnen 5% „GVO-frei“<br />
95% GVO<br />
Mais 100% „GVO-frei“<br />
aus Österreich <strong>und</strong><br />
weitreichend aus<br />
der EU<br />
Raps 100% „GVO-frei“<br />
aus der EU<br />
mittelfristig<br />
(3 bis 5 Jahre)<br />
Unter bestimmten<br />
Voraussetzungen<br />
ist die Erhöhung<br />
vom „GVO-freiem“<br />
Anteil bis <strong>zur</strong><br />
Volldeckung mit<br />
„GVO-freiem“ SES<br />
möglich.<br />
Gemäß Strategie<br />
<strong>zur</strong> Koexistenz in<br />
Österreich „GVOfrei“.<br />
Gemäß Strategie<br />
<strong>zur</strong> Koexistenz in<br />
Österreich „GVOfrei“.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
langfristig<br />
(über 5 Jahre)<br />
Unter bestimmten<br />
Voraussetzungen<br />
ist die Erhöhung<br />
vom „GVO-freiem“<br />
Anteil bis <strong>zur</strong><br />
Volldeckung mit<br />
„GVO-freiem“ SES<br />
möglich.<br />
Bei Beibehaltung<br />
der aktuellen<br />
Strategie in<br />
Österreich hoher<br />
Anteil an „GVOfreier“<br />
Produktion<br />
wahrscheinlich.<br />
Bei Beibehaltung<br />
der aktuellen<br />
Strategie in<br />
Österreich hoher<br />
Anteil an „GVOfreier“<br />
Produktion<br />
wahrscheinlich.<br />
Bemerkungen<br />
Siehe auch in<br />
Kapitel 3<br />
Siehe auch in<br />
Kapitel 3<br />
Siehe auch in<br />
Kapitel 3<br />
Seite 76 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 4: Verfügbarkeit Futtermittel<br />
Tabelle 4-13: Abschätzung der derzeitigen, mittelfristigen <strong>und</strong> langfristigen Verfügbarkeit von „GVOfrei“<br />
oder <strong>„gentechnikfrei“</strong> hergestellten Zusatzstoffen (wie Vitamine, Enzyme <strong>und</strong> Mikroorganismen,<br />
sowie Aminosäuren) in Österreich<br />
Zusatzstoffe Derzeit bis<br />
kurzfristig<br />
Vitamine A, D, E großteils<br />
noch Herstellung<br />
ohne GVM.<br />
Vit. B2/Vit. B12 <strong>zur</strong><br />
Gänze/zum Großteil<br />
aus GVM,<br />
Vit. C zu ca. <strong>zur</strong><br />
Hälfte aus GVO<br />
(Substrat).<br />
Enzyme Zum Großteil noch<br />
Herstellung ohne<br />
GVM.<br />
Phytasen sind<br />
bereits zum<br />
Großteil/<strong>zur</strong> Gänze<br />
aus GVM<br />
hergestellt.<br />
Mikroorganismen<br />
(Probiotika)<br />
Ohne GVM<br />
hergestellt<br />
Methionin Ohne GVM<br />
hergestellt<br />
Lysin Zu 95-100 %<br />
aus GVM<br />
Threonin Zu 95-100%<br />
aus GVM<br />
Tryptophan Zu 95-100%<br />
aus GVM<br />
mittelfristig<br />
(3 bis 5 Jahre)<br />
GVM-freier Anteil<br />
sinkend<br />
GVM-freier Anteil<br />
sinkend<br />
Ohne GVM<br />
hergestellt<br />
Ohne GVM<br />
hergestellt<br />
GVM-freier Anteil<br />
sinkend<br />
GVM-freier Anteil<br />
sinkend<br />
GVM-freier Anteil<br />
sinkend<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
langfristig<br />
(über 5 Jahre)<br />
GVM-freier Anteil<br />
sinkend<br />
GVM-freier Anteil<br />
sinkend<br />
Ohne GVM<br />
hergestellt<br />
Ohne GVM<br />
hergestellt<br />
GVM-freier Anteil<br />
sinkend<br />
GVM-freier Anteil<br />
sinkend<br />
GVM-freier Anteil<br />
sinkend<br />
Bemerkungen<br />
Tendenz geht<br />
deutlich <strong>zur</strong><br />
Herstellung mit<br />
GVM;<br />
Zertifikate aus<br />
Drittländern<br />
wurden nicht<br />
berücksichtigt.<br />
Tendenz geht<br />
deutlich <strong>zur</strong><br />
Herstellung mit<br />
GVM;<br />
Zertifikate aus<br />
Drittländern<br />
wurden nicht<br />
berücksichtigt.<br />
alle nach VO(EU)<br />
1831/2003<br />
zugelassenen<br />
Mikroorganismen<br />
sind keine GVM<br />
Wird zu 100% aus<br />
chem.-techn.<br />
Verfahren<br />
hergestellt.<br />
Rohstoffe bis 2010<br />
gesichert.<br />
Zertifikate aus<br />
Drittländern<br />
wurden nicht<br />
berücksichtigt.<br />
Zertifikate aus<br />
Drittländern<br />
wurden nicht<br />
berücksichtigt.<br />
Zertifikate aus<br />
Drittländern<br />
wurden nicht<br />
berücksichtigt.<br />
4.2. Einsatz von Substituten von Sojaextraktionsschrot (SES) in der Fütterung<br />
SES mit einer GVO-Verunreinigung unter 0,9 % (von in der EU zugelassenen GVO) bzw. 0,5 % (für von der EFSA<br />
befristet freigegebene GVO) war in Europa bis vor kurzer Zeit Mangelware bzw. schwer aufzutreiben. Zuletzt treten<br />
Anbieter für „GVO-freien“ SES aktiv auf <strong>und</strong> bieten zertifizierte Ware in großen Mengen an.<br />
„GVO-freie“, eiweißreiche Rohstoffe, erzeugt in Europa, können als Alternative zu SES in Betracht gezogen werden.<br />
Dafür kommen Produkte aus der Öl- <strong>und</strong> Stärkegewinnung, sowie verstärkt aus der Biospriterzeugung, aus Getreide,<br />
Seite 77 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 4: Verfügbarkeit Futtermittel<br />
Raps, Sonnenblumen etc. <strong>und</strong> Leguminosen als heimische Eiweißpflanzen sowie Kartoffeleiweiß, Milch <strong>und</strong> Hefe in<br />
Frage. Das vor einigen Jahren noch verwendete Tiermehl bzw. Fleischknochenmehl, kann aus gesetzlichen Gründen<br />
bekanntermaßen in der Fütterung nicht verwendet werden.<br />
Neben dem 100 % igen Ersatz des derzeit verwendeten als GVO gekennzeichneten SES durch „GVO-freien“ SES,<br />
wurde auch eine Substitution mit alternativen Eiweißträgern in Betracht gezogen. Dazu wurden umfangreiche<br />
Literaturrecherchen mit dem Ziel angestellt, gleichwertigen Ersatz für die Ernährung der wichtigsten Nutztiere (Rind,<br />
Schwein, Geflügel) ausfindig zu machen.<br />
Alle Körnerleguminosen (Ackerbohnen, Erbsen, Lupinen) aber auch Raps beinhalten spezielle Stoffe (Alkaloide,<br />
Glykoside u.ä.) <strong>und</strong> sind daher in der Fütterung monogastrischer Tiere (Schwein, Geflügel) nur bedingt einsetzbar.<br />
Sie können daher in den meisten Rationen aus ernährungsphysiologischen Gründen nur zu einer gewissen<br />
Einmischrate eingesetzt werden <strong>und</strong> SES daher nur teilweise ersetzen.<br />
Bei den Recherchen zu den Substitutionsmöglichkeiten, eine der Zentralfragen dieser Studie, wurden ca. 100<br />
Fütterungsstudien vorwiegend von Universitäten <strong>und</strong> Instituten aus dem mitteleuropäischen Raum (v.a. aus<br />
Österreich, aber auch aus Deutschland, Schweiz <strong>und</strong> Tschechien) herangezogen, damit ähnliche<br />
Produktionsbedingungen (Boden, Klima, Haltung) berücksichtigt werden können. Für die Bewertung von<br />
Trockenschlempe, auch als DDGS bezeichnet, wurden amerikanische Studien <strong>und</strong> ein Artikel von Chudaske (2005) im<br />
Feed Magazine 6/05 herangezogen. In den letzten 20 Jahren wurden an der Universität für Bodenkultur in Wien<br />
zahlreiche Studien, die sich mit teilweisem <strong>und</strong>/oder vollständigem Ersatz von SES beschäftigt haben, um den<br />
heimischen Anbau von Eiweißalternativen zu fördern, sowie um den (multifaktoriellen) Preisschwankungen des SES<br />
am Weltmarkt nicht mehr vollständig ausgeliefert zu sein, durchgeführt. Mit dem Tiermehlverbot, das in Österreich<br />
seit 1990 für Wiederkäuer <strong>und</strong> seit 2000 auch für monogastrische Nutztiere gilt, ergaben sich für den Einsatz von<br />
SES-Ersatzprodukten weitere Engpässe, nicht nur in der Eiweißversorgung, sondern auch bei der<br />
Aminosäurenversorgung.<br />
Die für Österreich möglichen Alternativen wurden nach den Tierarten (Rind, Schwein, Geflügel) <strong>und</strong> Tierkategorien<br />
(Milchvieh, Mastrind, Mastschwein, Ferkel, Zuchtsau, Legehennen <strong>und</strong> Mastgeflügel) gegliedert. Innerhalb der<br />
Tiergruppen wurde nach Pflanzenarten geordnet <strong>und</strong> darin die fütterungs- <strong>und</strong> leistungsspezifischen Möglichkeiten<br />
für die einzelnen Tierarten genauer betrachtet. Bei Rindern müssen wegen der unterschiedlichen Gr<strong>und</strong>futterbasis die<br />
speziellen Unterschiede der Grünland- <strong>und</strong> Ackerbaugebiete sowie vor allem das Leistungsniveau berücksichtigt<br />
werden, da von diesen Faktoren der Eiweiß- <strong>und</strong> Aminosäurenbedarf abhängt. Bei Substitutionsstudien ist jedenfalls<br />
das Niveau der Leistung zu betrachten. Manche Alternativen sind zwar im niederen bis mittleren Leistungsbereich<br />
möglich, können jedoch im höheren Leistungsbereich keine ausreichenden wirtschaftlichen Erfolge bringen <strong>und</strong> sind<br />
häufig physiologisch bedenklich. So sind zum Beispiel in der Schweinemast durchschnittliche Tageszunahmen von<br />
650-700g zu gering. Tageszunahmen von 800g-850g sind notwendig um am Markt wettbewerbsfähig bleiben zu<br />
können; Spitzenleistungen liegen bei 900g <strong>und</strong> mehr.<br />
In den herangezogenen Studien werden für die jeweilige Tierart die entsprechend benötigte Menge an SES durch<br />
Alternativpflanzen isoproteinogen, isoaminogen, aber auch isoenergetisch ersetzt.<br />
Als erste Alternative für den ausländischen SES bietet sich die heimische Sojabohne an, die in Österreich angebaut<br />
<strong>und</strong> physikalisch (thermisch) weiter behandelt werden müsste, um die Trypsininhibitoren abzubauen.<br />
Von den in Österreich derzeit geernteten ca. 44.000 t Sojabohnen werden ca. 26.000 t in der heimischen<br />
Futterindustrie <strong>und</strong> hier vor allem in der Biofuttermittelerzeugung verwendet. Eine Ausweitung des Anbaus ist bis zu<br />
einem gewissen Umfang zwar möglich, aufgr<strong>und</strong> der agronomischen Voraussetzungen aber unwahrscheinlich.<br />
Als nächste der „GVO-freien“ Alternativen werden in Österreich vorkommende Öl- <strong>und</strong> Hülsenfrüchte betrachtet,<br />
wovon im Speziellen auf Raps, Sonnenblume, Ackerbohne, Futtererbse <strong>und</strong> Lupine für jede Tierart einzeln genauer<br />
eingegangen werden soll.<br />
Zwei weitere Alternativen werden möglicherweise in den nächsten Jahren zusätzlich in größerer Menge als<br />
Futtermittel <strong>zur</strong> Verfügung stehen. Ca. 170.000 t DDGS ab 2007 fällt aus der Getreidedestillation für die<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 78 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 4: Verfügbarkeit Futtermittel<br />
Bioethanolerzeugung an <strong>und</strong> Rapskuchen (= Rapsexpeller) aus der Biodieselerzeugung. Rapsexpeller eignet sich für<br />
die Hühner-, Schweine- <strong>und</strong> Rindermast, während Trockenschlempe für alle Nutztierarten hervorragend geeignet zu<br />
sein scheint (vgl. Shurson, s.a.). Laut Chudaske (2005) stellt die getrocknete Getreideschlempe insgesamt eine<br />
interessante Komponente für Rinder (auch Hochleistungskühe) dar. Da DDGS in der Rationsberechnung neben<br />
Proteinträgern auch Getreide verdrängt, können insbesondere stärkereiche Rationen, welche eine hohe<br />
Azidosegefahr bergen, „entschärft“ werden. Auch in der Fütterung von Monogastrier ist der Einsatz von DDGS, wenn<br />
Einsatzraten von 5-10% nicht überschritten werden, durchaus empfehlenswert. In den USA gehen <strong>zur</strong>zeit 85% der<br />
DDGS in die Rinderfütterung, 5% wird an Geflügel verfüttert, <strong>und</strong> weitere 10% finden in Schweinerationen ihre<br />
Verwendung. DDGS hat sicherlich die beste Vorraussetzungen, sich am heimischen Markt als alternative Proteinquelle<br />
zu behaupten.<br />
• Beim Milchrind konnten in Summe über 12 Studien zu Raps, Erbse <strong>und</strong> Ackerbohne, Lupine,<br />
Sonnenblumenextraktionsschrot <strong>und</strong> DDGS ausgehoben werden.<br />
Nach Beleuchtung der bisher vorliegenden Studien <strong>und</strong> vorbehaltlich neuer <strong>und</strong>/oder neu ausgehobener Studien<br />
können für Milchrinder Rapsextraktionsschrot sowie physikalisch-behandelter Lupinenschrot bei einer mit Gras-<br />
<strong>und</strong> Maissilage optimal durchgestalteten Gr<strong>und</strong>futterration als erfolgreiche Alternative auch in<br />
Leistungsbereichen um 40 kg Milch pro Tag eingesetzt werden (vgl. Raab, 2002; vgl. Spiekers et al., 2002; vgl.<br />
Engelhardt et al., 2002; vgl. Pieper et al. 2004; vgl. Grünewald et al. 1996; vgl. Maierhofer et al., 2000;<br />
Steingass, H. 2003). Leider standen keine eigenen österreichischen Studien zu Rapsextraktionsschrot bei<br />
Milchvieh <strong>zur</strong> Verfügung.<br />
Für Rapsextraktionsschrot lagen ausreichend, jedoch für Lupinen nur sehr wenige Studien <strong>und</strong><br />
Erfahrungsberichte aus unseren Breiten vor. Der Anbau von Lupinen hat aber in Österreich <strong>und</strong> in der EU (ja<br />
weltweit) ohnehin geringe Bedeutung.<br />
DDGS, aber auch Nass-Schlempe, eignet sich vor allem beim Wiederkäuer hervorragend als teilweiser oder<br />
vollständiger SES-Einsatz <strong>und</strong> kann bis zu 20% in der Ration, bezogen auf die Trockenmasse, eingesetzt werden<br />
(vgl. Schingoethe, 2001 <strong>und</strong> vgl. Shurson, s.a.). Beim Rind könnte SES dadurch zu einem hohen Prozentsatz <strong>und</strong><br />
bei eiweißreichem Gr<strong>und</strong>futter vollständig ersetzt werden.<br />
• Auch beim Mastrind wurden Studien mit Ackerbohne, Futtererbse, Rapsexpeller bzw. -extraktionsschrot sowie<br />
mit Sonnenblumenextraktionsschrot betrachtet. Hier konnte Rapsschrot <strong>und</strong> -expeller als Ersatz für SES auch in<br />
höherem Mastniveau (1300-1400g tägliche Zunahmen), bei Maissilage als Gr<strong>und</strong>futter, erfolgreich eingesetzt<br />
werden (vgl. Feichtinger (1992), Preissinger, s.a.; Spann, 2000; Maierhofer, 2000).<br />
Mit Erbsen konnten bei gleichzeitig isonitrogenem <strong>und</strong> isoenergetischem Ausgleich in einem Versuch nur mittlere<br />
Tageszunahmen (1270g) erreicht werden (vgl. Lebzien, 2003).<br />
Alleinige Substitutionen mit Ackerbohnen bzw. auch in Kombination mit Erbsen konnten nur ein mittleres<br />
Mastleistungsniveau erreichen (vgl. Schwarz, 1989; Leitgeb, 1987; Leitgeb, 1988 <strong>und</strong> Müsch, 2001).<br />
Die Leistungen der Alternativen lagen im direkten Vergleich immer unter der SES-Gruppe. Auch<br />
Sonnenblumenextraktionsschrot kann nur 2/3 des SES in der Ration ersetzen.<br />
In der Rindermast wird von guten Erfolgen aus den USA über den Einsatz von 20% DDGS in der Ration<br />
berichtet. (vgl. Fanning et al. 1999 <strong>und</strong> Shurson et al., 2003).<br />
• In der Schweinemast wurden Ackerbohne, Erbsen, Lupinen, heimische Sojabohnen, Raps- <strong>und</strong><br />
Sonnenblumenextraktionsschrot untersucht. Mit Ackerbohnen <strong>und</strong> Erbsen kann bei vollständigem SES-Ersatz<br />
<strong>und</strong> ohne Aminosäurenergänzung nur ein niedriges bis mittleres Mastniveau erreicht werden.<br />
Lysin stellt beim Schwein die erstlimitierende Aminosäure dar <strong>und</strong> darf nach Codex nur eingesetzt werden, wenn<br />
ein Zertifikat für gentechnikfreie Herstellung vorliegt. Nach VO(EG)1829/2003 ist der Einsatz von Lysin ohne<br />
Zertifikat zugelassen. Eine Schweinemast ohne Lysinergänzung kann jedoch aus wirtschaftlichen <strong>und</strong><br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 79 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 4: Verfügbarkeit Futtermittel<br />
ernährungsphysiologischen Gründen nicht empfohlen werden, da hier vor allem mit deutlichen<br />
Leistungseinbußen zu rechnen ist.<br />
Eine Kombination von Ackerbohnen <strong>und</strong> des hochwertigen Kartoffeleiweißes als SES-Ersatz brachte jedoch sehr<br />
gute Masterfolge (vgl. S<strong>und</strong>rum, 1999). Mit Lupinen konnten in einem deutschen Versuch sehr hohe<br />
Masterfolge (800-900g Tageszunahmen) erreicht werden, wobei ein Ausgleich mit Lysin vorgenommen wurde<br />
(vgl. Quanz, 2003 <strong>und</strong> Priepke, 2004).<br />
Der Einsatz von Rapsexpeller (= Rapskuchen) mit einer Einmischrate bis zu 20% im Schweinemastalleinfutter,<br />
bzw. bis zu 50% im Schweinemastergänzungsfutter (was einen über 75% SES-Ersatz bedeutet) brachte zwar<br />
keine nachteiligen Auswirkungen auf die Mast- <strong>und</strong> Schlachtleistung, jedoch nur auf einem niedrigen<br />
Leistungsniveau von unter 700g Tageszunahmen (vgl. Wetscherek et al., 1988 <strong>und</strong> 1989; vgl. Lettner, 1992;<br />
Wetscherek, 1992).<br />
Der Einsatz von Kürbiskernkuchen kann nur bis 4% maximal 8% in der Ration empfohlen werden (vgl.<br />
Wetscherek-Seipelt, 1991).<br />
Für Sauen <strong>und</strong> Ferkel lagen nur sehr wenige vergleichende Studien vor. Bei diesen Tierkategorien wird es nur<br />
sehr schwer möglich sein, gleichzeitig ohne SES <strong>und</strong> Zusatz von Aminosäuren auszukommen.<br />
• Mastgeflügel:<br />
Rapsexpeller, Ackerbohne, Erbse, Sojabohne <strong>und</strong> Lupine wurden als Alternative für SES betrachtet. Die<br />
erstlimitierende Aminosäure beim Geflügel ist Methionin <strong>und</strong> kann nach Codex <strong>und</strong> VO (EU) 1829/2003<br />
eingesetzt werden. Gleichwertige Mastleistungen können ohne Methionin-Zusatz, wie z.B. der Biolandbau es<br />
vorschreibt, nicht erzielt werden. Der Einsatz von Rapsextraktionsschrot ist mit 15-20% bzw. der Einsatz von<br />
Rapskuchen mit 20% im Alleinfutter begrenzt, darüber hinaus sinken die Leistungen (vgl. Würzner, 1988 <strong>und</strong><br />
Würzner, 1989; vgl. Lorenz, 1990).<br />
Ackerbohne kann SES nur teilweise ersetzen, da der maximale Einsatz von Ackerbohne hier bei 15-20 % in der<br />
Ration begrenzt ist (vgl. Lettner, 1984).<br />
Auch Erbse kann SES nicht vollständig ersetzen. Lettner et al (1985) halten max. 30% Erbsen in der Ration für<br />
möglich. Lupine könnte mit bis zu 18% in einer Masthuhnration eingesetzt werden (vgl. Schams-Schargh, 1993).<br />
• Bei Legehennen führte schon ein teilweiser Ersatz des SES durch 10% Raps zu geschmacklichen<br />
Veränderungen im Ei, bzw. bei 20% Erbse kam es zu Leistungseinbußen (vgl. Genedey, 1994).<br />
Der Einsatz von Lupinen für Legehennen müsste erst in heimischen Studien nachgeprüft werden.<br />
Zusammenfassend kann festgehalten werden:<br />
• In der konventionellen Milch-Rinderhaltung ist der SES-Ersatz durch Substitute bis zu einem<br />
mittleren Leistungsniveau erfolgreich. Bei höherem Leistungsniveau kann anhand einer<br />
Literaturauswertung – optimale Gr<strong>und</strong>futterversorgung mit Gras-<strong>und</strong> Maissilage vorausgesetzt -<br />
SES allerdings nur durch Rapsextraktionsschrot vollständig ersetzt werden.<br />
• In der konventionellen Mast-Rinderhaltung ist im höheren Leistungsniveau eine vollständige<br />
Substitution von SES nur bei Rapsextraktionsschrot für alle Leistungsstufen durch Studien belegt.<br />
• In der konventionellen Mast-Schweineproduktion ist der SES-Ersatz im niedereren bis mittleren<br />
Leistungsniveau möglich. Im höheren Leistungsniveau kann SES nicht vollständig ersetzt werden.<br />
• In der konventionellen Mastgeflügel- <strong>und</strong> noch mehr in der Eierproduktion kann SES keinesfalls<br />
durch Substitute vollständig ersetzt werden.<br />
Abschließend soll festgehalten werden, dass ohne dem Einsatz von Aminosäuren <strong>und</strong> Vitamine,<br />
jedenfalls ab dem mittleren Leistungsniveau, zu wirtschaftlichen Rahmenbedingungen <strong>und</strong> ohne<br />
Mangelerscheinungen eine konventionelle Tierhaltung keinesfalls möglich <strong>und</strong> zu verantworten ist.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 80 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 4: Verfügbarkeit Futtermittel<br />
Dies trifft besonders für die Schweine- <strong>und</strong> Geflügelhaltung zu. Mangelerscheinungen <strong>und</strong> somit der<br />
Tierschutzaspekt, sollten aufgr<strong>und</strong> ernsthafter ges<strong>und</strong>heitlicher Beeinträchtigungen durch Vitamin B2-<br />
<strong>und</strong> B12-Mangel, sowie durch den Mangel essentieller Aminosäuren, bei der Haltung von Schwein <strong>und</strong><br />
Geflügel, neben massiven wirtschaftlichen Einbußen, nicht außer Acht gelassen werden.<br />
Die Menge von etwa 600.000 t SES kann nicht <strong>zur</strong> Gänze (1:1) durch andere pflanzliche Rohstoffe<br />
ersetzt werden. Die Eiweißlücke von 276.000 t Rohprotein (entspricht ca. 600.000 t SES) müsste<br />
durch ZUSÄTZLICHE Substitute (Anbau, Import) <strong>und</strong> „GVO-freiem“ SES gefüllt werden. Die derzeit<br />
verfügbaren Mengen der oben betrachteten <strong>und</strong> auch in den Modellrationen eingesetzten Substitute<br />
wurden im Kapitel 3.1.2. erörtert.<br />
4.2.1. Gegenüberstellung des Rohproteinwertes <strong>und</strong> des Aminosäuremusters von Soja 44 <strong>und</strong> Soja 48<br />
zu alternativen Eiweißträgern<br />
Um eine geeignete Substitution für SES vornehmen zu können, muss nicht nur der Rohproteingehalt, sondern auch<br />
das Muster der wichtigsten Aminosäuren vor allem Lysin <strong>und</strong> Methionin dem von SES gegenüber gestellt werden. Bei<br />
einigen Alternativen wird es jedoch auch wirtschaftliche Grenzen sowie mangelnde Verfügbarkeit geben, die einen<br />
hohen Einsatz in der Ration unmöglich machen, wie zum Beispiel beim teuren Kartoffeleiweiß oder bei<br />
Milchprodukten. Laut ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR WIRKSTOFFE IN DER TIERERNÄHRUNG (1998, 33) weisen die aufgelisteten<br />
alternativen Eiweißträger folgende Gehalte an den wichtigsten Aminosäuren auf:<br />
Tabelle 4-14: Rohproteinwerte <strong>und</strong> Aminosäuregehalte von SES <strong>und</strong> einzelner SES-Substitute in %<br />
Angabe in % Rohprotein Lysin Threonin Methionin Methionin+C Tryptophan<br />
SES/SES-Substitute Angaben in %<br />
Sojaschrot44 44 2,75 1,76 0,64 1,31 0,57<br />
Sojaschrot48 47,6 2,98 1,89 0,69 1,40 0,61<br />
Ackerbohne 25 1,57 0,9 0,19 0,5 0,22<br />
Erbse 20 1,46 0,78 0,21 0,53 0,19<br />
Rapsextraktionsschrot 35 1,95 1,53 0,71 1,59 0,45<br />
Maiskleber 60,5 1,02 2,08 1,43 2,52 0,31<br />
Sonnenblumenschrot 36,2 1,29 1,35 0,84 1,48 0,43<br />
Lupine* 34,4 5,4 3,6 0,8 2,6 0,7<br />
Fischmehl 55 56,3 4,1 2,31 1,53 2,08 0,53<br />
Magermilchpulver 35,8 2,76 1,58 0,89 1,17 0,49<br />
Kürbiskernkuchen 58,3 2,45 1,8 1 2,1 0,5<br />
Kartoffeleiweiss 84 6,2 4,1 1,85 2,75 1,85<br />
Grünmehl 17 0,74 0,7 0,25 0,43 0,27<br />
Rapskuchen 32 1,8 1,44 0,8 1,25 0,44<br />
DDGS (Weizen) 31 0,97 1,25 0,58 0,96 0,33<br />
*UNIVERSITÄT GIESSEN (2005); Es wird darauf hingewiesen, dass die Rohprotein- <strong>und</strong> Aminosäurewerte der Lupine sehr schwankend<br />
sind. Die Werte in der Tabelle sind auf 87% Trockensubstanz standardisiert.<br />
Quelle: Laut ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR WIRKSTOFFE IN DER TIERERNÄHRUNG 1998, 33<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 81 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 4: Verfügbarkeit Futtermittel<br />
Das Ergebnis der Gegenüberstellung der Protein- <strong>und</strong> Aminosäuregehalte von Soja44, Soja48 <strong>und</strong> der wichtigsten<br />
Alternativen wurde in Tabelle 4-14 zusammengefasst <strong>und</strong> in Tabelle 4-15 wurde versucht aufzuzeigen, zu welchem<br />
Grad (Prozentsatz) die SES-Substitute den Rohproteingehalt decken, <strong>und</strong> welche Menge aber gleichzeitig notwendig<br />
wäre, um den Aminosäurengehalt abzudecken. Daraus wird deutlich, dass beim Ersatz von SES <strong>zur</strong> Erzielung des<br />
gleichen Proteingehalts („isoproteinogen“) in den meisten Fällen zusätzlich mit Aminosäuren ergänzt werden müsste.<br />
Bei manchen Pflanzen müsste die 2-3 fache Menge in der Ration eingesetzt werden, damit das Aminosäuremuster<br />
von SES abgedeckt wäre. Nur wenige Substitute decken das Aminosäuremuster gleichzeitig mit dem<br />
Rohproteingehalt <strong>zur</strong> Gänze ab, wie dies am Beispiel Kartoffeleiweiß oder Lupine der Fall ist. Für alle Substitute<br />
ergeben sich mehr oder minder große Defizite in der ernährungsphysiologischen Wertigkeit im Vergleich zu SES. Es<br />
ist daher nicht verw<strong>und</strong>erlich, dass SES von der Futtermittelindustrie <strong>und</strong> von den Landwirten in den Futterrationen<br />
im Vergleich zu Substituten bevorzugt wird. Nichts destotrotz ist allerdings festzuhalten, dass die heimischen<br />
Substitute erhebliche Mengen an SES ersetzen können. Da diese, insbesondere österreichische Erzeugnisse, „GVO-<br />
frei“ oder <strong>„gentechnikfrei“</strong> sind, ergeben sich auch ökonomisch interessante Alternativen.<br />
Tabelle 4-15: Abdeckung des Rohproteingehaltes <strong>und</strong> Aminosäuregehaltes im Vergleich mit SES<br />
Pflanze Abdeckung<br />
Rohprotein<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Abdeckung der<br />
limitierenden Aminosäure<br />
Ackerbohne 55% 3 fache Menge an Methionin erforderlich<br />
Erbse 47% 3 fache Menge an Tryptophan erforderlich<br />
Rapsextraktionsschrot 75% 1,5 fache Menge an Lysin erforderlich<br />
Maiskleber 130% 2,5 bis 3 fache Menge an Lysin <strong>und</strong> Tryptophan<br />
Sonnenblumen-<br />
extraktionsschrot<br />
Lupine*<br />
erforderlich<br />
80% 2,5 fache Menge an Lysin erforderlich<br />
75%<br />
Aminosäuren sind gedeckt<br />
*Problem der großen Schwankungen<br />
Fischmehl 55 122% 1,5 fache Menge an Tryptophan erforderlich<br />
Magermilchpulver 78% 1,5 fache Menge an Tryptophan <strong>und</strong> Threonin erforderlich<br />
Kürbiskernkuchen<br />
127% Aminosäuren sind gedeckt bei Austausch von 1:1.<br />
Kartoffeleiweiß 200% Aminosäuren sind gedeckt, auch bei 50%<br />
Grünmehl<br />
Rapskuchen<br />
DDGS (Weizen)<br />
Quelle: eigene Darstellung<br />
35% 3-4 fache Menge an Lysin, Methionin,<br />
Threonin <strong>und</strong> Tryptophan erforderlich<br />
69% 1,5 fache Menge an Lysin, Threonin <strong>und</strong> Tryptophan<br />
erforderlich<br />
67% 3 fache Menge an Lysin, 1,5 fache Menge an Methionin u.<br />
Threonin <strong>und</strong><br />
doppelte Menge an Trypt. Erforderlich<br />
Seite 82 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 4: Verfügbarkeit Futtermittel<br />
4.2.2. Einsatzempfehlungen für alternative, eiweißreiche pflanzliche Futtermittel<br />
Bei manchen SES-Substituten gibt es von der ernährungsphysiologischen Seite her Einsatzgrenzen, ab deren<br />
Überschreitung mit Mangelerscheinungen <strong>und</strong> Leistungseinbußen zu rechnen ist. Die Zugabe von Zusatzstoffen ist<br />
jedenfalls bei Substituten von essentieller Bedeutung, sollen Mangelerscheinungen vermieden werden. Auf die<br />
Problematik der un<strong>zur</strong>eichenden Verfügbarkeit von Zusatzstoffen, welche die Codex-Anforderungen erfüllen, sei<br />
jedenfalls auch an dieser Stelle hingewiesen.<br />
Die in Kapitel 3 angeführte ZUSÄTZLICHE Verfügbarkeit von SES-Substituten kann den Gesamtbedarf an SES in<br />
Österreich keinesfalls decken. Durch die zukünftige Biosprit- <strong>und</strong> Biodieselerzeugung fallen zum aktuellen Stand<br />
zusätzliche SES-Substitute an. Diese könnten bei optimistischer Betrachtung zirka die Hälfte des SES-Bedarfs in<br />
Österreich abdecken.<br />
Zusätzlich stellt die Verfügbarkeit von Substituten eine Begrenzung dar, z.B. ist Kürbiskernkuchen sicher ein<br />
hervorragender Eiweißlieferant, kann aber nur einen kleinen Teil des österreichischen Bedarfes decken. In Tabelle 4-<br />
16 ist dargestellt, wo die maximalen physiologischen Einsatzgrenzen für jeweilige Alternativpflanzen <strong>und</strong> tierische<br />
Produktionssparten liegen. Die maximalen Einsatzgrenzen (siehe Tabelle 4-16) sollen veranschaulichen , dass<br />
Substitute innerhalb einer Ration nicht unbegrenzt nach oben ausgetauscht werden können, da<br />
ernährungsphysiologische Grenzen (Leistungsabfall, Akzeptanz, Verdaulichkeit etc.) überschritten werden könnten.<br />
Die Werte bei den Monogastriern stammen aus einer älteren Literaturangabe (vgl. Wetscherek, 1993) <strong>und</strong> wurden in<br />
Einzelversuchen ermittelt. Die dort angegebenen Maximalwerte gelten somit pro Einzelkomponente <strong>und</strong> dürfen<br />
keineswegs additiv in der Ration eingesetzt werden. Heimische Forschungsergebnisse für Substitute in der<br />
Nutztierfütterung, vor allem mit Trockenschlempe <strong>und</strong> neueren glucosinolatarmen Rapssorten, wären vorteilhaft.<br />
4.2.3. Verwertung von DDGS <strong>und</strong> Rapskuchen aus der Biokraftstofferzeugung<br />
Da mit dem Jahr 2007 etwa 340.000 t Rapspresskuchen <strong>und</strong> ca. 170.000 t DDGS aus der Biotreibstoffproduktion<br />
anfallen werden, soll in den unten stehenden Varianten die Möglichkeit einer sinnvollen Verwertung dieser<br />
zusätzlichen eiweißhaltigen Nebenprodukte als Futtermittel in Österreich betrachtet werden.<br />
Der durchschnittliche Rohproteingehalt von Rapskuchen liegt bei 32%, der von DDGS bei 31%. Ausgegangen wird<br />
von der SES-Importmenge des Jahres 2003 mit ca. 600.000 t. Der übliche Rohproteingehalt von SES (44% <strong>und</strong> 48%)<br />
wurde mit 46% gemittelt. Vorweggenommen sei, dass bei beiden Varianten der Aminosäuregehalt (durch<br />
Zusatzstoffe=Aminosäuren) ausgeglichen werden müsste. Die Studien über Trockenschlempe stammen aus den USA<br />
worin hervorragende Ergebnisse mit Trockenschlempe bei allen Nutztieren erzielt werden konnten. Dabei sollte aber<br />
erwähnt werden, dass bei der Erzeugung von Trockenschlempe wahrscheinlich Enzyme zum Einsatz kommen, welche<br />
mit Hilfe von gentechnisch veränderten Mikroorganismen hergestellt werden. Dies würde aber eine Verwendung<br />
gemäß Codex ausschließen <strong>und</strong> nur eine Verwendung nach VO (EG) 1829/2003 erlauben. Trotz dieser exzellenten<br />
Erfolge in den USA mit DDGS, sollten diese Forschungergebnisse bei allen Tierarten durch eigene österreichische<br />
Studien bestätigt werden, da in Österreich andere Rahmenbedingungen <strong>und</strong> Betriebsstrukturen herrschen. Zudem<br />
sollten auch heimische Fütterungsversuche mit Rapskuchen aus neueren Rapssorten angestrebt werden, da die<br />
letzen österreichischen Studien mit Raps bei Monogastriern noch mit alten Rapssorten aus dem Beginn der 90iger<br />
Jahre stammen.<br />
Variante 1: Gesamte anfallende Menge an Rapskuchen <strong>und</strong> DDGS sollen verfüttert werden<br />
600.000 t SES x 0,46 (Rohproteingehalt) = 276.000 t Rohprotein, die durch Trockenschlempe <strong>und</strong> Rapskuchen<br />
ersetzt werden müssten.<br />
____________________________________________________<br />
170.000 t Trockenschlempe* x 0,31 = 52.700 t Rohprotein<br />
340.000 t Rapskuchen** x 0,32 = 108.800 t Rohprotein<br />
276.000 t - 52.700 t – 108.800 t = 114.500 t Rohproteindifferenz<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 83 von 272
___________________________________________________<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 4: Verfügbarkeit Futtermittel<br />
Diese Differenz könnte durch 248.913 t „GVO-freien“ SES ausgeglichen werden.<br />
* gemäß geplantem Werk in Österreich<br />
** gemäß geplantem Werk in Österreich<br />
Die zusätzliche Menge von 340.000 t Rapskuchen kann jedoch aufgr<strong>und</strong> physiologischer <strong>und</strong> geschmacklicher<br />
Einsatzgrenzen in Österreich in der Tierernährung nicht verwertet werden. Die Menge von 170.000 t DDGS findet<br />
jedoch sehr wohl in der heimischen Fütterung ihre Verwendung.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 84 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 4: Verfügbarkeit Futtermittel<br />
Tabelle 4-16: Maximale Einsatzgrenzen in % bzw. kg für alternative, heimische Pflanzen in der Ration (vgl. Wetscherek, 1993; SHURSON, 2004 <strong>und</strong> s.a)<br />
Tierproduktion Ackerbohne Erbse Sojabohne<br />
(thermisch<br />
behandelt)<br />
Lupine Rapsexpeller Rapsextraktions-<br />
schrot<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Sonnenblumen-<br />
extraktionsschrot<br />
Kürbiskern-<br />
Kuchen ***<br />
DDGS<br />
Trockenschlempe<br />
Zuchtsauen 20% 20% 10-20% X 5- (10)% 5- (10)% 10% 5% 10-20%DMI<br />
Ferkelaufzucht 20% 10-20% 10-20% X 5- (10)% 5- (10)% 5% 5% 5-25%DMI<br />
Schweinemast 30% 30% 10- 20(30)% 10% 10-15 - (20)% 12-15 - (20)% 10- (20)% 4-(8)% 10-20% DMI<br />
Geflügelmast 30% 30% 20-30% 18% 15-(20)% 10-(20)% 15% 5% 5-10% DMI<br />
Legehennen (10-20)% 20% 10-15% 10% 10% (10)%* 10% 5% 10% DMI<br />
Milchvieh*** 1,5-2 kg 1,5-2 kg 2,5kg 3,0 kg 20%** 30%** 0,5-1,5kg X 20-30% DMI<br />
Mastrind*** 1,25kg 1,25kg 1,25kg 0,25-0,5kg 20%** 30%** 0,5-1 kg X 20-30% DMI<br />
Bei Werten in Klammer () ist bereits mit Leistungsabfällen zu rechnen. *:Nach thermischer Behandlung <strong>und</strong> nur bei Legehennen mit weißschaligen Eiern.<br />
Alle Werte für DDGS stammen aus amerikanischer Literatur <strong>und</strong> beziehen sich auf Trockenmasseaufnahme pro Tag (DMI- dry matter intake)<br />
X: Keine Erfahrungen. **: empfohlene Anteile im Kraftfutter; *** geschätzte Werte<br />
Seite 85 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 4: Verfügbarkeit Futtermittel<br />
VARIANTE 2: 200.000 t Rapskuchen <strong>und</strong> gesamte Menge an DDGS sollen verfüttert werden<br />
600.000 t x 0,46 = 276.000 t Rohprotein aus konventionellem SES sollen ersetzt werden<br />
_______________________________________________________________<br />
170.000 t x 0,31 = 52.700 t Rohprotein aus Trockenschlempe<br />
200.000 t x 0,32 = 64.000 t Rohprotein aus Rapskuchen<br />
276.000 t - 52.700 t – 64.000 t = 159.300 t Rohproteindifferenz<br />
________________________________________________________________<br />
Diese Differenz könnte/müsste durch 346.304 t „GVO-freien“ SES ausgeglichen werden.<br />
Mit dieser Variante könnten r<strong>und</strong> 250.000 t SES ersetzt werden <strong>und</strong> dem physiologischen Bedarf an Rapskuchen<br />
<strong>und</strong> Trockenschlempe (DDGS) in Österreich würde am ehesten entsprochen.<br />
Anzumerken ist, dass für den Biodieselbedarf in Österreich keinesfalls genügend Raps verfügbar ist, sodaß<br />
erhebliche Importe erforderlich sind. Damit wird jedoch das Risiko einer GVO-Verunreinigung bei Rapskuchen<br />
deutlich höher.<br />
4.2.4. Monetäre Betrachtung <strong>und</strong> Aspekte der Verfügbarkeit der Substitute<br />
Substitution mit Erbsen, Ackerbohnen, Lupine, Sojabohne :<br />
Bei Körnerleguminosen sind die Mengen, welche zusätzlich benötigt würden, um SES zu substituieren bei weitem<br />
nicht vorhanden. Eine zusätzliche Menge an Erbsen von 50.000 t im Jahr, wie es sie im Rekordjahr 1998 gegeben<br />
hat (siehe Kapitel 3), würde bei einem Einsatz von durchschnittlich 20 % im Schweinefutter nur die Erzeugung<br />
von 250.000 t der insgesamt 2,200.000 t Schweinefutter bewerkstelligen.<br />
Substitution mit DDGS :<br />
DDGS eignet sich besonders gut als Alternative zu SES, da amerikanischen Studien <strong>zur</strong> Folge, speziell im<br />
Rinderbereich keine ernährungsphysiologischen Höchstgrenzen bekannt sind <strong>und</strong> auch der Geschmack keinen<br />
begrenzenden Faktor in der Ration darstellt. Die Qualität <strong>und</strong> somit der mögliche Einsatz in der Tierernährung,<br />
der aufgr<strong>und</strong> der geplanten Erzeugung von Biosprit anfallenden Menge von 170.000 t österreichischer DDGS,<br />
wird sich in der nahen Zukunft zeigen. Eine Menge von 109.791 t SES könnte durch den Einsatz von 170.000 t<br />
DDGS substituiert werden. In der Schweine- <strong>und</strong> Geflügelfütterung ist darauf zu achten, dass ein entsprechender<br />
Ausgleich mit Aminosäuren vorgenommen wird. Die Preisentwicklung der DDGS kann noch nicht vorausgesagt<br />
werden, aufgr<strong>und</strong> der heimischen (kurze Transportwege,…) <strong>und</strong> geförderten Produktion wird DDGS aber auch in<br />
preislicher Hinsicht eine interessante Alternative darstellen.<br />
Substitution mit Rapsextraktionsschrot:<br />
Wie verschiedene Studien an den einzelnen Universitäten aufzeigen, stellt Rapsextraktionsschrot eine mögliche<br />
Alternative zu SES als Eiweißquelle in der Tierernährung dar. In Tabelle 4-15 (Kapitel 4.2.2.) ist jedoch ersichtlich,<br />
dass aufgr<strong>und</strong> geschmacklicher <strong>und</strong> ernährungsphysiologischer Grenzen, nicht für alle Tierkategorien eine<br />
Substitution durchführbar ist. Im speziellen kann nur in der Rinderfütterung eine Empfehlung für<br />
Rapsextraktionsschrot gegeben werden. Zusätzlich schränken noch weitere Faktoren die Verwendung von<br />
Rapsextraktionsschrot in der Fütterung ein:<br />
Die längerfristige Verfügbarkeit (über 5 Jahre hinaus) von „GVO-freiem“ Rapsextraktionsschrot konnte im Rahmen<br />
dieser Studie von keiner Seite zugesichert werden. Es wird von der weiteren Entwicklung der Gentechnik in der<br />
EU abhängen, ob Raps/Rübsen <strong>und</strong> deren Nebenprodukte aus der Biodieselerzeugung nach 2010 „GVO-frei“ sein<br />
werden.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 86 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 4: Verfügbarkeit Futtermittel<br />
In Österreich findet derzeit eine Menge von ca. 100.000 t an „GVO-freiem“ oder „gentechnikfreiem“<br />
Rapsextraktionsschrot in der Tierernährung Verwendung <strong>und</strong> es wird somit eine Rohproteinmenge von 35.000 t<br />
<strong>zur</strong> Verfügung gestellt. Die Rapsmenge für die Biotreibstoffproduktion ab 2007 müsste zum überwiegenden Teil<br />
importiert werden, weil in Österreich die nötigen Anbauflächen nicht zu Verfügung stehen.<br />
Aber auch hinsichtlich der qualitativen Eigenschaften kann Rapsextraktionsschrot die hohen Vorgaben von SES<br />
nicht erfüllen. Der niedere Energiegehalt im Vergleich zu SES, der Gehalt an antinutritiven Stoffen <strong>und</strong> der<br />
Geschmack erlauben in der konventionellen Tierernährung nur einen sehr geringen Einsatz von Rapsprodukten<br />
im Geflügelbereich <strong>und</strong> in der Schweinefütterung (siehe Kapitel 4, Tabelle 4-15). Für die Rindermast <strong>und</strong><br />
Milchviehfütterung belegen zwar verschiedene Studien aus Deutschland, dass mittlere bis hohe Leistungen<br />
durchaus erzielbar sind, eine allgemeingültige <strong>und</strong> österreichweite Aussage kann jedoch aufgr<strong>und</strong><br />
unterschiedlicher Gr<strong>und</strong>futterbeschaffenheit (Energie- <strong>und</strong> Eiweißgehalt) <strong>und</strong> Managementvoraussetzungen nicht<br />
getroffen werden. Außerdem stehen derzeit keine ZUSÄTZLICHEN Rapsmengen <strong>zur</strong> Verfügung, um SES durch<br />
RES ausreichend zu substituieren. Angemerkt muss außerdem werden, dass trotz des meist viel geringeren<br />
Preises <strong>und</strong> dem Vorliegen mehrerer positiver Studien über den Einsatz von Rapsextraktionsschrot in der<br />
Rinderfütterung, die Landwirte aufgr<strong>und</strong> praktischer Erfahrungen SES eindeutig bevorzugen. Herr Prof. Dr.<br />
Windisch (Universität für Bodenkultur) weist hin, dass im Hochleistungsbereich der Raps die Versorgung der Tiere<br />
mit Nährstoffen stärker limitiert als SES. Weiters liegen mündliche Berichte von Landwirten <strong>und</strong> Tierärzten vor,<br />
wonach durch den Einsatz von Raps im Milchviehbereich ein vermehrtes Auftreten von Sterilitäten (Umrindern) im<br />
Bestand zu beobachten ist. Durch Studien bzw. wissenschaftliche Literatur konnten diese Aussagen jedoch nicht<br />
verifiziert oder bestätigt werden.<br />
Substitution mit Kartoffeleiweiß, Kürbiskernkuchen,… :<br />
Laut eines bedeutenden Verarbeiters von Kartoffel in Österreich steht eine Menge von ca. 3.000 t Kartoffeleiweiß<br />
für die Tierernährung <strong>zur</strong> Verfügung. Bei einem durchschnittlichen Einsatz von 2,5 % im Schweinefutter könnte<br />
somit lediglich eine Menge von 120.000 t Schweinefutter (ca. 5 % des gesamten österreichischen<br />
Schweinefutters) gemischt werden. Der geschilderte Sachverhalt soll aufzeigen, dass die Substitutionsrezepturen<br />
mit Kartoffeleiweiß zwar physiologisch machbar sind, in diesem Fall jedoch die Verfügbarkeit den begrenzenden<br />
Faktor bildet, da die notwendigen, zusätzlichen Mengen nicht aufgetrieben werden können. Bei weiteren<br />
alternativen Eiweißpflanzen, wie z.B. dem Kürbiskernkuchen stellt sich der Sachverhalt ähnlich dar.<br />
Im Kapitel „spezielle Mehrkosten“ werden anhand unterschiedlicher Rohstoffpreise für „GVO-freien“ <strong>und</strong> GVO-<br />
SES, sowie Preise für zukünftig zusätzlich anfallende Substitute die unterschiedlichen Kosten von konventionellen<br />
<strong>und</strong> „GVO-freien“ Rationen berechnet. Für die Kostenwahrheit ist es jedoch unerlässlich, alle kostenrelevanten<br />
Aspekte einzubeziehen. Beispielsweise können durch die universelle Einsetzbarkeit von Soja auf gemischten<br />
Betrieben, aufgr<strong>und</strong> des geringeren Arbeitsaufwandes <strong>und</strong> der einfacheren Logistik (Beschaffung, Lagerung),<br />
erhebliche Kosten eingespart werden. Da SES in einer konventionellen Rezeptur als alleinige Eiweißquelle<br />
ausreicht, Substitute jedoch zumeist in Kombination eingesetzt werden müssen, um die physiologischen<br />
Ansprüche zu erfüllen, sind auch hier die entstehenden Kosten unterschiedlich zu bewerten. Leistungseinbußen<br />
durch Einsatz der Substitutionsrezeptur konnten aufgr<strong>und</strong> fehlender Versuche ebenfalls nicht monetär bewertet<br />
werden. Es sei erwähnt, dass Studien mit Raps (unter speziellen Voraussetzungen auch mit Lupinen) in der<br />
Rinderfütterung sehr wohl gute Leistungen belegen, unterschiedliche Gr<strong>und</strong>futter- <strong>und</strong><br />
Managementvoraussetzungen lassen jedoch keine österreichweiten Aussagen zu. Für alle anderen Substitute<br />
konnte der Ersatz von SES nur im unteren bis maximal mittleren Leistungsbereich erfolgreich umgesetzt werden.<br />
Praktische Erfahrungen vieler Landwirte zeigen, dass SES einfach einzusetzen ist <strong>und</strong> am ehesten Fehler im<br />
Fütterungs-Management verzeiht. Der Einsatz von Substituten erfordert gezieltes <strong>und</strong> genaueres <strong>und</strong> somit<br />
teureres Arbeiten. Der schwankende Rohproteingehalt der Substitute (z. B.: Erbsen zwischen 20 <strong>und</strong> 25 %) <strong>und</strong><br />
die nicht ganzjährige Verfügbarkeit zwingen außerdem zu einem konsequenten Rohstoffmonitoring <strong>und</strong> ständiger<br />
Anpassung der Rezepturen. Der ständige Austausch von Eiweißträgern in der Rezeptur bringt Einschränkungen in<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 87 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 4: Verfügbarkeit Futtermittel<br />
der Akzeptanz des Futters durch die Tiere mit sich. In der Praxis wird eine durchschnittliche Umstellungszeit, bis<br />
wieder eine 100%-ige Futteraufnahme erreicht ist, von ca. 2 Wochen beobachtet.<br />
Neben den entstehenden Mehrkosten aufgr<strong>und</strong> der Logistik, Leistungseinbußen, des höheren<br />
Arbeitsaufwandes etc. ist aufgr<strong>und</strong> der zu geringen Verfügbarkeit eine vollständige Substitution<br />
von SES in Österreich nicht möglich (siehe Kapitel 3.1.2., Tabelle 3-21 <strong>und</strong> Tabelle 3-24).<br />
4.3. Zwischenresümee aus Ernährungsphysiologie, Verfügbarkeit <strong>und</strong> gesetzlichen<br />
Rahmenbedingungen<br />
Um ein Zwischenresümee ziehen zu können sollen folgende drei Rahmenbedingungen gemeinsam betrachtet<br />
werden:<br />
1. Erfüllung der Anforderungen der Ernährungsphysiologie<br />
2. derzeitige Verfügbarkeit von „GVO-freien“ oder „gentechnikfreien“ Futtermittelausgangserzeugnissen<br />
(Rohstoffen) <strong>und</strong> Zusatzstoffen<br />
3. Erfüllung der gesetzlichen Rahmenbedingungen bzw. der Anforderungen gem. österreichischem Codex für die<br />
<strong>Auslobung</strong> „Gentechnikfrei“.<br />
Die Mehrkosten <strong>und</strong> die zu erwartende Problematik der Kleinlogistik sind hier noch nicht hinzugerechnet.<br />
Es werden insgesamt 4 Varianten für die Erstellung von Fütterungsrationen betrachtet:<br />
Zusatzstoffe u.<br />
Aminosäuren (AS)<br />
mit GVM<br />
Rationen mit „GVOfreien/m“<br />
oder<br />
„gentechnikfreien/m“<br />
Sojabohnen/SES<br />
„GVO-freier“ SES<br />
„gentechnikfreier“<br />
SES<br />
x x<br />
x X<br />
„GVO-freie“<br />
Substitute<br />
Die 1. Variante: „GVO-freier“ SES; Zusatzstoffe <strong>und</strong> Aminosäuren aus GVM sind erlaubt.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
„gentechnikfreie“<br />
Substitute<br />
Die 2. Variante: „gentechnikfreier“ SES (sofern verfügbar). Zusatzstoffe <strong>und</strong> Aminosäuren aus GVM werden<br />
NICHT verwendet.<br />
Die 3. Variante: „GVO-freie“ Substitute enthält keinen SES, verwendet aber Zusatzstoffe <strong>und</strong> Aminosäuren aus<br />
GVM.<br />
Die 4. Variante: „gentechnikfreie“ Substitute arbeitet ohne SES. Zusatzstoffe <strong>und</strong> Aminosäuren aus GVM werden<br />
NICHT angewendet.<br />
An dieser Stelle sei besonders auf die in der Studie angewandten Begriffe bzw. Definitionen hingewiesen:<br />
„Gentechnikfrei“ :<br />
Definition gemäß Codex Alimentarius Austriacus siehe<br />
http://www.bmgf.gv.at/cms/site/attachments/8/0/5/CH0264/CMS1085747609216/codex-rl.pdf<br />
„GVO-frei“:<br />
Der Begriff „GVO-frei“ wird in der Studie für nicht kennzeichnungspflichtige Lebensmittel <strong>und</strong> Futtermittel gemäß<br />
der Bestimmungen der VO (EG) 1829/2003 über genetisch veränderte Lebensmittel <strong>und</strong> Futtermittel verwendet.<br />
Darüber hinaus wird der Begriff „GVO-frei“ in der Studie im Zusammenhang mit Lebensmitteln aus tierischer<br />
Erzeugung (Milch, Eier, Fleisch) dann angewandt, wenn nicht kennzeichnungspflichtige Futtermittel gemäß der<br />
Bestimmungen der VO (EG) 1829/2003 in der Tierernährung eingesetzt werden.<br />
Seite 88 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 4: Verfügbarkeit Futtermittel<br />
Zum Anwendungsbereich der VO (EG) 1829/2003 hat der Ständige Ausschuss Lebensmittelkette <strong>und</strong><br />
Tierges<strong>und</strong>heit folgende Klarstellung getroffen, siehe<br />
http://europa.eu.int/comm/food/committees/regulatory/modif_genet/summary240904_en.pdf<br />
(Punkt 1).<br />
Die unten stehende Tabelle zieht Resümee aus den oben erwähnten drei Rahmenbedingungen für die wichtigsten<br />
Nutztierarten:<br />
Der rote Bereich soll den DROP OUT Bereich darstellen, in dem für die jeweilige Tierart eine oder auch mehrere<br />
Rahmenbedingungen (Ernährungsphysiologie bzw. Leistung, Verfügbarkeit <strong>und</strong>/oder gesetzliche/Codex-Vorgaben<br />
nicht mehr erfüllt werden kann [„nicht erfüllt“].<br />
Der grüne Bereich zeigt auf, wo bis zu einem gewissen Grad oder unter bestimmten Vorraussetzungen (u.b.V.)<br />
alle drei (!) Rahmenbedingungen erfüllt werden können [„erfüllt“]. Dies bedeutet, dass in diesem Bereich eine<br />
„GVO-freie“ <strong>und</strong>/ oder „gentechnikfreie“ Fütterung bis zu einem gewissen Grad möglich erscheint. Da hier weder<br />
Kleinlogistik <strong>und</strong> Mehrkosten noch andere Faktoren mit einkalkuliert wurden, ist anzunehmen, dass sich dieser<br />
Bereich noch reduzieren wird.<br />
Für Schwein, Geflügel <strong>und</strong> Pute fallen drei Varianten in den „roten Bereich“, da derzeit sowohl Substitute<br />
(Ackerbohne, Erbse, Sonnenblumen, Raps, Kürbiskerne, Kartoffeleiweiß, Maiskleber, DDGS usw.) als auch<br />
bestimmte Zusatzstoffe (Vitamin B2+12) <strong>und</strong> AS (Lysin, Threonin <strong>und</strong> Tryptophan) in viel zu geringen Mengen<br />
oder überhaupt nicht mehr in „gentechnikfreier“ (ohne GVM hergestellt) Qualität <strong>zur</strong> Verfügung stehen.<br />
Ein weiters „drop out“ ergibt sich für den Monogastrier bei ausschließlichem Einsatz von Substituten, da hier in<br />
nahezu allen Leistungsstufen – bis auf wenige Ausnahmen - keine dem SES gleichwertigen Leistungen erzielt<br />
werden können. Dies bedeutet für Monogastrier, dass alle beiden Codex-Varianten 2 + 4 [Gentechnikfreier“ SES<br />
gemäß Codex <strong>und</strong> Substitute gemäß Codex] <strong>und</strong> die Variante 3 [Substitute gemäß VO(EG)1829/2003] nicht<br />
zweckmäßig realisierbar sind.<br />
Die für alle Tierarten theoretisch erfüllbare erste Variante „GVO-freier“ SES setzt voraus, dass ausreichende<br />
Mengen an „GVO-freiem“ SES übers ganze Jahr aufgetrieben, verteilt <strong>und</strong> verarbeitet werden können. Dies<br />
fordert nicht nur eine getrennte Produktionsschiene im Futtermittelwerk <strong>und</strong> eine vermehrte Kontrolltätigkeit,<br />
sondern auch eine ausgeklügelte Kleinlogistik im regionalen Bereich Landwirt <strong>und</strong><br />
Lagerhaus/Landesproduktenhandel.<br />
Für das Rind ergeben sich hinsichtlich „gentechnikfreier“ Zusatzstoffe <strong>und</strong> Vitamine für den Codex weniger<br />
Einschränkungen, da hier weder AS noch Vitamin B2+12 unbedingt zusätzlich zugeführt werden müssen.<br />
Die zwei Substitutionsvarianten liegen beim Rind im „grünen Bereich“, da bei dieser Spezies laut vorliegender<br />
Studien ein vollständiger Ersatz des SES insbesondere durch Rapsextraktionsschrot - theoretisch - möglich ist. In<br />
der Praxis sind in Hochleistungsbereichen Leistungseinbußen möglich, mit Ackerbohne, Erbse oder<br />
Sonnenblumenschrot jedoch wahrscheinlich.<br />
Zurzeit könnte - bei einer theoretisch ausschließlichen Verwendung der gesamten verfügbaren Rapsmenge<br />
(100.000 t) für die Rinderwirtschaft - aber nur zirka die Hälfte des geschätzten Bedarfes für Rinder abgedeckt<br />
werden.<br />
In welchem Ausmaß sich diese Varianten in der österreichischen Futtermittelwirtschaft durchsetzen können bzw.<br />
verwirklichen lassen, hängt letztlich von den definitiven Kriterien eines Qualitätsprogrammes ab.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 89 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 4: Verfügbarkeit Futtermittel<br />
Tabelle 4-17: BETRACHTUNG <strong>und</strong> RESÜMEE der Machbarkeit zu den Anforderungen der Ernährungsphysiologie, derzeitiger Verfügbarkeit <strong>und</strong> gesetzlichen<br />
Rahmenbedingungen (ohne ökonomische Bewertung) unter Berücksichtigung der Anforderungen nicht kennzeichnungspflichtiger Rohstoffe gemäß<br />
VO(EG) 1829/2003 <strong>und</strong> der Anforderungen der österreichischen Codex-Richtlinie <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> von <strong>„gentechnikfrei“</strong><br />
Tierart<br />
Ration<br />
Milchvieh<br />
Mastrind<br />
Mastschwein<br />
Legehenne<br />
Masthuhn<br />
Pute<br />
Erklärungen<br />
u.b.V.:<br />
unter<br />
bestimmten<br />
Voraus-<br />
setzungen<br />
„GVO-frei“<br />
VO(EG)<br />
1829/2003:<br />
n.k. SES<br />
erfüllt<br />
erfüllt<br />
erfüllt<br />
erfüllt<br />
erfüllt<br />
erfüllt<br />
„Gentechnik-<br />
frei“<br />
Codex:<br />
SES<br />
erfüllt<br />
erfüllt<br />
nicht erfüllt**<br />
nicht erfüllt**<br />
nicht erfüllt**<br />
nicht erfüllt**<br />
SES verfügbar SES<br />
(Hard IP)<br />
verfügbar<br />
** Codex<br />
wegen AS <strong>und</strong><br />
Vit. B2+B12<br />
NICHT<br />
erfüllbar<br />
„GVO-frei“<br />
VO(EG)<br />
1829/2003:<br />
n.k. Substitute<br />
erfüllt*<br />
erfüllt*<br />
nicht erfüllt***<br />
nicht erfüllt***<br />
nicht erfüllt***<br />
nicht erfüllt***<br />
Insgesamt<br />
un<strong>zur</strong>eichende<br />
Verfügbarkeit<br />
der Substitute<br />
*** Leistungs-<br />
minderung<br />
„Gentechnik-<br />
frei“<br />
Codex:<br />
Substitute<br />
erfüllt*<br />
erfüllt*<br />
nicht erfüllt**/***<br />
nicht erfüllt**/***<br />
nicht erfüllt**/***<br />
nicht erfüllt**/***<br />
Insgesamt<br />
un<strong>zur</strong>eichende<br />
Verfügbarkeit der<br />
Substitute<br />
***Leistungs-<br />
minderung<br />
** Codex wegen AS<br />
<strong>und</strong> Vit. B2+ B12<br />
NICHT erfüllbar<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Bemerkungen<br />
Mit Raps als alleiniges Substitut sind laut Studien<br />
gleichwertige Leistungen erzielbar, in der Praxis sind in<br />
Hochleistungsbereichen Leistungseinbußen möglich,<br />
mit Ackerbohne, Erbse oder Sonnenblume jedoch<br />
wahrscheinlich .( *)<br />
AS, Vit. B2+ B12 sind hier nicht zwingend erforderlich.<br />
**Zusatzstoffmangel (Lysin, Vit.B2+B12)<br />
bzw. Mangelerscheinungen <strong>und</strong>/ oder<br />
***Leistungseinbußen<br />
**Zusatzstoffmangel (Vit. B2+B12)<br />
bzw. schwere Mangelerscheinungen <strong>und</strong> /oder<br />
***Leistungseinbußen<br />
**Zusatzstoffmangel (AS, Vit. B2+12)<br />
bzw. Mangelerscheinungen <strong>und</strong>/oder<br />
***Leistungseinbußen <strong>und</strong> Futterverweigerung<br />
Zusammenfassung:<br />
� Codex ist für Monogastrier NICHT umsetzbar<br />
� Codex ist bei Rindern u.b.V. umsetzbar<br />
� Substitute sind für Monogastrier NICHT<br />
vergleichbar umsetzbar.<br />
� Substitute sind für Rinder u.b.V. umsetzbar.<br />
AS – Aminosäuren; Vit. – Vitamin; SES – Sojaextraktionsschrot ; GVO – gentechnisch veränderte Organismen; IP – Identity Preservation; „GVO-frei“: studieneigene<br />
Definition für nichtkennzeichnungspflichtige Rohstoffe; „Gentechnikfrei“: Definition nach Codex ; n.k.: nicht kennzeichnungspflichtig nach VO (EG) 1829/2003<br />
Seite 90 von 243
Zusammenfassung:<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 4: Verfügbarkeit Futtermittel<br />
• In der konventionellen Landwirtschaft, insbesondere im Rahmen hoher Leistungsniveaus, stellt<br />
Sojaextraktionsschrot (SES) einen Hauptbestandteil der Futterrationen (insbesondere in Österreich) dar. Inzwischen<br />
als GVO gekennzeichneter SES wird hauptsächlich von deutschen Ölmühlen bezogen, die Sojabohnen aus den<br />
Hauptproduktionsländern verarbeiten.<br />
• In den letzten Jahren wurden im Schnitt ca. 550.000 t SES pro Jahr nach Österreich importiert. Dieser wird<br />
ungefähr zu 25% in Wiederkäuerfutter, zu 75% in Schweine- <strong>und</strong> Geflügelfutter verwendet. Im Jahr 2004 sind zirka<br />
95% dieses SES als gentechnisch verändert gem. VO(EG)1829/2003 zu kennzeichnen, d.h. über dem<br />
Schwellenwertregime liegend.<br />
• „GVO freier SES“ mit Verunreinigungen von unter 0,9 %/0,5 % gem. dem Schwellenwerteregime der<br />
VO(EG)1829/2003 war bis vor kurzem in Europa Mangelware <strong>und</strong> wird derzeit von einer Firma in OÖ direkt aus<br />
Brasilien importiert. In Deutschland gibt es seit kurzem zwei weitere Bezugsquellen, die SES direkt aus Brasilien<br />
importieren <strong>und</strong> eine kontinuierliche Versorgung anbieten. Eine weitere Ölmühle verarbeitet allerdings nur von Mai<br />
bis Oktober brasilianische Sojabohne. Laut aktuellen Informationen von Zertifizierungsfirmen sind bedeutende<br />
Mengen von „GVO-freiem“ SES direkt aus Brasilien verfügbar.<br />
• Die Verfügbarkeit von SES ist laut Umfrage an den österreichischen Landesproduktenhandel gegeben. Der<br />
Zeitrahmen <strong>und</strong> die Kontinuität der Verfügbarkeit kann jedoch nicht abgeschätzt werden. Erst die praktische<br />
Nachfrage am Weltmarkt wird etwaige Schwierigkeiten <strong>und</strong> vor allem den Preis aufzeigen. Die derzeit in Österreich<br />
importierte Menge an „GVO-freiem“ SES liegt bei ca. 30.000 t/Jahr <strong>und</strong> entspricht etwa 5 % des Gesamt-SES-<br />
Verbrauchs. Vor kurzem wurden zwei weitere Lieferanten für „GVO-freien“ SES in Deutschland eruiert, die direkten<br />
Kontakt zu Genossenschaften in Brasilien haben <strong>und</strong> laut eigenen Angaben den Bedarf Mitteleuropas an „GVO-<br />
freiem“ SES decken könnten.<br />
• Als „GVO-freie“ oder „gentechnikfreie“ Rohstoffe <strong>und</strong> Futtermittelausgangserzeugnisse mit hohem Eiweißgehalt<br />
(SES-Substitute) kommen weiters in Betracht: Raps-, Sonnenblumenextraktionsschrot, Ackerbohnen-, Erbsen- <strong>und</strong><br />
Lupinenprodukte als heimische Eiweißpflanzen, sowie Kartoffeleiweiß, Maiskleber <strong>und</strong> Maiskleberfutter, DDGS <strong>und</strong><br />
Hefe.<br />
• Der österreichische Vitamin-, Enzym- <strong>und</strong> Aminosäurebedarf in der Futtermittelherstellung wird zu nahezu 100%<br />
über Importe gedeckt. Die meisten Futterzusatzstoffe aus den Gruppen der Vitamine, Enzyme <strong>und</strong> Mikroorganismen<br />
(Probiotika) sowie die Aminosäure Methionin werden noch zum Großteil <strong>„gentechnikfrei“</strong> hergestellt <strong>und</strong> die<br />
Versorgung dürfte noch längerfristig gesichert sein. Hingegen werden Phytase, die Vitamine B2 <strong>und</strong> B12, sowie die<br />
Aminosäuren Lysin, Threonin <strong>und</strong> Tryptophan in großem Umfang bzw. vollständig durch GVM hergestellt <strong>und</strong> sind<br />
nicht oder kaum ohne Einsatz von GVM am Markt erhältlich.<br />
• Mit Hilfe von genetisch veränderten Mikroorganismen (GVM) biofermentativ hergestellte Zusatzstoffe fallen, sofern<br />
sie in geschlossenen Systemen hergestellt werden <strong>und</strong> keine GVM oder anders Material des verwendeten GVM im<br />
Endprodukt enthalten sind, nicht in den Anwendungsbereich der VO(EG)1829/2003 <strong>und</strong> bedürfen keiner spezifischen<br />
Kennzeichnung betreffend GVO. Wenn im Endprodukt jedoch GVM – ganz oder in Bruchstücken, lebend oder nicht –<br />
enthalten sind, so fallen diese Zusatzstoffe in den Anwendungsbereich der VO(EG) 1829/2003 bezüglich Zulassung<br />
<strong>und</strong> Kennzeichnung. Laut österreichischem Codex <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> „Gentechnikfrei“ ist allerdings der Einsatz von GVM<br />
nicht zulässig <strong>und</strong> es werden nur Produkte nach Vorlage eines Zertifikates über die gentechnikfreie Herstellung (ohne<br />
GVM) akzeptiert.<br />
• Die obigen Aussagen beziehen sich auf die derzeitige Situation <strong>und</strong> den Stand der Technik.<br />
• Die Entwicklung der Produktion von Futterzusatzstoffen wie Vitamine, Enzyme <strong>und</strong> Aminosäuren scheint eher in<br />
Richtung Fermentation aus GVM zu gehen (geringere Herstellungskosten, geringere Umweltbelastungen, geringerer<br />
Rohstoffbedarf, enormer Konkurrenzdruck aus Asien etc.).<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 91 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 4: Verfügbarkeit Futtermittel<br />
• Um die Menge des importierten SES zumindest teilweise zu ersetzen werden folgende Möglichkeiten jeweils für<br />
einen Teil der Gesamtmenge in Betracht gezogen: a) heimische Sojabohne („GVO-frei“ oder <strong>„gentechnikfrei“</strong>), b)<br />
importierter, „GVO freier SES [(erfüllt zumindest das Schwellenwerteregime der VO (EG)1829/2003], c) heimische,<br />
eiweißreiche Kulturarten werden verstärkt angebaut <strong>und</strong> d) Nebenprodukte der Biospriterzeugung (DDGS,<br />
Rapskuchen) als SES-Substitute werden zusätzlich verfügbar <strong>und</strong> eingesetzt .<br />
• Mit dem Tiermehlverbot, das seit 2000 auch für monogastrische Nutztiere (Schwein, Geflügel) gilt, ergaben sich<br />
weitere Engpässe in der Eiweißversorgung unserer Nutztiere, nicht nur hinsichtlich der Proteinversorgung, sondern<br />
auch bei der Aminosäurenversorgung, sodaß SES verstärkt eingesetzt wurde (siehe dazu Statistiken in Kapitel 3).<br />
• Die Einordnung von Futterzusatzstoffen, die aus/mit Hilfe von genetisch veränderten Mikroorganismen (GVM)<br />
hergestellt werden, war vorerst in der EU nicht ganz klar. Die EU-Kommission hat daher in ihrem Sitzungsprotokoll<br />
vom 23.9.2004 festgestellt, dass Zusatzstoffe wie Vitamine, Enzyme <strong>und</strong> auch Aminosäuren, welche aus GVM<br />
hergestellt werden, aber keine veränderte DNA <strong>und</strong> kein anderes Material aus dem verwendeten GVM im Endprodukt<br />
enthalten, nicht als GVO gekennzeichnet werden müssen.<br />
• Der österreichische Codex für die <strong>Auslobung</strong> „Gentechnikfrei“ gibt allerdings für Zusatzstoffe vor, dass sie aus<br />
„gentechnikfreier“ Erzeugung stammen. Vitamin B2, B12, Vitamin C, Phytase, Lysin, Threonin <strong>und</strong> Tryptophan<br />
können daher nur eingesetzt werden, wenn ein Zertifikat bzw. eine Zusicherungserklärung vom Hersteller über<br />
„gentechnikfreie“ Herstellung gemäß VO 2092/91 EWG i.d.g.F. (d.h. ohne GVM hergestellt) vorliegt, dessen<br />
Gültigkeit sich jeweils nur auf ein Jahr beschränkt. Diese Zusatzstoffe <strong>und</strong> Aminosäuren sind jedoch gem. den<br />
Recherchen im Rahmen dieser Studie derzeit nicht mehr ausreichend in „gentechnikfreier“ Herstellung erhältlich.<br />
• In den Achtziger-Jahren wurden von österreichischen <strong>und</strong> anderen europäischen Forschungseinrichtungen<br />
zahlreiche Fütterungsversuche mit der Frage durchgeführt, wieweit SES durch andere Eiweißfuttermittel bei den<br />
verschiedenen Tierarten <strong>und</strong> Produktionssparten <strong>und</strong> Leistungsstufen ersetzt werden könnte. Das Hauptziel war die<br />
Förderung des heimischen Eiweißpflanzenanbaus <strong>und</strong> der Verwendung der Ernteprodukte in den Futterrationen. Die<br />
damaligen Ergebnisse ergaben, dass SES in der Rinderfütterung relativ problemlos ersetzt werden könnte. Hingegen<br />
zeigten Versuche mit Monogastriern (Schwein, Geflügel), dass das hochwertige Eiweiß von SES, ohne Ausgleich<br />
durch tierisches Eiweiß <strong>und</strong>/oder Aminosäuren, durch andere Pflanzen nicht ersetzt werden kann.<br />
• Für die vorliegende Studie wurden vorwiegend Arbeiten von anerkannten <strong>und</strong> unabhängigen Universitäten <strong>und</strong><br />
Institutionen aus dem mitteleuropäischen Raum (Österreich, Deutschland, Schweiz <strong>und</strong> Tschechien) herangezogen,<br />
um ähnliche Produktionsbedingungen (Boden, Klima, Haltung) berücksichtigen zu können.<br />
• Sämtliche Studien mit Milchvieh <strong>und</strong> Mastrinder, Mastschweine, Legehennen <strong>und</strong> Masthühner wurden nach<br />
Kulturarten (Raps, Ackerbohne, Futtererbse, Sonnenblumenextraktionsschrot, Lupinen, heimische Sojabohne,<br />
Schlempe) sortiert <strong>und</strong> darin die fütterungs- <strong>und</strong> leistungsspezifischen Möglichkeiten für die einzelnen Tierarten <strong>und</strong><br />
Tierkategorien genauer betrachtet. Bei Rindern muss auf die speziellen Unterschiede im Grünland- <strong>und</strong><br />
Ackerbaugebiet hingewiesen werden, wo erhebliche Unterschiede in der Eiweißversorgung herrschen. Bei allen<br />
Substitutionsstudien muss immer das Leistungsniveau berücksichtigt werden. Manche Alternativen sind zwar im<br />
niederen bis mittleren Leistungsbereich möglich, können jedoch für höhere Leistungsbereiche nicht in Betracht<br />
gezogen werden. Beim Ersatz von SES durch andere Eiweißpflanzen ist aus der Sicht der Tierernährung immer eine<br />
Ergänzung mit Aminosäuren <strong>zur</strong> Abdeckung des Bedarfes von monogastrischen Tieren (Schwein <strong>und</strong> Geflügel) zu<br />
berücksichtigen.<br />
• Als Alternative bietet sich die heimische Sojabohne an, die jedoch immer physikalisch (thermisch) weiter behandelt<br />
werden muss, um die Trypsin-Inhibitoren abzubauen. Aus agronomischen Gründen wird sie in Österreich nie größere<br />
Bedeutung erzielen. Außerdem geht die heimische Sojabohne zu einem großen Teil in die Lebensmittelproduktion.<br />
• Als nächste der sich anbietenden Alternativen wurden in Österreich vorkommende Kulturarten aus der Gruppe der<br />
Ölfrüchte <strong>und</strong> Hülsenfrüchte betrachtet, wobei speziell auf Raps, Ackerbohne, Körnererbse,<br />
Sonnenblumenextraktionsschrot <strong>und</strong> Lupine für jede einzelne Tierart genauer eingegangen wurde.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 92 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 4: Verfügbarkeit Futtermittel<br />
• DDGS (Trockenschlempe) kann zukünftig nach Errichtung industrieller Anlagen <strong>zur</strong> Bioethanolerzeugung <strong>und</strong><br />
entsprechendem Aminosäureausgleich (Lysinergänzung) für alle Tierarten, vor allem bei Rindern, als Substitut für<br />
SES gut verwendet werden.<br />
• Für die Rinderhaltung (Milch <strong>und</strong> Mast) scheint nach derzeitigem Stand der vorliegenden Studien ein<br />
vollständiger Ersatz durch Rapsschrot bzw. –expeller möglich zu sein. Für Lupinen liegen zwar interessante aber noch<br />
zu wenige Untersuchungen <strong>und</strong> Erfahrungen vor, zudem sind die verfügbaren Mengen vernachlässigbar.<br />
Trockenschlempe (DDGS) kann in der Rinderhaltung laut amerikanischen Empfehlungen mit ausgezeichnetem Erfolg<br />
eingesetzt werden.<br />
• In der Geflügel <strong>und</strong> Schweineproduktion – vorbehaltlich neuer Studien <strong>und</strong> Erkenntnisse - kann SES nach<br />
derzeitigem Wissensstand durch heimische Ölfrüchte <strong>und</strong> Eiweißpflanzen nicht vollständig ersetzt werden.<br />
• Bestimmte Vitamine <strong>und</strong> Aminosäuren sind in „gentechnikfreier“ Qualität derzeit nicht mehr bzw. nicht in<br />
ausreichender Menge verfügbar. Ohne den Einsatz von Aminosäuren <strong>und</strong> Vitaminen kann jedoch in den vorliegenden<br />
Tierhaltungs-, Rassen- <strong>und</strong> Leistungsanforderungen <strong>und</strong> unter den derzeitigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen<br />
in der konventionellen Landwirtschaft nicht gearbeitet werden. Auch ein angemessener Tierschutzgedanke sollte, im<br />
Hinblick der auftretenden Mangelerscheinungen bei Nichtbeachtung ernährungsphyiologischer Gr<strong>und</strong>sätze in<br />
Interaktion v.a. zum Leistungsniveau, beachtet werden.<br />
• Derzeit kann konventioneller SES (ca. 600.000 t/Jahr) nicht <strong>zur</strong> Gänze durch Ernteprodukte andere Pflanzenarten<br />
ersetzt werden. Die zukünftig aus der Biotreibstoffproduktion anfallenden Mengen an Rapskuchen <strong>und</strong> DDGS könnten<br />
durchaus einen gewissen Teil der Eiweißversorgung bei gleichzeitigem Aminosäureausgleich <strong>und</strong> Phosphorreduktion<br />
abdecken, der Rest müsste durch „GVO-freien“ SES <strong>und</strong> anderen Alternativen ergänzt werden. Die aktuelle<br />
Eiweißlücke von 276.000 t Rohprotein in der Tierernährung in Österreich kann nach den vorliegenden Erhebungen<br />
durch zusätzliche Substitute nur zu etwa der Hälfte gefüllt werden. „GVO-freier“ SES aus Brasilien scheint allerdings<br />
derzeit in ausreichender Menge in Europa <strong>und</strong> im Speziellen für Österreich verfügbar zu sein.<br />
Für die in Zukunft anfallenden Nebenprodukte (v.a. Rapsexpeller <strong>und</strong> Trockenschlempe (DDGS)) aus der<br />
Biotreibstoffproduktion wäre die Durchführung von Fütterungsversuchen unter österreichischen<br />
Produktionsbedingungen für deren optimierten Einsatz in der Fütterung, insbesondere als SES-Ersatz, vorteilhaft.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 93 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 5: Probenahme <strong>und</strong> GVO-Analytik<br />
5. Probenahme <strong>und</strong> Analytik im Zusammenhang mit GVO – H. HÖRTNER <strong>und</strong><br />
R. HOCHEGGER, CC Biochemie, V. KOLAR, Institut für Futtermittel, G. WUNDERLICH, Institut für Saatgut, <strong>AGES</strong><br />
5.1. Methodik der Probenahme<br />
Gr<strong>und</strong>lage für jede GVO-Untersuchung bildet eine repräsentative Probenahme. Ziel der repräsentativen Probenahme<br />
ist in jedem Fall die Gewinnung einer<br />
• repräsentativen,<br />
• ausreichend großen,<br />
• identen Probe<br />
• aus einer homogenen Partie/Menge.<br />
Das bedeutet, dass eine repräsentative Probenahme dann vorliegt, wenn in der Probe jeder Bestandteil im gleichen<br />
Verhältnis wie in der Partie/Menge vorliegt.<br />
5.1.1. Saatgut<br />
Allgemeines <strong>zur</strong> amtlichen repräsentativen Probenahme:<br />
Beim Betriebsmittel Saatgut ist die so genannte „amtliche repräsentative Probenahme“ in den Methoden für Saatgut<br />
<strong>und</strong> Sorten gemäß Saatgutgesetz 1997 i.d.g.F., Teil „Normen <strong>und</strong> Verfahren der amtlichen repräsentativen<br />
Probenahme einschließlich Kontrolle der Kennzeichnung, Verpackung <strong>und</strong> Verschließung“ (= Probenahmemethoden)<br />
eingehend geregelt. Diese Probenahmemethoden setzen EU-Recht (EU-Vermarktungsrichtlinien für Saatgut) unter<br />
spezieller Bezugnahme <strong>und</strong> Berücksichtigung der ISTA-Regeln sowie OECD-Saatgutschemata um. Auch die<br />
Bestimmungen der Saatgut-Gentechnik-Verordnung finden in diesem Teil der Methoden für Saatgut <strong>und</strong> Sorten<br />
unmittelbare Umsetzung.<br />
Neben Bestimmungen <strong>zur</strong> technischen Durchführung der amtlich repräsentativen Probenahme enthalten die<br />
Probenahmemethoden Regelungen betreffend Aufbau der Kontrollnummer (bildet die Identität einer Saatgutpartie),<br />
der Verpackung, Verschließung <strong>und</strong> Kennzeichnung von Saatgut.<br />
Bei Saatgut bildet eine homogene Partie die absolute Bezugsbasis.<br />
Eine Partie ist eine eindeutig identifizierbare Saatgutmenge, die einheitlich geputzt <strong>und</strong> homogen ist, die vom<br />
Antragsteller als Einheit vorgestellt wird, deren Höchstgewicht den Bestimmungen der Probenahmemethoden<br />
entspricht <strong>und</strong> für die ein Untersuchungsbericht ausgestellt wird. Im Rahmen der amtlichen repräsentativen<br />
Probenahme darf kein Anzeichen oder Augenschein von Uneinheitlichkeit der Partie vorliegen.<br />
In den Probenahmemethoden sind für alle Arten, die durch das Saatgutgesetz 1997 i.d.g.F. geregelt sind, sowohl<br />
Höchstgewichte pro Saatgutpartie, als auch genaue Regelungen über das kleinste <strong>zur</strong> Prüfung einzusende Gewicht<br />
für Einsendungsproben enthalten. Als Zusatzbestimmung für Arten der Saatgut-Gentechnik-Verordnung gilt, dass das<br />
kleinste <strong>zur</strong> Prüfung einzusende Gewicht für GVO-Untersuchungen immer zumindest 3000 Korn betragen muss.<br />
Tabelle 5-1: Ausgewählte Beispiele für höchstzulässige Partiegewichte <strong>und</strong> kleinste <strong>zur</strong> Prüfung<br />
einzusendende Gewichte<br />
Art höchstzulässiges<br />
Partiegewicht (t)<br />
kleinstes <strong>zur</strong> Prüfung einzusendendes<br />
Gewicht (g)<br />
Mais (Zea mays) 40 1000<br />
Sojabohne (Glycine max) 25 1000<br />
Raps (Brassica napus) 10 200<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 94 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 5: Probenahme <strong>und</strong> GVO-Analytik<br />
Technische Durchführung der amtlichen repräsentativen Probenahme:<br />
Bei der Durchführung der amtlichen repräsentativen Probenahme werden kleine Anteile (=Erstproben) aus der Partie<br />
entnommen <strong>und</strong> in einer Mischprobe vereinigt. Aus der Mischprobe werden die so genannten Einsendungsproben<br />
mittels Probenteiler gemäß Probenahmemethoden hergestellt. Die Einsendungsproben werden nach Plombierung <strong>und</strong><br />
Kennzeichnung <strong>zur</strong> Untersuchung an das Untersuchungslabor übermittelt, wo die Herstellung der<br />
Untersuchungsprobe/n gemäß standardisierter Abläufe erfolgt.<br />
Für die zufällige oder systematische Entnahme von Erstproben stehen verschiedene Werkzeuge <strong>zur</strong> Verfügung.<br />
Befindet sich das zu beprobende Saatgut bereits fertig verschlossen <strong>und</strong> gekennzeichnet in handelsüblichen<br />
Behältnissen wie beispielsweise Säcken, werden die Erstproben mittels Nobbe-Probestecher entnommen.<br />
Als Werkzeug <strong>zur</strong> Durchführung der Probenahme aus beispielsweise Jumbobags oder Containern finden Stock- oder<br />
Rohrprobestecher Verwendung. Im Falle einer Probenahme aus dem fließenden Samenstrom kommen automatische<br />
Probenahmeanlagen zum Einsatz. Für alle verwendbaren Geräte sind Beschreibungen von Aufbau <strong>und</strong> Anwendung in<br />
den Probenahmemethoden enthalten; der Einsatz von automatischen Probenahmeanlagen ist im detaillierten<br />
Anforderungskatalog geregelt.<br />
Die Festlegung von Mindestanzahl der zu entnehmenden Erstproben orientiert sich im Fall von endgültig verpacktem<br />
<strong>und</strong> gekennzeichnetem Saatgut an der Anzahl der Behältnisse der Partie – die Tabelle der Probenahmemethoden 7.<br />
Teil Punkt 4.1 kommt <strong>zur</strong> Anwendung.<br />
Im Falle von Saatgutpartien in Behältnissen über 100 kg erfolgt die Festlegung von Mindestanzahl der zu<br />
entnehmenden Erstproben gemäß folgender Tabelle:<br />
Tabelle 5-2: Mindestanzahl der zu entnehmenden Erstproben bei Saatgut<br />
Gewicht der Partie Mindestanzahl der zu entnehmenden Erstproben<br />
bis 500 kg mindestens 5 Erstproben<br />
501 bis 3.000 kg für je 300 kg eine Erstprobe,<br />
mindestens aber 5 Erstproben<br />
3.001 bis 20.000 kg für je 500 kg eine Erstprobe,<br />
mindestens aber 10 Erstproben<br />
> 20.000 kg für je 700 kg eine Erstprobe,<br />
mindestens aber 40 Erstproben<br />
Wie bereits einleitend dargestellt hat eine Saatgutpartie homogen zu sein. Ergibt sich im Zuge der Durchführung der<br />
amtlichen repräsentativen Probenahme ein Hinweis auf begründeten Zweifel, ist auf Heterogenität zu prüfen. Dazu<br />
enthalten die Probenahmemethoden eine standardisierte Vorgangsweise.<br />
5.1.2. Futtermittelausgangserzeugnisse <strong>und</strong> Rohstoffe<br />
Die Futtermittelverordnung 2000, BGBL. II Nr. 93/2000 <strong>und</strong> die Richtlinie 76/371/EWG regeln die Probenahme von<br />
Futtermitteln (= Mischfuttermittel, Futtermittelausgangserzeugnisse <strong>und</strong> Zusatzstoffe) in Säcken, Big Bag, loser<br />
Schüttung <strong>und</strong> loser Verladung. Die Futtermittelkontrolle in Österreich wird vom B<strong>und</strong>esamt für Ernährungssicherheit<br />
(Handel <strong>und</strong> Erzeugung) <strong>und</strong> von den Ländern (Verfütterung an Nutztiere, d.h. im Wesentlichen die Verwendung auf<br />
landwirtschaftlichen Betrieben) wahrgenommen. Das Prinzip der Probenahme aus einer Partie erfolgt gemäß<br />
Richtlinie 76/371/EWG. Die Proben werden ins B<strong>und</strong>esamt für Ernährungssicherheit bzw. an eine Untersuchungsstelle<br />
transportiert. Die meisten Futtermittelausgangserzeugnisse (SES, Rapsextraktionsschrot, Mais, Getreide, usw.)<br />
werden in loser Form gehandelt.<br />
Bei der amtlichen Futtermittelkontrolle wird im Probenahmeverfahren nicht zwischen<br />
Futtermittelausgangserzeugnissen <strong>und</strong> Mischfuttermitteln unterschieden.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 95 von 272
5.1.3. Futtermittel<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 5: Probenahme <strong>und</strong> GVO-Analytik<br />
Mischfutter kommt gesackt <strong>und</strong> in loser Form in den Verkehr. Zusatzstoffe (Vitamine, Enzyme, Mikroorganismen<br />
usw.) dürfen nur verpackt in Verkehr gebracht werden.<br />
Für die amtliche Futtermittelkontrolle kommen zwei spezielle Geräte zum Einsatz, der Kammerstecher <strong>und</strong> Nobbe-<br />
Stecher. Der Kammerstecher ist ein Probenstecher für Futtermittel in loser Schüttung als auch in großen<br />
Behältnissen wie Big Bag, Silo oder Waggon <strong>zur</strong> gleichzeitigen Probennahme aus unterschiedlichen Tiefen. Der<br />
Nobbe-Probenstecher eignet sich besonders für die Probenahme von Produkten aus Säcken.<br />
Die Probenahme ist im Allgemeinen einer zuständigen Person (z.B. Geschäftsführer) des zu kontrollierenden Betriebs<br />
zu melden. Die Auswahl eines Produktes erfolgt entweder nach Zufall, Notwendigkeit (auf Auftrag, Rückverfolgung)<br />
oder nach Erfahrungswerten (geringe Kontrollrate, Kontrolle der Mischaufzeichnungen).<br />
Vor Auswahl der Partie ist die Kennzeichnung des Produktes zu überprüfen <strong>und</strong> nach Bedarf <strong>und</strong> Möglichkeit<br />
mitzunehmen. Die vorhandene Produktmenge ist immer schriftlich festzuhalten. Die Probenahme erfolgt jeweils von<br />
einer Partie. Dies ist die Menge eines Stoffes, die sich nach ihrer äußeren Beschaffenheit, Kennzeichnung <strong>und</strong><br />
räumlicher Zuordnung als eine Einheit darstellt. Ist eine Partie so groß oder so gelagert, dass nicht an jeder Stelle<br />
Proben entnommen werden können, so gilt für die Probenahme nur der Teil als Partie, wo dies möglich ist.<br />
Einzelproben sind immer nach dem Zufallsprinzip aus der gesamten Partie zu entnehmen. Gewicht <strong>und</strong> Volumen<br />
müssen ungefähr gleich sein.<br />
Bei verpackten Futtermitteln ist die erforderliche Anzahl der zu bemusternden Packungen nach 5.A.2. der Richtlinie<br />
76/371 EWG vorzunehmen. Aus jeder dieser Packungen ist mit dem Probestecher eine Probe zu ziehen.<br />
Flüssige oder halbflüssige homogene oder homogenisierbare Futtermittel: Die erforderliche Anzahl ist nach 5.A.2. der<br />
Richtlinie 76/371 EWG festgelegt. Die Probenahme kann auch beim Ablassen des Erzeugnisses erfolgen.<br />
5.1.3.1. Amtliche Probenahme im Rahmen der Kontrolle nach dem Futtermittelgesetz<br />
Die Durchführung der Probenahme erfolgt nach der in der Futtermittelverordnung, BGBl. II 93/2000 angeführten<br />
Richtlinie 76/371 EWG. Anzahl <strong>und</strong> Umfang der Einzelproben, Umfang der Sammelprobe, Anzahl <strong>und</strong> Umfang der<br />
Endproben, Entnahmen <strong>und</strong> Bildung der Proben <strong>und</strong> Behandlung der Endproben werden unter Punkt 5.<br />
„Mengenmäßige Anforderungen“ (5. A. Zur Kontrolle von Stoffen oder Erzeugnissen, die gleichmäßig im Futtermittel<br />
verteilt sind <strong>und</strong> 5.B. Zur Kontrolle von unerwünschten Stoffen, die ungleichmäßig im Futtermittel verteilt sein<br />
können) in dieser Richtlinie geregelt.<br />
Lose Produkte, Mischfuttermittel oder Einzelfuttermittel:<br />
Die Probenahme erfolgt entweder aus dem vor Ort gelagerten Schüttgut, wenn dieses gut zugänglich ist, oder es<br />
wird bei schwerer zugänglichem Schüttgut eine Teilmenge (1 t) durch einen Radlader entnommen. Die Probenahme<br />
erfolgt darauf direkt vom Schüttgutaliquot in der Radladerschaufel.<br />
Hierbei werden mit dem Kammerstecher aus dem ungestörten Schüttgut an verschiedenen Stellen Einzelproben<br />
entnommen <strong>und</strong> diese in einem eigenen Kübel zu einer Sammelprobe vereint. Bei der Probenahme aus der<br />
Radladerschaufel werden die Einzelproben mit einer Probenschaufel an verschiedenen Stellen gezogen <strong>und</strong> analog in<br />
einem Kübel zu einer Sammelprobe vereint. Die Einzelproben werden mit der Probenschaufel gut gemischt <strong>und</strong> zu<br />
gleich großen Portionen (Endproben) in drei Säckchen gefüllt. Hygroskopische <strong>und</strong> fettreiche Futtermittel sollen<br />
vorher noch in Plastiksäckchen gegeben werden. Die Säckchen werden darauf mit einer Blechplombe versiegelt <strong>und</strong><br />
mit Klebeband gut verschlossen.<br />
Lose Ware kann auch direkt bei der Verladung in den Tankwagen beprobt werden. Während des Ladevorganges aus<br />
einem Silo in das entsprechende Tankfahrzeug wird mit der Probenschaufel bei der Füllvorrichtung die Probe<br />
entnommen (mind. 20 Schaufeln) <strong>und</strong> zu einer Sammelprobe in einem sauberen Kübel vermischt. Besteht bei einer<br />
derartigen Verladung eine spezielle Probenahmeeinrichtung, so kann diese analog benützt werden. Ebenso kann erst<br />
nach dem Befüllen das Ladegut im Tankfahrzeug mit dem Kammerstecher bemustert werden.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 96 von 272
Verpackte Probe:<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 5: Probenahme <strong>und</strong> GVO-Analytik<br />
Die Probenahme bei staubfreien Säcken <strong>und</strong> Big Bags wird mit dem Nobbe-Stecher durchgeführt. Die Säcke sollten<br />
vorher vor allem bei der Einstichstelle vom Staub gesäubert werden. Die Entnahme erfolgt an verschiedenen Stellen<br />
in derselben Abfolge wie bei losem Schüttgut. Ist mit dem Nobbe-Stecher nicht mehr die Mitte des Sackes erreichbar<br />
(Big Bag), wird der Kammerstecher verwendet. Ebenso ist ein Aufschneiden des Sacks möglich, worauf die<br />
Probenahme mit einer Probenschaufel an verschiedenen Stellen durchgeführt wird. Die entstandenen Löcher sind<br />
nach der Probenahme sachgerecht zu verschließen.<br />
Die Probensäckchen werden nach ihrer Befüllung mit Klebeetikett beschriftet, verschnürt, versiegelt <strong>und</strong><br />
anschließend mit einem amtlichen Klebestreifen verschlossen. Die Behälter oder Packungen sind so zu versiegeln<br />
bzw. zu plombieren, dass sie nicht ohne Beschädigung des Siegels bzw. der Plombe geöffnet werden können. Die<br />
Kennzeichnung der Probe muss vom Siegel bzw. der Plombe miterfasst werden.<br />
Für jede Probenahme ist eine Niederschrift <strong>und</strong> ein Probenbegleitschreiben zu erstellen, aus dem die Identität<br />
der bemusterten Partie eindeutig hervorgeht. Eine Abschrift oder Kopie verbleibt beim kontrollierten Betrieb. Die<br />
Niederschrift wird vom Probennehmer bzw. Vertreter des kontrollierten Betriebes unterschrieben.<br />
5.1.3.2. Eigenprobenahme bzw. amtliche Probenahme auf Auftrag<br />
Die Durchführung erfolgt wie unter der amtlichen Probenahme im Rahmen der Futtermittelkontrolle. Abweichungen<br />
davon sind vom Auftraggeber bzw. den jeweiligen Gegebenheiten vorgegeben <strong>und</strong> sind zu vermerken.<br />
Über den Vorgang der Probenahme ist ein Protokoll zu verfassen. Kopien werden nach Bedarf angefertigt <strong>und</strong><br />
ausgehändigt.<br />
Der Transport der Proben in das B<strong>und</strong>esamt für Ernährungssicherheit bzw. Untersuchungsstelle erfolgt in einem<br />
isolierten Behälter, um es vor äußeren Temperatureinflüssen möglichst zu schützen.<br />
Die für die Probenahme gr<strong>und</strong>legende Richtlinie 76/371 EWG ist mitzuführen (vgl. BMLFUW, 2005).<br />
5.1.4. Lebensmittel<br />
Lebensmittel <strong>zur</strong> Kontrolle auf GVO-Verunreinigungen werden nach einem Probenplan gezogen, der jährlich vom<br />
BMGF als Erlass an die Landeshauptmänner in Form eines Aktionsplanes herausgegeben wird. Hier werden pro<br />
B<strong>und</strong>esland die Anzahl der Betriebskontrollen <strong>zur</strong> Rückverfolgbarkeit, die Anzahl der Probenziehungen <strong>und</strong> die Art der<br />
Probe (Lebensmittel aus Sojabohnen <strong>und</strong> Mais) festgelegt. Die Kontrolle <strong>und</strong> Probenziehung selbst obliegt nach dem<br />
LMG der Lebensmittelaufsichtsbehörde der Länder, die nach der Probennahmevorschrift PNV 16 (GVO) des Österr.<br />
Lebensmittelbuches III. Auflage ("Probennahmevorschriften für die amtliche Lebensmittelkontrolle") die<br />
Lebensmittelproben ziehen. Die PNV 16 schreibt die Mindestprobenmengen insbesondere bei inhomogenen/<br />
stückigen Proben (Maiskörner, Sojabohnen etc.), die Probenziehung bei offener Ware (Säcke, Container etc.) <strong>und</strong> die<br />
Vorgangsweise <strong>zur</strong> Vermeidung von Kontaminationen vor.<br />
In nächster Zukunft wird auch die Probenahmenorm für Lebensmittel zu berücksichtigen sein, die im CEN TC 275/WG<br />
11 erarbeitet wurde <strong>und</strong> derzeit als ÖNORM-Entwurf <strong>zur</strong> Endbegutachtung aufliegt (ÖNORM EN ISO 21568:<br />
Lebensmittel – Verfahren zum Nachweis von gentechnisch modifizierten Organismen <strong>und</strong> ihren Produkten -<br />
Probenahme).<br />
Die amtlich gezogenen Lebensmittelproben werden an die jeweilige, ländermäßig zuständige Lebensmittelunter-<br />
suchungsanstalt (<strong>AGES</strong>: 5 ILMU's, Länder 2) übermittelt. Derzeit werden alle GVO-Proben der ILMU's der <strong>AGES</strong> im CC<br />
Biochemie Wien analysiert.<br />
Fallweise können auch anlassbezogene, spezielle Probenziehungs-Aktionen vom BMGF angeordnet werden, wie nach<br />
EU-Warnungen (Papaya) oder Pressemeldungen (Tortilla Chips mit Mais GA21).<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 97 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 5: Probenahme <strong>und</strong> GVO-Analytik<br />
5.2. Prinzipien, Methodik <strong>und</strong> Limitationen der GVO-Analytik inklusive<br />
Probenvorbereitung im Labor<br />
Die Kontrolle von Lebensmittel, Futtermittel <strong>und</strong> Saatgut auf GVO-Bestandteile bzw. –Verunreinigungen ist sowohl<br />
auf nationaler als auch auf EU-Ebene durch verschiedene Verordnungen <strong>und</strong> den darin festgelegten (bzw. noch in<br />
Diskussion befindlichen) Schwellenwerten reguliert. Auf Gr<strong>und</strong> dieser Vorgaben werden Saatgut, Futtermittel <strong>und</strong><br />
Lebensmittel in Österreich einer verstärkten Kontrolle unterzogen. Diese Untersuchungen umfassen derzeit<br />
ausschließlich Produkte pflanzlicher Herkunft.<br />
Bei Lebens- <strong>und</strong> Futtermittel kommen je nach Zulassungsstufe verschiedene Schwellenwerte laut EU (VO) 1829/2003<br />
<strong>zur</strong> Anwendung. Für alle in der EU zugelassenen GV-Konstrukte ist der Schwellenwert von 0,9 % anzuwenden.<br />
Befindet sich ein GV-Konstrukt noch in der Zulassungsphase, hat aber von der EFSA bereits eine positive, hinsichtlich<br />
Mensch <strong>und</strong> Tier unbedenkliche <strong>und</strong> auf drei Jahre befristete Beurteilung, ist ab diesem Zeitpunkt ein Schwellenwert<br />
von 0,5 % gültig. Alle anderen Events, nicht zugelassene, sowie in einer Stufe der Zulassung befindlich, in der die<br />
Unbedenklichkeitsbeurteilung der EFSA noch ausständig ist, müssen ein negatives Analyseergebnis aufweisen.<br />
Saatgut: In Österreich sind <strong>zur</strong>zeit Methoden zum Nachweis von gentechnisch verändertem Saatgut bzw.<br />
Verunreinigungen von Saatgut in Mais, Raps <strong>und</strong> der Sojabohne etabliert, die geeignet sind alle handelsüblichen<br />
Konstrukte, die in der EU vorkommen, nachzuweisen. Seit 22.12.2001 gilt in Österreich die Saatgut-Gentechnik-<br />
Verordnung, welche festlegt, dass jede in Österreich in Verkehr gebrachte Saatgutpartie frei von GVO sein muss,<br />
wobei in der Erstuntersuchung keine GVO-Verunreinigung vorliegen darf <strong>und</strong> im Zuge der stichprobenartigen<br />
Nachkontrolle eine Verunreinigung von maximal 0,1 % toleriert wird. Daher muss ein Labor, welches<br />
Erstuntersuchungen oder auch Untersuchungen im Rahmen der Nachkontrolle durchführt, Methoden anwenden, die<br />
den Nachweis von zumindest einem gentechnisch veränderten Korn in 3000 Samen ermöglichen, damit eine<br />
zumindest 95%ige Sicherheit des Nichtvorhandenseins von GV-Saatgut gegeben ist (HOCHEGGER, 2004).<br />
Die gentechnische Veränderung eines Organismus erfolgt auf DNA-Ebene. Sie bewirkt in der Regel die Synthese<br />
eines zusätzlichen Proteins (wie z.B. ein bakterielles Enzym für eine Antibiotika- oder Herbizidresistenz) oder auch<br />
eine Unterdrückung der Proteinsynthese. Diese Veränderungen können sich auch auf weitere Inhaltsstoffe auswirken.<br />
Die Möglichkeiten der Unterscheidung eines GVO vom entsprechenden unveränderten Wildtyp können vielfältig sein:<br />
molekularbiologisch durch den Nachweis der gentechnischen Veränderung selbst, biochemisch durch den Nachweis<br />
des gebildeten Proteins, chemisch durch die neue/veränderte Zusammensetzung von Inhaltsstoffen bis zu Bioassays<br />
wie der Anwendung von Herbiziden (ANKLAM et al., 2002; HASSAN-HAUSER et al., 1998). Für ein gesichertes Ergebnis<br />
der amtlichen Kontrolle ist aber nach dem derzeitigen Stand einzig die Molekularbiologie geeignet.<br />
Die Nachweisbarkeit gentechnischer Veränderungen hängt vor allem vom Verarbeitungsgrad <strong>und</strong> der Art der<br />
Verarbeitung ab (HASSAN-HAUSER et al., 1998; HÖRTNER, 1997; HÖRTNER, 2004):<br />
• Lebensmittel, Futtermittel <strong>und</strong> Saatgut, welche(s) selbst GVO sind(ist), wie Sojabohnen, Tomaten, Erdäpfel,<br />
Maiskörner, Rapssamen enthalten noch die gesamte DNA <strong>und</strong> damit auch die gentechnische Veränderung.<br />
• Lebensmittel <strong>und</strong> Futtermittel, die aus verarbeiteten GVO´s bestehen, wie Ketchup, Chips, diverse Mehle<br />
<strong>und</strong> Schrote (Sojamehl), enthalten ebenfalls noch die gesamte DNA, die aber durch Verarbeitungsprozesse<br />
degradiert oder durch Inhaltsstoffe maskiert werden kann.<br />
• Lebensmittel, die GVO enthalten, wie Joghurt oder Rohwurst mit GVO als Starterkulturen, enthalten<br />
ebenfalls die gesamte DNA der GV-Starterkulturen.<br />
• Lebens-, Futtermittel <strong>und</strong> -zusatzstoffe, die aus GVO hergestellt bzw. isoliert werden, wie Öl, Stärke, Zucker<br />
<strong>und</strong> Lecithin, sind in der Regel chemisch definierte Substanzen bzw. Substanzgemische <strong>und</strong> selbst nicht<br />
verändert, sie können aber noch DNA enthalten.<br />
• Lebens- <strong>und</strong> Futtermittelzusatzstoffe u. -hilfsstoffe, die mittels GVO (vorwiegend Mikroorganismen)<br />
hergestellt werden (wie Enzyme, Aromen, Vitamine), sind chemisch definierte Substanzen <strong>und</strong> selbst nicht<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 98 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 5: Probenahme <strong>und</strong> GVO-Analytik<br />
gentechnisch verändert. Sie sind hoch gereinigt <strong>und</strong> sollten keine DNA (<strong>und</strong> andere Begleitsubstanzen)<br />
mehr enthalten.<br />
Zusammenfassend muss nochmals betont werden, dass bei chemisch definierten Substanzen – wenn überhaupt –<br />
nur über zufällige Verunreinigungen eine Herstellung mittels GVO nachgewiesen werden kann <strong>und</strong> eine Überprüfung<br />
nur durch die Rückverfolgbarkeit der Ausgangserzeugnisse zu erzielen ist.<br />
5.2.1. Methodik der GVO-Analytik<br />
Die Nachweismethode der Wahl ist derzeit die Polymerase-Ketten-Reaktion (PCR), ein auf Nukleinsäuren basierendes<br />
Verfahren, mit der die gesuchten Gensequenzen spezifisch vervielfältigt <strong>und</strong> detektiert werden können. Die<br />
labormäßige Vorgabe dafür sind räumlich getrennte Arbeitsbereiche der einzelnen Untersuchungsschritte, äußerst<br />
exaktes <strong>und</strong> sorgfältiges Arbeiten <strong>und</strong> entsprechend geschultes Laborpersonal (HÖRTNER, 2004). Voraussetzung für<br />
die Untersuchung auf gentechnische Veränderungen ist die Isolierung von DNA in ausreichender Menge <strong>und</strong> Qualität.<br />
In hochverarbeiteten Produkten (Lebensmittel <strong>und</strong> Futtermittel, Bsp.: Cornflakes), können Sek<strong>und</strong>ärstoffe auftreten,<br />
die eine DNA-Isolierung <strong>und</strong> die anschließende PCR-Analyse stören (z.B. Polyphenole, Polysaccharide <strong>und</strong><br />
Maltodextrine). Ist die Gewinnung von DNA nicht in ausreichender Menge <strong>und</strong> Qualität möglich, so kann der<br />
Nachweis <strong>und</strong> auch die Quantifizierung nicht durchgeführt werden. Zustand <strong>und</strong> Reinheit der DNA müssen aus oben<br />
genannten Gründen vor Beginn des eigentlichen GVO-Nachweisverfahrens überprüft werden. Geeignet ist dafür die<br />
Kontroll-PCR eines Genabschnitts, der in den Pflanzen konserviert vorliegt oder nur für die jeweilige Spezies typisch<br />
ist. Erhält man hierbei ein positives Ergebnis, kann mit dem eigentlichen Nachweis der potentiellen, gentechnischen<br />
Veränderung begonnen werden. Da die PCR zwar sehr spezifisch, gleichzeitig aber sehr sensitiv ist, müssen immer<br />
entsprechende Kontrollen im PCR-Ansatz mitgeführt werden. Eine Positivkontrolle bestätigt die Richtigkeit des PCR-<br />
Ansatzes, da vorkommende PCR-Inhibitoren an die DNA binden (Maskierung) <strong>und</strong> eine Vervielfältigung verhindern<br />
können. Falsch negative Ergebnisse bei der Amplifikation der isolierten DNA können durch das sogenannte "spiken"<br />
ausgeschlossen werden (Zugabe <strong>und</strong> Wiederfindung von GVO-positivem Material). Da bei der PCR als<br />
Analysentechnik (neben der Mikrobiologie) erstmals vor der Detektion eine Amplifizierung (Vermehrung auf n hoch<br />
10-12) des gesuchten Analyten erfolgt <strong>und</strong> zusätzlich die PCR ein stochastischer Prozess ist, ist sie sehr anfällig für<br />
Störungen, Inhibierungen <strong>und</strong> Verunreinigungen bzw. Kontaminationen (s.o.). Der Nachweis der berühmten "einen<br />
Kopie" ist daher illusorisch (s.u.: Nachweis- u. Bestimmungsgrenze). Ein Fehler von mindestens 30 % rel. ist daher<br />
bei der Quantifizierung systemimmanent.<br />
Der qualitative Nachweis von DNA-Zielsequenzen wird durchgeführt, um eine positive oder negative Antwort auf die<br />
Frage zu erhalten, ob ein bestimmter DNA-Abschnitt, bezogen auf geeignete Kontrollen <strong>und</strong> innerhalb der<br />
Nachweisgrenzen des angewendeten analytischen Verfahrens <strong>und</strong> der untersuchten Teilprobe, nachgewiesen wurde<br />
oder nicht. Innerhalb des qualitativen Verfahrens wird zwischen einem allgemeinen Nachweis (Ja/Nein-Screening)<br />
<strong>und</strong> den spezifischen Analyseverfahren <strong>zur</strong> Identifizierung, um welchen Event es sich handelt (Bsp.: Mais Bt 11,<br />
Ro<strong>und</strong>upReady TM Soja) unterschieden. Der Nachweis erfolgt über die eingebauten Fremdsequenzen (Insert), die in<br />
der Regel aus Strukturgen, Promotor <strong>und</strong> Terminator bestehen (siehe Abbildung 5-1).<br />
• Screening: Eine PCR-Analyse auf häufig vorkommende Regulatorelemente (Promotor- <strong>und</strong><br />
Terminatorsequenzen, auch Antibiotikaresistenzgene) kann Auskunft über eine mögliche Anwesenheit einer<br />
GVO-Sequenz geben <strong>und</strong> genügt in manchen Fällen als Aussage. Ein eindeutiger Beweis für einen GVO ist<br />
es aber nicht.<br />
• Ist eine Analyse auf den 35S-Promotor (aus dem Blumenkohlmosaikvirus) positiv, muss eine so genannte<br />
"Virusausschluss-PCR" die Abwesenheit des Blumenkohlmosaikvirus belegen.<br />
• Konstruktspezifischer Nachweis: Da die einzelnen Teile der eingesetzten Fremdsequenzen im Insert<br />
natürlich vorkommen, ist für den spezifischen Nachweis ein Übergangsbereich zwischen Strukturgen <strong>und</strong><br />
Promotor bzw. Terminator erforderlich. In diesem Übergangsbereich werden die PCR-Analysen durchgeführt<br />
(ANKLAM et al., 2002).<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 99 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 5: Probenahme <strong>und</strong> GVO-Analytik<br />
• Linien- (event-)spezifischer Nachweis: Da ein spezifisches Insert in mehreren Pflanzen eingesetzt werden<br />
kann, ist für einen spezifischen Nachweis eine PCR im Übergangsbereich vom Pflanzengenom in das<br />
Konstrukt notwendig. Zurzeit ist bei Mais T25 <strong>und</strong> bei Raps das pat-Gen (Glufosinatresistenz) gleich. Daher<br />
müssen die "border"-Sequenzen auch bekannt sein (ANKLAM et al., 2002).<br />
• Absicherung: Ist ein PCR-Ergebnis positiv, muss es entsprechend abgesichert werden: Hybridisierung mit<br />
einer markierten Sonde, Sequenzierung oder Restriktionsanalyse des PCR-Fragments oder eine nested PCR<br />
kann <strong>zur</strong> Bestätigung eingesetzt werden. Wird mittels Real-Time PCR quantifiziert, erfolgt die Absicherung<br />
währen der Analyse.<br />
Das Prinzip der quantitativen Bestimmung mit der Real-Time PCR besteht üblicherweise in der Ermittlung des<br />
Verhältnisses von zwei Nukleinsäuresequenzen, d.h. eine Sequenz ist spezifisch für den gentechnisch veränderten<br />
Organismus <strong>und</strong> die andere ist eine endogene, taxonomspezifische (artspezifische) Zielsequenz. Der Messwert wird<br />
als relatives Verhältnis dargestellt, wobei das Ergebnis in %GVO-DNA im Verhältnis <strong>zur</strong> Gesamt-DNA der<br />
untersuchten Pflanzenart (DNA-Kopienzahl entscheidend) angegeben wird.<br />
Die Nachweisgrenzen für qualitative Analysen (NG, LOD, limit of detection) sind <strong>zur</strong>zeit bei 0,02 % angesiedelt (das<br />
entspricht etwa 10 - 20 Kopien der Ziel-DNA im PCR-Ansatz). Das Limit für quantitative Analysen (BG,<br />
Bestimmungsgrenze, LOQ, limit of quantification) liegt bei 0,1 %, welches 30 – 50 Kopien im PCR-Ansatz entspricht.<br />
Diese Werte beziehen sich auf die jeweilige Reinsubstanz (Maismehl, Sojamehl), d.h. diese Werte können auch um<br />
einiges höher liegen, wenn es sich um schwierige Probenmatrices handelt, in Abhängigkeit der Genomgröße der zu<br />
untersuchenden Pflanzenart <strong>und</strong> der für die PCR eingesetzten DNA-Menge. Für die Saatgutanalytik, wo stets einzelne<br />
Individuen vorliegen, kann durch Anpassung des Testumfanges bzw. Erhöhung der untersuchten Samenanzahl, die<br />
Nachweisgrenze theoretisch sogar gegen null gesenkt werden (HÜBNER et al., 2001; KAY UND VAN DEN EEDE, 2001).<br />
5.2.2. Untersuchungsschema<br />
Die für die Untersuchungen von Saatgut, Lebens- <strong>und</strong> Futtermittel, durchgeführt im Kompetenzzentrum Biochemie<br />
der <strong>AGES</strong>, verwendeten Methoden entspringen dem Deutschen Lebensmittelgesetz (§35 LMBG), den Vorschlägen der<br />
CEN-Arbeitsgruppe, Informationen/Vorgaben des ENGL/JRC <strong>und</strong> diversen hausinternen Entwicklungen. Das CC<br />
Biochemie ist Mitglied im ENGL (European Network of GMO-Laboratories), geleitet vom DG/JRC Ispra als EU-<br />
Referenzlabor.<br />
Konstrukt, Insert<br />
Pflanzen-DNA Promotor<br />
Steuer-<br />
Element<br />
(optional)<br />
Strukturgen<br />
Protein<br />
Terminator<br />
Pflanzen-DNA<br />
Protein: ELISA, Dipstick<br />
DNA :<br />
Screening: Promotor Terminator<br />
Spezifischer Nachweis: Übergangsbereich<br />
konstrukt-spezif. Nachweis:<br />
linien-spezif. Nachweis:<br />
Abbildung 5-1: Übersicht über die Nachweisverfahren<br />
Folgendes Untersuchungsschema für amtliche Proben hat sich als praktikabel erwiesen:<br />
• Saatgut: Im Untersuchungsprogramm befinden sich <strong>zur</strong> Zeit Mais, Sojabohne <strong>und</strong> Raps. Zur Untersuchung<br />
gelangen 2x1500 Korn, welche getrennt aufgearbeitet werden. Jeweils im Doppelansatz wird auf GV-<br />
Bestandteile analysiert. Bei positivem Screening wird eine Identifizierung auf alle handelsüblichen Events<br />
durchgeführt. Beim Screening <strong>und</strong> der Identifikation kommt die qualitative PCR-Analytik zum Einsatz. Der<br />
identifizierte Event wird je nach Verfügbarkeit geeigneter Methoden, mit einem Real-Time PCR Verfahren<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 100 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 5: Probenahme <strong>und</strong> GVO-Analytik<br />
oder mit einem semi-quantitativen Verfahren (=qualitative subsample-Testung) auf den Gehalt an<br />
gentechnisch veränderten Samen untersucht.<br />
• Lebensmittel: Untersucht wird auf GV-Soja <strong>und</strong> GV-Mais. GV-Raps ist als Lebensmittel nur als Öl von<br />
Bedeutung <strong>und</strong> <strong>zur</strong>zeit im Öl mit vertretbarem analytischem Aufwand nicht erfassbar. Enthält die Probe nur<br />
Sojabohnen, wird sie nach einer qualitativen Analyse auf Lectin- <strong>und</strong> RR-Gen bei einem positiven Bef<strong>und</strong> mit<br />
einem RR-Testkit mittels Real-time PCR quantifiziert. Enthält die Probe nur Mais, wird sie qualitativ auf<br />
Invertase-Gen, 35S-Promotor <strong>und</strong> NOS-Terminator untersucht. Ist sie im Screening 35S-positiv (<strong>und</strong> Virus-<br />
negativ) wird sie mittels 35S-Kit bezogen auf Mais-DNA quantifiziert. Nur wenn der quantitative Wert über<br />
dem jeweiligen Schwellenwert liegt, werden die PCR's für die entsprechenden Mais-Events durchgeführt <strong>und</strong><br />
wie unten angegeben weiter verfahren. Enthält die Probe Sojabohne <strong>und</strong> Mais, muss sie nach einem<br />
positiven Screeningbef<strong>und</strong> (<strong>und</strong> negativer Virus-PCR) auf alle Einzelevents untersucht werden (in Summe 10<br />
- 15 PCR-Ansätze inkl. aller Kontroll-PCR's). Sojabohne kann quantifiziert werden.<br />
• Futtermittel: Die Futtermittelanalytik ist noch wesentlich aufwändiger, da zu Sojabohnen <strong>und</strong>/oder SES <strong>und</strong><br />
Mais der Lebensmittelanalytik noch Raps (mit 7 Events) hinzukommt. Bei positivem Screening (35S <strong>und</strong><br />
NOS) muss prinzipiell auf alle Einzelevents untersucht werden, was bis zu 20 PCR-Ansätze bedeuten kann!<br />
5.2.3. Limitationen <strong>und</strong> Herausforderungen der GVO-Analytik<br />
Das gleiche Insert (z.B. Herbizidresistenz) wird in verschiedenen Pflanzenarten eingesetzt. Dafür sind neue<br />
eventspezifische Verfahren zu entwickeln.<br />
Es sind Linien aus Kreuzungen zweier GVO´s <strong>zur</strong> Zulassung eingereicht ("stacked genes", z.B. Mais MON810xT25),<br />
deren analytische Erfassung noch völlig ungeklärt ist. In den USA <strong>und</strong> Kanada werden diese Kreuzungen im<br />
Gegensatz <strong>zur</strong> EU nicht als neuer Event angesehen <strong>und</strong> unterliegen keinem eigenen Zulassungsverfahren.<br />
Die Zulassung eines GVO betrifft auch dessen Nachkommen aus Kreuzungen mit konventionellen Linien. Da<br />
allgemein bei einzelnen Varietäten von Pflanzen die Genomgröße um bis zu 25 % differieren kann, stellt sich hier die<br />
Frage nach dem wahren analytischen Standard <strong>zur</strong> Quantifizierung: ursprüngliche Linie - Handelsvarietät. Auch die<br />
Erhaltung der Kopienzahl des Inserts nach Kreuzungen stellt ein weiteres Problem dar.<br />
Es sind Linien mit neuen, regulierbaren Promotoren <strong>und</strong> anderen Terminatoren eingereicht, die durch ein einfaches<br />
Screening nicht mehr erfassbar sind. Das bedeutet, dass mit der Zunahme der Zulassungen auch die Anzahl der<br />
Screeningparameter steigen muss, was wieder eine Zunahme der Kosten bewirkt.<br />
Derzeit sind von den in der EU zugelassenen bzw. im Zulassungsverfahren befindlichen Events noch immer nicht alle<br />
als zertifiziertes Referenzmaterial erhältlich. Einfache, preisgünstige Positivkontrollen (Kontrollproben oder Plasmid-<br />
DNA, ohne zertifizierte Konzentrationsangabe), wie sie für die Ausarbeitung von Nachweis- bzw. Screeningverfahren<br />
erforderlich sind, gibt es nur in beschränktem Umfang.<br />
Zusätzliche Probleme bereiten die Genetik (z.B. Mais) <strong>und</strong> die Genomgröße (z.B. Weizen). Es müsste genau<br />
unterschieden werden, was untersucht wird (Pflanze, Korn bzw. welcher Teil des Korns): Der Embryo eines<br />
Maiskorns hat ein normales diploides F2-Genom, das Endosperm ein triploides F1-Genom (aus der Verschmelzung<br />
von zwei weiblichen <strong>und</strong> einem männlichen Zellkern). Dies ist auch beim Standard zu berücksichtigen (VAN DE EEDEN,<br />
2000).<br />
Die angeführte Bestimmungsgrenze von 0,1 % gilt für die derzeit in der EU zugelassenen GVO. Sollten andere GVO –<br />
insbesondere Getreide - untersucht werden müssen, so kann ein Grenzwert von 0,1 % mit den derzeitigen Verfahren<br />
in Lebensmitteln nicht analysiert werden: In einem typischen PCR-Ansatz von 100 ng DNA sind z.B. bei Mais 36 000<br />
Genomkopien vorhanden. Bei 0,1 % GVO-Anteil sind 36 GVO-Kopien enthalten <strong>und</strong> die Real-time PCR durchführbar.<br />
In 100 ng Weizen-DNA liegen aber aufgr<strong>und</strong> der Hexaploidie des Weizens nur 6000 Genomkopien vor. Bei 0,1 %<br />
GVO-Anteil daher nur 6 GVO-Kopien. Die Bestimmungsgrenze muss daher mit 0,6 %(!) festgelegt werden, um in den<br />
Bereich von 30 – 50 Kopien im PCR-Ansatz zu kommen (HÜBNER et al., 2001; KAY <strong>und</strong> VAN DEN EEDE, 2001, VAN DEN<br />
EEDE, 2000).<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 101 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 5: Probenahme <strong>und</strong> GVO-Analytik<br />
Insbesondere für Rohwaren ist die repräsentative Probenahme die Voraussetzung für aussagekräftige Analysedaten<br />
für die Partie. Die Probenahmeverfahren stützen sich bislang auf die statistische Zufallsverteilung von GVO-<br />
Kontaminationen. Das entspricht, nach neuesten Erkenntnissen (z.B. Kelda-project, JRC/Ispra), nicht immer den<br />
tatsächlichen Begebenheiten, v.a. in sehr großen Transporteinheiten. Dadurch kann ein gewisses Maß an<br />
Heterogenität auftreten, welches vorwiegend die Repräsentativität der Quantifizierungsergebnisse nachteilig<br />
beeinflusst. Probengröße, komplexe Proben: Für die Erreichung der Bestimmungsgrenze von 0,1 % GVO-Anteil bei<br />
ganzen Körnern müssen bei der Annahme einer inhomogenen Verteilung 10 000 Körner homogenisiert werden. Bei<br />
einem Korngewicht von 4 mg bei Raps beträgt die Probenmenge 40 g, bei Sojabohnen (100 mg Korngewicht) 1 kg,<br />
bei Mais (290 mg) 2,9 – 3 kg. Bei größerem "Korngewicht" (Nüsse, Erdäpfel etc.) müssen für die Zukunft noch<br />
weitere Überlegungen angestellt werden (Dies gilt nicht für Saatgut, bei dessen Untersuchung andere Vorschriften<br />
<strong>zur</strong> Anwendung kommen).<br />
Mischungen verschiedener GVO bei Lebens- <strong>und</strong> Futtermittel (siehe Abbildung 5-2): Liegt in einem Maismehl eine<br />
Mischung aus drei Events (0,3 + 0,3 + 0,6 %) vor, beträgt die Summe 1,2 % GV-Mais bezogen auf die Zutat<br />
Maismehl <strong>und</strong> ist somit zu kennzeichnen. Ist hingegen in einer Mischung von Mais- <strong>und</strong> Sojamehl der 0,6 % Anteil<br />
GV-Soja, so ist nicht zu kennzeichnen, da sowohl GV-Mais als auch GV-Sojabohne unter 0,9 % pro Zutat liegen. Liegt<br />
aber in einer Mischung von Maismehl <strong>und</strong> Maisstärke die vorhin erwähnte Mischung von drei Mais-Events vor, so<br />
kann diese Probe nicht beurteilt werden, da die Summe von 1,2 % GV-Mais nicht zuzuordnen ist.<br />
Maismehl<br />
Summe: 1,2% GVO<br />
bez. auf Zutat Maismehl<br />
0,3 % Bt-176<br />
0,3 % MON 810<br />
0,6 % Bt-11<br />
zu kennzeichnen<br />
Untersuchungsbeispiele<br />
Hermann Hörtner, <strong>AGES</strong> - Kompetenzzentrum Biochemie<br />
Lebensmittel<br />
mit Mais- <strong>und</strong> Sojamehl<br />
0,9 % GVO bez. auf Mais<br />
0,6 % GVO bez. auf Soja<br />
0,3 % MON 810<br />
0,6 % Bt-11<br />
0,6 % RR-Soja<br />
nicht zu kennzeichnen<br />
Lebensmittel mit<br />
Maismehl <strong>und</strong><br />
Maisstärke<br />
Summe: 1,2% GVO<br />
bez. auf Zutat Maismehl<br />
<strong>und</strong> Maisstärke<br />
0,3 % Bt-176<br />
0,3 % MON 810<br />
0,6 % Bt-11<br />
nicht zuzuordnen<br />
Abbildung 5-2: Untersuchungsbeispiele für die Quantifizierung von GVO-Verunreinigungen<br />
<strong>und</strong>/oder Kontaminationen<br />
5.2.4. Lösungsansätze <strong>zur</strong> Bewältigung der Herausforderungen in der GVO-Analytik<br />
Eine Lösung für die Bewältigung der Analysenzahlen pro Probe nach Zulassung aller GVO's vor allem im<br />
Lebensmittel- oder Futtermittelbereich kann durch eine Verlagerung der Kontrolle vom Endprodukt im Verkaufsregal<br />
zum Ausgangsprodukt beim Erzeuger, Importeur oder Großhändler erzielt werden. Eine Kontrolle der Endprodukte ist<br />
jetzt schon fallweise sehr aufwändig <strong>und</strong> teuer. Sie wird in Zukunft, unter Beibehaltung der momentanen<br />
Probenzahlen, kaum zu bewältigen sein <strong>und</strong> enorm personal-, zeit- <strong>und</strong> kostenintensiv verlaufen. Durch die<br />
Anpassung der amtlichen Probenziehungspläne im Hinblick auf die Rohstoffe für die Lebensmittelerzeugung kann der<br />
Einsatz zuverlässiger <strong>und</strong> kostengünstiger GVO-Analysemethoden erfolgen. Eine weitere Lösung, um den erwähnten<br />
Problemen bei Mischungen <strong>und</strong> den Problemen der hohen Nachweisgrenzen bei Getreide zu begegnen ist, sich auf<br />
die Analyse von "stückigem Untersuchungsgut" zu beschränken: Wenn die Untersuchung auf GVO wie bei der<br />
Saatgutanalytik auf die Einzelindividuen beschränkt bleibt, kann durch Variation des Testumfangs die<br />
Nachweisgrenze entsprechend gesenkt <strong>und</strong> die aufwändige Analytik von Mischungen vermieden werden.<br />
Diesbezüglich ist allerdings eine Abklärung <strong>und</strong> Akkordierung auf internationaler Ebene anzudenken.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 102 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 6: Monitoring<br />
6. Betrachtungen zu einem effektiven <strong>und</strong> effizienten Monitoring- <strong>und</strong><br />
Überwachungssystem für die Sicherstellung der Anforderungen eines<br />
Qualitätsprogrammes - S. PÖCHTRAGER, S. GROßAUER, Institut für Marketing & Innovation, BOKU<br />
6.1. Allgemeines<br />
Um sicherzustellen, dass die Anforderungen an ein Qualitätsprogramm in Bezug auf „GVO-Freiheit“ oder<br />
„Gentechnikfreiheit“ eingehalten werden, bedarf es eines umfassenden Monitoringsystems = Überwachungssystems.<br />
Unter Monitoring versteht man die geplante Messung <strong>und</strong> Beobachtung hinsichtlich der festgelegten Grenzwerte <strong>und</strong><br />
Toleranzen von Verfahrensschritten <strong>und</strong> Methoden. Durch das Monitoring soll sichergestellt werden, dass der<br />
gesamte Prozess der Futtermittelerzeugung, beginnend vom Handel mit Futterrohstoffkomponenten über die<br />
Futtermittelerzeugung, unter Berücksichtigung der jeweiligen Lager <strong>und</strong> Transporttätigkeiten, der<br />
Futtermittelverwendung am landwirtschaftlichen Betrieb <strong>und</strong> der Weiterverarbeitung von Erzeugnissen aus der<br />
tierischen Produktion bis hin zum Handel dieser Produkte, einer Qualitätssicherung unterzogen wird. In derartige<br />
Überwachungssysteme <strong>zur</strong> Sicherstellung der Einhaltung der „GVO-Freiheit“ oder „Gentechnikfreiheit“ kann durchaus<br />
auch die gesamte Erzeugung des Futtermittelausgangserzeugnisses einbezogen werden. Dies ist gemäß den<br />
Bestimmungen des österreichischen Codex auch erforderlich, da diese auch Standards für Betriebsmittel neben<br />
Saatgut (Düngemittel, Pflanzenschutzmittel) in den landwirtschaftlichen Erzeugungsprozessen vorgeben. Es ist somit<br />
jedenfalls die Einhaltung eines Grenzwertes oder Schwellenwertes mit einer maximalen GVO-Verunreinigung der<br />
Futtermittelausgangserzeugnisse oder Rohstoffe gem. Schwellenwerteregime der EU sicherzustellen.<br />
Die Zertifizierung der Zulässigkeit der Systeme sollte durch unabhängige <strong>und</strong> kompetente Stellen vorgenommen<br />
werden. Derzeit werden derartige Systeme in Österreich von privaten Stellen, welche vom BMWIA akkreditiert sind,<br />
zertifiziert.<br />
Unabhängig davon ist die Wahrnehmung der Überwachung <strong>und</strong> Kontrolle durch staatliche Stellen im Zuge der<br />
Vollziehung des Futtermittel- <strong>und</strong> Lebensmittelrechtes in der EU <strong>und</strong> in Österreich zu betrachten.<br />
Darüber hinaus ist es eine Voraussetzung für die Implementierung eines Qualitätsprogrammes, dass die<br />
Unternehmen in der gesamten Erzeugungskette über zuverlässige, effektive Eigenkontrollsysteme verfügen. Dies<br />
bedeutet unter anderem, dass sich jeder Mitarbeiter eines Unternehmens, das „GVO-freie“ oder „gentechnikfreie“<br />
Produkte herstellt oder handelt, über die möglichen Gefahren der Verschleppung bewusst sein muss <strong>und</strong> daher<br />
bereits vorbeugend jegliche Verunreinigung möglichst vermeidet.<br />
Bei der Bewertung des Risikos einer GVO-Vermengung <strong>und</strong> Verunreinigung kommt der Überwachung auf „GVO-<br />
Freiheit“ oder „Gentechnikfreiheit“ der Rohstoffe (Zutaten, Zusatz- <strong>und</strong> Hilfsstoffen) <strong>und</strong> deren Herkünfte ein<br />
hoher Stellenwert zu. Die Versorgungslage mit „GVO-freien“ oder „gentechnikfreien“ Rohstoffen am Markt ist<br />
ebenfalls zu prüfen. Dies wurde bereits in den Kapiteln 3 <strong>und</strong> 4 dargestellt.<br />
Sicherlich sind <strong>zur</strong>zeit die Rohstoffe Sojabohne, Mais <strong>und</strong> Raps <strong>und</strong> Futtermittelzusatzstoffen wie Vitamine <strong>und</strong><br />
Aminosäuren etc. die Hauptrisikostoffe für eine gentechnische Verunreinigung (siehe Kapitel 3 <strong>und</strong> 4). Der Einsatz<br />
von Rohstoffen bzw. Futtermittelausgangserzeugnissen anderer Kulturarten (v.a. Baumwolle, Reis, Zuckerrübe etc.)<br />
bedarf einer Fall-zu-Fall-Überprüfung hinsichtlich des Risikos eines GVO-Eintrages.<br />
Betreffend der Verfügbarkeit von „GVO-freien“ oder „gentechnikfreien“ Rohstoffen oder<br />
Futtermittelausgangserzeugnisse sowie von „GVO-freien“ oder „gentechnikfreien“ Zusatz- <strong>und</strong> Hilfsstoffen, einerseits<br />
gemäß der Kriterien des österreichischen Codex <strong>und</strong> andererseits nach der Bewertung gemäß den Vorgaben der<br />
EG(VO) 1829/2003, sei auf Kapitel 3 <strong>und</strong> 4 verwiesen.<br />
Bei der Betrachtung der externen Monitoring- <strong>und</strong> Eigenkontrollsysteme wird auf die Differenzierung der<br />
Anforderungen gemäß dem österreichischen Codex <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> der Umsetzung für nicht<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 103 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 6: Monitoring<br />
kennzeichnungspflichtige Futter- <strong>und</strong> Lebensmittel gemäß EG (VO) 1829/2003, „GVO-frei“, hingewiesen. Ohne auf<br />
die Details näher einzugehen, sei auf die zusätzlichen Vorgaben gemäß Codexrichtlinie verwiesen:<br />
den Betriebsmitteleinsatz in der landwirtschaftlichen Produktion,<br />
der Mengenbegrenzungen von SES in der Futterration,<br />
der Erzeugung der Zusatzstoffe bzw. Futtermittelausgangserzeugnisse für Futtermittel,<br />
der Umstellungszeiträume in der Fütterung.<br />
Im Zuge der Betrachtung eines effektiven <strong>und</strong> effizienten Monitorings- <strong>und</strong> Überwachungssystems muss die Frage<br />
geklärt werden, an welchen kritischen Punkten in der gesamten Wertschöpfungskette sich die Risiken der<br />
Verunreinigung von „GVO-freien“ oder „gentechnikfreien“ Produkten mit GVO-Produkten ergeben.<br />
Weltweit werden immer mehr gentechnisch veränderte Produkte produziert <strong>und</strong> gehandelt, die in der Lebensmittel-<br />
<strong>und</strong> Futtermittelverarbeitung eingesetzt werden. In Europa ist <strong>zur</strong>zeit der Anbau von gentechnisch veränderten<br />
Pflanzen noch sehr eingeschränkt bzw. nicht erlaubt. In Österreich ist der Anbau von GVO derzeit nicht zulässig. Dies<br />
trifft aber nicht für die Anwendungen von als GVO gekennzeichneten Rohstoffen <strong>und</strong><br />
Futtermittelausgangserzeugnissen, sowie Zusatz- <strong>und</strong> Hilfsstoffen, welche die Anforderungen gemäß EG (VO)<br />
1829/2003 erfüllen, <strong>zur</strong> Futtermittelerzeugung zu. Änderungen in den nächsten Jahren vor allem im Umfeld Europa<br />
würden auch Änderungen der Risikobewertung <strong>und</strong> damit des vorgeschlagenen Monitoringsystems erforderlich<br />
machen.<br />
6.2. Orte <strong>und</strong> Quellen der Verunreinigung<br />
Die nächste Abbildung zeigt die gesamte Supply Chain / Wertschöpfungskette einer „GVO-freien“ oder<br />
„gentechnikfreien“ Produktion. Hier gilt es zu untersuchen, in welchen der Prozeßglieder es zu „GVO-<br />
Verunreinigungen“ insbesondere durch Verschleppungen kommen kann. Aufbauend auf einer ersten<br />
Situationsabschätzung wird in diesem Kapitel auf das Monitoring <strong>und</strong> das Aufzeigen von Kontrollpunkten entlang der<br />
gesamten Supply Chain eingegangen. Das Untersuchungsobjekt, die Supply Chain „GVO-freie“ oder „gentechnikfreie“<br />
Produktion, wird wie in der folgenden Grafik dargestellt abgegrenzt. Das Hauptaugenmerk wurde auf die Vorgänge in<br />
den Futtermittelwerken bis zum Landwirt gerichtet, da diese für die österreichische Produktion von „GVO-freien“<br />
oder „gentechnikfreien“ Produkten relevant <strong>und</strong> überwachbar sind. Ausgangspunkt muss ein „GVO-freier“ oder<br />
„gentechnikfreier“ Rohstoff oder Futtermittelausgangserzeugnis bzw. Zusatzstoff sein. Daher sei nochmals auf die<br />
unterschiedlichen Anforderungen, gemäß österreichischem Codex <strong>und</strong> EG (VO) 1829/2003, dargestellt in Kapitel 3<br />
<strong>und</strong> 4, hingewiesen.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 104 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 6: Monitoring<br />
Erzeugung des Futtermittels in der Futtermittelindustrie<br />
Landw. Erzeugung<br />
der<br />
Rohstoffe<br />
£££<br />
Landwirt<br />
tierische<br />
Produktion<br />
Transport<br />
<strong>und</strong><br />
Lager<br />
Transport<br />
<strong>und</strong><br />
Lager<br />
Mühle<br />
SES<br />
Verarbeitung<br />
tierische<br />
Produkte =<br />
Lebensmittel<br />
Transport<br />
<strong>und</strong><br />
Lager<br />
Transport<br />
<strong>und</strong><br />
Lager<br />
FM Werk<br />
<strong>und</strong>/oder<br />
Handel<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Handel /<br />
Verteiler<br />
Transport<br />
<strong>und</strong><br />
Lager<br />
Konsument<br />
Abbildung 6-1: Supply Chain vom Anbau des Rohstoffs/Futtermittelausgangserzeugnisses bis zum Lebensmittel<br />
tierischer Herkunft bzw. Konsum.<br />
� In der ersten Stufe der Produktionsprozesskette – der landwirtschaftlichen Erzeugung der Rohstoffe<br />
– ergeben sich bereits erste potentiell problematische Bereiche. Die Auswahl des richtigen Saatgutes, der<br />
Abstand zu konventionellen Kulturen, um Pollendrift zu vermeiden, <strong>und</strong> Verschleppungsrisiken in<br />
landwirtschaftlichen Maschinen <strong>und</strong> Transportfahrzeugen sind hier zu betrachten. Bezugnehmend auf den<br />
österreichischen Codex ergeben sich zusätzliche Anforderungen wie der Einsatz entsprechender Dünge- <strong>und</strong><br />
Pflanzenschutzmittel. Festzustellen bleibt, dass gerade die landwirtschaftliche Produktion in anderen EU-<br />
<strong>und</strong> Drittländern für österreichische Prüfstellen schwer überwachbar ist.<br />
� Sämtliche Vorgänge des Transportes <strong>und</strong> der Lagerung stellen auf Gr<strong>und</strong> der Möglichkeit einer<br />
Vermengung <strong>und</strong> Verunreinigung ein Risiko dar. Somit ist eine strikte Warenflusstrennung in diesem Bereich<br />
erforderlich.<br />
� Auch auf Ebene der SES Mühlen ist ebenfalls auf eine strikte Trennung der Warenströme zu achten.<br />
� Im Bereich der Futtermittelproduktion ist eine gr<strong>und</strong>sätzliche Feststellung zu treffen: In<br />
Futtermittelwerken mit gleichzeitiger Verarbeitung von „GVO-freien“ oder „gentechnikfreien“ <strong>und</strong><br />
konventionellen Produkten gewährleisten nur getrennte <strong>und</strong> geschlossene Produktionsprozesse die<br />
Einhaltung der Anforderungen an „GVO-freie“ oder „gentechnikfreie“ Futtermittel. Die Basis zu dieser<br />
Feststellung stellt die Forschungsarbeit MODER et al. aus dem Jahr 2004 dar. Folgendes Zitat stammt aus<br />
den Schlussfolgerungen dieser Studie:<br />
„In der Produktion von „GVO-freien“ oder „gentechnikfreien“ Futtermitteln ist es unter den derzeitigen<br />
Produktionsbedingungen trotz der Umsetzung vieler, durch Qualitätsmanagement geplanter <strong>und</strong> gelenkter<br />
Verbesserungsmaßnahmen nicht gelungen, dauerhaft sicherzustellen, dass der Grenzwert von 0,9% für<br />
zufällige <strong>und</strong> technisch unvermeidbare Verunreinigungen eingehalten wird.“<br />
Seite 105 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 6: Monitoring<br />
Folgende Gründe sind dafür ausschlaggebend (vgl. MODER et al.):<br />
� Verschleppungen in den Fördersystemen, sowie bei den zentralen Verarbeitungsschritten Mahlen,<br />
Mischen <strong>und</strong> Pressen sind, bei der Verwendung von konventionellem <strong>und</strong> „GVO-freien“ SES im selben<br />
Werk <strong>und</strong> auf der selben Linie in der Praxis wahrscheinlich.<br />
� Selbst bei besonderen Vorkehrungen ist das Verschleppungsrisiko in den Futtermittelwerken über die<br />
bestehenden Grenzwerte hinaus nicht in den Griff zu bekommen. Maßnahmen wie die Verwendung von<br />
Spülchargen waren in der Praxis nicht ausreichend, um dauerhaft <strong>und</strong> nachvollziehbar unter dem<br />
Schwellenwert von 0,9% zu bleiben.<br />
� Theoretisch denkbar wäre es, die „GVO-freie" Produktion in einem Futtermittelwerk mit gemischter<br />
Produktion durch eine Bündelung der „GVO-freien“ Produktion zu realisieren. Bei der derzeitigen<br />
Organisation der Produktion, mit einem System der kurzfristigen Bestellung <strong>und</strong> Auslieferung der<br />
Fertigprodukte, ist eine längerfristige Planung <strong>und</strong> sinnvolle Bündelung der „GVO-freien“ Produktion<br />
allerdings nicht durchführbar. Eine Bündelung in der Produktion wäre auch nur dann machbar, wenn<br />
nur wenige Produkte in gentechnikfreier Qualität hergestellt würden.<br />
� Denkbar, <strong>und</strong> zum Teil auch schon durchgeführt, ist der ausschließliche Einsatz von „GVO-freiem“ SES<br />
in Werken, die im Verhältnis wenig SES einsetzen, d.h. vor allem Mischfuttermittel für die<br />
Rinderhaltung produzieren. Zu prüfen ist hier vor allem die wirtschaftliche Machbarkeit, siehe Kapitel<br />
Mehrkosten.<br />
Die Auszüge aus der Studie MODER et al. legen klar dar, dass es nicht möglich ist, einen Schwellenwert<br />
von 0,9% für zufällige <strong>und</strong> technisch unvermeidbare Verunreinigungen (das Schwellenwerteregime<br />
der VO (EG) 1829/2003 betreffend in der EU nicht zugelassener GVO, 0,5/-0- %, wurde in dieser<br />
Studie nicht berücksichtigt) in einem „GVO-freien“ Futter sicherzustellen, wenn dieses in einem<br />
konventionellen Futtermittelwerk produziert wurde. Dementsprechend ist in den weiteren<br />
Betrachtungen immer von Futtermittelwerken auszugehen, die in einer geschlossenen getrennten<br />
Produktion ausschließlich „GVO-freies“ oder „gentechnikfreies“ Futter produzieren.<br />
Zur Absicherung dieser Aussage wurden in 3 („GVO-freien“) als deklariert <strong>„gentechnikfrei“</strong> arbeitenden<br />
Futtermittelwerken in Österreich (wo kein konventioneller SES gelagert oder verarbeitet wird) weitere 16 Proben<br />
gezogen <strong>und</strong> von der Österreichischen Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit untersucht. Damit auf einen<br />
größeren Zeitraum (2.11.2004 bis 12. Mai 2005) mit unterschiedlichen SES- <strong>und</strong> Maisanlieferungen <strong>zur</strong>ückgegriffen<br />
werden konnte, wurden auch Rückstellmuster in die Probenziehung mit eingeb<strong>und</strong>en.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 106 von 272
Tabelle 6-1: Probenziehungsorte <strong>und</strong> Analyseergebnisse<br />
Rohstoff/Futtermittel mit<br />
Probenziehungsort<br />
„GVO-freier“ SES direkt bei<br />
der Anlieferung aus dem LKW,<br />
aus der Silozelle oder von<br />
einem Rückstellmuster<br />
� Anzahl der Proben: 4<br />
„GVO-freier“ Mais von<br />
Rückstellmuster<br />
� Anzahl der Proben: 3<br />
Fertigfutter (Rind <strong>und</strong><br />
Geflügel) direkt bei der<br />
Verladung auf den LKW oder<br />
aus Rückstellmuster<br />
� Anzahl der Proben: 9<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 6: Monitoring<br />
Probe Screening* Identifikation*<br />
GI 2 – F5286<br />
GL 1 – F5457<br />
RH 1 – F5463<br />
RH 6 – F5468<br />
GL 2 – F5458<br />
GL 3 – F5459<br />
RH 2 – F5464<br />
GI 1 – F5285<br />
GI 3 – F5287<br />
GI 4 – F5288<br />
GL 4 – F5460<br />
GL 5 – F5461<br />
GL 6 – F5462<br />
RH 3 – F5465<br />
RH 4 – F5466<br />
RH 5 – F5467<br />
positiv<br />
positiv<br />
positiv<br />
negativ<br />
negativ<br />
positiv<br />
negativ<br />
positiv<br />
positiv<br />
positiv<br />
negativ<br />
negativ<br />
negativ<br />
negativ<br />
positiv<br />
positiv<br />
Quelle: Ergebnisse der GVO-Analytik des CC-Biochemie der <strong>AGES</strong><br />
Ro<strong>und</strong>upReady(RR)-Soja<br />
RR-Soja<br />
RR-Soja<br />
nicht durchgeführt (n.d.)<br />
n.d.<br />
RR-Soja<br />
n.d.<br />
RR-Soja<br />
RR-Soja<br />
RR-Soja<br />
n.d.<br />
n.d.<br />
n.d.<br />
n.d.<br />
RR-Soja<br />
RR-Soja<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Quantifizierung*<br />
(% RR-Soja in<br />
Gesamt-SES)<br />
0,2 %<br />
< 0,1 %<br />
< 0,1 %<br />
n.d.<br />
n.d.<br />
< 0,1 %<br />
n.d.<br />
< 0,1 %<br />
< 0,1 %<br />
< 0,1 %<br />
n.d.<br />
n.d.<br />
n.d.<br />
n.d.<br />
< 0,1 %<br />
< 0,1 %<br />
* Das Screening wurde auf Sequenzen, die für den 35S-Promotor <strong>und</strong> den NOS-Terminator von gentechnisch<br />
veränderten Pflanzen spezifisch sind, durchgeführt. Bei einem positiven Screening-Ergebnis wird der/die Event/s<br />
durch spezifische PCR-Reaktionen identifiziert. Der identifizierte Event wird, wenn Methoden vorhanden, mit einer<br />
Quantifizierung mengenmäßig erfasst. Im Falle von Ro<strong>und</strong>upReady SES wurde ein Quantifizierungskit der Firma<br />
GeneScan verwendet (Ro<strong>und</strong>upReady Soy DNA Quantification System).<br />
Interpretation der Ergebnisse<br />
Das Screening ergab ein negatives Resultat (d.h. 35S <strong>und</strong> Nos-negativ) für 7 der eingesandten Proben.<br />
9 der eingesandten 16 Proben wurden eindeutig als positiv erkannt (LOD 0,02%), die Identifizierung dieser Proben<br />
ergab eine Anwesenheit von RR-Soja, auch wenn keine Sojabestandteile ausgewiesen waren. Im Zuge der<br />
Quantifizierung (LOQ von 0,1%) wurden die Schwellenwerteregime gem. VO (EG) 1829/2003 nicht überschritten. Es<br />
gab keinen Hinweis auf Vorhandensein nicht zugelassener Events.<br />
Basierend auf den 16 gezogenen Proben, resultieren obige Analyseergebnisse, die bestätigen, dass die<br />
„GVO-freie“ Futtermittelproduktion in einem Futtermittelwerk möglich ist, unter der Bedingung, dass<br />
kein kennzeichnungspflichtiges SES in der gleichen Verarbeitungslinie gelagert <strong>und</strong> verarbeitet wird.<br />
� Neben den Hauptrohstoffkomponenten wie SES, Mais, Raps etc. sind auch die in der Futtermittelproduktion<br />
verwendeten Hilfs- <strong>und</strong> Zusatzstoffe zu berücksichtigen.<br />
Seite 107 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 6: Monitoring<br />
� Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit tierischer Produktion, die „GVO-freie“ oder „gentechnikfreie“<br />
Produkte hervorbringen, ist eine ausschließliche Verwendung von „GVO-freien“ oder „gentechnikfreien“<br />
Futtermitteln wünschenswert. Mindestens ist dies innerhalb einer Tiergattung zu fordern. Werden<br />
konventionelle Futtermittel dennoch eingesetzt (zweites Betriebsstandbein z.B. Schweine- <strong>und</strong> Geflügelmast)<br />
muss der betreffende Landwirt sämtliche Futtermittel klar kennzeichnen <strong>und</strong> separat lagern. Bei<br />
selbstmischenden Landwirrten ist, wie bei Futtermittelwerken, auf getrennte <strong>und</strong> geschlossene<br />
Produktionsprozesse zu bestehen.<br />
� Auch beim Transport der Erzeugnisse aus tierischer Produktion eines Qualitätsprogramms vom Landwirt<br />
zum Verarbeiter oder direkt zum Handel müssen Verwechslungen der Tiere oder der Waren<br />
ausgeschlossen werden können. Im Rinderbereich ist dies über die Verordnung (EG) Nr. 1760/00 <strong>zur</strong><br />
Kennzeichnung von Rindern <strong>und</strong> Rindfleisch sichergestellt, weil die Kennzeichnung der Tiere mit Ohrmarken,<br />
die mit oder ohne gentechnisch verändertem Futter gefüttert werden, leicht nachvollziehbar ist, wenn dies<br />
auf den Begleitdokumenten festgehalten wird. Anders sieht die Situation bei Milch aus, da diese nicht<br />
separat gekennzeichnet werden kann. Auch bei den Eiern wird in weiterer Folge auf das Monitoring genauer<br />
eingegangen werden müssen.<br />
� Ebenfalls wird es bei der Verarbeitung gewisse Mechanismen brauchen, um sicherzustellen, dass es zu<br />
keiner Vermischung von „GVO-freien“ oder „gentechnikfreien“ - <strong>und</strong> konventionellen Produkten kommt. Mit<br />
zu berücksichtigen ist hier auch das Einmischen von Lebensmittelzusatzstoffen.<br />
� Beim Transport zum Handel, in verpacktem <strong>und</strong> klar gekennzeichnetem Zustand, kann es zu keinen<br />
weiteren Verunreinigungen oder Verwechslungen kommen.<br />
� Beim eventuellen nochmaligen Verpacken/Umpacken (Fleischtheke) des jeweiligen Produktes im<br />
Lebensmitteleinzelhandel ist sicherzustellen, dass sich auch das richtige Produkt wieder in der richtigen<br />
Verpackung befindet.<br />
Anhand der nächsten Abbildung sollten mögliche Wege der Sojabohnen von Sojabohnen-Produzenten bis zum<br />
tierhaltenden Landwirt aufgezeigt werden.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 108 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 6: Monitoring<br />
Sojabohnen Anbau: USA, Brasilien, Argentinien<br />
Händler global: wenige große multinationale Konzerne<br />
a) Sojabohnen b) SES<br />
Sojabohnen werden überwiegend in den<br />
Ölmühlen der globalen Händler gepresst.<br />
Nebenprodukt: SES<br />
Große Futtermittelhersteller<br />
Händler<br />
Tierhaltende Landwirt<br />
Händler<br />
Kleine<br />
Futtermittelwerke<br />
Abbildung 6-2: Sojabohnen-Wege vom Sojabohnen-Produzenten bis zum tierhaltenden Landwirt<br />
Quelle: foodwatch Futtermittel-Report, 2005, 36<br />
Wichtige Literaturstellen/ Informationsstellen im Zusammenhang mit dem „GVO-frei“ Monitoring:<br />
� Sicherung der gentechnischen Bioproduktion von NOWACK et al. 2002<br />
� Analyse der GVO-Verunreinigung von NOWACK et al. 2003<br />
� Warenflusstrennung von GVO in Lebensmitteln von WENK et al. 2001<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Sog. integrierte<br />
Händler<br />
kontrollieren den<br />
gesamten<br />
Produktionsablauf.<br />
Vom Rohstoff bis<br />
zum fertigen<br />
Produkt.<br />
� Produktion mit <strong>und</strong> ohne Gentechnik: Standards für die Koexistenz <strong>und</strong> Warenflusstrennung von NOWACK<br />
HEIMGARTNER 2005<br />
� Produktion mit <strong>und</strong> ohne Gentechnik – ist ein Nebeneinander möglich? – Rahmenbedingungen <strong>und</strong><br />
Umsetzung der Koexistenz <strong>und</strong> Warenflusstrennung von NOVACK 2004<br />
� Positivliste für Futtermittel als Beitrag <strong>zur</strong> Futtermittelsicherheit – Erwartungen, Konzepte, Lösungen von<br />
PETERSEN <strong>und</strong> FLACHOWSKY 2004<br />
� Der kritische Agrarbericht vom AgrarBündnis e.V. 2005<br />
� Praxishandbuch „Bio-Produkte ohne Gentechnik“ für Erzeuger <strong>und</strong> Händler vom B<strong>und</strong> Ökologische<br />
Lebensmittelwirtschaft, Stand Mai 2005<br />
� Biolandbau <strong>und</strong> Gentechnik – So bleibt der Biolandbau gentechnikfrei von NOVACK HEIMGARTNER, et al. 2003<br />
� Analyse von GVO-Verunreinigungen in Bioprodukten – Belastungsgrad <strong>und</strong> Vermeidungsmöglichkeiten in<br />
Saatgut, Lebensmitteln <strong>und</strong> Futtermitteln von NOWACK HEIMGARTNER <strong>und</strong> OEHEN 2003<br />
� Rechtliche Aspekte der Sicherheit, Qualität <strong>und</strong> Kontrolle von Futtermitteln von SCHLAKE 2004<br />
� Umsetzung der Codex-Richtlinie <strong>zur</strong> Definition der Gentechnikfreiheit im Futtermittelbereich - basierend auf<br />
festgelegten Grenzwerten im Biobereich von MODER et al. 2004<br />
� Einen Informationsdienst für die gentechnikfreie Produktion bietet die Webseite: www.infoXgen.com. Diese<br />
Datenbank wurde von der Arbeitsgemeinschaft Lebensmittel ohne Gentechnik aufgebaut <strong>und</strong> wird derzeit<br />
Seite 109 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 6: Monitoring<br />
von drei Kontrollstellen betrieben (Austria Bio Garantie, bio.inspecta <strong>und</strong> AliconBioCert GmbH). Sie<br />
unterstützt Erzeuger <strong>und</strong> Hersteller von Lebens- <strong>und</strong> Futtermitteln, die ohne Gentechnik arbeiten möchten<br />
<strong>und</strong> die dazu erlaubten Vorprodukte suchen.<br />
6.3. Monitoring auf den einzelnen Stufen des Produktionsprozesses<br />
Die nachfolgenden Kapitel stellen einen detaillierten Vorschlag zum Ablauf bzw. <strong>zur</strong> Durchführung des Monitorings<br />
entlang eines „GVO-freien“ oder „gentechnikfreien“ Produktionsprozesses dar. Dabei wird auf die Lagerung, die<br />
Verarbeitung im Futtermittelwerk, die landwirtschaftlichen Selbstmischer von Futtermitteln, Eierproduktion,<br />
Geflügelmast, Milchproduktion, Rindermast <strong>und</strong> Schweinemast eingegangen. Auf die Sojaschrotaufbereitung wird<br />
nicht eingegangen, da gleiche Regeln gelten wie bei einem Futtermittelwerk: eine gleichzeitige Verarbeitung von<br />
„GVO-freien“ oder „gentechnikfreien“ <strong>und</strong> konventionellen Produkten ist nur in getrennten <strong>und</strong> geschlossenen<br />
Produktionsprozessen mit hoher Gewährleistung möglich. Auf die weiterverarbeitenden Bereiche in den Molkereien,<br />
Packstellen <strong>und</strong> Schlachtbetrieben wird weniger detailliert eingegangen, da dies der Projektauftrag nicht beinhaltete.<br />
Dennoch sei hier die Bemerkung erlaubt, dass auch in diesen Bereichen auf eine penible Trennung der<br />
Verarbeitungs- <strong>und</strong> Lagerprozesse zu achten ist.<br />
Die Ablaufdiagramme stellen die wesentlichen Tätigkeiten bei der „GVO-freien“ oder „gentechnikfreien“ Produktion<br />
dar, wobei folgende Symbole verwendet wurden.<br />
Tabelle 6-2: Beschreibung Ablaufdiagramme<br />
Grenzstelle<br />
Prozessstufe<br />
Entscheidung<br />
Flusslinie<br />
Seitenwechsel<br />
Ja<br />
Nein<br />
Die Grenzstelle kann eine oder mehrere Anfangs- oder<br />
Endschrittstellen in einem Prozess sein.<br />
Eine Prozessstufe kann eine beliebige Stufe des Herstellungs-<br />
<strong>und</strong> Erzeugungsprozesses sein. Eine Prozessstufe kann eine<br />
Tätigkeit oder ein Verfahrensschritt sein.<br />
Eine Entscheidung führt <strong>zur</strong> Aufteilung des Prozesses in ein<br />
„Ja“ oder „Nein“.<br />
Die Flusslinie bezeichnet den Weg oder die Richtung im<br />
Prozess.<br />
Ist ein Prozess so umfangreich, dass <strong>zur</strong> Darstellung mehrere<br />
Seiten benötigt sind, so wird jede Seitenumbruchstelle mit<br />
dem Symbol Seitenwechsel gekennzeichnet, die eine<br />
fortlaufende Nummer beinhaltet.<br />
Zusätzlich wird versucht, die wesentlichen Kriterien, die bei einem externen Monitoring anzuwenden sind,<br />
herauszuarbeiten. Diese befinden sich in den Darstellungen immer am rechten Rand des Ablaufdiagramms. Die<br />
Textfelder am linken Rand beschreiben den Geltungsbereich für die jeweiligen Tätigkeiten näher. Zusätzlich sind hier<br />
Vorschläge <strong>zur</strong> Eigenkontrolle angeführt.<br />
Für alle Glieder der Wertschöpfungskette bzw. des Produktionsprozesses gilt für GV-Produkte, auf Gr<strong>und</strong> der<br />
Verordnung (EG) Nr. 1830/2003, die lückenlose Dokumentation sämtlicher Warenflüsse.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 110 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 6: Monitoring<br />
In der nachfolgenden Abbildung sollen mögliche Verschleppungen, Verunreinigungspunkte in der<br />
Wertschöpfungskette aufgezeigt werden.<br />
Verwilderte GVO´s<br />
Saatgut<br />
Dünger<br />
Pollendrift<br />
Landw. Erzeugung<br />
der<br />
Rohstoffe<br />
nicht erlaubte Futtermittel,<br />
Hilfsstoffe<br />
Erntemaschinen<br />
Hilfsstoffe<br />
Pflanzenschutz<br />
Umstellzeiten bei<br />
Zukauf von Tieren<br />
nicht eingehalten<br />
£££<br />
Landwirt<br />
tierische<br />
Produktion<br />
Verunreinigungen<br />
Transport<br />
<strong>und</strong><br />
Lager<br />
Verunreinigungen<br />
Transport<br />
<strong>und</strong><br />
Lager<br />
nicht erlaubte<br />
Hilfsstoffe<br />
nicht erlaubte<br />
Hilfsstoffe<br />
Mühle<br />
SES<br />
Verschleppungen<br />
Verarbeitung<br />
tierische<br />
Produkte =<br />
Lebensmittel<br />
Verpackungsmaterial<br />
Transport<br />
<strong>und</strong><br />
Lager<br />
Transport<br />
<strong>und</strong><br />
Lager<br />
nicht erlaubte<br />
Hilfsstoffe<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Verpackungsmaterial<br />
FM Werk<br />
<strong>und</strong>/oder<br />
Handel<br />
Abbildung 6-3: Kritische Verschleppungs- <strong>und</strong> Verunreinigungspunkte in der Supply Chain<br />
Verunreinigungen<br />
Verunreinigungen<br />
Verschleppungen<br />
Verpackungsmaterial<br />
Handel /<br />
Verteiler<br />
Verunreinigungen<br />
Transport<br />
<strong>und</strong><br />
Lager<br />
Damit die obere Abbildung überschaubar bleibt, wurde auf Verunreinigungen, die durch Verladeeinrichtungen<br />
verursacht werden, keine Rücksicht genommen. Das heißt: nicht berücksichtigt wurden Verschleppungen in<br />
Konsument<br />
Elevatoren, Schnecken, Redlern <strong>und</strong> anderen Verladegeräten. Ebenso nicht dargestellt wurden Verschleppungen, die<br />
durch Produktverwechslungen zustande kommen können.<br />
In den nachfolgenden Flussdiagrammen zum „GVO-freien“ oder „gentechnikfreien“ Monitoring wird ausschließlich der<br />
Umgang mit den verschleppungskritischen Produkten Mais, Sojabohne, SES <strong>und</strong> Raps berücksichtigt.<br />
Verschleppungen durch anderes Pflanzenmaterial wie z.B. Kartoffeleiweiß, Getreide etc. ist nicht in die Betrachtungen<br />
eingeflossen. Der Begriff „Begleitpapiere mit Statuskennzeichnung“ ist sehr weit gefasst <strong>und</strong> beinhaltet alle<br />
relevanten Informationen, die für eine „GVO-freie“ oder „gentechnikfreie“ spezifische Produktkennzeichnung<br />
Seite 111 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 6: Monitoring<br />
notwendig sind (z.B. für Lebensmittelzusatzstoffe, Futtermittelzusatzstoffe, Düngermittel, Pflanzenschutzmittel,<br />
Viehverkehrsscheine etc.).<br />
6.3.1. Monitoring in der landwirtschaftlichen Produktion von Rohstoffen<br />
Ein risikobasiertes Überwachungs- <strong>und</strong> Monitoring- sowie Eigenkontrollsystem in der landwirtschaftlichen Erzeugung<br />
wird u.a. durch die rechtlichen Bestimmungen <strong>zur</strong> Koexistenz, die botanische Art, die Agrarstruktur, die Verfügbarkeit<br />
von GVO-freiem Saatgut, der Kulturartenanteil <strong>und</strong> der GVO-Anteil an der bezughabenden Kulturart, die Interaktion<br />
Umweltbedingungen zu Kulturpflanze (Persistenz <strong>und</strong> Durchwuchs, Gentransfer zu Wild- <strong>und</strong> Ruderalpflanzen) etc.<br />
bestimmt (siehe dazu <strong>AGES</strong>-Studie „Die Produktion von Saatgut in abgegrenzten Erzeugungsprozessen <strong>zur</strong><br />
Vermeidung einer Verunreinigung mit gentechnisch veränderten Organismen im Kontext mit der Koexistenz von<br />
konventioneller Landwirtschaft mit oder ohne GVO <strong>und</strong> ökologischer Landwirtschaft“, GIRSCH et al., 2004).<br />
Wenngleich seitens der EU-Kommission bereits 2003 Empfehlungen für eine harmonisierte Umsetzung von<br />
Koexistenz für ein Nebeneinander von GVO-Kulturen, konventionellen „GVO-freien“ Kulturen <strong>und</strong> der<br />
Biolandwirtschaft publiziert wurden, bleibt es den Mitgliedstaaten vorbehalten, entsprechende konkrete Maßnahmen<br />
zu setzen.<br />
Konkrete <strong>und</strong> rechtlich verbindliche Koexistenzbestimmungen in Drittländern sind im Hinblick auf die Einhaltung eines<br />
definierten Schwellenwerteregimes in den bedeutenden GVO-anbauenden Ländern nicht oder nur unter bestimmten<br />
Bedingungen vorliegend. Zumeist sind in diesen Ländern die Beziehungen der GVO- <strong>und</strong> Nicht-GVO-Landwirtschaft<br />
durch das Privatrecht bestimmt. Privatrechtliche Zertifizierungssysteme regeln die Mindestanforderungen an die<br />
landwirtschaftliche Produktion für "GVO-freie" Produkte.<br />
In Österreich selbst liegen umfassende Regelungen v.a. durch Landesgesetze <strong>und</strong> b<strong>und</strong>eseinheitliche Richtlinien<br />
(noch in Bearbeitung) <strong>zur</strong> Koexistenz vor, sodaß der Gentransfer von GVO-Pflanzenbeständen zu Nicht-GVO-<br />
Pflanzenbeständen auf technisch unvermeidbar <strong>und</strong> zufällig minimiert wird.<br />
In Abhängigkeit der Koexistenzmaßnahmen in der landwirtschaftlichen Erzeugung in bestimmten Ländern <strong>und</strong><br />
Regionen ist ein dem Risiko, insbesondere einer systematischen GVO-Verunreingung, angepaßtes Monitoring- <strong>und</strong><br />
Eigenkontrollsystem bei der Erntegutübernahme ein<strong>zur</strong>ichten, sodaß eine "Segregation" von Erntegut mit<br />
verschiedenem GVO-Status erfolgt. In der Regel beziehen private Zertifizierungssysteme bereits die<br />
landwirtschaftliche Erzeugung beginnend von der Auswahl von Saatgut <strong>und</strong> Feldern in ihr Qualitätssystem mit ein.<br />
Dies, um entsprechende Gewähr der Erfüllung der vorgegebenen qualitativen <strong>und</strong> quantitativen Kriterien <strong>und</strong><br />
Vorgaben sicherzustellen.<br />
Es kann aktuell <strong>und</strong> mittelfristig mit gesicherter Gewähr davon ausgegangen werden, dass von der österreichischen<br />
Landwirtschaft erzeugtes Erntegut "GVO-frei" oder <strong>„gentechnikfrei“</strong> ist. Die Besätigung der „Gentechnikfreiheit“ für<br />
Rohstoffe außerhalb Österreichs erzeugt bedarf einer besonderen Prüfung <strong>und</strong> Betrachtung.<br />
6.3.2. Monitoring bei der Sammelstelle, Transport <strong>und</strong> Zwischenlagerstelle<br />
Nach der Ernte werden „GVO-freie“ oder „gentechnikfreie“ Produkte in zertifizierten Sammelstellen gelagert. Um<br />
Verschleppungen zu vermeiden, ist die Lagerung von GVO- <strong>und</strong> „GVO-freien“ oder „gentechnikfreien“ Produkten in<br />
vollständig getrennten Sammelstellen wünschenswert. Ist dies in der Praxis nicht durchführbar, ist auf die<br />
Verwendung von Spülchargen in den sich überschneidenden Produktwegen zu bestehen. Als Spülcharge kann nur ein<br />
vollkommen unkritisches Produkt verwendet werden, wie z.B. Weizen, oder eine individuell zu bestimmende Menge<br />
des angelieferten „GVO-freien“ oder „gentechnikfreien“ Produktes, welches anschließend „konventionell“ bzw. „GVO-<br />
gekennzeichnet“ vermarktet wird. Im Falle nicht getrennter <strong>und</strong> geschlossener Produktionsprozesse kommt einem<br />
risikobasierten, in der Regel maßgeblich verstärkten Proben- <strong>und</strong> Untersuchungsplan entscheidende Bedeutung zu,<br />
um ein gleiches Niveau der Gewährleistung von „GVO-frei“ oder <strong>„gentechnikfrei“</strong> in getrennten <strong>und</strong> geschlossenen<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 112 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 6: Monitoring<br />
Produktionsprozessen sicherzustellen. Bei Überseetransporten per Schiff - von der Sammelstelle nach Europa - ist<br />
eine dokumentierte Reinigung wünschenswert. Sofern die Produkte nicht in geschlossenen Behältnissen transportiert<br />
werden, sollten keine gemischten Transporte durchgeführt werden.<br />
Bei der Einlagerung am Hafen in das Zwischenlager oder direkt aus dem Zwischenlager ist eine standardisierte<br />
Beprobung <strong>und</strong> Untersuchung erforderlich. Diese Probe muss als Voraussetzung für ein in Europa zum Verkauf<br />
vorgesehenes Produkt angesehen werden. Die Anzahl der Probenziehungen muss in Abhängigkeit vom<br />
Verunreinigungsrisiko <strong>und</strong> von der jeweiligen Transportmenge festgelegt werden. Nur wenn die Analyse nach dem<br />
standardisierten Probenplan die „GVO-Freiheit“ bestätigt, sollte das Produkt als „GVO-frei“ oder <strong>„gentechnikfrei“</strong><br />
vermarktet werden können. Die „GVO-Freiheit“ lässt sich hier am effizientesten überwachen, da die Zwischenlager<br />
am Hafen den Flaschenhals in der „GVO-freien“ oder „gentechnikfreien“ Wertschöpfungskette darstellen, durch den<br />
sämtliche Überseeprodukte fließen.<br />
Bei GVO Risikostoffen aus europäischer Produktionsländern, die den Einsatz von gentechnisch verändertem Saatgut<br />
zulassen, ist ebenfalls eine standardisiete Beprobung <strong>und</strong> Untersuchung eforderlich, bevor diese in den getrennten<br />
<strong>und</strong> geschlossenen „GVO-freien“ oder „gentechnikfreien“ Produktionsprozess in Österreich gelangen.<br />
Sowohl in den Zwischenlagern am Hafen, sowie allen weiteren Zwischenlagern in Europa, ist auf getrennte <strong>und</strong><br />
geschlossene Prozesse zu achen.<br />
Ladegeräte <strong>und</strong> Verladeeinrichtungen wie Redler, Schnecken <strong>und</strong> Elevatoren sind vor Verschleppungen zu schützen.<br />
Werden Abdeckplanen in Anspruch genommen, sind auch diese nach den gleichen Kriterien zu behandeln. Vor jeder<br />
Umlagerung/Verladung müssen die Lagerräume leer, sauber, trocken <strong>und</strong> frei von Resten vorhergehender Ladungen<br />
sein (vgl. KERSTEN et al., 2003, 38). Das Ziel muss sein, dass eine Vermengung <strong>und</strong> Verunreinigung bei der Verladung<br />
verhindert wird.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 113 von 272
Geltungsbereich<br />
Sammelstelle nach der Ernte: Aufzeichnung <strong>und</strong> Kontrolle der Rohstoff Ein- <strong>und</strong> Ausgänge<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 6: Monitoring<br />
Eigenkontrolle <strong>und</strong> externes<br />
Monitoring bei Überseeprodukten bei der<br />
Sammelstelle, Transport <strong>und</strong><br />
Zwischenlagerstelle<br />
Annahme<br />
Sammelstelle<br />
Prüfung ob<br />
anerkannter NON<br />
GVO Landwirt<br />
Kontrolle<br />
Reinigungsbestätigung<br />
LKW ev. Begleitpapiere<br />
mit Statuskennzeichnung<br />
Probenziehung<br />
ausschließliche<br />
Förderwege NON<br />
GVO?<br />
Ja<br />
Kontrolle Zielzelle<br />
auf konventionelle<br />
Verunreinigung<br />
Einlagerung bei gleichzeitiger<br />
Dokumentation von Lieferant,<br />
Menge <strong>und</strong> Zielzelle<br />
Auslagerung Sammelstelle, bei<br />
gleichzeitiger Dokumentation von<br />
Abnehmer, Menge <strong>und</strong> Quellzelle<br />
ausschließliche<br />
Förderwege NON<br />
GVO?<br />
Ja<br />
Kontrolle Zielzelle Schiff<br />
auf konventionelle<br />
Verunreinigung<br />
1<br />
Nein<br />
Nein<br />
Spülcharge<br />
Spülcharge<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Fremdkontrolle<br />
Vorschlag zum Monitoring bei<br />
Sammelstelle:<br />
� Reinigungsbestätigung<br />
Transport LKW<br />
� Siloprotokoll,<br />
� Mengenkontrolle Einkauf/<br />
Verkauf,<br />
� Musterziehung,<br />
� Prüfung auf Rückverfolgbarkeit<br />
Lieferant <strong>und</strong> Abnehmer,<br />
� Prüfung auf<br />
Verschleppungsgefahr<br />
Seite 114 von 272
Geltungsbereich<br />
Zwischenlager: Aufzeichnung <strong>und</strong> Kontrolle der Rohstoff Ein- <strong>und</strong> Ausgänge<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 6: Monitoring<br />
1<br />
Probenziehung auf<br />
Schiff oder bei der<br />
Verladung<br />
ausschließliche<br />
Förderwege NON<br />
GVO?<br />
Ja<br />
Kontrolle Zielzelle<br />
auf konventionelle<br />
Verunreinigung<br />
Einlagerung <strong>und</strong><br />
Probenziehung,<br />
Dokumentation von Lieferant,<br />
Menge <strong>und</strong> Zielzelle<br />
Probenanalyse<br />
OK?<br />
Ja<br />
für den Vekrauf<br />
NON GVO in<br />
Europa<br />
freigegeben<br />
Auslagerung Zwischenlager, bei<br />
gleichzeitiger Dokumentation von<br />
Abnehmer <strong>und</strong> Menge<br />
Kontrolle LKW auf<br />
konventionelle<br />
Verunreinigung<br />
Verladung LKW<br />
Spülcharge<br />
als konventionelle Ware<br />
in Europa abgesetzt<br />
Abbildung 6-4: Flussdiagramm Sammelstelle, Transport <strong>und</strong> Zwischenlagerstelle<br />
Nein<br />
Nein<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Fremdkontrolle<br />
Vorschlag zum Monitoring bei<br />
Zwischenlager:<br />
� Reinigungsbestätigung<br />
� Transport Schiff oder LKW,<br />
� Siloprotokoll,<br />
� Mengenkontrolle Einkauf/<br />
Verkauf,<br />
� Musterziehung, Probenanalyse<br />
� Prüfung auf Rückverfolgbarkeit<br />
Lieferant <strong>und</strong> Abnehmer,<br />
� Kontrolle der Eigenkontrolle,<br />
� Prüfung auf<br />
Verschleppungsgefahr<br />
Flaschenhals<br />
Hafen<br />
Seite 115 von 272
6.3.3. Monitoring beim Futtermittelwerk<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 6: Monitoring<br />
Wie bereits am Beginn dieses Kapitels ausführlich erklärt wurde, ist eine kombinierte, verschleppungsfreie<br />
Futtermittelproduktion nicht möglich. Von 100%-igen „GVO-freien" oder „gentechnikfreien“ Futtermittelwerken bzw.<br />
getrennten, geschlossenen Produktionsketten ausgehend ist die „GVO-freie“ oder „gentechnikfreie“<br />
Futtermittelproduktion technisch relativ einfach zu realisieren, wenn die Begleitdokumente der eingehenden Ware<br />
(Reinigungsbestätigung, „GVO-freie“ oder „gentechnikfreie“ Bestätigung etc.) entsprechend überprüft werden. Ein<br />
Monitoring der Zuverlässigkeit der Lieferanten ist allerdings in allen Fällen erforderlich. Die erlaubte Menge an Soft IP<br />
Soja Einmischung (<strong>zur</strong> Zeit maximal 20%) muss im Falle der Anwendung der österreichischen Codex-Richtlinie <strong>zur</strong><br />
<strong>Auslobung</strong> „Gentechnikfrei“ für das jeweilige Futtermittel eingehalten werden.<br />
Geltungsbereich<br />
<strong>und</strong><br />
Eigenkontrolle<br />
Futtermittelwerk: Eigenprüfung der Rohwaren <strong>und</strong> Fertigfuttermittel anhand eines Analysenplanes<br />
Eigenkontrolle <strong>und</strong> externes Monitoring beim<br />
Futtermittelwerk<br />
Anlieferung lose (Händler,<br />
Landwirt oder<br />
Verarbeitungsindustrie)<br />
Dokumentenprüfung<br />
(Reinigungsbestätigung,<br />
Begleitpapiere mit<br />
Statuskennzeichnung bei<br />
Mais, Sojaprodukten <strong>und</strong><br />
Rapsprodukten<br />
Probenziehung<br />
Einlagerung<br />
Futtermittelproduktion<br />
Prüfung Produktionsprotokoll<br />
auf kritische<br />
Einmischungsgrenze<br />
Verladung <strong>und</strong><br />
Musterziehung<br />
Abbildung 6-5: Flussdiagramm Futtermittelwerk<br />
Anlieferung<br />
Sackware<br />
Dokumentenprüfung<br />
erlaubter<br />
Lieferanten <strong>und</strong><br />
Produkte<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
externes<br />
Monitoring<br />
Vorschlag zum Monitoring beim<br />
Futtermittelwerk:<br />
� Reinigungsbestätigung bei loser<br />
Lieferung,<br />
� Mengenprüfung Anlieferung/<br />
Verkauf,<br />
� Prüfung der Zertifikante bei<br />
Mais-, Soja <strong>und</strong><br />
Rapsanlieferung,<br />
� Prüfung Sackanlieferung,<br />
� Aufzeichung über Lieferanten<br />
<strong>und</strong> Abnehmer,<br />
� Prüfung der<br />
Einmischungsgrenzen bei<br />
kritischen Rohstoffen,<br />
� Prüfung der Eigenkontrolle,<br />
� Produktionsprotokoll mit<br />
Kontaminationsmatrix,<br />
� eventuell Musterziehung,<br />
� Prüfung auf<br />
Verschleppungsgefahr<br />
Seite 116 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 6: Monitoring<br />
Anmerkung <strong>zur</strong> Abbildung: Bei der Prüfung der angelieferten Sackware auf Basis der infoXgen Datenbank<br />
(www.infoXgen.com ) ist zu bedenken, dass diese nicht alle Produkte enthält, die für die „GVO-freie“ Produktion von<br />
Bedeutung sein könnten. Futtermittel, die keine GVO oder GVO-Derivate sind (bei deren Herstellung aber<br />
Betriebsmittel verwendet wurden, die nicht der Codex-Richtlinie entsprechen), dürfen verfüttert werden, wenn sie<br />
nachweislich in „gentechnikfreier“ Qualität nicht ausreichend verfügbar sind. So finden sich zum Beispiel manche<br />
Aminosäuren, ohne die eine leistungsorientierte Fütterung am landwirtschaftlichen Betrieb nicht/ nur sehr schwer<br />
möglich wäre, nicht in der Datenbank der infoXgen. Auch bei manchen Vitaminen <strong>und</strong> Aromastoffen ist auf eine<br />
ähnliche Problematik hinzuweisen.<br />
Es wird hiermit darauf hingewiesen, dass die Datenbank infoXgen von einer Eigenkontrolle nicht<br />
entbindet <strong>und</strong> somit nur informellen Charakter hat.<br />
6.3.4. Monitoring beim Selbstmischer mit <strong>und</strong> ohne eigener Futterroh- <strong>und</strong> Zusatzstoffe<br />
Da in Österreich r<strong>und</strong> ¾ aller Kraftfutter von den Landwirten selbst gemischt werden, ist dieser Bereich beim „GVO-<br />
frei“ oder <strong>„gentechnikfrei“</strong> Monitoring besonders zu beachten. Prinzipiell bestehen zwei technische Optionen der<br />
Selbstmischung:<br />
Vor allem größere Betriebe verfügen über ausreichende technische Möglichkeiten, die Futtermischungen selbst<br />
durchzuführen. Kleinere Betriebe hingegen nehmen oft die Dienstleistung von selbstfahrenden Misch-LKW´s in<br />
Anspruch. Um Verschleppungen ausschließen zu können, ist bei den Misch-LKWs, analog <strong>zur</strong> Produktion in<br />
Mischfutterwerken, auf eine alleinige Produktion von „GVO-freien“ oder „gentechnikfreien“ Mischungen zu bestehen.<br />
Es wird davon ausgegangen, dass die selbstfahrenden Misch-LKW´s keine Roh- <strong>und</strong> Zusatzstoffe für den einzelnen<br />
Landwirt <strong>zur</strong> Verfügung stellen, sondern ausschließlich die Dienstleistung.<br />
Generell ist zu bemerken, dass auch bei landwirtschaftlichen Betrieben, die „GVO-freie“ oder „gentechnikfreie“<br />
Produkte hervorbringen, eine ausschließliche Verwendung von „GVO-freien“ oder „gentechnikfreien“ Futtermitteln<br />
wünschenswert ist. Mindestens ist dies innerhalb einer Tiergattung zu fordern (z.B. das gesamte Rinderfutter muss<br />
„GVO-frei“ oder <strong>„gentechnikfrei“</strong> sein, auch wenn nur die Milch „GVO-frei“ oder <strong>„gentechnikfrei“</strong> vermarktet wird).<br />
Werden konventionelle GVO-hältige Futtermittel dennoch eingesetzt (zweites Betriebsstandbein z.B. Schweine oder<br />
Geflügelmast), muss der betreffende Landwirt sämtliche Futtermittel klar kennzeichnen <strong>und</strong> separat lagern. Ein<br />
separates geschlossenes System in der Mischanlage, welche ausschließlich nur für die „GVO-freie“ oder<br />
„gentechnikfreie“ Futtermittelproduktion verwendet wird, gilt es jedenfalls sicherzustellen.<br />
Rohstoffe aus eigener Produktion bedürfen zumindest eines stichprobenartigen Nachweises der „GVO-Freiheit“ oder<br />
„Gentechnikfreiheit“ des Rohstoffes. Gleiches gilt beim Ankauf von Mais von anderen Landwirten. Generell ist bei<br />
loser Anlieferung von Mais, SES <strong>und</strong> Rapsprodukten eine Rückstellprobe zu ziehen. Die erlaubte Menge an Soft IP<br />
Soja Einmischung wird für das jeweilige Futtermittel im Falle der Implementierung der Codex-Richtlinie eingehalten.<br />
Im Falle der Umsetzung der österreichischen Codex-Richtlinie <strong>„gentechnikfrei“</strong> ist der Einsatz zulässiger Dünge- <strong>und</strong><br />
Pflanzenschutzmittel nachzuweisen.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 117 von 272
Geltungsbereich<br />
<strong>und</strong><br />
Eigenkontrolle<br />
Landwirt: Dokumentation <strong>und</strong> Aufzeichnung der Wareneingänge <strong>und</strong> Ausgänge<br />
Anlieferung lose (Händler,<br />
Landwirt oder<br />
Verarbeitungsindustrie)<br />
Dokumentenprüfung<br />
(Reinigungsbestätigung,<br />
Begleitpapiere mit<br />
Statuskennzeichnung bei<br />
Mais, Sojaprodukten <strong>und</strong><br />
Rapsprodukten<br />
Probenziehung<br />
Futtermittelproduktion<br />
am Hof<br />
Einlagerung<br />
Futtermittel<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 6: Monitoring<br />
Eigenkontrolle <strong>und</strong> externes Monitoring beim<br />
Selbstmischer<br />
Einlagerung<br />
eigener<br />
Mischer am<br />
Hof<br />
Ja<br />
Prüfung Produktionsprotokoll<br />
auf kritische<br />
Einmischungsgrenzen<br />
Anlieferung<br />
Sackware<br />
Dokumentenprüfung<br />
erlaubter<br />
Lieferanten <strong>und</strong><br />
Produkte<br />
Abbildung 6-6: Flussdiagramm Selbstmischer<br />
Nein<br />
Selbstfahrender Mischer:<br />
Mischprotokoll<br />
6.3.5. Monitoring beim Landwirt mit Eierproduktion<br />
Rohstoff aus<br />
eigener<br />
Produktion<br />
Selbstfahrender<br />
Mischer<br />
Prüfung des<br />
Landwirtes auf<br />
GVO-frei Zertifikat<br />
durch den Mischer<br />
Futtermittelproduktion<br />
mit<br />
selbstfahrendem<br />
Mischer<br />
Prüfung Produktionsprotokoll<br />
auf kritische<br />
Einmischungsgrenzung<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
externes<br />
Monitoring<br />
Vorschlag zum Monitoring beim<br />
Selbstmischer - Landwirt:<br />
� Reinigungsbestätigung bei loser<br />
Lieferung,<br />
� Mengenprüfung Anlieferung,<br />
Verkauf <strong>und</strong> Verbrauch,<br />
� Prüfung der Saatgut-Sackanhänger,<br />
Düngermittel <strong>und</strong><br />
Spritzmittelanwendungen bei<br />
Zukauf <strong>und</strong> Eigenanbau von Mais,<br />
� Prüfung der Zertifikate bei Mais-,<br />
Soja- <strong>und</strong> Rapsanlieferung,<br />
� Prüfung Sackanlieferung,<br />
� Aufzeichung über Lieferanten <strong>und</strong><br />
Abnehmer,<br />
� Prüfung Silierhilfsmittel,<br />
� eventuell Musterziehung,<br />
� Prüfung der Einmischungsgrenzen<br />
bei kritischen Rohstoffen,<br />
� Prüfung auf Verschleppungsgefahr<br />
Vorschlag zum Monitoring beim<br />
Selbstfahrenden Mischer:<br />
� eventuell Musterziehung<br />
� Produktionsprotokoll mit<br />
Kontaminationsmatrix,<br />
� Prüfung der<br />
Einmischungsgrenzen bei<br />
kritischen Rohstoffen,<br />
� Prüfung auf<br />
Verschleppungsgefahr<br />
Bei der Eierproduktion ist, laut österreichischem Codex, beim Zukauf von konventionell gefütterten Legehennen eine<br />
6 wöchige Übergangsfrist einzuhalten. Innerhalb dieser Frist müssen die Eier der betreffenden Hennen klar<br />
gekennzeichnet, separat gelagert <strong>und</strong> als „konventionelle“ Eier vermarktet werden.<br />
Seite 118 von 272
Geltungsbereich<br />
<strong>und</strong><br />
Eigenkontrolle<br />
Landwirt: Aufzeichnung <strong>und</strong> Prüfung der Futtermittel, Tieranlieferungen sowie Eier <strong>und</strong> Tierabgänge<br />
Packstelle: Verträge mit Landwirt,<br />
Prüfung der möglichen Eilieferungen<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 6: Monitoring<br />
Eigenkontrolle <strong>und</strong> externes Monitoring beim<br />
Landwirt mit Eierproduktion<br />
Selbstmischer<br />
Futtermittelanlieferung<br />
LKW<br />
Dokumentenprüfung<br />
(Reinigungsbestätigung bei<br />
Gemischttransporten, Begleitpapiere<br />
mit Statuskennzeichnung)<br />
<strong>und</strong> Übergabe der<br />
Rückstellmuster an den Landwirt<br />
Einlagerung<br />
Futtermittel<br />
Verfütterung an<br />
Tiere<br />
sofortige<br />
Eiervermarktung<br />
möglich<br />
Kennzeichnung<br />
der Eier am<br />
Betrieb<br />
Transport Packstelle<br />
Begleitpapiere mit<br />
Statuskennzeichnung<br />
Seperate/<br />
getrennte<br />
Abpackung <strong>und</strong><br />
Lagerung<br />
Zustellung Handel<br />
Abbildung 6-7: Flussdiagramm Eierproduktion<br />
* Übergangsfristen gemäß Codex beachten<br />
Ja<br />
Anlieferung Legehennen (mind. 6<br />
Wochen Übergangsfrist, wenn nicht aus<br />
GVO-freien Betrieb*) oder Kücken<br />
Nein<br />
Dokumentenprüfung<br />
Begleitpapiere mit<br />
Statuskennzeichnung<br />
Einstellung der<br />
Legehennen (ev.<br />
"Quarantäne<br />
notwendig") oder<br />
Kücken<br />
in Umstellungsphase<br />
(6 Wochen) muß<br />
getrennte Lagerung <strong>und</strong><br />
Vermarktung der Eier<br />
sichergestellt sein<br />
Kennzeichnung<br />
der Eier am<br />
Betrieb<br />
getrennter<br />
Eierverkauf<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
externes<br />
Monitoring<br />
Vorschlag zum Monitoring beim<br />
Landwirt:<br />
� Reinigungsbestätigung<br />
Transport LKW Futtermittel,<br />
� Begleitpapiere mit<br />
Statuskennzeichnung von<br />
Futtermittellieferant,<br />
� Begleitpapiere mit<br />
Statuskennzeichnung von<br />
Legehennenlieferant,<br />
� Mengenprüfung Einkauf/<br />
Verkauf,<br />
� eventuell Musterziehung,<br />
� Prüfung auf<br />
Rückverfolgbarkeit Lieferant<br />
<strong>und</strong> Abnehmer,<br />
� Prüfung auf<br />
Verschleppungsgefahr<br />
Vorschlag zum Monitoring bei<br />
Packstelle:<br />
� Begleitpapiere mit<br />
Statuskennzeichnung von<br />
Eierlieferant,<br />
� Mengenprüfung Einkauf/<br />
Verkauf,<br />
� Prüfung auf<br />
Rückverfolgbarkeit Lieferant<br />
<strong>und</strong> Abnehmer,<br />
� Prüfung auf<br />
Verwechslungsgefahr<br />
Seite 119 von 272
6.3.6. Monitoring beim Landwirt mit Geflügelmast<br />
Geltungsbereich<br />
<strong>und</strong><br />
Eigenkontrolle<br />
Landwirt: Aufzeichnung <strong>und</strong> Prüfung der Futtermittel, Tieranlieferungen sowie<br />
Eier <strong>und</strong> Tierabgänge<br />
Schlachthof: Verträge mit Landwirt,<br />
Prüfung der möglichen Geflügellieferungen<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 6: Monitoring<br />
Eigenkontrolle <strong>und</strong> externes Monitoring beim<br />
Landwirt mit Geflügelmast<br />
Selbstmischer<br />
Futtermittelanlieferung<br />
LKW<br />
Dokumentenprüfung<br />
(Reinigungsbestätigung bei<br />
Gemischttransporten,<br />
Begleitpapiere mit Statuskennzeichnung)<br />
<strong>und</strong> Übergabe der<br />
Rückstellmuster an den Landwirt<br />
Einlagerung<br />
Futtermittel<br />
Abbildung 6-8: Flussdiagramm Geflügelmast<br />
Verfütterung an<br />
Tiere<br />
Ausstellung von<br />
Begleitpapieren mit<br />
Statuskennzeichnung<br />
getrennter<br />
Geflügeltransport<br />
zum Schlachthof<br />
Seperate/getrennte Be<strong>und</strong><br />
Verarbeitung <strong>und</strong><br />
Lagerung<br />
Zustellung Handel<br />
6.3.7. Monitoring beim Landwirt mit Schweinemast<br />
Anlieferung Kücken<br />
Dokumentenprüfung<br />
Begleitpapiere mit<br />
Statuskennzeichnung<br />
Einstellung der<br />
Tiere<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
externes<br />
Monitoring<br />
Vorschlag zum Monitoring beim<br />
Landwirt:<br />
� Reinigungsbestätigung Transport<br />
LKW Futtermittel,<br />
� Begleitpapiere mit<br />
Statuskennzeichnung von<br />
Futtermittellieferant,<br />
� Begleitpapiere mit<br />
Statuskennzeichnung von<br />
Kückenlieferant,<br />
� Mengenprüfung Einkauf/Verkauf,<br />
� eventuell Musterziehung,<br />
� Prüfung auf Rückverfolgbarkeit<br />
Lieferant <strong>und</strong> Abnehmer,<br />
� Prüfung auf<br />
Verschleppungsgefahr<br />
Vorschlag zum Monitoring bei<br />
Schlachthof:<br />
� Begleitpapiere mit<br />
Statuskennzeichnung von<br />
Geflügelmastbetrieb,<br />
� Lagerbereichskennzeichnung,<br />
� Mengenprüfung Einkauf/Verkauf,<br />
� Prüfung auf Rückverfolgbarkeit<br />
Lieferant <strong>und</strong> Abnehmer,<br />
� Protokoll von der Schlachtung,<br />
Zerlegung <strong>und</strong> Verarbeitung,<br />
� Warenflussdokumentation,<br />
� Prüfung der Wareneingänge für<br />
die Weiterverarbeitung mit<br />
Begleitpapieren <strong>und</strong><br />
Statuskennzeichnung,<br />
� Prüfung auf<br />
Verwechslungsgefahr<br />
Werden bei der Schweinemast Silagefutter verwendet, ist darauf zu achten, dass die Silierzusätze aus „GVO-freier“<br />
oder „gentechnikfreier“ Produktion stammen. Es ist darauf zu achten, dass Ferkel laut österreichischem Codex nicht<br />
aus konventionellen Betrieben zugekauft werden dürfen.<br />
Seite 120 von 272
Geltungsbereich<br />
<strong>und</strong><br />
Eigenkontrolle<br />
Landwirt: Aufzeichnung <strong>und</strong> Prüfung der Futtermittel, Tieranlieferungen sowie Tierabgänge<br />
Schlachthof: Verträge mit Landwirt, Prüfung der<br />
möglichen Schweineanlieferungen<br />
Selbstmischer<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 6: Monitoring<br />
Eigenkontrolle <strong>und</strong> externes Monitoring beim<br />
Landwirt mit Schweinemast<br />
Futtermittelanlieferung<br />
lose<br />
<strong>und</strong> CCM<br />
Dokumentenprüfung<br />
(Reinigungsbestätigung bei<br />
Gemischttransporten, Begleitpapier<br />
mit Statuskennzeichnung)<br />
<strong>und</strong> Übergabe der<br />
Rückstellmuster an den<br />
Landwirt (entfällt bei CCM)<br />
Einlagerung<br />
Futtermittel<br />
Verfütterung an<br />
Tiere<br />
Kennzeichnung<br />
der Tiere mit<br />
Schlagstempel auf<br />
Schulter oder<br />
Schlögel<br />
Transport<br />
Schlachthof<br />
Prüfung<br />
Begleitpapiere mit<br />
Statuskennzeichnung<br />
von Landwirt<br />
Seperate/getrennte Be<strong>und</strong><br />
Verarbeitung <strong>und</strong><br />
Lagerung<br />
Zustellung Handel<br />
Abbildung 6-9: Flussdiagramm Schweinemast<br />
* Eingeschränkter Zukauf gemäß Codex beachten<br />
Anlieferung gekennzeichneter Ferkel<br />
von GVO-freien Ferkelproduzenten*<br />
Dokumentenprüfung<br />
Begleitpapiere mit<br />
Statuskennzeichnung<br />
Einstallen der<br />
Tiere<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
externes<br />
Monitoring<br />
Vorschlag zum Monitoring beim<br />
Landwirt:<br />
� Reinigungsbestätigung<br />
Transport LKW Futtermittel,<br />
� Begleitpapiere mit<br />
Statuskennzeichnung von<br />
Futtermittellieferant,<br />
� Begleitpapiere mit<br />
Statuskennzeichnung von<br />
Ferkellieferant,<br />
� Mengenprüfung Einkauf/<br />
Verkauf,<br />
� eventuell Musterziehung,<br />
� Prüfung auf Rückverfolgbarkeit<br />
Lieferant <strong>und</strong> Abnehmer,<br />
� Prüfung auf<br />
Verschleppungsgefahr<br />
Vorschlag zum Monitoring bei<br />
Schlachthof:<br />
� Begleitpapiere mit<br />
Statuskennzeichnung von<br />
Schweinelieferant,<br />
� Schlagstempelprüfung,<br />
� Mengenprüfung Einkauf/<br />
Verkauf,<br />
� Lagerbereichskennzeichnung,<br />
� Prüfung auf Rückverfolgbarkeit<br />
Lieferant <strong>und</strong> Abnehmer,<br />
� Protokoll von der Schlachtung,<br />
Zerlegung <strong>und</strong> Verarbeitung,<br />
� Warenflussdokumentation,<br />
� Prüfung der Wareneingänge für<br />
die Weiterverarbeitung mit<br />
Begleitpapieren <strong>und</strong><br />
Statuskennzeichnung,<br />
� Prüfung auf<br />
Verwechslungsgefahr<br />
Seite 121 von 272
6.3.8. Monitoring beim Landwirt mit Milchproduktion<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 6: Monitoring<br />
Werden Silagefutter verwendet, ist darauf zu achten, dass die Silierzusätze aus „GVO-freier“ oder gentechnikfreier“<br />
Produktion stammen. Bei der Milchproduktion ist beim Zukauf von Milchkühen laut österreichischem Codex eine 2-<br />
wöchige Übergangsfrist einzuhalten. Innerhalb dieser Frist muss die Milch der betreffenden Kühe separat vermarktet<br />
werden oder kann <strong>zur</strong> Fütterung der Jungtiere verwendet werden. Bei der Verarbeitung der Milch ist besonders<br />
darauf zu achten, dass die Arbeitsgänge in der Molkerei in geschlossener Folge für die gesamte Partie durchgeführt<br />
werden oder räumlich voneinander getrennt durchgeführt werden (vgl. NOWACK HEIMGARTNER, 2005. 17).<br />
Geltungsbereich<br />
<strong>und</strong><br />
Eigenkontrolle<br />
Landwirt: Aufzeichnung <strong>und</strong> Prüfung der Futtermittel, Tieranlieferungen sowie <strong>und</strong><br />
Tierabgänge<br />
Molkerei: Vertrag mit Landwirt<br />
Eigenkontrolle <strong>und</strong> externes Monitoring beim<br />
Landwirt mit Milchproduktion<br />
Selbstmischer<br />
Futtermittelanlieferung<br />
lose<br />
<strong>und</strong> Silomais<br />
Dokumentenprüfung<br />
(Reinigungsbestätigung bei<br />
Gemischttransporten, Begleitpapier<br />
mit Statuskennzeichnung)<br />
<strong>und</strong> Übergabe der<br />
Rückstellmuster an den<br />
Landwirt (entfällt bei Silomais)<br />
Einlagerung<br />
Futtermittel<br />
Verfütterung an<br />
Tiere<br />
sofortiger<br />
Milchverkauf<br />
möglich<br />
Abschlauchen<br />
durch GVO-freie<br />
Milchtanksammelfahrzeuge<br />
Transport Molkerei<br />
Seperate/<br />
getrennte<br />
Verarbeitung <strong>und</strong><br />
Lagerung<br />
Zustellung Handel<br />
Abbildung 6-10: Flussdiagramm Milchproduktion<br />
* Übergangsfristen gemäß Codex beachten<br />
Ja<br />
Anlieferung gekennzeichneter<br />
Milchkuh (mind. 2 Wochen<br />
Übergangsfrist wenn nicht aus GVOfreiem<br />
Betrieb*)<br />
Nein<br />
Dokumentenprüfung<br />
Begleitpapier mit<br />
Statuskennzeichnung<br />
Einstellung der<br />
Milchkuh<br />
in Umstellungsphase<br />
(2 Wochen) muß<br />
getrennte Lagerung<br />
oder Vermarktung der<br />
Milch sichergestellt sein<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
externes<br />
Monitoring<br />
Vorschlag zum Monitoring bei<br />
Landwirt:<br />
� Reinigungsbestätigung<br />
Transport LKW Futtermittel,<br />
� Begleitpapier mit<br />
Statuskennzeichnung von<br />
Futtermittellieferant,<br />
� Begleitpapier mit<br />
Statuskennzeichnung von<br />
Milchkuhlieferant,<br />
� Mengenprüfung Einkauf/<br />
Verkauf,<br />
� eventuell Musterziehung,<br />
� Prüfung auf Rückverfolgbarkeit<br />
Lieferant <strong>und</strong> Abnehmer,<br />
� Prüfung auf<br />
Verschleppungsgefahr<br />
Vorschlag zum Monitoring bei<br />
Molkerei:<br />
� Milchmengenaufzeichnung von<br />
Milchlieferant ,<br />
� Mengenprüfung Einkauf/<br />
Verkauf,<br />
� Prüfung auf Rückverfolgbarkeit<br />
Lieferant <strong>und</strong> Abnehmer,<br />
� Produktionsplan,<br />
� Lagerbereichskennzeichnung,<br />
� Warenflussdokumentation,<br />
� Prüfung der Wareneingänge für<br />
die Weiterverarbeitung mit<br />
Begleitpapieren <strong>und</strong><br />
Statuskennzeichnung,<br />
� Prüfung auf<br />
Verschleppungsgefahr<br />
Seite 122 von 272
6.3.9. Monitoring beim Landwirt mit Rindermast<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 6: Monitoring<br />
Werden Silagefutter verwendet, ist darauf zu achten, dass die Silierzusäzte aus „GVO-freier“ oder „gentechnikfreier“<br />
Produktion stammen. Bei der Rindermast ist beim Zukauf von Tieren darauf zu achten, dass diese mindestens 12<br />
Monate bzw. ¾ des Lebens mit „gentechnikfreien“ Futtermitteln gefüttert wurden - laut österreichischem Codex.<br />
Geltungsbereich<br />
<strong>und</strong><br />
Eigenkontrolle<br />
Landwirt: Aufzeichnung <strong>und</strong> Prüfung der Futtermittel, Tieranlieferungen sowie <strong>und</strong> Tierabgänge<br />
Schlachthof: Vertrag mit Landwirt<br />
Selbstmischer<br />
Eigenkontrolle <strong>und</strong> externes Monitoring beim<br />
Landwirt mit Rindermast<br />
Futtermittelanlieferung<br />
lose<br />
<strong>und</strong> Silomais<br />
Dokumentenprüfung<br />
(Reinigungsbestätigung bei<br />
Gemischttransporten, Begleitpapiere<br />
mit Statuskennzeichnung)<br />
<strong>und</strong> Übergabe der<br />
Rückstellmuster an den Landwirt<br />
(entfällt bei Silomais)<br />
Einlagerung<br />
Futtermittel<br />
Verfütterung an<br />
Tiere<br />
sofortiger<br />
Rinderverkauf<br />
möglich<br />
Ja<br />
Verkauf der Tiere<br />
an Schlachthof<br />
Transport zum<br />
Schlachtof<br />
Dokumentenprüfung<br />
(Begleitpapiere mit<br />
Statuskennzeichnung)<br />
Seperate/getrennte<br />
Schlachtung,<br />
Zerlegung,<br />
Verarbeitung <strong>und</strong><br />
Lagerung<br />
Zustellung Handel<br />
Abbildung 6-11: Flussdiagramm Rindermast<br />
* Übergangsfristen gemäß Codex beachten<br />
Anlieferung gekennzeichneter<br />
Kälber (mind.<br />
12 Monate bzw. 3/4 des Lebens mit<br />
GVO-freiem Futter zu füttern wenn<br />
aus konv. Betrieb - vor Verkauf*)<br />
Nein<br />
Dokumentenprüfung<br />
Lieferpapiere<br />
Einstallung der Tiere<br />
in Umstellungsphase<br />
(12 Monate bzw. 3/4 des<br />
Lebens) darf Tier nicht in<br />
GMO-freiem Programm<br />
verkauft werden<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
externes<br />
Monitoring<br />
Vorschlag zum Monitoring bei<br />
Landwirt:<br />
� Reinigungsbestätigung<br />
Transport LKW Futtermittel,<br />
� Begleitdokumente mit<br />
Statuskennzeichnung von<br />
Futtermittellieferant,<br />
� Begleitpapiere mit<br />
Statuskennzeichnung von<br />
Kälberlieferant,<br />
� Mengenprüfung Einkauf/<br />
Verkauf,<br />
� eventuell Musterziehung,<br />
� Prüfung auf Rückverfolgbarkeit<br />
Lieferant <strong>und</strong> Abnehmer,<br />
� Prüfung auf<br />
Verschleppungsgefahr<br />
Vorschlag zum Monitoring bei<br />
Schlachthof:<br />
� Begleitpapiere mit<br />
Statuskennzeichnung von<br />
Rindermastbetrieb,<br />
� Ohrmarkennummer,<br />
� Lagerbereichskennzeichnung,<br />
� Schlachtprotokoll von der<br />
Schlachtung <strong>und</strong> Zerlegung,<br />
� Mengenprüfung Einkauf/Verkauf,<br />
� Prüfung auf Rückverfolgbarkeit<br />
Lieferant <strong>und</strong> Abnehmer,<br />
� Protokoll von der Schlachtung,<br />
Zerlegung <strong>und</strong> Verarbeitung,<br />
� Warenflussdokumentation,<br />
� Prüfung der Wareneingänge für<br />
die Weiterverarbeitung mit<br />
Begleitpapieren <strong>und</strong><br />
Statuskennzeichnung,<br />
� Prüfung auf Verwechslungsgefahr<br />
Seite 123 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 6: Monitoring<br />
6.4. Übergeordnete Maßnahmen bei allen Stufen<br />
� Maßgeblich für die Erzeugung ist die Sicherstellung „gentechnikfreier“ bzw. „GVO-freier“ Rohstoffe in der<br />
landwirtschaftlichen Erzeugung durch entsprechende Koexistenzmaßnahmen <strong>und</strong> der Bestätigung der<br />
erfolgreichen Umsetzung auf der Gr<strong>und</strong>lage eines zumindest stichprobenartigen Monitorings.<br />
� Um eine „GVO-freie“ oder „gentechnikfreie“ Produktion einzuführen <strong>und</strong> dauerhaft aufrechterhalten zu<br />
können, muss eine wesentliche Voraussetzung geschaffen werden: Die Information <strong>und</strong> Schulung<br />
sämtlicher in der Wertschöpfungskette involvierten Personen. Nur wenn das Bewusstsein für<br />
Verschleppungsrisiken bei den jeweiligen Verantwortlichen <strong>und</strong> Beteiligten entsprechend ausgeprägt ist,<br />
werden Verunreinigung bzw. Kontamination nachhaltig verhindert werden können. Das beste Kontrollsystem<br />
wird nutzlos, wenn z.B. der sojaproduzierende Landwirt nicht auf „GVO-Verunreinigungen“ in den<br />
Erntemaschinen achtet (derzeit v.a. in Österreich aber auch Europa nicht aktuell).<br />
� Der Reinigung der verwendeten Transportmittel kommt bei der gentechnikfreien Produktion eine<br />
besondere Schlüsselfunktion zu. Besonders risikoreich ist der Transport zwischen Lieferant <strong>und</strong> K<strong>und</strong>e, da<br />
die Transportfahrzeuge in der Regel nicht nur für „GVO-freie“ oder „gentechnikfreie“ Waren eingesetzt<br />
werden. Die Sauberkeit der Transportmittel sollte durch ein doppeltes Kontrollsystem sichergestellt werden.<br />
Einerseits muss an der Verladestelle der Verlader auf Verunreinigungen achten, andererseits muss der<br />
Empfänger die Reinigung durch eine Reinigungsbestätigung garantiert bekommen.<br />
� „GVO-Freiheit“ oder “Gentechnikfreiheit“ kann sowohl prozessorientiert, als auch durch entsprechende<br />
Untersuchungen, im Besten Fall in Ergänzung zueinander garantiert werden. Zu diesem Zweck sind<br />
risikobasierte Proben entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu ziehen. Hierbei sollte zwischen<br />
standardisierter Probenziehung bei jeder Liefereinheit <strong>und</strong> Stichprobenziehung unterschieden werden.<br />
Die standardisierte Beprobung jeder Lieferung ist vor allem bei der Übernahme am Hafen zu fordern.<br />
Kommt die Anlieferung des zertifizierten „GVO-freien“ oder „gentechnikfreien“ SES aus einem<br />
geschlossenen, getrenten System, wird ein risikobasierter Probenplan zweckmäßig. Nur wenn die „GVO-<br />
Freiheit“ jeder Lieferung analytisch bestätigt ist, darf das Produkt als „GVO-frei“ oder <strong>„gentechnikfrei“</strong><br />
gehandelt werden. In allen übrigen Stufen der Wertschöpfungskette sollten risikobasierte Stichproben<br />
durchgeführt werden. „Die Proben müssen für das Untersuchungsgut / Warenlos repräsentativ sein. Die<br />
Probenzahl richtet sich nach dem akzeptierten Qualitätsniveau, wobei die Probennahme vereinheitlicht nach<br />
EU-Vorgaben bzw. internationalen Standards erfolgt (z.B. ISO, CEN). In der VO (EG) Nr. 882/2004 des<br />
Europäischen Parlaments <strong>und</strong> des Rates vom 29. April 2004, im Kapitel III, werden die Probenahme <strong>und</strong><br />
Analyse geregelt.<br />
Tabelle 6-3: Empfehlung der Probenahmen mit Kontrolldichte:<br />
Nr. Ort / Prozess Kontrolldichte<br />
1 Sammelstelle Ausladen Schiff (Eintritt Europa) hoch<br />
2 ev. Zwischenhändler punktuell<br />
3 Futtermittelwerk punktuell<br />
4 Selbstmischer oder Fahrender Misch LKW punktuell<br />
5 Landwirt punktuell<br />
6 Verarbeiter bis hin zum fertigen Produkt punktuell<br />
In Anlehnung an das Südtiroler Modell sollte bei der Einführung eines „GVO-freien“ Qualitätsprogrammes mit<br />
hoher Intensität kontrolliert werden (inkl. Probenziehung <strong>und</strong> Analyse), bis die „GVO-Freiheit“ in der<br />
gesamten Produktionskette sichergestellt werden kann. Ausgehend vom erreichten Niveau kann ein<br />
reduzierter Monitoring- <strong>und</strong> Eigenkontrollplan eingesetzt werden.<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich sollte, wie auch vom B<strong>und</strong>esministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten im „Leitfaden für<br />
die Kontrolle auf das Merkmal „ohne Verwendung von GVO <strong>und</strong> GVO-Derivaten“ der Verordnung (EWG)<br />
2092/91“ vorgeschlagen, im Zusammenhang mit der Probenanalyse der Gr<strong>und</strong>satz der Machbarkeit,<br />
Zumutbarkeit der Kosten <strong>und</strong> der Dauer gelten.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 124 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 6: Monitoring<br />
Zu den Probenahmeverfahren für die amtliche Untersuchung von Futtermitteln gibt es eine Richtlinie der<br />
Europäischen Kommission vom 1. März 1976 (76/371/EWR)<br />
Die Analyse der GVO-Gehalte sollte von einem Labor durchgeführt werden, das für qualitative <strong>und</strong><br />
quantitative GVO-Analytik <strong>und</strong> nach den Voraussetzungen von EN 45001 oder ISO 17025 arbeitet bzw.<br />
akkreditiert ist.<br />
� Zusätzlich zu den externen Probenziehungen ist gemäß einem risikobasierten Probenplan die Ziehung eines<br />
Rückstellmusters jedenfalls zweckmäßig. Ist die Produktionskette nicht geschlossen, ist die Ziehung eines<br />
Rückstellmusters in jedem Glied der Wertschöpfungskette erforderlich (Risikomatrix).<br />
o Rückstellmuster beim Landwirt:<br />
� Saatgut (kann derzeit in Österreich entfallen)<br />
� lose Futtermittelanlieferungen<br />
o Rückstellmuster bei der Sammelstelle:<br />
� von jedem Wareneingang <strong>und</strong> Ausgang<br />
o Rückstellmuster im Futtermittelwerk / Mühle SES<br />
� jeder Wareneingang lose<br />
� jeder Warenausgang<br />
o Rückstellmuster beim Selbstmischer<br />
� jeder Wareneingang lose<br />
� GVO-Arzneimittel werden weder nach 1829/2003 noch nach Codex bewertet <strong>und</strong> sind mit der<br />
Begründung zugelassen, dass diese einerseits zum Wohl der Tiere notwendig sein können, <strong>und</strong> die<br />
Vermeidung von Tierleid höher eingestuft wird als das generelle Verbot von GVO, <strong>und</strong> es nicht immer<br />
Alternativen gibt. Zusätzlich ist zu bedenken, dass bei staatlich angeordneten Impfungen in der Regel auch<br />
gentechnisch veränderte Impfstoffe vorgeschrieben werden (vgl. FIBL, 2003, 18).<br />
� Verpackungsmaterial muss auf Gentechnikfreiheit geprüft werden.<br />
� Besonders die kritischen Produkte wie Mais, Raps <strong>und</strong> SES sollten entweder in geschlossenen Systemen<br />
transportiert werden, oder die Verschleppungsgefahr beim Umladen auf ein Minimum reduziert werden.<br />
Maßnahme um das Risiko von Verunreinigungen in den Griff zu bekommen sind eine strikte räumliche<br />
Warenflusstrennung <strong>und</strong> lückenlose Rückverfolgbarkeit der Warenströme.<br />
� Qualitätssicherungsprogramme entlang einer Wertschöpfungskette benötigen, um effektiv <strong>und</strong> effizient zu<br />
funktionieren, geschlossene Informations- <strong>und</strong> Kommunikationssysteme, sowie abgestimmte<br />
Monitoringprogramme zwischen den verschiedenen Kontrollebenen, Kontrollstellen <strong>und</strong><br />
Kontrollsystemen. Dabei sollte die umfassende Erhebung von Qualitätsparametern – eine staatliche Aufgabe<br />
– bei industriell sowie gewerblich erzeugten Futtermitteln das allgemeine Qualitätsniveau festlegen <strong>und</strong> auf<br />
anstehende Probleme hinweisen, während die betriebliche Eigenkontrolle sich insbesondere auf aktuelle<br />
Probleme der Qualitätssicherung konzentrieren müsste (vgl. VON LENGERKEN, 2004, 246).<br />
� Generell bleibt festzustellen, dass je kürzer, überschaubarer <strong>und</strong> geschlossener die Wertschöpfungskette<br />
vom Anbau bis zum Konsumenten ist, desto einfacher, billiger <strong>und</strong> effektiver lässt sich ein externes<br />
Monitoringsystem <strong>und</strong> die Eigenkontrolle gestalten.<br />
Die Umsetzung der Forderungen hinsichtlich Sicherheit <strong>und</strong> Qualität der Produkte <strong>und</strong> Herstellungsprozesse ist ohne<br />
risikobasierter Konzeption <strong>und</strong> Struktur der Prozesse kaum möglich. Mit Hilfe eines normierten QM-Systems können<br />
die gestellten Anforderungen systematisch erfüllt <strong>und</strong> umgesetzt werden. Dokumentierte Verfahren nach den<br />
Anforderungen von Qualitätsmanagement-Systemen (QM-System) können eine sinnvolle Unterstützung <strong>zur</strong><br />
Umsetzung, Dokumentation <strong>und</strong> Aufrechterhaltung der jeweiligen qualitätsrelevanten Prozesse darstellen. Jeder<br />
einzelne Prozess in allen betroffenen Stufen der Wertschöpfungskette, der für die Verwirklichung der „GVO-freien“<br />
oder „gentechnikfreien“ Produktion relevant ist, muss in seinem Ablauf klar definiert werden, wobei ein<br />
überprüfendes System (Messung/Analyse/Verbesserung, Verantwortung der Leitung, Management der Mittel)<br />
integraler Bestandteil eines funktionierenden QM-Systems ist. So sollten die Prozesse Information <strong>und</strong> Schulung,<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 125 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 6: Monitoring<br />
Reinigung, Schädlingsbekämpfung, Produktion, Probenziehung, Rückstellmustergewinnung etc. in allen Stufen der<br />
Supply Chain für jeden Beteiligten genau festgelegt werden. Die Praxis hat gezeigt, dass vor allem in größeren<br />
Unternehmen ein QM-System nach der ISO 9001-2000 zu einer Minimierung der Fehlerhäufigkeit führt (vgl.<br />
Pöchtrager, 2001, 176). Auf Ebene der Landwirtschaft <strong>und</strong> kleineren Unternehmen ist die Anwendung von weniger<br />
umfangreichen QM-Systemen, die auf die Möglichkeiten der einzelnen Unternehmen genau abgestimmt werden,<br />
sinnvoll.<br />
Damit es zu keinen Wettbewerbsverzerrungen innerhalb der EU kommt, sind gleiche Qualitätsstandards in der<br />
jeweiligen Stufe der Supply Chain zu fordern, um unterschiedliche Standards bei einem freien Warenverkehr von<br />
Rohstoffen, Futtermitteln sowie veredelten Nahrungsmitteln zu vermeiden.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 126 von 272
Zusammenfassung:<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 6: Monitoring<br />
Um eine „GVO-freie“ oder „gentechnikfreie“ Produktion einzuführen <strong>und</strong> dauerhaft aufrechterhalten zu können, muss<br />
eine wesentliche Voraussetzung geschaffen werden: Die Information <strong>und</strong> Schulung sämtlicher in der<br />
Wertschöpfungskette involvierten Personen.<br />
� Das Anforderungsprofil für ein zuverlässiges <strong>und</strong> nachhaltiges Qualitätsprogramm für den Bereich<br />
Futtermittelproduktion fordert die Erfüllung folgender Punkte:<br />
o „GVO-freie“ oder „gentechnikfreie“ Produktion - ausschließlich in einem getrennten<br />
<strong>und</strong> geschlossenem Prozess – in einem Futtermittelwerk<br />
o die ausschließliche Verwendung von Rohstoffen, Zusatzstoffen/Vormischungen <strong>und</strong> Hilfsstoffen mit<br />
Begleitpapieren nach geforderter Statuskennzeichnung, gemäß einer „Positivliste“, die den<br />
Zukauf kritischer oder unerlaubter Rohstoffe/Einzelfuttermitteln verhindert (beispielsweise nach<br />
dem Südtiroler oder Deutschen Modell)<br />
o Dokumentierte Wareneingangskontrolle lose <strong>und</strong> Sack (bei loser Anlieferung enthält diese auch<br />
eine Überprüfung des verwendeten Transportmittels (Reinigungsbestätigung) bezüglich der zuvor<br />
transportierten Fracht <strong>und</strong> der durchgeführten Reinigungen, wenn nötig)<br />
o einen risikobasierten Stichprobenplan mit definierten Prüfungen für Gr<strong>und</strong>-, Einzel- <strong>und</strong><br />
Mischfutter (nach den Gr<strong>und</strong>sätzen der Verordnung des Europäischen Parlaments <strong>und</strong> des Rates<br />
VO (EG) Nr. 183/2005 mit Vorschriften für die Futtermittelhygiene)<br />
o die Entnahme von Rückstellproben aus jeder Produktionscharge auf Basis einer Risikomatrix<br />
(wobei unter Charge max. jene Produktionsmenge eines Futtermittels zu verstehen ist, welche die<br />
gleiche Futtermittelbezeichnung erhält <strong>und</strong> nach einer einheitlichen Rezeptur in ununterbrochener<br />
Reihenfolge hergestellt wird)<br />
o die „Offene Deklaration“ der Inhaltsstoffe von Mischfutter in absteigender Reihenfolge unter<br />
Berücksichtigung der Einmischgrenzen für IP Produkte<br />
o Transparente <strong>und</strong> nachvollziehbare Warenströme (nach der Verordnung (EG) Nr. 1830/2003<br />
<strong>und</strong> VO (EG) Nr. 1829/2003)<br />
o ausgewählte Lieferantenaudits<br />
o Implementierung eines effektiven <strong>und</strong> überprüfbaren QM-Systems, das alle qualitätsrelevanten<br />
Produktionsprozesse (inkl. Verunreinigungs- <strong>und</strong>/oder Kontaminationsmatrix, Prüfung auf<br />
Verschleppungsgefahr, Mitarbeiterschulung etc.) enthält. Wünschenswert wäre ein QM-System<br />
nach ISO 9001-2000.<br />
� Das Anforderungsprofil für ein zuverlässiges <strong>und</strong> nachhaltiges Qualitätsprogramm für den Bereich<br />
Landwirtschaft fordert die Erfüllung folgender Punkte:<br />
o Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit tierischer Produktion, die „GVO-freie“ oder<br />
„gentechnikfreie“ Produkte hervorbringen, ist eine ausschließliche Verwendung von „GVO-freien“<br />
oder „gentechnikfreien“ Futtermitteln wünschenswert. Mindestens ist dies innerhalb einer<br />
Tiergattung zu fordern. Werden konventionelle Futtermittel dennoch eingesetzt (zweites<br />
Betriebsstandbein z.B. Schweine- <strong>und</strong> Geflügelmast), muss der betreffende Landwirt sämtliche<br />
zugekaufte Futtermittel klar kennzeichnen <strong>und</strong> separat lagern. Bei selbstmischenden Landwirten<br />
ist, wie bei Futtermittelwerken, auf getrennte <strong>und</strong> geschlossene Produktionsprozesse zu<br />
bestehen.<br />
o Dokumentation aller Zu- <strong>und</strong> Abgänge im Tierbereich mit Begleitpapieren nach geforderter<br />
Statuskennzeichnung<br />
o Dokumentation aller Zu- <strong>und</strong> Verkäufe bei Futtermitteln, Rohstoffen,<br />
Zusatzstoffen/Vormischung <strong>und</strong> Hilfsmitteln mit Begleitpapieren nach geforderter<br />
Statuskennzeichnung, inkl. Reinigungsbestätigung bei loser Anlieferung<br />
o Transparente <strong>und</strong> nachvollziehbare Warenströme (nach der Verordnung (EG) Nr. 1830/2003<br />
<strong>und</strong> VO (EG) Nr. 1829/2003)<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 127 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 6: Monitoring<br />
o die Aufbewahrung <strong>und</strong> Kennzeichnung von Rückstellmustern auf Basis einer Risikomatrix für<br />
eingesetzte Futtermittel<br />
o Nachweis der geforderten Übergangsfristen beim Tierzukauf<br />
� Das Anforderungsprofil für ein zuverlässiges <strong>und</strong> nachhaltiges Qualitätsprogramm für den Bereich<br />
Verarbeiter fordert die Erfüllung folgender Punkte:<br />
o Dokumentation aller Zugänge im Tierbereich mit Begleitpapieren nach geforderter<br />
Statuskennzeichnung<br />
o Dokumentierte Kontrolle der Wareneingänge für die Weiterverarbeitung mit Begleitpapieren<br />
<strong>und</strong> Statuskennzeichnung<br />
o Transparente <strong>und</strong> nachvollziehbare Warenströme (nach der Verordnung (EG) Nr. 1830/2003<br />
<strong>und</strong> VO (EG) Nr. 1829/2003)<br />
o Aufzeichnungen über räumlich oder zeitlich getrennte Warenströme (Produktionsprotokolle<br />
Warenflussdiagramme, Gr<strong>und</strong>risspläne etc.)<br />
o Klare Statuskennzeichnung über alle Produktionsstufen<br />
o die ausschließliche Verwendung von Zusatzstoffen <strong>und</strong> Hilfsstoffen mit Begleitpapieren nach<br />
geforderter Statuskennzeichnung, gemäß einer „Positivliste“, die den Zukauf kritischer oder<br />
unerlaubter Stoffe verhindert (inkl. Kontrolle der Rezepturen)<br />
o Prüfung des Verpackungsmaterials<br />
o ausgewählte Lieferantenaudits<br />
o Implementierung eines effektiven <strong>und</strong> überprüfbaren QM-Systems, das alle qualitätsrelevanten<br />
Produktionsprozesse (inkl. Kontaminationsmatrix, Prüfung auf Verschleppungsgefahr,<br />
Mitarbeiterschulung etc.) enthält. Wünschenswert wäre ein QM-System nach ISO 9001-2000.<br />
� Das Anforderungsprofil für ein zuverlässiges <strong>und</strong> nachhaltiges Qualitätsprogramm für die Sammelstellen <strong>und</strong><br />
Lagerung fordert die Erfüllung folgender Punkte:<br />
o „GVO-freie“ oder „gentechnikfreie“ Lagerung - ausschließlich in einem getrennten <strong>und</strong><br />
geschlossenem Prozess – in einer Lagerstelle<br />
o Dokumentierte Wareneingangskontrolle lose <strong>und</strong> Sack (bei loser Anlieferung enthält diese auch<br />
eine Überprüfung des verwendeten Transportmittels (Reinigungsbestätigung) bezüglich der zuvor<br />
transportierten Fracht <strong>und</strong> der durchgeführten Reinigungen, wenn nötig)<br />
o einen Stichprobenkontrollplan mit definierten Kontrollen (nach den Gr<strong>und</strong>sätzen der<br />
Verordnung des Europäischen Parlaments <strong>und</strong> des Rates VO (EG) Nr. 183/2005 mit Vorschriften für<br />
die Futtermittelhygiene)<br />
o die Entnahme von Rückstellproben auf Basis einer Risikomatrix aus Eingangslieferungen <strong>und</strong><br />
Ausgangschargen<br />
o Klare Chargenabgrenzung<br />
o Transparente <strong>und</strong> nachvollziehbare Warenströme (nach der Verordnung (EG) Nr. 1830/2003<br />
<strong>und</strong> VO (EG) Nr. 1829/2003)<br />
o Implementierung eines effektiven <strong>und</strong> überprüfbaren QM-Systems, das alle qualitätsrelevanten<br />
Produktionsprozesse (inkl. Kontaminationsmatrix, Prüfung auf Verschleppungsgefahr,<br />
Mitarbeiterschulung etc.) enthält. Wünschenswert wäre ein QM-System nach ISO 9001-2000.<br />
o Mitverantwortung bei der Kontrolle von Transportfahrzeugen (auch bei Ab-Werk-Lieferungen)<br />
� Es ist auf Gr<strong>und</strong> der Erkenntnisse aus der Bearbeitung dieses Themenkomplexes anzumerken, dass das<br />
Anforderungsprofil des österreichischen Codex <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> ein maßgeblich<br />
aufwendigeres externes Monitoring <strong>und</strong> Eigenkontrollsystem fordert als die Umsetzung für nicht<br />
kennzeichnungspflichtige Futter- <strong>und</strong> Lebensmittel gemäß EG (VO) 1829/2003. Ohne auf die Details näher<br />
einzugehen sei auf die zusätzlichen Vorgaben gemäß Codexrichtlinie verwiesen:<br />
o den Betriebsmitteleinsatz in der landwirtschaftlichen Produktion,<br />
o der Mengenbegrenzungen von SES in der Futterration,<br />
o der Erzeugung der Zusatzstoffe bzw. Futtermittelausgangserzeugnisse für Futtermittel,<br />
o der Umstellungszeiträume in der Fütterung<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 128 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 6: Monitoring<br />
� Es sei jedoch angemerkt, dass das Monitoring auf das jeweilige Qualitätsprogramm anzupassen ist <strong>und</strong> die<br />
Risiken je nach Verunreinigungs-, bzw. Verschleppungsgefahr unterschiedlich zu ermitteln <strong>und</strong> zu bewerten<br />
sind.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 129 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 7: Allgemeine Betrachtung der Kosten<br />
7. Betrachtungen des landwirtschaftlichen Produktenhandels <strong>und</strong> der<br />
Futtermittelwirtschaft betreffend die Kostenbelastung für <strong>Auslobung</strong><br />
„GVO-frei“ oder <strong>„gentechnikfrei“</strong> mit einem Qualitätsprogramm – V. KOLAR<br />
<strong>und</strong> TH. KICKINGER, Institut für Futtermittel, <strong>AGES</strong><br />
Ein wichtiger Faktor, welchen es bei der Studie zu berücksichtigen galt, stellt die Einschätzung der Kosten bei der<br />
Umstellung auf eine „gentechnikfreie“ oder „GVO-freie“ Fütterung durch den Landwirtschaftlichen Produktenhandel<br />
<strong>und</strong> die Futtermittelwirtschaft dar. Diese Frage ist stark zukunftsbezogen <strong>und</strong> da starke Preisschwankungen bei<br />
pflanzlichen Rohstoffen in der Futtermittelbranche durchaus üblich sind, können Abschätzungen nur auf der Basis<br />
von begründeten Annahmen vorgenommen werden. Um eine seriöse <strong>und</strong> vergleichende Einschätzung der<br />
Kostenfrage vornehmen zu können, wurden repräsentative Umfragen an die österreichischen Mischfutterhersteller (in<br />
Kapitel 8 bereits beschrieben) bzw. an den landwirtschaftlichen Großhandel vorgenommen. Bei der Umfrage<br />
„Großhandel“ wurde an die 6 marktbeherrschenden landwirtschaftlichen Produktenhändler in Österreich ein<br />
Fragebogen versandt. Da die befragten Firmen der beiden Bereiche mehr als 90 % des heimischen SES- bzw.<br />
Futtermittelmarktes abdecken, darf von einer repräsentativen Umfrage gesprochen werden. Die Einschätzungen der<br />
monetären Belastungen bzw. der Entwicklung der Preise in der Futtermittelbranche sind in der Folge dargestellt <strong>und</strong><br />
beschrieben.<br />
Tabelle 7-1: Fragebogen-Qualitative Angaben zu möglichen Mehrkosten durch die Futtermittelindustrie in Österreich<br />
Erhöhte Gesamtkosten durch erhöhte<br />
Rohstoffkosten<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Erhöhte Gesamtkosten durch erhöhten Schw<strong>und</strong><br />
Häufigkeit Prozent Häufigkeit Prozent<br />
keine Angabe 10 31,3<br />
keine Angabe 10 31,3<br />
ja 22 68,7 Ja 12 37,4<br />
Gesamt 32 100 nein 10 31,3<br />
Gesamt 32 100<br />
Erhöhte Gesamtkosten durch erhöhten<br />
Erhöhte Gesamtkosten durch erhöhte<br />
logistischen Aufwand<br />
Lagerkosten<br />
Häufigkeit Prozent Häufigkeit Prozent<br />
keine Angabe 10 31,3<br />
keine Angabe 10 31,3<br />
ja 15 46,8 Ja 12 37,4<br />
nein 7 21,9 nein 10 31,3<br />
Gesamt 32 100 Gesamt 32 100<br />
Erhöhte Gesamtkosten durch Erhöhte Gesamtkosten durch die Errichtung einer<br />
zusätzliche QM-Maßnahmen getrennten „GVO-freien“ Produktionsschiene<br />
Häufigkeit Prozent Häufigkeit Prozent<br />
keine Angabe 10 31,3<br />
keine<br />
Angabe<br />
10 31,3<br />
ja 21 65,6 Ja 11 34,4<br />
nein 1 3,1 nein 11 34,4<br />
Gesamt 32 100 Gesamt 32 100<br />
Seite 130 von 272
Erhöhte Gesamtkosten durch Sonstige<br />
Faktoren<br />
Häufigkeit Prozent<br />
keine<br />
Angabe<br />
10 31,3<br />
ja 4 12,5<br />
nein 18 56,3<br />
Gesamt 32 100<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 7: Allgemeine Betrachtung der Kosten<br />
Die Tabellen lassen erkennen, dass erhöhte Rohstoffkosten, zusätzliches QM/QS <strong>und</strong> der erhöhte logistische Aufwand<br />
als wesentliche Kostenfaktoren für die „GVO-freie“ oder „gentechnikfreie“ Erzeugung von Futtermitteln angeführt<br />
werden. Einerseits sieht etwas mehr als ein Drittel der Betriebe durch die Faktoren „Einrichtung (Umstellung) einer<br />
getrennten Produktionsschiene, erhöhter Schw<strong>und</strong> <strong>und</strong> höhere Lagerkosten“ keine relevanten Auswirkungen auf eine<br />
Kostensteigerung (sofern z.B. die Werke auch ausgelastet sind), andererseits werden von etwa einem Drittel ein<br />
Mehraufwand angeführt. Nur 4 Befragte der Mischfutterproduzenten sind der Meinung, dass auch „Sonstige<br />
Faktoren“, wie z.B.: größerer Verwaltungsaufwand, zu den erhöhten Gesamtkosten aufgr<strong>und</strong> der Gentechnikfreiheit<br />
beitragen.<br />
Aus den Antworten <strong>zur</strong> Frage, welchem Abschnitt im Erzeugungsprozess die meisten Kosten aufgr<strong>und</strong> einer<br />
gentechnikfreien Erzeugung zuzuordnen sind, ergibt sich eine vergleichbare Verteilung wie in den vorigen Tabellen<br />
dargestellt wurde.<br />
Die Höhe der Mehrkosten beim Einkauf von „GVO-freien“ SES wird von über 20% der österreichischen<br />
Mischfuttererzeuger im Bereich von € 11,- bis € 25,- pro Tonne eingeschätzt. Dies entspricht einer Erhöhung<br />
zwischen 5 <strong>und</strong> 12 % bei der Annahme eines derzeitigen SES-Preises von € 220,- pro Tonne. Knapp 20% der Firmen<br />
rechnen jedoch sogar mit einem höheren Aufwand von € 26,- bis € 40,-. Ein Befragter gibt eine Kostensteigerung<br />
von über € 40,- pro Tonne an, was einer Kostensteigerung von ca. 20 % gleichkäme. Erwähnt werden muss auch,<br />
dass die Hälfte der Betriebe sich NICHT zu dieser Frage äußerte. Laut Aussagen der österreichischen<br />
landwirtschaftlichen Großhändler liegt der derzeitige Preisunterschied zwischen € 11,- bis € 25,- pro Tonne SES. Die<br />
Frage nach der gerade noch akzeptablen Preissteigerung von „GVO-freiem“ SES wird von fast 90 % der Befragten<br />
nicht beantwortet. 4 Betriebe führten die unterste Kategorie von 0,- bis € 5,- per Tonne an, was soviel bedeutet,<br />
dass keine Preissteigerung als wirtschaftlich akzeptabel eingestuft wird.<br />
Tabelle 7-2: Fragebogen-Wie hoch schätzen Sie eine Preissteigerung bei Mischfutter aufgr<strong>und</strong> des Einsatzes von<br />
„GVO-freiem“ SES ein?<br />
Häufigkeit Prozent<br />
keine Angabe 24 75<br />
bis zu 5 % 3 9,4<br />
6 bis zu 15 % 2 6,3<br />
mehr als 15 % 3 9,4<br />
Gesamt 32 100<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 131 von 272
Prozent<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
75<br />
keine A ngab e<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 7: Allgemeine Betrachtung der Kosten<br />
9<br />
bis 5 %<br />
6 bis 15 %<br />
mehr als 15 %<br />
Abbildung 7-1: Fragebogen-Wie hoch schätzen Sie eine Preissteigerung<br />
bei Mischfutter aufgr<strong>und</strong> des Einsatzes von „GVO-freiem“ SES ein?<br />
6<br />
Drei Viertel der Betriebe halten sich bei der Frage nach einer etwaigen Kosten- bzw. Preissteigerung für Mischfutter<br />
durch den Einsatz von „GVO-freiem“ SES bedeckt, wie Abbildung 9-1 <strong>und</strong> Tabelle 9-3 veranschaulichen. Die<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
9<br />
angegebenen Antworten sind gestreut von einer Kosten- / Preissteigerung unter 5% bis über 15 %. Die Auswertung<br />
zeigt, dass noch keine konkreten Aussagen zu einer Kosten- bzw. auch Preiserhöhung von Futtermitteln gemacht<br />
werden, da die Firmen sicherlich sehr stark ihren Mitbewerb beobachten werden <strong>und</strong> danach ihre Preispolitik<br />
gestalten werden. Eine Gesamtkosten <strong>und</strong> -Preisveränderung, durch den Einsatz von „GVO-freiem“ SES als auch<br />
„GVO-freien“ oder „gentechnikfreien“ Zusatzstoffen (Vitamine <strong>und</strong> Aminosäuren), wird von den Futtermittelfirmen <strong>zur</strong><br />
Zeit noch nicht konkret abgeschätzt. Die Streuung der Antworten war sehr groß <strong>und</strong> lässt auf Unsicherheit bzw.<br />
fehlende Informationen über die Kosten-<strong>und</strong> Preisentwicklung der „GVO-freien“ oder „gentechnikfreien“ Rohstoffe<br />
schließen.<br />
Auch der landwirtschaftliche Großhandel weist darauf hin, dass konkrete Aussagen <strong>zur</strong> Entwicklung der Kosten <strong>und</strong><br />
des Preises von „GVO-freiem“ SES nur sehr schwer möglich sind. Sehr oft wurden Bedenken geäußert, dass je größer<br />
die Nachfrage - bei einem eher kleiner werdenden Angebot ist - umso teurer wird „GVO-freier“ SES auch gehandelt<br />
werden. Der österreichische Landesproduktenhandel äußerte, dass eine starke Verteuerung von „GVO-freiem“ SES<br />
nicht auszuschließen ist, ja bei einer wesentlichen Erhöhung der Nachfrage sogar sehr wahrscheinlich ist. Wie die<br />
folgende Grafik zeigt, schätzt die Hälfte des österreichischen Landesproduktenhandels eine Erhöhung der Kosten <strong>und</strong><br />
des Preises von „GVO-freiem“ SES aufgr<strong>und</strong> einer größeren Nachfrage mit € 20,- pro Tonne ein. Ein Drittel der<br />
Befragten sieht die Verteuerung im Bereich von € 30,- bis € 50,- pro Tonne. Diese geschätzten Kosten- <strong>und</strong><br />
Preissteigerungen beziehen sich lediglich auf eine erhöhte Nachfrage unter der Annahme, dass alle anderen<br />
Parameter unverändert bleiben.<br />
Seite 132 von 272
Prozent<br />
6 0<br />
5 0<br />
4 0<br />
3 0<br />
2 0<br />
1 0<br />
0<br />
1 7<br />
ke in e A n g a b e<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 7: Allgemeine Betrachtung der Kosten<br />
€ 2 0<br />
€ 3 0 b is € 5 0<br />
Abbildung 7-2: Fragebogen-Wie hoch schätzen Sie eine Verteuerung<br />
Von „GVO-freiem“ SES pro Tonne, aufgr<strong>und</strong> einer erhöhten Nachfrage,<br />
am Weltmarkt im Verkauf ein?<br />
5 0<br />
3 3<br />
Zwischen 10 % <strong>und</strong> 15 % wird laut Ergebnis der Umfrage an den landwirtschaftlichen Großhandel die Kosten-<strong>und</strong><br />
Preissteigerung bei Rapsschrot <strong>und</strong> Rapskuchen aufgr<strong>und</strong> einer erhöhten Nachfrage betragen. 50 % machten jedoch<br />
zu diesem Punkt keine Angabe. Auch diesbezüglich ist die konkrete Preisbildung bei einer etwaigen erhöhten<br />
Nachfrage schwer vorauszusehen.<br />
Prozent<br />
6 0<br />
5 0<br />
4 0<br />
3 0<br />
2 0<br />
1 0<br />
0<br />
5 0<br />
ke in e A n g a b e<br />
Abbildung 7-3: Fragebogen - Wie hoch schätzen Sie eine Verteuerung<br />
von Rapsschrot, -kuchen pro Tonne, aufgr<strong>und</strong> einer erhöhten Nachfrage,<br />
am Weltmarkt im Verkauf ein?<br />
1 7<br />
1 0 %<br />
3 3<br />
1 5 %<br />
Auch bei Sonnenblumenschrot wird eine Verteuerung von 10 bis 15 % aufgr<strong>und</strong> einer erhöhten Nachfrage angeführt.<br />
Als gesichert kann diese Angabe jedoch nicht betrachtet werden, da ca. zwei Drittel der Befragten „keine Angabe“ als<br />
Antwort auf dieses fiktive Szenario geben.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 133 von 272
Prozent<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
67<br />
keine A ngab e<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 7: Allgemeine Betrachtung der Kosten<br />
Abbildung 7-4: Fragebogen-Wie hoch schätzen Sie eine Verteuerung<br />
von Sonnenblumenschrot pro Tonne, aufgr<strong>und</strong> einer erhöhten Nachfrage,<br />
am Weltmarkt im Verkauf ein?<br />
Zusammenfassung:<br />
17<br />
10 %<br />
In diesem Kapitel wird die Einschätzung einer Kosten- <strong>und</strong> Preisveränderung von „GVO-freien“ oder<br />
17<br />
15 %<br />
„gentechnikfreien“ Rohstoffen <strong>und</strong> Futtermittelausgangserzeugnissen im Vergleich zu als GVO gekennzeichneten<br />
Produkten durch den österreichischen Landesproduktenhandel <strong>und</strong> die österreichische Futtermittelwirtschaft<br />
wiedergegeben.<br />
Erhöhte Rohstoffkosten, zusätzliches QM <strong>und</strong> der erhöhte logistische Aufwand werden als die wesentlichen<br />
Kostenfaktoren bei der Umstellung auf eine „GVO-freie“ oder „gentechnikfreie“ Fütterung gesehen. Eine somit<br />
verb<strong>und</strong>ene Preissteigerung von Futtermitteln kann allerdings, wie die Auswertung des Fragebogens zeigt, nicht<br />
konkret eingeschätzt werden, da die erhaltenen Antworten stark variieren. Es ist anzunehmen, dass ohne<br />
Verteuerung eine Umstellung auf Gentechnikfreiheit nicht möglich sein wird, da speziell vom landwirtschaftlichen<br />
Großhandel ein starker Anstieg des schon jetzt höheren Preises von „GVO-freiem“ SES, aufgr<strong>und</strong> erhöhter Nachfrage,<br />
befürchtet wird. Die Einschätzung von Kosten- <strong>und</strong> Preissteigerungen variieren von etwa 5 % bis etwa 20 % für<br />
„GVO-freien“ SES oder „GVO-freie“ oder „gentechnikfreie“ Substitute.<br />
Anzumerken ist, dass für die Einschätzung der wahren Kosten es unerlässlich ist, noch weitere Aspekte in die<br />
Betrachtungen einzubeziehen. Leistungseinbußen durch ernährungsphysiologisch nicht abgestimmte Rationen (v.a.<br />
ab dem mittleren Leistungniveau) können oft beträchtliche Auswirkungen auf den wirtschaftlichen Erfolg in der<br />
Tierhaltung haben.<br />
Die Kosten- <strong>und</strong> Preiseinschätzungen des Landesproduktenhandels <strong>und</strong> der Futtermittelwirtschaft gehen jedenfalls<br />
von substantiellen Erhöhungen im Vergleich zu als GVO gekennzeichneten Rohstoffen <strong>und</strong> Futtermitteln aus.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 134 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 8: Rationsauswahl<br />
8. Auswahl von „gentechnikfreien“ oder „GVO-freien“ Futterrationen <strong>zur</strong><br />
Betrachtung der Verfügbarkeit <strong>und</strong> der Berechnung der Differenzkosten<br />
zu als GVO gekennzeichneten Futterrationen - V. KOLAR <strong>und</strong> TH. KICKINGER, Institut für<br />
Futtermittel, <strong>AGES</strong><br />
Eine Gr<strong>und</strong>lage <strong>zur</strong> Bewertung der Machbarkeit <strong>und</strong> der potentiellen Verfügbarkeit von Rohstoffen <strong>und</strong><br />
Futtermittelausgangserzeugnissen für ein Qualitätsprogramm <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> von „GVO-freien“ oder<br />
„gentechnikfreien“ tierischen Lebensmitteln, basierend auf „GVO-freiem“ oder „gentechnikfreiem“ Futtereinsatz, stellt<br />
eine Analyse <strong>und</strong> repräsentative Auswahl von Futterrationen dar.<br />
Die Erstellung der Rezepturen (Modellvarianten) wurde unter der fiktiven Annahme getroffen, dass alle Rohstoffe <strong>und</strong><br />
alle Zusatzstoffe nach Codex uneingeschränkt verfügbar sind. Die TATSÄCHLICHE Verfügbarkeit „gentechnikfreier“<br />
Rohstoffe <strong>und</strong> bestimmter Zusatstoffe gemäß Codex (Aminosäuren, Vitamin B2 <strong>und</strong> B12) wird in Kapitel 3 <strong>und</strong> 4<br />
abgehandelt (siehe Tabelle 3-24, Tabelle 4-8, Tabelle 4-9 <strong>und</strong> Tabelle 4-11).<br />
Die Futterrationen repräsentieren:<br />
1. die Vorgaben gemäß folgender Tabelle:<br />
Die in der Studie angewandten Begriffe bzw. Definitionen werden zum besseren Verständnis vorangestellt:<br />
„Gentechnikfrei“ :<br />
Definition gemäß Codex Alimentarius Austriacus siehe<br />
http://www.bmgf.gv.at/cms/site/attachments/8/0/5/CH0264/CMS1085747609216/codex-rl.pdf<br />
„GVO-frei“:<br />
Der Begriff „GVO-frei“ wird in der Studie für nicht kennzeichnungspflichtige Lebensmittel <strong>und</strong> Futtermittel gemäß der<br />
Bestimmungen der VO (EG) 1829/2003 über genetisch veränderte Lebensmittel <strong>und</strong> Futtermittel verwendet.<br />
Darüber hinaus wird der Begriff „GVO-frei“ in der Studie im Zusammenhang mit Lebensmitteln aus tierischer<br />
Erzeugung (Milch, Eier, Fleisch) dann angewandt, wenn nicht kennzeichnungspflichtige Futtermittel gemäß der<br />
Bestimmungen der VO (EG) 1829/2003 in der Tierernährung eingesetzt werden.<br />
Zum Anwendungsbereich der VO (EG) 1829/2003 hat der Ständige Ausschuss Lebensmittelkette <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
folgende Klarstellung getroffen, siehe<br />
http://europa.eu.int/comm/food/committees/regulatory/modif_genet/summary240904_en.pdf<br />
(Punkt 1).<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 135 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 8: Rationsauswahl<br />
Tabelle 8-1: Überblick <strong>und</strong> Beschreibung zu den betrachteten Modellrationen<br />
Überblick <strong>und</strong> Beschreibung der betrachteten Rationsarten<br />
„konventionell“ Rationen ohne Berücksichtigung des Einsatzes von „GVO-freiem“oder „gentechnikfreiem“<br />
SES bzw. von dementsprechenden Zusatzstoffen, Kennzeichnung als GVO gemäß<br />
VO(EG) 1829/2003 bzw. Kennzeichnung der Rohstoffe, insbesondere SES, <strong>und</strong><br />
Futtermittelausgangserzeugnisse<br />
„GVO-frei“ Rationen mit „GVO-freien“ Rohstoffen, insbesondere SES <strong>und</strong> Zusatzstoffe; VO(EG)<br />
1829/2003 (Siehe Kapitel 2)<br />
<strong>„gentechnikfrei“</strong> Rationen gemäß dem Österreichischen Codex <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> (Siehe<br />
Kapitel 2)<br />
Substitute „GVO-frei“ Substitution von „GVO-freiem“ SES durch andere eiweißhältige Rohstoffe <strong>und</strong><br />
Substitute<br />
<strong>„gentechnikfrei“</strong><br />
Futtermittelausgangserzeugnisse (insbesondere Zusatzstoffe); VO(EG) 1829 (Siehe<br />
Kapitel 2)<br />
Substitution von „gentechnikfreiem“ SES durch andere eiweißhältige Rohstoffe <strong>und</strong><br />
Futtermittelausgangserzeugnisse (insbesondere Zusatzstoffe) gemäß des<br />
Österreichischen Codex <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> (Siehe Kapitel 2)<br />
2. Ernährungsphysiologische Mindestanforderungen an die Futterrationen für bestimmte Tierarten<br />
3. Mindestanforderungen an die Futterrationen für bestimmte Tierarten <strong>zur</strong> Erzielung adäquater Leistungen<br />
der Tiere gemäß Anforderungsprofil <strong>und</strong> bedingt durch ökonomische Vorgaben <strong>zur</strong> Wettbewerbsfähigkeit.<br />
4. Regionale Differenzierungen in Zusammenhang mit dem Gr<strong>und</strong>futterangebot<br />
5. Aspekte der Erzeugung in der Futtermittelindustrie oder durch selbstmischende Landwirte<br />
6. Differenzierungen hinsichtlich extensiver <strong>und</strong> intensiver Haltungsformen<br />
Das Ziel der Rationsauswahl war, einen repräsentativen Querschnitt von „österreichischen“ Futtermittelrationen für<br />
die wichtigsten tierischen Produktionskategorien herzustellen. Dies wurde durch die Einbindung der<br />
Futtermittelindustrie, der Futtermittelexperten <strong>und</strong> -berater, insbesondere der Landwirtschaftskammern, erreicht.<br />
Die konventionellen Stammrationen sowie auch die abgeänderten Modellrationen wurden von Fütterungsexperten der<br />
Industrie, des Gewerbes <strong>und</strong> der LWK evaluiert <strong>und</strong> nachfolgend der AMA vorgelegt.<br />
Die Rationen <strong>und</strong> ihre Varianten wurden so aufgestellt, dass sie im Proteingehalt, Aminosäurengehalt <strong>und</strong><br />
Energiegehalt zumindest rechnerisch den konventionellen Stammrationen entsprechen.<br />
Anzumerken ist, dass innerhalb der Produktionseinheit darauf geachtet wurde, die wichtigsten regionsspezifischen<br />
Gegebenheiten <strong>und</strong> fütterungstechnischen Unterschiede zu berücksichtigen. Allen Gegebenheiten gerecht zu werden,<br />
würde aber den Rahmen der Studie sprengen. Kleinere geographische <strong>und</strong> firmeneigene Unterschiede sind für das<br />
Ergebnis nicht relevant, da es herauszuarbeiten gilt, wie sich die verschiedenen „GVO-freien“ oder<br />
„gentechnikfreien“ Rationen letztlich preislich <strong>zur</strong> „konventionellen“ Ration verhalten.<br />
Die „konventionellen“ Rationen wurden als Basis herangezogen <strong>und</strong> an 4 weitere unterschiedliche<br />
Rahmenbedingungen angepasst (ergibt in Summe 5 Varianten). Jede „konventionelle“ Ration wurde in eine Matrix<br />
mit 5 Varianten eingearbeitet, wenn ernährungsphysiologische Einwände vorlagen, wurden diese dann angemerkt.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 136 von 272
„Konventionell“:<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 8: Rationsauswahl<br />
Es wird wie oben dargestellt in der Regel vom Einsatz von kennzeichnungspflichtigen SES mit mehr als 0,9 %<br />
ausgegangen. Es gibt keine über die VO(EG) 1829/2003 hinausgehenden Einschränkungen. Für nicht zugelassene<br />
GVO gelten die Schwellenwerte 0,5 <strong>und</strong> 0 %. Weiters können die Zusatzstoffe aus GVM stammen.<br />
„GVO-frei“:<br />
Die Rationen enthalten nicht kennzeichnungspflichtigen SES mit maximal 0,9% GVO-Verunreinigungen. Für nicht<br />
zugelassene GVO gelten die Schwellenwerte 0,5 <strong>und</strong> 0 %. Es wurde der „konventionelle“ SES 1:1 durch „GVO-freien“<br />
SES ersetzt. Die Zusatzstoffe können wie bei der vorigen Modellvariante mit/aus gentechnisch veränderten<br />
Mikroorganismen hergestellt werden.<br />
<strong>„gentechnikfrei“</strong>:<br />
Diese Rahmenbedingungen setzen neben „gentechnikfreien“ Einzelfuttermitteln <strong>und</strong> Rohstoffen auch <strong>„gentechnikfrei“</strong><br />
hergestellte Zusatzstoffe voraus. Eine weitere Einschränkung stellt die Obergrenze von 20 % bzw. 10% für<br />
„gentechnikfreien“ SES dar. Bei Einsatz von SES aus Hard IP Programmen darf laut Mitteilung von Dr. Plsek, BMGF<br />
(Mail vom 7.4.2005) die 20% bzw. 10% Grenze für SES überschritten werden. Betreffend die Vorgaben beim<br />
Betriebsmitteleinsatz in den landwirtschaftlichen Erzeugungsprozessen, sei auf die Kapitel 2 <strong>und</strong> 3 verwiesen.<br />
Substitute „GVO-frei“:<br />
Voraussetzung für die Komposition dieser Rationen war der Ersatz von SES durch adäquate Eiweißrohstoffe (DDGS,<br />
Rapsextraktionsschrot, Erbse, Ackerbohne, etc.). Die Zusatzstoffe könne mit GVM hergestellt werden. Neben der<br />
Berücksichtigung der VO (EG) 1829/ 2003 wird bei diesen Rationen gänzlich auf SES verzichtet. Als Substitut stehen<br />
alle „GVO-freien“ erlaubten Eiweißfuttermittel <strong>zur</strong> Verfügung.<br />
Substitute <strong>„gentechnikfrei“</strong>:<br />
Zusätzlich zu den Vorschriften des „Codex gentechnikfrei“ wird bei diesen Rezepturen gänzlich auf SES verzichtet,<br />
sowie ausschließlich mit Zusatzstoffen, die nicht aus GVM hergestellt wurden, gearbeitet. Als Substitut stehen alle<br />
<strong>„gentechnikfrei“</strong> erlaubten Eiweißträger <strong>zur</strong> Verfügung.<br />
Wichtige Anmerkung:<br />
Die zwei Modellvarianten ohne SES [Substitute „GVO-frei“ <strong>und</strong> Substitute <strong>„gentechnikfrei“</strong>] sind<br />
ernährungsphysiologisch nicht ganz unmöglich <strong>und</strong> rechnerisch dem Gehalt an Rohprotein <strong>und</strong><br />
Aminsosäuren sowie dem Energiegehalt angepasst. Besonders im Geflügel- <strong>und</strong> Schweinebereich,<br />
insbesondere in üblichen <strong>und</strong> hohen Leistungsklassen müssen Rationen ohne SES mit äußerster<br />
Skepsis betrachtet werden. Wie uns auch Fütterungsexperten bestätigen, liegen genaue Zahlen über<br />
Leistungseinbußen <strong>und</strong> Akzeptanz für diese Modellrationen weder aus Studien noch aus der Praxis vor,<br />
wo SES erfolgreich (das heißt ohne Leistungseinbußen <strong>und</strong>/oder Mangelerscheinungen) durch andere<br />
Eiweißalternativen ersetzt werden konnte.<br />
Die letzten zwei Modellvarianten ohne SES – besonders im Monogastrierbereich - könnten erst durch<br />
Fütterungsversuche hinsichtlich Akzeptanz <strong>und</strong> Leistungseinbußen, sowie Mangelerscheinungen, in<br />
der Praxis geprüft werden.<br />
Milchviehhaltung:<br />
Im Milchviehsektor wird einerseits der extensive Sektor mit 20 kg Milchleistung <strong>und</strong> andererseits der intensive Sektor<br />
mit 35 kg berücksichtigt. Es wurden für beide Leistungsgruppen 4 relevante Gr<strong>und</strong>futterversorgungen (1 x<br />
Grassilage, 1 x Gras-/Maissilage, 1x Weide <strong>und</strong> 1x Heu) erstellt <strong>und</strong> somit wird auch zwischen unterschiedlichen<br />
Regionen Österreichs differenziert. Im Milchviehbereich wurde die Ration pro Tag berechnet, da auch die Leistung in<br />
kg Milch auf Tageseinheiten bezogen ist (Unterschied <strong>zur</strong> Rindermast).<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 137 von 272
Rindermast:<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 8: Rationsauswahl<br />
Auf Empfehlung wurde auch im Bereich der Rindermast die Notwendigkeit einer Unterscheidung zwischen einer<br />
extensiven <strong>und</strong> intensiven Ration gesehen. Wie vorhin erwähnt, wurden die Rationen auf die jeweiligen tierischen<br />
Leistungen bezogen. In der Rindermast stellt das Mastendgewicht bzw. der Mastverlauf über die gesamte<br />
Lebensperiode die Leistung dar. Darum wurden in diesem Bereich die einzelnen Mastabschnitte berücksichtigt. Bei<br />
der extensiven Rindermast auf der Weide ergeben sich somit 5 Abschnitte, da der Wechsel Stall <strong>und</strong> Weide <strong>und</strong><br />
somit die gesamte Zeit bis <strong>zur</strong> Schlachtung berücksichtigt werden muss. Auch die Trockenschlempe (DDGS) findet in<br />
einer Codex-Ration ihre Verwendung.<br />
Schweinemast:<br />
Für den Produktionsbereich Schweinemast wurden in Summe 36 praxisgerechte Modellvarianten aus 7 Basis-<br />
Rationen <strong>zur</strong> wirtschaftlichen Berechnung ausgearbeitet.<br />
Die Ferkelaufzucht musste dabei berücksichtigt werden, da gerade hier die Verwendung von SES eine besonders<br />
wichtige ernährungsphysiologische Rolle spielt. Die Futteraufnahme ist in diesem Bereich zwar gering, umso mehr<br />
Bedeutung ist hingegen der tierphysiologischen Qualität des Eiweißträgers beizumessen.<br />
Da der Anteil der Selbstmischer (Hof-Ration) bei Schweinemästern in Österreich sehr hoch ist, wurden jeweils eine<br />
Hofmischung <strong>und</strong> eine Industriemischung erstellt. Es war notwendig beide Varianten miteinzubeziehen, da sonst ein<br />
wesentlicher Teil der heimischen Futterproduktion ignoriert bliebe. Weiters wird zwischen Anfangmast <strong>und</strong> Endmast<br />
unterschieden, aber auch die Universalmast wurde berücksichtigt, da sie von ca. 50 % der Betriebe durchgeführt<br />
wird. Zusätzlich wurde als Eiweißalternative Trockenschlempe (DDGS) aus der Getreidedestillation in eine<br />
Universalmastration nach <strong>„gentechnikfrei“</strong>-Codex eingearbeitet, da dieses Futtermittel in Zukunft Bedeutung erlangen<br />
wird.<br />
Legehennenhaltung:<br />
Auch bei den Legehennen wurden neben intensiven auch extensive Haltungsformen im Rahmen der Studie<br />
berücksichtigt. Für die extensive Legehennenhaltung wurde eine Ration für die Produktion von Freilandeiern als<br />
Modellvorlage gewählt. Weiters wurde eine Junghennenration erstellt, um auch die ersten 4 Wochen vor Legebeginn<br />
zu berücksichtigen.<br />
Hühnermast:<br />
In der Hühnermast wurden für alle 3 in der Praxis üblichen Mastphasen Rationen erstellt.<br />
Eine Überschreitung der Obergrenze von 20% bei der Verwendung von „GVO-freiem“ SES aus Hard IP steht laut<br />
Information (e-Mail vom 7.4.2005) von Herrn Dr. Plsek, BMGF, in keinem Widerspruch <strong>zur</strong> Variante „getechnikfrei“.<br />
Dieser Umstand wurde in einer zusätzlichen Variante mit SES Hard IP berücksichtigt.<br />
Putenmast:<br />
In der Putenmast fanden die in der Praxis heute üblichen 6 Mastabschnitte ihre Berücksichtigung. Die Ration wurde<br />
von einem bekannten österreichischen Geflügelproduzenten bzw. dessen Mischfutterhersteller <strong>zur</strong> Verfügung gestellt<br />
<strong>und</strong> bestätigt somit ihre Praxistauglichkeit. Die Matrixvarianten ohne SES - Substitute „GVO-frei“ <strong>und</strong> Substitute<br />
<strong>„gentechnikfrei“</strong> - mussten nach Einspruch von mehreren im Prozess eingeb<strong>und</strong>enen Gutachtern aus<br />
ernährungsphysiologischer Sicht vollständig gestrichen werden, da Puten hinsichtlich der Akzeptanz beim Futter sehr<br />
eigenwilliges Verhalten zeigen.<br />
Für die Ration <strong>„gentechnikfrei“</strong> liegen Beschränkungen im SES-Gehalt bei 20% bezogen auf die Trockenmasse vor.<br />
Die Ration <strong>„gentechnikfrei“</strong> mit maximal 20% SES wurde von Putenexperten für gr<strong>und</strong>sätzlich möglich bef<strong>und</strong>en <strong>und</strong><br />
nicht abgelehnt, sollte aber mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden, da die Bewertung durch einen<br />
wissenschaftlich f<strong>und</strong>ierten Fütterungsversuch noch nicht bestätigt werden konnte.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 138 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 8: Rationsauswahl<br />
Da eine Überschreitung der Obergrenze von 20% bei der Verwendung von „GVO-freiem“ SES aus Hard IP laut<br />
Information von Herrn Dr. Plsek in keinem Widerspruch zum „Codex gentechnikfrei“ steht, wurde dies bei der<br />
Rationserstellung zusätzlich <strong>zur</strong> Matrixvorgabe berücksichtigt (= 2 „gentechnikfreie“ Codex – Rationen).<br />
Tabelle 8-2: Übersichtsdarstellung über die Entstehung der Futtermittelrationen unter Berücksichtigung<br />
der 5 Modell-Varianten, gemäß Vorgabe aus dem Leistungsverzeichnis <strong>zur</strong> Studie<br />
Produktionseinheit Ration x Phasen x Varianten<br />
Milchviehhaltung<br />
Rindermast<br />
Schweinemast<br />
Legehennenhaltung<br />
Hühnermast<br />
Putenmast<br />
SUMME<br />
4x2*x5=40<br />
2x5x5=50<br />
1x2x5=10<br />
Summe =60<br />
7x5=35<br />
+<br />
1x1 =(1Codex-Variante)=<br />
36<br />
3x1x5 =15<br />
1x3x5(6)=15 (18)<br />
1x6x3 (4) =18 (24)<br />
184 (193)<br />
Basisrationen<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
jeweils extensiv <strong>und</strong> intensive<br />
2xLeistungsstufen* (=20kg, 35kgMilch )<br />
bei jeweils<br />
-1Heuration (Winter)<br />
-1Weideration (Sommer)<br />
-1Grassilageration<br />
-1Gras/Maissilage-Ration<br />
2 Extensiv ( mit 5 Phasen)<br />
1 intensiv (2 Phasen)<br />
1Ferkelaufzucht<br />
1 Universalmast, 1 Anfang- <strong>und</strong> 1<br />
Endmast (Hof-Ration)<br />
1Unversalmast, 1Anfangs-<strong>und</strong> 1Endmast<br />
(Industrie-Ration)<br />
1Getreideschlempe (nur <strong>„gentechnikfrei“</strong>)<br />
1Legestarter<br />
1 Legealleinfutter,<br />
1Freilandration<br />
1 Mastration mit Phase I bis III<br />
(2 <strong>„gentechnikfrei“</strong>)<br />
1 Putenration mit Phase I bis VI<br />
keine Substitute <strong>„gentechnikfrei“</strong> oder<br />
„GVO-frei“, dafür 2 <strong>„gentechnikfrei“</strong> nach<br />
Codex<br />
Seite 139 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 9: Differenzkosten<br />
9. Differenzkosten bei der Erzeugung von tierischen Lebensmitteln bei<br />
Einsatz von „gentechnikfreien“ oder „GVO-freien“ Futterrationen im<br />
Vergleich zu als GVO gekennzeichneten Futterrationen sowie<br />
Kostenbetrachtung für tierische Lebensmittel in Österreich<br />
S. PÖCHTRAGER, J. PENZINGER, Institut für Marketing & Innovation, BOKU<br />
9.1. Kosten der Lebensmittel- <strong>und</strong> Futtermittelwirtschaft betreffend die Vermeidung<br />
von GVO in Österreich<br />
Es ist Aufgabe der Studie mögliche Differenzkosten zwischen der Produktion von tierischen Lebensmitteln mit<br />
Verwendung von „gentechnikfreien“ oder „GVO-freien“ Futtermitteln einerseits <strong>und</strong> mit Verwendung von<br />
konventionellen als GVO gekennzeichneten Futtermitteln andererseits, zu betrachten bzw. zu analysieren.<br />
Wie nachstehend ausgeführt, werden die Berechnungen der potenziellen Differenzkosten u.a. auf der Gr<strong>und</strong>lage der<br />
für die österreichische Tierhaltung repräsentativen Futterrationen gem. Kapitel 8 vorgenommen. Darin wurden<br />
unterschiedliche Intensitätsstufen – ausschließlich in der konventionellen Tierhaltung – berücksichtigt. Weitere<br />
Kostenelemente werden soweit Daten von der Futtermittelwirtschaft verfügbar sind, in die Berechnungen einbezogen<br />
bzw. wird die Höhe der Kosten nachstehend angeführt.<br />
Als repräsentatives Beispiel für ein österreichisches Qualitätsprogramm wurde das AMA-Gütesiegelprogramm der<br />
Agrar Markt Austria Marketing GmbH für die folgenden Berechnungen herangezogen, da dieses einen großen<br />
Marktanteil in vielen Produktionsbereichen aufweist. Das den Berechnungen zugr<strong>und</strong>e liegende Datenmaterial wurde<br />
teilweise von der Agrar Markt Austria Marketing GmbH <strong>zur</strong> Verfügung gestellt.<br />
Die Berechnungen werden auf der Basis begründeter Modellannahmen vorgenommen. Ein monetärer Mehraufwand<br />
bei Landwirten, Futtermittelhändlern <strong>und</strong> Futtermittelwerken ist, wie in Kapitel 7 dargestellt, zu erwarten. Es wurde<br />
versucht, die Berechnungen mit einem hohen Maß an Genauigkeit anhand von Fakten (z.B. Rohstoffe, Preise,<br />
Futtermittelrationen etc.) <strong>und</strong> andererseits auf der Basis von begründeten Annahmen durchzuführen. Einige mögliche<br />
Kostenelemente können nicht ausreichend quantifizierbar in das Berechnungsmodell einbezogen werden. Für die<br />
Kostenberechnungen wird davon ausgegangen, dass ausschließlich tiergerechte <strong>und</strong> ernährungsphysiologisch<br />
zulässige Futterrationen (unter Annahme von vergleichbarer Leistung) eingesetzt werden <strong>und</strong> die darin verwendeten<br />
Futtermittel in ausreichendem Ausmaß verfügbar sind.<br />
Untenstehende Abbildung soll veranschaulichen welche Teile der Wertschöpfungskette in den Betrachtungen der<br />
Differenzkosten berücksichtigt wurden.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 140 von 272
Landw. Erzeugung<br />
der<br />
Rohstoffe<br />
£££<br />
Landwirt<br />
tierische<br />
Produktion<br />
Transport<br />
<strong>und</strong><br />
Lager<br />
Transport<br />
<strong>und</strong><br />
Lager<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 9: Differenzkosten<br />
Mühle<br />
SES<br />
Verarbeitung<br />
tierische<br />
Produkte =<br />
Lebensmittel<br />
Transport<br />
<strong>und</strong><br />
Lager<br />
Transport<br />
<strong>und</strong><br />
Lager<br />
FM Werk<br />
<strong>und</strong>/oder<br />
Handel<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Handel /<br />
Verteiler<br />
Abbildung 9-1:Teile der Wertschöpfungskette in denen Differenzkosten aufgezeigt werden<br />
Transport<br />
<strong>und</strong><br />
Lager<br />
Konsument<br />
Soweit ausreichendes Zahlenmaterial <strong>zur</strong> Verfügung steht, werden Differenzkosten vom Futtermittelwerk bis zu den<br />
Landwirten aufgezeigt. Logistikkosten, die dem Futtermittelwerk <strong>und</strong> den Landwirten in der Beschaffung entstehen,<br />
konnten erhoben werden.<br />
Nicht berücksichtigt sind Kosten <strong>und</strong> Zuständigkeit einer Haftungsübernahme: Das Unternehmen, das die Haftung für<br />
eventuelle Verunreinigungen, Verschleppungen, usw. übernimmt, muss alle anderen, die am Wertschöpfungsprozess<br />
beteiligt sind schadlos halten. Zurzeit kann nicht abgeschätzt werden, wer die Haftung übernimmt bzw. wie hoch die<br />
Kosten einer solchen Haftungsübernahme sind.<br />
Kontrollkosten <strong>und</strong> zusätzliche Kosten für Logistik <strong>und</strong> Chargentrennung in den be- <strong>und</strong> verarbeitenden Betrieben<br />
sind nicht Teil dieser Studie (siehe Abbildung 9-1:Teile der Wertschöpfungskette in denen Differenzkosten<br />
aufgezeigt werden.<br />
Was nicht berücksichtigt wurde<br />
� Nicht berücksichtigt wurden Kosten, die durch die Umstellung <strong>und</strong> während der Umstellung von der<br />
Produktion als mit GVO gekennzeichneten Futtermitteln auf „GVO-freie“ oder „gentechnikfreie“ Produktion bei<br />
Landwirten <strong>und</strong> in Futtermittelwerken anfallen. In der Umstellungszeit auf „GVO-freie“ oder „gentechnikfreie“<br />
Produktion fallen die Mehrkosten bereits an, der Produkterlös bleibt allerdings noch gleich. Kosten für die<br />
Umstellung fallen beispielsweise dadurch an, dass sämtliche Futterlager <strong>und</strong> Fütterungsanlagen vollständig<br />
entleert <strong>und</strong> gereinigt werden müssen. In die Berechnungen fließen nur die Kosten in der laufenden Produktion<br />
ein.<br />
Der VERBAND DER FUTTERMITTELINDUSTRIE, 2005-07-14, gibt an, dass die Umstellungskosten ca. € 50.000,- je<br />
Futtermittelwerk betragen würden. Dieser Wert stammt aus Erfahrungen der Mischfutterindustrie, die durch die<br />
Umstellung auf Produktion von Mischfutter für die biologische Landwirtschaft gemacht wurden. In diesen<br />
Umstellungskosten sind neben den Kosten für kleine Umbauarbeiten <strong>und</strong> Reinigung vor allem die<br />
Deckungsbeitragsverluste infolge eines mindestens zweimonatigen Verkaufs von umgestellter „GVO-freier“ oder<br />
Seite 141 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 9: Differenzkosten<br />
„gentechnikfreier“ Ware noch zu konventionellen Preisen enthalten. Diese Umrüstkosten fallen in ungefähr der<br />
selben Höhe auch bei Landesproduktenhändlern <strong>und</strong> Lagerhäusern an. Die Gesamtzahl der betroffenen Betriebe<br />
beträgt damit ein Vielfaches der Mischfutterbetriebe. Für die Landwirtschaft können keine Kosten erhoben<br />
werden, da die diese in den einzelnen Betrieben unterschiedlich hoch sind.<br />
� Es wird davon ausgegangen, dass die Futterlagerung <strong>und</strong> -zubereitung (Schroten oder Mahlen <strong>und</strong> Mischen) mit<br />
den am Betrieb vorhandenen Einrichtungen erfolgt. Eine eventuelle Änderung der mit der Futterzubereitung<br />
verb<strong>und</strong>enen technischen Anlagen <strong>und</strong> der damit einhergehende Aufwand gehen nicht in die Berechnungen<br />
ein. Eventuelle Produktionsmehrkosten bei der Futterherstellung werden ebenfalls nicht bewertet.<br />
Wenn in Futtermittelwerken ausschließlich „GVO-freies“ oder „gentechnikfreies“ Futter produziert werden darf,<br />
geht der VERBAND DER FUTTERMITTELINDUSTRIE, 2005-07-14, davon aus, dass keine zusätzlichen Investitionskosten<br />
anfallen. Sollte jedoch eine Parallelproduktion (völlig getrennte Prozesse ohne Überschneidung der<br />
Warenströme in einem Werk) trotzdem gefordert werden, fallen enorme Investitionskosten für zusätzliche<br />
Lagerräume, Produktionslinien sowie Transportmittel an. Detailkosten hierzu können zum derzeitigen Zeitpunkt<br />
nicht genannt werden. Aus dem landwirtschaftlichen Sektor sind keine Zahlen bekannt.<br />
� Zusätzliche Verwaltungskosten sind schlecht quantifizierbar <strong>und</strong> werden im Rahmen dieser Studie nicht<br />
erhoben. Der VERBAND DER FUTTERMITTELINDUSTRIE, 2005-07-14, beziffert die zusätzlichen Verwaltungskosten je<br />
Futtermittelwerk <strong>und</strong> je Handelsfirma mit ca. € 50.000,- jährlich. Zusätzliche Verwaltungskosten in der<br />
Landwirtschaft können zum jetzigen Zeitpunkt nicht quantifiziert werden.<br />
� Des weiteren gehen jene Mehrkosten nicht in die Berechnung ein, die für den Zukauf von Tieren aus<br />
Betrieben mit „GVO-freier“ oder „gentechnikfreier“ Fütterung anfallen (z.B. Ferkel für die Schweinemast). Bei<br />
Milchkühen, Kälbern <strong>und</strong> Legehennen ist es erforderlich eine bestimmte Umstellungszeit einzuhalten (nach<br />
Codex, nicht nach VO (EG) 1829/2003).<br />
� Erhöhte Tierarztkosten, die durch den eventuellen Einsatz von speziellen Medikamenten <strong>und</strong><br />
Vitaminpräparaten o.ä. anfallen, finden ebenfalls keine Beachtung in der Bewertung. Es kann keine Literatur<br />
ausfindig gemacht werden, die Angaben über die Höhe dieser Kosten zulässt.<br />
� Kosten für die Implementierung <strong>und</strong> Aufrechterhaltung von Qualitätsmanagement- <strong>und</strong><br />
Qualitätssicherungssystemen werden nicht in die Berechnungen aufgenommen. Zu diesem Punkt wird<br />
ebenfalls keine ausreichende Literaturquelle gef<strong>und</strong>en.<br />
Nach eingehender Recherche <strong>und</strong> Analyse erscheint es nicht zulässig für die oben genannten Kostenfaktoren<br />
pauschale Multiplikatoren oder Sätze in das Rechenmodell aufzunehmen, da die anfallenden Kosten ausschließlich in<br />
einer Fall-zu-Fall-Bewertung objektiv <strong>und</strong> signifikant ermittelt werden können.<br />
In der Studie MODER et. al, 2004, 93 wurde untersucht, ob es möglich ist, konventionelles, als GVO gekennzeichnetes<br />
<strong>und</strong> „GVO-freies“ oder „gentechnikfreies“ Futter in einem Futtermittelwerk herzustellen. Die Autoren kommen zu dem<br />
Schluss, dass dies nicht möglich ist. Die in dieser Studie berechneten Mehrkosten (bei paralleler Produktion) betragen<br />
ca. € 20,- je t in einem Futtermittelwerk produziertem Futtermittel. Es ist davon auszugehen, dass ein Teil der<br />
Mehrkosten in den Futtermittelwerken entfallen, wenn nur „GVO-freie“ oder „gentechnikfreie“ Futtermittel produziert<br />
werden. Die Kosten, die in der Studie von MODER et al. erhoben wurden verteilen sich wie folgt:<br />
� 5 % Analysekosten<br />
Im Zuge des Eigenkontrollsystems müssen Proben gezogen <strong>und</strong> von einem akkreditierten Labor analysiert<br />
werden. Die Analysekosten liegen laut Studie bei € 200,- bis € 250,- je Probe. Die aktuellen Preise liegen bei<br />
ca. € 185,-.<br />
� 38 % Produktionskosten<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 142 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 9: Differenzkosten<br />
Unter Produktionskosten sind Personalkosten, Energiekosten, Instandhaltungskosten u.ä. zusammengefasst.<br />
Die zusätzlichen Produktionskosten entstehen vor allem durch die Verlängerung der Produktionszeit.<br />
� 5 % Verwaltung<br />
Hier werden alle Tätigkeiten zusammengefasst, die zusätzlich <strong>zur</strong> konkreten Produktion notwendig sind. Der<br />
Mehraufwand beginnt mit der Planung <strong>und</strong> Beschaffung. Für „GVO-freie“ oder „gentechnikfreie“ Produkte<br />
müssen Futterrationen angepasst werden. Es sind mehr Aufzeichnungen <strong>und</strong> eine detaillierte Dokumentation<br />
notwendig. Die notwendigen Kontrollen müssen vorbereitet <strong>und</strong> begleitet werden.<br />
� 49 % Rohstoffkosten<br />
Die erhöhten Rohstoffkosten entstehen durch den Einsatz von „GVO-freien“ oder „gentechnikfreien“<br />
Futtermitteln.<br />
� 3 % Kontrollkosten<br />
Die „GVO-freie„ oder „gentechnikfreie“ Produktion muss von akkreditierten Kontrollstellen überprüft werden.<br />
9.1.1. Durchschnittliche Produktionsmengen je Betrieb<br />
Die Differenzkosten müssen von jenen Produkten getragen werden, die den Qualitätskriterien, <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> „GVO-<br />
frei“ oder <strong>„gentechnikfrei“</strong>, entsprechen <strong>und</strong> für die ein Mehrerlös erzielt werden kann. Zu den einzelnen<br />
Produktionsbereichen sind Tabellen angeführt, aus denen die Produktionsmenge ersichtlich ist, die mit einer<br />
bestimmten Anzahl von Tieren in einem durchschnittlichen österreichischen Betrieb erzielt werden kann. In der<br />
rechten Spalte sind die Quellenangaben angeführt. Jene Zahlen, die von der AMA Marketing GmbH stammen, sind<br />
Daten aus den derzeitigen Gütesiegelprogrammen. Für Bereiche, wo keine Daten durch die AMA Marketing GmbH<br />
<strong>zur</strong> Verfügung standen, wird auf allgemein gültige Daten aus den beschriebenen Quellen <strong>zur</strong>ückgegriffen.<br />
9.1.2. Futterdifferenzkosten<br />
In diesem Kapitel werden zunächst die Berechnungsgr<strong>und</strong>lagen vorgestellt. Es wird beschrieben, anhand welcher<br />
Rationen die Differenzkosten berechnet wurden. Die Auswertung <strong>und</strong> Interpretation der Ergebnisse erfolgt ebenfalls<br />
in diesem Kapitel.<br />
9.1.2.1. Berechnungsgr<strong>und</strong>lagen<br />
Jeder landwirtschaftliche Betrieb hat seine Besonderheiten, <strong>und</strong> viele Produktionsfaktoren variieren in Abhängigkeit<br />
vom Betrieb. Daher müssen für die Berechnungen Annahmen getroffen werden. Es wird versucht, dadurch einen<br />
möglichst großen Teil der heimischen Landwirtschaft zu repräsentieren.<br />
Futterrationen:<br />
Die detaillierte Beschreibung der Rationen erfolgt in Kapitel 8.<br />
Futtermengen:<br />
Der Verbrauch der einzelnen Futtermittel ist in den Rationen teils in kg Frischmasse, teils in Prozentsätzen vom<br />
Gesamtfutterverbrauch angegeben. Im letztgenannten Fall muss die Lebendgewichtszunahme des Mastabschnitts mit<br />
der Futterverwertung multipliziert werden, um den Futterverbrauch zu errechnen. Durch die Multiplikation mit den<br />
Prozentangaben aus den jeweiligen Rationen ergibt sich der Verbrauch in kg Futtermittel.<br />
Kostenelemente, Preise:<br />
Eine entscheidende Berechnungsgr<strong>und</strong>lage stellen die zu Gr<strong>und</strong>e gelegten Preise der Rohstoffe <strong>und</strong> Zusatzstoffe dar.<br />
Da die meisten landwirtschaftlichen Betriebe in Österreich umsatzsteuerrechtlich pauschaliert sind, werden für alle<br />
Futtermittel Bruttopreise inkl. Umsatzsteuer herangezogen. Die erhobenen Preise sind Notierungspreise <strong>und</strong><br />
enthalten keine Frachtkosten. Daher wurde nach Rücksprache mit Experten aus der Futtermittelwirtschaft € 10,- je t<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 143 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 9: Differenzkosten<br />
als Pauschalwert zum Nettopreis hinzugerechnet. Für die Logistik von „GVO-freiem“ oder „gentechnikfreiem“ Futter<br />
entstehen zusätzliche Logistikkosten, die vom VERBAND DER FUTTERMITTELINDUSTRIE, 2005-07-14, wie folgt angegeben<br />
werden: Infolge wesentlich erhöhter Zustellungsradien für Fertigprodukte zu den Landwirten ergibt sich ein<br />
zusätzlicher Kostensatz von Minimum EUR 7,- je t Mischfutter bzw. je Tonne SES im Handel. Als zusätzliche<br />
Logistikkosten für den Beschaffungsmarkt fallen in den Futtermittelwerken weitere EUR 2,- je t bezogenes<br />
Eiweißfutter an.<br />
Viele Futtermittelpreise unterliegen sowohl im Jahresverlauf als auch über mehrere Jahre hinweg gesehen ständigen<br />
Schwankungen. Es wird daher nicht ein bestimmter Zeitpunkt für die Preiserhebung gewählt, sondern auf einen<br />
Zeitraum aus der näheren Vergangenheit (die Jahre 2003 <strong>und</strong> 2004) <strong>zur</strong>ückgegriffen. Eiweißfuttermittel spielen auf<br />
Gr<strong>und</strong> des hohen Einsatzes von (vor allem „gentechnisch“ verändertem) SES <strong>und</strong> wegen der Tatsache, dass sie vom<br />
überwiegenden Teil der Betriebe zugekauft werden, eine besondere Rolle. Daher wurde bei der Auswahl des<br />
Erhebungszeitraums darauf geachtet, dass in den Erhebungszeitraum sowohl eine Tief- als auch eine Hochpreisphase<br />
der wichtigsten Eiweißfuttermittel fallen, die beide nach Möglichkeit nicht weit in der Vergangenheit liegen. Wie aus<br />
Abbildung 9-2 ersichtlich stellen die Jahre 2003 <strong>und</strong> 2004 einen günstigen Zeitraum dar.<br />
400,00<br />
350,00<br />
300,00<br />
250,00<br />
€ je t<br />
200,00<br />
150,00<br />
100,00<br />
50,00<br />
-<br />
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X XI. XII.<br />
2003 2004<br />
SES mit 49 % Rohprotein, ohne GVO hergestellt<br />
SES mit 49 % Rohprotein, aus GVO hergestellt<br />
Rapsschrot<br />
Sonnenblumenschrot<br />
Körnererbse<br />
Abbildung 9-2: Preise für Eiweißprodukte <strong>zur</strong> Futtermittelherstellung in den Jahren 2003 <strong>und</strong> 2004<br />
Quelle: Eigene Abbildung nach Daten aus der Preiserhebung<br />
Alle den Berechnungen zugr<strong>und</strong>e gelegten Rohstoffpreise sind Durchschnittspreise aus den Jahren 2003 <strong>und</strong> 2004.<br />
Einzige Ausnahme stellt DDGS dar, weil dieses Produkt derzeit am Markt noch nicht erhältlich ist. Es wird daher von<br />
einem österreichischen Hersteller ein fiktiver Preis angegeben. Die Preisfindung für „GVO-freien“ (nicht<br />
„gentechnikfreien“, da nicht oder kaum verfügbar) SES wirft einige Schwierigkeiten auf, da er erst seit<br />
Kalenderwoche 28/2004 an der Wiener Börse für landwirtschaftliche Produkte notiert. Der Vorgang der<br />
Preisermittlung ist folgender: Aus der Studie von MODER et al. 2004, 90 kann entnommen werden, dass im Jahr 2003<br />
der Preisaufschlag gegenüber konventionellem SES mit 49 % Rohprotein 15 – 20 % betrug. Nachdem der Preis für<br />
„GVO-Ware“ auf Gr<strong>und</strong> der Börsennotierungen bekannt ist, wird für 2003 ein Aufschlag von 17,5 % hinzugerechnet.<br />
Für das erste Halbjahr 2004 werden von DI MESSNER, 2005-06-01, <strong>und</strong> von ING. KNITTELFELDER, 2005-06-06,<br />
Monatsdurchschnittspreise <strong>zur</strong> Verfügung gestellt. Die Preise für das zweite Halbjahr 2004 stammen aus<br />
Notierungsdaten der Wiener Börse. Aus den genannten Daten wurde der gewichtete Mittelwert des Preises für „GVO-<br />
freien“ SES mit 49 % Rohprotein errechnet. Laut Auskunft von DI MESSNER, 2005-06-01 wird „GVO-freier“ SES mit 44<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 144 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 9: Differenzkosten<br />
% Rohprotein um r<strong>und</strong> € 15,- je t billiger gehandelt, jedoch kaum verwendet. Dieser Betrag wird vom Preis für „GVO-<br />
freien“ SES mit 49 % Rohprotein abgezogen, um den Preis für „GVO-freien“ SES mit 44 % Rohprotein zu erhalten.<br />
Den Preis für HP-Soja Hard-IP erhält man, in dem man laut Auskunft von DI HISSEK, 2005-05-12 zum Preis für<br />
konventionellen, als GVO gekennzeichneten, SES € 30,- je t hin<strong>zur</strong>echnet. Im Erhebungszeitraum war kein<br />
signifikanter Preisunterschied zwischen Hard <strong>und</strong> Soft-IP Ware feststellbar. Das ist darauf <strong>zur</strong>ückzuführen, dass bei<br />
der Fütterung nach Codex die Regelung gilt, dass die Höhe des Soft-IP Sojaeinsatzes mit 10 bzw. 20 % der<br />
Futterration begrenzt ist. Seit 2005-04-07 kann Hard-IP-Soja unbegrenzt eingesetzt werden <strong>und</strong> wird daher seit<br />
diesem Zeitpunkt stärker nachgefragt (BMGF, Mitteilung DR. PLSEK).<br />
Die Quellen für die erhobenen Preise sind der AMA Marktbericht Februar 2005, die Notierungspreise der Wiener<br />
Börse für landwirtschaftliche Produkte, Angaben von DI DULLNIG <strong>und</strong> DI STERINGER, 2005-05-12, <strong>und</strong> DR. GATTERMAYER,<br />
2005-05-15, sowie Angaben von DI HAYDINGER, <strong>und</strong> DI KICKINGER, 2005-04-28. Es wird ausdrücklich darauf<br />
hingewiesen, dass es laut DI KICKINGER, 2005-04-21, im Erhebungszeitraum 2003/2004 keine Preisunterschiede<br />
zwischen Zusatzstoffen (Aminosäuren, Vitaminen, Enzymen <strong>und</strong> Spurenelementen), die mit „gentechnisch“<br />
veränderten Mikroorganismen hergestellt wurden <strong>und</strong> solchen, die nicht mit „gentechnisch“ veränderten<br />
Mikroorganismen hergestellt wurden, gab. Die Verfügbarkeit „gentechnikfreier“ Zusatzstoffe wird jedoch zunehmend<br />
schwieriger. Daher ist es naheliegend anzunehmen, dass dies in Zukunft Einfluss auf die Preise haben wird. Der<br />
VERBAND DER FUTTERMITTELINDUSTRIE, 2005-07-14, gibt an, dass die Mehrkosten für die Zusatzstoffe bei derzeitiger<br />
Preislage € 4,- je t Mischfutter betragen. Dieser Wert wird aber nicht in die Berechnungen aufgenommen, da er<br />
außerhalb des Preiserhebungszeitraums (2003 <strong>und</strong> 2004) liegt.<br />
Maiskornsilage stellt zwar die Hauptfuttergr<strong>und</strong>lage in der heimischen Schweinemast dar, wird aber fast vollständig<br />
von diesen Betrieben selbst erzeugt. Das hat <strong>zur</strong> Folge, dass es keinen Marktpreis für dieses Futtermittel gibt. Es ist<br />
zwar bekannt, dass gelegentlich ein regional begrenzter Handel stattfindet, diese Preise stellen allerdings keine<br />
offizielle Notierung dar <strong>und</strong> können hier auch nicht zitiert werden. Eine Möglichkeit <strong>zur</strong> Preisfindung besteht darin,<br />
Maiskornsilage anhand von Daten aus dem Standarddeckungsbeitragskatalog mit dem Herstellungswert zu bewerten.<br />
Zur Kalkulation der Futterkosten wird der Mittelwert der Herstellungswerte bei Erträgen zwischen 65 <strong>und</strong> 100 dt<br />
Trockenmais herangezogen.<br />
9.1.2.2. Durchführung der Kostenberechnungen<br />
Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der bereits in Kapitel 8 beschriebenen Fütterungsvarianten, die<br />
bei der Auswahl der Rationen herangezogen wurde. Sie dient an dieser Stelle als Übersicht <strong>und</strong> Hilfestellung für die<br />
weiteren Ausführungen:<br />
Konven-<br />
tionell<br />
mit GVO<br />
SES aus GVO x<br />
Futter mit „GVOfreiem“<br />
SES<br />
SES „GVO-frei“ x<br />
Max. 20 % SES „GVO-frei“<br />
Soft-IP<br />
Zusatzstoffe mit GVM<br />
hergestellt<br />
Zusatzstoffe ohne GVM<br />
hergestellt<br />
Futter mit<br />
„gentechnikfreiem“<br />
SES<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
x<br />
Futter ohne SES,<br />
mit Substituten<br />
„GVO-frei“<br />
x x x<br />
Futter ohne SES,<br />
mit Substituten<br />
<strong>„gentechnikfrei“</strong><br />
x x<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich werden alle Berechnungen nach demselben Prinzip durchgeführt. Die Futtermenge wird den Rationen<br />
entnommen oder anhand der Rationen berechnet. Diese Futtermengen werden dann mit den Preisen für das<br />
Seite 145 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 9: Differenzkosten<br />
jeweilige Futtermittel multipliziert. Die Summe der Produkte dieser Multiplikationen bilden die Futterkosten je Tier.<br />
Als Basis für die Berechnung der Differenzkosten dienen die Futterkosten bei konventioneller Produktion, d.h. als mit<br />
GVO gekennzeichneten Futtermitteln. Die Differenzkosten ergeben sich aus der Differenz zwischen den jeweiligen<br />
Varianten <strong>und</strong> der Produktion mit GVO. Die Differenzkosten werden als prozentueller Minder- oder Mehraufwand im<br />
Verhältnis <strong>zur</strong> konventionellen Produktion als mit GVO gekennzeichneten Futtermitteln (=100 %) ausgedrückt.<br />
Für die Rinderhaltung wird angenommen, dass der Gr<strong>und</strong>futterverbrauch aller Varianten, bei denen dasselbe<br />
Gr<strong>und</strong>futter eingesetzt wird, gleich hoch ist. Deshalb werden nur die Kraftfutterkosten berechnet. Das hat <strong>zur</strong> Folge,<br />
dass nur Varianten mit derselben Gr<strong>und</strong>futterbasis miteinander vergleichbar sind.<br />
Bei der Produktion von „GVO-freien“ oder „gentechnikfreien“ tierischen Produkten fallen eine Reihe von<br />
unterschiedlichen Kosten an. Die folgende Tabelle soll einen Überblick darüber geben, welche Kosten anfallen können<br />
<strong>und</strong> welche von diesen Kosten direkt in das Berechnungsmodell der Futterdifferenzkosten aufgenommen werden <strong>und</strong><br />
in den Abbildungen dargestellt sind.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 146 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 9: Differenzkosten<br />
Tabelle 9-1: Anfallende Kosten <strong>und</strong> deren Berücksichtigung in der Berechnung der Futterdifferenzkosten<br />
Anfallende Kosten bei „GVO-freier“<br />
oder „gentechnikfreier“ Produktion<br />
FM Handel FM Werk Landwirt<br />
Rohstoffkosten (gewichtet aus den<br />
Jahren 2003 <strong>und</strong> 2004)<br />
(Beim Wiederkäuer nur Kraftfutter)<br />
berücksichtigt berücksichtigt berücksichtigt<br />
Zusatzstoffkosten<br />
nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt<br />
(nicht vorhanden in den (nicht vorhanden in den (nicht vorhanden in den<br />
Jahren 2003 <strong>und</strong> 2004) Jahren 2003 <strong>und</strong> 2004) Jahren 2003 <strong>und</strong> 2004)<br />
Gr<strong>und</strong>futterkosten wie Heu,<br />
Maisganzpflanzen- <strong>und</strong> Grassilage<br />
fallen nicht an fallen nicht an fallen nicht an<br />
Erhöhte Logistikkosten berücksichtigt<br />
berücksichtigt<br />
berücksichtigt<br />
(Beschaffung für FM (Beschaffung für FM (Beschaffung für<br />
Handel, 2 €/t,<br />
Werk, 2 €/t, Zustellung Selbstmischer, 9 €/t)<br />
Zustellung zum<br />
Landwirt, 7 €/t)<br />
zum Landwirt, 7 €/t)<br />
Kontrollkosten durch externe Kontrolle nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt<br />
Externe Untersuchungskosten nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt<br />
Eigenkontrolle am Betrieb nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt<br />
Einmalige Umstellkosten nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt<br />
Einmalige Investitionskosten nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt<br />
Verwaltungs- <strong>und</strong><br />
Dokumentationskosten<br />
nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt<br />
Mehrkosten für Zukauf von Tieren<br />
(nach Codex)<br />
fallen nicht an fallen nicht an nicht berücksichtigt<br />
Kosten für Haftungsübernahme nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt<br />
Tierarztkosten fallen nicht an fallen nicht an nicht berücksichtigt<br />
Mögliche Leistungseinbußen bei den<br />
Tieren<br />
fallen nicht an fallen nicht an nicht berücksichtigt<br />
Preisänderungen bei Rohstoffen nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt<br />
Mehrkosten für andere nicht als<br />
<strong>„gentechnikfrei“</strong>, mit entsprechenden<br />
Zuschlägen, vermarktbare Produkte<br />
anderer<br />
Nutzungsrichtungen/Tiergattungen<br />
nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt<br />
höherer Managementaufwand nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt<br />
Verfügbarkeit von Roh- <strong>und</strong><br />
Zusatzstoffe<br />
Anfallende zusätzliche Kosten beim<br />
„Codex“ im Vergleich zu VO (EG)<br />
1829/2003<br />
nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt<br />
a) Düngemittel/Pflanzenschutzmittel in<br />
der Pflanzenproduktion<br />
nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt<br />
b) Nichtverwendung von GVM in der<br />
Zusatzstoffproduktion<br />
nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt<br />
c) Differenzierung von „Soft- <strong>und</strong> Hard-<br />
IP mit Begrenzungen in der<br />
Anwendung“ (ohne Standardvorgabe)<br />
nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt<br />
d) Aufwand im Zusammenhang mit den<br />
Umstellungszeiträumen<br />
nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt<br />
e) zusätzliche Kosten für die<br />
Komposition von Futterrationen<br />
aufgr<strong>und</strong> verminderter Verfügbarkeit<br />
der Roh- <strong>und</strong> Zusatzstoffe <strong>und</strong> damit<br />
verb<strong>und</strong>ener Kosten (Logistik,<br />
Administration, Vorratshaltung,<br />
Produktionsausfälle, Verwaltung etc.)<br />
nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt<br />
f) zusätzliche Kontrollkosten, Kosten für<br />
das Haftungsrisiko, mögliche<br />
zusätzliche Investitionskosten etc.<br />
betreffend der Punkte a) bis e)<br />
nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 147 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 9: Differenzkosten<br />
9.1.2.3. Ergebnisse <strong>und</strong> Interpretation der Futterdifferenzkosten (Mehr- <strong>und</strong> Minderkosten)<br />
Die Berechnungen haben eine Reihe von Ergebnissen geliefert, die in diesem Abschnitt beschrieben werden. Für alle<br />
Nutzungsrichtungen gilt, dass die Differenzkosten in erster Linie von der Höhe des Einsatzes von SES (inkl.<br />
zusätzlicher Logistikkosten) in der Ration abhängen. Je höher der Anteil von SES, desto höher fallen die<br />
Differenzkosten aus. Auffallend ist auch, dass viele Rationen, in denen SES vollständig substituiert wird,<br />
kostengünstiger wären als Rationen konventioneller Fütterung (mit GVO-SES). Es ist jedoch anzumerken, dass<br />
die ausreichende Verfügbarkeit der Substitue derzeit in Österreich nicht gegeben ist, siehe Kapitel 3,<br />
Tabelle 3-24, auch die Verfügbarkeit bestimmter Zusatzstoffe bei den Monogastrien nach Codex ist<br />
nicht gegeben, siehe Kapitel 4, Tabelle 4 -11, daher werden in weiterer Folge Kreuze über Teile der<br />
Abbildungen gelegt. Substitute erfordern eine differenziertere Betrachtung in Region, Logistik,<br />
Qualitätsabstimmung des Futtermittels, differenzierte Verfügbarkeiten, etc. <strong>und</strong> führen damit aller Voraussicht nach<br />
zu mehr Kosten im Management, die durch das Kostenrechnungsmodell nicht ausgedrückt werden. Abbildung 9-2<br />
veranschaulicht, dass sich die Preise für Raps-, Sonnenblumenextraktionsschrot <strong>und</strong> Körnererbse am Preis für SES<br />
orientieren.<br />
Es wird darauf hingewiesen, dass es notwendig ist, die Interpretation der einzelnen Ergebnisse zu<br />
beachten, um diese beurteilen zu können. Die Differenzkosten nur anhand der Ergebnisse, die in den<br />
Tabellen aufgelistet <strong>und</strong> in den Abbildungen dargestellt sind, zu beurteilen, kann zu<br />
Fehlinterpretationen führen.<br />
9.1.2.3.1. Milcherzeugung:<br />
Für die Berechnungen werden die Leistungen eines durchschnittlichen österreichischen Milchviehbetriebs<br />
herangezogen:<br />
Tabelle 9-2: Leistung eines durchschnittlichen österreichischen Milchviehbetriebs<br />
Milch Grüner Bericht 2004,<br />
Leistung 46.913 kg Milch je Betrieb <strong>und</strong> Jahr Seite 206<br />
ø Anteil im Qualitätsprogramm 97,88% Seite 82<br />
ø Leistung im Qualitätsprogr. 45.918 kg Milch je Betrieb u. Jahr Seite 82<br />
Milchleistung je Kuh 4.634 kg Seite 206<br />
Anzahl der Kühe 10,1 je Betrieb<br />
Es wird mit vier verschiedenen Gr<strong>und</strong>futtervarianten gerechnet. Dadurch ist bei der Interpretation der Ergebnisse<br />
Vorsicht geboten. Es dürfen nur Varianten, in denen dasselbe Gr<strong>und</strong>futter eingesetzt wird, miteinander verglichen<br />
werden. Vergleiche zwischen verschiedenen Gr<strong>und</strong>futtervarianten sind nicht zulässig, weil erstens die<br />
Gr<strong>und</strong>futterkosten, die ein wichtiger Bestandteil der Gesamtfutterkosten sind, unterschiedlich hoch sind <strong>und</strong> zweitens<br />
das jeweilige Kraftfutter auf das Gr<strong>und</strong>futter abgestimmt ist, wodurch die Zusammensetzung des Kraftfutters mehr<br />
oder weniger stark variiert. Die Ergebnisse sind in den folgenden Abbildungen zusammengefasst:<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 148 von 272
15%<br />
10%<br />
5%<br />
0%<br />
-5%<br />
-10%<br />
-15%<br />
-20%<br />
-25%<br />
Futter Kraftfutter mit GVO-freiem mit „GVO-freiem“ SES<br />
nach SES VO (EG) 1829/2003<br />
Futter Kraftfutter mit GVO-freiem mit SES<br />
nach „gentechnikfreim“ Codex SES<br />
Futter Kraftfutter ohne ohne SES SES nach nach VO VO<br />
(EG) (EG) 1829/2003<br />
Futter Kraftfutter ohne ohne SES nach<br />
Codex SES nach Codex<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 9: Differenzkosten<br />
Grassilage Heu Maissilage Weide<br />
5% 5% 8% 1%<br />
5% 5% 8% 1%<br />
X<br />
-7%<br />
X<br />
-6%<br />
X<br />
-19%<br />
X<br />
1%<br />
-7% -6% -19% 1%<br />
Abbildung 9-3: Kraftfutterdifferenzkosten bei 20 kg Milchleistung je Tag<br />
Anmerkungen <strong>zur</strong> Abbildung:<br />
� Die Berechnungen werden anhand von 20 Modellrationen durchgeführt.<br />
� Die eingesetzten Rohstoffpreise sind gemittelte Preise aus den Jahren 2003 <strong>und</strong> 2004.<br />
� Die uneingeschränkte Verfügbarkeit aller Rohstoffe wurde zu Berechnungszwecken angenommen, die<br />
Verfügbarkeit von Substituten ist jedoch derzeit nicht ausreichend gegeben (Verfügbarkeit Substitute in<br />
Österreich siehe Kapitel 3, Tabelle 3-24). Deshalb müssen Rationen, die Substitute enthalten, derzeit<br />
„gestrichen“ werden.<br />
X<br />
X<br />
� Preisänderungen bei Substituten bei geänderter Nachfrage sind nicht berücksichtigt.<br />
� Weitere berücksichtigte <strong>und</strong> nicht berücksichtigte Kosten sind in Tabelle 9-1 angeführt.<br />
X<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
X<br />
Seite 149 von 272
Kraftfutter mit “GVO-<br />
freiem“ SES<br />
SES<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 9: Differenzkosten<br />
Abbildung 9-4: Kraftfutterdifferenzkosten bei 35 kg Milchleistung je Tag<br />
Anmerkungen <strong>zur</strong> Abbildung:<br />
� Die Berechnungen werden anhand von 20 Modellrationen durchgeführt.<br />
� Die eingesetzten Rohstoffpreise sind gemittelte Preise aus den Jahren 2003 <strong>und</strong> 2004.<br />
� Die uneingeschränkte Verfügbarkeit aller Rohstoffe wurde zu Berechnungszwecken angenommen, die<br />
Verfügbarkeit von Substituten ist jedoch derzeit nicht ausreichend gegeben (Verfügbarkeit Substitute in<br />
Österreich siehe Kapitel 3, Tabelle 3-24). Deshalb müssen Rationen, die Substitute enthalten, derzeit<br />
„gestrichen“ werden.<br />
� Preisänderungen bei Substituten bei geänderter Nachfrage sind nicht berücksichtigt.<br />
� Weitere berücksichtigte <strong>und</strong> nicht berücksichtigte Kosten sind in Tabelle 9-1 angeführt.<br />
Erklärungen zu den Milchrationen (20 kg <strong>und</strong> 35 kg Milch):<br />
Gr<strong>und</strong>futterbasis Grassilage:<br />
Grassilage erfordert einen relativ niedrigen Einsatz an eiweißreichem Kraftfutter. Die Kostensteigerungen durch die<br />
Umstellung von konventionellem SES (GVO-gekennzeichnet) auf „GVO-freien“ liegen bei ca. 5,3 %. Durch den<br />
Einsatz von Rapsextraktionsschrot <strong>und</strong> Erbsen statt SES sinken nach den oben genannten Modellannahmen die<br />
Kraftfutterkosten.<br />
Gr<strong>und</strong>futterbasis Heu:<br />
10%<br />
5%<br />
0%<br />
-5%<br />
-10%<br />
-15%<br />
-20%<br />
-25%<br />
Kraftfutter mit<br />
“gentechnikfreiem” SES<br />
Kraftfutter SES ohne SES nach<br />
VO (EG) 1829/2003<br />
Kraftfutter ohne SES nach<br />
Codex<br />
X<br />
X<br />
X<br />
Grassilage Heu Maissilage Weide<br />
5% 6% 7% 3%<br />
5% 6% 7% 3%<br />
-6%<br />
X<br />
-9% -14% -1%<br />
-6% -9% -14% -1%<br />
X X X<br />
Wenn Heu die Gr<strong>und</strong>futterbasis bildet, ist der Einsatz an eiweißreichem Kraftfutter analog <strong>zur</strong> Grassilagefütterung<br />
eher gering. Die Ergebnisse sind daher ähnlich. Der Einsatz der Substitutionsprodukte Rapsextraktionsschrot <strong>und</strong><br />
DDGS bringt nach den oben genannten Modellannahmen eine Kostenreduktion.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
X<br />
Seite 150 von 272
Gr<strong>und</strong>futterbasis Maissilage:<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 9: Differenzkosten<br />
Der hohe Energiegehalt in der Maissilage erfordert einen hohen Rohproteingehalt im Kraftfutter. Wenn dazu SES<br />
verwendet wird, führt das bei Einsatz von „GVO-freiem“ SES zu Preissteigerungen. Dadurch ergibt sich nach den<br />
oben genannten Modellannahmen auch die Kostenreduktion durch den Einsatz von Raps- <strong>und</strong><br />
Sonnenblumenextraktionsschrot.<br />
Gr<strong>und</strong>futterbasis Weide:<br />
Bei dieser Variante sind in den Rationen für 20 kg Milch mit Getreide, Trockenschnitte <strong>und</strong> Mineralstoffmischung nur<br />
Futtermittel enthalten, die auch in der konventionellen Milchviehhaltung aus „gentechnikfreier“, heimischer<br />
Produktion stammen. Dadurch ergibt sich ein Kostenunterschied von unter 1 % durch die Umstellung, weil in der<br />
Modellration Mais eingesetzt wird, <strong>und</strong> dieser zertifiziert sein muss. Wenn die Kuh eine Milchleistung von 35 kg<br />
erreicht, ist der Anteil der benötigten Eiweißergänzung, <strong>und</strong> damit die Höhe des SES-Einsatzes, ebenfalls gering. SES<br />
wird in der Modellration (ohne SES) durch Rapsextraktionsschrot ersetzt.<br />
Von der abgelieferten Milchmenge werden 97,88 % als Milch im Qualitätsprogramm verkauft. Daher verändern sich<br />
die Kraftfutterkosten je kg Milch im Qualitätsprogramm gegenüber den bisher beschriebenen Differenzkosten<br />
abermals geringfügig.<br />
Die in den Ergebnissen angeführten Futterdifferenzkostenen beziehen sich nur auf das Kraftfutter. Die<br />
Kraftfutterkosten stellen allerdings nur einen Teil der gesamten Futterkosten dar, <strong>und</strong> zwar je nach Gr<strong>und</strong>futterbasis<br />
etwa 10 – 50 %. Der Kostenanteil des Kraftfutters steigt mit zunehmendem Energiegehalt bzw. abnehmendem<br />
Rohproteingehalt des Gr<strong>und</strong>futters <strong>und</strong> mit zunehmender Milchleistung.<br />
Einen weiteren Kostenfaktor in der „GVO-freien“ oder „gentechnikfreien“ Produktion stellen die später in Kapitel 9.1.3<br />
beschriebenen Kontrollkosten dar. Werden diese mit den geänderten Futterkosten addiert, ergeben sich daraus<br />
Differenzkosten, die in Tabelle 9-3 <strong>und</strong> zusammengefasst sind.<br />
Tabelle 9-3: Differenzkostenen je kg Milch im Qualitätsprogramm bei einem durchschnittlichen österreichischen<br />
Milchviehbetrieb<br />
Die Verfügbarkeit der Substitute wurde in dieser Tabelle nicht berücksichtigt!<br />
Angaben in Cent je kg Milch mit<br />
entsprechender Qualität mit „GVO-freiem“ SES<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
ohne SES<br />
(mit Substituten)<br />
von bis von bis<br />
Kraftfutterdifferenzkosten laut 20 Modellrationen<br />
nach VO (EG) 1829/2003 <strong>und</strong> Codex 0,20 0,30 - 0,80 0,00<br />
Erhobene Kontrollkosten nach Codex 0,20 0,30 0,20 0,30<br />
Summe nach Codex <strong>„gentechnikfrei“</strong> 0,40 0,60 - 0,60 0,30<br />
In den Verarbeitungsbetrieben (z.B. Molkerei) können durch die Umstellung auf „GVO-freie“ oder „gentechnikfreie“<br />
Produktion folgende Mehrkosten anfallen:<br />
• Einführungskosten:<br />
o Mehrkosten für einmalige Investitionen <strong>und</strong> Umbaumaßnahmen, beispielsweise für die Errichtung eigener<br />
Absaugeinrichtungen, Stapeltanks etc.<br />
o Mehrkosten, die durch den Aufbau der „GVO-freien“ oder „gentechnikfreien“ Vermarktungsschiene in den<br />
jeweiligen Verarbeitungsbetrieben entstehen (interner <strong>und</strong> externer Aufwand): z. B.: Beratungskosten,<br />
Werbekosten etc.<br />
• Laufende Mehrkosten:<br />
o Erhöhte Logistikkosten aufgr<strong>und</strong> geänderter Routenplanung, schlechterer Auslastung der<br />
Milchsammelfahrzeuge <strong>und</strong> dem Einsatz eigener Fahrzeuge<br />
Seite 151 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 9: Differenzkosten<br />
Die Logistikkosten schwanken je nach Dichte der Betriebe im jeweiligen Einzugsgebiet sehr stark.<br />
o Mehrkosten für erlaubte Zusatzstoffe bei Verarbeitungsprodukten (z.B. Labfermente, Enzyme, Aromen,<br />
Vitamine etc.)<br />
o Mehrkosten durch die Einhaltung einer bestimmten Verarbeitungsreihenfolge oder für zusätzliche<br />
Reinigungsspülungen, wenn die Verarbeitungsreihenfolge (bio � <strong>„gentechnikfrei“</strong> � konventionell) nicht<br />
eingehalten werden kann<br />
o Mehrkosten in den einzelnen Verarbeitungsbetrieben durch externe Kontrollstellen<br />
o Zusätzliche Personalkosten für spezielle Dokumentationen, Anwesenheit bei Kontrollen in der Molkerei,<br />
Sitzungen mit Bauern etc.<br />
o Erhöhte Rohstoffkosten für die Molkereien (Milchmehrpreis für die Bauern)<br />
o Andere Mehrkosten, beispielsweise für Verpackungsmaterial, Reinigungsmittel, o.ä.<br />
o Zur Erzeugung von Milchverarbeitungsprodukten muss mehr als ein Liter Milch eingesetzt werden um ein kg<br />
eines bestimmten Produkts zu erhalten. Daher müssen <strong>zur</strong> Preisbestimmung die Differenzkosten von einem<br />
Liter Milch mit der eingesetzten Milchmenge multipliziert werden. In Tabelle 9-4 sind einige Beispiele dafür<br />
angeführt, wie viel Milch für die einzelnen Produkte benötigt wird.<br />
Tabelle 9-4: Milchmengen, die <strong>zur</strong> Erzeugung einzelner Milchprodukte benötigt werden<br />
für 1kg benötigte Milchmenge<br />
Butter 22 bis 23 Liter<br />
Frischkäse 4 bis 5 Liter<br />
Weichkäse 8 bis 9 Liter<br />
Schnittkäse 10 bis 11 Liter<br />
Hartkäse 11 bis 13 Liter<br />
Quelle: AMA Marketing GmbH<br />
9.1.2.3.2. Rindermast:<br />
Für die Berechnungen werden die Leistungen eines durchschnittlichen österreichischen Rindermastbetriebs<br />
herangezogen:<br />
Tabelle 9-5: Leistung eines durchschnittlichen österreichischen Rindermastbetriebs auf Basis ganzer Schlachtkörper<br />
(d.h. inklusive Knochen, Abschnitte etc.)<br />
Rindermast<br />
Verkaufte Rinder je Betr. 19 Stück Auskunft AMA<br />
ø Anteil im Qualitätsprogramm 66% Prozentsatz d. d. Kriterien entspricht Auskunft AMA<br />
ø Leistung im Qualitätsprogr. 12,30 verkaufte Prod. m. Qualitätszuschlag Auskunft AMA<br />
Schlachtgewicht 350 kg Standard DB 02/03, Seite 140ff<br />
Rindfleischproduktion 4.305 kg Fleisch je Betr. u. Jahr errechnet<br />
Den Berechnungen für die Rindermast werden drei verschiedene Gr<strong>und</strong>futtervarianten zugr<strong>und</strong>e gelegt. Da aber in<br />
den Varianten mit der Gr<strong>und</strong>futterbasis Grassilage <strong>und</strong> Weide im Kraftfutter kein SES enthalten ist, kommt es bei<br />
diesen beiden Varianten zu keinen Differenzkosten.<br />
Für die Rationen mit Maissilage gilt, dass Maissilage sehr energiereich ist <strong>und</strong> daher Eiweiß in relativ großem Umfang<br />
ergänzt werden muss. Die Differenzen der Kraftfutterkosten sind in Abbildung 9-5 dargestellt.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 152 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 9: Differenzkosten<br />
Abbildung 9-5: Kraftfutterdifferenzkosten je Maststier bei Gr<strong>und</strong>futterbasis Maissilage<br />
Anmerkungen <strong>zur</strong> Abbildung:<br />
� Die Berechnungen werden anhand von 10 Modellrationen durchgeführt.<br />
� Die eingesetzten Rohstoffpreise sind gemittelte Preise aus den Jahren 2003 <strong>und</strong> 2004.<br />
� Die uneingeschränkte Verfügbarkeit aller Rohstoffe wurde zu Berechnungszwecken angenommen, die<br />
Verfügbarkeit von Substituten ist jedoch derzeit nicht ausreichend gegeben (Verfügbarkeit Substitute in<br />
Österreich siehe Kapitel 3, Tabelle 3-24). Deshalb müssen Rationen, die Substitute enthalten, derzeit<br />
„gestrichen“ werden.<br />
� Preisänderungen bei Substituten bei geänderter Nachfrage sind nicht berücksichtigt.<br />
� Weitere berücksichtigte <strong>und</strong> nicht berücksichtigte Kosten sind in Tabelle 9-1 angeführt.<br />
Bei diesen Modellrationen wird SES mit Raps- oder Sonnenblumenextraktionsschrot substituiert.<br />
Wenn die Differenzkosten auf jene Rinder umlegt werden, für die ein Qualitätszuschlag bezahlt wird, entstehen<br />
Kosten die in Abbildung 9-6 ersichtlich sind.<br />
Einleitend werden die in der Studie angewandten Begriffe bzw. Definitionen vorgestellt:<br />
„Gentechnikfrei“ :<br />
Definition gemäß Codex Alimentarius Austriacus siehe<br />
http://www.bmgf.gv.at/cms/site/attachments/8/0/5/CH0264/CMS1085747609216/codex-rl.pdf<br />
„GVO-frei“:<br />
15%<br />
10%<br />
5%<br />
0%<br />
-5%<br />
-10%<br />
-15%<br />
-20%<br />
Kraftfutterdifferenzkosten je<br />
Maststier<br />
8% 8%<br />
Futter mit “GVO-<br />
Freiem” SES<br />
Futter mit “gen-<br />
technikfreiem“<br />
SES<br />
Der Begriff „GVO-frei“ wird in der Studie für nicht kennzeichnungspflichtige Lebensmittel <strong>und</strong> Futtermittel gemäß der<br />
Bestimmungen der VO (EG) 1829/2003 über genetisch veränderte Lebensmittel <strong>und</strong> Futtermittel verwendet.<br />
Darüber hinaus wird der Begriff „GVO-frei“ in der Studie im Zusammenhang mit Lebensmitteln aus tierischer<br />
Erzeugung (Milch, Eier, Fleisch) dann angewandt, wenn nicht kennzeichnungspflichtige Futtermittel gemäß der<br />
Bestimmungen der VO (EG) 1829/2003 in der Tierernährung eingesetzt werden.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
X X<br />
-12% -12%<br />
Futter ohne SES<br />
nach VO (EG)<br />
1829/2003<br />
Futter ohne SES<br />
nach Codex<br />
X X<br />
8 % 8 % -12 % -12 %<br />
Seite 153 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 9: Differenzkosten<br />
Zum Anwendungsbereich der VO (EG) 1829/2003 hat der Ständige Ausschuss Lebensmittelkette <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
folgende Klarstellung getroffen, siehe<br />
http://europa.eu.int/comm/food/committees/regulatory/modif_genet/summary240904_en.pdf<br />
(Punkt 1).<br />
Abbildung 9-6: Kraftfutterdifferenzkosten je Maststier mit entsprechendem Qualitätszuschlag bei Gr<strong>und</strong>futterbasis<br />
Maissilage<br />
Anmerkungen <strong>zur</strong> Abbildung:<br />
� Die Berechnungen werden anhand von 10 Modellrationen durchgeführt.<br />
� Die eingesetzten Rohstoffpreise sind gemittelte Preise aus den Jahren 2003 <strong>und</strong> 2004.<br />
� Die uneingeschränkte Verfügbarkeit aller Rohstoffe wurde zu Berechnungszwecken angenommen, die<br />
Verfügbarkeit von Substituten ist jedoch derzeit nicht ausreichend gegeben (Verfügbarkeit Substitute in<br />
Österreich siehe Kapitel 3, Tabelle 3-24). Deshalb müssen Rationen, die Substitute enthalten, derzeit<br />
„gestrichen“ werden.<br />
15%<br />
10%<br />
5%<br />
0%<br />
-5%<br />
-10%<br />
-15%<br />
-20%<br />
Kraftfutterdifferenzkosten je Stier<br />
im Qualitätsprogramm<br />
12% 12%<br />
Futter mit “GVO-<br />
freiem” SES<br />
Futter mit “gen-<br />
technikfreiem”<br />
SES<br />
� Preisänderungen bei Substituten bei geänderter Nachfrage sind nicht berücksichtigt.<br />
� Weitere berücksichtigte <strong>und</strong> nicht berücksichtigte Kosten sind in Tabelle 9-1 angeführt.<br />
Die Kosten für konventionell (nicht mit Qualitätszuschlag) vermarktete Produkte bleiben immer gleich. Die<br />
Kostenveränderungen durch den Einsatz von Substituten werden <strong>zur</strong> Gänze den im Qualitätsprogramm<br />
vermarktbaren Produkten (das sind 66 % der Maststiere) angerechnet.<br />
Bei diesen Modellrationen wird SES mit Raps- oder Sonnenblumenextraktionsschrot substituiert.<br />
Wie schon bei der Milchviehhaltung erwähnt, machen die in den Ergebnissen aufgelisteten Kraftfutterkosten nur<br />
einen Teil der gesamten Futterkosten aus. Bei der Stiermast liegt der Anteil der Kraftfutterkosten im Bereich von ca.<br />
10 – 40 % je nach Art des Gr<strong>und</strong>futters <strong>und</strong> der Höhe der angestrebten Leistung.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
X X<br />
-18% -18%<br />
Futter ohne SES<br />
nach VO (EG)<br />
1829/2003<br />
Futter ohne SES<br />
nach Codex<br />
X X<br />
12 % 12 % -18 % -18 %<br />
Seite 154 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 9: Differenzkosten<br />
Einen weiteren Kostenfaktor in der „GVO-freien“ oder „gentechnikfreien“ Produktion stellen die später in Kapitel 9.1.3<br />
beschriebenen Kontrollkosten dar. Werden diese mit den geänderten Futterkosten addiert, ergeben sich daraus<br />
Differenzkosten, die in Tabelle 9-6 zusammengefasst sind.<br />
Tabelle 9-6: Differenzkosten je kg Rindfleisch im Qualitätsprogramm auf Basis ganzer Schlachtkörper (d.h. inklusive<br />
Knochen, Abschnitte etc.)<br />
Die Verfügbarkeit der Substitute wurde in dieser Tabelle nicht berücksichtigt!<br />
Angaben in Cent je kg Rindfleisch mit<br />
entsprechender Qualität mit „GVO-freiem“ SES<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
ohne SES<br />
(mit Substituten)<br />
von bis von bis<br />
Futterdifferenzkosten laut 60 Modellrationen<br />
nach VO (EG) 1829/2003 <strong>und</strong> Codex 7,00 7,00 - 10,00 0,00<br />
Erhobene Kontrollkosten nach Codex 2,10 2,90 2,10 2,90<br />
Summe nach Codex <strong>„gentechnikfrei“</strong> 9,10 9,90 - 7,90 2,90<br />
Zu bedenken ist, dass im Durchschnitt maximal die Hälfte eines Schlachtkörpers als Frischfleisch an die Konsumenten<br />
verkauft werden kann <strong>und</strong> sich somit die erhobenen Differenzkosten verdoppeln.<br />
9.1.2.3.3. Schweinemast:<br />
Für die Berechnungen werden die Leistungen eines durchschnittlichen österreichischen Schweinemastbetriebs<br />
herangezogen:<br />
Tabelle 9-7: Leistung eines durchschnittlichen österreichischen Schweinemastbetriebs auf Basis ganzer<br />
Schlachtkörper (d.h. inklusive Knochen, Abschnitte etc.).<br />
Schweinemast<br />
Verkaufte Schw. je Betr. 460 Stück Auskunft AMA<br />
ø Anteil im Qualitätsprogramm 64% Prozentsatz d. d. Kriterien entspricht Auskunft AMA<br />
ø Leistung im Qualitätsprogr. 293 verkaufte Prod. m. Qualitätszuschlag Auskunft AMA<br />
Schlachtgewicht 94 kg Standard DB 02/03, Seite 180ff<br />
Schweinefleischprod. 27.542 kg Fleisch je Betr. u. Jahr errechnet<br />
Die Futtermengen werden mit Hilfe von Aufmast <strong>und</strong> Futterverwertung errechnet. Das Ergebnis bezieht sich auf kg<br />
Futterverbrauch bei Lufttrockenmasse, d.h. Trockensubstanzgehalt 88 %. In der Schweinemast wird mit<br />
Maiskornsilage ein Futtermittel eingesetzt, dessen vergleichsweise hoher Wassergehalt (ca. 38 – 40 % im Vergleich<br />
zu 12 – 14 % bei Getreide) es erfordert, die Futtermengen bei Lufttrockenmasse auf Frischmasse um<strong>zur</strong>echnen, da<br />
sich sowohl die Prozentangaben in den Rationen als auch die Preise auf kg Frischmasse beziehen. Dazu ist es<br />
notwendig, den Trockensubstanzgehalt der Ration anhand der Trockensubstanzgehalte der eingesetzten Futtermittel<br />
zu berechnen.<br />
Die in der Schweinemast angeführten Futterkosten stellen, im Gegensatz zu den für die Rinderhaltung beschriebenen<br />
Futterkosten, die gesamten Futterkosten dar. Es werden in der Schweinemast mehrere Produktionsformen <strong>und</strong><br />
Fütterungsphasen unterschieden, die beliebig miteinander kombinierbar sind. Die Mast kann mit am eigenen Betrieb<br />
produziertem oder zugekauftem Futter erfolgen. Außerdem kann die Mast in eine Anfangs- <strong>und</strong> Endmastphase<br />
unterteilt werden, oder es kann in der gesamten Mastperiode ein sogenanntes Universalmastfutter eingesetzt<br />
werden. Laut Angaben aus den Rationsberechnungen der <strong>AGES</strong> wird von je ca. 50 % der heimischen Betriebe<br />
Phasen- <strong>und</strong> Universalmast angewendet. Die Berechnungen werden folgendermaßen unterteilt: In Mast auf der Basis<br />
von Maiskornsilage mit Eigenmischung <strong>und</strong> Mast auf der Basis einer Industriemischung mit Zukauffutter. Beide<br />
Varianten gibt es sowohl mit Universal- als auch mit Phasenmast. Die Ergebnisse der Varianten Eigen- <strong>und</strong><br />
Industriemischung werden extra ausgewiesen; aus den Varianten Universal- <strong>und</strong> Phasenmast wird der gewichtete<br />
Mittelwert als Differenzkosten angegeben. Die Ferkelaufzuchtkosten werden für alle Varianten in gleicher Höhe<br />
angenommen. Die Substitution von SES erfolgt bei den Ferkelaufzuchtrationen mit Sojabohne vollfett getoastet <strong>und</strong><br />
DDGS.<br />
Seite 155 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 9: Differenzkosten<br />
Die Ergebnisse der Kostenberechnungen für die Schweinemast mit Maiskornsilage sind in Abbildung 9-7<br />
zusammengefasst.<br />
Abbildung 9-7: Futterdifferenzkosten, inkl. Ferkelaufzucht, bei Schweinemast mit Maiskornsilage (Eigenmischung)<br />
Anmerkungen <strong>zur</strong> Abbildung:<br />
� Die Berechnungen werden anhand von 20 Modellrationen durchgeführt.<br />
� Die eingesetzten Rohstoffpreise sind gemittelte Preise aus den Jahren 2003 <strong>und</strong> 2004.<br />
� Die uneingeschränkte Verfügbarkeit aller Rohstoffe wurde zu Berechnungszwecken angenommen, die<br />
Verfügbarkeit von Substituten <strong>und</strong> bestimmter Zusatzstoffe nach Codex ist jedoch derzeit nicht ausreichend<br />
gegeben (Verfügbarkeit Substitute in Österreich siehe Kapitel 3, Tabelle 3-24, Verfügbarkeit Zusatzstoffe nach<br />
Codex siehe Kapitel 4, Tabelle 4-11). Deshalb müssen Rationen, die Substitute oder bestimmte<br />
Zusatzstoffe nach Codex enthalten, derzeit „gestrichen“ werden.<br />
� Preisänderungen bei Substituten bei geänderter Nachfrage sind nicht berücksichtigt.<br />
� Weitere berücksichtigte <strong>und</strong> nicht berücksichtigte Kosten sind in Tabelle 9-1 angeführt.<br />
Bei der Variante mit „gentechnikfreiem“ SES nach Codex ist der Einsatz von Soft-IP-Soja mit 20 % begrenzt, <strong>und</strong> es<br />
ist daher ein geringfügiger Einsatz von kostengünstigeren Substituten, in diesem Modellfall Ackerbohne, notwendig.<br />
Bei vollständiger Substitution wird SES durch Ackerbohne <strong>und</strong> Kartoffeleiweiß ersetzt.<br />
Wenn die Schweine mit Zukauffutter aus Industriemischung gefüttert werden, entstehen Kostenveränderungen, die<br />
in Abbildung 9-8 dargestellt sind.<br />
9%<br />
7%<br />
5%<br />
3%<br />
1%<br />
-1%<br />
-3%<br />
-5%<br />
-7%<br />
Futterdifferenzkosten je kg<br />
Schweinefleisch inkl. Ferkelaufzucht<br />
5%<br />
Futter mit “GVO-<br />
freiem” SES<br />
4%<br />
X<br />
Futter mit “gen-<br />
technikfreiem”<br />
SES<br />
X<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
X X<br />
0% 0%<br />
Futter ohne SES<br />
nach VO (EG)<br />
1829/2003<br />
Futter ohne SES<br />
nach Codex<br />
X X<br />
5 % 4 % 0 % 0 %<br />
Seite 156 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 9: Differenzkosten<br />
Abbildung 9-8: Futterdifferenzkosten, inkl. Ferkelaufzucht, bei Schweinemast mit Zukauffutter (Industriemischung)<br />
Anmerkungen <strong>zur</strong> Abbildung:<br />
� Die Berechnungen werden anhand von 20 Modellrationen durchgeführt.<br />
� Die eingesetzten Rohstoffpreise sind gemittelte Preise aus den Jahren 2003 <strong>und</strong> 2004.<br />
� Die uneingeschränkte Verfügbarkeit aller Rohstoffe wurde zu Berechnungszwecken angenommen, die<br />
Verfügbarkeit von Substituten <strong>und</strong> bestimmter Zusatzstoffe nach Codex ist jedoch derzeit nicht ausreichend<br />
gegeben (Verfügbarkeit Substitute in Österreich siehe Kapitel 3, Tabelle 3-24, Verfügbarkeit Zusatzstoffe nach<br />
Codex siehe Kapitel 4, Tabelle 4-11). Deshalb müssen Rationen, die Substitute oder bestimmte<br />
Zusatzstoffe nach Codex enthalten, derzeit „gestrichen“ werden.<br />
� Preisänderungen bei Substituten bei geänderter Nachfrage sind nicht berücksichtigt.<br />
� Weitere berücksichtigte <strong>und</strong> nicht berücksichtigte Kosten sind in Tabelle 9-1 angeführt.<br />
Die Substitution von SES erfolgt mit Rapsextraktionsschrot, Kartoffeleiweiß <strong>und</strong> Erbse.<br />
Wenn man berücksichtigt, dass nur ein Teil der Schweine den Qualitätskriterien entspricht, <strong>und</strong> die Kosten auf diese<br />
Schweine umgelegt werden müssen, entstehen veränderte Differenzkostenen, die in Abbildung 9-9 <strong>und</strong> Abbildung<br />
9-10 dargestellt sind.<br />
9%<br />
7%<br />
5%<br />
3%<br />
1%<br />
-1%<br />
-3%<br />
-5%<br />
-7%<br />
Futterdifferenzkosten je<br />
Mastschwein, inkl. Ferkelaufzucht<br />
4% 4%<br />
Futter mit “GVO-<br />
Freiem” SES<br />
X<br />
Futter mit “gen-<br />
technikfreiem”<br />
SES<br />
X<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
X X<br />
-4% -4%<br />
Futter ohne SES<br />
nach VO (EG)<br />
1829/2003<br />
Futter ohne SES<br />
nach Codex<br />
X X<br />
4 % 4 % -4 % -4 %<br />
Seite 157 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 9: Differenzkosten<br />
Abbildung 9-9: Futterdifferenzkosten je Mastschwein im Qualitätsprogramm, inkl. Ferkelaufzucht, bei<br />
Schweinemast mit Maiskornsilage (Eigenmischung)<br />
Anmerkungen <strong>zur</strong> Abbildung:<br />
9%<br />
7%<br />
5%<br />
3%<br />
1%<br />
-1%<br />
-3%<br />
-5%<br />
-7%<br />
Futterdifferenzkosten je<br />
Mastschwein im Qualitätsprogramm,<br />
inkl. Ferkelaufzucht<br />
� Die Berechnungen werden anhand von 20 Modellrationen durchgeführt.<br />
� Die eingesetzten Rohstoffpreise sind gemittelte Preise aus den Jahren 2003 <strong>und</strong> 2004.<br />
� Die uneingeschränkte Verfügbarkeit aller Rohstoffe wurde zu Berechnungszwecken angenommen, die<br />
Verfügbarkeit von Substituten <strong>und</strong> bestimmter Zusatzstoffe nach Codex ist jedoch derzeit nicht ausreichend<br />
gegeben (Verfügbarkeit Substitute in Österreich siehe Kapitel 3, Tabelle 3-24, Verfügbarkeit Zusatzstoffe nach<br />
Codex siehe Kapitel 4, Tabelle 4-11). Deshalb müssen Rationen, die Substitute oder bestimmte<br />
Zusatzstoffe nach Codex enthalten, derzeit „gestrichen“ werden.<br />
� Preisänderungen bei Substituten bei geänderter Nachfrage sind nicht berücksichtigt.<br />
� Weitere berücksichtigte <strong>und</strong> nicht berücksichtigte Kosten sind in Tabelle 9-1 angeführt.<br />
Die Kosten für konventionell (nicht mit Qualitätszuschlag) vermarktete Produkte bleiben immer gleich. Die<br />
Kostenveränderungen durch den Einsatz von Substituten werden <strong>zur</strong> Gänze den im Qualitätsprogramm<br />
vermarktbaren Produkten (das sind 64 % der Mastschweine) angerechnet.<br />
Bei der Variante mit „gentechnikfreiem“ SES nach Codex ist der Einsatz von Soft-IP-Soja mit 20 % begrenzt, <strong>und</strong> es<br />
ist daher ein geringfügiger Einsatz von kostengünstigeren Substituten, in diesem Modellfall Ackerbohne, notwendig.<br />
Bei vollständiger Substitution wird SES durch Ackerbohne <strong>und</strong> Kartoffeleiweiß ersetzt.<br />
8%<br />
Futter mit “GVO-<br />
Freiem” SES<br />
6%<br />
X<br />
Futter mit “gen-<br />
technikfreiem”<br />
SES<br />
X<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
X X<br />
0% 0%<br />
Futter ohne SES<br />
nach VO (EG)<br />
1829/2003<br />
Futter ohne SES<br />
nach Codex<br />
X X<br />
8 % 6 % 0 % 0 %<br />
Seite 158 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 9: Differenzkosten<br />
Abbildung 9-10: Futterdifferenzkosten je Mastschwein im Qualitätsprogramm, inkl. Ferkelaufzucht, bei<br />
Schweinemast mit Zukauffutter (Industriemischung)<br />
Anmerkungen <strong>zur</strong> Abbildung:<br />
9%<br />
7%<br />
5%<br />
3%<br />
1%<br />
-1%<br />
-3%<br />
-5%<br />
-7%<br />
Futterdifferenzkosten je<br />
Mastschwein im Qualitätsprogramm,<br />
inkl. Ferkelaufzucht<br />
7% 7%<br />
Futter mit “GVO-<br />
freiem” SES<br />
� Die Berechnungen werden anhand von 20 Modellrationen durchgeführt.<br />
� Die eingesetzten Rohstoffpreise sind gemittelte Preise aus den Jahren 2003 <strong>und</strong> 2004.<br />
� Die uneingeschränkte Verfügbarkeit aller Rohstoffe wurde zu Berechnungszwecken angenommen, die<br />
Verfügbarkeit von Substituten <strong>und</strong> bestimmter Zusatzstoffe nach Codex ist jedoch derzeit nicht ausreichend<br />
gegeben (Verfügbarkeit Substitute in Österreich siehe Kapitel 3, Tabelle 3-24, Verfügbarkeit Zusatzstoffe nach<br />
Codex siehe Kapitel 4, Tabelle 4-11). Deshalb müssen Rationen, die Substitute oder bestimmte<br />
Zusatzstoffe nach Codex enthalten, derzeit „gestrichen“ werden.<br />
� Preisänderungen bei Substituten bei geänderter Nachfrage sind nicht berücksichtigt.<br />
� Weitere berücksichtigte <strong>und</strong> nicht berücksichtigte Kosten sind in Tabelle 9-1 angeführt.<br />
Die Kosten für konventionell (nicht mit Qualitätszuschlag) vermarktete Produkte bleiben immer gleich. Die<br />
Kostenveränderungen durch den Einsatz von Substituten werden <strong>zur</strong> Gänze den im Qualitätsprogramm<br />
vermarktbaren Produkten (das sind 64 % der Mastschweine) angerechnet.<br />
Die Substitution von SES erfolgt mit Rapsextraktionsschrot, Kartoffeleiweiß <strong>und</strong> Erbse.<br />
Einen weiteren Kostenfaktor in der „GVO-freien“ oder „gentechnikfreien“ Produktion stellen die später in Kapitel 9.1.3<br />
beschriebenen Kontrollkosten dar. Werden diese mit den geänderten Futterkosten addiert, ergeben sich daraus<br />
Differenzkosten, die in Tabelle 9-8 zusammengefasst sind.<br />
X<br />
Futter mit “gen-<br />
technikfreiem”<br />
SES<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
X X<br />
-6% -6%<br />
Futter ohne SES<br />
nach VO (EG)<br />
1829/2003<br />
Futter ohne SES<br />
nach Codex<br />
X X<br />
X<br />
7 % 7 % -6 % -6 %<br />
Seite 159 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 9: Differenzkosten<br />
Tabelle 9-8: Differenzkosten je kg Schweinefleisch im Qualitätsprogramm auf Basis ganzer Schlachtkörper (d.h.<br />
inklusive Knochen, Abschnitte etc.)<br />
Die Verfügbarkeit der Substitute <strong>und</strong> Zusatzstoffe nach Codex wurden in dieser Tabelle nicht<br />
berücksichtigt!<br />
Angaben in Cent je kg Schweinefleisch mit<br />
entsprechender Qualität<br />
mit „GVO-freiem“ SES<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
ohne SES<br />
(mit Substituten)<br />
von bis von bis<br />
Futterdifferenzkosten laut 35 Modellrationen<br />
nach VO (EG) 1829/2003 <strong>und</strong> Codex 3,80 5,10 - 3,80 -0,20<br />
Erhobene Kontrollkosten nach Codex 0,40 0,50 0,40 0,50<br />
Summe nach Codex <strong>„gentechnikfrei“</strong> 4,20 5,60 - 3,40 0,30<br />
Bei Schweinefleisch ist zu berücksichtigen, dass es aufgr<strong>und</strong> der saisonal schwankenden Nachfrage nach bestimmten<br />
Teilstücken (z.B. Schnitzelteile <strong>und</strong> Karree), nicht immer möglich ist, die gesamte Schweinehälfte als Frischfleisch im<br />
Qualitätsprogramm zu vermarkten. Um diese schwankende Nachfrage von Konsumenten nach gewissen Teilstücken<br />
abdecken zu können, wird ein durchschnittlicher Überschuss von 50 Prozent des Frischfleisches, der nach den<br />
entsprechenden Richtlinien produziert wird, angenommen. Zusätzlich fallen auf der landwirtschaftlichen Erzeugerseite<br />
Produktionskosten an, die jedoch nur auf r<strong>und</strong> 50 Prozent der Tiere, die endgültig den Qualitätskriterien entsprechen,<br />
umgelegt werden können, da nicht alle Tiere bzw. Schlachtkörper den Qualitätskriterien (z.B. pH1 <strong>und</strong> pH12,<br />
Muskelfleischanteil etc.) entsprechen. Wenn man diese Zahlen in einem Faktor ausdrücken will, ergibt sich in Summe<br />
ein durchschnittlicher Faktor von 3. Diese Angaben stammen aus den Daten des derzeitigen AMA-<br />
Gütesiegelprogramms. Durch saisonal bedingte Spitzen (Grillzeit, Weihnachten etc.) <strong>und</strong> im Falle von Aktionen des<br />
Lebensmitteleinzelhandels kann sich der Faktor wie folgt vervielfachen. Wenn z.B. nur die Karreerose abgesetzt<br />
werden kann, müssen die Differenzkosten auf dieses Teilstück aufgeschlagen werden. Der dabei <strong>zur</strong> Anwendung<br />
kommende Faktor errechnet sich folgendermaßen: Eine durchschnittliche Schweinehälfte, z.B.: im AMA-<br />
Gütesiegelprogramm Frischfleisch, wiegt 46.5 kg <strong>und</strong> davon ist der Anteil der Karreerose ca. 8 Prozent (3.72 kg).<br />
Somit muss diesen 3.72 kg unter Umständen der gesamte Differenzpreis für die verbleibenden 42.78 kg<br />
aufgeschlagen werden.<br />
Tabelle 9-9: Ausschnitt aus einer durchschnittlichen Schnittliste einer Schweinehälfte<br />
Teilstück Anteil<br />
Karreerose 8,0 %<br />
Filet 1,0 %<br />
Bauch Hamburger 10,0 %<br />
Schopf ohne Knochen 5,5 %<br />
Quelle: AMA Marketing GmbH<br />
9.1.2.3.4. Legehennenhaltung:<br />
Für die Berechnungen werden die Leistungen eines durchschnittlichen österreichischen Legehennenbetriebs<br />
herangezogen:<br />
Tabelle 9-10: Leistung eines durchschnittlichen österreichischen Legehennenbetriebs<br />
Legehennen<br />
Anzahl der Hennen 2000 je Betrieb Auskunft AMA<br />
Eier je Henne <strong>und</strong> Jahr 271,2 Stück errechnet laut Auskunft AMA<br />
Eier je Betrieb <strong>und</strong> Jahr 542.400 Je Jahr 26 Start- u. 339 Legetage errechnet laut Auskunft AMA<br />
Legeleistung 80 %<br />
ø Anteil im Qualitätsprogramm 95% Auskunft AMA<br />
ø Leistung im Qualitätsprogr. 515.280 Stück errechnet<br />
Seite 160 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 9: Differenzkosten<br />
Die Haltungsperiode einer Legehenne setzt sich aus zwei Teilen, der Startperiode, in der Legestarter gefressen wird<br />
<strong>und</strong> der Legeperiode, in der Legealleinfutter gefressen wird, zusammen. Es werden Futterkosten für Boden- <strong>und</strong><br />
Freilandlegehennenhaltung berechnet. Nach den Rationsangaben der <strong>AGES</strong> beträgt der Futterverbrauch während der<br />
Startperiode bei beiden Haltungsvarianten 85 g je Henne <strong>und</strong> Tag. Während der Legeperiode liegt er bei 120 g je<br />
Henne <strong>und</strong> Tag in der Bodenhaltung <strong>und</strong> bei 130 g in der Freilandhaltung. Mit Hilfe des<br />
Standarddeckungsbeitragskataloges (BMLFUW, 2002, 197) wurde die Dauer der Startperiode mit 28 Tagen <strong>und</strong> die<br />
Dauer der Legeperiode mit 365 Tagen festgelegt, d.h. auf ein Jahr entfallen im Durchschnitt 26 Start- <strong>und</strong> 339<br />
Legetage. In den 339 Legetagen beträgt die durchschnittliche Legeleistung 80 %, d.h. eine Henne legt im Jahr (nicht<br />
in der gesamten Legeperiode) 271,2 Eier. Der Futterverbrauch für die gesamte Haltungsperiode ergibt sich daher aus<br />
dem täglichen Futterbedarf multipliziert mit der Anzahl der Haltungstage in der jeweiligen Periode. Dieser<br />
Futterbedarf wird mit den Prozentsätzen aus den Rationsangaben multipliziert, um zum Verbrauch in kg der<br />
einzelnen Futtermittel zu gelangen. Der Verbrauch je kg Futtermittel wird mit den erhobenen Preisen multipliziert <strong>und</strong><br />
die Produkte dieser Multiplikationen zu den Futterkosten je Henne <strong>und</strong> Haltungsperiode addiert.<br />
Die Futterkosten je Ei ergeben sich aus der Division der Futterkosten je Henne durch die Anzahl der gelegten Eier in<br />
der gesamten Haltungsdauer. Die Berechnung der Differenzkosten erfolgt durch Subtraktion der Futterkosten bei<br />
konventioneller Haltung von jenen der anderen Varianten.<br />
Der SES-Anteil ist bei intensiver Haltung deutlich höher, was <strong>zur</strong> Folge hat, dass die Kostensteigerung deutlich höher<br />
als bei extensiver Fütterung ausfällt.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 161 von 272
� Bodenhaltung:<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 9: Differenzkosten<br />
Die Ergebnisse bei Bodenhaltung sind in Abbildung 9-11: Futterdifferenzkosten je Ei bei Bodenhaltung<br />
zusammengefasst.<br />
Abbildung 9-11: Futterdifferenzkosten je Ei bei Bodenhaltung<br />
Anmerkungen <strong>zur</strong> Abbildung:<br />
� Die Berechnungen werden anhand von 10 Modellrationen durchgeführt.<br />
� Die eingesetzten Rohstoffpreise sind gemittelte Preise aus den Jahren 2003 <strong>und</strong> 2004.<br />
� Die uneingeschränkte Verfügbarkeit aller Rohstoffe wurde zu Berechnungszwecken angenommen, die<br />
Verfügbarkeit von Substituten <strong>und</strong> bestimmter Zusatzstoffe nach Codex ist jedoch derzeit nicht ausreichend<br />
gegeben (Verfügbarkeit Substitute in Österreich siehe Kapitel 3, Tabelle 3-24, Verfügbarkeit Zusatzstoffe nach<br />
Codex siehe Kapitel 4, Tabelle 4-11). Deshalb müssen Rationen, die Substitute oder bestimmte<br />
Zusatzstoffe nach Codex enthalten, derzeit „gestrichen“ werden.<br />
� Preisänderungen bei Substituten bei geänderter Nachfrage sind nicht berücksichtigt.<br />
� Weitere berücksichtigte <strong>und</strong> nicht berücksichtigte Kosten sind in Tabelle 9-1 angeführt.<br />
Bei Einhaltung der österreichischen Codex-Richtlinie wird in der vorliegenden Modellannahme wegen der<br />
Beschränkung des Soft-IP-Soja-Einsatzes auch ein Substitut, in diesem Fall Kürbiskernkuchen, eingesetzt. Wenn SES<br />
vollständig aus der Ration entfernt wird, werden im Modell Kürbiskernkuchen, Sonnenblumenextraktionsschrot, Erbse<br />
<strong>und</strong> Maiskleber eingesetzt.<br />
� Freilandhaltung:<br />
Wie bereits erwähnt, sind die Kostenunterschiede bei jenen Rationen, in denen SES enthalten ist, in der extensiven<br />
Legehennenhaltung wegen des niedrigeren SES-Anteils geringer. Die Mehrkosten sind in der folgenden Abbildung<br />
dargestellt.<br />
7%<br />
6%<br />
5%<br />
4%<br />
3%<br />
2%<br />
1%<br />
0%<br />
6%<br />
Futter mit “GVO-<br />
freiem” SES<br />
Futterdifferenzkosten je Ei 6 % 6 % 2 % 2 %<br />
6%<br />
X<br />
Futter mit “gen-<br />
technikfreiem SES<br />
t<br />
X<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
2% 2%<br />
X X<br />
Futter ohne SES<br />
nach VO (EG)<br />
1829/2003<br />
Futter ohne SES<br />
nach Codex<br />
X<br />
X<br />
Seite 162 von 272
7%<br />
6%<br />
5%<br />
4%<br />
3%<br />
Anmerkungen <strong>zur</strong> Abbildung:<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 9: Differenzkosten<br />
2% 2%<br />
2% 2%<br />
2%<br />
1%<br />
0% X X X<br />
Futterdifferenzkosten<br />
Futter mit<br />
“GVO-freiem” SES<br />
2 %<br />
Futter mit “gen- Futter ohne SES nach Futter ohne SES nach<br />
technikfreiem”<br />
-<br />
SES VO (EG) 1829/2003 Codex<br />
2 % 2 % 2 % X X<br />
Abbildung 9-12: Futterdifferenzkosten je Ei bei Freilandhaltung<br />
X<br />
� Die Berechnungen werden anhand von 14 Modellrationen durchgeführt.<br />
� Die eingesetzten Rohstoffpreise sind gemittelte Preise aus den Jahren 2003 <strong>und</strong> 2004.<br />
� Die uneingeschränkte Verfügbarkeit aller Rohstoffe wurde zu Berechnungszwecken angenommen, die<br />
Verfügbarkeit von Substituten <strong>und</strong> bestimmter Zusatzstoffe nach Codex ist jedoch derzeit nicht ausreichend<br />
gegeben (Verfügbarkeit Substitute in Österreich siehe Kapitel 3, Tabelle 3-24, Verfügbarkeit Zusatzstoffe nach<br />
Codex siehe Kapitel 4, Tabelle 4-11). Deshalb müssen Rationen, die Substitute oder bestimmte<br />
Zusatzstoffe nach Codex enthalten, derzeit „gestrichen“ werden.<br />
� Preisänderungen bei Substituten bei geänderter Nachfrage sind nicht berücksichtigt.<br />
� Weitere berücksichtigte <strong>und</strong> nicht berücksichtigte Kosten sind in Tabelle 9-1 angeführt.<br />
Als Substitute werden Sojabohne vollfett getoastet, Sonnenblumenextraktionsschrot, Erbse <strong>und</strong> Kürbiskernkuchen in<br />
die Modellration aufgenommen.<br />
Wenn nun für beide Haltungsformen die Futterdifferenzkosten auf jene 95 % der Eier aufgeteilt werden, die auch<br />
den Qualitätskriterien eines Qualitätsprogramms entsprechen, nehmen die Differenzkosten die Werte an, die in<br />
Abbildung 9-13 <strong>und</strong> Abbildung 9-14 dargestellt sind.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 163 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 9: Differenzkosten<br />
Abbildung 9-13: Futterdifferenzkosten je Ei im Qualitätsprogramm bei Bodenhaltung<br />
Anmerkungen <strong>zur</strong> Abbildung:<br />
� Die Berechnungen werden anhand von 10 Modellrationen durchgeführt.<br />
� Die eingesetzten Rohstoffpreise sind gemittelte Preise aus den Jahren 2003 <strong>und</strong> 2004.<br />
� Die uneingeschränkte Verfügbarkeit aller Rohstoffe wurde zu Berechnungszwecken angenommen, die<br />
Verfügbarkeit von Substituten <strong>und</strong> bestimmter Zusatzstoffe nach Codex ist jedoch derzeit nicht ausreichend<br />
gegeben (Verfügbarkeit Substitute in Österreich siehe Kapitel 3, Tabelle 3-24, Verfügbarkeit Zusatzstoffe nach<br />
Codex siehe Kapitel 4, Tabelle 4-11). Deshalb müssen Rationen, die Substitute oder bestimmte<br />
Zusatzstoffe nach Codex enthalten, derzeit „gestrichen“ werden.<br />
� Preisänderungen bei Substituten bei geänderter Nachfrage sind nicht berücksichtigt.<br />
� Weitere berücksichtigte <strong>und</strong> nicht berücksichtigte Kosten sind in Tabelle 9-1 angeführt.<br />
Bei Einhaltung der österreichischen Codex-Richtlinie wird in der vorliegenden Modellannahme wegen der<br />
Beschränkung des Soft-IP-Soja-Einsatzes auch ein Substitut, in diesem Fall Kürbiskernkuchen, eingesetzt. Wenn SES<br />
vollständig aus der Ration entfernt wird, werden im Modell Kürbiskernkuchen, Sonnenblumenextraktionsschrot, Erbse<br />
<strong>und</strong> Maiskleber eingesetzt.<br />
7%<br />
6%<br />
5%<br />
4%<br />
3%<br />
2%<br />
1%<br />
0%<br />
Futterdifferenzkosten je Ei im<br />
Qualitätsprogramm<br />
6%<br />
Futter mit “GVO-<br />
freiem” SES<br />
6%<br />
X<br />
Futter mit “gen-<br />
technikfreiem”<br />
SES<br />
X<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
2% 2%<br />
X X<br />
Futter ohne SES<br />
nach VO (EG)<br />
1829/2003<br />
Futter ohne SES<br />
nach Codex<br />
X X<br />
6 % 6 % 2 % 2 %<br />
Seite 164 von 272
7%<br />
6%<br />
5%<br />
4%<br />
3%<br />
2%<br />
1%<br />
0%<br />
Futterdifferenzkosten je Ei im<br />
Qualitätsprogramm<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 9: Differenzkosten<br />
Abbildung 9-14: Futterdifferenzkosten je Ei im Qualitätsprogramm bei Freilandhaltung<br />
Anmerkungen <strong>zur</strong> Abbildung:<br />
� Die Berechnungen werden anhand von 14 Modellrationen durchgeführt.<br />
� Die eingesetzten Rohstoffpreise sind gemittelte Preise aus den Jahren 2003 <strong>und</strong> 2004.<br />
� Die uneingeschränkte Verfügbarkeit aller Rohstoffe wurde zu Berechnungszwecken angenommen, die<br />
Verfügbarkeit von Substituten <strong>und</strong> bestimmter Zusatzstoffe nach Codex ist jedoch derzeit nicht ausreichend<br />
gegeben (Verfügbarkeit Substitute in Österreich siehe Kapitel 3, Tabelle 3-24, Verfügbarkeit Zusatzstoffe nach<br />
Codex siehe Kapitel 4, Tabelle 4-11). Deshalb müssen Rationen, die Substitute oder bestimmte<br />
Zusatzstoffe nach Codex enthalten, derzeit „gestrichen“ werden.<br />
� Preisänderungen bei Substituten bei geänderter Nachfrage sind nicht berücksichtigt.<br />
� Weitere berücksichtigte <strong>und</strong> nicht berücksichtigte Kosten sind in Tabelle 9-1 angeführt.<br />
Als Substitute werden Sojabohne vollfett getoastet, Sonnenblumenextraktionsschrot, Erbse <strong>und</strong> Kürbiskernkuchen in<br />
die Modellration aufgenommen.<br />
2% 2%<br />
Futter mit “GVO-<br />
freiem” SES<br />
Einen weiteren Kostenfaktor in der „GVO-freien“ oder „gentechnikfreien“ Produktion stellen die später in Kapitel 9.1.3<br />
beschriebenen Kontrollkosten dar. Werden diese mit den geänderten Futterkosten addiert, ergeben sich daraus<br />
Differenzkosten, die in Tabelle 9-11 zusammengefasst sind.<br />
X<br />
Futter mit “gentechnikfreiem”<br />
SES<br />
X<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
2% 2%<br />
X X<br />
Futter ohne SES<br />
nach VO (EG)<br />
1829/2003<br />
Futter ohne SES<br />
nach Codex<br />
X X<br />
2 % 2 % 2 % 2 %<br />
Seite 165 von 272
Tabelle 9-11: Differenzkosten je Ei im Qualitätsprogramm<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 9: Differenzkosten<br />
Die Verfügbarkeit der Substitute <strong>und</strong> Zusatzstoffe nach Codex wurden in dieser Tabelle nicht<br />
berücksichtigt!<br />
Angaben in Cent je Ei mit entsprechender<br />
Qualität mit „GVO-freiem“ SES<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
ohne SES<br />
(mit Substituten)<br />
von bis von bis<br />
Futterdifferenzkosten laut 15 Modellrationen<br />
nach VO (EG) 1829/2003 <strong>und</strong> Codex 0,10 0,20 0,10 0,10<br />
Erhobene Kontrollkosten nach Codex 0,02 0,03 0,02 0,03<br />
Summe nach Codex <strong>„gentechnikfrei“</strong> 0,12 0,23 0,12 0,13<br />
9.1.2.3.5. Hühnermast<br />
Für die Berechnungen werden die Leistungen eines durchschnittlichen österreichischen Hühnermastbetriebs<br />
herangezogen:<br />
Tabelle 9-12: Leistung eines durchschnittlichen österreichischen Hühnermastbetriebs<br />
Hühnermast<br />
Produzierte Stück je Betr. 9.546 errechnet aus dem Bestand laut Agrarstrukturerhebung 2003 u.<br />
d. durchschn. Umtrieb von 5,75 laut Standard DB 02/03, Seite 191<br />
Schlachtgewicht 1,70 kg<br />
Hühnerfleischproduktion 16.228 kg Fleisch je Betr. u. Jahr<br />
ø Anteil im Qualitätsprogramm 87,5% Prozentsatz d. d. Kriterien entspricht<br />
ø Leistung im Qualitätsprogr. 14.200 kg Fleisch je Betr. u. Jahr<br />
Die Berechnung der Futtermenge erfolgt anhand von Aufmast, Futterverwertung <strong>und</strong> den Angaben aus den<br />
Rationen. Die Futterkosten werden analog zu den bisher beschriebenen Nutzungsrichtungen berechnet.<br />
Erwartungsgemäß ergeben sich auch hier Kostensteigerungen durch die Umstellung auf „GVO-freien“ SES. Die<br />
Ergebnisse sind in Abbildung 9-15 zusammengefasst.<br />
Seite 166 von 272
7%<br />
6%<br />
5%<br />
4%<br />
3%<br />
2%<br />
1%<br />
0%<br />
Abbildung 9-15: Futterdifferenzkosten je Masthuhn<br />
Anmerkungen <strong>zur</strong> Abbildung:<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 9: Differenzkosten<br />
� Die Berechnungen werden anhand von 18 Modellrationen durchgeführt.<br />
5%<br />
� Die eingesetzten Rohstoffpreise sind gemittelte Preise aus den Jahren 2003 <strong>und</strong> 2004.<br />
� Die uneingeschränkte Verfügbarkeit aller Rohstoffe wurde zu Berechnungszwecken angenommen, die<br />
Verfügbarkeit von Substituten <strong>und</strong> bestimmter Zusatzstoffe nach Codex ist jedoch derzeit nicht ausreichend<br />
gegeben (Verfügbarkeit Substitute in Österreich siehe Kapitel 3, Tabelle 3-24, Verfügbarkeit Zusatzstoffe nach<br />
Codex siehe Kapitel 4, Tabelle 4-11). Deshalb müssen Rationen, die Substitute oder bestimmte<br />
Zusatzstoffe nach Codex enthalten, derzeit „gestrichen“ werden.<br />
� Preisänderungen bei Substituten bei geänderter Nachfrage sind nicht berücksichtigt.<br />
� Weitere berücksichtigte <strong>und</strong> nicht berücksichtigte Kosten sind in Tabelle 9-1 angeführt.<br />
Wenn der österreichische Codex eingehalten wird, gibt es zwei Möglichkeiten der Fütterung. Entweder wird maximal<br />
20 % „gentechnikfreier“ SES Soft-IP eingesetzt <strong>und</strong> das restliche benötigte Rohprotein mit Substituten ergänzt, oder<br />
SES wird <strong>zur</strong> Gänze durch „gentechnikfreien“ Hard-IP-SES ersetzt. Bei der Variante mit „gentechnikfreiem“ SES nach<br />
Codex wird SES im Modellfall mit dem im Erhebungszeitraum vergleichsweise teuren Substitut Kürbiskernkuchen<br />
ersetzt. Bei den Substitutionsrationen wurde SES vollständig durch Erbse, Ackerbohne, Maiskleber, Kartoffeleiweiß,<br />
Sonnenblumenkuchen <strong>und</strong> Kürbiskernkuchen ersetzt.<br />
6%<br />
X<br />
Einen weiteren Kostenfaktor in der „GVO-freien“ oder „gentechnikfreien“ Produktion stellen die später in Kapitel 9.1.3<br />
beschriebenen Kontrollkosten dar. Werden diese mit den geänderten Futterkosten addiert, ergeben sich daraus<br />
Differenzkosten, die in Tabelle 9-13 zusammengefasst sind.<br />
Wenn angenommen wird, dass der Anteil an erster Qualität den Kriterien eines Qualitätsprogramms entsprechen<br />
würde ergäbe sich folgendes Bild: Laut DI BAUER beträgt dieser Anteil 85 bis 90 % (d.h. durchschnittlich 87,5 %).<br />
5%<br />
Futter mit „GVO- Futter mit „gen- Futter mit „genfreiem“<br />
SES technikfreiem“<br />
SES<br />
technikfreiem”<br />
SES Hard IP<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
1% 1%<br />
Futter ohne<br />
SES nach VO<br />
(EG) 1829/2003<br />
Futter ohne<br />
SES nach<br />
Codex<br />
Futterdifferenzkosten je Masthuhn 5 % 6 % 5 % 1 % 1 %<br />
X<br />
X<br />
X X<br />
X X X<br />
Seite 167 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 9: Differenzkosten<br />
Werden die Futterdifferenzkosten auf diese Menge an Hühnern umgelegt verteilen sich die Kosten wie in der<br />
folgenden Abbildung dargestellt.<br />
Abbildung 9-16: Futterdifferenzkosten je Masthuhn im Qualitätsprogramm<br />
Anmerkungen <strong>zur</strong> Abbildung:<br />
7%<br />
6%<br />
5%<br />
4%<br />
3%<br />
2%<br />
1%<br />
0%<br />
Futterdifferenzkosten je Masthuhn<br />
im Qualitätsprogramm<br />
� Die Berechnungen werden anhand von 18 Modellrationen durchgeführt.<br />
� Die eingesetzten Rohstoffpreise sind gemittelte Preise aus den Jahren 2003 <strong>und</strong> 2004.<br />
� Die uneingeschränkte Verfügbarkeit aller Rohstoffe wurde zu Berechnungszwecken angenommen, die<br />
Verfügbarkeit von Substituten <strong>und</strong> bestimmter Zusatzstoffe nach Codex ist jedoch derzeit nicht ausreichend<br />
gegeben (Verfügbarkeit Substitute in Österreich siehe Kapitel 3, Tabelle 3-24, Verfügbarkeit Zusatzstoffe nach<br />
Codex siehe Kapitel 4, Tabelle 4-11). Deshalb müssen Rationen, die Substitute oder bestimmte<br />
Zusatzstoffe nach Codex enthalten, derzeit „gestrichen“ werden.<br />
6%<br />
Futter mit<br />
“GVO-freiem”<br />
SES<br />
� Preisänderungen bei Substituten bei geänderter Nachfrage sind nicht berücksichtigt.<br />
� Weitere berücksichtigte <strong>und</strong> nicht berücksichtigte Kosten sind in Tabelle 9-1 angeführt.<br />
Wenn der österreichische Codex eingehalten wird, gibt es zwei Möglichkeiten der Fütterung. Entweder wird maximal<br />
20 % „gentechnikfreier“ SES Soft-IP eingesetzt <strong>und</strong> das restliche benötigte Rohprotein mit Substituten ergänzt, oder<br />
SES wird <strong>zur</strong> Gänze durch „gentechnikfreien“ Hard-IP-SES ersetzt. Bei der Variante mit „gentechnikfreiem“ SES nach<br />
Codex wird SES im Modellfall mit dem im Erhebungszeitraum vergleichsweise teuren Substitut Kürbiskernkuchen<br />
ersetzt. Bei den Substitutionsrationen wurde SES vollständig durch Erbse, Ackerbohne, Maiskleber, Kartoffeleiweiß,<br />
Sonnenblumenkuchen <strong>und</strong> Kürbiskernkuchen ersetzt.<br />
7%<br />
6%<br />
X X<br />
1% 1%<br />
X X<br />
Futter mit “gen- Futter mit “gen- Futter ohne Futter ohne<br />
technikfreiem”<br />
SES<br />
technikfreiem” SES nach VO<br />
SES Hard IP (EG) 1829/2003<br />
SES nach<br />
Codex<br />
X<br />
6 % 7 % 6 % 1 % 1 %<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
X X X<br />
Seite 168 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 9: Differenzkosten<br />
Tabelle 9-13: Differenzkosten je kg Hühnerfleisch im Qualitätsprogramm auf Basis ganzer Geflügelschlachtkörper<br />
Die Verfügbarkeit der Substitute <strong>und</strong> Zusatzstoffe nach Codex wurden in dieser Tabelle nicht<br />
berücksichtigt!<br />
Angaben in Cent je kg Hühnerfleisch mit „GVO-freiem“ SES<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
ohne SES<br />
(mit Substituten)<br />
von bis von bis<br />
Futterdifferenzkosten laut 18 Modellrationen<br />
nach VO (EG) 1829/2003 <strong>und</strong> Codex 3,70 3,90 0,50 0,50<br />
Erhobene Kontrollkosten nach Codex 0,70 0,90 0,70 0,90<br />
Summe nach Codex <strong>„gentechnikfrei“</strong> 4,40 4,80 1,20 1,40<br />
9.1.2.3.6. Putenmast<br />
Für die Berechnungen werden die Leistungen eines durchschnittlichen österreichischen Putenmastbetriebs<br />
herangezogen:<br />
Tabelle 9-14: Leistung eines durchschnittlichen österreichischen Putenmastbetriebs<br />
Putenmast<br />
Produzierte Stück je Betr. 9.500 Stück Auskunft AMA<br />
ø Anteil im Qualitätsprogramm 98,65% errechnet laut Auskunft AMA<br />
ø Leistung im Qualitätsprogr. 9.372 Stück errechnet<br />
Schlachtgewicht 12,75 kg Standard DB 02/03, Seite 202<br />
Putenfleischproduktion 119.490 kg Fleisch je Betr. u. Jahr errechnet<br />
Eine Besonderheit der Putenmast ist, dass eine getrennt geschlechtliche Mast auf Gr<strong>und</strong> der unterschiedlichen<br />
Mastendgewichte von weiblichen <strong>und</strong> männlichen Masttieren notwendig ist. Die Mastendgewichte betragen laut <strong>AGES</strong><br />
bei weiblichen Puten 9,5 – 10 kg <strong>und</strong> bei männlichen 20 – 22 kg. Es wird angenommen, dass der Anteil weiblich-<br />
männlich je 50 % beträgt. Die Futterkosten müssen für beide Geschlechter separat berechnet werden. Die<br />
Vorgehensweise ist in beiden Fällen gleich. Mit Hilfe des Futterverbrauchs im jeweiligen Mastabschnitt <strong>und</strong> den<br />
angegebenen Rationen wird der Verbrauch je Futtermittel errechnet, <strong>und</strong> die Kosten werden analog zu den bereits<br />
beschriebenen Nutzungsrichtungen ermittelt. Ein wesentlicher Unterschied zu allen anderen Nutzungsrichtungen<br />
besteht darin, dass es nicht möglich ist, Puten in den ersten 3 Fütterungsphasen ohne SES bedarfsgerecht zu füttern.<br />
Da aus diesem Gr<strong>und</strong> keine Rationen ohne SES erstellt werden, können dazu auch keine Berechnungen durchgeführt<br />
werden. Es werden die Berechnungen nur für die drei Varianten mit „GVO-freiem“ SES, mit „gentechnikfreiem“ SES<br />
nach Codex mit max. 20 % Soft-IP-SES-Anteil <strong>und</strong> mit „gentechnikfreiem“ SES nach Codex mit Hard-IP-SES<br />
durchgeführt.<br />
Da es in der Putenmast notwendig ist, die Tiere nach Geschlechtern getrennt zu halten <strong>und</strong> Mastendgewichte <strong>und</strong><br />
Futterverbrauch sehr unterschiedlich sind, werden die Futterkosten für weibliche <strong>und</strong> männliche Masttiere getrennt<br />
berechnet. Die Ergebnisse enthalten den gewichteten Mittelwert aus den Kosten für weibliche <strong>und</strong> männliche Tiere<br />
<strong>und</strong> sind in Abbildung 9-17 angeführt.<br />
Seite 169 von 272
Futterdifferenzkosten je<br />
Mastpute<br />
9%<br />
8%<br />
7%<br />
6%<br />
5%<br />
4%<br />
3%<br />
2%<br />
1%<br />
0%<br />
Abbildung 9-17: Futterdifferenzkosten je Mastpute<br />
Anmerkungen <strong>zur</strong> Abbildung:<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 9: Differenzkosten<br />
� Die Berechnungen werden anhand von 24 Modellrationen durchgeführt.<br />
� Die eingesetzten Rohstoffpreise sind gemittelte Preise aus den Jahren 2003 <strong>und</strong> 2004.<br />
� Die uneingeschränkte Verfügbarkeit aller Rohstoffe wurde zu Berechnungszwecken angenommen, die<br />
Verfügbarkeit von bestimmten Zusatzstoffen nach Codex ist jedoch derzeit nicht ausreichend gegeben<br />
(Verfügbarkeit Zusatzstoffe nach Codex siehe Kapitel 4, Tabelle 4-11). Deshalb müssen Rationen, die<br />
bestimmte Zusatzstoffe nach Codex enthalten, derzeit „gestrichen“ werden.<br />
� Preisänderungen bei Substituten bei geänderter Nachfrage sind nicht berücksichtigt.<br />
� Weitere berücksichtigte <strong>und</strong> nicht berücksichtigte Kosten sind in Tabelle 9-1 angeführt.<br />
Im Modellfall wird der Rohproteinbedarf, der mit maximal 20 % Soft-IP-SES in der Ration nicht gedeckt werden kann,<br />
durch Maiskraftfutter, Maiskleber, Rapsextraktionsschrot, Sonnenblumenextraktionsschrot, Kartoffeleiweiß,<br />
Kürbiskernkuchen <strong>und</strong> Erbse ergänzt. Aufgr<strong>und</strong> der hochpreisigen Substitute (z.B. Kartoffeleiweiß € 63,- je dt) sind<br />
die Mehrkosten bei dieser Ration höher.<br />
Wenn berücksichtigt wird, dass von den geschlachteten Tieren 98,65 % den Kriterien eines Qualitätsprogramms<br />
entsprechen, erhöhen sich die Kosten wie in Abbildung 9-18 dargestellt.<br />
5%<br />
Futter mit “GVO-freiem”<br />
SES<br />
8%<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
X X<br />
Futter mit “gentechnik-<br />
freiem SES<br />
5%<br />
Futter mit “gentechnik-<br />
freiem” SES Hard IP<br />
X X<br />
5 % 8 % 5 %<br />
Seite 170 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 9: Differenzkosten<br />
Abbildung 9-18: Futterdifferenzkosten je Mastpute im Qualitätsprogramm<br />
Anmerkungen <strong>zur</strong> Abbildung:<br />
9%<br />
8%<br />
7%<br />
6%<br />
5%<br />
4%<br />
3%<br />
2%<br />
1%<br />
0%<br />
Futterdifferenzkosten je<br />
Mastpute im Qualitätsprogramm<br />
� Die Berechnungen werden anhand von 24 Modellrationen durchgeführt.<br />
� Die eingesetzten Rohstoffpreise sind gemittelte Preise aus den Jahren 2003 <strong>und</strong> 2004.<br />
� Die uneingeschränkte Verfügbarkeit aller Rohstoffe wurde zu Berechnungszwecken angenommen, die<br />
Verfügbarkeit von bestimmten Zusatzstoffen nach Codex ist jedoch derzeit nicht ausreichend gegeben<br />
(Verfügbarkeit Zusatzstoffe nach Codex siehe Kapitel 4, Tabelle 4-11). Deshalb müssen Rationen, die<br />
bestimmte Zusatzstoffe nach Codex enthalten, derzeit „gestrichen“ werden.<br />
� Preisänderungen bei Substituten bei geänderter Nachfrage sind nicht berücksichtigt.<br />
� Weitere berücksichtigte <strong>und</strong> nicht berücksichtigte Kosten sind in Tabelle 9-1 angeführt.<br />
Im Modellfall wird der Rohproteinbedarf, der mit maximal 20 % Soft-IP-SES in der Ration nicht gedeckt werden kann,<br />
durch Maiskraftfutter, Maiskleber, Rapsextraktionsschrot, Sonnenblumenextraktionsschrot, Kartoffeleiweiß,<br />
Kürbiskernkuchen <strong>und</strong> Erbse ergänzt. Aufgr<strong>und</strong> der hochpreisigen Substitute (z.B. Kartoffeleiweiß € 63,- je dt) sind<br />
die Mehrkosten bei dieser Ration höher.<br />
5%<br />
Futter mit “GVO-freiem”<br />
SES<br />
Einen weiteren Kostenfaktor in der „GVO-freien“ oder „gentechnikfreien“ Produktion stellen die später in Kapitel 9.1.3<br />
beschriebenen Kontrollkosten dar. Werden diese mit den geänderten Futterkosten addiert, ergeben sich daraus<br />
Differenzkosten, die in Tabelle 9-15 zusammengefasst sind.<br />
8%<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
X X<br />
Futter mit gentechnik-<br />
freiem” SES<br />
5%<br />
Futter mit “gentechnik-<br />
freiem” SES Hard IP<br />
X X<br />
5 % 8 % 5 %<br />
Seite 171 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 9: Differenzkosten<br />
Tabelle 9-15: Differenzkosten je kg Putenfleisch im Qualitätsprogramm<br />
Verfügbarkeit der Zusatzstoffe wurde in dieser Tabelle nicht berücksichtigt!<br />
Angaben in Cent je kg Putenfleisch mit<br />
entsprechender Qualität mit „GVO-freiem“ SES<br />
von bis<br />
Futterdifferenzkosten laut 24 Modellrationen<br />
nach VO (EG) 1829/2003 <strong>und</strong> Codex 5,70 10,20<br />
Erhobene Kontrollkosten nach Codex 0,10 0,10<br />
Summe nach Codex <strong>„gentechnikfrei“</strong> 5,80 10,30<br />
9.1.3. Kontrollkosten<br />
Zur Überprüfung der Einhaltung der Richtlinien ist es notwendig, in den landwirtschaftlichen Betrieben <strong>und</strong><br />
Futtermittelwerken Kontrollen durchzuführen. Bei der Erhebung der Kosten für diese Kontrollen wird davon<br />
ausgegangen, dass jeder Betrieb einmal jährlich überprüft wird <strong>und</strong> der Qualitätsprogrammbetreiber, <strong>und</strong> nicht<br />
einzelne Landwirte, den Vertrag mit der Kontrollstelle abschließt.<br />
9.1.3.1. Durchführung der Anfrage an österreichische Bio-Kontrollstellen<br />
In Österreich sind die akkreditierten Biokontrollstellen berechtigt die Prüfung auf eine „gentechnikfreie“ Produktion<br />
durchzuführen, wenn diese um die Aufnahme in das Akkreditierungsverfahren bei der Akkreditierungsstelle<br />
angesucht haben. Diese Kontrollstellen sind in Tabelle 9-16 angeführt:<br />
Tabelle 9-16: Akkreditierte Biokontrollstellen in Österreich<br />
Agrovet – Lebensmittel- <strong>und</strong> Umweltqualität Sicherung GmbH Königsbrunnerstraße 8<br />
Biokontrollservice Österreich<br />
2202 Enzersfeld<br />
Feyregg 39<br />
4552 Wartberg<br />
Lebensmittelversuchsanstalt Blaasstraße 29<br />
Privatinstitut für Qualitätssicherung <strong>und</strong> Zertifizierung<br />
ökologisch erzeugter Lebensmittel GmbH (lacon)<br />
1190 Wien<br />
Arnreit 13<br />
4122 Arnreit<br />
Salzburger Landwirtschaftliche Kontrolle Maria-Cebotari-Straße 3<br />
5020 Salzburg<br />
SGS Austria Controll-Co. GmbH Johannesgasse 14<br />
1015 Wien<br />
Verband Kontrollservice Tirol Brixnerstraße 1<br />
Quelle: www.bmwa.gv.at 2005-03-01<br />
6020 Innsbruck<br />
An diese Kontrollstellen wurde am 18. März 2005 ein Fragebogen ausgesandt, in dem sie gebeten wurden, die<br />
Kontrollkosten <strong>und</strong> den Kontrollumfang für jede Tierart nach der Anzahl der Betriebe gestaffelt anzugeben. Die<br />
Vorgabe war, dass laut Codex <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> geprüft werden muss; der genaue Kontrollumfang<br />
wurde nicht vorgegeben. Weiters wurde gefragt, ob eine Kontrolle, die im Zuge einer anderen Kontrolle (z.B.<br />
Tierschutz, AMA-Gütesiegel) durchgeführt wird, eine Kostenreduktion bringen würde. Dieser Punkt wurde als<br />
„reduzierte Kontrollkosten“ bezeichnet.<br />
Von vier Kontrollstellen wurden Informationen <strong>zur</strong> Verfügung gestellt.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 172 von 272
9.1.3.2. Kontrollumfang<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 9: Differenzkosten<br />
Unabhängig voneinander gaben alle Kontrollstellen im wesentlichen den selben Kontrollumfang bekannt, der sich wie<br />
folgt gliedert:<br />
� Pflanzenbau:<br />
o Saatgut<br />
� Tierhaltung:<br />
o Pflanzenschutzmittel<br />
o Düngemittel<br />
o Viehverkehr<br />
o Umstellungsfristen<br />
o Zukauffuttermittel<br />
o Silierhilfsmittel<br />
Zur Überprüfung dieser Punkte werden Rechnungen, Lieferscheine <strong>und</strong> sonstige Aufzeichnungen kontrolliert.<br />
Außerdem beinhaltet die Kontrolle eine Musterziehung. Sollte eine Laboranalyse notwendig sein, wären damit<br />
zusätzliche Kosten verb<strong>und</strong>en.<br />
9.1.3.3. Preise <strong>und</strong> Kosten je Einheit (Tier bzw. kg Fleisch, kg Milch, Ei)<br />
Aus den von den Kontrollstellen angegebenen Preisen wurde der Mittelwert berechnet <strong>und</strong> in Tabelle 9-17<br />
zusammengefasst. Betriebswirtschaftlich relevant sind nicht die Kosten je Betrieb, sondern die Kosten je produzierter<br />
Einheit. Sie hängen davon ab, wie viel von einem Produkt erzeugt wird. Die Produktionsmenge ist den Daten aus<br />
Kapitel 9.1.1 zu entnehmen. Es muss davon ausgegangen werden, dass jeder Betrieb nur einen Betriebszweig hat<br />
bzw. die Kontrollkosten für jeden einzelnen Betriebszweig anfallen, weil nicht bekannt ist, wie viele Betriebe welche<br />
Nutzungsrichtungen gleichzeitig haben. Aus den Angaben der Kontrollstellen <strong>und</strong> den Produktionsmengen wurden<br />
folgende anteilige Kontrollkosten je kg Milch, kg Fleisch <strong>und</strong> je Ei bzw. je Tier errechnet, die in Tabelle 9-17<br />
zusammengefasst sind.<br />
Tabelle 9-17: Anteilige Kontrollkosten je produzierter Einheit <strong>und</strong> je Tier<br />
Kontrollkosten<br />
Milchvieh<br />
zu kontrollierende Betriebe 500 2500 5000<br />
Kosten laut Kontrollstellen 124,3 121,5 118,0 je Betrieb<br />
Kontrollkosten je Betrieb in € 136,7 133,7 129,8 inkl. 10 % USt.<br />
kg Milch je Betrieb <strong>und</strong> Jahr 45.918,4<br />
Kontrollkosten je kg Milch in Cent 0,30 0,29 0,28<br />
Kühe je Betrieb 10,1<br />
Kontrollkosten je Kuh in € 13,53 10,87 10,55<br />
Reduzierte Kontrollkosten<br />
zu kontrollierende Betriebe 500 2500 5000<br />
Kosten laut Kontrollstellen 100,0 96,0 93,8 je Betrieb<br />
Kontrollkosten je Betrieb in € 110,0 105,6 103,1 inkl. 10 % USt.<br />
kg Milch je Betrieb <strong>und</strong> Jahr 45.918,4<br />
Kontrollkosten je kg Milch in Cent 0,24 0,23 0,22<br />
Kühe je Betrieb 10,1<br />
Kontrollkosten je Kuh in € 10,89 8,59 8,38<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 173 von 272
Kontrollkosten<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 9: Differenzkosten<br />
Rindermast<br />
zu kontrollierende Betriebe 500 2500 5000<br />
Kosten laut Kontrollstellen 114,3 111,5 108,0 je Betrieb<br />
Kontrollkosten je Betrieb in € 125,7 122,7 118,8 inkl. 10 % USt.<br />
kg Fleisch je Betrieb <strong>und</strong> Jahr 4.305,0<br />
Kontrollkosten je kg Fleisch in Cent 2,92 2,85 2,76<br />
Anzahl der Rinder 12,3 mit Qualitätszuschlag Jahresproduktion<br />
Kontrollkosten je Rind in € 10,22 9,97 9,66<br />
Reduzierte Kontrollkosten<br />
zu kontrollierende Betriebe 500 2500 5000<br />
Kosten laut Kontrollstellen 90,0 86,0 83,8 je Betrieb<br />
Kontrollkosten je Betrieb in € 99,0 94,6 92,1 inkl. 10 % USt.<br />
kg Fleisch je Betrieb <strong>und</strong> Jahr 4.305,0<br />
Kontrollkosten je kg Fleisch in Cent 2,30 2,20 2,14<br />
Anzahl der Rinder 12,3 mit Qualitätszuschlag Jahresproduktion<br />
Kontrollkosten je Rind in € 8,05 7,69 7,49<br />
Kontrollkosten<br />
Schweinemast<br />
zu kontrollierende Betriebe 500 2500 5000<br />
Kosten laut Kontrollstellen 114,3 111,5 108,0 je Betrieb<br />
Kontrollkosten je Betrieb in € 125,7 122,7 118,8 inkl. 10 % USt.<br />
kg Fleisch je Betrieb <strong>und</strong> Jahr 27.542,00<br />
Kontrollkosten je kg Fleisch in Cent 0,46 0,45 0,43<br />
Anzahl der Schweine je Betrieb 293,00 mit Qualitätszuschlag Jahresproduktion<br />
Kontrollkosten je Schwein in € 0,43 0,42 0,41<br />
Reduzierte Kontrollkosten<br />
zu kontrollierende Betriebe 500 2500 5000<br />
Kosten laut Kontrollstellen 100,5 96,5 94,3 je Betrieb<br />
Kontrollkosten je Betrieb in € 110,6 106,2 103,7 inkl. 10 % USt.<br />
kg Fleisch je Betrieb <strong>und</strong> Jahr 27.542,00<br />
Kontrollkosten je kg Fleisch in Cent 0,40 0,39 0,38<br />
Anzahl der Schweine je Betrieb 293,00 mit Qualitätszuschlag Jahresproduktion<br />
Kontrollkosten je Schwein in € 0,38 0,36 0,35<br />
Kontrollkosten<br />
Legehennen<br />
zu kontrollierende Betriebe 600<br />
Kosten laut Kontrollstellen 125,5 je Betrieb<br />
Kontrollkosten je Betrieb in € 138,1 inkl. 10 % USt.<br />
Eier je Betrieb <strong>und</strong> Jahr 515.280,0<br />
Kontrollkosten je Ei in Cent 0,03<br />
Hennen je Betrieb 2000<br />
Kontrollkosten je Henne in € 0,07<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 174 von 272
Reduzierte Kontrollkosten<br />
zu kontrollierende Betriebe 500<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 9: Differenzkosten<br />
Kosten laut Kontrollstellen 100,0 je Betrieb<br />
Kontrollkosten je Betrieb in € 110,0 inkl. 10 % USt.<br />
Eier je Betrieb <strong>und</strong> Jahr 515.280,0<br />
Kontrollkosten je Ei in Cent 0,02<br />
Hennen je Betrieb 2000<br />
Kontrollkosten je Henne in € 0,06<br />
Kontrollkosten<br />
Hühnermast<br />
zu kontrollierende Betriebe 100 200<br />
Kosten laut Kontrollstellen 134,3 128,0 je Betrieb<br />
Kontrollkosten je Betrieb in € 147,7 140,8 inkl. 10 % USt.<br />
kg Fleisch je Betrieb <strong>und</strong> Jahr 16.228,2<br />
Kontrollkosten je kg Fleisch in Cent 0,91 0,87<br />
Anzahl der Hühner 9546 Jahresproduktion<br />
Kontrollkosten je Huhn in € 0,015 0,015<br />
Reduzierte Kontrollkosten<br />
zu kontrollierende Betriebe 100 200<br />
Kosten laut Kontrollstellen 106,3 102,5 je Betrieb<br />
Kontrollkosten je Betrieb in € 116,9 112,8 inkl. 10 % USt.<br />
kg Fleisch je Betrieb <strong>und</strong> Jahr 16.228,2<br />
Kontrollkosten je kg Fleisch in Cent 0,72 0,69<br />
Anzahl der Hühner 9546 Jahresproduktion<br />
Kontrollkosten je Huhn in € 0,012 0,012<br />
Kontrollkosten<br />
Putenmast<br />
zu kontrollierende Betriebe 40<br />
Kosten laut Kontrollstellen 140,5 je Betrieb<br />
Kontrollkosten je Betrieb in € 154,6 inkl. 10 % USt.<br />
kg Fleisch je Betrieb <strong>und</strong> Jahr 119.489,8<br />
Kontrollkosten je kg Fleisch in Cent 0,13<br />
Anzahl der Puten 9.372,0 Jahresproduktion mit entsprechender Qualität<br />
Kontrollkosten je Pute in € 0,016<br />
Reduzierte Kontrollkosten<br />
zu kontrollierende Betriebe 40<br />
Kosten laut Kontrollstellen 112,5 je Betrieb<br />
Kontrollkosten je Betrieb in € 123,8 inkl. 10 % USt.<br />
kg Fleisch je Betrieb <strong>und</strong> Jahr 119.489,8<br />
Kontrollkosten je kg Fleisch in Cent 0,10<br />
Anzahl der Puten 9.372,0 Jahresproduktion mit entsprechender Qualität<br />
Kontrollkosten je Pute in € 0,013<br />
Quelle: Tabelle 9-2, Tabelle 9-5, Tabelle 9-7, Tabelle 9-10, Tabelle 9-12,<br />
Tabelle 9-14 <strong>und</strong> Angaben der Kontrollstellen<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 175 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 9: Differenzkosten<br />
Die Kontrollkosten je Futtermittelwerk betragen durchschnittlich € 900,- pro Jahr.<br />
9.1.3.4. Interpretation<br />
Die anteiligen Kontrollkosten je produzierter Einheit sind erwartungsgemäß sehr niedrig. Auffallend ist nur, dass sich<br />
mit Ausnahme der Rindermast die anfallenden Kosten je Produkt (1 kg Fleisch, 1 kg Milch bzw. 1 Ei) im Tausendstel-<br />
Euro-Bereich befinden, bei der Rindermast hingegen oft zehnmal so hoch sind wie bei den anderen Produkten.<br />
Betrachtet man die Kosten je Tier fällt auch hier wieder der Rinderbereich auf. Die Kontrollkosten je Rind (Mast <strong>und</strong><br />
Milchvieh) betragen durchschnittlich € 12,06. Im Vergleich dazu betragen die Kontrollkosten pro Mastschwein im<br />
teuersten Fall € 0,52. Bei Geflügel sind die Kosten je Tier noch niedriger. Der hohe Betrag in der Rinderhaltung<br />
entsteht durch die in Österreich sehr kleinen Bestände <strong>und</strong> die damit verb<strong>und</strong>ene geringe Kostenaufteilung auf<br />
wenige Einheiten. Es muss allerdings angemerkt werden, dass oft Milchviehhaltung <strong>und</strong> Rindermast am selben<br />
Betrieb kombiniert werden <strong>und</strong> dadurch die Kontrollkosten nur einmal anfallen, d.h. sie reduzieren sich je Tier, aber<br />
auch je produzierter Einheit auf die Hälfte, wären allerdings immer noch signifikant höher als in den anderen<br />
Bereichen. An dieser Stelle wird noch einmal darauf hingewiesen, dass bei der Kontrollkostenerhebung eine jährliche<br />
Kontrolle aller Betriebe zu Gr<strong>und</strong>e gelegt wurde. Eine risikobasierte Kontrolle (nicht alle Betriebe werden kontrolliert)<br />
führt zu einer Erhöhung der Kontrollkosten je Betrieb, weil die Fahrtkosten auf Gr<strong>und</strong> der geringeren Dichte der<br />
Betriebe steigen <strong>und</strong> eine eingehendere <strong>und</strong> umfangreichere Kontrolle notwendig ist. Die Kontrollkosten insgesamt<br />
wären aber wahrscheinlich niedriger.<br />
9.1.4. Mögliche weitere Kriterien für die Umsetzung eines Qualitätsprogrammes „GVO-frei“ oder<br />
“gentechnikfrei“<br />
� Hofmischung oder Fertigfutterzukauf<br />
� Verteilung nach B<strong>und</strong>esländern<br />
Diese zwei Kriterien werden nun kurz beschrieben.<br />
9.1.4.1. Hofmischung oder Fertigfutterzukauf<br />
Hofmischung heißt, dass der Landwirt die einzelnen Futterkomponenten entweder am eigenen Betrieb produziert<br />
oder zukauft <strong>und</strong> diese selbst mit einer (meist eigenen) Mischanlage mischt. Wenn das Mischen mit mobilen<br />
Mischanlagen erfolgt, muss auf allen Betrieben, auf denen mit der selben Anlage gemischt wird, ausschließlich Futter<br />
aus „GVO-freier“ oder „gentechnikfreier“ Produktion verwendet werden, um Verschleppungen zu vermeiden. Beim<br />
Fertigfutterzukauf wird das Futter so verfüttert wie es geliefert wird <strong>und</strong> beim Landwirt nicht mehr bearbeitet. Der<br />
Anteil von Hofmischung <strong>und</strong> Fertigfutterzukauf ist, wie in Abbildung 9-19 ersichtlich, je nach Tierart unterschiedlich<br />
hoch<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
Rinder Schw ein Geflügel<br />
Fertigfutter 24,0% 9,5% 77,6%<br />
Hofmischung 76,0% 90,5% 22,4%<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 176 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 9: Differenzkosten<br />
Abbildung 9-19: Anteil von Hofmischung <strong>und</strong> Fertigfutter nach Tierarten<br />
Quelle: www.mischfutter.at, 2004-04-24<br />
Ein großer Unterschied dieser beiden Verfahren besteht in der Logistik. Während bei der Verwendung von<br />
Fertigfutter das Mischfutterwerk die Beschaffung der Rohstoffe vornimmt, muss das im Falle der Hofmischungen der<br />
Landwirt selbst durchführen. In Mischfutterwerken werden große Mengen von verschiedenen Futtermitteln<br />
zugekauft, sodass es unproblematisch ist, zumindest die Menge eines LKW-Zugs zu übernehmen, der vom<br />
Großhandel geliefert wird. Ganz anders stellt sich die Situation in den heimischen landwirtschaftlichen Betrieben dar.<br />
Die Rohstoffe werden von den Landwirten bei Lagerhäusern, Landesproduktenhändlern <strong>und</strong> Mischfutterwerken<br />
gekauft. Gesackte Ware verursacht in diesem Zusammenhang kein Problem, weil sie einerseits beliebig teilbar ist <strong>und</strong><br />
andererseits auch mit konventioneller Ware transportiert werden kann, ohne dass es zu Vermischungen <strong>und</strong><br />
Verschleppungen kommt. Bei loser Ware muss sowohl bei der Lagerung im Handel als auch bei den<br />
Transportfahrzeugen sichergestellt sein, dass Vermischungen <strong>und</strong> Verschleppungen ausgeschlossen sind.<br />
Vorraussetzungen dafür wären, dass an einem Standort ausschließlich „GVO-freies“ oder „gentechnikfreies“ Futter<br />
vorhanden sein darf oder zumindest Überschneidungen der Warenströme auf einem Standort vermieden werden<br />
müssen <strong>und</strong> dass Fahrzeuge für Verladung <strong>und</strong> Transport nur für „GVO-freies“ oder „gentechnikfreies“ Futter<br />
verwendet werden dürfen. Eine andere Möglichkeit wäre, dass die Futtermittel vom Handel nicht zwischengelagert<br />
werden, sondern direkt vom Hafen zum Landwirt geliefert werden.<br />
9.1.4.2. Verteilung der Tierbestände nach B<strong>und</strong>esländern<br />
In Österreich werden laut Grüner Bericht 2004 (BMLFUW, 2004, 187) 2.024.079 Rinder, 3.174.658 Schweine <strong>und</strong><br />
10.095.814 Stück Geflügel gehalten.<br />
Die Tierbestände sind sehr unterschiedlich auf die einzelnen B<strong>und</strong>esländer verteilt. Die folgenden Abbildungen sollen<br />
einen Überblick darüber geben, in welchem B<strong>und</strong>esland wie viele Tiere gehalten werden <strong>und</strong> welche Futtermengen<br />
für die Fütterung dieser Tiere benötigt werden.<br />
400.000<br />
350.000<br />
300.000<br />
250.000<br />
200.000<br />
150.000<br />
100.000<br />
50.000<br />
0<br />
14.366<br />
110.207<br />
Viehbestand Rinder in Österreich (ohne Kühe)<br />
306.954<br />
367.403<br />
88.950<br />
194.717<br />
106.076<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
34.461<br />
35<br />
1.223.169<br />
B K NÖ OÖ S St T V W Ö<br />
Abbildung 9-20: Viehbestand Rinder (ohne Kühe)<br />
Quelle: Daten aus BMLFUW, 2004, 187<br />
Seite 177 von 272
800.000<br />
700.000<br />
600.000<br />
500.000<br />
400.000<br />
300.000<br />
200.000<br />
100.000<br />
0<br />
8.872<br />
68.060<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 9: Differenzkosten<br />
Futterverbrauch Rinder (ohne Kühe)<br />
189.564 226.895<br />
54.932<br />
120.250<br />
65.509<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
21.282<br />
22<br />
755.386<br />
B K NÖ OÖ S St T V W Ö<br />
Abbildung 9-21: Futterverbrauch Rinder (ohne Kühe) in t<br />
Quelle: Daten von www.mischfutter.at, 2004-04-24<br />
400.000<br />
350.000<br />
300.000<br />
250.000<br />
200.000<br />
150.000<br />
100.000<br />
50.000<br />
0<br />
8.100<br />
82.000<br />
Abbildung 9-22: Viehbestand Kühe<br />
Quelle: Daten aus BMLFUW, 2004, 187<br />
155.100<br />
Viehbestand Kühe in Österreich<br />
233.000<br />
79.800<br />
134.200<br />
80.900<br />
27.800<br />
10<br />
800.910<br />
B K NÖ OÖ S St T V W Ö<br />
Seite 178 von 272
800.000<br />
700.000<br />
600.000<br />
500.000<br />
400.000<br />
300.000<br />
200.000<br />
100.000<br />
0<br />
5.002<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 9: Differenzkosten<br />
50.640 95.784 143.893<br />
Futterverbrauch Kühe<br />
49.282 82.877 49.961 17.168 6<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
494.614<br />
B K NÖ OÖ S St T V W Ö<br />
Abbildung 9-23: Futterverbrauch Kühe in t<br />
Quelle: Daten von www.mischfutter.at, 2004-04-24<br />
1.200.000<br />
1.000.000<br />
800.000<br />
600.000<br />
400.000<br />
200.000<br />
0<br />
70.946<br />
158.197<br />
Viehbestand Schweine in Österreich<br />
904.179<br />
1.150.010<br />
11.748<br />
846.214<br />
21.264<br />
11.665<br />
435<br />
3.174.658<br />
B K NÖ OÖ S St T V W Ö<br />
Abbildung 9-24: Viehbestand Schweine<br />
Quelle: Daten aus BMLFUW, 2004, 187<br />
Seite 179 von 272
800.000<br />
700.000<br />
600.000<br />
500.000<br />
400.000<br />
300.000<br />
200.000<br />
100.000<br />
0<br />
46.930<br />
104.646<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 9: Differenzkosten<br />
598.104<br />
Futterverbrauch Schweine<br />
760.718<br />
7.771<br />
559.761<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
14.066 7.716 288<br />
2.100.000<br />
B K NÖ OÖ S St T V W Ö<br />
Abbildung 9-25: Futterverbrauch Schweine in t<br />
Quelle: Daten von www.mischfutter.at, 2004-04-24<br />
4.000.000<br />
3.500.000<br />
3.000.000<br />
2.500.000<br />
2.000.000<br />
1.500.000<br />
1.000.000<br />
500.000<br />
0<br />
245.507<br />
1.170.544<br />
Abbildung 9-26: Viehbestand Geflügel<br />
Quelle: Daten aus BMLFUW, 2004, 187<br />
Viehbestand Geflügel in Österreich<br />
2.699.392<br />
2.334.832<br />
114.125<br />
3.359.982<br />
96.578 74.202 652<br />
B K NÖ OÖ S St T V W<br />
Seite 180 von 272
800.000<br />
700.000<br />
600.000<br />
500.000<br />
400.000<br />
300.000<br />
200.000<br />
100.000<br />
0<br />
11.916<br />
56.812<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 9: Differenzkosten<br />
131.015 113.321<br />
Futterverbrauch Geflügel<br />
5.539<br />
163.077<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
4.687 3.601 32<br />
490.000<br />
B K NÖ OÖ S St T V W Ö<br />
Abbildung 9-27: Futterverbrauch Geflügel in t<br />
Quelle: Daten von www.mischfutter.at, 2004-04-24<br />
In diesen Abbildungen ist zu erkennen, dass die meisten Tiere in Ober-, Niederösterreich <strong>und</strong> der Steiermark<br />
gehalten werden. Es ist daher davon auszugehen, dass in diesen B<strong>und</strong>esländern auch die größten<br />
Futtermittelmengen nachgefragt werden. Das Ausmaß der Nachfrage hängt allerdings nicht nur von der Anzahl der<br />
Tiere, sondern auch von der Tierart ab. Der gesamte Futteraufwand in Österreich stellt sich wie aus Tabelle 9-18<br />
ersichtlich dar:<br />
Tabelle 9-18: Futterverbrauch in Österreich<br />
Angaben in t Fertigfutter Hofmischung Summe Tierart<br />
Rinder 300.000 950.000 1.250.000<br />
Schwein 200.000 1.900.000 2.100.000<br />
Geflügel 380.000 110.000 490.000<br />
Quelle: www.mischfutter.at, 2004-04-24<br />
Werden diese Futtermengen auf die bereits angeführten Tierbestände aufgeteilt, ergibt sich ein Futteräquivalent<br />
(Gesamtfutterverbrauch je Tierart : gehaltene Tiere) von 618 kg je Stallplatz Rind, 662 kg je Stallplatz Schwein, 49<br />
kg je Stallplatz Geflügel. Diese Zahlen stellen nicht den Verbrauch für ein einzelnes Tier dar. Diese Vorgehensweise<br />
ist sicherlich eine sehr vereinfachte Methode der Abschätzung der Futtermengen. Sie dient jedoch dazu, einen<br />
ungefähren Überblick über die Futtermittelnachfrageverteilung in der heimischen Landwirtschaft zu geben. In den<br />
folgenden Abbildungen sind links die Tierbestände der einzelnen B<strong>und</strong>esländer dargestellt; aus den Abbildungen auf<br />
der rechten Seite werden die Tierbestände in Österreich bzw. in den einzelnen B<strong>und</strong>esländern mit den<br />
Futterverbrauchszahlen der einzelnen Tierarten multipliziert <strong>und</strong> dargestellt. Es wird außerdem noch einmal zwischen<br />
Futtermitteln, die als Fertigfutter zugekauft <strong>und</strong> Futtermitteln, die am Hof gemischt werden, unterschieden. Der<br />
österreichische Durchschnitt wird auf alle B<strong>und</strong>esländer umgelegt, weil keine genaueren Zahlen vorliegen.<br />
Tatsächlich dürfte in Grünlandgebieten der Anteil an Fertigfutter <strong>und</strong> in Ackerbaugebieten der Anteil an<br />
Hofmischungen höher sein. Wien ist in diesem Zusammenhang völlig unbedeutend <strong>und</strong> wird nicht dargestellt.<br />
Seite 181 von 272
12.000.000<br />
10.000.000<br />
8.000.000<br />
6.000.000<br />
4.000.000<br />
2.000.000<br />
-<br />
3.000.000<br />
2.500.000<br />
2.000.000<br />
1.500.000<br />
1.000.000<br />
500.000<br />
0<br />
Viehbestand in Österrreich<br />
1.223.169<br />
Rinder ohne<br />
Kühe<br />
800.910<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln<br />
Kapitel 9: Differenzkosten<br />
3.174.658<br />
10.095.814<br />
Kühe Schweine Geflügel<br />
Viehbestand im Burgenland<br />
14.366 8100 70.946<br />
Rinder ohne<br />
Kühe<br />
245.507<br />
Kühe Schweine Geflügel<br />
2.500.000<br />
2.000.000<br />
1.500.000<br />
1.000.000<br />
500.000<br />
Futterverbrauch in Österreich bei Rindern,<br />
Schweinen <strong>und</strong> Geflügel in t<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
-<br />
Rinder Schweine Geflügel<br />
Fertigfutt. 300.000 199.500 380.240<br />
Hofmisch. 950.000 1.900.500 109.760<br />
800.000<br />
700.000<br />
600.000<br />
500.000<br />
400.000<br />
300.000<br />
200.000<br />
100.000<br />
-<br />
Futterverbrauch im Burgenland bei Rindern,<br />
Schweinen <strong>und</strong> Geflügel in t<br />
Rinder Schweine Geflügel<br />
Fertigfutt. 3.330 4.458 9.247<br />
Hofmisch. 10.544 42.472 2.669<br />
Seite 182 von 272
3.000.000<br />
2.500.000<br />
2.000.000<br />
1.500.000<br />
1.000.000<br />
500.000<br />
0<br />
3 000 000<br />
2 500 000<br />
2 000 000<br />
1 500 000<br />
1 000 000<br />
500 000<br />
0<br />
3.000.000<br />
2.500.000<br />
2.000.000<br />
1.500.000<br />
1.000.000<br />
500.000<br />
0<br />
3.000.000<br />
2.500.000<br />
2.000.000<br />
1.500.000<br />
1.000.000<br />
500.000<br />
0<br />
Viehbestand in Kärnten<br />
110.207 82.000 158.197<br />
Rinder ohne<br />
Kühe<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 9: Differenzkosten<br />
1.170.544<br />
Kühe Schweine Geflügel<br />
Viehbestand in Niederösterreich<br />
306 954<br />
Rinder ohne<br />
Kühe<br />
155 100<br />
904 179<br />
2 699 392<br />
Kühe Schweine Geflügel<br />
Viehbestand in Oberösterreich<br />
367.403<br />
Rinder ohne<br />
Kühe<br />
233.000<br />
1.150.010<br />
2.334.832<br />
Kühe Schweine Geflügel<br />
Viehbestand in Salzburg<br />
88.950 79.800 11.748<br />
Rinder ohne<br />
Kühe<br />
114.125<br />
Kühe Schweine Geflügel<br />
800.000<br />
700.000<br />
600.000<br />
500.000<br />
400.000<br />
300.000<br />
200.000<br />
100.000<br />
Futterverbrauch in Kärnten bei Rindern,<br />
Schweinen <strong>und</strong> Geflügel in t<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
-<br />
Rinder Schweine Geflügel<br />
Fertigfutt. 28.488 9.941 44.086<br />
Hofmisch. 90.212 94.704 12.726<br />
800.000<br />
700.000<br />
600.000<br />
500.000<br />
400.000<br />
300.000<br />
200.000<br />
100.000<br />
Futterverbrauch in Niederösterreich bei Rindern,<br />
Schweinen <strong>und</strong> Geflügel in t<br />
-<br />
Rinder Schweine Geflügel<br />
Fertigfutt. 68.484 56.820 101.668<br />
Hofmisch. 216.865 541.284 29.347<br />
800.000<br />
700.000<br />
600.000<br />
500.000<br />
400.000<br />
300.000<br />
200.000<br />
100.000<br />
-<br />
Futterverbrauch in Oberösterreich bei Rindern,<br />
Schweinen <strong>und</strong> Geflügel in t<br />
Rinder Schweine Geflügel<br />
Fertigfutt. 88.989 72.268 87.937<br />
Hofmisch. 281.799 688.450 25.384<br />
800.000<br />
700.000<br />
600.000<br />
500.000<br />
400.000<br />
300.000<br />
200.000<br />
100.000<br />
-<br />
Futterverbrauch in Salzburg bei Rindern,<br />
Schweinen <strong>und</strong> Geflügel in t<br />
Rinder Schweine Geflügel<br />
Fertigfutt. 25.011 738 4.298<br />
Hofmisch. 79.203 7.033 1.241<br />
Seite 183 von 272
4.000.000<br />
3.500.000<br />
3.000.000<br />
2.500.000<br />
2.000.000<br />
1.500.000<br />
1.000.000<br />
500.000<br />
0<br />
3.000.000<br />
2.500.000<br />
2.000.000<br />
1.500.000<br />
1.000.000<br />
500.000<br />
0<br />
3.000.000<br />
2.500.000<br />
2.000.000<br />
1.500.000<br />
1.000.000<br />
500.000<br />
0<br />
Viehbestand in der Steiermark<br />
194.717 134.200<br />
Rinder ohne<br />
Kühe<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 9: Differenzkosten<br />
846.214<br />
3.359.982<br />
Kühe Schweine Geflügel<br />
Viehbestand in Tirol<br />
106.076 80.900 21.264 96.578<br />
Rinder ohne<br />
Kühe<br />
Kühe Schweine Geflügel<br />
Viehbestand in Vorarlberg<br />
34.461 27.800 11.665 74.202<br />
Rinder ohne<br />
Kühe<br />
Kühe Schweine Geflügel<br />
800.000<br />
700.000<br />
600.000<br />
500.000<br />
400.000<br />
300.000<br />
200.000<br />
100.000<br />
Futterverbrauch in der Steiermark bei Rindern,<br />
Schweinen <strong>und</strong> Geflügel in t<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
-<br />
Rinder Schweine Geflügel<br />
Fertigfutt. 48.751 53.177 126.547<br />
Hofmisch. 154.377 506.584 36.529<br />
800.000<br />
700.000<br />
600.000<br />
500.000<br />
400.000<br />
300.000<br />
200.000<br />
100.000<br />
Futterverbrauch in Tirol bei Rindern, Schweinen<br />
<strong>und</strong> Geflügel in t<br />
-<br />
Rinder Schweine Geflügel<br />
Fertigfutt. 27.713 1.336 3.637<br />
Hofmisch. 87.757 12.730 1.050<br />
800.000<br />
700.000<br />
600.000<br />
500.000<br />
400.000<br />
300.000<br />
200.000<br />
100.000<br />
-<br />
Futterverbrauch in Vorarlberg bei Rindern,<br />
Schweinen <strong>und</strong> Geflügel in t<br />
Rinder Schweine Geflügel<br />
Fertigfutt. 9.228 733 2.795<br />
Hofmisch. 29.222 6.983 807<br />
Abbildung 9-28: Viehbestände <strong>und</strong> Futtermittelnachfrage in den einzelnen B<strong>und</strong>esländern<br />
Quellen: BMLFUW, 2004, 187 <strong>und</strong> www.mischfutter.at, 2005-04-24<br />
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich die B<strong>und</strong>esländer in drei Gruppen einteilen lassen. In<br />
Oberösterreich, Niederösterreich <strong>und</strong> der Steiermark werden die meisten Tiere gehalten. Somit wird dort bei allen<br />
Tierarten am meisten Futter verbraucht. Die zweite Gruppe bilden das Burgenland <strong>und</strong> Kärnten. In diesen beiden<br />
B<strong>und</strong>esländern ist der Futterverbrauch bei allen drei Tierarten etwa gleich hoch, wenn auch auf unterschiedlichem<br />
Niveau. Die dritte Gruppe bilden die westlichen B<strong>und</strong>esländer Salzburg, Tirol <strong>und</strong> Vorarlberg. Die Schweine- <strong>und</strong><br />
Geflügelproduktion ist in diesen B<strong>und</strong>esländern unbedeutend.<br />
Seite 184 von 272
Zusammenfassung:<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 9: Differenzkosten<br />
Als Basis für die Berechnung der Differenzkosten dienen die Futterkosten bei konventioneller Produktion, d.h. als mit<br />
GVO gekennzeichneten Futtermitteln. Die Differenzkosten ergeben sich aus der Differenz zwischen den jeweiligen<br />
Modellrationen <strong>und</strong> der Produktion mit GVO. Die Differenzkosten werden als prozentueller Minder- oder Mehraufwand<br />
im Verhältnis <strong>zur</strong> konventionellen Produktion als mit GVO gekennzeichneten Futtermitteln (=100 %) ausgedrückt.<br />
In diesem Kapitel wurden anhand von 184 Modellrationen (unter Annahme von vergleichbarer Leistungszunahme)<br />
jene Differenzkosten berechnet, die bei der „gentechnikfreien“ Herstellung von tierischen Produkten in<br />
Futtermittelwerken <strong>und</strong> landwirtschaftlichen Betrieben (in getrennten geschlossenen Prozessen) auftreten.<br />
Die uneingeschränkte Verfügbarkeit aller Rohstoffe wurde zu Berechnungszwecken angenommen. Allerdings ist die<br />
Verfügbarkeit von Substituten <strong>und</strong> bestimmter Zusatzstoffe nach Codex derzeit nicht ausreichend gegeben<br />
(Verfügbarkeit Substitute in Österreich siehe Kapitel 3, Tabelle 3-24, Verfügbarkeit Zusatzstoffe nach Codex siehe<br />
Kapitel 4, Tabelle 4-11). Deshalb müssen Rationen, die Substitute oder bestimmte Zusatzstoffe nach<br />
Codex enthalten, gestrichen werden.<br />
Diese Zusammenfassung soll einen kurzen Überblick über die gewonnen Erkenntnisse geben.<br />
Bei der Produktion von „gentechnikfreien“ tierischen Produkten fallen eine Reihe von unterschiedlichen Kosten an.<br />
Die Tabelle 9-1 aus dem Kapitel Differenzkosten soll einen Überblick darüber geben, welche Kosten anfallen können<br />
<strong>und</strong> welche von diesen Kosten direkt in das Berechnungsmodell der Futterdifferenzkosten aufgenommen werden.<br />
Die Differenzkosten, die bei der Differenzkostenberechnung berücksichtigt wurden, beziehen sich vor allem auf<br />
folgende Punkte:<br />
o erhöhte Rohstoffkosten <strong>und</strong><br />
o erhöhte Logistikkosten<br />
Im Rahmen dieser Studie konnte zu den einzelnen Punkten folgendes festgestellt werden:<br />
� Die eingesetzten Rohstoffpreise sind gemittelte Preise aus den Jahren 2003 <strong>und</strong> 2004. Erhöhte<br />
Rohstoffkosten treten bei der Beschaffung von „GVO-freiem“ SES auf. Für SES 44 liegen die erhöhten<br />
Rohstoffkosten im Erhebungszeitraum 2003/2004 bei ca. 16 %.<br />
� Erhöhte Logistikkosten entstehen aufgr<strong>und</strong> von geringeren Beschaffungsmengen im Futtermittelwerk<br />
<strong>und</strong> größerer Zustellradien zu den Landwirten. Sie werden von der Futtermittelindustrie, VERBAND DER<br />
FUTTERMITTELINDUSTRIE, 2005-07-14, mit € 7,- je t Mischfutter bzw. je t SES im Handel für den Transport zu<br />
den Landwirten angegeben. Als zusätzliche Logistikkosten für den Beschaffungsmarkt entstehen den<br />
Futtermittelwerken weitere € 2,- je t bezogenes Eiweißfuttermittel.<br />
Auszugsweise werden an dieser Stelle einige Kosten angeführt, die nicht berücksichtigt bzw. nicht in die<br />
Differenzkosten inkludiert werden konnten, eine vollständige Auflistung ist Tabelle 9-1: Anfallende Kosten <strong>und</strong><br />
deren Berücksichtigung in der Berechnung der Futterdifferenzkosten zu entnehmen:<br />
o Kosten, die durch die Umstellung <strong>und</strong> während der Umstellung anfallen, z.B. Reinigungskosten<br />
o Mehrkosten, die für den Zukauf von Tieren aus Betrieben mit „GVO-freier“ Fütterung anfallen <strong>und</strong><br />
Kosten, die durch das Einhalten von Umstellungszeiten (nach Codex, nicht nach VO (EG) 1829/2003)<br />
entstehen<br />
o Investitionskosten für Umbauten, wenn die Futterlagerung <strong>und</strong> –zubereitung nicht mit den<br />
vorhandenen Anlagen bewältigt werden kann<br />
o Analysekosten sind ausgewiesen, aber nicht in den Futterdifferenzkosten enthalten<br />
o Erhöhte Tierarztkosten, die durch den eventuellen Einsatz spezieller Medikamente entstehen<br />
o Zusätzliche Verwaltungskosten, beispielsweise für die Dokumentation, Vorbereitung <strong>und</strong><br />
Begleitung von Kontrollen (betragen laut Auskunft VERBAND DER FUTTERMITTELINDUSTRIE, 2005-07-14, für<br />
ein Futtermittelwerk ca. € 50.000,- jährlich)<br />
o Kosten, die durch eventuelle Umsatzrückgänge <strong>und</strong> geringere Auslastungskapazitäten<br />
entstehen (Der Verband der Futtermittelindustrie, 2005-07-14, gibt an, dass ca. € 10,- je t als<br />
verlorener Aufwand im Produktionsbereich anzusetzen sind)<br />
o entstehen bei allen berechneten Fütterungsvarianten Mehrkosten.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 185 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 9: Differenzkosten<br />
o Mögliche Anwendungseinschränkungen <strong>und</strong> Leistungseinbußen, die durch den Einsatz von Substituten<br />
entstehen (vgl. Kapitel 4). Für die Kostenwahrheit ist es jedoch unerlässlich, noch mehrere Aspekte in die<br />
Betrachtungen einzubeziehen.<br />
Allgemeine Erkenntnisse aus den Berechnungen der Differenzkosten (Details können in Kapitel 9.1.2.3 bei den einzelnen<br />
Nutzungsrichtungen nachgelesen werden).<br />
Beim Einsatz von SES-hältigen „gentechnikfreien“ oder nicht deklarationspflichtigen Futtermitteln ergeben sich Mehrkosten<br />
von mehr als 8 Prozent.<br />
o Wenn im Rinderbereich Grünland <strong>und</strong> Grünlanderzeugnisse die Gr<strong>und</strong>futterbasis bilden, entstehen durch den<br />
Einsatz von „GVO-freiem“ SES nur geringe Mehrkosten. Bei Mais als Gr<strong>und</strong>futter sind die zusätzlichen Kosten<br />
erheblich höher.<br />
o In der Schweinemast sind sowohl bei Eigenmischung, als auch bei Zukauffutter Mehrkosten durch die<br />
Umstellung auf die Fütterung von „GVO-freiem“ SES vorhanden.<br />
o Im Geflügelbereich ist der Einsatz eines hohen Anteils von „GVO-freiem“ SES <strong>und</strong> die ausschließliche<br />
Verwendung von höherwertigen (<strong>und</strong> teureren) Substituten notwendig. Aus diesem Gr<strong>und</strong> entstehen bei allen<br />
berechneten Fütterungsvarianten Mehrkosten.<br />
Futterrationen, bei denen SES durch alternative Eiweißfuttermittel (z.B. Rapsextraktionsschrot, Erbse, Kartoffeleiweiß)<br />
ersetzt wird, können <strong>zur</strong> Abschätzung der Differenzkosten nicht herangezogen werden, da die Verfügbarkeit dieser Rohstoffe<br />
<strong>zur</strong> Zeit in Österreich nicht gegeben ist (Verfügbarkeit Substitute in Österreich siehe Kapitel 3, Tabelle 3-24).<br />
Besonders wird darauf hingewiesen, dass von den Produkten, die unter der Auflage eines Qualitätsprogrammes erzeugt<br />
werden, nur ein Teil den Qualitätskriterien entspricht. Die entstehenden Mehrkosten müssen von jenen Produkten getragen<br />
werden, die auch tatsächlich als Produkte mit der <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> vermarktbar sind.<br />
Externe Kontrollkosten entstehen für Qualitätsprogramme (siehe in Kapitel 9.1.3 Kontrollkosten). Sie betragen durchschnittlich<br />
ca. € 120,- je landwirtschaftlichem Betrieb <strong>und</strong> durchschnittlich ca. € 900,- je Futtermittelwerk. Die Aufwendungen für<br />
Eigenkontrollen im Futtermittelwerk <strong>und</strong> beim Landwirt sind dabei nicht berücksichtigt.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 186 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 10: Zeitrahmen<br />
10. Zeitrahmen bis <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> von „GVO-Freiheit“ oder<br />
„Gentechnikfreiheit“ – V. KOLAR <strong>und</strong> TH. KICKINGER, Institut für Futtermittel, <strong>AGES</strong><br />
Für die Einführung eines Qualitätsprogrammes ist der erforderliche Zeitrahmen <strong>zur</strong> Schaffung technischer,<br />
logistischer, rechtlicher <strong>und</strong> marketingrelevanter Voraussetzungen von hohem Interesse. Die Umsetzung eines<br />
derartigen Qualitätsprogrammes setzt Maßnahmensetzungen in der Rohstoff- <strong>und</strong> Zusatzstoffrequirierung inklusive<br />
vertraglicher Sicherungen der Rohstoffe <strong>und</strong> Zusatzstoffe voraus. Weiters ist die Sicherstellung entsprechender<br />
Logistik in Transport, Lagerung <strong>und</strong> Bearbeitung des Rohstoffes bis hin <strong>zur</strong> Bewertung <strong>und</strong> Einführung allfälliger<br />
Substitute von SES notwendig. Die Verfügbarkeit „GVO-freier“ oder „gentechnikfreier“ Rohstoffe <strong>und</strong> „GVO-freier“<br />
oder „gentechnikfreier“ Zusatzstoffe ist einerseits für die Futtermittelindustrie <strong>und</strong> andererseits auch für den Vertrieb<br />
an die selbstmischenden Landwirte (Selbstmischer) sicherzustellen. Die Bewertung des Zeitrahmens setzt auch<br />
entsprechende Maßnahmensetzungen in Futtermittelwerken <strong>zur</strong> Schaffung getrennter <strong>und</strong> geschlossener<br />
Produktionslinien voraus. Desgleichen bedarf es entsprechender Maßnahmensetzungen auf den landwirtschaftlichen<br />
Betrieben. Der Zeitrahmen wird auch durch die ebenfalls erforderlichen Vorkehrungen in Lebensmittelbe- <strong>und</strong><br />
verarbeitenden Betrieben bestimmt. Letztlich gilt es in den Betrieben Eigenkontrollsysteme ein<strong>zur</strong>ichten <strong>und</strong> ein<br />
übergeordnetes Monitoringsystem, welches die Einhaltung der Qualitätsprogrammvorgaben sicherstellt bzw.<br />
überwacht, zu schaffen. Der Aufbau entsprechender Vertriebskanäle sowie die Setzung von Marketingmaßnahmen<br />
sind ebenfalls innerhalb eines gewissen Zeitrahmens anzusetzen.<br />
10.1. Großhandel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen <strong>und</strong> Rohstoffen,<br />
landwirtschaftlicher Produktenhandel<br />
Um den Zeitrahmen für die Umstellung auf „GVO-freie“ oder „gentechnikfreie“ Produktion realistisch abschätzen zu<br />
können, müssen auch die Aspekte des Transportes berücksichtigt werden. Der Schiffsweg von Südamerika nach<br />
Europa dauert laut Angaben verschiedener Anbieter ca. 18-21 Tage. Eine zusätzliche Woche kann für den Transport<br />
mit einem Binnenschiff/Bahn/LKW in den österreichischen Hafen an der Donau/nach Österreich gerechnet werden.<br />
Verzögerungen zwischen Dezember <strong>und</strong> März durch zugefrorene Flüsse z.B. Donau sind in diesem Zeitraum noch<br />
nicht mit einkalkuliert.<br />
Der landwirtschaftliche Großhandel gab an, bei entsprechender Nachfrage von „GVO-freien“ oder „gentechnikfreien“<br />
SES <strong>und</strong> Produkten – soweit keine anderen Kontrakte bestehen - keine besonderen zeitlichen Vorgaben für einen<br />
Umstellungszeitraum im Hinblick auf die Verfügbarkeit von Rohstoffen <strong>und</strong> Futtermittelausgangserzeugnissen zu<br />
benötigen (wird von den oben angegebenen technischen Fristen abgesehen).<br />
Vorsorge im Hinblick auf die logistischen <strong>und</strong> technischen Prozesse betreffend Lagerung <strong>und</strong> Vertrieb <strong>zur</strong> Einführung<br />
von getrennten <strong>und</strong> geschlossenen Prozessketten erfordert vergleichbar <strong>zur</strong> Futtermittelwirtschaft entsprechende<br />
Umstellungszeiträume.<br />
10.2. Futtermittelindustrie<br />
Die Umfrage an 32 Futtermittelfirmen deckt deutlich über 90% der Mischfutterwerke in Österreich ab <strong>und</strong> enthielt<br />
Fragenbereiche, die den notwendigen Zeitrahmen <strong>zur</strong> Umstellung auf „GVO-freie“ oder „gentechnikfreie“ Produktion<br />
bzw. der <strong>Auslobung</strong> von „GVO-Freiheit“ oder „Gentechnikfreiheit“ abschätzen sollte.<br />
Hier sollte zuerst abgeklärt werden:<br />
• ob bereits geschlossene Produktionsschienen vorhanden sind<br />
• ob welche in Zukunft geplant sind<br />
• <strong>und</strong> welche Aspekte den Umstellungszeitraum maßgeblich beeinflussen.<br />
Auf die Frage, ob derzeit Möglichkeit für eine getrennte, d.h. geschlossene „GVO-freie“ oder „gentechnikfreie“<br />
Produktionsschiene im Unternehmen besteht, wurde von ca. zwei Drittel der befragten Futtermittelbetriebe verneint.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 187 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 10: Zeitrahmen<br />
Lediglich 22% besitzen derzeit die Möglichkeit komplett getrennt von „GVO-deklarierter“ Produktion „GVO-freie“ oder<br />
„gentechnikfreie“ Futtermittel herzustellen. Von 16% der Unternehmen wurde keine Angabe gemacht.<br />
Prozent<br />
7 0<br />
6 0<br />
5 0<br />
4 0<br />
3 0<br />
2 0<br />
1 0<br />
0<br />
1 6<br />
ke in e A n g a b e<br />
2 2<br />
ja<br />
Abbildung 10-1: Fragebogen-Haben Sie eine Möglichkeit für eine<br />
geschlossene „GVO-freie“ oder „gentechnikfreie“ Produktionsschiene?<br />
6 3<br />
n e in<br />
Obwohl bereits 22% die Möglichkeit für eine getrennte „GVO-freie“ oder „gentechnikfreie“ Produktion hätten, wird<br />
diese von nur 19 % der befragten Mischfutterproduzenten für die Zukunft geplant. Zwei Drittel ziehen für die Zukunft<br />
keine separate „GVO-freie“ oder „gentechnikfreie“ Produktionsschiene in Betracht. 16% wiederum enthielten sich der<br />
Antwort.<br />
Prozent<br />
7 0<br />
6 0<br />
5 0<br />
4 0<br />
3 0<br />
2 0<br />
1 0<br />
0<br />
1 6<br />
ke in e A n g a b e<br />
1 9<br />
ja<br />
Abbildung 10-2: Fragebogen-Planen Sie in Zukunft eine<br />
geschlossene „GVO-freie“ oder „gentechnikfreie“ Produktionsschiene zu errichten?<br />
Mit der nächsten Frage im Fragebogen sollte abgeschätzt werden, welchen Umstellungszeitraum die<br />
6 6<br />
n e in<br />
Mischfutterindustrie für angemessen erachtet. Gefragt wurde nach einem angemessenen Mindestzeitraum, den<br />
Betriebe brauchen, um eine „GVO-freie“ oder „gentechnikfreie“ Produktion gewährleisten zu können, vorausgesetzt<br />
es käme zu einer landesweiten Umstellung auf „GVO-freie“ oder „gentechnikfreie“ Futtermittelproduktion. Die<br />
folgenden zwei Grafiken stellen die Verteilung der Antworten dar.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 188 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 10: Zeitrahmen<br />
Tabelle 10-1: Fragebogen-Welcher Umstellungszeitraum ist notwendig, um „GVO-frei“ oder<br />
<strong>„gentechnikfrei“</strong> produzieren zu können?<br />
Häufigkeit Prozent<br />
keine Angabe 5 15,6<br />
kein Umstellungszeitraum 6 18,8<br />
bis zu 6 Monate 7 21,9<br />
über 6 Monate bis 1 Jahr 7 21,9<br />
über 1 Jahr bis 2 Jahre 7 21,9<br />
Gesamt 32 100<br />
Prozent<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
16<br />
kein e A n g ab e<br />
1 9<br />
kein e r<br />
2 2<br />
b is 6 Mona te<br />
22<br />
ü be r 6 Mon . b is 1 J.<br />
ü be r 1 Ja hr b is 2 J.<br />
Abbildung 10-3: Fragebogen-Welcher Umstellungszeitraum ist<br />
notwendig, um „GVO-frei“ oder <strong>„gentechnikfrei“</strong> produzieren zu können?<br />
19 % der Mischfutterbetriebe gaben an, sofort „GVO-freie“ oder „gentechnikfreie“ Futtermittel herstellen zu können,<br />
da sie keine Zeit für eine Umstellung benötigen. Bis zu 6 Monate würde bei 22% die Umstellung in Anspruch<br />
nehmen. Die Kategorien „über 6 Monate bis 1 Jahr“ <strong>und</strong> „über 1 Jahr bis 2 Jahre“ wurden jeweils von 22% der<br />
befragten Mischfutterhersteller angekreuzt. Knapp 16 % äußerten sich dazu nicht.<br />
Die Umfrage sollte außerdem herausfinden, welche Faktoren den Umstellungszeitraum beeinflussen:<br />
• bestehende Lieferverträge (zu 50% der Befragten)<br />
• bauliche Veränderungen<br />
• Lagerbestände von als GVO gekennzeichneten SES.<br />
Diese drei Aspekte haben laut Mischfutterindustrie die größten Auswirkungen auf die Dauer der Umstellung. Am<br />
Häufigsten, nämlich von der Hälfte der Befragten, wird der Faktor bestehende Lieferverträge erwähnt. Das Schließen<br />
neuer Kontrakte, die Logistik <strong>und</strong> sonstige Faktoren, wie z.B. Personalrekrutierung, bauliche Maßnahmen werden nur<br />
zu geringen Prozentsätzen als Einflussfaktor genannt.<br />
Ein weiterer Anreiz bzw. Beschleunigung für eine „GVO-freie“ oder „gentechnikfreie“ Produktion würde eine erhöhte<br />
Nachfrage nach „GVO-freien“ oder „gentechnikfreien“ Produkten darstellen. Wie die folgende Darstellung zeigt, ist die<br />
Mehrheit der Befragten der Meinung, dass erst ab einer Nachfrage von über 50% die „GVO-freie“ oder<br />
„gentechnikfreie“ Produktion rentabel wäre. Einige Teilnehmer der Umfrage führten sogar eigenhändig „erst ab einer<br />
Nachfrage von 100 % rentabel“ hinzu. Es muss jedoch erwähnt werden, dass fast 44% der Befragten dazu keine<br />
Angabe machten.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
2 2<br />
Seite 189 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 10: Zeitrahmen<br />
Tabelle 10-2: Fragebogen-Wie hoch müsste die Nachfrage für eine rentable„GVO-freie“ oder<br />
„gentechnikfreie“ Produktion sein?<br />
Häufigkeit Prozent<br />
keine Angabe 14 43,8<br />
10% 1 3,1<br />
25% 3 9,4<br />
50% 1 3,1<br />
höher als 50 % 13 40,6<br />
Gesamt 32 100<br />
10.3. Landwirtschaftliche Erzeugung tierischer Produkte<br />
Ein großer Teil der landwirtschaftlichen Mischfutterherstellung, hier besonders im Schweinemast- <strong>und</strong> Rinderbereich,<br />
findet am Hof auf eigenen Mischanlagen statt (Selbstmischer). Da bei einer Umstellung auf „GVO-freie“ Produktion<br />
für landwirtschaftliche Betriebe die gleichen Kriterien gelten müssen, wie für industrielle Mischanlagen, kann<br />
angenommen werden, dass dafür mindestens auch die gleichen Umstellungszeiten wie für die<br />
Mischfutterproduzenten benötigt werden.<br />
Ein weiterer Aspekt des Umstellungszeitraumes für den landwirtschaftlichen Betrieb ergibt sich aus der Definition des<br />
Codex <strong>zur</strong> „Gentechnikfreiheit“. Wie bereits in Tabelle 2-1 im Kapitel 2 als Übersicht dargestellt, fordert der Codex<br />
hinsichtlich „Gentechnikfreiheit“ einen genau definierten Umstellungszeitraum. Schweine <strong>und</strong> Mastgeflügel müssen<br />
demnach von Geburt an bis <strong>zur</strong> Schlachtung, Mastrinder <strong>und</strong> Equiden drei Viertel ihres Lebens, Milchrinder<br />
mindestens zwei Wochen, Legehennen mindestens 6 Wochen lang mit Codex entsprechenden Futtermitteln gefüttert<br />
werden. Laut Codex benötigen somit Mastrinder [bei einer durchschnittlichen Lebens (=Mast)dauer von 18 - 20<br />
Monaten] einen Umstellungszeitraum von mindestens 13,5 -15 Monaten, für Mastschweine bräuchte man demnach<br />
eine Umstellungsdauer von ca. 6 Monaten, für Masthühner 6 Wochen <strong>und</strong> für Mastputen je nach Rasse bis zu 22<br />
Wochen, Legehennen 6 Wochen <strong>und</strong> Milchrinder 2 Wochen.<br />
Zur Umsetzung der VO(EG) 1829/2003 sind keine Umstellungsfristen für die einzelnen Spezies gefordert, <strong>und</strong> es<br />
könnte sofort produziert werden.<br />
10.4. Erzeugung von tierischen Lebensmittel (Be- <strong>und</strong> Verarbeitung) <strong>und</strong><br />
Lebensmittelhandel<br />
Der Umstellungszeitraum in der Be- <strong>und</strong> Verarbeitung von tierischen Lebensmitteln sowie im Lebensmittelhandel wird<br />
sich zumindest an den Umstellungszeiträumen in der Futtermittelindustrie <strong>und</strong> landwirtschaftlichen Erzeugung<br />
orientieren. Im Rahmen der Studie wurde der Umstellungszeitraum in der Lebensmittelwirtschaft <strong>und</strong> im<br />
Lebensmittelhandel nicht explizit erhoben.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 190 von 272
Zusammenfassung:<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 10: Zeitrahmen<br />
Der Fragebogen an die Mischfutterindustrie <strong>und</strong> den landwirtschaftlichen Großhandel enthielt ebenfalls<br />
Fragenbereiche, welche einen angemessenen Zeitrahmen bis zu einer etwaigen <strong>Auslobung</strong> „Gentechnikfreiheit“<br />
abklären sollte.<br />
- Der landwirtschaftliche Produktenhandel gab an, bei entsprechender Nachfrage von „GVO-freiem“ oder<br />
„gentechnikfreiem“ SES <strong>und</strong> Produkten keine besonderen zeitlichen Vorgaben für einen Umstellungszeitraum im<br />
Hinblick auf die Verfügbarkeit von Rohstoffen <strong>und</strong> Futtermittelausgangserzeugnissen zu benötigen. Für den Transport<br />
des SES per Schiff aus Übersee <strong>und</strong> den Binnentransport kann etwas über einem Monat als realistischer<br />
Beschaffungszeitraum angenommen werden.<br />
- Nur 22 % der Mischfutterbetriebe besitzen heute schon eine Möglichkeit für eine getrennte geschlossene „GVO-<br />
freie“ Produktionsschiene. 78 % produzieren <strong>zur</strong>zeit teilweise <strong>und</strong> im kleinen Rahmen „GVO-freie“ oder<br />
„gentechnikfreie“ Futtermittel. Da, wie Kapitel 13 dieser Studie aufzeigt, eine zukünftige „GVO-freie“ oder<br />
„gentechnikfreie“ Futtermittelproduktion nur mit hoher Wahrscheinlichkeit <strong>und</strong> angemessenem Aufwand in<br />
getrennten, d.h. geschlossenen Produktionsprozessen zweckmäßig ist, bedeutet dieses Ergebnis, dass aktuell 56 %<br />
der Betriebe entweder auf „GVO-freie “ oder „gentechnikfreie“ Prozesse umstellen müssten bzw. entsprechende<br />
bauliche Veränderungen für eine zweite Schiene ein<strong>zur</strong>ichten wären.<br />
- Zwei Drittel der Futtermittelfirmen planen für die Zukunft aktuell keine getrennte <strong>und</strong> geschlossene<br />
Produktionsschiene. Im Falle einer Umstellung wird der notwenige Umstellungszeitraum hier sehr unterschiedlich<br />
eingeschätzt.<br />
- Der Umstellungszeitraum wird vom Großteil der Betriebe (insgesamt 66%) mit „ bis zu 6 Monate“ bis hin zu „über 1<br />
Jahr bis 2 Jahre“ angegeben.<br />
- Bestehende Lieferverträge, bauliche Veränderungen <strong>und</strong> Lagerbestände von als GVO gekennzeichnetem SES haben<br />
laut Angabe der Futtermittelbranche die größten Auswirkungen auf den Umstellungszeitraum.<br />
- Eine rentable „GVO-freie“ oder „gentechnikfreie“ Produktion kann für 41 % der befragten Mischfutterfirmen erst mit<br />
einer Nachfrage von über 50 % des Marktvolumens erreicht werden.<br />
- Für landwirtschaftliche Betriebe kann betreffend die Futtermittelerzeugung der gleiche Umstellungszeitraum<br />
angenommen werden wie für die Mischfutterproduktion, da hier weitgehend die gleichen technischen<br />
Vorraussetzungen erforderlich sind.<br />
- Gemäß Codex <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> „Gentechnikfrei“ ergeben sich allerdings für die einzelnen Nutztierarten zusätzlich<br />
genau definierte Umstellungszeiten. Bei Mastrindern kann dieser Umstellungszeitraum bis zu 15 Monate betragen.<br />
- Nach VO (EG) 1829 sind keine fütterungstechnischen Umstellungszeiten am landwirtschaftlichen Betrieb<br />
erforderlich.<br />
Insgesamt ergeben sich somit für den landwirtschaftlichen Betrieb je nach Tierart <strong>und</strong> Produktionsform<br />
unterschiedliche Umstellungszeiträume, wobei auf in einer Fall zu Fall-Analyse der angemessene Umstellungszeitraum<br />
festzustellen ist. Eher kurze Umstellungszeiträume sind in der landwirtschaftlichen Erzeugung in der Milchproduktion<br />
zu erwarten.<br />
Der Zeitrahmen wird auch durch die ebenfalls erforderlichen Vorkehrungen in Lebensmittelbe- <strong>und</strong><br />
verarbeitenden Betrieben bestimmt. Die Umstellung kann parallel zu den Prozessen in den Vorstufen der<br />
Produktion erfolgen.<br />
Letztlich gilt es in den Futtermittelwerken, den landwirtschaftlichen Betrieben <strong>und</strong> den Lebensmittelbe- <strong>und</strong><br />
verarbeitenden Betrieben Eigenkontrollsysteme ein<strong>zur</strong>ichten.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 191 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 10: Zeitrahmen<br />
Der Zeitrahmen für die Einrichtung eines übergeordneten Monitoringsystem, welches die Einhaltung der<br />
Qualitätsprogrammvorgaben sicherstellt bzw. überwacht, wie auch der Aufbau entsprechender Vertriebskanäle sowie<br />
die Setzung von Marketingmaßnahmen können parallel <strong>zur</strong> Umstellung in den Produktionsbereichen erfolgen, so dass<br />
im wesentlichen keine zusätzlichen Zeiträume erforderlich sind.<br />
Die aktuelle Situation im Landesproduktenhandel, der Futtermittelwirtschaft <strong>und</strong> der landwirtschaftlichen Erzeugung<br />
erlaubt im Milchsektor einen relativ raschen Einstieg (ab etwa 6 Monate nach Fixierung der Leistungsmerkmale des<br />
Qualitätsprogrammes) während in der Fleischerzeugung – insbesondere bei Rindfleisch (v.a. im Falle der Anwendung<br />
der Codexbestimmungen) mit einer zumindest 2-jährigen Umstellung gerechnet werden muss. Der<br />
Umstellungszeitraum wird sicherlich maßgeblich durch das Anforderungsprofil des Qualitätsprogrammes bestimmt<br />
werden.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 192 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 11: Literaturrecherche<br />
11. Literaturrecherche <strong>zur</strong> aktuellen Datenlage bezüglich GVO-Transfer<br />
<strong>und</strong> potentielle GVO-Verunreinigungsquellen über Futtermittel<br />
11.1. Die mechanischen Verunreinigungsquellen über Futtermittel - V. KOLAR <strong>und</strong> TH.<br />
KICKINGER, Institut für Futtermittel, <strong>AGES</strong><br />
Wenn der Ersatz von konventionellem SES durch gentechnikfreien SES in Betracht gezogen wird, sind die möglichen<br />
mechanischen GVO-Verunreinigungsquellen in die Überlegungen <strong>zur</strong> Vermeidung bzw. Maßnahmensetzung<br />
entlang der Be- <strong>und</strong> Verarbeitungskette einzubeziehen. Dazu wurden Literaturrecherchen angestellt. Gabriele MODER<br />
ET AL. (2004) führen in ihren Schlussfolgerungen einer umfangreichen Studie aus, dass in der Produktion von<br />
gentechnikfreien Futtermitteln trotz vieler Verbesserungsmaßnahmen es nicht gelungen ist, dauerhaft sicherzustellen,<br />
dass der Grenzwert [Schwellenwert] von 0,9 % für zufällige <strong>und</strong> technisch unvermeidbare Verunreinigungen<br />
eingehalten werden kann.<br />
Bei Differenzierung von GVO ergibt sich ein Schwellenwert von 0,5% für durch die EFSA freigegebene GVO <strong>und</strong> 0<br />
[Null] für in der EU nicht zugelassene GVO.<br />
Alle Arten von möglichen Verunreinigungen beschreibt auch MEIER (2002) in einer umfangreichen Studie zum<br />
zunehmenden Einsatz der Gentechnik in der Landwirtschaft <strong>und</strong> Lebensmittelproduktion.<br />
Anhand der Ergebnisse der Studie von WENK ET AL. (2001, 37) wird in der folgenden Tabelle der Warenfluss von<br />
„GVO-freiem“ SES bis nach Europa, in diesem speziellen Fall bis nach Basel dargestellt. Verschiedene Maßnahmen <strong>zur</strong><br />
Trennung GVO-/GVO-freien-SES entlang des Warenflusses aus Übersee werden standardmäßig (Fettschrift) bzw. zum<br />
Teil (Standarddruck) durchgeführt.<br />
Tabelle 11-1: Warenfluss <strong>und</strong> Warenflusstrennung (nach WENK et al.2001, 37; abgeändert durch <strong>AGES</strong>)<br />
Stufe Warenfluss<br />
Maßnahmen <strong>zur</strong> Warenflusstrennung Sojabohnen od. SES<br />
Feld - Sammelstelle Prüfung Transportmittel<br />
Umschlag Sammelstelle Prüfung Silos/Silozellen<br />
Probenahme <strong>und</strong> GVO-Analyse (1)<br />
Absackung<br />
Sammelstelle-Überseehafen Prüfung Transportmittel<br />
Umschlag Überseehafen Direktumschlag<br />
Prüfung Förderanlagen<br />
Prüfung Laderäume Überseeschiff<br />
Probenahme <strong>und</strong> GVO-Analyse-Zertifikat (2)<br />
Überseehafen – ARAG-Häfen Separate Ladebucht<br />
Verschiffung zusammen mit Nicht-GVO-Soja<br />
Verschiffung zusammen mit anderem Nicht-GVO-Getreide<br />
Umschlag ARAG-Hafen Separate, Nicht-GVO Silos/Silozellen<br />
Prüfung Silos <strong>und</strong> Förderanlagen<br />
Üblicherweise Direktumschlag Übersee-, Rheinschiff<br />
Probenahme <strong>und</strong> GVO-Analyse (3)<br />
ARAG-Häfen - Basel Gereinigte Schiffe<br />
Umschlag Basel Separate, Nicht-GVO Silos/Silozellen<br />
Direktumschlag auf Bahn<br />
Probenahme <strong>und</strong> GVO-Analyse (4)<br />
Basel-Verarbeitungsbetrieb Gereinigte Transportmittel<br />
Verarbeitungsbetrieb Probenahme <strong>und</strong> GVO-Analyse (z.T. periodisch) (5)<br />
Da es jedoch, trotz der im Warenfluss dargestellten Maßnahmen, zahlreiche Quellen für eine Verunreinigung<br />
<strong>und</strong>/oder Kontamination gibt, werden im Anschluss die verschiedenen Möglichkeiten der Verunreinigung detailliert<br />
angeführt.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 193 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 11: Literaturrecherche<br />
Die Anzahl der in der Tabelle 11-1 vorgeschlagenen Stichproben (5) ist im Falle von Rückverfolgbarkeit schlichtweg<br />
unverhältnismäßig.<br />
Verunreinigungen <strong>und</strong>/oder Kontaminationen durch technische Prozesse:<br />
Unter Kontaminationen werden Verunreinigungen mit nicht zugelassenen GVO (z.B. Bt10, Starlink) verstanden. Bei<br />
allen technischen Prozessen können Verunreinigungen <strong>und</strong> Vermischungen von Chargen verschiedener Herkunft<br />
entstehen. Dies gilt für Waren, die ohne den Einsatz von GVO oder deren Derivaten hergestellt wurden als auch für<br />
GVO-Waren. Vom Feld bis zum fertigen Produkt durchlaufen die Waren einen mehrstufigen Prozess, in Verlauf<br />
dessen auf fast jeder Stufe Vermischungen, Verunreinigungen <strong>und</strong> oder Kontaminationen möglich sind. GVO sind in<br />
Europa hauptsächlich im Bereich von Importwaren relevant.<br />
Mit der Problematik der Koexistenz in der landwirtschaftlichen Produktion befasst sich eine Studie der <strong>AGES</strong> (GIRSCH,<br />
ET AL. 5/2004), worin die Quellen der GVO-Verunreinigung, sowie eine qualitative <strong>und</strong> quantitative Bewertung des<br />
Risikopotentials, unter anderem mit dem entwickelten Koexistenz-Index, dargestellt wird.<br />
Landwirtschaft:<br />
• Bodenbearbeitung, Kulturmaßnahmen, Aussaat (Sämaschinen)<br />
• Ernte (Erntemaschinen, Mähdrescher, Transportfahrzeuge)<br />
• Einlagerung (Transportmaschinen <strong>und</strong> Lagerstätten<br />
• Vermischung mit anderen Chargen<br />
Rohstoffhandel <strong>und</strong> Aufarbeitung:<br />
• Transport (Transportfahrzeuge, -behälter)<br />
• Lagerung (Lagerstätten)<br />
• Annahme, Reinigungs- <strong>und</strong> Transporttechnik<br />
• Vermischung mit anderen Chargen, Verstaubung<br />
Verarbeitung (z.B. in Getreidemühlen, Mischfutterwerken, Ölmühlen):<br />
• Annahme- <strong>und</strong> Transporttechnik<br />
• Lagerung (Lagerstätten)<br />
• Verarbeitungstechnologie <strong>und</strong> Geräte<br />
• Vermischungen mit anderen Chargen, Verstaubung<br />
Selbst wenn eine weitgehende Trennung der verschiedenen Warenströme <strong>und</strong> ein umfassendes Überprüfungssystem<br />
etabliert wären, ließen sich Verunreinigungen bei allen Vorgängen der Umlagerung <strong>und</strong> Verarbeitung von Rohstoffen<br />
in Betrieben <strong>und</strong> Systemen, in denen GVO-Ware <strong>und</strong> „GVO-freie“ Ware parallel gehandhabt werden, kaum<br />
vermeiden.<br />
Darüber hinaus muss bei der Anwendung komplexer, mehrstufiger Produktionsprozesse auch mit technischem oder<br />
menschlichem Versagen oder Ungenauigkeiten gerechnet werden.<br />
Zufällige <strong>und</strong> technische Verunreinigungen bei der Lagerung, Transport <strong>und</strong> Bearbeitung von GVO- Ware <strong>und</strong> „GVO-<br />
freier“ Ware einer Produktionskette gelten als unvermeidbar. Vermengungen bzw. Vermischungen sowie<br />
Überschneidungsmengen von GVO Ware <strong>und</strong> GVO-freier Ware sind zudem in einer nicht getrennten Produktionskette<br />
wahrscheinlich. Es wird daher bei Einführung eines Qualitätsprogrammes für „GVO-frei“ erzeugte Lebensmittel<br />
erforderlich sein, geschlossene Produktionsprozesse <strong>und</strong> Produktionsschiene insbesondere spezialisierte Werke <strong>und</strong><br />
landwirtschaftliche Betriebe für „GVO-freie“ Produktion auszuwählen, um Verunreinigungen nachhaltig <strong>und</strong> mit hoher<br />
Wahrscheinlichkeit zu vermeiden. Bei derartigen geschlossenen Werken <strong>und</strong> landwirtschaftlichen Betrieben reduziert<br />
sich in einem risikobasierten Überprüfungs- <strong>und</strong> Monitoringsystem maßgeblich der erforderliche Aufwand <strong>und</strong> damit<br />
die Kosten.<br />
GVO-Verunreinigungen <strong>und</strong>/oder GVO-Kontaminationen durch technische Prozesse in der Landwirtschaft:<br />
In der Landwirtschaft ergeben sich vielfältige Möglichkeiten einer mechanischen GVO-Verunreinigung Prozesse. Die<br />
gesetzlichen Vorgaben <strong>zur</strong> Koexistenz in der Landwirtschaft (siehe dazu die einschlägigen Landesgesetze in den<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 194 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 11: Literaturrecherche<br />
Ländern Österreichs) lassen eine maßgebliche GVO-Verunreinigung in der landwirtschaftlichen Produktion von<br />
Erntegut in Österreich allerdings als unwahrscheinlich erscheinen (vgl. GIRSCH, 2004; vgl. GIRSCH ET AL., 2004).<br />
Die mechanischen Verunreinigungen in den technischen Prozessen im landwirtschaftlichen Betrieb sind zumindest für<br />
einen bestimmten Zeitraum ausschließlich durch Einträge [Importe] von ausländischen Erntegut, Rohstoffen <strong>und</strong><br />
Futtermittelausgangserzeugnissen sowie zugekaufte Futtermittel wahrscheinlich. Die in der Studie „Die Produktion<br />
von Saatgut in abgegrenzten Erzeugungsprozessen <strong>zur</strong> Vermeidung einer Verunreinigung mit Gentechnisch<br />
Veränderten Organismen im Kontext mit der Koexistenz von konventioneller Landwirtschaft mit oder ohne GVO <strong>und</strong><br />
ökologischer Landwirtschaft“ (GIRSCH ET AL., 2004) gibt eine Risikobewertung betreffend der vermeidbaren<br />
potentiellen Kriterien für eine GVO-Verunreinigung bzw. eines Gentransfers in der landwirtschaftlichen Produktion.<br />
Mechanische Verunreinigungen stellen dabei ein durchaus beherrschbares Risiko dar. Wird auf die „klassischen“<br />
Produktionsländer für Sojabohnen wie USA, Brasilien <strong>und</strong> Argentinien Bezug genommen, so sei angeführt, dass bei<br />
üblichen Schlaggrößen von zumindest 100 ha mit Erntemengen von 200 – 450 t in diesen Ländern, auch gemäß<br />
Koexistenzindex, mechanische Verunreinigungen in der landwirtschaftlichen Erzeugung weitgehend vernachlässigbar<br />
sind.<br />
GVO-Verunreinigungen <strong>und</strong>/oder GVO-Kontaminationen durch Transportprozesse, -behälter:<br />
Für den Transport von Rohstoffen werden in der Praxis sehr verschiedene Behälter verwendet, wobei je nach Art des<br />
Behälters die Verunreinigungsrisiken variieren:<br />
Beim Offentransport in Bahn- oder Lastwagen innerhalb von Europa besteht immer ein Verunreinigungsrisiko. Ein<br />
Risiko der Vermischung entsteht durch un<strong>zur</strong>eichende Reinigung. Auch beim Versand von Produkten aus Übersee in<br />
Containern oder als Schüttgüter kann eine un<strong>zur</strong>eichende Reinigung Verunreinigungen verursachen. Dagegen<br />
besteht beim Transport von kleinen Mengen in Säcken (Kleinchargen) kein Verunreinigungsrisiko.<br />
GVO-Verunreinigungen <strong>und</strong>/oder GVO-Kontaminationen bei Umladevorgängen:<br />
Jeder Umladevorgang erhöht das Risiko von unbeabsichtigten Verunreinigungen. Üblicherweise sind keine getrennten<br />
Annahmestellen für GVO-Güter <strong>und</strong> konventionelle Güter vorhanden. Bedingt durch die Fördertechnik <strong>und</strong> die in den<br />
Systemen entstehenden Restmengen kann es auch bei Umladevorgängen zu Vermischungen kommen. Diese Risiken<br />
wären nur bei vollständiger räumlicher Trennung auszuschließen.<br />
Verschiedene Versuche wurden zu Annahmevorgängen durchgeführt. Dabei wurde überprüft, wie lange sich GVO-<br />
Material in einer „GVO-freien“ Charge von Sojaextraktionsschrot nachweisen lässt, wenn eine Charge von 50 t<br />
Sojaextraktionsschrot (GVO-Anteil von ca. 0,3 %) in einem Futtermittelwerk angenommen wurde (St<strong>und</strong>enleistung<br />
der Annahme etwa 50t).<br />
Dabei konnten nach 15 Minuten noch GVO-Sequenzen nachgewiesen werden. Man führte dies darauf <strong>zur</strong>ück, dass<br />
bestimmte Restbestandteile erst dann frei werden, wenn sich die Anlage <strong>zur</strong> Annahme der Schüttgüter leert (vgl.<br />
MEIER, 2002, 11ff).<br />
GVO-Verunreinigungen <strong>und</strong>/oder GVO-Kontaminationen bei der technischen Verarbeitung:<br />
Auch bei der Verarbeitung kann es zu Vermischungen von „GVO-freien“ <strong>und</strong> konventionellen Produkten kommen.<br />
Nach Angaben von Müllereifachleuten gibt es in den Mühlen einzelne Stellen, welche in Bezug auf die<br />
Vermischungsmöglichkeiten kritisch sind. Vor allem mechanische Transportanlagen können Vermischungen<br />
verursachen. Beim Mahlprozess sind es die Walzen in den Walzenstühlen <strong>und</strong> die Siebe in den nachgeschalteten<br />
Sichtern, welche nie staubfrei sind <strong>und</strong> immer geringe Mengen der vorherigen Charge aufweisen (vgl. WENK et al.,<br />
2001, 55).<br />
Ein besonders hohes Verunreinigungsrisiko liegt vor, wenn für die Produktion einer neuen Charge eine Anlage<br />
eingesetzt wird, die nicht oder nur unvollständig gereinigt wurde. Einige Anlagen, insbesondere solche, in denen<br />
Durchlaufverfahren eingesetzt werden (wie beispielsweise Mühlen), lassen sich nur mit erheblichem Aufwand<br />
vollständig entleeren bzw. reinigen.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 195 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 11: Literaturrecherche<br />
Im Rahmen eines im Auftrag des schweizerischen B<strong>und</strong>esamtes für Ges<strong>und</strong>heit bearbeiteten Projektes <strong>zur</strong><br />
Warenflusstrennung bei der Lebensmittelproduktion wurden in einer Mühle Verschleppungsversuche mit GVO-<br />
Sojaextraktionsschrot <strong>und</strong> GV-Mais durchgeführt. Bei normaler Reinigung zwischen den Verarbeitungsgängen von<br />
„GVO-freier“ <strong>und</strong> GVO-Ware wurden in der nachfolgenden Charge Anteile von GVO gef<strong>und</strong>en.<br />
In einer Maismühle wurde ein Versuch durchgeführt, welcher gezeigt hat, dass in einer Mühle bis an das Ende einer<br />
nachfolgenden Charge mit Verunreinigungen zu rechnen ist, selbst wenn zuvor eine Reinigung erfolgte (vgl. MEIER,<br />
2002, 13f).<br />
GVO-Verunreinigungen <strong>und</strong>/oder GVO-Kontaminationen durch Handel:<br />
Zwischen den einzelnen Verarbeitungsstufen der Produktionslinien von möglicherweise transgenen Rohwaren bilden<br />
sich Märkte. Auf diesen Märkten werden Erzeugnisse aus gentechnisch veränderten Rohwaren als Rohstoffe, Zutaten,<br />
Zusatz- <strong>und</strong> Verarbeitungshilfsstoffe gehandelt. Auf der Ebene des Handels findet eine „horizontale Migration“ von<br />
GVO bzw. deren Derivaten statt.<br />
Die Frage nach der Migration durch Handel auf den verschiedenen denkbaren Ebenen (Rohstoffe, Halberzeugnisse,<br />
Teilprodukte, Zusatzstoffe, etc.) <strong>und</strong> in den verschiedenen Branchensegmenten (Rohstoffindustrie,<br />
Futtermittelindustrie, chemische Industrie <strong>und</strong> Lebensmittelindustrie) ist äußerst komplex <strong>und</strong> vielschichtig. In<br />
einigen Bereichen ist heute praktisch keine Nachvollziehbarkeit herzustellen. Dies trifft insbesondere auf die<br />
chemische Industrie zu, die z.B. aus Fettsäuren unterschiedlichster Herkünfte technische Erzeugnisse wie<br />
Zusatzstoffe fertigt <strong>und</strong> diese weltweit vertreibt (vgl. MEIER, 2002, 14f).<br />
GVO-Verunreinigungen <strong>und</strong>/oder GVO-Kontaminationen durch den Zusatz verschiedener Substanzen bei der<br />
Verarbeitung (Mischprozesse)<br />
In ein zusammengesetztes Produkt, welches überwiegend aus agrarischer Erzeugung stammt, können über eine<br />
ganze Reihe verschiedener Wege Verunreinigungen mit transgenem Erbgut oder GVO-Derivaten erfolgen.<br />
1. Der Rohstoff, welcher als Hauptkomponente eingesetzt wird, kann GVO-Verunreinigungen <strong>und</strong>/oder GVO-<br />
Kontaminationen aufweisen<br />
2. Im Produkt werden verarbeitete Zutaten eingesetzt, die verunreinigt <strong>und</strong>/oder kontaminiert sein können:<br />
3. Verwendung von Zusatzstoffen <strong>und</strong> anderen Spezialzutaten (Vitamine, Aminosäuren), die verunreinigt <strong>und</strong>/oder<br />
kontaminiert sein können.<br />
4. Bei der Herstellung dieses Produktes werden (technische) Hilfsstoffe eingesetzt, die GVO-Verunreinigungen <strong>und</strong>/<br />
oder GVO-Kontaminationen verursachen können.<br />
Für die Herstellung von Futtermitteln werden große Mengen an SES <strong>und</strong> Maiskleber, aber auch Rapsschrot aus GVO-<br />
Produktion importiert. Diese werden in den meisten gängigen Futtermitteln eingesetzt. Da es bis auf den Einsatz von<br />
Futtermitteln in der biologischen Landwirtschaft bisher kaum eine Nachfrage nach Futtermittelrohstoffen<br />
[Futtermittelausgangserzeugnisse] gibt, die ohne gentechnische Verfahren hergestellt wurden, findet eine Trennung<br />
bei Lagerung <strong>und</strong> Transport in der Regel nicht statt. Dementsprechend gibt es <strong>zur</strong> Thematik der GVO-Verunreinigung<br />
<strong>und</strong> -Verschleppung im Wesentlichen nur Untersuchungen aus dem Bereich der Futtermittelherstellung für Öko-<br />
Betriebe. Die dort gemachten Aussagen <strong>zur</strong> Trennung der Warenströme <strong>und</strong> <strong>zur</strong> Verschleppungsproblematik können<br />
aber auf den konventionellen Sektor übertragen werden.<br />
Die GVO-Verunreinigungs- <strong>und</strong> Verschleppungswege beim Transport <strong>und</strong> bei der Herstellung von Futtermitteln sind<br />
vielfältig. Beim Transport werden die Rohstoffe oft mehrfach umgeladen. Als Transportmittel dienen Lastwagen,<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 196 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 11: Literaturrecherche<br />
Eisenbahnwaggons <strong>und</strong> Schiffe bzw. Schiffscontainer. In der Regel werden die Transportmittel <strong>und</strong> die Anlagen für<br />
das Umladen sowohl für GVO-Ware als auch für Ware, die ohne Gentechnik hergestellt wurde, verwendet, so dass<br />
sich bei jedem zusätzlichen Umladevorgang das Risiko einer GVO-Verunreinigung der Charge erhöht.<br />
Im Futtermittelwerk selbst gibt es in allen Prozessabschnitten Verunreinigungsmöglichkeiten:<br />
• Schüttgosse<br />
• Förderwege<br />
• Waagen<br />
• Silos, Lagerzellen<br />
• Absackstraße<br />
• Pelletierungsanlage<br />
Die Fördertechnik ist insbesondere in älteren Futtermittelwerken in vielen Fällen hinsichtlich der<br />
Verschleppungsproblematik nicht optimiert. So bilden sich in Rohren, Elevatoren oder auch in der Schüttgosse<br />
sogenannte Verunreinigungsnester, die nicht unbedingt durch die Spülcharge erfasst werden <strong>und</strong> damit oft die<br />
Ursache für Verunreinigungen darstellen (vgl. MEIER, 2002, 15f).<br />
Folgende gr<strong>und</strong>sätzliche Möglichkeiten für Spülchargen ergeben sich in den Produktionsprozessen:<br />
„GVO-freier“ SES Soja als Spülcharge:<br />
Sehr effizient wäre der Einsatz von „GVO-freien“-SES als Spülcharge, da es dadurch zu einer Reinigung der Anlage<br />
bzw. auch zu einer starken „Verdünnung“ des in der Anlage vorhandenen SES kommt. Nachdem die<br />
Verunreinigungen mit gentechnisch verändertem SES derzeit in Prozent des Gesamt-SES erfasst werden, wäre dies<br />
die effizienteste Methode um zu niedrigen Verschleppungswerten zu kommen. Allerdings müsste in diesem Fall der<br />
„GVO- freie“ SES über die Anlage gefahren werden. Die Kosten dieser Variante sind jedoch hoch: Zum einen fallen<br />
Mehrkosten für „GVO-freien“ SES aufgr<strong>und</strong> der Abwertung des Produktes an, da der Spülchargen-SES in Folge in der<br />
Produktion als regulärer, voraussichtlich als GVO gekennzeichneter SES eingesetzt wird. Zum zweiten fallen Kosten<br />
aufgr<strong>und</strong> einer benötigten Umstellungszeit für den Mischer an.<br />
Spülcharge mit Mais oder Getreide:<br />
Eine Spülung mit Mais oder Gerste würde nur über den Mischer <strong>und</strong> nicht über die Presse geführt. Daher würde<br />
keine vollständige Spülung der Produktionswege erreicht. Ein weiterer Nachteil ist, dass der Durchlauf dieser<br />
Produkte im Produktionsablauf nicht notwendig ist.<br />
Mehrere Chargen eines Produktes ohne SES:<br />
Produkte, die keinen SES enthalten, wie z.B. einzelne Rinderfutter, werden direkt vor „GVO-freien“ Produkten<br />
produziert <strong>und</strong> haben dadurch die Funktion einer Spülcharge.<br />
Konventionelles Produkt mit „GVO-freiem“ Soja:<br />
Bei dieser Variante wird als Spülcharge ein „konventionelles“ Produkt verwendet, das „GVO- freien“ SES enthält, aber<br />
als „konventionelles“ Produkt [kennzeichnungspflichtig nach VO(EG)1829/2003] vertrieben wird. Der Vorteil ist, dass<br />
kein zusätzlicher Zeitaufwand in der Produktion notwendig ist. Die Mehrkosten bei dieser Variante sind abhängig vom<br />
Sojaanteil in der Rezeptur. Eine Variante ist, nur einen Teil der Produktion mit „GVO- freiem“ Soja zu fahren, z.B.<br />
eine Charge einer Produktion dient gleichzeitig als Spülcharge. Wenn die Größe der Spülcharge ausreichend ist, stellt<br />
dies eine günstigere Variante dar.<br />
Folgende Maßnahmen können ergriffen werden, um das Verschleppungsrisiko möglichst gering zu halten:<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 197 von 272
• Möglichst kurze <strong>und</strong> reinigungsfähige Förderwege<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 11: Literaturrecherche<br />
• Vermeidung von Toträumen, die vom Produktstrom nicht oder nur zufällig erfasst werden<br />
• Kontrollierte Aspiration oder Förderwege<br />
• Einsatz von pneumatischer Fördertechnik in Teilstrecken oder kompletten Systemen<br />
• Vollständiges, kontrolliertes Leerfahren von Mischern, Dosierzellen <strong>und</strong> Pufferbehältern bei Produktwechsel<br />
• Regelmäßiges Putzen <strong>zur</strong> Beseitigung von Ablagerungen, z.B. in Förderschnecken <strong>und</strong> Elevatorfüßen (vgl.<br />
MODER et al, 2004, 38f);<br />
„Nach Angabe von Kontrolleuren von Öko-Kontrollstellen, Betreibern von Futtermittelwerken <strong>und</strong> für die<br />
Anerkennung von Futtermittelwerken zuständigen Behördenvertretern liegen die Verschleppungskoeffizienten je nach<br />
Qualität der Anlagen zwischen 0,7 <strong>und</strong> 7%. Das bedeutet, dass in einer produzierten Charge von 1 t eines<br />
Futtermittels zwischen 7 <strong>und</strong> 70 kg der zuvor auf der Anlage produzierten Mischung enthalten sind“ (MEIER, 2002,<br />
36).<br />
Obgleich in der Schweiz weder GVO-Lebensmittel noch GVO-Saatgut importiert werden <strong>und</strong> die Schweiz als praktisch<br />
gentechnikfrei gilt, ergaben GVO-Analysen bei Soja- <strong>und</strong> Maisprodukten im Zeitraum von 2000 bis 2002, dass bei<br />
mehr als einem Viertel der Proben GVO-Verunreinigungen in pflanzlichen Lebensmittel nachgewiesen werden<br />
konnten. Die Deklarationslimite von 1 % konnten jedoch bis auf wenige Ausnahmen eingehalten werden (vgl.<br />
NOWACK HEIMGARTNER, 2003, s.p.).<br />
Bei den Futtermitteln waren im Jahr 2002 weniger als 1% der gesamten Importe als GVO deklariert. GVO-Analysen<br />
bei Soja- <strong>und</strong> Maisprodukten ergaben im Zeitraum von 2000 bis 2002, dass in der Hälfte der untersuchten<br />
Futtermittelproben GVO nachweisbar waren. Der Grossteil der Verunreinigungen lag unter 0,1%, jedoch kamen<br />
Verunreinigungen zwischen 0,1 uns 1% bei einem größeren Teil als bei den Lebensmitteln vor. Auch hier sind die<br />
konventionellen Futtermittel häufiger <strong>und</strong> stärker verunreinigt als biokompatible Futtermittel (gemäß BIOSIUSSE<br />
unter 0,5% GVO-DNA) (vgl. NOWACK HEIMGARTNER, 2003, s.p.).<br />
Im Rahmen der Studie MODER et al (2004, 99) wurden Proben analysiert, welche ergaben, dass bereits bei der<br />
Anlieferung des „GVO-freien“ SES eine Bandbreite von nicht nachweisbaren Verunreinigungen bis zu einem GVO-<br />
Anteil von 1,4 % vorlagen. Handelsüblich ist eine Bestätigung, dass die maximale Verunreinigung von „GVO-freiem“<br />
SES unter 1% liegt. Der tatsächliche Grad der Verunreinigung wird durch Analysen nachgewiesen <strong>und</strong> mit<br />
Zertifikaten bestätigt. Es ist daher davon auszugehen, dass eine gewisse Heterogenität der Rohstoffe gegeben ist<br />
<strong>und</strong> der „handelsübliche“ Grenzwert von 1% nicht immer eingehalten wird. Ein „handelsüblicher“ Grenzwert von 1%<br />
im Ausgangsprodukt („GVO-freier“ SES) <strong>und</strong> von 0,9% im fertigen Futtermittel ist gr<strong>und</strong>sätzlich problematisch, da<br />
man die Reinheit des Ausgangsproduktes in der Verarbeitung nicht verbessern kann <strong>und</strong> auf jeden Fall hier mit<br />
Verschleppungen zu rechnen ist. (vgl. MODER et al, 2004, 99).<br />
Systeme, die die Nachvollziehbarkeit beim Sojabohnenanbau bis zum einzelnen Landwirt ermöglichen, könnten in<br />
Zukunft für „GVO-freien“ SES noch mehr an Bedeutung gewinnen. Derartige Hard IP Programme könnten die<br />
Einhaltung der vorgegebenen Grenzwerte [Schwellenwerte] besser bewerkstelligen (vgl. MODER et al., 2004, 99).<br />
Schlussfolgerung:<br />
Eine Mischfutterproduktion mit Rohstoffen <strong>und</strong>/oder Zusatzstoffen, die mit <strong>und</strong> ohne Gentechnik hergestellt sind,<br />
ohne dabei die Schwellenwertregime für GVO- Verunreinigungen von 0,9%/0,5%/0% bei Futtermitteln zu<br />
überschreiten, weist hohes Risiko einer Überschreitung auf. Als wahrscheinlich ist eine Verschleppung von GVO in die<br />
„GVO-freie“ Produktionsvariante anzusehen. Spülchargen stellen keine ausreichende Maßnahme dar, um dauerhaft<br />
<strong>und</strong> nachvollziehbar unter 0,9%/0,5%/0 % zu bleiben.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 198 von 272
Zusammenfassung:<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 11: Literaturrecherche<br />
Wenn der Ersatz von GVO-SES in Betracht gezogen wird, sind die möglichen mechanischen GVO-<br />
Verunreinigungsquellen zu berücksichtigen. Dazu wurden Literaturrecherchen angestellt. Gabriele MODER et al.<br />
(2004) führen in ihren Schlussfolgerungen aus, dass in der Produktion von gentechnikfreien Futtermitteln trotz vieler<br />
Verbesserungsmaßnahmen es nicht gelungen ist, dauerhaft sicherzustellen, dass der Grenzwert [Schwellenwert] von<br />
0,9 % für zufällige <strong>und</strong> technisch unvermeidbare Verunreinigungen eingehalten wird.<br />
Anzumerken ist, dass eine Differenzierung zwischen in der EU zugelassenen GVO (Schwellenwert 0,9%), in der EU<br />
nicht zugelassenen GVO jedoch mit vorläufiger Freigabe nach Risikobewertung durch die EFSA (Schwellenwert 0,5%)<br />
<strong>und</strong> in der EU nicht zugelassenen GVO (Schwellenwert 0%) zu differenzieren gilt (siehe VO (EG) 1829/2003).<br />
Alle Arten von möglichen Verunreinigungen beschreibt auch MEIER (2002) in einer umfangreichen Studie zum<br />
zunehmenden Einsatz der Gentechnik in der Landwirtschaft <strong>und</strong> Lebensmittelproduktion.<br />
Wie die vorliegende Literaturrecherche ergeben hat, ist der totale Ersatz von GVO-SES <strong>und</strong> der Verzicht auf<br />
gemischte Produktion in einem Betrieb Voraussetzung, um die Vermeidung von mechanischen Verunreinigungen<br />
über dem Schwellenwertregime sicherzustellen. Die Erzeugung „GVO-freier“ oder „gentechnikfreier“ Futtermittel kann<br />
also nach dem derzeitigen Stand der Kenntnisse <strong>und</strong> Möglichkeiten mit angemessenem Risiko ausschließlich durch<br />
eine getrennte Produktion erfolgen.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 199 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 11: Literaturrecherche<br />
11.2. GVO-Transfer in tierische Lebensmittel (Milch, Fleisch, Eier) – R. GROSSGUT <strong>und</strong><br />
D. HOFSTÄDTER, Bereich Risikobewertung, <strong>AGES</strong><br />
Wie alle Organismen nimmt der Mensch große Mengen fremder DNA über die Nahrung auf, durch eine gemischte<br />
Kost an die 0,1-1 g täglich. Zu weiteren Quellen einer DNA-Aufnahme zählen unter anderem der Pollenflug im<br />
Frühjahr sowie Viren <strong>und</strong> andere Mikroorganismen.<br />
Basierend auf der Datenlage können nach dem Verfüttern von Pflanzenmaterial Pflanzengene auch in den<br />
Gastrointestinaltrakt der Tiere aufgenommen werden.<br />
Zu der über das Futter aufgenommenen DNA kommen noch DNA-Mengen dazu, die aus der mikrobiellen Besiedelung<br />
des Verdauungstraktes resultieren.<br />
Im Zuge der <strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> der „Gentechnikfreiheit“ gemäß der Definition der österreichischen<br />
Codex-Richtlinie <strong>und</strong> der Verwendung nicht kennzeichnungspflichtiger Futter- <strong>und</strong> Lebensmittel gemäß der EU-<br />
Verordnung 1829/2003 stellt sich somit die Frage, ob ein Transfer gentechnisch veränderter DNA in tierische<br />
Lebensmittel, vor allem Milch, Fleisch <strong>und</strong> Eier stattfindet.<br />
In diesem Kapitel wird die Datenlage zum unmittelbaren GVO-Transfer in diese Lebensmittel dargestellt.<br />
Eine umfangreiche Literaturrecherche zu diesem Thema wurde durchgeführt.<br />
Das Kapitel wurde so aufgebaut, dass die Original-Zitate der einzelnen Studien angeführt werden. Ergänzt werden<br />
diese Original-Zitate durch eine kurze Zusammenfassung, die direkt aus dem Originaltext ohne Korrektur<br />
übernommen wurde, <strong>und</strong> durch etwaige Bemerkungen seitens des Projektteams. Diese Bemerkungen beziehen sich<br />
auf wesentliche Inhalte der Studie <strong>und</strong> geben diese wieder. Einige Literaturstellen enthalten keine Original-<br />
Zusammenfassungen. In diesen Fällen werden einzig die Bemerkungen des Projektteams angeführt.<br />
Am Ende des Kapitels wird die Datenlage zum GVO-Transfer zusammengefasst dargestellt, ohne dabei eine<br />
bewertende Stellungnahme abzugeben.<br />
Der horizontale Gentransfer zwischen GVO <strong>und</strong> Bakterien bzw. die mögliche Auswirkung von exprimierten Proteinen<br />
war nicht Bestandteil der Fragestellung <strong>und</strong> wurde im Rahmen dieser Literaturrecherche nicht mit aufgenommen.<br />
11.2.1. Zusammenfassung der Fütterungsversuche<br />
http://www.weihenstephan.de/fml/physio/sonstig/Mitteilung#1<br />
- Bemerkungen<br />
Zur Erforschung des Abbaus von transgener DNA <strong>und</strong> Cry1Ab Protein während des Magen-Darm-Traktes wurden<br />
Fütterungsstudien an Rindern durchgeführt.<br />
Mit dem Futter zugeführte DNA wird im Organismus abgebaut bis auf das Niveau nicht funktioneller Fragmente <strong>und</strong><br />
Einzelbausteine der Erbsubstanz, den Nukleotiden. In allen Proben aus dem Pansen <strong>und</strong> Labmagen von isogen <strong>und</strong><br />
transgen gefütterten Rindern konnte das Chloroplasten DNA-Fragment gef<strong>und</strong>en werden. Im Dünndarm <strong>und</strong><br />
Dickdarm konnte das DNA-Fragment nicht nachgewiesen werden. Die detektierten Fragmente sind keine<br />
funktionellen Gene mehr <strong>und</strong> können somit nicht in funktionelle Proteine exprimiert werden.<br />
Die gef<strong>und</strong>enen Chloroplasten-DNA-Fragmente kommen in allen grünen Teilen der Pflanze in mehreren tausend<br />
Kopien vor, während das cry1Ab-Gen in den Pflanzenzellen in zwei Kopien vorliegt.<br />
In kontrollierten Studien (Einspanier et al.) wurden jedoch nach Verfütterung von gentechnisch veränderten<br />
Futtermitteln weder im Gewebe der Kuh noch in Milch Spuren der transgenen Bt-DNA nachgewiesen.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 200 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 11: Literaturrecherche<br />
Die Ergebnisse der Fütterungsversuche deuten weiters darauf hin, dass kein horizontaler Gentransfer von pflanzlicher<br />
DNA auf Bakterien des Rindes nachweisbar ist. Die Bakterienflora im Pansen ändert sich durch die Fütterung von<br />
gentechnisch verändertem Mais nicht signifikant.<br />
Auf dieser Webseite findet sich weiters ein Hinweis darauf, dass „der Nachweis von Spuren gentechnisch veränderter<br />
Futtermittel in Milchproben, die im Auftrag der Hessischen Landesregierung für Milch <strong>und</strong> Milcherzeugnisse<br />
untersucht wurden, nicht zu einer abweichenden Betrachtung führen. Es handelt sich um private, nicht unter<br />
wissenschaftlichen Bedingungen gezogene Proben. Die Untersuchungsergebnisse sind aufgr<strong>und</strong> mangelnder<br />
Qualitätssicherung bei der Probengewinnung wissenschaftlich nicht verwertbar. Der Auftraggeber wurde darüber<br />
zeitnah informiert“.<br />
11.2.2. Gentransfer<br />
http://www.bfa-ernaehrung.de/Bfe-Deutsch/Information/e-docs/janybericht/bfe6a.htm<br />
- Zusammenfassung<br />
Im Zusammenhang mit dem Verzehr von Lebensmitteln, die mit Hilfe der Gentechnik hergestellt wurden, wird der<br />
Gentransfer auf Mikroorganismen der menschlichen Darmflora <strong>und</strong> auf die Mucosa-Epithelzellen des menschlichen<br />
Darms diskutiert. Der Gentransfer auf die Darmepithelzellen ist nur von geringer Bedeutung, da es sehr<br />
unwahrscheinlich ist, dass mit der Nahrung aufgenommene Gene den Darm vollkommen intakt erreichen oder die <strong>zur</strong><br />
Expression benötigten Regulationssequenzen aufweisen. Ergebnisse aus der Literatur zeigen zwar, dass mit der<br />
Nahrung aufgenommene DNA nicht vollständig hydrolysiert <strong>und</strong> teilweise in Zellen eintreten kann, aber auch die<br />
Autoren kommen zu dem Schluss, dass hier kein besonderes neues Risiko von rekombinanter DNA gegenüber<br />
"klassischer" DNA vorliegt. Außerdem wäre eine Etablierung der Gene, falls sie intakt <strong>und</strong> mit den entsprechenden<br />
Regulationssequenzen übertragen werden, aufgr<strong>und</strong> der ständigen Abschilferung der Epithelzellen sehr<br />
unwahrscheinlich. Von größerer Bedeutung ist der Transfer von DNA auf Mikroorganismen der Darmflora. Bei Verzehr<br />
von gentechnisch veränderten Mikroorganismen als Lebendkulturen besteht die Möglichkeit eines Gentransfers. Die<br />
Wahrscheinlichkeit ist beim Verzehr von unverarbeiteten (rohen) Lebensmitteln aus transgenen Pflanzen geringer, da<br />
bis zum Zeitpunkt der Exposition die verzehrte DNA durch die Aktivität von Verdauungsenzymen weitgehend<br />
abgebaut wird. Selbst wenn intakte Gene aus den verzehrten transgenen Pflanzen auf Mikroorganismen der<br />
Darmflora übertragen werden sollten, ist die Expression dieser Gene unwahrscheinlich, da die pflanzlichen<br />
Regulationssequenzen des übertragenen genetischen Materials in den Mikroorganismen der Darmflora keine Funktion<br />
ausüben.<br />
11.2.3. “Technische Universität München, Lehrstuhl der Physiologie, <strong>und</strong> Bayerische<br />
Landesanstalt für Tierzucht (BLT): “Untersuchung einer möglichen Übertragung von Genen<br />
auf Magen-Darm-Mikroorganismen von mit Bt-Mais gefütterten Rindern”. 2001-2004<br />
www.biosicherheit.de/features/printversion.php?context=1&id=19<br />
http://www.biosicherheit.de/lexikon/15.lexi.html<br />
- Bemerkungen<br />
Untersucht wurden mögliche Auswirkungen von gentechnisch veränderten Pflanzen - im Vergleich mit<br />
konventionellen Pflanzen - auf höhere Wirbeltiere am Beispiel des Rindes. Dabei wird der Verbleib der Fremd-DNA<br />
aus gentechnisch veränderten Futterpflanzen, in dem Fall Bt-Mais, verfolgt.<br />
Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, dass die DNA des Bt-Mais im Magen- Darm-Trakt der Rinder abgebaut<br />
wird. Es konnten zwar pflanzliche DNA-Fragmente nachgewiesen werden, aber nur solche, die im Genom vielfach<br />
auftraten.<br />
Ein seltener im Genom auftretendes pflanzliches Gen (Zein), das gentechnisch eingeführte Ampicillinresistenz-Gen<br />
sowie das Bt-Gen konnten nicht nachgewiesen werden.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 201 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 11: Literaturrecherche<br />
11.2.4. Trevor A. W. et al.: “Use of quantitative real-time and conventional PCR to assess the<br />
stability of the cp4 epsps transgene from Ro<strong>und</strong>up Ready® canola in the intestinal, ruminal,<br />
and fecal contents of sheep”. Journal of Biotechnology 112 (2004) 255–266<br />
- Zusammenfassung<br />
The stability of transgenic DNA encoding the synthetic cp4 epsps protein in a diet containing Ro<strong>und</strong>up Ready (RR)®<br />
canola meal was determined in duodenal fluid (DF) batch cultures from sheep. A real-time TaqMan® PCR assay was<br />
designed to quantify the degradation of cp4 epsps DNA during incubation in DF at pH 5 or 7. The copy number of<br />
cp4 epsps DNA in the diet declined more rapidly (P < 0.05) in DF at pH 5 as compared to pH 7. The decrease was<br />
attributed mainly to microbial activity at pH 7 and perhaps to plant endogenous enzymes at pH 5. The 62-bp<br />
fragment of cp4 epsps DNA detected by real-time PCR reached a maximum of approximately 1600 copies in the<br />
aqueous phase of DF at pH 7, whereas less than 20 copies were detected during incubations in DF at pH 5. A 1363-<br />
bp sequence of cp4 epsps DNA was never detected in the aqueous fraction of DF. Additionally, genomic DNA isolated<br />
from RR® canola seed was used to test the persistence of fragments of free DNA in DF at pH 3.2, 5, and 7, as well<br />
as in ruminal fluid and feces. Primers spanning the cp4 epsps DNA coding region amplified sequences ranging in size<br />
from 300 to 1363 bp. Free transgenic DNA was least stable in DF at pH 7 where fragments less than 527 bp were<br />
detected for up to 2 min and fragments as large as 1363 bp were detected for 0.5 min. This study shows that<br />
digestion of plant material and release of transgenic DNA can occur in the ovine small intestine. However, free DNA<br />
is rapidly degraded at neutral pH in DF, thus reducing the likelihood that intact transgenic DNA would be available for<br />
absorption through the Peyer’s Patches in the distal ileum.<br />
- Bemerkungen<br />
Das Ziel dieser Studie war es, die Stabilität transgener DNA („Ro<strong>und</strong>up Ready canola“, codiert für das cp4 epsps-Gen,<br />
1363 bp) entlang des Verdauungstraktes von Tieren zu untersuchen.<br />
Fragmente der DNA zwischen 300 <strong>und</strong> 1363 bp wurden untersucht.<br />
Aus den Ergebnissen der Studie geht hervor, dass bezüglich der Stabilität von transgener Raps-DNA Unterschiede<br />
beobachtet werden können, die einerseits vom jeweiligen Ort des Verdauungstraktes (Magen, Dünndarm, Dickdarm)<br />
<strong>und</strong> im Falle des Dünndarmsaftes zusätzlich vom pH-Wert abhängig sind.<br />
Die längste Persistenz der DNA konnte im Dünndarmsaft bei einem pH-Wert von 3.2 <strong>und</strong> in den Fäzes beobachtet<br />
werden (240 bzw. 120 Minuten für Fragment mit 1363 bp <strong>und</strong> 120 bzw. 240 Minuten für die kürzeren DNA-<br />
Fragmente mit 300-527 bp).<br />
Alle unterschiedlich langen Fragmente überdauerten im Dünndarmsaft bei einem pH-Wert von 5 <strong>und</strong> im Magensaft<br />
für 10 Minuten.<br />
Unter den neutralen pH-Wert-Bedingungen (pH-Wert=7) des Dünndarmsaftes konnte für die transgene DNA die<br />
geringste Stabilität beobachtet werden (2 Minuten für die kurzen Fragmente). Das 1363-bp cp4 epsps-Gen konnte<br />
nach 0.5 Minuten nicht mehr gef<strong>und</strong>en werden.<br />
Die Autoren dieser Studie sind der Meinung, dass „although fragments of DNA may persist in the contents of the<br />
duodenum at low pH, they are unlikely to persist long enough to reach the most probable site of absorption at the<br />
Peyer´s Patches in the ileum”.<br />
11.2.5. Nemeth A., Wurz A.: “Sensitive PCR Analysis of Animal Tissue Samples for Fragments<br />
of Endogenous and Transgenic Plant DNA”. J. Agric. Food Chem. 2004, 52, 6129-6135<br />
- Zusammenfassung<br />
An optimized DNA extraction protocol for animal tissues coupled with sensitive PCR methods was used to determine<br />
whether trace levels of feed-derived DNA fragments, plant and/or transgenic, are detectable in animal tissue samples<br />
including dairy milk and samples of muscle (meat) from chickens, swine, and beef steers. Assays were developed to<br />
detect DNA fragments of both the high copy number chloroplast-encoded maize rubisco gene (rbcL) and single copy<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 202 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 11: Literaturrecherche<br />
nuclear-encoded transgenic elements (p35S and a MON 810-specific gene fragment). The specificities of the two<br />
rbcLPCR assays and two transgenic DNA PCR assays were established by testing against a range of conventional<br />
plant species and genetically modified maize crops. The sensitivities of the two rbcLPCR assays (resulting in 173 and<br />
500 bp amplicons) were similar, detecting as little as 0.08 and 0.02 genomic equivalents, respectively. The<br />
sensitivities of the p35S and MON 810 PCR assays were approximately 5 and 10 genomic equivalents for 123 bp and<br />
149 bp amplicons, respectively, which were considerably less than the sensitivity of the rbcL assays in terms of plant<br />
cell equivalents, but approximately similar when the higher numbers of copies of the chloroplast genome per cell are<br />
taken into account. The 173 bp rbcLassay detected the target plant chloroplast DNA fragment in 5%, 15%, and 53%<br />
of the muscle samples from beef steers, broiler chickens, and swine, respectively, and in 86% of the milk samples<br />
from dairy cows. Reanalysis of new aliquots of 31 of the pork samples that were positive in the 173 bp rbcLPCR<br />
showed that 58% of these samples were reproducibly positive in this same PCR assay. The 500 bp rbcLassay<br />
detected DNA fragments in 43% of the swine muscle samples and 79% of the milk samples. By comparison, no<br />
statistically significant detections of transgenic DNA fragments by the p35SPCR assay occurred with any of these<br />
animal tissue samples.<br />
Keywords: Biotechnology, DNA, maize, PCR, transgenic feed<br />
- Bemerkungen<br />
Das Ziel dieser Studie ist die Bereitstellung zusätzlicher Daten bzw. Informationen zum Nachweis von pflanzlichen<br />
DNA-Fragmenten in tierischen Produkten <strong>und</strong> Bestätigung von Beobachtungen aus Studien, dass high-copy-<br />
Chloroplasten-DNA-Fragmente eher nachweisbar sind als DNA-Fragmente der gentechnischen Veränderung, die<br />
single-copy-Gene darstellen.<br />
Publizierte Studien zeigten bereits, dass DNA-Bruchstücke der gentechnischen Veränderung, single-copy-Gene, bis<br />
dato nicht in Geweben von Tieren, die GVO-Futtermittel verzehrt haben, nachzuweisen waren.<br />
Im Gegensatz dazu berichten diverse, zitierte Literaturstellen von Untersuchungen, wo pflanzliche DNA-Fragmente,<br />
die multi-copy-Gene darstellen, in Organen/Geweben von Tieren wie Kühen, Geflügel <strong>und</strong> Schweinen gef<strong>und</strong>en<br />
wurden.<br />
Die Ergebnisse dieser Studie lassen den Schluss zu, dass die Anzahl der „gene-copies“ einen signifikanten<br />
Einflussfaktor auf das Auffinden von pflanzlicher DNA in tierischen Geweben darstellt. Eine einzelne Pflanzenzelle<br />
enthält 500-50 000 Kopien des Chloroplastengenoms.<br />
Die Autoren dieser Studie stehen auf dem Standpunkt, dass „the presence of DNA fragments of high copy number<br />
plant sequences in some animal tissue appears to be a normal metabolic occurence that is variable between different<br />
animal species and between tissue types within animal species“.<br />
11.2.6. Flachowsky G., Institut für Tierernährung der B<strong>und</strong>esforschungsanstalt für<br />
Landwirtschaft, Braunschweig: “Zum Einsatz von Futtermitteln aus gentechnisch<br />
veränderten Pflanzen in der Wiederkäuerernährung”. Mühle + Mischfutter, 141. Jahrgang,<br />
Heft 9, 2004<br />
- Bemerkungen<br />
„Verbleib der Fremd-DNA“:<br />
Mensch <strong>und</strong> Tier werden auf vielfältige Weise seit Jahrmillionen mit „Fremd“-DNA konfrontiert. In verschiedenen<br />
Studien wurde der Weg der pflanzlichen Erbsubstanz im Organismus verfolgt.<br />
Bei gemischter Kost nehmen Menschen mit der Nahrung täglich 0,1-1 g, Schweine 0,5-4 g <strong>und</strong> Milchkühe 40-60 g<br />
DNA auf.<br />
Zu der über das Futter aufgenommenen DNA-Menge kommen Mengen an DNA dazu, die aus der mikrobiellen<br />
Besiedlung des Verdauungstraktes resultieren. Mensch <strong>und</strong> Tier müssen sich demnach seit Jahrmillionen mit<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 203 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 11: Literaturrecherche<br />
„Fremd“-DNA auseinandersetzen. Die durch Gentransfer in ein Futter- oder Lebensmittel neu eingeführten Gene<br />
verändern damit die Menge an zugeführter DNA nur in unbeutendem Maße.<br />
Laut dieser Literaturstelle wird die DNA durch verschiedene Behandlungen wie Silierung oder industrielle<br />
Verarbeitung (Erhitzen <strong>und</strong> Extraktion bei der Ölgewinnung) weitgehend abgebaut.<br />
Im Verdauungstrakt erfolgt durch Magensäure <strong>und</strong> weitere Nukleasen eine weitere Degradation.<br />
Dabei ist jedoch nicht auszuschließen, dass Genfragmente in die Darmepithelien gelangen <strong>und</strong> vom Wirtsorganismus<br />
absorbiert werden.<br />
Bei Nicht-Wiederkäuern konnten verschiedene Pflanzen-DNA-Bruchstücke in Organen <strong>und</strong> Geweben gef<strong>und</strong>en<br />
werden.<br />
Bisher erfolgte kein Nachweis von Bruchstücken der transgenen DNA in Organen <strong>und</strong> Geweben von Lebensmittel<br />
erzeugenden Tieren.<br />
Untersuchungen an Wiederkäuern zum DNA-Abbau wiesen darauf hin, dass Pflanzen-DNA-Bruchstücke in den<br />
Leukozyten <strong>und</strong> im Verdauungstrakt zu finden sind. Vereinzelt wurden diese Bruchstücke auch in der Milch <strong>und</strong> in<br />
den Fäzes nachgewiesen. In Organen wie der Muskulatur, der Leber, der Milz <strong>und</strong> der Niere konnte kein Nachweis<br />
festgestellt werden.<br />
Transgene DNA- Bruchstücke wurden in allen untersuchten Organen <strong>und</strong> Geweben nicht gef<strong>und</strong>en.<br />
Schlussfolgerung dieser Studie war, dass die „Fremd“-DNA im Verdauungstrakt nahezu vollständig abgebaut wird,<br />
sodass in den essbaren Tierprodukten keine entsprechenden Rückstände nachgewiesen werden konnten.<br />
11.2.7. Einspanier R., Lutz B., Rief S., Berezina O., Zverlov V., Schwarz W., Mayer J.: „Tracing<br />
residual recombinant feed molecules during digestion and rumen bacterial diversity in cattle<br />
fed transgene maize“. European Food Research Technology (2004) 218:269-273.<br />
- Zusammenfassung<br />
Abstract: The aim of this study was to trace selected nucleic acid and protein components of isogene versus Bt<br />
transgene maize within the bovine gastrointestinal tract (GIT). After feeding 22 cattle for 4 weeks with Bt176 maize,<br />
different plant genes and the recombinant protein CryIAb were quantified during digestion. Furthermore, a first initial<br />
characterization of rumen bacteria was approached, using 16rDNA gene sequencing comparing isogene- against<br />
transgene-fed animals. Ingesta samples of different GIT sections (rumen, abomasum, jejunum, colon) were analysed<br />
for chloroplast, maize invertase, zein and Bt toxin (CryIAb) gene fragments using quantitative real-time PCR. First,<br />
the initial gene dose of these maize genes was detected in maize silage. During digestion, a significant reduction of<br />
high-to-medium ab<strong>und</strong>ant plant gene fragments was shown depending on the dwell-time and the initial gene copy<br />
number. Immunoreactive CryIAb protein was quantified by ELISA in intestinal samples indicating a significant loss of<br />
that protein. Remarkable amounts of Bt toxin were fo<strong>und</strong> in all contents of the GIT and the protein was still present<br />
in faeces. For the first time, the influence of CryIAb transgene maize on rumen bacterial microflora was investigated<br />
compared to isogene material through analysis of 497 individual bacterial 16S rDNA sequences. In principle, specific<br />
bacterial leader-species could be identified in all bovine rumen extracts, but no significant influence of Bt176 maize<br />
feed was fo<strong>und</strong> on the composition of the microbial population. This investigation provides supplementing data to<br />
further evaluate the fate of novel recombinant material originating from transgene feed or food within the<br />
mammalian GIT.<br />
Keywords: Bt maize, Cattle, Intestinal tract, CryIAb protein, Plant DNA<br />
- Bemerkungen<br />
Auch diese zweite Studie von Einspanier et al. aus dem Jahre 2004 bestätigte die Ergebnisse aus der ersten Studie<br />
(2001). Pflanzliche DNA wurde im gastrointestinalen Trakt des Tieres rasch abgebaut <strong>und</strong> fand sich in den Fäzes<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 204 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 11: Literaturrecherche<br />
nicht wieder. Anders verhält sich das rekombinante CryIAb-Protein, von dem noch Spuren in den Fäzes nachweisbar<br />
sind. Weiters konnte kein signifikanter Einfluss von transgenem Mais (Bt176) auf die Zusammensetzung der<br />
Darmflora festgestellt werden.<br />
Die Autoren deuten darauf hin, dass in Kurzzeitversuchen sowohl für den Mensch als auch für das Tier keine<br />
nachteiligen ges<strong>und</strong>heitlichen Auswirkungen nach dem Verzehr transgenen Maises zu befürchten sind.<br />
11.2.8. Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften. Kommission Grüne Gentechnik.<br />
Memorandum: „Gibt es Risiken für den Verbraucher beim Verzehr von Nahrungsprodukten<br />
aus gentechnisch veränderten Pflanzen? Seite 1-4<br />
- Zusammenfassung<br />
Dieser Bericht untersucht auf der Gr<strong>und</strong>lage vorhandener wissenschaftlicher Literatur die potentielle Gefährdung der<br />
Verbraucher beim Verzehr von Produkten gentechnisch veränderter Pflanzen (GVO) im Hinblick auf Giftigkeit ,<br />
Krebserregung <strong>und</strong> Auslösung von Allergien sowie den Auswirkungen des Verzehrs der Fremd-DNA, darunter auch<br />
der DNA von Antibiotika-Resistenzgenen. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass beim Verzehr von Lebensmitteln<br />
aus in der EU zugelassenen GVO ein erhöhtes Ges<strong>und</strong>heitsrisiko gegenüber dem Verzehr von Produkten aus<br />
konventionellem Anbau nicht besteht, dass im Gegenteil in einzelnen Fällen Lebensmittel aus GVO den<br />
konventionellen Lebensmitteln in Bezug auf die Ges<strong>und</strong>heit sogar überlegen sind.<br />
11.2.9. Reuter T.: „Vergleichende Untersuchungen <strong>zur</strong> ernährungsphysiologischen<br />
Bewertung von isogenem <strong>und</strong> transgenem (Bt) Mais <strong>und</strong> zum Verbleib von „Fremd-DNA“ im<br />
Gastrointestinaltrakt <strong>und</strong> in ausgewählten Organen <strong>und</strong> Geweben des Schweines sowie in<br />
einem rohen Fleischerzeugnis“.<br />
Dissertation am Institut für Tierernährung der B<strong>und</strong>esforschungsanstalt für Landwirtschaft<br />
in Braunschweig <strong>und</strong> dem Institut für Ernährungswissenschaften der Landwirtschaftlichen<br />
Fakultät der Martin- Luther- Universität Halle- Wittenberg, 2003.<br />
- Zusammenfassung<br />
Vergleichende Untersuchungen <strong>zur</strong> ernährungsphysiologischen Bewertung von isogenem <strong>und</strong> transgenem (Bt) Mais<br />
<strong>und</strong> zum Verbleib von „Fremd“-DNA im Gastrointestinaltrakt <strong>und</strong> in ausgewählten Organen <strong>und</strong> Geweben des<br />
Schweines sowie in einem rohen Fleischerzeugnis. Der Einsatz neuer Technologien resultiert in der menschlichen<br />
Gesellschaft meist in einer Kontroverse. Die gentechnische Modifikation von landwirtschaftlichen Nutzpflanzen stellt in<br />
diesem Zusammenhang keine Ausnahme dar. Mit dem Einsatz von gentechnisch veränderten Pflanzen in der Human-<br />
<strong>und</strong> Tierernährung entwickelte sich die Frage nach der Sicherheit von gentechnisch veränderten Pflanzen für Mensch,<br />
Tier <strong>und</strong> Umwelt zu einer kontrovers geführten Diskussion auf öffentlicher <strong>und</strong> wissenschaftlicher Ebene. Die<br />
Kontroverse über transgene landwirtschaftliche Nutzpflanzen <strong>und</strong> dabei speziell Bt-Mais ist eng verb<strong>und</strong>en mit einer<br />
weitreichenden Meinungsverschiedenheit über die ökonomischen, ökologischen <strong>und</strong> sozialen Konsequenzen. Unter<br />
Berücksichtigung dieser Situation wurden umfangreiche Untersuchungen <strong>zur</strong> ernährungsphysiologischen Wertung<br />
von Futtermitteln aus gentechnisch veränderten Pflanzen aufgenommen. Die Fragestellung der vorliegenden<br />
Dissertation ordnet sich in die Gesamtthematik ein. Im Einzelnen wurden mit Bt-Mais die folgenden Themen<br />
bearbeitet:<br />
I. Chemisch-analytische Untersuchung von isogenem <strong>und</strong> transgenem Mais,<br />
II. Untersuchungen <strong>zur</strong> ernährungsphysiologischen Bewertung der Maishybriden bei Schweinen,<br />
III. Mastleistung von Schweinen gefüttert mit Diäten mit hohen Anteilen an isogenem oder transgenem Mais,<br />
IV. Schicksal der mit der Nahrung aufgenommen „Fremd“-DNA im Körper von Schweinen.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 205 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 11: Literaturrecherche<br />
zu I. Mit Hilfe von chemisch-analytischen Untersuchungen wurden in Bt-Mais parallel <strong>zur</strong> isogener Ausgangslinie<br />
wichtige Inhaltsstoffe ermittelt. Die Untersuchung der chemischen Zusammensetzung der beiden Hybriden ergab<br />
keine signifikanten Unterschiede in den Rohnährstoff- (Bsp. Rohprotein 11,59 vs. 11,06 %), Aminosäuren,-<br />
Fettsäuren- <strong>und</strong> Mineralstoffgehalten als auch für Stärke, Zucker <strong>und</strong> Nicht-Stärke-Polysaccharide. Beide Maishybride<br />
sind in ihrer stofflichen Zusammensetzung substanziell äquivalent.<br />
zu II. Beide Maishybriden wurden jeweils zu 70% in bedarfsdeckende Futtermischungen (FM) für Schweine<br />
eingemischt. Die ernährungsphysiologische Wertigkeit der FM wurde im Verdauungsversuch mit 12 männlichen,<br />
kastrierten Schweinen untersucht. Die Tiere wurden nach Bestimmung ihrer Lebendmasse in zwei Gruppen mit 6<br />
Schweinen eingeteilt. Mit jeder Gruppe wurden 3 Verdauungsversuche durchgeführt. Die Verdaulichkeit der<br />
Rohnährstoffe beider Maishybriden (Rohprotein 85,8 ±2,3 vs. 86,1 ±1,8 % <strong>und</strong> NfE 92,8 ±0,6 vs. 93,2 ±0,6 in T)<br />
unterschied sich ebenso wie der Energiegehalt (15,7 ±0,2 vs. 15,8 ±0,2 % MJ/kg T) nicht signifikant.<br />
zu III. Im langfristigen Fütterungsversuch bestand das Ziel, Leistungsparameter im Verlauf <strong>und</strong> am Ende der<br />
Mastperiode nach Aufnahme von Futtermischungen mit isogenem oder transgenem Mais zu vergleichen. Für den<br />
Mastversuch wurden 48 weibliche Schweine eingesetzt. Die Schweine wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Für 36<br />
Tiere enthielt die FM 70 % transgenen Mais, die verbliebenen 12 Tiere erhielten die FM mit 70 % der isogenen<br />
Ausgangssorte. Im Mastversuch zeigte sich, dass die Verfütterung von gentechnisch verändertem Bt-Mais im<br />
Vergleich zum isogenem Mais über einen Zeitraum von 91 Tagen zu einer identischen Leistung führt. Die Tiere der<br />
Gruppen realisierten eine mittlere tägliche Lebendmassezunahme (LMZ) von 815 ±93 vs. 804 ±63 g/d bei einem<br />
Futteraufwand von 2,41 ±0,17 vs. 2,41 ±0,15 kg/kg LMZ (isogen vs. transgen). Aus Sicht der Tierernährung konnten<br />
für beide Maishybriden keine vor- oder nachteiligen Eigenschaften für den Einsatz in der Schweinemast ermittelt<br />
werden.<br />
zu IV. In Untersuchungen an Rindern <strong>und</strong> Geflügel wurden pflanzliche DNA-Bruchstücke aus der Nahrung in<br />
verschiedenen Organen <strong>und</strong> Geweben nachgewiesen. Demgegenüber fand kein Nachweis transgener DNA-<br />
Fragmente nach der Verabreichung von gentechnisch veränderten Pflanzen im Tierkörper außerhalb des Magen-<br />
Darmtraktes statt. Im eigenen Versuch sollte das Schicksal von fremder DNA aus der Nahrung im Organismus von<br />
Schweinen verfolgt werden. Der Verbleib <strong>und</strong> die Passage von Fremd-DNA wurde an 48 Versuchstieren gefüttert mit<br />
Diäten mit 70 % isogenem (n = 12) bzw. transgenem (n = 36) Mais untersucht. Die mit transgenem Mais<br />
gemästeten Tiere wurden in 6 Gruppen mit jeweils 6 Tieren zum Zeitpunkt 4, 8, 12, 24, 48 <strong>und</strong> 72 h nach der letzten<br />
Fütterung einer maishaltigen Diät geschlachtet. Lediglich die zum Zeitpunkt 24, 48 <strong>und</strong> 72 h geschlachteten Tiere<br />
erhielten bis <strong>zur</strong> Schlachtung eine maisfreie, durch Gerste <strong>und</strong> Weizen substituierte Diät. Bei den Tieren der beiden<br />
Kontrollgruppen (n = 6) erfolgte die Schlachtung 4 <strong>und</strong> 8 h nach der letzten Fütterung. Die extrahierte DNA von<br />
Ingesta- <strong>und</strong> Gewebeproben wurde mit Hilfe der Polymerase-Kettenreaktion auf die Anwesenheit pflanzlicher <strong>und</strong><br />
transgener Gen-Fragmente untersucht.<br />
Transgene Gen-Fragmente konnten bis zu 48 h nach der letzten Fütterung einer Bt-maishaltigen Diät in<br />
Ingestaproben nachgewiesen werden. Weiterhin passieren kleine pflanzliche DNA-Fragmente aus dem Futtermittel<br />
die Darmbarriere <strong>und</strong> sind in tierischen Geweben sowie später noch in rohen Fleischerzeugnissen nachweisbar.<br />
Nicht nachweisbar waren im Gewebe DNA-Fragmente der gentechnischen Veränderung. Die Passage von pflanzlichen<br />
DNA-Fragmenten fand unabhängig von der Futtermittelquelle in den Organismus von Schweinen, die mit transgenem<br />
oder isogenem Mais gefüttert wurden, statt.<br />
Die stoffliche Äquivalenz <strong>und</strong> eine gleiche ernährungsphysiologische Wertigkeit der untersuchten isogenen <strong>und</strong><br />
gentechnisch veränderten Maishybriden lassen Unterschiede beim Einsatz in der Schweinemast nicht erwarten.<br />
Parallel zu anderen Tierspezies ist die Aufnahme von DNA-Bruchstücken aus der Nahrung in den Organismus von<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 206 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 11: Literaturrecherche<br />
Schweinen möglich. DNA-Fragmente der gentechnischen Veränderung wurden nicht aufgenommen oder lagen im<br />
Bereich unterhalb der Nachweisgrenze.<br />
Zur Bestimmung der Verweildauer von Nahrungskomponenten im Magen-Darm-Trakt stellt die Polymerase-<br />
Kettenreaktion in Verbindung mit selektiven Primersystemen eine sensitive Methode dar.<br />
- Bemerkungen<br />
In dieser Studie wurde untersucht, ob ein Übergang von fremder DNA aus der Nahrung in den Organismus von<br />
Schweinen stattfindet.<br />
Die Ergebnisse besagen, dass kleine pflanzliche DNA- Fragmente aus dem Futtermittel die Darmbarriere beim<br />
Schwein passieren <strong>und</strong> im tierischen Gewebe <strong>und</strong> sogar später noch in den rohen Fleischerzeugnissen nachweisbar<br />
sind.<br />
Nicht nachzuweisen waren im Gewebe DNA-Fragmente der gentechnischen Veränderung, d.h. laut dieser Studie,<br />
dass DNA-Fragmente der gentechnischen Veränderung nicht aufgenommen werden oder im Bereich unterhalb der<br />
Nachweisegrenze liegen.<br />
11.2.10. Poms R. E., Hochsteiner W., Luger K., Glössl J., Foissy H.: „Model Studies on<br />
the Detectybility of Genetically Modified Feed in Milk“. Journal of Food Protecion: Vol. 66,<br />
No. 2, 2003. 304-310.<br />
- Zusammenfassung<br />
Abstract: Detecting the use of genetically modified feeds in milk has become important, because the voluntary<br />
labeling of milk and dairy products as “GMO free” or as “organically grown” prohibits the employment of genetically<br />
modified organisms (GMOs). The aim of this work was to investigate whether a DNA transfer from foodstuffs like<br />
soya and maize was analytically detectable in cow’s milk after digestion and transportation via the bloodstream of<br />
dairy cows and, thus, whether milk could report for the employment of transgene feeds. Blood, milk, urine, and feces<br />
of dairy cows were examined, and foreign DNA was detected by polymerase chain reaction by specifically amplifying<br />
a 226-bp fragment of the maize invertase gene and a 118-bp fragment of the soya lectin gene. An intravenous<br />
application of purified plant DNA showed a fast elimination of marker DNA in blood or its reduction below the<br />
detection limit. With feeding experiments, it could be demonstrated that a specific DNA transfer from feeds into milk<br />
was not detectable. Therefore, foreign DNA in milk cannot serve as an indicator for the employment of transgene<br />
feeds unless milk is directly contaminated with feed components or airborne feed particles.<br />
- Bemerkungen<br />
Eine österreichische Forschungsgruppe der Universität für Bodenkultur hat im Jahre 2003 eine Studie publiziert, in<br />
der gezeigt wurde, dass Mais- bzw. Soja-DNA aus dem Futter nicht in der Milch nachweisbar ist.<br />
Die Fütterungsversuche wurden in Österreich <strong>und</strong> unter realen Stallbedingungen durchgeführt. Für die Versuche<br />
wurde kein GVO-Futter verwendet, sondern konventionelles Futter (Mais <strong>und</strong> Soja-hältige Futtermischungen), wobei<br />
endogene Mais- <strong>und</strong> Soja-Genfragmente (von single-copy Genen) als Marker-DNA verwendet wurden. Diese<br />
verhalten sich laut Literatur im Verdauungstrakt genauso wie transgene DNA-Abschnitte im GVO-Futter.<br />
Um die Kontamination durch Futterstaub zu messen, wurden im Stall offene Petrischalen mit Rohmilch in<br />
verschiedenen Abständen vom Futtertrog aufgestellt (bis zu 20 m Entfernung). In den Proben, die bis 10 m vom<br />
Futtertrog entfernt waren, konnte Mais bzw. Soja-DNA nachgewiesen werden. Milch, die über 10 m entfernt war,<br />
blieb hingegen unkontaminiert.<br />
In frisch gemolkener Milch konnten single-copy Gene nicht nachgewiesen werden. Da in GV-Pflanzen die Transgene<br />
oft auch als single-copy Gene eingebaut sind, ist es nicht unbedingt zielführend, in der Milch nach Spuren von<br />
Transgenen zu suchen, um nachzuweisen, dass ein Bauer GVO-Futter verwendet hat.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 207 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 11: Literaturrecherche<br />
Kommentar der Wissenschaftler: Unter den heute üblichen Hygienebedingungen beim Melken mit modernen<br />
Melkmaschinen kann man eine Kontamination der Milch aus der Umgebungsluft des Stalles in der Regel auch<br />
ausschließen. Wenn also jemand feststellen möchte, ob ein Bauer GVO-Futter verwendet, ist wohl nur eine<br />
Überprüfung des Futters vor Ort eine zuverlässige Methode.<br />
Das Ziel dieser Arbeit war die Etablierung eines Verfahrens zum Nachweis von Futtermittel- DNA in der komplexen<br />
Matrix „Milch“ <strong>und</strong> die Untersuchung, ob ein DNA-Transfer von Futtermitteln wie Soja <strong>und</strong> Mais nach Aufnahme,<br />
Verdauung <strong>und</strong> Transport durch die Blutbahn in Kuhmilch analytisch nachweisbar ist <strong>und</strong> ob dadurch die Milch für<br />
eine Kontrolle des Einsatzes transgener Futtermittel herangezogen werden könnte.<br />
Fremd-DNA wurde mittels der PCR-Methode anhand der Vervielfältigung eines 226-bp Fragmentes des Mais-<br />
Invertase-Gens <strong>und</strong> anhand eines 118-bp Fragmentes (beide relativ kurze Fragmente) des Soja-Lectin-Gens<br />
nachgewiesen.<br />
Eine Untersuchung mit isolierter pflanzlicher DNA, die Milchkühen intravenös verabreicht wurde, wies auf eine rasche<br />
Elimination dieser DNA im Blut hin. Diese rasche Elimination ist wiederum auf den raschen <strong>und</strong> effektiven Abbau<br />
freier DNA in der Leber <strong>und</strong> in den Makrophagen <strong>zur</strong>ückzuführen. Trotz einer teilweise hohen Applikationsmenge an<br />
freier DNA in das Blut, konnte einen Tag nach der Applikation keine DNA in der Kuhmilch gef<strong>und</strong>en werden.<br />
Weiters wurde eine Fütterungsstudie an Kühen durchgeführt. Selbst hohe Mengen an Mais <strong>und</strong> Soja im Viehfutter<br />
führten nicht zu einem Nachweis der spezifischen, kurzen 226-bp- <strong>und</strong> 118-bp Fragmente im Blut, Milch <strong>und</strong> Urin.<br />
Zusätzlich wird in dieser Studie jedoch darauf aufmerksam gemacht, dass „ taking into consideration that cows ingest<br />
several grams of nucleic acids via feed per day and that it takes about 600 liters of blood to circulate through udder<br />
tissue to produce 1 liter of milk, foreign DNA could be accumulated in milk despite a nondetectable concentration of<br />
marker DNA in blood”.<br />
In dieser Fütterungsstudie wurden jedoch keine single-copy Gene von Mais oder von Soja in der Milch gef<strong>und</strong>en.<br />
„The probability for positive detection of chloroplast DNA is about 10 3 to 10 4 higher- due to their high copy numbers<br />
per plant cell- than that for single-copy genes.<br />
Die Ergebnisse dieser Studie bestätigten die ähnliche Studie von Einspanier et al. (2001), die keinen spezifischen<br />
DNA-Transfer transgener DNA in das Blut, das Gewebe oder in die Milch von Kühen erkennen ließen. Hingegen<br />
wurde bei Einspanier et al. (2001) von einem Transfer kleiner pflanzlicher DNA-Fragmente (ca. 200 bp) in die<br />
Leukozyten <strong>und</strong> in die Milch (in Spuren vorkommend) berichtet.<br />
11.2.11. Phipps R. H., Deaville E. R., Maddison B. C. : “ Detection of Transgenic and<br />
Endogenous Plant DNA in Rumen Fluid, Duodenal Digesta, Milk, Blood, and Feces of<br />
Lactating Dairy Cows”. Journal of Dairy Science. Vol. 86, No. 12, 2003. 4070-4078.<br />
- Zusammenfassung<br />
Abstract: The objective was to determine the presence or absence of transgenic and endogenous plant DNA in<br />
ruminal fluid, duodenal digesta, milk, blood, and feces, and if fo<strong>und</strong>, to determine fragment size. Six multiparous<br />
lactating Holstein cows fitted with ruminal and duodenal cannulas received a total mixed ration. There were two<br />
treatments (T). In T1, the concentrate contained genetically modified (GM) soybean meal (cp4epsps gene) and GM<br />
corn grain (cry1a[b] gene), whereas T2 contained the near isogenic non-GM counterparts. Polymerase chain reaction<br />
analysis was used to determine the presence or absence of DNA sequences. Primers were selected to amplify small<br />
fragments from singlecopy genes (soy lectin and corn high-mobility protein and cp4epsps and cry1a[b] genes from<br />
the GM crops) and multicopy genes (bovine mitochondrial cytochrome b and rubisco). Single-copy genes were only<br />
detected in the solid phase of rumen and duodenal digesta. In contrast, fragments of the rubisco gene were detected<br />
in the majority of samples analyzed in both the liquid and solid phases of ruminal and duodenal digesta, milk, and<br />
feces, but rarely in blood. The size of the rubisco gene fragments detected decreased from 1176 bp in ruminal and<br />
duodenal digesta to 351 bp in fecal samples.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 208 von 272
Keywords: DNA detection, digesta, GM feeds, milk<br />
- Bemerkungen<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 11: Literaturrecherche<br />
Eine englische Arbeitsgruppe bestätigte die Ergebnisse von Einspanier et al. mit Versuchen zu transgenem Soja.<br />
Das Ziel dieser Studie war es nachzuweisen, ob transgene oder endogene Pflanzen- DNA in den Verdauungssäften, in<br />
der Milch, im Blut <strong>und</strong> in den Fäzes vorkommen oder nicht <strong>und</strong> falls doch, die Größe der einzelnen Fragmente zu<br />
bestimmen.<br />
Diese Studie bestätigte die Ergebnisse anderer Untersuchungen, wonach in der Milch von Kühen, denen GVO-<br />
Futtermittel verfüttert wurde, keine transgene DNA zu finden sei. Single-Copy-Gene wurden lediglich im Pansen <strong>und</strong><br />
im Duodenalsaft gef<strong>und</strong>en.<br />
Hingegen wurde pflanzliche DNA in den Verdauungssäften, in der Milch, in den Fäzes <strong>und</strong> selten im Blut<br />
aufgef<strong>und</strong>en.<br />
Die Autoren dieser Studie stellen jedoch die Frage in den Raum, ob nicht auch die transgene DNA absorbiert wird.<br />
Falls eine derartige Absorption zustande kommt, ist die Häufigkeit jedoch als gering einzuschätzen.<br />
Diesbezüglich werden von den Autoren noch weitere Untersuchungen <strong>und</strong> Informationen bezüglich des Mechanismus<br />
<strong>und</strong> einer Kontamination bei der Probenziehung gefordert <strong>und</strong> empfohlen.<br />
11.2.12. Wackernagel Wilfried: „Fakten <strong>und</strong> Fantasien zum horizontalen Gentransfer<br />
von rekombinanter DNA“. Akademie-Journal 1/2002. Seite 28-31.<br />
- Zusammenfassung<br />
Horizontaler Gentransfer wird im Kontext der Gentechnik in der Öffentlichkeit als eine Ursache ständiger Gefahr<br />
diskutiert. Auf der Gr<strong>und</strong>lage von Reagenzglasversuchen beinhaltender Begriff, dass Gene <strong>und</strong> Gengruppen von<br />
Bakterien auf andere Bakterien übertragen werden können. Dadurch wäre eine unkontrollierbare Ausbreitung<br />
rekombinanter DNA möglich. Die neuere umfassende Erforschung der Gentransferprozesse<br />
(Konjugation,Transformation <strong>und</strong> Transduktion) in bakteriellen Lebensräumen, die nicht zuletzt im Rahmen der<br />
Sicherheitsbewertung gentechnisch veränderter Mikroorganismen <strong>und</strong> Pflanzen durchgeführt wurde, zeigt, dass<br />
Gentransfer wohl überall möglich ist, jedoch nur sehr selten stattfindet. Es wurden Transferaktivitäten zwischen<br />
Bakterien unterschiedlicher Arten <strong>und</strong> sogar von Bakterien zu Hefe- <strong>und</strong> Pilzzellen <strong>und</strong> auch zu Pflanzen- <strong>und</strong><br />
Tierzellen gef<strong>und</strong>en. Gleichzeitig wurden jedoch limitierende Faktoren in der Umwelt <strong>und</strong> Barrieren für dauerhafte<br />
Integration der transferierten DNA in den Empfängerorganismen identifiziert. Übertragene Gene können sich nur<br />
dann etablieren, wenn ein entsprechender Selektionsdruck besteht, der den Genträgern Vorteile verleiht. Insgesamt<br />
ist die Möglichkeit eines Transfers von Genen aus transgenen Pflanzen auf Bakterien als sehr unwahrscheinlich<br />
einzustufen. Sie ist damit unvergleichlich niedriger als die schon geringe Möglichkeit des natürlichen Gentransfers<br />
zwischen Bakterien. Obwohl also ein Transfer von Pflanzen auf Bakterien, z. B. im Boden oder Darm, nicht zu<br />
erwarten ist, haben die verantwortlichen Behörden in Amerika <strong>und</strong> Europa bei der Zulassung von Freisetzungen <strong>und</strong><br />
beim Inverkehrbringen von transgenen Pflanzen noch zusätzlich darauf geachtet, dass in den Pflanzen keine Gene<br />
vorliegen, die potentiell gefährlich sind für Menschen, andere Lebewesen oder die Umwelt.<br />
11.2.13. Nowack Heimgartner K., Bickel R., Pushparajah Lorenzen R. Wyss E.:<br />
„Sicherung der gentechnikfreien Bioproduktion“. Schriftenreihe Umwelt Nr. 340. B<strong>und</strong>esamt<br />
für Umwelt, Wald <strong>und</strong> Landschaft, Bern, 2002<br />
- Zusammenfassung<br />
Die Bioproduktion verwendet weder gentechnisch veränderte Organismen (GVO) noch deren Folgeprodukte. Infolge<br />
der weltweiten Verbreitung <strong>und</strong> Anwendung von GVOs in der konventionellen Landwirtschaft <strong>und</strong><br />
Lebensmittelherstellung besteht aber zunehmend die Gefahr unerwünschter Verunreinigungen von Bioprodukten mit<br />
GVO-Erzeugnissen. Die vorliegende Studie zeigt die relevanten Kontaminationspfade auf, stellt die bisherigen<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 209 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 11: Literaturrecherche<br />
gesetzlichen Vorschriften <strong>und</strong> die Regelungen der Bioorganisationen dar <strong>und</strong> diskutiert Massnahmen <strong>zur</strong> Vermeidung<br />
der Verunreinigungen. Die folgenden Strategien stehen dabei im Vordergr<strong>und</strong>: strikte räumliche Trennung <strong>und</strong><br />
lückenlose Warenflussdokumentation, Ausschluss von kritischen Stoffen, Verwendung von Lebens- <strong>und</strong><br />
Futtermittelkomponenten ausschließlich in zertifizierter Bioqualität sowie Sicherheitsabstände zwischen GVO- <strong>und</strong><br />
Biofeldern.<br />
Stichwörter: Biolandbau, Kontamination, GVO<br />
- Bemerkungen<br />
Die Studie, die in diesem Dokument vorgestellt wird, zeigt für den Biologischen Landbau mögliche<br />
Kontaminationswege über die Produktion - Landwirtschaft <strong>und</strong> Verarbeitung- auf <strong>und</strong> schildert die derzeit<br />
bestehenden Maßnahmen, diesen Verunreinigungen entgegenzuwirken. Darüber hinaus gibt sie Empfehlungen über<br />
weitergehende zukünftige nötige Maßnahmen.<br />
Im Rahmen dieser Studie wurde auch die Frage aufgeworfen, ob gentechnisch veränderte DNA in tierischen<br />
Lebensmitteln wie dem Fleisch, der Milch oder den Eiern vorkommt.<br />
Da es jedoch erst wenige Untersuchungen zu diesem Thema gibt, sind die Ergebnisse unterschiedlich. Offensichtlich<br />
können Nukleinsäuren von Pflanzen die Darmwand passieren <strong>und</strong> im Tier in verschiedenen Organen auftauchen. Je<br />
nach Tier <strong>und</strong> Futter wurden jedoch unterschiedliche Resultate gef<strong>und</strong>en. Gentechnisch veränderte DNA wurde<br />
bisher nicht in den Produkten nachgewiesen.<br />
Jedoch kann die Milch durch Verstaubung (Milch, die offen neben dem Futtertrog steht) mit Futtermittel- DNA<br />
verunreinigt werden.<br />
Es lassen sich beim derzeitigen Kenntnisstand noch keine abschließenden Aussagen darüber treffen.<br />
11.2.14. Klotz A., Mayer J., Einspanier R.: “Degradation and possible carry over of feed<br />
DNA monitored in pigs and poultry”. European Food Research Technology (2002) 214: 271-<br />
275<br />
- Zusammenfassung<br />
A possible carry over of foreign food DNA into the body after consumption was examined. After feeding pigs with<br />
conventional and recombinant (Bt-) maize, different body samples were investigated using DNA extraction followed<br />
by PCR procedures to detect.<br />
Chloroplast genes of different length (199 bp and 532 bp), a maize-specific gene (zein) and a specific transgene<br />
present in Bt-maize (cryIa). Initially, a time-dependent degradation of feed DNA in the gastrointestinal tract of pigs<br />
was analysed within the juices from stomach and three parts of the small intestine (duodenum, jejunum, ileum).<br />
Subsequently, a possible transfer of residual chloroplast specific DNA as well as recombinant Bt-maize DNA<br />
fragments into different pig organs (blood, muscle, liver, spleen and lymph nodes) was examined. The suitability of<br />
the introduced DNA extraction procedure was verified through amplification of a universal gene (ubiquitin)<br />
demonstrating the successful PCR analysis within a range of 189–417 bp long DNA. Short chloroplast DNA fragments<br />
(199 bp) could be successfully amplified from the intestinal juices of pigs up to 12 h after the last feeding. In<br />
contrast, chloroplast specific DNA was not fo<strong>und</strong> in any pig organ investigated so far. Specific gene fragments from<br />
the transgene maize (Bt-maize) were never detected in any pig sample. A field study examining supermarket poultry<br />
samples (leg, breast and wing muscle, stomach) led to frequent detections of the short chloroplast DNA fragment<br />
(199 bp). Furthermore, faint signals for the maize specific zein gene fragment were detected in these poultry tissues.<br />
Additional PCR examinations using unhatched chicken embryos provided the first indication that neither chloroplast<br />
nor maize genes are present endogenously within the wild-type poultry genome. Therefore, a transient transfer of<br />
short forage DNA into most poultry organs can be suspected.<br />
Keywords: Feed-DNA, DNA transfer, Bacillus thuringiensis toxin maize, Polymerase chain reaction, Pigs and poultry<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 210 von 272
- Bemerkungen<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 11: Literaturrecherche<br />
Das Ziel dieser Studie war es, den Abbau <strong>und</strong> den möglichen „carry over“ von über Futter aufgenommener DNA an<br />
Beobachtungen <strong>und</strong> Fütterungsversuchen an Schweinen <strong>und</strong> Geflügel zu beschreiben.<br />
Schweinen wurde sowohl konventioneller als auch transgener Mais verfüttert.<br />
In den Verdauungssäften des Dünndarmes konnten kurze, pflanzliche DNA-Fragmente (199 bp) nachgewiesen<br />
werden. Hingegen fanden sich in anderen Geweben <strong>und</strong> Organen der Schweine wie Blut, Muskulatur, Leber, Milz <strong>und</strong><br />
Lymphknoten keine Anzeichen einer pflanzlichen Chloroplasten-DNA.<br />
Die Ergebnisse dieser Studie weisen weiters darauf hin, dass sich in keiner einzigen Probe, die von Schweinen<br />
gezogen wurde, Fragmente des transgenen Mais (Bt-Mais) wieder finden. Die Autoren dieser Studie führen dass auf<br />
rascheren Abbau des cry1A-Gens <strong>zur</strong>ück, da es sich hierbei nur um ein single-copy Gen handelt.<br />
Dies wird von den Autoren als Erklärung dafür angesehen, dass für die pflanzlichen DNA-Fragmente positive Signale<br />
existieren, jedoch für den Bt-Mais nicht.<br />
Die Autoren sprechen weiters davon, dass es wahrscheinlicher ist, kurze Fragmente (199 bp) im Gegensatz zu langen<br />
Bruchstücken (532 bp) zu finden.<br />
Andere Studien (Einspanier et al., Klotz et al. etc.) beschrieben bereits, dass ein Transfer von single-copy Genen<br />
durch die Darmwand eher ein seltenes Ereignis darstellt.<br />
Die Schlussfolgerung der Autoren aus dieser Studie lautet, dass es als eher unwahrscheinlich angesehen werden<br />
kann, dass ein signifikanter Transfer in das Blut oder in andere Gewebe stattfindet bzw. dass Gene den GIT-Trakt in<br />
Form ihrer gesamten Größe (mehr als 500 bp) passieren ohne teilweise abgebaut zu werden.<br />
PCR-Produkte:<br />
Mais spezifisches Zein-Gen = 277 bp<br />
Chloproplast Gene = 199 bp <strong>und</strong> 532 bp<br />
Cry1A-Gen (Bt-Mais) = 211 bp<br />
Universelles Gen (Ubiquitin) = 189-417 bp<br />
Die Autoren dieser Studie berichten weiters über die Untersuchung an Geflügelproben aus dem Supermarkt (Bein,<br />
Muskulatur der Brust <strong>und</strong> des Flügels, Magen). Aus diesen geht hervor, dass kurze Chloroplasten-DNA Fragmente<br />
(199 bp) in diesen Proben sehr häufig zu finden sind. Weiters geht hervor, dass schwache bzw. <strong>und</strong>eutliche Signale<br />
in den Geflügelproben aufgetreten sind, die auf das Auftreten von Mais spezifischem Zein-Gen-Fragment hindeuten.<br />
Zusätzliche Untersuchungen an noch nicht geschlüpften Hühnerembryonen zeigen, dass weder Chloroplasten noch<br />
Mais-Gene Bestandteile des genetischen Materials von Geflügel darstellen.<br />
Somit scheint ein Transfer kurzer DNA-Fragmente (Chloroplasten- <strong>und</strong> Zein-Gene) in die meisten Organe des<br />
Geflügels möglich zu sein.<br />
11.2.15. „GVO-Futter: Fakten statt Mythen“<br />
www.animal-health-online.de/drms/rinder/genfeed.htm<br />
- Bemerkungen<br />
Am 08. Feber 2001 fand am Institut für Tierernährung der ETH Zürich unter Mitveranstaltung des „Schweizerischen<br />
Arbeitskreises für Forschung <strong>und</strong> Ernährung“ die Tagung „GVO-Futter: Fakten statt Mythen“ statt.<br />
Experten betrachteten das Thema GVO aus unterschiedlichen Gesichtspunkten.<br />
Eine Frage beschäftigte sich mit der Frage, was mit der DNA im Tier geschieht!?<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 211 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 11: Literaturrecherche<br />
Nach dem heutigen Wissensstand wird Erbmaterial zwar weitestgehend im Magen <strong>und</strong> Dünndarm verdaut, allerdings<br />
ist es möglich, dass DNA-Fragmente zumindest vorübergehend in Körperzellen (meist Immunzellen) aufgenommen<br />
<strong>und</strong> verzögert abgebaut werden.<br />
Kernaussage dieser Tagung war, dass aus einer großen Zahl von Versuchen an landwirtschaftlichen Nutztieren bis<br />
heute keine Nukleinsäuren bzw. Proteine aus transgenem Material der Futtermittel in den Produkten nachgewiesen<br />
werden. Dies betrifft Milch, Fleisch <strong>und</strong> Eier.<br />
Laut Literatur bestehen effektive Abbaumechanismen, um solche Substanzen aus dem Futter auf den verschiedenen<br />
Stufen der Verarbeitung, Verdauung <strong>und</strong> des Stoffwechsels abbauen zu können.<br />
Diese Aussage trifft nicht in gleichem Umfang für pflanzeneigene Nukleinsäuren zu. DNA-Fragmente eines<br />
Chloroplast-Gens konnten in Geweben von Säugetieren <strong>und</strong> Geflügel nachgewiesen werden. Zu diesen Geweben<br />
werden die Darmmukosa, die Leber <strong>und</strong> die Milz gezählt.<br />
11.2.16. Einspanier R., Klotz A., Kraft J., Aulrich K., Poser R., Schwägele F., Jahreis G.,<br />
Flachowsky G.: „The fate of forage plant DNA in farm animals: a collaborative case-study<br />
investigating cattle and chicken fed recombinant plant material. European Food Research<br />
Technology (2001) 212: 129-134.<br />
- Zusammenfassung<br />
Abstract: The fate of ingested recombinant plant DNA in farm animals (cattle and chicken) being fed a diet<br />
containing conventional maize or recombinant Bacillus thuringiensis toxin-maize (Bt-maize) is described. The<br />
probability of the detection by polymerase chain reaction of chloroplast-specific gene fragments of different lengths<br />
(199 bp and 532 bp) and a Bt-maize-specific fragment [truncated version of CryIA(b)] is shown. First data indicated<br />
that only short DNA fragments (~200 bp) derived from plant chloroplasts could be detected in the blood lymphocytes<br />
of cows. In all other cattle organs investigated (muscle, liver, spleen, kidney) plant DNAs were not fo<strong>und</strong>, except for<br />
faint signals in milk. Furthermore, Bt-gene fragments possibly recording the uptake of recombinant maize, were not<br />
detected in any sample from cattle. However, in all chicken tissues (muscle, liver, spleen, kidney) the short maize<br />
chloroplast gene fragment was amplified. In contrast to this, no foreign plant DNA fragments were fo<strong>und</strong> in eggs. Bt-<br />
gene specific constructs originating from recombinant Bt-maize were not detectable in any of these poultry samples<br />
either.<br />
Keywords: Recombinant plants, DNA transfer, Polymerase chain reaction, Farm animals, Bacillus thuringiensis toxin-<br />
maize<br />
- Bemerkungen<br />
In dieser Studie wurde das Vorkommen von rekombinanter Pflanzen-DNA in Tieren, an Rindern <strong>und</strong> Geflügel, denen<br />
konventioneller Mais <strong>und</strong> Bt-Mais verfüttert wurden, untersucht. DNA-Fragmente des Bt-Gens konnten in keiner<br />
Probe von tierischen Organen <strong>und</strong> Geweben nachgewiesen werden.<br />
Kurze pflanzliche DNA-Bruchstücke (200 bp) konnten in Lymphozyten der Kuh <strong>und</strong> in Spuren in der Milch gef<strong>und</strong>en<br />
werden. Beim Geflügel wurde kurze Chloroplasten-DNA im Gewebe, jedoch nicht in Eiern nachgewiesen.<br />
11.2.17. „Gentechnisch veränderte Lebensmittel – Eine Gefährdung durch horizontalen<br />
Gentransfer?“<br />
http://www.dge.de/Pages/navigation/fach_infos/dge_info/2000/fkp0900.htm<br />
- Zusammenfassung<br />
Seit der Veröffentlichung des so genannten Pustzai-Reports über die ges<strong>und</strong>heitlichen Risiken von gentechnisch<br />
veränderten Kartoffeln <strong>und</strong> mit der weltweiten Zunahme von Lebensmitteln im Handel, die Zutaten aus gentechnisch<br />
veränderten Organismen enthalten, werden Fragen nach der Sicherheit neuartiger Erzeugnisse verstärkt diskutiert.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 212 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 11: Literaturrecherche<br />
Sind diese Lebensmittel sicher? Müssen wir uns um horizontalen Gentransfer sorgen? Werden vermehrt Antibiotika-<br />
Resistenzen auftreten? Nachfolgend wird dieser Fragenkomplex an Hand ausgewählter Literatur diskutiert.<br />
Im Zusammenhang mit dem Verzehr von Lebensmitteln, die mit Hilfe der Gentechnik hergestellt wurden, wird ein<br />
möglicher Gentransfer aus diesen Lebensmitteln auf Mikroorganismen der menschlichen Darmflora <strong>und</strong> auf die<br />
Mucosa-Epithelzellen des menschlichen Darms bzw. in körpereigene Zellen diskutiert. Würde dies aus pflanzlichen<br />
transgenen Produkten erfolgen, so spricht man von einem horizontalen Gentransfer. Ein horizontaler Gentransfer<br />
bedeutet, dass eine genetische Information aus einer Spenderzelle (hier transgene pflanzliche Zelle) in die<br />
Empfängerzelle (Mikroorganismus oder humane Zelle) gelangt <strong>und</strong> hier in seiner aktiven Form in die Empfänger-DNA<br />
eingebaut wird <strong>und</strong> damit auch auf Nachkommen weitergegeben werden kann.<br />
Stichwörter: Gentechnik, horizontaler Gentransfer, Antibiotika-Resistenzgene, transgene Pflanzen<br />
11.2.18. Doerfler W., Schubbert R.: „Fremde DNA im Säugetiersystem. DNA aus der<br />
Nahrung gelangt über die Darmschleimhaut in den Organismus“. Deutsches Ärzteblatt 94,<br />
Heft 51-52, Dezember 1997 (29), S. 3465-3470<br />
- Zusammenfassung<br />
Fremde Desoxyribonukleinsäure (DNA) ist Teil unseres Ökosystems. Mit der Nahrung werden laufend erhebliche<br />
Mengen fremder DNA unterschiedlichster Herkunft aufgenommen. Experimente mit der DNA des Bakteriophagen<br />
M13, die an Mäuse verfüttert wird, zeigen, dass einige Prozent der M13-Test-DNA in Form von Fragmenten die<br />
Passage durch den Gastrointestinaltrakt überstehen. Die M13-DNA gelangt über die Epithelien der Darmwand in<br />
Zellen der Peyerschen Plaques, in periphere weiße Blutzellen <strong>und</strong> in Zellen von Milz <strong>und</strong> Leber. Wir haben gute<br />
Evidenz für die Annahme, dass M13-DNA-Fragmente kovalent in mausähnliche DNA integriert werden. Nach<br />
Applikation von M13-DNA an trächtige Mäuse findet man M13-DNA in einzelnen Zellen von Föten <strong>und</strong> Neugeborenen<br />
in den unterschiedlichsten Organsystemen, aber bisher nie in allen Zellen der neuen Mausgeneration. Wir nehmen<br />
an, dass die Fremd-DNA über die Plazenta in den fötalen Organismus gelangt. Die Folgen der Aufnahme fremder<br />
DNA sind noch nicht untersucht worden.<br />
- Bemerkungen<br />
Mit der Nahrung wird laufend fremde DNA unterschiedlichster Herkunft aufgenommen. Einige Prozent dieser DNA-<br />
Mengen überstehen den Gastrointestinaltrakt <strong>und</strong> gelangen über die Epithelien der Darmwand in die Peyerschen<br />
Plaque, weiter in die weißen Blutzellen <strong>und</strong> in die Zellen von Organen <strong>und</strong> Gewebe (Milz, Leber).<br />
Zusammenfassung:<br />
Im Rahmen der <strong>Machbarkeitsstudie</strong> wird die Frage aufgeworfen, ob ein unmittelbarer GVO-Transfer in tierische<br />
Lebensmittel (Milch, Fleisch, Eier) möglich sei.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der durchgeführten Literaturrecherche konnten DNA-Fragmente von gentechnischen Veränderungen in<br />
tierischen Lebensmitteln (Milch, Fleisch, Eier) nicht nachgewiesen werden.<br />
Der horizontale Gentransfer zwischen GVO <strong>und</strong> Bakterien bzw. die mögliche Auswirkung von exprimierten Proteinen<br />
war nicht Bestandteil der Fragestellung <strong>und</strong> wurde im Rahmen dieser Literaturrecherche nicht mit aufgenommen.<br />
∙ DNA – AUFNAHME<br />
Den Ergebnissen der Literaturrecherche zufolge werden nach dem Verfüttern von Pflanzenmaterial Pflanzengene<br />
über den Gastrointestinaltrakt der Tiere aufgenommen.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 213 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 11: Literaturrecherche<br />
Wie aufgr<strong>und</strong> der biochemischen Abbauprozesse von DNA im Körper nicht anders zu erwarten, wird der weitaus<br />
größte Teil der DNA im Magen-Darm-Trakt abgebaut.<br />
Desweiteren ergab die Literaturrecherche, dass im Magen-Darm-Trakt bzw. Blut- <strong>und</strong> Lymphsystem von<br />
Wiederkäuern freie DNA sehr effektiv eliminiert wird, jedoch keine absolute Barriere für Fremd-DNA darstellt.<br />
Es können DNA-Fragmente (insbesondere von Chloroplastengenen) die Darmwand passieren <strong>und</strong> in der Blutbahn<br />
sowie in Gewebezellen <strong>und</strong> Organen des Tieres nachweisbar sein.<br />
∙ NACHWEIS VON DNA – FRAGMENTEN AUS PFLANZENGENEN<br />
Je nach Tier <strong>und</strong> Futter wurden unterschiedliche Resultate festgestellt.<br />
In Rindern wurden kurze DNA-Fragmente von Pflanzengenen in Blutzellen (Lymphozyten) festgestellt, nicht aber in<br />
den übrigen Organen / Geweben wie Muskel, Leber oder Niere. Vereinzelt konnten pflanzliche DNA-Bruchstücke in<br />
Spuren in der Milch nachgewiesen werden.<br />
Einige Literaturstellen deuten darauf hin, dass kleine pflanzliche DNA-Fragmente aus dem Futtermittel die<br />
Darmpassage in Schweinen passieren <strong>und</strong> in tierischen Geweben sowie später noch in rohen Fleischerzeugnissen<br />
nachweisbar sein können.<br />
In den Hühnern wurden die kurzen pflanzlichen DNA-Fragmente sowohl in Geweben als auch in Organen (Muskeln,<br />
Leber, Niere) gef<strong>und</strong>en.<br />
∙ NACHWEIS TRANSGENER DNA – FRAGMENTE<br />
Wie erwähnt, konnten gentechnisch veränderte DNA-Fragmente nach Verfütterung von gentechnisch verändertem<br />
Futtermittel weder in den Geweben der Kuh noch in Milch nachgewiesen werden. Das Gewebe von Hühnern <strong>und</strong><br />
deren Eier zeigten ebenfalls keine Spuren von transgener DNA.<br />
Bruchstücke von gentechnisch veränderter DNA wurden auch von Schweinen nicht ins Gewebe aufgenommen oder<br />
lagen im Bereich unterhalb der Nachweisgrenze.<br />
∙ BEGRÜNDUNG DER UNTERSCHIEDLICHEN AUFNAHME VON DNA – FRAGMENTEN<br />
Als mögliche Erklärung dafür, dass für die pflanzlichen (kurzen) DNA-Fragmente positive Signale existieren, jedoch<br />
für die transgene DNA nicht, wird angeführt, dass es sich bei transgenen Pflanzengenen um single-copy-Gene<br />
handelt, die im Genom nur selten auftreten. Chloroplasten-DNA kommen hingegen in allen grünen Teilen der Pflanze<br />
in mehreren tausend Kopien vor.<br />
Die Literaturrecherche ergab, dass die Wahrscheinlichkeit des Nachweises von Chloroplasten-DNA aufgr<strong>und</strong> der<br />
großen Anzahl von Kopien je Pflanzenzelle 10 3 -10 4 fach höher ist als für single-copy-Gene.<br />
Auch frühere Studien (Einspanier et al., Klotz et al. etc.) beschrieben bereits, dass ein Transfer von single-copy-<br />
Genen durch die Darmwand ein seltenes Ereignis darstellt.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 214 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 11: Literaturrecherche<br />
11.3. Potentieller GVO-Transfer in der Honigproduktion <strong>und</strong> bei Bienenprodukten –<br />
R. MOOSBECKHOFER, Institut für Bienenk<strong>und</strong>e, <strong>AGES</strong><br />
11.3.1. Gesetzliche Gr<strong>und</strong>lagen für Bienen- <strong>und</strong> Bienenprodukte<br />
In Richtlinie 2001/110/EG des Rates vom 20.12. 2001 über Honig, wird in Anhang I unter Punkt 1. ausgeführt:<br />
„Honig ist der natursüße Stoff, der von Bienen der Art Apis mellifera erzeugt wird, indem die Bienen Nektar von<br />
Pflanzen oder Absonderungen lebender Pflanzenteile oder sich auf den lebenden Pflanzenteilen befindliche Sekrete<br />
von an Pflanzen saugenden Insekten aufnehmen, durch Kombination mit eigenen spezifischen Stoffen umwandeln,<br />
einlagern, dehydrieren <strong>und</strong> in den Waben des Bienenstockes speichern <strong>und</strong> reifen lassen.“ Eine im Wortlaut nahezu<br />
identische Definition für Honig gibt die Österreichische Honigverordnung (siehe Abschnitt 11.3.3).<br />
Basierend auf dieser Definition von Honig als tierischem Produkt ist die VO (EG) Nr. 1829/2003 vom 22.9.2003 über<br />
genetisch veränderte Lebensmittel <strong>und</strong> Futtermittel auf Honig nicht direkt anwendbar, da darin unter Punkt (16)<br />
festgelegt wird, „dass Produkte, die aus Tieren gewonnen worden sind, welche mit genetisch veränderten<br />
Futtermitteln gefüttert oder mit genetisch veränderten Arzneimitteln behandelt wurden, weder den<br />
Zulassungsbestimmungen noch den Kennzeichnungsbestimmungen dieser Verordnung unterliegen“.<br />
Die Europäische Kommission hat sich im „Ständigen Ausschuss Lebensmittelkette <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit, Abt. genetisch<br />
veränderte Lebensmittel <strong>und</strong> Futtermittel“ mit dem Thema Honig <strong>und</strong> seiner möglichen GM-Kennzeichnung befasst.<br />
Im zusammenfassenden Bericht <strong>zur</strong> 2. Sitzung vom 23. Juni 2004 wird bezüglich Honig ausgeführt:<br />
• Gemäß Übereinkunft der Sitzung vom 13. Juni 2002, fällt Honig nicht unter die Novel Food<br />
Regulation (EC) No 258/97 <strong>und</strong> das mögliche Vorkommen von GVO-Pollen in Honig ist als zufällig<br />
<strong>und</strong> unvermeidlich anzusehen.<br />
• Unter Bezug auf Regulation (EC) No 1829/2003 betreffend Lebens- <strong>und</strong> Futtermittel bestätigte<br />
der Ständige Ausschuss obige Ansicht, gemäß Richtlinie 2001/110/EG des Rates vom 20.12.2001<br />
über Honig, diesen als tierisches Produkt zu betrachten. Folglich fällt er nicht unter Regulation<br />
(EC) No 1829/2003 für Lebens- <strong>und</strong> Futtermittel, sofern er nicht von genetisch modifizierten<br />
Bienen produziert wird. Da die Bienen über Entfernungen von mehreren Kilometern sowohl an<br />
Wild- als auch an Kulturpflanzen sammeln, <strong>und</strong> dieser Vorgang außerhalb der Kontrollmöglichkeit<br />
des Bienenhalters liegt, sollte das Vorkommen von GVO-Pollen in Honig als zufällig <strong>und</strong><br />
unvermeidlich angesehen werden, welches nicht zu kennzeichnen ist, vorausgesetzt, der Anteil<br />
von GVO-Pollen im Honig liegt nicht über 0,9%.<br />
In Österreich wird in der Codex-Richtlinie <strong>zur</strong> Definition der „Gentechnikfreiheit“ vom 7.3.2001, Österreichisches<br />
Lebensmittelbuch III. Auflage, ausgeführt:<br />
Lebensmittel- <strong>und</strong> Verzehrprodukte im Sinne dieser Richtlinie werden ohne Verwendung von GVO (genetisch<br />
veränderte/r Organismus/men) <strong>und</strong> GVO-Derivaten hergestellt.<br />
Im Abschnitt „Kontrolle“ wird unter Punkt 10 ausgeführt: „Sofern über die Kontrolle die Einhaltung der vorgegebenen<br />
Kriterien nachgewiesen werden kann, bleiben aus technischen Gründen unvermeidbare Verunreinigungen mit GVO<br />
oder daraus hergestellten bzw. gewonnenen Produkten außer Betracht.“<br />
Laut Übereinkunft der Codex-Unterkommission Honig wird dabei der Pollen als originärer Bestandteil des Honigs<br />
angesehen, somit ist der Anteil allfälliger GVO-Pollen auf die Gesamtmenge des Honigs zu beziehen (pers. Mitteilung<br />
Dr. Wiedner, 2005).<br />
Die zu den „Nahrungsergänzungsmitteln“ zählenden Bienenprodukte Blütenpollen, Propolis <strong>und</strong> Gelee royale sind<br />
unter dem alten Begriff „Verzehrprodukte“ im Regelungsbereich der Codex-Richtlinie <strong>zur</strong> Definition der<br />
„Gentechnikfreiheit“ vom 7.3.2001 enthalten. Für sie gelten demnach die gleichen Regelungen wie für Honig, damit<br />
sie mit Bezeichnungen im Sinne dieser Richtlinie in Verkehr gesetzt werden können.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 215 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 11: Literaturrecherche<br />
Ob die in der EU vom „Ständigen Ausschuss Lebensmittelkette <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit, Abt. genetisch veränderte<br />
Lebensmittel <strong>und</strong> Futtermittel“ für den Honig getroffenen Auslegungen analog auch für Blütenpollen, Propolis <strong>und</strong><br />
Gelee royale Gültigkeit haben, ist in den verfügbaren Unterlagen nicht dezidiert dargelegt.<br />
Im Falle eines Anbaues von GVO in Österreich könnten auch diese Produkte in die Diskussion eingebracht <strong>und</strong> klare<br />
Antworten gefordert werden. Für einige der in Frage kommenden Bienenprodukte, steht die tierische Herkunft außer<br />
Diskussion (z.B. für Gelee royale, das in Österreich gemäß LMG zu den „Nahrungsergänzungsmitteln“ gezählt wird,<br />
oder Bienenwachs), während andere (z.B. Propolis, Blütenpollen) sich von pflanzlichen Rohstoffen herleiten, die wie<br />
der Honig von den Bienen mit Drüsensekreten vermengt <strong>und</strong> bearbeitet werden <strong>und</strong> im Bienenstock weitere<br />
Reifungs- <strong>und</strong> Veränderungsprozesse durchlaufen.<br />
Da Propolis <strong>und</strong> Gelee royale in der Regel in weiter verarbeiteter Form in den Verkehr gebracht werden, wird im<br />
Rahmen dieser Studie nicht näher auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen eingegangen. Dies gilt auch für andere<br />
Bienenprodukte auf verschiedenen Verarbeitungsstufen (z.B. Honig mit Zusatz von Blütenpollen,<br />
Propoliszubereitungen, Gelee royale-Zubereitungen, Honig mit Entdeckelungswachs, Met, Honigessig, Honigbier,<br />
Honigbrand, Bärenfang).<br />
Manche dieser Zubereitungen würden einem aus mehr als einer Komponente zusammengesetzten Nahrungsmittel<br />
entsprechen. Gemäß dem zusammenfassenden Bericht der 2. Sitzung vom 23. Juni 2004 des „Ständigen Ausschuss<br />
Lebensmittelkette <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit, Abt. genetisch veränderte Lebensmittel <strong>und</strong> Futtermittel“, wäre es in diesem<br />
Fall erforderlich zu klären, woher eine derartige zufällige bzw. technisch nicht vermeidbare Verunreinigung stammt,<br />
<strong>und</strong> auf Basis der Einzelkomponenten die Schwellenwerte zu berechnen. Wird der Schwellenwert bei einer dieser<br />
Komponenten überschritten, dann sollte auf dem Etikett das Vorhandensein dieser GVO-Komponente gekennzeichnet<br />
werden.<br />
11.3.2. Nahrungsquellen <strong>und</strong> –bedürfnisse der Honigbiene<br />
Die Honigbienen sammeln Nektar- bzw. Honigtau <strong>und</strong> Pollen <strong>zur</strong> Deckung ihres Bedarfes an Kohlenhydraten, Eiweiß,<br />
Fett <strong>und</strong> Vitaminen - sowie teilweise auch <strong>zur</strong> Deckung des Mineralstoffbedarfes.<br />
Als „Nektar“ werden die zuckerhaltigen Absonderungen spezieller Pflanzenorgane (Nektardrüsen) bezeichnet, die<br />
häufig in Blüten zu finden sind (= florale Nektarien), aber auch außerhalb von Blüten an anderen Pflanzenteilen (=<br />
extraflorale Nektarien) vorkommen können.<br />
Als „Honigtau“ werden die süßen Ausscheidungen pflanzensaugender Insekten bezeichnet. Dieser kann von den<br />
Bienen noch am Ort der Entstehung in Tröpfchenform bzw. durch Auflecken des klebrigen Honigtauüberzuges von<br />
Blättern <strong>und</strong> Rinden eingesammelt werden.<br />
Ein Teil der eingetragenen Nahrungsstoffe wird für die Aufrechterhaltung des Stockbetriebes sofort verbraucht<br />
(Sammelaktivität, Temperaturregulation, Enzymproduktion, Wachserzeugung, Bereitung von Larvenfutter, u.a.).<br />
Überschüsse werden durch Wasserentzug, Enzymzusatz <strong>und</strong> Weiterverarbeitung konserviert <strong>und</strong> in den Zellen der<br />
Waben für den späteren Verbrauch in Mangelzeiten (Ende der Blühperiode bzw. Honigtauproduktion,<br />
Überwinterungszeit) als „Honig“ bzw. „Bienenbrot“ (= in den Zellen eingestampfter <strong>und</strong> konservierter Pollen)<br />
eingelagert.<br />
Pollen <strong>und</strong> Nektar, aber auch Zucker, Fertigfutterzubereitungen (Sirupe aus der Lebensmittelindustrie bzw. speziell<br />
für Bienen hergestellte flüssige <strong>und</strong> feste Futterstoffe <strong>und</strong> Eiweißersatzmittel) können – analog zu anderen tierischen<br />
Produktionszweigen - als „Futtermittel“ eingestuft werden.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 216 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 11: Literaturrecherche<br />
Tabelle 11-2: Gesetzliche Rahmenbedingungen betreffend Bienenprodukte <strong>und</strong> GVO hinsichtlich<br />
<strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong><br />
Bienenprodukt VO (EG) 1829/2003 Codex-Richtlinie <strong>zur</strong> Definition der<br />
„Gentechnik-freiheit“ vom<br />
7.3.2001, Österreichisches<br />
Lebensmittelbuch III. Auflage<br />
Honig Als „tierisches Produkt“ (gem. Directive<br />
2001/110/EEC) fällt Honig nicht in den<br />
Regelungsbereich der VO (EG) 1829/2003, sofern<br />
er von Nicht-GVO-Bienen produziert wurde [Gem.<br />
„GM labelling of honey“ in Sum. Rec. 2nd Meeting<br />
– 23 June 2004, Standing Committee on the Food<br />
Blütenpollen*<br />
Propolis*<br />
Gelee royale*<br />
Chain an Animal Health, Sect. on geneticalliy<br />
modified food and Feed].<br />
a) Bzgl. des Gehalts an GVO-Pollen: keine<br />
Kennzeichnungspflicht, da zufällige <strong>und</strong><br />
technisch unvermeidbare Verunreinigung,<br />
solange der Anteil von GVO-Pollen im Honig<br />
nicht über 0,9% ist. [Gem. „GM labelling of<br />
honey“ in Sum. Rec. 2nd Meeting – 23 June<br />
2004, Standing Committee on the Food Chain<br />
an Animal Health, Sect. on geneticalliy<br />
modified food and Feed).<br />
**In EU nicht zugelassene GVO dürfen<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich nicht nachweisbar sein [VO (EG)<br />
1829/2003, Art. 4 (2)], ausgenommen bei<br />
positiver Sicherheitsbewertung, dann nicht<br />
höher als 0,5% [VO (EG) 1829/2003, Art. 47].<br />
b) Bzgl. Verwendung GVO-haltiger Futtermittel in<br />
Bienenzucht: durch Einstufung des Honigs als<br />
„tierisches Produkt“ (siehe oben) unterliegt er<br />
[gem. Punkt (16) VO (EG) 1829/2003] weder<br />
den Zulassungs- noch den Kennzeichnungsbestimmungen<br />
dieser Verordnung.<br />
Vom „Ständigen Ausschuss Lebensmittelkette <strong>und</strong><br />
Tierges<strong>und</strong>heit, Abt. genetisch veränderte Lebensmittel<br />
<strong>und</strong> Futtermittel“, sind dazu keine speziellen<br />
Regelungen verfügbar.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Lebensmittel- <strong>und</strong> Verzehrprodukte* im<br />
Sinne dieser Richtlinie werden ohne<br />
Verwendung von GVO <strong>und</strong> GVO-<br />
Derivaten hergestellt.<br />
[Gemäß Nahrungsergänzungsmittelverordnung<br />
2004 gelten die<br />
früheren Verzehrprodukte Propolis, Gelee<br />
royale <strong>und</strong> Blütenpollen) nunmehr als<br />
Nahrungsergän-zungmittel].<br />
Pollen gilt als originärer Honigbestandteil,<br />
folglich wäre ein allfälliger GVO-Anteil auf<br />
die Gesamtmenge des Honigs zu<br />
beziehen (Konsens der Codex-<br />
Unterkommission „Honig“; pers.<br />
Mitteilung Dr. Wiedner, 2005).<br />
* Diese Bienenprodukte fallen seit 18.2.2004 in den Regelungsbereich der Nahrungsergänzungsmittelverordnung<br />
(NEMV). Vorher wurden sie gem. LMG 1975 als „Verzehrprodukte“ geführt.<br />
** Gemäß schriftlicher Mitteilung von Dr. Jank, BMGF (Mail vom 8.3.2005) sprechen die Ausführungen der<br />
Europäischen Kommission im Ständigen Ausschuss Lebensmittelkette <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit, Abt. genetisch veränderte<br />
Lebensmittel <strong>und</strong> Futtermittel am 23. Juni 2004 zu Honig dafür, (siehe<br />
http://europa.eu.int/comm/food/committees/regulatory/modif_genet/summary230604_en.pdf unter TOP1, GM-<br />
Labelling of honey) [Zitat]: „sich bei der Kennzeichnung gemäß EU-Verordnung 1829/2003 über genetisch veränderte<br />
Lebensmittel <strong>und</strong> Futtermittel am Schwellenwert für zufälliges oder technisch nicht vermeidbares Vorhandensein von<br />
genetisch verändertem Material von 0.9% bezogen auf den Honig zu orientieren. In der EU nicht zugelassenes<br />
Material darf gr<strong>und</strong>sätzlich nicht vorhanden sein, ausgenommen bei bereits erfolgter positiver Sicherheitsbewertung,<br />
dann nicht höher als 0.5%).“<br />
11.3.3. Bienenprodukte<br />
• Honig<br />
Definition gemäß österreichischer „Honigverordnung“ (2004), § 2:<br />
„Im Sinne dieser Verordnung ist „Honig“ der natursüße Stoff, der von Bienen der Art Apis mellifera erzeugt wird,<br />
indem die Bienen Nektar von Pflanzen, Absonderungen lebender Pflanzenteile oder auf den lebenden Pflanzenteilen<br />
Seite 217 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 11: Literaturrecherche<br />
befindliche Sekrete von an Pflanzen saugenden Insekten aufnehmen, diese mit arteigenen Stoffen versetzen,<br />
umwandeln, einlagern, dehydratisieren <strong>und</strong> in den Waben des Bienenstockes speichern <strong>und</strong> reifen lassen.“<br />
Honig ist aus Sicht der Verbraucher – insbesondere für Käufer von österreichischem Honig – ein sehr sensibles<br />
Produkt, da ihm das Attribut „naturrein“ zugesprochen wird <strong>und</strong> er bei vielen Konsumenten den Status eines<br />
„Naturheilmittels“ einnimmt.<br />
Naturbelassener, nicht gefilterter Honig enthält große Mengen von Blütenpollen, die eine Bestimmung seiner<br />
geografischen <strong>und</strong> botanischen Herkunft mittels Pollenanalyse erlauben. Daneben finden sich darin noch in kleinerem<br />
Umfang andere geformte Bestandteile (z.B. Zuckerkristalle, Hefen, Pilzsporen, u.a.).<br />
Je nach pflanzlicher Herkunft des zugr<strong>und</strong>e liegenden Rohstoffes <strong>und</strong> Methode der Honiggewinnung (Schleudern,<br />
Pressen bzw. Verkauf als Wabenhonig), ist der Pollengehalt des Honigs beträchtlichen Schwankungen unterworfen.<br />
In der Literatur werden für verschiedene Honige Werte von weniger als 20.000 bis über 100.000 Pollenkörner pro 10<br />
g Honig angegeben. Der Großteil der Honige hat einen Gehalt zwischen 20.000 <strong>und</strong> 100.000 Pollenkörnern pro 10 g<br />
Honig (HORN, LÜLLMANN, 1992; WILLIAMS, 2002).<br />
In den Honig kommt der Pollen über die so genannte „primäre“ Einstäubung (= Blütenstaub, der unmittelbar mit<br />
dem Nektar in den Honig gelangt). Daneben beeinflussen noch die „sek<strong>und</strong>äre“ Einstäubung (= Pollen, der im Zuge<br />
der Honigbereitung durch die Bienen zwischen dem Eintragen des Nektars <strong>und</strong> dem Verdeckeln der Honigzellen in<br />
den Honig gelangt) <strong>und</strong> die „tertiäre“ Einstäubung (= Pollen, der durch imkerliche Betriebs- <strong>und</strong> Erntemaßnahmen in<br />
den Honig gelangt), den Pollengehalt des Honigs. Werden beispielsweise Waben mit Pollenvorräten geschleudert,<br />
können bis zu 500.000 Pollenkörner pro 10 g Honig enthalten sein (WILLIAMS, 2002).<br />
Honigtauhonig kann ebenfalls beträchtliche Pollenmengen – insbesondere von windblütigen Pflanzen (HORN,<br />
LÜLLMANN, 1992) – enthalten, da sich deren Pollenkörner auf den Honigtautropfen bzw. dem Honigtaubelag ablagern,<br />
<strong>und</strong> beim Sammeln mit eingetragen werden. In WILLIAMS (2002) werden für Honigtauhonig zwischen 10.000 <strong>und</strong><br />
20.000 Pollenkörner pro 10 g Honig angegeben.<br />
Da Honigtau auf vielen Pflanzen in großen Mengen auftreten kann – auch von Getreide oder Mais wurde bereits über<br />
Honigernten berichtet (FOSSEL, 2000; pers. Mitteilung eines italienischen Imkers im Raum Tolmezzo im Rahmen einer<br />
Exkursion der „EURBEE“-Tagung 2004 in Udine), wirken diese Honigtaubeläge wie riesige Pollenfallen, die dann –<br />
speziell in Maisanbaugebieten - eine mögliche Quelle von GVO-Verunreinigungen sein können.<br />
WILLIAMS (2002) gibt die Gesamtmenge an Pollen in normal geerntetem Honig (= Schleuderhonig aus Waben ohne<br />
Pollenvorräte) mit weniger als 0,1 % - bezogen auf die Gesamtmenge Honig - an.<br />
• Pollen<br />
Pollen sind die männlichen Keimzellen der Blütenpflanzen. Dementsprechend sind sie auch mit dem haploiden<br />
Chromosomensatz der Mutterpflanze ausgestattet. Im Fall von GV-Pflanzen werden über den Blütenpollen die<br />
transgenen DNA-Sequenzen in den Honig transportiert, wo sie für lange Zeit konserviert bleiben. Da Pollen Eiweiß<br />
enthält (13 – 36 %), können durch transgene DNA-Sequenzen codierte Eiweißverbindungen – sofern sie im Pollen<br />
oder den anhaftenden Tapetumzellen exprimiert werden - in den Honig gelangen.<br />
Neben Honig zählt er zu den wichtigsten <strong>und</strong> interessantesten Produkten der Bienenwirtschaft (DANY, 1983; 1989).<br />
Da Pollen jedes Jahr geerntet werden kann – was bei Honig nicht immer der Fall ist – stellt er für darauf spezialisierte<br />
Betriebe eine wichtige Einnahmequelle mit einer deutlich höheren Wertschöpfung als Honig dar.<br />
Je nach Produktionsart wird zwischen „Höschenpollen“ <strong>und</strong> „Bienenbrot“ (= in den Waben eingelagerter Pollen, der<br />
bereits verschiedene Umwandlungsprozesse durchlaufen hat, die ihn haltbar machen) unterschieden.<br />
In den Handel kommt Pollen meist in getrockneter Form, seltener als tiefgekühlter Frischpollen, sowie in<br />
verschiedenen Verarbeitungsstufen (z.B. Honig mit Blütenpollen) <strong>und</strong> Veredelungsprodukten (z.B. Dragees,<br />
Bienenbrotextrakte, etc.).<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 218 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 11: Literaturrecherche<br />
Bis <strong>zur</strong> Novelle des LMG 1975 im Jahr 2003 wurden die Bienenprodukte Pollen, Propolis <strong>und</strong> Gelee royale zu den<br />
„Verzehrprodukten eingeordnet. Vor dem Inverkehrbringen sind sie mittels eigenem Meldeformular beim BMGF<br />
anzumelden (gemäß § 18 LMG 1975 im Sinne der Novelle zum LMG 1975, BGBl. I Nr. 69/2003).<br />
Seit der Novelle werden sie den „Nahrungsergänzungsmitteln“ zugeordnet, ohne explizit aufgezählt zu sein, <strong>und</strong><br />
unterliegen damit der Nahrungsergänzungsmittelverordnung vom 18.2.2004.<br />
• Propolis<br />
Propolis oder Kittharz ist der klebrige Überzug, mit dem das Bienenvolk alle Teile der Bienenwohnung inklusive des<br />
Wabenbaues überzieht. Von den Bienen nicht passierbare Hohlräume <strong>und</strong> Spalten in der Bienenwohnung werden<br />
damit abgedichtet <strong>und</strong> Eindringlinge in den Stock (z.B. Spitzmäuse, Käfer, Totenkopfschwärmer, u.a.) nach ihrem<br />
Tod einbalsamiert.<br />
Als Rohmaterial für das Kittharz werden von den Bienen harzige Überzüge von Pflanzenknospen <strong>und</strong> Baumharze<br />
gesammelt. Der Heimtransport in den Stock erfolgt in den gleichen Sammelvorrichtungen (Pollenkörbchen der<br />
Hinterbeine) wie der Pollentransport.<br />
Gesetzlich ist Propolis als Nahrungsergänzungsmittel eingestuft.<br />
Für zahlreiche Imker stellt die Vermarktung von Propolisprodukten eine wichtige zusätzliche Einkommensquelle aus<br />
der Bienenzucht dar.<br />
Wegen seiner erwiesenen Hemmwirkung gegen verschiedene Bakterien, Viren <strong>und</strong> Pilze, sowie seine die<br />
W<strong>und</strong>heilung fördernden Eigenschaften, wird es in verschiedenen Verarbeitungsstufen <strong>und</strong> Zubereitungen<br />
(Tinkturen, Salben, Cremen, Propolis in Honig) eingesetzt.<br />
Da Propolis - neben Harz, Balsam, Wachs <strong>und</strong> ätherischen Ölen - auch bis zu 5 % Blütenpollen enthält (HILL, 1986;<br />
HEROLD, 1982) ist es als sensibles Produkt für allfällige GVO-Verunreinigungen zu bewerten. Während sich bei<br />
bestimmten Zubereitungsformen (z.B. wässrige oder alkoholische Auszüge) die Pollenkörner durch Filterung großteils<br />
entfernen lassen würden, ist dies bei anderen nicht möglich (z.B. bei gemahlenem Propolis in Honig, Salben oder<br />
Cremen).<br />
• Gelee royale<br />
Gelee royale ist der in den Futtersaftdrüsen der Ammen gebildete <strong>und</strong> an die königlichen Larven verfütterte,<br />
eiweißreiche Futtersaft.<br />
Obwohl Königinnenlarven – im Gegensatz zu Arbeiterinnenlarven – auch in späteren Larvenstadien nur Gelee royale<br />
erhalten – <strong>und</strong> nicht wie die Arbeiterinnenlarven ab dem 3. Tag auch zusätzlich Pollen – kann eine geringfügige<br />
Verunreinigung des Weiselfuttersaftes durch auf den Ammenbienen anhaftende Pollen nicht völlig ausgeschlossen<br />
werden.<br />
In der Beschreibung zu den Inhaltsstoffen von Gelee royale wird neben anderen Bestandteilen auch Pollen angeführt<br />
(BOGDANOV, 1999).<br />
• Bienenwachs<br />
Bienenwachs ist ein von den Wachsdrüsen der Bienen sezerniertes Produkt. Da Pollen in den Wabenzellen<br />
eingelagert wird – <strong>und</strong> solche Pollenzellen bei der Wachsverarbeitung (z.B. beim Einschmelzen von Baurahmen,<br />
Altwaben, Entdeckelungswachs) nicht gesondert entfernt werden, kann Bienenwachs je nach Reinigungsgrad immer<br />
auch gewisse Pollenbeimengungen enthalten. Für Verzehrzwecke wird Bienenwachs meist in Kombination mit Honig<br />
als Waben- oder Scheibenhonig bzw. als Entdeckelungswachs zum Kauen vermarktet. Als Trennmittel für Backwaren<br />
wird es auch als „Backwachs“ verkauft.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 219 von 272
11.3.4. Bienenflugweiten<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 11: Literaturrecherche<br />
Die Flugweite von Honigbienen kann sehr variabel sein. Sie richtet sich nach Trachtangebot (= Quellen für Pollen,<br />
Nektar, Honigtau), Attraktivität <strong>und</strong> Ergiebigkeit der Trachtquelle (vorhandene Pflanzenbestände, Zuckergehalt von<br />
Nektar bzw. Honigtau sowie der Pollenwertigkeit), Witterung <strong>und</strong> lokalen Verhältnissen (Trachtpflanzenkonkurrenz,<br />
Landschaftsstruktur um den Bienenstand) sowie dem aktuellen Nahrungsbedarf (Pollen bzw. Nektar).<br />
Wie bei VON FRISCH (1965) dargestellt, konnte in Dressurversuchen die mit steigender Entfernung abnehmende<br />
Attraktivität einer Trachtquelle durch entsprechende Erhöhung der Zuckerkonzentration egalisiert werden.<br />
Beispielsweise löste eine in 6 km Entfernung angebotene 2 molare Rohrzuckerlösung die gleiche Prozentzahl an<br />
Tänzen aus wie eine 1 molare in 3 km <strong>und</strong> eine 0,5 molare in 100 m Entfernung vom Stock.<br />
Für die Praxis bedeutet dieses Beispiel, dass auch mehrere Kilometer entfernte Trachtquellen für die Bienen noch<br />
attraktiv sind, wenn die Zuckerkonzentration in Nektar bzw. Honigtau eine entsprechende Höhe erreicht. [Nach Von<br />
Frisch, S. 20 erhält man ein 2 molare Rohrzuckerlösung durch Lösung von 68,4 g Rohrzucker in 100 ml Wasser; eine<br />
1 molare Lösung würde damit einer Nektarkonzentration von 34,2 % entsprechen, ein Wert, der in der Praxis<br />
durchaus gemessen wird.]<br />
In der Literatur werden als Radius der Sammeltätigkeit Werte zwischen einigen h<strong>und</strong>ert Metern (im Frühjahr bei<br />
Schlechtwetter) <strong>und</strong> mehr als 6 km (VON FRISCH, 1965) angegeben.<br />
Für Rapsflächen in Großbritannien finden sich Flugweitenangaben in WILLIAMS (2002). Demnach lag die mittlere<br />
Flugdistanz markierter Bienen zwischen Bienenstock <strong>und</strong> Sammelort bei 127 m, die maximale bei 955 m, wenn<br />
verschiedene Rapsflächen <strong>zur</strong> Auswahl standen.<br />
DROEGE (1993) gibt als Flugradius, in dem sich die Sammelbienen eines Volkes im Allgemeinen bewegen, mit 2 km<br />
an.<br />
In WILLE u. WILLE (1984) wird eine Untersuchung von VISSHER and SEELEY (1982) aus den USA zitiert, in der gezeigt<br />
werden konnte, dass der Medianwert der Sammeldistanz vom Stock 1,7 km betrug. 95 % der Sammelbienen blieben<br />
innerhalb eines Radius von 6 km.<br />
Neuere Untersuchungen in der BRD bestätigten, dass Sammlerinnen der „Italienerbiene“ (Apis mellifera ligustica)<br />
noch in einer Entfernung von 6,5 km Entfernung vom Stock vereinzelt auf den beobachteten Probeflächen<br />
nachweisbar waren (WALTHER-HELLWIG et al.; 2002).<br />
An einem einzigen Tag kann ein Bienenvolk verschieden weit entfernte <strong>und</strong> in verschiedenen Richtungen liegende<br />
Trachtquellen (Entfernung Nektarquelle 1: 2-4 km; Nektarquelle 2: 500 m; Pollenquelle: 500 m) nutzen (in SEELEY,<br />
1997). Die Bienen konzentrierten sich dabei auf die ergiebigsten Quellen für Pollen <strong>und</strong> Nektar – auch wenn diese<br />
weit entfernt lagen -, <strong>und</strong> vernachlässigten die wenig ergiebigen.<br />
MORSE and HOOPER (1985) geben an, dass Bienen üblicherweise bis zu 6,4 km fliegen, der Großteil davon sammelt<br />
aber in geringerer Entfernung, sofern sich dort attraktive Trachtpflanzen finden.<br />
Diese Angaben stützen sich einerseits auf Versuche mit an den Trachtquellen markierten oder auf Futterplätze in<br />
bestimmten Entfernungen dressierten Bienen, andererseits aber auch auf Praxisbeobachtungen mit Völkern, die in<br />
unterschiedlichen Entfernungen zu bekannten Trachtquellen aufgestellt wurden, um den Zusammenhang zwischen<br />
erzielter Honigernte <strong>und</strong> Entfernung der Trachtquelle zu klären. Als Ergebnis daraus werden als Grenze für eine gute<br />
Trachtnutzung 700 m bis 1000 m angegeben, als Grenze für eine mäßige Trachtnutzung 1500 – 2000 m (HÜSING,<br />
NITSCHMANN; 1995).<br />
Eine weitere Abschätzung der Bienenflugweite lässt sich aus schweren Bienenvergiftungen nach<br />
Pflanzenschutmittelanwendung im badischen Weinbaugebiet ableiten (BUCHNER, 1970; VORWOHL, 1981). Wie die<br />
Untersuchung der Pollenhöschen vergifteter Bienen zeigte, flogen diese – bei voller Tannentracht mit<br />
Tageszunahmen von 3 kg/Volk - 3,5 km weit aus Waldgebieten über einen Höhenrücken hinweg in die blühenden<br />
Weinrieden, um ihren Pollenbedarf zu decken.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 220 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 11: Literaturrecherche<br />
Wird aus dem Flugradius eines Bienenvolkes die Fläche des Sammelgebietes errechnet, beträgt dieses bei 500 m<br />
Flugradius 79 ha, bei 1000 m Flugradius 314 ha <strong>und</strong> bei 2 km Flugradius 1256 ha. Damit wird klar, dass das<br />
Sammelgebiet weit über die Anbaufläche eines Durchschnittsbetriebes hinausreicht (siehe Tabelle 11-3).<br />
Tabelle 11-3: Bienen-Sammelgebiet bei unterschiedlichem Flugradius<br />
Flugradius Sammelgebiet<br />
(m)<br />
(m 2 Sammelgebiet<br />
)<br />
(ha)<br />
50 7850 0,8<br />
100 31400 3<br />
500 785000 79<br />
1000 3140000 314<br />
2000 12560000 1256<br />
3000 28260000 2826<br />
5000 78500000 7850<br />
11.3.5. Trachtquellen<br />
• Raps<br />
Raps ist wegen seines Nektar- <strong>und</strong> Pollenreichtums eine der attraktivsten Trachtpflanzen für die Bienen, die noch aus<br />
großer Entfernung angeflogen wird. Er gehört zu den ertragreichsten Honigquellen in der Imkerei <strong>und</strong> wird sowohl<br />
von Stand- als auch von Wanderimkern mit den Bienen intensiv genutzt. Der Anteil des Rapspollens am Jahres-<br />
Gesamteintrag wurde sowohl für Großbritannien als auch die Schweiz mit 5-6% ermittelt (in HÜSING, NITSCHMANN;<br />
1995).<br />
Der im Frühjahr eingetragene Rapspollen findet sich in vielen später produzierten <strong>und</strong> geernteten Blüten- <strong>und</strong><br />
Waldhonigen (HORN, LÜLLMANN, 1992) wieder.<br />
Rapshonig wird zum Teil von Bioimkern im Spätsommer wieder an die Bienen als „Futterhonig“ verabreicht (WURM,<br />
pers. Mittlg., 2002), um den geforderten Honiganteil im Wintervorrat - gemäß EU-VO 2092/91 über den ökologischen<br />
Landbau - zu erreichen.<br />
Nach eigenen Ergebnissen des Instituts für Bienenk<strong>und</strong>e (unveröffentlicht), die im Rahmen eines derzeit noch<br />
laufenden Projektes <strong>zur</strong> Charakterisierung österreichischer Sortenhonige <strong>und</strong> regionaler Honigsorten erarbeitet<br />
wurden, war Rapspollen in 75%, Sonnenblumenpollen in 26% <strong>und</strong> Maispollen in 24% der insgesamt 97 untersuchten<br />
Honigproben zu finden (Details siehe nachfolgende Tabelle 11-4).<br />
Wie aus unveröffentlichten Daten von Honiguntersuchungen an insgesamt 25 Proben des Kärntner Landesverbandes<br />
für Bienenzucht hervorgeht (schriftliche Mitteilung, Fr. Mag. Angelika Siedler, 2005), waren Pollen der Cruciferae-<br />
Gruppe in jedem untersuchten Honig zu finden (siehe Tabelle 11-5). Dieser Bef<strong>und</strong> ist insofern interessant, da im<br />
Falle des Anbaues von GV-Raps eine Auskreuzung in andere Arten der Cruciferae -Gruppe nicht ausgeschlossen<br />
werden kann. Mais- <strong>und</strong> Sonnenblumenpollen waren in 56 % bzw. 68 % der untersuchten Honigproben zu finden.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 221 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 11: Literaturrecherche<br />
Tabelle 11-4: Vorkommen von Mais-, Sonnenblumen- <strong>und</strong> Rapspollen in Honig (persönliche Mitteilung<br />
H. HEIGL, <strong>AGES</strong>- Institut für Bienenk<strong>und</strong>e)<br />
Honigsorte<br />
(Sortenbezeichnung laut Imkerangabe)<br />
Summe Proben<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Anzahl Proben mit Pollen von<br />
Mais* Sonnenblume Raps*<br />
Robinie 14 2 5 14<br />
Alpenrose 3 0 0 0<br />
Blüte 9 2 3 8<br />
Blüte mit Wald 10 2 2 9<br />
Honig 12 1 0 4<br />
Edelkastanie 3 2 2 2<br />
Linde 2 1 0 2<br />
Löwenzahn 2 0 0 1<br />
Raps 6 0 3 6<br />
Sonnenblume 5 4 4 5<br />
Wald 31 9 6 22<br />
Gesamtprobenzahl 97 23 25 73<br />
Anteil (%) an Gesamtprobenzahl 24 26 75<br />
* Arten mit aktuell potentieller Anwendung von GV-Sorten.<br />
Tabelle 11-5: Vorkommen von Mais, Sonnenblumen- <strong>und</strong> Cruciferae-Pollen in Kärntner Honigen des<br />
Jahres 2004 (Mag. Angelika SIEDLER, unveröffentlichte, schriftl. Mitteilung 2005, Kärntner Imkerschule)<br />
Honigsorte<br />
(Sortenbezeichnung laut Imkerangabe)<br />
Summe Proben<br />
Anzahl Proben mit Pollen von<br />
Mais* Sonnenblume Cruciferae*<br />
Waldhonig 20 10 16 20<br />
Waldblütenhonig 5 4 1 5<br />
Gesamtprobenzahl 25 14 17 25<br />
Anteil (%) an Gesamtprobenzahl 56 68 100<br />
* Arten mit aktuell potentieller Anwendung von GV-Sorten.<br />
• Mais<br />
Mais wird von Bienen regelmäßig besucht (FOSSEL, 2000; PECHHACKER 2003). Der reichlich vorhandene Pollen wird oft<br />
in Massen eingetragen (WILLE; KLIEN: beide pers. Mitteilung). Das Maximum des Polleneintrags erfolgt in den<br />
Morgenst<strong>und</strong>en.<br />
Aufgr<strong>und</strong> seines hohen Eiweißgehaltes von 17 % gehört Maispollen zu den für Bienen besonders wertvollen<br />
Pollensorten. Im Fütterungsversuch mit Bienen wurde eine hohe biologische Wirksamkeit festgestellt (MAURIZIO,<br />
SCHAPER, 1994).<br />
Seite 222 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 11: Literaturrecherche<br />
In allen Gebieten mit Maisanbau zählt er zu den ergiebigsten Spätpollenspendern mit dem Haupteintrag im Juli <strong>und</strong><br />
August (MAURIZIO, SCHAPER, 1994; HÜSING, NITSCHMANN; 1995; GEFFCKEN, 1980).<br />
Laut Untersuchungen des Schweizer Bienenforschungszentrums in Liebefeld kann an verschiedenen Standorten <strong>und</strong><br />
in unterschiedlichen Jahren der Anteil des Maispollens zwischen 0,8 % <strong>und</strong> 15 % am Pollen-Jahresgesamteintrag<br />
erreichen (WILLE <strong>und</strong> WILLE, 1984).<br />
Mit einer Größe von 116x107x107 µm (LxBxH) <strong>und</strong> einem Gewicht von 247x10-9 g (HORN, LÜLLMANN, 1992) gehören<br />
seine Pollenkörner zu den größten <strong>und</strong> schwersten Pollen der bei uns vorkommenden Pflanzenarten.<br />
In manchen Jahren liefern an den Maispflanzen sitzende Blattläuse zusätzlich große Mengen von Honigtau, der von<br />
den Bienen ebenfalls gesammelt <strong>und</strong> zu Blatthonig verarbeitet wird (GEFFCKEN, 1980; FOSSEL, 2000; pers. Mitteilung<br />
2004 eines italienischen Imkers im Raum Tolmezzo im Rahmen einer Exkursion der „EURBEE“-Tagung in Udine).<br />
Laut eigenen Untersuchungen des Instituts für Bienenk<strong>und</strong>e war Maispollen in 24% der insgesamt 97 untersuchten<br />
Honigproben zu finden. Nach Daten VON SIEDLER (Imkerschule Kärnten, unveröffentlichte, pers. Mitteilung, 2005), war<br />
in 14 (= 56%) von 25 untersuchten Kärntner Honigen Maispollen nachweisbar.<br />
• Sonnenblume<br />
Die Sonnenblume ist eine gute Pollen- <strong>und</strong> Nektarquelle (wenn Fläche, Sorte, Witterung <strong>und</strong> Wasserversorgung<br />
passen), die von den Bienen gerne genutzt <strong>und</strong> noch aus großer Entfernung angeflogen wird. Sonnenblumenpollen<br />
ist für die Bienen den ganzen Tag verfügbar, das Angebotsmaximum liegt zwischen 9 <strong>und</strong> 10 Uhr vormittags (HÜSING,<br />
NITSCHMANN; 1995).<br />
Laut eigenen Untersuchungen des Instituts für Bienenk<strong>und</strong>e war Sonnenblumenpollen in 25 (= 26%) der insgesamt<br />
97 untersuchten Honigproben zu finden.<br />
Nach Daten VON SIEDLER (Imkerschule Kärnten, unveröffentlichte, pers. Mitteilung, 2005), war in 17 (= 68%) von 25<br />
untersuchten Kärntner Honigen Sonnenblumenpollen nachweisbar.<br />
• Sojabohne<br />
Nach Literaturangaben (MAURIZIO u. SCHAPER, 1994; JAYCOX, 1970 a,b) wird die Sojabohne von Bienen beflogen, die<br />
daraus reichlich Pollen <strong>und</strong> in variabler Menge Nektar gewinnen.<br />
In Abhängigkeit von verschiedenen Einflüssen (Standort, Sorte, u.a.) wird aus Teilen der USA über Honigernten aus<br />
Sojabohne berichtet, die bis zu 50 kg pro Volk erreichten (in JAYCOX, 1970a). Sojabohnen besitzen keine extrafloralen<br />
Nektarien. Die Zuckerkonzentration im Nektar ist mit 35 – 53 % hoch (JAYCOX, 1970b).<br />
Für Deutschland erwarteten Maurizio u. Schaper (1994) in den neunziger Jahren des vorigen Jahrh<strong>und</strong>erts noch<br />
kaum Sojabohnen-Sortenhonig. Laut Horn (pers. Mitteilung, 2005) sind aus Sojabohnen Anbauflächen auch in den<br />
letzten Jahren keine nennenswerten Honigernten bekannt geworden.<br />
Als Beimischung in anderen Honigen ist Sojabohnenhonig nach JAYCOX (1970a) durch seine helle Farbe <strong>und</strong> den nicht<br />
sehr ausgeprägten Geschmack kaum zu erkennen, außer mittels Pollenanalyse.<br />
Für Österreich sind keine Angaben zum Bienenbeflug von Sojabohnen bzw. <strong>zur</strong> Häufigkeit des Auftretens von<br />
Sojabohnenpollen im Honig verfügbar.<br />
11.3.6. mögliche Quellen für GVO-Eintrag bzw. GVO-Einwirkung<br />
• Pollen von GV-Pflanzen<br />
GV-Pflanzen – speziell Raps - sind sehr attraktive Trachtpflanzen für Pollen- bzw. Nektarsammlerinnen –<br />
insbesondere auch in Sondersituationen (fehlendes Trachtangebot im Nahbereich).<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 223 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 11: Literaturrecherche<br />
Pollen von GV-Pflanzen kann auf verschiedene Art in den Honig gelangen:<br />
• Primäre, sek<strong>und</strong>äre <strong>und</strong> tertiäre Einstäubung (Näheres dazu siehe Abschnitt 11.3.3).<br />
Vor allem die tertiäre Einstäubung bei der Honigextraktion aus den Waben (= Schleuderung; in Ausnahmefällen<br />
durch Pressen) kann beträchtliche zusätzliche Pollenmengen aus den Waben in den Honig bringen. Dies hängt damit<br />
zusammen, dass ein Teil des von den Bienen eingelagerten Pollens mit Honig überschichtet wird <strong>und</strong> sich auch im<br />
Honigraum befinden kann, insbesondere dann, wenn mit Honig gefüllte Randwaben aus dem Brutnestbereich in den<br />
Honigraum umgehängt werden.<br />
• Honigvorräte, die von GV-Pflanzen stammen<br />
Da am Ende einer Tracht niemals die gesamten Honigvorräte aus den Bienenvölkern entnommen werden können,<br />
um die Völker nicht dem Hungertod bei kommenden trachtlosen Perioden preiszugeben, müssen immer<br />
entsprechende Futtervorräte - in Form von Honigwaben oder Futterkränzen auf den Brutwaben -, in den Völkern<br />
verbleiben.<br />
Dass diese Honigvorräte mit ihrem allfälligen Gehalt an GVO-Pollen Auswirkungen auf alle nachfolgenden Trachten<br />
haben, wird in einer Arbeit von TUCKEY (1998) klar bestätigt:<br />
Zitat: „If you gather a honey crop from “clean“ plants after a flow of transgenic plants, you can´t be sure your honey<br />
is “clean” – the bees may have moved honey up from the brood chambers. In Alberta it is now impossible to certifiy<br />
non-transgenic honey, and this will soon be the case over most of Canada and the United States”.<br />
In Großbritanien wurde Pollen von genetisch verändertem Raps in Honig aus Bienenvölkern nachgewiesen, die drei<br />
Kilometer von einem Feld mit transgenem Raps standen. Die britische Imkervereinigung empfiehlt zu den<br />
Versuchsfeldern einen Sicherheitsabstand von 10 km einzuhalten. Seitens der Regierung werden lediglich 50 – 200 m<br />
breite Pufferzonen um die Versuchsfelder vorgeschrieben (in Deutsches Bienen Journal, 10.Jg., (H.12), 2002 – zit.<br />
Aus: Gen-Lex-News/The Scottish Beekeeper 11/02).<br />
Nach WILLIAMS (2002) wird ein weit verbreiteter Einsatz von gentechnisch verändertem Raps unvermeidbar auch zum<br />
Auftreten von GVO-Pollen in Honig <strong>und</strong> anderen Bienenprodukten - wie Wabenhonig <strong>und</strong> Blütenpollen, der mit Hilfe<br />
von Pollenfallen gewonnen wurde, führen.<br />
Dass sich Pollen aus vorher genutzen Trachten auch in der Folgetracht finden kann, wird bei HORN, LÜLLMANN (1992)<br />
in Abb. 81 für einen deutschen Honigtauhonig dokumentiert, in dem Rapspollen nachweisbar war.<br />
Eigene, bisher unveröffentlichte Untersuchungen im Rahmen eines derzeit am Institut für Bienenk<strong>und</strong>e der <strong>AGES</strong><br />
laufenden Projektes zeigen ebenfalls einen Einfluss der „Vortracht“ Raps auf das Pollenspektrum der „Nachtrachten“<br />
(Robinie, Sonnenblume, Honigtauhonig [= „Waldhonig“]) auf.<br />
Für Maispollen, der in den Anbaugebieten in großen Mengen im Juli <strong>und</strong> August eingetragen wird, ist auch noch nach<br />
Überwinterung der Bienenvölker in den Frühjahrshonigen des nächsten Jahres ein GVO-Einfluß denkbar (z.B.<br />
Maispollen in Raps-, Löwenzahn, Frühjahrsblütenhonig).<br />
2 F<strong>und</strong>e von Maispollen in Robinienhonig im Rahmen des bereits angeführten Sortenhonigprojektes des Instituts für<br />
Bienenk<strong>und</strong>e belegen diese Möglichkeit der Pollenweitergabe über die Überwinterungsperiode hinaus in Honige des<br />
Folgejahres.<br />
Laut bisher unveröffentlichten Daten von BIENEFELD (schriftl. Mitteilung, 2005), waren in einigen deutschen<br />
Frühjahrshonigen, die zwischen 2003 <strong>und</strong> 2005 pollenanalytisch untersucht worden waren, sowohl Mais- als auch<br />
Sonnenblumenpollen nachweisbar.<br />
• Umhängen von Pollenwaben<br />
Manche imkerliche Betriebsweisen empfehlen die Entnahme pollengefüllter Waben aus den Völkern in Zeiten des<br />
Pollenüberschusses <strong>und</strong> ihre Rückgabe zu einem späteren Zeitpunkt bzw. ein Umhängen in andere Völker mit<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 224 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 11: Literaturrecherche<br />
Pollenmangel. Damit wird zwangsläufig auch allfällig vorhandener GVO-Pollen zeitlich <strong>und</strong> örtlich im Bienenvolk<br />
verlagert <strong>und</strong> kann Folgetrachten verunreinigen.<br />
• Mit GVO-Pollen belastete Honigreste bzw. Pollenzellen in den ausgeschleuderten Waben <strong>und</strong> Vorratswaben<br />
Nach der Schleuderung bleiben immer Honig- <strong>und</strong> Pollenreste in den Waben <strong>zur</strong>ück. Da diese Waben zu einem<br />
späteren Zeitpunkt wieder in – meist andere – Bienenvölker <strong>zur</strong>ückgegeben werden, oft auch erst im nächsten Jahr,<br />
kann eine allfällige GVO-Belastung sich sowohl auf die Folgetrachten des laufenden als auch der folgenden<br />
Erntejahre auswirken.<br />
• Nachweisproblem bei „gefiltertem Honig“<br />
Gemäß EU-Honigrichtlinie (RL 2001/110/EG vom 20. Dezember 2001 ist die Vermarktung von gefiltertem Honig – bei<br />
entsprechendem Deklarationshinweis möglich. Gefilterter Honig ist - lt. Definition in Anhang I - Honig, der gewonnen<br />
wird, indem anorganische oder organische Fremdstoffe so entzogen werden, dass Pollen in erheblichem Maße<br />
entfernt werden.<br />
Werden Pollenkörner von GV-Pflanzen mit Hilfe von Sieben mit entsprechender Maschenweite entfernt – die Größe<br />
der „heiklen“ Pollen ist ja bekannt -, bleiben die GVO-Nektaranteile im Honig erhalten, aber sowohl der genetische als<br />
auch der botanische Fingerabdruck der zugr<strong>und</strong>e liegenden Pflanze fehlen. Damit ist die einfache Nachweismethode<br />
der mikroskopischen Pollenanalyse nicht mehr zielführend <strong>und</strong> ein etablierter PCR-Nachweis möglicherweise nicht<br />
mehr sensibel genug. Ob die Untersuchung GVO-codierter Eiweißverbindungen im Honig – falls solche überhaupt<br />
auftreten - in diesem Fall zu einem positiven Ergebnis kommen würde, müsste erst in entsprechenden Versuchen<br />
erprobt werden.<br />
In den USA ist die Filterung von Honig <strong>zur</strong> Verringerung seiner Kristallisationsneigung durch die Entfernung von<br />
Kristallisationskernen schon seit Jahren eine gängige Praxis. WILLIAMS (2002) gibt an, dass dabei weniger als 1000<br />
Pollenkörner pro 10 g Honig verbleiben.<br />
• Bienenfuttermittel<br />
Sofern der GVO-Anteil in einem Futtermittel nicht höher ist als 0,9% des Futtermittels oder der<br />
Futtermittelbestandteile, aus denen es zusammengesetzt ist, vorausgesetzt, dieser Anteil ist zufällig oder technisch<br />
nicht <strong>zur</strong> vermeiden, besteht keine Kennzeichnungspflicht [VO (EG) 1829/2003, Art. 24 (2)].<br />
Kohlenhydrathaltige Futtermittel<br />
Für die entnommenen Honigvorräte muss den Bienenvölkern nach Ende der Trachtperiode – in Ausnahmefällen auch<br />
bei Totalausfall der Tracht - ein entsprechender Ersatz geboten werden, um das Überleben bzw. den Aufbau der<br />
nötigen Wintervorräte zu gewährleisten.<br />
Dazu werden in der Regel gelöster Kristallzucker, für Bienen optimierte Fertigfuttersirupe, Sirupe aus der<br />
Lebensmittelindustrie oder pastöse Futterteige verabreicht. Von manchen Imkern wird auch Honig gezielt als<br />
Futtermittel eingesetzt. Es ist dies eine Praxis, die z.B. in der Bioimkerei - gemäß EU-VO 2092/91 idgF über den<br />
ökologischen Landbau <strong>und</strong> die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse <strong>und</strong> Lebensmittel<br />
-, ausdrücklich gefordert wird.<br />
Ein GVO-Einfluß über diese Futtermittel kann zustande kommen durch<br />
• Zucker aus GV-Rüben (bzw. GV-Zuckerrohr)<br />
• Zucker Fertigfuttersirupe auf Stärkebasis – hergestellt z.B. aus GV-Mais<br />
• Zucker Fertigfuttersirupe auf Stärkebasis – hergestellt mit Hilfe von GVO-Enzymen<br />
• GVO-haltigen Fütterungshonig (z.B. Rapshonig, u.a.).<br />
Da der österreichische Bienenbedarfshandel bzw. die österreichische Zuckerindustrie die Bienenfuttermittel bzw.<br />
Sirupe zum Teil aus dem Ausland einführen, bzw. manche Imker die Futtermittel auch selbst aus den Nachbarländern<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 225 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 11: Literaturrecherche<br />
beziehen, müsste der Ursprung der Futtermittel aus „GVO“- bzw. GVO-freien Herkünften anhand der Begleitpapiere<br />
dokumentiert <strong>und</strong> lückenlos rückverfolgbar sein, um eine GVO-freie Produktion ausloben zu können.<br />
Eiweißhaltige Futtermittel<br />
Pollenersatzmittel auf Sojabohnenmehlbasis:<br />
Die Gabe von eiweißreichen Pollenersatzmitteln ist in manchen Ländern bzw. Imkereibetrieben bei schlechten Tracht-<br />
oder Witterungsbedingungen im Frühjahr eine verbreitete Praxis. Sojabohnenmehl, das in sogenanntem „Futterteig“<br />
eingearbeitet oder zum „Höseln“ in Pulverform angeboten wird, ist eines der eingesetzten Pollenersatzmittel (HÜSING,<br />
NITSCHMANN; 1995).<br />
Stammt das verwendete Sojabohnenmehl von GV-Sojabohne, sind im geernteten Honig die entsprechenden<br />
Transgene nachweisbar (SIEDE, BÜCHLER, 2001). In dieser Arbeit waren verschiedene Honige aus Rheinland Pfalz bei<br />
mikroskopischen Untersuchungen auf Gr<strong>und</strong> relativ hoher Mengen von Sojabohnenbestandteilen aufgefallen. Ein<br />
spezifischer PCR-Test wies in 17 der 19 getesteten Honige Sojabohnenbestandteile nach. Transgenes Material wurde<br />
in 11 Proben gef<strong>und</strong>en. Die Autoren vermuten einen Zusammenhang mit der Verfütterung proteinhaltiger<br />
Bienenfuttermittel, die nach ihren Untersuchungen teilweise gentechnisch modifizierte Sojabohnen enthalten.<br />
Da einige der sojabohnenpositiven Proben von Betrieben stammten, die keinerlei sojabohnenhältiges Futter<br />
eingesetzt hatten, mussten die Bienen das Material von außen eingetragen haben. Die Autoren halten es für<br />
wahrscheinlich, dass die Bienen in trachtarmer Zeit sojabohnenhaltige Futtermittel (z.B. Sojabohnenmehl, Abrieb von<br />
geformten Futterpartikeln) der Großtierhaltung gehöselt haben. Denkbar wäre aber auch ein Eintrag im Zuge von<br />
Räuberei aus Imkereien, die sojabohnenhaltige Futtermittel verwendet haben.<br />
Naturpollen:<br />
Auf die Problematik des Einsatzes von Naturpollen in Form von Pollenwaben wurde bereits unter dem Punkt<br />
„Umhängen von Pollenwaben“ hingewiesen. Für die Einbringung von Naturpollen über Futterteige gelten die gleichen<br />
Vorbehalte, wenn der Naturpollen aus GVO-Quellen stammt.<br />
Spezifische, durch transgene DNA-Sequenzen codierte Proteine, die in bestimmten Pflanzenteilen (z.B. Pollen,<br />
Nektarien, Tapetumzellen) exprimiert bzw. im Siebröhrensaft (= Ausgangsstoff für die Honigtauproduktion saugender<br />
Insekten) transportiert <strong>und</strong> damit für die Bienen verfügbar werden <strong>und</strong> in die Bienenprodukte gelangen, könnten<br />
ebenfalls zum Problem werden. Gleiches gilt für die Gr<strong>und</strong>stoffe der Propolisproduktion, die ebenfalls harzigen bzw.<br />
gummiartigen Pflanzenexsudaten entstammen.<br />
Varroabekämpfungsmittel, Futterzusatzstoffe<br />
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass gewisse, <strong>zur</strong> Varroabekämpfung verwendete Wirkstoffe (z.B. Milchsäure),<br />
bzw. die manchmal als Futterzusatzstoff empfohlene Zitronensäure mittels GV-Mikroorganismen produziert wurden.<br />
Unter Punkt 8 der Codex Richtlinie v. 7.3.2001 wird für Tierarzneimittel darauf kurz Bezug genommen:<br />
„Tierarzneimittel dürfen für therapeutische Zwecke bis zum Erlass einschränkender Regelungen aus gentechnischer<br />
Erzeugung stammen, sie dürfen aber keine GVO enthalten.“<br />
11.3.7. Künftige Verfügbarkeit von<br />
• GVO-freien Trachtquellen<br />
In welchem Umfang in Zukunft „GVO-freie“ Trachtquellen für die Imkerei verfügbar sein werden, wird ausschließlich<br />
durch die Rechtslage, die Lage der GVO-Anbauflächen <strong>und</strong> die Standplätze der Bienenvölker bestimmt werden.<br />
Dadurch wird sowohl die Menge an produzierbarem „GVO-freiem“ Honig als auch die produzierbaren Honigsorten<br />
entscheidend beeinflusst werden.<br />
Unter Berücksichtigung der kleinen Parzellengrößen in vielen Ackerbaugebieten Österreichs ist nur bei Ausweisung<br />
von großen, zusammenhängenden Flächen ohne GVO-Einfluß (ab einem Mindestdurchmesser von mehr als 10 km)<br />
<strong>und</strong> bei entsprechend zentraler Bienenaufstellung eine „GVO-freie“ Produktion von Bienenprodukten denkbar.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 226 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 11: Literaturrecherche<br />
In der <strong>AGES</strong>-Studie „Die Produktion von Saatgut in abgegrenzten Erzeugungsprozessen <strong>zur</strong> Vermeidung einer<br />
Verunreinigung mit gentechnisch veränderten Organismen im Kontext mit der Koexistenz von konventioneller<br />
Landwirtschaft mit oder ohne GVO <strong>und</strong> ökologischer Landwirtschaft“ (GIRSCH et al., 2004) wird eine nahezu<br />
identische Vorgangsweise als notwendig erachtet. Zitat: „Die Entwicklung von geschlossenen Anbaugebieten <strong>und</strong><br />
geschlossenen Produktionsprozessen bei Vorliegen von externen GVO-Kontaminationsquellen ist daher eine der<br />
zentralen Maßnahmen, ein Gebot der St<strong>und</strong>e.“<br />
Unter den Bedingungen der Landwirtschaft in Österreich ist laut obiger Studie Koexistenz bei Raps / Rübsen in der<br />
landwirtschaftlichen Produktion, insbesondere beim Hybridraps, auszuschließen. Hohe, langjährige Durchwuchsrate,<br />
Ruderalraps <strong>und</strong> Auskreuzen in Cruciferae-Wildpflanzen führen beim Anbau von GV-Raps zu einem umfangreichen,<br />
nachhaltigen GVO-Genpool. Betreffend eines potentiellen GVO-Polleneintrages aus Raps in Honig gelten zumindest<br />
die Koexistenzkriterien für Hybridraps, sodaß eine Koexistenz mit „GVO-freier“ Honigproduktion mit hoher Sicherheit<br />
auszuschließen ist.<br />
Dass sich in der Umsetzung der Koexistenz von gentechnisch veränderten, konventionellen <strong>und</strong> biologisch<br />
angebauten Kulturpflanzen in der österreichischen Landwirtschaft gr<strong>und</strong>sätzliche Probleme in der Kulturart Raps<br />
erwarten lassen, wird im Zusammenhang mit der Imkerei in der Studie von PASCHER <strong>und</strong> DOLEZEL (2005) dezidiert<br />
angesprochen: Zitat: „Die Entfernung von Bienenstöcken aus Rapsanbaugebieten würde zwar eine zusätzliche<br />
Fremdpollenquelle eliminieren, würde jedoch gleichzeitig eine Ertrags- sowie Qualitätseinbuße für die Imker<br />
bedeuten.“<br />
Konkret würde diese Vorgangsweise in der Praxis beträchtliche Produktionsmengen- <strong>und</strong> Einkommensverluste für die<br />
von einer solchen Maßnahme betroffenen Imker bedeuten. Da die Nutzung der Rapstracht starke<br />
entwicklungsfördernde Eigenschaften für die Bienenvölker hat, würden sich durch den Wegfall dieser Trachtquelle<br />
auch negative Auswirkungen auf die Volksstärke, <strong>und</strong> damit auf die Ausnutzung der Folgetrachten, ergeben.<br />
Ein Anhaltspunkt für die erforderlichen Abstände <strong>zur</strong> Vermeidung einer GVO-Kontamination des Honigs findet sich in<br />
WILLIAMS (2002): „To meet supermarket requirements and to avoid the prohibitive costs of testing honey for GM<br />
content, the Honey Association advises beekeepers to site their hives at least six miles (9 km) from GMHT oilseed<br />
rape being grown in the farm-scale evaluations (FSE) of GM crops in the UK”.<br />
Diese Empfehlung ist unbequem <strong>und</strong> kostenintensiv für Imker <strong>und</strong> verursacht Konflikte, wenn sie<br />
Bestäubungskontrakte in der Nähe von FSE-Flächen haben.<br />
Außerdem ergibt sich durch die Vermeidung von GVO-Kulturen durch Bienenzüchter ein umweltrelevanter Einfluss<br />
auf die Bestäubung von GVO- <strong>und</strong> Nicht-GVO-Kulturen sowie von Wildpflanzen in solchen bienenleeren Gebieten<br />
(WILLIAMS, 2002).<br />
Auf den ersten Blick relativ sicher erscheint die Möglichkeit <strong>zur</strong> GVO-freien Produktion von Bienenprodukten in<br />
Naturschutzgebieten <strong>und</strong> auf ökologisch sensiblen Flächen realisierbar zu sein, sofern keine Wanderimkerei in GVO-<br />
Anbaugebiete betrieben wird. Eine aufeinander folgende Nutzung von GV-Pflanzen <strong>und</strong> nicht GV-Pflanzen durch<br />
Wanderimkerei würde unweigerlich zu nicht mehr zu beseitigenden Kontaminationen der Honig- <strong>und</strong> Pollenvorräte<br />
führen.<br />
Wird jedoch die im Endbericht zu den Arbeiten der Expertengruppe betreffend der „Erarbeitung von Empfehlungen<br />
für eine nationale Strategie <strong>zur</strong> Koexistenz“ angedachte Ausnahmeregelung für diese Gebiete umgesetzt, ist auch in<br />
Naturschutzgebieten <strong>und</strong> auf ökologisch sensiblen Flächen ein Einfluss von GVO-Kulturen auf die Bienenprodukte<br />
nicht völlig auszuschließen, da eine Ausnahmeregelung vom Anbauverbot von Saatgut von GV-Sorten in diesen<br />
Gebieten unter bestimmten Voraussetzungen vorgesehen ist (GIRSCH et al., 2004).<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 227 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 11: Literaturrecherche<br />
In dem entsprechenden Abschnitt des Strategiepapieres heißt es (Zitat):<br />
„Nicht betroffen von diesem Verbot ist der Anbau von Saatgut von GVO-Sorten jener botanischen Arten in<br />
Naturschutzgebieten <strong>und</strong> ökologisch sensiblen Gebieten oder Flächen, welche NICHT<br />
• wildlebend vorkommen,<br />
• mit botanischen Arten, welche wildlebend vorkommen, auskreuzen.<br />
Beispiele für derartige Kulturpflanzen, für welche derzeit bereits GVO-Saatgut international angewandt wird, sind mit<br />
MAIS (Zea mays) <strong>und</strong> SOJABOHNE (Glycine max) auch sehr wichtige Kulturpflanzen für die österreichische<br />
Landwirtschaft.“<br />
• Futtermitteln ohne GVO-Einfluss, bzw. frei von GVO-Derivaten<br />
Gr<strong>und</strong>voraussetzung für eine „GVO-freie“ Produktion von Bienenprodukten – zumindest gem. Codex- bzw. BIO-<br />
Richtlinie der EU – ist die Verwendung „GVO-freier“ Futtermittel (Rohrzucker, Fertigfuttersirupe, Pollenersatzmittel).<br />
Wie dem Institut für Bienenk<strong>und</strong>e auf entsprechende Anfrage von zwei österreichischen Lieferanten von<br />
Bienenfuttermitteln Ende Dezember 2004 bzw. Anfang 2005 mitgeteilt wurde, sind bei Bedarf genügend zertifizierte<br />
zuckerhaltige Bienenfuttermittel - sowohl aus „GVO-freier“ Produktion als auch aus biologischem Anbau - verfügbar.<br />
Für Stärkesirupe gibt es sowohl mit als auch ohne GVO-Derivate produzierte Chargen.<br />
Falls Pollenersatzmittel eingesetzt werden sollen, müsste auf die Verwendung von „GVO-freiem“, zertifiziertem<br />
Ausgangsmaterial – insbesondere bei Verwendung von Sojabohnenmehl – geachtet werden.<br />
11.3.8. Einfluss von GVO-Verunreinigungen in Bienenprodukten auf die Vermarktung im Inland<br />
Es ist zu erwarten, dass die Vermarktung von Honig, der GVO-Pollen enthält – unabhängig von einem Schwellenwert<br />
-, auf Schwierigkeiten stoßen wird – sobald diese Möglichkeit in der Öffentlichkeit thematisiert wird, da viele<br />
Honigkonsumenten <strong>und</strong> auch der Imkersektor Lebensmittel mit GVO-basierten Inhaltsstoffen aus gr<strong>und</strong>sätzlichen<br />
Überlegungen heraus ablehnen. Solche Inhaltsstoffe würden den Ruf des Honigs als „reines Naturprodukt mit<br />
ges<strong>und</strong>heitlichem Wert“ gefährden.<br />
Daher besteht die britische Honigvereinigung, die Honig aus Großbritannien <strong>und</strong> aus Übersee ankauft, ihn verpackt<br />
<strong>und</strong> weiter verkauft darauf, dass der angekaufte Honig frei von GVO sein soll (WILLIAMS, 2002). In der zitierten Arbeit<br />
findet sich aber auch der Hinweis, dass gegenwärtig noch eine gesetzliche Definition fehlt, was unter GVO-frei zu<br />
verstehen ist.<br />
In diesem Zusammenhang ist besonders darauf hinzuweisen, dass mit einer massiven Verunsicherung <strong>und</strong> starkem<br />
Misstrauen der Konsumenten zu rechnen ist, wenn eine <strong>Auslobung</strong> als <strong>„gentechnikfrei“</strong> gemäß gesetzlich definierter<br />
Schwellenwerte erfolgen sollte, im gekauften Produkt sich aber dann mittels der auf dem letzten Stand der Analytik<br />
verfügbaren Methoden GVO-Belastungen nachweisen lassen. Ein solcher <strong>Auslobung</strong>sansatz würde auch Artikel 4 (1)<br />
b) der VO (EG) Nr. 1829/2003, in dem der Passus „die Verbraucher nicht irreführen“ verankert ist, zuwiderlaufen.<br />
Diesem Umstand Rechnung tragend, fordert auch die Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten, die nationale Regelungen <strong>zur</strong><br />
<strong>Auslobung</strong> der „Gentechnikfreiheit“ haben, dass der Schwellenwert für zufällige <strong>und</strong> technisch unvermeidbare GVO-<br />
Verunreinigungen in „GVO-freien“ Produkten unter der Nachweisgrenze liegen sollte. Zitat: „Most of the Member<br />
States that have such national rules stipulate that the threshold for adventitious and technically unavoidable<br />
presence of GM material in GM free products should be below the detection level”. (Sum. Rec. 2nd Meeting – 23<br />
June 2004, Standing Committee on the Food Chain an Animal Health, Sect. on geneticalliy modified food and Feed,<br />
Punkt 7: GM free labelling scheme.)<br />
Wie telefonische Anfragen bei zwei bedeutenden heimischen Honigabfüllern ergaben, ist für Honig die Frage einer<br />
Kennzeichnung hinsichtlich GVO-Freiheit derzeit kein Thema, da einerseits in Österreich kein GVO-Anbau stattfindet<br />
<strong>und</strong> andererseits der Pollengehalt des Honigs nur bei einem Bruchteil des Schwellenwertes von 0,9% liegt, ab dem<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 228 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 11: Literaturrecherche<br />
eine Kennzeichnung erfolgen müsste. (Diese Beurteilung der Sachlage durch den Handel stützt sich auf die<br />
Auslegungen des „Ständigen Ausschuss Lebensmittelkette <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit, Abt. genetisch veränderte<br />
Lebensmittel <strong>und</strong> Futtermittel“ zum Thema Honig <strong>und</strong> seiner möglichen GM-Kennzeichnung (siehe Abschnitt 11.3.1),<br />
sowie auf die Ausführungen der Codex-Unterkommssion Honig zu diesem Thema.)<br />
11.3.9. Einfluss auf Vermarktung im Ausland<br />
Exporte von Bienenprodukten in andere Länder (z.B. Saudi Arabien, Japan) sind nur mit entsprechenden Zertifikaten<br />
möglich, aus denen die „GVO-Freiheit“ hervorgeht (mündliche Mitteilung, ELSASSER, 2004; einem erfolgreichen<br />
Produzenten <strong>und</strong> Exporteur von österreichischen Gelee Royale Produkten nach Mittel- <strong>und</strong> Fernost). Einige<br />
österreichische Betriebe haben gute <strong>und</strong> finanziell lukrative Absatzquellen in diese Länder.<br />
Bei TUCKEY (1998) findet sich ein weiterer ganz konkreter Hinweis darauf, dass die Vermarktung von Honig, der von<br />
transgenen Pflanzen stammt, auf manchen Absatzmärkten nicht möglich ist: „The popularity of these transgenic<br />
canolas, and other transgenic plants, has very definite implications for beekeepers. Some markets are resisting the<br />
purchase of any honey that may originate from transgenic plants.“<br />
Wie rasch diese Vermarktungsprobleme für kanadischen „Raps-Klee-Honig” schlagend wurden, zeigte sich bereits im<br />
Jahr 2000. Im Auftrag von GLOBAL 2000 wurden im Handel befindliche Honige dieser Herkunft am<br />
Umweltb<strong>und</strong>esamt mit positivem Ergebnis getestet, worauf die vertreibenden Supermarktketten (Spar-Gruppe,<br />
Metro, Adeg, Zielpunkt) den Honig umgehend aus den Regalen nahmen. Entsprechende Artikel in verschiedenen<br />
Tageszeitungen (Kurier, OÖ-Nachrichten, Täglich Alles, Der Standard) sorgten für die entsprechende mediale<br />
„Vermarktung“ dieser, das Image des Honigs schädigenden Ergebnisse.<br />
Laut KLEIN (2004) betrug der GVO-Pollenanteil (= Anteil der DNA aus GV-Raps an der Gesamtmenge der im Honig<br />
vorhandenen DNA) in kanadischen Honigprodukten nach Untersuchungen des Chemischen- <strong>und</strong><br />
Veterinäruntersuchungsamtes (CVUA) Freiburg in den Jahren 2002 <strong>und</strong> 2003 über 30 %, während in deutschen<br />
Rapshonigen in keinem Fall GV-Raps nachweisbar war.<br />
11.3.10. Zusatzkosten für GVO-Analysen bei Honig <strong>und</strong> anderen Bienenprodukten<br />
Wie Untersuchungen mittels PCR zeigten, waren transgene Sequenzen von Pollen-DNA in Honig noch nach 7 Wochen<br />
intakt. In Honig inkubierte Pollenproteine waren zumindest für 6 Wochen stabil (in WILLIAMS, 2002). Damit ist<br />
zumindest bei Honig <strong>und</strong> Pollen von einer Nachweisbarkeit zeitlich weit <strong>zur</strong>ückliegender Verunreinigungen <strong>und</strong> / oder<br />
Kontaminiationen mit GVO-Material auszugehen.<br />
Da sich Ziel <strong>und</strong> Entfernung der Sammelflüge der Bienen dem Einfluss des Imkers entziehen, sind <strong>zur</strong> Absicherung<br />
der GVO-Freiheit – im Falle einer Auszeichnung als <strong>„gentechnikfrei“</strong> vor der Vermarktung entsprechende Analysen<br />
vorzusehen (Österr. Lebensmittelbuch III. Auflage, Codex-Richtlinie <strong>zur</strong> Definition der „Gentechnikfreiheit“ vom<br />
7.3.2001; Pkt. 10).<br />
Die dafür anfallenden Kosten von bis zu einigen h<strong>und</strong>ert Euro pro Probe würden bei kleinen Chargengrößen stark auf<br />
den Produktpreis durchschlagen. Damit würden wahrscheinlich kleinere Imkereien – wie sie der Mehrheit der<br />
österreichischen Imkerbetriebe darstellen – als Lieferanten ausfallen.<br />
Vom Kompetenzzentrum Biochemie der <strong>AGES</strong> werden beispielsweise folgende Untersuchungskosten angegeben:<br />
GVO-Screening: 150 €, GVO-Identifizierung: je 50 €, GVO-Quantifizierung: 150 €, DNA-Präparation: 150 €. Für das<br />
Gesamtpaket würden sich somit Kosten von 500 € ergeben, die bei Vorhandensein von verschiedenen GVO <strong>und</strong><br />
erforderlicher Identifizierung auch noch höher ausfallen könnten.<br />
11.3.11. Erforderliche Maßnahmen <strong>zur</strong> Erhaltung der „GVO-Freiheit“ von Bienenprodukten von der<br />
Gewinnung über die Verarbeitung bis <strong>zur</strong> Abfüllung<br />
Die Gewinnung, Anlieferung, Verarbeitung <strong>und</strong> Abfüllung von „GVO-freiem“ Honig müsste - analog <strong>zur</strong> „GVO-freien“<br />
Futtermittelerzeugung – in getrennten <strong>und</strong> dokumentierten Prozessen – möglicherweise sogar getrennten Anlagen -<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 229 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 11: Literaturrecherche<br />
erfolgen, um den Eintrag von GVO-Spuren aus verunreinigten Vorchargen sicher auszuschließen.<br />
Gleiches gilt für Blütenpollen, wo sowohl für die Sammlung als auch die Trocknung, Reinigung <strong>und</strong> Mischung<br />
getrennte Prozesse <strong>und</strong> Anlagen vorzusehen wären. Da beim Blütenpollen gr<strong>und</strong>sätzlich mit keinem<br />
Verdünnungseffekt – wie beim Honig durch Nektar oder Honigtau zu rechnen ist, kommt bei der Gewinnung GVO-<br />
freier Ware dem Standort der Bienenvölker zum Zeitpunkt der Pollengewinnung eine ganz besondere Bedeutung zu.<br />
Befinden sich GVO-Kulturen im Flugbereich der Bienen, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Überschreiten des Anteils<br />
von GV-Pollen von 0,9%, bezogen auf die Gesamtpollenmenge, zu erwarten.<br />
Eine lückenlose Rückverfolgbarkeit der Einzelchargen <strong>und</strong> Chargenbestandteile ist erforderlich, um gegebenenfalls die<br />
Ursache von GVO-Verunreinigungen aufklären zu können.<br />
Wie weit auch die Herstellung anderer Bienenprodukte (Mittelwände aus Bienenwachs, Propolislösungen, Gelee<br />
royale) von solchen Vorbeugemaßnahmen betroffen wäre, müsste erst in Praxisversuchen getestet werden.<br />
11.3.12. Abschätzung der möglichen Folgen der <strong>Auslobung</strong> bestimmter Honige als <strong>„gentechnikfrei“</strong><br />
auf den österreichischen Honigmarkt<br />
Eine <strong>Auslobung</strong> bestimmter Honige als <strong>„gentechnikfrei“</strong> mit einem Qualitätsprogramm wird auf jeden Fall die<br />
Aufmerksamkeit der Konsumenten erregen.<br />
Es ist damit zu rechnen, dass kritische Konsumenten argwöhnisch werden <strong>und</strong> die Kennzeichnung an sich<br />
hinterfragen (siehe dazu auch die Ausführungen unter Punkt 11.3.8), bzw. annehmen, dass jeder nicht als<br />
<strong>„gentechnikfrei“</strong> ausgelobte Honig mit GVO belastet ist. Damit würde sich für andere Honige ohne dieses<br />
Qualitätsprogramm– möglicherweise ungerechtfertigt - zusätzlicher Aufklärungsbedarf ergeben.<br />
Es ist zu erwarten, dass die Konsumenten eine intensive Diskussion <strong>und</strong> Aufklärung über die GVO-Gefahr durch den<br />
Konsum von Bienenprodukten von den Imkern <strong>und</strong> dem Honighandel einfordern werden.<br />
11.3.13. Einschätzung der Machbarkeit für eine <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> bei Bienenprodukten,<br />
insbesondere Honig<br />
So lange es in Österreich keinen Anbau von GV-Pflanzen gibt, erscheint aus heutiger Sicht eine <strong>Auslobung</strong><br />
<strong>„gentechnikfrei“</strong> generell für alle Bienenprodukte als machbar.<br />
• Produktion <strong>und</strong> <strong>Auslobung</strong> „GVO-freien“ Honigs mit einem Kennzeichnungsschwellenwert von 0,9% / 0,5%<br />
(zu letzterem Wert siehe detailliertere Ausführungen im ersten Abschnitt) für zufällige <strong>und</strong> technisch nicht<br />
vermeidbare GVO-Verunreinigungen, wie vom „Ständigen Ausschuss Lebensmittelkette <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit,<br />
Abt. genetisch veränderte Lebensmittel <strong>und</strong> Futtermittel“ der EU vorgeschlagen, sollte in ganz Österreich<br />
möglich sein. Da der Gesamtanteil des Pollens im Honig laut Literaturangaben nur zwischen 0,1 – 0,5 %<br />
beträgt (WILLIAMS, 2002; Transgen, 2005), ist zu erwarten, dass der Anteil des GVO-Pollens in jedem Fall<br />
unterhalb des Schwellenwertes von 0,9% / 0,5% bleibt. Nach HORN (pers. Mitteilung, 2005) liegt selbst bei<br />
Presshonig der Pollenanteil unter 0,9 %, bezogen auf den Gesamthonig.<br />
• Produktion <strong>und</strong> <strong>Auslobung</strong> von Honig gemäß Codex-Richtlinie <strong>zur</strong> Definition der „Gentechnikfreiheit“ vom<br />
7.3.2001, Österreichisches Lebensmittelbuch III. Auflage, erscheint ebenfalls möglich, sofern bei der<br />
Auswahl der in der Bienenzucht verwendeten Futtermittel auf „GVO-freie“ Herkunft - bzw. deren Herstellung<br />
ohne GVO-Derivate - geachtet wird.<br />
• Produktion <strong>und</strong> <strong>Auslobung</strong> „GVO-freien“ Blütenpollens ist in Österreich derzeit sicher möglich, sofern sich im<br />
Flugkreis der Pollensammelvölker keine GVO-Anbauflächen der Nachbarstaaten befinden. Ein Problem<br />
könnte bei grenznah aufgestellten Bienenständen auftreten.<br />
Sollte es zu einem GVO-Anbau in größerem Umfang kommen, ist eine Einschränkung der Möglichkeit <strong>zur</strong> GVO-freien<br />
Produktion von Bienenprodukten nicht auszuschließen. Insbesondere dürfte eine gentechnikfreie<br />
Blütenpollenproduktion nur mehr in geschlossenen, großräumigen, „GVO-freien“ Gebieten machbar sein. Der Gr<strong>und</strong><br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 230 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 11: Literaturrecherche<br />
liegt darin, dass GV-Pflanzen - insbesondere der Raps – für Bienen über große Entfernungen attraktiv sind <strong>und</strong><br />
angeflogen werden. Da Raps auch große Pollenmengen liefern kann, ist im Falle der Blütenpollenernte <strong>zur</strong> Zeit der<br />
Rapsblüte mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Überschreiten des 0,9%-Schwellenwertes im produzierten Pollen zu<br />
erwarten, wenn im Flugkreis transgener Raps angebaut wird.<br />
Sowohl für die Honig- als auch die Blütenpollenproduktion wird ein entscheidendes Kriterium für die <strong>Auslobung</strong><br />
<strong>„gentechnikfrei“</strong> die derzeitige bzw. künftige Auslegung der Begriffe „zufällige <strong>und</strong> technisch unvermeidbare<br />
Verunreinigungen mit GVO“ sein, insbesondere für die Wanderbienenzucht.<br />
Technisch wären GVO-Verunreinigungen der Bienenprodukte durch Verzicht auf die Anwanderung von Gebieten mit<br />
GVO-Anbau <strong>zur</strong> Honig- bzw. Pollengewinnung gr<strong>und</strong>sätzlich vermeidbar. Aufgr<strong>und</strong> der damit verb<strong>und</strong>enen<br />
Produktionsverluste <strong>und</strong> Einkommenseinbußen erscheint es angemessen, auch die Bienenwirtschaft vollinhaltlich in<br />
die Koexistenzüberlegungen <strong>und</strong> gesetzlichen Bestimmungen in Österreich <strong>und</strong> der EU einzubeziehen.<br />
Für die standortfixierte Imkerei mit meist nicht für die Wanderung geeigneten Bienenbeuten – wie sie heute im<br />
Großteil Österreichs üblich ist – würde die im vorigen Absatz dargelegte Vermeidungsstrategie von vornherein<br />
ausscheiden.<br />
Honig mit zugesetztem Bütenpollen (z.B. Frischpollen, Höschenpollen, Bienenbrot) würde im Falle einer GVO-<br />
Verunreinigung der verwendeten Pollenchargen wahrscheinlich in jedem Fall kennzeichnungspflichtig, da einerseits<br />
die meisten Rezepte einen Pollenanteil von bis zu 10 % (DANY, 1983), bezogen auf die Honigmenge, vorsehen <strong>und</strong><br />
andererseits bei diesem Produkt das Argument der „unvermeidlichen technischen Verunreinigung“ nicht mehr<br />
stichhaltig wäre.<br />
Sollte sich die Interpretation des Schwellenwertes ändern, bzw. dieser auch für Honig auf den Anteil transgener DNA<br />
an der Gesamtmenge an DNA Bezug nehmen, kann eine Überschreitung des Schwellenwertes von 0,9 % (im Falle<br />
eines GVO-Anbaues in Österreich) nicht ausgeschlossen werden, wie das Beispiel des kanadischen Rapshonigs mit bis<br />
zu einem Drittel transgenem DNA-Anteil zeigt (TRANSGEN, 2004).<br />
Würde ein Verzicht auf die Kennzeichnungspflicht von der Nichtnachweisbarkeit abhängig gemacht werden (siehe<br />
Ausführungen dazu unter Punkt 11.3.8), ist es nur in speziell geführten Imkereien möglich, GVO-freie<br />
Bienenprodukte zu erzeugen.<br />
Produktionsvoraussetzungen für solche Imkereien wären: Bienenaufstellung nur in großräumig GVO-freien Gebieten<br />
(mindestens 10 km Durchmesser); ausschließliche Verwendung GVO-freier Futtermittel mit entsprechendem<br />
Zertifikat; Mindestabstand zu Tierhaltungsbetrieben mit Fütterung von GVO-haltigen Futtermitteln (kein<br />
Sojabohnenmehl darf Bienen in Mangelperioden zugänglich sein (siehe SIEDE <strong>und</strong> BÜCHLER, 2001).<br />
Zusammenfassung:<br />
Im Rahmen dieser Studie wurden folgende Themen bearbeitet (die angeführten Gliederungspunkte entsprechen dem<br />
jeweiligen Abschnitt im Langtext):<br />
11.3.1 Gesetzliche Gr<strong>und</strong>lagen für Bienen- <strong>und</strong> Bienenprodukte:<br />
Unter Bezug auf Regulation (EC) No 1829/2003 betreffend Lebens- <strong>und</strong> Futtermittel bestätigte der „Ständige<br />
Ausschuss Lebensmittelkette <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit, Abt. genetisch veränderte Lebensmittel <strong>und</strong> Futtermittel“<br />
der Europäischen Kommission, dass gemäß Richtlinie 2001/110/EG des Rates vom 20.12.2001 über Honig,<br />
dieser als tierisches Produkt zu betrachten ist. Folglich fällt er nicht unter die Regulation (EC) No 1829/2003<br />
für Lebens- <strong>und</strong> Futtermittel, sofern er nicht von genetisch modifizierten Bienen produziert wird. Da die<br />
Bienen über Entfernungen von mehreren Kilometern sowohl an Wild- als auch an Kulturpflanzen sammeln,<br />
<strong>und</strong> dieser Vorgang außerhalb der Kontrollmöglichkeit des Bienenhalters liegt, sollte das Vorkommen von<br />
GVO-Pollen in Honig als zufällig <strong>und</strong> unvermeidlich angesehen werden, welches nicht zu kennzeichnen ist,<br />
vorausgesetzt, der Anteil von GVO-Pollen im Honig liegt nicht über dem Schwellenwertregime (vgl. dazu<br />
Anmerkung in Tabelle 11-2)<br />
In Österreich wird in der Codex-Richtlinie <strong>zur</strong> Definition der „Gentechnikfreiheit“ vom 7.3.2001,<br />
Österreichisches Lebensmittelbuch III. Auflage, ausgeführt:<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 231 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 11: Literaturrecherche<br />
Lebensmittel- <strong>und</strong> Verzehrprodukte im Sinne dieser Richtlinie werden ohne Verwendung von GVO (genetisch<br />
veränderte/r Organismus/men) <strong>und</strong> GVO-Derivaten hergestellt.<br />
Im Abschnitt „Kontrolle“ wird unter Punkt 10 ausgeführt: „Sofern über die Kontrolle die Einhaltung der<br />
vorgegebenen Kriterien nachgewiesen werden kann, bleiben aus technischen Gründen unvermeidbare<br />
Verunreinigungen mit GVO oder daraus hergestellten bzw. gewonnenen Produkten außer Betracht.“<br />
Laut Übereinkunft der Codex-Unterkommission Honig wird dabei der Pollen als originärer Bestandteil des<br />
Honigs angesehen, somit ist der Anteil allfälliger GVO-Pollen auf die Gesamtmenge des Honigs zu beziehen<br />
Die zu den „Nahrungsergänzungsmitteln“ zählenden Bienenprodukte Blütenpollen, Propolis <strong>und</strong> Gelee royale<br />
sind unter dem alten Begriff „Verzehrprodukte“ im Regelungsbereich der Codex-Richtlinie <strong>zur</strong> Definition der<br />
„Gentechnikfreiheit“ enthalten. Für sie gelten demnach die gleichen Regelungen wie für Honig, damit sie mit<br />
Bezeichnungen im Sinne dieser Richtlinie in Verkehr gesetzt werden können.<br />
11.3.2 Nahrungsquellen <strong>und</strong> –bedürfnisse der Honigbiene<br />
Pollen <strong>und</strong> Nektar, aber auch Zucker, Fertigfutterzubereitungen (Sirupe aus der Lebensmittelindustrie bzw.<br />
speziell für Bienen hergestellte flüssige <strong>und</strong> feste Futterstoffe <strong>und</strong> Eiweißersatzmittel) können – analog zu<br />
anderen tierischen Produktionszweigen als „Futtermittel“ eingestuft werden.<br />
11.3.3 Bienenprodukte<br />
• Honig: Honig ist aus Sicht der Verbraucher – insbesondere für Käufer von österreichischem Honig – ein sehr<br />
sensibles Produkt, da ihm das Attribut „naturrein“ zugesprochen wird <strong>und</strong> er bei vielen Konsumenten den<br />
Status eines „Naturheilmittels“ einnimmt.<br />
In normal geerntetem Honig (= Schleuderhonig aus Waben ohne Pollenvorräte) wird die Gesamtmenge an<br />
Pollen mit weniger als 0,1 % angegeben.<br />
• Pollen: Pollen sind die männlichen Keimzellen der Blütenpflanzen. Gelangt Blütenpollen von GV-Pflanzen in<br />
den Honig oder wird Blütenpollen von solchen Pflanzen gewonnen, ist die transgene DNA-im Erntegut<br />
nachweisbar.<br />
• Propolis: Propolis oder Kittharz ist der klebrige Überzug, mit dem das Bienenvolk alle Teile der<br />
Bienenwohnung inklusive des Wabenbaues überzieht. Propolis enthält bis zu 5 % Blütenpollen <strong>und</strong> ist damit<br />
ein sensibles Produkt für allfällige GVO-Verunreinigungen.<br />
• Gelee Royale: Gelee royale ist der in den Futtersaftdrüsen der Ammen gebildete <strong>und</strong> an die königlichen<br />
Larven verfütterte, eiweißreiche Futtersaft. Er enthält auch Spuren von Pollen<br />
• Bienenwachs: Bienenwachs ist ein von den Wachsdrüsen der Bienen sezerniertes Produkt. Je nach<br />
Reinigungsgrad sind darin auch Pollenbeimengungen enthalten.<br />
11.3.4 Bienenflugweiten<br />
Die Flugweite von Honigbienen kann sehr variabel sein <strong>und</strong> sich von einigen h<strong>und</strong>ert Metern Radius um den<br />
Bienenstock bis zu mehr als 6 km erstrecken.<br />
11.3.5 Trachtquellen<br />
• Raps: Wegen seines Nektar- <strong>und</strong> Pollenreichtums ist er eine der attraktivsten Trachtpflanzen, die noch aus<br />
großer Entfernung angeflogen wird. Rapshonig wird zum Teil von Bioimkern im Spätsommer wieder an die<br />
Bienen verfüttert.<br />
• Mais: Dieser wird von Bienen regelmäßig besucht <strong>und</strong> der reichlich vorhandene Pollen oft in Massen<br />
eingetragen. Zusätzlich liefern Blattläuse in manchen Jahren große Mengen von Honigtau, der von den<br />
Bienen zu Honigtauhonig verarbeitet wird.<br />
• Sonnenblume: Sie ist eine gute Pollen- <strong>und</strong> Nektarquelle, die noch aus großer Entfernung angeflogen wird.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 232 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 11: Literaturrecherche<br />
• Sojabohne: Nach Literaturangaben wird sie von Bienen beflogen <strong>zur</strong> Pollen- <strong>und</strong> Nektargewinnung. Für<br />
Österreich sind keine Angaben zum Bienenbeflug von Sojabohnen verfügbar.<br />
11.3.6 Mögliche Quellen für GVO-Eintrag bzw. GVO-Einwirkung<br />
• GV-Pflanzen: Spuren des eingetragenen Pollens finden sich in allen Bienenprodukten <strong>und</strong> auf bzw. in den<br />
Bienenwaben wieder. Durch Filtration des Honigs könnten GVO-Pollen weitestgehend eliminiert werden,<br />
wenn die Filter-Maschenweite auf die Größe der GVO-Pollen abgestimmt wird.<br />
• GVO-Verunreinigungen in Honigvorräten können auch die nachfolgenden Honigernten beeinträchtigen.<br />
• Bienenfuttermittel:: Ein GVO-Einfluss kann durch kohlenhydrathaltige Futtermittel, Fütterungshonig mit<br />
GVO-Verunreinigungen, Eiweißhaltige Futtermittel (Naturpollen bzw. Pollenersatzmittel auf<br />
Sojabohnenmehlbasis) auftreten<br />
11.3.7 Künftige Verfügbarkeit von<br />
• „GVO-freien“ Trachtquellen: Ihr Umfang wird durch die Rechtslage, die Lage der GVO-Anbauflächen <strong>und</strong> die<br />
Standplätze der Bienenvölker bestimmt werden. Dadurch wird sowohl die Menge an produzierbarem Honig<br />
als auch die produzierbaren Sorten entscheidend beeinflusst werden. Für eine „GVO-freie“ Produktion sind<br />
große, zusammenhängende Flächen (Mindestdurchmesser über 10 km) ohne GVO-Anbau erforderlich.<br />
• Futtermitteln ohne GVO-Einfluss, bzw. frei von GVO-Derivaten: Laut Firmenmitteilungen sind bei Bedarf<br />
genügend zertifizierte, zuckerhaltige Bienenfuttermittel - sowohl aus „GVO-freier“ Produktion als auch aus<br />
biologischem Anbau - verfügbar.<br />
11.3.8 Einfluss von GVO-Verunreinigungen in Bienenprodukten auf die Vermarktung im Inland:<br />
Es ist zu erwarten, dass die Vermarktung von Honig, der nachweisbar GVO-Pollen enthält, auf<br />
Schwierigkeiten stoßen wird. Laut telefonischer Anfrage bei großen österreichischen Honighändlern<br />
orientieren sich diese am 0,9%-Schwellenwert für eine allfällige Kennzeichnungspflicht. Da Honig als<br />
tierisches Lebensmittel definitionsgemäß nicht unter die VO (EG) 1829/2003 fällt, wird das darin festgelegte<br />
Schwellenwertregime auch nicht vollinhaltlich umgesetzt.<br />
11.3.9 Einfluss auf Vermarktung im Ausland: Exporte von Bienenprodukten sind in manche Länder (z.B. Saudi<br />
Arabien, Japan) nur für „GVO-frei“ zertifizierte Ware möglich.<br />
11.3.10 Zusatzkosten für GVO-Analysen bei Honig <strong>und</strong> anderen Bienenprodukten<br />
Da sich Ziel <strong>und</strong> Entfernung der Sammelflüge der Bienen dem Einfluss des Imkers entziehen, sind <strong>zur</strong><br />
Absicherung der GVO-Freiheit – im Falle einer Auszeichnung als <strong>„gentechnikfrei“</strong> - vor der Vermarktung<br />
entsprechende Analysen vorzusehen, die Zusatzkosten von einigen h<strong>und</strong>ert Euro pro Probe verursachen<br />
können.<br />
11.3.11 Erforderliche Maßnahmen <strong>zur</strong> Erhaltung der „GVO-Freiheit“ von Bienenprodukten von der Produktion über<br />
die Verarbeitung bis <strong>zur</strong> Abfüllung<br />
Die Anlieferung, Verarbeitung <strong>und</strong> Abfüllung von „GVO-freiem“ Honig <strong>und</strong> Blütenpollen müsste - analog <strong>zur</strong><br />
„GVO-freien“ Futtermittelerzeugung – in getrennten <strong>und</strong> dokumentierten Prozessen erfolgen, um den<br />
Eintrag von GVO-Spuren aus verunreinigten Vorchargen mit hoher Wahrscheinlichkeit auszuschließen.<br />
11.3.12 Abschätzung der möglichen Folgen der <strong>Auslobung</strong> bestimmter Honige als <strong>„gentechnikfrei“</strong> auf den<br />
österreichischen Honigmarkt<br />
Bei <strong>Auslobung</strong> bestimmter Honige als <strong>„gentechnikfrei“</strong> mittels Qualitätsprogramm ist zu erwarten, dass die<br />
Aufmerksamkeit der Konsumenten erregt wird. Damit ergibt sich voraussichtlich für die nicht als<br />
<strong>„gentechnikfrei“</strong> ausgelobten Honige ein zusätzlicher Erklärungsbedarf.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 233 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 11: Literaturrecherche<br />
11.3.13 Einschätzung der Machbarkeit für eine <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> bei Bienenprodukten, insbesondere Honig<br />
So lange es in Österreich keinen Anbau von GV-Pflanzen gibt, erscheint aus heutiger Sicht eine <strong>Auslobung</strong><br />
<strong>„gentechnikfrei“</strong> generell für alle Bienenprodukte als machbar.<br />
• Produktion <strong>und</strong> <strong>Auslobung</strong> „GVO-freien“ Honigs mit einem Kennzeichnungsschwellenwert von 0,9% / 0,5%<br />
(zu letzterem Wert siehe detailliertere Ausführungen im ersten Abschnitt) für zufällige <strong>und</strong> technisch nicht<br />
vermeidbare GVO-Verunreinigungen, wie vom „Ständigen Ausschuss Lebensmittelkette <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit,<br />
Abt. genetisch veränderte Lebensmittel <strong>und</strong> Futtermittel“ der EU vorgeschlagen, sollte in ganz Österreich<br />
möglich sein. Da der Gesamtanteil des Pollens im Honig laut Literaturangaben nur zwischen 0,1 – 0,5 %<br />
beträgt, ist zu erwarten, dass der Anteil des GVO-Pollens in jedem Fall unterhalb des Schwellenwertes von<br />
0,9% bleibt.<br />
• Produktion <strong>und</strong> <strong>Auslobung</strong> von Honig gemäß Codex-Richtlinie <strong>zur</strong> Definition der „Gentechnikfreiheit“ vom<br />
7.3.2001, Österreichisches Lebensmittelbuch III. Auflage, erscheint ebenfalls möglich, sofern bei der<br />
Auswahl der in der Bienenzucht verwendeten Futtermittel auf „gentechnikfreie Herkunft“, bzw. deren<br />
Herstellung ohne GVO-Derivate, geachtet wird.<br />
• Produktion <strong>und</strong> <strong>Auslobung</strong> „GVO-freien“ Blütenpollens ist in Österreich möglich, sofern sich im Flugkreis der<br />
Pollensammelvölker keine GVO-Anbauflächen befinden.<br />
• Die Produktion von „GVO-freien“ Bienenprodukten könnte durch die Einrichtung großräumiger „GVO-freier“<br />
Zonen ganz wesentlich unterstützt werden.<br />
• Sollte es zu einem GVO-Anbau in größerem Umfang kommen, ist eine Einschränkung der Möglichkeit <strong>zur</strong><br />
„GVO-freien“ Produktion von Bienenprodukten nicht auszuschließen. Insbesondere dürfte eine<br />
„gentechnikfreie“ Blütenpollenproduktion nur mehr in geschlossenen, großräumigen, „GVO-freien Gebieten“<br />
machbar sein.<br />
• Die Einbeziehung der Bienenwirtschaft in die Koexistenzregelungen in Österreich <strong>und</strong> der EU erscheint im<br />
Hinblick auf die besondere Betroffenheit des Sektors durch einen potentiellen GVO-Anbau angemessen.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 234 von 272
12. Zusammenfassung<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 12: Zusammenfassung<br />
Die <strong>Machbarkeitsstudie</strong> betreffend der Erzeugung <strong>und</strong> <strong>Auslobung</strong> „gentechnikfreier“ oder „GVO-freier“ tierischer<br />
Lebensmittel wurde im Spätherbst 2004 beauftragt. Molkereien <strong>und</strong> auch fleischverarbeitende Unternehmen planen<br />
die Einführung der <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong>. Ein namhaftes Molkereiunternehmen hat sich kürzlich für diese<br />
Produktionsform entschieden. Weiters ergaben sich vor allem in der kurz- <strong>und</strong> mittelfristigen Verfügbarkeit von<br />
Rohstoffen für die Futtermittelerzeugung neue Perspektiven. Diese Entwicklungen beschränken sich nicht nur auf<br />
das aktuelle Angebot von zertifiziertem „GVO-freien“ Sojaextraktionsschrot (SES) am Weltmarkt, sondern auch auf<br />
die zukünftige Verfügbarkeit von „GVO-freien“ oder „gentechnikfreien“ eiweißreichen Substituten für SES vor allem<br />
aus der Biosprit- <strong>und</strong> Bidodieselerzeugung in Österreich <strong>und</strong> Europa.<br />
Der Einsatz von gentechnisch verändertem Saatgut in Österreich <strong>und</strong> mehreren Mitgliedstaaten der EU wird durch die<br />
Bestätigung der Verbotsverordnungen, insbesondere bei Mais, durch eine kürzlich ergangene Ratsentscheidung<br />
verhindert. Es wird damit die Einschätzung einer mehrjährigen Verzögerung für die potentielle Einführung von GV-<br />
Sorten <strong>und</strong> Saatgut in Österreich, in der im Februar 2004 vom B<strong>und</strong>esministerium für Land- <strong>und</strong> Forstwirtschaft,<br />
Umwelt <strong>und</strong> Wasserwirtschaft beauftragten <strong>und</strong> auf dessen Homepage publizierten „Strategie <strong>zur</strong> Koexistenz in<br />
Österreich“, bestätigt. Während der Einsatz von GV-Sorten <strong>und</strong> Saatgut in der Pflanzenproduktion <strong>und</strong> damit von<br />
Rohstoffen <strong>und</strong> Futtermittel-Ausgangserzeugnissen für die Futtermittelerzeugung in weiten Teilen der EU <strong>und</strong> im<br />
besonderen in Österreich derzeit <strong>und</strong> auch mittelfristig unwahrscheinlich, ja auszuschließen ist, ergibt sich in der<br />
Erzeugung von Zusatzstoffen wie Vitaminen, essentiellen Aminosäuren etc., erzeugt in geschlossenen Systemen<br />
mittels gentechnisch veränderten Mikroorganismen (GVM), eine dazu differenzierte Entwicklung.<br />
Nachfolgend werden die in der Studie angewandten Definitionen vorgestellt:<br />
„Gentechnikfrei“ :<br />
Definition gemäß Codex Alimentarius Austriacus siehe<br />
http://www.bmgf.gv.at/cms/site/attachments/8/0/5/CH0264/CMS1085747609216/codex-rl.pdf<br />
„GVO-frei“:<br />
Der Begriff „GVO-frei“ wird in der Studie für nicht kennzeichnungspflichtige Lebensmittel <strong>und</strong> Futtermittel gemäß der<br />
Bestimmungen der VO (EG) 1829/2003 über genetisch veränderte Lebensmittel <strong>und</strong> Futtermittel verwendet.<br />
Darüber hinaus wird der Begriff „GVO-frei“ in der Studie im Zusammenhang mit Lebensmitteln aus tierischer<br />
Erzeugung (Milch, Eier <strong>und</strong> Fleisch) dann angewandt, wenn nicht kennzeichnungspflichtige Futtermittel gemäß der<br />
Bestimmungen der VO (EG) 1829/2003 in der Tierernährung eingesetzt werden.<br />
Zum Anwendungsbereich der VO (EG) 1829/2003 hat der Ständige Ausschuss Lebensmittelkette <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
folgende Klarstellung getroffen, siehe<br />
http://europa.eu.int/comm/food/committees/regulatory/modif_genet/summary240904_en.pdf<br />
(Punkt 1).<br />
� Rechtsnormen <strong>und</strong> Systeme <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>und</strong>/oder Kennzeichnung als <strong>„gentechnikfrei“</strong> oder<br />
„GVO-frei“ bei Futter- <strong>und</strong> Lebensmitteln:<br />
Als Voraussetzung für die Einschätzung der Verfügbarkeit von Rohstoffen <strong>und</strong> Futtermittel-Ausgangserzeugnissen<br />
sowie für die Machbarkeit eines Qualitätsprogrammes <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> von Futtermitteln <strong>und</strong> tierischen Lebensmitteln<br />
als <strong>„gentechnikfrei“</strong> oder „GVO-frei“ wurden die rechtlichen Rahmenbedingungen bzw. Vorgaben analysiert.<br />
Dabei wurde einerseits auf die obligaten Vorgaben der VO(EG) 1829/2003 <strong>und</strong> andererseits auf die Anforderungen<br />
gemäß der österreichischen Codex-Richtlinie für die <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> Bezug genommen. Die<br />
Zusammenfassung kann nicht die gesamte Komplexität der nationalen, EU- <strong>und</strong> internationalen Rechtsnormen <strong>und</strong><br />
Vorgaben wiedergeben, sodass bei näherer Betrachtung auf das bezugnehmende Kapitel verwiesen wird.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 235 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 12: Zusammenfassung<br />
Zusammenfassend sind die wichtigsten Vorgaben der VO(EG) 1829/2003, welche auch den gesetzlichen<br />
Mindestanforderungen für nicht als GVO kennzeichnungspflichtige Futter- <strong>und</strong> Lebensmittel entsprechen,<br />
nachfolgend kurz angeführt:<br />
• Das Schwellen-/Grenzwertregime für eine zufällige technisch unvermeidbare GVO-Verunreingung/Kontamination<br />
in Futter- <strong>und</strong> Lebensmittel:<br />
� 0,9 % für in der EU zugelassene GVO,<br />
� 0,5 % für in der EU nicht zugelassene GVO, befristet, bei Vorliegen einer positiven Risikobewertung (ist<br />
Grenzwert)<br />
� 0% für in der EU nicht zugelassene GVO.<br />
Zu beachten ist, dass nur eine entsprechende Differenzierung <strong>und</strong> Identifizierung der GVO in der Analytik eine<br />
zuverlässige Bewertung nach dem Schwellenwertregime der VO(EG) 1829/2003 zulässt.<br />
• Die Verordnung (EG) 1829/2003 ist anzuwenden auf:<br />
� <strong>zur</strong> Verwendung als Lebensmittel <strong>und</strong> Futtermittel bestimmte GVO (z.B. GV-Mais, GV-Sojabohnen);<br />
� Lebensmittel <strong>und</strong> Futtermittel, die GVO enthalten oder aus solchen bestehen (z.B. Fertigprodukte mit Lezithin<br />
aus GV-Sojabohnen);<br />
� Lebensmittel <strong>und</strong> Futtermittel, die aus GVO hergestellt sind oder Zutaten enthalten, die aus GVO hergestellt<br />
werden (aber keine GVO mehr enthalten): z.B. Rapsöl aus GV-Raps, Lezithin aus GV-Sojabohnen.<br />
• Nicht in den Anwendungsbereich der VO(EG) 1829/2003 fallen:<br />
� Zusatzstoffe (Vitamine, Aminosäuren, Enzyme etc.) <strong>und</strong> Aromen, die mit Hilfe von GVO hergestellt worden sind.<br />
� Enzyme, sofern sie als technologischer Hilfsstoff (keine technologische Wirkung im Endprodukt) verwendet<br />
werden.<br />
� Produkte von mit „GVO-Futtermitteln“ gefütterten Tieren (z.B. Milch oder Fleisch von einer mit „GVO-Futter“<br />
gefütterten Kuh).<br />
Im Zuge der weiteren Betrachtungen <strong>und</strong> Analyse zum Qualitätsprogramm <strong>„gentechnikfrei“</strong> oder „GVO-frei“ für<br />
tierische Lebensmittel werden auf der Gr<strong>und</strong>lage der Anforderungen der VO(EG) 1829/2003 Rohstoffe,<br />
Futtermittelausgangserzeugnisse <strong>und</strong> Futtermittel zugr<strong>und</strong>e gelegt, die NICHT kennzeichnungspflichtig sind.<br />
Die Anforderungen der österreichischen Codex-Richtlinie für die <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> gehen in substantiellen<br />
Anforderungen <strong>und</strong> Vorgaben weit über nicht kennzeichnungspflichtige Futter- <strong>und</strong> Lebensmittel gem. VO(EG)<br />
1829/2003 hinaus. Ohne auf die Details näher einzugehen (siehe dazu die Studie im Detail) sei auf die zusätzlichen<br />
Vorgaben betreffend<br />
� den Betriebsmitteleinsatz in der landwirtschaftlichen Produktion,<br />
� die Mengenbegrenzung von Sojaextraktionsschrot in der Futterration,<br />
� die Erzeugung der Zusatzstoffe bzw. Futtermittelausgangserzeugnisse für Futtermittel,<br />
� die Umstellungsvorgaben <strong>und</strong> -zeiträume in der Fütterung<br />
verwiesen. Vor allem die Kohärenz der Überprüfung der Vorgaben des Betriebsmitteleinsatzes bei Importprodukten<br />
aus landwirtschaftlicher Erzeugung in Drittländern einerseits <strong>und</strong> in der landwirtschaftlichen Erzeugung in Österreich<br />
andererseits, ist aus den vorliegenden Recherchen <strong>zur</strong> Studie nicht gegeben. Die Verfügbarkeit bestimmter<br />
Zusatzstoffe, z.B.: bestimmter Vitamine wie B2 <strong>und</strong> B12 ohne den Einsatz von GVM erscheint aus den Recherchen im<br />
Zuge der Studie ebenfalls nur sehr bedingt gegeben. Inwiefern Mengenbeschränkungen an sich <strong>und</strong> eine<br />
Differenzierung von Hard- <strong>und</strong> Soft-IP Sojabohnen bzw. SES im Hinblick auf die angebotenen Qualitäten <strong>und</strong><br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 236 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 12: Zusammenfassung<br />
Sicherstellungen der „Gentechnikfreiheit“ durch aktuell angebotene Zertifizierungssysteme gerechtfertigt sind, bedarf<br />
einer Neubewertung.<br />
Bei Betrachtung der in den Nachbarstaaten eingeführten Gütesiegelprogramme mit einer vergleichbaren <strong>Auslobung</strong><br />
„GVO-frei“ oder <strong>„gentechnikfrei“</strong> für tierische Lebensmittel fällt auf, dass die näher analysierten Programme als<br />
Gr<strong>und</strong>lage die Anforderungen der VO(EG) 1829/2003 für nicht kennzeichnungspflichtige Futtermittel für den Einsatz<br />
von Rohstoffen, Futtermittelausgangserzeugnissen bzw. Zusatzstoffen <strong>und</strong> Futtermittel haben. Die Betreiber der<br />
österreichischen Gütesiegel-Programme geben an, die <strong>Auslobung</strong> gem. den Vorgaben der österreichischen Codex-<br />
Richtlinie für die <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong>, anzuwenden.<br />
� Abschätzung der Verfügbarkeit <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Futter- <strong>und</strong> Lebensmitteln <strong>zur</strong><br />
<strong>Auslobung</strong> <strong>und</strong>/oder Kennzeichnung <strong>„gentechnikfrei“</strong> oder „GVO-frei“ aufgr<strong>und</strong> der Anbau-<br />
<strong>und</strong> Marktsituation von GVO in der landwirtschaftlichen Erzeugung:<br />
Eine mittelfristige Einschätzung von Anbau, Handel <strong>und</strong> Verfügbarkeit von Rohstoffen, für zumindest 20 %<br />
bis 100 % des Futtermittelbedarfs in Österreich, welcher gem. VO(EG) 1829/2003 nicht kennzeichnungspflichtig ist,<br />
ergibt auf der Gr<strong>und</strong>lage der vorliegenden Daten jedenfalls eine mittelfristig gesicherte theoretische Verfügbarkeit.<br />
Als Rohstoffe bzw. Futtermittel-Ausgangserzeugnisse werden sowohl nicht kennzeichnungspflichtiger SES als auch<br />
v.a. heimische nicht kennzeichnungspflichtige Eiweißsubstitute verstanden. Differenziert <strong>zur</strong> theoretischen<br />
Verfügbarkeit ist die Abschätzung der tatsächlichen <strong>und</strong> ökonomisch „akzeptablen“ Verfügbarkeit von Rohstoffen<br />
<strong>„gentechnikfrei“</strong> oder“GVO-frei“ für die Futtermittelerzeugung in der Zeitachse zu betrachten. Die in der Studie<br />
angeführten theoretisch verfügbaren Rohstoffmengen, insbesondere von Sojabohnen <strong>und</strong> SES, sind aus<br />
verschiedenen Gründen keinesfalls <strong>zur</strong> Gänze für den österreichischen Markt verfügbar. Vermengungen <strong>und</strong><br />
Verunreinigungen mit GVO-Produkten, die Verwendung von „GVO-freiem“ SES auf anderen Märkten etc. begrenzen<br />
die tatsächliche Verfügbarkeit für den österreichischen Markt. Die Verfügbarkeit von „GVO-freien“ Sojabohnen <strong>und</strong> -<br />
SES beschränkt sich auf wenige Staaten, insbesondere Brasilien <strong>und</strong> die USA. Der aktuelle Gesamtbedarf Österreichs,<br />
ca. 600.000 t SES/Jahr entspricht allerdings nur etwa einen halben Prozentpunkt der globalen Gesamtanbaufläche<br />
mit „GVO-freien“ Sojabohnen. Bestimmend für die Verfügbarkeit von „GVO-freiem“ SES ist auch der Bedarf an<br />
anderen „GVO-freien“ Rohstoffen aus Sojabohnen für die Lebensmittelerzeugung wie Lezithin <strong>und</strong> Öle <strong>und</strong> in diesem<br />
Zusammenhang die zukünftigen Strategien in der Lebensmittelindustrie.<br />
Mit dem Einsatz von SES-Substituten v. a. aus der Bio-Sprit- <strong>und</strong> Biodieselerzeugung in Österreich <strong>und</strong> Europa sinkt<br />
der Anteil des österreichischen Bedarfs von SES ab 2007 sogar mittelfristig auf unter einen halben Prozentpunkt der<br />
globalen Erzeugung. Dies trotz angenommener Verengung zwischen den Steigerungen des Anbaus von GV-<br />
Sojabohnen <strong>und</strong> des globalen Gesamt-Sojabohnenanbaus. Voraussichtlich sind im Jahr 2008 nur mehr ca. 31% der<br />
weltweit angebauten Sojabohnen „GVO-frei“. Im Jahr 2003 – als auf 50% der weltweiten Anbaufläche GV-<br />
Sojabohnen angebaut wurden - entsprach die von der EU-15 jährlich importierte Menge an Sojabohnenäquivalent<br />
etwa 43% der theoretischen, weltweiten Produktionsmenge an „GVO-freier“ Sojabohne.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 237 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 12: Zusammenfassung<br />
Nachfolgende Abbildung gibt eine Einschätzung der mittelfristigen Entwicklung der weltweiten<br />
Anbauflächen von GV-Sojabohnen einerseits <strong>und</strong> der Gesamtanbaufläche von Sojabohnen andererseits<br />
wieder.<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
Anbaufläche von Sojabohnen<br />
Schätzung der mittelfristigen Entwicklung 1997-2008<br />
relative<br />
Anbaufläche<br />
Sojabohnen<br />
insgesamt<br />
relative<br />
Anbaufläche<br />
GVO-<br />
Sojabohnen<br />
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008<br />
Quelle: Darstellung durch <strong>AGES</strong> nach TRANSGEN WISSENSCHAFTSKOMMUNIKATION <strong>und</strong> FAOSTAT 2004<br />
Die Verfügbarkeit von „GVO-freiem“ SES auf dem Weltmarkt ist letztendlich abhängig von der Einhaltung der für die<br />
„GVO-freie“ Erzeugung zusätzlichen Anforderungen im primären Sektor. Zertifizierungsprogramme für „GVO-freie“<br />
Sojabohnen bzw. SES nehmen Bezug auf den Einsatz von „GVO-freiem“ Saatgut, üblicherweise allerdings nicht auf<br />
den Einsatz von „gentechnikfreien“ Düngemitteln <strong>und</strong> Pflanzenschutzmitteln in der landwirtschaftlichen Erzeugung.<br />
Dies ist von Relevanz bei Betrachtung der Vorgaben für die <strong>Auslobung</strong> von <strong>„gentechnikfrei“</strong> gemäß der<br />
österreichischen Codex-Richtlinie <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong>. Zertifizierungsprogramme, ausgehend von den<br />
Sojabohnenproduktionsländern, nehmen auch Bezug auf die Entwicklung einer Produktionskette für „GVO-freie“<br />
Ware (insbesondere von SES) in der gesamten Verarbeitungsindustrie <strong>und</strong> in den Logistikprozessen, basierend auf<br />
„GVO-freiem“ oder „gentechnikfreiem“ Erntegut aus der Landwirtschaft.<br />
Andere Rohstoffe wie Getreide <strong>und</strong> Mais <strong>und</strong> auch weitere Futtermittel-Ausgangserzeugnisse für die Biosprit- <strong>und</strong><br />
Biodieselerzeugung stehen nach den abschätzbaren Entwicklungen jedenfalls mittelfristig in Europa <strong>und</strong> Österreich<br />
in ausreichenden Mengen ohne den Einsatz von GVO für die Futtermittelerzeugung <strong>zur</strong> Verfügung.<br />
Entwicklungen selbst <strong>zur</strong> theoretischen Verfügbarkeit über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahre sind nur schwer<br />
abschätzbar. Dies umso mehr für Rohstoffe, welche primär in Drittstaaten <strong>und</strong> nicht in der EU erzeugt werden. Unter<br />
der Voraussetzung der Verfügbarkeit von „GVO-freien“ oder „gentechnikfreien“ Substituten erscheint vor allem für die<br />
Rinderfütterung auch eine längerfristige Verfügbarkeit von „GVO-freien“ oder „gentechnikfreien“ Rohstoffen für die<br />
Futtermittelerzeugung gegeben. Kommt es allerdings auch in Europa zu einem verstärkten Anbau von GV-Raps <strong>und</strong><br />
GV-Mais, bedeutet dies eine substantielle Einschränkung der Verfügbarkeit wichtiger Rohstoffe. Es wird daher bei<br />
Einführung eines Qualitätsprogrammes <strong>„gentechnikfrei“</strong> oder „GVO-frei“ für Futtermittel, als Voraussetzung für die<br />
<strong>Auslobung</strong> von <strong>„gentechnikfrei“</strong> oder „GVO-frei“ für tierische Lebensmittel, erforderlich sein, die Entwicklung des<br />
Anbaus von GVO in Europa <strong>und</strong> in Drittstaaten zu beobachten <strong>und</strong> eine Evaluierung der Verfügbarkeit in gewissen<br />
Zeitabständen vorzunehmen.<br />
Anzumerken ist, dass keine Daten vorliegen, die die Verfügbarkeit von Sojabohnen oder anderen Rohstoffen (über<br />
die Erzeugung in Österreich hinaus), welche den Anforderungen an „Gentechnikfreiheit“ genügen, bestätigen.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 238 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 12: Zusammenfassung<br />
� Abschätzung der Verfügbarkeit von Futtermittel <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> oder „GVO-<br />
frei“:<br />
Für die Abschätzung der Verfügbarkeit von Futtermitteln <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> von tierischen Lebensmitteln<br />
als <strong>„gentechnikfrei“</strong> oder „GVO-frei“ bedurfte es der Analyse von ernährungsphysiologisch akzeptablen, den<br />
Anforderungen einerseits der VO(EG) 1829/2003 <strong>und</strong> andererseits der österreichischen Codex-Richtlinie<br />
entsprechenden Futterrationen unter österreichischen Produktionsbedingungen. Für die österreichischen<br />
Tierhaltungsbedingungen repräsentative <strong>und</strong>/oder wissenschaftlich f<strong>und</strong>ierte 184 Futterrationen bilden die Basis für<br />
das Kostenrechnungsmodell <strong>und</strong> für die Bewertung der Machbarkeit <strong>und</strong> Verfügbarkeit von Rohstoffen für ein<br />
Qualitätsprogramm <strong>„gentechnikfrei“</strong> oder „GVO-frei“. Die Einbeziehung unterschiedlicher Intensitätsstufen in der<br />
konventionellen Tierhaltung in Österreich führten zu dieser großen Zahl von durchwegs durch Futtermittelexperten<br />
evaluierten Futterrationen.<br />
In der konventionellen Landwirtschaft, insbesondere im Rahmen hoher Leistungsniveaus, stellt<br />
Sojaextraktionsschrot (SES) einen Hauptbestandteil der Futterrationen dar. In Österreich wird inzwischen als GVO<br />
gekennzeichneter SES hauptsächlich von deutschen Ölmühlen bezogen, die Sojabohnen aus den<br />
Hauptproduktionsländern verarbeiten. In den letzten Jahren wurden im Schnitt ca. 550.000 t SES pro Jahr nach<br />
Österreich importiert. Dieser wird ungefähr zu 25% in Wiederkäuerfutter <strong>und</strong> zu 75% in Schweine- bzw.<br />
Geflügelfutter verwendet. Im Jahr 2004 waren ca. 95% dieses SES als gentechnisch verändert gem. VO(EG)<br />
1829/2003 zu kennzeichnen. Mit dem Tiermehlverbot, das seit 2000 auch für monogastrische Nutztiere (Schwein,<br />
Geflügel) gilt, lässt sich die deutliche Zunahme von SES-Importen nach Österreich <strong>und</strong> in die EU nicht nur hinsichtlich<br />
der Proteinversorgung, sondern auch bei der Aminosäurenversorgung in der vergangenen Dekade erklären.<br />
„GVO freier“ SES mit Verunreinigungen von unter 0,9 %/0,5 % gem. dem Schwellenwerteregime der VO(EG)<br />
1829/2003 war bis vor kurzem in Europa Mangelware. Inzwischen haben sich verschiedene Bezugsquellen für<br />
zertifizierten „GVO-freien“ SES, direkt importiert aus Brasilien, etabliert. Auch zertifizierte „GVO-freie“ Sojabohnen <strong>zur</strong><br />
Weiterverarbeitung in Europa werden nunmehr am Weltmarkt angeboten. Die Verfügbarkeit von „GVO-freiem“ SES<br />
ist laut Umfrage an den Landesproduktenhandel für den gesamten österreichischen Bedarf in Futtermittel gegeben.<br />
Der Zeitrahmen <strong>und</strong> die Kontinuität der Verfügbarkeit kann jedoch nicht abgeschätzt werden. Erst die praktische<br />
Nachfrage am Weltmarkt wird etwaige Schwierigkeiten <strong>und</strong> vor allem den Preis aufzeigen. Die 2004 nach Österreich<br />
importierte Menge an „GVO-freiem“ SES liegt bei ca. 30.000 t/Jahr <strong>und</strong> entspricht etwa 5 % des Gesamt-SES-<br />
Verbrauchs. Als „GVO-freie“ Rohstoffe <strong>und</strong> Futtermittelausgangserzeugnisse mit hohem Eiweißgehalt (SES-<br />
Substitute) kommen neben „GVO-freiem“ SES, Raps-, Sonnenblumenextraktionsschrot, Ackerbohnen-, Erbsen- <strong>und</strong><br />
Lupinenprodukte aus heimischen Eiweißpflanzen, sowie Kartoffeleiweiß, Maiskleber, zunehmend DDGS (Distillers<br />
Dried Grain with Solubles) <strong>und</strong> Hefe in Betracht.<br />
Der Vitamin-, Enzym- <strong>und</strong> Aminosäurebedarf in der Futtermittelherstellung in Österreich wird zu beinahe<br />
zu 100% über Importe gedeckt. Die meisten Futterzusatzstoffe aus den Gruppen der Vitamine, Enzyme <strong>und</strong><br />
Mikroorganismen (Probiotika) sowie die Aminosäure Methionin werden noch zum Großteil ohne den Einsatz von<br />
Gentechnik hergestellt <strong>und</strong> die Versorgung dürfte noch längerfristig gesichert sein. Hingegen werden Phytase, die<br />
Vitamine B2 <strong>und</strong> B12, sowie die Aminosäuren Lysin, Threonin <strong>und</strong> Tryptophan in großem Umfang bzw. vollständig<br />
mit GVM (Gentechnisch Veränderte Mikroorganismen) hergestellt <strong>und</strong> sind nicht oder kaum ohne Einsatz von GVM<br />
am Markt erhältlich. Die Produktion von Futterzusatzstoffen wie Vitamine, Enzyme <strong>und</strong> Aminosäuren scheint eher in<br />
Richtung Fermentation mit GVM zu gehen (geringere Herstellungskosten, geringere Umweltbelastungen, geringerer<br />
Rohstoffbedarf, enormer Konkurrenzdruck aus Asien etc.).<br />
Die Einordnung von Futterzusatzstoffen, die mit Hilfe von gentechnisch veränderten Mikroorganismen (GVM)<br />
hergestellt werden, bedurfte einer Klarstellung der EU-Kommission am 24.9.2004, sodass Zusatzstoffe wie Vitamine,<br />
Enzyme <strong>und</strong> auch Aminosäuren, welche mit GVM hergestellt werden, sofern das Schwellenwerteregime der VO(EG)<br />
1829/2003 eingehalten wird, nicht als GVO gekennzeichnet werden müssen. Mit gentechnisch veränderten<br />
Mikroorganismen (GVM) biofermentativ hergestellte Zusatzstoffe fallen somit, soweit das Schwellenwerteregime der<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 239 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 12: Zusammenfassung<br />
VO(EG) 1829/2003 eingehalten wird, nicht in den Anwendungsbereich der VO(EG) 1829/2003 <strong>und</strong> bedürfen keiner<br />
spezifischen Kennzeichnung als GVO.<br />
Laut österreichischem Codex <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> ist allerdings der Einsatz von GVM nicht zulässig. Der<br />
österreichische Codex für die <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> bestimmt für Zusatzstoffe, dass diese aus „gentechnikfreier“<br />
Erzeugung stammen bzw. nicht mit GVM hergestellt wurden. Vitamin B2, B12, Vitamin C, Phytase, Lysin, Threonin<br />
<strong>und</strong> Tryptophan können daher nur eingesetzt werden, wenn ein Zertifikat bzw. eine Zusicherungserklärung vom<br />
Hersteller über „gentechnikfreie“ Herstellung vorliegt, dessen Gültigkeit sich jeweils nur auf ein Jahr beschränkt.<br />
Diese Zusatzstoffe <strong>und</strong> Aminosäuren werden jedoch gemäß den Recherchen im Rahmen dieser Studie derzeit nicht<br />
bzw. nicht mehr in ausreichenden Mengen ohne GVM hergestellt. Ohne den Einsatz von Aminosäuren <strong>und</strong> Vitaminen<br />
kann jedoch aufgr<strong>und</strong> der vorliegenden Tierhaltungs-, Rassen- <strong>und</strong> Leistungsanforderungen bei Schwein, Geflügel<br />
<strong>und</strong> Pute unter den derzeitigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der konventionellen Landwirtschaft nicht<br />
gearbeitet werden. Auch ein angemessener Tierschutzgedanke sollte, im Hinblick auf die auftretenden<br />
Mangelerscheinungen bei Nichtbeachtung ernährungsphysiologischer Gr<strong>und</strong>sätze in Interaktion von Tierart,<br />
Produktionsform <strong>und</strong> Leistungsniveau, beachtet werden.<br />
In den Achtziger-Jahren wurden von österreichischen <strong>und</strong> anderen europäischen Forschungseinrichtungen zahlreiche<br />
Fütterungsversuche mit der Frage durchgeführt, inwieweit SES durch heimische Eiweißfuttermittel bei<br />
den verschiedenen Tierarten <strong>und</strong> Produktionssparten <strong>und</strong> Leistungsstufen ersetzt werden könnte. Die<br />
damaligen Ergebnisse ergaben, dass SES in der Rinderfütterung relativ problemlos ersetzt werden könnte. Hingegen<br />
zeigten Versuche mit Monogastriern (Schwein, Geflügel), dass das hochwertige Eiweiß von SES, ohne Ausgleich<br />
durch tierisches Eiweiß <strong>und</strong>/oder Aminosäuren, durch andere Pflanzen nicht ersetzt werden kann. Für die vorliegende<br />
Studie wurden Arbeiten von anerkannten <strong>und</strong> unabhängigen Universitäten <strong>und</strong> Institutionen vor allem aus dem<br />
mitteleuropäischen Raum Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien, Slowakei herangezogen. Die Studien mit<br />
Milchvieh <strong>und</strong> Mastrindern, Mastschweinen, Legehennen, Masthühnern <strong>und</strong> Puten wurden in Hinblick auf den Einsatz<br />
der SES-Substitute Ackerbohne, Futtererbse, Lupinen, Raps- <strong>und</strong> Sonnenblumenextraktionsschrot, DDGS, etc. nach<br />
fütterungs- <strong>und</strong> leistungsspezifischen Möglichkeiten genauer betrachtet. Bei Rindern muss auf die erheblichen<br />
Unterschiede in der Eiweißversorgung durch das Gr<strong>und</strong>futter im Grünland- <strong>und</strong> Ackerbaugebiet hingewiesen werden.<br />
Maßgeblich für die Machbarkeit des Einsatzes von SES-Substituten ist, dass bei Analyse der Substitutionsstudien das<br />
jeweilige Leistungsniveau der untersuchten Tierart <strong>und</strong> Produktionsform unbedingt zu berücksichtigen ist, um<br />
Fehlschlüsse zu vermeiden.<br />
Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass diese Studie ausschließlich auf eine wettbewerbsfähige<br />
konventionelle Tierhaltung in Österreich Bezug nimmt. Die Studien <strong>und</strong> Forschungsergebnisse zeigen, dass<br />
der Einsatz von SES-Substituten bei Monogastriern oft nur im niederen bis maximal mittleren Leistungsbereich<br />
möglich ist. Für höhere Leistungsbereiche kann dies allerdings nicht oder nur in entsprechender Kombination mit SES<br />
in Betracht gezogen werden. Beim Ersatz von SES durch andere Eiweißpflanzen ist aus der Sicht der Tierernährung<br />
immer eine Ergänzung mit Aminosäuren <strong>zur</strong> Abdeckung des Bedarfes von monogastrischen Tieren (Schwein, Geflügel<br />
<strong>und</strong> Pute) zu berücksichtigen.<br />
Für die Rinderhaltung (Milch <strong>und</strong> Mast) ist nach derzeitigem Stand der vorliegenden Studien ein vollständiger Ersatz<br />
durch Rapsschrot bzw. –expeller möglich. Da keine heimischen Fütterungsstudien vorliegen, ist eine Extrapolation auf<br />
Gesamtösterreich schwierig. Mit Lupinen liegen zwar interessante aber noch zu wenige Untersuchungen <strong>und</strong><br />
Erfahrungen vor, zudem sind die verfügbaren Mengen vernachlässigbar. Trockenschlempe (DDGS) kann in der<br />
Rinderhaltung laut amerikanischen Empfehlungen mit ausgezeichnetem Erfolg eingesetzt werden. Der Einsatz von<br />
Körnererbse <strong>und</strong> Ackerbohne ist auch aufgr<strong>und</strong> der eher geringen zusätzlich verfügbaren Mengen keine Alternative<br />
zu SES.<br />
In der Geflügel <strong>und</strong> Schweineproduktion – vorbehaltlich neuer Studien <strong>und</strong> Erkenntnisse - kann SES nach derzeitigem<br />
Wissensstand durch heimische Ölfrüchte <strong>und</strong> Eiweißpflanzen nicht vollständig ersetzt werden. DDGS<br />
(Trockenschlempe) kann zukünftig nach Errichtung einer industriellen Anlage <strong>zur</strong> Bioethanolerzeugung <strong>und</strong><br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 240 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 12: Zusammenfassung<br />
entsprechendem Aminosäureausgleich (Lysinergänzung) für alle Tierarten, vor allem bei Rindern, als Substitut für<br />
SES gut verwendet werden.<br />
Auch aus der Umfrage an die Futtermittelwirtschaft geht hervor, dass SES, mit ca. 600.000 t/Jahr,<br />
nicht <strong>zur</strong> Gänze durch Ernteprodukte anderer Pflanzenarten in der Tierernährung ersetzt werden kann.<br />
Die zukünftig aus der Biotreibstoffproduktion anfallenden Mengen an Rapskuchen <strong>und</strong> DDGS könnten<br />
durchaus einen gewissen Teil der Eiweißversorgung bei gleichzeitigem Aminosäureausgleich <strong>und</strong><br />
Phosphorreduktion abdecken. Der Rest müsste durch „GVO-freien“ SES <strong>und</strong> andere Alternativen<br />
ergänzt werden. Die aktuelle Eiweißlücke von 276.000 t Rohprotein in der Tierernährung in Österreich<br />
könnte ab 2007 nach den vorliegenden Erhebungen durch zusätzliche Substitute (vor allem DDGS <strong>und</strong><br />
Rapskuchen) etwa <strong>zur</strong> Hälfte gefüllt werden. „GVO-freier“ SES aus Brasilien scheint seit Kurzem in<br />
ausreichender Menge für Österreich verfügbar zu sein. Dies wird auch durch die Futtermittelwirtschaft<br />
<strong>und</strong> den Landesproduktenhandel sowie international agierende Firmen <strong>und</strong> Zertifizierungsstellen<br />
bestätigt. Für Trockenschlempe <strong>und</strong> Rapsprodukte liegen jedoch nur ausländische Studien vor. Für eine<br />
Extrapolation auf österreichische Verhältnisse wären sicher zusätzliche heimische Forschungsstudien<br />
mit Raps (neuere Sorten) <strong>und</strong> Trockenschlempe von großem Vorteil.<br />
Während gem. VO(EG) 1829/2003 der Einsatz von „GVO-freien“ oder „gentechnikfreien“ SES-<br />
Substituten für den damit erforderlichen Ausgleich mit Zusatzstoffen, unterschiedlich v. a. nach<br />
Tierart, Produktionsform <strong>und</strong> Leistungsstufe keine Begrenzungen vorliegen, ist die Bewertung gemäß<br />
dem österreichischen Codex für die <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> diesbezüglich differenzierter zu<br />
betrachten. Da laut österreichischem Codex <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> der Einsatz von GVM nicht<br />
zulässig ist <strong>und</strong> die Zusatzstoffe wie die Vitamine B2, B12, weiters Phytase, Lysin, Threonin <strong>und</strong><br />
Tryptophan nahezu ausschließlich bzw. Vitamin C in großem Umfang mit gentechnisch veränderten<br />
Mikroorganismen (GVM) hergestellt werden, werden der Umsetzbarkeit dieser Codexrichtlinie enge<br />
Grenzen gesetzt. In diesem Zusammenhang sei auch auf die mangelnde Überprüfbarkeit des Einsatzes<br />
von „gentechnikfreien“ Betriebsmitteln in einer „GVO-freien“ oder „gentechnikfreien“ Sojabohnen- <strong>und</strong><br />
folglich SES-Erzeugung in Drittländern verwiesen. In der nachstehenden Tabelle wird eine<br />
vergleichende Betrachtung <strong>und</strong> ein Resümee der Machbarkeit, einerseits unter Berücksichtigung der<br />
Anforderungen „GVO-frei“ <strong>und</strong> andererseits unter Berücksichtigung der Anforderungen der<br />
österreichischen Codex-Richtlinie <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> von <strong>„gentechnikfrei“</strong> dargestellt. Es werden in dieser<br />
vergleichenden Matrix ausschließlich ernährungsphysiologische Gesichtspunkte <strong>und</strong> die Verfügbarkeit<br />
von Rohstoffen <strong>und</strong> Zusatzstoffen in den geforderten Qualitäten für die Futtermittelherstellung<br />
berücksichtigt. Eine detaillierte Analyse dazu findet sich in der Studie.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 241 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 12: Zusammenfassung<br />
BETRACHTUNG <strong>und</strong> RESÜMEE der Machbarkeit zu den Anforderungen der Ernährungsphysiologie, derzeitiger Verfügbarkeit <strong>und</strong> gesetzlichen<br />
Rahmenbedingungen (ohne ökonomische Bewertung) unter Berücksichtigung der Anforderungen nicht kennzeichnungspflichtiger Rohstoffe gemäß<br />
VO(EG) 1829/2003 <strong>und</strong> der Anforderungen der österreichischen Codex-Richtlinie <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> von <strong>„gentechnikfrei“</strong><br />
Ration „GVO-frei“ „Gentechnik- „GVO-frei“ „Gentechnik- Bemerkungen<br />
VO(EG) frei“<br />
VO(EG)<br />
frei“<br />
Tierart 1829/2003: Codex: 1829/2003: Codex:<br />
n.k. SES SES<br />
n.k. Substitute Substitute<br />
Mit Raps als alleiniges Substitut sind laut Studien<br />
Milchvieh erfüllt<br />
erfüllt<br />
erfüllt*<br />
erfüllt*<br />
gleichwertige Leistungen erzielbar, in der Praxis sind in<br />
Hochleistungsbereichen Leistungseinbußen möglich,<br />
mit Ackerbohne, Erbse oder Sonnenblume jedoch<br />
Mastrind erfüllt<br />
erfüllt<br />
erfüllt*<br />
erfüllt*<br />
wahrscheinlich .( *)<br />
AS, Vit. B2+ B12 sind hier nicht zwingend erforderlich.<br />
**Zusatzstoffmangel (Lysin, Vit.B2+B12)<br />
Mastschwein erfüllt<br />
nicht erfüllt** nicht erfüllt*** nicht erfüllt**/*** bzw. Mangelerscheinungen <strong>und</strong>/ oder<br />
***Leistungseinbußen<br />
Legehenne<br />
Masthuhn<br />
Pute<br />
Erklärungen<br />
u.b.V.:<br />
unter<br />
bestimmten<br />
Voraus-<br />
setzungen<br />
erfüllt<br />
erfüllt<br />
erfüllt<br />
nicht erfüllt**<br />
nicht erfüllt**<br />
nicht erfüllt**<br />
SES verfügbar SES<br />
(Hard IP)<br />
verfügbar<br />
** Codex<br />
wegen AS <strong>und</strong><br />
Vit. B2+B12<br />
NICHT<br />
erfüllbar<br />
nicht erfüllt***<br />
nicht erfüllt***<br />
nicht erfüllt***<br />
Insgesamt<br />
un<strong>zur</strong>eichende<br />
Verfügbarkeit<br />
der Substitute<br />
*** Leistungs-<br />
minderung<br />
nicht erfüllt**/***<br />
nicht erfüllt**/***<br />
nicht erfüllt**/***<br />
Insgesamt<br />
un<strong>zur</strong>eichende<br />
Verfügbarkeit der<br />
Substitute<br />
***Leistungs-<br />
minderung<br />
** Codex wegen AS<br />
<strong>und</strong> Vit. B2+ B12<br />
NICHT erfüllbar<br />
**Zusatzstoffmangel (Vit. B2+B12)<br />
bzw. schwere Mangelerscheinungen <strong>und</strong> /oder<br />
***Leistungseinbußen<br />
**Zusatzstoffmangel (AS, Vit. B2+12)<br />
bzw. Mangelerscheinungen <strong>und</strong>/oder<br />
***Leistungseinbußen <strong>und</strong> Futterverweigerung<br />
Zusammenfassung:<br />
� Codex ist für Monogastrier NICHT umsetzbar<br />
� Codex ist bei Rindern u.b.V. umsetzbar<br />
� Substitute sind für Monogastrier NICHT<br />
vergleichbar umsetzbar.<br />
� Substitute sind für Rinder u.b.V. umsetzbar.<br />
AS – Aminosäuren; Vit. – Vitamin; SES – Sojaextraktionsschrot ; GVO – gentechnisch veränderte Organismen; IP – Identity Preservation; „GVO-frei“: studieneigene Definition<br />
für nichtkennzeichnungspflichtige Rohstoffe; „Gentechnikfrei“: Definition nach Codex ; n.k.: nicht kennzeichnungspflichtig nach VO (EG) 1829/20003<br />
Seite 242 von 272 Seite 242 von 272<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 12: Zusammenfassung<br />
� Probenahme- <strong>und</strong> Analytik im Zusammenhang mit GVO:<br />
Erheblicher zusätzlicher Aufwand für die Implementierung <strong>und</strong> dauerhafte Umsetzung eines<br />
Qualitätsprogrammes für „gentechnikfreie“ oder „GVO-freie“ tierische Lebensmittel, insbesondere in<br />
der Futtermittelwirtschaft <strong>und</strong> in der landwirtschaftlichen Produktion, wird durch die zu setzenden<br />
Qualitätsmanagement- <strong>und</strong> Qualitätssicherungsmaßnahmen bestimmt. Davon nehmen die Kosten für die<br />
Probenahme <strong>und</strong> Untersuchung auf eine GVO-Verunreinigung einen maßgeblichen Anteil in Anspruch. Die Studie<br />
geht überblicksmäßig auf die Anforderungen einer repräsentativen Probenahme entlang des Produktionsprozesses<br />
beginnend von Saatgut über das Erntegut <strong>und</strong> die Rohstoffe bis hin zum fertigen Futtermittel, ein. Bezug wird auch<br />
auf die Prinzipien <strong>und</strong> Limitationen der GVO-Analytik genommen. Besondere Beachtung sollte somit nicht nur der<br />
Problematik der Quantifizierung in verarbeiteten Produkten – Futtermittel <strong>und</strong> Lebensmittel – sondern auch der<br />
Machbarkeit <strong>und</strong> der Kosten der erforderlichen Identifizierung der GVO-Verunreinigungen gemäß dem<br />
Schwellenwerte-/Grenzwerte-Regime der VO(EG) 1829/2003 gewidmet werden. Die Zuverlässigkeit der<br />
Probenahme- <strong>und</strong> Analytikmethoden bestimmen maßgeblich die Anforderungen <strong>und</strong> Kriterien v. a. für die Umsetzung<br />
<strong>und</strong> das Monitoring eines Qualitätsprogrammes <strong>und</strong> damit auch einen zuverlässigen Täuschungsschutz.<br />
� Betrachtungen zu einem effektiven <strong>und</strong> effizienten Monitoring- <strong>und</strong> Überwachungssystem für<br />
die Sicherstellung der Anforderungen eines Qualitätsprogrammes:<br />
Eine zentrale Aufgabe der Studie war die Auseinandersetzung mit <strong>und</strong> die Betrachtung zu einem effektiven<br />
<strong>und</strong> effizienten Monitoring- <strong>und</strong> Überwachungssystem für die Sicherstellung der Anforderungen eines<br />
Qualitätsprogrammes <strong>und</strong> damit auch des Schutzes des Konsumenten vor Täuschung. Es war nicht<br />
Gegenstand der Studie einen statistisch abgesicherten <strong>und</strong> risikobasierten Probenahmeplan für ein<br />
Qualitätsmanagementsystem (QM-System) <strong>und</strong> Monitoring in den verschiedenen Prozessebenen der Produktionskette<br />
zu entwickeln. Dazu bedarf es insbesondere einer Fall zu Fall – Analyse <strong>und</strong> eines konkreten Anforderungsprofils<br />
eines Qualitätsprogrammes.<br />
Im Rahmen der Studie wurde allerdings eine generische Betrachtung der Anforderungen für die Sicherung eines<br />
zuverlässigen <strong>und</strong> nachhaltigen Qualitätsprogrammes vom Erzeuger bis zum Konsumenten, insbesondere für den<br />
Bereich Futtermittelerzeugung <strong>und</strong> Futtermittelanwendung vorgenommen. Prozessschritte im Produktions- <strong>und</strong><br />
Logistikablauf mit hohem Potential einer Vermengung mit GVO <strong>und</strong> einer GVO-Verunreinigung wurden analysiert. In<br />
detaillierten Flussdiagrammen wurde das jeweilige Qualitätsmanagementsystem im Hinblick auf die erforderliche<br />
Eigenkontrolle <strong>und</strong> ein externes Monitoring gegliedert dargestellt.<br />
Die im Rahmen der Studie durchgeführten Probenahmen <strong>und</strong> Untersuchungen von als „GVO-frei“ deklarierten<br />
Rohstoffen <strong>und</strong> Futtermitteln von 16 Proben ergaben für 7 Proben einen negativen GVO-Nachweis <strong>und</strong> bei 8 Proben<br />
eine Quantifizierung unter 0,1 %. Nur für eine Probe SES ergab die Quantifizierung eine GVO-Verunreinigung mit 0,2<br />
% „Ro<strong>und</strong>upReady TM -Soja“. Gestützt durch diese Ergebnisse kann die Aussage getroffen, dass es möglich ist, in<br />
Futtermittelwerken, wo kein konventioneller SES eingesetzt wird, verschleppungs- <strong>und</strong> verunreinigungsfrei zu<br />
produzieren.<br />
Im Kontext mit der aktuellen Literatur wird folgendes Anforderungsprofil für eine angemessene Zuverlässigkeit eines<br />
Qualitätsprogrammes <strong>und</strong> dessen Monitoring zusammengefasst:<br />
� „GVO-freie“ oder „gentechnikfreie“ Produktion sollte vom Rohstofflieferanten bis hin zum Landwirt ausschließlich<br />
in getrennten <strong>und</strong> geschlossenen Prozessen erfolgen.<br />
� Ein dokumentierter Warenfluss entlang der gesamten Erzeugungskette insbesondere beim jeweiligen Waren-<br />
eingang mit Prüfung des GVO-Status der Ware ist eine unverzichtbare Maßnahme.<br />
� Auf das externe Monitoring z.B.: bei der Anlieferung am Hafen soll dabei größtes Augenmerk gelegt werden. Nur<br />
wenn die Analyse am Hafen die „GVO-Freiheit“ bestätigt, sollte das Produkt als „GVO-frei“ oder <strong>„gentechnikfrei“</strong><br />
vermarktet werden können.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 243 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 12: Zusammenfassung<br />
� Ein risikobasierter Stichprobenplan mit definierten Prüfungen für die Rohstoffe, für Gr<strong>und</strong>-, Einzel- <strong>und</strong><br />
Mischfutter ist einerseits entlang der Produktionskette für die Futtermittelerzeugung <strong>und</strong> andererseits im Rahmen der<br />
Futtermittelanwendung Teil eines zuverlässigen QM-Systems <strong>zur</strong> Sicherstellung der „GVO-Freiheit“ oder<br />
„Gentechnikfreiheit“. Die Abstimmung der Maßnahmensetzung der Eigenkontrolle <strong>und</strong> des externen Monitorings dient<br />
dabei der Implementierung eines effektiven <strong>und</strong> effizienten QM-Systems <strong>zur</strong> Sicherstellung der Anforderungen eines<br />
Qualitätsprogrammes.<br />
� Die Implementierung eines effektiven <strong>und</strong> überprüfbaren QM-Systems, das alle qualitätsrelevanten<br />
Produktionsprozesse berücksichtigt, erfordert u. a. die Erstellung einer Verunreinigungs- <strong>und</strong>/oder<br />
Kontaminationsmatrix in den verschiedenen Produktionsstufen <strong>und</strong> v. a. umfassende Schulung der handelnden<br />
Personen.<br />
In der nachfolgenden Abbildung werden mögliche Vermengungen, Verschleppungen <strong>und</strong> Verunreinigungsquellen<br />
entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Überblick aufgezeigt.<br />
Verwilderte GVO´s<br />
Saatgut<br />
Dünger<br />
Pollendrift<br />
Landw. Erzeugung<br />
der<br />
Rohstoffe<br />
nicht erlaubte Futtermittel,<br />
Hilfsstoffe<br />
Erntemaschinen<br />
Hilfsstoffe<br />
Pflanzenschutz<br />
Umstellzeiten bei<br />
Zukauf von Tieren<br />
nicht eingehalten<br />
£££<br />
Landwirt<br />
tierische<br />
Produktion<br />
Verunreinigungen<br />
Transport<br />
<strong>und</strong><br />
Lager<br />
Verunreinigungen<br />
Transport<br />
<strong>und</strong><br />
Lager<br />
nicht erlaubte<br />
Hilfsstoffe<br />
nicht erlaubte<br />
Hilfsstoffe<br />
Mühle<br />
SES<br />
Verschleppungen<br />
Verarbeitung<br />
tierische<br />
Produkte =<br />
Lebensmittel<br />
Verpackungsmaterial<br />
Verunreinigungen<br />
Transport<br />
<strong>und</strong><br />
Lager<br />
Verunreinigungen<br />
Transport<br />
<strong>und</strong><br />
Lager<br />
nicht erlaubte<br />
Hilfsstoffe<br />
FM Werk<br />
<strong>und</strong>/oder<br />
Handel<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Verpackungsmaterial<br />
Verschleppungen<br />
Verpackungsmaterial<br />
Handel /<br />
Verteiler<br />
Verunreinigungen<br />
Transport<br />
<strong>und</strong><br />
Lager<br />
Konsument<br />
Seite 244 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 12: Zusammenfassung<br />
� Das Anforderungsprofil für ein zuverlässiges <strong>und</strong> nachhaltiges Qualitätsprogramm im Bereich der Futtermittel-<br />
anwendung <strong>und</strong> Tierhaltung in der Landwirtschaft fordert zusätzlich die Erfüllung folgender Punkte, wenn die<br />
<strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> gemäß den Codex-Richtlinien erfolgt:<br />
In der Futtermittelerzeugung <strong>und</strong> der Futtermittelanwendung wird von getrennten <strong>und</strong> geschlossenen Produktions-<br />
prozessen für den „gentechnikfreien“ Betriebszweig ausgegangen, um eine zuverlässige Umsetzung eines<br />
Qualitätsprogrammes gewährleisten zu können. Am landwirtschaftlichen Betrieb ergeben sich gemäß des<br />
Anforderungsprofils des österreichischen Codex <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> ein maßgeblich aufwendigeres<br />
externes Monitoring <strong>und</strong> Eigenkontrollsystem als im Falle der Umsetzung für „GVO-freie“ Futter- <strong>und</strong> Lebensmittel<br />
aus tierischer Erzeugung. Die zusätzlichen Vorgaben gemäß Codexrichtlinie werden nachfolgend zusammenfassend<br />
dargestellt:<br />
• zusätzliche Anforderungen im Bezug auf den Betriebsmitteleinsatz in der landwirtschaftlichen Produktion von<br />
Futtermittelrohstoffen bzw.- Futtermittelausgangserzeugnissen<br />
• zusätzliche Anforderungen im Bezug auf die Mengenbegrenzungen „differenzierter Qualitäten“ von SES in der<br />
Futterration<br />
• zusätzliche Anforderungen im Bezug auf den Zukauf der Zusatzstoffe <strong>und</strong><br />
• zusätzliche Anforderungen im Bezug auf die Umstellungszeiträume in der Fütterung <strong>und</strong> der Tierhaltung<br />
Diese Anforderungen sind in einem entsprechenden QM-System sicherzustellen. Dies erfordert u. a. die<br />
Dokumentation aller Zu- <strong>und</strong> Abgänge im Tierbereich mit Begleitpapieren nach geforderter Statuskennzeichnung <strong>und</strong><br />
Berücksichtigung der Erfordernisse für eine Umstellung inkl. Umstellungszeiträume. Dazu gehört u. a. der Nachweis<br />
der geforderten Übergangsfristen beim Tierzukauf etc..<br />
� Differenzkosten bei der Erzeugung von tierischen Lebensmitteln bei Einsatz von<br />
„gentechnikfreien“ oder „GVO-freien“ Futterrationen im Vergleich zu als GVO<br />
gekennzeichneten Futterrationen sowie Kostenbetrachtung für tierische Lebensmittel in<br />
Österreich:<br />
Bei der Betrachtung <strong>und</strong> Analyse der Differenzkosten <strong>und</strong> der Gesamtkosten bei der Erzeugung von tierischen<br />
Lebensmitteln bei Einsatz von „gentechnikfreien“ oder „GVO-freien“ Futterrationen im Vergleich zu als GVO<br />
gekennzeichneten Futtermitteln <strong>und</strong> Futterrationen wurde einerseits die Einschätzung des Landesproduktenhandels<br />
<strong>und</strong> der Futtermittelwirtschaft eingeholt <strong>und</strong> es wurden andererseits an Hand von Modellanstellungen mit<br />
begründeten Annahmen zu den Kostenfaktoren umfassende Berechnungen vorgenommen.<br />
Zusammenfassend rechnet der Landesproduktenhandel <strong>und</strong> die Futtermittelwirtschaft v.a. mit erhöhten<br />
Rohstoffkosten, zusätzlichen Kosten für QM-Maßnahmen <strong>und</strong> erhöhtem logistischen Aufwand. Die Quantifizierung der<br />
Differenzkosten variiert beträchtlich, dies auch deshalb, da letztlich der Markt für „GVO-freie“ oder „gentechnikfreie“<br />
Rohstoffe <strong>und</strong> das Anforderungsprofil eines Qualitätsprogrammes die Kosten maßgeblich bestimmen werden <strong>und</strong> zu<br />
diesen Faktoren derzeit konkrete Fakten fehlen. Aus der Befragung ist anzunehmen, dass ohne Verteuerung der<br />
tierischen Lebensmittel eine Umstellung auf „Gentechnikfreiheit“ oder „GVO-Freiheit“ nicht möglich sein wird, da<br />
speziell vom landwirtschaftlichen Großhandel ein starker Anstieg des schon jetzt höheren Preises von „GVO-freiem“<br />
SES, aufgr<strong>und</strong> erhöhter Nachfrage, befürchtet wird. Die Einschätzung von Kosten- <strong>und</strong> Preissteigerungen variieren<br />
von etwa 5 % bis etwa 20 % für „GVO-freien“ SES oder „GVO-freie“ oder „gentechnikfreie“ Substitute. Dazu ist<br />
anzumerken, dass damit noch nicht die voraussichtlich zusätzlichen Kosten in der Tierhaltung <strong>und</strong> Fütterung auf den<br />
landwirtschaftlichen Betrieben <strong>und</strong> folglich in der Lebensmittelwirtschaft zum Ausdruck kommen. Insbesondere bei<br />
Erfüllung der Anforderungen gemäß der Codex-Richtlinie <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> ist es für die Einschätzung<br />
der wahren Kosten unerlässlich, den Aspekt möglicher Leistungseinbußen v.a. bei Monogastriern, neben der<br />
Umsetzung der anderen zusätzlichen Anforderungen, durch ernährungsphysiologisch nicht abgestimmte Rationen<br />
(v.a. ab dem mittleren Leistungsniveau), was beträchtliche Auswirkungen auf den wirtschaftlichen Erfolg in der<br />
Tierhaltung haben kann, in die Überlegungen einzubeziehen.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 245 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 12: Zusammenfassung<br />
Die umfassenden Berechnungen <strong>und</strong> die Analyse der potentiellen Differenzkosten erfolgen u.a. auf der Gr<strong>und</strong>lage<br />
einer für die österreichische Tierhaltung repräsentativen <strong>und</strong>/oder wissenschaftlich basierten Auswahl von insgesamt<br />
184 Futterrationen, die von Fütterungsberatern <strong>und</strong> Experten der Futtermittelwirtschaft in Österreich evaluiert<br />
wurden. Als Basis für die Berechnung der Differenzkosten dienen die Futterkosten bei konventioneller Produktion,<br />
d.h. als mit GVO gekennzeichneten Futtermitteln. Die Differenzkosten ergeben sich aus der Differenz zwischen den<br />
jeweiligen Modellrationen “GVO-frei“ oder <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> GVO gekennzeichneten Futtermitteln. Die<br />
Differenzkosten werden als prozentueller Minder- oder Mehraufwand im Verhältnis <strong>zur</strong> konventionellen Produktion als<br />
mit GVO gekennzeichneten Futtermitteln (=100 %) ausgedrückt. Auf die Vergleichbarkeit der Futterrationen<br />
innerhalb der 5 Varianten (gleicher Protein-, Aminosäure- <strong>und</strong> Energiegehalt) für die jeweiligen Leistungsstufen bei<br />
den einzelnen Tierarten wurde im Besonderen Bedacht genommen. Weitere Kostenelemente wurden soweit diese<br />
von der Futtermittelwirtschaft verfügbar waren, in die Berechnungen einbezogen bzw. sind in der Studie angeführt.<br />
Anzumerken ist, dass die Berechnungen auf der Basis begründeter Modellannahmen vorgenommen wurden. Einige<br />
mögliche Kostenelemente sind aktuell nicht ausreichend quantifizierbar <strong>und</strong> daher nicht im Berechnungsmodell<br />
berücksichtigt. Für die Kostenberechnungen werden ausschließlich tiergerechte <strong>und</strong> ernährungsphysiologisch<br />
zulässige Futterrationen eingesetzt. Weiters wird vorausgesetzt, dass die Futtermittel in ausreichendem Ausmaß<br />
verfügbar sind.<br />
Die Ergebnisse einer vergleichenden Betrachtung der Angaben der Mischfutterhersteller <strong>und</strong> der Erkenntnisse aus<br />
den Berechnungen der Studie decken sich weitestreichend. Von den Mischfutterherstellern wurde angegeben, dass<br />
Differenzkosten für die Produktion von „GVO-freien“ oder „gentechnikfreien“ Futtermitteln durch folgende Faktoren<br />
entstehen:<br />
• erhöhte Rohstoffkosten<br />
• erhöhter logistischer Aufwand<br />
• zusätzliches Qualitätsmanagement<br />
• erhöhte Lagerkosten <strong>und</strong><br />
• die mögliche Errichtung einer zusätzlichen Produktionsschiene<br />
In den Modellberechnungen im Rahmen dieser Studie wurden zu den einzelnen Punkten folgende Ergebnisse<br />
ermittelt:<br />
• Erhöhte Rohstoffkosten treten bei der Beschaffung von „GVO-freiem“ oder „gentechnikfreiem“ SES <strong>und</strong> „GVO-<br />
freien“ oder „gentechnikfreien“ Zusatzstoffen auf (soweit <strong>„gentechnikfrei“</strong> verfügbvar). Bei SES 44 liegen die<br />
Rohstoffkosten für die „GVO-freie“ Ware im Erhebungszeitraum 2003/2004 um ca. 16 % über den Rohstoffkosten<br />
des kennzeichnungspflichtigen SES 44. Aufgr<strong>und</strong> einer erhöhten Nachfrage wird jedoch laut Umfrage an die<br />
Mischfutterindustrie <strong>und</strong> den österreichischen Landesproduktenhandel ein Preisanstieg von 5 bis 20 % für die „GVO-<br />
freie“ Ware erwartet. Exakte Prognosen für zukünftige Preisentwicklungen können freilich nicht abgegeben werden.<br />
• Erhöhte Logistikkosten entstehen möglicherweise aufgr<strong>und</strong> von geringeren Beschaffungsmengen im<br />
Futtermittelwerk <strong>und</strong> größerer Zustellradien zu den Landwirten. Sie werden von der Futtermittelindustrie, im<br />
speziellem vom Verband der Futtermittelindustrie, mit € 7,- je t Mischfutter bzw. je t SES im Handel für den<br />
Transport zu den Landwirten angegeben. Als zusätzliche Logistikkosten für den Beschaffungsmarkt entstehen den<br />
Futtermittelwerken weitere € 2,- je t bezogenes Eiweißfuttermittel.<br />
• Die Kosten, die für das externe Monitoring zum Qualitätsprogramm entstehen, betragen durchschnittlich ca. €<br />
120,- je landwirtschaftlichem Betrieb <strong>und</strong> durchschnittlich ca. € 900,- je Futtermittelwerk <strong>und</strong> Jahr. Nicht<br />
berücksichtigt sind darin die voraussichtlich höheren Kosten für zusätzliche Qualitätssicherungsmaßnahmen<br />
einschließlich der Aufwendungen für Eigenkontrollen.<br />
• Erhöhte Lagerkosten treten nur dann auf, wenn in einem Werk eine zweite Produktionsschiene errichtet werden<br />
muss. Deren Errichtung, die eine Überschneidung der Warenströme verhindert, ist dann notwendig, wenn in einem<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 246 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 12: Zusammenfassung<br />
Werk GVO-gekennzeichnetes <strong>und</strong> „GVO-freies“ oder „gentechnikfreies“ Futter nebeneinander produziert oder<br />
gehandelt wird. Es liegen aber keine Zahlen vor, die Auskunft über die Höhe solcher Kosten geben.<br />
Wenngleich verschiedene Kostenelemente in den Modellberechnungen (u. a. potentielle zusätzliche Kosten für die<br />
Umstellung, insbesondere im Zusammenhang mit dem Zukauf von Tieren, der Administration, zusätzliche Kosten für<br />
Schadenersatz <strong>und</strong> Versicherung sowie mögliche Leistungseinbußen durch Futterwechsel, weiters werden für die<br />
Vorbereitung <strong>und</strong> Begleitung von Kontrollen Kosten von ca. 50.000 € pro Futtermittelwerk <strong>und</strong> Jahr sowie mangelnde<br />
Auslastung insbesondere Umsatzrückgänge mit Kosten von 10 € je t durch die Futtermittelwirtschaft beziffert, etc.)<br />
unberücksichtigt blieben, gibt das Ergebnis doch eine deutliche Differenzierung der potentiellen Kostenbelastung für<br />
die einzelnen Tierarten <strong>und</strong> Produktionsformen wider. Die Kosten für den Einsatz der SES-Substitute dürften auf der<br />
Basis der den Berechnungen zugr<strong>und</strong>e liegenden Modellannahmen unterschätzt worden sein (Verfügbarkeit<br />
beachten). Es sollten daher zu untenstehenden Minderkosten mögliche Folgekosten in zusätzliche Logistik,<br />
kontinuierliche Versorgung in den Futter-rationen <strong>und</strong> u.a. mögliche Leistungsminderungen in der Tierproduktion<br />
zukünftig für eine Kostenrechung in Betracht gezogen werden. Es bedarf allerdings durch weitere Untersuchungen<br />
einer qualitativen <strong>und</strong> quantitativen Bewertung dieser möglichen zusätzlichen Kostenelemente beim Einsatz von SES-<br />
Substituten in der Tierernährung.<br />
Die uneingeschränkte Verfügbarkeit aller Rohstoffe wurde zu Berechnungszwecken angenommen. Allerdings ist die<br />
Verfügbarkeit von Substituten <strong>und</strong> bestimmten Zusatzstoffen nach Codex derzeit nicht ausreichend gegeben<br />
(Verfügbarkeit Substitute in Österreich siehe Kapitel 3, Tabelle 3-24, Verfügbarkeit Zusatzstoffe nach Codex siehe<br />
Kapitel 4, Tabelle 4-11) <strong>und</strong> können daher <strong>zur</strong> Abschätzung der Differenzkosten derzeit nicht herangezogen werden.<br />
• Im Rinderbereich, sowohl in der Milchproduktion als auch in der Rindermast, kommt es sofern Grünland <strong>und</strong><br />
Grünlanderzeugnisse die Gr<strong>und</strong>futterbasis bilden, durch den Einsatz von „GVO-freiem“ SES nur zu geringen<br />
Mehrkosten. Bei Mais als Gr<strong>und</strong>futter sind die zusätzlichen Kosten erheblich höher. In der Schweinemast liegen<br />
sowohl bei Eigenmischung, als auch bei Zukauffutter Mehrkosten durch die Umstellung auf die Fütterung von „GVO-<br />
freiem“ SES vor. Im Geflügelbereich ergeben sich durch den ernährungsphysiologisch erforderlichen hohen Anteil von<br />
„GVO-freiem“ SES in allen Fütterungsvarianten deutliche Mehrkosten. Die Mehrkosten sind bei Puten am höchsten.<br />
Besonders wird darauf hingewiesen, dass von den unter den Auflagen eines Qualitätsprogrammes erzeugten<br />
Produkten nicht alle den Qualitätskriterien dieses Qualitätsprogrammes entsprechen. Die für die Gesamtproduktion<br />
entstehenden Mehrkosten müssen allerdings von den tatsächlich vermarkteten Qualitätsprogramm-Produkten<br />
getragen werden.<br />
Die Ergebnisse der Modellberechnungen zeigen, dass es einer Fall zu Fall Bewertung bedarf, um die Kosten<br />
signifikant einzuschätzen. Die aus der Biotreibstofferzeugung anfallenden „GVO-freien“ SES-Substitute sind v. a.<br />
unter den Bedingungen für nicht kennzeichnungspflichtige Futtermittel gemäß VO(EG) 1829/2003 eine auch<br />
ökonomisch interessante Alternative, vorausgesetzt die Preisbildung am Markt verändert sich zukünftig nicht in<br />
Relation zum Preis von SES.<br />
In der nachfolgenden Matrix werden zusammenfassend die Kostenelemente, welche in der Berechnung der<br />
Futterdifferenzkosten berücksichtigt <strong>und</strong> nicht berücksichtigt wurden, dargestellt.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 247 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 12: Zusammenfassung<br />
Anfallende Kosten bei „gentechnikfreier“<br />
oder „GVO-freier“ Produktion<br />
FM Handel FM Werk Landwirt<br />
Rohstoffkosten (gewichtet aus den<br />
Jahren 2003 <strong>und</strong> 2004)<br />
(Beim Wiederkäuer nur Kraftfutter)<br />
berücksichtigt berücksichtigt berücksichtigt<br />
Zusatzstoffkosten<br />
nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt<br />
(nicht vorhanden in den (nicht vorhanden in den (nicht vorhanden in den<br />
Jahren 2003 <strong>und</strong> 2004) Jahren 2003 <strong>und</strong> 2004) Jahren 2003 <strong>und</strong> 2004)<br />
Gr<strong>und</strong>futterkosten wie Heu,<br />
Maisganzpflanzen- <strong>und</strong> Grassilage<br />
fallen nicht an fallen nicht an fallen nicht an<br />
Erhöhte Logistikkosten berücksichtigt<br />
berücksichtigt<br />
berücksichtigt<br />
(Beschaffung für FM (Beschaffung für FM (Beschaffung für<br />
Handel, 2 €/t,<br />
Werk, 2 €/t, Zustellung Selbstmischer, 9 €/t)<br />
Zustellung zum<br />
Landwirt, 7 €/t)<br />
zum Landwirt, 7 €/t)<br />
Kontrollkosten durch externe Kontrolle nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt<br />
Externe Untersuchungskosten nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt<br />
Eigenkontrolle am Betrieb nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt<br />
Einmalige Umstellkosten nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt<br />
Einmalige Investitionskosten nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt<br />
Verwaltungs- <strong>und</strong><br />
Dokumentationskosten<br />
nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt<br />
Mehrkosten für Zukauf von Tieren<br />
(nach Codex)<br />
fallen nicht an fallen nicht an nicht berücksichtigt<br />
Kosten für Haftungsübernahme nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt<br />
Tierarztkosten fallen nicht an fallen nicht an nicht berücksichtigt<br />
Mögliche Leistungseinbußen bei den<br />
Tieren<br />
fallen nicht an fallen nicht an nicht berücksichtigt<br />
Preisänderungen bei Rohstoffen nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt<br />
Mehrkosten für andere nicht als<br />
<strong>„gentechnikfrei“</strong>, mit entsprechenden<br />
Zuschlägen, vermarktbare<br />
Nutzungsrichtungen/Tiergattungen<br />
nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt<br />
höherer Managementaufwand nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt<br />
Verfügbarkeit von Roh- <strong>und</strong><br />
Zusatzstoffe<br />
Anfallende zusätzliche Kosten beim<br />
„Codex“ im Vergleich zu EG/VO<br />
1829/2003<br />
nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt<br />
a) Düngemittel/Pflanzenschutzmittel in<br />
der Pflanzenproduktion<br />
nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt<br />
b) Nichtverwendung von GVM in der<br />
Zusatzstoffproduktion<br />
nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt<br />
c) Differenzierung von „Soft- <strong>und</strong> Hard-<br />
IP mit Begrenzungen in der<br />
Anwendung“ (ohne Standardvorgabe)<br />
nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt<br />
d) Aufwand im Zusammenhang mit den<br />
Umstellungszeiträumen<br />
nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt<br />
e) zusätzliche Kosten für die<br />
Komposition von Futterrationen<br />
aufgr<strong>und</strong> verminderter Verfügbarkeit<br />
der Roh- <strong>und</strong> Zusatzstoffe <strong>und</strong> damit<br />
verb<strong>und</strong>ener Kosten (Logistik,<br />
Administration, Vorratshaltung,<br />
Produktionsausfälle, Verwaltung etc.)<br />
nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt<br />
f) zusätzliche Kontrollkosten, Kosten für<br />
das Haftungsrisiko, mögliche<br />
zusätzliche Investitionskosten etc.<br />
betreffend der Punkte a) bis e)<br />
nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 248 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 12: Zusammenfassung<br />
� Zeitrahmen bis <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> der „Gentechnikfreiheit“ oder „GVO-Freiheit“:<br />
Für die Einführung eines Qualitätsprogrammes ist der erforderliche Zeitrahmen <strong>zur</strong> Schaffung<br />
technischer, logistischer, rechtlicher <strong>und</strong> marketingrelevanter Voraussetzungen von hohem Interesse.<br />
Die Umsetzung eines derartigen Qualitätsprogrammes setzt Maßnahmen in der Rohstoff- <strong>und</strong><br />
Zusatzstoffrequirierung inklusive vertraglicher Sicherungen der Rohstoffe <strong>und</strong> Zusatzstoffe voraus. Weiters ist die<br />
Sicherstellung entsprechender Logistik in Transport, Lagerung <strong>und</strong> Bearbeitung des Rohstoffes bis hin <strong>zur</strong> Bewertung<br />
<strong>und</strong> Einführung allfälliger Substitute von SES notwendig. Die Verfügbarkeit „GVO-freier“ oder „gentechnikfreier“<br />
Rohstoffe <strong>und</strong> „GVO-freier“ oder „gentechnikfreier“ Zusatzstoffe ist einerseits für die Futtermittelindustrie <strong>und</strong><br />
andererseits auch für den Vertrieb an die selbst mischenden Landwirte (Selbstmischer) sicherzustellen. Die<br />
Bewertung des Zeitrahmens setzt auch entsprechende Maßnahmen in Futtermittelwerken <strong>zur</strong> Schaffung getrennter<br />
<strong>und</strong> geschlossener Produktionslinien voraus. Desgleichen bedarf es entsprechender Maßnahmen auf den<br />
landwirtschaftlichen Betrieben. Der Zeitrahmen wird auch durch die ebenfalls erforderlichen Vorkehrungen in<br />
lebensmittelbe- <strong>und</strong> verarbeitenden Betrieben bestimmt. Letztlich gilt es in den Betrieben Eigenkontrollsysteme<br />
ein<strong>zur</strong>ichten <strong>und</strong> ein übergeordnetes Monitoringsystem, welches die Einhaltung der Qualitätsprogrammvorgaben<br />
sicherstellt bzw. überwacht, zu schaffen. Der Aufbau entsprechender Vertriebskanäle sowie die Setzung von<br />
Marketingmaßnahmen sind ebenfalls innerhalb eines gewissen Zeitrahmens anzusetzen.<br />
Um den Zeitrahmen für die Umstellung auf „GVO-freie“ oder „gentechnikfreie“ Produktion realistisch abschätzen zu<br />
können, müssen auch die Aspekte des Transportes berücksichtigt werden. Der Schiffsweg von Südamerika nach<br />
Europa dauert laut Angaben verschiedener Anbieter ca. 18-21 Tage. Eine zusätzliche Woche kann für den Transport<br />
mit einem Binnenschiff/Bahn/LKW in den österreichischen Hafen an der Donau/nach Österreich gerechnet werden.<br />
Verzögerungen zwischen Dezember <strong>und</strong> März durch zugefrorene Flüsse z.B. Donau sind in diesem Zeitraum noch<br />
nicht mit einkalkuliert.<br />
Der landwirtschaftliche Produktenhandel gab an, bei entsprechender Nachfrage von „GVO-freiem“ SES <strong>und</strong><br />
Produkten – soweit keine anderen Kontrakte bestehen - keine besonderen zeitlichen Vorgaben für einen<br />
Umstellungszeitraum im Hinblick auf die Verfügbarkeit von Rohstoffen <strong>und</strong> Futtermittel-Ausgangserzeugnissen zu<br />
benötigen (wird von den oben angegebenen technischen Fristen abgesehen). Vorsorge im Hinblick auf die<br />
logistischen <strong>und</strong> technischen Prozesse betreffend Lagerung <strong>und</strong> Vertrieb <strong>zur</strong> Einführung von getrennten <strong>und</strong><br />
geschlossenen Prozessketten erfordert auch im Produktenhandel vergleichbar <strong>zur</strong> Futtermittelwirtschaft<br />
entsprechende Umstellungszeiträume.<br />
Etwa zwei Drittel der an einer Umfrage im Zuge dieser Studie beteiligten 32 Futtermittelfirmen (decken deutlich<br />
über 90% der Mischfutterproduktion in Österreich ab) geben einen Umstellungszeitraum von 6 Monate bis zu 2 Jahre<br />
an. Ungefähr 19 % der Futtermittelwerke benötigen keine besonderen Umstellungszeiträume. Bestehende<br />
Lieferverträge, notwendige bauliche Veränderungen <strong>und</strong> bestehende Lagerbestände von als GVO gekennzeichnetem<br />
SES haben laut Angabe der Futtermittelbranche die größten Auswirkungen auf den Umstellungszeitraum.<br />
Anzumerken ist, dass erst ab einer Nachfrage von mehr als 50 % des Marktvolumens eine rentable „GVO-freie“<br />
Futtermittelproduktion von immerhin 41 % der befragten Mischfutterfirmen angegeben wird, wobei ca. 44 % keine<br />
Angaben dazu machten.<br />
Für landwirtschaftliche Betriebe kann betreffend die Futtermittelerzeugung der gleiche Umstellungszeitraum wie<br />
für die Mischfutterproduktion angenommen werden, da hier weitgehend die gleichen technischen Vorraussetzungen<br />
erforderlich sind. Gemäß Codex-Richtlinie <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> ergeben sich allerdings für die einzelnen<br />
Nutztierarten zusätzlich genau definierte Umstellungszeiten. Bei Mastrindern kann dieser Umstellungszeitraum bis zu<br />
15 Monate betragen. Nach VO (EG) 1829/2003 sind keine fütterungstechnischen Umstellungszeiten am<br />
landwirtschaftlichen Betrieb erforderlich. Insgesamt ergeben sich somit für den landwirtschaftlichen Betrieb je nach<br />
Tierart <strong>und</strong> Produktionsform unterschiedliche Umstellungszeiträume, wobei in einer Fall zu Fall-Analyse der<br />
angemessene Umstellungszeitraum festzustellen ist. Eher kurze Umstellungszeiträume sind in der<br />
landwirtschaftlichen Erzeugung in der Milchproduktion zu erwarten.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 249 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 12: Zusammenfassung<br />
Der Zeitrahmen wird auch durch die ebenfalls erforderlichen Vorkehrungen in lebensmittelbe- <strong>und</strong><br />
verarbeitenden Betrieben bestimmt. Die Umstellung kann parallel zu den Prozessen in den Vorstufen der<br />
Produktion erfolgen.<br />
Letztlich gilt es in den Futtermittelwerken, den landwirtschaftlichen Betrieben <strong>und</strong> den lebensmittelbe- <strong>und</strong><br />
verarbeitenden Betrieben Eigenkontrollsysteme ein<strong>zur</strong>ichten. Der Zeitrahmen für die Einrichtung eines<br />
übergeordneten Monitoringsystem, welches die Einhaltung der Qualitätsprogrammvorgaben sicherstellt bzw.<br />
überwacht, wie auch der Aufbau entsprechender Vertriebskanäle sowie die Setzung von Marketingmaßnahmen<br />
können parallel <strong>zur</strong> Umstellung in den Produktionsbereichen erfolgen, so dass im wesentlichen keine zusätzlichen<br />
Zeiträume erforderlich sind.<br />
Die aktuelle Situation im Landesproduktenhandel, der Futtermittelwirtschaft <strong>und</strong> der landwirtschaftlichen Erzeugung<br />
erlaubt im Milchsektor einen relativ raschen Einstieg (ab etwa 6 Monate nach Fixierung der Leistungsmerkmale eines<br />
Qualitätsprogrammes) während in der Fleischerzeugung – insbesondere bei Rindfleisch (v.a. im Falle der Anwendung<br />
der Codexbestimmungen) mit einer zumindest 2-jährigen Umstellung gerechnet werden muss. Der<br />
Umstellungszeitraum wird jedenfalls maßgeblich durch das Anforderungsprofil eines Qualitätsprogrammes bestimmt<br />
werden.<br />
� GVO-Transfer in tierische Lebensmittel:<br />
Eine umfassende Literaturstudie, ob ein unmittelbarer GVO-Transfer in tierische Lebensmittel (Milch,<br />
Fleisch, Eier) möglich sei, r<strong>und</strong>et die Thematik der Studie ab.<br />
Auf der Gr<strong>und</strong>lage der durchgeführten Literaturrecherche konnten DNA-Fragmente von gentechnischen<br />
Veränderungen in tierischen Lebensmitteln (Milch, Fleisch, Eier) nicht nachgewiesen werden. Der horizontale<br />
Gentransfer zwischen GVO <strong>und</strong> Bakterien bzw. die mögliche Auswirkung von exprimierten Proteinen war nicht<br />
Bestandteil der Fragestellung <strong>und</strong> wurde im Rahmen dieser Literaturrecherche nicht mit aufgenommen.<br />
• DNA-AUFNAHME<br />
Den Ergebnissen der Literaturrecherche zufolge werden nach dem Verfüttern von Pflanzenmaterial Pflanzengene<br />
über den Gastrointestinaltrakt der Tiere aufgenommen. Wie aufgr<strong>und</strong> der biochemischen Abbauprozesse von DNA<br />
im Körper nicht anders zu erwarten, wird der weitaus größte Teil der DNA im Magen-Darm-Trakt abgebaut.<br />
Desweiteren ergab die Literaturrecherche, dass im Magen-Darm-Trakt bzw. Blut- <strong>und</strong> Lymphsystem von<br />
Wiederkäuern freie DNA sehr effektiv eliminiert wird, jedoch keine absolute Barriere für Fremd-DNA darstellt.<br />
Es können DNA-Fragmente (insbesondere von Chloroplastengenen) die Darmwand passieren <strong>und</strong> in der Blutbahn<br />
sowie in Gewebezellen <strong>und</strong> Organen des Tieres nachweisbar sein.<br />
• NACHWEIS VON DNA-FRAGMENTEN AUS PFLANZENGENEN<br />
Je nach Tier <strong>und</strong> Futter wurden unterschiedliche Resultate festgestellt. In Rindern wurden kurze DNA-Fragmente<br />
von Pflanzengenen in Blutzellen (Lymphozyten) festgestellt, nicht aber in den übrigen Organen / Geweben wie<br />
Muskel, Leber oder Niere. Vereinzelt konnten pflanzliche DNA-Bruchstücke in Spuren in der Milch nachgewiesen<br />
werden. Einige Literaturstellen deuten darauf hin, dass kleine pflanzliche DNA-Fragmente aus dem Futtermittel die<br />
Darmpassage in Schweinen passieren <strong>und</strong> in tierischen Geweben sowie später noch in rohen Fleischerzeugnissen<br />
nachweisbar sein können. In den Hühnern wurden die kurzen pflanzlichen DNA-Fragmente sowohl in Geweben als<br />
auch in Organen (Muskeln, Leber, Niere) gef<strong>und</strong>en.<br />
• NACHWEIS TRANSGENER DNA-FRAGMENTE<br />
Wie erwähnt, konnten gentechnisch veränderte DNA-Fragmente nach Verfütterung von gentechnisch<br />
verändertem Futtermittel weder in den Geweben der Kuh noch in Milch nachgewiesen werden. Das<br />
Gewebe von Hühnern <strong>und</strong> deren Eier zeigten ebenfalls keine Spuren von transgener DNA. Bruchstücke<br />
von gentechnisch veränderter DNA wurden auch von Schweinen nicht ins Gewebe aufgenommen oder lagen im<br />
Bereich unterhalb der Nachweisgrenze.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 250 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 12: Zusammenfassung<br />
• BEGRÜNDUNG DER UNTERSCHIEDLICHEN AUFNAHME VON DNA-FRAGMENTEN<br />
Als mögliche Erklärung dafür, dass für die pflanzlichen (kurzen) DNA-Fragmente positive Signale existieren, jedoch<br />
für die transgene DNA nicht, wird angeführt, dass es sich bei transgenen Pflanzengenen um single-copy-Gene<br />
handelt, die im Genom nur selten auftreten. Chloroplasten-DNA kommt hingegen in allen grünen Teilen der Pflanze in<br />
mehreren tausend Kopien vor. Die Literaturrecherche ergab, dass die Wahrscheinlichkeit des Nachweises von<br />
Chloroplasten-DNA aufgr<strong>und</strong> der großen Anzahl von Kopien je Pflanzenzelle 10 3 -10 4 fach höher ist als für single-copy-<br />
Gene.<br />
Auch frühere Studien (Einspanier et al., Klotz et al. etc.) beschrieben bereits, dass ein Transfer von single-copy-<br />
Genen durch die Darmwand ein seltenes Ereignis darstellt.<br />
� Potentieller GVO-Transfer in der Honigproduktion <strong>und</strong> bei Bienenprodukten:<br />
Einen Sonderfall der tierischen Produktion stellen Produkte der Honigbiene dar. Eine Literaturrecherche <strong>und</strong> die<br />
Darstellung der aktuellen Datenlage in Österreich betreffend potentielle GVO-Verunreinigungsquellen<br />
in Honig <strong>und</strong> Imkereiprodukten wurden bearbeitet.<br />
Unter Bezug auf VO(EG) 1829/2003 betreffend Lebens- <strong>und</strong> Futtermittel bestätigte der „Ständige Ausschuss<br />
Lebensmittelkette <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit, Abt. genetisch veränderte Lebensmittel <strong>und</strong> Futtermittel“ der Europäischen<br />
Kommission, dass gemäß Richtlinie 2001/110/EG des Rates vom 20.12.2001 über Honig, dieser als tierisches Produkt<br />
zu betrachten ist. Folglich fällt er nicht unter die VO(EG) 1829/2003 für Lebens- <strong>und</strong> Futtermittel, sofern er nicht von<br />
genetisch modifizierten Bienen produziert wird. Da die Bienen über Entfernungen von mehreren Kilometern sowohl<br />
an Wild- als auch an Kulturpflanzen sammeln, <strong>und</strong> dieser Vorgang außerhalb der Kontrollmöglichkeit des<br />
Bienenhalters liegt, sollte das Vorkommen von GVO-Pollen in Honig als zufällig <strong>und</strong> unvermeidlich angesehen<br />
werden, welches nicht zu kennzeichnen ist, vorausgesetzt, der Anteil von GVO-Pollen im Honig liegt nicht über dem<br />
Schwellenwertregime.<br />
In Österreich wird in der Codex-Richtlinie <strong>zur</strong> Definition der „Gentechnikfreiheit“ vom 7.3.2001, Österreichisches<br />
Lebensmittelbuch III. Auflage, ausgeführt: „Lebensmittel- <strong>und</strong> Verzehrprodukte im Sinne dieser Richtlinie werden<br />
ohne Verwendung von GVO (genetisch veränderte/r Organismus/men) <strong>und</strong> GVO-Derivaten hergestellt.“ Im Kapitel<br />
„Kontrolle“ wird ausgeführt: „Sofern über die Kontrolle die Einhaltung der vorgegebenen Kriterien nachgewiesen<br />
werden kann, bleiben aus technischen Gründen unvermeidbare Verunreinigungen mit GVO oder daraus hergestellten<br />
bzw. gewonnenen Produkten außer Betracht.“ Laut Übereinkunft der Codex-Unterkommission Honig wird dabei der<br />
Pollen als originärer Bestandteil des Honigs angesehen, somit ist der Anteil allfälliger GVO-Pollen auf die<br />
Gesamtmenge des Honigs zu beziehen. Die zu den „Nahrungsergänzungsmitteln“ zählenden Bienenprodukte<br />
Blütenpollen, Propolis <strong>und</strong> Gelee royale sind unter dem Begriff „Verzehrprodukte“ im Regelungsbereich der Codex-<br />
Richtlinie <strong>zur</strong> Definition der „Gentechnikfreiheit“ enthalten. Für sie gelten demnach die gleichen Regelungen wie für<br />
Honig, damit sie mit Bezeichnungen im Sinne dieser Richtlinie in Verkehr gesetzt werden können.<br />
Pollen <strong>und</strong> Nektar, aber auch Zucker, Fertigfutterzubereitungen (Sirupe aus der Lebensmittelindustrie bzw. speziell<br />
für Bienen hergestellte flüssige <strong>und</strong> feste Futterstoffe <strong>und</strong> Eiweißersatzmittel) können – analog zu anderen tierischen<br />
Produktionszweigen als „Futtermittel“ eingestuft werden.<br />
Die nachfolgend angeführten Produkte werden als Bienenprodukte subsumiert <strong>und</strong> können in<br />
unterschiedlichem Ausmaß mit GVO-Pollen verunreinigt werden:<br />
� Honig ist aus Sicht der Verbraucher – insbesondere für Käufer von österreichischem Honig – ein sehr sensibles<br />
Produkt, da ihm das Attribut „naturrein“ zugesprochen wird <strong>und</strong> er bei vielen Konsumenten den Status eines<br />
„Naturheilmittels“ einnimmt. In üblicherweise geerntetem Honig (= Schleuderhonig aus Waben ohne Pollenvorräte)<br />
wird die Gesamtmenge an Pollen mit weniger als 0,1 % angegeben.<br />
� Pollen sind die männlichen Keimzellen der Blütenpflanzen. Gelangt Blütenpollen von GV-Pflanzen in den Honig<br />
oder wird Blütenpollen von solchen Pflanzen gewonnen, ist die transgene DNA im Erntegut nachweisbar.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 251 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 12: Zusammenfassung<br />
� Propolis oder Kittharz ist der klebrige Überzug, mit dem das Bienenvolk alle Teile der Bienenwohnung<br />
inklusive des Wabenbaues überzieht. Propolis enthält bis zu 5 % Blütenpollen <strong>und</strong> ist damit ein sensibles Produkt für<br />
allfällige GVO-Verunreinigungen.<br />
� Gelee royale ist der in den Futtersaftdrüsen der Ammen gebildeter <strong>und</strong> an die königlichen Larven verfütterter,<br />
eiweißreiche Futtersaft. Er enthält auch Spuren von Pollen<br />
� Bienenwachs ist ein von den Wachsdrüsen der Bienen sezerniertes Produkt. Je nach Reinigungsgrad sind<br />
darin auch Pollenbeimengungen enthalten.<br />
Die Trachtquellen <strong>und</strong> damit Futter- bzw. Honigquellen der Honigbienen werden in einem sehr variablen<br />
Umkreis von einigen h<strong>und</strong>ert Metern Radius um den Bienenstock bis zu mehr als 6 km angeflogen. Die nachfolgend<br />
angeführten Trachtquellen haben derzeit ein potentielles Risiko als GV-Pflanzen.<br />
• Raps: Wegen seines Nektar- <strong>und</strong> Pollenreichtums ist er eine der attraktivsten Trachtpflanzen, die noch aus<br />
großer Entfernung angeflogen wird. Rapshonig wird zum Teil von Bioimkern im Spätsommer wieder an die Bienen<br />
verfüttert.<br />
• Mais: Dieser wird von Bienen regelmäßig besucht <strong>und</strong> der reichlich vorhandene Pollen oft in Massen<br />
eingetragen. Zusätzlich liefern Blattläuse auf Mais in manchen Jahren große Mengen von Honigtau, der von den<br />
Bienen zu Honigtauhonig verarbeitet wird.<br />
• Sojabohne: Nach Literaturangaben wird sie von Bienen <strong>zur</strong> Pollen- <strong>und</strong> Nektargewinnung beflogen. Für<br />
Österreich sind keine Angaben zum Bienenbeflug von Sojabohnen verfügbar.<br />
Mögliche Quellen für einen GVO-Eintrag sind die Pollen von Kulturpflanzen, welche den Bienen als Tracht dienen.<br />
Spuren des eingetragenen Pollens finden sich in allen Bienenprodukten <strong>und</strong> auf bzw. in den Bienenwaben wieder.<br />
Durch Filtration des Honigs könnten GVO-Pollen weitestgehend eliminiert werden, wenn die Filter-Maschenweite auf<br />
die Größe der GVO-Pollen abgestimmt wird. GVO-Verunreinigungen in Honigvorräten können auch die nachfolgenden<br />
Honigernten betreffen. Bienenfuttermittel können auch über Fütterungshonig sowie eiweißhaltige Futtermittel<br />
(Naturpollen bzw. Pollenersatzmittel auf Sojabohnenmehlbasis) als Quelle für GVO-Verunreinigungen wirken.<br />
Die künftige Verfügbarkeit von „GVO-freien“ Trachtquellen wird durch den Umfang <strong>und</strong> die Lage von GVO-<br />
Anbauflächen <strong>und</strong> der Standplätze der Bienenvölker bestimmt werden. Dadurch wird sowohl die Menge an<br />
produzierbarem Honig als auch die produzierbaren Sorten entscheidend beeinflusst werden. Für eine „GVO-freie“<br />
oder „gentechnikfreie“ Produktion sind große, zusammenhängende Flächen (Mindestdurchmesser über 10 km) ohne<br />
GVO-Anbau erforderlich. Bienen-Futtermittel ohne GVO-Einfluss, bzw. frei von GVO-Derivaten sind bei Bedarf sowohl<br />
aus „GVO-freier“ oder „gentechnikfrier“ Produktion als auch aus biologischem Anbau in ausreichender Menge<br />
verfügbar.<br />
Betreffend die Vermarktung von Honig ist zu erwarten, dass nachweisbare GVO-Pollen die Vermarktung des Honigs<br />
erschweren. Laut telefonischer Anfrage bei großen österreichischen Honighändlern orientieren sich diese am 0,9%-<br />
Schwellenwert für eine allfällige Kennzeichnungspflicht. Da Honig als tierisches Lebensmittel definitionsgemäß nicht<br />
unter die VO (EG) 1829/2003 fällt, wird das darin festgelegte Schwellenwertregime auch nicht vollinhaltlich<br />
umgesetzt. Exporte von Bienenprodukten sind in manche Länder (z.B. Saudi Arabien, Japan) nur für „GVO-frei“<br />
zertifizierte Ware möglich.<br />
Bei <strong>Auslobung</strong> bestimmter Honige als <strong>„gentechnikfrei“</strong> mittels Qualitätsprogramm ist zu erwarten, dass die<br />
Aufmerksamkeit der Konsumenten erregt wird. Damit ergibt sich voraussichtlich für die nicht als <strong>„gentechnikfrei“</strong><br />
ausgelobten Honige Erklärungsbedarf.<br />
Auf der Gr<strong>und</strong>lage der Empfehlungen der Strategie <strong>zur</strong> Koexistenz in Österreich besteht unmittelbar <strong>und</strong> mittelfristig<br />
kein Risiko eines großflächigen GVO-Anbaues in Österreich. Die Produktion von „gentechnikfreien“ oder GVO-freien“<br />
Bienenprodukten ist daher machbar. Eine Einschränkung besteht dann wenn in den Nachbarstaaten GVO angebaut<br />
werden. Ist dies der Fall sind die Standplätze entsprechend grenzfern auszuwählen.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 252 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 12: Zusammenfassung<br />
Produktion <strong>und</strong> <strong>Auslobung</strong> „GVO-freien“ Honigs mit einem Kennzeichnungsschwellenwert von 0,9% / 0,5% für<br />
zufällige <strong>und</strong> technisch nicht vermeidbare GVO-Verunreinigungen, wie vom „Ständigen Ausschuss Lebensmittelkette<br />
<strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit, Abt. genetisch veränderte Lebensmittel <strong>und</strong> Futtermittel“ der EU vorgeschlagen, sollte in ganz<br />
Österreich möglich sein. Da der Gesamtanteil des Pollens im Honig laut Literaturangaben nur zwischen 0,1 – 0,5 %<br />
beträgt, ist zu erwarten, dass der Anteil des GVO-Pollens unterhalb der Werte des Schwellenwerteregimes,<br />
insbesondere von 0,9% bleibt.<br />
Produktion <strong>und</strong> <strong>Auslobung</strong> von Honig gemäß Codex-Richtlinie <strong>zur</strong> Definition der „Gentechnikfreiheit“ erscheint<br />
ebenfalls möglich, sofern bei der Auswahl der in der Bienenzucht verwendeten Futtermittel auf „gentechnikfreie<br />
Herkunft“, bzw. deren Herstellung ohne GVO-Derivate, geachtet wird.<br />
Die Einbeziehung der Bienenwirtschaft in die Koexistenzregelungen in Österreich <strong>und</strong> der EU erscheint im Hinblick auf<br />
die besondere Betroffenheit des Sektors durch einen potentiellen GVO-Anbau angemessen.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 253 von 272
13. Literaturverzeichnis<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 13: Literaturverzeichnis<br />
AMERICAN SOYBEAN ASSOCIATION, AVENTIS CROP SCIENCE DEUTSCHLAND, BUND FÜR LEBENSMITTELRECHT UND LEBENSMITTELKUNDE,<br />
MONSANTO AGRAR DEUTSCHLAND GMBH, SYNGENTA SEEDS GMBH (HRSG.) (2001): Kompendium Sojabohne, Züchtung <strong>und</strong><br />
Anbau, Verwertung <strong>und</strong> Markt. 1. Aufl., unter:<br />
http://www.monsanto.de/biotechnologie/Kompendium_Sojabohne_2001.pdf (22.03.2005).<br />
ANKLAM, E., GADANI, F., HEINZE, P., PIJNENBURG, H., VAN DEN EEDE, G. (2002): "Analytical methods for detection and<br />
determination of genetically modified organisms in agricutural crops and plant-derived food products", Eur.Food<br />
Res.Technol. 214, 3-26.<br />
ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR WIRKSTOFFE IN DER TIERERNÄHRUNG (1998): Aminosäuren in der Tierernährung. Frankfurt am<br />
Main: Albert Strothe Verlag.<br />
ARBEITSGEMEINSCHAFT GESUNDE TIERERNÄHRUNG E.V.(2003): Struktur der österreichischen Mischfutterbranche.Wien.<br />
http://www.mischfutter.at (18.4.2005).<br />
ARGE GENTECHNIK-FREI ( 2005): Mitglieder http://www.gentechnikfrei.at (11.3.2005)<br />
ARGE GENTECHNIK-FREI: Kontrolliert Gentechnik-frei erzeugt vom Bauern bis zum Endprodukt,<br />
http://www.gentechnikfrei.at/start.html (02.06.2005)<br />
BAUERNZEITUNG (2005): Agrana steigt jetzt in die Bioethanol-Produktion ein. Artikel auf Seite 5 der Ausgabe vom 19.<br />
Mai 2005.<br />
BAUERNZEITUNG (2005): GVO-Importverbot bleibt. Artikel auf Seite 5 der Ausgabe vom 30. Juni 2005.<br />
BIENEFELD, K. (2005): Schriftl. Mitteilung.<br />
BMGF (2004): Österreichisches Lebensmittelbuch III. Auflage, Codex-Richtlinie <strong>zur</strong> Definition der „Gentechnikfreiheit“<br />
Abs. 3- Änderung (5.9.2004); <strong>und</strong> gesamt: http://dielebensmittel.at/Dokumente/schwerpunktthemen/gentfrei.pdf<br />
(02.06.2005)<br />
BMGF (2004): Persönliche Mitteilung des B<strong>und</strong>esministeriums für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Frauen, Abteilung IV/B/10;<br />
7.4.2005<br />
BMGF: Änderung der Richtlinie <strong>zur</strong> Definition der „Gentechnikfreiheit“,<br />
http://www.bmgf.gv.at/cms/site/attachments/8/0/5/CH0264/CMS1085747609216/codex-rl.pdf (02.06.2005)<br />
BMGF: CODEX ALIMENTARIUS RICHTLINIEN FÜR GENTECHNISCH VERÄNDERTE LEBENSMITTEL,<br />
http://www.bmgf.gv.at/cms/site/detail.htm?thema=CH0131&doc=CMS1056641057751 <strong>und</strong><br />
http://www.bmgf.gv.at/cms/site/detail.htm?thema=CH0339&doc=CMS1056124185019 (02.06.2005)<br />
BMGF: Ergebnisse der Schwerpunktaktionen zu genetisch veränderten Lebensmitteln in Österreich (gesamt),<br />
http://www.bmgf.gv.at/cms/site/detail.htm?thema=CH0339&doc=CMS1056124185019 (02.06.2005)<br />
BMLF (1991): Bericht über die Lage der österreiischen Landwirtschaft 1990 gemäß § 9 des Landwirtschaftsgesetzes<br />
BGBl. Nr. 299/1976, Wien.<br />
BMLF (1992): Bericht über die Lage der österreiischen Landwirtschaft 1991 gemäß § 9 des Landwirtschaftsgesetzes<br />
BGBl. Nr. 299/1976, Wien.<br />
BMLF (1993): Bericht über die Lage der österreichischen Landwirtschaft 1992 gemäß § 9 des Landwirtschaftsgesetzes<br />
BGBl. Nr. 375/1992, Wien.<br />
BMLF (1994): Bericht über die Lage der österreichischen Landwirtschaft 1993 gemäß § 9 des Landwirtschaftsgesetzes<br />
BGBl. Nr. 375/1992, Wien.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 254 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 13: Literaturverzeichnis<br />
BMLF (1995): Bericht über die Lage der österreichischen Landwirtschaft 1994 gemäß § 9 des Landwirtschaftsgesetzes<br />
BGBl. Nr. 375/1992, Wien.<br />
BMLF (1996): Grüner Bericht 1995, Bericht über die Lage der österreichischen Landwirtschaft 1995, Wien.<br />
BMLF (1996): Bericht über die Lage der österreichischen Landwirtschaft 1995 gemäß § 9 des Landwirtschaftsgesetzes<br />
BGBl. Nr. 375/1992, Wien.<br />
BMLFUW - BUNDESMINISTERIUM FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, UMWELT UND WASSERWIRTSCHAFT (2002):<br />
Standarddeckungsbeiträge <strong>und</strong> Daten für die Betriebsberatung 2002/03, Ausgabe Westösterreich. Wien<br />
BMLFUW - BUNDESMINISTERIUM FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, UMWELT UND WASSERWIRTSCHAFT (2004): Bericht über die<br />
Situation der österreichischen Land- <strong>und</strong> Forstwirtschaft im Jahr 2003. Wien<br />
BMLFUW (2001): Anfragebeantwortung 2082/AB (XXI. GP) Untersuchungen von Futtermitteln auf gentechnisch<br />
veränderte Bestandteile, unter<br />
http://www.parlament.gv.at/portal/page?_pageid=908,285305&_dad=portal&_schema=PORTAL (07.04.2005).<br />
BMLFUW (2004): Grüner Bericht 2004, Bericht über die Situation der österreichischen Land- <strong>und</strong> Forstwirtschaft 2003,<br />
Wien: Selbstverlag.<br />
BMLFUW (2005): AKTIONSPLAN FUTTERMITTEL, FUTTERMITTELKONTROLLE, RISIKOANALYSE UND RISIKOKONMANAGEMENT (3.1.2005)<br />
BMLFUW (2005): AKTIONSPLAN FUTTERMITTEL, FUTTERMITTELKONTROLLE, RISIKOANALYSE UND RISIKOMANAGEMENT (STAND 3.1.2005)<br />
BMLFUW (2005): persönliche Mitteilung des B<strong>und</strong>esministeriums für Land- <strong>und</strong> Forstwirtschaft, Umwelt <strong>und</strong><br />
Wasserwirtschaft – SB: III 9, 31.03.2005.<br />
BOGDANOV, S. (1999): GELÉE ROYALE. SCHWEIZERISCHES ZENTRUM FÜR BIENENFORSCHUNG.<br />
HTTP://WWW.APIS.ADMIN.CH/DE/BIENENPRODUKTE/DOCS/PRODUKTE/GELEEROYALE_D.PDF<br />
BRAUNER, R., ROTH, E. UND TAPPESER, B. (2002): Entwicklung <strong>und</strong> Auswertung von Szenarien <strong>zur</strong> Verbreitung von<br />
transgenem Raps. Unpublished report to the GenEERA research projekt of the UFT Bremen in the scope of the<br />
BMBF-Sicherheitsforschung „Biotechnologie 2000“.<br />
BRIMI (2005): Persönliche Mitteilung des Südtiroler Sennereiverbandes (6.4.2005)<br />
BROLL, H.; JANSEN, B.; KLEMPT, L. (2004): Abschlussbericht, Projekt 020OE072; Praktikabilität des Kontrollverfahrens<br />
zum GVO Verbot im ökologischen Landbau,<br />
BRUINSMA, J. et al. (Hrsg.) (2003): World agriculture: towards 2015/2030, an FAO Perspective. London: Earthscan<br />
Publications Ltd.<br />
BUCHNER, R. (1970): Ein katastrophales Bienensterben im Regierungsbezirk Südbaden. ADIZ 4 (9), 223-224.<br />
BUNDESARBEITERKAMMER: Mehr Schutz vor Verunreinigungen durch Gentechnik, http://wien.arbeiterkammer.at/www-<br />
405-IP-16682-AD-16681.html<br />
BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND FORSCHUNG (2005) unter http://www.biosicherheit.de/lexikon.<br />
BUNDESMINISTERIUM FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ, ERNÄHRUNG UND LANDWIRTSCHAFT (2005) unter http://www.bba.de.<br />
CARTAGENA PROTOCOL (2000): Cartagena Protocol on Biosafety to the convention on biological diversity. Montreal:<br />
Secretariat of the Convention on Biological Diversity.<br />
CERT ID CERTIFICADORA LTDA. (2005): Meldung der Geschäftsführung von CertID Certificadora Ltda vom 19. April 2005.<br />
CHUDASKE, Ch. (2005): Feed magazine – Kraftfutter 6/05, 20-23.<br />
DANY, B. (1983): Pollensammeln heute: Anleitung zum wirtschaftlichen Pollensammeln. München: Ehrenwirth Verlag.<br />
DANY, B. (1989): R<strong>und</strong> um den Blütenpollen. München: Ehrenwirth Verlag.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 255 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 13: Literaturverzeichnis<br />
DOERFLER, W., SCHUBBERT, R. (1997): Fremde DNA im Säugetiersystem. DNA aus der Nahrung gelangt über die<br />
Darmschleimhaut in den Organismus. Deutsches Ärzteblatt 94, Heft 51-52, 3465-3470.<br />
DROEGE, G. (1993): Die Honigbiene von A bis Z: ein lexikalisches Fachbuch. Berlin: DLV Deutscher<br />
Landwirtschaftsverlag.<br />
DULLNIG, H. <strong>und</strong> STERINGER, M. (2005-05-12): Schriftliche Auskunft, Raiffeisen Ware Austria AG, Wien<br />
EC DG-AGRI (2000): Economic Impacts of genetically modified crops on the Agri-Food-Sector. Published by European<br />
Commission Directorate-General for Agriculture, at<br />
http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/gmo/fullrep/index.htm (11.04.2005).<br />
EC DG-AGRI (2004): Prospects for Agricultural Markets and Income 2004-2011 for EU-25. Published by European<br />
Commission Directorate-General for Agriculture, at<br />
http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/caprep/prospects2004b/fullrep.pdf (22.03.2005).<br />
EICH, K.-O. (1985): Handbuch der Schweinekrankheiten. Österreichischjer Agrarverlag Wien. 2. Auflage; 269-271<br />
EINSPANIER, R., KLOTZ, A., KRAFT, J., AULRICH, K., POSER, R., SCHWÄGELE, F., JAHREIS, G., FLACHOWSKY, G. (2001): The fate of<br />
forage plant DNA in farm animals: a collaborative case-study investigating cattle and chicken fed recombinant<br />
plant material. European Food Research Technology 212: 129-134.<br />
EINSPANIER, R., LUTZ, B., RIEF, S., BEREZINA, O., ZVERLOV, V., SCHWARZ, W., MAYER, J. (2004): Tracing residual recombinant<br />
feed molecules during digestion and rumen bacterial diversity in cattle fed transgene maize. European Food<br />
Research Technology 218: 269-273.<br />
ELSASSER, K. (2004): persönliche Mitteilung.<br />
ENGELHARD, T.; KLUTH, H.; HELM, L.; RODEHUTSCORD (2003): Zum Ersatz von Sojaextraktionsschrot durch<br />
Rapsextraktionsschrot in der Fütterung der Hochleistungskuh. Forum angewandte Forschung in der Rinder-<strong>und</strong><br />
Schweinefütterung. Fulda, 02./03.04.2003, 46-48<br />
EUROPÄISCHE KOMMISSION (2001): Pressebericht Nr. IP/01/412 vom 19. März 2001, unter:<br />
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/01/412&format=HTML&aged=0&language=DE&<br />
guiLanguage=en (05.04.2005).<br />
EUROPÄISCHE KOMMSSION (2005): persönliche Mitteilung der Europäischen Kommission, SANCO E 1 Pflanzenschutz,<br />
04.05.2005.<br />
EUROSTAT (2004): on-line database of the European Commission, at<br />
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1090,30070682,1090_30298591&_dad=portal&_schema=PO<br />
RTAL, (11.12.2004).<br />
FACHVERBAND DER NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELINDUSTRIE ÖSTERREICHS: Zur Marktsituation <strong>und</strong> wirtschaftlichen Bedeutung<br />
der Gentechnik in der Lebensmittelherstellung,<br />
http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?AngID=1&StID=89751&DstID=323 (02.06.2005)<br />
FANNING, K.; MILTON, T.; KLOPFENSTEIN, T.; AND KLEMESRUD, M. (1999): 1999 Nebraska Beef Cattle Report; Corn and<br />
Sorghum Distillers Grains for Finishing Cattle; University of Nebraska; http://pubs@unl.edu<br />
FAOSTAT (2004): on-line database of the Food and Agriculture Organization of the United Nations, at<br />
http://faostat.fao.org/faostat/, (22.03.2005).<br />
FEICHTINGER, K. UND LEITGEB, R. (1992): Einsatz von 00-Raspextraktionsschrot in der Jungbullenmast. Züchtungsk<strong>und</strong>e<br />
64, 1992, S 57-65.<br />
FIBL, (2003): Biolandbau <strong>und</strong> Gentechnik – So bleibt der Biolandbau Gentechnikfrei. www.fibl.org.<br />
FLACHOWSKY, G. (2004): Zum Einsatz von Futtermitteln aus gentechnisch veränderten Pflanzen in der<br />
Wiederkäuerernährung. Institut für Tierernährung der B<strong>und</strong>esforschungsanstalt für Landwirtschaft, Braunschweig.<br />
Mühle + Mischfutter 141, Heft 9.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 256 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 13: Literaturverzeichnis<br />
FOSSEL, A.; H. PECHHACKER (Hrsg.) (2000): Bienen <strong>und</strong> Blumen. Lunz am See: Eigenverlag<br />
FRISCH, K. von (1965): Tanzsprache <strong>und</strong> Orientierung der Bienen. Berlin – Heidelberg – New York: Springer-Verlag.<br />
GATTERMAYER, F. (2005-05-15): Mündliche Auskunft, Agrana AG, Wien.<br />
GEFFCKEN, H. (1980): Bienen <strong>und</strong> Mais. ADIZ 14(8), 233-235.<br />
GENEDEY, S.G.K. (1994): Einsatz von extrudiertem Rapsextraktionschrot im Legehennenalleinfutter. Dissertation.<br />
Universität für Bodenkultur. Wien<br />
Gerber, A., Beck, A., Brauner, R., Hermann, A., Hermansowski,R., Liebl, B., Mäder, R., Moch, K., Nowack, K., Oehen,<br />
B. <strong>und</strong> Röhrig, P. (2005): Praxishandbuch „Bio-Produkte ohne Gentechnik“. B<strong>und</strong> Ökologische<br />
Lebensmittelwirtschaft e.V. (Herausgeber), www.bioXgen.de (03.06.2005).<br />
GIRSCH, L. et al. (2004): Die Produktion von Saatgut in abgegrenzten Erzeugungsprozessen <strong>zur</strong> Vermeidung einer<br />
Verunreinigung mit gentechnisch veränderten Organismen im Kontext mit der Koexistenz von konventioneller<br />
Landwirtschaft mit oder ohne GVO <strong>und</strong> ökologischer Landwirtschaft“. Hrsg.: <strong>AGES</strong><br />
GIRSCH, L. et al. (2004): Endbericht zu den Arbeiten der Expertengruppe betreffend der „Erarbeitung von<br />
Empfehlungen für eine nationale Strategie <strong>zur</strong> Koexistenz“, unter<br />
http://land.lebensministerium.at/article/articleview/16406/1/5113/<br />
GROTE, H. (2004): Futtermittelsicherheit als Aufgabe der Futtermittelwirschaft. In: PETERSEN, U. <strong>und</strong> FLACHOWSKY, G.<br />
(Hrsg.): Positivliste für Futtermittel als Beitrag <strong>zur</strong> Futtermittelsicherheit – Erwartungen, Konzepte, Lösungen.<br />
Braunschweig: Eigenverlag.<br />
GRÜNEWALD, K.-H., SPANN, B. UND OBERMAIER, A. (1996): EINSATZ VON RAPSSAAT IN DER MILCHVIEHFÜTTERUNG. DAS<br />
WIRTSCHAFTSEIGENE FUTTER, BAND 42, HEFT2, SEITE 101-114<br />
HÄFFNER, J.; KAHRS, D.; LIMPER, J.; DE MOL, J. <strong>und</strong> PEISKER, M. (1998): Aminosäuren in der Tierernährung. Frankfurt am<br />
Main: Alfred Strothe.<br />
HASSAN-HAUSER, CH., MAYER, W., HÖRTNER, H. (1998): "Detection of the starch modifying gbss-antisense construct in<br />
transgenic potatoes" Z.Lebensm.Unters.Forsch. A, 206, 83-87.<br />
HAYDINGER, G. (2005-04-28): Schriftliche Auskunft, Fixkraft GmbH & Co KG, Enns.<br />
HEIDER, G., MONREAL G. UND MÉSZÁROS, J. (1992): Krankheiten des Wirtschaftsgeflügels, Stuttgart: Gustav Fischer<br />
Verlag; Band 2<br />
HEIGL, H. (2005): schriftliche Mitteilung.<br />
HEROLD, E.; LEIBOLD, G. (1991): Heilwerte aus dem Bienenvolk. 12. neub. Aufl., München: Ehrenwirth Verlag.<br />
HILL, R.: Propolis – Kittharz (1986): Das natürliche Antibiotikum. München: Ehrenwirth Verlag.<br />
HISSEK, F. (2005-05-12): Schriftliche Auskunft, Raiffeisen Ware Austria AG, Wien<br />
HOCHEGGER, R. (2004): "Probenahme <strong>und</strong> GVO-Analytik" in L.Girsch et al.: "Die Produktion von Saatgut in<br />
abgegrenzten Erzeugungsprozessen <strong>zur</strong> Vermeidung einer Verunreinigung mit Gentechnisch Veränderten<br />
Organismen im Kontext mit der Koexistenz von konventioneller Landwirtschaft mit oder ohne GVO <strong>und</strong><br />
ökologischer Landwirtschaft." (2004). Hrsg.: <strong>AGES</strong>.<br />
HORN, H. (2005): Pers. Mitteilung.<br />
HORN, H.; Lüllmann, C. (1992): Das große Honigbuch. München: Ehrenwirth Verlag.<br />
HÖRTNER, H. (1997): "Nachweismöglichkeiten gentechnisch hergestellter Lebensmittel", Ernährung/ Nutrition 21, 443-<br />
446 .<br />
HÖRTNER, H. (2004): "Genetically modified food and feeds; definition and identification", in F.J.M.Smulders, J.D.Collins<br />
(ed.): "Food safety assurance and veterinary public health, Vol. 2 – Safety assurance during food processing"<br />
Wageningen Academic Publishers, The Netherlands, 2004, p. 267-278.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 257 von 272
http://www.orgprints.org/00003257<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 13: Literaturverzeichnis<br />
HÜBNER, PH., WAIBLINGER, H.-U., PIETSCH, K., BRODMANN, P. (2001): "Validation of PCR Methods for Quantitation of<br />
Genetically Modified Plants in Food", J. AOAC Int., 84, 1855-1864.<br />
HÜSING, J.O.; NITSCHMANN, J. (Hrsg.) (1995): Lexikon der Bienenk<strong>und</strong>e. Augsburg: Weltbild Verlag.<br />
JAMES, C. (2003): Preview: Global Status of Commercialized Transgenic Crops: 2003. ISAAA Briefs Nr. 30-2003.<br />
ISAAA: Ithaca, N.Y.<br />
JAMES, C. (2004): Preview: Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2004. ISAAA Briefs Nr. 32-2004.<br />
ISAAA: Ithaca, N.Y.<br />
JANK, B. (2005): schriftliche Mitteilung vom 08.03.2005.<br />
JAYCOX, E.R. (1970 a): Ecological relationships between honey bees and soybeans. American Bee J. 110(8), 306-307.<br />
JAYCOX, E.R. (1970 b): Ecological relationships between honey bees and soybeans. II The plant factors. American Bee<br />
J. 110(9), 343-345.<br />
KAY, S.; VAN DEN EEDE, G. (2001): "The limits of GMO detection", Nature Biotechnology 19, 405.<br />
KERSTEN, J., ROHDE, H.R. <strong>und</strong> NEF, E. (2003): Mischfutterherstellung - Rohware, Prozesse, Technologie.<br />
Bergen/Dumme: Agrimedia GmbH.<br />
KICKINGER, TH. (2005-04-28): Schriftliche Auskunft, <strong>AGES</strong>, Wien.<br />
KIRCHGESSNER, M. (1992): Tierernährung. 8., neubearbeitete Aufl., Frankfurt am Main: DLG.<br />
KLEIN, B. (2004): Wenn die Gentechnik kommt - Stoppschild für Bienen? Pollenflug großes Problem bei der<br />
Honigherstellung. aid.<br />
KLOTZ, A., MAYER, J., EINSPANIER, R. (2002): Degradation and possible carry over of feed DNA monitored in pigs and<br />
poultry. European Food Research Technology 214, 271-275.<br />
KLUTH, H., ENGELHARD, T. UND RODEHUTSCORD, M. (2005): Zum Ersatz von Sojaextraktionsschrot durch<br />
Rapsextraktionsschrot in der Fütterung der Hochleistungskuh. Züchtungsk<strong>und</strong>e, 77.<br />
KNITTELFELDER, F. (2005-06-06): Schriftliche Auskunft, Herbert Lugitsch <strong>und</strong> Söhne GmbH, Feldbach.<br />
KRAMMER, K. <strong>und</strong> PRANKL, H. (2003): Bericht der B<strong>und</strong>esanstalt für Landtechnik Wieselburg. Abschlussbericht zum<br />
Projekt BLT013314 Verwendung bon Pflanzenölkraftstoffen – Marktbedeutung II. Wieselburg: B<strong>und</strong>esanstalt für<br />
Landtechnik.<br />
KÜNAST, R. ; LOSKE, R. ; (2005) : Weiße Biotechnologie – Nachhaltigkeit <strong>und</strong> Wettbewerbsfähigkeit im Einklang;<br />
Bündnis90/Die Grünen; Eigenverlag<br />
LE MONDE (2005): Le Monde, Vingt régions européennes défient Bruxelles en refusant les OGM, 14.2.2005.<br />
LEBZIEN, P., MEYER, U. UND FLACHOWSKY (2003): Vergleich des Einsatzes von Erbsen <strong>und</strong> Sojaextraktionsschrot in der<br />
Bullenmast; Landbauforschung Völkenrode 4/2003 (53): 235-239<br />
LEESON, S., REINHART, B.S. AND SUMMERS, J.D. (1979): 2. Embryo mortality and abnormalities. Can. J. Anim. Sci. 59, 561-<br />
567 (1979b)<br />
LEESON, S., REINHART, B.S. AND SUMMERS, J.D. (1979): Response of white Leghorn and Rhode Island red breeder hens to<br />
dietary defieciencies of synthtetic vitamins. 1. Egg production, hatchability and chick growth. Can. J. Anim. Sci.<br />
59, 561-567 (1979a)<br />
LEITGEB, R. (1987): Einsatz von Ackerbohnen (Vicia faba) in der Bullenmast. Das wirtschaftseigene Futter 33, 1987,<br />
S. 140-146.<br />
LEITGEB, R. (1988): Einsatz von Ackerbohnen in der Stiermast. Der Förderungsdienst 36, 1988, S 165 <strong>und</strong> 168<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 258 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 13: Literaturverzeichnis<br />
LEITGEB, R. (1988): Einsatz von Erbsen (Pisum sativum) in der Bullenmast. Das wirtschaftseigene Futter 34, 19988,<br />
Seite 100-106<br />
LEITGEB, R. (s.a): Österreichische Eiweißfuttermittel für die Rindermast. Landwirtschaftliche & Forstwirtschaftliche<br />
Beratung.<br />
LETTNER, F (1990): Alternative Eiweißfuttermittel für Schweine <strong>und</strong> Geflügel. Der Förderungsdienst/Beratungsservice –<br />
Heft1/1990, Seite 1-7<br />
LETTNER, F. UND ROSENBERGER, A. UND WÜRZNER, H. (1984): Einsatz von Ackerbohne (Vicia faba L.) im Hühnermastfutter.<br />
I. Mitteilung: Einfluss auf die Mastleistung <strong>und</strong> Schlachtkörperqualität. Die Bodenkultur 35, 355-363,<br />
LORENZ, T. (1990) : Einsatz von Rapsprodukten in der Hühnermast. Diplomarbeit. Universität für Bodenkultur. Wien.<br />
MAIERHOFER, R. ; OBERMAIER, A. ; SPANN, B. (2000): Einsatz von Rapsextraktionsschrot im Milchleistungsfutter (LKF-<br />
Raps) im Vergleich zu Sojaextraktionsschrot (LKF-Soja).<br />
MAIERHOFER, R. ; OBERMAIER, A. ; SPANN, B. (2002): Einsatz von Erbsen <strong>und</strong> Ackerbohnen in der Mast von Bullen mit<br />
Mischrationen.<br />
MAIERHOFER, R.; SPANN, B.; OBERMAIER, A.; HITZLSPERGER, L.; <strong>und</strong> ZENS, H.-G. (s.a.): Einsatz von Rapsextraktionsschrot<br />
in der intensiven Bullenmast<br />
MAURIZIO, A.; SCHAPER, F. (1994): Das Trachtpflanzenbuch. 4. erw. Aufl., München: Ehrenwirth Verlag.<br />
MEIER, J. (2002): Bleibt in Deutschland bei zunehmendem Einsatz der Gentechnik in Landwirtschaft <strong>und</strong><br />
Lebensmittelproduktion die Wahlfreiheit auf GVO-unbelastete Nahrung erhalten? Berlin: Forschungsinstitut für<br />
biologischen Landbau Berlin e.V. .<br />
MESSNER, P. (2005-06-01): Schriftliche Auskunft, Unser Lagerhaus Warenhandels GmbH, Klagenfurt.<br />
MEYER, H.; BRONSCH, K. <strong>und</strong> LEIBETSEDER, J. (1989): Supplemente Tierernährung. 7., überarbeitete Aufl., Hannover:<br />
M.&H. Schaper.<br />
MODER, G.; HEISSENBERGER A.; PÖCHTRAGER, S. (2004): Umsetzung der Codex-Richtlinie <strong>zur</strong> Definition der<br />
Gentechnikfreiheit im Futtermittelbereich- basierend auf festgelegten Grenzwerten im Biobereich. Wien:<br />
B<strong>und</strong>esministerium für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Frauen, Wien.<br />
MODER, G.; HEISSENBERGER, A.; PÖCHTRAGER, S. (2004): Umsetzung der Codex-Richtlinie <strong>zur</strong> Definition der<br />
Gentechnikfreiheit im Futtermittelbereich – basierend auf festgelegten Grenzwerten im Biobereich. Wien<br />
MORSE, R.; HOOPER, T. (Editors) (1985): The illustrated Encyclopedia of Beekeeping. Sherborne, Dorset: Alphabooks.<br />
MÜLLER, A. (2004): Eröffnung. In: PETERSEN, U. <strong>und</strong> FLACHOWSKY, G. (Hrsg.): Positivliste für Futtermittel als Beitrag <strong>zur</strong><br />
Futtermittelsicherheit – Erwartungen, Konzepte, Lösungen. Braunschweig: Eigenverlag.<br />
MÜSCH, W. (2001): Mastversuch mit heimischen Eiweißträgern, Berichte <strong>und</strong> Ergebnisse; Jahresbericht 2001,<br />
Landwirtschaftszentrum Haus Düsse; Seite 5-7<br />
NEMETH, A., WURZ, A. (2004): Sensitive PCR Analysis of Animal Tissue Samples for Fragments of Endogenous and<br />
Transgenic Plant DNA. Journal Agric. Food. Chem. 52, 6129-6135.<br />
NOWACK HEIMGARTNER, K. (2005): Produktion mit <strong>und</strong> ohne Gentechnik: Standards für die Koexistenz <strong>und</strong><br />
Warenflusstrennung. http://orgprints.org/4561/01/nowack-2005-standards.pdf (17.05.2005).<br />
NOWACK HEIMGARTNER, K. <strong>und</strong> OEHEN, B. (2003): Analyse von GVO-Verunreinigungen in Bioprodukten. Belastungsgrade<br />
<strong>und</strong> Vermeidungsmöglichkeiten in Saatgut, Lebensmitteln <strong>und</strong> Futtermitteln. Frick: Forschungsinstitut für<br />
biologischen Landbau.<br />
NOWACK HEIMGARTNER, K. <strong>und</strong> OEHEN, B. (2003): Analyse von GVO-Verunreinigungen in Bioprodukten, Belastungsgrade<br />
<strong>und</strong> Vermeidungsmöglichkeiten in Saatgut, Lebensmitteln <strong>und</strong> Futtermitteln.<br />
http://orgprints.org/2388/01/nowack-heimgartner-et-al-2004-gvo-verunreinigungen.pdf (17.12.2004).<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 259 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 13: Literaturverzeichnis<br />
NOWACK HEIMGARTNER, K., BICKEL, R., PUSHPARAJAH LORENZEN, R., WYSS, E. (2002): Sicherung der gentechnikfreien<br />
Bioproduktion. Schriftenreihe Umwelt Nr. 340. B<strong>und</strong>esamt für Umwelt, Wald <strong>und</strong> Landschaft, Bern.<br />
OECD OUTLOOK (2004): OECD Agricultural Outlook for Cereals, Rice, Oilseeds, Sugar 2003-2008, OECD Statistical<br />
Databases.<br />
OOE BAUERNBUND (2005): http://www.ooe.bauernb<strong>und</strong>.at/html/h_aktuell/news.asp?nnummer=220, 09.05.2005.<br />
ORGANISATION FÜR WIRTSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT UND ENTWICKLUNG (2004): OECD Seed Schemes „2004“ - OECD<br />
Schemes for the Varietal Certification or the Control of Seed Moving in International Trade, as revised by the<br />
OECD Council on 28 September 2000 and subsequently amended. Paris: Selbstverlag.<br />
PACK, M.; FICKLER, J.; RADEMACHER, M.; LEMME, A.; MACK, S. ; HÖHLER, D. ; FONTAINE, J. UND PETRI, A. (2002): Amino acids in<br />
animal nutrition: a compendium of recent reviews and reports. Bukarest: Coral Sanivet<br />
PASCHER, K., DOLEZEL, M. (2005): Koexistenz von gentechnisch veränderten, konventionellen <strong>und</strong> biologisch<br />
angebauten Kulturpflanzen in der österreichischen Landwirtschaft – Handlungsempfehlungen aus ökologischer<br />
Sicht. BMGF, Forschungsberichte der Sektion IV, Band 2/2005<br />
PECHHACKER, H. (2003) Mais als Bienennährpflanze. Bienenvater 124 (12), 12-15.<br />
PHIPPS, R. H., DEAVILLE, E. R., MADDISON B. C. (2003): Detection of Transgenic and Endogenous Plant DNA in Rumen<br />
Fluid, Duodenal Digesta, Milk, Blood and Feces of Lactating Dairy Cows. Journal of Dairy Science. Vol, 86, No. 12,<br />
4070-4078.<br />
PIEPER, R.; PIEPER, B.; GABEL, M. (2004): Einfluss der Verfütterung von opticon®-behandelten Lupinen (lupinus<br />
angustifolius) auf Milchleistung, Inhaltsstoffe <strong>und</strong> Stoffwechselparameter von Milchkühen. Vortragtagung der<br />
DGfZ <strong>und</strong> GfT am 29.-30. September 2004 in Rostock.<br />
PÖCHTRAGER, S. (2002): Die Ermittlung der Bedeutung von Erfolgsfaktoren in Qualitätsmanagementsystemen mit Hilfe<br />
des Analytischen Hierarchieprozesses am Beispiel der österreichischen <strong>und</strong> Südtiroler Ernährungswirtschaft.<br />
Dissertationen der Universität für Bodenkultur in Wien, Band 50, Wien: Österreichischer Kunst- <strong>und</strong> Kulturverlag.<br />
POMS, R. E., HOCHSTEINER, W., LUGER, K., GLÖSSL, J., FOISSY, H. (2003): Model Studies on the Detectybility of Genetically<br />
Modified Feed in Milk. Journal of Food Protection. Vol. 66, No. 2, 304-310.<br />
PREIßINGER, W. (s.a.) : Wirtschaftlichkeit <strong>und</strong> Einsatzmöglichkeit von Rapsprodukten in der Rinderfütterung.<br />
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Institut für Tierernährung <strong>und</strong> Futterwirtschaft, Grub.<br />
PREIßINGER, W., OBERMAIER, A. ; HITZLSPERGER, L. UND MAIERHOFER, R., (s.a.): Der Einsatz von Rapskuchen in der<br />
intensiven Bullenmast.<br />
PRIEPKE, A.; DRESCHES, H.; HACKL, W.; HENNING, U.; (2004): Blaue Süßlupine kann eine interessante Alternative sein.<br />
DGS Magazin, Woche 6/2004, Seite 42-46<br />
PROLEA (2004): Statistiques des oléagineux et protéagineux, Huiles et proteines végétales, 2003-2004. Paris :<br />
Selbstverlag.<br />
QUANZ, G. UND WEIß, J. (2003) : Prüfung der blauen Lupinensorte „Borweta“ in der Schweinemastmischungen, die<br />
nach der praecaecalen Verdaulichkeit der Aminosäuren optimiert waren. Jahrestbericht des Hessischen<br />
Dienstleistungszentrums für Landwirtschaft, Gartenbau <strong>und</strong> Naturschutz, S 35-36.<br />
RAAB, L.; JANKNECHT, G. (2002): Einsatz von Raspschrot bei Milchkühen. Selbstverlag. info@veredlungsproduktion.de<br />
REUTER, T. (2003): Vergleichende Untersuchungen <strong>zur</strong> ernährungsphysiologischen Bewertung von isogenem <strong>und</strong><br />
transgenem (Bt) Mais <strong>und</strong> zum Verbleib von „Fremd-DNA“ im Gastrointestinaltrakt <strong>und</strong> in ausgewählten Organen<br />
<strong>und</strong> Geweben des Schweines sowie in einem rohen Fleischerzeugnis. Dissertation am Institut für Tierernährung<br />
der B<strong>und</strong>esforschungsanstalt für Landwirtschaft in Braunschweig <strong>und</strong> dem Institut für Ernährungswissenschaften<br />
der Landwirtschaftlichen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 260 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 13: Literaturverzeichnis<br />
SALCHENEGGER, S. (2004): Biokraftstoffe im Verkehrssektor in Österreich 2004. Bericht <strong>zur</strong> Zusammenfassung der<br />
Daten der Republik Österreich gemäß Art. 4, Abs. 1 der Richtlinie 2003/30/EG für das Berichtsjahr 2003. Berichte,<br />
Bd. 251. Wien: Umweltb<strong>und</strong>esamt.<br />
SCHAMS-SCHARGH, M. (1993): Der Einsatz von Lupinen im Legehennenalleinfutter <strong>und</strong> im Hühnermastfutter.<br />
Dissertation. Universität für Bodenkultur.<br />
SCHINGOETHE, D. (2001): Using Distillers Grains in the Dairy Ration. Dairy Science Department, South Dakota State<br />
University.<br />
SCHUMACHER, K.D.; SINEMUS K.; SPRICK, P. (S.A.): Hintergr<strong>und</strong>papier des Gesprächskreis Grüne Gentechnik (GGG) zum<br />
Thema « Gentechnik-frei », at http://www.oelmuehlen.de/archiv/archiv.html.<br />
SCHWARZ, F.J.; UND KIRCHGESSNER, M. (1989): Verfütterung von Samen verschiedener Leguminosen (Ackerbohnen,<br />
Erbse, Lupine) <strong>und</strong> Rapsextraktionsschrot aus 0- <strong>und</strong> 00-Sorten in der Bullenmast; 1. Mitteilung: Zum Austausch<br />
von Sojaextraktionsschrot gegen alternative Eiweißkomponente; Züchtungsk<strong>und</strong>e, 61, (1), S. 71-82; © Eugen<br />
Ulmer Verlag GmbH& Co; Stuttgart<br />
SEELEY, T.H. (1997): Honigbienen. Basel – Boston – Berlin: Birkhäuser Verlag.<br />
SHURSON, G.C. (s.a.): Use of „ New Generation“ Distiller`s Dried Grains with Solubles in Livestock and Poultry<br />
Production Systems; Department of Animal Science; University of Minnesota; http://www.ddgs.umn.edu<br />
SIEDE, R., BÜCHLER, R. (2001) Molekularbiologische Honiganalytik <strong>zur</strong> Detektion transgenen Materials <strong>und</strong> <strong>zur</strong><br />
Herkunftsbestimmung. Apidologie 32(5), 466-468.<br />
SIEDLER, A (2005) Schriftl. Mitteilung<br />
SPANN, B.; HITZLSPERGER L.; OBERMAIER, A. UND MAIERHOFER (2000): Einsatz von geschütztem Rapsextraktionsschrot in<br />
der intensiven Bullenmast.<br />
SPIEKERS, H., SÜDEKUM K.-H. (2002): Der Einsatz von Rapsextraktionsschrot <strong>und</strong> Rapskuchen in der<br />
Milchkuhfütterung.<br />
STADLER, M. (2004): fentaco – Importpraxis bei GVO - kritischen Futtermitteln, am Beispiel der Sojaprodukte. In:<br />
NOVACK, K. (Hrsg.): Produktion mit <strong>und</strong> ohne Gentechnik – ist ein Nebeneinander möglich? Rahmenbedingungen<br />
<strong>und</strong> Umsetzung der Koexistenz <strong>und</strong> Warenflusstrennung. Frick: Forschungsinstitut für Biologischen Landbau.<br />
STATISTIK AUSTRIA (2003): Feldfruchtproduktion 2003, 5. Bericht-Endgültige Ergebnisse. Wien: Selbstverlag.<br />
STATISTIK AUSTRIA (2004): Feldfruchtproduktion 2004, 5. Bericht-Endgültige Ergebnisse. Wien: Selbstverlag.<br />
STATISTIK AUSTRIA (2005): Agrarstrukturerhebung 2003, Betriebsstruktur. Wien<br />
STATISTIK AUSTRIA (2005): Versorgungsbilanzen für pflanzliche Produkte 2003/2004,<br />
http://www.statistik.at/fachbereich_landwirtschaft/txt4.shtml<br />
STEINGASS, H. (2003): Kann Rapsschrot Sojaschrot ersetzen? Zum Futterwert <strong>und</strong> zum Einsatz von<br />
Rapsnebenprodukten bei Milchhkühen. In: In: Proc. 12th Conference on Nutrition of Domestic Animals. Hrsg: A.<br />
Pen (Ed.). Zadravec-Erjavec Days, Radenci/Slowenien, 06.-07.11.2003. Murska Sobota, 2003, S 131-140,<br />
(Nurtition of Domestic Animals)<br />
SUISSE GARANTIE (2005): Persönliche Mitteilung (6.4.2005), www.suissegarantie.ch<br />
SUNDRUM, A. , L. BÜTFERING, I. RUBELOWSKI, M., HENNING, G. STALLJOHANN UND K.H. HOPPENBROCK, 1999: Erzeugung von<br />
schweinefleisch unter den Prämissen des Ökologischen Landbaus. In HOFFMANN, H. <strong>und</strong> S. MÜLLER: Beiträge<br />
<strong>zur</strong> 5. Wissenschaftstagung zum ökologischen Landbau. 23. – 25. Februar 1999, Berlin<br />
TAUPP, M. (2001): Biodiesel. Würzburg: Seminararbeit, Bayerische Julius-Maximilians-Universität Würzburg.<br />
TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN, LEHRSTUHL DER PHYSIOLOGIE UND BAYERISCHE LANDESANSTALT FÜR TIERZUCHT (BLT) 2001-<br />
2004: Untersuchung einer möglichen Übertragung von Genen auf Magen-Darm-Mikroorganismen von mit Bt-Mais<br />
gefütterten Rindern. www.biosicherheit.de/features/printversion.php?context=1&id=19<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 261 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 13: Literaturverzeichnis<br />
TOEPFER INTERNATIONAL (2004): Statistische Informationen zum Getreide- <strong>und</strong> Futtermittelmarkt Edition 2004/05.<br />
Hamburg: Selbstverlag.<br />
TOEPFER INTERNATIONAL (2005): Marktbericht März 2005, at http://www.acti.de/frameset.html<br />
TRANSGEN WISSENSCHAFTSKOMMUNIKATION (2004): http://www.transgen.de<br />
TRANSGEN, 2004: Honig. http://www.transgen.de/datenbank/lebensmittel/238.doku.html<br />
TRANSGEN, 2005: Mais <strong>und</strong> Bienen. Bt-Mais: Pollen im Honig.<br />
http://www.transgen.de/einkauf/lebensmittel/208.doku.html<br />
TRETTER, H. (2004): Umsetzung der Bio-Kraftstoff-RL lt. KraftstoffVO in Österreich. Energieverwertungsagentur –the<br />
Austrian Energy Agency (E.V.A.). Wien: Selbstverlag.<br />
TREVOR, A. W. et al. (2004). Use of quantitative real-time and conventional PCR to assess the stability of the cp4<br />
epsps transgene from Roudup Ready canola in the intestinal, ruminal, and fecal contents of sheep. Journal of<br />
Biotechnology 122, 255-266.<br />
TUCKEY K. (1998): Canola. Those yellow fields are changing. Bee culture Vol. 126 (9), 21-23 .<br />
UHLMANN, F. (2003): Internationaler Handel mit gentechnisch veränderten pflanzlichen Erzeugnissen, FAL-MA-<br />
Arbeitsbericht 1/2003. Braunschweig: B<strong>und</strong>esforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL), Institut für Marktanalyse<br />
<strong>und</strong> Agrarhandelspolitik.<br />
UMWELTBUNDESAMT (2000): Monitoring von gentechnisch veränderten Pflanzen – Prioritätensetzung.<br />
http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/prio.pdf (01.04.2005).<br />
UNION DER DEUTSCHEN AKADEMIEN DER WISSENSCHAFTEN: Kommission Grüne Gentechnik. Gibt es Risiken für den<br />
Verbraucher beim Verzehr von Nahrungsprodukten aus gentechnisch veränderten Pflanzen. S. 1-4.<br />
USDA (2004): U.S. Departement of Agriculture, National Agricultural Statistics Service (NASS), at<br />
http://usda.mannlib.cornell.edu/reports/nassr/field/pcp-bba/acrg0604.txt (11.04.2005).<br />
VAN DEN EEDE, G. (2000): Vortrag, EU/JRC-ILSI Joint Workshop on "Method Development in Relation to Regulatory<br />
Requirements for the Detection of GMOs in the Food Chain" (Brüssel, 11.-13.12. 2000).<br />
Verband der Futtermittelindustrie Österreich, KAPELLER, J. (2005-07-14): Schriftliche Auskunft.<br />
VISSHER, P.K. and SEELEY, T.D. (1982): Foraging strategy of honeybee colonies in a temperate deciduous forest.<br />
Ecology 63 (6), 1790-1801 (in WILLE, H. <strong>und</strong> WILLE, M., 1984: Die Pollenversorgung des Bienenvolkes: Die<br />
wichtigsten Pollenarten, bewertet nach ihrem Eiweißgehalt <strong>und</strong> ihrer Häufigkeit im Pollensammelgut. Schweiz.<br />
Bienen-Zeitung 107 (7/8), 353-362.<br />
VON LENGERKEN, J. (2004): Qualität <strong>und</strong> Qualitätskontrolle bei Futtermitteln – Methodik – Analytik – Bewertung.<br />
Frankfurt am Main: Deutscher Fachverlag.<br />
VORWOHL, G. (1981): Imkerei <strong>und</strong> Weinbau. Imkerfre<strong>und</strong>, 36(7).<br />
WACKERNAGEL, W. (2002): Fakten <strong>und</strong> Fantasien zum horizontalen Gentransfer von rekombinanter DNA. Akademie-<br />
Journal 1/2002, 28-31.<br />
WALTHER-HELLWIG, K., BÜCHLER, R., FRANKL, R. HIMMEL, S. (2002): Honigbienendichte <strong>und</strong> Flugweite. Imkerfre<strong>und</strong> 57<br />
(9), 10-13.<br />
WENK, N.; STEBLER, D. UND BICKEL, R. (2001): Warenflusstrennung von GVO in Lebensmitteln. Basel: Europäisches<br />
Zentrum für Wirtschaftsforschung <strong>und</strong> Strategieberatung (Prognos).<br />
WETSCHEREK, W.; WÜRZNER, H UND LETTNER, F. (1988): Einsatz von Rapsexpeller in der Schweinemast. Der<br />
Förderungsdienst 36, Seite 264-266, 1988a<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 262 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 13: Literaturverzeichnis<br />
WETSCHEREK, W.; WÜRZNER, H UND LETTNER, F. (1988): Einsatz von Rapsexpeller im Schweinemastergänzungsfuttermittel<br />
für die Maiskornsilage. Der Förderungsdienst 36, Seite 260-264, 1988b<br />
WETSCHEREK, W.; ZOLLITSCH, W. UND LETTNER, F. (1988): Einsatz von Rapsextraktionsschrot im Ergänzungsfutter für die<br />
Schweinemast mit Maiskornsilage. Sonderdruck Die Bodenkultur, Journal für landwirtschaftliche Forschung Seite<br />
363-370<br />
WETSCHEREK-SEIPELT, G.; WETSCHEREK, W. UND ZOLLITSCH W. (1991): Einsatzmöglichkeit von Kürbiskernkuchen in der<br />
schweinemast. Sonderdruck Die Bodenkultur, Journal für landwirtschaftliche Forschung, Seite 277- 290<br />
WIEDNER, P. (2005): Pers. Mitteilung<br />
WIESENHOFGRUPPE (2005): Persönliche Mitteilung ( 5.4.2005)<br />
WILLIAMS, I. (2002): The EU regulatory framework for GM foods in relation to bee products. Bee World 83(2), 78-87<br />
WÜEST, J. (2004) Koexistenz aus der Sicht der Bauern. In: NOVACK, K. (Hrsg.): Produktion mit <strong>und</strong> ohne Gentechnik –<br />
ist ein Nebeneinander möglich? Rahmenbedingungen <strong>und</strong> Umsetzung der Koexistenz <strong>und</strong> Warenflusstrennung.<br />
Frick: Fibl-Report.<br />
WURM, C. (2002): persönliche Mitteilung.<br />
WÜRZNER, H. , WETSCHEREK, W. UND LETTNER, F. (1989): Rapsextraktionsschrot in der Hühnermast. Arch. Gefügelk<strong>und</strong>e<br />
53, 6-12.<br />
WÜRZNER, H. UND LETTNER, F. (1988): Der Einsatz von Rapsexpeller in der Geflügelmast ist problemlos. Der<br />
Förderungsdienst 36, Heft 6.<br />
Link:<br />
www.dge.de/Pages/navigation/fach_infos/dge_info/2000/fkp0900.htm<br />
www.weihenstephan.de/fml/physio/sonstig/Mitteilung#1<br />
www.bfa-ernaehrung.de/Bfe-Deutsch/Information/e-docs/janybericht/bfe6a.htm<br />
www.animal-health-online.de/drms/rinder/genfeed.htm<br />
www.mischfutter.at, 2005-04-24<br />
www.bmwa.gv.at, 2005-03-01<br />
Normen <strong>und</strong> amtliche Publikationen:<br />
2002/628/EG: Beschluß des Rates vom 25. Juni 2002 über den Abschluß des Protokolls von Cartagena über die<br />
biologische Sicherheit im Namen der Europäischen Gemeinschaft. Amtsblatt Nr. L 095 vom 12/04/2002 S. 0025 –<br />
0025.<br />
2003/17/EG: Entscheidung des Rates vom 16. Dezember 2002 über die Gleichstellung von Feldbesichtigungen von<br />
Saatgutvermehrungsbeständen in Drittländern <strong>und</strong> über die Gleichstellung von in Drittländern erzeugtem Saatgut.<br />
Amtsblatt Nr. L 008 vom 14/01/2003 S. 0010 – 0017.<br />
2004/842/EG: Entscheidung der Kommission vom 1. Dezember 2004 über Durchführungsbestimmungen, nach denen<br />
die Mitgliedstaaten das Inverkehrbringen von Saatgut der Sorten genehmigen können, für die die Aufnahme in<br />
den einzelstaatlichen Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflanzenarten oder für Gemüsearten beantragt wurde<br />
(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2004) 4493)Text von Bedeutung für den EWR Amtsblatt Nr. L 362 vom<br />
09/12/2004 S. 0021 - 0027<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 263 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 13: Literaturverzeichnis<br />
2003/556/EG: Empfehlung der Kommission vom 23. Juli 2003 mit Leitlinien für die Erarbeitung einzelstaatlicher<br />
Strategien <strong>und</strong> geeigneter Verfahren fr die Koexistenz gentechnisch veränderter, konventioneller <strong>und</strong> ökologischer<br />
Kulturen (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2003) 2624). Amtsblatt Nr. L 189 vom 29/07/2003 S. 0036 –<br />
0047.<br />
93/355/EWG: Beschluss des Rates vom 8. Juni 1993 über den Abschluss eines erläuternden Vermerks zwischen der<br />
Europaeischen Wirtschaftsgemeinschaft <strong>und</strong> den Vereinigten Staaten von Amerika über bestimmte Ölsaaten im<br />
Rahmen des GATT. Amtsblatt Nr. L 147 vom 18/06/1993 S. 0025 – 0025, berichtigt in Amtsblatt Nr. L 314 vom<br />
16/12/1993 S. 0051.<br />
ÄNDERUNG DES GENTECHNIKGESETZES UND DES LEBENSMITTELGESETZES 1975 (BGBI Nr. 126/04), Innerstaatliche Durchführung<br />
der VO (EG) Nr. 1830/2003 <strong>und</strong> 608/2004 (BGBI II Nr. 373/04) mit 1. Dezember 2004 in Kraft getreten.<br />
ÄNDERUNG DER KRAFTSTOFFVERORDNUNG (2004): 417. Verordnung des B<strong>und</strong>esministers für Land- <strong>und</strong> Forstwirtschaft,<br />
Umwelt <strong>und</strong> Wasserwirtschaft, mit der die Kraftstoffverordnung 1999 geändert wird. B<strong>und</strong>esgesetzblatt II Nr.<br />
417/2004 vom 4. November 2004.<br />
DÜNGEMITTELGESETZ 1994: B<strong>und</strong>esgesetz über den Verkehr mit Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten <strong>und</strong><br />
Pflanzenhilfsmitteln ( Düngemittelgesetz 1994 - DMG 1994). B<strong>und</strong>esgesetzblatt Nr. 513/1994 vom 12. Juli 1994,<br />
idgF.<br />
DÜNGEMITTELVERORDNUNG 2004: Verordnung des B<strong>und</strong>esministers für Land- <strong>und</strong> Forstwirtschaft, Umwelt <strong>und</strong><br />
Wasserwirtschaft, mit der Bestimmungen <strong>zur</strong> Durchführung des Düngemittelgesetzes 1994 erlassen werden<br />
(Düngemittelverordnung 2004). B<strong>und</strong>esgesetzblatt II Nr. 100/2004 vom 01. Februar 2004, idgF.<br />
GENTECHNIKGESETZ 1994: B<strong>und</strong>esgesetz, mit dem Arbeiten mit gentechnisch veränderten Organismen, das Freisetzen<br />
<strong>und</strong> Inverkehrbringen von gentechnisch veränderten Organismen <strong>und</strong> die Anwendung von Genanalyse <strong>und</strong><br />
Gentherapie am Menschen geregelt werden. B<strong>und</strong>esgesetzblatt Nr. 510/1994 vom 12. Juli 1994, idgF.<br />
GENTECHNIK-KENNZEICHNUNGSVERORNUNG 1998: 59. Verordnung der B<strong>und</strong>esministerin für Frauenangelegenheiten <strong>und</strong><br />
Verbraucherschutz über die Kennzeichnung von Erzeugnissen, die aus gentechnisch veränderten Organismen<br />
bestehen oder solche enthalten, <strong>und</strong> über weitere Angaben zu deren Inverkehrbringen (Gentechnijk-<br />
Kennzeichnungsverordnung). B<strong>und</strong>esgesetzblatt II Nr. 59/1998 vom 26. Februar 1998, i.d.g.F.<br />
METHODEN FÜR SAATGUT UND SORTEN – ANFORDERUNGEN AN DIE BESCHAFFENHEIT (2000): Methoden für Saatgut <strong>und</strong> Sorten –<br />
„Anforderungen an die Beschaffenheit <strong>und</strong> Methoden <strong>zur</strong> Bestimmung der Beschaffenheit von Saatgut“. Sorten-<br />
<strong>und</strong> Saatgutblatt 2000, 8. Jahrgang, Sondernummer 10 vom 04.05.2000, geändert im Sorten- <strong>und</strong> Saatgutblatt<br />
2001, 9. Jahrgang, Sondernummer 11, 24.08.2001, im Sorten- <strong>und</strong> Saatgutblatt 2002, 10. Jahrgang,<br />
Sondernummer 12, 21.01.2002, im Sorten- <strong>und</strong> Saatgutblatt 2002/1, 10. Jahrgang, Heft 1, 08.03.2002 <strong>und</strong> im<br />
Sorten- <strong>und</strong> Saatgutblatt 2002, 10. Jahrgang, Sondernummer 14, 13.08.2002.<br />
METHODEN FÜR SAATGUT UND SORTEN - gemäß § 5 Saatgutgesetz 1997, BGBl. I Nr. 72/1997, Änderung der Normen <strong>und</strong><br />
Verfahren <strong>zur</strong> Saatgutanerkennung betreffend die Anforderungen an den Vermehrungsbetrieb, die<br />
Vermehrungsfläche <strong>und</strong> den Feldbestand der Vermehrungsfläche bei Mais <strong>und</strong> Sorghum. Sorten- <strong>und</strong> Saatgutblatt<br />
2002, S 48, Wien, 08. März 2002.<br />
RL 76/371 EWG: Erste Richtlinie der Kommission vom 1. März 1976 <strong>zur</strong> Festlegung gemeinschaftlicher<br />
Probenahmeverfahren für die amtliche Untersuchung von Futtermitteln<br />
RL 2001/18/EG: Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments <strong>und</strong> des Rates vom 12. März 2001 über die<br />
absichtliche Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt <strong>und</strong> <strong>zur</strong> Aufhebung der Richtlinie<br />
90/220/EWG des Rates - Erklärung der Kommission. Amtsblatt Nr. L 106 vom 17/04/2001 S. 0001 – 0039.<br />
RL 2002/53/EG: Richtlinie 2002/53/EG des Rates vom 13. Juni 2002 über einen gemeinsamen Sortenkatalog für<br />
landwirtschaftliche Pflanzenarten. Amtsblatt Nr. L 193 vom 20/07/2002 S. 0001 – 0011.<br />
RL 2002/55/EG: Richtlinie 2002/55/EG des Rates vom 13. Juni 2002 über den Verkehr mit Gemüsesaatgut Amtsblatt<br />
Nr. L 193 vom 20/07/2002 S. 0033 - 0059<br />
RL 2002/57/EG: Richtlinie 2002/57/EG des Rates vom 13. Juni 2002 über den Verkehr mit Saatgut von Öl- <strong>und</strong><br />
Faserpflanzen. Amtsblatt Nr. L 193 vom 20/07/2002 S. 0074 – 0097.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 264 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 13: Literaturverzeichnis<br />
RL 2003/30/EG: Richtlinie 2003/30/EG des Europäischen Parlaments <strong>und</strong> des Rates vom 8. Mai 2003 <strong>zur</strong> Förderung<br />
der Verwendung von Biokraftstoffen oder anderen erneuerbaren Kraftstoffen im Verkehrssektor. Amtsblatt Nr. L<br />
123 vom 17/05/2003 S. 0042 – 0046.<br />
RL 66/402/EWG: Richtlinie 66/402/EWG des Rates vom 14. Juni 1966 über den Verkehr mit Getreidesaatgut.<br />
Amtsblatt Nr. 125 vom 11/07/1966 S. 2309 – 2319.<br />
SAATGUT-GENTECHNIK-VERORDNUNG 2001: BGBl. II Nr. 478/2001, 478. Verordnung des B<strong>und</strong>esministers für Land- <strong>und</strong><br />
Forstwirtschaft, Umwelt <strong>und</strong> Wasserwirtschaft über die Verunreinigung von Saatgut mit gentechnisch veränderten<br />
Organismen <strong>und</strong> die Kennzeichnung von GVO-Sorten <strong>und</strong> Saatgut von GVO-Sorten (Saatgut-Gentechnik-<br />
Verordnung), 21.Dezember 2001.<br />
SAATGUTGESETZ 1997: BGBl. I Nr. 72/1997, 72. B<strong>und</strong>esgesetz über die Saatgutanerkennung, die Saatgutzulassung <strong>und</strong><br />
das Inverkehrbringen von Saatgut sowie die Sortenzulassung, 11. Juli 1997 idgF.<br />
SANCO/1542/2000 Rev.: Internes Papier der Kommission (Entwurf einer Richtlinie), unter<br />
http://www.saveourseeds.org/downloads/com_inf_note_28_01_04.pdf (27.04.2005).<br />
VERBOT DES INVERKEHRBRINGENS DES GENTECHNISCH VERÄNDERTEN MAISES ZEA MAYS L., LINIE MON 810, IN ÖSTERREICH (1999):<br />
BGBl. II Nr. 175/1999, 175. Verordnung der B<strong>und</strong>esministerin für Frauenangelegenheiten <strong>und</strong><br />
Konsumentenschutz, mit der das Inverkehrbringen des gentechnisch veränderten Maises Zea Mays L., Linie MON<br />
810, in Österreich verboten wird, 10. Juni 1999.<br />
VERBOT DES INVERKEHRBRINGENS DES GENTECHNISCH VERÄNDERTEN MAISES ZEA MAYS L. T25 IN ÖSTERREICH (2000): BGBl. II Nr.<br />
120/2000, 120. Verordnung der B<strong>und</strong>esministerin für soziale Sicherheit <strong>und</strong> Generationen, mit der das<br />
Inverkehrbringen des gentechnisch veränderten Maises Zea Mays L. T25 in Österreich verboten wird, 28. April<br />
2000.<br />
VERBOT DES INVERKEHRBRINGENS VON GENTECHNISCH VERÄNDERTEM MAIS MIT DER KOMBINIERTEN VERÄNDERUNG DER<br />
INSEKTIZIDWIRKUNG DES BT-ENDOTOXIN-GENS UND ERHÖHTER TOLERANZ GEGENÜBER DEM HERBIZID GLUFOSINATAMMONIUM<br />
(1997): BGBl. II Nr. 45/1997, 45. Verordnung der B<strong>und</strong>esministerin für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Konsumentenschutz, mit<br />
der das Inverkehrbringen von gentechnisch verändertem Mais mit der kombinierten Veränderung der<br />
Insektizidwirkung des BT-Endotoxin-Gens <strong>und</strong> erhöhter Toleranz gegenüber dem Herbizid Glufosinatammonium<br />
verboten wird, 13. Februar 1997.<br />
VO (EG) NR. 258/97: Verordnung (EG) Nr. 258/97 des Europäischen Parlaments <strong>und</strong> des Rates vom 27. Januar 1997<br />
über neuartige Lebensmittel <strong>und</strong> neuartige Lebensmittelzutaten, Amtsblatt Nr. L 43/1 vom 14/02/1997.<br />
VO (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments <strong>und</strong> des Rates vom 29. April 2004 über amtliche Kontrolle <strong>zur</strong><br />
Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittel- <strong>und</strong> Futtermittelrechts sowie der Bestimmung über Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>und</strong> Tierschutz.<br />
VO (EG) NR. 641/2004: Verordnung (EG) Nr. 641/2004 der Kommission vom 06. April 2004 mit<br />
Durchführungsbestimmungen <strong>zur</strong> Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments <strong>und</strong> des Rates<br />
hinsichtlich des Antrags auf Zulassung neuer genetisch veränderter Lebensmittel <strong>und</strong> Futtermittel, der Meldung<br />
bestehender Erzeugnisse <strong>und</strong> des zufällligen oder technisch unvermeidbaren Vorhandenseins genetisch<br />
veränderten Materials, zu dem die Risikobewertung befürwortend ausgefallen ist, Amtsblatt Nr. L 102/14 vom<br />
07/04/2004.<br />
VO (EG) NR. 1515/2004: Verordnung (EG) Nr. 1515/2004 vom 26. August 2004 <strong>zur</strong> Änderung der Verordnung (EG)<br />
Nr. 2295/2003 mit Durchführungsbestimmungen <strong>zur</strong> Verordnung (EWG) Nr. 1907/90 des Rates über bestimmte<br />
Vermarktungsnormen für Eier, Amtsblatt Nr. L 278/7 vom 27/08/2004.<br />
VO (EG) NR. 1782/2003: Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 des Rates vom 29. September 2003 mit gemeinsamen<br />
Regeln für Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik <strong>und</strong> mit bestimmten Stützungsregelungen<br />
für Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe <strong>und</strong> <strong>zur</strong> Änderung der Verordnungen (EWG) Nr. 2019/93, (EG) Nr.<br />
1452/2001, (EG) Nr. 1453/2001, (EG) Nr. 1454/2001, (EG) Nr. 1868/94, (EG) Nr. 1251/1999, (EG) Nr.<br />
1254/1999, (EG) Nr. 1673/2000, (EWG) Nr. 2358/71 <strong>und</strong> (EG) Nr. 2529/2001. Amtsblatt Nr. L 270 vom<br />
21/10/2003, S. 0001-0069, berichtigt in Amtsblatt Nr. L 094 vom 31/03/2004, S. 0070-0070.<br />
VO (EG) NR. 1829/2003: Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments <strong>und</strong> des Rates vom 22.<br />
September 2003 über genetisch veränderte Lebensmittel <strong>und</strong> Futtermittel, Amtsblatt Nr. L 268/1 vom<br />
18/10/2003.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 265 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Kapitel 13: Literaturverzeichnis<br />
VO (EG) NR. 1830/2003: Verordnung (EG) Nr. 1830/2003 des Europäischen Parlaments <strong>und</strong> des Rates vom 22.<br />
September 2003 über die Rückverfolgbarkeit <strong>und</strong> Kennzeichnung von genetisch veränderten Organismen <strong>und</strong><br />
über die Rückverfolgbarkeit von aus genetisch veränderten Organismen hergestellten Lebensmitteln <strong>und</strong><br />
Futtermitteln sowie <strong>zur</strong> Änderung der Richtlinie 2001/18/EG, Amtsblatt Nr. L 268/24 vom 18/10/2003.<br />
VO (EWG) NR. 1907/90: Verordnung (EWG) Nr. 1907/90 vom 26. Juni 1990 über bestimmte Vermarktungsnormen für<br />
Eier, Amtsblatt Nr. L 173/5 vom 26/06/1990.<br />
VO (EG) NR. 1973/2004: Verordnung (EG) Nr. 1973/2004 der Kommission vom 29. Oktober 2004 mit<br />
Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 des Rates hinsichtlich der Stützungsregelungen<br />
nach Titel IV <strong>und</strong> IVa der Verordnung <strong>und</strong> der Verwendung von Stilllegungsflächen für die Erzeugung von<br />
Rohstoffen. Amtsblatt Nr. L 345 vom 20/11/2004, S. 0001-0084.<br />
VO (EWG) Nr. 2092/1991: Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates vom 24. Juni 1991 ueber den oekologischen<br />
Landbau <strong>und</strong> die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse <strong>und</strong> Lebensmittel. Amtsblatt<br />
Nr. L 198 vom 22/07/1991 S. 0001 – 0015.<br />
VO (EG) NR. 2295/2003: Verordnung (EG) Nr. 2295/2003 der Kommission vom 23. Dezember 2003 mit<br />
Durchführungsvorschriften <strong>zur</strong> Verordnung (EWG) Nr. 1907/90 des Rates über bestimmte Vermarktungsnormen<br />
für Eier, Amtsblatt Nr. L 340/16 vom 24/12/2003.<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 266 von 272
Tabellenverzeichnis<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Tabellenverzeichnis<br />
Tabelle 2-1: Zusammenfassung der verschiedenen gesetzlichen Rahmenbedingungen für „gentechnikfreie“ oder<br />
„GVO-freie“ Futtermittel-Ausgangserzeugnisse <strong>und</strong> Futtermittelzusatzstoffe.................................................15<br />
Tabelle 2-2: Zusammenfassung der wichtigsten vertraglichen Rahmenbedingungen von österreichischen <strong>und</strong> einigen<br />
ausländischen Gütesiegelprogrammen......................................................................................................20<br />
Tabelle 3-1: Sojabohnenproduktion - weltweit ...................................................................................................22<br />
Tabelle 3-2: Sojabohnenanbau <strong>und</strong> -produktion – Europa...................................................................................22<br />
Tabelle 3-3 : Mittelfristige Entwicklung der Sojabohnenproduktion ......................................................................23<br />
Tabelle 3-4: Maisproduktion - weltweit..............................................................................................................23<br />
Tabelle 3-5: Maisanbau <strong>und</strong> -produktion - Europa..............................................................................................24<br />
Tabelle 3-6: Mittelfristige Entwicklung der Maisproduktion ..................................................................................24<br />
Tabelle 3-7: Rapsproduktion – weltweit ...........................................................................................................24<br />
Tabelle 3-8: Rapsanbau <strong>und</strong> -produktion in Europa ............................................................................................25<br />
Tabelle 3-9: Mittelfristige Entwicklung der Rapsproduktion .................................................................................25<br />
Tabelle 3-10: Weizenproduktion - weltweit........................................................................................................25<br />
Tabelle 3-11: Weizenanbau <strong>und</strong> -produktion in Europa.......................................................................................26<br />
Tabelle 3-12: Mittelfristige Entwicklung der Weizenproduktion ............................................................................26<br />
Tabelle 3-13: Gerstenproduktion - weltweit .......................................................................................................26<br />
Tabelle 3-14: Gerstenanbau <strong>und</strong> -produktion in Europa ......................................................................................27<br />
Tabelle 3-15: Mittelfristige Entwicklung der .......................................................................................................27<br />
Tabelle 3-16: Kartoffelanbau <strong>und</strong> –produktion in Europa ....................................................................................28<br />
Tabelle 3-17: Futtererbsenanbau <strong>und</strong> –produktion in Europa ..............................................................................28<br />
Tabelle 3-18: Ackerbohnenanbau <strong>und</strong> –produktion in Europa..............................................................................28<br />
Tabelle 3-19: Lupinenanbau <strong>und</strong> –produktion in Europa .....................................................................................28<br />
Tabelle 3-20: Anbau- <strong>und</strong> Produktionsdaten ausgesuchter Kulturarten für Futtermittelzwecken..............................29<br />
Tabelle 3-21: Versorgungsbilanzen 2002/2003, Hülsenfrüchte <strong>und</strong> Ölfrüchte.......................................................30<br />
Tabelle 3-22: Prognose der benötigten Biokraftstoffmengen auf Basis einer Umsetzung der Ziele entsprechend der<br />
Kraftstoffverordnung ..............................................................................................................................32<br />
Tabelle 3-23: Prognose des Anfalls von Nebenprodukten der Biodiesel- <strong>und</strong> Bioethanolproduktion auf Basis einer<br />
Umsetzung der Ziele entsprechend der Kraftstoffverordnung......................................................................33<br />
Tabelle 3-24: Aufkommen von Rohprotein in Österreich (2004)...........................................................................34<br />
Tabelle 3-25: Freisetzungsanträge der ..............................................................................................................35<br />
Tabelle 3-26: Anzahl der gestellten Freisetzungsanträge: Auswahl einiger Kulturen unterteilt in Eigenschaften ........36<br />
Tabelle 3-27: Die Verbreitung von GV-Sojabohne im Jahr 2003...........................................................................39<br />
Tabelle 3-28: Die Verbreitung von GV-Sojabohne im Jahr 2004...........................................................................41<br />
Tabelle 3-29: Die Verbreitung von GV-Mais im Jahr 2003....................................................................................42<br />
Tabelle 3-30: Die Verbreitung von GV-Mais im Jahr 2004....................................................................................44<br />
Tabelle 3-31: Die Verbreitung von GV-Raps im Jahr 2003 ...................................................................................45<br />
Tabelle 3-32: Die Verbreitung von GV-Raps im Jahr 2004 ...................................................................................45<br />
Tabelle 3-33: Gesamtimport in die EU 15 von Sojabohnen <strong>und</strong> Sojaextraktionsschrot (umgerechnet in<br />
Sojabohnenäquivalente) in den Jahren 1999 bis 2003................................................................................47<br />
Tabelle 3-34: Der Import von Sojabohnen <strong>und</strong> SES der EU 15 von 1999 bis 2003 aus den drei GVO-<br />
Hauptanbauländern................................................................................................................................47<br />
Tabelle 3-35: Import an Sojabohnen <strong>und</strong> Sojaextraktionsschrot (SES) nach Österreich von 1999 bis 2003 ..............49<br />
Tabelle 3-36: Maisimport (inklusive Saatgut) der EU 15 aus Ländern mit GVO - Anbau von 1998 bis 2003 ..............50<br />
Tabelle 3-37: Maisimport in die EU 15 von 1998 bis 2003 ...................................................................................50<br />
Tabelle 3-38: Raps-/Rübsen-saatimport der EU 15 .............................................................................................51<br />
Tabelle 3-39: Raps-/Rübsenimport in die EU 15 von 1999 bis 2003 .....................................................................52<br />
Tabelle 3-40: Theoretisch verfügbare Menge an „GVO-freiem“ Sojabohnen ..........................................................55<br />
Tabelle 3-41: Schätzung der mittelfristigen........................................................................................................57<br />
Tabelle 4-1: Fragebogen-Verwenden Sie “GVO-freien“ SES? ...............................................................................62<br />
Tabelle 4-2: Fragebogen-Welche Höchstmenge an „GVO-freiem“ SES können Sie umschlagen? .............................63<br />
Tabelle 4-3: Fragebogen-Wie lange kann „GVO-freie“ SES-Menge garantiert werden? ...........................................64<br />
Tabelle 4-4: Fragebogen - Wie lange kann „GVO-freie“ SES-Menge oder mögliche Höchstmenge an „GVO-frei“ SES<br />
(Kreuztabelle) garantiert werden .............................................................................................................65<br />
Tabelle 4-5: Fragebogen-Produzieren Sie „GVO-freies“ Futter?............................................................................66<br />
Tabelle 4-6: Fragebogen - Welche Menge an zusätzlichem Rapsschrot können Sie pro Jahr auftreiben?..................67<br />
Tabelle 4-7: Fragebogen-Welche Menge an zusätzlichem Sonnenblumenschrot können Sie pro Jahr auftreiben? .....67<br />
Tabelle 4-8: Zusammenfassung <strong>zur</strong> Fragebogenauswertung betreffend Verfügbarkeit, des Zeitraumes für die<br />
Beschaffung, der Qualität <strong>und</strong> der potentiellen Preisanpassungen bei Sojaextraktionsschrot (SES) (Stand<br />
28.4.2005) ............................................................................................................................................69<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 267 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Tabellenverzeichnis<br />
Tabelle 4-9: Übersicht über importierte Aminosäuremengen nach Österreich <strong>und</strong> derzeitiger Anteil von „mit“ <strong>und</strong><br />
„ohne GVM“ in den Produktionsprozessen.................................................................................................71<br />
Tabelle 4-10: Geschätzter Vitaminbedarf in Tonnen pro Jahr für den gesamten Tierernährungsbereich in Österreich<br />
............................................................................................................................................................72<br />
Tabelle 4-11: Einschätzung der derzeitigen Situation, der mittelfristigen <strong>und</strong> langfristigen Verfügbarkeit von<br />
Vitaminen, die chemisch-synthetisch oder aus GVM hergestellt werden:.....................................................73<br />
Tabelle 4-12: Abschätzung der derzeitigen, mittelfristigen <strong>und</strong> langfristigen Verfügbarkeit von „GVO-freien“<br />
Rohstoffen oder Futtermittel-Ausgangserzeugnissen (v.a. SES, Mais, Raps) in Österreich..............................76<br />
Tabelle 4-13: Abschätzung der derzeitigen, mittelfristigen <strong>und</strong> langfristigen Verfügbarkeit von „GVO-frei“ oder<br />
<strong>„gentechnikfrei“</strong> hergestellten Zusatzstoffen (wie Vitamine, Enzyme <strong>und</strong> Mikroorganismen, sowie Aminosäuren)<br />
in Österreich..........................................................................................................................................77<br />
Tabelle 4-14: Rohproteinwerte <strong>und</strong> Aminosäuregehalte von SES <strong>und</strong> einzelner SES-Substitute in % .......................81<br />
Tabelle 4-15: Abdeckung des Rohproteingehaltes <strong>und</strong> Aminosäuregehaltes im Vergleich mit SES..........................82<br />
Tabelle 4-16: Maximale Einsatzgrenzen in % bzw. kg für alternative, heimische Pflanzen in der Ration (vgl.<br />
Wetscherek, 1993; SHURSON, 2004 <strong>und</strong> s.a)............................................................................................85<br />
Tabelle 4-17: BETRACHTUNG <strong>und</strong> RESÜMEE der Machbarkeit zu den Anforderungen der Ernährungsphysiologie,<br />
derzeitiger Verfügbarkeit <strong>und</strong> gesetzlichen Rahmenbedingungen (ohne ökonomische Bewertung) unter<br />
Berücksichtigung der Anforderungen nicht kennzeichnungspflichtiger Rohstoffe gemäß VO(EG) 1829/2003 <strong>und</strong><br />
der Anforderungen der österreichischen Codex-Richtlinie <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> von <strong>„gentechnikfrei“</strong> .......................90<br />
Tabelle 5-1: Ausgewählte Beispiele für höchstzulässige Partiegewichte <strong>und</strong> kleinste <strong>zur</strong> Prüfung einzusendende<br />
Gewichte ...............................................................................................................................................94<br />
Tabelle 5-2: Mindestanzahl der zu entnehmenden Erstproben bei Saatgut............................................................95<br />
Tabelle 6-1: Probenziehungsorte <strong>und</strong> Analyseergebnisse .................................................................................. 107<br />
Tabelle 6-2: Beschreibung Ablaufdiagramme ................................................................................................... 110<br />
Tabelle 6-3: Empfehlung der Probenahmen mit Kontrolldichte: ......................................................................... 124<br />
Tabelle 7-1: Fragebogen-Qualitative Angaben zu möglichen Mehrkosten durch die Futtermittelindustrie in Österreich<br />
.......................................................................................................................................................... 130<br />
Tabelle 7-2: Fragebogen-Wie hoch schätzen Sie eine Preissteigerung bei Mischfutter aufgr<strong>und</strong> des Einsatzes von<br />
„GVO-freiem“ SES ein? ......................................................................................................................... 131<br />
Tabelle 8-1: Überblick <strong>und</strong> Beschreibung zu den betrachteten Modellrationen .................................................... 136<br />
Tabelle 8-2: Übersichtsdarstellung über die Entstehung der Futtermittelrationen unter Berücksichtigung der 5 Modell-<br />
Varianten, gemäß Vorgabe aus dem Leistungsverzeichnis <strong>zur</strong> Studie......................................................... 139<br />
Tabelle 9-1: Anfallende Kosten <strong>und</strong> deren Berücksichtigung in der Berechnung der Futterdifferenzkosten............. 147<br />
Tabelle 9-2: Leistung eines durchschnittlichen österreichischen Milchviehbetriebs ............................................... 148<br />
Tabelle 9-3: Differenzkostenen je kg Milch im Qualitätsprogramm bei einem durchschnittlichen österreichischen<br />
Milchviehbetrieb................................................................................................................................... 151<br />
Tabelle 9-4: Milchmengen, die <strong>zur</strong> Erzeugung einzelner Milchprodukte benötigt werden ...................................... 152<br />
Tabelle 9-5: Leistung eines durchschnittlichen österreichischen Rindermastbetriebs auf Basis ganzer Schlachtkörper<br />
(d.h. inklusive Knochen, Abschnitte etc.) ................................................................................................ 152<br />
Tabelle 9-6: Differenzkosten je kg Rindfleisch im Qualitätsprogramm auf Basis ganzer Schlachtkörper (d.h. inklusive<br />
Knochen, Abschnitte etc.) ..................................................................................................................... 155<br />
Tabelle 9-7: Leistung eines durchschnittlichen österreichischen Schweinemastbetriebs auf Basis ganzer<br />
Schlachtkörper (d.h. inklusive Knochen, Abschnitte etc.).......................................................................... 155<br />
Tabelle 9-8: Differenzkosten je kg Schweinefleisch im Qualitätsprogramm auf Basis ganzer Schlachtkörper (d.h.<br />
inklusive Knochen, Abschnitte etc.)........................................................................................................ 160<br />
Tabelle 9-9: Ausschnitt aus einer durchschnittlichen Schnittliste einer Schweinehälfte ......................................... 160<br />
Tabelle 9-10: Leistung eines durchschnittlichen österreichischen Legehennenbetriebs......................................... 160<br />
Tabelle 9-11: Differenzkosten je Ei im Qualitätsprogramm ................................................................................ 166<br />
Tabelle 9-12: Leistung eines durchschnittlichen österreichischen Hühnermastbetriebs......................................... 166<br />
Tabelle 9-13: Differenzkosten je kg Hühnerfleisch im Qualitätsprogramm auf Basis ganzer Geflügelschlachtkörper 169<br />
Tabelle 9-14: Leistung eines durchschnittlichen österreichischen Putenmastbetriebs ........................................... 169<br />
Tabelle 9-15: Differenzkosten je kg Putenfleisch im Qualitätsprogramm............................................................. 172<br />
Tabelle 9-16: Akkreditierte Biokontrollstellen in Österreich................................................................................ 172<br />
Tabelle 9-17: Anteilige Kontrollkosten je produzierter Einheit <strong>und</strong> je Tier ........................................................... 173<br />
Tabelle 9-18: Futterverbrauch in Österreich..................................................................................................... 181<br />
Tabelle 10-1: Fragebogen-Welcher Umstellungszeitraum ist notwendig, um „GVO-frei“ oder <strong>„gentechnikfrei“</strong><br />
produzieren zu können?........................................................................................................................ 189<br />
Tabelle 10-2: Fragebogen-Wie hoch müsste die Nachfrage für eine rentable„GVO-freie“ oder „gentechnikfreie“<br />
Produktion sein? .................................................................................................................................. 190<br />
Tabelle 11-1: Warenfluss <strong>und</strong> Warenflusstrennung (nach WENK et al.2001, 37; abgeändert durch <strong>AGES</strong>)............. 193<br />
Tabelle 11-2: Gesetzliche Rahmenbedingungen betreffend Bienenprodukte <strong>und</strong> GVO hinsichtlich <strong>Auslobung</strong><br />
<strong>„gentechnikfrei“</strong> ................................................................................................................................... 217<br />
Tabelle 11-3: Bienen-Sammelgebiet bei unterschiedlichem Flugradius ............................................................... 221<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 268 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Tabellenverzeichnis<br />
Tabelle 11-4: Vorkommen von Mais-, Sonnenblumen- <strong>und</strong> Rapspollen in Honig (persönliche Mitteilung H. HEIGL,<br />
<strong>AGES</strong>- Institut für Bienenk<strong>und</strong>e) ............................................................................................................ 222<br />
Tabelle 11-5: Vorkommen von Mais, Sonnenblumen- <strong>und</strong> Cruciferae-Pollen in Kärntner Honigen des Jahres 2004<br />
(Mag. Angelika SIEDLER, unveröffentlichte, schriftl. Mitteilung 2005, Kärntner Imkerschule) ......................... 222<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 269 von 272
Abbildungsverzeichnis<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Abbildungsverzeichnis<br />
Abbildung 2-1: Die Rechtslage in der EU <strong>und</strong> in Österreich bezüglich GVO im Bereich Saatgut <strong>und</strong> Landwirtschaft....8<br />
Abbildung 2-2: Die Rechtslage in der EU <strong>und</strong> in Österreich bezüglich GVO im Bereich Futtermittel..........................10<br />
Abbildung 2-3: Die Rechtslage in der EU <strong>und</strong> in Österreich bezüglich GVO im Bereich tierischer Lebensmittel..........12<br />
Abbildung 3-1: Sojabohnenproduktion – weltweit, Quelle TOEPFER INTERNATIONAL 2004, Darstellung <strong>AGES</strong>.................22<br />
Abbildung 3-2: Maisproduktion – weltweit, Quelle TOEPFER INTERNATIONAL 2004, Darstellung <strong>AGES</strong>..........................23<br />
Abbildung 3-3: Rapsproduktion – weltweit, Quelle TOEPFER INTERNATIONAL 2004, Darstellung <strong>AGES</strong> .........................24<br />
Abbildung 3-4: Weizenproduktion – weltweit, Quelle TOEPFER INTERNATIONAL 2004, Darstellung <strong>AGES</strong>......................25<br />
Abbildung 3-5: Gerstenproduktion - weltweit, Quelle: TOEPFER INTERNATIONAL 2004, Darstellung <strong>AGES</strong> .....................26<br />
Abbildung 3-6: Freisetzungsanträge nach Eigenschaften.....................................................................................36<br />
Abbildung 3-7: Die Flächenanteile von GV-Sojabohne im Jahr 2003.....................................................................40<br />
Abbildung 3-8: Aufteilung der weltweiten Produktion von gentechnisch veränderten Sojabohnen im Jahr 2003 .......40<br />
Abbildung 3-9: Die Flächenanteile von GV-Sojabohne im Jahr 2004.....................................................................41<br />
Abbildung 3-10: Die Flächenanteile von GV-Mais im Jahr 2003............................................................................43<br />
Abbildung 3-11: Aufteilung der weltweiten Produktion von genetisch verändertem Mais im Jahr 2003 ...................43<br />
Abbildung 3-12: Die Flächenanteile von GV-Mais im Jahr 2004............................................................................44<br />
Abbildung 3-13: Maisimport der EU 15 von 1998 bis 2003 ..................................................................................50<br />
Abbildung 3-14: Maisimport (inklusive Saatgut) nach Österreich zwischen 1999 bis 2003 aus/über die Länder der EU<br />
............................................................................................................................................................51<br />
Abbildung 3-15: Raps-/Rübsen-saatimport der EU15 von 1999 bis 2003 ..............................................................52<br />
Abbildung 3-16: Rapsimport von 1999 bis 2003 nach Österreich .........................................................................53<br />
Abbildung 3-17: Die Entwicklung des weltweiten GVO-Sojabohnenanbaus von 1997 bis 2004...............................55<br />
Abbildung 3-18: Schätzung der mittelfristigen Entwicklung der Anbauflächen von (GV-)Sojabohnen, weltweit .........57<br />
Abbildung 4-1: Fragebogen-Verwenden Sie „GVO-freien“ SES? ...........................................................................62<br />
Abbildung 4-2: Fragebogen-Welche Höchstmenge an „GVO-...............................................................................63<br />
Abbildung 4-3: Fragebogen - Wie lange kann „GVO-freie“ SES-...........................................................................65<br />
Abbildung 4-4: Fragebogen - Produzieren Sie „GVO-freies“ Futter?......................................................................66<br />
Abbildung 4-5: Fragebogen-Welche Menge an zusätzlichem................................................................................67<br />
Abbildung 4-6: Fragebogen-Welche Menge an...................................................................................................68<br />
Abbildung 6-1: Supply Chain vom Anbau des Rohstoffs/Futtermittelausgangserzeugnisses bis zum Lebensmittel<br />
tierischer Herkunft bzw. Konsum. .......................................................................................................... 105<br />
Abbildung 6-2: Sojabohnen-Wege vom Sojabohnen-Produzenten bis zum tierhaltenden Landwirt......................... 109<br />
Abbildung 6-3: Kritische Verschleppungs- <strong>und</strong> Verunreinigungspunkte in der Supply Chain .................................. 111<br />
Abbildung 6-4: Flussdiagramm Sammelstelle, Transport <strong>und</strong> Zwischenlagerstelle................................................ 115<br />
Abbildung 6-5: Flussdiagramm Futtermittelwerk .............................................................................................. 116<br />
Abbildung 6-6: Flussdiagramm Selbstmischer .................................................................................................. 118<br />
Abbildung 6-7: Flussdiagramm Eierproduktion ................................................................................................. 119<br />
Abbildung 6-8: Flussdiagramm Geflügelmast ................................................................................................... 120<br />
Abbildung 6-9: Flussdiagramm Schweinemast ................................................................................................. 121<br />
Abbildung 6-10: Flussdiagramm Milchproduktion ............................................................................................. 122<br />
Abbildung 7-1: Fragebogen-Wie hoch schätzen Sie eine Preissteigerung ............................................................ 132<br />
Abbildung 7-2: Fragebogen-Wie hoch schätzen Sie eine Verteuerung ................................................................ 133<br />
Abbildung 7-3: Fragebogen - Wie hoch schätzen Sie eine Verteuerung ............................................................. 133<br />
Abbildung 7-4: Fragebogen-Wie hoch schätzen Sie eine Verteuerung ................................................................ 134<br />
Abbildung 9-1:Teile der Wertschöpfungskette in denen Differenzkosten aufgezeigt werden ................................. 141<br />
Abbildung 9-2: Preise für Eiweißprodukte <strong>zur</strong> Futtermittelherstellung in den Jahren 2003 <strong>und</strong> 2004 ..................... 144<br />
Abbildung 9-3: Kraftfutterdifferenzkosten bei 20 kg Milchleistung je Tag............................................................ 149<br />
Abbildung 9-4: Kraftfutterdifferenzkosten bei 35 kg Milchleistung je Tag............................................................ 150<br />
Abbildung 9-5: Kraftfutterdifferenzkosten je Maststier bei Gr<strong>und</strong>futterbasis Maissilage ........................................ 153<br />
Abbildung 9-6: Kraftfutterdifferenzkosten je Maststier mit entsprechendem Qualitätszuschlag bei Gr<strong>und</strong>futterbasis<br />
Maissilage............................................................................................................................................ 154<br />
Abbildung 9-7: Futterdifferenzkosten, inkl. Ferkelaufzucht, bei Schweinemast mit Maiskornsilage (Eigenmischung) 156<br />
Abbildung 9-8: Futterdifferenzkosten, inkl. Ferkelaufzucht, bei Schweinemast mit Zukauffutter (Industriemischung)<br />
.......................................................................................................................................................... 157<br />
Abbildung 9-9: Futterdifferenzkosten je Mastschwein im Qualitätsprogramm, inkl. Ferkelaufzucht, bei.................. 158<br />
Abbildung 9-10: Futterdifferenzkosten je Mastschwein im Qualitätsprogramm, inkl. Ferkelaufzucht, bei ................ 159<br />
Abbildung 9-11: Futterdifferenzkosten je Ei bei Bodenhaltung........................................................................... 162<br />
Abbildung 9-12: Futterdifferenzkosten je Ei bei Freilandhaltung ........................................................................ 163<br />
Abbildung 9-13: Futterdifferenzkosten je Ei im Qualitätsprogramm bei Bodenhaltung.......................................... 164<br />
Abbildung 9-14: Futterdifferenzkosten je Ei im Qualitätsprogramm bei Freilandhaltung ....................................... 165<br />
Abbildung 9-15: Futterdifferenzkosten je Masthuhn.......................................................................................... 167<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 270 von 272
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Abbildungsverzeichnis<br />
Abbildung 9-16: Futterdifferenzkosten je Masthuhn im Qualitätsprogramm ........................................................ 168<br />
Abbildung 9-17: Futterdifferenzkosten je Mastpute .......................................................................................... 170<br />
Abbildung 9-18: Futterdifferenzkosten je Mastpute im Qualitätsprogramm ......................................................... 171<br />
Abbildung 9-19: Anteil von Hofmischung <strong>und</strong> Fertigfutter nach Tierarten ........................................................... 176<br />
Abbildung 9-20: Viehbestand Rinder (ohne Kühe) ............................................................................................ 177<br />
Abbildung 9-21: Futterverbrauch Rinder (ohne Kühe) in t ................................................................................. 178<br />
Abbildung 9-22: Viehbestand Kühe................................................................................................................. 178<br />
Abbildung 9-23: Futterverbrauch Kühe in t ...................................................................................................... 179<br />
Abbildung 9-24: Viehbestand Schweine........................................................................................................... 179<br />
Abbildung 9-25: Futterverbrauch Schweine in t................................................................................................ 180<br />
Abbildung 9-26: Viehbestand Geflügel ............................................................................................................ 180<br />
Abbildung 9-27: Futterverbrauch Geflügel in t ................................................................................................. 181<br />
Abbildung 9-28: Viehbestände <strong>und</strong> Futtermittelnachfrage in den einzelnen B<strong>und</strong>esländern .................................. 184<br />
Abbildung 10-1: Fragebogen- Möglichkeit für eine geschlossene Produktionsschiene........................................... 188<br />
Abbildung 10-2: Fragebogen- Planenungsvorhaben einer geschlossenen Produktionsschiene ............................... 188<br />
Abbildung 10-3: Fragebogen- Umstellungszeitraum ist ..................................................................................... 189<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 271 von 272
Abkürzungsverzeichnis<br />
<strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>zur</strong> <strong>Auslobung</strong> <strong>„gentechnikfrei“</strong> <strong>und</strong> Vermeidung von GVO bei Lebensmittel<br />
Abkürzungsverzeichnis<br />
Abkürzung Erklärung<br />
AS Aminosäure<br />
bp base pairs (Basenpaare)<br />
Bt-maize Bacillus thuringiensis toxin-maize<br />
chem.-synth. chemisch-synthetisch<br />
DNA deoxyribonucleic acid<br />
DNS Desoxyribonukleinsäure<br />
ELISA enzyme-linked immunosorbent assay<br />
epsps-(Gen) 5-Enolpyruvylshikiminat-3-Phosphat-Synthetase-(Gen)<br />
ETH Zürich Eidgenössische Technische Hochschule Zürich<br />
GIT-Trakt Gastrointestinaltrakt<br />
GM Gentechnisch modifiziert / genetically modified<br />
GMO genetically modified organism<br />
GV Gentechnisch verändert<br />
GVM gentechnisch veränderte Mikroorganismen<br />
GVO Gentechnisch veränderter Organismus<br />
I.P. identity preservation<br />
PCR polymerase chain reaction (Polymerase-Kettenreaktion)<br />
QM Qualitätsmanagement<br />
QS Qualitätssicherung<br />
- N - keine Daten verfügbar<br />
s.a. sine annum<br />
SES Sojaextraktionsschrot<br />
syn. Synthetisch<br />
Österreichische Agentur für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 272 von 272