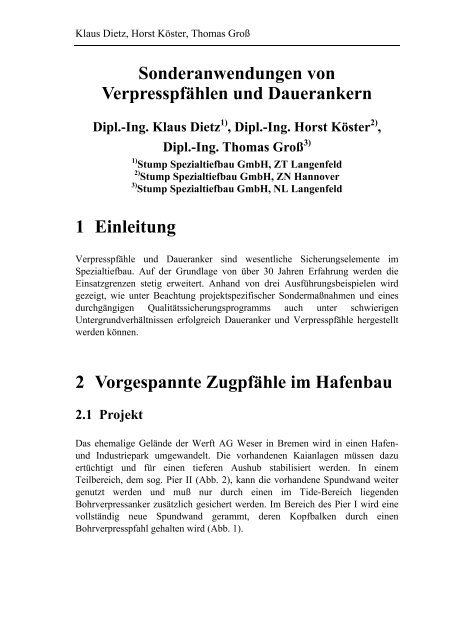Ing. Klaus Dietz1), Dipl. - Stump Spezialtiefbau GmbH
Ing. Klaus Dietz1), Dipl. - Stump Spezialtiefbau GmbH
Ing. Klaus Dietz1), Dipl. - Stump Spezialtiefbau GmbH
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Klaus</strong> Dietz, Horst Köster, Thomas Groß<br />
Sonderanwendungen von<br />
Verpresspfählen und Dauerankern<br />
<strong>Dipl</strong>.-<strong>Ing</strong>. <strong>Klaus</strong> Dietz 1) , <strong>Dipl</strong>.-<strong>Ing</strong>. Horst Köster 2) ,<br />
<strong>Dipl</strong>.-<strong>Ing</strong>. Thomas Groß 3)<br />
1 Einleitung<br />
1) <strong>Stump</strong> <strong>Spezialtiefbau</strong> <strong>GmbH</strong>, ZT Langenfeld<br />
2) <strong>Stump</strong> <strong>Spezialtiefbau</strong> <strong>GmbH</strong>, ZN Hannover<br />
3) <strong>Stump</strong> <strong>Spezialtiefbau</strong> <strong>GmbH</strong>, NL Langenfeld<br />
Verpresspfähle und Daueranker sind wesentliche Sicherungselemente im<br />
<strong>Spezialtiefbau</strong>. Auf der Grundlage von über 30 Jahren Erfahrung werden die<br />
Einsatzgrenzen stetig erweitert. Anhand von drei Ausführungsbeispielen wird<br />
gezeigt, wie unter Beachtung projektspezifischer Sondermaßnahmen und eines<br />
durchgängigen Qualitätssicherungsprogramms auch unter schwierigen<br />
Untergrundverhältnissen erfolgreich Daueranker und Verpresspfähle hergestellt<br />
werden können.<br />
2 Vorgespannte Zugpfähle im Hafenbau<br />
2.1 Projekt<br />
Das ehemalige Gelände der Werft AG Weser in Bremen wird in einen Hafenund<br />
Industriepark umgewandelt. Die vorhandenen Kaianlagen müssen dazu<br />
ertüchtigt und für einen tieferen Aushub stabilisiert werden. In einem<br />
Teilbereich, dem sog. Pier II (Abb. 2), kann die vorhandene Spundwand weiter<br />
genutzt werden und muß nur durch einen im Tide-Bereich liegenden<br />
Bohrverpressanker zusätzlich gesichert werden. Im Bereich des Pier I wird eine<br />
vollständig neue Spundwand gerammt, deren Kopfbalken durch einen<br />
Bohrverpresspfahl gehalten wird (Abb. 1).
2 16. Chr. Veder Kolloquium, Graz 2001<br />
Abb. 1: Sanierung Gelände AG Weser Gelände Pier I<br />
2.2 Baugrund und Randbedingungen<br />
Oberflächennahe ist der Untergrund im Projektgebiet durch zahlreiche<br />
Veränderungen auf dem Gelände mit Kulturschutt überdeckt. Dieser Bereich der<br />
Auffüllungen mit Ziegelresten und Betoneinbauten reicht bis ca. - 7 m. Darunter<br />
stehen weitere sandig-kiesige Auffüllungen an, die als Gründungsbereich<br />
aufgeschüttet worden waren. Schließlich folgt ein locker gelagertes Kies-Sand-<br />
Gemisch, das ab –8 bis - 10 müNN von Ton und Schluff unterlagert wird. Durch<br />
die lockere Lagung des Kies-Sand-Gemisches war es notwendig,<br />
Zusatzmaßnahmen –in Form eines aufgedüsten Fußes- zu ergreifen, um die<br />
Gebrauchskräfte der Pfähle von 900 kN mit der nötigen Sicherheit in den<br />
Untergrund einzubringen. Da die Ankeransatzpunkte im Pier II im<br />
Wasserwechselbereich lagen, konnten das Setzen der Anker und die<br />
Spannarbeiten nur bei Niedrigwasser erfolgen.
<strong>Klaus</strong> Dietz, Horst Köster, Thomas Groß<br />
Abb. 2: Sanierung Gelände AG Weser Gelände Pier II<br />
2.3 Sondermaßnahmen und Qualitätssicherung<br />
Die Tragfähigkeit der Pfähle sowie der Anker wurde durch einen aufgedüsten<br />
HDI-Fuß gewährleistet. Dazu wurde zuerst eine Bohrung im<br />
Überlagerungsbohrverfahren Ø 160 mm abgeteuft. Nach Erreichen der Endteufe<br />
von ca. 27 m wurden die letzten 3 m der Krafteinleitungsstrecke im HDI-<br />
Verfahren aufgefräst. Danach wurde die Verrohrung wieder auf Endteufe<br />
gebracht und das Stahltragglied aus St 52 Ø 90 mm eingeführt. Anschließend<br />
erfolgte stufenweise die Verpressung der 12 m langen Krafteinleitungsstrecke.<br />
Sämtliche Anker wurden einer Abnahmeprüfung unterzogen und auf 1200 kN<br />
gespannt. Alle Zugglieder haben die zulässigen Verformungswerte eingehalten.<br />
Neben der Gewährleistung der Tragfähigkeit der Pfähle stellte die Herstellung<br />
der Bohrlöcher eine weitere Herausforderung dar. Im Bereich des Pier I, wo der<br />
Pfahl im Kopfbalken endete, wurde mit einem Hängegerüst gearbeitet, das auf<br />
der Kaimauer verschoben werden konnte (Abb. 3). Am Pier II dürfte die<br />
Spundwand im Bauzustand nicht zusätzlich belastet werden, so daß das<br />
Hängegerüst nicht eingesetzt werden konnte. Die Arbeiten erfolgten deshalb von<br />
der Wasserseite mittels eines Pontons(Abb. 4). Während des Bohrvorgangs<br />
mußte infolge des Tideeinflusses ( Tidehub ca. 3,0 m) das Bohrgestänge ständig<br />
nachjustiert werden. Aufgrund der sorgfältigen Arbeitsweise der Bohrmannschaft<br />
traten nur vereinzelt Gestängebrüche auf.
4 16. Chr. Veder Kolloquium, Graz 2001<br />
Abb.3: Bohrarbeiten im Kopfbereich vom Hängegerüst aus (Pier I).<br />
Abb.4: Bohrarbeiten im Tidebereich vom Ponton (PierII)
<strong>Klaus</strong> Dietz, Horst Köster, Thomas Groß<br />
3 Daueranker in aggressivem Baugrund<br />
3.1 Projekt<br />
Die DB AG baut zwischen Köln und Frankfurt eine neue Trasse für<br />
Hochgeschwindigkeitszüge. Im Rahmen dieses Bauvorhabens sind zahlreiche<br />
Sonderbauwerke erforderlich, die teilweise auch mit Ankern gesichert werden.<br />
Im besonderen Fall war eine Stützwand zur Sicherung eines Hangeinschnitts<br />
notwendig. Die zunächst vorgesehene Winkelstützmauer wurde durch eine am<br />
Kopfbalken rückverankerte, aufgelöste Bohrpfahlwand ersetzt (Abb. 5).<br />
Insgesamt mußten 431 Daueranker mit Gebrauchslasten bis zu 1.130 kN und<br />
Längen bis zu 45 m hergestellt werden. Bei ca. 290 Dauerankern lag die<br />
Verankerungslänge unter dem Grundwasserspiegel. Da das Grundwasser<br />
betonangreifende freie Kohlensäure enthielt, mußten Sondermaßnahmen<br />
getroffen werden.<br />
Abb. 5: Querschnitt Stützwand Hombach NBS Köln – Rhein/Main
6 16. Chr. Veder Kolloquium, Graz 2001<br />
3.2 Baugrund und Randbedingungen<br />
Unter einer etwa 1 m starken Überlagerung steht eine ca. 1,5 m mächtige Schicht<br />
aus Hanglehm an. Darunter folgt zersetzter bis verwitterter Fels und schließlich<br />
mäßig verwittert devonischer Fels, der überwiegend aus Ton, Schluff und<br />
Sandsteinen sowie Sand und Tonschiefer besteht. In Abhängigkeit von den mehr<br />
oder weniger offenen Klüften und Störzonen sind diese Gesteine des rheinischen<br />
Schiefergebirges in der Regel mäßig durchlässige Grundwasserleiter. Gemäß<br />
Baugrundgutachten konnte mit einer mittleren Durchlässigkeit von kf ≈ 10 -7 m/s<br />
ausgegangen werden. Aufgrund der kalkaggressiven Kohlensäure mit Anteilen<br />
zwischen etwa 20 und 100 mg/l muß das Grundwasser nach DIN 4030 als<br />
schwach bis stark betonangreifend bezeichnet werden.<br />
3.3 Sondermaßnahmen und Qualitätssicherung<br />
Gemäß DIN 4125, 5.1.3 dürfen Daueranker im Fels nur dann bei aggressiven<br />
Angriffsgraden eingebaut werden, wenn durch geeignete Sondermaßnahmen die<br />
Tragfähigkeit der Anker auf Dauer sichergestellt ist, z. B. Bohrlochvergütung<br />
durch Einpressen nach DIN 4093, um aggressives Wasser vom Verpreßkörper<br />
fernzuhalten (Abb. 6). Entscheidend ist, daß eine Entfestigung der<br />
Zementsteinoberfläche nur dort zu erwarten ist, wo das in den Kluft- oder<br />
Störzonen fließende Wasser auf den Verpreßkörper trifft. In den Bereichen des<br />
Verpreßkörpers ohne offene Klüfte oder Störungen sind keine Entfestigungen der<br />
Zementsteinoberfläche zu erwarten. Zunächst wurde im Rahmen von<br />
Eignungsversuchen überprüft, inwieweit das anstehende Gebirge ausreichend<br />
verpreßt werden konnte.<br />
Abb. 6: Verdrängung des Kluftwassers durch Vorinjektion
<strong>Klaus</strong> Dietz, Horst Köster, Thomas Groß<br />
Dazu wurden nach Abteufen (Abb. 7) der Bohrlöcher im Bereich der<br />
Krafteinleitungstrecke Wasserdurchlässigkeitsversuche mit einem Maximaldruck<br />
von 1,5 bar durchgeführt. Als Qualitätskriterium für den Einbau eines<br />
Dauerankers wurde festgesetzt, daß der Durchfluß bei 1 bar kleiner als 3 l/min<br />
auf der gesamten Verpreßstrecke von 6 m sein mußte. Die WD-Tests wurden<br />
automatisch aufgezeichnet und mittels EDV ausgewertet. Beim Überschreiten<br />
des WD-Kriteriums erfolgte die Vorinjektion der Krafteinleitungsstrecke mit<br />
Zementsuspension. In Abhängigkeit von der Injektionsgutaufnahme wurde der<br />
W/Z-Wertes zwischen 1,0 und 0,45 variiert. Zum Einsatz kam CEM 42,5R mit<br />
einer Beimengung von 20% Flugasche. Die mittlere Verpreßmenge bei den<br />
Probeankern lag über 500 kg. Am folgenden Tag wurde die Verpreßstrecke<br />
aufgebohrt und erneut ein WD-Test durchgeführt. Bei positiven Ergebnis konnte<br />
dann der Anker eingebaut werden oder die Vorinjektion mußte wiederholt<br />
werden. Jeder Arbeitsgang wurde in einem Qualitätssicherungsplan eingetragen<br />
und von der Bauüberwachung abgezeichnet.<br />
Abb. 7: Bohrarbeiten mit Magazinbohrgerät<br />
3.4 Ausführung<br />
Während der Ausführung zeigte sich, daß die Durchlässigkeit des anstehenden<br />
verwitterten Felsens deutlich höher war als im Baugrundgutachten angenommen.<br />
Dies führte dazu, daß insgesamt etwa 840 WD-Tests durchgeführt werden
8 16. Chr. Veder Kolloquium, Graz 2001<br />
mußten, teilweise bis zu sieben mal in einer Bohrung. Daraus resultierten<br />
erhebliche Störungen im Bauablauf. Auch bei der Bauausführung wurde jeder<br />
einzelne Arbeitsschritt festgehalten und abgezeichnet, von WD-Tests über die<br />
Vorvergütung, den Einbau bis zum Spannen (Abb. 8). Die Daueranker wurden in<br />
einer Bauzeit von 8 Monaten hergestellt.<br />
Abb. 8: Abnahmeprüfung gemäß DIN 4125<br />
4 Verpreßpfähle in Böden mit<br />
organischen Beimengungen<br />
4.1 Projekt<br />
Die Staatsbibliothek Unter den Linden ist das Stammhaus der größten<br />
wissenschaftlichen Universalbibliothek in Deutschland. Das zwischen 1903 und<br />
1904 errichtete Bauwerk stellt den weitläufigsten historischen Gebäudekomplex<br />
in Berlin dar. Zur Sicherung der Bausubstanz aber auch zur Umsetzung einer<br />
neuen Nutzungskonzeption wurden umfangreiche Nachgründungsarbeiten an
<strong>Klaus</strong> Dietz, Horst Köster, Thomas Groß<br />
dem denkmalgeschützten Gebäude erforderlich. Neben einer<br />
Untergrundverfestigung in Düsenstrahlverfahren von 8.000 m³ und einer<br />
Bodenverfestigung mittels Feinstzementinjektionen von 2.000 m³ wurden 50.000<br />
lfm Kleinbohrpfähle mit Gebrauchslasten von 860 kN und maximalen Längen<br />
von 32 m hergestellt.<br />
4.2 Baugrund und Randbedingungen<br />
Der Gebäudekomplex, welcher sich auf einer Grundfläche von 106 m x 170 m<br />
erstreckt, ist im Berliner Urstromtal im Bereich der Spreeniederung gegründet.<br />
Die ausgeführten Baugrunduntersuchungen ergaben, daß unter dem<br />
Gebäudekomplex aus nordwestlicher Richtung bis zum Brunnenhof eine Mudde<br />
- Rinne verläuft. Diese Rinne ist durch eine diskontinuierliche Wechsellagerung<br />
aus Sanden und Torf gekennzeichnet. Die Ablagerungen bestehen aus<br />
Faulschlamm und rolligen Bodenmaterial mit starken organischen<br />
Beimengungen und sind deshalb als nicht tragfähig einzustufen. Unterhalb dieser<br />
Rinne stehen mitteldicht gelagerte Sande an, welche als tragfähige<br />
Bodenschichten zur Abtragung der Gebäudelasten herangezogen werden (Abb.<br />
9). Aufgrund der stark diskontinuierlichen Baugrundsituation wurden bei der<br />
Errichtung der Staatsbibliothek drei verschiedene Gründungsvarianten<br />
eingesetzt:<br />
Abb 9: Baugrundsituation Staatsbibliothek, Neues Museum Berlin
10 16. Chr. Veder Kolloquium, Graz 2001<br />
1. Flachgründung mittels Streifenfundamenten<br />
2. Tiefgründung aus Kiefernholzpfählen mit einem Durchmesser von ca. 30 cm<br />
3. Tiefgründung auf Holzsenkkästen mit einer Auffüllung aus Geröll und Beton<br />
Im Zuge der Errichtung von Neubauten in der Nachbarschaft in den 70er und<br />
80er Jahren wurde periodisch der Grundwasserspiegel, welcher in diesem<br />
Bereich bei ca. 31 m üNN liegt abgesenkt. In der Folge gelangten die Köpfe der<br />
Holzpfahlgründung in einen Bereich ständigen Wechsels zwischen<br />
Durchfeuchtung und Austrocknung mit Sauerstoffzutritt. Der dadurch<br />
eingeleitete Fäulnisprozeß war inzwischen soweit fortgeschritten, daß eine<br />
Schädigung von durchschnittlich 70%, in Teilbereichen sogar bis zu 95%, des<br />
ursprünglichen Querschnitts festgestellt wurde. Aufgrund dieser Tatsachen<br />
wurde eine umfassende Sanierung der Gründung beschlossen. Das<br />
Sanierungskonzept beruhte auf einer Umlagerung der Vertikallasten von den<br />
vorhandenen geschädigten Holzpfählen auf neu herzustellende Kleinbohrpfähle.<br />
Abb. 10: Sanierungsmaßnahmen Durchsteck- und Einsteckträger in<br />
Verbindung mit Rohrpfählen oder Verbundpfählen System <strong>Stump</strong><br />
Um die vorhandene Gründungssituation nicht negativ zu beeinflussen wurde<br />
jeweils eine Pfahlreihe beiderseits von den alten Kopfbalken angeordnet ( Abb.<br />
10). Gemäß einem Sondervorschlag der <strong>Stump</strong> <strong>Spezialtiefbau</strong> <strong>GmbH</strong> kamen<br />
Verbundpfähle System <strong>Stump</strong> mit GEWI-Stahltraggliedern zu Einsatz. Die<br />
ungünstigen Baugrundbedingungen wurden dadurch berücksichtigt, daß der<br />
Pfahlschachtdurchmesser auf 240 mm vergrößert wurde. Durch eine intensive,<br />
stufenweise Verpressung des Pfahlschachtes wurde ein inniger Verbund<br />
zwischen dem Untergrund und ein dichter Pfahlbeton hergestellt. Die<br />
durchgeführten Probebelastungen erbrachten den Nachweis der geforderten<br />
Lastabtragung von 800 kN mit zweifacher Sicherheit.
<strong>Klaus</strong> Dietz, Horst Köster, Thomas Groß<br />
Die Bohrungen für die im Gebäude angeordneten Pfählen mußten mit<br />
Spezialbohrgeräten nieder gebracht werden, da teilweise nur eine Raumhöhe von<br />
2,50 m zur Verfügung stand. (Abb. 11)<br />
Abb. 11: Bohrarbeiten für die Pfahlherstellung<br />
Zur Überprüfung der Baugrundsituation und zur Feststellung von<br />
Bohrhindernissen wurden während des Bohrvorgangs alle relevanten Bohrdaten<br />
wie zu Beispiel Vorschub und Andruck kontinuierlich aufgezeichnet. Da die<br />
sorgfältige Injektion für die Dauerhaftigkeit der Gründungsmaßnahme ebenfalls<br />
von entscheidender Bedeutung war, wurde jeder Injektionsvorgang über einen<br />
Druck-Mengen-Schreiber ebenfalls vollständig aufgenommen.<br />
Die Bohrungen für die Steck- beziehungsweise Durchsteckträger in den<br />
vorhandenen Fundamenten wurden schonend als Kernbohrung ausgeführt. Nach<br />
Einbau der Träger erfolgte eine Verpressung mit Spezialmörtel, um den<br />
Kraftschluß sicher zu gewährleisten (Abb. 12).
12 16. Chr. Veder Kolloquium, Graz 2001<br />
Abb. 12: Pfähle und Steckträger vor dem Betonieren der Bodenplatte<br />
5 Zusammenfassung<br />
Anhand der vorgestellten Beispiele konnte gezeigt werden, daß auch unter<br />
schwierigen Umwelt- und Untergrundbedingungen Anker und Verpreßpfähle<br />
sicher hergestellt werden können. Dazu ist es erforderlich, daß projektspezifische<br />
Sondermaßnahmen mit einem gezielten Qualitätssicherungsprogramm überwacht<br />
werden.