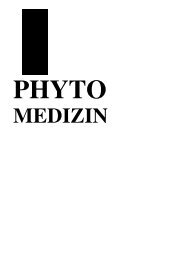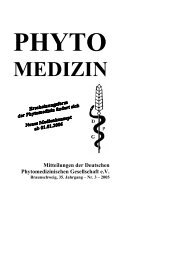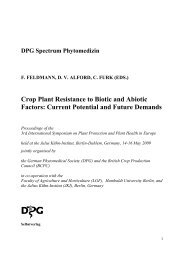Informationen aus dem Vorstand - Die DPG
Informationen aus dem Vorstand - Die DPG
Informationen aus dem Vorstand - Die DPG
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
epiphytischen Bakterien kontaminiert waren. Das Verfahren ist daher evtl. für die<br />
Testung von Gewebekulturpflanzen geeignet. Ob das Verfahren auch für stark mit<br />
Endo- und Epiphyten besiedelte Freilandproben einsetzbar ist, ist noch zu prüfen. Der<br />
Einsatz eines semi-selektiven Mediums, das derzeit nicht verfügbar ist, wäre hierbei<br />
sicherlich hilfreich.<br />
<strong>Die</strong> Arbeiten wurden mit Forschungsmitteln des BML gefördert.<br />
Phytopathogene Bakterien an Zwetschgenbäumen<br />
Orober, M.; Landesanstalt für Pflanzenschutz, Reinburgstr. 107, 70197 Stuttgart.<br />
In den Zwetschgenanbaugebieten in Baden-Württemberg treten in den letzten Jahren<br />
verstärkt bakterielle Erkrankungen auf, die erhebliche Schäden verursachen. Betroffen<br />
sind vor allem 2-6jährige Bäume neuer Zwetschgensorten. Das Schad<strong>aus</strong>maß liegt in<br />
der überwiegenden Zahl der Anlagen im Bereich von 10-30, jedoch sind in stark<br />
betroffenen Anlagen Ausfälle von mehr als 70 % aufgetreten. Einige Bestände<br />
wurden bereits gerodet.<br />
Als Krankheitsymptome treten im Frühsommer an den Ästen sowie Stämmen<br />
großflächige, spitz zulaufende nekrotische Läsionen auf. Oberflächlich sind die<br />
Läsionen von rötlicher Farbe und erscheinen eingesunken. Der Übergangsbereich<br />
zwischen nekrotisiertem und gesun<strong>dem</strong> Gewebe ist diffus, oliv bis dunkelgrün, fettigglänzend<br />
und z.T. marmoriert. Der für Steinobst typische Gummifluss tritt auf. Im<br />
fortgeschrittenen Befallsstadium ist die Rinde des gesamten Stammes nekrotisiert, die<br />
Blätter verfärben sich hell und der Baum stirbt innerhalb weniger Wochen ab. Auf<br />
den Blättern treten z.T. im Frühjahr/Sommer zunächst hellgrüne Flecken auf, die<br />
nachfolgend aufreißen und zu Schrotschußsymptomen führen.<br />
<strong>Die</strong> Erreger des Bakterienbrandes Pseudomonas syringae pv. syringae bzw. P. s. pv.<br />
morsprunorum wurden <strong>aus</strong> infizierten Trieben, Ästen und Stämmen isoliert. Aus den<br />
bisher untersuchten Proben <strong>aus</strong> 54 Zwetschgenanlagen konnte in 37 % der Fälle P.s.<br />
pv. syringae sowie in 11 % P.s. pv. morsprunorum isoliert werden. <strong>Die</strong> Bestimmung<br />
der Erreger erfolgte anhand physiologischer Tests (u.a. LOPAT-Methode).<br />
Schwierigkeiten für die Diagnose bereitet die Eigenschaft der Erreger sich nur <strong>aus</strong><br />
sehr frischen Symptomen isolieren zu lassen, sowie das häufige, sekundäre Auftreten<br />
von Pilzkrankheiten (u.a. Cytospora, Phomopsis). Zu<strong>dem</strong> wurden in wenigen Fällen<br />
intermediäre Stämme zwischen den Pathovaren „ syringae“ und „ morsprunorum“<br />
gefunden, die nicht eindeutig zugeordnet werden können. Untersuchungen zur<br />
Biologie der Erreger werden zu<strong>dem</strong> durch das beinahe ubiquitäre Vorkommen von P.<br />
s. pv. syringae sowie der grossen Spannweite der Virulenz der einzelnen Stämme<br />
innerhalb dieses Pathovars erschwert. Neben <strong>dem</strong> Bakterienbrand trat in den<br />
Sommermonaten der letzten Jahre eine als Schlagfluss bezeichnete Krankheit an<br />
Zwetschgen und Kirschen auf, die durch starke Exsudatbildung am nekrotisierten<br />
Stamm- und Tragastgewebe auffällt und sich dadurch von den bisher beschriebenen<br />
Krankheiten unterscheidet. Aus erkrankten Bäumen wurden mehrfach Bakterien der<br />
Gattung Erwinia isoliert, deren Pathogenität noch nicht nachgewiesen werden konnte.<br />
<strong>Die</strong> Blasenfleckenkrankheit an der Apfelsorte „Delbarestivale“ verursacht durch<br />
Pseudomonas syringae pv. papulans<br />
Moltmann, E.; Landesanstalt für Pflanzenschutz, Reinburgstr. 107, 70197 Stuttgart.<br />
Im Juli 1999 bzw. Mai 2000 wurden <strong>aus</strong> baden-württembergischen<br />
Obstanbaugebieten unreife Früchte der Apfelsorte `Delbarestivale´ mit zahlreichen<br />
34