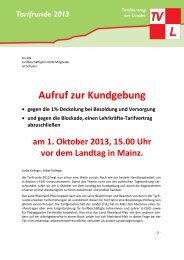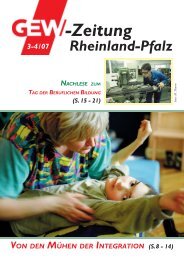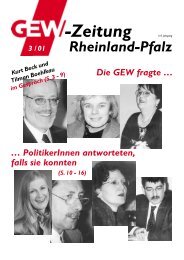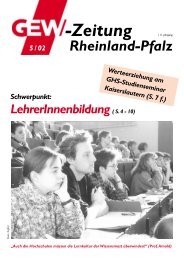GEW-ZEITUNG Rheinland-Pfalz
GEW-ZEITUNG Rheinland-Pfalz
GEW-ZEITUNG Rheinland-Pfalz
- TAGS
- www.gew-rlp.de
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
12/ 02<br />
-Zeitung<br />
111. Jahrgang<br />
<strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong><br />
Jetztreicht’s!<br />
Rücknahme der<br />
Arbeitszeitverlängerungen<br />
Wie versprochen…<br />
Wie versprochen…<br />
...sogebrochen?
Kolumne / Inhalt / Impressum<br />
Schöne<br />
Bescherung<br />
Die Bescherungen stehen uns eigentlich<br />
noch bevor, doch die Redaktion<br />
hat ihre „schöne Bescherung“ bereits<br />
hinter sich. Exakt zu dem Zeitpunkt<br />
geschah es, als eigentlich schon Redaktionsschluss<br />
war: Ein bösartiger Wurm<br />
namens Klez hatte sich, attestiert von<br />
einigen ähnlich fiesen Kumpels, ausgerechnet<br />
in den Redaktions-PC eingenistet, auf dem die meisten der<br />
geplanten Beiträge für die Dezember-Ausgabe gespeichert waren. Was<br />
dann passierte, braucht nicht weiter beschrieben zu werden. Nur mit<br />
den größten Mühen gelang es, die unleserlichen Texte zu rekonstruieren<br />
und dann letztlich doch noch eine Zeitung zu produzieren, was<br />
zwischenzeitlich mehr als fraglich war. Ganz herzlich bedanken dürfen<br />
wir uns bei Reinhard Stang vom Verlag Pfälzische Post und Jörg<br />
Pfeiffer, die uns die entscheidenden Tipps gaben, wie wir den aggressiven<br />
Viren auf die Spur und sie eliminieren konnten.<br />
Und wenn´s schon dicke kommt, dann bitteschön knüppeldick. Fast<br />
zum gleichen Zeitpunkt waren auch die redigierten Manuskripte, die<br />
mit der gar nicht mehr so „guten alten Post“ verschickt wurden, im<br />
postalischen All verschwunden und landeten dann mit einigen Tagen<br />
Verspätung zum Glück wieder beim Absender. Selber schuld, werden<br />
jetzt sicher die denken, die es immer schon besser gewusst haben. Wir<br />
haben jedenfalls daraus gelernt und werden die drei fundamentalen<br />
Regeln im Umgang mit der elektronischen und der Schnecken- Post<br />
künftig akribisch beachten. Und die lauten: 1. sichern, 2. sichern, 3.<br />
sichern bzw. 1. kopieren, 2. kopieren, 3. kopieren.<br />
Kommen jetzt die guten Nachrichten, vielleicht gar die besinnlichen<br />
Worte zu den bevorstehenden Feiertagen? Sorry, damit können wir leider<br />
nicht dienen. Weiter geht´s mit Verdrießlichem. Die Rede sein muss<br />
leider von einem Konflikt zwischen unserer <strong>GEW</strong>-Landesredaktion und<br />
der <strong>GEW</strong>-Bundesredaktion. Vorauszuschicken ist, dass wir großen Respekt<br />
haben vor der schweren Arbeit der E&W-Macher. Das ist schon<br />
ein verdammt harter Job, für diese heterogene <strong>GEW</strong> eine lesenswerte<br />
Zeitung zu schaffen. Eine fast unlösbare Aufgabe, denn irgendwer wird<br />
sich immer auf den Schlips getreten fühlen. Die Landesredaktionen<br />
haben es da weitaus leichter, weil sie viel näher an den konkreten Problemen<br />
der Mitglieder in den einzelnen Bundesländer sein können.<br />
Deshalb gibt es für uns auch gar keinen Grund, uns selbst auf die Schulter<br />
zu klopfen, wenn eine Untersuchung mal wieder gezeigt hat, dass die<br />
Aus dem Inhalt <strong>GEW</strong>-<strong>ZEITUNG</strong> <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> Nr. 12 / 2002:<br />
Kolumne Seite 2<br />
Aufruf: Jetzt reicht‘s Seite 3<br />
Schulen Seiten 4 - 11<br />
<strong>GEW</strong>-Fortbildung / Weiterbildung Seite 12<br />
Bildung International Seiten 13 - 15<br />
Internationales Seiten 16 - 17<br />
Leserbrief / Alter + Ruhestand Seiten 18 - 19<br />
<strong>GEW</strong>-Intern Seite 20<br />
Tipps + Termine Seiten 21 - 22<br />
Kreis + Region Seite 23<br />
Weihnachtsgeist Seite 24<br />
Sonderbeilage zur pol. Bildung in <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> Seiten I - XVI<br />
Akzeptanz der Landeszeitungen größer ist als die der Bundeszeitung.<br />
Nur, bei allem Respekt, wenn etwas daneben geht, muss das auch artikuliert<br />
werden. Wäre sicher einfacher, zu sagen: Wir machen unser<br />
Ding, was andere tun, geht uns nix an. Vielleicht sind wir auch bald so<br />
weit, aber im Moment ist die Identifikation mit der <strong>GEW</strong> noch zu<br />
groß. Noch.<br />
Um nun endlich zur Sache zu kommen. Einer unserer Mitarbeiter hat<br />
die Ursache des Dissenses in einem Fax an unsere Redaktion sehr treffend<br />
charakterisiert: In Bezug auf die E&W schrieb er: „Was mir - und<br />
auch vielen meiner KollegInnen & Bekannten - schon seit geraumer<br />
Zeit unangenehmer aufstößt: die Tendenz zur praxisfernen, gleichwohl<br />
höchst schulmeisterlichen Besserwisserei..“<br />
Exakt aus diesem Grund wurde folgender Leserbrief zur E&W 10/02<br />
formuliert:<br />
„Gute Frage: Wer motiviert die Motivateure? Klare Antwort: Die E&W<br />
ganz sicher nicht. Jetzt kommt ausnahmsweise mal ein Schulpraktiker<br />
zu Wort - nach all den weisen Ratschlägen, die wir uns ansonsten von<br />
den immer gleichen Hochschullehrern, Bildungsjournalisten, Bildungspolitikern<br />
etc anhören dürfen -, und wieder fehlt der Knackpunkt:<br />
Mehr Qualität ist nicht zum Nulltarif zu haben. Unsere überalterten,<br />
überforderten, vielfach ausgebrannten Kollegien brauchen spürbare Entlastungen<br />
und nicht dauernd neue Ansprüche. Dafür hat eine Bildungsgewerkschaft<br />
zu sorgen. Die <strong>GEW</strong> muss nicht ´die Bildung`, sondern<br />
ihre Mitglieder retten. ´Die Bildung` zahlt keine Mitgliedsbeiträge.“<br />
Unterzeichnet war der Brief mit dem Namen des Verfassers. Der Leserbrief<br />
kam dann in der nächsten E&W tatsächlich, allerdings mit „kleinen“<br />
Veränderungen mit „großer“ Wirkung“. Aus dem Satz „Die E&W<br />
ganz sicher nicht“ wurde „Die <strong>GEW</strong> ganz sicher nicht“ Ein Riesenunterschied,<br />
ob die <strong>GEW</strong> insgesamt oder die Redaktion der E&W kritisiert<br />
wird!. Weiterhin wurden die letzten vier Sätze gestrichen, wodurch<br />
aus einem bewusst kurzen Leserbrief ein sehr kurzer wurde. Da<br />
tauchen schon Zweifel auf, ob kritische Anmerkungen von Mitgliedern<br />
überhaupt erwünscht sind. Schließlich wurde der Verfassername um<br />
„<strong>GEW</strong> <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong>“ ergänzt. Der fatale Eindruck bei den LeserInnen:<br />
Da maßt sich einer an, für die gesamte rheinland-pfälzische<br />
<strong>GEW</strong> zu sprechen!<br />
„Setzen! Sechs!“, unseren Orden für sprachliche Fehlleistungen hat sich<br />
die E&W - Redaktion durch solche Fehler beim Redigieren redlich verdient.<br />
Jetzt aber Schluss mit dem Verdruss. Die Redaktion darf bis zur Ausgabe<br />
1-2/03 eine kleine Auszeit nehmen. Wir wünschen unsern LeserInnen<br />
schöne Weihnachtsferien, ein frohes Fest und einen guten Rutsch<br />
ins Jahr 2003.<br />
Günter Helfrich<br />
Impressum <strong>GEW</strong>-<strong>ZEITUNG</strong> <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong><br />
Herausgeber: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong>, Neubrunnenstr. 8, 55116<br />
Mainz, Tel.: (0 61 31) 28988-0, Fax: (06131) 28988-80, E-mail: <strong>GEW</strong>@<strong>GEW</strong>-<strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong>.de<br />
Redaktion: Günter Helfrich (verantw.) und Karin Helfrich, Postfach 22 02 23, 67023 Ludwigshafen,<br />
Tel./ Fax: (0621) 564995, e-mail: <strong>GEW</strong>ZTGRL1@aol.com; Ursel Karch ( Anzeigen), Arnimstr.<br />
14, 67063 Ludwigshafen, Tel.: (0621) 69 73 97, Fax.: (0621) 6 33 99 90, e-mail:<br />
UKarch5580@aol.com; Antje Fries, Rheindürkheimer Str. 3, 67574 Osthofen, Tel./Fax: (0 62 42)<br />
91 57 13, e-mail: antje.fries@gmx.de<br />
Verlag, Satz und Druck: Verlag Pfälzische Post GmbH, Winzinger Str. 30, 67433 Neustadt a.d.W.,<br />
Tel.: (06321) 8 03 77; Fax: (0 63 21) 8 62 17; e-mail: VPP.NW@t-online.de, Datenübernahme per<br />
ISDN: (0 63 21) 92 90 92 (Leonardo-SP - = 2 kanalig)<br />
Manuskripte und Beiträge: Die in den einzelnen Beiträgen wiedergegebenen Gedanken entsprechen<br />
nicht in jedem Falle der Ansicht des <strong>GEW</strong>-Vorstandes oder der Redaktion. Nur maschinengeschriebene<br />
Manuskripte können angenommen werden. Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine<br />
Gewähr übernommen. Manuskripte und sonstige Zuschriften für die Redaktion der <strong>GEW</strong>-Zeitung<br />
<strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> werden nach 67023 Ludwigshafen, Postfach 22 02 23, erbeten.<br />
Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten; für Nichtmitglieder jährlich Euro 18,-- incl. Porto<br />
+ MWSt. (Bestellungen nur beim Herausgeber.) Kündigung 3 Monate vor Ablauf des Kalenderjahres.<br />
Im anderen Falle erfolgt stillschweigend Verlängerung um ein weiteres Jahr.<br />
Anzeigenpreisliste Nr. 12 beim Verlag erhältlich. Redaktionsschluss: jeweils der 5. des Vormonats.<br />
2 <strong>GEW</strong>-Zeitung <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> 12 /2002
Jetzt reicht’s<br />
Vor zehn Jahren, am 22. Dezember<br />
1992, wurden die 1. Arbeitszeitverlängerung<br />
sowie weitere Einschnitte<br />
in das Bildungswesen in <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong><br />
beschlossen. Diese Arbeitszeitverlängerung<br />
sollte auf 10<br />
Jahre befristet sein und ab dem<br />
Schuljahr 2003/2004 rückgängig<br />
gemacht werden. Davon ist heute<br />
nicht mehr die Rede! Die Landesregierung<br />
ist der Ansicht, dass mit<br />
der Lehrkräfte-Arbeitszeitverordnung<br />
vom 30. Juni 1999 - basierend<br />
auf der Erhöhung der Arbeitszeit<br />
aller LandesbeamtInnen (40-Stunden-Woche)<br />
- die befristete Anhebung<br />
der LehrerInnen-Arbeitszeit<br />
gegenstandslos sei.<br />
Wir dürfen dies nicht widerspruchslos<br />
hinnehmen und fordern auf einer<br />
landesweiten Protestveranstaltung<br />
die Rücknahme der Arbeitszeitverlängerung.<br />
Wir wollen im<br />
Rahmen der bundesweiten Kampagne<br />
„Rettet die Bildung! Qualität<br />
Wie versprochen…<br />
...sogebrochen?<br />
<strong>GEW</strong>-Zeitung <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> 12 /2002<br />
entwickeln - Arbeitsbedingungen<br />
verbessern!“ die verantwortlichen<br />
PolitikerInnen auch darauf hinweisen,<br />
dass schulische, pädagogische<br />
und unterrichtliche Qualität etwas<br />
mit den Arbeitsbedingungen der<br />
Beschäftigten an den Bildungseinrichtungen<br />
zu tun hat. Die Belastungen<br />
der KollegInnen haben<br />
enorm zugenommen, immer neue<br />
Anforderungen werden an alle<br />
Schulen gestellt: So hat z. B. Ministerin<br />
Doris Ahnen mit ihrem<br />
Schreiben „Qualitätsentwicklung<br />
an Schulen in <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong>“<br />
vom 16. September 2002 die „...Erarbeitung<br />
eines Qualitätsprogramms<br />
durch jede Schule...“ gefordert.<br />
Nun kommt auch noch die Diskussion<br />
um eine Öffnungsklausel bei<br />
der Beamtenbesoldung hinzu, die es<br />
den Ländern erlauben soll, das Urlaubsgeld<br />
zu streichen, das Weihnachtsgeld<br />
zu kürzen, Tarifsteige-<br />
Zentrale<br />
Protestveranstaltung<br />
18. Dezember 2002, ab 15:00Uhr<br />
Eltzer Hof, Mainz<br />
Aufruf<br />
Rücknahme der Arbeitszeitverlängerungen<br />
rungen nicht mitzumachen und<br />
eine geringere Eingangsbesoldung<br />
festzulegen!<br />
„Jetzt reicht´s!“ Wir müssen alle<br />
aktiv werden, um unsere Arbeitsbedingungen<br />
zu verbessern, damit<br />
Qualität entwickelt werden kann<br />
und wir zufriedener unsere wichtige<br />
pädagogische Arbeit leisten können.<br />
Die <strong>GEW</strong> fordert, dass die finanziellen<br />
Spielräume, die durch<br />
den Rückgang der SchülerInnen-<br />
Zahlen entstehen, für Verbesserungen<br />
im Bildungsbereich genutzt<br />
werden.<br />
Deshalb, KollegInnen, kommen Sie<br />
/kommt ihr am Mittwoch, dem 18.<br />
Dezember 2002 ab 15.00 Uhr nach<br />
Mainz in den Eltzer Hof. Die <strong>GEW</strong>-<br />
Kreise organisieren bei Bedarf Busreisen<br />
nach Mainz.<br />
Es ist höchste Zeit zum Handeln!<br />
3
Schulen<br />
<strong>GEW</strong> fordert Verhandlungen mit dem Ministerium<br />
Einstimmiger Landesvorstandsbeschluss zu „Ganztagsschulen in neuer Form“<br />
Auf der Grundlage des Beschlusses<br />
des <strong>GEW</strong> Hauptvorstandes (Bund)<br />
vom 23. Juni 2001 und des Beschlusses<br />
des rheinland-pfälzischen<br />
Landesvorstandes vom 29. August<br />
2001 verabschiedete der LV der<br />
<strong>GEW</strong> <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> auf seiner<br />
Sitzung am 23. Oktober 2002 einstimmig<br />
folgenden Beschluss zum<br />
Thema „Ganztagsschulen in neuer<br />
Form“:<br />
1. Nach wie vor fordert die <strong>GEW</strong><br />
<strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> den Ausbau von<br />
mehr Ganztagsangeboten in der<br />
Form verpflichtender Ganztagsschulen<br />
- anders als bei den Ganztagsschulen<br />
in neuer Form in <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong>.<br />
Langfristiges Ziel ist die<br />
ganztägig geöffnete Stadtteil- oder<br />
Nachbarschaftsschule, die von allen<br />
Kindern und Jugendlichen gemeinsam<br />
und verbindlich besucht wird.<br />
Wie in anderen europäischen Ländern<br />
sollen auch in <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong><br />
Ganztagsschulen zur Regelform und<br />
ihr Besuch zur Normalität werden.<br />
Ganztagsangebote, die lediglich Betreuungscharakter<br />
haben, erfüllen<br />
aus Sicht der <strong>GEW</strong> <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong><br />
nicht die Kriterien einer Ganztagsschule.<br />
2. Kooperationsformen mit vorhandenen<br />
Ganztagsangeboten (z.B.<br />
Horten) sind zu schaffen und zu etablieren.<br />
Ein Verdrängungswettbewerb<br />
darf nicht stattfinden.<br />
3. Die <strong>GEW</strong> begründet die Ganztagsschulen<br />
mit<br />
a) dem Recht von Kindern und Jugendlichen<br />
auf Bildung und Erziehung<br />
in einer interkulturellen Gesellschaft,<br />
auf soziales Lernen unter<br />
Gleichaltrigen sowie auch in altersgemischten<br />
Gruppen, auf Förderung<br />
und Unterstützung sowie auf anregende<br />
und herausfordernde Freizeitaktivitäten<br />
b) dem Streben nach Chancengleichheit<br />
sowie<br />
c) dem Recht auf Vereinbarkeit von<br />
Erwerbs- und Familientätigkeit,<br />
d) aber auch wirtschafts-, sozial- und<br />
gesellschaftspolitische Interessen gemäß<br />
dem Sozialstaatsgebot im<br />
Grundgesetz und in der Landesverfassung.<br />
4. Für jedes Kind muss es einen<br />
Rechtsanspruch auf einen Ganztagsschulplatz<br />
geben.<br />
5. Der Besuch einer Ganztagsschule<br />
muss gebührenfrei sein.<br />
6. Die Lehrerschaft braucht verbindliche<br />
Zusagen, dass es nicht schon<br />
allein durch eine längere Anwesenheitspflicht<br />
in der Schule zu einer<br />
weiteren Erhöhung der Gesamtarbeitszeit<br />
und der Arbeitsbelastung<br />
führt. Eine zeitliche Ausdehnung der<br />
Präsenzzeiten darf nicht zusätzlich zu<br />
den hohen Unterrichtsverpflichtungen<br />
verordnet werden.<br />
7. Damit sich die Ganztagsschulen<br />
zu guten und gern besuchten Ganztagsschulen<br />
entwickeln können, sind<br />
zusätzliche Investitionen durch z. B.<br />
die Schulträger und das Land notwendig<br />
wie<br />
a) zusätzliche Stellen für PädagogInnen,<br />
b) eine anregungsreiche räumliche<br />
Gestaltung mit Lern-, Ruhe-, Kommunikations-<br />
und Produktionsräumen,<br />
c) eine Infrastruktur, die eine hochwertige<br />
Ernährung sichert und nicht<br />
zuletzt<br />
d) Einzelarbeitsplätze, die sich für<br />
Beratung und Kommunikation, aber<br />
auch zur konzentrierten Eigenarbeit<br />
der PädagogInnen eignen.<br />
8. Die <strong>GEW</strong> <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> geht<br />
davon aus, dass dies nicht im Hau-<br />
Ruck-Verfahren umzusetzen ist, sondern<br />
dazu ein gesellschaftlicher Konsens<br />
notwendig ist.<br />
9. In einer Übergangsphase sind<br />
nachfrageorientierte Ganztagsschulen,<br />
an denen die Teilnahme freigestellt<br />
und bei Teilnahme der Vormittagsunterricht<br />
verbindlich und der<br />
Nachmittagsbesuch für mindestens<br />
ein Jahr verpflichtend ist, eine pragmatische<br />
Zwischenlösung auf dem<br />
Weg zu einer verpflichtenden Ganztagsschule.<br />
Aber auch für diese Übergangslösungen<br />
müssen Ziele, pädagogisch<br />
tragfähige Konzepte, verbindliche<br />
Qualitätsstandards und<br />
Vereinbarungen über die stufenweise<br />
Umsetzung in Verhandlungen umgehend<br />
zwischen <strong>GEW</strong>, Ministerium<br />
und Schulträgern sowie den kommunalen<br />
Spitzenverbänden ausgehandelt<br />
werden.<br />
Im Einzelnen bekräftigt die <strong>GEW</strong><br />
<strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> folgende Detailpunkte<br />
aus ihrem Beschluss vom 29.<br />
August 2001:<br />
1. Es dürfen keine Arbeitsverhältnisse<br />
begründet werden, die weder den<br />
Anforderungen nach einer Mindestentlohnung<br />
noch den ansonsten im<br />
öffentlichen Dienst geltenden Vereinbarungen<br />
entsprechen. Die <strong>GEW</strong><br />
fordert unbefristete Arbeitsverträge<br />
für alle Beschäftigten an den Ganztagsschulen,<br />
die die Bedingungen<br />
nach BAT und TdL erfüllen.<br />
Es ist sicherzustellen, dass nur in<br />
Ausnahmefällen befristete Verträge<br />
angeboten werden, nämlich dann,<br />
wenn die Befristung durch ein zeitlich<br />
eindeutig begrenztes Projekt begründet<br />
ist.<br />
2. Auch die Rahmenvereinbarungen<br />
und Kooperationsverträge mit außerschulischen<br />
Partnern sind den<br />
Hauptpersonalräten zur Mitbestimmung<br />
vorzulegen.<br />
3. Die Anwendung der Dienst- und<br />
Konferenzordnung sowie der Lehrerarbeitszeitverordnung<br />
bzw. entsprechender<br />
tariflicher Vorschriften für<br />
das zusätzlich angeworbene Personal<br />
muss unter Beteiligung der Hauptpersonalräte<br />
und der <strong>GEW</strong> geregelt<br />
werden.<br />
4. Die Verbesserung für das Verwaltungspersonal<br />
im Hinblick auf eine<br />
Höhergruppierung und eine Erhöhung<br />
der Verwaltungsstunden an den<br />
neuen Ganztagsschulen muss dringend<br />
erfolgen.<br />
5. Es muss eindeutige Qualitätsstandards<br />
für die Ausstattung und das<br />
pädagogische Konzept, insbesondere<br />
aber für das Personal geben. Hierbei<br />
können Zusatzangebote von Eltern,<br />
Vereinen, Kirchen und Betrieben einbezogen<br />
werden, die aber Teil des<br />
pädagogischen Konzepts sein müssen.<br />
6. Die Klassengröße in sog. „sozia-<br />
4 <strong>GEW</strong>-Zeitung <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> 12 /2002
len Brennpunktschulen“ muss vordringlich<br />
abgesenkt werden.<br />
7. Die Überarbeitung der Schulbaurichtlinien<br />
muss erfolgen, damit ein<br />
<strong>GEW</strong>-Zeitung <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> 12 /2002<br />
Mindeststandard bei der Ausstattung<br />
in den einzelnen Schulen gewährleistet<br />
und nicht vom „guten Willen“<br />
des Schulträgers abhängig ist.<br />
8. Die Ganztagsschule<br />
in neuer<br />
Form ist in das<br />
Schulgesetz aufzunehmen.<br />
Viele der o. g. für<br />
die <strong>GEW</strong> unverzichtbarenGrundsätze<br />
sind in den<br />
derzeit geltenden<br />
Regelungen und<br />
Festlegungen zur<br />
Einrichtung der<br />
„neuen Ganztagsschulen“<br />
in Rhein-<br />
Schulen<br />
land-<strong>Pfalz</strong> nur unzureichend oder<br />
gar nicht berücksichtigt.<br />
Weder die Landesregierung noch das<br />
Ministerium haben öffentlich erklärt,<br />
dass sie die neuen Ganztagsschulen<br />
als Übergangslösung zu verpflichtenden<br />
Ganztagsschulen ansehen.<br />
Der Landesvorstand der <strong>GEW</strong><br />
<strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> fordert deshalb die<br />
Landesregierung bzw. das MBFJ<br />
auf, umgehend in Verhandlungen<br />
einzutreten, damit die noch strittigen<br />
Punkte geklärt und die am 01.<br />
August 2002 gestarteten sowie die<br />
in Zukunft geplanten Ganztagsschulen<br />
mitgetragen werden können.<br />
Zu Ganztagsschulen noch viele Fragen offen<br />
Wohl und Wehe der Ganztagsschule<br />
beherrschen die bildungspolitische<br />
Debatte in <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong><br />
ebenso wie der Zustand unseres Bildungssystems<br />
im Lichte der Erkenntnisse<br />
aus der so genannten<br />
Pisa-Studie. Themen, die auch beim<br />
Landeselterntag am 9.11. in Alzey<br />
behandelt wurden.<br />
Über die Pisa-Studie sprach Bildungsministerin<br />
Doris Ahnen (SPD) mit<br />
dem Bielefelder Bildungsexperten Otto<br />
Herz. „Fördern und Fordern statt Auslesen<br />
- Perspektiven nach Pisa“’ so der<br />
Titel des Podiumsgesprächs. Herz vertritt<br />
beispielsweise die Auffassung, dass<br />
individuelles Lernen den Kindern mehr<br />
bringt als Lernen auf Kommando, dass<br />
Schüler mehr gesellschaftliche Verantwortung<br />
übernehmen könnten, als ihnen<br />
gemeinhin zugebilligt wird. Er<br />
wirft dem konventionellen Schulsystem<br />
vor, überwiegend Themen der Vergangenheit<br />
aufzugreifen, statt fachübergreifend<br />
und fächerverbindend Zukunftsstudien<br />
zu betreiben. (...)<br />
Was sein könnte, ist das eine, was Schulrealität<br />
ist, darüber sprachen Elternvertreter<br />
in acht kleineren Arbeitskreisen.<br />
Ein Thema dabei: die Mitarbeit der<br />
Eltern in der Ganztagsschule. Es ging<br />
um praktische Erfahrungen mit dem<br />
„Lieblingskind“ von Bildungsministerin<br />
Ahnen. Doch was Väter und Mütter<br />
berichteten, ist für das Ganztagsschul-Konzept<br />
der Ministerin alles an-<br />
dere als schmeichelhaft. Birgit Burkey,<br />
Schul-elternsprecherin der Wendelinus-<br />
Grundschule in Ramstein, ist froh, dass<br />
ihr Kind am „normalen“ Angebot teilnimmt<br />
und sie es nicht für das Ganztagsangebot<br />
angemeldet hat. 153 der<br />
480 Schüler werden an der Schule<br />
ganztags betreut. Burkey berichtete, dass<br />
es beispielsweise sehr schwierig sei, Vereine<br />
für die Mitarbeit zu gewinnen.<br />
Diese verpflichten sich nicht nur für ein<br />
bestimmtes Arbeitsgemeinschafts-Angebot,<br />
sondern müssten auch sicherstellen,<br />
dass Vertretungskräfte im Krankheitsfall<br />
bereitstehen. „Das können sich die<br />
Vereine nicht leisten“, glaubt Burkey.<br />
Probleme sieht sie darüber hinaus bei<br />
den Hausaufgaben-Stunden. Da zu<br />
wenig Lehrer-Wochenstunden zur Verfügung<br />
stünden, seien die Gruppen mit<br />
über zwanzig Schülern einfach zu groß.<br />
„Machen sie da mal Hausaufgaben“,<br />
beschreibt die Mutter eines der Probleme<br />
aus der Praxis. Die Situation verschärfe<br />
sich, wenn ein Lehrer ausfalle,<br />
so dass ein einzelner Kollege dann 40<br />
Schüler zu beaufsichtigen habe. Burkey<br />
wirft der Landesregierung vor, die<br />
Ganztagsschule „auf Biegen und Brechen<br />
eingeführt“ zu haben. „Und das<br />
wird jetzt auf dem Rücken der Eltern<br />
ausgetragen“, sagt sie.<br />
Ein Urteil, das auch andere Eltern teilen.<br />
Es könne nicht sein, dass die Mitarbeit<br />
von Eltern über kurz oder lang<br />
zum Muss werde, um den finanziell<br />
klammen Staat bei seinen Aufgaben zu<br />
entlasten. Und so beschwerte sich ein<br />
Vater aus Monsheim (Kreis Alzey-<br />
Worms), dass hinter dem Ganztagsangebot<br />
der Halbtagsschulen ein unausgereiftes<br />
pädagogisches Konzept stehe.<br />
„Das können die Eltern nicht leisten,<br />
was da verlangt wird“, sagt er. Viele<br />
Eltern würden ihre Kinder außerdem<br />
gerade deshalb am Ganztagsangebot<br />
teilnehmen lassen, weil sie aus beruflichen<br />
Gründen nicht die Zeit für sie<br />
hätten, so eine andere Teilnehmerin.<br />
Das Ergebnis sei, dass sich einige wenige<br />
Eltern verstärkt auch für die anderen<br />
Sprösslinge engagierten und sich<br />
über kurz oder lang ausgenutzt fühlten.<br />
In einem Punkt waren sich die Elternvertreter<br />
des Arbeitskreises weitgehend<br />
einig: Die Ganztagsschule dürfe nicht<br />
nur eine Halbtagsschule mit Betreuung<br />
sein. Oder, wie ein Vater sagt: „Wenn<br />
das Ganztagskonzept nicht mehr als die<br />
Aufbewahrung vorsieht, kann mein<br />
Sohn auch zu Hause bleiben.“ Einige<br />
Elternvertreter lehnen das Ganztagsangebot<br />
der Halbtagsschulen deshalb ganz<br />
ab. „Wenn der billige Weg gangbar ist,<br />
wird es den anderen Weg nicht geben“,<br />
so eine Mutter aus dem Raum Bitburg.<br />
Andere wiederum befürworten den<br />
Einstieg in die Ganztagsschule, sehen<br />
aber noch erheblichen Nachbesserungsbedarf.<br />
(...)<br />
Marco Heinen<br />
Aus: Sonntag aktuell vom 10.11.02<br />
5
Schulen<br />
Mit „Qualifikation Mutter“ an Grundschule<br />
Interview mit Helmut Thyssen vom BPR Grund- und Hauptschulen / Reg.Sch.<br />
Du bist in die zur<br />
Zeit laufende Diskussion<br />
über die<br />
Beschäftigten<br />
ohne bzw. ohne<br />
abgeschlossene<br />
Lehramtsqualifikation<br />
im Regelunterricht<br />
in deiner<br />
Funktion als<br />
Vorsitzender des<br />
Bezirkspersonalrates<br />
Grund-<br />
Haupt- Regionale<br />
Schule direkt eingebunden.<br />
Wie siehst du die Problematik?<br />
Die Problematik ist durch verschiedene<br />
Veröffentlichungen offenkundig<br />
geworden. Es ist leider richtig,<br />
dass seit 1.8.2002 nach meiner Information<br />
an den allgemeinbildenden<br />
Schulen mehr als 300 Personen<br />
im Vertretungsvertrag eingestellt<br />
wurden, die keine oder keine abgeschlossene<br />
Lehramtsqualifikation<br />
haben, davon mehr als 200 in unserem<br />
Bereich Grund- und Hauptschulen<br />
/ Regionale Schulen.<br />
Zur Klarstellung, du redest nicht von<br />
den Beschäftigten im Nachmittagsprogramm<br />
der neuen Ganztagsschulen?<br />
Ich bin sehr dankbar für diese Nachfrage.<br />
Es handelt sich ausschließlich<br />
um Beschäftigte im Regelunterricht,<br />
in allen Fächern, selbstverständlich<br />
auch in Klassenleiterfunktion.<br />
Kannst du einige der gravierendsten<br />
Beispiele nennen?<br />
Da mir diese Informationen auch<br />
außerhalb meiner Personalratsarbeit<br />
durch Anfragen an die <strong>GEW</strong> vorliegen,<br />
kann ich darüber reden. So sind<br />
z.B. in Einzelfällen Personen mit der<br />
Qualifikation „Mutter“ mit<br />
einigen Stunden im Regelunterricht<br />
an einer Grundschule eingesetzt.<br />
Außerdem unterrichten Studierende<br />
das Fach Physik, Jugendleiter und<br />
Übungsleiter Pflichtfächer an verschiedenen<br />
Schulen.<br />
Das ist zwar alles andere als gut, aber<br />
könnte man nicht dennoch sagen: besser<br />
als Unterrichtsausfall?<br />
Wir kennen Fälle, in denen es als<br />
Notmaßnahme besser gewesen wäre,<br />
Unterricht insgesamt zu kürzen. Es<br />
gibt ganz sicher auch Beispiele, wo<br />
durch die Unterstützung des<br />
„Stammpersonals“ solche Notlösungen<br />
mit Minderqualifizierten zu akzeptieren<br />
sind, allerdings geht dies<br />
niemals ohne Zusatzbelastung unserer<br />
Kolleginnen und Kollegen. Dafür<br />
müsste ein Ausgleich geschaffen werden.<br />
Für Grundschulen lehnen wir<br />
allerdings solche Mangelverwaltung<br />
nach wie vor ab, da es noch immer<br />
Zwangsteilzeit gibt. Außerdem wäre<br />
es in dieser schwierigen Situation<br />
angezeigt, dass sich das Ministerium<br />
wenigstens einmal äußert.<br />
Wie siehst du die Beschäftigung von<br />
Bewerbern mit nur 1. Staatsexamen?<br />
Mit dieser so genannten Minderqualifikation<br />
wurden schon immer Bewerberinnen<br />
und Bewerber im Vertretungsvertrag<br />
eingestellt. Allerdings<br />
waren es bisher lediglich Einzelfälle.<br />
Zur Zeit ist dies aber in einigen<br />
Regionen und von Schulart zu<br />
Schulart durchaus unterschiedlich<br />
zum Regelfall geworden.<br />
Das ist doch ein Skandal, wenn man<br />
bedenkt, dass an unseren Grundschulen<br />
noch immer voll ausgebildete<br />
Zwangsteilzeitbeschäftigte arbeiten,<br />
worauf du oben ja schon hingewiesen<br />
hast.<br />
Das sehe ich auch so. Die Vollbeschäftigung<br />
dieses Personenkreises<br />
muss für uns absoluten Vorrang haben.<br />
Gerade die Zwangsteilzeit hat in<br />
den letzten Jahren dazu geführt, dass<br />
immer mehr hochqualifizierte, mit<br />
Steuermitteln des Landes <strong>Rheinland</strong>-<br />
<strong>Pfalz</strong> ausgebildete Kolleginnen und<br />
Kollegen in andere Bundesländer<br />
abgewandert sind, weil sie dort sofort<br />
eine volle Stelle erhalten haben.<br />
Zu Zeiten des großen Bewerberüberhangs<br />
war die Zwangsteilzeit aber doch<br />
eine Lösung, die vorhandenen Stellen<br />
auf mehr Köpfe zu verteilen.<br />
Bücherspalte<br />
<strong>GEW</strong>-Handbuch für Lehrerinnen<br />
und Lehrer<br />
4. Auflage 1998 Loseblattausgabe<br />
- Gesamtwerk mit Spezialordner<br />
3. überarbeitete Fassung<br />
Stand Juni 2001<br />
Das rund 1.400 Seiten starke<br />
Werk enthält alle wichtigen Gesetze<br />
und Verwaltungsvorschriften<br />
für den Schulbereich in<br />
<strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong>.<br />
Mitglieder: 19,90 Euro<br />
Nichtmitglieder: 31,00 Euro<br />
zzgl. Porto<br />
<strong>GEW</strong>-Information Nr. 10<br />
Formulierungsvorschläge<br />
für die ersten zwei Zeugnisse der<br />
Grundschule ohne Noten<br />
gegen Portokosten<br />
BAT/BAT-O<br />
Textfassung mit Erläuterungen<br />
392 Seiten, 8.Aufl. 2002<br />
Euro 5,60 zzgl. Porto<br />
Rund ums Geld im öffentlichen<br />
Dienst<br />
Der Ratgeber mit den praktischen<br />
Tipps und wichtigen Informationen<br />
ums Geld für Beschäftigte<br />
im öffentlichen Dienst<br />
260 Seiten, Aufl. 2002<br />
Euro 1,80 zzgl. Porto<br />
Die Beihilfe<br />
Der Ratgeber mit praktischen<br />
Tipps zu Beihilfeberechtigung,<br />
Bemessung, beihilfefähige Aufwendungen<br />
uvm.<br />
240 Seiten, Aufl. 2001<br />
Euro 1,80 zzgl. Porto<br />
Bestellungen an:<br />
<strong>GEW</strong> <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong><br />
Neubrunnenstr. 8 · 55116 Mainz<br />
6 <strong>GEW</strong>-Zeitung <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> 12 /2002
Auch ich bin der Auffassung, dass<br />
es eine Zeit gab, in der Zwangsteilzeit<br />
vertretbar war. Aber die ist längst<br />
vorbei, ohne dass die Landesregierung<br />
für die Kolleginnen und Kollegen<br />
an den Grundschulen die notwendigen<br />
Konsequenzen gezogen<br />
hat und volle Stellen vergibt.<br />
Das müsste eigentlich doch auch den<br />
Verantwortlichen im Ministerium klar<br />
sein. Lässt sich diese eindeutige Sichtweise<br />
nicht vermitteln bzw. wo muss<br />
nach deiner Auffassung noch Überzeugungsarbeit<br />
geleistet werden?<br />
Es fällt mir schwer diese Frage zu<br />
beantworten, weil ich mir nicht vorstellen<br />
kann, dass diese Problematik<br />
den Verantwortlichen nicht bekannt<br />
ist. Ich vermute, dass man wie in<br />
anderen Bereichen von Schule die<br />
evidenten Schwachstellen einfach<br />
nicht zur Kenntnis nehmen will. Es<br />
sind offensichtlich nur gute Botschaften<br />
gefragt, die man über die<br />
Medien positiv transportieren kann.<br />
Dies scheint mir im Moment vom<br />
Grundsatz her das größte Problem<br />
<strong>GEW</strong>: Vertretungsunterricht nur<br />
mit voll ausgebildeten Lehrkräften<br />
Mit dem Ziel, einen anspruchsvollen<br />
Vertretungsunterrichtes zu sichern,<br />
fasste der <strong>GEW</strong>-Landesvorstandes auf<br />
seiner jüngsten Sitzung folgenden<br />
Beschluss:<br />
Mit Beginn des laufenden Schuljahres<br />
hat in allen Schularten der Anteil von<br />
Vertretungsunterricht, der von nicht<br />
oder nur teilweise ausgebildeten Lehrkräften<br />
erteilt werden soll, in erheblichem<br />
Maße zugenommen. Diese Praxis<br />
steht im Widerspruch zum Schulgesetz,<br />
das die Lehramtsbefähigung für die<br />
Lehrkräfte vorschreibt.<br />
Die <strong>GEW</strong> <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> lehnt entschieden<br />
die Beschäftigung von nicht<br />
oder nur teilweise ausgebildeten Lehrkräften<br />
in Vertretungsverträgen ab. Nur<br />
vollständig ausgebildete LehrerInnen<br />
bieten die Gewähr für einen qualifizierten<br />
Unterricht, wie er von allen<br />
gesellschaftlichen Gruppen eingefordert<br />
<strong>GEW</strong>-Zeitung <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> 12 /2002<br />
zu sein. Ein Problem mit fatalen Folgen<br />
auf die Motivation unserer Kolleginnen<br />
und Kollegen.<br />
In Zeiten von PISA und Qualitätsverpflichtungen<br />
für die Schulen wären<br />
andere Wege angezeigt.<br />
Abschließende Frage: Was wurde bisher<br />
getan, um gegen das Problem vorzugehen?<br />
Sicher wurden Gespräche in dieser<br />
Angelegenheit geführt. Wie in meiner<br />
Antwort auf deine vorhergehende<br />
Frage aber schon angedeutet, weiß<br />
ich allerdings nicht, was überhaupt<br />
zu besprechen wäre, denn die Begründung<br />
des Ministeriums für<br />
Zwangsteilzeit ist Bewerberüberhang.<br />
Was soll man dazu noch sagen<br />
in Zeiten absoluten Lehrkräftemangels?<br />
Wenn du konkret wissen willst,<br />
was wir Personalräte getan haben:<br />
Wir prüfen sehr verantwortlich jeden<br />
Einzelfall und haben vorgelegten<br />
Einstellungen von Minderqualifizierten<br />
an Grundschulen gemäß<br />
Landespersonalvertretungsgesetz<br />
bereits die Zustimmung verweigert.<br />
wird - insbesondere nach der Veröffentlichung<br />
der PISA-Studie.<br />
Die vom Bildungsministerium verordnete<br />
Qualitätsentwicklung durch Festlegung<br />
und Evaluation eines Schulprogramms<br />
an jeder Einzelschule kann nur<br />
mit gut ausgebildeten KollegInnen gelingen.<br />
Seit Schuljahresbeginn ist das Projekt<br />
Erweiterte Selbstständigkeit von Schulen<br />
(PES) auf rund 200 Schulen des<br />
Landes <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> ausgedehnt<br />
worden. In diesen Schulen können<br />
Schulleitungen unter Beteiligung der<br />
Schulpersonalräte Vertretungslehrkräfte<br />
für kurzfristige Vertretungsanlässe<br />
(Max. vier Wochen) vor Ort auswählen<br />
und beschäftigen. Auch für diese<br />
Maßnahmen fordert die <strong>GEW</strong> <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong>,<br />
ausschließlich mit voll ausgebildeten<br />
Lehrkräften Beschäftigungsverhältnisse<br />
zu vereinbaren.<br />
Schulen<br />
Mehr können Personalräte zurzeit<br />
nicht tun, dies haben Beratungsgespräche<br />
mit kompetenten Juristen<br />
ergeben. Wir hoffen noch immer auf<br />
Einsicht.<br />
Interview: Günter Helfrich<br />
Aktuelle<br />
Ergänzung<br />
Kurz vor Redaktionsschluss war es in<br />
der Presse zu lesen: Das CDU-regierte<br />
Saarland wird zum 1. August<br />
2003 ausschließlich volle BeamtInnenstellen<br />
für Grundschullehrkräfte<br />
vergeben. Vor diesem Hintergrund ist<br />
zu befürchten, dass sich die Personalsituation<br />
an rheinland-pfälzischen<br />
Grundschulen insbesondere in den<br />
Grenzregionen dramatisch zuspitzen<br />
wird, wenn das Ministerium nicht<br />
umgehend handelt.<br />
gh<br />
7
Schulen<br />
Unterrichtsversorgung gibt immer noch Anlass zur Sorge<br />
<strong>GEW</strong> stellt das Ergebnis der landesweiten Erhebung an allen Schularten vor<br />
„Die Schulen des Landes haben der <strong>GEW</strong> eine zum Teil Besorgnis erregende<br />
Unterrichtsversorgung mitgeteilt“, stellte Tilman Boehlkau bei der Präsentation<br />
der Ergebnisse der landesweiten <strong>GEW</strong>-Erhebung vor der Presse fest.<br />
An der landesweiten, alljährlich<br />
durchgeführten Umfrage haben sich<br />
427 der 1.582 allgemeinbildenden<br />
Schulen beteiligt (28,1 %). „Aus dieser<br />
repräsentativen Erhebung errechnet<br />
die <strong>GEW</strong> einen durchschnittlichen<br />
strukturellen Unterrichtsausfall<br />
in Höhe von ca. 2 %, verteilt über<br />
alle Schularten. Dies entspricht einem<br />
LehrerInnen-Defizit von annähernd<br />
500 Planstellen“, so Boehlkau.<br />
Besonders schwierig stellt sich laut<br />
Umfrage die Situation an den Realund<br />
Sonderschulen dar. „In beiden<br />
Schularten steigen die SchülerInnen-<br />
Zahlen und damit der Bedarf an aus-<br />
Fehlende Lehrerstellen<br />
100<br />
2<br />
1<br />
0<br />
-1<br />
-2<br />
-3<br />
-4<br />
-5<br />
-6<br />
0<br />
-100<br />
-200<br />
-300<br />
-400<br />
-500<br />
90,52<br />
1,26<br />
-37,3<br />
-2,05<br />
-20,5<br />
-2,76<br />
2,88<br />
0,19<br />
-120,23<br />
-3,64<br />
Fehlende Lehrerstellen<br />
-103<br />
Unterrichtsausfall 2002/03 in %<br />
-5,9<br />
-117,66<br />
-1,72<br />
-2,82<br />
gebildeten Lehrkräften“, so der<br />
<strong>GEW</strong>-Landesvorsitzende. Während<br />
an den Sonderschulen der LehrerInnen-Mangel<br />
hausgemacht sei, weil<br />
zwischen 1982 und 1992 in <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong><br />
keine SonderpädagogInnen<br />
ausgebildet wurden und Mitte<br />
bis Ende der 90-iger Jahre wegen falscher<br />
Prognosen vor dem Studium<br />
der Sonderpädagogik gewarnt worden<br />
ist, sei der hohe Ersatzbedarf an<br />
den Realschulen vor allem auf die<br />
dort benötigten KlassenlehrerInnen<br />
bzw. den schulspezifischen Fächerbedarf<br />
zurückzuführen.<br />
„Bei dem Bedarf an Sonderpädago-<br />
-22,32<br />
GS GHS HS RegS RS SoSch Gym IGS DOS Summe<br />
-1,49<br />
-0,47<br />
gInnen sind die Schwerpunktschulen<br />
zu berücksichtigen, an denen Integration<br />
beeinträchtiger SchülerInnen<br />
in den Regelunterricht stattfindet.<br />
Im Rahmen dieser bildungspolitisch<br />
richtigen Zielorientierung<br />
muss die Landesregierung besser<br />
dafür Sorge tragen, dass die notwendige<br />
Unterrichtsversorgung an den<br />
Sonder- und Schwerpunktschulen<br />
gewährleistet wird“, stellte Boehlkau<br />
fest.<br />
Um den Bedarf an Realschulen und<br />
Gymnasien zu decken, müsse gezielt<br />
unter den AbiturientInnen für bestimmte<br />
Mangelfächer geworben<br />
und LehrerInnen die Möglichkeit<br />
eingeräumt werden sich umzuqualifzieren,<br />
forderte die <strong>GEW</strong>.<br />
An den Grundschulen hat die <strong>GEW</strong><br />
ein Plus von ca. 90 Stellen festgestellt.<br />
Trotz dieses rechnerisch bestehenden<br />
Überhangs werde dieses Stellenvolumen<br />
dringend zur Abdeckung von<br />
Vertretungsunterricht bzw. für Förderunterricht<br />
benötigt. Dass Bedarf<br />
auch an dieser Schulart bestehe, zeige<br />
sich dadurch, dass dort ca. 150<br />
Personen als VertretungslehrerInnen<br />
ohne erstes oder zweites Staatsexamen<br />
(Studierende oder ReferendarInnen)<br />
beschäftigt werden. „Diese<br />
Art von Unterrichtsversorgung lehnen<br />
wir ab, wenn immer noch rund<br />
2.000 GrundschullehrerInnen mit 3/<br />
4-Zwangsteilzeitverträgen beschäftigt<br />
werden. Bevor mit ‚Minderqualifizierten‘<br />
der Unterricht aufrecht erhalten<br />
wird, muss den ausgebildeten<br />
Lehrkräften eine volle Stelle angeboten<br />
werden. Dies gilt um so mehr,<br />
da die Diskussion um die PISA-Studie<br />
gezeigt hat und die Qualitätsanforderungen,<br />
die das Ministerium<br />
selbst an jede einzelne Schule stellt,<br />
dies bestätigen, dass qualifizierter<br />
Unterricht nur mit qualifizierten<br />
LehrerInnen erreicht werden kann!“,<br />
stellte Boehlkau unmissverständlich<br />
fest. „Deshalb warnen wir ausdrücklich<br />
vor der vermeintlichen Beseitigung<br />
von Unterrichtsausfall durch<br />
nicht ausgebildete Personen. Quali-<br />
8 <strong>GEW</strong>-Zeitung <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> 12 /2002<br />
-461,43<br />
GS GHS HS RegS RS SoSch Gym IGS DOS Summe<br />
Unterrichtsausfall 2002/03 in %<br />
-1,99<br />
GS<br />
GHS<br />
HS<br />
RegS<br />
RS<br />
SoSch<br />
Gym<br />
IGS<br />
DOS<br />
Summe<br />
GS<br />
GHS<br />
HS<br />
RegS<br />
RS<br />
SoSch<br />
Gym<br />
IGS<br />
DOS<br />
Summe
1000<br />
-500<br />
-1000<br />
-1500<br />
-2000<br />
-2500<br />
-3000<br />
tät hat ihren Preis!“, sagte der <strong>GEW</strong>-<br />
Landesvorsitzende.<br />
Die rückläufigen SchülerInnen- und<br />
Klassen-Zahlen in den Grundschulen<br />
müssen darüber hinaus für dringend<br />
notwendige Verbesserungen<br />
innerhalb der Vollen Halbtagsschule<br />
(Grundschule) genutzt werden,<br />
wie z. B. die Wiedereinführung der<br />
Drittelpauschale.<br />
Unterrichtsausfall in Unterrichtsausfall Stunden in Stunden 2002/03<br />
500<br />
0<br />
646,25<br />
-255,3<br />
-777,5<br />
GRÜNE unterstützen Forderungen der <strong>GEW</strong><br />
In <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> fehlt es nach Ansicht<br />
von Bündnis 90/DIE GRÜNEN<br />
im Landtag weiterhin massiv an Vollzeit-Lehrkräften,<br />
um den rheinlandpfälzischen<br />
SchülerInnen den Unterricht<br />
zu erteilen, der rechtlich als Bildungsauftrag<br />
vorgesehen ist. Durch die<br />
aktuelle <strong>GEW</strong>-Untersuchung zum<br />
Unterrichtsausfall sehen sich DIE<br />
GRÜNEN in ihrer Einschätzung bestätigt.<br />
„Wer allein auf sinkende SchülerInnen-<br />
Zahlen setzt, schafft keine qualitative<br />
CDU: Schon wieder mangelhaft!<br />
„Ministerin Ahnen hat aus den niederschmetternden<br />
PISA-Ergebnissen noch<br />
immer nichts gelernt.“ Mit diesen Worten<br />
kommentierte der bildungspolitische<br />
Sprecher der CDU-Landtagsfraktion,<br />
Josef Keller, die Unterrichtsstatistik für<br />
die allgemeinbildenden Schulen.<br />
Josef Keller: „Dieser Landesregierung ist<br />
es noch nie gelungen, für eine volle<br />
<strong>GEW</strong>-Zeitung <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> 12 /2002<br />
45<br />
-687<br />
-1114,1<br />
-300,5<br />
„Zu dem sog. strukturellen Unterrichtsausfall<br />
wegen fehlender LehrerInnen-Stellen<br />
kommt noch der temporäre<br />
Unterrichtsausfall, der die Situation<br />
an den Schulen weiter verschärft!“,<br />
betonte der <strong>GEW</strong>-Vorsitzende.<br />
Zwar könnten derzeit ca. 110<br />
Schulen kurzfristigen temporären<br />
Unterrichtsausfall bis zu sechs Wo-<br />
-232,5<br />
-16<br />
-2691,65<br />
GS GHS HS RegS RS SoSch Gym IGS DOS Summe<br />
GS<br />
GHS<br />
HS<br />
RegS<br />
RS<br />
SoSch<br />
Gym<br />
IGS<br />
DOS<br />
Summe<br />
Verbesserung des Unterrichts, wie sie<br />
auch von Wirtschaft und Hochschulen<br />
übereinstimmend gefordert wird. Das<br />
Land stellt weiterhin zu wenig Lehrkräfte<br />
ein, an der Zukunftsinvestition<br />
Bildung wird in <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> wider<br />
besseren Wissens gespart. Deshalb<br />
unterstützen wir die Forderungen der<br />
<strong>GEW</strong>, den strukturellen Unterrichtsausfall<br />
zu beseitigen und den Schulen<br />
eine Personalreserve zur Verfügung zu<br />
stellen,um den temporären Unterrichtsausfall<br />
auffangen zu können“,<br />
Unterrichtsabdeckung zu sorgen. Die<br />
traurige Bilanz für das Schuljahr 2002/<br />
2003: Im Land fehlen immer noch 500<br />
Lehrerinnen und Lehrer.“<br />
Eine gute Lehrerversorgung, so Keller,<br />
sei die Grundlage für eine erfolgreiche<br />
Bildungspolitik. Josef Keller: „Allmählich<br />
stellt sich die Frage: Will diese Landesregierung<br />
das Problem „Unterrichts-<br />
Schulen<br />
chen im Rahmen des ‚Projekts Erweiterte<br />
Selbstständigkeit von Schulen<br />
(PES)‘ selbst „beseitigen“, dies<br />
führe aber u. a. dazu, dass vor allem<br />
die o. g. „Minderqualifizierten“ in<br />
den Schulen aushelfen.<br />
„Die <strong>GEW</strong> ist der Ansicht, dass gute<br />
Schule nur mit gut qualifiziertem<br />
Personal gelingen kann. Dies haben<br />
uns andere Länder eindrucksvoll<br />
vorgemacht. Auch wenn der strukturelle<br />
Unterrichtsausfall landesweit<br />
‚nur‘ ca. 2 % beträgt, so hilft das<br />
den einzelnen Schulen vor Ort<br />
überhaupt nicht. Rund 500 fehlende<br />
LehrerInnen-Stellen sind immer<br />
noch zu viel! Die <strong>GEW</strong> <strong>Rheinland</strong>-<br />
<strong>Pfalz</strong> fordert das zuständige Ministerium<br />
auf, den strukturellen Unterrichtsausfall<br />
zu beseitigen und<br />
den Schulen eine Personalreserve<br />
zur Verfügung zu stellen, um den<br />
temporären Unterrichtsausfall<br />
durch qualifiziertes Personal auffangen<br />
zu können“, betonte Boehlkau.<br />
erklärte Nils Wiechmann, bildungspolitischer<br />
Sprecher von Bündnis 90/DIE<br />
GRÜNEN im Landtag.<br />
Aus Sicht DER GRÜNEN muss die<br />
Landesregierung bereits jetzt deutlich<br />
machen, dass die ab 2004 zurückgehende<br />
Zahl von Schülerinnen und<br />
Schülern dazu genutzt wird, dem<br />
Schulsystem ausreichende Personalressourcen<br />
für die Qualitätsentwicklung<br />
des Unterrichts und weitere Ganztagsschulangebote<br />
zu erhalten.<br />
ausfall“ überhaupt beseitigen?“<br />
Nach Informationen der CDU-Landtagsfraktion,<br />
so Keller , liege der Unterrichtsausfall<br />
bei den Berufsbildenden<br />
Schulen bei fast 7 Prozent(!). In der<br />
Unterrichtsstatistik sucht man diese<br />
schlimmen Zahlen vergebens. pm<br />
9
Schulen<br />
Im Gespräch mit „Mr. PISA“<br />
Prof. Dr. Baumert: „Die Reformen haben überhaupt noch<br />
nicht richtig begonnen!“<br />
In mehreren Bundesländern - Berlin,<br />
Baden-Württemberg, Hessen,<br />
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,<br />
<strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> - laufen Projekte<br />
der „Pädagogischen Schulentwicklung“.<br />
Weshalb ist das Thema<br />
Schul- und Unterrichtsentwicklung<br />
so dringlich?<br />
Schulentwicklung ist ein Thema so alt<br />
wie die Schule selbst. Neu ist, dass sie<br />
systematische Formen gewonnen hat<br />
und alle Kolleginnen und Kollegen einbezogen<br />
werden. Sie wurde zum Kern<br />
der Modernisierung des Schulwesens, als<br />
auch der Bildungsverwaltung klar geworden<br />
war, dass sich Schulen nicht<br />
bürokratisch steuern lassen.<br />
Wie reformresistent oder reformgeschädigt<br />
ist die deutsche Lehrerschaft?<br />
Ich glaube, die Reformen haben<br />
überhaupt noch nicht richtig begonnen.<br />
Wir haben immer an der falschen Stelle<br />
über Reformen diskutiert - über<br />
Strukturreformen, Klassengröße,<br />
Pflichtstundenzahl. Diese Fragen sind<br />
nicht unbedeutend, aber wir sind nicht<br />
an das Kerngeschehen der Schule, an<br />
den Unterricht, seine Qualität und seine<br />
Ergebnisse herangegangen.<br />
Was muss sich am traditionellen<br />
Unterricht, bei dem der Lehrer an<br />
der Tafel steht und doziert, die<br />
Schüler zuhören, mitschreiben und<br />
memorieren, entscheidend verändern?<br />
Das Problem des deutschen Unterrichts<br />
ist wahrscheinlich nicht die Tatsache,<br />
dass die Lehrkraft im Mittelpunkt steht<br />
und das Heft in der Hand hält. Das<br />
gibt es in allen anderen Ländern, die<br />
bei den internationalen Vergleichsstudien<br />
- zuletzt Pisa -bessere Ergebnisse<br />
als Deutschland erreicht haben. Problematisch<br />
ist die Logik des Unterrichtskripts,<br />
also die dem Lehrerhandeln<br />
zugrunde liegende Idee eines guten Unterrichts.<br />
In Deutschland dominiert das<br />
Muster des fragend-entwickelnden Unterrichts.<br />
Diese Unterrichtsform findet<br />
man auch in anderen Ländern, aber<br />
als ein Muster unter anderen, nicht als<br />
Monokultur<br />
Wie sieht dieser Unterricht aus?<br />
Ihm liegt die Vorstellung zugrunde, dass<br />
der Lehrer durch Fragen an den Schüler<br />
das latente vorhandene Wissen ans<br />
Tageslicht hebt, es reinigt, entfaltet und<br />
anreichert. Wenn man diese literarische<br />
Kunstform auf den Unterricht überträgt,<br />
handelt man sich Probleme ein.<br />
Am deutlichsten wird das im Tafelanschrieb,<br />
auf dessen Vervollständigung<br />
die Lehrkraft den Unterricht hinlenken<br />
muss. Um zum Ziel zu gelangen,<br />
ist sie auf die richtigen Antworten der<br />
Schüler, und zwar bei knapper Zeit,<br />
angewiesen. In der Regel beginnt der<br />
Lehrer den Unterricht mit einem komplexen<br />
und anspruchsvollen Problem,<br />
dessen Bearbeitung relativ viel Spielraum<br />
lässt. Da die Schüler das Unterrichtsziel<br />
in der Regel nicht kennen,<br />
tasten sie sich auf die eröffnenden Fragen<br />
assoziativ an die vermeintliche Idee<br />
des Lehrers heran. Um in 45 Minuten<br />
zum vorgegebenen Unterrichtsziel zu<br />
gelangen, muss die Lehrkraft die Schülerantworten<br />
so kanalisieren, dass sie in<br />
die geplante Bahn einmünden. Dies geschieht<br />
in der Regel durch eine Fragefolge,<br />
bei der die Nachfragen von Schritt<br />
zu Schritt enger und trivialer werden.<br />
Am Ende steht dann eine simple Antwort,<br />
die zu geben Schülern geradezu<br />
peinlich sein kann.<br />
Aber es kommt eine Antwort?<br />
Mathematikdidaktiker, die in Fallstudien<br />
Unterrichtsabläufe in subtiler<br />
Weise analysiert haben, beschreiben das<br />
Grundmuster des deutschen Mathematikunterrichts<br />
als die „Trivialisierung<br />
eines komplexen Ausgangsproblems“.<br />
Wenn man diesem Unterrichtsskript<br />
folgt, haben Lehrkräfte es schwer, mit<br />
zwei Typen von Antworten umzugehen.<br />
Eine Antwort ist die falsche Antwort.<br />
Bei einer konvergent auf ein vorgegebenes<br />
Unterrichtsziel ausgerichteten<br />
Gesprächsführung kann man Fehler<br />
nicht produktiv nutzen. Man kann sie<br />
nicht bis zum Ende durchspielen und<br />
fragen: Was folgt eigentlich daraus,<br />
wenn wir diese Antwort als richtig annehmen?<br />
Man kann aber auch nicht<br />
zu den Ursachen des Fehlers zurückgehen:<br />
In welchen Schritten bist du zu<br />
dieser Antwort gekommen?<br />
Die zweite Antwortart, mit der man<br />
im fragend-entwickelnden Unterricht<br />
schlecht umgehen kann, ist der wirklich<br />
intelligente weiterführende Beitrag,<br />
der das Ziel einer Stunde vorwegnimmt.<br />
Solche Antworten werden<br />
beiseite geschoben oder Schüler und<br />
Schülerinnen, von denen die Lehrkraft<br />
zur unrechten Zeit Antworten dieser<br />
Art erwartet, werden am Gespräch<br />
nicht beteiligt. Der leistungsschwächere<br />
und der leistungsstärkere Schüler<br />
kommt bei dieser Unterrichtsführung<br />
nicht zu seinem Recht.<br />
Wir sprechen viel von Basiskompetenzen,<br />
die Schülerinnen und Schüler<br />
brauchen, welche brauchen eigentlich<br />
die Lehrkräfte?<br />
Entscheidend ist die Entwicklung professioneller<br />
Handlungskompetenz:<br />
Dazu gehören die Stärkung des Verantwortungsbewusstseins<br />
für die Klienten,<br />
die Öffnung des Unterrichts und seiner<br />
Vor- und Nachbereitung für den<br />
professionellen Blick und die Entwicklung<br />
einer Sprache, die es erlaubt, ohne<br />
wechselseitige Verletzung über die eigene<br />
Tätigkeit zu reden. Ich glaube, das<br />
ist die entscheidende Hürde, die man<br />
in den nächsten Jahren nehmen muss,<br />
wenn man Unterricht verbessern will,<br />
und Schulentwicklung heißt im Kern<br />
zu aller erst Unterrichtsentwicklung.<br />
Wie müssen dann die neuen Lern–<br />
strategien aussehen, wie die neue<br />
Lernkultur?<br />
Sie müssen erlauben, mit Unterschiedlichkeit<br />
intelligent umzugehen. Schon<br />
ein Wechsel von Lehrervortrag und Einzel-<br />
oder Gruppenarbeit kann schon<br />
mehr Spielraum als der fragend-entwickelnde<br />
Unterricht bieten. An Aufgaben<br />
für Einzel- oder Gruppenarbeit<br />
können sich leistungsstarke und leistungsschwächere<br />
Schüler gleichermaßen<br />
bewähren. Dies sind Aufgaben,<br />
die unterschiedlich schwierige Teilaufgaben<br />
enthalten und wenn sie besonders<br />
gut sind, auch unterschiedliche Lösungen<br />
und Lösungswege auf unterschiedlichem<br />
Niveau zulassen.<br />
10 <strong>GEW</strong>-Zeitung <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> 12 /2002
Sie werden notiert und anschließend<br />
an der Tafel dokumentiert oder vorgetragen<br />
und dann im Klassengespräch<br />
gegeneinander diskutiert. Diese Form<br />
der Unterrichtschoreographie ist im<br />
Vergleich zum fragend-entwickelnden<br />
Unterricht, der die Lehrkraft psychisch<br />
kontinuierlich fordert, bemerkenswert<br />
stressarm.<br />
Ist die Schule mit ihren Bordmitteln<br />
überhaupt in der Lage, den Unterricht<br />
weiter zu entwickeln und<br />
sich selbst zu erneuern?<br />
Langfristig muss sie in die Lage versetzt<br />
werden, sich selbst zu arrangieren.<br />
Dafür benötigt sie aber Spielräume,<br />
geeignete Instrumente und die notwendigen<br />
Mittel. Sie benötigt auch<br />
freie Finanzmittel, um das einzukaufen,<br />
was sie braucht - seien es Zeithilfen<br />
oder die Fortbildung, die für die<br />
Weiterentwicklung ihres Programms<br />
sinnvoll ist. Regulativ der Fortbildung<br />
ist nicht das Angebot der Universitäten<br />
oder Landesinstitute, aus dem das<br />
einigermaßen Passende ausgesucht<br />
wird, sondern der Bedarf der Einzelschule.<br />
Da die Schulen auf dem freien<br />
Markt kaufen, nicht nur bei den staatlichen<br />
Anbietern, wird es auch eine implizite<br />
Qualitätskontrolle geben.<br />
Geht das ohne Hilfe von außen?<br />
Die Schulen sind am Anfang ihres Veränderungsprozesses<br />
auf externe Unterstützung<br />
angewiesen, die sie gezielt<br />
abrufen können. Das SINUS-Programm<br />
zur Verbesserung des mathematisch-naturwissenschaftlichenUnterrichts,<br />
das von der Bund-Länder-Kommission<br />
finanziert wird, funktioniert<br />
zur Zeit auch deshalb so gut, weil in<br />
Netzwerken lokale und zentrale Unterstützung<br />
angeboten wird.<br />
Die Kultusministerkonferenz hat<br />
Vergleichsarbeiten in der Grundschule<br />
und nach der 5. Klasse beschlossen.<br />
Wie sinnvoll ist es eigentlich,<br />
mit dieser Testeritis, wie manche<br />
spötteln, immer wieder das Althergebrachte<br />
zu evaluieren? Müsste<br />
nicht die Reihenfolge lauten: erst<br />
Innovation, dann Evaluation?<br />
Die Vorstellung, dass die Reform in den<br />
Grundschulen erst jetzt beginne, ist<br />
gründlich falsch. Die Grundschulen<br />
haben in den vergangenen 25 Jahren<br />
<strong>GEW</strong>-Zeitung <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> 12 /2002<br />
Das Gespräch mit Prof. Dr. Baumert, dem Direktor des Max-Planck-Instituts<br />
für Bildungsforschung, führte unser Mitarbeiter Dr. Paul Schwarz.<br />
ein neues Gesicht erhalten - nicht<br />
zuletzt unter dem Einfluss der Reformpädagogik.<br />
Über die Ergebnisse ist aber<br />
so gut wie nichts bekannt. IGLU, die<br />
Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung<br />
von 2001, ist die erste Studie,<br />
die den Blick auf die Erträge der<br />
Grundschularbeit freigeben wird. Von<br />
Testeritis zu sprechen, ist eine Polemik,<br />
die darauf zielt, die Voraussetzungen für<br />
Verbesserungen, nämlich Transparenz,<br />
zu verhindern. Doch wenn sich die<br />
Lehrkräfte nicht in ihren Unterricht<br />
schauen lassen und ihre Ergebnisse nicht<br />
ausbreiten und austauschbar machen,<br />
wird sich wenig ändern. Die Kommunikation<br />
über Unterricht - und zwar<br />
über seine Vorbereitung, Durchführung<br />
und Ergebnisse - gehört zum Kern der<br />
Professionalität des Lehrerberufs.<br />
Wie optimistisch sind sie, was die<br />
Zukunft der Bildung in Deutschland<br />
angeht, wie zuversichtlich, dass<br />
ein Ruck, wie ihn der frühere Bundespräsident<br />
Roman Herzog gefordert<br />
hat, durch die Gesellschaft geht.<br />
Ich glaube, es ruckt nichts so ohne weiteres.<br />
Der Erfolg hängt vom Bohren dicker<br />
und harter Bretter ab. Wir werden<br />
uns mit einer Entwicklungsperspektive<br />
von zehn Jahren anfreunden müssen,<br />
bis messbare Erfolge nachweisbar<br />
sein werden. Aber auch in zehn Jahren<br />
wird man nicht alle Schulen erreicht<br />
haben. Ein realistisches Ziel könnte es<br />
sein, den Kreis der wirklich aktiven<br />
Schulen zu vergrößern und diese tonangebend<br />
werden zu lassen.<br />
Schulen<br />
11
<strong>GEW</strong>-Fortbildung / Weiterbildung<br />
In diverse Rollen geschlüpft<br />
Hilfreiches <strong>GEW</strong>-Seminar über Gesprächsführung<br />
Ist Gesprächsführung lernbar? Kann man in einem Gespräch auch dann den<br />
roten Faden behalten, wenn die Person gegenüber ständig versucht, einen<br />
aus dem Konzept zu bringen?<br />
Rheinzeitung,<br />
Ausgabe Mayen,<br />
6.11.02<br />
Diese Hoffnung hatten zumindest<br />
die acht LehrerInnen und drei Erzieherinnen,<br />
die am <strong>GEW</strong>-Seminar<br />
„Gesprächsführung“ auf der Ebernburg<br />
in Bad Münster am Stein Ende<br />
Oktober teilnahmen. Und sie wurden<br />
nicht enttäuscht!<br />
Souverän und abwechslungsreich gestaltete<br />
der Referent Uwe Becker das<br />
Seminar, wobei das praktische Handeln<br />
durch vielfältige Kommunikationsübungen<br />
im Vordergrund stand.<br />
In den auf das notwendige Maß beschränkten<br />
Theoriephasen konnten<br />
die TeilnehmerInnen z.B. die fünf<br />
Phasen eines Gesprächs kennen lernen,<br />
an denen man sich auch in<br />
schwierigen Gesprächssituationen<br />
recht gut orientieren kann. Wie man<br />
Konflikte anspricht, ohne jemanden<br />
anzugreifen, wurde in einem weiteren<br />
Modell gezeigt, das für das kommunikative<br />
Miteinander im Alltag<br />
und im Beruf wertvoll sein kann.<br />
In den praktischen Übungen orientierte<br />
man sich so nah wie möglich<br />
am Berufsleben der PädagogInnen.<br />
In Form von Rollenspielen wurden<br />
verschiedene Gesprächssituationen<br />
rekonstruiert und nachgespielt.<br />
Dabei ließ Uwe Becker die TeilnehmerInnen<br />
in diverse Rollen schlüpfen.<br />
Beispielsweise musste sich eine<br />
Erzieherin gegen eine ununterbrochen<br />
redende Mutter behaupten oder<br />
eine Schulleiterin sich gegen einen<br />
aggressiv auftretenden Vater durchsetzen.<br />
Wie man sein Gesprächsziel<br />
auch in solchen Situationen erreichen<br />
kann, wurde durch Analyse der<br />
Situation und Tipps zur Gesprächsleitung<br />
gezeigt.<br />
Im letzten Teil des Seminars stellte<br />
der Referent ein Modell zur kollegialen<br />
Praxisberatung vor, das von allen<br />
TeilnehmerInnen als äußerst hilfreich<br />
für den Berufsalltag bewertet<br />
wurde. Dabei übernehmen die PädagogInnen<br />
selbst die gegenseitige<br />
Beratung in Konfliktfällen, um diese<br />
mit kollegialer Unterstützung besser<br />
und effektiver lösen zu können.<br />
Mit Hilfe der klar strukturierten<br />
Schritte des Modells und mit ein bis-<br />
schen Übung ist es somit möglich,<br />
KollegInnen vielfältige konkrete<br />
Tipps in einer Beratung anzubieten.<br />
Alle TeilnehmerInnen waren der<br />
Meinung, dass es sinnvoll wäre,<br />
wenn an vielen pädagogischen Einrichtungen<br />
feste Gruppen zur kollegialen<br />
Praxisberatung installiert<br />
werden würden.<br />
Alles in allem war das Seminar für<br />
alle Beteiligten ein voller Erfolg. Der<br />
Dank geht auch an Mehmet Kilic,<br />
der es immer wieder schafft, interessante<br />
Seminare im Bildungsbereich<br />
der <strong>GEW</strong> anzubieten.<br />
Anne Bilke<br />
Lepra<br />
nimmt Würde<br />
Fordern Sie Informationen an!<br />
Telefon: 09 31/79 48-0<br />
Internet: www.dahw.de<br />
12 <strong>GEW</strong>-Zeitung <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> 12 /2002<br />
B
<strong>GEW</strong>-Zeitung <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> 12 /2002<br />
Bildung international<br />
Standardisierte Leistungstests beschädigen Qualität<br />
Qutput-Steuerung von Bildungssystemen am Beispiel Kanadas<br />
Wie die deutschen Bundesländer<br />
verfügen die 10 kanadischen Provinzen<br />
und 3 Territorien über eine eigene<br />
Zuständigkeit für Bildung und<br />
sprechen sich lediglich über die Einrichtung<br />
des Council of Ministers<br />
of Education, Canada (CMEC) in<br />
Grundsatzfragen ab. Dies ist aber<br />
auch die einzige Gemeinsamkeit. Im<br />
Gegensatz zu uns besitzt Kanada in<br />
allen Landesteilen ein integriertes<br />
Schulsystem von der Grundschule<br />
bis zum Ende der High School. Seine<br />
Leistungsfähigkeit hat dieses System<br />
durch die Verbindung von hoher<br />
Qualität mit hoher Bildungsbeteiligung<br />
und Chancengleichheit<br />
unter Beweis gestellt.<br />
In der internationalen Leistungsvergleichsstudie<br />
PISA 2000 hat Kanada<br />
in der Gesamtwertung einen zweiten<br />
Platz in der Lesekompetenz der fünfzehnjährigen<br />
erreicht. Mit diesem außerordentlichen<br />
Erfolg konnte es an<br />
die guten TIMSS-Ergebnisse (1996)<br />
in Mathematik und Naturwissenschaften<br />
anknüpfen.<br />
Statt vor dem Hintergund dieser Erfogsserie<br />
das Bewährte zu stärken, ist<br />
die kanadische Bildungspolitik in allen<br />
Provinzen dabei, den Schulen einschneidende<br />
Veränderungen „von<br />
oben“ zu verpassen und sie auf eine<br />
rigorose Output-Steuerung umzustellen.<br />
Da die KMK einen Systemwechsel<br />
von der Input- zur Output-<br />
Steuerung beschlossen hat, ist der folgenreiche<br />
„kanadische Weg“ für<br />
Deutschland durchaus lehrreich.<br />
Den kanadischen<br />
Schulen wird ein Testsystem<br />
aufgezwungen<br />
Dies gilt auch für die Schulen in<br />
Ontario, der größten und wirtschaftlich<br />
bedeutendsten Provinz in Kanada<br />
mit der multikulturellen Metropole<br />
Toronto als Zentrum. Ontarios<br />
Schulen, die durch die Bertelsmann<br />
Stiftung auch in Deutschland als<br />
Musterbeispiele für gute Schulen<br />
bekannt geworden sind, sehen sich<br />
seit einigen Jahren einer Politik des<br />
Misstrauens ausgesetzt. Als Garant<br />
für Schulqualität gilt der konservativen<br />
Regierung von Ontario nicht<br />
die professionelle Arbeit der LehrerInnen,<br />
sondern das von ihr Ende der<br />
neunziger Jahre eingeführte Testsystem.<br />
Gegen den Widerstand von<br />
LehrerInnen und deren Gewerkschaften<br />
ist sie dabei, dieses System<br />
auszuweiten.<br />
Die Ontario Teachers’ Federation<br />
wirft der kanadischen Provinzregierung<br />
die Verfälschung der TIMSS-<br />
Ergebnisse vor. Um die Einführung<br />
des Testsystems nicht zu gefährden,<br />
habe die Regierung durch Manipulation<br />
des Datenmaterials den öffentlichen<br />
Eindruck erzeugt, die Schulen<br />
in Ontario hätten im Vergleich<br />
besonders schlecht abgeschnitten.<br />
Auch der PISA-Erfolg wird laut Lehrergewerkschaft<br />
bewusst fehlinterpretiert.<br />
Während die Regierung das<br />
erfolgreiche Abschneiden bei PISA<br />
als Erfolg ihrer neuen Politik der<br />
Standardsicherung verbucht, rechnet<br />
die Gewerkschaft vor, dass die in<br />
PISA geprüften Fünfzehnjährigen<br />
den größten Teil ihrer Schulzeit im<br />
alten System verbracht haben.<br />
Vielleicht ist diese durchsichtige Argumentation<br />
auch der Grund, warum<br />
die Bildungspolitik in Kanada<br />
von sich aus auffällig wenig Interesse<br />
gezeigt hat, PISA medial für sich<br />
auszuschlachten.<br />
Der Druck auf die<br />
Kinder der Elementary<br />
School wächst<br />
Konzipiert als Schule für alle, auch<br />
der behinderten Kinder, umfasst sie<br />
die Klassen 1 - 8 und als freiwilliges<br />
und kostenfreies Angebot einen Kindergarten.<br />
Sie ist traditionell von ihrem<br />
Selbstverständnis eine Schule<br />
der individuellen Förderung und<br />
nicht des harten Leistungswettbewerbs.<br />
Dass die Elementary School Schaden<br />
nimmt, ist inzwischen keine bloße<br />
Befürchtung von Kritikern der Regierungspolitik,<br />
sondern in der<br />
Schulwirklichkeit spürbar. Um die<br />
eingetretene Verschlechterung im<br />
Unterricht auf den Punkt zu bringen,<br />
beklagt eine Schulleiterin aus<br />
Ontario: „We don’t even have time<br />
for laughing.“<br />
Der Lese- und Rechtschreibtest in<br />
Klasse 3 und der Mathematiktest in<br />
6 wird provinzweit zentral gestellt<br />
und ausgewertet. Die Tests werden<br />
als Diagnosetest ausgegeben, schaffen<br />
aber faktisch einen enormen Leistungsdruck.<br />
Die Tests orientieren<br />
sich an einem neuen und nach Aussagen<br />
von Pädagogen stofflich überfrachteten<br />
Curriculum. Sie laufen<br />
damit dem Anspruch an einen individualisierenden<br />
Unterricht völlig<br />
zuwider. Die LehrerInnen bekommen<br />
keinen Einblick in das Verfahren,<br />
wie den SchülerInnen werden<br />
ihnen nur die Testergebnisse mitgeteilt.<br />
Die Ergebnisse werden von den<br />
School Boards, die die Funktion der<br />
regionalen Schulaufsicht haben, geprüft<br />
und diskutiert. Seit kurzem<br />
müssen die Schulen auf der Basis<br />
ihrer Ergebnisse Ziele zur Leistungsverbesserung<br />
formulieren (Target<br />
Setting). Im Rahmen von Action<br />
Plans sind diese dem School Board<br />
und den Eltern darzulegen. „Like a<br />
blitz“, so eine Schulleiterin, sei diese<br />
Neuerung über die Schulen gekommen<br />
und schaffe ein Spannungsfeld<br />
zwischen den pädagogischen Ansprüchen<br />
an einen inklusiven Unterricht,<br />
der allen SchülerInnen gerecht<br />
werden will, und den äußeren Anforderungen<br />
an die Schulen.<br />
Zusätzliche Mittel für eine entsprechende<br />
individuelle Förderung ziehen<br />
die Diagnosetests nicht nach<br />
sich. Im Gegenteil, die Handlungs-<br />
13
Bildung International<br />
möglichkeiten zur individuellen Förderung<br />
sind wegen drastischer Haushaltskürzungen<br />
in den letzten Jahren<br />
eingeschränkt worden, während<br />
die allgemeinen unterrichtlichen<br />
Rahmenbedingungen sich ebenfalls<br />
wesentlich verschlechtert haben.<br />
Die Medien veröffentlichen die Testergebnisse<br />
der Schulen, ohne jedoch<br />
über die soziokulturellen Hintergründe<br />
der Schulen und der Schüler<br />
zu informieren. Als Folge der<br />
Schul-Rankings wird aktuell gefordert,<br />
die freie Schulwahl für Eltern<br />
gesetzlich zu garantieren. Die Liberalen<br />
haben diese Forderung als erste<br />
Partei in ihr Wahlprogramm aufgenommen.<br />
Wenn der Grundsatz<br />
nicht mehr gilt, dass die SchülerInnen<br />
der Elementary School die<br />
nächstgelegene Schule ihres Wohnbezirks<br />
besuchen, wird soziale Segregation<br />
zu Lasten von Integration<br />
und Chancengleichheit bildungspolitisch<br />
gefördert.<br />
Der Lesetest in Klasse<br />
10 verändert die High<br />
School<br />
Im Jahr 2000 wurde der Lese- und<br />
Rechtschreibtest in Ontario für die<br />
Klasse 10 eingeführt und auf freiwilliger<br />
Basis durchgeführt. Schon ein<br />
Jahr später wurde er für alle SchülerInnen<br />
verbindlich vorgeschrieben.<br />
Die Veröffentlichung der Ergebnisse<br />
des letztjährigen Lese- und Rechtschreibtestes<br />
in Klasse 10 hat im<br />
Oktober 2002 für öffentliche Kontroversen<br />
und sehr viel Unmut an<br />
den Schulen gesorgt. 75 % der TeilnehmerInnen<br />
haben den Test bestanden,<br />
da im Jahr davor nur 68% bei<br />
diesem Test erfolgreich waren, sieht<br />
sich die Regierung mit ihrem Testsystem<br />
auf Erfolgskurs.<br />
Die Kritiker, insbesondere aus den<br />
Reihen der Gewerkschaft, finden das<br />
Schweigen über die große Zahl der<br />
Gescheiterten skandalös. Schließlich<br />
handelt es sich nicht um einen Diagnosetest.<br />
Von seinem Bestehen<br />
hängt der Abschluss in der High<br />
School am Ende von Klasse 12 ab.<br />
Außerdem sind von dem Scheitern<br />
im Wesentlichen sozial benachteiligte<br />
und behinderte SchülerInnen betroffen.<br />
Der Test kann zwar wiederholt werden,<br />
aber mit welchen Chancen? Es<br />
gab zwischen der Bekanntgabe der<br />
Ergebnisse und der Aufforderung<br />
zur Wiederholung weder ein offizielles<br />
Förderangebot noch Zeit für<br />
eigene persönliche Anstrengungen.<br />
Nach Einschätzung der Gewerkschaft<br />
nimmt die Regierung in Kauf,<br />
dass die Betroffenen die Schulen verlassen,<br />
da sie mit dem Ende der Klasse<br />
10 ihre Schulpflicht absolviert haben.<br />
Vieles spricht dafür, dass die Regierung<br />
darauf hinarbeitet, die von ihr<br />
herbeigeführte Notlage der Gescheiterten<br />
für eine „Modernisierung“ der<br />
integrativen High School zu nutzen.<br />
Bislang gilt noch die bewährte Regelung<br />
eines einheitlichen Abschlusses<br />
für alle am Ende der High School<br />
mit den Zusatzberechtigungen für<br />
Universität und College bei entsprechenden<br />
Leistungsnachweisen. Der<br />
Vorschlag, einen eigenen Abschluss<br />
auf der Basis eigener Curricula für<br />
die Leistungsschwächeren anzubie-<br />
Tests machen noch keinen guten Unterricht<br />
Nach dem PISA-<br />
Schock wird<br />
allerorten für Parallel-<br />
und Vergleichsarbeiten<br />
plädiert. Ist das<br />
der Weg zu effektiverem<br />
Lernen<br />
und besserem<br />
Unterricht? Wohl<br />
kaum! Zentrale<br />
Prüfungen verleiten<br />
eher dazu,<br />
die typischen<br />
Testaufgaben<br />
und Sternchenthemen<br />
systematisch zu pauken und<br />
andere wichtige Kompetenzen und<br />
Lernanlässe über Gebühr zu vernachlässigen.<br />
Wenn PISA-E im Bereich Leseverständnis<br />
feststellt, dass vier der sieben<br />
am besten platzierten Bundeslän-<br />
der keine zentralen Prüfungen durchführen,<br />
dann ist das doch nicht ein Indiz<br />
dafür, dass das Heil offenbar nicht<br />
von zentralen Prüfungen und regelmäßigen<br />
Vergleichsarbeiten zu erwarten<br />
ist.<br />
Tests haben dann einen Sinn, wenn es<br />
darum geht, einen bestimmten Impuls<br />
zu geben. Dieser Impuls ist durch PISA<br />
und TIMSS hinreichend gesetzt worden.<br />
Viele Lehrkräfte sind inzwischen<br />
durchaus bereit, ihren Unterricht zu<br />
verändern. Das zeigt nicht zuletzt das<br />
rege Interesse am PSE-Programm des<br />
EFWI. Nur wünschen und brauchen<br />
sie praktische Hilfen und substanzielle<br />
Unterstützung, um die geforderte neue<br />
Lernkultur rasch, wirksam und in arbeitsökonomischer<br />
Weise aufbauen zu<br />
können. Die in Aussicht gestellten zentralen<br />
Prüfungen und Testreihen sind<br />
unter diesem Aspekt eher kontrapro-<br />
duktiv. Wenn neuen Lehr- und Lernformen<br />
tatsächlich der Weg geebnet<br />
werden soll, dann brauchen wir eine<br />
nach vorne gerichtete Qualifizierungsoffensive<br />
mit einschlägigen Seminaren<br />
und Workshops und gezielten<br />
Freistellungsmaßnahmen für engagierte<br />
LehrerInnen. Die Großbetriebe<br />
haben uns das doch vorgemacht.<br />
Sie haben nach dem offenkundigen<br />
Scheitern der alten Unterweisungsmethode<br />
die bestehenden Defizite<br />
nicht länger getestet und beklagt, sondern<br />
aufwändige Trainingscamps für<br />
ihre Ausbilder organisiert und finanziert.<br />
Daran sollten wir uns im staatlichen<br />
Schulwesen ein Beispiel nehmen!<br />
Dr. Heinz Klippert,<br />
Aus: PSE-Netzwerkzeitung des<br />
EFWI Landau<br />
14 <strong>GEW</strong>-Zeitung <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> 12 /2002
ten. Läuft darauf hinaus, dass sich<br />
entlang sozialer Herkünfte die Bildungswege<br />
der SchülerInnen am<br />
Anfang der High School in ungleichwertige<br />
Angebote trennen. Dieser<br />
Verzicht auf Integration muss vor<br />
dem Hintergrund von Kanada als<br />
Einwanderungsland besonders bedenklich<br />
stimmen.<br />
Was kommt auf uns zu?<br />
Das deutsche Schulsystem steht vor<br />
der Einführung von Bildungsstandards<br />
und Leistungstests. Durch das<br />
kanadische Beispiel drängt sich die<br />
Erkenntnis auf, dass wir bei einem<br />
selektiven Schulmodell als Ausgangslage<br />
und der politischen Verweigerung,<br />
diese Strukturen zu verändern,<br />
mit dem „harten kanadischen Weg“<br />
nichts Besseres als die Verschärfung<br />
unserer bestehenden sozialen Selektion<br />
zu erwarten haben. Aber selbst<br />
wenn wir „weichere Wege“ zur Herstellung<br />
von Verlässlichkeit und Sicherung<br />
allgemeiner Standards gehen<br />
sollten wie in Skandinavien,<br />
dann zeigen uns diese Länder, dass<br />
zur Vermeidung von sozialer Selek-<br />
<strong>GEW</strong>-Zeitung <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> 12 /2002<br />
Bildung International<br />
Zehntausende Lehrkräfte streikten in Frankreich<br />
Mehr als 30.000 französische LehrerInnen<br />
und HochschulprofessorInnen<br />
sind am 17. Oktober im ganzen<br />
Land gegen die Sparpläne der<br />
Regierung in der Bildungspolitik auf<br />
die Straße gegangen. Die fünf gro-<br />
ßen Gewerkschaften hatten zu einem<br />
nationalen Streiktag in sämtlichen<br />
Bildungsbereichen aufgerufen. Die<br />
Proteste richteten sich nach Angaben<br />
der Gewerkschaften gegen die geplante<br />
Streichung von insgesamt 25.600<br />
630 streikende Lehrkräfte in Simbabwe entlassen<br />
Im afrikanischen Krisenstaat Simbabwe<br />
sind fast 630 Lehrkräfte, die<br />
wegen einer 135-prozentigen Inflation<br />
für höhere Gehälter gestreikt<br />
hatten, nach Angaben vom 15. Oktober<br />
entlassen worden. Die Entlassenen<br />
hatten eine Einkommserhöhung<br />
von 200 Prozent gefordert. Sie<br />
gehörten dem 10.000 Mitglieder<br />
starken Progressiven Lehrerverband<br />
(Progressive Teachers Association)<br />
tion ein integriertes System die notwendige<br />
Voraussetzung ist. Wer Bildungsstandards<br />
in den alten Schulstrukturen<br />
will, folgt immer noch<br />
dem Irrglauben, dass eine selektive<br />
Bildungsbeteiligung Qualität im<br />
System herstellen und sichern kann.<br />
Brigitte Schumann<br />
Psychotherapeutische Praxis<br />
Dipl.-Psychologe H. von Vangerow<br />
• Beihilfeberechtigte<br />
c/o Euteneuer, Kurfürstemstr. 87a<br />
56068 Koblenz T: 0178 / 392 71 36<br />
an, deren Generalsekretär Raymond<br />
Majongwe als Organisator des nicht<br />
genehmigten Streiks festgenommen<br />
worden war. Unter den neuen scharfen<br />
Gesetzen des Landes drohen ihm<br />
nun bis zu 10 Jahre Haft.<br />
Der konkurrierende 70.000 Mitglieder<br />
starke Simbabwe Lehrerverband<br />
(Zimbabwe Teachers Association)<br />
beteiligte sich nicht an dem<br />
Streik. Er hatte auf Zusagen der<br />
Klassenfahrten nach Berlin<br />
(incl. Transfer, Unterkunft,<br />
Programmgestaltung nach Absprache).<br />
Broschüre anfordern bei:<br />
Biss, Freiligrathstr. 3, 10967 Berlin,<br />
Tel. (030) 6 93 65 30<br />
Stellen beim Aufsichts- und Erziehungspersonal.<br />
Bildung sei für die<br />
konservative Regierung nicht mehr<br />
vorrangig.<br />
dpa<br />
Regierung vertraut, die gegenwärtigen<br />
Gehaltsbedingungen zügig zu<br />
„überprüfen“. Zur Zeit verdient ein<br />
Lehrer im Schnitt 27.000 Simbabwe-Dollar<br />
pro Monat, nach offiziellem<br />
Umtauschkurs entspricht das<br />
etwa 500 Euro, nach dem weitaus<br />
gebräuchlicheren Schwarzmarktkurs<br />
dagegen gerade mal 30 Euro.<br />
dpa<br />
15
Internationales<br />
„Tesekkür ederim, Mehmet!“<br />
10 Jahre Solidarität und Begegnung der <strong>GEW</strong> mit Egitim-Sen<br />
Unter der Leitung von Mehmet Kilic nahmen 25 <strong>GEW</strong>-Mitglieder in Izmir an<br />
der Feier zum 10-jährigen Jubiläum der Begegnung zwischen der <strong>GEW</strong><br />
<strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> und der türkischen Gewerkschaft Egitim-Sen teil. Ihre Solidarität<br />
zeigten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei einer Protestveranstaltung<br />
am internationalen Lehrertag in Izmir. Auf dem Reiseprogramm<br />
standen auch historische Sehenswürdigkeiten, Besuche von Schulen und weitere<br />
Begegnungen mit türkischen Kolleginnen und Kollegen.<br />
Jubiläumsfeier in Izmir<br />
Mittelpunkt der diesjährigen Reise<br />
war die 10-jährige Jubiläumsfeier der<br />
Begegnungen zwischen der <strong>GEW</strong><br />
<strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> und der türkischen<br />
Gewerkschaft Egitim-Sen, die Mehmet<br />
Kilic, Landesvorstandsmitglied<br />
für den Bereich Gewerkschaftliche<br />
Mehmet zusammen mit dem Gewerkschaftsekretär<br />
Nihat Sefer<br />
Bildung und Mitgliederwerbung,<br />
über diese Jahre hinweg organisierte.<br />
Zu der Feier in Izmir hatte die<br />
<strong>GEW</strong> Mitglieder der türkischen Gewerkschaft<br />
aus der ganzen Türkei<br />
eingeladen. Einzelne waren über 20<br />
Stunden aus der Osttürkei oder von<br />
der Schwarzmeerküste in Bussen<br />
unterwegs, um zu dieser Feier zu gelangen.<br />
Mehmet Kilic erinnerte in<br />
seiner Rede an die Begegnungen der<br />
letzten Jahre und äußerte die Hoffnung,<br />
dass die deutsch-türkische<br />
Freundschaft sich weiter stärken<br />
möge und auch in Zukunft weitere<br />
Treffen in der Türkei und in <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong><br />
stattfinden mögen. In seiner<br />
Rede dankte der türkische Gewerkschaftssekretär<br />
Nihat Sefer<br />
Mehmet für sein unermüdliches Engagement<br />
und wünschte ebenfalls<br />
weitere und häufigere Begegnungen<br />
in der Türkei und in Deutschland.<br />
Mit einen musikalischen Beitrag unter<br />
der Leitung von Paul Römer steuerte<br />
die Reisegruppe einen Programmpunkt<br />
zu der Feier bei, die<br />
dann mit einem türkischen Essen<br />
und türkischer Musik bis spät in die<br />
Nacht andauerte. Viele türkische<br />
Lehrkräfte haben dabei die deutschen<br />
TeilnehmerInnen angesprochen, um<br />
Kontakte zu deutschen Schulklassen<br />
aufnehmen zu können.<br />
Am nächsten Tag, dem internationalen<br />
Lehrertag, nahmen die rheinlandpfälzischen<br />
Besucher an der Veranstaltung<br />
von Egitim-Sen im Lehrerhaus<br />
in Izmir teil. Deutsche Teilnehmer<br />
verlasen Grußworte von Eva<br />
Maria Stange und Tilman Boehlkau.<br />
„Der Dialog und die Zusammenarbeit<br />
auf pädagogischer und gewerkschaftlicher<br />
Ebene soll fort gesetzt<br />
werden“, so die Vorsitzende Eva Maria<br />
Stange. Gemeinsames Ziel sei eine<br />
qualitativ hochstehende Bildung und<br />
Erziehung für alle Kinder und Jugendliche<br />
durch ein öffentliches<br />
Schulwesen. Mit großem Interesse<br />
habe sie zur Kenntnis genommen,<br />
dass die Türkei endlich bereit sei,<br />
Angebote im muttersprachlichen<br />
Unterricht zuzulassen. „Leider werden<br />
aber immer noch Egitim-Sen-<br />
Kolleginnen und -Kollegen verfolgt,<br />
die sich für diese pädagogische Selbstverständlichkeit<br />
einsetzen.“ Eva Maria<br />
Stange erwartet von der türkischen<br />
Regierung und den türkischen<br />
Behörden, dass sie Lehrerinnen und<br />
Lehrern, die sich für demokratische<br />
Reformen in ihrem Lande einsetzen,<br />
fördern und nicht drangsalieren und<br />
dass die Kolleginnen und Kollegen<br />
von Egitim-Sen auf allen Ebenen der<br />
Gewerkschaft frei und ohne Angst<br />
vor Repression arbeiten können.<br />
Beim Besuch einer Grundschule bei Fethiye<br />
16 <strong>GEW</strong>-Zeitung <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> 12 /2002
Auf der Pressekonferenz mit dem Fernsehen in Fethiye zusammen mit<br />
Egitim-Sen<br />
Ein Protestschwerpunkt der Gewerkschaft<br />
Egitim-Sen war die willkürliche<br />
Zwangsversetzung von<br />
Lehrkräften in der Türkei. Tilman<br />
Boehlkau dankte sowohl Mehmet<br />
Kilic als auch den Kolleginnen und<br />
Kollegen von Egitim-Sen für die Organisation<br />
der seit 10 Jahren erfolgreich<br />
verlaufenen Begegnungen in<br />
der Türkei und 1996 sowie 2001 in<br />
Deutschland. Das Zusammentreffen<br />
unterschiedlicher Kulturen und<br />
Sprachen im Unterricht und in Lehrerzimmern<br />
sei von besonderer Bedeutung<br />
für die Weiterentwicklung<br />
unserer Bildungseinrichtungen.<br />
„Aber noch bedeutsamer ist es, wenn<br />
wir voneinander lernen: Lernen, wie<br />
wir in unseren Heimatländern leben;<br />
lernen, wie wir aus unterschiedlichsten<br />
Rahmenbedingungen doch das<br />
Beste für unsere Schülerinnen und<br />
Reisegruppe in Ephesus<br />
<strong>GEW</strong>-Zeitung <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> 12 /2002<br />
Schüler machen; lernen aber auch,<br />
wenn sich Gewerkschaften für die<br />
Interessen der Lehrerinnen und Lehrer,<br />
auch der Schülerinnen und Schüler,<br />
einsetzen“, so Tilman Boehlkau<br />
in seinem Grußwort. „Der internationale<br />
Lehrertag könne dazu beitragen,<br />
die beiderseitigen Beziehungen<br />
auszubauen und die Freundschaft<br />
weiter zu vertiefen. Allzu häufig<br />
müssten wir immer wieder feststellen,<br />
dass unserem pädagogischen Engagement<br />
nicht die notwendige Aufmerksamkeit<br />
von Seiten der Politik<br />
und der Eltern geschenkt wird.<br />
Ohne eine starke gewerkschaftliche<br />
Unterstützung ließen sich aber viele<br />
Ziele nicht erreichen.“ Das Grußwort<br />
von Tilman schloss mit dem<br />
Wunsch, bald wieder eine Delegation<br />
aus der Türkei in <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong><br />
begrüßen zu können.<br />
Die Bildungsreise führte die TeilnehmerInnen<br />
zuerst nach Fethiye im<br />
Südwesten der Türkei. Sowohl Naturdenkmäler<br />
wie die Schlucht von<br />
Saklikent als auch die weißen Kalkfelsen<br />
von Pamukkale standen auf<br />
dem Programm. Besucht wurden<br />
aber auch die historischen Stätten<br />
Ephesus, Pergamon, Didyma, Hierapolis<br />
und Troja. Mehrere Tage weilte<br />
die Reisegruppe in Istanbul, um<br />
die Sehenswürdigkeiten der Stadt zu<br />
erleben. Eine abschließende Bootsfahrt<br />
auf dem Bosporus bis zum<br />
Schwarzen Meer krönte eine gelungene<br />
Bildungsreise. Auf der abendlichen<br />
Abschiedsfeier dankten die<br />
TeilnehmerInnen Mehmet für die<br />
zeitaufwändige Vorbereitung und<br />
die gelungene Organisation.<br />
Text und Fotos: Günter Schmitt<br />
Internationales<br />
Die weißen Kalkfelsen bei Pamukkale<br />
Beim Besuch eines Gymnasiums in Bursa<br />
17
Leserbrief<br />
„Wertungen anstelle abgesicherter Aussagen“<br />
Alter + Ruhestand<br />
Betr.: Leserbrief zu „Forschungsprojekt<br />
Schulen“ in der <strong>GEW</strong>-Zeitung<br />
11/2002<br />
In meinem Aufsatz in der <strong>GEW</strong>-Zeitung<br />
10/02 versuchte ich zu verdeutlichen,<br />
dass die Qualität von Schule in<br />
der Zukunft davon abhängig ist, ob es<br />
gelingt, den Betroffenen mehr Selbstverantwortung<br />
bei begrenzter Selbstständigkeit<br />
zu geben und der Einzelschule<br />
als System einen größeren Handlungsspielraum<br />
zu eröffnen. Die Kenntnis<br />
der Einstellungen zu verschiedenen<br />
Schulrealitätsbereichen könnte helfen,<br />
so meine Überzeugung, Verständnis<br />
und Hilfen bei der Neugestaltung eines<br />
Systems der Qualitätsentwicklung<br />
in den verschiedenen Ebenen des Schulsystems<br />
zu entwickeln.<br />
Diesen grundlegenden Ansatz hat Jörg<br />
Pfeiffer nicht verstanden. Statt dessen<br />
setzt er gegenüber abgesicherten detaillierten<br />
Fakten seine eigene Meinung mit<br />
teils spöttischen Aussagen wie „.. weiß<br />
ich über Schulqualität Bescheid,<br />
allerdings nicht im Sinne des Autors“<br />
oder: „ .. mich nicht überzeugen, dass<br />
sich die Untersuchung an der Schulrealität<br />
orientiert hätte“, oder: „mehr<br />
Altern und Gesundheit<br />
Zu einer gemeinsamen Tagung der<br />
<strong>GEW</strong> Bezirksseniorenausschüsse<br />
Rheinhessen-<strong>Pfalz</strong>, Koblenz und<br />
Trier hatte Landesseniorenvorsitzender<br />
Edmund Theiß nach Neuwied<br />
eingeladen.<br />
Annette Seim, Neuwied, hatte ein<br />
Programm erstellt, das nach der Abarbeitung<br />
gewerkschaftlicher Themen<br />
einen zweistündigen Stadtrundgang<br />
vorsah. Dabei erfuhren die 20<br />
TeilnehmerInnen Interessantes aus<br />
der Geschichte des Fürstenhauses zu<br />
Wied, bestaunten sehenswerte Bauwerke<br />
aus verschiedenen Stilepochen,<br />
bestiegen den Deich gegen das Hochwasser<br />
des Rheins und besuchten das<br />
Stadtviertel der „Herrenhuter Brüdergemeinde“<br />
mit seiner schlichten,<br />
aber eindrucksvollen Kirche.<br />
„Bodenhaftigkeit“ und „messianische<br />
Einschätzung des Gestaltungspotentials<br />
der Schulräte“, „Wunschdenken statt<br />
Realität“. Eine abgewogene argumentengestützte<br />
Gegenposition fehlt. Diese<br />
wäre zur Zeit umso nötiger, als Veränderungen<br />
in der Schule nach den Ergebnissen<br />
verschiedener Testserien wie<br />
TIMSS, MARKUS und PISA eher auf<br />
der Grundlage von Fakten anstelle von<br />
privaten Meinungen zu erwarten sind.<br />
Ziel des Forschungsprojektes war es,<br />
Einstellungen zu verschiedenen Aspekten<br />
des Autonomiegedankens zu erheben<br />
und in Zusammenhänge einzuordnen.<br />
Natürlich müssen die Ergebnisse<br />
auch bewertet werden. Dies geschieht<br />
in meiner Dissertation jeweils am Ende<br />
der Teilkapitel. Ein Beispiel: Kontrolle<br />
ist norma-lerweise bei allen Gruppen<br />
des Schulsystems - auch bei SchulrätInnen<br />
- mit negativen Emotionen besetzt.<br />
Da stimme ich dem Verfasser zu. Ich<br />
stelle aber auch fest: „Wir schließen<br />
daraus, dass bei 48 % der LehrerInnen<br />
die Einsicht in die Notwendigkeit<br />
vorhanden ist, Eingriffe von Seiten der<br />
Schulaufsicht in den Unterricht zu ermöglichen,<br />
wenn der Lehrer durch<br />
Auch die Kreisvorsitzende Waltraud<br />
Heckmann ließ es sich nicht nehmen,<br />
die SeniorenvertreterInnen zu<br />
begrüßen, den gesamten Vormittag<br />
an der Tagung teilzunehmen und die<br />
Gäste zum Abschluß noch zu Kaffee<br />
und Kuchen einzuladen.<br />
Im gewerkschaftlichen Teil der Tagung<br />
informierte Edmund Theiß die<br />
Teilnehmer über<br />
• Abtretung der Abschlagszahlung<br />
bei stationärem Aufenthalt an das<br />
Krankenhaus<br />
• Gewährung von Beihilfen für<br />
Wahlleistungen gegen Zahlung eines<br />
monatlichen Beitrags<br />
• Gesundheit im Alter (Bericht über<br />
ein Seminar in Göttingen)<br />
• Neues Tarifsystem der „Deutschen<br />
Bahn AG“ ab 15.12.2002<br />
Nachlässigkeit und Exzentrizität beginnt,<br />
die Schüler zu schädigen.“ (Dissertation,<br />
S. 230)<br />
Es wäre deshalb besser, den Begriff der<br />
„Kontrolle“ in unserem Zusammenhang<br />
durch den der internen und externen<br />
Evaluation zu ersetzen. Damit<br />
wäre ihm der Charakter einer Eingriffsverwaltung<br />
genommen. Dass der für<br />
das Bildungssystem verantwortliche<br />
Staat auf die Gestaltung des Schulwesens<br />
durch Vorgaben und Prüfung der<br />
Einhaltung derselben nicht verzichten<br />
kann, erscheint einsichtig. Die angemahnte<br />
fehlende „Bodenhaftung“ im<br />
Bezugsartikel wird gerade dadurch hergestellt,<br />
dass sehr detailliert die originale<br />
Meinung der betroffenen LehrerInnen,<br />
SchulleiterInnen und SchulrätInnen<br />
erhoben wurde.<br />
Ich bin der Auffassung, dass die Landesregierung<br />
ihre Einsparpolitik in der<br />
Schulverwaltung und in der Schule<br />
endlich beenden muss, dass der Anteil<br />
der Bildungsausgaben am Bruttosozialprodukt<br />
erhöht und über eine Strukturreform<br />
nachgedacht werden sollte.<br />
Doch dies war nicht Thema meiner<br />
Arbeit. (...)<br />
Kurt Biehler, Bellheim<br />
Da alle Kreisverbände in Rheinhessen/<strong>Pfalz</strong>,<br />
die einen Seniorenvertreter<br />
gemeldet haben, in den letzten<br />
10 Jahren schon eine Tagung ausgerichtet<br />
haben (ein- oder dreitägig),<br />
erklärten sich Liselotte Ludwig und<br />
Walter Edinger aus dem Donnersbergkreis<br />
bereit, erneut die Organisation<br />
für die dreitägige Zusammenkunft<br />
2003 zu übernehmen. Diese<br />
Tagung wird im Bereich des Kreisverbands<br />
Alzey-Worms stattfinden.<br />
Es sollte jedoch möglich sein, dass<br />
in <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> alle Kreisverbände<br />
einen Seniorenvertreter benennen.<br />
Vielleicht klappt’s ja noch.<br />
Ich wünsche allen SeniorInnen in<br />
unserem Landesverband ein friedvolles<br />
Weihnachtsfest und ein glückliches,<br />
vor allem gesundes neues Jahr<br />
2003.<br />
Edmund Theiß<br />
18 <strong>GEW</strong>-Zeitung <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> 12 /2002
Die <strong>GEW</strong> gratuliert<br />
im Januar 2003<br />
zum 70. Geburtstag<br />
Herrn Ottmar Ernst Koch<br />
08.01.1933<br />
Spelzenhofstr. 31 · 67678 Mehlingen<br />
Frau Rea Keidel<br />
12.01.1933<br />
Staffelstr. 12 · 67292 Kirchheimbolanden<br />
Herrn Otto Steeg<br />
19.01.1933<br />
Bergstr. 6 · 56357 Oelsberg<br />
zum 75. Geburtstag<br />
Herrn Aribert Schäfer<br />
04.01.1928<br />
Driescheider Weg 31 · 57610 Altenkirchen<br />
Herrn Günter Brandt<br />
08.01.1928<br />
Neuer Weg 11 · 57642 Alpenrod<br />
Herrn Herbert Reiss<br />
10.01.1928<br />
Deidesheimer Str. 23 · 67067 Ludwigshafen<br />
Herrn Richard Schuch<br />
15.01.1928<br />
Sponheimer Weg 2 · 55765 Birkenfeld<br />
Herrn Heinz R. Anhäusser<br />
21.01.1928<br />
Goethestr. 15 · 67435 Neustadt<br />
Herrn Manfred Keiling<br />
21.01.1928<br />
In der Sommerbach 7 · 56368 Klingelbach<br />
Herrn Werner Kast<br />
25.01.1928<br />
Friesenstr. 10 · 67063 Ludwigshafen<br />
Frau Annelies Reichenauer<br />
31.01.1928<br />
Pestalozzistr. 28 · 56567 Neuwied<br />
zum 80. Geburtstag<br />
Herrn Helmut <strong>Pfalz</strong><br />
01.01.1923<br />
Holbeinstr. 48 · 55543 Bad Kreuznach<br />
Frau Ruth Schoner<br />
06.01.1923<br />
Rich.-Wagner-Str. 7 · 67655 Kaiserslautern<br />
Herrn Alfred Schank<br />
15.01.1923<br />
Donnersbergstr. 3 · 67294 Morschheim<br />
zum 85. Geburtstag<br />
Herrn Theodor Schütz<br />
18.01.1918<br />
An der Russhütte 13 · 67468 Frankenstein<br />
<strong>GEW</strong>-Zeitung <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> 12 /2002<br />
zum 91. Geburtstag<br />
Frau Meta Keller<br />
13.01.1912<br />
Merzheimer Hauptstr. 28 · 76829 Landau<br />
Frau Justine Kröhle<br />
17.01.1912<br />
Muskatellerweg 9 · 55291 Saulheim<br />
im Februar 2003<br />
zum 70. Geburtstag<br />
Herrn Tony Heymann<br />
19.02.1933<br />
Hauptstr. 20 · 56370 Eisighofen<br />
Herrn Daniel Chatziiliadis<br />
23.02.1933<br />
Kurze Str. 1 · 67063 Ludwigshafen<br />
zum 75. Geburtstag<br />
Herrn Karl Andre<br />
11.02.1928<br />
Kirchstr. 14 · 76833 Knöringen<br />
Herrn Karl Storck<br />
13.02.1928<br />
Hauptstr. 28 · 76833 Walsheim<br />
Frau Gertrud Schläfer<br />
23.02.1928<br />
Joh.-Schwebel-Str. 28 · 66482 Zweibrücken<br />
Herrn Paul Schrupp<br />
29.02.1928<br />
Kneippstr. 1 · 65549 Limburg<br />
zum 80. Geburtstag<br />
Herrn Helmut Guthmann<br />
11.02.1923<br />
Spelzengasse 14 · 65474 Bischofsheim<br />
Herrn Heinz Halbe<br />
19.02.1923<br />
Ulandstr. 5 · 67677 Enkenbach-Alsenborn<br />
zum 87. Geburtstag<br />
Frau Elisabeth Herres<br />
12.02.1916<br />
Breitestr. 68 · 56626 Andernach<br />
zum 90. Geburtstag<br />
Frau Anna Dickes<br />
06.02.1913<br />
Pfarrgasse 35 · 55234 Flomborn<br />
Alter + Ruhestand<br />
Der Landesvorstand<br />
19
<strong>GEW</strong>-intern<br />
<strong>GEW</strong> Trier vergibt Preis für<br />
kreativen Unterricht<br />
Am Rednerpult:<br />
Dr. Peter Mertes,<br />
ADD Trier<br />
(oben), Sylvia<br />
Sund für den<br />
<strong>GEW</strong>-Landesverband<br />
(Mitte)<br />
sowie Peter Heisig,<br />
<strong>GEW</strong>-Trier<br />
(unten).<br />
Alle Fotos: Bernhard<br />
Clessienne<br />
Schon im Frühsommer hatte die<br />
<strong>GEW</strong> Trier bei den LehrerInnen aller<br />
Schularten Preise für Kreativen<br />
Unterricht ausgeschrieben. Denn in<br />
Zeiten tiefgreifender Umbrüche<br />
und weitreichender gesellschaftlicher<br />
Veränderungen kann eine Gewerkschaft<br />
nicht nur einseitig vordrängende<br />
Interessen ihrer Mitglieder<br />
durchsetzen wollen, vielmehr<br />
gilt es im Zusammenhang aller an<br />
der Schule beteiligten Kräfte gute<br />
Arbeitsbedingungen sowohl für<br />
SchülerInnen als auch für die dort<br />
tätigen LehrerInnen zu finden.<br />
Ziel des Preisausschreibens war es,<br />
sowohl die Lernbedingungen zu verbessern<br />
und durch kreative Arbeitsansätze<br />
die Arbeitszufriedenheit der<br />
beteiligten Lehrer und Lehrerinnen<br />
deutlich zu erhöhen.<br />
Nach der Veröffentlichung der Bildungsstudie<br />
PISA bläst den deutschen<br />
Schulen, LehrerInnen und<br />
auch SchülerInnen der Wind in Gesicht,<br />
aber es gilt nicht zu resignieren,<br />
sondern positive Beispiele vorzustellen<br />
und vermehrt zu verwirklichen.<br />
Dies ist der <strong>GEW</strong> im Bezirk<br />
Trier nachhaltig gelungen. Sie hat<br />
aus den unterschiedlichsten Schulformen<br />
sechs preiswürdige Projekte<br />
gefunden, die den Schülerinnen und<br />
Verdienstorden des Landes<br />
<strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> für<br />
Erika Schmitt-Neßler<br />
Schülern, aber auch den Eltern und<br />
Lehrern Spaß an Schule machen.<br />
Die Preisverleihung im großen Saal<br />
des Kurfürstlichen Palais der ADD<br />
hat dies eindrucksvoll bewiesen. Zu<br />
den Klängen der Schülerband SMO<br />
aus Saarburg konnten die Projekte<br />
der Grundschule Altrich, der<br />
Grundschule Hillesheim, der Astrid-<br />
Lindgren-Schule Prüm, der<br />
Deutschherren-Schule Trier, der<br />
Alois-Thomas-Schule Klotten und<br />
der Grundschule Osann-Monzel<br />
ausgezeichnet werden. Auch der<br />
ADD-Präsident Dr. Mertes war mit<br />
dem Ergebnis zufrieden. Er bedankte<br />
sich ausdrücklich für Ideenreichtum<br />
und Kreativität im Unterricht<br />
und animierte leidenschaftlich zum<br />
Ausprobieren neuer Lehr- und Lernformen.<br />
Die Dokumentation mit den Projekten<br />
aller Preisträger, aus der Teile in<br />
der nächsten <strong>GEW</strong>-Zeitung veröffentlicht<br />
werden, kann angefordert<br />
werden bei:<br />
LET der <strong>GEW</strong>, Roonstr.4, 54292<br />
Trier, Tel. 0651 / 2 38 33, Fax 0651<br />
/ 140 247, e-mail. LET@gewtrier.de<br />
Die Dokumentation wird auch ins<br />
Netz gestellt unter:<br />
www.gew-trier.de<br />
Peter Heisig<br />
Für ihre vielfältigen Verdienste in der Gewerkschafts- und Personalratsarbeit wurde<br />
die stellvertretende <strong>GEW</strong>-Landesvorsitzende Erika Schmitt-Neßler am 20. November<br />
von Ministerpräsident Kurt Beck mit dem Verdienstorden des Landes <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong><br />
ausgezeichnet.<br />
20 <strong>GEW</strong>-Zeitung <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> 12 /2002
Kalle im Wingert<br />
Kalle, ein vielleicht<br />
zehnjähriger Junge,<br />
zieht von Berlin in ein<br />
rheinhessisches Winzerdorf.<br />
Er ist ein typischesGroßstadtgewächs<br />
und hat deshalb<br />
keine Ahnung vom Leben<br />
auf dem Lande,<br />
vom Wechsel der Jahreszeiten<br />
und natürlich<br />
auch nicht vom Winzern.<br />
Da er aber die<br />
gleichaltrige Mia in der<br />
Schule kennen lernt<br />
sowie auch ihren Opa<br />
Erwin, der Winzer ist,<br />
ändert sich dies sehr<br />
rasch.<br />
Diese Geschichte aus dem schön<br />
gestalteten Band „Kalle im Wingert“<br />
von Antje Fries und Maike Müller<br />
(Leinpfad-Verlag) beginnt im Januar<br />
und endet im Januar des darauf<br />
folgenden Jahres. Kalle lernt so alle<br />
Arbeiten kennen, die ein Winzer im<br />
Laufe des Jahres im Weinberg und<br />
<strong>GEW</strong>-Zeitung <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> 12 /2002<br />
im Keller zu leisten hat. Aber nicht<br />
nur, wie die Arbeit heute getan wird,<br />
erfahren Kalle und die LeserInnen.<br />
Opas Fotosammlung zeigt auch, wie<br />
sich die Arbeit in den letzten 50 Jahren<br />
verändert hat. Die Gegenüberstellung<br />
- Gegenwart als Zeichnung,<br />
Vergangenheit im vergilbten Foto -<br />
machen das Buch fast zu einem „Bilderbuch“,<br />
bei dem man den Text<br />
unbedingt lesen will, um noch mehr<br />
über den abgebildeten Vorgang zu<br />
erfahren. In Zeiten von PISA und<br />
nachgewiesener Leseschwäche und<br />
Leseunlust ein nicht zu unterschätzendes<br />
Qualitätsmerkmal.<br />
Die schweren Arbeitsbedingungen<br />
der Winzer in der Vergangenheit vermittelt<br />
der Opa so ganz nebenbei,<br />
wenn er die Fotos erklärt. Auch der<br />
ökologische Weinbau wird ganz unaufdringlich<br />
angesprochen. Die<br />
mundartlichen Begriffe aus der Arbeit<br />
der Winzer werden durch lustige<br />
Missverständnisse einprägsam vermittelt.<br />
All das geschieht ganz selbstverständlich<br />
in der Geschichte, in der<br />
Mia versucht, das Großstadtgewächs<br />
Kalle zu einem echten Rheinhessen<br />
zu machen.<br />
Pädagogisches Material zu Frankreich<br />
Seit dem 7. Oktober 2002 bietet der<br />
Sender ARTE einen online-Service<br />
auf Abonnement an: http://<br />
www.arte-scope.com. In ARTE Scope<br />
sind zu finden: Informationsquellen<br />
über Frankreich (Filmskripte von<br />
auf ARTE ausgestrahlten Reporta-<br />
Personalentwicklung in Schulen<br />
Konzepte, Praxisbausteine und Methoden<br />
bietet das neue Buch „Personalentwicklung<br />
in Schulen“ aus dem<br />
Beltz-Verlag, und damit passt es<br />
bestens zu den aktuellen Bedürfnissen<br />
von Schulleitungen und Kollegien.<br />
Wieso eigentlich Personalentwicklung?<br />
Brauchen wir sowas auch?<br />
Damit befasst sich der Theorie-Teil<br />
des Buchs, bevor es um konkrete<br />
Ansätze zur Personalförderung geht,<br />
zum Teil mit kopierbaren Arbeitsblättern<br />
bzw. Fragebögen für die Arbeit<br />
mit Einzelnen oder ganzen Kollegien.<br />
Ein dritter Teil skizziert Voraussetzungen<br />
für lohnenswerte Per-<br />
gen, journalistische Artikel, ein Glossar<br />
von Fachausdrücken aus dem<br />
audiovisuellen Bereich, pädagogisches<br />
Material (Auswertung der im<br />
Fernsehen gesendeten Beiträge, Analyse<br />
von gesellschaftsbezogenen Themen,<br />
Sprachübungen und Einfü-<br />
sonalentwicklung und zeigt auch<br />
ihre Grenzen auf. Ziel der Autoren<br />
C.G. Buhren und H.G Rolff ist es,<br />
die LeserInnen zu inspirieren, mit<br />
dem einen oder anderen Vorhaben<br />
an ihrer Schule zu beginnen, ob es<br />
nun ein Jahresgespräch oder eine<br />
„Lernpartnerschaft“ sei. Dazu mei-<br />
Tipps + Termine<br />
Beim Betrachten und Lesen des Buches<br />
schloss auch die Schreiberin dieser<br />
Zeilen einige Wissenslücken und<br />
außerdem fühlte sie sich durch<br />
„Opas Fotos“ auf angenehme Weise<br />
an ihre eigene Kinderzeit erinnert.<br />
Den Autorinnen ist es gelungen, ein<br />
hoch informatives und trotzdem sehr<br />
unterhaltsames Sachbuch für Kinder<br />
zu gestalten, das hilft, Vorgänge in<br />
unserer nächsten Umgebung zu verstehen.<br />
Und da nicht nur Berliner<br />
Kinder keine Ahnung vom Wein<br />
machen, vom Leben auf dem Land<br />
und von den Jahreszeiten haben, sollte<br />
das Buch künftig in keiner rheinland-pfälzischenGroßstadtgrundschule<br />
fehlen. Ein Klassensatz sollte<br />
zur Pflichtausstattung jeder SchülerInnenbücherei<br />
gehören.<br />
U.K<br />
Antje Fries /Maike Müller und Illustrationen<br />
von Carolin Klein: Kalle<br />
im Wingert. Von Ausbrechern, einem<br />
Lesekönig und verschwundenen Rebläusen,<br />
Leinpfad-Verlag, Leinpfad 5,<br />
55218 Ingelheim 2002, 11,50 Euro<br />
gung des Erlernten in einen Kontext).<br />
Der Inhalt ist in folgende Rubriken<br />
unterteilt: „Internet dans votre<br />
métier“, „L’audiovisuel en classe“<br />
und „Langue & Civilisation Française“.<br />
ARTE Scope erscheint 14-tägig und<br />
hat somit immer einen aktuellen<br />
Bezug.<br />
pm<br />
nen sie aufmunternd mit Hartmut<br />
von Hentig: „Die Schritte können<br />
klein sein, wenn das Konzept nur<br />
groß ist“. (tje)<br />
C.G. Buhren/H.G.Rolff: Personalentwicklung<br />
in Schulen. Beltz: Weinheim<br />
2002.<br />
Hinweis zur Beitragsquittung für das Jahr 2002<br />
Die Beitragsquittung für das Jahr 2002 erhalten alle Mitglieder mit der<br />
Februarausgabe 2003 der <strong>GEW</strong>-Bundeszeitung Erziehung und Wissenschaft.<br />
Sie befindet sich dort auf der zusammengeklebten Rückseite (Datenschutz).<br />
Ihre <strong>GEW</strong>-Mitgliederverwaltung<br />
21
Tipps + Termine<br />
Ein Buch verändert die Schule<br />
Zu Beginn des Schuljahres 2002/<br />
2003 schenkte die Stiftung CIVIL-<br />
COURAGE jeder der 16.200 allgemeinbildenden<br />
und berufsbildenden<br />
Schulen das neue ARENA-Taschenbuch<br />
„Zivilcourage JETZT“!<br />
Damit das neue Buch sein Ziel erreichen<br />
möge, wird es von einer Beilage<br />
begleitet, in der unter dem<br />
Stichwort „Liebe und Struktur“ die<br />
beiden Pole angesprochen werden,<br />
zwischen denen sich Erziehung heute<br />
abspielen muss:<br />
• Jeder Mensch braucht die Sicherheit,<br />
geliebt zu werden und braucht<br />
• ebenso dringend Riten, Grenzen,<br />
Selbst- und Sozialverantwortung.<br />
Um dies praktisch umzusetzen, haben<br />
sich die drei Herausgeber des<br />
Buches - Anne und Reiner Engelmann<br />
und Otto Herz - etwas Besonderes<br />
einfallen lassen:<br />
Sie geben den Lehrerinnen und Lehrern<br />
nicht nur ein druckwarmes<br />
Lese-Exemplar in die Hand, sondern<br />
dazu gleich drei konkrete Kopiervorlagen<br />
zu den drei wohl wichtigsten<br />
Beiträgen aus dem Buch, damit Sie<br />
als Lehrerinnen und Lehrer gleich<br />
starten können.<br />
Und: sie stellen ihnen eine kleine<br />
Handbibliothek verwandter Bücher<br />
aus verschiedenen Verlagen zusammen,<br />
die in jeweils einem Exemplar<br />
in jeder Klassenbücherei stehen sollten.<br />
Das Buch ist nicht – wie sonst üblich<br />
– eine Sammlung gut gemeinter<br />
Beiträge, sondern etwas ganz Erstaunliches:<br />
Teil eines Konzepts, die<br />
Schule für die Diskussion über Meinungsfreiheit,<br />
Menschenrechte, Demokratie<br />
und Gerechtigkeit zu gewinnen.<br />
- „Erfurt“ und PISA sind<br />
Pole, zwischen denen Veränderung<br />
stattfinden muss.<br />
Dabei kann dieses Buch ganz konkret<br />
helfen:<br />
• In dem Beitrag von Hartmut Hein<br />
wird die Geschichte der Zivilcourage<br />
von der Steinzeit bis zur Gegenwart<br />
geschildert – mit fiktiven, aber<br />
durchaus möglichen Ereignissen und<br />
ganz konkreten historischen Figuren<br />
wir der erstaunlichen Kämpferin<br />
Olympe de Gouges in der Französischen<br />
Revolution. Schon der Ansatz<br />
reizt dazu, daraus ein Klassenprojekt<br />
zu machen. Die Erde bewirbt sich<br />
Plädoyer für eine neue Familienkultur<br />
Susanne Mayer ist Redakteurin der<br />
ZEIT und mehrfach ausgezeichnete<br />
Journalistin (u.a. EMMA-Journalistinnenpreis).<br />
Mit ihrem gerade<br />
erschienenen Buch „Deutschland<br />
armes Kinderland“ hält sie ein engagiertes<br />
Plädoyer für einen radikalen<br />
Umbruch in der Gesellschaft,<br />
um den gesellschaftlichen Kollaps zu<br />
verhindern. Sie verlangt eine ganz<br />
neue Familienkultur: massive Privilegien<br />
für Familien, volle Bürger-<br />
rechte für Kinder, den radikalen<br />
Umbau des Sozialsystems oder bezahlte<br />
Elternzeit.<br />
In Deutschland leben über 50 Prozent<br />
der Menschen in Single-Haushalten<br />
und müssen ihr Einkommen<br />
nicht teilen, wer aber ein oder gar<br />
mehrere Kinder groß zieht, gelangt<br />
ganz schnell an finanzielle Grenzen.<br />
Zwar predige die Politik über die<br />
Bereicherung durch Kinder, in der<br />
Realität lasse sich dies in Deutsch-<br />
Rechtsschutz:<br />
Bei Morddrohung fristlose Kündigung<br />
Wer Vorgesetzten im Streit mit Mord<br />
droht, darf fristlos entlassen werden.<br />
Dem Arbeitgeber ist die Weiterbeschäftigung<br />
solcher Mitarbeiter bis<br />
zum Ablauf der Kündigungsfrist<br />
nicht zuzumuten.<br />
Landesarbeitsgericht <strong>Rheinland</strong>-<br />
<strong>Pfalz</strong>, Urteil vom 27. März 2002 -<br />
10 Sa 1111/01<br />
um einen Sitz im Rat der UPO (Vereinte<br />
Planeten) und muss nun ihre<br />
Eignung nachweisen.<br />
• Bewegend der Beitrag des Journalisten-Ehepaares<br />
Schröder über das<br />
Holocaust-Mahnmal der Kinder der<br />
Middle-School in der 1.600-Seelen-<br />
Gemeinde Whitwell in Tennessee:<br />
Dort steht auf dem grünen Rasen ein<br />
Original-Reichsbahn-Waggon (mit<br />
dem früher Juden wie Vieh in die<br />
Vernichtungslager transportiert wurden),<br />
gefüllt mit 11 Millionen Büroklammern,<br />
die die Kinder der<br />
Schule in der ganzen Welt für dieses<br />
Mahnmal gesammelt haben.<br />
In zahlreichen weiteren Bausteinen<br />
wird für Zivilcourage geworben - bis<br />
hin zu dem Bericht über die Auszeichnung<br />
der Schülerinnen und<br />
Schüler der Gesamtschule Essen-<br />
Holsterhausen für erwiesene Zivilcourage<br />
in deren Alltag: zum Nachund<br />
Bessermachen.<br />
pm<br />
„Zivilcourage JETZT!“, Rainer und<br />
Anne Engelmann / Otto Herz<br />
(Hrsg), Arena-Taschenbuch, Band<br />
2081, ISBN 3-401-02081-1, Würzburg<br />
2002, Originalausgabe, 144 S,<br />
6,50 Euro<br />
land aber nicht erleben. Vor allem<br />
junge, gebildete Frauen entschieden<br />
sich daher immer seltener für das<br />
„Risiko Kind“.<br />
Susanne Mayer kritisiert die finanzielle<br />
Benachteiligung der Familie:<br />
Ausbildungskosten sind nicht steuerlich<br />
absetzbar, Arbeitszimmer<br />
schon. Die Subventionen für zwei<br />
monatliche Theaterkarten sind höher<br />
als das Kindergeld. Doch Mayers<br />
Buch klagt nicht nur an, es zeigt<br />
auch Auswege auf, das nennt sich<br />
hier „Brutstätten schaffen, Kraftwerke<br />
gründen, Netze spinnen“. Und<br />
ganz zum Schluss hat die Autorin<br />
auch noch „Zehn dumme Sprüche<br />
zum Thema Familie und was man<br />
entgegnet“ zu bieten: Blödsinn wie<br />
„Kinder sind Privatsache“ oder<br />
„Glück ist Lohn genug“ wird schön<br />
frech pariert und gleichzeitig sachlich<br />
widerlegt. (tje)<br />
Susanne Mayer: Deutschland armes<br />
Kinderland. Eichborn: Frankfurt<br />
2002. 17,90 Euro.<br />
22 <strong>GEW</strong>-Zeitung <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> 12 /2002
Kreis Neuwied<br />
Ein Stück Heimat<br />
Der <strong>GEW</strong>-Kreis Neuwied traf sich zu einer Mitgliederversammlung aus<br />
besonderem Anlass: Langjährige Mitglieder sollten geehrt werden. Nach<br />
einer kurzen Begrüßung durch die Kreisvorsitzende Waltraud Heckmann,<br />
gab der Bezirksvorsitzende Achim Wagner einen kurzen Überblick über<br />
die bildungspolitischen Entwicklungen im Land, insbesondere über die<br />
neue Ausbildungsverordnung für Lehrerinnen und Lehrer. Danach wurden<br />
Mitglieder für langjährige aktive Mitarbeit in der Gewerkschaft geehrt:<br />
Über 50 Jahre in der <strong>GEW</strong> sind die Kollegen Johannes Drewig und<br />
Karl-Heinz Frankhäuser, beide waren auch schon Kreisvorsitzende, Kollege<br />
Frankhäuser arbeitet noch immer im Arbeitskreis für Jugendschriften<br />
der <strong>GEW</strong> mit. Übrigens sucht er eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger<br />
für diese Arbeit. 50 Jahre Mitglied ist Kollege Rolf Meissner, er<br />
arbeitete lange Jahre als Schriftführer im Kreisverband. Für 45 Jahre Mitgliedschaft<br />
wurde Kollege Alfred Kurz geehrt. Die Ehrung nahm Achim<br />
Wagner vor. Er überreichte Ehrenurkunden und jedem das <strong>GEW</strong>-Erinnerungsbuch<br />
„…wie es damals war“.<br />
Beim gemütlichen Teil der Veranstaltung erzählten alle KollegInnen aus<br />
ihrer Junglehrerzeit. Zwei Kollegen traten ihren Dienst kurz nach dem<br />
Krieg an. Weil der Dienstort in der französischen Besatzungszone lag,<br />
mussten sie ihre schon bestandene 1. Lehrerprüfung noch einmal bei den<br />
Franzosen in Andernach wiederholen. Alle meinten, die <strong>GEW</strong> sei ein<br />
Stück Heimat für sie, selbst wenn sie sich schon einmal über sie geärgert<br />
hätten. Kollege Kurz erinnerte an sie stürmischen siebziger Jahre im Kreisverband<br />
Neuwied. Annette Seim<br />
Kreis Zweibrücken<br />
„Heißer Herbst“ in Zweibrücken<br />
Mit mehreren Veranstaltungen bot der Kreisverband Zweibrücken seinen<br />
Mitgliedern einen „heißen Herbst“. Den Auftakt dazu bildete eine<br />
Schulung von Personalräten aus dem Kreis im „Auerbacher Hof“ in Zweibrücken.<br />
Weiterhin fand in der Zweibrücker Canada-Schule eine umfassende<br />
Information zum Thema „Altersvorsorge und Riester-Rente“ statt.<br />
Peter Blase-Geiger vom Regionalbüro Süd in Kaiserslautern referierte und<br />
diskutierte in der Niederauerbacher Hilgardschule über Kindertagesstätten.<br />
Kollege Klaus Bundrück informierte die zahlreich erschienenen PersonalvertreterInnen<br />
aus dem Kreis über deren Mitbestimmung bei der Erstellung<br />
der Gliederungspläne. Aufgrund von Rückfragen äußerte er sich<br />
dabei auch zur Praxis der schulscharfen Stellenausschreibung. Hinsichtlich<br />
des Gliederungsplans betonte Bundrück, dass dessen Erörterung<br />
Gremienrecht sei, mithin der gesamte örtliche Personalrat und nicht nur<br />
dessen Vorsitzende/r in die Erörterung eingebunden werden müsse. Ferner<br />
müsse der ÖPR durch die Schulleitungen in Sachen Gliederungsplan<br />
umfassend, kontinuierlich und rechtzeitig informiert werden, damit<br />
das Gremium noch Einfluss auf die Gestaltung nehmen könne. Claus<br />
Schehl, beim Bildungsministerium für die Entwicklung elektronischer<br />
Schulstatistik zuständig, referierte über die elektronische Bearbeitung der<br />
Schul-Statistiken. Am Nachmittag informierte Kollegin Hildegard Knauf<br />
über das Procedere bei den Vierteljahresgesprächen zwischen Schulleitung<br />
und örtlichem PR.<br />
<strong>GEW</strong>-Zeitung <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> 12 /2002<br />
Kreis Worms-Alzey-Frankenthal<br />
Gefragte Altersteilzeit<br />
Kreis + Region<br />
„Die Riester-Rente ist kompliziert, muss das aber auch sein, da im entsprechenden<br />
Gesetz die unterschiedlichsten Berufswege und Familiensituationen<br />
aufgefangen werden müssen“, verteidigte Kollege Peter Haun<br />
das Konzept zur Altersvorsorge des ehemaligen Arbeitsministers. Kollege<br />
Klaus Bundrück wartete mit einigen Neuerungen zum Beamtenversorgungsrecht<br />
auf. Für den Versicherer Debeka erläuterte Michael Brunck<br />
das Angebot „Das Renten-Plus“, das bei hoher Rentabilität DGB-Mitgliedern<br />
kostengünstig eine Möglichkeit zusätzlicher Altersvorsorge bieten<br />
soll.<br />
„Das Kindertagesstätten-Gesetz vorwärts und rückwärts“, wie Peter Blase-Geiger<br />
es beschreibt, war Gegenstand einer ganztägigen Fortbildungsveranstaltung<br />
des Gewerkschaftssekretärs in der Zweibrücker Hilgardschule.<br />
Ein Grundlagenseminar für ErzieherInnen, das gut angenommen<br />
wurde. Anhand praxisbezogener Beispiele wurden für die Arbeit in Kitas<br />
wesentliche Passagen des Gesetzes, etwa die Zusammenarbeit mit dem<br />
Elternausschuss, erläutert. Besonders lobte Peter Blase-Geiger die angenehme<br />
Atmosphäre der Veranstaltung, nicht zuletzt das Verdienst von<br />
Schulleitung und Hausmeister der Hilgardschule, die ihre Gäste bestens<br />
versorgten. ar<br />
Ein Dauerbrenner in den Gesprächen in vielen Lehrerzimmern ist das<br />
Thema „Altersteilzeit“.<br />
Annähernd einhundertfünfzig Kolleginnen und Kollegen in Alzey,<br />
Frankenthal und Worms wollten mehr darüber wissen und nahmen an<br />
den jeweiligen Informationsveranstaltungen des Kreisverbands Worms-<br />
Alzey-Frankenthal zu dieser Thematik teil. Kreisvorsitzender Jörg Pfeiffer<br />
gab interessierten KollegInnen während dieser Veranstaltung vielfältige<br />
Informationen und Hilfen zur Sache. Dabei setzte er stets gekonnt<br />
trockene Zahlen und Gesetzestexte mittels moderner Technik in leicht<br />
verständliche Computer-Animationen um. Die sehr zufriedenen TeilnehmerInnen<br />
konnten auch selbst eine Berechnung ihrer individuellen Eckdaten<br />
durchführen und weiteres Informationsmaterial mit nach Hause<br />
nehmen.<br />
aw<br />
Studienreisen / Klassenfahrten<br />
8-Tage-Busreise z.B. nach<br />
WIEN ÜF 192,-- €<br />
BUDAPEST ÜF 192,-- €<br />
LONDON ÜF 254,-- €<br />
PRAG ÜF 199,-- €<br />
PARIS ÜF 224,-- €<br />
ROM ÜF 238,-- €<br />
10-Tage-Busreise z.B. nach<br />
SÜDENGLAND Ü 213,-- €<br />
TOSKANA Ü 202,-- €<br />
SÜDFRANKREICH Ü 230,-- €<br />
(Unterbringung in<br />
Selbstversorgerunterkünften)<br />
Alle Ausflugsfahrten inklusive.<br />
Flug- und Bahnanreise sowie andere Ziele (z.B. Ferienparks<br />
in den Niederlanden oder Belgien) auf Anfrage möglich!<br />
REISEBÜRO KRAUSE GMBH · MÜNSTERSTR. 55a · 44534 LÜNEN<br />
TEL: (0 23 06) 7 57 55-0 · FAX: (0 23 06) 7 57 55-49 · E-mail: info@rsb-krause.de<br />
23
<strong>GEW</strong>-Zeitung <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong><br />
Beilage zur E&W<br />
Weihnachtsgeist<br />
Weihnachtsmärchen 2002<br />
Es war einmal ein König, Kurt II., der<br />
regierte sein Reich mit sicherer Hand.<br />
Was er befahl, das wurde umgesetzt,<br />
und so machte er vor seinen Kollegen<br />
am Königs-Stammtisch stets einen guten<br />
Eindruck.<br />
Wie er allein mit der Ausbildung neuer<br />
Untertanen umging, bewundernswert!<br />
Fast hundert Prozent Unterrichtsabdeckung,<br />
das sollte ihm erstmal ein<br />
Kollege nachmachen. Aber dafür hatte<br />
er sich ja auch eine Unterrichtsministerin<br />
verdingt, die Tag und Nacht arbeitete,<br />
um ihr Soll zu erfüllen. Was<br />
König Kurt nicht wusste, war, dass die<br />
Ärmste nahezu täglich beim obersten<br />
Kämmerer vorsprach, um ihren Etat erhöht<br />
zu bekommen, denn die Lehrer<br />
des Landes waren nicht gewillt, nur für<br />
die Ehre ihr Wissen weiterzugeben. Der<br />
Kämmerer ließ sie jedoch zappeln, denn<br />
er wusste, sie würde ihm jederzeit zu<br />
Gefallen sein: Jung an Jahren, könnte<br />
sie es sich niemals leisten, in Ungnade<br />
zu fallen, sonst bliebe ihr nur noch<br />
der Ausweg, ins Reich der Müßiggänger<br />
zu ziehen, regiert<br />
von König Florian.<br />
Nach ihrem letzten<br />
Kniefall gab der<br />
Kämmerer ein<br />
kleines bisschen<br />
nach: Er wusste ja, König Kurt<br />
war stolz darauf, dass die<br />
jungen Untertanen nun<br />
vielerorts den ganzen<br />
Tag über in<br />
den Genuss<br />
der staatlichenBildung<br />
kamen,<br />
da durfte er sich nicht lumpen<br />
lassen. Also bewilligte<br />
er der Unterrichtsministerin<br />
einen<br />
Sack<br />
reinen<br />
Goldes,<br />
und sie machte sich<br />
mit ihren Vasallen sogleich daran,<br />
es auszugeben: Nahezu zweihun-<br />
<strong>GEW</strong> <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong><br />
Neubrunnenstraße 8 · 55116 Mainz<br />
Telefon: 06131-28988-0 • FAX 06131-28988- 80<br />
E-mail: <strong>GEW</strong>@<strong>GEW</strong>-RLP.de<br />
dert Untertanen konnte sie gewinnen,<br />
die bereit waren, die Jugend des Landes<br />
eigennützig zu fördern:<br />
Früher einmal studierten Töchter und<br />
Söhne aus mindestens mittelgutem<br />
Hause ewig und drei Tage, weil ihnen<br />
auch gar nichts anderes eingefallen<br />
wäre, als irgendwann das Lehramt zu<br />
erreichen. Nun aber meldete sich eine<br />
Schulsekretärin freiwillig und unterrichtete<br />
mit allen Pflichten einer Lehrerin<br />
und natürlich dem Recht, dafür<br />
nur halb so viel gezahlt zu bekommen,<br />
das Fach Biologie, denn qualifiziert<br />
war sie durch ihr Gärtlein zu Hause.<br />
Lehrerin hatte sie schon immer gern gespielt,<br />
und so wurde ein Traum wahr<br />
und der Goldsack der Unterrichtsministerin<br />
musste gleichzeitig nicht allzu<br />
weit geöffnet werden.<br />
Ebenso verhielt es sich mit einem Fußballer,<br />
der seinen Vertrag nicht verlängert<br />
bekommen hatte. Er bewarb sich<br />
als Sportlehrer und wurde mit einem<br />
3/4-Vertretungsvertrag angestellt. Drei<br />
Mütter leisteten Großes, denn als die<br />
Klassenlehrerin ihrer Kinder das Handtuch<br />
warf und einen Ruf als Kammerzofe<br />
an den Hof annahm, führten sie<br />
die Klasse ehrenamtlich weiter, was ihren<br />
Oberschulmeister lediglich vor die<br />
Frage stellte, wie er drei Mütter in eine<br />
Spalte im Gliederungsplan quetschen<br />
sollte, denn dort wurden sie tatsächlich<br />
vermerkt. Auch ein junger Germanist,<br />
dem wegen seiner Lese-Rechtschreibschwäche<br />
schon zweimal die Zulassung<br />
zum Schuldienst auf offiziellem Wege<br />
versagt worden war, stieg nun als Helfer<br />
in der Not mit Jahresvertrag zum<br />
halben Preis ein und freute sich, sein<br />
Bafög endlich aufbessern zu können.<br />
Auch eine Ballettmeisterin aus dem<br />
Ausland hatte gehört, man suche kompetente<br />
Menschen, und so wurde sie<br />
sofort eingestellt. Sie sprach zwar noch<br />
kein Wort der Landessprache und unterrichtete<br />
auch weder Breakdance noch<br />
Aerobic, doch waren die Jugendlichen<br />
wenigstens betreut. Ja, so glücklich<br />
konnte man sich schätzen, seine Kinder<br />
im Reiche König Kurts in der Schule<br />
zu wissen, denn zu Hause hingen sie<br />
dann schon mal nicht mehr herum.<br />
Doch wie immer, wo Licht ist, wird<br />
auch bald ein Schatten fallen:<br />
Aus einer dunklen Höhle nahe des Berges<br />
Kalmit meldete sich eines Tages der<br />
Drache zu Wort, dem die Unterrichtsministerin<br />
immer vorwarf, er vertilge<br />
Jungfrauen, was aber gar nicht stimmte:<br />
Er sollte bloß in Verruf gebracht werden.<br />
In Wahrheit war der Drache<br />
Wächter über die Qualität der Bildung<br />
im Lande König Kurts. Da der Drache<br />
Verwandtschaft in Italien besaß, hatte<br />
er einmal eine Postkarte aus Pisa bekommen<br />
und gesehen, wie schief sie dort<br />
ihren Turm gebaut hatten, nur weil sie<br />
nie gescheit rechnen gelernt hatten. Das<br />
befürchtete er auch für das eigene Land<br />
in naher Zukunft. Und es gefiel ihm<br />
auch nicht, dass die Unterrichtsministerin<br />
sich im fernen Finnland in Fotos<br />
stellte, die sie zwischen lauter glücklichen<br />
und schlauen Kinderchen zeigte.<br />
Im eigenen Lande hätte es diese Bilder<br />
niemals gegeben. Also spuckte der<br />
Drache Feuer: Er sengte dem vorbeireitenden<br />
König Kurt den Hosenboden<br />
an und verlangte, alle Schulmeister, die<br />
gern mit vollem Einsatz für ihren<br />
Herrn arbeiten wollten, dies auch tun<br />
zu lassen, um wenigstens einige der notwendigen<br />
Vertretungsverträge mit Fach-<br />
Schulmeistern besetzt zu wissen. Außerdem<br />
kokelte er ein wenig an der Prüfungs-<br />
und Studienordnung der Uni<br />
Landau herum, so dass der irrsinnigerweise<br />
frisch eingeführte Numerus Clausus<br />
auf das Lehramtsstudium abbrannte.<br />
Nun konnten dann doch wieder ein<br />
paar Menschen versuchen, qualifizierte<br />
Schulmeister zu werden und der Bildung<br />
zu dienen.<br />
Fortan war die Unterrichtsversorgung<br />
wirklich hundertprozentig, kein Schulmeister<br />
musste sich mehr nebenher verdingen,<br />
um überleben zu können, und<br />
die Sekretärinnen tippten wieder Briefe<br />
und die Ex-Fußballer legten wieder<br />
die Waden hoch und die Mütter hatten<br />
endlich Zeit für Reisen ins sonnige<br />
Pisa. Und wer’s nicht glaubt, der soll<br />
sich nur genau umsehen im Reiche<br />
König Kurts.<br />
Antje Fries<br />
24 <strong>GEW</strong>-Zeitung <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> 12 /2002
12/ 02<br />
Sonderbeilage der<br />
-Zeitung<br />
<strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong><br />
zur politischen Bildung in <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong><br />
„Demokratie braucht politische Bildung"<br />
Zur Lage der politischen Bildung in Schule, Hochschule, Jugend- und<br />
Erwachsenenbildung<br />
<strong>GEW</strong> und Deutsche Vereinigung<br />
für politische Bildung (DVPB) wollen<br />
mit dieser Beilage gemeinsam<br />
und in gedrängter Form einen<br />
Überblick über die politische Bildungslandschaft<br />
in <strong>Rheinland</strong>-<br />
<strong>Pfalz</strong> geben. Dabei wird die Lage<br />
der politischen Bildung in Hochschule,<br />
Schule, Lehrerausbildung<br />
und Erwachsenenbildung untersucht.<br />
Bestandsaufnahme, Kritik<br />
und Reformforderungen sind Bestandteil der Einzelbeiträge,<br />
die die Situation des Faches Sozialkunde aber auch<br />
der politischen Bildung insgesamt an den verschiedenen<br />
Politische Bildung in <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong><br />
Historische Entwicklung – aktuelle Problemlagen<br />
In der Gründungsphase des Landes <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> kam der Politischen<br />
Bildung im weitesten Sinne eine erzieherische Bedeutung<br />
zu. Es finden sich, in Kontinuität seit Annahme der Verfassung<br />
am 18. Mai 1947 bis heute, in Artikel 33 und Art. 39 der<br />
Landesverfassung (LV) Hinweise auf die Aufgaben der Politischen<br />
Bildung.<br />
So heißt es in Art. 33 LV zum Schulwesen: „Die Schule hat die<br />
Jugend ... in freier, demokratischer Gesinnung und im Geiste der<br />
Völkerversöhnung zu erziehen.“ und in Abs. 3 von Art. 39 LV<br />
zum Hochschulwesen: „Jeder Student ist verpflichtet, neben seinem<br />
Fachstudium allgemein bildende, insbesondere Staatsbürger<br />
kundliche Vorlesungen zu hören.“ 1<br />
Schulische und außerschulische Politische<br />
Bildung in <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong><br />
Der Staatsbürger kundlichen Bildung und der Erziehung in demokratischer<br />
Gesinnung wird Wert von Verfassungsrang eingeräumt.<br />
Einen derartigen Stellenwert erfährt die Politische Bildung<br />
nur noch in den Verfassungen der Länder Baden-Württemberg<br />
(Artikel 12), Nordrhein-Westfalen (Art. 11), Saarland (Art. 30)<br />
und Sachsen (Art. 101) sowie - indirekt - Hessen (Art. 56).<br />
Dieser herausragenden Bedeutung der Politischen Bildung wird<br />
MT_Berkessel_12/02 1<br />
22.11.2002, 10:03 Uhr<br />
Schwarz<br />
Schularten und -stufen zum Gegenstand haben. Ein Gespräch<br />
mit der neuen Bildungsministerin Doris Ahnen bietet<br />
Gelegenheit, die Situation der politischen Bildung auf<br />
den Prüfstand zu stellen und Handlungs- und Veränderungsmöglichkeiten<br />
auszuloten. Abgerundet werden die<br />
Beiträge durch einen Überblick über die Einrichtungen<br />
der politischen Bildungsarbeit im Land. In einem zweiten<br />
Teil sollen praktische Beispiele einer Adressaten- und<br />
handlungsorientierten politischen Bildung für Jugendliche<br />
und Erwachsene vorgestellt werden, die Mut machen,<br />
neue Lernformen auszuprobieren. Aus Platzgründen werden<br />
diese Beiträge in lockerer Folge in späteren Ausgaben<br />
der <strong>GEW</strong>-Zeitung veröffentlicht werden.<br />
Hans Berkessel<br />
in <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> letztlich dadurch Rechnung getragen, dass heute<br />
alle Universitäten des Landes über Institute, Fachgebiete oder Professuren<br />
für Politikwissenschaft verfügen, obwohl es bis heute keinen<br />
einzigen Lehrstuhl für Didaktik der Politik- bzw. Sozialwissenschaften<br />
gibt. Wegen der relativ späten Einrichtung des (neuen)<br />
Faches Politikwissenschaft an den rheinland-pfälzischen Universitäten<br />
fehlte es den Schulen zunächst an ausgebildeten Politiklehrenden;<br />
anfangs übernahmen vor allem die Kollegen der Geschichte<br />
den Sozialkundeunterricht. Die Bildungsoffensive der 70er<br />
Jahre unter der CDU-geführten Regierung Helmut Kohl’s (Minister<br />
für Unterricht und Kultus war Bernhard Vogel) mündete u.<br />
a. in die Gründung dreier Institute für Lehrerfortbildung (dem<br />
Staatlichen Institut für Lehrerfort- und Weiterbildung (SIL); heute:<br />
Institut für schulische Fortbildung und schulpsychologische<br />
Beratung des Landes <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> (IFB), dem Institut für Lehrerfort-<br />
und -weiterbildung Mainz (ILF) und dem Erziehungswissenschaftlichen<br />
Fort- und Weiterbildungsinstitut der Evangelischen<br />
Kirchen in <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> (EFWI). Das Pädagogische Zentrum<br />
in Bad Kreuznach (PZ) nimmt seit 1985 die Aufgabe der konzeptionellen<br />
Weiterentwicklung des Schulwesens wahr.<br />
Andererseits kamen auch die Hochschullehrenden der Aufgabe<br />
nach, Pflöcke in die rheinland-pfälzische politische Bildungslandschaft<br />
einzuschlagen. Besonders hervorzuheben ist an dieser Stelle<br />
aus universitärer Sicht das Engagement von Professoren wie Hans<br />
Buchheim, Werner Weidenfeld und Oscar Gabriel u. a., die im<br />
Rahmen der von Bernhard Sutor organisierten SIL-Weiterbildungs-<br />
I
Politische Bildung<br />
lehrgänge „Sozialkunde“ in den 70er Jahren Politikwissenschaft<br />
und Politische Bildung zusammengebracht und wichtige Impulse<br />
für die Einrichtung sowohl fachwissenschaftlich wie auch fachdidaktisch<br />
fundierter Politischer Bildung in den Schulen des Landes<br />
gegeben haben. So heißt es in den Lehrplänen der gymnasialen<br />
Oberstufe seit 1983 entsprechend: „Sozialkunde ist Politikunterricht.<br />
Die Perspektive, unter der in diesem Fach gesellschaftliche<br />
Phänomene, Bereiche und Prozesse betrachtet werden, ist die politische.“<br />
2 Unter „politisch“ wird dabei „alles soziale Handeln<br />
[verstanden], das auf gesamtgesellschaftlich verbindliche Regelungen<br />
zielt, sie intendiert oder beeinflussen soll.“ 3 Das Sutor’sche<br />
didaktische Konzept, auf der Grundlage des Grundgesetzes (schulische)<br />
politische Bildungsarbeit zu orientieren, war dabei prägend.<br />
Für die Entwicklung der schulischen Politischen Bildung waren<br />
ebenso die fachdidaktischen Kommissionen von besonderer Bedeutung.<br />
Deren Leiter waren stets auch Mitglieder der DVPB mit<br />
besonderen Funktionen. Viele andere Arbeitskreise und Vereine,<br />
Gremien und Institutionen trugen und tragen zu einer vielfältigen<br />
politischen Bildungslandschaft in <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> bei. In der<br />
Schnittstelle von schulischer und außerschulischer Bildung stehen<br />
u. a. der rheinland-pfälzische Landtag und die Friedtjof-Nansen-<br />
Akademie in Ingelheim. Die Bildungsveranstaltungen des Landtages<br />
4 in Mainz sind Landtagspräsident Christoph Grimm ein besonderes<br />
Anliegen. Die Friedtjof-Nansen-Akademie für Politische<br />
Bildung im Weiterbildungszentrum Ingelheim hat sich die Schwerpunkte<br />
der Deutsch-Deutschen Vereinigung, des europäischen<br />
Integrationsprozesses, der Entwicklungszusammenarbeit und der<br />
internationalen Friedens- und Sicherheitsordnung gesetzt. Für schulische<br />
wie außerschulische Politische Bildung zeichnet besonders<br />
die Landeszentrale für Politische Bildung in Mainz (1957-1974:<br />
Institut für staatsbürgerkundliche Bildung in RLP) verantwortlich,<br />
die den politischen Bildungsauftrag einer klassischen Landeszentrale<br />
mit Seminaren, Ausstellungen und Publikationen erfüllt.<br />
Mit der 1996 von Ministerpräsident Kurt Beck ins Leben gerufenen<br />
Atlantischen Akademie in Kaiserslautern will das Land <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong><br />
die mit seinem „Nachbar Amerika“ bestehende Zusammenarbeit<br />
insbesondere mit der in <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> beheimateten<br />
amerikanischen Gemeinde sowie mit Partnern jenseits des Atlantiks<br />
(z.B. dem Partnerland South Carolina) intensivieren und institutionalisieren.<br />
Das Heinrich-Pesch-Haus in Ludwigshafen besteht<br />
seit 1974 und widmet sich als Bildungshaus insbesondere<br />
der sozialen Jugend- und Erwachsenenbildung.<br />
Die <strong>Pfalz</strong>akademie in Lambrecht bietet als Einrichtung des Bezirksverbandes<br />
<strong>Pfalz</strong> in Partnerschaft mit vielen Trägern der politischen<br />
Bildungslandschaft exzellente Tagungsbedingungen. Das<br />
Europahaus Marienberg, gegründet 1951 als erstes europäisches<br />
Bildungs- und Begegnungszentrum und Stammhaus von über 100<br />
Europahäusern in 23 Ländern, fördert die internationale Zusammenarbeit<br />
und europäische Integration durch außerschulische Projekte<br />
der politischen Jugend- und Erwachsenenbildung.<br />
Die Katholische Erwachsenenbildung und die Evangelische Landesarbeitsgemeinschaft<br />
für Erwachsenenbildung in <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong><br />
e. V: (KEB und ELAG) sowie die Landesarbeitsgemeinschaft Arbeit<br />
und Leben, als gemeinsame Landesorganisation des Deutschen<br />
Gewerkschaftsbundes und des Volkshochschulverbandes, runden<br />
den außerschulischen Strang ab. Bei dieser Vielfalt des Angebotes<br />
versucht der Landesverband die Interessen der in der Politischen<br />
Bildung in <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> Tätigen zu vertreten.<br />
II<br />
MT_Berkessel_12/02 2<br />
22.11.2002, 10:03 Uhr<br />
Schwarz<br />
Genese des Landesverbandes<br />
Da es bis Anfang der 70er Jahre keine Politiklehrerausbildung in<br />
<strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> gab, blieb die Mitgliederzahl gering. Mit der Übernahme<br />
des Vorsitzes durch Bernhard Sutor 1969 zählte der Verband<br />
18 Mitglieder, deren Zahl bis zur Weitergabe an Josef Schreiber<br />
im Jahre 1978 auf 38 verdoppelt wurde. Unter dessen Vorsitz<br />
wuchs der Verband auf 136 Mitglieder bis zum Jahre 1995 an.<br />
Traditionsgemäß wurde einmal im Jahr eine hochkarätige Fortbildungsveranstaltung<br />
- oftmals in Kooperation mit dem Landtag<br />
<strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> - durchgeführt. Jürgen Henze übernahm von 1995<br />
- 1999 den Vorsitz und führte den Verband erfolgreich in sich<br />
ankündigende wechselvolle Zeiten. So schieden in dieser Zeit Mitglieder<br />
der ersten Stunden aus, neue konnten hinzugewonnen<br />
werden. Im Spätherbst 1998 wurde in Kooperation mit dem Institut<br />
für Politikwissenschaft der Universität Koblenz-Landau und<br />
dem SIL/IFB in Speyer die jährlich einmal stattfindenden „Tage<br />
der Politischen Bildung“ aus der Taufe gehoben.<br />
Heute hat der Landesverband 160 Mitglieder. Der Landesvorstand<br />
hat sich für die nächste Zeit insbesondere die Gewinnung engagierter<br />
KollegInnen der Haupt-, Real- und Berufsbildenden Schule<br />
ebenso wie der außerschulischen Politischen BildnerInnen als<br />
Aufgabe gestellt.<br />
Aktuelle Problemlagen<br />
Trotz der erfreulichen Entwicklung des Landesverbandes mangelt<br />
es nicht an Herausforderungen:<br />
• Die Lage des Politikunterrichts an rheinland-pfälzischen Schulen<br />
(insbesondere der BBS) ist - vielleicht mit Ausnahme der Leistungskurse<br />
an Gymnasien - verbesserungswürdig. Es bestehen erhebliche<br />
Zweifel, ob alle Schulen in ausreichender Zahl mit Lehrenden<br />
mit voller Fakultas ausgestattet sind. Oftmals müssen die<br />
KollegInnen der angrenzenden Fächer Geschichte und Erdkunde<br />
ersatzweise einspringen, und leisten hier gute Arbeit. Dennoch ist<br />
diese Praxis an manchen Schulen zur Dauereinrichtung geworden,<br />
ausgebildete Sozialkundelehrer werden im Umkehrschluss von<br />
den Schulen kaum angefordert. Die Qualitätssicherung der politischen<br />
Bildung ist daher - nicht nur in der Schule - ein herausragendes<br />
Problemfeld. Im Widerspruch dazu weisen die politisch<br />
Verantwortlichen auf Berufsrisiken hin, indem die Einstellungschancen<br />
nach dem Lehramtsstudium Sozialkunde als „eher ungünstig“<br />
(BBS) oder „sehr und äußerst ungünstig“ (Realschule),<br />
wenn nicht sogar als ein „erhebliches Berufsrisiko“ (Gymnasien)<br />
dargestellt werden.<br />
• Der zweite Problemkreis betrifft die Finanzierung der Politischen<br />
Bildung. Hier zeigt sich für den schulischen Bereich gerade bei<br />
jüngsten Gesprächen mit dem IFB, wie eng der Finanzrahmen des<br />
Faches gesteckt ist. Politische Bildung soll zugleich - unausgesprochen<br />
- als „Feuerwehr“ fungieren, um soziale Flächenbrände und<br />
Problemlagen unterhalb der juristischen Sanktionsschwelle bekämpfen<br />
zu helfen. Schulische wie außerschulische politische Bildung<br />
eignet sich hierfür sicherlich - nur dann sollte man die Mannschaft<br />
der tätigen Männer und Frauen mit der für die zusätzlichen<br />
Aufgaben notwendigen personellen und sächlichen Mindestausstattung<br />
versehen.<br />
• Aus Sicht des Landesvorstandes sollte Politik und nachgeordnete<br />
Administration sogar einen Schritt weiter gehen und „Politische<br />
Bildung als eine wesentliche Entwicklungskomponente der Bürgergesellschaft“<br />
begreifen. Um in den sozialen, politischen und<br />
wirtschaftlichen Bereichen in <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> eine zukunftsfähi-
ge und nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten, sind in unserem<br />
rohstoffarmen Land angesichts seiner geografischen und geopolitischen<br />
europäischen Lage nicht nur gut ausgebildete sondern<br />
vor allem mündige und sozial, politisch und wirtschaftlich engagierte<br />
<strong>Rheinland</strong>-Pfälzerinnen und <strong>Rheinland</strong>-Pfälzer der entscheidende<br />
Standortfaktor. Deshalb hat sich der Landesverband für die<br />
Aufnahme des „Staatsziels Politische Bildung“ in die Landesverfassung<br />
gegenüber allen Fraktionen im Landtag ausgesprochen.<br />
Anmerkungen<br />
1 Vgl.: Landtag <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> (Hrsg.): Grundgesetz für die Bundesrepublik<br />
Deutschland - Verfassung für <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong>, Koblenz 1949, S. 54f. und Landeszentrale<br />
für Politische Bildung (Hrsg.): Grundgesetz für die Bundesrepublik<br />
Deutschland - Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und<br />
Grundfreiheiten - Verfassung für <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> - Gemeindeordnung, Mainz<br />
1997 37 ., S. 125f.<br />
2 vgl. z.B.: Kultusministerium <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> (Hrsg.): Lehrplan Gemeinschafts-<br />
Gedanken zur Situation des Sozialkundeunterrichts<br />
an Hauptschulen<br />
Im Sozialkundeunterricht sollen die Schülerinnen und Schüler zu politisch<br />
mündigen Bürgerinnen und Bürgern erzogen werden. Sie sollen<br />
also Bereitschaft entwickeln, politische Aufgaben zu übernehmen, Interesse<br />
und Engagement zeigen, Entscheidungskompetenz und Konfliktfähigkeit<br />
lernen, eigenverantwortlich handeln und sich Urteile bilden<br />
können.<br />
In der Beliebtheitsskala von Schülerinnen und Schülern liegt das<br />
Fach Sozialkunde oft ganz am Schluss, obwohl es von seinem Stellenwert<br />
und Anspruch her im Hinblick auf die Erziehung zum<br />
politisch mündigen Bürger und seiner Mitgestaltung in der demokratischen<br />
Gesellschaft sehr hoch anzusiedeln ist.<br />
Nach der Stundentafel wird Sozialkunde in der Hauptschule als<br />
einstündiges Fach vom 7. bis zum 9. Schuljahr unterrichtet. Zurecht<br />
muss die Frage gestellt werden, ob man mit diesem geringen<br />
Stundenansatz den Themenbereichen des Lehrplans und dem aktuellen<br />
politischen Geschehen in der Welt gerecht werden und die<br />
dazu speziellen Methoden der politischen Bildung wie u. a. Debatten<br />
und Diskussionen, Analyse von Fallbeispielen, Meinungsbefragungen<br />
und Expertengespräche entsprechend einüben kann.<br />
Dabei hängt der gültige Lehrplan immer noch den verstaubten<br />
Ansichten KURT GERHARD FISCHERS und BERNHARD SUTORS an. Danach<br />
soll ein Schüler wissen, was es gibt und wie es funktioniert.<br />
Ist das Interesse bei den Themen Familie, Jugendliche in sozialen<br />
Gruppen und Rechtsprechung noch sehr groß, weil die Schülerinnen<br />
und Schüler hier „mitreden“ können, eigene Erfahrungen und<br />
„Vorwissen“ haben oder selbst „betroffen“ sind, so nimmt es mit<br />
dem Thema Gemeinde rapide ab. Noch schwieriger ist die Behandlung<br />
der politischen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland<br />
und der Europäischen Einigung. Hier ist das methodische<br />
Können des Lehrers gefragt: Mit Fallbeispielen oder Planspielen<br />
kann die Umsetzung der „trockenen“ Institutionenkunde noch am<br />
ehesten gelingen.<br />
Dr. Thomas Simon - Landesvorsitzender der<br />
Deutschen Vereinigung für Politische Bildung<br />
(DVPB) e.V. , Landesverband <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong><br />
Am Birnbaum 16, 54296 Trier<br />
Tel./Fax: 0651-9916849<br />
Thomas.Simon@dvpb.de www.dvpb.de<br />
MT_Berkessel_12/02 3<br />
22.11.2002, 10:03 Uhr<br />
Schwarz<br />
Politische Bildung<br />
kunde in der Oberstufe des Gymnasiums, Mainz 1983, S. 5f.. Ebenso könnten<br />
hier die Lehrpläne für die Sekundarstufe I aller Schularten und der Lehrplan<br />
Gesellschaftslehre an Integrierten Gesamtschulen angeführt werden. Im Rahmen<br />
des Punktes ‚Aktuelle Problemlagen‘ (s.u.) wird auf diese konzeptionellen<br />
Überlegungen unter dem Gedanken „Politische Bildung als eine Entwicklungskomponente<br />
der Bürgergesellschaft“ einzugehen sein.<br />
3 vgl. ebd., S. 5<br />
4 vgl: Berkessel, Hans: Einblicke in die Parlamentsarbeit. Informations- und Bildungsveranstaltungen<br />
für Schüler, Auszubildende und Lehrer im Landtag <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong>,<br />
in: dvpb aktuell 3/99, S. 37f.<br />
Der Lehrplan bietet aber auch Freiräume, die von Schülern und Lehrern<br />
mit eigenen Themen gefüllt werden können. Hier hin gehören<br />
aktuelle politische Fragen, deren Behandlung aber leider häufig an<br />
dem geringen Vorwissen der Schülerinnen und Schüler und der begrenzten<br />
Zeit scheitert. Immer wenn persönliche Schicksale (biografische<br />
Elemente) bearbeitet werden, wie HEIDRUN HOPPE 1 fordert, erfahrungsorientierte<br />
Unterrichtsmethoden angewandt werden, wie es<br />
HEINZ KLIPPERT 2 wünscht, und Betroffenheit erzeugt werden kann,<br />
z.B. beim Thema Friedenssicherung/Nah-Ost-Konflikt, Gesetzgebung<br />
in der Gentechnologie oder Bekämpfung des Terrorismus, steigt das<br />
Interesse der Schülerinnen und Schüler. Dann ist Aufmerksamkeit<br />
da, die Bereitschaft „zu lernen“ und sich mit dem Inhalt auseinanderzusetzen<br />
wächst. Wir brauchen Inhalte, die wirklich für die Schülerinnen<br />
und Schüler von Bedeutung sind, sie im Innersten „treffen“<br />
und für die politische Bildung relevant sind (Vgl. W. KLAFKIS Schlüsselprobleme,<br />
so u.a. Generationenkonflikt, Gleichberechtigung, Tierund<br />
Umweltschutz). 3<br />
Auch die Schulbücher 4 „sprechen“ häufig weder die Sprache der<br />
Schülerinnen und Schüler noch sind sie angemessen gestaltet. Texte<br />
sind oft gefüllt mit Informationen, die das Verständnis für die eigentliche<br />
Sache erschweren und enorm viele Vorkenntnisse und<br />
Detailwissen voraussetzen. Quellen wie Zeitungsmeldungen und<br />
Reden von Politikern sind sprachlich kaum zu bewältigen. Ein<br />
positiver Ansatz in den Büchern sind die Methodenseiten. Hier<br />
werden ausgewählte Inhalte mit spezifischen Methoden erarbeitet.<br />
Allerdings überfordern auch sie häufig die Schülerinnen und<br />
Schüler der Hauptschule oder die Zeit für eine sinnvolle Bearbeitung<br />
fehlt.<br />
Die größten Chancen für einen erfolgreichen und zufriedenstellenden<br />
Sozialkundeunterricht in der Hauptschule, der die eingangs<br />
formulierte Zielsetzung rechtfertigt, sehen wir in den folgenden<br />
Punkten:<br />
• Das Fach Sozialkunde muss aufgewertet werden und mehr Wochenstunden<br />
erhalten.<br />
• Die Fächer Sozialkunde, Geschichte und Erdkunde müssen an<br />
der Hauptschule zu Gesellschaftslehre zusammengefasst werden.<br />
Es sollte nur eine Note erteilt werden.<br />
III
Politische Bildung<br />
• Es muss Fächer übergreifend und Projekt orientiert gearbeitet<br />
werden.<br />
• Möglichst viele Themen sollten so aufbereitet sein, dass eine persönliche<br />
Betroffenheit bei den Schülerinnen und Schülern hervorgerufen<br />
wird. Damit sie selbstständig arbeiten und Freiräume verantwortlich<br />
nutzen lernen, sollten interessante Methoden wie<br />
Wochenplanarbeit und Stationenlernen stärker berücksichtigt werden.<br />
• Durch Gespräche mit Experten und durch Besuche von öffentlichen<br />
Einrichtungen (außerschuliche Lernorte) wird das Interesse<br />
der Schülerinnen und Schüler für die politische Bildung größer.<br />
IV<br />
Eckard Hanke, Fachleiter,<br />
Adolf-Reichwein-Studienseminar Westerburg<br />
Erwin Henn, Konrektor Hauptschule Altenkirchen<br />
Zur Stellung des Fachbereichs<br />
Sozialkunde an der Realschule in<br />
<strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong><br />
Einige Anmerkungen zum Lehrplan Sozialkunde und zur<br />
Unterrichtspraxis an Realschulen<br />
Wie man der beigefügten Themenübersicht des Lehrplans entnehmen<br />
kann, wird in dieses Ein-Stunden-Fach eine Fülle von Themen<br />
hineingepackt. Um bei der geringen verfügbaren Unterrichtsstundenzahl<br />
Synergieeffekte nutzen zu können, empfiehlt es sich<br />
z. B. beim Berufswahlunterricht, Fächer übergreifend mit dem Fach<br />
Deutsch eng zusammenzuarbeiten (z. B. Rollenspiele zum Vorstellungsgespräch,<br />
Anfertigen schriftlicher Bewerbungen usw.).<br />
Viele Realschulen haben sich darauf verständigt, das Fach Sozialkunde<br />
aus Stundenplan technischen Gründen epochal zu unterrichten.<br />
Dies kann z. B. bedeuten, dass Sozialkunde in der 8. Klasse<br />
einstündig und in Klasse 9 zweistündig unterrichtet wird, aber<br />
in Klasse 10 überhaupt kein Sozialkundeunterricht erteilt wird.<br />
Der Nachteil solcher Modelle liegt auf der Hand: Gerade in Klasse<br />
10, wenn aufgrund des Alters der Schülerinnen und Schüler das<br />
Interesse an Politik eher zunimmt, kann keine politische Bildung<br />
mehr stattfinden.<br />
Neben der Einstündigkeit des Fachs und dem fachfremden Unterricht<br />
wird die politische Bildungsarbeit auch dadurch beeinträchtigt,<br />
dass das Interesse an Politik insgesamt immer mehr zurückgeht<br />
und eine hohe Frustration bezüglich Parteien und Politikern<br />
festzustellen ist. Bestimmte politische Themen wie z. B. „rechte<br />
Gewalt“, die im täglichen Umfeld erlebbar werden (können), stoßen<br />
dagegen auf größeres Interesse. Ein Anliegen gerade unserer<br />
Schulart muss es sein, die politische Grundbildung zu verstärken.<br />
Alle Beteiligten am Bildungsprozess müssen der „Politik-“ bzw.<br />
„Politikerverdrossenheit“ gemeinsam entgegen arbeiten. Die Wahlen<br />
zu den Kommunalparlamenten, die Landtags- und die Europawahl<br />
haben dies an der Wahlbeteiligung gemessen wieder ganz<br />
deutlich werden lassen. Kinder und Jugendliche aus allen Schichten<br />
unserer Gesellschaft müssen für das politische Geschehen mo-<br />
Anmerkungen<br />
MT_Berkessel_12/02 4<br />
22.11.2002, 10:03 Uhr<br />
Schwarz<br />
1HEIDRUN HOPPE, Subjektorientierte politische Bildung. Begründung einer biographiezentrierten<br />
Didaktik der Gesellschaftswissenschaften, Opladen 1996. Vgl.<br />
Einmischen. Subjektorientierung als didaktisches Prinzip, hrsg. von der Landeszentrale<br />
für politische Bildung <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong>, Mainz 2001.<br />
2HEINZ KLIPPERT, Durch Erfahrung lernen, in: Erfahrungsorientierte Methoden<br />
der politischen Bildung, hrsg. von der Bundeszentrale für politische Bildung,<br />
Bonn 1988 S. 75-93.<br />
3WOLFGANG KLAFKI Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik, Weinheim<br />
1993. Vgl. auch Bildungskommission NRW, Zukunft der Bildung - Schule der<br />
Zukunft, Neuwied 1995, S. 112ff.<br />
4 Vgl. ECKARD HANKE, ERWIN HENN, FRIEDHELM ZÖLLNER., Demokratie leben,<br />
Sozialkunde <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong>/Saarland, Neubearbeitung, Hannover: Schroedel<br />
2000. ROLF ARNOLD U. A., Sozialkunde 1, <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong>, Unterrichtswerk<br />
für das 7.-10. Schuljahr (insgesamt 3 Bände), Neubearbeitung, Hannover: Schroedel:<br />
2001.<br />
WOLFGANG MATTES U. A., Politik erleben, Sozialkunde, Paderborn: Schöningh<br />
2001. HERBERT BAUMANN U. A., Der einzelne und die Gesellschaft, Lern- und<br />
Arbeitsbuch für Sozialkunde, Sekundarstufe 1, Neubearbeitung, Köln, München:<br />
Stam 1994.<br />
Lehrplananteil der Realschule - Themenübersicht<br />
Klasse 8<br />
1. Thema:<br />
Jugendliche in sozialen Gruppen - oder - 8 Stunden<br />
2. Thema:<br />
Erziehung und soziales Lernen in der Familie<br />
3. Thema:<br />
Politische Beteiligung in der Gemeinde, in der<br />
Region und im Land <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> 10 Stunden<br />
4. Thema: Umgang mit Massenmedien 7 Stunden<br />
Klasse 9<br />
5. Thema:<br />
Recht und Rechtsprechung 7 Stunden<br />
6. Thema:<br />
Berufswahlunterricht 9 Stunden<br />
7. Thema: Wirtschaft und Umwelt 9 Stunden<br />
Klasse 10<br />
8. Thema:<br />
Die politische Ordnung der Bundesrepublik<br />
Deutschland 13 Stunden<br />
9. Thema:<br />
Der Prozess der europäischen Einigung 5 Stunden<br />
10. Thema:<br />
Friedenssicherung als Aufgabe internationaler<br />
Politik 7 Stunden<br />
Das frühere Lehrplan-Thema "Politische Willensbildung durch<br />
die Parteien" wurde herausgenommen.<br />
tiviert und zum Verständnis auch komplexerer politischer Strukturen<br />
befähigt werden. Versäumnisse, die hier gemacht werden,<br />
können die Berufsbildenden Schulen später nicht mehr kompensieren.<br />
Wichtig ist es, im Fach Sozialkunde viel Hintergrundwissen nicht<br />
abstrakt theoretisch, sondern an konkreten Beispielen aktuellen<br />
Geschehens aufzuzeigen. Dazu kann die verstärkte Einbeziehung
der Medien (Zeitung, Fernsehen, Internet) ebenso beitragen wie<br />
Exkursionen zu Institutionen wie Gerichten, Rathäusern, Landtag,<br />
Bundestag und Bundesrat sowie die Einladung von Experten<br />
oder Abgeordneten der unterschiedlichen Ebenen zu Anhörungen<br />
oder Fachgesprächen. Auch mit der Vorbereitung und Durchführung<br />
von Projekttagen oder -wochen (z. B. im Zusammenhang<br />
mit Themen von Wettbewerben aus dem Bereich der politischen<br />
Zur Situation des Sozialkunde-<br />
Unterrichts an Gymnasien in<br />
<strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong><br />
Vorbemerkungen<br />
„Sozialkunde“ in <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> bedeutet Unterricht über folgende,<br />
das menschliche Zusammenleben betreffende Sachbereiche:<br />
Sozialstrukturen, soziale Prozesse; politische Strukturen und<br />
Prozesse in Gemeinde, Land, Bund, EU und weltweit; Rechtswesen,<br />
Gerichte; Massenmedien; Wirtschaft, Ökologie; Zeitgeschichte.<br />
Alles dies soll unter dem Primat der Politik behandelt werden.<br />
Der Gemeinschaftskunde-Lehrplan für die Sekundarstufe II von<br />
1998 formuliert lapidar: „Sozialkunde ist Politikunterricht.“ (Didaktische<br />
Konzeption S. 8). Das bedeutet, dass einerseits die sich<br />
in diesen Gebieten menschlichen Handelns ergebenden politischen<br />
Probleme, z.B. Schulpolitik, Rechtspolitik, Medienpolitik, Sozialpolitik,<br />
Wirtschafts- und Umweltpolitik im Mittelpunkt stehen<br />
sollen; das impliziert aber auch, dass ein sachliches Grundwissen<br />
aus diesen Bereichen erarbeitet werden muss, das zumindest ausreichend<br />
für eine politischen Beurteilung ist. Studieren kann man<br />
das „Fach“ in dieser Breite natürlich nicht, denn welcher Kandidat<br />
des Lehramtes könnte neben einem anderen Schulfach (!) auch<br />
noch gleichzeitig Politik, Soziologie, Jura, Publizistik, Volks- und<br />
Betriebswirtschaft, Ökologie und Geschichte bewältigen? Sozialkundelehrer<br />
in <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong>, auch wenn sie universitär dazu<br />
ausgebildet worden sind, müssen daher in vielen Bereichen dilettieren,<br />
in denen sie ihren Schülern, was das Sachwissen angeht,<br />
vielleicht nur um ein Weniges voraus sind. Sie müssen „Generalisten“<br />
sein, wie das manche Politiker für sich ja auch reklamieren.<br />
Sozialkunde in <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> ist also das am wenigsten professionalisierte<br />
Fach mit den am weitesten gespannten Inhalten und<br />
zugleich das Fach mit der geringsten Gesamtstundenzahl aller Fächer.<br />
Sekundarstufe I (= Klasse 9 und 10)<br />
Lehrplanthemen und vorgeschlagene Stundenzahl<br />
Klasse 9:<br />
1. Thema: Jugendliche in sozialen Gruppen 7 Stunden<br />
2. Thema: Erziehung und soziales Lernen<br />
in der Familie 5 Stunden<br />
3. Thema: Politische Beteiligung in der Gemeinde,<br />
in der Region und im Land <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> 10 Stunden<br />
4. Thema: Recht und Rechtsprechung 9 Stunden<br />
5. Thema: Umgang mit Massenmedien 7 Stunden<br />
8. Thema: Wirtschaft und Umwelt 12 Stunden<br />
50 Unterrichtsstunden<br />
Politische Bildung<br />
Bildung) kann Interesse an Politik geweckt werden. Die Bedeutung<br />
und das Spezifische unseres Faches muss bei allen politischen<br />
Gremien und Entscheidungsträgern immer wieder deutlich herausgestellt<br />
werden: Es darf trotz mancher Bestrebungen seine Eigenständigkeit<br />
nicht verlieren.<br />
Doris John, Realschulkonrektorin,<br />
Realschule/Kooperative Gesamtschule Altenkirchen<br />
Klasse 10:<br />
7. Thema: Die politische Ordnung der<br />
Bundesrepublik Deutschland 14 Stunden<br />
8. Thema: Der Prozess der europäischen Einigung 4 Stunden<br />
9. Thema: Friedenssicherung als Aufgabe<br />
internationaler Politik 7 Stunden<br />
25 Unterrichtsstunden<br />
MT_Berkessel_12/02 5<br />
22.11.2002, 10:03 Uhr<br />
Schwarz<br />
Quantitative Bewertung<br />
Der zweistündige Unterricht in Klasse 9 ist seit der Aufstockung<br />
der Stundenzahl im Zuge der letzten Neuordnung der Stundentafel<br />
der Sekundarstufe I endlich einigermaßen zufriedenstellend,<br />
auch wenn die Vielfalt der Lehrplanthemen (s.o.) Stoff für soliden<br />
Unterricht von mehreren Schuljahren ergäbe. So bleibt es meist<br />
beim oberflächlichen Anreißen, und manches Thema fällt gelegentlich<br />
dabei ganz aus.<br />
Die Unterrichtspraxis der Klasse 10 allerdings leidet sehr stark unter<br />
drei Beeinträchtigungen:<br />
• Einstündigkeit;<br />
• häufiger Ausfall gerade in Klasse 10 wegen allerlei außerunterrichtlicher<br />
Aktivitäten (Betriebspraktikum, Sprachaustauschfahrten,<br />
Abschlussfahrten, Reflexionstagen u.ä.)<br />
• stets hinterherhinkender Geschichtsunterricht (Geschichte nach<br />
1945), dessen Lehrplan gemäße Vorarbeit gerade für die Sozialkunde<br />
dieser Jahrgangsstufe besonders notwendig wäre; vielfach<br />
endet der Geschichtsunterricht in den 10. Klassen um 1950 herum!<br />
Alle drei Faktoren in Kombination führen oft, ja oft dazu, dass<br />
ganze Themen der Jahrgangsstufe 10 gar nicht unterrichtet werden<br />
(können)! Von daher muss die Ausweitung auf zwei Wochenstunden<br />
auch in Klasse 10 gefordert werden. Die zu geringe Unterrichtsstundenzahl<br />
von Sozialkunde - bekanntlich die geringste<br />
aller Fächer überhaupt - etwa dadurch ausgleichen zu wollen, dass<br />
man zusätzlich möglichst viele Unterrichtsgänge u.ä. organisiert,<br />
lässt sich zwar methodisch gut begründen, treibt aber den Teufel<br />
mit dem Beelzebub aus, denn das Mehr an Unterrichtszeit wird<br />
anderem Unterricht „geraubt“. Dies kann keine Lösung für den<br />
Mangel an Unterrichtszeit sein.<br />
Didaktische Bewertung<br />
Alle Themen für 9 und 10 sind wichtige Themen, die auch ich zu<br />
einer sozialkundlichen Grundbildung der Sekundarstufe I zählen<br />
würde. Für die Schüler sind die Themen zumeist motivierend („interessant“),<br />
am wenigsten bisweilen der Rechtsunterricht, was sich<br />
aber mit einem Gerichtsbesuch deutlich bessern lässt. Die Qualität<br />
des Wirtschaftsunterrichts lässt sich durch Betriebsbesichtigung(en)<br />
und häufiges Einbeziehung der Wirtschaftsseiten einer<br />
regionalen Tageszeitung verbessern. Er wird von vielen Klassen<br />
V
Politische Bildung<br />
dieser Altersstufe, vor allem von Mädchen, als eher nicht so interessant<br />
empfunden, obwohl er sicherlich aus der Sicht eines Erwachsenen<br />
zu den wichtigsten Themen zählt. Wie im wirklichen<br />
Leben drängt die Ökonomie auch hier leicht die Ökologie in den<br />
Hintergrund. Ein Lehrer, der auch dieses letzte Thema der Klasse<br />
10 noch ausreichend bearbeiten will, muss sich sehr in seiner Unterrichtsplanung<br />
disziplinieren. In den letzten Jahren ist das Interesse<br />
von Jugendlichen an Europa-Politik deutlich zurückgegangen,<br />
andererseits aber das Verständnis für internationale politische Prozesse<br />
von Krieg und Friedenssicherung deutlich angestiegen. Methodisch<br />
steht die geringe Stundenzahl einer Ausweitung von Projektunterricht<br />
u.ä. stark im Wege. Mit einer Wochenstunde kann<br />
man keine großen methodischen Kunststücke vollführen (lassen).<br />
Defizite des Lehrplans:<br />
In der Soziologie sollten demografische Erkenntnisse (Bevölkerungsentwicklung,<br />
Geburtenrückgang mit seinen zukünftigen Folgen<br />
u.ä.) einen größeren Stellenwert erhalten. Auffällig und für<br />
mich persönlich zunehmend problematisch ist die Tatsache, dass<br />
unser gesamter Sozialkundeunterricht - auch in der Sek. II - einseitig<br />
auf den Beruf hin ausgerichtet ist, aber nirgendwo den Willen<br />
zum Kinderkriegen und Großziehen bewusst zu fördern versucht.<br />
Können wir uns diese kulturelle Kurzsichtigkeit, die zurzeit<br />
wohl typisch für alle hoch entwickelten Industriegesellschaften ist,<br />
auf die Dauer wirklich leisten?<br />
Sekundarstufe II (MSS)<br />
Sozialkunde in der MSS kann entweder als Schwerpunktfach eines<br />
Leistungskurses mit vier Wochenstunden gewählt werden oder<br />
ist mit zwei Wochenstunden verpflichtender Teil eines Grundkurses<br />
oder Zusatzfach („Beifach“, als verpflichtender Teil eines Leistungskurses<br />
mit den anderen Schwerpunkten Geschichte oder Erdkunde)<br />
- letzteres allerdings nur zeitweise.<br />
Alle drei Fächer - Geschichte, Erdkunde und Sozialkunde - sollen<br />
unter dem Dachbegriff „Gemeinschaftskunde“ kooperieren und<br />
sich ergänzen. Damit ist auch sichergestellt, dass alle Schüler -<br />
gleich, welche Fächerwahl sie treffen - in allen drei Fächern irgendwie<br />
unterrichtet werden. Sie erhalten auch nur eine gemeinsame<br />
Zeugnisnote unter dem Begriff „Gemeinschaftskunde“. Das<br />
Dach „Gemeinschaftskunde“ darf daher nicht mit Fächern gleichen<br />
Namens in anderen Bundesländern verwechselt werden, die<br />
eher mit der rheinland-pfälzischen „Sozialkunde“ gleichzusetzen<br />
sind. Nur als Leistungsfach hat Sozialkunde einen durchgehenden<br />
Kurs von 11 bis 13, und zwar als vierstündiges „Schwerpunktfach“,<br />
das gewählt werden kann. Im Verbund des Grundfaches „Gemeinschaftskunde“<br />
hat Sozialkunde von 11 bis 12/1 eigene zweistündige<br />
Anteile, die aber häufig auch von Geschichtslehrern unterrichtet<br />
werden. Ab 12/1 ersetzt die Erdkunde die Sozialkunde.<br />
Der Gegenstand des fortgesetzten Geschichtsunterrichts befasst sich<br />
aber mit einem durchaus politischen Thema, nämlich der Geschichte<br />
der Demokratie in Deutschland Ost und West. In der Jahrgangsstufe<br />
13 werden neben den zwei Stunden der Erdkunde zwei<br />
Stunden „Geschichte/Sozialkunde“ erteilt. Die Themen sind die<br />
gleichen wie im Leistungsfach Sozialkunde, sie werden aber in aller<br />
Regel von Geschichtslehrern unterrichtet.<br />
Quantitative Bewertung<br />
a) Leistungsfach: Die Unterrichtszeit von 11 bis 13 reicht aus,<br />
auch wenn sie im Interesse des Zusatzfaches um eine Stunde ge-<br />
VI<br />
genüber anderen Leistungsfächern reduziert ist: vier statt der sonstigen<br />
fünf Wochenstunden. Man merkt das als unterrichtender<br />
Lehrer vor allem im Vergleich zur 9. und 10. Klasse, wenn man<br />
endlich einmal ähnliche Themen in angemessener Ruhe und Tiefe<br />
bearbeiten kann.<br />
b) Grundfach: Auch hier ist die Stundenzahl gegenüber den meisten<br />
anderen Grundkursen, denen drei Stunden zur Verfügung stehen,<br />
auf zwei gekürzt. Dies wäre aber wohl noch ausreichend, wenn<br />
nicht durch das Verbundsystem der „Gemeinschaftskunde“ die<br />
Sozialkunde als eigenständiges Fach nur auf 11/1 bis 12/1 beschränkt<br />
wäre und die restliche Zeit der Geschichte und der Erdkunde<br />
vorbehalten wäre. Das bedeutet übrigens auch, dass in aller<br />
Regel in den mündlichen Abiturprüfungen keine genuin sozialkundlichen<br />
Themen vorkommen, sondern nur historische bzw.<br />
erdkundliche, was natürlich auch an den prüfenden Fachlehrern<br />
liegt: es sind in aller Regel Geschichts- und Erdkundelehrer.<br />
c) Zusatzfächer: Zum gewählten Schwerpunktfach Geschichte wird<br />
Sozialkunde als zweistündiges „Zusatzfach“ (auch „Beifach“ genannt)<br />
in 11/1 bis 12/1 unterrichtet - mit denselben Themen wie<br />
im Grundfach (Bewertung siehe Grundfach!). Zum Schwerpunktfach<br />
Erdkunde ist aber nur „Geschichte“ bzw. „Geschichte /Sozialkunde“<br />
als Zusatzfach vorgesehen, also ein eigenständiger Sozialkundeunterricht<br />
durch Sozialkundelehrer gar nicht. Der Lehrplan<br />
versucht diese Lücke mit folgender „Anmerkung“ (S. 146) zu<br />
füllen:<br />
„In Jahrgangstufe 12 muss im Zusatzfach Geschichte mit Teilthema<br />
4 (Die politische Ordnung der Bundesrepublik Deutschland)<br />
ein Thema des Faches Sozialkunde aufgegriffen werden (siehe dort<br />
TT 3 des Grundfaches), da Sozialkunde in diesem Schwerpunkt<br />
in der Oberstufe kein Zusatzfach ist. Deshalb müssen die Teilthemen<br />
bei der Behandlung entsprechend gekürzt werden. Die Kürzung<br />
der Themen sollte so erfolgen, dass keines der Themen unbearbeitet<br />
bleibt.“<br />
Das bedeutet zusammenfassend, dass die Sozialkunde, wenn sie<br />
nicht Leistungsfach ist, in der Studienstufe nur eine sehr beschränkte<br />
Rolle spielt, innerhalb des Leistungsfaches Erdkunde praktisch<br />
gar keine.<br />
Didaktische Bewertung (des Leistungskurslehrplanes)<br />
Ich beschränke mich hier auf den Lehrplan des Leistungskurses,<br />
weil der vom Grundfach bzw. vom Zusatzfach Geschichte zu fragmentarisch<br />
ist und keiner eigenen, sondern nur der Logik des Fächerkompromisses<br />
folgt.<br />
11/1 - Soziales<br />
11/2 - Wirtschaft und Umwelt<br />
12/1 - Innenpolitik BRD und DDR<br />
13 - Außen- und Sicherheitspolitik Ost-West, Europa, global<br />
MT_Berkessel_12/02 6<br />
22.11.2002, 10:03 Uhr<br />
Schwarz<br />
Es fällt auf, dass an keiner Stelle explizit juristische oder Medien-<br />
Themen (wie in Klasse 9) vorgesehen sind. Das muss auch nicht<br />
unbedingt so sein, Wissenslücken in diesen Bereichen kann man<br />
durchaus implizit falls nötig füllen.<br />
Durch die Vorverlegung des Abiturs kann nun auch das Halbjahr<br />
11/2 mit Wirtschaft und Umwelt in die schriftlichen Aufgaben<br />
einbezogen werden. Die bisherigen (wenigen) Erfahrungen zeigen<br />
allerdings, dass dies sehr wenig von Lehrerseite (Aufgabenvorschläge)<br />
und noch seltener von Schülerseite (Auswahl der Aufgaben)<br />
genutzt wird. Das ist auch verständlich, weil Schüler die wirtschaft-
lichen Themen ohnehin als schwierig einschätzen, und wenn sie<br />
auch noch am längsten zurückliegen, dann vergrößert dies noch<br />
die Schwierigkeitsempfindung. Wenn man also die Bedeutung von<br />
Wirtschaft auch im Abitur verstärken möchte, dann müsste man<br />
die Prüfungsordnung für Sozialkunde ändern. Mein Vorschlag: Die<br />
Lehrer legen dem Ministerium wie bisher drei Aufgaben vor,<br />
darunter eine aus 11/2. Die Schüler müssen diese und eine weitere<br />
Die Ausbildung zum Sozialkundelehrer<br />
im Studienseminar für das Lehramt<br />
an Gymnasien<br />
Der Politikwissenschaftler im Studienseminar<br />
Nach Ablegung der wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt<br />
an Gymnasien im Fach Politikwissenschaft werden die Referendare<br />
des Faches Sozialkunde in 2 Jahren auf ihren Beruf als Sozialkundelehrer<br />
vorbereitet. Die praktische Ausbildung an den Seminarschulen<br />
wird angeleitet und begleitet von einem der sechs Studienseminare<br />
des Landes. Die Uni-Absolventen sollen ihre Fachkenntnisse<br />
inhaltlich vervollständigen, didaktisch reflektieren lernen<br />
und ein breites fachbezogenes Methodenrepertoire entwickeln.<br />
Die didaktische Orientierung nimmt in der Ausbildung zum Sozialkundelehrer<br />
einen besonderen Rang ein:<br />
a) das Fach hat statt einer Mutterwissenschaft ein breites Feld von<br />
Bezugswissenschaften, deren Selbstverständnis und deren facheigenen<br />
Methoden teilweise weit auseinander liegen und hohe Anforderungen<br />
an die Differenzierungs- und die Integrationsfähigkeit,<br />
d.h. an die Professionalität des Lehrers stellen.<br />
b) Politikunterricht und Politiklehrern haftet ein latenter Indoktrinierungsverdacht<br />
an. Sie unterliegen besonders hohem Legitimationsdruck.<br />
c) Die Verankerung des Faches im Fächerkanon der Schule bleibt<br />
gefährdet. Die konkrete inhaltliche Ausgestaltung war und ist umstritten.<br />
d) Sozialkundeunterricht stellt höchste Anforderungen an Aktualität<br />
und Reaktionsschnelligkeit des Lehrers. So richteten sich in<br />
vielen Schulen nach dem 11. September 2001 Hilfe suchende Blicke<br />
von Kollegen und Schulleitern aber auch von Schülern auf<br />
Religions- und Sozialkundelehrer.<br />
Das Fach Sozialkunde<br />
Die Relevanz von Politikunterricht wird grundsätzlich kaum noch<br />
bezweifelt „Demokratie braucht politische Bildung. Die Grundlagen<br />
hierzu müssen im Schulunterricht gelegt werden...“ ( Münchner<br />
Manifest vom 26. Mai 1997) Als Grundlage des heutigen Politikunterrichts<br />
gilt nach der Überwindung der ideologischen Grabenkämpfe<br />
der 60er und 70er Jahre seit 1976 der „Beutelsbacher<br />
Konsens“. Folgende zwei Grundsätze sind für die unterrichtliche<br />
Tätigkeit bestimmend:<br />
Überwältigungsverbot: Es ist nicht erlaubt, den Schüler - mit welchen<br />
Mitteln auch immer - im Sinne erwünschter Meinungen zu<br />
überrumpeln und damit an der Gewinnung eines selbstständigen<br />
Urteils zu hindern. Hier genau verläuft nämlich die Grenze zwischen<br />
Politischer Bildung und Indoktrination. Indoktrination aber<br />
ist unvereinbar mit der Rolle des Lehrers in einer demokratischen<br />
MT_Berkessel_12/02 7<br />
22.11.2002, 10:03 Uhr<br />
Schwarz<br />
Politische Bildung<br />
nach Wahl bearbeiten, also zwei (die dann natürlich kürzer sein<br />
müssten).<br />
Fazit: Die Situation von Sozialkunde an rheinland-pfälzischen<br />
Gymnasien: gut bis mangelhaft!<br />
Hartmut Geißler, StD am Sebastian-<br />
Münster-Gymnasium, Ingelheim<br />
Gesellschaft und der - rundum akzeptierten - Zielvorstellung von<br />
der Mündigkeit des Schülers.<br />
Kontroversität: Was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, muss<br />
auch im Unterricht kontrovers erscheinen. Diese Forderung ist mit<br />
der vorgenannten aufs Engste verknüpft, denn wenn unterschiedliche<br />
Standpunkte unter den Tisch fallen, Optionen unterschlagen werden,<br />
Alternativen unerörtert bleiben, ist der Weg zur Indoktrination beschritten.<br />
Beide Grundsätze ergeben sich zwingend aus dem Wertehorizont<br />
des Grundgesetzes und den Funktionsbedingungen einer<br />
pluralen Demokratie. Damit erhält der Politikunterricht die Aufgabe,<br />
zur Werteerziehung in der Schule beizutragen.<br />
Erwartungen an den Sozialkundelehrer<br />
Der Sozialkundelehrer versteht sich - mehr noch als in anderen<br />
Fächern - als Moderator, nicht als bloßer Instruktor. Er stößt Denkprozesse<br />
an, regt Werturteile an und kommt zu Ergebnissen, die<br />
überprüfbar, aber auch revidierbar sind. Die Beherrschung von<br />
Methoden ist nicht nur zum Hinterfragen fachlicher Aussagen von<br />
Bedeutung sondern bildet im Zusammenhang mit dem Erwerb<br />
von politischer Handlungskompetenz (staatsbürgerlicher Kompetenz)<br />
ein Fundamentum des Sozialkundeunterrichts.<br />
Die Problemanalyse gehört zu den Standards des<br />
„problemorientierten Unterrichts“:<br />
Neben den herkömmlichen Formen der Analysetechnik, problembezogen<br />
oder zielorientiert, erfährt die Medienanalyse zunehmend<br />
in Verbindung mit produktionsorientierter Medienarbeit immer<br />
mehr an Wichtigkeit. Medienkompetenz wird zur fachunabhängigen<br />
Schlüsselqualifikation. Neben den bekannten unterrichtlichen<br />
Organisationsformen wie Rollenspiel, Projekt, Diskussion, Streitgespräch,<br />
Podiumsgespräch werden in der letzten Zeit weitere Formen<br />
angeboten, wie Expertensysteme und die Fish-bowl-Diskussion.<br />
Die Fallstudie ist eine klassische Großform der politischen<br />
Bildung. Auch Simulation und Zukunftswerkstatt gehören zu den<br />
verbreiteten Großformen im Sozialkundeunterricht. Neueren Datums<br />
sind die Produktlinienanalyse (TH. RETZMANN 2000) und<br />
die Szenario-Technik (P. WEINBRENNER 1999)<br />
Unter dem gemeinsamen fachübergreifenden Ziel der „Politischen<br />
Bildung“ wird die Kooperation der Sozialkunde mit anderen Fächern<br />
als selbstverständlich vorausgesetzt. So sind die drei gesellschaftswissenschaftlichen<br />
Fächer in der S II unter dem Dach der<br />
Gemeinschaftskunde zusammengefasst. An den Integrierten Gesamtschulen<br />
und z. T. an Regionalen Schulen sind Sozialkunde,<br />
Geschichte und Erdkunde sogar im Fach Gesellschaftslehre integriert.<br />
Insbesondere von der Sozialkunde als Leitfach müssen Grenzüberschreitungen<br />
zwischen den Fächern angestoßen und Kooperationen<br />
organisiert werden.<br />
Über die rein (fach)unterrichtlichen Aufgaben werden besonders<br />
Sozialkundelehrer mit weiter gehenden Erwartungen der Schulge-<br />
VII
Politische Bildung<br />
meinschaft konfrontiert. Das Spektrum reicht von der Wahrnehmung<br />
des Amtes eines Verbindungslehrers über die Initiierung und<br />
Betreuung von Streitschlichterprojekten bis zur Mitarbeit am Schulprofil.<br />
Es werden an sie auch Erwartungen gerichtet, eigenständige<br />
Beiträge zur Werteerziehung in der Schule zu leisten. Viele Ansätze<br />
zur Öffnung von Schule (derzeit verstärkt im Rahmen lokaler<br />
AGENDA 21 Prozesse) fordern den Sozialkundelehrer unmittelbar<br />
heraus. Es wird außerdem eine Vertrautheit im Umgang mit<br />
Schul- und Verwaltungsrecht unterstellt sowie eine besondere Kompetenz<br />
bei der Regelung innerschulischer Konflikte.<br />
Dieses komplexe Berufsbild hat für die Ausbildung im Studienseminar<br />
Konsequenzen:<br />
• Methodenkompetenz muss systematisch und praktisch vermittelt<br />
werden.<br />
• Um wissenschaftspropädeutisch wirken zu können, müssen Fachprofile<br />
der Bezugswissenschaften geklärt werden.<br />
• Fächer übergreifendes Arbeiten muss in Fächer übergreifenden<br />
Ausbildungsvorhaben erprobt und als machbar und bereichernd<br />
erfahren werden.<br />
• Politische Bildung fordert eine Fach unabhängige pädagogische<br />
Gestaltungskompetenz.<br />
Ausblick<br />
Fachleiter der Studienseminare beteiligen sich seit jeher intensiv<br />
an der (noch sehr geringen) fachdidaktischen Ausbildung in der<br />
ersten Ausbildungsphase und an der Lehrerfortbildung in allen<br />
Instituten. Wissenschaftsminister Zöllner hat im März 2002 einen<br />
Vorschlag für eine Reform der Lehrerbildung vorgelegt: „Professionalität<br />
und Praxisnähe sollen ausgebaut werden, die Ausbildung<br />
soll dichter an den Arbeitsmarkt rücken und die Ausbildungszeiten<br />
sollen verkürzt werden, aber es sollen keine Abstriche an die<br />
Zur Situation des Fachs Sozialkunde<br />
im Unterricht und in der Lehrerausbildung<br />
an berufsbildenden Schulen<br />
Der Sozialkundeunterricht in verschiedenen Schulformen der BBS<br />
Sozialkundelehrerinnen und -lehrer sind in der Regel in verschiedenen<br />
Schulformen der BBS eingesetzt und müssen sich permanent<br />
unterschiedlichen fachdidaktischen, -methodischen und pädagogischen<br />
Herausforderungen stellen. Im Umgang mit größtenteils<br />
schwierigen, teils bildungsunwilligen Schülern im Berufsvorbereitungsjahr<br />
(BVJ) oder im Berufsgrundbildungsjahr (BGJ)<br />
müssen sie entsprechende Lernarrangements finden, um der Schülerklientel<br />
Hilfen anzubieten in elementaren Lebensfragen, sie<br />
müssen aber auch versuchen, die Schülerinnen und Schüler für<br />
wichtige politische Fragen zu sensibilisieren und Grundeinsichten<br />
über das Politische zu vermitteln. Für die Kolleginnen und Kollegen<br />
bedeutet das Flexibilität und Einfühlungsvermögen, aber auch<br />
Einsatzbereitschaft, die manchmal bis an die Grenzen der körperlichen<br />
und psychischen Belastbarkeit gehen kann. Der flankierende<br />
Einsatz von Sozialarbeitern in diesen Schulformen hat sich bewährt<br />
und sollte unbedingt weitergeführt werden, damit die Lehrkräfte<br />
sich verstärkt mit Fragen der politischen Bildung und der<br />
Vermittlung politischen Fachwissens auseinandersetzen können und<br />
nicht ausschließlich sozialpädagogische Aufgaben übernehmen<br />
müssen, für die sie letztendlich nur teilweise ausgebildet wurden.<br />
VIII<br />
MT_Berkessel_12/02 8<br />
22.11.2002, 10:03 Uhr<br />
Schwarz<br />
Fachwissenschaft gemacht werden. „Bei der geplanten Reform der<br />
Lehrerausbildung werden die Studienseminare nochmals eine stärkere<br />
Verantwortung für eine qualifizierte Ausbildung des Lehrernachwuchses<br />
erhalten.“<br />
Dabei unterstützen alle Studienseminare eine deutliche Verstärkung<br />
der fachdidaktischen und unterrichtspraktischen Anteile in<br />
der ersten Phase der Lehrerausbildung. Die seit einigen Jahren von<br />
den Studienseminaren als Veranstaltung der Universitäten durchgeführten<br />
Fachpraktika können als erfolgreicher Probelauf für die<br />
angestrebte Verzahnung von Theorie und Praxis gelten. Ihre Übertragung<br />
auf alle Studenten überstiege die Personalressourcen der<br />
Studienseminare um ein Mehrfaches und die Kapazität der Schulen<br />
ebenso.<br />
Sorge bereiten, die Verdrängung einer soliden grundständigen fachwissenschaftlichen<br />
Ausbildung vom ersten Semester an durch die<br />
Zusammenführung der Studenten aller Schularten und die drastische<br />
Erhöhung pädagogischer Anteile im BA-Studium und damit<br />
einhergehend der Verlust an Durchlässigkeit zu anderen universitären<br />
Abschlüssen. Stärker wissenschaftsorientierte Studienanfänger<br />
(und dies gilt für einen großen Teil der jetzigen Gymnasiallehrer)<br />
könnten für Lehramtsstudiengänge verloren gehen.<br />
... ein letzter Blick<br />
Seit einigen Jahren steigen die Einstellungschancen für Sozialkundelehrer<br />
beträchtlich. 2002 erhielten nahezu alle Absolventen der<br />
Studienseminare eine Beschäftigung. In den nächsten Jahren wird<br />
die Lage ähnlich gut bleiben!<br />
Ulrike Westerburg, Fachleiterin für Sozialkunde,<br />
Studienseminar Koblenz<br />
Rainer Kohlhaas, Fachleiter für Sozialkunde,<br />
Studienseminar Bad Kreuznach<br />
Die Umsetzung von Lernarrangements in weiterführenden Schulformen<br />
der BBS (z.B. in der Fachoberschule oder in einem Leistungskurs<br />
Sozialkunde am beruflichen Gymnasium - Technisches<br />
Gymnasium) mit den Bildungsabschlüssen Fachhochschulreife oder<br />
Allgemeine Hochschulreife erfordert umfassende fachwissenschaftliche,<br />
-didaktische und methodische Kenntnisse- und Fähigkeiten.<br />
Aus diesen Rahmenbedingungen ergibt sich zwangsläufig, dass<br />
Sozialkundelehrerinnen und -lehrer an der BBS sich ständig mit<br />
Fragen der didaktischen Reduktion, der Binnendifferenzierung und<br />
Fach übergreifenden Unterrichtsprojekten auseinandersetzen und<br />
dabei Lernarrangements entwickeln, die elementare didaktische<br />
Prinzipien politischer Bildung, wie Problem- und Handlungsorientierung,<br />
Schülerorientierung (u. a. Bezüge zur Lebens- und Arbeitswelt)<br />
und Wertebewusstsein umsetzen.<br />
Für die meisten dieser Schulformen liegen neuere Lehrpläne vor,<br />
die sich (soweit das Fach Sozialkunde als Schulfach vorgesehen ist)<br />
modernen didaktischen Prinzipien politischer Bildung (wie z.B.<br />
Problemorientierung, Handlungsorientierung, Schülerorientierung,<br />
Projektidee etc.) verpflichtet fühlen. Viele Kolleginnen und<br />
Kollegen engagieren sich zusätzlich in Schulentwicklungsprojekten,<br />
Schulleitbildkommissionen und Teamprojekten, womit sie<br />
letztendlich auch „politische Bildungsarbeit“ verrichten, indem sie<br />
ihren qualitativen Beitrag leisten zur Entwicklung einer demokratischen,<br />
Werte bewussten Schulkultur.<br />
Der Sozialkundeunterricht an der Schulform „Berufsschule“<br />
Der zahlenmäßig größte Teil der Schülerinnen und Schüler der
BBS besucht die Schulform „Berufschule“ im Rahmen des sog.<br />
Dualen Systems. Dabei wird die Ausbildung von den dualen Partnern<br />
Betrieb und Schule organisiert, meist so, dass die Schülerinnen<br />
und Schüler an 1 - 2 Tagen in der Woche die Berufsschule<br />
besuchen. Aus dem Schulgesetz und den gültigen Lehrplänen lassen<br />
sich hehre Ziele für den Sozialkundeunterricht ableiten: „Die<br />
Demokratie braucht mündige Bürger, die fähig und bereit sind, Zukunftsaufgaben<br />
zu übernehmen und elementare Herausforderungen<br />
in der Gesellschaft zu meistern.“ Entgegen diesen Zielvorgaben und<br />
den Lippenbekenntnissen vieler Politiker über den Stellenwert<br />
politischer Bildung gerade auch im Rahmen einer fundierten Berufsausbildung<br />
wurde mit der Berufsschulverordnung vom 13.<br />
August 1997 der Unterricht radikal gekürzt. Die ursprünglich getrennten<br />
Fächer Sozialkunde und Wirtschaftslehre wurden zusammengefasst,<br />
wobei der Unterrichtsumfang insgesamt etwa um die<br />
Hälfte von 240 auf 120 Stunden reduziert wurde.<br />
Der mit dieser radikalen Verkürzung des Unterrichts verbundene<br />
Kahlschlag in der politischen Bildung an der Berufsschule wird<br />
auch nicht durch die Einführung eines Wahlpflichtfaches „Politik“<br />
behoben, das gemäß Berufsschulverordnung angeboten werden<br />
muss, wenn mindestens 15 Schülerinnen und Schüler, die organisatorisch<br />
in einer Lerngruppe zusammengefasst werden können,<br />
sich dafür melden. Bisherige Erfahrungen haben gezeigt, dass<br />
diese Möglichkeit von den meisten Schulen erst gar nicht angeboten<br />
wird und somit reinen Alibicharakter besitzt. Dies stimmt auch<br />
insofern traurig, als inzwischen genügend gut ausgebildete Fachlehrerinnen<br />
und -lehrer zur Verfügung stehen, um einen qualifizierten<br />
Unterricht zu erteilen. Auch der entsprechende Lehrplanentwurf<br />
zum Wahlpflichtfach Politik als Curriculum im Prozess<br />
kann mit seinen inhaltlichen Schwerpunktsetzungen und den dargelegten<br />
Handlungsimpulsen in seiner Konzeption überzeugen. Es<br />
bleibt zu hoffen, dass er zumindest in den Fachkonferenzen rezipiert<br />
wird und auch wertvolle Anregungen geben kann für Projekte,<br />
die im Rahmen des neuen Unterrichtsfaches Sozialkunde/Wirtschaftslehre<br />
umgesetzt werden können.<br />
Ein elementarer Kritikpunkt in der Ausbildung ist die bisherige<br />
Form der Kammerprüfung (Gesellenprüfung), die sich überhaupt<br />
nicht an den im Lehrplan orientierten Zielvorgaben orientiert und<br />
die jegliche schulische Vorleistungen der Schülerinnen und Schüler<br />
ignoriert. Die Kenntnisprüfung im Fach Wirtschafts- und Sozialkunde<br />
ist größtenteils immer noch als reine Ankreuzübung<br />
konzipiert und zeigt sich als Mischung zwischen teils banal anmutenden<br />
Aufgaben und Abfragen arbeitsrechtlichen Spezialwissens.<br />
Beispielfragen aus der programmierten Aufgabendatenbank<br />
Welcher Betrieb ist ein Handwerksbetrieb?<br />
a) Baumarkt b) Buchhandlung c) die Bäckerei<br />
d) das Einzelhandelsgeschäft<br />
Wie hoch ist der Zuschlag für das zusätzliche Urlaubsgeld?<br />
a) 35 % des Urlaubsentgelts b) 15 % des Urlaubsentgelts<br />
c) 25 % des Urlaubsentgelts d) 10 % des Urlaubsentgelts<br />
Fragen, die das Denk- und Urteilsvermögen der Schülerinnen und<br />
Schüler herausfordern und kreative Lösungsvarianten zulassen, sind<br />
nicht vorgesehen. Der Anteil der Fragen aus dem Bereich Wirtschaftslehre<br />
beträgt teilweise bis zu 70 %. Als verantwortlicher Pädagoge,<br />
der die Klasse gewissenhaft auf die Prüfung vorbereitet, ist<br />
man folglich gezwungen, die letzten Wochen vor der Gesellenprüfung<br />
mit den Schülerinnen und Schüler wertvolle Unterrichtszeit auf<br />
MT_Berkessel_12/02 9<br />
22.11.2002, 10:03 Uhr<br />
Schwarz<br />
Politische Bildung<br />
das stupide Ausfüllen von sog. Prüfungsvorbereitungsheften (vergleichbar<br />
der Führerscheinprüfung) zu verwenden. Mit politischer und ökonomischer<br />
Bildung und der Vermittlung eines kritischen Denk- und<br />
Urteilsvermögens haben diese Modalitäten nicht das Geringste zu tun.<br />
Folgende Forderungen sind daher überfällig:<br />
1. Die schulischen Vorleistungen der Schülerinnen und Schüler<br />
sollten mit einem Anteil von 40 % als Vornote in die Gesellenprüfung<br />
einfließen.<br />
2. Die Fragestellungen sollten sich stärker an den Zielvorstellungen<br />
des bestehenden Lehrplans orientieren und federführend von<br />
den Lehrkräften konzipiert werden.<br />
Zur Situation des Faches Sozialkunde in der Ausbildung<br />
(Lehramt für berufsbildende Schulen)<br />
Die Universität Kaiserslautern ist für Lehramtsstudierende mit Erstfach<br />
Elektrotechnik, Maschinenbau oder Bautechnik ein beliebter<br />
Studienort, als Zweitfach wird dabei oft das Studienfach Sozialkunde<br />
gewählt. In Anbetracht der Tatsache, dass in Zukunft in<br />
vielen Fachgebieten in der Ausbildung Lernfeld orientierte, Fach<br />
übergreifende Lehrplankonzepte verstärkt umgesetzt werden, erscheint<br />
diese Studienkombination (technisches Fach + allgemein<br />
bildendes Fach) sehr sinnvoll. Als Konsequenz aus der Zusammenlegung<br />
der Fächer Sozialkunde und Wirtschaftslehre in der Schulform<br />
Berufsschule wurde der Studiengang Wirtschaftslehre eingestellt,<br />
wobei grundlegende wirtschaftswissenschaftliche Studieninhalte<br />
Eingang fanden in die neue Studienordnung für das Fach<br />
Sozialkunde. Diese Regelung erscheint als sinnvolle Verzahnung<br />
politischer und ökonomischer Bildung.<br />
Im Hinblick auf Professionalisierung und Qualitätssicherung künftiger<br />
Lehrerausbildung ist es bereits zu einer stärkeren Verzahnung der<br />
ersten und zweiten Phase der Lehrerausbildung in Kaiserslautern gekommen.<br />
Im Rahmen der Erstausbildung an der Universität werden<br />
einzelne fachdidaktische Übungen und Seminare von Fachleitern aus<br />
den Studienseminaren mitgestaltet. Auf Anregung des Landesprüfungsamtes<br />
wird seit 1999 an der Universität Kaiserslautern auch ein Fachpraktikum<br />
in Sozialkunde/Wirtschaftslehre angeboten, das vom Studienseminar<br />
betreut und von den Studierenden sehr positiv bewertet<br />
wird. Ziel dieses Pilotprojektes ist die stärkere Verzahnung der wissenschaftlich<br />
orientierten Hochschulausbildung in der ersten Phase mit<br />
der stärker berufspraktisch orientierten zweiten Phase der Lehrerausbildung.<br />
Die Heranführung an die Unterrichtspraxis und das Kennenlernen<br />
zentraler Elemente des Unterrichtens und Erziehens im Berufsfeld<br />
Schule soll den Studierenden Chancen eröffnen, ihre an der<br />
Universität erworbenen fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen und<br />
erziehungswissenschaftlichen Kenntnisse frühzeitig im eigenen Unterricht<br />
einer fachpraktischen Überprüfung zu unterziehen. Die Auswertungen<br />
und Beratungsgespräche sollen ihnen auch Hilfestellungen<br />
leisten bei ihrer weiteren Studien- und Berufsmotivation.<br />
Diese ersten Kooperationsmodelle zeigen, dass die Universität Kaiserslautern<br />
geeignet erscheint als möglicher Standort eines Lehrerbildungszentrums<br />
im Konzept der neuen Lehrerausbildung. Es bleibt zu<br />
hoffen, dass der frei werdende Lehrstuhl „Politisches System der Bundesrepublik<br />
Deutschland / Innenpolitik“ wieder besetzt wird, damit<br />
in der künftigen Sozialkundelehrerausbildung für allgemein- und berufsbildende<br />
Schulen in Kaiserslautern auch qualifizierte Angebote<br />
gemacht werden können.<br />
StD Alfred Lui, Fachleiter für Sozialkunde und Wirtschaftslehre,<br />
Staatliches Studienseminar für BBS Speyer/<br />
Außenstelle Kaiserslautern<br />
IX
Politische Bildung<br />
„Wir brauchen eine Verstärkung der ökonomischen Bildung, aber wir brauchen<br />
kein eigenes Fach Ökonomie“<br />
Interview mit der Ministerin für Bildung, Frauen und Jugend, Doris Ahnen<br />
Aus Anlass der in dieser Sonderbeilage<br />
zur <strong>GEW</strong>-Zeitung<br />
dargestellten Bestandsaufnahme<br />
zur Lage der politischen Bildung<br />
in <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong>, führten<br />
Dr. Thomas Simon, Vorsitzender<br />
des rheinland-pfälzischen<br />
Landesverbandes der<br />
Deutschen Vereinigung für politische<br />
Bildung (DVPB), und<br />
Hans Berkessel (<strong>GEW</strong> und<br />
DVPB-LV-RLP) ein etwa eineinhalbstündiges<br />
Gespräch zum<br />
Thema, das hier in einer gekürzten<br />
Fassung abgedruckt<br />
wird. Dabei wurden die Situation<br />
des Sozialkundeunterrichts an allgemeinbildenden und berufsbildenden<br />
Schulen, die Frage nach der Bedeutung einer ökonomischen<br />
Grundbildung, die Situation der Sozialkundelehrer-<br />
Ausbildung, Schlussfolgerungen, die sich aus der PISA-Studie<br />
für die politische Bildung ergeben und schließlich Maßnahmen<br />
zur Stärkung der Partizipation von Jugendlichen diskutiert.<br />
Dr. Simon: Der erste Themenkomplex, den wir ansprechen möchten,<br />
betrifft die Situation des Sozial- und Gemeinschaftskundeunterrichts<br />
an allgemeinbildenden und insbesondere an berufsbildenden Schulen.<br />
Wie beurteilen Sie diese Situation? Welche Anregungen können Sie den<br />
Lehrer/innen im Lande mitgeben, die das Fach an der Berufsbildenden<br />
Schule unterrichten.<br />
Ahnen: Der Sozialkundeunterricht an unseren Schulen ist aus<br />
meiner Sicht ein wichtiges Fach, wobei wir, wenn wir über politische<br />
Bildung reden, nicht nur den Sozialkundeunterricht in den<br />
Blick nehmen dürfen. Der Sozialkundeunterricht vermittelt wichtige<br />
Inhalte und wichtige Grundlagen, aber in Teilbereichen findet<br />
politische Bildung zwangsläufig auch in Fächern wie Erdkunde<br />
und Geschichte statt. Dies muss ineinander greifen. Im Übrigen<br />
bin ich der Meinung, dass über die Fächer hinaus, politische<br />
Bildung und dabei insbesondere die aktive Beteiligung von Jugendlichen<br />
eben auch insgesamt eine Aufgabe der Schulgemeinschaft<br />
ist und sich nicht nur auf ein einzelnes Fach beschränken<br />
kann. Die Situation in den berufsbildenden Schulen ist sicher noch<br />
einmal eine spezifische - wobei man hier auch unterscheiden muss<br />
zwischen Teilzeit und Vollzeit berufsbildenden Schulen - weil die<br />
politische Bildung hier natürlich stärker auf berufsbezogene Inhalte<br />
konzentriert ist. Trotzdem finde ich es wichtig, dass auch<br />
allgemein bildende Inhalte in den berufsbildenden Schulen vermittelt<br />
werden, und auf dieser Linie haben wir uns in der Vergangenheit<br />
immer engagiert und werden dies auch in Zukunft tun.<br />
Dr. Simon: Könnten Sie sich vorstellen, den Prüfungsbereich Sozialkunde<br />
aus der alleinigen Verantwortung der IHK herauszunehmen<br />
und den berufsbildenden Schulen und den Kollegien ein Stück Mitverantwortung<br />
zu übertragen?<br />
X<br />
MT_Berkessel_12/02 10<br />
22.11.2002, 10:03 Uhr<br />
Schwarz<br />
Ahnen: Da ja der Unterricht an den berufsbildenden Schulen nicht<br />
auf den Sozialkundeunterricht beschränkt ist, ist dies eine generelle<br />
Frage: Wie verhält es sich mit der Prüfung? Und wieweit sind<br />
schulische Leistungen in diese Prüfung einbezogen? Ich sehe im<br />
Moment keine Chance, hier jetzt isoliert für die Sozialkunde zu<br />
Veränderungen zu kommen. Und bezüglich der generellen Frage<br />
sind wir immer wieder im Gespräch.<br />
Berkessel: Aus einer Erhebung unter Mitgliedern unseres Verbandes<br />
geht hervor, dass neben der verständlichen Klage über die Einstündigkeit<br />
des Faches, viele Kolleginnen und Kollegen monieren, dass der<br />
Sozialkundeunterricht an vielen Schulen offenbar als fachfremder Unterricht<br />
erteilt wird. Andererseits sind die Empfehlungen, die vom Ministerium<br />
in Richtung Lehrerausbildung gegeben werden, so gehalten,<br />
dass nun nicht gerade zugeraten wird, Sozialkunde zu studieren, obwohl<br />
doch offenkundig in der Praxis des schulischen Alltags ein Mangel<br />
an Sozialkundelehrerinnen und -lehrern besteht. Wie passt das zusammen?<br />
Ahnen: Ich möchte zunächst noch einmal auf die Frage nach dem<br />
Stundenansatz und die Problematik der einstündigen Fächer eingehen.<br />
Ich sehe sehr wohl auch die didaktischen Schwierigkeiten<br />
der einstündigen Fächer. Deswegen halte ich es für sehr wichtig,<br />
dass eine Fächer übergreifende Abstimmung stattfindet, damit so<br />
etwas wie politische Bildung eben auch über die Sozialkunde hinaus,<br />
verknüpft mit Erdkunde und Geschichte vermittelt werden<br />
kann. Ich bin aber andererseits sehr vorsichtig, die Wertigkeit eines<br />
inhaltlichen Bereiches am Stundenansatz zu messen. Ich möchte<br />
dies gerne an einem Beispiel aus dem Sommer des vergangenen<br />
Jahres verdeutlichen. Wir hatten rechtsextremistische Vorfälle und<br />
viele sagten, jetzt muss der Anteil der Sozialkunde gesteigert werden.<br />
Zur gleichen Zeit forderten die Wirtschaftsverbände ein eigenes<br />
Fach Wirtschaft; der VDI ein Fach Technik. Dann war das<br />
europäische Jahr der Sprachen, und alle Welt sagte, die modernen<br />
Fremdsprachen brauchen einen höheren Stundenansatz, und<br />
schließlich gab es aufgrund der gesamtgesellschaftlichen Situation<br />
auch genügend Stimmen, die nach einer Ausweitung der Fächer<br />
Religion und Ethik verlangten. Jeder hat seine Interessen richtig<br />
vertreten, und jede dieser Forderungen war für sich genommen<br />
auch nachvollziehbar. Die Politik hat aber nun die Aufgabe diese<br />
divergierenden Interessen und Forderungen zusammenzubringen.<br />
Und selbst bei einer denkbaren Erweiterung der Stundentafel hätte<br />
ich diese unterschiedlichen Anliegen nie unterbringen können.<br />
Insofern kann sich auch ein Fach wie Sozialkunde nicht der Diskussion<br />
um die Frage entziehen: Was wollen wir unseren Schülerinnen<br />
und Schülern vermitteln und mit auf ihren weiteren Lebensweg<br />
geben? Und dann müssen die Lehrerinnen und Lehrer,<br />
muss die Schule sagen: Wie können wir das erreichen? Ich habe<br />
aber den Eindruck, bei uns läuft die Debatte immer umgekehrt:<br />
Zuerst reden wir mal über den Stundenansatz, dann überlegen wir,<br />
wie das alles auch noch zueinander passt. So werden wir - davon<br />
bin ich fest überzeugt - nicht weiterkommen.<br />
Dr. Simon: Zwei ergänzende Fragen: Kennen Sie ungefähr den Bedarf<br />
an Sozialkundelehrerinnen und -lehrern in den nächsten fünf bis zehn
Jahren? Und welches Maß an fachfremdem Unterricht halten Sie für<br />
erträglich?<br />
Ahnen: Also zur ersten Frage, den fächerspezifischen Bedarf kann<br />
ich Ihnen im Moment nicht sagen. Das ist auch ausgesprochen<br />
schwierig. Wir versuchen im Moment eine stärker fächerbedarfsorientierte<br />
Prognose zu erstellen, aber auch die hat erhebliche<br />
Ungenauigkeiten. Insofern ist das im Moment für mich nicht mit<br />
einer Zahl quantifizierbar. Das gilt aber insgesamt für Lehrerbedarfsprognosen.<br />
Es gibt dabei eine ganze Reihe von Unbekannten,<br />
z.B. die Frage der Ruhestandsversetzung, der Inanspruchnahme<br />
der Altersteilzeit und vieles anderes. Zu Ihrer Frage nach dem fachfremden<br />
Unterricht kann ich nur sagen, da gibt es eigentlich kein<br />
erträgliches Maß, das ist vielmehr immer eine Frage der Alternative.<br />
Wenn ich z.B. an einer kleinen Schule nur einen Sozialkundelehrer<br />
habe, der aber den Unterricht z.B. in den 9. Klassen nicht<br />
abdecken kann, dann sage ich, wenn es jemanden gibt, der Geschichte<br />
studiert hat und eine Lehrerfort- und -weiterbildung in<br />
Sozialkunde gemacht hat, dann ist es besser, dass der in der 9a und<br />
in der 9b Sozialkundeunterricht anbietet, als wenn keiner stattfände.<br />
Ich möchte ergänzend darauf hinweisen, dass es inzwischen die<br />
ersten schulscharfen Ausschreibungen im Fach Sozialkunde gibt,<br />
d. h. wir haben hier noch ein zusätzliches Bedarfssteuerinstrument<br />
eingebaut, um solchen Unterrichtsausfall auch zu verhindern.<br />
Berkessel: Lassen Sie uns an dieser Stelle noch einmal zur Frage nach<br />
den Anforderungen an das Fach Sozialkunde zurückkommen. Ich nenne<br />
als Stichwort die „ökonomische Bildung“. Welche Position vertreten Sie<br />
denn innerhalb der öffentlichen Diskussion, deren eine Richtung ein<br />
eigenes Fach „Ökonomie“ oder „Wirtschaftskunde“ zu Lasten etwa der<br />
Sozialkunde verlangt, während andere gute Ansätze sehen, wirtschaftskundliche<br />
Inhalte in das Fach Sozialkunde zu integrieren?<br />
Ahnen: Wir brauchen eine Verstärkung der ökonomischen Bildung,<br />
aber wir brauchen aus meiner Sicht kein eigenes Fach Ökonomie,<br />
wobei wir in Teilbereichen ja bereits etwas Ähnliches haben, wenn<br />
ich etwa an den Wahlpflichtbereich an Realschulen oder an das<br />
Fach Arbeitslehre an Haupt- und Gesamtschulen denke. Ein eigenes<br />
zusätzliches Fach halte ich nicht für praktikabel, eine Verstärkung<br />
der Anteile der ökonomischen Bildung allerdings ja. Ich kann<br />
mir weder vorstellen, dass man Sozialkunde unterrichtet, ohne auch<br />
Kenntnisse wirtschaftlicher Zusammenhänge zu vermitteln, noch<br />
dass man Erdkunde oder Geschichte lehren kann, ohne dabei auch<br />
wirtschaftlichen globalen aktuellen oder historischen Fragestellungen<br />
nachzugehen. Ich kann mir im Gegenteil sehr wohl vorstellen,<br />
dass man auch in einem Fach wie Mathematik stärker auf ökonomische<br />
Zusammenhänge eingehen kann. Das gilt auch für den<br />
Deutschunterricht und viele andere Fächer.<br />
Da ich aber den Ansatz, bei jedem inhaltlichen Bedürfnis immer<br />
noch ein zusätzliches Fach draufzusatteln, für nicht praktikabel<br />
und letztlich auch nicht für wirkungsvoll halte, weil es sich ja dabei<br />
wieder um ein einstündiges Fach handelte und damit um eine<br />
Unterrichtssituation, die Sie ja zu recht beklagen, bin ich sehr dezidiert<br />
der Meinung, dass wir diesen Bereich Fächer übergreifend<br />
integrieren müssen. Deswegen haben wir ja Richtlinien zur ökono-mischen<br />
Bildung erarbeitet, die in die Schulen gegeben wurden.<br />
Berkessel: Können Sie uns einmal sagen, wie man sich das in der Praxis<br />
vorzustellen hat? Nach unserem Eindruck haben sowohl die Erstaus-<br />
MT_Berkessel_12/02 11<br />
22.11.2002, 10:03 Uhr<br />
Schwarz<br />
Politische Bildung<br />
bildung als auch die Lehrerfortbildung bisher im Bereich ökonomische<br />
Bildung enorme Defizite. Was kann aus Ihrer Sicht hier geschehen, um<br />
Lehrerinnen und Lehrern Mut zu machen, sich an dieses Thema mehr<br />
als bisher heranzutrauen.<br />
Ahnen: Die Frage nach der praktischen Umsetzung stellt sich natürlich<br />
bei jedem Projekt, das wir auf den Weg bringen, weil sich<br />
die praktische Umsetzung letztlich in 1.700 Schulen im Land<br />
vollziehen muss. Daher werden diese Empfehlungen an die Schule<br />
als Ganzes herantragen. Und wir bitten die Schulleitungen, alle,<br />
die davon betroffen sind, in den Schulen zusammen zu rufen und<br />
dann auch ein entsprechendes Konzept für die jeweilige Schule zu<br />
entwickeln. Das ist ein Bestandteil von Qualitätsentwicklung von<br />
Schule, so wie wir das ja insgesamt auf den Weg bringen. Sie wissen,<br />
mit dem Schuljahr 2002/2003 sollen die Schulen sich ein<br />
Qualitätsprogramm geben, in dem sie auch Ziele festschreiben und<br />
formulieren: Auf welchem Wege und mit welchen Methoden wollen<br />
wir diese Ziele erreichen? Dazu gehört für mich auch der Bereich<br />
ökonomische Bildung. Die Einführung dieses Bereichs muss<br />
natürlich durch entsprechende Maßnahmen der Fort- und Weiterbildung<br />
begleitet werden. Da gibt es auch bereits Ansatzpunkte,<br />
wobei man nicht nur mit Hilfe von Präsenzveranstaltungen<br />
sondern auch durch Fernweiterbildungsangebote Zusatzqualifikationen<br />
erwerben kann, wie beispielsweise in dem Projekt „Ökonomische<br />
Bildung online“ deutlich wird, das wir gemeinsam mit der<br />
Bertelsmann-Stiftung durchführen.<br />
Zudem ist schon heute zum Beispiel in der neuen Landesverordnung<br />
für Gymnasien festgelegt, dass Studierende des Faches Sozialkunde<br />
im Grundstudium eine Übung in Volkswirtschaft oder<br />
Wirtschaftspolitik belegen müssen.<br />
Dr. Simon: Das kann ich bestätigen: Der Stundenansatz ökonomischer<br />
Inhalte in den Studienordnungen hat sich relevant erhöht. Andererseits<br />
hängt aber die Wahlentscheidung der Studierenden zentral vom<br />
realen Studienangebot und der Betreuung ab. Es gibt in diesem Zusammenhang<br />
die Empfehlung der Deutschen Vereinigung für politische<br />
Wissenschaften, die von den klassischen fünf Teilgebieten ausgeht, die<br />
am besten jeweils durch eine Professur vertreten würden. Im Minimum<br />
sollten aber mindestens zwei Teilgebiete durch eine Professur vertreten<br />
sein.. Gibt es von Ihrer Seite Wünsche bzw. Mindestforderungen<br />
bezüglich der personellen Mindeststandards für die Erstausbildung der<br />
künftigen Sozialkundelehrerinnen und - lehrer?<br />
Ahnen: Zunächst gibt es da den Wunsch, dass eine qualifizierte<br />
Erstausbildung der Sozialkundelehrerinnen und -lehrer weiterhin<br />
an den Universitäten erfolgt. Aber, dazu habe ich viel zu lange<br />
Wissenschaftspolitik gemacht, als dass ich mich auf eine Debatte<br />
einlassen würde, die da heißt: Die Qualität misst sich daran, ob es<br />
für fünf oder 27 Teilgebiete fünf Professoren oder 27 Professoren<br />
habe. Ich kann Ihnen aufgrund ganz persönlicher Erfahrungen<br />
sagen: Wenn Sie einen hervorragenden Professor haben, dann gehen<br />
die Studierenden ganz jenseits von irgendwelchen Teilgebieten<br />
in dessen Veranstaltungen und bekommen dort sehr viel mit.<br />
Berkessel: Aber dennoch - unabhängig davon, ob die Teilgebiete nun<br />
durch eine Professur oder andere Vertreter der akademischen Lehre abgedeckt<br />
werden - spielt ja die Breite des Lehrangebotes, d. h., welche<br />
Teilgebiete überhaupt angeboten werden, eine entscheidende Rolle für<br />
die Qualität der Ausbildung. Wenn das Lehrangebot so aussieht, dass<br />
bestimmte Teilbereiche überhaupt nicht oder nur in Rudimenten vorhanden<br />
sind, also etwa nur durch Übungen oder fakultative Veranstal-<br />
XI
Politische Bildung<br />
tungen repräsentiert sind, dann sind damit doch unabdingbar Defizite<br />
hinsichtlich der Qualität verbunden. Wenn man also z.B. das Studienangebot<br />
an den Universitäten Mainz und Kaiserslautern vergleicht,<br />
dann liegen da schon Welten dazwischen. Und es kann doch nicht angehen,<br />
dass künftige Lehrerinnen und Lehrer mit völlig unterschiedlichem<br />
Fundament in die Schulen kommen.<br />
Ahnen: Die Qualität eines Studiengangs lässt sich nicht allein an<br />
der Anzahl der dort beschäftigten Professorinnen und Professoren<br />
messen. Ich lege Wert darauf, dass es eine vernünftige Ausbildung<br />
gibt. Dazu gehört sicher auch eine vernünftige Personalausstattung.<br />
Ich möchte meine generelle Position noch einmal an einem<br />
Beispiel verdeutlichen: Wenn ich zum Beispiel an einer Hochschule<br />
einen tollen Ökonomen in einem benachbarten Fachbereich zur<br />
Politikwissenschaft habe, dann ist dies auch eine andere Situation,<br />
als wenn ich nur einen oder zwei Professoren in der Politikwissenschaft<br />
habe, die nur ganz eng ihr Fachgebiet abdecken. Da muss<br />
man sich die Situation vor Ort anschauen. Eine Definition, die<br />
sich darauf beschränkt zu sagen, für jedes Teilgebiete der Politikwissenschaft<br />
muss es auch jeweils einen Professor geben, der dieses<br />
abdecken, ist aus meiner Sicht nicht zielführend. Entscheidend<br />
ist, dass das, was in den Studienordnungen gefordert wird, auch<br />
vorgehalten und qualitativ hochstehend angeboten wird. Das ist<br />
für mich die Messlatte.<br />
Berkessel: Wenn Sie die Ergebnisse der PISA-Studie und auch des Ländervergleichs<br />
nehmen, gibt es da für Sie Zusammenhänge mit der politischen<br />
Bildung. Ich nenne einmal zwei Stichworte: Aus der Studie<br />
ergibt sich, dass die Förderung der schwächeren Schüler, insbesondere<br />
auch ausländischer Schülerinnen und Schüler, also von Kindern und<br />
Jugendlichen aus Migrationsfamilien, bei weitem nicht ausreicht bzw.<br />
zu unbefriedigenden Ergebnissen führt. Der zweite Aspekt, der unseren<br />
Bereich vielleicht tangiert, ist die Frage nach der Chancengleichheit.<br />
Dies war ja in den siebziger Jahren ein zentrales Thema, gerade<br />
auch sozialdemokratischer Bildungspolitik. Und nun stellen wir fest,<br />
dass auch da, wo man sich dieses Ziel besonders auf die Fahnen geschrieben<br />
hat, es in der Realität, doch nicht so bewerkstelligt worden<br />
ist.<br />
Ahnen: Also, wenn Sie damit ausdrücken wollten, dass die Sozialdemokraten<br />
und die sozialdemokratisch regierten Länder damit<br />
besondere Schwierigkeiten haben, dann muss ich Ihnen mit Nachdruck<br />
widersprechen. Es gibt insgesamt für die Bundesrepublik,<br />
explizit schon bei PISA-International und jetzt bei PISA-E bestätigt<br />
für alle Bundesländer, zwei Erkenntnisse, die neben dem<br />
schlechten Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler aus meiner<br />
Sicht sehr betrüblich sind. Das eine ist, dass es nach wie vor<br />
einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Bildungserfolg und<br />
sozialer Herkunft gibt. Der Bildungserfolg wird auch bei PISA<br />
anhand zweier unabhängiger und nicht miteinander korrelierender<br />
Indikatoren festgestellt. Der eine ist formal die Bildungsbeteiligung,<br />
d.h. wieviel Kinder - nach dem klassischen Schichtenmodell<br />
- aus einem Arbeiterhaushalt besuchen ein Gymnasium bzw.<br />
wieviel schwieriger ist es für ein Arbeiterkind ein Gymnasium zu<br />
besuchen. Das wird dann noch einmal korreliert mit den tatsächlichen<br />
kognitiven Fähigkeiten dieser Kinder. Und hier ist es nun<br />
so, dass Bayern dabei sehr schlecht abschneidet, und Bayern ist ja<br />
nun nicht gerade sozialdemokratisch regiert. Aber auch <strong>Rheinland</strong>-<br />
<strong>Pfalz</strong> hat hier ein Problem so wie auch alle anderen Bundesländer.<br />
Der zweite Punkt ist, dass dann untersucht wird, wie der Leistungsstand<br />
der Schülerinnen und Schüler unter dem Aspekt der sozia-<br />
XII<br />
MT_Berkessel_12/02 12<br />
22.11.2002, 10:03 Uhr<br />
Schwarz<br />
len Herkunft aussieht. Und da ist es dann so, dass wir in <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong>,<br />
wenn auch nicht zufrieden stellend, - es schneidet in<br />
diesem Zusammenhang niemand zufriedenstellend ab - aber auch<br />
nicht auffällig schlecht abschneiden. Wir lösen dieses Problem sogar<br />
etwas besser als andere Bundesländer. Insofern ist dieses Problem<br />
aus meiner Sicht sehr differenziert zu betrachten. Der zweite<br />
Befund bezieht sich auf die Kinder mit Migrationshintergrund,<br />
die nach wie vor erhebliche Benachteiligungen und Schwierigkeiten<br />
haben. Wahrscheinlich überlagern sich auch die beiden Befunde<br />
und ihre Ursachen, diese sind nicht völlig unabhängig voneinander.<br />
Und auch hier gilt: Alle Länder haben Handlungsbedarf,<br />
manche etwas mehr und manche etwas weniger. Bei uns in<br />
<strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> ist es so, dass wir hier im mittleren Bereich liegen.<br />
Es gibt Bundesländer, in denen die Diskrepanz zwischen deutschen<br />
Kindern und Kindern mit Migrationshintergrund sehr viel<br />
größer ist. In beiden Fällen ergibt sich hieraus die klare Aufforderung<br />
zum Handeln, damit kann man nicht zufrieden sein, da muss<br />
man etwas tun im Bereich der Migrationskinder. Inzwischen haben<br />
wir eine ganze Reihe von Maßnahmen auf den Weg gebracht,<br />
die vor allem auf eine frühere Förderung der Deutschkenntnisse<br />
hinaus laufen, schon im Kindertagesstättenbereich, die aber auch<br />
in andere Bereiche hinein reichen. So wollen wir Realschulen und<br />
Gymnasien in Ballungszentren auswählen, die für „Seiteneinsteiger“,<br />
die zu einem späteren Zeitpunkt nach Deutschland gekommen<br />
sind, zwar noch sprachliche Probleme haben, aber ansonsten<br />
erfolgreich an einem Realschul- oder Gymnasialbildungsgang teilnehmen<br />
können, besondere Förderangebote machen. Der Aspekt<br />
der sozialen Herkunft ist mindestens genauso problematisch. Ich<br />
sage Ihnen, bisher hat mir niemand eine bessere Antwort gegeben,<br />
als die der Ganztagsschule. Die Analysen zeigen, dass diese Kinder<br />
dadurch benachteiligt sind, dass sie ein wenig bildungsnahes<br />
und wenig bildungsanregendes heimisches Umfeld haben, im Gegensatz<br />
zu den Schülerinnen und Schülern, die Bildungsangebote<br />
im Elternhaus oder durch vom Elternhaus organisierte Angebote<br />
erfahren. Wenn man hier ein Stück mehr Chancengleichheit herstellen<br />
will, kann dies mit Hilfe der Ganztagsschule funktionieren.<br />
Das ist zumindest einer der zentralen Ansatzpunkte. Ich war beispielsweise<br />
in einer Schule in einem sozialen Brennpunkt, die zum<br />
laufenden Schuljahr Ganztagsschule geworden ist und deshalb über<br />
enorm hohe Anmeldezahlen verfügt. Ich habe erfahren, was die<br />
Kinder brauchen und was sie, wenn sie keine Ganztagsangebot<br />
haben, am Nachmittag erleben. Insofern bin ich fest davon überzeugt,<br />
dass Ganztagsschule hier eine mögliche Antwort ist. Nun<br />
zum Zusammenhang mit der politischen Bildung: Da politische<br />
Bildung im weitesten Sinne unser Zusammenleben in dieser Gesellschaft<br />
behandelt, betrifft das alles auch die politische Bildung.<br />
Und wenn ich jetzt an Kinder mit Migrationshintergrund denke<br />
oder auch an solche, die soziale Benachteiligung erfahren, dann<br />
hat die Schule insgesamt - sicherlich auch über die politische Bildung<br />
- natürlich auch den Auftrag, solche Dinge bewusst zu machen,<br />
dafür zu sensibilisieren und den Umgang damit einzuüben.<br />
Das wären für mich die mittelbaren Konsequenzen aus PISA. Zur<br />
politischen Bildung direkt macht die PISA-Studie selbst keine<br />
Aussagen.<br />
Berkessel: Sie haben ja eben selbst an einem konkreten Beispiel deutlich<br />
gemacht, dass gerade Schulen, die sich in so genannten „sozialen<br />
Brennpunkten“ befinden, gerne zu dem Instrumentarium der Ganztagsschule<br />
greifen. Gibt es von Seiten des Ministeriums Überlegungen
oder bereits Konzepte, wie man mit Problemen wie Gewalt in der Schule<br />
oder Diskriminierung von Ausländern auch im Rahmen der Ganztagsangebote<br />
und vielleicht in Kooperation mit anderen Trägern stärker<br />
und nachhaltiger einwirken kann?<br />
Ahnen: Ich möchte in zwei Teilen antworten. Zunächst mal zu<br />
den Maßnahmen jenseits von Ganztagsschule: Wenn ich über politische<br />
Bildung spreche, dann rede ich im Kern von Erziehung<br />
zur Demokratie und von Beteiligungsmöglichkeiten von Schülerinnen<br />
und Schülern. Deswegen verstehe ich politische Bildung<br />
auch als Angebot, das über den Sozialkundeunterricht hinaus geht,<br />
zum Beispiel auch in alledem, was wir im Bereich der Schülerinnen-<br />
und Schülervertretung haben; in all dem, was wir an Jugendprojekten<br />
auf den Weg bringen, bis hin zu der Verankerung von<br />
Beteiligungsmöglichkeiten von Jugendlichen in der Kommunalverfassung.<br />
Da ist es ja auch eine ganz gute Situation, dass wir das<br />
beides in der Regierung innerhalb eines Ressorts haben, sowohl<br />
den Kinder- und Jugendbereich, als auch den Schulbereich. Und<br />
wenn es eine wirklich dominante Debatte im Moment in diesem<br />
Bereich gibt, so ist es die, dass wir die Institutionengrenzen ein<br />
Stück weit aufweichen und die Bildungsprozesse von Kindern und<br />
Jugendlichen übergreifend verstehen. Die Ganztagsschule hat für<br />
mich gerade in diesem Bereich die riesige Chance - einfach durch<br />
einen erweiterten Zeitrahmen - ein Stück weit ganzheitlicher und<br />
beispielsweise ohne zeitlich Stückelung Projekt orientiert zu arbeiten<br />
und - das hoffe ich natürlich auch - eine Reihe von konkreten<br />
Beteiligungsmöglichkeiten stärker noch ins Schulleben einbringen<br />
zu können.<br />
Berkessel: Lassen Sie uns noch etwas konkreter auf die Jugendpolitik<br />
eingehen. Welche Möglichkeiten sehen Sie persönlich, um dem, was ja<br />
in allen Jugendstudien immer wieder bestätigt wird, nämlich dass Jugendliche<br />
eine zunehmende Distanz zu den traditionellen Formen und<br />
Institutionen der Politik, also etwa Parteien und deren Vertretern, entwickeln<br />
- was ja nicht heißt, dass die Mehrzahl der Jugendlichen unpolitisch<br />
ist - ein Stück weit entgegen zu wirken?<br />
Die Landeszentrale für politische Bildung<br />
<strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong><br />
Bildung verändert Denken und Verhalten der Menschen, vermittelt Orientierung<br />
und ist damit eine Investition in die Zukunft. Politische Bildung zu<br />
leisten und zu fördern, das ist die Aufgabe der „Landeszentrale politische Bildung<br />
<strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong>“ (LpB). Das Team der Landeszentrale erfüllt diese<br />
Aufgabe mit Veranstaltungen und Publikationen, mit alltäglicher Kleinarbeit<br />
und mit großen „Events“.<br />
Die LpB unterstützt die Bildungsarbeit vor allem durch Förderung und Zusammenarbeit<br />
mit anderen Bildungseinrichtungen in Form von Projekten<br />
und Seminaren, aber auch mit Materialien. Sie berät und führt eigene Veranstaltungen<br />
und Fachtagungen zu Themen politischer Bildung durch und gibt<br />
eigene Publikationen heraus. Ihre Schriftenausgabe und die Bibliothek stehen<br />
allen Bürgerinnen und Bürgern in <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> zur Verfügung.<br />
Bei all dem gilt: Besonders wichtig ist der LpB die Entwicklung, Umsetzung<br />
und Evaluierung von Modernisierungselementen in der politischen Bildung,<br />
die Besetzung und Aufbereitung neuer Themen für die politische Bildung,<br />
Politische Bildung<br />
Ahnen: Wir haben zum Beispiel das übergreifende Programm Kinderfreundliches<br />
<strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong>. Dort finden die unterschiedlichsten<br />
Aktivitäten aus den verschiedenen Ressorts meines Hauses<br />
Eingang. Ich nenne zwei Beispiele aus dem schulischen Bereich.<br />
So haben wir schon für die Grundschule diese wunderbare Broschüre<br />
„Kinder mischen mit“, die an vielen praktischen Beispielen<br />
zeigt, was man auch schon in der Grundschule tun kann. Das zweite<br />
Beispiel ist Kinder gestalten Gemeinschaft, für die dritte bis sechste<br />
Klasse und schließlich die Aktion Menschenrechte - Menschenpflichten.<br />
Das sind für mich wichtige Dinge und konkrete Beispiele um<br />
deutlich zu machen, was man in der Schule tun kann. Wir haben<br />
ein Netzwerk Partizipation, mit dem wir die Jugendvertreterinnen<br />
und Jugendvertreter zusammen bringen wollen. Wir haben darüber<br />
hinaus konkrete Projekte, in denen wir uns an die Kommunen<br />
wenden und aufzeigen, wie Kinder schon bei der Gestaltung<br />
Ihres Ortes beteiligt werden können. Spielleitplanung ist jetzt das<br />
Neueste dieser Projekte, das wir mit einigen Kommunen zusammen<br />
umsetzen. Wir haben inzwischen 53 Beraterinnen und Berater<br />
für Partizipation, die genau solche Projekte vor Ort mit auf<br />
den Weg bringen. Also, es gibt eine ganze Reihe von unterschiedlichen<br />
Maßnahmen, die versuchen diese unterschiedlichen Bereiche<br />
miteinander zu verzahnen. Aktuell beteiligen wir uns an einem<br />
Modellversuch der Bund-Länder-Kommission Demokratie<br />
lernen und leben, mit der Zielrichtung, vermehrt Beteiligungsmöglichkeiten<br />
von Schülerinnen und Schülern in und außerhalb von<br />
Schulen zu erproben.<br />
Dr. Simon: Herzlichen Dank, Frau Ministerin, für dieses Gespräch.<br />
Das MBFJ hält unter dem Titel Gewalt- und Extremismus-Prävention<br />
in der Schule in <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> eine Zusammenstellung<br />
der bisherigen Programme und Aktivitäten vorrätig, die bei Herrn<br />
Gernot Stiwitz (Tel: 06131/16-4593;<br />
e-mail: Gernot.Stiwitz@mbfj.rlp.de) angefordert werden kann.<br />
Politische Bildung in <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> - die Institutionen<br />
und ihre Aktivitäten<br />
auch unpopulärer. Thematisch ist die inhaltliche und methodisch-didaktische<br />
Weiterentwicklung der politischen Bildung im Hinblick auf neue Aufgaben<br />
und sich verändernde Rahmenbedingungen ein Schwerpunkt der Arbeit<br />
der LpB.<br />
Die parteipolitisch neutrale Tätigkeit der LpB wird von einem Kuratorium<br />
überwacht. Beraten wird die LpB durch den Landesarbeitsausschuss. Ein ständiger<br />
Gedankenaustausch findet mit der Bundeszentrale und den anderen 16<br />
Landeszentralen für politische Bildung statt.<br />
Landeszentrale für politische Bildung <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong><br />
Direktor: Hans-Georg Meyer<br />
Am Kronberger Hof 6, 55116 Mainz<br />
Telefon: 06131-16 29 70; Telefax: 16 29 80<br />
Internet: www.politische-bildung-rlp.de<br />
MT_Berkessel_12/02 13<br />
22.11.2002, 10:03 Uhr<br />
Schwarz<br />
XIII
Politische Bildung<br />
Fridtjof-Nansen-Akademie für politische<br />
Bildung im Weiterbildungszentrum<br />
Ingelheim<br />
Ziele und inhaltliche Schwerpunkte: Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen<br />
die großen gesellschaftlichen Umbrüche mit ihren Herausforderungen an die<br />
nationale und internationale Politik. Diese gewaltigen Aufgaben können nur<br />
bewältigt werden, wenn möglichst viele Menschen in die gesellschaftlichen<br />
Entscheidungs- und Verstehensprozesse eingebunden werden. Dazu wollen<br />
wir einen Beitrag leisten. Unsere Veranstaltungen zielen deshalb auf eine<br />
umfassende Information über ausgewählte Entwicklungen in Politik, Wirtschaft<br />
und Gesellschaft. Unser Leitziel ist auf den Aufbau von gerechten, sozialen<br />
und demokratischen Strukturen gerichtet. Der Grundsatz der parteipolitischen<br />
und weltanschaulichen Unabhängigkeit bleibt davon unberührt.<br />
Zu unseren Analyse-Schwerpunkten zählen insbesondere:<br />
• das Aufarbeiten von drängenden gesellschaftlichen Fragen in der Bundesrepublik;<br />
• das Vorantreiben des europäischen Integrationsprozesses und der Transformationsprozesse<br />
in den Ländern des ehemaligen Ostblocks;<br />
• Fragen der Entwicklungszusammenarbeit und der Einbindung der „Dritten<br />
Welt“ in die internationale Staatengemeinschaft;<br />
Politische Bildung im Europa-Haus<br />
Marienberg<br />
Die politische Bildung des Europa-Hauses soll die Vielzahl der Motive der<br />
europäischen Einigung verdeutlichen. Diese reichen von der Friedenssicherung<br />
über wirtschaftliche Zielsetzungen im Zusammenhang mit dem europäischen<br />
Binnenmarkt und die Notwendigkeit gemeinsamen europäischen<br />
Handelns angesichts zunehmender Globalisierungszwänge bis hin zur Völkerfreundschaft<br />
und zur Pflege gut nachbarlicher Beziehungen im zusammen<br />
wachsenden Europa. Besondere Bedeutung im Gesamtprogramm haben dabei<br />
unserer Angebote für Jugendliche.<br />
Schülerseminare im Schuljahr 2002/2003<br />
• Keine Chance der Gewalt!<br />
Bei diesen „Anti-Gewalt-Seminaren“ geht es um das frühzeitige Erkennen<br />
von Konfliktsituationen in Schule, Familie, Freizeit, die Analyse von Ursachen<br />
und Hintergründen von Gewalt. Wir trainieren Streitschlichtung und<br />
entwickeln Lösungsstrategien.<br />
• Globaler Terror und neue Herausforderungen<br />
Seit dem 11.September 2001 gibt es eine neue Dimension des Schreckens,<br />
die jeden von uns treffen kann. Daher geht die weltweite Bekämpfung des<br />
Extremismus uns alle an und ist darüber hinaus gemeinsame Aufgabe der<br />
zivilisierten Staatengemeinschaft.<br />
• Das Ende der Spaßgesellschaft: null Bock - no future, oder was sonst?<br />
Was bleibt im Zeitalter der Globalisierung übrig von den eigenen Wünschen<br />
und Hoffnungen? Was bedeutet Erfolg für mich, wie möchte ich leben, wofür<br />
mich einsetzen? Dies sind auch Fragen an soziale Marktwirtschaft und<br />
Das Institut für schulische Fortbildung<br />
und schulpsychologische Beratung des<br />
Landes <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> (IFB) - Beiträge<br />
des IFB zur politischen Bildung<br />
Das IFB besteht aus den zwei Fachbereichen „Schulische Fort- und Weiterbildung“<br />
und „Schulpsychologischer Dienst“; es gliedert sich in drei Regionale<br />
Fortbildungs- und Beratungszentren (Speyer, Boppard, Saarburg) und<br />
gegenwärtig 32 schulpsychologische Beratungsstellen, die über das Land verteilt<br />
sind. Leitung und Zentrale Verwaltung haben ihren Sitz in Speyer.<br />
Neben kontinuierlichen Fortbildungs- und Beratungsangeboten in den Schularten,<br />
Fächern und Lernbereichen bietet das IFB seine Leistungen vor allem<br />
XIV<br />
• Probleme der internationalen Friedensordnungs- und Sicherheitspolitik.<br />
Zielgruppen: Unsere Veranstaltungen sind offen für alle an gesellschaftspolitischen<br />
Fragen Interessierte. Besonders angesprochen sind Multiplikatoren,<br />
die im schulischen und außerschulischen Bereich für die politische Bildung<br />
verantwortlich sind. Daneben wenden wir uns besonders an Jugendliche, die<br />
sich im Rahmen der außerschulischen Bildung für politische Themen interessieren.<br />
Die im Programm ausgeworfenen Zielgruppen bieten Ihnen einen<br />
Hinweis auf die schwerpunktmäßig zu erwartende Zusammensetzung der<br />
Teilnehmer und die didaktische Ausrichtung der Angebote.<br />
Didaktisch-methodische Umsetzung: Die Seminare sind als offene Foren angelegt,<br />
in denen ein breites Spektrum von kontroversen Standpunkten und<br />
Theorieansätzen zu den ausgewählten Themen vorgestellt und diskutiert wird.<br />
Den unterschiedlichen Zielgruppen wird mit dem Einsatz von teilnehmeradäquaten<br />
Methoden Rechnung getragen.<br />
Fridtjof-Nansen-Akademie für politische Bildung<br />
Direktor: Dr. Peter Becker<br />
Wilhelm-Leuschner-Straße 61, 55218 Ingelheim<br />
Telefon: 06132-79 00 316 ;Telefax: 06132-79 00 322<br />
e-mail: fna@wbz-ingelheim.de, Internet: www.wbz-ingelheim.de<br />
Sozialstaat: Haben wir überhaupt Chancen auf dem Arbeitsmarkt? Wie könnte<br />
mein Weg in die Arbeitswelt aussehen?<br />
• Unsere Zukunft in der Europäischen Union<br />
Europa prägt unseren Alltag von morgens bis abends. Aktuelle Fortschritte<br />
und Probleme der europäischen Integration werden dargestellt und diskutiert<br />
aus der Sicht junger Menschen: z.B. die Erweiterung der Union, Erfahrungen<br />
mit dem Euro, die Notwendigkeit einer Charta der Grundrechte.<br />
• Wie sicher ist der Frieden in Europa?<br />
Was sind die Aufgaben Deutschlands und der Europäischen Union auf unserem<br />
Kontinent? Wie reagieren wir auf die jüngsten Krisen und Kriege auf<br />
dem Balkan, in Afrika, in Südostasien, ...<br />
Gästehaus und Pädagogisches Zentrum „Villa Europa“ sind modern eingerichtet<br />
und verfügen über alle erforderlichen Voraussetzungen für eine erfolgreiche<br />
und angenehme Seminararbeit. Die Seminare richten sich vor allem<br />
an Jugendliche ab 16 Jahren. Auf Wunsch ist die Seminardurchführung<br />
gemeinsam mit gleichaltrigen Jugendlichen aus Mitteleuropa möglich. Die<br />
Lerninhalte werden jeweils durch Teilnehmer orientierte Methoden vermittelt<br />
und gemeinsam mit den Jugendlichen erarbeitet.<br />
Europa-Haus Marienberg<br />
Öffentliche Stiftung bürgerlichen Rechts<br />
Leiter: Burkhardt Siebert<br />
Postfach 12 04 · D - 56464 Bad Marienberg<br />
Telefon: (0 26 61) 6 40 - 0 · Telefax: (0 26 61) 640 - 100<br />
e-Mail: ehm@europa-haus-marienberg.de<br />
Internet: www.europa-haus-marienberg.de<br />
MT_Berkessel_12/02 14<br />
22.11.2002, 10:03 Uhr<br />
Schwarz<br />
auch in den großen bildungspolitischen Schwerpunktbereichen wie z.B.<br />
„PISA“ und „Ganztagsschule“ an.<br />
Im Bereich der politischen Bildung hält das IFB Leistungen in folgenden<br />
Themen- und Handlungsfeldern vor:<br />
• Im Rahmen ihrer Qualitätsprogramme, die alle Schulen des Landes verbindlich<br />
zum Schuljahresende 2002/2003 vorlegen, klären die Schulen mittelfristig<br />
ihren Fortbildungsbedarf. Qualitätsprogramme und mittelfristige<br />
schulinterne Fortbildungsplanung gelten selbstverständlich auch für den Bereich<br />
der politischen Bildung.<br />
• Neben den schulischen Nachfragen wird es auch weiterhin in den Bezugsfächern<br />
der politischen Bildung qualifizierte Angebote für die Kolleginnen und<br />
Kollegen in den Schulen des Landes geben. Didaktische, fachwissenschaftliche<br />
und aktuelle internationale bzw. nationale Entwicklungen sind im Bereich<br />
einschlägiger Angebote ausschlaggebend für die Fortbildungsarbeit des<br />
IFB. Besonders werden wir darum bemüht sein, Konsequenzen aus der großen<br />
internationalen Studie „Civic Education Across Countries: Twenty-four
National Case Studies from the IEA Civic Education Project“ zu ziehen. Für<br />
den Bereich politischer Bildung und Erziehung hat diese Studie fast vergleichbare<br />
Auswirkungen wie die Studien TIMSS und PISA für das Schulwesen<br />
insgesamt.<br />
• Besondere Brennpunkte und Probleme wie z. B. interkulturelle Bildung,<br />
Gewalt, Rechtsradikalismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus werden<br />
auch weiterhin Schwerpunkte für einschlägige Fortbildungsangebote und<br />
Fortbildungsnachfragen im und an das IFB sein.<br />
Besonders möchten wir Sie auf Publikationen des IFB hinweisen; neben den<br />
Reihen Schulisches Qualitätsmanagement und Ganztagsschule in <strong>Rheinland</strong>-<br />
<strong>Pfalz</strong> erscheint eine dritte Reihe Erziehung, deren bisher vorgelegte Bände<br />
von besonderer Bedeutung auch für die politische Bildung sind: „Jetzt reicht’s:<br />
Schüler brauchen Erziehung! - Was die neuen Kinder nicht mehr können -<br />
Das Institut für Lehrerfort- und<br />
-weiterbildung (ILF), Mainz<br />
Das Institut für Lehrerfort- und -weiterbildung (ILF) in privater Trägerschaft<br />
sieht einen seiner Schwerpunkte in der Fortbildungsarbeit im Breich Geschichté/Politische<br />
Bildung. Damit möchte das ILF den Bedürfnissen der Lehrerinnen<br />
und Lehrer begegnen, Informationen zu erhalten, Geschichte und Gesellschaft<br />
besser zu verstehen und im Unterricht darstellen zu können. Dem<br />
ILF ist es wichtig, adäquate Methodenkenntnisse zu vermitteln.<br />
An den Angeboten der letzten Jahre lässt sich folgende Konzeption erkennen:<br />
• Einen Schwerpunkt stellt die Zeitgeschichte mit den Themen „ Erster Weltkrieg“,<br />
„Nationalsozialismus“ und „Rechtsradikalismus in Vergangenheit und<br />
Gegenwart“. Die große Geschichte wird herunter gebrochen in dem weiteren<br />
Schwerpunkt „Geschichte vor Ort“, der die Lokal- und Regionalgeschichte<br />
untersucht. Das Institut öffnet aber auch den Blick auf die europäische und<br />
die außereuropäische Geschichte (z.B. Indien, Afrika).<br />
• Der Bereich Politische Bildung/Gesellschaftslehre beschäftigt sich mit den<br />
Entstehen und den Auswirkungen gesellschaftlicher Gewalt. Das Angebot<br />
des ILF umfasst darüber hinaus die Schlichtung von Konflikten im schulischen<br />
Bereich (Konfliktmanagement, Schulmediation).<br />
Politische Bildung im Pädagogischen<br />
Zentrum des Landes <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong><br />
Das Pädagogische Zentrum (PZ) Bad Kreuznach und seine Außenstellen leisten<br />
zurzeit insbesondere in den folgenden Arbeitsschwerpunkten einen Beitrag<br />
zur politischen Bildung:<br />
Gesellschaftswissenschaften<br />
Dieser Schwerpunkt umfasst die Erarbeitung eines Lehrplans Gesellschaftslehre<br />
(gemeinsam mit einer Lehrplankommission), Aktivitäten zu seiner Präsentation<br />
und Evaluation und seiner Umsetzung durch Erstellung von bisher<br />
3 Handreichungen für den Unterricht an den Schulen. Darüber hinaus führt<br />
das PZ in Verbindung mit dem IFB ein mehrjähriges Fortbildungskonzept<br />
für Lehrerinnen und Lehrer des Fachs Gesellschaftslehre an Integrierten Gesamtschulen<br />
und Regionalen Schulen durch. Weiterhin werden Themenfelder<br />
in den Fächern Sozialkunde und Geschichte sowie im Wahlpflichtfach<br />
Sozialpädagogik an Realschulen bearbeitet. Dabei werden Handreichungen<br />
(je vier in Sozialkunde SII und in Sozialpädagogik) sowie zahlreiche PZ-Informationen<br />
in Sozialkunde und Geschichte herausgegeben (zuletzt zu Nationalsozialismus,<br />
Menschenrechte und Recht im Unterricht) sowie Veranstaltungen<br />
zu ihrer Bekanntmachung durchgeführt.<br />
Region und Unterricht<br />
Im Rahmen dieses Arbeitsschwerpunkts des PZ entstanden zahlreiche Veröffentlichungen<br />
zu vielen relevanten Fragestellungen. Die letzten Arbeiten (2002)<br />
bezogen sich auf historische, geografische und soziale Aspekte der Thematik<br />
„Rhein“ (4 Hefte) sowie der Landwirtschaft im Kreis Altenkirchen.<br />
Rechtsextremismus und Gewalt<br />
Diese Thematik wurde in zahlreichen Veranstaltungen des PZ sowie in Veröffentlichungen,<br />
die meist mit der Landeszentrale für politische Bildung gemeinsam<br />
herausgegeben wurden: Nein zur Gewalt und Gewaltprävention im<br />
Team (PIT) behandelt.<br />
Umwelterziehung<br />
Seit mehr als 10 Jahren gibt es diesen Arbeitsschwerpunkt des PZ. Er führte<br />
zu Erstellung eines Lehrplankonzepts und zu zahlreichen Veröffentlichun-<br />
und was in der Schule zu tun ist“ und „Gegen Mobbing und Gewalt! - Ein<br />
Arbeitsbuch für Lehrer, Schüler und Lehrergruppen“. Bitte wenden Sie sich<br />
ggf. an die Veröffentlichungsstelle des IFB in Speyer.<br />
Institut für schulische Fortbildung und<br />
schulpsychologische Beratung (IFB)<br />
Direktor: Botho Priebe<br />
Butenschönstr. 2, 67326 Speyer<br />
Telefon: 06232/659-0; Telefax: 06232/659-110<br />
e-mail: zentrale@ifb.bildung-rp.de<br />
Politische Bildung<br />
• Zunehmende Aufmerksamkeit schenkt das ILF den Neuen Medien in Gesellschaft<br />
und Unterricht. Dabei sollen technische Fertigkeiten und kritisches<br />
Bewußtsein vermittelt werden. Neben der Weiterführung dieser Schwerpunkte<br />
wird das ILF in Zukunft ein besonderes Augenmerk auf das Fächer verbindende<br />
Arbeiten legen. Durch die Verknüpfung von Fachinhalten, moderner<br />
Didaktik und Methodik leistet das ILF einen wichtigen Beitrag im Rahmen<br />
der Lehreraus- und -weiterbildung.<br />
Zu vielen der aufgeführten Themen sind Publikationen mit Arbeitsmaterialien<br />
erschienen, die im Fortbildungskatalog des Landes <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> aufgeführt<br />
sind.<br />
Institut für Lehrerfort- und -weiterbildung<br />
Direktor: Dr. Wolfgang Hissnauer<br />
Fachbereichsleiter Geschichte und Politische Bildung:<br />
Dr. Ralph Erbar, Kötherhofstr. 4, 55116 Mainz,<br />
Telefon: 06131-28 45 10; Telefax: 06131-28 45 25<br />
e-mail: erbar@ilf.bildung-rp.de, Internet: www.ilf.bildung-rp.de<br />
gen, z.T. als PZ-Informationen, z.T. in Fachzeitschriften. Zusätzlich halfen<br />
die PZ-Referenten häufig bei der Umsetzung des Konzeptes der Umwelterziehung<br />
in den schulischen Alltag.<br />
Entwicklungszusammenarbeit / „Bildung für Nachhaltigkeit-Agenda 21“<br />
In dem Modellversuch der Bund-Länder-Kommission (BLK) kooperiert das<br />
PZ mit dem Landeskoordinator Bildung für Nachhaltigkeit und organisiert<br />
regionale und überregionale Veranstaltungen. Die Partnerschaft des Landes<br />
mit Ruanda wird durch Veröffentlichungen (zuletzt eine CD-ROM) und organisatorische<br />
Hilfen für Schulen (Go for Ruanda) unterstützt.<br />
Demokratie lernen und leben<br />
Die Koordination dieses BLK-Modellversuch, an dem sich das Land <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong><br />
beteiligen wird, ist im PZ angesiedelt und startet im Frühjahr 2003<br />
mit zunächst 16 ausgewählten Schulen verschiedener Schularten.<br />
Werteerziehung/Streitschlichtung/SV-Arbeit<br />
Diese Themen werden seit über zehn Jahren als schulartübergreifende Querschnittsaufgaben<br />
bearbeitet. Sie haben zu einer Reihe von grundlegenden<br />
Veröffentlichungen geführt und wurden durch Entsendung von Referenten<br />
zu Studientagen und Lehrerfortbildungen vorangebracht.<br />
Ökonomische Bildung<br />
Seit Gründung des Regionalen Pädagogischen Zentrums, der Vorläuferorganisation<br />
des heutigen PZ, wird der Arbeitsschwerpunkt Arbeitslehre durch<br />
Veröffentlichungen, schulnahe Beratungen und Fortbildungen gefördert.<br />
Derzeit läuft in diesem Rahmen der Modellversuch BORIS, der die Kooperation<br />
zwischen Schulen und Firmen systematisch weiterentwickelt. In Zusammenarbeit<br />
mit dem PZ entwickelt das Ministerium für Bildung, Frauen und<br />
Jugend (MBFJ) derzeit Richtlinien zur ökonomischen Bildung an allgemein<br />
bildenden Schulen, die im September 2002 in die Anhörung gegangen sind<br />
Pädagogisches Zentrum <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong><br />
Direktor: Dr. Otwilm Ottweiler<br />
Europaplatz 7-9, 55543 Bad Kreuznach<br />
Telefon: 0671/840 88 20; Telefax: 840 88 10<br />
e-mail: pzkh@t-online.de, Internet: www.bildung-rp.de/PZ<br />
MT_Berkessel_12/02 15<br />
22.11.2002, 10:03 Uhr<br />
Schwarz<br />
XV
Politische Bildung<br />
Katholische Erwachsenenbildung<br />
<strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> e. V. (KEB)<br />
Die Katholische Erwachsenenbildung <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> e. V. (KEB) ist der größte<br />
anerkannte Weiterbildungsträger in freier Trägerschaft in <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong>. Schwerpunkte<br />
ihres Engagements sind dabei die Sachgebiete Philosophie/Theologie,<br />
Pädagogik, Gleichstellung sowie persönlichkeits- und allgemein bildende Angebote.<br />
Pro Jahr führt die KEB dabei ca. 7 - 8.000 Maßnahmen mit fast 70.000<br />
Unterrichtsstunden durch, bei denen über 160.000 Menschen erreicht werden.<br />
Kennzeichnend für Katholische Erwachsenenbildung ist dabei die Durchführung<br />
von Weiterbildungsveranstaltungen, bei denen Menschen über gesellschaftliche<br />
Entwicklungen, über persönliche Erfahrungen und über Veränderungen in<br />
ihrer Lebenswirklichkeit reden und neue Handlungsperspektiven kennen lernen<br />
können. Den zentralen Orientierungsrahmen bietet dabei ihr selbst definierter<br />
emanzipatorischer Grundsatz:<br />
„Katholische Erwachsenenbildung bringt auf dem Hintergrund das christlichen<br />
Menschenbildes Orientierungsangebote mit dem Ziel verbesserter individueller<br />
und gesellschaftlicher Handlungsfähigkeiten in den vierten Bildungsbereich ein<br />
als ein Beitrag zur Stärkung der Wertebasis, der Entfaltung der Persönlichkeit,<br />
die Qualifikation im beruflichen Bereich und die Verantwortung des einzelnen<br />
für das Gemeinwohl in einer spannungsvollen Einheit hält“ (KEB 1992).<br />
Politische Bildung in der Evangelischen<br />
Erwachsenenbildung in <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong><br />
Gesellschaftspolitische Themen haben in der Evangelischen Erwachsenenbildung<br />
einen festen Platz. Im 1994 verabschiedeten Selbstverständnis heißt es<br />
dazu unter dem Titel Gesellschaftliche Verantwortung: „Krisenhafte Entwicklungen<br />
fordern dem Einzelnen ethische Urteilsbildung und politische Verantwortung<br />
ab. Die Gestaltung politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Verhältnisse<br />
nach den Grundsätzen von Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der<br />
Umwelt ist eine protestantische Aufgabe.Wichtig ist die Erinnerungsarbeit an<br />
geschichtlichen Entwicklungsereignissen. Die gesellschaftlichen Veränderungen in<br />
Arbeitswelt, Kommunikation und Medien erfordern ständige Aufmerksamkeit<br />
und Dialogbereitschaft.“<br />
Auf dieser Grundlage führen die Weiterbildungsveranstalter im Evangelischen<br />
Spektrum ein breites Programm von Angeboten durch. Im Jahr 2001 kamen<br />
zu den ca. 1.400 Veranstaltungen über 31.000 Teilnehmende. Die Themen<br />
decken das gesamte Spektrum eines umfassenden Verständnisses von Gesell-<br />
Landesarbeitsgemeinschaft Arbeit und<br />
Leben e.V.<br />
Als staatlich anerkannter Träger der Weiterbildung, deren Gesellschafter der<br />
DGB-Landesbezirk und der Verband der Volkshochschulen <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong><br />
sind, stellen wir seit 1973 eine feste Größe in der Bildungslandschaft von<br />
<strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> dar. Mit ca. 30 hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
gestalten wir rund 15.000 Unterrichtsstunden und 800 Veranstaltungen<br />
pro Jahr, mit einem Jahresumsatz von 2,7 Mio. Euro. Mit unseren<br />
Zweigstellen Westpfalz, Mittelrhein, Vorder-/Südpfalz, Rheinhessen-Nahe und<br />
Trier sowie der Geschäftsstelle in Mainz sind wir für unsere Kundinnen und<br />
Kunden überall in <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> erreichbar.<br />
Die Schwerpunkte unseres Angebots sind:<br />
Moderation - Training - Beratung - Begleitung<br />
Komplexe Zusammenhänge und konfliktreiche Arbeitsbeziehungen erschweren<br />
die Bearbeitung von Aufgaben und Problemen oft mehr als nötig. Wir<br />
bieten problem- und Ziel orientierte Lösungen an.<br />
Themen- und Zielgruppen bezogene Angebote<br />
An der Schnittstelle zwischen beruflicher und gesellschaftspolitischer Weiterbildung<br />
machen wir beispielsweise Angebote für bestimmte Zielgruppen: Jugendliche,<br />
Betriebs- und Personalräte aber auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br />
aus spezifischen Berufsgruppen finden bei uns auf sie zugeschnittene<br />
Seminare.<br />
Wir verstehen Weiterbildung nicht einfach als Wissensvermittlung, sondern<br />
vielmehr als einen Prozess, in dem sich Lehrende und Lernende gemeinsam<br />
bewegen. Wir haben das ganze System im Blick und beziehen Wissen, Erfahrungen<br />
und Einschätzung aller Beteiligten mit ein. Die Verknüpfung von<br />
systematischer Weiterbildung mit der Beteiligung der Betroffenen an Verän-<br />
XVI<br />
Das Themenspektrum ist dabei weit gefächert: Traditionell ist zum einen das<br />
Thema entwicklungs- bzw. weltpolitischer Fragestellungen nicht aus unserer Angebotspalette<br />
wegzudenken, gleiches gilt für das Thema Frauenpolitik, das in den<br />
letzten Jahren zunehmend durch die Gender-Thematik ergänzt wurde. Veranstaltungen<br />
zur Lebenssituation von MigrantInnen und sinnvollen Integrationskonzepten<br />
spielen ebenso eine zentrale Rolle. Zahlreiche Angebote der politischen<br />
Bildung befassen sich auch mit den Facetten des Themenkomplexes Lokale Agenda,<br />
beschäftigen sich z. B. mit Nachhaltigkeit, anderem Einkaufs- und VerbraucherInnenverhalten<br />
oder Umweltfragen. Natürlich ist für Katholische Erwachsenenbildung<br />
auch die Wertefrage besonders bedeutsam, die Gegenstand zahlreicher<br />
Weiterbildungsangebote ist.<br />
Katholische Erwachsenenbildung <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> e.V.<br />
Geschäftsführerin: Elisabeth Vanderheiden<br />
Welschnonnengasse 2-4<br />
55116 Mainz<br />
Telefon: 06131-23 16 05; Telefax: 06131-23 67 92<br />
e-mail: vanderheiden.elisabeth@t-online.de<br />
internet: www.keb.rheinland-pfalz.de<br />
schaftspolitik ab. Besondere Schwerpunkte liegen neben aktuellen Fragen der<br />
Politik in Deutschland beim interreligiösen Dialog, bei der Geschlechtergerechtigkeit<br />
und den Problemen in den Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas.<br />
Exemplarisch können hier die vielen Bildungsangebote der Evangelischen<br />
Frauenarbeit im Zusammenhang mit dem Weltgebetstag der Frauen angeführt<br />
werden, die am Beispiel jeweils eines Landes über die gesellschaftliche,<br />
wirtschaftliche, religiöse, kulturelle und politische Situation insbesondere der<br />
Frauen informieren.<br />
Evangelische Landesarbeitsgemeinschaft<br />
Erwachsenenbildung <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> e.V.<br />
Geschäftsführer: Rainer Christ<br />
Kaiserstraße 19, 55116 Mainz<br />
Telefon: 06131-67 77 10; Telefax: 67 83 83<br />
e-mail: elag@mainz-online.de, internet: www.elag.de<br />
derungsprozessen machen die zwei wesentlichen Seiten erfolgreicher Weiterbildung<br />
aus.<br />
Grundsätze unserer Aufgaben<br />
In unserer Arbeit fühlen wir uns verpflichtet, zu einem ausgewogenen und<br />
gemeinsam bestimmten Geschlechterverhältnis beizutragen. Die Gestaltung<br />
einer modernen Arbeits- und Lebenswelt schließt nach unserem Verständnis<br />
einen ständigen interkulturellen Dialog mit ein. Dabei stehen insbesondere<br />
der Austausch und die Auseinandersetzung mit unseren europäischen Kooperationspartnern<br />
im Vordergrund.<br />
ARBEIT&LEBEN e.V.<br />
Geschäftsführerin: Gabriele Schneidewind<br />
Walpodenstraße 10, 55116 Mainz<br />
Telefon:06131-1 40 86-0;Telefax: 06131-1 40 86-40<br />
e-mail: info@arbeit-und-leben.de<br />
Internet: www.arbeit-und-leben.de<br />
Impressum:<br />
Sonderbeilage zur <strong>GEW</strong>-Zeitung 12/2002<br />
über Politische Bildung in <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong><br />
Verantwortlich für Inhalt, Textbearbeitung (i.S.d.P):<br />
Hans Berkessel, Joh.-Hinrich-Wichern-Str. 3, 55218 Ingelheim<br />
Tel: 06132 / 849 70 · Fax 0 6132 / 8 79 27 · E-Mail: HansBerkessel@aol.com<br />
Gesamtherstellung:<br />
Verlag Pfälzische Post GmbH, 67433 Neustadt, Tel. 06321-80377<br />
MT_Berkessel_12/02 16<br />
22.11.2002, 10:03 Uhr<br />
Schwarz