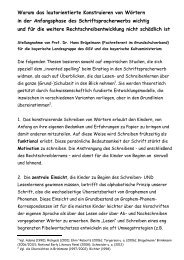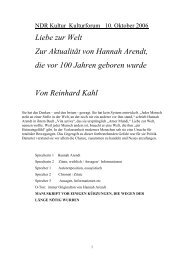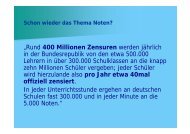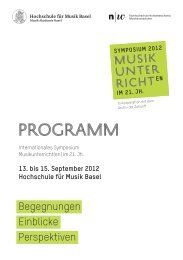Schularchitektur für Kinder : Drei Waldorfschulen
Schularchitektur für Kinder : Drei Waldorfschulen
Schularchitektur für Kinder : Drei Waldorfschulen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Schularchitektur</strong> <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong> :<br />
<strong>Drei</strong> <strong>Waldorfschulen</strong><br />
Peter Hübner und Olaf Hübner<br />
<strong>Waldorfschulen</strong> zeichnen sich durch eine außerordentlich moderne Pädagogik<br />
auf der Grundlage der Menschenkunde Rudolf Steiners aus, bei der Herz,<br />
Kopf und Hand gleichermaßen gefördert und dem einzelnen Schüler große<br />
Freiheiten in der eigenen Entwicklung zugebilligt werden.<br />
Für die <strong>Waldorfschulen</strong> 1 sind zwei Forderungen von zentraler Bedeutung,<br />
die nach unserer Überzeugung auch Grundlage einer Erneuerung des gesamten<br />
Erziehungswesens sein könnten : Die Unterrichtsform sowie das Spektrum<br />
der Unterrichtsinhalte und Fächer muss sich an der Entwicklung der<br />
Heranwachsenden orientieren und in ihnen gleichgewichtig das Denken,<br />
Fühlen und Wollen ansprechen und ausbilden. Erziehung muss, weil sie die<br />
<strong>Kinder</strong> und Jugendlichen zur Freiheit und Mündigkeit führen will, von freien<br />
und mündigen Erziehern verantwortet werden. Dies ist aber nur möglich,<br />
wenn die Schule von den unmittelbar Beteiligten selbst verwaltet wird. Konsequenzen<br />
aus diesen beiden Prinzipien sind :<br />
• <strong>Waldorfschulen</strong> organisieren sich in freier Trägerschaft aus der Zusammenarbeit<br />
von Lehrerinnen und Lehrern, Eltern, Schülerinnen und Schülern.<br />
Das Lehrerkollegium verwaltet sich selbst. Es gibt keinen Direktor.<br />
Für alle, Lehrerinnen und Mitarbeiter, gilt die gleiche Gehaltsordnung.<br />
In wöchentlichen Konferenzen werden die Entwicklungen der <strong>Kinder</strong> von<br />
den Lehrerinnen und Lehrern, unterstützt durch Schularzt, Therapeutinnen<br />
und Therapeuten, begleitet und pädagogische Probleme bearbeitet.<br />
Entwicklungsorientierte Erziehung erfordert von Pädagogen ein intensives<br />
Studieren der Entwicklungsgesetze des heranwachsenden Menschen.<br />
1 Der folgende Abschnitt zu den Wesenmerkmalen der <strong>Waldorfschulen</strong> stammt von Werner Ehringfeld<br />
(Lehrer an der FWS Kirchhein/Teck) unter Verwendung einer Informationschrift der FWS-Chiemgau.
210<br />
<strong>Schularchitektur</strong> und neue Lernkultur<br />
Der Waldorfpädagogik liegen Erkenntnisse zugrunde, die Rudolf Steiner<br />
durch geisteswissenschaftliche Forschung gewonnen hat ; sie geben Anregungen<br />
<strong>für</strong> das ständige Bemühen um eine dem Wesen und Entwicklungsstand<br />
der <strong>Kinder</strong> entsprechende Erziehungspraxis. Die Schüler und Schülerinnen<br />
leben und lernen in einer Klassengemeinschaft, die im<br />
Wesentlichen von der ersten bis zur zwölften Klasse bestehen bleibt.<br />
Dadurch lernen die <strong>Kinder</strong> sich in ihren individuellen Schwächen und<br />
Stärken gut kennen, lernen auch, rücksichtsvoll miteinander umzugehen<br />
und sich gegenseitig Hilfestellung zu geben. Derartig gestalteter Unterricht<br />
ist ein ständiges Übungsfeld <strong>für</strong> ein – in unserer heutigen Zeit verloren<br />
gegangenes und vermisstes – praktisches Sozialverhalten.<br />
• Schülerinnen und Schüler unterschiedlichster Begabungen und sozialer<br />
Herkunft werden gemeinsam unterrichtet. Erst gegen Ende der Mittelstufe<br />
kann eine innere Differenzierung durchgeführt werden, die den<br />
Klassenverband aber nicht sprengt.<br />
• Es gibt kein Sitzenbleiben und keinen mit Zensuren verbundenen äußeren<br />
Leistungsdruck. Dennoch wird leistungsorientiert gearbeitet ; Leistungen,<br />
die in den handwerklichen und künstlerischen Fächern – wie Schmieden,<br />
Töpfern, Buchbinden, Gartenbau, Handarbeit, Holzwerken, Eurythmie,<br />
Musik, Theater – und in den sportlichen Fächern erbracht werden, stehen<br />
gleichwertig neben den Leistungen in intellektuellen Fächern.<br />
• Der Fremdsprachenunterricht ( Englisch, Französisch ) beginnt bereits in<br />
der ersten Klasse, weil die <strong>Kinder</strong> da fremde Sprachen noch unmittelbar<br />
nachahmend aufnehmen können. Es wird epochenweise ( täglich etwa<br />
zwei Stunden über ca. drei Wochen ) unterrichtet. Diese Form der Unterrichtsökonomie<br />
ermöglicht eine besonders intensive und konzentrierte<br />
Verbindung mit dem Stoff.<br />
Entgegen der landläufigen Meinung haben wir keine orthodoxen anthroposophischen<br />
Lehrmeinungen kennengelernt und waren immer wieder überrascht<br />
von der Modernität des Unterrichts und der Schnelligkeit im Umsetzen<br />
neuer, teilweise sogar radikaler Ideen. <strong>Waldorfschulen</strong> werden ohne Hierarchie<br />
von einem Kollegium geführt, erwarten von den Eltern rege Teilnahme<br />
am Schulgeschehen und bilden zusammen mit den <strong>Kinder</strong>n eine echte<br />
Gemeinschaft, die wir unsere jeweilige Baufamilie nennen. Selbstverständlich<br />
ist, dass sich jede Schulgemeinschaft sehr sorgfältig in einem oft langwierigen<br />
Prozess ihren Architekten sucht und diesen dann über den Bauausschuss in<br />
einen langen und intensiven Partizipationsprozess einbindet. Wenn man sich<br />
vorurteilsfrei auf diese Beteiligung einlässt, ergeben sich als Resultate Häuser<br />
von einer ganz eigenen Ausstrahlung und Wärme, die einen gleichsam umarmen.<br />
Den einzelnen Räumen wird eine große Individualität gegeben, die den<br />
spezifischen Anforderungen der verschiedenen Altersstufen und Nutzungen<br />
entsprechen sollten. Eine Waldorfschule versteht sich als ein lebendiger<br />
Organismus, bei dem das Schulgebäude eine wesentliche Rolle spielt.<br />
Wir haben bisher acht <strong>Waldorfschulen</strong> geplant und wollen hier drei Bauten<br />
vorstellen, die jeweils von einem anderen Partner unseres Büros verantwortet<br />
wurden :
1<br />
Die Freie Waldorfschule Köln<br />
Peter Hübner war der Projektarchitekt <strong>für</strong> die Freie Waldorfschule in Köln.<br />
Sie wurde im Jahr 1980 gegründet und zog 1982 in ein Gebäude der ehemaligen<br />
Hauptschule in Esch ein. Seit 1987 suchte die Schule intensiv nach<br />
einem Grundstück <strong>für</strong> einen eigenen Neubau. Nach mehreren Rückschlägen<br />
fand man im Jahre 1992 ein Grundstück in Köln-Chorweiler. Wie bei allen<br />
<strong>Waldorfschulen</strong> musste <strong>für</strong> ein außerordentlich knappes Budget eine Schulanlage<br />
entworfen werden, die maßgeschneidert <strong>für</strong> die spezielle Schulgemeinschaft<br />
und den Ort war und, so die Herausforderung der Baufamilie, die<br />
«schönste Waldorfschule» der Welt werden sollte !<br />
Es folgte eine zweieinhalbjährige Planungsphase, an der alle Schülerinnen<br />
und Schüler, das gesamte Lehrerkollegium und viele Eltern stark beteiligt<br />
waren. In vielen gemeinsamen, meist zweitägigen Planungssitzungen wurde<br />
das Besondere der Kölner Schule diskutiert, wurden viele alternative Ansätze<br />
entwickelt und verworfen und letztlich die Lösung gefunden.<br />
Das Bild der Rose erwies sich als tragfähiges Traummodell. Die Klassen<br />
sind gleichsam die Blütenblätter, die zentrale Baumstütze ist der Stängel. Wie<br />
bei der Rose entwickelt jedes Blütenblatt und damit auch jede Klasse ihre<br />
eigene Freiheit, folgt einer eigenen inneren Ordnung und behauptet sich<br />
gegen das Diktat des Zentralbaus mit seiner radialen fünf-, zehn-, zwanzigeckigen<br />
Geometrie.<br />
<strong>Schularchitektur</strong> <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong>: <strong>Drei</strong> <strong>Waldorfschulen</strong><br />
1 Peter Hübner, Freie Waldorfschule<br />
Köln, Gesamtansicht von Norden.<br />
Bild: Suhan Su<br />
211
212<br />
<strong>Schularchitektur</strong> und neue Lernkultur<br />
Der dreigeschossige Klassenbau entwickelt sich um eine zentrale Oase, die<br />
gleichzeitig Marktplatz und überdeckte Pausenhalle ist. Der Saal schiebt sich<br />
über zwei Geschosse in das Zentralgebäude hinein und nimmt im zweiten<br />
Obergeschoss den Hörsaal mit ansteigendem Gestühl auf. Das Schulgebäude<br />
entwickelt sich von innen nach außen und erzeugt so eine lebendige Fassade,<br />
die nichts von der Monotonie eines Zentralgebäudes hat.<br />
Die Stahlbetonwände und Decken sind teilweise sichtbar belassen und<br />
farbig lasiert, die gemauerten Wände sind verputzt und ebenfalls lasurtechnisch<br />
behandelt. Die Bodenbeläge der Halle sind aus naturgebrannten Tonfliesen,<br />
die sich aus der Geometrie ergebenden dreieckigen Zwischenräume<br />
wurden mit Marmorbruch mosaikartig gefüllt und durch wenige farbige Quadratfliesen<br />
aufgelockert.<br />
Die Außenfassaden sind da, wo sie aus Mauerwerk bestehen, verputzt und<br />
blau-grau gestrichen. Die Holzleichtbaufassaden der Klassen sind mit farbigen<br />
Faserzementtafeln verkleidet, die Holzfenster grau lasiert. Die Dächer<br />
sämtlicher Anbauten sind begrünt, das Dach über dem Zentralbau ist mit<br />
Bitumenbahnen eingedeckt.<br />
Das Bauprogramm wird vervollständigt durch eine zweiteilbare Sporthalle.<br />
Sämtliche Werkstätten sowie die Hausmeisterwohnung sind direkt an<br />
Außenmauern der Sporthalle angebaut. Dadurch konnten die Kosten <strong>für</strong> zwei<br />
Außenwände eingespart und außerdem der gewünschte Selbsthilfeanteil beim<br />
Bau der Werkstätten auf einfache Art und Weise erfüllt werden. Die intensive<br />
Beteiligung an der Planung und am Bau durch viele der späteren Nutzer<br />
führte zu einer <strong>für</strong> alle erlebbaren Ausstrahlung des gesamten Gebäudes und<br />
zu einer sofortigen Inbesitznahme durch Schüler und Lehrer. Die Schule hat<br />
<strong>für</strong> jeden spürbar eine ganz besondere Aura, die durch die lange anhaltenden<br />
Selbsthilfeaktivitäten ständig intensiver wurde. Die liebevolle Teilnahme und<br />
Pflege ist allenthalben spürbar. Die Schule lebt.<br />
Bauherr : Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Köln<br />
Architekt : plus+ Prof. Dipl.-Ing. Peter Hübner, Mitarbeit Dipl.-Ing. Klaus Eggler<br />
Planung : 1994–1995, Bauzeit :1995 –1997
2<br />
<strong>Schularchitektur</strong> <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong>: <strong>Drei</strong> <strong>Waldorfschulen</strong><br />
2 Peter Hübner, Freie Waldorfschule<br />
Köln: Oase mit Wasserbecken (oben<br />
links), Stützenfuß mit Lufteinlässen<br />
(oben rechts); Hausmeisterwohnung<br />
und Sporthalle (unten)<br />
213
214<br />
<strong>Schularchitektur</strong> und neue Lernkultur<br />
3
<strong>Schularchitektur</strong> <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong>: <strong>Drei</strong> <strong>Waldorfschulen</strong><br />
3 Peter Hübner, Freie Waldorfschule<br />
Köln.<br />
Seite 214: Pausenhalle (oben), Oase<br />
mit Glasdach «Die Rose von Köln<br />
Chorweiler» als Sinnbild der Schule<br />
(Mitte links; Bild: W. Janzer), «Hier<br />
wird die 6. Klasse ‹wohnen›»<br />
(unten)<br />
Seite 215: Von Schülern gebautes<br />
Modell der Freien Waldorfschule<br />
Köln im Maßstab 1:20 (oben); Oase<br />
mit Baustütze, «Himmelsauge»,<br />
Computersimulation<br />
215
216<br />
<strong>Schularchitektur</strong> und neue Lernkultur<br />
4
<strong>Schularchitektur</strong> <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong>: <strong>Drei</strong> <strong>Waldorfschulen</strong><br />
4 Peter Hübner, Freie Waldorfschule<br />
Köln.<br />
Seite 217: Grundriss Erdgeschoss<br />
(oben), Grundriss 2. Obergeschoss<br />
Seite 218: Maulwurfsperspektive<br />
(oben), Werkplan mit digitaler<br />
Koordinatenvermaßung<br />
217
218<br />
<strong>Schularchitektur</strong> und neue Lernkultur<br />
5 Peter Hübner, Freie Waldorfschule<br />
Köln: Schnittisometrie (oben),<br />
Querschnitt 1:200 (unten)<br />
5
Die Freie Waldorfschule Kirchheim<br />
Die Freie Waldorfschule in Kirchheim unter Teck wurde im ersten Bauabschnitt<br />
von Olaf Hübner über zwei Jahre und im zweiten Bauabschnitt über drei Jahre<br />
von Christoph Forster betreut. Die zeitintensive Beteiligung des Bauausschusses<br />
ist oft mühsam, bringt aber das besondere Ergebnis, das man selbst nicht<br />
hätte finden können. Der Architekt ist gleichsam der Katalysator, der mit<br />
seinem Talent und seinem Fachwissen das Bauwerk generiert. Niemand in<br />
unserem Büro möchte auf den Prozess einer echten Partizipation verzichten.<br />
Für uns Architekten, die wir schon viele Bauten mit ungewöhnlich niedrigem<br />
Etat und unter großen Selbsthilfeanteilen realisiert haben, ist es immer wieder<br />
verblüffend, dass jedes dieser Projekte seine eigene Geschichte hat.<br />
Im Januar 1997 wurden wir seitens der Waldorfschule Kirchheim / Teck<br />
gefragt, ob wir bei der Aufstellung einer gebrauchten Baracke planend helfen<br />
könnten, um aus dieser einen dringend benötigten weiteren Klassenraum in<br />
Eigenleistung zu realisieren. Wir spürten den vitalen Bauwillen und willigten<br />
in ein Gespräch mit Eltern und dem Kollegium ein. Anhand von Dias wurde<br />
gezeigt, wohin uns unsere Erfahrung bei unseren bisherigen Projekten geführt<br />
hatte. Es gab eine übermütige euphorische Forderung seitens meiner Person,<br />
die Mithilfe davon abhängig zu machen, dass man die gebrauchte Baracke<br />
auf keinen Fall nehmen solle. Stattdessen solle <strong>für</strong> das gleiche Geld in Selbsthilfe<br />
ein schöner Klassenraum in Holzbauweise errichtet werden, dem dann<br />
sukzessive Jahr <strong>für</strong> Jahr ein weiterer Klassenraum hinzugefügt werden soll.<br />
Diesem Vorschlag wurde zugestimmt. Es ergab sich auf wunderbare Weise,<br />
dass, gefördert durch den Wunsch nach mehr und nach ersten vorsichtigen<br />
Kostenkalkulationen, sich die Idee herauskristallisierte, doch lieber gleich<br />
drei oder gar sechs Klassenräume zu bauen. Es wurde ein zweigeschossiger<br />
Bau entworfen, bei dem auf einem nackten Erdgeschoss aus Stahlbeton ein<br />
Holzbau errichtet werden sollte, der wenigstens <strong>für</strong> drei Klassen ausreicht.<br />
Zur Verwirklichung der Entwurfsidee wollten wir die späteren Nutzer,<br />
wie bei uns üblich, beteiligen, und es gab einen Projekttag mit den Sechst-<br />
und Siebtklässlern, der zu einem <strong>für</strong> uns alle überraschenden Ergebnis führte :<br />
Die Schüler hatten die Aufgabe, sich selbst auszumessen und im Maßstab<br />
eins zu zehn eine Puppe aus Ton zu formen. Es folgten noch am gleichen<br />
Vormittag Tische, Stühle, Tafeln und alles, was man glaubte in der Klasse<br />
nötig zu haben. Am Nachmittag wurde der Klassenraum entwickelt, er sollte<br />
ungefähr 8 ~ 8 m groß sein und abgestumpfte Ecken haben, brauchte neben<br />
Wänden natürlich auch ein Dach. Aber die von uns mitgebrachten Modellbauhölzer<br />
waren, bedingt durch die Lieferabmessung der späteren Balken,<br />
nur maximal 65 cm lang. Unsere gerunzelten Stirnen und die Frage, was zu<br />
tun wäre, beantworteten die <strong>Kinder</strong> frei von den Ängsten der Erwachsenenwelt,<br />
ganz sinnfällig und einfach mit der Aussage : «Man kann ja Säulen oder<br />
Pfeiler in den Klassenraum stellen – das würde diesen ja nur lustiger und<br />
schöner machen.» So entstand als Entwurfskonzept die sicher einmalige Idee,<br />
jeweils vier Holzstützen in jedem achteckigen Klassenraum aufzustellen und<br />
darüber ein polygonal gefaltetes Dach zu errichten.<br />
<strong>Schularchitektur</strong> <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong>: <strong>Drei</strong> <strong>Waldorfschulen</strong><br />
219
220<br />
<strong>Schularchitektur</strong> und neue Lernkultur<br />
Dieser Entwurfsansatz wurde der Elternschaft vorgestellt und von dieser<br />
begeistert aufgenommen und führte in einer gemeinsamen Eltern-Lehrer-<br />
Architekten-Bauaktion noch am gleichen Abend zu einem Eins-zu-zweihundert-Modell<br />
einer möglichen Gesamtanlage <strong>für</strong> den Endausbau, die alle<br />
Klassen- und Fachräume, einen Saal und alle Werkstätten beinhaltete.<br />
Der zweite Bauabschnitt erfolgte wenige Jahre später unter Leitung von<br />
Christoph Forster. Die «kleine Schule» des ersten Bauabschnittes ergibt auf<br />
der dreieckigen Grundstücksfläche als Solitär den Auftakt <strong>für</strong> das gesamte<br />
Ensemble und bildet den nördlichen Abschluss eines großzügigen Eingangs-<br />
und Pausenhofes, der durch die «große Schule» mit seinen beiden Flügeln<br />
gefasst wird.<br />
Die große Schule besteht aus dem inneren Marktplatz mit Bühne und<br />
Theater, um die sich wie Häuser alle Räume reihen. Auch hier wurden die<br />
Grundrisse aus den spezifischen Funktionen entwickelt und bewusst als Individuen<br />
ausgebildet, so dass jeder Raum ein ganz besonderer Ort – ein<br />
Lebensort –geworden ist.<br />
Ein Unikat stellt die Bühne dar, die aus der langen Diskussion mit der<br />
Baufamilie entstand : Die einen wollten ein griechisches Theatron mit ansteigendem<br />
Halbrund, die anderen ein Marktplatztheater. Die Architekten zerschlugen<br />
den gordischen Knoten, indem sie als Kompromiss beiden Parteien<br />
recht gaben und die Bühne zwischen beiden anordneten und mit einer umlaufenden<br />
Trennwand versahen, so dass beide Theaterformen möglich sind, aber<br />
auch experimentelle Aufführungen mit einer Mittelbühne sowie große Feste<br />
und Basare. Der Bau ist im Bereich der Eurythmie wegen der größeren Raumhöhe<br />
ein-, sonst aber zweigeschossig und hat lediglich über der Bühne mit<br />
dem Zeichensaal ein drittes Obergeschoss. Viele Herzen und Hände waren<br />
nötig, um dem Schulbau seine endgültige Gestalt zu geben, auch und gerade<br />
die der Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler.<br />
Etwas Einmaliges ist entstanden, das von dieser ganz besonderen Hingabe<br />
an das neue Haus kündet, die scheinbar toten Dinge sind lebendig und jeder<br />
spürt das Besondere dieses Gebäudes, seine Ausstrahlung, ja seine Aura. Es<br />
ist ein Ort entstanden, der weit mehr ist als eine normale Schule, nämlich ein<br />
Lebensort, in dem man gerne verweilt und der von innen nach außen<br />
strahlt.<br />
Auf der südlichen Grundstücksfläche ist ein dritter Bauabschnitt mit einer<br />
Sporthalle und weiteren Werkstätten vorgesehen.<br />
Bauherr : Verein Eingetragene Genossenschaft Freie Waldorfschule Kirchheim unter<br />
Teck e. G.<br />
Architekt : plus + bauplanung GmbH Hübner-Forster-Hübner<br />
1. BA Olaf Hübner, Planung : 1997. Bau : 1998<br />
Projektarchitekt : 2. BA Christoph Forster. Planung : 2000. Bau : 2001–2002
6<br />
<strong>Schularchitektur</strong> <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong>: <strong>Drei</strong> <strong>Waldorfschulen</strong><br />
6 Olaf Hübner/Christoph Forster,<br />
plus+bauplanung GmbH, Freie<br />
Waldorfschule Kirchheim, kleine<br />
Schule (oder 1. Bauabschnitt):<br />
Grundriss Erdgeschoss (oben),<br />
Blick von Nordwesten (unten links)<br />
und von Norden (rechts). Bilder:<br />
Peter Blundell-Jones<br />
221
222<br />
<strong>Schularchitektur</strong> und neue Lernkultur<br />
7
<strong>Schularchitektur</strong> <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong>: <strong>Drei</strong> <strong>Waldorfschulen</strong><br />
7 Olaf Hübner, plus+bauplanung<br />
GmbH, Freie Waldorfschule Kirchheim,<br />
kleine Schule (oder 1. Bauabschnitt).<br />
Seite 222: Dachaufsicht (oben),<br />
Galerie der Eingangshalle (unten<br />
links, beide Bilder: Peter Blundell-<br />
Jones), Oberlicht der Eingangshalle<br />
mit Galerie (rechts)<br />
Seite 223: Lehrer mit <strong>Kinder</strong>n beim<br />
Bäumepflanzen (oben), Klasse,<br />
zweiseitig belichtet (Bild: Peter<br />
Blundell-Jones)<br />
223
224<br />
<strong>Schularchitektur</strong> und neue Lernkultur<br />
8
<strong>Schularchitektur</strong> <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong>: <strong>Drei</strong> <strong>Waldorfschulen</strong><br />
8 Christoph Forster, plus+bauplanung<br />
GmbH, Freie Waldorfschule Kirchheim,<br />
große Schule (oder 2. Bauabschnitt).<br />
Seite 224: Plan Erstes Obergeschoss<br />
(oben), Eingangshof. Beide Bilder:<br />
Suhan Su<br />
Seite 225: Zweigeschossige Halle<br />
(oben rechts, Bild: W. Janzer, und<br />
oben links, Bild: Suhan Su), Galerie<br />
im ersten Geschoss (Mitte, Bild:<br />
Suhan Su), Kunstraum (unten)<br />
225
226<br />
<strong>Schularchitektur</strong> und neue Lernkultur<br />
9 Olaf Hübner/Christoph Forster,<br />
plus+bauplanung GmbH, Freie<br />
Waldorfschule Kirchheim.<br />
Bibliothek mit Blick auf kleine Schule<br />
(oben links), Bibliotheksraum (oben<br />
rechts, Bild: Peter Blundell-Jones),<br />
Bühne, vorder- und rückseitig geöffnet,<br />
mit Blick auf Halle (Mitte), Saal<br />
(unten, Bild: Peter Blundell-Jones)<br />
9
Die Freie Waldorfschule Frankfurt<br />
Die Freie Waldorfschule in Frankfurt ist durchgängig zweizügig. Sie sollte auf<br />
einem beengten Grundstück um ein Gebäude erweitert werden, das hauptsächlich<br />
den ersten drei Jahrgängen eine neue Heimat bieten sollte. Neben<br />
dem Kollegium und den Eltern haben wir die Drittklässler intensiv in die<br />
Planung einbezogen. Betreut wurde dieses Projekt von Olaf Hübner, der<br />
damals noch in Frankfurt wohnte und so den wöchentlichen Bauausschusssitzungen<br />
und den täglichen Bauleitungsaufgaben nachkommen konnte.<br />
Nach dem Abriss eines obsoleten Pavillons entstand in der Nordostecke<br />
des bestehenden Waldorfschulgeländes der zwei- bis dreigeschossige Neubau.<br />
Die <strong>Kinder</strong> erreichen ihre Klasse über den «Marktplatz». Jeder Klassenraum<br />
ist als «Haus» im Haus konzipiert : wie eine eigene Wohnung mit einem<br />
eigenen Eingangsbereich, eigenen Garderoben und Toiletten, außerdem<br />
schließt an jeden Klassenraum ein kleiner Rückzugsbereich zum Lesen,<br />
Unterhalten und zu vielem mehr an, ein kleines Nest oder eine Höhle, die<br />
einen Rückzug aus dem Schulalltag ermöglicht. Es soll so schön und «heimelig»<br />
werden wie zu Hause, Ausgänge aus jeder der Klassen verstärken den<br />
Charakter der eigenen Unabhängigkeit.<br />
Große Fenster machen den Raum hell und einladend. In den «Häusern»<br />
des Obergeschosses erblickt man die kühne Dachkonstruktion aus Holz.<br />
Oberlichter zum Marktplatz sorgen <strong>für</strong> zusätzliche Belichtung.<br />
Verschachtelt wie in einem Bergdorf laufen die Treppen und Vorplätze<br />
der Klassenhäuser auf den «Marktplatz» zu. Sitznischen und Aussichtspunkte<br />
laden zum Verweilen und Beobachten ein. Das Glasdach bringt Sonne und<br />
Licht ins Innere. Die Holzkonstruktion wirft vielfältige Schattenspiele. Große<br />
und kleine, hohe und niedrige Räume finden sich zusammen. Wie eine kleine<br />
Stadt mit ihren vielen unterschiedlichen Elementen, ähnlich den Plätzen eines<br />
Dorfes, entsteht die Schule als Ort des Tätigseins.<br />
Die Handarbeit mit ihren zwei Ebenen lädt zum konzentrierten Arbeiten<br />
ein. Der hohe Teil schafft Platz <strong>für</strong> Zusammenkünfte und Diskussionen. Die<br />
Treppe ist breit genug, so dass auch hier genügend Platz zum Sitzen oder zum<br />
Ablegen von allem möglichen Krimskrams ist.<br />
Die Heileurythmie, am «Marktplatz» gelegen, baut auf einem Sechseck<br />
auf. Das Dachtragwerk bildet sich als Quadrat im Quadrat, ein indianischer<br />
Hogan. Eine Regalwand trennt den kleinen Garderobenbereich ab. Während<br />
der Bauphase haben wir als kleines Geschenk noch zwei Oberlichter eingebaut.<br />
Nun entsteht zu jeder Tageszeit ein anderes Licht- und Farbenspiel auf<br />
den Wänden. Die unterspannten Träger der Dachkonstruktion lassen die<br />
Musikräume zu einem Saiteninstrument werden. Das neuartige Instrument<br />
verlangt noch nach einer eigenen Komposition. Darunter liegt der größte<br />
Raum, der Eurythmiesaal, dessen hölzerne Wandverkleidung sich zum Altarraum<br />
der Handlung des freien christlichen Religionsunterrichtes öffnen lässt.<br />
Er hat eine übergroße Raumhöhe, im Inneren spürt man nicht, dass er eingegraben<br />
ist.<br />
<strong>Schularchitektur</strong> <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong>: <strong>Drei</strong> <strong>Waldorfschulen</strong><br />
227
228<br />
<strong>Schularchitektur</strong> und neue Lernkultur<br />
Zur Einweihung im März 2002 schrieb Stephan Sigler, eine der treibenden<br />
Kräfte aus dem Baukreis : «Das Projekt Neubau hat vom ersten Entschluss<br />
bis zur Einweihung fast zwei Jahre gedauert. Sehr viel Arbeit war in dieser<br />
Zeit von allen Beteiligten in die Planung und Ausführung gesteckt worden.<br />
Wir denken, es hat sich gelohnt ! Es ist ein schönes Haus geworden, und es<br />
wird vor allem das Haus der <strong>Kinder</strong> werden, die es beziehen. Angeregt durch<br />
die lebendigen Formen und Farben, sollen sie sich zu Hause und geborgen<br />
fühlen und mit Freude und Begeisterung lernen können, so dass sie sich tief<br />
in die Welt einwurzeln können.»<br />
Heute können wir sagen, dass die Schule lebt und von allen geliebt wird.<br />
Bauherr : Waldorfschulverein Frankfurt<br />
Architekt : plus+bauplanung GmbH<br />
Projektarchitekt Dipl. Ing. Olaf Hübner<br />
Planung : 2000. Bau 1 / 2001–3 / 2002<br />
10
<strong>Schularchitektur</strong> <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong>: <strong>Drei</strong> <strong>Waldorfschulen</strong><br />
10 Olaf Hübner, plus+bauplanung<br />
GmbH, Freie Waldorfschule<br />
Frankfurt.<br />
Seite 228: Plan Ebene 1 mit<br />
Umgebung<br />
Seite 229: Nordansicht (oben),<br />
Eingang (unten links), Eingangshalle<br />
Canyon (Mitte rechts), Eingangsfront<br />
(unten rechts, Bild: Suhan Su)<br />
229
230<br />
<strong>Schularchitektur</strong> und neue Lernkultur<br />
11
<strong>Schularchitektur</strong> <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong>: <strong>Drei</strong> <strong>Waldorfschulen</strong><br />
11 Olaf Hübner, plus+bauplanung<br />
GmbH, Freie Waldorfschule<br />
Frankfurt.<br />
Seite 230: Separater Eingangsraum<br />
einer Klasse mit Garderobe und WC<br />
(oben), Handarbeitsraum mit Galerie<br />
(links), Galerie Obergeschoss<br />
(rechts).<br />
Seite 231: Ansicht Nord (oben),<br />
Ansicht Ost.<br />
Alle Bilder: Suhan Su<br />
231
232<br />
<strong>Schularchitektur</strong> und neue Lernkultur<br />
12 Olaf Hübner, plus+bauplanung<br />
GmbH, Freie Waldorfschule Frankfurt:<br />
Ansicht Innenhof/West (oben),<br />
Ansicht Turm/Süd (unten).<br />
Beide Bilder: Suhan Su<br />
Literatur<br />
Blundell Jones, Peter ( 2006 ) : Peter Hübner – Building as a Social Process / Bauen als<br />
ein sozialer Prozess. Stuttgart / London : Edition Axel Menges.<br />
Blundell Jones, Peter ( 2001 ) : Lifelong Learning. In : Architectural Review, Heft 1,<br />
S. 55–59.<br />
Blundell Jones, Peter ( 1999 ) : Social Engagement. In : Architectural Review, Heft 2,<br />
S. 40–44.<br />
Hübner, Peter / Spirandelli, Beatrice ( 2001 ) : Peter Hübner : Una Scuola-Città. In :<br />
L’Architettura Naturale, Heft 2, S. 24–35.<br />
Hübner, Peter ( 2001 ) : Schule mit Wohlfühlfaktor. In : AIT Intelligente Architektur,<br />
Heft 3 ( Sonderdruck ).<br />
12