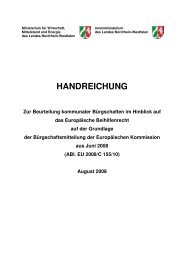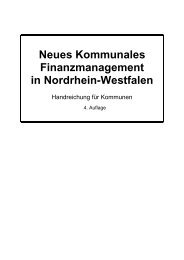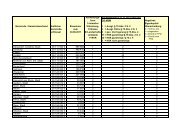Die Kopie als unehrlichstes Kompliment (4 MB) - MIK NRW
Die Kopie als unehrlichstes Kompliment (4 MB) - MIK NRW
Die Kopie als unehrlichstes Kompliment (4 MB) - MIK NRW
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Foto: bilderbox - Fotolia.com<br />
8<br />
Titelthema<br />
<strong>Die</strong> <strong>Kopie</strong> <strong>als</strong><br />
<strong>unehrlichstes</strong> <strong>Kompliment</strong><br />
<strong>Die</strong> Produkt- und Markenpiraterie ist ein wachsendes Problem für die Wirtschaft,<br />
doch bei der Bekämpfung fehlt es an nachhaltigen Konzepten und Regelungen<br />
Von Peter Niggl<br />
Kaum hatte die diesjährige Technologiemesse „CeBIT“ in Hannover ihre Pforten<br />
geöffnet, da rauschten auch schon Polizei, Staatsanwaltschaft und sogar zwei<br />
Richter aufs Messegelände. Ihnen ging es darum, worum es mittlerweile auf<br />
zahlreichen Messen und Ausstellungen geht: um Plagiate, F<strong>als</strong>ifikate oder wie<br />
man den gegenständlich gewordenen geistigen <strong>Die</strong>bstahl auch immer nennen<br />
mag. <strong>Die</strong> Richter hatten ihre juristischen Utensilien sozusagen griffbereit<br />
dabei, um die Messehallen für Eilverfahren in Gerichtssäle zu verwandeln. Der<br />
Staatsanwaltschaft der niedersächsischen Hauptstadt hatten 28 Anzeigen von<br />
Rechteinhabern vorgelegen; die meisten wegen mutmaßlichen Verstoßes gegen<br />
das Patentrecht, wie Gerichtssprecher Michael Siegfried erläuterte. <strong>Die</strong> Gesetzeshüter<br />
und erstm<strong>als</strong> auch Ermittlungsrichter waren bereits am 1. Messetag im<br />
Einsatz. Sie stellten in 14 Fällen Schutzrechtsverletzungen fest.<br />
Fachleute empfehlen Firmenvertretern<br />
für ihren Messebesuch inzwischen, möglichst<br />
früh ihren Rundgang zu beginnen.<br />
Wessen Produktsortiment dafür prädestiniert<br />
ist, gefälscht zu werden, sollte sich<br />
rechtzeitig einen Überblick verschaffen,<br />
rät beispielsweise Rechtsanwalt Dr. Ralph<br />
Egerer von der Nürnberger Anwaltssozietät<br />
Rödl & Partner. Auf einer Veranstaltung<br />
der IHK Mittelfranken empfahl er zudem,<br />
solche Rundgänge zu wiederholen: „Um<br />
Entdeckung zu vermeiden, werden Produktfälschungen<br />
häufig erst am zweiten<br />
oder dritten Messetag ausgestellt.“<br />
Messebesuche des Zolls<br />
Inzwischen ist es eine ganze Reihe von<br />
Messen, die mit solchen Polizeiaktionen<br />
in die Schlagzeilen gerieten. Das Hauptzollamt<br />
Darmstadt beschlagnahmte am 30.<br />
Januar 2010 nicht weniger <strong>als</strong> 5.909 Fälschungen<br />
markengeschützter Produkte<br />
auf der „Paperworld 2010“, der Fachmes-<br />
se für Büroartikel. <strong>Die</strong> sichergestellten<br />
Büroartikel, insbesondere Stifte, Radiergummis<br />
und Aktenvernichter, stammten<br />
zum größten Teil aus China, aber auch<br />
aus Indien, Pakistan, Korea, Malaysia<br />
und Taiwan. Keine zwei Wochen später<br />
beschlagnahmten Zollbeamte auf der<br />
Frankfurter Konsumgütermesse „Ambiente“<br />
beispielsweise Servierplatten, die im<br />
Design denen der Firma Villeroy & Boch<br />
im wahrsten Sinne des Wortes täuschend<br />
ähnlich waren. <strong>Die</strong> Zollbeamten waren<br />
bereits im fünften Jahr auf der „Ambiente“<br />
unterwegs.<br />
Vor ihrem Einsatz müssen sie Kataloge<br />
wälzen und die Produktpalette im Internet<br />
studieren. Bereits am Eröffnungstag<br />
durchkämmen sie in zwei Teams die Hallen<br />
und werden dabei von Vertretern der<br />
Firmen und deren Anwälten begleitet.<br />
Ob der Dichter Theodor Fontane, Chrysler-<br />
Manager Lee Iacocca oder die Modezarin<br />
Coco Chanel – sie alle fanden, dass die<br />
Produkt- und Markenschutz<br />
Unsere IP-Videosysteme<br />
lassen Technikerherzen schneller schlagen.<br />
compe<br />
Unsere Erfahrung beruhigt.<br />
<strong>Kopie</strong> das ehrlichste <strong>Kompliment</strong> sei. Wie<br />
die Praxis jedoch zeigt, ist kaum jemand<br />
auf dieses <strong>Kompliment</strong> erpicht. Als erste<br />
Messegesellschaft unterstützt deshalb<br />
die Messe Frankfurt seit Januar 2006<br />
Aussteller im Kampf gegen Marken- und<br />
Produktpiraterie. Allein im vergangenen<br />
Jahr nutzten rund 5.000 Betroffene diese<br />
Anlaufstelle.<br />
Im Allgemeinen spricht man von Produktpiraterie,<br />
aber das Feld der Rechtsverstöße<br />
ist weit. „Nehmen wir <strong>als</strong> einfaches<br />
Beispiel eine x-beliebige Textilie“, erläutert<br />
Robert Eck die Problematik, „denn<br />
Textilien sind immer noch der Renner bei<br />
den F<strong>als</strong>ifikaten. Irgendjemand nimmt ein<br />
T-Shirt und druckt einen bekannten Martence<br />
kennamen drauf; dann ist das einfach<br />
Markenpiraterie. Mehr Mühe macht sich<br />
der Fälscher gar nicht.“ Im gegenteiligen<br />
Fall, so der Geschäftsführer der r.o.l.a.<br />
Business Solutions GmbH, „sieht es vielleicht<br />
so aus: Der Fälscher verwendet<br />
Sicherheit – von GEUTEBRÜCK! Videosicherheit ist unsere Kompetenz – schon seit 40 Jahren.<br />
Unsere intelligenten Systeme, analog, hybrid oder rein IP-basiert, liefern die richtige Information,<br />
zuverlässig genau im entscheidenden Moment. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Unsere<br />
Systeme sorgen dafür, dass sich unsere Kunden ganz entspannt auf Ihre Aufgaben konzentrieren<br />
können. So anspruchsvoll die Anforderungen auch sein mögen. Was Sie davon haben, wenn<br />
wir unsere Kompetenz in Videosicherheit mit Expertenwissen aus dem Bereich IT kombinieren,<br />
Competence in Video Security<br />
SECURITY insight<br />
erfahren Sie unter www.geutebrueck.de<br />
2/2010 9
10<br />
Titelthema<br />
schon etwas mehr Mühe darauf, sein<br />
Produkt genauso aussehen zu lassen<br />
wie das begehrte Original, schreibt aber<br />
einen Fantasienamen darauf. Auch das<br />
ist illegal und fällt im engeren Wortsinne<br />
unter den Begriff Produktpiraterie.“<br />
Aber neben diesen beiden Begriffen sind<br />
noch weitere Bezeichnungen von Bedeutung.<br />
<strong>Die</strong> Konzeptpiraterie bezieht sich auf<br />
von Herstellern und <strong>Die</strong>nstleistern entwickelte<br />
Prozesse. Nachahmer übernehmen<br />
ein definiertes Konzept und generieren<br />
das gleiche Konzept unter einem anderen<br />
„Branding“. <strong>Die</strong>ser Begriff steht für<br />
die enge Koppelung von Produkt, Marke,<br />
Unternehmen und Konsument. Dann kennt<br />
man den für fast alles benutzten Terminus<br />
„Plagiat“. Er bezeichnet Verletzungen<br />
des Designs nach dem Urheberrecht und<br />
Geschmacksmuster. Der Plagiator verletzt<br />
diese Rechte bewusst, indem er fremdes<br />
Ideengut <strong>als</strong> sein eigenes ausgibt.<br />
Dann gibt es noch das „F<strong>als</strong>ifikat“ (= Fälschung).<br />
Der Fälscher verletzt bewusst<br />
bestehende Schutzrechte der Rechteinhaber.<br />
Im Gegensatz zum Plagiat entwendet<br />
er nicht die Idee, sondern produziert<br />
einen Gegenstand und kennzeichnet ihn<br />
mit einer Marke, an der er keine Rechte<br />
besitzt. Etwas neuer im Wörterbuch<br />
des Ideenklaus ist „Counterfeiting“. Der<br />
Begriff bedeutet in der deutschen Sprache<br />
ebenfalls nur schlicht „Fälschung“<br />
und wird dort synonym mit Produkt- und<br />
Markenpiraterie verwendet. <strong>Die</strong> EU-Kommission<br />
erarbeitet derzeit eine geeignete<br />
Definition für Produkt-, Marken- und<br />
<strong>Die</strong>nstleistungspiraterie. Und dann gibt<br />
es noch die „Sklavische Nachahmung“:<br />
Bei einem Plagiat steht die Nachahmung<br />
eines Produkts im Zentrum. Es kann entweder<br />
sklavisch exakt oder mit kleineren<br />
Änderungen nachgebaut werden.<br />
Den Ausschlag gibt<br />
die Verwechslungsgefahr<br />
Für r.o.l.a.-Chef Eck, zu dessen vornehmlichsten<br />
Aufgaben das Aufstöbern von<br />
Plagiaten im Internet und anderswo<br />
sowie das Erforschen ihrer Herkunft und<br />
Verbreitung zählt, gilt der Kernsatz: <strong>Die</strong><br />
Einstufung einer Ware <strong>als</strong> Fälschung ist<br />
dann gegeben, „wenn Verwechslungsgefahr<br />
besteht“. Zum buchstäblich heißen<br />
Eisen wurde in einem solchen Fall<br />
ein Waffeleisen, das Tchibo in seinen<br />
Filialen angeboten hatte. Ein Rechtsstreit<br />
mit dem Sauerländer Waffeleisen-Hersteller<br />
Cloer folgte auf dem Fuße. Das<br />
Kölner Landgericht verbot den Vertrieb<br />
des Waffeleisens. Ein Gerichtssprecher<br />
Jedes Jahr zeichnet die Aktion Plagiarius<br />
e. V. besonders dreiste Produktfälschungen<br />
mit diesem Zwerg mit<br />
goldener Nase – dem „Plagiarius – aus<br />
und benennt dabei auch, wenn bekannt,<br />
explizit die Fälscher und Vertreiber.<br />
Nicht nur die Plagiatoren seien die<br />
bösen Buben, so Robert Eck. Gar nicht<br />
so selten komme es vor, dass hiesige,<br />
durchaus renommierte Geschäftsleute<br />
und Unternehmen nach Fälschern regelrecht<br />
Ausschau halten, um ein interessantes<br />
Produkt zu einem verlockend<br />
günstigen Preis zu bekommen.<br />
sagte, die 31. Zivilkammer sehe in dem<br />
Tchibo-Produkt eine unzulässige Nachahmung<br />
eines Cloer-Waffeleisens.<br />
Ein Gutachter hatte die pikante Peinlichkeit<br />
festgestellt, dass bei dem Waffeleisen<br />
sogar ein Konstruktionsfehler des<br />
Origin<strong>als</strong> mit kopiert worden war. Mit<br />
ihrem Spruch verpflichteten die Kölner<br />
Richter den Kaffeeröster, Cloer „jedweden<br />
Schaden zu ersetzen“, der ihr durch<br />
den Vertrieb des Plagiats entstanden ist<br />
oder noch entstehen wird. Zweifelsfrei ein<br />
bitterer Nachgeschmack für den renommierten<br />
Kaffeeröster aus Hamburg, auch<br />
wenn er im Parallelverfahren um ein Waffeleisen,<br />
das er ein Jahr später in den<br />
Handel brachte, gegen Cloer obsiegte. <strong>Die</strong><br />
Zivilkammer bewertete die Ähnlichkeit in<br />
diesem Fall <strong>als</strong> „nicht so augenfällig“.<br />
In Sachen Plagiate klaffen dann auch<br />
schon mal Anspruch und Wirklichkeit<br />
etwas auseinander. So können Besucher<br />
der Website von Bitburger der Erkenntnis<br />
sicher nur zustimmen: „<strong>Die</strong> sich häufenden<br />
Skandale in der Lebensmittelbranche<br />
verleihen der Parole ‚Geiz ist Geil‘ einen<br />
bitteren Nachgeschmack. Denn immer<br />
mehr und immer billiger produzieren – das<br />
geht oft nur auf Kosten der Produktqualität.“<br />
Der Satz bekommt vielleicht eine etwas<br />
herbe Note, wenn man im Berliner<br />
Tagesspiegel vom 6. September vergangenen<br />
Jahres einen Bericht über das<br />
Museum Plagiarius liest: zum Beispiel<br />
die Geschichte „der zwei kleinen, länglichen<br />
Metalltaschenlampen und damit<br />
die der Brauerei Bitburger, die zu jedem<br />
SECURITY insight 2/2010<br />
Foto: Foto-Ramminger - Fotolia.com<br />
gekauften Kasten Bier zu Werbezwecken<br />
eine Taschenlampe der Marke Maglite<br />
verschenken wollte. Das Angebot von<br />
Maglite war der Brauerei zu teuer, und<br />
so wurde einfach eine chinesische Firma<br />
beauftragt, Taschenlampen herzustellen,<br />
die von den Originalen kaum zu unterscheiden<br />
waren.“<br />
Eck benutzt dafür den Begriff der „Auftragsfälschung“<br />
und verlegt den Ursprung<br />
derartiger F<strong>als</strong>ifikate in heimische Gefilde.<br />
Er steht mit seiner Einschätzung nicht<br />
allein da. Bei der diesjährigen Verleihung<br />
des gefürchteten Negativpreises „Plagiarius”<br />
am 12. Februar 2010 auf der<br />
Frankfurter „Ambiente” wurde zwar festgestellt:<br />
„Mehr <strong>als</strong> die Hälfte (54 %) der<br />
beschlagnahmten Waren hatten dabei<br />
laut EU-Kommission ihren Ursprung in<br />
China.“ Zugleich aber wurde das Augenmerk<br />
auch auf andere Schuldige der<br />
Plagiat-Hausse gelenkt: „Produkt- und<br />
Markenpiraterie ist aber ein globales<br />
Problem. Der Fokus darf daher nicht<br />
nur auf diejenigen gerichtet werden, die<br />
die Nachahmungen herstellen, sondern<br />
auch auf diejenigen, die sie in Auftrag<br />
geben beziehungsweise billig ein- und<br />
teuer weiterverkaufen. Bewiesenermaßen<br />
profitieren Firmen sowie Groß- und<br />
Einzelhändler aus aller Welt vom Handel<br />
mit Plagiaten und Fälschungen.“<br />
Gesellschaftsfähig<br />
Obwohl gelegentlich rückläufige Entwicklungen<br />
bei den Plagiaten konstatiert<br />
werden, sprechen die absoluten Zahlen<br />
eine andere Sprache. Allein an den<br />
Titelthema<br />
Ungeliebte <strong>Kopie</strong>n gibt es nicht nur im<br />
Zusammenhang mit der Produkt- und<br />
Markenpiraterie, sondern auch in der<br />
industriell gesteuerten Biologie. Das<br />
nennt man dann „Klon“ – von Wissenschaft<br />
und Teilen der Wirtschaft gefeiert,<br />
von der Bevölkerung meist abgelehnt.<br />
EU-Außengrenzen haben Zollbeamte im<br />
Jahr 2008 mehr <strong>als</strong> 178 Millionen rechtsverletzende<br />
Artikel sichergestellt – eine<br />
Steigerung um mehr <strong>als</strong> 100 Prozent im<br />
Vergleich zum Vorjahr. „Studien zeigen<br />
erschreckenderweise, dass Fälschungen<br />
im 21. Jahrhundert gesellschaftsfähig<br />
sind. Argumentiert wird häufig mit<br />
dem günstigen Preis. Das Problem liegt<br />
darin, dass Verbraucher zugleich Marken-<br />
und Schnäppchenjäger sind“, hieß<br />
es anlässlich der diesjährigen Plagiarius-<br />
Verleihung. <strong>Die</strong> Aktion wurde 1977 vom<br />
Designer Prof. Rido Busse ins Leben<br />
gerufen. Es sei „wichtig, die bewusste<br />
Nachfrage im Keim zu ersticken. Der<br />
vermeintlich hohe Preis des Origin<strong>als</strong><br />
muss nachvollziehbar sein, dann sind die<br />
Kunden auch bereit, ihn zu zahlen.“<br />
Nicht selten werden Firmen zuweilen<br />
Opfer ihrer eigenen Unternehmensstrategie.<br />
Produktionsstätten werden aus<br />
Kostengründen beispielsweise in den<br />
asiatischen Raum verlegt. <strong>Die</strong> Manager<br />
transferieren Technik und Know-how<br />
dorthin und stellen schließlich entrüstet<br />
fest, dass die Anlagen für ein gewisses<br />
„Mehrprodukt“ genutzt werden, das sich<br />
dann auf verschlungenen Wegen neben<br />
dem Original in den Warenlagern wiederfindet.<br />
Dabei sind nicht nur Messen hier zu<br />
Lande oder auf dem europäischen Kontinent<br />
äußerst aufschlussreich, auch<br />
Messebesuche in Fernost haben, wie<br />
faz.net feststellt, „für die deutschen<br />
Maschinenbauer häufig den lehrreichen<br />
Nebeneffekt, aus nächster Nähe<br />
11<br />
Mit einer intelligenten<br />
Zutrittsorganisation<br />
ist es egal,<br />
wer oder was da noch<br />
auf Sie zukommt.<br />
BlueChip TimeLine.<br />
<strong>Die</strong> elektronische<br />
Zutritts organisation<br />
der Zukunft.<br />
+ Schlüsselbetätigt<br />
+ Örtlich und zeitlich begrenzte<br />
Zutrittsberechtigungen<br />
+ Schnelle und kostengünstige<br />
Erweiterung und Änderung<br />
+ Maximaler Komfort, minimaler<br />
Aufwand<br />
www.winkhaus.de
12<br />
Titelthema<br />
Jede Kleinigkeit perfekt erkennen.<br />
Megapixel Vari Focal Objektive für 1/2" und 1/3".<br />
www.fujinon.de Medical TV CCTV Machine Vision Binoculars<br />
Mit den Megapixel Vari Focal Objektiven von Fujinon<br />
entgeht Ihnen nichts mehr. Das umfangreiche<br />
Sortiment bietet für jeden Einsatz die ideale Lösung und deckt alle<br />
nötigen Brennweitenbereiche ab: Vom maxima len Bildwinkel von<br />
120° bei 1/3" bis zum Teleobjektiv mit einem Brenn wei ten bereich von<br />
FUJINON (EUROPE) G<strong>MB</strong>H, HALSKESTRASSE 4, 47877 WILLICH, GERMANY, TEL.: +49 (0)21 54 924-0, FAX: +49 (0)21 54 924-290, www.fujinon.de, cctv@fujinon.de<br />
FUJINON CORPORATION, 1-324 UETAKE, KITAKU, SAITAMA CITY, 331-9624 SAITAMA, JAPAN, TEL.: +81 (0)48 668 21 52, FAX: +81 (0)48 651 85 17, www.fujinon.co.jp<br />
Besuchen Sie uns in Birmingham<br />
IFSEC, Halle 5 Stand E25<br />
10.–13. Mai 2010<br />
8 bis 80 mm für 1/2". Alle Objektive verfügen über eine brillante<br />
Auflösung mit 3 Megapixel und eine gute Lichtstärke ab F1.2. Für<br />
die Überwachung rund um die Uhr bietet Fujinon Infrarot korrigierte<br />
Modelle, die gestochen scharfe Bilder bei Tag und Nacht liefern, ohne<br />
dass nachfokussiert werden muss. Fujinon. Mehr sehen. Mehr wissen.<br />
Schaffte es auf den zweifelhaften<br />
1. Platz beim „Plagiarius 2010“: der<br />
gefälschte Eiswürfelbehälter „Eisi“ (r.)<br />
der Shanghai Yuhao Household Appliance<br />
Manufacturing Co. Ltd. Zwei<br />
deutsche Händler haben inzwischen<br />
Unterlassungserklärungen unterschrieben,<br />
die Plagiate vom Markt<br />
genommen und Restbestände vernichtet.<br />
Das Original (l.) stammt von der<br />
Tupperware Deutschland GmbH.<br />
Auf den 3. Platz beim „Plagiarius 2010“<br />
gelangte die Fälschung des Multimediasessels<br />
„Music Rocker cubic“ (r.),<br />
die hier zu Lande die friboss Handelsgesellschaft<br />
mbH & Co. KG aus Heilbronn<br />
vertrieb . Das Original (l.) stammt<br />
von der Blomberger Easychair GmbH.<br />
studieren zu können, wie aggressiv die<br />
Produktpiraten aus China oder Indien<br />
inzwischen vorgehen“. Nicht selten<br />
stießen „die Ingenieure dabei auf<br />
Maschinen und Teile, die im eigenen<br />
Unternehmen gerade erst <strong>als</strong> Prototypen<br />
die Tests durchlaufen haben. Den<br />
Verkauf solcher Plagiate insbesondere<br />
in den Schwellenländern zu unterbinden<br />
ist in der Regel ein fast aussichtsloses<br />
Unterfangen, lautet die Erkenntnis im<br />
Maschinenbauverband VDMA.“<br />
<strong>Die</strong> Chancen, den Produkt-Freibeutern<br />
mit immer neuen und verbesserten Fabrikaten<br />
in der rauen See der Warenwelt<br />
Produkt- und Markenschutz<br />
Da Fälscher ohnehin keine Scham<br />
empfinden, darf es nicht weiter verwundern,<br />
dass auch solche Produkte<br />
nachgemacht werden. <strong>Die</strong> Original-Liebeskugeln<br />
„Smartballs“ (l.) sind von der<br />
Bremer Fun Factory, für den illegalen<br />
Vertrieb der Fälschungen (r.) zeichnete<br />
der Luxemburger Internet-Vertriebler<br />
Dretschler.com Sarl verantwortlich.<br />
Dass er inzwischen den Domain-Namen<br />
gewechselt hat, mag Zufall sein…<br />
Immer wieder gern kopiert: hochwertiges<br />
Schneidwerkzeug „made in Germany“.<br />
Das dreiteilige Küchenmesserset<br />
(l.) von Zwilling aus Solingen kopierte<br />
das chinesische Unternehmen Cheng Fa<br />
Hotel Product. <strong>Die</strong> <strong>Kopie</strong> (r.) bekam den<br />
„Plagiarius”-Sonderpreis.<br />
davonsegeln zu können, wie es häufig<br />
mittelständische Unternehmen versuchen,<br />
sehen Fachleute <strong>als</strong> gering an.<br />
„Man meint, mit Innovationen einen Vorsprung<br />
halten zu können, aber das ist<br />
eine teuere Strategie, weil die technologische<br />
Entwicklung immer schneller voranschreitet“,<br />
sagt der Münchener Wirtschaftsprofessor<br />
Horst Wildemann. Von<br />
ihm stammt auch die Formel, der zufolge<br />
„bei Produktpiraterie eine Ware nachgeahmt<br />
[wird], für welche der Originalhersteller<br />
Verfahrens-, Erfindungs- oder<br />
Designrechte besitzt, er <strong>als</strong>o Patentinhaber<br />
oder Urheber ist, oder ein gebrauchs-<br />
beziehungsweise geschmacksmusterrechtlicher<br />
Schutz besteht“.<br />
Bei allen bisherigen Anstrengungen, diesem<br />
Wildwuchs des „freien Handels“ zu<br />
begegnen, sprechen offizielle Zahlen<br />
immer noch eine beredte Sprache. 29<br />
Milliarden Euro Schaden für die deutsche<br />
Wirtschaft konstatiert die Politik. Ein<br />
Nennwert, der allerdings seit Jahren fortgeschrieben<br />
wird und verdeutlicht, wie<br />
extrem schwer eine wirkliche Quantifizierung<br />
ist.<br />
Keine umfassende Regelung<br />
in Sicht<br />
Den Kampf gegen die Fälschungsindustrie<br />
haben sich viele Verbände und Organisationen,<br />
Unternehmen und Anwaltskanzleien<br />
auf die Fahnen geschrieben. Eine umfassende<br />
Regelung ist nicht in Sicht. Auch die<br />
seit 1919 bestehende und inzwischen in 90<br />
Länder vertretene Internationale Handelskammer<br />
(ICC), die sich der Förderung der<br />
freien Marktwirtschaft verpflichtet fühlt,<br />
hat sich mit ihrer Initiative BASCAP (Business<br />
Action to Stop Counterfeiting and<br />
Piracy) zu Wort gemeldet und verfolgt<br />
damit nach eigenem Dafürhalten das Ziel,<br />
das Bewusstsein der Öffentlichkeit für die<br />
Gefahren der Marken- und Produktpiraterie<br />
zu schärfen. Konkrete Zielvorgaben<br />
sehen anders aus.<br />
So bleibt die mehr oder minder offene<br />
Seeschlacht mit den Likedeelern des geistigen<br />
Eigentums, die allein mit Justitias<br />
Schwert nicht gewonnen werden kann.<br />
„Es geht darum, den Unternehmen zu zeigen,<br />
dass die Kosten für moderne Sicherungssysteme<br />
sich rechnen können und<br />
dass die Abwehr von Plagiaten präventiv<br />
erfolgen muss. Der Schutz vor Fälschern<br />
ist keine juristische Aufgabe, sondern<br />
eine für das Management“, schreibt Wildemann<br />
den Piratenopfern und denen, die<br />
es werden könnten, ins Stammbuch.<br />
SECURITY insight 2/2010 13
14<br />
Titelthema<br />
Das Merkmal macht<br />
den Unterschied<br />
Ein geeigneter Schutz vor Produktpiraterie ist die Kennzeichnung von Bauteilen<br />
Von Prof. Dr. Willibald A. Günthner und Dominik Stockenberger<br />
Produktpiraterie verursacht für den Originalhersteller neben unmittelbaren<br />
betriebswirtschaftlichen Schäden wie Umsatz- und Gewinnverluste auch Kosten<br />
für Schutzmaßnahmen und Aufwendungen für Anmeldung und Verfolgung<br />
von Schutzrechten. Langfristig kann Produktpiraterie negative Folgen wie<br />
Imageverlust, Senkung des Preisniveaus und Verlust des Know-how-Vorsprungs<br />
haben. Besonders problematisch für die Originalhersteller ist dabei, dass sich<br />
die Originale nicht mehr wie früher deutlich durch die hohe Qualität von <strong>Kopie</strong>n<br />
abheben. <strong>Die</strong> Unterschiede zwischen Original und <strong>Kopie</strong> sind mittlerweile für<br />
Kunden nur schwer oder gar nicht mehr erkennbar.<br />
Auswahl möglicher<br />
Sicherheitsmerkmale<br />
Bildquelle: Schreiner ProSecure<br />
Anforderungen an<br />
Sicherheitsmerkmale<br />
Grundvoraussetzung zur Bekämpfung<br />
von Produktpiraterie ist folglich die nachhaltige<br />
sichere Unterscheidbarkeit von<br />
Original und <strong>Kopie</strong>. Dazu eignet sich insbesondere<br />
die Anbringung von Sicherheitsmerkmalen<br />
an den Originalprodukten,<br />
die in verschiedensten Formen am<br />
Markt verfügbar sind. <strong>Die</strong>se müssen folgenden<br />
Anforderungen genügen:<br />
� �����������������������������������<br />
muss das Objekt eindeutig <strong>als</strong> Original<br />
erkennbar machen.<br />
� ������������������������������heitsmerkmal<br />
darf nur mit höchstem<br />
Aufwand und Kosten von Dritten nachgeahmt<br />
werden können. Auch soll es<br />
nicht nachträglich angebracht werden<br />
können, sondern möglichst fester<br />
Bestandteil des Produkts sein.<br />
� ����������������������������������mal<br />
soll während des gesamten Produktlebenszyklus<br />
vorhanden und nicht<br />
(spurenfrei) entfernt oder auf andere<br />
Produkte übertragbar sein.<br />
� ��������������������������������<br />
Sicherheitsmerkm<strong>als</strong> soll wirtschaftlich<br />
sein. <strong>Die</strong>s beinhaltet auch die einfache<br />
Anbringung sowie schnelle und<br />
einfache Verifizierbarkeit.<br />
Auswahl schützenswerter<br />
Bauteile und Komponenten<br />
<strong>Die</strong> Feststellung der Originalität von Bauteilen<br />
und Komponenten ist im Maschinen-<br />
und Anlagenbau insbesondere im<br />
Moment des Einbaus in die Maschine<br />
beim Kunden oder im eingebauten<br />
Zustand von besonderer Bedeutung. Der<br />
Betreiber muss spätestens jetzt sichergehen,<br />
dass er nicht fälschlicherweise<br />
eine <strong>Kopie</strong> verwendet. Daher wird<br />
im Forschungsprojekt „ProAuthent“ ein<br />
System entwickelt, mit dem Bauteile und<br />
Komponenten von Maschinen und Anla-<br />
gen im eingebauten Zustand auf Echtheit<br />
überprüft werden können. Das Projekt<br />
wird mit Mitteln des Bundesministeriums<br />
für Bildung und Forschung innerhalb des<br />
Rahmenkonzeptes „Forschung für die<br />
Produktion von morgen“ gefördert und<br />
vom Projektträger Karlsruhe im Karlsruher<br />
Institut für Technologie betreut.<br />
<strong>Die</strong> Kennzeichnung und spätere Originalitätsprüfungen<br />
sind stets mit Zusatzaufwendungen<br />
verbunden. Deshalb ist es nicht<br />
zielführend, prinzipiell jedes Bauteil einer<br />
Maschine mit einem Sicherheitsmerkmal<br />
auszustatten. Es müssen folglich jene Bauteile<br />
ausgewählt werden, die sowohl von<br />
Nachahmung bedroht <strong>als</strong> auch von besonderem<br />
Interesse für den Originalhersteller<br />
sind. Mit Hilfe von vier Basiskriterien<br />
und vier ergänzende Kriterien können die<br />
schützenswerten Bauteile und Komponenten<br />
identifiziert werden (vgl. Grafik oben).<br />
Um Sicherheit und Wirtschaftlichkeit<br />
in Ihrem Unternehmen zu erhöhen,<br />
bieten unsere modernsten IP-Video-<br />
systeme ungeahnte Möglichkeiten:<br />
In telli gente Videobildanalyse, Wärme-<br />
bild-Technik und Kameras für extreme<br />
Umweltbedingungen überwachen alle<br />
Ab läufe. Sie unterstützen so Zutritts -<br />
kon troll- und Einbruchmelde an lagen<br />
beim Schutz von Beschäftig ten, Kunden,<br />
Gebäuden und Grund stücken.<br />
Inves ti tionsschonend auch <strong>als</strong> indi vidu-<br />
elle Mietlösung.<br />
Mehr Infor mationen erhal ten Sie unter<br />
0800 7000 444.<br />
www.bosch-sicherheitssysteme.de<br />
Produkt- und Markenschutz<br />
Sicherheitsmerkmale<br />
auf Basis technischer<br />
Einflussgrößen<br />
<strong>Die</strong> zu schützenden Bauteile sind beim<br />
Betrieb von Maschinen und Anlagen<br />
unterschiedlichsten Belastungen wie<br />
hohen Temperaturen, Kühlschmiermittel,<br />
starker Verschmutzung, elektromagnetischen<br />
Feldern, Scheuern und starker<br />
Bestrahlung ausgesetzt. Dennoch sollen<br />
sie dauerhaft <strong>als</strong> Originale erkennbar<br />
sein. Daher kann nicht jedes Sicherheitsmerkmal<br />
zur Anwendung für jedes<br />
Kriterien zur<br />
Identifizierung<br />
schützenswerter<br />
Bauteile<br />
Bauteil geeignet sein. Fünf technische<br />
Einflussgrößen helfen dabei, die Anzahl<br />
der möglichen Kennzeichnungstechnologien<br />
stark einzugrenzen.<br />
Bei der gespeicherten Information ist<br />
zunächst wichtig, ob das schützenswerte<br />
Bauteil <strong>als</strong> Unikat erkannt werden muss<br />
oder ob ein reines Originalitätskennzeichen<br />
ausreicht, bei dem keine Individualisierung<br />
möglich ist. Außerdem muss<br />
festgestellt werden, in welcher Form das<br />
Bauteil beim Prüfen zugänglich ist. Eine<br />
elektromagnetische Prüfung kann bei-<br />
Bieten mehr:<br />
IP-Videosysteme von Bosch.<br />
SECURITY insight 2/2010 15
OBID i-scan ® HF<br />
RFID-Gate-Antennen<br />
-Antennen<br />
für Bibliotheken heken<br />
Perfektion in Design, Funktion<br />
und Service<br />
t 3D-Identifikation<br />
bei Gatebreiten bis 130 cm<br />
t Attraktives Design<br />
t Einfache Montage<br />
t Flexible IT-Integration<br />
t Internationale Zertifizierungen<br />
(ETSI & FCC)<br />
Besuchen Sie uns auf der<br />
Euro ID in Köln<br />
4. – 6. Mai<br />
Expo XXI, Stand B6<br />
OBID ® – RFID by FEIG ELECTRONIC<br />
FEIG ELECTRONIC GmbH<br />
Lange Straße 4 · D-35781 Weilburg<br />
Phone: +49 6471 3109-0<br />
Fax: +49 6471 3109-99 · www.feig.de<br />
Titelthema<br />
Technische Einflussgrößen zur Bestimmung passender Sicherheitsmerkmale<br />
spielsweise bei starker Verschmutzung<br />
der Bauteile ratsam sein. In Bereichen<br />
mit starken elektromagnetischen Feldern<br />
ist der Einsatz optisch oder gar berührend<br />
zu prüfender Merkmale besser geeignet.<br />
<strong>Die</strong> Kriterien Prüfaufwand und Automatisierungsgrad<br />
bedingen sich gegenseitig.<br />
Bei weniger lukrativen Bauteilen kann<br />
die manuelle Prüfung ausreichen, bei<br />
der keinerlei Hilfsmittel für die Prüfung<br />
benötigt werden. Soll hingegen eine<br />
automatische oder halbautomatische<br />
Prüfung möglich sein, müssen Hilfsmittel<br />
wie Barcodescanner, RFID-Lesegeräte,<br />
digitale Kamerasysteme oder andere<br />
Erfassungsgeräte in die Maschine eingebaut<br />
werden. <strong>Die</strong>se werden dann von<br />
der Maschinensteuerung abgefragt oder<br />
vom Maschinenbediener für einen Lesevorgang<br />
ausgelöst. Bei der Infrastruktur<br />
für die Prüfung genügt es zu wissen, ob<br />
elektrischer Strom für die Prüfung zur<br />
Verfügung steht.<br />
Sicherheitsmerkmale<br />
auf Basis betriebswirtschaftlicher<br />
Einflussgrößen<br />
Nach Eingrenzung der für ein Bauteil aus<br />
technischer Sicht verbleibenden möglichen<br />
Sicherheitsmerkmale wird abschließend<br />
eine betriebswirtschaftliche Beurteilung<br />
durchgeführt. Dabei spielen zwei<br />
SI-Autor Prof. Dr.-<br />
Ing. Dipl.-Wirtsch.-<br />
Ing. Willibald<br />
A. Günthner (l.)<br />
arbeitete nach<br />
der Promotion <strong>als</strong><br />
Konstruktions- und<br />
Technischer Leiter für Förder- und<br />
Materialflusstechnik in der Industrie.<br />
1989 übernahm er die Professur für<br />
Förder- und Materialflusstechnik an der<br />
quantitative Größen eine zentrale Rolle:<br />
Gesamtinvestitions- und Gesamtkostenvolumen<br />
des Unternehmens.<br />
Im Gesamtinvestitionsvolumen wird der<br />
Betrag erfasst, den das Unternehmen<br />
bereit ist, für die Einführung und Nutzung<br />
des Sicherheitsmerkm<strong>als</strong> auszugeben.<br />
Darin sind enthalten der Betrag, der<br />
sich aus dem möglichen Invest aus dem<br />
bestehendem Umsatz mit diesem Bauteil<br />
ableitet, aber auch der Betrag, der sich<br />
aus dem Umsatz ergibt, den man durch<br />
den Einsatz eines Sicherheitsmerkm<strong>als</strong><br />
zurückzugewinnen erwartet. <strong>Die</strong> Gesamtkosten<br />
beinhalten die Kosten je Kennzeichen,<br />
die auf die Sicherheitstechnologie<br />
bezogenen Initialkosten sowie die Kosten<br />
für etwaige Prüfgeräte. Sofern der<br />
Gesamtinvest die Gesamtkosten übersteigt,<br />
kann eine Sicherheitstechnologie<br />
sinnvoll eingesetzt werden.<br />
Durch die Nutzung passender Sicherheitsmerkmale<br />
für schützenswerte<br />
Bauteile ist es somit möglich, Originale<br />
jederzeit von Nachbauten und <strong>Kopie</strong>n zu<br />
unterscheiden und Schäden für Originalhersteller<br />
und Kunden zu verringern.<br />
WWW.FML.MW.TUM.DE<br />
WWW.PROAUTHENT.DE<br />
FH Regensburg. Seit<br />
1994 leitet er den<br />
Lehrstuhl für FördertechnikMaterialfluss<br />
Logistik (fml)<br />
an der TU München.<br />
Dipl.-Wi.-Ing. Dominik<br />
Stockenberger ist nach zweijähriger<br />
Tätigkeit in der Automobilindustrie seit<br />
2007 wissenschaftlicher Mitarbeiter am<br />
fml-Lehrstuhl.<br />
Produkt- und Markenschutz<br />
Tinte<br />
<strong>als</strong> Botenstoff<br />
Gedruckte Elektronik bietet für Markenschutz,<br />
Logistik und Zutrittskontrolle langfristig manche Option<br />
Von Frank Baier<br />
Seit über fünf Jahren ist „Print-Elektronik“ ein Begriff in der „grafischen“ Branche<br />
und unter Druckereien, obwohl die Technologie eher eine Domäne der<br />
Elektronikindustrie und des Maschinenbaus bleiben dürfte. Allerdings dürften<br />
sich in zunehmendem Maße auch jene Sicherheits-Entscheider in Unternehmen<br />
damit befassen, die sich um Rahmen der Identifikationstechnologien (zum Beispiel<br />
RFID) mit Warenverfolgung und Produktschutz beschäftigen – ein neues,<br />
aber vielfältiges Einsatzfeld mit großen Effizienzvorteilen.<br />
Völlig gleich bleibt, ob man von gedruckter,<br />
plastischer oder Polymer-Elektronik<br />
spricht – damit sind aus leitfähigen Polymeren<br />
oder auch kleineren Molekülen<br />
der organischen Chemie bestehende<br />
Lösungen gemeint. Anstatt Aluminium-<br />
oder Kupferdrähte für die Übertragung<br />
von elektrischen Signalen oder Strom<br />
zu verwenden, versetzen Chemikalienhersteller<br />
Farben oder Tinten mit leitfähigen<br />
Silber- oder Kohlepartikeln. „Print-<br />
Elektronik ist dünn, leicht und flexibel,<br />
dennoch robust, nicht zerbrechlich und<br />
insbesondere kostengünstig“, nennt<br />
Dr. Klaus Hecker, Geschäftsführer der<br />
Arbeitsgruppe „Organic Electronics<br />
Association“ (OE-A) im Maschinenbau-<br />
Verband VDMA, einige Vorteile.<br />
Mittels gedruckter Elektronik produzierte<br />
Etiketten für RFID-Anwendungen<br />
(Radiofrequenz-Identifikation) – eines<br />
der wichtigsten Felder – können direkt<br />
<strong>als</strong> Firmenlogo fungieren oder in die Markengestaltung<br />
integriert werden. Ebenso<br />
ist die unproblematische Entsorgung<br />
der organischen Elemente im Sinne der<br />
umweltorientierten Nachhaltigkeit einer<br />
der wichtigen Vorzüge.<br />
Experten der OE-A in Frankfurt am Main<br />
machen auf derart produzierte organische<br />
Solarzellen, flexible Displays und<br />
großflächige Leuchtelemente, flache<br />
Batterien, Sensoren und Aktuatoren zur<br />
Integration in „intelligente“ Verpackungen<br />
Hoffnung. Angeblich stehe schon<br />
heute die gedruckte Elektronik – in Form<br />
von dünnen Schaltungen, Halbleitern,<br />
Isolatoren und Laminierungen auf flexiblen<br />
Kunststoff-Substraten – an der<br />
Schwelle zur industriellen Massenfertigung.<br />
Vorrangig soll die Technologie<br />
eine preisgünstige Herstellung mit sehr<br />
hohem Durchsatz besonders in hohen<br />
Volumina ermöglichen – wobei diese<br />
16 SECURITY insight 2/2010 17<br />
Foto: PolyIC GmbH & Co. KG<br />
Professioneller Sicherheitsdruck:<br />
Verschiedene Technologien erlauben<br />
die Massenfertigung von organischen<br />
Komponenten.
18<br />
Titelthema<br />
Gedruckte RFID-Etiketten: Mehrere Kofferanhänger werden<br />
in einer thüringischen Fabrik mit solchen Polymerchips<br />
bestückt.<br />
für favorisierte Verfahren wie den Sieb-,<br />
Flexo- oder Offsetdruck erforderlichen<br />
Auflagengrößen vielfach noch nicht existieren.<br />
Entweder sind viele Materialien<br />
noch nicht oder lediglich in begrenzter<br />
Stückzahl verfügbar: Demnach gibt es in<br />
Deutschland derzeit kaum eine Handvoll<br />
Anbieter für die spezielle Farbpaste.<br />
Chancen für die Logistik<br />
Was nun sind die Sicherheitsaspekte der<br />
gedruckten Elektronik? Beispiel Logistik:<br />
Bislang gilt die Leitfähigkeit von polymer<br />
gedruckten RFID-Etiketten <strong>als</strong> begrenzt.<br />
Wenn sich dieser Nachteil auch durch<br />
die Verwendung von zusätzlichen neuen<br />
(Nano-, Kohlenstoff- oder Hybrid-)Materialien<br />
allmählich aufheben wird, dürften<br />
Logistikanwendungen zur Produktnachverfolgung<br />
<strong>als</strong> Sicherheitsnachweis erst<br />
sehr zögerlich infrage kommen. <strong>Die</strong>se<br />
Tatsache liegt auch in der problematischen<br />
Lesefähigkeit der RFID-Etiketten<br />
bei besonderen Umgebungsbedingungen<br />
bezüglich Temperatur, Chemie,<br />
Feuchtigkeit oder Metallen begründet.<br />
Foto: Bartsch International GmbH<br />
Foto: E-Pinc GmbH<br />
„Unsere Lösungen von gedruckten, polymerbasierten<br />
RFID-Lösungen laufen<br />
langfristig auf die Entwicklungen des<br />
Electronic Product Code (EPC) und des<br />
Item Level Tagging hinaus“, erläutert<br />
Dr. Wolfgang Clemens, Head of Applications<br />
der PolyIC GmbH & Co. KG, einem<br />
Anbieter für organische Elektronik. Damit<br />
meint der Experte, dass mittels standardisierter<br />
Produktschlüssel eine einheitliche<br />
Auszeichnung und Identifizierung<br />
auf Artikel- beziehungsweise Stückgutebene<br />
und über die gesamte Wertschöpfungskette<br />
der (Handels-)Logistik<br />
hinweg ein hohes Sicherheitsniveau<br />
gewährleistet werden könnte. „PolyID“-<br />
Etiketten werden zur Präsenzerkennung<br />
oder zur autorisierten Identifikation<br />
eingesetzt, zum Beispiel <strong>als</strong> automatisches<br />
Echtheitsmerkmal beim Erkennen<br />
und Bedienen technischer Geräte mit<br />
Nachfüllbehälter. Längst sehen die „Chip<br />
Printers“ ein Anwendungspotenzial für<br />
Marketing- und Logistikzwecke, Markenschutz<br />
und Echtheitskontrolle und damit<br />
auch für die Sicherheit von Produkten,<br />
Spezialchemie erforderlich: Elektrisch leitfähige Farben oder<br />
metallbasierte Tinten werden für Anwendungen gedruckter<br />
Elektronik eingesetzt.<br />
deren Herstellern und Kunden. Angaben<br />
der OE-A zufolge, die 2009 ein neues<br />
„Roadmap White Paper“ publiziert hat,<br />
werde die Elektronikindustrie gedruckte<br />
RFID-Anwendungen für Logistik und<br />
„LOPE-C 2010“<br />
Über das Neueste auf dem Gebiet der<br />
gedruckten Elektronik wird in diesem<br />
Jahr die „Large-area, Organic and Printed<br />
Electronics Convention“, kurz LOPE-<br />
C 2010, informieren. <strong>Die</strong> Konferenz und<br />
Ausstellung der Arbeitsgruppe „Organic<br />
Electronics Association“ (OE-A) im<br />
Maschinenbau-Verband VDMA wird<br />
vom 31. Mai bis 2. Juni 2010 im Congress<br />
Center der Messe Frankfurt am Main<br />
zum zweiten Mal die wirtschaftlichen<br />
Trends, die neuesten Prozesstechnologien<br />
und Applikationen einem weltweiten<br />
Fachpublikum von Technologen, Investoren<br />
und Anwendern demonstrieren.<br />
WWW.LOPE-C.COM<br />
Das Da as Portal o ta für ü Sicherheits-Entscheider.<br />
S c e e ts tsc e de<br />
www.security-insight.com<br />
secu y- y ins<br />
g co<br />
Automatisierung erst zwischen 2012 und<br />
2017 schaffen.<br />
„Alternative“ Identifikation<br />
Produkt- und Markenschutz ist ein anderes<br />
Beispiel – dafür gelten jedoch andere<br />
Technologien <strong>als</strong> etwa polymer gedruckte<br />
Elektronik <strong>als</strong> relevant. Sicherheits- und<br />
Spezialfarben, holografische und Sicherheitsmuster,<br />
magnetische Markierungen,<br />
Lasersignaturen, Fingerabdruck-Elemente,<br />
Kryptografie-Kodierungen oder DNA-<br />
Kennzeichnungen sind nur einige Möglichkeiten.<br />
Indessen agieren auch einige<br />
spezialisierte Anbieter für Print-Elektronik,<br />
etwa im sensiblen IT-Sektor: Mit Hilfe<br />
eines elektronischen Sensors will ein<br />
süddeutsches Unternehmen Angriffe auf<br />
vertrauliche Daten mit hohem Sicherheitspotenzial<br />
verhindern. Hier werden<br />
hauchdünne Leiterbahnen bis 0,2 Milli-<br />
Bin ich sicher auf<br />
meinem Weg nach Hause?<br />
Produkt- und Markenschutz<br />
Wie sicher ist eigentlich<br />
mein Unternehmen?<br />
Mit intelligenten Sicherheitslösungen schützen wir Menschenleben<br />
und Werte – überall.<br />
Immer mehr Menschen leben in urbanen Gebieten mit wachsenden Anforderungen an Infrastruktur und Sicherheit.<br />
Sicherheit und Schutz sind Grundbedürfnisse von höchster Priorität. Funktionsfähige und sichere Infrastruktur,<br />
wie Flughäfen, Krankenhäuser und U-Bahnen sind entscheidend für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und die<br />
gesamte Gesellschaft. Mit intelligenten Lösungen bieten wir unseren Kunden mehr Sicherheit zum Schutz von<br />
Menschenleben und Werten – überall. www.siemens.de/buildingtechnologies<br />
Answers for infrastructure.<br />
meter auf eine Folie gedruckt, die sich um<br />
Mikrochips oder andere Speichermedien<br />
verkleben lässt. Riskiert ein Unbefugter<br />
die Manipulation eines damit ausgestatteten<br />
Geräts, entstehen Kurzschlüsse und<br />
Unterbrechungen, werden die entsprechenden<br />
„kritischen“ Daten gelöscht.<br />
Weitere Beispiele sind Identifikation,<br />
Zugangskontrolle und Ticketing. „Papier-<br />
Elektronik“ ist das Geschäft der Crosslink<br />
GmbH, die polymere leitfähige Strukturen<br />
beispielsweise auf personalisierten<br />
Tickets mit integriertem Messeführer<br />
oder auf ID-Karten mit zusätzlicher<br />
Mikrobezahl-Funktion erzeugt. Letztlich<br />
handelt es sich bei den ID-Karten um<br />
wirtschaftliche „Low-Cost“-Produkte,<br />
die Codierung, Online-Abgleich und<br />
Auslesung von Daten seitens Crosslink<br />
erlauben. Perspektiven für die Technologie<br />
sieht Crosslink-Mitgesellschafter<br />
Tino Zillger nicht nur im Direktmarketing,<br />
Spiele- und Entertainment-Sektor:<br />
„‚Papier-Elektronik’ könnten wir auch <strong>als</strong><br />
Fälschungsschutz-Merkmal auf Verpackungen<br />
oder für einfache Zugangskontrollen<br />
mit Gültigkeitsanzeige nutzen.“<br />
Sicherheits-Anwendungen ist die<br />
Bartsch International GmbH schon näher<br />
gekommen: Das Unternehmen druckt für<br />
Fluggesellschaften nicht nur verschiedene<br />
Formulare und Tickets, sondern auch<br />
Kofferanhänger mit integriertem Polymerchip.<br />
Pressesprecher Stefan Scheller<br />
schätzt die jährliche Kapazität der RFID-<br />
Produkte von Bartsch für die Gepäcksortierung<br />
auf derzeit 1,5 Millionen.<br />
WWW.OE-A.ORG<br />
WWW.POLYID.DE<br />
WWW.CLNK.DE<br />
WWW.BARTSCH.DE<br />
SECURITY insight 2/2010 19
Foto: OpSec<br />
20<br />
Titelthema<br />
Ermittler auf dem virtuellen<br />
Tauschbörsenparkett<br />
Maßnahmen zur Bekämpfung der Raubkopierer im Internet<br />
Produktpiraten machen nicht nur Herstellern von Markenartikeln und dem<br />
Maschinenbau zu schaffen. Auch der Film-, Musik-, Buch- und Software-Industrie<br />
entstehen massive Schäden – begünstigt durch das Internet. Täglich werden<br />
unzählige urheberrechtlich geschützte Werke – teilweise sogar noch vor ihrer<br />
offiziellen Erstveröffentlichung – illegal ins Web gestellt und massenhaft von<br />
Internetnutzern heruntergeladen. Doch Raubkopierer, die glauben, im Internet<br />
anonym bleiben zu können, irren sich: Heutzutage gibt es verschiedene Technologien<br />
und Möglichkeiten, um Raubkopien aufzuspüren, illegale Inhalte zu<br />
löschen und die Personen, die die illegalen Vorlagen online stellen, zu ermitteln.<br />
Darauf hat sich OpSec Security, Anbieter von Anti-Fälschungstechnologien und<br />
<strong>Die</strong>nstleistungen für Off- und Online-Markenschutz, spezialisiert, um Rechteinhaber<br />
bei der Bekämpfung digitaler Piraterie zu unterstützen.<br />
Am häufigsten nutzen User für das Up- und<br />
Downloaden legaler und illegaler Dateien<br />
so genannte Peer-to-Peer-Networks (P2P-<br />
Netzwerke), umgangssprachlich Tauschbörsen<br />
genannt. Sie spielen daher bei der<br />
Piraterie-Bekämpfung eine zentrale Rolle.<br />
Der Fokus liegt dabei auf dem Vorgehen<br />
gegen die „First Seeder“, <strong>als</strong>o jene Personen,<br />
die die allerersten illegalen <strong>Kopie</strong>n<br />
eines Werkes online stellen und dadurch<br />
den größten Schaden verursachen. Mit<br />
Hilfe einer speziellen Software werden<br />
klassische Tauschbörsen (zum Beispiel<br />
BitTorrent) sowie einschlägige Portale,<br />
Foren und Blogs nach illegalen Dateien<br />
durchkämmt.<br />
Um zu beweisen, dass urheberrechtlich<br />
geschützte Inhalte tatsächlich auch ange-<br />
boten werden, müssen sie heruntergeladen<br />
und anschließend mit dem Original<br />
verglichen werden. Dabei werden auch<br />
die IP-Adressen (Computer-Adressen) der<br />
Raubkopierer gespeichert. Damit hat der<br />
Rechteinhaber die Möglichkeit, über die<br />
jeweiligen Internet-Service-Provider an die<br />
persönlichen Kontaktdaten des Rechtsverletzers<br />
zu gelangen, um schließlich rechtliche<br />
Schritte gegen ihn einleiten zu können.<br />
Welche IP-Adresse hätten’s denn gern?<br />
Neben P2P-Netzwerken gewinnen vor<br />
allem Streaming-Portale wie kino.to und<br />
One-Click-Hoster wie Rapidshare, die die<br />
Übermittlung großer Dateien im Internet<br />
ermöglichen, an Bedeutung. Neben der<br />
legalen Nutzung werden One-Click-Hoster,<br />
auch Sharehoster genannt, vielfach auch<br />
für die illegale Verbreitung urheberrechtlich<br />
geschützter Inhalte genutzt. So werden<br />
dort beispielsweise aktuelle Kinofilme<br />
hochgeladen und gespeichert. Der Speicherort<br />
dieser Dateien wird anschließend<br />
in Foren und speziellen Portalen veröffentlicht,<br />
sodass andere Nutzer die Raubkopien<br />
problemlos downloaden können.<br />
Um dies einzudämmen, durchsucht OpSec<br />
diese Foren, darunter auch komplexe Seiten<br />
mit verschlüsselten Links, mit einer<br />
besonderen Software nach entsprechenden<br />
Hinweisen. Dadurch können die illegalen<br />
Inhalte auf den Sharehostern identifiziert<br />
und kontinuierlich gelöscht werden.<br />
Da OpSec weltweit elf Sprachgebiete und<br />
über 360 unterschiedliche Share- und<br />
Videohoster beobachtet, werden täglich<br />
im Durchschnitt 20.000 Dateien entfernt.<br />
Aber auch Streaming-Portale werden mit<br />
Hilfe einer speziellen Software durchforstet.<br />
Dabei gefundene Links zu illegalen<br />
Dateien melden die Mitarbeiter anschließend<br />
den jeweiligen Hosting-Firmen, bei<br />
denen die Inhalte „geparkt“ sind. <strong>Die</strong>se<br />
löschen daraufhin die illegalen Dateien<br />
von ihren Servern. Dank dieser Maßnahme<br />
wurden bereits mehrere Plattformen<br />
so geschwächt, dass sie ihren <strong>Die</strong>nst<br />
eingestellt haben.<br />
Petur Agustsson<br />
WWW.OPSECSECURITY.DE<br />
Produkt- und Markenschutz<br />
Polymere verleihen Eindeutigkeit<br />
Wie die weltweit kleinsten Mikro-Farbcodes dabei helfen,<br />
Original und Fälschung zu unterscheiden<br />
Produkt- und Markenpiraten werden immer dreister und dringen in die<br />
unterschiedlichsten Industriezweige vor. Daher sind spezielle und vor allem<br />
fälschungssichere Lösungen für Produkte, Verpackungen und Dokumente notwendig.<br />
Für das bloße Auge unsichtbare Mikro-Farbcodes tragen ihren Teil zur<br />
Bekämpfung der Produktpiraterie bei.<br />
Nicht nur das Image von Markenartiklern<br />
wird durch Marken- und Produktpiraterie<br />
empfindlich in Mitleidenschaft gezogen,<br />
auch der finanzielle Verlust durch ungerechtfertigte<br />
Schadenersatzklagen und<br />
rückläufige Verkaufszahlen ist nicht zu<br />
unterschätzen. Leidvolle Erfahrungen mit<br />
dem Thema Fälschungen musste auch<br />
ein in Konstanz ansässiger internationaler<br />
Prüfmittelhersteller machen: „Wir<br />
waren auf einmal mit der Situation konfrontiert,<br />
dass <strong>Kopie</strong>n unserer Produkte<br />
aufgetaucht sind – auf den ersten Blick<br />
sehr gut gemacht, im Detail dann aber<br />
von sehr schlechter Qualität“, so Armin<br />
Karl, Geschäftsführer der Ingun Prüfmittelbau<br />
GmbH. Seit einigen Jahren setzt<br />
das Unternehmen die Mikro-Farbcode-<br />
Technologie Secutag der 3S Simons<br />
Security Systems GmbH auf den Verpackungen<br />
ihrer gefederten Kontaktstifte<br />
ein – mit Erfolg.<br />
Dabei werden speziell von 3S entwickelte,<br />
aus Dokumentenfolie gefertigte<br />
Verschlussetiketten kreuzförmig über<br />
alle vier Seiten der Kunststoffschachteln<br />
geklebt. Sie sind im Corporate Design<br />
des Prüfmittelherstellers gestaltet und<br />
zum Fälschungsschutz mit dem firmeneigenen<br />
Mikro-Farbcode versehen. <strong>Die</strong><br />
variablen Daten und Inhaltsangaben<br />
druckt Ingun im Thermoverfahren auf.<br />
„Durch die Sicherheitsetiketten weiß der<br />
Kunde sofort, ob er eine Originalverpackung<br />
in den Händen hält und ob<br />
die Schachtel bereits geöffnet wurde.<br />
Auch die Direktsicherung von Produkten,<br />
etwa Ersatzteile in der Automobil- und Elektronikindustrie,<br />
ist mit „Secutag“ möglich.<br />
Fälschungen werden schnell entlarvt<br />
und der Kunde ist vor billigen Imitaten<br />
geschützt“, erklärt Karl. Bei Kontrollen<br />
und Grenzbeschlagnahmeverfahren wird<br />
den Zollbeamten die Identifikation der<br />
Originalprodukte – und somit auch der<br />
Fälschungen – erheblich erleichtert.<br />
<strong>Die</strong> weltweit kleinsten Mikro-Farbcodes<br />
bestehen aus Melamin-Alkyd-Polymeren.<br />
Sie sind für das bloße Auge unsichtbar,<br />
ein handelsübliches Stabmikroskop<br />
genügt jedoch zur Identifizierung. Jedes<br />
Unternehmen erhält aus über 4,35 Milliarden<br />
möglicher Zusammensetzungen<br />
seinen firmeneigenen Code, der alle<br />
gekennzeichneten Waren eindeutig identifiziert.<br />
Auch die Direktsicherung von<br />
Produkten, beispielsweise Ersatzteile<br />
So nutzt der Konstanzer Prüfmittelhersteller<br />
Ingun die Verschlusssiegel auf<br />
seinen Verpackungen.<br />
in der Automobil- und Elektronikindustrie,<br />
ist mit Secutag möglich, ebenso die<br />
Kennzeichnung von Frachtpapieren und<br />
sonstigen Dokumenten. Durch die leichte<br />
Aufbringung mittels Druckverfahren oder<br />
Dispenser kann die Sicherheitstechnologie<br />
in den verschiedensten Industriezweigen<br />
variabel eingesetzt werden. <strong>Die</strong><br />
Farbcode-Technologie ist seit 15 Jahren<br />
fälschungssicher und international<br />
vor Gericht <strong>als</strong> Beweismittel anerkannt.<br />
Unternehmen, die solche rechtssicheren<br />
Systeme einsetzen, können so ihre<br />
Produkte schützen und den Fälschern<br />
den entscheidenden Strich durch ihre<br />
Rechnung machen.<br />
WWW.SECUTAG.DE<br />
SECURITY insight 2/2010 21