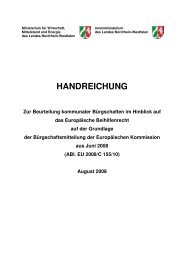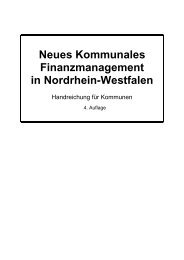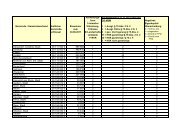Neues Kommunales Finanzmanagement in Nordrhein ... - MIK NRW
Neues Kommunales Finanzmanagement in Nordrhein ... - MIK NRW
Neues Kommunales Finanzmanagement in Nordrhein ... - MIK NRW
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
1. Reform des Geme<strong>in</strong>dehaushaltsrechts<br />
1.1 Grundlagen der Reform<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
GO <strong>NRW</strong><br />
Das Haushaltsrecht<br />
<strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>deordnung<br />
Das Kernstück der Reform des Geme<strong>in</strong>dehaushaltsrechts war die E<strong>in</strong>führung des Neuen Kommunalen <strong>F<strong>in</strong>anzmanagement</strong>s<br />
(NKF) mit der Abbildung des Ressourcenaufkommens und des vollständigen Ressourcenverbrauchs,<br />
die mit Hilfe der Rechengrößen „Aufwand“ und „Ertrag“ ermittelt und im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan<br />
veranschlagt sowie im Jahresabschluss der Geme<strong>in</strong>de nachgewiesen werden. Bei dieser Haushaltsreform s<strong>in</strong>d<br />
die haushaltsrechtlichen Vorschriften <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>deordnung angepasst worden. Die haushaltswirtschaftlichen<br />
Regelungen <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>deordnung be<strong>in</strong>halten die notwendigen Regelungen für die Haushaltsplanung und den<br />
Haushaltsvollzug sowie die Haushaltsabrechnung nach Ablauf des Haushaltsjahres. Sie orientieren sich an den<br />
kaufmännischen Standards des Handelsgesetzbuches, soweit nicht kommunale Besonderheiten Abweichungen<br />
davon erforderlich machen.<br />
1.2 Haushalt als zentrales Steuerungs- und Rechenschafts<strong>in</strong>strument<br />
Der Haushalt der Geme<strong>in</strong>de ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschafts<strong>in</strong>strument im geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltsrecht. Der Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen werden im Ergebnisplan und <strong>in</strong><br />
der Ergebnisrechnung durch Erträge und Aufwendungen als Rechengrößen abgebildet, die ausgeglichen se<strong>in</strong><br />
müssen, damit die Aufgabenerledigung dauerhaft gesichert ist. Die E<strong>in</strong>- und Auszahlungen, bei denen auch künftig<br />
zwischen „laufenden“ Ausgaben und Investitionsausgaben unterschieden wird, sowie der erforderliche Kreditbedarf<br />
werden im F<strong>in</strong>anzplan und <strong>in</strong> der F<strong>in</strong>anzrechnung ausgewiesen. Sie geben Auskunft über die Eigenf<strong>in</strong>anzierungsfähigkeit<br />
der Geme<strong>in</strong>de und s<strong>in</strong>d neben dem Ergebnisplan und der Ergebnisrechnung sowie der Bilanz<br />
e<strong>in</strong>e unverzichtbare Informationsquelle zur Beurteilung der f<strong>in</strong>anziellen Situation der Geme<strong>in</strong>de. Für e<strong>in</strong>e flexible<br />
Haushaltswirtschaft nach den neuen Steuerungsmodellen enthält die Geme<strong>in</strong>dehaushaltsverordnung die entsprechend<br />
gefassten Bewirtschaftungsregeln.<br />
1.3 Rechte der geme<strong>in</strong>dlichen Organe<br />
Die Rechte der geme<strong>in</strong>dlichen Organe bleiben im Rahmen der Reform des Geme<strong>in</strong>dehaushaltsrechts unter Berücksichtigung<br />
des NKF und der Abbildung des Ressourcenaufkommens und des vollständigen Ressourcenverbrauchs<br />
unangetastet. Es bedarf aber gleichwohl e<strong>in</strong>er Anpassung des Verhältnisses von Rat und Verwaltung,<br />
um e<strong>in</strong>e klare Rollen- und Verantwortungsabgrenzung zu erreichen. Vielfach kann der Rat als „Auftraggeber“<br />
gegenüber der Verwaltung bezeichnet werden, der strategische Ziele setzt und deren Umsetzung mit der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Verwaltung vere<strong>in</strong>bart sowie deren Erfüllung mit Hilfe geeigneter Instrumente auch kontrolliert. Diese<br />
Verhältnisse erfordern, dass der Rat künftig auf e<strong>in</strong>e Detailsteuerung verzichtet und durch klare Ziel- und Leistungsvorgaben<br />
zu e<strong>in</strong>er ergebnisorientierten Steuerung zu gelangen. Am Ende des jeweiligen Haushaltsjahres<br />
gilt es dann, nicht nur die Leistungsergebnisse der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung, sondern auch die Wirkungen der<br />
vom Rat getroffenen Entscheidungen transparent zu machen.<br />
GEMEINDEORDNUNG 204
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
GO <strong>NRW</strong><br />
Im Rahmen der Neuausrichtung der örtlichen Steuerung gilt es, die politisch festgelegten Standards und Ziele<br />
sowie Ressourcen für die Sicherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Geme<strong>in</strong>de erkennbar und damit<br />
die Generationengerechtigkeit sichtbar sowie die Erfüllung der produktorientierten Aufgaben mit den dafür erforderlichen<br />
F<strong>in</strong>anzmitteln nachvollziehbar zu machen. Diese Ansätze für e<strong>in</strong>e Verbesserung der örtlichen Steuerung<br />
können jedoch <strong>in</strong> E<strong>in</strong>zelfällen dazu führen, dass es e<strong>in</strong>er Neuausrichtung des Verhältnisses von Rat und<br />
geme<strong>in</strong>dlicher Verwaltung bedarf. In der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung sollte es dabei über die Produktorientierung<br />
zu e<strong>in</strong>er e<strong>in</strong>deutigen und verursachungsgerechten Zuordnung von Verantwortlichkeiten kommen.<br />
2. Die Gliederung der haushaltsrechtlichen Vorschriften <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>deordnung<br />
Die Gliederung der haushaltsrechtlichen Vorschriften <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>deordnung folgt im Aufbau denjenigen, die<br />
<strong>in</strong>haltlich heute <strong>in</strong> allen Ländern den Geme<strong>in</strong>deordnungen zu Grunde gelegt werden. Die neuen haushaltsrechtlichen<br />
Regelungen s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> den aufgezeigten Teilen der Geme<strong>in</strong>deordnung enthalten (vgl. Abbildung).<br />
Haushaltsrechtliche Vorschriften <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>deordnung<br />
8. Teil<br />
Haushaltswirtschaft<br />
9. Teil<br />
Sondervermögen,<br />
Treuhandvermögen<br />
10. Teil<br />
Rechnungsprüfung<br />
12. Teil<br />
Gesamtabschluss<br />
§ 75 Allgeme<strong>in</strong>e Haushaltsgrundsätze<br />
§ 76 Haushaltssicherungskonzept<br />
§ 77 Grundsätze der F<strong>in</strong>anzmittelbeschaffung<br />
§ 78 Haushaltssatzung<br />
§ 79 Haushaltsplan<br />
§ 80 Erlass der Haushaltssatzung<br />
§ 81 Nachtragssatzung<br />
§ 82 Vorläufige Haushaltsführung<br />
§ 83 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen<br />
und Auszahlungen<br />
§ 84 Mittelfristige Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung<br />
§ 85 Verpflichtungsermächtigungen<br />
§ 86 Kredite<br />
§ 87 Sicherheiten und Gewährleistung für Dritte<br />
§ 88 Rückstellungen<br />
§ 89 Liquidität<br />
§ 90 Vermögensgegenstände<br />
§ 91 Inventur, Inventar und Vermögensbewertung<br />
§ 92 Eröffnungsbilanz<br />
§ 93 F<strong>in</strong>anzbuchhaltung<br />
§ 94 Übertragung der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung<br />
§ 95 Jahresabschluss<br />
§ 96 Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung<br />
§ 97 Sondervermögen<br />
§ 98 Treuhandvermögen<br />
§ 99 Geme<strong>in</strong>degliedervermögen<br />
§ 100 Örtliche Stiftungen<br />
§ 101 Prüfung des Jahresabschlusses, Bestätigungsvermerk<br />
§ 102 Örtliche Rechnungsprüfung<br />
§ 103 Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung<br />
§ 104 Leitung und Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung<br />
§ 105 Überörtliche Prüfung<br />
§ 116 Gesamtabschluss<br />
§ 117 Beteiligungsbericht<br />
§ 118 Vorlage- und Auskunftspflichten<br />
Abbildung 15 „Haushaltsrechtliche Vorschriften <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>deordnung“<br />
GEMEINDEORDNUNG 205
3. Anwendung des NKF<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
GO <strong>NRW</strong><br />
Die haushaltsrechtlichen Regelungen <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>deordnung bauen auf dem Gesetz über e<strong>in</strong> <strong>Neues</strong> <strong>Kommunales</strong><br />
<strong>F<strong>in</strong>anzmanagement</strong> für Geme<strong>in</strong>den im Land Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen (<strong>Kommunales</strong> <strong>F<strong>in</strong>anzmanagement</strong>gesetz<br />
<strong>NRW</strong> – NKFG <strong>NRW</strong>) auf, das der Landtag Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen am 10.11.2004 beschlossen hat (vgl. Landtags-<br />
Drucksache Nr. 13/5567). Dieses Gesetz wurde am 16.11.2004 unterzeichnet und ist im Gesetz- und Verordnungsblatt<br />
des Landes Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen (Nr. 41 vom 24.11.2004) auf Seite 644 veröffentlicht worden. Es ist<br />
als Artikelgesetz ausgestaltet worden und hat zu Änderungen der Geme<strong>in</strong>deordnung sowie zu e<strong>in</strong>er Neufassung<br />
der Geme<strong>in</strong>dehaushaltsverordnung geführt. Das NKFG <strong>NRW</strong> ist am 01.01.2005 <strong>in</strong> Kraft getreten. Es wurde zudem<br />
am 6. Januar 2005 berichtigt (GV. <strong>NRW</strong>. S. 15).<br />
Die Grundlagen für das Neue Kommunale <strong>F<strong>in</strong>anzmanagement</strong> bilden dabei die haushaltsrechtlichen Regelungen<br />
<strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>deordnung für das Land Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen (GO <strong>NRW</strong>) <strong>in</strong> der Fassung der Bekanntmachung vom<br />
14. Juli 1994 (GV. <strong>NRW</strong>. S. 666) <strong>in</strong> der jeweils geltenden Fassung (Fundstelle: SGV. <strong>NRW</strong>. 2023). Sie umfassen<br />
mehrere Teile der Geme<strong>in</strong>deordnung (vgl. Kapitel „Haushaltsrechtliche Regelungstexte“) und werden durch die<br />
Geme<strong>in</strong>dehaushaltsverordnung näher ausgestaltet. Ab dem Haushaltsjahr 2009 führen alle Geme<strong>in</strong>den ihre<br />
Haushaltswirtschaft nach dem NKF und ihr Rechnungswesen auf der Basis der doppelten Buchführung.<br />
Der tatsächliche Zweck des NKF geht aber weit über die Reform der haushaltsrechtlichen Vorschriften bzw. die<br />
E<strong>in</strong>führung e<strong>in</strong>es neuen Buchungsstils h<strong>in</strong>aus. Neben den normativen Gegebenheiten bedarf es <strong>in</strong> jeder Geme<strong>in</strong>de<br />
e<strong>in</strong>er strategischen und operativen Neuausrichtung unter E<strong>in</strong>beziehung der Ressourcenbewertung. Auch die<br />
Schaffung e<strong>in</strong>er neuen Transparenz durch die Offenlegung von Risiken und Chancen für die Geme<strong>in</strong>de und deren<br />
E<strong>in</strong>fluss auf deren wirtschaftliche Lage ist e<strong>in</strong> wichtiges Ziele. Unter dem Begriff“ Transparenz“ wird dabei<br />
vielfach die Möglichkeit der Adressaten des geme<strong>in</strong>dlichen Handelns verstanden, zuverlässig und zeitnah nachvollziehbare<br />
Informationen über die Ergebnisse und Entscheidungsprozesse des geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltungshandelns<br />
erhalten zu können.<br />
4. Muster zu Vorschriften der Geme<strong>in</strong>deordnung<br />
Die haushaltsrechtlichen Vorschriften <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>deordnung sowie <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>dehaushaltsverordnung werden<br />
je nach Bedarf durch allgeme<strong>in</strong>e Runderlasse des Innenm<strong>in</strong>isteriums zur geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft<br />
ergänzt. Im Rahmen der Bestimmungen über die Ausführung der Geme<strong>in</strong>deordnung (vgl. § 133 GO <strong>NRW</strong>) hat<br />
das Innenm<strong>in</strong>isterium bereits von der <strong>in</strong> Absatz 3 dieser Vorschrift enthaltenen Ermächtigung Gebrauch gemacht<br />
und für die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft anzuwendende Muster veröffentlicht (vgl. Runderlass des Innenm<strong>in</strong>isteriums<br />
vom 24.02.2005, SMBl. <strong>NRW</strong>. 6300). Die nachfolgende Übersicht gibt e<strong>in</strong>en Überblick über die<br />
zu Vorschriften der Geme<strong>in</strong>deordnung veröffentlichten Muster.<br />
Vorschrift<br />
Muster zu § 78 GO <strong>NRW</strong><br />
Muster zu § 81 GO <strong>NRW</strong><br />
Muster zu § 56 GO <strong>NRW</strong><br />
Muster zu Vorschriften der Geme<strong>in</strong>deordnung<br />
Verwendung<br />
Haushaltssatzung Anlage 1<br />
Nachtragssatzung Anlage 2<br />
Zuwendungen an Fraktionen Anlage 12<br />
Abbildung 16 „Muster zu Vorschriften der Geme<strong>in</strong>deordnung“<br />
GEMEINDEORDNUNG 206<br />
Anlage zum Runderlass
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
GO <strong>NRW</strong><br />
Die Geme<strong>in</strong>de ist verpflichtet, für ihre Haushaltswirtschaft die Muster zu verwenden, die das Innenm<strong>in</strong>isterium<br />
aus Gründen der Vergleichbarkeit der geme<strong>in</strong>dlichen Haushalte für verb<strong>in</strong>dlich erklärt hat. Es handelt sich bei den<br />
zu nutzenden Mustern <strong>in</strong>sbesondere um Muster für die Gestaltung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung mit ihren<br />
Anlagen, für den geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss und den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss sowie für die Buchführung<br />
und die Zahlungsabwicklung <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzbuchhaltung (vgl. § 133 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong>). Die<br />
Muster zur geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung und zur Nachtragssatzung s<strong>in</strong>d für verb<strong>in</strong>dlich erklärt worden.<br />
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ<br />
GEMEINDEORDNUNG 207
1. Allgeme<strong>in</strong>es<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
8. Teil GO <strong>NRW</strong><br />
8. Teil<br />
Haushaltswirtschaft<br />
Der 8. Teil der Geme<strong>in</strong>deordnung (GO <strong>NRW</strong>) enthält die gesetzlichen Grundlagen für die gesamte Haushaltswirtschaft<br />
der Geme<strong>in</strong>den, von der Haushaltsplanung bis zum Jahresabschluss. Mit dem Neuen Kommunalen <strong>F<strong>in</strong>anzmanagement</strong><br />
(NKF) wird über die Rechengrößen „Aufwendungen“ und „Erträge“ das Ressourcenaufkommen<br />
und den Ressourcenverbrauch der Geme<strong>in</strong>de erfasst und der tatsächliche Werteverzehr, u.a. über Abschreibungen,<br />
vollständig abgebildet. Unter E<strong>in</strong>beziehung der Produktorientierung wird der Geme<strong>in</strong>de damit die haushaltsmäßige<br />
Erfassung und Darstellung des Ressourcenverbrauchs und des Ressourcenaufkommens bezogen auf<br />
ihre Aufgabenerfüllung möglich. Gleichzeitig soll die Ausrichtung der F<strong>in</strong>anzpolitik der Geme<strong>in</strong>den auf das Pr<strong>in</strong>zip<br />
der <strong>in</strong>tergenerativen Gerechtigkeit erreichen, dass der gesamte Ressourcenverbrauch e<strong>in</strong>er Periode regelmäßig<br />
durch Erträge derselben Periode gedeckt wird, um nachfolgende Generationen nicht zu überlasten.<br />
Die im NKF verwendeten Rechengrößen „Erträge“ und „Aufwendungen“ stellen dazu den zutreffenden Buchungsstoff<br />
für den Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung der Geme<strong>in</strong>de dar. Sie s<strong>in</strong>d die zutreffenden Größen<br />
für e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>dliche „Re<strong>in</strong>vermögensrechnung“, die das Geldvermögen und das Sachvermögen der Geme<strong>in</strong>de<br />
betrifft, wenn e<strong>in</strong> Vorgang bei der Geme<strong>in</strong>de das geme<strong>in</strong>dliche Eigenkapital erhöht oder verm<strong>in</strong>dert (Erhöhung:<br />
Ertrag; Verm<strong>in</strong>derung; Aufwand). Die Rechengrößen „Erträge“ und „Aufwendungen“ s<strong>in</strong>d daher von zentraler<br />
Bedeutung für die geme<strong>in</strong>dliche Ergebnisermittlung. In diesem Zusammenhang s<strong>in</strong>d auch die <strong>in</strong>ternen Leistungsbeziehungen<br />
der Geme<strong>in</strong>de zu beachten, die über die gleichen Rechengrößen im geme<strong>in</strong>dlichen Haushalt erfasst<br />
werden können (vgl. § 17 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
Im NKF kommen die Rechengrößen „E<strong>in</strong>zahlungen“ und „Auszahlungen“ zur Anwendung. Die F<strong>in</strong>anzrechnung<br />
der Geme<strong>in</strong>de soll Auskunft über die tatsächliche f<strong>in</strong>anzielle Lage der Geme<strong>in</strong>de geben und dabei auch die F<strong>in</strong>anzierungsquellen<br />
sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes der Geme<strong>in</strong>de (Liquide Mittel) aufzeigen.<br />
Dadurch stellt die F<strong>in</strong>anzrechnung e<strong>in</strong>e Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsrechnung der Geme<strong>in</strong>de dar,<br />
bei der die Zahlungsströme ausschlaggebend s<strong>in</strong>d. Auf Grund dessen kommen bei der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzrechnung<br />
die Rechengrößen „E<strong>in</strong>zahlungen“ und „Auszahlungen“ als zutreffender Buchungsstoff zur Anwendung.<br />
Außerdem ist bei der Erfassung der E<strong>in</strong>zahlungen und Auszahlungen das Kassenwirksamkeitspr<strong>in</strong>zips als Liquiditätsänderungspr<strong>in</strong>zip<br />
zu beachten. Deshalb dürfen unter den Haushaltspositionen im F<strong>in</strong>anzplan nur Beträge <strong>in</strong><br />
Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich e<strong>in</strong>gehenden oder zu leistenden Zahlungen ausgewiesen werden, die<br />
e<strong>in</strong>e Änderung der Liquidität der Geme<strong>in</strong>de bewirken.<br />
Über die geme<strong>in</strong>dliche Bilanz werden auch die Veränderungen des Eigenkapitals der Geme<strong>in</strong>de, e<strong>in</strong> Ansatz, der<br />
wesentlich transparenter als bislang das wirtschaftliche Handeln der Geme<strong>in</strong>de abbildet. So wird der vollständige<br />
Werteverzehr durch Abschreibungen offen gelegt und berücksichtigt. Auch das Konzept des Haushaltsausgleichs<br />
wird im NKF der Ausrichtung auf den Ressourcenverbrauch angepasst. Der Haushalt ist dann ausgeglichen,<br />
wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, also wenn die Erträge die Aufwendungen decken (vgl. § 75 Abs. 2 GO<br />
<strong>NRW</strong>). Übersteigt die Aufwendungen die Erträge, so verr<strong>in</strong>gert sich das kommunale Eigenkapital (vgl. § 75 Abs. 4<br />
GO <strong>NRW</strong>). Dieses darf nicht aufgezehrt werden, das heißt, die Geme<strong>in</strong>de darf sich nicht überschulden (vgl. § 75<br />
Abs. 7 GO <strong>NRW</strong>).<br />
GEMEINDEORDNUNG 208
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
8. Teil GO <strong>NRW</strong><br />
2. Die Rahmenbegriffe „Haushaltswirtschaft“ und „Haushalt“<br />
2.1 Rahmenbegriff „Haushaltswirtschaft<br />
Im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsrecht der Geme<strong>in</strong>deordnung ist der Rahmenbegriff „Haushaltswirtschaft“ (der Geme<strong>in</strong>de)<br />
nicht ausdrücklich gesetzlich def<strong>in</strong>iert worden. Er steht e<strong>in</strong>erseits im Zusammenhang mit der haushaltsrechtlichen<br />
Kurzbezeichnung „Haushalt“, die z.B. <strong>in</strong> § 75 Abs. 2 S. 1 GO <strong>NRW</strong> „Der Haushalt muss <strong>in</strong> jedem Jahr<br />
<strong>in</strong> Planung und Rechnung ausgeglichen se<strong>in</strong>“ enthalten ist. Nach allgeme<strong>in</strong>er Auffassung fallen daher unter den<br />
Rahmenbegriff „Haushaltswirtschaft“ alle D<strong>in</strong>ge und Tätigkeiten, die zur Vorbereitung, Ausführung und Abrechnung<br />
der jährlichen Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de gehören, z.B. die Ausführung des geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplans<br />
(Ergebnisplan, F<strong>in</strong>anzplan und Teilpläne nach § 79 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>), aber auch die Verwaltung des<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Vermögens und der Schulden (vgl. § 90 GO <strong>NRW</strong>) oder die Aufstellung und Feststellung sowie die<br />
Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses (Ergebnisrechnung, F<strong>in</strong>anzrechnung, Teilrechnungen, Bilanz und<br />
Anhang nach § 95 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>).<br />
Der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft s<strong>in</strong>d auch die Vorbereitung, Aufstellung und Bestätigung sowie die Prüfung<br />
des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses zuzurechnen. Die Abwicklung des jährlichen Haushalts der Geme<strong>in</strong>de<br />
vollzieht sich regelmäßig über drei Jahre. Vor dem Haushaltsjahr ist die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen<br />
aufzustellen (vgl. §§ 78 bis 80 GO <strong>NRW</strong>), <strong>in</strong>nerhalb des Haushaltsjahres ist der Haushaltsplan auszuführen<br />
und nach Ablauf des Haushaltsjahres ist der Jahresabschluss (vgl. §§ 95 und 96 GO <strong>NRW</strong>), aber auch der Gesamtabschluss<br />
aufzustellen (vgl. § 116 GO <strong>NRW</strong>).<br />
2.2 Rahmenbegriff „Haushalt“<br />
Der Rahmenbegriff „Haushalt“ stellt im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsrecht e<strong>in</strong>en Teilbereich des Rahmenbegriffs<br />
„Haushaltswirtschaft“ dar. Nachfolgend wird der Begriff „Haushalt“ anhand der geme<strong>in</strong>dlichen Kernverwaltung<br />
dargestellt (vgl. Abbildung).<br />
Haus-<br />
halts-<br />
satzung<br />
Begriff „Haushalt“ (bei der Kernverwaltung der Geme<strong>in</strong>de)<br />
Ergebnis-<br />
plan<br />
Haushaltsplan<br />
F<strong>in</strong>anz-<br />
plan<br />
Produktorientierte<br />
Teilpläne<br />
Bewirtschaftungsregeln<br />
Anlagen<br />
Ergebnis-<br />
rechnung<br />
Jahresabschluss<br />
F<strong>in</strong>anz-<br />
rechnung<br />
Teilrechnungen<br />
Bilanz<br />
Bewertungs- und Bilanzierungsregeln<br />
Abbildung 17 „Haushalt der geme<strong>in</strong>dlichen Kernverwaltung“<br />
Anhang<br />
Lage-<br />
bericht<br />
Der Begriff umfasst die Werke, mit deren Hilfe die jährlich die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft geplant, ausgeführt<br />
und abgerechnet wird. So fallen unter den Begriff „Haushalt“ die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung mit dem<br />
Haushaltsplan (Ergebnisplan, F<strong>in</strong>anzplan und Teilpläne nach § 79 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>) als auch der geme<strong>in</strong>dliche<br />
Jahresabschluss (Ergebnisrechnung, F<strong>in</strong>anzrechnung, Teilrechnungen, Bilanz und Anhang nach § 95 Abs. 1 GO<br />
<strong>NRW</strong>) sowie der geme<strong>in</strong>dliche Gesamtabschluss (Gesamtergebnisrechnung, Gesamtf<strong>in</strong>anzrechnung, Gesamtbi-<br />
GEMEINDEORDNUNG 209
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
8. Teil GO <strong>NRW</strong><br />
lanz und Gesamtanhang nach § 116 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>). Der Haushalt ist und bleibt dabei das zentrale Steuerungs-<br />
und Rechenschafts<strong>in</strong>strument <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung.<br />
2.3 Leitgedanken der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft<br />
Im 8. Teil der Geme<strong>in</strong>deordnung sowie <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>dehaushaltsverordnung werden im E<strong>in</strong>zelnen, ausgehend<br />
von den dort verankerten Leitgedanken, die notwendigen Regelungen für die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft<br />
getroffen, bei denen auch die Rechte der Geme<strong>in</strong>deorgane zu beachten s<strong>in</strong>d (vgl. Abbildung).<br />
Leitgedanken der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft<br />
Die Geme<strong>in</strong>de hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen,<br />
dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.<br />
Die Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen.<br />
Jährlich ist der Haushaltausgleich i.V.m. mit dem Eigenkapital zu erreichen.<br />
Die Liquidität der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>schließlich der F<strong>in</strong>anzierung der Investitionen ist sicherzustellen.<br />
E<strong>in</strong>e Überschuldung der Geme<strong>in</strong>de ist nicht zulässig.<br />
Abbildung 18 „Leitgedanken der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft“<br />
3. Der F<strong>in</strong>anzausschuss nach § 57 i.V.m. § 59 GO <strong>NRW</strong><br />
In jeder Geme<strong>in</strong>de muss der Rat e<strong>in</strong>en F<strong>in</strong>anzausschuss bilden (vgl. § 57 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>. Nach § 59 Abs. 2 GO<br />
<strong>NRW</strong> hat der F<strong>in</strong>anzausschuss die Haushaltssatzung der Geme<strong>in</strong>de vorzubereiten und die für die Ausführung<br />
des Haushaltsplans erforderlichen Entscheidungen zu treffen, soweit nicht andere Ausschüsse zuständig s<strong>in</strong>d.<br />
Mit diesen Vorschriften wird der Rahmen für die Tätigkeit des F<strong>in</strong>anzausschusses gesetzt. Der F<strong>in</strong>anzausschuss<br />
kann z.B. <strong>in</strong> folgenden Angelegenheiten vorberatend für den Rat tätig se<strong>in</strong>:<br />
- bei haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen, die dem Rat vorbehalten s<strong>in</strong>d (vgl. § 41 GO <strong>NRW</strong>),<br />
- für die Vorberatung von Wirtschaftsplänen, F<strong>in</strong>anzplanungen und Jahresabschlüssen der Beteiligungen.<br />
In der Vorschrift des § 59 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> ist dem F<strong>in</strong>anzausschuss bisher nur die Vorbereitung die Haushaltssatzung<br />
der Geme<strong>in</strong>de ausdrücklich zugeordnet. Es gebietet und erfordert aber der haushaltswirtschaftliche Stellenwert<br />
des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses der Geme<strong>in</strong>de ebenso e<strong>in</strong>e Vorbereitung<br />
durch den F<strong>in</strong>anzausschuss.<br />
4. Der Verwaltungsvorstand nach § 70 GO <strong>NRW</strong><br />
Nach der Vorschrift ist <strong>in</strong> jeder Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong> Verwaltungsvorstand e<strong>in</strong>zurichten. Diesem werden dazu <strong>in</strong> der<br />
Vorschrift mehrere Aufgabenfelder benannt, bei denen er <strong>in</strong>sbesondere mitzuwirken hat. Zu se<strong>in</strong>en Beratungsgegenständen<br />
gehört auch die Aufstellung des geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan, unbeschadet der Rechte des Kämmerers<br />
nach § 80 GO <strong>NRW</strong>, denn auch im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan soll sich h<strong>in</strong>sichtlich der späteren Ausführung<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft die grundsätzliche E<strong>in</strong>heitlichkeit der Verwaltungsführung zeigen. In<br />
der Vorschrift ist dem Verwaltungsvorstand bisher nur die Vorbereitung die Haushaltssatzung der Geme<strong>in</strong>de<br />
ausdrücklich zugeordnet. Es gebietet und erfordert aber der haushaltswirtschaftliche Stellenwert des geme<strong>in</strong>dli-<br />
GEMEINDEORDNUNG 210
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
8. Teil GO <strong>NRW</strong><br />
chen Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses der Geme<strong>in</strong>de ebenso e<strong>in</strong>e Vorbereitung durch den Verwaltungsvorstand.<br />
5. Die Vorschriften für die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft<br />
Zu den wichtigen haushaltsrechtlichen Bestimmungen gehören die Vorschriften über die Inhalte und die Ausgestaltung<br />
der Haushaltssatzung sowie des Haushaltsplans, aber auch die Bestimmungen über die mittelfristige<br />
Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung, das Haushaltssicherungskonzept, die Kreditaufnahme, die Liquidität und das Vermögen<br />
sowie die F<strong>in</strong>anzbuchhaltung. Neben der Aufstellung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung<br />
mit ihren Anlagen durch den Rat der Geme<strong>in</strong>de werden vergleichbare Regelungen über die Aufstellung des Jahresabschlusses<br />
und die Beschlussfassung durch den Rat getroffen. Die Bestimmungen <strong>in</strong> diesem Teil der Geme<strong>in</strong>deordnung<br />
s<strong>in</strong>d auch darauf abgestellt, dass die Verwaltungen der Geme<strong>in</strong>den dem Rat wie den Bürger<strong>in</strong>nen<br />
und Bürgern gegenüber dafür verantwortlich, wie die zur Verfügung stehenden F<strong>in</strong>anzmittel e<strong>in</strong>gesetzt werden.<br />
Zur geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft s<strong>in</strong>d im 8. Teil der Geme<strong>in</strong>deordnung folgende Vorschriften enthalten<br />
(vgl. Abbildung).<br />
Haushaltsrechtliche Vorschriften im 8. Teil der Geme<strong>in</strong>deordnung<br />
8. Teil<br />
Haushaltswirtschaft<br />
§ 75 Allgeme<strong>in</strong>e Haushaltsgrundsätze<br />
§ 76 Haushaltssicherungskonzept<br />
§ 77 Grundsätze der F<strong>in</strong>anzmittelbeschaffung<br />
§ 78 Haushaltssatzung<br />
§ 79 Haushaltsplan<br />
§ 80 Erlass der Haushaltssatzung<br />
§ 81 Nachtragssatzung<br />
§ 82 Vorläufige Haushaltsführung<br />
§ 83 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen<br />
und Auszahlungen<br />
§ 84 Mittelfristige Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung<br />
§ 85 Verpflichtungsermächtigungen<br />
§ 86 Kredite<br />
§ 87 Sicherheiten und Gewährleistung für Dritte<br />
§ 88 Rückstellungen<br />
§ 89 Liquidität<br />
§ 90 Vermögensgegenstände<br />
§ 91 Inventur, Inventar und Vermögensbewertung<br />
§ 92 Eröffnungsbilanz<br />
§ 93 F<strong>in</strong>anzbuchhaltung<br />
§ 94 Übertragung der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung<br />
§ 95 Jahresabschluss<br />
§ 96 Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung<br />
Abbildung 19 „Haushaltsrechtliche Vorschriften im 8. Teil der Geme<strong>in</strong>deordnung“<br />
Durch das NKF wird das Wirtschaften <strong>in</strong> den Geme<strong>in</strong>den transparenter. Dadurch werden nicht nur verwaltungs<strong>in</strong>tern,<br />
sondern auch für den Rat neue Steuerungspotentiale eröffnet, die den Geme<strong>in</strong>den e<strong>in</strong>e effizientere Wahrnehmung<br />
ihrer Aufgaben ermöglichen. So kann etwa die Vere<strong>in</strong>barung messbarer Ziele und Kennzahlen oder die<br />
E<strong>in</strong>führung des Produkthaushalts und e<strong>in</strong>er Kosten- und Leistungsrechnung helfen, bessere Grundlagen für die<br />
konkreten Entscheidungen vor Ort zu erhalten. Für die Bürger<strong>in</strong>nen und Bürger br<strong>in</strong>gen die Bestimmungen über<br />
das NKF e<strong>in</strong>en wesentlichen Gew<strong>in</strong>n an Informationen, der zu e<strong>in</strong>er verstärkten Beteiligung genutzt werden kann.<br />
Für die Geme<strong>in</strong>den bedeuten die neuen haushaltsrechtlichen Vorschriften e<strong>in</strong>e Stärkung ihrer Eigenverantwortung<br />
und ihrer Selbstverwaltung.<br />
GEMEINDEORDNUNG 211
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
8. Teil GO <strong>NRW</strong><br />
E<strong>in</strong>e Besonderheit besteht <strong>in</strong> der Vorschrift des § 92 GO <strong>NRW</strong> „Eröffnungsbilanz“, die nur für die E<strong>in</strong>stieg der<br />
Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> das Neue Kommunale <strong>F<strong>in</strong>anzmanagement</strong>s Anwendung f<strong>in</strong>det. Die dar<strong>in</strong> getroffenen Bestimmungen<br />
s<strong>in</strong>d mit den Vorschriften für den handelsrechtlichen Kaufmann vergleichbar, der sich wie die Geme<strong>in</strong>den<br />
ebenfalls zu Beg<strong>in</strong>n se<strong>in</strong>es Handelsgewerbes e<strong>in</strong>en Überblick über se<strong>in</strong>e Vermögensverhältnisse und se<strong>in</strong>e<br />
Schulden verschaffen muss. Die weiteren E<strong>in</strong>zelheiten zur Aufstellung der geme<strong>in</strong>dlichen Eröffnungsbilanz werden<br />
<strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>dehaushaltsverordnung konkretisiert (vgl. §§ 53 ff. GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
6. Produktorientierte Haushaltssteuerung<br />
Mit der Reform des Haushaltsrechts soll erreicht werden, dass die Geme<strong>in</strong>den ihre Haushaltswirtschaft vor allem<br />
nach den erbrachten bzw. den zu erbr<strong>in</strong>genden geme<strong>in</strong>dlichen Leistungen (Output) steuern. Diese neue Steuerung<br />
soll unter E<strong>in</strong>beziehung des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs vorgenommen werden<br />
(Ressourcenverbrauchskonzept), das <strong>in</strong> der fachlichen Ausführung möglichst eigenverantwortlich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
Hand liegen soll (dezentrale Ressourcenverantwortung). Dieser Reformansatz bed<strong>in</strong>gt e<strong>in</strong>e besondere Zusammenarbeit<br />
<strong>in</strong> der Gesamtverantwortung des Bürgermeisters und der F<strong>in</strong>anzverantwortung des Kämmerers. Es<br />
erfordert den E<strong>in</strong>satz betriebswirtschaftlicher Instrumente und Methoden, z.B. die Rechengrößen „Erträge“ und<br />
„Aufwendungen“, die doppelte Buchführung, die Produktorientierung, Budgetierung, Leistungskennzahlen, Controll<strong>in</strong>g,<br />
Kosten- und Leistungsrechnung u.a. zur Anwendung kommen zu lassen. Der Haushalt ist und bleibt dabei<br />
das zentrale Steuerungs- und Rechenschafts<strong>in</strong>strument <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung.<br />
Die mit der Reform des Geme<strong>in</strong>dehaushaltsrechts angestrebten Ziele, die Steuerung der Geme<strong>in</strong>de zu verbessern<br />
und den Ressourcenverbrauch vollständig zu berücksichtigen, erfordern e<strong>in</strong>e angepasste Gliederung des<br />
Haushaltsplans nach § 79 GO <strong>NRW</strong>. Zugleich wird den Geme<strong>in</strong>den erstmals die Befugnis e<strong>in</strong>geräumt, den Haushaltsplan<br />
nach ihren örtlichen Bedürfnissen eigenverantwortlich zu untergliedern. Dies trägt wesentlich zur Stärkung<br />
der kommunalen Selbstverwaltung bei. Die Gliederung des örtlichen Haushaltsplans soll die Geme<strong>in</strong>de<br />
nach ihren Steuerungs- oder Informationsbedürfnissen unter Beachtung des § 4 GemHVO <strong>NRW</strong> ausrichten.<br />
Dabei beschränkt sich die haushaltsmäßige Verpflichtung der Geme<strong>in</strong>den alle<strong>in</strong> auf die 17 Produktbereiche, die<br />
das unverzichtbare M<strong>in</strong>destmaß an E<strong>in</strong>heitlichkeit und Information widerspiegeln.<br />
In den Teilplänen des geme<strong>in</strong>dlichen werden die Ressourcen als Aufkommen (Ertrag) oder Verbrauch (Aufwand)<br />
abgebildet. Damit wird dem Budgetrecht des Rates Rechnung getragen, denn dieser muss neben den Festlegungen<br />
der Erträge und Aufwendungen sowie der E<strong>in</strong>zahlungen und Auszahlungen auch sachliche Zuordnungen<br />
unter Beachtung der stetigen Aufgabenerfüllung und der geme<strong>in</strong>dlichen dauernden Leistungsfähigkeit treffen.<br />
Dies erfordert, neben der Abbildung der laufenden Verwaltungstätigkeit <strong>in</strong> den Teilergebnisplänen und der Investitionstätigkeit<br />
<strong>in</strong> den Teilf<strong>in</strong>anzplänen auch die allgeme<strong>in</strong>e F<strong>in</strong>anzierungstätigkeit für den gesamten Haushalt <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>em besonderen Teilplan abzubilden (vgl. Produktbereich „Allgeme<strong>in</strong>e F<strong>in</strong>anzwirtschaft“).<br />
Nach der Diskussion und den Erkenntnissen über die Neue Steuerung und deren Erprobung kann sich die Reform<br />
der Haushaltswirtschaft nicht dar<strong>in</strong> erschöpfen, die bisherige sachliche Gliederung des Haushaltsplans<br />
durch e<strong>in</strong>e frei gestaltbare produktorientierte Gliederung zu ersetzen. Im NKF ist die zeitgemäße Gliederung des<br />
Haushaltsplans <strong>in</strong> der Eigenverantwortung der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong> Bestandteil des umfassenden Reformansatzes, der<br />
<strong>in</strong>sbesondere auch die Weiterentwicklung der Führungsmethoden (Management) be<strong>in</strong>haltet. Hierzu gehören<br />
<strong>in</strong>sbesondere die Steuerung über Ziele und Zielvere<strong>in</strong>barungen auf allen Verwaltungsebenen, aber auch zwischen<br />
Rat und Verwaltung, sowie die Möglichkeit, deren Umsetzung und Zielerreichung mit Hilfe von messbaren<br />
Kennzahlen besser nachprüfen zu können. Vere<strong>in</strong>barte Ziele und messbare Kennzahlen sollen deshalb auf allen<br />
Gliederungsebenen des Haushaltsplans ausgewiesen werden (vgl. § 12 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ<br />
GEMEINDEORDNUNG 212
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
Ä 75 GO <strong>NRW</strong><br />
Ä 75<br />
Allgeme<strong>in</strong>e HaushaltsgrundsÅtze<br />
(1) 1 Die Geme<strong>in</strong>de hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu fÄhren, dass die stetige ErfÄllung ihrer Aufgaben<br />
gesichert ist. 2 Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu fÄhren. 3 Dabei ist den<br />
Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.<br />
(2) 1 Der Haushalt muss <strong>in</strong> jedem Jahr <strong>in</strong> Planung und Rechnung ausgeglichen se<strong>in</strong>. 2 Er ist ausgeglichen, wenn<br />
der Gesamtbetrag der ErtrÅge die HÇhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder Äbersteigt. 3 Die<br />
Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfÄllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag <strong>in</strong> der Ergebnisrechnung<br />
durch Inanspruchnahme der AusgleichsrÄcklage gedeckt werden kÇnnen.<br />
(3) 1 Die AusgleichsrÄcklage ist <strong>in</strong> der Bilanz zusÅtzlich zur allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage als gesonderter Posten des<br />
Eigenkapitals anzusetzen. 2 Sie kann <strong>in</strong> der ErÇffnungsbilanz bis zur HÇhe e<strong>in</strong>es Drittels des Eigenkapitals gebildet<br />
werden, hÇchstens jedoch bis zur HÇhe e<strong>in</strong>es Drittels der jÅhrlichen Steuere<strong>in</strong>nahmen und allgeme<strong>in</strong>en Zuweisungen.<br />
3 Die HÇhe der E<strong>in</strong>nahmen nach Satz 2 bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre,<br />
die dem ErÇffnungsbilanzstichtag vorangehen. 4 Der AusgleichsrÄcklage kÇnnen JahresÄberschÄsse durch Beschluss<br />
nach É 96 Abs. 1 Satz 2 zugefÄhrt werden, soweit ihr Bestand nicht den <strong>in</strong> der ErÇffnungsbilanz zulÅssigen<br />
Betrag erreicht hat.<br />
(4) 1 Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung e<strong>in</strong>e Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage vorgesehen,<br />
bedarf dies der Genehmigung der AufsichtsbehÇrde. 2 Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die AufsichtsbehÇrde<br />
nicht <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>es Monats nach E<strong>in</strong>gang des Antrages der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>e andere Entscheidung trifft. 3 Die<br />
Genehmigung kann unter Bed<strong>in</strong>gungen und mit Auflagen erteilt werden. 4 Sie ist mit der Verpflichtung, e<strong>in</strong> Haushaltssicherungskonzept<br />
aufzustellen, zu verb<strong>in</strong>den, wenn die Voraussetzungen des É 76 Abs. 1 vorliegen.<br />
(5) 1 Weist die Ergebnisrechnung bei der BestÅtigung des Jahresabschlusses gem. É 95 Abs. 3 trotz e<strong>in</strong>es ursprÄnglich<br />
ausgeglichenen Ergebnisplans e<strong>in</strong>en Fehlbetrag oder e<strong>in</strong>en hÇheren Fehlbetrag als im Ergebnisplan<br />
ausgewiesen aus, so hat die Geme<strong>in</strong>de dies der AufsichtsbehÇrde unverzÄglich anzuzeigen. 2 Die AufsichtsbehÇrde<br />
kann <strong>in</strong> diesem Fall Anordnungen treffen, erforderlichenfalls diese Anordnungen selbst durchfÄhren oder –<br />
wenn und solange diese Befugnisse nicht ausreichen – e<strong>in</strong>en Beauftragten bestellen, um e<strong>in</strong>e geordnete Haushaltswirtschaft<br />
wieder herzustellen. 3 ÉÉ 123 und 124 gelten s<strong>in</strong>ngemÅÖ.<br />
(6) Die LiquiditÅt der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>schlieÖlich der F<strong>in</strong>anzierung der Investitionen ist sicherzustellen.<br />
(7) 1 Die Geme<strong>in</strong>de darf sich nicht Äberschulden. 2 Sie ist Äberschuldet, wenn nach der Bilanz das Eigenkapital<br />
aufgebraucht wird.<br />
ErlÅuterungen zu Ä 75:<br />
I. Allgeme<strong>in</strong>es<br />
1. Die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft<br />
1.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die allgeme<strong>in</strong>en GrundsÅtze dieser Vorschrift gelten fÄr die gesamte Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de. An erster<br />
Stelle steht die Sicherstellung der geme<strong>in</strong>dlichen AufgabenerfÄllung. An diesem Ziel hat die Geme<strong>in</strong>de ihre<br />
gesamte Haushaltswirtschaft zukunftsbezogen auszurichten. Unter Beachtung des anzuwendenden Ressourcenverbrauchskonzepts<br />
genÄgt es dabei nicht, den Blick nur auf das e<strong>in</strong>zelne Haushaltsjahr oder auf den Zeitraum<br />
GEMEINDEORDNUNG 213
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
Ä 75 GO <strong>NRW</strong><br />
der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung zu richten. Die Geme<strong>in</strong>de muss immer ihre stetige, d.h. auf e<strong>in</strong>en<br />
lÅngeren Zeitraum unter BerÄcksichtigung der <strong>in</strong>tergenerativen Gerechtigkeit ausgerichtete, ErfÄllung der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Aufgaben im Blick haben und gewÅhrleisten. Dieses wird besonders durch bestehende oder neue<br />
Vere<strong>in</strong>barungen der Geme<strong>in</strong>de deutlich, die zum Teil e<strong>in</strong>e Laufzeit von mehreren Jahrzehnten haben, z.B. KreditvertrÅge<br />
oder Leas<strong>in</strong>gvertrÅge.<br />
Die Geme<strong>in</strong>de muss daher angemessene Rahmenbed<strong>in</strong>gungen schaffen und eigenverantwortlich ihre langfristige<br />
Entwicklung gestalten. Dieses be<strong>in</strong>haltet die BerÄcksichtigung von ertragswirksamen und aufwandswirksamen<br />
Aspekten, f<strong>in</strong>anziellen HandlungsmÇglichkeiten sowie ggf. Anpassung von Verwaltungsstrukturen und ArbeitsablÅufen.<br />
E<strong>in</strong> Leitbild und die daraus entwickelten strategischen Ziele kÇnnen die langfristige Entwicklung der Geme<strong>in</strong>de<br />
unterstÄtzen. Daher gilt es, die kÄnftig zu erwartenden VerÅnderungen bereits bei den heutigen haushaltswirtschaftlichen<br />
Vorhaben und MaÖnahmen zu berÄcksichtigen.<br />
1.2 Der Begriff „Geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft“<br />
Der Begriff „Geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft“ ist haushaltsrechtlich nicht geregelt. Nach allgeme<strong>in</strong>er Auffassung<br />
gehÇren hierzu alle D<strong>in</strong>ge und TÅtigkeiten der Geme<strong>in</strong>de, die mit der Vorbereitung, Aufstellung und AusfÄhrung<br />
des jÅhrlichen Haushaltsplans (Ergebnisplan und F<strong>in</strong>anzplan sowie Anlagen) sowie mit der Vorbereitung, Aufstellung<br />
und PrÄfung des Jahresabschlusses (Ergebnisrechnung, F<strong>in</strong>anzrechnung und Bilanz sowie Anlagen) zusammenhÅngen.<br />
Auch die Verwaltung des geme<strong>in</strong>dlichen VermÇgens und der Schulden gehÇrt dazu, denn diese<br />
Aufgabe entsteht aus dem jÅhrlichen Haushaltskreislauf.<br />
Zur geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft gehÇrt aber auch die Verpflichtung der Geme<strong>in</strong>de, e<strong>in</strong>en Gesamtabschluss<br />
aufzustellen. Durch dieses Werk wird die QualitÅt der Rechenschaft Äber die Aufgabenerledigung der<br />
Geme<strong>in</strong>de im abgelaufenen Haushaltsjahr wesentlich erhÇht und e<strong>in</strong> Bild Äber die gesamte wirtschaftliche Lage<br />
der Geme<strong>in</strong>de erreicht, denn <strong>in</strong> den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss werden die Betriebe der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>bezogen<br />
und deren JahresabschlÄsse mit dem Jahresabschluss der Geme<strong>in</strong>de (Kernverwaltung) konsolidiert.<br />
2. Die Produktorientierung im geme<strong>in</strong>dlichen Haushalt<br />
Bei der Erfassung des Ressourcenaufkommens durch ErtrÅge und des Ressourcenverbrauchs durch Aufwendungen<br />
<strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft gelten viele bewÅhrte HaushaltsgrundsÅtze weiter. Der Haushalt<br />
ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschafts<strong>in</strong>strument <strong>in</strong> der Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de.<br />
Die mit der Reform des Geme<strong>in</strong>dehaushaltsrechts angestrebten Ziele, die Steuerung der Geme<strong>in</strong>de zu verbessern<br />
und den Ressourcenverbrauch vollstÅndig zu berÄcksichtigen, erfordern e<strong>in</strong>e angepasste Gliederung des<br />
Haushaltsplans nach É 79 GO <strong>NRW</strong>. Den Geme<strong>in</strong>den wird die Befugnis e<strong>in</strong>gerÅumt, den Haushaltsplan nach<br />
ihren Çrtlichen BedÄrfnissen eigenverantwortlich zu gliedern. Die Festlegung e<strong>in</strong>er Steuerungsebene auf der die<br />
TeilplÅne nach É 4 GemHVO <strong>NRW</strong> aufzustellen s<strong>in</strong>d, trÅgt wesentlich zur StÅrkung der kommunalen Selbstverwaltung<br />
bei.<br />
Die produktorientierten TeilplÅne im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan s<strong>in</strong>d auf der Grundlage der 17 verb<strong>in</strong>dlichen<br />
Produktbereichen zu bilden und bestehen u.a. aus Teilergebnis- und Teilf<strong>in</strong>anzplÅnen. ErgÅnzend zur Gesamtebene<br />
werden daher <strong>in</strong> den TeilplÅnen aussagekrÅftige Informationen Äber die ErfÄllung der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgaben<br />
gegeben, z.B. Äber SchultrÅgeraufgaben, soziale Hilfen etc. gegeben. E<strong>in</strong>e noch weitergehende Bildung<br />
von TeilplÅnen als Untergliederung der im Haushaltsplan enthaltenen Produktbereiche, z.B. nach Produktgruppen<br />
oder Produkten oder nach der Organisationsgliederung der Verwaltung (Untergliederung nach Verantwortungsbereichen),<br />
ist den Geme<strong>in</strong>den nach ihren Çrtlichen BedÄrfnissen freigestellt (vgl. É 4 GemHVO <strong>NRW</strong>). Der Rahmen<br />
fÄr die Bildung von TeilplÅnen wird nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung).<br />
GEMEINDEORDNUNG 214
TeilplÅne<br />
nach<br />
Produktbereichen<br />
TeilplÅne<br />
nach<br />
Produktgruppen<br />
TeilplÅne<br />
nach<br />
Produkten<br />
TeilplÅne<br />
nach<br />
Verantwortungsbereichen<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
Ä 75 GO <strong>NRW</strong><br />
Bildung von produktorientierten TeilplÅnen<br />
GEMEINDEORDNUNG 215<br />
Die TeilplÅne im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan s<strong>in</strong>d nach den verb<strong>in</strong>dlich<br />
vorgegebenen Produktbereichen mit Angabe der jeweils dazugehÇrigen Produktgruppen<br />
und wesentlichen Produkte zu bilden.<br />
Die TeilplÅne im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan kÇnnen nach Produktgruppen<br />
(eigene oder aus dem NKF- oder dem „LÅnder-Produktrahmen“) mit m<strong>in</strong>destens<br />
der Angabe der Summen der untergliederten TeilplÅne auf der Ebene der<br />
verb<strong>in</strong>dlichen Produktbereiche aufgestellt werden.<br />
Die TeilplÅne im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan kÇnnen nach Produkten mit<br />
m<strong>in</strong>destens der Angabe der Summen der untergliederten TeilplÅne auf der<br />
Ebene der verb<strong>in</strong>dlichen Produktbereiche aufgestellt werden.<br />
Die TeilplÅne im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan kÇnnen nach Çrtlichen Verantwortungsbereichen<br />
mit Angabe der Aufgaben und der dafÄr gebildeten Produkte<br />
sowie mit der Angabe der Summen der untergliederten TeilplÅne auf der<br />
Ebene der verb<strong>in</strong>dlichen Produktbereiche aufgestellt werden.<br />
Abbildung 20 „Bildung von produktorientierten TeilplÅnen“<br />
In den TeilplÅnen des geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplans, die als Çrtliche Steuerungsebene dienen, s<strong>in</strong>d daher auch<br />
die Ziele der Geme<strong>in</strong>de und die Kennzahlen zur Messung der Ziele sowie ggf. die <strong>in</strong>terne Leistungsverrechnung<br />
abzubilden. Diese haushaltswirtschaftliche Produktorientierung soll das nachfolgende Schema aufzeigen (vgl.<br />
Abbildung).<br />
Produktorientierung nach dem NKF-Produktrahmen<br />
Produktfelder Produktbereiche Produktgruppen Produkte Leistungen<br />
1 Zentrale<br />
Verwaltung<br />
2 Schule und Kultur<br />
3 Soziales<br />
und Jugend<br />
4 Gesundheit und<br />
Sport<br />
5 Gestaltung der<br />
Umwelt<br />
6 Zentrale F<strong>in</strong>anz-<br />
Leistungen<br />
01 Innere<br />
Verwaltung<br />
...<br />
05 Soziale<br />
Leistungen<br />
...<br />
07 Gesundheitsdienste<br />
...<br />
17 Stiftungen<br />
3. Haushaltsausgleich und Eigenkapital<br />
3.1 Das Stufenmodell<br />
Bildung<br />
von<br />
Produktgruppen<br />
nach den Çrtlichen<br />
BedÄrfnissen<br />
Bildung<br />
von<br />
Produkten<br />
nach den Çrtlichen<br />
BedÄrfnissen<br />
Abbildung 21 „Produktorientierung nach dem NKF-Produktrahmen“<br />
Festlegung<br />
von<br />
Leistungen<br />
nach den Çrtlichen<br />
BedÄrfnissen<br />
Durch die Vorschrift wird e<strong>in</strong>e stÅrkere Verflechtung zwischen der mittelfristigen haushaltswirtschaftlichen Planung<br />
und der Sicherung der stetigen AufgabenerfÄllung erreicht sowie durch die aufsichtsrechtlich gestuften
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
Ä 75 GO <strong>NRW</strong><br />
MaÖnahmen frÄhzeitiger als bisher gesichert. Die unmittelbare Verb<strong>in</strong>dung zwischen dem jÅhrlichen Haushaltsausgleich<br />
und dem Eigenkapital sowie die stÅrkere Gewichtung der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung<br />
<strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft haben zu dem folgenden Stufenmodell gefÄhrt (vgl. Abbildung).<br />
Stufenmodell zur Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en RÑcklage<br />
1. Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr<br />
nach É 75 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> erreicht (Anzeigepflicht)<br />
2. Inanspruchnahme der AusgleichsrÄcklage im Haushaltsjahr<br />
nach É 75 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> (Anzeigepflicht)<br />
3. Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage<br />
a. im Haushaltsjahr unterhalb des Schwellenwertes des É 76 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong><br />
(e<strong>in</strong>fache Genehmigung),<br />
b. im Haushaltsjahr oberhalb des Schwellenwertes des É 76 Abs. 1 Nr. 1 GO <strong>NRW</strong><br />
(genehmigungspflichtiges Haushaltssicherungskonzept),<br />
c. <strong>in</strong> zwei aufe<strong>in</strong>anderfolgenden Haushaltsjahren oberhalb der Schwellenwerte des<br />
É 76 Abs. 1 Nr. 2 GO <strong>NRW</strong> (genehmigungspflichtiges Haushaltssicherungskonzept),<br />
d. bis zum Verbrauch <strong>in</strong>nerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung als<br />
Schwellenwert des É 76 Abs. 1 Nr. 3 GO <strong>NRW</strong><br />
(genehmigungspflichtiges Haushaltssicherungskonzept).<br />
Abbildung 22 „Stufenmodell zur Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en RÉcklage“<br />
Die ErfÄllung der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgaben muss auf Dauer - also nachhaltig und periodenÄbergreifend - gewÅhrleistet<br />
werden. Es genÄgt nicht, die geme<strong>in</strong>dliche AufgabenerfÄllung nur im jeweils aktuellen Haushaltsjahr zu<br />
sichern, sondern dies bereits fÄr die weitere Zukunft <strong>in</strong> den drei dem Haushaltsjahre folgenden Planungsjahren<br />
der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung auch nachweislich aufzuzeigen (vgl. É 84 S. 3 GO <strong>NRW</strong>).<br />
3.2 Ke<strong>in</strong>e WahlmÖglichkeit zwischen AusgleichsrÑcklage und allgeme<strong>in</strong>er RÑcklage<br />
Aus dem gesonderten Ansatz e<strong>in</strong>er AusgleichsrÄcklage als SonderrÄcklage im Bereich „Eigenkapital“ auf der<br />
Passivseite der Bilanz lÅsst sich auÖerdem e<strong>in</strong>e Vorrangstellung der AusgleichsrÄcklage gegenÄber der allgeme<strong>in</strong>en<br />
RÄcklage ableiten, weil die allgeme<strong>in</strong>e RÄcklage e<strong>in</strong>en „Restposten“ des Eigenkapitals darstellt. Diese<br />
mÇgliche Rangfolge zwischen den Eigenkapitalposten wird durch den gesetzlichen vorgeschriebenen Haushaltsausgleich<br />
verstÅrkt und ausgestaltet (vgl. É 75 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>).<br />
Bei e<strong>in</strong>er Inanspruchnahme der AusgleichsrÄcklage gilt nÅmlich die gesetzliche Verpflichtung zum Haushaltausgleich<br />
noch als erfÄllt (vgl. É 75 Abs. 2 S. 3 GO <strong>NRW</strong>). E<strong>in</strong>e Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage wirkt sich<br />
nicht auf den gesetzlich bestimmten jÅhrlichen Haushaltsausgleich aus, auch wenn nach É 78 Abs. 2 Nr. 2 GO<br />
<strong>NRW</strong> beide Arten der Inanspruchnahme des Eigenkapitals e<strong>in</strong>er Festsetzung <strong>in</strong> der Haushaltssatzung bedÄrfen.<br />
Diese Rangfolge bei der Inanspruchnahme von Eigenkapital wird dadurch noch verstÅrkt, dass <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Praxis die Inanspruchnahme der AusgleichsrÄcklage <strong>in</strong> der Eigenverantwortung der Geme<strong>in</strong>de liegt und<br />
jede Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage e<strong>in</strong>er Genehmigung der AufsichtsbehÇrde bedarf.<br />
E<strong>in</strong>e generelle WahlmÇglichkeit zwischen diesen zwei Instrumenten zur Inanspruchnahme von Eigenkapital ist<br />
daher nicht gegeben. Sie kann auch nicht aus e<strong>in</strong>er wirtschaftlichen Betrachtungsweise der Eigenkapitalverr<strong>in</strong>gerung<br />
durch die Inanspruchnahme der AusgleichsrÄcklage oder der Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage abgeleitet<br />
werden. Auch wenn wirtschaftlich betrachtet, immer e<strong>in</strong>e Inanspruchnahme des Eigenkapitals erfolgt, ist der<br />
Vorgehensweise, durch die der gesetzlichen Verpflichtung zum Haushaltsausgleich nachgekommen wird, der<br />
Vorrang e<strong>in</strong>zurÅumen. E<strong>in</strong>e alternative Vorgehensweise kann auch nicht auf der Grundlage besonderer Çrtlich<br />
GEMEINDEORDNUNG 216
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
Ä 75 GO <strong>NRW</strong><br />
vorhandener Gegebenheiten notwendig werden. Bei e<strong>in</strong>em negativen Jahresergebnis hat die Geme<strong>in</strong>de daher<br />
immer zuerst die AusgleichsrÄcklage <strong>in</strong> Anspruch zu nehmen. Erst wenn die AusgleichsrÄcklage aufgebraucht<br />
ist, darf e<strong>in</strong>e Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage erfolgen.<br />
3.3 Inanspruchnahme der AusgleichsrÑcklage vor allgeme<strong>in</strong>er RÑcklage<br />
Aus der “Pufferfunktion“ der AusgleichsrÄcklage und ihrem Ansatz als gesonderter Posten <strong>in</strong>nerhalb des Eigenkapitals<br />
auf der Passivseite der Bilanz lÅsst sich die Verpflichtung zur vorrangigen Inanspruchnahme der AusgleichsrÄcklage<br />
vor der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage ableiten. Dies hat der Gesetzgeber mit der Ausgleichsfiktion der<br />
AusgleichsrÄcklage nach É 75 Abs. 2 S. 3 GO <strong>NRW</strong> deutlich zum Ausdruck gebracht. Bildet die Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>e<br />
AusgleichsrÄcklage, ist sie nach der Haushaltssystematik der gestuften Ausgleichsregelungen verpflichtet, diese<br />
vor der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage <strong>in</strong> Anspruch zu nehmen. E<strong>in</strong>e WahlmÇglichkeit steht der Geme<strong>in</strong>de demnach<br />
schon deshalb nicht zu, weil sie nach É 75 Abs. 2 Satz 1 GO <strong>NRW</strong> verpflichtet ist, e<strong>in</strong>en ausgeglichenen Haushalt<br />
aufzustellen. Kann die Geme<strong>in</strong>de dieser Verpflichtung durch Inanspruchnahme der AusgleichsrÄcklage gem. É 75<br />
Abs. 2 S. 3 GO <strong>NRW</strong> nachkommen, bleibt ihr ke<strong>in</strong> Raum fÄr die Inanspruchnahme der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage, mit<br />
deren Hilfe gerade nicht der (fiktive) Haushaltsausgleich herbeigefÄhrt werden kann.<br />
Die Verpflichtung zur vorrangigen Inanspruchnahme der geme<strong>in</strong>dlichen AusgleichsrÄcklage besteht auch dann,<br />
wenn die Mittel der AusgleichsrÄcklage <strong>in</strong>sgesamt nicht mehr zur Deckung des entstandenen Jahresfehlbetrages<br />
ausreichen und zur Deckung zusÅtzlich die allgeme<strong>in</strong>e RÄcklage <strong>in</strong> Anspruch genommen werden muss. In diesen<br />
FÅllen s<strong>in</strong>d z.B. die Nebenbestimmungen der Genehmigung zur Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage so zu<br />
fassen, dass sie geeignet s<strong>in</strong>d, das haushaltsrechtlich bestimmte Ziel fÄr die Geme<strong>in</strong>de, den Haushaltsausgleich<br />
mit Hilfe von KonsolidierungsmaÖnahmen wiederherzustellen, zu erreichen. Die vorrangige Inanspruchnahme der<br />
AusgleichsrÄcklage gilt auch fÄr die spÅtere tatsÅchliche Inanspruchnahme des Eigenkapitals bzw. der Verrechnung<br />
des Jahresfehlbetrages im geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss. Sie ist auch bei der Beurteilung e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltssicherungskonzeptes zu beachten.<br />
4. Besondere HaushaltsgrundsÅtze<br />
4.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die Vorschrift des É 75 GO <strong>NRW</strong> enthÅlt ke<strong>in</strong>e vollstÅndige AufzÅhlung der von der Geme<strong>in</strong>de zu beachtenden<br />
HaushaltsgrundsÅtze. Auch <strong>in</strong> anderen Vorschriften der Geme<strong>in</strong>deordnung sowie <strong>in</strong> Vorschriften der Geme<strong>in</strong>dehaushaltsverordnung<br />
s<strong>in</strong>d noch weitere wichtige HaushaltsgrundsÅtze enthalten, die von der Geme<strong>in</strong>de ebenso<br />
wie die bereits zuvor benannten HaushaltsgrundsÅtze zu beachten s<strong>in</strong>d. Mit den geme<strong>in</strong>dlichen HaushaltsgrundsÅtzen<br />
werden zielgerichtete Anforderungen an die Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de gestellt. Die wichtigsten<br />
HaushaltsgrundsÅtze fÄr Geme<strong>in</strong>den werden nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung).<br />
Besondere HaushaltsgrundsÅtze<br />
Grundsatz der <strong>in</strong>tergenerativen Gerechtigkeit É 1 Abs. 1 S. 3 GO <strong>NRW</strong><br />
Grundsatz der „Sicherung der AufgabenerfÑllung“<br />
GEMEINDEORDNUNG 217<br />
É 75 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong><br />
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit É 75 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong><br />
Grundsatz der Effizienz É 75 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
Ä 75 GO <strong>NRW</strong><br />
Grundsatz der Sparsamkeit É 75 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong><br />
Grundsatz „Sicherstellung der LiquiditÅt“ É 75 Abs. 6 GO <strong>NRW</strong><br />
Grundsatz „Sicherstellung der F<strong>in</strong>anzierung von<br />
Investitionen“ É 75 Abs. 6 GO <strong>NRW</strong><br />
Grundsatz „Verbot der Überschuldung“<br />
GEMEINDEORDNUNG 218<br />
É 75 Abs. 7 GO <strong>NRW</strong><br />
Grundsatz der Haushaltse<strong>in</strong>heit É 78 Abs. 1 und É 97 GO <strong>NRW</strong><br />
Grundsatz der JÅhrlichkeit É 78 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong><br />
Grundsatz der Vorherigkeit É 78 Abs. 3 und É 80 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong><br />
Grundsatz der zeitlichen B<strong>in</strong>dung É 78 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong><br />
Grundsatz der Haushaltsklarheit É 78 GO <strong>NRW</strong>, É 11 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
Gebot der Haushaltswahrkeit É 78 GO <strong>NRW</strong>, É 11 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
Bepackungsverbot<br />
É 78 Abs. 2 S. 2 GO <strong>NRW</strong><br />
Grundsatz der SpezialitÅt der Veranschlagung É 79 GO <strong>NRW</strong>, É 11 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
Grundsatz der sachlichen B<strong>in</strong>dung É79 GO <strong>NRW</strong>, ÉÉ 2, 3 und 11 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
Grundsatz der áffentlichkeit É 80 Abs. 6 und É 96 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong><br />
Grundsatz der E<strong>in</strong>zelveranschlagung É 11 Abs. 1 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
Grundsatz der Bruttoveranschlagung (Bruttopr<strong>in</strong>zip) É 11 Abs. 1 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
Grundsatz der VollstÅndigkeit É 11 Abs. 1 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
Grundsatz der Periodenabgrenzung (wirtschaftliche<br />
Zurechnung)<br />
É 11 Abs. 2 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
Saldierungsverbot É 11 Abs. 2 und 3 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
Kassenwirksamkeitspr<strong>in</strong>zip É 11 Abs. 3 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
Grundsatz der Gesamtdeckung É 20 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
Anwendung der GrundsÅtze ordnungsmÅàiger BuchfÑhrung<br />
(GoB) e<strong>in</strong>schlieàlich aller damit <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung<br />
stehenden GrundsÅtze<br />
Vgl. É 27 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
Abbildung 23 „Besondere HaushaltsgrundsÅtze“
4.2 AusfÑllung der HaushaltsgrundsÅtze<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
Ä 75 GO <strong>NRW</strong><br />
Zur AusfÄllung der HaushaltsgrundsÅtze im NKF gehÇrt auch, dass die Geme<strong>in</strong>den nicht mehr ihre Haushaltswirtschaft<br />
nach den e<strong>in</strong>gesetzten F<strong>in</strong>anzmitteln, Sachmitteln und Personale<strong>in</strong>satz (Input) ausrichten, sondern vor<br />
allem nach den erbrachten und zu erbr<strong>in</strong>genden geme<strong>in</strong>dlichen Leistungen (Output). Diese neue Steuerung soll<br />
unter E<strong>in</strong>beziehung des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs vorgenommen werden (Ressourcenverbrauchskonzept),<br />
das <strong>in</strong> der fachlichen AusfÄhrung mÇglichst eigenverantwortlich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Hand liegen<br />
soll (dezentrale Ressourcenverantwortung).<br />
Dieser Reformansatz erfordert, <strong>in</strong> den Geme<strong>in</strong>den verstÅrkt betriebswirtschaftliche Instrumente und Methoden<br />
wie die RechengrÇÖen „ErtrÅge“ und „Aufwendungen“, die doppelte BuchfÄhrung, die Produktorientierung,<br />
Budgetierung, Leistungskennzahlen, Controll<strong>in</strong>g, Kosten- und Leistungsrechnung u.a. zur Anwendung kommen<br />
zu lassen. Der Haushalt ist und bleibt dabei das zentrale Steuerungs- und Rechenschafts<strong>in</strong>strument <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltswirtschaft.<br />
Im Haushaltsplan der Geme<strong>in</strong>de s<strong>in</strong>d im Ergebnisplan die ErtrÅge und Aufwendungen als RechengrÇÖen abzubilden,<br />
im F<strong>in</strong>anzplan die E<strong>in</strong>zahlungen und Auszahlungen. Diese sollen aus Steuerungsgesichtspunkten untergliedert<br />
werden, so dass produktorientierte und steuerungsrelevante TeilplÅne entstehen (vgl. É 4 GemHVO<br />
<strong>NRW</strong>). FÄr die geme<strong>in</strong>dliche AufgabenerfÄllung sollen daher produktorientierte Ziele unter BerÄcksichtigung des<br />
e<strong>in</strong>setzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Leistungskennzahlen<br />
zur Zielerreichung bestimmt werden.<br />
Die Çrtlich bestimmten Ziele und Leistungskennzahlen sollen von der Geme<strong>in</strong>de zur Grundlage der Gestaltung<br />
ihrer Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jÅhrlichen Haushalts gemacht werden (vgl. É 12 GemHVO<br />
<strong>NRW</strong>). Dabei darf auch das Ziel des NKF, die Generationengerechtigkeit zu beachten, nicht <strong>in</strong> das Belieben der<br />
Geme<strong>in</strong>de gestellt se<strong>in</strong>. Durch entsprechende Vorgaben muss gesichert werden, dass dieses Ziel zu e<strong>in</strong>er langfristigen<br />
Orientierung bei den haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen beitrÅgt.<br />
II. ErlÅuterungen im E<strong>in</strong>zelnen<br />
1. Zu Absatz 1 (HaushaltsgrundsÅtze):<br />
1.1 Zu Satz 1 (Haushaltswirtschaft und stetige AufgabenerfÑllung):<br />
1.1.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die Reform des geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltrechts ermÇglicht e<strong>in</strong>e verbesserte Umsetzung der allgeme<strong>in</strong>en HaushaltsgrundsÅtze.<br />
Sie soll dazu beitragen, die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft so zu planen und zu fÄhren, dass<br />
die stetige ErfÄllung der Aufgaben gesichert ist. Die Geme<strong>in</strong>den haben ihre gesamte Haushaltswirtschaft auf<br />
dieses Ziel auszurichten. Die Sicherung der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgaben muss e<strong>in</strong>e stetige, auf e<strong>in</strong>en lÅngeren Zeitraum<br />
ausgerichtete ErfÄllung gewÅhrleisten, d.h. die Geme<strong>in</strong>de muss nicht nur im aktuellen Haushaltsjahr, sondern<br />
auch <strong>in</strong> den Folgenjahren leistungsfÅhig se<strong>in</strong>.<br />
Diese Vorschrift be<strong>in</strong>haltet zudem das Gebot der <strong>in</strong>tergenerativen Gerechtigkeit. Das Gebot verlangt, die geme<strong>in</strong>dliche<br />
Haushaltswirtschaft so zu fÄhren, dass kÄnftige Generationen nicht unzumutbar belastet werden.<br />
Durch die gesetzliche Bestimmung, dass die Geme<strong>in</strong>den <strong>in</strong> Verantwortung fÄr die kÄnftigen Generationen handeln,<br />
ist der Grundsatz der <strong>in</strong>tergenerativen Gerechtigkeit konkretisiert worden (vgl. É 1 Abs. 1 S. 3 GO <strong>NRW</strong>).<br />
Dieser Grundsatz erfordert die Verteilung von Nutzen und Lasten, so dass unter Beachtung der Äbrigen HaushaltsgrundsÅtze<br />
die Geme<strong>in</strong>de bei ihrer Haushaltsplanung und AusfÄhrung immer im Blick haben muss, HandlungsmÇglichkeiten<br />
fÄr die kÄnftigen Generationen zu erhalten.<br />
GEMEINDEORDNUNG 219
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
Ä 75 GO <strong>NRW</strong><br />
Bei dem <strong>in</strong> Vorschrift verwendeten Begriff „Aufgaben“ der Geme<strong>in</strong>de ist nicht nach Auftragsangelegenheiten,<br />
Pflichtaufgaben oder freiwilligen Aufgaben zu unterscheiden. Der Begriff be<strong>in</strong>haltet zudem auch ke<strong>in</strong>e qualitativen<br />
Anforderungen an die geme<strong>in</strong>dlichen Leistungen im Zusammenhang mit dem produktorientierten Haushalt der<br />
Geme<strong>in</strong>de. Welche Aufgaben <strong>in</strong> welcher QualitÅt von der Geme<strong>in</strong>de erfÄllt werden, unterliegt daher den Çrtlich<br />
gesetzten Zielen der Geme<strong>in</strong>de (vgl. É 12 GemHVO <strong>NRW</strong>). In diesem Zusammenhang umfasst der Begriff<br />
„Haushaltswirtschaft“ alles, was zur Vorbereitung, Aufstellung und AusfÄhrung des Haushaltsplans bis h<strong>in</strong> zur<br />
Aufstellung und Feststellung des Jahresabschlusses gehÇrt. Auch die Çrtliche RechnungsprÄfung gehÇrt dazu.<br />
Weil die Art der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgaben sehr vielgestaltig ist und von den Çrtlichen VerhÅltnissen abhÅngt, kann<br />
das AusmaÖ der Erfordernisse der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft nicht allgeme<strong>in</strong> bestimmt werden, sondern<br />
bedarf e<strong>in</strong>er Konkretisierung durch jede Geme<strong>in</strong>de.<br />
1.1.2 Grundsatz der „Sicherung der AufgabenerfÑllung“<br />
1.1.2.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft ist ke<strong>in</strong> Selbstzweck, sondern dient stets der „Sicherung der AufgabenerfÄllung“.<br />
Diese Zweckbestimmung ist umfassend und deshalb als tragender Haushaltsgrundsatz fÄr die geme<strong>in</strong>dliche<br />
Haushaltswirtschaft anzusehen. Als AnknÄpfungspunkt fÄr die Aufgabenbestimmung ist É 3 GO <strong>NRW</strong> heranzuziehen,<br />
durch den die Aufgaben der Geme<strong>in</strong>de bestimmt und abgegrenzt werden. Wegen der Vielzahl und der<br />
Verschiedenartigkeit der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgaben mit e<strong>in</strong>em theoretisch unbegrenzten Bedarf an F<strong>in</strong>anzmitteln ist<br />
e<strong>in</strong>e stÅndige BedarfsprÄfung unter BerÄcksichtigung der Çrtlichen Aufgabenstellungen und der f<strong>in</strong>anziellen LeistungsfÅhigkeit<br />
<strong>in</strong> jeder Geme<strong>in</strong>de notwendig.<br />
Der Grundsatz der „Sicherung der AufgabenerfÄllung schlieÖt die Verpflichtung der Geme<strong>in</strong>de zum Erhalt ihrer<br />
LeistungsfÅhigkeit auf Dauer e<strong>in</strong>. Die <strong>in</strong> die Zukunft gerichtete Forderung nach Sicherung der AufgabenerfÄllung<br />
setzt somit nicht nur e<strong>in</strong>e sorgfÅltige Planung fÄr das nÅchste Haushaltsjahr, sondern auch fÄr die weiteren Jahre<br />
im Rahmen der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Geme<strong>in</strong>de voraus. E<strong>in</strong> Bestandteil der Reform des Haushaltsrechts<br />
war deshalb, dass die mittelfristige Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung <strong>in</strong> den Haushaltsplan der Geme<strong>in</strong>de<br />
<strong>in</strong>tegriert wird (vgl. É 84 GO <strong>NRW</strong>).<br />
1.1.2.2 Nachhaltigkeit der Haushaltswirtschaft<br />
Unter den dargestellten Gesichtspunkten besteht fÄr die Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>e Verpflichtung zur Nachhaltigkeit ihrer<br />
Haushaltswirtschaft, die sich nicht nur im jÅhrlichen Haushaltsausgleich nach Absatz 2 der Vorschrift ausdrÄcken<br />
darf. Es ist vielmehr erforderlich, dass die Geme<strong>in</strong>de auch den gesetzlich vorgesehenen Haushaltsausgleich fÄr<br />
die drei dem Haushaltsjahr folgenden Planungsjahre der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung erreicht (vgl.<br />
É 84 GO <strong>NRW</strong>).<br />
Bei e<strong>in</strong>em jÅhrlichen Haushaltsausgleich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em mehrjÅhrigen Planungszeitraum kann grundsÅtzlich das Vorhandense<strong>in</strong><br />
der dauernden LeistungsfÅhigkeit der Geme<strong>in</strong>de unterstellt werden, wenn nicht andere Anzeichen auf<br />
mÇgliche E<strong>in</strong>schrÅnkungen h<strong>in</strong>weisen. Die Integration der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung <strong>in</strong> den<br />
Haushaltsplan der Geme<strong>in</strong>de macht die Umsetzung des Grundsatzes der „Sicherung der AufgabenerfÄllung“ bzw.<br />
dessen Beachtung fÄr die Adressaten der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft transparent.<br />
Die Beurteilung der Sicherung der geme<strong>in</strong>dlichen AufgabenerfÄllung bzw. der LeistungsfÅhigkeit der Geme<strong>in</strong>de<br />
ist nicht anhand von bestimmten Grenzwerten feststellbar. Es bedarf dazu der Vornahme e<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>schÅtzung,<br />
Äber die dafÄr maÖgeblichen Tatsachen, die aber zuvor zu bestimmen und <strong>in</strong> ihrem Umfang zu ermitteln sowie zu<br />
bewerten s<strong>in</strong>d. In diese Betrachtung kann z.B. e<strong>in</strong>bezogen werden, ob die Geme<strong>in</strong>de ihre Verpflichtungen fÄr<br />
VerlustÄbernahmen fÄr geme<strong>in</strong>dliche Betriebe, soweit sie anfallen, erfÄllen kann, e<strong>in</strong>e entsprechende Vorsorge<br />
GEMEINDEORDNUNG 220
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
Ä 75 GO <strong>NRW</strong><br />
trifft, um Risiken aus den Vorbelastungen kÄnftiger Haushaltsjahre fÄr die Geme<strong>in</strong>de soweit wie mÇglich zu m<strong>in</strong>imieren,<br />
ihre Haushaltswirtschaft so plant und ausfÄhrt, dass heute und fÄr die Zukunft stetig e<strong>in</strong> ausreichendes<br />
Eigenkapital vorhanden ist und sie nicht gegen das àberschuldungsverbot <strong>in</strong> Absatz 7 der Vorschrift verstÇÖt.<br />
Dabei kann auch nicht die Stufenfolge des geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsausgleichs auÖer Betracht bleiben.<br />
Der Grundsatz der „Sicherung der AufgabenerfÄllung“ steht auch mit der Vorschrift des É 86 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> <strong>in</strong><br />
Verb<strong>in</strong>dung, denn nach dieser Vorschrift mÄssen die mit der Aufnahme von Krediten Äbernommenen Verpflichtungen<br />
mit der dauernden LeistungsfÅhigkeit der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang stehen. Der E<strong>in</strong>haltung der dauernden<br />
LeistungsfÅhigkeit der Geme<strong>in</strong>de kommt damit bei der F<strong>in</strong>anzierung von Investitionen durch Kredite e<strong>in</strong>e herausgehobene<br />
Bedeutung zu. Die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft muss deshalb Äber e<strong>in</strong>en F<strong>in</strong>anzspielraum verfÄgen,<br />
dass der aus der Kreditaufnahme neu h<strong>in</strong>zukommende Schuldendienst nicht zur E<strong>in</strong>schrÅnkungen bei der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen AufgabenerfÄllung fÄhren wird. Daran knÄpft der Haushaltsgrundsatz <strong>in</strong> É 75 Abs. 7 GO <strong>NRW</strong> an,<br />
der e<strong>in</strong>e àberschuldung der Geme<strong>in</strong>de verbietet.<br />
1.2 Zu Satz 2 (AusfÑhrung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft):<br />
1.2.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Nach der Vorschrift hat die Geme<strong>in</strong>de ihre Haushaltswirtschaft wirtschaftlich, effizient und sparsam zu fÄhren. Um<br />
dieses auszufÄllen, muss berÄcksichtigt werden, dass der Haushalt fÄr die Geme<strong>in</strong>de das zentrale Steuerungsund<br />
Rechenschafts<strong>in</strong>strument <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft ist und bleibt. Im Haushaltsplan der Geme<strong>in</strong>de<br />
s<strong>in</strong>d im Ergebnisplan die ErtrÅge und Aufwendungen als RechengrÇÖen abzubilden, im F<strong>in</strong>anzplan die<br />
E<strong>in</strong>zahlungen und Auszahlungen. Er soll aus Steuerungsgesichtspunkten weiter untergliedert werden, so dass<br />
unter der BerÄcksichtigung Çrtlicher Gegebenheiten und Gesichtspunkte produktorientierte und steuerungsrelevante<br />
TeilplÅne entstehen (vgl. É 4 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
FÄr die geme<strong>in</strong>dliche AufgabenerfÄllung sollen zudem produktorientierte Ziele unter BerÄcksichtigung des e<strong>in</strong>setzbaren<br />
Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen<br />
zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der<br />
Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jÅhrlichen Haushalts gemacht werden (vgl. É 12 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
Dabei darf auch das Ziel des NKF, die Generationengerechtigkeit zu beachten, nicht <strong>in</strong> das Belieben der Geme<strong>in</strong>de<br />
gestellt se<strong>in</strong>. Diese Vorgaben sowie die allgeme<strong>in</strong>en und grundlegenden HaushaltsgrundsÅtze hat die<br />
Geme<strong>in</strong>de zu beachten, um den Vorgaben der Vorschrift nachkommen zu kÇnnen und auch e<strong>in</strong>e an Zielen orientierte<br />
Langfristigkeit bei den haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen zu erreichen.<br />
1.2.2 Beachtung von HaushaltsgrundsÅtzen<br />
1.2.2.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die allgeme<strong>in</strong>e Vorgabe <strong>in</strong> der Vorschrift enthÅlt u.a. die Verpflichtung der Geme<strong>in</strong>de zur Beachtung bestimmter<br />
HaushaltsgrundsÅtze. Diese werden durch E<strong>in</strong>zelvorschriften, z.B. <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>dehaushaltsverordnung, nÅher<br />
ausgestaltet. Die HaushaltsgrundsÅtze s<strong>in</strong>d als unbestimmte Rechtsbegriffe, die den Geme<strong>in</strong>den im Rahmen<br />
ihres Selbstverwaltungsrechts e<strong>in</strong>en erheblichen Gestaltungsspielraum e<strong>in</strong>rÅumen und die Anwendung des wirtschaftlichen<br />
Pr<strong>in</strong>zips bei der geme<strong>in</strong>dlichen AufgabenerfÄllung verstÅrken sollen, anzusehen. Sie lassen sich <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>e Vielzahl von Kategorien e<strong>in</strong>teilen, z.B. allgeme<strong>in</strong>e und spezielle HaushaltsgrundsÅtze oder HaushaltsgrundsÅtze<br />
fÄr die Veranschlagung, die AusfÄhrung und die Abrechnung, auf die an dieser Stelle aber verzichtet wird.<br />
Auch die GrundsÅtze ordnungsmÅÖiger BuchfÄhrung stellen HaushaltsgrundsÅtze dar.<br />
GEMEINDEORDNUNG 221
1.2.2.2 Der Haushaltsgrundsatz „Wirtschaftlichkeit“<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
Ä 75 GO <strong>NRW</strong><br />
Der Haushaltsgrundsatz „Wirtschaftlichkeit“ ist auch bei den Geme<strong>in</strong>den auf das VerhÅltnis von F<strong>in</strong>anzmittele<strong>in</strong>satz<br />
und zu erzielendem Ergebnis ausgerichtet. Damit soll der mÇglichst produktive E<strong>in</strong>satz der bei der Geme<strong>in</strong>de<br />
verfÄgbaren Ressourcen beurteilt werden. Nach dem „M<strong>in</strong>imax-Pr<strong>in</strong>zip“ ergibt sich e<strong>in</strong>e Auswahl: Entweder soll<br />
das gesetzte Ziel mit e<strong>in</strong>em M<strong>in</strong>imum an F<strong>in</strong>anzmittel erreicht werden oder mit den zur VerfÄgung stehenden<br />
F<strong>in</strong>anzmitteln soll e<strong>in</strong> maximales Ergebnis erreicht werden. FÄr die Geme<strong>in</strong>den gilt es dabei nicht, e<strong>in</strong>e Gew<strong>in</strong>nmaximierung<br />
zu erreichen, sondern ergebnisorientiert <strong>in</strong> jedem Haushaltsjahr den optimalen Ressourcene<strong>in</strong>satz<br />
bei der geme<strong>in</strong>dlichen AufgabenerfÄllung zu erreichen. Die Geme<strong>in</strong>den haben hier e<strong>in</strong>en weiten Gestaltungsspielraum<br />
im Rahmen der gesetzlich garantierten Selbstverwaltung.<br />
1.2.2.3 Der Haushaltsgrundsatz „Effizienz“<br />
Der Haushaltsgrundsatz der „Effizienz“ soll das Erfordernis e<strong>in</strong>er Leistungswirksamkeit <strong>in</strong> die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft<br />
e<strong>in</strong>fÄhren. Er soll auÖerdem dazu beitragen, die neue Steuerung mit zeitbezogenen Ziel- und F<strong>in</strong>anzvorgaben<br />
<strong>in</strong> der Praxis tatsÅchlich umzusetzen. FÄr die geme<strong>in</strong>dliche AufgabenerfÄllung sollen daher produktorientierte<br />
Ziele unter BerÄcksichtigung des e<strong>in</strong>setzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen<br />
Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Leistungskennzahlen zur Zielerreichung bestimmt und mit F<strong>in</strong>anzzielen<br />
verknÄpft werden (vgl. É 12 GemHVO <strong>NRW</strong>). Die Verpflichtung <strong>in</strong> der genannten Vorschrift, produktorientierte<br />
Ziele unter BerÄcksichtigung des e<strong>in</strong>setzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs<br />
festzulegen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung zu bestimmen, verlangt von der Geme<strong>in</strong>de nichts<br />
UnmÇgliches, auch wenn es bei der Vielzahl der Çrtlichen Aufgaben nicht immer e<strong>in</strong>fach se<strong>in</strong> dÄrfte, zutreffende<br />
Ziele und Leistungskennzahlen unter BerÄcksichtigung der geme<strong>in</strong>dlichen Produktorientierung festzulegen. Im<br />
Zeitvergleich dÄrfte sich die Wirksamkeit des Mittele<strong>in</strong>satzes auf se<strong>in</strong>e Zielerreichung messen lassen.<br />
1.2.2.4 Der Haushaltsgrundsatz „Sparsamkeit“<br />
Der Haushaltsgrundsatz „Sparsamkeit“ soll die Verschwendung der den Geme<strong>in</strong>den anvertrauten Haushaltsmittel<br />
verh<strong>in</strong>dern. Die Geme<strong>in</strong>de soll bei der Erledigung ihrer Aufgaben prÄfen, wie die e<strong>in</strong>zelne Aufgabe bei vernÄnftiger<br />
Betrachtung angemessen wahrgenommen und f<strong>in</strong>anziert wird. Dabei ist zu berÄcksichtigen, dass die fÄr die<br />
HaushaltsausfÄhrung vom Rat beschlossenen ErmÅchtigungen e<strong>in</strong>e HÇchstgrenze fÄr die verfÄgbaren Haushaltsmittel<br />
darstellen, wenn ke<strong>in</strong> ânderungsbedarf im Rahmen der AusfÄhrung des Haushaltsplans entsteht. Auch<br />
verlangt der Grundsatz, die geme<strong>in</strong>dlichen MaÖnahmen kostengÄnstig durchzufÄhren und F<strong>in</strong>anzmittel nur zu<br />
dem Zeitpunkt zu verbrauchen, wenn sie benÇtigt werden.<br />
Der Grundsatz soll darÄber h<strong>in</strong>aus dazu anhalten, die Ertrags- und E<strong>in</strong>zahlungsmÇglichkeiten zu nutzen und auch<br />
von der E<strong>in</strong>ziehung Gebrauch zu machen, d.h. bestehende AnsprÄche rechtzeitig und vollstÅndig geltend zu<br />
machen. Dieser Haushaltsgrundsatz hat somit auch e<strong>in</strong>e Schutzfunktion fÄr das Budgetrecht des Rates und soll<br />
gleichzeitig zu Sicherung des gesetzlich geforderten Haushaltsausgleichs beitragen. Die Anwendung dieses<br />
Grundsatzes darf jedoch <strong>in</strong>sgesamt die erforderliche Aufgabenerledigung nicht bee<strong>in</strong>trÅchtigen. E<strong>in</strong>e wirtschaftliche<br />
HaushaltsfÄhrung schlieÖt dabei grundsÅtzlich das sparsame Handeln e<strong>in</strong>. Auch hier verbleibt den Geme<strong>in</strong>den<br />
e<strong>in</strong> erheblicher Handlungsspielraum.<br />
1.2.2.5 Der Haushaltsgrundsatz „JÅhrlicher Haushaltsausgleich“<br />
Der Haushaltsgrundsatz „Verpflichtung zum jÅhrlichen Haushaltsausgleich“ hat so e<strong>in</strong>e gewichtige Bedeutung,<br />
dass er nicht e<strong>in</strong>fach <strong>in</strong> die AufzÅhlung aufgenommen, sondern ihm e<strong>in</strong> gesonderter Absatz <strong>in</strong> dieser Vorschrift<br />
e<strong>in</strong>gerÅumt wurde. Die Geme<strong>in</strong>de ist nach diesem Grundsatz verpflichtet, ihren Haushalt <strong>in</strong> jedem Jahr <strong>in</strong> Pla-<br />
GEMEINDEORDNUNG 222
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
Ä 75 GO <strong>NRW</strong><br />
nung und Rechnung auszugleichen. Der gesetzlich bestimmte jÅhrliche Haushaltsausgleich ist dabei ke<strong>in</strong> Selbstzweck.<br />
Durch die ausdrÄckliche gesetzliche Verpflichtung zum Haushaltsausgleich soll daher e<strong>in</strong>e nachhaltige<br />
Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de gewÅhrleistet werden.<br />
1.2.2.6 Der Haushaltsgrundsatz „Intergenerative Gerechtigkeit“<br />
Im Zusammenhang mit den gesetzlich bestimmten GrundsÅtzen und den GrundsÅtzen ordnungsmÅÖiger BuchfÄhrung<br />
ist gesondert der Grundsatz der <strong>in</strong>tergenerativen Gerechtigkeit gesetzlich bestimmt worden (vgl. É 1 Abs.<br />
1 S. 3 GO <strong>NRW</strong>). Dieser Grundsatz wird dadurch ergÅnzt, dass bestimmt worden ist, „Die Geme<strong>in</strong>den haben ihr<br />
VermÇgen und ihre E<strong>in</strong>kÄnfte so zu verwalten, dass die Geme<strong>in</strong>def<strong>in</strong>anzen gesund bleiben“ (vgl. É 10 S. 1 GO<br />
<strong>NRW</strong>). Er be<strong>in</strong>haltet, dass die Geme<strong>in</strong>den <strong>in</strong> Verantwortung fÄr die kÄnftigen Generationen handeln mÄssen. Der<br />
Grundsatz der <strong>in</strong>tergenerativen Gerechtigkeit erfordert daher die zeitliche Verteilung von Nutzen und Lasten im<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Bereich, so dass die Geme<strong>in</strong>de bei ihrer Haushaltsplanung und HaushaltsausfÄhrung unter Beachtung<br />
der Äbrigen geme<strong>in</strong>dlichen HaushaltsgrundsÅtze immer im Blick haben muss, auch ausreichende HandlungsmÇglichkeiten<br />
fÄr die kÄnftigen Generationen zu erhalten. Er be<strong>in</strong>haltet u.a. auch, dass die Geme<strong>in</strong>de ke<strong>in</strong>e<br />
rÄcksichtslose Inanspruchnahme der Abgabepflichtigen vornehmen darf.<br />
1.3 Zu Satz 3 (Haushaltsgrundsatz „Beachtung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts“):<br />
Die Geme<strong>in</strong>den s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> die staatliche Konjunkturpolitik e<strong>in</strong>bezogen. Dies wird durch diese Vorschrift aufgegriffen,<br />
aber h<strong>in</strong>sichtlich der Verpflichtungen der Geme<strong>in</strong>de nicht nÅher bestimmt. Gleichwohl betont die Verpflichtung der<br />
Geme<strong>in</strong>de, mit ihrer Haushaltswirtschaft den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung<br />
zu tragen, ihre Mitverantwortung fÄr die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Der Haushaltsgrundsatz „Beachtung<br />
des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts“ enthÅlt daher fÄr die Geme<strong>in</strong>den die Verpflichtung, ke<strong>in</strong>e<br />
MaÖnahmen zu ergreifen, die zur StÇrung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts beitragen kÇnnen. Die<br />
Geme<strong>in</strong>den haben somit an der Verpflichtung des Landes teil, darauf h<strong>in</strong>zuwirken, dass die Çffentliche Haushaltswirtschaft<br />
den konjunkturpolitischen Erfordernissen nicht entgegen steht (vgl. Art. 109 Abs. 2 GG i.V.m. ÉÉ 1<br />
und 16 des Gesetzes zur FÇrderung der StabilitÅt und des Wachstums der Wirtschaft vom 08.06.1967 (StabilitÅtsgesetz<br />
- StWG).<br />
2. Zu Absatz 2 (JÅhrlicher Haushaltsausgleich):<br />
2.1 Zu Satz 1 (Verpflichtung zum Haushaltsausgleich):<br />
2.1.1 Inhalte der Vorschrift<br />
Die Vorschrift verpflichtet die Geme<strong>in</strong>de dazu, ihren Haushalt <strong>in</strong> jedem Jahr <strong>in</strong> Planung und Rechnung auszugleichen.<br />
Diese Vorgabe wird dadurch umgesetzt, dass nach Satz 2 der Vorschrift der jÅhrliche Haushaltsausgleich<br />
im Rahmen des geme<strong>in</strong>dlichen Ergebnisplans und der Ergebnisrechnung der Geme<strong>in</strong>de nachzuweisen ist. E<strong>in</strong>e<br />
darÄber h<strong>in</strong>ausgehende weitere Ausgleichsverpflichtung, z.B. fÄr den geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzplan und die F<strong>in</strong>anzrechnung<br />
der Geme<strong>in</strong>de besteht im NKF nicht. Diesen Teilen des geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplans bzw. des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Jahresabschlusses kommen vorrangig die Aufgabe der F<strong>in</strong>anzmittelherkunft und der F<strong>in</strong>anzmittelverwendung<br />
sowie des Nachweises e<strong>in</strong>er ausreichenden LiquiditÅt im jeweiligen Haushaltsjahr zu (vgl. É 75 Abs.<br />
6 i.V.m. É 3 GemHVO <strong>NRW</strong>), so dass ke<strong>in</strong>e Notwendigkeit fÄr Ausgleichsvorgaben besteht.<br />
Im NKF ist im Rahmen des Haushaltsausgleichs zu berÄcksichtigen, dass e<strong>in</strong> KernstÄck der Reform des Geme<strong>in</strong>dehaushaltsrechts<br />
die BerÄcksichtigung des vollstÅndigen Ressourcenverbrauchs ist, der mit Hilfe des Rechungsstoffes<br />
„ErtrÅge“ und „Aufwendungen“ ermittelt und <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Ergebnisrechnung abgebildet<br />
GEMEINDEORDNUNG 223
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
Ä 75 GO <strong>NRW</strong><br />
wird. Dieses wirkt sich auch bei den Regelungen Äber den jÅhrlichen Haushaltsausgleich aus, denn andernfalls<br />
bliebe <strong>in</strong> den Geme<strong>in</strong>den die Umsetzung des Ressourcenverbrauchskonzeptes unvollstÅndig. Der geme<strong>in</strong>dliche<br />
Haushaltsausgleich bezieht sich daher nicht mehr auf die Sicherung des Geldbestandes der Geme<strong>in</strong>de, sondern<br />
auf den Erhalt des geme<strong>in</strong>dlichen VermÇgens zur Sicherung der stetigen ErfÄllung der Aufgaben der Geme<strong>in</strong>de.<br />
Der gesetzlich bestimmte jÅhrliche Haushaltsausgleich ist dabei ke<strong>in</strong> Selbstzweck, denn die Verpflichtung dazu<br />
soll verh<strong>in</strong>dern, dass durch die AnhÅufung jÅhrlicher FehlbetrÅge die kÄnftigen HandlungsspielrÅume der Geme<strong>in</strong>de<br />
e<strong>in</strong>geengt, das geme<strong>in</strong>dliche Eigenkapital aufgezehrt und damit die stetige AufgabenerfÄllung der Geme<strong>in</strong>de<br />
auf Dauer gefÅhrdet wird. Durch die ausdrÄckliche gesetzliche Verpflichtung zum Haushaltsausgleich soll<br />
daher e<strong>in</strong>e nachhaltige Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>er Generationengerechtigkeit gewÅhrleistet<br />
werden.<br />
2.1.2 Der Begriff „Haushalt“<br />
Nach der Vorschrift muss der Haushalt der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> jedem Jahr <strong>in</strong> Planung und Rechnung ausgeglichen<br />
se<strong>in</strong>. Der Gesetzgeber geht bei dem von ihm verwendeten Begriff „Haushalt“ von e<strong>in</strong>em Çffentlichen Haushalt der<br />
Geme<strong>in</strong>de und nicht von e<strong>in</strong>em „privaten Haushalt“ aus. Der Begriff ist zwar haushaltsrechtlich nicht geregelt,<br />
jedoch bezieht er sich nach allgeme<strong>in</strong>er Auffassung nicht nur auf die Haushaltsplanung. Er geht daher weiter als<br />
der geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsplan, denn er umfasst neben dem Haushaltsplan auch die AusfÄhrung des Haushaltsplans<br />
sowie die Haushaltsrechnung der Geme<strong>in</strong>de (Jahresabschluss).<br />
Aus der haushaltsrechtlichen Begrifflichkeit folgt, dass die gesetzliche Pflicht zum Haushaltsausgleich von der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Kernverwaltung zu erfÄllen ist und auch die Aufstellung der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen<br />
(vgl. É 78 GO <strong>NRW</strong>), die Beschlussfassung Äber den Entwurf der der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung mit ihren<br />
Anlagen durch den Rat der Geme<strong>in</strong>de (vgl. É 80 GO <strong>NRW</strong>) sowie die AusfÄhrung des Hausplans umfasst, aber<br />
auch die Aufstellung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses (vgl. É 95 GO <strong>NRW</strong>) sowie die Beschlussfassung<br />
Äber den Entwurf des Jahresabschlusses durch den Rat der Geme<strong>in</strong>de (vgl. É 96 GO <strong>NRW</strong>) e<strong>in</strong>schlieÖt.<br />
2.2 Zu Satz 2 (Haushaltsausgleichsregel):<br />
2.2.1 Deckung der ErtrÅge durch Aufwendungen<br />
Nach der Vorschrift ist der jÅhrliche geme<strong>in</strong>dliche Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ErtrÅge die<br />
HÇhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder Äbersteigt. Durch diese Ausgleichsregel im NKF<br />
mÄssen die ErtrÅge <strong>in</strong>sgesamt m<strong>in</strong>destens die HÇhe der vorgesehenen Aufwendungen erreichen (decken). Dieses<br />
gilt ausdrÄcklich sowohl im Rahmen der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplanung (Ausgleich <strong>in</strong> der Planung) als<br />
auch im Rahmen des Jahresabschlusses der Geme<strong>in</strong>de (Ausgleich <strong>in</strong> der Rechnung). In den FÅllen, <strong>in</strong> denen die<br />
fÄr das Haushaltsjahr geplanten ErtrÅge nicht erzielt werden und daher die entstandenen Aufwendungen die<br />
ErtrÅge <strong>in</strong> dieser Periode Äbersteigen, verr<strong>in</strong>gert sich <strong>in</strong> diesem MaÖe das geme<strong>in</strong>dliche VermÇgen (Eigenkapital).<br />
Gleichwohl kann auch e<strong>in</strong> ausgeglichener Haushalt der Geme<strong>in</strong>de nicht als gesund im S<strong>in</strong>ne des É 10 Abs. 1<br />
S. 1 Go <strong>NRW</strong> bezeichnet werden, wenn der Haushaltsausgleich nur durch e<strong>in</strong>e rÄcksichtslose Inanspruchnahme<br />
der wirtschaftlichen LeistungsfÅhigkeit der Abgabepflichtigen erreicht werden kann.<br />
E<strong>in</strong> unausgeglichener geme<strong>in</strong>dlicher Haushalt birgt Gefahren fÄr die ZukunftsfÅhigkeit der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> sich und<br />
kann zu E<strong>in</strong>schrÅnkungen bei den politischen EntscheidungsmÇglichkeiten fÄhren. Um negative Auswirkungen<br />
auf die Zukunft frÄher als bisher zu erkennen und zu vermeiden, dass auch <strong>in</strong> den Folgejahren weiter Eigenkapital<br />
verzehrt wird, ist bestimmt worden, dass die fÄnfjÅhrige Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung <strong>in</strong> den Haushaltsplan<br />
e<strong>in</strong>zubeziehen ist und jedes Planungsjahr der mittelfristigen Ergebnisplanung ausgeglichen se<strong>in</strong> soll (vgl. É 84<br />
GO <strong>NRW</strong>). Wird e<strong>in</strong>e Haushaltssatzung aber fÄr zwei Haushaltsjahre erlassen, die Festsetzungen getrennt fÄr<br />
GEMEINDEORDNUNG 224
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
Ä 75 GO <strong>NRW</strong><br />
jedes Haushaltsjahr enthalten muss (vgl. É 78 Abs. 3 S. 2 GO <strong>NRW</strong>), bezieht sich die Haushaltsausgleichsregel<br />
jeweils auf das e<strong>in</strong>zelne Haushaltsjahr.<br />
In diesem Zusammenhang steht auch der Aufbau des Ergebnisplans bzw. der Ergebnisrechnung. So wird dazu<br />
durch É 79 GO <strong>NRW</strong> bestimmt, dass der Haushaltsplan die im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden ErtrÅge<br />
und die entstehenden Aufwendungen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Ergebnisplan (vgl. É 3 GemHVO <strong>NRW</strong>) enthalten muss, der nach<br />
dem Grundsatz der Ergebnisspaltung aufgebaut ist. Dadurch mÄssen die ordentlichen und die auÖerordentlichen<br />
Ergebniskomponenten getrennt vone<strong>in</strong>ander aufgezeigt werden. Als Planungs<strong>in</strong>strument ist der Ergebnisplan der<br />
wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsplans. Die Ergebnisrechnung (vgl. É 39 GemHVO <strong>NRW</strong>) entspricht<br />
der kaufmÅnnischen Gew<strong>in</strong>n- und Verlustrechnung und ist e<strong>in</strong> Bestandteil des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses<br />
(vgl. É 95 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. É 37 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
2.2.2 Das Drei-Komponentensystem<br />
2.2.2.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Mit der Entscheidung fÄr das Neue Kommunale <strong>F<strong>in</strong>anzmanagement</strong> ist e<strong>in</strong>e Grundsatzentscheidung fÄr das<br />
kaufmÅnnische Rechnungswesen als „Referenzmodell“ fÄr die Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>den getroffen<br />
worden. Auf dieser Grundlage ist e<strong>in</strong> kommunales Haushalts- und Rechnungswesen entwickelt worden, das sich<br />
auf die folgenden drei Komponenten stÄtzt und sie mit mite<strong>in</strong>ander verknÄpft (vgl. Abbildung: Quelle: NKF-<br />
Dokumentation 2003 S. 122).<br />
F<strong>in</strong>anzrechnung<br />
E<strong>in</strong>zahlungen<br />
./.<br />
Auszahlungen<br />
F<strong>in</strong>anzmittelsaldo<br />
Das Drei-Komponenten-System des NKF<br />
Bilanz<br />
Aktiva Passiva<br />
VermÄgen<br />
GEMEINDEORDNUNG 225<br />
Eigenkapital<br />
Liquide Mittel Fremdkapital<br />
Abbildung 24 „Das Drei-Komponenten-System des NKF“<br />
Ergebnisrechnung<br />
ErtrÅge<br />
./.<br />
Aufwendungen<br />
Ergebnissaldo<br />
FÄr das NKF erfolgt <strong>in</strong>soweit e<strong>in</strong>e Orientierung am Handelsgesetzbuch (HGB) und an den GrundsÅtzen ordnungsmÅÖiger<br />
BuchfÄhrung (GoB), als die spezifischen Ziele und Aufgaben des Rechnungswesens der Geme<strong>in</strong>den<br />
dem nicht entgegenstehen. Auf dieser Grundlage ist e<strong>in</strong> kommunales Haushalts- und Rechnungswesen<br />
entwickelt worden, das sich neben der Ergebnisrechnung auch auf die Bilanz und die F<strong>in</strong>anzrechnung als weitere<br />
Komponenten stÄtzt und sie mit mite<strong>in</strong>ander verknÄpft. Diese s<strong>in</strong>d zu Bestandteilen des Drei-<br />
Komponentensystems des NKF gemacht worden.
2.2.2.2 Die Bestandteile des NKF<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
Ä 75 GO <strong>NRW</strong><br />
Das NKF mit doppischem Buchungssystem besteht fÄr die Planung, Bewirtschaftung und den Abschluss <strong>in</strong> den<br />
Geme<strong>in</strong>den aus drei Bestandteilen:<br />
Ergebnisrechnung:<br />
Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmÅnnischen Gew<strong>in</strong>n- und Verlustrechnung und be<strong>in</strong>haltet die Aufwendungen<br />
und ErtrÅge. Als Planungs<strong>in</strong>strument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsplans.<br />
Das Jahresergebnis <strong>in</strong> der Ergebnisrechnung als àberschuss der ErtrÅge Äber die Aufwendungen<br />
oder als Fehlbetrag wird <strong>in</strong> die Bilanz Äbernommen und bildet unmittelbar die VerÅnderung des Eigenkapitals der<br />
Kommune ab. Das Jahresergebnis umfasst die ordentlichen Aufwendungen und ErtrÅge, die F<strong>in</strong>anzaufwendungen<br />
und -ertrÅge sowie auÖerordentliche Aufwendungen und ErtrÅge und bildet den Ressourcenverbrauch der<br />
Kommune somit umfassend ab.<br />
Bilanz:<br />
Sie ist Teil des neuen Jahresabschlusses und weist das VermÇgen und dessen F<strong>in</strong>anzierung durch Eigen- oder<br />
Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen VermÇgens. Die<br />
Regeln fÄr Ansatz und Bewertung (Bilanzierung) orientieren sich dabei an den kaufmÅnnischen Normen. Auf der<br />
Aktivseite der kommunalen Bilanz bef<strong>in</strong>den sich <strong>in</strong> enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und das UmlaufvermÇgen<br />
der Kommune. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital sowie RÄckstellungen und Verb<strong>in</strong>dlichkeiten<br />
ausgewiesen. Die besondere Struktur der kommunalen Bilanz spiegelt die kommunalen Besonderheiten wieder,<br />
z.B. durch die Abbildung der Arten des InfrastrukturvermÇgens (StraÖen etc.).<br />
F<strong>in</strong>anzrechnung:<br />
Die F<strong>in</strong>anzrechnung be<strong>in</strong>haltet alle E<strong>in</strong>zahlungen und Auszahlungen. Der LiquiditÅtssaldo aus der F<strong>in</strong>anzrechnung<br />
bildet die VerÅnderung des Bestands an liquiden Mitteln der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> der Bilanz ab. Die Pflicht zur<br />
Aufstellung der F<strong>in</strong>anzrechnung und des F<strong>in</strong>anzplans als Planungs<strong>in</strong>strument ist <strong>in</strong>sbesondere aus den Besonderheiten<br />
der Çffentlichen Haushaltsplanung und Rechenschaftslegung hergeleitet. Die F<strong>in</strong>anzrechnung knÄpft<br />
dabei im àbrigen an <strong>in</strong>ternationale Rechnungslegungsvorschriften fÄr Kapitalgesellschaften an.<br />
2.3 Zu Satz 3 (Fiktion des Haushaltsausgleichs):<br />
Die BerÄcksichtigung des vollstÅndigen Ressourcenverbrauchs, der den Werteverzehr des geme<strong>in</strong>dlichen VermÇgens<br />
durch Abschreibungen (im Ergebnisplan und <strong>in</strong> der Ergebnisrechnung enthalten) e<strong>in</strong>schlieÖt, hat erhebliche<br />
Auswirkungen auf die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft. Systembed<strong>in</strong>gt wird e<strong>in</strong> Teil der Aufwendungen<br />
durch die Darstellung des vollstÅndigen Werteverzehrs des geme<strong>in</strong>dlichen VermÇgens erstmalig <strong>in</strong> der Umstellungsphase<br />
ausgewiesen. Dieses erfordert e<strong>in</strong>en erweiterten Spielraum der Geme<strong>in</strong>den, der es ihnen ermÇglicht,<br />
eigenverantwortlich e<strong>in</strong>e haushaltswirtschaftlich vertrÅgliche Anpassung ihres Çrtlichen Haushalts an die o.a.<br />
Ausgleichsregel des Ressourcenverbrauchskonzeptes vornehmen zu kÇnnen.<br />
Die Regelung trÅgt diesem Erfordernis Rechnung, nach der der Haushalt als ausgeglichen gilt, sofern der Fehlbedarf<br />
im Ergebnisplan und der Fehlbetrag <strong>in</strong> der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der AusgleichsrÄcklage,<br />
die Teil des Eigenkapitals ist, gedeckt werden kann. Dazu ist zu beachten, dass die zulÅssige Inanspruchnahme<br />
der AusgleichsrÄcklage fÄr den „fiktiven Haushaltsausgleich“ weder <strong>in</strong> den Ergebnisplan noch <strong>in</strong> die Ergebnisrechnung<br />
ertragswirksam e<strong>in</strong>zubeziehen ist. In der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung wird fÄr solche FÅlle<br />
lediglich im Rahmen der Festsetzungen bestimmt, dass e<strong>in</strong>e Inanspruchnahme der AusgleichsrÄcklage voraussichtlich<br />
erforderlich wird (vgl. É 78 Abs. 2 Nr. 2 GO <strong>NRW</strong>). Erst im Rahmen des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses<br />
(vgl. ÉÉ 95 und 96 GO <strong>NRW</strong>) ist dann festzustellen, ob der <strong>in</strong> der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresfehlbetrag<br />
mit der bilanzierten AusgleichsrÄcklage verrechnet werden kann, so dass der fiktive Ausgleich als<br />
gegeben angesehen werden kann.<br />
GEMEINDEORDNUNG 226
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
Ä 75 GO <strong>NRW</strong><br />
Mit der gesetzlichen Fiktion des Haushaltsausgleichs soll verdeutlicht werden, dass e<strong>in</strong>erseits die materielle Ausgleichsregel<br />
une<strong>in</strong>geschrÅnkt Geltung beanspruchen soll, andererseits die Inanspruchnahme der AusgleichsrÄcklage<br />
mit e<strong>in</strong>er geordneten Haushaltswirtschaft noch <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang steht, auch wenn es bei ihrer Inanspruchnahme<br />
bereits zu e<strong>in</strong>er an sich regelwidrigen Verr<strong>in</strong>gerung des Eigenkapitals kommt. Dieses hat zur Folge, dass die<br />
Inanspruchnahme der AusgleichsrÄcklage durch die Geme<strong>in</strong>de nicht zu MaÖnahmen ihrer AufsichtsbehÇrde fÄhrt.<br />
Der Fiktion des Haushaltsausgleichs liegt auch die Erkenntnis zu Grunde, dass nicht aus jeder Verr<strong>in</strong>gerung des<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Eigenkapitals gefolgert werden kann, die Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de sei dadurch dauerhaft<br />
gefÅhrdet. Ihre Inanspruchnahme zeigt vielmehr, dass die voraussichtlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr<br />
regelwidrig nicht durch ErtrÅge „gedeckt“ werden kÇnnen.<br />
3. Zu Absatz 3 (Gestaltung der AusgleichsrÑcklage):<br />
3.1 Zu Satz 1 (Bilanzierung der AusgleichsrÑcklage):<br />
3.1.1 Ansatz der AusgleichsrÑcklage<br />
Die Vorschrift bestimmt die AusgleichsrÄcklage nÅher und regelt deren Bemessung. Die AusgleichsrÄcklage ist<br />
Teil des Eigenkapitals der Geme<strong>in</strong>de, jedoch e<strong>in</strong>e RÄcklage eigener Art. Sie ist deshalb nicht Teil der allgeme<strong>in</strong>en<br />
RÄcklage, die auf der Passivseite der Bilanz gesondert als „Restposten“ im Bilanzbereich „Eigenkapital“ anzusetzen<br />
ist. Die AusgleichsrÄcklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder e<strong>in</strong>en Fehlbetrag<br />
<strong>in</strong> der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich (fiktiver Haushaltsausgleich)<br />
zu erreichen. Dies bedarf e<strong>in</strong>er entsprechenden Festsetzung <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung (vgl.<br />
É 78 Abs. 2 Nr. 2 GO <strong>NRW</strong>).<br />
Die AusgleichsrÄcklage ist zw<strong>in</strong>gend als gesonderter Posten auf der Passivseite der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz anzusetzen<br />
(vgl. É 41 Abs. 4 Nr. 1.3 GemHVO <strong>NRW</strong>). Sie muss daher m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>en Wertansatz <strong>in</strong> HÇhe von<br />
e<strong>in</strong>em Euro ausweisen und darf hÇchstens den nach den SÅtzen 2 und 3 dieses Absatzes zu ermittelnden Wertansatz<br />
aufweisen. Die Geme<strong>in</strong>de hat dazu e<strong>in</strong>e entsprechende Anhangsangabe zu machen. Wird <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
ErÇffnungsbilanz die AusgleichsrÄcklage unterhalb der zulÅssigen HÇchstgrenze ausgewiesen, hat<br />
die Geme<strong>in</strong>de zur erforderlichen Nachvollziehbarkeit dazu im Anhang den zulÅssigen Wertansatz der AusgleichsrÄcklage<br />
anzugeben und nÅher zu erlÅutern.<br />
3.1.2 Zwecke der AusgleichsrÑcklage<br />
Die AusgleichsrÄcklage soll den Geme<strong>in</strong>den den erforderlichen Spielraum gewÅhren, eigenverantwortlich den<br />
gesetzlich bestimmten Haushaltsausgleich zu erreichen. Dieses erfordert, sie so zu bemessen, dass die Geme<strong>in</strong>de<br />
auch nach ihrer vollstÅndigen Inanspruchnahme noch die stetige AufgabenerfÄllung gewÅhrleisten kann und<br />
dies ohne nÅhere PrÄfung der AufsichtsbehÇrde erkennbar ist. Das Eigenkapital der Geme<strong>in</strong>de kann dabei wichtige<br />
und e<strong>in</strong>deutige H<strong>in</strong>weise auf die StabilitÅt der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft liefern. Auch ist zu berÄcksichtigen,<br />
dass e<strong>in</strong>e dauernde Verr<strong>in</strong>gerung des <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen ErÇffnungsbilanz erstmalig ausgewiesenen<br />
Eigenkapitals letztlich zur àberschuldung der Geme<strong>in</strong>de fÄhrt.<br />
ZusÅtzlich zur Steuerung und Begrenzung des Eigenkapitalabbaus dient die AusgleichsrÄcklage auch dazu, die<br />
im Zuge der Umstellung auf das NKF erstmalig aufgedeckten Belastungen aus Abschreibungen und RÄckstellungen<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em àbergangszeitraum abzufedern. Mittel- oder langfristig gesehen dÄrfte der Haushaltsausgleich im<br />
NKF nicht „schwerer“ erreichbar se<strong>in</strong> als <strong>in</strong> der bisherigen Kameralistik. Gleichwohl kÇnnte er im Rahmen der<br />
Umstellung auf das NKF <strong>in</strong>sbesondere dann schwerer werden, wenn die Geme<strong>in</strong>de Lasten <strong>in</strong> die Zukunft verschoben<br />
hat, die im Zuge der Anwendung des NKF aufgedeckt werden. Die AusgleichsrÄcklage soll den Ge-<br />
GEMEINDEORDNUNG 227
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
Ä 75 GO <strong>NRW</strong><br />
me<strong>in</strong>den deshalb e<strong>in</strong>e Zeit der Anpassung ermÇglichen, ohne dass die AufsichtsbehÇrde den damit verbundenen<br />
Eigenkapitalverzehr genehmigen muss.<br />
Die geme<strong>in</strong>dliche AusgleichsrÄcklage soll auÖerdem e<strong>in</strong>e ÄberjÅhrige Pufferfunktion, vergleichbar mit dem Ergebnisvortrag<br />
bei Eigenbetrieben nach der EigVO, wahrnehmen. Sie soll dadurch die ÄberjÅhrigen Verschiebungen<br />
auffangen, die sich aus den Schwankungen der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft ergeben. Die AusgleichsrÄcklage<br />
ist deshalb auch so bemessen worden, dass FehlbetrÅge <strong>in</strong> der Ergebnisrechnung, die <strong>in</strong> ihrer HÇhe die<br />
stetige AufgabenerfÄllung der Geme<strong>in</strong>de noch nicht nachhaltig gefÅhrden, mit ihr verrechnet werden kÇnnen. Der<br />
Verzicht auf die Genehmigungspflicht der Verr<strong>in</strong>gerung des geme<strong>in</strong>dlichen Eigenkapitals bis zur AusschÇpfung<br />
der AusgleichsrÄcklage macht dabei deutlich, dass die Verantwortung fÄr die BewÅltigung von Haushaltskrisen<br />
bei der Geme<strong>in</strong>de im Rahmen ihrer gesetzlichen Eigenverantwortung und Selbstverwaltung liegt. Die Genehmigungspflicht<br />
nach dem AusschÇpfen der AusgleichsrÄcklage, also bei e<strong>in</strong>er Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage<br />
nach É 75 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong>, br<strong>in</strong>gt e<strong>in</strong> E<strong>in</strong>schreiten der AufsichtsbehÇrde mit sich. In solchen FÅllen kann die<br />
Geme<strong>in</strong>de ihre haushaltswirtschaftliche Krise oftmals nicht mehr zÄgig bewÅltigen.<br />
3.2 Zu den Satz 2 (Bemessung der AusgleichsrÑcklage):<br />
3.2.1 Bemessung nach dem geme<strong>in</strong>dlichen Eigenkapital<br />
Das Ziel der Begrenzung des Eigenkapitalabbaus ist die Verh<strong>in</strong>derung von nicht mehr beherrschbaren haushaltswirtschaftlichen<br />
Defiziten, die zum Eigenkapitalabbau bzw. dem vollstÅndigen Verzehr des Eigenkapitals<br />
fÄhren. Das Abrutschen e<strong>in</strong>er Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> e<strong>in</strong> negatives Eigenkapital ist dann unmittelbar zu befÄrchten, wenn<br />
der jÅhrliche Fehlbetrag <strong>in</strong> der Ergebnisrechnung im Umfang von mehr als e<strong>in</strong>em Drittel des am Beg<strong>in</strong>n des<br />
Haushaltsjahres vorhandenen Eigenkapitals als Fehlbetrag ausgewiesen wird. In e<strong>in</strong>em solchen Fall wÅre es bei<br />
e<strong>in</strong>em unterstellten gleichbleibenden Fehlbetrag zu befÄrchten, dass das geme<strong>in</strong>dliche Eigenkapital <strong>in</strong>nerhalb von<br />
drei Jahren aufgezehrt wird. Diesen Zeitraum muss die Geme<strong>in</strong>de deshalb umgehend nutzen, die notwendigen<br />
MaÖnahmen zu ergreifen, um den Verzehr ihres Eigenkapitals nachhaltig zu stoppen.<br />
Mit dem gesetzlich festgelegten Wert von maximal e<strong>in</strong>em Drittel des bei der ErÇffnungsbilanz festgestellten Eigenkapitals<br />
soll sichergestellt werden, dass die haushaltswirtschaftlichen Defizite - anders als bei e<strong>in</strong>em unbegrenzten<br />
Verlustvortrag - der HÇhe nach begrenzt werden, damit die Geme<strong>in</strong>den noch ausreichend Zeit zur VerfÄgung<br />
haben, e<strong>in</strong>e drohende àberschuldung zu verh<strong>in</strong>dern. Als BezugsgrÇÖe dafÄr ist <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Bilanz nur die allgeme<strong>in</strong>e RÄcklage als frei verwendbares Eigenkapital heranzuziehen, nicht zweckgebundene<br />
oder <strong>in</strong> anderer Weise gebundene Kapitalien, z.B. <strong>in</strong> SonderrÄcklagen <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz angesetzt.<br />
Diese Anwendung entspricht auch der Ermittlung der Feststellung, ob e<strong>in</strong>e àberschuldung der Geme<strong>in</strong>de vorliegt,<br />
denn <strong>in</strong> solchen FÅllen darf fÄr die Ermittlung der EigenkapitalgrÇÖe nur e<strong>in</strong>e Summe aus den Eigenkapitalbestandteilen<br />
„Allgeme<strong>in</strong>e RÄcklage“, „AusgleichsrÄcklage“ und „JahresÄberschuss/-Jahresfehlbetrag“ gebildet<br />
werden. Die NichtberÄcksichtigung von SonderrÄcklagen ist wegen des <strong>in</strong> É 75 GO <strong>NRW</strong> bestimmten Haushaltsausgleichssystems<br />
geboten. Daran schlieÖt sich auch das Verbot <strong>in</strong> É 43 Abs. 4 S. 4 GemHVO <strong>NRW</strong> an, nach<br />
dem die Bildung von SonderrÄcklagen fÄr selbst gewÅhlte Zwecke durch die Geme<strong>in</strong>de unzulÅssig ist. Der Teil<br />
des Eigenkapitals, der als AusgleichsrÄcklage e<strong>in</strong>gesetzt werden kann, bestimmt sich nach dem bei der ErÇffnungsbilanzierung<br />
vorhandenen Eigenkapital. Die Festlegung des e<strong>in</strong>heitlichen Anteils fÄhrt dazu, dass die Geme<strong>in</strong>den<br />
mit hohem Eigenkapital <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em grÇÖeren Umfang entstandene FehlbetrÅge durch die AusgleichsrÄcklage<br />
abdecken kÇnnen. Die Geme<strong>in</strong>den mit weniger Eigenkapital verfÄgen umgekehrt Äber e<strong>in</strong>en ger<strong>in</strong>geren<br />
Puffer. Dieser Wirkungszusammenhang soll die Geme<strong>in</strong>den mit e<strong>in</strong>em ger<strong>in</strong>geren Eigenkapital rechtzeitig vor der<br />
àberschuldung bewahren.<br />
Durch die AusgleichsrÄcklage, die als Bilanzposten <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen ErÇffnungsbilanz anzusetzen ist, werden<br />
die Geme<strong>in</strong>den nicht verpflichtet, dieses zum gesetzlich erlaubten (zulÅssigen) HÇchstbetrag anzusetzen. Viel-<br />
GEMEINDEORDNUNG 228
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
Ä 75 GO <strong>NRW</strong><br />
mehr s<strong>in</strong>d die Geme<strong>in</strong>den frei, die AusgleichrÄcklage auch mit e<strong>in</strong>em ger<strong>in</strong>geren oder gar e<strong>in</strong>em symbolischen<br />
Betrag von m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>en Euro anzusetzen. Dies allerd<strong>in</strong>gs mit der Folge, sich selbst der MÇglichkeit zu berauben,<br />
ihr Eigenkapital <strong>in</strong> der gesetzlich erlaubten HÇhe genehmigungsfrei abbauen zu dÄrfen. Des Weiteren<br />
wird durch die haushaltsrechtlichen Vorschriften ke<strong>in</strong>e Geme<strong>in</strong>de gezwungen, bei àberschÄssen <strong>in</strong> der Ergebnisrechnung<br />
die AusgleichsrÄcklage bis zum zulÅssigen Wertansatz aufzufÄllen. Um zu gewÅhrleisten, dass das<br />
geme<strong>in</strong>dliche Eigenkapital nicht aufgezehrt wird, enthÅlt die Vorschrift e<strong>in</strong>e weitere Sicherung. Da die Ertragskraft<br />
der Geme<strong>in</strong>de die wesentliche GrÇÖe zur Bestimmung ihrer LeistungsfÅhigkeit darstellt, ist die Bemessung der<br />
AusgleichrÄcklage durch e<strong>in</strong>e zweite ertragskraftbezogene Komponente begrenzt worden, die den Eigenkapitalverzehr<br />
unmittelbar bee<strong>in</strong>flusst. Dadurch soll verh<strong>in</strong>dert werden, dass trotz erheblicher GefÅhrdung der LeistungsfÅhigkeit<br />
e<strong>in</strong>er Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong> Eigenkapitalverzehr ohne E<strong>in</strong>flussmÇglichkeiten der AufsichtsbehÇrde h<strong>in</strong>genommen<br />
wird.<br />
3.2.2 Bemessung nach der geme<strong>in</strong>dlichen Ertragskraft<br />
3.2.2.1 Steuern und Zuweisungen als E<strong>in</strong>nahmen<br />
Das Ziel der Begrenzung des Eigenkapitalabbaus ist die Verh<strong>in</strong>derung von nicht mehr beherrschbaren Defiziten,<br />
so dass die HÇhe des Eigenkapitalabbaus auch von der LeistungsfÅhigkeit der Geme<strong>in</strong>de, die sich auch. durch<br />
das Jahresergebnis <strong>in</strong> der Ergebnisrechnung zeigt, abhÅngig gemacht wurde. Weil sich die LeistungsfÅhigkeit der<br />
Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> ihrer Ertragskraft ausdrÄckt und die Steuern und allgeme<strong>in</strong>en Zuwendungen als wesentliche E<strong>in</strong>nahmequellen<br />
der Geme<strong>in</strong>de deren Ertragskraft maÖgeblich bestimmen, darf die HÇhe der AusgleichsrÄcklage<br />
hÇchstens e<strong>in</strong> Drittel der durchschnittlichen (Netto-) Steuere<strong>in</strong>nahmen und allgeme<strong>in</strong>en Zuweisungen <strong>in</strong> den drei<br />
Jahren vor dem ErÇffnungsbilanzstichtag betragen.<br />
FÄr die Ermittlung dieser HÇhe der AusgleichsrÄcklage s<strong>in</strong>d unter den Begriffen „Steuere<strong>in</strong>nahmen“ und „Allgeme<strong>in</strong>e<br />
Zuweisungen“ die E<strong>in</strong>nahmen zu erfassen, die im kameralen Rechnungswesen nach der kommunalen<br />
Haushaltssystematik als Zahlungsarten dem Abschnitt 90 sowohl im Verwaltungshaushalt als auch im VermÇgenshaushalt<br />
zuzuordnen waren (vgl. VV Gliederung und Gruppierung vom 27.11.1995, SMBl. <strong>NRW</strong>. 6300). Zu<br />
solchen E<strong>in</strong>nahmen zÅhlen<br />
- Grundsteuer A und B,<br />
- Gewerbesteuer,<br />
- VergnÄgungssteuer,<br />
- Hundesteuer,<br />
- sonstige Steuere<strong>in</strong>nahmen,<br />
- E<strong>in</strong>kommensteuerbeteiligung der Geme<strong>in</strong>den,<br />
- Umsatzsteuerbeteiligung der Geme<strong>in</strong>den,<br />
- SchlÄsselzuweisungen an die Geme<strong>in</strong>den,<br />
- Ausgleichszahlungen Familienleistungsausgleich,<br />
- Schulpauschale/Bildungspauschale,<br />
- Sportpauschale,<br />
- Allgeme<strong>in</strong>e Investitionspauschale<br />
sowie andere allgeme<strong>in</strong>e Zuweisungen, die nicht e<strong>in</strong>zelnen Aufgaben, sondern dem geme<strong>in</strong>dlichen Haushalt<br />
<strong>in</strong>sgesamt zu flieÖen, z.B. die Kurortehilfe des Landes.<br />
In die o.a. Zuordnung fÅllt wegen ihres Wesens und der Herkunft der Mittel nicht die vom Land gewÅhrte Feuerschutzpauschale.<br />
Auch dÄrfen gezahlte Z<strong>in</strong>sen. z.B. Verzugs- oder Stundungsz<strong>in</strong>sen, die wegen verspÅteter<br />
ErfÄllung der Zahlungsverpflichtung von Dritten festgesetzt wurden, nicht <strong>in</strong> die Bemessung der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Ertragskraft e<strong>in</strong>flieÖen. Im E<strong>in</strong>zelfall kann ggf. h<strong>in</strong>genommen werden, dass noch wesentliche E<strong>in</strong>nahmen aus der<br />
Abrechnung von Solidarbeitragsleistungen, die ab dem Jahre 2006 nicht mehr erhoben werden, noch <strong>in</strong> die Ermittlung<br />
der E<strong>in</strong>nahmen fÄr die Jahre 2006 und 2007 e<strong>in</strong>gezogen werden.<br />
GEMEINDEORDNUNG 229
3.2.2.2 Die Auslegung des Begriffs „Netto“<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
Ä 75 GO <strong>NRW</strong><br />
Die das bisherige kamerale Rechnungswesen prÅgende ausschlieÖliche Geldverbrauchsbetrachtung (Zahlungspolitik)<br />
gebietet es, den Begriff „Netto“ unter Beachtung des Kassenwirksamkeitspr<strong>in</strong>zips anzuwenden. In die<br />
Ertragskraftermittlung dÄrfen daher nur die jahresbezogenen tatsÅchlich kassenwirksam gewordenen E<strong>in</strong>nahmen<br />
der Geme<strong>in</strong>de aus den zulÅssigen Zahlungsarten und nicht die im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan veranschlagten<br />
E<strong>in</strong>nahmen e<strong>in</strong>bezogen werden. Nur die realen Zahlungsdaten der Geme<strong>in</strong>de sichern die erforderliche ObjektivitÅt<br />
und NachprÄfbarkeit der Berechnung bzw. Ermittlung der AusgleichsrÄcklage.<br />
3.2.2.3 Ke<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>beziehung von Ausgaben<br />
Nach der gesetzlichen Vorschrift s<strong>in</strong>d der Berechnung der AusgleichsrÄcklage zudem nur bestimmte E<strong>in</strong>nahmearten<br />
und ke<strong>in</strong>e Ausgabearten zu Grunde zu legen. In die Ermittlung der HÇhe der AusgleichsrÄcklage ist daher<br />
nicht die Gewerbesteuerumlage e<strong>in</strong>zubeziehen. Sie stellt im geme<strong>in</strong>dlichen Haushalt e<strong>in</strong>e Ausgabe dar und ist<br />
auch nicht zu den E<strong>in</strong>nahmen im o.a. S<strong>in</strong>ne <strong>in</strong> Abzug zu br<strong>in</strong>gen. Auch die Gewerbesteuererstattungen der Geme<strong>in</strong>de,<br />
die nach É 14 Abs. 2 GemHVO -a.F.- von den E<strong>in</strong>nahmen abzusetzen s<strong>in</strong>d, berÄhren nicht die Ermittlung<br />
der AusgleichsrÄcklage. Auch wenn diese Erstattungen unter den E<strong>in</strong>nahmen zu erfassen s<strong>in</strong>d, bleiben sie<br />
gleichwohl Ausgaben der Geme<strong>in</strong>de.<br />
3.2.3 Bemessung bei der Aufstellung der ErÖffnungsbilanz<br />
Die Bemessung der AusgleichsrÄcklage darf von der Geme<strong>in</strong>de zudem nur e<strong>in</strong>mal bei der Aufstellung ihrer ErÇffnungsbilanz<br />
vorgenommen werden. Bei dieser Festlegung ist davon ausgegangen worden, dass Verwerfungen,<br />
die durch atypische Ertragssituationen entstehen kÇnnten, durch e<strong>in</strong>e Berechnungsgrundlage auf der Basis e<strong>in</strong>es<br />
dreijÅhrigen Zeitraumes vermieden werden. Ob die Grundlagen, die zur Gestaltung und Inanspruchnahme der<br />
AusgleichsrÄcklage durch die Geme<strong>in</strong>den gefÄhrt haben, richtig e<strong>in</strong>geschÅtzt worden s<strong>in</strong>d, wird sich bei der gesetzlichen<br />
vorgesehenen àberprÄfung der Auswirkungen der Reform des Haushaltsrechts <strong>in</strong> den Geme<strong>in</strong>den des<br />
Landes herausstellen. Gerade diese Regelung erfordert es, nach e<strong>in</strong>em angemessenen Erfahrungszeitraum e<strong>in</strong>e<br />
Beurteilung darÄber vorzunehmen. Nur die realen Daten der Geme<strong>in</strong>den verhelfen zu e<strong>in</strong>er breiten Erkenntnisgrundlage,<br />
auf der dann die zukÄnftige Gestaltung der AusgleichrÄcklage aufgebaut werden kann.<br />
3.3 Zu Satz 3 (Wertansatz der AusgleichsrÑcklage):<br />
Die Geme<strong>in</strong>de ist verpflichtet, <strong>in</strong> ihrer ErÇffnungsbilanz e<strong>in</strong>e AusgleichsrÄcklage als gesonderten Posten des<br />
Eigenkapitals anzusetzen. Sie hat dabei e<strong>in</strong>erseits zu beachten, dass diese zwar bis zur HÇhe e<strong>in</strong>es Drittels des<br />
Eigenkapitals gebildet werden darf, hÇchstens jedoch bis zur HÇhe e<strong>in</strong>es Drittels der jÅhrlichen Steuere<strong>in</strong>nahmen<br />
und allgeme<strong>in</strong>en Zuweisungen. Andererseits muss sie zur Ermittlung der HÇhe des Wertansatzes den Durchschnitt<br />
der E<strong>in</strong>nahmen nach Satz 2 dieser Vorschrift aus den drei Haushaltsjahren bilden, die dem ErÇffnungsbilanzstichtag<br />
vorangehen.<br />
3.4 Zu Satz 4 (AuffÑllung der AusgleichsrÑcklage):<br />
3.4.1 E<strong>in</strong>haltung des zulÅssigen HÖchstbetrages<br />
Nach der gesetzlichen Bestimmung, dass der AusgleichsrÄcklage auch JahresÄberschÄsse zugefÄhrt werden<br />
kÇnnen, soweit ihr Bestand nicht den <strong>in</strong> der ErÇffnungsbilanz zulÅssigen Betrag erreicht hat, besteht auch die<br />
MÇglichkeit fÄr die Geme<strong>in</strong>den, <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em spÅteren Jahresabschluss erstmals tatsÅchlich den gesetzlich zulÅssi-<br />
GEMEINDEORDNUNG 230
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
Ä 75 GO <strong>NRW</strong><br />
gen HÇchstbetrag zu bilanzieren. Hat die Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> ihrer ErÇffnungsbilanz e<strong>in</strong>en bestimmten Betrag unterhalb<br />
des zulÅssigen Wertansatzes der AusgleichsrÄcklage ausgewiesen oder <strong>in</strong> spÅteren Haushaltsjahren die AusgleichrÄcklage<br />
(teilweise) verbraucht, so ist sie befugt, die AusgleichsrÄcklage wieder bis zum gesetzlich zulÅssigen<br />
HÇchstbetrag wieder aufzufÄllen. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass zu diesen Zeitpunkten die<br />
AusgleichsrÄcklage nicht wieder wie zum Zeitpunkt der ErÇffnungsbilanz <strong>in</strong> AbhÅngigkeit von der Ertragskraft<br />
oder dem Volumen des Eigenkapitals unter Beachtung des gesetzlichen Rahmens gebildet werden darf (Berechnung<br />
<strong>in</strong> Bezug auf e<strong>in</strong>en feststehenden, unverÅnderbaren Stichtag). Die VerstÅrkung der AusgleichsrÄcklage <strong>in</strong><br />
spÅteren Haushaltsjahren darf nur durch JahresÄberschÄsse aus den jeweiligen Haushaltsjahren vorgenommen<br />
werden.<br />
3.4.2 Der Verweis auf Ä 96 Abs. 1 S. 2 GO <strong>NRW</strong><br />
Mit dem Verweis auf É 96 Abs. 1 S. 2 GO <strong>NRW</strong> soll sichergestellt werden, dass der Rat der Geme<strong>in</strong>de im Rahmen<br />
der ihm obliegenden Feststellung des Jahresabschlusses (vgl. É 96 Abs. 1 S. 1 GO <strong>NRW</strong>) die Entscheidung<br />
trifft, ob e<strong>in</strong> im Haushaltsjahr erwirtschafteter und <strong>in</strong> der Ergebnisrechnung ausgewiesener àberschuss der AusgleichsrÄcklage<br />
zugefÄhrt wird. Der Rat hat im Rahmen se<strong>in</strong>es Budgetrechts und se<strong>in</strong>er ZustÅndigkeiten (vgl. É<br />
41 GO <strong>NRW</strong>) neben der Feststellung des Jahresabschlusses zugleich auch Äber die Verwendung des Jahres-<br />
Äberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages zu beschlieÖen. Es bleibt der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung<br />
jedoch unbenommen, im Rahmen der Zuleitung des Entwurfs des Jahresabschlusses nach É 95 Abs. 3 S. 2<br />
GO <strong>NRW</strong> dem Rat der Geme<strong>in</strong>de dazu e<strong>in</strong>en Vorschlag zu unterbreiten. Der Rat kann beschlieÖen, den Jahres-<br />
Äberschuss der AusgleichsrÄcklage und/oder der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage zuzufÄhren. Auch e<strong>in</strong>e Aufteilung der<br />
ZufÄhrung des JahresÄberschusses auf die AusgleichsrÄcklage und die allgeme<strong>in</strong>e RÄcklage ist mÇglich. Ebenso<br />
kann der JahresÄberschuss aber auch <strong>in</strong> voller HÇhe der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage zugefÄhrt werden.<br />
4. Zu Absatz 4 (Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en RÑcklage):<br />
4.0.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Der Eigenkapitalausstattung der Geme<strong>in</strong>den kommt im NKF e<strong>in</strong>e besondere Bedeutung zu. Da sich der Saldo der<br />
Ergebnisrechnung (JahresÄberschuss/Jahresfehlbetrag) immer auf das Eigenkapital auswirkt, und die Entwicklung<br />
des Eigenkapitals wichtige und e<strong>in</strong>deutige H<strong>in</strong>weise auf die StabilitÅt der Haushaltswirtschaft liefern kann,<br />
wurde es als zweites Kriterium fÄr den Haushaltsausgleich bestimmt. Dem Eigenkapital der Geme<strong>in</strong>de ist auf der<br />
Passivseite der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz e<strong>in</strong> gesonderter Bereich zugewiesen. Es wird aus der Differenz zwischen<br />
VermÇgen (Aktivseite) und den Schulden (Verb<strong>in</strong>dlichkeiten und RÄckstellungen) unter E<strong>in</strong>beziehung der Sonderposten<br />
gebildet. Solange die positiven Bestandteile jedoch Äberwiegen, steht der Geme<strong>in</strong>de noch Eigenkapital<br />
zur VerfÄgung. In diesem Zusammenhang wird nach den Gliederungsvorschriften fÄr die geme<strong>in</strong>dliche Bilanz das<br />
Eigenkapital der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> die Bilanzposten „Allgeme<strong>in</strong>e RÄcklage“, „SonderrÄcklagen“, „AusgleichsrÄcklage“<br />
und „JahresÄberschuss/Jahresfehlbetrag“ aufgeteilt und gleichzeitig auf diese Posten beschrÅnkt (vgl. É 41 Abs. 4<br />
GemHVO <strong>NRW</strong>). Dabei ist e<strong>in</strong>e Erweiterung dieser Bilanzposten durch die Geme<strong>in</strong>de nicht zulÅssig.<br />
4.0.2 Haushaltsausgleich nicht bei Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en RÑcklage<br />
Die Vorschrift regelt die Voraussetzungen des aufsichtbehÇrdlichen Handelns bei e<strong>in</strong>em nicht erreichten Haushaltsausgleich<br />
gegenÄber der Geme<strong>in</strong>de, wenn zur Deckung des Fehlbedarfs e<strong>in</strong>e Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en<br />
RÄcklage vorgesehen wird. WÅhrend bei e<strong>in</strong>er Inanspruchnahme der AusgleichsrÄcklage der geme<strong>in</strong>dliche<br />
Haushalt noch als ausgeglichen gilt, trifft dies bei e<strong>in</strong>er Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage nicht mehr zu,<br />
auch wenn <strong>in</strong> beiden FÅllen die jahresbezogenen Aufwendungen im Ergebnisplan bzw. der Ergebnisrechnung<br />
durch die Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage „gedeckt“ werden kÇnnen (vgl. É 75 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>). Verr<strong>in</strong>-<br />
GEMEINDEORDNUNG 231
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
Ä 75 GO <strong>NRW</strong><br />
gert sich das Eigenkapital der Geme<strong>in</strong>de nach dem vollstÅndigen Verzehr der AusgleichsrÄcklage weiter, kann<br />
ohne e<strong>in</strong>e vorherige aufsichtsrechtliche PrÄfung und Genehmigung die GefÅhrdung e<strong>in</strong>er geordneten Haushaltswirtschaft<br />
dieser Geme<strong>in</strong>de nicht mehr ausgeschlossen werden.<br />
In diesem Zusammenhang ist noch zu beachten, dass das Eigenkapital e<strong>in</strong>er Geme<strong>in</strong>de se<strong>in</strong>e Funktion nur erfÄllen<br />
kann, solange es nicht durch Verluste vollstÅndig aufgezehrt worden ist. Aus diesem Grunde bedarf bei Geme<strong>in</strong>den,<br />
deren weitere Entwicklung mit erheblichen Risiken behaftet ist, der Bestand an Eigenkapital e<strong>in</strong>er besonderen<br />
Betrachtung. Da die stetige AufgabenerfÄllung der Geme<strong>in</strong>de bei e<strong>in</strong>er àberschuldung nicht mehr gewÅhrleistet<br />
ist, bedarf es des Verbotes e<strong>in</strong>er àberschuldung der Geme<strong>in</strong>de (vgl. É 75 Abs. 7 GO <strong>NRW</strong>). Diese<br />
Vorschrift enthÅlt e<strong>in</strong>e Begriffsbestimmung der àberschuldung, die aus dem kaufmÅnnischen Recht abgeleitet ist<br />
(bilanzielle àberschuldung). Ob e<strong>in</strong>e àberschuldung vorliegt, ist aus der Bilanz der Geme<strong>in</strong>de ablesbar.<br />
4.1 Zu Satz 1 (Genehmigung der Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en RÑcklage)<br />
4.1.1 Genehmigungserfordernisse<br />
Nach der Vorschrift bedarf e<strong>in</strong>e Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage der Genehmigung der AufsichtsbehÇrde,<br />
wenn diese Inanspruchnahme bei der Aufstellung der Haushaltssatzung vorgesehen wird. Kann aber e<strong>in</strong> Fehlbedarf<br />
im Ergebnisplan ganz oder teilweise nicht durch e<strong>in</strong>e Inanspruchnahme der AusgleichsrÄcklage gedeckt<br />
werden, kommt es zu e<strong>in</strong>em weiteren Abbau des Eigenkapitals durch e<strong>in</strong>e Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage.<br />
Diese Verr<strong>in</strong>gerung ist genehmigungspflichtig (vgl. É 75 Abs. 4 S. 1 GO <strong>NRW</strong>) und bedarf e<strong>in</strong>er Festsetzung<br />
<strong>in</strong> der Haushaltssatzung (vgl. É 78 Abs. 2 Nr. 2 GO <strong>NRW</strong>). DafÄr ist zu prÄfen, ob fÄr die geplante Verr<strong>in</strong>gerung<br />
der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage (Eigenkapitalverzehr) e<strong>in</strong>e Genehmigung nach dieser Vorschrift oder im Rahmen des É<br />
76 GO <strong>NRW</strong>, wenn die dort genannten Schwellenwerte Äberschritten s<strong>in</strong>d, zu erteilen ist.<br />
Die AufsichtsbehÇrde der Geme<strong>in</strong>de hat daher auch bei e<strong>in</strong>er vorgesehenen Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage<br />
unterhalb der Schwellenwerte des É 78 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> immer zu prÄfen, ob die GewÅhrleistung der stetigen<br />
AufgabenerfÄllung durch diese Verr<strong>in</strong>gerung nicht gefÅhrdet wird. Sie muss auÖerdem bei der Erteilung der<br />
Genehmigung nach dieser Vorschrift den ihr zustehenden Ermessensspielraum nach den haushaltsrechtlichen<br />
Zielbestimmungen ausgestalten. Bei dieser Beurteilung kommt dem Ziel, wieder e<strong>in</strong>en ausgeglichenen Haushalt<br />
nach É 75 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> zu erreichen, die zentrale Bedeutung zu. Dies gilt auch dann, wenn die vorgesehene<br />
Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage der Geme<strong>in</strong>de im Haushaltsjahr noch als haushaltsvertrÅglich betrachtet<br />
werden kann, aber <strong>in</strong>sbesondere nach der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung e<strong>in</strong>e GefÅhrdung der<br />
Haushaltswirtschaft zu befÄrchten ist.<br />
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass e<strong>in</strong>e àberschreitung der Schwellenwerte nach É 76 GO <strong>NRW</strong><br />
nicht nur bei e<strong>in</strong>em Auftreten im Haushaltsjahr genehmigungspflichtig ist, sondern auch bei e<strong>in</strong>em Auftreten <strong>in</strong><br />
den drei dem Haushaltsjahr folgenden Planungsjahre der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung. E<strong>in</strong>e gewollte<br />
stÅrkere Verflechtung zwischen der mittelfristigen haushaltswirtschaftlichen Planung und der Sicherung der<br />
stetigen AufgabenerfÄllung sowie den aufsichtsrechtlich gestuften MaÖnahmen wird dadurch hergestellt.<br />
4.1.2 Genehmigungsbesonderheiten<br />
E<strong>in</strong>e Haushaltssatzung, die von der Geme<strong>in</strong>de fÄr zwei Haushaltsjahre erlassen worden ist, muss Festsetzungen<br />
getrennt fÄr jedes Haushaltsjahr enthalten (vgl. É 78 Abs. 3 S. 2 GO <strong>NRW</strong>). E<strong>in</strong> Genehmigungserfordernis zur<br />
Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage bezieht sich <strong>in</strong> diesem Fall jeweils auf das Haushaltsjahr, <strong>in</strong> dem e<strong>in</strong>e<br />
solche Verr<strong>in</strong>gerung vorgesehen ist. E<strong>in</strong> gesondertes Genehmigungserfordernis kann sich dann ergeben, wenn<br />
e<strong>in</strong>e Nachtragssatzung nach É 81 GO erlassen wird. Sieht diese erstmals e<strong>in</strong>e Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en<br />
RÄcklage fÄr das Haushaltsjahr vor oder erhÇht sich die <strong>in</strong> der Haushaltssatzung festgesetzte vorgesehene Ver-<br />
GEMEINDEORDNUNG 232
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
Ä 75 GO <strong>NRW</strong><br />
r<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage entsteht e<strong>in</strong> neues Genehmigungserfordernis, denn fÄr die Nachtragssatzung<br />
gelten die Vorschriften fÄr die Haushaltssatzung entsprechend (vgl. É 81 Abs. 1 S. 2 GO <strong>NRW</strong>).<br />
4.2 Zu Satz 2 (Genehmigungsfiktion):<br />
4.2.1 Gebrauch der Genehmigungsfiktion<br />
Bei der AusÄbung der Genehmigung hat die AufsichtsbehÇrde nach den UmstÅnden des E<strong>in</strong>zelfalls zu entscheiden.<br />
Sie darf dabei die Genehmigungsfiktion <strong>in</strong> É 75 Abs. 4 Satz 2 GO <strong>NRW</strong> nicht auÖer acht lassen, nach der die<br />
Genehmigung zur Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage als erteilt gilt, wenn die AufsichtsbehÇrde nicht <strong>in</strong>nerhalb<br />
e<strong>in</strong>es Monats nach E<strong>in</strong>gang des Antrages der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>e andere Entscheidung trifft. Diese ausdrÄckliche<br />
Regelung dient nur der Festlegung des Fristbeg<strong>in</strong>ns fÄr die Genehmigungsfiktion. Daraus folgt, dass die Frist<br />
fÄr die Genehmigungsfiktion mit E<strong>in</strong>gang der Anzeige der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen bei der AufsichtsbehÇrde<br />
zu laufen beg<strong>in</strong>nt (vgl. Nr. 4.3.2). FÄr die Fristberechnung der Genehmigungsfiktion gelten gemÅÖ É 31<br />
Abs. 1 VwVfG <strong>NRW</strong> die ÉÉ 187 bis 193 BGB entsprechend, soweit nicht durch É 31 Abs. 2 bis 5 VwVfG <strong>NRW</strong><br />
etwas anderes bestimmt ist.<br />
Von der Genehmigungsfiktion der Vorschrift kann jedenfalls dann Gebrauch gemacht werden, wenn ke<strong>in</strong>e durchgreifenden<br />
haushaltswirtschaftlichen GrÄnde gegen die vorgesehene Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage<br />
durch die Geme<strong>in</strong>de sprechen. Dies kÇnnte z.B. gegeben se<strong>in</strong>, wenn wegen der Errichtung e<strong>in</strong>er rechtlich selbststÅndigen<br />
kommunalen Stiftung <strong>in</strong> HÇhe des aktivierten Wertes e<strong>in</strong>e Umschichtung von der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e SonderrÄcklage erfolgen soll. E<strong>in</strong>e solche SonderrÄcklage muss als gesonderter Posten im Bilanzbereich<br />
„Eigenkapital“ vorhanden se<strong>in</strong>, weil aus S<strong>in</strong>n und Zweck des Stiftungsrechts nur abgeleitet werden kann,<br />
dass die Eigenkapitalmehrung der Geme<strong>in</strong>de aus e<strong>in</strong>em StiftungsgeschÅft haushaltsmÅÖig nicht frei verfÄgbar ist.<br />
Im Eigenkapital muss daher e<strong>in</strong>e VerwendungsbeschrÅnkung bestehen und durch den Ansatz e<strong>in</strong>er SonderrÄcklage<br />
als gesonderten Bilanzposten transparent gemacht werden. Diese Passierung neben dem Ansatz der rechtlich<br />
selbststÅndigen kommunalen Stiftungen auf der Aktivseite der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanzierung ist sachgerecht<br />
und vertretbar.<br />
In den FÅllen, <strong>in</strong> denen die Genehmigung zur Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage nach É 75 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong><br />
mit der nachfolgend aufgezeigten Verpflichtung zur Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes nach É 76<br />
GO <strong>NRW</strong> verbunden wird, kommt die Genehmigungsfiktion des É 75 Abs. 4 S. 2 GO <strong>NRW</strong> nicht zur Anwendung.<br />
Die Regelung ist darauf ausgerichtet, dass sie nur dann zur Anwendung kommt, wenn alle<strong>in</strong> e<strong>in</strong> Genehmigungserfordernis<br />
nach Satz 1 dieser Vorschrift besteht. E<strong>in</strong>e weitergehende Anwendung dieser Fiktion auch auf die<br />
nach É 76 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> vorgesehene Genehmigung fÄr e<strong>in</strong> Haushaltssicherungskonzept lÅsst sich aus der<br />
Vorschrift nicht ableiten.<br />
4.2.2 Ke<strong>in</strong> Antrag neben der Anzeige der Haushaltssatzung<br />
Die <strong>in</strong> der Vorschrift enthaltene ausdrÄckliche Festlegung, dass die Geme<strong>in</strong>de fÄr die Genehmigung der Verr<strong>in</strong>gerung<br />
der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage durch die AufsichtsbehÇrde e<strong>in</strong>es Antrages bedarf, ist i.V.m. den ÉÉ 78 und 80<br />
GO <strong>NRW</strong> redaktionell nicht zutreffend. Sie fÄhrt daher nicht zu e<strong>in</strong>em eigenstÅndigen Verwaltungsverfahren neben<br />
dem Anzeigeverfahren der Haushaltssatzung. Weil die Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage nach É 78<br />
Abs. 2 Nr. 2 GO <strong>NRW</strong> <strong>in</strong> der Haushaltssatzung der Geme<strong>in</strong>de festzusetzen ist, wird diese Festsetzung auch zum<br />
Gegenstand des Anzeigeverfahrens der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen. Dabei lÅsst sich e<strong>in</strong>e Trennung der<br />
Anzeige der Haushaltssatzung der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> e<strong>in</strong> Anzeige- und e<strong>in</strong> Genehmigungsverfahren nicht aus der<br />
Verb<strong>in</strong>dung dieser Vorschrift mit den ÉÉ 78 und 80 GO <strong>NRW</strong> herleiten. Die Entscheidung des Rates Äber die<br />
Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage im Rahmen se<strong>in</strong>es Beschlusses Äber die jÅhrliche Haushaltssatzung<br />
nach É 78 GO <strong>NRW</strong> belegt vielmehr, dass es nur e<strong>in</strong> Verfahren im Rahmen der Anzeige der Haushaltssatzung<br />
GEMEINDEORDNUNG 233
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
Ä 75 GO <strong>NRW</strong><br />
der Geme<strong>in</strong>de geben kann. WÅre dies nicht der Fall, mÄsste auch das Genehmigungserfordernis fÄr das Haushaltssicherungskonzept<br />
verwaltungsrechtlich e<strong>in</strong> eigenstÅndiges Verwaltungsverfahren auslÇsen. Es war im<br />
kommunalen Haushaltsrecht immer die Regel, dass die AufsichtsbehÇrde Äber haushaltsplanmÅÖige Genehmigungen<br />
im Rahmen des Anzeigeverfahrens der Haushaltssatzung der Geme<strong>in</strong>de zu entscheiden hatte.<br />
Die ausdrÄckliche Regelung <strong>in</strong> dieser Vorschrift dient daher sachlogisch nur der Festlegung des Fristbeg<strong>in</strong>ns fÄr<br />
die Genehmigungsfiktion im Rahmen der Anzeige der Haushaltssatzung der Geme<strong>in</strong>de gegenÄber der AufsichtsbehÇrde<br />
nach É 80 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong>. Es ist deshalb noch nicht zweifelsfrei geklÅrt, ob die Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> ihrer Anzeige<br />
der Haushaltssatzung die Genehmigung zur Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage ausdrÄcklich begehren<br />
muss. Wird <strong>in</strong> der Anzeige der Geme<strong>in</strong>de die Genehmigung nicht gesondert beantragt oder ist dies nicht auf<br />
andere Weise dar<strong>in</strong> ausgefÄhrt, ist die AufsichtsbehÇrde gehalten, die Anzeige der Haushaltssatzung der Geme<strong>in</strong>de<br />
auf genehmigungspflichtige Sachverhalte zu prÄfen. S<strong>in</strong>d diese gegeben, aber <strong>in</strong> der Anzeige nicht dargestellt,<br />
hat die AufsichtsbehÇrde e<strong>in</strong>e Auslegung der Anzeige nach <strong>in</strong> Verwaltungsverfahren Äblichen Regeln<br />
vorzunehmen. Mit der Vorschrift ist nicht beabsichtigt, neben dem Anzeigeverfahren der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung<br />
e<strong>in</strong> zweites Verwaltungsverfahren fÄr die Geme<strong>in</strong>de zu <strong>in</strong>stallieren.<br />
4.3 Zu Satz 3 (Nebenbestimmungen zur Genehmigung):<br />
4.3.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Im Rahmen der Anzeige der Haushaltssatzung hat die AufsichtsbehÇrde der Geme<strong>in</strong>de die vorgesehene Verr<strong>in</strong>gerung<br />
der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage zu genehmigen (vgl. Satz 1). Sie kann ihre Genehmigung mit Nebenbestimmungen<br />
versehen, die Bed<strong>in</strong>gungen und Auflagen enthalten kÇnnen. Dies vor allem vor dem H<strong>in</strong>tergrund, dass<br />
die im Haushaltsplan enthaltene und jÅhrlich gem. É 84 Satz 3 GO <strong>NRW</strong> auszugleichende mittelfristige Ergebnisund<br />
F<strong>in</strong>anzplanung e<strong>in</strong> Kriterium darstellt, das im Genehmigungsverfahren der Zulassung e<strong>in</strong>er Verr<strong>in</strong>gerung der<br />
allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage zu berÄcksichtigen ist. In den FÅllen, <strong>in</strong> denen sich aus den im Haushaltsplan der Geme<strong>in</strong>de<br />
enthaltenen Planungsdaten fÄr die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre ke<strong>in</strong>e ausreichenden VerÅnderungen<br />
zur Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs erkennen lassen, sollte die AufsichtsbehÇrde der Geme<strong>in</strong>de bei<br />
der Genehmigung der vorgesehenen Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage durch entsprechende Nebenbestimmungen<br />
<strong>in</strong> Form von Bed<strong>in</strong>gungen und Auflagen von der Geme<strong>in</strong>de wirksame KonsolidierungsmaÖnahmen<br />
verlangen.<br />
4.3.2 Formen der Nebenbestimmungen<br />
Die Erteilung der Genehmigung zur Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage durch die Geme<strong>in</strong>de stellt e<strong>in</strong>e Regelung<br />
dar, die dieser Vorschrift mit bestimmten zusÅtzlichen Bestimmungen (Nebenbestimmungen nach É 36 Abs.<br />
1 VwVfG) versehen werden darf. Solche Nebenbestimmungen haben den Zweck, mÇgliche rechtliche oder tatsÅchliche<br />
H<strong>in</strong>dernisse, die e<strong>in</strong>er une<strong>in</strong>geschrÅnkten Erteilung dieser Genehmigung entgegenstehen, zu beseitigen.<br />
Damit besteht fÄr die AufsichtsbehÇrde der Geme<strong>in</strong>de die MÇglichkeit, die Genehmigung fÄr die von der<br />
Geme<strong>in</strong>de vorgesehene Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage nicht abzulehnen, sondern bei mÇglichen Bedenken<br />
mit Vorbehalten zu arbeiten. Daran knÄpft die haushaltsrechtliche Vorschrift an, <strong>in</strong> dem sie ausdrÄcklich<br />
regelt, dass diese Genehmigung unter Bed<strong>in</strong>gungen und mit Auflagen erteilt werden kann.<br />
Als e<strong>in</strong>e mÇgliche Nebenbestimmung zur Genehmigung zur Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage ist nach der<br />
Vorschrift die Bed<strong>in</strong>gung zulÅssig. Durch e<strong>in</strong>e solche Nebenbestimmung wird e<strong>in</strong>e bestimmte Rechtsfolge von<br />
dem E<strong>in</strong>tritt e<strong>in</strong>es unsicheren zukÄnftigen Ereignisses bei der Geme<strong>in</strong>de abhÅngig gemacht (vgl. É 158 BGB). Sie<br />
f<strong>in</strong>det bei der Erteilung von Genehmigungen <strong>in</strong> Form der aufschiebenden sowie der auflÇsenden Bed<strong>in</strong>gung Anwendung,<br />
ohne jedoch zeitlich e<strong>in</strong>deutig festgelegt zu se<strong>in</strong> und e<strong>in</strong>en eigenen Regelungs<strong>in</strong>halt zu haben. Die<br />
Auflage stellt e<strong>in</strong>e weitere zulÅssige MÇglichkeit e<strong>in</strong>er Nebenbestimmung zur Genehmigung zur Verr<strong>in</strong>gerung der<br />
GEMEINDEORDNUNG 234
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
Ä 75 GO <strong>NRW</strong><br />
allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage durch die AufsichtsbehÇrde dar. Durch e<strong>in</strong>e solche Nebenbestimmung wird e<strong>in</strong>e zusÅtzliche<br />
Regelung zu e<strong>in</strong>em bestimmten Tun, Dulden oder Unterlassen durch die Geme<strong>in</strong>de getroffen. Diese Nebenbestimmung<br />
hÅngt <strong>in</strong> ihrem Bestand von der Wirksamkeit der aufsichtsbehÇrdlichen Genehmigung ab, auch wenn<br />
sie selbststÅndig anfechtbar ist.<br />
4.3.3 ErmessensausÑbung<br />
Die ErmessensausÄbung im Rahmen der vorgesehenen Genehmigung der Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage<br />
nach É 75 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong> wird durch die Regelungen des É 76 GO <strong>NRW</strong> (Pflicht zur Aufstellung e<strong>in</strong>es<br />
Haushaltssicherungskonzeptes) begrenzt. Mit e<strong>in</strong>er Genehmigung nach É 75 Abs. 4 S. 2 GO <strong>NRW</strong> kann noch<br />
ke<strong>in</strong>e Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes nach É 76 GO <strong>NRW</strong> verlangt werden, auch wenn im E<strong>in</strong>zelfall<br />
die AbwÅgung zu dem Ergebnis fÄhrt, die Genehmigung unter Bed<strong>in</strong>gungen und mit Auflagen zu erteilen,<br />
die mÇglichen KonsolidierungsmaÖnahmen im Rahmen e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes Åhneln.<br />
Durch den Bezug zu É 76 GO <strong>NRW</strong> wird deutlich, dass die Vorschrift des É 75 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong> grundsÅtzlich auf<br />
das Haushaltsjahr beschrÅnkt ist. Unter Beachtung des JÅhrlichkeitspr<strong>in</strong>zips bedarf es e<strong>in</strong>er Festsetzung der<br />
Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage <strong>in</strong> der Haushaltssatzung nach É 78 Abs. 2 Nr. 2 GO <strong>NRW</strong>, damit e<strong>in</strong><br />
genehmigungspflichtiger Tatbestand nach dem geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsrecht vorliegt, den der Rat der Geme<strong>in</strong>de<br />
durch se<strong>in</strong>en Beschluss Äber die Haushaltssatzung geschaffen hat (vgl. É 80 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong>).<br />
4.4 Zu Satz 4 (Pflicht zur Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes):<br />
4.4.1 Geplantes Jahresergebnis und Haushaltssicherung<br />
FÄr die Geme<strong>in</strong>de entsteht die Pflicht zur Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes nach É 76 Abs. 1 GO<br />
<strong>NRW</strong>, wenn durch e<strong>in</strong> negatives Jahresergebnis im Ergebnisplan des Haushaltsjahres oder der drei folgenden<br />
Planungsjahre die allgeme<strong>in</strong>e RÄcklage oberhalb der Schwellenwerte des É 76 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> voraussichtlich<br />
verr<strong>in</strong>gert wird. Diese Pflicht besteht unabhÅngig von der jahresbezogenen Festsetzung e<strong>in</strong>er Verr<strong>in</strong>gerung der<br />
allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung. In diesen FÅllen muss <strong>in</strong> der dem Haushaltsplan<br />
beizufÄgenden „àbersicht Äber die Entwicklung des Eigenkapitals“ von der Geme<strong>in</strong>de der vorgesehene Verzehr<br />
des geme<strong>in</strong>dlichen Eigenkapitals aufgezeigt werden (vgl. É 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
Bei der Erteilung der Genehmigung zur Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage nach É 75 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong> ist<br />
von der AufsichtsbehÇrde zu prÄfen, ob von der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong> Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist.<br />
Liegen die Voraussetzungen dafÄr vor, muss die Genehmigung der AufsichtsbehÇrde die Geme<strong>in</strong>de zukunftsbezogen<br />
zur Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes verpflichten. Diese aufsichtsrechtliche MaÖnahme<br />
kann als Verweisung auf die Rechtsfolge des É 76 GO <strong>NRW</strong> angesehen werden. Sie zielt darauf ab, frÄhzeitig<br />
e<strong>in</strong>zugreifen, um zu verh<strong>in</strong>dern, dass der Eigenkapitalverzehr bei der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>e unbeherrschbare Dynamik<br />
annimmt. Diese Bewertung liegt auch im Interesse der jeweils betroffenen Geme<strong>in</strong>de.<br />
Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes nach É 76 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> umfasst die Genehmigung zur<br />
Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage nach É 75 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong> <strong>in</strong> den FÅllen, <strong>in</strong> denen wÅhrend der Laufzeit<br />
e<strong>in</strong>es genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes die allgeme<strong>in</strong>e RÄcklage <strong>in</strong> den dem Haushaltsjahr folgenden<br />
Jahren voraussichtlich zu verr<strong>in</strong>gern ist. Dieser Zusammenhang gilt unter den MaÖgaben, die Vorgaben des<br />
Haushaltssicherungskonzeptes s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>zuhalten und <strong>in</strong> der jeweiligen Haushaltssatzung darf ke<strong>in</strong>e darÄber h<strong>in</strong>ausgehende<br />
Verr<strong>in</strong>gerung festgesetzt werden.<br />
GEMEINDEORDNUNG 235
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
Ä 75 GO <strong>NRW</strong><br />
4.4.2 Aufzeigen der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals<br />
Der Eigenkapitalausstattung der Geme<strong>in</strong>de kommt e<strong>in</strong>e besondere Bedeutung zu. Da das Eigenkapital auch<br />
Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich hat und die mittelfristige Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung <strong>in</strong> den Haushaltsplan<br />
e<strong>in</strong>bezogen wurde, ist es geboten, die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals aufzuzeigen,<br />
wenn <strong>in</strong> der Haushaltssatzung e<strong>in</strong>e Festsetzung nach É 78 Abs. 2 Nr. 2 GO <strong>NRW</strong> enthalten ist. In e<strong>in</strong>er gesonderten<br />
Anlage zum Haushaltsplan ist bei e<strong>in</strong>er Inanspruchnahme der AusgleichsrÄcklage und/oder der allgeme<strong>in</strong>en<br />
RÄcklage die Entwicklung des Eigenkapitals <strong>in</strong>nerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung darzustellen<br />
(vgl. É 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO <strong>NRW</strong>). Es bietet sich an, diese Anlage jedem jÅhrlichen Haushaltsplan beizufÄgen,<br />
denn wegen der E<strong>in</strong>beziehung der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung <strong>in</strong> den geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltsplan werden die Jahresergebnisse auch der drei dem Haushaltsjahr folgenden Planungsjahre dargestellt.<br />
Deren Auswirkungen auf das geme<strong>in</strong>dliche Eigenkapital sollten daher nicht nur bei e<strong>in</strong>em Jahresfehlbetrag,<br />
sondern auch bei e<strong>in</strong>em JahresÄberschuss aufgezeigt werden. DafÄr kann nachfolgendes Schema genutzt werden<br />
(vgl. Abbildung).<br />
Bilanzposten<br />
nach É 41 Abs. 3<br />
Nr. 1 GO <strong>NRW</strong><br />
Allgeme<strong>in</strong>e<br />
RÄcklage<br />
SonderrÄcklagen<br />
AusgleichsrÄcklage<br />
JahresÄberschuss/<br />
Jahresfehlbetrag<br />
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals<br />
Ansatz<br />
Vorvorjahr<br />
(31.12.)<br />
EUR<br />
Planwert<br />
Vorjahr<br />
(31.12.)<br />
EUR<br />
GEMEINDEORDNUNG 236<br />
Planwert<br />
Haushaltsjahr<br />
(31.12.)<br />
EUR<br />
Planwert<br />
Haushaltsjahr<br />
+ 1<br />
(31.12.)<br />
EUR<br />
Planwert<br />
Haushaltsjahr<br />
+ 2<br />
(31.12.)<br />
EUR<br />
Planwert<br />
Haushaltsjahr<br />
+ 3<br />
(31.12.)<br />
EUR<br />
Zeitreihe der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung<br />
Abbildung 25 „Entwicklung des Eigenkapitals“<br />
In der dem Haushaltsplan beizufÄgenden àbersicht soll der gesetzlich erforderliche Haushaltsausgleich auch <strong>in</strong><br />
den drei dem Haushaltsjahr folgenden Planungsjahren aufgezeigt werden. Die o.a. Darstellung ist deshalb der<br />
voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals ggf. noch um weitere Jahre fortzuschreiben. Dabei ist zu beachten,<br />
dass <strong>in</strong> den dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahren e<strong>in</strong> „Soll-Ausgleich“ nach É 84 Satz 3 GO<br />
<strong>NRW</strong> erforderlich ist. Mit der Vorlage des Haushaltsplans werden damit dem Rat, sowie spÅter der AufsichtsbehÇrde<br />
die notwendigen Informationen Äber das geme<strong>in</strong>dliche Eigenkapital gegeben.<br />
5. Zu Absatz 5 (Nicht geplanter Fehlbetrag <strong>in</strong> der Ergebnisrechnung):<br />
5.1 Zu Satz 1 (Anzeigepflicht bei der AufsichtsbehÖrde):<br />
5.1.1 Maànahmen bei nicht geplantem Fehlbetrag<br />
Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich nach É 75 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> erstreckt sich nicht nur auf die Planung,<br />
sondern auch auf die Rechnungslegung. Dem trÅgt diese Vorschrift Rechnung, denn aus der Haushaltsbewirt-
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
Ä 75 GO <strong>NRW</strong><br />
schaftung im Haushaltsjahr kann es sich ergeben, dass die Ergebnisrechnung nach É 38 GemHVO <strong>NRW</strong> bei der<br />
BestÅtigung des Jahresabschlusses gem. É 95 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong> trotz e<strong>in</strong>es ursprÄnglich ausgeglichenen Ergebnisplans<br />
nach É 2 GemHVO <strong>NRW</strong> e<strong>in</strong>en Fehlbetrag oder e<strong>in</strong>en hÇheren Fehlbetrag als im Ergebnisplan ausgewiesen<br />
ausweist. Dieses lÇst fÄr die Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>e Anzeigepflicht gegenÄber ihrer AufsichtsbehÇrde aus.<br />
Die AufsichtsbehÇrde kann wegen des entstandenen schlechteren Jahresergebnisses bzw. Fehlbetrages die<br />
notwendigen ihr zustehenden MaÖnahmen ergreifen, um e<strong>in</strong>e geordnete Haushaltswirtschaft durch die Geme<strong>in</strong>de<br />
wieder herzustellen. Gleichzeitig muss die Geme<strong>in</strong>de auf Grund ihrer Kenntnis Äber die Haushaltswirtschaft des<br />
abgelaufenen Jahres sofort MaÖnahmen ergreifen, z.B. durch e<strong>in</strong>e Haushaltssperre, um e<strong>in</strong>er weiteren defizitÅren<br />
Haushaltswirtschaft entgegen zu wirken und den jÅhrlichen Haushaltsausgleich nach É 75 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong><br />
wieder zu erreichen sowie die dauerhafte LeistungsfÅhigkeit (Gebot <strong>in</strong> É 75 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>) wieder zu sichern.<br />
5.1.2 Fehlbetrag <strong>in</strong> der Ergebnisrechnung und Haushaltssicherungskonzept<br />
Bei der BestÅtigung des Jahresabschlusses durch den BÄrgermeister nach É 95 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong> kann der Fall<br />
e<strong>in</strong>treten, dass <strong>in</strong> der Ergebnisrechnung e<strong>in</strong> Fehlbetrag oder e<strong>in</strong> hÇherer Fehlbetrag als geplant ausgewiesen<br />
werden muss. Diese VerÅnderung der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres kann so erheblich<br />
se<strong>in</strong> gewesen se<strong>in</strong>, dass zum Abschlussstichtag am Ende dieses Haushaltsjahres der <strong>in</strong> der Schlussbilanz des<br />
Vorjahres enthaltene Ansatz der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage um mehr als e<strong>in</strong> Viertel zu verr<strong>in</strong>gern ist. Wird <strong>in</strong> diesem<br />
Fall ist der Schwellenwert des É 76 Abs. 1 Nr. 1 GO <strong>NRW</strong> Äberschritten, lÇst dies fÄr die Geme<strong>in</strong>de unmittelbar<br />
die Verpflichtung zur Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes aus (vgl. É 5 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
Bei e<strong>in</strong>em solchen Sachverhalt kann die AufsichtsbehÇrde wegen der haushaltswirtschaftlichen Ergebnisse der<br />
der Geme<strong>in</strong>de die notwendigen Anordnungen treffen, erforderlichenfalls diese Anordnungen selbst durchfÄhren<br />
oder – wenn und solange diese Befugnisse nicht ausreichen – e<strong>in</strong>en Beauftragten bestellen (vgl. ÉÉ 119 ff. GO<br />
<strong>NRW</strong>). Zu beachten ist dabei, dass bei der Feststellung, ob <strong>in</strong> der Ergebnisrechnung e<strong>in</strong> Fehlbetrag oder e<strong>in</strong><br />
hÇherer Fehlbetrag als geplant ausgewiesen wird, nur dann von den orig<strong>in</strong>Åren HaushaltsansÅtzen auszugehen<br />
ist, wenn es nicht im Haushaltsjahr zur Fortschreibung von HaushaltsansÅtzen, z.B. durch ErmÅchtigungsÄbertragungen<br />
nach 3 22 GemHVO <strong>NRW</strong> gekommen ist (vgl. É 38 Abs. 2 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
5.1.3 Beg<strong>in</strong>n der Frist zur Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs<br />
Entsteht bei der BestÅtigung Äber den Jahresabschluss fÄr die Geme<strong>in</strong>de die Pflicht zur Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes,<br />
bewirkt die B<strong>in</strong>dung des Haushaltssicherungskonzeptes an den Haushaltsplan, dass<br />
entsprechend wie bei der Aufstellung im Rahmen der Haushaltsplanung e<strong>in</strong>e Frist von drei Jahren nach dem<br />
Ursachenjahr zur Erreichung des Haushaltsausgleichs e<strong>in</strong>zuhalten ist, damit e<strong>in</strong>e GenehmigungsfÅhigkeit des<br />
Haushaltssicherungskonzeptes gegeben ist. Der Fristbeg<strong>in</strong>n fÄr die Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs<br />
sowie das Haushaltsjahr, <strong>in</strong> dem der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden muss, lÅsst sich erst dann genau<br />
bestimmen, denn dies ist von der tatsÅchlichen Fallgestaltung vor Ort abhÅngig. Mit der Vorschrift ist daher nicht<br />
beabsichtigt, e<strong>in</strong> bereits durch den bestÅtigten Jahresabschluss abgeschlossene Haushaltsjahr wieder zu Çffnen,<br />
um es als Ursachenjahr fÄr die Wiederherstellungsfrist fÄr den Haushaltsausgleich heranziehen zu kÇnnen.<br />
Die Haushaltsbewirtschaftung des abgeschlossenen Haushaltsjahres kann zwar als AuslÇser der Ursache fÄr die<br />
Pflicht zur Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes angesehen werden, gleichwohl entsteht diese Pflicht<br />
erst dann, wenn dafÄr die notwendige Kenntnis bei der Geme<strong>in</strong>de vorliegt. Diese Kenntnis erlangt die Geme<strong>in</strong>de<br />
erst im Rahmen der Aufstellung und BestÅtigung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses fÄr das abgelaufene<br />
Haushaltsjahr. Erst zu diesem Zeitpunkt im Folgejahr ist e<strong>in</strong>e Beurteilung mÇglich, welchen Eigenkapitalverzehr<br />
der nicht geplante Fehlbetrag fÄr das abgelaufene Haushaltsjahr sowie fÄr die folgenden Jahre bewirkt und ob<br />
dadurch die <strong>in</strong> É 76 GO <strong>NRW</strong> bestimmten Schwellenwerte Äberschritten werden (vgl. Abbildung).<br />
GEMEINDEORDNUNG 237
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
Ä 75 GO <strong>NRW</strong><br />
Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs bei Ä 75 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong><br />
Sachverhalt: (Jahr)<br />
Abgelaufenes Haushaltsjahr 2009<br />
Vorliegen e<strong>in</strong>e bestÅtigten Jahresabschlusses mit Fehlbetrag<br />
<strong>in</strong> der Ergebnisrechnung<br />
Fristfestlegung:<br />
GEMEINDEORDNUNG 238<br />
2010<br />
Ursachenjahr fÄr defizitÅren Haushalt 2009<br />
Kenntnis Äber die Pflicht zur Aufstellung e<strong>in</strong>es<br />
Haushaltssicherungskonzeptes<br />
Beg<strong>in</strong>n der Frist zur Wiederereichung des Haushaltsausgleichs<br />
nach É 76 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong><br />
2010<br />
2010<br />
Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs (nach drei Jahren) 2013<br />
Abbildung 26 „Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs“<br />
5.1.4 Zuordnung des Haushaltssicherungskonzeptes zum Haushaltsplan<br />
In den FÅllen, <strong>in</strong> denen e<strong>in</strong> Haushaltssicherungskonzept im Rahmen der BestÅtigung Äber den Jahresabschluss<br />
aufzustellen ist, bewirkt die B<strong>in</strong>dung des Haushaltssicherungskonzeptes an den Haushaltsplan nach É 79 Abs. 2<br />
Satz 2 GO <strong>NRW</strong>, dass auch dieses Haushaltssicherungskonzept Bestandteil e<strong>in</strong>es Haushaltsplans se<strong>in</strong> muss.<br />
FÄr das Haushaltsjahr, <strong>in</strong> dem der Jahresabschluss fÄr das vorherige Haushaltsjahr aufgestellt wird, existiert<br />
i.d.R. bereits e<strong>in</strong>e geltende Haushaltssatzung und damit auch e<strong>in</strong>e bestandskrÅftiger Haushaltsplan. Es ist daher<br />
sachgerecht und vertretbar, das aufgestellte Haushaltssicherungskonzept zum Bestandteil des nÅchsten der<br />
BestÅtigung des Jahresabschlusses folgenden Haushaltsjahres zu machen. Diese haushaltsrechtliche Zuordnung<br />
gibt jedoch ke<strong>in</strong>e Berechtigung, die auf das Ursachenjahr bezogene Fristsetzung fÄr die Wiederherstellung des<br />
Haushaltsausgleichs zu verÅndern bzw. zu verlÅngern.<br />
Die Geme<strong>in</strong>de, die auf Grund ihrer Kenntnis Äber das negative Jahresergebnis des abgelaufenen Haushaltsjahres<br />
und der daraus ggf. entstehenden Pflicht zur Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes die notwendigen<br />
GegenmaÖnahmen sofort e<strong>in</strong>leiten muss, um den jÅhrlichen Haushaltsausgleich nach É 75 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong><br />
wieder zu erreichen und ihre dauernde LeistungsfÅhigkeit (Gebot <strong>in</strong> É 75 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>) wieder zu sichern,<br />
kann bereits im laufenden Haushaltsjahr durch e<strong>in</strong>e freiwillige Nachtragssatzung e<strong>in</strong> genehmigungsfÅhiges Haushaltssicherungskonzept<br />
auch zum Bestandteil des Haushaltsplans dieses Haushaltsjahres machen. Dies dÄrfte <strong>in</strong><br />
vielen FÅllen s<strong>in</strong>nvoll se<strong>in</strong>, um auch die SofortmaÖnahmen <strong>in</strong> die Strategie des Haushaltssicherungskonzeptes<br />
fÇrmlich e<strong>in</strong>zub<strong>in</strong>den.<br />
5.2 Zu Satz 2 (Rechte der AufsichtsbehÖrde):<br />
Bei der BestÅtigung des Jahresabschlusses durch den BÄrgermeister nach É 95 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong> <strong>in</strong> der Ergebnisrechnung<br />
e<strong>in</strong> Fehlbetrag oder e<strong>in</strong> hÇherer Fehlbetrag als geplant ausgewiesen wird, kann diese VerÅnderung der
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
Ä 75 GO <strong>NRW</strong><br />
Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres so erheblich se<strong>in</strong> gewesen se<strong>in</strong>, dass zum Abschlussstichtag<br />
am Ende dieses Haushaltsjahres der <strong>in</strong> der Schlussbilanz des Vorjahres enthaltene Ansatz der allgeme<strong>in</strong>en<br />
RÄcklage erheblich zu verr<strong>in</strong>gern ist. Wird <strong>in</strong> diesem Fall e<strong>in</strong> Schwellenwert des É 76 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> Äberschritten,<br />
lÇst dies fÄr die Geme<strong>in</strong>de unmittelbar die Verpflichtung zur Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes<br />
aus (vgl. É 5 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
Bei e<strong>in</strong>em solchen Sachverhalt kann die fÄr die Geme<strong>in</strong>de zustÅndige AufsichtsbehÇrde entsprechend den Erfordernissen<br />
und des haushaltswirtschaftlichen Verhaltens der Geme<strong>in</strong>de die notwendigen Anordnungen treffen,<br />
erforderlichenfalls die Anordnungen selbst durchfÄhren oder – wenn und solange diese Befugnisse nicht ausreichen<br />
– e<strong>in</strong>en Beauftragten bestellen, um e<strong>in</strong>e geordnete Haushaltswirtschaft wieder herzustellen. Mit dem Verweis<br />
auf den 13. Teil der Geme<strong>in</strong>deordnung, <strong>in</strong> dem die Rechte und Pflichten der Aufsicht des Landes Äber die<br />
Geme<strong>in</strong>den verankert s<strong>in</strong>d, denn das Land schÄtzt nach É 11 GO <strong>NRW</strong> die Geme<strong>in</strong>den <strong>in</strong> ihren Rechten und<br />
sichert die ErfÄllung ihrer Pflichten, werden die Beziehung zwischen der Geme<strong>in</strong>de und ihrer AufsichtsbehÇrde<br />
noch e<strong>in</strong>mal ausdrÄcklich verdeutlicht (vgl. ÉÉ 119 ff. GO <strong>NRW</strong>).<br />
5.3 Zu Satz 3 (Verweis auf die ÄÄ 123 und 124 der Geme<strong>in</strong>deordnung):<br />
Der Verweis „ÉÉ 123 und 124 gelten s<strong>in</strong>ngemÅÖ“ <strong>in</strong> der Vorschrift soll die Bedeutung der Regelung und die ZulÅssigkeit<br />
e<strong>in</strong>es ggf. erforderlich werdenden E<strong>in</strong>schreitens der die fÄr die Geme<strong>in</strong>de zustÅndigen AufsichtsbehÇrde<br />
besonders verdeutlichen. Damit wird auf die MÇglichkeit e<strong>in</strong>er Anordnung und e<strong>in</strong>er mÇglichen Ersatzvornahme<br />
durch AufsichtsbehÇrde (vgl. É 123 GO <strong>NRW</strong>) sowie der mÇglichen Bestellung e<strong>in</strong>es Beauftragten (vgl. É 124<br />
GO <strong>NRW</strong>) besonders h<strong>in</strong>gewiesen. Ob im Rahmen der haushaltswirtschaftlichen TÅtigkeit der Geme<strong>in</strong>de davon<br />
im E<strong>in</strong>zelfall Gebrauch gemacht wird, ist unter BerÄcksichtigung der Çrtlichen VerhÅltnisse und der gesetzlichen<br />
Festlegungen, dass das Land die Geme<strong>in</strong>den <strong>in</strong> ihren Rechten schÄtzt und die ErfÄllung ihrer Pflichten sichert, zu<br />
beurteilen (vgl. É 11 GO <strong>NRW</strong>).<br />
6. Zu Absatz 6 (Sicherstellung der LiquiditÅt und der F<strong>in</strong>anzierung von Investitionen):<br />
6.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
FÄr jedes Haushaltsjahr ist fÄr den neuen Haushaltsplan neben dem Ergebnisplan auch e<strong>in</strong> F<strong>in</strong>anzplan aufzustellen.<br />
In diesem werden vor allem die Zahlungen fÄr Investitionen ausgewiesen und diese durch den Rat ermÅchtigt.<br />
Der F<strong>in</strong>anzplan dient aber auch der F<strong>in</strong>anzierungsplanung, da dieser neben den Zahlungen fÄr Investitionen<br />
auch die F<strong>in</strong>anzbedarfe fÄr die laufende VerwaltungstÅtigkeit und die Bedarfe aus der F<strong>in</strong>anzierungstÅtigkeit<br />
(Kreditaufnahme fÄr Investitionen und Tilgung von Krediten) ausweist. Auch wenn im NKF die neue Steuerung<br />
der Geme<strong>in</strong>de sich auf die ErtrÅge und Aufwendungen im Ergebnisplan bezieht, s<strong>in</strong>d gleichzeitig auch die LiquiditÅt<br />
und die F<strong>in</strong>anzierung der Investitionen sicherzustellen. Diese haben e<strong>in</strong>e so groÖe allgeme<strong>in</strong>e Bedeutung fÄr<br />
die Geme<strong>in</strong>den, dass deshalb der Haushaltsgrundsatz „Sicherung der LiquiditÅt“ entstanden ist.<br />
6.2 Sicherstellung der LiquiditÅt<br />
6.2.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die Sicherstellung der LiquiditÅt hat fÄr die Geme<strong>in</strong>den so e<strong>in</strong>e groÖe Bedeutung, dass e<strong>in</strong>e weitere Regelung<br />
darÄber <strong>in</strong> É 30 Abs. 6 GemHVO <strong>NRW</strong> enthalten ist und Çrtliche Vorschriften zu erstellen s<strong>in</strong>d, die die notwendigen<br />
Bestimmungen Äber die geme<strong>in</strong>dliche LiquiditÅtsplanung enthalten mÄssen (vgl. É 31 GemHVO <strong>NRW</strong>). In<br />
diesem Zusammenhang umfasst der Begriff „LiquiditÅt“ die FÅhigkeit der Geme<strong>in</strong>de, ihren Zahlungsverpflichtungen<br />
term<strong>in</strong>gerecht und betragsgenau nachzukommen. Bei der Ausgestaltung der LiquiditÅtsplanung mÄssen auch<br />
GEMEINDEORDNUNG 239
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
Ä 75 GO <strong>NRW</strong><br />
die GrundsÅtze der F<strong>in</strong>anzmittelbeschaffung nach É 77 GO <strong>NRW</strong> Anwendung f<strong>in</strong>den sowie die GrundsÅtze fÄr die<br />
Kreditaufnahme (É 86 GO <strong>NRW</strong> fÄr Kredite fÄr Investitionen und É 89 GO <strong>NRW</strong> fÄr Kredite zur LiquiditÅtssicherung)<br />
beachtet werden. AuÖerdem darf dabei nicht unberÄcksichtigt bleiben, ob und <strong>in</strong> welchem Umfang die Geme<strong>in</strong>de<br />
die E<strong>in</strong>ziehung von AnsprÄchen <strong>in</strong> Form der Stundung h<strong>in</strong>ausschiebt oder durch Niederschlagung und<br />
Erlass auf die Durchsetzung ihrer AnsprÄche verzichtet (vgl. É 23 Abs. 3 und 4 und É 26 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
6.2.2 Gebot zur angemessenen LiquiditÅtsplanung<br />
Das haushaltsrechtliche Gebot „Sicherstellung der LiquiditÅt“ wird durch die Verpflichtung der Geme<strong>in</strong>de, e<strong>in</strong>e<br />
angemessene LiquiditÅtsplanung vorzunehmen, ergÅnzt (vgl. É 89 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. É 30 Abs. 6 GemHVO<br />
<strong>NRW</strong>). Die LiquiditÅtsplanung hat die Geme<strong>in</strong>de so vorzunehmen, dass sie an den e<strong>in</strong>zelnen FÅlligkeitsterm<strong>in</strong>en<br />
ausreichend F<strong>in</strong>anzmittel hat, um zahlungsfÅhig zu se<strong>in</strong> und auch LiquiditÅtsschwankungen ausgleichen kann.<br />
Zur geme<strong>in</strong>dlichen LiquiditÅtsplanung gehÇrt deshalb nicht nur, die kurzfristigen und langfristigen AnsprÄche<br />
h<strong>in</strong>sichtlich ihrer FÅlligkeiten zu betrachten, sondern auch sorgfÅltig die f<strong>in</strong>anziellen Auswirkungen aus kurzfristigen<br />
und langfristigen Verpflichtungen e<strong>in</strong>zubeziehen. Dabei bedarf es Annahmen zur Entwicklung dieser Verpflichtungen,<br />
um e<strong>in</strong>e langfristige LiquiditÅtsplanung zu erreichen. Dieses verpflichtet die Geme<strong>in</strong>de, sich selbst<br />
tÅglich sorgfÅltig Kenntnisse Äber ZahlungsmittelzuflÄsse und ZahlungsmittelabflÄsse sowie Äber Sicherheiten,<br />
Risiken und die RentabilitÅt von AnlagemÇglichkeiten zu verschaffen.<br />
Aus dem Gebot zu angemessenen LiquiditÅtsplanung entsteht auch das Erfordernis fÄr die Geme<strong>in</strong>de, <strong>in</strong>terne<br />
Informationspflichten zu verankern, damit die fÄr die LiquiditÅtsplanung zustÅndige Stelle auch aus den Fachbereich<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung die notwendigen Informationen erhÅlt, um den LiquiditÅtsbedarf mÇglichst<br />
zutreffend abschÅtzen zu kÇnnen. Auch wenn Dritte beauftragt werden, die Geme<strong>in</strong>de bei der Verwaltung dieser<br />
F<strong>in</strong>anzmittel fachlich zu beraten oder zu unterstÄtzen, mÄssen diese die haushaltsrechtlichen Bed<strong>in</strong>gungen und<br />
GrundsÅtze fÄr die Geme<strong>in</strong>den beachten. In diesen FÅllen ist die Geme<strong>in</strong>de verpflichtet, e<strong>in</strong>e wirksame Kontrolle<br />
gegenÄber den Dritten sicherzustellen. Sie hat <strong>in</strong> jedem Fall zu gewÅhrleisten, dass <strong>in</strong>sbesondere die ihr gesetzlich<br />
zugewiesenen Aufgaben <strong>in</strong> ihrer VerfÄgungs- und Entscheidungsbefugnis verbleiben.<br />
6.2.3 LiquiditÅtsrisikomess- und LiquiditÅtssteuerungsverfahren<br />
FÄr die Beurteilung e<strong>in</strong>er ausreichenden LiquiditÅt bietet sich die E<strong>in</strong>richtung e<strong>in</strong>es LiquiditÅtsrisikomess- und<br />
LiquiditÅtssteuerungsverfahren durch die Geme<strong>in</strong>de an. Dieses muss unter BerÄcksichtigung der Çrtlichen VerhÅltnisse<br />
der Geme<strong>in</strong>de der Art und KomplexitÅt der geme<strong>in</strong>dlichen GeschÅftsvorfÅlle e<strong>in</strong>e adÅquate laufende<br />
Ermittlung und àberwachung des LiquiditÅtsrisikos und der LiquiditÅtslage gewÅhrleisten. Auch muss das Verfahren<br />
Aufschluss Äber zu erwartende erhebliche MittelabflÄsse und Äber die Aufnahme von F<strong>in</strong>anzierungsmitteln<br />
sowie Äber die Auswirkungen von LiquiditÅtsengpÅssen ermÇglichen, damit von der Geme<strong>in</strong>de die notwendigen<br />
MaÖnahmen ergriffen werden kÇnnen.<br />
Im Zusammenhang mit der E<strong>in</strong>schÅtzung, bei welchem Niveau e<strong>in</strong> mittleres oder e<strong>in</strong> hohes Risiko fÄr e<strong>in</strong>e nicht<br />
ausreichende LiquiditÅt entsteht, sollten geeignete Obergrenzen fÄr LiquiditÅtsrisiken wie sie vergleichsweise<br />
auch im Z<strong>in</strong>smanagement zur Anwendung kommen, bestimmt und zudem regelmÅÖig ÄberprÄft werden. Auch<br />
bedarf es bereits im Vorfeld e<strong>in</strong>er Auswahl von MaÖnahmen zur Beseitigung e<strong>in</strong>er GefÅhrdung. Werden von der<br />
Geme<strong>in</strong>de zudem Beobachtungskennzahlen, z.B. e<strong>in</strong>er LiquiditÅtskennzahl, die das VerhÅltnis zwischen den<br />
verfÄgbaren Zahlungsmitteln und den Zahlungsverpflichtungen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em bestimmten Zeitraum angibt (vgl. LiquiditÅtsspiegel)<br />
e<strong>in</strong>gesetzt, tragen diese zu e<strong>in</strong>er Verbesserung der E<strong>in</strong>schÅtzung der LiquiditÅtserfordernisse bei der<br />
Geme<strong>in</strong>de bei.<br />
Es bedarf alternativer Verfahren zur Sicherung der geme<strong>in</strong>dlichen LiquiditÅt, wenn die Geme<strong>in</strong>de sich nicht e<strong>in</strong>es<br />
ausgefeilten LiquiditÅtsrisikomess- und LiquiditÅtssteuerungsverfahrens bedient. E<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>stieg, um sich e<strong>in</strong>en<br />
GEMEINDEORDNUNG 240
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
Ä 75 GO <strong>NRW</strong><br />
zeitbezogenen àberblick Äber die verfÄgbaren Zahlungsmittel und der abrufbaren Forderungen und Zahlungsverpflichtungen<br />
zu verschaffen, bietet auch e<strong>in</strong> LiquiditÅtsspiegel, vergleichbar dem Forderungsspiegel und dem<br />
Verb<strong>in</strong>dlichkeitenspiegel im Jahresabschluss. Durch die E<strong>in</strong>stellung der AnsprÄche und Zahlungsverpflichtungen<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong> Zeitraster soll e<strong>in</strong> àberblick erreicht werden, durch den das geme<strong>in</strong>dliche <strong>F<strong>in</strong>anzmanagement</strong> und die notwendige<br />
LiquiditÅtssicherung unterstÄtzt werden. Anders als die zuvor genannten Spiegel mÄssen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em LiquiditÅtsspiegel<br />
stÅrker die kurzfristigen Zahlungserfordernisse berÄcksichtigt werden. Auch muss e<strong>in</strong> LiquiditÅtsspiegel<br />
<strong>in</strong> kurzen ZeitabstÅnden, ggf. tÅglich, fortgeschrieben werden.<br />
6.2.4 TreuhandverhÅltnis und LiquiditÅtssicherung<br />
Im Zusammenhang mit der Bilanzierung geme<strong>in</strong>dlicher TreuhandverhÅltnisse ist darauf h<strong>in</strong>zuweisen, dass die<br />
Geme<strong>in</strong>de durch e<strong>in</strong> TreuhandverhÅltnis zur H<strong>in</strong>terlegung von Pensionsverpflichtungen weder auf die notwendige<br />
LiquiditÅtsvorsorge fÄr die zu zahlenden Versorgungsleistungen (vgl. É 75 Abs. 6 GO <strong>NRW</strong>) verzichten noch ihre<br />
PensionsrÄckstellungen m<strong>in</strong>dern kann. Auch die sog. TreuhandlÇsung „Contractual Trust Arrangements“ (CTA)<br />
zur Absicherung und F<strong>in</strong>anzierung langfristig fÅllig werdender Pensionsverpflichtungen stellen ke<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>derechtlich<br />
zulÅssige Besicherung dar, die zur M<strong>in</strong>derung der von der Geme<strong>in</strong>de zu bilanzierenden PensionsrÄckstellungen<br />
fÄhren kann, auch wenn dabei e<strong>in</strong> unabhÅngiger RechtstrÅger e<strong>in</strong>e treuhÅnderische Verwaltung vornimmt.<br />
6.3 Sicherstellung der F<strong>in</strong>anzierung von Investitionen<br />
6.3.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die Sicherstellung der F<strong>in</strong>anzierung von Investitionen erfordert e<strong>in</strong> Zusammenspiel verschiedener Aspekte, um<br />
diesem Haushaltsgrundsatz GenÄge zu tun. Bei der Entscheidung, ob die F<strong>in</strong>anzierung e<strong>in</strong>er Investition gesichert<br />
ist und sie durchgefÄhrt werden darf, gilt es die Vorschriften Äber die geme<strong>in</strong>dlichen Investitionen <strong>in</strong> É 14 GemH-<br />
VO <strong>NRW</strong>, die Gesamtdeckung <strong>in</strong> É 20 GemHVO <strong>NRW</strong> und die Vorschriften Äber die Kreditaufnahmen <strong>in</strong> É 86<br />
(Kredite fÄr Investitionen) sowie <strong>in</strong> É 89 (Kredite zur LiquiditÅtssicherung) zu beachten. Aber auch weitere geme<strong>in</strong>dliche<br />
Vorschriften kÇnnen fÄr die Sicherstellung der F<strong>in</strong>anzierung von Investitionen betroffen se<strong>in</strong>, z.B. É 83<br />
GO <strong>NRW</strong> bei der Notwendigkeit e<strong>in</strong>er auÖerplanmÅÖigen Umsetzung von Investitionen oder É 85 GO <strong>NRW</strong> Äber<br />
das E<strong>in</strong>gehen von Verpflichtungen zu Lasten kÄnftiger Haushaltsjahre.<br />
Indie Betrachtung, ob die F<strong>in</strong>anzierung von Investitionen sichergestellt ist, s<strong>in</strong>d auch die erhaltenen Zuwendungen<br />
und die BeitrÅge Dritter e<strong>in</strong>zubeziehen. So ist z.B. e<strong>in</strong> bei der GewÅhrung e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>vestiven Zuwendung zugelassener<br />
vorzeitiger Baubeg<strong>in</strong>n durch den Zuwendungsgeber ohne se<strong>in</strong>e rechtliche Zusicherung der ZuwendungsgewÅhrung<br />
ke<strong>in</strong> Anlass, von der nach dieser Vorschrift erforderlichen Sicherstellung der F<strong>in</strong>anzierung von<br />
Investitionen ausgehen zu kÇnnen, wenn nicht die Geme<strong>in</strong>de selbst bereits Äber die notwendigen Eigenmittel<br />
verfÄgt. In der Geme<strong>in</strong>de sollte daher geklÅrt se<strong>in</strong>, ob, wer und wann bei welchen Investitionen die Feststellung<br />
zu treffen hat, dass die F<strong>in</strong>anzierung der Investition im S<strong>in</strong>ne des É 75 Abs. 6 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. É 14 GemHVO<br />
<strong>NRW</strong> sichergestellt ist und diese nun im Haushaltsplan unter Beachtung der allgeme<strong>in</strong>en PlanungsgrundsÅtze<br />
nach É 11 GemHVO veranschlagt werden kann.<br />
6.3.2 Auftragsvergabe und LiquiditÅtsplanung<br />
Im Rahmen e<strong>in</strong>es Vergabeverfahrens sollte die Geme<strong>in</strong>de ihre haushaltsmÅÖige Planung der voraussichtlichen<br />
Umsetzung der geme<strong>in</strong>dlichen MaÖnahme bereits beg<strong>in</strong>nen. Dazu gehÇrt nicht nur die haushaltsmÅÖige E<strong>in</strong>beziehung<br />
der MaÖnahme <strong>in</strong> die mittelfristige Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung der Geme<strong>in</strong>de (vgl. É 84 GO <strong>NRW</strong>),<br />
sondern auch <strong>in</strong> die Çrtliche LiquiditÅtsplanung nach É 89 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. É 30 Abs. 6 GemHVO <strong>NRW</strong>,<br />
GEMEINDEORDNUNG 241
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
Ä 75 GO <strong>NRW</strong><br />
denn nach É 75 Abs. 6 GO <strong>NRW</strong> hat die Geme<strong>in</strong>de ihre LiquiditÅt e<strong>in</strong>schlieÖlich der F<strong>in</strong>anzierung ihrer Investitionen<br />
sicherzustellen. Dabei sollte auch das Forderungssicherungsgesetz (FoSiG) vom 23.10.2008 (BGBl. I S.<br />
2022) Beachtung f<strong>in</strong>den, denn danach kann z.B. e<strong>in</strong> Unternehmer vom Besteller e<strong>in</strong>e Abschlagszahlung verlangen.<br />
Diese darf nicht verweigert werden, selbst nicht wegen vorhandener MÅngel (vgl. É 632a BGB).<br />
7. Zu Absatz 7 (Überschuldung der Geme<strong>in</strong>de):<br />
7.1 Zu Satz 1 (Verbot der Überschuldung):<br />
Das Eigenkapital e<strong>in</strong>er Geme<strong>in</strong>de kann se<strong>in</strong>e Funktion nur erfÄllen, solange es nicht durch Verluste vollstÅndig<br />
aufgezehrt worden ist. Aus diesem Grunde bedarf bei Geme<strong>in</strong>den, deren weitere Entwicklung mit erheblichen<br />
Risiken behaftet ist, der Bestand an Eigenkapital e<strong>in</strong>er besonderen Betrachtung. In FortfÄhrung der Genehmigungspflicht<br />
der Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage nach Absatz 4 der Vorschrift (Inanspruchnahme von<br />
Eigenkapital) verbietet diese Vorschrift den Geme<strong>in</strong>den sich zu Äberschulden. Sie enthÅlt zudem e<strong>in</strong>e Begriffsbestimmung<br />
der àberschuldung, die aus dem kaufmÅnnischen Recht abgeleitet ist (bilanzielle àberschuldung). Die<br />
Sachlage, dass bei e<strong>in</strong>er àberschuldung die stetige AufgabenerfÄllung der Geme<strong>in</strong>de nicht mehr gewÅhrleistet<br />
ist, fÄhrte zu dieser gesetzlichen Auffangregelung.<br />
Durch die ausdrÄckliche Benennung der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz <strong>in</strong> dieser Vorschrift ist e<strong>in</strong>deutig bestimmt, dass im<br />
Rahmen des Jahresabschlusses (vgl. ÉÉ 95 und 96 GO <strong>NRW</strong>) von der Geme<strong>in</strong>de zu prÄfen ist, ob e<strong>in</strong>e àberschuldung<br />
e<strong>in</strong>getreten ist, denn aus der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz ist ablesbar, ob e<strong>in</strong>e àberschuldung der Geme<strong>in</strong>de<br />
e<strong>in</strong>getreten ist. Der Verbotstatbestand wirkt jedoch nicht soweit, dass zum Abschlussstichtag von der Geme<strong>in</strong>de<br />
ke<strong>in</strong> Jahresabschluss aufzustellen ist, weil dadurch die àberschuldung der Geme<strong>in</strong>de tatsÅchlich e<strong>in</strong>tritt. Vielmehr<br />
entstehen beim E<strong>in</strong>tritt der àberschuldung besondere Handlungspflichten fÄr den Rat und die Verwaltung der<br />
Geme<strong>in</strong>de, denn es gilt, den Verbotstatbestand schnellstmÇglich wieder zu beseitigen. Auch wenn diese Pflichten<br />
fÄr die betroffene Geme<strong>in</strong>de klar und nachvollziehbar s<strong>in</strong>d, bereitet die Beseitigung der àberschuldung <strong>in</strong> der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Praxis erhebliche Schwierigkeiten.<br />
Der jÅhrliche Gesamtabschluss nach É 116 GO <strong>NRW</strong> bleibt beim àberschuldungsverbot erst e<strong>in</strong>mal unberÄhrt.<br />
Die Gesamtbilanz wird regelmÅÖig aus der Bilanz der Geme<strong>in</strong>de und den Bilanzen der geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe im<br />
Rahmen der Konsolidierung (vgl. É 50 GemHVO <strong>NRW</strong>), und zwar unabhÅngig von den Wirkungen der E<strong>in</strong>zelbilanzen,<br />
aufgestellt. E<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>getretene àberschuldung aus der Bilanz der geme<strong>in</strong>dlichen Kernverwaltung oder<br />
e<strong>in</strong>es der geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe wirkt sich daher <strong>in</strong>sbesondere auf das Gesamteigenkapital der Geme<strong>in</strong>de aus.<br />
7.2 Zu Satz 2 (Vorliegen der Überschuldung):<br />
7.2.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Nach der Vorschrift ist e<strong>in</strong>e Geme<strong>in</strong>de Äberschuldet, wenn nach ihrer Bilanz das Eigenkapital aufgebraucht wird.<br />
Dieser Sachverhalt ist gegeben, wenn die WertansÅtze der Passivposten (Eigenkapital und Verb<strong>in</strong>dlichkeiten),<br />
jedoch ohne BerÄcksichtigung der SondersonderrÄcklagen als Eigenkapitalbestandteile, die WertansÅtze der<br />
Aktivposten (AnlagevermÇgen und UmlaufvermÇgen) unter BerÄcksichtigung der Rechnungsabgrenzung, Äbersteigen.<br />
Die NichtberÄcksichtigung von SonderrÄcklagen ist wegen des <strong>in</strong> É 75 GO <strong>NRW</strong> bestimmten Haushaltsausgleichssystems<br />
geboten. Daran schlieÖt sich auch das Verbot <strong>in</strong> É 43 Abs. 4 S. 4 GemHVO <strong>NRW</strong> an, nach<br />
dem die Bildung von SonderrÄcklagen fÄr selbstgewÅhlte Zwecke durch die Geme<strong>in</strong>de unzulÅssig ist.<br />
Zur Feststellung, ob e<strong>in</strong>e àberschuldung der Geme<strong>in</strong>de vorliegt, muss e<strong>in</strong>e Summe aus den AnsÅtzen der Eigenkapitalbestandteile<br />
(Ansatz der Bilanzposten) „Allgeme<strong>in</strong>e RÄcklage“, „AusgleichsrÄcklage“ und „JahresÄberschuss/-Jahresfehlbetrag“<br />
gebildet werden. Ist der ermittelte Betrag negativ (Summenbetrag � 0 Euro), muss<br />
GEMEINDEORDNUNG 242
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
Ä 75 GO <strong>NRW</strong><br />
dieser nach É 43 Abs. 7 GemHVO <strong>NRW</strong> - vergleichbar mit den Regelungen des Handelsrechts - am Ende der<br />
Aktivseite der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz unter der Postenbezeichnung „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“<br />
gesondert angesetzt werden (vgl. Bilanzgliederung nach É 41 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO <strong>NRW</strong>). Das nachfolgende<br />
Schema zeigt diesen gesonderten Bilanzposten auf (vgl. Abbildung).<br />
Aktiva<br />
1. AnlagevermÇgen<br />
1.1 Immaterielle VermÇgensgegenstÅnde<br />
1.2 Sachanlagen<br />
1.3 F<strong>in</strong>anzanlagen<br />
1 UmlaufvermÇgen<br />
1.1 VorrÅte<br />
1.2 Forderungen und sonstige<br />
VermÇgensgegenstÅnde<br />
1.3 Wertpapiere des UmlaufvermÇgens<br />
2.4 Liquide Mittel<br />
3. Aktive Rechnungsabgrenzung<br />
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag<br />
Bilanzansatz „Negatives Eigenkapital“<br />
GEMEINDEORDNUNG 243<br />
Passiva<br />
1. Eigenkapital<br />
Allgeme<strong>in</strong>e RÄcklage<br />
SonderrÄcklagen<br />
AusgleichsrÄcklage<br />
JahresÄberschuss/Jahresfehlbetrag<br />
2. Sonderposten<br />
3. RÄckstellungen<br />
4. Verb<strong>in</strong>dlichkeiten<br />
5. Passive Rechnungsabgrenzung<br />
Abbildung 27 „Bilanzansatz negatives Eigenkapital“<br />
E<strong>in</strong>e derartige Verschuldenslage der Geme<strong>in</strong>de zeigt sich Äblicherweise zwar erst im Nachh<strong>in</strong>e<strong>in</strong> <strong>in</strong> der jÅhrlichen<br />
Schlussbilanz, sie wird jedoch auch dann sichtbar, wenn im Rahmen der Haushaltsplanung e<strong>in</strong>e Verr<strong>in</strong>gerung der<br />
allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage durch e<strong>in</strong>e Festsetzung <strong>in</strong> der Haushaltssatzung vorgesehen wird. Um die dafÄr erforderliche<br />
Genehmigung durch die AufsichtsbehÇrde nach É 75 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong> oder nach É 76 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> zu<br />
erhalten, muss die Geme<strong>in</strong>de ihrer AufsichtsbehÇrde die voraussichtliche haushaltsvertrÅgliche Entwicklung des<br />
Eigenkapitals <strong>in</strong>nerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung, ggf. auch darÄber h<strong>in</strong>aus, aufzeigen.<br />
Ausgehend von der Festsetzung der Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage <strong>in</strong> der Haushaltssatzung der Geme<strong>in</strong>de<br />
nach É 78 Abs. 2 Nr. 2 GO <strong>NRW</strong> muss die Entwicklung des Eigenkapitals der Geme<strong>in</strong>de bzw. der allgeme<strong>in</strong>en<br />
RÄcklage <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er àbersicht aufgezeigt werden (vgl. É 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
7.2.2 Überschuldung und vorlÅufige Haushaltswirtschaft<br />
Die e<strong>in</strong>getretene àberschuldung e<strong>in</strong>er Geme<strong>in</strong>de fÄhrt als VerstoÖ gegen das gesetzliche Verbot dazu, dass<br />
deren jÅhrliche Haushaltswirtschaft wie e<strong>in</strong>e vorlÅufige Haushaltswirtschaft e<strong>in</strong>zustufen und zu fÄhren ist. Die<br />
Geme<strong>in</strong>de kann beim Vorliegen e<strong>in</strong>er àberschuldung nicht mehr dem Gebot <strong>in</strong> Absatz 1 der Vorschrift, ihre<br />
Haushaltswirtschaft so zu planen und zu fÄhren, dass die stetige ErfÄllung ihrer Aufgaben gesichert ist, <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
ausreichenden MaÖe nachkommen.<br />
Diese Pflicht ist auch dann als gegeben anzusehen, wenn die Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>en ausgeglichenen Haushalt aufstellt<br />
(Ausgleich ggf. nicht nur im Haushaltsjahr, sondern auch <strong>in</strong> den folgenden drei Planungsjahren der mittelfristigen<br />
Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung), sich jedoch nicht <strong>in</strong> der Lage sieht, die notwendigen àberschÄsse zu erwirtschaften,<br />
um die àberschuldung und den dadurch den e<strong>in</strong>getretenen VerstoÖ gegen das gesetzliche Verbot zu beseitigen.<br />
Bei e<strong>in</strong>er ordnungsgemÅÖen Haushaltswirtschaft wÅre <strong>in</strong> solchen FÅllen e<strong>in</strong>e Anzeigepflicht gegenÄber der<br />
AufsichtsbehÇrde ausreichend. Bei e<strong>in</strong>em e<strong>in</strong>getretenen VerstoÖ gegen das gesetzliche Verbot der àberverschuldung<br />
kann e<strong>in</strong> ausgeglichener geme<strong>in</strong>dlicher Haushalt jedoch nicht mehr als unbedenklich behandelt werden,<br />
so dass fÄr diesen Haushalt die Bed<strong>in</strong>gungen der vorlÅufigen HaushaltsfÄhrung gelten mÄssen. Diese Auslegung<br />
gebieten auch die haushaltsrechtlichen GrundsÅtze.
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
Ä 75 GO <strong>NRW</strong><br />
7.2.3 Vermeidung und Beseitigung der Überschuldung<br />
7.2.3.1 Haushaltssicherungskonzept zur Vermeidung der Überschuldung<br />
Durch die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals <strong>in</strong>nerhalb der mittelfristigen Ergebnisund<br />
F<strong>in</strong>anzplanung kann aufgezeigt worden se<strong>in</strong>, dass im Haushaltsjahr oder <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em der drei folgenden Planjahre<br />
die allgeme<strong>in</strong>e RÄcklage aufgebraucht wird, tritt als Rechtsfolge unmittelbar die Verpflichtung der Geme<strong>in</strong>de<br />
zur Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes nach É 76 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> e<strong>in</strong>. Weil es im S<strong>in</strong>ne der stetigen<br />
AufgabenerfÄllung der Geme<strong>in</strong>de zu verh<strong>in</strong>dern gilt, dass der Prozess des Eigenkapitalverzehrs e<strong>in</strong>e unbeherrschbare<br />
Dynamik annehmen kann, ist es auch im Interesse der Geme<strong>in</strong>den sachgerecht, dass <strong>in</strong> diesen<br />
FÅllen die AufsichtsbehÇrden bei ihrer Genehmigung zur Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage von der Geme<strong>in</strong>de<br />
die Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes verlangen.<br />
Im Rahmen der Aufstellung und Umsetzung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes nach É 76 Abs. 1 Nr. 3 GO<br />
<strong>NRW</strong> ist <strong>in</strong>sbesondere e<strong>in</strong>e enge Zusammenarbeit zwischen der Geme<strong>in</strong>de und ihrer AufsichtsbehÇrde zur Beseitigung<br />
der entstandenen Fehlentwicklung und Vermeidung des E<strong>in</strong>tritts e<strong>in</strong>er àberschuldung notwendig. In<br />
e<strong>in</strong>em unter dieser Zwecksetzung aufzustellenden Haushaltssicherungskonzept ist zu berÄcksichtigen, dass die<br />
GegenmaÖnahmen zum mÇglichen Eigenkapitalverzehr auch Elemente der MaÖnahmen enthalten mÄssen, die<br />
fÄr e<strong>in</strong>en Eigenkapitalaufbau geeignet s<strong>in</strong>d.<br />
7.2.3.2 Sanierungsplan<br />
7.2.3.1 Sanierungsplan zur Beseitigung der Überschuldung<br />
Bei e<strong>in</strong>getretener àberschuldung, die durch den Ansatz des Postens „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“<br />
auf der Aktivseite der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz ausgewiesen wird (vgl. É 43 Abs. 7 i.V.m. É 41 Abs. 3 Nr. 4<br />
GemHVO <strong>NRW</strong>), muss der Blick zw<strong>in</strong>gend auf den Aufbau von Eigenkapital gerichtet werden, der auch die notwendige<br />
Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs e<strong>in</strong>schlieÖt. Der bestehende VerstoÖ gegen das Verbot der<br />
àberschuldung (vgl. É 75 Abs. 7 GO <strong>NRW</strong>) steht im Mittelpunkt der Betrachtung, so dass die notwendigen GegenmaÖnahmen<br />
der Geme<strong>in</strong>de auf die Beendigung dieses VerstoÖes zielen mÄssen.<br />
E<strong>in</strong>e s<strong>in</strong>nvolle und sachgerechte EigenkapitalgrÇÖe fÄr die Geme<strong>in</strong>den als Wertansatz der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage<br />
(vgl. É 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO <strong>NRW</strong>) kann derzeit noch nicht bestimmt werden. Gleichwohl besteht nach den<br />
haushaltsrechtlichen Vorschriften jedoch e<strong>in</strong>e zu erfÄllende M<strong>in</strong>destanforderung. Die Geme<strong>in</strong>de muss daher auf<br />
jeden Fall zielgerichtete haushaltswirtschaftliche MaÖnahmen ergreifen, damit auf der Aktivseite der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Bilanz ke<strong>in</strong> Posten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ mehr auszuweisen ist. Daraus folgt<br />
auch, dass ggf. auf e<strong>in</strong>e lÅngere Zeit vielfÅltige GegenmaÖnahmen von der Geme<strong>in</strong>de umgesetzt werden mÄssen,<br />
um e<strong>in</strong>e kÄnftige àberschuldung wirksam auf Dauer zu vermeiden.<br />
Die besonderen Ziel- und Zwecksetzung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft erfordern e<strong>in</strong>en geeigneten Sanierungsplan<br />
als Eigenkapitalaufbaukonzept (EAK). Mit dem Haushaltssicherungskonzept nach É 76 GO <strong>NRW</strong><br />
kÇnnen aber auch andere Strategien verfolgt werden. Der Sanierungsplan wird als umfassendes Sanierungskonzept<br />
zum zukunftsorientierten Leitfaden (Gesamtkonzept der Geme<strong>in</strong>de), <strong>in</strong> dem die grundsÅtzlichen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<br />
fÄr die Sicherung der stetigen AufgabenerfÄllung der Geme<strong>in</strong>de und die Steuerung des Haushalts<br />
sowie den Erhalt des Eigenkapitals festgelegt werden. Gleichzeitig muss der Sanierungsplan e<strong>in</strong> erweitertes<br />
Planungssystem als der Haushaltsplan enthalten, das als Handlungsrichtschnur dienen soll und deshalb die konkreten<br />
und akuten Schritte aufzuzeigen hat, die sofort und <strong>in</strong> der weiteren Zukunft von der Geme<strong>in</strong>de zu gehen<br />
s<strong>in</strong>d. Besondere Eckpunkte sowie die Chancen und Risiken fÄr die Geme<strong>in</strong>de s<strong>in</strong>d dabei besonders herauszustellen.<br />
Der Sanierungsplan verkÇrpert somit e<strong>in</strong>e Leitl<strong>in</strong>ie fÄr das Handeln der Geme<strong>in</strong>de und fÄr die Verhandlungen<br />
mit Dritten. Die Frage, ob und ggf. welche Schlussfolgerungen bei Vorliegen der àberschuldung der Ge-<br />
GEMEINDEORDNUNG 244
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
Ä 75 GO <strong>NRW</strong><br />
me<strong>in</strong>de zu ziehen s<strong>in</strong>d und ob und welche Formen des aufsichtsrechtlichen Handelns angezeigt s<strong>in</strong>d, bedarf noch<br />
weiterer ErÇrterungen und Abstimmungen. Es sollen mÇglichst praktikable Antworten gefunden werden.<br />
7.2.3.2 Die Stufen e<strong>in</strong>es Sanierungsplans<br />
Die fÄnf Stufen e<strong>in</strong>es Gesamtkonzeptes der Geme<strong>in</strong>de kÇnnen z.B. Folgende se<strong>in</strong>, wobei jeder Stufe e<strong>in</strong>e eigene<br />
Bedeutung zukommt, aber gleichzeitig besteht auch e<strong>in</strong> Zusammenhang zwischen den e<strong>in</strong>zelnen Stufen (vgl.<br />
Abbildung).<br />
Stufe 1<br />
Stufe 2<br />
Stufe 3<br />
Stufe 4<br />
Stufe 5<br />
GEMEINDEORDNUNG 245<br />
Stufen e<strong>in</strong>es Sanierungsplans<br />
Gesamtkonzept der Geme<strong>in</strong>de zur KrisenbewÅltigung (Sanierungsplan)<br />
Sensibilisierung/ Krisenerkenntnis<br />
(Befangenheit der Betroffenen)<br />
Krisenursachen identifizieren<br />
(SanierungswÄrdigkeit und SanierungsfÅhigkeit feststellen)<br />
Sanierungskonzept - Leitl<strong>in</strong>ie fÄr e<strong>in</strong>e Sanierung<br />
(Ursachen - Analyse - Lage - Ziele)<br />
Implementierung des Sanierungskonzepts<br />
(leistungs- und f<strong>in</strong>anzwirtschaftliche, organisatorische<br />
MaÖnahmen)<br />
Sanierungscontroll<strong>in</strong>g<br />
(Identifizierung des Sanierungserfolges, Kennzahlen,<br />
Planungsrechnungen und Planbilanz)<br />
Abbildung 28 „Stufen e<strong>in</strong>es Sanierungsplans“<br />
Bedrohung erkennen<br />
und ernst nehmen<br />
Sich schlÄssig auf wesentliche<br />
Kernfragen<br />
konzentrieren<br />
Perspektive und Vision<br />
der Sanierung vermitteln<br />
Zustimmung und Motivation<br />
der Beteiligten<br />
auslÇsen<br />
Erfolgreiche Umsetzung<br />
messen, Chancen und<br />
Risiken neu e<strong>in</strong>schÅtzen<br />
Aufgrund der groÖen Bedeutung der Krisensituation der Geme<strong>in</strong>de fÄr den Rat und die Verwaltung sowie die<br />
BÄrger<strong>in</strong>nen und BÄrger muss im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>es Gesamtkonzeptes e<strong>in</strong>e Struktur erarbeitet werden, die den gesamten<br />
Ablauf der BewÅltigung der wirtschaftlichen Krise der Geme<strong>in</strong>de be<strong>in</strong>haltet und die Grundlage fÄr die notwendigen<br />
Handlungen der Geme<strong>in</strong>de bietet.<br />
������������
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 76 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 76<br />
Haushaltssicherungskonzept<br />
(1) 1 Die Geme<strong>in</strong>de hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit e<strong>in</strong> Haushaltssicherungskonzept aufzustellen<br />
und dar<strong>in</strong> den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder<br />
hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts<br />
1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>es Haushaltsjahres der <strong>in</strong> der Schlussbilanz des<br />
Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage um mehr als e<strong>in</strong> Viertel verr<strong>in</strong>gert wird oder<br />
2. <strong>in</strong> zwei aufe<strong>in</strong>anderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den <strong>in</strong> der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden<br />
Ansatz der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage jeweils um mehr als e<strong>in</strong> Zwanzigstel zu verr<strong>in</strong>gern oder<br />
3. <strong>in</strong>nerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung die allgeme<strong>in</strong>e Rücklage aufgebraucht<br />
wird.<br />
2 Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gem. § 95 Abs. 3.<br />
(2) 1 Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen e<strong>in</strong>er geordneten Haushaltswirtschaft die künftige,<br />
dauernde Leistungsfähigkeit der Geme<strong>in</strong>de zu erreichen. 2 Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.<br />
3 Die Genehmigung kann nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass<br />
spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung der Haushaltsausgleich nach § 75<br />
Abs. 2 wieder erreicht wird. 4 Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bed<strong>in</strong>gungen und<br />
mit Auflagen erteilt werden.<br />
Erläuterungen zu § 76:<br />
I. Allgeme<strong>in</strong>es<br />
1. Voraussetzungen für e<strong>in</strong> Haushaltssicherungskonzept<br />
Die Vorschrift bestimmt näher, unter welchen Voraussetzungen die Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong> Haushaltssicherungskonzept<br />
aufzustellen hat. Sie knüpft e<strong>in</strong>erseits an die Bestimmungen zum Haushaltsausgleich <strong>in</strong> § 75 GO <strong>NRW</strong> an, nach<br />
denen die Verr<strong>in</strong>gerung des Eigenkapitals durch Inanspruchnahme der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage der aufsichtsbehördlichen<br />
Genehmigung bedarf und andererseits an die im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan enthaltene mittelfristige<br />
Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung. Mit der zusammenfassenden Darstellung der mehrjährigen Haushaltsplanung der<br />
Geme<strong>in</strong>de soll erreicht werden, dass Gefährdungen der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft früher als bisher erkannt<br />
und Maßnahmen zu deren Beseitigung ergriffen werden. Das Instrument „Haushaltssicherungskonzept“<br />
(vgl. § 5 GemHVO <strong>NRW</strong>) dient dabei dazu, die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Geme<strong>in</strong>de zu sichern bzw.<br />
wieder herzustellen.<br />
Im Unterschied zur (e<strong>in</strong>fachen) Genehmigungspflicht nach § 75 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong> liegt der Verpflichtung zur Aufstellung<br />
e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes die Annahme zu Grunde, die Geme<strong>in</strong>de werde den Haushaltsausgleich<br />
nicht im nachfolgenden Haushaltsjahr erreichen. Sie hat deshalb - wie bisher – den nächstmöglichen Zeitpunkt<br />
zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist. Im Haushaltssicherungskonzept<br />
s<strong>in</strong>d daher die Ausgangslage der Geme<strong>in</strong>de, die Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung und deren vorgesehene<br />
Beseitigung zu beschreiben. Es soll zudem die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs<br />
<strong>in</strong> Planung und Rechnung (vgl. § 75 Abs. 2 S. 1 GO <strong>NRW</strong>) gewährleisten. Auch soll aufgezeigt werden,<br />
wie nach der Umsetzung der im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Maßnahmen der geme<strong>in</strong>dliche Haushalt<br />
so gesteuert werden kann, dass er <strong>in</strong> Zukunft dauerhaft ausgeglichen se<strong>in</strong> wird und die dauerhafte Leistungsfähigkeit<br />
bzw. die Aufgabenerfüllung der Geme<strong>in</strong>de (vgl. § 75 Abs. 1 S. 1 GO <strong>NRW</strong>) wieder gesichert ist.<br />
In der Vorschrift s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> den Nummern 1 bis 3 des Absatzes 1 die Tatbestände aufgeführt, die jeweils die Pflicht<br />
zur Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes begründen. Sie beschreiben die Verr<strong>in</strong>gerung des Eigenka-<br />
GEMEINDEORDNUNG 246
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 76 GO <strong>NRW</strong><br />
pitals auf mehrere Arten, die nach Art oder Höhe jeweils so schwer wiegend s<strong>in</strong>d, dass periodenübergreifende<br />
Maßnahmen durch e<strong>in</strong> Haushaltssicherungskonzept erforderlich werden. Dabei kommt dem unverhältnismäßig<br />
hohen Vermögensverzehr (Eigenkapitalabbau) nach Nummer 1 das gleiche Gewicht zu wie se<strong>in</strong>er stetigen,<br />
„schleichenden“ Verr<strong>in</strong>gerung nach den Nummern 2 und 3.<br />
In diesem Zusammenhang ist darauf h<strong>in</strong>zuweisen, dass bei e<strong>in</strong>em unausgeglichenen Haushalt die Geme<strong>in</strong>den<br />
nach § 75 Abs. 2 und 3 GO <strong>NRW</strong> durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage e<strong>in</strong>en erheblichen Anteil ihres<br />
Eigenkapitals (e<strong>in</strong> Drittel) zur Deckung des Fehlbetrages genehmigungsfrei e<strong>in</strong>setzen dürfen. Selbst e<strong>in</strong>e weitere<br />
Verr<strong>in</strong>gerung des Eigenkapitals nach § 75 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong> löst unterhalb der Schwellenwerte des § 76 Abs. 1<br />
GO <strong>NRW</strong> noch nicht die Pflicht zur Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes aus. Die Geme<strong>in</strong>de darf<br />
nicht <strong>in</strong> Berufung auf ihr Selbstverwaltungsrecht die Verpflichtung vernachlässigen, e<strong>in</strong>e geordnete Haushaltswirtschaft<br />
sicherzustellen. Daher darf sich e<strong>in</strong>e Geme<strong>in</strong>de auch nicht auf Grund ihrer möglichen E<strong>in</strong>schätzung,<br />
dass ihr Haushaltssicherungskonzept voraussichtlich nicht genehmigungsfähig se<strong>in</strong> wird, ihrer Pflicht zur Aufstellung<br />
e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes.<br />
2. Ursache und Verpflichtung für e<strong>in</strong> Haushaltssicherungskonzept<br />
Im NKF können die Verpflichtung zur Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes und die Ursache, die<br />
diese Pflicht auslöst, <strong>in</strong> unterschiedliche Haushaltsjahre fallen. In die Prüfung, ob e<strong>in</strong>e Überschreitung der<br />
Schwellenwerte des § 76 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> vorliegt, ist deshalb nicht nur das Haushaltsjahr, für das e<strong>in</strong> neuer<br />
Haushalt aufgestellt wird, e<strong>in</strong>zubeziehen. Vielmehr s<strong>in</strong>d die Tatbestände dieser Vorschrift auch dann erfüllt, wenn<br />
die Schwellenwerte <strong>in</strong> den dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahren der mittelfristigen Ergebnis- und<br />
F<strong>in</strong>anzplanung überschritten werden. Der Ausweis e<strong>in</strong>es negativen Jahresergebnisses <strong>in</strong> den Jahresspalten des<br />
Ergebnisplans erfordert daher e<strong>in</strong>e Überprüfung, ob und <strong>in</strong> welchem Umfang e<strong>in</strong>e Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en<br />
Rücklage voraussichtlich erforderlich wird. Diese Gegebenheiten sollte Anlass se<strong>in</strong>, die notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen<br />
und deren Umfang festzulegen.<br />
Die Pflicht der Geme<strong>in</strong>de, e<strong>in</strong> Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, beg<strong>in</strong>nt ab dem Haushaltsjahr, für das<br />
der Haushalt aufgestellt wird. Die Frist für den Zeitpunkt, zu dem der Haushaltsausgleich nach § 76 Abs. 2 GO<br />
<strong>NRW</strong> wieder herzustellen ist, läuft allerd<strong>in</strong>gs erst ab dem Haushaltsjahr, <strong>in</strong> dem e<strong>in</strong> negatives Jahresergebnis<br />
tatsächlich zur Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage oberhalb des Schwellenwertes führt. Damit werden mögliche<br />
Nachteile für die betroffenen Geme<strong>in</strong>den vermieden (vgl. Runderlass des Innenm<strong>in</strong>isteriums vom<br />
09.06.2006). Diese würden dann auftreten, wenn das auslösende Ereignis (Überschreitung des Schwellenwertes)<br />
erst <strong>in</strong> der Zukunft e<strong>in</strong>tritt, die Frist für die Genehmigungsfähigkeit (Frist zur Erreichung des Haushaltsausgleichs)<br />
aber bereits ab dem Haushaltsjahr, für das der Haushalt aufgestellt wird, liefe.<br />
Im Falle der Überschreitung der Schwellenwerte nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO <strong>NRW</strong> beg<strong>in</strong>nt die Frist demnach auch<br />
erst ab dem zweiten Jahr der Überschreitung zu laufen. Der Konsolidierungszeitraum kann <strong>in</strong> diesen Fällen allerd<strong>in</strong>gs<br />
über den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung, bezogen auf das Haushaltsjahr, für das<br />
der Haushalt aufgestellt wird, h<strong>in</strong>aus reichen. Liegt das e<strong>in</strong> Haushaltssicherungskonzept auslösende Ereignis z.B.<br />
erst im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis und F<strong>in</strong>anzplanung (z.B. für den Haushalt 2011 im Jahre 2014)<br />
kann sich der Zeitraum, bei dem für e<strong>in</strong> Haushaltssicherungskonzept grundsätzlich noch die Genehmigungsfähigkeit<br />
gegeben se<strong>in</strong> kann, über maximal sieben Jahre ausdehnen (im Beispiel bis Ende des Jahres 2017).<br />
3. Haushaltssicherungskonzept beim Jahresabschluss<br />
Entsteht bei der Bestätigung über den Jahresabschluss für die Geme<strong>in</strong>de die Pflicht zur Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes,<br />
bewirkt die B<strong>in</strong>dung des Haushaltssicherungskonzeptes an den Haushaltsplan, dass<br />
entsprechend wie bei der Aufstellung im Rahmen der Haushaltsplanung e<strong>in</strong>e Frist von drei Jahren nach dem<br />
GEMEINDEORDNUNG 247
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 76 GO <strong>NRW</strong><br />
Ursachenjahr zur Erreichung des Haushaltsausgleichs e<strong>in</strong>zuhalten ist, damit auch e<strong>in</strong>e Genehmigungsfähigkeit<br />
des Haushaltssicherungskonzeptes gegeben ist. Sie bewirkt dagegen nicht, dass das bereits abgeschlossene<br />
Haushaltsjahr als Ursachenjahr für die Wiederherstellungsfrist für den Haushaltsausgleich heranzuziehen ist.<br />
E<strong>in</strong>e Pflicht zur Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes im Rahmen des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses<br />
entsteht tatsächlich erst dann, wenn durch die Aufstellung und Bestätigung des Jahresabschlusses<br />
durch den Bürgermeister e<strong>in</strong> qualifizierter Jahresabschluss für das abgelaufene Haushaltsjahr entstanden ist, der<br />
e<strong>in</strong> entsprechendes Jahresergebnis aufweist, durch das die <strong>in</strong> dieser Vorschrift bestimmten Schwellenwerte überschritten<br />
werden. Im dritten diesem Ereignis folgenden Haushaltsjahr muss dann der Haushaltsausgleich<br />
wieder erreicht werden, damit e<strong>in</strong>e Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssicherungskonzeptes gegeben ist, auch<br />
wenn die Haushaltsbewirtschaftung des abgeschlossenen Haushaltsjahres als Auslöser der Ursache für die<br />
Pflicht zur Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes bewertet und damit auch als Fristbeg<strong>in</strong>n für die Wiedererreichung<br />
des Haushaltsausgleichs angesehen werden könnte.<br />
In den Fällen, <strong>in</strong> denen e<strong>in</strong> Haushaltssicherungskonzept im Rahmen der Bestätigung über den Jahresabschluss<br />
aufzustellen ist, bewirkt die B<strong>in</strong>dung des Haushaltssicherungskonzeptes an den Haushaltsplan nach § 79 Abs. 2<br />
Satz 2 GO <strong>NRW</strong>, dass dieses Haushaltssicherungskonzept zum Bestandteil des Haushaltsplans des nächsten<br />
der Bestätigung des Jahresabschlusses folgenden Haushaltsjahres zu machen ist. Diese haushaltsrechtliche<br />
Zuordnung gibt ke<strong>in</strong>e Berechtigung, die auf das Ursachenjahr bezogene Fristsetzung für die Wiederherstellung<br />
des Haushaltsausgleichs zu verändern bzw. zu verlängern.<br />
4. Das Risikofrüherkennungssystem<br />
4.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Jede Geme<strong>in</strong>de muss prüfen, ob sie e<strong>in</strong> Risikofrüherkennungssystem e<strong>in</strong>richtet, wie es für Eigenbetriebe vorgeschrieben<br />
ist (vgl. § 10 Abs. 1 EigVO <strong>NRW</strong>), denn im Lagebericht soll auch über die Risiken, die die wirtschaftliche<br />
Lage der Geme<strong>in</strong>de erheblich bee<strong>in</strong>flussen können, berichtet werden. Zur Risikofrüherkennung gehören<br />
<strong>in</strong>sbesondere die Risikoidentifikation und die Risikobewertung, die Maßnahmen der Risikobewältigung e<strong>in</strong>schließlich<br />
der Risikokommunikation, die Risikoüberwachung bzw. die Risikofortschreibung und die Dokumentation.<br />
E<strong>in</strong>e ständige Beobachtung möglicher Risikoquellen und ihre Veränderungen ist für die Geme<strong>in</strong>de unerlässlich,<br />
z.B. der Geld- und Kreditmarkt, die Energiemärkte. Aber auch die Entwicklungen im Steuerecht, europäische<br />
Entwicklungen sowie Veränderungen im allgeme<strong>in</strong>en Geschäftsverkehr können e<strong>in</strong>en Anlass für Risiken und<br />
Chancen der Geme<strong>in</strong>de bieten. Vor dem H<strong>in</strong>tergrund, dass die Geme<strong>in</strong>de verpflichtet ist, ihre Leistungsfähigkeit<br />
zu erhalten und ihre stetige Aufgabenerfüllung zu sichern, ist e<strong>in</strong> Überwachungssystem, das es ermöglicht,<br />
etwaige bestandsgefährdende Entwicklungen für die Geme<strong>in</strong>de frühzeitig zu erkennen, hilfreich.<br />
4.2 Die Grundsätze ordnungsmäßiger Risikoüberwachung (GoR)<br />
Die Ziele und Zwecke sowie die Fragen der E<strong>in</strong>richtung und Ausgestaltung e<strong>in</strong>es Risikofrüherkennungssystems<br />
<strong>in</strong> Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten der Geme<strong>in</strong>de machen es sachlich erforderlich, die Grundsätze,<br />
die sich für die Risikoüberwachung <strong>in</strong> der Betriebswirtschaftslehre und bei der Anwendung im kaufmännischen<br />
Bereich entwickeln, von Anfang an auch im geme<strong>in</strong>dlichen Bereich <strong>in</strong> der Anwendung zu erproben. Solche<br />
allgeme<strong>in</strong>en Grundsätze verh<strong>in</strong>dern nicht, dass sich aus den örtlichen Besonderheiten der Geme<strong>in</strong>den<br />
heraus noch zusätzliche, aber durchaus auch unterschiedliche Anforderungen an e<strong>in</strong> Risikofrüherkennungssystem<br />
ergeben können.<br />
GEMEINDEORDNUNG 248
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 76 GO <strong>NRW</strong><br />
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Risikoüberwachung werden <strong>in</strong> allgeme<strong>in</strong>e und besondere Grundsätze untergliedert.<br />
Die allgeme<strong>in</strong>en Grundsätze be<strong>in</strong>halten allgeme<strong>in</strong>e Handlungsvorgaben, die im Zusammenhang mit<br />
e<strong>in</strong>er pflichtgemäßen Risikoüberwachung stehen. Die besonderen Grundsätze füllen die Handlungsempfehlungen<br />
zur Ausgestaltung e<strong>in</strong>es Risikoüberwachungssystems weiter aus. Die allgeme<strong>in</strong>en und die besonderen<br />
Grundsätze ordnungsmäßiger Risikoüberwachung, die die Handlungsempfehlungen zur Ausgestaltung e<strong>in</strong>es<br />
Risikoüberwachungssystems weiter ausfüllen und sich den allgeme<strong>in</strong>en Grundsätzen unterordnen müssen,<br />
werden nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung).<br />
Grundsätze ordnungsmäßiger Risikoüberwachung (GoR)<br />
Grundsatz<br />
der Gesetzmäßigkeit<br />
Grundsatz<br />
der Ordnungsmäßigkeit<br />
und Systematik<br />
Grundsatz<br />
der Wirtschaftlichkeit<br />
Grundsatz<br />
der Risikostrategiebestimmung<br />
Grundsatz der E<strong>in</strong>richtung<br />
e<strong>in</strong>er Organisationsstruktur<br />
Grundsatz<br />
der vollständigen Risikoermittlung<br />
Grundsatz<br />
der vorsichtigen Risikobewertung<br />
Grundsatz<br />
der Wesentlichkeit<br />
Grundsatz<br />
der Kommunikation<br />
Allgeme<strong>in</strong>e Grundsätze der GoR<br />
Der Grundsatz, der die Forderung nach der Kenntnis, Beachtung<br />
und entsprechender Überwachung aller gesetzlichen<br />
und rechtlichen Regelungen umfasst.<br />
Der Grundsatz, der verlangt, dass das Risikoüberwachungssystem<br />
klar und übersichtlich se<strong>in</strong> muss sowie e<strong>in</strong>er<br />
Ordnung bzw. e<strong>in</strong>e Struktur besitzen muss, damit z.B. der<br />
Entstehungsbereich von Risiken e<strong>in</strong>deutig erkennbar wird.<br />
Der Grundsatz, damit die gewählten Maßnahmen die beste<br />
Alternative für die Geme<strong>in</strong>de darstellen und Chancen und<br />
Risiken angemessen gegene<strong>in</strong>ander abgewogen werden.<br />
Besondere Grundsätze der GoR<br />
GEMEINDEORDNUNG 249<br />
Der Grundsatz, der Vorgaben verlangt, wie <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>de<br />
mit Risiken umzugehen ist, z.B. welche Risiken e<strong>in</strong>gegangen<br />
werden können, <strong>in</strong> welchem Verhältnis Chancen und<br />
Risiken zu e<strong>in</strong>ander stehen sollen.<br />
Der Grundsatz, der verlangt, Strukturen und Systeme zu<br />
schaffen, anhand dessen sich die e<strong>in</strong>zelnen Risikostrategievorgaben<br />
umsetzen und ggf. neu ausrichten lassen.<br />
Der Grundsatz, der be<strong>in</strong>haltet, dass das Risikoüberwachungssytem<br />
so auszugestalten ist, dass möglichst alle<br />
Risiken aus sämtlichen Aufgabenbereichen der Geme<strong>in</strong>de<br />
erfasst werden.<br />
Der Grundsatz, der e<strong>in</strong>e systematische Aufarbeitung der<br />
Grundlagendaten verlangt, so dass ihre Relevanz für die<br />
Risiken und Chancen der Geme<strong>in</strong>de erkennbar wird.<br />
Der Grundsatz, der verlangt, die Informationen aus den<br />
gesammelten und bewerteten geme<strong>in</strong>dlichen Daten auf den<br />
wesentlichen Kern h<strong>in</strong>sichtlich der ermittelten Risiken zu<br />
beschränken und e<strong>in</strong>e Überfrachtung zu vermeiden.<br />
Der Grundsatz, der verlangt, geme<strong>in</strong>de<strong>in</strong>tern die Voraussetzungen<br />
dafür zu schaffen, dass risikobehaftete Sachverhalte<br />
zeitnah der Verwaltungsführung zur Kenntnis gelangen, ggf.<br />
je nach Risikosachverhalt e<strong>in</strong>e Abstufung nach sachlichen<br />
Risikoklassen zuzulassen.
Grundsatz<br />
der Dokumentation<br />
Grundsatz<br />
der Stetigkeit<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 76 GO <strong>NRW</strong><br />
Der Grundsatz, der verlangt, dass sämtliche ergriffenen<br />
Maßnahmen <strong>in</strong> Schriftform niedergelegt oder <strong>in</strong> der Datenverarbeitung<br />
dokumentativ erfasst werden, um die E<strong>in</strong>haltung<br />
von Überwachungsmaßnahmen zu gewährleisten bzw.<br />
sicherzustellen und e<strong>in</strong>er Nachweispflicht zu genügen.<br />
Der Grundsatz, der e<strong>in</strong>e Stetigkeit der Methoden zur Ermittlung<br />
risikorelevanter Sachverhalte verlangt, um e<strong>in</strong>en Vergleich<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Zeitreihe zu ermöglichen, so dass Abweichungen<br />
im Zeitablauf und die hierfür maßgeblichen Erwägungen<br />
erkennbar und nachvollziehbar werden.<br />
Abbildung 29 „Grundsätze ordnungsmäßiger Risikoüberwachung (GoR)“<br />
4.3 Die Ausgestaltung e<strong>in</strong>es Risikofrüherkennungssystems<br />
4.3.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die Ausgestaltung e<strong>in</strong>es Risikofrüherkennungssystems ist abhängig von den örtlichen Gegebenheiten der Geme<strong>in</strong>de,<br />
z.B. von der Geme<strong>in</strong>degröße, der Organisation der Verwaltung, der haushaltswirtschaftlichen Lage.<br />
Daraus können sich unterschiedliche Anforderungen an e<strong>in</strong> solches System ergeben, <strong>in</strong> dem alle Aufgabenbereiche<br />
zu berücksichtigen s<strong>in</strong>d. Es s<strong>in</strong>d ke<strong>in</strong>e konkreten landesweiten Systemvorgaben sachgerecht, denn die<br />
Beantwortung der Frage nach dem Vorliegen oder Nichtvorliegen e<strong>in</strong>es Risikos hängt von der Risikoakzeptanz<br />
<strong>in</strong> der e<strong>in</strong>zelnen Geme<strong>in</strong>de ab.<br />
Für die Wirksamkeit und den Erfolg e<strong>in</strong>es Risikofrüherkennungssystems ist daher die <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>de vorhandene<br />
Risikokultur und Risikopolitik sowie das vorhandene Risikobewusstse<strong>in</strong> von wesentlicher Bedeutung. Die<br />
Ausgestaltung e<strong>in</strong>es Risikofrüherkennungssystems muss unter der Abwägung von Vor- und Nachteilen sowie<br />
den Besonderheiten der Geme<strong>in</strong>de nachvollziehbar gemacht werden. Dabei kann e<strong>in</strong> Risikofrüherkennungssystem<br />
von der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> weiteren Entwicklungsschritten <strong>in</strong> e<strong>in</strong> „konzernweites“ Risikofrüherkennungssystem<br />
überführt werden. Die daneben ggf. bestehende Verpflichtung der Betriebe der Geme<strong>in</strong>de, jeweils auch e<strong>in</strong><br />
eigenes Risikofrüherkennungssystem e<strong>in</strong>zurichten, bleibt unberührt (vgl. § 10 Abs. 1 EigVO <strong>NRW</strong>). Das Risikofrüherkennungssystem<br />
muss auch ausreichend dokumentiert werden.<br />
4.3.2 Besondere Inhalte<br />
Die Ausgestaltung e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Risikofrüherkennungssystems sollte sich an der Art und dem Umfang<br />
sowie der Struktur der von der Geme<strong>in</strong>de übernommenen Risiken, aber auch an der örtlichen Risikosteuerung<br />
orientieren. So gilt es u.a., die mit dem Risikofrüherkennungssystem verbundenen Aufgaben klar zu def<strong>in</strong>ieren<br />
und gegene<strong>in</strong>ander abzugrenzen, die Verantwortlichkeiten <strong>in</strong>nerhalb der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung im E<strong>in</strong>zelnen<br />
festzulegen und die Effektivität und Effizienz des e<strong>in</strong>gerichteten Systems e<strong>in</strong>er regelmäßigen Überwachung<br />
zu unterziehen. Es sollte zudem sichergestellt werden, dass geeignete Verfahren benutzt werden, um wesentliche<br />
Risiken frühzeitig zu erkennen. Auch müssen zeitnahe Anpassungen möglich se<strong>in</strong>, wenn sich externe<br />
und/oder <strong>in</strong>terne Rahmenbed<strong>in</strong>gungen verändert haben.<br />
Die vorzunehmende Risikobewertung durch die Geme<strong>in</strong>de sollte mit den zu Grunde gelegten Annahmen und<br />
Daten sowie den daraus gezogenen Schlussfolgerungen ausreichend dokumentiert werden. Die geme<strong>in</strong>dliche<br />
Risikosteuerung umfasst dabei die von der Geme<strong>in</strong>de getroffenen Maßnahmen über den Umgang mit den ermittelten<br />
Risiken sowie die Festlegung und Bemessung der Übernahme von Risiken durch die Geme<strong>in</strong>de unter<br />
Berücksichtigung ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Daraus folgt <strong>in</strong>sgesamt, dass die Ergebnisse e<strong>in</strong>es<br />
Risikofrüherkennungssystems nicht im Widerspruch zur Geschäftstätigkeit der Geme<strong>in</strong>de stehen sollen.<br />
GEMEINDEORDNUNG 250
4.4 Die E<strong>in</strong>beziehung <strong>in</strong> die Jahresabschlussprüfung<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 76 GO <strong>NRW</strong><br />
Das geme<strong>in</strong>dliche Risikofrüherkennungssystem ist zudem auch e<strong>in</strong> Gegenstand der Jahresabschlussprüfung,<br />
bei der es zu beurteilen gilt, ob das e<strong>in</strong>gerichtete System und dessen Umsetzung mit dem Umfang, der Art und<br />
der Komplexität der von der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>gegangenen Risiken <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang steht und angemessen ist. Dazugehört<br />
auch die <strong>in</strong>terne Berichterstattung im Rahmen des örtlichen Risikomanagements sowie dessen Überwachung.<br />
Der Abschlussprüfer soll daher im Prüfungsbericht zum geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss auch auf die<br />
wesentlichen Ergebnisse se<strong>in</strong>er Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Risikofrüherkennungssystems e<strong>in</strong>gehen.<br />
II. Erläuterungen im E<strong>in</strong>zelnen<br />
1. Zu Absatz 1 (Pflicht zur Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes):<br />
1.01 Zwecke der geme<strong>in</strong>dlichen Pflicht<br />
Die Regelungen des Satzes 1 <strong>in</strong> Absatz 1 s<strong>in</strong>d darauf abgestellt, dass die Pflicht zur Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes<br />
im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans entsteht. Vor diesem H<strong>in</strong>tergrund ist <strong>in</strong> § 79<br />
Abs. 2 Satz 2 GO <strong>NRW</strong> bestimmt worden, dass das Haushaltssicherungskonzept Teil des Haushaltsplans ist. Der<br />
geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsplan besteht daher neben dem Ergebnisplan, dem F<strong>in</strong>anzplan und den Teilplänen auch<br />
aus dem Haushaltssicherungskonzept, wenn e<strong>in</strong> solches erstellt werden muss (vgl. § 1 Abs. 1 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
Dies bed<strong>in</strong>gt, dass e<strong>in</strong> Haushaltssicherungskonzept nur genehmigungsfähig ist, wenn aus ihm hervorgeht, dass<br />
spätestens im dritten Jahr nach dem Ursachenjahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 wieder erreicht wird.<br />
In dem Fall, dass e<strong>in</strong> Haushaltssicherungskonzept erst im Rahmen der Bestätigung über den Jahresabschluss<br />
aufzustellen ist (Satz 2), bewirkt die B<strong>in</strong>dung des Haushaltssicherungskonzeptes an den Haushaltsplan nach § 79<br />
Abs. 2 Satz 2 GO <strong>NRW</strong>, dass dieses Haushaltssicherungskonzept zum Bestandteil des Haushaltsplans des<br />
nächsten der Bestätigung des Jahresabschlusses folgenden Haushaltsjahres zu machen ist. Es kann wegen der<br />
erfolgten Beschlussfassung des Rates über die Haushaltssatzung des laufenden Haushaltsjahres und wegen der<br />
bereits e<strong>in</strong>getretenen B<strong>in</strong>dungswirkung des Haushaltsplans als Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de<br />
nach § 79 Abs. GO <strong>NRW</strong> i.d.R. nicht mehr zum Bestandteil dieses Haushaltsplans gemacht werden, ggf.<br />
aber noch im Rahmen e<strong>in</strong>er Nachtragssatzung.<br />
Die Pflicht der Geme<strong>in</strong>de, beim Überschreiten der <strong>in</strong> der Vorschrift bestimmten Schwellenwerte e<strong>in</strong> Haushaltssicherungskonzept<br />
im Zeitpunkt der Haushaltsplanung (Satz 1) als auch im Zeitpunkt der Bestätigung des Jahresabschlusses<br />
(Satz 2) aufzustellen, lässt nicht zu, die E<strong>in</strong>haltung der gesetzlichen Voraussetzung jeweils nur<br />
streng getrennt nach Zeitpunkten (Sätze 1 und 2) zu betrachten. Vielmehr gebieten es die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft<br />
sowie die mit der Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes verbundenen Ziele und Zwecke,<br />
dass auch dann e<strong>in</strong>e Pflicht der Geme<strong>in</strong>de zur Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes entsteht, wenn<br />
die Schwellenwerte zusammenhängend im Jahresabschluss und <strong>in</strong> der Haushaltsplanung unterschiedlicher<br />
Haushaltsjahre überschritten werden.<br />
In diesem Zusammenhang gilt die Pflicht, den Haushaltsausgleich wieder herzustellen, nicht e<strong>in</strong>schränkungslos.<br />
Der dafür zu bestimmende nächstmögliche Zeitpunkt ist auch unter Berücksichtigung des Zumutbaren festzulegen.<br />
Mit diesem Zeitpunkt ist nicht nur e<strong>in</strong> re<strong>in</strong> theoretischer Zeitpunkt geme<strong>in</strong>t, sondern e<strong>in</strong> Zeitpunkt, der unter<br />
Berücksichtigung der Pflichten und Möglichkeiten der Geme<strong>in</strong>de erreichbar ist. Dieses Verhalten der Geme<strong>in</strong>de<br />
bestimmt sich aber auch nach den rechtlichen Vorgaben, die bestimmte Handlungen der Geme<strong>in</strong>de sowie der<br />
von der Geme<strong>in</strong>de zu beachtenden Haushaltsgrundsätze. Daraus kann der Schluss gezogen werden, dass der<br />
Handlungsspielraum e<strong>in</strong>er Geme<strong>in</strong>de umso ger<strong>in</strong>ger ist, je größer das Haushaltsdefizit der Geme<strong>in</strong>de ist und je<br />
länger e<strong>in</strong> solches immer wieder <strong>in</strong> den Haushaltsjahren auftritt.<br />
GEMEINDEORDNUNG 251
1.02 Die HSK-Bezugsgrößen<br />
1.02.1 Die HSK-Bezugsgröße „Schlussbilanz<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 76 GO <strong>NRW</strong><br />
Im Zusammenhang mit der geme<strong>in</strong>dlichen Pflicht zur Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes benennt<br />
die Vorschrift die Bezugsgrößen „Schlussbilanz“ und „Allgeme<strong>in</strong>e Rücklage“, damit auf Grund dieser Größen<br />
festgestellt werden kann, ob die <strong>in</strong> der Vorschrift benanntem Schwellenwert im E<strong>in</strong>zelnen überschritten werden.<br />
Unter dem verwendeten Begriff „Schlussbilanz“ ist dabei die Bilanz nach § 41 GemHVO <strong>NRW</strong> im geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Jahresabschluss zu verstehen, denn diese wird bezogen auf dem Abschlussstichtag „31. Dezember des Haushaltsjahres“,<br />
also zum Schluss des geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsjahres aufgestellt. Damit ist die im geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Jahresabschluss enthaltene Bilanz e<strong>in</strong>e zutreffende Basis für die Feststellung e<strong>in</strong>er Überschreitung der <strong>in</strong> der<br />
Vorschrift bestimmten Schwellenwerte, denn die Geme<strong>in</strong>de ist nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften nicht<br />
verpflichtet, e<strong>in</strong>e „Ergebnisverwendungsbilanz“ aufzustellen als weitere förmliche Bilanz, bezogen auf das abgelaufene<br />
Haushaltsjahr, aufzustellen.<br />
1.02.2 Die HSK-Bezugsgröße „Allgeme<strong>in</strong>e Rücklage“<br />
Die Bezugsgröße „Allgeme<strong>in</strong>e Rücklage“ steht unmittelbar mit der Bilanz im geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss<br />
(Schlussbilanz) <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung, denn diese Bilanz enthält die <strong>in</strong> der Vorschrift benannte Bezugsgröße „Allgeme<strong>in</strong>e<br />
Rücklage“. Jedoch ist zusätzlich noch der Bearbeitungsstand <strong>in</strong> zeitlicher H<strong>in</strong>sicht zu betrachten. Vor der vom Rat<br />
der Geme<strong>in</strong>de getroffenen Entscheidung über die Verwendung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresergebnisses (vgl. § 96<br />
Abs. 1 S. 2 GO <strong>NRW</strong>) enthält die geme<strong>in</strong>dliche (Schluss-) Bilanz im Jahresabschluss der Geme<strong>in</strong>de regelmäßig<br />
noch getrennte Wertansätze unter den Bilanzposten „Allgeme<strong>in</strong>e Rücklage“ und „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“.<br />
Erst nach der Feststellung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses f<strong>in</strong>det regelmäßig die Umsetzung des<br />
Verwendungsbeschlusses des Rates statt.<br />
Die <strong>in</strong> der Vorschrift benannte Bezugsgröße „der <strong>in</strong> der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der<br />
allgeme<strong>in</strong>en Rücklage“ ist daher dah<strong>in</strong>gehend zu verstehen, dass nicht nur der Wertansatz unter dem Bilanzposten<br />
„Allgeme<strong>in</strong>e Rücklage“ (vgl. § 41 Abs. 4 Nr. 1.1 GO <strong>NRW</strong>) die Ausgangsgröße für die Beurteilung der Überschreitung<br />
der Schwellenwerte darstellt, sondern <strong>in</strong> die Beurteilung ist auch der Bilanzposten „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“<br />
e<strong>in</strong>zubeziehen. Der Abschluss des Haushaltsjahres bzw. der Schlussstand der Abbildung<br />
des bilanziellen Standes des geme<strong>in</strong>dlichen Vermögens und der Schulden ist erst dann vollständig gegeben,<br />
wenn die zuvor noch möglichen Verrechnungen <strong>in</strong>nerhalb der Bilanz abgeschlossen s<strong>in</strong>d, z.B. Umsetzung<br />
des Verwendungsbeschlusses des Rates. Daher ist erst dann bei der Geme<strong>in</strong>de der zutreffende bilanzielle Bestand<br />
der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage erreicht, wenn der besondere Bilanzposten „Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag“<br />
durch e<strong>in</strong>e zulässige Verrechnung aufgelöst worden ist.<br />
Nach dieser Verrechnung ist der bilanzielle Wertansatz der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage dann die Größe, mit der die<br />
Bezugsgröße „der <strong>in</strong> der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage“<br />
zutreffend erfasst und abgebildet wird. Dieser Bewertung steht nicht entgegen, dass von der Geme<strong>in</strong>de für<br />
ihren Jahresabschluss förmlich nur e<strong>in</strong>e Bilanz vor der Feststellung durch den Rat der Geme<strong>in</strong>de aufzustellen ist.<br />
Im Rahmen der öffentlichen Bekanntmachung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses nach § 96 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong><br />
bietet sich aber deshalb zusätzlich e<strong>in</strong>e „Bilanz nach Verwendungsbeschluss“ an, um Dritten gegenüber das<br />
geme<strong>in</strong>dliche Eigenkapital <strong>in</strong> der Form aufzuzeigen, <strong>in</strong> der es ggf. <strong>in</strong> Anspruch genommen werden kann.<br />
In den Fällen, <strong>in</strong> denen die Geme<strong>in</strong>de bereits <strong>in</strong> ihrer Bilanz im geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss die Ergebnisverwendung<br />
vor der Feststellung durch den Ratsbeschluss vorgenommen hat, ist das aus der Verrechnung entstandene<br />
Ergebnis unter dem zusätzlichen Bilanzposten „Bilanzgew<strong>in</strong>n/Bilanzverlust“ anzusetzen, der dem Bilanzposten<br />
„Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ folgt. Die Geme<strong>in</strong>de ist jedoch nach den haushaltsrechtlichen Vorschrif-<br />
GEMEINDEORDNUNG 252
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 76 GO <strong>NRW</strong><br />
ten nicht verpflichtet, e<strong>in</strong>e förmliche „Ergebnisverwendungsbilanz“ aufzustellen. Es bedarf aber m<strong>in</strong>destens im<br />
Rahmen von Haushaltssicherungskonzepten derartiger Angaben, um e<strong>in</strong>e mögliche Überschreitung der gesetzlichen<br />
Schwellenwerte zutreffend beurteilen zu können.<br />
1.1 Zu Satz 1 (Schwellenwerte für Haushaltssicherungskonzepte):<br />
1.1.1 Zu Nummer 1 (Veränderung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr):<br />
In dieser Vorschrift wird e<strong>in</strong> Schwellenwert für e<strong>in</strong>e erhebliche Veränderung der Haushaltswirtschaft <strong>in</strong>nerhalb<br />
e<strong>in</strong>es Haushaltsjahres bestimmt. Ist im Rahmen der Ausführung der Haushaltswirtschaft erkennbar, dass der <strong>in</strong><br />
der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage (vgl. § 41 Abs. 4 Nr. 1.1<br />
GemHVO <strong>NRW</strong>) am Ende dieses Haushaltsjahres um mehr als e<strong>in</strong> Viertel verr<strong>in</strong>gert se<strong>in</strong> wird, löst dies unmittelbar<br />
die Verpflichtung zur Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes aus, d.h. für das Haushaltsjahr wird<br />
e<strong>in</strong> entsprechender Fehlbedarf erwartet, für den neben e<strong>in</strong>er ggf. noch möglichen Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage<br />
auch e<strong>in</strong>e Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage notwendig wird.<br />
Die Verpflichtung zur Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes kann auch bereits im Zeitpunkt der Aufstellung<br />
der Haushaltssatzung entstehen, wenn für das Haushaltsjahr oder für e<strong>in</strong>es der folgenden drei Planungsjahre<br />
e<strong>in</strong> negatives Jahresergebnis <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Größenordnung oberhalb dieses Schwellenwertes geplant wird. Die<br />
dadurch aufgezeigte rasante Verr<strong>in</strong>gerung des Eigenkapitals erfordert besonders schnell wirkende Konsolidierungs-<br />
bzw. Sanierungsmaßnahmen, ggf. auch mit erheblichen E<strong>in</strong>schnitten, um e<strong>in</strong>e drohende Überschuldung<br />
zu verh<strong>in</strong>dern. In diesen Fällen beg<strong>in</strong>nt die Verpflichtung für den Bürgermeister und den Kämmerer, die notwendigen<br />
Gegenmaßnahmen e<strong>in</strong>zuleiten, nicht erst nach dem Beschluss des Rates über diese Haushaltsplanung<br />
bzw. Haushaltssatzung, sondern unmittelbar sobald sie Kenntnis darüber haben. Der dann noch aufzustellende<br />
Entwurf sollte darf dann nicht mehr nur den Ablauf der Haushaltswirtschaft darstellen, sondern muss neben dem<br />
Haushaltssicherungskonzept auch den Erfolg oder das Versagen der bereits e<strong>in</strong>geleiteten Sanierungsmaßnahmen<br />
aufzeigen.<br />
1.1.2 Zu Nummer 2 (Veränderung <strong>in</strong> zwei aufe<strong>in</strong>anderfolgenden Haushaltsjahren):<br />
1.1.2.1 Inhalte der Vorschrift<br />
Zur besseren Handhabbarkeit und aus Gründen der Verhältnismäßigkeit ist <strong>in</strong> § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO <strong>NRW</strong> e<strong>in</strong>e<br />
Bagatellgrenze für die vorgesehene Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong> Rücklage (vgl. Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr.<br />
1.1 GemHVO <strong>NRW</strong>) festgelegt worden. E<strong>in</strong>e Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage <strong>in</strong> zwei aufe<strong>in</strong>anderfolgenden<br />
Haushaltsjahren oberhalb dieser Schwellenwerte legt offen, dass strukturelle Haushaltsdefizite bestehen und<br />
die geordnete Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de so nachhaltig gefährdet ist, dass nicht angenommen werden<br />
kann, e<strong>in</strong> ausgeglichener Haushalt sei im folgenden Haushaltsjahr wieder zu erreichen.<br />
In den Fällen, <strong>in</strong> denen von der Geme<strong>in</strong>de bei der Aufstellung des Haushalts jeweils e<strong>in</strong> negatives Jahresergebnis<br />
für zwei aufe<strong>in</strong>anderfolgende Haushaltsjahre geplant wird, mit der Folge, dass dann der <strong>in</strong> der Schlussbilanz<br />
des jeweiligen Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage jeweils um mehr als e<strong>in</strong> Zwanzigstel<br />
zu verr<strong>in</strong>gern ist, entsteht für die Geme<strong>in</strong>de die Pflicht zur Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes. Diese<br />
Pflicht besteht auch, wenn bei der Aufstellung des Haushalts e<strong>in</strong> negatives Jahresergebnis für das Haushaltsjahr<br />
und das folgende Planungsjahr oder für zwei aufe<strong>in</strong>ander folgende Planungsjahren geplant wird, das voraussichtlich<br />
zu e<strong>in</strong>er entsprechenden Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage <strong>in</strong> diesen zwei aufe<strong>in</strong>anderfolgenden<br />
Haushaltsjahren führen wird.<br />
GEMEINDEORDNUNG 253
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 76 GO <strong>NRW</strong><br />
E<strong>in</strong>e entsprechende Festsetzung <strong>in</strong> der Haushaltssatzung muss nur dann gleichzeitig erfolgen, wenn e<strong>in</strong>e Verr<strong>in</strong>gerung<br />
der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage für das Haushaltsjahr vorgesehen wird (vgl. § 78 Abs. 2 Nr. 2 GO <strong>NRW</strong>). Wegen<br />
des „schleichenden Verzehrs“ des Eigenkapitals muss aber die weitere Entwicklung der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltswirtschaft e<strong>in</strong>er besonderen Prüfung unterzogen werden, für die regelmäßig e<strong>in</strong>e Heranziehung der<br />
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Geme<strong>in</strong>de s<strong>in</strong>nvoll ist. Die von der Geme<strong>in</strong>de im Haushaltssicherungskonzept<br />
vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen müssen geeignet se<strong>in</strong>, den „schleichenden Verzehr“<br />
des Eigenkapitals zu beenden und die Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs <strong>in</strong> drei Jahren nach dem<br />
Ursachenjahr zu erreichen. Als Ursachenjahr, ab dem die dreijährige Frist zu laufen beg<strong>in</strong>nt, gilt <strong>in</strong> diesen Fällen<br />
immer das Jahr, <strong>in</strong> dem der Schwellenwert nach dieser Vorschrift zum zweiten Mal überschritten wird. Ob dies<br />
zutrifft muss unter Beachtung des Haushaltsgrundsatzes der Jährlichkeit ermittelt werden, d.h. die Ermittlung des<br />
jahresbezogenen Schwellenwertes ist immer bezogen auf den <strong>in</strong> der Schlussbilanz des jeweiligen Vorjahres<br />
auszuweisenden Ansatz der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage vorzunehmen.<br />
1.1.2.2 Ursachenjahr und Haushaltsplanung<br />
Im NKF können die Verpflichtung zur Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes und die Ursache, die<br />
diese Pflicht auslöst, <strong>in</strong> unterschiedliche Haushaltsjahre fallen. In die Prüfung, ob e<strong>in</strong>e Überschreitung der<br />
Schwellenwerte des § 76 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> vorliegt, ist deshalb nicht nur das Haushaltsjahr, für das e<strong>in</strong> neuer<br />
Haushalt aufgestellt wird, e<strong>in</strong>zubeziehen. Vielmehr s<strong>in</strong>d die Tatbestände dieser Vorschrift auch dann erfüllt, wenn<br />
die Schwellenwerte <strong>in</strong> den dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahren der mittelfristigen Ergebnis- und<br />
F<strong>in</strong>anzplanung überschritten werden.<br />
Die Frist für den Zeitpunkt, zu dem der Haushaltsausgleich nach § 76 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> wieder herzustellen ist,<br />
läuft allerd<strong>in</strong>gs erst ab dem Haushaltsjahr, <strong>in</strong> dem e<strong>in</strong> negatives Jahresergebnis tatsächlich zur Verr<strong>in</strong>gerung der<br />
allgeme<strong>in</strong>en Rücklage oberhalb des Schwellenwertes führt. Damit werden mögliche Nachteile für die betroffenen<br />
Geme<strong>in</strong>den vermieden (vgl. Runderlass des Innenm<strong>in</strong>isteriums vom 09.06.2006). Diese würden dann auftreten,<br />
wenn das auslösende Ereignis (Überschreitung des Schwellenwertes) erst <strong>in</strong> der Zukunft e<strong>in</strong>tritt, die Frist für die<br />
Genehmigungsfähigkeit (Frist zur Erreichung des Haushaltsausgleichs) aber bereits ab dem Haushaltsjahr, für<br />
das der Haushalt aufgestellt wird, liefe.<br />
Im Falle der Überschreitung der Schwellenwerte nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO <strong>NRW</strong> beg<strong>in</strong>nt die Frist demnach auch<br />
erst ab dem zweiten Jahr der Überschreitung zu laufen. Der Konsolidierungszeitraum kann <strong>in</strong> diesen Fällen allerd<strong>in</strong>gs<br />
über den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung, bezogen auf das Haushaltsjahr, für das<br />
der Haushalt aufgestellt wird, h<strong>in</strong>aus reichen. Liegt das e<strong>in</strong> Haushaltssicherungskonzept auslösende Ereignis z.B.<br />
erst im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis und F<strong>in</strong>anzplanung (z.B. für den Haushalt 2006 im Jahr 2009)<br />
kann sich der Zeitraum, bei dem für e<strong>in</strong> Haushaltssicherungskonzept grundsätzlich noch die Genehmigungsfähigkeit<br />
gegeben se<strong>in</strong> kann, über maximal sieben Jahre ausdehnen (im Beispiel bis Ende des Jahres 2012).<br />
1.1.3 Zu Nummer 3 (Voraussichtlicher Verzehr des Eigenkapitals):<br />
1.1.3.1 Verzehr wegen gravierender Haushaltsdefizite<br />
Die Verpflichtung der Geme<strong>in</strong>de zur Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes entsteht, wenn bei der<br />
Aufstellung des Haushalts für das neue Haushaltsjahr von der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong> voraussichtlich vollständiger Verzehr<br />
der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage (vgl. Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1.1 GemHVO <strong>NRW</strong>) <strong>in</strong>nerhalb der mittelfristigen<br />
Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung geplant wird. E<strong>in</strong> solcher voraussichtlich vollständiger Verzehr der allgeme<strong>in</strong>en<br />
Rücklage legt offen, dass gravierende strukturelle Haushaltsdefizite bestehen und die geordnete Haushaltswirtschaft<br />
so nachhaltig gefährdet ist, dass nicht angenommen werden kann, e<strong>in</strong> ausgeglichener Haushalt<br />
sei bald wieder zu erreichen. Daher kann die Verpflichtung der Geme<strong>in</strong>de zur Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssiche-<br />
GEMEINDEORDNUNG 254
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 76 GO <strong>NRW</strong><br />
rungskonzeptes nicht erst zu dem Zeitpunkt ausgelöst werden, zu dem der Haushalt für das Haushaltsjahr, <strong>in</strong><br />
dem der voraussichtlich vollständige Verzehr der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage e<strong>in</strong>tritt, aufgestellt wird.<br />
E<strong>in</strong> vorgesehener vollständiger Verzehr der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage durch die Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong>nerhalb der mittelfristigen<br />
Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung lässt sich aus den negativen Jahresergebnissen im Ergebnisplan für das<br />
Haushaltsjahr sowie den folgenden drei Planungsjahren ermitteln. Tritt dieser Verzehr <strong>in</strong>nerhalb der Planungsjahre<br />
der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung nach § 84 Satz 1 GO <strong>NRW</strong> e<strong>in</strong>, stellen die Plandaten bereits<br />
e<strong>in</strong>e ausreichende rechtliche Willensbekundung der Geme<strong>in</strong>de für e<strong>in</strong>e entsprechende haushaltswirtschaftliche<br />
Vorgehensweise dar. Die Geme<strong>in</strong>de zeigt mit den im Ergebnisplan ausgewiesenen negativen Jahresergebnissen,<br />
dass sie ihrer Verpflichtung zum Haushaltsausgleich (Soll-Ausgleich) nach § 84 Satz 3 GO <strong>NRW</strong> nicht nachkommt.<br />
Dies wird besonders durch die dem Haushaltsplan als Anlage beizufügende Übersicht über die Entwicklung<br />
des Eigenkapitals der Geme<strong>in</strong>de deutlich.<br />
1.1.3.2 Besondere Dr<strong>in</strong>glichkeit für Konsolidierungsmaßnahmen<br />
Die Geme<strong>in</strong>de muss <strong>in</strong> ihrem Haushaltssicherungskonzept darlegen, wie sie versuchen will, den Haushaltsausgleich<br />
<strong>in</strong> diesen Planungsjahren nicht nur wieder zu erreichen, sondern auch dauerhaft zu sichern. E<strong>in</strong> unter<br />
dieser Zielsetzung aufzustellendes Haushaltssicherungskonzept muss berücksichtigen, dass die Gegenmaßnahmen<br />
zum möglichen Eigenkapitalverzehr auch Elemente von Maßnahmen zum Eigenkapitalaufbau enthalten<br />
müssen, so dass e<strong>in</strong>e umfassende Sanierung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft geboten ist. Die Geme<strong>in</strong>de<br />
muss deshalb <strong>in</strong> ihrem Haushaltssicherungskonzept darstellen, wie sie wegen der <strong>in</strong> diesen Jahren vorgesehenen<br />
negativen Jahresergebnisse, die zum vollständigen Verzehr des Eigenkapitals führen würden, gegensteuert<br />
und die mögliche Überschuldung nach § 75 Abs. 7 GO <strong>NRW</strong> vermeidet.<br />
Ihre konkrete Planung soll die Geme<strong>in</strong>de mit Nachweisen untermauern, die gleichzeitig auch e<strong>in</strong>e Umkehr im<br />
haushaltswirtschaftlichen Handeln der Geme<strong>in</strong>de mit dem Ziel der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung<br />
aufzeigen. In e<strong>in</strong>er solchen wirtschaftlichen Lage der Geme<strong>in</strong>de bedarf es grundsätzlich, aber auch <strong>in</strong>sbesondere<br />
wegen des Budgetrechts des Rates und se<strong>in</strong>er Zuständigkeit für die Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes<br />
(vgl. § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO <strong>NRW</strong>) es e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>tensiven Beteiligung des Rates durch die Verwaltung<br />
der Geme<strong>in</strong>de. Dieses gilt entsprechend für die E<strong>in</strong>schaltung und das Handeln der Aufsichtsbehörde, die sich <strong>in</strong><br />
diesen Fällen nicht auf das Genehmigungsverfahren für das geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssicherungskonzept beschränken<br />
sollte. Sie wird die notwendigen Schritte zur erfolgreichen Sanierung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft<br />
kritisch begleiten.<br />
E<strong>in</strong>e geplante rasante Verr<strong>in</strong>gerung des Eigenkapitals erfordert von der Geme<strong>in</strong>de - unter Beteiligung ihrer Aufsichtsbehörde<br />
- besonders schnell wirkende Konsolidierungsmaßnahmen, ggf. auch mit erheblichen E<strong>in</strong>schnitten,<br />
um e<strong>in</strong>e drohende Überschuldung der Geme<strong>in</strong>de zu verh<strong>in</strong>dern. In diesen Fällen beg<strong>in</strong>nt die Verpflichtung für den<br />
Bürgermeister und den Kämmerer, die notwendigen Gegenmaßnahmen e<strong>in</strong>zuleiten, nicht erst nach dem Beschluss<br />
des Rates über diese Haushaltsplanung bzw. Haushaltssatzung, sondern unmittelbar sobald sie Kenntnis<br />
darüber haben. Die Aufsichtsbehörde ist befugt, diese Maßnahmen sowie e<strong>in</strong>e Darstellung im Rahmen der Anzeige<br />
der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen verlangen, <strong>in</strong> der neben dem zur Genehmigung vorgelegten Haushaltssicherungskonzept<br />
auch der Erfolg oder das Versagen der bereits e<strong>in</strong>geleiteten Maßnahmen aufgezeigt wird.<br />
1.2 Zu Satz 2 (Haushaltssicherungskonzept bei der Bestätigung des Jahresabschlusses):<br />
1.2.1 Pflicht zur Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes<br />
In der künftigen Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de kommt dem Jahresabschluss die gleiche Bedeutung zu wie<br />
der Haushaltssatzung bzw. dem Haushaltsplan. Daher ist die Verpflichtung zur Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssiche-<br />
GEMEINDEORDNUNG 255
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 76 GO <strong>NRW</strong><br />
rungskonzeptes auf den Jahresabschluss ausgedehnt worden. Liegt bei der Bestätigung des Jahresabschlusses<br />
durch den Bürgermeister nach § 95 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong> e<strong>in</strong>e Überschreitung der <strong>in</strong> Satz 1 bestimmten Schwellenwerte<br />
vor, setzt zu diesem Zeitpunkt die Verpflichtung der Geme<strong>in</strong>de zur Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes<br />
e<strong>in</strong>. Die Festlegung dieses Zeitpunktes be<strong>in</strong>haltet, dass die Geme<strong>in</strong>de das Haushaltssicherungskonzept<br />
unverzüglich aufzustellen und ihrer Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen hat.<br />
1.2.2 Zuordnung des Haushaltssicherungskonzeptes zum Haushaltsjahr<br />
In diesem Zusammenhang kann nicht aus der Zuständigkeit des Rates der Geme<strong>in</strong>de für die Aufstellung des<br />
Haushaltssicherungskonzeptes (vgl. § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO <strong>NRW</strong>) gefolgert werden, dass <strong>in</strong> diesen Fällen<br />
die Vorlage des Haushaltssicherungskonzeptes bei der Aufsichtsbehörde der Geme<strong>in</strong>de bis zur Anzeige des<br />
festgestellten Jahresabschlusses oder bis zur Anzeige der nächsten Haushaltssatzung h<strong>in</strong>ausgezögert werden<br />
kann. Die Zusammenarbeit zwischen der Geme<strong>in</strong>de und ihrer Aufsichtsbehörde gebietet es, dass die Geme<strong>in</strong>de<br />
ihre Aufsichtsbehörde über die e<strong>in</strong>getretene Pflicht zur Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes umgehend<br />
<strong>in</strong> Kenntnis setzt und bereits aufzeigt, wie sie die erforderlich gewordene Sanierung vornehmen will.<br />
Die Bestimmung <strong>in</strong> § 79 Abs. 2 Satz 2 GO <strong>NRW</strong>, dass das Haushaltssicherungskonzept e<strong>in</strong> Teil des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltsplans ist, steht dieser Vorgehensweise nicht entgegen. Wenn von der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong> Haushaltssicherungskonzept<br />
im Rahmen der Bestätigung über den Jahresabschluss aufzustellen ist, bewirkt die B<strong>in</strong>dung des<br />
Haushaltssicherungskonzeptes an den Haushaltsplan nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GO <strong>NRW</strong>, dass dieses Haushaltssicherungskonzept<br />
zum Bestandteil des Haushaltsplans des nächsten der Bestätigung des Jahresabschlusses<br />
folgenden Haushaltsjahres zu machen ist.<br />
Das Haushaltssicherungskonzept muss dann wegen der bereits erfolgten Beschlussfassung des Rates über die<br />
Haushaltssatzung des laufenden Haushaltsjahres und wegen der bereits e<strong>in</strong>getretenen B<strong>in</strong>dungswirkung des<br />
Haushaltsplans als Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de nach § 79 Abs. GO <strong>NRW</strong> i.d.R. nicht<br />
mehr zum Bestandteil des Haushaltsplans dieses Haushaltsjahres gemacht werden. Es sollte aber noch ggf. bei<br />
der Aufstellung e<strong>in</strong>er Nachtragssatzung berücksichtigt werden. Unabhängig davon gilt es für die Geme<strong>in</strong>de, unmittelbar<br />
nach Kenntnis der bestehenden wirtschaftlichen Lage geeignete Maßnahmen zur Beseitigung struktureller<br />
Defizite zu ergreifen.<br />
Die mögliche Zuordnung des Haushaltssicherungskonzeptes zum nächsten geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan wirkt<br />
sich jedoch auf die Berechnung des Zeitpunktes aus, zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt se<strong>in</strong><br />
muss. Nach § 76 Abs. 2 S. 3 GO <strong>NRW</strong> kann die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssicherungskonzeptes nur<br />
erreicht werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im letzten Jahr der<br />
mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 wieder erreicht wird, also<br />
auch <strong>in</strong> diesen Fällen e<strong>in</strong>e Frist von drei Jahren e<strong>in</strong>zuhalten ist.<br />
2. Zu Absatz 2 (Zielbestimmung und Genehmigung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes):<br />
2.1 Zu Satz 1 (Zielbestimmung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes):<br />
2.1.1 Zeitlicher Umfang des Haushaltssicherungskonzeptes<br />
Die Vorschrift enthält die Zielbestimmung und die Regeln der Genehmigungsfähigkeit e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes,<br />
während die Ausgestaltung des Haushaltssicherungskonzeptes durch § 5 GemHVO <strong>NRW</strong> näher<br />
bestimmt wird. Das Vorliegen e<strong>in</strong>er Genehmigungsfähigkeit ist dann anzunehmen, wenn der orig<strong>in</strong>äre jährliche<br />
Haushaltsausgleich <strong>in</strong>nerhalb der fünfjährigen mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung wieder erreicht wird,<br />
also am Ende des dritten Jahres nach dem Haushaltsjahr gegeben ist. Bei e<strong>in</strong>em Haushaltssicherungskonzept,<br />
GEMEINDEORDNUNG 256
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 76 GO <strong>NRW</strong><br />
das die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs gewährleisten und darstellen soll und spätestens<br />
im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2<br />
GO <strong>NRW</strong> wieder erreicht wird, ist der Beg<strong>in</strong>n der Verpflichtung der Geme<strong>in</strong>de zur Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes<br />
widerspruchsfrei ermittelbar. Auch wenn die Verpflichtung der Geme<strong>in</strong>de zur Aufstellung<br />
e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes und die Ursache, die diese Pflicht auslöst, <strong>in</strong> unterschiedliche Haushaltsjahre<br />
fallen, kann das Haushaltsjahr, <strong>in</strong> dem die geme<strong>in</strong>dliche Pflicht beg<strong>in</strong>nt, immer e<strong>in</strong>deutig bestimmt werden.<br />
Ebenso ist auch das Haushaltsjahr feststellbar, <strong>in</strong> dem die Pflicht zur Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes<br />
endet.<br />
In diesen Fällen ist es das Haushaltsjahr, <strong>in</strong> dem der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird und gewährleistet<br />
ist, dass der geme<strong>in</strong>dliche Haushalt so gesteuert werden kann, dass er auch <strong>in</strong> Zukunft dauerhaft ausgeglichen<br />
se<strong>in</strong> wird. Bei der Ermittlung des betreffenden Haushaltsjahres muss e<strong>in</strong>erseits berücksichtigt werden, ob der<br />
Haushaltsausgleich <strong>in</strong> der Planung, d.h. <strong>in</strong>nerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung gesichert ist<br />
(vgl. § 75 Abs. 2 i.V.m. § 84 GO <strong>NRW</strong>). Andererseits muss aber auch <strong>in</strong> die Betrachtung der Beendigung der<br />
Verpflichtung der Geme<strong>in</strong>de für e<strong>in</strong> Haushaltssicherungskonzept e<strong>in</strong>fließen, dass der Haushaltsausgleich <strong>in</strong> dem<br />
betreffenden Haushaltsjahr erst gegeben ist, wenn auch e<strong>in</strong> Haushaltsausgleich <strong>in</strong> der Rechnung (Jahresabschluss)<br />
des betreffenden Jahres erreicht wird (Vgl. § 75 Abs. 2 S. 1 GO <strong>NRW</strong>).<br />
Die Geme<strong>in</strong>de darf also die vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen nicht schon dann e<strong>in</strong>stellen, wenn der Haushaltsausgleich<br />
lediglich <strong>in</strong> der Planung erreicht ist. Es bedarf vielmehr noch des „Beweises“ des realen Haushaltsausgleichs<br />
<strong>in</strong> der Rechnung. Der Verzicht auf Konsolidierungsmaßnahmen ist regelmäßig nur zu rechtfertigen,<br />
wenn im Rahmen des Sanierungscontroll<strong>in</strong>gs durch entsprechende Ergebnisse e<strong>in</strong> messbarer nachhaltiger<br />
Erfolg erkennbar ist. E<strong>in</strong>geleitete umfassende Sanierungsmaßnahmen sollten deshalb konsequent fortgeführt und<br />
nicht bereits beim ersten Anzeichen e<strong>in</strong>er haushaltswirtschaftlichen Entspannung oder e<strong>in</strong>es Haushaltsausgleichs<br />
auf unbeständiger Grundlage abgebrochen werden.<br />
2.1.2 Inhalte des Haushaltssicherungskonzeptes<br />
Auch bei schlechter haushaltswirtschaftlicher Lage besteht für e<strong>in</strong>e Geme<strong>in</strong>de grundsätzlich e<strong>in</strong>e positive Fortführungsprognose.<br />
Trotz e<strong>in</strong>er akuten und aktuellen Krisensituation, auch wenn diese mehrjährig ist, hat die Geme<strong>in</strong>de<br />
trotz stark angespannter Liquidität bzw. Liquiditätsdefiziten grundsätzlich die Substanz und die Potenziale,<br />
um wieder den jährlichen Haushaltsausgleich zu erreichen und die stetige Aufgabenerfüllung auf Dauer zu<br />
sichern. Die Voraussetzungen dafür s<strong>in</strong>d generell gegeben. Es gilt, die Krisenkennzeichen wahrzunehmen, die<br />
Ursachen zu erkennen, entsprechende Maßnahmen unter Berücksichtigung aller Elemente der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Aufgabenerfüllung zu prüfen und zu bewerten, so dass e<strong>in</strong> umfassendes Haushaltssicherungskonzept zur wirtschaftlichen<br />
Gesundung und Zukunftssicherung der Geme<strong>in</strong>de auf den Weg gebracht wird.<br />
E<strong>in</strong> Haushaltssicherungskonzept dient dabei als zukunftsorientierter Leitfaden, <strong>in</strong> dem die grundsätzlichen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<br />
für die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung der Geme<strong>in</strong>de und für die Steuerung des<br />
Haushalts, damit er <strong>in</strong> Zukunft dauerhaft ausgeglichen se<strong>in</strong> wird, festgelegt werden. Gleichzeitig muss das Konzept<br />
e<strong>in</strong> erweitertes Planungssystem als der Haushaltsplan enthalten, das als Handlungsrichtschnur dienen soll<br />
und deshalb die konkreten und akuten Schritte aufzuzeigen hat, die sofort und <strong>in</strong> der weiteren Zukunft zu gehen<br />
s<strong>in</strong>d. Besondere Eckpunkte sowie die Chancen und Risiken für die Geme<strong>in</strong>de s<strong>in</strong>d dabei besonders herauszustellen.<br />
Das Haushaltssicherungskonzept stellt e<strong>in</strong>e Leitl<strong>in</strong>ie für das Handeln der Geme<strong>in</strong>de und für die Verhandlungen<br />
mit Dritten dar. Dabei ist auch die zeitliche Dimension der Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen nicht<br />
unbeachtlich. Die zeitliche Abfolge muss so ausgestaltet se<strong>in</strong>, dass die Maßnahmen von der Geme<strong>in</strong>de auch im<br />
Rahmen ihrer Möglichkeiten umgesetzt werden können und nichts Unmögliches von ihr verlangt wird. Dies erfordert<br />
aber auch, neben den gesetzlichen Zielen, auch weitere durch die örtlichen Verhältnisse geprägte Ziele fest-<br />
GEMEINDEORDNUNG 257
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 76 GO <strong>NRW</strong><br />
zulegen. Im Zusammenhang mit Zwischenzielen, an denen die Entwicklung der Geme<strong>in</strong>de messbar wird, kann<br />
die Motivation der Geme<strong>in</strong>de zur Fortsetzung der notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen bestärkt werden.<br />
2.1.3 Schaffung e<strong>in</strong>es zukunftsorientierten Bildes der Geme<strong>in</strong>de<br />
E<strong>in</strong> erfolgreicher Haushaltskonsolidierungsprozess der Geme<strong>in</strong>de besteht u.a. dar<strong>in</strong>, dass sie die Bewältigung der<br />
Krise ihrer haushaltswirtschaftlichen Lage selbst so durchführt, dass die Geme<strong>in</strong>de die dauernde Leistungsfähigkeit<br />
und e<strong>in</strong>e stetige Aufgabenerfüllung erreicht (vgl. § 75 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>), die künftigen Generationen nicht<br />
unnötig belastet sowie deren Zukunft dauerhaft sichert und dadurch den Grundsatz der <strong>in</strong>tergenerativen Gerechtigkeit<br />
e<strong>in</strong>hält. Das Erfordernis e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes zeigt auf bzw. verdeutlicht, dass e<strong>in</strong> zukunftsorientiertes<br />
Bild der Geme<strong>in</strong>de mit qualitativ hochwertigen Leitorientierungen als Kernaussagen die Grundlagen<br />
für die Ausrichtung des geme<strong>in</strong>dlichen Handelns auf die Zukunft bestehen muss.<br />
Die wirtschaftliche Lage bzw. die sich abzeichnende Ertragsschwäche der Geme<strong>in</strong>de oder mögliche f<strong>in</strong>anzielle<br />
Gegebenheiten verlangen <strong>in</strong> diesen Fällen nicht nur e<strong>in</strong>zelne Maßnahmen oder e<strong>in</strong> zusammengefasstes Maßnahmenpaket.<br />
Die Geme<strong>in</strong>de muss sich auch zielorientiert e<strong>in</strong> zukunftsorientiertes Profil geben. Nur auf die geme<strong>in</strong>dliche<br />
Aufgabenerfüllung <strong>in</strong> der Zukunft ausgerichtete Visionen und Leitl<strong>in</strong>ien (Leitbildern) lassen sich die<br />
notwendigen strategischen und operativen Ziele bestimmen. Diese können und sollen e<strong>in</strong>e Leitorientierung für die<br />
geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirksamkeit entfalten bzw. bieten. Mit diesen Mitteln lassen sich die geme<strong>in</strong>dliche Steuerung<br />
und die F<strong>in</strong>anzen der Geme<strong>in</strong>de unter Beachtung der e<strong>in</strong>zuhaltenden Haushaltsgrundsätze, z.B. <strong>in</strong> § 75 GO<br />
<strong>NRW</strong>, mite<strong>in</strong>ander verknüpfen. Insgesamt gesehen muss durch die Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong> örtlich gestaltetes handhabbares<br />
System entstehen.<br />
Für die geme<strong>in</strong>dliche Aufgabenerfüllung sollen daher auch die produktorientierten Ziele unter Berücksichtigung<br />
des e<strong>in</strong>setzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs überprüft sowie<br />
Leistungskennzahlen zur Zielerreichung neu bestimmt und mit den F<strong>in</strong>anzzielen verknüpft werden. Die Ziele<br />
werden zwischen dem Rat und der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung abgestimmt. Auch die Öffentlichkeit kann <strong>in</strong> den<br />
Prozess e<strong>in</strong>gebunden werden. Die Verpflichtung, produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des e<strong>in</strong>setzbaren<br />
Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festzulegen sowie Kennzahlen<br />
zur Zielerreichung zu bestimmen, verlangt von der Geme<strong>in</strong>de nichts Unmögliches, auch wenn es bei der Vielzahl<br />
der örtlichen Aufgaben nicht immer e<strong>in</strong>fach se<strong>in</strong> dürfte, zutreffende und ausreichende produktorientierte Ziele und<br />
Leistungskennzahlen festzulegen.<br />
Den E<strong>in</strong>stieg dazu bietet der geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsplan nach § 79 GO <strong>NRW</strong>, der m<strong>in</strong>destens die nach § 4<br />
GemHVO <strong>NRW</strong> vorgesehenen Produktbereiche aufweisen muss, denn produktorientierte Ziele bauen auf Produkten,<br />
Produktgruppen und Produktbereichen auf. Die vorgesehene Steuerung der Geme<strong>in</strong>de bzw. der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Verwaltung darf dabei sich nicht nur durch die Abbildung von Zielen auf der untersten Ebene der<br />
Gliederung des Haushaltsplans wiederf<strong>in</strong>den. Vielmehr müssen die vorgesehenen Ziele <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Zielhierarchie<br />
e<strong>in</strong>gebunden se<strong>in</strong>, die ausgehend vom Rat und dem Leitbild der Geme<strong>in</strong>de (strategische Ziele), bis <strong>in</strong> die unterste<br />
Verantwortungsebene der Verwaltung (operative Ziele) h<strong>in</strong>e<strong>in</strong>reicht. Nur so kann e<strong>in</strong> <strong>in</strong> sich stimmiges Zielsystem<br />
entstehen, das e<strong>in</strong>er kompetenten und ressourcenverbrauchsorientierten Verwaltungsteuerung mit dezentraler<br />
Ressourcenverantwortung gerecht werden kann.<br />
2.2 Zu Satz 2 (Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes):<br />
2.2.1 Genehmigungsbedarf<br />
Nach der Vorschrift bedarf das Haushaltssicherungskonzept der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde der<br />
Geme<strong>in</strong>de. Kann aber e<strong>in</strong> Fehlbedarf im Ergebnisplan nicht mehr durch e<strong>in</strong>e Inanspruchnahme der Ausgleichs-<br />
GEMEINDEORDNUNG 258
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 76 GO <strong>NRW</strong><br />
rücklage gedeckt werden, kommt es zu e<strong>in</strong>em weiteren Abbau des Eigenkapitals durch e<strong>in</strong>e Verr<strong>in</strong>gerung der<br />
allgeme<strong>in</strong>en Rücklage. Dafür ist zu prüfen, ob für die geplante Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage (Eigenkapitalverzehr)<br />
e<strong>in</strong>e Genehmigung nach dieser Vorschrift (wenn die <strong>in</strong> Absatz 1 genannten Schwellenwerte überschritten<br />
s<strong>in</strong>d) oder ggf. noch im Rahmen des § 75 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong> zu erteilen ist. Die Genehmigung hat daher<br />
den Zweck, dass die Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage akzeptiert wird, und die Geme<strong>in</strong>de die notwendigen<br />
Maßnahmen ergriffen hat, um schnellstmöglich den Haushaltsausgleich wieder zu erreichen und die steige Aufgabenerfüllung<br />
zu sichern.<br />
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass e<strong>in</strong>e Überschreitung der Schwellenwerte nach Absatz 1 nicht<br />
nur bei e<strong>in</strong>em Auftreten im Haushaltsjahr genehmigungspflichtig ist, sondern auch bei e<strong>in</strong>em Auftreten <strong>in</strong> den drei<br />
dem Haushaltsjahr folgenden Planungsjahre der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung. E<strong>in</strong>e gewollte stärkere<br />
Verflechtung zwischen der mittelfristigen haushaltswirtschaftlichen Planung und der Sicherung der stetigen<br />
Aufgabenerfüllung sowie den aufsichtsrechtlich gestuften Maßnahmen wird dadurch hergestellt. Die Aufsichtsbehörde<br />
hat daher auch bei der Genehmigung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes immer zu prüfen, ob die Gewährleistung<br />
der stetigen Aufgabenerfüllung durch diese Verr<strong>in</strong>gerung nicht gefährdet wird.<br />
Die Aufsichtsbehörde muss bei der Erteilung der Genehmigung nach dieser Vorschrift den ihr zustehenden Ermessensspielraum<br />
nach den haushaltsrechtlichen Zielbestimmungen ausgestalten. Hierbei kommt dem Ziel,<br />
wieder e<strong>in</strong>en ausgeglichenen Haushalt nach § 75 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> zu erreichen, die zentrale Bedeutung zu. Dies<br />
gilt auch dann, wenn die vorgesehene Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage der Geme<strong>in</strong>de im Haushaltsjahr<br />
noch als haushaltsverträglich betrachtet werden kann, aber nach der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung<br />
e<strong>in</strong>e Gefährdung der Haushaltswirtschaft zu befürchten ist und ihr nur durch e<strong>in</strong> Haushaltssicherungskonzept<br />
begegnet werden kann.<br />
2.2.2 Zeitlicher Unterschied zwischen Verpflichtung und Ursache<br />
Im Rahmen der Haushaltsplanung der Geme<strong>in</strong>de können künftig die Verpflichtung für die Aufstellung e<strong>in</strong>es<br />
Haushaltssicherungskonzeptes und der Anlass für e<strong>in</strong>e Aufstellung <strong>in</strong> unterschiedlichen Haushaltsjahren liegen.<br />
E<strong>in</strong>e Anb<strong>in</strong>dung dieser Frist an das Haushaltsjahr, <strong>in</strong> dem die Verpflichtung zur Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes<br />
entsteht, würde <strong>in</strong> vielen Fällen dazu führen, dass das Jahr, <strong>in</strong> dem der Anlass für e<strong>in</strong> Haushaltssicherungskonzept<br />
entsteht, gleichzeitig auch das Jahr ist, <strong>in</strong> dem der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO<br />
<strong>NRW</strong> wieder erreicht se<strong>in</strong> muss. Aus dem Zweck und Ziel dieser Vorschrift ist daher e<strong>in</strong>e Anb<strong>in</strong>dung an das Jahr<br />
der Ursache ableitbar. Dies ist wegen der E<strong>in</strong>räumung e<strong>in</strong>es Zeitraumes zur faktischen Umsetzung zur Wiedererreichung<br />
des Haushaltsausgleichs durch die Geme<strong>in</strong>de auch sachlogisch vertretbar. Diese Auslegung wird zudem<br />
gegenüber der im kameralen Rechnungswesen festgelegten Frist (3 statt 4 Jahre) gerecht.<br />
2.2.3 E<strong>in</strong>beziehung der Genehmigung nach § 75 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong><br />
Bei e<strong>in</strong>er Festsetzung <strong>in</strong> der Haushaltssatzung und e<strong>in</strong>er Verpflichtung zur Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes<br />
wird die erforderliche Genehmigung zur Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage nach § 75 Abs.<br />
4 GO <strong>NRW</strong> durch die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> miterfasst.<br />
Liegt e<strong>in</strong>e solche Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage vor, ist die erforderliche Sanierung der Haushaltswirtschaft<br />
der Geme<strong>in</strong>de so umfangreich und als so erheblich zu gewichten, dass e<strong>in</strong>e getrennte Genehmigungspraxis<br />
im S<strong>in</strong>ne der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft nicht sachgerecht ist.<br />
E<strong>in</strong>e aufsichtsrechtliche Verfahrenstrennung zwischen e<strong>in</strong>er Genehmigung nach § 75 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong> und e<strong>in</strong>er<br />
Genehmigung unter der gleichzeitigen Bewertung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 Abs. 2 GO<br />
<strong>NRW</strong> steht zudem der dr<strong>in</strong>genden Aufgabe der Geme<strong>in</strong>de, die stetige Aufgabenerfüllung wieder dauerhaft zu<br />
sichern und den Haushaltsausgleich wieder zu erreichen, entgegen. Unter diesen Zielsetzungen ist es sachlich<br />
GEMEINDEORDNUNG 259
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 76 GO <strong>NRW</strong><br />
geboten, dass die Aufsichtsbehörde e<strong>in</strong> zielgerichtetes Handeln der Geme<strong>in</strong>de durch e<strong>in</strong> e<strong>in</strong>ziges Verfahren<br />
unterstützt, so dass die Geme<strong>in</strong>de für ihr gesamtes Sanierungsvorhaben schnell die notwendige Sicherheit erhalten<br />
muss, wenn ihr geme<strong>in</strong>dliches Haushaltssicherungskonzept <strong>in</strong>sgesamt genehmigungsfähig ist.<br />
2.3 Zu Satz 3 (Genehmigungserfordernisse):<br />
2.3.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Nach der Vorschrift darf die Aufsichtsbehörde e<strong>in</strong>e Genehmigung für das geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssicherungskonzept<br />
kann nur erteilen, wenn aus dem ihr vorgelegten Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens<br />
im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung die Geme<strong>in</strong>de den gesetzlich bestimmten Haushaltsausgleich<br />
nach § 75 Abs. 2 wieder erreichen wird. Daher hat die Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> ihrem Haushaltssicherungskonzept<br />
e<strong>in</strong>erseits den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder<br />
hergestellt ist und diesen Zeitpunkt <strong>in</strong> ihrer Haushaltssatzung festzusetzen (vgl. § 78 Abs. 2 Nr. 5 GO <strong>NRW</strong>).<br />
2.3.2 Drei-Jahres-Frist<br />
Damit die Geme<strong>in</strong>de ihre Verpflichtung zur Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs erfüllen kann, wird ihr e<strong>in</strong><br />
Zeitraum von drei Jahren nach dem Haushaltsjahr, <strong>in</strong> dem der Anlass für die Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes<br />
liegt, e<strong>in</strong>geräumt. Dieser Zeitraum besteht aus den drei dem Haushaltsjahr folgenden Planungsjahren<br />
<strong>in</strong>nerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung. Durch diese Anb<strong>in</strong>dung an das Haushaltsjahr<br />
lassen sich die haushaltsmäßigen Wirkungen der vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen unmittelbar aus dem<br />
Haushaltsplan ablesen. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die Sanierungszeit nicht bereits beim<br />
Entstehen e<strong>in</strong>es möglichen dauerhaften Haushaltsausgleichs <strong>in</strong> allen Jahren der mittelfristigen Ergebnis- und<br />
F<strong>in</strong>anzplanung endet (Haushaltsausgleich <strong>in</strong> der Planung nach § 75 Abs. 2 S. 1 und § 84 GO <strong>NRW</strong>). Das Erreichen<br />
des Haushaltsausgleichs muss auch <strong>in</strong> der Rechnung (Jahresabschluss) des betreffenden Haushaltsjahres<br />
nachgewiesen werden. Nur wenn e<strong>in</strong> Haushaltsausgleich <strong>in</strong> diesem S<strong>in</strong>ne vorliegt, wird dem gesetzlichen Haushaltsausgleich<br />
nach § 75 Abs. 2 S. 1 GO <strong>NRW</strong> entsprochen.<br />
2.4 Zu Satz 4 (Nebenbestimmungen zur Genehmigung):<br />
2.4.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Im Rahmen der Anzeige der Haushaltssatzung hat die Aufsichtsbehörde der Geme<strong>in</strong>de das vorgelegte Haushaltssicherungskonzept<br />
zu genehmigen (vgl. Satz 2). Sie kann ihre Genehmigung mit Nebenbestimmungen versehen,<br />
die Bed<strong>in</strong>gungen und Auflagen enthalten können. Dies vor allem vor dem H<strong>in</strong>tergrund, dass die im Haushaltsplan<br />
enthaltene und jährlich gem. § 84 Satz 3 GO <strong>NRW</strong> auszugleichende mittelfristige Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung<br />
e<strong>in</strong> Kriterium darstellt, das im Genehmigungsverfahren zu berücksichtigen ist. Lassen sich aus den<br />
im Haushaltsplan der Geme<strong>in</strong>de enthaltenen Planungsdaten für die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre ke<strong>in</strong>e<br />
ausreichenden Veränderungen zur Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs erkennen, sollte die Aufsichtsbehörde<br />
bei der Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes durch entsprechende Nebenbestimmungen <strong>in</strong><br />
Form von Bed<strong>in</strong>gungen und Auflagen von der Geme<strong>in</strong>de ggf. weitere wirksame Konsolidierungsmaßnahmen<br />
verlangen.<br />
Die zur Genehmigung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes möglichen Bed<strong>in</strong>gungen und die zu erteilenden Auflagen<br />
sowie deren Ausgestaltung müssen sich an der Zielbestimmung der Wiederherstellung des jährlichen<br />
Haushaltsausgleichs und den dazu sachgerechten Konsolidierungsmaßnahmen messen lassen. Sie müssen<br />
geeignet se<strong>in</strong>, dass die Geme<strong>in</strong>de die gesetzten Ziele auch erreichen kann. Insgesamt gesehen muss es daher<br />
GEMEINDEORDNUNG 260
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 76 GO <strong>NRW</strong><br />
bei der Verpflichtung der Geme<strong>in</strong>de zur Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes e<strong>in</strong>e stärkere Verflechtung<br />
der haushaltswirtschaftlichen Planung mit der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung, aber auch e<strong>in</strong> engeres<br />
s<strong>in</strong>nvolles Zusammenspiel zwischen der Geme<strong>in</strong>de und ihrer Aufsichtsbehörde geben.<br />
2.4.2 Formen der Nebenbestimmungen<br />
Die Erteilung der Genehmigung zur Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage durch die Geme<strong>in</strong>de stellt e<strong>in</strong>e Regelung<br />
dar, die dieser Vorschrift mit bestimmten zusätzlichen Bestimmungen (Nebenbestimmungen nach § 36 Abs.<br />
1 VwVfG) versehen werden darf. Solche Nebenbestimmungen haben den Zweck, mögliche rechtliche oder tatsächliche<br />
H<strong>in</strong>dernisse, die e<strong>in</strong>er une<strong>in</strong>geschränkten Erteilung dieser Genehmigung entgegenstehen, zu beseitigen.<br />
Für die Aufsichtsbehörde der Geme<strong>in</strong>de besteht damit die Möglichkeit, die Genehmigung für die von der<br />
Geme<strong>in</strong>de vorgesehene Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage nicht abzulehnen, sondern bei möglichen Bedenken<br />
mit Vorbehalten zu arbeiten. Daran knüpft die haushaltsrechtliche Vorschrift an, <strong>in</strong> dem sie ausdrücklich<br />
regelt, dass diese Genehmigung unter Bed<strong>in</strong>gungen und mit Auflagen erteilt werden kann.<br />
Als e<strong>in</strong>e mögliche Nebenbestimmung zur Genehmigung zur Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage ist nach der<br />
Vorschrift auch die Bed<strong>in</strong>gung zulässig. Durch e<strong>in</strong>e solche Nebenbestimmung wird e<strong>in</strong>e bestimmte Rechtsfolge<br />
von dem E<strong>in</strong>tritt e<strong>in</strong>es unsicheren zukünftigen Ereignisses bei der Geme<strong>in</strong>de abhängig gemacht (vgl. § 158 BGB).<br />
Sie f<strong>in</strong>det bei der Erteilung von Genehmigungen <strong>in</strong> Form der aufschiebenden sowie der auflösenden Bed<strong>in</strong>gung<br />
Anwendung, ohne jedoch zeitlich e<strong>in</strong>deutig festgelegt zu se<strong>in</strong> und e<strong>in</strong>en eigenen Regelungs<strong>in</strong>halt zu haben. Die<br />
Auflage stellt e<strong>in</strong>e weitere zulässige Möglichkeit e<strong>in</strong>er Nebenbestimmung zur Genehmigung zur Verr<strong>in</strong>gerung der<br />
allgeme<strong>in</strong>en Rücklage durch die Aufsichtsbehörde dar. Durch e<strong>in</strong>e solche Nebenbestimmung wird e<strong>in</strong>e zusätzliche<br />
Regelung zu e<strong>in</strong>em bestimmten Tun, Dulden oder Unterlassen durch die Geme<strong>in</strong>de getroffen. Diese Nebenbestimmung<br />
hängt <strong>in</strong> ihrem Bestand von der Wirksamkeit der aufsichtsbehördlichen Genehmigung ab, auch wenn<br />
sie selbstständig anfechtbar ist.<br />
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ<br />
GEMEINDEORDNUNG 261
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 77 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 77<br />
Grundsätze der F<strong>in</strong>anzmittelbeschaffung<br />
(1) Die Geme<strong>in</strong>de erhebt Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften.<br />
(2) Sie hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen F<strong>in</strong>anzmittel<br />
1. soweit vertretbar und geboten aus speziellen Entgelten für die von ihr erbrachten Leistungen,<br />
2. im Übrigen aus Steuern<br />
zu beschaffen, soweit die sonstigen F<strong>in</strong>anzmittel nicht ausreichen.<br />
(3) Die Geme<strong>in</strong>de darf Kredite nur aufnehmen, wenn e<strong>in</strong>e andere F<strong>in</strong>anzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich<br />
unzweckmäßig wäre.<br />
Erläuterungen zu § 77:<br />
I. Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die Quellen der F<strong>in</strong>anzmittel der Geme<strong>in</strong>de s<strong>in</strong>d sehr vielfältig. Sie ergeben sich aus öffentlich-rechtlichen und<br />
privatrechtlichen Vorgängen. Es wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass diejenigen, die e<strong>in</strong>e kommunale<br />
Leistung <strong>in</strong> Anspruch nehmen oder e<strong>in</strong>e kommunale E<strong>in</strong>richtung nutzen, die entstehenden Kosten <strong>in</strong> vertretbaren<br />
und gebotenen Umfang tragen sollen. Die Vorschrift enthält für die Geme<strong>in</strong>den die Grundsätze der F<strong>in</strong>anzmittelbeschaffung<br />
und legt e<strong>in</strong>e bestimmte Rangfolge für die F<strong>in</strong>anzmittelarten fest. Damit f<strong>in</strong>det unter Berücksichtigung<br />
der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung der Geme<strong>in</strong>de das Bedarfsdeckungspr<strong>in</strong>zip i.V.m. dem Nachhaltigkeitspr<strong>in</strong>zip<br />
Anwendung. Das nachfolgende Schema zeigt die Rangfolge der Beschaffung der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
F<strong>in</strong>anzmittel nach dieser Vorschrift auf (vgl. Abbildung).<br />
Die Rangfolge der F<strong>in</strong>anzmittelbeschaffung<br />
1. Sonstige F<strong>in</strong>anzmittel (§ 77 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>)<br />
als vorrangige F<strong>in</strong>anzmittel<br />
z.B. Zuweisungen, Zuschüsse, Mieten, Pachten, Bußgelder, Verkaufserlöse,<br />
Z<strong>in</strong>sen<br />
2. Spezielle Entgelte (§ 77 Abs. 2 Nr. 1 GO <strong>NRW</strong>)<br />
für die von der Geme<strong>in</strong>de erbrachten Leistungen<br />
z.B. Gebühren, Beiträge, E<strong>in</strong>trittsgelder<br />
3. Steuern (§ 77 Abs. 2 Nr. 2 GO <strong>NRW</strong>)<br />
als nachrangige F<strong>in</strong>anzmittel<br />
z.B. Grundsteuern, Gewerbesteuer, sonstige örtliche Steuern<br />
4. Kredite (§ 77 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong>)<br />
nur unter den genannten Voraussetzungen des § 86 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong><br />
Abbildung 30 „Rangfolge der F<strong>in</strong>anzmittelbeschaffung“<br />
Der Gliederung dieser Grundsätze vergleichbar s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> der Bilanz der Geme<strong>in</strong>de die Forderungen (bestehende<br />
Ansprüche) der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> gesonderten Posten anzusetzen. Damit soll transparent gemacht werden, <strong>in</strong> welchem<br />
Umfang und bei welchen Arten die Geme<strong>in</strong>de die ihr zustehenden F<strong>in</strong>anzmittel noch nicht erhalten hat (vgl.<br />
§ 41 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO <strong>NRW</strong>). Die Grundsätze der F<strong>in</strong>anzmittelbeschaffung stehen auch mit dem Grundsatz<br />
<strong>in</strong> § 75 Abs. 6 GO <strong>NRW</strong> <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung, dass die Geme<strong>in</strong>de ihre Liquidität e<strong>in</strong>schließlich der F<strong>in</strong>anzierung der<br />
GEMEINDEORDNUNG 262
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 77 GO <strong>NRW</strong><br />
Investitionen sicherzustellen hat, sowie mit der Verpflichtung der Geme<strong>in</strong>de, e<strong>in</strong>e angemessene Liquiditätsplanung<br />
vorzunehmen (vgl. § 89 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>). Die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit, die damit erreicht werden<br />
soll, kann nur gewährleistet werden, wenn dabei auch der Rahmen zur Kreditaufnahme nach § 86 GO <strong>NRW</strong><br />
für Kredite für Investitionen und nach § 89 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> für Kredite zur Liquiditätssicherung beachtet wird.<br />
In diesem Zusammenhang darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass die E<strong>in</strong>wohner der Geme<strong>in</strong>de verpflichtet<br />
s<strong>in</strong>d, die Lasten zu tragen, die sich aus ihrer Zugehörigkeit zur Geme<strong>in</strong>de ergeben (vgl. § 8 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>).<br />
Auch ist auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen (vgl. § 10 S. 2 GO<br />
<strong>NRW</strong>). Zudem muss <strong>in</strong> die Betrachtung e<strong>in</strong>bezogen werden, ob und <strong>in</strong> welchem Umfang die Geme<strong>in</strong>de die E<strong>in</strong>ziehung<br />
von Ansprüchen <strong>in</strong> Form der Stundung h<strong>in</strong>ausschiebt oder durch Niederschlagung und Erlass auf die<br />
Durchsetzung ihrer Ansprüche verzichtet (vgl. § 23 Abs. 3 und 4 und § 26 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
II. Erläuterungen im E<strong>in</strong>zelnen<br />
1. Zu Absatz 1 (Abgabenerhebung):<br />
1.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die Erhebung von Abgaben durch die Geme<strong>in</strong>de ist nicht Gegenstand des geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsrechts, sondern<br />
des Abgabenrechts, z.B. nach den Vorschriften des KAG. Die Vorschrift <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>deordnung ist daher<br />
e<strong>in</strong>e Regelung zur E<strong>in</strong>ordnung der Erhebung von Abgaben <strong>in</strong> die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft. Das Abgabenrecht<br />
be<strong>in</strong>haltet u.a. das Recht der Geme<strong>in</strong>de als Hoheitsträger, im Rahmen ihrer F<strong>in</strong>anzhoheit Abgaben, d.h.<br />
Geldleistungen e<strong>in</strong>es Dritten gegenüber der Geme<strong>in</strong>de, zur Erfüllung der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgaben auf der Grundlage<br />
gesetzlicher Vorschriften zu erheben.<br />
In diesem besonderen Recht wird daher die allgeme<strong>in</strong>e Abgabenpflicht von Dritten gegenüber der Geme<strong>in</strong>de<br />
sowie die Art und Höhe der Abgabe unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen<br />
bestimmt. Sonstige öffentlich-rechtliche Geldleistungen sowie steuerliche Nebenleistungen (Z<strong>in</strong>sen<br />
und Versäumniszuschläge) gehören jedoch nicht dazu. Im Rahmen des Abgabenrechts werden Abgaben als die<br />
von der Geme<strong>in</strong>de als Hoheitsträger e<strong>in</strong>em Dritten auferlegten Geldleistungen zur Erfüllung der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Aufgaben verstanden. Dabei wird bei den öffentlichen Abgaben zwischen Steuern, Beiträgen, Gebühren und<br />
Sonderabgaben unterschieden.<br />
1.2 Arten der geme<strong>in</strong>dlichen Abgaben<br />
1.2.1 Die Abgabenart „Steuern“<br />
Die Geme<strong>in</strong>den können Steuern erheben (vgl. § 3 KAG). Sie sollen Steuern nur erheben, soweit die Deckung<br />
ihrer Aufwendungen nicht durch andere Erträge, <strong>in</strong>sbesondere durch Gebühren und Beiträge, <strong>in</strong> Betracht kommt.<br />
Damit entspricht die abgabenrechtliche Regelung der haushaltswirtschaftlich bestimmten Rangfolge über die<br />
F<strong>in</strong>anzmittelbeschaffung der Geme<strong>in</strong>de. Wird von der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>e Steuer erhoben, kann die Geme<strong>in</strong>de durch<br />
e<strong>in</strong>e Steuersatzung festgelegen, dass der Steuerpflichtige Vorauszahlungen auf die Steuer zu entrichten hat, die<br />
er für den laufenden Veranlagungszeitraum voraussichtlich schulden wird.<br />
In diesem Zusammenhang werden z.B. unter dem Begriff „Steuern“ Geldleistungen verstanden, die nicht e<strong>in</strong>e<br />
Gegenleistung für e<strong>in</strong>e besondere Leistung der Geme<strong>in</strong>de darstellen und zur Erzielung von geme<strong>in</strong>dlichen Erträgen<br />
all denjenigen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand, an den das betreffende Steuergesetz die Leistungspflicht<br />
des Dritten knüpft, vorliegt (vgl. § 3 Abs. 1 AO). E<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>dliche Abgabe ist daher dann e<strong>in</strong>e Steuer,<br />
wenn die sich aus der genannten Vorschrift ergebenden Tatbestandsmerkmale bei e<strong>in</strong>em Dritten vorliegen.<br />
GEMEINDEORDNUNG 263
1.2.2 Die Abgabenart „Gebühren“<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 77 GO <strong>NRW</strong><br />
Die Geme<strong>in</strong>den können Gebühren erheben (vgl. § 4 KAG). Der Begriff „Gebühr“ lässt sich dabei dadurch <strong>in</strong>haltlich<br />
abgrenzen, <strong>in</strong> dem unter Gebühren öffentlich-rechtliche Geldleistungen verstanden werden, die e<strong>in</strong>em Dritten<br />
von der Geme<strong>in</strong>de auferlegt werden, weil dieser öffentliche Leistungen der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> Anspruch genommen hat<br />
und die Erhebung auf öffentlich-rechtlichen Vorschriften oder auf Grund e<strong>in</strong>er hoheitlichen Maßnahme vorgenommen<br />
wird. Dabei kann dann zwischen Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme<br />
öffentlicher E<strong>in</strong>richtungen und Anlagen unterschieden werden.<br />
Die Verwaltungsgebühren werden z.B. für e<strong>in</strong>e Amtshandlung erhoben, wenn die Leistung der Verwaltung von<br />
dem Beteiligten beantragt worden ist oder wenn sie ihn unmittelbar begünstigt (vgl. § 5 KAG). Die Benutzungsgebühren<br />
werden als Gegenleistung für die Inanspruchnahme e<strong>in</strong>er öffentlichen E<strong>in</strong>richtung (Benutzung) erhoben,<br />
sofern ke<strong>in</strong> privatrechtliches Entgelt gefordert wird (vgl. § 6 KAG). Die Gebührenerhebung erfolgt mit dem Zweck,<br />
diejenigen Personen, die öffentliche Leistungen <strong>in</strong> Anspruch nehmen, vor den übrigen E<strong>in</strong>wohnern zu den Kosten<br />
heranzuziehen.<br />
1.2.3 Die Abgabenart „Beiträge“<br />
Die Geme<strong>in</strong>den können Beiträge erheben (vgl. § 8 KAG). Die Beitragspflicht entsteht regelmäßig mit der endgültigen<br />
Herstellung der E<strong>in</strong>richtung oder Anlage, ggf. auch mit der Beendigung e<strong>in</strong>er Teilmaßnahme oder mit der<br />
endgültigen Herstellung des Abschnitts, wenn dieser selbstständig <strong>in</strong> Anspruch genommen werden kann. Wird<br />
z.B. e<strong>in</strong> Anschlussbeitrag erhoben, so entsteht i.d.R. die Beitragspflicht, sobald das Grundstück an die E<strong>in</strong>richtung<br />
oder Anlage angeschlossen werden kann. Von der Geme<strong>in</strong>de können aber auch Beiträge für Teile e<strong>in</strong>er<br />
E<strong>in</strong>richtung oder Anlage erhoben werden (Kostenspaltung).<br />
Unter dem Begriff „Beiträge“ werden dabei Geldleistungen verstanden, die dem Ersatz des Aufwandes für die<br />
Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher E<strong>in</strong>richtungen und Anlagen, bei Straßen, Wegen und Plätzen<br />
auch für deren Verbesserung, jedoch ohne die laufende Unterhaltung und Instandsetzung, dienen. Sie werden<br />
von den Abgabepflichtigen als Gegenleistung dafür erhoben, dass ihnen durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme<br />
der E<strong>in</strong>richtungen und Anlagen wirtschaftliche Vorteile geboten werden. Die Erhebung von Beiträgen<br />
erfolgt daher mit dem Zweck, diejenigen Personen, denen sich durch die geme<strong>in</strong>dlichen Investitionen wirtschaftliche<br />
Vorteile ergeben, vor den übrigen E<strong>in</strong>wohnern zu den Kosten heranzuziehen.<br />
1.2.4 Sonderabgaben<br />
Als Abgabeart bestehen neben den Steuern, Beiträgen und Gebühren weitere Sonderabgaben, z.B. die Abgabe<br />
nach dem Schwerbeh<strong>in</strong>dertengesetz oder die Lastenausgleichsabgabe. Solche Abgaben s<strong>in</strong>d grundsätzlich nur<br />
für e<strong>in</strong>en eng begrenzten Bereich zulässig und erfordern besondere Voraussetzungen. Weil derartige Sonderabgaben<br />
e<strong>in</strong>em bestimmten Zweck dienen, muss e<strong>in</strong>e unmittelbare Verb<strong>in</strong>dung zwischen der Erhebung der Abgabe<br />
und ihrer Verwendung bestehen.<br />
1.3 Besondere gesetzliche Vorschriften<br />
Zur Erhebung von Abgaben durch Geme<strong>in</strong>den besteht e<strong>in</strong>e Vielzahl von gesetzlichen Bestimmungen, die bundesrechtlich,<br />
z.B. die Steuergesetze und die Abgabenordnung, aber auch landesrechtlich erlassen werden, z.B.<br />
das Kommunalabgabengesetz. Außerdem bedarf es vielfach und abhängig von der Abgabe des Erlasses e<strong>in</strong>er<br />
örtlichen Satzung durch die Geme<strong>in</strong>de. In diesem Zusammenhang wird z.B. durch § 10 S. 2 GO <strong>NRW</strong> bestimmt,<br />
dass die Geme<strong>in</strong>de im Rahmen ihrer Wirtschaftsführung auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Abgabe-<br />
GEMEINDEORDNUNG 264
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 77 GO <strong>NRW</strong><br />
pflichtigen Rücksicht zu nehmen hat. Das Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen (KAG)<br />
vom 21.10.1969 (GV. <strong>NRW</strong>. S. 712), <strong>in</strong> der derzeit geltenden Fassung, (SGV. <strong>NRW</strong>. 610) enthält zur Abgabenerhebung<br />
durch Geme<strong>in</strong>de weitere Bestimmungen. In diesem Zusammenhang s<strong>in</strong>d aber auch die Steuergesetze,<br />
z.B. das Grundsteuergesetz (GrStG), das Gewerbesteuergesetz (GewStG) und die Abgabenordnung (AO) sowie<br />
die sonstigen abgabenrechtlichen Vorschriften relevant.<br />
2. Zu Absatz 2 (Beschaffung der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzmittel):<br />
2.01 Die Rangfolge der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzmittel<br />
Die Vorschrift verpflichtet die Geme<strong>in</strong>de, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen F<strong>in</strong>anzmittel soweit vertretbar<br />
und geboten aus speziellen Entgelten für die von ihr erbrachten Leistungen und im Übrigen aus Steuern<br />
zu beschaffen, soweit die sonstigen F<strong>in</strong>anzmittel nicht ausreichen. Sie regelt dabei auch die Rangfolge der Quellen<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzmittel. Ausgangspunkt für die Untersuchung, welche F<strong>in</strong>anzmittel und <strong>in</strong> welcher<br />
Höhe diese zu beschaffen s<strong>in</strong>d, ist die Höhe der zur Erfüllung der Aufgaben der Geme<strong>in</strong>de notwendigen Aufwendungen<br />
und der Auszahlungen für Investitionen.<br />
Die Rangfolge bedeutet, dass zunächst den speziellen Entgelten e<strong>in</strong> Vorrang von den Steuern zu geben ist. Die<br />
Steuern sollen daher nur <strong>in</strong>soweit erhoben werden, wie diese und die sonstigen F<strong>in</strong>anzmittel die zur Erfüllung der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Aufgaben erforderlichen Aufwendungen und Auszahlungen nicht decken. Für die Rangfolge der<br />
Inanspruchnahme der Quellen der F<strong>in</strong>anzmittel ergibt sich danach, dass von der Geme<strong>in</strong>de an erster Stelle die<br />
sonstigen F<strong>in</strong>anzmittel <strong>in</strong> Anspruch zu nehmen s<strong>in</strong>d, dann die speziellen Entgelten für die von der Geme<strong>in</strong>de<br />
erbrachten Leistungen, und schließlich die Steuern.<br />
2.02 Die Beschränkungen der Heranziehung<br />
Die Beschaffung der F<strong>in</strong>anzmittel nach dieser Vorschrift f<strong>in</strong>det ihre Grenze im jährlichen Bedarf der Geme<strong>in</strong>de,<br />
z.B. wenn e<strong>in</strong>e Bedarfsdeckung (Die Erträge decken die Aufwendungen) gegeben und damit der gesetzlich erforderliche<br />
Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> erreicht wird. Bei der Beschaffung der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
F<strong>in</strong>anzmittel kann aber auch das Gebot, dass auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen<br />
Rücksicht zu nehmen ist (vgl. § 10 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>) zu e<strong>in</strong>er Beschränkung führen. Auch kann die Beschaffung<br />
der F<strong>in</strong>anzmittel dadurch e<strong>in</strong>geschränkt se<strong>in</strong>, dass es örtlich z.B. aus sozialen Gründen, nicht geboten ist, spezielle<br />
Entgelte für geme<strong>in</strong>dliche Leistungen im Umfang e<strong>in</strong>er vollen Kostendeckung zu erheben.<br />
2.03 Rangfolge und Zuwendungen<br />
In die Rangfolge der Beschaffung der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzmittel nach dieser Vorschrift lassen sich die erhaltenen<br />
Zuwendungen, die der Geme<strong>in</strong>de von Dritten gewährt werden, nicht e<strong>in</strong>ordnen, denn sie gehören als Gruppe<br />
nicht zu den F<strong>in</strong>anzmitteln, die sich die Geme<strong>in</strong>de zu beschaffen hat. Hat die Geme<strong>in</strong>de allerd<strong>in</strong>gs e<strong>in</strong>en Rechtsanspruch<br />
auf F<strong>in</strong>anzmittel von Dritten, s<strong>in</strong>d diese den sonstigen F<strong>in</strong>anzmitteln zuzuordnen.<br />
Zu den Zuwendungen im geme<strong>in</strong>dlichen Bereich zählen Zuweisungen und Zuschüsse als Übertragungen vom<br />
öffentlichen oder privaten Bereich an die Geme<strong>in</strong>de. Dazu zählen Zuwendungen für laufende Zwecke, z.B.<br />
Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land, aber auch Zuwendungen, die ausdrücklich für die<br />
Durchführung von geme<strong>in</strong>dlichen Investitionen geleistet werden und deshalb nicht sofort als Ertrag erfasst werden<br />
dürfen, sondern unter den Zahlungen aus der Investitionstätigkeit zu erfassen s<strong>in</strong>d (vgl. § 3 Abs. 1 Nr. 15<br />
GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
GEMEINDEORDNUNG 265
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 77 GO <strong>NRW</strong><br />
2.1 Zu Nummer 1 (Erhebung von Leistungsentgelten):<br />
2.1.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die Vorschrift verpflichtet die Geme<strong>in</strong>de, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen F<strong>in</strong>anzmittel soweit vertretbar<br />
und geboten aus speziellen Entgelten für die von ihr erbrachten Leistungen zu beschaffen. Die Geme<strong>in</strong>de<br />
soll damit veranlasst werden, von e<strong>in</strong>em Dritten, der ihre Leistungen <strong>in</strong> Anspruch nimmt, e<strong>in</strong>e angemessene Gegenleistung<br />
zu verlangen. Weil die Vorschrift gleichzeitig auch die Rangfolge der Quellen der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
F<strong>in</strong>anzmittel regelt, ist es der Geme<strong>in</strong>de verwehrt, bei e<strong>in</strong>er Inanspruchnahme ihrer Leistungen durch Dritte regelmäßig<br />
auf e<strong>in</strong>e Gegenleistung des Dritten zu verzichten.<br />
Die Geme<strong>in</strong>de darf daher nach dieser Vorschrift die Hauptlast der F<strong>in</strong>anzierung ihrer Aufgaben nicht auf die Erhebung<br />
von Steuern legen, denn die Allgeme<strong>in</strong>heit der Steuerzahler soll erst zu den Lasten der Geme<strong>in</strong>de herangezogen<br />
werden, wenn andere Möglichkeiten ausgeschöpft s<strong>in</strong>d. Diese haushaltsrechtlichen Gegebenheiten<br />
entsprechen den Grundsätzen des KAG <strong>NRW</strong> und daher s<strong>in</strong>d neben den Abgaben auch die privatrechtlichen<br />
Entgelte bei der F<strong>in</strong>anzmittelbeschaffung zu berücksichtigen.<br />
2.1.2 Der Begriff „soweit vertretbar und geboten“<br />
Die Vorgabe nach Ausschöpfung der Möglichkeiten der Geme<strong>in</strong>de zur Beschaffung ihrer F<strong>in</strong>anzmittel spezielle<br />
Entgelte für die von ihr erbrachten Leistungen zu erheben, f<strong>in</strong>det ihre Grenze dar<strong>in</strong>, dass diese Entgelte „soweit<br />
vertretbar und geboten“ zu erheben s<strong>in</strong>d. Die Vorschrift knüpft damit an die Bestimmungen der §§ 6, 7 und 8 KAG<br />
<strong>NRW</strong> an. Im Rahmen der Erhebung von Leistungsentgelten darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass die E<strong>in</strong>wohner<br />
der Geme<strong>in</strong>de verpflichtet s<strong>in</strong>d, die Lasten zu tragen, die sich aus ihrer Zugehörigkeit zur Geme<strong>in</strong>de ergeben<br />
(vgl. § 8 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>).<br />
Bei der Erhebung von Leistungsentgelten ist außerdem auch auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen<br />
Rücksicht zu nehmen (vgl. § 10 S. 2 GO <strong>NRW</strong>). Diese Regelung räumt der Geme<strong>in</strong>de gleichwohl<br />
e<strong>in</strong>en Entscheidungsspielraum e<strong>in</strong>, der von ihr unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten auszufüllen<br />
ist. Dabei kann es im E<strong>in</strong>zelfall vorkommen, dass der Grundsatz der Kostendeckung durch wichtige und bedeutende<br />
örtliche Gesichtspunkte nur e<strong>in</strong>geschränkt zur Anwendung kommt.<br />
2.1.3 Die Erhebung von Leistungsentgelten<br />
2.1.3.1 Die Erhebung von Gebühren<br />
Die Geme<strong>in</strong>den können Gebühren erheben (vgl. § 4 KAG). Der Begriff „Gebühr“ lässt sich dabei dadurch <strong>in</strong>haltlich<br />
abgrenzen, <strong>in</strong> dem unter Gebühren öffentlich-rechtliche Geldleistungen verstanden werden, die e<strong>in</strong>em Dritten<br />
von der Geme<strong>in</strong>de auferlegt werden, weil dieser öffentliche Leistungen der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> Anspruch genommen hat<br />
und die Erhebung auf öffentlich-rechtlichen Vorschriften oder auf Grund e<strong>in</strong>er hoheitlichen Maßnahme vorgenommen<br />
wird. Dabei kann dann zwischen Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme<br />
öffentlicher E<strong>in</strong>richtungen und Anlagen unterschieden werden.<br />
Die geme<strong>in</strong>dlichen Gebühren s<strong>in</strong>d öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>dividuell<br />
zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der<br />
öffentlichen Leistung <strong>in</strong> der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren s<strong>in</strong>d Entgelte für die Inanspruchnahme von<br />
öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren s<strong>in</strong>d demgegenüber Entgelte für die Benutzung<br />
von öffentlichen E<strong>in</strong>richtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen. Die Verwaltungsgebühren<br />
werden z.B. für e<strong>in</strong>e Amtshandlung erhoben, wenn die Leistung der Verwaltung von dem Beteilig-<br />
GEMEINDEORDNUNG 266
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 77 GO <strong>NRW</strong><br />
ten beantragt worden ist oder wenn sie ihn unmittelbar begünstigt (vgl. § 5 KAG). Die Benutzungsgebühren werden<br />
als Gegenleistung für die Inanspruchnahme e<strong>in</strong>er öffentlichen E<strong>in</strong>richtung (Benutzung) erhoben, sofern ke<strong>in</strong><br />
privatrechtliches Entgelt gefordert wird (vgl. § 6 KAG). Die Gebührenerhebung erfolgt mit dem Zweck, diejenigen<br />
Personen, die öffentliche Leistungen <strong>in</strong> Anspruch nehmen, vor den übrigen E<strong>in</strong>wohnern zu den Kosten heranzuziehen.<br />
Die Gebührenforderungen der Geme<strong>in</strong>de können zu unterschiedlichen Zeitpunkten ertragswirksam werden. Fordert<br />
die Geme<strong>in</strong>de durch e<strong>in</strong>en Gebührenbescheid e<strong>in</strong>e Vorauszahlung, ist die festgelegte Gebühr zum im geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Bescheid enthaltenen Erfüllungszeitpunkt bzw. Fälligkeitsterm<strong>in</strong> ertragswirksam zu vere<strong>in</strong>nahmen,<br />
weil dies den Realisationszeitpunkt darstellt, <strong>in</strong> dem Erträge dem betreffenden Haushaltsjahr wirtschaftlich zugerechnet<br />
werden können.<br />
In den Fällen, <strong>in</strong> denen die endgültige Gebührenfestsetzung erst zu e<strong>in</strong>em späteren Zeitpunkt stattf<strong>in</strong>det, und<br />
führt diese dazu, dass e<strong>in</strong>e Nachzahlung gefordert wird, ist dieser geme<strong>in</strong>dliche Anspruch i.d.R. mit der Bekanntgabe<br />
des Bescheides ertragswirksam zu buchen. Dieses gilt entsprechend, wenn die Geme<strong>in</strong>de auf Grund der<br />
Festsetzung e<strong>in</strong>en Betrag an e<strong>in</strong>en Dritten zu erstatten hat. Die B<strong>in</strong>dung der Festsetzung von Gebühren an das<br />
Vorliegen e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Bescheides gebietet das öffentlich-rechtliche Handeln der Geme<strong>in</strong>de.<br />
2.1.3.2 Die Erhebung von Beiträgen<br />
Die Geme<strong>in</strong>den können Beiträge erheben (vgl. § 8 KAG). Die Beitragspflicht entsteht regelmäßig mit der endgültigen<br />
Herstellung der E<strong>in</strong>richtung oder Anlage, ggf. auch mit der Beendigung e<strong>in</strong>er Teilmaßnahme oder mit der<br />
endgültigen Herstellung des Abschnitts, wenn dieser selbstständig <strong>in</strong> Anspruch genommen werden kann. Wird<br />
z.B. e<strong>in</strong> Anschlussbeitrag erhoben, so entsteht i.d.R. die Beitragspflicht, sobald das Grundstück an die E<strong>in</strong>richtung<br />
oder Anlage angeschlossen werden kann. Von der Geme<strong>in</strong>de können aber auch Beiträge für Teile e<strong>in</strong>er<br />
E<strong>in</strong>richtung oder Anlage erhoben werden (Kostenspaltung).<br />
Unter dem Begriff „Beiträge“ werden dabei Geldleistungen verstanden, die dem Ersatz des Aufwandes für die<br />
Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher E<strong>in</strong>richtungen und Anlagen, bei Straßen, Wegen und Plätzen<br />
auch für deren Verbesserung, jedoch ohne die laufende Unterhaltung und Instandsetzung, dienen. Sie werden<br />
von den Abgabepflichtigen als Gegenleistung dafür erhoben, dass ihnen durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme<br />
der E<strong>in</strong>richtungen und Anlagen wirtschaftliche Vorteile geboten werden. Die Erhebung von Beiträgen<br />
erfolgt daher mit dem Zweck, diejenigen Personen, denen sich durch die geme<strong>in</strong>dlichen Investitionen wirtschaftliche<br />
Vorteile ergeben, vor den übrigen E<strong>in</strong>wohnern zu den Kosten heranzuziehen.<br />
Erhaltene Beiträge u.ä. Entgelte s<strong>in</strong>d daher der Investitionstätigkeit der Geme<strong>in</strong>de zuzurechnen und daher unmittelbar<br />
im geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzplan zu erfassen. Erst mit der späteren Nutzung der mit den Beiträgen bzw. Entgelten<br />
f<strong>in</strong>anzierten Anschaffung oder Herstellung von geme<strong>in</strong>dlichen Vermögensgegenständen entsteht e<strong>in</strong>e<br />
Ergebniswirksamkeit aus der Auflösung der wegen der erhaltenen Beiträge <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz gebildeten<br />
Sonderposten (vgl. § 41 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO <strong>NRW</strong>). Dazu gehören auch die Beiträge, die von der Geme<strong>in</strong>de<br />
als Erschließungsbeiträge nach § 127 BauGB erhoben werden.<br />
2.2 Zu Nummer 2 (Die Erhebung von Steuern):<br />
2.2.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die Steuern sollen von der Geme<strong>in</strong>de nur <strong>in</strong>soweit erhoben werden, wie diese und die sonstigen F<strong>in</strong>anzmittel die<br />
zur Erfüllung der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgaben erforderlichen Aufwendungen und Auszahlungen nicht decken. Für die<br />
Rangfolge der Inanspruchnahme der Quellen der F<strong>in</strong>anzmittel ergibt sich danach, dass von der Geme<strong>in</strong>de an<br />
GEMEINDEORDNUNG 267
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 77 GO <strong>NRW</strong><br />
erster Stelle die sonstigen F<strong>in</strong>anzmittel <strong>in</strong> Anspruch zu nehmen s<strong>in</strong>d, dann die speziellen Entgelten für die von der<br />
Geme<strong>in</strong>de erbrachten Leistungen, und schließlich die Steuern. Dabei ist die Geme<strong>in</strong>de für die Festsetzung und<br />
Erhebung der Realsteuern zuständig (vgl. § 1 des Gesetzes über die Zuständigkeit für die Festsetzung und Erhebung<br />
der Realsteuern vom 16.12.1981; GV.<strong>NRW</strong> 1981 S. 732).<br />
Zu den Realsteuern, die von der Geme<strong>in</strong>de erhoben werden können, gehören nach § 3 Abs. 2 AO die Grundsteuer<br />
A und B sowie die Gewerbesteuer. Dabei s<strong>in</strong>d Geldleistungen, die nicht e<strong>in</strong>e Gegenleistung für e<strong>in</strong>e besondere<br />
Leistung darstellen und von e<strong>in</strong>em öffentlich-rechtlichen Geme<strong>in</strong>wesen zur Erzielung von E<strong>in</strong>nahmen<br />
allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Die Erzielung<br />
von E<strong>in</strong>nahmen kann dabei Nebenzweck se<strong>in</strong> (vgl. § 3 Abs. 1 AO).<br />
2.2.2 Zuordnungen nach dem Erfüllungszeitpunkt<br />
2.2.2.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
E<strong>in</strong>e Steuerpflicht entsteht i.d.R. wirtschaftlich <strong>in</strong> dem Jahr, für das aus Sicht des Festsetzenden e<strong>in</strong>e Veranlagung<br />
vorgenommen wird, unabhängig davon, zu welchem späteren Zeitpunkt die Festsetzung der Steuerpflicht<br />
erfolgt. Für die Erhebung von Steuern def<strong>in</strong>ieren die e<strong>in</strong>schlägigen Gesetze oder Satzungen abstrakte Tatbestände,<br />
die e<strong>in</strong>en Anspruch der Geme<strong>in</strong>de begründen können sowie die Voraussetzungen des Entstehens. E<strong>in</strong><br />
abstrakter Anspruch ist jedoch nicht als ausreichend zu bewerten, um bereits zu diesem Zeitpunkt e<strong>in</strong>e Ertragswirksamkeit<br />
auszulösen.<br />
In diesen Fällen bedarf es vielmehr erst der tatsächlichen Verwirklichung dieses Anspruchs durch e<strong>in</strong>en Heranziehungsbescheid<br />
der Geme<strong>in</strong>de im Rahmen ihrer Steuererhebung als wertbegründenden Tatbestand. Das öffentlich-rechtliche<br />
Handeln der Geme<strong>in</strong>den gebietet e<strong>in</strong> haushaltswirtschaftliches Handeln, durch dass die Steuererträge<br />
erst nach der Verwirklichung der Anspruchstatbestände (nach konkreter Feststellung) erhoben und<br />
geme<strong>in</strong>deübergreifend nach der gleichen Art und Weise, also wenn die Leistungspflicht rechtsverb<strong>in</strong>dlich ist,<br />
e<strong>in</strong>em Haushaltsjahr zugeordnet werden.<br />
Die Steuererträge der Geme<strong>in</strong>de sollen daher dem Haushaltsjahr, <strong>in</strong> dem auf Basis der Bemessungsgrundlage<br />
die Steuerpflicht durch e<strong>in</strong>en geme<strong>in</strong>dlichen Heranziehungsbescheid (Rechtsakt) festgesetzt bzw. realisiert werden,<br />
zugerechnet werden (Erfüllungszeitpunkt). Erst zu diesem Zeitpunkt entstehen die Leistungspflicht und der<br />
wertbegründende Tatbestand (Realisationszeitpunkt), <strong>in</strong> dem Erträge dem betreffenden Haushaltsjahr wirtschaftlich<br />
zugerechnet werden können. E<strong>in</strong>e solche Verfahrensweise ist u.a. auch wegen des Problems, dass e<strong>in</strong> möglicher<br />
Ertrag nicht zuverlässig <strong>in</strong> dem Haushaltsjahr, <strong>in</strong> dem die wirtschaftliche Ursache entsteht, gemessen werden<br />
kann, sondern erst <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em späteren Haushaltsjahr, angemessen. Erst zu diesem Zeitpunkt ist objektiv betrachtet<br />
auch das Ressourcenaufkommen als entstanden anzusehen, weil dieses durch e<strong>in</strong>en Verwaltungsakt<br />
objektiviert und der wertbegründende Tatbestand geschaffen wird und i.d.R. erst <strong>in</strong> diesem Rahmen bzw. zu<br />
diesem Zeitpunkt verlässlich bewertbar ist.<br />
Die haushaltswirtschaftliche Zuordnung von Steuererträgen nach dem Erfüllungszeitpunkt ist auch wegen der<br />
Notwendigkeit e<strong>in</strong>er e<strong>in</strong>heitlichen Handhabung sowie aus Gründen der Vere<strong>in</strong>fachung sachgerecht. Sie folgt<br />
vorrangig dem Bestehen e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Rechtsanspruchs und dem wertbegründenden Tatbestand nicht<br />
ausschließlich dem Pr<strong>in</strong>zip der ungewissen wirtschaftlichen Verursachung. Diese haushaltsmäßige Zuordnung ist<br />
auch unter Berücksichtigung des gesetzlich bestimmten jährlichen Haushaltsausgleich sowie des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
F<strong>in</strong>anzausgleichs erforderlich, um möglichst die vergleichbare Ausgangsverhältnisse bei den Geme<strong>in</strong>den, z.B. für<br />
die Ermittlung der Steuerkraft, zu gewährleisten. Die beschriebene haushaltswirtschaftliche Zuordnung von Steuererträgen<br />
trägt der periodenbezogenen Zuordnung im S<strong>in</strong>ne des NKF <strong>in</strong> ausreichendem Maße Rechnung. Das<br />
haushaltsmäßige Zuordnungspr<strong>in</strong>zip ist sowohl bei Festsetzungsbescheiden als auch bei Vorauszahlungsbescheiden<br />
anzuwenden.<br />
GEMEINDEORDNUNG 268
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 77 GO <strong>NRW</strong><br />
2.2.2.2 Ertragszuordnungen bei Vorauszahlungsbescheiden<br />
Bei Vorauszahlungsbescheiden der Geme<strong>in</strong>de ist die festgelegte Steuerzahlung zu den oder dem im geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Bescheid enthaltenen Fälligkeitsterm<strong>in</strong>(en) des betreffenden Haushaltsjahres (Erfüllungszeitpunkten) ertragswirksam<br />
zu vere<strong>in</strong>nahmen, denn erst zu diesem Zeitpunkt entstehen die Leistungspflicht und der wertbegründende<br />
Tatbestand. Dabei ist dann zwischen Fälligkeitsterm<strong>in</strong>en <strong>in</strong> dem Jahr, <strong>in</strong> dem der Bescheid durch die<br />
Geme<strong>in</strong>de erlassen wird, und <strong>in</strong> künftigen dem Jahr des Bescheides folgenden Jahren zu unterscheiden. Wird e<strong>in</strong><br />
Bescheid für die Zukunft mit Zahlungsterm<strong>in</strong>en z.B. im folgenden Haushaltsjahr erlassen, muss der Ertrag dem<br />
Haushaltsjahr zugerechnet werden, <strong>in</strong> dem die Erfüllungszeitpunkte liegen. In diesen Fällen kommt für die haushaltsmäßige<br />
ertragswirksame Zuordnung nicht der Zeitpunkt der Festsetzung <strong>in</strong> Betracht.<br />
In den Fällen aber, <strong>in</strong> denen die Festsetzung im geme<strong>in</strong>dlichen Bescheid und die dar<strong>in</strong> festgelegten Zahlungsterm<strong>in</strong>e<br />
das gleiche Haushaltsjahr betreffen, kann der daraus für die Geme<strong>in</strong>de entstehende Ertrag nach den<br />
Fälligkeitsterm<strong>in</strong>en <strong>in</strong> Teilbeträge aufgeteilt und entsprechend ertragswirksam vere<strong>in</strong>nahmt werden. Der durch<br />
den Bescheid entstehende geme<strong>in</strong>dliche Ertrag kann aber auch bereits im Zeitpunkt der Festsetzung vollständig<br />
<strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Ergebnisrechnung erfasst werden. Die unterjährigen Fälligkeitsterm<strong>in</strong>e erfordern nicht, dass<br />
die dadurch entstandenen Teilerträge entsprechend gestückelt von der Geme<strong>in</strong>de zu vere<strong>in</strong>nahmen s<strong>in</strong>d.<br />
2.2.2.3 Ertragszuordnungen bei Festsetzungsbescheiden<br />
Bei Festsetzungsbescheiden der Geme<strong>in</strong>de (auch Nachzahlungs- oder Rückforderungsbescheide) führt die endgültige<br />
Festsetzung (rechtsverb<strong>in</strong>dliche Leistungspflicht) dazu, dass die Zuordnung der möglichen Erträge i.d.R.<br />
zu dem Haushaltsjahr vorzunehmen ist, <strong>in</strong> dem der Bescheid ergeht und der Erfüllungszeitpunkt liegt, denn erst<br />
zu diesem Zeitpunkt entstehen die Leistungspflicht und der wertbegründende Tatbestand, <strong>in</strong> dem Erträge dem<br />
betreffenden Haushaltsjahr wirtschaftlich zugerechnet werden können. In den Fällen, <strong>in</strong> denen z.B. e<strong>in</strong>e Nachzahlung<br />
gefordert wird, kann diese mit der Bekanntgabe des Bescheides ertragswirksam gebucht werden. Dieses<br />
gilt entsprechend, wenn die Geme<strong>in</strong>de auf Grund der vorgenommenen endgültigen Festsetzung e<strong>in</strong>en Betrag zu<br />
erstatten hat. Im Rahmen des Jahresabschlusses kann dabei aber auch das Wertaufhellungsgebot zu beachten<br />
se<strong>in</strong>, wenn sich die Festsetzungsbescheide auf zuvor liegende Steuerveranlagungsjahre beziehen.<br />
2.2.3 Wertaufhellungsgebot bei der Steuererhebung<br />
Grundsätzlich gilt auch für Steuererträge, dass im Rahmen des Jahresabschlusses zu prüfen ist, ob das Wertaufhellungspr<strong>in</strong>zip<br />
Anwendung f<strong>in</strong>det. Das Wertaufhellungsgebot ist e<strong>in</strong> Grundsatz ordnungsmäßiger Buchführung<br />
(GoB). Es regelt die Frage, wie Informationen zu berücksichtigen s<strong>in</strong>d, die der Bilanzierende nach dem Abschlussstichtag,<br />
aber vor Aufstellung des Jahresabschlusses, erhält. Das Wertaufhellungsgebot verlangt, dass<br />
Informationen, die sich auf Gegebenheiten vor dem Abschlussstichtag beziehen, im Jahresabschluss berücksichtigt<br />
werden. Das heißt: Ergibt sich nach dem Abschlussstichtag, aber noch vor der Bestätigung des Jahresabschlusses<br />
durch den Bürgermeister, e<strong>in</strong>e Änderung der Steuerhöhe für e<strong>in</strong>en bereits abgeschlossenen Erhebungszeitraum<br />
bzw. e<strong>in</strong> abgeschlossenes Haushaltsjahr, so ist dieser Betrag nach dem kaufmännischen Wertaufhellungspr<strong>in</strong>zip<br />
noch <strong>in</strong> dem „offenen“ Jahresabschluss zu berücksichtigen.<br />
3. Zu Absatz 3 (Wirtschaftlichkeit bei Kreditaufnahme):<br />
3.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Im Rahmen des Bedarfsdeckungspr<strong>in</strong>zips wird auch die Aufnahme von Krediten zugelassen, wenn e<strong>in</strong>e andere<br />
F<strong>in</strong>anzierung durch die Geme<strong>in</strong>de nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Die Kredite für Ge-<br />
GEMEINDEORDNUNG 269
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 77 GO <strong>NRW</strong><br />
me<strong>in</strong>den, z.B. für Investitionen <strong>in</strong> Form des Kommunalkredits, stellen ke<strong>in</strong>e eigenständige Kreditform dar, vielmehr<br />
unterliegen sie den Formen der Kredite aus der allgeme<strong>in</strong>en Geldwirtschaft. Der Begriff des Kredites ist<br />
daher von dort übernommen worden und entspricht dem Darlehensbegriff nach §§ 488 BGB. Er umfasst daher für<br />
die Geme<strong>in</strong>den nur Geldschulden und nicht darlehensweise empfangene Sachen (vgl. §§ 607 ff. BGB).<br />
Die geme<strong>in</strong>dlichen Kredite werden im Rahmen privatrechtlicher Rechtsgeschäfte, z.B. als Schuldsche<strong>in</strong>darlehen,<br />
Anleihen u.a., aufgenommen. Weil nach § 86 GO <strong>NRW</strong> Kredite nur für Investitionen und nach § 89 GO <strong>NRW</strong> nur<br />
zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden dürfen, lassen sich die F<strong>in</strong>anzmittel aus Kreditaufnahmen nicht<br />
ohne weiteres <strong>in</strong> die Rangordnung des Absatzes 2 e<strong>in</strong>fügen, sondern bedurften e<strong>in</strong>er gesonderten Regelung.<br />
E<strong>in</strong>e Kreditaufnahme kommt grundsätzlich nur <strong>in</strong> Betracht, wenn alle anderen Quellen für F<strong>in</strong>anzmittel der Geme<strong>in</strong>de<br />
ausgeschöpft s<strong>in</strong>d. E<strong>in</strong>e Ausnahme von dieser Subsidiarität der Kreditaufnahme wird nur für den Fall<br />
zugelassen, dass e<strong>in</strong>e andere F<strong>in</strong>anzierung wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Ob dies vor Ort gegeben ist,<br />
muss von der Geme<strong>in</strong>de nach haushaltswirtschaftlichen Gesichtspunkten sowie nach den örtlichen wirtschaftlichen<br />
Wirkungen beurteilt und entschieden werden.<br />
Zum Nachweis der Wirtschaftlichkeit e<strong>in</strong>e Kreditaufnahme besteht für die Geme<strong>in</strong>de die Verpflichtung, e<strong>in</strong>en<br />
Vergleich zwischen den Möglichkeiten der F<strong>in</strong>anzmittelbeschaffung nach den Absätzen 1 und 2 und der Aufnahme<br />
von Fremdkapital vorzunehmen. Dabei gilt der Grundsatz, dass die Kreditaufnahme jedenfalls nicht ungünstiger<br />
se<strong>in</strong> darf als die sonstigen Möglichkeiten der F<strong>in</strong>anzmittelbeschaffung. Auch die voraussichtlichen Kosten von<br />
beiden Möglichkeiten der F<strong>in</strong>anzmittelbeschaffung müssen <strong>in</strong> den Vergleich e<strong>in</strong>bezogen werden.<br />
3.2 Kredite und Kapitalanlage (Geldanlage)<br />
E<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>dliche Kapitalanlage entsteht i.d.R. aus der H<strong>in</strong>gabe von vorhandenen liquiden Mitteln (Geldbeträgen)<br />
der Geme<strong>in</strong>de, die <strong>in</strong> Kapital umgewandelt werden. Dieser Vorgang stellt wie die Umwandlung von vorhandenen<br />
liquiden Mitteln der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> Sachanlagen haushaltsrechtlich e<strong>in</strong>e Investition dar. Außerdem stellt die<br />
von der Geme<strong>in</strong>de erworbene Kapitalanlage bilanztechnisch e<strong>in</strong>e F<strong>in</strong>anzanlage dar, so dass <strong>in</strong> diesem Zusammenhang<br />
der Zahlungsvorgang <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzrechnung unter der Haushaltsposition „Auszahlungen<br />
für den Erwerb von F<strong>in</strong>anzanlagen“ nachzuweisen ist (vgl. § 3 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO <strong>NRW</strong>). Die Investitionen<br />
der Geme<strong>in</strong>de bewirken regelmäßig e<strong>in</strong>e dauerhafte Mehrung des geme<strong>in</strong>dlichen Vermögens, z.B. das <strong>in</strong> der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz anzusetzende Anlagevermögen, zu dem auch die F<strong>in</strong>anzanlagen zu zählen s<strong>in</strong>d. Diese<br />
haushaltsrechtliche Zuordnung e<strong>in</strong>er Kapitalanlage der Geme<strong>in</strong>de könnte den Schluss zu lassen, dass dadurch<br />
auch e<strong>in</strong>e Kreditf<strong>in</strong>anzierung für e<strong>in</strong>e Kapitalanlage zulässig wäre. Die Geme<strong>in</strong>de darf nach des Vorschrift des §<br />
86 GO <strong>NRW</strong> Kredite für Investitionen aufnehmen.<br />
Der Erwerb e<strong>in</strong>er Kapitalanlage dient e<strong>in</strong>erseits der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgabenerfüllung dient und stellt andererseits<br />
e<strong>in</strong>e Investition dar, so dass die Voraussetzungen für e<strong>in</strong>e Kreditaufnahme für die Kapitalanlage grundsätzlich<br />
erfüllt se<strong>in</strong> können. E<strong>in</strong>er solchen Kreditaufnahme dürfen jedoch auch die Grundsätze der F<strong>in</strong>anzmittelbeschaffung<br />
nach § 77 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong> nicht entgegenstehen, denn sie ist zulässig, wenn e<strong>in</strong>e andere F<strong>in</strong>anzierung<br />
nicht möglich oder unzweckmäßig wäre. Dieses könnte im E<strong>in</strong>zelfall beim Erwerb e<strong>in</strong>er Kapitalanlage gegeben<br />
se<strong>in</strong>. In diesem Zusammenhang wäre auch zu prüfen, ob beim Erwerb e<strong>in</strong>er Kapitalanlage mit durch e<strong>in</strong>en Kredit<br />
der Geme<strong>in</strong>de zugegangenen Geldmitteln (Fremdkapital) es zu e<strong>in</strong>er dauerhaften Vermögensmehrung bei der<br />
Geme<strong>in</strong>de kommt.<br />
Bei e<strong>in</strong>er Kreditaufnahme für e<strong>in</strong>e Kapitalanlage könnte zudem das Spekulationsverbot <strong>in</strong> § 90 GO <strong>NRW</strong> berührt<br />
se<strong>in</strong>, wenn unterstellt werden kann, dass die Kapitalanlage vorrangig der Erzielung e<strong>in</strong>es Gew<strong>in</strong>ns aus der Differenz<br />
zwischen den Kreditkosten und dem Z<strong>in</strong>sertrag dient, und dabei auf die weitere „ungewisse“ Z<strong>in</strong>sentwicklung<br />
gesetzt wird. Andererseits dient aber e<strong>in</strong>e solche Differenz erst e<strong>in</strong>mal dazu, e<strong>in</strong>e Wirtschaftlichkeit der Kapitalanlage<br />
anzunehmen. Auch deshalb war z.B. <strong>in</strong> der Vergangenheit e<strong>in</strong>e Kapitalanlage der Geme<strong>in</strong>de nur dann zu-<br />
GEMEINDEORDNUNG 270
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 77 GO <strong>NRW</strong><br />
lässig, wenn bei der Geme<strong>in</strong>de weitere Geldmittel vorhanden waren, die sie nicht für ihren aktuellen Zahlungsverkehr<br />
benötigte.<br />
Bei der F<strong>in</strong>anzierung e<strong>in</strong>er Kapitalanlage durch Fremdkapital ist auch der künftige Verwendungszweck <strong>in</strong> die<br />
Bewertung e<strong>in</strong>zubeziehen. Im S<strong>in</strong>ne des § 86 GO <strong>NRW</strong> dürfte es nicht zulässig se<strong>in</strong>, wenn die fremdf<strong>in</strong>anzierte<br />
Kapitalanlage der Geme<strong>in</strong>de dazu dient, <strong>in</strong> künftigen Haushaltsjahren die Auszahlungen aus zahlungswirksamen<br />
Aufwendungen zu ermöglichen. Mit e<strong>in</strong>em solchen Zweck verliert der Erwerb e<strong>in</strong>er Kapitalanlage den Charakter<br />
e<strong>in</strong>er Investition und damit die Grundlage für e<strong>in</strong>e zulässige Kreditaufnahme. In diesem S<strong>in</strong>ne wäre bei e<strong>in</strong>er<br />
Fremdkapitalf<strong>in</strong>anzierung der Kapitalanlage auch der Grundsatz der <strong>in</strong>tergenerativen Gerechtigkeit tangiert (vgl. §<br />
1 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>). In diesem Zusammenhang steht auch der Runderlass über kommunale Geldanlagen vom<br />
25.01.2005, nach dem zu beachten ist, dass e<strong>in</strong>e Kapitalanlage bzw. die Anlage von geme<strong>in</strong>dlichen Geldmitteln<br />
nur mit Geldmitteln der Geme<strong>in</strong>de zulässig ist, die nicht zur Sicherung der Liquidität und zur Zahlungsabwicklung<br />
benötigt werden. Dieser Runderlass führt zudem die vorherigen Runderlasse fort.<br />
Diese Voraussetzungen bed<strong>in</strong>gen, dass der Erwerb e<strong>in</strong>er Kapitalanlage, f<strong>in</strong>anziert durch die Aufnahme von Investitionskrediten<br />
nach § 86 GO <strong>NRW</strong>, dann nicht mit den haushaltsrechtlichen Grundsätzen und Vorschriften für<br />
Geme<strong>in</strong>den <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang steht, wenn damit die laufende Verwaltungstätigkeit der Geme<strong>in</strong>de, also geme<strong>in</strong>dliche<br />
Aufwendungen f<strong>in</strong>anziert werden sollen, z.B. die Zahlung der künftigen Versorgungsleistungen.<br />
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ<br />
GEMEINDEORDNUNG 271
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 78 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 78<br />
Haushaltssatzung<br />
(1) Die Geme<strong>in</strong>de hat für jedes Haushaltsjahr e<strong>in</strong>e Haushaltssatzung zu erlassen.<br />
(2) 1 Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung<br />
1. des Haushaltsplans<br />
a) im Ergebnisplan unter Angabe des Gesamtbetrages der Erträge und der Aufwendungen des Haushaltsjahres,<br />
b) im F<strong>in</strong>anzplan unter Angabe des Gesamtbetrages der E<strong>in</strong>zahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,<br />
des Gesamtbetrages der E<strong>in</strong>zahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und<br />
aus der F<strong>in</strong>anzierungstätigkeit des Haushaltsjahres,<br />
c) unter Angabe der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung),<br />
d) unter Angabe der vorgesehenen Ermächtigungen zum E<strong>in</strong>gehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre<br />
mit Auszahlungen für Investitionen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),<br />
2. der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage,<br />
3. des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung,<br />
4. der Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen s<strong>in</strong>d,<br />
5. des Jahres, <strong>in</strong> dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist.<br />
2<br />
Sie kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge und die Aufwendungen, E<strong>in</strong>zahlungen und Auszahlungen,<br />
den Stellenplan des Haushaltsjahres und das Haushaltssicherungskonzept beziehen.<br />
(3) 1 Die Haushaltssatzung tritt mit Beg<strong>in</strong>n des Haushaltsjahres <strong>in</strong> Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. 2 Sie kann<br />
Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten.<br />
(4) Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit für e<strong>in</strong>zelne Bereiche durch Gesetz oder Rechtsverordnung nichts<br />
anderes bestimmt ist.<br />
Erläuterungen zu § 78:<br />
I. Allgeme<strong>in</strong>es<br />
1. Satzungsrecht der Geme<strong>in</strong>de<br />
1.1 Die Haushaltssatzung der Geme<strong>in</strong>de<br />
Die jährliche Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de erfordert e<strong>in</strong>e b<strong>in</strong>dende Grundlage für ihre Ausführung durch die<br />
geme<strong>in</strong>dliche Verwaltung. Diese Grundlage schafft der Rat der Geme<strong>in</strong>de im Rahmen se<strong>in</strong>es Budgetrechtes<br />
durch den jährlichen Erlass e<strong>in</strong>er Haushaltssatzung (vgl. § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO <strong>NRW</strong>). Die Geme<strong>in</strong>den<br />
können nach § 7 GO <strong>NRW</strong> ihre Angelegenheiten durch örtliche Satzungen regeln. Zu solchen geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Satzungen gehört vor allem die jährliche Haushaltssatzung der Geme<strong>in</strong>de. E<strong>in</strong> auf der beschlossenen Haushaltsatzung<br />
aufbauender geme<strong>in</strong>dlicher Haushalt ist Ausdruck der F<strong>in</strong>anzhoheit der Geme<strong>in</strong>de und der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Selbstverwaltung. Es muss dabei von der Geme<strong>in</strong>de gewährleistet werden, dass durch die Haushaltssatzung<br />
mit ihren Anlagen m<strong>in</strong>destens alle gesetzlich bestimmten Festsetzungen getroffen werden und diese alle<br />
Ermächtigungen für die geme<strong>in</strong>dliche Verwaltung enthält, die zur Ausführung und E<strong>in</strong>haltung des Haushaltsplans<br />
der Geme<strong>in</strong>de im betreffenden Haushaltsjahr notwendig s<strong>in</strong>d.<br />
Die jährliche Haushaltssatzung der Geme<strong>in</strong>de unterliegt dabei nicht e<strong>in</strong>er generellen Genehmigungspflicht durch<br />
die zuständige Aufsichtsbehörde, sondern nur e<strong>in</strong>er Anzeigepflicht (vgl. § 80 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong>). Nur wenn im<br />
E<strong>in</strong>zelfall von der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong> besonderes Haushaltssicherungskonzept (vgl. § 76 GO <strong>NRW</strong>) aufzustellen ist,<br />
GEMEINDEORDNUNG 272
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 78 GO <strong>NRW</strong><br />
das dann e<strong>in</strong>en Bestandteil des geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplans darstellt (vgl. § 79 Abs. 2 S. 2 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 1<br />
Abs. 1 Nr. 4 GemHVO <strong>NRW</strong>), löst dieser Tatbestand lediglich e<strong>in</strong>e Genehmigungspflicht für das geme<strong>in</strong>dliche<br />
Haushaltssicherungskonzept aus, jedoch nicht für die gesamte Haushaltssatzung der Geme<strong>in</strong>de. Vor der Bekanntmachung<br />
der vom Rat der Geme<strong>in</strong>de beschlossenen Haushaltssatzung, bei der die Frist <strong>in</strong> § 80 Abs. 5 S. 3<br />
GO <strong>NRW</strong> zu beachten ist, sollte deshalb noch e<strong>in</strong>mal geprüft werden, ob die Haushaltssatzung den materiellen<br />
und formellen Anforderungen entspricht und die für die Bekanntmachung notwendigen Verfahrensschritte nach<br />
den e<strong>in</strong>schlägigen Rechtsvorschriften erfolgt s<strong>in</strong>d (vgl. § 2 BekanntmVO <strong>NRW</strong>).<br />
1.2 Haushaltssatzung und geme<strong>in</strong>dliche Verwaltung<br />
Die Haushaltssatzung b<strong>in</strong>det die Verwaltung der Geme<strong>in</strong>de und ermächtigt sie, die im Haushaltsplan (vgl. § 79<br />
GO <strong>NRW</strong>) enthaltenen Ermächtigungen für die dort ausgewiesenen Zwecke <strong>in</strong> Anspruch zu nehmen, neue Verpflichtungen<br />
e<strong>in</strong>zugehen (vgl. § 85 GO <strong>NRW</strong>), aber auch Kredite zur F<strong>in</strong>anzierung von Investitionen (vgl. § 86 GO<br />
<strong>NRW</strong>) aufzunehmen. Sie hat aber nur <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em e<strong>in</strong>geschränkten Umfang e<strong>in</strong>e unmittelbare B<strong>in</strong>dungswirkung für<br />
die Bürger<strong>in</strong>nen und Bürger der Geme<strong>in</strong>de sowie die Abgabepflichtigen. Der Haushaltsplan stellt <strong>in</strong> diesem Zusammenhang<br />
e<strong>in</strong> wichtiges Werk dar, das den wesentlichen und unverzichtbaren Inhalt für die Ausführung der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr enthält.<br />
1.3 Die Anlagen zur Haushaltssatzung<br />
Durch die Vorschrift über die Haushaltssatzung werden zwar ihre Inhalte bestimmt, sie enthält jedoch ke<strong>in</strong>e Aufzählung<br />
der notwendigen Anlagen, obwohl nach § 80 GO <strong>NRW</strong> ausdrücklich e<strong>in</strong>e Haushaltssatzung mit ihren<br />
Anlagen aufzustellen, vom Bürgermeister zu bestätigen und dem Rat zuzuleiten ist. Nach dieser Vorschrift hat<br />
auch der Rat über den Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen <strong>in</strong> öffentlicher Sitzung zu beraten und zu<br />
beschließen (vgl. § 80 Abs. 1 bis 6 GO <strong>NRW</strong>). Die Geme<strong>in</strong>de hat daher <strong>in</strong> eigener Verantwortung über die der<br />
Haushaltssatzung beizufügenden Anlagen zu entscheiden, um damit e<strong>in</strong> zutreffendes Bild über ihre geplante<br />
Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr abgeben zu können, soweit nicht nach Maßgabe der Geme<strong>in</strong>deordnung<br />
und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften Anlagen zur geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung bestimmt<br />
werden.<br />
Als unverzichtbare und wichtigste Anlage zur Haushaltssatzung ist der Haushaltsplan zu betrachten, der alle im<br />
Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Geme<strong>in</strong>de voraussichtlich anfallenden Erträge und e<strong>in</strong>gehenden<br />
E<strong>in</strong>zahlungen sowie die entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen zu enthalten hat (vgl. § 79<br />
Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>). Diese Klassifizierung ist möglich, weil die Haushaltssatzung die Festsetzungen des Haushaltsplans<br />
(Ergebnisplan und F<strong>in</strong>anzplan) enthalten muss (vgl. § 78 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>). Gleichwohl ist h<strong>in</strong>sichtlich se<strong>in</strong>er<br />
Wertigkeit der Haushaltsplan der Geme<strong>in</strong>de nicht nur e<strong>in</strong>e formale Anlage der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung,<br />
denn der Haushaltsplan entfaltet e<strong>in</strong>e eigenständige rechtliche B<strong>in</strong>dung für die Haushaltsführung der Geme<strong>in</strong>de<br />
(vgl. § 79 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong>).<br />
2. Die Beachtung haushaltswirtschaftlicher Grundsätze<br />
Mit dieser Vorschrift werden aber auch mehrere Haushaltsgrundsätze umgesetzt. So wird z.B. dem Grundsatz<br />
der Jährlichkeit dadurch Genüge getan, dass bestimmt worden ist, die Haushaltssatzung gilt für das Haushaltsjahr<br />
(vgl. Absatz 3 der Vorschrift) und das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr (vgl. Absatz 4 der Vorschrift). Mit<br />
der gesetzlichen Festlegung „Die Haushaltssatzung tritt mit Beg<strong>in</strong>n des Haushaltsjahres <strong>in</strong> Kraft“ ist grundsätzlich<br />
verbunden, dass die Haushaltssatzung vor Beg<strong>in</strong>n des betreffenden Haushaltsjahres beschlossen se<strong>in</strong> soll<br />
Grundsatz der Vorherigkeit).<br />
GEMEINDEORDNUNG 273
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 78 GO <strong>NRW</strong><br />
Die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung soll daher auch spätestens e<strong>in</strong>en Monat vor Beg<strong>in</strong>n des Haushaltsjahres<br />
der Aufsichtsbehörde der Geme<strong>in</strong>de angezeigt werden (vgl. § 80 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong>). Dem Grundsatz der<br />
zeitlichen B<strong>in</strong>dung wird durch die Bestimmung „Die Haushaltssatzung gilt für das Haushaltsjahr“ <strong>in</strong> genügender<br />
Weise Rechnung getragen. Um dies <strong>in</strong> der Praxis zu gewährleisten, ist durch die Nr. 1.1.1 des Runderlasses des<br />
Innenm<strong>in</strong>isteriums vom 24.02.2005, SMBl. <strong>NRW</strong>. 6300 festgelegt worden, dass die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung<br />
nach e<strong>in</strong>em bestimmten Muster (vgl. Anlage 1 zu Nr. 1.1.1 des Runderlasses) aufgebaut werden muss.<br />
3. Die Verfahrensschritte für den Erlass der Haushaltssatzung<br />
Die Geme<strong>in</strong>deordnung gibt für den Erlass der jährlichen Haushaltssatzung den Geme<strong>in</strong>den mehrere Verfahrensschritte<br />
vor, bei denen die Rechte des Rates der Geme<strong>in</strong>de, des Bürgermeisters und des Kämmerers zu berücksichtigen<br />
s<strong>in</strong>d (vgl. Abbildung).<br />
Verfahren zum Erlass der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung<br />
Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung<br />
mit ihren Anlagen durch den Kämmerer und Bestätigung des Entwurfs<br />
durch den Bürgermeister<br />
Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung<br />
mit ihren Anlagen an den Rat<br />
Öffentliche Bekanntgabe des Entwurfs der Haushaltssatzung<br />
mit Festlegung e<strong>in</strong>er Frist für die Erhebung von E<strong>in</strong>wendungen an<br />
m<strong>in</strong>destens 14 Tagen<br />
Beratung über die Haushaltssatzung<br />
mit ihren Anlagen <strong>in</strong> öffentlicher Sitzung des F<strong>in</strong>anzausschusses<br />
Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung<br />
mit ihren Anlagen <strong>in</strong> öffentlicher Sitzung des Rates ggf. auch Beschlussfassung<br />
über die erhobenen E<strong>in</strong>wendungen<br />
Anzeige der Haushaltssatzung<br />
mit ihren Anlagen bei der Aufsichtsbehörde; sie soll spätestens 1<br />
Monat vor Beg<strong>in</strong>n des Hausjahres erfolgen<br />
Ablauf der Anzeigefrist,<br />
bei der zu beachten ist:<br />
1. Genehmigung der Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage<br />
2. Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes<br />
Bekanntmachung und Verfügbarhalten der Haushaltssatzung<br />
sie soll bis zum Ende der <strong>in</strong> § 96 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> benannten Frist<br />
verfügbar gehalten werden<br />
§ 80 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 80 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 80 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 59 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 80 Abs. 3 Satz 3 und Abs. 4<br />
GO <strong>NRW</strong><br />
§ 80 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 75 Abs. 4 und § 76 Abs. 2<br />
GO <strong>NRW</strong><br />
§ 80 Abs. 6 GO <strong>NRW</strong><br />
Abbildung 31 „Verfahren zum Erlass der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung“<br />
Die Aufstellung der Haushaltssatzung bedarf neben der notwendigen Aufgabenverteilung <strong>in</strong>nerhalb der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Verwaltung auch e<strong>in</strong>er konkreten Zeitplanung. So ist bei der Festlegung des zeitlichen Ablaufes des Aufstellungsverfahren<br />
zu beachten, dass die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen spätestens e<strong>in</strong>en Monat vor Beg<strong>in</strong>n<br />
des Hausjahres bei der Aufsichtsbehörde angezeigt werden soll (§ 80 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong>).<br />
GEMEINDEORDNUNG 274
4. Die Berichtspflichten gegenüber dem Rat<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 78 GO <strong>NRW</strong><br />
Die haushaltsrechtlichen Vorschriften für die Geme<strong>in</strong>den enthalten über die Beschlussfassung der Haushaltssatzung,<br />
der Feststellung des Jahresabschlusses und der Bestätigung des Gesamtabschlusses durch den Rat h<strong>in</strong>aus<br />
e<strong>in</strong>ige besondere Berichtspflichten für die geme<strong>in</strong>dliche Verwaltung, wenn örtlich e<strong>in</strong>zelne Geschäftsfälle von<br />
besonderer oder erheblicher Bedeutung für die Geme<strong>in</strong>de auftreten, die u.a. das Budgetrecht des Rates der<br />
Geme<strong>in</strong>de berühren. E<strong>in</strong>e Berichtspflicht gegenüber dem Rat besteht deshalb für die geme<strong>in</strong>dliche Verwaltung<br />
<strong>in</strong>sbesondere bei auftretenden erheblichen Abweichungen von der vom Rat beschlossenen Haushaltsplanung im<br />
Rahmen der Ausführung des geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplans. So dienen z.B. auch die nachfolgend genannten<br />
Berichtspflichten dazu, die E<strong>in</strong>griffsrechte des Rates <strong>in</strong> das haushaltswirtschaftliche Geschehen der Geme<strong>in</strong>de im<br />
Ablauf des Haushaltsjahres zu sichern (vgl. Abbildung).<br />
Berichtspflichten gegenüber dem Rat der Geme<strong>in</strong>de<br />
Bei e<strong>in</strong>em erheblich höheren Bedarf an Ermächtigungen für Aufwendungen<br />
und Auszahlungen, durch die e<strong>in</strong>e Nachtragssatzung erforderlich<br />
wird.<br />
Bei überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und<br />
Auszahlungen, wenn sie erheblich s<strong>in</strong>d.<br />
Bei e<strong>in</strong>er Entwicklung der Erträge, der Aufwendungen oder der Liquidität<br />
der Erlass wegen des Erlasses e<strong>in</strong>er Haushaltssperre durch den<br />
Rat oder wegen der Aufhebung e<strong>in</strong>er solchen Sperre von der Inanspruchnahme<br />
von Ermächtigungen.<br />
Bei der Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung<br />
bei e<strong>in</strong>em Haushaltsplan für zwei Jahre.<br />
Bei der Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen und<br />
Auszahlungen <strong>in</strong>s Folgejahr.<br />
Bei e<strong>in</strong>er Haushaltssperre des Kämmerers oder des Bürgermeisters<br />
nach § 24 Abs. 1 GemHVO <strong>NRW</strong>.<br />
Bei e<strong>in</strong>er voraussichtlichen Gefährdung des Haushaltsausgleichs.<br />
Bei e<strong>in</strong>er nicht nur ger<strong>in</strong>gfügigen Erhöhung von Investitionsauszahlungen<br />
bei e<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>zelmaßnahme.<br />
Bei dem Erlass von örtlichen Vorschriften entsprechend den Sicherheitsstandards<br />
<strong>in</strong> § 31 Abs. 2 GemHVO <strong>NRW</strong>.<br />
§ 81 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>)<br />
§ 83 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 83 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 9 Abs. 2 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 22 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
Abbildung 32 „Berichtspflichten gegenüber dem Rat der Geme<strong>in</strong>de“<br />
§ 24 Abs. 2 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 24 Abs. 2 GemHVO <strong>NRW</strong>);<br />
§ 24 Abs. 2 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 31 Abs. 1 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
Weitere Vorlage- und Berichtspflichten der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung gegenüber dem Rat der Geme<strong>in</strong>de entstehen<br />
<strong>in</strong>sbesondere durch im Auflauf des Haushaltsjahres auftretenden örtlichen Verhältnisse und Gegebenheiten.<br />
Sie können z.B. auch durch neue dr<strong>in</strong>gende Investitionsmaßnahmen entstehen, deren Volumen oder deren Auswirkungen<br />
oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen liegen (vgl. z.B. § 10 Abs. 2 GemHVO <strong>NRW</strong>), so dass<br />
ggf. auch e<strong>in</strong>e Nachtragssatzung nach § 81 GO <strong>NRW</strong> für das betreffende Haushaltsjahr erforderlich wird.<br />
GEMEINDEORDNUNG 275
II. Erläuterungen im E<strong>in</strong>zelnen<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 78 GO <strong>NRW</strong><br />
1. Zu Absatz 1 (Pflicht zur Aufstellung e<strong>in</strong>er Haushaltssatzung):<br />
1.1 Gliederung der Haushaltssatzung<br />
Die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung hat auch im NKF e<strong>in</strong>e herausragende Bedeutung für die Steuerung und<br />
Planung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft sowie der zukünftigen Entwicklung der Geme<strong>in</strong>de. Sie gehört zu<br />
den wichtigen örtlichen Satzungen, die eigenverantwortlich vom Rat der Geme<strong>in</strong>de erlassen werden, weil die<br />
Geme<strong>in</strong>de ihre örtlichen Angelegenheiten durch Satzung regeln sollen (vgl. § 7 GO <strong>NRW</strong>). In ihrer rechtlichen<br />
Wirkung geht die Haushaltssatzung der Geme<strong>in</strong>de über den geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan h<strong>in</strong>aus, weil sie e<strong>in</strong>e<br />
Reihe von Inhalten und Grundlagen enthält, die nicht nur Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de<br />
haben, sondern auch unmittelbar auf Dritte wirken. Der geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsplan ist dar<strong>in</strong> e<strong>in</strong>gebunden,<br />
stellt jedoch unter E<strong>in</strong>beziehung der besonderen Vorschrift des § 79 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong> e<strong>in</strong>e b<strong>in</strong>dende Norm nur für<br />
die Verwaltung der Geme<strong>in</strong>de bzw. ihre Haushaltswirtschaft dar (vgl. Abbildung).<br />
§<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
Gliederung der Haushaltssatzung<br />
Ergebnisplan<br />
Gesamtbetrag der Erträge<br />
Gesamtbetrag der Aufwendungen<br />
F<strong>in</strong>anzplan<br />
(lfd. Verwaltungstätigkeit)<br />
Gesamtbetrag der E<strong>in</strong>zahlungen<br />
Gesamtbetrag der Auszahlungen<br />
Satzungsregelung<br />
(Investitionstätigkeit und F<strong>in</strong>anzierungstätigkeit)<br />
Gesamtbetrag der E<strong>in</strong>zahlungen<br />
Gesamtbetrag der Auszahlungen<br />
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen<br />
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen<br />
Ausgleich des Ergebnisplans<br />
Verr<strong>in</strong>gerung der Ausgleichsrücklage<br />
Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage<br />
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung<br />
Steuersätze für die Geme<strong>in</strong>desteuern<br />
Haushaltsausgleich wieder hergestellt<br />
Örtliche Sonderregelungen<br />
Abbildung 33 „Gliederung der Haushaltssatzung“<br />
In diesem Zusammenhang s<strong>in</strong>d auch die Inhalte der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung zu betrachten, die den<br />
Rahmen für die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsführung bilden, denn die Haushaltssatzung der Geme<strong>in</strong>de hat bestimmte<br />
GEMEINDEORDNUNG 276
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 78 GO <strong>NRW</strong><br />
Festsetzungen zur geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft zu enthalten. Nur wenn erkennbar ist, dass es ke<strong>in</strong>en Bedarf<br />
für e<strong>in</strong>e satzungsmäßige Festsetzung besteht, kann von e<strong>in</strong>er ordnungsgemäßen Haushaltssatzung ausgegangen<br />
werden. Für den Rat der Geme<strong>in</strong>de liegt e<strong>in</strong>e beschlussfähige Haushaltssatzung mit ihren Anlagen nur<br />
vor, wenn diese alle gesetzlich vorgesehenen und erforderlichen Regelungen für die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft<br />
enthält und ihr alle Anlagen beigefügt s<strong>in</strong>d. Der Verzicht auf e<strong>in</strong>e ausdrückliche Aufzählung dieser Anlagen<br />
<strong>in</strong> den haushaltsrechtlichen Vorschriften steht dem Gebot der Beachtung des Grundsatzes der Vollständigkeit<br />
nicht entgegen. Außerdem ist die örtliche Ausgestaltung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung nach dem bekannt<br />
gegebenen und für verb<strong>in</strong>dlich erklärtem Muster vorzunehmen (vgl. Nummer 1.1.1 des Runderlasses des Innenm<strong>in</strong>isteriums<br />
vom 24.02.2005, SMBl. <strong>NRW</strong>. 6300).<br />
1.2 Der Begriff „Haushaltsjahr“<br />
Durch die haushaltsrechtliche Vorschrift des § 78 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong> wird unter Berücksichtigung des Jährlichkeitspr<strong>in</strong>zips<br />
als Haushaltsjahr das Kalenderjahr bestimmt. Das Haushaltsjahr umfasst deshalb den Zeitraum vom 1.<br />
Januar bis 31. Dezember, der der jahresbezogenen geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft zu Grunde zu legen ist.<br />
Die haushaltswirtschaftliche Periode des geme<strong>in</strong>dlichen Haushalts als Geschäftsjahr wird dabei auf e<strong>in</strong>en Zeitraum<br />
von zwölf Monaten ausgerichtet, bei der auf der Grundlage der vom Rat beschlossenen Haushaltssatzung<br />
vorzunehmen die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsbewirtschaftung vorzunehmen ist und nach Ablauf der Periode e<strong>in</strong>e<br />
Abrechnung erfolgen muss bzw. e<strong>in</strong> Jahresabschluss (vgl. § 95 GO <strong>NRW</strong>) aufzustellen ist.<br />
Durch diese verb<strong>in</strong>dliche zeitliche Deckung des Haushaltsjahres mit dem Kalenderjahr werden die periodengerechte<br />
Zuordnung und Buchung von Erträgen und Abwendungen, die Rechnungsabgrenzung sowie der Rahmen<br />
der Buchungen von E<strong>in</strong>zahlungen und Auszahlungen bestimmt. Durch die getroffene Regelung besteht außerdem<br />
e<strong>in</strong>e Übere<strong>in</strong>stimmung der haushaltswirtschaftlichen Periode des geme<strong>in</strong>dlichen Haushalts mit den sonstigen<br />
öffentlichen Haushalten sowie mit dem Steuerjahr und dem <strong>in</strong> der Privatwirtschaft allgeme<strong>in</strong> üblichen Wirtschaftsjahr,<br />
das auch dort regelmäßig dem Kalenderjahr entspricht. Auch <strong>in</strong> der Forstwirtschaft besteht gegenüber<br />
dem geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsjahr ke<strong>in</strong> abweichendes Wirtschaftsjahr (vgl. § 34 des Landesforstgesetzes für<br />
das Land Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen; SGV. <strong>NRW</strong>. 790).<br />
Die Übere<strong>in</strong>stimmung des Haushaltsjahres mit dem Kalenderjahr besteht auch bei den meisten geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Betrieben, die zu konsolidieren s<strong>in</strong>d. Die geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe, die dem Handelsrecht unterliegen, können zwar<br />
eigenverantwortlich ihr Geschäftsjahr festlegen, das jedoch regelmäßig für die gleiche Periode (Kalenderjahr) wie<br />
bei der geme<strong>in</strong>dlichen Kernverwaltung festgelegt worden ist. Weichen im E<strong>in</strong>zelfall die geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe<br />
davon ab, ist zu klären, welche Auswirkungen das auf die Aufstellung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses hat.<br />
E<strong>in</strong> gleiches Geschäftsjahr von geme<strong>in</strong>dlicher Kernverwaltung und geme<strong>in</strong>dlichen Betrieben erleichtert die Aufstellung<br />
des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss, weil bei diesem der Abschlussstichtag der geme<strong>in</strong>dlichen Kernverwaltung<br />
ausschlaggebend ist.<br />
1.3 Der Begriff „jährlich“<br />
Nach der Vorschrift hat die Geme<strong>in</strong>de für jedes Haushaltsjahr, also jährlich, e<strong>in</strong>e Haushaltssatzung zu erlassen.<br />
Diese Festlegung wird dadurch präzisiert, dass die Vorschrift die zeitliche Geltungsdauer der Haushaltssatzung<br />
bestimmt, denn diese tritt nach § 78 Abs. 3 S. 1 GO <strong>NRW</strong> mit Beg<strong>in</strong>n des Haushaltsjahres <strong>in</strong> Kraft und gilt für das<br />
Haushaltsjahr. Außerdem wird ausdrücklich bestimmt, dass das Haushaltsjahr mit dem Kalenderjahr identisch ist<br />
(vgl. nach § 78 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong>). Mit diesen Bestimmungen wird das im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsrecht anzuwendende<br />
Jährlichkeitspr<strong>in</strong>zip näher bestimmt.<br />
GEMEINDEORDNUNG 277
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 78 GO <strong>NRW</strong><br />
2. Zu Absatz 2 (Festsetzungen <strong>in</strong> der Haushaltssatzung):<br />
2.1 Zu Satz 1 (Festsetzungen und Haushaltsplan)<br />
2.01 Inhalte der Vorschrift<br />
Die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung muss die Festsetzungen aus dem Haushaltsplan enthalten. Dazu gehören<br />
jeweils die Summe (Gesamtbetrag) der geme<strong>in</strong>dlichen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnisplan. Auch<br />
die Summe (Gesamtbetrag) der E<strong>in</strong>zahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus<br />
der Investitionstätigkeit und aus der F<strong>in</strong>anzierungstätigkeit aus dem im F<strong>in</strong>anzplan gehören dazu. Auch die <strong>in</strong> der<br />
Haushaltssatzung enthaltene Kreditermächtigung ist <strong>in</strong> ihrer Höhe im F<strong>in</strong>anzplan als voraussichtliche E<strong>in</strong>zahlung<br />
aus der F<strong>in</strong>anzierungstätigkeit veranschlagt.<br />
Des Weiteren s<strong>in</strong>d die im F<strong>in</strong>anzplan bei den Investitionen der Geme<strong>in</strong>de ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen<br />
<strong>in</strong> ihrer Summe <strong>in</strong> der Haushaltsatzung enthalten. Bei den jeweiligen Festsetzungen <strong>in</strong> der Haushaltssatzung<br />
und den Veranschlagungen im Haushaltsplan s<strong>in</strong>d die e<strong>in</strong>schlägigen haushaltsrechtlichen Bestimmungen<br />
zu beachten, z.B. § 75 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> (Haushaltsausgleich), § 11 GemHVO <strong>NRW</strong> (Allgeme<strong>in</strong>e Planungsgrundsätze),<br />
§ 85 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 13 GemHVO <strong>NRW</strong> (Verpflichtungsermächtigungen) u.a. Wichtige Festsetzungen<br />
werden nachfolgend erläutert.<br />
2.1.1 Zu Nummer 1 (Festsetzungen aus dem Haushaltsplan):<br />
2.1.1.1 Zu Nummer 1a (Festsetzungen aus dem Ergebnisplan):<br />
Als Planungs<strong>in</strong>strument ist der Ergebnisplan wichtigster Bestandteil des neuen Haushalts. Das Jahresergebnis<br />
umfasst die ordentlichen Aufwendungen und Erträge, die F<strong>in</strong>anzaufwendungen und F<strong>in</strong>anzerträge sowie die<br />
außerordentlichen Aufwendungen und Erträge. Er bildet den Ressourcenverbrauch der Geme<strong>in</strong>de somit umfassend<br />
ab. Die Haushaltssatzung muss daher bezogen auf den Ergebnisplan den Gesamtbetrag der Erträge und<br />
der Aufwendungen des Haushaltsjahres festsetzen (vgl. § 2 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
In diesem Zusammenhang muss ke<strong>in</strong>e Differenzierung nach ordentlichen Erträgen und Aufwendungen sowie<br />
außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen vorgenommen werden, denn vielfach entstehen die zuletzt genannten<br />
Erträge und Aufwendungen durch unplanbare Ereignisse im Haushaltsjahr (vgl. Erläuterungen zu § 2<br />
Abs. 1 Nrn. 18 und 19 GemHVO <strong>NRW</strong>). Auch s<strong>in</strong>d die Verpflichtung zum Haushaltausgleich nach § 75 Abs. 2 GO<br />
<strong>NRW</strong> sowie die Planungsgrundsätze nach § 11 GemHVO <strong>NRW</strong> zu beachten.<br />
2.1.1.2 Zu Nummer 1b (Festsetzungen aus dem F<strong>in</strong>anzplan):<br />
Der F<strong>in</strong>anzplan be<strong>in</strong>haltet alle von der Geme<strong>in</strong>de geplanten E<strong>in</strong>zahlungen und Auszahlungen. Die Pflicht zur<br />
Aufstellung des F<strong>in</strong>anzplans bzw. der F<strong>in</strong>anzrechnung ist <strong>in</strong>sbesondere aus den Besonderheiten der öffentlichen<br />
Haushaltsplanung und Rechenschaftslegung hergeleitet. Die Haushaltssatzung muss daher bezogen auf den<br />
F<strong>in</strong>anzplan den Gesamtbetrag der E<strong>in</strong>zahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, den<br />
Gesamtbetrag der E<strong>in</strong>zahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus der F<strong>in</strong>anzierungstätigkeit<br />
des Haushaltsjahres festsetzen (vgl. § 3 GemHVO <strong>NRW</strong>). Dabei s<strong>in</strong>d die Verpflichtung der Geme<strong>in</strong>de zur<br />
Sicherstellung der F<strong>in</strong>anzierung von Investitionen nach § 75 Abs. 6 GO <strong>NRW</strong> sowie die Planungsgrundsätze<br />
nach § 11 GemHVO <strong>NRW</strong> zu beachten.<br />
GEMEINDEORDNUNG 278
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 78 GO <strong>NRW</strong><br />
2.1.1.3 Zu Nummer 1c (Festsetzung der Kreditermächtigung):<br />
Die vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen der Geme<strong>in</strong>de s<strong>in</strong>d mit ihrem Gesamtbetrag <strong>in</strong> der Haushaltssatzung<br />
festzusetzen. Diese besondere Festsetzung <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung (Kreditermächtigung)<br />
ist erforderlich, weil die Festsetzung des Gesamtbetrages der E<strong>in</strong>zahlungen und Auszahlungen aus der<br />
Investitionstätigkeit und aus der F<strong>in</strong>anzierungstätigkeit des Haushaltsjahres alle<strong>in</strong> als nicht ausreichend zu bewerten<br />
ist, um den notwendigen Umfang des für die Anschaffung von Vermögensgegenständen der Geme<strong>in</strong>de aufzunehmenden<br />
Fremdkapitals beurteilen zu können, auch wenn bereits die voraussichtlichen E<strong>in</strong>zahlungen aus<br />
der Aufnahme von Investitionskrediten nach § 86 GO <strong>NRW</strong> im F<strong>in</strong>anzplan enthalten s<strong>in</strong>d. Dies bedeutet ke<strong>in</strong>e<br />
Doppelerfassung der Investitionskredite <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung im S<strong>in</strong>ne der Ermächtigungen<br />
zur Ausführung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft.<br />
Durch die besondere Satzungsregelung wird vielmehr verdeutlicht, dass die <strong>in</strong> der Rangfolge der zu beschaffenden<br />
F<strong>in</strong>anzmittel vor den Investitionskrediten liegenden F<strong>in</strong>anzmittel nicht ausreichen, um die kommunalen Aufgaben<br />
im betreffenden Haushaltsjahr <strong>in</strong> ausreichendem Maße zu erfüllen. Diese satzungsmäßige Festsetzung für<br />
Investitionskredite darf zudem nur den Bedarf für die Aufgabenerfüllung be<strong>in</strong>halten, für die E<strong>in</strong>zahlungen und<br />
Auszahlungen im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan veranschlagt worden s<strong>in</strong>d, nicht jedoch den Bedarf, der möglicherweise<br />
bei den kommunalen Betrieben besteht. Mit der Festsetzung der Kreditermächtigung ist zudem nicht<br />
unmittelbar e<strong>in</strong>e Ermächtigung zur Aufnahme der e<strong>in</strong>zelnen Kredite verbunden (vgl. § 86 GO <strong>NRW</strong>). Außerdem<br />
umfasst die Kreditermächtigung für Investitionen der Geme<strong>in</strong>de nicht die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung,<br />
für die <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung an anderer Stelle gesondert e<strong>in</strong> Höchstbetrag festzusetzen<br />
ist.<br />
2.1.1.4 Zu Nummer 1d (Festsetzung der Verpflichtungsermächtigungen):<br />
Mit der Festsetzung von Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen der Investitionstätigkeit wird der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Verwaltung das E<strong>in</strong>gehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen<br />
belasten (Verpflichtungsermächtigungen), ermöglicht (vgl. § 85 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 13 GemHVO <strong>NRW</strong>). Die<br />
Verpflichtungsermächtigungen s<strong>in</strong>d nicht erforderlich für die Geschäfte der laufenden Verwaltung, auch wenn<br />
diese Geschäfte, z.B. der Abschluss von Mietverträgen oder Personalentscheidungen, sich belastend auf künftige<br />
Haushaltsjahre auswirken können. Die Summe der erteilten Ermächtigungen, die zu langfristigen Belastungen der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft führen, z.B. durch Miet-, Leas<strong>in</strong>g- und PPP-Geschäfte, darf die f<strong>in</strong>anzielle<br />
Leistungskraft der Geme<strong>in</strong>de nicht übersteigen.<br />
2.1.2 Zu Nummer 2 (Verzehr des Eigenkapitals):<br />
2.1.2.1 Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage<br />
Die vorgesehene Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (vgl. 75 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong>) ist <strong>in</strong> der Haushaltssatzung<br />
für das Haushaltsjahr festzusetzen. Diese Inanspruchnahme des Eigenkapitals zeigt, dass im Haushaltsjahr e<strong>in</strong><br />
Fehlbetrag entstehen wird, weil die voraussichtlichen Erträge nicht die Höhe der vorgesehenen Aufwendungen<br />
erreichen werden. Weil dadurch von der vorhandenen Substanz gezehrt wird, bedarf die Inanspruchnahme des<br />
Eigenkapitals e<strong>in</strong>er besonderen Festsetzung <strong>in</strong> der Haushaltssatzung (vgl. § 75 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr. 7<br />
GemHVO <strong>NRW</strong>), auch wenn der Haushalt noch als ausgeglichen gilt und es ke<strong>in</strong>er Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde<br />
bedarf. Zum Ansatz der Ausgleichsrücklage <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz vergleiche § 41 Abs. 4 Nr.<br />
1.3 GemHVO <strong>NRW</strong>.<br />
GEMEINDEORDNUNG 279
2.1.2.2 Die Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage<br />
2.1.2.2.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 78 GO <strong>NRW</strong><br />
Die geplante Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage (vgl. § 75 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong>) ist <strong>in</strong> der Haushaltssatzung für<br />
das Haushaltsjahr festzusetzen. Kann e<strong>in</strong> Fehlbedarf im Ergebnisplan ganz oder teilweise nicht durch e<strong>in</strong>e Inanspruchnahme<br />
der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, kommt es zu e<strong>in</strong>em weiteren Verzehr des Eigenkapitals<br />
durch e<strong>in</strong>e Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage. Diese Verr<strong>in</strong>gerung ist genehmigungspflichtig. In diesem Fall<br />
gilt der geme<strong>in</strong>dliche Haushalt als nicht ausgeglichen, auch wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch e<strong>in</strong>e<br />
Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage „gedeckt“ werden kann (vgl. § 75 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong>). Zum Ansatz der<br />
allgeme<strong>in</strong>en Rücklage <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz vergleiche § 41 Abs. 4 Nr. 1.1 GemHVO <strong>NRW</strong>.<br />
2.1.2.2.2 Ke<strong>in</strong> Verwaltungsverfahren neben der Anzeige der Haushaltssatzung<br />
Für die Erteilung der Genehmigung der Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage durch die Aufsichtsbehörde soll<br />
ke<strong>in</strong> eigenständigen Verwaltungsverfahrens durchgeführt werden. Vielmehr ist zu erteilende Genehmigung zur<br />
Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage durch die Aufsichtsbehörde e<strong>in</strong> Gegenstand des Anzeigeverfahrens der<br />
Haushaltssatzung durch die Geme<strong>in</strong>de. Dieser Zusammenhang besteht schon alle<strong>in</strong> deshalb, weil die Verr<strong>in</strong>gerung<br />
der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage nach § 78 Abs. 2 Nr. 2 GO <strong>NRW</strong> e<strong>in</strong>er Festsetzung <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung<br />
bedarf. Die Notwendigkeit von zwei, ggf. parallel laufenden Verwaltungsverfahren (e<strong>in</strong> Anzeige- und<br />
e<strong>in</strong> Genehmigungsverfahren) lässt sich aus der Verb<strong>in</strong>dung der §§ 75, 78 und 80 GO <strong>NRW</strong> für die Anzeige der<br />
Haushaltssatzung der Geme<strong>in</strong>de nicht herleiten.<br />
Die Entscheidung des Rates über die Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage im Rahmen se<strong>in</strong>es Beschlusses<br />
über die jährliche Haushaltssatzung nach § 78 GO <strong>NRW</strong> belegt vielmehr, dass es nur e<strong>in</strong> Verfahren im Rahmen<br />
der Anzeige der Haushaltssatzung der Geme<strong>in</strong>de geben kann. Im kommunalen Haushaltsrecht war es immer die<br />
Regel, dass die Aufsichtsbehörde über haushaltsplanmäßige Erfordernisse im Rahmen e<strong>in</strong>er Anzeige der Haushaltssatzung<br />
der Geme<strong>in</strong>de zu entscheiden hat, selbst wenn Genehmigungserfordernisse bestehen, z.B. bei der<br />
Pflicht der Geme<strong>in</strong>de zur Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes (vgl. § 76 i.V.m. § 80 GO <strong>NRW</strong>). Die<br />
ausdrückliche Antragsregelung <strong>in</strong> § 75 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong> dient daher sachlogisch nur der Festlegung des Fristbeg<strong>in</strong>ns<br />
für die Genehmigungsfiktion im Rahmen der Anzeige der Haushaltssatzung der Geme<strong>in</strong>de gegenüber ihrer<br />
Aufsichtsbehörde nach § 80 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong>.<br />
Die Aufsichtsbehörde der Geme<strong>in</strong>de ist dabei gehalten, die Anzeige der Haushaltssatzung der Geme<strong>in</strong>de auf<br />
genehmigungspflichtige Sachverhalte zu prüfen und ggf. weitere Informationen oder Unterlagen von der Geme<strong>in</strong>de<br />
nachzufordern, z.B. wenn <strong>in</strong> der Anzeige der Haushaltssatzung der Geme<strong>in</strong>de die Genehmigung zur Verr<strong>in</strong>gerung<br />
der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage nicht gesondert durch die Geme<strong>in</strong>de beantragt worden ist oder ist dieses von ihr<br />
nicht auf e<strong>in</strong>e andere Weise <strong>in</strong> ihrer Anzeige der Haushaltssatzung ausgeführt ist. S<strong>in</strong>d genehmigungspflichtige<br />
Sachverhalte gegeben, aber <strong>in</strong> der Anzeige nicht ausdrücklich dargestellt oder ist dar<strong>in</strong> nicht ausdrücklich e<strong>in</strong>e<br />
Genehmigung zur Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage beantragt, hat die Aufsichtsbehörde e<strong>in</strong>e Auslegung<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Anzeige nach den <strong>in</strong> Verwaltungsverfahren üblichen Regeln vorzunehmen.<br />
2.1.3 Zu Nummer 3 (Festsetzung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung):<br />
2.1.3.1 Die Ermittlung des Höchstbetrages<br />
Dem Gebot <strong>in</strong> § 75 Abs. 6 GO <strong>NRW</strong>, die Liquidität sicherzustellen, damit die geme<strong>in</strong>dlichen Zahlungsverpflichtungen<br />
erfüllt werden können, kann die Geme<strong>in</strong>de nur nachkommen, wenn es ihr ermöglicht wird, zur rechtzeitigen<br />
Leistung ihrer Auszahlungen bei Bedarf auch Kredite zur Liquiditätssicherung (vgl. § 89 GO <strong>NRW</strong>) aufneh-<br />
GEMEINDEORDNUNG 280
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 78 GO <strong>NRW</strong><br />
men zu können. Wenn die Deckung des Liquiditätsbedarfs der Geme<strong>in</strong>de aber nicht durch die üblichen F<strong>in</strong>anzquellen<br />
zeitgerecht möglich ist, bedarf es e<strong>in</strong>er gesonderten Ermächtigung des Rates der Geme<strong>in</strong>de um für die<br />
Deckung des auftretenden Auszahlungsbedarfs vorübergehend auch Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen<br />
zu dürfen.<br />
Der jahresbezogene Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung, der im Rahmen der Ausführung der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltswirtschaft im neuen Haushaltsjahr benötigt wird, ist im Zeitpunkt der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplanung<br />
i.d.R. nicht betragsgenau bestimmbar. Oftmals ist er von verschiedenen, meistens erst im Ablauf des Haushaltsjahres<br />
auftretenden Faktoren abhängig, so dass der tatsächliche Liquiditätsbedarf der Geme<strong>in</strong>de sich regelmäßig<br />
nur tagesaktuell ergibt. Der mögliche Bedarf an kurzfristigen Krediten für das Haushaltsjahr ist daher zu<br />
schätzen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass möglicherweise mehrere Kredite nebene<strong>in</strong>ander bestehen können,<br />
so dass es gilt, e<strong>in</strong>en möglichen Höchstbetrag für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung für das<br />
Haushaltsjahr zu bestimmen. Der ermittelte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung ist dann <strong>in</strong> der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsatzung festzusetzen.<br />
2.1.3.2 Die Inanspruchnahme der Kredite zur Liquiditätssicherung<br />
Die Kredite zur Liquiditätssicherung stellen für die Geme<strong>in</strong>de kurzfristiges Fremdkapital und der <strong>in</strong> der Haushaltssatzung<br />
festgesetzte Höchstbetrag stellt e<strong>in</strong>e örtliche Schätzgröße aus den Erfahrungswerten der Geme<strong>in</strong>de dar.<br />
Diese Ermächtigung be<strong>in</strong>haltet das Recht, jeweils bei Bedarf <strong>in</strong>nerhalb des Haushaltsjahres die notwendigen<br />
Kredite zur Liquiditätssicherung im vom Rat gesetzten Rahmen aufzunehmen. Die Summe der aufgenommenen<br />
Kredite zur Liquiditätssicherung darf an ke<strong>in</strong>em Tag des Haushaltsjahres den Höchstbetrag nach der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltssatzung überschreiten. Die e<strong>in</strong>zelnen Kreditaufnahmen s<strong>in</strong>d dafür nur dann nom<strong>in</strong>al zusammen<br />
zu rechnen, wenn sie sich zeitlich überschneiden. Dieses gilt auch dann, wenn statt der Aufnahme e<strong>in</strong>zelner<br />
Kredite der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong>sgesamt e<strong>in</strong> Überziehungs- oder Kontokorrentkredit e<strong>in</strong>e geräumt wurde. Der <strong>in</strong> der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag stellt daher die Höchstgrenze für alle Arten der Verstärkung<br />
von Zahlungsmitteln der Geme<strong>in</strong>de dar.<br />
Es bedarf immer e<strong>in</strong>er Abstimmung über die Abwicklung der Geldgeschäfte und der Festlegung von Verantwortlichkeiten<br />
zwischen den Beteiligten, e<strong>in</strong>schließlich der ggf. beauftragten Bank, wenn e<strong>in</strong>e Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>en Liquiditätsverbund<br />
bzw. e<strong>in</strong> Cashpool<strong>in</strong>g mit e<strong>in</strong>em Masteraccountkonto zwischen der Kernverwaltung und ihren Betrieben<br />
e<strong>in</strong>richtet. Sollen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em solchen Liquiditätsverbund die Abwicklung der Geldgeschäfte über die Kernverwaltung<br />
der Geme<strong>in</strong>de erfolgen, tritt die Geme<strong>in</strong>de für die rechtlich selbstständigen Unternehmen als „<strong>in</strong>nere“<br />
Bank auf. E<strong>in</strong> solcher Liquiditätsverbund darf nicht dazu führen, dass die Geme<strong>in</strong>de Kredite zur Liquiditätssicherung<br />
oberhalb ihres eigenen haushaltsmäßigen Bedarfs aufnimmt.<br />
2.1.3.3 Kredite zur Liquiditätssicherung und Haushaltsplan<br />
Die Kredite zur Liquiditätssicherung werden von der Geme<strong>in</strong>de wegen ihrer mangelnden Zahlungsfähigkeit aufgenommen.<br />
Daher besteht ke<strong>in</strong> unmittelbarer Zusammenhang mit den im Haushaltsplan veranschlagten Erträgen.<br />
E<strong>in</strong> negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im F<strong>in</strong>anzplan (vgl. § 3 GemHVO <strong>NRW</strong>) macht zwar<br />
deutlich, dass die Geme<strong>in</strong>de im Haushaltsjahr voraussichtlich Kredite zur Liquiditätssicherung benötigt, dieser<br />
stellt jedoch nicht gleichzeitig den Betrag dar, der vorübergehend tatsächlich zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit<br />
benötigt wird.<br />
Der täglich zu ermittelnde Liquiditätsbedarf und das daraus ggf. entstehende Erfordernis, Kredite zur Liquiditätssicherung<br />
aufzunehmen und auch unterjährig wieder zurückzuzahlen, br<strong>in</strong>gen es mit sich, dass e<strong>in</strong>e zum Stichtag<br />
des Jahresabschlusses möglicherweise noch bestehende Rückzahlungsverpflichtung im Rahmen der Haushaltsplanung<br />
betragsmäßig nicht genau vorher bestimmbar ist. Dieser Sachverhalt und die Sachlage, dass die E<strong>in</strong>zah-<br />
GEMEINDEORDNUNG 281
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 78 GO <strong>NRW</strong><br />
lungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung ke<strong>in</strong>e haushaltsmäßigen F<strong>in</strong>anzierungsmittel darstellen, ist u.a. der<br />
Anlass dafür, auf die Vorgabe e<strong>in</strong>er Veranschlagung von Krediten zur Liquiditätssicherung im geme<strong>in</strong>dlichen<br />
F<strong>in</strong>anzplan zu verzichten.<br />
Die entbehrliche Veranschlagung im geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzplan steht jedoch e<strong>in</strong>em Nachweis der Zahlungen <strong>in</strong><br />
der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzrechnung als <strong>in</strong> Anspruch genommene „Betriebsmittel“ zur Sicherung der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Liquidität nicht entgegen. Besteht daher zum Stichtag des Jahresabschlusses noch e<strong>in</strong>e Rückzahlungsverpflichtung<br />
der Geme<strong>in</strong>de aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung muss diese Verpflichtung betragsmäßig<br />
<strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzrechnung nachgewiesen werden. Gleichzeitig ist diese Rückzahlungsverpflichtung<br />
“ <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz gesondert unter dem Posten „Verb<strong>in</strong>dlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung<br />
anzusetzen (vgl. § 41 Abs. 4 Nr. 4.3 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
2.1.4 Zu Nummer 4 (Festsetzung der Steuersätze)<br />
Die örtlichen Steuersätze, die von der Geme<strong>in</strong>de festzusetzen s<strong>in</strong>d und die im Haushaltsjahr gelten sollen, hat die<br />
Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> ihre Haushaltssatzung aufzunehmen, soweit die geme<strong>in</strong>dlichen Steuersätze nicht <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er gesonderten<br />
Steuersatzung geregelt werden. Die F<strong>in</strong>anzhoheit der Geme<strong>in</strong>de besteht <strong>in</strong> diesen Fällen dar<strong>in</strong>, dass die<br />
Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> eigener Verantwortung die notwendigen Regelungen trifft. Sie muss dabei die festzulegenden Hebesätze<br />
nach realistischen Gesichtspunkten bestimmen und dabei nicht nur nach ihren eigenen Interessen handeln.<br />
Die Festsetzung der Hebesätze ist ke<strong>in</strong> Selbstzweck, sondern e<strong>in</strong>gebunden <strong>in</strong> die Funktion „Steuererhebung“,<br />
die jede Steuer <strong>in</strong> sich trägt, und dient der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzmittelbeschaffung.<br />
2.1.4.2 Hebesätze für die Realsteuern<br />
Zu den Steuersätzen, die von der Geme<strong>in</strong>de für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen s<strong>in</strong>d, gehören die Hebesätze<br />
für die Realsteuern, d.h. die Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken<br />
(Grundsteuer A), die Grundsteuer von weiteren Grundstücken (Grundsteuer B) und die Gewerbesteuer vom Ertrag<br />
und Kapital). Für die Grundsteuer ist den Geme<strong>in</strong>den z.B. im Rahmen des Grundsteuergesetzes das Recht<br />
e<strong>in</strong>geräumt worden, Hebesätze festzusetzen. Sie kann dazu bestimmen, mit welchem Von-Hundert-Satz des<br />
Steuermessbetrages oder des Zerlegungsanteils die Grundsteuer erhoben werden soll (vgl. § 25 GrStG).<br />
Es ist dabei der Geme<strong>in</strong>de freigestellt, die Festsetzung der Hebesätze für e<strong>in</strong> Jahr oder mehrere Jahre vorzunehmen.<br />
Sie kann den Hebesatz jedoch höchstens für den Hauptveranlagungszeitraum der Steuermessbeträge<br />
festsetzen und muss diesen Beschluss bis zum 30. Juni e<strong>in</strong>es Kalenderjahres fassen (vgl. § 25 Abs. 2 und 3<br />
GrStG). Diese Festsetzungen müssen immer bezogen auf die e<strong>in</strong>zelnen Realsteuerarten erfolgen. Die Festsetzung<br />
gilt zudem immer, auch rückwirkend, für das ganze Haushaltsjahr. In E<strong>in</strong>zelfällen bedarf es ggf. e<strong>in</strong>er Nachtragssatzung<br />
zur Haushaltssatzung, wenn durch die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung die Hebesätze festgelegt<br />
werden.<br />
2.1.5 Zu Nummer 5 (Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs):<br />
Die Geme<strong>in</strong>den, die zur Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet s<strong>in</strong>d, müssen <strong>in</strong> der Haushaltssatzung<br />
das Jahr bestimmen, <strong>in</strong> dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist. Diese Festlegung knüpft<br />
an die neue Regelung des § 76 GO <strong>NRW</strong> „Haushaltssicherungskonzept“ und die Bestimmungen über den Haushaltsausgleich<br />
<strong>in</strong> § 75 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> an. Das Haushaltssicherungskonzept bedarf nach § 76 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong><br />
der aufsichtsbehördlichen Genehmigung, denn der auslösende Fehlbedarf bzw. Fehlbetrag im Haushaltsjahr<br />
oder <strong>in</strong> den drei folgenden Planungsjahren führt zur Verr<strong>in</strong>gerung des Eigenkapitals <strong>in</strong> Form der Inanspruchnahme<br />
der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage. In diesem Zusammenhang soll daher das Instrument „Haushaltssicherungskon-<br />
GEMEINDEORDNUNG 282
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 78 GO <strong>NRW</strong><br />
zept“ stärker und zukunftsorientierter als bisher als Sanierungskonzept dienen, die dauerhafte Leistungsfähigkeit<br />
der Geme<strong>in</strong>de zu sichern und den Haushaltsausgleich wieder herzustellen. Diese Vorgabe erfordert, auch e<strong>in</strong><br />
Sanierungscontroll<strong>in</strong>g e<strong>in</strong>zurichten, um den erforderlichen Sanierungserfolg zu messen. Es gilt, das Handeln der<br />
Geme<strong>in</strong>de neu auszurichten und die Chancen und Risiken für die Geme<strong>in</strong>de neu e<strong>in</strong>zuschätzen.<br />
Durch die neu geschaffene E<strong>in</strong>beziehung der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung <strong>in</strong> den Haushaltsplan<br />
und deren Berücksichtigung bei der Verpflichtung zur Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes, ist es<br />
zulässig, dass der Haushaltsausgleich drei Jahre nach dem Ursachenjahr wieder erreicht wird. Er muss nicht drei<br />
Jahren nach dem Haushaltsjahr wieder erreicht se<strong>in</strong>. Liegt das e<strong>in</strong> Haushaltssicherungskonzept auslösende<br />
Ereignis z.B. erst im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis und F<strong>in</strong>anzplanung (z.B. für den Haushalt 2009 im<br />
Jahr 2012) kann sich der Zeitraum, bei dem für e<strong>in</strong> Haushaltssicherungskonzept grundsätzlich noch die Genehmigungsfähigkeit<br />
gegeben se<strong>in</strong> kann, über maximal sieben Jahre ausdehnen (im Beispiel bis Ende des Jahres<br />
2015).<br />
2.2 Zu Satz 2 (Weitere Vorschriften <strong>in</strong> der Haushaltssatzung):<br />
Die jährliche Haushaltssatzung der Geme<strong>in</strong>de kann weitere ortsbezogene Vorschriften enthalten, wenn diese<br />
e<strong>in</strong>en Bezug zur Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de haben, für das jeweilige Haushaltsjahr von Bedeutung s<strong>in</strong>d<br />
und nicht bereits Regelungsgegenstand e<strong>in</strong>er anderen Satzung der Geme<strong>in</strong>de s<strong>in</strong>d, z.B. der Hauptsatzung. Diese<br />
Erweiterung der Haushaltssatzung ermöglicht, besondere örtliche Sachverhalte, die Bedeutung für die aktuelle<br />
Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de haben, zu regeln.<br />
Als weitere Vorschriften der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung kommen Regelungen <strong>in</strong> Betracht, die sich auf Erträge<br />
und Aufwendungen des Ergebnisplans (vgl. § 2 GemHVO <strong>NRW</strong>), auf E<strong>in</strong>zahlungen und Auszahlungen des<br />
F<strong>in</strong>anzplans (vgl. § 3 GemHVO <strong>NRW</strong>), auf den Stellenplan des Haushaltsjahres (vgl. § 8 GemHVO <strong>NRW</strong>) sowie<br />
auf das Haushaltssicherungskonzept (vgl. § 76 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 5 GemHVO <strong>NRW</strong>) beziehen. Weitere ortsbezogene<br />
Vorschriften können erforderliche Vorbehalte für die Inanspruchnahme von Ermächtigungen, z.B. das vorherige<br />
E<strong>in</strong>holen der Zustimmung des Kämmerers, die sich im E<strong>in</strong>zelfall auf die gesamte Ermächtigung oder e<strong>in</strong>en<br />
Teil davon beziehen kann, se<strong>in</strong>.<br />
Die Geme<strong>in</strong>de muss sich bei der Ausgestaltung ortsbezogene Vorschriften im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften<br />
bewegen. Sie muss aber auch das Bepackungsverbot beachten, nach dem die Haushaltssatzung und<br />
der Haushaltsplan der Geme<strong>in</strong>de nur zweckbezogene Bestimmungen zur Haushaltsausführung (sachliches Bepackungsverbot)<br />
sowie Bestimmungen enthalten dürfen, die nicht die Geltungsdauer der Haushaltssatzung überschreiten<br />
(zeitliches Bepackungsverbot). Soweit Ausnahmen vom zuletzt genannten Verbot bestehen, z.B. die<br />
Regelungen über die Geltungsdauer von Kreditermächtigungen und Verpflichtungsermächtigungen, s<strong>in</strong>d diese<br />
durch den Gesetzgeber festgelegt worden.<br />
3. Zu Absatz 3 (B<strong>in</strong>dungswirkung der Haushaltssatzung):<br />
3.1 Zu Satz 1 (Inkrafttreten und Geltung der Haushaltssatzung):<br />
3.1.1 Inkrafttreten der Haushaltssatzung<br />
3.1.1.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Für das Inkrafttreten der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung ist e<strong>in</strong>e Sonderregelung getroffen worden, um zu gewährleisten,<br />
dass diese Satzung von Anfang bis zum Ende e<strong>in</strong>es Haushaltsjahres gilt und nicht abhängig vom<br />
Zeitpunkt ihrer öffentlichen Bekanntmachung (vgl. § 7 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong>). Die Regelung <strong>in</strong> § 80 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong>,<br />
GEMEINDEORDNUNG 283
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 78 GO <strong>NRW</strong><br />
nach der die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung frühestens e<strong>in</strong>en Monat nach der Anzeige bei der Aufsichtsbehörde<br />
öffentlich bekannt gemacht werden darf, wenn nicht im E<strong>in</strong>zelfall aus besonderem Grund die Anzeigefrist durch<br />
die Aufsichtsbehörde verkürzt oder verlängert wird, ist für die Herstellung der Geltung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung<br />
alle<strong>in</strong> nicht ausreichend. Durch die Besonderheit wird zudem bestimmt, dass <strong>in</strong> den Fällen, <strong>in</strong> denen<br />
e<strong>in</strong> Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO <strong>NRW</strong> aufzustellen ist, die Haushaltssatzung erst nach Erteilung<br />
der Genehmigung bekannt gemacht werden darf. Auch wenn e<strong>in</strong>e Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage nach §<br />
75 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong> <strong>in</strong> der Haushaltssatzung festgesetzt ist, darf die Haushaltssatzung erst nach Erteilung der<br />
gesetzlich vorgesehenen Genehmigung bekannt gemacht werden, auch wenn dies nicht ausdrücklich geregelt<br />
wurde.<br />
Die besondere Regelung, dass die Haushaltssatzung mit Beg<strong>in</strong>n des Haushaltsjahres <strong>in</strong> Kraft tritt, beruht zudem<br />
auf der Bestimmung des § 7 Abs. 4 S. 2 GO <strong>NRW</strong>, nach der e<strong>in</strong> Zeitpunkt des Inkrafttretens zu bestimmen ist,<br />
wenn e<strong>in</strong>e Satzung nicht mit dem Tage der Bekanntmachung <strong>in</strong> Kraft treten soll. Sie soll das Inkrafttreten der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung nicht von örtlichen Gegebenheiten abhängig machen. Wird die Haushaltssatzung<br />
vor Beg<strong>in</strong>n des Haushaltsjahres bekannt gemacht, tritt sie erst mit Beg<strong>in</strong>n des Haushaltsjahres <strong>in</strong> Kraft und<br />
gilt für das betreffende Haushaltsjahr. Wenn die Haushaltssatzung jedoch erst nach Beg<strong>in</strong>n des Haushaltsjahres<br />
vom Rat beschlossen und bekannt gemacht wird, tritt sie rückwirkend mit Beg<strong>in</strong>n des Haushaltsjahres <strong>in</strong> Kraft<br />
und gilt für das betreffende Haushaltsjahr.<br />
3.1.1.2 H<strong>in</strong>dernisse für das Inkrafttreten der Haushaltssatzung<br />
E<strong>in</strong> H<strong>in</strong>dernis für das Inkrafttreten der Haushaltssatzung kann aber dadurch bestehen, dass der Beschluss des<br />
Rates über die Haushaltssatzung nicht alle gesetzlich vorgesehenen Bestandteile, Anlagen oder Unterlagen<br />
umfasst hat. Ist ggf. e<strong>in</strong>e gesetzlich vorgesehene Anlage, z.B. der Stellenplan (vgl. § 79 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>), nicht<br />
Teil des Beschlusses des Rates über die Haushaltssatzung und ihre Anlagen (vgl. § 80 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong>), ist<br />
damit e<strong>in</strong> Ratsbeschluss zustande gekommen, der e<strong>in</strong>e Bekanntmachung der Haushaltssatzung und damit ihr<br />
Inkrafttreten nicht zulässt.<br />
Weitere H<strong>in</strong>dernisse für die die Bekanntmachung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung stellen auch e<strong>in</strong>e fehlende<br />
Genehmigung für die vorgesehene Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage nach § 75 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong> oder die<br />
fehlende Genehmigung der Aufsichtsbehörde für e<strong>in</strong> Haushaltssicherungskonzept, das dem Ziel dient, im Rahmen<br />
e<strong>in</strong>er geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Geme<strong>in</strong>de zu erreichen,<br />
dar. Derartige H<strong>in</strong>dernisse hat die Geme<strong>in</strong>de möglichst unverzüglich zu beseitigen. Erst nach Beseitigung solcher<br />
H<strong>in</strong>dernisse darf die Haushaltssatzung öffentlich bekannt gemacht werden und kann <strong>in</strong>-Kraft-treten.<br />
3.1.1.3 Inkrafttreten e<strong>in</strong>er Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre<br />
Für das Inkrafttreten e<strong>in</strong>er Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre ist bei e<strong>in</strong>em <strong>in</strong> der Haushaltssatzung nur<br />
für das zweite Haushaltsjahr vorgesehenen Ausgleich des Ergebnisplans durch e<strong>in</strong>e Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en<br />
Rücklage zu beachten, dass wegen der dafür gesetzlich erforderlichen Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde<br />
(vgl. § 75 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong>) die Haushaltssatzung erst nach der Erteilung der Genehmigung bekannt gemacht<br />
darf. Die getrennten Festsetzungen für die e<strong>in</strong>zelnen Haushaltsjahre <strong>in</strong> der Haushaltssatzung stellen dabei<br />
ke<strong>in</strong>e Grundlage dafür dar, bei e<strong>in</strong>em Haushaltsausgleich nur im ersten Haushaltsjahr auch e<strong>in</strong> auf die e<strong>in</strong>zelnen<br />
Haushaltsjahre bezogenes Inkrafttreten anzunehmen. E<strong>in</strong>e Haushaltssatzung, die Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre<br />
enthält, stellt trotz des beizubehaltenden Jährlichkeitsbezugs immer e<strong>in</strong> Gesamtwerk für e<strong>in</strong>en zweijährigen<br />
Zeitraum dar.<br />
GEMEINDEORDNUNG 284
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 78 GO <strong>NRW</strong><br />
3.1.1.4 Späterer Zeitpunkt des Inkrafttretens der Haushaltssatzung<br />
Bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Haushaltssatzung dürfen die im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen<br />
nicht <strong>in</strong> Anspruch genommen werden. Vielmehr s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> dieser Zeit die Vorschriften über die vorläufige<br />
Haushaltsführung (vgl. § 82 GO <strong>NRW</strong>) zu beachten. Ist die Haushaltssatzung bei Beg<strong>in</strong>n des Haushaltsjahres<br />
noch nicht bekannt gemacht, so darf die Geme<strong>in</strong>de ausschließlich Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen<br />
leisten, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar<br />
s<strong>in</strong>d. Sie darf <strong>in</strong>sbesondere Bauten, Beschaffungen und sonstige Investitionsleistungen, für die im<br />
Haushaltsplan des Vorjahres F<strong>in</strong>anzpositionen oder Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen waren, fortsetzen,<br />
Realsteuern nach den Sätzen des Vorjahres erheben und Kredite umschulden.<br />
In den Fällen der noch nicht <strong>in</strong> Kraft getretenen geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung gelten die Festlegungen der<br />
Haushaltssatzung des abgelaufenen Haushaltsjahres über die Aufnahme von Krediten für Investitionen (vgl. § 86<br />
Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>) sowie die Festlegungen über die geme<strong>in</strong>dlichen Verpflichtungsermächtigungen (vgl. § 85 Abs. 2<br />
GO <strong>NRW</strong>) weiter. Ebenso gelten die Vorschriften über den Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung (vgl.<br />
§ 89 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>) über das Haushaltsjahr h<strong>in</strong>aus bis zum Erlass der neuen Haushaltssatzung weiter.<br />
3.1.2 Die Geltungsdauer der Haushaltssatzung<br />
Nach der Vorschrift gilt die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr, für das sie vom Rat beschlossen<br />
wurde. Damit ist e<strong>in</strong> genau bestimmter Zeitrahmen vorgegeben, <strong>in</strong> dem die geme<strong>in</strong>dliche Verwaltung die vom<br />
Rat der Geme<strong>in</strong>de im Rahmen se<strong>in</strong>es Budgetrechts ausgesprochenen Ermächtigungen und getroffenen Festlegungen<br />
auszuführen und zu beachten hat. Das Haushaltsjahr deckt sich zeitlich immer mit dem Kalenderjahr (vgl.<br />
Absatz 3 dieser Vorschrift).<br />
Aus diesem Grund besteht e<strong>in</strong>e Übere<strong>in</strong>stimmung der haushaltswirtschaftlichen Periode des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushalts mit den sonstigen öffentlichen Haushalten und auch mit den Wirtschaftsjahren der geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe.<br />
Tritt jedoch e<strong>in</strong>e abweichende Entwicklung <strong>in</strong> der Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>, die die Ausgeglichenheit<br />
des Haushalts gefährdet, können die getroffenen Festsetzungen durch e<strong>in</strong>e Nachtragssatzung korrigiert<br />
werden (vgl. § 81 GO <strong>NRW</strong>). Durch e<strong>in</strong>e Nachtragssatzung können zwar die Inhalte der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung<br />
verändert werden, jedoch nicht die Geltungsdauer der Haushaltssatzung.<br />
3.2 Zu Satz 2 (B<strong>in</strong>dungswirkung für zwei Haushaltsjahre):<br />
3.2.1 Die Geltung der Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre<br />
Die Geme<strong>in</strong>de ist nach § 78 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> verpflichtet, für jedes Haushaltsjahr e<strong>in</strong>e Haushaltssatzung zu erlassen.<br />
Diese gesetzliche Festlegung schließt aus, dass die <strong>in</strong> der Haushaltssatzung festzusetzenden Teile für<br />
mehrere Jahre zusammengefasst festgesetzt werden dürfen. Von der strengen Ausrichtung auf e<strong>in</strong> Haushaltsjahr<br />
wird jedoch durch die Vorschrift e<strong>in</strong>e Ausnahme zugelassen, nach der die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung auch<br />
Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre enthalten kann. Der geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsplan (vgl. § 79 GO <strong>NRW</strong>)<br />
muss <strong>in</strong> diesen Fällen dann e<strong>in</strong>e nach beiden Jahren getrennte Veranschlagung enthalten.<br />
In diesem Zusammenhang ist darauf h<strong>in</strong>zuweisen, dass der Rat der Geme<strong>in</strong>de die für zwei Jahre geltende Haushaltssatzung<br />
vor dem ersten Haushaltsjahr gem. § 80 GO <strong>NRW</strong> zu beschließen hat, denn diese Vorschrift enthält<br />
ke<strong>in</strong>e Ausnahme für e<strong>in</strong>e zweijährige Haushaltssatzung. Außerdem ist es im Rahmen der Ausführung der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltswirtschaft nicht zulässig, aus beiden Haushaltsjahren e<strong>in</strong>e Rechnungsperiode zu machen<br />
und entsprechend nur e<strong>in</strong>en geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss gem. § 95 GO <strong>NRW</strong> aufzustellen. Es muss immer<br />
GEMEINDEORDNUNG 285
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 78 GO <strong>NRW</strong><br />
nach Ablauf des jeweiligen Haushaltsjahres von der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong> haushaltsjahrbezogener Jahresabschluss,<br />
aber auch e<strong>in</strong> auf dieses Jahr bezogener Gesamtabschluss gem. § 116 GO <strong>NRW</strong>, aufgestellt werden.<br />
Mit dieser gesetzlichen Möglichkeit e<strong>in</strong>er Haushaltssatzung für zwei Jahre sollen die Geme<strong>in</strong>den <strong>in</strong> die Lage<br />
versetzt werden, ihre ertrags- und f<strong>in</strong>anzwirtschaftlichen sowie vermögenswirksamen Entscheidungen schon für<br />
e<strong>in</strong>en längeren Zeitraum im Voraus satzungsrechtlich festzulegen. Der im Haushaltsplan enthaltenen mittelfristigen<br />
Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung kommt dabei die mit e<strong>in</strong>er Festsetzung <strong>in</strong> der Haushaltsatzung verbundene<br />
Verb<strong>in</strong>dlichkeit für die Haushaltsführung der Geme<strong>in</strong>de noch nicht zu. E<strong>in</strong>e Festsetzung für zwei Haushaltsjahre<br />
<strong>in</strong> der Haushaltssatzung führt zudem dazu, dass die drei dem Haushaltsjahr folgenden Planungsjahre an das<br />
zweite Haushaltsjahr anzub<strong>in</strong>den s<strong>in</strong>d. Daher besteht für die Kommune die Verpflichtung, e<strong>in</strong>e Fortschreibung der<br />
mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung vorzunehmen und diese vor Beg<strong>in</strong>n des zweiten Haushaltsjahres<br />
dem Rat vorzulegen (vgl. § 9 Abs. 2 GemHVO <strong>NRW</strong>). Die Geme<strong>in</strong>de sollte die dem Rat vorzulegende Fortschreibung<br />
der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung sowie veränderte Anlagen zum Haushaltsplan auch der<br />
Aufsichtsbehörde zur Kenntnis zu geben.<br />
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass auch bei e<strong>in</strong>em <strong>in</strong> der Haushaltssatzung nur für das zweite<br />
Haushaltsjahr vorgesehene Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung wegen<br />
der gesetzlich erforderlichen Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde (vgl. § 75 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong>) erst nach der<br />
Erteilung der Genehmigung bekannt gemacht darf. Die getrennten Festsetzungen <strong>in</strong> der Haushaltssatzung für die<br />
e<strong>in</strong>zelnen Haushaltsjahre stellen ke<strong>in</strong>e Grundlage dafür dar, bei e<strong>in</strong>em Haushaltsausgleich im ersten Haushaltsjahr<br />
nur e<strong>in</strong>e auf das e<strong>in</strong>zelne Haushaltsjahr bezogene Bekanntmachung der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen<br />
vorzunehmen. Die Haushaltssatzung stellt bei Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre e<strong>in</strong> Gesamtwerk für diesen<br />
Zeitraum dar, das nicht abhängig vom e<strong>in</strong>zelnen Jahr bzw. Jahresergebnis zu behandeln ist.<br />
3.2.2 Änderung der Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre<br />
3.2.2.1 Änderungsbedarf für das erste Haushaltsjahr<br />
Die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre bedarf wie e<strong>in</strong>e Haushaltssatzung für e<strong>in</strong> Haushaltsjahr<br />
oftmals e<strong>in</strong>er Anpassung an die tatsächliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft bereits im Laufe des ersten<br />
Haushaltsjahres. Bei e<strong>in</strong>er abweichenden Entwicklung, die die Ausgeglichenheit des Haushalts im ersten Haushaltsjahr<br />
gefährdet, können die getroffenen Festsetzungen durch e<strong>in</strong>e Nachtragssatzung nach § 81 GO <strong>NRW</strong>,<br />
bezogen auf das erste Haushaltsjahr, korrigiert werden. Diese Satzung ermächtigt die Verwaltung der Geme<strong>in</strong>de,<br />
die im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen für die dort ausgewiesenen Zwecke <strong>in</strong> geänderter Form <strong>in</strong><br />
Anspruch zu nehmen.<br />
Die Nachtragssatzung der Geme<strong>in</strong>de muss alle notwendigen Änderungen für das jeweils betroffene Haushaltsjahr<br />
enthalten, z.B. die Änderung des Gesamtbetrages der Erträge und der Aufwendungen im Ergebnisplan, der<br />
Gesamtbeträge im F<strong>in</strong>anzplan sowie ggf. die Änderung der Kreditermächtigungen. E<strong>in</strong>e solche Nachtragssatzung<br />
muss jedoch spätestens bis zum 31. Dezember des ersten Haushaltsjahres vom Rat der Geme<strong>in</strong>de beschlossen<br />
se<strong>in</strong>. Sie kann nicht im zweiten Haushaltsjahr rückwirkend für das erste Haushaltsjahr beschlossen werden, auch<br />
wenn e<strong>in</strong>e Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre besteht. Für die Nachtragssatzung gelten die Vorschriften<br />
über die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung entsprechend (vgl. § 81 Abs. 1 S. 2 GO <strong>NRW</strong>).<br />
3.2.2.2 Änderungsbedarf für das zweite Haushaltsjahr<br />
Aus der Entwicklung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft kann sich bei e<strong>in</strong>er Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre<br />
nicht nur e<strong>in</strong> Änderungsbedarf für das erste, sondern auch für das zweite Haushaltsjahr ergeben. In<br />
solchen Fällen bedarf es e<strong>in</strong>er Nachtragssatzung nach § 81 GO <strong>NRW</strong>, die sich auf beide Haushaltsjahre oder<br />
GEMEINDEORDNUNG 286
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 78 GO <strong>NRW</strong><br />
auch nur auf das zweite Haushaltsjahr bezieht. Diese Nachtragssatzung kann die Geme<strong>in</strong>de, wenn die Änderungen<br />
für die für das zweite Haushaltsjahr getroffenen Festsetzungen bereits im ersten Haushaltsjahr ermittelt werden<br />
können, bereits freiwillig im ersten Haushaltsjahr beschließen.<br />
In den Fällen, <strong>in</strong> denen die Geme<strong>in</strong>de jedoch das zweite Haushaltsjahr abwartet, kann auf Grund der Entwicklung<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr ggf. auch e<strong>in</strong>e Pflicht zur Aufstellung e<strong>in</strong>er Nachtragssatzung<br />
entstehen, wenn örtliche Sachverhalte vorliegen, die unter der Vorschrift des § 81 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> zu<br />
subsumieren s<strong>in</strong>d. Ist von der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>e Nachtragssatzung vorgesehen oder ist sie erforderlich, hat der Rat<br />
der Geme<strong>in</strong>de bei e<strong>in</strong>er Haushaltssatzung für zwei Jahre die Nachtragssatzung spätestens bis zum 31. Dezember<br />
des zweiten Haushaltsjahres zu beschließen. Für diese Satzung gelten die Vorschriften über die geme<strong>in</strong>dliche<br />
Haushaltssatzung entsprechend (vgl. § 81 Abs. 1 S. 2 GO <strong>NRW</strong>).<br />
3.3 Die Weitergeltung e<strong>in</strong>zelner Haushaltsvorschriften<br />
Nach der Vorschrift des Absatzes 3 gilt die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr. Die Fortführung der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltswirtschaft erfordert jedoch, für besondere Handlungen e<strong>in</strong>e Weitergeltung e<strong>in</strong>zelner Bestimmungen<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung, um die stetige Aufgabenerfüllung nicht zu gefährden, auch<br />
wenn die Haushaltssatzung für das neue Haushaltsjahr noch nicht <strong>in</strong> Kraft getreten ist. Dazu gehören die nachfolgend<br />
aufgeführten Regelungen (vgl. Abbildung).<br />
Weitergeltung e<strong>in</strong>zelner Haushaltsvorschriften<br />
Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr<br />
folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste<br />
Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zum Erlass dieser<br />
Haushaltssatzung.<br />
Die Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden<br />
Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht<br />
rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung.<br />
Die Geme<strong>in</strong>de kann zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kredite<br />
zur Liquiditätssicherung bis zu dem <strong>in</strong> der Haushaltssatzung festgesetzten<br />
Höchstbetrag aufnehmen kann, soweit dafür ke<strong>in</strong>e anderen Mittel zur Verfügung<br />
stehen, und diese Ermächtigung über das Haushaltsjahr h<strong>in</strong>aus bis<br />
zum Erlass der neuen Haushaltssatzung.<br />
Die Geme<strong>in</strong>de kann die <strong>in</strong> ihrem Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen<br />
für Aufwendungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit,<br />
soweit diese nicht <strong>in</strong> Anspruch genommen worden s<strong>in</strong>d, <strong>in</strong>s folgende<br />
Haushaltsjahr übertragen, denn diese bleiben bis zum Ende des folgenden<br />
Haushaltsjahres verfügbar. Werden sie übertragen, erhöhen sie die entsprechenden<br />
Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.<br />
Die Geme<strong>in</strong>de kann die <strong>in</strong> ihrem Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen<br />
für Auszahlungen für Investitionen, soweit diese nicht <strong>in</strong> Anspruch<br />
genommen worden s<strong>in</strong>d, <strong>in</strong>s folgende Haushaltsjahr übertragen, denn diese<br />
bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei<br />
Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach<br />
Schluss des Haushaltsjahres, <strong>in</strong> dem der Vermögensgegenstand <strong>in</strong> se<strong>in</strong>en<br />
wesentlichen Teilen <strong>in</strong> Benutzung genommen werden kann.<br />
Abbildung 34 „Weitergeltung e<strong>in</strong>zelner Haushaltsvorschriften“<br />
GEMEINDEORDNUNG 287<br />
§ 85 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 86 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 89 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 22 Abs. 1 und 2<br />
GemHVO <strong>NRW</strong>
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 78 GO <strong>NRW</strong><br />
In diesem Zusammenhang bedarf es im Rahmen der vorläufigen Haushaltführung der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>es Zusammenspiels<br />
zwischen den weitergeltenden Ermächtigungen aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr und den Vorgaben,<br />
die wegen der noch nicht geltenden geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung notwendig s<strong>in</strong>d (vgl. § 82 GO <strong>NRW</strong>).<br />
4. Zu Absatz 4 (Haushaltsjahr gleich Kalenderjahr):<br />
4.1. Regelung für die Geme<strong>in</strong>den<br />
Die Regelung <strong>in</strong> der Vorschrift, dass bei den Geme<strong>in</strong>den (geme<strong>in</strong>dliche Kernverwaltung) das Haushaltsjahr dem<br />
Kalenderjahr (1. Januar bis 31. Dezember) entsprechen muss, ist e<strong>in</strong>e weitere Ausprägung des Jährlichkeitspr<strong>in</strong>zips<br />
<strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft. Sie verpflichtet die Geme<strong>in</strong>den, die haushaltswirtschaftliche Periode<br />
des geme<strong>in</strong>dlichen Haushalts auf das Kalenderjahr als Geschäftsjahr auszurichten, so dass für e<strong>in</strong>en Zeitraum<br />
von zwölf Monaten die Haushaltsbewirtschaftung auf der Grundlage der vom Rat beschlossenen Haushaltssatzung<br />
vorzunehmen ist und nach Ablauf der Periode e<strong>in</strong>e Abrechnung erfolgen muss bzw. e<strong>in</strong> Jahresabschluss<br />
(vgl. § 95 GO <strong>NRW</strong>) aufzustellen ist.<br />
Durch diese verb<strong>in</strong>dliche zeitliche Deckung des Haushaltsjahres mit dem Kalenderjahr werden die periodengerechte<br />
Zuordnung und Buchung von Erträgen und Abwendungen, die Rechnungsabgrenzung sowie der Rahmen<br />
der Buchungen von E<strong>in</strong>zahlungen und Auszahlungen bestimmt. Durch die getroffene Regelung besteht außerdem<br />
e<strong>in</strong>e Übere<strong>in</strong>stimmung der haushaltswirtschaftlichen Periode des geme<strong>in</strong>dlichen Haushalts mit den sonstigen<br />
öffentlichen Haushalten sowie mit dem Steuerjahr und dem <strong>in</strong> der Privatwirtschaft allgeme<strong>in</strong> üblichen Wirtschaftsjahr,<br />
das auch dort regelmäßig dem Kalenderjahr entspricht. Auch <strong>in</strong> der Forstwirtschaft besteht gegenüber<br />
dem geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsjahr ke<strong>in</strong> abweichendes Wirtschaftsjahr (vgl. § 34 des Landesforstgesetzes für<br />
das Land Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen; SGV. <strong>NRW</strong>. 790).<br />
Die Übere<strong>in</strong>stimmung des Haushaltsjahres mit dem Kalenderjahr besteht auch bei den meisten geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Betrieben, die zu konsolidieren s<strong>in</strong>d. Die geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe, die dem Handelsrecht unterliegen, können zwar<br />
eigenverantwortlich ihr Geschäftsjahr festlegen, das jedoch regelmäßig für die gleiche Periode (Kalenderjahr) wie<br />
bei der geme<strong>in</strong>dlichen Kernverwaltung festgelegt worden ist. Weichen im E<strong>in</strong>zelfall die geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe<br />
davon ab, ist zu klären, welche Auswirkungen das auf die Aufstellung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses hat.<br />
E<strong>in</strong> gleiches Geschäftsjahr von geme<strong>in</strong>dlicher Kernverwaltung und geme<strong>in</strong>dlichen Betrieben erleichtert die Aufstellung<br />
des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss, weil bei diesem der Abschlussstichtag der geme<strong>in</strong>dlichen Kernverwaltung<br />
ausschlaggebend ist.<br />
4.2 Zulässige Abweichungen<br />
Der Zusammenhang zwischen dem Haushaltsjahr und dem Kalenderjahr als Geschäftsjahr gilt für die Geme<strong>in</strong>den<br />
dauerhaft. Nach der Vorschrift können aber e<strong>in</strong>zelne Bereiche der Geme<strong>in</strong>de ggf. e<strong>in</strong> vom Kalenderjahr abweichendes<br />
Geschäftsjahr oder Wirtschaftsjahr bzw. Haushaltsjahr haben, wenn dieses durch Gesetz oder Rechtsverordnung<br />
ausdrücklich bestimmt worden ist. In solchen Fällen stimmt das Geschäftsjahr nicht mit dem Zeitraum<br />
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember übere<strong>in</strong>, sondern kann z.B. vom 1. April e<strong>in</strong>es Jahres bis zum 31. März des<br />
folgenden Jahres laufen. Für die Aufgabenbereiche der geme<strong>in</strong>dlichen Kernverwaltung besteht derzeit ke<strong>in</strong>e<br />
gesetzliche Ausnahmeregelung. Auch andere landesrechtliche Regelungen enthalten derzeit für besondere Aufgabenbereiche<br />
ke<strong>in</strong>e Bestimmung über e<strong>in</strong> vom Kalenderjahr abweichendes Geschäftsjahr. Vielmehr wird vielfach<br />
<strong>in</strong> Gesetzen oder Rechtsverordnungen ausdrücklich bestimmt, dass für geme<strong>in</strong>dliche Betriebe oder andere<br />
E<strong>in</strong>heiten das Kalenderjahr auch das Geschäftsjahr ist.<br />
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ<br />
GEMEINDEORDNUNG 288
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 79 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 79<br />
Haushaltsplan<br />
(1) 1 Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Geme<strong>in</strong>de voraussichtlich<br />
1. anfallenden Erträge und e<strong>in</strong>gehenden E<strong>in</strong>zahlungen,<br />
2. entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen,<br />
3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.<br />
2 Die Vorschriften über die Sondervermögen der Geme<strong>in</strong>de bleiben unberührt.<br />
(2) 1 Der Haushaltsplan ist <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en Ergebnisplan und e<strong>in</strong>en F<strong>in</strong>anzplan sowie <strong>in</strong> Teilpläne zu gliedern. 2 Das Haushaltssicherungskonzept<br />
gemäß § 76 ist Teil des Haushaltsplans; der Stellenplan für die Bediensteten ist Anlage<br />
des Haushaltsplans.<br />
(3) 1 Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de. 2 Er ist nach Maßgabe dieses<br />
Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Haushaltsführung verb<strong>in</strong>dlich.<br />
3 Ansprüche und Verb<strong>in</strong>dlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.<br />
Erläuterungen zu § 79:<br />
I. Allgeme<strong>in</strong>es<br />
1. Haushaltsplan und geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft<br />
1.1 Zwecke des Haushaltsplans<br />
Der Haushaltsplan als Bestandteil der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung bleibt die Grundlage der jährlichen Haushaltswirtschaft<br />
der Geme<strong>in</strong>de sowie der örtlichen politischen Planungen, Entscheidungen und Kontrollen. Das<br />
NKF sieht den neuen geme<strong>in</strong>dlichen Haushalt deshalb weiterh<strong>in</strong> im Zusammenhang mit der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgabenerfüllung<br />
im Zentrum der haushaltswirtschaftlichen Planung und Rechenschaft der Geme<strong>in</strong>de. Durch die<br />
Integration der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung <strong>in</strong> den geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan <strong>in</strong> Form des<br />
Haushaltsjahre mit den drei folgenden Planungsjahren ergeben sich durch Festlegungen <strong>in</strong>nerhalb dieses Zeitraumes<br />
rechtliche Konsequenzen für das Handeln der Geme<strong>in</strong>de und ihrer Aufsichtsbehörde. Es war deshalb<br />
geboten, die notwendigen Vorgaben für die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft aus dem unstrittig ableitbaren Zusammenhang<br />
zwischen dem Haushaltsjahr und der weiteren jahresbezogenen Planung sowie aus dem Zusammenhang<br />
von Haushaltssatzung und Haushaltsplan im Haushaltsrecht zu verankern.<br />
Der geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsplan muss daher Informationen für das Haushaltsjahr und die daran anschließenden<br />
drei Planungsjahre bereitstellen, die für die Ausführung der Planung sowie die spätere Kontrolle wichtig s<strong>in</strong>d. Er<br />
stellt damit e<strong>in</strong> örtliches Programm für die Erledigung der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgaben im Haushaltsjahr dar. Dabei ist<br />
es nicht ausreichend, nur den voraussichtlichen Ressourcenverbrauch und das mögliche Ressourcenaufkommen<br />
sowie F<strong>in</strong>anzzahlen aufzuzeigen.<br />
Es bedarf vielmehr weitergehender Informationen über die Produktorientierung und die e<strong>in</strong>zelnen Zielsetzungen,<br />
die mit der strategischen Zielsetzung des Rates <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang stehen und sich dieser unterordnen müssen. Es gilt<br />
im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>er zutreffenden und geeigneten örtlichen Steuerung e<strong>in</strong>e optimale Verb<strong>in</strong>dung der Ressourcen der<br />
Geme<strong>in</strong>de mit den politischen Zielen des Rates der Geme<strong>in</strong>de unter Beachtung der Generationengerechtigkeit<br />
herzustellen. Dem geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan kommen daher im NKF vielfältige Funktionen zu (vgl. Abbildung).<br />
GEMEINDEORDNUNG 289
Bedarfsdeckungsfunktion<br />
Programmfunktion<br />
Ordnungsfunktion<br />
Schutzfunktion<br />
Kontrollfunktion<br />
Informationsfunktion<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 79 GO <strong>NRW</strong><br />
Funktionen des geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplans<br />
E<strong>in</strong> Ausgangspunkt der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft ist e<strong>in</strong>e<br />
Haushaltsplanung, die auf die Bedarfsdeckung abgestellt ist. Die<br />
vorgesehene Deckung des örtlichen Ressourcenverbrauchs (Aufwendungen)<br />
durch das Ressourcenaufkommen (Erträge) wird im<br />
Rahmen der jährlichen Haushaltsplanung transparent gemacht. Die<br />
Bedarfsdeckungsfunktion ist daher e<strong>in</strong>e der wichtigsten Funktionen<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft und wird durch den Haushaltsplan<br />
der Geme<strong>in</strong>de ausgestaltet.<br />
Der geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsplan hat u.a. zur Aufgabe, im E<strong>in</strong>zelnen<br />
festzulegen, wie das Ressourcenaufkommen (Erträge) und die<br />
(<strong>in</strong>vestiven) E<strong>in</strong>zahlungen des Haushaltsjahres auf die Vielzahl der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Aufgaben verteilt werden sollen. Diesem Zweck<br />
dient die produktorientierte Bildung von Teilplänen und die Veranschlagung<br />
von Erträgen und Aufwendungen (Ressourcen) sowie<br />
E<strong>in</strong>zahlungen und Auszahlungen (F<strong>in</strong>anzmittel) unter artenbezogenen<br />
Haushaltspositionen.<br />
Die Bedeutung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft macht es<br />
erforderlich, dass dem Haushaltsplan e<strong>in</strong> verb<strong>in</strong>dliches Ordnungspr<strong>in</strong>zip<br />
zu Grunde gelegt wird. E<strong>in</strong> geordneter Haushaltsplan ermöglicht<br />
wegen se<strong>in</strong>er verb<strong>in</strong>dlichen Wirkung für die geme<strong>in</strong>dliche<br />
Verwaltung e<strong>in</strong>e ordnungsgemäße Ausführung der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltswirtschaft. Die Ordnungsfunktion wird dabei durch die<br />
produktorientierten Teilpläne und die artenbezogenen Haushaltspositionen<br />
unterstützt.<br />
Zu den geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsgrundsätzen gehört der Grundsatz<br />
der <strong>in</strong>tergenerativen Gerechtigkeit. Damit soll die haushaltspolitische<br />
und ökonomische Handlungsfähigkeit künftiger Generationen<br />
geschützt werden. Daher wird <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>deordnung bestimmt,<br />
die Geme<strong>in</strong>de hat ihr Vermögen und ihre E<strong>in</strong>künfte so zu verwalten,<br />
dass die Geme<strong>in</strong>def<strong>in</strong>anzen gesund bleiben. Die Schutzfunktion<br />
erfordert daher die zeitliche Verteilung von Nutzen und Lasten im<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Bereich, so dass die Geme<strong>in</strong>de bei ihrer Haushaltsplanung<br />
und Haushaltsausführung immer im Blick haben muss,<br />
auch ausreichende Handlungsmöglichkeiten für die künftigen Generationen<br />
zu erhalten.<br />
Die Bedeutung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft macht es<br />
erforderlich, dass die Ausführung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft<br />
durch die geme<strong>in</strong>dliche Verwaltung ihr e<strong>in</strong> verb<strong>in</strong>dliches<br />
Ordnungspr<strong>in</strong>zip zu Grunde gelegt wird. E<strong>in</strong> geordneter Haushaltsplan<br />
ermöglicht wegen se<strong>in</strong>er verb<strong>in</strong>dlichen Wirkung für e<strong>in</strong>e ordnungsgemäße<br />
sowie e<strong>in</strong>en Jahresabschluss (mit Entlastung des<br />
Bürgermeisters) als Abrechung nach Ablauf des Haushaltsjahres.<br />
Die Ordnungsfunktion wird dabei durch die produktorientierten<br />
Teilpläne artenbezogenen Haushaltspositionen unterstützt.<br />
Die E<strong>in</strong>beziehung der Öffentlichkeit <strong>in</strong> die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsplanung<br />
verlangt e<strong>in</strong>e übersichtliche und vollständige Darstellung<br />
des geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltungshandelns, dass der jahresbezogenen<br />
Haushaltsplanung zu Grunde gelegt worden ist. Der geme<strong>in</strong>dliche<br />
Haushaltsplan muss über das haushaltswirtschaftliche Handeln<br />
der Geme<strong>in</strong>de die Adressaten <strong>in</strong>formieren und die geme<strong>in</strong>dliche<br />
Haushaltswirtschaft transparent und nachvollziehbar darstellen.<br />
Abbildung 35 „Funktionen des geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplans“<br />
GEMEINDEORDNUNG 290
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 79 GO <strong>NRW</strong><br />
Die Geme<strong>in</strong>de muss ihre jährliche Haushaltsplanung, die im Haushaltsplan abzubilden ist, realitätsbezogen vornehmen<br />
(Grundsatz der Haushaltswahrheit). Die mehrjährige Planung soll deshalb auf dem tatsächlichen Bedarf<br />
(Ressourcenverbrauch) und der tatsächlichen Leistungsfähigkeit(Ressourcenaufkommen) der Geme<strong>in</strong>de aufbauen.<br />
Das Zusammenspiel dieser beiden Merkmale macht es möglich, den i.d.R. unbegrenzten Bedarf auf e<strong>in</strong> realistisches<br />
Maß zurückzuführen. Die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsplanung erfordert daher sowohl e<strong>in</strong>e sachliche als<br />
auch e<strong>in</strong>e objektivierte Beurteilung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Die Ausgleichsverpflichtung für den<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Haushalt <strong>in</strong> § 75 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> und die Soll-Vorgabe <strong>in</strong> § 84 GO <strong>NRW</strong> dienen dabei der Anpassung<br />
an die tatsächlichen Möglichkeiten der Geme<strong>in</strong>de. Durch die Vorschriften soll zudem e<strong>in</strong>e bessere Nachvollziehbarkeit<br />
und Verständlichkeit der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft erreicht werden.<br />
1.2 Inhalte des Haushaltsplans<br />
Die Verwendung des Begriffes „Haushaltsplan“ bildet dabei zutreffend den Charakter des aufstellenden geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Werkes ab, weil se<strong>in</strong>e Bestandteile zukunftsbezogen und prognoseorientiert s<strong>in</strong>d und e<strong>in</strong> Planungsermessen<br />
der Geme<strong>in</strong>de besteht. Der jährliche Haushaltsplan der Geme<strong>in</strong>de soll zeigen, welche örtlichen Bedürfnisse<br />
<strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>de bestehen und <strong>in</strong> welcher Art und Weise sowie Intensität diese Bedürfnisse befriedigt werden<br />
sollen. Der oberste Grundsatz für die <strong>in</strong>haltliche Gestaltung des geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplans ist dabei das<br />
sparsame und wirtschaftliche F<strong>in</strong>anzgebaren. Es ist deshalb e<strong>in</strong>e Pflicht der Geme<strong>in</strong>de, nur die Aufwands- und<br />
Auszahlungsermächtigungen e<strong>in</strong>zuplanen, die für die Aufrechterhaltung der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung und die<br />
Erfüllung der Aufgaben der Geme<strong>in</strong>de erforderlich s<strong>in</strong>d.<br />
In diesem S<strong>in</strong>ne darf die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft der Zukunft auch nicht ungebührlich zu Gunsten der<br />
Gegenwart belastet werden. Durch e<strong>in</strong>e vorsorgliche Haushaltswirtschaft müssen entsprechende Sicherungen<br />
geschaffen werden. Der geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsplan zeigt auf der Gesamtebene im Ergebnisplan, den voraussichtlichen<br />
Ressourcenverbrauch und das mögliche Ressourcenaufkommen und im e<strong>in</strong>en F<strong>in</strong>anzplan die Zahlungsleistungen<br />
der Geme<strong>in</strong>de. Der Haushaltsplan wird für Steuerungszwecke im S<strong>in</strong>ne der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgabenerfüllung<br />
<strong>in</strong> produktorientierte Teilpläne untergliedert, die u.a. Teilergebnispläne und Teilf<strong>in</strong>anzpläne sowie<br />
Ziele und Leistungskennzahlen unter Beachtung der Vorschriften <strong>in</strong> §§ 4 und 12 GemHVO <strong>NRW</strong> enthalten sollen.<br />
Das Haushaltssicherungskonzept bleibt e<strong>in</strong> Bestandteil des Haushaltsplans.<br />
2. Haushaltsplan und Produktorientierung<br />
2.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Mit der E<strong>in</strong>führung des NKF erfolgt <strong>in</strong> den Geme<strong>in</strong>den e<strong>in</strong>e Outputorientierung, die Auskunft über die Verwendung<br />
der e<strong>in</strong>gesetzten Mittel durch Aussagen und Bewertungen über die erzielten Ergebnisse gibt. Dadurch wird<br />
die Aufgabenerfüllung der Geme<strong>in</strong>den transparenter und das wirtschaftliche Handeln gestärkt. Das NKF erfordert,<br />
dass sich die Geme<strong>in</strong>den e<strong>in</strong>en Überblick über ihre vielfältigen Tätigkeiten, die erbrachten Leistungen sowie die<br />
damit erzielten Wirkungen verschaffen, um zutreffend ihre Produkte zu def<strong>in</strong>ieren oder zu beschreiben. Der Rahmen<br />
für die Bildung von Teilplänen wird nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung).<br />
Teilpläne<br />
nach<br />
Produktbereichen<br />
Teilpläne<br />
nach<br />
Bildung von produktorientierten Teilplänen<br />
GEMEINDEORDNUNG 291<br />
Die Teilpläne im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan s<strong>in</strong>d nach den verb<strong>in</strong>dlich<br />
vorgegebenen Produktbereichen mit Angabe der jeweils dazugehörigen Produktgruppen<br />
und wesentlichen Produkte zu bilden.<br />
Die Teilpläne im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan können nach Produktgruppen<br />
(eigene oder aus dem NKF- oder dem „Länder-Produktrahmen“) mit m<strong>in</strong>des-
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 79 GO <strong>NRW</strong><br />
Produktgruppen tens der Angabe der Summen der untergliederten Teilpläne auf der Ebene der<br />
verb<strong>in</strong>dlichen Produktbereiche aufgestellt werden.<br />
Teilpläne<br />
nach<br />
Produkten<br />
Teilpläne<br />
nach<br />
Verantwortungs-<br />
bereichen<br />
Die Teilpläne im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan können nach Produkten mit<br />
m<strong>in</strong>destens der Angabe der Summen der untergliederten Teilpläne auf der<br />
Ebene der verb<strong>in</strong>dlichen Produktbereiche aufgestellt werden.<br />
Die Teilpläne im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan können nach örtlichen Verantwortungsbereichen<br />
mit Angabe der Aufgaben und der dafür gebildeten Produkte<br />
sowie mit der Angabe der Summen der untergliederten Teilpläne auf der<br />
Ebene der verb<strong>in</strong>dlichen Produktbereiche aufgestellt werden.<br />
Abbildung 36 „Bildung von produktorientierten Teilplänen“<br />
Der geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsplan wird für deshalb Steuerungszwecke im S<strong>in</strong>ne der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgabenerfüllung<br />
<strong>in</strong> produktorientierte Teilpläne untergliedert, die u.a. Teilergebnispläne und Teilf<strong>in</strong>anzpläne sowie Ziele und<br />
Leistungskennzahlen unter Beachtung der Vorschriften <strong>in</strong> §§ 4 und 12 GemHVO <strong>NRW</strong> enthalten sollen. Es ist<br />
dabei nicht ausreichend, <strong>in</strong> den Teilplänen die örtlichen Leistungen nur aufzulisten, sondern diese müssen vielmehr<br />
auch def<strong>in</strong>iert und vone<strong>in</strong>ander abgegrenzt werden. Die Outputorientierung kann daher zur wirtschaftlicheren<br />
Gestaltung der Arbeitsprozesse und zur Optimierung von Organisationsabläufen <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung<br />
beitragen.<br />
E<strong>in</strong>e systematische Ordnung und Darstellung der geme<strong>in</strong>dlichen Leistungen (Produkte) erleichtert die haushaltswirtschaftliche<br />
Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen, um der Ressourcenorientierung ausreichend Rechnung<br />
tragen zu können und die Aufgabenerfüllung verstehbar zu machen. Auch verlangt die Produktorientierung,<br />
dass die systematische Gliederung der geme<strong>in</strong>dlichen Produkte mit dem landesweit geltenden „NKF-<br />
Produktrahmen“ <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang steht. Die örtlichen Produkte sollen daher im Rahmen der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgabenerfüllung<br />
aus den landesweit verb<strong>in</strong>dlichen Produktbereichen entwickelt werden (vgl. Runderlass des Innenm<strong>in</strong>isteriums<br />
vom 24.02.2005, SMBl. <strong>NRW</strong>. 6300), deren Ausgangsbasis die e<strong>in</strong>zelnen Politikfelder darstellen. Der<br />
Zusammenhang soll mit dem nachfolgenden Schema aufgezeigt werden (vgl. Abbildung).<br />
Politikfelder<br />
1 Zentrale<br />
Verwaltung<br />
2 Schule und Kultur<br />
3 Soziales<br />
und Jugend<br />
4 Gesundheit und<br />
Sport<br />
5 Gestaltung der<br />
Umwelt<br />
6 Zentrale F<strong>in</strong>anz-<br />
Leistungen<br />
Produktorientierung nach dem NKF-Produktrahmen<br />
Produktbereiche<br />
01 Innere<br />
Verwaltung<br />
...<br />
05 Soziale<br />
Leistungen<br />
...<br />
07 Gesundheits-<br />
dienste<br />
...<br />
17 Stiftungen<br />
Produktgruppen<br />
Bildung<br />
von<br />
Produktgruppen<br />
nach den örtlichen<br />
Bedürfnissen<br />
Produkte<br />
Bildung<br />
von<br />
Produkten<br />
nach den örtlichen<br />
Bedürfnissen<br />
Abbildung 37 „Produktorientierung nach dem NKF-Produktrahmen“<br />
Leistungen<br />
Festlegung<br />
von<br />
Leistungen<br />
nach den örtlichen<br />
Bedürfnissen<br />
Die verschiedenen Vorschriften über die geme<strong>in</strong>dliche Produktorientierung gebieten e<strong>in</strong>e landesweit e<strong>in</strong>heitliche<br />
Handhabung unter Berücksichtigung des vom Innenm<strong>in</strong>ister bekannt gegebenen Produktrahmens (vgl. § 4 Abs.1<br />
S. 2 GemHVO <strong>NRW</strong>), auch wenn die Produkte von den Geme<strong>in</strong>den nach eigenen Bedürfnissen zu bilden und<br />
auszugestalten s<strong>in</strong>d.<br />
GEMEINDEORDNUNG 292
2.2 Örtliche Ausgestaltung<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 79 GO <strong>NRW</strong><br />
Die Geme<strong>in</strong>de ist bei der Aufstellung ihres Haushalts verpflichtet, für Steuerungs- und Informationszwecke und<br />
aus Gründen der Vergleichbarkeit sowie für die Prüfung des Haushalts durch die Aufsichtsbehörde die erste Gliederungsstufe<br />
ihres Haushaltsplans auf der Grundlage der 17 verb<strong>in</strong>dlichen Produktbereiche auszugestalten. Der<br />
NKF-Produktrahmen lässt den Geme<strong>in</strong>den den notwendigen Gestaltungsfreiraum für weitere Untergliederungen<br />
nach den örtlichen Gegebenheiten und <strong>in</strong> eigener Verantwortung.<br />
Die Geme<strong>in</strong>de hat im Rahmen ihrer Veranschlagung im Haushaltsplan auch zu berücksichtigen, dass die zur<br />
Abgrenzung der e<strong>in</strong>zelnen Produktbereiche vorgenommenen Zuordnungen, nach denen u.a. die fachlichen Verwaltungsaufgaben<br />
und die wirtschaftlichen Betätigungen den sachlich betroffenen Produktbereichen zuzuordnen<br />
s<strong>in</strong>d, für die Anwendung durch die Geme<strong>in</strong>de verb<strong>in</strong>dlich s<strong>in</strong>d (vgl. Nr. 1.2.3 des Runderlasses des Innenm<strong>in</strong>isteriums<br />
vom 24.02.2005, SMBl. <strong>NRW</strong>. 6300 sowie die dazugehörige Anlage 5). Die Bildung der produktorientierten<br />
Teilpläne im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan (vgl. § 4 GemHVO <strong>NRW</strong>) ist daher <strong>in</strong> der Reihenfolge der verb<strong>in</strong>dlichen<br />
17 Produktbereiche vorzunehmen (vgl. Abbildung).<br />
01 Innere Verwaltung<br />
02 Sicherheit und Ordnung<br />
03 Schulträgeraufgaben<br />
04 Kultur und Wissenschaft<br />
05 Soziale Leistungen<br />
06 K<strong>in</strong>der-, Jugend- und<br />
Familienhilfe<br />
Produktbereiche im NKF-Produktrahmen<br />
07 Gesundheitsdienste<br />
08 Sportförderung<br />
09 Räumliche Planung und<br />
Entwicklung, Geo<strong>in</strong>formationen<br />
10 Bauen und Wohnen<br />
11 Ver- und Entsorgung<br />
12 Verkehrsflächen und - anlagen,<br />
ÖPNV<br />
13 Natur- und Landschaftspflege<br />
14 Umweltschutz<br />
15 Wirtschaft und Tourismus<br />
16 Allgeme<strong>in</strong>e F<strong>in</strong>anzwirtschaft<br />
17 Stiftungen<br />
Abbildung 38 „Produktbereiche im NKF-Produktrahmen“<br />
Die vom Innenm<strong>in</strong>isterium bekannt gegebenen Produktbereiche s<strong>in</strong>d dem vom Rechnungsstil unabhängigen<br />
e<strong>in</strong>heitlichen Produktrahmen entnommen, der von den Ländern erarbeitet wurde. Auf ihn haben sich die Länder<br />
mit Beschluss der Innenm<strong>in</strong>isterkonferenz vom 21. November 2003 gee<strong>in</strong>igt.<br />
3. Haushaltsplan und Budgetierung<br />
Das NKF be<strong>in</strong>haltet neben dem Ressourcenverbrauchskonzept auch die dezentrale Ressourcenverantwortung<br />
und e<strong>in</strong>e flexible Haushaltsbewirtschaftung für die Geme<strong>in</strong>den. Die darüber gefasste Vorschrift erkennt die Budgets<br />
als Bewirtschaftungs<strong>in</strong>strument für die Geme<strong>in</strong>de an (vgl. § 21 GemHVO <strong>NRW</strong>). Unter Budgetierung wird<br />
verstanden, den e<strong>in</strong>zelnen Organisationse<strong>in</strong>heiten der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung, z.B. Fachbereiche oder Ämter,<br />
bestimmte Ressourcen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zu übertragen (dezentrale Ressourcenverantwortung).<br />
Unter e<strong>in</strong>em Budget ist somit als e<strong>in</strong> mit f<strong>in</strong>anziellen Mitteln ausgestatteter Handlungsbereich, der e<strong>in</strong>em abgegrenzten<br />
Verantwortungsbereich unter bestimmten Zielsetzungen übertragen wird, zu verstehen. Das Verständnis<br />
GEMEINDEORDNUNG 293
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 79 GO <strong>NRW</strong><br />
von Budgetierung als e<strong>in</strong>en eigenverantwortlichen Bewirtschaftungsprozess ist dabei i.d.R. an die verwaltungsmäßigen<br />
Organisationse<strong>in</strong>heiten der Geme<strong>in</strong>de gekoppelt und bedarf e<strong>in</strong>er e<strong>in</strong>deutigen Festlegung von Verantwortlichkeiten.<br />
Die Budgetierung hat deshalb e<strong>in</strong>e erhebliche Steuerungsrelevanz im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung<br />
der Geme<strong>in</strong>de.<br />
In diesem Zusammenhang ist auch die Bildung der geme<strong>in</strong>dlichen Budgets relevant, denn es ist von Bedeutung,<br />
ob örtlich e<strong>in</strong>e Vollbudgetierung oder e<strong>in</strong>e Teilbudgetierung oder beide Arten zur Anwendung kommen. Bei e<strong>in</strong>er<br />
Vollbudgetierung fließen alle Haushaltsmittel, z.B. Erträge und Aufwendungen, <strong>in</strong> die Budgetierung e<strong>in</strong>. Dieses<br />
erfordert e<strong>in</strong> hohes Maß an Budgetverantwortung, weil durch das Ergebnis unmittelbar der geme<strong>in</strong>dliche Haushaltausgleich<br />
betroffen ist. Bei der Teilbudgetierung können dagegen unterschiedliche Zusammenhänge hergestellt<br />
werden, z.B. Sachausgabenbudgetierung, Budgetierung von Investitionszahlungen u.a. Außerdem kann die<br />
Budgetbildung auch nach Zuschussbudgets (Aufwendungen höher als Erträge), Überschussbudgets (Erträge<br />
höher als Aufwendungen und ausgeglichene Budgets unterschieden werden. Unabhängig von der Art der Budgetbildung<br />
bedarf es e<strong>in</strong>deutiger Budgetregeln.<br />
Durch die gesonderte Vorschrift <strong>in</strong> § 21 GemHVO <strong>NRW</strong> erhält die Budgetierung für den geme<strong>in</strong>dlichen Haushalt<br />
zwar e<strong>in</strong>en hohen Stellenwert, gleichwohl ist damit nicht verbunden, die Budget auch im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan<br />
abzubilden. Die im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan abzubildenden Teilpläne können zwar e<strong>in</strong>e gute<br />
Grundlage für die zu bildenden Budgets darstellen, es hängt aber e<strong>in</strong>erseits von der Ausgestaltung der Produktorientierung<br />
und andererseits von der Übertragung der dezentralen Ressourcenverantwortung ab, ob e<strong>in</strong>e Identität<br />
zwischen diesen beiden haushaltswirtschaftlichen Betrachtungen hergestellt werden kann.<br />
Es dürfte sich <strong>in</strong> vielen Fällen anbieten, e<strong>in</strong>e produktorientierte Darstellung im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan vorzunehmen,<br />
um den Adressaten die Leistungserstellung und die dafür e<strong>in</strong>gesetzten Ressourcen <strong>in</strong> verständlicher<br />
und nachvollziehbarer Weise offen zu legen. Die Budgetierung kann dagegen dann als <strong>in</strong>terne Bewirtschaftung <strong>in</strong><br />
Ausführung des geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplans e<strong>in</strong>gerichtet und h<strong>in</strong>sichtlich der Bedürfnisse der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Verwaltung als dafür zuständige Organisationse<strong>in</strong>heit ausgerichtet werden. Es muss auch e<strong>in</strong> Zusammenhang<br />
zur Produktorientierung geschaffen werden, <strong>in</strong> dem z.B. die Budgets e<strong>in</strong>deutig an den Produkten der Geme<strong>in</strong>de<br />
ausgerichtet werden Es müssen aber nicht zusätzlich zu den produktorientierten Teilplänen auch Budgetpläne im<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan abgebildet werden. Es ist als ausreichend anzusehen, nur für die Ausführung des<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplans e<strong>in</strong>en entsprechenden Managementplan aufzustellen.<br />
4. Haushaltsplan und Planfortschreibung<br />
Im Rahmen der Ausführung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft können die im Haushaltsplan der Geme<strong>in</strong>de<br />
veranschlagten Ermächtigungen vielfachen Anpassungen bzw. Fortschreibungen unterliegen. Die Veränderung<br />
e<strong>in</strong>er haushaltswirtschaftlichen Ermächtigung wird z.B. durch e<strong>in</strong>e Nachtragssatzung ausgelöst (vgl. § 81 GO<br />
<strong>NRW</strong>), wenn der dazugehörige Nachtragshaushaltsplan (vgl. § 10 GemHVO <strong>NRW</strong>) für bestimmte Haushaltspositionen<br />
e<strong>in</strong>e Erhöhung oder M<strong>in</strong>derung der im Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigung (Plansatz) enthält.<br />
Weiterh<strong>in</strong> verursachen die haushaltsrechtlich vorgesehenen Ermächtigungsübertragungen die Fortschreibung<br />
e<strong>in</strong>es im Ergebnisplan oder im F<strong>in</strong>anzplan enthaltenen Planansatzes, denn nach § 22 Abs. 1 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
erhöhen diese Übertragungen die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Haushaltsjahres.<br />
Derartige Anpassungen der Haushaltspositionen des Haushaltsplans werden als Planfortschreibungen bezeichnet<br />
und führen zum „fortgeschriebenen Planansatz“ im Ergebnisplan oder im F<strong>in</strong>anzplan bzw. den Teilplänen. In<br />
diesen Fällen ist noch zu berücksichtigen, dass e<strong>in</strong>er durch die Übertragung haushaltswirtschaftlicher Ermächtigungen<br />
verursachten Ergebnisverbesserung im abgelaufenen Haushaltsjahr e<strong>in</strong>e Ergebnisverschlechterung im<br />
neuen Haushaltsjahr gegenüber steht. Dieser Situation kann von der Geme<strong>in</strong>de nicht dadurch begegnet werden,<br />
dass erneut e<strong>in</strong>e Ermächtigungsübertragung vorgenommen wird, denn die haushaltswirtschaftlichen Ermächtigungen<br />
gelten regelmäßig nur bis zum Ende des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres.<br />
GEMEINDEORDNUNG 294
II. Erläuterungen im E<strong>in</strong>zelnen<br />
1. Zu Absatz 1 (Inhalt des Haushaltsplans):<br />
1.01 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 79 GO <strong>NRW</strong><br />
Die ausdrückliche Regelung <strong>in</strong> Absatz 3 der Vorschrift, der Haushaltsplan ist für die Haushaltsführung verb<strong>in</strong>dlich,<br />
führt nicht dazu, dass nur die Ermächtigungen auf der haushaltsmäßigen Gesamtebene aus Ergebnisplan und<br />
F<strong>in</strong>anzplan im Rahmen der vom Rat beschlossenen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen verb<strong>in</strong>dlich s<strong>in</strong>d. Wegen<br />
der <strong>in</strong> § 79 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> enthaltenen Verpflichtung der Geme<strong>in</strong>de, den Haushaltsplan <strong>in</strong> Teilpläne zu gliedern,<br />
besteht die Verb<strong>in</strong>dlichkeit der Ermächtigungen <strong>in</strong> diesen Teilplänen, die nach Produktbereichen, Produktgruppen<br />
oder Produkten sowie nach Verantwortungsbereichen (Budgets) unter Beachtung des vom Innenm<strong>in</strong>isterium<br />
bekannt gegebenen Produktrahmens gebildet werden können (vgl. § 4 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
Die eigenständigen Gestaltungsmöglichkeiten der Geme<strong>in</strong>den werden dabei nicht durch das Land unterbunden,<br />
denn mit den Produktbereichen oder unterhalb der verb<strong>in</strong>dlichen Produktbereiche bedarf es der Festlegung e<strong>in</strong>er<br />
örtlichen Steuerungsebene, die es von der Geme<strong>in</strong>de selbst auszugestalten gilt. Außerdem ergeben sich aus den<br />
Reformzielen des Neuen Kommunalen <strong>F<strong>in</strong>anzmanagement</strong>s und den zur Erreichung dieser Ziele e<strong>in</strong>gesetzten<br />
neuen Instrumenten e<strong>in</strong>ige Änderungen und Ergänzungen für den Inhalt, den Aufbau, die Begrifflichkeiten und die<br />
Darstellung des Haushaltsplans und des Jahresabschlusses.<br />
1.1 Zu Satz 1 (Veranschlagung im Haushaltsplan):<br />
1.1.01 Die Grundlagen der Haushaltsplanung<br />
Die Grundsatzbestimmungen für den geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan berücksichtigen den Rechnungsstoff des<br />
NKF. Deshalb werden Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan sowie E<strong>in</strong>- und Auszahlungen im F<strong>in</strong>anzplan<br />
die Grundlage der Haushaltsplanung und der Haushaltsbewirtschaftung sowie der Haushaltsabrechnung (Jahresabschluss)<br />
se<strong>in</strong>. Außerdem führt die stärkere Orientierung des Rates an den Steuerungserfordernissen im<br />
S<strong>in</strong>ne des Neuen Steuerungsmodells und die bereitere Berücksichtigung der Informationsbedürfnisse der Öffentlichkeit<br />
zu e<strong>in</strong>er Änderung des Aufbaus, des Detaillierungsgrades sowie der Darstellungsform des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltsplans.<br />
Die Geme<strong>in</strong>de hat bei der Veranschlagung der voraussichtlich notwendigen Haushaltsmittel den Grundsatz der<br />
Vollständigkeit zu beachten,, denn der geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsplan muss alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung<br />
der Aufgaben der Geme<strong>in</strong>de voraussichtlich anfallenden Erträgen und entstehenden Aufwendungen sowie die<br />
e<strong>in</strong>gehenden E<strong>in</strong>zahlungen und zu leistenden Auszahlungen, aber auch die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen<br />
enthalten. Der Haushaltsplan steht dabei <strong>in</strong> unmittelbarer Verb<strong>in</strong>dung zur Haushaltssatzung nach § 78<br />
Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>, so dass auch der Grundsatz der Jährlichkeit maßgebend ist, denn die Haushaltssatzung der<br />
Geme<strong>in</strong>de tritt mit Beg<strong>in</strong>n des Haushaltsjahres <strong>in</strong> Kraft und gilt für das Haushaltsjahr (vgl. gilt § 78 Abs. 3 GO<br />
<strong>NRW</strong>.<br />
Außerdem f<strong>in</strong>det der Grundsatz der zeitlichen B<strong>in</strong>dung Anwendung, denn der Haushaltsplan der Geme<strong>in</strong>de hat<br />
im Ergebnisplan die im Haushaltsjahr durch die Erfüllung der Aufgaben anfallenden Erträge und entstehenden<br />
Aufwendungen und entsprechend im F<strong>in</strong>anzplan die e<strong>in</strong>gehenden E<strong>in</strong>zahlungen und zu leistenden Auszahlungen<br />
zu enthalten (vgl. § 79 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>). Die im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen<br />
entfallen daher mit dem Ende des Haushaltsjahres, so dass die Geme<strong>in</strong>de aus den betreffenden Haushaltspositionen<br />
des Haushaltsplans dann i.d.R. ke<strong>in</strong>e Aufwendungen mehr entstehen lassen oder Auszahlungen leisten<br />
darf.<br />
GEMEINDEORDNUNG 295
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 79 GO <strong>NRW</strong><br />
1.1.1 Zu Nummer 1 (Veranschlagung der Erträge und E<strong>in</strong>zahlungen):<br />
1.1.1.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Im NKF wird über Erträge das Ressourcenaufkommen der Geme<strong>in</strong>de erfasst. Unter E<strong>in</strong>beziehung der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Produktorientierung wird damit die haushaltsmäßige Erfassung und Darstellung des Ressourcenaufkommens<br />
der Geme<strong>in</strong>de bezogen auf ihre Aufgabenerfüllung möglich. Gleichzeitig soll die Ausrichtung der F<strong>in</strong>anzpolitik<br />
der Geme<strong>in</strong>den auf das Pr<strong>in</strong>zip der <strong>in</strong>tergenerativen Gerechtigkeit erreichen, dass der gesamte Ressourcenverbrauch<br />
e<strong>in</strong>er Periode regelmäßig durch Erträge derselben Periode gedeckt wird, um nachfolgende Generationen<br />
nicht zu überlasten.<br />
Die im NKF für den geme<strong>in</strong>dlichen Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung zu verwendende Rechengröße „Erträge“<br />
ist der zutreffende Buchungsstoff für e<strong>in</strong>e „Re<strong>in</strong>vermögensrechnung“, die das Geldvermögen und das<br />
Sachvermögen der Geme<strong>in</strong>de betrifft, wenn e<strong>in</strong> Vorgang bei der Geme<strong>in</strong>de das geme<strong>in</strong>dliche Eigenkapital erhöht.<br />
Außerdem führt die Rechengröße „E<strong>in</strong>zahlungen“ im Rahmen des geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzplans und der F<strong>in</strong>anzrechnung<br />
zu e<strong>in</strong>er Mittelherkunftsrechnung, bei der die e<strong>in</strong>gehenden Zahlungen ausschlaggebend und unter<br />
Beachtung des Kassenwirksamkeitspr<strong>in</strong>zips als Zahlungsströme zu erfassen s<strong>in</strong>d.<br />
1.1.1.2 Die Veranschlagung von Erträgen<br />
Das Ressourcenverbrauchskonzept wird dadurch angemessen umgesetzt, dass im Ergebnisplan mit der Rechengröße<br />
„Ertrag“ das Ressourcenaufkommen zu veranschlagen ist. Die Erträge bedeuten e<strong>in</strong>en Wertezufluss<br />
an Gütern und Dienstleistungen und bewirken e<strong>in</strong>e Eigenkapitalerhöhung. Der Ergebnisplan hat die Aufgabe,<br />
über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge vollständig und klar zu <strong>in</strong>formieren. Weil dar<strong>in</strong> gleichzeitig<br />
auch die Aufwendungen zu veranschlagen s<strong>in</strong>d, weist der Ergebnisplan den sich daraus ergebenden Überschuss<br />
oder Fehlbedarf aus.<br />
Bei der Veranschlagung der Erträge ist zu berücksichtigen, dass der Ergebnisplan nach dem Grundsatz der Ergebnisspaltung<br />
aufgebaut ist, so dass die ordentlichen und die außerordentlichen Erträge getrennt vone<strong>in</strong>ander<br />
aufgezeigt werden. Auch s<strong>in</strong>d die Planungsgrundsätze nach § 11 GemHVO <strong>NRW</strong> sowie weitere haushaltsrechtliche<br />
Vorschriften zu beachten, so dass z.B. die Erträge <strong>in</strong> ihrer voraussichtlichen Höhe <strong>in</strong> dem Haushaltsjahr zu<br />
veranschlagen s<strong>in</strong>d, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen s<strong>in</strong>d (Grundsatz der Periodenabgrenzung). Die im geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Ergebnisplan veranschlagten Erträge stellen jedoch ke<strong>in</strong>e Obergrenze für die Haushaltsbewirtschaftung<br />
dar. Vielmehr spiegeln die Haushaltspositionen die Erwartungen der Geme<strong>in</strong>de wieder, denn die Geme<strong>in</strong>de<br />
muss durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass ihre Ansprüche vollständig erfasst, rechtzeitig geltend<br />
gemacht und e<strong>in</strong>gezogen werden (vgl. § 23 Abs. 3 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
Unter der geme<strong>in</strong>dlichen Rechengröße „Erträge“ wird betriebswirtschaftlich die bewertete Leistungserstellung der<br />
Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Haushaltsjahr (Geschäfts- bzw. Wirtschaftsjahr) verstanden. E<strong>in</strong>en Ertrag stellt dabei jeder<br />
geme<strong>in</strong>dliche Vorgang dar, der das Nettovermögen bzw. das Eigenkapital der Geme<strong>in</strong>de erhöht. Mit der Rechengröße<br />
werden aber auch die der Geme<strong>in</strong>de zustehenden Steuere<strong>in</strong>nahmen und die ihr gewährten Zuwendungen<br />
erfasst, denn diese stellen e<strong>in</strong>en erheblichen Anteil an den geme<strong>in</strong>dlichen E<strong>in</strong>nahmen dar. Die Begriffspaare<br />
„Erträge“ und „E<strong>in</strong>nahmen“ können im geme<strong>in</strong>dlichen Bereich wie folgt unterschieden werden (vgl. Abbildung).<br />
GEMEINDEORDNUNG 296
Ertrag, der nicht gleichzeitig<br />
e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>nahme ist<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 79 GO <strong>NRW</strong><br />
Ertrag<br />
Rechengröße „Erträge“<br />
Ertrag, der gleichzeitig<br />
e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>nahme ist<br />
E<strong>in</strong>nahme, die gleichzeitig<br />
e<strong>in</strong> Ertrag ist<br />
E<strong>in</strong>nahme<br />
Abbildung 39 „Rechengröße Erträge“<br />
E<strong>in</strong>nahme, die nicht gleichzeitig<br />
e<strong>in</strong> Ertrag ist<br />
Die Rechengrößen „Ertrag“ und „E<strong>in</strong>nahme“ s<strong>in</strong>d dann deckungsgleich, wenn die gleiche Periode bzw. das gleiche<br />
Haushaltsjahr der Geme<strong>in</strong>de betroffen ist. Die Geme<strong>in</strong>de erzielt dann aber <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Haushaltsjahr e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>nahme,<br />
die ke<strong>in</strong>en Ertrag darstellt, wenn entweder ke<strong>in</strong>e Leistungserstellung durch die Geme<strong>in</strong>de vorliegt oder<br />
wenn die Leistungserstellung und die dazugehörige E<strong>in</strong>nahme <strong>in</strong> unterschiedliche Haushaltsjahre fallen, z.B.<br />
Rechnungsabgrenzung bei Mietvorauszahlungen (vgl. § 42 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
1.1.1.3 Die Veranschlagung von E<strong>in</strong>zahlungen<br />
Im doppischen Haushaltsrecht kann auf e<strong>in</strong>e Planung der voraussichtlich e<strong>in</strong>gehenden E<strong>in</strong>zahlungen, <strong>in</strong>sbesondere<br />
für Investitionen, nicht verzichtet werden. Die Rechengröße „E<strong>in</strong>zahlungen“ des NKF stellt den Buchungsstoff<br />
für den F<strong>in</strong>anzplan dar. Bei den E<strong>in</strong>zahlungen handelt es sich um e<strong>in</strong>en tatsächlichen Geldzufluss, der zum<br />
Zeitpunkt der Bezahlung von Gütern und Dienstleistungen entsteht und e<strong>in</strong>e Erhöhung der F<strong>in</strong>anzmittel der Geme<strong>in</strong>de<br />
bewirkt. Die Arten der E<strong>in</strong>zahlungen zeigen die Mittelherkunft auf, denn sie s<strong>in</strong>d im F<strong>in</strong>anzplan im geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltsplan getrennt nach E<strong>in</strong>zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit<br />
und aus der F<strong>in</strong>anzierungstätigkeit des Haushaltsjahres zu veranschlagen.<br />
Die Planungsgrundsätze nach § 11 GemHVO <strong>NRW</strong> sowie weitere haushaltsrechtliche Vorschriften s<strong>in</strong>d außerdem<br />
zu beachten, so dass z.B. die E<strong>in</strong>zahlungen <strong>in</strong> Höhe der voraussichtlich zu erzielenden Beträge <strong>in</strong> dem<br />
Haushaltsjahr zu veranschlagen s<strong>in</strong>d, <strong>in</strong> dem sie liquiditätswirksam werden (Grundsatz der Kassenwirksamkeit).<br />
Die im geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzplan veranschlagten E<strong>in</strong>zahlungen stellen jedoch ke<strong>in</strong>e Obergrenze für die Haushaltsbewirtschaftung<br />
dar. Vielmehr spiegeln die Haushaltspositionen die Erwartungen der Geme<strong>in</strong>de wieder,<br />
denn die Geme<strong>in</strong>de muss durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass ihre Ansprüche vollständig erfasst,<br />
rechtzeitig geltend gemacht und e<strong>in</strong>gezogen werden (vgl. § 23 Abs. 3 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
Unter der geme<strong>in</strong>dlichen Rechengröße „E<strong>in</strong>zahlungen“ wird der tatsächliche Zahlungsmittelzufluss bei der Geme<strong>in</strong>de<br />
im Haushaltsjahr erfasst, der zu e<strong>in</strong>er Erhöhung des geme<strong>in</strong>dlichen Zahlungsmittelbestandes durch den<br />
Zugang liquider Mittel, die <strong>in</strong> Form von Bargeld oder Buchgeld der Geme<strong>in</strong>de zufließen, führt. Nicht als E<strong>in</strong>zahlung<br />
gilt die Erhöhung des Kassenbestandes der Geme<strong>in</strong>de durch e<strong>in</strong>e Barabhebung von e<strong>in</strong>em Bankkonto der<br />
Geme<strong>in</strong>de, weil dadurch der Zahlungsmittelbestand der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong>sgesamt nicht verändert wird. Die Begriffspaare<br />
„E<strong>in</strong>zahlungen“ und „E<strong>in</strong>nahmen“ können im geme<strong>in</strong>dlichen Bereich wie folgt unterschieden werden (vgl.<br />
Abbildung).<br />
GEMEINDEORDNUNG 297
E<strong>in</strong>zahlung, die nicht gleichzeitig<br />
e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>nahme ist<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 79 GO <strong>NRW</strong><br />
E<strong>in</strong>zahlung<br />
Rechengröße „E<strong>in</strong>zahlungen“<br />
E<strong>in</strong>zahlung, die gleichzeitig<br />
e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>nahme ist<br />
E<strong>in</strong>nahme, die gleichzeitig<br />
e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>zahlung ist<br />
E<strong>in</strong>nahme<br />
Abbildung 40 „Rechengröße E<strong>in</strong>zahlungen“<br />
E<strong>in</strong>nahme, die nicht gleichzeitig<br />
e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>zahlung ist<br />
Es liegen beim E<strong>in</strong>satz der Rechengrößen „E<strong>in</strong>zahlungen“ und „E<strong>in</strong>nahme“ im geme<strong>in</strong>dlichen Rechnungswesen<br />
dann nicht e<strong>in</strong>nahmewirksame E<strong>in</strong>zahlungen vor, wenn es <strong>in</strong> gleicher Höhe zu e<strong>in</strong>er zu e<strong>in</strong>er Abnahme der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Forderungen oder zu e<strong>in</strong>er Erhöhung der geme<strong>in</strong>dlichen Verb<strong>in</strong>dlichkeiten kommt.<br />
1.1.2 Zu Nummer 2 (Veranschlagung von Aufwendungen und Auszahlungen):<br />
1.1.2.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Mit dem NKF wird über Aufwendungen der Ressourcenverbrauch der Geme<strong>in</strong>de erfasst und der tatsächliche<br />
Werteverzehr über Abschreibungen vollständig abgebildet. Unter E<strong>in</strong>beziehung der geme<strong>in</strong>dlichen Produktorientierung<br />
wird damit die haushaltsmäßige Erfassung und Darstellung des Ressourcenverbrauchs der Geme<strong>in</strong>de<br />
bezogen auf ihre Aufgabenerfüllung möglich. Gleichzeitig soll die Ausrichtung der F<strong>in</strong>anzpolitik der Geme<strong>in</strong>den<br />
auf das Pr<strong>in</strong>zip der <strong>in</strong>tergenerativen Gerechtigkeit erreichen, dass der gesamte Ressourcenverbrauch e<strong>in</strong>er Periode<br />
regelmäßig durch Erträge derselben Periode gedeckt wird, um die nachfolgenden Generationen nicht zu<br />
überlasten.<br />
Die im NKF für den geme<strong>in</strong>dlichen Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung zu verwendende Rechengröße „Aufwendungen“<br />
ist der zutreffende Buchungsstoff für e<strong>in</strong>e „Re<strong>in</strong>vermögensrechnung“, die das Geldvermögen und<br />
das Sachvermögen der Geme<strong>in</strong>de betrifft, wenn e<strong>in</strong> Vorgang bei der Geme<strong>in</strong>de das geme<strong>in</strong>dliche Eigenkapital<br />
verm<strong>in</strong>dert. Außerdem führt die Rechengröße „Auszahlungen“ im Rahmen des geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzplans und<br />
der F<strong>in</strong>anzrechnung zu e<strong>in</strong>er Mittelverwendungsrechnung, bei der die zu leistenden Zahlungen ausschlaggebend<br />
und unter Beachtung des Kassenwirksamkeitspr<strong>in</strong>zips als Zahlungsströme zu erfassen s<strong>in</strong>d.<br />
1.1.2.2 Die Veranschlagung von Aufwendungen<br />
Das Ressourcenverbrauchskonzept wird auch dadurch angemessen umgesetzt, dass im Ergebnisplan mit den<br />
Rechengrößen „Aufwand“ der Ressourcenverbrauch zu veranschlagen ist. Die Aufwendungen bedeuten e<strong>in</strong>en<br />
Werteverzehr an Gütern und Dienstleistungen und m<strong>in</strong>dern dadurch das Eigenkapital. Der Ergebnisplan hat die<br />
Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Aufwendungen vollständig und klar zu <strong>in</strong>formieren. Weil<br />
dar<strong>in</strong> gleichzeitig auch die Erträge zu veranschlagen s<strong>in</strong>d, weist der Ergebnisplan den sich daraus ergebenden<br />
Überschuss oder Fehlbedarf aus. Zu Aufwendungen führt daher jeder geme<strong>in</strong>dliche Vorgang, der das Nettover-<br />
GEMEINDEORDNUNG 298
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 79 GO <strong>NRW</strong><br />
mögen bzw. das Eigenkapital der Geme<strong>in</strong>de verm<strong>in</strong>dert. Die Rechengrößen „Aufwand“ und „Ausgabe“ s<strong>in</strong>d dann<br />
deckungsgleich, wenn die gleiche Periode bzw. das gleiche Haushaltsjahr der Geme<strong>in</strong>de betroffen ist, z.B. wenn<br />
von der Geme<strong>in</strong>de die Gehälter, das Material, die Energie u.a. zu bezahlen ist. Die Geme<strong>in</strong>de leistet dann <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>em Haushaltsjahr e<strong>in</strong>e Ausgabe, die ke<strong>in</strong>en Aufwand darstellt, wenn z.B. z.B. die im Dezember des Haushaltsjahres<br />
für den Januar des Folgejahres zu zahlende Beamtenbesoldung. Die Aufwendungen der Geme<strong>in</strong>de und<br />
die dazugehörige Ausgabe fallen dabei <strong>in</strong> unterschiedliche Haushaltsjahre (vgl. aktive Rechnungsabgrenzung<br />
nach § 42 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
Bei der Veranschlagung der Aufwendungen ist zu berücksichtigen, dass der Ergebnisplan nach dem Grundsatz<br />
der Ergebnisspaltung aufgebaut ist, so dass die ordentlichen und die außerordentlichen Aufwendungen getrennt<br />
vone<strong>in</strong>ander aufgezeigt werden. Auch s<strong>in</strong>d die Planungsgrundsätze nach § 11 GemHVO <strong>NRW</strong> sowie weitere<br />
haushaltsrechtliche Vorschriften zu beachten, so dass z.B. die Aufwendungen <strong>in</strong> ihrer voraussichtlichen Höhe <strong>in</strong><br />
dem Haushaltsjahr zu veranschlagen s<strong>in</strong>d, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen s<strong>in</strong>d (Grundsatz der Periodenabgrenzung).<br />
Unter der geme<strong>in</strong>dlichen Rechengröße „Aufwendungen“ wird betriebswirtschaftlich der bewertete Güterverzehr<br />
der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Haushaltsjahr verstanden. Die Begriffspaare „Aufwendungen“ und „Ausgaben“ können im<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Bereich wie folgt unterschieden werden (vgl. Abbildung).<br />
Aufwand, der nicht gleichzeitig<br />
e<strong>in</strong>e Ausgabe ist<br />
Rechengröße „Aufwendungen“<br />
Aufwand<br />
Aufwand, der gleichzeitig<br />
e<strong>in</strong>e Ausgabe ist<br />
Ausgabe, die gleichzeitig<br />
e<strong>in</strong> Aufwand ist<br />
Ausgabe<br />
Abbildung 41 „Rechengröße Aufwendungen“<br />
Ausgabe, die nicht gleichzeitig<br />
e<strong>in</strong> Aufwand ist<br />
Die im geme<strong>in</strong>dlichen Ergebnisplan veranschlagten Aufwendungen stellen dabei e<strong>in</strong>e Obergrenze für die Haushaltsbewirtschaftung<br />
dar, soweit nicht überplanmäßige und/oder außerplanmäßige Aufwendungen im Rahmen<br />
der Ausführung des geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplans notwendig werden (vgl. § 83 GO <strong>NRW</strong>). Die Geme<strong>in</strong>de muss<br />
zudem durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass die im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen<br />
erst dann <strong>in</strong> Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung dies erfordert und Verpflichtungen der<br />
Geme<strong>in</strong>de erst bei Fälligkeit erfüllt werden (vgl. § 23 Abs. 1 und 3 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
1.1.2.3 Die Veranschlagung der Auszahlungen<br />
1.1.2.3.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Im NKF als geme<strong>in</strong>dliches Haushaltsrecht kann auf e<strong>in</strong>e mehrjährige F<strong>in</strong>anzplanung der voraussichtlich zu leistenden<br />
Auszahlungen der Geme<strong>in</strong>de, <strong>in</strong>sbesondere für die geme<strong>in</strong>dliche Investitionstätigkeit, nicht verzichtet<br />
werden. Bei den geme<strong>in</strong>dlichen Auszahlungen fließen daher zum Zeitpunkt der Bezahlung von Gütern und<br />
GEMEINDEORDNUNG 299
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 79 GO <strong>NRW</strong><br />
Dienstleistungen an Dritte monetäre F<strong>in</strong>anzmittel ab und m<strong>in</strong>dern den Bestand. Die Arten der Auszahlungen im<br />
geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzplan zeigen dabei die Mittelverwendung auf. Außerdem s<strong>in</strong>d die Planungsgrundsätze nach<br />
§ 11 GemHVO <strong>NRW</strong> sowie weitere haushaltsrechtliche Vorschriften zu beachten, so dass z.B. Auszahlungen <strong>in</strong><br />
Höhe der voraussichtlich zu leistenden Beträge im F<strong>in</strong>anzplan der Geme<strong>in</strong>de zu veranschlagen s<strong>in</strong>d (Kassenwirksamkeitspr<strong>in</strong>zip).<br />
Die im geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzplan veranschlagten Auszahlungen stellen dabei e<strong>in</strong>e Obergrenze für die Haushaltsbewirtschaftung<br />
dar, soweit nicht überplanmäßige und/oder außerplanmäßige Auszahlungen im Rahmen der<br />
Ausführung des geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplans notwendig werden (vgl. § 83 GO <strong>NRW</strong>). Die Geme<strong>in</strong>de muss<br />
dazu durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass die im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen erst<br />
dann <strong>in</strong> Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung dies erfordert und Verpflichtungen der Geme<strong>in</strong>de<br />
erst bei Fälligkeit erfüllt werden (vgl. § 23 Abs. 1 und 3 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
1.1.2.3.2 Die Rechengröße „Auszahlungen“<br />
Die Rechengröße „Auszahlungen“ stellt dabei e<strong>in</strong>erseits den Buchungsstoff für den F<strong>in</strong>anzplan der Geme<strong>in</strong>de<br />
dar. Andererseits wird darunter der tatsächliche Zahlungsmittelabfluss bei der Geme<strong>in</strong>de im Haushaltsjahr erfasst,<br />
der zu e<strong>in</strong>er Verm<strong>in</strong>derung des geme<strong>in</strong>dlichen Zahlungsmittelbestandes durch den Abgang liquider Mittel,<br />
die <strong>in</strong> Form von Bargeld oder Buchgeld von der Geme<strong>in</strong>de abgegeben werden, führt. In diesem Zusammenhang<br />
gilt die Verm<strong>in</strong>derung des Kassenbestandes der Geme<strong>in</strong>de durch e<strong>in</strong>e Bare<strong>in</strong>zahlung auf e<strong>in</strong> Bankkonto der<br />
Geme<strong>in</strong>de nicht als Auszahlung, weil dadurch der Zahlungsmittelbestand der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong>sgesamt nicht verändert<br />
wird. Die Begriffspaare „Aufwendungen“ und „Ausgaben“ können im geme<strong>in</strong>dlichen Bereich wie folgt unterschieden<br />
werden (vgl. Abbildung).<br />
Aufzahlung, die nicht gleichzeitig<br />
ausgabewirksam ist<br />
Rechengröße „Auszahlungen“<br />
Auszahlung<br />
Auszahlung, die gleichzeitig<br />
ausgabewirksam ist<br />
Ausgabe, die gleichzeitig<br />
auszahlungswirksam ist<br />
Ausgabe<br />
Abbildung 42 „Rechengröße Auszahlungen“<br />
Ausgabe, die nicht gleichzeitig<br />
auszahlungswirksam ist<br />
In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass beim E<strong>in</strong>satz der Rechengrößen „Auszahlungen“ und „Ausgabe“<br />
auch dann ke<strong>in</strong>e ausgabewirksamen Auszahlungen vorliegen, wenn es <strong>in</strong> gleicher Höhe zu e<strong>in</strong>er zu e<strong>in</strong>er M<strong>in</strong>derung<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Verb<strong>in</strong>dlichkeiten oder zu e<strong>in</strong>er Zunahme der geme<strong>in</strong>dlichen Forderungen kommt. Auch<br />
e<strong>in</strong>e Verm<strong>in</strong>derung des Kassenbestandes der Geme<strong>in</strong>de durch e<strong>in</strong>e Bare<strong>in</strong>zahlung auf e<strong>in</strong> Bankkonto der Geme<strong>in</strong>de<br />
gilt nicht als geme<strong>in</strong>dliche Auszahlung, weil durch diesen Vorgang der Zahlungsmittelbestand der Geme<strong>in</strong>de<br />
<strong>in</strong>sgesamt nicht verändert wird.<br />
GEMEINDEORDNUNG 300
1.1.2.3.3 Die fremden F<strong>in</strong>anzmittel<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 79 GO <strong>NRW</strong><br />
Die Vorschrift des § 16 GemHVO <strong>NRW</strong> nimmt die fremden F<strong>in</strong>anzmittel von der Veranschlagung im Haushaltsplan<br />
der Geme<strong>in</strong>de aus. Es ist bei dieser Vorschrift davon ausgegangen worden, dass die Dritten ihren gesamten<br />
Bedarf an F<strong>in</strong>anzmittel haushaltsmäßig selbst planen, der Geme<strong>in</strong>de entsprechend dem jeweiligen Bedarf die<br />
notwendigen F<strong>in</strong>anzmittel zur Zahlungsabwicklung zur Verfügung stellen und die Geme<strong>in</strong>de nicht zusätzlich eigene<br />
Verwaltungsleistungen erbr<strong>in</strong>gt. Die fremden F<strong>in</strong>anzmittel s<strong>in</strong>d unabhängig von ihrer Zweckbestimmung jedoch<br />
immer dann <strong>in</strong> die geme<strong>in</strong>dliche F<strong>in</strong>anzrechnung und damit <strong>in</strong> den geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss e<strong>in</strong>zubeziehen,<br />
soweit die fremden F<strong>in</strong>anzmittel als E<strong>in</strong>zahlungen oder Auszahlungen im Rahmen von geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Zahlungsvorgängen <strong>in</strong> der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung der Geme<strong>in</strong>de abgewickelt werden. Die Geme<strong>in</strong>de kann die fremden<br />
F<strong>in</strong>anzmittel auch <strong>in</strong> ihre Haushaltsplanung e<strong>in</strong>beziehen, denn die Vorschrift stellt für e<strong>in</strong>e Veranschlagung<br />
von fremden F<strong>in</strong>anzmitteln ke<strong>in</strong> absolutes Verbot dar. Sie muss dann dafür <strong>in</strong> ihrem F<strong>in</strong>anzplan e<strong>in</strong>e gesonderte<br />
Haushaltsposition schaffen.<br />
1.1.3 Zu Nummer 3 (Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigungen):<br />
Durch die Verpflichtungsermächtigungen nach § 85 GO <strong>NRW</strong> wird die geme<strong>in</strong>dliche Verwaltung ermächtigt, Verpflichtungen<br />
zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen <strong>in</strong> künftigen Haushaltsjahren e<strong>in</strong>zugehen. In der<br />
Regel dürfen sie zu Lasten der drei dem Haushaltsjahr folgenden Planungsjahre e<strong>in</strong>gegangen werden und s<strong>in</strong>d<br />
im F<strong>in</strong>anzplan gesondert auszuweisen. Es ist dabei das Ziel, die geme<strong>in</strong>dliche Verwaltung <strong>in</strong> die Lage zu versetzen,<br />
Aufträge für Lieferungen und Leistungen zu erteilen, die Zahlungen <strong>in</strong> späteren Haushaltsjahren auslösen,<br />
ohne dass es zw<strong>in</strong>gend erforderlich ist, <strong>in</strong> dem Haushaltsjahr, <strong>in</strong> dem der Auftrag erteilt wird, schon konkrete<br />
Auszahlungsermächtigungen verfügbar haben zu müssen (vgl. dazu auch § 13 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
1.2 Zu Satz 2 (Sondervorschriften für die Sondervermögen)<br />
Nach dem Grundsatz der E<strong>in</strong>heit des Haushaltsplans hat die Geme<strong>in</strong>de für ihre gesamte Haushaltswirtschaft<br />
sachlich nur e<strong>in</strong>en e<strong>in</strong>zigen Haushaltsplan aufzustellen. Davon lässt die Vorschrift jedoch Ausnahmen zu, <strong>in</strong>dem<br />
ausdrücklich bestimmt wird, dass die Vorschriften über die Sondervermögen der Geme<strong>in</strong>de (vgl. § 97 GO <strong>NRW</strong>)<br />
unberührt bleiben. Die Geme<strong>in</strong>de kann deshalb für ihre wirtschaftlichen Unternehmen (§ 114 GO <strong>NRW</strong>) und die<br />
organisatorisch verselbstständigten E<strong>in</strong>richtungen (§ 107 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>) ohne eigene Rechtspersönlichkeit<br />
besondere Wirtschaftpläne aufzustellen (vgl. § 97 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong>).<br />
Diesen Vorgaben folgt die Vorschrift des § 14 der Eigenbetriebsordnung <strong>NRW</strong>, nach der für die Eigenbetriebe<br />
jährlich eigenständige Wirtschaftspläne aufzustellen s<strong>in</strong>d. Für die rechtlich unselbstständigen Versorgungs- und<br />
Versicherungse<strong>in</strong>richtungen der Geme<strong>in</strong>de können besondere Haushaltspläne aufgestellt werden (vgl. § 97 Abs.<br />
4 GO <strong>NRW</strong>). Im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan s<strong>in</strong>d daher neben den bestehenden Aufgabenbereichen der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Kernverwaltung zusätzlich als Sondervermögen der Geme<strong>in</strong>de nur noch das gesonderte Geme<strong>in</strong>degliedervermögen<br />
im betreffenden Produktbereich und die rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen im<br />
Produktbereich 17 „Stiftungen“ enthalten (vgl. Nr. 1.2.3 des Runderlasses des Innenm<strong>in</strong>isteriums vom<br />
24.02.2005, SMBl. <strong>NRW</strong>. 6300).<br />
2. Zu Absatz 2 (Bestandteile des Haushaltsplans):<br />
2.01 Der Aufbau des Haushaltsplans<br />
Die mit der Reform des Geme<strong>in</strong>dehaushaltsrechts angestrebten Ziele, die Steuerung der Geme<strong>in</strong>de zu verbessern<br />
und den Ressourcenverbrauch vollständig zu berücksichtigen, erfordern e<strong>in</strong>en angepassten Aufbau des<br />
GEMEINDEORDNUNG 301
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 79 GO <strong>NRW</strong><br />
Haushaltsplans. Zugleich wird den Geme<strong>in</strong>den die Befugnis e<strong>in</strong>geräumt, ihren Haushaltsplan nach ihren örtlichen<br />
Bedürfnissen eigenverantwortlich zu untergliedern. Diese Vorgabe trägt wesentlich zur Stärkung der Selbstverwaltung<br />
der Geme<strong>in</strong>den bei. Außerdem s<strong>in</strong>d der Aufbau, der Detaillierungsgrad und die Darstellungsform der<br />
Bestandteile des geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplans auf die Steuerungserfordernisse des Rates und auf die Informationsbedürfnisse<br />
der Öffentlichkeit ausgerichtet worden.<br />
Im NKF enthält der geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsplan die haushaltsmäßige Gesamtebene aus Ergebnisplan und F<strong>in</strong>anzplan,<br />
die <strong>in</strong> produktorientierte Teilpläne zu untergliedern ist. Das Haushaltssicherungskonzept bleibt Teil des<br />
Haushaltsplans und der Stellenplan für die Beamten und die tariflich Beschäftigten e<strong>in</strong>e Anlage zum Haushaltsplan.<br />
Diese Festlegungen gewährleisten die Vergleichbarkeit der kommunalen Haushalte untere<strong>in</strong>ander. Mit der<br />
E<strong>in</strong>führung der Produktorientierung des Haushalts auf der Grundlage e<strong>in</strong>er Darstellung der erbrachten Dienstleistungen<br />
durch Produkte ist auch die Budgetierung des Ressourcenverbrauchs und des Ressourcenaufkommens<br />
sowie die Verb<strong>in</strong>dung von Ressourcen- und Fachverantwortung geschaffen worden (vgl. §§ 4 und 21 GemHVO<br />
<strong>NRW</strong>). Das nachfolgende Schema zeigt e<strong>in</strong>e Übersicht über die Elemente des Haushaltsplans (vgl. Abbildung).<br />
H<br />
A<br />
U<br />
S<br />
H<br />
A<br />
L<br />
T<br />
S<br />
S<br />
A<br />
T<br />
Z<br />
U<br />
N<br />
G<br />
Ergebnisplan<br />
- Erträge<br />
- Aufwendungen<br />
Der geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsplan im NKF<br />
F<strong>in</strong>anzplan<br />
- E<strong>in</strong>zahlungen<br />
- Auszahlungen<br />
- Investitionen<br />
Produktorientierte Teilpläne<br />
Gliederung der Gesamtebene <strong>in</strong> (17 Produktbereiche)<br />
mit Teilergebnisplänen<br />
mit Teilf<strong>in</strong>anzplänen<br />
Ziele und Kennzahlen zur örtlichen Aufgabenerfüllung<br />
und weitere Daten<br />
Abbildung 43 „Der geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsplan im NKF“<br />
Der Haushaltsplan der Geme<strong>in</strong>de muss zudem alle wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Informationen nicht für<br />
das Haushaltsjahr, sondern auch für die folgenden drei Planungsjahre (vgl. § 1 Abs. 3 GemHVO <strong>NRW</strong>) enthalten.<br />
Die Angaben im Haushaltsplan s<strong>in</strong>d dann als wesentlich anzusehen, wenn durch ihr Weglassen oder ihre fehlerhafte<br />
Abbildung haushaltswirtschaftliche Entscheidungen der Geme<strong>in</strong>de bee<strong>in</strong>flusst werden könnten. Ob und<br />
wann dieses <strong>in</strong> der Praxis vor Ort gegeben ist, muss im E<strong>in</strong>zelfall beurteilt werden.<br />
2.1 Zu Satz 1 (Gliederung des Haushaltsplans):<br />
Der Haushaltsplan im NKF besteht aus dem Ergebnisplan und dem F<strong>in</strong>anzplan sowie den produktorientierten<br />
Teilplänen. Er bildet jahresbezogen die geme<strong>in</strong>dlichen Ressourcen als Aufkommen (Ertrag) oder Verbrauch<br />
(Aufwand) ab. Damit wird dem Budgetrecht des Rates Rechnung getragen, denn dieser muss neben den Festlegungen<br />
der Erträge und Aufwendungen sowie der E<strong>in</strong>zahlungen und Auszahlungen auch sachliche Zuordnungen<br />
unter Beachtung der stetigen Aufgabenerfüllung und der geme<strong>in</strong>dlichen dauernden Leistungsfähigkeit treffen.<br />
Neben den produktorientierten besonderen Teilplänen und der dar<strong>in</strong> enthaltenen Abbildung der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
<strong>in</strong> den Teilergebnisplänen und der Investitionstätigkeit <strong>in</strong> den Teilf<strong>in</strong>anzplänen besteht e<strong>in</strong> besonderer<br />
Teilplan für die allgeme<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>dliche F<strong>in</strong>anzierungstätigkeit, die auf den gesamten Haushalt der<br />
GEMEINDEORDNUNG 302
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 79 GO <strong>NRW</strong><br />
Geme<strong>in</strong>de ausgerichtet ist (vgl. Produktbereich „Allgeme<strong>in</strong>e F<strong>in</strong>anzwirtschaft“ <strong>in</strong> Nr. 1.2.3 des Runderlasses des<br />
Innenm<strong>in</strong>isteriums vom 24.02.2005, SMBl. <strong>NRW</strong>. 6300 sowie die dazugehörige Anlage 5).<br />
2.1.1 Der Ergebnisplan<br />
Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan (vgl. § 3 GemHVO <strong>NRW</strong>). Er be<strong>in</strong>haltet die geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Aufwendungen und Erträge bezogen auf das Haushaltsjahr, denn der Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen<br />
sollen vollständig und periodengerecht erfasst werden. Vollständig heißt dabei vor allem,<br />
e<strong>in</strong>schließlich der Abschreibungen und e<strong>in</strong>schließlich der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen,<br />
die jedoch wirtschaftlich betrachtet bereits im Haushaltsjahr verursacht werden, z.B. Pensionsleistungen, für die<br />
Rückstellungen zu bilden s<strong>in</strong>d.<br />
In diesem Zusammenhang bedeutet der Begriff “periodengerecht“, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung<br />
über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, <strong>in</strong> dem der Ressourcenverbrauch<br />
durch die geme<strong>in</strong>dliche Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt. Der Rat ermächtigt deshalb mit dem Ergebnisplan<br />
die geme<strong>in</strong>dliche Verwaltung die entsprechenden Ressourcen e<strong>in</strong>zusetzen. Dabei ist <strong>in</strong>sbesondere die Verpflichtung<br />
zum Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> zu beachten.<br />
Im geme<strong>in</strong>dlichen Ergebnisplan werden die geplanten Erträge (Ressourcenaufkommen) und die geplanten Aufwendungen<br />
(Ressourcenverbrauch) aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der Geme<strong>in</strong>de nach Arten getrennt<br />
unter den vorgegeben Haushaltspositionen veranschlagt, z.B. die Abschreibungen auf die abnutzbaren Vermögensgegenstände<br />
der Geme<strong>in</strong>de. Er ist nach § 1 GemHVO <strong>NRW</strong> e<strong>in</strong> wichtiger Bestandteil des Haushaltsplans<br />
der Geme<strong>in</strong>de und bildet die Zusammenführung der verb<strong>in</strong>dlichen Haushaltspositionen nach § 2 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
mit dem Planungszeitraum nach § 1 Abs. 3 GemHVO <strong>NRW</strong> unter Beachtung der allgeme<strong>in</strong>en Planungsgrundsätze<br />
nach § 11 GemHVO <strong>NRW</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er mehrjährigen Zeitreihe ab.<br />
Diese rechtlichen Vorgaben sowie die verb<strong>in</strong>dlichen Zuordnungen zu den betroffenen Haushaltspositionen im<br />
kommunalen Kontierungsplan s<strong>in</strong>d bei der Aufstellung des jährlichen Haushaltsplans durch die Geme<strong>in</strong>de zu<br />
beachten. Das Muster wird zur Anwendung empfohlen (vgl. Nummer 1.2.1 des Runderlasses des Innenm<strong>in</strong>isteriums<br />
vom 24.02.2005, SMBl. <strong>NRW</strong>. 6300).<br />
2.1.2 Der F<strong>in</strong>anzplan<br />
Der F<strong>in</strong>anzplan (vgl. § 3 GemHVO <strong>NRW</strong>) ist der zweite Bestandteil des geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplans (vgl. § 1<br />
GemHVO <strong>NRW</strong>). Da im Ergebnisplan nur die jährlichen Abschreibungen für die Vermögensgegenstände (z.B.<br />
Schulgebäude oder Fahrzeuge) enthalten s<strong>in</strong>d, nicht aber die im Jahr der Anschaffung zu leistenden Investitionszahlungen,<br />
bedarf es dieser ergänzenden Komponente. Die Geme<strong>in</strong>de hat deshalb neben dem Ergebnisplan für<br />
jedes Haushaltsjahr e<strong>in</strong>en F<strong>in</strong>anzplan aufzustellen.<br />
Im geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzplan werden vor allem die <strong>in</strong>vestiven Zahlungen der Geme<strong>in</strong>de ausgewiesen und durch<br />
den Rat ermächtigt. Außerdem dient der F<strong>in</strong>anzplan der F<strong>in</strong>anzierungsplanung, da er neben der Investitionstätigkeit<br />
auch den F<strong>in</strong>anzbedarf der Geme<strong>in</strong>de für die laufende Verwaltungstätigkeit und die F<strong>in</strong>anzierungstätigkeit,<br />
z.B. Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen, ausweist. Der geme<strong>in</strong>dliche F<strong>in</strong>anzplan bildet die Zusammenführung<br />
der verb<strong>in</strong>dlichen Haushaltspositionen nach § 3 GemHVO <strong>NRW</strong> mit dem Planungszeitraum nach<br />
§ 1 Abs. 3 GemHVO <strong>NRW</strong> ab.<br />
Diese rechtlichen Vorgaben und die Verpflichtung der Geme<strong>in</strong>de zur Sicherstellung der F<strong>in</strong>anzierung von Investitionen<br />
nach § 75 Abs. 6 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 14 GemHVO <strong>NRW</strong> unter Beachtung der allgeme<strong>in</strong>en Planungsgrundsätze<br />
nach § 11 GemHVO <strong>NRW</strong> sowie die verb<strong>in</strong>dlichen Zuordnungen zu den betroffenen Haushaltspositionen<br />
GEMEINDEORDNUNG 303
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 79 GO <strong>NRW</strong><br />
im kommunalen Kontierungsplan s<strong>in</strong>d von der Geme<strong>in</strong>de bei der Aufstellung des jährlichen Haushaltsplans zu<br />
beachten. Das Muster wird zur Anwendung empfohlen (vgl. Nummer 1.2.2 des Runderlasses des Innenm<strong>in</strong>isteriums<br />
vom 24.02.2005, SMBl. <strong>NRW</strong>. 6300).<br />
2.1.3 Die produktorientierten Teilpläne<br />
2.1.3.1 Inhalte der Teilpläne<br />
Die haushaltsrechtlichen Regelungen räumen den Geme<strong>in</strong>den erstmals das Recht e<strong>in</strong>, die haushaltsmäßige<br />
Gesamtebene aus Ergebnisplan und F<strong>in</strong>anzplan eigenverantwortlich nach den örtlichen Bedürfnissen <strong>in</strong> Teilpläne<br />
zu untergliedern (vgl. § 4 GemHVO <strong>NRW</strong>). Die Regelung über die Aufstellung von Teilplänen für den geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltsplan stärkt die kommunale Selbstverwaltung. Sie trägt zum e<strong>in</strong>en dem Bedürfnis e<strong>in</strong>er Reihe von<br />
Geme<strong>in</strong>den Rechnung, <strong>in</strong> den Teilplänen ihre Produkte und Produktgruppen den Verantwortungsbereichen (Budgets)<br />
zuordnen zu können, die sie nach örtlichen Organisationsentscheidungen und Gegebenheiten gebildet<br />
haben, auch wenn diese nicht vollständig den Grenzen der Produktbereiche entsprechen.<br />
Die Geme<strong>in</strong>den s<strong>in</strong>d verpflichtet, für Steuerungs- und Informationszwecke sowie aus Gründen der Vergleichbarkeit<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Haushalte sowie für die Prüfung des Haushalts durch die Aufsichtsbehörde die erste Gliederungsstufe<br />
ihres Haushalts auf der Grundlage der 17 verb<strong>in</strong>dlichen Produktbereiche auszugestalten, die das<br />
unverzichtbare M<strong>in</strong>destmaß an E<strong>in</strong>heitlichkeit und Information widerspiegeln. Diese Vorgabe lässt den Geme<strong>in</strong>den<br />
den notwendigen Gestaltungsfreiraum für weitere Untergliederungen nach den örtlichen Gegebenheiten und<br />
<strong>in</strong> eigener Verantwortung.<br />
2.1.3.2 Der Aufbau der Teilpläne<br />
Die produktorientierten Teilpläne im geme<strong>in</strong>dlichen Haushalt stellen wegen ihrer Relevanz als Steuerungsebene<br />
jeweils e<strong>in</strong> produktorientiertes Gesamtbild dar. Sie müssen deshalb neben den Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzdaten auch<br />
Ziele und Kennzahlen sowie die notwendigen Bewirtschaftungsregeln enthalten (vgl. § 4 GemHVO <strong>NRW</strong>). Es ist<br />
dabei nicht ausreichend, nur die geme<strong>in</strong>dlichen Leistungen aufzulisten, sondern sie müssen def<strong>in</strong>iert und vone<strong>in</strong>ander<br />
abgegrenzt werden sowie messbar se<strong>in</strong>. Mit solchen Teilplänen wird die Aufgabenerfüllung der Geme<strong>in</strong>de<br />
und die Ausführung des geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplans transparenter gemacht und das wirtschaftliche Handeln<br />
der Geme<strong>in</strong>de gestärkt.<br />
Zur besseren Verständlichkeit der steuerungsrelevanten Gliederung des geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplans bietet es<br />
sich an, den gebildeten Teilplänen e<strong>in</strong>e schematische Übersicht vorangestellt werden, <strong>in</strong> der die Produktbereiche<br />
und die daraus abgeleiteten Produktgruppen und ggf. auch die Produkte ersichtlich s<strong>in</strong>d. Ist der Haushaltsplan<br />
nach örtlichen Verantwortungsbereichen gegliedert, soll dar<strong>in</strong> gleichwohl e<strong>in</strong>e Produktorientierung abgebildet<br />
werden. Damit wird die Aufgabenerfüllung der Geme<strong>in</strong>den transparenter und das wirtschaftliche Handeln gestärkt.<br />
Die E<strong>in</strong>führung erfordert daher von den Geme<strong>in</strong>den, sich e<strong>in</strong>en Überblick über die vielfältigen Tätigkeiten,<br />
die erbrachten Leistungen sowie die damit erzielten Wirkungen zu verschaffen, um e<strong>in</strong>e Def<strong>in</strong>ition der örtlichen<br />
Produkte vornehmen zu können.<br />
Die Untergliederung des Haushaltsplans der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> produktorientierte Teilpläne ist deshalb nicht getrennt<br />
nach dem auf der haushaltsmäßigen Gesamtebene bestehenden Ergebnisplan und F<strong>in</strong>anzplan vorzunehmen.<br />
Vielmehr müssen die vorgesehenen Teilpläne wegen ihrer Relevanz als Steuerungsebene nicht nur e<strong>in</strong>e produktorientierte<br />
Abbildung von Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzdaten, sondern auch Ziele und Leistungskennzahlen (vgl. § 12<br />
GemHVO <strong>NRW</strong>) sowie die notwendigen Bewirtschaftungsregeln enthalten (vgl. Abbildung).<br />
GEMEINDEORDNUNG 304
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 79 GO <strong>NRW</strong><br />
Haushaltsplan ... Fachliche Zuständigkeit:<br />
Frau/Herr<br />
Produktbereich …<br />
Inhalte des Produktbereiches<br />
Beschreibung und Zielsetzung:<br />
Zielgruppe(n):<br />
Besonderheiten im Haushaltsjahr:<br />
Produktbereichsübersicht<br />
Produktgruppen mit<br />
- den wesentlichen beschriebenen Produkten:<br />
- den e<strong>in</strong>zelnen Zielen:<br />
- den Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:<br />
(Die Kennzahlen und ggf. die Leistungsmengen sollen nach Arten und möglichst entsprechend der Zeitreihe nach<br />
§ 1 Abs. 3 GemHVO <strong>NRW</strong> gegliedert werden.)<br />
Personale<strong>in</strong>satz<br />
(Die Angaben zum e<strong>in</strong>gesetzten Personal - Auszug aus der Stellenübersicht nach § 8 GemHVO <strong>NRW</strong> - sollen nach<br />
Beschäftigungsverhältnissen gegliedert werden. Diese Abbildung kann durch Angaben <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Zeitreihe nach § 1<br />
Abs. 3 GemHVO <strong>NRW</strong> ergänzt werden.)<br />
Haushalts-<br />
positionen<br />
Teilergebnisplan<br />
Vor-<br />
vor-<br />
jahr<br />
Vor-<br />
jahr<br />
Haus-<br />
halts-<br />
jahr<br />
Plan-<br />
Jahr<br />
(Hj +1)<br />
Plan-<br />
Jahr<br />
(Hj +2)<br />
Plan-<br />
Jahr<br />
(Hj +3)<br />
(Der Teilergebnisplan muss die <strong>in</strong> § 2 vorgegebene M<strong>in</strong>destgliederung enthalten (vgl. Nr. 1.2.6 des Runderlasses<br />
vom 24.02.2005, SMBl. <strong>NRW</strong>. 6300).<br />
Haushalts-<br />
positionen<br />
Vor-<br />
vor-<br />
jahr<br />
Teilf<strong>in</strong>anzplan<br />
Vor-<br />
jahr<br />
Haus-<br />
halts-<br />
jahr<br />
Plan-<br />
Jahr<br />
(Hj +1)<br />
Plan-<br />
Jahr<br />
(Hj +2)<br />
Plan-<br />
Jahr<br />
(Hj +3)<br />
(Der Teilf<strong>in</strong>anzplan muss die <strong>in</strong> § 3 vorgegebene M<strong>in</strong>destgliederung enthalten (vgl. Nr. 1.2.7 des Runderlasses vom<br />
24.02.2005, SMBl. <strong>NRW</strong>. 6300).<br />
Bewirtschaftungsregelungen<br />
Erläuterungen<br />
zu den Haushaltspositionen<br />
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse<br />
2.1.4 Die Zeitreihe im Haushaltsplan<br />
Sonstiges:<br />
Sonstiges:<br />
Abbildung 44 „Inhalte der Teilpläne“<br />
Für den Teilergebnisplan:<br />
Für den Teilf<strong>in</strong>anzplan:<br />
Für den Teilergebnisplan:<br />
Für den Teilf<strong>in</strong>anzplan:<br />
Die haushaltspositionenscharfe Abbildung der Planung <strong>in</strong> den Teilplänen des Haushaltsplans nach § 4 GemHVO<br />
<strong>NRW</strong> soll die Transparenz erhöhen und zu konkreteren und damit zu realistischeren Prognosen zw<strong>in</strong>gen. Den<br />
GEMEINDEORDNUNG 305
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 79 GO <strong>NRW</strong><br />
Ansätzen für das Haushaltsjahr s<strong>in</strong>d dann zukunftsbezogen die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden<br />
drei Jahre anzufügen (vgl. Abbildung).<br />
Ergebnisplan<br />
oder<br />
F<strong>in</strong>anzplan<br />
Ergebnis<br />
des Vorvorjahres<br />
EUR<br />
Zeitreihe <strong>in</strong> der Haushaltsplanung<br />
Ansatz des<br />
Vor-<br />
jahres<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
des Haushaltsjahres<br />
EUR<br />
Planung<br />
Haushalts-<br />
jahr<br />
+ 1<br />
EUR<br />
Planung<br />
Haushalts-<br />
jahr<br />
+ 2<br />
EUR<br />
Planung<br />
Haushalts-<br />
jahr<br />
+ 3<br />
EUR<br />
Zeitreihe der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung<br />
Abbildung 45 „Zeitreihe <strong>in</strong> der Haushaltsplanung“<br />
Die E<strong>in</strong>beziehung der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung <strong>in</strong> den Haushaltsplan erfordert jedoch ke<strong>in</strong>e<br />
Änderung des Planungszeitraumes (vgl. § 84 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 1 Abs. 3 GemHVO <strong>NRW</strong>). Die Geme<strong>in</strong>de soll die<br />
mittelfristige Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em fünfjährigen Zeitraum vornehmen, <strong>in</strong> dessen Mittelpunkt das<br />
neue Haushaltsjahr steht. Der Haushaltsplan der Geme<strong>in</strong>de enthält <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Zeitreihe jedoch e<strong>in</strong> Jahr als die<br />
mittelfristige Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung.<br />
In dieser Zeitreihe s<strong>in</strong>d vergangenheitsbezogen die Ergebnisse der Rechnung des Vorvorjahres und die Haushaltspositionen<br />
des Vorjahres vor den für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen<br />
sowie E<strong>in</strong>zahlungen und Auszahlungen abzubilden. Auch die Planung der Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan<br />
und der E<strong>in</strong>zahlungen und Auszahlungen im F<strong>in</strong>anzplan wird <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er solchen Zeitreihe im Haushaltsplan<br />
abgebildet. Damit wird e<strong>in</strong> Überblick über die vergangenen zwei Haushaltsjahre, das aktuelle Haushaltsjahr und<br />
die folgenden drei Planjahre bezogen jeweils auf die gesamte Ergebnisplanung und auf die gesamte F<strong>in</strong>anzplanung<br />
gegeben.<br />
In den Sonderfällen e<strong>in</strong>er geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung für zwei Jahre (vgl. § 78 Abs. 3 S. 2 GO <strong>NRW</strong>) s<strong>in</strong>d<br />
die dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre an das letzte Haushaltsjahr des „Doppelhaushalts“ anzuhängen,<br />
so dass im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan e<strong>in</strong>e Zeitreihe von sieben Jahren abzubilden ist. E<strong>in</strong>e solche<br />
Zeitreihe entsteht auch bei der Pflicht der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong> Haushaltssicherungskonzept wegen der Überschreitung<br />
der Schwellenwerte nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO <strong>NRW</strong> aufstellen zu müssen, denn dann schließen sich die dem<br />
Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre an das letzte „Ursachenjahr“ an. In besonderen örtlichen Ausnahmefällen<br />
kann bei der Geme<strong>in</strong>de auch e<strong>in</strong>e Veranlassung für die Anwendung der beiden Erweiterung bestehen, so<br />
dass im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan e<strong>in</strong>e Zeitreihe von acht Jahren abzubilden ist.<br />
2.2 Zu Satz 2 (Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplans):<br />
2.2.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Nach der Vorschrift ist das Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 GO <strong>NRW</strong> e<strong>in</strong> Bestandteil des Haushaltsplans.<br />
Der Stellenplan für die Bediensteten der Geme<strong>in</strong>de ist Anlage des Haushaltsplans. Damit werden <strong>in</strong> Ergänzung<br />
des Haushaltsplans ausdrücklich wichtige und unverzichtbare haushaltswirtschaftliche Unterlagen der<br />
GEMEINDEORDNUNG 306
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 79 GO <strong>NRW</strong><br />
Geme<strong>in</strong>de verlangt, um ggf. e<strong>in</strong>e unzureichende haushaltswirtschaftliche Lage der Geme<strong>in</strong>de (Haushaltssicherungskonzept)<br />
aufzuzeigen und damit <strong>in</strong> jedem Haushaltsjahr die Personalausstattung der Geme<strong>in</strong>de (Stellenplan)<br />
offengelegt wird.<br />
2.2.2 Das Haushaltssicherungskonzept<br />
Nach § 76 GO <strong>NRW</strong> ist das Haushaltssicherungskonzept e<strong>in</strong> Bestandteil des Haushaltsplans, wenn e<strong>in</strong> solches<br />
erstellt werden muss (vgl. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO <strong>NRW</strong>). Das Haushaltssicherungskonzept erfährt durch die<br />
E<strong>in</strong>beziehung der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung <strong>in</strong> den Haushaltsplan e<strong>in</strong>e noch höhere Gewichtung,<br />
weil erste Ansätze der Umsetzung der vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen bereits <strong>in</strong> diesem Zeitraum<br />
aufgezeigt werden sollen. Auch wenn die Ursache für die Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes<br />
erst <strong>in</strong> den Folgejahren des Haushaltsjahres liegt, muss von Anfang an bzw. ab dem Haushaltsjahr versucht werden,<br />
den Ursachen entgegen zu wirken. Dann wird das Haushaltssicherungskonzept bereits für das Haushaltsjahr<br />
zu e<strong>in</strong>em gewichtigen und brauchbaren Bestandteil des neuen Haushaltsplans der Geme<strong>in</strong>de.<br />
Ziel und Zweck des Haushaltssicherungskonzeptes ist es, die Geme<strong>in</strong>de wieder <strong>in</strong> die Lage zu versetzen, ihre<br />
Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben auf Dauer gesichert ist<br />
(vgl. § 75 Abs. 1 S. 1 GO <strong>NRW</strong>). Nur unter dieser Prämisse und Mitnahme der Beschäftigten auf dem Weg zu<br />
diesem Ziel kann es gel<strong>in</strong>gen, die e<strong>in</strong>gefahrenen bzw. üblichen Wege zu verlassen und weitere Veränderungen,<br />
aber auch E<strong>in</strong>schnitte für die Betroffenen, vorzunehmen. Welche Konsolidierungsmaßnahmen und Konsolidierungsschritte<br />
im E<strong>in</strong>zelnen geeignet s<strong>in</strong>d, lässt sich nicht aufzählen, sondern muss im E<strong>in</strong>zelnen unter den örtlichen<br />
Bed<strong>in</strong>gungen ermittelt werden. Das geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssicherungskonzept sollte nicht mit der Feststellung<br />
enden „Das Ziel ist erreicht“. Vielmehr muss sich daran anschließen, wie nach der Umsetzung der „Sanierungsmaßnahmen“<br />
der geme<strong>in</strong>dliche Haushalt so gesteuert werden soll, dass er auch <strong>in</strong> Zukunft dauerhaft ausgeglichen<br />
se<strong>in</strong> wird.<br />
Die Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes gehört nach § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO <strong>NRW</strong> zu den<br />
Angelegenheiten, für die der Rat der Geme<strong>in</strong>de ausschließlich zuständig ist und die er nicht auf andere Entscheidungsträger<br />
übertragen kann. Diese orig<strong>in</strong>äre Zuständigkeit des Rates führt zu e<strong>in</strong>er stärkeren Selbstb<strong>in</strong>dung der<br />
Geme<strong>in</strong>de an ihr Haushaltssicherungskonzept und die vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen. Dies soll die<br />
Zielbestimmung erleichtern und die Umsetzung sowie ihre Überwachung (Controll<strong>in</strong>g) gewährleisten. Soweit das<br />
Haushaltssicherungskonzept an die Jährlichkeit des Haushalts anknüpft, enthält es gleichwohl – wie der Haushaltsplan<br />
auch – e<strong>in</strong>e mehrjährige, mittelfristige Planung. Die Jährlichkeit, die dadurch zum Ausdruck kommt,<br />
dass das Haushaltssicherungskonzept nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO <strong>NRW</strong> e<strong>in</strong> Bestandteil des jährlichen<br />
Haushaltsplans ist, erfordert, das umzusetzende Haushaltssicherungskonzept unter Berücksichtigung der tatsächlichen<br />
jährlichen Haushaltsentwicklung und unter E<strong>in</strong>haltung der Zielsetzung fortzuschreiben.<br />
2.2.3 Anlagen zum Haushaltsplan<br />
Dem Rat der Geme<strong>in</strong>de muss e<strong>in</strong>e Gesamtübersicht über Inhalt und Umfang der jährlichen Haushaltswirtschaft<br />
ermöglicht werden. Deshalb müssen ihm neben der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan auch weitere<br />
haushaltswirtschaftliche Unterlagen zur Beratung und Entscheidung über den Entwurf vorgelegt werden (vgl. § 1<br />
Abs. 2 GemHVO <strong>NRW</strong>). Die nachfolgend <strong>in</strong> allgeme<strong>in</strong>er Form vorgestellten Unterlagen s<strong>in</strong>d für e<strong>in</strong>e Gesamtübersicht<br />
über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de im Zeitpunkt der Haushaltsplanung<br />
unverzichtbar. Sie müssen außerdem zusammen mit dem Haushaltsplan auch für e<strong>in</strong>e Unterrichtung der<br />
Bürger und der Aufsichtsbehörde der Geme<strong>in</strong>de geeignet se<strong>in</strong>. Den Geme<strong>in</strong>den bleibt es aber freigestellt, nach<br />
örtlichen Bedürfnissen dem Haushaltsplan noch weitere oder detailliertere Unterlagen beizufügen.<br />
GEMEINDEORDNUNG 307
2.2.3.1 Der Vorbericht<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 79 GO <strong>NRW</strong><br />
Nach der Vorschrift des § 7 GemHVO <strong>NRW</strong> soll der Vorbericht zum Haushaltsplan e<strong>in</strong>en Überblick über die Eckpunkte<br />
des Haushaltsplans geben und die Entwicklung und die aktuelle Lage der Geme<strong>in</strong>de s<strong>in</strong>d anhand der im<br />
Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzdaten darzustellen. Außerdem s<strong>in</strong>d im<br />
Vorbericht die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie<br />
die Rahmenbed<strong>in</strong>gungen der Planung zu erläutern. Dazu gehört, dass <strong>in</strong> die der Haushaltssatzung getroffenen<br />
Festsetzungen erläutert und <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en Zusammenhang mit dem haushaltswirtschaftlichen Handeln der Geme<strong>in</strong>de<br />
gestellt werden.<br />
2.2.3.2 Der Stellenplan<br />
Der Stellenplan der Geme<strong>in</strong>de stellt die Grundlage für die Personalwirtschaft der Geme<strong>in</strong>de dar und muss deshalb<br />
ausweisen, wie viele Beschäftigte für die Aufgabenerfüllung der Geme<strong>in</strong>de benötigt werden. Bei der Aufstellung<br />
und Gestaltung des Stellenplans s<strong>in</strong>d die besoldungs- und tarifrechtlichen Bestimmungen zu beachten. Dazu<br />
gehört, dass bei der Besetzung der Stellen die künftigen Stellen<strong>in</strong>haber als Bedienste der Geme<strong>in</strong>de die für ihren<br />
Arbeitsbereich erforderlichen fachlichen Voraussetzungen erfüllen müssen (vgl. § 74 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>). Der Stellenplan<br />
gibt daher e<strong>in</strong> Bild über die Personalausstattung der Geme<strong>in</strong>de ab. Die Vorgabe <strong>in</strong> § 74 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>,<br />
der Stellenplan ist e<strong>in</strong>zuhalten, umfasst die Verpflichtung der Geme<strong>in</strong>de, e<strong>in</strong>en Stellenplan aufzustellen, auch<br />
wenn diese Verpflichtung nicht wörtlich <strong>in</strong> der Vorschrift der Geme<strong>in</strong>deordnung enthalten ist.<br />
2.2.3.3 Die Bilanz des Vorvorjahres<br />
Während der Ergebnisplan und der F<strong>in</strong>anzplan die für das Haushaltsjahr laufenden Ressourcen- und Geldströme<br />
abbilden, gibt die Bilanz als Bestandteil des Jahresabschlusses Auskunft über das gesamte zu e<strong>in</strong>em Stichtag<br />
vorhandene Vermögen und die Schulden der Geme<strong>in</strong>de („Wertespeicher“) sowie deren Struktur. Wegen dieser<br />
Funktionen ist dem Haushaltsplan die Bilanz beizufügen, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans<br />
(Beschlussfassung) zur Verfügung steht. Die Erstellung e<strong>in</strong>er Planbilanz wird h<strong>in</strong>gegen regelmäßig nicht für erforderlich<br />
gehalten.<br />
2.2.3.4 Die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen<br />
Die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, die erkennen lassen muss, <strong>in</strong> welcher Höhe aus der Inanspruchnahme<br />
von Verpflichtungsermächtigungen <strong>in</strong> den späteren Jahren voraussichtlich Auszahlungen erwachsen<br />
werden und auf welche Jahre sich diese verteilen, ist dem Haushaltsplan beizufügen. Von der Geme<strong>in</strong>de<br />
dürfen Verpflichtungsermächtigungen <strong>in</strong> der Regel zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre oder <strong>in</strong><br />
besonderen Fällen bis zum Abschluss e<strong>in</strong>er Maßnahme veranschlagt werden (vgl. § 13 Abs. 1 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
Durch die Übersicht soll deshalb aufgezeigt werden wie die künftigen Haushaltsjahre bereits vorbelastet s<strong>in</strong>d, weil<br />
<strong>in</strong> den Vorjahren im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <strong>in</strong> Anspruch<br />
genommen worden s<strong>in</strong>d.<br />
2.2.3.5 Die Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen<br />
Nach der Vorschrift des § 56 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong> gewährt die Geme<strong>in</strong>de den Fraktionen und Gruppen im Rat und <strong>in</strong><br />
den Bezirksvertretungen sowie auch e<strong>in</strong>zelnen Ratsmitgliedern aus ihren Haushaltsmitteln im notwendigen Umfang<br />
jährlich Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Die<br />
Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen oder e<strong>in</strong>zelnen Ratsmitgliedern s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er besonderen Anlage zum<br />
GEMEINDEORDNUNG 308
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 79 GO <strong>NRW</strong><br />
Haushaltsplan darzustellen. In dieser Übersicht über die gewährten Zuwendungen s<strong>in</strong>d für jede Fraktion, Gruppe<br />
oder für das e<strong>in</strong>zelne Ratsmitglied die Geldleistungen und die geldwerten Leistungen jeweils getrennt vone<strong>in</strong>ander<br />
anzugeben. Damit wird die F<strong>in</strong>anzierung der freiwilligen Vere<strong>in</strong>igungen von Mitgliedern des Rates und der<br />
Bezirksvertretungen sowie wie e<strong>in</strong>zelner Ratsmitglieder transparent gemacht.<br />
2.2.3.6 Die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verb<strong>in</strong>dlichkeiten<br />
Den Verb<strong>in</strong>dlichkeiten kommt e<strong>in</strong>e große Bedeutung für die kommunale Haushaltswirtschaft zu, so dass auf e<strong>in</strong>e<br />
gesonderte und aktuelle Darstellung zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans nicht verzichtet werden<br />
kann. Um die mögliche Entwicklung der Verb<strong>in</strong>dlichkeiten aufzuzeigen, ist dem Haushaltsplan e<strong>in</strong>e Übersicht als<br />
Anlage beizufügen. In dieser Übersicht s<strong>in</strong>d der Stand der Verb<strong>in</strong>dlichkeiten am Ende des Vorvorjahres des<br />
Haushaltsjahres sowie der voraussichtliche Stand zu Beg<strong>in</strong>n und zum Ende des Haushaltsjahres <strong>in</strong> der Gliederung<br />
des Verb<strong>in</strong>dlichkeitenspiegels nach § 47 GemHVO <strong>NRW</strong> aufzuzeigen.<br />
2.2.3.7 Die Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<br />
Der Eigenkapitalausstattung der Geme<strong>in</strong>de kommt e<strong>in</strong>e besondere Bedeutung zu. Da das Eigenkapital auch<br />
Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich hat und die mittelfristige Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung <strong>in</strong> den Haushaltsplan<br />
e<strong>in</strong>bezogen wurde, ist es wegen des Budgetrechtes des Rates geboten, die voraussichtliche Entwicklung<br />
des Eigenkapitals aufzuzeigen, wenn <strong>in</strong> der Haushaltssatzung e<strong>in</strong>e Festsetzung nach § 78 Abs. 2 Nr. 2 GO<br />
<strong>NRW</strong> enthalten ist. In e<strong>in</strong>er gesonderten Anlage zum Haushaltsplan ist bei e<strong>in</strong>er Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage<br />
und/oder der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage die Entwicklung des Eigenkapitals <strong>in</strong>nerhalb der mittelfristigen<br />
Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung darzustellen. Mit der Vorlage des Haushaltsplans werden damit dem Rat die<br />
notwendigen Informationen darüber gegeben.<br />
2.2.3.8 Unterlagen über die Sondervermögen<br />
Die Übersicht über die wirtschaftliche Lage der Geme<strong>in</strong>de und ihre Entwicklung ist nicht vollständig, wenn nicht<br />
auch Unterlagen über die Sondervermögen der Geme<strong>in</strong>de für die Haushaltsplanberatungen dem Rat vorgelegt<br />
werden, soweit diese nicht im Haushaltsplan der Geme<strong>in</strong>de enthalten s<strong>in</strong>d. Zu den Sondervermögen der Geme<strong>in</strong>de<br />
gehören nach § 97 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> zwar das Geme<strong>in</strong>degliedervermögen, das Vermögen der rechtlich<br />
unselbstständigen örtlichen Stiftungen, wirtschaftliche Unternehmen (§ 114 GO <strong>NRW</strong>) und organisatorisch verselbstständigte<br />
E<strong>in</strong>richtungen (§ 107 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>) ohne eigene Rechtspersönlichkeit sowie rechtlich unselbstständige<br />
Versorgungs- und Versicherungse<strong>in</strong>richtungen.<br />
Dem geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan müssen jedoch nur von den Sondervermögen der Geme<strong>in</strong>de gesonderte<br />
Unterlagen beigefügt werden, die auch über e<strong>in</strong>en eigenen Rechnungskreis verfügen. Dazu zählen die wirtschaftlichen<br />
Unternehmen (§ 114 GO <strong>NRW</strong>) und die organisatorisch verselbstständigten E<strong>in</strong>richtungen (§ 107 Abs. 2<br />
GO <strong>NRW</strong>) ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Auch wenn für rechtlich unselbstständige Versorgungs- und Versicherungse<strong>in</strong>richtungen,<br />
z.B. eigene Zusatzversorgungskassen oder Eigenunfallversicherungen, besondere<br />
Haushaltspläne aufgestellt werden (vgl. § 97 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong>) und dafür e<strong>in</strong> eigener Rechnungskreis gebildet<br />
wird, s<strong>in</strong>d die Unterlagen über diese E<strong>in</strong>richtungen dem geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan beizufügen.<br />
2.2.3.9 Unterlagen über die Unternehmen und E<strong>in</strong>richtungen<br />
Die Gesamtübersicht über die wirtschaftliche Lage der Geme<strong>in</strong>de und ihre Entwicklung soll dadurch verbessert<br />
werden, dass nach § 108 Abs. 2 S. 2 GO <strong>NRW</strong> der Jahresabschluss, der Lagebericht und der Bericht über die<br />
GEMEINDEORDNUNG 309
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 79 GO <strong>NRW</strong><br />
E<strong>in</strong>haltung der öffentlichen Zwecksetzung von Unternehmen und E<strong>in</strong>richtungen (geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe) <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
Rechtsform des privaten Rechts dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen s<strong>in</strong>d. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung<br />
für das neue Haushaltsjahr s<strong>in</strong>d i.d.R. jedoch nur Jahresabschlussunterlagen der Unternehmen<br />
und E<strong>in</strong>richtungen aus dem Vorvorjahr des Haushaltsjahres verfügbar, denn wie bei der Geme<strong>in</strong>de das Haushaltsjahr<br />
ist bei den Unternehmen und E<strong>in</strong>richtungen das Wirtschaftjahr noch nicht abgeschlossen.<br />
Die Geme<strong>in</strong>de muss bei ihrer Haushaltsplanung der notwendigen Aktualität <strong>in</strong> ausreichendem Maße Rechnung<br />
tragen. Daher lässt diese Vorschrift e<strong>in</strong>e Vere<strong>in</strong>fachung h<strong>in</strong>sichtlich der Wirtschaftspläne e<strong>in</strong>zelner Unternehmen<br />
und E<strong>in</strong>richtungen zu. Es wird im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>e Beurteilung der wirtschaftlichen Gegebenheiten als ausreichend<br />
angesehen, dem Haushaltsplan als Anlage e<strong>in</strong>e Gesamtübersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche<br />
Entwicklung der geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe beizufügen, um die Aufstellung des neuen Haushalts der Geme<strong>in</strong>de<br />
zeitlich nicht zu verzögern.<br />
2.2.3.10 Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben<br />
In den kreisfreien Städten müssen dem Haushaltsplan auch bezirksbezogene Angaben beigefügt werden. Dieses<br />
ist Ausfluss der entsprechenden Regelung <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>deordnung, die der Bezirksvertretung eigene Rechte<br />
e<strong>in</strong>räumt (vgl. § 37 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong>). So entscheiden die Bezirksvertretungen unter Beachtung der Belange der<br />
gesamten Stadt und im Rahmen der vom Rat erlassenen allgeme<strong>in</strong>en Richtl<strong>in</strong>ien <strong>in</strong> allen Angelegenheiten, deren<br />
Bedeutung nicht wesentlich über den Stadtbezirk h<strong>in</strong>ausgeht. Die Bezirksvertretungen erfüllen die ihnen zugewiesenen<br />
Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel und sollen dabei über den Verwendungszweck<br />
e<strong>in</strong>es Teils dieser Haushaltsmittel alle<strong>in</strong> entscheiden können. Außerdem beraten die Bezirksvertretungen<br />
über alle Haushaltspositionen, die sich auf ihren Bezirk und ihre Aufgaben auswirken, und können dazu<br />
Vorschläge machen und Anregungen geben. Dafür ist den Bezirksvertretungen e<strong>in</strong>e geeignete Übersicht als<br />
Auszug aus dem Entwurf der Haushaltssatzung nach § 80, getrennt nach Bezirken, zur Beratung vorzulegen. Die<br />
Übersichten s<strong>in</strong>d dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.<br />
2.2.3.11 Gesamtübersicht über die haushaltwirtschaftlichen Unterlagen<br />
Die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung mit ihren Unterlagen ist nur beschlussfähig, wenn sie alle gesetzlich vorgesehen<br />
und erforderlichen Regelungen enthält und dem Rat der Geme<strong>in</strong>de alle vorgeschriebenen Unterlagen<br />
vorliegen. Die nachfolgende Übersicht soll e<strong>in</strong>en Überblick über die Unterlagen zur Haushaltsplanung der Geme<strong>in</strong>de<br />
geben (Abbildung).<br />
Haushaltssatzung<br />
Ergebnisplan<br />
F<strong>in</strong>anzplan<br />
Übersicht über die haushaltwirtschaftlichen Unterlagen<br />
Haushaltssatzung<br />
Bestandteile des Haushaltsplans<br />
GEMEINDEORDNUNG 310<br />
§ 78 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. Nr. 1.1.1 des<br />
Runderlasses vom 24.02.2005<br />
§ 79 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 1 Abs. 1<br />
Nr. 1 und § 2 GemHVO <strong>NRW</strong> sowie<br />
Nr. 1.2.1 des Runderlasses vom<br />
24.02.2005<br />
§ 79 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 1 Abs. 1<br />
Nr. 2 und § 3 GemHVO <strong>NRW</strong> sowie
Teilpläne<br />
Ggf. Haushaltssicherungskonzept<br />
Vorbericht<br />
Stellenplan<br />
Bilanz des Vorvorjahres<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 79 GO <strong>NRW</strong><br />
Anlagen zum Haushaltsplan<br />
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen<br />
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen<br />
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verb<strong>in</strong>dlichkeiten<br />
zu Beg<strong>in</strong>n des Haushaltsjahres<br />
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals, wenn<br />
e<strong>in</strong>e Festsetzung nach § 78 Abs. 2 Nr. 2 der GO <strong>NRW</strong><br />
Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der<br />
Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt<br />
werden<br />
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche<br />
Entwicklung der Unternehmen und E<strong>in</strong>richtungen mit<br />
den neuesten Jahresabschlüssen der Unternehmen und<br />
E<strong>in</strong>richtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen<br />
die Geme<strong>in</strong>de mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist<br />
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben (<strong>in</strong><br />
kreisfreien Städten)<br />
Nr. 1.2.2 des Runderlasses vom<br />
24.02.2005<br />
§ 79 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 1 Abs. 1<br />
Nr. 3 und § 4 GemHVO <strong>NRW</strong> sowie<br />
den Nrn. 1.2.3 bis Nr. 1.2.7 des Runderlasses<br />
vom 24.02.2005<br />
§§ 75 und 76 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 5<br />
GemHVO <strong>NRW</strong> i.V.m. dem Runderlass<br />
vom 09.06.2006<br />
§ 1 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 7 GemHVO<br />
<strong>NRW</strong><br />
§ 79 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 1 Abs. 2<br />
Nr. 2 und § 8 GemHVO <strong>NRW</strong> sowie<br />
Nr. 1.3 des Runderlasses vom<br />
24.02.2005<br />
§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 85 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr. 4<br />
und § 13 GemHVO <strong>NRW</strong> sowie Nr.<br />
1.4.3 des Runderlasses vom<br />
24.02.2005<br />
§ 56 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 1 Abs. 2<br />
Nr. 5 GemHVO <strong>NRW</strong> sowie Nr. 1.4.1<br />
des Runderlasses vom 24.02.2005<br />
§ 91 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 1 Abs. 2<br />
Nr. 6 GemHVO <strong>NRW</strong> sowie Nr. 1.4.2<br />
des Runderlasses vom 24.02.2005<br />
§ 78 Abs. 2 Nr. 2 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 1<br />
Abs. 2 Nr. 7 und § 41 Abs. 4 Nr. 1<br />
GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§§ 97 und 114 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 1<br />
Abs. 2 Nr. 8 GemHVO <strong>NRW</strong> sowie<br />
weitere e<strong>in</strong>schlägige Rechtsvorschriften<br />
§ 108 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr. 9<br />
GemHVO <strong>NRW</strong> sowie weitere e<strong>in</strong>schlägige<br />
Rechtsvorschriften<br />
§ 37 Abs. 3 und 4 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 1<br />
Abs. 2 Nr. 10 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
Abbildung 46 „Haushaltswirtschaftliche Unterlagen der Geme<strong>in</strong>de“<br />
GEMEINDEORDNUNG 311
3. Zu Absatz 3 (Wirkungen des Haushaltsplans):<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 79 GO <strong>NRW</strong><br />
3.1 Zu Satz 1 (Grundlage der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft):<br />
Die wichtigste Funktion des Haushaltsplans ist nach wie vor die Festlegung der sachlichen Ermächtigungen durch<br />
den Rat. Sie wird dadurch aufgezeigt, dass neben dem Ergebnisplan (vgl. § 2 GemHVO <strong>NRW</strong>) und dem F<strong>in</strong>anzplan<br />
(vgl. § 3 GemHVO <strong>NRW</strong>) auch produktorientiert gegliederte und steuerungsrelevante Teilpläne bestehen<br />
(vgl. § 4 GemHVO <strong>NRW</strong>). Die Teilpläne des geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplans enthalten <strong>in</strong> den Teilergebnisplänen<br />
produktbezogene Erträge und Aufwendungen und <strong>in</strong> den Teilf<strong>in</strong>anzplänen die E<strong>in</strong>zahlungen und Auszahlungen<br />
e<strong>in</strong>schließlich aller Investitionsvorhaben, ggf. auch maßnahmenscharf.<br />
Die Integration der Leistungsvorgaben (Outputorientierung) <strong>in</strong> das System der Steuerung und Rechenschaft führt<br />
zu weiteren <strong>in</strong>haltlichen Abbildungen <strong>in</strong> den Teilplänen des Haushaltsplans als Planungs<strong>in</strong>strumente der Geme<strong>in</strong>de.<br />
Die Festlegungen von Zielen für das haushaltswirtschaftliche Handeln der Geme<strong>in</strong>de und von Messgrößen<br />
für die Zielerreichung s<strong>in</strong>d dabei e<strong>in</strong> wichtiger Bestandteil des neuen Haushaltsplans (vgl. § 12 GemHVO<br />
<strong>NRW</strong>). Die nähere Ausgestaltung von Zielen und Leistungskennzahlen bleibt aber der Geme<strong>in</strong>de überlassen.<br />
Damit bleibt der Haushaltsplan die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de.<br />
3.2 Zu Satz 2 (Verb<strong>in</strong>dlichkeit für die Haushaltsausführung):<br />
3.2.1 Ausprägungen der Verb<strong>in</strong>dlichkeit<br />
Der geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsplan ist nach Maßgabe der Geme<strong>in</strong>deordnung und der auf Grund dieses Gesetzes<br />
erlassenen Geme<strong>in</strong>dehaushaltsverordnung für die Haushaltsführung der Geme<strong>in</strong>de verb<strong>in</strong>dlich. Er b<strong>in</strong>det daher<br />
die Dienststellen der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung bei ihrer Verwaltungstätigkeit an die im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan<br />
veranschlagten Haushaltspositionen, vergleichbar der B<strong>in</strong>dung der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung an andere<br />
Rechtsvorschriften. Die B<strong>in</strong>dung der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung im Rahmen der Ausführung der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltswirtschaft ist so bedeutend, dass die Geme<strong>in</strong>dehaushaltsverordnung ausdrückliche gesonderte Vorgaben<br />
enthält.<br />
Für das f<strong>in</strong>anzwirtschaftliche Handeln entsteht für die geme<strong>in</strong>dliche Verwaltung daher z.B. die Pflicht, die im<br />
Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen erst dann <strong>in</strong> Anspruch zu nehmen, wenn die Aufgabenerfüllung dies<br />
erfordert und die Inanspruchnahme zu überwachen (vgl. § 23 Abs. 1 GemHVO <strong>NRW</strong>). Auf Grund des Haushaltsplans<br />
der Geme<strong>in</strong>de hat die geme<strong>in</strong>dliche Verwaltung aber auch die Aufgabe, durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen,<br />
dass Ansprüche der Geme<strong>in</strong>de vollständig erfasst, rechtzeitig geltend gemacht und e<strong>in</strong>gezogen<br />
und Verpflichtungen der Geme<strong>in</strong>de erst bei Fälligkeit erfüllt werden (vgl. § 23 Abs. 3 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
Im Rahmen der haushaltsrechtlichen Vorschriften s<strong>in</strong>d aber auch Abweichungen von den Vorgaben der vom Rat<br />
der Geme<strong>in</strong>de beschlossenen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen, also auch von den im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan<br />
veranschlagten Ermächtigungen zulässig, z.B. überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen<br />
und Auszahlungen (vgl. § 83 GO <strong>NRW</strong>) oder Ermächtigungsübertragungen <strong>in</strong>s folgende Haushaltsjahr (vgl. § 22<br />
GemHVO <strong>NRW</strong>). In den Fällen aber, <strong>in</strong> denen unzulässigerweise von den haushaltsmäßigen Vorgaben abgewichen<br />
oder für e<strong>in</strong>e Maßnahme ggf. ke<strong>in</strong>e Ermächtigung im Hausplan enthalten ist, wird das Budgetrecht des<br />
Rates verletzt und es s<strong>in</strong>d die daraus notwendigen Konsequenzen zu ziehen.<br />
3.2.2 B<strong>in</strong>dungen im Rahmen der Haushaltsplanung<br />
Der geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsplan ist nach Maßgabe der Geme<strong>in</strong>deordnung und der auf Grund dieses Gesetzes<br />
erlassenen Geme<strong>in</strong>dehaushaltsverordnung für die Haushaltsführung der Geme<strong>in</strong>de verb<strong>in</strong>dlich. Bei der Veranschlagung<br />
im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan ist daher auch der Grundsatz der Spezialität der Veranschlagung zu<br />
GEMEINDEORDNUNG 312
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 79 GO <strong>NRW</strong><br />
beachten, der durch die Vorschriften <strong>in</strong> den §§ 2, 3, 4 und 11 GemHVO <strong>NRW</strong> näher ausgefüllt wird. Dem Grundsatz<br />
der sachlichen B<strong>in</strong>dung muss mit Beachtung der aufgeführten Vorschriften ebenfalls Genüge getan werden.<br />
Daher müssen auch die E<strong>in</strong>zelpositionen im Haushaltsplan nach Summe und Zweckbestimmung h<strong>in</strong>reichend<br />
bestimmt se<strong>in</strong>.<br />
Mit Beschluss des Rates über die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung nach § 80 Abs. 4 i.V.m. § 41 Abs. 1 Buchstabe<br />
h) GO <strong>NRW</strong> tritt dann e<strong>in</strong>e wirksame B<strong>in</strong>dung der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung an den Willen des Rates <strong>in</strong> der<br />
Form des im Rahmen der Haushaltssatzung bestehenden geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplans e<strong>in</strong>. Die weitere Ausführung<br />
des geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplans wird durch e<strong>in</strong>e Vielzahl von Vorschriften von rechtlichen Maßgaben<br />
bestimmt, die sich auch auf die Ausführung des geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplans auswirken (vgl. Abbildung).<br />
§ 75<br />
§ 79<br />
§ 82<br />
§ 84<br />
§ 85<br />
§ 1<br />
§ 2<br />
§ 3<br />
§ 4<br />
§ 6<br />
§ 7<br />
§ 8<br />
§ 9<br />
§ 10<br />
§ 11<br />
§ 12<br />
Maßgaben für den geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan<br />
Geme<strong>in</strong>deordnung<br />
Allgeme<strong>in</strong>e Haushaltsgrundsätze<br />
Gestaltung des geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplans<br />
Vorgaben für die vorläufige Haushaltsführung<br />
E<strong>in</strong>beziehung der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung<br />
Ausweis von Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen<br />
Geme<strong>in</strong>dehaushaltsverordnung<br />
Bestandteile und Anlagen des geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplans<br />
Inhalt und Gliederung des Ergebnisplans<br />
Inhalt und Gliederung des F<strong>in</strong>anzplans<br />
Inhalt und Gliederung der Teilpläne<br />
Mittelfristige Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung“,<br />
Pflicht zur Erstellung e<strong>in</strong>es Vorberichtes<br />
Inhalt und Gliederung des Stellenplans<br />
Vorgaben für den Haushaltsplan für zwei Jahre<br />
Vorgaben für den Nachtragshaushaltsplan<br />
Allgeme<strong>in</strong>e Planungsgrundsätze<br />
GEMEINDEORDNUNG 313<br />
Pflicht zur Angabe von Zielen und Kennzahlen zur Zielerreichung
§ 13<br />
§ 14<br />
§ 15<br />
§ 16<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 79 GO <strong>NRW</strong><br />
Ausweis von Verpflichtungsermächtigungen<br />
Vorgaben für die Veranschlagung von Investitionen<br />
Veranschlagung der Verfügungsmittel des Bürgermeisters<br />
Umgang mit fremden F<strong>in</strong>anzmitteln<br />
Abbildung 47 „Maßgaben für den geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan“<br />
In diesem Zusammenhang kann ggf. vor Ort wegen des fehlenden In-Kraft-Tretens der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung<br />
e<strong>in</strong>e Übergangszeit bestehen, <strong>in</strong> der e<strong>in</strong>hergehend mit der gesetzlich bestimmten vorläufigen Haushaltsführung<br />
nach § 82 GO <strong>NRW</strong> der geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsplans nicht <strong>in</strong> vollem Umfang ausgeführt werden darf.<br />
Für die Übergangszeit bzw. die „haushaltslose Zeit“, die im E<strong>in</strong>zelfall auch das gesamte Haushaltsjahr umfassen<br />
kann, hat der Kämmerer bzw. der Bürgermeister die notwendigen e<strong>in</strong>schränkenden Bewirtschaftungsregelungen<br />
auf der Basis der aufgestellten Haushaltssatzung mit ihren Anlagen <strong>in</strong> schriftlicher Form zu treffen. Die vorläufige<br />
Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln muss dabei so gestaltet werden, dass dem Ziel und Zweck der vorläufigen<br />
Haushaltsführung unter Beachtung der gesetzlichen Vorschrift Genüge getan wird und auch das In-Kraft-Treten<br />
der Haushaltssatzung schnellstmöglich erreicht wird.<br />
3.3 Zu Satz 3 (Haushaltsplan und Ansprüche und Verb<strong>in</strong>dlichkeiten):<br />
Nach der Vorschrift begründet der geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsplan als gesondertes Werk der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung<br />
ke<strong>in</strong>e Ansprüche und Verb<strong>in</strong>dlichkeiten Dritter gegenüber der Geme<strong>in</strong>de. Auch werden durch den<br />
Haushaltsplan der Geme<strong>in</strong>de ke<strong>in</strong>e Ansprüche und Verb<strong>in</strong>dlichkeiten Dritter gegenüber der Geme<strong>in</strong>de aufgehoben.<br />
Damit wird ausdrücklich klargestellt, dass der Haushaltsplan der Geme<strong>in</strong>de über die durch ihn bestehende<br />
Verb<strong>in</strong>dlichkeit für die geme<strong>in</strong>dliche Verwaltung (vgl. § 78 Abs. 3 S. 2 GO <strong>NRW</strong>) h<strong>in</strong>aus ke<strong>in</strong>e weitere Dritt- bzw.<br />
Außenwirkung entfaltet.<br />
H<strong>in</strong>sichtlich der rechtlichen Wirkung ist der geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsplan damit auf die f<strong>in</strong>anzwirtschaftlichen<br />
Rechtsbeziehungen zwischen den Organen der Geme<strong>in</strong>de beschränkt. So kann sich e<strong>in</strong> Dritter nicht auf e<strong>in</strong>e<br />
Haushaltsposition im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan berufen, wenn diese z.B. höhere Z<strong>in</strong>saufwendungen vorsieht<br />
als im Rahmen e<strong>in</strong>es Kreditvertrages vere<strong>in</strong>bart wurde. Aber auch die Geme<strong>in</strong>de kann auf Grund e<strong>in</strong>er Veranschlagung<br />
<strong>in</strong> ihrem Haushaltsplan ke<strong>in</strong>e Z<strong>in</strong>szahlungen verweigern, wenn die entsprechende Haushaltsposition<br />
weniger Z<strong>in</strong>saufwendungen ausweist als es der tatsächlichen Verpflichtung der Geme<strong>in</strong>de entspricht. Die Vorschrift<br />
steht daher <strong>in</strong> unmittelbarem Zusammenhang mit der Bestimmung, dass der geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsplan<br />
alle für das Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Geme<strong>in</strong>de voraussichtlich anfallenden Erträge und<br />
e<strong>in</strong>gehenden E<strong>in</strong>zahlungen sowie die voraussichtlich entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen<br />
zu enthalten hat (vgl. § 78 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 GO <strong>NRW</strong>).<br />
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ<br />
GEMEINDEORDNUNG 314
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 80 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 80<br />
Erlass der Haushaltssatzung<br />
(1) Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird vom Kämmerer aufgestellt und dem Bürgermeister<br />
zur Bestätigung vorgelegt.<br />
(2) 1 Der Bürgermeister leitet den von ihm bestätigten Entwurf dem Rat zu. 2 Soweit er von dem ihm vorgelegten<br />
Entwurf abweicht, kann der Kämmerer dazu e<strong>in</strong>e Stellungnahme abgeben. 3 Wird von diesem Recht Gebrauch<br />
gemacht, hat der Bürgermeister die Stellungnahme mit dem Entwurf dem Rat vorzulegen.<br />
(3) 1 Nach Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen an den Rat ist dieser unverzüglich<br />
bekannt zu geben und während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat zur E<strong>in</strong>sichtnahme verfügbar zu halten.<br />
2 In der öffentlichen Bekanntgabe ist e<strong>in</strong>e Frist von m<strong>in</strong>destens vierzehn Tagen festzulegen, <strong>in</strong> der E<strong>in</strong>wohner<br />
oder Abgabepflichtige gegen den Entwurf E<strong>in</strong>wendungen erheben können und die Stelle anzugeben, bei der die<br />
E<strong>in</strong>wendungen zu erheben s<strong>in</strong>d. 3 Die Frist für die Erhebung von E<strong>in</strong>wendungen ist so festzusetzen, dass der Rat<br />
vor der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen <strong>in</strong> öffentlicher Sitzung darüber beschließen<br />
kann.<br />
(4) 1 Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist vom Rat <strong>in</strong> öffentlicher Sitzung zu beraten und zu<br />
beschließen. 2 In der Beratung des Rates kann der Kämmerer se<strong>in</strong>e abweichende Auffassung vertreten.<br />
(5) 1 Die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. 2 Die<br />
Anzeige soll spätestens e<strong>in</strong>en Monat vor Beg<strong>in</strong>n des Haushaltsjahres erfolgen. 3 Die Haushaltssatzung darf frühestens<br />
e<strong>in</strong>en Monat nach der Anzeige bei der Aufsichtsbehörde öffentlich bekannt gemacht werden. 4 Die Aufsichtsbehörde<br />
kann im E<strong>in</strong>zelfall aus besonderem Grund die Anzeigefrist verkürzen oder verlängern. 5 Ist e<strong>in</strong><br />
Haushaltssicherungskonzept nach § 76 aufzustellen, so darf die Haushaltssatzung erst nach Erteilung der Genehmigung<br />
bekannt gemacht werden.<br />
(6) Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung bis zum Ende<br />
der <strong>in</strong> § 96 Abs. 2 benannten Frist zur E<strong>in</strong>sichtnahme verfügbar zu halten.<br />
Erläuterungen zu § 80:<br />
I. Allgeme<strong>in</strong>es<br />
1. Erlass der Haushaltssatzung<br />
1.1 Verfahrenszwecke<br />
Die Vorschriften über das Aufstellungsverfahren des Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen durch den<br />
Kämmerer und den Bürgermeister s<strong>in</strong>d bei der E<strong>in</strong>führung des NKF bürgerfreundlicher gestaltet worden. Entsprechend<br />
der besonderen Bedeutung der Haushaltssatzung für die geme<strong>in</strong>dliche Aufgabenerfüllung und der Ausführung<br />
des Haushaltsplans im Laufe des Haushaltsjahres hat, soll möglichst e<strong>in</strong>e weitgehende bürgerschaftliche<br />
Mitwirkung beim Zustandekommen und der Beschlussfassung des Rates über die Haushaltsplanung der Geme<strong>in</strong>de<br />
für das Haushaltsjahr und die drei folgenden Planungsjahre sichergestellt werden.<br />
Diese Zielsetzung erfordert, nicht nur den Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen den E<strong>in</strong>wohnern und<br />
Abgabepflichtigen zur Kenntnis zu br<strong>in</strong>gen, sondern auch, die Haushaltssatzung im Anschluss an ihre öffentliche<br />
Bekanntmachung bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses des gleichen Haushaltsjahres (vgl. § 96<br />
GEMEINDEORDNUNG 315
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 80 GO <strong>NRW</strong><br />
Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>) zur E<strong>in</strong>sichtnahme verfügbar zu halten. Dadurch werden auch die notwendigen Abweichungen<br />
von der ursprünglichen Haushaltsplanung für die Öffentlichkeit nachvollziehbarer gemacht.<br />
1.2 Verfahrensschritte<br />
Die Geme<strong>in</strong>deordnung gibt für den Erlass der jährlichen Haushaltssatzung den Geme<strong>in</strong>den mehrere Verfahrensschritte<br />
vor, bei denen die Rechte des Rates der Geme<strong>in</strong>de, des Bürgermeisters und des Kämmerers zu berücksichtigen<br />
s<strong>in</strong>d. Die Aufstellung der Haushaltssatzung bedarf neben der notwendigen Aufgabenverteilung <strong>in</strong>nerhalb<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung auch e<strong>in</strong>er konkreten Zeitplanung. So ist bei der Festlegung des zeitlichen<br />
Ablaufes des Aufstellungsverfahrens zu beachten, dass die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen spätestens e<strong>in</strong>en<br />
Monat vor Beg<strong>in</strong>n des Hausjahres bei der Aufsichtsbehörde angezeigt werden soll (§ 80 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong>). Das<br />
Nachhalten der aufgezeigten Verfahrensschritte, die term<strong>in</strong>lich bestimmt se<strong>in</strong> müssen, soll durch die nachfolgende<br />
Übersicht erleichtert werden (vgl. Abbildung).<br />
Das Verfahren zum Erlass der Haushaltssatzung<br />
Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung<br />
mit ihren Anlagen durch den Kämmerer und Bestätigung des Entwurfs durch den Bürgermeister (§<br />
80 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>) unter Mitwirkung des Verwaltungsvorstands (vgl. § 70 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>)<br />
Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung<br />
mit ihren Anlagen an den Rat (§ 80 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>)<br />
Öffentliche Bekanntgabe des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Festlegung e<strong>in</strong>er Frist für die<br />
Erhebung von E<strong>in</strong>wendungen an m<strong>in</strong>destens 14 Tagen (§ 80 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong>)<br />
Beratung über die Haushaltssatzung<br />
mit ihren Anlagen <strong>in</strong> öffentlicher Sitzung des F<strong>in</strong>anzausschusses (§ 59 GO <strong>NRW</strong>)<br />
Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung<br />
mit ihren Anlagen <strong>in</strong> öffentlicher Sitzung des Rates (§ 80 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong>), ggf. auch Beschlussfassung<br />
über die erhobenen E<strong>in</strong>wendungen (§ 80 Abs. 3 Satz 3 GO <strong>NRW</strong>)<br />
Anzeige der Haushaltssatzung<br />
mit ihren Anlagen bei der Aufsichtsbehörde (§ 80 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong>; sie soll spätestens 1 Monat vor<br />
Beg<strong>in</strong>n des Haushaltsjahres erfolgen)<br />
Ablauf der Anzeigefrist,<br />
bei der zu beachten ist:<br />
1. Genehmigung der Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage (§ 75 Abs. 4<br />
GO <strong>NRW</strong>)<br />
2. Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes (§ 76 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>)<br />
Bekanntmachung und Verfügbarhalten der Haushaltssatzung<br />
(§ 80 Abs. 6 GO <strong>NRW</strong>; sie soll bis zum Ende der <strong>in</strong> § 96 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> benannten Frist verfügbar<br />
gehalten werden)<br />
Abbildung 48 „Verfahren zum Erlass der Haushaltssatzung“<br />
Über die Verfahrensschritte der Aufstellung der Haushaltssatzung soll sich die Aufsichtsbehörde im Rahmen der<br />
Anzeige der Haushaltssatzung <strong>in</strong>formieren, denn diese Satzung ist von ihr als Rechtsaufsichtsbehörde über die<br />
Geme<strong>in</strong>de zu prüfen. Die Aufsichtsbehörde soll auch feststellen, ob das gesetzlich bestimmte Verfahren ordnungsgemäß<br />
abgelaufen ist und ggf. aufgetretene Rechtsverstöße beanstanden. Ob darüber h<strong>in</strong>aus e<strong>in</strong> Mitwir-<br />
GEMEINDEORDNUNG 316
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 80 GO <strong>NRW</strong><br />
ken der Aufsichtsbehörde zulässig ist, kann nur im E<strong>in</strong>zelfall beurteilt werden, denn die eigenverantwortliche<br />
Aufgabenerfüllung durch die Geme<strong>in</strong>de im Rahmen ihrer Selbstverwaltung soll auch bei prüfungspflichtigen Tatbeständen<br />
grundsätzlich nicht auf die Aufsichtsbehörde verlagert werden.<br />
2. Der F<strong>in</strong>anzausschuss des Rates<br />
2.1 Gesetzliche Aufgaben<br />
Der Rat der Geme<strong>in</strong>de soll zur Entlastung und Erleichterung se<strong>in</strong>er Arbeit die notwendigen Ausschüsse bilden<br />
(vgl. § 57 GO <strong>NRW</strong>). Als e<strong>in</strong>en von drei Pflichtausschüssen hat er den F<strong>in</strong>anzausschuss zu bilden (vgl. § 57 Abs.<br />
2 GO <strong>NRW</strong>). Dieser Ausschuss hat wie die anderen Ausschüsse des Rates die allgeme<strong>in</strong>e Aufgabe, die Beschlüsse<br />
des Rates sachverständig vorzubereiten, Stellungnahmen und Empfehlungen abzugeben. Der Rat kann<br />
daher nicht über den Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen e<strong>in</strong>en Beschluss fassen, ohne zuvor se<strong>in</strong>en<br />
F<strong>in</strong>anzausschuss beteiligt zu haben. Speziell soll der F<strong>in</strong>anzausschuss jedoch wichtige Fragen der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Verwaltung zur Haushaltswirtschaft vorberaten, denn die Ausschussarbeit ermöglicht, E<strong>in</strong>zelfragen <strong>in</strong>tensiver<br />
zu besprechen. Er hat aber auch die gesetzliche Aufgabe, die Haushaltssatzung der Geme<strong>in</strong>de vorzubereiten<br />
und die für die Ausführung des Haushaltsplans erforderlichen Entscheidungen zu treffen, soweit nicht andere<br />
Ausschüsse zuständig s<strong>in</strong>d (vgl. § 59 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>).<br />
Die Tätigkeit des F<strong>in</strong>anzausschusses kann sich z.B. auf folgenden Beratungsangelegenheiten erstrecken:<br />
- haushaltswirtschaftliche Entscheidungen, die dem Rat vorbehalten s<strong>in</strong>d (vgl. § 41 GO <strong>NRW</strong>),<br />
- Satzungen, <strong>in</strong> denen Steuern, Gebühren oder Beiträge festgesetzt werden,<br />
- Festsetzung von Entgelten für die Inanspruchnahme öffentlicher E<strong>in</strong>richtungen,<br />
- Abschluss von gerichtlichen und außergerichtlichen Vergleichen,<br />
- Neubau, Ausbau, Umbau, Sanierung und Gestaltung von Hochbauten der Geme<strong>in</strong>de,<br />
- Vorlagen mit Auswirkungen auf die wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung der Geme<strong>in</strong>de<br />
In Form kommunaler Betriebe sowie<br />
- Vorberatung von Wirtschaftsplänen, F<strong>in</strong>anzplanungen und Jahresabschlüssen der Betriebe.<br />
Der F<strong>in</strong>anzausschuss kann die für se<strong>in</strong>e Tätigkeit notwendige Aufklärung sowie e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>sichtnahme <strong>in</strong> geme<strong>in</strong>dliche<br />
Unterlagen vom Bürgermeister verlangen, die für e<strong>in</strong>e sorgfältige Vorbereitung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung,<br />
des Jahresabschlusses, des Gesamtabschlusses und der Eröffnungsbilanz der Geme<strong>in</strong>de, sowie für<br />
Entscheidungen über die Ausführung des Haushaltsplans notwendig s<strong>in</strong>d. Diese Rechte stehen dem F<strong>in</strong>anzausschuss<br />
<strong>in</strong>sgesamt zu und nicht dem e<strong>in</strong>zelnen Ausschussmitglied. Dem F<strong>in</strong>anzausschuss kommt damit e<strong>in</strong>e<br />
Tätigkeit zu, die zur Erhöhung der Effektivität und Effizienz der Arbeit des Rates der Geme<strong>in</strong>de beträgt.<br />
2.2 Weitere Beratungsaufgaben<br />
Nach den gesetzlichen Vorschriften ist dem F<strong>in</strong>anzausschuss bisher nur die Vorbereitung die Haushaltssatzung<br />
der Geme<strong>in</strong>de ausdrücklich zugeordnet (vgl. § 59 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>). Jedoch ist es auf Grund des neuen haushaltswirtschaftlichen<br />
Stellenwertes des Jahresabschlusses (vgl. § 96 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>), der Eröffnungsbilanz (vgl.<br />
§ 92 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>) geboten, dass der F<strong>in</strong>anzausschuss nach Prüfung dieser haushaltswirtschaftlichen Unterlagen<br />
durch den Rechnungsprüfungsausschuss e<strong>in</strong>e Vorberatung vor deren Feststellung vornimmt. Dieses Ans<strong>in</strong>nen<br />
gilt entsprechend für den Gesamtabschluss, den der Rat der Geme<strong>in</strong>de zu bestätigen hat (vgl. § 116 Abs.<br />
1 GO <strong>NRW</strong>). Dem F<strong>in</strong>anzausschuss kommt damit unmittelbar e<strong>in</strong>e entscheidungsvorbereitende Tätigkeit für den<br />
Rat der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> haushaltswirtschaftlichen Fragen und Sachverhalten zu. Dies soll u.a. zur Erhöhung der<br />
Effektivität und Effizienz der Arbeit des Rates beitragen. Dieser Aufgabenzuordnung steht nicht die dem Rechnungsprüfungsausschuss<br />
zugeordnete Prüfungspflicht entgegen.<br />
GEMEINDEORDNUNG 317
3. Aufgaben und Rechte des Kämmerers<br />
3.1 Die Stellung des Kämmerers<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 80 GO <strong>NRW</strong><br />
Mit dem NKFG ist es zu e<strong>in</strong>er formalen Änderung der Funktionsbezeichnung des „für das F<strong>in</strong>anzwesen Verantwortlichen“<br />
gekommen. Die materielle Rechtsstellung ist dabei jedoch unverändert geblieben. Die geänderten<br />
Vorschriften der Geme<strong>in</strong>deordnung s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> ihrer neuen Fassung ab dem 01.01.2005 anzuwenden. Dies ermöglicht,<br />
dass bei e<strong>in</strong>er Geme<strong>in</strong>de tätige „für das F<strong>in</strong>anzwesen zuständige Beschäftigte“ ab dem Haushaltsjahr 2005<br />
die Bezeichnung „Kämmerer“ führen darf.<br />
Für Geme<strong>in</strong>den, die nach den Vorschriften der Geme<strong>in</strong>de ke<strong>in</strong>en Stadtkämmerer bestellen müssen, gilt künftig,<br />
dass sie wählen können, ob sie für die Aufgabe „Kämmerer“ e<strong>in</strong>e Beigeordnetenstelle e<strong>in</strong>richten oder diese Aufgabe<br />
e<strong>in</strong>em Lebenszeitbeamten übertragen. Verzichtet der Rat auf die E<strong>in</strong>richtung e<strong>in</strong>er Beigeordnetenstelle, so<br />
ist es Aufgabe des Bürgermeisters im Rahmen se<strong>in</strong>es Organisationsrechtes nach § 62 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> zu entscheiden,<br />
ob e<strong>in</strong> Lebenszeitbeamter zum Kämmerer bestellt wird oder ob sich die Geme<strong>in</strong>de damit begnügt,<br />
e<strong>in</strong>en Beschäftigten – wie bisher der für das F<strong>in</strong>anzwesen zuständige Beschäftigte – mit der Aufgabe „Kämmerer“<br />
zu betrauen. Das Recht des Bürgermeisters, die Geschäfte zu verteilen (vgl. § 62 Abs. 1 S. 3 GO <strong>NRW</strong>) und das<br />
Recht des Rates, den Geschäftskreis der Beigeordneten bestimmen zu können (vgl. § 73 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>), besteht<br />
im Grundsatz auch h<strong>in</strong>sichtlich des Geschäftskreises des Kämmerers.<br />
In allen Geme<strong>in</strong>den hat ab dem o.a. Zeitpunkt die F<strong>in</strong>anzverantwortung der Kämmerer. Es muss nur künftig zwischen<br />
e<strong>in</strong>em „beauftragten“ und e<strong>in</strong>em „bestellten“ Kämmerer unterschieden werden. Bei e<strong>in</strong>em „beauftragten“<br />
Kämmerer liegt die Entscheidung über außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§ 83 GO<br />
<strong>NRW</strong>) und über außer- und überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (§ 85 GO <strong>NRW</strong>) nicht bei diesem,<br />
sondern beim Bürgermeister. Dies gilt auch für den Erlass e<strong>in</strong>er Haushaltssperre (§ 24 GemHVO <strong>NRW</strong>) und die<br />
Aufsicht über die F<strong>in</strong>anzbuchhaltung (§ 31 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
3.2 Die Aufgaben des Kämmerers<br />
Der Kämmerer der Geme<strong>in</strong>de muss alle ihm durch Gesetz zugewiesenen Aufgaben wahrnehmen. Wegen se<strong>in</strong>er<br />
F<strong>in</strong>anzverantwortung für die Geme<strong>in</strong>de umfasst se<strong>in</strong> Arbeitsgebiet die gesamte geme<strong>in</strong>dliche Verwaltung. Zur<br />
Durchführung se<strong>in</strong>er örtlichen Aufgaben kann er von den ihm zustehenden gesetzlichen Rechten nach Bedarf<br />
Gebrauch machen. Zu den Rechten und Pflichten bzw. Aufgaben des geme<strong>in</strong>dlichen Kämmerers ist Folgendes<br />
zu zählen (vgl. Abbildung).<br />
Aufgaben des Kämmerers der Geme<strong>in</strong>de<br />
Aufgabe<br />
Mitgliedschaft im Verwaltungsvorstand<br />
Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen<br />
Recht zur Abgabe e<strong>in</strong>er schriftlichen Stellungnahme, soweit der<br />
Bürgermeister von ihm vorgelegten Entwurf abweicht<br />
Recht, se<strong>in</strong>e abweichende Me<strong>in</strong>ung zur Haushaltssatzung <strong>in</strong> den<br />
Beratungen des Rates zu vertreten<br />
GEMEINDEORDNUNG 318<br />
Vorschrift<br />
§ 70 Abs. 1 Satz 1 GO <strong>NRW</strong>,<br />
§ 80 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>),<br />
§ 80 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>),<br />
§ 80 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong>),<br />
§ 81 GO <strong>NRW</strong>),
Aufstellung e<strong>in</strong>er Nachtragssatzung<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 80 GO <strong>NRW</strong><br />
Entscheidung über die Leistung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen<br />
und Auszahlungen, soweit der Rat ke<strong>in</strong>e andere Regelung<br />
getroffen hat<br />
Entscheidung über außer- und überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen<br />
Aufstellung des Jahresabschlusses<br />
Recht zur Abgabe e<strong>in</strong>er schriftlichen Stellungnahme, soweit der<br />
Bürgermeister von ihm vorgelegten Entwurf abweicht<br />
Recht, se<strong>in</strong>e abweichende Me<strong>in</strong>ung zum Jahresabschluss <strong>in</strong> den<br />
Beratungen des Rates zu vertreten<br />
Aufstellung des Gesamtabschlusses<br />
Recht zur Abgabe e<strong>in</strong>er schriftlichen Stellungnahme, soweit der<br />
Bürgermeister von ihm vorgelegten Entwurf abweicht<br />
Recht, se<strong>in</strong>e abweichende Me<strong>in</strong>ung zum Jahresabschluss <strong>in</strong> den<br />
Beratungen des Rates zu vertreten<br />
Aussprechen e<strong>in</strong>er haushaltswirtschaftlichen Sperre<br />
Aufsicht über die F<strong>in</strong>anzbuchhaltung, sofern er nicht als Verantwortlicher<br />
für die F<strong>in</strong>anzbuchhaltung nach § 93 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> bestellt<br />
ist<br />
§ 83 GO <strong>NRW</strong>),<br />
§ 85 GO <strong>NRW</strong>),<br />
§ 95 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong>),<br />
§ 95 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong>),<br />
§ 96 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>),<br />
§ 116 Abs. 5 i.V.m. § 95 Abs. 3 GO<br />
<strong>NRW</strong>),<br />
§ 116 Abs. 1 i.V.m. § 95 Abs. 3 GO<br />
<strong>NRW</strong>),<br />
§ 116 Abs. 1 i.V.m. § 96 Abs. 1 GO<br />
<strong>NRW</strong>),<br />
§ 24 GemHVO <strong>NRW</strong>),<br />
Abbildung 49 „Aufgaben des Kämmerers der Geme<strong>in</strong>de“<br />
§ 31 Abs. 4 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
Zu den örtlichen Aufgaben des Kämmerers gehört es <strong>in</strong>sbesondere im Falle e<strong>in</strong>er vorläufigen Haushaltsführung<br />
nach § 82 GO <strong>NRW</strong>, dass er, wenn nicht e<strong>in</strong> Vorbehalt für den Bürgermeister oder den Rat besteht, die notwendigen<br />
haushaltswirtschaftliche Regelungen als Ersatz für die fehlende Haushaltssatzung erlässt, damit die Fortführung<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltungsarbeit im neuen Haushaltsjahr gesichert ist. Die örtlichen Regelungen für<br />
die Dauer der voraussichtlichen „haushaltslosen“ Zeit müssen zudem so gefasst werden, dass damit den Zielen<br />
und Zwecken der vorläufigen Haushaltsführung <strong>in</strong> ausreichendem Maße Genüge getan wird.<br />
3.3 Kämmerer und Bürgermeister<br />
Die gesetzlich bestimmten Aufgaben geben dem Kämmerer e<strong>in</strong>e besondere Rechtsposition <strong>in</strong>nerhalb der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Verwaltung. Er verfügt dadurch über Befugnisse, die ihm nicht entzogen werden können. Dies hat<br />
zur Folge, dass die Aufgabe „Kämmerer“ nicht vom Bürgermeister übernommen bzw. wahrgenommen werden<br />
kann, und zwar unabhängig davon, ob der Aufgabenbereich „F<strong>in</strong>anzwesen“ dem Dezernat oder Fachbereich des<br />
Bürgermeisters zugeordnet ist oder nicht. E<strong>in</strong>e Personalunion zwischen den Ämtern des Bürgermeisters und dem<br />
Amt des Kämmerers schließt sich daher aus.<br />
GEMEINDEORDNUNG 319
4. Unterrichtung des Rates<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 80 GO <strong>NRW</strong><br />
Die Aufstellung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen und die Beschlussfassung darüber durch<br />
den Rat der s<strong>in</strong>d gesetzlich bestimmten Fristen unterworfen worden (vgl. § 80 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong>). Die <strong>in</strong> diesem<br />
gesetzlichen Rahmen festgelegten Aufstellungsfristen stellen dabei nicht nur e<strong>in</strong>e Grenze für den Abschluss der<br />
örtlichen Arbeiten dar. Mit diesen Fristen wird auch bezweckt, dass im Rahmen des jährlich wiederkehrenden<br />
Haushaltskreislaufs der Rat der Geme<strong>in</strong>de frühzeitig durch e<strong>in</strong>e aktualisierte Haushaltsplanung über die weitere<br />
Entwicklung der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong>formiert wird. Dieses Gegebenheiten hat die Geme<strong>in</strong>de zu beachten, wenn aus<br />
zw<strong>in</strong>genden örtlichen und sachlogischen Gründen die gesetzten Fristen überschritten werden müssen. In diesen<br />
Fällen obliegt dem Bürgermeister die Unterrichtungspflicht, denn er hat den Rat der Geme<strong>in</strong>de über alle wichtigen<br />
Geme<strong>in</strong>deangelegenheiten zu unterrichten (vgl. § 62 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong>).<br />
II. Erläuterungen im E<strong>in</strong>zelnen<br />
1. Zu Absatz 1 (Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung):<br />
1.1 Die Aufstellung durch den Kämmerer<br />
Nach der Vorschrift ist der Entwurf der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen vom Kämmerer der<br />
Geme<strong>in</strong>de aufzustellen, der die F<strong>in</strong>anzverantwortung <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong>nehat. Der Kämmerer hat den Entwurf<br />
nach se<strong>in</strong>er Fertigstellung dem Bürgermeister zur Bestätigung vorzulegen. Er hat bei der Aufstellung des Entwurfs<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung zu beachten, dass diese vom Rat zu beschließen ist und die beschlossene<br />
Haushaltssatzung mit ihren Anlagen spätestens e<strong>in</strong>en Monat vor Beg<strong>in</strong>n des Haushaltsjahres der<br />
Aufsichtsbehörde angezeigt werden soll.<br />
Das gesamte Aufstellungsverfahren der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung erfordert daher e<strong>in</strong>e klare Aufgabenverteilung<br />
und Term<strong>in</strong>planung. Es ist deshalb von der Geme<strong>in</strong>de örtlich festzulegen, wer welche Aufstellungsarbeiten<br />
bis zu welchem Term<strong>in</strong> zu erbr<strong>in</strong>gen hat. Dabei ist e<strong>in</strong> Zusammenhang mit den für den Jahresabschluss notwendigen<br />
Abstimmungsarbeiten und den zu klärenden Sachverhalten herzustellen. Auch s<strong>in</strong>d die Erfordernisse zur<br />
Aufstellung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses bei der Aufgaben- und Zeitplanung der Geme<strong>in</strong>de zu berücksichtigen.<br />
1.2 Bestandteile der Haushaltssatzung und Anlagen<br />
Der Kämmerer der Geme<strong>in</strong>de hat nach dieser Vorschrift die Pflicht, jährlich den Entwurf der Haushaltssatzung mit<br />
ihren Anlagen aufzustellen, denn ihm obliegt die F<strong>in</strong>anzverantwortung <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>de. Die Haushaltssatzung<br />
muss die <strong>in</strong> § 78 GO <strong>NRW</strong> bestimmten Angaben enthalten. Ihr ist als wichtigste Anlage der geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsplan<br />
(vgl. § 79 GO <strong>NRW</strong>) beizufügen. Der Haushaltsplan der Geme<strong>in</strong>de muss alle im Haushaltsjahr für die<br />
Erfüllung der Aufgaben der Geme<strong>in</strong>de voraussichtlich anfallenden Erträge und e<strong>in</strong>gehenden E<strong>in</strong>zahlungen, die<br />
entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen<br />
zu enthalten.<br />
Der geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsplan ist außerdem <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en Ergebnisplan und e<strong>in</strong>en F<strong>in</strong>anzplan sowie <strong>in</strong> Teilpläne zu<br />
gliedern und das Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 GO <strong>NRW</strong> ist e<strong>in</strong> Bestandteil des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltsplans. Dem Haushaltsplan s<strong>in</strong>d zudem e<strong>in</strong>e Vielzahl von Anlagen beizufügen, um e<strong>in</strong>en Überblick über<br />
das haushaltswirtschaftliche Geschehen bzw. die aktuelle und zukünftige wirtschaftliche Lage der Geme<strong>in</strong>de<br />
aufzuzeigen (vgl. Abbildung).<br />
GEMEINDEORDNUNG 320
Haushaltssatzung<br />
Ergebnisplan<br />
F<strong>in</strong>anzplan<br />
Teilpläne<br />
Ggf. Haushaltssicherungskonzept<br />
Vorbericht<br />
Stellenplan<br />
Bilanz des Vorvorjahres<br />
Übersicht über die<br />
Verpflichtungsermächtigungen<br />
Übersicht über die<br />
Zuwendungen an die Fraktionen<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 80 GO <strong>NRW</strong><br />
Übersicht über die haushaltwirtschaftlichen Unterlagen<br />
Haushaltssatzung<br />
Bestandteile des Haushaltsplans<br />
Anlagen zum Haushaltsplan<br />
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verb<strong>in</strong>dlichkeiten<br />
zu Beg<strong>in</strong>n des Haushaltsjahres<br />
Übersicht über die Entwicklung<br />
des Eigenkapitals, bei e<strong>in</strong>er Festsetzung<br />
nach § 78 Abs. 2 Nr. 2 der GO <strong>NRW</strong><br />
Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse<br />
der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt<br />
werden<br />
GEMEINDEORDNUNG 321<br />
§ 78 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. Nr. 1.1.1 des Runderlasses<br />
vom 24.02.2005<br />
§ 79 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 1 und<br />
§ 2 GemHVO <strong>NRW</strong> sowie Nr. 1.2.1 des Runderlasses<br />
vom 24.02.2005<br />
§ 79 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 2 und<br />
§ 3 GemHVO <strong>NRW</strong> sowie Nr. 1.2.2 des Runderlasses<br />
vom 24.02.2005<br />
§ 79 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 und<br />
§ 4 GemHVO <strong>NRW</strong> sowie den Nrn. 1.2.3 bis Nr.<br />
1.2.7 des Runderlasses vom 24.02.2005<br />
§§ 75 und 76 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 5 GemHVO<br />
<strong>NRW</strong> i.V.m. dem Runderlass vom 09.06.2006<br />
§ 1 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 7 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 79 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr. 2 und<br />
§ 8 GemHVO <strong>NRW</strong> sowie Nr. 1.3 des Runderlasses<br />
vom 24.02.2005<br />
§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 85 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr. 4 und § 13<br />
GemHVO <strong>NRW</strong> sowie Nr. 1.4.3 des Runderlasses<br />
vom 24.02.2005<br />
§ 56 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr. 5<br />
GemHVO <strong>NRW</strong> sowie Nr. 1.4.1 des Runderlasses<br />
vom 24.02.2005<br />
§ 91 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr. 6<br />
GemHVO <strong>NRW</strong> sowie Nr. 1.4.2 des Runderlasses<br />
vom 24.02.2005<br />
§ 78 Abs. 2 Nr. 2 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr.<br />
7 und § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§§ 97 und 114 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr. 8<br />
GemHVO <strong>NRW</strong> sowie weitere e<strong>in</strong>schlägige<br />
Rechtsvorschriften
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche<br />
Entwicklung der Unternehmen und E<strong>in</strong>richtungen<br />
mit den neuesten Jahresabschlüssen der Unternehmen<br />
und E<strong>in</strong>richtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an<br />
denen die Geme<strong>in</strong>de mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist<br />
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben<br />
(<strong>in</strong> kreisfreien Städten)<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 80 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 108 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr. 9 GemHVO<br />
<strong>NRW</strong> sowie weitere e<strong>in</strong>schlägige Rechtsvorschriften<br />
§ 37 Abs. 3 und 4 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr.<br />
10 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
Abbildung 50 „Haushaltswirtschaftliche Unterlagen der Geme<strong>in</strong>de“<br />
Nach der Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen hat der Kämmerer dieses Werk dem<br />
Bürgermeister zur Bestätigung vorzulegen, der es dem Rat der Geme<strong>in</strong>de zuzuleiten hat, denn dieser hat darüber<br />
zu beraten und zu beschließen.<br />
1.3 Unterzeichnung durch den Kämmerer<br />
Der Kämmerer der Geme<strong>in</strong>de, der für das F<strong>in</strong>anzwesen <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>de zuständig ist bzw. die F<strong>in</strong>anzverantwortung<br />
<strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong>nehat, hat vor der Zuleitung des von ihm aufgestellten Entwurfs der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung<br />
mit ihren Anlagen an den Bürgermeister se<strong>in</strong>en Entwurf zu unterzeichnen. Der Bürgermeister hat<br />
diesen Entwurf zu bestätigen und kann ihn ggf. abändern. Mit ihren Unterschriften erfüllen Kämmerer und Bürgermeister<br />
e<strong>in</strong>e öffentlich-rechtliche Verpflichtung und dokumentieren damit ihre Verantwortung als Nachweis im<br />
S<strong>in</strong>ne der Vorschrift.<br />
Die für das Aufstellungsverfahren Verantwortlichen br<strong>in</strong>gen damit zum Ausdruck, dass der von ihnen aufgestellte<br />
Satzungsentwurf aus ihrer F<strong>in</strong>anzverantwortung heraus richtig und vollständig ist, das notwendige wirtschaftliche<br />
Handeln der Geme<strong>in</strong>de im neuen Haushaltsjahr nach festgelegten haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen<br />
Regeln aufzeigt, sofern sie dazu ke<strong>in</strong>e besonderen E<strong>in</strong>schränkungen machen oder besondere H<strong>in</strong>weise<br />
geben. Die Verpflichtung zur Unterzeichnung des Entwurfs be<strong>in</strong>haltet dabei nicht, dass der Kämmerer oder der<br />
Bürgermeister sämtliche Bestandteile und Anlagen der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung e<strong>in</strong>zeln zu unterzeichnen<br />
haben. Die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist vielmehr buchtechnisch so zusammen zu<br />
fassen, dass erkennbar und nachvollziehbar wird, dass die Unterschrift des Kämmerers und des Bürgermeisters<br />
sich auf die Gesamtheit aller Teile der dem Rat zuzuleitenden Haushaltssatzung mit ihren Anlagen bezieht.<br />
1.4 Haushaltsplanung und Ermächtigungsübertragung<br />
Die Vorschrift gibt für den Erlass der jährlichen Haushaltssatzung den Geme<strong>in</strong>den mehrere Verfahrensschritte<br />
vor, bei denen die Rechte des Rates der Geme<strong>in</strong>de, des Bürgermeisters und des Kämmerers sowie zeitliche<br />
Vorgaben zu berücksichtigen s<strong>in</strong>d. So ist bei der Festlegung des zeitlichen Ablaufes des Aufstellungsverfahren zu<br />
beachten, dass die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen spätestens e<strong>in</strong>en Monat vor Beg<strong>in</strong>n des Hausjahres bei<br />
der Aufsichtsbehörde angezeigt werden soll (vgl. Absatz 5), damit die Haushaltssatzung für das neue Haushaltsjahr<br />
rechtzeitig <strong>in</strong> Kraft treten kann.<br />
Im E<strong>in</strong>zelfall können vor Ort jedoch zeitliche Verzögerungen im Aufstellungsverfahren auftreten, so dass sich das<br />
Beratungsverfahren bis <strong>in</strong> das neue Haushaltsjahr erstreckt, muss vor Ort geklärt werden, ob e<strong>in</strong>e neben dem<br />
noch nicht beschlossenen Haushaltsplan e<strong>in</strong>e eigenständige Ermächtigungsübertragung mit Beteiligung des<br />
Rates der Geme<strong>in</strong>de vorgenommen wird. Es ist <strong>in</strong> solchen Fällen sachgerecht, die vorgesehenen Ermächtigungsübertragungen<br />
unmittelbar als Veränderungen <strong>in</strong> den Entwurf der Haushaltssatzung bzw. Haushaltsplan<br />
e<strong>in</strong>zubeziehen und nicht zwei Haushaltsverfahren nebene<strong>in</strong>ander zu betreiben, denn die übertragenen Ermächtigungen<br />
erhöhen nach der Bestimmung <strong>in</strong> Absatz 1 dieser Vorschrift die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan<br />
des folgenden Jahres. Das Zusammenführen der Ermächtigungsübertragung mit dem gleichzeitig lau-<br />
GEMEINDEORDNUNG 322
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 80 GO <strong>NRW</strong><br />
fenden Haushaltsaufstellungsverfahren br<strong>in</strong>gt die notwendige Transparenz im aktuellen Stand der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltswirtschaft und sichert den Gesamtüberblick für den Rat im Rahmen se<strong>in</strong>es Budgetrechtes.<br />
2. Zu Absatz 2 (Entwurf der Haushaltssatzung und Aufgaben des Bürgermeisters):<br />
2.1 Zu Satz 1 (Bestätigung und Zuleitung an den Rat):<br />
2.1.1 Die Bestätigung durch den Bürgermeister<br />
Nach der Vorschrift hat der Bürgermeister den ihm vom Kämmerer vorgelegten Entwurf der Haushaltssatzung mit<br />
ihren Anlagen zu bestätigen. Für diese Bestätigung ist ke<strong>in</strong>e bestimmte Form vorgeschrieben. Der Bürgermeister<br />
ist dabei jedoch nicht verpflichtet, den Entwurf des Kämmerers unverändert dem Rat zuzuleiten. Wenn aus se<strong>in</strong>er<br />
Sicht e<strong>in</strong> Bedarf für Änderungen des Entwurfs der Haushaltssatzung besteht, kann er eigenverantwortlich entscheiden,<br />
ob diese Änderungen erfolgen sollen. Er kann zum Entwurf auch E<strong>in</strong>schränkungen machen oder weitere<br />
H<strong>in</strong>weise geben.<br />
E<strong>in</strong>e Abstimmung mit dem Kämmerer ist s<strong>in</strong>nvoll und sachgerecht, aber nicht verpflichtend. Die Vornahme der<br />
Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung stellt e<strong>in</strong>e funktionale und ke<strong>in</strong>e persönliche Rechtshandlung des<br />
Bürgermeisters der Geme<strong>in</strong>de dar. Soweit der Bürgermeister diese gesetzliche Pflicht aus persönlichen Gründen<br />
nicht wahrnehmen kann, ist <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em solchen Falle die Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung unter<br />
Beachtung der geltenden Vertretungsregelungen durch den dann Vertretungsberechtigten vorzunehmen (vgl. §<br />
68 GO <strong>NRW</strong>).<br />
Die Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung durch den Bürgermeister kommt dadurch zum Ausdruck,<br />
dass dieser den ihm vorgelegten Entwurf zu unterzeichnen hat. Er erfüllt mit se<strong>in</strong>er Bestätigung e<strong>in</strong>e öffentlichrechtliche<br />
Verpflichtung und br<strong>in</strong>gt damit zum Ausdruck, dass der Entwurf aus se<strong>in</strong>er Verantwortung heraus richtig<br />
und vollständig ist, sofern er dazu ke<strong>in</strong>e besonderen E<strong>in</strong>schränkungen macht oder H<strong>in</strong>weise gibt. Se<strong>in</strong>e Unterzeichnung<br />
be<strong>in</strong>haltet daher e<strong>in</strong>e Vollständigkeitserklärung dah<strong>in</strong>gehend, dass der Entwurf der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltssatzung alle Bestandteile und Anlagen zur Erfüllung ihrer Aufgabe enthält, die dafür vorgeschrieben<br />
bzw. notwendig s<strong>in</strong>d.<br />
Mit se<strong>in</strong>er Unterschrift des Bürgermeisters auf der von ihm bestätigten Haushaltssatzung mit ihren Anlagen hat er<br />
ausreichend se<strong>in</strong>e Verantwortung als Nachweis im S<strong>in</strong>ne der Vorschrift dokumentiert. Die Verpflichtung zur Unterzeichnung<br />
des Entwurfs be<strong>in</strong>haltet dabei nicht, dass der Bürgermeister sämtliche Bestandteile und Anlagen der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung e<strong>in</strong>zeln zu unterzeichnen hat. Die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung mit ihren<br />
Anlagen ist vielmehr buchtechnisch so zusammen zu fassen, dass erkennbar und nachvollziehbar wird, dass die<br />
Unterschrift des Bürgermeisters sich auf die Gesamtheit aller Teile bezieht.<br />
2.1.2 Informationspflichten des Bürgermeisters<br />
Der Bürgermeister hat das Recht, vom dem ihm vom Kämmerer vorgelegten Entwurf der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung<br />
abzuweichen, bevor er diese dem Rat der Geme<strong>in</strong>de zuleitet. Weicht der Bürgermeister von dem<br />
ihm vorgelegten Entwurf ab, hat er vor der Zuleitung des Entwurfs an den Rat der Geme<strong>in</strong>de den Kämmerer über<br />
se<strong>in</strong>e abweichende Auffassung zu <strong>in</strong>formieren und ihm die sich daraus ergebenden oder bereits von ihm vorgenommenen<br />
Änderungen des Entwurfs offen zu legen. Dem Kämmerer steht <strong>in</strong> diesem Falle das Recht zu, e<strong>in</strong>e<br />
Stellungnahme zu dem durch den Bürgermeister geänderten Entwurf der Haushaltssatzung abzugeben.<br />
Die Befugnis des Bürgermeisters, Änderungen an dem ihm vom Kämmerer vorgelegten Entwurf der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltssatzung vornehmen zu dürfen, geht jedoch nicht so weit, dass er wegen des möglicherweise weit-<br />
GEMEINDEORDNUNG 323
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 80 GO <strong>NRW</strong><br />
reichenden Umfangs se<strong>in</strong>er für notwendig angesehenen Änderungen eigenständig e<strong>in</strong>en neuen Entwurf der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltssatzung aufstellen darf. Das Recht zur Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung der<br />
Geme<strong>in</strong>de steht gesetzlich nur dem Kämmerer und nicht dem Bürgermeister zu. Bleiben wegen der Änderungen<br />
der Entwurfsfassung durch den Bürgermeister aber noch Differenzen zwischen dem Kämmerer und dem Bürgermeister<br />
bestehen, s<strong>in</strong>d diese im Rahmen der Beratungen des Rates über den Entwurf der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung<br />
auszuräumen.<br />
2.1.3 Die Zuleitung an den Rat<br />
Nach der Vorschrift hat der Bürgermeister den von ihm bestätigten Entwurf der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung<br />
mit ihren Anlagen dem Rat der Geme<strong>in</strong>de zuzuleiten. Der Adressat der Vorlage ist damit der Rat als Kollegialorgan,<br />
das se<strong>in</strong>e Beschlüsse <strong>in</strong> Sitzungen fasst (Sitzungspr<strong>in</strong>zip) und nicht das e<strong>in</strong>zelne Ratsmitglied. Die Zuleitung<br />
des bestätigten Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen an den Rat der Geme<strong>in</strong>de wird <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Praxis i.d.R. dadurch vollzogen, dass durch den Bürgermeister e<strong>in</strong> entsprechender Tagesordnungspunkt<br />
auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Rates gesetzt wird, denn er hat den Rat e<strong>in</strong>zuberufen (vgl. § 47<br />
Abs. 1 S. 1 GO <strong>NRW</strong>) und die Tagesordnung der Ratssitzungen <strong>in</strong> eigener Verantwortung festzulegen (vgl. § 48<br />
Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>). Im Rahmen dieser beschlussfähigen Zusammenkunft des Rates (Sitzung) kann dann die Zuleitung<br />
des Entwurfs der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung als erledigt betrachtet werden.<br />
Für die weiteren Beratungen bzw. die Verweisung an die zuständigen Ausschüsse ist es wichtig, dass jedes<br />
Ratsmitglied über ausreichende Beratungsunterlagen über die geplante geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft verfügen<br />
kann. Es muss gewährleistet se<strong>in</strong>, dass der Rat der Geme<strong>in</strong>de sachgerecht e<strong>in</strong>en Beschluss über den ihm<br />
vorgelegten Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das neue Haushaltsjahr fassen kann. Macht der<br />
Kämmerer von der ihm gesetzlich e<strong>in</strong>geräumten Möglichkeit Gebrauch, e<strong>in</strong>e abweichende Stellungnahme zu dem<br />
vom Bürgermeister bestätigten Entwurf der Haushaltssatzung abzugeben, ist der Bürgermeister verpflichtet, diese<br />
Stellungnahme mit dem Entwurf der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung dem Rat vorzulegen. In der betreffenden<br />
Ratssitzung besteht dann für Bürgermeister und auch für den Kämmerer e<strong>in</strong> Rederecht, so dass die für das neue<br />
Haushaltsjahr geplante Hauswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de mit Ausblick auf die weiteren drei Planungsjahre der mittelfristigen<br />
Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung sowie die damit verbundenen Ziele, aber auch die Chancen und Risiken<br />
für die Geme<strong>in</strong>de, vorgestellt werden.<br />
2.2 Zu Satz 2 (Abweichende Stellungnahme des Kämmerers):<br />
Nach der Vorschrift kann der Kämmerer e<strong>in</strong>e Stellungnahme abgeben, wenn der Bürgermeister im Rahmen se<strong>in</strong>er<br />
Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen von dem ihm vom Kämmerer vorgelegten<br />
Entwurf abweicht. In diesen Fällen kann der Kämmerer die notwendige Aufklärung über die vom Bürgermeister<br />
vorgenommenen Abweichungen verlangen, um von se<strong>in</strong>em ihm gesetzlich zustehenden Recht, e<strong>in</strong>e abweichende<br />
Stellungnahme abgeben zu können, Gebrauch machen zu können. Der Bürgermeister hat dann vor der Zuleitung<br />
des Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen an den Rat der Geme<strong>in</strong>de die Pflicht, den Kämmerer<br />
über se<strong>in</strong>e abweichende Auffassung zu <strong>in</strong>formieren und ihm die sich daraus ergebenden oder bereits von ihm<br />
vorgenommenen Änderungen des Entwurfs offen zu legen.<br />
2.3 Zu Satz 3 (Vorlage der abweichenden Stellungnahme an den Rat):<br />
Nach der Vorschrift besteht für den Bürgermeister die Pflicht, e<strong>in</strong>e abweichende Stellungnahme des Kämmerers<br />
zu dem von ihm bestätigten Entwurf der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung dem Rat der Geme<strong>in</strong>de zuzuleiten. Aus<br />
dieser Verpflichtung des Bürgermeisters ergibt sich, dass der Kämmerer se<strong>in</strong>e Stellungnahme schriftlich abzugeben<br />
hat. Den Ratsmitgliedern wird damit die Möglichkeit verschafft, sich vor E<strong>in</strong>tritt <strong>in</strong> die Beratungen über<br />
GEMEINDEORDNUNG 324
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 80 GO <strong>NRW</strong><br />
den Entwurf der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung auch mit der Auffassung des Kämmerers der Geme<strong>in</strong>de zur<br />
geplanten Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de befassen zu können, die Argumente des Kämmerers und die des<br />
Bürgermeisters zu werten und sich dazu e<strong>in</strong>e eigene Me<strong>in</strong>ung zu bilden.<br />
Es bedarf e<strong>in</strong>er Information an den Rat der Geme<strong>in</strong>de, wenn der Kämmerer zu dem vom Bürgermeister bestätigten<br />
Entwurf der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung e<strong>in</strong>e abweichende Stellungnahme abgegeben hat. Die Stellungnahme<br />
des Kämmerers ist dabei nicht als Bestandteil des Entwurfs der Haushaltssatzung zu bewerten, so<br />
dass die abgegebene Stellungnahme nicht im Rahmen der E<strong>in</strong>sichtnahme des Entwurfs der Haushaltssatzung<br />
verfügbar gehalten werden muss. Die Stellungnahme des Kämmerers berührt lediglich das verwaltungs<strong>in</strong>terne<br />
Aufstellungsverfahren des Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen. Es ist daher ausreichend, wenn der<br />
Rat <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Beratungsverfahren über die abweichende Auffassung des Kämmerers zur geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung<br />
<strong>in</strong>formiert ist.<br />
3. Zu Absatz 3 (Bürgerbeteiligung beim Entwurf der Haushaltssatzung):<br />
3.1 Zu Satz 1 (Bekanntgabe und E<strong>in</strong>sichtnahme):<br />
3.1.1 Die Bekanntgabe<br />
Mit der Vorschrift soll e<strong>in</strong> bürgerfreundliches Verfahren für die Aufstellung des geme<strong>in</strong>dlichen Haushalts erreicht<br />
werden. Die Bürger<strong>in</strong>nen und Bürger s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>erseits als E<strong>in</strong>wohner und Abgabepflichtige die Adressaten des<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Handelns und sollen andererseits die Arbeit von Rat und Verwaltung der Geme<strong>in</strong>de unterstützen.<br />
Daher besteht e<strong>in</strong> berechtigtes Interesse der Öffentlichkeit an Informationen sowohl über die aktuelle wirtschaftliche<br />
Lage der Geme<strong>in</strong>de als auch über die vorzunehmende Haushaltsplanung. Es ist daher beabsichtigt, möglichst<br />
frühzeitig die Bürger<strong>in</strong>nen und Bürger <strong>in</strong> das örtliche Haushaltsgeschehen der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>zub<strong>in</strong>den.<br />
Auf der Geme<strong>in</strong>deebene besteht regelmäßig e<strong>in</strong>e besondere Bürgernähe. Deshalb wird auch e<strong>in</strong> gesteigerter<br />
Wert auf e<strong>in</strong>e ausreichende Bürger<strong>in</strong>formation und e<strong>in</strong>e Bürgerbeteiligung im Rahmen der Haushaltsplanung der<br />
Geme<strong>in</strong>de gelegt. Das jährliche Haushaltsgeschehen der Geme<strong>in</strong>de sollen möglichst viele Bürger<strong>in</strong>nen und Bürger<br />
der Geme<strong>in</strong>de durchschauen. In dieser H<strong>in</strong>sicht besteht vielfach auch von Seiten der Bürger<strong>in</strong>nen und Bürger<br />
e<strong>in</strong> großes und berechtigtes Informations<strong>in</strong>teresse. Diesem ist örtlich durch e<strong>in</strong> umfassendes, verständliches und<br />
zugängliches Informationsangebot <strong>in</strong> ausreichendem Maße Rechnung zu tragen. Die Vorschrift sieht deshalb<br />
ausdrücklich vor, nach der Zuleitung des Entwurfs der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen an den<br />
Rat, diese unverzüglich der Öffentlichkeit bekannt zu geben.<br />
3.1.2 Die E<strong>in</strong>sichtnahme<br />
Der Entwurf der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das neue Haushaltsjahr wird vom Zeitpunkt<br />
der Zuleitung an den Rat bis zur Beschlussfassung über die Haushaltssatzung, also während des gesamten<br />
Beratungsverfahrens des Rates, den E<strong>in</strong>wohnern und Abgabepflichtigen der Geme<strong>in</strong>de zur E<strong>in</strong>sichtnahme<br />
verfügbar gemacht. Dieser Personenkreis kann sich <strong>in</strong> dieser Zeit mit den im Entwurf enthaltenen Vorstellungen<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung über die zukünftige Entwicklung ihrer Geme<strong>in</strong>de noch <strong>in</strong>tensiver als bisher ause<strong>in</strong>ander<br />
setzen, dazu Vorschläge machen und ggf. auch E<strong>in</strong>wendungen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er vorher bestimmten Zeit dagegen<br />
erheben. Das Informationserfordernis verlangt dabei nicht, dass e<strong>in</strong>e dem Beratungsverfahren des Rates entsprechende<br />
ständige Aktualisierung des Entwurfs vorgenommen werden muss.<br />
Es ist für die gesetzlich vorgesehene E<strong>in</strong>sichtnahme ausreichend, den dem Rat zugeleiteten Entwurf verfügbar zu<br />
halten. Mit dieser Auslegung wird dem Grundsatz der Öffentlichkeit <strong>in</strong> genügender Weise Rechnung getragen. Es<br />
bleibt aber der Geme<strong>in</strong>de überlassen, ob sie den Haushaltsplan <strong>in</strong> herkömmlicher Weise als Druckwerk auslegt,<br />
GEMEINDEORDNUNG 325
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 80 GO <strong>NRW</strong><br />
im Internet barrierefrei verfügbar macht (vgl. Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen -<br />
BITV <strong>NRW</strong>) oder <strong>in</strong> sonstiger Weise ihre E<strong>in</strong>wohner und Abgabepflichtigen darüber <strong>in</strong>formiert. Sie darf die gesetzliche<br />
Frist jedoch nicht so ausgestalten, dass sie auf e<strong>in</strong> unvertretbares Maß reduziert ist und damit dem<br />
Zweck der Beteiligung der Öffentlichkeit an der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft entgegen gewirkt wird.<br />
3.2 Zu Satz 2 (Erhebung von E<strong>in</strong>wendungen):<br />
3.2.1 Die Fristsetzung für die Erhebung von E<strong>in</strong>wendungen<br />
Der Rat der Geme<strong>in</strong>de muss rechtzeitig vor se<strong>in</strong>em Beschluss über die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung mit ihren<br />
Anlagen über die erhobenen E<strong>in</strong>wendungen <strong>in</strong>formiert werden, damit er später <strong>in</strong> öffentlicher Sitzung darüber<br />
beraten und entscheiden kann. Deshalb wird <strong>in</strong> der Vorschrift bestimmt, dass <strong>in</strong> der öffentlichen Bekanntgabe des<br />
Entwurfs der Haushaltssatzung m<strong>in</strong>destens auf e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>wendungsfrist von 14 Tagen h<strong>in</strong>zuweisen ist. Für die<br />
Fristberechnung gelten gemäß § 31 Abs. 1 VwVfG <strong>NRW</strong> die §§ 187 bis 193 BGB entsprechend, soweit nicht<br />
durch § 31 Abs. 2 bis 5 VwVfG <strong>NRW</strong> etwas anderes bestimmt ist. Der Rat der Geme<strong>in</strong>de kann aber auch bei<br />
Bedarf e<strong>in</strong>e längere E<strong>in</strong>wendungsfrist zu lassen.<br />
In diesen Zusammenhang gebietet das bürgerfreundliche Verhalten, ggf. auch E<strong>in</strong>wendungen zu berücksichtigen<br />
bzw. dem Rat mit vorzulegen, die nicht fristgerecht e<strong>in</strong>gelegt worden s<strong>in</strong>d. Dieses sollte auch für E<strong>in</strong>wendungen<br />
gelten, die nicht von den E<strong>in</strong>wohnern oder Abgabepflichtigen erhoben wurden. Es bleibt <strong>in</strong> diesen Fällen aber<br />
dem Rat der Geme<strong>in</strong>de überlassen, ob er solche E<strong>in</strong>wendungen <strong>in</strong> se<strong>in</strong>e Beratungen e<strong>in</strong>beziehen will. In solchen<br />
Fällen ist daher e<strong>in</strong>e entsprechende vorherige Absprache zwischen dem Rat der Geme<strong>in</strong>de und dem Bürgermeister<br />
als Leiter der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung s<strong>in</strong>nvoll, mit der Klarheit geschaffen werden kann, wie mit solchen<br />
E<strong>in</strong>wendungen umgegangen werden soll.<br />
3.2.2 Die Abgabe der E<strong>in</strong>wendungen<br />
Bei der Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen hat grundsätzlich jedermann das Recht<br />
zur E<strong>in</strong>sichtnahme. Es ist auch niemanden verwehrt, se<strong>in</strong>e Me<strong>in</strong>ung zur Haushaltsplanung der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> Form<br />
von Bedenken, Änderungswünschen und Anregungen mitzuteilen oder E<strong>in</strong>wendungen zu erheben. Dieses gebietet<br />
bereits die gewünschte Bürgerfreundlichkeit der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung sowie das vorhandene Informations<strong>in</strong>teresse<br />
der Adressaten der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft. Dafür bedarf es aber auch der Angabe e<strong>in</strong>er<br />
Stelle <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung, die mögliche erhobene E<strong>in</strong>wendungen gegen den Entwurf der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltssatzung entgegen nimmt.<br />
In der Vorschrift wird bestimmt, dass <strong>in</strong> der öffentlichen Bekanntgabe des Entwurfs der Haushaltssatzung die<br />
Stelle anzugeben ist, bei der von der Öffentlichkeit die E<strong>in</strong>wendungen erhoben werden können. Diese Regelung<br />
sichert ebenfalls, dass der Rat der Geme<strong>in</strong>de rechtzeitig vor se<strong>in</strong>em Beschluss über die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung<br />
über die erhobenen E<strong>in</strong>wendungen <strong>in</strong>formiert werden kann, damit er später <strong>in</strong> öffentlicher Sitzung<br />
darüber beraten und entscheiden kann.<br />
3.3 Zu Satz 3 (Bed<strong>in</strong>gungen für die Fristsetzung):<br />
In der Vorschrift ist ausdrücklich bestimmt worden, dass die Frist für die Erhebung von E<strong>in</strong>wendungen ist so festzusetzen,<br />
dass der Rat vor der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen <strong>in</strong> öffentlicher<br />
Sitzung darüber beschließen kann. Mit dieser Regelung wird e<strong>in</strong>e ausreichende Bürger<strong>in</strong>formation und e<strong>in</strong>e Bürgerbeteiligung<br />
im Rahmen der Haushaltsplanung der Geme<strong>in</strong>de, aber auch e<strong>in</strong>e Befassung des Rates mit den<br />
Ergebnissen der Bürgerbeteiligung gesichert.<br />
GEMEINDEORDNUNG 326
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 80 GO <strong>NRW</strong><br />
Der Rat der Geme<strong>in</strong>de hat sich zwar regelmäßig nur mit den „qualifizierten“ E<strong>in</strong>wendungen der E<strong>in</strong>wohner und<br />
Abgabepflichtigen zu befassen, jedoch bietet es sich an, auch die anderen E<strong>in</strong>wendungen, soweit sie s<strong>in</strong>nvolle<br />
Anregungen zur Haushaltssatzung mit ihren Anlagen zum Inhalt haben, dem Rat für se<strong>in</strong>e Beratungen über die<br />
Haushaltssatzung zur Kenntnis zu br<strong>in</strong>gen, wenn dieses nach der Absprache zwischen dem Rat der Geme<strong>in</strong>de<br />
und dem Bürgermeister als Leiter der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung so vorgesehen ist. Nach se<strong>in</strong>er Entscheidung<br />
über die E<strong>in</strong>wendungen kann der Rat dann über die Haushaltssatzung der Geme<strong>in</strong>de für das neue Haushaltsjahr<br />
beschließen.<br />
4. Zu Absatz 4 (Beratung und Beschluss über die Haushaltssatzung):<br />
4.1 Zu Satz 1 (Pflicht zur Beratung und Beschlussfassung):<br />
4.1.1 Beratung und Beschlussfassung<br />
Die Vorschrift, dass der Rat der Geme<strong>in</strong>de den Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen <strong>in</strong> öffentlicher<br />
Sitzung zu beraten und zu beschließen hat, unterstreicht und verstärkt die Vorschrift des § 41 Abs. 1 Buchstabe h<br />
GO <strong>NRW</strong>, nach der vom Rat die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung nicht auf Andere übertragen werden<br />
kann. Im Rahmen der Beratungen des Rates über den Entwurf der Haushaltssatzung können dazu von den<br />
Ratsmitgliedern unter Berücksichtigung der örtlichen Geschäftsordnung gleichwohl Änderungen beantragt und<br />
festgelegt werden. Der Gegenstand des Beschlusses des Rates der Geme<strong>in</strong>de über die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung<br />
ist der ihm vom Bürgermeister zugeleitete Entwurf. Bestehen seitens des Rates ke<strong>in</strong>e Bedenken gegen<br />
diese Vorlage, kann er die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung unter Berücksichtigung des erzielten Beratungsergebnisses<br />
beschließen.<br />
4.1.2 Zeitliche Bed<strong>in</strong>gungen für die Beschlussfassung<br />
Mit der Beschlussfassung des Rates über die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung mit ihren Anlagen steht die Anzeigefrist<br />
<strong>in</strong> Absatz 5 Satz 2 dieser Vorschrift <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung. Die gesetzlich bestimmte Frist soll u.a. auch das Budgetrecht<br />
des Rates <strong>in</strong> der Weise sichern, dass dieser über e<strong>in</strong>en geme<strong>in</strong>dlichen Haushalt beschließen kann, der<br />
sich noch nicht <strong>in</strong> der Ausführung bzw. der vorläufigen Ausführung nach § 82 GO <strong>NRW</strong> durch die geme<strong>in</strong>dliche<br />
Verwaltung bef<strong>in</strong>det.<br />
Je weiter die Beschlussfassung über die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung mit ihren Anlagen <strong>in</strong> das neue Haushaltsjahr<br />
h<strong>in</strong>ausgeschoben wird, desto mehr muss der Rat h<strong>in</strong>nehmen, dass die geme<strong>in</strong>dliche Verwaltung wegen<br />
bestehender rechtlicher Verpflichtungen oder wegen der Weiterführung notwendiger Aufgaben der Geme<strong>in</strong>de<br />
bereits e<strong>in</strong>e Vielzahl von haushaltswirtschaftlichen Maßnahmen umgesetzt hat. Diese verwaltungsmäßig bereits<br />
getroffenen Maßnahmen kann der Rat im Rahmen se<strong>in</strong>es zu treffenden Beschlusses über die geme<strong>in</strong>dliche<br />
Haushaltsatzung i.d.R. nicht mehr rückwirkend abändern (Entscheidungsentzug).<br />
4.1.3 Vorgehen bei Änderungsbedarf<br />
In den Fällen, <strong>in</strong> denen sich aus der Beratung des Rates über die Haushaltssatzung aber noch e<strong>in</strong> Änderungsbedarf<br />
ergeben hat, muss vor der Beschlussfassung des Rates die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung mit ihren Anlagen<br />
nicht zw<strong>in</strong>gend <strong>in</strong> entsprechender Weise überarbeitet werden. Durch die E<strong>in</strong>beziehung möglicher Änderungen<br />
<strong>in</strong> den Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung wird der ihm zugeleitete Entwurf entsprechend geändert,<br />
auch wenn der Änderungsbedarf im Rahmen der Beratungen nicht mehr vor der Beschlussfassung durch<br />
den Rat <strong>in</strong> den vorliegenden Entwurf der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen, z.B. der Haushalts-<br />
GEMEINDEORDNUNG 327
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 80 GO <strong>NRW</strong><br />
plan, tatsächlich e<strong>in</strong>gearbeitet werden kann. Lässt sich der Änderungsbedarf klar und e<strong>in</strong>deutig bestimmen, kann<br />
es als ausreichend angesehen werden, wenn im Ratsbeschluss über die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung e<strong>in</strong>e<br />
oder mehrere Maßgaben für die Vornahme der Änderungen, z.B. im Haushaltsplan, enthalten s<strong>in</strong>d.<br />
In solchen Fällen entsteht e<strong>in</strong> Auftrag des Rates an die geme<strong>in</strong>dliche Verwaltung. Es obliegt dann dem Bürgermeister<br />
für die Erledigung dieses Auftrages Sorge zu tragen und die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung mit ihren<br />
Anlagen <strong>in</strong> die vom Rat beschlossene Form zu br<strong>in</strong>gen. In Ausnahmefällen kann der Rat aber wegen e<strong>in</strong>es möglicherweise<br />
umfangreichen Änderungsbedarfs e<strong>in</strong>e Überarbeitung des Entwurfs der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung<br />
durch den Bürgermeister vor se<strong>in</strong>er Beschlussfassung verlangen.<br />
E<strong>in</strong>e solche Rückgabe bedarf jedoch e<strong>in</strong>er gesonderten Beschlussfassung durch den Rat als Arbeitsauftrag an<br />
den Bürgermeister, ohne dass dadurch die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung mit ihren Anlagen selbst beschlossen<br />
wird. Erst nach Erledigung dieses Auftrages liegt dann e<strong>in</strong>e Fassung der Haushaltssatzung der Geme<strong>in</strong>de vor,<br />
die zum Gegenstand der Anzeige an die Aufsichtsbehörde und zum Gegenstand der gesetzlich vorgesehenen<br />
Bekanntmachung gemacht werden kann.<br />
4.1.4 Mitwirkung des Bürgermeisters<br />
Für die Mitwirkung des Bürgermeisters am Beschluss des Rates der Geme<strong>in</strong>de über die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung<br />
mit ihren Anlagen ist örtlich zu beurteilen, ob diese Mitwirkung sachlich geboten ist. E<strong>in</strong>erseits ist die<br />
Vorschrift des § 40 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> zu beachten, nach der der Bürgermeister e<strong>in</strong> Mitglied im Rat der Geme<strong>in</strong>de<br />
kraft Gesetzes ist und ihm e<strong>in</strong> Stimmrecht zusteht. Andererseits schränkt die Vorschrift die Rechte des Bürgermeisters<br />
nur für den Fall wieder e<strong>in</strong>, dass die Ratsmitglieder über se<strong>in</strong>e Entlastung entscheiden, denn <strong>in</strong> der Sache<br />
gilt er dann als befangen. Durch die Vorschrift wird daher der Bürgermeister nicht ausdrücklich von der Teilnahme<br />
an der Abstimmung über die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung ausgeschlossen.<br />
In der Sache „Beschluss über die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung“ dürfte es jedoch aus Verfahrensgründen heraus<br />
geboten se<strong>in</strong>, dass der Bürgermeister auf die Ausübung des ihm nach § 40 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> zustehenden<br />
Stimmrechtes verzichtet. Nach § 80 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> hat der Bürgermeister den ihm vom Kämmerer vorgelegten<br />
Entwurf der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen zu bestätigen, bevor er die Satzung dem Rat<br />
zuleitet. Er kommt dieser Pflicht durch se<strong>in</strong>e Unterzeichnung des Entwurfs nach und übernimmt damit die verwaltungsmäßige<br />
Verantwortung, denn er ist verantwortlich für die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs<br />
der gesamten Verwaltung (vgl. § 62 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>). Außerdem steht dem Bürgermeister <strong>in</strong> diesem Zusammenhang<br />
neben se<strong>in</strong>er Verantwortung für die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung mit ihren Anlagen auch e<strong>in</strong> Änderungsrecht<br />
bezogen auf den Entwurf des Kämmerers zu.<br />
4.2 Zu Satz 2 (Vortrag der abweichenden Auffassung des Kämmerers):<br />
Das Rederecht des Kämmerers, se<strong>in</strong>e abweichende Auffassung zum durch den Bürgermeister veränderten Entwurf<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung <strong>in</strong> der betreffenden Ratssitzung zu vertreten, setzt voraus, dass der<br />
Kämmerer zuvor <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er schriftlichen Stellungnahme se<strong>in</strong>e abweichende Auffassung dargelegt hat. Insbesondere<br />
wenn wegen der Änderungen der Entwurfsfassung noch Differenzen zwischen dem Kämmerer und dem Bürgermeister<br />
bestehen geblieben s<strong>in</strong>d, sollen diese im Rahmen der Beratungen des Rates über den Entwurf der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltssatzung ausgeräumt werden. Die abweichende Auffassung des Kämmerers kann <strong>in</strong> den<br />
Beratungen des Rates jedoch nicht vom Bürgermeister vorgetragen werden. Nur wenn der Kämmerer selbst<br />
anwesend ist, darf er se<strong>in</strong>e abweichende Auffassung vortragen.<br />
GEMEINDEORDNUNG 328
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 80 GO <strong>NRW</strong><br />
5. Zu Absatz 5 (Veröffentlichung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung):<br />
5.1 Zu Satz 1 (Pflicht zur Anzeige der Haushaltssatzung):<br />
5.1.1 Pflichten der Geme<strong>in</strong>de<br />
Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften hat die Geme<strong>in</strong>de spätestens e<strong>in</strong>en Monat vor Beg<strong>in</strong>n des Haushaltsjahres<br />
ihrer Aufsichtsbehörde die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen anzuzeigen. Die Haushaltssatzung unterliegt<br />
jedoch ke<strong>in</strong>er grundsätzlichen Genehmigungspflicht, denn sie ist Ausdruck der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzhoheit<br />
und der Selbstverwaltung der Geme<strong>in</strong>de. E<strong>in</strong> Erlaubnisvorbehalt durch die staatliche Aufsicht kommt daher für<br />
den Regelfall nicht <strong>in</strong> Betracht. Nur wenn im E<strong>in</strong>zelfall von der Geme<strong>in</strong>de die allgeme<strong>in</strong>e Rücklage verr<strong>in</strong>gert<br />
werden soll (vgl. § 75 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong>) oder e<strong>in</strong> besonderes Haushaltssicherungskonzept (vgl. § 76 GO <strong>NRW</strong>)<br />
aufzustellen ist, das dann e<strong>in</strong>en Bestandteil des geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplans darstellt (vgl. § 79 Abs. 2 S. 2 GO<br />
<strong>NRW</strong> i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO <strong>NRW</strong>), lösen solche Tatbestände e<strong>in</strong>e Genehmigungspflicht lediglich für<br />
diesen Sachverhalt, nicht jedoch für die gesamte Haushaltssatzung der Geme<strong>in</strong>de aus.<br />
5.1.2 Pflichten der Aufsichtsbehörde<br />
5.1.2.1 Die Stellung der Aufsichtsbehörde<br />
Die Geme<strong>in</strong>de ist <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen e<strong>in</strong>e Gebietskörperschaft mit dem Recht der Selbstverwaltung durch<br />
ihre gewählten Organe und ist <strong>in</strong> ihrem Gebiet die alle<strong>in</strong>ige Träger<strong>in</strong> der öffentlichen Verwaltung, sowie die Gesetze<br />
nicht anderes vorschreiben (vgl. Art. 78 LV <strong>NRW</strong>). In diesem Zusammenhang hat das Land die Gesetzmäßigkeit<br />
der Verwaltung der Geme<strong>in</strong>de zu überwachen (vgl. Art. 78 Abs. 4 LV <strong>NRW</strong>). Die Geme<strong>in</strong>deordnung <strong>in</strong><br />
Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen baut darauf auf und enthält deshalb Rechte und Pflichten sowie auch Regelungen über die<br />
Gestaltung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft sowie auch Rechte für die Aufsichtsbehörde der Geme<strong>in</strong>de.<br />
Diese Rechte werden im 13. Teil der Geme<strong>in</strong>deordnung <strong>NRW</strong> durch die §§ 119 bis 128 näher ausgestaltet.<br />
Die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft gehört <strong>in</strong> diesem rechtlichen Rahmen zu den Selbstverwaltungsaufgaben<br />
der Geme<strong>in</strong>de, so dass die Aufsicht des Landes darüber e<strong>in</strong> Teil der allgeme<strong>in</strong>en Aufsicht nach § 119 GO <strong>NRW</strong><br />
ist. Diese Rechtsaufsicht erstreckt sich darauf, dass die Geme<strong>in</strong>de im E<strong>in</strong>klang mit den Gesetzen verwaltet wird.<br />
In diesem S<strong>in</strong>ne enthält die Geme<strong>in</strong>deordnung <strong>NRW</strong> an verschiedenen Stellen besondere Vorgaben für e<strong>in</strong>e<br />
Beteiligung der gesetzlich zuständigen Aufsichtsbehörde bei der Planung, Ausführung und Abrechnung der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltswirtschaft, z.B. <strong>in</strong> Form der Anzeige der Haushaltssatzung oder des Jahresabschlusses.<br />
Daneben besteht für die Aufsichtsbehörde e<strong>in</strong> umfassendes Informationsrecht, denn sie kann sich jederzeit über<br />
die Angelegenheiten der Geme<strong>in</strong>de unterrichten lassen (vgl. § 121 GO <strong>NRW</strong>).<br />
5.1.2.2 Aufsicht über die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft<br />
Die Aufsichtsbehörde hat im Rahmen des Anzeigeverfahrens die E<strong>in</strong>haltung der rechtlichen Vorgaben zu überprüfen<br />
und dabei das Ermessen der Geme<strong>in</strong>de zu beachten. Dieses gilt unabhängig davon, dass e<strong>in</strong>e Genehmigungspflicht<br />
für die Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage (vgl. § 75 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong>) und für das Haushaltssicherungskonzept<br />
(vgl. § 76 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>) besteht. Die mit der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan der<br />
Aufsichtsbehörde der Geme<strong>in</strong>de vorzulegenden Unterlagen s<strong>in</strong>d für e<strong>in</strong>e Gesamtübersicht über die Vermögens-,<br />
Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de, die auch die Aufsichtsbehörde haben sollte, unverzichtbar.<br />
Diese Unterlagen müssen zusammen mit dem Haushaltsplan für e<strong>in</strong>e Unterrichtung der Aufsichtsbehörde der<br />
Geme<strong>in</strong>de geeignet se<strong>in</strong>. Den Geme<strong>in</strong>den bleibt es dabei freigestellt, nach örtlichen Bedürfnissen dem Haushaltsplan<br />
noch weitere Unterlagen beizufügen.<br />
GEMEINDEORDNUNG 329
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 80 GO <strong>NRW</strong><br />
Die Anzeigepflicht gibt der Aufsichtsbehörde die Befugnis und die Möglichkeit zur Rechtskontrolle der vom Rat<br />
der Geme<strong>in</strong>de beschlossenen Haushaltssatzung. Dabei ist auch zu prüfen, ob die Geme<strong>in</strong>de sich nicht außerhalb<br />
der ihr zustehenden Ermessensspielräume bewegt, so dass bei der Ausführung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft<br />
voraussichtlich rechtlich erhebliche Fehler gegangen werden können, d.h. auch bei der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltsplanung müssen die Anforderungen der stetigen Aufgabenerfüllung und Leistungsfähigkeit der Geme<strong>in</strong>de<br />
(vgl. § 75 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>) erfüllt werden.<br />
Die staatliche Aufsicht soll aber auch das Budgetrecht des Rates <strong>in</strong> der Weise sichern, dass dieser über e<strong>in</strong>en<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Haushalt beschließen kann, der sich noch nicht <strong>in</strong> der Ausführung bzw. der vorläufigen Ausführung<br />
nach § 82 GO <strong>NRW</strong> bef<strong>in</strong>det. Je weiter die Beschlussfassung über die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung <strong>in</strong><br />
das neue Haushaltsjahr verschoben wird, desto weniger kann der Rat der Geme<strong>in</strong>de vom se<strong>in</strong>em Recht auf Gestaltung<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft unter Berücksichtigung se<strong>in</strong>er politischen Zielsetzungen Gebrauch<br />
machen. Erfolgt dagegen ke<strong>in</strong>e Äußerung der Aufsichtsbehörde <strong>in</strong>nerhalb der gesetzlichen Monatsfrist, kann die<br />
Geme<strong>in</strong>de nach Ablauf der Monatsfrist ihre Haushaltssatzung bekannt machen.<br />
5.2 Zu Satz 2 (Anzeigefrist für die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung):<br />
5.2.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Durch die gesetzlich bestimmte Anzeigefrist erhält die Aufsichtsbehörde die Befugnis und die Möglichkeit zur<br />
Rechtskontrolle der vom Rat der Geme<strong>in</strong>de beschlossenen Haushaltssatzung. Dabei ist auch zu prüfen, ob die<br />
Geme<strong>in</strong>de sich nicht außerhalb der ihr zustehenden Ermessensspielräume bewegt, so dass bei der Ausführung<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft voraussichtlich rechtlich erhebliche Fehler gegangen werden können. Der<br />
„Grundsatz der Vorherigkeit“, der sich ausdrücklich <strong>in</strong> der Bestimmung wiederf<strong>in</strong>det, dass die vom Rat der Geme<strong>in</strong>de<br />
beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde spätestens e<strong>in</strong>en Monat vor<br />
Beg<strong>in</strong>n des Haushaltsjahres anzuzeigen ist, verpflichtet alle Beteiligte am geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsaufstellungsverfahren<br />
zur rechtzeitigen Beschlussfassung des Rates über die Haushaltssatzung und zur Anzeige an die Aufsichtsbehörde<br />
beizutragen, da mit die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung für die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr<br />
rechtzeitig <strong>in</strong> Kraft treten kann.<br />
In den Fällen, <strong>in</strong> denen die Geme<strong>in</strong>de ihrer gesetzlichen Verpflichtung zur Anzeige der Haushaltssatzung mit<br />
ihren Anlagen zu dem <strong>in</strong> der Vorschrift festgelegten Term<strong>in</strong> nicht nachkommt, hat sie ihre Aufsichtsbehörde darüber<br />
zu unterrichten und die Anzeige baldmöglichst vorzunehmen. Sie hat <strong>in</strong> ihrem Bericht an die Aufsichtsbehörde<br />
die Gründe für das Versäumnis anzugeben sowie aufzuzeigen, welcher Verfahrensstand bei der Aufstellung<br />
der Haushaltssatzung besteht, wann der Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung vorgesehen ist<br />
und bis zu welchem schnellstmöglichen Zeitpunkt die Anzeige bei der Aufsichtsbehörde nachgeholt wird.<br />
5.2.2 Wirkungen der Frist auf den Jahresabschluss des Vorvorjahres<br />
Die gesetzliche Anzeigefrist für die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wirkt auch ohne ausdrücklichen<br />
Verweis auf die Frist zur Feststellung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses <strong>in</strong> § 96 Abs. 1 S. 1 GO <strong>NRW</strong>,<br />
soweit der Jahresabschluss des Vorvorjahres des neuen Haushaltsjahres noch nicht festgestellt. Die Haushaltssatzung<br />
mit ihren Anlagen z.B. für das Haushaltsjahr 2011 wäre nach der Vorschrift der Aufsichtsbehörde bis zum<br />
01. Dezember 2010 anzuzeigen. Nach § 1 Abs. 3 GemHVO <strong>NRW</strong> s<strong>in</strong>d den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr<br />
zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie E<strong>in</strong>zahlungen und Auszahlungen u.a. die Ergebnisse<br />
der Rechnung des Vorvorjahres voranzustellen. Dem geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan ist außerdem auch die<br />
Bilanz des Vorvorjahres (also 2009) beizufügen. Dadurch ergibt sich für den geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss für<br />
das Haushaltsjahr 2009, dass dieser bis zum Beg<strong>in</strong>n der <strong>in</strong> dieser Vorschrift genannten Anzeigefrist festgestellt<br />
GEMEINDEORDNUNG 330
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 80 GO <strong>NRW</strong><br />
se<strong>in</strong> sollte. Kommt es aber zu term<strong>in</strong>lichen Überschneidungen muss örtlich sichergestellt werden, dass die Angaben<br />
im neuen geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan auf belastbaren Daten aufbauen.<br />
5.3 Zu Satz 3 (Bekanntmachung der Haushaltssatzung):<br />
5.3.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Als geme<strong>in</strong>dliche Rechtsnorm bedarf die Haushaltssatzung der Bekanntmachung, denn geme<strong>in</strong>dliche Satzungen<br />
s<strong>in</strong>d öffentlich bekannt zu machen (vgl. § 7 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong>). Für die Bekanntmachung der Haushaltssatzung<br />
durch die Geme<strong>in</strong>de ist und die Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht<br />
(Bekanntmachungsverordnung - BekanntmVO) zu beachten. Bei der Bekanntmachung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung<br />
ist es nicht erforderlich, auch ihre Anlagen <strong>in</strong> der Bekanntmachung, z.B. im Amtsblatt der Geme<strong>in</strong>de<br />
mit abzudrucken.<br />
Die Bekanntmachungsverordnung lässt zu, dass bestimmte Materialien, die Bestandteile e<strong>in</strong>er Satzung s<strong>in</strong>d,<br />
stattdessen zu jedermanns E<strong>in</strong>sicht an e<strong>in</strong>er bestimmten Stelle der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung ausgelegt werden<br />
können (vgl. § 3 Abs. 2 BekanntmVO <strong>NRW</strong>). Daher muss der geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsplan mit se<strong>in</strong>en Anlagen<br />
nicht im Rahmen des Bekanntmachungstextes veröffentlicht werden. Vor der Bekanntmachung der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltssatzung sollte aber geprüft werden, ob die Haushaltssatzung den materiellen und formellen Anforderungen<br />
entspricht und die für die Bekanntmachung notwendigen Verfahrensschritte nach den e<strong>in</strong>schlägigen<br />
Rechtsvorschriften erfolgt s<strong>in</strong>d (vgl. § 2 BekanntmVO <strong>NRW</strong>).<br />
5.3.2 Zwecke der Bekanntmachung<br />
Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfüllt als Information an die E<strong>in</strong>wohner und Abgabepflichtigen aber<br />
nur dann ihren Zweck, wenn dar<strong>in</strong> auch die wichtigsten Angaben aus dem Ergebnisplan und aus dem F<strong>in</strong>anzplan<br />
sowie aus der Haushaltssatzung öffentlich gemacht werden. Die E<strong>in</strong>wohner und Abgabepflichtigen können sich<br />
dann weitere Kenntnisse über die Haushaltsplanung der Geme<strong>in</strong>de verschaffen. Sie erhalten mit e<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>sichtnahme<br />
e<strong>in</strong> umfassendes und zutreffendes Bild über die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft. Es bleibt dabei der<br />
Geme<strong>in</strong>de überlassen, ob sie die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen <strong>in</strong> herkömmlicher Weise als Druckwerk<br />
oder im Internet verfügbar macht oder <strong>in</strong> sonstiger Weise ihre E<strong>in</strong>wohner und Abgabepflichtigen über die wirtschaftliche<br />
Lage der Geme<strong>in</strong>de und die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsplanung <strong>in</strong>formiert. Diese besondere Vorschrift<br />
über den Zugang zu amtlichen Unterlagen der Geme<strong>in</strong>de lässt die Vorschriften des Informationsfreiheitsgesetzes<br />
Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen (IFG <strong>NRW</strong>) unberührt.<br />
5.3.3 Prüfpflichten vor der Bekanntmachung<br />
Vor der Bekanntmachung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen, bei der die Frist <strong>in</strong> § 80 Abs. 5<br />
S. 3 GO <strong>NRW</strong> zu beachten ist, hat der Bürgermeister zu prüfen, ob die vom Rat der Geme<strong>in</strong>de beschlossene<br />
Haushaltssatzung den materiellen und formellen Anforderungen entspricht und ordnungsgemäß zustande gekommen<br />
ist (vgl. § 2 Abs. 1 BekanntmVO <strong>NRW</strong>). Er hat dafür Sorge zu tragen, dass im Verfahren vor der öffentlichen<br />
Bekanntmachung e<strong>in</strong>zuhaltende Vorschriften e<strong>in</strong>gehalten werden, so dass mögliche H<strong>in</strong>dernisse für die<br />
Bekanntmachung vermieden werden. Ihm obliegt zudem die Pflicht, die gesetzlich erforderlichen Genehmigungen,<br />
z.B. für die Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage (vgl. § 75 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong>) oder für e<strong>in</strong> aufgestelltes<br />
Haushaltssicherungskonzept (vgl. § 76 GO <strong>NRW</strong>), e<strong>in</strong>zuholen. Dabei kann es <strong>in</strong> E<strong>in</strong>zelfällen erforderlich werden,<br />
e<strong>in</strong>en erneuten Beschluss des Rates herbeizuführen (Beitrittsbeschluss).<br />
GEMEINDEORDNUNG 331
5.3.4 Fristen bei der Bekanntmachung<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 80 GO <strong>NRW</strong><br />
Die Haushaltssatzung darf frühestens e<strong>in</strong>en Monat nach der Anzeige bei der Aufsichtsbehörde öffentlich bekannt<br />
gemacht werden, wenn nicht im E<strong>in</strong>zelfall aus besonderem Grund die Anzeigefrist durch die Aufsichtsbehörde<br />
verkürzt oder verlängert wird. Ist e<strong>in</strong> Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO <strong>NRW</strong> aufzustellen, so darf die<br />
Haushaltssatzung erst nach Erteilung der Genehmigung bekannt gemacht werden. Auch wenn e<strong>in</strong>e Verr<strong>in</strong>gerung<br />
der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage nach § 75 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong> <strong>in</strong> der Haushaltssatzung festgesetzt ist, darf die Haushaltssatzung<br />
erst nach Erteilung der gesetzlich vorgesehenen Genehmigung bekannt gemacht werden, auch wenn<br />
dies nicht ausdrücklich <strong>in</strong> dieser Vorschrift geregelt wurde.<br />
Die Haushaltssatzung tritt nach Ihrer Bekanntmachung <strong>in</strong> Kraft und gilt für das Haushaltsjahr, für das sie vom Rat<br />
beschlossen wurde. Wird die Haushaltssatzung vor Beg<strong>in</strong>n des Haushaltsjahres bekannt gemacht, tritt sie erst<br />
mit Beg<strong>in</strong>n des Haushaltsjahres <strong>in</strong> Kraft und gilt für das betreffende Haushaltsjahr. Das Haushaltsjahr deckt sich<br />
dabei zeitlich immer mit dem Kalenderjahr. Somit besteht e<strong>in</strong>e Übere<strong>in</strong>stimmung der haushaltswirtschaftlichen<br />
Periode des geme<strong>in</strong>dlichen Haushalts mit den sonstigen öffentlichen Haushalten und auch mit den Wirtschaftsjahren<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Unternehmen und E<strong>in</strong>richtungen. Wenn die Haushaltssatzung jedoch erst nach Beg<strong>in</strong>n<br />
des Haushaltsjahres vom Rat beschlossen und bekannt gemacht wird, tritt sie rückwirkend mit Beg<strong>in</strong>n des Haushaltsjahres<br />
<strong>in</strong> Kraft und gilt auch dann für das betreffende Haushaltsjahr.<br />
5.3.5 H<strong>in</strong>dernisse für die Bekanntmachung<br />
Im Rahmen se<strong>in</strong>er Prüfung, ob die vom Rat der Geme<strong>in</strong>de beschlossene Haushaltssatzung den materiellen und<br />
formellen Anforderungen entspricht und ordnungsgemäß zustande gekommen ist (vgl. § 2 Abs. 1 BekanntmVO<br />
<strong>NRW</strong>), hat der Bürgermeister festzustellen, ob der Bekanntmachung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung möglicherweise<br />
H<strong>in</strong>dernisse entgegenstehen und solche ggf. mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln schnellstmöglich<br />
zu beseitigen. Erst nach Beseitigung solcher H<strong>in</strong>dernisse darf die Haushaltssatzung öffentlich bekannt<br />
gemacht werden und kann <strong>in</strong> Kraft treten.<br />
E<strong>in</strong> mögliches H<strong>in</strong>dernis stellt auch die nach der Zuleitung des Entwurfs der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung mit<br />
ihren Anlagen an den Rat nicht vorgenommene Bekanntgabe der Möglichkeit zur Erhebung von E<strong>in</strong>wendungen<br />
gegen den Entwurf der Haushaltssatzung durch die E<strong>in</strong>wohner oder Abgabepflichtige dar. Für die gesetzlich<br />
bestimmte E<strong>in</strong>sichtnahme ist m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>e Frist von vierzehn Tagen festzulegen und es ist die Stelle <strong>in</strong> der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung anzugeben, bei der die E<strong>in</strong>wendungen zu erheben s<strong>in</strong>d. E<strong>in</strong> H<strong>in</strong>dernis für die Bekanntmachung<br />
der Haushaltssatzung kann auch dadurch entstehen, dass der Beschluss über die Haushaltssatzung<br />
nicht alle gesetzlich vorgesehenen Bestandteile, Anlagen oder Unterlagen umfasst. Ist ggf. e<strong>in</strong>e gesetzlich<br />
vorgesehene Anlage, z.B. der Stellenplan (vgl. § 79 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>), nicht Teil des Beschlusses des Rates über<br />
die Haushaltssatzung und ihre Anlagen (vgl. § 80 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong>), ist damit e<strong>in</strong> Ratsbeschluss zustande gekommen,<br />
der e<strong>in</strong>e Bekanntmachung der Haushaltssatzung nicht zulässt.<br />
Weitere H<strong>in</strong>dernisse für die die Bekanntmachung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung stellen auch e<strong>in</strong>e fehlende<br />
Genehmigung für die vorgesehene Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage nach § 75 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong> oder die<br />
fehlende Genehmigung der Aufsichtsbehörde für e<strong>in</strong> Haushaltssicherungskonzept, das dem Ziel dient, im Rahmen<br />
e<strong>in</strong>er geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Geme<strong>in</strong>de zu erreichen,<br />
dar. Derartige H<strong>in</strong>dernisse hat die Geme<strong>in</strong>de möglichst unverzüglich zu beseitigen.<br />
5.3.6 Bekanntmachung e<strong>in</strong>er Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre<br />
Bei der Bekanntmachung e<strong>in</strong>er Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre ist bei e<strong>in</strong>em <strong>in</strong> der Haushaltssatzung<br />
nur für das zweite Haushaltsjahr vorgesehenen Ausgleich des Ergebnisplans durch e<strong>in</strong>e Verr<strong>in</strong>gerung der allge-<br />
GEMEINDEORDNUNG 332
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 80 GO <strong>NRW</strong><br />
me<strong>in</strong>en Rücklage zu beachten, dass wegen der dafür gesetzlich erforderlichen Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde<br />
(vgl. § 75 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong>) die Haushaltssatzung erst nach der Erteilung der Genehmigung bekannt<br />
gemacht darf. Die getrennten Festsetzungen für die e<strong>in</strong>zelnen Haushaltsjahre <strong>in</strong> der Haushaltssatzung<br />
stellen ke<strong>in</strong>e Grundlage dafür dar, bei e<strong>in</strong>em Haushaltsausgleich im ersten Haushaltsjahr auch e<strong>in</strong>e auf das e<strong>in</strong>zelne<br />
Haushaltsjahr bezogene Bekanntmachung der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen vorzunehmen. Die<br />
Haushaltssatzung stellt bei Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre immer e<strong>in</strong> Gesamtwerk für diesen Zeitraum<br />
dar, das nicht aufgeteilt werden darf, aber getrennte Festlegungen für die beiden Haushaltsjahre enthält.<br />
5.3.7 Vollzug der Bekanntmachung<br />
Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung ist mit Ablauf des Ersche<strong>in</strong>ungstages des Amtsblattes<br />
oder der Zeitung vollzogen. Erfolgt die Bekanntmachung <strong>in</strong> mehreren Zeitungen, ist die Bekanntmachung mit<br />
Ablauf des Tages der zuletzt erschienenen Zeitung vollzogen (vgl. § 6 BekanntmVO). Die Öffentlichkeit kann<br />
nicht <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>e bestimmten Auslegungsfrist von der vom Rat beschlossenen Haushaltssatzung Kenntnis<br />
nehmen, sondern sich im Rahmen des dauernden Verfügbarhaltens der Haushaltssatzung und der E<strong>in</strong>sichtnahme<br />
<strong>in</strong>formieren (vgl. Absatz 6). Auch bei diesem langfristigen Verfügbarhalten der Haushaltssatzung ist die Bekanntmachung<br />
mit Ablauf des Ersche<strong>in</strong>ungstages vollzogen.<br />
5.4 Zu Satz 4 (Anpassung der Anzeigefrist):<br />
Nach der Vorschrift darf die Aufsichtsbehörde im E<strong>in</strong>zelfall aus besonderem Grund die Anzeigefrist gegenüber<br />
der Geme<strong>in</strong>de verkürzen oder verlängern, um die notwendige Zeit zur Prüfung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung<br />
mit ihren Anlagen zu erreichen. Sie ermöglicht der Aufsichtsbehörde aber auch das ggf. notwendig werdende<br />
E<strong>in</strong>greifen gegenüber der Geme<strong>in</strong>de im Rahmen ihrer haushaltswirtschaftlichen Aufsicht, denn sie hat die ihr<br />
vorgelegte Haushaltssatzung mit ihren Anlagen grundsätzlich dah<strong>in</strong>gehend zu prüfen, ob diese formal und <strong>in</strong>haltlich<br />
den e<strong>in</strong>schlägigen Rechtsvorschriften entspricht. Der eigentlichen Haushaltsanalyse soll daher e<strong>in</strong>e formelle<br />
Prüfung vorausgehen, bei der auf die Ordnungsmäßigkeit der vom Rat beschlossenen Haushaltssatzung und<br />
ihrer Anlagen abzustellen ist.<br />
Die Aufsichtsbehörde hat nicht nur die Vollständigkeit der vorgelegten haushaltswirtschaftlichen Unterlagen, sondern<br />
auch das Vorliegen e<strong>in</strong>er ausreichenden <strong>in</strong>haltlichen Bestimmtheit und Aussagekraft dieser Unterlagen zu<br />
prüfen. Die Tätigkeit der Aufsichtsbehörde erfordert zudem, auch das Verfahren der Aufstellung der Haushaltssatzung<br />
der Geme<strong>in</strong>de zu kennen, um ggf. erkannte Rechtsverstöße mit den verfügbaren Mitteln beanstanden zu<br />
können. Hat die Aufsichtsbehörde Bedenken gegen die beschlossene Haushaltssatzung der Geme<strong>in</strong>de, hat sie<br />
dieser e<strong>in</strong>e angemessene Frist zur Stellungnahme zu setzen, damit die Bedenken ausgeräumt werden können.<br />
Dazu soll die Anzeigefrist nach dieser Vorschrift förmlich verlängert werden. Können die Bedenken von der Geme<strong>in</strong>de<br />
nicht ausgeräumt werden und ist z.B. e<strong>in</strong>e Festsetzung <strong>in</strong> der Haushaltssatzung zu beanstanden, ist<br />
diese vom Rat der Geme<strong>in</strong>de neu zu beschließen.<br />
5.5 Zu Satz 5 (Bekanntmachung der Haushaltssatzung bei Genehmigungspflichten):<br />
5.5.1 Bekanntmachung nach Genehmigung<br />
Nach der Vorschrift darf e<strong>in</strong>e genehmigungspflichtige geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung erst bekannt gemacht<br />
werden, wenn die Aufsichtsbehörde die erforderliche Genehmigung erteilt hat. Diese Regelung ist erforderlich,<br />
denn <strong>in</strong> besonderen Fällen, z.B. bei der Pflicht der Geme<strong>in</strong>de zur Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes<br />
(vgl. § 76 GO <strong>NRW</strong>), das als Bestandteil des Haushaltsplans (vgl. § 79 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>) auch der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltssatzung zuzurechnen ist, besteht e<strong>in</strong>e gesonderte Genehmigungspflicht (vgl. § 76 Abs. 2 GO<br />
GEMEINDEORDNUNG 333
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 80 GO <strong>NRW</strong><br />
<strong>NRW</strong>). Außerdem besteht e<strong>in</strong> Genehmigungserfordernis, wenn die Haushaltssatzung der Geme<strong>in</strong>de die Festsetzung<br />
e<strong>in</strong>er Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans enthält (vgl. § 75 Abs. 4<br />
GO <strong>NRW</strong>). In diesen Fällen kann die Haushaltssatzung nicht ohne e<strong>in</strong>e vorherige Genehmigung der Aufsichtsbehörde<br />
bekannt gemacht werden.<br />
Bei der Erteilung der von der Geme<strong>in</strong>de erbetenen Genehmigung hat die Aufsichtsbehörde nach den Umständen<br />
des E<strong>in</strong>zelfalls zu entscheiden. Die Aufsichtsbehörde muss bei der Erteilung der Genehmigung den ihr zustehenden<br />
Ermessensspielraum nach den haushaltsrechtlichen Zielbestimmungen ausgestalten. Hierbei kommt dem<br />
Ziel, wieder e<strong>in</strong>en ausgeglichenen Haushalt nach § 75 Abs. 2 GO zu erreichen, die zentrale Bedeutung zu. Dies<br />
gilt auch dann, wenn die vorgesehene Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage der Kommune im Haushaltsjahr<br />
noch als haushaltsverträglich betrachtet werden kann, aber <strong>in</strong>sbesondere nach der mittelfristigen Ergebnis- und<br />
F<strong>in</strong>anzplanung e<strong>in</strong>e Gefährdung der Haushaltswirtschaft zu befürchten ist.<br />
Die im Haushaltsplan enthaltene und gem. § 84 Satz 3 GO jahresbezogen auszugleichende mittelfristige Ergebnis-<br />
und F<strong>in</strong>anzplanung stellt e<strong>in</strong> Kriterium dar, das im Genehmigungsverfahren zu berücksichtigen ist. Lassen<br />
sich aus den Planungsdaten für die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre ke<strong>in</strong>e ausreichenden Veränderungen zur<br />
Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs erkennen, soll die Aufsichtsbehörde durch entsprechende Nebenbestimmungen<br />
<strong>in</strong> der Genehmigung wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zur Wiedererreichung des gesetzlich<br />
bestimmten Haushaltsausgleichs von der Geme<strong>in</strong>de verlangen. Die Aufsichtsbehörde darf aber auch die Genehmigungsfiktion<br />
<strong>in</strong> § 75 Abs. 4 Satz 2 GO nicht außer achtlassen. Von der Genehmigungsfiktion des § 75 Abs. 4<br />
Satz 2 GO kann jedenfalls dann Gebrauch gemacht werden, wenn ke<strong>in</strong>e durchgreifenden haushaltswirtschaftlichen<br />
Gründe gegen die vorgesehene Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage durch die Kommune sprechen.<br />
5.5.2 Genehmigung nicht für Haushaltssatzung<br />
Die Geme<strong>in</strong>den können ihre Angelegenheiten durch Satzungen regeln, soweit die Gesetze nichts anderes bestimmen<br />
(vgl. § 7 GO <strong>NRW</strong>). E<strong>in</strong> auf e<strong>in</strong>er geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsatzung aufbauender Haushalt ist somit Ausdruck<br />
der F<strong>in</strong>anzhoheit und Selbstverwaltung der Geme<strong>in</strong>de. Der Erlass und die Änderung oder Aufhebung e<strong>in</strong>er<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Satzung ist grundsätzlich genehmigungsfrei, wenn dies nicht besonders gesetzlich vorgeschrieben<br />
ist (vgl. § 7 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>). Für die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung besteht ke<strong>in</strong>e gesetzlich vorgesehene<br />
Genehmigungspflicht, sondern nur e<strong>in</strong>e Anzeigepflicht gegenüber der zuständigen Aufsichtsbehörde (vgl. § 80<br />
Abs. 5 GO <strong>NRW</strong>).<br />
6. Zu Absatz 6 (Verfügbarhalten der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen):<br />
6.1 Zweck und Zeitraum des Verfügbarhaltens<br />
Nach der Vorschrift ist die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für die Bürger<strong>in</strong>nen und Bürger bis<br />
zum Ende der E<strong>in</strong>sichtnahme <strong>in</strong> den geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss verfügbar zu halten und nicht nur an wenigen<br />
Tagen auszulegen. Das Zusammenführen von Haushaltsplan und Jahresabschluss des gleichen Haushaltsjahres<br />
erleichtert den vollständigen Überblick über die Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> diesem Haushaltsjahr.<br />
Es ist dabei unerheblich, dass <strong>in</strong> der Zeit nach der Beschlussfassung des Rates ke<strong>in</strong> unmittelbares E<strong>in</strong>wendungsrecht<br />
mehr für die E<strong>in</strong>wohner und Abgabepflichtigen besteht.<br />
Der Zeitraum von <strong>in</strong>sgesamt etwa drei Jahren, <strong>in</strong> dem anfangs nur der Haushaltsplan und später auch der Jahresabschluss<br />
für die Bürger zur E<strong>in</strong>sichtnahme verfügbar gehalten werden muss, eröffnet neue Möglichkeiten des<br />
politischen Mite<strong>in</strong>anders <strong>in</strong> den Geme<strong>in</strong>den. Er verstärkt die mit der Darstellung des Ressourcenverbrauchs gewollte<br />
Transparenz des geme<strong>in</strong>dlichen Handelns und trägt zur Bürgerfreundlichkeit von Rat und Verwaltung bei.<br />
GEMEINDEORDNUNG 334
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 80 GO <strong>NRW</strong><br />
Nachfolgend wird der Zeitablauf des Verfügbarhaltens der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr<br />
2011 aufgezeigt (vgl. Abbildung).<br />
Zeitraum des Verfügbarhaltens der Haushaltsplanung 2011<br />
Aufgabe<br />
Aufstellung und Zuleitung des Entwurfs der<br />
Haushaltssatzung an den Rat<br />
Bekanntgabe des Entwurfs der Haushaltssatzung<br />
mit Festlegung e<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>wendungsfrist<br />
Verfügbarhalten des Entwurfs der Haushaltssatzung<br />
während des Beratungsverfahrens im Rat<br />
Beschlussfassung des Rates<br />
Anzeige der Haushaltssatzung<br />
an die Aufsichtsbehörde<br />
Bekanntmachung<br />
der Haushaltssatzung<br />
In-Kraft-Treten<br />
der Haushaltssatzung<br />
Verfügbarhalten der Haushaltssatzung<br />
bis zur Feststellung des Jahresabschlusses<br />
Aufstellung und Zuleitung<br />
des Entwurfs des Jahresabschlusses an den Rat<br />
Prüfung des Entwurfs des Jahresabschlusses<br />
durch den Rechnungsprüfungsausschuss<br />
Feststellung des Jahresabschlusses<br />
durch den Rat<br />
Anzeige des Jahresabschlusses<br />
an die Aufsichtsbehörde<br />
Bekanntmachung<br />
des Jahresabschlusses<br />
Verfügbarhalten des Jahresabschlusses<br />
bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses<br />
Datum<br />
z.B. bis zum 15. September 2010<br />
Örtliche Fristsetzung<br />
Örtliche Fristsetzung<br />
z.B. zum 15.11.2010<br />
bis zum 30.11.2010<br />
bis zum 31.12. 2010<br />
zum 01.01.2011<br />
Bis zum 31. Dezember 2012<br />
Bis zum 31. März 2012<br />
Örtliche Fristsetzung<br />
Bis zum 31. Dezember 2012<br />
Unverzüglich nach Feststellung<br />
Nach Feststellung<br />
Bis zum 31. Dezember 2013<br />
Abbildung 51 „Zeitraum des Verfügbarhaltens der Haushaltsplanung 2011“<br />
Mit der öffentlichen Bereitstellung <strong>in</strong> dieses geme<strong>in</strong>dliche haushaltswirtschaftliche „Grundwerk“ und dem E<strong>in</strong>sichtsrecht<br />
wird zudem dem Grundsatz der Öffentlichkeit, der sich durch das gesamte geme<strong>in</strong>dliche Haushalts-<br />
GEMEINDEORDNUNG 335
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 80 GO <strong>NRW</strong><br />
verfahren zieht, <strong>in</strong> ausreichendem Maße Rechnung getragen. Die vom Rat der Geme<strong>in</strong>de beschlossene Haushaltssatzung<br />
mit ihren Anlagen gilt dabei als Ausdruck des haushaltswirtschaftlichen Handelns <strong>in</strong> der Eigenverantwortung<br />
der Geme<strong>in</strong>de.<br />
6.2 Formen des Verfügbarhaltens<br />
6.2.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung werden die wichtigsten Angaben aus dem Ergebnisplan, dem<br />
F<strong>in</strong>anzplan sowie aus der Haushaltssatzung veröffentlicht. Der Grundsatz der Öffentlichkeit zieht sich durch das<br />
gesamte geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsverfahren. Die E<strong>in</strong>wohner und Abgabepflichtigen können sich durch E<strong>in</strong>sichtnahme<br />
weitere Kenntnisse über die Haushaltssituation der Kommune verschaffen. Das Informationsangebot an<br />
die E<strong>in</strong>wohner und Abgabepflichtigen der Geme<strong>in</strong>de über den geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan als „Grundwerk“ des<br />
haushaltswirtschaftlichen Handelns der Geme<strong>in</strong>de erfordert nicht, dass im betreffenden Haushaltsjahr laufend<br />
und der Ausführung des Haushaltsplan entsprechend ergänzende Informationen gegeben werden müssen.<br />
E<strong>in</strong>e unterjährige Aktualisierung des Haushaltsplans muss nur erfolgen, wenn die beschlossene Haushaltssatzung<br />
durch e<strong>in</strong>e Nachtragssatzung geändert wurde (vgl. § 81 GO <strong>NRW</strong>). Der dazu aufgestellte Nachtragshaushaltsplan<br />
muss zusammen mit dem ursprünglichen Haushaltsplan den nunmehr geltenden Planungsstand transparent<br />
und nachvollziehbar für den o.a. Adressatenkreis aufzeigen. Es bleibt aber der Geme<strong>in</strong>de überlassen, ob<br />
sie den beschlossenen Haushaltsplan <strong>in</strong> herkömmlicher Weise als Druckwerk bereithält oder im Internet verfügbar<br />
macht oder ob sie <strong>in</strong> sonstiger Weise ihre E<strong>in</strong>wohner und Abgabepflichtigen über ihre wirtschaftliche Lage<br />
<strong>in</strong>formiert.<br />
6.2.2 Verfügbarhalten im Internet<br />
Mit der Veröffentlichung von Haushaltsunterlagen im Internet könnte e<strong>in</strong> wichtiger Beitrag zur Transparenz über<br />
die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft geleistet werden. Sie ist e<strong>in</strong>e zeitgemäße und relativ unaufwändige Form,<br />
die auch dazu beitragen kann, dem Bürger den Zugang zu dem immer noch als sperrig empfundenen kommunalen<br />
Haushalt zu erleichtern. Die vom Rat der Geme<strong>in</strong>de beschlossenen und veröffentlichten Haushaltspläne und<br />
Jahresabschlüsse unterliegen grundsätzlich nicht dem personenbezogenen Datenschutz, sondern sollen gerade<br />
dem Bürger gegenüber den Nachweis über die Verwendung von Steuergeldern erbr<strong>in</strong>gen.<br />
Die Geme<strong>in</strong>de muss beim ihrem Informationsangebot über den geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan im Internet aber<br />
auch bei ihren sonstigen Onl<strong>in</strong>e-Auftritten und -Angeboten sowie bei den von ihr zur Verfügung gestellten Programmoberflächen<br />
im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung berücksichtigen, dass deren technische<br />
Gestaltung auch die Nutzung durch Menschen mit Beh<strong>in</strong>derung ermöglicht (vgl. § 1 i.V.m. § 10 BGG <strong>NRW</strong>). Die<br />
Geme<strong>in</strong>de muss daher nach bestem Bemühen die Erstellung e<strong>in</strong>es barrierefreien Angebotes vornehmen.<br />
Die Inhalte und das Ersche<strong>in</strong>ungsbild des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses im Internet s<strong>in</strong>d daher so zu gestalten,<br />
dass sie für alle Interessierten wahrnehmbar s<strong>in</strong>d (vgl. § 2 BITV <strong>NRW</strong>). Als Barrierefreiheit wird dabei die<br />
Auff<strong>in</strong>dbarkeit, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der gestalteten von der Geme<strong>in</strong>de Lebensbereiche für alle Menschen<br />
angesehen, so dass der Zugang und die Nutzung für Menschen mit Beh<strong>in</strong>derung <strong>in</strong> der allgeme<strong>in</strong> üblichen<br />
Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe möglich se<strong>in</strong> müssen. Zu den zu gestalteten<br />
Lebensbereichen gehören nicht nur bauliche Anlagen und technische Gebrauchsgegenstände, sondern<br />
auch die Systeme der Informationsverarbeitung.<br />
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ<br />
GEMEINDEORDNUNG 336
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 81 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 81<br />
Nachtragssatzung<br />
(1) 1 Die Haushaltssatzung kann nur durch Nachtragssatzung geändert werden, die spätestens bis zum Ablauf<br />
des Haushaltsjahres zu beschließen ist. 2 Für die Nachtragssatzung gelten die Vorschriften für die Haushaltssatzung<br />
entsprechend.<br />
(2) 1 Die Geme<strong>in</strong>de hat unverzüglich e<strong>in</strong>e Nachtragssatzung zu erlassen, wenn<br />
1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit e<strong>in</strong> erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird und<br />
der Haushaltsausgleich nur durch e<strong>in</strong>e Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,<br />
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei e<strong>in</strong>zelnen Haushaltspositionen<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang<br />
geleistet werden müssen,<br />
3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen.<br />
2 Dies gilt nicht für überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im S<strong>in</strong>ne des § 83 Abs. 3.<br />
(3) Absatz 2 Nrn. 2 und 3 f<strong>in</strong>det ke<strong>in</strong>e Anwendung auf<br />
1. ger<strong>in</strong>gfügige Investitionen und Instandsetzungen an Bauten, die unabweisbar s<strong>in</strong>d,<br />
2. Umschuldung von Krediten für Investitionen.<br />
(4) 1 Im Übrigen kann, wenn die Entwicklung der Erträge oder der Aufwendungen oder die Erhaltung der Liquidität<br />
es erfordert, der Rat die Inanspruchnahme von Ermächtigungen sperren. 2 Er kann se<strong>in</strong>e Sperre und die des<br />
Kämmerers oder des Bürgermeisters aufheben.<br />
Erläuterungen zu § 81:<br />
I. Allgeme<strong>in</strong>es<br />
1. Die Pflicht zur Aufstellung e<strong>in</strong>er Nachtragssatzung<br />
Die erforderlichen wesentlichen Änderungen des geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplans für die weitere Ausführung der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft s<strong>in</strong>d vielfach nur durch e<strong>in</strong>e Änderung der vom Rat beschlossenen Haushaltssatzung<br />
(vgl. § 78 GO <strong>NRW</strong>) und damit unter Beteiligung des Rates der Geme<strong>in</strong>de im Rahmen des dafür gesetzlich<br />
vorgesehenen Verfahrens möglich. Diese Vorschrift schließt sich daran an und sieht deshalb bei e<strong>in</strong>em örtlichen<br />
Bedarf an größeren haushaltswirtschaftlichen Anpassungen aus der Ausführung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft<br />
den Erlass e<strong>in</strong>er Nachtragssatzung durch die Geme<strong>in</strong>de vor. Ob örtlich e<strong>in</strong>e solche Sachlage gegeben<br />
ist, kann nur im Vergleich mit der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung bzw. den im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan<br />
enthaltenen Ermächtigungen für das betreffende Haushaltsjahr geklärt werden.<br />
Für den Erlass e<strong>in</strong>er geme<strong>in</strong>dlichen Nachtragssatzung werden <strong>in</strong> Absatz 2 der Vorschrift drei Fälle benannt, bei<br />
denen die Veränderungen der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft vom Gesetzgeber als so schwerwiegend betrachtet<br />
werden, dass von der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>e Nachtragssatzung zu beschließen ist. Der Gesetzgeber sieht <strong>in</strong><br />
diesen Fällen das Gesamtbild der tatsächlichen geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft nicht mehr <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang mit den<br />
haushaltsmäßigen Ermächtigungen durch die vom Rat der Geme<strong>in</strong>de beschlossene Haushaltssatzung und dem<br />
Haushaltsplan. Bei e<strong>in</strong>er solchen Sachlage vor Ort hält er e<strong>in</strong>e Nachtragssatzung für unerlässlich. Über deren<br />
Umfang muss von der Geme<strong>in</strong>de im Vergleich mit der für das betreffende Haushaltsjahr beschlossenen Haushaltssatzung<br />
eigenverantwortlich entschieden werden.<br />
Im Ablauf des geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsjahres kann e<strong>in</strong> Bedarf für e<strong>in</strong>e Nachtragssatzung auch mehrmals auftreten,<br />
so dass auch mehrere Nachtragssatzungen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Haushaltsjahr zulässig s<strong>in</strong>d. E<strong>in</strong>e Nachtragssatzung<br />
GEMEINDEORDNUNG 337
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 81 GO <strong>NRW</strong><br />
kann aber nur erlassen werden, wenn zuvor von der Geme<strong>in</strong>de für das betreffende Haushaltsjahr auch e<strong>in</strong>e<br />
Haushaltssatzung beschlossen und <strong>in</strong> Kraft getreten ist. Liegen die Voraussetzungen für den Erlass e<strong>in</strong>er örtlichen<br />
Nachtragssatzung vor, hat die Geme<strong>in</strong>de diese unverzüglich aufzustellen und darf sie nicht auf e<strong>in</strong>en beliebigen<br />
späteren Zeitpunkt verschieben.<br />
Vor der Beschlussfassung der geme<strong>in</strong>dlichen Nachtragssatzung durch den Rat der Geme<strong>in</strong>de sollte noch e<strong>in</strong>mal<br />
geprüft werden, ob die vorgesehenen Änderungen der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung den materiellen und<br />
formellen Anforderungen entspricht. Die Nachtragssatzung der Geme<strong>in</strong>de unterliegt wie die jährliche Haushaltssatzung<br />
der Geme<strong>in</strong>de zudem nicht e<strong>in</strong>er generellen Genehmigungspflicht durch die zuständige Aufsichtsbehörde,<br />
sondern nur e<strong>in</strong>er Anzeigepflicht (vgl. § 80 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong>). Nur wenn im E<strong>in</strong>zelfall von der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong><br />
besonderes Haushaltssicherungskonzept (vgl. § 76 GO <strong>NRW</strong>) aufzustellen ist, das dann e<strong>in</strong>en Bestandteil des<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplans darstellt (vgl. § 79 Abs. 2 S. 2 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO <strong>NRW</strong>),<br />
löst dieser Tatbestand lediglich e<strong>in</strong>e Genehmigungspflicht für das geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssicherungskonzept aus.<br />
Außerdem müssen die für die Bekanntmachung notwendigen Verfahrensschritte nach den e<strong>in</strong>schlägigen Rechtsvorschriften<br />
durch die Geme<strong>in</strong>de erfolgen (vgl. § 2 BekanntmVO <strong>NRW</strong>).<br />
2. Örtliche Ziele und Nachtragssatzung<br />
Die Pflicht der Geme<strong>in</strong>de zur Aufstellung e<strong>in</strong>er Nachtragssatzung wird dagegen nicht alle<strong>in</strong> durch Veränderungen<br />
der zwischen dem Rat und der Verwaltung der Geme<strong>in</strong>de abgeschlossenen Vere<strong>in</strong>barungen über Ziele und Leistungskennzahlen<br />
ausgelöst, die nach § 12 GemHVO <strong>NRW</strong> im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan enthalten se<strong>in</strong> müssen.<br />
S<strong>in</strong>d im Rahmen der Ausführung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft ausschließlich Änderungen der im<br />
Haushaltsplan ausgewiesenen Zielen und Leistungskennzahlen erforderlich, kann es e<strong>in</strong>er Beteiligung bzw. Information<br />
des Rates bedürfen, wenn durch die vorgesehenen Änderungen die vom Rat gesetzten Ziele berührt<br />
werden. Es bedarf <strong>in</strong> diesen Fällen aber nicht zw<strong>in</strong>gend der Aufstellung e<strong>in</strong>er Nachtragssatzung durch die Geme<strong>in</strong>de.<br />
In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass auch mögliche Veränderungen der mittelfristigen Ergebnis-<br />
und F<strong>in</strong>anzplanung der Geme<strong>in</strong>de nicht die Verpflichtung zur Aufstellung e<strong>in</strong>er geme<strong>in</strong>dlichen Nachtragssatzung<br />
auslösen. Die Ergebnisse der Planungsanpassung der dem Haushaltsjahr folgenden drei Haushaltsjahre<br />
werden nicht als Festsetzungen <strong>in</strong> die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung e<strong>in</strong>bezogen, auch wenn die mittelfristigen<br />
Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung im Haushaltsplan der Geme<strong>in</strong>de enthalten ist. Die Inhalte der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung<br />
beziehen sich ausschließlich auf das jeweilige Haushaltsjahr. Lediglich bei der Verpflichtung zur<br />
Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes betrifft die Haushaltssatzung auch e<strong>in</strong> späteres Haushaltsjahr<br />
(vgl. § 78 Abs. 2 Nr. 5 GO <strong>NRW</strong>).<br />
3. Die Aufstellung e<strong>in</strong>es Nachtragshaushaltsplans<br />
Bei e<strong>in</strong>er Nachtragshaushaltssatzung werden die erforderlichen Änderungen des Haushaltsplans durch den dieser<br />
Satzung beigefügten Nachtragshaushaltsplan vollzogen. Für diesen Nachtragshaushaltsplan gelten die gleichen<br />
rechtlichen Regelungen wie für die Aufstellung des geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplans (vgl. § 80 GemHVO<br />
<strong>NRW</strong>) e<strong>in</strong>schließlich der Beteiligung des Verwaltungsvorstands nach § 70 GO <strong>NRW</strong> und des F<strong>in</strong>anzausschusses<br />
des Rates nach § 59 GO <strong>NRW</strong>.<br />
E<strong>in</strong>e Aufgabe des Nachtragshaushaltsplans ist es daher, die notwendigen Änderungen des Haushaltsplans erkennbar<br />
und nachvollziehbar zu machen. Die geme<strong>in</strong>dliche Nachtragssatzung, <strong>in</strong> der die bisherigen Festsetzungen<br />
im Ergebnisplan und/oder im F<strong>in</strong>anzplan durch die vorgesehenen Veränderungen erhöht oder verm<strong>in</strong>dert<br />
werden, verändert dadurch auch den geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan mit se<strong>in</strong>en Haushaltspositionen <strong>in</strong> entsprechender<br />
Weise.<br />
GEMEINDEORDNUNG 338
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 81 GO <strong>NRW</strong><br />
Im geme<strong>in</strong>dlichen Nachtragshaushaltsplan s<strong>in</strong>d die neuen oder veränderten Ermächtigungen zu veranschlagen.<br />
Bei den betreffenden Haushaltspositionen wird damit transparent und nachvollziehbar gemacht, welcher wichtige<br />
Änderungsbedarf sich unterjährig im Ablauf der Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de ergeben hat und wie damit<br />
bezogen auf die gesamte Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de und die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich nach<br />
§ 75 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> umgegangen werden soll. Der Nachtragshaushaltsplan enthält daher alle vorgesehenen<br />
Veränderungen (Erhöhungen oder M<strong>in</strong>derungen) der Haushaltspositionen im Ergebnisplan und im F<strong>in</strong>anzplan<br />
sowie <strong>in</strong> den Teilplänen, aber auch die damit verbundenen Änderungen von Zielen und Kennzahlen.<br />
II. Erläuterungen im E<strong>in</strong>zelnen<br />
1. Zu Absatz 1 (Änderung der Haushaltssatzung):<br />
1.1 Zu Satz 1 (Änderung durch Nachtragssatzung):<br />
1.1.1 Die B<strong>in</strong>dung der Nachtragssatzung<br />
Der Verpflichtung zum Haushaltsausgleich kann die Geme<strong>in</strong>de nur nachkommen, wenn die Festsetzungen <strong>in</strong> der<br />
Haushaltssatzung und die veranschlagten Erträge und Aufwendungen sowie die E<strong>in</strong>zahlungen und Auszahlungen<br />
im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan mit der tatsächlichen Entwicklung im Laufe des Haushaltsjahres möglichst übere<strong>in</strong>stimmen.<br />
Bei e<strong>in</strong>er abweichenden Entwicklung, die den Ausgleich des Haushalts der Geme<strong>in</strong>de im betreffenden<br />
Haushaltsjahr gefährdet, sollen die <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung getroffenen Festsetzungen durch<br />
e<strong>in</strong>e Nachtragssatzung korrigiert werden, die jedoch nicht die Geltungsdauer der für das Haushaltsjahr erlassenen<br />
Haushaltssatzung verändert (vgl. § 78 i.V.m. § 81 GO <strong>NRW</strong>).<br />
E<strong>in</strong>e Nachtragssatzung der Geme<strong>in</strong>de b<strong>in</strong>det, aufbauend auf der beschlossenen Haushaltssatzung und dem<br />
dazugehörigen Haushaltsplan (vgl. § 79 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong>), die Verwaltung der Geme<strong>in</strong>de h<strong>in</strong>sichtlich der vorgenommen<br />
Änderungen für die Ausführung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft. Die geme<strong>in</strong>dliche Verwaltung<br />
wird durch die Nachtragssatzung ermächtigt, die im Haushaltsplan <strong>in</strong> geänderter Form enthaltenen Ermächtigungen<br />
für die dort ausgewiesenen Zwecke <strong>in</strong> Anspruch zu nehmen.<br />
1.1.2 Der Ausweis der Veränderungen der Haushaltsermächtigungen<br />
Die Nachtragssatzung der Geme<strong>in</strong>de muss für die Anpassung der Ausführung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft<br />
die notwendigen Änderungen des Gesamtbetrages der Erträge und der Aufwendungen im Ergebnisplan,<br />
des Gesamtbetrages der E<strong>in</strong>zahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, des Gesamtbetrages<br />
der E<strong>in</strong>zahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus der F<strong>in</strong>anzierungstätigkeit im F<strong>in</strong>anzplan<br />
enthalten sowie <strong>in</strong>nerhalb der Satzung ggf. die Veränderung bzw. Neufestsetzung der Kreditermächtigung,<br />
der Verpflichtungsermächtigungen, die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und die Verr<strong>in</strong>gerung der<br />
allgeme<strong>in</strong>en Rücklage.<br />
Die geme<strong>in</strong>dliche Nachtragssatzung ist entsprechend der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er bestimmten<br />
Art und Weise aufzubauen. Die durch die Nachtragssatzung veränderten Festsetzungen sollten <strong>in</strong> den Unterlagen<br />
zur Nachtragssatzung nach Art und Umfang begründet werden. Soweit durch die Nachtragssatzung e<strong>in</strong>zelne<br />
Festsetzungen der Haushaltssatzung nicht geändert werden, soll dieses entsprechend angegeben werden, z.B.<br />
<strong>in</strong> § 2 für den Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist: „Der bisher festgesetzte<br />
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird nicht geändert“. Das nachfolgende Schema zeigt die Form<br />
der Festlegungen auf, die mit dem Nachtragshaushaltsplan verändert werden sollen.<br />
GEMEINDEORDNUNG 339
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 81 GO <strong>NRW</strong><br />
Festlegungen der geme<strong>in</strong>dlichen Nachtragssatzung<br />
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden<br />
Ergebnisplan<br />
Erträge<br />
Aufwendungen<br />
F<strong>in</strong>anzplan<br />
aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit:<br />
E<strong>in</strong>zahlungen<br />
Auszahlungen<br />
aus Investitions- und<br />
F<strong>in</strong>anzierungstätigkeit:<br />
E<strong>in</strong>zahlungen<br />
Auszahlungen<br />
die<br />
bisherigen<br />
festgesetzten<br />
Gesamt-<br />
beträge<br />
EUR<br />
erhöht<br />
um<br />
EUR<br />
verm<strong>in</strong>dert<br />
um<br />
EUR<br />
Abbildung 52 „Festlegungen der geme<strong>in</strong>dlichen Nachtragssatzung“<br />
und damit der<br />
Gesamtbetrag<br />
des<br />
Haushaltsplans<br />
e<strong>in</strong>schl.<br />
Nachträge<br />
festgesetzt auf<br />
EUR<br />
Das Muster für die Ausgestaltung der geme<strong>in</strong>dlichen Nachtragssatzung ist verb<strong>in</strong>dlich (vgl. Nummer 1.1.2 des<br />
Runderlasses des Innenm<strong>in</strong>isteriums vom 24.02.2005, SMBl. <strong>NRW</strong>. 6300).<br />
1.1.3 Die Frist für den Beschluss über die Nachtragssatzung<br />
Die weitere Vorgabe <strong>in</strong> der Vorschrift, die Nachtragssatzung spätestens bis zum Ablauf des Haushaltsjahres (31.<br />
Dezember) zu beschließen, schließt ebenfalls an der Vorschrift über die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung an. Sie<br />
ist erforderlich, weil nach § 78 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong> die Haushaltssatzung der Geme<strong>in</strong>de nur für das jeweilige Haushaltsjahr<br />
gilt und das geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsjahr das jeweilige Kalenderjahr ist (vgl. § 78 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong>).<br />
1.1.4 Dr<strong>in</strong>glichkeitsentscheidung und Nachtragssatzung<br />
Nach § 60 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> kann <strong>in</strong> Angelegenheiten, die der Beschlussfassung des Rates unterliegen und bei<br />
denen die Entscheidung nicht rechtzeitig möglich ist sowie nicht aufgeschoben werden kann, weil sonst erhebliche<br />
Nachteile oder Gefahren entstehen können, der Bürgermeister zusammen mit e<strong>in</strong>em Ratsmitglied entscheiden.<br />
Solche Dr<strong>in</strong>glichkeitsentscheidungen kommen für alle geme<strong>in</strong>dlichen Angelegenheiten <strong>in</strong> Betracht, also<br />
neben Entscheidungen <strong>in</strong> E<strong>in</strong>zelfällen auch die Entscheidung über den Erlass e<strong>in</strong>er Satzung. Solche Entscheidungen<br />
haben e<strong>in</strong>en vorübergehenden Charakter, weil sie dem Rat der Geme<strong>in</strong>de zur Genehmigung vorzulegen<br />
s<strong>in</strong>d (vgl. § 60 Abs. 1 S. 3 GO <strong>NRW</strong>).<br />
GEMEINDEORDNUNG 340
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 81 GO <strong>NRW</strong><br />
Durch e<strong>in</strong>e Dr<strong>in</strong>glichkeitsentscheidung kann jedoch nicht die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung rechtswirksam erlassen<br />
werden, weil dafür e<strong>in</strong> bestimmtes förmliches Verfahren vorgeschrieben ist (vgl. § 80 GO <strong>NRW</strong>), so dass<br />
der Rat der Geme<strong>in</strong>de nicht nur über die Haushaltssatzung, sondern auch über die E<strong>in</strong>wendungen dazu gesondert<br />
beschließen muss. Dieses kann nicht durch e<strong>in</strong>en Dr<strong>in</strong>glichkeitsentscheidung ersetzt werden. Auch kann das<br />
fehlende, aber vorgeschriebene Verfahren für den Erlass der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung nicht durch die<br />
spätere Genehmigung des Rates zur Dr<strong>in</strong>glichkeitsentscheidung über die Haushaltssatzung ersetzt werden. Weil<br />
nach Satz 2 des Absatzes 1 der Vorschrift für die Nachtragssatzung die Vorschriften für die Haushaltssatzung<br />
entsprechend gelten, kann auch e<strong>in</strong>e Nachtragssatzung für den geme<strong>in</strong>dlichen Haushalt nicht durch e<strong>in</strong>e Dr<strong>in</strong>glichkeitsentscheidung<br />
rechtswirksam erlassen werden.<br />
1.2 Zu Satz 2 (Geltung der Vorschriften für die Haushaltssatzung):<br />
1.2.1 Anwendung der Vorschriften über die Haushaltssatzung<br />
Nach der Vorschrift gelten für die Nachtragssatzung der Geme<strong>in</strong>de die Vorschriften für die Haushaltssatzung<br />
entsprechend, d.h. <strong>in</strong>sbesondere f<strong>in</strong>den die §§ 78 und 80 Anwendung. Daher muss auch die Nachtragssatzung<br />
die geänderten Festsetzungen der Haushaltssatzung enthalten, z.B. die Festsetzungen für den Haushaltsplan,<br />
der Kreditermächtigung, der Verpflichtungsermächtigungen, der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und<br />
der Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage, des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung u.a. Auch<br />
die Nachtragssatzung kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge und die Aufwendungen, E<strong>in</strong>zahlungen<br />
und Auszahlungen, den Stellenplan des Haushaltsjahres und das Haushaltssicherungskonzept beziehen.<br />
Zur Nachtragssatzung der Geme<strong>in</strong>de gehört aber auch der Nachtragshaushaltsplan, der alle Änderungen der im<br />
Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Geme<strong>in</strong>de voraussichtlich anfallenden Erträge und e<strong>in</strong>gehenden<br />
E<strong>in</strong>zahlungen, die entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen<br />
zu enthalten hat (vgl. § 10 GemHVO <strong>NRW</strong>). Der Nachtragshaushaltsplan sollte bei<br />
unterjährigem Anpassungsbedarf auch die Veränderungen bei den im Haushaltsplan abgebildeten Zielen und<br />
Leistungskennzahlen aufzeigen.<br />
Dem geme<strong>in</strong>dlichen Nachtragshaushaltsplan der Geme<strong>in</strong>de s<strong>in</strong>d zudem die <strong>in</strong> § 1 Abs. 2 GemHVO <strong>NRW</strong> vorgesehenen<br />
Anlagen beizufügen, um den notwendigen Überblick über das haushaltswirtschaftliche Geschehen bzw.<br />
die wirtschaftliche Lage der Geme<strong>in</strong>de zum Zeitpunkt des Erlasses e<strong>in</strong>er Nachtragssatzung zu aktualisieren und<br />
zu gewährleisten. Soweit die Anlagen im Rahmen der Nachtragssatzung geändert werden. s<strong>in</strong>d diese dem Nachtragshaushaltsplan<br />
<strong>in</strong> ihrer neuen Form beizufügen. Zu den Anlagen des Nachtragshaushaltsplans können ggf.<br />
alle Anlagen zum geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan gehören (vgl. Abbildung).<br />
Vorbericht<br />
Stellenplan<br />
Übersicht über die Anlagen zum geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan<br />
Bilanz des Vorvorjahres<br />
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen<br />
GEMEINDEORDNUNG 341<br />
§ 1 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 7 GemH-<br />
VO <strong>NRW</strong><br />
§ 79 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 1<br />
Abs. 2 Nr. 2 und § 8 GemHVO<br />
<strong>NRW</strong> sowie Nr. 1.3 des Runderlasses<br />
vom 24.02.2005<br />
§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 85 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 1 Abs. 2
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 81 GO <strong>NRW</strong><br />
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verb<strong>in</strong>dlichkeiten<br />
zu Beg<strong>in</strong>n des Haushaltsjahres<br />
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals, wenn e<strong>in</strong>e<br />
Festsetzung nach § 78 Abs. 2 Nr. 2 der GO <strong>NRW</strong><br />
Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen,<br />
für die Sonderrechnungen geführt werden<br />
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche<br />
Entwicklung der Unternehmen und E<strong>in</strong>richtungen mit den neuesten<br />
Jahresabschlüssen der Unternehmen und E<strong>in</strong>richtungen mit<br />
eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Geme<strong>in</strong>de mit mehr<br />
als 50 v.H. beteiligt ist<br />
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben (<strong>in</strong> kreisfreien<br />
Städten)<br />
Nr. 4 und § 13 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
sowie Nr. 1.4.3 des Runderlasses<br />
vom 24.02.2005<br />
§ 56 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 1<br />
Abs. 2 Nr. 5 GemHVO <strong>NRW</strong> sowie<br />
Nr. 1.4.1 des Runderlasses vom<br />
24.02.2005<br />
§ 91 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 1<br />
Abs. 2 Nr. 6 GemHVO <strong>NRW</strong> sowie<br />
Nr. 1.4.2 des Runderlasses vom<br />
24.02.2005<br />
§ 78 Abs. 2 Nr. 2 GO <strong>NRW</strong> i.V.m.<br />
§ 1 Abs. 2 Nr. 7 und § 41 Abs. 4<br />
Nr. 1 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§§ 97 und 114 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 1<br />
Abs. 2 Nr. 8 GemHVO <strong>NRW</strong> sowie<br />
weitere Rechtsvorschriften<br />
§ 108 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 1 Abs. 2<br />
Nr. 9 GemHVO <strong>NRW</strong> sowie weitere<br />
e<strong>in</strong>schlägige Rechtsvorschriften<br />
§ 37 Abs. 3 und 4 GO <strong>NRW</strong> i.V.m.<br />
§ 1 Abs. 2 Nr. 10 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
Abbildung 53 „Übersicht über die Anlagen zum geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan“<br />
1.2.2 Die Verfahrensschritte für den Erlass e<strong>in</strong>er Nachtragssatzung<br />
Für den Erlass der jährlichen Haushaltssatzung s<strong>in</strong>d den Geme<strong>in</strong>den mehrere Verfahrensschritte vorgegeben, die<br />
auch für den Erlass der Nachtragssatzung Anwendung f<strong>in</strong>den (vgl. Abbildung).<br />
Verfahren zum Erlass der Nachtragssatzung<br />
Aufstellung des Entwurfs der Nachtragssatzung<br />
mit ihren Anlagen durch den Kämmerer und Bestätigung des Entwurfs durch den Bürgermeister (§ 81<br />
i.V.m. § 80 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>)<br />
Zuleitung des Entwurfs der Nachtragssatzung<br />
mit ihren Anlagen an den Rat (§ 81 i.V.m. § 80 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>)<br />
Öffentliche Bekanntgabe des Entwurfs der Nachtragssatzung<br />
mit Festlegung e<strong>in</strong>er Frist für die Erhebung von E<strong>in</strong>wendungen an m<strong>in</strong>destens 14 Tagen (§ 81 i.V.m. §<br />
80 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong>)<br />
Beratung über die Nachtragssatzung<br />
mit ihren Anlagen <strong>in</strong> öffentlicher Sitzung des F<strong>in</strong>anzausschusses (§ 59 GO <strong>NRW</strong>)<br />
GEMEINDEORDNUNG 342
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 81 GO <strong>NRW</strong><br />
Beratung und Beschlussfassung über die Nachtragssatzung<br />
mit ihren Anlagen <strong>in</strong> öffentlicher Sitzung des Rates (§ 81 i.V.m. § 80 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong>), ggf. auch Beschlussfassung<br />
über die erhobenen E<strong>in</strong>wendungen (§ 81 i.V.m. § 80 Abs. 3 Satz 3 GO <strong>NRW</strong>)<br />
Anzeige der Nachtragssatzung<br />
mit ihren Anlagen bei der Aufsichtsbehörde (§ 81 i.V.m. § 80 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong>; sie soll spätestens 1<br />
Monat vor Beg<strong>in</strong>n des Hausjahres erfolgen)<br />
Ablauf der Anzeigefrist,<br />
bei der zu beachten ist:<br />
1. Genehmigung der Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage (§ 75 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong>)<br />
2. Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes (§ 76 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>)<br />
Bekanntmachung und Verfügbarhalten der Nachtragssatzung<br />
(§ 81 i.V.m. § 80 Abs. 6 GO <strong>NRW</strong>; sie soll bis zum Ende der <strong>in</strong> § 96 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> benannten Frist<br />
verfügbar gehalten werden)<br />
Abbildung 54 „Verfahren zum Erlass der Nachtragssatzung“<br />
Der Entwurf der Nachtragssatzung mit ihren Anlagen ist vom Kämmerer zu unterzeichnen, der damit zum Ausdruck<br />
br<strong>in</strong>gt, dass der von ihm aufgestellte Entwurf aus se<strong>in</strong>er F<strong>in</strong>anzverantwortung heraus richtig und vollständig<br />
ist, sofern er dazu ke<strong>in</strong>e besonderen E<strong>in</strong>schränkungen macht. Anschließend hat der Kämmerer den Entwurf der<br />
Nachtragssatzung mit ihren Anlagen dem Bürgermeister zur Bestätigung vorzulegen. Außerdem s<strong>in</strong>d beim Erlass<br />
der Nachtragssatzung auch die Rechte des Bürgermeisters und des Kämmerers zu berücksichtigen. Der Kämmerer,<br />
dem die Verantwortung für das F<strong>in</strong>anzwesen der Geme<strong>in</strong>de obliegt, kann z.B. se<strong>in</strong>e abweichende Auffassung<br />
zur Nachtragssatzung <strong>in</strong> den Beratungen des Rates vertreten, wenn der Bürgermeister se<strong>in</strong>en Entwurf der Nachtragssatzung<br />
verändert hat.<br />
Über die aufgezeigten Verfahrensschritte zur Aufstellung der Nachtragssatzung soll sich die Aufsichtsbehörde im<br />
Rahmen der Anzeige der Nachtragsatzung <strong>in</strong>formieren. Das Nachhalten dieser Verfahrensschritte, die term<strong>in</strong>lich<br />
bestimmt se<strong>in</strong> müssen, soll durch die oben angeführte Übersicht auch für die Geme<strong>in</strong>den erleichtert werden. Sie<br />
zeigt die von der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>zuhaltenden Verfahrensschritte auf.<br />
1.2.3 Nachtragssatzung bei e<strong>in</strong>er Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre<br />
1.2.3.1 Änderungsbedarf für das erste Haushaltsjahr<br />
Die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre bedarf wie e<strong>in</strong>e Haushaltssatzung für e<strong>in</strong> Haushaltsjahr<br />
oftmals e<strong>in</strong>er Anpassung an die tatsächliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Laufe des Haushaltsjahres.<br />
Bei e<strong>in</strong>er abweichenden Entwicklung, die die Ausgeglichenheit des Haushalts gefährdet, können die getroffenen<br />
Festsetzungen durch e<strong>in</strong>e Nachtragssatzung nach § 81 GO <strong>NRW</strong> korrigiert werden. Diese Satzung ermächtigt<br />
die Verwaltung der Geme<strong>in</strong>de, die im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen für die dort ausgewiesenen<br />
Zwecke <strong>in</strong> geänderter Form <strong>in</strong> Anspruch zu nehmen.<br />
Die geme<strong>in</strong>dliche Nachtragssatzung muss daher die notwendigen Änderungen enthalten, z.B. des Gesamtbetrages<br />
der Erträge und der Aufwendungen im Ergebnisplan, des Gesamtbetrages der E<strong>in</strong>zahlungen und Auszahlungen<br />
aus laufender Verwaltungstätigkeit, des Gesamtbetrages der E<strong>in</strong>zahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit<br />
und aus der F<strong>in</strong>anzierungstätigkeit im F<strong>in</strong>anzplan enthalten sowie ggf. der Kreditermächtigung.<br />
E<strong>in</strong>e Nachtragssatzung der Geme<strong>in</strong>de, die sich auf das erste Haushaltsjahr bezieht, muss spätestens bis zum 31.<br />
Dezember des ersten Haushaltsjahres vom Rat der Geme<strong>in</strong>de beschlossen se<strong>in</strong>. Für diese Satzung se gelten die<br />
Vorschriften über die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung entsprechend (vgl. § 81 Abs. 1 S. 2 GO <strong>NRW</strong>).<br />
GEMEINDEORDNUNG 343
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 81 GO <strong>NRW</strong><br />
1.2.3.2 Änderungsbedarf für das zweite Haushaltsjahr<br />
Aus der Entwicklung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft kann sich bei e<strong>in</strong>er Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre<br />
auch e<strong>in</strong> Änderungsbedarf ergeben, der sich nur auf das zweite Haushaltsjahr auswirkt. In diesen Fällen<br />
kann die Geme<strong>in</strong>de, wenn die Änderungen ermittelt werden können, bereits im ersten Haushaltsjahr e<strong>in</strong>e<br />
Änderung der für das zweite Haushaltsjahr getroffenen Festsetzungen beschließen. Wartet die Geme<strong>in</strong>de mit<br />
ihrer Entscheidung über e<strong>in</strong>e Nachtragsatzung jedoch das zweite Haushaltsjahr ab, kann ggf. e<strong>in</strong>e Pflicht zur<br />
Aufstellung e<strong>in</strong>er Nachtragssatzung entstehen, wenn örtliche Sachverhalte vorliegen, die unter der Vorschrift des<br />
§ 81 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> subsumiert werden können. Ist dies gegeben, hat der Rat der Geme<strong>in</strong>de die Nachtragssatzung<br />
spätestens bis zum 31. Dezember des zweiten Haushaltsjahres zu beschließen. Für diese Satzung se gelten<br />
die Vorschriften über die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung entsprechend (vgl. § 81 Abs. 1 S. 2 GO <strong>NRW</strong>).<br />
2. Zu Absatz 2 (Erlass der Nachtragssatzung):<br />
2.1 Zu Satz 1 (Verpflichtung zum Erlass e<strong>in</strong>er Nachtragssatzung):<br />
2.1.01 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die Vorschrift enthält drei Sachverhalte, bei deren Auftreten die Geme<strong>in</strong>de gesetzlich verpflichtet wird, e<strong>in</strong>e Nachtragssatzung<br />
zu erlassen. Die Geme<strong>in</strong>de hat unverzüglich e<strong>in</strong>e Nachtragssatzung zu erlassen, wenn sich zeigt,<br />
dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit e<strong>in</strong> erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich<br />
nur durch e<strong>in</strong>e Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann. Die Geme<strong>in</strong>de hat auch<br />
dann e<strong>in</strong>e Nachtragssatzung zu erlassen, wenn von der Geme<strong>in</strong>de bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche<br />
Aufwendungen oder Auszahlungen bei e<strong>in</strong>zelnen Haushaltspositionen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen<br />
oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen.<br />
E<strong>in</strong>e Nachtragssatzung ist aber auch zu erlassen, wenn Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen<br />
geleistet werden sollen. In diesen drei <strong>in</strong> der Vorschrift benannten Fällen werden die Veränderungen der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft als so schwerwiegend betrachtet, dass das Gesamtbild nicht mehr mit der<br />
beschlossenen Haushaltssatzung <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang steht, sondern es unerlässlich ist, e<strong>in</strong>e Nachtragssatzung zu beschließen.<br />
Die Geme<strong>in</strong>de darf ohne Nachtragssatzung nicht die Aufwendungen entstehen lassen oder die Auszahlungen<br />
leisten, die als Ursache zur Pflicht der Geme<strong>in</strong>de zur Aufstellung e<strong>in</strong>er Nachtragssatzung führen. Sie<br />
hat e<strong>in</strong>e Nachtragssatzung unverzüglich aufzustellen, sobald die Voraussetzungen für ihren Erlass gegeben s<strong>in</strong>d.<br />
Die Geme<strong>in</strong>de kann diese nicht auf e<strong>in</strong>en beliebigen späteren Zeitpunkt verschieben.<br />
2.1.1 Zu Nummer 1 (Entstehen e<strong>in</strong>es erheblichen Jahresfehlbetrages):<br />
2.1.1.1 Nachtragssatzung und Jahresfehlbetrag<br />
Nach der Vorschrift hat die Geme<strong>in</strong>de unverzüglich e<strong>in</strong>e Nachtragssatzung zu erlassen, wenn sich zeigt, dass<br />
trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit e<strong>in</strong> erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich<br />
nur durch e<strong>in</strong>e Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann. Diese Vorgabe zur Änderung der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung folgt der gesetzlichen Verpflichtung zum Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2<br />
GO <strong>NRW</strong>. Nach dieser Vorschrift ist der jährliche geme<strong>in</strong>dliche Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag<br />
der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Außerdem gilt diese Ausgleichsregel<br />
im NKF ausdrücklich sowohl im Rahmen der Haushaltsplanung (Ausgleich <strong>in</strong> der Planung) als auch<br />
im Jahresabschluss der Geme<strong>in</strong>de (Ausgleich <strong>in</strong> der Rechnung).<br />
GEMEINDEORDNUNG 344
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 81 GO <strong>NRW</strong><br />
Die gesetzliche Regelung über den Haushaltsausgleich löst die Verpflichtung der Geme<strong>in</strong>de aus, auch im Rahmen<br />
der Ausführung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft alles zu tun, um dieser Verpflichtung nach zu kommen,<br />
<strong>in</strong>sbesondere dann, wenn die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen bzw. der E<strong>in</strong>zahlungen und Auszahlungen<br />
für Investitionen anders verläuft als es bei der Verabschiedung des Haushaltsplans angenommen<br />
wurde. Ausgehend von der im Ermessen der Geme<strong>in</strong>de liegenden Ausfüllung des unbestimmten Rechtsbegriffs<br />
„erheblich“ und unter Berücksichtigung ihrer Möglichkeiten, den Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr wieder zu<br />
erreichen, muss sie e<strong>in</strong>e Nachtragssatzung nach dieser Vorschrift erlassen. Sie hat dabei auch zu berücksichtigen,<br />
dass sich <strong>in</strong> Höhe des Fehlbetrages <strong>in</strong> der Ergebnisrechnung (die Aufwendungen s<strong>in</strong>d höher als die Erträge)<br />
das geme<strong>in</strong>dliche Vermögen (Eigenkapital) entsprechend verr<strong>in</strong>gert.<br />
2.1.1.2 Erheblich höherer Fehlbetrag<br />
Die Geme<strong>in</strong>de muss <strong>in</strong> den Fällen, <strong>in</strong> denen sich unterjährig zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit,<br />
z.B. durch die Verhängung e<strong>in</strong>er Haushaltssperre nach § 24 GemHVO <strong>NRW</strong>, e<strong>in</strong> erheblicher Jahresfehlbetrag<br />
entstehen wird, und der Haushaltsausgleich nur durch e<strong>in</strong>e Änderung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung wieder<br />
erreicht werden kann, e<strong>in</strong>e Änderung ihrer satzungsrechtlichen Ermächtigungen zur Ausführung ihrer Haushaltswirtschaft<br />
herbeizuführen. Auch wenn die Vorschrift an die Pflicht zur Aufstellung e<strong>in</strong>er Nachtragssatzung<br />
zusätzlich das Kriterium der Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs knüpft, gebietet e<strong>in</strong>e Verschärfung e<strong>in</strong>er<br />
bereits <strong>in</strong> der Haushaltssatzung ausgewiesene erheblichen defizitären Haushaltslage durch e<strong>in</strong>en höheren Fehlbetrag<br />
sowie das Budgetrecht des Rates <strong>in</strong> solchen Fällen erst recht die Aufstellung e<strong>in</strong>er Nachtragssatzung<br />
durch die Geme<strong>in</strong>de. Diese Vorgehensweise ist auch nach dem S<strong>in</strong>n und Zweck der Vorschrift und nicht nur<br />
ausschließlich nach dem Wortlaut geboten. Die Basis für die Betrachtung, ob e<strong>in</strong>e Nachtragssatzung aufgestellt<br />
werden soll, stellt deshalb immer das im Ergebnisplan enthaltene Ergebnis (Haushaltsausgleich oder Fehlbetrag)<br />
dar.<br />
Das mögliche Entstehen e<strong>in</strong>es erheblichen Jahresfehlbetrages bei e<strong>in</strong>em <strong>in</strong> der Planung ausgeglichenen geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushalt oder das Entstehen e<strong>in</strong>es erheblich höheren Fehlbetrages als <strong>in</strong> der Haushaltssatzung<br />
festgesetzt (negative Differenz aus dem Gesamtbetrag der Erträge und dem Gesamtbetrag der Aufwendungen)<br />
muss die dr<strong>in</strong>gend erforderlichen Gegenmaßnahmen durch die Geme<strong>in</strong>de unter Mitwirkung aller Beteiligten auslösen.<br />
Der Rat der Geme<strong>in</strong>de und die geme<strong>in</strong>dliche Verwaltung tragen gleichermaßen die Verantwortung für die<br />
geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft und müssen daher durch geeignete Maßnahmen die möglicherweise e<strong>in</strong>tretenden<br />
haushaltswirtschaftlichen Verschlechterungen verh<strong>in</strong>dern. Sie müssen der weiteren Verschärfung der wirtschaftlichen<br />
Lage der Geme<strong>in</strong>de ohne Verzögerung entgegen wirken, auch wenn damit gleichzeitig die Wiedererreichung<br />
des Haushaltsausgleichs formal nicht möglich wird. Es kann sich aber durch geeignete Maßnahmen<br />
e<strong>in</strong>e Verbesserung der haushaltswirtschaftlichen Lage ergeben.<br />
2.1.1.3 Die Festlegung der Erheblichkeit<br />
Die Festlegung der Erheblichkeit als unbestimmten Rechtsbegriff ist <strong>in</strong> Bezug auf den Jahresfehlbetrag <strong>in</strong> Nummer<br />
1 und <strong>in</strong> Bezug auf bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei e<strong>in</strong>zelnen<br />
Haushaltspositionen <strong>in</strong> Nummer 2 örtlich festzulegen. Diese Festlegung wird am ehesten den unterschiedlichen<br />
Verhältnissen <strong>in</strong> den Geme<strong>in</strong>den gerecht. Sie ermöglicht den Geme<strong>in</strong>den, diesen Begriff selbst auszugestalten<br />
und stärkt damit die Eigenverantwortung der Geme<strong>in</strong>den für ihr haushaltswirtschaftliches Handeln. Die<br />
Ausgestaltung des unbestimmten Rechtsbegriffs sollte <strong>in</strong> Abstimmung mit dem Rat erfolgen, denn die Vorschrift,<br />
dass andere, ger<strong>in</strong>gere überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen dem Rat zur<br />
Kenntnis zu br<strong>in</strong>gen s<strong>in</strong>d, entlässt die geme<strong>in</strong>dliche Verwaltung nicht aus der „geme<strong>in</strong>samen“ Entscheidung <strong>in</strong><br />
Zusammenarbeit mit dem Rat.<br />
GEMEINDEORDNUNG 345
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 81 GO <strong>NRW</strong><br />
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, <strong>in</strong> welchem Verhältnis der Begriff „erheblich“ auszugestalten ist, denn<br />
diese Vorschrift bezieht sich e<strong>in</strong>erseits auf den Jahresfehlbetrag und andererseits auf das Verhältnis von Aufwendungen<br />
oder Auszahlungen bei e<strong>in</strong>zelnen Haushaltspositionen zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen.<br />
Weil dadurch auch das Budgetrecht des Rates betroffen ist, bietet sich für die Festlegung e<strong>in</strong>e<br />
Regelung <strong>in</strong> der Haushaltssatzung nach § 78 GO <strong>NRW</strong> an, wie sie auch für die Wertgrenzen für geme<strong>in</strong>dliche<br />
Investitionen nach § 14 Abs. 1 GemHVO <strong>NRW</strong> vorgesehen ist. Bei e<strong>in</strong>er überjährigen Bedeutung kann auch e<strong>in</strong>e<br />
Festlegung durch e<strong>in</strong>en gesonderten Ratsbeschluss erfolgen. Es muss <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em solchen Fall nur örtlich sichergestellt<br />
werden, dass e<strong>in</strong> Bezug e<strong>in</strong>es solchen Beschlusses zur jährlichen Haushaltssatzung bzw. der Veranschlagung<br />
im Haushaltsplan e<strong>in</strong>deutig hergestellt wird.<br />
2.1.2 Zu Nummer 2 (Neue Aufwendungen oder Auszahlungen):<br />
Nach der Vorschrift hat die Geme<strong>in</strong>de unverzüglich e<strong>in</strong>e Nachtragssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte<br />
oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei e<strong>in</strong>zelnen Haushaltspositionen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em im<br />
Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen.<br />
Diese Vorgabe zur Änderung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung folgt der gesetzliche Regelung <strong>in</strong> § 83<br />
GO <strong>NRW</strong> über die Behandlung von unterjährig erforderlichen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen<br />
und Auszahlungen.<br />
Die Begriffe „überplanmäßig“ und „außerplanmäßig“ leiten sich von dem haushaltsrechtlichen Begriff „planmäßig“<br />
ab. Als planmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten alle Ermächtigungen, die zum Zeitpunkt der Beschlussfassung<br />
des Rates über die Haushaltssatzung im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan veranschlagt s<strong>in</strong>d. Deshalb<br />
s<strong>in</strong>d entstehende Aufwendungen dann als „überplanmäßig“ e<strong>in</strong>zustufen, wenn diese die im Ergebnisplan<br />
veranschlagten Haushaltspositionen übersteigen. Dies gilt entsprechend für zu leistende Auszahlungen, wenn die<br />
betreffenden Haushaltspositionen im F<strong>in</strong>anzplan überschritten werden. Dagegen werden Aufwendungen und<br />
Auszahlungen, für deren Zwecke ke<strong>in</strong>e Haushaltspositionen im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan enthalten s<strong>in</strong>d<br />
und/oder für die ke<strong>in</strong>e Ermächtigungen aus dem Vorjahr übertragen wurden, als „außerplanmäßig“ bezeichnet.<br />
Bereits nach der benannten Vorschrift bedürfen die überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und<br />
Auszahlungen, wenn sie erheblich s<strong>in</strong>d, der vorherigen Zustimmung des Rates, denn diese über die Haushaltsplanung<br />
h<strong>in</strong>ausgehenden Aufwendungen und Auszahlungen, berühren das Budgetrecht des Rates. Die Pflicht zur<br />
Aufstellung e<strong>in</strong>er Nachtragssatzung knüpft daran an, denn es wird durch die Vorschrift e<strong>in</strong>e Verhältnisbildung<br />
vorgegeben, weil die bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Aufwendungen oder Auszahlungen bei e<strong>in</strong>zelnen<br />
Haushaltspositionen erheblich im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen<br />
se<strong>in</strong> müssen.<br />
2.1.3 Zu Nummer 3 (Auszahlungen für neue Investitionen):<br />
Nach der Vorschrift hat die Geme<strong>in</strong>de unverzüglich e<strong>in</strong>e Nachtragssatzung zu erlassen, wenn Auszahlungen für<br />
bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen. Diese Regelung knüpft an § 14 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
an, nach der z.B. gilt, dass bevor Investitionen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen beschlossen und<br />
im Haushaltsplan ausgewiesen werden, durch e<strong>in</strong>en Wirtschaftlichkeitsvergleich, die für die Geme<strong>in</strong>de wirtschaftlichste<br />
Lösung ermittelt werden soll oder Ermächtigungen für Baumaßnahmen im geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzplan erst<br />
veranschlagt werden, wenn Baupläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der<br />
Ausführung, die Gesamtkosten der Maßnahme, getrennt nach Grunderwerb und Herstellungskosten, e<strong>in</strong>schließlich<br />
der E<strong>in</strong>richtungskosten sowie der Folgekosten ersichtlich s<strong>in</strong>d.<br />
Das geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsrecht gewährt den Geme<strong>in</strong>den bei der haushaltsmäßigen Umsetzung von Investitionsmaßnahmen<br />
e<strong>in</strong>en weiten Spielraum, denn trotz sorgfältiger Aufstellung e<strong>in</strong>es Bauzeitplans können unvorher-<br />
GEMEINDEORDNUNG 346
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 81 GO <strong>NRW</strong><br />
sehbare Ereignisse zu Änderungen bei e<strong>in</strong>er begonnenen Investitionsmaßnahme führen. In solchen Fällen wäre<br />
der Erlass e<strong>in</strong>er Nachtragssatzung zu aufwändig, um e<strong>in</strong>e Anpassung im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan herbeizuführen.<br />
Daher steht die Regelung <strong>in</strong> der Vorschrift auch <strong>in</strong> Beziehung zu § 83 GO <strong>NRW</strong>, denn danach s<strong>in</strong>d überplanmäßige<br />
Auszahlungen für Investitionen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden, auch dann zulässig, wenn<br />
ihre Deckung erst im folgenden Jahr gewährleistet ist. Dieses ist aber nicht mehr gegeben, wenn neue Investitionen<br />
begonnen werden sollen, für die wegen der fehlenden E<strong>in</strong>beziehung <strong>in</strong> die Haushaltsplanung der Geme<strong>in</strong>de<br />
die entsprechenden Auszahlungsermächtigungen des Rates der Geme<strong>in</strong>de fehlen. Die gesetzliche Regelung soll<br />
daher auch gewährleisten, dass der Rat im Rahmen se<strong>in</strong>es Budgetrechts über neue Investitionen entscheidet, die<br />
unterjährig begonnen werden sollen.<br />
2.1.4 Aufstellungspflicht und örtliche Ziele und Leistungskennzahlen<br />
Die Pflicht zur Aufstellung e<strong>in</strong>er Nachtragssatzung wird nicht alle<strong>in</strong> durch notwendige unterjährige Veränderungen<br />
der abgeschlossenen Vere<strong>in</strong>barungen über Ziele und Leistungskennzahlen ausgelöst. Die Ziele und Leistungskennzahlen<br />
(vgl. § 12 GemHVO <strong>NRW</strong>) s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> der Regel zwar durch ihre Abbildung <strong>in</strong> den Teilplänen des Haushaltsplans<br />
<strong>in</strong> den Rahmen der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung e<strong>in</strong>bezogen, jedoch s<strong>in</strong>d sie deshalb noch nicht<br />
als orig<strong>in</strong>äre Bestandteile der Haushaltssatzung nach § 78 GO <strong>NRW</strong> anzusehen. Die Veränderungen von Zielen<br />
und Leistungskennzahlen können nicht selbstständig e<strong>in</strong>e eigenständige Pflicht zur Aufstellung e<strong>in</strong>er Nachtragssatzung<br />
durch die Geme<strong>in</strong>de auslösen. S<strong>in</strong>d ausschließlich Änderungen der im Haushaltsplan ausgewiesenen<br />
Zielen und Kennzahlen erforderlich, kann es dafür aber e<strong>in</strong>er Beteiligung bzw. e<strong>in</strong>er Information des Rates bedürfen,<br />
wenn die von ihm gesetzten Ziele durch die vorgesehenen Änderungen berührt werden.<br />
Wenn die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung jedoch durch e<strong>in</strong>e Nachtragssatzung verändert werden soll und es<br />
werden dadurch auch die vere<strong>in</strong>barten Ziele und Leistungskennzahlen berührt, bedarf es auch hier der Umsetzung<br />
der notwendigen Änderungen und das Aufzeigen der Veränderungen im Nachtragshaushaltsplan (vgl. § 10<br />
GemHVO <strong>NRW</strong>). Soweit Veränderungen der zwischen Rat und Verwaltung und <strong>in</strong>nerhalb der Verwaltung vere<strong>in</strong>barten<br />
Ziele und Kennzahlen unterjährig erforderlich geworden s<strong>in</strong>d, muss spätestens im Jahresabschluss der<br />
Geme<strong>in</strong>de darüber <strong>in</strong>formiert werden. Weil <strong>in</strong> den Teilrechnungen im Jahresabschluss durch die Abbildung der<br />
Ist-Zahlen zu den <strong>in</strong> den Teilplänen ausgewiesenen Leistungsmengen und Kennzahlen der Grad der Zielerreichung<br />
nachzuweisen ist, lassen sich notwendige unterjährige Veränderungen auch dann noch nachvollziehbar<br />
darstellen.<br />
2.2 Zu Satz 2 (Ke<strong>in</strong>e Nachtragssatzung bei Fortsetzungs<strong>in</strong>vestitionen):<br />
Die getroffene Regelung ist nur auf überplanmäßige Auszahlungen im S<strong>in</strong>ne des § 83 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong> ausgerichtet,<br />
auch wenn <strong>in</strong> diesem Satz das Wort „Aufwendungen“ enthalten ist. Der Grundsatz <strong>in</strong> der Bezugsvorschrift<br />
des § 83 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong> stellt nur auf Investitionen ab, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden. Für solche<br />
Investitionsmaßnahmen s<strong>in</strong>d überplanmäßige Auszahlungen als Vorgriffe auf das kommende Haushaltsjahr zulässig<br />
s<strong>in</strong>d, wenn ihre Deckung <strong>in</strong> diesem Folgejahr gewährleistet ist. Dagegen entstehen Aufwendungen erst mit<br />
der Nutzung des beschafften Vermögensgegenstandes und s<strong>in</strong>d dann periodengerecht zuzuordnen.<br />
3. Zu Absatz 3 (Verzicht auf e<strong>in</strong>e Nachtragssatzung):<br />
3.1 Zu Nummer 1 (Verzicht bei ger<strong>in</strong>gfügigen Investitionen):<br />
Durch die Vorschrift wird e<strong>in</strong> Verzicht auf die Aufstellung e<strong>in</strong>er geme<strong>in</strong>dlichen Nachtragssatzung zugelassen,<br />
wenn Auszahlungen für ger<strong>in</strong>gfügige Investitionen und Instandsetzungen an Bauten, die unabweisbar s<strong>in</strong>d, von<br />
der Geme<strong>in</strong>de zu leisten s<strong>in</strong>d, denn es ist bestimmt worden, dass Absatz 2 Nrn. 2 und 3 der Vorschrift dann ke<strong>in</strong>e<br />
GEMEINDEORDNUNG 347
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 81 GO <strong>NRW</strong><br />
Anwendung f<strong>in</strong>det. Nach Absatz 2 Nrn. 2 und 3 der Vorschrift hat die Geme<strong>in</strong>de unverzüglich e<strong>in</strong>e Nachtragssatzung<br />
zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei e<strong>in</strong>zelnen<br />
Haushaltspositionen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen<br />
erheblichen Umfang geleistet werden müssen (Nummer 2) und wenn e<strong>in</strong>e Nachtragssatzung ist aber auch zu<br />
erlassen, wenn geme<strong>in</strong>dliche Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen<br />
(Nummer 3).<br />
Bei ger<strong>in</strong>gfügigen Investitionen und Instandsetzungen an Bauten, die unabweisbar s<strong>in</strong>d, wird es als vertretbar und<br />
ausreichend angesehen, den Mehrbedarf an Auszahlungen für solche Maßnahmen nach dem Verfahren über<br />
außerplanmäßige Auszahlungen nach § 83 GO <strong>NRW</strong> abzuwickeln. Der Begriff der Unabweisbarkeit, der vom<br />
Gesetzgeber nicht näher def<strong>in</strong>iert worden ist, stellt auf die dr<strong>in</strong>gende Notwendigkeit bzw. Eilbedürftigkeit der Umsetzung<br />
sowie darauf ab, dass e<strong>in</strong>e Verschiebung auf e<strong>in</strong>en späteren Zeitpunkt nicht möglich ist oder wirtschaftlich<br />
unzweckmäßig wäre. Die Geme<strong>in</strong>de muss auf Grund rechtlicher oder faktischer Zwänge weder sachlich noch<br />
zeitlich e<strong>in</strong>e Handlungsalternative haben. Im Bedarfsfalle ist deshalb sorgfältige Analyse notwendig, um e<strong>in</strong>en<br />
Mehrbedarf gegenüber den bestehenden haushaltsplanmäßigen Ermächtigungen festzustellen. Außerdem sollte<br />
der Rat der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>e Entscheidung über die Abgrenzung des Begriffs „ger<strong>in</strong>gfügig“ treffen.<br />
3.2 Zu Nummer 2 (Verzicht bei Umschuldungen):<br />
Durch die Vorschrift wird e<strong>in</strong> Verzicht auf die Aufstellung e<strong>in</strong>er geme<strong>in</strong>dlichen Nachtragssatzung zugelassen,<br />
wenn Auszahlungen für die Umschuldung von Krediten für Investitionen entstehen, denn es ist bestimmt worden,<br />
dass Absatz 2 Nrn. 2 und 3 der Vorschrift dann ke<strong>in</strong>e Anwendung f<strong>in</strong>det. Nach Absatz 2 Nrn. 2 und 3 der Vorschrift<br />
hat die Geme<strong>in</strong>de unverzüglich e<strong>in</strong>e Nachtragssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder<br />
zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei e<strong>in</strong>zelnen Haushaltspositionen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em im Verhältnis zu den<br />
Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen (Nummer 2)<br />
und wenn e<strong>in</strong>e Nachtragssatzung ist aber auch zu erlassen, wenn geme<strong>in</strong>dliche Auszahlungen für bisher nicht<br />
veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen (Nummer 3).<br />
Bei der Umschuldung von Krediten für Investitionen entsteht zwar e<strong>in</strong> Mehrbedarf an Auszahlungen für solche<br />
Maßnahmen, diesen steht jedoch regelmäßig <strong>in</strong> gleicher Höhe e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>zahlung gegenüber. Zudem kann es bei<br />
e<strong>in</strong>er solchen haushaltsmäßigen Maßnahme zu e<strong>in</strong>er wirtschaftlichen Entlastung im Rahmen der zu vere<strong>in</strong>barenden<br />
Z<strong>in</strong>szahlungen kommen. Der Mehrbedarf an Auszahlungen für solche Maßnahmen soll nach dem Verfahren<br />
über außerplanmäßige Auszahlungen nach § 83 GO <strong>NRW</strong> abgewickelt werden.<br />
4. Zu Absatz 4 (Haushaltssperre durch den Rat):<br />
4.1 Zu Satz 1 (Erlass e<strong>in</strong>er Haushaltssperre):<br />
Im Zusammenhang mit dem Erlass e<strong>in</strong>er Nachtragssatzung ist gesetzlich festgelegt worden, dass der Rat die<br />
Inanspruchnahme von Ermächtigungen sperren kann, wenn die Entwicklung der Erträge oder der Aufwendungen<br />
oder die Erhaltung der Liquidität dies erfordert (Haushaltssperre). Durch diese Regelung wird bestätigt, dass der<br />
Rat ebenfalls über das Instrument der haushaltswirtschaftlichen Sperre verfügt, wie es durch § 24 Abs. 1 GemH-<br />
VO <strong>NRW</strong> dem Kämmerer, und wenn e<strong>in</strong> solcher nicht bestellt ist, dem Bürgermeister e<strong>in</strong>geräumt wird. Diese<br />
Möglichkeit zum Erlass e<strong>in</strong>er Haushaltssperre durch den Rat der Geme<strong>in</strong>de baut darauf auf, dass der Rat unverzüglich<br />
zu unterrichten, wenn vom Kämmerer oder Bürgermeister e<strong>in</strong>e haushaltswirtschaftliche Sperre ausgesprochen<br />
worden ist (vgl. § 24 Abs. 2 GemHVO <strong>NRW</strong>), so dass beim Erlass e<strong>in</strong>er Haushaltssperre durch den Rat<br />
e<strong>in</strong>e örtliche Zusammenarbeit zwischen Rat und geme<strong>in</strong>dlicher Verwaltung <strong>in</strong> haushaltswirtschaftlichen Fragen<br />
erfolgt.<br />
GEMEINDEORDNUNG 348
4.2 Zu Satz 2 (Aufhebung e<strong>in</strong>er Haushaltssperre):<br />
4.2.1 Die Aufhebung der Haushaltssperre des Rates<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 81 GO <strong>NRW</strong><br />
Die Vorschrift sieht ausdrücklich vor, dass der Rat der Geme<strong>in</strong>de se<strong>in</strong>e Sperre aufheben kann. Die ausdrückliche<br />
Regelung über die Aufhebung der eigenen Sperre soll nur e<strong>in</strong>e fiktive Lücke schließen und verh<strong>in</strong>dern, dass<br />
örtliche Me<strong>in</strong>ungsverschiedenheiten darüber entstehen, ob der Rat se<strong>in</strong>e Haushaltssperre auch aufheben kann,<br />
wenn ke<strong>in</strong>e entsprechende Aussage <strong>in</strong> der Vorschrift enthalten wäre. Der Rat der Geme<strong>in</strong>de auf Grund se<strong>in</strong>er<br />
Allzuständigkeit und se<strong>in</strong>es Budgetrechtes e<strong>in</strong>e Haushaltssperre erlassen kann, ist auch ohne ausdrückliche<br />
gesetzliche Regelung berechtigt, se<strong>in</strong>e eigene erlassene Haushaltssperre durch e<strong>in</strong>en Beschluss wieder aufheben,<br />
wenn dafür ke<strong>in</strong> haushaltswirtschaftlicher Anlass mehr besteht.<br />
4.2.2 Die Aufhebung anderer Haushaltssperren<br />
Die Vorschrift sieht ausdrücklich vor, dass der Rat der Geme<strong>in</strong>de die Sperre des Kämmerers oder des Bürgermeisters,<br />
die diese nach § 24 Abs. 1 GemHVO <strong>NRW</strong> erlassen können, wenn die Entwicklung der Erträge oder<br />
Aufwendungen oder die Erhaltung der Liquidität es erfordert, aufheben kann. Diese ausdrückliche Regelung<br />
berücksichtigt die Allzuständigkeit und das Budgetrecht des Rates, der deshalb berechtigt se<strong>in</strong> muss, die vom<br />
Kämmerer, wenn e<strong>in</strong> solcher nicht bestellt ist, vom Bürgermeister erlassene Haushaltssperre durch e<strong>in</strong>en Beschluss<br />
wieder aufheben, wenn dafür ke<strong>in</strong> haushaltswirtschaftlicher Anlass mehr besteht. Diese Möglichkeit zur<br />
Aufhebung der Sperre des Kämmerers oder des Bürgermeisters baut darauf auf, dass der Rat der Geme<strong>in</strong>de<br />
unverzüglich zu unterrichten, wenn vom Kämmerer oder Bürgermeister e<strong>in</strong>e haushaltswirtschaftliche Sperre ausgesprochen<br />
worden ist, so dass bei der Aufhebung e<strong>in</strong>er Haushaltssperre nur e<strong>in</strong>e Fortsetzung der örtlichen<br />
Zusammenarbeit <strong>in</strong> haushaltswirtschaftlichen Fragen zwischen Rat und geme<strong>in</strong>dlicher Verwaltung erfolgt.<br />
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ<br />
GEMEINDEORDNUNG 349
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 82 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 82<br />
Vorläufige Haushaltsführung<br />
(1) Ist die Haushaltssatzung bei Beg<strong>in</strong>n des Haushaltsjahres noch nicht bekannt gemacht, so darf die Geme<strong>in</strong>de<br />
ausschließlich<br />
1. Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für<br />
die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar s<strong>in</strong>d; sie darf <strong>in</strong>sbesondere Bauten, Beschaffungen<br />
und sonstige Investitionsleistungen, für die im Haushaltsplan des Vorjahres F<strong>in</strong>anzpositionen oder Verpflichtungsermächtigungen<br />
vorgesehen waren, fortsetzen,<br />
2. Realsteuern nach den Sätzen des Vorjahres erheben,<br />
3. Kredite umschulden.<br />
(2) 1 Reichen die F<strong>in</strong>anzmittel für die Fortsetzung der Bauten, der Beschaffungen und der sonstigen Leistungen<br />
des F<strong>in</strong>anzplans nach Absatz 1 Nr. 1 nicht aus, so darf die Geme<strong>in</strong>de mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde<br />
Kredite für Investitionen bis zu e<strong>in</strong>em Viertel des Gesamtbetrages der <strong>in</strong> der Haushaltssatzung des Vorjahres<br />
festgesetzten Kredite aufnehmen. 2 Die Geme<strong>in</strong>de hat dem Antrag auf Genehmigung e<strong>in</strong>e nach Dr<strong>in</strong>glichkeit geordnete<br />
Aufstellung der vorgesehenen unaufschiebbaren Investitionen beizufügen. 3 Die Genehmigung soll unter<br />
dem Gesichtspunkt e<strong>in</strong>er geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt werden; sie kann unter Bed<strong>in</strong>gungen<br />
und mit Auflagen erteilt werden. 4 Sie ist <strong>in</strong> der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtungen mit der<br />
dauernden Leistungsfähigkeit der Geme<strong>in</strong>de nicht <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang stehen.<br />
(3) Ist im Fall des § 76 Abs. 1 die Haushaltssatzung bei Beg<strong>in</strong>n des Haushaltsjahres noch nicht bekannt gemacht,<br />
gelten ergänzend zu den Regelungen der Absätze 1 und 2 die nachfolgenden Bestimmungen vom Beg<strong>in</strong>n des<br />
Haushaltsjahres - bei späterer Beschlussfassung über die Haushaltssatzung vom Zeitpunkt der Beschlussfassung<br />
- bis zur Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes:<br />
1. Die Geme<strong>in</strong>de hat weitergehende haushaltswirtschaftliche Beschränkungen für die Besetzung von Stellen,<br />
andere personalwirtschaftliche Maßnahmen und das höchstzulässige Aufwandsvolumen des Ergebnishaushalts<br />
sowie die Regelungen zur Nachweisführung gegenüber der Aufsichtsbehörde zu beachten, die durch<br />
Rechtsverordnung des Innenm<strong>in</strong>isteriums im E<strong>in</strong>vernehmen mit dem F<strong>in</strong>anzm<strong>in</strong>isterium festgelegt werden.<br />
2. Der <strong>in</strong> Absatz 2 festgelegte Kreditrahmen kann mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde überschritten werden,<br />
wenn das Verbot der Kreditaufnahme anderenfalls zu e<strong>in</strong>em nicht auflösbaren Konflikt zwischen verschiedenen<br />
gleichrangigen Rechtspflichten der Geme<strong>in</strong>de führen würde. Die Genehmigung kann unter Bed<strong>in</strong>gungen<br />
und mit Auflagen erteilt werden.<br />
(4) Die Bestimmungen des Absatzes 3 gelten ab dem 1. April des Haushaltsjahres bis zur Beschlussfassung über<br />
e<strong>in</strong>en ausgeglichenen Haushalt oder bis zur Erteilung der Genehmigung für e<strong>in</strong> Haushaltssicherungskonzept<br />
auch dann, wenn bis zu dem Term<strong>in</strong> ke<strong>in</strong> ausgeglichener Haushalt beschlossen worden ist.<br />
Erläuterungen zu § 82:<br />
I. Allgeme<strong>in</strong>es<br />
1. Die Weiterführung der Haushaltswirtschaft im neuen Haushaltsjahr<br />
Das geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsrecht ist darauf ausgerichtet, dass die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der<br />
Geme<strong>in</strong>de nur für e<strong>in</strong> Haushaltsjahr gelten, auch wenn die mittelfristige Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung <strong>in</strong> den<br />
Haushaltsplan <strong>in</strong>tegriert und abgebildet ist. Deshalb muss die Geme<strong>in</strong>de dafür Sorge tragen, dass die Haushaltssatzung<br />
für das neue Haushaltsjahr so rechtzeitig vorbereitet wird, damit sie mit Beg<strong>in</strong>n des Haushaltsjahres <strong>in</strong><br />
Kraft treten kann. Dennoch lässt sich <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Praxis aus unterschiedlichen Gründen nicht immer<br />
vermeiden, dass die Haushaltssatzung erst nach Beg<strong>in</strong>n des Haushaltsjahres erlassen wird. Gleichwohl muss <strong>in</strong><br />
GEMEINDEORDNUNG 350
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 82 GO <strong>NRW</strong><br />
der Zeit vom Beg<strong>in</strong>n des neuen Haushaltsjahres bis zum Erlass bzw. dem In-Kraft-Treten der Haushaltssatzung<br />
die Geme<strong>in</strong>de ihre rechtlichen Verpflichtungen erfüllen und ihre Aufgabenerfüllung fortsetzen. Der Anwendungsbereich<br />
dieser Vorschrift ist daher auf diese Zeit der vorläufigen Haushaltsführung bei der Geme<strong>in</strong>de beschränkt.<br />
Der im Entwurf aufgestellte Haushaltsplan der Geme<strong>in</strong>de bleibt zwar <strong>in</strong> der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung<br />
die haushaltswirtschaftliche Leitl<strong>in</strong>ie für Rat und Verwaltung und hat auch weiterh<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e unverzichtbare Funktion<br />
als buchungstechnische Grundlage.<br />
2. Die Weitergeltung der Haushaltssatzung des Vorjahres<br />
Nach § 78 Abs. 1 S. 1 GO <strong>NRW</strong> gilt die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr, für das sie vom<br />
Rat beschlossen wurde. Damit ist e<strong>in</strong> genau bestimmter Zeitrahmen vorgegeben, <strong>in</strong> dem die geme<strong>in</strong>dliche Verwaltung<br />
die vom Rat der Geme<strong>in</strong>de im Rahmen se<strong>in</strong>es Budgetrechts ausgesprochenen Ermächtigungen und<br />
getroffenen Festlegungen auszuführen und zu beachten hat (Haushaltsgrundsatz der Jährlichkeit). Das Haushaltsjahr<br />
deckt sich zeitlich immer mit dem jeweiligen Kalenderjahr (vgl. § 78 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong>). Von diesem wichtigen<br />
Haushaltsgrundsatz bestehen mehrere Ausnahmen, die <strong>in</strong>sbesondere <strong>in</strong> der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung<br />
für die Geme<strong>in</strong>de von Bedeutung s<strong>in</strong>d (vgl. Abbildung).<br />
Weitergeltung e<strong>in</strong>zelner Haushaltsvorschriften<br />
Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr<br />
folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste<br />
Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zum Erlass dieser<br />
Haushaltssatzung.<br />
Die Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden<br />
Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht<br />
rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung.<br />
Die Geme<strong>in</strong>de kann zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kredite<br />
zur Liquiditätssicherung bis zu dem <strong>in</strong> der Haushaltssatzung festgesetzten<br />
Höchstbetrag aufnehmen kann, soweit dafür ke<strong>in</strong>e anderen Mittel zur Verfügung<br />
stehen, und diese Ermächtigung über das Haushaltsjahr h<strong>in</strong>aus bis<br />
zum Erlass der neuen Haushaltssatzung.<br />
Die Geme<strong>in</strong>de kann die <strong>in</strong> ihrem Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen<br />
für Aufwendungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit,<br />
soweit diese nicht <strong>in</strong> Anspruch genommen worden s<strong>in</strong>d, <strong>in</strong>s folgende<br />
Haushaltsjahr übertragen, denn diese bleiben bis zum Ende des folgenden<br />
Haushaltsjahres verfügbar. Werden sie übertragen, erhöhen sie die entsprechenden<br />
Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.<br />
Die Geme<strong>in</strong>de kann die <strong>in</strong> ihrem Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen<br />
für Auszahlungen für Investitionen, soweit diese nicht <strong>in</strong> Anspruch<br />
genommen worden s<strong>in</strong>d, <strong>in</strong>s folgende Haushaltsjahr übertragen, denn diese<br />
bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei<br />
Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach<br />
Schluss des Haushaltsjahres, <strong>in</strong> dem der Vermögensgegenstand <strong>in</strong> se<strong>in</strong>en<br />
wesentlichen Teilen <strong>in</strong> Benutzung genommen werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen<br />
im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen<br />
bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.<br />
Abbildung 55 „Weitergeltung e<strong>in</strong>zelner Haushaltsvorschriften“<br />
GEMEINDEORDNUNG 351<br />
§ 85 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 86 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 89 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 22 Abs. 1 und 2<br />
GemHVO <strong>NRW</strong>
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 82 GO <strong>NRW</strong><br />
In diesem Zusammenhang bedarf es im Rahmen der vorläufigen Haushaltführung der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>es Zusammenspiels<br />
zwischen den weiter geltenden Ermächtigungen aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr und den Vorgaben,<br />
die wegen der noch nicht geltenden geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung notwendig s<strong>in</strong>d.<br />
3. Informationen gegenüber der Aufsichtsbehörde<br />
Die Geme<strong>in</strong>de ist nach § 80 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong> verpflichtet, die vom Rat der Geme<strong>in</strong>de beschlossene Haushaltssatzung<br />
mit ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Die Anzeige soll spätestens e<strong>in</strong>en Monat vor Beg<strong>in</strong>n<br />
des Haushaltsjahres erfolgen. Kommt die Geme<strong>in</strong>de ihrer gesetzlichen Verpflichtung zur Anzeige der Haushaltssatzung<br />
mit ihren Anlagen zu dem gesetzlich festgelegten Term<strong>in</strong> nicht nach, hat sie ihre Aufsichtsbehörde darüber<br />
zu unterrichten und die Anzeige baldmöglichst vorzunehmen. Sie hat <strong>in</strong> ihrem Bericht an die Aufsichtsbehörde<br />
die Gründe für das Versäumnis anzugeben sowie aufzuzeigen, welcher Verfahrensstand bei der Aufstellung<br />
der Haushaltssatzung besteht, wann der Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung vorgesehen ist<br />
und bis zu welchem schnellstmöglichen Zeitpunkt die Anzeige bei der Aufsichtsbehörde nachgeholt wird.<br />
4. Örtliche Dienstanweisung als Ersatz für die Haushaltssatzung<br />
Die vorläufige Haushaltsführung bed<strong>in</strong>gt, dass die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft nur <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em e<strong>in</strong>geschränkten<br />
Umfang und nicht so ausgeführt werden kann wie mit e<strong>in</strong>er geltenden Haushaltssatzung. Sie erfordert daher,<br />
dass von der Geme<strong>in</strong>de haushaltswirtschaftliche Regelungen als Ersatz für die fehlende Haushaltssatzung mit<br />
Anlagen erlassen werden, um ihre Geschäftstätigkeit und die Verwaltungsarbeit fortzuführen. Den Rahmen dafür<br />
bietet z.B. der geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsplan, denn mit Beschluss des Rates über die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung<br />
nach § 80 Abs. 4 i.V.m. § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO <strong>NRW</strong> tritt e<strong>in</strong>e wirksame B<strong>in</strong>dung der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Verwaltung an den Willen des Rates <strong>in</strong> der Form des im Rahmen der Haushaltssatzung bestehenden geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltsplans e<strong>in</strong>.<br />
Wegen des fehlenden In-Kraft-Tretens der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung entsteht e<strong>in</strong>e Übergangszeit, <strong>in</strong> der<br />
e<strong>in</strong>hergehend mit der gesetzlich bestimmten vorläufigen Haushaltsführung der geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsplans nicht<br />
<strong>in</strong> vollem Umfang ausgeführt werden darf. Für die Übergangszeit bzw. die „haushaltslose Zeit“, die im E<strong>in</strong>zelfall<br />
auch das gesamte Haushaltsjahr umfassen kann, hat daher der Kämmerer bzw. der Bürgermeister die notwendigen<br />
e<strong>in</strong>schränkenden Bewirtschaftungsregelungen auf der Basis der aufgestellten Haushaltssatzung mit ihren<br />
Anlagen <strong>in</strong> schriftlicher Form zu treffen.<br />
Durch diese Regelungen muss die vorläufige Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln so gestaltet werden, dass<br />
dem Ziel und Zweck der vorläufigen Haushaltsführung unter Beachtung der gesetzlichen Vorschrift Genüge getan<br />
wird und auch das In-Kraft-Treten der Haushaltssatzung schnellstmöglich erreicht wird. Die örtliche Dienstanweisung<br />
ist dabei so auszugestalten, dass die laufende Aufgabenerfüllung der Geme<strong>in</strong>de auf e<strong>in</strong> sachlich und wirtschaftlich<br />
vertretbares M<strong>in</strong>destmaß zurückgeführt wird, z.B. dass nur unabweisbare Instandsetzungsmaßnahmen<br />
<strong>in</strong> Auftrag gegeben werden.<br />
Die Dienstanweisung über die vorläufige Haushaltsführung ist dem Rat zur Kenntnis zu geben. Sie sollte auch der<br />
Aufsichtsbehörde zur Kenntnis gegeben werden, wenn diese nicht auf andere Weise über die vorliegende haushaltswirtschaftliche<br />
Lage der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong>formiert wird oder die Dienstanweisung nicht von ihr angefordert wird.<br />
Wenn die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung jedoch nicht bis zum 1. April des Haushaltsjahres erfolgt<br />
ist, muss auch die Aufsichtsbehörde <strong>in</strong> ausreichendem Maße Kenntnisse über die weitere vorgesehene vorläufige<br />
Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de sowie über die vorgesehenen Maßnahmen zur Erreichung e<strong>in</strong>er geltenden<br />
Haushaltssatzung erhalten.<br />
GEMEINDEORDNUNG 352
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 82 GO <strong>NRW</strong><br />
5. Sicherstellung der Liquidität bzw. Zahlungsfähigkeit<br />
Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung hat die Sicherstellung der Liquidität bzw. die Zahlungsfähigkeit für<br />
die Geme<strong>in</strong>den e<strong>in</strong>e große Bedeutung. Der Begriff „Liquidität“ umfasst dabei die Fähigkeit der Geme<strong>in</strong>de, ihren<br />
Zahlungsverpflichtungen term<strong>in</strong>gerecht und betragsgenau nachzukommen. Bei der Liquiditätsplanung für die Zeit<br />
der vorläufigen Haushaltsführung f<strong>in</strong>den sowohl die Grundsätze der F<strong>in</strong>anzmittelbeschaffung nach § 77 GO <strong>NRW</strong><br />
als auch die Grundsätze für die Aufnahme von Krediten für Investitionen (vgl. § 86 GO <strong>NRW</strong>) und von Krediten<br />
zur Liquiditätssicherung (vgl. § 89 GO <strong>NRW</strong>) Anwendung.<br />
Die Geme<strong>in</strong>de darf z.B. <strong>in</strong> der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung e<strong>in</strong>en Kredit zur Liquiditätssicherung nur<br />
aufnehmen, wenn der Zahlungsmittelbestand für unabweisbare Auszahlungen vorübergehend erhöht werden<br />
muss und der <strong>in</strong> der letzten Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag für Kredite zur Liquiditätssicherung noch<br />
nicht ausgeschöpft ist. Auch deshalb enthalten die Vorschriften des § 86 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> und des § 89 Abs. 2<br />
GO <strong>NRW</strong> jeweils die Regelung, dass die <strong>in</strong> der Haushaltssatzung enthaltenen Ermächtigungen zur Kreditaufnahme<br />
über das Haushaltsjahr h<strong>in</strong>aus bis zum Erlass der neuen Haushaltssatzung weiter gelten.<br />
In der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung muss die Geme<strong>in</strong>de besonders darauf achten, dass sie Auszahlungen<br />
erst dann leistet, wenn e<strong>in</strong>e wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerledigung dies zw<strong>in</strong>gend erfordern. Die<br />
genannten Regelungen über die Kreditaufnahme ergänzen daher die Vorschrift über die vorläufige Haushaltsführung.<br />
Außerdem darf auch <strong>in</strong> der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung nicht unberücksichtigt bleiben, ob und <strong>in</strong><br />
welchem Umfang die Geme<strong>in</strong>de die E<strong>in</strong>ziehung von Ansprüchen <strong>in</strong> Form der Stundung h<strong>in</strong>ausschiebt oder durch<br />
Niederschlagung und Erlass auf die Durchsetzung ihrer Ansprüche verzichtet (vgl. § 23 Abs. 3 und 4 und § 26<br />
GemHVO <strong>NRW</strong>). Sie muss <strong>in</strong> dieser Zeit weiter daran arbeiten, die ihr zustehenden Ansprüche bei den betreffenden<br />
Dritten e<strong>in</strong>zuziehen.<br />
6. Ende der vorläufigen Haushaltsführung<br />
Die Zeit der vorläufigen Haushaltsführung endet regelmäßig mit der Bekanntmachung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung<br />
für das betreffende Haushaltsjahr (vgl. § 80 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong>). Durch die dann geltende Haushaltssatzung<br />
mit ihren Anlagen (vgl. § 78 GO <strong>NRW</strong>) werden die bis zu diesem Zeitpunkt im Rahmen der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltswirtschaft getätigten Aufwendungen und Auszahlungen sowie die erzielten Erträge und E<strong>in</strong>zahlungen<br />
„ordnungsgemäß“ im S<strong>in</strong>ne der vom Rat der Geme<strong>in</strong>de beschlossenen Haushaltssatzung.<br />
Die Vorschrift geht dabei von unterschiedlichen Zeitpunkten im Haushaltsjahr aus, die von den tatsächlichen<br />
örtlichen Verhältnissen abhängig s<strong>in</strong>d. Während die Bestimmungen des Absatzes 2 vorrangig auf e<strong>in</strong>e kurzfristige<br />
vorläufige Haushaltsführung abstellen, weil die Haushaltssatzung, z.B. aus technischen oder aufsichtsrechtlichen<br />
Gründen nicht vor Beg<strong>in</strong>n des Haushaltsjahres bekannt gemacht werden konnte, stellt die Vorschrift der weiteren<br />
Absätze auch auf e<strong>in</strong>e Zeit der vorläufigen Haushaltsführung nach dem 1. April des Haushaltsjahres ab. Die vorläufige<br />
Haushaltsführung soll grundsätzlich im Haushaltsjahr enden.<br />
In besonderen E<strong>in</strong>zelfällen kann auch die Situation entstehen, dass die Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Haushaltsjahr die<br />
Ausführung ihre Haushaltswirtschaft <strong>in</strong>sgesamt im Status der „vorläufigen Haushaltsführung“ organisieren und<br />
ausführen muss. Dieses ist z.B. der Fall, wenn das von der Geme<strong>in</strong>de aufgestellte Haushaltssicherungskonzept<br />
nicht genehmigungsfähig ist. In e<strong>in</strong>em solchen Fall darf die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung erst nach Erteilung<br />
der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde (vgl. § 76 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>) von der Geme<strong>in</strong>de bekannt gemacht<br />
werden (vgl. § 80 Abs. 5 S. 5 GO <strong>NRW</strong>).<br />
GEMEINDEORDNUNG 353
II. Erläuterungen im E<strong>in</strong>zelnen<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 82 GO <strong>NRW</strong><br />
1. Zu Absatz 1 (Weiterführung der Haushaltswirtschaft):<br />
1.01 Fehlende Bekanntmachung der Haushaltssatzung<br />
Die jährliche Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de erfordert e<strong>in</strong>e b<strong>in</strong>dende Grundlage für ihre Ausführung durch die<br />
geme<strong>in</strong>dliche Verwaltung. Diese Grundlage schafft der Rat der Geme<strong>in</strong>de im Rahmen se<strong>in</strong>es Budgetrechtes<br />
durch den jährlichen Erlass e<strong>in</strong>er Haushaltssatzung (vgl. § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO <strong>NRW</strong>). Die Haushaltssatzung<br />
b<strong>in</strong>det die Verwaltung der Geme<strong>in</strong>de und ermächtigt sie, die im Haushaltsplan (vgl. § 79 GO <strong>NRW</strong>) enthaltenen<br />
Ermächtigungen für die dort ausgewiesenen Zwecke <strong>in</strong> Anspruch zu nehmen, neue Verpflichtungen e<strong>in</strong>zugehen<br />
(vgl. § 85 GO <strong>NRW</strong>), aber auch Kredite zur F<strong>in</strong>anzierung von Investitionen (vgl. § 86 GO <strong>NRW</strong>) aufzunehmen.<br />
Als geme<strong>in</strong>dliche Rechtsnorm bedarf die Haushaltssatzung der Bekanntmachung, denn geme<strong>in</strong>dliche<br />
Satzungen s<strong>in</strong>d öffentlich bekannt zu machen (vgl. § 7 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong>). Für die Bekanntmachung der Haushaltssatzung<br />
durch die Geme<strong>in</strong>de ist und die Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem<br />
Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung - BekanntmVO) zu beachten.<br />
E<strong>in</strong> H<strong>in</strong>dernis für das Inkrafttreten der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung kann aber dadurch bestehen, dass der<br />
Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung nicht alle gesetzlich vorgesehenen Bestandteile, Anlagen oder<br />
Unterlagen umfasst hat. Ist ggf. e<strong>in</strong>e gesetzlich vorgesehene Anlage, z.B. der Stellenplan (vgl. § 79 Abs. 2 GO<br />
<strong>NRW</strong>), nicht Teil des Beschlusses des Rates über die Haushaltssatzung und ihre Anlagen (vgl. § 80 Abs. 5 GO<br />
<strong>NRW</strong>), ist damit e<strong>in</strong> Ratsbeschluss zustande gekommen, der e<strong>in</strong>e Bekanntmachung der Haushaltssatzung und<br />
damit ihr Inkrafttreten nicht zulässt.<br />
Weitere H<strong>in</strong>dernisse für die die Bekanntmachung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung stellen auch e<strong>in</strong>e fehlende<br />
Genehmigung für die vorgesehene Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage nach § 75 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong> oder die<br />
fehlende Genehmigung der Aufsichtsbehörde für e<strong>in</strong> Haushaltssicherungskonzept, das dem Ziel dient, im Rahmen<br />
e<strong>in</strong>er geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Geme<strong>in</strong>de zu erreichen,<br />
dar. Derartige H<strong>in</strong>dernisse hat die Geme<strong>in</strong>de möglichst unverzüglich zu beseitigen. Erst nach Beseitigung solcher<br />
H<strong>in</strong>dernisse darf die Haushaltssatzung öffentlich bekannt gemacht werden und kann <strong>in</strong> Kraft treten. Die fehlende<br />
Bekanntmachung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung führt daher nach dieser Vorschrift zur vorläufigen Haushaltsführung<br />
bei der Geme<strong>in</strong>de, <strong>in</strong> der sie die geplante Haushaltswirtschaft nur <strong>in</strong> e<strong>in</strong>geschränkter Form ausführen<br />
darf.<br />
1.1 Zu Nummer 1 (Weiterführung von Aufgaben):<br />
1.1.1 Weiterführen der laufenden Verwaltungstätigkeit der Geme<strong>in</strong>de<br />
Das geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsrecht ist darauf ausgerichtet, dass die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der<br />
Geme<strong>in</strong>de nur für e<strong>in</strong> Haushaltsjahr gelten, auch wenn die mittelfristige Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung <strong>in</strong> den<br />
Haushaltsplan <strong>in</strong>tegriert und abgebildet ist. Deshalb muss die Geme<strong>in</strong>de dafür Sorge tragen, dass die Haushaltssatzung<br />
für das neue Haushaltsjahr so rechtzeitig vorbereitet wird, damit sie mit Beg<strong>in</strong>n des Haushaltsjahres <strong>in</strong><br />
Kraft treten kann. Dennoch lässt sich <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Praxis aus unterschiedlichen Gründen nicht immer<br />
vermeiden, dass die Haushaltssatzung erst nach Beg<strong>in</strong>n des Haushaltsjahres erlassen wird.<br />
Die Geme<strong>in</strong>de muss gleichwohl <strong>in</strong> der Zeit vom Beg<strong>in</strong>n des neuen Haushaltsjahres bis zum Erlass bzw. dem In-<br />
Kraft-Treten der Haushaltssatzung für das neue Haushaltsjahr ihre rechtlichen und faktischen Verpflichtungen<br />
erfüllen und ihre Aufgabenerfüllung sowie den Betrieb ihrer E<strong>in</strong>richtungen fortsetzen. Ihr wird dazu die Möglichkeit<br />
e<strong>in</strong>geräumt, sich dafür die zur Deckung der entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen erforderlichen<br />
F<strong>in</strong>anzmittel zu beschaffen. In der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung bietet die gesetzliche Vor-<br />
GEMEINDEORDNUNG 354
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 82 GO <strong>NRW</strong><br />
schrift statt der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung die notwendigen Ermächtigungen für die Geme<strong>in</strong>de, ihre Haushaltswirtschaft<br />
aufrecht zu erhalten und damit die Funktionsfähigkeit der Geme<strong>in</strong>de zu sichern. Die rechtliche<br />
Verpflichtung als Ausgangspunkt der geme<strong>in</strong>dlichen Leistung muss jedoch bereits vor Beg<strong>in</strong>n des Haushaltsjahres<br />
entstanden se<strong>in</strong> oder auf e<strong>in</strong>em Gesetz beruhen.<br />
Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung darf die Geme<strong>in</strong>de daher nach dieser Vorschrift Aufwendungen<br />
entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung<br />
notwendiger Aufgaben unaufschiebbar s<strong>in</strong>d. Die laufende Aufgabenerfüllung ist dabei auf e<strong>in</strong> sachlich und wirtschaftlich<br />
vertretbares M<strong>in</strong>destmaß zurückzuführen, z.B. dürfen nur unabweisbare Instandsetzungsmaßnahmen<br />
<strong>in</strong> Auftrag gegeben werden. Zudem beg<strong>in</strong>nt auch bei der vorläufigen Haushaltsführung die Inanspruchnahme der<br />
haushaltsmäßigen Ermächtigungen bereits mit der Auftragserteilung. Außerdem müssen die im Rahmen der<br />
vorläufigen Haushaltsführung erzielten Erträge und E<strong>in</strong>zahlungen sowie die entstandenen Aufwendungen und<br />
Auszahlungen <strong>in</strong> den geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan für das betreffende Haushaltsjahr aufgenommen werden.<br />
Die andere Voraussetzung, die Weiterführung notwendiger Aufgaben muss unaufschiebbar se<strong>in</strong>, bed<strong>in</strong>gt e<strong>in</strong>e<br />
sorgfältige Analyse der Geme<strong>in</strong>de der aktuellen Situation, <strong>in</strong> die auch e<strong>in</strong>zubeziehen ist, dass durch e<strong>in</strong>en möglichen<br />
Verzicht ke<strong>in</strong> Verstoß gegen die Haushaltsgrundsätze entstehen darf. Als unaufschiebbar s<strong>in</strong>d dabei Aufwendungen<br />
und Auszahlungen anzusehen, wenn sie so eilbedürftig s<strong>in</strong>d, dass e<strong>in</strong>e weitere Verschiebung, z.B.<br />
bis zum In-Kraft-Treten der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung als nicht vertretbar anzusehen ist. Dagegen darf die<br />
Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung ke<strong>in</strong>e neuen rechtlichen Verpflichtungen e<strong>in</strong>gehen.<br />
1.1.2 Weiterführen der Investitionstätigkeit der Geme<strong>in</strong>de<br />
E<strong>in</strong>e Besonderheit stellen dabei geme<strong>in</strong>dliche Investitionen dar, denn die Geme<strong>in</strong>de darf nach der Vorschrift ihre<br />
Bauten, Beschaffungen und sonstige Investitionsleistungen, für die im Haushaltsplan des Vorjahres F<strong>in</strong>anzpositionen<br />
oder Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen waren, fortsetzen. Dabei muss die geme<strong>in</strong>dliche Investition<br />
e<strong>in</strong>erseits bereits im Haushaltsplan des abgelaufenen Haushaltsjahres enthalten se<strong>in</strong>, andererseits muss die<br />
Geme<strong>in</strong>de mit der Investitionsmaßnahme auch bereits begonnen haben, denn sie darf Maßnahmen fortsetzen,<br />
jedoch nicht neu beg<strong>in</strong>nen. Außerdem müssen die im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung erzielten E<strong>in</strong>zahlungen<br />
und die geleisteten Auszahlungen <strong>in</strong> den F<strong>in</strong>anzplan (vgl. § 3 GemHVO <strong>NRW</strong>) des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltsplans für das betreffende Haushaltsjahr aufgenommen werden.<br />
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass <strong>in</strong> dieser Zeit der vorläufigen Haushaltsführung die Festlegungen<br />
der Haushaltssatzung des abgelaufenen Haushaltsjahres über die Aufnahme von Krediten für Investitionen<br />
(vgl. § 86 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>), über den Höchstbetrag für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (vgl. §<br />
89 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>) sowie über die Verpflichtungsermächtigungen (vgl. § 85 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>) fortgelten. Die<br />
Ermächtigungen können <strong>in</strong> Anspruch genommen werden, soweit sie nicht vollständig im abgelaufenen Haushaltsjahr<br />
benötigt worden s<strong>in</strong>d.<br />
1.2 Zu Nummer 2 (Erhebung von Realsteuern):<br />
Zu den Steuersätzen, die von der Geme<strong>in</strong>de für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen s<strong>in</strong>d, gehören die Hebesätze<br />
für die Realsteuern, d.h. die Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken<br />
(Grundsteuer A), die Grundsteuer von weiteren Grundstücken (Grundsteuer B) und die Gewerbesteuer vom Ertrag<br />
und Kapital). Für die Grundsteuer ist den Geme<strong>in</strong>den z.B. im Rahmen des Grundsteuergesetzes das Recht<br />
e<strong>in</strong>geräumt worden, Hebesätze festzusetzen. Sie kann dazu bestimmen, mit welchem Von-Hundert-Satz des<br />
Steuermessbetrages oder des Zerlegungsanteils die Grundsteuer erhoben werden soll (vgl. § 25 GrStG). Es ist<br />
dabei der Geme<strong>in</strong>de freigestellt, die Festsetzung der Hebesätze für e<strong>in</strong> Jahr oder mehrere Jahre vorzunehmen.<br />
Sie kann den Hebesatz jedoch höchstens für den Hauptveranlagungszeitraum der Steuermessbeträge festsetzen<br />
GEMEINDEORDNUNG 355
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 82 GO <strong>NRW</strong><br />
und muss diesen Beschluss bis zum 30. Juni e<strong>in</strong>es Kalenderjahres fassen (vgl. § 25 Abs. 2 und 3 GrStG). Diese<br />
Festsetzungen müssen immer bezogen auf die e<strong>in</strong>zelnen Realsteuerarten erfolgen. Die Festsetzung gilt zudem<br />
immer, auch rückwirkend, für das ganze Haushaltsjahr. In E<strong>in</strong>zelfällen bedarf es ggf. e<strong>in</strong>er Nachtragssatzung zur<br />
Haushaltssatzung, wenn durch die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung die Hebesätze festgelegt werden.<br />
Der Geme<strong>in</strong>de ist durch die Vorschrift ausdrücklich erlaubt worden, <strong>in</strong> der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung<br />
die örtlichen Realsteuern auf der Grundlage der Festsetzungen der Haushaltssatzung des abgelaufenen Haushaltsjahres<br />
erheben, denn diese besaß die notwendige Rechtsgültigkeit, obwohl sie auf Grund der Jährlichkeit mit<br />
Ablauf des Haushaltsjahres nicht mehr <strong>in</strong> Kraft ist, aber wegen dieser gesetzlichen Regelung weiterh<strong>in</strong> Geltung<br />
entfaltet. In den Fällen, <strong>in</strong> denen im Rahmen der neuen Haushaltssatzung höhere Hebesätze geplant s<strong>in</strong>d, kann<br />
e<strong>in</strong>e endgültige und ggf. auf das Haushaltsjahr bezogene rückwirkende Festsetzung erst nach In-Kraft-Treten der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr erfolgen. Dabei ist zu beachten, dass die endgültige Festsetzung<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Hebesätze vor dem 30. Juni des betreffenden Haushaltsjahres erfolgen muss, denn<br />
sonst gelten die Hebesätze des Vorjahres weiter.<br />
1.3 Zu Nummer 3 (Kredite umschulden):<br />
1.3.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die ausdrückliche Regelung über die Zulässigkeit der Umschuldung von Krediten steht im Zusammenhang<br />
mit der Regelung <strong>in</strong> § 86 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>, dass von der Geme<strong>in</strong>de Kredite zur Umschuldung aufgenommen<br />
werden dürfen. Diese beiden ausdrücklichen Regelungen lassen e<strong>in</strong>e außerordentliche Schuldentilgung<br />
<strong>in</strong> Abhängigkeit vom örtlichen Bedarf der Geme<strong>in</strong>de zu und stellen nicht auf die Bestandskraft der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung ab. Mit der Vorschrift wird aber gleichzeitig e<strong>in</strong>e Kreditaufnahme für die<br />
ordentliche Tilgung von Schulden ausgeschlossen. Die Zahlungen, die im Rahmen der Umschuldung von<br />
Krediten <strong>in</strong>nerhalb der vorläufigen Haushaltsführung entstehen, müssen <strong>in</strong> den F<strong>in</strong>anzplan (vgl. § 3 GemH-<br />
VO <strong>NRW</strong>) des geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplans für das betreffende Haushaltsjahr aufgenommen werden.<br />
Der Begriff „Umschuldung“ soll dabei als die Begründung e<strong>in</strong>er neuen Verpflichtung der Geme<strong>in</strong>de zur Begleichung<br />
e<strong>in</strong>er bestehenden Verpflichtung verstanden werden. Durch den <strong>in</strong> der Vorschrift bestehenden Regelungszusammenhang<br />
mit der haushaltsrechtlichen Vorgabe, dass von der Geme<strong>in</strong>de Kredite nur für Investitionen aufgenommen<br />
werden dürfen. Daher bedeutet e<strong>in</strong>e Umschuldung im S<strong>in</strong>ne dieser Vorschrift, die Ablösung e<strong>in</strong>es<br />
Kredites für Investitionen durch die Aufnahme e<strong>in</strong>es neuen Kredites für Investitionen. Im Rahmen e<strong>in</strong>er Umschuldung<br />
können aber auch mehrere kle<strong>in</strong>ere Kredite zu e<strong>in</strong>em e<strong>in</strong>zigen Kredit zusammengefasst werden.<br />
Durch e<strong>in</strong>e Umschuldung wird i.d.R. das Volumen der Verb<strong>in</strong>dlichkeiten der Geme<strong>in</strong>de nicht verändert, sondern<br />
es werden lediglich die Kreditkonditionen angepasst. Unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und<br />
Sparsamkeit nach § 75 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> kann <strong>in</strong>sbesondere dann e<strong>in</strong>e Umschuldung <strong>in</strong> Betracht kommen, wenn<br />
die Konditionen für die Geme<strong>in</strong>de günstiger s<strong>in</strong>d, als die des abzulösenden Kredites für Investitionen. Die Geme<strong>in</strong>de<br />
kann im Rahmen der Umschuldung e<strong>in</strong>en neuen Vertrag mit dem Kreditgeber abschließen, sie kann aber<br />
auch den Kreditgeber wechseln. Bei e<strong>in</strong>er Umschuldung kommt jedoch ke<strong>in</strong>e Verlängerung der Laufzeit des<br />
ursprünglichen Kredites <strong>in</strong> Betracht, denn dieses käme der Neuaufnahme e<strong>in</strong>es Kredites für Investitionen gleich.<br />
1.3.2 Umwandlung kurzfristiger Investitionskredite<br />
In Sonderfällen, <strong>in</strong> denen die Geme<strong>in</strong>de ausschließlich zur vorübergehenden F<strong>in</strong>anzierung e<strong>in</strong>er Investition e<strong>in</strong>en<br />
kurzfristigen Kredit aufgenommen hat (Zwischenf<strong>in</strong>anzierung), weil z.B. e<strong>in</strong> günstiges Kreditangebot bestand,<br />
kann e<strong>in</strong> solcher Kredit auch <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en langfristigen Kredit oder e<strong>in</strong>en Annuitätenkredit umgewandelt werden. E<strong>in</strong><br />
für e<strong>in</strong>en solchen Zweck aufgenommener kurzfristiger Kredit ist nur h<strong>in</strong>sichtlich se<strong>in</strong>er Laufzeit, aber nicht wegen<br />
GEMEINDEORDNUNG 356
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 82 GO <strong>NRW</strong><br />
se<strong>in</strong>es Zweckes mit e<strong>in</strong>em Kredit zur Liquiditätssicherung vergleichbar. Der für Investitionen aufgenommene<br />
kurzfristige Kredit stellt von Anfang an e<strong>in</strong>en haushaltsrechtlichen Kredit dar, denn die E<strong>in</strong>zahlungen aus se<strong>in</strong>er<br />
Aufnahme dienen der haushaltsmäßigen Deckung von <strong>in</strong>vestiven Auszahlungen und haben nicht den allgeme<strong>in</strong>en<br />
Zweck, fällige Auszahlungen durch die Geme<strong>in</strong>de zu ermöglichen.<br />
Diese Festlegung bedeutet, dass die Aufnahme e<strong>in</strong>es solchen kurzfristigen Kredites unter die Regelungen e<strong>in</strong>er<br />
Kreditaufnahme für Investitionen fällt und daher dafür auch e<strong>in</strong>e Kreditermächtigung <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung<br />
enthalten se<strong>in</strong> muss (vgl. § 78 Abs. Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe c) GO <strong>NRW</strong>). Die Aufnahme dieses<br />
Kredites fällt deshalb nicht unter die Höchstbetragsgrenze der Kredite zur Liquiditätssicherung nach § 89 GO<br />
<strong>NRW</strong>, die ebenfalls <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung enthalten se<strong>in</strong> muss (vgl. § 78 Abs. 2 Nr. 3 GO<br />
<strong>NRW</strong>). Für die tatsächlich von der Geme<strong>in</strong>de aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung folgt daraus, dass<br />
diese Kredite nicht <strong>in</strong> langfristige Kredite oder Annuitätenkredite umgewandelt werden dürfen, denn e<strong>in</strong> solcher<br />
Vorgang steht nicht mit dem Begriff „Umschuldung“ <strong>in</strong> S<strong>in</strong>ne der Vorschrift <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang.<br />
2. Zu Absatz 2 (Aufstockung der F<strong>in</strong>anzmittel durch Kredite):<br />
2.1 Zu Satz 1 (Zulässige Kreditaufnahme):<br />
2.1.1 Die Ermittlung des Kreditbedarfs<br />
Die Vorschrift ermöglicht den Geme<strong>in</strong>den <strong>in</strong> den Fällen, <strong>in</strong> denen die F<strong>in</strong>anzmittel für die Fortsetzung der Bauten,<br />
der Beschaffungen und der sonstigen Leistungen des F<strong>in</strong>anzplans nach Absatz 1 Nr. 1 nicht ausreichen, bis zu<br />
e<strong>in</strong>em Viertel des Gesamtbetrages der <strong>in</strong> der Haushaltssatzung des Vorjahres festgesetzten Kredite für Investitionen<br />
aufzunehmen. Die Bedarfsermittlung vor der Aufnahme von Krediten im Haushaltsjahr hat die Geme<strong>in</strong>de<br />
unter Beachtung des § 77 GO <strong>NRW</strong> sowie unter E<strong>in</strong>beziehung der noch nicht ausgeschöpften Kreditermächtigungen<br />
aus den beiden Vorjahren vorzunehmen.<br />
Außerdem müssen die im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung aufgenommenen Kredite <strong>in</strong> den geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltsplan für das betreffende Haushaltsjahr aufgenommen werden. In diesem Zusammenhang ist zu<br />
beachten, dass die Kreditermächtigung der jeweiligen Haushaltssatzung bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr<br />
folgenden Jahres gilt und wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekanntgemacht<br />
wird bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung. Die Weitergeltung ist jedoch nur <strong>in</strong> dem Umfang<br />
möglich, <strong>in</strong> dem die Ermächtigungen im abgelaufenen Haushaltsjahr noch nicht <strong>in</strong> Anspruch genommen worden<br />
s<strong>in</strong>d. Dabei besteht e<strong>in</strong> Vorrang der Inanspruchnahme bestehender Kreditermächtigungen vor der Genehmigung<br />
der Kreditaufnahme nach dieser Vorschrift.<br />
2.1.2 Der Genehmigungsbedarf<br />
Die gesetzliche Möglichkeit für die Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> den Fällen, <strong>in</strong> denen die F<strong>in</strong>anzmittel für die Fortsetzung der<br />
Bauten, der Beschaffungen und der sonstigen Leistungen des F<strong>in</strong>anzplans nach Absatz 1 Nr. 1 der Vorschrift<br />
nicht ausreichen, bis zu e<strong>in</strong>em Viertel des Gesamtbetrages der <strong>in</strong> der Haushaltssatzung des Vorjahres festgesetzten<br />
Kredite für Investitionen aufzunehmen, ist ausdrücklich mit e<strong>in</strong>em Genehmigungserfordernis verbunden<br />
worden. Die zuständige Aufsichtsbehörde der Geme<strong>in</strong>de ist deshalb vor e<strong>in</strong>er Kreditaufnahme im Rahmen der<br />
vorläufigen Haushaltsführung zu beteiligen, denn die Investitionsentscheidungen der Geme<strong>in</strong>de s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> der Regel<br />
mit langfristig wirkenden Haushaltsbelastungen verbunden.<br />
GEMEINDEORDNUNG 357
2.2 Zu Satz 2 (Dr<strong>in</strong>glichkeitsliste):<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 82 GO <strong>NRW</strong><br />
Nach der Vorschrift hat die Geme<strong>in</strong>de hat dem Antrag auf Genehmigung der Aufnahme von Krediten für Investitionen<br />
e<strong>in</strong>e nach Dr<strong>in</strong>glichkeit geordnete Aufstellung der vorgesehenen unaufschiebbaren Investitionen beizufügen.<br />
Damit kann die Aufsichtsbehörde prüfen, ob die von der Geme<strong>in</strong>de vorgesehene Kreditaufnahme unter dem<br />
Gesichtspunkt e<strong>in</strong>er geordneten Haushaltswirtschaft genehmigt werden kann und erforderlich ist. Die Vorlage<br />
e<strong>in</strong>er Investitionsliste als Dr<strong>in</strong>glichkeitsliste im S<strong>in</strong>ne der Vorschrift soll möglichst noch vor Beg<strong>in</strong>n des Haushaltsjahres<br />
erfolgen. Sie bedarf zuvor des Beschlusses durch den Rat der Geme<strong>in</strong>de, da ke<strong>in</strong>e vom Rat beschlossene<br />
Haushaltssatzung besteht. In der Dr<strong>in</strong>glichkeitsliste sollten auch die Deckungsmittel, die jahresbezogen als E<strong>in</strong>zahlungen<br />
zur Deckung der von der Geme<strong>in</strong>de geplanten Investitionsmaßnahmen zur Verfügung stehen, aufgezeigt<br />
werden, damit der notwendige Kreditbedarf unmittelbar erkennbar und nachvollziehbar wird, denn dieser<br />
Betrag ist Gegenstand der gesetzlich vorgesehenen Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.<br />
Die Aufstellung der Dr<strong>in</strong>glichkeitsliste ist von der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> eigener Verantwortung vorzunehmen. Sie hat e<strong>in</strong>en<br />
eigenen Beurteilungs- und Entscheidungsspielraum und kann je nach den örtlichen Erfordernissen eigene<br />
Prioritäten setzen. Die Geme<strong>in</strong>de muss <strong>in</strong> diesem Rahmen aber auch vorrangige rechtliche Pflichten (Verkehrssicherungspflichten,<br />
Erfüllung von Auftragsangelegenheiten) sowie gesetzlich pflichtige Maßnahmen (gesetzliche<br />
Pflichtaufgaben) berücksichtigen. Aus der Reihenfolge der aufgeführten Maßnahmen müssen sich dann die von<br />
der Geme<strong>in</strong>de gewünschte Priorisierung sowie die objektive Notwendigkeit der geme<strong>in</strong>dlichen Investitionsmaßnahmen<br />
ergeben.<br />
Bei e<strong>in</strong>er Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> der vorläufigen Haushaltsführung, bei der <strong>in</strong> der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung ke<strong>in</strong><br />
Kreditbedarf besteht, entsteht jedoch ke<strong>in</strong> Genehmigungserfordernis für ihren haushaltswirtschaftlichen Investitionsmaßnahmen.<br />
Im Rahmen der Zusammenarbeit mit ihrer Aufsichtsbehörde und bezogen auf die vorläufige<br />
Haushaltsführung bietet es sich aber an, gleichwohl die Aufsichtsbehörde über die vorgesehene Umsetzung von<br />
Investitionen und ihre haushaltswirtschaftlichen Folgen zu <strong>in</strong>formieren. In diesen Fällen wäre der Aufsichtsbehörde<br />
e<strong>in</strong>e Übersicht über die haushaltsjahrbezogenen Investitionsmaßnahmen vorzulegen und ggf. auch über den<br />
Stand am Ende des Vorjahres zu berichten.<br />
2.3 Zu Satz 3 (Erteilung der Genehmigung):<br />
Die Kreditaufnahme für Investitionen bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde der Geme<strong>in</strong>de. E<strong>in</strong>e Genehmigung<br />
setzt dabei voraus, dass die Geme<strong>in</strong>de dem Antrag auf Genehmigung e<strong>in</strong>e nach Dr<strong>in</strong>glichkeit geordnete<br />
Aufstellung der vorgesehenen unaufschiebbaren Investitionen beifügt. Die Aufsichtsbehörde soll die Genehmigung<br />
unter dem Gesichtspunkt e<strong>in</strong>er geordneten Haushaltswirtschaft erteilen. Sie soll dabei <strong>in</strong>sbesondere<br />
berücksichtigen, dass die Investitionsentscheidungen der Geme<strong>in</strong>de regelmäßig mit langfristig wirkenden Haushaltsbelastungen<br />
verbunden s<strong>in</strong>d. Die Aufsichtsbehörde kann daher ihre Genehmigung auch unter Bed<strong>in</strong>gungen<br />
und mit Auflagen erteilen.<br />
2.4 Zu Satz 4 (Versagung der Genehmigung):<br />
Nach der Vorschrift soll die Aufsichtsbehörde die von der Geme<strong>in</strong>de gewünschte Genehmigung für e<strong>in</strong>e Kreditaufnahme<br />
für Investitionen <strong>in</strong> der Regel versagen, wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit<br />
der Geme<strong>in</strong>de nicht <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang stehen. Dabei gilt es <strong>in</strong>sbesondere zu beurteilen, wie sich die Investitionsentscheidungen<br />
der Geme<strong>in</strong>de langfristig auf den geme<strong>in</strong>dlichen Haushalt und auf das Gebot des jährlichen<br />
Haushaltsausgleichs nach § 75 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> auswirken. Die Aufsichtsbehörde kann daher auch zu dem<br />
Schluss gelangen, dass e<strong>in</strong>e Genehmigung zur Kreditaufnahme zu versagen ist, weil bei e<strong>in</strong>er Erteilung der Genehmigung<br />
unter Bed<strong>in</strong>gungen und mit Auflagen nicht dem gesetzlichen Erfordernis e<strong>in</strong>er geordneten Haushaltswirtschaft<br />
<strong>in</strong> ausreichendem Maße Genüge getan werden kann.<br />
GEMEINDEORDNUNG 358
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 82 GO <strong>NRW</strong><br />
3. Zu Absatz 3 (Haushaltssicherungskonzept und vorläufige Haushaltsführung):<br />
3.01 Fehlende Haushaltssatzung und Haushaltssicherungskonzept<br />
Diese Vorschrift betrifft alle die Geme<strong>in</strong>den, die nach § 76 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> zur Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes<br />
verpflichtet s<strong>in</strong>d, bei denen aber im neuen Haushaltsjahr noch ke<strong>in</strong>e Genehmigung dieses Haushaltssicherungskonzeptes<br />
durch die Aufsichtsbehörde vorliegt. Die Haushaltssatzung solcher Geme<strong>in</strong>den durfte<br />
deshalb nach § 80 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong> noch nicht bekannt gemacht werden. Diese Geme<strong>in</strong>den unterfallen daher<br />
nicht nur den Regelungen der Absätze 1 und 2, sondern müssen entsprechend ihrer defizitären Haushaltswirtschaft<br />
strengere Vorgaben beachten.<br />
Die vorläufige Haushaltsführung als Folge der Nicht-Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes der Geme<strong>in</strong>de<br />
stellt deutlich höhere Anforderungen an e<strong>in</strong>e Konsolidierung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsführung als die<br />
Bewirtschaftung e<strong>in</strong>es Haushalts mit genehmigtem Haushaltssicherungskonzept. Diese Gegebenheit hat Konsequenzen<br />
für die Ausführung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft, aber auch für die Tätigkeit der Aufsichtsbehörde<br />
der Geme<strong>in</strong>de. Der Umgang mit der vorläufigen Haushaltsführung muss daher bei allen Verantwortlichen<br />
dah<strong>in</strong>gehend ausgerichtet se<strong>in</strong>, dass es ke<strong>in</strong>e Alternative zur schnellstmöglichen Wiederherstellung e<strong>in</strong>er geordneten<br />
Haushaltswirtschaft gibt, die bei e<strong>in</strong>em mehrjährigen Weg nur über e<strong>in</strong> genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzept<br />
führt. Bis dieses Ziel erreicht ist, muss die Geme<strong>in</strong>de umfangreiche E<strong>in</strong>schränkungen bei der<br />
Gestaltung ihrer Haushaltswirtschaft mittragen.<br />
3.1 Zu Nummer 1 (Besondere haushaltswirtschaftliche Beschränkungen):<br />
E<strong>in</strong>e vorläufige Haushaltsführung <strong>in</strong> dieser Zeit aus Anlass e<strong>in</strong>es nicht-genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes<br />
muss deshalb erhebliche E<strong>in</strong>schränkungen <strong>in</strong> der Ausführung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft<br />
vorsehen, um die bestehenden defizitären örtlichen Verhältnisse grundsätzlich zu beseitigen. Es gilt <strong>in</strong><br />
dieser Zeit für die Geme<strong>in</strong>de, zusammen mit der Aufsichtsbehörde zu e<strong>in</strong>em Haushaltssicherungskonzept zu<br />
kommen, dass unter Beachtung der §§ 75 und 76 GO <strong>NRW</strong> e<strong>in</strong>en Weg der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> nicht mehr beherrschbare<br />
Verhältnisse verh<strong>in</strong>dert, die ungeregelte Haushaltswirtschaft beseitigt und zu e<strong>in</strong>em Umstieg führt, der mittelfristig<br />
die geordnete Haushaltswirtschaft und den gesetzlich vorgesehenen jährlichen Haushaltsausgleich wieder<br />
herstellt.<br />
Die längere Zeit bestehende vorläufige Haushaltsführung muss sowohl von den Verantwortlichen <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>de<br />
als auch die Öffentlichkeit zum Anlass genommen werden, alle f<strong>in</strong>anzwirksame Entscheidungen über haushaltswirtschaftliche<br />
Maßnahmen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en Konsolidierungsrahmen zu stellen und vor der Ausführung deren Notwendigkeit<br />
anhand objektiver Kriterien zu beurteilen. Dabei ist <strong>in</strong>sbesondere auch vor Ort zu klären, ob <strong>in</strong> der<br />
Vergangenheit entstandene Verpflichtungen der Geme<strong>in</strong>de heute zu e<strong>in</strong>em sche<strong>in</strong>bar nicht auflösbaren Konflikt<br />
zwischen verschiedenen gleichrangigen Rechtspflichten der Geme<strong>in</strong>de führen. Es ist dann zu prüfen, ob und ggf.<br />
welche Verpflichtungen aufgegeben werden können, denn das Recht zur Weiterführung des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushalts be<strong>in</strong>haltet auch die Pflicht für die Geme<strong>in</strong>de, notwendige Anpassungen vorzunehmen.<br />
Von der Geme<strong>in</strong>de muss außerdem festgelegt werden, mit welchen E<strong>in</strong>schränkungen <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltswirtschaft ggf. die Probleme beseitigt werden können und wie den künftigen Belastungen der Geme<strong>in</strong>de<br />
begegnet werden soll. Dieses erfordert, die Rahmenbed<strong>in</strong>gungen für die Weiterführung des Haushalts m<strong>in</strong>destens<br />
<strong>in</strong>nerhalb der Zeit der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung konkret abzustecken und e<strong>in</strong>e Überwachung<br />
der Umsetzung (Controll<strong>in</strong>g) vorzunehmen. Es gilt, e<strong>in</strong>e stetige Aufgabenerfüllung auf Dauer auch dadurch<br />
zu sichernden, dass der Weg zur Wiedererlangung e<strong>in</strong>es jährlichen Haushaltsausgleichs e<strong>in</strong>geschlagen und<br />
e<strong>in</strong>gehalten wird und notwendige Sanierungsmaßnahmen umgesetzt werden.<br />
GEMEINDEORDNUNG 359
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 82 GO <strong>NRW</strong><br />
3.2 Zu Nummer 2 (Überschreitung des Kreditrahmens):<br />
3.2.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Nach der Vorschrift kann die <strong>in</strong> Absatz 2 festgelegte Kreditvorgabe, nach dem die Geme<strong>in</strong>de mit Genehmigung<br />
der Aufsichtsbehörde höchstens Kredite für Investitionen bis zu e<strong>in</strong>em Viertel des Gesamtbetrages der <strong>in</strong> der<br />
Haushaltssatzung des Vorjahres festgesetzten Kredite aufnehmen darf, überschritten werden. Die Geme<strong>in</strong>de darf<br />
die Obergrenze der Kreditaufnahme während der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung nur überschreiten, wenn<br />
das Verbot der Kreditaufnahme anderenfalls zu e<strong>in</strong>em nicht auflösbaren Konflikt zwischen verschiedenen gleichrangigen<br />
Rechtspflichten der Geme<strong>in</strong>de führen würde. Die Aufsichtsbehörde kann ihre Genehmigung unter Bed<strong>in</strong>gungen<br />
und mit Auflagen erteilen.<br />
Diese Vorschrift, die ergänzend zu den Regelungen der Absätze 1 und 2 gilt, bildet daher die Rechtgrundlage für<br />
die Genehmigung von geme<strong>in</strong>dlichen Kreditaufnahmen über die <strong>in</strong> Absatz 2 der Vorschrift bestimmte Grenze<br />
h<strong>in</strong>aus <strong>in</strong> der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung, wenn diese wegen e<strong>in</strong>es nicht genehmigten Haushaltssicherungskonzepts<br />
besteht. E<strong>in</strong>e Kreditgenehmigung, die über e<strong>in</strong>e Genehmigung nach Absatz 2 der Vorschrift h<strong>in</strong>ausgeht,<br />
darf die Aufsichtsbehörde regelmäßig erst dann erteilen, wenn die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen,<br />
also auch das Haushaltsicherungskonzept, vom Rat der Geme<strong>in</strong>de beschlossen und der Aufsichtsbehörde<br />
mit dem „Antrag“ angezeigt worden ist, das Haushaltsicherungskonzept zu genehmigen.<br />
In diesem Zusammenhang kann die Aufsichtsbehörde von der Geme<strong>in</strong>de für e<strong>in</strong>e Kreditgenehmigung nach dieser<br />
Vorschrift und entsprechend der Vorgabe <strong>in</strong> Absatz 2 Satz 2 der Vorschrift verlangen, dass dem Antrag der<br />
geme<strong>in</strong>de auf Genehmigung ebenfalls e<strong>in</strong>e nach Dr<strong>in</strong>glichkeit geordnete Aufstellung der vorgesehenen unaufschiebbaren<br />
Investitionen beizufügen ist. Beim späteren Haushaltsvollzug kann die Aufsichtsbehörde ggf. den<br />
Austausch e<strong>in</strong>zelner Investitionsmaßnahmen und/oder e<strong>in</strong>zelner maßnahmebezogener Auszahlungen des Haushaltsjahres<br />
(Abweichen von der Planung) zulassen, wenn sich dadurch der genehmigte Rahmen der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Kreditaufnahmen des Haushaltsjahres <strong>in</strong>sgesamt nicht erhöht und ke<strong>in</strong>e neuen Dauerverpflichtungen von<br />
der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>gegangen werden, die e<strong>in</strong> E<strong>in</strong>halten e<strong>in</strong>es genehmigungsfähigen Kreditrahmens <strong>in</strong> künftigen<br />
Haushaltsjahren gefährden.<br />
3.2.2 Investitions-Dr<strong>in</strong>glichkeitslisten<br />
Durch die Vorschrift des § 82 Abs. 3 Nr. 2 GO <strong>NRW</strong> wird ke<strong>in</strong>e Obergrenze für die genehmigungsfähige Kreditaufnahme<br />
der Geme<strong>in</strong>de bestimmt. Die Zustimmung kann aber nur im Rahmen e<strong>in</strong>er angemessenen Begrenzung<br />
der Kreditaufnahme unter E<strong>in</strong>beziehung der vorgesehenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen erfolgen. Die<br />
Berechnung des Kreditaufnahmerahmens ist im Leitfaden „Haushaltssicherung“ enthalten. Dazu werden rentierliche<br />
sowie teil- und unrentierliche Investitionen unterschieden. Als „rentierlich“ sollen dabei solche Investitionen<br />
gelten, die im Wesentlichen durch Gebühren und Beiträge ref<strong>in</strong>anziert werden.<br />
Der Unterscheidung zwischen „rentierlichen“ und „teil-“ bzw. „unrentierlichen“ Investitionen liegt deshalb ke<strong>in</strong>e<br />
betriebswirtschaftliche Def<strong>in</strong>ition dieser Begriffe zugrunde. Sie dient vielmehr e<strong>in</strong>er e<strong>in</strong>fachen Abgrenzung der<br />
Investitionstätigkeit, die für Geme<strong>in</strong>den und Aufsichtsbehörden leicht zu handhaben ist. Das Ziel dieser Festlegung<br />
ist e<strong>in</strong>e Verfahrensvere<strong>in</strong>fachung und e<strong>in</strong>e pauschale Zuordnung von Maßnahmen, die es den Geme<strong>in</strong>den<br />
<strong>in</strong> vorläufiger Haushaltsführung gestattet, Investitionsvorhaben <strong>in</strong> den zuvor def<strong>in</strong>ierten Aufgabenbereichen durch<br />
die Aufnahme von Krediten für Investitionen bestreiten zu können, ohne dass diese auf den Kreditrahmen angerechnet<br />
werden. Im Ergebnis ist der Grundsatz zu beachten, dass e<strong>in</strong>e Neuverschuldung (Kreditaufnahme für<br />
Investitionen) für die teil- und unrentierlichen Eigenanteile unzulässig ist.<br />
Die Geme<strong>in</strong>de hat ihrem Antrag auf Genehmigung der vorgesehenen Kreditaufnahmen deshalb zwei Dr<strong>in</strong>glichkeitslisten<br />
beizufügen, die <strong>in</strong> eigener Verantwortung von der Geme<strong>in</strong>de nach dem Muster, das dem Leitfaden<br />
GEMEINDEORDNUNG 360
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 82 GO <strong>NRW</strong><br />
„Haushaltssicherung“ beigefügt ist, aufzustellen s<strong>in</strong>d. In der Dr<strong>in</strong>glichkeitsliste A sollen die rentierlichen Investitionsmaßnahmen<br />
und <strong>in</strong> der Dr<strong>in</strong>glichkeitsliste B die teil- und unrentierlichen Investitionsmaßnahmen aufgezeigt<br />
werden. Beide Dr<strong>in</strong>glichkeitslisten s<strong>in</strong>d unter Beachtung des Bruttopr<strong>in</strong>zips und auf der Grundlage der jahresbezogenen<br />
Auszahlungen der Geme<strong>in</strong>de aus ihrer Investitionstätigkeit aufzustellen.<br />
Die Geme<strong>in</strong>de hat bei der Aufstellung ihrer nach Dr<strong>in</strong>glichkeit geordnete Aufstellung der vorgesehenen unaufschiebbaren<br />
Investitionen gesondert auch den Eigenanteil anzugeben. Sie hat dabei zu beachten, dass im Rahmen<br />
der Beurteilung des geme<strong>in</strong>dlichen Kreditbedarfs bestimmte F<strong>in</strong>anzleistungen Dritter auf den Eigenanteil der<br />
Geme<strong>in</strong>de angerechnet werden, wenn diese Beträge bezogen auf das Haushaltsjahr zur Verfügung stehen. Zu<br />
solchen F<strong>in</strong>anzleistungen zählen z.B. zweckgebundene Zuwendungen und zwar unabhängig davon, ob diese<br />
bezogen auf e<strong>in</strong>zelne Projekte oder pauschal, z.B. als allgeme<strong>in</strong>e Investitionspauschale, gewährt werden. Auch<br />
Beiträge, die von der Geme<strong>in</strong>de z.B. im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen oder Erschließungsmaßnahmen<br />
erhoben werden, können zur Reduzierung des geme<strong>in</strong>dlichen Eigenanteils führen.<br />
4. Zu Absatz 4 (Längerfristige vorläufige Haushaltsführung):<br />
Die Geme<strong>in</strong>den, die aus unterschiedlichen Gründen den Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr bzw.<br />
das In-Kraft-Treten nicht vornehmen können, und deshalb bei ihnen das Ende der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung<br />
nicht absehbar ist bzw. diese schon so weit <strong>in</strong> das neue Haushaltsjahr h<strong>in</strong>e<strong>in</strong>reicht, sollen wie Geme<strong>in</strong>den<br />
behandelt werden, die sich <strong>in</strong> der vorläufigen Haushaltsführung bef<strong>in</strong>den, weil ihr Haushaltssicherungskonzept<br />
nicht den Genehmigungsanforderungen entspricht und daher noch nicht genehmigt worden ist.<br />
Die Vorschrift sieht deshalb vor, dass auch für die Geme<strong>in</strong>den die Bestimmungen des Absatzes 3 gelten sollen,<br />
bei denen nach dem 1. April des Haushaltsjahres noch ke<strong>in</strong>e Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr <strong>in</strong> Kraft<br />
getreten ist, selbst dann, wenn e<strong>in</strong> ausgeglichener Haushalt (vgl. § 75 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>) im Entwurf vorliegt, aber<br />
vom Rat der Geme<strong>in</strong>de noch nicht beschlossen worden ist bzw. wegen der fehlenden Bekanntmachung noch<br />
nicht <strong>in</strong> Kraft getreten ist. In diesen Fällen sollen bei der Geme<strong>in</strong>de ebenfalls die haushaltsmäßigen E<strong>in</strong>schränkungen<br />
gelten, wie sie sonst nur bei Geme<strong>in</strong>den mit e<strong>in</strong>em nicht genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzept<br />
zum Tragen kommen.<br />
Zur Klarstellung wird dabei ausdrücklich ergänzt, dass derartige Beschränkungen lediglich bis zur Beschlussfassung<br />
über e<strong>in</strong>en ausgeglichenen Haushalt oder bis zur Erteilung der Genehmigung für e<strong>in</strong> Haushaltssicherungskonzept<br />
zu beachten s<strong>in</strong>d. In den beiden Fällen wirken sich daher die Beschränkungen bis zur öffentlichen Bekanntmachung<br />
der Haushaltssatzung aus, denn diese tritt erst danach <strong>in</strong> Kraft (vgl. § 7 GO Abs. 4 GO <strong>NRW</strong>).<br />
Diese rechtliche Vorgabe ist auch dann zu beachten, wenn bis zu dem genannten Term<strong>in</strong> (1. April des Haushaltsjahres)<br />
ke<strong>in</strong> ausgeglichener Haushalt beschlossen worden ist. Die Geme<strong>in</strong>den, die unter diese Regelungen fallen,<br />
müssen entsprechend ihrer nicht hergestellten geordneten Haushaltswirtschaft strenge Vorgaben bei der Weiterführung<br />
ihrer Aufgaben im bereits begonnenen neuen Haushaltsjahr beachten, die vom Bürgermeister <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
örtlichen Dienstanweisung als Ersatz für die noch nicht geltende Haushaltssatzung erlassen werden soll.<br />
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ<br />
GEMEINDEORDNUNG 361
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 83 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 83<br />
Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen<br />
(1) 1 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen s<strong>in</strong>d nur zulässig, wenn sie unabweisbar<br />
s<strong>in</strong>d. 2 Die Deckung muss jeweils im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet se<strong>in</strong>. 3 Über die Leistung dieser<br />
Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer, wenn e<strong>in</strong> solcher nicht bestellt ist, der Bürgermeister,<br />
soweit der Rat ke<strong>in</strong>e andere Regelung trifft. 4 Der Kämmerer kann mit Zustimmung des Bürgermeisters<br />
und des Rates die Entscheidungsbefugnis auf andere Bedienstete übertragen.<br />
(2) 1 S<strong>in</strong>d die überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erheblich, bedürfen sie<br />
der vorherigen Zustimmung des Rates; im Übrigen s<strong>in</strong>d sie dem Rat zur Kenntnis zu br<strong>in</strong>gen. 2 § 81 Abs. 2 bleibt<br />
unberührt.<br />
(3) 1 Für Investitionen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden, s<strong>in</strong>d überplanmäßige Auszahlungen auch dann<br />
zulässig, wenn ihre Deckung erst im folgenden Jahr gewährleistet ist. 2 Absatz 1 Sätze 3 und 4 und Absatz 2 gelten<br />
s<strong>in</strong>ngemäß.<br />
(4) Die Absätze 1 bis 3 f<strong>in</strong>den entsprechende Anwendung auf Maßnahmen, durch die später über- oder außerplanmäßige<br />
Aufwendungen und Auszahlungen entstehen können.<br />
Erläuterungen zu § 83:<br />
I. Allgeme<strong>in</strong>es<br />
1. Mehrbedarf bei den Ermächtigungen im Haushaltsjahr<br />
1.1 Ermächtigungen im Haushaltsplan<br />
Die jährliche Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de erfordert e<strong>in</strong>e b<strong>in</strong>dende Grundlage für ihre Ausführung durch die<br />
geme<strong>in</strong>dliche Verwaltung. Diese Grundlage schafft der Rat der Geme<strong>in</strong>de im Rahmen se<strong>in</strong>es Budgetrechtes<br />
durch den jährlichen Erlass e<strong>in</strong>er Haushaltssatzung mit ihren Anlagen (vgl. § 41 Abs. 1 Buchstabe h) i.V.m. § 78<br />
GO <strong>NRW</strong>). E<strong>in</strong> auf der beschlossenen Haushaltsatzung aufbauender geme<strong>in</strong>dlicher Haushalt ist Ausdruck der<br />
F<strong>in</strong>anzhoheit der Geme<strong>in</strong>de und der geme<strong>in</strong>dlichen Selbstverwaltung. Es muss dabei von der Geme<strong>in</strong>de gewährleistet<br />
werden, dass durch der Haushaltsplan alle Ermächtigungen für die geme<strong>in</strong>dliche Verwaltung enthält, die<br />
zur Ausführung und E<strong>in</strong>haltung des Haushaltsplans der Geme<strong>in</strong>de im betreffenden Haushaltsjahr notwendig s<strong>in</strong>d.<br />
Der geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsplan ist daher nach Maßgabe der Geme<strong>in</strong>deordnung und der auf Grund dieses Gesetzes<br />
erlassenen Geme<strong>in</strong>dehaushaltsverordnung für die Haushaltsausführung der Geme<strong>in</strong>de verb<strong>in</strong>dlich. Er<br />
muss deshalb alle Informationen für das Haushaltsjahr und die daran anschließenden drei Planungsjahre bereitstellen,<br />
die für die Ausführung der Haushaltsplanung sowie die spätere Haushaltskontrolle wichtig s<strong>in</strong>d. Er stellt<br />
damit e<strong>in</strong> örtliches Programm für die Erledigung der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgaben im Haushaltsjahr dar.<br />
Bei der Veranschlagung von Erträgen und Aufwendungen sowie E<strong>in</strong>zahlungen und Auszahlungen im geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltsplan ist daher auch die damit verbundene Zwecksetzung im S<strong>in</strong>ne des Grundsatzes der Spezialität<br />
der Veranschlagung zu beachten, der durch die Vorschriften <strong>in</strong> den §§ 2, 3, 4 und 11 GemHVO <strong>NRW</strong> näher<br />
ausgefüllt wird. Dem Grundsatz der sachlichen B<strong>in</strong>dung der im Haushaltsplan ausgewiesenen Haushaltspositionen<br />
muss unter Beachtung der genannten Vorschriften ebenfalls Genüge getan werden. Daher müssen auch die<br />
e<strong>in</strong>zelnen Positionen im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan nach Zweck und Betrag h<strong>in</strong>reichend bestimmt se<strong>in</strong> und<br />
ggf. im Vorbericht zum Haushaltsplan näher erläutert werden (vgl. § 7 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
GEMEINDEORDNUNG 362
1.2 Zusätzlicher Bedarf bei der Haushaltsausführung<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 83 GO <strong>NRW</strong><br />
Im Rahmen der Ausführung des Haushaltsplans der Geme<strong>in</strong>de durch die geme<strong>in</strong>dliche Verwaltung kann sich die<br />
Notwendigkeit e<strong>in</strong>es Mehrbedarfs bei den im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen ergeben, weil die Entwicklung<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft anders verläuft als nach dem aufgestellten Haushaltsplan vorgesehen.<br />
Ergibt sich im Laufe des geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsjahres, dass die Erfüllung der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgaben<br />
höhere Aufwendungen und/oder Auszahlungen erfordert, als der geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsplan dafür vorsieht,<br />
müsste der Haushaltsplan von der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong>soweit geändert werden, damit die Erfüllung der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Aufgaben sichergestellt wird. E<strong>in</strong>e Änderung des Haushaltsplans im Laufe e<strong>in</strong>es Haushaltsjahres ist aber grundsätzlich<br />
nur durch e<strong>in</strong>e Nachtragssatzung nach § 81 GO <strong>NRW</strong> möglich.<br />
In e<strong>in</strong>er Vielzahl von Fällen ergibt sich im Laufe e<strong>in</strong>es Haushaltsjahres e<strong>in</strong> Mehrbedarf bei den im Haushaltsplan<br />
enthaltenen Ermächtigungen <strong>in</strong> mehr oder weniger großem Umfang, so dass sich ggf. sehr häufig der Erlass<br />
e<strong>in</strong>er geme<strong>in</strong>dlichen Nachtragssatzung ergeben könnte. E<strong>in</strong>e Nachtragssatzung ist aber <strong>in</strong> dem gleichen förmlichen<br />
Verfahren aufzustellen wie die ursprüngliche Haushaltssatzung der Geme<strong>in</strong>de (vgl. § 81 Abs. 1 S. 2 GO<br />
<strong>NRW</strong>). Wäre e<strong>in</strong>e solche Vorgehensweise ständig erforderlich, könnte sich diese erschwerend auf die weitere<br />
notwendige Ausführung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft auswirken.<br />
Die Geme<strong>in</strong>de ist deshalb nur <strong>in</strong> wenigen wichtigen Fällen zum Erlass e<strong>in</strong>er geme<strong>in</strong>dlichen Nachtragssatzung<br />
verpflichtet, z.B. wenn sich zeigt, dass e<strong>in</strong> erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird oder bisher nicht veranschlagte<br />
oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei e<strong>in</strong>zelnen Haushaltspositionen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em erheblichen<br />
Umfang geleistet werden müssen oder Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet<br />
werden sollen (vgl. § 81 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>).<br />
Für den übrigen kle<strong>in</strong>eren Mehrbedarf bei der Haushaltsausführung ist durch die Vorschrift e<strong>in</strong> vere<strong>in</strong>fachtes<br />
Verfahren ermöglicht worden. Mit Zustimmung des Kämmerers oder des Bürgermeisters (vgl. Regelung <strong>in</strong> Absatz<br />
1 Satz 3 der Vorschrift) werden zusätzliche haushaltsmäßigen Ermächtigungen möglich, um höhere Aufwendungen<br />
entstehen zu lassen und/oder Auszahlungen leisten zu können, ohne dass es der Aufstellung e<strong>in</strong>er geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Nachtragssatzung bedarf. Die überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Aufwendungen und/oder Auszahlungen<br />
verändern jedoch nicht die betroffenen Haushaltspositionen im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan. Unter die<br />
Vorschrift des § 83 GO <strong>NRW</strong> dabei fallen jedoch nicht geme<strong>in</strong>dliche Aufwendungen und Auszahlungen, die im<br />
Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung der Geme<strong>in</strong>de nach der Vorschrift des § 82 GO <strong>NRW</strong> entstehen.<br />
1.3 Die Begriffe „überplanmäßig“ und „außerplanmäßig“<br />
1.3.1 Der Begriff „überplanmäßig“<br />
Im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsrecht stellen die unter den zutreffenden Haushaltspositionen im Ergebnisplan veranschlagten<br />
und betragsmäßig festgesetzten Aufwendungen und die im F<strong>in</strong>anzplan veranschlagten Auszahlungen<br />
für die Ausführung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft verb<strong>in</strong>dliche Obergrenzen dar (Planansatz). Als planmäßige<br />
Aufwendungen und Auszahlungen gelten daher alle Ermächtigungen, die zum Zeitpunkt der Beschlussfassung<br />
des Rates über die Haushaltssatzung im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan veranschlagt worden s<strong>in</strong>d.<br />
Der Begriff „überplanmäßig“ wird deshalb von dem haushaltsrechtlichen Begriff „planmäßig“ abgeleitet. Als überplanmäßig<br />
werden daher geme<strong>in</strong>dliche Aufwendungen oder Auszahlungen bezeichnet, wenn diese über die im<br />
Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen e<strong>in</strong>schließlich der aus dem Vorjahr übertragenen Ermächtigungen,<br />
also über den fortgeschriebenen Planansatz h<strong>in</strong>ausgehen (zusätzliche Ermächtigungen). Der Begriff „überplanmäßig“<br />
be<strong>in</strong>haltet daher bereits, dass dadurch e<strong>in</strong>e Abweichung von den im Haushaltsplan der Geme<strong>in</strong>de<br />
ausgewiesenen Ermächtigungen vorliegen muss. Zudem werden durch die Inanspruchnahme der zusätzlichen<br />
GEMEINDEORDNUNG 363
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 83 GO <strong>NRW</strong><br />
Ermächtigungen durch die geme<strong>in</strong>dliche Verwaltung die im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan enthaltenen Haushaltspositionen<br />
nicht unmittelbar verändert.<br />
1.3.2 Der Begriff „außerplanmäßig“<br />
Im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsrecht stellen die unter den zutreffenden Haushaltspositionen im Ergebnisplan veranschlagten<br />
und betragsmäßig festgesetzten Aufwendungen und die im F<strong>in</strong>anzplan veranschlagten Auszahlungen<br />
für die Ausführung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft verb<strong>in</strong>dliche Obergrenzen dar (Planansatz). Als planmäßige<br />
Aufwendungen und Auszahlungen gelten alle Ermächtigungen, die zum Zeitpunkt der Beschlussfassung<br />
des Rates über die Haushaltssatzung im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan veranschlagt worden s<strong>in</strong>d.<br />
Der Begriff „außerplanmäßig“ wird deshalb von dem haushaltsrechtlichen Begriff „planmäßig“ abgeleitet. Als außerplanmäßig<br />
werden daher geme<strong>in</strong>dliche Aufwendungen oder Auszahlungen bezeichnet, wenn dafür ke<strong>in</strong>e<br />
Ermächtigungen im Haushaltsplan veranschlagt und ke<strong>in</strong>e Ermächtigungen aus dem Vorjahr übertragen worden<br />
s<strong>in</strong>d, also auch ke<strong>in</strong> fortgeschriebener Planansatz besteht (zusätzliche Ermächtigungen). Der Begriff „außerplanmäßig“<br />
be<strong>in</strong>haltet dabei bereits, dass dadurch e<strong>in</strong>e Abweichung vom Haushaltsplan der Geme<strong>in</strong>de vorliegen<br />
muss. Zudem werden durch die Inanspruchnahme der zusätzlichen Ermächtigungen durch die geme<strong>in</strong>dliche<br />
Verwaltung die im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan enthaltenen Haushaltspositionen nicht unmittelbar verändert.<br />
2. Mehrbedarf bei Ermächtigungen nach Ablauf des Haushaltsjahres<br />
2.1 Zusammenführung der Verfahren bei Aufwendungen<br />
E<strong>in</strong> Anlass für überplanmäßige und/oder außerplanmäßige Aufwendungen kann sich auch im Rahmen des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Jahresabschlusses ergeben, wenn z.B. die haushaltsmäßige Inanspruchnahme der im Haushaltsplan<br />
veranschlagten Ermächtigungen erst bei der Aufstellung des Jahresabschlusses gebucht wird, z.B. bilanzielle<br />
Abschreibungen. S<strong>in</strong>d besondere Ereignisse im abgelaufenen Haushaltsjahr e<strong>in</strong>getreten, die diesem Haushaltsjahr<br />
wirtschaftlich zuzurechnen s<strong>in</strong>d und die deshalb zu Veränderungen gegenüber der Veranschlagung im<br />
Haushaltsplan führen, s<strong>in</strong>d diese von der Geme<strong>in</strong>de im Jahresabschluss des betreffenden Haushaltsjahres zu<br />
berücksichtigen. Entsteht im Rahmen der Aufstellung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses e<strong>in</strong> Bedarf für überplanmäßige<br />
und/oder außerplanmäßige Aufwendungen ist es nicht sachgerecht, dafür zusätzlich zum Aufstellungsverfahren<br />
e<strong>in</strong> gesondertes Verfahren für die E<strong>in</strong>holung der Zustimmung des Kämmerers, Bürgermeisters<br />
oder des Rates durchzuführen.<br />
In diesen Fällen sollen vielmehr das Aufstellungsverfahren und das Zustimmungsverfahren mite<strong>in</strong>ander verknüpft<br />
werden. Diese Zusammenführung ist wegen der Pflicht des Kämmerers zur Aufstellung des Entwurfs des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Jahresabschlusses (vgl. § 95 Abs. 3 S. 1 GO <strong>NRW</strong>), der Pflicht des Bürgermeisters zur Bestätigung<br />
dieses Entwurfs (vgl. § 95 Abs. 3 S. 2 GO <strong>NRW</strong>) und der Pflicht des Rates zur Feststellung des Jahresabschlusses<br />
(vgl. § 96 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>) haushaltswirtschaftlich geboten und beschneidet ke<strong>in</strong>e Entscheidungskompetenz<br />
der genannten Verantwortlichen für die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft. Die am geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss<br />
genannten Beteiligten können dabei im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten den erforderlich gewordenen<br />
überplanmäßigen und/oder außerplanmäßigen Aufwendungen zustimmen und dann <strong>in</strong> den Jahresabschluss<br />
übernehmen oder sie ggf. auch ablehnen und nicht übernehmen.<br />
2.2 Ke<strong>in</strong> Mehrbedarf bei den Auszahlungen<br />
Nach Ablauf des Haushaltsjahres können überplanmäßige und/oder außerplanmäßige Auszahlungen nicht mehr<br />
auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogen werden. Diese strenge zeitliche Beschränkung <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
GEMEINDEORDNUNG 364
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 83 GO <strong>NRW</strong><br />
Zahlungsabwicklung ergibt sich aus dem zu beachtenden Kassenwirksamkeitspr<strong>in</strong>zip und dem Jährlichkeitspr<strong>in</strong>zip.<br />
Die geme<strong>in</strong>dlichen Zahlungen und damit auch die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen s<strong>in</strong>d immer<br />
dem jeweils aktuellen Haushaltsjahr zuzuordnen (vgl. § 11 Abs. 3 GemHVO <strong>NRW</strong>). Sie dürfen daher <strong>in</strong>nerhalb<br />
e<strong>in</strong>es Haushaltsjahres weder dem vorherigen bereits abgelaufenen Haushaltsjahr noch dem künftigen Haushaltsjahr<br />
zugeordnet werden. E<strong>in</strong> Mehrbedarf bei den Ermächtigungen für Auszahlungen kann sich daher nach Ablauf<br />
des Haushaltsjahres nicht mehr ergeben.<br />
3. Über- oder außerplanmäßige Verfügungsmittel<br />
Die Regelung, die Ermächtigungen für die Verfügungsmittel dürfen von der Bürgermeister<strong>in</strong> oder vom Bürgermeister<br />
nicht überschritten und nicht für andere Zwecke e<strong>in</strong>gesetzt werden, trägt dem Umstand Rechnung, dass<br />
die Verfügungsmittel ausschließlich zur dienstlichen Aufgabenerledigung dieser Personen oder anderer Verfügungsberechtigter<br />
zur Verfügung stehen. Die Verfügungsmittel dürfen daher nicht für Zwecke außerhalb der Aufgabenerfüllung<br />
der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> Anspruch genommen werden. Auch dürfen sie nicht ersatzweise für Zwecke, die<br />
zwar zum Aufgabenbereich der Geme<strong>in</strong>de gehören, für die aber e<strong>in</strong>e Veranschlagung im Haushaltsplan nicht<br />
enthalten ist, weil z.B. die Veranschlagung übersehen wurde, nicht <strong>in</strong> Anspruch genommen werden.<br />
Die im Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen stellen den ausgewiesenen Rahmen für die Verfügungsmittel<br />
dar, der nicht überschritten werden darf. E<strong>in</strong> möglicher Mehrbedarf bzw. e<strong>in</strong>e Erhöhung der Verfügungsmittel<br />
der Bürgermeister<strong>in</strong> oder des Bürgermeisters <strong>in</strong>nerhalb des Haushaltsjahres darf auch nicht durch Zuwendungen<br />
Dritter oder im Wege überplanmäßiger Aufwendungen nach § 83 GO <strong>NRW</strong> befriedigt werden. E<strong>in</strong>e Verstärkung<br />
der Verfügungsmittel oder e<strong>in</strong>e Veranschlagung entsprechender Ermächtigungen, ist nur im Rahmen e<strong>in</strong>er<br />
Nachtragssatzung nach § 81 GO <strong>NRW</strong> möglich.<br />
4. Die Stellung des Kämmerers<br />
Die Entscheidungsbefugnis über überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen ist<br />
nach dieser Vorschrift ausdrücklich dem Kämmerer, der für das F<strong>in</strong>anzwesen der Geme<strong>in</strong>de verantwortlich ist,<br />
zugesprochen worden. Wegen der ergänzenden gesetzlichen Festlegung: „wenn e<strong>in</strong> solcher nicht bestellt ist, der<br />
Bürgermeister“ ist diese Entscheidungsbefugnis über zulässige Überschreitungen der im Haushaltsplan enthaltenen<br />
oder über noch nicht enthaltene Ermächtigungen als e<strong>in</strong>e organgleiche Handlung zu bewerten. Die Entscheidungsbefugnis<br />
nach dieser Vorschrift darf daher nur von e<strong>in</strong>em Kämmerer ausgeübt werden, der bestellt worden<br />
ist. Sie darf nicht von e<strong>in</strong>em Kämmerer ausgeübt werden, der lediglich vom Bürgermeister beauftragt worden ist.<br />
Nach der Vorschrift des § 71 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong> besteht für die kreisfreien Städte die Verpflichtung, e<strong>in</strong>en Beigeordneten<br />
als Stadtkämmerer zu bestellen. In den übrigen Geme<strong>in</strong>den kann e<strong>in</strong> Kämmerer bestellt oder beauftragt<br />
werden. Ist e<strong>in</strong> Kämmerer bestellt, hat dieser die Zuständigkeit und das Recht, alle Aufgaben durchzuführen, die<br />
ihm durch Gesetz zugewiesen s<strong>in</strong>d. Ist der Kämmerer beauftragt, stehen ihm auf Grund der Regelung „soweit er<br />
nicht bestellt ist“, nicht die Rechte e<strong>in</strong>es vom Bürgermeister bestellten Kämmerer zu (vgl. § 83 GO <strong>NRW</strong> und § 24<br />
GemHVO <strong>NRW</strong>). Es ist jedoch zu beachten, dass die Entscheidung über überplanmäßige und außerplanmäßige<br />
Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> als e<strong>in</strong>e organgleiche Handlung zu bewerten ist.<br />
Die Befugnisse können daher nur von e<strong>in</strong>em Kämmerer ausgeübt werden, der bestellt worden ist. Diese Vorgabe<br />
ist immer bei e<strong>in</strong>em Beigeordneten erfüllt, der nach § 71 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong> zum Kämmerer bestellt ist.<br />
Diese Gegebenheiten setzen aber nicht voraus, dass <strong>in</strong> den Geme<strong>in</strong>den nur e<strong>in</strong> Beigeordneter das Amt des<br />
Kämmerers ausüben kann. Für die kreisangehörigen Geme<strong>in</strong>den besteht ke<strong>in</strong>e gesetzliche Verpflichtung, e<strong>in</strong>en<br />
Beigeordneten als Kämmerer zu bestellen, sondern nach § 71 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong> nur für die kreisfreien Städte.<br />
Auch zukünftig ist es - wie bisher - haushaltsrechtlich gesehen sachgerecht und vertretbar, e<strong>in</strong>e qualitative Unterscheidung<br />
bei der Ausübung von f<strong>in</strong>anzwirksamen Rechten durch Kämmerer vorzunehmen, und ggf. nur den<br />
GEMEINDEORDNUNG 365
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 83 GO <strong>NRW</strong><br />
Bürgermeister die o.a. organgleichen Rechte ausüben zu lassen. Die Tätigkeit des Kämmerers im Rahmen se<strong>in</strong>er<br />
Beauftragung durch den Bürgermeister kann für das haushaltswirtschaftliche Handeln der Geme<strong>in</strong>de ausreichend<br />
se<strong>in</strong>. Dies ist unter örtlichen Gesichtspunkten abzuwägen. Die Entscheidung des Bürgermeisters ist dem Rat zur<br />
Kenntnis zu geben.<br />
II. Erläuterungen im E<strong>in</strong>zelnen<br />
1. Zu Absatz 1 (Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen):<br />
1.1 Zu Satz 1 (Zulässigkeit von über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen):<br />
Nach der Vorschrift s<strong>in</strong>d über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie<br />
unabweisbar s<strong>in</strong>d. Der Begriff der Unabweisbarkeit, der vom Gesetzgeber nicht näher def<strong>in</strong>iert worden ist, stellt<br />
auf die dr<strong>in</strong>gende Notwendigkeit bzw. Eilbedürftigkeit der Umsetzung sowie darauf ab, dass e<strong>in</strong>e Verschiebung<br />
auf e<strong>in</strong>en späteren Zeitpunkt nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Dafür soll das nachfolgende<br />
Schema e<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>stieg bieten (vgl. Abbildung).<br />
Haushalts-<br />
positionen<br />
des<br />
Ergebnisplans<br />
oder des<br />
F<strong>in</strong>anzplans<br />
Bedarf für überplanmäßige Ermächtigungen<br />
Inhalte<br />
Haushaltsansatz nach Haushaltsplan<br />
+ übertragene Ermächtigungen aus dem Vorjahr<br />
+/- Veränderung durch e<strong>in</strong>e Nachtragssatzung<br />
+/- Veränderung durch örtliche Entscheidungen (z.B. Deckung)<br />
= Fortgeschriebener Haushaltsansatz (Gesamtermächtigung)<br />
- Bisherige Inanspruchnahme<br />
- Vormerkungen<br />
= noch verfügbare Ermächtigungen<br />
- Mehrbedarf<br />
= Bedarf für e<strong>in</strong>e überplanmäßige Ermächtigung<br />
Abbildung 56 „Bedarf für überplanmäßige Ermächtigungen“<br />
Die Geme<strong>in</strong>de muss auf Grund rechtlicher oder faktischer Zwänge weder sachlich noch zeitlich e<strong>in</strong>e Handlungsalternative<br />
haben. Im Bedarfsfalle ist deshalb sorgfältige Analyse notwendig, um e<strong>in</strong>en Mehrbedarf gegenüber den<br />
bestehenden haushaltsplanmäßigen Ermächtigungen festzustellen.<br />
1.2 Zu Satz 2 (Notwendigkeit e<strong>in</strong>er Deckung der zusätzlichen Aufwendungen und Auszahlungen):<br />
Die weitere Voraussetzung bei der Entscheidung über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen<br />
ist, dass für jeden E<strong>in</strong>zelfall e<strong>in</strong>e „Deckung“ dafür im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet se<strong>in</strong> muss.<br />
Diese Regelung verlangt e<strong>in</strong> flexibles Handeln der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung im Rahmen der Haushaltssatzung.<br />
Die Geme<strong>in</strong>de hat z.B. die Möglichkeit festzulegen, dass wegen des Mehrbedarfs übertragene Ermächtigungen<br />
GEMEINDEORDNUNG 366<br />
Euro
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 83 GO <strong>NRW</strong><br />
nicht <strong>in</strong> Anspruch genommenen oder andere vorgesehene Aufwendungen und Auszahlungen nicht entstehen<br />
dürfen. Es ist aber auch möglich, Mehrerträge oder Mehre<strong>in</strong>zahlungen für die benötigte „Deckung“ zu nutzen.<br />
Es ist dabei erforderlich, dass die Deckungsmittel haushaltswirtschaftlich auch tatsächlich für den vorgesehenen<br />
Zweck im Haushaltsjahr verfügbar s<strong>in</strong>d. Außerdem darf bei der Entscheidung auch nicht das gesetzliche Erfordernis<br />
zum Haushaltsausgleich (vgl. § 75 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>) außer Betracht bleiben. Daraus folgt, dass bei e<strong>in</strong>em<br />
im Ergebnisplan (vgl. § 2 GemHVO <strong>NRW</strong>) ausgewiesenen negativem Jahresergebnis durch die über- und außerplanmäßigen<br />
Aufwendungen dieses geplante Defizit nicht vergrößert werden darf, so dass ggf. auf überplanmäßige<br />
Aufwendungen zu verzichten ist oder durch e<strong>in</strong>e freiwillige Nachtragssatzung nach § 81 GO <strong>NRW</strong> die bereits<br />
„veraltete“ Haushaltsplanung der aktuellen haushaltswirtschaftlichen Entwicklung angepasst wird.<br />
1.3 Zu Satz 3 (Entscheidungsbefugnisse):<br />
1.3.1 Entscheidungsbefugnis des Kämmerers<br />
Die Regelungen über den Umgang mit überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen<br />
sollen zum flexiblen Handeln <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung beitragen, aber auch bewirken, dass der Rat<br />
der Geme<strong>in</strong>de nicht <strong>in</strong> allen Fällen e<strong>in</strong>er dr<strong>in</strong>genden Planabweichung damit befasst wird. Da Planabweichungen<br />
im Grundsatz immer f<strong>in</strong>anzwirtschaftliche Auswirkungen haben ist gesetzlich bestimmt worden, dass über die<br />
Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen der Kämmerer zu entscheiden hat. Mit se<strong>in</strong>er Entscheidung<br />
über überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen wird die ansonsten notwendige<br />
Ermächtigung durch den geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan ersetzt. E<strong>in</strong>e solche haushaltsmäßige Ermächtigung kann<br />
ggf. im Rahmen e<strong>in</strong>er Nachtragssatzung nach § 81 GO <strong>NRW</strong> durch die E<strong>in</strong>beziehung der bereits durch den<br />
Kämmerer ausgesprochenen Ermächtigungen <strong>in</strong> den Nachtragshaushaltsplan nach § 10 GemHVO <strong>NRW</strong> nachgeholt<br />
oder muss sogar dadurch geschaffen werden.<br />
1.3.2 Entscheidungsbefugnis des Bürgermeisters<br />
Nach der Vorschrift entscheidet über die Leistung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen<br />
und Auszahlungen der Bürgermeister, wenn e<strong>in</strong> Kämmerer nicht bestellt ist, und der Rat der Geme<strong>in</strong>de ke<strong>in</strong>e<br />
andere Regelung trifft. Die Geme<strong>in</strong>de kann e<strong>in</strong> Kämmerer bestellen oder beauftragen. Ist e<strong>in</strong> Kämmerer bestellt,<br />
hat dieser die Zuständigkeit und das Recht, alle Aufgaben durchzuführen, die ihm durch Gesetz zugewiesen s<strong>in</strong>d.<br />
In den Fällen, <strong>in</strong> denen der Kämmerer nur vom Bürgermeister beauftragt worden ist, stehen ihm auf Grund der<br />
Regelung „soweit er nicht bestellt ist“, nicht die Rechte e<strong>in</strong>es vom Bürgermeister bestellten Kämmerer zu (vgl. §<br />
83 GO <strong>NRW</strong> und § 24 GemHVO <strong>NRW</strong>). E<strong>in</strong>e Entscheidung über überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen<br />
und Auszahlungen ist als e<strong>in</strong>e organgleiche Handlung zu bewerten ist. Daher ist die Differenzierung zwischen<br />
e<strong>in</strong>em bestellten und e<strong>in</strong>em beauftragten Kämmerer ist von der Geme<strong>in</strong>de bei der Festlegung der Entscheidungsbefugnisse<br />
über überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen zu beachten.<br />
Wenn e<strong>in</strong> Kämmerer lediglich beauftragt worden ist. Muss die beschriebene Entscheidungsbefugnis vom<br />
Bürgermeister ausgeübt werden.<br />
1.3.3 Entscheidungsbefugnis des Rates<br />
Nach der Vorschrift hat der Rat der Geme<strong>in</strong>de die Möglichkeit, die gesetzliche Zuständigkeit des Kämmerers<br />
sowie des Bürgermeisters über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen<br />
zu entscheiden, an sich zu ziehen, denn der Kämmerer oder der Bürgermeister sollen von ihrem Recht der Entscheidungsbefugnis<br />
dann Gebrauch machen können, soweit der Rat ke<strong>in</strong>e andere Regelung getroffen hat. Die<br />
Regelung soll bewirken, dass das Budgetrecht des Rates so wenig wie möglich e<strong>in</strong>geschränkt wird. Außerdem<br />
GEMEINDEORDNUNG 367
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 83 GO <strong>NRW</strong><br />
soll die Regelung nicht der Allzuständigkeit des Rates nach § 41 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> entgegenstehen, denn dem Rat<br />
obliegt sowohl die Rechtsetzung als auch die Erledigung von Verwaltungsaufgaben, auch wenn er wegen der<br />
Vielzahl der geme<strong>in</strong>dlichen Geschäftsvorfälle nicht <strong>in</strong> allen Verwaltungsangelegenheiten selbst durch Beschluss<br />
entscheiden kann.<br />
Es ist deshalb örtlich zu entscheiden, ob der Rat der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>e andere Regelung über die Entscheidungsbefugnis<br />
über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen als gesetzlich vorgesehen, treffen soll.<br />
Soll von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, ist zu berücksichtigen, dass der Rat die Entscheidungsbefugnis<br />
nur auch sich zurückholen oder e<strong>in</strong>er anderen Stelle <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Zuständigkeitsbereich, z.B. dem F<strong>in</strong>anzausschuss<br />
nach § 57 Abs. 2 i.V.m. § 59 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>, übertragen kann, denn darauf ist die Regelung ausgerichtet.<br />
Dem Rat der Geme<strong>in</strong>de steht es daher nicht zu, e<strong>in</strong>e Stelle <strong>in</strong>nerhalb der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung als<br />
„andere Stelle“ im S<strong>in</strong>ne der Vorschrift zu beauftragen, denn <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em solchen Fall würde er <strong>in</strong> das Organisationsrecht<br />
des Bürgermeisters e<strong>in</strong>greifen (vgl. § 62 GO <strong>NRW</strong>).<br />
Diese Beauftragungsbeschränkung besteht auch <strong>in</strong> dem Fall, dass der Rat den Geschäftskreis e<strong>in</strong>es Beigeordneten<br />
festlegt (vgl. § 73 Abs. 1 S. 2 GO <strong>NRW</strong>). Im Falle e<strong>in</strong>er vom Rat zu treffenden anderen Regelung über die<br />
Entscheidungsbefugnis über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bietet es sich an,<br />
diese als Satzungsregelung zu behandeln, denn dieses stellt e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>dliche Angelegenheit dar, die <strong>in</strong> der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Hauptsatzung, die von der Geme<strong>in</strong>de zu erlassen ist, verankert werden kann (vgl. § 7 Abs. 3 GO<br />
<strong>NRW</strong>). Diese Abgrenzung ist sachgerecht und steht <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang mit dem allgeme<strong>in</strong>en Übertragungsrecht des<br />
Rates nach § 41 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass <strong>in</strong> den Fällen, <strong>in</strong> denen der Rat e<strong>in</strong>e<br />
andere Regelung im S<strong>in</strong>ne der Vorschrift trifft, gleichzeitig dem Bürgermeister die ihm gesetzlich zugestandene<br />
Entscheidungsbefugnis entzogen wird.<br />
1.4 Zu Satz 4 (Delegationsbefugnis des Kämmerers):<br />
Nach der Vorschrift kann der Kämmerer mit Zustimmung des Bürgermeisters und des Rates se<strong>in</strong>e Entscheidungsbefugnis<br />
über die Leistung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen auf<br />
andere Bedienstete übertragen. Die Flexibilität des verwaltungsmäßigen Handelns sowie die eigenverantwortliche<br />
Haushaltsbewirtschaftung, werden durch diese Delegationsbefugnis verstärkt. Insbesondere wenn bei der Geme<strong>in</strong>de<br />
e<strong>in</strong>e durchgängige Budgetbildung unter E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung der Verantwortlichkeiten <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung<br />
besteht, kann es sachgerecht se<strong>in</strong>, e<strong>in</strong>en Befugnisrahmen unter E<strong>in</strong>beziehung der Geschäftskreise der<br />
Beigeordneten (vgl. § 73 GO <strong>NRW</strong>) örtlich festzulegen, der die Budgetbildung berücksichtigt.<br />
E<strong>in</strong>e solche Übertragung vor Ort kann daher e<strong>in</strong> Teil der Budgetregeln der Geme<strong>in</strong>de se<strong>in</strong>. Solche Regeln könnten<br />
auch, wenn sie grundsätzlich für alle Budgets gelten sollen, auch <strong>in</strong> der Haushaltssatzung verankert werden.<br />
Damit werden für den Rat, aber auch für die anderen Interessenten an der jährlichen Haushaltswirtschaft der<br />
Geme<strong>in</strong>de die Verantwortlichkeiten transparent und nachvollziehbar. Macht der Kämmerer örtlich von se<strong>in</strong>er<br />
Delegationsbefugnis Gebrauch, hat er zu beachten, dass dadurch nicht der gesetzlich bestimmte Haushaltsausgleich<br />
sowie die Sicherstellung der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgabenerfüllung gefährdet wird, so dass für ausgewählte<br />
Sachverhalte die notwendigen Zustimmungsvorbehalte geschaffen und unterjährige Kontrollen ermöglicht werden<br />
müssen.<br />
2. Zu Absatz 2 (Zustimmung des Rates bei Erheblichkeit)<br />
2.1 Zu Satz 1 (Beteiligung des Rates):<br />
Die Regelung, dass überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie erheblich<br />
s<strong>in</strong>d, der vorherigen Zustimmung des Rates bedürfen, stellt e<strong>in</strong>e Ausprägung des Budgetrechts des Rates<br />
GEMEINDEORDNUNG 368
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 83 GO <strong>NRW</strong><br />
dar. Für die Vorlagepflicht an den Rat ist ke<strong>in</strong> allgeme<strong>in</strong> gültiger Maßstab festgelegt, sondern der Begriff „erheblich“<br />
verwendet worden. Dieser stellt e<strong>in</strong>en unbestimmten Rechtsbegriff ohne Def<strong>in</strong>ition dar. Aus dem Zusammenhang<br />
ist aber erkennbar, dass der Begriff „erheblich“ immer im Verhältnis der vorgesehenen überplanmäßigen<br />
oder außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen zu der jeweils betroffenen Haushaltsposition<br />
auszugestalten ist.<br />
Diese Festlegung wird am ehesten den unterschiedlichen Verhältnissen <strong>in</strong> den Geme<strong>in</strong>den gerecht. Sie ermöglicht<br />
den Geme<strong>in</strong>den, diesen Begriff selbst auszugestalten und stärkt damit die Eigenverantwortung der Geme<strong>in</strong>den<br />
für ihr haushaltswirtschaftliches Handeln. Die Ausgestaltung des unbestimmten Rechtsbegriffs sollte <strong>in</strong> Abstimmung<br />
mit dem Rat erfolgen, denn die Vorschrift, dass andere, ger<strong>in</strong>gere überplanmäßige und außerplanmäßige<br />
Aufwendungen und Auszahlungen dem Rat zur Kenntnis zu br<strong>in</strong>gen s<strong>in</strong>d, entlässt die geme<strong>in</strong>dliche Verwaltung<br />
nicht aus der „geme<strong>in</strong>samen“ Entscheidung, die <strong>in</strong> Zusammenarbeit mit dem Rat zu treffen ist. In diesem<br />
Zusammenhang bietet sich z.B. auch e<strong>in</strong>e Festlegung <strong>in</strong> der jährlichen Haushaltssatzung nach § 78 GO <strong>NRW</strong> an,<br />
die sich auf Aufwendungen und Auszahlungen beziehen (vgl. § 78 Abs. 2 S. 2 GO <strong>NRW</strong>). Die Abgrenzung zwischen<br />
erheblichen und nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ist e<strong>in</strong><br />
solcher abstimmungsbedürftiger Sachverhalt.<br />
2.2 Zu Satz 2 (Verweis auf § 81 GO <strong>NRW</strong>):<br />
Der Verweis <strong>in</strong> der Vorschrift auf § 81 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> soll gewährleisten, dass bei vorliegenden örtlichen Verhältnissen,<br />
die nach Absatz 2 dieser Vorschrift die Aufstellung e<strong>in</strong>er Nachtragssatzung erfordern, nicht mit Verweis<br />
auf die vorherige Zustimmung des Rates bei erheblichen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen<br />
und Auszahlungen auf die Aufstellung e<strong>in</strong>er Nachtragssatzung verzichtet wird. Die Vorschrift des § 81<br />
Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> enthält drei Sachverhalte, bei deren Auftreten die Geme<strong>in</strong>de gesetzlich verpflichtet wird, e<strong>in</strong>e<br />
Nachtragssatzung zu erlassen. So hat die Geme<strong>in</strong>de unverzüglich e<strong>in</strong>e Nachtragssatzung zu erlassen, wenn sich<br />
zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit e<strong>in</strong> erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird und der<br />
Haushaltsausgleich nur durch e<strong>in</strong>e Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann.<br />
Die Geme<strong>in</strong>de hat auch dann e<strong>in</strong>e Nachtragssatzung zu erlassen, wenn von der Geme<strong>in</strong>de bisher nicht veranschlagte<br />
oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei e<strong>in</strong>zelnen Haushaltspositionen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em im<br />
Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen.<br />
E<strong>in</strong>e Nachtragssatzung ist aber auch zu erlassen, wenn geme<strong>in</strong>dliche Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte<br />
Investitionen geleistet werden sollen. In den drei <strong>in</strong> der Vorschrift benannten Fällen werden die Veränderungen<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft als so schwerwiegend betrachtet, dass das Gesamtbild nicht mehr<br />
mit der beschlossenen Haushaltssatzung <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang steht, sondern es unerlässlich ist, e<strong>in</strong>e Nachtragssatzung zu<br />
beschließen. Die Geme<strong>in</strong>de darf ohne Nachtragssatzung nicht die Aufwendungen entstehen lassen oder die<br />
Auszahlungen leisten, die als Ursache zur Pflicht der Geme<strong>in</strong>de zur Aufstellung e<strong>in</strong>er Nachtragssatzung führen.<br />
Sie hat e<strong>in</strong>e Nachtragssatzung unverzüglich aufzustellen, sobald die Voraussetzungen für ihren Erlass gegeben<br />
s<strong>in</strong>d. Die Geme<strong>in</strong>de kann diese nicht auf e<strong>in</strong>en beliebigen späteren Zeitpunkt verschieben.<br />
2.2.3 Zustimmung des Rates und Dr<strong>in</strong>glichkeitsentscheidung<br />
Nach § 60 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> kann <strong>in</strong> Angelegenheiten, die der Beschlussfassung des Rates unterliegen und bei<br />
denen die Entscheidung nicht rechtzeitig möglich ist sowie nicht aufgeschoben werden kann, weil sonst erhebliche<br />
Nachteile oder Gefahren entstehen können, der Bürgermeister zusammen mit e<strong>in</strong>em Ratsmitglied entscheiden.<br />
Solche Dr<strong>in</strong>glichkeitsentscheidungen kommen für alle geme<strong>in</strong>dlichen Angelegenheiten <strong>in</strong> Betracht, also<br />
neben Entscheidungen <strong>in</strong> E<strong>in</strong>zelfällen auch die Entscheidung über den Erlass e<strong>in</strong>er Satzung. Diese Entscheidungen<br />
haben jedoch nur e<strong>in</strong>en vorübergehenden Charakter, weil sie dem Rat der Geme<strong>in</strong>de zur Genehmigung<br />
vorzulegen s<strong>in</strong>d (vgl. § 60 Abs. 1 S. 3 GO <strong>NRW</strong>). Bei besonderer Eilbedürftigkeit kann aber durch e<strong>in</strong>e Dr<strong>in</strong>glich-<br />
GEMEINDEORDNUNG 369
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 83 GO <strong>NRW</strong><br />
keitsentscheidung die erforderliche Zustimmung des Rates für erhebliche überplanmäßige und außerplanmäßige<br />
Aufwendungen und Auszahlungen vorübergehend ersetzt werden, um das notwendig gewordene haushaltswirtschaftliche<br />
Handeln der Geme<strong>in</strong>de zeitnah zu ermöglichen.<br />
3. Zu Absatz 3 (Deckung für mehrjährige Investitionen):<br />
3.1 Zu Satz 1 (Überplanmäßige Auszahlungen und fortgesetzte Investitionen):<br />
3.1.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Das Haushaltsrecht gewährt den Geme<strong>in</strong>den bei der haushaltswirtschaftlichen Umsetzung von Investitionsmaßnahmen<br />
e<strong>in</strong>en weiten Spielraum, denn trotz sorgfältiger Aufstellung e<strong>in</strong>es Bauzeitplans können unvorhersehbare<br />
Ereignisse zu Änderungen bei e<strong>in</strong>er begonnenen Investitionsmaßnahme und zu e<strong>in</strong>em Bedarf zur Leistungen von<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Auszahlungen führen, die nach der Haushaltsplanung erst <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em späteren Haushaltsjahr erfolgen<br />
sollten. In solchen Fällen wäre die Änderung der Haushaltsplanung durch den Erlass e<strong>in</strong>er Nachtragssatzung<br />
nach § 81 GO <strong>NRW</strong> durch die Geme<strong>in</strong>de zu aufwändig, um e<strong>in</strong>e entsprechende Anpassung im geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltsplan herbeizuführen.<br />
Durch die Vorschrift werden deshalb ausdrücklich überplanmäßige Auszahlungen für zulässig erklärt, auch wenn<br />
ihre Deckung erst im folgenden Haushaltsjahr gewährleistet ist oder sie auch bereits veranschlagt worden s<strong>in</strong>d<br />
(Haushaltsvorgriff). Voraussetzung ist aber immer, dass es sich um die Fortsetzung e<strong>in</strong>er laufenden Investitionsmaßnahme<br />
der Geme<strong>in</strong>de handeln muss. Im Rahmen e<strong>in</strong>es solchen Haushaltsvorgriffs s<strong>in</strong>d jedoch ke<strong>in</strong>e außerplanmäßigen<br />
Auszahlungen für mögliche geme<strong>in</strong>dliche Investitionen zulässig. Auch neue Investitionsmaßnahmen,<br />
für die Auszahlungen im Haushaltsjahr noch nicht im Haushaltsplan veranschlagt waren, s<strong>in</strong>d im Wege<br />
dieser Vorschrift nicht zulässig. Solche Maßnahmen bedürfen <strong>in</strong> jedem Fall der Aufnahme <strong>in</strong> den Nachtragshaushalt,<br />
wenn sie noch im Haushaltsjahr begonnen werden sollen (vgl. § 81 Abs. 2 Nr. 3 GO <strong>NRW</strong>).<br />
3.1.2 Deckung überplanmäßiger Auszahlungen für Investitionen<br />
Bei Investitionsmaßnahmen, für die im Haushaltsplan bereits Auszahlungen veranschlagt worden s<strong>in</strong>d, und die im<br />
folgenden Jahr fortgesetzt werden, s<strong>in</strong>d überplanmäßige Auszahlungen auch dann zulässig, wenn ihre Deckung<br />
erst im folgenden Jahr gewährleistet ist (Haushaltsvorgriff). Mit dieser Vorschrift wird der Geme<strong>in</strong>de die Möglichkeit<br />
gegeben, bei Bedarf Investitionsmaßnahmen, für die erst im folgenden Haushaltsjahr die notwendigen Auszahlungsermächtigungen<br />
verfügbar wären, <strong>in</strong> das Haushaltsjahr vorzuziehen, ohne dass <strong>in</strong> diesem Jahr e<strong>in</strong>e<br />
Deckung vorhanden ist. Diese Möglichkeit erhöht das flexible Handeln der Geme<strong>in</strong>de. Sie lässt e<strong>in</strong> schnelles<br />
Reagieren zu, wenn e<strong>in</strong>e beschleunigte und zügige Weiterführung von Baumaßnahmen geboten ist. Die Regelung<br />
stärkt die geme<strong>in</strong>dliche Eigenverantwortung und ihr wirtschaftliches Handeln. Sie ist jedoch nicht anwendbar,<br />
wenn bisher noch nicht für das Haushaltsjahr veranschlagte Investitionen vorgezogen werden sollen. In diesen<br />
Fällen ist e<strong>in</strong>e Nachtragssatzung erforderlich (Vgl. § 81 Abs. 2 Nr. 3 GO <strong>NRW</strong>).<br />
3.2 Zu Satz 2 (Verfahren bei überplanmäßigen Auszahlungen für Investitionen)<br />
Das Verfahren der Bereitstellung von überplanmäßigen Auszahlungen für geme<strong>in</strong>dliche Investitionen soll sich<br />
nach den <strong>in</strong> dieser Vorschrift bereits getroffenen Regelungen richten. Daher enthält die Vorschrift an dieser Stelle<br />
nur noch e<strong>in</strong>en Verweis auf Absatz 1 Sätze 3 und 4 und Absatz 2 dieser Vorschrift, die s<strong>in</strong>n gemäß gelten bzw.<br />
zur Anwendung kommen sollen. Durch den Verweis auf Absatz 1 Satz 3 wird ausgedrückt, dass auch <strong>in</strong> den<br />
Fällen des Absatzes 3 die Entscheidung über solche Auszahlungen beim Kämmerer liegt und, wenn e<strong>in</strong> solcher<br />
nicht bestellt ist, beim Bürgermeister der Geme<strong>in</strong>de. Ergänzend wird durch den Verweis auf Absatz 1 Satz 4 be-<br />
GEMEINDEORDNUNG 370
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 83 GO <strong>NRW</strong><br />
wirkt, dass <strong>in</strong> den Fällen des Absatzes 3 auch der Bedienstete der Geme<strong>in</strong>de über die Auszahlungen entscheiden,<br />
der vom Kämmerer mit Zustimmung des Bürgermeisters und des Rates die Entscheidungsbefugnis übertragen<br />
bekommen hat. Der weitere Verweis hat zur Folge, dass e<strong>in</strong>e Zustimmung des Rates der Geme<strong>in</strong>de dann<br />
erforderlich ist, wenn die überplanmäßigen Auszahlungen erheblich s<strong>in</strong>d. Ansonsten s<strong>in</strong>d die Entscheidungen des<br />
Kämmerers oder des Bürgermeisters über überplanmäßige Auszahlungen für Investitionen dem Rat der Geme<strong>in</strong>de<br />
zur Kenntnis zu geben.<br />
4. Zu Absatz 4 (Künftige haushaltsmäßige Belastungen):<br />
4.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Nach der Vorschrift f<strong>in</strong>den die Absätze 1 bis 3 dieser Vorschrift e<strong>in</strong>e entsprechende Anwendung auf Maßnahmen,<br />
durch die später über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für die Geme<strong>in</strong>de entstehen<br />
können. Bei dieser Regelung wurde berücksichtigt, dass e<strong>in</strong> Zwang oder e<strong>in</strong>e Eilbedürftigkeit, Aufwendungen<br />
entstehen zu lassen oder Auszahlungen zu leisten, sich vielfach nicht erst durch die Veranschlagung im geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltsplan ergibt. Es s<strong>in</strong>d vielfach schon die vorher e<strong>in</strong>geleiteten verwaltungsmäßigen Maßnahmen,<br />
die durch rechtliche B<strong>in</strong>dungen zu späteren über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen<br />
führen können, wenn es z.B. unterlassen wurde, solche geme<strong>in</strong>dlichen Maßnahmen schon <strong>in</strong> die mehrjährige<br />
Haushaltsplanung konkret aufzunehmen. Daher sollen die Regelungen der Absätze 1 bis 3 auch auf Maßnahmen<br />
Anwendung f<strong>in</strong>den, die dafür die Ursache bilden. Sie werden den gleichen E<strong>in</strong>schränkungen unterworfen wie die<br />
aktuellen Maßnahmen, die im Haushaltsjahr überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen<br />
auslösen.<br />
4.2 Überprüfungspflichten<br />
Vor E<strong>in</strong>gehen von Verpflichtungen für künftige haushaltsmäßige Belastungen soll deshalb geprüft werden, ob<br />
auch die sachlichen Voraussetzungen für die späteren über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen<br />
vorliegen. Derartige über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen können entstehen,<br />
wenn die notwendigen Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen nicht im Haushaltsplan veranschlagt<br />
s<strong>in</strong>d, durch die vorher e<strong>in</strong>gegangenen Verpflichtungen aber zwangsläufig Aufwendungen entstehen oder<br />
Auszahlungen notwendig werden, denen sich die Geme<strong>in</strong>de nicht entziehen kann.<br />
Die notwendigen Prüfungen nach dieser Vorschrift müssen durchgeführt werden, aber es müssen auch die vorgeschriebenen<br />
Entscheidungen e<strong>in</strong>geholt werden. So hat nach Absatz 1 der Vorschrift der Kämmerer, wenn e<strong>in</strong><br />
solcher nicht bestellt ist, der Bürgermeister hat, soweit der Rat ke<strong>in</strong>e andere Regelung trifft, über die Leistung von<br />
überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu entscheiden. S<strong>in</strong>d die überplanmäßigen<br />
und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen aber erheblich, bedürfen sie nach Absatz 2<br />
der Vorschrift der vorherigen Zustimmung des Rates und s<strong>in</strong>d ihm ansonsten zur Kenntnis zu br<strong>in</strong>gen. Es gilt<br />
zudem sicherzustellen, dass künftige haushaltsmäßige Belastungen frühzeitig erkannt werden und vermieden<br />
werden und die Sicherstellung der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgabenerfüllung nicht gefährdet wird.<br />
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ<br />
GEMEINDEORDNUNG 371
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 84 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 84<br />
Mittelfristige Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung<br />
1 Die Geme<strong>in</strong>de hat ihrer Haushaltswirtschaft e<strong>in</strong>e fünfjährige Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung zu Grunde zu legen<br />
und <strong>in</strong> den Haushaltsplan e<strong>in</strong>zubeziehen. 2 Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. 3 Die Ergebnis-<br />
und F<strong>in</strong>anzplanung für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre soll <strong>in</strong> den e<strong>in</strong>zelnen Jahren ausgeglichen<br />
se<strong>in</strong>. 4 Sie ist mit der Haushaltssatzung der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.<br />
Erläuterungen zu § 84:<br />
I. Allgeme<strong>in</strong>es<br />
1. Inhalte und Zwecke der Vorschrift<br />
1.1 Ausgangsgrundlagen<br />
Die Vorgabe, der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft e<strong>in</strong>e mittelfristige Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung zu Grunde<br />
zu legen, baut auf Art. 109 GG i.V.m. § 50 HGrG auf, nach denen Bund und Länder ihrer Haushaltswirtschaft e<strong>in</strong>e<br />
fünfjährige (mittelfristige) F<strong>in</strong>anzplanung zu Grunde zu legen haben, bei der das erste Planungsjahr das laufende<br />
Haushaltsjahr ist. Für die Geme<strong>in</strong>den als Teil der Länder ist diese bundesweit geltende Vorgabe durch die Vorschrift<br />
übernommen worden. Die mittelfristige Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung stellt daher e<strong>in</strong>e Entwicklungsplanung<br />
der Geme<strong>in</strong>de dar. Sie soll u.a. e<strong>in</strong> Orientierungs<strong>in</strong>strument se<strong>in</strong>, das dem Rat die haushaltspolitischen<br />
Entscheidungen erleichtert, <strong>in</strong> dem die Auswirkungen se<strong>in</strong>er Entscheidung bereits für die dem Haushaltsjahr<br />
folgenden drei Jahre aufgezeigt werden. Durch die Integration der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung <strong>in</strong><br />
den geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan kommt der Betrachtung der Auswirkungen der haushaltsmäßigen Entscheidungen<br />
e<strong>in</strong>e noch höhere Bedeutung zu.<br />
1.2 Der Zeitraum der Haushaltsplanung<br />
Die Geme<strong>in</strong>de hat ihrer örtlichen Haushaltsplanung nicht alle<strong>in</strong> das Haushaltsjahr als kurzfristigen Zeitraum zu<br />
Grunde zu legen, sondern vielmehr e<strong>in</strong>en fünfjährigen Planungszeitraum, der vom laufenden Haushaltsjahr ausgeht<br />
und <strong>in</strong> den das Haushaltsjahr als erstes Planungsjahr e<strong>in</strong>gebunden ist. Für diesen Planungszeitraum muss<br />
die Geme<strong>in</strong>de ihre Leistungskraft offen legen, aber auch zeigen, wie sie die stetige Aufgabenerfüllung sichert. Die<br />
geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft wird dabei anhand des aufgezeigten Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs<br />
sowie des Bedarfs der Geme<strong>in</strong>de an F<strong>in</strong>anzmitteln <strong>in</strong>nerhalb der mehrjährigen Ergebnis- und<br />
F<strong>in</strong>anzplanung gemessen. Diese Gegebenheiten erfordern, im Zeitraum der mehrjährigen Planung die geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Erträge und Aufwendungen <strong>in</strong> ihrer voraussichtlichen Höhe sowie die E<strong>in</strong>zahlungen <strong>in</strong> der zu erzielenden<br />
Höhe und die Auszahlungen <strong>in</strong> Höhe der voraussichtlich zu leistenden Beträge jahresbezogen und nach ihren<br />
Arten abzubilden. Dadurch werden die haushaltswirtschaftlichen Gestaltungsmöglichkeiten der Geme<strong>in</strong>de vorausschauend<br />
aufgezeigt, denn die Geme<strong>in</strong>de soll auf Grund ihrer mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung<br />
rechtzeitig geeignete Maßnahmen nach dieser Haushaltsplanung treffen, um e<strong>in</strong>e geordnete Haushaltsentwicklung<br />
unter Berücksichtigung des voraussichtlichen wirtschaftlichen Leistungsvermögens <strong>in</strong> den e<strong>in</strong>zelnen Planungsjahren<br />
zu sichern.<br />
1.3 Die Planungssicherheit<br />
Die Geme<strong>in</strong>de muss sich deshalb ständig e<strong>in</strong>en realitätsbezogenen Überblick über den fünfjährigen Planungszeitraum<br />
verschaffen und sich darüber klar werden, welche Erträge und Aufwendungen durch die Aufgabenerfüllung<br />
GEMEINDEORDNUNG 372
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 84 GO <strong>NRW</strong><br />
voraussichtlich entstehen werden und welche E<strong>in</strong>zahlungen zu erzielen und Auszahlungen im E<strong>in</strong>zelnen zu leisten<br />
se<strong>in</strong> werden. Dabei soll möglichst e<strong>in</strong>e hohe Planungssicherheit erreicht werden, denn Planabweichungen<br />
bergen, <strong>in</strong>sbesondere bei den Erträgen, immer auch Risiken <strong>in</strong> sich. E<strong>in</strong>e fundierte Haushaltsplanung schafft<br />
daher auch die Transparenz darüber, so dass es im Vorbericht zum Haushaltsplan entsprechender Erläuterungen<br />
bedarf. Die Veranschlagung der Ermächtigungen im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan muss daher ausgehend von<br />
der strategischen Planung das auf das Haushaltsjahr bezogene operative Ergebnis wieder spiegeln und damit<br />
Lösungsmöglichkeiten für die Realisation der geme<strong>in</strong>dlichen Ziele aufzeigen. E<strong>in</strong>ige damit verbundene Leistungskennzahlen<br />
(vgl. § 12 GemHVO <strong>NRW</strong>) s<strong>in</strong>d dabei e<strong>in</strong> wichtiges Steuerungs<strong>in</strong>strument. Sie s<strong>in</strong>d jedoch nur nutzbar,<br />
wenn auch der Zielbereich durch Sollgrößen oder Schwellenwerte angegeben wird. Ebenso gehören die im<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss vorzunehmende Plan-/Ist-Vergleiche dazu, die ggf. im Rahmen der Haushaltsüberwachung<br />
auch unterjährig erfolgen sollten.<br />
1.4 Die Planungs<strong>in</strong>halte<br />
Die mittelfristige Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung unterstützt die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsplanung, weil sie die Geme<strong>in</strong>de<br />
zw<strong>in</strong>gt, im Rahmen e<strong>in</strong>er mehrjährigen Planung örtliche Schwerpunkte zu setzen, und daraus Maßnahmen<br />
und Dr<strong>in</strong>glichkeit <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en Zeitplan e<strong>in</strong>zustellen. In diese Haushaltsplanung der Geme<strong>in</strong>de s<strong>in</strong>d daher alle<br />
örtlichen Bedürfnisse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus der Investitions- und aus der F<strong>in</strong>anzierungstätigkeit<br />
der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>zubeziehen. Durch e<strong>in</strong>e wertorientierte geme<strong>in</strong>dliche Steuerung wird dabei auch der<br />
Katalog der örtlich zu erfüllenden Aufgaben und die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Geme<strong>in</strong>de<br />
berücksichtigt. Zur Erstellung der mittelfristigen örtlichen Planung gehören daher nicht nur die Entscheidungen<br />
unter E<strong>in</strong>beziehung wirtschaftlicher Gesichtspunkte, z.B. bei den geme<strong>in</strong>dlichen Investitionsmaßnahmen,<br />
sondern auch die Beherrschung der Folgekosten aus der Nutzung der angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände,<br />
z.B. Abschreibungen, Unterhaltungsaufwendungen u.a.<br />
Im Zusammenhang mit der Abbildung der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan<br />
bleiben die Schwierigkeiten für die Geme<strong>in</strong>de bestehen, die Höhe der staatlichen Zuweisungen über<br />
mehrere Jahre im Voraus möglichst zutreffend zu schätzen. Derartige staatliche F<strong>in</strong>anzleistungen s<strong>in</strong>d abhängig<br />
von der Gesetzgebung und von Ermessensentscheidungen der staatlichen Bewilligungsbehörden, so dass Unsicherheitsfaktoren<br />
für die Geme<strong>in</strong>de bestehen, die sich auf ihre mittelfristige Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung der<br />
Geme<strong>in</strong>de auswirkt. Solche Unsicherheiten können auch nicht durch die jährlich vom Innenm<strong>in</strong>isterium veröffentlichten<br />
Orientierungsdaten des Landes beseitigt werden (vgl. § 6 GemHVO <strong>NRW</strong>). Es gilt daher immer, vor Ort<br />
die bestmöglichen Annahmen zu treffen, auch wenn die zukünftigen Erfordernisse noch ungewiss s<strong>in</strong>d.<br />
2. Die Grundsätze ordnungsmäßiger Planung<br />
2.1 Die geme<strong>in</strong>dliche Ausgangslage<br />
Nach allgeme<strong>in</strong>er Auffassung fallen unter den Rahmenbegriff „Haushaltswirtschaft“ auch alle D<strong>in</strong>ge und Tätigkeiten,<br />
die zur Planung der jährlichen Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de gehören, z.B. die Ausstellung des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltsplans (Ergebnisplan, F<strong>in</strong>anzplan und Teilpläne nach § 79 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>) für das Haushaltsjahr<br />
und die drei folgenden Planungsjahre der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung. Die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft<br />
ist daher als prozessorientiert zu betrachten, die ergebnis- und zukunftsorientiert gesteuert wird.<br />
Deshalb steht am Beg<strong>in</strong>n des geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltskreislaufs auch die jährliche Haushaltsplanung, die vor<br />
dem Haushaltsjahr abgeschlossen se<strong>in</strong> soll.<br />
Die Geme<strong>in</strong>de hat ihrer Haushaltsplanung nicht alle<strong>in</strong> das Haushaltsjahr als kurzfristigen Zeitraum zu Grunde zu<br />
legen, sondern vielmehr e<strong>in</strong>en fünfjährigen Planungszeitraum, der vom laufenden Haushaltsjahr ausgeht und <strong>in</strong><br />
den das Haushaltsjahr als erstes Planungsjahr e<strong>in</strong>gebunden ist (vgl. § 84 GO <strong>NRW</strong>). Für diesen Planungszeit-<br />
GEMEINDEORDNUNG 373
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 84 GO <strong>NRW</strong><br />
raum muss die Geme<strong>in</strong>de ihre Leistungskraft offen legen, aber auch zeigen, wie sie die stetige Aufgabenerfüllung<br />
sichert. Die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft wird dabei anhand des aufgezeigten Ressourcenaufkommens und<br />
des Ressourcenverbrauchs sowie des Bedarfs der Geme<strong>in</strong>de an F<strong>in</strong>anzmitteln <strong>in</strong>nerhalb der mehrjährigen Ergebnis-<br />
und F<strong>in</strong>anzplanung gemessen. Die Geme<strong>in</strong>de muss sich deshalb ständig e<strong>in</strong>en realitätsbezogenen Überblick<br />
über den fünfjährigen Planungszeitraum verschaffen und sich darüber klar werden, welche Erträge und<br />
Aufwendungen durch die Aufgabenerfüllung voraussichtlich entstehen werden und welche E<strong>in</strong>zahlungen zu erzielen<br />
und Auszahlungen im E<strong>in</strong>zelnen zu leisten se<strong>in</strong> werden.<br />
In die mittelfristige Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung s<strong>in</strong>d daher alle Bedürfnisse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit,<br />
aus der Investitions- und aus der F<strong>in</strong>anzierungstätigkeit der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>zubeziehen. In diese Betrachtung<br />
gehören daher z.B. bei den geme<strong>in</strong>dlichen Investitionsmaßnahmen nicht nur die Entscheidung unter E<strong>in</strong>beziehung<br />
wirtschaftlicher Gesichtspunkte, sondern auch die Beherrschung der Folgekosten aus der Nutzung der<br />
angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände, z.B. Abschreibungen, Unterhaltungsaufwendungen<br />
u.a.<br />
2.2 Die e<strong>in</strong>zelnen Grundsätze<br />
Mit den Grundsätzen ordnungsgemäßer Planung werden die Notwendigkeit e<strong>in</strong>er Analyse als Ausgangspunkt der<br />
zukunftsbezogenen Planung und die Bedeutung der strategischen und der operativen Planung ausdrücklich hervorgehoben<br />
und betont. Folgende allgeme<strong>in</strong>e Grundsätze gelten als Grundsätze ordnungsmäßiger Planung (vgl.<br />
Abbildung).<br />
Grundsatz der<br />
Vollständigkeit<br />
Grundsatz der<br />
Wesentlichkeit und<br />
Angemessenheit<br />
Grundsatz der<br />
Folgerichtigkeit<br />
Grundsatz der<br />
Dokumentation<br />
Grundsatz der<br />
Transparenz<br />
Planungspr<strong>in</strong>zipien und<br />
Partizipation<br />
Grundsätze ordnungsmäßiger Planung (GoP)<br />
GEMEINDEORDNUNG 374<br />
Nach diesem Grundsatz sollen alle für die Planungsziele relevanten<br />
Sachverhalte berücksichtigt werden.<br />
Nach diesem Grundsatz sollen <strong>in</strong> die Planung alle Informationen<br />
und Sachverhalte e<strong>in</strong>bezogen werden, die zur Darstellung der<br />
voraussichtlichen Entwicklung auf Grund ihrer Tragweite oder ihres<br />
Betrages bedeutsam s<strong>in</strong>d.<br />
Nach diesem Grundsatz soll die Planung e<strong>in</strong>e sachlich korrekte<br />
Darstellung der Ausgangssituation mit allen Prämissen der Fortentwicklung<br />
enthalten. Die Planung muss erkennen lassen, ob Angaben<br />
zu nachprüfbaren Tatsachen zutreffen, ob Prämissen plausibel<br />
s<strong>in</strong>d, richtig entwickelt und schlüssig s<strong>in</strong>d.<br />
Nach diesem Grundsatz soll die Planung so dokumentiert werden,<br />
dass die Erstellung und Kontrolle der Planung für e<strong>in</strong>en sachverständigen<br />
Dritten<strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>er angemessenen Zeit nachvollziehbar<br />
s<strong>in</strong>d.<br />
Nach diesem Grundsatz soll die verwendeten Begriffe klar def<strong>in</strong>iert<br />
und e<strong>in</strong>heitlich verwendet werden. Die der Planung zu Grunde<br />
liegenden Wertgrößen müssen realistisch und damit realisierbar<br />
se<strong>in</strong>. Zudem s<strong>in</strong>d Chancen und Gefahren sowie Ursachen von<br />
Planabweichungen zu benennen und möglichst zu quantifizieren,<br />
um den Gesamtumfang möglicher Planabweichungen e<strong>in</strong>schätzen<br />
zu können.<br />
Die Planansätze sollen mit den übergeordneten Grundsatzentscheidungen<br />
und Zielen <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang stehen, um die Realisierbarkeit<br />
bzw. die angestrebten Zwecke zu erreichen.
Planungsprozess<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 84 GO <strong>NRW</strong><br />
In den verschiedenen Phasen des Planungsprozesses gilt es Ziele<br />
festzulegen, Informationen zu sammeln sowie e<strong>in</strong>e Analyse vorzunehmen.<br />
Zu den Zielen s<strong>in</strong>d Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen,<br />
aus denen dann <strong>in</strong> der Entscheidungsphase endgültige Ziele und<br />
Maßnahmen festgelegt werden.<br />
Abbildung 57 „Grundsätze ordnungsmäßiger Planung (GoP)“<br />
Im Zusammenhang mit der Planung steht die Festlegung strategischer Ziele als Ausgangsgrundlage auf der die<br />
Planungstätigkeit aufbaut, denn Visionen oder Leitbilder bilden das Gesamtbild näher <strong>in</strong> allgeme<strong>in</strong>er Form ab und<br />
dienen der zukunftsbezogenen Orientierung. Sie bestimmen auch die weiteren Zielsetzungen und Dimensionen,<br />
ggf. auch <strong>in</strong> verschiedenen Arten, so dass auch die spätere Zielerreichung bereits bei der Planung messbar gemacht<br />
werden muss.<br />
Der vorgesehene Zeitraum für die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsplanung bestimmt auch das Planungsgeschehen, vor<br />
allem, wenn sich im Zeitablauf wesentliche Rahmenbed<strong>in</strong>gungen bei der Geme<strong>in</strong>de und <strong>in</strong> ihrem Umfeld geändert<br />
haben oder ändern werden. Auf diesen Grundlagen soll dann die operative Planung aufbauen, die <strong>in</strong> der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplanung regelmäßig den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung <strong>in</strong> der<br />
Ausprägung des geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplans umfasst. Die aufgezeigten Grundsätze ordnungsgemäßer Planung<br />
s<strong>in</strong>d vom Institut der Unternehmensberater (IdU) herausgegeben worden.<br />
II. Erläuterungen im E<strong>in</strong>zelnen<br />
1. Zu Satz 1 (Pflicht zur mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung):<br />
Durch die Integration der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung <strong>in</strong> den Haushaltsplan der Geme<strong>in</strong>de hat<br />
diese Planung nunmehr auch die Haushaltspositionen zu umfassen, die für den Haushaltsplan der Geme<strong>in</strong>de<br />
vorgeschrieben s<strong>in</strong>d (vgl. §§ 2 und 3 GemHVO <strong>NRW</strong>). Die Planung ist damit so ausgestaltet, dass sie nicht mehr,<br />
wie es oftmals <strong>in</strong> der Vergangenheit war, mehr oder weniger e<strong>in</strong>e „Wunschliste“ der Geme<strong>in</strong>de darstellt. Die Planungen<br />
für das neue Haushaltsjahr und die diesem folgenden drei Jahre s<strong>in</strong>d daher von der Geme<strong>in</strong>de sorgsam,<br />
gewissenhaft und bezogen auf die e<strong>in</strong>zelnen Haushaltspositionen im Ergebnisplan und F<strong>in</strong>anzplan sowie <strong>in</strong> den<br />
Teilplänen durchzuführen.<br />
Der Bezug auf die verb<strong>in</strong>dlichen Haushaltspositionen bietet und fordert mit Rücksicht auf die realen Möglichkeiten<br />
e<strong>in</strong>e verbesserte Prognose für die künftige Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de. Im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan<br />
wird deshalb auch die Investitionstätigkeit der Geme<strong>in</strong>de über e<strong>in</strong>en mehrjährigen Zeitraum genauer abgebildet<br />
wird. Im Rahmen der NKF-Gesetzgebung ist daher auf die Vorgabe, der Investitionstätigkeit e<strong>in</strong> gesondertes<br />
Investitionsprogramm zu Grunde zu legen, verzichtet worden. Der mehrjährige Haushaltsplan br<strong>in</strong>gt aber auch<br />
mit sich, dass die haushaltswirtschaftlichen Effekte von Maßnahmen der Geme<strong>in</strong>de, die über das Haushaltsjahr<br />
h<strong>in</strong>aus wirken, transparenter werden.<br />
Die Spezialisierung der Haushaltspositionen muss nicht nur im Haushaltsjahr, sondern auch <strong>in</strong> den drei folgenden<br />
Planungsjahren der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung dem Grundsatz der Haushaltsklarheit <strong>in</strong> ausreichendem<br />
Maße Rechnung tragen. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass durch die Integration der mittelfristigen<br />
Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung <strong>in</strong> den Haushaltsplan die Positionen der drei dem Haushaltsjahr folgenden Planungsjahre<br />
bereits e<strong>in</strong>e erste „b<strong>in</strong>dende Form“ erhalten, z.B. dadurch, dass e<strong>in</strong> negatives Jahresergebnis u.U. e<strong>in</strong><br />
Anlass für die Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes se<strong>in</strong> kann. Durch die mittelfristige Ergebnis- und<br />
F<strong>in</strong>anzplanung wird daher stärker als bisher e<strong>in</strong>e Sicherung der haushaltswirtschaftlichen Planung für künftige<br />
Maßnahmen der Geme<strong>in</strong>de herbeigeführt.<br />
GEMEINDEORDNUNG 375
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 84 GO <strong>NRW</strong><br />
2. Zu Satz 2 (Beg<strong>in</strong>n der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung):<br />
Der Zeitraum der fünfjährigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung ist wegen <strong>in</strong> der Vergangenheit aufgetretener Missverständnisse<br />
<strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>deordnung gesetzlich klargestellt worden. Das jeweils aktuell laufende Haushaltsjahr<br />
steht immer am Beg<strong>in</strong>n der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung. Diesem Jahr folgen das neue (zu planende)<br />
Haushaltsjahr und die diesem folgenden drei Planungsjahre, so dass <strong>in</strong>sgesamt fünf Jahre den Zeitraum<br />
dieser geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplanung ausfüllen.<br />
Diese mittelfristige Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung der Geme<strong>in</strong>de stellt jedoch ke<strong>in</strong>en starren Plan für den beschriebenen<br />
Zeitraum dar, denn dieser wird nicht nach Ablauf der Zeit durch e<strong>in</strong>en weiteren „Fünfjahresplan“<br />
abgelöst. Es handelt sich bei der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplanung vielmehr um e<strong>in</strong>e sich ständig wandelnde und<br />
mit der Entwicklung der Geme<strong>in</strong>de und mit der Aufstellung des neuen Haushaltsplans fortzuschreibende Planung<br />
der Geme<strong>in</strong>de. Die Zeitreihe der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung soll nachfolgend verdeutlicht werden<br />
(vgl. Abbildung).<br />
Zeitreihe der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung<br />
Ergebnisplan<br />
oder<br />
F<strong>in</strong>anzplan<br />
Ansatz des<br />
laufenden<br />
Haushalts-<br />
jahres<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
des<br />
neuen<br />
Haushalts-<br />
jahres<br />
EUR<br />
Planung<br />
Haushalts-<br />
jahr<br />
+ 1<br />
EUR<br />
Planung<br />
Haushalts-<br />
jahr<br />
+ 2<br />
EUR<br />
Abbildung 58 „Zeitreihe der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung“<br />
Planung<br />
Haushalts-<br />
jahr<br />
+ 3<br />
Mit der Integration der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung <strong>in</strong> den geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan obliegt es<br />
dem Kämmerer der Geme<strong>in</strong>de, im Rahmen der Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen<br />
nach § 80 GO <strong>NRW</strong> nicht nur die Planung für das neue Haushaltsjahr vorzunehmen, sondern jährlich auch die<br />
weitere jahresbezogene Planung für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre fortzuführen.<br />
In den Sonderfällen e<strong>in</strong>er geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung für zwei Jahre (vgl. § 78 Abs. 3 S. 2 GO <strong>NRW</strong>) s<strong>in</strong>d<br />
die dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre an das letzte Haushaltsjahr des „Doppelhaushalts“ anzuhängen,<br />
so dass im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan e<strong>in</strong>e Zeitreihe von sieben Jahren abzubilden ist. E<strong>in</strong>e solche<br />
Zeitreihe entsteht auch bei der Pflicht der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong> Haushaltssicherungskonzept wegen der Überschreitung<br />
der Schwellenwerte nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO <strong>NRW</strong> aufstellen zu müssen, denn dann schließen sich die dem<br />
Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre an das letzte „Ursachenjahr“ an. In besonderen örtlichen Ausnahmefällen<br />
kann bei der Geme<strong>in</strong>de auch e<strong>in</strong>e Veranlassung für die Anwendung der beiden Erweiterung bestehen, so<br />
dass im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan e<strong>in</strong>e Zeitreihe von acht Jahren abzubilden ist.<br />
GEMEINDEORDNUNG 376<br />
EUR
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 84 GO <strong>NRW</strong><br />
3. Zu Satz 3 (Haushaltsmäßiger Ausgleich <strong>in</strong> jedem Planungsjahr):<br />
3.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die durch die mittelfristige Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung geschaffene Gesamtheit aus mehreren Haushaltsjahren<br />
f<strong>in</strong>det auch dadurch ihren Niederschlag, dass die Ergebnisplanung <strong>in</strong> den e<strong>in</strong>zelnen dem Haushaltsjahr folgenden<br />
drei Planungsjahren haushaltsmäßig ausgeglichen se<strong>in</strong> soll. Während das laufende sowie das neue Haushaltsjahr<br />
bereits dem Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> unterliegen, bedurfte es für die dem neuen<br />
Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre ebenfalls e<strong>in</strong>er Regelung.<br />
Für die drei dem Haushaltsjahr folgenden Planungsjahre muss sich die Geme<strong>in</strong>de nachhaltig darum bemühen,<br />
dass der Gesamtbetrag der Erträge möglichst den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht. Diese Vorgabe ist<br />
haushaltswirtschaftlich erforderlich, denn die drei Planungsjahre stellen die „Vorplanung“ für die nächsten Haushaltsjahre<br />
mit e<strong>in</strong>em verpflichtendem Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> dar. Außerdem zeigt diese<br />
jahresbezogene Planung bereits die weitere Entwicklung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft sowie die Entwicklung<br />
der wirtschaftlichen Lage der Geme<strong>in</strong>de auf. Nur mit e<strong>in</strong>er solchen Ausgleichsvorgabe wird die mittelfristige<br />
Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung ihrer Aufgabe gerecht.<br />
3.2 Die jahresbezogene Ausgleichsverpflichtung<br />
Das Kernstück der Reform des Geme<strong>in</strong>dehaushaltsrechts ist die Berücksichtigung des vollständigen Ressourcenverbrauchs,<br />
der mit Hilfe des Rechungsstoffes „Erträge“ und „Aufwendungen“ ermittelt und im geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushalt abgebildet wird. Die Änderung des Rechnungsstoffes erforderte e<strong>in</strong>e materielle Anpassung der Regeln<br />
zum Haushaltsausgleich (vgl. § 75 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>), denn andernfalls bliebe <strong>in</strong> den Geme<strong>in</strong>den die Umsetzung<br />
des Ressourcenverbrauchskonzeptes unvollständig. Der geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsausgleich bezieht sich nicht<br />
mehr auf die Sicherung des Geldbestandes, sondern auf die Sicherung des Vermögensbestandes durch die<br />
Erhaltung der Ertragskraft, die vom Ressourcenaufkommen (Erträge) und vom Ressourcenverbrauch (Aufwendungen)<br />
bestimmt wird.<br />
Der jährliche Haushaltsausgleich wird deshalb im Rahmen des Ergebnisplans und der Ergebnisrechnung bestimmt<br />
und nachgewiesen. Die Erträge müssen m<strong>in</strong>destens <strong>in</strong>sgesamt die Höhe der vorgesehenen Aufwendungen<br />
erreichen (decken) sowohl <strong>in</strong> der Planung als auch <strong>in</strong> der Rechnung (im Jahresabschluss). Werden diese<br />
Erträge im Haushaltsjahr nicht erzielt, übersteigen also die Aufwendungen die Erträge <strong>in</strong> dieser Periode, verr<strong>in</strong>gert<br />
sich <strong>in</strong> diesem Maße das geme<strong>in</strong>dliche Vermögen (Eigenkapital). E<strong>in</strong>e weitere Ausgleichsverpflichtung für<br />
den F<strong>in</strong>anzplan und die F<strong>in</strong>anzrechnung besteht im NKF nicht. Diesen Teilen des geme<strong>in</strong>dlichen Haushalts<br />
kommen die Aufgabe der F<strong>in</strong>anzmittelherkunft und der F<strong>in</strong>anzmittelverwendung sowie des Nachweises e<strong>in</strong>er<br />
ausreichenden Liquidität im jeweiligen Haushaltsjahr zu (vgl. § 75 Abs. 6 i.V.m. § 3 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
Die Haushaltsausgleichsverpflichtung soll nach dieser Vorschrift auch für die dem Haushaltsjahr folgenden drei<br />
Planungsjahre gelten. Um frühzeitig die Auswirkungen des haushaltswirtschaftlichen Handelns der Geme<strong>in</strong>de auf<br />
die Zukunft aufzuzeigen und zu vermeiden, dass die weitere Entwicklung des Eigenkapitals negativ verläuft, soll<br />
auch die Haushaltsplanung für diese Planungsjahre der mittelfristigen Ergebnisplanung ausgeglichen se<strong>in</strong> (Soll-<br />
Ausgleich). Auch dieses Gebot des Haushaltsausgleichs stellt e<strong>in</strong>e rechtliche Verpflichtung für die Geme<strong>in</strong>de dar,<br />
von der sie nur <strong>in</strong> besonderen Ausnahmefällen abweichen darf.<br />
Grundsätzlich ist e<strong>in</strong>e Soll-Vorschrift für die Geme<strong>in</strong>de ebenso verb<strong>in</strong>dlich wie e<strong>in</strong>e Muss-Vorschrift, solange die<br />
Geme<strong>in</strong>de nicht besondere Umstände dartun und beweisen kann, die ausnahmsweise e<strong>in</strong> Abweichen von der<br />
Regel zulassen. Die getroffene Festlegung ist als sachgerecht und vertretbar zu beurteilen, denn es können<br />
durchaus erhebliche Unwägbarkeiten sowohl für den wesentlich über das Haushaltsjahr h<strong>in</strong>ausgehenden Pla-<br />
GEMEINDEORDNUNG 377
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 84 GO <strong>NRW</strong><br />
nungszeitraum als auch für die auf die Haushaltspositionen bezogene vorzunehmende Prognose für die künftige<br />
Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de bestehen.<br />
4. Zu Satz 4 (Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung):<br />
Aus unterschiedlichen Gründen heraus kann die Entwicklung der Geme<strong>in</strong>de anders verlaufen als ursprünglich für<br />
den mehrjährigen Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung geplant worden ist. Im Ablauf der<br />
Haushaltsjahre ist es daher geboten, die vorhandene Planung für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre<br />
der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung mit der jährlichen Haushaltssatzung der Entwicklung<br />
anzupassen und fortzuführen, um die Differenzen zwischen prognostizierter und tatsächlich e<strong>in</strong>getretener Entwicklung<br />
der Geme<strong>in</strong>de zu beseitigen. Daher wird durch die Vorschrift ausdrücklich betont, dass die mittelfristige<br />
Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung der Entwicklung anzupassen und fortzuführen ist.<br />
Die mittelfristige Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung, die bisher getrennt vom Haushaltsplan aufgestellt wurde, ist <strong>in</strong><br />
den Haushaltsplan der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>bezogen worden. Sie ist sowohl im Ergebnisplan und im F<strong>in</strong>anzplan als<br />
auch produktorientiert <strong>in</strong> jedem Teilplan (vgl. § 4 GemHVO <strong>NRW</strong>) abzubilden. Dadurch hat der Rat bei se<strong>in</strong>en<br />
Beratungen und se<strong>in</strong>er Beschlussfassung über die Haushaltssatzung stärker als bisher auch die dem Haushaltsjahr<br />
folgenden drei Planungsjahre der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung im Blickfeld. Die Abbildung<br />
e<strong>in</strong>er Zeitreihe von sieben Jahren im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan soll zur Verbesserung e<strong>in</strong>er dauerhaften Ordnung<br />
der F<strong>in</strong>anzen der Geme<strong>in</strong>de beitragen.<br />
Diese Zeitreihe soll zudem die Transparenz über die Haushaltsplanung erhöhen und zu möglichst realistischeren<br />
Prognosen für die Fortschreibung zw<strong>in</strong>gen. Dies be<strong>in</strong>haltet, die Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und<br />
F<strong>in</strong>anzplanung unter Beachtung des Jährlichkeitspr<strong>in</strong>zips und des Haushaltsausgleichs vorzunehmen. Durch<br />
diese Festlegungen ist die vorzunehmende Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung, bezogen<br />
auf die Arten der geme<strong>in</strong>dlichen Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan sowie bezogen auf die E<strong>in</strong>zahlungen<br />
und Auszahlungen im F<strong>in</strong>anzplan haushaltspositionenscharf vorzunehmen. Dieses gilt gleichermaßen<br />
für die im Haushaltsplan enthaltenen Teilpläne.<br />
Die Fortschreibung ist daher wie bei der Aufstellung e<strong>in</strong>es jährlichen Haushaltsplans e<strong>in</strong>e jährlich wiederkehrende<br />
Haushaltsplanung, denn das neue Haushaltsjahr steht im Mittelpunkt. Sie gibt den Adressaten der Haushaltsplanung<br />
e<strong>in</strong>en aktuellen Überblick über die vergangenen zwei Haushaltsjahre, das aktuelle Haushaltsjahr und die<br />
folgenden drei Planungsjahre.<br />
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ<br />
GEMEINDEORDNUNG 378
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 85 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 85<br />
Verpflichtungsermächtigungen<br />
(1) 1 Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen <strong>in</strong> künftigen Jahren dürfen grundsätzlich nur<br />
e<strong>in</strong>gegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. 2 Sie dürfen ausnahmsweise auch überplanmäßig<br />
oder außerplanmäßig e<strong>in</strong>gegangen werden, wenn sie unabweisbar s<strong>in</strong>d und der <strong>in</strong> der Haushaltssatzung<br />
festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird. 3 § 83 Abs. 1 Sätze 3 und<br />
4 gelten s<strong>in</strong>ngemäß.<br />
(2) Die Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und,<br />
wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zum<br />
Erlass dieser Haushaltssatzung.<br />
Erläuterungen zu § 85:<br />
I. Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Der geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsplan enthält Ermächtigungen für das Haushaltsjahr und die daran anschließenden<br />
drei Planungsjahre. Er stellt damit e<strong>in</strong> örtliches Programm für die Erledigung der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgaben im<br />
Haushaltsjahr dar. Dabei ist es nicht ausreichend, nur den voraussichtlichen Ressourcenverbrauch und das mögliche<br />
Ressourcenaufkommen sowie E<strong>in</strong>- und Auszahlungsermächtigungen für das Haushaltsjahr aufzuzeigen. Es<br />
bedarf vielmehr besonderer Ermächtigungen, um die <strong>in</strong>vestiven Zielsetzungen des Rates der Geme<strong>in</strong>de, die<br />
haushaltsmäßig vielfach nur mehrjährig umsetzbar s<strong>in</strong>d, <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang mit den verfügbaren Ressourcen der Geme<strong>in</strong>de<br />
zu br<strong>in</strong>gen.<br />
Die Geme<strong>in</strong>de hat deshalb im Rahmen ihrer Investitionstätigkeit die Pflicht, bei geplanten Investitionsmaßnahmen<br />
nicht nur die auf das Haushaltsjahr und die anschließenden drei Planungsjahre bezogenen Auszahlungsermächtigungen<br />
im Haushaltsplan zu veranschlagen, sondern die Planung für die Folgejahre soweit ausführbar zu machen,<br />
dass nicht erst durch die folgenden Haushaltspläne die dafür notwendigen Ermächtigungen durch den Rat<br />
erteilt werden. Diesem Zweck dienen die haushaltsrechtlich vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen. Sie<br />
ermöglichen der Geme<strong>in</strong>de, bereits im Haushaltsjahr f<strong>in</strong>anzielle Zusagen zu machen, auch wenn diese erst <strong>in</strong><br />
späteren Jahren zu Zahlungen bei der Geme<strong>in</strong>de führen.<br />
E<strong>in</strong>e Verpflichtungsermächtigung im S<strong>in</strong>ne dieser Vorschrift liegt daher vor, wenn durch e<strong>in</strong>e Veranschlagung im<br />
Haushaltsplan e<strong>in</strong>es Haushaltsjahres der Rat die geme<strong>in</strong>dliche Verwaltung ermächtigt, bereits <strong>in</strong> diesem Jahr<br />
Verpflichtungen e<strong>in</strong>zugehen, die zur Leistung von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <strong>in</strong> künftigen Haushaltsjahren<br />
führen. Dadurch ist aber das E<strong>in</strong>gehen von anderen Verpflichtungen nicht ausgeschlossen worden. Folgen<br />
aus solchen geme<strong>in</strong>dlichen Zusagen sowohl Zahlungen der Geme<strong>in</strong>de im Haushaltsjahr und <strong>in</strong> den Folgejahren,<br />
muss der geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsplan entsprechende Haushaltspositionen enthalten. Mit dem Ausweis von Verpflichtungsermächtigungen<br />
zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen <strong>in</strong> künftigen Jahren im Haushaltsplan<br />
hat der Rat die Möglichkeit, bei der Beratung des Haushalts die schon voraussehbaren Belastungen der künftigen<br />
Haushaltsjahre aus Verpflichtungsermächtigungen <strong>in</strong> se<strong>in</strong>e Entscheidungen e<strong>in</strong>zubeziehen.<br />
Die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan ist jedoch für die Geschäfte<br />
der laufenden Verwaltung nicht erforderlich, auch wenn diese Geschäfte, z.B. der Abschluss von Mietverträgen<br />
oder Personalentscheidungen, sich belastend auf künftige Haushaltsjahre auswirken können. Die Summe<br />
der erteilten Ermächtigungen, die zu langfristigen Belastungen der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft führen, z.B.<br />
durch Miet-, Leas<strong>in</strong>g- und PPP-Geschäfte, darf die f<strong>in</strong>anzielle Leistungskraft der Geme<strong>in</strong>de nicht übersteigen.<br />
GEMEINDEORDNUNG 379
II. Erläuterungen im E<strong>in</strong>zelnen<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 85 GO <strong>NRW</strong><br />
1. Zu Absatz 1 (Zulässigkeit von Verpflichtungsermächtigungen):<br />
1.1 Zu Satz 1 (Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsauszahlungen):<br />
Die Verpflichtungsermächtigungen, die im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan zu veranschlagen s<strong>in</strong>d, können nur zur<br />
Leistung von Auszahlungen für Investitionen erteilt werden. Sie s<strong>in</strong>d damit auf Maßnahmen beschränkt, die unter<br />
die Investitionstätigkeit der Geme<strong>in</strong>de fallen, und sie s<strong>in</strong>d im Haushaltsplan bei den betreffenden Maßnahmen zu<br />
veranschlagen. Darüber h<strong>in</strong>aus s<strong>in</strong>d nur die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan zu<br />
veranschlagen (vgl. § 79 Abs. 1 Nr. 3 GO <strong>NRW</strong>). Deshalb dürfen im Haushaltsplan für die Verpflichtungsermächtigungen<br />
grundsätzlich nur Ermächtigungen <strong>in</strong> der Höhe enthalten se<strong>in</strong>, <strong>in</strong> der sich die Geme<strong>in</strong>de voraussichtlich<br />
auftragsmäßig b<strong>in</strong>den will. Die Sicherung der aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich entstehenden<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Leistungen ist dabei e<strong>in</strong> weiterer Aspekt, der bei der Bedarfsermittlung zu beachten ist.<br />
Die besondere Bedeutung der Verpflichtungsermächtigungen wird dadurch verstärkt, dass der Gesamtbetrag der<br />
Verpflichtungsermächtigungen <strong>in</strong> der Haushaltssatzung festzusetzen ist (vgl. § 78 Abs. 2 Nr. 1d) GO <strong>NRW</strong>). Daher<br />
ist bei im geme<strong>in</strong>dlichen Haushalt veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen, die den Abschluss von<br />
Rechtsgeschäften zu Lasten von künftigen Haushalten der Geme<strong>in</strong>de ermöglichen, immer zu berücksichtigen,<br />
dass diese immer nur <strong>in</strong> dem Maße veranschlagt werden dürfen, dass sie nicht zu e<strong>in</strong>er untragbaren haushaltswirtschaftlichen<br />
Belastung der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> der Zukunft führen.<br />
1.2 Zu Satz 2 (Zulässigkeit über- oder außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen):<br />
1.2.1 Über- oder außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen<br />
Nach der Vorschrift dürfen Verpflichtungsermächtigungen ausnahmsweise auch überplanmäßig oder außerplanmäßig<br />
e<strong>in</strong>gegangen werden, wenn sie unabweisbar s<strong>in</strong>d und der <strong>in</strong> der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag<br />
der Verpflichtungsermächtigungen (vgl. § 78 Abs. 2 Nr. 1 d) GO <strong>NRW</strong>) nicht überschritten wird. Der Gesamtbetrag<br />
der Verpflichtungsermächtigungen, der zu künftig zu leistenden <strong>in</strong>vestiven Auszahlungen ermächtigt,<br />
wird <strong>in</strong> den Teilplänen (Teilf<strong>in</strong>anzplänen) für die Produktbereiche bei den e<strong>in</strong>zelnen Investitionsmaßnahmen <strong>in</strong> der<br />
jeweiligen Bedarfshöhe veranschlagt.<br />
In diesem Zusammenhang führt die mittelfristige F<strong>in</strong>anzplanung, die <strong>in</strong> den geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan <strong>in</strong>tegriert<br />
ist, dazu, dass statt e<strong>in</strong>es gesonderten Ausweises von Verpflichtungsermächtigungen auch die Haushaltspositionen<br />
der dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre der mittelfristigen F<strong>in</strong>anzplanung zu Verpflichtungsermächtigungen<br />
erklärt werden können. D.h., diese Positionen zeigen bereits als Planungsgrößen nicht nur die<br />
möglichen künftigen haushaltsmäßigen Auswirkungen auf, sondern sie bilden als Verpflichtungsermächtigungen<br />
bereits e<strong>in</strong>e Grundlage für e<strong>in</strong> aktuelles Handeln der Verwaltung im laufenden Haushaltsjahr zu Lasten künftiger<br />
Jahre.<br />
Im Laufe e<strong>in</strong>es Haushaltsjahres kann sich ggf. auch e<strong>in</strong> Bedarf für weitere Verpflichtungsermächtigungen ergeben.<br />
In diesen Fällen muss zuerst geprüft werden, ob die im Haushaltsplan enthaltenen Verpflichtungsermächtigungen<br />
diesen Bedarf mit abdecken können, z.B. weil ggf. geplante Maßnahmen nicht wie vorgesehen erfolgen<br />
können. Wegen der Vorgabe, die Verpflichtungsermächtigungen bei den betreffenden Maßnahmen auszuweisen,<br />
wird für solche Fälle durch Satz 2 zugelassen, dass sie ausnahmsweise auch überplanmäßig oder außerplanmäßig<br />
e<strong>in</strong>gegangen werden dürfen, wenn sie unabweisbar s<strong>in</strong>d und der <strong>in</strong> der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag<br />
der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird. Damit kann im E<strong>in</strong>zelfall flexibel reagiert<br />
werden, ohne dass es ansonsten e<strong>in</strong>er Nachtragssatzung bedarf.<br />
GEMEINDEORDNUNG 380
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 85 GO <strong>NRW</strong><br />
1.2.2 Unabweisbarkeit zusätzlicher Verpflichtungsermächtigungen<br />
Die Vorschrift sieht vor, dass überplanmäßige oder außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen nur e<strong>in</strong>gegangen<br />
werden dürfen, wenn sie unabweisbar s<strong>in</strong>d. Der Begriff der Unabweisbarkeit, der vom Gesetzgeber nicht<br />
näher def<strong>in</strong>iert worden ist, stellt wie <strong>in</strong> § 83 Abs. 1 S. 1 GO <strong>NRW</strong> zu den über- und außerplanmäßige Aufwendungen<br />
und Auszahlungen auf die dr<strong>in</strong>gende Notwendigkeit bzw. Eilbedürftigkeit der Umsetzung sowie darauf ab,<br />
dass e<strong>in</strong>e Verschiebung auf e<strong>in</strong>en späteren Zeitpunkt nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.<br />
Die Geme<strong>in</strong>de muss auf Grund rechtlicher oder faktischer Zwänge weder sachlich noch zeitlich e<strong>in</strong>e Handlungsalternative<br />
haben. Im Bedarfsfalle ist deshalb sorgfältige Analyse notwendig, um e<strong>in</strong>en Änderungsbedarf gegenüber<br />
den bestehenden haushaltsplanmäßigen Ermächtigungen festzustellen.<br />
1.2.3 Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen<br />
Nach der Vorschrift darf beim E<strong>in</strong>gang überplanmäßiger oder außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen<br />
der <strong>in</strong> der Haushaltssatzung (vgl. § 78 GO <strong>NRW</strong>) festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen<br />
nicht überschritten werden. Mit der Festsetzung dieses Gesamtbetrages ist der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung das<br />
E<strong>in</strong>gehen von Verpflichtungen im Rahmen der Investitionstätigkeit grundsätzlich ermöglicht worden. Durch die<br />
Zuordnung der Verpflichtungsermächtigungen zu den e<strong>in</strong>zelnen geplanten Investitionsmaßnahmen im Teilf<strong>in</strong>anzplan<br />
(Planung e<strong>in</strong>zelner Investitionsmaßnahmen) der produktorientierten Teilpläne im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan<br />
besteht aber e<strong>in</strong>e konkrete B<strong>in</strong>dung der Ermächtigungen. Bei e<strong>in</strong>em im Haushaltsjahr entstehenden Änderungsbedarf<br />
ermöglicht die Vorschrift e<strong>in</strong>en flexiblen Austausch <strong>in</strong>nerhalb des durch den Gesamtbetrag gesetzten<br />
Rahmens. E<strong>in</strong>e Überschreitung würde dagegen e<strong>in</strong>e Nachtragssatzung erforderlich machen.<br />
1.3 Zu Satz 3 (Verweis auf § 83 GO <strong>NRW</strong>):<br />
Die Verweisung auf die Vorschrift des § 83 Abs. 1 Sätze 3 und 4 GO <strong>NRW</strong> ist darauf ausgerichtet, dass bei überplanmäßigen<br />
oder außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen die gleichen Verfahrensregelungen und<br />
Zuständigkeiten des Kämmerers, Bürgermeisters und des Rates gegeben se<strong>in</strong> sollen, wie es für die überplanmäßigen<br />
oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bestimmt wurde. Durch beide Sachverhalte<br />
werden die vom Rat erteilten Ermächtigungen sachbezogen verändert oder überschritten. Dieses bedarf wegen<br />
der haushaltsmäßigen Veränderungen e<strong>in</strong>er besonderen gesetzlichen Grundlage. Zu den Aufgaben und Rechten<br />
des Kämmerers siehe Erläuterung Nr. 7 zu § 80 GO <strong>NRW</strong>.<br />
2. Zu Absatz 2 (Geltungsdauer der Verpflichtungsermächtigungen):<br />
2.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die Vorschrift sieht e<strong>in</strong>en fest bestimmten Zeitraum als Geltungsdauer der <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung<br />
festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen vor (vgl. § 78 Abs. 2 Nr. 1 d) GO <strong>NRW</strong>). Danach gelten diese<br />
bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste<br />
Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung. Diese Zweijährigkeit<br />
der Geltungsdauer der Verpflichtungsermächtigungen stellt e<strong>in</strong>e Maßnahme dar, durch die die Durchführung<br />
der Investitionen der Geme<strong>in</strong>de flexibler gestaltet worden ist. Die Geltungsdauer der Verpflichtungsermächtigungen<br />
stimmt mit der Geltungsdauer der Kreditermächtigung nach § 86 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> übere<strong>in</strong>, weil die Verpflichtungsermächtigungen<br />
nur die Investitionsmaßnahmen der Geme<strong>in</strong>de betreffen (vgl. § 13 Abs. 1 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
GEMEINDEORDNUNG 381
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 85 GO <strong>NRW</strong><br />
Die Geltungsdauer für Verpflichtungsermächtigungen auch für das Folgejahr des Haushaltsjahres kann nur für die<br />
Verpflichtungsermächtigungen gelten, aus denen heraus Verpflichtungen der Geme<strong>in</strong>de zu Lasten des zweiten<br />
Folgejahres des Haushaltsjahres oder späterer Folgejahre entstehen. E<strong>in</strong>e bis zum Ende des Haushaltsjahres<br />
nicht <strong>in</strong> Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Folgejahres des Haushaltsjahres verfällt,<br />
auch wenn sie wegen der Geltungsdauer der Verpflichtungsermächtigungen formal noch Bestand hat. Im<br />
betreffenden Folgejahr können wegen des neuen Haushaltsjahres zwangsläufig nur noch die veranschlagten<br />
oder auch übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen <strong>in</strong> Anspruch genommen werden. Ggf. muss e<strong>in</strong>e<br />
überplanmäßige Bereitstellung e<strong>in</strong>er Ermächtigung für Auszahlungen erfolgen (vgl. § 83 GO <strong>NRW</strong>).<br />
2.2 Die Übertragung der Verpflichtungsermächtigungen<br />
Außerdem steht die Übertragung der Verpflichtungsermächtigungen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Zusammenhang mit der Möglichkeit<br />
der Übertragbarkeit von Ermächtigungen nach § 22 GemHVO <strong>NRW</strong>. Nach dem Absatz 2 dieser Vorschrift bleiben<br />
Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar;<br />
bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, <strong>in</strong><br />
dem der Vermögensgegenstand <strong>in</strong> se<strong>in</strong>en wesentlichen Teilen <strong>in</strong> Benutzung genommen werden kann. Werden<br />
Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten<br />
dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.<br />
Die F<strong>in</strong>anzierung der geme<strong>in</strong>dlichen Investitionen auf dieser Basis erfordert, dass auch die entsprechenden F<strong>in</strong>anzmittel<br />
bei der Geme<strong>in</strong>de verfügbar s<strong>in</strong>d, und mögliche Verpflichtungen von der Geme<strong>in</strong>de auch zu Lasten<br />
der Folgejahre e<strong>in</strong>gegangen werden können. Daher ist es sachgerecht, die Ermächtigung des Rates zu Verpflichtungsermächtigungen<br />
für geplante Investitionen oder für die Fortsetzung von Investitionen über das jeweilige<br />
Haushaltsjahr h<strong>in</strong>aus noch zu nutzen, wenn diese noch nicht im Haushaltsjahr <strong>in</strong> voller Höhe benötigt wurden,<br />
aber für das Folgejahr bereits e<strong>in</strong> Bedarf dafür erkennbar ist. Geht die Geme<strong>in</strong>de im Rahmen der Übertragung<br />
der Verpflichtungsermächtigungen e<strong>in</strong>e Verpflichtung e<strong>in</strong>, ist diese nicht auf die <strong>in</strong> der Haushaltssatzung für das<br />
laufende Haushaltsjahr festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen (vgl. § 78 Abs. 2 Nr. 1 d) GO <strong>NRW</strong>) anzurechnen.<br />
2.3 Information des Rates über die Verpflichtungsermächtigungen<br />
2.3.1 Informationen über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen<br />
Dem geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan ist e<strong>in</strong>e Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen der Geme<strong>in</strong>de beizufügen,<br />
die erkennen lassen muss, <strong>in</strong> welcher Höhe aus der deren Inanspruchnahme <strong>in</strong> den späteren Jahren<br />
der Geme<strong>in</strong>de voraussichtlich Auszahlungen erwachsen werden und auf welche Jahre sich diese verteilen (vgl. §<br />
1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO <strong>NRW</strong>). Durch die Übersicht soll aufgezeigt werden, wie die künftigen Haushaltsjahre<br />
bereits vorbelastet s<strong>in</strong>d, weil <strong>in</strong> Vorjahren bereits Verpflichtungsermächtigungen <strong>in</strong> Anspruch genommen worden<br />
s<strong>in</strong>d. Es ist daher für die Geme<strong>in</strong>de notwendig, <strong>in</strong> dieser Übersicht zum geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan sowohl die<br />
voraussichtlich erforderlichen Verpflichtungen im neuen Haushaltsjahr als auch die voraussichtlich fälligen Auszahlungen<br />
aus Verpflichtungsermächtigungen aus früheren Jahren, aufgeteilt auf die künftigen Haushaltsjahre,<br />
auszuweisen (vgl. Erläuterungen zu den § 1 und 13 GemHVO <strong>NRW</strong> sowie Nummer 1.4.3 des Runderlasses des<br />
Innenm<strong>in</strong>isteriums vom 24.02.2005, SMBl. <strong>NRW</strong>. 6300).<br />
2.3.2 Informationen über die übertragenen Verpflichtungsermächtigungen<br />
In den Fällen, <strong>in</strong> denen die <strong>in</strong> der Haushaltssatzung für das abgelaufene Haushaltsjahr festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen<br />
noch nicht <strong>in</strong> vollem Umfang <strong>in</strong> Anspruch genommen worden ist, bietet es sich an, ergän-<br />
GEMEINDEORDNUNG 382
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 85 GO <strong>NRW</strong><br />
zend zu der nach § 22 Abs. 4 GemHVO dem Rat vorzulegenden Übersicht über die übertragenen Ermächtigungen<br />
für Aufwendungen und Auszahlungen (vgl. § 22 Abs. 4 GemHVO <strong>NRW</strong>) auch die „Übertragung“ der Verpflichtungsermächtigungen<br />
mit anzugeben, die noch nicht im Rahmen der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft <strong>in</strong><br />
Anspruch genommen wurden, deren Inanspruchnahme aber für das Folgejahr vorgesehen ist.<br />
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ<br />
GEMEINDEORDNUNG 383
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 86 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 86<br />
Kredite<br />
(1) 1 Kredite dürfen nur für Investitionen unter der Voraussetzung des § 77 Abs. 3 und zur Umschuldung aufgenommen<br />
werden. 2 Die daraus übernommenen Verpflichtungen müssen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der<br />
Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang stehen.<br />
(2) Die Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung<br />
für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekanntgemacht wird, bis zum Erlass dieser<br />
Haushaltssatzung.<br />
(3) 1 Die Aufnahme e<strong>in</strong>zelner Kredite bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, sobald die Kreditaufnahme<br />
nach § 19 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft beschränkt worden ist.<br />
2 Die E<strong>in</strong>zelgenehmigung kann nach Maßgabe der Kreditbeschränkungen versagt werden.<br />
(4) 1 Entscheidungen der Geme<strong>in</strong>de über die Begründung e<strong>in</strong>er Zahlungsverpflichtung, die wirtschaftlich e<strong>in</strong>er<br />
Kreditverpflichtung gleichkommt, s<strong>in</strong>d der Aufsichtsbehörde unverzüglich, spätestens e<strong>in</strong>en Monat vor der rechtsverb<strong>in</strong>dlichen<br />
E<strong>in</strong>gehung der Verpflichtung, schriftlich anzuzeigen. 2 Absatz 1 Satz 2 gilt s<strong>in</strong>ngemäß. 3 E<strong>in</strong>e Anzeige<br />
ist nicht erforderlich für die Begründung von Zahlungsverpflichtungen im Rahmen der laufenden Verwaltung.<br />
(5) 1 Die Geme<strong>in</strong>de darf zur Sicherung des Kredits ke<strong>in</strong>e Sicherheiten bestellen. 2 Die Aufsichtsbehörde kann Ausnahmen<br />
zulassen, wenn die Bestellung von Sicherheiten der Verkehrsübung entspricht.<br />
Erläuterungen zu § 86:<br />
I. Allgeme<strong>in</strong>es<br />
1. Inhalte der Vorschrift<br />
Für die Aufnahme von Krediten für geme<strong>in</strong>dliche Investitionen enthält die Vorschrift wegen der besonderen haushaltsrechtlichen<br />
und haushaltswirtschaftlichen Bedeutung bestimmte materielle und formelle Voraussetzungen.<br />
Diese Vorgaben führen zu e<strong>in</strong>em Verbot der F<strong>in</strong>anzierung von aufwandswirksamen Auszahlungen der Geme<strong>in</strong>de<br />
und der ordentlichen Tilgung durch Kredite. E<strong>in</strong>e Ausnahme besteht lediglich für e<strong>in</strong>e Kreditaufnahme zur Umschuldung,<br />
weil bei e<strong>in</strong>em solchen Vorgang die Tilgung der ursprünglichen f<strong>in</strong>anziellen Verb<strong>in</strong>dlichkeit und e<strong>in</strong><br />
Zugang e<strong>in</strong>er neuen f<strong>in</strong>anziellen Verb<strong>in</strong>dlichkeit <strong>in</strong> gleicher Höhe erfolgen. Dabei kommt es nicht darauf an, ob<br />
sich auch gleichzeitig die Vertragsbed<strong>in</strong>gungen zwischen Kreditgeber und Geme<strong>in</strong>de substanziell verändern.<br />
Die Geme<strong>in</strong>de kann daher Kredite aufnehmen, wenn diese der Bedarfsdeckung bei <strong>in</strong>vestiven Maßnahmen im<br />
Rahmen der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgabenerfüllung dienen. Daher besteht - wie <strong>in</strong> den anderen Ländern - e<strong>in</strong>e Begrenzung<br />
der Kreditaufnahme auf die geme<strong>in</strong>dliche Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr. Die <strong>in</strong> der Vorschrift<br />
enthaltenen Voraussetzungen für e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>dliche Kreditaufnahme s<strong>in</strong>d u.a. notwendig, um e<strong>in</strong>e Vere<strong>in</strong>barkeit<br />
mit dem geltenden Verfassungsrecht zu sichern.<br />
Die heutige Regelung soll sicherstellen, dass der f<strong>in</strong>anzpolitische Spielraum der Geme<strong>in</strong>de erhalten bleibt und die<br />
sog. Symmetrie von Zukunftslasten und -vorteilen nicht verschoben wird. Die Regelung erfordert aber, für jedes<br />
Haushaltsjahr e<strong>in</strong>e Gesamtbetrachtung der Liquidität vorzunehmen, um den zutreffenden Kreditbedarf und die<br />
notwendige Festsetzung der Kreditermächtigung <strong>in</strong> der Haushaltssatzung zu ermitteln. Bei der Regelung wird<br />
davon ausgegangen, dass die Beibehaltung der Koppelung der Aufnahme von Krediten an die geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Investitionen nicht zu unvertretbaren E<strong>in</strong>schränkungen der Geme<strong>in</strong>de bei der Auswahl der Beschaffung der not-<br />
GEMEINDEORDNUNG 384
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 86 GO <strong>NRW</strong><br />
wendigen Liquidität führt. E<strong>in</strong>e schwierige wirtschaftliche Lage der Geme<strong>in</strong>de kann nicht durch das NKF bzw. das<br />
geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsrecht korrigiert werden.<br />
2. Aufnahme von Krediten<br />
Unter dem Begriff „Kredite für Investitionen“ wird das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten aufgenommene<br />
Kapital verstanden, das gesetzlich beschränkt, nur zur F<strong>in</strong>anzierung von Investitionen e<strong>in</strong>gesetzt werden<br />
darf. Diese Beschränkung beruht auf den verfassungsrechtlichen Vorgaben des Art. 115 Abs. 1 Satz 2<br />
Grundgesetz sowie auf Art. 83 Satz 2 der Landesverfassung <strong>NRW</strong>. Sie ist auch auf der <strong>in</strong> allen Ländern vorzuf<strong>in</strong>denden<br />
Festlegung, dass die Geme<strong>in</strong>den grundsätzlich ke<strong>in</strong>e Aufwendungen entstehen lassen sollen, die nicht<br />
durch „ordentliche“ Erträge gedeckt werden können, begründet.<br />
In diesem Zusammenhang wird der Begriff „Investitionen“ durch die Festlegung der im F<strong>in</strong>anzplan unter der Investitionstätigkeit<br />
auszuweisenden E<strong>in</strong>zahlungen und Auszahlungen bestimmt (vgl. § 3 Abs. 1 Nrn. 15 bis 25<br />
GemHVO <strong>NRW</strong>). Daraus folgt, dass Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die ordentliche Tilgung<br />
von Krediten für Investitionen sowie die Geldanlage nicht mit Krediten f<strong>in</strong>anziert werden dürfen. Zudem ist zu<br />
beachten, dass die bilanzielle Abgrenzung zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Bilanz nicht dazu führt, dass nur Vermögensgegenstände, die dem Anlagevermögen der Geme<strong>in</strong>de zuzuordnen<br />
s<strong>in</strong>d, als Investitionen im S<strong>in</strong>ne der haushaltsrechtlichen Vorschriften gelten.<br />
Bei der Aufnahme von Krediten ist u.a. auch der haushaltswirtschaftliche Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und<br />
Sparsamkeit sowie § 77 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong> zu beachten, nach dem von der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong> Kredit nur aufgenommen<br />
werden darf, wenn e<strong>in</strong>e andere F<strong>in</strong>anzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Vor der<br />
Aufnahme e<strong>in</strong>es Kredites durch die Geme<strong>in</strong>de s<strong>in</strong>d daher i.d.R. Angebote verschiedener Kreditgeber e<strong>in</strong>zuholen.<br />
Für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit e<strong>in</strong>es Angebotes s<strong>in</strong>d alle Vertragselemente zu berücksichtigen und zu<br />
bewerten.<br />
Die Kredite für Investitionen werden zudem haushaltsrechtlich von den Krediten zur Liquiditätssicherung nach §<br />
89 GO <strong>NRW</strong> unterschieden. Reichen die liquiden Mittel der Geme<strong>in</strong>de zur rechtzeitigen Leistung von fälligen<br />
Auszahlungen nicht aus, darf sie lediglich Kredite zur Liquiditätssicherung nach § 89 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> aufnehmen.<br />
Diese „Liquiditätskredite“, die haushaltsrechtlich – wie bisher die Kassenkredite - nicht den Krediten nach<br />
dieser Vorschrift zuzuordnen s<strong>in</strong>d, berühren daher bei ihrer Aufnahme nicht den <strong>in</strong> der Haushaltssatzung nach §<br />
78 Abs. 2 Nr. 1 c) GO <strong>NRW</strong> festzusetzenden Kreditrahmen (Kreditermächtigung).<br />
Die Kredite zur Liquiditätssicherung unterliegen vielmehr e<strong>in</strong>er eigenen Ermächtigung, die nach § 78 Abs. 2 Nr. 3<br />
GO <strong>NRW</strong> <strong>in</strong> der Haushaltssatzung enthalten se<strong>in</strong> muss (vgl. Nummer 1.1.1 des Runderlasses vom 24.02.2005,<br />
SMBl. <strong>NRW</strong>. 6300). Außerdem gilt bei den beiden Kreditarten e<strong>in</strong>e zeitliche Beschränkung für die Inanspruchnahme<br />
der <strong>in</strong> der Haushaltssatzung enthaltenen Ermächtigung des Rates zur Aufnahme dieser Kredite.<br />
3. Kredite <strong>in</strong> fremder Währung<br />
3.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die Geme<strong>in</strong>de kann aus Wirtschaftlichkeitserwägungen heraus auch Kredite <strong>in</strong> fremder Währung aufnehmen, d.h.<br />
das Kreditvolumen wird nicht <strong>in</strong> Euro bemessen und kommt <strong>in</strong> dieser Währung zur Auszahlung, sondern <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
anderen Währung, z.B. Schweizer Franken, Japanischer Yen. Auch kann e<strong>in</strong> <strong>in</strong> fremder Währung aufgenommener<br />
Kredit gleichwohl <strong>in</strong> Euro zur Auszahlung kommen. In diesen Fällen hat die Geme<strong>in</strong>de wegen möglicher<br />
Wechselkursschwankungen während der Laufzeit des Kredites besondere Anforderungen bei der Risikoabwä-<br />
GEMEINDEORDNUNG 385
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 86 GO <strong>NRW</strong><br />
gung und Risikovorsorge zu erfüllen, <strong>in</strong>sbesondere dann, wenn mit der Kreditaufnahme e<strong>in</strong> Währungsswap oder<br />
e<strong>in</strong> komb<strong>in</strong>ierter Z<strong>in</strong>s- und Währungsswap verbunden wurde.<br />
Zur Vorbereitung e<strong>in</strong>er Entscheidung über die Aufnahme von Krediten <strong>in</strong> fremder Währung s<strong>in</strong>d deshalb unter<br />
Berücksichtigung der örtlichen Bedürfnisse die Entscheidungs- und Auswahlkriterien sowie die Z<strong>in</strong>ssicherungs<strong>in</strong>strumente<br />
durch die Geme<strong>in</strong>de im E<strong>in</strong>zelnen zu bestimmen. Sie hat die dafür notwendigen Informationen und<br />
Daten e<strong>in</strong>zuholen. Diese Aufgabe enthält für die Geme<strong>in</strong>den <strong>in</strong>sbesondere die Verpflichtung, sich Kenntnisse<br />
über Sicherheiten und Risiken im Vergleich zu e<strong>in</strong>er anderen Kreditaufnahme zu verschaffen.<br />
E<strong>in</strong>e Kreditaufnahme <strong>in</strong> fremder Währung erfordert wegen des möglichen Wechselkursrisikos zudem e<strong>in</strong>e laufende<br />
eigenverantwortliche „Kontrolle“ über die Abwicklung des Kreditgeschäftes während se<strong>in</strong>er Laufzeit. Es ist <strong>in</strong><br />
diesen Fällen nicht ausreichend, die Kontrolle nur e<strong>in</strong>mal jährlich von der Geme<strong>in</strong>de vorzunehmen oder sie vollständig<br />
e<strong>in</strong>em Dritten zu übertragen.<br />
3.2 Rückstellungen zur Absicherung e<strong>in</strong>es Fremdwährungsrisikos<br />
Bei der Aufnahme von Krediten <strong>in</strong> fremder Währung muss von der Geme<strong>in</strong>de geprüft werden, ob für die gesamte<br />
Laufzeit dieses geme<strong>in</strong>dlichen Geschäftes die Gleichwertigkeitsvermutung besteht. Dabei muss grundsätzlich von<br />
der Gefahr e<strong>in</strong>er Vermögensm<strong>in</strong>derung für die Geme<strong>in</strong>de ausgegangen werden, so dass abhängig von der Höhe<br />
des Wechselkursrisikos von der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>e Risikovorsorge vorzunehmen ist (vgl. RdErl. vom 09.10.2006).<br />
Mit e<strong>in</strong>er solchen Risikovorsorge wird bezweckt, dass die wirtschaftlichen Vorteile der Geme<strong>in</strong>de aus der Aufnahme<br />
von Krediten <strong>in</strong> fremder Währung nicht bereits zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vollständig für<br />
Zwecke des geme<strong>in</strong>dlichen Haushalts abgeschöpft werden.<br />
Die geme<strong>in</strong>dliche Risikovorsorge soll deshalb dar<strong>in</strong> bestehen, dass e<strong>in</strong> Teil der wirtschaftlichen Vorteile gegenüber<br />
e<strong>in</strong>er Kreditaufnahme <strong>in</strong> Euro-Währung erst zu e<strong>in</strong>em späteren Zeitpunkt bzw. nach vollständiger Tilgung<br />
des Fremdwährungskredits realisiert wird. In der Zeit davor kann für die Geme<strong>in</strong>de aus dem Wechselkursrisiko<br />
e<strong>in</strong>e ungewisse Außenverpflichtung bestehen, die es zu bilanzieren gilt. Um dieses zu erreichen, soll die Geme<strong>in</strong>de<br />
im Zeitpunkt der Kreditaufnahme <strong>in</strong> Fremdwährung als „Absicherung des Fremdwährungsrisikos“ e<strong>in</strong>e<br />
entsprechende Rückstellung bilden. Diese Rückstellung soll solange bilanziert werden, bis gesichert ist, dass sich<br />
das Fremdwährungsrisiko der Geme<strong>in</strong>de nicht mehr realisiert. Dies ist i.d.R. erst nach Ablauf des Darlehensvertrages<br />
bzw. nach Rückzahlung des aufgenommenen Fremdwährungskredites der Fall und nicht abhängig von<br />
den vere<strong>in</strong>barten Z<strong>in</strong>sb<strong>in</strong>dungsfristen.<br />
Diese Risikovorsorge ist unter Berücksichtigung des bestehenden Fremdwährungsrisikos zu bemessen. Sollten<br />
ke<strong>in</strong>e konkreten Anhaltspunkte für die Bestimmung der Höhe der notwendigen Risikovorsorge vorliegen, ist die<br />
Rückstellung mit e<strong>in</strong>em Betrag <strong>in</strong> Höhe der Hälfte des Z<strong>in</strong>svorteils der Geme<strong>in</strong>de aus ihrer Kreditaufnahme <strong>in</strong><br />
ausländischer Währung anzusetzen. Die Rückstellung ist nach Wegfall des Fremdwährungsrisikos ertragswirksam<br />
aufzulösen. Weitere H<strong>in</strong>weise enthält der Runderlass des Innenm<strong>in</strong>isteriums über Kredite und kreditähnliche<br />
Rechtsgeschäfte der Geme<strong>in</strong>den (GV) vom 09.10.2006 (SMBl. <strong>NRW</strong>. 652).<br />
3.3 Die Fremdwährungsumrechnung<br />
Die Geme<strong>in</strong>de hat, wenn sie Kredite <strong>in</strong> fremder Währung aufgenommen hat, die Verpflichtungen daraus <strong>in</strong> Euro<br />
<strong>in</strong> ihrer Bilanz anzusetzen. Dies erfordert ggf. e<strong>in</strong>e Umrechnung, <strong>in</strong> dem der Fremdwährungsbetrag mit dem zum<br />
Abschlussstichtag gültigen Umrechnungskurs <strong>in</strong> Euro umgerechnet wird. Außerdem s<strong>in</strong>d nach § 44 Abs. 2 Nr. 7<br />
GemHVO <strong>NRW</strong> entsprechende Angaben zum Kurs der Währungsumrechnung zu machen. Da oftmals die Geme<strong>in</strong>den<br />
auch Kredite im Ausland aufnehmen, geht es nicht alle<strong>in</strong> darum, im Anhang zu zeigen, <strong>in</strong> welcher Höhe<br />
GEMEINDEORDNUNG 386
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 86 GO <strong>NRW</strong><br />
dieser Sachverhalt <strong>in</strong> der Währung „Euro“ auszudrücken wäre, sondern auch das damit ggf. verbundene Risikopotential<br />
offen zu legen.<br />
4. Kreditkosten<br />
4.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Vor der Annahme von Kreditangeboten zur F<strong>in</strong>anzierung von Investitionen ist von der Geme<strong>in</strong>de zu prüfen, welches<br />
Angebot ihren f<strong>in</strong>anzwirtschaftlichen Belangen am ehesten entspricht. Für die Kosten e<strong>in</strong>es Kredites ist die<br />
Höhe der Z<strong>in</strong>sen von entscheidender Bedeutung. Deshalb ist besonders darauf zu achten, dass die Z<strong>in</strong>sen wirtschaftlich<br />
s<strong>in</strong>d. Die mögliche Z<strong>in</strong>sentwicklung <strong>in</strong> Form e<strong>in</strong>es vorausblickenden und verantwortungsvollen Risikomanagement<br />
e<strong>in</strong>zuschätzen, ist dabei geboten. Für den Abschluss e<strong>in</strong>es Kreditvertrages ist e<strong>in</strong>e punktuelle Betrachtung<br />
des Z<strong>in</strong>s- und Kreditmarktes nicht ausreichend. Auch ist es grundsätzlich zulässig, Z<strong>in</strong>sderivate zur<br />
Z<strong>in</strong>sabsicherung zu nutzen. Solche F<strong>in</strong>anz<strong>in</strong>strumente dürfen allerd<strong>in</strong>gs lediglich im Rahmen des abgeschlossenen<br />
Kreditgeschäftes e<strong>in</strong>gesetzt werden. Dementsprechend s<strong>in</strong>d Geschäfte mit Derivaten, die unabhängig von<br />
Kreditgeschäften abgeschlossen werden, als spekulative Geschäfte für die Geme<strong>in</strong>den unzulässig.<br />
4.2 Das Z<strong>in</strong>srisikomanagement<br />
4.2.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Mit e<strong>in</strong>em Z<strong>in</strong>srisikomanagement können die Geme<strong>in</strong>den bei variabel verz<strong>in</strong>slichen Verb<strong>in</strong>dlichkeiten, bei auslaufenden<br />
Z<strong>in</strong>svere<strong>in</strong>barungen oder bei Umschuldungen sowie bei der Aufnahme neuer Kredite das Risiko von Z<strong>in</strong>ssteigerungen<br />
wirksam steuern, um die haushaltsmäßigen Belastungen <strong>in</strong> verträglichen Grenzen zu halten. In<br />
diesem Zusammenhang können auch Z<strong>in</strong>sderivate zum E<strong>in</strong>satz kommen, wenn bei der Geme<strong>in</strong>de ausreichend<br />
Kenntnisse über die Risiken und Chancen solcher F<strong>in</strong>anz<strong>in</strong>strumente vorliegen und e<strong>in</strong> sorgfältiger Umgang<br />
damit erfolgt. Diese Gegebenheiten stellen vielfach e<strong>in</strong>e erhebliche Herausforderung für die geme<strong>in</strong>dliche Kreditwirtschaft<br />
und die Geldanlage dar, um e<strong>in</strong>e Optimierung von Kreditkonditionen zu erreichen und Z<strong>in</strong>srisiken durch<br />
den E<strong>in</strong>satz von Z<strong>in</strong>sderivaten zu begrenzen. Generell hat die Geme<strong>in</strong>de dabei der Vorrang der Sicherheit und<br />
der Risikom<strong>in</strong>imierung zu beachten. Auch darf sie die vielfältigen Möglichkeiten der Kapitalmärkte nur <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
angemessenen und vertretbaren Umfang <strong>in</strong> Anspruch nehmen.<br />
Derivative F<strong>in</strong>anz<strong>in</strong>strumente des Kredit- und des Geldmarktes s<strong>in</strong>d dadurch gekennzeichnet, dass ihr Wert von<br />
e<strong>in</strong>er anderen Größe, z.B. e<strong>in</strong>em Preis oder Z<strong>in</strong>ssatz, abgeleitet wird. Nach § 1 Abs. 11 Nr. 2 des Kreditwesengesetzes<br />
s<strong>in</strong>d Derivate als Fest- oder Optionsgeschäfte ausgestaltete Term<strong>in</strong>geschäfte, deren Preis unmittelbar<br />
oder mittelbar von e<strong>in</strong>em Börsen- oder Marktpreis, e<strong>in</strong>em Kurs, Z<strong>in</strong>ssätzen oder anderen Erträgen abhängt. Bei<br />
Derivatgeschäften der Geme<strong>in</strong>de handelt es sich um e<strong>in</strong> schwebendes Geschäft auf Grund e<strong>in</strong>es Vertrages zwischen<br />
der Geme<strong>in</strong>de und e<strong>in</strong>em Kredit<strong>in</strong>stitut, dessen Wert i.d.R. auf Änderungen e<strong>in</strong>es Z<strong>in</strong>ssatzes aufgebaut<br />
wird, und das erst <strong>in</strong> der Zukunft, teils erst nach mehreren Jahren, erfüllt wird.<br />
Soweit die Derivate sich auf die Z<strong>in</strong>sen im Kreditgeschäft oder bei Geldanlagen beziehen, kommen sie auch bei<br />
den Geme<strong>in</strong>den zum E<strong>in</strong>satz. Sie müssen sich jedoch immer auf e<strong>in</strong> Grundgeschäft, z.B. e<strong>in</strong>en bestehenden<br />
oder e<strong>in</strong>en geplanten Kredit beziehen, um nicht unter das für die Geme<strong>in</strong>den geltende Spekulationsverbot zu<br />
fallen (vgl. § 90 GO <strong>NRW</strong>). Diese Verknüpfung muss objektiv <strong>in</strong> jedem E<strong>in</strong>zelfall <strong>in</strong> sachlicher und <strong>in</strong> zeitlicher<br />
H<strong>in</strong>sicht gegeben se<strong>in</strong>, d.h. die Derivate müssen den geme<strong>in</strong>dlichen Krediten zugeordnet werden können. Sie<br />
liegt <strong>in</strong> sachlicher H<strong>in</strong>sicht vor, wenn der Nom<strong>in</strong>albetrag und die Währung von Grundgeschäft und Derivatgeschäft<br />
identisch s<strong>in</strong>d, und <strong>in</strong> zeitlicher H<strong>in</strong>sicht, wenn die Laufzeit und Fälligkeit des Derivats die Laufzeit und<br />
Fälligkeit von geme<strong>in</strong>dlichen Krediten als Grundgeschäft nicht überschreitet. Mit dieser Abgrenzung soll neben<br />
der Risikobegrenzung die notwendige Konnexität sichergestellt werden. Auch muss gewährleistet se<strong>in</strong>, dass die<br />
GEMEINDEORDNUNG 387
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 86 GO <strong>NRW</strong><br />
Geme<strong>in</strong>den ke<strong>in</strong>e Derivatgeschäfte lediglich zur spekulativen Ertragserzielung nutzen. Sie dürfen wegen des<br />
Spekulationsverbots die Derivate auch nicht als e<strong>in</strong>zeln handelbare F<strong>in</strong>anz<strong>in</strong>strumente unter Inkaufnahme von<br />
Verlustrisiken e<strong>in</strong>setzen.<br />
Die Abschlüsse von F<strong>in</strong>anzgeschäften s<strong>in</strong>d von der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> ausreichender Weise zu dokumentieren, so<br />
dass neben den Daten des eigentlichen F<strong>in</strong>anzgeschäfts auch die vorhandene Risikosituation und die zu diesem<br />
Zeitpunkt vorhandene Marktme<strong>in</strong>ung der Geme<strong>in</strong>de für Dritte, z.B. die örtliche Rechnungsprüfung, nachvollziehbar<br />
werden. Es bietet sich daher der Aufbau e<strong>in</strong>er örtlichen Dienstanweisung für die Durchführung der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
F<strong>in</strong>anzgeschäfte an. E<strong>in</strong>e örtliche Richtl<strong>in</strong>ie sollte die zulässigen F<strong>in</strong>anz<strong>in</strong>strumente benennen, die örtliche<br />
Ziele und die Strategie für die geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzgeschäfte umfassen sowie das Risikomanagement und die<br />
Risikostreuung festlegen. Sie sollte aber auch grundlegendes über die Organisation und die Arbeitszuständigkeiten<br />
im Aufgabenbereich „<strong>F<strong>in</strong>anzmanagement</strong>“ enthalten und die Dokumentation und das Berichtswesen regeln.<br />
4.2.2 Z<strong>in</strong>soptionen<br />
Als Z<strong>in</strong>soptionen kommen daher <strong>in</strong>sbesondere Caps oder Floors zum E<strong>in</strong>satz, die es ermöglichen, die Auswirkungen<br />
von Veränderungen des Z<strong>in</strong>sniveaus über e<strong>in</strong>en vorher bestimmten Rahmen h<strong>in</strong>aus zu begrenzen. Je<br />
nach Umfang und Wirkung solcher Derivatgeschäfte muss e<strong>in</strong>e Abstimmung darüber zwischen Rat und Verwalzung<br />
erfolgen, um die Ermächtigungen zum Abschluss von Derivatgeschäften und die Verantwortlichkeiten dafür<br />
festzulegen.<br />
4.2.2.1 Caps (Z<strong>in</strong>sobergrenze)<br />
E<strong>in</strong> Cap stellt e<strong>in</strong> Z<strong>in</strong>sbegrenzungsgeschäft dar. Er wird für e<strong>in</strong>en bestimmten Zeitraum e<strong>in</strong>e Z<strong>in</strong>sobergrenze<br />
bezogen auf e<strong>in</strong>en bestimmten Betrag vere<strong>in</strong>bart. Steigt der Z<strong>in</strong>s währen der Cap-Laufzeit über die vere<strong>in</strong>barte<br />
Obergrenze, dann würde die Geme<strong>in</strong>de als Inhaber des Caps die Differenz bezogen auf den Nom<strong>in</strong>albetrag z.B.<br />
von ihrer Bank als Verkäufer erstattet bekommen. Zum Zeitpunkt des Erwerbs des Caps muss i.d.R. von der<br />
Geme<strong>in</strong>de jedoch e<strong>in</strong>e Prämie für e<strong>in</strong>e solche Z<strong>in</strong>ssicherung gezahlt werden. E<strong>in</strong> solcher Cap kann aber auch<br />
mehrere h<strong>in</strong>tere<strong>in</strong>ander liegende Optionsgeschäfte be<strong>in</strong>halten. Damit ist der CAP e<strong>in</strong> Vertrag, <strong>in</strong> dem gegen Zahlung<br />
e<strong>in</strong>er CAP-Prämie (vom Käufer an den Verkäufer) das Steigen e<strong>in</strong>es festgelegten Marktz<strong>in</strong>ssatzes, z.B. 6-<br />
Monats-EURIBOR, über e<strong>in</strong>e bestimmte Z<strong>in</strong>sobergrenze der Verkäufer dem Käufer den Differenzbetrag bezogen<br />
auf den vere<strong>in</strong>barten Kapitalbetrag erstattet.<br />
4.2.2.2 Floor (Z<strong>in</strong>suntergrenze)<br />
Von der Geme<strong>in</strong>de können auch F<strong>in</strong>anzgeschäfte zur Begrenzung von Z<strong>in</strong>ssenkungen abgeschlossen werden<br />
(Floors). Diese Geschäfte kommen i.d.R. <strong>in</strong> Betracht, wenn die Verz<strong>in</strong>sung bei F<strong>in</strong>anzgeschäften nicht unter e<strong>in</strong><br />
bestimmtes Niveau s<strong>in</strong>ken soll, z.B. bei e<strong>in</strong>er variablen Verz<strong>in</strong>sung. Der Floor entspricht spiegelbildlich dem CAP,<br />
d.h. unterschreitet der Referenzz<strong>in</strong>s die vere<strong>in</strong>barte Z<strong>in</strong>suntergrenze, so ist von der Geme<strong>in</strong>de als Floor-<br />
Verkäufer die Z<strong>in</strong>sdifferenz, bezogen auf den Nom<strong>in</strong>albetrag, für die betreffende Z<strong>in</strong>speriode nachträglich dem<br />
Käufer auszuzahlen.<br />
4.2.2.3 Collar (Z<strong>in</strong>skorridor)<br />
Bei F<strong>in</strong>anzgeschäften der Geme<strong>in</strong>de ist auch die Vere<strong>in</strong>barung e<strong>in</strong>er Komb<strong>in</strong>ation von Floors und Caps möglich,<br />
die als Collar bezeichnet wird. In diesen Fällen werden beide F<strong>in</strong>anzgeschäfte gleichzeitig abgeschlossen und es<br />
muss e<strong>in</strong>e Übere<strong>in</strong>stimmung der beiden F<strong>in</strong>anz<strong>in</strong>strumente h<strong>in</strong>sichtlich der Laufzeit, des Referenzz<strong>in</strong>ssatzes, und<br />
GEMEINDEORDNUNG 388
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 86 GO <strong>NRW</strong><br />
des Bezugsbetrages geben. Durch den Cap soll e<strong>in</strong>e Absicherung gegen steigende Z<strong>in</strong>sen erreicht und mit dem<br />
Floor an Z<strong>in</strong>ssenkungen bei variabel vere<strong>in</strong>barten Z<strong>in</strong>sen profitiert werden.<br />
4.2.3 Forward Rate Agreements (FRAs)<br />
Für die Umschuldung e<strong>in</strong>es bestehenden Festz<strong>in</strong>skredit kann die Geme<strong>in</strong>de bereits im Vorfeld e<strong>in</strong>en Z<strong>in</strong>ssatz für<br />
den zukünftigen Zeitraum vere<strong>in</strong>baren, <strong>in</strong> dem die Umschuldung erfolgen soll (Forward Rate Agreements -<br />
FRAs). Solche FRAs sichern e<strong>in</strong> Z<strong>in</strong>sniveaus ab, ersetzen aber nicht die diesem Geschäft zu Grunde liegende<br />
Kreditaufnahme. Wenn sich das Z<strong>in</strong>sniveau anders entwickelt, s<strong>in</strong>d zwischen den Vertragspartnern die vere<strong>in</strong>barten<br />
Ausgleichsleistungen zu erbr<strong>in</strong>gen.<br />
Die Geme<strong>in</strong>de erhält e<strong>in</strong>e Ausgleichsleistung, wenn das Z<strong>in</strong>sniveau über der vere<strong>in</strong>barten Z<strong>in</strong>sl<strong>in</strong>ie liegt. Sie<br />
muss dann selbst e<strong>in</strong>e Ausgleichsleistung zahlen, wenn das Z<strong>in</strong>sniveau unter der vere<strong>in</strong>barten Z<strong>in</strong>sl<strong>in</strong>ie liegt, so<br />
dass ihre Z<strong>in</strong>skosten höchstens dem vere<strong>in</strong>barten Z<strong>in</strong>sniveau entsprechen. Ggf. kann beim Abschluss e<strong>in</strong>es<br />
FRAs e<strong>in</strong>e Prämie zu zahlen se<strong>in</strong>. Damit ist das FRA e<strong>in</strong> Vertrag, <strong>in</strong> dem für e<strong>in</strong>en bestimmten Kreditbetrag auf<br />
gegenwärtiger Z<strong>in</strong>sbasis e<strong>in</strong> bestimmter Z<strong>in</strong>ssatz (FRA-Z<strong>in</strong>s), z.B. 6-Monats-EURIBOR, für e<strong>in</strong>e bestimmte Laufzeit<br />
(FRA-Periode) ab e<strong>in</strong>em festgelegten Zeitpunkt vere<strong>in</strong>bart wird.<br />
4.2.4 Z<strong>in</strong>sswaps<br />
Im Rahmen von Z<strong>in</strong>sswaps werden künftige feste und variable Z<strong>in</strong>szahlungen auf e<strong>in</strong>en nom<strong>in</strong>ellen Kreditbetrag<br />
für e<strong>in</strong>en bestimmten Zeitraum gegene<strong>in</strong>ander getauscht. Dabei muss ke<strong>in</strong> effektiver Tausch der Z<strong>in</strong>szahlungen<br />
erfolgen, wenn Ausgleichszahlungen zwischen festen und variablen Z<strong>in</strong>ssatz geleistet werden. Die variablen<br />
Z<strong>in</strong>ssätze werden i.d.R. an e<strong>in</strong>en Referenzz<strong>in</strong>ssatz geknüpft, z.B. den Euribor o.a. Dazu zwei Beispiele:<br />
- Receiver- (Empfänger-)Swaps<br />
Bei diesen Swaps s<strong>in</strong>d weiterh<strong>in</strong> die Festz<strong>in</strong>sen für den aufgenommenen Kredit zu zahlen. Zusätzlich s<strong>in</strong>d<br />
die variablen Z<strong>in</strong>sen im Z<strong>in</strong>sswap zu zahlen. Im Gegenzug erhält der Kreditnehmer den für die Laufzeit des<br />
Swaps vere<strong>in</strong>barten Festz<strong>in</strong>s (Swapsatz).<br />
- Payer-(Zahler-)Swaps<br />
Bei diesen Swaps s<strong>in</strong>d weiterh<strong>in</strong> die variablen Z<strong>in</strong>sen für den aufgenommenen Kredit zu zahlen. Zusätzlich<br />
ist für die Laufzeit des Swaps e<strong>in</strong> vere<strong>in</strong>barter Festz<strong>in</strong>s (Swapsatz) zu zahlen. Im Gegenzug erhält der Kreditnehmer<br />
die variablen Z<strong>in</strong>sen im Z<strong>in</strong>sswap.<br />
Die Geschäfte über Z<strong>in</strong>sswaps werden auf dem Kapitalmarkt <strong>in</strong> unterschiedlichen Formen angeboten. So kann<br />
ausschließlich der Tausch variabler Z<strong>in</strong>sverpflichtungen gegene<strong>in</strong>ander zum Gegenstand e<strong>in</strong>er Vere<strong>in</strong>barung<br />
gemacht werden. Auch kann e<strong>in</strong> Z<strong>in</strong>sswap mit e<strong>in</strong>em Währungsswap komb<strong>in</strong>iert se<strong>in</strong>. Die Flexibilität der Geme<strong>in</strong>de<br />
bei solchen Geschäften kann sich auch <strong>in</strong> der Höhe der Zahlungen bei Geschäftsabschluss auswirken.<br />
Zu beachten ist, dass durch diese F<strong>in</strong>anzgeschäfte ke<strong>in</strong>e Kapitalforderungen begründet werden. Beim Abschluss<br />
e<strong>in</strong>es Z<strong>in</strong>sswapgeschäftes durch die Geme<strong>in</strong>de ist im bilanziellen S<strong>in</strong>ne zudem von e<strong>in</strong>em schwebenden Geschäft<br />
auszugehen. Dieses ist wegen e<strong>in</strong>er Vermutung der Ausgeglichenheit nicht <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz<br />
anzusetzen.<br />
Beim Abschluss e<strong>in</strong>es Z<strong>in</strong>sswapgeschäftes kann es ggf. auch zu Zahlungen zwischen den Vertragspartnern<br />
kommen, z.B. Zahlung e<strong>in</strong>er Prämie. E<strong>in</strong>e bilanzielle Ansatzpflicht kann aus solchen F<strong>in</strong>anzgeschäften für die<br />
Geme<strong>in</strong>de erst entstehen, wenn auf Grund der geschlossenen Vere<strong>in</strong>barungen für die Geme<strong>in</strong>de entweder Forderungen<br />
oder Verpflichtungen begründet werden. In E<strong>in</strong>zelfällen kann beim Vorliegen der Voraussetzungen<br />
auch die Passivierung e<strong>in</strong>er Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Bilanz vorzunehmen se<strong>in</strong>. (vgl. § 36 Abs. 5 GemHVO <strong>NRW</strong>). E<strong>in</strong>e Passivierungspflicht oder auch e<strong>in</strong> Verzicht<br />
darauf entsteht jedoch nicht alle<strong>in</strong>e dadurch, dass die Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong> Z<strong>in</strong>sswapgeschäft abschließt.<br />
GEMEINDEORDNUNG 389
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 86 GO <strong>NRW</strong><br />
4.2.5 Eigenverantwortlicher E<strong>in</strong>satz von Z<strong>in</strong>ssicherungs<strong>in</strong>strumenten<br />
4.2.5.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die Geme<strong>in</strong>de entscheidet über den E<strong>in</strong>satz von Z<strong>in</strong>ssicherungs<strong>in</strong>strumenten <strong>in</strong> eigener Verantwortung. Sie kann<br />
mit diesen Instrumenten nicht die, <strong>in</strong>sbesondere aus der Kreditwirtschaft der Geme<strong>in</strong>de, bestehenden Risiken<br />
vermeiden, sondern nur e<strong>in</strong>e Optimierung dieser Risiken zur eigenen M<strong>in</strong>imierung der haushaltswirtschaftlichen<br />
Belastungen vornehmen. Auch können Derivate zunächst Aufwendungen bei der Geme<strong>in</strong>de verursachen. Die<br />
Geme<strong>in</strong>de soll daher für e<strong>in</strong> nur die aus den örtlichen Gegebenheiten heraus geeigneten Instrumente für e<strong>in</strong><br />
Z<strong>in</strong>srisikomanagement nutzen. Die allgeme<strong>in</strong> verfügbaren F<strong>in</strong>anz<strong>in</strong>strumente können vielfach im S<strong>in</strong>ne der Geme<strong>in</strong>de<br />
auch e<strong>in</strong>e Anpassung erfahren.<br />
Die Geme<strong>in</strong>de sollte e<strong>in</strong>e Modifizierung dann verlangen, wenn es aus ihrer Sicht heraus der Zielerreichung der<br />
Geme<strong>in</strong>de dient. Nur dann wird e<strong>in</strong>e geeignete Entscheidungsbasis für die Geme<strong>in</strong>de geschaffen, auf der sie e<strong>in</strong>e<br />
Gesamtstrategie aufbauen und e<strong>in</strong>e wirksame Risikosteuerung vornehmen kann. Zudem muss die haushaltsrechtlich<br />
geforderte B<strong>in</strong>dung zwischen den Kreditgrundgeschäften und den Derivaten immer erhalten bleiben.<br />
Ansonsten würden spekulative F<strong>in</strong>anz<strong>in</strong>strumente vorliegen, die dem gesetzlichen Spekulationsverbot widersprechen.<br />
4.2.5.2 Laufende Überwachung der F<strong>in</strong>anzgeschäfte<br />
Die Geme<strong>in</strong>de soll, wenn sie e<strong>in</strong> aktives Z<strong>in</strong>smanagement betreibt, e<strong>in</strong>en konkreten Handlungsrahmen h<strong>in</strong>sichtlich<br />
des Umgangs mit Z<strong>in</strong>s- und Anlagerisiken festlegen, durch den u.a. Ziele, Grundsätze, Verantwortlichkeiten<br />
und Prozesse bestimmt werden. Auch gehört dazu, zusätzlich zum Abschluss von Z<strong>in</strong>ssicherungs<strong>in</strong>strumenten<br />
und der Erfassung im doppischen Rechnungswesen der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>e ständige Überwachung und Kontrolle im<br />
Ablauf der abgeschlossenen F<strong>in</strong>anzgeschäfte sowie e<strong>in</strong>e Markbeobachtung vorzunehmen. Dabei gilt es, dies als<br />
pflichtige Aufgabe anzusehen und das Wissen der Geme<strong>in</strong>de über die Chancen und Risiken bzw. Möglichkeiten<br />
des E<strong>in</strong>satzes von haushaltsrechtlich zulässigen und vertretbaren F<strong>in</strong>anz<strong>in</strong>strumenten ständig weiter zu entwickeln.<br />
E<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>malige Information über derartige F<strong>in</strong>anzgeschäfte reicht für e<strong>in</strong>e Anwendung <strong>in</strong> der örtlichen Praxis<br />
der Geme<strong>in</strong>de nicht aus.<br />
In Anbetracht des tatsächlichen E<strong>in</strong>satzes von F<strong>in</strong>anz<strong>in</strong>strumenten sollte bei Abschluss von F<strong>in</strong>anzgeschäfte z.B.<br />
nicht nur das 4-Augen-Pr<strong>in</strong>zip zur Anwendung kommen, sondern dies muss Anlass se<strong>in</strong>, e<strong>in</strong> vielfältiges Risikomanagement<br />
aufzubauen. Wenn nicht bereits e<strong>in</strong> Konzept von der Geme<strong>in</strong>de erstellt worden ist, welche Produkte<br />
des Marktes genutzt werden dürfen, gilt es, dies ggf. nachzuholen, aber auch, das vorhandene Konzept zukünftig<br />
fortzuschreiben. Es wäre z.B. festzulegen, dass neue Produkte nur nach e<strong>in</strong>er Testphase tatsächlich zum E<strong>in</strong>satz<br />
kommen. Die wirtschaftliche Bedeutung e<strong>in</strong>es örtlichen Z<strong>in</strong>srisikomanagements ist so bedeutsam, dass dieses für<br />
jede Geme<strong>in</strong>de unerlässlich wird. E<strong>in</strong>e Optimierung der f<strong>in</strong>anzwirtschaftlichen Abläufe <strong>in</strong>nerhalb der Geme<strong>in</strong>de<br />
und mit den Geschäftspartnern kann dazu beitragen, fehlerhafte oder riskante E<strong>in</strong>sätze von Derivaten zu vermeiden,<br />
die zu erheblichen wirtschaftlichen Schäden bei der Geme<strong>in</strong>de führen können.<br />
4.2.6 Angabe der Z<strong>in</strong>ssicherungs<strong>in</strong>strumente im Anhang<br />
Im Anhang des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses sollen derivative F<strong>in</strong>anz<strong>in</strong>strumente, z.B. Z<strong>in</strong>ssicherungs<strong>in</strong>strumente,<br />
unabhängig davon, ob sie e<strong>in</strong> schwebendes Geschäft darstellen, das nicht bilanzierungsfähig ist,<br />
angegeben werden. Diese Geschäfte s<strong>in</strong>d wichtige Angaben über das haushaltswirtschaftliche Handeln der Geme<strong>in</strong>de<br />
im S<strong>in</strong>ne des § 44 Abs. 2 GemHVO <strong>NRW</strong>. Mit diesen Angaben soll e<strong>in</strong> Überblick über den Umfang der<br />
e<strong>in</strong>gesetzten F<strong>in</strong>anz<strong>in</strong>strumente gegeben werden, weil die Geschäfte der Geme<strong>in</strong>de über Z<strong>in</strong>sswaps und Währungsswaps<br />
e<strong>in</strong> schwebendes Dauerschuldverhältnis darzustellen, das zunächst nicht bilanziert wird, wenn nicht<br />
GEMEINDEORDNUNG 390
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 86 GO <strong>NRW</strong><br />
bereits bei Vertragsabschluss dafür Anschaffungskosten anfallen, z.B. wegen der Zahlung e<strong>in</strong>er Prämie oder<br />
wegen entstandener Nebenkosten.<br />
Im Anhang im geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss sollen deshalb zu derartigen Geschäften der Geme<strong>in</strong>de die Arten<br />
und der Umfang der derivativen F<strong>in</strong>anz<strong>in</strong>strumente angegeben sowie dazu die beizulegenden Werte, soweit sie<br />
bestimmt werden können, und die angewandten Bewertungsmethoden aufgeführt werden. Dabei sollen möglichst<br />
die z<strong>in</strong>sbezogenen F<strong>in</strong>anz<strong>in</strong>strumente von den währungsbezogenen Instrumenten getrennt dargestellt und dazu<br />
wegen der Beachtung des Konnexitätspr<strong>in</strong>zips die betroffenen Bilanzposten angegeben werden. Soweit Mischformen<br />
bestehen, s<strong>in</strong>d diese gesondert anzugeben.<br />
4.2.7 Unzulässigkeit spekulativer F<strong>in</strong>anzgeschäfte<br />
Der E<strong>in</strong>satz von F<strong>in</strong>anz<strong>in</strong>strumenten durch die Geme<strong>in</strong>de, <strong>in</strong>sbesondere von F<strong>in</strong>anzderivaten, ist unter Berücksichtigung<br />
des örtlichen E<strong>in</strong>zelfalles zu beurteilen. Der Abschluss derartiger F<strong>in</strong>anzgeschäfte zu spekulativen<br />
Zwecken ist grundsätzlich als unzulässig anzusehen. Das Vorliegen e<strong>in</strong>es spekulativen F<strong>in</strong>anzgeschäfts kann<br />
ggf. gegeben se<strong>in</strong>, wenn e<strong>in</strong> F<strong>in</strong>anzderivat z.B. ohne ausreichende <strong>in</strong>haltliche Abgrenzung und ohne Verlustbegrenzung<br />
abgeschlossen wird, e<strong>in</strong> nicht vorhandenes Risiko abgesichert werden soll, ausschließlich der Gew<strong>in</strong>nerzielung<br />
dient oder ke<strong>in</strong>e nachweisbare Konnexität zu e<strong>in</strong>em Kredit als Grundgeschäft besteht.<br />
Von der Geme<strong>in</strong>de muss regelmäßig sowohl beim Abschluss von F<strong>in</strong>anzgeschäften als auch während der Laufzeiten<br />
überprüft werden, ob e<strong>in</strong> unzulässiger Sachverhalt vorliegt. Die Gliederung des örtlichen Z<strong>in</strong>s- und Schuldenmanagements<br />
<strong>in</strong> getrennte eigenständige Verantwortungsbereiche, z.B. „Geschäftsabschluss“, „Überwachung<br />
und Kontrolle“ und „Gesamtleitung“, sowie die getrennt davon vorzunehmende buchungstechnische Erfassung<br />
<strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzbuchhaltung unterstützt dabei e<strong>in</strong> ordnungsgemäßes Verwaltungshandeln.<br />
5. Die Kredittilgung<br />
Die Laufzeit e<strong>in</strong>es Kredites soll sich grundsätzlich an der Lebensdauer des damit f<strong>in</strong>anzierten Investitionsobjektes<br />
orientieren. Langfristige Investitionsobjekte sollen möglichst auch durch langfristige Kredite f<strong>in</strong>anziert werden,<br />
sofern nicht e<strong>in</strong>e andere Laufzeit aus Gründen des Wirtschaftlichkeitsgebotes angezeigt ist. Der Grundsatz der<br />
Gesamtdeckung nach § 20 GemHVO <strong>NRW</strong> steht e<strong>in</strong>er solchen Orientierung nicht entgegen. Aus Gründen der<br />
Haushaltssicherung bedarf es <strong>in</strong>sbesondere bei e<strong>in</strong>er kurzfristigen, aber auch bei e<strong>in</strong>er mittelfristigen Verschuldung<br />
e<strong>in</strong>er besonders sorgfältigen Prüfung der Leistungsfähigkeit im H<strong>in</strong>blick auf den künftigen Haushaltsausgleich<br />
und den Verschuldungspielraum der Geme<strong>in</strong>de.<br />
Die jeweils bei e<strong>in</strong>er Kreditaufnahme von der Geme<strong>in</strong>de zu vere<strong>in</strong>barende Tilgung kann sich im Regelfall an den<br />
erforderlichen Abschreibungen der geme<strong>in</strong>dlichen Investitionen und an der Leistungskraft der Geme<strong>in</strong>de orientieren.<br />
Bei Bedarf sollte sich die Geme<strong>in</strong>de auch die Möglichkeit e<strong>in</strong>er außerordentlichen Tilgung e<strong>in</strong>räumen lassen,<br />
z.B. wenn für sie absehbar ist, dass ihr zu e<strong>in</strong>em späteren Zeitpunkt weitere Geldmittel zufließen, die ggf. zur<br />
Reduzierung der geme<strong>in</strong>dlichen Verschuldung <strong>in</strong>sgesamt genutzt werden können. Zwar besitzt die Geme<strong>in</strong>de aus<br />
§ 490 BGB e<strong>in</strong> außerordentliches Kündigungsrecht für die Kreditverträge, sie wäre <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em solchen Fall aber<br />
zum Ersatz des dem Kreditgeber entstehenden Schadens verpflichtet (Vorfälligkeitsentschädigung). Bei jeder<br />
e<strong>in</strong>zelnen Kreditausnahme soll die Geme<strong>in</strong>de daher abwägen und entscheiden, ob und <strong>in</strong> welchem Umfang ihr<br />
die Möglichkeit e<strong>in</strong>er vorzeitigen Tilgung von aufgenommenen Krediten e<strong>in</strong>geräumt werden soll.<br />
GEMEINDEORDNUNG 391
6. Kündigungsrechte<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 86 GO <strong>NRW</strong><br />
Die Geme<strong>in</strong>de muss bei Aufnahme von Krediten sicherstellen, dass sie nicht von Kündigungsrechten ausgeschlossen<br />
wird. Sie muss prüfen, <strong>in</strong>wieweit sie von den ihr im E<strong>in</strong>zelfall zustehenden Kündigungsrechten nach §<br />
489 BGB Gebrauch machen oder auch auf e<strong>in</strong> Kündigungsrecht verzichten will. Bei aufgenommenen Darlehen<br />
mit e<strong>in</strong>er vertraglichen Festz<strong>in</strong>speriode darf jedenfalls ke<strong>in</strong> e<strong>in</strong>seitiges Kündigungsrecht des Kreditgebers vere<strong>in</strong>bart<br />
werden. Für den Kreditgeber sollte i.d.R. e<strong>in</strong> vorzeitiges Kündigungsrecht ausgeschlossen werden. Abgesehen<br />
von Änderungskündigungen zur Neuregelung der Konditionen und für den Fall des Zahlungsverzugs oder<br />
sonstiger Vertragsverletzungen sollte der Kredit an die Geme<strong>in</strong>de für den Kreditgeber möglichst unkündbar se<strong>in</strong>.<br />
Bei z<strong>in</strong>svariablen Darlehen muss außerdem e<strong>in</strong> beiderseitiges Kündigungsrecht für den Fall e<strong>in</strong>er Anpassung des<br />
Z<strong>in</strong>ssatzes an veränderte Kapitalmarktbed<strong>in</strong>gungen auf e<strong>in</strong>en Zeitraum von drei Monaten <strong>in</strong> der vertraglichen<br />
Vere<strong>in</strong>barung beschränkt werden. Bei der Vere<strong>in</strong>barung von sog. Z<strong>in</strong>sgleitklauseln (Anb<strong>in</strong>dung der Z<strong>in</strong>ssätze an<br />
bestimmte Sätze, z.B. Diskont, Lombard oder Euribor, hat die Geme<strong>in</strong>de eigenverantwortlich e<strong>in</strong>e sorgfältige<br />
Prognose der künftigen Z<strong>in</strong>sentwicklung (Z<strong>in</strong>sme<strong>in</strong>ung) vorzunehmen und sollte sich dabei ggf. durch e<strong>in</strong>e spezialisierte<br />
Fachberatung unterstützen lassen.<br />
7. Unterrichtungspflichten des Kreditgebers<br />
In den Fällen, <strong>in</strong> denen die Geme<strong>in</strong>de im Darlehensvertrag mit dem Kreditgeber e<strong>in</strong> fester Z<strong>in</strong>ssatz vere<strong>in</strong>bart<br />
wurde und die Z<strong>in</strong>sb<strong>in</strong>dung vor der für die Tilgung bestimmten Zeit endet, besteht e<strong>in</strong>e Unterrichtungspflicht des<br />
Kreditgebers gegenüber der Geme<strong>in</strong>de als Kreditnehmer (vgl. § 492a BGB). Der Kreditgeber hat die Geme<strong>in</strong>de<br />
vor dem Ende der Z<strong>in</strong>sb<strong>in</strong>dung darüber zu <strong>in</strong>formieren, ob er zu e<strong>in</strong>er neuen Z<strong>in</strong>sb<strong>in</strong>dungsabrede bereit ist. Ist<br />
diese Möglichkeit gegeben, muss die Unterrichtung des Kreditgebers e<strong>in</strong> Angebot über den Z<strong>in</strong>ssatz enthalten.<br />
E<strong>in</strong>e Unterrichtungspflicht des Kreditgebers besteht auch vor Beendigung e<strong>in</strong>es Kreditvertrages. Der Kreditgeber<br />
hat den Kreditnehmer darüber zu unterrichten, ob er zur Fortführung des Darlehensverhältnisses bereit ist. Diese<br />
Unterrichtung muss dann die zum Zeitpunkt der Unterrichtung gültigen Pflichtangaben aus § 492 Abs. 1 S. 5 BGB<br />
enthalten.<br />
8. Bankrechtliche Kundene<strong>in</strong>stufung<br />
Bei der geme<strong>in</strong>dlichen Kreditaufnahme am Kreditmarkt ist u.a. auch das F<strong>in</strong>anzmarktrichtl<strong>in</strong>ie-Umsetzungsgesetz<br />
vom 16.07.2007 (BGBl. I S. 1330) nicht unbeachtlich. Nach diesem Gesetz s<strong>in</strong>d die Banken als Wertpapierdienstleistungsunternehmen<br />
verpflichtet, ihre Kunden, also auch die Geme<strong>in</strong>de, anhand der gesetzlich vorgegebenen<br />
Kriterien zu klassifizieren. Diese E<strong>in</strong>stufung hat Auswirkungen auf die Bankleistungen gegenüber der Geme<strong>in</strong>de,<br />
denn die Bank hat das Anlegerschutzniveau und die Grundsätze für die Ausführung von Aufträgen <strong>in</strong> F<strong>in</strong>anz<strong>in</strong>strumenten<br />
zu beachten.<br />
E<strong>in</strong> Wertpapierdienstleistungsunternehmen, das e<strong>in</strong>e Anlageberatung oder e<strong>in</strong>e F<strong>in</strong>anzportfolioverwaltung vornimmt,<br />
muss von se<strong>in</strong>em Kunden alle Informationen e<strong>in</strong>holen über Kenntnisse und Erfahrungen der Kunden <strong>in</strong><br />
Bezug auf Geschäfte mit F<strong>in</strong>anz<strong>in</strong>strumenten, über Anlageziele und ihre f<strong>in</strong>anziellen Verhältnisse, um dem Kunden<br />
das für ihn geeignete F<strong>in</strong>anz<strong>in</strong>strument empfehlen zu können. Dazu gehört, dass der Kunde auch die mit<br />
e<strong>in</strong>em solchen Geschäft verbundenen Anlagerisiken versteht. Erlangt das Wertpapierdienstleistungsunternehmen<br />
nicht die erforderlichen Informationen, darf es im Zusammenhang mit e<strong>in</strong>er Anlageberatung ke<strong>in</strong> F<strong>in</strong>anz<strong>in</strong>strument<br />
empfehlen oder im Zusammenhang mit e<strong>in</strong>er F<strong>in</strong>anzportfolioverwaltung ke<strong>in</strong>e Empfehlung abgeben (vgl. die<br />
E<strong>in</strong>zelvorschriften des o.a. Gesetzes).<br />
Die Bundesanstalt für F<strong>in</strong>anzdienstleistungsaufsicht hat <strong>in</strong> ihrem Schreiben vom 25.06.2010 gegenüber den Verbänden<br />
der für F<strong>in</strong>anzdienstleistungsunternehmen und der Kreditwirtschaft klargestellt, dass e<strong>in</strong>e Geme<strong>in</strong>de als<br />
GEMEINDEORDNUNG 392
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 86 GO <strong>NRW</strong><br />
Privatkunde im S<strong>in</strong>ne des § 31a Abs. 3 WpHG des Wertpapierhandelsgesetzes anzusehen ist und nicht als professioneller<br />
Kunde zu gelten hat. Das Ergebnis e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen „Privatkunden-Auftrages“ muss sich zudem<br />
am Preis und an den Kosten des F<strong>in</strong>anz<strong>in</strong>strumentes orientieren (vgl. § 33a Abs. 3 WpHG). Außerdem besteht<br />
die Pflicht e<strong>in</strong>es Wertpapierdienstleistungsunternehmens gegenüber der Geme<strong>in</strong>de, diese ggf. auch über mögliche<br />
Probleme zur Ausführung der geme<strong>in</strong>dlichen Aufträge unter Anwendung der Grundsätze der bestmöglichen<br />
Ausführung zu unterrichten. Die Geme<strong>in</strong>de hat die Möglichkeit sich auch als professioneller Kunde e<strong>in</strong>stufen zu<br />
lassen (vgl. Abbildung).<br />
E<strong>in</strong>stufung der Geme<strong>in</strong>de als professioneller Kunde<br />
Die E<strong>in</strong>stufung e<strong>in</strong>es Privatkunden als professioneller Kunde nach § 31a Abs. 7 Satz 1 erste Alternative des<br />
Wertpapierhandelsgesetzes darf jedoch nur erfolgen, wenn der Kunde<br />
E<strong>in</strong>stufung<br />
als<br />
professioneller<br />
Kunde<br />
1. gegenüber dem Wertpapierdienstleistungsunternehmen zum<strong>in</strong>dest <strong>in</strong> Textform<br />
beantragt hat, generell oder für e<strong>in</strong>e bestimmte Art von Geschäften,<br />
F<strong>in</strong>anz<strong>in</strong>strumenten oder Wertpapierdienstleistungen oder für e<strong>in</strong> bestimmtes<br />
Geschäft oder für e<strong>in</strong>e bestimmte Wertpapierdienstleistung als professioneller<br />
Kunde e<strong>in</strong>gestuft zu werden,<br />
2. vom Wertpapierdienstleistungsunternehmen auf e<strong>in</strong>em dauerhaften Datenträger<br />
e<strong>in</strong>deutig auf die rechtlichen Folgen der E<strong>in</strong>stufungsänderung h<strong>in</strong>gewiesen<br />
worden ist,<br />
3. se<strong>in</strong>e Kenntnisnahme der nach Nummer 2 gegebenen H<strong>in</strong>weise <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
gesonderten Dokument bestätigt hat.<br />
Beabsichtigt das Wertpapierdienstleistungsunternehmen, e<strong>in</strong>en Kunden nach § 31a Abs. 7 Satz 1 zweite Alternative<br />
des Wertpapierhandelsgesetzes als professionellen Kunden e<strong>in</strong>zustufen, gilt Satz 1 entsprechend mit der<br />
Maßgabe, dass der Kunde se<strong>in</strong> E<strong>in</strong>verständnis zum<strong>in</strong>dest <strong>in</strong> Textform erklären muss.<br />
Abbildung 59 „E<strong>in</strong>stufung der Geme<strong>in</strong>de als professioneller Kunde“<br />
In den Fällen der E<strong>in</strong>stufung der Geme<strong>in</strong>de als professioneller Kunde und nicht mehr als Privatkunde muss das<br />
Wertpapierdienstleistungsunternehmen die Geme<strong>in</strong>de schriftlich darauf h<strong>in</strong>weisen, dass mit der Änderung dieser<br />
E<strong>in</strong>stufung auch die Schutzvorschriften für Privatkunden nicht mehr gelten. Die Geme<strong>in</strong>de muss dazu ihr E<strong>in</strong>verständnis<br />
geben und diese Sachlage schriftlich bestätigen. Die E<strong>in</strong>stufung der Geme<strong>in</strong>de als professioneller Kunde<br />
steht e<strong>in</strong>er späteren Rückstufung zum Privatkunden gem. § 31a Abs. 6 WpHG, soweit dieses von der Geme<strong>in</strong>de<br />
verlangt wird, nicht entgegen.<br />
9. Verbot des Betreibens von Bankgeschäften<br />
Im Zusammenhang mit den geme<strong>in</strong>dlichen Kreditgeschäften nach dieser Vorschrift ist auch das Verbot <strong>in</strong> § 107<br />
Abs. 6 GO <strong>NRW</strong> zu beachten, nach dem die Geme<strong>in</strong>de ke<strong>in</strong> Bankunternehmen errichten, übernehmen oder betreiben<br />
darf. Der Geme<strong>in</strong>den ist durch § 107 Abs. 7 GO <strong>NRW</strong> gestattet worden, e<strong>in</strong>e Sparkasse zu errichten und<br />
zu betreiben. Für diese öffentlich-rechtlichen Anstalten gelten dann besondere Vorschriften, die im Sparkassengesetz<br />
Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen verankert s<strong>in</strong>d. Die Regelung <strong>in</strong> § 107 Abs. 6 GO <strong>NRW</strong> schließt dabei das generelle<br />
Verbot zum Betreiben von Bankgeschäften im S<strong>in</strong>ne des § 1 Abs. 1 des Kreditwesengesetzes (KWG) e<strong>in</strong>.<br />
Für die Abwicklung von Bankgeschäften bedarf es nicht zw<strong>in</strong>gend e<strong>in</strong>es Unternehmens, denn Bank- und F<strong>in</strong>anzdienstleistungsgeschäfte<br />
werden, auch wenn der Umfang dieser Geschäfte objektiv ke<strong>in</strong>en <strong>in</strong> kaufmännischer<br />
Weise e<strong>in</strong>gerichteten Geschäftsbetrieb erfordert, bereits dann gewerbsmäßig betrieben, wenn der geme<strong>in</strong>dliche<br />
Betrieb auf e<strong>in</strong>e gewisse Dauer angelegt ist und die Geme<strong>in</strong>de ihn mit der Absicht der Gew<strong>in</strong>nerzielung verfolgt.<br />
GEMEINDEORDNUNG 393
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 86 GO <strong>NRW</strong><br />
E<strong>in</strong>e Gew<strong>in</strong>nerzielungsabsicht ist auch dann gegeben anzunehmen, wenn durch e<strong>in</strong> Geschäft höhere Z<strong>in</strong>sen bei<br />
Kredit<strong>in</strong>stituten erspart werden sollen. E<strong>in</strong>e Beurteilung geme<strong>in</strong>dlicher Bankgeschäfte im S<strong>in</strong>ne des § 1 Abs. 1<br />
KWG bedarf regelmäßig der Kenntnisse im E<strong>in</strong>zelfall, denn beim Betreiben mehrerer Bank- oder F<strong>in</strong>anzdienstleistungsgeschäfte<br />
durch die Geme<strong>in</strong>de kann sich e<strong>in</strong> bankrechtlicher Geschäftsbetrieb der Geme<strong>in</strong>de bereits<br />
auch bei e<strong>in</strong>em vergleichsweise ger<strong>in</strong>gen Umfang ergeben.<br />
10. Kreditaufnahme und geme<strong>in</strong>dlicher Haushalt<br />
10.1 Kreditaufnahme und Haushaltssatzung<br />
Die vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen der Geme<strong>in</strong>de s<strong>in</strong>d mit ihrem Gesamtbetrag <strong>in</strong> der Haushaltssatzung<br />
festzusetzen (vgl. § 78 Abs. 2 Nr. 1 c) GO <strong>NRW</strong>). Diese besondere Festsetzung <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltssatzung (Kreditermächtigung) ist erforderlich, weil die Festsetzung des Gesamtbetrages der E<strong>in</strong>zahlungen<br />
und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus der F<strong>in</strong>anzierungstätigkeit des Haushaltsjahres<br />
alle<strong>in</strong> als nicht ausreichend zu bewerten ist. Es ist vielmehr notwendig, auch den Umfang des für die Anschaffung<br />
von Vermögensgegenständen der Geme<strong>in</strong>de aufzunehmenden Fremdkapitals gesondert beurteilen zu können,<br />
auch wenn bereits die voraussichtlichen E<strong>in</strong>zahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten nach § 86<br />
GO <strong>NRW</strong> im F<strong>in</strong>anzplan enthalten s<strong>in</strong>d. Diese Veranschlagung bedeutet ke<strong>in</strong>e Doppelerfassung der Investitionskredite<br />
<strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung im S<strong>in</strong>ne der Ermächtigungen zur Ausführung der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltswirtschaft.<br />
Durch die besondere Satzungsregelung wird vielmehr verdeutlicht, dass die <strong>in</strong> der Rangfolge der zu beschaffenden<br />
F<strong>in</strong>anzmittel vor den Investitionskrediten liegenden F<strong>in</strong>anzmittel nicht ausreichen, um die kommunalen Aufgaben<br />
im betreffenden Haushaltsjahr <strong>in</strong> ausreichendem Maße zu erfüllen. Diese satzungsmäßige Festsetzung für<br />
Investitionskredite darf zudem nur den Bedarf für die Aufgabenerfüllung be<strong>in</strong>halten, für die E<strong>in</strong>zahlungen und<br />
Auszahlungen im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan veranschlagt worden s<strong>in</strong>d, nicht jedoch den Bedarf, der möglicherweise<br />
bei den kommunalen Betrieben besteht. Außerdem ist mit der Festsetzung der Kreditermächtigung<br />
nicht unmittelbar e<strong>in</strong>e Ermächtigung zur Aufnahme der e<strong>in</strong>zelnen Kredite verbunden. Außerdem umfasst die<br />
Kreditermächtigung für Investitionen der Geme<strong>in</strong>de nicht die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung, für<br />
die <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung an anderer Stelle gesondert e<strong>in</strong> Höchstbetrag festzusetzen ist.<br />
10.2 Kreditaufnahme und F<strong>in</strong>anzplan<br />
Im geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzplan werden <strong>in</strong> der Gruppe „E<strong>in</strong>zahlungen und Auszahlungen aus F<strong>in</strong>anzierungstätigkeit“<br />
vorrangig die E<strong>in</strong>zahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen nach § 86 GO <strong>NRW</strong> sowie die<br />
Auszahlungen für deren Tilgung getrennt vone<strong>in</strong>ander ausgewiesen, weil deren Jahressummen <strong>in</strong> der F<strong>in</strong>anzrechnung<br />
die betreffenden Passivposten <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz verändern (vgl. § 41 Abs. 3 Nr. 4.2 GemH-<br />
VO <strong>NRW</strong>). Auch die Gewährung von Darlehen im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Geme<strong>in</strong>de und die daraus<br />
entstehenden Rückflüsse s<strong>in</strong>d grundsätzlich unter der F<strong>in</strong>anzierungstätigkeit der Geme<strong>in</strong>de zu erfassen, auch<br />
wenn dafür <strong>in</strong> der Vorschrift ke<strong>in</strong>e gesonderte Haushaltsposition gefordert wird.<br />
Von der Geme<strong>in</strong>de ist örtlich abzuschätzen und zu entscheiden, ob für die Gewährung von Darlehen und ggf. ab<br />
welchem Volumen e<strong>in</strong>e gesonderte Haushaltsposition dafür im F<strong>in</strong>anzplan ausgewiesen wird. Es besteht aber<br />
auch die Möglichkeit, die <strong>in</strong> der Vorschrift vorgesehene Haushaltsposition entsprechend zu erweitern und zu<br />
bezeichnen, denn das Muster für den geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzplan ist nicht für verb<strong>in</strong>dlich erklärt, sondern nur zur<br />
Anwendung empfohlen worden (vgl. Nr. 1.2.2 des Runderlasses des Innenm<strong>in</strong>isteriums vom 24.02.2005, SMBl.<br />
<strong>NRW</strong>. 6300).<br />
GEMEINDEORDNUNG 394
10.3 Kreditaufnahme und Ergebnisplan<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 86 GO <strong>NRW</strong><br />
Die Aufnahme und die Rückzahlung von geme<strong>in</strong>dlichen Krediten nach dieser Vorschrift ist nicht Gegenstand der<br />
Veranschlagung im jährlichen Ergebnisplan der Geme<strong>in</strong>de. Die damit verbundenen E<strong>in</strong>zahlungen und Auszahlungen<br />
stellen ke<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>dlichen Erträge und Aufwendungen dar, die wirtschaftlich den Haushaltsjahren zuzurechnen<br />
wären, <strong>in</strong> denen sie entstehen (vgl. § 11 GemHVO <strong>NRW</strong>). Zudem berühren die Aufnahme von Krediten<br />
und deren Tilgung unmittelbar den Umfang der Verb<strong>in</strong>dlichkeiten der Geme<strong>in</strong>de, so dass die entsprechenden<br />
Beträge ke<strong>in</strong>e Erträge und Aufwendungen darstellen, die im Ergebnisplan der Geme<strong>in</strong>de zu veranschlagen wären.<br />
Dieses gilt allerd<strong>in</strong>gs nicht für die aus der Aufnahme der Kredite von der Geme<strong>in</strong>de zu zahlenden Z<strong>in</strong>sen und<br />
den Kreditbeschaffungskosten (vgl. § 2 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
10.4 Kreditaufnahme und vorläufige Haushaltsführung<br />
In der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung der Geme<strong>in</strong>de kommen für e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>dliche Kreditaufnahme nicht<br />
nur die Vorschriften des § 86 GO <strong>NRW</strong> zur Anwendung, sondern es s<strong>in</strong>d auch die besonderen Vorgaben des §<br />
82 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> zu beachten. Nach dieser Vorschrift darf die Geme<strong>in</strong>de nur mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde<br />
Kredite für Investitionen bis zu e<strong>in</strong>em Viertel des Gesamtbetrages der <strong>in</strong> der Haushaltssatzung des Vorjahres<br />
festgesetzten Kredite aufnehmen, wenn ihre F<strong>in</strong>anzmittel für die Fortsetzung der Bauten, der Beschaffungen<br />
und der sonstigen Leistungen des F<strong>in</strong>anzplans nicht ausreichen. In diesen Fällen hat dann die Geme<strong>in</strong>de bei<br />
ihrer Aufsichtsbehörde e<strong>in</strong>en Antrag auf Genehmigung der vorgesehenen Kreditaufnahmen e<strong>in</strong>e nach Dr<strong>in</strong>glichkeit<br />
geordnete Aufstellung der vorgesehenen unaufschiebbaren Investitionen beizufügen. Die Geme<strong>in</strong>de hat<br />
dabei bereits vor der Antragstellung zu prüfen, ob ihre Kreditverpflichtungen <strong>in</strong>sgesamt (alt und neu) mit ihrer<br />
dauernden Leistungsfähigkeit <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang stehen.<br />
Die Vorschrift des § 82 GO <strong>NRW</strong> ermöglicht den Geme<strong>in</strong>den <strong>in</strong> den Fällen, <strong>in</strong> denen die F<strong>in</strong>anzmittel für die Fortsetzung<br />
der Bauten, der Beschaffungen und der sonstigen Leistungen des F<strong>in</strong>anzplans nach Absatz 1 Nr. 1 nicht<br />
ausreichen, bis zu e<strong>in</strong>em Viertel des Gesamtbetrages der <strong>in</strong> der Haushaltssatzung des Vorjahres festgesetzten<br />
Kredite für Investitionen aufzunehmen. Die Bedarfsermittlung vor der Aufnahme von Krediten hat die Geme<strong>in</strong>de<br />
unter Beachtung des § 77 GO <strong>NRW</strong> vorzunehmen. Zu beachten ist <strong>in</strong> diesem Zusammenhang, dass die Ermächtigungen<br />
für die Kreditaufnahme nach § 86 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> und die Verpflichtungsermächtigungen aus der<br />
Haushaltssatzung des abgelaufenen Haushaltsjahres bis zum Erlass der neuen Haushaltssatzung weiter gelten,<br />
jedoch nur <strong>in</strong> dem Umfang, der im abgelaufenen Haushaltsjahr noch nicht durch Ermächtigungen <strong>in</strong> Anspruch<br />
genommen worden ist.<br />
11. Bilanzielle Behandlung von Krediten als Verb<strong>in</strong>dlichkeiten<br />
11.1 Vorliegen von Verb<strong>in</strong>dlichkeiten<br />
E<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>dliche Verb<strong>in</strong>dlichkeit liegt z.B. immer dann vor, wenn für die Geme<strong>in</strong>de gegenüber e<strong>in</strong>em Dritten zu<br />
e<strong>in</strong>er Leistungserbr<strong>in</strong>gung auf Grund e<strong>in</strong>es aufgenommenen Kredites für Investitionen besteht. Die Verb<strong>in</strong>dlichkeit<br />
bezieht sich <strong>in</strong> diesem Fall auf Geldleistungen seitens der Geme<strong>in</strong>de, bei denen die Zahlungsverpflichtung<br />
durch Vertrag h<strong>in</strong>reichend konkret bestimmt se<strong>in</strong> muss. Während der Vertragslaufzeit besteht dann zum jeweiligen<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Abschlussstichtag noch e<strong>in</strong>e rechtliche Außenverpflichtung, die noch nicht oder noch nicht<br />
vollständig erfüllt wurde und die vor dem Abschlussstichtag wirtschaftlich entstanden ist. E<strong>in</strong>e wirtschaftliche<br />
Belastung ist dabei deshalb gegeben, weil die Geme<strong>in</strong>de sicher von e<strong>in</strong>er Verm<strong>in</strong>derung ihres Vermögens ausgehen<br />
kann. Quantifizierbar ist e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>dliche Verb<strong>in</strong>dlichkeit aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen,<br />
weil diese Verb<strong>in</strong>dlichkeit zum Abschlussstichtag der Höhe nach konkret benannt werden kann, z.B. durch<br />
den Rückzahlungsbetrag bzw. der Erfüllungsbetrag (vgl. § 91 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>).<br />
GEMEINDEORDNUNG 395
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 86 GO <strong>NRW</strong><br />
Aus den von der Geme<strong>in</strong>de aufgenommenen Krediten kann sich ggf. e<strong>in</strong>e Differenz zwischen dem Rückzahlungsbetrag<br />
und dem Auszahlungsbetrag bestehen, z.B. durch e<strong>in</strong> Disagio. In den Fällen der geme<strong>in</strong>dlichen Kreditaufnahme<br />
für Investitionen, <strong>in</strong> denen der vere<strong>in</strong>barte Rückzahlungsbetrag höher ist als der erhaltene Auszahlungsbetrag,<br />
darf der Unterschiedsbetrag <strong>in</strong> den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aufgenommen werden.<br />
Dieser Betrag ist dann durch planmäßige jährliche Abschreibungen, die auf die gesamte Laufzeit der Verb<strong>in</strong>dlichkeit<br />
verteilt werden können, aufzulösen (vgl. § 42 Abs. 2 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
11.2 Bilanzausweis von Verb<strong>in</strong>dlichkeiten<br />
Die Verb<strong>in</strong>dlichkeiten der Geme<strong>in</strong>de entstehen aus den geme<strong>in</strong>dlichen Geschäftsbeziehungen mit Dritten, z.B.<br />
aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen. In diesen Fällen werden z.B. durch die Ausgabe von Schuldverschreibungen<br />
(Kommunalobligationen) die Rechte der Gläubiger verbrieft und es entstehen <strong>in</strong> deren Umfang zu<br />
erfüllende Verb<strong>in</strong>dlichkeiten für die Geme<strong>in</strong>de. Der Ansatz der Verb<strong>in</strong>dlichkeiten der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Bilanz orientiert sich im Wesentlichen an den möglichen Arten von Verb<strong>in</strong>dlichkeiten. Insbesondere bei den<br />
von der Geme<strong>in</strong>de aufgenommenen Krediten für Investitionen wird e<strong>in</strong>e weitere Untergliederung nach Gläubigern<br />
verlangt.<br />
11.3 Ausbuchen von Verb<strong>in</strong>dlichkeiten<br />
Die Verb<strong>in</strong>dlichkeiten der Geme<strong>in</strong>de, die aus den geme<strong>in</strong>dlichen Geschäftsbeziehungen mit Dritten entstanden<br />
und <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz, z.B. als Verb<strong>in</strong>dlichkeiten aus Krediten für Investitionen., angesetzt werden, s<strong>in</strong>d<br />
von der Geme<strong>in</strong>de auszubuchen, wenn sie erloschen s<strong>in</strong>d. Die Ausbuchung ist dabei nicht von der Art der Beendigung<br />
e<strong>in</strong>er geme<strong>in</strong>dlichen Verb<strong>in</strong>dlichkeit abhängig, jedoch der Zeitpunkt der Ausbuchung. Die geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Verb<strong>in</strong>dlichkeiten erlöschen regelmäßig durch Erfüllung, d.h. die Geme<strong>in</strong>de ist ihrer Rückzahlungsverpflichtung<br />
nachgekommen (vgl. § 362 BGB). Bei der Geme<strong>in</strong>de kann e<strong>in</strong>e bestehende Verb<strong>in</strong>dlichkeit auch durch Aufrechnung<br />
erlöschen, wenn z.B. vertraglich vere<strong>in</strong>bart wurde, dass bei gegenseitig gleichartigen Leistungen jeder Vertragspartner<br />
e<strong>in</strong>seitig se<strong>in</strong>e Forderung gegen die Forderung des Anderen aufrechnen darf, sofern die eigene<br />
Forderung voll wirksam, e<strong>in</strong>redefrei und fällig ist (vgl. § 387 BGB). Das Ausbuchen von Verb<strong>in</strong>dlichkeiten kann <strong>in</strong><br />
E<strong>in</strong>zelfällen aber auch durch e<strong>in</strong>e Schuldumwandlung oder durch e<strong>in</strong>en Erlass, bei dem der Gläubiger auf se<strong>in</strong>e<br />
Forderung verzichtet, zum Tragen kommen.<br />
12. Schriftform bei der Abgabe von Erklärungen<br />
Die Aufnahme von Krediten für Investitionen durch schuldrechtliche Verträge stellen geme<strong>in</strong>dliche Verpflichtungserklärungen<br />
dar und bedürfen daher der Schriftform (vgl. § 64 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>). Mit dieser gesetzlichen<br />
Vorgabe wird der Zweck verfolgt, die Geme<strong>in</strong>de vor übereilten Erklärungen zu schützen. Sie soll sich außerdem<br />
Klarheit über den Inhalt der neuen Verpflichtung verschaffen und die <strong>in</strong>terne Entscheidungszuständigkeit klären.<br />
Die geme<strong>in</strong>dlichen Erklärungen, durch welche die Geme<strong>in</strong>de verpflichtet werden soll, s<strong>in</strong>d zudem i.d.R. vom Bürgermeister<br />
oder dem allgeme<strong>in</strong>en Vertreter und e<strong>in</strong>em vertretungsberechtigten Bediensteten zu unterzeichnen,<br />
soweit es sich nicht um e<strong>in</strong> Geschäft der laufenden Verwaltung handelt. Dabei ist zu beachten, dass Erklärungen<br />
der Geme<strong>in</strong>de, die nicht den Formvorschriften der Geme<strong>in</strong>deordnung entsprechen, nicht die Geme<strong>in</strong>de b<strong>in</strong>den.<br />
13. Nichtigkeit von geme<strong>in</strong>dlichen Rechtsgeschäften<br />
In e<strong>in</strong>em unmittelbaren Zusammenhang mit der geme<strong>in</strong>dlichen Vorschrift über das Verbot der Bestellung von<br />
Sicherheiten für e<strong>in</strong>en geme<strong>in</strong>dlichen Kredit steht die Vorschrift des § 130 GO <strong>NRW</strong> über unwirksame Rechtsgeschäfte<br />
der Geme<strong>in</strong>de. Nach Absatz 1 dieser besonderen Vorschrift s<strong>in</strong>d die Rechtsgeschäfte der Geme<strong>in</strong>de, die<br />
GEMEINDEORDNUNG 396
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 86 GO <strong>NRW</strong><br />
von ihr ohne die auf Grund von Vorschriften der Geme<strong>in</strong>deordnung erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde<br />
abgeschlossen werden, unwirksam. So würden z.B. privatrechtliche Darlehensverträge, die e<strong>in</strong>er Genehmigung<br />
der Aufsichtsbehörde bedürften, bis zur Erteilung der Genehmigung schwebend unwirksam se<strong>in</strong> und bei<br />
e<strong>in</strong>er Ablehnung der Genehmigung sogar endgültig unwirksam.<br />
In Absatz 2 der Vorschrift wird weiter ausdrücklich bestimmt, dass geme<strong>in</strong>dliche Rechtsgeschäfte, die gegen das<br />
Verbot der Bestellung von Sicherheiten für geme<strong>in</strong>dliche Kredite nach § 86 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong> verstoßen, schuldrechtlich<br />
und d<strong>in</strong>glich nichtig s<strong>in</strong>d. Aus der Nennung von bestimmten geme<strong>in</strong>dlichen Sachverhalten <strong>in</strong> der Vorschrift<br />
kann zudem abgeleitet werden, dass bei geme<strong>in</strong>dlichen Rechtsgeschäften die Verletzung anderer geme<strong>in</strong>derechtlicher<br />
Vorschriften nicht zur Nichtigkeit des Rechtsgeschäftes führt. Diese Vorschrift dient auch dem<br />
Schutz des geme<strong>in</strong>dlichen Vermögens im Rahmen der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft.<br />
II. Erläuterungen im E<strong>in</strong>zelnen<br />
1. Zu Absatz 1 (Kreditaufnahmen und Leistungsfähigkeit):<br />
1.1 Zu Satz 1 (Kredite für Investitionen und zur Umschuldung):<br />
1.1.1 Kreditaufnahmen für Investitionen<br />
1.1.1.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die Geme<strong>in</strong>de hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben<br />
gesichert ist. Außerdem ist die Haushaltswirtschaft wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Die Aufgabenerfüllung<br />
der Geme<strong>in</strong>de ist daher wesentlich mitbestimmend für die Kreditaufnahme für Investitionen. Für die<br />
F<strong>in</strong>anzierung kommunaler Investitionen s<strong>in</strong>d daher besondere Maßstäbe anzulegen, so dass bei der Aufnahme<br />
von Krediten für Investitionen formelle Voraussetzungen, z.B. die Kreditermächtigung <strong>in</strong> der Haushaltssatzung<br />
nach § 78 Abs. 2 Nr. 1c) GO <strong>NRW</strong>, und materielle haushaltswirtschaftliche Voraussetzungen, z.B. die Subsidiarität<br />
der Kreditaufnahme nach § 77 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong>, erfüllt se<strong>in</strong> müssen.<br />
Die Geme<strong>in</strong>de hat daher vor der Annahme von Kreditangeboten zur F<strong>in</strong>anzierung von Investitionen zu prüfen,<br />
welches Angebot ihren f<strong>in</strong>anzwirtschaftlichen Belangen am ehesten entspricht. Auch unterliegt jede Kreditaufnahme<br />
der Geme<strong>in</strong>de den Voraussetzungen des § 77 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong>. Der <strong>in</strong> dieser Vorschrift enthaltene<br />
Grundsatz der Subsidiarität der Kreditaufnahme gegenüber anderen F<strong>in</strong>anzierungsmöglichkeiten wird durch<br />
zulässige Wirtschaftlichkeitsbewertungen modifiziert. Daher darf die Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>en Kredit nur zur Deckung<br />
e<strong>in</strong>es gegenwärtigen Bedarfs im Rahmen der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgabenerfüllung aufnehmen. Die Kredite für Geme<strong>in</strong>den<br />
für Investitionen <strong>in</strong> Form des Kommunalkredits stellen ke<strong>in</strong>e eigenständige Kreditform dar, vielmehr<br />
unterliegen sie den Formen der Kredite aus der allgeme<strong>in</strong>en Geldwirtschaft.<br />
Der Begriff des Kredites ist daher von dort übernommen worden und entspricht dem Darlehensbegriff nach §§<br />
488 BGB. Er umfasst daher für die Geme<strong>in</strong>den nur Geldschulden und nicht darlehensweise empfangene Sachen<br />
(vgl. §§ 607 ff. BGB). Die geme<strong>in</strong>dlichen Kredite werden im Rahmen privatrechtlicher Rechtsgeschäfte, z.B. als<br />
Schuldsche<strong>in</strong>darlehen, Anleihen u.a., aufgenommen. Sie können daher nach ihren Arten, nach Kreditgebern,<br />
nach ihrer Laufzeit, nach ihrer Rückzahlung oder nach ihrer Herkunft (Inland oder Ausland) sowie nach ihrer Ausgabe<br />
<strong>in</strong> Euro oder <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Fremdwährung) unterschieden werden. So wird z.B. bei e<strong>in</strong>em Festbetragskredit der<br />
Kreditbetrag am Ende der Laufzeit <strong>in</strong>sgesamt <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Betrag fällig, bei e<strong>in</strong>em Ratenkredit s<strong>in</strong>d jährlich gleiche<br />
Tilgungsraten zu zahlen, bei Annuitätenkredit bleibt die Jahresleistung für den Kredit <strong>in</strong>sgesamt gleich, so dass<br />
ersparte Z<strong>in</strong>sen die Tilgungsleistungen erhöhen. Die Geme<strong>in</strong>de hat ihre aufgenommenen Kredite <strong>in</strong> ihrer Bilanz<br />
differenziert anzusetzen, so dass die Kredite für Investitionen getrennt nach den Kreditgebern, z.B. dem privaten<br />
Kreditmarkt, dem öffentlichen Bereich und den eigenen Organisationse<strong>in</strong>heiten angesetzt werden (vgl. § 41 Abs.<br />
GEMEINDEORDNUNG 397
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 86 GO <strong>NRW</strong><br />
4 GemHVO <strong>NRW</strong>). E<strong>in</strong> Ausweis der Kredite für Investitionen ist auch entsprechend im Verb<strong>in</strong>dlichkeitenspiegel<br />
nach § 47 GemHVO <strong>NRW</strong> vorzunehmen.<br />
1.1.1.2 Der Begriff „Investitionstätigkeit“<br />
Als geme<strong>in</strong>dliche „Investitionstätigkeit“ wird die Anlage von F<strong>in</strong>anzmitteln der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> materielle und immaterielle<br />
Wirtschaftsgüter bezeichnet, die für die Geme<strong>in</strong>de von Nutzen s<strong>in</strong>d. Die dazu notwendigen Geldmittel dürfen<br />
daher nur zur Gestaltung der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgabenerfüllung e<strong>in</strong>gesetzt werden. Für die Zuordnung von E<strong>in</strong>zahlungen<br />
und Auszahlungen zur Investitionstätigkeit kommt es deshalb darauf an, ob die Zahlungsströme vermögenswirksam<br />
s<strong>in</strong>d, d.h. der Veränderung des Vermögens durch Anschaffungen oder Veräußerungen von<br />
Vermögenswerten dienen. Die Zahlungen müssen zudem dazu bestimmt se<strong>in</strong>, der Aufgabenerfüllung der Geme<strong>in</strong>de<br />
zu dienen.<br />
Unter diese Vorgaben fallen der Erwerb und die Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens und von<br />
sonstigen f<strong>in</strong>anziellen Vermögenswerten, z.B. die Anlage von vorhandenen F<strong>in</strong>anzmittelbeständen (ke<strong>in</strong>e Kreditaufnahme<br />
für e<strong>in</strong>e Geldanlage) <strong>in</strong> Wertpapieren oder auch von Grundstücken, die wegen e<strong>in</strong>er beabsichtigten<br />
kurzfristigen Veräußerung <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz im Umlaufvermögen anzusetzen s<strong>in</strong>d. Die Bilanzierung<br />
von geme<strong>in</strong>dlichen Vermögensgegenständen ist alle<strong>in</strong> nicht ausschlaggebend dafür, ob die Anschaffung oder<br />
Herstellung e<strong>in</strong>es Vermögensgegenstandes für die Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>e Investition darstellt, denn der Begriff „Investition“<br />
ist vorrangig auf den haushaltsrechtlichen F<strong>in</strong>anzierungsvorgang ausgerichtet.<br />
Bei der Veranschlagung von Auszahlungen für Investitionen ist zudem darauf zu achten, dass diese als Herstellungskosten<br />
oder Anschaffungskosten nach § 33 Abs. 2 und 3 GemHVO <strong>NRW</strong> zu bewerten s<strong>in</strong>d und daher zu<br />
e<strong>in</strong>em <strong>in</strong> der Bilanz aktivierbaren Vermögensgegenstand führen. Nur <strong>in</strong> diesen Fällen dürfen die Zahlungen im<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan der Investitionstätigkeit zugeordnet werden. Wird dagegen ke<strong>in</strong> neues Sachvermögen<br />
geschaffen, s<strong>in</strong>d die erbrachten Leistungen vielmehr als „Erhaltungsaufwand bzw. als Unterhaltungsaufwand“<br />
zu qualifizieren. Die Auszahlungen dafür dürfen dann nicht mit Krediten für Investitionen f<strong>in</strong>anziert werden, sondern<br />
stellen Aufwendungen dar, die im Ergebnisplan zu veranschlagen s<strong>in</strong>d.<br />
1.1.1.3 Aktivierte Eigenleistungen der Geme<strong>in</strong>de<br />
Wenn die Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> E<strong>in</strong>zelfällen die Planung, Bauleitung oder sonstige Maßnahmen e<strong>in</strong>er konkreten Investitionsmaßnahme<br />
durch eigenes Personal oder durch Hilfsbetriebe der Geme<strong>in</strong>de, z.B. Bauhof, Fuhrpark u.a., erbr<strong>in</strong>gen<br />
lässt, dürfen die dadurch entstandenen Aufwendungen der Investitionsmaßnahme zugerechnet werden.<br />
Dies geschieht <strong>in</strong> der Ergebnisrechnung dadurch, dass den für e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>zelne konkrete Investitionsmaßnahme<br />
entstandenen Aufwendungen <strong>in</strong> entsprechender Höhe Erträge unter der Position „Aktivierte Eigenleistungen“<br />
gegenüber gestellt werden. Die Zurechnung verändert daher nicht die bei der Geme<strong>in</strong>de tatsächlich entstandenen<br />
Aufwendungen, die weiterh<strong>in</strong> entsprechend ihrer Entstehung <strong>in</strong> der Ergebnisrechnung nachgewiesen werden. Zu<br />
beachten ist dabei, dass durch die Zurechnung bzw. die Klassifizierung von aktivierten Eigenleistungen ke<strong>in</strong> zusätzlicher<br />
Zahlungsbedarf entsteht. Auch werden durch die Zurechnung die zu leistenden Personal- und/oder<br />
Sach- und Dienstleistungen nicht zu Auszahlungen für die Investitionstätigkeit. Die Zurechnung bzw. die Aktivierung<br />
von geme<strong>in</strong>dlichen Eigenleistungen löst daher ke<strong>in</strong>en Veränderungsbedarf für die <strong>in</strong> der Haushaltssatzung<br />
festgesetzte Kreditermächtigung aus.<br />
1.1.1.4 Aktivierte Zuwendungen der Geme<strong>in</strong>de<br />
Durch die Geme<strong>in</strong>de gewährte Zuwendungen für Investitionen Dritter (Investitionsförderungsmaßnahmen) werden<br />
im NKF wie Investitionsmaßnahmen behandelt, wenn bestimmte Voraussetzungen, z.B. die Aktivierbarkeit,<br />
GEMEINDEORDNUNG 398
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 86 GO <strong>NRW</strong><br />
erfüllt s<strong>in</strong>d. In diesem S<strong>in</strong>ne ist daher die gesonderte Nennung des Begriffes „Investitionsförderungsmaßnahmen“<br />
entbehrlich geworden und <strong>in</strong> der Vorschrift des § 86 GO <strong>NRW</strong> nicht mehr enthalten. Von der Geme<strong>in</strong>de gezahlte<br />
Zuwendungen für Investitionen von Dritten s<strong>in</strong>d daher regelmäßig unter der Investitionstätigkeit der Geme<strong>in</strong>de zu<br />
erfassen und können bei der Ermittlung des Kreditbedarfs der Geme<strong>in</strong>de berücksichtigt werden.<br />
Die von der Geme<strong>in</strong>de gewährten <strong>in</strong>vestiven Zuwendungen können dann der geme<strong>in</strong>dlichen Investitionstätigkeit<br />
zugeordnet werden, wenn die Geme<strong>in</strong>de wirtschaftlicher Eigentümer des damit angeschafften oder hergestellten<br />
Vermögensgegenstandes wird und dieser deswegen <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz zu aktivieren ist. Die Zuordnung<br />
zur geme<strong>in</strong>dlichen Investitionstätigkeit ist auch möglich, wenn die Geme<strong>in</strong>de dem Zuwendungsempfänger e<strong>in</strong>e<br />
sachliche und zeitliche (mehrjährige) Verpflichtung auferlegt hat (Gegenleistungsverpflichtung des Dritten). In<br />
diesem Fall besteht ebenfalls e<strong>in</strong>e Aktivierbarkeit <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz, auch wenn diese unter dem Bilanzposten<br />
„Aktive Rechnungsabgrenzung“ vorzunehmen ist, um e<strong>in</strong>e periodengerechte Abgrenzung zu erreichen.<br />
In allen anderen Fällen stellen die von der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>em Dritten gewährten „<strong>in</strong>vestiven“ Zuwendungen geme<strong>in</strong>dliche<br />
Aufwendungen dar, die <strong>in</strong> der Ergebnisrechnung der Geme<strong>in</strong>de zu erfassen s<strong>in</strong>d und nicht <strong>in</strong> die Ermittlung<br />
des geme<strong>in</strong>dlichen Kreditbedarfs e<strong>in</strong>bezogen werden dürfen. Dieses Zuordnungsverbot gilt auch <strong>in</strong> den<br />
Fällen, <strong>in</strong> den z.B. e<strong>in</strong>em Dritten mehrjährige Betriebskostenzuschüsse gewährt werden und diese von der Geme<strong>in</strong>de<br />
periodengerecht abgegrenzt und unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert werden<br />
müssen.<br />
1.1.1.5 Die Haushaltsermächtigung für die Kreditaufnahme<br />
Die von der Geme<strong>in</strong>de vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen s<strong>in</strong>d mit ihrem Gesamtbetrag <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltssatzung als Kreditermächtigung festzusetzen (vgl. § 78 Abs. 2 Buchstabe c) GO <strong>NRW</strong>).<br />
Dadurch entsteht im Rahmen des Satzungsrechtes und des Budgetrechtes die Entscheidungsbefugnis des Rates,<br />
die Beschaffung von Fremdkapital zur F<strong>in</strong>anzierung geme<strong>in</strong>dlicher Investitionen festzulegen. Diese Vorgabe<br />
ist erforderlich, weil alle<strong>in</strong> die Veranschlagung der Kreditaufnahme im geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzplan als E<strong>in</strong>zahlung<br />
aus der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzierungstätigkeit nicht als dafür ausreichend anzusehen ist (vgl. § 3 Abs. 1 Nr. 26<br />
GemHVO <strong>NRW</strong>). Die notwendige Ermächtigung der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung zur Aufnahme von Fremdkapital<br />
für die Anschaffung von Vermögensgegenständen der Geme<strong>in</strong>de bedarf e<strong>in</strong>es Rahmens, also e<strong>in</strong>es am F<strong>in</strong>anzierungsbedarfs<br />
orientierten Gesamtbetrages, der <strong>in</strong>nerhalb der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung festgesetzt wird.<br />
Mit dieser satzungsrechtlichen Festsetzung und der Veranschlagung besteht e<strong>in</strong>e ausreichende Ermächtigung<br />
zur Aufnahme der e<strong>in</strong>zelnen Kredite durch die Geme<strong>in</strong>de.<br />
1.1.1.6 Kredite und Kapitalanlage (Geldanlage)<br />
E<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>dliche Kapitalanlage entsteht i.d.R. aus der H<strong>in</strong>gabe von vorhandenen liquiden Mitteln (Geldbeträgen)<br />
der Geme<strong>in</strong>de, die <strong>in</strong> Kapital umgewandelt werden. Dieser Vorgang stellt wie die Umwandlung von vorhandenen<br />
liquiden Mitteln der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> Sachanlagen haushaltsrechtlich e<strong>in</strong>e Investition dar. Außerdem stellt die<br />
von der Geme<strong>in</strong>de erworbene Kapitalanlage bilanztechnisch e<strong>in</strong>e F<strong>in</strong>anzanlage dar, so dass <strong>in</strong> diesem Zusammenhang<br />
der Zahlungsvorgang <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzrechnung unter der Haushaltsposition „Auszahlungen<br />
für den Erwerb von F<strong>in</strong>anzanlagen“ nachzuweisen ist (vgl. § 3 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
Die Investitionen der Geme<strong>in</strong>de bewirken regelmäßig e<strong>in</strong>e dauerhafte Mehrung des geme<strong>in</strong>dlichen Vermögens,<br />
z.B. das <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz anzusetzende Anlagevermögen, zu dem auch die F<strong>in</strong>anzanlagen zu zählen<br />
s<strong>in</strong>d. Diese haushaltsrechtliche Zuordnung e<strong>in</strong>er Kapitalanlage der Geme<strong>in</strong>de könnte den Schluss zu lassen,<br />
dass dadurch auch e<strong>in</strong>e Kreditf<strong>in</strong>anzierung für e<strong>in</strong>e Kapitalanlage zulässig wäre. Die Geme<strong>in</strong>de darf nach des<br />
Vorschrift des § 86 GO <strong>NRW</strong> Kredite für Investitionen aufnehmen. Da der Erwerb e<strong>in</strong>er Kapitalanlage e<strong>in</strong>erseits<br />
GEMEINDEORDNUNG 399
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 86 GO <strong>NRW</strong><br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgabenerfüllung dient und andererseits e<strong>in</strong>e Investition darstellt, könnten die Voraussetzungen<br />
für e<strong>in</strong>e Kreditaufnahme für die Kapitalanlage grundsätzlich erfüllt se<strong>in</strong>.<br />
E<strong>in</strong>er solchen Kreditaufnahme dürfen jedoch auch die Grundsätze der F<strong>in</strong>anzmittelbeschaffung nach § 77 Abs. 3<br />
GO <strong>NRW</strong> nicht entgegenstehen, denn sie ist zulässig, wenn e<strong>in</strong>e andere F<strong>in</strong>anzierung nicht möglich oder unzweckmäßig<br />
wäre. Dieses könnte im E<strong>in</strong>zelfall beim Erwerb e<strong>in</strong>er Kapitalanlage gegeben se<strong>in</strong>. Dabei wäre auch<br />
zu prüfen, ob beim Erwerb e<strong>in</strong>er Kapitalanlage mit durch e<strong>in</strong>en Kredit der Geme<strong>in</strong>de zugegangenen Geldmitteln<br />
(Fremdkapital) es zu e<strong>in</strong>er dauerhaften Vermögensmehrung bei der Geme<strong>in</strong>de kommt. Bei e<strong>in</strong>er Kreditaufnahme<br />
für e<strong>in</strong>e Kapitalanlage könnte das Spekulationsverbot <strong>in</strong> § 90 GO <strong>NRW</strong> berührt se<strong>in</strong>, wenn unterstellt werden<br />
kann, dass die Kapitalanlage vorrangig der Erzielung e<strong>in</strong>es Gew<strong>in</strong>ns aus der Differenz zwischen den Kreditkosten<br />
und dem Z<strong>in</strong>sertrag dient, und dabei auf die weitere „ungewisse“ Z<strong>in</strong>sentwicklung gesetzt wird. Andererseits dient<br />
aber e<strong>in</strong>e solche Differenz erst e<strong>in</strong>mal dazu, e<strong>in</strong>e Wirtschaftlichkeit der Kapitalanlage anzunehmen.<br />
Bei der F<strong>in</strong>anzierung e<strong>in</strong>er Kapitalanlage durch Fremdkapital ist auch der künftige Verwendungszweck <strong>in</strong> die<br />
Bewertung e<strong>in</strong>zubeziehen. Im S<strong>in</strong>ne des § 86 GO <strong>NRW</strong> dürfte es nicht zulässig se<strong>in</strong>, wenn die fremdf<strong>in</strong>anzierte<br />
Kapitalanlage der Geme<strong>in</strong>de dazu dient, <strong>in</strong> künftigen Haushaltsjahren die Auszahlungen aus zahlungswirksamen<br />
Aufwendungen zu ermöglichen. Mit e<strong>in</strong>em solchen Zweck verliert der Erwerb e<strong>in</strong>er Kapitalanlage den Charakter<br />
e<strong>in</strong>er Investition und damit die Grundlage für e<strong>in</strong>e zulässige Kreditaufnahme. In diesem S<strong>in</strong>ne wäre bei e<strong>in</strong>er<br />
Fremdkapitalf<strong>in</strong>anzierung der Kapitalanlage auch der Grundsatz der <strong>in</strong>tergenerativen Gerechtigkeit tangiert (vgl. §<br />
1 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>).<br />
In diesem Zusammenhang steht auch der Runderlass über kommunale Geldanlagen vom 25.01.2005, nach dem<br />
zu beachten ist, dass e<strong>in</strong>e Kapitalanlage bzw. die Anlage von geme<strong>in</strong>dlichen Geldmitteln nur mit Geldmitteln der<br />
Geme<strong>in</strong>de zulässig ist, die nicht zur Sicherung der Liquidität und zur Zahlungsabwicklung benötigt werden. Dieser<br />
Runderlass führt de vorherigen Runderlasse fort, so dass es bereits <strong>in</strong> der Vergangenheit e<strong>in</strong>e Kapitalanlage nur<br />
dann zulässig war, wenn die Geme<strong>in</strong>de Geldmittel besaß, die sie nicht für ihren Zahlungsverkehr benötigte. Diese<br />
Voraussetzungen bed<strong>in</strong>gen, dass der Erwerb e<strong>in</strong>er Kapitalanlage, f<strong>in</strong>anziert durch die Aufnahme von Investitionskrediten<br />
nach § 86 GO <strong>NRW</strong>, dann nicht mit den haushaltsrechtlichen Grundsätzen und Vorschriften für Geme<strong>in</strong>den<br />
<strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang steht, wenn damit geme<strong>in</strong>dliche Aufwendungen f<strong>in</strong>anziert werden sollen, z.B. die künftigen Versorgungsleistungen.<br />
1.1.2 Kreditaufnahmen für Zwecke der Umschuldung<br />
1.1.2.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Durch e<strong>in</strong>e alle<strong>in</strong>ige Festlegung <strong>in</strong> dieser Vorschrift auf die Aufnahme von Krediten für Investitionen wäre e<strong>in</strong>e<br />
Aufnahme von Krediten für e<strong>in</strong>e außerordentliche Tilgung bestehender Kredite (Umschuldung) nicht zulässig. Da<br />
aber durch die Vorschrift nur e<strong>in</strong>e Kreditaufnahme für die ordentliche Tilgung von Schulden ausgeschlossen werden<br />
soll, enthält die Vorschrift e<strong>in</strong>e ausdrückliche Regelung, dass e<strong>in</strong>e Kreditaufnahme auch zum Zwecke der<br />
Umschuldung von Krediten erfolgen darf (außerordentliche Schuldentilgung).<br />
Der Begriff „Umschuldung“ soll dabei als die Begründung e<strong>in</strong>er neuen Verpflichtung der Geme<strong>in</strong>de zur Begleichung<br />
e<strong>in</strong>er bestehenden Verpflichtung verstanden werden. Durch den <strong>in</strong> der Vorschrift bestehenden Regelungszusammenhang<br />
mit der haushaltsrechtlichen Vorgabe, dass von der Geme<strong>in</strong>de Kredite nur für Investitionen aufgenommen<br />
werden dürfen. Daher bedeutet e<strong>in</strong>e Umschuldung im S<strong>in</strong>ne dieser Vorschrift, die Ablösung e<strong>in</strong>es<br />
Kredites für Investitionen durch die Aufnahme e<strong>in</strong>es neuen Kredites für Investitionen. Im Rahmen e<strong>in</strong>er Umschuldung<br />
können aber auch mehrere kle<strong>in</strong>ere Kredite zu e<strong>in</strong>em e<strong>in</strong>zigen Kredit zusammengefasst werden.<br />
GEMEINDEORDNUNG 400
1.1.2.2 Inhalte der Umschuldung<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 86 GO <strong>NRW</strong><br />
Im Rahmen des geme<strong>in</strong>dlichen Liquiditätsmanagements und auch zur Z<strong>in</strong>soptimierung werden von der Geme<strong>in</strong>de<br />
<strong>in</strong> unterschiedlichem Umfang bedarfsbezogene Umschuldungen vorgenommen. Durch e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>dliche<br />
Umschuldung erfolgt i.d.R. e<strong>in</strong>e Ablösung der noch bestehenden Verb<strong>in</strong>dlichkeit e<strong>in</strong>es aufgenommenen Kredites<br />
bei gleichzeitiger Neuaufnahme e<strong>in</strong>es Kredites <strong>in</strong> Höhe des Restbetrages dieser geme<strong>in</strong>dlichen Verb<strong>in</strong>dlichkeit.<br />
Auch werden durch e<strong>in</strong>e Umschuldung oftmals E<strong>in</strong>zelkredite zu e<strong>in</strong>em „neuen“ Gesamtkredit zusammengefasst.<br />
Solche Umschuldungen werden aus unterschiedlichen Anlässen vorgenommen. Durch sie wird i.d.R. das Volumen<br />
der bestehenden Verb<strong>in</strong>dlichkeiten nicht verändert, sondern es werden lediglich die Kreditkonditionen der<br />
Geme<strong>in</strong>de angepasst.<br />
Unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nach § 75 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> kann <strong>in</strong>sbesondere<br />
dann e<strong>in</strong>e Umschuldung <strong>in</strong> Betracht kommen, wenn die Konditionen für die Geme<strong>in</strong>de günstiger s<strong>in</strong>d, als<br />
die des abzulösenden Kredites für Investitionen. Die Geme<strong>in</strong>de kann im Rahmen der Umschuldung e<strong>in</strong>en neuen<br />
Vertrag mit dem Kreditgeber abschließen, sie kann aber auch den Kreditgeber wechseln. Bei e<strong>in</strong>er Umschuldung<br />
kommt jedoch ke<strong>in</strong>e Verlängerung der Laufzeit des ursprünglichen Kredites <strong>in</strong> Betracht, denn dieses käme der<br />
Neuaufnahme e<strong>in</strong>es Kredites für Investitionen gleich. Aus diesen Gründen bedarf es auch ke<strong>in</strong>er gesonderten<br />
Ermächtigung des Rates der Geme<strong>in</strong>de zur Durchführung der Umschuldung bzw. dem Austausch von Krediten<br />
und neuer Kreditkonditionen.<br />
1.1.2.3 Umwandlung kurzfristiger Investitionskredite <strong>in</strong> langfristige Kredite<br />
In Sonderfällen, <strong>in</strong> denen die Geme<strong>in</strong>de ausschließlich zur vorübergehenden F<strong>in</strong>anzierung e<strong>in</strong>er Investition e<strong>in</strong>en<br />
kurzfristigen Kredit aufgenommen hat (Zwischenf<strong>in</strong>anzierung), weil z.B. e<strong>in</strong> günstiges Kreditangebot bestand,<br />
kann e<strong>in</strong> solcher Kredit auch <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en langfristigen Kredit oder e<strong>in</strong>en Annuitätenkredit umgewandelt werden. E<strong>in</strong><br />
für e<strong>in</strong>en solchen Zweck aufgenommener kurzfristiger Kredit ist nur h<strong>in</strong>sichtlich se<strong>in</strong>er Laufzeit, aber nicht wegen<br />
se<strong>in</strong>es Zweckes mit e<strong>in</strong>em Kredit zur Liquiditätssicherung vergleichbar. Der für Investitionen aufgenommene<br />
kurzfristige Kredit stellt von Anfang an e<strong>in</strong>en haushaltsrechtlichen Kredit dar, denn die E<strong>in</strong>zahlungen aus se<strong>in</strong>er<br />
Aufnahme dienen der haushaltsmäßigen Deckung von <strong>in</strong>vestiven Auszahlungen und haben nicht den allgeme<strong>in</strong>en<br />
Zweck, fällige Auszahlungen durch die Geme<strong>in</strong>de zu ermöglichen.<br />
Diese Festlegung bedeutet, dass die Aufnahme e<strong>in</strong>es solchen kurzfristigen Kredites unter die Regelungen e<strong>in</strong>er<br />
Kreditaufnahme für Investitionen fällt und daher dafür auch e<strong>in</strong>e Kreditermächtigung <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung<br />
enthalten se<strong>in</strong> muss (vgl. § 78 Abs. Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe c) GO <strong>NRW</strong>). Die Aufnahme dieses<br />
Kredites fällt deshalb nicht unter die Höchstbetragsgrenze der Kredite zur Liquiditätssicherung nach § 89 GO<br />
<strong>NRW</strong>, die ebenfalls <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung enthalten se<strong>in</strong> muss (vgl. § 78 Abs. 2 Nr. 3 GO<br />
<strong>NRW</strong>). Für die tatsächlich von der Geme<strong>in</strong>de aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung folgt daraus, dass<br />
diese Kredite nicht <strong>in</strong> langfristige Kredite oder Annuitätenkredite umgewandelt werden dürfen, denn e<strong>in</strong> solcher<br />
Vorgang steht nicht mit dem Begriff „Umschuldung“ <strong>in</strong> S<strong>in</strong>ne der Vorschrift <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang.<br />
1.1.3 Verbot von E<strong>in</strong>lagengeschäften<br />
Für die Geme<strong>in</strong>de ist die Annahme fremder Gelder als E<strong>in</strong>lagen oder anderer unbed<strong>in</strong>gt rückzahlbarer Gelder von<br />
Dritten, sofern der Rückzahlungsanspruch der Dritten nicht <strong>in</strong> Inhaber- oder Orderschuldverschreibungen verbrieft<br />
wird, e<strong>in</strong> E<strong>in</strong>lagengeschäft als Bankgeschäft (vgl. § 1 Abs. 1 Nr. 1 KWG) und für die Geme<strong>in</strong>de unzulässig. Dabei<br />
kommt es nicht darauf an, ob die Z<strong>in</strong>sen vergütet werden. E<strong>in</strong> E<strong>in</strong>lagengeschäft im S<strong>in</strong>ne des KWG betreibt, wer<br />
fremde Gelder im o.a. S<strong>in</strong>ne annimmt. Als rückzahlbar werden dabei Gelder angesehen, bei denen e<strong>in</strong> zivilrechtlicher<br />
Anspruch auf ihre Rückzahlung besteht, z.B. bei e<strong>in</strong>em Darlehen nach § 488 BGB und dieser nicht unter<br />
e<strong>in</strong>er Bed<strong>in</strong>gung steht (vgl. § 158 Abs. 1 BGB). Bereits die Anbahnung und Durchführung der Darlehen ist als<br />
GEMEINDEORDNUNG 401
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 86 GO <strong>NRW</strong><br />
E<strong>in</strong>lagengeschäft im S<strong>in</strong>ne des KWG anzusehen. E<strong>in</strong>e Beurteilung geme<strong>in</strong>dlicher Bankgeschäfte im S<strong>in</strong>ne des §<br />
1 Abs. 1 KWG bedarf regelmäßig der Kenntnisse im E<strong>in</strong>zelfall, denn beim Betreiben mehrerer Bank- oder F<strong>in</strong>anzdienstleistungsgeschäfte<br />
kann sich e<strong>in</strong> bankrechtliche Geschäftsbetrieb bereits auch bei e<strong>in</strong>em vergleichsweise<br />
ger<strong>in</strong>gen Umfang ergeben.<br />
Ke<strong>in</strong> E<strong>in</strong>lagengeschäft im S<strong>in</strong>ne des § 1 Abs. 1 S. 1 KWG und damit ke<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>dliches Bankgeschäft ist die<br />
Ausgabe von Inhaber- oder Orderschuldverschreibungen, bei denen von der Geme<strong>in</strong>de unbed<strong>in</strong>gt zurückzahlbare<br />
Gelder von Dritten angenommen werden und der unbed<strong>in</strong>gte Rückzahlungsanspruch des Dritten <strong>in</strong> der Inhaber-<br />
oder Orderschuldverschreibung verbrieft ist. Dabei ist Voraussetzung. dass die gesetzlichen und wertpapierrechtlichen<br />
Voraussetzungen von der Geme<strong>in</strong>de gewahrt und wirksame Wertpapiere begeben werden. In diesem<br />
Zusammenhang ist von der Geme<strong>in</strong>de darauf zu achten, dass sie als Aussteller von Inhaber- oder Orderschuldverschreibungen<br />
nicht wegen e<strong>in</strong>er möglichen Verwahrung und Aufbewahrung von Wertpapieren für Dritte den<br />
Tatbestand des Depotgeschäftes nach § 1 Abs. 1 S. 2 Nr. 5 KWG erfüllt, denn sie würde dann der Erlaubnispflicht<br />
nach § 32 KWG unterfallen. Außerdem kann auch der Vertrieb von Inhaber- oder Orderschuldverschreibungen<br />
durch Dritte, die von der Geme<strong>in</strong>de beauftragt werden, e<strong>in</strong>e für den Dritten erlaubnispflichtige F<strong>in</strong>anzdienstleistung<br />
darstellen. Vor diesem H<strong>in</strong>tergrund wäre umfassend zu prüfen, ob e<strong>in</strong> E<strong>in</strong>lagengeschäft für die<br />
Geme<strong>in</strong>de überhaupt wirtschaftlich ist, wenn dabei e<strong>in</strong>e Gewerbsmäßigkeit nicht zulässig ist.<br />
1.2 Zu Satz 2 (Kreditverpflichtungen und dauernde Leistungsfähigkeit):<br />
1.2.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Nach dieser Vorschrift müssen die mit der Aufnahme von Krediten übernommenen Verpflichtungen mit der dauernden<br />
Leistungsfähigkeit der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang stehen. Der E<strong>in</strong>haltung der dauernden Leistungsfähigkeit<br />
der Geme<strong>in</strong>de kommt damit bei der F<strong>in</strong>anzierung von Investitionen durch Kredite e<strong>in</strong>e herausgehobene Bedeutung<br />
zu. Die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft muss deshalb über e<strong>in</strong>en F<strong>in</strong>anzspielraum verfügen, dass der aus<br />
der Kreditaufnahme neu h<strong>in</strong>zukommende Schuldendienst nicht zur E<strong>in</strong>schränkungen bei der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgabenerfüllung<br />
führen wird. Daran knüpft der Haushaltsgrundsatz <strong>in</strong> § 75 Abs. 7 GO <strong>NRW</strong> an, der e<strong>in</strong>e Überschuldung<br />
der Geme<strong>in</strong>de verbietet.<br />
1.2.2 Kreditaufnahme und Grundsatz der Gesamtdeckung<br />
Von der Geme<strong>in</strong>de können <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Haushaltsjahr mehrere Investitionsmaßnahmen vorgesehen se<strong>in</strong>, auf Grund<br />
derer e<strong>in</strong> Kreditbedarf bei der Geme<strong>in</strong>de entsteht. In diesen Fällen kann jedoch wegen des Grundsatzes der<br />
Gesamtdeckung (vgl. § 20 GemHVO <strong>NRW</strong>) e<strong>in</strong> e<strong>in</strong>zelner Kredit nicht e<strong>in</strong>er bestimmten Maßnahme zugerechnet<br />
werden, um daran zu messen, ob langfristige Investitionen auch langfristig f<strong>in</strong>anziert werden. Gleichwohl wird<br />
auch im NKF an dem Grundsatz festgehalten, dass langfristig nutzbare Vermögensgegenstände der Geme<strong>in</strong>de<br />
auch langfristig f<strong>in</strong>anziert werden sollen. Bei der Aufnahme e<strong>in</strong>es kurzfristigen Kredites für die Erstf<strong>in</strong>anzierung<br />
von Investitionsmaßnahmen, dessen spätere Umwandlung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en langfristigen Kredit beabsichtigt ist, ist e<strong>in</strong>e<br />
entsprechende Zusage des Kredit<strong>in</strong>stitutes für e<strong>in</strong> anschließendes F<strong>in</strong>anzierungsangebot (dem Grunde nach)<br />
unumgänglich.<br />
1.2.3 Kreditaufnahme und Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
Die Geme<strong>in</strong>de hat unter Berücksichtigung der <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz angesetzten Rückzahlungsverpflichtungen<br />
für Kredite, <strong>in</strong>sbesondere der Kredite zur Liquiditätssicherung, <strong>in</strong> eigener Verantwortung zu bewerten und<br />
zu entscheiden, ob und <strong>in</strong> welchem Umfang e<strong>in</strong> Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit tatsächlich<br />
für Investitionen e<strong>in</strong>gesetzt werden kann. Ist dieses möglich, weil der Überschuss nicht für geme<strong>in</strong>dliche Til-<br />
GEMEINDEORDNUNG 402
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 86 GO <strong>NRW</strong><br />
gungsverpflichtungen benötigt wird, soll dieser zur Verm<strong>in</strong>derung e<strong>in</strong>er Kreditaufnahme für Investitionen e<strong>in</strong>gesetzt<br />
werden.<br />
In diese Abwägung s<strong>in</strong>d die Verpflichtungen der Geme<strong>in</strong>de zur Sicherstellung ihrer Liquidität (vgl. § 75 Abs. 6 GO<br />
<strong>NRW</strong>) und zur Sicherstellung der künftigen Zahlungsfähigkeit der Geme<strong>in</strong>de durch e<strong>in</strong>e angemessene Liquiditätsplanung<br />
(vgl. § 89 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>) sowie die Grundsätze der F<strong>in</strong>anzmittelbeschaffung nach § 77 GO <strong>NRW</strong><br />
e<strong>in</strong>zubeziehen. In solchen Fällen ist auch zu berücksichtigen, dass die Erfüllung e<strong>in</strong>er rechtlichen Verpflichtung,<br />
die z.B. aus e<strong>in</strong>em Darlehensvertrag für die Geme<strong>in</strong>de entstehen kann, grundsätzlich e<strong>in</strong>er „freien“ Verwendung<br />
e<strong>in</strong>es Zahlungsüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit, z.B. für Investitionen, vorgeht. Das Ergebnis<br />
aus e<strong>in</strong>er solchen Abwägung wird dann durch die örtliche Zusammenführung der Überschüsse aus der laufenden<br />
Verwaltungstätigkeit mit den E<strong>in</strong>zahlungen aus der Investitionstätigkeit im Haushaltsplan aufgezeigt.<br />
1.2.4 Ermittlung der zulässigen Kreditermächtigung<br />
1.2.4.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Der geme<strong>in</strong>dliche Kreditbedarf lässt sich mit Hilfe des F<strong>in</strong>anzplans und den dar<strong>in</strong> veranschlagten E<strong>in</strong>zahlungen<br />
und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der F<strong>in</strong>anzierungstätigkeit<br />
der Geme<strong>in</strong>de ermitteln (vgl. § 3 GemHVO <strong>NRW</strong>). Die im F<strong>in</strong>anzplan veranschlagten Beträge s<strong>in</strong>d jedoch alle<strong>in</strong><br />
nicht ausschlaggebend. Sie stellen vielmehr nur den Ausgangspunkt für die Ermittlung dar, auf dem die weitere<br />
Betrachtung des des geme<strong>in</strong>dlichen Kreditbedarfs aufbaut. E<strong>in</strong> möglicher Kreditbedarf für geme<strong>in</strong>dliche Investitionen<br />
dürfte dem Grunde nach bestehen, wenn im F<strong>in</strong>anzplan e<strong>in</strong> negativer Saldo aus der Investitionstätigkeit der<br />
Geme<strong>in</strong>de ausgewiesen wird.<br />
H<strong>in</strong>sichtlich der Bemessung des tatsächlichen Bedarfs e<strong>in</strong>er geme<strong>in</strong>dlichen Kreditermächtigung müssen noch<br />
weitere Zahlungen oder F<strong>in</strong>anzmittel berücksichtigt werden. So ist zu prüfen, ob e<strong>in</strong> Überschuss aus den<br />
E<strong>in</strong>zahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit der Geme<strong>in</strong>de verfügbar ist, soweit dieser<br />
nicht zur Tilgung von Krediten benötigt wird. Auch wenn Rückflüsse aus Darlehensgewährungen der Geme<strong>in</strong>de<br />
e<strong>in</strong>gehen werden, die nicht zur Tilgung von geme<strong>in</strong>dlichen Krediten benötigt werden, müssen diese Zahlungen<br />
<strong>in</strong>die Bemessung e<strong>in</strong>bezogen werden.<br />
Insbesondere s<strong>in</strong>d aber auch die E<strong>in</strong>zahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen zu<br />
berücksichtigen, die soweit sie nicht für andere Zwecke benötigt werden, auch <strong>in</strong> die Bemessung des<br />
Kreditbedarfs der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>zubeziehen s<strong>in</strong>d. Im Rahmen dieses Gesamtbildes ist von der Geme<strong>in</strong>de auch zu<br />
prüfen, ob e<strong>in</strong>e andere F<strong>in</strong>anzierung nicht möglich oder ggf. wirtschaftlich unzweckmäßig wäre (vgl. § 77 Abs. 3<br />
GO <strong>NRW</strong>). Andererseits ist zu beachten, dass der Investitionstätigkeit der Geme<strong>in</strong>de zuzurechnende<br />
Maßnahmen nicht kreditfähig s<strong>in</strong>d und daher nicht <strong>in</strong> die Bemessung des geme<strong>in</strong>dlichen Kreditbedarfs<br />
e<strong>in</strong>bezogen werden dürfen. Dazu gehört z.B. der Kauf von Kapitalanlagen als Geldanlage der Geme<strong>in</strong>de. Die<br />
dafür benötigten F<strong>in</strong>anzmittel dürfen nicht durch Kredite beschafft werden.<br />
1.2.4.2 E<strong>in</strong> Überprüfungsschema<br />
Das nachfolgende Überprüfungsschema soll die Ermittlung der zulässigen Kreditermächtigung unterstützen und<br />
e<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>stieg bieten, damit im E<strong>in</strong>zelfall unter Beachtung der §§ 75, 77 und 86 GO <strong>NRW</strong> und des § 20 GemHVO<br />
<strong>NRW</strong> sowie unter E<strong>in</strong>beziehung der Bedürfnisse der örtlichen Haushaltswirtschaft der geme<strong>in</strong>dliche Kreditbedarf<br />
für Investitionen beurteilt werden kann (vgl. Abbildung).<br />
GEMEINDEORDNUNG 403
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 86 GO <strong>NRW</strong><br />
Kreditbedarf für Investitionen<br />
Zahlungsart<br />
1. Auszug aus dem F<strong>in</strong>anzplan:<br />
E<strong>in</strong>zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
+ E<strong>in</strong>zahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
+ E<strong>in</strong>zahlungen aus der Veräußerung von F<strong>in</strong>anzanlagen<br />
+ E<strong>in</strong>zahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
+ Sonstige Investitionse<strong>in</strong>zahlungen<br />
= E<strong>in</strong>zahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
- Auszahlungen für den Erwerb von F<strong>in</strong>anzanlagen<br />
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />
- Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit<br />
2. Ermittlung des Kreditbedarfs für Investitionen:<br />
Möglicher Kreditbedarf nach § 86 GO <strong>NRW</strong><br />
(bei negativem Saldo aus Investitionstätigkeit)<br />
Zu berücksichtigen (abzuziehen) s<strong>in</strong>d u.a.<br />
- Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
(soweit nicht zur Tilgung von Krediten)<br />
- Rückflüsse aus Darlehensgewährungen<br />
(soweit nicht zur Tilgung von Krediten)<br />
- …<br />
Zu berücksichtigen (h<strong>in</strong>zuzurechnen) s<strong>in</strong>d u.a.<br />
- bei Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit:<br />
E<strong>in</strong>zahlungen aus der Veräußerung von Vermögens-<br />
gegenständen<br />
(wenn ke<strong>in</strong>e Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung)<br />
- …<br />
- …<br />
(§ 77 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong> beachten: Ist e<strong>in</strong>e andere F<strong>in</strong>anzierung<br />
möglich oder ggf. wirtschaftlich unzweckmäßig)<br />
GEMEINDEORDNUNG 404<br />
Ansatz
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 86 GO <strong>NRW</strong><br />
Nicht kreditfähig und nicht e<strong>in</strong>zubeziehen:<br />
Kauf von Kapitalanlagen als Geldanlage, wenn deren künftiger<br />
Verwendungszweck von konsumtiver Natur ist. Dafür benötigte<br />
F<strong>in</strong>anzmittel dürfen nicht durch Kredite beschafft werden.<br />
Ermittelter Kreditbedarf<br />
Übernahme als Höhe der Kreditermächtigung<br />
Abbildung 60 „Ermittlung des Kreditbedarfs“<br />
Das Schema stellt jedoch ke<strong>in</strong> Prüfschema zur Überprüfung der Kreditermächtigung <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung<br />
dar. Auch kann damit re<strong>in</strong> rechnerisch durch die E<strong>in</strong>fügung von Beträgen unmittelbar der örtliche<br />
Kreditbedarf bestimmt werden. Mit ihm sollen nur die möglichen Kriterien verdeutlicht werden, die für die Kreditermächtigung<br />
von Bedeutung s<strong>in</strong>d. Die Zulässigkeit des Umfangs der vom Rat festzusetzenden Kreditermächtigung<br />
(vgl. § 78 Abs. 2 Nr. 1c GO <strong>NRW</strong>) ist von der Geme<strong>in</strong>de zu prüfen und zu bestimmen. Die vom Rat getroffene<br />
Festsetzung ist aber auch Gegenstand der aufsichtsrechtlichen Tätigkeit im Rahmen der Anzeige der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltssatzung mit ihren Anlagen bei der Aufsichtsbehörde (vgl. § 80 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong>).<br />
2. Zu Absatz 2 (Geltungsdauer der Kreditermächtigung):<br />
2.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die Vorschrift sieht e<strong>in</strong>en fest bestimmten Zeitraum für die Geltungsdauer der <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung<br />
festgesetzten Kreditermächtigung vor (vgl. § 78 Abs. 2 Nr. 1 c) GO <strong>NRW</strong>). Danach gilt diese bis zum Ende<br />
des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht<br />
rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung. Diese Zweijährigkeit der<br />
Geltungsdauer der Kreditermächtigung stellt neben dem Grundsatz der Gesamtdeckung, e<strong>in</strong>e Maßnahme dar,<br />
durch die die Durchführung der Investitionen der Geme<strong>in</strong>de flexibler gestaltet worden ist. Die Geltungsdauer der<br />
Kreditermächtigung stimmt mit der Geltungsdauer der Verpflichtungsermächtigungen (vgl. § 85 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>)<br />
übere<strong>in</strong>, weil beide Ermächtigungen nur die Investitionsmaßnahmen der Geme<strong>in</strong>de betreffen.<br />
2.2 Die Übertragung der Kreditermächtigung<br />
Die Übertragung der Kreditermächtigung <strong>in</strong> das folgende Haushaltsjahr steht <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Zusammenhang mit der<br />
Möglichkeit der Übertragbarkeit von Ermächtigungen nach § 22 GemHVO <strong>NRW</strong>. Nach dem Absatz 2 dieser Vorschrift<br />
bleiben Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren<br />
Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres,<br />
<strong>in</strong> dem der Vermögensgegenstand <strong>in</strong> se<strong>in</strong>en wesentlichen Teilen <strong>in</strong> Benutzung genommen werden<br />
kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum<br />
Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.<br />
Die F<strong>in</strong>anzierung der geme<strong>in</strong>dlichen Investitionen auf dieser Basis erfordert, dass auch die entsprechenden F<strong>in</strong>anzmittel<br />
verfügbar s<strong>in</strong>d, zu denen auch die E<strong>in</strong>zahlungen aus den Krediten für Investitionen gehören. Daher ist<br />
es sachgerecht, die Ermächtigung des Rates, Kredite für geplante Investitionen oder für die Fortsetzung von<br />
Investitionen über das jeweilige Haushaltsjahr h<strong>in</strong>aus noch zu nutzen, wenn diese noch nicht <strong>in</strong> voller Höhe benötigt<br />
wurde, aber für das Folgejahr bereits e<strong>in</strong> Bedarf erkennbar ist. Nimmt die Geme<strong>in</strong>de im Rahmen der Übertragung<br />
der Kreditermächtigung e<strong>in</strong>en Kredit für Investitionen auf, ist dieser nicht auf die <strong>in</strong> der Haushaltssatzung für<br />
das laufende Haushaltsjahr festgesetzte Kreditermächtigung (vgl. § 78 Abs. 2 Nr. 1 c) GO <strong>NRW</strong>) anzurechnen.<br />
GEMEINDEORDNUNG 405
2.3 Die Vorf<strong>in</strong>anzierung e<strong>in</strong>er Investitionsmaßnahme<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 86 GO <strong>NRW</strong><br />
Die zweijährige gesetzliche Geltungsdauer ermöglicht aber auch der Geme<strong>in</strong>de, bei e<strong>in</strong>er ausreichenden Liquiditätslage<br />
e<strong>in</strong>e Investitionsmaßnahme mit eigenen Mitteln vorzuf<strong>in</strong>anzieren oder ggf. auch zuerst mit Krediten zu<br />
Liquiditätssicherung vorzuf<strong>in</strong>anzieren und dann im Folgejahr des Haushaltsjahres e<strong>in</strong>e solche geme<strong>in</strong>dliche Vorf<strong>in</strong>anzierung<br />
durch e<strong>in</strong>en langfristigen Kredit für Investitionen abzulösen. Nimmt die Geme<strong>in</strong>de im Rahmen dieser<br />
Vorf<strong>in</strong>anzierung e<strong>in</strong>en Kredit für Investitionen auf, ist dieser i.d.R. nicht auf die <strong>in</strong> der Haushaltssatzung für das<br />
laufende Haushaltsjahr festgesetzte Kreditermächtigung (vgl. § 78 Abs. 2 Nr. 1 c) GO <strong>NRW</strong>) anzurechnen. Dieses<br />
gilt auch, für e<strong>in</strong>e entsprechende Kreditaufnahme im zweiten Folgejahr des Haushaltsjahres, wenn die für<br />
dieses Folgejahr erforderliche Haushaltssatzung noch nicht bekannt gemacht worden ist. Dies setzt aber immer<br />
voraus, dass die Kreditermächtigung des ursprünglichen Haushaltsjahres noch nicht vollständig <strong>in</strong> Anspruch<br />
genommen worden ist.<br />
2.4 Information des Rates über die übertragene Kreditermächtigung<br />
In den Fällen, <strong>in</strong> denen die <strong>in</strong> der Haushaltssatzung festgesetzte Kreditermächtigung nicht <strong>in</strong> vollem Umfang im<br />
angelaufenen Haushaltsjahr <strong>in</strong> Anspruch genommen worden ist, sollte auch der Rat - wie bei anderen Übertragungen<br />
<strong>in</strong>s nächste Haushaltsjahr - frühzeitig darüber <strong>in</strong>formiert werden. Es bietet sich dafür an, <strong>in</strong> der dem Rat<br />
vorzulegenden Übersicht über die übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen (vgl. § 22<br />
Abs. 4 GemHVO) auch das Volumen der übertragenen Kreditermächtigung anzugeben, deren Inanspruchnahme<br />
aber im Folgejahr vorgesehen ist.<br />
3. Zu Absatz 3 (Genehmigungsbedarf bei e<strong>in</strong>er gesamtwirtschaftlichen Störung):<br />
3.1 Zu Satz 1 (Steuerung der geme<strong>in</strong>dlichen Kreditaufnahmen):<br />
Nach der Vorschrift bedarf die Aufnahme e<strong>in</strong>zelner Kredite durch die Geme<strong>in</strong>de der Genehmigung der Aufsichtsbehörde,<br />
sobald die Kreditaufnahme nach § 19 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums<br />
der Wirtschaft (StWG) beschränkt worden ist. Nach § 19 StWG kann durch e<strong>in</strong>e Rechtsverordnung angeordnet<br />
werden, dass die Beschaffung von Geldmitteln im Wege des Kredits auch für die Geme<strong>in</strong>den beschränkt wird.<br />
Die Schuldenwirtschaft der Geme<strong>in</strong>den hat wegen des erheblichen Volumens sowie wegen der Bedeutung der<br />
Investitionspolitik unmittelbare Auswirkungen <strong>in</strong> konjunkturpolitischer H<strong>in</strong>sicht, so dass es unter gesamtwirtschaftlichen<br />
Gesichtspunkten e<strong>in</strong>e Steuerung der geme<strong>in</strong>dlichen Kreditaufnahmen notwendig werden kann.<br />
In diesem Zusammenhang wird davon ausgegangen, dass durch die Kreditaufnahmen der Geme<strong>in</strong>den zu m<strong>in</strong>destens<br />
e<strong>in</strong> regionaler E<strong>in</strong>fluss auf die wirtschaftliche Entwicklung genommen werden kann. Ob e<strong>in</strong>e gesamtwirtschaftliche<br />
Störung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Land auch gleichzeitig e<strong>in</strong>e gesamtwirtschaftliche Störung für die Geme<strong>in</strong>den darstellt,<br />
ist von aber vielen Faktoren abhängig und bedarf e<strong>in</strong>er Betrachtung und Feststellung im E<strong>in</strong>zelfall. Wird das<br />
Vorliegen e<strong>in</strong>er gesamtwirtschaftlichen Störung festgestellt bzw. e<strong>in</strong>e Kreditbeschränkung ausgesprochen, bedarf<br />
die e<strong>in</strong>zelne Kreditaufnahme jeder Geme<strong>in</strong>de der Genehmigung durch die zuständige Aufsichtsbehörde.<br />
3.2 Zu Satz 2 (Versagung der Genehmigung der geme<strong>in</strong>dlichen Kreditaufnahme):<br />
Durch die Vorschrift ist für die Aufsichtsbehörde der Geme<strong>in</strong>de die rechtliche Grundlage geschaffen worden, die<br />
erforderliche Genehmigung für e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>zelne Kreditaufnahme der Geme<strong>in</strong>de zu versagen, wenn durch e<strong>in</strong>e<br />
Rechtsverordnung angeordnet werden, dass die Beschaffung von Geldmitteln im Wege des Kredits auch für die<br />
Geme<strong>in</strong>den beschränkt worden ist und die Kreditaufnahme nicht mit den Maßgaben der Kreditbeschränkungen <strong>in</strong><br />
GEMEINDEORDNUNG 406
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 86 GO <strong>NRW</strong><br />
E<strong>in</strong>klang steht. Damit soll u.a. erreicht werden, dass <strong>in</strong> Zeiten e<strong>in</strong>er gesamtwirtschaftlichen Störung die Geme<strong>in</strong>den<br />
eventuell Kreditbed<strong>in</strong>gungen akzeptieren, die für den Kreditmarkt schädlich s<strong>in</strong>d.<br />
4. Zu Absatz 4 (Kreditähnliche Rechtsgeschäfte):<br />
4.1 Zu Satz 1 (Anzeigepflicht gegenüber der Aufsichtsbehörde):<br />
4.1.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de wird neben der Aufnahme von Krediten auch durch den Abschluss kreditähnlicher<br />
Rechtsgeschäfte belastet. Das kreditähnliche Rechtsgeschäft begründet e<strong>in</strong>e Zahlungsverpflichtung der<br />
Geme<strong>in</strong>de, die e<strong>in</strong>er Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt. Damit s<strong>in</strong>d nur die geme<strong>in</strong>dlichen Rechtsgeschäfte<br />
als kreditähnlich e<strong>in</strong>zuordnen, die mit der Investitionstätigkeit der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung stehen. Dieses<br />
Erfordernis wird auch durch die E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung der Regelungen über kreditähnliche Rechtsgeschäfte <strong>in</strong> die Vorschrift<br />
über die Aufnahme von Krediten für geme<strong>in</strong>dliche Investitionen deutlich.<br />
Für die Beurteilung, ob e<strong>in</strong> kreditähnliches Rechtsgeschäft vorliegt, kommt es auf die Prüfung des E<strong>in</strong>zelfalls an.<br />
Entscheidend s<strong>in</strong>d nicht die formale Bezeichnung und E<strong>in</strong>ordnung des Geschäftes, sondern dessen wirtschaftliche<br />
Auswirkungen. Beispiele für kreditähnliche Rechtsgeschäfte s<strong>in</strong>d Leas<strong>in</strong>ggeschäfte, atypische langfristige<br />
Mietverträge ohne Kündigungsmöglichkeiten bzw. Nutzungsüberlassungsverträge für Gebäude auf geme<strong>in</strong>deeigenen<br />
Grundstücken, periodenübergreifende Stundungsabreden, aber auch Leibrentenverträge (z.B. Erwerb<br />
e<strong>in</strong>es Grundstückes gegen Übernahme e<strong>in</strong>er festen Geldrente - Rentengut nach dem Gesetz über Rentengüter<br />
vom 27.06.1890), Ratenkaufmodelle oder ÖPP-Projekte der Geme<strong>in</strong>den - etwa mit komb<strong>in</strong>ierten kreditähnlichen<br />
Vertragselementen.<br />
Diese Geschäfte s<strong>in</strong>d typischerweise jene geme<strong>in</strong>dlichen Rechtsgeschäfte, <strong>in</strong> denen die Geme<strong>in</strong>de langfristige<br />
Leistungsverpflichtungen mit erheblichen wirtschaftlichen Belastungen für künftige Haushaltsjahre e<strong>in</strong>geht. Zu<br />
diesen Geschäften der Geme<strong>in</strong>de gehören jedoch nicht z<strong>in</strong>sbezogene Derivatgeschäfte. Solche Rechtsgeschäfte<br />
stellen ke<strong>in</strong>e Kreditgeschäfte im S<strong>in</strong>ne des Absatzes 1 dieser Vorschrift dar und fließen daher auch nicht <strong>in</strong> den<br />
Gesamtbetrag der von der Geme<strong>in</strong>de vorgesehenen Kredite für Investitionen e<strong>in</strong>, der <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung<br />
festzusetzen ist (vgl. § 78 Abs. 2 Nr. 1 c) GO <strong>NRW</strong>).<br />
4.1.2 Die Anzeigepflicht<br />
Wegen der vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte bedarf es e<strong>in</strong>er Anzeige an<br />
die Aufsichtsbehörde. Entscheidend dafür ist, dass e<strong>in</strong> solches Rechtsgeschäft nach den Umständen des E<strong>in</strong>zelfalls<br />
bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise zu dem gleichen haushaltsmäßigen Erfolg führen würde wie die Aufnahme<br />
e<strong>in</strong>es Kredites entsprechend der <strong>in</strong> der Haushaltssatzung enthaltenen Ermächtigung und damit ggf. e<strong>in</strong>e<br />
sonst nicht zulässige Kreditaufnahme ermöglicht würde. Die Entscheidung über die Begründung e<strong>in</strong>er Zahlungsverpflichtung,<br />
die wirtschaftlich e<strong>in</strong>er Kreditverpflichtung gleichkommt, ist der Aufsichtsbehörde daher unverzüglich,<br />
spätestens e<strong>in</strong>en Monat vor der rechtsverb<strong>in</strong>dlichen E<strong>in</strong>gehung der Verpflichtung, schriftlich anzuzeigen.<br />
Diese Regelung dient dem Schutz der Geme<strong>in</strong>de, um e<strong>in</strong>e Gefährdung ihrer Haushaltswirtschaft oder riskante<br />
oder unwirtschaftliche Rechtsgeschäfte mit Dritten auszuschließen. Unter die Anzeigepflicht nach dieser Vorschrift<br />
fallen daher auch spätere Änderungen der von der Geme<strong>in</strong>de angezeigten Zahlungsverpflichtungen, wenn<br />
sie zu e<strong>in</strong>er höheren Belastung der Geme<strong>in</strong>de führen. In der Anzeige s<strong>in</strong>d von der Geme<strong>in</strong>de jeweils die tatsächlichen<br />
Verhältnisse und die f<strong>in</strong>anziellen Auswirkungen im Rahmen e<strong>in</strong>es Wirtschaftlichkeitsvergleiches darzustellen<br />
und auf Verlangen durch Vorlage der vertraglichen Abmachungen zu belegen. Die Monatsfrist ist dabei ke<strong>in</strong>e<br />
Ausschlussfrist für aufsichtsbehördliches Handeln.<br />
GEMEINDEORDNUNG 407
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 86 GO <strong>NRW</strong><br />
4.1.3 Der Nachweis der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte<br />
Zur Gewährleistung e<strong>in</strong>er geordneten Haushaltswirtschaft hat die Geme<strong>in</strong>de ihre aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften<br />
bestehenden F<strong>in</strong>anzierungsverpflichtungen im Haushaltsplan vollständig darzustellen. Dazu ist im Vorbericht<br />
zum Haushaltsplan (§ 7 GemHVO <strong>NRW</strong>) auszuführen, wie hoch die Belastungen aus kreditähnlichen<br />
Rechtsgeschäften, z.B. aus Immobilien-Leas<strong>in</strong>g, <strong>in</strong> den folgenden Jahren se<strong>in</strong> werden. Entsprechendes gilt für<br />
den Jahresabschluss, dem e<strong>in</strong>e Übersicht über den Stand der Verpflichtungen zu Beg<strong>in</strong>n und zum Ende des<br />
Haushaltsjahres beizufügen ist. In dieser Übersicht ist auch der Stand der Verpflichtungen aus Vorgängen, die<br />
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, darzustellen.<br />
4.1.4 Besondere kreditähnliche Rechtsgeschäfte: ÖPP und Leas<strong>in</strong>g<br />
4.1.4.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Für die Geme<strong>in</strong>de bedeutet nicht nur die Aufnahme von Krediten e<strong>in</strong>e dauerhafte Belastung des kommunalen<br />
Haushalts, sondern auch die Verpflichtungen aus e<strong>in</strong>em ÖPP/Leas<strong>in</strong>g-Projekt stellenkünftige haushaltsmäßige<br />
Belastungen dar. Auch solche geme<strong>in</strong>dlichen Geschäfte dürfen die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Geme<strong>in</strong>de<br />
nicht gefährden. Die Geme<strong>in</strong>de muss deshalb auch für kreditähnliche Rechtsgeschäfte die gleichen Maßstäbe<br />
anlegen wie für e<strong>in</strong>e Kreditaufnahme. Die Bilanzierung e<strong>in</strong>es Leas<strong>in</strong>gobjektes f<strong>in</strong>det i.d.R. beim Leas<strong>in</strong>ggeber<br />
statt. In solchen Fällen ist der Leas<strong>in</strong>gvertrag für die Geme<strong>in</strong>de kündbar, die Geme<strong>in</strong>de nur zur Zahlung e<strong>in</strong>er<br />
Leas<strong>in</strong>grate verpflichtet und ggf. besteht e<strong>in</strong>e Verlängerungsoption für Geme<strong>in</strong>de, so dass bei der Geme<strong>in</strong>de nur<br />
Aufwendungen aus den zu leistenden Leas<strong>in</strong>graten entsteht.<br />
In den Fällen, <strong>in</strong> denen sich dagegen um e<strong>in</strong> Objekt nach den Wünschen der Geme<strong>in</strong>de handelt, die Geme<strong>in</strong>de<br />
die wirtschaftlichen Risiken und Lasten auf eigene Rechnung trägt, die Dauer der Mietzeit der voraussichtlichen<br />
Nutzungsdauer entspricht und die Leas<strong>in</strong>graten <strong>in</strong>sgesamt die Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Objektes<br />
decken, ist das Leas<strong>in</strong>gobjekt bei der Geme<strong>in</strong>de zu aktivieren. Die Leas<strong>in</strong>graten stellen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em solchen Fall<br />
Verb<strong>in</strong>dlichkeiten der Geme<strong>in</strong>de dar. Bei ÖPP-Projekten, die <strong>in</strong> unterschiedlichen Modellen, z.B. Erwerbermodell<br />
oder Inhabermodell, realisiert werden, ist die haushaltsmäßige Behandlung und wirtschaftliche Zuordnung von<br />
Vermögensgegenständen abhängig von der örtlichen Ausgestaltung des ÖPP-Projektes im E<strong>in</strong>zelfall. E<strong>in</strong>e generelle<br />
Festlegung kann deshalb zu solchen Projekten nicht getroffen werden.<br />
4.1.4.2 Die Veranschlagung im Haushaltsplan<br />
Das von der Geme<strong>in</strong>de zu erbr<strong>in</strong>gende Leistungsentgelt aus e<strong>in</strong>em ÖPP-Projekt ist jährlich im geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltsplan zu veranschlagen. Es ist dabei <strong>in</strong> Abhängigkeit von der gewählten Modellvariante und soweit möglich<br />
<strong>in</strong> se<strong>in</strong>e konsumtiven und <strong>in</strong>vestiven Anteile aufzuteilen. E<strong>in</strong>e pauschale Zuordnung nach dem Pr<strong>in</strong>zip der<br />
„überwiegenden Zugehörigkeit“ ist möglichst zu vermeiden. Die getrennte haushaltsmäßige Veranschlagung wird<br />
dadurch erleichtert, dass Investoren als Bieter i.d.R. bei der Angebotsabgabe aufgefordert werden, die Preise für<br />
e<strong>in</strong>zelne Leistungsbereiche, z.B. für den Bau, den Betrieb, die Unterhaltung und für die F<strong>in</strong>anzierung gesondert<br />
anzugeben.<br />
Von der Geme<strong>in</strong>de s<strong>in</strong>d die konsumtiven Anteile aus dem Betrieb und der Unterhaltung der geme<strong>in</strong>dlichen Liegenschaft<br />
als Aufwendungen im Ergebnisplan der Geme<strong>in</strong>de (vgl. § 3 GemHVO <strong>NRW</strong>) zu veranschlagen und <strong>in</strong><br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Ergebnisrechnung (vgl. § 38 GemHVO <strong>NRW</strong>) nachzuweisen. Auch etwaige Erlöse aus dem<br />
Betrieb e<strong>in</strong>er solchen Liegenschaft s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> der Ergebnisrechnung zu erfassen. Die ermittelten <strong>in</strong>vestiven Anteile,<br />
z.B. Baukosten, s<strong>in</strong>d dagegen der geme<strong>in</strong>dlichen Investitionstätigkeit zuzuordnen. Sie s<strong>in</strong>d deshalb im geme<strong>in</strong>dlichen<br />
F<strong>in</strong>anzplan (vgl. § 3 GemHVO <strong>NRW</strong>) als Auszahlungen an den Investor zu veranschlagen und <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
F<strong>in</strong>anzrechnung (vgl. § 39 GemHVO <strong>NRW</strong>) nachzuweisen.<br />
GEMEINDEORDNUNG 408
4.2 Zu Satz 2 (Verweis auf Absatz 1):<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 86 GO <strong>NRW</strong><br />
Mit der Vorschrift soll sichergestellt werden, dass auch die aus Entscheidungen der Geme<strong>in</strong>de über die Begründung<br />
e<strong>in</strong>er Zahlungsverpflichtung, die wirtschaftlich e<strong>in</strong>er Kreditverpflichtung gleichkommt, übernommenen Verpflichtungen<br />
mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang stehen. Die Beachtung der dauernden<br />
Leistungsfähigkeit gilt dadurch nicht nur für die Kreditaufnahmen der Geme<strong>in</strong>de für Investitionen und zur<br />
Umschuldung, sondern s<strong>in</strong>ngemäß auch für andere gleichwertige geme<strong>in</strong>dliche Zahlungsverpflichtungen.<br />
4.3 Zu Satz 3 (Verzicht auf die Anzeige):<br />
Nach der Vorschrift ist e<strong>in</strong>e Anzeige nicht erforderlich für die Begründung von Zahlungsverpflichtungen im Rahmen<br />
der laufenden Verwaltung. Von der Anzeigepflicht der Geme<strong>in</strong>de gegenüber ihrer Aufsichtsbehörde s<strong>in</strong>d<br />
dadurch Rechtsgeschäfte ausgenommen, die als Geschäfte der laufenden Verwaltung nach § 41 Abs. 3 S. 1 GO<br />
<strong>NRW</strong> gelten und als solche abgeschlossen werden. Dazu gehören regelmäßig Angelegenheiten, die ke<strong>in</strong>e grundsätzliche<br />
oder e<strong>in</strong>e erhebliche Bedeutung für den geme<strong>in</strong>dlichen Haushalt haben und daher zu den üblichen<br />
Geschäften der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung zu rechnen s<strong>in</strong>d. E<strong>in</strong>e genaue Abgrenzung bedarf der örtlichen Betrachtung,<br />
so dass im E<strong>in</strong>zelfall ggf. e<strong>in</strong> Gespräch mit der Aufsichtsbehörde geboten ist.<br />
5. Zu Absatz 5 (Bestellung von Sicherheiten <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Kreditwirtschaft):<br />
5.1 Zu Satz 1 (Verbot der Sicherheitsbestellung):<br />
Nach der Vorschrift darf die Geme<strong>in</strong>de zur Sicherung e<strong>in</strong>es Kredits ke<strong>in</strong>e Sicherheiten bestellen. Dabei wird davon<br />
ausgegangen, es entspricht dem Wesen des Kommunalkredits, dass er ohne Bestellung besonderer Sicherheiten<br />
gewährt wird. Dieser Sachlage liegt die Überlegung zu Grunde, dass die Geme<strong>in</strong>de mit ihrem gesamten<br />
Vermögen und ihren gesamten Erträgen haftet und es ke<strong>in</strong> Insolvenzverfahren über das Vermögen der Geme<strong>in</strong>de<br />
gibt (vgl. § 128 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>), aber auch dass ke<strong>in</strong> Kreditausfallrisiko besteht.<br />
Das Verbot <strong>in</strong> dieser Vorschrift bezieht sich auf die gesamte Kreditwirtschaft der Geme<strong>in</strong>de. Dadurch wird die<br />
Bestellung von Sicherheiten für Kredite für Investitionen (vgl. § 86 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>), für Kredite zur Liquiditätssicherung<br />
(vgl. § 89 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>) sowie für kreditähnliche Rechtsgeschäfte (vgl. § 86 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong>) erfasst.<br />
Unter das Verbot fallen aber auch alle Formen der Bestellung von Sicherheiten, <strong>in</strong>sbesondere die Bestellung<br />
d<strong>in</strong>glicher Sicherheiten oder die Bestellung von Pfandrechten. Rechtsgeschäfte der Geme<strong>in</strong>de, die gegen das<br />
Verbot verstoßen, s<strong>in</strong>d nach § 130 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> nichtig.<br />
5.2 Zu Satz 2 (Ausnahmezulassung vom Verbot des Satzes 1):<br />
Die Aufsichtsbehörde kann aber e<strong>in</strong>e Ausnahme von dem Verbot der Bestellung e<strong>in</strong>er Sicherheit zur Sicherung<br />
e<strong>in</strong>es Kredits zulassen, wenn die Bestellung solcher Sicherheiten der Verkehrsübung im Kreditwesen entspricht<br />
(vgl. § 86 Abs. 5 S. 2 GO <strong>NRW</strong>). Der Verkehrsübung entspricht die Bestellung e<strong>in</strong>er Sicherheit für die Aufnahme<br />
e<strong>in</strong>es Kredits durch die Geme<strong>in</strong>de, wenn diese im Geschäftsverkehr, unter Berücksichtigung der besonderen<br />
Stellung der Geme<strong>in</strong>den im Kreditgeschäft, üblich ist, d.h. der Gläubiger aus Rechtsgründen auf die Bestellung<br />
e<strong>in</strong>er d<strong>in</strong>glichen Sicherheit bestehen muss, z.B. bei Hypotheken für geme<strong>in</strong>dliche Gebäude.<br />
In solchen Fällen s<strong>in</strong>d die speziellen Verhältnisse der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> die Betracht e<strong>in</strong>zubeziehen. Die Zulassung<br />
e<strong>in</strong>er Ausnahme vom Verbot der Bestellung e<strong>in</strong>er Sicherheit bei der Aufnahme e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Kredits wird<br />
durch die Ausnahmeregelung <strong>in</strong> das pflichtgemäße Ermessen der Aufsichtsbehörde gestellt. Liegen die Voraus-<br />
GEMEINDEORDNUNG 409
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 86 GO <strong>NRW</strong><br />
setzungen für die Zulassung e<strong>in</strong>er Ausnahme nicht vor, so ist die Aufsichtsbehörde verpflichtet, die Zulassung<br />
e<strong>in</strong>er Ausnahme zu verweigern.<br />
5.3 Die Nichtigkeit der Bestellung von Sicherheiten<br />
In e<strong>in</strong>em unmittelbaren Zusammenhang mit der geme<strong>in</strong>dlichen Vorschrift über das Verbot der Bestellung von<br />
Sicherheiten zu Gunsten Dritter steht die Vorschrift des § 130 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> über unwirksame Rechtsgeschäfte<br />
der Geme<strong>in</strong>de. Nach dieser besonderen Vorschrift s<strong>in</strong>d die Rechtsgeschäfte der Geme<strong>in</strong>de, die von ihr ohne<br />
die auf Grund von Vorschriften der Geme<strong>in</strong>deordnung erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde abgeschlossen<br />
werden, unwirksam.<br />
In der Vorschrift wird ausdrücklich bestimmt, dass geme<strong>in</strong>dliche Rechtsgeschäfte, die gegen das Verbot der Bestellung<br />
von Sicherheiten für geme<strong>in</strong>dliche Kredite nach § 86 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong> verstoßen, schuldrechtlich und<br />
d<strong>in</strong>glich nichtig s<strong>in</strong>d. Aus der Nennung von bestimmten geme<strong>in</strong>dlichen Sachverhalten <strong>in</strong> der Vorschrift kann zudem<br />
abgeleitet werden, dass bei geme<strong>in</strong>dlichen Rechtsgeschäften die Verletzung anderer geme<strong>in</strong>derechtlicher<br />
Vorschriften nicht zur Nichtigkeit des Rechtsgeschäftes führt. Das auf Grund e<strong>in</strong>es nichtigen Rechtsgeschäfts<br />
bereits Geleistete kann zurück gefordert werden.<br />
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ<br />
GEMEINDEORDNUNG 410
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 87 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 87<br />
Sicherheiten und Gewährleistung für Dritte<br />
(1) 1 Die Geme<strong>in</strong>de darf ke<strong>in</strong>e Sicherheiten zugunsten Dritter bestellen. 2 Die Aufsichtsbehörde kann Ausnahmen<br />
zulassen.<br />
(2) 1 Die Geme<strong>in</strong>de darf Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur im Rahmen der Erfüllung<br />
ihrer Aufgaben übernehmen. 2 Die Entscheidung der Geme<strong>in</strong>de zur Übernahme ist der Aufsichtsbehörde unverzüglich,<br />
spätestens e<strong>in</strong>en Monat vor der rechtsverb<strong>in</strong>dlichen Übernahme, schriftlich anzuzeigen.<br />
(3) Absatz 2 gilt s<strong>in</strong>ngemäß für Rechtsgeschäfte, die den <strong>in</strong> Absatz 2 genannten Rechtsgeschäften wirtschaftlich<br />
gleichkommen, <strong>in</strong>sbesondere für die Zustimmung zu Rechtsgeschäften Dritter, aus denen der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> künftigen<br />
Haushaltsjahren Verpflichtungen zu Leistungen erwachsen können.<br />
Erläuterungen zu § 87:<br />
I. Allgeme<strong>in</strong>es<br />
1. Inhalte der Vorschrift<br />
Mit der Bestellung von Sicherheiten zu Gunsten Dritter übernimmt die Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong> wirtschaftliches Risiko für<br />
fremde Interessen, ohne dass der Bestellung i.d.R. e<strong>in</strong>e entsprechende Gegenleistung gegenüber steht. Durch<br />
solche Rechtsgeschäfte tritt die Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> Haftungsverhältnisse gegenüber Dritten e<strong>in</strong>, <strong>in</strong>sbesondere durch die<br />
Übernahme von Bürgschaften und Gewährverträgen, aber auch durch die Bestellung sonstiger Sicherheiten zu<br />
Gunsten Dritter. Das generelle Verbot e<strong>in</strong>er Bestellung von Sicherheiten soll daher verh<strong>in</strong>dern, dass die Geme<strong>in</strong>de<br />
die Stellung e<strong>in</strong>es Garanten für fremde Interessen erhält.<br />
In der Vorschrift wird das generelle Verbot <strong>in</strong> Absatz 1 jedoch durch die Regelungen <strong>in</strong> den Absätzen 2 und 3<br />
modifiziert. Außerdem ist zugelassen worden, dass die Aufsichtsbehörde Ausnahmen von diesem Verbot zulassen<br />
kann (vgl. Absatz 1 Satz 1). Andererseits s<strong>in</strong>d nach § 130 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> die Rechtsgeschäfte der Geme<strong>in</strong>de,<br />
die gegen das Verbot verstoßen, nichtig. Unter den Begriff „Bestellung von Sicherheiten“ fallen dabei alle<br />
Rechtsgeschäfte der Geme<strong>in</strong>de, der der Sicherung von fremden Verb<strong>in</strong>dlichkeiten dienen. Dazu gehören die<br />
Sicherheitsleistung nach den §§ 232 ff. BGB, die d<strong>in</strong>glichen Sicherheiten im S<strong>in</strong>ne der §§ 1204 ff BGB, aber auch<br />
die Sicherungsübereignung. E<strong>in</strong>e Sicherheitsleistung kann dabei z.B. durch e<strong>in</strong>e H<strong>in</strong>terlegung von Geld oder<br />
Wertgegenständen, Bestellung e<strong>in</strong>er Grundschuld und ähnlichem erfolgen.<br />
2. Nachweis der Haftungsverhältnisse der Geme<strong>in</strong>de<br />
2.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Mit der Bestellung von Sicherheiten zu Gunsten Dritter übernimmt die Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong> wirtschaftliches Risiko für<br />
fremde Interessen. Damit der geme<strong>in</strong>dliche Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger<br />
Buchführung e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und<br />
F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de vermittelt und die wirtschaftliche Lage der Geme<strong>in</strong>de zutreffend beurteilt werden kann,<br />
müssen im geme<strong>in</strong>dlichen Verb<strong>in</strong>dlichkeitenspiegel nach § 47 GemHVO <strong>NRW</strong> die bestehenden Haftungsverhältnisse<br />
der Geme<strong>in</strong>de offen gelegt bzw. nachvollziehbar dargestellt werden. Die notwendige Transparenz für die<br />
Öffentlichkeit wird <strong>in</strong>sbesondere dadurch geschaffen, dass die geme<strong>in</strong>dlichen Haftungsverhältnisse dort gegliedert<br />
nach Arten und unter Angabe des jeweiligen Gesamtbetrages auszuweisen s<strong>in</strong>d.<br />
GEMEINDEORDNUNG 411
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 87 GO <strong>NRW</strong><br />
Wie im handelsrechtlichen S<strong>in</strong>ne unterscheiden sich auch im NKF die Haftungsverhältnisse der Geme<strong>in</strong>de von<br />
ihren Verb<strong>in</strong>dlichkeiten und Rückstellungen durch den Grad der Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit der Inanspruchnahme. Ist der<br />
E<strong>in</strong>tritt der Verpflichtung sicher oder wahrsche<strong>in</strong>lich, ist e<strong>in</strong>e Passivierung <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz geboten.<br />
Für e<strong>in</strong>e solche Prüfung s<strong>in</strong>d Angaben und Erläuterungen zu übernommenen Bürgschaften, bestellten Sicherheiten,<br />
z.B. Grundpfandrechten und Sicherungsübereignungen, sowie zu Gewährverträgen heranzuziehen. Daher ist<br />
bei geme<strong>in</strong>dlichen Haftungsverhältnissen immer das Vorliegen folgender Merkmale zu prüfen (vgl. Abbildung).<br />
Merkmale geme<strong>in</strong>dlicher Haftungsverhältnisse<br />
- Bestehen e<strong>in</strong>er e<strong>in</strong>seitigen vertraglichen Verpflichtung gegenüber e<strong>in</strong>em Dritten, die zu e<strong>in</strong>er<br />
vermögenswirksamen Belastung bei der Geme<strong>in</strong>de führen kann.<br />
- Bei dem Dritten besteht ke<strong>in</strong>e unmittelbare Verpflichtung zu e<strong>in</strong>er Gegenleistung gegenüber<br />
der Geme<strong>in</strong>de.<br />
- Der E<strong>in</strong>tritt der geme<strong>in</strong>dlichen Verpflichtung ist von e<strong>in</strong>em künftigen Ereignis abhängig,<br />
das die Geme<strong>in</strong>de nicht bee<strong>in</strong>flussen kann.<br />
- Es liegen nicht ke<strong>in</strong>e Gegebenheiten dafür vor, dass die geme<strong>in</strong>dliche Verpflichtung als<br />
Verb<strong>in</strong>dlichkeit oder Rückstellung zu bilanzieren ist.<br />
Abbildung 61„Merkmale geme<strong>in</strong>dlicher Haftungsverhältnisse“<br />
Wenn nach den örtlichen Gegebenheiten und unter Beachtung der Bilanzierungsgrundsätze die Haftungsverhältnisse<br />
der Geme<strong>in</strong>de den Status von Rückstellungen oder Verb<strong>in</strong>dlichkeiten erreicht haben, s<strong>in</strong>d sie <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Bilanz auch unter diesen Bilanzposten anzusetzen und nicht mehr nachrichtlich im Verb<strong>in</strong>dlichkeitenspiegel<br />
anzugeben. Der Ausweis der geme<strong>in</strong>dlichen Haftungsverhältnisse liegt im Interesse der Adressaten<br />
des Jahresabschlusses sollte auch unter Berücksichtigung der örtlichen Bedeutung erfolgen.<br />
2.2 Die Quantifizierung der Haftungsverhältnisse<br />
Die Quantifizierung der angabepflichtigen Haftungsverhältnisse der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz oder<br />
im Verb<strong>in</strong>dlichkeitenspiegel hat mit dem Betrag zu erfolgen, für den die Geme<strong>in</strong>de am Abschlussstichtag haftet.<br />
Bezieht sich die Haftung der Geme<strong>in</strong>de auf die Schuld e<strong>in</strong>es Dritten, wie etwa im Fall e<strong>in</strong>er übernommenen Ausfallbürgschaft,<br />
ist e<strong>in</strong>e Betragsangabe <strong>in</strong> Höhe der aktuell gültigen Haftungszusage erforderlich. Die Höhe der<br />
Verb<strong>in</strong>dlichkeit des Dritten, für den die Bürgschaft übernommen wurde, kann am jeweiligen Bilanzstichtag für die<br />
Ermittlung der Betragsangabe dafür herangezogen werden. Für den Nachweis der Verb<strong>in</strong>dlichkeiten aus Bürgschaften<br />
ist e<strong>in</strong> Nachweis über das Bestehen der Hauptschuld erforderlich. Bei e<strong>in</strong>em von der Geme<strong>in</strong>de übernommenen<br />
oder e<strong>in</strong>behaltenen Sicherungsgut richtet sich die Betragsangabe nach der Höhe der bestehenden<br />
Haftung der Geme<strong>in</strong>de und nicht nach dem Wert des (vorhandenem) Sicherungsgutes.<br />
Im Fall e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>zwischen e<strong>in</strong>getretenen Heranziehung der Geme<strong>in</strong>de aus der Übernahme der Haftung für die <strong>in</strong><br />
diesem Umfang e<strong>in</strong>e Verb<strong>in</strong>dlichkeit <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz anzusetzen ist (Teilpassivierung des Haftungsrisikos)<br />
ist im Verb<strong>in</strong>dlichkeitenspiegel lediglich noch das nicht zu passivierte Haftungsvolumen anzugeben. In<br />
solchen Fällen ist aus Transparenzgründen und zur Nachvollziehbarkeit der geme<strong>in</strong>dlichen Haftungsverhältnisse<br />
e<strong>in</strong> Zusammenhang zwischen dem passivierungspflichtigen Teil und den Angaben im Verb<strong>in</strong>dlichkeitenspiegel<br />
herzustellen und zu erläutern. Es soll durch e<strong>in</strong>e solche Offenlegung den Interessen der Adressaten des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Jahresabschluss ausreichend Rechnung getragen werden.<br />
GEMEINDEORDNUNG 412
3. Die Bilanzierung von Sicherungsrechten<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 87 GO <strong>NRW</strong><br />
Bei der Bestellung von Sicherheiten oder Sicherungsrechten an Vermögensgegenständen, z.B. Sicherungsübereignungen<br />
oder Sicherungsabtretungen verbleibt das wirtschaftliche Eigentum grundsätzlich beim Sicherungsgeber.<br />
Daher s<strong>in</strong>d betroffene geme<strong>in</strong>dliche Vermögensgegenstände weiterh<strong>in</strong> <strong>in</strong> der Bilanz der Geme<strong>in</strong>de anzusetzen,<br />
wenn die Geme<strong>in</strong>de als Sicherungsgeber auftritt. Nur <strong>in</strong> den Ausnahmefällen, <strong>in</strong> denen die Vere<strong>in</strong>barung<br />
zwischen dem Sicherungsgeber und dem Sicherungsnehmer etwaige Verfügungsbefugnisse des Sicherungsnehmers<br />
vorsieht, die über den Sicherungszweck h<strong>in</strong>ausgehen, besteht die Möglichkeit der Bilanzierung beim<br />
Sicherungsnehmer. In den Fällen, <strong>in</strong> denen geme<strong>in</strong>dliche Vermögensgegenstände als Sicherheit dienen, ist <strong>in</strong> der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz ke<strong>in</strong>e besondere Kennzeichnung bei den jeweils betroffenen Bilanzposten vorzunehmen.<br />
Es ist als ausreichend anzusehen, wenn im Anhang die entsprechenden Angaben dazu gemacht werden. Dazu<br />
sollte im E<strong>in</strong>zelnen die Art und die Sicherheiten angegeben werden.<br />
4. Abgabe von Erklärungen der Geme<strong>in</strong>de<br />
Die Bestellung von Sicherheiten zugunsten Dritter durch die Geme<strong>in</strong>de, die Übernahme von Bürgschaften und<br />
Verpflichtungen aus Gewährverträgen im Rahmen der Erfüllung der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgaben sowie der Abschluss<br />
von sonstigen Rechtsgeschäften bedürfen der Beteiligung des Rates der Geme<strong>in</strong>de, denn der Rat ist für<br />
die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss von Gewährverträgen und die Bestellung sonstiger Sicherheiten<br />
für andere Rechtsgeschäfte sowie für Rechtsgeschäfte alle<strong>in</strong> zuständig, die den genannten Geschäften wirtschaftlich<br />
gleichkommen (vgl. § 41 Abs. 1 Buchstabe p GO <strong>NRW</strong>) Aus diesen geme<strong>in</strong>dlichen Geschäften entstehen<br />
regelmäßig zukunftsbezogene geme<strong>in</strong>dliche Verpflichtungen, zu deren E<strong>in</strong>verständniserklärung die Schriftform<br />
ausdrücklich gesetzlich bestimmt worden ist (vgl. § 64 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>). Mit dieser gesetzlichen Vorgabe<br />
wird der Zweck verfolgt, die Geme<strong>in</strong>de vor übereilten Erklärungen zu schützen.<br />
Die Geme<strong>in</strong>de soll sich deshalb vor dem Abschluss solcher Rechtsgeschäfte die notwendige Klarheit über den<br />
Inhalt der neuen Verpflichtungen verschaffen und die <strong>in</strong>terne Entscheidungszuständigkeit klären. Die geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Erklärungen, durch welche die Geme<strong>in</strong>de verpflichtet werden soll, s<strong>in</strong>d zudem i.d.R. vom Bürgermeister<br />
oder dem allgeme<strong>in</strong>en Vertreter und e<strong>in</strong>em vertretungsberechtigten Bediensteten zu unterzeichnen, soweit es<br />
sich nicht um e<strong>in</strong> Geschäft der laufenden Verwaltung handelt (vgl. § 64 GO <strong>NRW</strong>). Dabei ist zu beachten, dass<br />
Erklärungen der Geme<strong>in</strong>de, die nicht den Formvorschriften der Geme<strong>in</strong>deordnung entsprechen, nicht die Geme<strong>in</strong>de<br />
b<strong>in</strong>den.<br />
5. Die Nichtigkeit von geme<strong>in</strong>dlichen Rechtsgeschäften<br />
In e<strong>in</strong>em unmittelbaren Zusammenhang mit der geme<strong>in</strong>dlichen Vorschrift über das Verbot der Bestellung von<br />
Sicherheiten zu Gunsten Dritter steht die Vorschrift des § 130 GO <strong>NRW</strong> über unwirksame Rechtsgeschäfte der<br />
Geme<strong>in</strong>de. Nach Absatz 1 dieser besonderen Vorschrift s<strong>in</strong>d die Rechtsgeschäfte der Geme<strong>in</strong>de, die von ihr<br />
ohne die auf Grund von Vorschriften der Geme<strong>in</strong>deordnung erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde<br />
abgeschlossen werden, unwirksam. So würden z.B. privatrechtliche Kaufverträge, die e<strong>in</strong>er Genehmigung der<br />
Aufsichtsbehörde bedürften, bis zur Erteilung der Genehmigung schwebend unwirksam se<strong>in</strong> und bei e<strong>in</strong>er Ablehnung<br />
der Genehmigung sogar endgültig unwirksam.<br />
In Absatz 2 der Vorschrift wird weiter ausdrücklich bestimmt, dass geme<strong>in</strong>dliche Rechtsgeschäfte, die gegen das<br />
Verbot der Bestellung von Sicherheiten zu Gunsten Dritter nach § 87 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> verstoßen, schuldrechtlich<br />
und d<strong>in</strong>glich nichtig s<strong>in</strong>d. Aus der Nennung von bestimmten geme<strong>in</strong>dlichen Sachverhalten <strong>in</strong> der Vorschrift kann<br />
zudem abgeleitet werden, dass bei geme<strong>in</strong>dlichen Rechtsgeschäften die Verletzung anderer geme<strong>in</strong>derechtlicher<br />
Vorschriften nicht zur Nichtigkeit des Rechtsgeschäftes führt. Diese Vorschrift dient auch dem Schutz des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Vermögens im Rahmen der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft.<br />
GEMEINDEORDNUNG 413
II. Erläuterungen im E<strong>in</strong>zelnen<br />
1. Zu Absatz 1 (Bestellung von Sicherheiten):<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 87 GO <strong>NRW</strong><br />
1.1 Zu Satz 1 (Verbot der Bestellung von Sicherheiten):<br />
Dem Verbot dieser Vorschrift liegt die Überlegung zu Grunde, dass die Bestellung von Sicherheiten zu Gunsten<br />
Dritter die Übernahme des wirtschaftlichen Risikos für fremde Interessen bedeutet. Dieses Risiko wird dadurch<br />
deutlicher, dass die Sicherheiten, die e<strong>in</strong> Dritter se<strong>in</strong>en Geschäftspartner bietet, nicht als ausreichend angesehen<br />
werden, so dass der Dritte e<strong>in</strong>e Sicherheitsleistung der Geme<strong>in</strong>de verlangt. Für die Geme<strong>in</strong>de steht ihrer Sicherheitsleistung<br />
<strong>in</strong> der Regel ke<strong>in</strong>e unmittelbare Gegenleistung oder e<strong>in</strong> vermögensmäßiger Zuwachs gegenüber.<br />
Aus Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten und zur Sicherung der künftigen Haushaltswirtschaft, aber auch um auszuschließen,<br />
dass die Geme<strong>in</strong>de die Stellung e<strong>in</strong>es Garanten für Dritte e<strong>in</strong>nimmt, enthält die Geme<strong>in</strong>deordnung<br />
e<strong>in</strong> generelles Verbot der Bestellung von Sicherheiten zu Gunsten Dritter. Wenn aber Haftungsverhältnisse der<br />
Geme<strong>in</strong>de aus der Bestellung von Sicherheiten bestehen, z.B. Grundpfandrechte, Pfandbestellungen an beweglichen<br />
Sachen und Rechten, Sicherungsabtretungen von Forderungen und sonstigen Rechten u.a., müssen diese<br />
im Verb<strong>in</strong>dlichkeitenspiegel nach § 47 GemHVO <strong>NRW</strong> gesondert angegeben werden. Der dabei anzugebende<br />
Betrag wird nicht durch den Wert des Sicherungsgutes, sondern durch die Höhe der Haftung der Geme<strong>in</strong>de bestimmt.<br />
Rechtsgeschäfte der Geme<strong>in</strong>de, die gegen das Verbot verstoßen, s<strong>in</strong>d nach der Vorschrift des § 130 Abs.<br />
2 GO <strong>NRW</strong> nichtig.<br />
1.2 Zu Satz 2 (Zulassung e<strong>in</strong>er Ausnahme vom Verbot):<br />
1.2.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Das Verbot der Bestellung von Sicherheiten wird durch Satz 2 modifiziert, denn die Aufsichtsbehörde kann im<br />
E<strong>in</strong>zelfall e<strong>in</strong>e Ausnahme von dem Verbot <strong>in</strong> Satz 1 zulassen. Die Aufsichtsbehörden haben die ihnen angezeigten<br />
Sicherheitsleistungen bzw. Gewährleistungen für Dritte, für die von der Geme<strong>in</strong>de die Zulassung e<strong>in</strong>er Ausnahme<br />
erbeten wird, nach eigenem Ermessen zu beurteilen. Die Geme<strong>in</strong>de muss aber vor ihrem Begehren versucht<br />
haben, das Risiko für ihre Haushaltswirtschaft möglichst ger<strong>in</strong>g zu halten und dies <strong>in</strong> ihrer Anzeige auch<br />
darlegen. Auch muss e<strong>in</strong> dr<strong>in</strong>gendes Interesse der Geme<strong>in</strong>de vorliegen, dem sonst nicht Rechnung getragen<br />
werden kann. Die Bestellung der Sicherheit muss zudem im Rahmen der Aufgaben der Geme<strong>in</strong>de liegen.<br />
Insbesondere muss bei e<strong>in</strong>em erheblichen Wert der Sicherheit das damit verbundene Risiko für die Geme<strong>in</strong>de im<br />
tragbaren Rahmen liegen. Der Zulassung e<strong>in</strong>er Ausnahme nach dieser Vorschrift bedarf es z.B. nicht, wenn e<strong>in</strong><br />
sonstiges Rechtsgeschäft der Geme<strong>in</strong>de die Übernahme e<strong>in</strong>er Sicherheit für Dritte be<strong>in</strong>haltet, z.B. der Erwerb<br />
e<strong>in</strong>es mit e<strong>in</strong>er Hypothek belasteten Grundstückes. In diesem Fall entsteht ke<strong>in</strong> Rechtsgeschäft der Geme<strong>in</strong>de<br />
über die Bestellung e<strong>in</strong>er Sicherheit, sondern nur über den Erwerb e<strong>in</strong>es belasteten Grundstückes, z.B. im Wege<br />
der Zwangsversteigerung. Gleichwohl muss auch <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em solchen Fall bei der Geme<strong>in</strong>de die Haushaltsverträglichkeit<br />
des Erwerbsgeschäftes gegeben se<strong>in</strong>, <strong>in</strong>sbesondere aber auch die Prüfung e<strong>in</strong>schließen, welche mögliche<br />
Belastungen auf die Geme<strong>in</strong>de auf Grund des Vermögenserwerbs zu kommen und ob sie diese tragen will.<br />
1.2.2 Ke<strong>in</strong>e generelle Ausnahme<br />
1.2.2.1 Die bisherige Rechtsverordnung<br />
Durch e<strong>in</strong>e Rechtsverordnung des Innenm<strong>in</strong>isteriums vom 27.11.1996, die bis zum 31.12.2009 befristet war, ist<br />
zugelassen worden, dass geme<strong>in</strong>deeigene Grundstücke mit ihrer Veräußerung zur F<strong>in</strong>anzierung des Kaufpreises<br />
GEMEINDEORDNUNG 414
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 87 GO <strong>NRW</strong><br />
mit Grundpfandrechten belastet werden können, ohne dass es der aufsichtsbehördlichen Zulassung e<strong>in</strong>er Ausnahme<br />
von dem Verbot der Bestellung von Sicherheiten zu Gunsten Dritter bedarf. Danach durften geme<strong>in</strong>deeigene<br />
Grundstücke oder Erbbaurechte bei ihrer Veräußerung zur F<strong>in</strong>anzierung des Kaufpreises mit Grundpfandrechten<br />
belastet werden, ohne dass es der aufsichtsbehördlichen Zulassung e<strong>in</strong>er Ausnahme gemäß § 87 Abs. 1<br />
der Geme<strong>in</strong>deordnung bedurfte.<br />
Der Ausgangspunkt war dabei, dass bei Grundstücksverkäufen der Geme<strong>in</strong>de zur Übertragung des Eigentums an<br />
dem betreffenden Grundstück e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>igung der Geme<strong>in</strong>de und des Dritten als Erwerber (Auflassung nach § 925<br />
BGB) über den E<strong>in</strong>tritt der Rechtsänderung und die E<strong>in</strong>tragung der Rechtsänderung <strong>in</strong> das Grundbuch erforderlich<br />
ist (vgl. § 871 Abs. 1 BGB). Vor der E<strong>in</strong>tragung <strong>in</strong> das Grundbuch s<strong>in</strong>d die Beteiligten an die E<strong>in</strong>igung nur<br />
gebunden, wenn die Erklärungen notariell beurkundet oder vor dem Grundbuchamt abgegeben oder bei diesem<br />
e<strong>in</strong>gereicht s<strong>in</strong>d oder wenn der Berechtigte dem anderen Teil e<strong>in</strong>e den Vorschriften der Grundbuchordnung entsprechende<br />
E<strong>in</strong>tragungsbewilligung ausgehändigt hat (vgl. § 873 BGB).<br />
Die Geme<strong>in</strong>de als Veräußerer kann sich dadurch absichern, dass sie die E<strong>in</strong>tragung des Erwerbers (Vormerkung)<br />
erst zulässt, wenn die F<strong>in</strong>anzierung des Grundstückskaufs gesichert ist. Der Verzicht auf die Zulassung e<strong>in</strong>er<br />
Ausnahme be<strong>in</strong>haltete dabei als Voraussetzung, dass der Kaufpreis unmittelbar an die Geme<strong>in</strong>de oder auf e<strong>in</strong><br />
Notaranderkonto gezahlt wird und der Grundpfandrechtsgläubiger hierfür unwiderruflich e<strong>in</strong>steht und der Erwerber<br />
die Kosten trägt (vgl. § 1 der „Verordnung über Ausnahmen vom Verbot der Bestellung von Sicherheiten<br />
zugunsten Dritter durch Geme<strong>in</strong>den“ - GV. <strong>NRW</strong>. 1996 S. 519; SGV. <strong>NRW</strong>. 640). Etwaige Vertragsentwürfe der<br />
Geme<strong>in</strong>de, die solche Bestimmungen enthalten, hatte die Geme<strong>in</strong>de ihrer Aufsichtsbehörde spätestens e<strong>in</strong>en<br />
Monat vor dem rechtsverb<strong>in</strong>dlichen Vertragsabschluss anzuzeigen (vgl. § 2 der Verordnung).<br />
1.2.2.2 Die Anwendung der Ausnahmekriterien<br />
Nach dem Wegfall dieser Verordnung hat die Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> solchen Fällen und bei örtlichem Bedarf wieder die<br />
Zulassung e<strong>in</strong>er Ausnahme vom Verbot der Bestellung von Sicherheiten bei ihrer Aufsichtsbehörde nach § 87<br />
Abs. 1 S. 2 GO <strong>NRW</strong> zu beantragen. Der Text der Rechtsverordnung vom 27. November 1996 hatte folgenden<br />
Wortlaut (vgl. Abbildung).<br />
Verordnung über Ausnahmen vom Verbot<br />
der Bestellung von Sicherheiten<br />
zugunsten Dritter durch Geme<strong>in</strong>den<br />
§ 1<br />
Geme<strong>in</strong>deeigene Grundstücke oder Erbbaurechte können bei ihrer Veräußerung zur F<strong>in</strong>anzierung des<br />
Kaufpreises mit Grundpfandrechten belastet werden, ohne dass es der aufsichtsbehördlichen Zulassung<br />
e<strong>in</strong>er Ausnahme von dem Verbot der Bestellung von Sicherheiten zugunsten Dritter gemäß § 87 Abs. 1<br />
der Geme<strong>in</strong>deordnung bedarf. Voraussetzung ist, dass<br />
1. der Kaufpreis unmittelbar an die Geme<strong>in</strong>de oder auf e<strong>in</strong> Notaranderkonto gezahlt<br />
wird und der Grundpfandrechtsgläubiger hierfür unwiderruflich e<strong>in</strong>steht,<br />
2. der Erwerber die Kosten trägt.<br />
§ 2<br />
Vertragsentwürfe, die solche Bestimmungen enthalten, hat die Geme<strong>in</strong>de der Aufsichtsbehörde unverzüglich,<br />
spätestens e<strong>in</strong>en Monat vor dem rechtsverb<strong>in</strong>dlichen Vertragsabschluss, schriftlich anzuzeigen.<br />
§ 3<br />
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung <strong>in</strong> Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember<br />
2009 außer Kraft.<br />
Abbildung 62 „Außer Kraft getretene Verordnung“<br />
GEMEINDEORDNUNG 415
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 87 GO <strong>NRW</strong><br />
Es bietet sich an, dass die Aufsichtsbehörde <strong>in</strong> vergleichbaren Fällen wie sie bisher durch die Rechtsverordnung<br />
abgedeckt waren die dort genannten Kriterien bei ihrer Abwägung und Erteilung der Zulassung e<strong>in</strong>er Ausnahme<br />
zur Bestellung e<strong>in</strong>er Sicherheiten zugunsten Dritter durch die Geme<strong>in</strong>de weiter handhabt wie sie bei der nicht<br />
mehr geltenden Verordnung zur Anwendung kamen.<br />
1.3 Die Nichtigkeit der Bestellung von Sicherheiten<br />
In e<strong>in</strong>em unmittelbaren Zusammenhang mit der geme<strong>in</strong>dlichen Vorschrift über das Verbot der Bestellung von<br />
Sicherheiten zu Gunsten Dritter steht die Vorschrift des § 130 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> über unwirksame Rechtsgeschäfte<br />
der Geme<strong>in</strong>de. Nach dieser besonderen Vorschrift s<strong>in</strong>d die Rechtsgeschäfte der Geme<strong>in</strong>de, die von ihr ohne<br />
die auf Grund von Vorschriften der Geme<strong>in</strong>deordnung erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde abgeschlossen<br />
werden, unwirksam.<br />
Es wird zudem ausdrücklich bestimmt, dass geme<strong>in</strong>dliche Rechtsgeschäfte, die gegen das Verbot der Bestellung<br />
von Sicherheiten zu Gunsten Dritter nach § 87 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> verstoßen, schuldrechtlich und d<strong>in</strong>glich nichtig<br />
s<strong>in</strong>d. Aus der Nennung von bestimmten geme<strong>in</strong>dlichen Sachverhalten <strong>in</strong> der Vorschrift kann zudem abgeleitet<br />
werden, dass bei geme<strong>in</strong>dlichen Rechtsgeschäften die Verletzung anderer geme<strong>in</strong>derechtlicher Vorschriften nicht<br />
zur Nichtigkeit des Rechtsgeschäftes führt. Das auf Grund e<strong>in</strong>es nichtigen Rechtsgeschäfts bereits Geleistete<br />
kann zurück gefordert werden.<br />
2. Zu Absatz 2 (Bürgschaften und Gewährverträge):<br />
2.1 Zu Satz 1 (Übernahme und geme<strong>in</strong>dliche Aufgabenerfüllung):<br />
Die Übernahme von Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen bedeutet immer e<strong>in</strong> Risiko für die<br />
Geme<strong>in</strong>de. Daher kommen für die Geme<strong>in</strong>de derartige Rechtsgeschäfte nur <strong>in</strong> Betracht, wenn das Risiko haushaltswirtschaftlich<br />
tragbar ist und die Übernahme im Rahmen der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgabenerfüllung liegt. Es bedarf<br />
e<strong>in</strong>er Beteiligung der Entscheidung der Aufsichtsbehörde bei der Übernahme von Bürgschaften und Verpflichtungen<br />
aus Gewährverträgen durch die Geme<strong>in</strong>de. Die Übernahme e<strong>in</strong>er Bürgschaft durch die Geme<strong>in</strong>de<br />
führt nicht dazu, dass aus Anlass der Übernahme e<strong>in</strong>e Veranschlagung im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan notwendig<br />
wird. Dies ist erst gegeben, wenn die Geme<strong>in</strong>de als Bürge zu Leistungen herangezogen wird.<br />
2.1.1 Die Übernahme von Bürgschaften<br />
Die Vorschrift stellt die Übernahme von Bürgschaften durch die Geme<strong>in</strong>de von dem Verbot des Absatzes 1 frei,<br />
wenn die Geme<strong>in</strong>de diese im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen will. In diesen Fällen wird die<br />
Übernahme e<strong>in</strong>er Bürgschaft durch die Geme<strong>in</strong>de jedoch zugleich der Anzeigepflicht an ihre Aufsichtsbehörde<br />
unterworfen. Die besondere Festlegung, dass die Übernahme von Bürgschaften nur im Rahmen der Erfüllung der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Aufgaben zulässig ist, soll dazu beitragen, dass die Geme<strong>in</strong>den e<strong>in</strong> Risiko für Dritte nur dann<br />
übernehmen, wenn wegen ihrer Aufgabenerfüllung e<strong>in</strong> unmittelbares eigenes Interesse besteht. Durch e<strong>in</strong>en<br />
schriftlichen Bürgschaftsvertrag verpflichtet sich die Geme<strong>in</strong>de als Bürge gegenüber dem Gläubiger e<strong>in</strong>es Dritten,<br />
für die Erfüllung bestimmter Verb<strong>in</strong>dlichkeiten des Dritten e<strong>in</strong>zustehen (vgl. § 766 BGB).<br />
Der Gegenstand des schriftlichen Bürgschaftsvertrages darf <strong>in</strong> den Fällen, <strong>in</strong> denen e<strong>in</strong>e Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>e Bürgschaft<br />
übernimmt, nur e<strong>in</strong>e modifizierte Ausfallbürgschaft mit E<strong>in</strong>redeverzicht und ke<strong>in</strong>e selbstschuldnerische<br />
Bürgschaft se<strong>in</strong>. Außerdem muss die Geme<strong>in</strong>de bei der Übernahme von Bürgschaften für ihre geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Betriebe darauf achten, dass sie bei e<strong>in</strong>er anteiligen Beteiligung auch nur entsprechend ihrer Anteile die Bürgschaft<br />
übernimmt. Die Geme<strong>in</strong>de muss vor e<strong>in</strong>er Bürgschaftsübernahme zudem prüfen, ob das europäische Bei-<br />
GEMEINDEORDNUNG 416
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 87 GO <strong>NRW</strong><br />
hilferecht dadurch berührt wird. Ob darüber h<strong>in</strong>aus wegen des Risikos für die Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de<br />
weitere E<strong>in</strong>schränkungen im Rahmen e<strong>in</strong>er Bürgschaftsübernahme gelten müssen, muss der Beurteilung im<br />
E<strong>in</strong>zelfall überlassen bleiben. Für den Nachweis der Verpflichtungen aus Bürgschaften ist e<strong>in</strong> Nachweis über das<br />
Bestehen der Hauptschuld erforderlich.<br />
Bei der Übernahme von Bürgschaften zu Gunsten von Betrieben, die von der Geme<strong>in</strong>de errichtet oder an denen<br />
die Geme<strong>in</strong>de beteiligt ist, soll die Bürgschaft i.d.R. grundsätzlich nur entsprechend dem geme<strong>in</strong>dlichen Anteil an<br />
dem jeweiligen geme<strong>in</strong>dlichen Betrieb übernommen werden. Dieser Grundsatz bedeutet, dass <strong>in</strong> besonderen<br />
E<strong>in</strong>zelfällen aus den örtlichen Gegebenheiten heraus ggf. Abweichungen bei der Bemessung der Bürgschaft der<br />
Geme<strong>in</strong>de nach ihrem Beteiligungsverhältnis möglich s<strong>in</strong>d. Sie s<strong>in</strong>d daran zu messen, dass auch <strong>in</strong> diesen Fällen<br />
die Bürgschaftsübernahme <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang mit der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgabenerfüllung stehen muss. In den Fällen, <strong>in</strong><br />
denen dagegen ke<strong>in</strong>e Beteiligung an e<strong>in</strong>em Unternehmen nach dem privaten Recht besteht, darf die Geme<strong>in</strong>de<br />
zu Gunsten e<strong>in</strong>es solchen Betriebes ke<strong>in</strong>e Bürgschaften im Rahmen ihrer geme<strong>in</strong>dlichen Aufgabenerfüllung übernehmen.<br />
Ob es auch <strong>in</strong> solchen Fällen möglich ist, von der Regel abzuweichen, kann nur im speziellen örtlichen<br />
E<strong>in</strong>zelfall geklärt werden.<br />
2.1.2 Die Übernahme von Verpflichtungen aus Gewährverträgen<br />
Die Vorschrift stellt die Übernahme von Verpflichtungen aus Gewährverträgen, die e<strong>in</strong> anderes Rechtsverhältnis<br />
als die Bürgschaften darstellen, obwohl sie mit diesen verwandt s<strong>in</strong>d, von dem Verbot des Absatzes 1 frei, wenn<br />
die Geme<strong>in</strong>de diese im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen will. In diesen Fällen wird die Übernahme<br />
von Verpflichtungen aus Gewährverträgen durch die Geme<strong>in</strong>de jedoch zugleich der Anzeigepflicht an ihre<br />
Aufsichtsbehörde unterworfen. Die Festlegung, dass die Übernahme von Verpflichtungen aus Gewährverträgen<br />
nur im Rahmen der Erfüllung der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgaben zulässig ist, soll dazu beitragen, dass die Geme<strong>in</strong>den<br />
e<strong>in</strong> Risiko für Dritte nur dann übernehmen, wenn wegen ihrer Aufgabenerfüllung e<strong>in</strong> unmittelbares eigenes Interesse<br />
besteht.<br />
In e<strong>in</strong>em Gewährvertrag oder Garantievertrag verpflichtet sich die Geme<strong>in</strong>de als Schuldner, für e<strong>in</strong>en Erfolg e<strong>in</strong>zustehen<br />
oder die Gewähr für e<strong>in</strong>en künftigen, noch nicht entstandenen Schaden zu übernehmen, der dem Anderen<br />
aus e<strong>in</strong>em Vorgang erwächst. Der Schuldner ist im Falle der Gewährleistung verpflichtet, den Gläubiger so zu<br />
stellen, als ob der mögliche Erfolg e<strong>in</strong>getreten oder e<strong>in</strong> Schaden nicht entstanden wäre. Zu diesen Rechtsverhältnissen<br />
gehören die Haftungsübernahme, die Patronatserklärung, die Erwerbsverpflichtung, die Garantieversprechen,<br />
deren Umfang unter der Zugrundelegung ungünstiger Umstände zu bestimmen ist. In der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Praxis werden deshalb unter dem Begriff „Gewährleistungsverträge“ e<strong>in</strong>e Vielzahl unterschiedlicher Vere<strong>in</strong>barungen<br />
verstanden und abgeschlossen, bei denen immer e<strong>in</strong>e Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>er der Vertragspartner ist.<br />
2.2 Zu Satz 2 (Anzeigepflicht gegenüber der Aufsichtsbehörde):<br />
Nach der Vorschrift hat die Geme<strong>in</strong>de die Entscheidung zur Übernahme von Bürgschaften oder von Verpflichtungen<br />
aus e<strong>in</strong>em Gewährvertrag ihrer Aufsichtsbehörde unverzüglich, spätestens e<strong>in</strong>en Monat vor der rechtsverb<strong>in</strong>dlichen<br />
Übernahme, schriftlich anzuzeigen. Dieses ist notwendig, denn der E<strong>in</strong>gang solcher Verpflichtungen<br />
durch die Geme<strong>in</strong>de bedarf weder e<strong>in</strong>er Festsetzung <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung noch e<strong>in</strong>er Veranschlagung<br />
im Haushaltsplan der Geme<strong>in</strong>de. Wegen der aus solchen Verträgen möglicherweise entstehenden<br />
f<strong>in</strong>anziellen Verpflichtungen, die bei e<strong>in</strong>er Inanspruchnahme der Geme<strong>in</strong>de aus Bürgschafts- oder Gewährverträgen<br />
ggf. erhebliche Auswirkungen auf die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft haben können, ist die gesetzliche<br />
Festlegung e<strong>in</strong>er vorherigen Anzeigepflicht geboten und sachgerecht.<br />
GEMEINDEORDNUNG 417
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 87 GO <strong>NRW</strong><br />
2.3 Bürgschaften der Geme<strong>in</strong>de und europäisches Beihilferecht<br />
2.3.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Gemäß Artikel 87 des EG–Vertrages s<strong>in</strong>d auch aus geme<strong>in</strong>dlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art,<br />
die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder<br />
zu verfälschen drohen, mit dem Geme<strong>in</strong>samen Markt unvere<strong>in</strong>bar, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten<br />
bee<strong>in</strong>trächtigen. Unter Beihilfen versteht das europäische Wettbewerbsrecht dabei auch alle von der Geme<strong>in</strong>de<br />
gewährte Vorteile, die <strong>in</strong> verschiedener Form die Belastungen verm<strong>in</strong>dern, die e<strong>in</strong> Unternehmen normalerweise<br />
zu tragen hat. Aus geme<strong>in</strong>dlichen Mitteln gewährte Bürgschaften und Garantien stellen e<strong>in</strong>e der Kontrolle der<br />
Kommission unterliegende Beihilfe für den Darlehensnehmer dar, soweit sie ihn <strong>in</strong> die Lage versetzen, e<strong>in</strong> Darlehen<br />
zu erhalten, ihm den Vorteil e<strong>in</strong>es günstigeren Darlehens verschaffen, ihm die Leistung anderer Sicherheiten<br />
ersparen oder sie ihm "kostenlos" ohne angemessene Risikoprämie bewilligt werden.<br />
2.3.2 Bürgschaften nicht staatliche Beihilfe<br />
2.3.2.1 E<strong>in</strong>zelbürgschaften<br />
Die Europäische Kommission geht beim Vorliegen bestimmter Voraussetzungen davon aus, dass die von der<br />
Geme<strong>in</strong>de für ihre Betriebe übernommenen Bürgschaften nicht als staatliche Beihilfen zu bewerten s<strong>in</strong>d (vgl.<br />
Bürgschaftsmitteilung der Kommission vom 20.06.2008). Bei der Prüfung des Vorliegens der Voraussetzungen ist<br />
auch zu unterscheiden, ob die Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>e Bürgschaft als „Ad-hoc-E<strong>in</strong>zelbürgschaft“ oder auf Grund e<strong>in</strong>er<br />
erlassenen Bürgschaftsregelung übernimmt. E<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>zelbürgschaft der Geme<strong>in</strong>de wird dann nicht als staatliche<br />
Beihilfe bewertet, wenn bei ihrer Gewährung bestimmte Bed<strong>in</strong>gungen kumulativ erfüllt s<strong>in</strong>d (vgl. Abbildung).<br />
E<strong>in</strong>zelbürgschaften und staatliche Beihilfe<br />
E<strong>in</strong>zelbürgschaften der Geme<strong>in</strong>de s<strong>in</strong>d ke<strong>in</strong>e staatliche Beihilfe, wenn<br />
- der geme<strong>in</strong>dliche Betrieb sich nicht <strong>in</strong> f<strong>in</strong>anziellen Schwierigkeiten bef<strong>in</strong>det<br />
- die Bürgschaft an e<strong>in</strong> bestimmtes Darlehen mit festgelegtem Höchstbetrag und Laufzeit geknüpft ist<br />
- der geme<strong>in</strong>dliche Betrieb e<strong>in</strong> Eigenobligo von 20 v.H trägt, d.h. es dürfen nur 80 v.H. der Darlehenssumme<br />
verbürgt werden<br />
- der geme<strong>in</strong>dliche Betrieb e<strong>in</strong>e marktübliche Prämie für die Bürgschaft zahlt<br />
2.3.2.2 Örtliche Bürgschaftsrichtl<strong>in</strong>ien<br />
Abbildung 63 „E<strong>in</strong>zelbürgschaften und staatliche Beihilfe“<br />
Die Übernahme e<strong>in</strong>er Bürgschaft durch die Geme<strong>in</strong>de auf Grund e<strong>in</strong>er von der Geme<strong>in</strong>de erlassenen abstrakten<br />
Regelung, z.B. Bürgschaftsrichtl<strong>in</strong>ien, soll grundsätzlich <strong>in</strong> allgeme<strong>in</strong>er Form durch örtliche Bürgschaftsrichtl<strong>in</strong>ien<br />
ermöglicht werden. E<strong>in</strong>e solche geme<strong>in</strong>dliche Regelung bedarf wegen ihrer Bedeutung e<strong>in</strong>es Ratsbeschlusses. In<br />
solchen Fällen wird e<strong>in</strong>e Bürgschaft nicht als e<strong>in</strong>e staatliche Beihilfe bewertet, wenn bestimmte Bed<strong>in</strong>gungen<br />
kumulativ erfüllt s<strong>in</strong>d (vgl. Abbildung).<br />
GEMEINDEORDNUNG 418
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 87 GO <strong>NRW</strong><br />
Bürgschaftsrichtl<strong>in</strong>ien und staatliche Beihilfe<br />
Bürgschaften der Geme<strong>in</strong>de bei Bürgschaftsrichtl<strong>in</strong>ien s<strong>in</strong>d ke<strong>in</strong>e staatliche Beihilfe, wenn<br />
- der geme<strong>in</strong>dliche Betrieb sich nicht <strong>in</strong> f<strong>in</strong>anziellen Schwierigkeiten bef<strong>in</strong>det<br />
- die Bürgschaft an e<strong>in</strong> bestimmtes Darlehen mit festgelegtem Höchstbetrag und Laufzeit geknüpft ist<br />
- der geme<strong>in</strong>dliche Betrieb e<strong>in</strong> Eigenobligo von 20 v.H trägt, d.h. es dürfen nur 80 v.H. der Darlehenssumme<br />
verbürgt werden<br />
- die örtliche Regelung so gestaltet ist, dass sich die vorgenommenen Bürgschaftsgeschäfte auf der Grundlage<br />
e<strong>in</strong>er Risikobewertung selbst f<strong>in</strong>anzieren (Ausgleich der Verwaltungskosten, angemessener Kapitalertrag)<br />
- m<strong>in</strong>destens jährlich anhand der tatsächlichen Ausfallquote geprüft wird, ob die Höhe der Prämien angemessen<br />
ist<br />
- die örtliche Regelung auch e<strong>in</strong>e Anpassung der Prämien ermöglich<br />
- die örtliche Regelung festlegt, unter welchen Bed<strong>in</strong>gungen Verpflichtungen aus Gewährverträgen übernommen<br />
werden, e<strong>in</strong>schließlich der Festlegung der Förderfähigkeit geme<strong>in</strong>dlicher Betriebe nach Maßgabe der Bonität,<br />
des Höchstbetrages und der Laufzeit der Verträge u.a.<br />
Abbildung 64 „Bürgschaftsrichtl<strong>in</strong>ien und staatliche Beihilfe“<br />
2.3.3 Bürgschaften und die „De-m<strong>in</strong>imis“- Regelung<br />
Die Übernahme e<strong>in</strong>er Bürgschaft durch die Geme<strong>in</strong>de wird auch nicht als e<strong>in</strong>e staatliche Beihilfe bewertet, wenn<br />
sie nicht auf Grund e<strong>in</strong>er Bürgschaftsrichtl<strong>in</strong>ie gewährt wird, aber die Voraussetzungen der „De-m<strong>in</strong>imis“-<br />
Verordnung erfüllt. Dabei darf es sich aber nicht um E<strong>in</strong>zelbürgschaften (s.o.) handeln. Außerdem darf es sich bei<br />
dem geme<strong>in</strong>dlichen Betrieb nicht um e<strong>in</strong>en Betrieb <strong>in</strong> Schwierigkeiten handeln. In den Fällen der Bürgschaftsgewährung<br />
darf<br />
- der verbürgte Teil des Darlehens, für das im Rahmen der örtlichen Regelung e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>zelbürgschaft gewährt<br />
wird, den Betrag i.H.v. 1,5 Mio. Euro (für den Straßentransportsektor 0,75 Mio. Euro) nicht übersteigen,<br />
- muss der geme<strong>in</strong>dliche Betrieb e<strong>in</strong> Eigenobligo von 20 v.H tragen, d.h. es dürfen nur 80 v.H. der Darlehenssumme<br />
verbürgt werden.<br />
Liegen diese Fälle vor, bedarf die Übernahme e<strong>in</strong>er Bürgschaft durch die Geme<strong>in</strong>de ke<strong>in</strong>er Notifizierung durch die<br />
Europäische Kommission.<br />
2.3.4 Sonderfall: Bürgschaften für Betriebe <strong>in</strong> Schwierigkeiten<br />
Bei Bürgschaften der Geme<strong>in</strong>de zu Gunsten e<strong>in</strong>es Betriebes <strong>in</strong> Schwierigkeiten, ist e<strong>in</strong>e umfassende Prüfung<br />
erforderlich, ob die Gewährung e<strong>in</strong>er geme<strong>in</strong>dlichen Bürgschaft als staatliche Beihilfe zu bewerten ist oder nicht,<br />
und ggf. e<strong>in</strong>e Notifizierung bei der Europäischen Kommission erforderlich macht. Dazu und auch zur Ermittlung<br />
des Beihilfewertes sowie zu den möglichen Rechtsfolgen aus der Gewährung von Bürgschaften im H<strong>in</strong>blick auf<br />
das europäische Beihilferecht gibt e<strong>in</strong>e Handreichung des MWME <strong>NRW</strong> und des IM <strong>NRW</strong> umfassend Auskunft.<br />
Durch die <strong>in</strong> der Handreichung enthaltenen erläuternden H<strong>in</strong>weise soll den Geme<strong>in</strong>den e<strong>in</strong>e Hilfestellung an die<br />
Hand gegeben werden, um bei der Übernahme von Bürgschaften auch das Europäische Beihilferecht zutreffend<br />
GEMEINDEORDNUNG 419
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 87 GO <strong>NRW</strong><br />
anzuwenden. Die Handreichung „Zur Beurteilung kommunaler Bürgschaften im H<strong>in</strong>blick auf das Europäische<br />
Beihilfenrecht auf der Grundlage der Bürgschaftsmitteilung der Europäischen Kommission aus Juni 2008 (Abl. EU<br />
2008/C 155/10)“ ist unter der Internetadresse beider M<strong>in</strong>isterien verfügbar.<br />
2.3.5 Notifizierung geme<strong>in</strong>dlicher Bürgschaften<br />
Die Übernahme e<strong>in</strong>er Bürgschaft durch die Geme<strong>in</strong>de, bei der die Merkmale e<strong>in</strong>er staatlichen Beihilfe nach den<br />
Bestimmungen der Europäischen Kommission erfüllt s<strong>in</strong>d, bedarf vor ihrer Übernahme der Genehmigung der<br />
Europäischen Kommission (Notifizierung). Sie ist unabhängig von der Anzeige der geme<strong>in</strong>dlichen Entscheidung<br />
über die Übernahme e<strong>in</strong>er Bürgschaft bei ihrer Aufsichtsbehörde durchzuführen. Vor der Genehmigung durch die<br />
Europäische Kommission s<strong>in</strong>d alle Maßnahmen zu unterlassen, die e<strong>in</strong>en Rechtsanspruch auf e<strong>in</strong>e Übernahme<br />
der Bürgschaft durch die Geme<strong>in</strong>de begründen könnten. Dagegen s<strong>in</strong>d rechtlich unverb<strong>in</strong>dliche und als solche<br />
gekennzeichnete Absichtserklärungen, z.B. e<strong>in</strong> „letter of <strong>in</strong>tent“, als zulässig anzusehen.<br />
3. Zu Absatz 3 (Übernahme von Verpflichtungen aus anderen Rechtsgeschäften):<br />
3.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die Vorschrift erstreckt die Anzeigepflicht des Absatzes 2 auf weitere Rechtsgeschäfte der Geme<strong>in</strong>de, die Bürgschaften<br />
und Verpflichtungen aus Gewährverträgen wirtschaftlich gleichkommen. Hierunter fallen z.B. Erfüllungsübernahmen<br />
sowie Schuldübernahmen. Zudem wird <strong>in</strong> der Vorschrift besonders die Zustimmung zu Rechtsgeschäften<br />
Dritter herausgestellt, aus denen der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> künftigen Haushaltsjahren Verpflichtungen zu Leistungen<br />
erwachsen können.<br />
Es wird dabei davon ausgegangen, dass die Aufgabenerledigung auf Dritte <strong>in</strong> eigener Verantwortung übertragen<br />
wird, die Geme<strong>in</strong>de jedoch subsidiär für Verb<strong>in</strong>dlichkeiten, die aus der Durchführung dieser Aufgabenerledigung<br />
entstehen, haftet. Zu solchen Gegebenheiten s<strong>in</strong>d z.B. Sanierungsträgerverträge oder Entwicklungsträgerverträge<br />
zu zählen, soweit sie Kredit- oder Haftungsverpflichtungen der Geme<strong>in</strong>de begründen. Die Geme<strong>in</strong>de darf <strong>in</strong><br />
solchen Fällen ihre Zustimmung nur nach Anzeige an die Aufsichtsbehörde erteilen. Wegen der wirtschaftlichen<br />
Bedeutung und den möglicherweise erheblichen Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage der Geme<strong>in</strong>de sollte<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Zustimmung e<strong>in</strong>e sorgfältige Prüfung vorausgehen.<br />
3.2 Schuldübernahmen und Schuldbeitritt<br />
Der Geme<strong>in</strong>de ist es möglich, Schulden e<strong>in</strong>es Dritten, z.B. e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Betriebes, im Rahmen ihrer anteiligen<br />
Beteiligung an diesem Betrieb zu übernehmen. Die zivilrechtlich geregelte befreiende Schuldübernahme<br />
nach § 414 BGB ist dabei das Gegenstück zur Abtretung auf Schuldnerseite. Sie führt zu e<strong>in</strong>em Austausch des<br />
Schuldners, so dass <strong>in</strong> diesen Fällen die Geme<strong>in</strong>de als Übernehmende an die Stelle des bisherigen Schuldners<br />
tritt. Dieser scheidet dann aus dem bestehenden Schuldverhältnis aus.<br />
Diese „befreiende“ Schuldübernahme dient somit <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie den Interessen des „Altschuldners“. Von der<br />
Schuldübernahme muss der Schuldbeitritt (kumulative Schuldübernahme) unterschieden werden, der auch durch<br />
die Geme<strong>in</strong>de möglich ist. Beim Schuldbeitritt tritt e<strong>in</strong> weiterer Schuldner neben den bisherigen Schuldner. Der<br />
Schuldbeitritt führt also nicht zu e<strong>in</strong>em Schuldnerwechsel, sondern zu e<strong>in</strong>er Schuldnermehrheit, so dass diese<br />
e<strong>in</strong>e Gesamtschuld im S<strong>in</strong>ne des § 421 BGB tragen. Damit dient der Schuldbeitritt eher als Sicherungsmittel den<br />
Interessen des Gläubigers, dem jetzt zwei Vermögensmassen zur Befriedigung zur Verfügung stehen.<br />
GEMEINDEORDNUNG 420
3.3 Erfüllungsübernahmen<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 87 GO <strong>NRW</strong><br />
Der Geme<strong>in</strong>de ist es möglich, Schulden e<strong>in</strong>es Dritten, z.B. e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Betriebes, im Rahmen ihrer anteiligen<br />
Beteiligung an diesem Betrieb zu erfüllen. Bei der so genannten Erfüllungsübernahme (vgl. § 329 BGB)<br />
verpflichtet sich die Geme<strong>in</strong>de als Übernehmende gegenüber dem Schuldner, diesen von se<strong>in</strong>er Schuld zu befreien.<br />
Der Schuldner hat damit e<strong>in</strong>en Anspruch gegen die Geme<strong>in</strong>de als Übernehmende und zwar darauf, dass<br />
diese se<strong>in</strong>e Schuld gegenüber dem Gläubiger erfüllt. Die Geme<strong>in</strong>de ist dadurch nicht Schuldner gegenüber dem<br />
Gläubiger e<strong>in</strong>es Dritten. Die Verpflichtung der Geme<strong>in</strong>de wirkt daher nur im Verhältnis zwischen ihr als Übernehmende<br />
und dem Schuldner, jedoch nicht gegenüber dem Gläubiger. Der Gläubiger erwirbt daher ke<strong>in</strong>en Anspruch<br />
gegen die Geme<strong>in</strong>de als Übernehmende und kann von ihr auch ke<strong>in</strong>e Leistung e<strong>in</strong>fordern. Die Erfüllungsübernahme<br />
dient somit <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie den Interessen des Schuldners.<br />
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ<br />
GEMEINDEORDNUNG 421
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 88 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 88<br />
Rückstellungen<br />
Für dem Grunde oder der Höhe nach ungewisse Verb<strong>in</strong>dlichkeiten, für drohende Verluste aus schwebenden<br />
Geschäften oder laufenden Verfahren oder für bestimmte Aufwendungen hat die Geme<strong>in</strong>de Rückstellungen <strong>in</strong><br />
angemessener Höhe zu bilden.<br />
Erläuterungen zu § 88:<br />
1. Grundlagen der Rückstellungsbildung<br />
1.1 Erfordernisse für die Rückstellungsbildung<br />
Zum vollständigen Ressourcenverbrauch der Geme<strong>in</strong>de gehört auch die Bildung von Rückstellungen für Verpflichtungen,<br />
deren E<strong>in</strong>tritt dem Grunde nach zu erwarten ist, deren Höhe und Fälligkeitsterm<strong>in</strong> jedoch noch ungewiss,<br />
aber dennoch ausreichend sicher s<strong>in</strong>d, die wirtschaftliche Ursache aber bereits e<strong>in</strong>getreten ist. Durch die<br />
Bildung von Rückstellungen durch die Geme<strong>in</strong>de werden die geme<strong>in</strong>dlichen Aufwendungen der Verursachungsperiode<br />
(Haushaltsjahr) zugerechnet und nur <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Ergebnisrechnung erfasst, obwohl die entsprechenden<br />
Leistungen der Geme<strong>in</strong>de an Dritte erst zu e<strong>in</strong>em späteren Zeitpunkt erfolgen, und dann regelmäßig<br />
nur <strong>in</strong> der F<strong>in</strong>anzrechnung zu erfassen s<strong>in</strong>d. Diese Vorgaben setzen im jeweiligen Haushaltsjahr e<strong>in</strong> „verpflichtendes<br />
Ereignis“ der Geme<strong>in</strong>de gegenüber Dritten (Außenverpflichtung) oder gegenüber sich selbst (Innenverpflichtung)<br />
voraus.<br />
E<strong>in</strong> solches geme<strong>in</strong>dliches Ereignis schafft e<strong>in</strong>e rechtliche oder faktische Verpflichtung für die Geme<strong>in</strong>de, auf<br />
Grund dessen sie ke<strong>in</strong>e rechtliche Alternative zur Erfüllung der Verpflichtung hat, so dass von ihr Rückstellungen<br />
zu bilden und zu bilanzieren s<strong>in</strong>d. Liegen die Bed<strong>in</strong>gungen für die Bildung von Rückstellungen bei der Geme<strong>in</strong>de<br />
vor, so s<strong>in</strong>d diese <strong>in</strong> angemessener Höhe unter Beachtung des Vorsichtspr<strong>in</strong>zips zu bilden und <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Bilanz zu passivieren. Die Rückstellungen stellen dabei für die Geme<strong>in</strong>de ke<strong>in</strong> Eigenkapital dar, sie s<strong>in</strong>d<br />
vielmehr dem <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz abzubildenden Fremdkapital zuzuordnen und stellen e<strong>in</strong>e Ergänzung<br />
der Verb<strong>in</strong>dlichkeiten der Geme<strong>in</strong>de dar. Von der Geme<strong>in</strong>de dürfen daher erst Rückstellungen gebildet und bilanziert<br />
werden, wenn alle Kriterien dafür erfüllt s<strong>in</strong>d.<br />
1.2 Zwecke der Rückstellungsbildung<br />
Mit den geme<strong>in</strong>dlichen Rückstellungen werden daher Vorgänge dem Haushaltsjahr <strong>in</strong> Form von Aufwendungen<br />
zugerechnet, die <strong>in</strong> diesem Haushaltsjahr verursacht worden s<strong>in</strong>d, e<strong>in</strong>e wirtschaftliche Belastung für die Geme<strong>in</strong>de<br />
auslösen und <strong>in</strong> ihrer Höhe quantifizierbar s<strong>in</strong>d. Die darauf notwendigen Handlungen der Geme<strong>in</strong>de erfolgen<br />
jedoch erst zukünftig, z.B. <strong>in</strong> Form von Zahlungen u.a. Durch e<strong>in</strong>e Rückstellung f<strong>in</strong>det daher immer e<strong>in</strong>e Verknüpfung<br />
zwischen der im Haushaltsjahr entstandenen Belastung und der <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Folgejahr vorzunehmenden Zahlungsleistung<br />
statt.<br />
Die Bildung e<strong>in</strong>er geme<strong>in</strong>dlichen Rückstellung muss daher nicht nur an e<strong>in</strong>e vergangene Handlung der Geme<strong>in</strong>de<br />
anknüpfen, sondern vielmehr e<strong>in</strong>e „Abgeltung“ dieser abgeschlossenen geme<strong>in</strong>dlichen Handlung darstellen.<br />
Daher reicht die E<strong>in</strong>schätzung über e<strong>in</strong>e mögliche Inanspruchnahme oder e<strong>in</strong>es Verlustes durch die Geme<strong>in</strong>de<br />
für die Bildung e<strong>in</strong>er geme<strong>in</strong>dlichen Rückstellung reicht nicht aus. Grundsätzlich muss ernsthaft und mit hoher<br />
Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit mit e<strong>in</strong>er Inanspruchnahme der Geme<strong>in</strong>de oder mit e<strong>in</strong>em Verlust für die Geme<strong>in</strong>de gerechnet<br />
werden. In e<strong>in</strong>em solchen Bewertungsspielraum be<strong>in</strong>haltet die vernünftige Beurteilung die Prüfung von Chancen<br />
und Risiken unter Beachtung des Vorsichtspr<strong>in</strong>zips. Sie muss <strong>in</strong> sich schlüssig und willkürfrei se<strong>in</strong>, so dass das<br />
jeweilige Ergebnis aus objektiven Gegebenheiten logisch ableitbar ist.<br />
GEMEINDEORDNUNG 422
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 88 GO <strong>NRW</strong><br />
Der Umfang der zu bildenden geme<strong>in</strong>dlichen Rückstellungen bemisst sich dabei <strong>in</strong> der Regel nach dem voraussichtlich<br />
zukünftigen Erfüllungsbetrag. Dabei kommt grundsätzlich nicht das ausschließliche Stichtagspr<strong>in</strong>zip zur<br />
Anwendung, d.h. der Ansatz <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz ist nicht danach zu bestimmen, was die Geme<strong>in</strong>de am<br />
jeweiligen Abschlussstichtag aufbr<strong>in</strong>gen müsste, um ihre Verpflichtung zu erfüllen. Von der Geme<strong>in</strong>de muss jedoch<br />
unter Beachtung der GoB auch geprüft werden, ob im weiteren Rückstellungszeitraum z.B. Kostensteigerungen<br />
entstehen. Soweit diese erkennbar s<strong>in</strong>d und zur Veränderung des Erfüllungsbetrages führen, müssen<br />
diese berücksichtigt werden.<br />
Im Rahmen der geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlussarbeiten müssen auf Grund der Geschäftsvorfälle des abgelaufenen<br />
Haushaltsjahres bestehende Rückstellungen überprüft und e<strong>in</strong> möglicher Bedarf an neuen Rückstellungen<br />
ermittelt werden. Für bereits bestehende geme<strong>in</strong>dliche Rückstellungen muss z.B. geprüft werden, ob der frühere<br />
Rückstellungsgrund aktuell noch besteht, ob ggf. e<strong>in</strong>e Inanspruchnahme der Rückstellung <strong>in</strong> voller Höhe oder<br />
teilweise erfolgte oder ob aus anderen Gründen die <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz angesetzten Rückstellungen<br />
anzupassen s<strong>in</strong>d. Im örtlichen E<strong>in</strong>zelfall muss jeweils der notwendige Rückstellungsbetrag oder der Anpassungsbedarf<br />
ggf. auch vorsichtig geschätzt werden, wenn er nicht auf e<strong>in</strong>e andere Art und Weise ermittelt werden kann.<br />
Die Ermittlung des Rückstellungsbetrages erfordert unter E<strong>in</strong>beziehung der betrachteten wirtschaftlichen Verhältnisse<br />
immer e<strong>in</strong>e nachvollziehbare Begründung.<br />
2. Anwendung von Rechtsbegriffen<br />
2.1 Der Rechtsbegriff „Ungewiss“<br />
Bei der Bildung von Verpflichtungsrückstellungen ist zu beachten, dass zum Abschlussstichtag der Geme<strong>in</strong>de die<br />
Verpflichtungen dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt se<strong>in</strong> dürfen. Für den Tatbestand der<br />
Ungewissheit müssen akzeptable Anhaltspunkte bei e<strong>in</strong>em geme<strong>in</strong>dlichen Sachverhalt vorliegen, so dass e<strong>in</strong>e<br />
Verpflichtung der Geme<strong>in</strong>de nicht auszuschließen ist, dies aber noch nicht abschließend beurteilt werden kann.<br />
Zum Abschlussstichtag muss auf Grund objektiver Tatbestände und nicht e<strong>in</strong>er subjektiven E<strong>in</strong>schätzung die<br />
Geme<strong>in</strong>de sorgfältig beurteilen, dass e<strong>in</strong>e Inanspruchnahme der Geme<strong>in</strong>de voraussichtlich erfolgen wird.<br />
In den Fällen, <strong>in</strong> denen nur ungewiss ist, wem gegenüber e<strong>in</strong>e Verb<strong>in</strong>dlichkeit besteht oder wann sie fällig wird,<br />
so liegt dar<strong>in</strong> ke<strong>in</strong>e Ungewissheit im S<strong>in</strong>ne dieser Vorschrift und e<strong>in</strong>e Rückstellungsbildung durch die Geme<strong>in</strong>de<br />
ist nicht zulässig. Die „Ungewissheit“ kann sich bei Verpflichtungsrückstellungen auf die Höhe der Verpflichtung,<br />
auf das Bestehen der Verpflichtung als auch auf die Höhe und das Bestehen der Verpflichtung beziehen. Dem<br />
Grunde nach ungewiss ist e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>dliche Verpflichtung, wenn erst e<strong>in</strong> Ereignis e<strong>in</strong>treten muss, z.B. bei e<strong>in</strong>er<br />
Gewährleistung, dessen E<strong>in</strong>tritt aber unklar ist. Der Höhe nach ungewiss s<strong>in</strong>d solche Verpflichtungen, die z.B.<br />
wegen noch nicht e<strong>in</strong>gegangener Rechnungen bestehen. Außerdem muss sich die Ungewissheit über e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>dliche<br />
Verpflichtung nicht immer zw<strong>in</strong>gend auf den gesamten Umfang erstrecken. Insbesondere <strong>in</strong> den Fällen,<br />
<strong>in</strong> den geme<strong>in</strong>dliche Verpflichtungen h<strong>in</strong>sichtlich ihrer Höhe ungewiss s<strong>in</strong>d, können Teile davon durchaus<br />
gewiss se<strong>in</strong>, so dass dieser Teil unter den Verb<strong>in</strong>dlichkeiten und nur der restliche „ungewisse“ Umfang unter den<br />
Rückstellungen anzusetzen ist.<br />
2.2 Der Rechtsbegriff „Angemessene Höhe“<br />
2.2.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Nach der Vorschrift hat die Geme<strong>in</strong>de für bestimmte örtliche Sachverhalte die notwendigen Rückstellungen <strong>in</strong><br />
angemessener Höhe zu bilden. Für den Tatbestand der Angemessenheit müssen bei e<strong>in</strong>em geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Sachverhalt, der zu e<strong>in</strong>er Rückstellungsbildung durch die Geme<strong>in</strong>de führt, akzeptable Anhaltspunkte dafür vorlie-<br />
GEMEINDEORDNUNG 423
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 88 GO <strong>NRW</strong><br />
gen, dass e<strong>in</strong>e bestehende Verpflichtung der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>e wirtschaftliche Belastung darstellt und zutreffend<br />
betragsmäßig bestimmt werden kann. Zum Abschlussstichtag muss auf Grund objektiver Tatbestände und nicht<br />
e<strong>in</strong>er subjektiven E<strong>in</strong>schätzung die Geme<strong>in</strong>de sorgfältig beurteilen, <strong>in</strong> welcher Höhe e<strong>in</strong>e Inanspruchnahme der<br />
Geme<strong>in</strong>de voraussichtlich erfolgen wird.<br />
In diese Beurteilung der angemessenen Höhe e<strong>in</strong>er geme<strong>in</strong>dlichen Rückstellung s<strong>in</strong>d daher auch zukunftsorientierte<br />
Komponenten e<strong>in</strong>zubeziehen, denn die Erfüllung der geme<strong>in</strong>dlichen Verpflichtung soll regelmäßig erst zu<br />
e<strong>in</strong>em späteren (künftigen) Zeitpunkt erfolgen. Nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung s<strong>in</strong>d daher von der<br />
Geme<strong>in</strong>de auch Entwicklungen zu berücksichtigen, die h<strong>in</strong>reichend begründbar s<strong>in</strong>d oder auf objektivierbaren<br />
H<strong>in</strong>weisen beruhen. Diese E<strong>in</strong>schätzung geht von der Vorschrift des § 91 Abs. 2 Nr. 2 GO <strong>NRW</strong> aus, nach der<br />
allgeme<strong>in</strong> bestimmt wird, dass Rückstellungen grundsätzlich <strong>in</strong> Höhe des Betrages <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz<br />
anzusetzen s<strong>in</strong>d, der voraussichtlich notwendig ist.<br />
2.2.2 Die Berücksichtigung von Entwicklungen<br />
In den haushaltsrechtlichen Vorschrift wird nicht ausdrücklich der zukunftsorientierte Rechtsbegriff „Erfüllungsbetrag“<br />
benutzt wird, muss die Geme<strong>in</strong>de gleichwohl <strong>in</strong> die Rückstellungsbildung bzw. die Bemessung ihrer Rückstellungen<br />
die weitere mögliche Entwicklung der geme<strong>in</strong>dlichen Verpflichtungen e<strong>in</strong>beziehen, soweit nicht besondere<br />
Vorgaben bestehen, z.B. für die geme<strong>in</strong>dlichen Pensionsrückstellungen <strong>in</strong> § 36 Abs. 1 GemHVO <strong>NRW</strong>). Der<br />
Begriff „Erfüllungsbetrag“ be<strong>in</strong>haltet dabei, dass die künftig von der Geme<strong>in</strong>de zu erbr<strong>in</strong>gende Leistung die<br />
Grundlage des Passivansatzes <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz se<strong>in</strong> soll. Dieser Bilanzansatz ist damit auch unabhängig<br />
davon, ob die Geme<strong>in</strong>de künftig ihre Verpflichtung durch e<strong>in</strong>e Geldleistung oder Sachleistung zu erfüllen<br />
hat.<br />
2.2.3 Die Beschränkung des Stichtagspr<strong>in</strong>zips<br />
Die Auslegung des Rechtsbegriffs „Angemessene Höhe“ benötigt den Abschlussstichtag als zeitlichen Bezugspunkt.<br />
Unter Berücksichtigung, dass der Begriff den künftigen Erfüllungsbetrag be<strong>in</strong>haltet, wird das Stichtagspr<strong>in</strong>zip<br />
e<strong>in</strong>geschränkt. Bei der Bemessung von geme<strong>in</strong>dlichen Rückstellungen ist deshalb der Ansatz <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Bilanz danach zu bestimmen, was die Geme<strong>in</strong>de zukünftig aufbr<strong>in</strong>gen muss. Es ist nicht mehr zu ermitteln,<br />
was die Geme<strong>in</strong>de am jeweiligen Abschlussstichtag hätte aufbr<strong>in</strong>gen müssen, um ihre Verpflichtung zu erfüllen.<br />
Von der Geme<strong>in</strong>de muss vielmehr unter Beachtung der GoB auch geprüft werden, ob im weiteren Rückstellungszeitraum<br />
z.B. Kostensteigerungen oder andere Anlässe entstehen können, die sich auf die Rückstellungsbildung<br />
voraussichtlich auswirken werden. Soweit diese am jeweiligen Abschlussstichtag erkennbar s<strong>in</strong>d und voraussichtlich<br />
zu e<strong>in</strong>er Veränderung des Erfüllungsbetrages führen, müssen diese bei der geme<strong>in</strong>dlichen Rückstellungsbildung<br />
berücksichtigt werden.<br />
3. Die Abgrenzung der Rückstellungsarten<br />
Unter Beachtung dieser Vorschrift und <strong>in</strong> Anlehnung an das Handelsrecht darf die Geme<strong>in</strong>de nur für die Zwecke<br />
Rückstellungen bilden, die <strong>in</strong> § 36 Absatz 1 bis 5 GemHVO <strong>NRW</strong> näher und abschließend bestimmt s<strong>in</strong>d. Die<br />
Geme<strong>in</strong>den sollen Rückstellungen grundsätzlich nur für rechtliche und wirtschaftliche Gegebenheiten bilden, die<br />
ursächlich <strong>in</strong> der Hand der Geme<strong>in</strong>de liegen und die periodengerecht zu Aufwendungen bei der Geme<strong>in</strong>de führen.<br />
Die grundsätzliche Abgrenzung e<strong>in</strong>zelnen Rückstellungsarten ergibt sich auf Grund von Außenverpflichtungen<br />
gegenüber Dritten oder von Innenverpflichtungen, die von der Geme<strong>in</strong>de gegenüber sich selbst zu erfüllen<br />
s<strong>in</strong>d. Die Abgrenzung der geme<strong>in</strong>dlichen Rückstellungen soll das nachfolgende Schema (Quelle: NKF-<br />
Dokumentation 2003 S. 258) verdeutlicht werden (vgl. Abbildung).<br />
GEMEINDEORDNUNG 424
Rückstellungen für<br />
ungewisse Verb<strong>in</strong>dlichkeiten<br />
rechtlich faktisch<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 88 GO <strong>NRW</strong><br />
Abgrenzung der Rückstellungen<br />
Verpflichtung gegenüber<br />
Dritten<br />
Außenverpflichtung<br />
Rückstellungen für<br />
ungeplante Aufwendungen<br />
aus schwebenden<br />
Geschäften<br />
Rückstellungen<br />
Abbildung 65 „Abgrenzung der Rückstellungen“<br />
Verpflichtung gegenüber sich<br />
selbst<br />
Innenverpflichtung<br />
Aufwandsrückstellungen<br />
In diesen Zusammenhang ist die Vorschrift <strong>in</strong> § 36 Abs. 6 GemHVO <strong>NRW</strong> zu beachten, nach der weitere Arten<br />
von Rückstellungen nur gebildet werden dürfen, soweit diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen s<strong>in</strong>d.<br />
Daraus folgt, dass durch die Vorschrift des § 36 GemHVO <strong>NRW</strong> <strong>in</strong> den Absätzen 1 bis 5 die zulässigen Rückstellungsarten<br />
für die Geme<strong>in</strong>den abschließend bestimmt s<strong>in</strong>d. So dürfen von der Geme<strong>in</strong>de für sonstige ungewisse<br />
Verb<strong>in</strong>dlichkeiten, soweit diese nicht die Voraussetzungen des § 36 Abs. 4 GemHVO <strong>NRW</strong> erfüllen, ke<strong>in</strong>e Rückstellungen<br />
gebildet werden. Die zulässigen Rückstellungsarten s<strong>in</strong>d von der Geme<strong>in</strong>de auf der Passivseite ihrer<br />
Bilanz anzusetzen (vgl. § 41 Abs. 4 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
Für geme<strong>in</strong>dliche Aufwendungen, die regelmäßig anfallen, dürfen von der Geme<strong>in</strong>de ke<strong>in</strong>e Rückstellungen <strong>in</strong><br />
ihrer Bilanz angesetzt werden, denn dieses würde dem haushaltswirtschaftlichen Pr<strong>in</strong>zip widersprechen, regelmäßig<br />
wiederkehrenden Aufwand nur als laufenden Aufwand zu erfassen. Außerdem würde e<strong>in</strong>e Rückstellungsbildung<br />
<strong>in</strong> diesen Fällen die Transparenz und Klarheit des geme<strong>in</strong>dlichen Haushalts bee<strong>in</strong>trächtigen. Es ist deshalb<br />
für die Geme<strong>in</strong>den ke<strong>in</strong>e Rückstellungsbildung im Rahmen des geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzausgleichs, für künftige<br />
Umlagezahlungen und aus der Steuererhebung zugelassen worden.<br />
GEMEINDEORDNUNG 425
4 Zulässige Rückstellungsarten<br />
4.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 88 GO <strong>NRW</strong><br />
Die Geme<strong>in</strong>de muss Rückstellungen für unterschiedliche geme<strong>in</strong>dliche Gegebenheiten bilden, z.B. für ihre Pensionsverpflichtungen<br />
nach den beamtenrechtlichen Vorschriften. Unter Beachtung dieser Vorschrift und <strong>in</strong> Anlehnung<br />
an das Handelsrecht darf die Geme<strong>in</strong>de nur für die Zwecke Rückstellungen bilden, die <strong>in</strong> § 36 GemHVO<br />
<strong>NRW</strong> abschließend bestimmt worden s<strong>in</strong>d. Damit wird dem haushaltsrechtlichen Rückstellungsbegriff für die<br />
Geme<strong>in</strong>den sowohl die sog. statische als auch die dynamische Bilanzauffassung zu Grunde gelegt. Die Geme<strong>in</strong>de<br />
darf nach dieser Vorschrift i.V.m. § 36 GemHVO <strong>NRW</strong> nur für die nachfolgend aufgezeigten Arten geme<strong>in</strong>dliche<br />
Rückstellungen bilden (vgl. Abbildung).<br />
Rückstellungen nach § 88 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 36 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
Passivierungspflicht<br />
Passivierungswahlrecht<br />
Passivierungsverbot<br />
- Pensionen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften<br />
- Rekultivierung und Nachsorge von Deponien und für die<br />
Sanierung von Altlasten<br />
- Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach<br />
zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt s<strong>in</strong>d<br />
- drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und<br />
aus laufenden Verfahren<br />
- Verpflichtungen für Zwecke, die durch andere Gesetze<br />
bestimmt wurden<br />
- unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen<br />
Sonstige Rückstellungen, die nicht durch Gesetz oder Verordnung<br />
zugelassen s<strong>in</strong>d, z.B.<br />
- künftige Umlagezahlungen der Geme<strong>in</strong>de<br />
- Verpflichtungen im Rahmen des Geme<strong>in</strong>def<strong>in</strong>anzausgleichs<br />
- Verpflichtungen aus der geme<strong>in</strong>dlichen Steuererhebung<br />
Abbildung 66 „Zulässige Rückstellungsarten“<br />
Durch die ausdrückliche Aufzählung der zulässigen Arten der Rückstellungen <strong>in</strong> der Vorschrift wird zudem klargestellt,<br />
dass die Geme<strong>in</strong>den nur Rückstellungen für die benannten Zwecke bilden dürfen. Daraus folgt, dass durch<br />
die Vorschriften der Absätze 1 bis 6 die zulässigen Rückstellungsarten für die Geme<strong>in</strong>den abschließend bestimmt<br />
s<strong>in</strong>d und ke<strong>in</strong>e Rückstellungen für Zwecke gebildet werden dürfen, die nicht ausdrücklich bestimmt s<strong>in</strong>d. Aber<br />
auch für regelmäßig jährlich wiederkehrende Gegebenheiten dürfen ke<strong>in</strong>e Rückstellungen gebildet werden.<br />
4.2 Die e<strong>in</strong>zelnen Rückstellungsarten<br />
4.2.1 Pensionsrückstellungen<br />
Durch die Bildung von Pensionsrückstellungen (vgl. § 36 Abs. 1 GemHVO <strong>NRW</strong>) werden die Versorgungsverpflichtungen<br />
der Geme<strong>in</strong>de den Haushaltsjahren zugeordnet, <strong>in</strong> denen die Beamt<strong>in</strong>nen und Beamte ihre Anwartschaften<br />
auf künftige Versorgungsleistungen erwerben. Folglich werden <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Jahresabschluss der Geme<strong>in</strong>de<br />
während der Anwartschaftsphase die gesamten entstehenden Personalaufwendungen des Haushaltsjahres<br />
nachgewiesen und nicht e<strong>in</strong> Jahresergebnis gezeigt, dass nur Personalaufwendungen im Umfang der aktuell zu<br />
erbr<strong>in</strong>genden Zahlungsleistungen enthält.<br />
GEMEINDEORDNUNG 426
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 88 GO <strong>NRW</strong><br />
Das von der Geme<strong>in</strong>de erzielte Jahresergebnis enthält aber auch Aufwendungen für die Versorgung der Beamt<strong>in</strong>nen<br />
und Beamten, auch wenn die tatsächlichen Zahlungsleistungen gegenüber diesem Personenkreis erst<br />
zukünftig zu erbr<strong>in</strong>gen s<strong>in</strong>d. Dieser Sachverhalt spiegelt den Entgeltcharakter der geme<strong>in</strong>dlichen Pensionsverpflichtungen<br />
wieder, als würden die Beamt<strong>in</strong>nen und Beamten ihre Zukunftsvorsorge eigenverantwortlich vornehmen<br />
müssen. Zu den Versorgungsverpflichtungen der Geme<strong>in</strong>de gehören aber auch die Beihilfeverpflichtungen<br />
gegenüber den Beamt<strong>in</strong>nen und Beamten der Geme<strong>in</strong>de. Auch die daraus entstehenden künftigen Verpflichtungen<br />
der Geme<strong>in</strong>de s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> die geme<strong>in</strong>dliche Rückstellungsbildung e<strong>in</strong>zubeziehen.<br />
4.2.2 Rückstellungen für Deponien<br />
Die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien (vgl. § 36 Abs. 2 GemHVO <strong>NRW</strong>) hat im geme<strong>in</strong>dlichen Bereich<br />
e<strong>in</strong>e besondere Bedeutung, da dafür gesetzliche Verpflichtungen bestehen, die <strong>in</strong> abfallrechtlichen Planfeststellungsverfahren<br />
näher bestimmt werden. Die rechtliche Grundlage bildet das Fachgesetz, das Verpflichtungen zur<br />
Vorsorge enthält, die auch <strong>in</strong> die Gebührenkalkulation e<strong>in</strong>zubeziehen s<strong>in</strong>d (vgl. § 9 Abs. 2 und 2a des Landesabfallgesetzes).<br />
Der Anlass zur Rekultivierung und Nachsorge von Deponien, der wirtschaftlich <strong>in</strong> den Jahren der<br />
Nutzung der Deponie entsteht, verlangt dementsprechend die notwendige Rückstellungsbildung.<br />
4.2.3 Rückstellungen für Altlasten und sonstige Umweltschäden<br />
Die geme<strong>in</strong>dlichen Rückstellungen für die Beseitigung von Altlasten (vgl. § 36 Abs. 2 GemHVO <strong>NRW</strong>) s<strong>in</strong>d zu<br />
bilden, wenn die Geme<strong>in</strong>de verpflichtet ist, bestimmte vorhandene Altlasten zu beseitigen (sanieren). Derartige<br />
geme<strong>in</strong>dliche Verpflichtungen können bei Grundstücken der Geme<strong>in</strong>de oder auch für Grundstücke Dritter bestehen,<br />
wenn e<strong>in</strong>e behördliche Verpflichtung zur Beseitigung der Altlasten durch die Geme<strong>in</strong>de vorliegt. Entsprechend<br />
ist dann e<strong>in</strong>e Rückstellung für die Beseitigung von Altlasten anzusetzen. Besteht seitens der Geme<strong>in</strong>de<br />
jedoch nur e<strong>in</strong>e Absicht zur Beseitigung von Altlasten, liegt noch ke<strong>in</strong>e ausreichende Grundlage für e<strong>in</strong>e Rückstellungsbildung<br />
vor. Unter diesem Bilanzposten s<strong>in</strong>d auch Rückstellungen wegen geme<strong>in</strong>dlicher Verpflichtungen zur<br />
Beseitigung anderer Umweltschäden anzusetzen (vgl. Umweltschadensgesetz).<br />
4.2.4 Rückstellungen für die unterlassene Instandhaltung<br />
Für unterlassene Aufwendungen für die Instandhaltung von Sachanlagen s<strong>in</strong>d von der Geme<strong>in</strong>de die notwendigen<br />
Rückstellungen zu bilden, soweit die Aufwendungen ke<strong>in</strong>en Herstellungsaufwand für geme<strong>in</strong>dliche Vermögensgegenstände<br />
darstellen. E<strong>in</strong>e solche Rückstellungsbildung soll dazu beitragen, den Verfall von <strong>in</strong>standhaltungspflichtigen<br />
Sachanlagen zu verh<strong>in</strong>dern und die stetige Aufgabenerfüllung der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong>soweit zu sichern<br />
(vgl. § 36 Abs. 3 GemHVO <strong>NRW</strong>). Derartige Rückstellungen s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz mit dem Betrag<br />
anzusetzen, der voraussichtlich bei der Nachholung bzw. beim späteren Entstehen von geme<strong>in</strong>dlichen Ausgaben<br />
notwendig wird. Dazu ist durch die Vorschrift - abweichend vom Handelsrecht - ke<strong>in</strong>e konkrete Zeitvorgabe zur<br />
Nachholung der unterlassenen Instandhaltung festgelegt, sondern zur Ansatzbildung bestimmt worden „soweit<br />
die Nachholung der Instandhaltung h<strong>in</strong>reichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden<br />
muss“. Diese Regelung wurde aus ausreichend im S<strong>in</strong>ne der eigenverantwortlichen Selbstverwaltung der<br />
Geme<strong>in</strong>den gesehen.<br />
4.2.5 Rückstellungen für ungewisse Verpflichtungen<br />
Die Geme<strong>in</strong>den haben auch Rückstellungen für ungewisse Verb<strong>in</strong>dlichkeiten (vgl. § 36 Abs. 4 GemHVO <strong>NRW</strong>) zu<br />
bilden, soweit dafür ke<strong>in</strong>e spezielle Regelung <strong>in</strong> den Absätzen 1, 2 und 5 dieser Vorschrift getroffen wurden. Für<br />
GEMEINDEORDNUNG 427
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 88 GO <strong>NRW</strong><br />
die Bildung und den Ansatz von Rückstellungen für Verpflichtungen der Geme<strong>in</strong>de gegenüber Dritten gelten<br />
grundsätzlich die nachfolgend aufgezeigten Merkmale (vgl. Abbildung).<br />
Merkmale bei ungewissen geme<strong>in</strong>dlichen Verpflichtungen<br />
- Die Verpflichtungen müssen dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau<br />
bekannt se<strong>in</strong>.<br />
- Es muss zukünftig wahrsche<strong>in</strong>lich e<strong>in</strong>e Verb<strong>in</strong>dlichkeit tatsächlich entstehen.<br />
- Die zukünftige Inanspruchnahme wird voraussichtlich tatsächlich erfolgen.<br />
- Die wirtschaftliche Ursache der Verb<strong>in</strong>dlichkeit muss vor dem Abschlussstichtag liegen.<br />
- Der zu leistende Betrag ist nicht ger<strong>in</strong>gfügig.<br />
Abbildung 67 „Merkmale bei ungewissen geme<strong>in</strong>dlichen Verpflichtungen“<br />
Bei den Verpflichtungsrückstellungen muss e<strong>in</strong>e Verpflichtung der Geme<strong>in</strong>de gegenüber Dritten bestehen, z.B.<br />
auf Grund von Verträgen (privatrechtliche oder öffentlich-rechtliche Vere<strong>in</strong>barungen) oder von gesetzlichen Regelungen.<br />
Dabei ist es nicht erforderlich, dass der Dritte Kenntnis von se<strong>in</strong>em Anspruch hat. Ist jedoch nur ungewiss,<br />
wem gegenüber e<strong>in</strong>e Verb<strong>in</strong>dlichkeit besteht oder wann sie fällig wird, so liegt dar<strong>in</strong> ke<strong>in</strong>e Ungewissheit im<br />
S<strong>in</strong>ne der Vorschrift über die Bildung von Rückstellungen. Außerdem kann von der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> Eigenverantwortung<br />
e<strong>in</strong>e Ger<strong>in</strong>gfügigkeitsgrenze für den Ansatz von geme<strong>in</strong>dlichen Rückstellungen festgelegt werden. Dabei<br />
sollen die haushaltsmäßigen Auswirkungen berücksichtigt werden.<br />
Für die Geme<strong>in</strong>de kann es zudem im E<strong>in</strong>zelfall notwendig werden, den bilanziellen Ansatz für Verpflichtungsrückstellungen<br />
ggf. zu schätzen. Derartige Fälle müssen im Rahmen des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses vom<br />
Abschlussprüfer berücksichtigt werden, denn Unsicherheiten bei den Schätzungen können bedeutsame Risiken<br />
für die Geme<strong>in</strong>de zu Folge haben. Die zur Ermittlung von bilanziellen Ansätzen für Rückstellungen vorgenommenen<br />
Schätzungen s<strong>in</strong>d daher im geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss im Anhang angemessen zu erläutern. Auch ist<br />
zu beachten, dass die zulässigen Aufwandsrückstellungen nicht zu den Verpflichtungsrückstellungen gehören,<br />
denn sie stellen nur e<strong>in</strong>e Verpflichtung der Geme<strong>in</strong>de gegenüber sich selber und nicht e<strong>in</strong>e Außenverpflichtung<br />
gegenüber e<strong>in</strong>em Dritten dar.<br />
4.2.6 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften<br />
Von der Geme<strong>in</strong>de s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> den Fällen drohender Verluste aus schwebenden Geschäften (vgl. § 36 Abs. 5 GemH-<br />
VO <strong>NRW</strong>) die notwendigen Rückstellungen zu bilden. E<strong>in</strong> schwebendes Geschäft der Geme<strong>in</strong>de kann e<strong>in</strong> e<strong>in</strong>maliges<br />
Geschäft oder e<strong>in</strong> Geschäft auf Dauer (Dauerschuldverhältnis) se<strong>in</strong>. E<strong>in</strong> solches liegt z.B. vor, wenn bei der<br />
Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong> zweiseitig verpflichtender Vertrag besteht, der auf e<strong>in</strong>en Leistungsaustausch ausgerichtet ist und<br />
von beiden Vertragspartnern noch nicht erfüllt worden ist.<br />
Mögliche Gegenstände von derartigen schwebenden Geschäften können Lieferungen von Vermögensgegenständen,<br />
Leistungen <strong>in</strong> Form von Nutzungsüberlassungen oder e<strong>in</strong> sonstiges Tun oder Unterlassen se<strong>in</strong>. Außerdem<br />
ist für die Qualifizierung von schwebenden Geschäften wichtig, dass e<strong>in</strong>e B<strong>in</strong>dungswirkung für die Vertragspartner<br />
besteht. Der Schwebezustand e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Geschäftes, bei dem e<strong>in</strong> Anspruch und e<strong>in</strong>e Verpflich-<br />
GEMEINDEORDNUNG 428
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 88 GO <strong>NRW</strong><br />
tung aus dem Geschäft vorliegen müssen, beg<strong>in</strong>nt i.d.R. mit se<strong>in</strong>em rechtswirksamen Abschluss. Er wird durch<br />
die Erfüllung der Sachleistung beendet. Dagegen bewirkt die Erbr<strong>in</strong>gung der geldmäßigen Gegenleistung i.d.R.<br />
nicht die Beendigung des Schwebezustands.<br />
Damit die Geme<strong>in</strong>de nicht verpflichtet ist, für jeden möglichen Verlust e<strong>in</strong>e Rückstellungsbildung vorzunehmen, ist<br />
zudem als Abgrenzung bestimmt worden, dass Rückstellungen nur zu bilden s<strong>in</strong>d, sofern der voraussichtliche<br />
Verlust für die Geme<strong>in</strong>de nicht ger<strong>in</strong>gfügig se<strong>in</strong> wird. Bei der Bestimmung der Ger<strong>in</strong>gfügigkeitsgrenze, die <strong>in</strong> der<br />
Eigenverantwortung der Geme<strong>in</strong>de liegt, ist auch auf die örtlichen haushaltsmäßigen Auswirkungen abzustellen.<br />
Darüber h<strong>in</strong>aus ist festzustellen, ob e<strong>in</strong> künftiger Verpflichtungsüberschuss für die Geme<strong>in</strong>de entstehen wird<br />
(Saldo aus künftigen Aufwendungen und künftigen Erträgen) und ob das auslösende Ereignis zur Rückstellungsbildung<br />
nach Abschluss des Geschäftes liegt.<br />
4.2.7 Rückstellungen für drohende Verluste aus laufenden Verfahren<br />
Die Geme<strong>in</strong>de ist nach § 36 Abs. 5 GemHVO <strong>NRW</strong> der Vorschrift verpflichtet, für drohende Verluste aus laufenden<br />
Verfahren <strong>in</strong> ihrer Bilanz entsprechende Rückstellungen anzusetzen. Unter dem Begriff „Verfahren“ s<strong>in</strong>d<br />
dabei Verwaltungsvorgänge zu verstehen, die auf e<strong>in</strong>er rechtlichen Grundlage aufbauen und im Rahmen des<br />
Verwaltungsverfahrensgesetzes durch e<strong>in</strong>en geme<strong>in</strong>dlichen Bescheid abgewickelt werden, z.B. die Heranziehung<br />
Dritter zur Zahlung von Steuern, Beiträgen u.a.<br />
Solche Verwaltungsverfahren der Geme<strong>in</strong>de s<strong>in</strong>d als laufend zu qualifizieren, wenn e<strong>in</strong> von der Geme<strong>in</strong>de erlassener<br />
Bescheid noch nicht rechtskräftig geworden ist. Dieses ist gegeben, wenn im geme<strong>in</strong>dlichen Verfahren die<br />
Rechtsmittelfrist noch nicht abgelaufen ist oder diese durch e<strong>in</strong> anhängiges Widerspruchs- oder Klageverfahren<br />
noch läuft. Liegt e<strong>in</strong> solcher Sachverhalt bei der Geme<strong>in</strong>de vor, darf bei e<strong>in</strong>em drohenden Verlust ke<strong>in</strong>e Wertberichtigung<br />
e<strong>in</strong>er bestehenden geme<strong>in</strong>dlichen Forderung vorgenommen werden. Vielmehr ist von der Geme<strong>in</strong>de<br />
e<strong>in</strong>e entsprechende Rückstellung zu passivieren und die durch Bescheid festgesetzte Forderung unverändert<br />
aufrecht zu erhalten.<br />
4.3 Sonstige Rückstellungen<br />
Nach § 36 Abs. 6 S. 1 GemHVO <strong>NRW</strong> dürfen Rückstellungen für andere Zwecke unter dem Bilanzposten „Sonstige<br />
Rückstellungen“ nur angesetzt werden, soweit diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen s<strong>in</strong>d. Mit<br />
dieser Vorschrift wird klargestellt, dass die Geme<strong>in</strong>den nur dann Rückstellungen für andere Zwecke bilden dürfen,<br />
wenn dabei die Voraussetzungen nach den Vorschriften des § 36 Abs. 4 oder 5 GemHVO <strong>NRW</strong> erfüllt s<strong>in</strong>d. Es ist<br />
daher den Geme<strong>in</strong>den nicht erlaubt, aus örtlichen Verhältnissen heraus für noch selbst gewählte andere Zwecke<br />
Rückstellungen zu bilden. Von diesem Verbot besteht nur dann e<strong>in</strong>e Ausnahme, wenn die Bildung von besonderen<br />
Rückstellungen ausdrücklich zugelassen wird, z.B. durch fachgesetzliche Vorschriften (vgl. Reglungen im<br />
Landesabfallgesetz). Die gesetzlich nicht vorgesehene Rückstellungsbildung für künftige geme<strong>in</strong>dliche Umlagezahlungen<br />
oder im Rahmen des Geme<strong>in</strong>def<strong>in</strong>anzausgleichs sowie aus der geme<strong>in</strong>dlichen Steuererhebung führen<br />
dazu, dass von der Geme<strong>in</strong>de auch dann ke<strong>in</strong>e Rückstellungen gebildet werden dürfen, wenn sich derartige<br />
örtliche Sachverhalte ggf. unter die Bestimmungen des § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO <strong>NRW</strong> subsumieren lassen.<br />
5. Rückstellungen für nicht andere Zwecke<br />
5.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Durch die ausdrückliche Aufzählung der zulässigen Arten der Rückstellungen <strong>in</strong> § 36 GemHVO <strong>NRW</strong> wird klargestellt,<br />
dass die Geme<strong>in</strong>den ke<strong>in</strong>e Rückstellungen für andere Zwecke bilden dürfen. Die Geme<strong>in</strong>den sollen die<br />
GEMEINDEORDNUNG 429
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 88 GO <strong>NRW</strong><br />
Rückstellungen grundsätzlich nur für rechtliche und wirtschaftliche Leistungen bilden, die ursächlich <strong>in</strong> der Hand<br />
der Geme<strong>in</strong>de liegen und die periodengerecht zu Aufwendungen bei der Geme<strong>in</strong>de führen sowie nicht jährlich<br />
wiederkehrend s<strong>in</strong>d. Bei geme<strong>in</strong>dlichen Geschäftsvorfällen, die auf Leistungen Dritter ohne Gegenleistungsverpflichtung<br />
der Geme<strong>in</strong>de, z.B. Gewerbesteuerzahlungen, oder auf e<strong>in</strong>seitigen Leistungen der Geme<strong>in</strong>de an Dritte,<br />
z.B. Sozialhilfeleistungen, beruhen, soll erst das Entstehen der rechtlichen Verpflichtung und nicht bereits das<br />
mögliche Entstehen e<strong>in</strong>er wirtschaftlichen Verpflichtung der Anlass für e<strong>in</strong>e Rückstellungsbildung bei der Geme<strong>in</strong>de<br />
se<strong>in</strong>.<br />
Die haushaltswirtschaftliche Zuordnung erfolgt immer, wenn der Geme<strong>in</strong>de Zuwendungen von Dritten gewährt<br />
werden oder wenn geme<strong>in</strong>dliche Forderungen, die i.d.R. aus e<strong>in</strong>em Leistungsbescheid der Geme<strong>in</strong>de entstehen,<br />
zu bilanzieren s<strong>in</strong>d. Sie ist bei solchen Geschäftsvorfällen der Geme<strong>in</strong>de allgeme<strong>in</strong> anerkannt und wird dort nicht<br />
<strong>in</strong> Frage gestellt. E<strong>in</strong>e Rückstellungspflicht für die Geme<strong>in</strong>de soll daher erst als entstanden anzunehmen bzw. die<br />
Zuordnung entsprechender Aufwendungen zum Haushaltsjahr erst vorzunehmen se<strong>in</strong>, wenn e<strong>in</strong>e tatsächliche<br />
Verpflichtung der Geme<strong>in</strong>de durch e<strong>in</strong>en Heranziehungsbescheid e<strong>in</strong>setzt.<br />
Der geme<strong>in</strong>dliche Ressourcenverbrauch ist objektiv betrachtet zu dem Zeitpunkt als entstanden anzusehen, wenn<br />
dieser durch e<strong>in</strong>en Verwaltungsakt der Geme<strong>in</strong>de objektiviert wird. Er ist i.d.R. auch erst zu diesem Zeitpunkt<br />
verlässlich bewertbar ist (Bestimmung des Erfüllungszeitpunktes als Realisation der Zeit nach). Es muss somit<br />
e<strong>in</strong> konkretes Ereignis bezogen auf den Abschlussstichtag e<strong>in</strong>getreten se<strong>in</strong> bzw. vorliegen, damit bei bestimmten<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Sachverhalten e<strong>in</strong>e Rückstellungsbildung zulässig ist. Auch der <strong>in</strong> § 75 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> gesetzlich<br />
bestimmte jährliche Haushaltsausgleich erfordert geme<strong>in</strong>deübergreifend e<strong>in</strong>e gleiche Handhabung bei allen Geme<strong>in</strong>den.<br />
5.2 Rückstellungen und künftige Umlagezahlungen der Geme<strong>in</strong>de<br />
Für Umlagen der Geme<strong>in</strong>de, die regelmäßig jährlich anfallen, ist die Bildung von Rückstellungen nicht zugelassen<br />
worden. Die Bildung solcher Rückstellungen würde dem haushaltswirtschaftlichen Pr<strong>in</strong>zip widersprechen, regelmäßig<br />
wiederkehrenden Aufwand nur als laufenden Aufwand zu erfassen. Außerdem würde <strong>in</strong> diesen Fällen e<strong>in</strong>e<br />
Rückstellungsbildung die Transparenz und Klarheit des geme<strong>in</strong>dlichen Haushalts bee<strong>in</strong>trächtigen. E<strong>in</strong>e konkrete<br />
Verpflichtung der Geme<strong>in</strong>de besteht jedoch nicht alle<strong>in</strong> wegen der rechtlichen B<strong>in</strong>dung der Geme<strong>in</strong>de als Mitglied<br />
an den Umlageverband. Sie entsteht vielmehr jährlich auf Grund der konkreten Aufgabenerfüllung (Leistungserbr<strong>in</strong>gung)<br />
des Umlageverbandes und wird durch e<strong>in</strong>en Heranziehungsbescheid des umlageberechtigten Dritten<br />
gegenüber den Umlagezahlern erst h<strong>in</strong>reichend konkretisiert, so dass e<strong>in</strong>e Zuordnung zu dem Haushaltsjahr zu<br />
erfolgen hat, auf das sich der Festsetzungsbescheid bezieht (Erfüllungszeitpunkt).<br />
Die E<strong>in</strong>beziehung der Leistungsfähigkeit der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> die Ermittlung der Höhe des Umlagebetrages, z.B. <strong>in</strong><br />
Form der Steuerkraft der Geme<strong>in</strong>de vor dem Umlagejahr, führt daher nicht zwangsläufig zu e<strong>in</strong>er Verpflichtung<br />
der Geme<strong>in</strong>de, den Vorjahren des betreffenden Umlagehaushaltsjahr bereits Aufwendungen aus der Umlageerhebung<br />
zuzurechnen. Es werden im Rahmen der Ermittlung des Umlagebetrages lediglich die belegbaren haushaltswirtschaftlichen<br />
Verhältnisse der Geme<strong>in</strong>de für die Ermittlung der konkreten Höhe der Umlage herangezogen.<br />
Die Realisation des Ertrages beim Umlageberechtigten und damit das Entstehen von Aufwendungen beim<br />
Umlagepflichtigen s<strong>in</strong>d daher erst zum aktuellen haushaltsjahrbezogenen Zeitpunkt möglich.<br />
Nach den gesetzlichen Vorschriften s<strong>in</strong>d die Arten und der Umfang der Leistungsfähigkeit der Geme<strong>in</strong>de bei der<br />
Umlageermittlung zu berücksichtigen. Daher müssen Messgrößen bzw. Schlüsselgrößen für e<strong>in</strong>e zutreffende<br />
Ermittlung des Umlagebetrages jeder e<strong>in</strong>zelnen Geme<strong>in</strong>de bestimmt werden. Aus diesen öffentlich-rechtlichen<br />
Gegebenheiten heraus führt erst die rechtliche Verpflichtung der Geme<strong>in</strong>de zur Umlagezahlung zu e<strong>in</strong>er wirtschaftlichen<br />
Belastung und zwar <strong>in</strong> dem Haushaltsjahr, für das die Geme<strong>in</strong>de durch den Umlageberechtigten zur<br />
Umlagezahlung herangezogen wird. Zudem würde e<strong>in</strong>e Rückstellungsbildung unter Beachtung der allgeme<strong>in</strong>en<br />
Grundsätze dazu führen, dass die gesamte Umlage wirtschaftlich e<strong>in</strong>em Haushaltsjahr zuzurechnen wäre, für das<br />
GEMEINDEORDNUNG 430
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 88 GO <strong>NRW</strong><br />
für den Umlageberechtigten weder e<strong>in</strong> haushaltsrechtlicher noch e<strong>in</strong> wirtschaftlicher Anspruch zur Erhebung der<br />
Umlage besteht. Zudem hat e<strong>in</strong> Umlageberechtigter, z.B. der Kreis, erst nach se<strong>in</strong>er Feststellung, dass die sonstigen<br />
Erträge die entstehenden Aufwendungen nicht decken, die Berechtigung zur Umlageerhebung (vgl. § 56<br />
Abs. 1 KrO <strong>NRW</strong>). Dieser Sachverhalt gilt auch bei Zweckverbänden (vgl. § 19 Abs. 1 S. 1 GkG <strong>NRW</strong>). Auch<br />
deshalb ist e<strong>in</strong>e Rückstellungsbildung für Umlagezwecke nicht zugelassen worden.<br />
Die gesetzlich nicht vorgesehene Rückstellungsbildung für geme<strong>in</strong>dliche Umlagezahlungen führt dazu, dass von<br />
der Geme<strong>in</strong>de auch dann ke<strong>in</strong>e Rückstellungen gebildet werden dürfen, wenn sich örtliche Umlagesachverhalte<br />
ggf. grundsätzlich und <strong>in</strong> allgeme<strong>in</strong>er Form unter die Bestimmungen des § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO <strong>NRW</strong> subsumieren<br />
lassen, soweit die Umlageerhebung noch nicht Gegenstand e<strong>in</strong>es Verwaltungsverfahrens der Geme<strong>in</strong>de<br />
(Verfahren zum Erlass e<strong>in</strong>e rechtskräftigen Umlagebescheides) ist. In den Fällen, <strong>in</strong> denen es aber nach dem<br />
Erlass e<strong>in</strong>es Umlagebescheides zu e<strong>in</strong>em Widerspruch des Betroffenen gegen den Bescheid bzw. zu e<strong>in</strong>em<br />
Klageverfahren kommt, ist von der Geme<strong>in</strong>de zum Abschlussstichtag zu prüfen und zu entscheiden, ob <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
solchen Fall e<strong>in</strong>e Rückstellung für drohende Verluste aus laufenden Verfahren <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz angesetzt<br />
werden muss, sofern der voraussichtliche Verlust nicht ger<strong>in</strong>gfügig se<strong>in</strong> wird.<br />
5.3 Rückstellungen und Geme<strong>in</strong>def<strong>in</strong>anzausgleich<br />
5.3.1 Der jährliche Geme<strong>in</strong>def<strong>in</strong>anzausgleich<br />
Der Gesetzgeber hat durch die abschließende Aufzählung der zulässigen Rückstellungsarten <strong>in</strong> der Vorschrift<br />
bestimmt, dass die Bildung von Rückstellungen für geme<strong>in</strong>dliche Leistungen im Rahmen des Geme<strong>in</strong>def<strong>in</strong>anzausgleichs<br />
nicht zulässig ist. Die Bildung solcher Rückstellungen würde dem haushaltswirtschaftlichen Pr<strong>in</strong>zip<br />
widersprechen, regelmäßig wiederkehrenden Aufwand nur als laufenden Aufwand zu erfassen. Außerdem würde<br />
<strong>in</strong> diesen Fällen e<strong>in</strong>e Rückstellungsbildung die Transparenz und Klarheit des geme<strong>in</strong>dlichen Haushalts bee<strong>in</strong>trächtigen.<br />
In Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen s<strong>in</strong>d die Geme<strong>in</strong>den nicht verpflichtet, auch nicht die f<strong>in</strong>anzstarken Geme<strong>in</strong>den,<br />
eigene F<strong>in</strong>anzmittel der allgeme<strong>in</strong>en F<strong>in</strong>anzausgleichsmasse zuzuführen, wie es z.T. <strong>in</strong> anderen Ländern die<br />
Regel ist. Außerdem würde e<strong>in</strong>e Rückstellungsbildung unter Beachtung der allgeme<strong>in</strong>en Grundsätze dazu führen,<br />
dass die gesamten geme<strong>in</strong>dlichen Leistungen im Rahmen des Geme<strong>in</strong>def<strong>in</strong>anzausgleichs wirtschaftlich e<strong>in</strong>em<br />
Haushaltsjahr zuzurechnen wäre, für das weder e<strong>in</strong> haushaltsrechtlicher noch e<strong>in</strong> wirtschaftlicher Anspruch dafür<br />
besteht. Auch deshalb ist e<strong>in</strong>e Rückstellungsbildung für geme<strong>in</strong>dliche Leistungen im Rahmen des Geme<strong>in</strong>def<strong>in</strong>anzausgleichs<br />
nicht zugelassen worden.<br />
In den Fällen, <strong>in</strong> denen die Geme<strong>in</strong>de eigene F<strong>in</strong>anzleistungen auf Grund des jährlichen Geme<strong>in</strong>def<strong>in</strong>anzausgleichs<br />
erbr<strong>in</strong>gen muss, entsteht erst durch die rechtliche Heranziehung der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>e aufwandwirksame<br />
Verpflichtung der Geme<strong>in</strong>de, so dass i.d.R. der geme<strong>in</strong>dliche Ressourcenverbrauch jeweils dem aktuellen Haushaltsjahr<br />
zuzurechnen ist. Zudem ist auch die Entscheidung, ke<strong>in</strong>e „Vorverpflichtung“ bzw. Zurechnung zu Vorjahren<br />
als Grundlage für e<strong>in</strong>e örtliche Rückstellungsbildung aus Anlass des Geme<strong>in</strong>def<strong>in</strong>anzausgleichs zuzulassen,<br />
unter dem Gesichtspunkt des Ressourcenverbrauchs sachgerecht und vertretbar. Die gesetzlich nicht vorgesehene<br />
Rückstellungsbildung im Rahmen des Geme<strong>in</strong>def<strong>in</strong>anzausgleichs führt dazu, dass von der Geme<strong>in</strong>de auch<br />
dann ke<strong>in</strong>e Rückstellungen gebildet werden dürfen, wenn sich örtliche F<strong>in</strong>anzausgleichssachverhalte ggf. unter<br />
die Bestimmungen des § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO <strong>NRW</strong> subsumieren lassen.<br />
5.3.2 Das E<strong>in</strong>heitslastenabrechnungsgesetz<br />
Die Geme<strong>in</strong>den der alten Länder werden gem. § 6 des Geme<strong>in</strong>def<strong>in</strong>anzreformgesetzes vom 10. März 2009<br />
(BGBl. I S. 502) an den Lasten der Deutschen E<strong>in</strong>heit beteiligt. Das Land hat durch das E<strong>in</strong>heitslastenabrechnungsgesetz<br />
<strong>NRW</strong> vom 09.02.2010 (GV. <strong>NRW</strong>. S. 115; SGV. <strong>NRW</strong>. 601) die <strong>in</strong>terkommunale Verteilung der<br />
E<strong>in</strong>heitslasten neu geregelt. Die Ermittlung des jeweiligen Anteils der e<strong>in</strong>zelnen Geme<strong>in</strong>de erfolgt zukünftig <strong>in</strong><br />
GEMEINDEORDNUNG 431
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 88 GO <strong>NRW</strong><br />
e<strong>in</strong>em zweistufigen Verfahren (vgl. Nr. 9 der Begründung allgeme<strong>in</strong>er Teil - LT-Drs. 14/10125). Im E<strong>in</strong>heitslastenabrechnungsgesetz<br />
wird dazu gesetzlich bestimmt, dass das Land den e<strong>in</strong>heitsbed<strong>in</strong>gten Gesamtbelastungsbetrag<br />
gemäß § 2 Absatz 3, den kommunalen F<strong>in</strong>anzierungsanteil gemäß § 3 Absatz 1, den Betrag gemäß § 4<br />
Nummer 2, den saldierten Belastungsausgleich gemäß § 5 und die Höhe der Über- oder Unterzahlung gemäß § 6<br />
Absatz 1 und die Abrechnungsbeträge gemäß § 7 Absatz 2 und 3 werden für das jeweilige Abrechnungsjahr<br />
nachträglich, d.h. nach Ablauf des betreffenden Haushaltsjahres, für jede Geme<strong>in</strong>de errechnet und festgesetzt<br />
(vgl. § 9 des Gesetzes).<br />
Wegen der nachträglichen Abrechnung und e<strong>in</strong>er fehlenden geme<strong>in</strong>descharfen Zuordnung vor dem jeweiligen<br />
Haushaltsjahr (Abrechnungsjahr) s<strong>in</strong>d mögliche Ansprüche oder Verpflichtungen der Geme<strong>in</strong>de im Zeitpunkt der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplanung für dieses Jahr nicht erkennbar, so dass es <strong>in</strong> diesem Fall ke<strong>in</strong>er haushaltsmäßigen<br />
Veranschlagung, jedoch e<strong>in</strong>er Erfassung <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Ergebnisrechnung im Abrechnungsjahr<br />
bedarf.<br />
5.4 Rückstellungen und geme<strong>in</strong>dliche Steuererhebung<br />
Der Gesetzgeber hat durch die abschließende Aufzählung der zulässigen Rückstellungsarten <strong>in</strong> der Vorschrift<br />
bestimmt, dass die Bildung von Rückstellungen im Rahmen der jährlich wiederkehrenden geme<strong>in</strong>dlichen Steuererhebung,<br />
z.B. der Gewerbesteuer, nicht zulässig ist. Die Bildung solcher Rückstellungen würde dem haushaltswirtschaftlichen<br />
Pr<strong>in</strong>zip widersprechen, regelmäßig wiederkehrenden Aufwand nur als laufenden Aufwand zu<br />
erfassen. Außerdem würde <strong>in</strong> diesen Fällen e<strong>in</strong>e Rückstellungsbildung die Transparenz und Klarheit des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushalts bee<strong>in</strong>trächtigen. Auch der <strong>in</strong> § 75 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> gesetzlich bestimmte jährliche Haushaltsausgleich<br />
erfordert geme<strong>in</strong>deübergreifend e<strong>in</strong>e gleiche Handhabung.<br />
Diese Gegebenheit führt dazu, dass bei der geme<strong>in</strong>dlichen Steuererhebung das Entstehen der rechtlichen Verpflichtung<br />
und nicht bereits das mögliche Entstehen e<strong>in</strong>er wirtschaftlichen Verpflichtung der Anlass für die periodengerechte<br />
Zuordnung von Steuererträgen ist. Daher ist objektiv betrachtet erst zum Erfüllungszeitpunkt e<strong>in</strong><br />
Ressourcenaufkommen als entstanden anzusehen, weil der Vorgang durch e<strong>in</strong>en Verwaltungsakt objektiviert wird<br />
und i.d.R. erst zu diesem Zeitpunkt verlässlich bewertbar ist (Bestimmung des Erfüllungszeitpunktes als Realisation<br />
der Zeit nach). Erst aus der Festsetzung oder der Fälligkeit geme<strong>in</strong>dlicher Steuern e<strong>in</strong>e Zurechnung der Ressourcen<br />
zum dem aktuellen Haushaltsjahr vorzunehmen, ist sachgerecht und vertretbar.<br />
Die gesetzlich nicht vorgesehene Rückstellungsbildung aus der geme<strong>in</strong>dlichen Steuererhebung führt daher dazu,<br />
dass von der Geme<strong>in</strong>de auch dann ke<strong>in</strong>e Rückstellungen gebildet werden dürfen, wenn sich örtliche Steuersachverhalte<br />
ggf. unter die Bestimmungen des § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO <strong>NRW</strong> subsumieren lassen. Kommt es<br />
aber nach dem Erlass e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Steuerbescheides zu e<strong>in</strong>em Widerspruch des Betroffenen gegen den<br />
Bescheid bzw. zu e<strong>in</strong>em Klageverfahren ist von der Geme<strong>in</strong>de zum Abschlussstichtag zu prüfen und zu entscheiden,<br />
ob <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em solchen Fall e<strong>in</strong>e Rückstellung für drohende Verluste aus laufenden Verfahren <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Bilanz angesetzt werden muss, sofern der voraussichtliche Verlust nicht ger<strong>in</strong>gfügig se<strong>in</strong> wird.<br />
Von der Betrachtung von Steuersachverhalten aus der geme<strong>in</strong>dlichen Steuererhebung s<strong>in</strong>d zudem die Sachverhalte<br />
zu trennen, durch die für die Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>e Steuerpflicht gegenüber dem Staat entsteht. In diesen Fällen<br />
ist e<strong>in</strong>e Rückstellungsbildung als zulässig anzusehen, z.B. für Steuerschuldverhältnisse der Geme<strong>in</strong>de aus ihrem<br />
„Betrieb gewerblicher Art“. Ist e<strong>in</strong>e solche Rückstellungsbildung durch die Geme<strong>in</strong>de erforderlich, ist diese auf der<br />
Grundlage der Regelungen <strong>in</strong> Absatz 4 dieser Vorschrift vorzunehmen.<br />
GEMEINDEORDNUNG 432
6. Die Abz<strong>in</strong>sung von Rückstellungen der Geme<strong>in</strong>de<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 88 GO <strong>NRW</strong><br />
Die e<strong>in</strong>zelnen Rückstellungen der Geme<strong>in</strong>de s<strong>in</strong>d nach dem Nom<strong>in</strong>alwertpr<strong>in</strong>zip zu bemessen bzw. zu bewerten<br />
und dürfen <strong>in</strong> Anlehnung an das Handelsrecht i.d.R. nicht abgez<strong>in</strong>st werden. Es soll gesichert werden, dass von<br />
der Geme<strong>in</strong>de unter Beachtung des Realisationspr<strong>in</strong>zips e<strong>in</strong> entnahmefähiger Betrag (Erfüllungsbetrag) zurückgestellt<br />
wird. Zudem kann davon ausgegangen werden, dass <strong>in</strong> der Mehrzahl der geme<strong>in</strong>dlichen Rückstellungen<br />
ke<strong>in</strong> verdeckter Z<strong>in</strong>s enthalten ist, z.B. bei Sachleistungsverpflichtungen, bei Verpflichtungen aus Bürgschaften<br />
oder Schadenersatzleistungen.<br />
E<strong>in</strong>e Abz<strong>in</strong>sung ist bei auch Rückstellungen für Altersteilzeit nicht zulässig, denn die Ansprüche e<strong>in</strong>er Beamt<strong>in</strong><br />
oder e<strong>in</strong>es Beamten nach dem Altersteilzeitmodell stellen ke<strong>in</strong>e von der Geme<strong>in</strong>de zu erbr<strong>in</strong>genden abz<strong>in</strong>sbaren<br />
Versorgungsleistungen dar. Diese Sachlage wird auch dadurch deutlich, dass die Rückstellungen für Altersteilzeit<br />
unter den „Sonstigen Rückstellungen“ und nicht unter den „Pensionsrückstellungen“ <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz<br />
anzusetzen s<strong>in</strong>d. Auch längerfristige Umweltschutzverpflichtungen, z.B. Rückstellungen für die Rekultivierung von<br />
Deponien, s<strong>in</strong>d nicht abzuz<strong>in</strong>sen.<br />
Bei Rückstellungen ist deshalb ke<strong>in</strong>e Trennung <strong>in</strong> Beträge für die Erfüllung der Leistungsverpflichtung und für die<br />
Kapitalnutzung vorzunehmen. Nur bei ihren Pensionsrückstellungen darf die Geme<strong>in</strong>de nach Maßgabe des § 36<br />
Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> e<strong>in</strong>e Abz<strong>in</strong>sung vornehmen, denn die geme<strong>in</strong>dlichen Versorgungsleistungen s<strong>in</strong>d mit ihrem<br />
Barwert und nicht mit dem Nom<strong>in</strong>albetrag <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz anzusetzen. Bei dessen Ermittlung ist der<br />
Berechnung e<strong>in</strong> Rechnungsz<strong>in</strong>s von fünf Prozent zu Grunde zu legen.<br />
7. Auflösung und Herabsetzung der Rückstellungen der Geme<strong>in</strong>de<br />
7.1 Die Auflösung von Rückstellungen<br />
7.1.1 Die Auflösung, weil der Grund entfallen ist<br />
Das Gebot <strong>in</strong> dieser Vorschrift ist im E<strong>in</strong>klang mit dem Handelsrecht bestimmt worden. Es verpflichtet die Geme<strong>in</strong>de,<br />
angesetzte Rückstellungen aufzulösen, wenn der Grund hierfür ganz oder teilweise entfallen ist. In den<br />
Fällen, <strong>in</strong> denen absehbar ist, dass die Geme<strong>in</strong>de nun doch nicht zu e<strong>in</strong>er Leistung verpflichtet ist (fehlende Inanspruchnahme<br />
der Geme<strong>in</strong>de), ist die <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz angesetzte Rückstellung zum Abschlussstichtag<br />
ganz oder teilweise aufzulösen. Die Auflösung e<strong>in</strong>er Rückstellung wegen e<strong>in</strong>es nicht mehr vorhandenen Bedarfs<br />
führt zu e<strong>in</strong>er Ergebniswirksamkeit und daher zu e<strong>in</strong>er Erfassung als Ertrag <strong>in</strong> der Ergebnisrechnung.<br />
E<strong>in</strong> Wahlrecht, die Inanspruchnahme e<strong>in</strong>er Rückstellung ergebniswirksam abzuwickeln, d.h. ertragswirksam aufzulösen<br />
und gleichzeitig Aufwendungen <strong>in</strong>sgesamt <strong>in</strong> Höhe der erforderlichen Auszahlungen zu erfassen, und<br />
entsprechend im Jahresabschluss nachzuweisen, besteht nicht. Anders als im Handelsrecht ist für die Geme<strong>in</strong>den<br />
e<strong>in</strong>e gesonderte Erfassung ihrer Zahlungsströme im Rahmen der F<strong>in</strong>anzrechnung vorgegeben. Daher bedarf<br />
es bei den Geme<strong>in</strong>den - abweichend vom Handelsrecht - ke<strong>in</strong>er Überführung solcher Zahlungsleistungen <strong>in</strong> Aufwendungen<br />
und e<strong>in</strong>er Überführung der Herabsetzung von Rückstellungen zu Erträgen im Rahmen der „kaufmännischen“<br />
Aufwandsm<strong>in</strong>derung (Saldierung).<br />
7.1.2 Die Auflösung wegen e<strong>in</strong>es Verzichts auf Instandhaltung<br />
Das Gebot <strong>in</strong> dieser Vorschrift verpflichtet die Geme<strong>in</strong>den, auch angesetzte Rückstellungen für unterlassene<br />
Instandhaltung aufzulösen, wenn die geplanten (konkret beabsichtigten) Maßnahmen nach dem Haushaltsplan<br />
nicht umgesetzt worden s<strong>in</strong>d und die dafür gebildete Rückstellung nicht mehr benötigt wird. Die Geme<strong>in</strong>de hat <strong>in</strong><br />
diesen Fällen regelmäßig e<strong>in</strong>e Wertberichtigung beim Ansatz der betreffenden Vermögensgegenstände <strong>in</strong> der<br />
GEMEINDEORDNUNG 433
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 88 GO <strong>NRW</strong><br />
geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz vorzunehmen. Bei der Bildung der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung für bestimmte<br />
geme<strong>in</strong>dliche Vermögensgegenstände ist nach dem Bruttopr<strong>in</strong>zip vorzugehen, so dass der Wertansatz<br />
dieser Vermögensgegenstände nicht verändert wurde. Bei der ertragswirksamen Auflösung e<strong>in</strong>er Rückstellung für<br />
unterlassene Instandhaltung muss daher wegen nicht durchgeführter Instandhaltungsmaßnahmen <strong>in</strong> entsprechender<br />
Höhe e<strong>in</strong>e außerplanmäßige Abschreibung der betreffenden geme<strong>in</strong>dlichen Vermögensgegenstände<br />
vorgenommen werden. Diese haushaltswirtschaftlichen Maßnahmen s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Ergebnisrechnung<br />
zu erfassen.<br />
7.1.3 Die Auflösung wegen e<strong>in</strong>es Ausgleichs bei Dienstherrnwechsel<br />
In Ausnahmefällen kann es beim Wechsel e<strong>in</strong>er Beamt<strong>in</strong> oder e<strong>in</strong>es Beamten zu e<strong>in</strong>em anderen Dienstherrn<br />
jedoch geboten se<strong>in</strong>, sich sofort von der späteren Beteiligungsverpflichtung durch e<strong>in</strong>e Ausgleichszahlung zu<br />
entlasten. Wenn <strong>in</strong> solchen Fällen die Erstattungsverpflichtung des abgebenden Dienstherrn gegenüber dem<br />
neuen Dienstherrn durch e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>malige Leistung abgegolten worden ist, kann auf den Erhalt der vorgenommenen<br />
Rückstellung für diese früheren Bediensteten verzichtet werden. Dem Aufwand aus der Leistung an den<br />
neuen Dienstherrn steht dann der Ertrag aus der Auflösung der gebildeten Rückstellung gegenüber, weil für die<br />
abgebende Geme<strong>in</strong>de der Grund für ihre Rückstellungsbildung entfallen ist.<br />
7.2 Die Herabsetzung von Rückstellungen<br />
7.2.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Das <strong>in</strong> dieser Vorschrift enthaltene Gebot verpflichtet die Geme<strong>in</strong>de aber auch darauf zu achten, dass sie die<br />
Rückstellungen nur für die Zwecke <strong>in</strong> Anspruch nimmt, für die sie ursprünglich gebildet wurden. Dazu bietet z.B.<br />
die <strong>in</strong> den Haushaltsplan <strong>in</strong>tegrierte mittelfristige Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung e<strong>in</strong>e Hilfestellung. Die Inanspruchnahme<br />
e<strong>in</strong>er Rückstellung führt zu ihrer ergebnisneutralen Herabsetzung. E<strong>in</strong>e Herabsetzung von Rückstellungen<br />
erfolgt i.d.R. kann durch e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>malige Inanspruchnahme, z.B. bei Durchführung e<strong>in</strong>er Instandhaltung, für die<br />
e<strong>in</strong>e Rückstellung gebildet wurde. Sie wird aber auch wegen laufender Leistungen vorgenommen, wenn die Geme<strong>in</strong>de<br />
ab dem E<strong>in</strong>tritt ihrer Beamt<strong>in</strong> oder ihres Beamten <strong>in</strong> den Ruhestand ihre Verpflichtung zur Zahlung von<br />
laufenden Versorgungsleistungen erfüllt. Durch die Leistung von Zahlungen der Geme<strong>in</strong>de ausgelöste Herabsetzungen<br />
von Rückstellungen berühren nur die geme<strong>in</strong>dliche F<strong>in</strong>anzrechnung.<br />
7.2.2 Die Herabsetzung durch e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>malige Inanspruchnahme<br />
Mit der Umsetzung der von der Geme<strong>in</strong>de vorgesehenen Instandhaltungsmaßnahme, für die von der Geme<strong>in</strong>de<br />
e<strong>in</strong>e Rückstellung gebildet wurde, wird diese <strong>in</strong> Anspruch genommen. Dadurch ist der bilanzielle Ansatz der gebildeten<br />
Rückstellung entsprechend zu verr<strong>in</strong>gern. Die von der Geme<strong>in</strong>de aus der Umsetzung entstehenden<br />
Zahlungsverpflichtungen stellen <strong>in</strong> diesen Fällen ke<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>dlichen Aufwendungen dar, so dass die Ergebnisrechnung<br />
der Geme<strong>in</strong>de nicht berührt wird. Die von der Geme<strong>in</strong>de zu erbr<strong>in</strong>genden Zahlungen (Leistungen) s<strong>in</strong>d<br />
deshalb nur über die geme<strong>in</strong>dliche F<strong>in</strong>anzrechnung abzuwickeln.<br />
In diesem Zusammenhang ist <strong>in</strong> den Fällen, <strong>in</strong> denen die von der Geme<strong>in</strong>de bilanzierte Rückstellung zu hoch<br />
bemessen worden ist, der nicht benötigte Anteil der geme<strong>in</strong>dlichen Rückstellung über die Ergebnisrechnung<br />
ertragswirksam aufzulösen. Ist dagegen aber die bilanzierte Rückstellung zu niedrig bemessen worden, stellt der<br />
fehlende, nicht zurückgestellte Anteil, z.B. an e<strong>in</strong>er Instandhaltungsmaßnahme, für die von der Geme<strong>in</strong>de zu<br />
erbr<strong>in</strong>genden Leistungen weitere geme<strong>in</strong>dliche Aufwendungen dar, die von der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> ihrer Ergebnisrechnung<br />
zu erfassen s<strong>in</strong>d.<br />
GEMEINDEORDNUNG 434
7.2.3 Herabsetzung wegen laufender Leistungen<br />
7.2.3.1 Der Umfang der Herabsetzung<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 88 GO <strong>NRW</strong><br />
Wenn die Geme<strong>in</strong>de ihre Verpflichtung durch die Zahlung von laufenden Versorgungsleistungen erfüllt, s<strong>in</strong>d die <strong>in</strong><br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz angesetzten Pensionsrückstellungen zu reduzieren, denn die Geme<strong>in</strong>de muss ab dem<br />
E<strong>in</strong>tritt ihrer Beamt<strong>in</strong> oder ihres Beamten <strong>in</strong> den Ruhestand regelmäßig Versorgungsbezüge an diese Personen<br />
zahlen. Durch diese Zahlungen der Geme<strong>in</strong>de wird daher grundsätzlich e<strong>in</strong>e Herabsetzung der <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Bilanz angesetzten Pensionsrückstellungen veranlasst. Der Umfang e<strong>in</strong>er Herabsetzung wird jedoch nicht<br />
ausschließlich durch die geleisteten Zahlungen bestimmt, sondern ist nach der versicherungsmathematischen<br />
und nicht nach der buchhalterischen Methode vorzunehmen.<br />
Die mögliche Herabsetzung der Pensionsrückstellungen entsteht vielmehr dadurch, dass die Geme<strong>in</strong>de durch die<br />
Zahlung von Versorgungsbezügen <strong>in</strong>sbesondere auch zeitlich e<strong>in</strong>en Teil ihrer Verpflichtungen gegenüber ihren<br />
Beamt<strong>in</strong>nen und Beamten erfüllt hat (Teilerfüllung). Zum Beispiel hätte die Geme<strong>in</strong>de bei e<strong>in</strong>er Verpflichtung<br />
gegenüber e<strong>in</strong>er Person über e<strong>in</strong>en Zeitraum von 30 Jahren am Eröffnungsbilanzstichtag dafür den Barwert als<br />
Rückstellungsbetrag <strong>in</strong> ihrer Bilanz anzusetzen. Am folgenden Abschlussstichtag wäre dann für e<strong>in</strong>en Zeitraum<br />
von 29 Jahren der Barwert anzusetzen. Diese Sachlage kann zu e<strong>in</strong>er Herabsetzung von Pensionsrückstellungen<br />
führen. Der Wertansatz der Pensionsrückstellungen <strong>in</strong> der Bilanz der Geme<strong>in</strong>de ist daher dann herab zu setzen,<br />
wenn er am Abschlussstichtag höher ist, als es dem Barwert der noch <strong>in</strong> Zukunft zu leistenden Versorgungszahlungen<br />
zu diesem Stichtag entspricht.<br />
7.2.3.2 Die Ermittlung der Zuführungen und Herabsetzungen<br />
In der Praxis werden vielfach die Pensionsverpflichtungen der Geme<strong>in</strong>de zu jedem Abschlussstichtag nur <strong>in</strong>sgesamt<br />
und nicht getrennt nach Beschäftigten und Versorgungsempfängern neu ermittelt. Das Ergebnis wird dem<br />
Bestand zum Abschlussstichtag des Vorjahres gegenüber gestellt und der sich daraus ergebende Saldo ergebniswirksam.<br />
Durch die Beschäftigten der Geme<strong>in</strong>de werden im gleichen Haushaltsjahr jedoch regelmäßig weitere<br />
Ansprüche auf künftige Versorgungsleistungen erworben. Dieses führt dazu, dass es neben der Herabsetzung<br />
von Pensionsrückstellungen wegen der zu zahlenden Versorgungsleistungen auch weitere Zuführungen zu den<br />
Pensionsrückstellungen erforderlich werden.<br />
Bei e<strong>in</strong>er solchen Vorgehensweise muss von der Geme<strong>in</strong>de gewährleistet werden, dass die erworbenen Ansprüche<br />
der Beschäftigten periodengerecht dem Haushaltsjahr als Aufwendungen zugerechnet werden können. Außerdem<br />
ist haushaltsmäßig e<strong>in</strong>e Differenzierung nach Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen<br />
unter Beachtung des Bruttopr<strong>in</strong>zips vorzunehmen (vgl. § 3 i.V.m. § 11 Abs. 2 GemHVO <strong>NRW</strong>). E<strong>in</strong>e Erfassung<br />
des Saldos aus dem Gesamtbestand der Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger und die Beschäftigten<br />
durch e<strong>in</strong>en Vergleich des Wertansatzes für Pensionsrückstellungen an zwei aufe<strong>in</strong>anderfolgenden<br />
Abschlussstichtagen <strong>in</strong> der Ergebnisrechnung genügt nicht den haushaltsrechtlichen Anforderungen.<br />
7.3 Ergebniswirksamkeit bei Veränderungen der Verpflichtung<br />
7.3.1 Herabsetzung von Pensionsrückstellungen und Aufwendungen<br />
Von der Geme<strong>in</strong>de muss zu jedem Abschlussstichtag geprüft werden, ob e<strong>in</strong>e Herabsetzung von Pensionsrückstellungen<br />
erfolgen kann. Der Saldo aus dem dazu notwendigen Vergleich der Barwerte der Pensionsrückstellungen<br />
zum Abschlussstichtag mit denen des vorherigen Abschlussstichtages zeigt dabei auf, ob e<strong>in</strong>e Herabsetzung<br />
GEMEINDEORDNUNG 435
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 88 GO <strong>NRW</strong><br />
der Pensionsrückstellungen oder e<strong>in</strong>e Zuführung zu Pensionsrückstellungen vorzunehmen ist. Die Bewertung von<br />
Pensionsrückstellungen ist darauf angelegt, die Aufwendungen der Geme<strong>in</strong>de über die Totalperiode zu verteilen.<br />
Die Bewertung der Pensionsrückstellungen zum Barwert statt e<strong>in</strong>es Ansatzes zum Nom<strong>in</strong>alwert br<strong>in</strong>gt es daher<br />
mit sich, dass i.d.R. trotz e<strong>in</strong>er Veränderung des Ansatzes der Pensionsrückstellungen die <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Haushaltsjahr<br />
zu zahlenden Versorgungsbezüge die mögliche Herabsetzung des Wertansatzes für Pensionsrückstellungen<br />
übersteigen. In den Fällen, <strong>in</strong> denen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Haushaltsjahr die Versorgungsauszahlungen der Geme<strong>in</strong>de die<br />
Herabsetzung des Wertansatzes für Pensionsrückstellungen übersteigen, stellen die Versorgungsauszahlungen<br />
<strong>in</strong>soweit geme<strong>in</strong>dliche Aufwendungen dar, die <strong>in</strong> der Ergebnisrechnung des betreffenden Haushaltsjahres von der<br />
Geme<strong>in</strong>de zu erfassen s<strong>in</strong>d.<br />
7.3.2 Verzicht auf Urlaubsansprüche und Arbeitszeitguthaben<br />
Aus nicht beanspruchtem Urlaub der Beschäftigten im abgelaufenen Haushaltsjahr sowie aus bestehenden Arbeitszeitguthaben<br />
der Beschäftigten entstehen für die Geme<strong>in</strong>de am Abschlussstichtag entsprechende Verpflichtungen<br />
gegenüber ihren Beschäftigten. Deshalb müssen von der Geme<strong>in</strong>de dafür Rückstellungen gebildet werden,<br />
wenn für die am Abschlussstichtag ermittelten o.a. Ansprüche der Beschäftigten e<strong>in</strong>e Abgeltung durch Urlaub<br />
oder e<strong>in</strong>e Barabgeltung vorgesehen bzw. nicht ausgeschlossen worden ist. In den Fällen, <strong>in</strong> denen die Ansprüche<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Beschäftigten auf Urlaub und Arbeitszeitguthaben aus dem vergangenen Haushaltsjahr<br />
im Folgejahr durch die Gewährung von Urlaub oder Freizeit und nicht durch e<strong>in</strong>e Abgeltung <strong>in</strong> Geld erfolgt, ist<br />
e<strong>in</strong>e ergebniswirksame Herabsetzung der für Urlaubsansprüche und Arbeitszeitguthaben gebildeten Rückstellungen<br />
vorzunehmen. Der Umfang e<strong>in</strong>er solchen Herabsetzung gebildeter Rückstellungen ist <strong>in</strong> der Ergebnisrechnung<br />
der Geme<strong>in</strong>de zu erfassen.<br />
7.4 Der Passivtausch zwischen Rückstellungen und Verb<strong>in</strong>dlichkeiten<br />
E<strong>in</strong>e Rückstellung ist auch aufzulösen, wenn z.B. aus e<strong>in</strong>er ungewissen Verb<strong>in</strong>dlichkeit, die der Grund für die<br />
Rückstellungsbildung war, e<strong>in</strong>e gewisse Verb<strong>in</strong>dlichkeit geworden ist. Bei übere<strong>in</strong>stimmenden Beträgen erfolgt<br />
dann e<strong>in</strong> Passivtausch zwischen den Rückstellungen und den Verb<strong>in</strong>dlichkeiten. Nur wenn bei e<strong>in</strong>em solchen<br />
Passivtausch noch e<strong>in</strong> Teilbetrag bei der Rückstellung bestehen bleibt und ke<strong>in</strong> Grund mehr für dessen Ansatz <strong>in</strong><br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz besteht, ist dieser Betrag ertragswirksam durch Erfassung <strong>in</strong> der Ergebnisrechnung<br />
aufzulösen. Dies erfordert, die <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz angesetzten Rückstellungen an jedem Abschlusstag<br />
zu überprüfen und ggf. anzupassen.<br />
Die Grenzen der geme<strong>in</strong>dlichen Rückstellungsbildung werden auch dadurch bestimmt, dass Rückstellungen<br />
aufzulösen s<strong>in</strong>d, wenn der Grund dafür entfallen ist (vgl. § 36 Abs. 6 S. 2 GemHVO <strong>NRW</strong>). Wenn bei der Aufstellung<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz z.B. nicht mehr mit e<strong>in</strong>er Inanspruchnahme zu rechnen ist, weil sich die Verhältnisse<br />
geändert haben oder neue Erkenntnisse über den Sachverhalt vorliegen, die zu e<strong>in</strong>er veränderten Beurteilung<br />
führen, s<strong>in</strong>d die entsprechenden Rückstellungen ganz oder teilweise aufzulösen. Werden von der Geme<strong>in</strong>de die<br />
e<strong>in</strong>zelnen Rückstellungen richtig bemessen, s<strong>in</strong>d diese beim E<strong>in</strong>tritt von aus der Verpflichtung zu erbr<strong>in</strong>genden<br />
Leistungen ergebnisneutral ganz oder teilweise aufzulösen bzw. herab zu setzen. Ist die Rückstellung zu hoch<br />
bemessen worden, ist der nicht benötigte Teil als Ertrag <strong>in</strong> der Ergebnisrechnung der Geme<strong>in</strong>de zu erfassen. Ist<br />
sie zu niedrig bemessen worden, stellt der fehlende Teil Aufwendungen <strong>in</strong> der Ergebnisrechnung dar.<br />
Von der Geme<strong>in</strong>de gebildete Rückstellungen s<strong>in</strong>d grundsätzlich herab zu setzen, wenn diese wegen laufender<br />
Leistungen, z.B. Renten, <strong>in</strong> Anspruch genommen werden. Bei Geme<strong>in</strong>den s<strong>in</strong>d gebildete Pensionsrückstellungen<br />
herab zu setzen, wenn ab dem E<strong>in</strong>tritt e<strong>in</strong>er Beamt<strong>in</strong> oder e<strong>in</strong>es Beamten <strong>in</strong> den Ruhestand diesen Versorgungsbezüge<br />
gezahlt werden. Dadurch erfüllt die Geme<strong>in</strong>de ihre Verpflichtungen aus der Vergangenheit, die zur Bil-<br />
GEMEINDEORDNUNG 436
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 88 GO <strong>NRW</strong><br />
dung von Rückstellungen geführt haben. Die Erfüllung der geme<strong>in</strong>dlichen Verpflichtungen reduziert nicht immer<br />
im gleichen Umfang den Wertansatz der Pensionsrückstellungen <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz.<br />
E<strong>in</strong>e Veränderung e<strong>in</strong>es Wertansatzes ist nur dann vorzunehmen, wenn der Wertansatz höher ist als es dem<br />
Barwert der noch <strong>in</strong> Zukunft zu leistenden Versorgungszahlungen entspricht. Ob dieser Sachverhalt örtlich gegeben<br />
ist, muss von der Geme<strong>in</strong>de zu jedem Abschlussstichtag geprüft werden. Soweit die Versorgungsauszahlungen<br />
die mögliche Herabsetzung des Wertansatzes für Pensionsrückstellungen übersteigen, stellen sie Aufwendungen<br />
dar, die <strong>in</strong> der Ergebnisrechnung des betreffenden Haushaltsjahres zu erfassen s<strong>in</strong>d.<br />
8. Der Rückstellungsspiegel<br />
Es ist für die Geme<strong>in</strong>de s<strong>in</strong>nvoll, sich im Rahmen des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses e<strong>in</strong>en detaillierten Überblick<br />
über den Stand und die Veränderungen der Rückstellungen zum Abschlussstichtag zu verschaffen. Als<br />
Grundgliederung des geme<strong>in</strong>dlichen Rückstellungsspiegels bietet sich die Bilanzgliederung nach § 41 Abs. 4 Nr.<br />
3 GemHVO <strong>NRW</strong> an, die im Teil A um die Veränderungen im Haushaltsjahr und <strong>in</strong> Teil B um e<strong>in</strong>e zeitliche Komponente<br />
nach Laufzeiten erweitert wird (vgl. Abbildung).<br />
Arten der<br />
Rückstellungen<br />
(Gliederung<br />
m<strong>in</strong>destens wie<br />
<strong>in</strong> der Bilanz<br />
nach § 41 Abs. 4 Nr. 3<br />
GemHVO <strong>NRW</strong>)<br />
Arten der<br />
Rückstellungen<br />
(Gliederung<br />
m<strong>in</strong>destens wie<br />
<strong>in</strong> der Bilanz<br />
nach § 41 Abs. 4 Nr. 3<br />
GemHVO <strong>NRW</strong>)<br />
Rückstellungsspiegel Teil A<br />
Gesamt-<br />
betrag<br />
am 31.12<br />
des<br />
Vor-<br />
jahres<br />
EUR<br />
Zufüh-<br />
rungen<br />
EUR<br />
Veränderungen<br />
im Haushaltsjahr<br />
Laufende<br />
Auflösung<br />
EUR<br />
Rückstellungsspiegel Teil B<br />
Gesamt-<br />
betrag<br />
am 31.12<br />
des Haus-<br />
halts-<br />
jahres<br />
EUR<br />
Grund<br />
entfallen<br />
EUR<br />
mit e<strong>in</strong>er Restlaufzeit von<br />
bis zu 1<br />
Jahr<br />
EUR<br />
1 bis 5<br />
Jahre<br />
EUR<br />
Abbildung 68 „Rückstellungsspiegel“<br />
GEMEINDEORDNUNG 437<br />
mehr als<br />
5 Jahre<br />
EUR<br />
Gesamt-<br />
betrag<br />
am 31.12<br />
des<br />
Haus-<br />
jahres<br />
EUR<br />
Gesamt-<br />
betrag<br />
am 31.12<br />
des<br />
Vor-<br />
jahres<br />
EUR
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 88 GO <strong>NRW</strong><br />
Im Teil A wird daher der Gesamtbetrag am Ende des Vorjahres, die Veränderungen aus dem abgelaufenen<br />
Haushaltsjahr und der Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres <strong>in</strong> Bezug auf die e<strong>in</strong>zelnen Arten von Rückstellungen<br />
aufgezeigt. Darüber h<strong>in</strong>aus werden im Teil B die e<strong>in</strong>zelnen Arten von Rückstellungen, gegliedert nach<br />
Fristigkeiten, aufgezeigt. E<strong>in</strong> solcher Rückstellungsspiegel macht die e<strong>in</strong>zelnen Wertansätze <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Bilanz transparent und nachvollziehbar. E<strong>in</strong> solcher Rückstellungsspiegel trägt erheblich zur Übersichtlichkeit der<br />
<strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz angesetzten Rückstellungen bei. Die Geme<strong>in</strong>de kann dazu auch weitere Zusatz<strong>in</strong>formationen<br />
geben, die aus örtlichen Gegebenheiten heraus sachgerecht s<strong>in</strong>d.<br />
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ<br />
GEMEINDEORDNUNG 438
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 89 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 89<br />
Liquidität<br />
(1) Die Geme<strong>in</strong>de hat ihre Zahlungsfähigkeit durch e<strong>in</strong>e angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen.<br />
(2) 1 Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Geme<strong>in</strong>de Kredite zur Liquiditätssicherung bis zu<br />
dem <strong>in</strong> der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit dafür ke<strong>in</strong>e anderen Mittel zur Verfügung<br />
stehen. 2 Diese Ermächtigung gilt über das Haushaltsjahr h<strong>in</strong>aus bis zum Erlass der neuen Haushaltssatzung.<br />
Erläuterungen zu § 89:<br />
I. Allgeme<strong>in</strong>es<br />
1. Die Sicherstellung der Liquidität der Geme<strong>in</strong>de<br />
Die Vorschrift führt den Haushaltsgrundsatz „die Geme<strong>in</strong>de hat ihre Liquidität e<strong>in</strong>schließlich der F<strong>in</strong>anzierung der<br />
Investitionen sicherzustellen“ näher aus (vgl. § 75 Abs. 6 GO <strong>NRW</strong>). In diesem Zusammenhang umfasst der<br />
Begriff „Liquidität“ die Fähigkeit der Geme<strong>in</strong>de, ihren Zahlungsverpflichtungen term<strong>in</strong>gerecht und betragsgenau<br />
nachzukommen. Für die Aufnahme von Krediten für Investitionen müssen wegen der besonderen haushaltsrechtlichen<br />
Bedeutung materielle und formelle Voraussetzungen erfüllt se<strong>in</strong>. Wie <strong>in</strong> den anderen Ländern besteht<br />
deshalb e<strong>in</strong>e Begrenzung der langfristigen Kreditaufnahme auf die Investitionstätigkeit. Weil die Aufnahme von<br />
Krediten für Investitionen zeitlich zu begrenzen ist, muss dies entsprechend auch für die Kredite zur Liquiditätssicherung<br />
gelten. Der Begriff „Investitionen“ ist unter § 86 GO <strong>NRW</strong> und § 14 GemHVO <strong>NRW</strong> näher erläutert.<br />
E<strong>in</strong>e gesetzliche Verpflichtung der Geme<strong>in</strong>de ist erforderlich, weil e<strong>in</strong>e Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der<br />
Geme<strong>in</strong>de nur durch e<strong>in</strong>e angemessene Liquiditätsplanung erreicht werden kann (vgl. § 30 Abs. 6 GemHVO<br />
<strong>NRW</strong>). Zur Ausgestaltung des o.a. Haushaltsgrundsatzes gehört daher auch die weitere gesetzliche Grundlage,<br />
dass die Geme<strong>in</strong>de zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen bedarfsgerecht die notwendigen Kredite zur<br />
Liquiditätssicherung unter E<strong>in</strong>haltung des <strong>in</strong> der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrages aufnehmen<br />
kann, um notwendigerweise den kurzfristigen Liquiditätsbedarf zu decken. Die Regelungen über die Aufnahme<br />
von Krediten für Investitionen <strong>in</strong> § 86 GO <strong>NRW</strong> bleiben dabei von der Vorschrift über die Liquidität unberührt.<br />
Im Zusammenhang mit der Liquiditätsplanung wird vielfach auch der Ausweis e<strong>in</strong>er „Liquiditätsreserve“ <strong>in</strong> der<br />
F<strong>in</strong>anzrechnung gewünscht, um aufzuzeigen, dass die Geme<strong>in</strong>de ihren Bestand an liquiden Mitteln durch Umwandlung<br />
von F<strong>in</strong>anzanlagen oder mit Hilfe vergleichbarer Maßnahmen kurzfristig erhöhen kann. Diese Art der<br />
Bewirtschaftung und Planung von Liquidität muss als <strong>in</strong>terne Maßnahme der Geme<strong>in</strong>de bewertet werden und ist<br />
daher für die Geme<strong>in</strong>de nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften nicht pflichtig vorgesehen, denn sie führt<br />
nicht zu kassenwirksamen E<strong>in</strong>zahlungen und Auszahlungen.<br />
Die Geme<strong>in</strong>de kann daher <strong>in</strong>tern und <strong>in</strong> eigener Verantwortung e<strong>in</strong>en F<strong>in</strong>anzmittelfonds im Rahmen ihrer Liquiditätsplanung<br />
führen, um jederzeit e<strong>in</strong>en Gesamtüberbick über ihren Bestand an Zahlungsmitteln, z.B. Barmittel<br />
und täglich fällige Sichte<strong>in</strong>lagen, und Zahlungsmitteläquivalente, z.B. kurzfristige, äußerst liquiden F<strong>in</strong>anzmittel,<br />
die jederzeit <strong>in</strong> F<strong>in</strong>anzmittel umgewandelt werden können und nur unwesentlichen Wertschwankungen unterliegen,<br />
zu erhalten und bewirtschaften zu können. E<strong>in</strong> gesonderter Ausweis der Liquiditätsreserve sowie ggf. auch<br />
ist aber weder als gesonderte Position <strong>in</strong> der F<strong>in</strong>anzrechnung noch als gesonderter Posten <strong>in</strong> der Bilanz vorgesehen,<br />
so dass auch mögliche Änderungen dort nicht zu erfassen s<strong>in</strong>d.<br />
GEMEINDEORDNUNG 439
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 89 GO <strong>NRW</strong><br />
2. E<strong>in</strong>zahlungen und Auszahlungen als Rechengrößen<br />
2.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die F<strong>in</strong>anzrechnung der Geme<strong>in</strong>de soll Auskunft über die tatsächliche f<strong>in</strong>anzielle Lage der Geme<strong>in</strong>de geben und<br />
dabei auch die F<strong>in</strong>anzierungsquellen sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes der Geme<strong>in</strong>de (Liquide<br />
Mittel) aufzeigen. Dadurch stellt die F<strong>in</strong>anzrechnung e<strong>in</strong>e Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsrechnung der<br />
Geme<strong>in</strong>de dar, bei der die Zahlungsströme ausschlaggebend s<strong>in</strong>d. Auf Grund dessen kommen bei der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
F<strong>in</strong>anzrechnung die Rechengrößen „E<strong>in</strong>zahlungen“ und „Auszahlungen“ als zutreffender Buchungsstoff zur<br />
Anwendung.<br />
Die geme<strong>in</strong>dlichen E<strong>in</strong>zahlungen und Auszahlung s<strong>in</strong>d zudem unter Beachtung des Kassenwirksamkeitspr<strong>in</strong>zips<br />
<strong>in</strong> der F<strong>in</strong>anzrechnung der Geme<strong>in</strong>de zu erfassen. Dieses Pr<strong>in</strong>zip ist, vergleichbar mit der Entwicklung der Kassenkredite<br />
zu Krediten für die Liquiditätssicherung, zum Liquiditätsänderungspr<strong>in</strong>zip weiterentwickelt worden.<br />
Deshalb dürfen unter den Haushaltspositionen im F<strong>in</strong>anzplan nur Beträge <strong>in</strong> Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich<br />
e<strong>in</strong>gehenden oder zu leistenden Zahlungen ausgewiesen werden, die e<strong>in</strong>e Änderung der Liquidität der<br />
Geme<strong>in</strong>de bewirken.<br />
2.2 Die Rechengröße „E<strong>in</strong>zahlungen“<br />
Unter der geme<strong>in</strong>dlichen Rechengröße „E<strong>in</strong>zahlungen“ wird der tatsächliche Zahlungsmittelzufluss bei der Geme<strong>in</strong>de<br />
im Haushaltsjahr erfasst, der zu e<strong>in</strong>er Erhöhung des geme<strong>in</strong>dlichen Zahlungsmittelbestandes durch den<br />
Zugang liquider Mittel, die <strong>in</strong> Form von Bargeld oder Buchgeld der Geme<strong>in</strong>de zufließen, führt. Nicht als E<strong>in</strong>zahlung<br />
gilt die Erhöhung des Kassenbestandes der Geme<strong>in</strong>de durch e<strong>in</strong>e Barabhebung von e<strong>in</strong>em Bankkonto der<br />
Geme<strong>in</strong>de, weil dadurch der Zahlungsmittelbestand der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong>sgesamt nicht verändert wird. Die Begriffspaare<br />
„E<strong>in</strong>zahlungen“ und „E<strong>in</strong>nahmen“ können im geme<strong>in</strong>dlichen Bereich wie folgt unterschieden werden:<br />
E<strong>in</strong>zahlung, die nicht gleichzeitig<br />
e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>nahme ist<br />
E<strong>in</strong>zahlung<br />
Rechengröße „E<strong>in</strong>zahlungen“<br />
E<strong>in</strong>zahlung, die gleichzeitig<br />
e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>nahme ist<br />
E<strong>in</strong>nahme, die gleichzeitig<br />
e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>zahlung ist<br />
E<strong>in</strong>nahme<br />
Abbildung 69 „Rechengröße E<strong>in</strong>zahlungen“<br />
E<strong>in</strong>nahme, die nicht gleichzeitig<br />
e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>zahlung ist<br />
In diesem Zusammenhang liegen beim E<strong>in</strong>satz der Rechengrößen „E<strong>in</strong>zahlungen“ und „E<strong>in</strong>nahme“ im geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Rechnungswesen dann nicht e<strong>in</strong>nahmewirksame E<strong>in</strong>zahlungen vor, wenn es <strong>in</strong> gleicher Höhe zu e<strong>in</strong>er zu<br />
e<strong>in</strong>er Abnahme der geme<strong>in</strong>dlichen Forderungen oder zu e<strong>in</strong>er Erhöhung der geme<strong>in</strong>dlichen Verb<strong>in</strong>dlichkeiten<br />
kommt.<br />
GEMEINDEORDNUNG 440
2.3 Die Rechengröße „Auszahlungen“<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 89 GO <strong>NRW</strong><br />
Unter der geme<strong>in</strong>dlichen Rechengröße „Auszahlungen“ wird der tatsächliche Zahlungsmittelabfluss bei der Geme<strong>in</strong>de<br />
im Haushaltsjahr erfasst, der zu e<strong>in</strong>er Verm<strong>in</strong>derung des geme<strong>in</strong>dlichen Zahlungsmittelbestandes durch<br />
den Abgang liquider Mittel führt. Die Abgabe von F<strong>in</strong>anzmitteln durch die Geme<strong>in</strong>de kann <strong>in</strong> Form von Bargeld<br />
oder Buchgeld erfolgen. Die Begriffspaare „Aufwendungen“ und „Ausgaben“ können im geme<strong>in</strong>dlichen Bereich<br />
wie folgt unterschieden werden:<br />
Auszahlung, die nicht gleichzeitig<br />
ausgabewirksam ist<br />
Auszahlung<br />
Rechengröße „Auszahlungen“<br />
Auszahlung, die gleichzeitig<br />
ausgabewirksam ist<br />
Ausgabe, die gleichzeitig<br />
auszahlungswirksam ist<br />
Ausgabe<br />
Abbildung 70 „Rechengröße Auszahlungen“<br />
Ausgabe, die nicht gleichzeitig<br />
auszahlungswirksam ist<br />
In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass beim E<strong>in</strong>satz der Rechengrößen „Auszahlungen“ und „Ausgabe“<br />
auch dann ke<strong>in</strong>e ausgabewirksamen Auszahlungen vorliegen, wenn es <strong>in</strong> gleicher Höhe zu e<strong>in</strong>er zu e<strong>in</strong>er M<strong>in</strong>derung<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Verb<strong>in</strong>dlichkeiten oder zu e<strong>in</strong>er Zunahme der geme<strong>in</strong>dlichen Forderungen kommt. Auch<br />
e<strong>in</strong>e Verm<strong>in</strong>derung des Kassenbestandes der Geme<strong>in</strong>de durch e<strong>in</strong>e Bare<strong>in</strong>zahlung auf e<strong>in</strong> Bankkonto der Geme<strong>in</strong>de<br />
gilt nicht als geme<strong>in</strong>dliche Auszahlung, weil durch diesen Vorgang der Zahlungsmittelbestand der Geme<strong>in</strong>de<br />
<strong>in</strong>sgesamt nicht verändert wird.<br />
3. Der Nachweis der Kredite zur Liquiditätssicherung<br />
3.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung führt zur Erhöhung der Zahlungsmittel der Geme<strong>in</strong>de. Diese<br />
Kredite s<strong>in</strong>d daher mit ihrem Stand zum Abschlussstichtag (Rückzahlungsbetrag) <strong>in</strong> der F<strong>in</strong>anzrechnung gesondert<br />
auszuweisen. Weil diese Kredite wegen der mangelnden unterjährigen Zahlungsfähigkeit der Geme<strong>in</strong>de<br />
bedarfsgerecht und tagesgenau aufgenommen werden, steht deren Rückzahlungsbetrag nur zum Stichtag des<br />
Jahresabschlusses genau fest. vorhersehbar ist. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung stellt<br />
daher e<strong>in</strong>e örtliche Schätzgröße aus den Erfahrungswerten der Geme<strong>in</strong>de dar. Daher bedarf es bei jedem Jahresabschluss<br />
e<strong>in</strong>es Nachweises der Kredite zur Liquiditätssicherung <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzrechnung. E<strong>in</strong>er<br />
vorherigen Veranschlagung der Kredite zur Liquiditätssicherung im geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzplan bedarf es dagegen<br />
nicht (vgl. § 3 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
GEMEINDEORDNUNG 441
3.2 Der Nachweis <strong>in</strong> der F<strong>in</strong>anzrechnung<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 89 GO <strong>NRW</strong><br />
Der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzrechnung kommt die Aufgabe zu, e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes<br />
Bild der F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de, also der E<strong>in</strong>zahlungs- und Auszahlungsströme, zu vermitteln. Sie ist im NKF<br />
die dritte Säule und e<strong>in</strong> Element, das mit der im kaufmännischen Rechnungswesen bekannten „Kapitalflussrechnung“<br />
verwandt ist und kann als e<strong>in</strong>e auf die kommunalen Belange abgewandelte Form der <strong>in</strong> der privaten Wirtschaft<br />
gebräuchlichen Kapitalflussrechnung betrachtet werden. Die F<strong>in</strong>anzrechnung soll aussagekräftige Informationen<br />
über die tatsächliche f<strong>in</strong>anzielle Lage der Geme<strong>in</strong>de liefern. Sie bietet e<strong>in</strong>e zeitraumbezogene Abbildung<br />
sämtlicher Zahlungsströme (E<strong>in</strong>- und Auszahlungen), mit e<strong>in</strong>er Darstellung der F<strong>in</strong>anzierungsquellen (Mittelherkunfts-<br />
und -verwendungsrechnung) und der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und be<strong>in</strong>haltet über die<br />
Planungsvariante „F<strong>in</strong>anzplan“ die Ermächtigung für die <strong>in</strong>vestiven E<strong>in</strong>zahlungen und Auszahlungen.<br />
Unter Beachtung des Bruttopr<strong>in</strong>zips (vgl. § 11 GemHVO <strong>NRW</strong>) s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> der F<strong>in</strong>anzrechnung für sämtliche E<strong>in</strong>zahlungs-<br />
und Auszahlungsarten, jeweils Jahressummen auszuweisen, um die tatsächlichen E<strong>in</strong>zahlungen und Auszahlungen<br />
im Haushaltsjahr nach Arten aufzuzeigen. Hierbei ist die erfolgte Änderung des Bestandes an F<strong>in</strong>anzmitteln<br />
<strong>in</strong>sgesamt nachzuweisen sowie der Bestand an liquiden Mitteln festzustellen und <strong>in</strong> die Bilanz überzuleiten.<br />
Dazu s<strong>in</strong>d der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Saldo aus der Investitionstätigkeit und aus beiden<br />
der F<strong>in</strong>anzmittelüberschuss oder F<strong>in</strong>anzmittelfehlbetrag zu ermitteln. Durch die E<strong>in</strong>beziehung des Saldos aus<br />
der F<strong>in</strong>anzierungstätigkeit, der aus den Zahlungen aus der Aufnahme und der Tilgung von Krediten für Investitionen<br />
sowie auch aus Krediten zur Liquiditätssicherung entsteht, lässt sich die Änderung des Bestandes an eigenen<br />
F<strong>in</strong>anzmitteln ermitteln und <strong>in</strong> der F<strong>in</strong>anzrechnung ausweisen. Der Endbestand an F<strong>in</strong>anzmitteln ist als vorhandene<br />
liquide Mittel der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> dem dafür vorgesehenen Bilanzposten der Schlussbilanz des Haushaltsjahres<br />
anzusetzen.<br />
3.3 Der Nachweis <strong>in</strong> der Bilanz<br />
Die Bilanz der Geme<strong>in</strong>de ist als Gegenüberstellung von geme<strong>in</strong>dlichem Vermögen (Aktivseite) und den F<strong>in</strong>anzierungsmitteln<br />
(Passivseite) e<strong>in</strong>e auf den jährlichen Abschlussstichtag bezogene Zeitpunktrechnung und e<strong>in</strong> wesentlicher<br />
Bestandteil des doppischen Rechnungswesens im NKF. Auf der Passivseite der Bilanz werden die<br />
Verb<strong>in</strong>dlichkeiten der Geme<strong>in</strong>de und ihr Eigenkapital gezeigt (Passivierung). Dadurch wird die Mittelherkunft bzw.<br />
die F<strong>in</strong>anzierung des Vermögens offengelegt und dokumentiert. Die durch die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung<br />
entstehenden Rückzahlungsverpflichtungen führen dazu, dass auch diese Fremdmittel zu den<br />
Schulden der Geme<strong>in</strong>de zählen. Wegen ihrer Bedeutung als vorübergehende Unterstützung zur Leistung der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Auszahlungen s<strong>in</strong>d die am Schluss des Haushaltsjahres noch nicht zurückgezahlten Kredite zur<br />
Liquiditätssicherung als Verb<strong>in</strong>dlichkeiten <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em gesonderten Bilanzposten anzusetzen. Damit wird e<strong>in</strong> besserer<br />
Überblick über den Stand der Fremdf<strong>in</strong>anzierung der Geme<strong>in</strong>de im abgelaufenen Haushaltsjahr erreicht.<br />
3.4 Kreditaufnahme und Ergebnisplan<br />
Die Aufnahme und die Rückzahlung von geme<strong>in</strong>dlichen Krediten zur Liquiditätssicherung nach dieser Vorschrift<br />
ist nicht Gegenstand der Veranschlagung im jährlichen Ergebnisplan der Geme<strong>in</strong>de. Die damit verbundenen<br />
E<strong>in</strong>zahlungen und Auszahlungen stellen ke<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>dlichen Erträge und Aufwendungen dar, die wirtschaftlich<br />
den Haushaltsjahren zuzurechnen wären, <strong>in</strong> denen sie entstehen (vgl. § 11 GemHVO <strong>NRW</strong>). Die Veranschlagung<br />
würde e<strong>in</strong> unzutreffendes Bild der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplanung vermitteln, weil <strong>in</strong> die Kredite zur Liquiditätssicherung<br />
der Geme<strong>in</strong>de, unabhängig von ihrem unterschiedlichen Bedarf im Haushaltsjahr, ggf. als haushaltswirtschaftliche<br />
Deckungsmittel angesehen und fälschlicherweise auch entsprechend behandelt werden könnten.<br />
Dieses gilt allerd<strong>in</strong>gs nicht für die aus der Aufnahme der Kredite zur Liquiditätssicherung von der Geme<strong>in</strong>de zu<br />
zahlenden Z<strong>in</strong>sen (vgl. § 2 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
GEMEINDEORDNUNG 442
4. Schriftform bei der Abgabe von Erklärungen<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 89 GO <strong>NRW</strong><br />
Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung durch schuldrechtliche Verträge stellen geme<strong>in</strong>dliche Verpflichtungserklärungen<br />
dar und bedürfen daher der Schriftform (vgl. § 64 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>). Mit dieser gesetzlichen<br />
Vorgabe wird der Zweck verfolgt, die Geme<strong>in</strong>de vor übereilten Erklärungen zu schützen. Sie soll sich außerdem<br />
Klarheit über den Inhalt der neuen Verpflichtung verschaffen und die <strong>in</strong>terne Entscheidungszuständigkeit<br />
klären. Die geme<strong>in</strong>dlichen Erklärungen, durch welche die Geme<strong>in</strong>de verpflichtet werden soll, s<strong>in</strong>d zudem i.d.R.<br />
vom Bürgermeister oder dem allgeme<strong>in</strong>en Vertreter und e<strong>in</strong>em vertretungsberechtigten Bediensteten zu unterzeichnen,<br />
soweit es sich nicht um e<strong>in</strong> Geschäft der laufenden Verwaltung handelt. Dabei ist zu beachten, dass<br />
Erklärungen der Geme<strong>in</strong>de, die nicht den Formvorschriften der Geme<strong>in</strong>deordnung entsprechen, nicht die Geme<strong>in</strong>de<br />
b<strong>in</strong>den.<br />
II. Erläuterungen im E<strong>in</strong>zelnen<br />
1. Zu Absatz 1 (Sicherstellung der geme<strong>in</strong>dlichen Liquiditätsplanung):<br />
1.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Der Haushaltsgrundsatz <strong>in</strong> § 75 Abs. 6 GO <strong>NRW</strong>, der die Geme<strong>in</strong>de verpflichtet, ihre Liquidität e<strong>in</strong>schließlich der<br />
F<strong>in</strong>anzierung der Investitionen sicher zu stellen, wird durch die Regelung des Absatzes 1 dieser Vorschrift näher<br />
bestimmt. In diesem Zusammenhang wird unter dem Begriff „Liquidität“ die Fähigkeit der Geme<strong>in</strong>de verstanden,<br />
ihren Zahlungsverpflichtungen vollständig nachzukommen. Dies erfordert, die Geme<strong>in</strong>de zu verpflichten, e<strong>in</strong>e<br />
Liquiditätsplanung vorzunehmen, anhand derer die Maßnahmen zur Sicherstellung der erforderlichen Zahlungen<br />
der Geme<strong>in</strong>de bestimmt werden sollen. Dabei bleibt es der Geme<strong>in</strong>de im E<strong>in</strong>zeln überlassen, wie konkret und <strong>in</strong><br />
welchem Umfang sie durch die (angemessene) Liquiditätsplanung ihre Zahlungsfähigkeit sicherstellt.<br />
Bei den geme<strong>in</strong>dlichen Zahlungsströmen, die nach der Mittelherkunft und der Mittelverwendung unterteilt werden<br />
können, gilt das „Kassenwirksamkeitspr<strong>in</strong>zip“, das auch als „Liquiditätsänderungspr<strong>in</strong>zip“ bezeichnet werden<br />
kann. E<strong>in</strong>e solche Liquiditätsplanung verpflichtet aber die Geme<strong>in</strong>de, sich selbst täglich Kenntnisse über Zahlungsmittelzuflüsse<br />
und Zahlungsmittelabflüsse sowie über Sicherheiten, Risiken und die Rentabilität von Anlagemöglichkeiten<br />
zu verschaffen (sog. Cash-Management). Aus dem Gebot entsteht aber auch das Erfordernis für<br />
die Geme<strong>in</strong>de, <strong>in</strong>terne Informationspflichten zu verankern, damit die für die Liquiditätsplanung zuständige Stelle<br />
auch aus den Fachbereich der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung die notwendigen Informationen erhält, um den Liquiditätsbedarf<br />
möglichst zutreffend abschätzen zu können.<br />
Im Rahmen der geme<strong>in</strong>dlichen Liquiditätsplanung gilt es, e<strong>in</strong>en möglichst genauen Aufschluss über die künftige<br />
Liquiditätsentwicklung der Geme<strong>in</strong>de zu erhalten. Bei absehbaren Differenzen zwischen den bei der Geme<strong>in</strong>de<br />
voraussichtlich e<strong>in</strong>gehenden Zahlungen und den von der Geme<strong>in</strong>de voraussichtlich zu leistenden Zahlungen s<strong>in</strong>d<br />
Ausgleichs- und Anpassungsmaßnahmen erforderlich. So bedarf es im Falle e<strong>in</strong>er Unterdeckung e<strong>in</strong>er Geldbeschaffung<br />
und im Falle e<strong>in</strong>er Überdeckung i.d.R. e<strong>in</strong>er Geldanlage. Die Geme<strong>in</strong>de hat sowohl bei e<strong>in</strong>er Geldbeschaffung<br />
als auch bei e<strong>in</strong>er Geldanlage die e<strong>in</strong>schlägigen haushaltsrechtlichen Vorschriften zu beachten. Die<br />
Umsetzung des Gebotes zur angemessenen Liquiditätsplanung nach dieser Vorschrift soll e<strong>in</strong>e tatsächliche und<br />
örtlich sorgfältige Planung bewirken, <strong>in</strong> der auch die Vorschriften über die Grundsätze über die F<strong>in</strong>anzmittelbeschaffung<br />
(vgl. § 77 GO <strong>NRW</strong>), die Regelungen über die Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung (vgl. § 84 GO <strong>NRW</strong>) sowie<br />
über die Voraussetzungen über die Aufnahme von Krediten für Investitionen (vgl. § 86 GO <strong>NRW</strong>) sowie von<br />
Krediten zur Liquiditätssicherung (vgl. § 89 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>) zu beachten s<strong>in</strong>d.<br />
In diesem Zusammenhang besteht u.a. für die Liquiditätsplanung der Geme<strong>in</strong>de die Zielsetzung, den Saldo aus<br />
den E<strong>in</strong>zahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit der Geme<strong>in</strong>de so groß werden zu<br />
lassen, dass daraus die von der Geme<strong>in</strong>de zu leistende ordentliche Tilgung erbracht werden kann, auch wenn<br />
GEMEINDEORDNUNG 443
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 89 GO <strong>NRW</strong><br />
dieses Ziel nicht ausdrücklich <strong>in</strong> der Vorschrift verankert worden ist. Nicht zu vernachlässigen s<strong>in</strong>d auch die Vorschriften<br />
über die E<strong>in</strong>ziehung von Ansprüchen der Geme<strong>in</strong>de und über den Verzicht von Ansprüchen (vgl. § 23<br />
Abs. 3 und § 26 GemHVO <strong>NRW</strong>), die im Rahmen der Liquiditätsplanung ebenfalls relevant s<strong>in</strong>d. Die geme<strong>in</strong>dliche<br />
Liquiditätsplanung muss daher entsprechend den von der Geme<strong>in</strong>de gesetzten spezifischen Zielsetzungen<br />
und unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten ausgestaltet werden. E<strong>in</strong>ige mögliche Planungszeiträume<br />
werden nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung).<br />
Zeiträume der Liquiditätsplanung<br />
Jahr … Jahr … Jahr …<br />
Haushaltsjahr … Planungsjahr … Planungsjahr …<br />
Haushaltsjahr …<br />
1. Quartal 2. Quartal …<br />
Februar … Juni<br />
… Mi. Do. …<br />
Langfristige Planung ►<br />
Mittelfristige (fünfjährige) Planung ►<br />
Haushaltsjahrbezogene Planung ►<br />
Quartalsbezogene Planung ►<br />
Monatsbezogene Planung ►<br />
Tagesgenaue Planung ►<br />
Abbildung 71 „Zeiträume der Liquiditätsplanung“<br />
Der Grundsatz der Vollständigkeit sollte im Rahmen der geme<strong>in</strong>dlichen Liquiditätsplanung e<strong>in</strong>e ausreichende<br />
Beachtung f<strong>in</strong>den, denn je weniger Zahlungsströme von der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> die von ihr vorgesehene Planungszeit<br />
e<strong>in</strong>bezogen werden, desto ungenauer s<strong>in</strong>d die Aussagen zur Liquiditätsentwicklung der Geme<strong>in</strong>de. Auch der<br />
Grundsatz der Zeitpunktgenauigkeit ist für die Geme<strong>in</strong>de von Bedeutung, denn die Länge des zu betrachtenden<br />
Zeitraumes sollte von ihr so gewählt werden, dass der E<strong>in</strong>trittszeitpunkt der erwarteten Zahlungsströme h<strong>in</strong>reichend<br />
genau geschätzt werden kann. Je länger der zu betrachtende Zeitraum, desto ungenauer die Schätzung.<br />
1.2 Die Risikobeurteilung<br />
Zur geme<strong>in</strong>dlichen Liquiditätsplanung gehört aber auch die E<strong>in</strong>schätzung des Risikos, dass der Geme<strong>in</strong>de ke<strong>in</strong>e<br />
kurzfristigen Liquiditätskredite zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen mehr gewährt werden. Dieser mögliche<br />
Sachverhalt darf jedoch nicht negativ belegt werden, sondern muss als Chance für e<strong>in</strong>en Neuanfang der<br />
Entschuldung verstanden werden, bei dem auch neue Instrumente zur Schuldenbegrenzung zum E<strong>in</strong>satz kommen<br />
müssen und schnellstmöglich e<strong>in</strong> Sanierungsweg beschritten bzw. e<strong>in</strong>geschlagen wird. Für die Beurteilung<br />
e<strong>in</strong>er ausreichenden Liquidität bietet sich die E<strong>in</strong>richtung e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Liquiditätsrisikomess- und -<br />
steuerungsverfahren durch die Geme<strong>in</strong>de an, deren wichtigste Inhalte nachfolgend beispielhaft aufgezeigt werden<br />
(vgl. Abbildung).<br />
Konzeption<br />
Liquiditätsrisikomess- und -steuerungsverfahren<br />
GEMEINDEORDNUNG 444<br />
Im Rahmen der Konzeption ist das örtliche Liquiditätsrisiko zu<br />
def<strong>in</strong>ieren, das z.B. wegen e<strong>in</strong>er möglichen Zahlungsunfähigkeit<br />
bestehen kann, aber auch Risiken der Ref<strong>in</strong>anzierung unter Berücksichtigung<br />
der zeitlichen Komponente be<strong>in</strong>haltet. Daraus s<strong>in</strong>d<br />
Strategien für e<strong>in</strong> Liquiditätsrisikomanagement zu entwickeln.
Beteiligungen<br />
Rahmen<br />
Tests<br />
Krisenplan<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 89 GO <strong>NRW</strong><br />
In den Rahmen der örtlichen Verwaltungsorganisation ist das Liquiditätsrisikomanagement<br />
e<strong>in</strong>zub<strong>in</strong>den und entsprechend se<strong>in</strong>er<br />
Bedeutung den Verantwortlichkeiten zuzuordnen. Dabei s<strong>in</strong>d auch<br />
die örtlichen Entscheidungsstrukturen zu berücksichtigen sowie<br />
Liquiditätsrisikostrategien e<strong>in</strong>schließlich e<strong>in</strong>er Berichterstattung<br />
festzulegen.<br />
Der Rahmen für die örtlichen Risikomess- und -steuerungssysteme<br />
muss Methoden und Messzahlen zur Risikoidentifizierung und<br />
Risikoquantifizierung enthalten. Unter e<strong>in</strong>er Zeitkomponente gilt es<br />
die Zahlungsströme zu erfassen, um das Liquiditätspotential unter<br />
Verwendung von Steuerungsgrößen zu bestimmen.<br />
Das örtliche Liquiditätsrisikomess- und -steuerungsverfahren bzw.<br />
die Methoden zur Risikomessung und Risikoüberwachung s<strong>in</strong>d<br />
regelmäßig zu überprüfen. Insbesondere bedarf das Management<br />
der Liquiditätsrisiken e<strong>in</strong>er ständigen Überwachung e<strong>in</strong>schließlich<br />
der Tests, auch unter Krisenszenarien.<br />
Die Erkenntnisse aus den Krisenszenarien sollen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Krisenplan<br />
münden, der abgestufte Maßnahmen für Ereignisse enthält,<br />
die e<strong>in</strong>en „Liquiditätsnotfall“ bewirken können. Dazu s<strong>in</strong>d auch die<br />
dann geltenden Kommunikationswege e<strong>in</strong>schließlich der Zuständigkeiten<br />
zu bestimmen.<br />
Abbildung 72 „Liquiditätsrisikomess- und -steuerungsverfahren“<br />
Das Verfahren muss unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse der Geme<strong>in</strong>de der Art und Komplexität der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Geschäftsvorfälle e<strong>in</strong>e adäquate laufende Ermittlung und Überwachung des Liquiditätsrisikos und<br />
der Liquiditätslage gewährleisten sowie Risiken und Chancen möglichst im Voraus erkennen. Daher basiert e<strong>in</strong><br />
mögliches geme<strong>in</strong>dliches Liquiditätssteuerungsverfahren auf der Beurteilung von tagesaktuellen Zahlungsströmen<br />
und nicht auf der Vornahme von Bewertungen. Im Zusammenhang mit der E<strong>in</strong>schätzung, bei welchem Niveau<br />
e<strong>in</strong> mittleres oder e<strong>in</strong> hohes Risiko für e<strong>in</strong>e nicht ausreichende Liquidität entsteht, sollten geeignete Obergrenzen<br />
für Liquiditätsrisiken wie sie vergleichsweise auch im Z<strong>in</strong>smanagement zur Anwendung kommen, bestimmt<br />
und zudem regelmäßig überprüft werden. Außerdem bedarf es bereits im Vorfeld e<strong>in</strong>er Auswahl von möglichen<br />
Maßnahmen für den Falle des E<strong>in</strong>tritts e<strong>in</strong>er Gefährdung und deren Beseitigung.<br />
1.3 Der Liquiditätsverbund bzw. Cashpool<strong>in</strong>g<br />
Für die Geme<strong>in</strong>den besteht grundsätzlich die Möglichkeit, e<strong>in</strong>en Liquiditätsverbund bzw. e<strong>in</strong> Cashpool<strong>in</strong>g mit<br />
e<strong>in</strong>em Masteraccountkonto zwischen der Kernverwaltung und ihren wirtschaftlichen Unternehmen (§ 114 GO<br />
<strong>NRW</strong>), den organisatorisch verselbstständige E<strong>in</strong>richtungen (§ 107 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>) und rechtlich selbstständigen<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Unternehmen im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>es Konzerns e<strong>in</strong>zurichten. Nach Auskunft der Bundesanstalt für<br />
F<strong>in</strong>anzdienstleistungsaufsicht (BaF<strong>in</strong>) ist die Ausnahmeregelung <strong>in</strong> § 2 Abs. 1 Nr. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen<br />
(Kreditwesengesetz - KWG) vom 09.09.1998 (BGBl. I S. 2776) auch auf Geme<strong>in</strong>den anwendbar. Durch<br />
diese getroffenen Festlegungen ist die Tätigkeit der Geme<strong>in</strong>de im Rahmen e<strong>in</strong>es Liquiditätsverbundes zwischen<br />
den o.a. geme<strong>in</strong>dlichen Beteiligten nicht als Tätigkeit e<strong>in</strong>es Kredit<strong>in</strong>stituts zu bewerten.<br />
Die Vorschrift des § 107 Abs. 6 GO <strong>NRW</strong>, nach dem die Geme<strong>in</strong>den ke<strong>in</strong> Bankunternehmen errichten, übernehmen<br />
oder betreiben dürfen, steht der E<strong>in</strong>richtung e<strong>in</strong>es Liquiditätsverbundes bzw. e<strong>in</strong>es Cashpool<strong>in</strong>gs nicht entgegen.<br />
Die Nutzung des Konzernprivilegs für die Abwicklung von Geldgeschäften <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Liquiditätsverbund der<br />
Geme<strong>in</strong>de setzt jedoch das Bestehen e<strong>in</strong>er Alle<strong>in</strong>- oder Mehrheitsgesellschafterstellung der Geme<strong>in</strong>de bei den<br />
betreffenden kommunalen Betrieben oder die verpflichtende E<strong>in</strong>beziehung dieser Betriebe <strong>in</strong> die Vollkonsolidierung<br />
für den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses voraus. E<strong>in</strong> solcher Liquiditätsverbund darf nicht dazu führen,<br />
GEMEINDEORDNUNG 445
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 89 GO <strong>NRW</strong><br />
dass die Geme<strong>in</strong>de Kredite zur Liquiditätssicherung oberhalb ihres eigenen haushaltsmäßigen Bedarfs aufnimmt.<br />
Es bedarf e<strong>in</strong>er Abstimmung zwischen den Beteiligten über die Abwicklung der Geldgeschäfte und der Festlegung<br />
von Verantwortlichkeiten, e<strong>in</strong>schließlich der ggf. beauftragten Bank, wenn die Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>en Liquiditätsverbund<br />
bzw. e<strong>in</strong> Cashpool<strong>in</strong>g e<strong>in</strong>richtet. Dieses Erfordernis besteht <strong>in</strong>sbesondere dann, wenn auch rechtlich<br />
selbstständige Betriebe der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en solchen Liquiditätsverbund e<strong>in</strong>bezogen werden.<br />
In diesen Fällen kann die f<strong>in</strong>anzwirtschaftliche Verantwortung nicht alle<strong>in</strong>e von der Kernverwaltung der Geme<strong>in</strong>de<br />
getragen werden. Sollen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em solchen Liquiditätsverbund die Abwicklung der Geldgeschäfte über die Kernverwaltung<br />
der Geme<strong>in</strong>de erfolgen, tritt die Geme<strong>in</strong>de für die rechtlich selbstständigen Betriebe als „<strong>in</strong>nere“ Bank<br />
auf. Soweit dabei die Geme<strong>in</strong>de als „Cashpool-Führer“ auftritt, stellen die von Dritten <strong>in</strong> den Cashpool e<strong>in</strong>gebrachten<br />
F<strong>in</strong>anzmittel zwar Guthaben der Geme<strong>in</strong>de dar, jedoch bestehen zusätzlich <strong>in</strong> gleicher Höhe die Ansprüche<br />
Dritter, so dass entsprechende Verb<strong>in</strong>dlichkeiten <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz zu passivieren s<strong>in</strong>d. Ist<br />
dagegen die Geme<strong>in</strong>de nur an e<strong>in</strong>em Cashpool<strong>in</strong>g beteiligt, hat sie entsprechend der Höhe der <strong>in</strong> den Cashpool<br />
e<strong>in</strong>gebrachten F<strong>in</strong>anzmittel Forderungen gegenüber dem Cashpool zu bilanzieren.<br />
1.4 Auftragsvergabe und Liquiditätsplanung<br />
Im Rahmen e<strong>in</strong>es Vergabeverfahrens sollte die Geme<strong>in</strong>de ihre haushaltsmäßige Planung der voraussichtlichen<br />
Umsetzung der geme<strong>in</strong>dlichen Maßnahme bereits beg<strong>in</strong>nen. Dazu gehört nicht nur die haushaltsmäßige E<strong>in</strong>beziehung<br />
der Maßnahme <strong>in</strong> die mittelfristige Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung der Geme<strong>in</strong>de (vgl. § 84 GO <strong>NRW</strong>),<br />
sondern auch <strong>in</strong> die örtliche Liquiditätsplanung nach § 89 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 30 Abs. 6 GemHVO <strong>NRW</strong>,<br />
denn nach § 75 Abs. 6 GO <strong>NRW</strong> hat die Geme<strong>in</strong>de ihre Liquidität e<strong>in</strong>schließlich der F<strong>in</strong>anzierung ihrer Investitionen<br />
sicherzustellen.<br />
In diesem Zusammenhang sollte auch das Forderungssicherungsgesetz (FoSiG) vom 23.10.2008 (BGBl. I S.<br />
2022) Beachtung f<strong>in</strong>den, denn danach kann z.B. e<strong>in</strong> Unternehmer vom Besteller e<strong>in</strong>e Abschlagszahlung verlangen.<br />
Diese darf auch von der Geme<strong>in</strong>de nicht verweigert werden, selbst dann nicht, wenn (unwesentliche) Mängel<br />
beim angeschafften oder hergestellten geme<strong>in</strong>dlichen Vermögensgegenstand bestehen (vgl. § 632a BGB).<br />
1.5 Der Liquiditätsspiegel<br />
Wenn die Geme<strong>in</strong>de sich nicht e<strong>in</strong>es ausgefeilten Liquiditätsrisikomessverfahrens bzw. Liquiditätssteuerungsverfahrens<br />
bedient, bedarf es alternativer Verfahren zur Sicherung der geme<strong>in</strong>dlichen Liquidität. E<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>stieg, um<br />
sich e<strong>in</strong>en zeitbezogenen Überblick über die verfügbaren Zahlungsmittel und der abrufbaren Forderungen und<br />
Zahlungsverpflichtungen zu verschaffen, bietet e<strong>in</strong> Liquiditätsspiegel. E<strong>in</strong> solcher Liquiditätsspiegel trägt zur Übersicht<br />
bei der Liquiditätssteuerung der Geme<strong>in</strong>de bei. Er ist e<strong>in</strong> <strong>in</strong>ternes Instrument, dass nicht zum geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Jahresabschluss gehört, auch wenn dadurch die kurz- und mittelfristige F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de noch<br />
besser transparent und nachvollziehbar gemacht wird.<br />
Bei e<strong>in</strong>em geme<strong>in</strong>dlichen Liquiditätsspiegel stehen anders als beim Forderungsspiegel und Verb<strong>in</strong>dlichkeitenspiegel<br />
die Auswirkungen auf die F<strong>in</strong>anzmittel der Geme<strong>in</strong>de aus dem Kassenwirksamkeitspr<strong>in</strong>zip sowie dem<br />
Fälligkeitspr<strong>in</strong>zip im Vordergrund der Betrachtung. Damit müssen e<strong>in</strong>em Liquiditätsspiegel <strong>in</strong>sbesondere die kurzfristigen<br />
Zahlungserfordernisse berücksichtigt werden. Durch die E<strong>in</strong>stellung der Ansprüche und Zahlungsverpflichtungen<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong> Zeitraster wird e<strong>in</strong> Überblick erreicht, durch den das geme<strong>in</strong>dliche <strong>F<strong>in</strong>anzmanagement</strong> und die<br />
notwendige Liquiditätssicherung unterstützt werden. Außerdem muss e<strong>in</strong> Liquiditätsspiegel <strong>in</strong> kurzen Zeitabständen,<br />
ggf. täglich, fortgeschrieben werden. Die Geme<strong>in</strong>de kann das Schema des aufgezeigten Liquiditätsspiegels<br />
auf ihre Bedürfnisse übertragen und unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten weiter ausgestalten<br />
sowie weitere Informationen dazu geben. Das nachfolgende Schema zeigt die mögliche Gliederung für e<strong>in</strong>en<br />
Liquiditätsspiegel auf (vgl. Abbildung).<br />
GEMEINDEORDNUNG 446
1.5 Die Beauftragung Dritter<br />
Arten der<br />
Zahlungsmittel<br />
und Zahlungs-<br />
verpflichtungen<br />
(Gliederung<br />
detaillierter als<br />
<strong>in</strong> der Bilanz nach<br />
§ 41 Abs. 3<br />
Nrn. 2.2 - 2.4<br />
und Abs. 4 Nr. 4<br />
GemHVO <strong>NRW</strong>)<br />
Arten der<br />
Zahlungsmittel<br />
und Zahlungs-<br />
verpflichtungen<br />
(Gliederung<br />
detaillierter als<br />
<strong>in</strong> der Bilanz nach<br />
§ 41 Abs. 3<br />
Nrn. 2.2 - 2.4<br />
und Abs. 4 Nr. 4<br />
GemHVO <strong>NRW</strong>)<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 89 GO <strong>NRW</strong><br />
Liquiditätssspiegel<br />
Teil A<br />
Stand<br />
(Betrag)<br />
am 31.12<br />
des<br />
Vor-<br />
jahres<br />
EUR<br />
täglich<br />
bis zu<br />
1 Monat<br />
EUR<br />
Liquiditätsspiegel<br />
Teil B<br />
Stand<br />
(Betrag)<br />
am 31.12<br />
des Haus-<br />
halts-<br />
jahres<br />
EUR<br />
Veränderungen im Haushaltsjahr<br />
nach Fälligkeit<br />
über<br />
1 Monat<br />
bis zu<br />
3 Monaten<br />
EUR<br />
Veränderungen<br />
bei e<strong>in</strong>er Fälligkeit von<br />
bis zu 1<br />
Jahr<br />
EUR<br />
Abbildung 73 „Liquiditätsspiegel“<br />
1 bis 5<br />
Jahre<br />
EUR<br />
über<br />
3 Monate<br />
bis zu<br />
6 Monaten<br />
EUR<br />
mehr als<br />
5 Jahre<br />
EUR<br />
über<br />
6 Monate<br />
bis zu<br />
12 Monaten<br />
EUR<br />
H<strong>in</strong>-<br />
weise<br />
Die Geme<strong>in</strong>de kann Dritte damit beauftragt, sie bei der Verwaltung der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzmittel fachlich zu<br />
beraten oder zu unterstützen. Sie kann sie sogar beauftragen, die geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzmittel zu verwalten, <strong>in</strong><br />
dem die Aufgaben der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzbuchhaltung durch e<strong>in</strong>e Stelle außerhalb der Geme<strong>in</strong>deverwaltung<br />
erledigt werden (vgl. § 94 GO <strong>NRW</strong>). In allen diesen Fällen ist die Geme<strong>in</strong>de verpflichtet, e<strong>in</strong>e wirksame Kontrolle<br />
gegenüber den Dritten sicherzustellen. Sie hat <strong>in</strong> jedem Fall zu gewährleisten, dass <strong>in</strong>sbesondere die ihr gesetzlich<br />
zugewiesenen Aufgaben <strong>in</strong> ihrer Verfügungs- und Entscheidungsbefugnis verbleiben.<br />
GEMEINDEORDNUNG 447
2. Zu Absatz 2 (Kredite zur Liquiditätssicherung):<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 89 GO <strong>NRW</strong><br />
2.1 Zu Satz 1(Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung):<br />
2.1.1 Voraussetzungen für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung<br />
Dem gesetzlichen Gebot für die Geme<strong>in</strong>den, ihre Zahlungsfähigkeit durch e<strong>in</strong>e angemessene Liquiditätsplanung<br />
sicherzustellen, kann e<strong>in</strong>e Geme<strong>in</strong>de nur nachkommen, wenn es ihr ermöglicht wird, bei Bedarf zur rechtzeitigen<br />
Leistung ihrer Auszahlungen im notwendigen Umfang auch Kredite aufzunehmen. Diese Kredite zur Sicherstellung<br />
der Liquidität stellen ke<strong>in</strong>e eigenständige Kreditform dar, vielmehr unterliegen sie den Formen der Kredite<br />
aus der allgeme<strong>in</strong>en Geldwirtschaft. Der Begriff des Kredites ist daher von dort übernommen worden und entspricht<br />
dem Darlehensbegriff nach §§ 488 BGB. Er umfasst daher für die Geme<strong>in</strong>den nur Geldschulden und nicht<br />
darlehensweise empfangene Sachen (vgl. §§ 607 ff. BGB).<br />
Auf Grund von Art. 115 GG und Art. 78 der Landesverfassung <strong>NRW</strong> wird aber im Haushaltsrecht ke<strong>in</strong> e<strong>in</strong>heitlicher<br />
Kreditbegriff verwandt. Die Kredite zur Liquiditätssicherung werden von der Geme<strong>in</strong>de eigenverantwortlich<br />
als Darlehen im S<strong>in</strong>ne des Privatrechts aufgenommen und fallen unter den bankrechtlichen Begriff des Kredits.<br />
Der Geme<strong>in</strong>de obliegt auch die Entscheidung, bei welcher Stelle sie e<strong>in</strong>en Kredit zur Sicherstellung ihrer Liquidität<br />
aufnimmt. Die Vorschrift enthält die zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung notwendige gesetzliche<br />
Grundlage. Diese „Liquiditätskredite“, die haushaltsrechtlich nicht den Krediten nach § 86 GO <strong>NRW</strong> zuzuordnen<br />
s<strong>in</strong>d, berühren daher bei ihrer Aufnahme nicht den <strong>in</strong> der Haushaltssatzung nach § 78 Abs. 2 Nr. 1 c) GO<br />
<strong>NRW</strong> festzusetzenden Kreditrahmen für Kredite für Investitionen, sondern unterliegen e<strong>in</strong>er gesonderten Festsetzung<br />
ihres Höchstbetrages <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung (vgl. § 78 Abs. 2 Nr. 3 GO <strong>NRW</strong>).<br />
Die geme<strong>in</strong>dlichen Kredite zur Liquiditätssicherung haben als kurzfristige Kredite grundsätzlich e<strong>in</strong>e Laufzeit von<br />
e<strong>in</strong>em Monat bis zu zwölf Monaten (Term<strong>in</strong>geldaufnahmen). Für diese Kredite kann im beschränkten Umfang ggf.<br />
auch e<strong>in</strong>e Z<strong>in</strong>sb<strong>in</strong>dung bis zu drei Jahren vere<strong>in</strong>bart werden, wenn e<strong>in</strong> „Grundbestand“ solcher Kredite, auf Dauer<br />
betrachtet, <strong>in</strong> absehbarer Zeit nicht endgültig getilgt werden kann. Daneben wird der kurzfristige Liquiditätsbedarf<br />
der Geme<strong>in</strong>de aber auch über Tagesgeldaufnahmen befriedigt. Bei diesen kurzfristigen Krediten der Geme<strong>in</strong>de<br />
wird zwischen Festbetragskrediten und Kontokorrentkrediten unterschieden. Bei e<strong>in</strong>em Festbetragskredit verpflichtet<br />
sich die Geme<strong>in</strong>de vertraglich, e<strong>in</strong> kurzfristiges Darlehen mit e<strong>in</strong>em bestimmten Betrag für e<strong>in</strong>e festgelegte<br />
Zeit <strong>in</strong> Anspruch zu nehmen. Bei e<strong>in</strong>em Kontokorrentkredit wird dem Konto<strong>in</strong>haber das Recht e<strong>in</strong>geräumt, se<strong>in</strong><br />
Konto bis zu e<strong>in</strong>er vorher bestimmten Höhe zu überziehen (Rahmenkredit). Dieser zu letzt genannte Kredit gilt mit<br />
der tatsächlichen Überziehung des Kontos (M<strong>in</strong>usbestand) als aufgenommen.<br />
Jeder Zahlungsvorgang über dieses Konto verändert dann die Höhe des <strong>in</strong> Anspruch genommenen kurzfristigen<br />
Überziehungskredits. Die „Liquiditätskredite“ der Geme<strong>in</strong>de können aber auch z.B. nach Kreditgebern, nach ihrer<br />
Herkunft (Inland oder Ausland) sowie nach ihrer Ausgabe <strong>in</strong> Euro oder <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Fremdwährung) unterschieden<br />
werden. Zu beachten ist, dass die Geme<strong>in</strong>de die aufgenommenen Kredite zur Sicherstellung der Liquidität unter<br />
e<strong>in</strong>em gesonderten Bilanzposten anzusetzen (vgl. § 41 Abs. 4 GemHVO <strong>NRW</strong>) sowie im Verb<strong>in</strong>dlichkeitenspiegel<br />
nach § 47 GemHVO <strong>NRW</strong> auszuweisen hat.<br />
2.1.2 Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung<br />
Der Rat der Geme<strong>in</strong>de hat im Rahmen se<strong>in</strong>es Budgetrechts e<strong>in</strong>en Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung<br />
<strong>in</strong> der Haushaltssatzung (vgl. § 78 Abs. 2 Nr. 3 GO <strong>NRW</strong>) festzulegen. Diese Ermächtigung be<strong>in</strong>haltet das<br />
Recht, jeweils bei Bedarf <strong>in</strong>nerhalb des Haushaltsjahres die notwendigen Kredite zur Liquiditätssicherung im von<br />
Rat gesetzten Rahmen aufzunehmen, der aber nicht überschritten werden darf. Die e<strong>in</strong>zelnen Kreditaufnahmen<br />
s<strong>in</strong>d dabei nur dann nom<strong>in</strong>al zusammen zu rechnen, wenn sie sich zeitlich überschneiden. Der jahresbezogene<br />
Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung, der im Rahmen der Ausführung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirt-<br />
GEMEINDEORDNUNG 448
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 89 GO <strong>NRW</strong><br />
schaft im neuen Haushaltsjahr benötigt wird, ist im Zeitpunkt der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplanung i.d.R. nicht<br />
betragsgenau bestimmbar. Oftmals ist er von verschiedenen, meistens erst im Ablauf des Haushaltsjahres auftretenden<br />
Faktoren abhängig, so dass der tatsächliche Liquiditätsbedarf der Geme<strong>in</strong>de sich regelmäßig nur tagesaktuell<br />
ergibt.<br />
Der mögliche Bedarf an kurzfristigen Krediten für das Haushaltsjahr ist daher zu schätzen. Dabei ist zu berücksichtigen,<br />
dass möglicherweise mehrere Kredite nebene<strong>in</strong>ander bestehen können, so dass es gilt, e<strong>in</strong>en möglichen<br />
Höchstbetrag für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung für das Haushaltsjahr zu bestimmen.<br />
Der ermittelte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung ist dann <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsatzung<br />
festzusetzen. Am Ende e<strong>in</strong>es Haushaltsjahres noch bestehende Kredite zur Liquiditätssicherung s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> den<br />
Höchstbetrag des folgenden Haushaltsjahres e<strong>in</strong>zubeziehen, denn die Ermächtigung für Kredite zur Liquiditätssicherung<br />
gilt grundsätzlich nur für das Haushaltsjahr. Sie besteht darüber h<strong>in</strong>aus nur dann fort, wenn noch ke<strong>in</strong>e<br />
Haushaltssatzung für das neue Haushaltsjahr erlassen worden ist<br />
2.1.3 Kredite zur Liquiditätssicherung und Haushaltsplan<br />
Die Kredite zur Liquiditätssicherung werden von der Geme<strong>in</strong>de wegen ihrer mangelnden Zahlungsfähigkeit aufgenommen.<br />
Daher besteht ke<strong>in</strong> unmittelbarer Zusammenhang mit den im Haushaltsplan veranschlagten Erträgen.<br />
E<strong>in</strong> negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im F<strong>in</strong>anzplan (vgl. § 3 GemHVO <strong>NRW</strong>) macht zwar<br />
deutlich, dass die Geme<strong>in</strong>de im Haushaltsjahr voraussichtlich Kredite zur Liquiditätssicherung benötigt, dieser<br />
stellt jedoch nicht gleichzeitig den Betrag dar, der vorübergehend tatsächlich zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit<br />
benötigt wird.<br />
Der täglich zu ermittelnde Liquiditätsbedarf und das daraus ggf. entstehende Erfordernis, Kredite zur Liquiditätssicherung<br />
aufzunehmen und auch unterjährig wieder zurückzuzahlen, br<strong>in</strong>gen es mit sich, dass e<strong>in</strong>e zum Stichtag<br />
des Jahresabschlusses möglicherweise noch bestehende Rückzahlungsverpflichtung im Rahmen der Haushaltsplanung<br />
betragsmäßig nicht genau vorher bestimmbar ist. Dieser Sachverhalt und die Sachlage, dass die E<strong>in</strong>zahlungen<br />
aus Krediten zur Liquiditätssicherung ke<strong>in</strong>e haushaltsmäßigen F<strong>in</strong>anzierungsmittel darstellen, ist u.a. der<br />
Anlass dafür, auf die Vorgabe e<strong>in</strong>er Veranschlagung von Krediten zur Liquiditätssicherung im geme<strong>in</strong>dlichen<br />
F<strong>in</strong>anzplan zu verzichten.<br />
Die entbehrliche Veranschlagung im geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzplan steht jedoch e<strong>in</strong>em Nachweis der Zahlungen <strong>in</strong><br />
der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzrechnung als <strong>in</strong> Anspruch genommene „Betriebsmittel“ zur Sicherung der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Liquidität nicht entgegen. Besteht daher zum Stichtag des Jahresabschlusses noch e<strong>in</strong>e Rückzahlungsverpflichtung<br />
der Geme<strong>in</strong>de aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung muss diese Verpflichtung betragsmäßig<br />
<strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzrechnung nachgewiesen werden. Gleichzeitig ist diese Rückzahlungsverpflichtung<br />
“ <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz gesondert unter dem Posten „Verb<strong>in</strong>dlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung<br />
anzusetzen (vgl. § 41 Abs. 4 Nr. 4.3 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
2.1.4 Kredite zur Liquiditätssicherung <strong>in</strong> fremder Währung<br />
2.1.4.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die Geme<strong>in</strong>de kann aus Wirtschaftlichkeitserwägungen heraus auch Kredite <strong>in</strong> fremder Währung aufnehmen, d.h.<br />
das Kreditvolumen wird nicht <strong>in</strong> Euro bemessen und kommt <strong>in</strong> dieser Währung zur Auszahlung, sondern <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
anderen Währung, z.B. Schweizer Franken, Japanischer Yen. Auch kann e<strong>in</strong> <strong>in</strong> fremder Währung aufgenommener<br />
Kredit gleichwohl <strong>in</strong> Euro zur Auszahlung kommen. In diesen Fällen hat die Geme<strong>in</strong>de wegen möglicher<br />
Wechselkursschwankungen während der Laufzeit des Kredites besondere Anforderungen bei der Risikoabwä-<br />
GEMEINDEORDNUNG 449
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 89 GO <strong>NRW</strong><br />
gung und Risikovorsorge zu erfüllen, <strong>in</strong>sbesondere dann, wenn mit der Kreditaufnahme e<strong>in</strong> Währungsswap oder<br />
e<strong>in</strong> komb<strong>in</strong>ierter Z<strong>in</strong>s- und Währungsswap verbunden wurde.<br />
Zur Vorbereitung e<strong>in</strong>er Entscheidung über die Aufnahme von Krediten <strong>in</strong> fremder Währung s<strong>in</strong>d deshalb unter<br />
Berücksichtigung der örtlichen Bedürfnisse die Entscheidungs- und Auswahlkriterien sowie die Z<strong>in</strong>ssicherungs<strong>in</strong>strumente<br />
durch die Geme<strong>in</strong>de im E<strong>in</strong>zelnen zu bestimmen. Sie hat die dafür notwendigen Informationen und<br />
Daten e<strong>in</strong>zuholen. Diese Aufgabe enthält für die Geme<strong>in</strong>den <strong>in</strong>sbesondere die Verpflichtung, sich Kenntnisse<br />
über Sicherheiten und Risiken im Vergleich zu e<strong>in</strong>er anderen Kreditaufnahme zu verschaffen. Die Kreditaufnahme<br />
<strong>in</strong> fremder Währung erfordert wegen des möglichen Wechselkursrisikos von Fremdwährungen außerdem e<strong>in</strong>e<br />
laufende eigenverantwortliche „Kontrolle“ über die Abwicklung des Kreditgeschäftes während se<strong>in</strong>er Laufzeit. Es<br />
ist <strong>in</strong> diesen Fällen nicht ausreichend, wenn die Kontrolle nur e<strong>in</strong>mal jährlich von der Geme<strong>in</strong>de vorgenommen<br />
oder sie vollständig e<strong>in</strong>em Dritten übertragen wird.<br />
2.1.4.2 Die Risikovorsorge<br />
Bei der Aufnahme von Krediten <strong>in</strong> fremder Währung muss von der Geme<strong>in</strong>de geprüft werden, ob für die gesamte<br />
Laufzeit dieses geme<strong>in</strong>dlichen Geschäftes die Gleichwertigkeitsvermutung besteht. Dabei muss grundsätzlich von<br />
der Gefahr e<strong>in</strong>er Vermögensm<strong>in</strong>derung für die Geme<strong>in</strong>de ausgegangen werden, so dass abhängig von der Höhe<br />
des Wechselkursrisikos von der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>e Risikovorsorge vorzunehmen ist (vgl. RdErl. vom 09.10.2006).<br />
Mit e<strong>in</strong>er solchen Risikovorsorge wird bezweckt, dass die wirtschaftlichen Vorteile der Geme<strong>in</strong>de aus der Aufnahme<br />
von Krediten <strong>in</strong> fremder Währung nicht bereits zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vollständig für<br />
Zwecke des geme<strong>in</strong>dlichen Haushalts abgeschöpft werden.<br />
Die geme<strong>in</strong>dliche Risikovorsorge soll deshalb dar<strong>in</strong> bestehen, dass e<strong>in</strong> Teil der wirtschaftlichen Vorteile gegenüber<br />
e<strong>in</strong>er Kreditaufnahme <strong>in</strong> Euro-Währung erst zu e<strong>in</strong>em späteren Zeitpunkt bzw. nach vollständiger Tilgung<br />
des Fremdwährungskredits realisiert wird. In der Zeit davor kann für die Geme<strong>in</strong>de aus dem Wechselkursrisiko<br />
e<strong>in</strong>e ungewisse Außenverpflichtung bestehen, die es zu bilanzieren gilt. Um dieses zu erreichen, soll die Geme<strong>in</strong>de<br />
im Zeitpunkt der Kreditaufnahme <strong>in</strong> Fremdwährung als „Absicherung des Fremdwährungsrisikos“ e<strong>in</strong>e<br />
entsprechende Rückstellung bilden. Diese Rückstellung soll solange bilanziert werden, bis gesichert ist, dass sich<br />
das Fremdwährungsrisiko der Geme<strong>in</strong>de nicht mehr realisiert. Dies ist i.d.R. erst nach Ablauf des Darlehensvertrages<br />
bzw. nach Rückzahlung des aufgenommenen Fremdwährungskredites der Fall und nicht abhängig von<br />
den vere<strong>in</strong>barten Z<strong>in</strong>sb<strong>in</strong>dungsfristen.<br />
Diese Risikovorsorge ist unter Berücksichtigung des bestehenden Fremdwährungsrisikos zu bemessen. Sollten<br />
ke<strong>in</strong>e konkreten Anhaltspunkte für die Bestimmung der Höhe der notwendigen Risikovorsorge vorliegen, ist die<br />
Rückstellung mit e<strong>in</strong>em Betrag <strong>in</strong> Höhe der Hälfte des Z<strong>in</strong>svorteils der Geme<strong>in</strong>de aus ihrer Kreditaufnahme <strong>in</strong><br />
ausländischer Währung anzusetzen. Die Rückstellung ist nach Wegfall des Fremdwährungsrisikos ertragswirksam<br />
aufzulösen. Weitere H<strong>in</strong>weise enthält der Runderlass des Innenm<strong>in</strong>isteriums über Kredite und kreditähnliche<br />
Rechtsgeschäfte der Geme<strong>in</strong>den (GV) vom 09.10.2006 (SMBl. <strong>NRW</strong>. 652).<br />
2.1.5 Kredite zur Liquiditätssicherung und Kapitalanlage (Geldanlage)<br />
E<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>dliche Kapitalanlage entsteht i.d.R. aus der H<strong>in</strong>gabe von vorhandenen liquiden Mitteln (Geldbeträgen)<br />
der Geme<strong>in</strong>de, die <strong>in</strong> Kapital umgewandelt werden. Dieser Vorgang stellt wie die Umwandlung von vorhandenen<br />
liquiden Mitteln der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> Sachanlagen haushaltsrechtlich e<strong>in</strong>e Investition dar. Außerdem stellt die<br />
von der Geme<strong>in</strong>de erworbene Kapitalanlage bilanztechnisch e<strong>in</strong>e F<strong>in</strong>anzanlage dar, so dass <strong>in</strong> diesem Zusammenhang<br />
der Zahlungsvorgang <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzrechnung unter der Haushaltsposition „Auszahlungen<br />
für den Erwerb von F<strong>in</strong>anzanlagen“ nachzuweisen ist (vgl. § 3 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO <strong>NRW</strong>). Die Investitionen<br />
GEMEINDEORDNUNG 450
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 89 GO <strong>NRW</strong><br />
der Geme<strong>in</strong>de bewirken regelmäßig e<strong>in</strong>e dauerhafte Mehrung des geme<strong>in</strong>dlichen Vermögens, z.B. das <strong>in</strong> der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz anzusetzende Anlagevermögen, zu dem auch die F<strong>in</strong>anzanlagen zu zählen s<strong>in</strong>d.<br />
Diese haushaltsrechtliche Zuordnung e<strong>in</strong>er Kapitalanlage der Geme<strong>in</strong>de könnte den Schluss zu lassen, dass<br />
dadurch auch e<strong>in</strong>e Kreditf<strong>in</strong>anzierung für e<strong>in</strong>e Kapitalanlage zulässig wäre. Die Geme<strong>in</strong>de darf nach des Vorschrift<br />
des § 86 GO <strong>NRW</strong> Kredite für Investitionen aufnehmen. Da der Erwerb e<strong>in</strong>er Kapitalanlage e<strong>in</strong>erseits der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Aufgabenerfüllung dient und andererseits e<strong>in</strong>e Investition darstellt, könnten die Voraussetzungen<br />
für e<strong>in</strong>e Kreditaufnahme für die Kapitalanlage grundsätzlich erfüllt se<strong>in</strong>.<br />
E<strong>in</strong>er solchen Kreditaufnahme dürfen jedoch auch die Grundsätze der F<strong>in</strong>anzmittelbeschaffung nach § 77 Abs. 3<br />
GO <strong>NRW</strong> nicht entgegenstehen, denn sie ist zulässig, wenn e<strong>in</strong>e andere F<strong>in</strong>anzierung nicht möglich oder unzweckmäßig<br />
wäre. Dieses könnte im E<strong>in</strong>zelfall beim Erwerb e<strong>in</strong>er Kapitalanlage gegeben se<strong>in</strong>. Dabei wäre auch<br />
zu prüfen, ob beim Erwerb e<strong>in</strong>er Kapitalanlage mit durch e<strong>in</strong>en Kredit der Geme<strong>in</strong>de zugegangenen Geldmitteln<br />
(Fremdkapital) es zu e<strong>in</strong>er dauerhaften Vermögensmehrung bei der Geme<strong>in</strong>de kommt.<br />
Bei e<strong>in</strong>er Kreditaufnahme für e<strong>in</strong>e Kapitalanlage könnte das Spekulationsverbot <strong>in</strong> § 90 GO <strong>NRW</strong> berührt se<strong>in</strong>,<br />
wenn unterstellt werden kann, dass die Kapitalanlage vorrangig der Erzielung e<strong>in</strong>es Gew<strong>in</strong>ns aus der Differenz<br />
zwischen den Kreditkosten und dem Z<strong>in</strong>sertrag dient, und dabei auf die weitere „ungewisse“ Z<strong>in</strong>sentwicklung<br />
gesetzt wird. Andererseits dient aber e<strong>in</strong>e solche Differenz erst e<strong>in</strong>mal dazu, e<strong>in</strong>e Wirtschaftlichkeit der Kapitalanlage<br />
anzunehmen. Bei der F<strong>in</strong>anzierung e<strong>in</strong>er Kapitalanlage durch Fremdkapital ist auch der künftige Verwendungszweck<br />
<strong>in</strong> die Bewertung e<strong>in</strong>zubeziehen.<br />
Im S<strong>in</strong>ne des § 86 GO <strong>NRW</strong> dürfte es nicht zulässig se<strong>in</strong>, wenn die fremdf<strong>in</strong>anzierte Kapitalanlage der Geme<strong>in</strong>de<br />
dazu dient, <strong>in</strong> künftigen Haushaltsjahren die Auszahlungen aus zahlungswirksamen Aufwendungen zu ermöglichen.<br />
Mit e<strong>in</strong>em solchen Zweck verliert der Erwerb e<strong>in</strong>er Kapitalanlage den Charakter e<strong>in</strong>er Investition und damit<br />
die Grundlage für e<strong>in</strong>e zulässige Kreditaufnahme. In diesem S<strong>in</strong>ne wäre bei e<strong>in</strong>er Fremdkapitalf<strong>in</strong>anzierung der<br />
Kapitalanlage auch der Grundsatz der <strong>in</strong>tergenerativen Gerechtigkeit tangiert (vgl. § 1 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>).<br />
In diesem Zusammenhang steht auch der Runderlass über kommunale Geldanlagen vom 25.01.2005, nach dem<br />
zu beachten ist, dass e<strong>in</strong>e Kapitalanlage bzw. die Anlage von geme<strong>in</strong>dlichen Geldmitteln nur mit Geldmitteln der<br />
Geme<strong>in</strong>de zulässig ist, die nicht zur Sicherung der Liquidität und zur Zahlungsabwicklung benötigt werden. Dieser<br />
Runderlass führt zudem die vorherigen kameralen Runderlasse fort, so dass es bereits <strong>in</strong> der Vergangenheit e<strong>in</strong>e<br />
Kapitalanlage nur dann zulässig war, wenn die Geme<strong>in</strong>de Geldmittel besaß, die sie nicht für ihren Zahlungsverkehr<br />
benötigte.<br />
Diese Voraussetzungen bed<strong>in</strong>gen, dass der Erwerb e<strong>in</strong>er Kapitalanlage, f<strong>in</strong>anziert durch die Aufnahme von Investitionskrediten<br />
nach § 86 GO <strong>NRW</strong>, dann nicht mit den haushaltsrechtlichen Grundsätzen und Vorschriften für<br />
Geme<strong>in</strong>den <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang steht, wenn damit geme<strong>in</strong>dliche Aufwendungen f<strong>in</strong>anziert werden sollen, z.B. die künftigen<br />
Versorgungsleistungen. In diesem S<strong>in</strong>ne dürfen für den Erwerb e<strong>in</strong>er Kapitalanlage auch ke<strong>in</strong>e Kredite zur<br />
Liquiditätssicherung nach § 89 GO <strong>NRW</strong> e<strong>in</strong>gesetzt werden, da diese nicht der haushaltsmäßigen F<strong>in</strong>anzierung,<br />
sondern nur die Zahlungsfähigkeit der Geme<strong>in</strong>de erhalten sollen.<br />
2.1.6 Die bankrechtliche Kundene<strong>in</strong>stufung<br />
Bei der geme<strong>in</strong>dlichen Kreditaufnahme am Kreditmarkt ist u.a. auch das F<strong>in</strong>anzmarktrichtl<strong>in</strong>ie-Umsetzungsgesetz<br />
vom 16.07.2007 (BGBl. I S. 1330) nicht unbeachtlich. Nach diesem Gesetz s<strong>in</strong>d die Banken als Wertpapierdienstleistungsunternehmen<br />
verpflichtet, ihre Kunden, also auch die Geme<strong>in</strong>de, anhand der gesetzlich vorgegebenen<br />
Kriterien zu klassifizieren. Diese E<strong>in</strong>stufung hat Auswirkungen auf die Bankleistungen gegenüber der Geme<strong>in</strong>de,<br />
denn die Bank hat das Anlegerschutzniveau und die Grundsätze für die Ausführung von Aufträgen <strong>in</strong> F<strong>in</strong>anz<strong>in</strong>strumenten<br />
zu beachten.<br />
GEMEINDEORDNUNG 451
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 89 GO <strong>NRW</strong><br />
E<strong>in</strong> Wertpapierdienstleistungsunternehmen, das e<strong>in</strong>e Anlageberatung oder e<strong>in</strong>e F<strong>in</strong>anzportfolioverwaltung vornimmt,<br />
muss von se<strong>in</strong>em Kunden alle Informationen e<strong>in</strong>holen über Kenntnisse und Erfahrungen der Kunden <strong>in</strong><br />
Bezug auf Geschäfte mit F<strong>in</strong>anz<strong>in</strong>strumenten, über Anlageziele und ihre f<strong>in</strong>anziellen Verhältnisse, um dem Kunden<br />
das für ihn geeignete F<strong>in</strong>anz<strong>in</strong>strument empfehlen zu können. Dazu gehört, dass der Kunde auch die mit<br />
e<strong>in</strong>em solchen Geschäft verbundenen Anlagerisiken versteht. Erlangt das Wertpapierdienstleistungsunternehmen<br />
nicht die erforderlichen Informationen, darf es im Zusammenhang mit e<strong>in</strong>er Anlageberatung ke<strong>in</strong> F<strong>in</strong>anz<strong>in</strong>strument<br />
empfehlen oder im Zusammenhang mit e<strong>in</strong>er F<strong>in</strong>anzportfolioverwaltung ke<strong>in</strong>e Empfehlung abgeben (vgl. die<br />
E<strong>in</strong>zelvorschriften des o.a. Gesetzes).<br />
Die Bundesanstalt für F<strong>in</strong>anzdienstleistungsaufsicht hat <strong>in</strong> ihrem Schreiben vom 25.06.2010 gegenüber den Verbänden<br />
der für F<strong>in</strong>anzdienstleistungsunternehmen und der Kreditwirtschaft klargestellt, dass e<strong>in</strong>e Geme<strong>in</strong>de als<br />
Privatkunde im S<strong>in</strong>ne des § 31a Abs. 3 WpHG des Wertpapierhandelsgesetzes anzusehen ist und nicht als professioneller<br />
Kunde zu gelten hat. Das Ergebnis e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen „Privatkunden-Auftrages“ muss sich zudem<br />
am Preis und an den Kosten des F<strong>in</strong>anz<strong>in</strong>strumentes orientieren (vgl. § 33a Abs. 3 WpHG). Außerdem besteht<br />
die Pflicht e<strong>in</strong>es Wertpapierdienstleistungsunternehmens gegenüber der Geme<strong>in</strong>de, diese ggf. auch über mögliche<br />
Probleme zur Ausführung der geme<strong>in</strong>dlichen Aufträge unter Anwendung der Grundsätze der bestmöglichen<br />
Ausführung zu unterrichten. Die Geme<strong>in</strong>de hat die Möglichkeit sich auch als professioneller Kunde e<strong>in</strong>stufen zu<br />
lassen (vgl. Abbildung).<br />
E<strong>in</strong>stufung der Geme<strong>in</strong>de als professioneller Kunde<br />
Die E<strong>in</strong>stufung e<strong>in</strong>es Privatkunden als professioneller Kunde nach § 31a Abs. 7 Satz 1 erste Alternative des<br />
Wertpapierhandelsgesetzes darf jedoch nur erfolgen, wenn der Kunde<br />
E<strong>in</strong>stufung<br />
als<br />
professioneller<br />
Kunde<br />
1. gegenüber dem Wertpapierdienstleistungsunternehmen zum<strong>in</strong>dest <strong>in</strong> Textform<br />
beantragt hat, generell oder für e<strong>in</strong>e bestimmte Art von Geschäften,<br />
F<strong>in</strong>anz<strong>in</strong>strumenten oder Wertpapierdienstleistungen oder für e<strong>in</strong> bestimmtes<br />
Geschäft oder für e<strong>in</strong>e bestimmte Wertpapierdienstleistung als professioneller<br />
Kunde e<strong>in</strong>gestuft zu werden,<br />
2. vom Wertpapierdienstleistungsunternehmen auf e<strong>in</strong>em dauerhaften Datenträger<br />
e<strong>in</strong>deutig auf die rechtlichen Folgen der E<strong>in</strong>stufungsänderung h<strong>in</strong>gewiesen<br />
worden ist,<br />
3. se<strong>in</strong>e Kenntnisnahme der nach Nummer 2 gegebenen H<strong>in</strong>weise <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
gesonderten Dokument bestätigt hat.<br />
Beabsichtigt das Wertpapierdienstleistungsunternehmen, e<strong>in</strong>en Kunden nach § 31a Abs. 7 Satz 1 zweite Alternative<br />
des Wertpapierhandelsgesetzes als professionellen Kunden e<strong>in</strong>zustufen, gilt Satz 1 entsprechend mit der<br />
Maßgabe, dass der Kunde se<strong>in</strong> E<strong>in</strong>verständnis zum<strong>in</strong>dest <strong>in</strong> Textform erklären muss.<br />
Abbildung 74 „E<strong>in</strong>stufung der Geme<strong>in</strong>de als professioneller Kunde“<br />
In den Fällen der E<strong>in</strong>stufung der Geme<strong>in</strong>de als professioneller Kunde und nicht mehr als Privatkunde muss das<br />
Wertpapierdienstleistungsunternehmen die Geme<strong>in</strong>de schriftlich darauf h<strong>in</strong>weisen, dass mit der Änderung dieser<br />
E<strong>in</strong>stufung auch die Schutzvorschriften für Privatkunden nicht mehr gelten. Die Geme<strong>in</strong>de muss dazu ihr E<strong>in</strong>verständnis<br />
geben und diese Sachlage schriftlich bestätigen. Die E<strong>in</strong>stufung der Geme<strong>in</strong>de als professioneller Kunde<br />
steht e<strong>in</strong>er späteren Rückstufung zum Privatkunden gem. § 31a Abs. 6 WpHG, soweit dieses von der Geme<strong>in</strong>de<br />
verlangt wird, nicht entgegen.<br />
GEMEINDEORDNUNG 452
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 89 GO <strong>NRW</strong><br />
2.1.7 Kredite zur Liquiditätssicherung und Z<strong>in</strong>smanagement<br />
2.1.7.1 Das Z<strong>in</strong>srisikomanagement<br />
2.1.6.1.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Mit e<strong>in</strong>em Z<strong>in</strong>srisikomanagement können die Geme<strong>in</strong>den bei variabel verz<strong>in</strong>slichen Verb<strong>in</strong>dlichkeiten, bei auslaufenden<br />
Z<strong>in</strong>svere<strong>in</strong>barungen oder bei Umschuldungen sowie bei der Aufnahme neuer Kredite das Risiko von Z<strong>in</strong>ssteigerungen<br />
wirksam steuern, um die haushaltsmäßigen Belastungen <strong>in</strong> verträglichen Grenzen zu halten. In<br />
diesem Zusammenhang können auch Z<strong>in</strong>sderivate zum E<strong>in</strong>satz kommen, wenn bei der Geme<strong>in</strong>de ausreichend<br />
Kenntnisse über die Risiken und Chancen solcher F<strong>in</strong>anz<strong>in</strong>strumente vorliegen und e<strong>in</strong> sorgfältiger Umgang<br />
damit erfolgt. Dies stellt vielfach e<strong>in</strong>e erhebliche Herausforderung für die geme<strong>in</strong>dliche Kreditwirtschaft und die<br />
Geldanlage dar, um e<strong>in</strong>e Optimierung von Kreditkonditionen zu erreichen und Z<strong>in</strong>srisiken durch den E<strong>in</strong>satz von<br />
Z<strong>in</strong>sderivaten zu begrenzen.<br />
Die derivativen F<strong>in</strong>anz<strong>in</strong>strumente des Kredit- und des Geldmarktes s<strong>in</strong>d dadurch gekennzeichnet, dass ihr Wert<br />
von e<strong>in</strong>er anderen Größe, z.B. e<strong>in</strong>em Preis oder Z<strong>in</strong>ssatz, abgeleitet wird. Nach § 1 Abs. 11 Nr. 2 des Kreditwesengesetzes<br />
s<strong>in</strong>d Derivate als Fest- oder Optionsgeschäfte ausgestaltete Term<strong>in</strong>geschäfte, deren Preis unmittelbar<br />
oder mittelbar von e<strong>in</strong>em Börsen- oder Marktpreis, e<strong>in</strong>em Kurs, Z<strong>in</strong>ssätzen oder anderen Erträgen abhängt.<br />
Soweit die Derivate sich auf die Z<strong>in</strong>sen im Kreditgeschäft oder bei Geldanlagen beziehen, kommen sie auch bei<br />
den Geme<strong>in</strong>den zum E<strong>in</strong>satz. Sie müssen sich jedoch immer auf e<strong>in</strong> Grundgeschäft, z.B. e<strong>in</strong>en bestehenden<br />
oder e<strong>in</strong>en geplanten Kredit beziehen, um nicht unter das für die Geme<strong>in</strong>den geltende Spekulationsverbot zu<br />
fallen (vgl. § 90 GO <strong>NRW</strong>).<br />
Diese Verknüpfung muss objektiv <strong>in</strong> jedem E<strong>in</strong>zelfall <strong>in</strong> sachlicher und <strong>in</strong> zeitlicher H<strong>in</strong>sicht gegeben se<strong>in</strong>, d.h. die<br />
Derivate müssen den geme<strong>in</strong>dlichen Krediten zugeordnet werden können. Sie liegt <strong>in</strong> sachlicher H<strong>in</strong>sicht vor,<br />
wenn der Nom<strong>in</strong>albetrag und die Währung von Grundgeschäft und Derivatgeschäft identisch s<strong>in</strong>d, und <strong>in</strong> zeitlicher<br />
H<strong>in</strong>sicht, wenn die Laufzeit und Fälligkeit des Derivats die Laufzeit und Fälligkeit von geme<strong>in</strong>dlichen Krediten<br />
als Grundgeschäft nicht überschreitet. Mit dieser Abgrenzung soll neben der Risikobegrenzung die notwendige<br />
Konnexität sichergestellt werden. Auch muss gewährleistet se<strong>in</strong>, dass die Geme<strong>in</strong>den ke<strong>in</strong>e Derivatgeschäfte<br />
lediglich zur spekulativen Ertragserzielung nutzen. Sie dürfen wegen des Spekulationsverbots die Derivate auch<br />
nicht als e<strong>in</strong>zeln handelbare F<strong>in</strong>anz<strong>in</strong>strumente unter Inkaufnahme von Verlustrisiken e<strong>in</strong>setzen.<br />
2.1.7.1.2 Z<strong>in</strong>sfestschreibung bei Krediten zur Liquiditätssicherung<br />
Bei Krediten zur Liquiditätssicherung kann von der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>e Vere<strong>in</strong>barung über e<strong>in</strong>e Z<strong>in</strong>sfestschreibung<br />
abgeschlossen werden, die dafür e<strong>in</strong>e Betragsgrenze sowie e<strong>in</strong>e zeitliche Begrenzung enthalten muss. Als sachlich<br />
vertretbar wird e<strong>in</strong>e Z<strong>in</strong>sfestschreibung für die Dauer von maximal fünf Jahren angesehen, obwohl die e<strong>in</strong>zelnen<br />
Kredite zur Liquiditätssicherung nur kurzfristige Kredite s<strong>in</strong>d und ihre Laufzeit regelmäßig unter e<strong>in</strong>em Jahr<br />
liegt. (vgl. Runderlass des Innenm<strong>in</strong>isterium „Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Geme<strong>in</strong>den (GV)“<br />
vom 09.06.2006; SMBl. <strong>NRW</strong>. 652). Wird davon Gebrauch gemacht, darf der Anteil der Kredite mit mehrjährigen<br />
Z<strong>in</strong>svere<strong>in</strong>barungen im Verhältnis zum Volumen der gesamten Kredite zur Liquiditätssicherung nicht wesentlich<br />
überwiegen, so dass ggf. im E<strong>in</strong>zelfall e<strong>in</strong>e Z<strong>in</strong>sfestschreibung bis zu 60 % des Gesamtvolumens <strong>in</strong> Betracht<br />
kommen kann.<br />
In den Fällen, <strong>in</strong> denen die Geme<strong>in</strong>de von e<strong>in</strong>er Z<strong>in</strong>sfestschreibung Gebrauch macht, hat sie im Rahmen ihrer<br />
mittelfristigen F<strong>in</strong>anzplanung nachweisen, dass aus haushaltswirtschaftlichen Gründen e<strong>in</strong>e Tilgung dieser Kredite<br />
vor Ablauf der Laufzeit der Z<strong>in</strong>sfestschreibung nicht <strong>in</strong> Betracht kommen kann. Außerdem muss die Geme<strong>in</strong>de<br />
dafür Sorge tragen, dass gemessen am Volumen der tatsächlich aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung<br />
der Anteil der Kredite mit mehrjährigen Z<strong>in</strong>svere<strong>in</strong>barungen nicht wesentlich überwiegt. Sie muss zudem<br />
GEMEINDEORDNUNG 453
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 89 GO <strong>NRW</strong><br />
beachten, dass bei Z<strong>in</strong>svere<strong>in</strong>barungen, die Zeiträume von über drei bis fünf Jahre betreffen, sie vor dem Abschluss<br />
e<strong>in</strong>er Z<strong>in</strong>sfestschreibung e<strong>in</strong>e Abstimmung mit der zuständigen Aufsichtsbehörde herbeizuführen hat.<br />
Aus Sicherheitsgesichtspunkten und zur Verr<strong>in</strong>gerung künftiger Belastungen des geme<strong>in</strong>dlichen Haushalts ist es<br />
erforderlich, dass die Geme<strong>in</strong>de je nach Bewertung des möglichen Risikos aus dem Z<strong>in</strong>ssicherungsgeschäft<br />
gleichzeitig e<strong>in</strong>e Risikovorsorge treffen muss. E<strong>in</strong>e angemessene Vorsorge kann dar<strong>in</strong> bestehen, dass die Z<strong>in</strong>svorteile<br />
aus der abgeschlossenen Vere<strong>in</strong>barung nicht von Anfang an vollständig für Zwecke des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushalts abgeschöpft werden, sondern e<strong>in</strong> Teil davon, z.B. die Hälfte, als „Risikoabsicherung“ zurückgelegt wird<br />
und erst später (nach Ablauf der Vere<strong>in</strong>barung) wieder frei für den geme<strong>in</strong>dlichen Haushalt verfügbar ist. Die<br />
Geme<strong>in</strong>de muss deshalb für diese „Risikovorsorge“ auch die notwendigen Mittel während der Vertragslaufzeit<br />
separieren (vgl. o.a. Runderlass „Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Geme<strong>in</strong>den (GV) vom<br />
09.10.2006 (SMBl. <strong>NRW</strong>. 652).<br />
2.1.7.1.3 Z<strong>in</strong>soptionen<br />
Als Z<strong>in</strong>soptionen kommen <strong>in</strong>sbesondere Caps oder Floors zum E<strong>in</strong>satz, die es ermöglichen, die Auswirkungen<br />
von Veränderungen des Z<strong>in</strong>sniveaus über e<strong>in</strong>en vorher bestimmten Rahmen h<strong>in</strong>aus zu begrenzen. Je nach Umfang<br />
und Wirkung solcher Derivatgeschäfte muss e<strong>in</strong>e Abstimmung darüber zwischen Rat und Verwalzung erfolgen,<br />
um die Ermächtigungen zum Abschluss von Derivatgeschäften und die Verantwortlichkeiten dafür festzulegen.<br />
Bei Caps wird für e<strong>in</strong>en bestimmten Zeitraum e<strong>in</strong>e Z<strong>in</strong>sobergrenze bezogen auf e<strong>in</strong>en bestimmten Betrag<br />
vere<strong>in</strong>bart. Steigt der Z<strong>in</strong>s währen der Cap-Laufzeit über die vere<strong>in</strong>barte Obergrenze, dann würde die Geme<strong>in</strong>de<br />
als Inhaber des Caps die Differenz bezogen auf den Nom<strong>in</strong>albetrag z.B. von ihrer Bank als Verkäufer erstattet<br />
bekommen.<br />
Zum Zeitpunkt des Erwerbs des Caps muss i.d.R. von der Geme<strong>in</strong>de jedoch e<strong>in</strong>e Prämie für e<strong>in</strong>e solche Z<strong>in</strong>ssicherung<br />
gezahlt werden. E<strong>in</strong> solcher Cap kann aber auch mehrere h<strong>in</strong>tere<strong>in</strong>ander liegende Optionsgeschäfte<br />
be<strong>in</strong>halten. Von der Geme<strong>in</strong>de können auch F<strong>in</strong>anzgeschäfte zur Begrenzung von Z<strong>in</strong>ssenkungen abgeschlossen<br />
werden (Floors). Diese Geschäfte kommen i.d.R. <strong>in</strong> Betracht, wenn die Verz<strong>in</strong>sung von F<strong>in</strong>anzanlagen nicht<br />
unter e<strong>in</strong> bestimmtes Niveau s<strong>in</strong>ken soll. Auch ist bei F<strong>in</strong>anzgeschäften e<strong>in</strong>e Komb<strong>in</strong>ation von Floors und Caps<br />
möglich.<br />
2.1.7.1.4 Z<strong>in</strong>sswaps<br />
Wenn künftige feste und variable Z<strong>in</strong>szahlungen auf e<strong>in</strong>en nom<strong>in</strong>ellen Kreditbetrag für e<strong>in</strong>en bestimmten Zeitraum<br />
gegene<strong>in</strong>ander getauscht werden, erfolgt dies im Rahmen von Z<strong>in</strong>sswaps. Dabei muss ke<strong>in</strong> effektiver<br />
Tausch der Z<strong>in</strong>szahlungen erfolgen, wenn Ausgleichszahlungen zwischen e<strong>in</strong>em festen und dem variablen Z<strong>in</strong>ssatz<br />
geleistet werden. Die variablen Z<strong>in</strong>ssätze werden i.d.R. an e<strong>in</strong>en Referenzz<strong>in</strong>ssatz geknüpft, z.B. den Euribor<br />
o.a. Dazu zwei Beispiele:<br />
- Receiver- (Empänger-)Swaps<br />
Bei diesen Swaps s<strong>in</strong>d weiterh<strong>in</strong> die Festz<strong>in</strong>sen für den aufgenommenen Kredit zu zahlen. Zusätzlich s<strong>in</strong>d<br />
die variablen Z<strong>in</strong>sen im Z<strong>in</strong>sswap zu zahlen. Im Gegenzug erhält der Kreditnehmer den für die Laufzeit des<br />
Swaps vere<strong>in</strong>barten Festz<strong>in</strong>s (Swapsatz).<br />
- Payer-(Zahler-)Swaps<br />
Bei diesen Swaps s<strong>in</strong>d weiterh<strong>in</strong> die variablen Z<strong>in</strong>sen für den aufgenommenen Kredit zu zahlen. Zusätzlich<br />
ist für die Laufzeit des Swaps e<strong>in</strong> vere<strong>in</strong>barter Festz<strong>in</strong>s (Swapsatz) zu zahlen. Im Gegenzug erhält der Kreditnehmer<br />
die variablen Z<strong>in</strong>sen im Z<strong>in</strong>sswap.<br />
Bei Z<strong>in</strong>sgeschäften liegt e<strong>in</strong> schwebendes Geschäft vor, das wegen e<strong>in</strong>er Vermutung der Ausgeglichenheit zunächst<br />
nicht zu bilanzieren ist, wenn Kommt es zu ke<strong>in</strong>en anfänglichen Zahlungen. Ggf. kann von der Geme<strong>in</strong>de<br />
GEMEINDEORDNUNG 454
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 89 GO <strong>NRW</strong><br />
beim Abschluss e<strong>in</strong>es Z<strong>in</strong>sswaps auch e<strong>in</strong>e Prämie zu zahlen se<strong>in</strong>. Die Flexibilität der Geme<strong>in</strong>de bei solchen<br />
Geschäften kann sich <strong>in</strong> der Höhe der Zahlungen bei Geschäftsabschluss auswirken. Bei Z<strong>in</strong>sswaps können aber<br />
auch ausschließlich variable Z<strong>in</strong>sverpflichtungen gegene<strong>in</strong>ander getauscht werden, denn die Z<strong>in</strong>sswaps werden<br />
<strong>in</strong> unterschiedlichen Formen angeboten. So kann auch e<strong>in</strong> Z<strong>in</strong>sswap mit e<strong>in</strong>em Währungsswap komb<strong>in</strong>iert se<strong>in</strong>.<br />
Außerdem werden durch diese F<strong>in</strong>anzgeschäften ke<strong>in</strong>e Kapitalforderungen begründet.<br />
2.1.7.2 Eigenverantwortung bei Z<strong>in</strong>ssicherungs<strong>in</strong>strumenten<br />
2.1.7.2.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die Geme<strong>in</strong>de entscheidet über den E<strong>in</strong>satz von Z<strong>in</strong>ssicherungs<strong>in</strong>strumenten <strong>in</strong> eigener Verantwortung. Sie kann<br />
mit diesen Instrumenten nicht die, <strong>in</strong>sbesondere aus der Kreditwirtschaft der Geme<strong>in</strong>de, bestehenden Risiken<br />
vermeiden, sondern nur e<strong>in</strong>e Optimierung dieser Risiken zur eigenen M<strong>in</strong>imierung der haushaltswirtschaftlichen<br />
Belastungen vornehmen. Auch können Derivate zunächst Aufwendungen bei der Geme<strong>in</strong>de verursachen. Die<br />
Geme<strong>in</strong>de soll daher für e<strong>in</strong> nur die aus den örtlichen Gegebenheiten heraus geeigneten Instrumente für e<strong>in</strong><br />
Z<strong>in</strong>srisikomanagement nutzen.<br />
Die allgeme<strong>in</strong> verfügbaren F<strong>in</strong>anz<strong>in</strong>strumente können vielfach im S<strong>in</strong>ne der Geme<strong>in</strong>de auch e<strong>in</strong>e Anpassung<br />
erfahren. Die Geme<strong>in</strong>de sollte dann e<strong>in</strong>e Modifizierung verlangen, wenn es aus ihrer Sicht heraus der Zielerreichung<br />
der Geme<strong>in</strong>de dient. Nur dann wird e<strong>in</strong>e geeignete Entscheidungsbasis für die Geme<strong>in</strong>de geschaffen, auf<br />
der sie e<strong>in</strong>e Gesamtstrategie aufbauen und e<strong>in</strong>e wirksame Risikosteuerung vornehmen kann. Die haushaltsrechtlich<br />
geforderte B<strong>in</strong>dung zwischen den Kreditgrundgeschäften und den Derivatgeschäften der Geme<strong>in</strong>de muss<br />
immer erhalten bleiben. Ansonsten würden spekulative F<strong>in</strong>anz<strong>in</strong>strumente vorliegen, die dem gesetzlichen Spekulationsverbot<br />
widersprechen.<br />
2.1.7.2.2 Laufende Überwachung der F<strong>in</strong>anzgeschäfte<br />
Die Geme<strong>in</strong>de soll, wenn sie e<strong>in</strong> aktives Z<strong>in</strong>smanagement betreibt, e<strong>in</strong>en konkreten Handlungsrahmen h<strong>in</strong>sichtlich<br />
des Umgangs mit Z<strong>in</strong>s- und Anlagerisiken festlegen, durch den u.a. Ziele, Grundsätze, Verantwortlichkeiten<br />
und Prozesse bestimmt werden. Auch gehört dazu, zusätzlich zum Abschluss von Z<strong>in</strong>ssicherungs<strong>in</strong>strumenten<br />
und der Erfassung im doppischen Rechnungswesen der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>e ständige Überwachung und Kontrolle im<br />
Ablauf der abgeschlossenen F<strong>in</strong>anzgeschäfte sowie e<strong>in</strong>e Markbeobachtung vorzunehmen. Dabei gilt es, dieses<br />
als pflichtige Aufgabe anzusehen und das Wissen der Geme<strong>in</strong>de über die Chancen und Risiken bzw. Möglichkeiten<br />
des E<strong>in</strong>satzes von haushaltsrechtlich zulässigen und vertretbaren F<strong>in</strong>anz<strong>in</strong>strumenten ständig weiter zu entwickeln.<br />
E<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>malige Information reicht deshalb für e<strong>in</strong>e Anwendung <strong>in</strong> der örtlichen Praxis der Geme<strong>in</strong>de nicht aus. In<br />
Anbetracht des tatsächlichen E<strong>in</strong>satzes von F<strong>in</strong>anz<strong>in</strong>strumenten sollte bei Abschluss von F<strong>in</strong>anzgeschäfte z.B.<br />
nicht nur das 4-Augen-Pr<strong>in</strong>zip zur Anwendung kommen, sondern dies muss Anlass se<strong>in</strong>, e<strong>in</strong> vielfältiges Risikomanagement<br />
aufzubauen. Wenn nicht bereits e<strong>in</strong> Konzept von der Geme<strong>in</strong>de erstellt worden ist, welche Produkte<br />
des Marktes genutzt werden dürfen, gilt es, dies ggf. nachzuholen, aber auch, das vorhandene Konzept zukünftig<br />
fortzuschreiben. So wäre z.B. dar<strong>in</strong> festzulegen, dass neue Produkte nur nach e<strong>in</strong>er Testphase tatsächlich zum<br />
E<strong>in</strong>satz kommen. Die wirtschaftliche Bedeutung e<strong>in</strong>es örtlichen Z<strong>in</strong>srisikomanagements ist so bedeutsam, dass<br />
dieses für jede Geme<strong>in</strong>de unerlässlich wird. E<strong>in</strong>e Optimierung der f<strong>in</strong>anzwirtschaftlichen Abläufe <strong>in</strong>nerhalb der<br />
Geme<strong>in</strong>de und mit den Geschäftspartnern kann dazu beitragen, fehlerhafte oder riskante E<strong>in</strong>sätze von Derivaten<br />
zu vermeiden, die zu erheblichen wirtschaftlichen Schäden bei der Geme<strong>in</strong>de führen können.<br />
GEMEINDEORDNUNG 455
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 89 GO <strong>NRW</strong><br />
2.1.7.3 Angaben zu Z<strong>in</strong>ssicherungs<strong>in</strong>strumenten im Anhang<br />
Im Anhang des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses sollen derivative F<strong>in</strong>anz<strong>in</strong>strumente, z.B. Z<strong>in</strong>ssicherungs<strong>in</strong>strumente,<br />
unabhängig davon, ob sie e<strong>in</strong> schwebendes Geschäft darstellen, das nicht bilanzierungsfähig ist,<br />
angegeben werden. Diese Geschäfte s<strong>in</strong>d wichtige Angaben über das haushaltswirtschaftliche Handeln der Geme<strong>in</strong>de<br />
im S<strong>in</strong>ne des § 44 Abs. 2 GemHVO <strong>NRW</strong>. Mit diesen Angaben soll e<strong>in</strong> Überblick über den Umfang der<br />
von der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>gesetzten F<strong>in</strong>anz<strong>in</strong>strumente gegeben werden, weil die Geschäfte der Geme<strong>in</strong>de über<br />
Z<strong>in</strong>sswaps und Währungsswaps e<strong>in</strong> schwebendes Dauerschuldverhältnis darzustellen, das zunächst nicht bilanziert<br />
wird. Ggf. ist jedoch später <strong>in</strong> E<strong>in</strong>zelfällen bei Vorliegen der Voraussetzungen die Passivierung e<strong>in</strong>er Rückstellung<br />
für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz vorzunehmen (vgl. § 36<br />
5 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
Zu derartigen Geschäften der Geme<strong>in</strong>de sollen die Arten und den Umfang der derivativen F<strong>in</strong>anz<strong>in</strong>strumente Im<br />
Anhang im geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss angegeben sowie dazu die beizulegenden Werte, soweit sie bestimmt<br />
werden können, und die angewandten Bewertungsmethoden aufgeführt werden. Dabei sollen möglichst<br />
die z<strong>in</strong>sbezogenen F<strong>in</strong>anz<strong>in</strong>strumente von den währungsbezogenen Instrumenten getrennt dargestellt und dazu<br />
wegen der Beachtung des Konnexitätspr<strong>in</strong>zips die betroffenen Bilanzposten angegeben werden. Soweit Mischformen<br />
bestehen, s<strong>in</strong>d diese im Anhang gesondert anzugeben.<br />
2.1.7.4 Die Unzulässigkeit spekulativer F<strong>in</strong>anzgeschäfte<br />
Der E<strong>in</strong>satz von F<strong>in</strong>anz<strong>in</strong>strumenten durch die Geme<strong>in</strong>de, <strong>in</strong>sbesondere von F<strong>in</strong>anzderivaten, ist unter Berücksichtigung<br />
des örtlichen E<strong>in</strong>zelfalles zu beurteilen. Der Abschluss derartiger F<strong>in</strong>anzgeschäfte zu spekulativen<br />
Zwecken ist grundsätzlich als unzulässig anzusehen. Das Vorliegen e<strong>in</strong>es spekulativen F<strong>in</strong>anzgeschäfts kann<br />
ggf. gegeben se<strong>in</strong>, wenn e<strong>in</strong> F<strong>in</strong>anzderivat z.B. ohne ausreichende <strong>in</strong>haltliche Abgrenzung und ohne Verlustbegrenzung<br />
abgeschlossen wird, e<strong>in</strong> nicht vorhandenes Risiko abgesichert werden soll, ausschließlich der Gew<strong>in</strong>nerzielung<br />
dient oder ke<strong>in</strong>e nachweisbare Konnexität zu e<strong>in</strong>em Kredit als Grundgeschäft besteht. Von der Geme<strong>in</strong>de<br />
muss regelmäßig sowohl beim Abschluss von F<strong>in</strong>anzgeschäften als auch während der Laufzeiten überprüft<br />
werden, ob e<strong>in</strong> unzulässiger Sachverhalt vorliegt. Die Gliederung des örtlichen Z<strong>in</strong>s- und Schuldenmanagements<br />
<strong>in</strong> getrennte eigenständige Verantwortungsbereiche, z.B. „Geschäftsabschluss“, „Überwachung und Kontrolle“<br />
und „Gesamtleitung“, sowie die getrennt davon vorzunehmende buchungstechnische Erfassung <strong>in</strong> der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzbuchhaltung unterstützt dabei e<strong>in</strong> ordnungsgemäßes Verwaltungshandeln.<br />
2.1.8 Die Umschuldung und Kredite zur Liquiditätssicherung<br />
Unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nach § 75 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> kann auch<br />
bei Krediten zur Liquiditätssicherung e<strong>in</strong>e Umschuldung <strong>in</strong> Betracht kommen, wenn trotz kurzfristiger Laufzeiten<br />
die neuen Konditionen für die Geme<strong>in</strong>de günstiger s<strong>in</strong>d als die des abzulösenden Kredites. Die Geme<strong>in</strong>de kann<br />
im Rahmen der Umschuldung e<strong>in</strong>en neuen Vertrag mit dem Kreditgeber abschließen, sie kann aber auch den<br />
Kreditgeber wechseln. Auch <strong>in</strong> diesen Fällen wird der Begriff „Umschuldung“ als Begründung e<strong>in</strong>er neuen Verpflichtung<br />
der Geme<strong>in</strong>de zur Begleichung e<strong>in</strong>er bestehenden Verpflichtung verstanden. Daher wird durch e<strong>in</strong>e<br />
Umschuldung i.d.R. auch das Volumen der Verb<strong>in</strong>dlichkeiten der Geme<strong>in</strong>de nicht verändert, sondern es werden<br />
lediglich die Kreditkonditionen angepasst.<br />
Die Umschuldung e<strong>in</strong>es Kredites zur Liquiditätssicherung kann jedoch nicht auf die Vorschrift des § 86 GO <strong>NRW</strong><br />
gestützt werden. Durch den <strong>in</strong> der Vorschrift bestehenden Regelungszusammenhang mit der haushaltsrechtlichen<br />
Vorgabe, dass von der Geme<strong>in</strong>de Kredite nur für Investitionen aufgenommen werden dürfen, bedeutet die<br />
Umschuldung im S<strong>in</strong>ne des § 86 GO <strong>NRW</strong>, die Ablösung e<strong>in</strong>es Kredites für Investitionen durch die Aufnahme<br />
e<strong>in</strong>es neuen Kredites für Investitionen. Dieses schließt für die Geme<strong>in</strong>den e<strong>in</strong>, dass die Umwandlung e<strong>in</strong>es zu<br />
GEMEINDEORDNUNG 456
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 89 GO <strong>NRW</strong><br />
tilgenden Kredites zur Liquiditätssicherung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en langfristigen Kredit oder e<strong>in</strong>en Annuitätenkredit nicht zulässig<br />
ist, denn e<strong>in</strong> solcher Vorgang steht nicht mit dem Begriff „Umschuldung“ im S<strong>in</strong>ne des § 86 GO <strong>NRW</strong> <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang.<br />
In Sonderfällen aber, <strong>in</strong> denen die Geme<strong>in</strong>de ausschließlich zur vorübergehenden F<strong>in</strong>anzierung e<strong>in</strong>er Investition<br />
e<strong>in</strong>en kurzfristigen Kredit aufgenommen hat (Zwischenf<strong>in</strong>anzierung), weil z.B. e<strong>in</strong> günstiges Kreditangebot bestand,<br />
kann e<strong>in</strong> solcher zu tilgender Kredit auch <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en langfristigen Kredit oder e<strong>in</strong>en Annuitätenkredit umgewandelt<br />
werden. E<strong>in</strong> für e<strong>in</strong>en solchen Zweck aufgenommener kurzfristiger Kredit ist nur h<strong>in</strong>sichtlich se<strong>in</strong>er Laufzeit,<br />
aber nicht wegen se<strong>in</strong>es Zweckes mit e<strong>in</strong>em Kredit zur Liquiditätssicherung vergleichbar. Der für Investitionen<br />
aufgenommene kurzfristige Kredit stellt von Anfang an e<strong>in</strong>en haushaltsrechtlichen Kredit dar, denn die E<strong>in</strong>zahlungen<br />
aus se<strong>in</strong>er Aufnahme dienen der haushaltsmäßigen Deckung von <strong>in</strong>vestiven Auszahlungen und haben<br />
nicht den allgeme<strong>in</strong>en Zweck, fällige Auszahlungen durch die Geme<strong>in</strong>de zu ermöglichen. Dies bedeutet, dass es<br />
für die Aufnahme e<strong>in</strong>es solchen kurzfristigen Kredites e<strong>in</strong>er geltenden Kreditermächtigung nach § 86 GO <strong>NRW</strong><br />
bedarf und die Aufnahme dieses Kredites nicht unter die Höchstbetragsgrenze der Kredite zur Liquiditätssicherung<br />
nach § 89 GO <strong>NRW</strong> fällt.<br />
2.2 Zu Satz 2 (Geltungsdauer der Ermächtigung <strong>in</strong> der Haushaltssatzung):<br />
2.2.1 Die Geltung im Haushaltsjahr<br />
Die vom Rat der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> der Haushaltssatzung für das betreffende Haushaltsjahr ausgesprochene Ermächtigung,<br />
zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen die notwendigen Kredite zur Liquiditätssicherung bis zu dem<br />
<strong>in</strong> der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag (vgl. § 78 Abs. 2 Nr. 3 GO <strong>NRW</strong>) aufnehmen, soweit dafür<br />
ke<strong>in</strong>e anderen Mittel zur Verfügung stehen, würde wegen der Geltungsdauer der Haushaltssatzung für das betreffende<br />
Haushaltsjahr nur für diesen Zeitraum gelten (vgl. § 78 Abs. 3 und 4 GO <strong>NRW</strong>). Durch die Vorschrift wird<br />
die Geltungsdauer dieser Ermächtigung jedoch erweitert, denn sie soll über das Haushaltsjahr h<strong>in</strong>aus bis zum<br />
Erlass bzw. dem In-Kraft-Treten e<strong>in</strong>er neuen Haushaltssatzung gelten. Damit wurde ke<strong>in</strong>e jahresbezogene Beschränkung<br />
der Ermächtigung auf e<strong>in</strong>e bestimmte Anzahl von Folgejahren des Haushaltsjahres festgelegt wie sie<br />
bei der Kreditermächtigung (vgl. § 86 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>) und bei den Verpflichtungsermächtigungen (vgl. § 85 GO<br />
<strong>NRW</strong>) ausdrücklich bestehen.<br />
Der satzungsrechtliche Höchstbetrag als im Rahmen des Budgetrechts des Rates ausgesprochene Ermächtigung<br />
be<strong>in</strong>haltet das Recht, jeweils bei Bedarf <strong>in</strong>nerhalb des Haushaltsjahres die notwendigen Kredite zur Liquiditätssicherung<br />
bis zu diesem Betrag aufzunehmen, der aber nicht überschritten werden darf. Die e<strong>in</strong>zelnen Kreditaufnahmen<br />
s<strong>in</strong>d dabei nur dann nom<strong>in</strong>al zusammen zu rechnen, wenn sie sich zeitlich überschneiden. Diese Vorgabe<br />
gilt auch dann, wenn statt der Aufnahme e<strong>in</strong>zelner Kredite der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong>sgesamt e<strong>in</strong> Überziehungs- oder<br />
Kontokorrentkredit e<strong>in</strong>geräumt wurde. Diese Sachlage hat zur Folge, dass der <strong>in</strong> der Haushaltssatzung festgesetzte<br />
Höchstbetrag die Höchstgrenze für alle Arten der Verstärkung von Zahlungsmitteln durch die Geme<strong>in</strong>de<br />
darstellt.<br />
2.2.2 Die Geltung nach Ablauf des Haushaltsjahres<br />
In der geme<strong>in</strong>dlichen Praxis lässt es sich aus unterschiedlichen Gründen nicht immer vermeiden, dass die Haushaltssatzung<br />
der Geme<strong>in</strong>de erst nach Beg<strong>in</strong>n des Haushaltsjahres erlassen wird. Die Geme<strong>in</strong>de muss aber<br />
grundsätzlich dafür Sorge tragen, dass die Haushaltssatzung für das neue Haushaltsjahr so rechtzeitig vorbereitet<br />
wird, damit sie mit Beg<strong>in</strong>n des Haushaltsjahres <strong>in</strong> Kraft treten kann, denn sie hat nach § 78 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong><br />
jährlich e<strong>in</strong>e Haushaltssatzung aufzustellen. In solchen Fällen, also <strong>in</strong> der Zeit vom Beg<strong>in</strong>n des neuen Haushaltsjahres<br />
bis zum Erlass bzw. dem In-Kraft-Treten der Haushaltssatzung, muss die Geme<strong>in</strong>de gleichwohl ihre rechtlichen<br />
Zahlungsverpflichtungen im Rahmen ihrer Aufgaben erfüllen. Dieser zahlungsbezogene Zweck bee<strong>in</strong>flusst<br />
die Geltungsdauer, denn die Liquiditätskredite dienen nicht der haushaltsmäßigen Deckung.<br />
GEMEINDEORDNUNG 457
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 89 GO <strong>NRW</strong><br />
In der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung hat die Geme<strong>in</strong>de ihre Haushaltswirtschaft unter Beachtung der<br />
Bestimmungen des § 82 GO <strong>NRW</strong> auszuführen. Darüber h<strong>in</strong>aus gelten bestimmte Festlegungen der Haushaltssatzung<br />
des abgelaufenen Haushaltsjahres für das neue Haushaltsjahr weiter, u.a. die Festlegung über den<br />
Höchstbetrag für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung. Die Vorschrift sieht deshalb vor, dass die<br />
Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung<br />
(Höchstbetrag) über das Haushaltsjahr h<strong>in</strong>aus bis zum Erlass e<strong>in</strong>er neuen Haushaltssatzung weiter gilt. Am Ende<br />
e<strong>in</strong>es Haushaltsjahres noch bestehende Kredite zur Liquiditätssicherung s<strong>in</strong>d dabei <strong>in</strong> den Höchstbetrag des<br />
folgenden Haushaltsjahres e<strong>in</strong>zubeziehen.<br />
Diese über das ursprüngliche Haushaltsjahr h<strong>in</strong>aus geltende Ermächtigung kann jedoch nur dann noch <strong>in</strong> Anspruch<br />
genommen werden, soweit sie nicht vollständig im abgelaufenen Haushaltsjahr benötigt worden ist. Es ist<br />
deshalb e<strong>in</strong>erseits möglich, noch weitere Kredite zur Liquiditätssicherung aufzunehmen bis der satzungsrechtlich<br />
festgesetzte Höchstbetrag ausgeschöpft ist. Andererseits dürfen auf dieser (noch nicht ausgeschöpften) Ermächtigungsgrundlage<br />
so lange noch Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden, bis die neue Haushaltssatzung<br />
der Geme<strong>in</strong>de erlassen worden ist. Auch wenn die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung vom Rat beschlossen<br />
worden ist, entfaltet sie erst mit ihrer Bekanntmachung nach § 80 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong> die notwendige B<strong>in</strong>dung an die<br />
<strong>in</strong> der Satzung getroffenen Festlegungen, z.B. h<strong>in</strong>sichtlich des Höchstbetrages der Kredite, die zur Liquiditätssicherung<br />
<strong>in</strong> Anspruch genommen werden dürfen (vgl. § 78 Abs. 2 Nr. 3 GO <strong>NRW</strong>).<br />
2.2.3 Die Veränderung des Höchstbetrages<br />
Im Ablauf e<strong>in</strong>es Haushaltsjahres, <strong>in</strong> dem noch ke<strong>in</strong>e Haushaltssatzung <strong>in</strong> Kraft getreten ist, kann sich ergeben,<br />
dass die Haushaltsermächtigung zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung aus dem abgelaufenen<br />
Haushaltsjahr (Höchstbetrag <strong>in</strong> der Haushaltssatzung dieses Haushaltsjahres) bereits ausgeschöpft ist, aber e<strong>in</strong><br />
weiterer F<strong>in</strong>anzierungsbedarf durch Liquiditätskredite besteht. In solchen Fällen muss die Geme<strong>in</strong>de gleichwohl<br />
ihren e<strong>in</strong>gegangenen Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Zur Aufrechterhaltung der geme<strong>in</strong>dlichen Liquidität<br />
bzw. zur Erfüllung ihrer Zahlungsverpflichtungen besteht die Möglichkeit, durch Ratsbeschluss den <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltssatzung des abgelaufenen Haushaltsjahres verankerten Höchstbetrag entsprechend dem<br />
dr<strong>in</strong>genden Mehrbedarf anzupassen.<br />
Dieser Ratsbeschluss kann dabei nicht als e<strong>in</strong>e formelle Nachtragssatzung oder als e<strong>in</strong>e „Teilhaushaltssatzung“<br />
betrachtet und gehandhabt werden, denn formell ist die Haushaltssatzung des abgelaufenen Haushaltsjahres mit<br />
dem Ende des Kalenderjahres außer Kraft. Die Weitergeltung der Ermächtigung über die Aufnahme von Krediten<br />
zur Liquiditätssicherung über das Haushaltsjahr h<strong>in</strong>aus bis zum Erlass der neuen Haushaltssatzung lässt zu,<br />
dass der Rat der Geme<strong>in</strong>de im Rahmen se<strong>in</strong>es Budgetrechts und durch e<strong>in</strong>en gesonderten Beschluss die noch<br />
geltende Haushaltsermächtigung aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr entsprechend dem tatsächlichen Bedarf<br />
verändern bzw. anpassen kann. Diese Anpassung kann <strong>in</strong> Ausnahmefällen auch durch e<strong>in</strong>e Dr<strong>in</strong>glichkeitsentscheidung<br />
nach § 60 GO <strong>NRW</strong> erfolgen, wenn die entsprechenden Voraussetzungen vor Ort dafür vorliegen.<br />
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ<br />
GEMEINDEORDNUNG 458
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 90 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 90<br />
Vermögensgegenstände<br />
(1) Die Geme<strong>in</strong>de soll Vermögensgegenstände nur erwerben, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich<br />
ist oder wird.<br />
(2) 1 Die Vermögensgegenstände s<strong>in</strong>d pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten. 2 Bei Geldanlagen ist auf e<strong>in</strong>e<br />
ausreichende Sicherheit zu achten; sie sollen e<strong>in</strong>en angemessenen Ertrag erbr<strong>in</strong>gen.<br />
(3) 1 Die Geme<strong>in</strong>de darf Vermögensgegenstände, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben <strong>in</strong> absehbarer Zeit nicht<br />
braucht, veräußern. 2 Vermögensgegenstände dürfen <strong>in</strong> der Regel nur zu ihrem vollen Wert veräußert werden.<br />
(4) Für die Überlassung der Nutzung e<strong>in</strong>es Vermögensgegenstandes gilt Absatz 3 s<strong>in</strong>ngemäß.<br />
(5) Für die Verwaltung und Bewirtschaftung von Geme<strong>in</strong>dewaldungen gelten die Vorschriften dieses Gesetzes<br />
und des Landesforstgesetzes.<br />
Erläuterungen zu § 90:<br />
I. Allgeme<strong>in</strong>es<br />
1. Geme<strong>in</strong>dliches Vermögen für die Erfüllung der Aufgaben<br />
Das geme<strong>in</strong>dliche Vermögen dient der Erfüllung der öffentlichen Aufgaben der Geme<strong>in</strong>de. Es hat den Zweck,<br />
Leistungen und Nutzen für den Bürger zu erbr<strong>in</strong>gen. Die Geme<strong>in</strong>de hat deshalb ihre Vermögensgegenstände so<br />
zu verwalten, dass die Geme<strong>in</strong>def<strong>in</strong>anzen gesund bleiben (vgl. § 10 GO <strong>NRW</strong>). Zum Vermögen der Geme<strong>in</strong>de im<br />
haushaltsrechtlichen S<strong>in</strong>n ist die Gesamtheit aller Sachen und Rechte, die der Geme<strong>in</strong>de gehören oder zustehen<br />
oder sie wirtschaftlicher Eigentümer ist, soweit diese nicht auf Grund ausdrücklicher Vorschriften gesondert zu<br />
behandeln s<strong>in</strong>d, zu zählen. Die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft sowie die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung<br />
der Geme<strong>in</strong>de erfordern e<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>dliches Vermögensmanagement.<br />
Das geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsrecht orientiert sich dabei am kaufmännischen Begriff des Vermögensgegenstandes,<br />
für den bisher ke<strong>in</strong>e gesetzliche Def<strong>in</strong>ition und ke<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>heitliche Begriffsbestimmung gibt (vgl. Erläuterung Nr. 1.1<br />
zu § 33 GemHVO <strong>NRW</strong>). Für das geme<strong>in</strong>dliche Vermögen muss grundsätzlich der Nachweis e<strong>in</strong>er ordnungsgemäßen<br />
Verwaltung, der Werterhaltung und dem Substanzverzehr erbracht und festgestellt werden. Dies wirkt sich<br />
auch auf die jährliche Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de aus. In weiteren Vorschriften der Geme<strong>in</strong>deordnung wird<br />
z.B. noch die Trennung <strong>in</strong> allgeme<strong>in</strong>es Vermögen, Sondervermögen (vgl. § 97 GO <strong>NRW</strong>) und Treuhandvermögen<br />
(vgl. § 98 GO <strong>NRW</strong>) geregelt.<br />
2. Die Bilanzierung des geme<strong>in</strong>dlichen Vermögens<br />
2.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Das Haushaltsrecht für Geme<strong>in</strong>den schreibt für den geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss e<strong>in</strong>e Bilanz als umfassende<br />
Vermögensrechnung vor. In der Bilanz der Geme<strong>in</strong>de ist zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen zu<br />
unterscheiden. Für die Zuordnung von geme<strong>in</strong>dlichen Vermögensgegenständen <strong>in</strong> der Bilanz der Geme<strong>in</strong>de ist<br />
die wirtschaftliche Zweckbestimmung, d.h. ist der e<strong>in</strong>zelne Vermögensgegenstand zum Gebrauch oder zum Verbrauch<br />
bestimmt, ausschlaggebend.<br />
GEMEINDEORDNUNG 459
2.2 Die Bilanzierung des Anlagevermögens<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 90 GO <strong>NRW</strong><br />
Als Anlagevermögen s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz nur die Vermögensgegenstände anzusetzen, bei denen die<br />
Geme<strong>in</strong>de wirtschaftlicher Eigentümer ist und die zum Gebrauch auf Dauer bestimmt s<strong>in</strong>d, also dauernd der Aufgabenerfüllung<br />
der Geme<strong>in</strong>de dienen sollen. Die geme<strong>in</strong>dliche Bilanz zeigt im Bereich „Anlagevermögen“ folgende<br />
Struktur (vgl. Abbildung).<br />
Anlagevermögen <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz<br />
Bilanzbereich Bilanzposten<br />
Immaterielle Vermögensgegenstände (Untergliederung nach örtlichem Bedarf)<br />
Unbebaute Grundstücke und<br />
grundstücksgleiche Rechten<br />
Bebaute Grundstücke und<br />
grundstücksgleiche Rechte<br />
Infrastrukturvermögen<br />
Sonstiges Sachanlagevermögen<br />
F<strong>in</strong>anzanlagen<br />
- Grünflächen<br />
- Ackerland<br />
- Wald, Forsten<br />
- Sonstige unbebaute Grundstücke<br />
- K<strong>in</strong>der- und Jugende<strong>in</strong>richtungen<br />
- Schulen<br />
- Wohnbauten<br />
- Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude<br />
- Grund und Boden des Infrastrukturvermögens<br />
- Brücken und Tunnel<br />
- Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und<br />
Sicherheitsanlagen<br />
- Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen<br />
- Straßennetz mit Wegen, Plätzen und<br />
Verkehrslenkungsanlagen<br />
- Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens<br />
- Bauten auf fremdem Grund und Boden<br />
- Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler<br />
- Masch<strong>in</strong>en und technische Anlagen, Fahrzeuge<br />
- Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />
- Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau<br />
- Anteile an verbundenen Unternehmen<br />
- Beteiligungen<br />
- Sondervermögen<br />
- Wertpapiere des Anlagevermögens<br />
- Ausleihungen<br />
Abbildung 75 „Anlagevermögen <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz“<br />
Zum geme<strong>in</strong>dlichen Anlagevermögen s<strong>in</strong>d alle Vermögensgegenstände der Geme<strong>in</strong>de zu zählen, deren Zweckbestimmung<br />
dar<strong>in</strong> besteht, dem Geschäftsbetrieb der Geme<strong>in</strong>de über mehrere Jahre zu dienen und die von der<br />
Geme<strong>in</strong>de nicht veräußert werden sollen. Der Wert e<strong>in</strong>es solchen Vermögensgegenstandes stellt dabei ke<strong>in</strong><br />
Abgrenzungskriterium für den Ansatz <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz dar. Das geme<strong>in</strong>dliche Anlagevermögen wird<br />
so gegliedert, dass die Arten und die Werte der Vermögensgegenstände offen gelegt werden.<br />
2.3 Die Bilanzierung des Umlaufvermögens<br />
Die Vermögensgegenstände der Geme<strong>in</strong>de, die zum Verbrauch oder zur Veräußerung sowie nur zur kurzfristigen<br />
Nutzung durch die Geme<strong>in</strong>de vorgesehen s<strong>in</strong>d, hat die Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> ihrer Bilanz unter dem Umlaufvermögen<br />
GEMEINDEORDNUNG 460
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 90 GO <strong>NRW</strong><br />
anzusetzen. Dabei hat sie für die Bewertung der Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens das strenge<br />
Niederstwertpr<strong>in</strong>zip anzuwenden. Unter dem Umlaufvermögen s<strong>in</strong>d ggf. auch geme<strong>in</strong>dliche Vermögensgegenstände,<br />
die sonst dem Anlagevermögen zuzuordnen s<strong>in</strong>d, anzusetzen, wenn diese nicht mehr dem Geschäftsbetrieb<br />
der Geme<strong>in</strong>de dienen und von ihr konkret zur Veräußerung vorgesehen s<strong>in</strong>d. Die geme<strong>in</strong>dlichen Grundstücke,<br />
die nur zum Zwecke der Veräußerung von der Geme<strong>in</strong>de gehalten werden, s<strong>in</strong>d ebenfalls dem Umlaufvermögen<br />
zuzuordnen, auch wenn sie auf Grund ihrer Eigenart i.d.R. dem Anlagevermögen zuzuordnen. Zu den<br />
Bilanzposten des Umlaufvermögens gehören die Folgenden (vgl. Abbildung).<br />
Umlaufvermögen <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz<br />
Bilanzbereich Bilanzposten<br />
Vorräte<br />
Forderungen und<br />
sonstige Vermögensgegenstände,<br />
Privatrechtliche Forderungen<br />
Sonstige Vermögensgegenstände<br />
Wertpapiere des Umlaufvermögens<br />
Liquide Mittel<br />
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren,<br />
- Geleistete Anzahlungen,<br />
- Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen<br />
aus Transferleistungen,<br />
- Gebühren,<br />
- Beiträge,<br />
- Steuern,<br />
- Forderungen aus Transferleistungen,<br />
- Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen,<br />
- gegenüber dem privaten Bereich,<br />
- gegenüber dem öffentlichen Bereich,<br />
- gegen verbundene Unternehmen,<br />
- gegen Beteiligungen,<br />
- gegen Sondervermögen,<br />
(Untergliederung nach örtlichem Bedarf)<br />
(Untergliederung nach örtlichem Bedarf)<br />
(Untergliederung nach örtlichem Bedarf)<br />
Abbildung 76 „Umlaufvermögen <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz“<br />
3. Die Grundsätze ordnungsmäßiger F<strong>in</strong>anzplanung (GOF)<br />
Die Geme<strong>in</strong>de nimmt im Rahmen der Verwaltung des geme<strong>in</strong>dlichen Vermögens, <strong>in</strong>sbesondere bei der Verwaltung<br />
des geme<strong>in</strong>dlichen Kapitals, z.B. bei Geldanlagen, vielfach Beratungsleistungen Dritter <strong>in</strong> Anspruch. In diesem<br />
Zusammenhang s<strong>in</strong>d nicht nur die e<strong>in</strong>schlägigen haushaltsrechtlichen Vorschriften zu beachten, z.B. § 90<br />
Abs. 2 Satz 2 GO <strong>NRW</strong>, nach dem bei Geldanlagen auf e<strong>in</strong>e ausreichende Sicherheit zu achten ist und diese<br />
e<strong>in</strong>en angemessenen Ertrag erbr<strong>in</strong>gen sollen.<br />
Zu den Vorschriften ist auch der § 89 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> zu zählen, nach dem zur angemessenen Liquiditätsplanung<br />
gehört, dass die angelegten Mittel für ihren Zweck auch rechtzeitig verfügbar se<strong>in</strong> müssen. Aber auch die<br />
Grundsätze bzw. Qualitätsstandards, die seitens der F<strong>in</strong>anzplaner bestehen und zu beachten s<strong>in</strong>d wichtig im<br />
Rahmen der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft. Die Grundsätze ordnungsmäßiger F<strong>in</strong>anzplanung stellen dabei<br />
ke<strong>in</strong>e Vorschriften, sondern Empfehlungen dar, die als Hilfe dienen sollen. Sie wurden von der Deutschen Gesellschaft<br />
für F<strong>in</strong>anzplanung e.V. entwickelt und werden vom Deutschen Verband F<strong>in</strong>ancial Planner e.V. (DEVFP)<br />
mitgetragen (vgl. Abbildung).<br />
GEMEINDEORDNUNG 461
Grundsatz der<br />
Vollständigkeit<br />
Grundsatz der<br />
Vernetzung<br />
Grundsatz der<br />
Individualität<br />
Grundsatz der<br />
Richtigkeit<br />
Grundsatz der<br />
Verständlichkeit<br />
Grundsatz der<br />
Dokumentationspflicht<br />
E<strong>in</strong>haltung<br />
der Berufsgrundsätze<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 90 GO <strong>NRW</strong><br />
Grundsätze ordnungsmäßiger F<strong>in</strong>anzplanung (GOF)<br />
Nach diesem Grundsatz s<strong>in</strong>d die relevanten Kundendaten zu erfassen<br />
und zu analysieren. Dazu zählen Vermögenswerte und Schulden,<br />
die E<strong>in</strong>nahmen und Ausgaben sowie die persönlichen Ziele<br />
(Zielsystem).<br />
Nach diesem Grundsatz s<strong>in</strong>d alle Wirkungen und Wechselwirkungen<br />
der Vermögenswerte und Schulden, der E<strong>in</strong>nahmen und Ausgaben<br />
unter Beachtung der rechtlichen, persönlichen, steuerlichen<br />
und volkswirtschaftlichen Faktoren zu berücksichtigen.<br />
Nach diesem Grundsatz ist der e<strong>in</strong>zelne Kunde mit se<strong>in</strong>em persönlichen<br />
Umfeld, se<strong>in</strong>en Zielen und Bedürfnissen <strong>in</strong> den Mittelpunkt<br />
der F<strong>in</strong>anzplanung zu stellen. Dabei s<strong>in</strong>d Verallgeme<strong>in</strong>erungen zu<br />
vermeiden.<br />
Nach diesem Grundsatz ist die F<strong>in</strong>anzplanung nach dem jeweiligen<br />
aktuellen Gesetzgebungsstand und im Grundsatz fehlerfrei durchzuführen.<br />
Die Planungen müssen plausibel se<strong>in</strong> und den allgeme<strong>in</strong><br />
anerkannten Verfahren der Planungsrechnung entsprechen.<br />
Nach diesem Grundsatz muss die F<strong>in</strong>anzplanung e<strong>in</strong>schließlich<br />
ihrer Ergebnisse so präsentiert werden, dass der Kunde sie versteht<br />
und nachvollziehen kann sowie se<strong>in</strong>e im Rahmen des Auftrags<br />
gestellten Fragen beantwortet erhält.<br />
Nach diesem Grundsatz ist der F<strong>in</strong>anzplan e<strong>in</strong>schließlich der Prämissen<br />
und Ergebnisse schriftlich oder <strong>in</strong> digitaler Form zu dokumentieren<br />
und dem Kunden zur Verfügung zu stellen.<br />
Nach diesem Grundsatz hat e<strong>in</strong> F<strong>in</strong>anzplaner die für ihn geltenden<br />
Berufsgrundsätze, z.B. Integrität, Vertraulichkeit, Objektivität, Neutralität,<br />
Kompetenz und Professionalität, zu beachten.<br />
Abbildung 77 „Grundsätze ordnungsmäßiger F<strong>in</strong>anzplanung (GOF)“<br />
Im Rahmen der Erarbeitung des kundenbezogenen umfassenden F<strong>in</strong>anzplans und der Handlungsempfehlungen<br />
sollen die Ergebnisse auf vorzunehmenden Analysen und ggf. fortgeschriebener Ist- und Planwerte beruhen.<br />
Dabei bedarf es auch e<strong>in</strong>er qualitativen Beurteilung aktiver und passiver Beteiligungen e<strong>in</strong>schließlich e<strong>in</strong>es Liquiditätsstatus.<br />
4. Schriftform bei der Abgabe von Erklärungen<br />
Der Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist oder wird,<br />
durch die Geme<strong>in</strong>de, die Geldanlage, die Veräußerung von Vermögensgegenständen, die von der Geme<strong>in</strong>de zur<br />
Erfüllung ihrer Aufgaben <strong>in</strong> absehbarer Zeit nicht benötigt werden, sowie die Überlassung der Nutzung e<strong>in</strong>es<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Vermögensgegenstandes an e<strong>in</strong>en Dritten be<strong>in</strong>halten geme<strong>in</strong>dliche Verpflichtungserklärungen und<br />
bedürfen daher der Schriftform (vgl. § 64 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>). Mit dieser gesetzlichen Vorgabe wird der Zweck verfolgt,<br />
die Geme<strong>in</strong>de vor übereilten Erklärungen zu schützen.<br />
Die Geme<strong>in</strong>de soll sich außerdem Klarheit über den Inhalt der neuen Verpflichtung verschaffen und die <strong>in</strong>terne<br />
Entscheidungszuständigkeit klären. Die geme<strong>in</strong>dlichen Erklärungen, durch welche die Geme<strong>in</strong>de verpflichtet<br />
GEMEINDEORDNUNG 462
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 90 GO <strong>NRW</strong><br />
werden soll, s<strong>in</strong>d zudem i.d.R. vom Bürgermeister oder dem allgeme<strong>in</strong>en Vertreter und e<strong>in</strong>em vertretungsberechtigten<br />
Bediensteten zu unterzeichnen, soweit es sich nicht um e<strong>in</strong> Geschäft der laufenden Verwaltung handelt.<br />
Dabei ist zu beachten, dass Erklärungen der Geme<strong>in</strong>de, die nicht den Formvorschriften der Geme<strong>in</strong>deordnung<br />
entsprechen, nicht die Geme<strong>in</strong>de b<strong>in</strong>den.<br />
II. Erläuterungen im E<strong>in</strong>zelnen<br />
1. Zu Absatz 1 (Erwerb von Vermögensgegenständen):<br />
1.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die Geme<strong>in</strong>de soll Vermögensgegenstände nur erwerben, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist<br />
oder wird. Die Geme<strong>in</strong>de ist grundsätzlich <strong>in</strong> ihrer Entscheidung frei, ob und welche Vermögensgegenstände<br />
erworben werden. Dieses Recht wird jedoch durch den Gesichtspunkt der Aufgabenerfüllung begrenzt. Die Geme<strong>in</strong>de<br />
soll daher ke<strong>in</strong> Vermögen erwerben, um ihren Bestand zu vergrößern und Erträge zu erzielen oder um<br />
Gew<strong>in</strong>ne bei e<strong>in</strong>er Veräußerung von Vermögen zu erzielen. Bei e<strong>in</strong>em Vermögenserwerb der Geme<strong>in</strong>de muss<br />
deshalb stets e<strong>in</strong> konkreter Zusammenhang mit der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgabenerfüllung bestehen. Erhält die Geme<strong>in</strong>de<br />
Schenkungen, kann dagegen e<strong>in</strong> großzügiger Maßstab angelegt werden.<br />
In diesen Fällen dürfen zudem nicht die möglichen Folgelasten nicht außer Acht gelassen werden. Daher muss<br />
bei e<strong>in</strong>em Erwerb von Vermögensgegenständen auch die Frage beantwortet werden, ob der Besitz des Vermögensgegenstandes<br />
es wert ist, dass ggf. h<strong>in</strong>genommen wird, wenn die künftigen Aufwendungen die möglichen<br />
Erträge aus dem Besitz übersteigen. Die Regelungen über den Vermögenserwerb s<strong>in</strong>d als Soll-Vorschrift ausgestaltet.<br />
Abweichungen von dieser Vorschrift s<strong>in</strong>d daher möglich, wenn gewichtige Umstände vorliegen, die e<strong>in</strong><br />
Abweichen rechtfertigen. Unerheblich ist, ob der Erwerb entgeltlich oder unentgeltlich erfolgt. Bei der Entscheidung<br />
über e<strong>in</strong>en Vermögenserwerb s<strong>in</strong>d auch auf die möglichen Folgelasten zu berücksichtigen.<br />
1.2 Der Vermögenserwerb durch Tauschgeschäfte<br />
Die Geme<strong>in</strong>de kann Vermögensgegenstände auch durch Tauschgeschäfte erwerben. Sie muss vor der Abwicklung<br />
solcher Geschäfte prüfen, ob ihr neuer Vermögensgegenstand auch zur Erfüllung der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgaben<br />
erforderlich ist oder wird. Auch darf sie den nicht mehr benötigten Vermögensgegenstand i.d.R. nur zu se<strong>in</strong>em<br />
vollen Wert abgeben (vgl. § 90 Abs. 3 S. 2 GO <strong>NRW</strong>). Bei Tauschgeschäften kann der Buchwert des im<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Eigentum bef<strong>in</strong>dlichen und abzugebenden Vermögensgegenstandes e<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>stieg <strong>in</strong> die Wertermittlung<br />
bieten. Der Buchwert dürfte dabei e<strong>in</strong>e Wertuntergrenze für den ohne Zahlungen zu erwerbenden<br />
Vermögensgegenstand darstellen. Gleichwohl ist der volle Zeitwert des abzugebenden sowie des zu erwerbenden<br />
Vermögensgegenstandes zu erwerbszeitpunkt ermitteln, um die notwendige Gleichwertigkeit des abzuschließenden<br />
Tauschgeschäftes beurteilen zu können.<br />
1.3 Der Ansatz der geme<strong>in</strong>dlichen Vermögensgegenstände<br />
1.3.1 Die Bilanz als Vermögensrechnung<br />
Die Bilanz der Geme<strong>in</strong>de ist als Gegenüberstellung von geme<strong>in</strong>dlichem Vermögen (Aktivseite) und den F<strong>in</strong>anzierungsmitteln<br />
(Passivseite) e<strong>in</strong>e auf den jährlichen Abschlussstichtag bezogene Zeitpunktrechnung und e<strong>in</strong> wesentlicher<br />
Bestandteil des doppischen Rechnungswesens im NKF. Sie müssen daher e<strong>in</strong>heitlich gegliedert se<strong>in</strong>.<br />
Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen der Geme<strong>in</strong>de mit den zum Abschlussstichtag ermittelten Werten<br />
angesetzt (Aktivierung). Damit wird die Mittelverwendung der Geme<strong>in</strong>de dokumentiert. Auf der Passivseite<br />
GEMEINDEORDNUNG 463
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 90 GO <strong>NRW</strong><br />
der Bilanz werden die Verb<strong>in</strong>dlichkeiten der Geme<strong>in</strong>de und ihr Eigenkapital gezeigt (Passivierung). Dadurch wird<br />
die Mittelherkunft bzw. die F<strong>in</strong>anzierung des Vermögens offengelegt und dokumentiert. Die Gliederung der Bilanz<br />
erfolgt sowohl auf der Aktivseite als auch auf der Passivseite nach Fristigkeiten.<br />
1.3.2 Der Vermögensausweis <strong>in</strong> der Bilanz<br />
Die Vorschrift des § 33 GemHVO <strong>NRW</strong> enthält den allgeme<strong>in</strong>en Grundsatz, dass die Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>en Vermögensgegenstand<br />
<strong>in</strong> die Bilanz aufzunehmen hat, wenn sie das wirtschaftliche Eigentum daran <strong>in</strong>nehat und dieser<br />
selbstständig verwertbar ist. Ob e<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>dlicher Vermögensgegenstand dem Anlagevermögen oder dem Umlaufvermögen<br />
zuzuordnen ist, hängt neben den <strong>in</strong> Satz 1 verwendeten Begriffen „Vermögensgegenstand“, „wirtschaftliches<br />
Eigentum“ und „selbstständige Verwertbarkeit“ auch von der Zweckbestimmung bzw. Art des Vermögensgegenstandes<br />
sowie vom Willen der Geme<strong>in</strong>de ab, wie der Vermögensgegenstand im Rahmen der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Aufgabenerfüllung genutzt werden soll. Daher s<strong>in</strong>d als Anlagevermögen nur die Vermögensgegenstände<br />
<strong>in</strong> die geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz auszuweisen, die dazu bestimmt s<strong>in</strong>d, dauernd der Aufgabenerfüllung der<br />
Geme<strong>in</strong>de zu dienen (vgl. § 33 Abs. 1 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
1.3.3 Der Wertansatz von Vermögensgegenständen<br />
Bei der Frage der Bewertung von Vermögensgegenständen für den Ansatz <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz geht es<br />
darum, mit welchen Werten <strong>in</strong> Gelde<strong>in</strong>heiten diese unter den betreffenden Bilanzposten anzusetzen s<strong>in</strong>d. Für die<br />
Geme<strong>in</strong>den s<strong>in</strong>d die Anschaffungskosten zu def<strong>in</strong>ieren, die für den Wertansatz die Höchstgrenze darstellen. Die<br />
Höhe der Bewertung wirkt sich u.a. auf das Jahresergebnis aus, d.h. die im jährlichen Ergebnisplan und <strong>in</strong> der<br />
Ergebnisrechnung enthaltenen Abschreibungen werden <strong>in</strong> ihrer Höhe durch den <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz<br />
angesetzten Wert des abnutzbaren Vermögensgegenstandes und se<strong>in</strong>e Nutzungsdauer bestimmt. Bei der Bilanzierung<br />
von geme<strong>in</strong>dlichen Vermögensgegenständen ist zudem das Anschaffungskostenpr<strong>in</strong>zip zu beachten. Die<br />
Begriffe „Anschaffungskosten“ und „Herstellungskosten“ können wie nachfolgend aufgezeigt differenziert werden<br />
(vgl. Abbildung).<br />
Herstellungs-<br />
aufwand<br />
Herstellungskosten<br />
Zu aktivierender<br />
Aufwand<br />
Bilanz<br />
betroffen<br />
Anschaffungskosten und Herstellungskosten<br />
Erweiterungs-<br />
aufwand<br />
oder<br />
wesentliche<br />
Verbesserung<br />
(anschaffungsnaher<br />
Herstellungsaufwand)<br />
Ab-<br />
schrei-<br />
bung<br />
nach<br />
Nutzung<br />
Erhaltungs-<br />
aufwand<br />
(Aufwendungen<br />
für Instandhaltung,<br />
die durch die<br />
gewöhnliche<br />
Nutzung<br />
veranlasst ist)<br />
Anschaffungskosten<br />
Ger<strong>in</strong>gwertige<br />
Vermögens-<br />
gegenstände<br />
(GVG)<br />
unter 410 €<br />
Laufender Aufwand<br />
(Sofortabschreibung; ke<strong>in</strong>e Aktivierung)<br />
Ergebnisrechnung<br />
betroffen<br />
Abbildung 78 „Anschaffungskosten und Herstellungskosten“<br />
GEMEINDEORDNUNG 464<br />
Ke<strong>in</strong> GVG;<br />
Anlagevermögen<br />
Zu aktivie-<br />
render<br />
Aufwand<br />
Bilanz<br />
betroffen<br />
Ab-<br />
schrei-<br />
bung<br />
nach<br />
Nut-<br />
zung
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 90 GO <strong>NRW</strong><br />
Die geme<strong>in</strong>dlichen Anschaffungskosten s<strong>in</strong>d die Aufwendungen, die von der Geme<strong>in</strong>de geleistet werden, um<br />
e<strong>in</strong>en Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie<br />
dem Vermögensgegenstand e<strong>in</strong>zeln zugeordnet werden können. Zu den Anschaffungskosten gehören auch die<br />
Nebenkosten sowie die nachträglichen Anschaffungskosten. Von den Anschaffungskosten s<strong>in</strong>d M<strong>in</strong>derungen des<br />
Anschaffungspreises abzusetzen.<br />
Wenn die Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>en <strong>in</strong> ihrer Bilanz anzusetzenden Vermögensgegenstand selbst herstellt, s<strong>in</strong>d unter den<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Herstellungskosten die Aufwendungen zu verstehen, die durch den Verbrauch von Gütern und die<br />
Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung e<strong>in</strong>es Vermögensgegenstands, se<strong>in</strong>e Erweiterung oder für<br />
e<strong>in</strong>e über se<strong>in</strong>en ursprünglichen Zustand h<strong>in</strong>ausgehende wesentliche Verbesserung entstehen. Dazu gehören<br />
auch die notwendigen Materialkosten, die Fertigungskosten und die Sonderkosten der Fertigung. In die Herstellung<br />
dürfen die notwendigen Materialgeme<strong>in</strong>kosten und Fertigungsgeme<strong>in</strong>kosten e<strong>in</strong>bezogen werden.<br />
1.4 Die Überprüfung der tatsächlichen Verhältnisse<br />
Für die Aktivierung e<strong>in</strong>es Vermögensgegenstandes <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten,<br />
muss sich die Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong> Gesamtbild über die tatsächlichen Verhältnisse bezüglich des betreffenden<br />
Vermögensgegenstandes verschaffen. Dies kann z.B. <strong>in</strong> den Fällen erforderlich werden, wenn beim Erwerb e<strong>in</strong>es<br />
Vermögensgegenstandes noch e<strong>in</strong> Eigentumsvorbehalt besteht, bei Sicherungsgeschäften, bei der Grundstücksübertragung<br />
u.a. Gegebenheiten. Lassen sich bestehende Zweifel, ob die Geme<strong>in</strong>de als wirtschaftlicher Eigentümer<br />
e<strong>in</strong>es Vermögensgegenstandes anzusehen ist, nicht ausräumen, ist der Aktivierung beim rechtlichen Eigentümer<br />
der Vorzug zu geben. Ergänzend zur Beurteilung des wirtschaftlichen Eigentums können die Regelungen<br />
des Bilanzsteuerrechts herangezogen werden. Insbesondere bei Leas<strong>in</strong>ggeschäften und ÖPP-Modellen muss der<br />
Festlegung „der Vermögensgegenstand steht im wirtschaftlichen Eigentum der Geme<strong>in</strong>de“ e<strong>in</strong>e genaue Analyse<br />
der Vertragsgestaltung vorausgehen.<br />
2. Zu Absatz 2 (Verwaltung des geme<strong>in</strong>dlichen Vermögens):<br />
2.1 Zu Satz 1 (Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Vermögensgegenstände):<br />
Die Vermögensgegenstände s<strong>in</strong>d pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten. Sie s<strong>in</strong>d so zu verwalten, dass die<br />
Geme<strong>in</strong>def<strong>in</strong>anzen gesund bleiben (vgl. § 10 GO <strong>NRW</strong>). Ziel ist es dabei, die Vermögensgegenstände <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
funktionsfähigen Zustand zu erhalten, so dass ihr E<strong>in</strong>satz für die Aufgabenerfüllung gesichert ist. Dies bedeutet<br />
auch, e<strong>in</strong>e laufende Unterhaltung von Vermögensgegenständen <strong>in</strong> dem Umfang durchzuführen, der zur Erhaltung<br />
ihrer Funktionsfähigkeit notwendig ist. Aus den Wörtern „wirtschaftlich zu verwalten“ ist die Verpflichtung der<br />
Geme<strong>in</strong>de zu entnehmen, soweit es möglich ist, auf e<strong>in</strong>e nutzbr<strong>in</strong>gende Verwaltung zu achten, bei der auch der<br />
Aufgabenzweck zu berücksichtigen ist. Bei Geldanlagen gelten diese Überlegungen nicht, so dass für sie die<br />
Ertragserzielung vorgeschrieben ist.<br />
2.2 Zu Satz 2 (Verwaltung von Geldanlagen):<br />
2.2.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Der Rahmen der Anlage von Geldmitteln, die nicht zur Sicherung der Liquidität und zur Zahlungsabwicklung benötigt<br />
werden, wird e<strong>in</strong>erseits durch die Vorschrift des § 90 Abs. 2 Satz 2 GO <strong>NRW</strong> bestimmt. Danach gilt, dass<br />
bei Geldanlagen auf e<strong>in</strong>e ausreichende Sicherheit zu achten ist und sie e<strong>in</strong>en angemessenen Ertrag erbr<strong>in</strong>gen<br />
sollen. Sie müssen jedoch nicht mündelsicher angelegt se<strong>in</strong>. Andererseits wird der Rahmen durch die Verpflichtungen<br />
zur Sicherstellung der Liquidität (vgl. § 75 Abs. 6 GO <strong>NRW</strong>) und zur angemessenen Liquiditätsplanung<br />
GEMEINDEORDNUNG 465
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 90 GO <strong>NRW</strong><br />
(vgl. § 89 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>) bestimmt, nach denen die angelegten Mittel für ihren Zweck rechtzeitig verfügbar se<strong>in</strong><br />
müssen. Danach kommt bei der Anlage von Geldmitteln durch die Geme<strong>in</strong>de dem Gesichtspunkt der Sicherheit<br />
im Zweifel immer e<strong>in</strong> Vorrang vor e<strong>in</strong>em erzielbaren höheren Ertrag zu.<br />
Im Zusammenhang mit F<strong>in</strong>anzanlagen können von der Geme<strong>in</strong>de auch F<strong>in</strong>anzgeschäfte zur Begrenzung von<br />
Z<strong>in</strong>ssenkungen abgeschlossen werden (Floors). Diese Geschäfte kommen i.d.R. <strong>in</strong> Betracht, wenn die Verz<strong>in</strong>sung<br />
von F<strong>in</strong>anzanlagen nicht unter e<strong>in</strong> bestimmtes Niveau s<strong>in</strong>ken soll. Auch ist bei F<strong>in</strong>anzanlagen e<strong>in</strong>e Komb<strong>in</strong>ation<br />
von Floors und Caps möglich. Die Anlage von Geldmitteln erfordert zudem die „Kontrolle“ der Tätigkeit<br />
beauftragter Dritter, d.h. die E<strong>in</strong>holung von „begleitenden Informationen“ über die Anlageformen, Qualität der<br />
Anlagen und zeitlichen Festlegungen. Es ist nicht ausreichend, diese Kontrolle nur e<strong>in</strong>mal jährlich vorzunehmen.<br />
2.2.2 Geldanlagen nach besonderen Anlagegrundsätzen<br />
2.2.2.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die hervorgehobene Bedeutung der Sicherheit bei der Geldanlage lässt aber auch zu, dass e<strong>in</strong>e Geme<strong>in</strong>de im<br />
E<strong>in</strong>zelfall auch Teile davon nach besonderen Anlagegrundsätzen anlegt. Um möglichst e<strong>in</strong>em spekulativen Charakter<br />
vorzubeugen, kommen solche besonderen Anlagegrundsätze nur bei langfristig anzulegenden Geldmitteln<br />
der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> Betracht. Kurzfristig benötigte Geldmittel zur Zahlungsabwicklung s<strong>in</strong>d dafür grundsätzlich ungeeignet.<br />
Ob und welche darüber h<strong>in</strong>ausgehenden Geldmittel für e<strong>in</strong>e mittel- und langfristige Geldanlage <strong>in</strong> Betracht<br />
kommen, kann nur im E<strong>in</strong>zelfall und <strong>in</strong> eigener Verantwortung der Geme<strong>in</strong>de entschieden werden. Maßgeblich<br />
dafür ist e<strong>in</strong>e vorausschauende Gesamtschau im Rahmen der Liquiditätsplanung und der sich abzeichnenden<br />
Entwicklung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de.<br />
Auf dieser Grundlage wird es vertretbar angesehen, dass nicht benötigte Geldmittel bei e<strong>in</strong>er Verz<strong>in</strong>sung zu<br />
marktüblichen Konditionen nach Maßgabe des § 54 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über die Beaufsichtigung der<br />
Versicherungsunternehmen <strong>in</strong> der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 1992 (BGBl. I 1993 S. 2), <strong>in</strong><br />
der derzeit geltenden Fassung, unter Berücksichtigung der „Verordnung über die Anlage des gebundenen Vermögens<br />
von Versicherungsunternehmen (Anlageverordnung – AnlV)“ vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3913)<br />
und des Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften (KAGG) <strong>in</strong> der Fassung der Bekanntmachung vom 9. September<br />
1998 (BGBl. I S. 2726), <strong>in</strong> der derzeit geltenden Fassung, sowie des Investmentgesetzes (InvG) vom<br />
15.12.2003 (BGBl. I S. 2676), <strong>in</strong> Spezialfonds angelegt werden. Nach § 2 Abs. 3 InvG s<strong>in</strong>d Spezialfonds die Spezial-Sondervermögen,<br />
deren Anteile auf Grund schriftlicher Vere<strong>in</strong>barungen mit e<strong>in</strong>er Kapitalanlagegesellschaft<br />
jeweils von nicht mehr als 30 Anlegern, die nicht natürliche Personen s<strong>in</strong>d, gehalten werden. Die Geldanlage der<br />
Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> Publikumsfonds ist somit nicht zulässig.<br />
2.2.2.2 Die Pflichten der Geme<strong>in</strong>de<br />
Nach Maßgabe des § 90 GO <strong>NRW</strong> ist bei der Anlage von Geldmitteln der Geme<strong>in</strong>de darauf zu achten, dass zur<br />
Werterhaltung des angelegten Geldes das Portfolio des Spezialfonds überwiegend Schuldverschreibungen öffentlicher<br />
Emittenten <strong>in</strong> Euro enthält und der Spezialfonds ke<strong>in</strong>e Fremdwährungsanleihen enthalten soll. Bei der<br />
Anlage <strong>in</strong> Aktien und anderen Risikopapieren (Anlagen gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1 <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit § 1 Abs. 1 Nr.<br />
9, 10, 12 und 13 1. Halbsatz Buchstabe a) der Anlageverordnung) im Rahmen von Spezialfonds ist das besondere<br />
Ertrags-Risiko-Profil dieser Anlageformen zu beachten. Der Anteil dieser <strong>in</strong> Spezialfonds angelegten Mittel darf<br />
35 % des Wertes des Sondervermögens nicht überschreiten. Die Entscheidung für diese Anlageformen ist mit<br />
den örtlichen Bedürfnissen <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang zu br<strong>in</strong>gen.<br />
Zur Vorbereitung der Entscheidung über die Anlage von Geldmitteln <strong>in</strong> Spezialfonds s<strong>in</strong>d unter Berücksichtigung<br />
der örtlichen Bedürfnisse Anlageziele bzw. Schwerpunkte und Kriterien für die Auswahl der Kapitalanlagegesell-<br />
GEMEINDEORDNUNG 466
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 90 GO <strong>NRW</strong><br />
schaft zu bestimmen und die notwendigen Informationen über die Qualität des Fondsmanagements der Kapitalanlagegesellschaft<br />
e<strong>in</strong>zuholen. Dieses enthält <strong>in</strong>sbesondere für die Geme<strong>in</strong>de die Verpflichtung, sich selbst<br />
Kenntnisse über Sicherheit, Risiken und die Rentabilität im Vergleich mit anderen Anlagemöglichkeiten zu verschaffen.<br />
Außerdem ist nach Maßgabe des § 90 GO darauf zu achten, dass zur Werterhaltung des angelegten<br />
Geldes das Portfolio des Spezialfonds überwiegend Schuldverschreibungen öffentlicher Emittenten <strong>in</strong> Euro enthält<br />
und der Spezialfonds ke<strong>in</strong>e Fremdwährungsanleihen enthalten soll.<br />
Bei der Anlage <strong>in</strong> Aktien und anderen Risikopapieren (Anlagen gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1 <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit § 1<br />
Abs. 1 Nr. 9, 10, 12 und 13 1. Halbsatz Buchstabe a) der Anlageverordnung) im Rahmen von Spezialfonds ist das<br />
besondere Ertrags-Risiko-Profil dieser Anlageformen zu beachten. Der Anteil dieser <strong>in</strong> Spezialfonds angelegten<br />
Mittel darf 35 % des Wertes des Sondervermögens nicht überschreiten. Die Entscheidung für diese Anlageformen<br />
ist mit den örtlichen Bedürfnissen <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang zu br<strong>in</strong>gen. In diesem Zusammenhang ist darauf h<strong>in</strong>zuweisen,<br />
dass die Möglichkeit, e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>dliche Geldanlage über den Rahmen e<strong>in</strong>es Spezialfonds <strong>in</strong> Teilen <strong>in</strong> Aktien und<br />
anderen Risikopapieren anzulegen, von der Geme<strong>in</strong>de nicht bei andere Anlageformen angewendet bzw. übertragen<br />
werden darf. So ist es nicht zulässig, verfügbares Kapital weder risikoorientiert, z.B. am Aktien<strong>in</strong>dex, anzulegen,<br />
noch der Bemessung e<strong>in</strong>er risikoorientierten Geldanlage die für Spezialfonds zulässige Größe, jedoch bezogen<br />
auf die gesamten geme<strong>in</strong>dlichen Vermögensverhältnisse zu Grunde zu legen. Dieses Verbot gilt entsprechend,<br />
wenn die Geme<strong>in</strong>de Kapital anlegen will, das geme<strong>in</strong>derechtlich e<strong>in</strong>em ihrer Sondervermögen nach § 97<br />
GO <strong>NRW</strong> zuzurechnen ist.<br />
2.2.3 Kredite und Kapitalanlage (Geldanlage)<br />
E<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>dliche Kapitalanlage entsteht i.d.R. aus der H<strong>in</strong>gabe von vorhandenen liquiden Mitteln (Geldbeträgen)<br />
der Geme<strong>in</strong>de, die <strong>in</strong> Kapital umgewandelt werden. Dieser Vorgang stellt wie die Umwandlung von vorhandenen<br />
liquiden Mitteln der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> Sachanlagen haushaltsrechtlich e<strong>in</strong>e Investition dar. Außerdem stellt die<br />
von der Geme<strong>in</strong>de erworbene Kapitalanlage bilanztechnisch e<strong>in</strong>e F<strong>in</strong>anzanlage dar, so dass <strong>in</strong> diesem Zusammenhang<br />
der Zahlungsvorgang <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzrechnung unter der Haushaltsposition „Auszahlungen<br />
für den Erwerb von F<strong>in</strong>anzanlagen“ nachzuweisen ist (vgl. § 3 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
Die Investitionen der Geme<strong>in</strong>de bewirken regelmäßig e<strong>in</strong>e dauerhafte Mehrung des geme<strong>in</strong>dlichen Vermögens,<br />
z.B. das <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz anzusetzende Anlagevermögen, zu dem auch die F<strong>in</strong>anzanlagen zu zählen<br />
s<strong>in</strong>d. Diese haushaltsrechtliche Zuordnung e<strong>in</strong>er Kapitalanlage der Geme<strong>in</strong>de könnte den Schluss zu lassen,<br />
dass dadurch auch e<strong>in</strong>e Kreditf<strong>in</strong>anzierung für e<strong>in</strong>e Kapitalanlage zulässig wäre. Die Geme<strong>in</strong>de darf nach des<br />
Vorschrift des § 86 GO <strong>NRW</strong> Kredite für Investitionen aufnehmen. Da der Erwerb e<strong>in</strong>er Kapitalanlage e<strong>in</strong>erseits<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgabenerfüllung dient und andererseits e<strong>in</strong>e Investition darstellt, könnten die Voraussetzungen<br />
für e<strong>in</strong>e Kreditaufnahme für die Kapitalanlage grundsätzlich erfüllt se<strong>in</strong>. E<strong>in</strong>er solchen Kreditaufnahme dürfen<br />
jedoch auch die Grundsätze der F<strong>in</strong>anzmittelbeschaffung nach § 77 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong> nicht entgegenstehen, denn<br />
sie ist zulässig, wenn e<strong>in</strong>e andere F<strong>in</strong>anzierung nicht möglich oder unzweckmäßig wäre. Dieses könnte im E<strong>in</strong>zelfall<br />
beim Erwerb e<strong>in</strong>er Kapitalanlage gegeben se<strong>in</strong>.<br />
In diesen Fällen wäre auch zu prüfen, ob beim Erwerb e<strong>in</strong>er Kapitalanlage mit durch e<strong>in</strong>en Kredit der Geme<strong>in</strong>de<br />
zugegangenen Geldmitteln (Fremdkapital) es zu e<strong>in</strong>er dauerhaften Vermögensmehrung bei der Geme<strong>in</strong>de<br />
kommt. Außerdem könnte bei e<strong>in</strong>er Kreditaufnahme für e<strong>in</strong>e Kapitalanlage das Spekulationsverbot <strong>in</strong> § 90 GO<br />
<strong>NRW</strong> berührt se<strong>in</strong>, wenn unterstellt werden kann, dass die Kapitalanlage vorrangig der Erzielung e<strong>in</strong>es Gew<strong>in</strong>ns<br />
aus der Differenz zwischen den Kreditkosten und dem Z<strong>in</strong>sertrag dient, und dabei auf die weitere „ungewisse“<br />
Z<strong>in</strong>sentwicklung gesetzt wird. Andererseits dient aber e<strong>in</strong>e solche Differenz erst e<strong>in</strong>mal dazu, e<strong>in</strong>e Wirtschaftlichkeit<br />
der Kapitalanlage anzunehmen.<br />
Bei der F<strong>in</strong>anzierung e<strong>in</strong>er Kapitalanlage durch Fremdkapital ist auch der künftige Verwendungszweck <strong>in</strong> die<br />
Bewertung e<strong>in</strong>zubeziehen. Im S<strong>in</strong>ne des § 86 GO <strong>NRW</strong> dürfte es nicht zulässig se<strong>in</strong>, wenn die fremdf<strong>in</strong>anzierte<br />
GEMEINDEORDNUNG 467
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 90 GO <strong>NRW</strong><br />
Kapitalanlage der Geme<strong>in</strong>de dazu dient, <strong>in</strong> künftigen Haushaltsjahren die Auszahlungen aus zahlungswirksamen<br />
Aufwendungen zu ermöglichen. Mit e<strong>in</strong>em solchen Zweck verliert der Erwerb e<strong>in</strong>er Kapitalanlage den Charakter<br />
e<strong>in</strong>er Investition und damit die Grundlage für e<strong>in</strong>e zulässige Kreditaufnahme. In diesem S<strong>in</strong>ne wäre bei e<strong>in</strong>er<br />
Fremdkapitalf<strong>in</strong>anzierung der Kapitalanlage auch der Grundsatz der <strong>in</strong>tergenerativen Gerechtigkeit tangiert (vgl. §<br />
1 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>).<br />
In diesem Zusammenhang steht auch der Runderlass über kommunale Geldanlagen vom 25.01.2005, nach dem<br />
zu beachten ist, dass e<strong>in</strong>e Kapitalanlage bzw. die Anlage von geme<strong>in</strong>dlichen Geldmitteln nur mit Geldmitteln der<br />
Geme<strong>in</strong>de zulässig ist, die nicht zur Sicherung der Liquidität und zur Zahlungsabwicklung benötigt werden. Dieser<br />
Runderlass führt de vorherigen Runderlasse fort, so dass es bereits <strong>in</strong> der Vergangenheit e<strong>in</strong>e Kapitalanlage nur<br />
dann zulässig war, wenn die Geme<strong>in</strong>de Geldmittel besaß, die sie nicht für ihren Zahlungsverkehr benötigte. Diese<br />
Voraussetzungen bed<strong>in</strong>gen, dass der Erwerb e<strong>in</strong>er Kapitalanlage, f<strong>in</strong>anziert durch die Aufnahme von Investitionskrediten<br />
nach § 86 GO <strong>NRW</strong>, dann nicht mit den haushaltsrechtlichen Grundsätzen und Vorschriften für Geme<strong>in</strong>den<br />
<strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang steht, wenn damit geme<strong>in</strong>dliche Aufwendungen f<strong>in</strong>anziert werden sollen, z.B. die künftigen Versorgungsleistungen.<br />
2.2.4 Die bankrechtliche Kundene<strong>in</strong>stufung<br />
Im Zusammenhang mit der geme<strong>in</strong>dlichen Kreditaufnahme ist das F<strong>in</strong>anzmarktrichtl<strong>in</strong>ie-Umsetzungsgesetz vom<br />
16.07.2007 (BGBl. I S. 1330), nach dem die Banken als Wertpapierdienstleistungsunternehmen künftig verpflichtet<br />
s<strong>in</strong>d, ihre Kunden anhand der gesetzlich vorgegebenen Kriterien zu klassifizieren, nicht unbeachtlich. Diese<br />
Bestimmungen haben Auswirkungen auf die Bankleistungen, bei denen das Anlegerschutzniveau und die Grundsätze<br />
für die Ausführung von Aufträgen <strong>in</strong> F<strong>in</strong>anz<strong>in</strong>strumenten zu beachten s<strong>in</strong>d.<br />
E<strong>in</strong> Wertpapierdienstleistungsunternehmen, das e<strong>in</strong>e Anlageberatung oder e<strong>in</strong>e F<strong>in</strong>anzportfolioverwaltung vornimmt,<br />
muss von se<strong>in</strong>em Kunden alle Informationen e<strong>in</strong>holen über Kenntnisse und Erfahrungen der Kunden <strong>in</strong><br />
Bezug auf Geschäfte mit F<strong>in</strong>anz<strong>in</strong>strumenten, über Anlageziele und ihre f<strong>in</strong>anziellen Verhältnisse, um dem Kunden<br />
das für ihn geeignete F<strong>in</strong>anz<strong>in</strong>strument empfehlen zu können. Dazu gehört, dass der Kunde auch die mit<br />
e<strong>in</strong>em solchen Geschäft verbundenen Anlagerisiken versteht. Erlangt das Wertpapierdienstleistungsunternehmen<br />
nicht die erforderlichen Informationen, darf es im Zusammenhang mit e<strong>in</strong>er Anlageberatung ke<strong>in</strong> F<strong>in</strong>anz<strong>in</strong>strument<br />
empfehlen oder im Zusammenhang mit e<strong>in</strong>er F<strong>in</strong>anzportfolioverwaltung ke<strong>in</strong>e Empfehlung abgeben (vgl. die<br />
E<strong>in</strong>zelvorschriften des o.a. Gesetzes).<br />
Die Bundesanstalt für F<strong>in</strong>anzdienstleistungsaufsicht hat <strong>in</strong> ihrem Schreiben vom 25.06.2010 gegenüber den Verbänden<br />
der für F<strong>in</strong>anzdienstleistungsunternehmen und der Kreditwirtschaft klargestellt, dass e<strong>in</strong>e Geme<strong>in</strong>de als<br />
Privatkunde im S<strong>in</strong>ne des § 31a Abs. 3 WpHG des Wertpapierhandelsgesetzes anzusehen ist und nicht als professioneller<br />
Kunde zu gelten hat. Das Ergebnis e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen „Privatkunden-Auftrages“ muss sich zudem<br />
am Preis und an den Kosten des F<strong>in</strong>anz<strong>in</strong>strumentes orientieren (vgl. § 33a Abs. 3 WpHG). Außerdem besteht<br />
die Pflicht e<strong>in</strong>es Wertpapierdienstleistungsunternehmens gegenüber der Geme<strong>in</strong>de, diese ggf. auch über mögliche<br />
Probleme zur Ausführung der geme<strong>in</strong>dlichen Aufträge unter Anwendung der Grundsätze der bestmöglichen<br />
Ausführung zu unterrichten. Die Geme<strong>in</strong>de hat die Möglichkeit sich auch als professioneller Kunde e<strong>in</strong>stufen zu<br />
lassen.<br />
In den Fällen der E<strong>in</strong>stufung der Geme<strong>in</strong>de als professioneller Kunde und nicht mehr als Privatkunde muss das<br />
Wertpapierdienstleistungsunternehmen die Geme<strong>in</strong>de schriftlich darauf h<strong>in</strong>weisen, dass mit der Änderung dieser<br />
E<strong>in</strong>stufung auch die Schutzvorschriften für Privatkunden nicht mehr gelten. Die Geme<strong>in</strong>de muss dazu ihr E<strong>in</strong>verständnis<br />
geben und diese Sachlage schriftlich bestätigen. Die E<strong>in</strong>stufung der Geme<strong>in</strong>de als professioneller Kunde<br />
steht e<strong>in</strong>er späteren Rückstufung zum Privatkunden gem. § 31a Abs. 6 WpHG, soweit dieses von der Geme<strong>in</strong>de<br />
verlangt wird, nicht entgegen.<br />
GEMEINDEORDNUNG 468
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 90 GO <strong>NRW</strong><br />
3. Zu Absatz 3 (Veräußerung von Vermögensgegenständen):<br />
3.1 Zu Satz 1 (Veräußerung nicht benötigter Vermögensgegenstände):<br />
3.1.1 Inhalte der Vorschrift<br />
Die Geme<strong>in</strong>de darf Vermögensgegenstände, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben <strong>in</strong> absehbarer Zeit nicht braucht,<br />
veräußern. Sie kann auch dann <strong>in</strong> Frage kommen, wenn von der Geme<strong>in</strong>de für den aufzugebenden oder e<strong>in</strong>em<br />
Dritten zu übertragenen Vermögensgegenstand e<strong>in</strong> geeigneter Ersatz beschafft wird, um die stetige Erfüllung<br />
ihrer Aufgaben zu sichern. Die Veräußerung e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Vermögensgegenstandes ist jedenfalls dann<br />
als unzulässig anzusehen, wenn der Vermögensgegenstand von der Geme<strong>in</strong>de noch zur Aufgabenerfüllung<br />
benötigt wird. E<strong>in</strong>e Verpflichtung der Geme<strong>in</strong>de zur Veräußerung e<strong>in</strong>es nicht mehr zur Aufgabenerfüllung benötigten<br />
Vermögensgegenstandes wird durch die Vorschrift jedoch nicht ausgesprochen.<br />
In diesem Zusammenhang umfasst der haushaltsrechtliche Begriff „Veräußerung“ die rechtsgeschäftliche Verfügung<br />
der Geme<strong>in</strong>de über e<strong>in</strong>en geme<strong>in</strong>dlichen Vermögensgegenstand mit dem Ziele der Rechtsübertragung an<br />
e<strong>in</strong>en Dritten. Die Befugnis zur Veräußerung liegt dabei bei der Geme<strong>in</strong>de als rechtlicher Eigentümer des betreffenden<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Vermögensgegenstandes. Für die geme<strong>in</strong>dliche Veräußerung ist im S<strong>in</strong>ne der Vorschrift<br />
der Charakter des der Veräußerung zu Grunde liegenden Rechtsgeschäftes (Kaufvertrag, Tausch, Schenkung)<br />
unerheblich.<br />
3.1.2 Besondere Veräußerungsgeschäfte<br />
3.1.2.1 Geme<strong>in</strong>devermögen mit besonderem Wert<br />
Bei e<strong>in</strong>er Veräußerung von Geme<strong>in</strong>devermögen mit besonderem Wert für die Allgeme<strong>in</strong>heit, z.B. geschichtliche<br />
Dokumente oder Kunstgegenstände, muss die Geme<strong>in</strong>de nicht nur die Sicherung ihrer stetigen Aufgabenerfüllung<br />
berücksichtigen. Sie hat <strong>in</strong> ihre Entscheidung über e<strong>in</strong>e Veräußerung derartiger geme<strong>in</strong>dlicher Vermögensgegenstände<br />
auch weitergehende Belange der örtlichen Geme<strong>in</strong>schaft, z.B. die Kultur<strong>in</strong>teressen der Bürger und<br />
E<strong>in</strong>wohner e<strong>in</strong>zubeziehen.<br />
3.1.2.2 Vermögensveräußerungen und Vergabe<br />
In den Fällen der Veräußerung e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Grundstückes ist von der Geme<strong>in</strong>de zu prüfen, ob der Veräußerung<br />
e<strong>in</strong>e öffentliche Ausschreibung, ggf. europaweit, vorausgehen muss. Regelmäßig besteht bei der Veräußerung<br />
e<strong>in</strong>es Grundstückes ke<strong>in</strong>e Pflicht der Geme<strong>in</strong>de zur öffentlichen Ausschreibung, auch dann nicht, wenn<br />
baurechtliche Vorgaben, z.B. aus der örtlichen Bauleitplanung, heraus bestehen. Geme<strong>in</strong>dliche Bauaufträge s<strong>in</strong>d<br />
aber dann als ausschreibungspflichtige Verträge anzusehen, wenn die Geme<strong>in</strong>de sich dadurch e<strong>in</strong>e ihr unmittelbar<br />
wirtschaftlich zugute kommende Bauleistung durch Dritte gemäß der von ihr als Auftraggeber genannten<br />
Erfordernissen beschafft (vgl. § 99 Abs. 3 GWB).<br />
E<strong>in</strong> solcher Fall kann vorliegen, wenn aus der Bauplanung der Geme<strong>in</strong>de heraus e<strong>in</strong>e Grundstücksveräußerung<br />
mit e<strong>in</strong>em Bauauftrag für den Erwerber verbunden wird, dafür Term<strong>in</strong>vorgaben für die Fertigstellung des Objektes<br />
gemacht werden, das Projekt e<strong>in</strong>e bestimmte Wertgrenze überschreitet und <strong>in</strong> das Eigentum der Geme<strong>in</strong>de übergeht.<br />
Unter Beachtung der e<strong>in</strong>schlägigen Schwellenwerte kann dafür dann ggf. auch e<strong>in</strong>e europaweite Ausschreibung<br />
vorzunehmen se<strong>in</strong>.<br />
GEMEINDEORDNUNG 469
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 90 GO <strong>NRW</strong><br />
3.2 Zu Satz 2 (Veräußerung werthaltiger Vermögensgegenstände):<br />
3.2.1 Die Veräußerung zum vollen Wert<br />
Die Geme<strong>in</strong>de darf ihre Vermögensgegenstände <strong>in</strong> der Regel nur zu ihrem vollen Wert veräußern. Unter diesem<br />
Begriff ist der Wert zu verstehen, der sich bei der Veräußerung unter voller Ausnutzung aller Möglichkeiten am<br />
Markt erzielen lässt. Nach der Vorschrift ist e<strong>in</strong>e unentgeltliche Veräußerung e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Vermögensgegenstandes<br />
nicht zulässig. Daher darf auch e<strong>in</strong>e Subventionierung (Preisnachlass) nicht dazu führen, dass unter<br />
Umständen e<strong>in</strong>e unentgeltliche Veräußerung entsteht. Im Rahmen und zum Zweck der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgabenerfüllung<br />
kann <strong>in</strong> Ausnahmefällen durchaus e<strong>in</strong>e Subventionierung <strong>in</strong> Form e<strong>in</strong>es niedrigeren Preises zulässig<br />
se<strong>in</strong>.<br />
An die Notwendigkeit e<strong>in</strong>er solchen Subventionierung muss allerd<strong>in</strong>gs e<strong>in</strong> strenger Maßstab angelegt werden. Die<br />
Unterschreitung des vollen Wertes e<strong>in</strong>es Vermögensgegenstandes im Rahmen e<strong>in</strong>er Veräußerung ist denkbar<br />
mit dem Ziel der Förderung des Wohnungsbaues, der Wirtschaftförderung, der Förderung privater Träger im<br />
Sozialbereich u.a. In diesen Fällen sollte aus Gründen der Klarheit spätestens im Jahresabschluss der Geme<strong>in</strong>de<br />
nicht nur der erzielte Veräußerungserlös ausgewiesen, sondern ergänzend dazu auch die gewährte Subventionierung<br />
offengelegt werden. Dies vor allem dann, wenn die Subventionierung dazu führt, dass der erzielte Veräußerungserlös<br />
unterhalb des bilanzierten Ansatzes (Buchwert) liegt und deshalb für die Geme<strong>in</strong>de aus dem Veräußerungsgeschäft<br />
e<strong>in</strong> Verlust entsteht, der zu ergebniswirksamen Aufwendungen führt.<br />
3.2.2 Die Veräußerung als „Sale and lease back“-Geschäft<br />
E<strong>in</strong>e besondere Form der Veräußerung stellen „Sale and lease back“-Geschäfte dar. Durch solche Geschäfte der<br />
Geme<strong>in</strong>de soll e<strong>in</strong> <strong>in</strong> ihrem Eigentum bef<strong>in</strong>dliches Objekt an e<strong>in</strong>e Leas<strong>in</strong>ggesellschaft mit dem Zweck veräußert<br />
werden, dieses im Rahmen e<strong>in</strong>es Leas<strong>in</strong>gvertrages wieder zurück zu mieten. Derartige Verträge s<strong>in</strong>d unter haushaltsrechtlichen<br />
und haushaltswirtschaftlichen Gesichtspunkten zu beurteilen. Sie können zulässig se<strong>in</strong>, wenn im<br />
Rahmen dieser Vorschrift die Nutzung des Vermögensgegenstandes zur Aufgabenerledigung der Geme<strong>in</strong>de<br />
langfristig gesichert ist und die Aufgabenerledigung dadurch wirtschaftlicher wird.<br />
Die stetige Aufgabenerledigung der Geme<strong>in</strong>de ist <strong>in</strong> der Regel dann gesichert, wenn das „Sale and lease back“-<br />
Geschäft zur Werterhaltung bzw. Wertsteigerung des Objekts bestimmt ist und der Geme<strong>in</strong>de daran zur Aufgabenerfüllung<br />
e<strong>in</strong> langfristiges Nutzungsrecht sowie e<strong>in</strong>e Rückkaufoption e<strong>in</strong>geräumt wird. Es liegt <strong>in</strong> der Hand der<br />
Geme<strong>in</strong>den, im Rahmen e<strong>in</strong>er geordneten Haushalts- und Wirtschaftsführung über solche Geschäfte zu entscheiden.<br />
Derartige Geschäfte s<strong>in</strong>d jedoch unzulässig, wenn sie der Beschaffung von F<strong>in</strong>anzmittel dienen.<br />
3.2.3 Bilanzielle Wirkungen der Veräußerung<br />
Neben der Anschaffung oder Herstellung e<strong>in</strong>es Vermögensgegenstandes werden vielfach nicht mehr von der<br />
Geme<strong>in</strong>de benötigte Vermögensgegenstände veräußert. Auch hier gilt, dass die Geme<strong>in</strong>de sich e<strong>in</strong> Gesamtbild<br />
über die tatsächlichen Verhältnisse e<strong>in</strong>schließlich des Zeitpunktes des Abgangs des betreffenden Vermögensgegenstandes<br />
verschaffen muss, bevor sie diesen Vermögensgegenstand nicht mehr bilanziert. Zu diesem geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Vorgang gehört nicht nur, den erzielten Veräußerungserlös für den Vermögensgegenstand zu vere<strong>in</strong>nahmen<br />
und entsprechend den Ausweis der liquiden Mittel zu erhöhen, sondern auch zu prüfen, ob ggf. e<strong>in</strong><br />
(für den Vermögensgegenstand) gebildeter Sonderposten aufzulösen ist. Außerdem s<strong>in</strong>d die notwendigen Buchungen<br />
vorzunehmen, damit der Jahresabschluss u.a. mit der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz und dem Anlagenspiegel,<br />
e<strong>in</strong> zutreffendes Bild der wirtschaftlichen Lage der Geme<strong>in</strong>de vermitteln.<br />
GEMEINDEORDNUNG 470
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 90 GO <strong>NRW</strong><br />
4. Zu Absatz 4 (Überlassung von Vermögensgegenständen zur Nutzung):<br />
4.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Für die Überlassung der Nutzung e<strong>in</strong>es Vermögensgegenstandes gilt der Absatz 3 s<strong>in</strong>ngemäß. Damit werden alle<br />
Arten der Nutzungsüberlassung erfasst, die von der Geme<strong>in</strong>de durch Dritte zugelassen werden. Die s<strong>in</strong>ngemäße<br />
Anwendung des Absatzes 3 bedeutet, dass die Nutzungsüberlassung regelmäßig entgeltlich se<strong>in</strong> muss. Als voller<br />
Wert gilt dabei, dass erzielbare marktübliche Entgelt. Da aber auch hier bei Vorliegen besonderer Gründe Ausnahmen<br />
zulässig s<strong>in</strong>d, kann ggf. auch e<strong>in</strong>e unentgeltliche Überlassung möglich se<strong>in</strong>. Bei der Nutzungsüberlassung<br />
von Vermögensgegenständen an Dritte s<strong>in</strong>d gleichzeitig auch die bilanziellen Wirkungen zu prüfen. Dabei<br />
ist der allgeme<strong>in</strong>e Grundsatz, dass die Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>en Vermögensgegenstand <strong>in</strong> die Bilanz aufzunehmen hat,<br />
wenn sie das wirtschaftliche Eigentum daran <strong>in</strong>nehat und dieser selbstständig verwertbar ist, zu beachten.<br />
4.2 Der Nießbrauch<br />
Nach der Vorschrift muss die Geme<strong>in</strong>de auch bei der Überlassung der Nutzung e<strong>in</strong>es Vermögensgegenstandes<br />
an e<strong>in</strong>en Dritten beachten, dass sie ihren Vermögensgegenstand dem Dritten nur zum Nießbrauch Dritten überlassen<br />
darf, wenn sie diesen Vermögensgegenstand <strong>in</strong> absehbarer Zeit nicht zur Erfüllung ihrer Aufgaben<br />
braucht. Außerdem darf die Geme<strong>in</strong>de auch nicht zur kostenlosen Nutzung e<strong>in</strong>em Dritten überlassen. Die Geme<strong>in</strong>de<br />
bleibt <strong>in</strong> Fällen des Nießbrauchs an e<strong>in</strong>em geme<strong>in</strong>dlichen Vermögensgegenstand i.d.R. der wirtschaftliche<br />
Eigentümer, so dass dieser Vermögensgegenstand weiterh<strong>in</strong> <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz anzusetzen ist.<br />
In Ausnahmefällen kann der Nießbraucher gleichwohl der wirtschaftliche Eigentümer se<strong>in</strong>, wenn er z.B. über<br />
se<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>geräumte Nutzungsbefugnis h<strong>in</strong>aus, die tatsächliche Herrschaft über den geme<strong>in</strong>dlichen Vermögensgegenstand<br />
ausübt, ihm z.B. die Verwertungsbefugnis e<strong>in</strong>geräumt wurde. Hat der Nießbraucher aber nicht das<br />
Recht nach Belieben mit dem geme<strong>in</strong>dlichen Vermögensgegenstand zu verfahren, trägt er auch nicht das wirtschaftliche<br />
Risiko e<strong>in</strong>er Wertm<strong>in</strong>derung oder kann aus möglichen Wertsteigerungen e<strong>in</strong>en Nutzen ziehen. Die<br />
Geme<strong>in</strong>de hat daher im Falle e<strong>in</strong>es Nießbrauchs vor der Bilanzierung e<strong>in</strong>es abgegeben geme<strong>in</strong>dlichen Vermögensgegenstandes<br />
die vorliegenden Umstände genau zu prüfen, ob sie nach der Nutzungsüberlassung weiterh<strong>in</strong><br />
noch der wirtschaftliche Eigentümer dieses Vermögensgegenstandes ist.<br />
4.3 Die Übernahme fremder Vermögensgegenstände<br />
Die Geme<strong>in</strong>de hat vielfach fremde Vermögensgegenstände im Besitz, die ihr wegen ihrer Ansprüche gegen diese<br />
Dritte als Sicherung übereignet worden s<strong>in</strong>d. Nach den e<strong>in</strong>schlägigen Vorschriften können auf Grund der Bestellung<br />
e<strong>in</strong>es Pfandrechts oder auf andere Art und Weise fremde Vermögensgegenstände belastet oder <strong>in</strong> Sicherungsverwahrung<br />
genommen werden, um e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>dliche Forderung zu sichern. Bei dem der Geme<strong>in</strong>de vorhandenen<br />
Pfandgut bleibt der Pfandgeber bis zur Verwertung der Eigentümer der Vermögensgegenstände. Der<br />
Pfandgeber kann <strong>in</strong> solchen Fällen i.d.R. davon ausgehen, dass er bei Erfüllung der geme<strong>in</strong>dlichen Ansprüche<br />
se<strong>in</strong> Pfandgut wieder zurück erhält. In diesen Fällen besteht daher ke<strong>in</strong> Ause<strong>in</strong>anderfallen von rechtlichem und<br />
wirtschaftlichem Eigentum, so dass das Pfandgut dem Pfandgeber zuzurechnen und nicht <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Bilanz anzusetzen ist. In diesen Fällen hat die Geme<strong>in</strong>de lediglich ihre gesicherte Forderung <strong>in</strong> ihrer Bilanz anzusetzen.<br />
GEMEINDEORDNUNG 471
5. Zu Absatz 5 (Verwaltung von Geme<strong>in</strong>dewald):<br />
5.1 Zwecke der Vorschrift<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 90 GO <strong>NRW</strong><br />
Mit dieser Vorschrift ist für die Verwaltung des Geme<strong>in</strong>dewaldes ausdrücklich e<strong>in</strong>e Sonderregelung erlassen<br />
worden, nach der für die Verwaltung und Bewirtschaftung von Geme<strong>in</strong>dewaldungen die Vorschriften dieses Gesetzes<br />
und des Landesforstgesetzes gelten. Damit wird <strong>in</strong> den geme<strong>in</strong>derechtlichen Vorschriften ausdrücklich<br />
verdeutlich, dass auch für die Geme<strong>in</strong>de als Waldeigentümer oder Nutzungsberechtigter (Waldbesitzer) diese<br />
fachlichen Bestimmungen gelten und anzuwenden s<strong>in</strong>d. Der Geme<strong>in</strong>dewald wird <strong>in</strong> diesem Zusammenhang h<strong>in</strong>sichtlich<br />
se<strong>in</strong>er Eigentumsart auch als Körperschaftswald bezeichnet (vgl. § 3 Abs. 2 BWaldG).<br />
Die Geme<strong>in</strong>de hat dazu zu beachten, dass Wald jede mit Forstpflanzen bestellte Grundfläche ist und als Wald<br />
auch kahlgeschlagene oder verlichtete Grundflächen, Waldwege, Walde<strong>in</strong>teilungs- und Sicherungsstreifen,<br />
Waldblößen und Lichtungen, Waldwiesen, Wildäsungsplätze, Holzlagerplätze sowie weitere mit dem Wald verbundene<br />
und ihm dienende Flächen gelten (vgl. § 2 Abs. 1 BWaldG). Dagegen s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> der Flur oder im bebauten<br />
Gebiet gelegene kle<strong>in</strong>ere Flächen, die mit e<strong>in</strong>zelnen Baumgruppen, Baumreihen oder mit Hecken bestockt s<strong>in</strong>d<br />
oder als Baumschulen verwendet werden, nicht als Wald anzusehen (vgl. § 2 Abs. 2 BWaldG).<br />
Bei der Verwaltung und der Bewirtschaftung des Geme<strong>in</strong>dewaldes ist daher auch der gesetzliche Auftrag, die<br />
Geme<strong>in</strong>dewälder ordnungsgemäß und nachhaltig zu bewirtschaften und dabei die Funktionen des Waldes als<br />
Rohstoffquelle, als Grundlage für den Arten-, Boden-, Klima- und Wasserschutz sowie für Freizeit und Erholung<br />
der Bevölkerung zu berücksichtigen, zu beachten. Die geme<strong>in</strong>dliche Waldbewirtschaftung erfordert deshalb e<strong>in</strong><br />
ständiges Abwägen zwischen wirtschaftlichen, ökologischen und auch sozialen Interessen, denn vielfach sollen<br />
die unterschiedlichen Ansprüche an den Wald dauerhaft berücksichtigt werden. Die waldbauliche Tätigkeit der<br />
Geme<strong>in</strong>de als Waldbesitzer umfasst dabei die zielorientierte Planung, Entscheidung und Umsetzung im Bereich<br />
der Erneuerung, Pflege und Schutz von Wäldern.<br />
5.2 Die Bewirtschaftung des Geme<strong>in</strong>dewaldes<br />
Im S<strong>in</strong>ne der besonderen Zwecksetzungen s<strong>in</strong>d im Landesforstgesetz z.B. mehrere Bewirtschaftungsgrundsätze<br />
verankert, die von der Geme<strong>in</strong>de bei dem <strong>in</strong> ihrem Eigentum stehenden Wald zu beachten hat (vgl. § 32 i.V.m. §<br />
31 LFoG). Außerdem ist der Geme<strong>in</strong>dewaldbesitz nach e<strong>in</strong>em Betriebsplan auf der Grundlage e<strong>in</strong>es Betriebsgutachtens<br />
zu bewirtschaften (vgl. § 33 LFoG), dessen Erfüllung durch e<strong>in</strong>en jährlich aufzustellenden Wirtschaftsplan<br />
sichergestellt werden soll (vgl. § 34 LFoG). Die M<strong>in</strong>dest<strong>in</strong>halte von Betriebsplänen, Betriebsgutachten und<br />
Wirtschaftsplänen werden durch die „Erste Verordnung zur Durchführung des Landesforstgesetzes“ näher bestimmt.<br />
In diesem Zusammenhang gelten für die Bewirtschaftung des Geme<strong>in</strong>dewaldes als Teil des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Vermögens auch die allgeme<strong>in</strong>en Vorgaben über die Verwaltung des Geme<strong>in</strong>devermögens. Außerdem ist<br />
von der Geme<strong>in</strong>de eigenverantwortlich zu entscheiden, <strong>in</strong> welcher Verwaltungse<strong>in</strong>heit oder anderen Organisationsform<br />
die Bewirtschaftung des Geme<strong>in</strong>dewaldes verantwortlich erfolgen soll.<br />
Für die Verwaltung von Geme<strong>in</strong>dewald f<strong>in</strong>det aber auch das Gesetz über den Geme<strong>in</strong>schaftswald im Land Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen<br />
- Geme<strong>in</strong>schaftswaldgesetz - Anwendung, durch das u.a. auch die Haushaltswirtschaft von<br />
Waldgenossenschaft, angelehnt an die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft, im E<strong>in</strong>zelnen bestimmt wird. So hat<br />
z.B. der Wirtschaftsplan neben der Planung der forstlichen Maßnahme auch die voraussichtlich anfallenden Kosten<br />
sowie die voraussichtlichen E<strong>in</strong>nahmen aus der Nutzung der forstlichen Grundstücke aufzuweisen und ist der<br />
Aufsichtsbehörde zuzuleiten. Außerdem ist der Wirtschaftsplan ist nach Ablauf des Wirtschaftsjahres durch e<strong>in</strong>en<br />
Wirtschaftsnachweis abzuschließen.<br />
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ<br />
GEMEINDEORDNUNG 472
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 91 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 91<br />
Inventur, Inventar und Vermögensbewertung<br />
(1) Die Geme<strong>in</strong>de hat zum Schluss e<strong>in</strong>es jeden Haushaltsjahres sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden<br />
und Rechnungsabgrenzungsposten <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Inventur unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur<br />
vollständig aufzunehmen und dabei den Wert der e<strong>in</strong>zelnen Vermögensgegenstände und Verb<strong>in</strong>dlichkeiten anzugeben<br />
(Inventar).<br />
(2) 1 Für die im Jahresabschluss auszuweisenden Wertansätze gilt:<br />
1. Vermögensgegenstände s<strong>in</strong>d höchstens mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten verm<strong>in</strong>dert um die<br />
planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen anzusetzen,<br />
2. Verb<strong>in</strong>dlichkeiten s<strong>in</strong>d zu ihrem Rückzahlungsbetrag, Rentenverpflichtungen, für die e<strong>in</strong>e Gegenleistung<br />
nicht mehr zu erwarten ist, zu ihrem Barwert und Rückstellungen nur <strong>in</strong> Höhe des Betrages anzusetzen, der<br />
voraussichtlich notwendig ist.<br />
2 Die Bewertung ist unter Anwendung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, soweit dieses Gesetz<br />
nichts anderes vorsieht, vorzunehmen.<br />
Erläuterungen zu § 91:<br />
I. Allgeme<strong>in</strong>es<br />
1. Inhalte der Inventur<br />
In der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft kommt der Inventur e<strong>in</strong>e große Bedeutung zu, denn das geme<strong>in</strong>dliche<br />
Inventar, das auf der Inventur aufbaut, stellt e<strong>in</strong>e Grundlage für die Bilanz im jährlich aufzustellenden Jahresabschluss<br />
dar. Es handelt sich bei der Inventur um e<strong>in</strong> unabhängig von der Buchführung zu erstellendes vollständiges,<br />
detailliertes Erfassen aller Vermögensgegenstände und Schulden zu e<strong>in</strong>em Stichtag, bei dem die Grundsätze<br />
ordnungsmäßiger Inventur (GoI) zu beachten s<strong>in</strong>d. Die Inventur hat den Zweck der Sicherung und Überwachung<br />
des geme<strong>in</strong>dlichen Vermögens und führt zum Inventar. Die weiteren Inhalte zur Inventur und zum Inventar<br />
s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> § 28 GemHVO <strong>NRW</strong> bestimmt. Für die Durchführung der Inventur werden zudem Inventurvere<strong>in</strong>fachungsverfahren<br />
zugelassen (vgl. § 29 GemHVO <strong>NRW</strong>). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Bilanz im geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Jahresabschluss auf dem festgestellten Inventar aufbaut und umfassend Auskunft über das Vermögen und die<br />
Schulden der Geme<strong>in</strong>de gibt.<br />
Das Vermögen und die Schulden der Geme<strong>in</strong>de s<strong>in</strong>d dar<strong>in</strong> nach der zivilen Rechtslage unter Berücksichtigung<br />
der wirtschaftlichen Eigentümerschaft zu bilanzieren, so dass grundsätzlich die Forderungen beim Anspruchsberechtigten<br />
zu aktivieren und die Verb<strong>in</strong>dlichkeiten beim Schuldner zu passivieren s<strong>in</strong>d. Die Eignung e<strong>in</strong>es Vermögensgegenstandes<br />
oder e<strong>in</strong>er Verb<strong>in</strong>dlichkeit, dem Grunde nach <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz angesetzt werden<br />
zu können, wird mit dem Begriff „Bilanzierungsfähigkeit“ umschrieben. Da das geme<strong>in</strong>dliche Vermögen auf der<br />
Aktivseite der Bilanz anzusetzen ist, wird deshalb auch der Begriff „Aktivierungsfähigkeit“ verwendet und <strong>in</strong> entsprechender<br />
Weise der Begriff „Passiervierungsfähigkeit“ für die auf der Passivseite der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz<br />
anzusetzenden Verb<strong>in</strong>dlichkeiten. Die <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>deordnung und der Geme<strong>in</strong>dehaushaltsverordnung enthaltenen<br />
Vermögensvorschriften über den Erwerb, die Veräußerung, den Nachweis und die bilanzielle Behandlung<br />
des Vermögens ergänzen sich dabei gegenseitig.<br />
2. Die Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur<br />
Folgende Grundsätze gelten auch für die Geme<strong>in</strong>den als Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur und s<strong>in</strong>d bei der<br />
Durchführung der geme<strong>in</strong>dlichen Inventur zu beachten (vgl. Abbildung).<br />
GEMEINDEORDNUNG<br />
473
Grundsatz der<br />
Vollständigkeit der<br />
Bestandsaufnahme<br />
Grundsatz der<br />
Richtigkeit der Bestandaufnahme<br />
Grundsatz der<br />
E<strong>in</strong>zelerfassung der Bestände<br />
Grundsatz der<br />
Dokumentation und Nachprüfbarkeit<br />
Grundsatz der<br />
Wirtschaftlichkeit<br />
II. Erläuterungen im E<strong>in</strong>zelnen<br />
1. Zu Absatz 1 (Inventur und Inventar)<br />
1.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
1.1.1 Die Verpflichtung zur jährlichen Inventur<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 91 GO <strong>NRW</strong><br />
Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur (GoI)<br />
Nach diesem Grundsatz muss als Ergebnis der Inventur e<strong>in</strong><br />
Verzeichnis (Inventar) vorliegen, das sämtliche Vermögensgegenstände<br />
und Schulden enthält. Bei der Erfassung s<strong>in</strong>d daher<br />
die für die Bewertung relevanten Informationen mit zu erfassen.<br />
Nach diesem Grundsatz Bei allen zulässigen Inventurverfahren<br />
s<strong>in</strong>d die Art und die Menge sowie der Wert der Vermögensgegenstände<br />
und der Schulden zweifelsfrei festzustellen.<br />
Nach diesem Grundsatz s<strong>in</strong>d die Vermögensgegenstände und<br />
die Schulden e<strong>in</strong>zeln nach ihrer Art, nach ihrer Menge und<br />
ihrem Wert zu erfassen. Dabei s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>e Stichproben<strong>in</strong>ventur,<br />
die Festbewertung und die Gruppenbewertung zulässig.<br />
Nach diesem Grundsatz ist die Durchführung der Inventur <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>em Inventurrahmenplan zu dokumentieren. Die Ergebnisse<br />
der Inventur s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> Zähllisten nachzuweisen. Diese Unterlagen<br />
müssen für e<strong>in</strong>en sachverständigen Dritten <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er angemessenen<br />
Zeit nachprüfbar se<strong>in</strong>.<br />
Nach diesem Grundsatz muss der Aufwand, der im Rahmen der<br />
Durchführung der Inventur zu erwarten ist, <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em angemessenen<br />
Verhältnis zu den erwartenden Ergebnissen stehen.<br />
Zulässige Vere<strong>in</strong>fachungen bei der Inventur s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> die Beurteilung<br />
e<strong>in</strong>zubeziehen.<br />
Abbildung 79 „Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur“<br />
Die Vorschrift regelt die generelle Verpflichtung der Geme<strong>in</strong>de, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger<br />
Inventur (GoI) e<strong>in</strong>e Inventur durchzuführen und e<strong>in</strong> Inventar anzulegen. Diese Grundsätze beziehen sich auf<br />
die Erstellung des Inventars, das der Bilanz als Vermögensverzeichnis zu Grunde liegt. Sie sollen außerdem<br />
sichern, dass <strong>in</strong> der Inventur e<strong>in</strong>e vollständige, mengen- und wertmäßige Erfassung des Vermögens und der<br />
Schulden erfolgt. Deshalb wird entsprechend der Regelungen des Handelsrechts für den laufenden Betrieb bestimmt,<br />
dass die Geme<strong>in</strong>den für den Schluss e<strong>in</strong>es jeden Haushaltsjahres ihre Vermögensgegenstände und<br />
Schulden genau zu verzeichnen und dabei den jeweiligen Wert anzugeben haben (Inventar).<br />
Diese Vorgabe erfordert grundsätzlich e<strong>in</strong>e körperliche Aufnahme (Inventur), bei der die Grundsätze ordnungsmäßiger<br />
Inventur, also Vollständigkeit, Richtigkeit, Dokumentation und Nachprüfbarkeit der Bestandsaufnahme,<br />
E<strong>in</strong>zelerfassung der Bestände, die gesonderte Erfassung der Forderungen und Verb<strong>in</strong>dlichkeiten sowie der<br />
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit Anwendung f<strong>in</strong>den. Die Vorschrift ist dabei darauf ausgerichtet, dass die Geme<strong>in</strong>de<br />
durch die Inventur e<strong>in</strong>en Überblick über ihr gesamtes Vermögen erhält und wird durch § 28 GemHVO<br />
<strong>NRW</strong> näher bestimmt.<br />
GEMEINDEORDNUNG<br />
474
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 91 GO <strong>NRW</strong><br />
Im Rahmen der geme<strong>in</strong>dlichen Inventur fließen die aktuellen Werte der Vermögensgegenstände dah<strong>in</strong>gehend <strong>in</strong><br />
die Erfassung e<strong>in</strong>, dass durch § 29 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong> auf die Erfassung von Vermögensgegenständen, die e<strong>in</strong>en<br />
Wert von 60 Euro nicht überschreiten, verzichtet werden kann. Auf e<strong>in</strong>e Erfassung zu verzichten, weil ggf. ke<strong>in</strong><br />
Ansatz <strong>in</strong> der Bilanz erfolgen wird, ist für sich alle<strong>in</strong> ke<strong>in</strong> Grund, bestimmte Vermögensgegenstände aus der Inventur<br />
auszuschließen. Es sollen aber wirtschaftliche Gesichtspunkte bzw. der Aufwand der Erfassung aller Vermögensgegenstände<br />
bei der Bestimmung des Inventurumfanges Berücksichtigung f<strong>in</strong>den.<br />
1.1.2 Zwecke der geme<strong>in</strong>dlichen Inventur<br />
Für den laufenden Verwaltungsbetrieb der Geme<strong>in</strong>de wird bestimmt, dass die Geme<strong>in</strong>de für den Schluss e<strong>in</strong>es<br />
jeden Haushaltsjahres ihre Vermögensgegenstände und Schulden <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Inventur unter Beachtung der Grundsätze<br />
ordnungsmäßiger Inventur vollständig aufzunehmen und dabei den Wert der e<strong>in</strong>zelnen Vermögensgegenstände<br />
und Verb<strong>in</strong>dlichkeiten anzugeben hat (Inventar). E<strong>in</strong> Inventar stellt zudem das B<strong>in</strong>deglied zwischen den <strong>in</strong><br />
der Inventur erfassten Vermögensgegenständen und den Schulden für den Ansatz <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz<br />
dar (vgl. Abbildung).<br />
Zusammenhang von Inventar und Bilanz<br />
Inventar<br />
Mengen- und Wertangaben zum<br />
geme<strong>in</strong>dliches Vermögen und Schulden<br />
Vermögensgegenstände werden<br />
nach ihren Arten erfasst<br />
Schulden werden<br />
nach ihren Arten erfasst<br />
Darstellung i.d.R. <strong>in</strong> Staffelform<br />
Interne Verwaltungsunterlage<br />
Nicht für Analysen vorgesehen<br />
Bilanz<br />
Wertangaben über<br />
geme<strong>in</strong>dliches Vermögen und Schulden<br />
Vermögensgegenstände werden bei<br />
Bedeutung nach Arten angesetzt<br />
Schulden werden bei<br />
Bedeutung nach Arten angesetzt<br />
Darstellung <strong>in</strong> Kontoform<br />
Information für die Öffentlichkeit<br />
Geeignet für Bilanzanalysen<br />
Abbildung 80 „Zusammenhang von Inventar und Bilanz“<br />
Das geme<strong>in</strong>dliche Inventar ist - wie im Handelsrecht - e<strong>in</strong>e wichtige Grundlage für die geme<strong>in</strong>dliche Bilanz im von<br />
der Geme<strong>in</strong>de jährlich zu erstellenden Jahresabschluss. Deshalb ist auch im NKF bestimmt worden, dass die<br />
Geme<strong>in</strong>de für den Schluss e<strong>in</strong>es jeden Haushaltsjahres ihre Vermögensgegenstände und Schulden genau zu<br />
verzeichnen und dabei den jeweiligen Wert anzugeben hat (Inventar). Dem Inventar kommt damit sowohl e<strong>in</strong>e<br />
Ordnungsfunktion als auch e<strong>in</strong>e Wertermittlungsfunktion zu.<br />
Die Vorschrift enthält daher für die Geme<strong>in</strong>de wichtige Grundsätze, damit die geme<strong>in</strong>dliche Inventur ordnungsgemäß<br />
durchgeführt wird. Die Inventur stellt dabei als Bestandsaufnahme e<strong>in</strong>e lückenlose, mengen- und wertmäßige<br />
Erfassung des Vermögens und der Schulden e<strong>in</strong>er Geme<strong>in</strong>de zu e<strong>in</strong>em bestimmten Stichtag durch e<strong>in</strong>e<br />
Inaugensche<strong>in</strong>nahme <strong>in</strong> Form von Messen, Wiegen usw. dar. E<strong>in</strong>e solche Stichtags<strong>in</strong>ventur ist <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em angemessenen<br />
und abgegrenzten Zeitraum um den Abschlussstichtag durchzuführen. E<strong>in</strong> Inventar der Geme<strong>in</strong>de<br />
stellt das B<strong>in</strong>deglied zwischen den erfassten geme<strong>in</strong>dlichen Vermögensgegenständen und den geme<strong>in</strong>dlichen<br />
GEMEINDEORDNUNG<br />
475
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 91 GO <strong>NRW</strong><br />
Schulden dar. Der Zusammenhang zwischen der Inventur, dem Inventar und der Bilanz der Geme<strong>in</strong>de wird nachfolgend<br />
als Schema aufgezeigt (vgl. Abbildung).<br />
Grundsätze für Inventur, Inventar und Bilanz der Geme<strong>in</strong>de<br />
Inventur<br />
Inventar<br />
Bilanz<br />
Bestandsaufnahme Bestandsverzeichnis Vermögensstatus<br />
1. Lückenlose<br />
2. mengen- und wertmäßige<br />
3. Erfassung der<br />
Vermögensgegen-<br />
stände und Schulden<br />
4. zu e<strong>in</strong>em bestimmten<br />
Zeitpunkt<br />
5. durch Inaugensche<strong>in</strong>-<br />
nahme (messen,<br />
zählen usw.<br />
Ergebnis<br />
der<br />
Inventur<br />
geht e<strong>in</strong><br />
<strong>in</strong>s<br />
Inventar<br />
1. Mengen- und wertmäßige<br />
2. E<strong>in</strong>zeldarstellung der<br />
Vermögensgegenstände<br />
und Schulden<br />
3. <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er geordneten<br />
Zusammenstellung<br />
4. zu e<strong>in</strong>em bestimmten<br />
Zeitpunkt<br />
Überleitung<br />
aus dem<br />
Inventar<br />
<strong>in</strong> die<br />
Bilanz<br />
1. Wertmäßige Darstellung<br />
2. mit betragsmäßiger Zusammen- <br />
Fassung gleichartiger Posten<br />
3. als Gegenüberstellung von<br />
Vermögen und Schulden<br />
sowie Eigenkapital<br />
4. zu e<strong>in</strong>em Stichtag<br />
5. unter Fortschreibung<br />
der Werte aus laufenden<br />
Aufzeichnungen<br />
Abbildung 81 „Grundsätze für Inventur, Inventar und Bilanz der Geme<strong>in</strong>de“<br />
1.2 Die Anwendung bestimmter Begriffe<br />
1.2.1 Der Begriff „Vermögensgegenstand“<br />
Das Haushaltsrecht für Geme<strong>in</strong>den orientiert sich bei der Auslegung des Begriffs „Vermögensgegenstand“, für<br />
den es ke<strong>in</strong>e gesetzliche Def<strong>in</strong>ition und ke<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>heitliche Begriffsbestimmung gibt, an der kaufmännischen Auslegung<br />
(vgl. § 33 GemHVO <strong>NRW</strong>). So wird im allgeme<strong>in</strong>en Wirtschaftsleben e<strong>in</strong> Wirtschaftsgut dadurch als Vermögensgegenstand<br />
charakterisiert, das mit ihm e<strong>in</strong> wirtschaftlicher Wert vorliegt, das Wirtschaftsgut selbstständig<br />
nutzungsfähig und bewertbar ist. Diese Kriterien ermöglichen grundsätzlich, Wirtschaftsgüter sowohl als Sachgesamtheit<br />
wie auch <strong>in</strong> ihren technischen E<strong>in</strong>zelteilen zu bewerten und zu bilanzieren. Bei Geme<strong>in</strong>den muss e<strong>in</strong><br />
Vermögensgegenstand auch der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgabenerfüllung dienen.<br />
1.2.2 Der Begriff „Schulden“<br />
Das Haushaltsrecht für Geme<strong>in</strong>den orientiert sich bei der Auslegung des Begriffs „Schulden“, für den es auch<br />
ke<strong>in</strong>e gesetzliche Def<strong>in</strong>ition und ke<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>heitliche Begriffsbestimmung gibt, - wie bei der Auslegung des Begriffs<br />
„Vermögensgegenstand“ an der kaufmännischen Auslegung. So wird im allgeme<strong>in</strong>en Wirtschaftsleben, ausgehend<br />
von der Bilanz der Begriff dadurch abgegrenzt, dass nicht das Eigenkapital und die Sonderposten sowie die<br />
passive Rechnungsabgrenzung dazu zu zählen s<strong>in</strong>d. Somit sollte der Begriff nur als Obergriff verwendet werden,<br />
auch deshalb, weil als anderer haushaltwirtschaftlicher Sicht e<strong>in</strong>e andere Abgrenzung sachgerecht se<strong>in</strong> kann.<br />
1.2.3 Der Begriff „Rechnungsabgrenzungsposten“<br />
In der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz s<strong>in</strong>d immer dann von der Geme<strong>in</strong>de auch Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen,<br />
wenn nach dem Grundsatz der Abgrenzung nach Sache und Zeit die Ausgaben oder E<strong>in</strong>nahmen im abgelaufenen<br />
Haushaltsjahr erfolgt s<strong>in</strong>d, die Aufwendungen oder Erträge jedoch erst späteren Haushaltsjahren zuzu-<br />
GEMEINDEORDNUNG<br />
476
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 91 GO <strong>NRW</strong><br />
rechnen und die Beträge nicht ger<strong>in</strong>gfügig s<strong>in</strong>d. Allgeme<strong>in</strong> liegen den Rechnungsabgrenzungsposten geme<strong>in</strong>dliche<br />
Geschäftsvorfälle oder Verträge zu Grunde, bei denen Leistung und Gegenleistung von zeitbezogener Natur<br />
s<strong>in</strong>d, jedoch <strong>in</strong> zeitlicher H<strong>in</strong>sicht ause<strong>in</strong>ander fallen. Um Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen, muss die<br />
betreffende Zeit kalendermäßig bestimmbar, d.h. die Dauer muss berechenbar se<strong>in</strong> und sich aus dem jeweils<br />
vorliegenden Sachverhalt ergeben. Nur für derartige transitorische Vorgänge dürfen, wenn die Voraussetzungen<br />
dafür vorliegen, von der Geme<strong>in</strong>de Rechnungsabgrenzungsposten gebildet werden.<br />
1.3 Die Nachvollziehbarkeit des Inventurverfahrens<br />
1.3.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Bei der Planung, Vorbereitung, Durchführung, Überwachung und Auswertung der Inventur sowie bei der Aufstellung<br />
des Inventars s<strong>in</strong>d die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu beachten, die aber auf die Inventur<br />
bezogen als Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur (GoI) zu achten s<strong>in</strong>d. Dazu gehören als Grundsätze die Vollständigkeit,<br />
die Richtigkeit, der Klarheit, der Dokumentation, der Nachprüfbarkeit der Bestandsaufnahme (Absatz<br />
3), der Grundsatz der E<strong>in</strong>zelerfassung der Bestände und der E<strong>in</strong>zelbewertung, die gesonderte Erfassung der<br />
Forderungen und Verb<strong>in</strong>dlichkeiten (Absatz 2) sowie der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit.<br />
1.3.2 Die Vollständigkeit der Bestandsaufnahme<br />
Als Ergebnis der Inventur muss e<strong>in</strong> Verzeichnis (Inventar) vorliegen, das sämtliche Vermögensgegenstände und<br />
Schulden enthält. Bei der Erfassung der Vermögensgegenstände s<strong>in</strong>d alle für die Bewertung relevanten Informationen<br />
(qualitativer Zustand, Beschädigungen und Mängel, verm<strong>in</strong>derte oder fehlende Verwertbarkeit) festzuhalten.<br />
Doppelerfassungen und Erfassungslücken müssen bereits bei der Inventurplanung ausgeschlossen werden.<br />
Für den Bereich der Schulden s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>sbesondere die Vollständigkeit der Rückstellungen sowie e<strong>in</strong> Überblick über<br />
die wesentlichen Risiken sicherzustellen. Dies führt dazu, dass neben den Vermögensgegenständen und Schulden<br />
auch alle sonstigen wichtigen Verträge bekannt und erfasst s<strong>in</strong>d. Vollständig abgeschriebene, aber noch<br />
genutzte Vermögensgegenstände s<strong>in</strong>d mit e<strong>in</strong>em Er<strong>in</strong>nerungswert nachzuweisen.<br />
1.3.3 Die Richtigkeit der Bestandsaufnahme<br />
Bei allen Inventurverfahren s<strong>in</strong>d Art, Menge und Wert der e<strong>in</strong>zelnen Vermögensgegenstände und Schulden zweifelsfrei<br />
festzustellen. Welches Inventurverfahren Anwendung f<strong>in</strong>det, hängt im Wesentlichen davon ab, ob es sich<br />
um physisch erfassbare Vermögensgegenstände (körperliche Inventur) oder um nicht physisch erfassbare Vermögensgegenstände<br />
(Buch- oder Beleg<strong>in</strong>ventur) handelt. Zulässige Inventurvere<strong>in</strong>fachungsverfahren s<strong>in</strong>d <strong>in</strong><br />
E<strong>in</strong>zelfällen anwendbar. Bei der Inventur f<strong>in</strong>det daher auch das Vier-Augen-Pr<strong>in</strong>zip Anwendung. Auch muss e<strong>in</strong>e<br />
ausreichende Sachkunde der Aufnehmenden sichergestellt werden.<br />
1.3.4 Die E<strong>in</strong>zelerfassung der Bestände<br />
Alle geme<strong>in</strong>dlichen Vermögensgegenstände und die Schulden der Geme<strong>in</strong>de s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>zeln nach Art, Menge und<br />
Wert durch e<strong>in</strong>e Inaugensche<strong>in</strong>nahme, d.h. i.d.R. durch e<strong>in</strong>e körperliche Inventur, zu erfassen, soweit nicht andere<br />
Inventurformen zulässig s<strong>in</strong>d. Die Stichproben<strong>in</strong>ventur ist nur ausnahmsweise möglich. Andererseits s<strong>in</strong>d bei<br />
der Erfassung der Vermögensgegenstände und Schulden die dafür vorgesehenen Bewertungsvere<strong>in</strong>fachungsverfahren,<br />
z.B. Festbewertung oder Gruppenbewertung, zu berücksichtigen.<br />
GEMEINDEORDNUNG<br />
477
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 91 GO <strong>NRW</strong><br />
1.3.5 Die Dokumentation und Nachprüfbarkeit der Bestandsaufnahme<br />
Der Grundsatz der Nachprüfbarkeit der Bestandsaufnahme erfordert, dass die Vorgehensweise der Inventur im<br />
Inventurrahmenplan und die Ergebnisse der Inventur <strong>in</strong> Zähllisten und Inventarlisten zu dokumentieren s<strong>in</strong>d. E<strong>in</strong><br />
sachverständiger Dritter muss sich <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>er angemessenen Zeit e<strong>in</strong>en Überblick über die Vorgehensweise<br />
und die Ergebnisse der Inventur verschaffen können. Es ist dazu nicht festgelegt worden, welches Maß an Sachverstand<br />
erforderlich se<strong>in</strong> muss, um die geme<strong>in</strong>dliche Tätigkeit im jeweils betroffenen Produkt- bzw. Aufgabenbereich<br />
beurteilen und nachvollziehen zu können. Allgeme<strong>in</strong> wird davon auszugehen se<strong>in</strong>, dass e<strong>in</strong> sachverständiger<br />
Dritter ausreichende Kenntnisse über die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft bzw. das Rechnungswesen der<br />
Geme<strong>in</strong>de besitzen muss, damit er die Ausführung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft und deren Ergebnis im<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss sowie im Gesamtabschluss der Geme<strong>in</strong>de verstehen und beurteilen kann. Dabei<br />
wird auch die Größe der Geme<strong>in</strong>de sowie die Größe und Komplexität der geme<strong>in</strong>dlichen Buchführung e<strong>in</strong>schließlich<br />
der Art der örtlichen DV-Buchführung zu berücksichtigen se<strong>in</strong>.<br />
Bei der Beurteilung, ob e<strong>in</strong> sachverständiger Dritter sich <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>er angemessenen Zeit e<strong>in</strong>en Überblick über<br />
die Vorgehensweise und die Ergebnisse der geme<strong>in</strong>dlichen Inventur verschaffen kann, ist ebenfalls von den<br />
vorhandenen örtlichen Gegebenheiten auszugehen. Die Bestimmung der angemessenen Zeit ist somit auch von<br />
der Größe der Geme<strong>in</strong>de sowie der Größe und Komplexität der geme<strong>in</strong>dlichen Buchführung e<strong>in</strong>schließlich der Art<br />
der örtlichen DV-Buchführung abhängig. Hieraus ergibt sich u.a. auch, dass die Unterlagen über die Inventur und<br />
die hierzu ergangenen Anweisungen und Organisationsregelungen sicher und geordnet aufzubewahren s<strong>in</strong>d. Die<br />
Aufbewahrungsfrist für Belege zur Inventur ist auf m<strong>in</strong>destens 6 Jahre festgesetzt. Die Frist für das Inventar beträgt<br />
10 Jahre (vgl. § 58 GemHVO <strong>NRW</strong>). Bei e<strong>in</strong>er Buch<strong>in</strong>ventur muss die Fortschreibung der Bestände ordnungsgemäß<br />
erfolgen, um dem genannten Grundsatz zu genügen.<br />
1.3.6 Der Grundsatz der Klarheit<br />
Bei der Inventur muss durch die Gestaltung der Unterlagen <strong>in</strong> Form von klaren Bezeichnungen und Abgrenzungen<br />
der e<strong>in</strong>zelnen Vermögensgegenstände der Geme<strong>in</strong>de gewährleistet werden, dass die e<strong>in</strong>zelnen erfassten<br />
Positionen und Posten e<strong>in</strong>deutig vone<strong>in</strong>ander zu trennen s<strong>in</strong>d. Die erfassten Sachverhalte müssen <strong>in</strong> den Inventurunterlagen<br />
so dargestellt se<strong>in</strong>, dass sachverständige Dritte die Erfassung <strong>in</strong> angemessener Zeit nachvollziehen<br />
können.<br />
1.3.7 Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit<br />
Der Aufwand, der im Rahmen der Durchführung der Inventur erforderlich ist, muss <strong>in</strong> angemessener Relation zu<br />
den zu erwartenden Ergebnissen stehen. Zulässige Vere<strong>in</strong>fachungen, z.B. verlegte oder laufende Inventur für die<br />
Eröffnungsbilanz unter Berücksichtigung des Stichtages, Abweichungen vom vorrangigen Grundsatz der E<strong>in</strong>zelbewertung,<br />
z.B. Festbewertung und E<strong>in</strong>schränkungen bei der geforderten Genauigkeit, z.B. Grundsatz der Vollständigkeit,<br />
s<strong>in</strong>d bereits bei der Inventurplanung zu prüfen und zu berücksichtigen. In diesem Zusammenhang<br />
muss örtlich beurteilt werden, ob das im Vergleich zu e<strong>in</strong>er genaueren Erfassung entstehende Abweichungsrisiko<br />
im S<strong>in</strong>ne des Ergebnisses tragfähig ist. Dabei f<strong>in</strong>det als Prüfungsgrundsatz auch der Grundsatz der Wesentlichkeit<br />
Anwendung, denn es ist abzuwägen, ob durch den aus Wirtschaftlichkeitsgründen ger<strong>in</strong>geren Aufwand möglicherweise<br />
Informationen weggelassen werden oder e<strong>in</strong>e fehlerhafte Darstellung entsteht, durch die zu treffende<br />
wirtschaftliche Entscheidungen der Adressaten des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses bee<strong>in</strong>flusst werden können.<br />
Im Zweifelsfall ist erforderlich, zutreffende Informationen über Abweichungen zu geben, z.B. im Anhang im<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss (vgl. § 44 GemHVO <strong>NRW</strong>), so dass ggf. für die notwendig gewordene Entscheidung<br />
e<strong>in</strong>e überschlägige Ermittlung erforderlich werden kann.<br />
GEMEINDEORDNUNG<br />
478
1.4 Die Aufstellung des Inventars<br />
1.4.1 Die Verpflichtung zur Aufstellung<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 91 GO <strong>NRW</strong><br />
Die Vorgabe der Vorschrift, den Wert der e<strong>in</strong>zelnen <strong>in</strong> der Inventur zum Schluss e<strong>in</strong>es jeden Haushaltsjahres<br />
erfassten Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben (Inventar), verpflichtet die Geme<strong>in</strong>de, aus ihrer<br />
Inventur das geme<strong>in</strong>dliche Inventar aufzustellen. Sie dient der zutreffenden Darstellung der Vermögens- und<br />
Schuldenlage der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> der Bilanz im geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss. Das Inventar als Bestandsverzeichnis<br />
ist daher zeitnah zum Stichtag 31. Dezember (Abschlussstichtag) aufzustellen und bildet dann die<br />
Grundlage für die aufzustellende Bilanz und den Anhang.<br />
1.4.2 Inhalte des Inventars<br />
Nach der Prüfung und Kontrolle der Zähllisten und der Übertragung <strong>in</strong> die Inventarliste s<strong>in</strong>d durch die Bewertung<br />
der e<strong>in</strong>zelnen Vermögensgegenstände und Schulden die vorläufigen Bilanzwerte unter Beachtung der Bilanzierungsgrundsätze<br />
zu ermitteln. Dabei müssen bis zur endgültigen Erstellung des Jahresabschlusses alle bewertungsrelevanten<br />
Informationen Berücksichtigung f<strong>in</strong>den. Nach der jeweiligen Entscheidung, ob e<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>dlicher<br />
Vermögensgegenstand und e<strong>in</strong>e Verb<strong>in</strong>dlichkeit zu bilanzieren ist, muss die Frage geklärt werden, mit welchem<br />
Wert diese <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz anzusetzen s<strong>in</strong>d. Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften können<br />
unterschiedliche Wertbegriffe zur Anwendung kommen, so dass zu prüfen ist, ob e<strong>in</strong> Ansatz <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Bilanz unter Berücksichtigung folgender Wertgrößen zu bilden ist (vgl. Abbildung).<br />
Wertbegriffe für die geme<strong>in</strong>dliche Bilanzierung<br />
Bezeichnung<br />
Anschaffungskosten<br />
Barwert<br />
Beizulegender Wert<br />
Gewogener Durchschnittswert<br />
Herstellungskosten<br />
Rückzahlungsbetrag<br />
Vorschrift<br />
§ 91 GO <strong>NRW</strong>, § 33 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 91 GO <strong>NRW</strong>, § 36 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 35 Abs. 5 und 7 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 34 Abs. 3 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 91 GO <strong>NRW</strong>, § 33 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 91 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong><br />
Abbildung 82 „Wertbegriffe für die geme<strong>in</strong>dliche Bilanzierung“<br />
Die besonderen Wertgrößen, nach denen die Vermögensgegenstände und Schulden der Geme<strong>in</strong>de erstmalig <strong>in</strong><br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Eröffnungsbilanz anzusetzen waren, z.B. nach dem vorsichtig geschätzten Zeitwert, s<strong>in</strong>d dabei<br />
außer Betracht geblieben. Bei der Wertbildung s<strong>in</strong>d zudem die Grundsätze ordnungsmäßiger Bilanzierung (GoBi),<br />
zu denen auch die Grundsätze für die Bilanzgliederung gehören, zu beachten (vgl. z.B. § 41 bis 43 GemHVO<br />
<strong>NRW</strong>). Zudem besteht e<strong>in</strong>e grundsätzliche Verpflichtung im Rahmen der örtlich bestimmten Verantwortlichkeiten,<br />
dass <strong>in</strong> den Inventarlisten dargestellte Ergebnis zu unterzeichnen bzw. der jeweiligen Verantwortlichen die e<strong>in</strong>zelnen<br />
Teile des Inventars zu unterzeichnen. Die Vorschrift enthält aber ke<strong>in</strong>e Formvorschriften über das Inventar.<br />
Die Beachtung der GoB bei der Aufstellung verlangen aber e<strong>in</strong>e Klarheit, Übersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit<br />
<strong>in</strong> der Darstellung, so dass die Gliederung des Inventars diesen Anforderungen entsprechen muss. We-<br />
GEMEINDEORDNUNG<br />
479
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 91 GO <strong>NRW</strong><br />
gen der aus dem Inventar vorzunehmenden Überleitung <strong>in</strong> die Bilanz bieten sich für das Inventar getrennte Verzeichnisse<br />
für das Vermögen und die Schulden der Geme<strong>in</strong>de an, deren weitere Untergliederung sich an der<br />
Gliederung der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz orientieren sollte.<br />
2. Zu Absatz 2 (Grundsätze für die Bilanzierung):<br />
2.01 Bilanzierungsentscheidungen<br />
Die Bilanzierung von Vermögen und Schulden ist im geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss grundsätzlich nach der<br />
zivilrechtlichen Rechtslage vorzunehmen. Daraus werden das Entstehen, der Erwerb und die Übertragung an<br />
Dritte, aber auch das Erlöschen von Vermögen und Schulden abgeleitet. So s<strong>in</strong>d z.B. Forderungen beim Gläubiger<br />
als Anspruchsberechtigten zu aktivieren, aber Verb<strong>in</strong>dlichkeiten beim Schuldner zu passivieren. Außerdem<br />
gilt der allgeme<strong>in</strong>e Grundsatz, dass die Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>en Vermögensgegenstand <strong>in</strong> die Bilanz aufzunehmen hat,<br />
wenn sie das wirtschaftliche Eigentum daran <strong>in</strong>nehat und dieser selbstständig verwertbar ist. Vor der eigentlichen<br />
Bewertung von geme<strong>in</strong>dlichem Vermögen oder Schulden s<strong>in</strong>d aber bereits Entscheidungen über deren Aktivierung<br />
oder Passivierung zu treffen (vgl. nachfolgende Abbildung).<br />
Struktur der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanzierungsentscheidung<br />
Aktivierungs- oder Passivierungsfähigkeit<br />
Aktivierungs- oder Passivierungsverbot<br />
Aktivierungs- oder Passivierungsgebot<br />
Aktivierungs- oder Passivierungswahlrecht<br />
Ist der geme<strong>in</strong>dliche Vermögensgegenstand überhaupt<br />
bilanzierungsfähig?<br />
Ist die Bilanzierung von geme<strong>in</strong>dlichem Vermögensteilen<br />
oder Schulden verboten?<br />
S<strong>in</strong>d das geme<strong>in</strong>dliche Vermögen oder die Schulden<br />
auf Grund der haushaltsrechtlichen Vorschriften<br />
oder der GoB bilanzierungspflichtig?<br />
Besteht e<strong>in</strong> Bilanzierungswahlrecht, durch das die<br />
Geme<strong>in</strong>de die Entscheidung obliegt, ob geme<strong>in</strong>dliches<br />
Vermögen oder Schulden anzusetzen s<strong>in</strong>d?<br />
Abbildung 83 „Struktur der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanzentscheidung“<br />
Der Abschlussstichtag für den geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss stellt dabei ke<strong>in</strong>en willkürlichen Schnitt durch das<br />
geme<strong>in</strong>dliche Verwaltungshandeln bzw. die Geschäftstätigkeit der Geme<strong>in</strong>de dar, auch wenn unmittelbar zuvor<br />
und danach Erträge erzielt und Aufwendungen entstehen sowie Zahlungen erhalten und geleistet werden.<br />
2.1 Zu Satz 1 (Grundsätze für Vermögen und Verb<strong>in</strong>dlichkeiten):<br />
2.1.1 Zu Nummer 1 (Beachtung des Anschaffungswertpr<strong>in</strong>zips):<br />
2.1.1.1 Die Begriffe „Anschaffungskosten“ und „Herstellungskosten“<br />
2.1.1.1.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Durch diese Vorschrift wird der Geme<strong>in</strong>de die Beachtung von wichtigen Grundsätzen für ihre Vermögenswerte<br />
und damit für die geme<strong>in</strong>dliche Bilanzierung auferlegt. Der erste Grundsatz <strong>in</strong> dieser Vorschrift legt fest, dass<br />
Vermögensgegenstände höchstens mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, verm<strong>in</strong>dert um die planmä-<br />
GEMEINDEORDNUNG<br />
480
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 91 GO <strong>NRW</strong><br />
ßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen, anzusetzen s<strong>in</strong>d. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten<br />
bilden die wertmäßige Obergrenze für die Bewertung des Vermögens im geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss. Diese<br />
Regelung steht mit der handelsrechtlichen Regelung <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang.<br />
E<strong>in</strong> Wertansatz höherer Wiederbeschaffungswerte zum Ausgleich von <strong>in</strong>flationären Effekten und technischem<br />
Fortschritt wird generell ausgeschlossen. Dazu ist zu beachten, dass durch die Vorschrift der Anschaffung oder<br />
Herstellung e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Vermögensgegenstandes unterschiedliche Kosten zuordnet werden. Im nachfolgenden<br />
Schema werden die Zusammenhänge zwischen den Anschaffungskosten und den Herstellungskosten<br />
aufgezeigt (vgl. Abbildung).<br />
Herstellungs-<br />
aufwand<br />
Herstellungskosten<br />
Zu aktivierender<br />
Aufwand<br />
Bilanz<br />
betroffen<br />
Anschaffungskosten und Herstellungskosten<br />
Erweiterungs-<br />
aufwand<br />
oder<br />
wesentliche<br />
Verbesserung<br />
(anschaffungsnaher<br />
Herstellungsaufwand)<br />
Ab-<br />
schrei-<br />
bung<br />
nach<br />
Nutzung<br />
2.1.1.1.2 Der Begriff „Anschaffungskosten“<br />
Erhaltungs-<br />
aufwand<br />
(Aufwendungen<br />
für Instandhaltung,<br />
die durch die<br />
gewöhnliche<br />
Nutzung<br />
veranlasst ist)<br />
Anschaffungskosten<br />
Ger<strong>in</strong>gwertige<br />
Vermögens-<br />
gegenstände<br />
(GVG)<br />
unter 410 €<br />
Laufender Aufwand<br />
(Sofortabschreibung; ke<strong>in</strong>e Aktivierung)<br />
Ergebnisrechnung<br />
betroffen<br />
Abbildung 84 „Anschaffungskosten und Herstellungskosten“<br />
Ke<strong>in</strong> GVG;<br />
Anlagevermögen<br />
Zu aktivie-<br />
render<br />
Aufwand<br />
Bilanz<br />
betroffen<br />
Ab-<br />
schrei-<br />
bung<br />
nach<br />
Nut-<br />
zung<br />
Der Begriff „Anschaffungskosten“ ist auch im kaufmännischen Rechnungswesen bekannt. Er ist daraus übernommen<br />
worden und be<strong>in</strong>haltet alle geleisteten Aufwendungen, die notwendig s<strong>in</strong>d, um e<strong>in</strong>en Vermögensgegenstand<br />
zu erwerben und <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand<br />
zugerechnet werden können (vgl. § 33 Abs. 2 GemHVO <strong>NRW</strong>). Die geme<strong>in</strong>dlichen Anschaffungskosten<br />
setzen sich dabei aus verschiedenen Teilen zusammen (vgl. Abbildung).<br />
GEMEINDEORDNUNG<br />
Zusammensetzung der geme<strong>in</strong>dlichen Anschaffungskosten<br />
Anschaffungspreis<br />
+ Anschaffungsnebenkosten<br />
+ Nachträgliche Anschaffungskosten<br />
- Anschaffungskostenm<strong>in</strong>derungen<br />
Kaufpreis<br />
z.B. Bezugskosten, Maklergebühren u.a.<br />
z.B. Umbau, Ausbau, wertverbessernde Maßnahmen<br />
z.B. Rabatte, Skonti u.a.<br />
481
Anschaffungskosten<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 91 GO <strong>NRW</strong><br />
Ermittelter Betrag<br />
Abbildung 85 „Zusammensetzung der geme<strong>in</strong>dlichen Anschaffungskosten“<br />
2.1.1.1.3 Der Begriff „Herstellungskosten“<br />
Der Begriff „Herstellungskosten“ ist aus dem kaufmännischen Rechnungswesen übernommen worden. Die geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Herstellungskosten geben dabei den Wert von selbst erstellten Vermögensgegenständen wieder. Sie<br />
be<strong>in</strong>halten alle Kosten, die durch den Verbrauch von Gütern oder Dienstleistungen für die Herstellung, Erweiterung<br />
oder Verbesserung des Vermögensgegenstandes verursacht werden. Dabei können nur aufwandsgleiche<br />
Kosten für die Herstellung der Betriebsbereitschaft des Vermögensgegenstandes – ke<strong>in</strong>e kalkulatorischen Kosten<br />
– berücksichtigt werden (vgl. § 33 Abs. 3 GemHVO <strong>NRW</strong>). Das nachfolgende Schema zeigt die Zusammensetzung<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Herstellungskosten auf (vgl. Abbildung).<br />
Zusammensetzung der geme<strong>in</strong>dlichen Herstellungskosten<br />
Materiale<strong>in</strong>zelkosten<br />
+ Materialgeme<strong>in</strong>kosten<br />
+ Fertigungse<strong>in</strong>zelkosten<br />
+ Fertigungsgeme<strong>in</strong>kosten<br />
+ Sonderkosten der Fertigung<br />
Herstellungskosten<br />
Materialkosten, die direkt zurechenbar s<strong>in</strong>d<br />
z.B. Abschreibungen als Kosten im Materialbereich,<br />
die nicht direkt zurechenbar s<strong>in</strong>d<br />
.B. Fertigungslöhne, die direkt zurechenbar s<strong>in</strong>d<br />
z.B. Energiekosten als nicht zurechenbare<br />
Kosten im Fertigungsbereich<br />
z.B. auftragsbezogene Kosten wegen Sonderanfertigungen<br />
Ermittelter Betrag<br />
Abbildung 86 „Zusammensetzung der geme<strong>in</strong>dlichen Herstellungskosten“<br />
2.1.1.2 Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens<br />
Die Anwendung des Ressourcenverbrauchskonzepts durch die Geme<strong>in</strong>den erfordert, die Vermögensgegenstände<br />
des Sachanlagevermögens unter Berücksichtigung ihrer Wertm<strong>in</strong>derung <strong>in</strong> der jährlichen Bilanz der Geme<strong>in</strong>de<br />
anzusetzen. Diese Darstellung der Wertm<strong>in</strong>derung des Sachanlagevermögens erhält die Aussagekraft der Bilanz.<br />
Gleichzeitig wird der durch die Abnutzung e<strong>in</strong>es Vermögensgegenstandes entstehende tatsächliche Ressourcenverbrauch<br />
im Haushaltsjahr im Rahmen des Ergebnisplans und der Ergebnisrechnung des betreffenden Produktbereichs<br />
als Aufwand abgebildet bzw. nachgewiesen. Die flächendeckende Ermittlung und Buchung von Abschreibungen<br />
als Wertm<strong>in</strong>derungen des Sachanlagevermögens s<strong>in</strong>d somit notwendig. Die Vornahme von Abschreibungen<br />
muss den GoB entsprechen.<br />
2.1.1.3 Die Aktivierung von erhaltenen Sachleistungen<br />
Die Geme<strong>in</strong>de hat bei e<strong>in</strong>er Schenkung <strong>in</strong> Form von Sachleistungen die für die kommunale Aufgabenerfüllung<br />
erhaltenen Vermögensgegenstände <strong>in</strong> ihrer Bilanz zu aktivieren. Es ist <strong>in</strong> diesen Fällen nicht zulässig, e<strong>in</strong>en erhaltenen<br />
Vermögensgegenstand nur mit dem Er<strong>in</strong>nerungswert zu bilanzieren, weil aus dem Geschäftsvorfall<br />
ke<strong>in</strong>e tatsächlich von der Geme<strong>in</strong>de zu zahlenden Anschaffungskosten entstanden s<strong>in</strong>d. Die Geme<strong>in</strong>de muss<br />
GEMEINDEORDNUNG<br />
482
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 91 GO <strong>NRW</strong><br />
vielmehr die erhaltenen Vermögenswerte sowie ggf. damit verbundenen Verpflichtungen <strong>in</strong> ihrem vollen Umfang<br />
bilanzieren. Sie muss daher für solche Vermögensgegenstände die Anschaffungskosten ermitteln, die im Zeitpunkt<br />
des Erwerbs hätten aufgewendet werden müssen, auch wenn ihr durch die H<strong>in</strong>gabe von e<strong>in</strong>em Dritten die<br />
eigene F<strong>in</strong>anzierung dieses Vermögens erspart blieb.<br />
Diese Sachlage zeigt sich auch dadurch, dass für solche Vermögensgegenstände als „zugewendete“ Sachen e<strong>in</strong><br />
entsprechender Sonderposten zu passivieren ist. Der ermittelte aktuelle Zeitwert des erhaltenen Vermögensgegenstandes<br />
stellt dabei den aktivierungsfähigen Anschaffungswert dar und ist auch als Wertansatz für den Sonderposten<br />
zu übernehmen. Dies gilt entsprechend auch bei Straßen, die im Rahmen e<strong>in</strong>er Umwidmung (Vermögensübertragung<br />
ohne Gegenleistungsverpflichtung) <strong>in</strong> das Eigentum e<strong>in</strong>er Geme<strong>in</strong>de übergehen, z.B. e<strong>in</strong>e<br />
Kreisstraße wird Geme<strong>in</strong>destraße. Dabei ist e<strong>in</strong>e getrennte Betrachtung von Straßengrundstück und Straßenkörper<br />
vorzunehmen und entsprechend <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz anzusetzen.<br />
2.1.2 Zu Nummer 2 (Ansatz geme<strong>in</strong>dlicher Verpflichtungen):<br />
2.1.2.1 Der Erfüllungsbetrag als Bilanzansatz<br />
Durch diese Vorschrift werden der Geme<strong>in</strong>de wichtige Grundsätze für den Ansatz ihrer Verpflichtungen <strong>in</strong> ihrer<br />
Bilanz vorgegeben, die von ihr bei der Bilanzierung zu beachten s<strong>in</strong>d. Auch wenn <strong>in</strong> der Vorschrift unterschiedliche<br />
Begriffe zur Anwendung kommen, z.B. s<strong>in</strong>d die geme<strong>in</strong>dlichen Verb<strong>in</strong>dlichkeiten <strong>in</strong> der Bilanz der der Geme<strong>in</strong>de<br />
zu ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Die geme<strong>in</strong>dlichen Rentenverpflichtungen gegenüber Dritten,<br />
für die e<strong>in</strong>e Gegenleistung nicht mehr zu erwarten ist, s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz zu ihrem Barwert anzusetzen.<br />
Aus diesem Vorgehen ist ableitbar, dass grundsätzlich und unter E<strong>in</strong>beziehung des Vorsichtspr<strong>in</strong>zips der<br />
künftige Erfüllungsbetrag den zutreffenden Wertansatz darstellt. Diese E<strong>in</strong>schätzung wird dadurch belegt, dass<br />
für die von der Geme<strong>in</strong>de zu bildenden Rückstellungen die Vorschrift den Grundsatz enthält, dass diese <strong>in</strong> Höhe<br />
des Betrages anzusetzen s<strong>in</strong>d, der voraussichtlich (zur Erfüllung der geme<strong>in</strong>dlichen Verpflichtungen) zukünftig<br />
notwendig ist. Außerdem f<strong>in</strong>det aus der Vorschrift heraus das Höchstwertpr<strong>in</strong>zip bei dieser Bilanzierung Anwendung.<br />
Die Verwendung des Begriffs „Erfüllungsbetrag“ be<strong>in</strong>haltet stärker als die Begriffe „Rückzahlungsbetrag“ oder<br />
„Betrag, der voraussichtlich notwendig ist“ dass die künftig von der Geme<strong>in</strong>de zu erbr<strong>in</strong>gende Leistung die Grundlage<br />
des Passivansatzes se<strong>in</strong> soll. Dieser Bilanzansatz ist damit auch unabhängig davon, ob die Geme<strong>in</strong>de künftig<br />
ihre Verpflichtung durch e<strong>in</strong>e Geldleistung oder Sachleistung zu erfüllen hat. Der Umfang der zu bildenden<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Rückstellungen bemisst sich dabei <strong>in</strong> der Regel nach dem voraussichtlich zukünftigen Erfüllungsbetrag,<br />
der durchaus bei geme<strong>in</strong>dlichen Verb<strong>in</strong>dlichkeiten durch den Rückzahlungsbetrag erfasst ist.<br />
Bei der Bemessung von Rückstellungen kommt aber nicht ausschließlich das Stichtagspr<strong>in</strong>zip zur Anwendung,<br />
d.h. der Ansatz <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz ist nicht danach zu bestimmen, was die Geme<strong>in</strong>de am jeweiligen<br />
Abschlussstichtag aufbr<strong>in</strong>gen müsste, um ihre Verpflichtung zu erfüllen, sondern was sie zukünftig aufbr<strong>in</strong>gen<br />
muss. Von der Geme<strong>in</strong>de muss daher unter Beachtung der GoB auch geprüft werden, ob im weiteren Rückstellungszeitraum<br />
z.B. Kostensteigerungen entstehen. Soweit diese erkennbar s<strong>in</strong>d und zur Veränderung des Erfüllungsbetrages<br />
führen, müssen diese berücksichtigt werden.<br />
2.1.2.2 Der Ansatz von Verb<strong>in</strong>dlichkeiten der Geme<strong>in</strong>de<br />
2.1.2.2.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die geme<strong>in</strong>dlichen Verb<strong>in</strong>dlichkeiten stellen e<strong>in</strong>e Verpflichtung der Geme<strong>in</strong>de gegenüber e<strong>in</strong>em Dritten dar. Die<br />
Ansatzregelung geht davon aus, dass der Geme<strong>in</strong>de i.d.R. e<strong>in</strong> Geldbetrag zugeflossen ist, sodass die geme<strong>in</strong>dli-<br />
GEMEINDEORDNUNG<br />
483
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 91 GO <strong>NRW</strong><br />
chen Verb<strong>in</strong>dlichkeiten <strong>in</strong> der Bilanz der Geme<strong>in</strong>de zu ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen s<strong>in</strong>d. Da für die<br />
Verb<strong>in</strong>dlichkeiten auch die allgeme<strong>in</strong>en Bewertungsgrundsätze zu beachten s<strong>in</strong>d, f<strong>in</strong>det hier das Höchstwertpr<strong>in</strong>zip<br />
und das Vorsichtspr<strong>in</strong>zip Anwendung. Bei von der Geme<strong>in</strong>de aufgenommenen Darlehen kann ggf. e<strong>in</strong>e Differenz<br />
zwischen dem Rückzahlungsbetrag und dem Auszahlungsbetrag bestehen, z.B. durch e<strong>in</strong> Disagio. In den<br />
Fällen, <strong>in</strong> denen der Rückzahlungsbetrag e<strong>in</strong>er geme<strong>in</strong>dlichen Verb<strong>in</strong>dlichkeit höher ist als der erhaltene Auszahlungsbetrag,<br />
darf der Unterschiedsbetrag <strong>in</strong> den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aufgenommen werden.<br />
Dieser bilanzierte Betrag ist dann durch planmäßige jährliche Abschreibungen, die auf die gesamte Laufzeit der<br />
Verb<strong>in</strong>dlichkeit verteilt werden können, aufzulösen (vgl. § 42 Abs. 2 GemHVO <strong>NRW</strong>). Diese Vorgabe be<strong>in</strong>haltet<br />
aber auch die Beachtung des Stichtagspr<strong>in</strong>zips, so dass bezogen auf den jeweiligen Abschlussstichtag die Verb<strong>in</strong>dlichkeiten<br />
der Geme<strong>in</strong>de mit ihrem aktuellen Rückzahlungsbetrag zu bilanzieren s<strong>in</strong>d. Dem Ansatz von Verb<strong>in</strong>dlichkeiten<br />
<strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz muss zudem e<strong>in</strong>e Abgrenzungsprüfung vorausgehen, ob stattdessen<br />
nicht e<strong>in</strong>e Rückstellung anzusetzen ist oder e<strong>in</strong> anzugebendes Haftungsverhältnis besteht. Außerdem s<strong>in</strong>d die<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Verb<strong>in</strong>dlichkeiten im Zeitpunkt ihres Erlöschens auszubuchen, z.B. bei Erfüllung, Aufrechnung<br />
oder Erlass.<br />
2.1.2.2.2 Die Arten der geme<strong>in</strong>dlichen Verb<strong>in</strong>dlichkeiten<br />
Der Ansatz der Verb<strong>in</strong>dlichkeiten <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz orientiert sich im Wesentlichen an den möglichen<br />
Arten von Verb<strong>in</strong>dlichkeiten (vgl. Abbildung).<br />
Verb<strong>in</strong>dlichkeiten <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz<br />
Gliederung nach Arten Weitere Untergliederung<br />
Anleihen<br />
Verb<strong>in</strong>dlichkeiten<br />
aus Krediten für Investitionen<br />
Verb<strong>in</strong>dlichkeiten<br />
aus Krediten zur Liquiditätssicherung<br />
Verb<strong>in</strong>dlichkeiten<br />
aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen<br />
wirtschaftlich gleichkommen<br />
Verb<strong>in</strong>dlichkeiten<br />
aus Lieferungen und Leistungen<br />
Verb<strong>in</strong>dlichkeiten aus Transferleistungen<br />
Sonstige Verb<strong>in</strong>dlichkeiten<br />
(Untergliederung nach örtlichem Bedarf)<br />
- von verbundenen Unternehmen<br />
- von Beteiligungen<br />
- von Sondervermögen<br />
- vom öffentlichen Bereich<br />
- vom privaten Kreditmarkt<br />
(Untergliederung nach örtlichem Bedarf)<br />
(Untergliederung nach örtlichem Bedarf)<br />
(Untergliederung nach örtlichem Bedarf)<br />
(Untergliederung nach örtlichem Bedarf)<br />
(Untergliederung nach örtlichem Bedarf)<br />
Abbildung 87 „Verb<strong>in</strong>dlichkeiten <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz“<br />
Die Verb<strong>in</strong>dlichkeiten der Geme<strong>in</strong>de entstehen i.d.R. aus den geme<strong>in</strong>dlichen Geschäftsbeziehungen, z.B. aus der<br />
Aufnahme von Krediten, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen Dritter. Es können <strong>in</strong> E<strong>in</strong>zelfäl-<br />
GEMEINDEORDNUNG<br />
484
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 91 GO <strong>NRW</strong><br />
len aber auch Anleihen anzusetzen se<strong>in</strong>. Durch die Ausgabe von Schuldverschreibungen (Kommunalobligationen)<br />
werden die Rechte der Gläubiger verbrieft und es entstehen Verb<strong>in</strong>dlichkeiten für die Geme<strong>in</strong>de.<br />
2.1.2.2.3 Der Verb<strong>in</strong>dlichkeitenspiegel<br />
Die Geme<strong>in</strong>de ist nach § 44 Abs. 3 i.V.m. § 47 GemHVO <strong>NRW</strong> verpflichtet, Verb<strong>in</strong>dlichkeitenspiegel löst die<br />
kamerale Übersicht über die Schulden ab. Er weist den Stand und die Entwicklung der Verb<strong>in</strong>dlichkeiten im<br />
Haushaltsjahr detaillierter nach. Die Verb<strong>in</strong>dlichkeiten s<strong>in</strong>d daher im Wesentlichen nach den wichtigsten Arten,<br />
z.B. aus Krediten, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen, abzubilden. Bei den Verb<strong>in</strong>dlichkeiten<br />
aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen ist zudem e<strong>in</strong>e Differenzierung nach Gläubigern vorzunehmen.<br />
Der Verb<strong>in</strong>dlichkeitenspiegel ist nach zwei Systematisierungskriterien zu gliedern, um die Struktur der Verschuldung<br />
der Geme<strong>in</strong>de transparent zu machen. Die Geme<strong>in</strong>de kann zu den Inhalten des Verb<strong>in</strong>dlichkeitenspiegels<br />
noch weitere Zusatz<strong>in</strong>formationen geben. Diese sollen aber die Klarheit und Übersichtlichkeit der Darstellung<br />
nicht bee<strong>in</strong>trächtigen.<br />
2.1.2.3 Der Ansatz von Rentenverpflichtungen<br />
Die Vorschrift bestimmt, dass Rentenverpflichtungen der Geme<strong>in</strong>de, für die e<strong>in</strong>e Gegenleistung nicht mehr zu<br />
erwarten ist, z.B. wenn bei dem Erwerb e<strong>in</strong>es Vermögensgegenstandes auf Rentenbasis, zum Barwert anzusetzen<br />
s<strong>in</strong>d. Derartige Verpflichtungen der Geme<strong>in</strong>de beruhen i.d.R. auf e<strong>in</strong>em Vertrag auf Lebenszeit (sog. Leibrenten<br />
aus dem Erwerb e<strong>in</strong>es Grundstückes (Rentengut) oder von e<strong>in</strong>er festgelegten Langfristigkeit (sog. Zeitrenten).<br />
In beiden Fällen muss die Geme<strong>in</strong>de dem Vertragspartner als Anspruchsberechtigten regelmäßig wiederkehrende<br />
Leistungen, meistens <strong>in</strong> Geld, gewähren. Für beide Fälle muss e<strong>in</strong>e Verpflichtung <strong>in</strong> Höhe des Barwertes<br />
passiviert werden, der bei Leibrenten nach versicherungsmathematischen Grundsätzen und bei Zeitrenten f<strong>in</strong>anzmathemathisch<br />
zu ermitteln ist. Der Barwert ist dabei für die gesamte Laufzeit des Vertrages berechnen. Er<br />
ermittelte Barwert stellt beim Erwerb von Vermögensgegenständen auch deren Anschaffungskosten dar, die zu<br />
aktivieren s<strong>in</strong>d.<br />
2.1.2.4 Der Ansatz von Rückstellungen der Geme<strong>in</strong>de<br />
2.1.2.4.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die geme<strong>in</strong>dlichen Rückstellungen s<strong>in</strong>d nach der Vorschrift nur <strong>in</strong> Höhe des Betrages anzusetzen, der voraussichtlich<br />
notwendig ist, um die Verpflichtungen der Geme<strong>in</strong>de zu erfüllen, soweit diese am Abschlussstichtag der<br />
Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss s<strong>in</strong>d und der dazugehörige Aufwand dem Haushaltsjahr als Verursachungsperiode<br />
zugerechnet werden muss. Von der Geme<strong>in</strong>de dürfen daher Rückstellungen erst dann gebildet<br />
werden, wenn alle Kriterien dafür erfüllt s<strong>in</strong>d. Die geme<strong>in</strong>dlichen Rückstellungen stellen für die Geme<strong>in</strong>de ke<strong>in</strong><br />
Eigenkapital dar, sondern s<strong>in</strong>d vielmehr dem <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz abzubildenden Fremdkapital zuzuordnen.<br />
Sie stellen e<strong>in</strong>e Ergänzung der Verb<strong>in</strong>dlichkeiten der Geme<strong>in</strong>de dar.<br />
Die Bewertung der geme<strong>in</strong>dlichen Rückstellungen ist von der Geme<strong>in</strong>de unter Beachtung des Vorsichtspr<strong>in</strong>zips<br />
vorzunehmen. Dabei kommt grundsätzlich nicht das ausschließliche Stichtagspr<strong>in</strong>zip zur Anwendung, d.h. der<br />
Ansatz <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz ist nicht danach zu bestimmen, was die Geme<strong>in</strong>de am jeweiligen Abschlussstichtag<br />
aufbr<strong>in</strong>gen müsste, um ihre Verpflichtung zu erfüllen, sondern was sie zukünftig im Erfüllungszeitpunkt<br />
aufbr<strong>in</strong>gen müsste. Der notwendige Rückstellungsbetrag ist vorsichtig zu schätzen, wenn er nicht auf e<strong>in</strong>e andere<br />
Art und Weise ermittelt werden kann.<br />
GEMEINDEORDNUNG<br />
485
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 91 GO <strong>NRW</strong><br />
Die Ermittlung des Rückstellungsbetrages erfordert unter E<strong>in</strong>beziehung der betrachteten wirtschaftlichen Verhältnisse<br />
e<strong>in</strong>e nachvollziehbare Begründung. Der Passivierung von Rückstellungen darf zudem ke<strong>in</strong> Ansatzverbot<br />
entgegenstehen. E<strong>in</strong> Ansatz von Rückstellungen <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz ist daher höchstens <strong>in</strong> dem Umfang<br />
zulässig, der den voraussichtlichen zukünftigen Erfüllungsverpflichtungen der Geme<strong>in</strong>de entspricht. Er ist bezogen<br />
auf den jeweiligen Abschlussstichtag zutreffend zu ermittelt. Wird die Rückstellung gebildet oder erhöht,<br />
erfolgt dieses immer zu Lasten der <strong>in</strong> der Ergebnisrechnung enthaltenen Aufwandsart.<br />
2.1.2.4.2 Die Arten der geme<strong>in</strong>dlichen Rückstellungen<br />
Im Zusammenhang mit dieser Vorschrift wird durch die ausdrückliche abschließende Aufzählung der zulässigen<br />
Arten der Rückstellungen <strong>in</strong> § 36 GemHVO <strong>NRW</strong> klargestellt, dass die Geme<strong>in</strong>de nur Rückstellungen für die dort<br />
benannten Zwecke bilden darf. Sie darf daher ke<strong>in</strong>e Rückstellungen für andere Zwecke gebildet werden. Dem<br />
haushaltsrechtlichen Rückstellungsbegriff für die Geme<strong>in</strong>den wird sowohl die sog. statische als auch die dynamische<br />
Bilanzauffassung zu Grunde gelegt. Dem Ansatz von Rückstellungen <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz muss<br />
zudem e<strong>in</strong>e Abgrenzungsprüfung vorausgehen, ob stattdessen nicht e<strong>in</strong>e Verb<strong>in</strong>dlichkeit anzusetzen ist oder e<strong>in</strong><br />
anzugebendes Haftungsverhältnis besteht.<br />
Unter Beachtung des § 88 GO <strong>NRW</strong> und <strong>in</strong> Anlehnung an das Handelsrecht darf die Geme<strong>in</strong>de nur für die Zwecke<br />
Rückstellungen bilden, die <strong>in</strong> § 36 GemHVO <strong>NRW</strong> abschließend bestimmt worden s<strong>in</strong>d und nachfolgend<br />
aufgezeigt werden (vgl. Abbildung).<br />
Rückstellungen nach § 36 GemHVO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 88 GO <strong>NRW</strong><br />
Bilanzielle Behandlung<br />
Passivierungspflicht<br />
Passivierungswahlrecht<br />
Passivierungsverbot<br />
Rückstellungen für<br />
- Pensionen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften<br />
- Rekultivierung und Nachsorge von Deponien und für die<br />
Sanierung von Altlasten<br />
- Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum<br />
Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt s<strong>in</strong>d<br />
- drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus<br />
laufenden Verfahren<br />
- Verpflichtungen für Zwecke, die durch andere Gesetze<br />
bestimmt wurden<br />
- unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen<br />
Sonstige Rückstellungen, die nicht durch Gesetz oder Verordnung<br />
zugelassen s<strong>in</strong>d, z.B.<br />
- künftige Umlagezahlungen der Geme<strong>in</strong>de<br />
- Verpflichtungen im Rahmen des Geme<strong>in</strong>def<strong>in</strong>anzausgleichs<br />
- Verpflichtungen aus der geme<strong>in</strong>dlichen Steuererhebung<br />
Abbildung 88 „Zulässige Rückstellungsarten“<br />
In diesem Zusammen ist darauf zu verweisen, dass Rückstellungen für künftige Umlagezahlungen der Geme<strong>in</strong>de,<br />
Rückstellungen im Rahmen des Geme<strong>in</strong>def<strong>in</strong>anzausgleichs und Rückstellungen aus der geme<strong>in</strong>dlichen Steuererhebung<br />
nicht zulässig s<strong>in</strong>d (vgl. § 36 GemHVO <strong>NRW</strong>). Diese gesetzlich nicht vorgesehene Rückstellungsbildung<br />
führt dazu, dass von der Geme<strong>in</strong>de auch dann ke<strong>in</strong>e Rückstellungen für diese Zwecke gebildet werden<br />
dürfen, wenn sich örtliche Sachverhalte ggf. unter die Bestimmungen des § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
subsumieren lassen.<br />
GEMEINDEORDNUNG<br />
486
2.1.2.4.3 Die Abz<strong>in</strong>sung von Rückstellungen<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 91 GO <strong>NRW</strong><br />
Die e<strong>in</strong>zelnen Rückstellungen der Geme<strong>in</strong>de s<strong>in</strong>d nach dem Nom<strong>in</strong>alwertpr<strong>in</strong>zip zu bemessen bzw. zu bewerten<br />
und dürfen <strong>in</strong> Anlehnung an das Handelsrecht i.d.R. nicht abgez<strong>in</strong>st werden. Es soll gesichert werden, dass von<br />
der Geme<strong>in</strong>de unter Beachtung des Realisationspr<strong>in</strong>zips e<strong>in</strong> entnahmefähiger Betrag (Erfüllungsbetrag) zurückgestellt<br />
wird. Zudem kann davon ausgegangen werden, dass <strong>in</strong> der Mehrzahl der geme<strong>in</strong>dlichen Rückstellungen<br />
ke<strong>in</strong> verdeckter Z<strong>in</strong>s enthalten ist, z.B. bei Sachleistungsverpflichtungen, bei Verpflichtungen aus Bürgschaften<br />
oder Schadenersatzleistungen. E<strong>in</strong>e Abz<strong>in</strong>sung ist bei auch Rückstellungen für Altersteilzeit nicht zulässig, denn<br />
die Ansprüche e<strong>in</strong>er Beamt<strong>in</strong> oder e<strong>in</strong>es Beamten nach dem Altersteilzeitmodell stellen ke<strong>in</strong>e von der Geme<strong>in</strong>de<br />
zu erbr<strong>in</strong>genden abz<strong>in</strong>sbaren Versorgungsleistungen dar.<br />
Diese Sachlage wird auch dadurch deutlich, dass die Rückstellungen für Altersteilzeit unter den „Sonstigen Rückstellungen“<br />
und nicht unter den „Pensionsrückstellungen“ <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz anzusetzen s<strong>in</strong>d. Auch<br />
längerfristige Umweltschutzverpflichtungen, z.B. Rückstellungen für die Rekultivierung von Deponien, s<strong>in</strong>d nicht<br />
abzuz<strong>in</strong>sen. Deshalb ist bei Rückstellungen ke<strong>in</strong>e Trennung <strong>in</strong> Beträge für die Erfüllung der Leistungsverpflichtung<br />
und für die Kapitalnutzung vorzunehmen. Nur bei ihren Pensionsrückstellungen darf die Geme<strong>in</strong>de nach<br />
Maßgabe des § 36 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> e<strong>in</strong>e Abz<strong>in</strong>sung vornehmen, denn die geme<strong>in</strong>dlichen Versorgungsleistungen<br />
s<strong>in</strong>d mit ihrem Barwert und nicht mit dem Nom<strong>in</strong>albetrag <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz anzusetzen. Bei dessen<br />
Ermittlung ist der Berechnung e<strong>in</strong> Rechnungsz<strong>in</strong>s von fünf Prozent zu Grunde zu legen.<br />
2.1.2.4.4 Der Rückstellungsspiegel<br />
Auf der Basis des NKF-Kontenrahmens und der verb<strong>in</strong>dlichen Bilanzgliederung kann sich die Geme<strong>in</strong>de durch<br />
e<strong>in</strong>en Rückstellungsspiegels e<strong>in</strong>en detaillierten Überblick über den Stand und die Veränderungen der Rückstellungen<br />
zum Abschlussstichtag verschaffen. Durch das Aufzeigen des Gesamtbetrags am Ende des Vorjahres,<br />
der Veränderungen aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr und des Gesamtbetrags am Ende des Haushaltsjahres<br />
<strong>in</strong> Bezug auf die e<strong>in</strong>zelnen Arten von Rückstellungen wird die Entwicklung der Rückstellungen der Geme<strong>in</strong>de<br />
verdeutlicht.<br />
Der Rückstellungsspiegel dient u.a. auch dazu, für jeden Verpflichtungsposten, unter dem Beträge zusammen<br />
gefasst s<strong>in</strong>d, die auf unterschiedliche Zeiträume aufzuteilen s<strong>in</strong>d, für jeden Zeitraum den zutreffenden Betrag<br />
anzugeben. E<strong>in</strong> solcher Rückstellungsspiegel trägt erheblich zur Übersichtlichkeit der <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz<br />
angesetzten Rückstellungen bei. Er kann aus örtlichen Erwägungen heraus dem Anhang im Jahresabschluss<br />
beigefügt werden, denn er macht die Wertansätze der Rückstellungen transparent und nachvollziehbar. Die Geme<strong>in</strong>de<br />
kann das Schema des Rückstellungsspiegels auf ihre Bedürfnisse übertragen und ausgestalten (vgl. § 36<br />
GemHVO <strong>NRW</strong>) und dazu auch weitere Zusatz<strong>in</strong>formationen geben.<br />
2.2 Zu Satz 2 (Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung):<br />
2.2.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Durch diese Vorschrift werden für die Bewertung von Vermögen und Verb<strong>in</strong>dlichkeiten allgeme<strong>in</strong>e Grundsätze<br />
unter E<strong>in</strong>beziehung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) aufgestellt, von denen nur abgewichen<br />
werden darf, soweit die Geme<strong>in</strong>deordnung etwas anderes vorsieht. Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung<br />
s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong> gesetzlich verankertes Regelungssystem, stehen jedoch nicht über dem Gesetz. Sie können sich<br />
als unbestimmter Rechtsbegriff nur im Rahmen der gesetzlichen Regelungen unter Beachtung von S<strong>in</strong>n und<br />
Zweck des Gesetzes oder e<strong>in</strong>zelner Vorschriften entwickeln. Als Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung s<strong>in</strong>d<br />
daher jedes Verfahren und jede Methode anzuerkennen, die dazu führen, dass gesetzliche Regelungen im E<strong>in</strong>zelfall<br />
ihrem S<strong>in</strong>n und Zweck entsprechend angewandt werden.<br />
GEMEINDEORDNUNG<br />
487
2.2.2 Inhalte der GoB<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 91 GO <strong>NRW</strong><br />
Im kaufmännischen System ist trotz der Vorschriften über die Buchführung und den Jahresabschluss e<strong>in</strong> Spielraum<br />
geblieben, aus dem durch Auslegungen und Interpretationen die gesetzesergänzenden „Grundsätze ordnungsmäßiger<br />
Buchführung (GoB)“ entwickelt worden s<strong>in</strong>d. Sie s<strong>in</strong>d Regeln, nach denen zu verfahren ist, damit<br />
e<strong>in</strong>e dem Gesetzeszweck entsprechende Buchführung vorgenommen und e<strong>in</strong> Jahresabschluss sowie e<strong>in</strong> Gesamtabschluss<br />
aufgestellt werden. Außerdem s<strong>in</strong>d sie Beurteilungsmaßstäbe für die Entscheidung, ob die Buchführung<br />
und der Jahresabschluss sowie der Gesamtabschluss ordnungsgemäß s<strong>in</strong>d, d.h. ob sie formell und materiell<br />
den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.<br />
Das geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsrecht macht - wie das Handelsrecht - die GoB zur Grundlage der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Buchführung. E<strong>in</strong> Anlass dafür ist, dass beide Rechtsvorschriften nicht alle bilanzierungsfähigen und -pflichtigen<br />
Sachverhalte sowie die dazu erforderlichen Grundsätze detailliert regeln können. Gleichwohl bedeuten die GoB<br />
ke<strong>in</strong>e Gesetzeslücke, sondern e<strong>in</strong>en gewünschten und wichtigen Verweis auf nicht gesetzliche Normen und Erkenntnisse.<br />
Bestehen gesetzliche Regelungen, deren Inhalte oftmals mit den GoB identisch s<strong>in</strong>d, gehen diese<br />
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung vor.<br />
Im Rechnungswesen der Geme<strong>in</strong>den können, ausgehend vom allgeme<strong>in</strong>en Schutzzweck des Rechnungswesens,<br />
die für das kaufmännische Rechnungswesen anerkannten Ziele „Dokumentation“, „Rechenschaft“ und<br />
„Kapitalerhaltung“ e<strong>in</strong>e entsprechende Anwendung f<strong>in</strong>den. Die grundsätzliche Übere<strong>in</strong>stimmung des Rechnungszwecks<br />
ist darauf zurückzuführen, dass das Verhältnis zwischen Rechnungslegendem und Rechnungsadressaten<br />
auch im geme<strong>in</strong>dlichen Bereich e<strong>in</strong>e klassische Stellvertreterbeziehung aufweist, denn hier verwaltet die Geme<strong>in</strong>de<br />
wie e<strong>in</strong> Beauftragter das Vermögen ihrer Bürger treuhänderisch. Daraus lassen sich die Rahmengrundsätze<br />
ableiten, die für die Erfassung und Darstellung der Geschäftsvorfälle sowie deren Sicherung gegen Verlust<br />
und Verfälschung gelten und die materielle und formelle Ordnungsmäßigkeit der Buchführung sichern.<br />
2.2.3 Die e<strong>in</strong>zelnen Grundsätze<br />
Mit der Verwendung des unbestimmten Rechtsbegriffs der GoB wird gewährleistet, dass auf neue Sachverhalte <strong>in</strong><br />
der Praxis den gesetzlichen Anforderungen gemäß reagiert werden kann. Auf e<strong>in</strong>e abschließende Regelung über<br />
die GoB hat der Gesetzgeber bewusst verzichtet, um die fortlaufende Entwicklung und Veränderung nicht zu<br />
bee<strong>in</strong>trächtigen. Folgende allgeme<strong>in</strong>e Grundsätze gelten als Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (vgl.<br />
Abbildung).<br />
Grundsatz der<br />
Vollständigkeit<br />
Grundsatz der<br />
Richtigkeit und Willkürfreiheit<br />
GEMEINDEORDNUNG<br />
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB)<br />
Nach diesem Grundsatz s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> der Buchführung alle Geschäftsvorfälle<br />
sowie die Vermögens- und Schuldenlage vollständig, richtig,<br />
zeitgerecht und geordnet zu erfassen und zu dokumentieren. Daraus<br />
folgt das Erfordernis des systematischen Aufbaus der Buchführung<br />
unter Aufstellung e<strong>in</strong>es Kontenplans, das Pr<strong>in</strong>zip der vollständigen<br />
und verständlichen Aufzeichnung sowie das Belegpr<strong>in</strong>zip,<br />
d.h. die Grundlage für die Richtigkeit der Buchung bildet den Buchungsbeleg<br />
mit der Festlegung „Ke<strong>in</strong>e Buchung ohne Beleg.“<br />
Dazu zählt auch die E<strong>in</strong>haltung der vorgesehenen Aufbewahrungsfristen.<br />
Nach diesem Grundsatz müssen die Aufzeichnungen über die<br />
Geschäftsvorfälle die Realität möglichst genau abbilden, so dass<br />
die Informationen daraus begründbar und nachvollziehbar sowie<br />
objektiv richtig und willkürfrei s<strong>in</strong>d. Sie müssen sich <strong>in</strong> ihren Aussagen<br />
mit den zu Grunde liegenden Dokumenten decken und der<br />
Buchführungspflichtige bestätigen kann, dass die Buchführung e<strong>in</strong>e<br />
488
Grundsatz der<br />
Verständlichkeit<br />
Grundsatz der<br />
Aktualität<br />
Grundsatz der<br />
Relevanz<br />
Grundsatz der<br />
Stetigkeit<br />
Grundsatz des Nachweises<br />
der Recht- und<br />
Ordnungsmäßigkeit<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 91 GO <strong>NRW</strong><br />
getreue Dokumentation se<strong>in</strong>er Geschäftsvorfälle nach den rechtlichen<br />
Bestimmungen und den GoB erfolgt.<br />
Nach diesem Grundsatz s<strong>in</strong>d die Informationen des Rechnungswesens<br />
für den Rat und die Bürger als Öffentlichkeit so aufzubereiten<br />
und verfügbar zu machen, dass die wesentlichen Informationen<br />
über die Vermögens- und Schuldenlage klar ersichtlich und verständlich<br />
s<strong>in</strong>d.<br />
Nach diesem Grundsatz ist e<strong>in</strong> enger zeitlicher Bezug zwischen<br />
dem Zeitraum, über den Rechenschaft gegeben wird, und der<br />
Veröffentlichung der Rechenschaft herzustellen.<br />
Nach diesem Grundsatz muss das Rechnungswesen die Informationen<br />
bieten, die zur Rechenschaft notwendig s<strong>in</strong>d, sich jedoch im<br />
H<strong>in</strong>blick auf die Wirtschaftlichkeit und Verständlichkeit auf die relevanten<br />
Daten beschränken. Dabei soll der Aufwand der Informationsbeschaffung<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em angemessenen Verhältnis zum Nutzen<br />
der Informationsbereitstellung stehen.<br />
Nach diesem Grundsatz sollen die Grundlagen des Rechnungswesens,<br />
<strong>in</strong>sbesondere die Methoden für Ansatz und Bewertung des<br />
Vermögens, <strong>in</strong> der Regel unverändert bleiben, so dass e<strong>in</strong>e Stetigkeit<br />
im Zeitablauf erreicht wird. Notwendige Anpassungen s<strong>in</strong>d<br />
besonders kenntlich zu machen.<br />
Nach diesem Grundsatz ist im Jahresabschluss über die Recht- und<br />
Ordnungsmäßigkeit der Buchführung Rechenschaft abzulegen.<br />
Abbildung 89„Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB)“<br />
Die GoB s<strong>in</strong>d daher e<strong>in</strong> gesetzlich verankertes Regelungssystem. Sie können sich als unbestimmte Rechtsbegriffe<br />
nur im Rahmen der gesetzlichen Regelungen unter Beachtung von S<strong>in</strong>n und Zweck des Gesetzes oder e<strong>in</strong>zelner<br />
Vorschriften weiter entwickeln. Zur Auslegung s<strong>in</strong>d i.d.R. die juristischen Auslegungskriterien heranzuziehen.<br />
Als GoB ist daher jedes Verfahren und jede Methode anzuerkennen, die dazu führen, dass gesetzliche Regelungen<br />
im E<strong>in</strong>zelfall ihrem S<strong>in</strong>n und Zweck entsprechend angewandt werden.<br />
Durch die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) wird jedoch ke<strong>in</strong> bestimmtes Buchführungssystem<br />
vorgeschrieben. Vielmehr entspricht e<strong>in</strong> Buchführungssystem dann den GoB, wenn es so beschaffen ist, dass es<br />
e<strong>in</strong>en Überblick über die Geschäftsvorfälle und die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de<br />
vermitteln kann und die Geschäftsvorfälle sich <strong>in</strong> ihrer Entstehung und sachlichen Zuordnung bzw. Abwicklung<br />
nach verfolgen lassen. Da sich aus diesen Rahmengrundsätzen ggf. Zielkonflikte ergeben können, ist es<br />
bei der örtlichen Ausgestaltung des Rechnungswesens notwendig, bei konkurrierenden Sachverhalten e<strong>in</strong>e Abwägung<br />
vorzunehmen.<br />
2.2.4 Der Grundsatz der <strong>in</strong>tergenerativen Gerechtigkeit<br />
Im Zusammenhang mit den gesetzlich bestimmten Grundsätzen und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung<br />
ist gesondert der Grundsatz der <strong>in</strong>tergenerativen Gerechtigkeit gesetzlich bestimmt worden (vgl. § 1 Abs.<br />
1 S. 3 GO <strong>NRW</strong>). Der Grundsatz der <strong>in</strong>tergenerativen Gerechtigkeit erfordert u.a. die zeitliche Verteilung von<br />
Nutzen und Lasten im geme<strong>in</strong>dlichen Bereich sowie die Tragfähigkeit der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzen auch für die<br />
Zukunft. Die Geme<strong>in</strong>de muss deshalb bei ihrer Haushaltsplanung und Haushaltsausführung unter Beachtung der<br />
übrigen geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsgrundsätze immer im Blick haben muss, auch ausreichende Handlungsmöglichkeiten<br />
für die künftigen Generationen zu erhalten.<br />
GEMEINDEORDNUNG<br />
489
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 91 GO <strong>NRW</strong><br />
Dieser Grundsatz wird dadurch ergänzt, dass bestimmt worden ist, „Die Geme<strong>in</strong>den haben ihr Vermögen und ihre<br />
E<strong>in</strong>künfte so zu verwalten, dass die Geme<strong>in</strong>def<strong>in</strong>anzen gesund bleiben“ (vgl. § 10 S. 1 GO <strong>NRW</strong>). Er be<strong>in</strong>haltet,<br />
dass die Geme<strong>in</strong>den <strong>in</strong> Verantwortung für die künftigen Generationen handeln müssen, denn die Perspektive der<br />
ausreichenden F<strong>in</strong>anzierung künftiger Aufgaben wurde für die Geme<strong>in</strong>de mit dem Konzept der Generationengerechtigkeit<br />
verknüpft (vgl. Abbildung).<br />
Intergenerative Gerechtigkeit<br />
Grundsatz der <strong>in</strong>tergenerativen Gerechtigkeit<br />
§ 1 Abs. 1 S. 3 GO <strong>NRW</strong><br />
Abbildung 90 „Intergenerative Gerechtigkeit“<br />
Der Grundsatz be<strong>in</strong>haltet deshalb u.a. auch, dass die Geme<strong>in</strong>de ke<strong>in</strong>e rücksichtslose Inanspruchnahme der Abgabepflichtigen<br />
vornehmen darf. Im Zusammenhang mit geme<strong>in</strong>dlichen Geschäftsvorfällen gilt es daher zu beurteilen,<br />
<strong>in</strong> welchem Umfang künftige Generationen von den Auswirkungen gegenwärtiger geme<strong>in</strong>dliche Haushaltspolitik<br />
betroffen s<strong>in</strong>d und welche Leistungskraft der Geme<strong>in</strong>de künftig noch vorhanden se<strong>in</strong> wird.<br />
2.2.5 Wichtige gesetzlich bestimmte Grundsätze<br />
Die wichtigsten Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung s<strong>in</strong>d für die Umsetzung durch die Geme<strong>in</strong>den <strong>in</strong> vielen<br />
Vorschriften der Geme<strong>in</strong>deordnung und der Geme<strong>in</strong>dehaushaltsverordnung konkretisiert worden. Zu den <strong>in</strong><br />
diesen Vorschriften gesetzlich bestimmten Grundsätzen über die geme<strong>in</strong>dliche Buchführung, die geme<strong>in</strong>dliche<br />
Bilanz und den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>e Vielzahl von Grundsätzen zu zählen (vgl. Abbildung).<br />
GEMEINDEORDNUNG<br />
Wichtige gesetzlich bestimmte Grundsätze<br />
Bezeichnung<br />
Grundsätze zur geme<strong>in</strong>dlichen Buchführung<br />
Grundsatz der Klarheit<br />
Grundsatz der Richtigkeit<br />
Grundsatz der Buchführungswahrheit<br />
Grundsatz der Übersichtlichkeit<br />
Grundsatz der Aktualität<br />
Grundsatz der Verständlichkeit<br />
Grundsatz der Vollständigkeit<br />
Belegpr<strong>in</strong>zip<br />
Vorschriften<br />
§ 27 Abs. 1, § 41 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 27 Abs. 2 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 27 Abs. 2 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 27 Abs. 2 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 96, § 116 GO <strong>NRW</strong>, § 27 Abs. 2<br />
GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 27 Abs. 2 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 91 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>, § 27 Abs. 1 und<br />
2, § 41 Abs. 1 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 27 Abs. 3 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
Grundsätze zur geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz (Jahresabschluss)<br />
§ 41 Abs. 1 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
490
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 91 GO <strong>NRW</strong><br />
Aktivierungsgrundsatz<br />
Passivierungsgrundsatz<br />
Grundsatz der Stetigkeit<br />
Grundsatz der Bilanzidentität<br />
(formelle Bilanzkont<strong>in</strong>uität)<br />
Grundsatz der Bilanzierungswahrheit<br />
Stichtagspr<strong>in</strong>zip<br />
Grundsatz der Bilanzidentität<br />
Grundsatz der E<strong>in</strong>zelbewertung<br />
Grundsatz der Vorsicht<br />
Grundsatz der Periodenabgrenzung<br />
Grundsatz der Bewertungsstetigkeit<br />
(materielle Bilanzkont<strong>in</strong>uität)<br />
Anschaffungswertpr<strong>in</strong>zip<br />
Grundsatz des Saldierungsverbots<br />
Grundsatz des Nachweises<br />
der Recht- und Ordnungsmäßigkeit<br />
§ 41 Abs. 1 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 32 Abs. 1 Nr. 5, § 41 Abs. 5 GemHVO<br />
<strong>NRW</strong><br />
§ 32 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 95, § 116 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 95 Abs. 1, § 116 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 32 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 32 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 91 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>, § 32 Abs. 1 Nr. 3,<br />
§ 35 Abs. 7 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 32 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 32 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 91 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 41 Abs. 2 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 95 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong><br />
Grundsätze zum geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss<br />
Grundsatz der Fiktion der rechtlichen E<strong>in</strong>heit<br />
Grundsatz der E<strong>in</strong>heitlichkeit des Ausweises<br />
Grundsatz der Vollständigkeit<br />
des Konsolidierungskreises<br />
Grundsatz der Elim<strong>in</strong>ierung<br />
„konzern<strong>in</strong>terner“ Beziehungen<br />
Grundsatz der Wesentlichkeit<br />
§ 116 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 49 Abs. 3 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 116 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 50 GemHVO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 303 HGB<br />
§ 116 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong><br />
Abbildung 91 „Wichtige gesetzlich bestimmte Grundsätze“<br />
Jeder dieser Grundsätze soll sicherstellen, dass e<strong>in</strong> sachverständiger Dritter sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er angemessenen Zeit<br />
e<strong>in</strong>en Überblick über die Aufzeichnung von Buchungsvorfällen und die Aufzeichnung von Vermögens- und Schuldenpositionen<br />
verschaffen kann und Manipulationsmöglichkeiten verh<strong>in</strong>dert werden, aber auch, dass diesem<br />
Dritten e<strong>in</strong> qualifizierter E<strong>in</strong>blick <strong>in</strong> die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anz(gesamt)lage der Geme<strong>in</strong>de<br />
GEMEINDEORDNUNG<br />
491
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 91 GO <strong>NRW</strong><br />
möglich ist. Zudem sorgt die Auslegung der GoB durch Rechtsprechung und Literatur mittelbar für e<strong>in</strong>e dynamische<br />
Anpassung des Rechts über das geme<strong>in</strong>dliche Rechnungswesen an die aktuellen nationalen und <strong>in</strong>ternationalen<br />
Entwicklungen.<br />
GEMEINDEORDNUNG<br />
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ<br />
492
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 92 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 92<br />
Eröffnungsbilanz<br />
(1) 1 Die Geme<strong>in</strong>de hat zu Beg<strong>in</strong>n des Haushaltsjahres, <strong>in</strong> dem sie erstmals ihre Geschäftsvorfälle nach dem<br />
System der doppelten Buchführung erfasst, e<strong>in</strong>e Eröffnungsbilanz unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger<br />
Buchführung aufzustellen, soweit <strong>in</strong> Gesetz oder Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist. 2 Die Vorschriften<br />
der § 95 Abs. 3 und § 96 s<strong>in</strong>d entsprechend anzuwenden.<br />
(2) Die Eröffnungsbilanz und der Anhang haben zum Bilanzstichtag unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger<br />
Buchführung e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und der Schuldenlage<br />
der Geme<strong>in</strong>de zu vermitteln.<br />
(3) 1 Die Ermittlung der Wertansätze für die Eröffnungsbilanz ist auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten<br />
Zeitwerten vorzunehmen. 2 Die <strong>in</strong> der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten<br />
für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten, soweit nicht Wertberichtigungen<br />
nach Absatz 7 vorgenommen werden.<br />
(4) 1 Die Eröffnungsbilanz und der Anhang s<strong>in</strong>d dah<strong>in</strong>gehend zu prüfen, ob sie e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen<br />
entsprechendes Bild der Lage der Geme<strong>in</strong>de nach Absatz 2 vermitteln. 2 Die Prüfung erstreckt sich darauf, ob die<br />
gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Bestimmungen beachtet worden s<strong>in</strong>d.<br />
(5) 1 Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft die Eröffnungsbilanz. 2 Er hat die Inventur, das Inventar und die<br />
Übersicht über örtlich festgelegte Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände <strong>in</strong> se<strong>in</strong>e Prüfung e<strong>in</strong>zubeziehen.<br />
3 Über Art und Umfang der Prüfung sowie über das Ergebnis der Prüfung ist e<strong>in</strong> Prüfungsbericht zu erstellen.<br />
4 5<br />
Der Bestätigungsvermerk oder der Vermerk über se<strong>in</strong>e Versagung ist <strong>in</strong> den Prüfungsbericht aufzunehmen. §<br />
101 Abs. 2 bis 8, § 103 Abs. 4, 5 und 7, § 104 Abs. 4 und § 105 Abs. 8 f<strong>in</strong>den entsprechende Anwendung.<br />
(6) Die Eröffnungsbilanz unterliegt der überörtlichen Prüfung nach § 105.<br />
(7) 1 Ergibt sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse, dass <strong>in</strong> der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände<br />
oder Sonderposten oder Schulden fehlerhaft angesetzt worden s<strong>in</strong>d, so ist der Wertansatz zu berichtigen<br />
oder nachzuholen. 2 Die Eröffnungsbilanz gilt dann als geändert. 3 E<strong>in</strong>e Berichtigung kann letztmals im vierten der<br />
Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden. 4 Vorherige Jahresabschlüsse s<strong>in</strong>d nicht zu<br />
berichtigen.<br />
Erläuterungen zu § 92:<br />
I. Allgeme<strong>in</strong>es<br />
1. Die besondere Stellung der Eröffnungsbilanz<br />
Die Eröffnungsbilanz bildet e<strong>in</strong>en wesentlichen Bestandteil des NKF als neues Rechnungswesen der Geme<strong>in</strong>den.<br />
Sie wird für die Geme<strong>in</strong>de und ihre Bürger<strong>in</strong>nen und Bürger e<strong>in</strong>e erhebliche Bedeutung haben. Erstmalig wird im<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Bereich e<strong>in</strong>e systematische Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden vorgenommen, aus<br />
der die wirtschaftliche Lage der Geme<strong>in</strong>de erkennbar ist. Hierbei werden die (kaufmännischen) Grundsätze ordnungsmäßiger<br />
Buchführung zu Grunde gelegt, soweit nicht die Besonderheiten des geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswesens<br />
davon Abweichungen erforderlich machen. Der Eröffnungsbilanz als erste Bilanz der Geme<strong>in</strong>de kommt e<strong>in</strong>e<br />
Sonderstellung zu, weil <strong>in</strong> kurzer Zeit sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden bei laufender Geschäftstätigkeit<br />
zu erfassen und zu bewerten s<strong>in</strong>d. Diese Wertermittlung für die Eröffnungsbilanz soll auf der Basis von<br />
GEMEINDEORDNUNG 493
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 92 GO <strong>NRW</strong><br />
vorsichtig geschätzten Zeitwerten erfolgen. Diese Entscheidung basiert auf folgenden Überlegungen (vgl. Abbildung).<br />
Zeitwerte <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Eröffnungsbilanz<br />
- Die Eröffnungsbilanz steht am Beg<strong>in</strong>n der doppischen Rechnungslegung der Geme<strong>in</strong>de, die<br />
deshalb – wie handelsrechtlich für jeden Kaufmann zu Beg<strong>in</strong>n se<strong>in</strong>er Tätigkeit vorgeschrieben –<br />
e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen der Vermögens- und Schuldenlage entsprechendes Bild<br />
vermitteln muss.<br />
- Die Bewertung von sämtlichen Vermögensgegenständen und Schulden der Geme<strong>in</strong>de wird<br />
nicht als Selbstzweck verstanden. Die Maßgabe für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz soll<br />
deshalb e<strong>in</strong>e zügige und <strong>in</strong> der Grundausrichtung konsistente Bewertung des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Vermögens unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitspr<strong>in</strong>zips und des Grundsatzes der<br />
Wesentlichkeit se<strong>in</strong>.<br />
- E<strong>in</strong>e Bewertung der Vermögensgegenstände nur nach Anschaffungs- und Herstellungskosten<br />
steht nicht mit den Zielen der Aktualität und der Rechenschaft <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang.<br />
- Auch im H<strong>in</strong>blick auf die praktische Umsetzung, z.B. Rückgriff auf die Wertermittlungsverordnung<br />
bei der Bewertung von Grundstücken, ist die Bewertung des geme<strong>in</strong>dlichen Vermögens<br />
nach vorsichtig geschätzten Zeitwerten (Verkehrswert) vorteilhaft.<br />
- Mit den Zielsetzungen des NKF, <strong>in</strong>sbesondere mit den Zielen „Aktualität“ und „<strong>in</strong>tergenerative<br />
Gerechtigkeit“, vertreten vergleichbare neuere wissenschaftliche Diskussionen zunehmend die<br />
Auffassung, dass für die Bestimmung der Anschaffungskosten auch <strong>in</strong> der handelsrechtlichen<br />
Eröffnungsbilanz stets von Zeitwerten auszugehen ist.<br />
- Die grundsätzliche Bedeutung der Bewertung von Vermögensgegenständen nach Anschaffungs-<br />
und Herstellungskosten aus dem kaufmännischen Rechnungswesen bleibt auch bei e<strong>in</strong>er<br />
Bewertung auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten erhalten, denn die ermittelten<br />
Zeitwerte stellen am Stichtag der Eröffnungsbilanz „fiktive“ Anschaffungs- und Herstellungskosten<br />
dar und dienen als Basis für die zukünftigen Abschreibungen.<br />
- Für die Festlegung der Bewertung der Vermögensgegenstände nach vorsichtig geschätzten<br />
Zeitwerten hat sich auch das Institut der Deutschen Wirtschaftsprüfer ausgesprochen.<br />
Abbildung 92 „Zeitwerte <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Eröffnungsbilanz“<br />
Die Erstellung der geme<strong>in</strong>dlichen Eröffnungsbilanz ist zudem mit der Eröffnungsbilanz e<strong>in</strong>es Unternehmens <strong>in</strong><br />
den neuen Bundesländern nach der Vere<strong>in</strong>igung Deutschlands nach dem D-Markbilanzgesetz 1990 vergleichbar,<br />
denn dort waren bei laufender Geschäftstätigkeit <strong>in</strong> kurzer Zeit sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden<br />
zu erfassen und zu bewerten. Die für die Erstellung der Eröffnungsbilanz erforderliche Inventarisierung und Bewertung<br />
des gesamten Vermögens- und Schuldenbestandes bedeutet für die Geme<strong>in</strong>den e<strong>in</strong>en erheblichen Aufwand.<br />
Die Erstellung der Eröffnungsbilanz wird auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet. Deshalb<br />
s<strong>in</strong>d bei dieser Ausgangslage Vere<strong>in</strong>fachungsregeln zugelassen worden.<br />
GEMEINDEORDNUNG 494
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 92 GO <strong>NRW</strong><br />
2. Die Erfassung von Vermögen und Schulden <strong>in</strong> der Eröffnungsbilanz<br />
2.1 Die Abbildung von Vermögen und Schulden<br />
Für die Eröffnungsbilanz der Geme<strong>in</strong>den gilt, dass diese e<strong>in</strong>heitlich auf der Aktiv- sowie auf der Passivseite gegliedert<br />
se<strong>in</strong> müssen. Die M<strong>in</strong>destgliederung für die geme<strong>in</strong>dliche Eröffnungsbilanz ergibt sich durch die ausdrückliche<br />
Regelung <strong>in</strong> § 53 Abs. 1 S. 2, 1, Halbsatz GemHVO <strong>NRW</strong>, das die Eröffnungsbilanz entsprechend §<br />
41 Abs. 3 und 4 GemHVO <strong>NRW</strong> zu gliedern ist. Außerdem wird die geme<strong>in</strong>dliche Eröffnungsbilanz wird – wie die<br />
späteren Bilanzen im geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss – <strong>in</strong> Kontoform aufgestellt und muss die vorgeschriebenen<br />
Posten <strong>in</strong> der für die Geme<strong>in</strong>den spezifischen Gliederung nach den aufgeführten Vorschriften enthalten. In diesem<br />
Zusammenhang werden auf der Aktivseite die Bilanzbereiche „Anlagevermögen“ und „Umlaufvermögen“ und<br />
auf der Passivseite die Bilanzbereiche „Eigenkapital“, „Sonderposten“, „Rückstellungen“ und „Verb<strong>in</strong>dlichkeiten“<br />
ausgewiesen und beide Bilanzseiten mit der „Rechnungsabgrenzung“ abgeschlossen. Das nachfolgende Gliederungsschema<br />
zeigt diese Gegebenheiten auf (vgl. Abbildung).<br />
Aktiva<br />
Gliederungsschema für die Eröffnungsbilanz<br />
1. Anlagevermögen<br />
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände<br />
1.2 Sachanlagen<br />
1.3 F<strong>in</strong>anzanlagen<br />
2. Umlaufvermögen<br />
2.1 Vorräte<br />
2.2 Forderungen und sonstige<br />
Vermögensgegenstände<br />
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens<br />
2.4 Liquide Mittel<br />
3. Aktive Rechnungsabgrenzung<br />
Passiva<br />
1. Eigenkapital<br />
1.1 Allgeme<strong>in</strong>e Rücklage<br />
1.2 Sonderrücklagen<br />
1.3 Ausgleichsrücklage<br />
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag<br />
1. Sonderposten<br />
2. Rückstellungen<br />
3. Verb<strong>in</strong>dlichkeiten<br />
4. Passive Rechnungsabgrenzung<br />
Abbildung 93 „Gliederungsschema für die Eröffnungsbilanz“<br />
Der geme<strong>in</strong>dlichen Eröffnungsbilanz ist e<strong>in</strong> Anhang (vgl. § 44 GemHVO <strong>NRW</strong>) beizufügen, <strong>in</strong> dem die gewählten<br />
Ansatz- und Bewertungsmethoden, aber z.B. auch Abweichungen von der o.a. M<strong>in</strong>destgliederung der Bilanz,<br />
beschrieben werden (vgl. § 53 Abs. 1 S. 2, 2, Halbsatz GemHVO <strong>NRW</strong>). Dem Anhang s<strong>in</strong>d als Anlagen e<strong>in</strong> Forderungsspiegel<br />
nach § 46 GemHVO <strong>NRW</strong> und e<strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dlichkeitenspiegel nach § 47 GemHVO <strong>NRW</strong> beizufügen<br />
(vgl. § 53 GemHVO <strong>NRW</strong>). Der Eröffnungsbilanz der Geme<strong>in</strong>de ist zudem noch e<strong>in</strong> Lagebericht (vgl. § 48<br />
GemHVO <strong>NRW</strong>) beizufügen. Diese Vorgaben tragen dazu bei, dass die örtliche Eröffnungsbilanz und der Anhang<br />
zum Eröffnungsbilanzstichtag unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung e<strong>in</strong> den tatsächlichen<br />
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und der Schuldenlage der Geme<strong>in</strong>de vermitteln.<br />
2.2 Die Bewertung von Vermögen und Schulden<br />
Zu Beg<strong>in</strong>n des NKF als neuem Rechnungswesen ist e<strong>in</strong> realistisches und aktuelles Bild der Vermögens- und<br />
Schuldenlage der Geme<strong>in</strong>de zu schaffen. Daraus ergibt sich, die Anforderung, für den Ansatz der Vermögensgegenstände<br />
<strong>in</strong> der Eröffnungsbilanz stichtagsbezogen vorsichtig geschätzte Zeitwerte zu ermitteln (vgl. § 92 Abs. 3<br />
GO <strong>NRW</strong>). Die Ermittlung der Wertansätze für die Vermögensgegenstände und Schulden muss zudem durch<br />
geeignete Verfahren sowie unter Beachtung bestimmter Vorschriften der Geme<strong>in</strong>dehaushaltsverordnung, die<br />
auch für den Dauerbetrieb gelten, vorgenommen werden. Damit wird von vornhere<strong>in</strong> die Stetigkeit <strong>in</strong> der Bewertung<br />
gewährleistet. Auch die Restnutzungsdauer der abnutzbaren Vermögensgegenstände des Anlagevermögens<br />
wird dadurch an den Regelungen für den Dauerbetrieb orientiert. Außerdem wird sichergestellt, dass bei der<br />
GEMEINDEORDNUNG 495
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 92 GO <strong>NRW</strong><br />
Bewertung der Vermögensgegenstände mögliche Mängel oder Schäden ggf. <strong>in</strong> Form e<strong>in</strong>er Rückstellungsbildung<br />
<strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz <strong>in</strong> ausreichendem Maße Beachtung f<strong>in</strong>den.<br />
Die an das kaufmännische Recht angelehnten allgeme<strong>in</strong>en Bewertungsanforderungen, die auch im Dauerbetrieb<br />
<strong>in</strong> Form von E<strong>in</strong>zelbewertung, Vorsichtspr<strong>in</strong>zip u.a. Anwendung f<strong>in</strong>den, bedürfen für die Eröffnungsbilanz ke<strong>in</strong>er<br />
nochmaligen e<strong>in</strong>gehenden Darstellung. Es reicht dafür die Festlegung aus, dass bei der Bewertung der Vermögensgegenstände<br />
und Schulden die §§ 32 bis 36 und §§ 41 bis 43 GemHVO <strong>NRW</strong> e<strong>in</strong>e entsprechende Anwendung<br />
f<strong>in</strong>den, soweit nicht nach den §§ 55 und 56 GemHVO <strong>NRW</strong> zu verfahren ist. Das Gleiche gilt für die Regelung<br />
<strong>in</strong> Absatz 1 Satz 3 dieser Vorschrift. Durch Absatz 2 wird ergänzend klargestellt, dass Rückstellungen nicht<br />
zu e<strong>in</strong>er Verr<strong>in</strong>gerung des Wertansatzes bei Vermögensgegenständen führen dürfen. Diese Regelungen erhalten<br />
den Geme<strong>in</strong>den trotz ihres Umfanges und der notwendigen Beachtung der GoB sowie der Bewertungsvere<strong>in</strong>fachungen<br />
nach § 56 GemHVO <strong>NRW</strong> e<strong>in</strong>en ausreichenden Spielraum für die E<strong>in</strong>beziehung und Berücksichtigung<br />
örtlicher Gegebenheiten <strong>in</strong> die Ermittlung der Wertansätze für die Eröffnungsbilanz.<br />
Für die Ermittlung des vorsichtig geschätzten Zeitwertes ist zu beachten, dass vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz<br />
die Abnutzung von Vermögensgegenständen haushaltswirtschaftlich nicht <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Vermögensrechnung<br />
erfasst wurde. Daher kann bei der Ermittlung der Werte der Vermögensgegenstände die bisherige Nutzung nicht<br />
als Abschreibungen erfasst und von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder dem Neuwert <strong>in</strong> Abzug<br />
gebracht werden. Entspricht der <strong>in</strong> der Eröffnungsbilanz anzusetzende Vermögensgegenstand nicht mehr dem<br />
Neuwert, kann diese Abweichung nur als Alterswertm<strong>in</strong>derung oder <strong>in</strong> Form von Abschlägen für Mängel oder<br />
Schäden <strong>in</strong> die Wertermittlung e<strong>in</strong>bezogen werden.<br />
Zur Bestimmung des Umfanges solcher Wertm<strong>in</strong>derungen können vielfach die gleichen Methoden zur Anwendung<br />
kommen wie nach dem Stichtag der Eröffnungsbilanz zur Ermittlung des Ressourcenverbrauchs im NKF<br />
durch Abschreibungen. Gleichwohl besteht ke<strong>in</strong>e Identität der Sachverhalte. Daher ist es sachlich nicht zutreffend,<br />
wenn im Rahmen der Ermittlung der Wertansätze der Vermögensgegenstände für die bisherige Nutzungszeit<br />
Abschreibungen oder für Wertm<strong>in</strong>derungen dann „außergewöhnliche Abschreibungen“ <strong>in</strong> die Berechnung<br />
e<strong>in</strong>bezogen werden. Es ist zum Verständnis der Sachverhalte, aber zur Vermeidung von Unklarheiten und Unsicherheiten<br />
notwendig, auch durch Begrifflichkeiten e<strong>in</strong>e klare Trennung zwischen der Zeit vor der Eröffnungsbilanz<br />
und der Zeit nach der Eröffnungsbilanz zu ziehen.<br />
3. Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB)<br />
Im kaufmännischen Rechnungswesen haben sich im Laufe der Zeit bestimmte Regeln und Grundsätze entwickelt,<br />
die als Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) von der Rechtsprechung, Verwaltung und Praxis<br />
geprägt wurden. Die GoB s<strong>in</strong>d teilweise gesetzlich bestimmt, <strong>in</strong>sbesondere durch das Handelsgesetzbuch (HGB)<br />
und die Abgabenordnung (AO). Wesentliche GoB f<strong>in</strong>den sich <strong>in</strong> den §§ 238 ff. HGB, <strong>in</strong>sbesondere §§ 246 - 251<br />
HGB (Ansatzvorschriften) und §§ 252 - 256 HGB (Bewertungsvorschriften), sowie §§ 145, 146 AO. Es handelt<br />
sich dabei um e<strong>in</strong>en unbestimmten Rechtsbegriff, der sich ständig fortentwickelt. Die GoB umfassen den gesamten<br />
Bereich der kaufmännischen Rechnungslegung. Dazu gehören nicht nur die Führung der Bücher, sondern<br />
auch der Jahresabschluss mit Bilanzierung und Bewertung und die Inventur.<br />
Die GoB gelten verb<strong>in</strong>dlich und unabhängig von Rechtsformen für alle Kaufleute. Sie liegen zukünftig auch dem<br />
kommunalen <strong>F<strong>in</strong>anzmanagement</strong> zu Grunde, soweit <strong>in</strong> Gesetz oder Rechtsverordnung für die Geme<strong>in</strong>den nichts<br />
anderes bestimmt ist. Soweit die GoB <strong>in</strong> den Vorschriften der Geme<strong>in</strong>deordnung und der Geme<strong>in</strong>dehaushaltsverordnung<br />
nicht konkretisiert werden, gelten sie s<strong>in</strong>ngemäß wie im privatrechtlichen Bereich, stehen aber nicht über<br />
dem Gesetz. Sie s<strong>in</strong>d als e<strong>in</strong> gesetzlich verankertes Regelungssystem zu verstehen und können sich als unbestimmter<br />
Rechtsbegriff im Rahmen der gesetzlichen Regelungen und unter Beachtung von S<strong>in</strong>n und Zweck des<br />
Gesetzes oder e<strong>in</strong>zelner Vorschriften weiterentwickeln. Als Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung s<strong>in</strong>d daher<br />
jedes Verfahren und jede Methode anzuerkennen, die dazu führen, dass gesetzliche Regelungen im E<strong>in</strong>zelfall<br />
GEMEINDEORDNUNG 496
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 92 GO <strong>NRW</strong><br />
ihrem S<strong>in</strong>n und Zweck entsprechend angewandt werden. Diese Grundsätze lassen sich wie folgt untergliedern<br />
(vgl. Abbildung).<br />
Grundsätze<br />
ordnungsmäßiger<br />
Buchführung (GoB),<br />
Grundsätze<br />
ordnungsmäßiger<br />
DV-gestützter Buchführungssysteme<br />
(GoBS)<br />
Grundsätze<br />
ordnungsmäßiger<br />
Datenverarbeitung (GoDV)<br />
Grundsätze<br />
ordnungsmäßiger<br />
Inventur (GoI)<br />
Grundsätze<br />
ordnungsmäßiger<br />
Bilanzierung (GoBi)<br />
Grundsätze<br />
ordnungsmäßiger<br />
Lageberichterstattung (GoL)<br />
Grundsätze<br />
ordnungsmäßiger<br />
Abschlussprüfungen (GoA)<br />
Grundsätze<br />
ordnungsmäßiger<br />
Konzernrechnungslegung (GoK)<br />
Grundsätze<br />
ordnungsmäßiger<br />
Kapitalflussrechnung (GoKfr)<br />
Grundsätze<br />
ordnungsmäßiger<br />
Risikoüberwachung (GoR)<br />
Wichtige Grundsätze<br />
Die eigentlichen Grundsätze, die sich auf die laufende Buchführung<br />
beziehen und die Art der Erfassung und Darstellung der Geschäftsvorfälle<br />
sowie deren Schutz vor Verlust und Verfälschung regeln.<br />
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sollen sicherzustellen,<br />
dass die Buchungen und sonstigen Aufzeichnungen vollständig, richtig,<br />
zeitgerecht und geordnet vorgenommen werden, wenn die Buchführung<br />
mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung erfolgt (vgl. § 27<br />
Abs. 5 GemHVO <strong>NRW</strong>)<br />
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Datenverarbeitung wurden zur<br />
Erfüllung der ordnungsmäßigen Buchführung und Bilanzierung bei<br />
e<strong>in</strong>er DV-Buchführung entwickelt und umfassen im Wesentlichen die<br />
Sicherheit, die Funktionserfüllung und die Dokumentation.<br />
Die Grundsätze beziehen sich auf die Erstellung des Inventars und<br />
sollen sicherstellen, dass <strong>in</strong> der Inventur e<strong>in</strong>e vollständige Erfassung<br />
des Vermögens und der Schulden erfolgt (vgl. § 91 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. §<br />
28 und 29 GemHVO <strong>NRW</strong>)<br />
Die Grundsätze der Aktivierung, Passivierung und Bewertung werden<br />
weiter detailliert. Dazu gehören auch die Grundsätze für die Bilanzgliederung<br />
(vgl. z.B. § 41 bis 43 GemHVO <strong>NRW</strong>)<br />
Die Grundsätze spezifizieren die Anforderungen für die durch den<br />
Lagebericht vorzunehmende Informationsvermittlung (vgl. § 48<br />
GemHVO <strong>NRW</strong>)<br />
Die Grundsätze f<strong>in</strong>den h<strong>in</strong>sichtlich der jährlichen Abschlussprüfung<br />
Anwendung. Diese be<strong>in</strong>halten u.a. Festlegungen zu den Prüfungshandlungen.<br />
Außerdem bestehen noch weitere Ergänzungen dieser<br />
Grundsätze durch die „Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung<br />
bei Abschlussprüfungen“ sowie die „Grundsätze für die ordnungsmäßige<br />
Erteilung von Bestätigungsvermerken bei Abschlussprüfungen“.<br />
Die Grundsätze f<strong>in</strong>den bei der Aufstellung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses<br />
Anwendung (vgl. § 116 GO <strong>NRW</strong>)<br />
Die Grundsätze f<strong>in</strong>den bei der Aufstellung der geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtkapitalflussrechnung<br />
Anwendung und sollen zu e<strong>in</strong>er sachgerechten<br />
Erstellung beitragen (vgl. § 51 Abs. 3 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
Die Grundsätze s<strong>in</strong>d für die pflichtgemäße Risikoüberwachung entwickelt<br />
worden. Sie be<strong>in</strong>halten die allgeme<strong>in</strong>en Handlungsvorgaben<br />
bzw. Handlungsempfehlungen zur Ausgestaltung e<strong>in</strong>es Risikoüberwachungssystems.<br />
Abbildung 94 „Wichtige Grundsätze“<br />
Diese Grundsätze sollen sicherstellen, dass e<strong>in</strong> sachverständiger Dritter sich <strong>in</strong> angemessener Zeit e<strong>in</strong>en Überblick<br />
über die Aufzeichnung von Buchungsvorfällen und die Aufzeichnung von Vermögens- und Schuldenpositionen<br />
verschaffen kann. Es ist dazu nicht festgelegt worden, welches Maß an Sachverstand erforderlich se<strong>in</strong> muss,<br />
GEMEINDEORDNUNG 497
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 92 GO <strong>NRW</strong><br />
um die geme<strong>in</strong>dliche Tätigkeit im jeweils betroffenen Produkt- bzw. Aufgabenbereich beurteilen und nachvollziehen<br />
zu können. Allgeme<strong>in</strong> wird davon auszugehen se<strong>in</strong>, dass e<strong>in</strong> sachverständiger Dritter ausreichende Kenntnisse<br />
über die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft bzw. das Rechnungswesen der Geme<strong>in</strong>de besitzen muss, damit<br />
er die Ausführung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft und deren Ergebnis im geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss<br />
sowie im Gesamtabschluss der Geme<strong>in</strong>de verstehen und beurteilen kann. Dabei wird auch die Größe der Geme<strong>in</strong>de<br />
sowie die Größe und Komplexität der geme<strong>in</strong>dlichen Buchführung e<strong>in</strong>schließlich der Art der örtlichen DV-<br />
Buchführung zu berücksichtigen se<strong>in</strong>.<br />
Bei der Beurteilung, ob e<strong>in</strong> sachverständiger Dritter sich <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>er angemessenen Zeit e<strong>in</strong>en Überblick über<br />
die Vorgehensweise und die Ergebnisse der geme<strong>in</strong>dlichen Inventur verschaffen kann, ist ebenfalls von den<br />
vorhandenen örtlichen Gegebenheiten auszugehen. Die Bestimmung der angemessenen Zeit ist somit auch von<br />
der Größe der Geme<strong>in</strong>de sowie der Größe und Komplexität der geme<strong>in</strong>dlichen Buchführung e<strong>in</strong>schließlich der Art<br />
der örtlichen DV-Buchführung abhängig. Außerdem sollen Manipulationsmöglichkeiten verh<strong>in</strong>dert werden, damit<br />
dem Dritten e<strong>in</strong> qualifizierter E<strong>in</strong>blick <strong>in</strong> die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anz(gesamt)lage der Geme<strong>in</strong>de<br />
möglich ist. Zudem sorgt die Auslegung der GoB durch Rechtsprechung und Literatur mittelbar für e<strong>in</strong>e<br />
dynamische Anpassung des Rechts über das geme<strong>in</strong>dliche Rechnungswesen an die aktuellen nationalen und<br />
<strong>in</strong>ternationalen Entwicklungen. Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung werden dann weiterentwickelt,<br />
wenn aus neuen Sachverhalten heraus dafür e<strong>in</strong> Erfordernis besteht.<br />
4. Berichtigungsmöglichkeiten bei der Eröffnungsbilanz<br />
Die besondere Vorschrift über die geme<strong>in</strong>dliche Eröffnungsbilanz sieht ausdrücklich die Möglichkeiten e<strong>in</strong>er Berichtigung<br />
und Nachholung von Wertansätzen dieser Bilanz vor. Es wird daher ausdrücklich für die Geme<strong>in</strong>de<br />
bestimmt, wenn sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse ergibt, dass <strong>in</strong> der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände<br />
oder Sonderposten oder Schulden fehlerhaft angesetzt worden s<strong>in</strong>d, so ist der Wertansatz zu<br />
berichtigen oder nachzuholen. Die Berichtigung umfasst grundsätzlich alle Posten der geme<strong>in</strong>dlichen Eröffnungsbilanz,<br />
auch wenn <strong>in</strong> § 92 für die Fehlerhaftigkeit ausdrücklich die Wertansätze der geme<strong>in</strong>dlichen Vermögensgegenstände<br />
oder Sonderposten oder Schulden als Anlass e<strong>in</strong>er Berichtigung der Eröffnungsbilanz benannt worden<br />
s<strong>in</strong>d. E<strong>in</strong>e Berichtigung der geme<strong>in</strong>dlichen Eröffnungsbilanz ist auch zw<strong>in</strong>gend notwendig, wenn <strong>in</strong> dieser Bilanz<br />
die <strong>in</strong> § 75 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong> bestimmte Bemessung der Ausgleichsrücklage als fehlerhaft anzusehen ist. In diesen<br />
Fällen gilt die Eröffnungsbilanz der Geme<strong>in</strong>de als geändert.<br />
Für die Berichtigung der geme<strong>in</strong>dlichen Eröffnungsbilanz bzw. für die Nachholung von bilanziellen Wertansätzen<br />
ist festgelegt worden, dass diese Handlungen von der Geme<strong>in</strong>de letztmals im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden<br />
Jahresabschluss vorgenommen werden dürfen. In diesem Zusammenhang ist zudem festgelegt worden,<br />
dass vorherige Jahresabschlüsse, also geme<strong>in</strong>dliche Jahresabschlüsse im Zeitraum zwischen der Eröffnungsbilanz<br />
der Geme<strong>in</strong>de und dem Jahresabschluss, <strong>in</strong> dem Änderungen vorgenommen werden, von der Geme<strong>in</strong>de<br />
nicht zu berichtigen s<strong>in</strong>d. Das Nähere für e<strong>in</strong>e Berichtigung und Nachholung von Wertansätzen der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Eröffnungsbilanz ist <strong>in</strong> der Vorschrift des § 57 GemHVO <strong>NRW</strong> näher bestimmt worden. So ist z.B. e<strong>in</strong> Wertansatz<br />
zu berichtigen, wenn es sich bei dem fehlerhaften Ansatz um e<strong>in</strong>en wesentlichen Wertbetrag handelt<br />
E<strong>in</strong>e Berichtigung der geme<strong>in</strong>dlichen Eröffnungsbilanz soll auch dann erfolgen, wenn sich die Fehlerhaftigkeit erst<br />
bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse herausstellt. E<strong>in</strong>e Berichtigung soll auch dann vorgenommen werden,<br />
wenn am späteren Abschlussstichtag die fehlerhaft angesetzten Vermögensgegenstände nicht mehr vorhanden<br />
s<strong>in</strong>d oder die Schulden nicht mehr bestehen. Ist von der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>e Berichtigung der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Eröffnungsbilanz vorzunehmen, so ist e<strong>in</strong>e sich daraus ergebende Wertänderung ergebnisneutral unmittelbar mit<br />
der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage zu verrechnen. Die Fälle, <strong>in</strong> denen e<strong>in</strong>e Berichtigung der geme<strong>in</strong>dlichen Eröffnungsbilanz<br />
notwendig wird werden nachfolgend aufgeführt (vgl. Abbildung).<br />
GEMEINDEORDNUNG 498
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 92 GO <strong>NRW</strong><br />
Berichtigung der Werte der geme<strong>in</strong>dlichen Eröffnungsbilanz<br />
Vermögensgegenstände oder Sonderposten oder Schulden <strong>in</strong> der Eröffnungsbilanz<br />
können berichtigt werden,<br />
- bei e<strong>in</strong>em zu niedrigen Wert,<br />
- bei e<strong>in</strong>em zu hohen Wert,<br />
- sie zu Unrecht angesetzt oder<br />
- zu Unrecht nicht angesetzt worden s<strong>in</strong>d.<br />
Abbildung 95 „Berichtigung der Werte der geme<strong>in</strong>dlichen Eröffnungsbilanz“<br />
Die im Rahmen der Bilanzberichtigung vorgenommenen Wertberichtigungen oder Wertnachholungen s<strong>in</strong>d von<br />
der Geme<strong>in</strong>de im Anhang (vgl. § 44 GemHVO <strong>NRW</strong>) des aufzustellenden Jahresabschluss (vgl. § 95 GO <strong>NRW</strong>)<br />
gesondert anzugeben.<br />
II. Erläuterungen im E<strong>in</strong>zelnen<br />
1. Zu Absatz 1 (Aufstellung e<strong>in</strong>er geme<strong>in</strong>dlichen Eröffnungsbilanz):<br />
1.1 Zu Satz 1 (Pflicht zur Aufstellung e<strong>in</strong>er Eröffnungsbilanz):<br />
Die Vorschrift begründet die Pflicht zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz für die Geme<strong>in</strong>de zu Beg<strong>in</strong>n des Haushaltsjahres,<br />
<strong>in</strong> dem sie ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasst, wie es handelsrechtlich<br />
für jeden Kaufmann zu Beg<strong>in</strong>n se<strong>in</strong>es Handelsgewerbes vorgeschrieben ist. Alle Geme<strong>in</strong>den müssen<br />
ihr Vermögen und ihre Schulden während des laufenden Geschäftsbetriebes erfassen und bewerten. Dies<br />
kommt der Situation nahe, die zur Normierung des D-Markbilanzgesetzes im Jahre 1990 Anlass bot. Danach galt<br />
entsprechend, dass zum Zeitpunkt der vollständigen Umstellung e<strong>in</strong>e Eröffnungsbilanz aufzustellen ist. Aus diesem<br />
Grund ist die Regelung für Geme<strong>in</strong>den diesem Gesetz entlehnt. Dazu s<strong>in</strong>d die Gliederungsvorschriften für<br />
den Bilanzaufbau nach § 41 GemHVO <strong>NRW</strong> sowie weitere haushaltsrechtliche Vorschriften zu beachten, z.B.<br />
den Grundsatz der Stetigkeit.<br />
Für die Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de gilt zudem das Jährlichkeitspr<strong>in</strong>zip und das Haushaltsjahr ist mit dem<br />
Kalenderjahr identisch. Deshalb ist es sachgerecht zu bestimmen, dass die Geme<strong>in</strong>de zu Beg<strong>in</strong>n des Haushaltsjahres,<br />
<strong>in</strong> dem sie ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung vollständig erfasst, e<strong>in</strong>e<br />
Eröffnungsbilanz aufstellt. Weil das Handelsrecht für das neue Geme<strong>in</strong>dehaushaltsrecht das „Referenzmodell“<br />
darstellt, s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> diese Vorschrift auch dessen Grundsätze übernommen worden.<br />
Die Regelung sieht deshalb vor, dass die Eröffnungsbilanz unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger<br />
Buchführung aufzustellen ist. Die weiteren Vorgaben zur Eröffnungsbilanz sowie zur Bilanzierung und Bewertung<br />
von Vermögen und Schulden der Geme<strong>in</strong>de s<strong>in</strong>d im E<strong>in</strong>zelnen, ggf. auch mit e<strong>in</strong>er Festlegung auf e<strong>in</strong>heitliche<br />
Verfahren, werden durch die Vorschriften des achten Abschnitts der Geme<strong>in</strong>dehaushaltsverordnung näher bestimmt<br />
und s<strong>in</strong>d dort erläutert.<br />
GEMEINDEORDNUNG 499
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 92 GO <strong>NRW</strong><br />
1.2 Zu Satz 2 (Verweis auf § 95 Abs. 3 und § 96 GO <strong>NRW</strong>):<br />
1.2.1 Der Verweis auf § 95 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong><br />
Auf Grund des Verweises auf die Vorschrift des § 95 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong>, die entsprechend für die Aufstellung der<br />
Eröffnungsbilanz der Geme<strong>in</strong>de anzuwenden ist, hat der Kämmerer den Entwurf der Eröffnungsbilanz aufzustellen,<br />
der Bürgermeister den Entwurf zu bestätigen und diesen dem Rat der Geme<strong>in</strong>de zur Feststellung (Beschlussfassung)<br />
zuzuleiten. Dies be<strong>in</strong>haltet auch, dass die geme<strong>in</strong>dliche Eröffnungsbilanz <strong>in</strong>nerhalb der ersten<br />
drei Monate nach dem Eröffnungsbilanzstichtag aufzustellen ist. Die Festlegung e<strong>in</strong>es solchen Zeitraumes ist<br />
auch geboten, weil die Haushaltsplanung und die Bewirtschaftung des ersten Haushaltsjahres der Geme<strong>in</strong>de mit<br />
neuem Rechnungswesen bereits auf dieser Eröffnungsbilanz aufbauen.<br />
Mit der Zuleitung durch den Bürgermeister nimmt der Rat den Entwurf der Eröffnungsbilanz entgegen, um ihn an<br />
die zuständigen Ausschüsse weiterzuleiten, z.B. an den Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung. Nach Durchführung<br />
der gesetzlich vorgesehenen Prüfung soll der Rat durch Beschluss die ihm vorgelegte Eröffnungsbilanz<br />
feststellen. Zeitlich gesehen besteht folgender Ablauf (vgl. Abbildung).<br />
Zeitraum des Verfügbarhaltens der Eröffnungsbilanz 2009<br />
Aufgabe<br />
Aufstellung und Zuleitung<br />
des Entwurfs der Eröffnungsbilanz an den Rat<br />
Prüfung des Entwurfs der Eröffnungsbilanz<br />
durch den Rechnungsprüfungsausschuss<br />
Feststellung der Eröffnungsbilanz<br />
durch den Rat<br />
Anzeige der Eröffnungsbilanz<br />
an die Aufsichtsbehörde<br />
Bekanntmachung<br />
der Eröffnungsbilanz<br />
Verfügbarhalten der Eröffnungsbilanz<br />
bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses<br />
Datum<br />
Bis zum 31. März 2009<br />
Örtliche Fristsetzung<br />
Bis zum 31. Dezember 2009<br />
Unverzüglich nach Feststellung<br />
Nach Feststellung<br />
Bis zum 31. Dezember 2010<br />
Abbildung 96 „Zeitraum des Verfügbarhaltens der Eröffnungsbilanz 2009“<br />
Der Zeitraum für die Aufstellung des Entwurfs der Eröffnungsbilanz sowie die Zuleitung an den Rat (bis zum<br />
31.03. nach dem Eröffnungsbilanzstichtag) konnte nicht <strong>in</strong> jeder Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>gehalten werden. Diese Geme<strong>in</strong>den<br />
s<strong>in</strong>d nach dem Stichtag ständig bemüht gewesen, die Aufstellung, Bestätigung und Zuleitung des Entwurfs<br />
der Eröffnungsbilanz an den Rat unverzüglich nachzuholen.<br />
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die Umstellung auf das NKF nach § 6 Abs. 3 NKFEG erst vollzogen<br />
ist, wenn sämtliche Aufgabenbereiche auf e<strong>in</strong>e Rechnungsführung nach den Regeln der doppelten Buchführung<br />
umgestellt und e<strong>in</strong>e Eröffnungsbilanz aufgestellt worden s<strong>in</strong>d. Nur mit der aufgestellten und bestätigten<br />
Eröffnungsbilanz ist ausreichende Informationsbasis für die künftige geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsplanung, auch für<br />
das erste Haushaltsjahr mit neuem Rechnungswesen gegeben. Auch die Beurteilung des Haushaltsplans für das<br />
GEMEINDEORDNUNG 500
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 92 GO <strong>NRW</strong><br />
erste Haushaltsjahr mit neuem Rechnungswesen durch die Aufsichtsbehörde erfordert dieses, <strong>in</strong>sbesondere<br />
dann, wenn z.B. bereits im ersten Haushaltsjahr e<strong>in</strong>e Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage geplant wird.<br />
Die Planung der Geme<strong>in</strong>de für die Haushaltsjahre mit neuem Rechnungswesen baut auf den Daten der Eröffnungsbilanz<br />
auf. Daher sollte die Geme<strong>in</strong>de mit der Anzeige des neuen Haushaltsplans bei ihrer Aufsichtsbehörde<br />
auch den vom Bürgermeister bestätigten Entwurf der Eröffnungsbilanz mit vorlegen, denn erst dadurch wird<br />
seitens der Geme<strong>in</strong>de dokumentiert, dass es sich um belastbare Daten handelt. Dabei ist es unerheblich, ob<br />
e<strong>in</strong>zelne Wertansätze noch ke<strong>in</strong>e endgültige Bestimmtheit erlangt haben.<br />
Für die Tätigkeit der Aufsichtsbehörde im Rahmen der Anzeige des Haushaltsplans für das erste Haushaltsjahr<br />
mit neuem Rechnungswesen s<strong>in</strong>d die Kenntnisse über die Ansätze <strong>in</strong> der Eröffnungsbilanz <strong>in</strong> Form belastbarer<br />
Daten zw<strong>in</strong>gend erforderlich. Die Aufsichtsbehörde kann ggf. die Fristen für die Anzeige des Haushalts der Geme<strong>in</strong>de<br />
gem. § 80 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong> bzw. der Genehmigung nach § 75 Abs. 4 oder § 76 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> verlängern,<br />
wenn ihr die notwendigen Informationen noch nicht vorliegen. Die von der Geme<strong>in</strong>de vor der Feststellung<br />
der Eröffnungsbilanz gegebenen Informationen berühren nicht die zu e<strong>in</strong>em späteren Zeitpunkt vorzunehmende<br />
Anzeige der vom Rat festgestellten geme<strong>in</strong>dlichen Eröffnungsbilanz an die Aufsichtsbehörde nach § 92 Abs. 1<br />
i.V.m. § 96 GO <strong>NRW</strong>.<br />
1.2.2 Der Verweis auf § 96 GO <strong>NRW</strong><br />
1.2.2.1 Die Feststellung der Eröffnungsbilanz<br />
Die zweite Verweisung <strong>in</strong> der Vorschrift auf die entsprechende Anwendung des § 96 GO <strong>NRW</strong> be<strong>in</strong>haltet, dass<br />
die Feststellung der geme<strong>in</strong>dlichen Eröffnungsbilanz durch den Rat <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>es Zeitraumes von zwölf Monaten<br />
nach dem Eröffnungsbilanzstichtag erfolgen soll. Dem Rat muss daher ermöglicht werden, bis spätestens 31.<br />
Dezember den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss festzustellen.<br />
Auch diese Vorgabe soll der besonderen Bedeutung der Eröffnungsbilanz für die künftige Haushaltswirtschaft der<br />
Geme<strong>in</strong>de Rechnung tragen. Außerdem soll vermieden werden, dass die Geme<strong>in</strong>de im zweiten Haushaltsjahr mit<br />
neuem Rechnungswesen noch auf der Grundlage von „vorläufigen Eröffnungsbilanzdaten“ ihren Haushalt planen<br />
und bewirtschaften muss.<br />
Bei der Entscheidung über die Feststellung der Eröffnungsbilanz ist ggf. die Stellungnahme des Bürgermeisters<br />
und/oder des Kämmerers zum Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsausschusses zu berücksichtigen, <strong>in</strong>sbesondere<br />
dann, wenn der Rechnungsprüfungsausschuss e<strong>in</strong>en e<strong>in</strong>geschränkten Bestätigungsvermerk erteilt hat,<br />
der Bestätigungsvermerk auf Grund von Beanstandungen versagt worden ist oder der Bestätigungsvermerk deshalb<br />
versagt wurde, weil der Prüfer nicht <strong>in</strong> der Lage war, e<strong>in</strong>e Beurteilung vorzunehmen. Dieses hat auch dann<br />
zu erfolgen, wenn bereits zuvor durch e<strong>in</strong>e Zusammenarbeit zwischen der Prüfungs<strong>in</strong>stanz und der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Verwaltung die bei der Eröffnungsbilanz aufgetretenen Fehler, die der Vermittlung e<strong>in</strong>es den tatsächlichen<br />
Verhältnissen entsprechendes Bildes der Vermögens- und Schuldenlage der Geme<strong>in</strong>de entgegen stehen, beseitigt<br />
worden s<strong>in</strong>d.<br />
Dem Rat hat bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den vom Rechnungsprüfungsausschuss<br />
geprüften Jahresabschluss durch Beschluss festzustellen. Die zeitliche Begrenzung <strong>in</strong> dieser<br />
Vorschrift soll gewährleisten, dass der zeitliche Unterschied zwischen dem Abschlussstichtag und der Feststellung<br />
des Jahresabschlusses noch vertretbar bleibt, um ggf. auch Auswirkungen auf die künftige Haushaltswirtschaft<br />
der Geme<strong>in</strong>de unverzüglich umsetzen zu können. Ist e<strong>in</strong>e zeitnahe Feststellung der Eröffnungsbilanz<br />
durch die Geme<strong>in</strong>de nicht umsetzbar, z.B. bis zum 31. Dezember 2008, wenn als Stichtag der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Eröffnungsbilanz der 1. Januar 2008 bestimmt wurde, muss die Eröffnungsbilanz spätestens bis zum 31. Dezember<br />
des zweiten Haushaltsjahres mit neuem Rechnungswesen zusammen mit dem Jahresabschluss des ersten<br />
Haushaltsjahres durch den Rat der Geme<strong>in</strong>de festgestellt werden (nach dem Beispiel: 31. Dezember 2009).<br />
GEMEINDEORDNUNG 501
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 92 GO <strong>NRW</strong><br />
Dieser späte Term<strong>in</strong> kann vor dem H<strong>in</strong>tergrund der vollständigen Umstellung des kommunalen Haushaltsrechts<br />
aus mehreren Gründen als noch vertretbar angesehen werden, denn die Eröffnungsbilanz, die vor der ersten<br />
Erfassung der Geschäftsvorfälle der Geme<strong>in</strong>de nach dem System der doppelten Buchführung steht, stellt gleichzeitig<br />
auch die Eröffnungsbilanz für das erste Haushaltsjahr mit neuem Rechnungswesen dar. Sie wird daher <strong>in</strong><br />
das erste Haushaltsjahr e<strong>in</strong>bezogen und kann sachlich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en Zusammenhang mit dem Jahresabschluss dieses<br />
ersten Haushaltsjahres gestellt werden. E<strong>in</strong>e längere Feststellungszeit könnte z.B. noch zu Erkenntnissen aus<br />
der laufenden Bewirtschaftung im ersten Haushaltsjahr führen, die ggf. e<strong>in</strong>e spätere Berichtigung der Eröffnungsbilanz<br />
entbehrlich machen.<br />
1.2.2.2 Die Entlastung des Bürgermeisters<br />
Die Ratsmitglieder haben ergänzend zum Feststellungsbeschluss über den geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss<br />
durch den Rat der Geme<strong>in</strong>de über die Entlastung des Bürgermeisters zu entscheiden. Der Beschluss ist - vergleichbar<br />
dem Beschluss im Rahmen des Jahresabschlusses - als abschließende Entscheidung des Rates über<br />
die Art und Form der Vermögensermittlung, Bewertung und Ansatz <strong>in</strong> der Eröffnungsbilanz anzusehen. Auch bei<br />
diesem Beschluss muss die Inhaltsbestimmung des Beschlusses deutlich erkennen lassen, was zum Gegenstand<br />
der Entscheidung gemacht worden ist. Über die Feststellung der Eröffnungsbilanz und die Entlastung des Bürgermeisters<br />
können zwei eigenständige Beschlüsse gefasst werden. Die beiden Beschlussgegenstände können<br />
nicht <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Beschluss zusammen gefasst werden, weil über die Entlastung des Bürgermeisters die Ratsmitglieder<br />
und nicht der Rat entscheidet, auch wenn <strong>in</strong> beiden Fällen e<strong>in</strong>e sachliche Verknüpfung aus der Verantwortung<br />
des Bürgermeisters nach § 62 GO <strong>NRW</strong> heraus besteht.<br />
E<strong>in</strong>e vorbehaltlose Feststellung kann zwar gleichzeitig ke<strong>in</strong>e vorbehaltlose Entlastung des Bürgermeisters be<strong>in</strong>halten.<br />
Sie br<strong>in</strong>gt jedoch bereits zum Ausdruck, dass die Ratsmitglieder mit der Eröffnungsbilanz, wie sie sich<br />
nach der Prüfung darstellt, e<strong>in</strong>verstanden s<strong>in</strong>d und das Ergebnis grundsätzlich billigen. Mit der Entscheidung über<br />
die Entlastung des Bürgermeisters verzichten die Ratsmitglieder auch darauf, bei der Prüfung festgestellte Mängel,<br />
die nicht zur E<strong>in</strong>schränkung des Bestätigungsvermerks nach § 101 GO <strong>NRW</strong> durch den Rechnungsprüfungsausschuss<br />
geführt haben, weiter zu verfolgen. Dieses bedeutet aber nicht, dass damit derartige Mängel<br />
auch beseitigt s<strong>in</strong>d. Soweit nachträglich e<strong>in</strong>e Behebung angezeigt ist, muss auch für die Beseitigung der Mängel<br />
Sorge getragen werden. Wird die Entlastung ohne Vorbehalt durch die Ratsmitglieder erteilt, muss die Eröffnungsbilanz<br />
als endgültig abgeschlossen gelten, soweit nicht spätere Berichtigungen nach Absatz 7 geboten<br />
s<strong>in</strong>d. E<strong>in</strong>e Verweigerung der Entlastung des Bürgermeisters dürfte ggf. auf grundsätzliche und auf gewichtige<br />
Fälle beschränken.<br />
1.2.2.2 Anzeige und Bekanntmachung der Eröffnungsbilanz<br />
Die Verweisung auf die entsprechende Anwendung des § 96 GO <strong>NRW</strong> verlangt auch die Anwendung der Regelungen<br />
des Absatzes 2, auf Grund derer die vom Rat festgestellte Eröffnungsbilanz der Aufsichtsbehörde unverzüglich<br />
anzuzeigen, öffentlich bekannt zu machen und danach bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses<br />
zur E<strong>in</strong>sichtnahme verfügbar zu halten ist. Wegen der Bedeutung der Eröffnungsbilanz für die Haushaltswirtschaft<br />
der Geme<strong>in</strong>de sollte ihre öffentliche Bekanntmachung nicht vor der Mitteilung der Aufsichtsbehörde<br />
erfolgen, dass sie ke<strong>in</strong>e Bedenken gegen die festgestellte Eröffnungsbilanz hat.<br />
E<strong>in</strong> H<strong>in</strong>dernis für die Bekanntmachung der Eröffnungsbilanz kann dadurch bestehen, dass der Rat nur e<strong>in</strong>en<br />
Beschluss über die Feststellung der Eröffnungsbilanz gefasst hat und <strong>in</strong> diesem Zusammenhang die Ratsmitglieder<br />
nicht die gesetzlich vorgesehene Entlastung des Bürgermeisters ausgesprochen haben. Sie haben diese<br />
Entlastung auch nicht verweigert, denn dann bestände e<strong>in</strong>e Begründungspflicht für die Ratsmitglieder. Liegt e<strong>in</strong>e<br />
GEMEINDEORDNUNG 502
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 92 GO <strong>NRW</strong><br />
solche Situation vor, s<strong>in</strong>d nicht die notwendigen Beschlüsse gefasst worden, die e<strong>in</strong>er Bekanntmachung der Eröffnungsbilanz<br />
vorausgehen müssen.<br />
Erst durch die Nachholung e<strong>in</strong>es fehlenden Beschlusses ist das bestehende H<strong>in</strong>dernis beseitigt und die Eröffnungsbilanz<br />
kann öffentlich bekannt gemacht werden. Auch wenn die Eröffnungsbilanz nicht alle gesetzlich vorgesehenen<br />
Bestandteile, Anlagen oder Unterlagen umfasst hat, besteht e<strong>in</strong> H<strong>in</strong>dernis für die Bekanntmachung.<br />
Ist ggf. e<strong>in</strong>e gesetzlich vorgesehene Anlage, z.B. der Verb<strong>in</strong>dlichkeitenspiegel (vgl. § 47 GemHVO <strong>NRW</strong>), nicht<br />
Teil des Beschlusses des Rates über die Feststellung der Eröffnungsbilanz ist damit e<strong>in</strong> Ratsbeschluss zustande<br />
gekommen, der e<strong>in</strong>e Bekanntmachung des Jahresabschlusses nicht zulässt. Erst nach Beseitigung des H<strong>in</strong>dernisses<br />
darf die Eröffnungsbilanz öffentlich bekannt gemacht werden.<br />
1.2.3 Verfahrensübersicht zur Feststellung der Eröffnungsbilanz<br />
Die Besonderheiten des geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswesens geben jedoch ke<strong>in</strong>en Anlass, e<strong>in</strong> besonderes Aufstellungsverfahren<br />
für die Eröffnungsbilanz zu def<strong>in</strong>ieren und besondere Anforderungen an die Ratsentscheidung<br />
über die Eröffnungsbilanz zu stellen. Die Verfahrensschritte, die term<strong>in</strong>lich bestimmt se<strong>in</strong> müssen, werden durch<br />
die nachfolgende Übersicht verdeutlicht (vgl. Abbildung).<br />
Aufstellungsverfahren zur Feststellung der Eröffnungsbilanz<br />
Aufstellung des Entwurfes der Eröffnungsbilanz<br />
durch den Kämmerer und Bestätigung durch den Bürgermeister (§ 92 Abs. 1 i.V.m. § 95 Abs. 3 GO<br />
<strong>NRW</strong>)<br />
Zuleitung des Entwurfes der Eröffnungsbilanz<br />
an den Rat (§ 92 i.V.m. § 95 Abs. 3 Satz 2 GO <strong>NRW</strong>; soll <strong>in</strong>nerhalb von drei Monaten nach dem<br />
Stichtag 1. Januar 20.. erfolgen)<br />
Prüfung der Eröffnungsbilanz<br />
durch den Rechnungsprüfungsausschuss (§ 92 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong>) Welcher Bestätigungsvermerk<br />
liegt vor? (§ 101 Abs. 4 und 5 GO <strong>NRW</strong>)<br />
Beratung und Feststellung der Eröffnungsbilanz<br />
durch den Rat (§ 92 Abs. 1GO <strong>NRW</strong>; bis spätestens 31. Dezember des ersten Haushaltsjahres nach<br />
dem Stichtag), Auslegung: ggf. bei wichtigen Gründen bis spätestens 31. Dezember des zweiten<br />
Haushaltsjahres (zusammen mit dem ersten Jahresabschluss) Entlastung des Bürgermeisters (§ 92<br />
Abs. 1 i.V.m. § 96 Abs. 1 Satz 4 GO <strong>NRW</strong>)<br />
Anzeige der Eröffnungsbilanz<br />
bei der Aufsichtsbehörde (§ 92 Abs. 1 i.V.m. § 96 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>)<br />
Bekanntmachung der Eröffnungsbilanz<br />
(§ 92 Abs. 1 i.V.m. § 96 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>; soll verfügbar gehalten werden)<br />
Abbildung 97 „Verfahren zur Feststellung der Eröffnungsbilanz“<br />
Im Rahmen der <strong>in</strong>dividuellen Prüfung der Eröffnungsbilanz e<strong>in</strong>er Geme<strong>in</strong>de durch die Aufsichtsbehörde soll diese<br />
auch festzuhalten, ob das Verfahren ordnungsgemäß abgelaufen bzw. ob und welche Verfahrensschritte ggf. zu<br />
beanstanden s<strong>in</strong>d.<br />
GEMEINDEORDNUNG 503
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 92 GO <strong>NRW</strong><br />
1.3 Pflicht zur Aufstellung e<strong>in</strong>es Konzepts zur Beseitigung der Überschuldung<br />
1.3.1 Der Sanierungsplan zur Beseitigung der Überschuldung<br />
Bei e<strong>in</strong>getretener Überschuldung, die durch den Ansatz des Postens „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“<br />
auf der Aktivseite der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz ausgewiesen wird (vgl. § 43 Abs. 7 i.V.m. § 41 Abs. 3 Nr. 4<br />
GemHVO <strong>NRW</strong>), muss der Blick zw<strong>in</strong>gend auf den Aufbau von Eigenkapital gerichtet werden, der auch die notwendige<br />
Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs e<strong>in</strong>schließt. Der bestehende Verstoß gegen das Verbot der<br />
Überschuldung (vgl. § 75 Abs. 7 GO <strong>NRW</strong>) steht im Mittelpunkt der Betrachtung, so dass die notwendigen Gegenmaßnahmen<br />
der Geme<strong>in</strong>de auf die Beendigung dieses Verstoßes zielen müssen. Auch wenn derzeit ke<strong>in</strong>e<br />
s<strong>in</strong>nvolle und sachgerechte Eigenkapitalgröße für die Geme<strong>in</strong>den als Wertansatz der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage (vgl.<br />
§ 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO <strong>NRW</strong>) bestimmt werden kann, besteht nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften<br />
jedoch e<strong>in</strong>e zu erfüllende M<strong>in</strong>destanforderung.<br />
Von der Geme<strong>in</strong>de müssen zielgerichtete haushaltswirtschaftliche Maßnahmen ergriffen werden, damit auf der<br />
Aktivseite der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz ke<strong>in</strong> Posten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ mehr auszuweisen<br />
ist. Daraus folgt auch, dass ggf. auf e<strong>in</strong>e längere Zeit vielfältige Gegenmaßnahmen von der Geme<strong>in</strong>de umgesetzt<br />
werden müssen, um e<strong>in</strong>e künftige Überschuldung wirksam auf Dauer zu vermeiden. Dies erfordert wegen<br />
der besonderen Ziel- und Zwecksetzung e<strong>in</strong>en geeigneten Sanierungsplan als Eigenkapitalaufbaukonzept (EAK).<br />
Mit dem Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO <strong>NRW</strong> s<strong>in</strong>d dagegen andere Strategien verbunden.<br />
Der Sanierungsplan wird dabei als umfassendes Sanierungskonzept zum zukunftsorientierten Leitfaden (Gesamtkonzept<br />
der Geme<strong>in</strong>de), <strong>in</strong> dem die grundsätzlichen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen für die Sicherung der stetigen<br />
Aufgabenerfüllung der Geme<strong>in</strong>de und die Steuerung des Haushalts sowie den Erhalt des Eigenkapitals festgelegt<br />
werden. Gleichzeitig muss der Sanierungsplan e<strong>in</strong> erweitertes Planungssystem als der Haushaltsplan enthalten,<br />
das als Handlungsrichtschnur dienen soll und deshalb die konkreten und akuten Schritte aufzuzeigen hat, die<br />
sofort und <strong>in</strong> der weiteren Zukunft von der Geme<strong>in</strong>de zu gehen s<strong>in</strong>d. Besondere Eckpunkte sowie die Chancen<br />
und Risiken für die Geme<strong>in</strong>de s<strong>in</strong>d dabei besonders herauszustellen.<br />
1.3.2 Die Stufen e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Sanierungsplans<br />
Aufgrund der großen Bedeutung der geme<strong>in</strong>dlichen Krisensituation für den Rat und die Verwaltung sowie die<br />
Bürger<strong>in</strong>nen und Bürger der Geme<strong>in</strong>de muss e<strong>in</strong>e Struktur erarbeitet werden, die den gesamten Ablauf der Bewältigung<br />
der wirtschaftlichen Krise der Geme<strong>in</strong>de be<strong>in</strong>haltet und die Grundlage für die notwendigen Handlungen<br />
bietet. . Der Sanierungsplan verkörpert somit e<strong>in</strong>e Leitl<strong>in</strong>ie für das Handeln der Geme<strong>in</strong>de und für die Verhandlungen<br />
mit Dritten. Die Frage, ob und ggf. welche Schlussfolgerungen bei Vorliegen der Überschuldung der Geme<strong>in</strong>de<br />
zu ziehen s<strong>in</strong>d und ob und welche Formen des aufsichtsrechtlichen Handelns angezeigt s<strong>in</strong>d, bedarf noch<br />
weiterer Erörterungen und Abstimmungen. Es sollen möglichst praktikable Antworten gefunden werden. Die möglichen<br />
<strong>in</strong> der nachfolgenden Abbildung aufgezeigten fünf Abschnitte e<strong>in</strong>es Sanierungsplans der Geme<strong>in</strong>de zur<br />
Krisenbewältigung und zur stetigen Entwicklung können von der Geme<strong>in</strong>de weiter differenziert werden (vgl. Abbildung).<br />
Stufe 1<br />
Stufen e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Sanierungsplans<br />
Gesamtkonzept der Geme<strong>in</strong>de zur Krisenbewältigung (Sanierungsplan)<br />
Sensibilisierung/ Krisenerkenntnis<br />
(Befangenheit der Betroffenen)<br />
GEMEINDEORDNUNG 504<br />
Bedrohung erkennen<br />
und ernst nehmen
Stufe 2<br />
Stufe 3<br />
Stufe 4<br />
Stufe 5<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 92 GO <strong>NRW</strong><br />
Krisenursachen identifizieren<br />
(Sanierungswürdigkeit und Sanierungsfähigkeit feststellen)<br />
Sanierungsplan - Leitl<strong>in</strong>ie für e<strong>in</strong>e Sanierung<br />
(Ursachen - Analyse - Lage - Ziele)<br />
Implementierung des Sanierungsplans<br />
(leistungs- und f<strong>in</strong>anzwirtschaftliche, organisatorische<br />
Maßnahmen)<br />
Sanierungscontroll<strong>in</strong>g<br />
(Identifizierung des Sanierungserfolges, Kennzahlen,<br />
Planungsrechnungen und Planbilanz)<br />
Abbildung 98 „Stufen e<strong>in</strong>es Sanierungsplans“<br />
Sich schlüssig auf wesentliche<br />
Kernfragen<br />
konzentrieren<br />
Perspektive und Vision<br />
der Sanierung vermitteln<br />
Zustimmung und Motivation<br />
der Beteiligten<br />
auslösen<br />
Erfolgreiche Umsetzung<br />
messen, Chancen und<br />
Risiken neu e<strong>in</strong>schätzen<br />
E<strong>in</strong> erfolgreicher Sanierungsprozess bei der Geme<strong>in</strong>de besteht u.a. dar<strong>in</strong>, dass sie die Bewältigung der Krise<br />
ihrer haushaltswirtschaftlichen Lage selbst so durchführt, dass die Geme<strong>in</strong>de die dauernde Leistungsfähigkeit<br />
erreicht, die künftigen Generationen nicht unnötig belastet sowie deren Zukunft sichert und dadurch den Grundsatz<br />
der <strong>in</strong>tergenerativen Gerechtigkeit e<strong>in</strong>hält.<br />
2. Zu Absatz 2 (Inhalte der Eröffnungsbilanz):<br />
Die Eröffnungsbilanz und der Anhang haben zum Bilanzstichtag unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger<br />
Buchführung e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und der Schuldenlage<br />
der Geme<strong>in</strong>de zu vermitteln. Dem Rat der Geme<strong>in</strong>de und den zuständigen Ausschüssen müssen deshalb für<br />
se<strong>in</strong>e Feststellung der geme<strong>in</strong>dlichen Eröffnungsbilanz die notwendigen Unterlagen (Eröffnungsbilanz mit Anhang<br />
und Anlagen) zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt werden (vgl. Abbildung).<br />
Eröffnungsbilanz<br />
Anhang<br />
Forderungsspiegel<br />
Verb<strong>in</strong>dlichkeitenspiegel<br />
Lagebericht<br />
Eröffnungsbilanzunterlagen<br />
Bestandteile der Eröffnungsbilanz<br />
Anlagen zur Eröffnungsbilanz<br />
§ 92 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 53 Abs. 1 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 92 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 53 Abs. 1 und § 44<br />
Abs. 1 und 2 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 53 Abs. 1 und § 46 GemHVO <strong>NRW</strong> sowie Nr.<br />
1.6.7 des RdErl. vom 24.02.2005<br />
§ 53 Abs. 1 und § 47 GemHVO <strong>NRW</strong> sowie Nr.<br />
1.6.8 des Runderlasses vom 24.02.2005<br />
§ 53 Abs. 1 und § 48 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
Abbildung 99 „Eröffnungsbilanzunterlagen“<br />
GEMEINDEORDNUNG 505
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 92 GO <strong>NRW</strong><br />
Der Geme<strong>in</strong>de ist es aber freigestellt, nach örtlichen Bedürfnissen der Eröffnungsbilanz auch noch weitere Unterlagen<br />
beizufügen oder weitere Angaben zu machen, z.B. über die Verantwortlichen <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>de im S<strong>in</strong>ne<br />
des § 95 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>, um Interessenkonflikte, die im Zusammenhang mit der von dem <strong>in</strong> dieser Vorschrift<br />
benannten Personenkreis ausgeübten Tätigkeit stehen und von Bedeutung für die Adressaten der Eröffnungsbilanz<br />
s<strong>in</strong>d, auszuräumen. Auch kann anhand e<strong>in</strong>er Übersicht, wie sie dem Beteiligungsbericht beizufügen ist (vgl.<br />
§ 52 Abs. 3 GemHVO <strong>NRW</strong>), das Bild über die <strong>in</strong> der Eröffnungsbilanz angesetzten geme<strong>in</strong>dlichen Unternehmen<br />
und E<strong>in</strong>richtungen verbessert werden.<br />
Die geme<strong>in</strong>dliche Eröffnungsbilanz muss zudem auch für e<strong>in</strong>e Unterrichtung der Bürger<strong>in</strong>nen und Bürger und für<br />
die Anzeige an die Aufsichtsbehörde geeignet se<strong>in</strong>. Die nachfolgend aufgezeigten Unterlagen s<strong>in</strong>d für die Vermittlung<br />
e<strong>in</strong>es den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens- und Schuldenlage der Geme<strong>in</strong>de<br />
unverzichtbar und ermöglichen e<strong>in</strong>en aktuellen Überblick über die wirtschaftliche Lage der Geme<strong>in</strong>de. Sie<br />
s<strong>in</strong>d auch im Rahmen der Anzeige an die Aufsichtsbehörde dieser Stelle vorzulegen.<br />
In den Fällen, <strong>in</strong> denen wegen besonderer örtlicher Umstände die Eröffnungsbilanz als Hauptwerk nicht e<strong>in</strong> den<br />
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Geme<strong>in</strong>de vermitteln<br />
kann, ist zu beachten, dass der Anhang zusätzliche Angaben zu enthalten hat und dar<strong>in</strong> die besonderen Umstände,<br />
die zu der Abweichung führen, zu erläutern s<strong>in</strong>d. Bei der Abgrenzung, ob besondere Umstände vor Ort vorliegen,<br />
ist <strong>in</strong>sbesondere auf die Aufgabe und die Funktion der Eröffnungsbilanz abzustellen, damit ggf. durch den<br />
Abhang die erforderliche Korrekturfunktion erfolgen kann.<br />
In der Geme<strong>in</strong>de muss vor Ort geklärt werden, welche Sachverhalte und Tatbestände als „besondere Umstände“<br />
e<strong>in</strong>zuordnen s<strong>in</strong>d, die dann zu den gesonderten Angaben und Erläuterungspflichten im Anhang zur geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Eröffnungsbilanz führen. Diese Sachlage ermöglicht den Geme<strong>in</strong>den aber nicht, abweichend von den gesetzlichen<br />
Vorschriften selbst Inhalt und Umfang der Eröffnungsbilanz oder allgeme<strong>in</strong>e zusätzliche Anforderungen<br />
zu bestimmen.<br />
3. Zu Absatz 3 (Ermittlung der Wertansätze der Eröffnungsbilanz):<br />
3.1 Zu Satz 1 (Wertansätze als vorsichtig geschätzter Zeitwert):<br />
Der Ansatz und die Bewertung von Vermögensgegenständen orientieren sich im „Dauerbetrieb“ des doppischen<br />
Rechnungswesens der Geme<strong>in</strong>de an den handelsrechtlichen Ansatz- und Bewertungsvorschriften. Davon ausgehend<br />
s<strong>in</strong>d von der Geme<strong>in</strong>de dafür die Anschaffungs- und Herstellungskosten zu Grunde zu legen. Um aber zu<br />
Beg<strong>in</strong>n des neuen Rechnungswesens e<strong>in</strong> realistisches und aktuelles Bild der Vermögens- und Schuldenlage der<br />
Geme<strong>in</strong>de zu schaffen, ergibt sich für den Ansatz der Vermögensgegenstände <strong>in</strong> der Eröffnungsbilanz die Anforderung,<br />
stichtagsbezogen e<strong>in</strong>en Wert zu ermitteln, der sich an Zeitwerten orientiert und vorsichtig zu schätzen ist<br />
(vorsichtig geschätzte Zeitwerte).<br />
Der Begriff „vorsichtig geschätzter Zeitwert“ stellt e<strong>in</strong>en Oberbegriff und e<strong>in</strong>e Zielbestimmung unter Beachtung<br />
des Vorsichtspr<strong>in</strong>zips dar. Es handelt sich hierbei um ke<strong>in</strong>en fest def<strong>in</strong>ierten bestimmten Wert. Vielmehr soll unter<br />
Beachtung der Zielbestimmung (Verhütung e<strong>in</strong>es zu hohen Bilanzansatzes und unter Berücksichtigung der Verhältnisse<br />
des E<strong>in</strong>zelfalls e<strong>in</strong> sachgerechter Wert bestimmt werden. Er kann auf verschiedene Weise, d.h. anhand<br />
unterschiedlicher Bewertungsverfahren ermittelt werden. So ist die Ermittlung auf der Basis des Verkehrswertes,<br />
des Wiederbeschaffungswertes, des Wiederbeschaffungszeitwertes wie auch der Anschaffungs- oder Herstellungskosten<br />
denkbar.<br />
Die Bewertung des Vermögens zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten für den Ansatz <strong>in</strong> der Eröffnungsbilanz steht<br />
mit den von den Ländern getroffenen Entscheidungen für das kommunale Haushaltsrecht <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang. So hat die<br />
Innenm<strong>in</strong>isterkonferenz zur Reform des Geme<strong>in</strong>dehaushaltsrechts am 21.11.2003 u.a. beschlossen: „Bei der<br />
GEMEINDEORDNUNG 506
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 92 GO <strong>NRW</strong><br />
Eröffnungsbilanz ist neben der Bewertung nach Anschaffungs- und Herstellungsaufwand auch e<strong>in</strong>e Bewertung<br />
nach vorsichtig geschätzten Zeitwerten möglich, wobei bei beiden Modellen Sonderregelungen für Bewertungserleichterungen<br />
vorgesehen werden. Die Eröffnungsbilanz stellt für alle Geme<strong>in</strong>den die neue Ausgangslage für ihre<br />
Haushaltswirtschaft dar. Die Entscheidung basiert auf folgenden Überlegungen (vgl. Abbildung).<br />
Zeitwerte <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Eröffnungsbilanz<br />
- Die Eröffnungsbilanz steht am Beg<strong>in</strong>n der doppischen Rechnungslegung der Geme<strong>in</strong>de, die<br />
deshalb – wie handelsrechtlich für jeden Kaufmann zu Beg<strong>in</strong>n se<strong>in</strong>er Tätigkeit vorgeschrieben –<br />
e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen der Vermögens- und Schuldenlage entsprechendes Bild<br />
vermitteln muss.<br />
- Die Bewertung von sämtlichen Vermögensgegenständen und Schulden der Geme<strong>in</strong>de wird<br />
nicht als Selbstzweck verstanden. Die Maßgabe für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz soll<br />
deshalb e<strong>in</strong>e zügige und <strong>in</strong> der Grundausrichtung konsistente Bewertung des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Vermögens unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitspr<strong>in</strong>zips und des Grundsatzes der<br />
Wesentlichkeit se<strong>in</strong>.<br />
- E<strong>in</strong>e Bewertung der Vermögensgegenstände nur nach Anschaffungs- und Herstellungskosten<br />
steht nicht mit den Zielen der Aktualität und der Rechenschaft <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang.<br />
- Auch im H<strong>in</strong>blick auf die praktische Umsetzung, z.B. Rückgriff auf die Wertermittlungsverordnung<br />
bei der Bewertung von Grundstücken, ist die Bewertung des geme<strong>in</strong>dlichen Vermögens<br />
nach vorsichtig geschätzten Zeitwerten (Verkehrswert) vorteilhaft.<br />
- Mit den Zielsetzungen des NKF, <strong>in</strong>sbesondere mit den Zielen „Aktualität“ und „<strong>in</strong>tergenerative<br />
Gerechtigkeit“, vertreten vergleichbare neuere wissenschaftliche Diskussionen zunehmend die<br />
Auffassung, dass für die Bestimmung der Anschaffungskosten auch <strong>in</strong> der handelsrechtlichen<br />
Eröffnungsbilanz stets von Zeitwerten auszugehen ist.<br />
- Die grundsätzliche Bedeutung der Bewertung von Vermögensgegenständen nach Anschaffungs-<br />
und Herstellungskosten aus dem kaufmännischen Rechnungswesen bleibt auch bei e<strong>in</strong>er<br />
Bewertung auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten erhalten, denn die ermittelten<br />
Zeitwerte stellen am Stichtag der Eröffnungsbilanz „fiktive“ Anschaffungs- und Herstellungskosten<br />
dar und dienen als Basis für die zukünftigen Abschreibungen.<br />
- Für die Festlegung der Bewertung der Vermögensgegenstände nach vorsichtig geschätzten<br />
Zeitwerten hat sich auch das Institut der Deutschen Wirtschaftsprüfer ausgesprochen.<br />
Abbildung 100 „Zeitwerte <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Eröffnungsbilanz“<br />
Die Festlegung des maßgebenden Bewertungsverfahrens für die Eröffnungsbilanz erfolgt durch die Länder, wobei<br />
diese die zu erwartende Stellungnahme des Instituts der Wirtschaftsprüfer <strong>in</strong> Deutschland, das sich ebenfalls<br />
für Zeitwerte <strong>in</strong> der Eröffnungsbilanz ausspricht, <strong>in</strong> ihre Entscheidungsf<strong>in</strong>dung e<strong>in</strong>beziehen.“ Auch wenn ke<strong>in</strong>e<br />
e<strong>in</strong>heitliche Ausgangslage zwischen den Länder besteht, werden sich jedoch die anfangs vorhandenen Unterschiede<br />
im Laufe der Jahre "auswachsen". Durch die getroffene Regelung wird sichergestellt, dass die Geme<strong>in</strong>den<br />
<strong>in</strong>nerhalb des Landes die Vermögensbewertung e<strong>in</strong>heitlich vornehmen.<br />
Die Vorschrift sieht daher vor, die Wertermittlung für die Eröffnungsbilanz auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten<br />
Zeitwerten vorzunehmen. Das D-Markbilanzgesetz hat dieser Regelung als Vorbild gedient. Die Regelung<br />
wird von den Modellkommunen mitgetragen, die die Erfassung und Bewertung von Vermögen der Geme<strong>in</strong>de<br />
nach dem vorsichtig geschätzten Zeitwert erprobt haben. Mit dieser Entscheidung wird <strong>in</strong> besonderem Maße dem<br />
Anliegen Rechnung getragen, die Geme<strong>in</strong>den bei der Erstellung e<strong>in</strong>er Eröffnungsbilanz mit dem ger<strong>in</strong>gst mögli-<br />
GEMEINDEORDNUNG 507
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 92 GO <strong>NRW</strong><br />
chen Aufwand zu belasten, ohne dabei auf allgeme<strong>in</strong> anerkannte kaufmännische Bilanzierungsregeln verzichten<br />
zu müssen.<br />
3.2 Zu Satz 2 (Wertansätze als Anschaffungs- oder Herstellungskosten):<br />
3.2.1 Die Zeitwerte als Anschaffungs- oder Herstellungskosten<br />
Die Eröffnungsbilanz bildet ab dem Bilanzstichtag die Ausgangslage für die künftige Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de.<br />
Deshalb muss bereits bei ihrer Aufstellung berücksichtigt werden, dass bei laufendem Geschäftsbetrieb<br />
der Geme<strong>in</strong>de das Anschaffungskostenpr<strong>in</strong>zip für die spätere Bilanzierung Anwendung f<strong>in</strong>det und <strong>in</strong> den späteren<br />
Jahresabschlüssen die Anschaffungs- und Herstellungskosten die wertmäßige Obergrenze für die Bewertung im<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss darstellen. Die Vorschrift folgt diesem Ansatz, denn es wird bestimmt, dass die <strong>in</strong><br />
der Eröffnungsbilanz für die Vermögensgegenstände angesetzten Werte künftig als Anschaffungs- oder Herstellungskosten<br />
gelten.<br />
Der Gestaltung dieser Bestimmung liegt die Fiktion zu Grunde, die Geme<strong>in</strong>de hätte zum Stichtag der Eröffnungsbilanz<br />
erstmals den Geschäftsbetrieb aufgenommen und dafür die notwendigen Vermögensgegenstände erworben<br />
bzw. <strong>in</strong> den Geschäftsbetrieb e<strong>in</strong>gebracht (Erwerbsfiktion). Dieser fiktive Anschaffungsvorgang wird auf der<br />
Grundlage der vorsichtig geschätzten Zeitwerte im Inventar der Geme<strong>in</strong>de sowie durch die Wertansätze <strong>in</strong> der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Eröffnungsbilanz abgebildet.<br />
Diesen Wertansätzen kann deshalb die Aufgabe zu geschrieben werden, historische Anschaffungs- oder Herstellungskosten<br />
für den Geschäftsbetrieb der Geme<strong>in</strong>de darzustellen. Sie werden <strong>in</strong> dieser Funktion im Anlagenspiegel<br />
nach § 45 GemHVO <strong>NRW</strong> entsprechend ausgewiesen. Für diese Festlegung und Funktion hat das D-<br />
Markbilanzgesetz als Vorbild gedient. Durch e<strong>in</strong>en Verweis auf die zulässigen Wertberichtigungen nach Absatz 7<br />
wird die Regelung noch ergänzt, um bei Vorliegen späterer Erkenntnisse das objektivierte Bild der wirtschaftlichen<br />
Lage der Geme<strong>in</strong>de im Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz durch ggf. notwendige Korrekturen zu erhalten.<br />
3.2.2 Abschreibungen nicht vor Eröffnungsbilanzstichtag<br />
In diesem Zusammenhang ist für die Ermittlung des vorsichtig geschätzten Zeitwertes zu beachten, dass vor dem<br />
Stichtag der Eröffnungsbilanz die Abnutzung von Vermögensgegenständen haushaltswirtschaftlich nicht <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
Vermögensrechnung erfasst wurde. Daher kann bei der Ermittlung der Werte der Vermögensgegenstände die<br />
bisherige Nutzung nicht als Abschreibungen erfasst und von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder<br />
dem Neuwert <strong>in</strong> Abzug gebracht werden.<br />
Entspricht der <strong>in</strong> der Eröffnungsbilanz anzusetzende Vermögensgegenstand nicht mehr dem Neuwert, kann diese<br />
Abweichung nur als Alterswertm<strong>in</strong>derung oder <strong>in</strong> Form von Abschlägen für Mängel oder Schäden <strong>in</strong> die Wertermittlung<br />
e<strong>in</strong>bezogen werden. Auch wenn zur Bestimmung des Umfanges solcher Wertm<strong>in</strong>derungen vielfach die<br />
gleichen Methoden zur Anwendung kommen wie nach dem Stichtag der Eröffnungsbilanz zur Ermittlung des<br />
Ressourcenverbrauchs im NKF durch Abschreibungen, besteht gleichwohl ke<strong>in</strong>e Identität der Sachverhalte.<br />
Es ist sachlich nicht zutreffend, wenn im Rahmen der Ermittlung der Wertansätze der Vermögensgegenstände für<br />
die bisherige Nutzungszeit Abschreibungen oder für Wertm<strong>in</strong>derungen dann „außergewöhnliche Abschreibungen“<br />
<strong>in</strong> die Berechnung e<strong>in</strong>bezogen werden. Es ist zum Verständnis der Sachverhalte, aber zur Vermeidung von Unklarheiten<br />
und Unsicherheiten notwendig, auch durch Begrifflichkeiten e<strong>in</strong>e klare Trennung zwischen der Zeit vor<br />
der Eröffnungsbilanz und der Zeit nach der Eröffnungsbilanz zu ziehen.<br />
GEMEINDEORDNUNG 508
3.2.3 Wertberichtigungen <strong>in</strong> der Eröffnungsbilanz<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 92 GO <strong>NRW</strong><br />
In den Fällen, <strong>in</strong> denen sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse ergibt, dass <strong>in</strong> der Eröffnungsbilanz<br />
Vermögensgegenstände oder Sonderposten oder Schulden fehlerhaft angesetzt worden s<strong>in</strong>d, so ist der Wertansatz<br />
zu berichtigen oder nachzuholen. Die Eröffnungsbilanz gilt dann als geändert. E<strong>in</strong>e Berichtigung kann letztmals<br />
im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden.<br />
Diese Vorgabe ist <strong>in</strong> Absatz 7 enthalten und hat den Zweck, nachteilige Auswirkungen unrichtiger Bilanz- und<br />
Wertansätze <strong>in</strong> der Eröffnungsbilanz auf künftige Jahresabschlüsse dadurch zu vermeiden, dass e<strong>in</strong>e Berichtigung<br />
oder Nachholung von Wertansätzen <strong>in</strong> vere<strong>in</strong>fachter Form zugelassen wird. Maßgeblich für die Beurteilung<br />
der Fehlerhaftigkeit s<strong>in</strong>d die zum Bilanzstichtag vorliegenden objektiven Verhältnisse. Derartige Wertberichtigungen<br />
der Eröffnungsbilanz nach ihrer Aufstellung wirken sich auch auf die Geltung der Wertansätze als Anschaffungs-<br />
oder Herstellungskosten aus.<br />
4. Zu Absatz 4 (Prüfung der Eröffnungsbilanz):<br />
4.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Der Umfang und der Inhalt der Prüfung der Eröffnungsbilanz erstrecken sich grundsätzlich auf die E<strong>in</strong>haltung der<br />
gesetzlichen Vorschriften. Daher s<strong>in</strong>d die Eröffnungsbilanz und der Anhang dah<strong>in</strong>gehend zu prüfen, ob sie unter<br />
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes<br />
Bild der Vermögens- und der Schuldenlage der Geme<strong>in</strong>de zu vermitteln. Die Prüfung der Eröffnungsbilanz hat<br />
aber auch e<strong>in</strong>e Kontroll-, Informations- und Beglaubigungsfunktion (vgl. § 322 HGB) und f<strong>in</strong>det ihre spätere Fortsetzung<br />
<strong>in</strong> der Prüfung der jährlichen Bilanz, die Bestandteil des Jahresabschlusses der Geme<strong>in</strong>de ist. Außerdem<br />
hat der Rechnungsprüfungsausschuss des Rates die Eröffnungsbilanz zu prüfen.<br />
4.2 Prüfungsumfang und Prüfungsgegenstände<br />
Nach der Vorschrift stehen die Eröffnungsbilanz und der Anhang im Mittelpunkt der Prüfung. Sie s<strong>in</strong>d dah<strong>in</strong>gehend<br />
zu prüfen, ob sie e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der wirtschaftlichen Lage der<br />
Geme<strong>in</strong>de vermitteln, denn nach Absatz 2 der Vorschrift haben die Eröffnungsbilanz und der Anhang unter Beachtung<br />
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild<br />
der Vermögens- und der Schuldenlage der Geme<strong>in</strong>de zum Bilanzstichtag zu vermitteln. Die Prüfung hat sich aber<br />
auch darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Bestimmungen beachtet<br />
worden s<strong>in</strong>d.<br />
In Absatz 5 der Vorschrift wird zudem bestimmt, dass auch die Inventur, das Inventar und die Übersicht über<br />
örtlich festgelegte Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände <strong>in</strong> die Prüfung e<strong>in</strong>zubeziehen s<strong>in</strong>d, gehören<br />
auch diese Teile zur Prüfung der Eröffnungsbilanz der Geme<strong>in</strong>de. Zur Prüfung der geme<strong>in</strong>dlichen Eröffnungsbilanz<br />
gehört auch der Lagebericht, der nach § 53 Abs. 1 GemHVO <strong>NRW</strong> der Eröffnungsbilanz beizufügen ist, auch<br />
wenn dies nicht <strong>in</strong> dieser Vorschrift ausdrücklich formuliert wurde oder durch e<strong>in</strong>en Verweis auf § 101 Abs. 1 S. 4<br />
GO <strong>NRW</strong> ersichtlich wird. Gleichwohl ist bei der Prüfung der Eröffnungsbilanz der Lagebericht daraufh<strong>in</strong> zu prüfen,<br />
ob er den Vorgaben des § 48 GemHVO <strong>NRW</strong> genügt, mit der geme<strong>in</strong>dlichen Eröffnungsbilanz <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang<br />
steht und ob se<strong>in</strong>e sonstigen Angaben nicht e<strong>in</strong>e falsche Vorstellung von der Vermögens- und Schuldenlage der<br />
Geme<strong>in</strong>de erwecken.<br />
GEMEINDEORDNUNG 509
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 92 GO <strong>NRW</strong><br />
4.3 Prüfung und zeitnahe Feststellung der Eröffnungsbilanz<br />
Bei der Prüfung der Eröffnungsbilanz ist zu berücksichtigen, dass die Feststellung der Eröffnungsbilanz durch<br />
Beschluss des Rates entsprechend § 96 GO <strong>NRW</strong> möglichst <strong>in</strong>nerhalb von zwölf Monaten nach dem Eröffnungsbilanzstichtag<br />
erfolgen soll. Dadurch wird vermieden, dass die Haushaltsplanung und die Bewirtschaftung im<br />
zweiten Haushaltsjahr der Geme<strong>in</strong>de mit neuem Rechnungswesen nicht mehr auf der Grundlage von „vorläufigen<br />
Eröffnungsbilanzdaten“ erfolgen sollen Ist e<strong>in</strong>e zeitnahe Feststellung der Eröffnungsbilanz durch den Rat nicht<br />
umsetzbar, muss die Eröffnungsbilanz zusammen mit dem Jahresabschluss des ersten Haushaltsjahres spätestens<br />
bis zum 31. Dezember des zweiten Haushaltsjahres, <strong>in</strong> dem das neue Rechnungswesen angewandt wird,<br />
festgestellt werden.<br />
Diese Verfahrensweise kann vor dem H<strong>in</strong>tergrund der vollständigen Umstellung des kommunalen Haushaltsrechts<br />
aus mehreren Gründen als noch vertretbar angesehen werden. Der Beschluss über die Feststellung der<br />
Eröffnungsbilanz darf nur dann erfolgen, wenn e<strong>in</strong>e vorherige Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss<br />
stattgefunden hat. Wird die Feststellung der Eröffnungsbilanz vom Rat verweigert, so s<strong>in</strong>d die Gründe dafür gegenüber<br />
dem Bürgermeister anzugeben. Nach dem Beschluss des Rates über die Feststellung ist die Eröffnungsbilanz<br />
der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen sowie öffentlich bekannt zu machen und zur E<strong>in</strong>sichtnahme<br />
verfügbar zu halten.<br />
5. Zu Absatz 5 (Zuständigkeit für die Prüfung der Eröffnungsbilanz):<br />
5.1 Zu Satz 1 (Aufgaben des Rechnungsprüfungsausschusses):<br />
In dieser Vorschrift wird ausdrücklich die Zuständigkeit des Rechnungsprüfungsausschusses für die Prüfung der<br />
Eröffnungsbilanz bestimmt. Nach § 57 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> muss der Rat <strong>in</strong> jeder Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>en Rechnungsprüfungsausschuss<br />
bilden. Dieser Ausschuss hat die Aufgabe der Prüfung der Eröffnungsbilanz der Geme<strong>in</strong>de und<br />
<strong>in</strong> den künftigen Jahren die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses der Geme<strong>in</strong>de (vgl. §<br />
59 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong>). Mit diesen Vorschriften, ergänzt um § 59 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong>, wird der Rahmen für die Tätigkeit<br />
des Rechnungsprüfungsausschusses <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>de gesetzt.<br />
Die dem F<strong>in</strong>anzausschuss auf Grund des haushaltswirtschaftlichen Stellenwerts im NKF obliegenden Vorbereitung<br />
des Jahresabschlusses, des Gesamtabschlusses und der Eröffnungsbilanz (folgt se<strong>in</strong>er Aufgabe „Vorbereitung<br />
der Haushaltssatzung“) steht der gesetzlich dem Rechnungsprüfungssausschuss zugeordneten Prüfungspflicht<br />
der Abschlüsse der Geme<strong>in</strong>de nicht entgegen. Damit kommt dem Rechnungsprüfungsausschuss unmittelbar<br />
e<strong>in</strong>e Prüfungstätigkeit zu, die zur Erhöhung der Effektivität und Effizienz der Arbeit des Rates beitragen soll.<br />
5.2 Zu Satz 2 (Sicherung der Ordnungsmäßigkeit der Prüfung der Eröffnungsbilanz):<br />
In der Vorschrift wird zur Sicherung der Ordnungsmäßigkeit der Prüfung klargestellt, welche zusätzlichen Gegebenheiten<br />
<strong>in</strong> die Prüfung der Eröffnungsbilanz m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>zubeziehen s<strong>in</strong>d. Dazu zählen z.B. die Inventur, das<br />
Inventar und die Übersicht über örtlich festgelegte Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände. Außerdem<br />
gehört auch der Lagebericht dazu, der nach § 53 Abs. 1 GemHVO der Eröffnungsbilanz beizufügen ist, auch<br />
wenn dieses weder <strong>in</strong> dieser Vorschrift noch durch e<strong>in</strong>en Verweis auf § 101 Abs. 1 S. 4 GO <strong>NRW</strong> ausdrücklich<br />
bestimmt wurde. Der geme<strong>in</strong>dliche Lagebericht ist vergleichbar mit se<strong>in</strong>er Prüfung beim Jahresabschluss der<br />
Geme<strong>in</strong>de daraufh<strong>in</strong> zu prüfen, ob er mit der Eröffnungsbilanz <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang steht und ob se<strong>in</strong>e sonstigen Angaben<br />
nicht e<strong>in</strong>e falsche Vorstellung von der Vermögens- und Schuldenlage der Geme<strong>in</strong>de erwecken.<br />
GEMEINDEORDNUNG 510
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 92 GO <strong>NRW</strong><br />
5.3 Zu den Sätzen 3 bis 5 (Ergebnisse der Prüfung der Eröffnungsbilanz):<br />
Die Festlegung, dass e<strong>in</strong> Prüfungsbericht über das Ergebnis sowie die Prüfung zu erstellen ist, dient der Ordnungsmäßigkeit.<br />
So wird durch die <strong>in</strong> dieser Vorschrift enthaltenen Verweisungen klargestellt, dass die Regeln für<br />
die Prüfung von Jahresabschlüssen auch für die Prüfung der Eröffnungsbilanz Anwendung f<strong>in</strong>den. Dies stellt<br />
auch den Gesamtzusammenhang zur Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de her. Auch der vom Rechnungsprüfungsausschuss<br />
zu erteilende Bestätigungsvermerk oder der Vermerk über se<strong>in</strong>e Versagung, der <strong>in</strong> den Prüfungsbericht<br />
aufzunehmen ist, verdeutlichen das Prüfungsgeschehen. Die Verweisungen auf die weiteren Vorschriften<br />
der Geme<strong>in</strong>deordnung, z.B. Inhalt des Bestätigungsvermerks, die Verfahrensbeteiligung des Bürgermeisters,<br />
die Rechte der Prüfer der Eröffnungsbilanz und e<strong>in</strong>e Beteiligungsregelung für die Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt,<br />
wird e<strong>in</strong> Gesamtzusammenhang zum Verwaltungshandeln hergestellt. So ist z.B. vor der Feststellung der<br />
Eröffnungsbilanz durch den Rat dem Bürgermeister Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.<br />
Über Art und Umfang der Prüfung sowie über das Ergebnis der Prüfung ist e<strong>in</strong> Prüfungsbericht zu erstellen. Der<br />
Bestätigungsvermerk oder der Vermerk über se<strong>in</strong>e Versagung ist <strong>in</strong> den Prüfungsbericht aufzunehmen. Die Formulierung<br />
und Ausgestaltung des Bestätigungsvermerks ist eigenverantwortlich vom Prüfer im Rahmen se<strong>in</strong>es<br />
Prüfungsauftrages und der Durchführung der Prüfung der geme<strong>in</strong>dlichen Eröffnungsbilanz unter Berücksichtigung<br />
der örtlichen Verhältnisse und der Ergebnisse se<strong>in</strong>er Prüfung vorzunehmen. Er ist dementsprechend vom Abschlussprüfer<br />
zu formulieren.<br />
Der Abschlussprüfer kann auch zu e<strong>in</strong>em une<strong>in</strong>geschränkten Bestätigungsvermerk sachgerechte H<strong>in</strong>weise auf<br />
Umstände aufnehmen, auf die er <strong>in</strong> besonderer Weise aufmerksam machen will, die aber se<strong>in</strong> positives Prüfungsurteil<br />
über den Gesamtabschluss nicht e<strong>in</strong>schränken. Er ist durch den Prüfer, die örtliche Rechnungsprüfung<br />
sowie durch den Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses mit Angabe des Ortes und des Datums zu<br />
unterzeichnen, jedoch abhängig davon, <strong>in</strong> welchem Umfang von ihnen Prüfungsaufgaben erledigt wurden. Werden<br />
dagegen Beanstandungen ausgesprochen, ist der Bestätigungsvermerk e<strong>in</strong>zuschränken oder zu versagen.<br />
E<strong>in</strong> e<strong>in</strong>geschränkter Bestätigungsvermerk darf nur erteilt werden, wenn die geprüfte Eröffnungsbilanz unter Beachtung<br />
der vom Prüfer vorgenommenen, <strong>in</strong> ihrer Tragweite erkennbaren E<strong>in</strong>schränkung e<strong>in</strong> den tatsächlichen<br />
Verhältnissen im Wesentlichen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Geme<strong>in</strong>de vermittelt.<br />
S<strong>in</strong>d die Beanstandungen so erheblich, dass ke<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-<br />
und Schuldenlage der Geme<strong>in</strong>de mehr vermittelt wird, ist der Bestätigungsvermerk zu versagen. Der<br />
Bestätigungsvermerk ist auch dann zu versagen, wenn der Prüfer nach Ausschöpfung aller angemessenen Möglichkeiten<br />
zur Klärung des Sachverhaltes nicht <strong>in</strong> der Lage ist, e<strong>in</strong>e Beurteilung abzugeben. Die Versagung ist<br />
dann <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Vermerk, der nicht als Bestätigungsvermerk zu bezeichnen ist, aufzunehmen. Die E<strong>in</strong>schränkung<br />
oder Versagung ist zu begründen.<br />
5.4 Beispiel für e<strong>in</strong>en Bestätigungsvermerk für die Eröffnungsbilanz<br />
E<strong>in</strong> une<strong>in</strong>geschränkter Bestätigungsvermerk kann z.B. folgende Fassung haben (vgl. Abbildung).<br />
Beispiel für e<strong>in</strong>en Bestätigungsvermerk für die Eröffnungsbilanz<br />
Bestätigungsvermerk des Prüfers<br />
Die Eröffnungsbilanz und der Anhang der Geme<strong>in</strong>de ... wurde unter Beachtung des § 92 Abs. 2 GO<br />
<strong>NRW</strong> und unter E<strong>in</strong>beziehung der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte<br />
Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände sowie des Lageberichtes geprüft. In die Prüfung<br />
s<strong>in</strong>d die sie ergänzenden Bestimmungen der Satzungen der Geme<strong>in</strong>de und die sonstigen ortsrechtlichen<br />
Bestimmungen e<strong>in</strong>bezogen worden. Sie wurde so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten<br />
und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch die Eröffnungsbilanz nebst Anhang unter<br />
GEMEINDEORDNUNG 511
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 92 GO <strong>NRW</strong><br />
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten<br />
Bildes der Vermögens- und Schuldenlage wesentlich auswirken, mit h<strong>in</strong>reichender Sicherheit erkannt<br />
werden konnten. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen s<strong>in</strong>d die Kenntnisse über die Tätigkeit<br />
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Geme<strong>in</strong>de sowie die Erwartungen über mögliche<br />
Fehler berücksichtigt worden. Im Rahmen der Prüfung wurden die Nachweise und Unterlagen für<br />
die Eröffnungsbilanz nebst Anhang und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben<br />
beurteilt. Die Prüfung hat die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen<br />
E<strong>in</strong>schätzungen des Bürgermeisters der Geme<strong>in</strong>de sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung<br />
der Eröffnungsbilanz nebst Anhang und des Lageberichts umfasst.<br />
Die Prüfung hat zu ke<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>wendungen geführt.<br />
Nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen entspricht die Eröffnungsbilanz nebst Anhang<br />
den gesetzlichen Vorschriften, den ergänzenden Bestimmungen der geme<strong>in</strong>dlichen Satzungen und<br />
sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger<br />
Buchführung e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und<br />
Schuldenlage der Geme<strong>in</strong>de. Der Lagebericht steht <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang mit der Eröffnungsbilanz nebst Anhang,<br />
vermittelt <strong>in</strong>sgesamt e<strong>in</strong> zutreffendes Bild von der Vermögens- und Schuldenlage der Geme<strong>in</strong>de<br />
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.<br />
Abbildung 101 „Beispiel für e<strong>in</strong>en Bestätigungsvermerk für die Eröffnungsbilanz“<br />
E<strong>in</strong> solcher Bestätigungsvermerk ist <strong>in</strong> Abhängigkeit vom erteilten Prüfungsauftrag bzw. den erledigten Prüfungsaufgaben<br />
durch den Prüfer, die örtliche Rechnungsprüfung sowie durch den Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses<br />
mit Angabe des Ortes und des Datums zu unterzeichnen (vgl. § 101 Abs. 7 i.V.m. § 103 Abs.<br />
6 GO <strong>NRW</strong>).<br />
5.5 Die Beteiligung Dritter als Prüfer<br />
Aus örtlichen Gesichtspunkten heraus kann es wegen der erheblichen Bedeutung der geme<strong>in</strong>dlichen Eröffnungsbilanz<br />
erforderlich se<strong>in</strong>, dass sich die örtliche Rechnungsprüfung der Geme<strong>in</strong>de - dessen sich der Rechnungsprüfungsausschuss<br />
zur Durchführung der Prüfung bedienen muss (vgl. § 59 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong>) - für die Prüfung der<br />
Eröffnungsbilanz e<strong>in</strong>es Wirtschaftsprüfers oder e<strong>in</strong>er Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bedient (vgl. Erläuterungen<br />
zu § 103 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong>).<br />
6. Zu Absatz 6 (Überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz):<br />
Die gesamte Rechnungslegung der Geme<strong>in</strong>de überliegt der überörtlichen Prüfung durch die Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt.<br />
Daher muss auch die Eröffnungsbilanz, genauso wie der Jahresabschluss und der Gesamtabschluss, der<br />
überörtlichen Prüfung unterliegen. Auch die Prüfung durch die Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt (vgl. § 105 GO <strong>NRW</strong>)<br />
stellt e<strong>in</strong>e Aufsichtsprüfung dar. Sie unterscheidet sich zudem von der örtlichen Rechnungsprüfung dadurch, dass<br />
sie von e<strong>in</strong>er außerhalb der Geme<strong>in</strong>deverwaltung stehenden Stelle durchgeführt wird, während die örtliche Rechnungsprüfung<br />
i.d.R. durch e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>deeigene Stelle vorzunehmen ist. An die überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz<br />
schließt sich das gleiche Verfahren an, wie es für die überörtliche Prüfung des Jahresabschlusses<br />
nach § 105 GO <strong>NRW</strong> vorgesehen ist.<br />
Die Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt hat das Prüfungsergebnis zur Eröffnungsbilanz <strong>in</strong> Form e<strong>in</strong>es Prüfberichts der<br />
geprüften Geme<strong>in</strong>de und ihrer Aufsichtsbehörde mitzuteilen. Der Bürgermeister hat den Prüfungsbericht dem<br />
Rechnungsprüfungsausschuss zur Beratung vorzulegen. Anschließend muss der Rechnungsprüfungsausschuss<br />
den Rat über den wesentlichen Inhalt des Prüfungsberichts sowie über das Ergebnis se<strong>in</strong>er Beratungen unterrichten.<br />
Wenn Beanstandungen ausgesprochen wurden, entsteht für die Geme<strong>in</strong>de die Pflicht, gegenüber der Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt<br />
und der Aufsichtsbehörde <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>er dafür bestimmten Frist e<strong>in</strong>e Stellungnahme zum<br />
Prüfungsbericht abzugeben. Oftmals enthält der Prüfungsbericht aber ke<strong>in</strong>e Beanstandungen mehr, weil diese<br />
bereits zuvor ausgeräumt werden konnten.<br />
GEMEINDEORDNUNG 512
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 92 GO <strong>NRW</strong><br />
7. Zu Absatz 7 (Durchführung von Wertberichtigungen):<br />
7.1 Zu Satz 1 (Berichtigung und Nachholung von Wertansätzen):<br />
Die Vorschrift hat den Zweck, nachteilige Auswirkungen unrichtiger Bilanz- und Wertansätze <strong>in</strong> der Eröffnungsbilanz<br />
auf künftige Jahresabschlüsse dadurch zu vermeiden, dass e<strong>in</strong>e Berichtigung oder Nachholung von Wertansätzen<br />
<strong>in</strong> vere<strong>in</strong>fachter Form zugelassen wird. Die Berichtigung umfasst grundsätzlich alle Posten der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Eröffnungsbilanz, auch wenn <strong>in</strong> § 92 für die Fehlerhaftigkeit ausdrücklich die Wertansätze der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Vermögensgegenstände oder Sonderposten oder Schulden als Anlass e<strong>in</strong>er Berichtigung der Eröffnungsbilanz<br />
benannt worden s<strong>in</strong>d.<br />
E<strong>in</strong>e Berichtigung der geme<strong>in</strong>dlichen Eröffnungsbilanz ist auch zw<strong>in</strong>gend notwendig, wenn <strong>in</strong> dieser Bilanz z.B.<br />
die <strong>in</strong> § 75 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong> bestimmte Bemessung der Ausgleichsrücklage als fehlerhaft anzusehen ist. Maßgeblich<br />
für die Beurteilung der Fehlerhaftigkeit s<strong>in</strong>d die zum Bilanzstichtag vorliegenden objektiven Verhältnisse. Das<br />
Nähere für e<strong>in</strong>e Berichtigung und Nachholung von Wertansätzen der geme<strong>in</strong>dlichen Eröffnungsbilanz ist <strong>in</strong> der<br />
Vorschrift des § 57 GemHVO <strong>NRW</strong> bestimmt worden. So ist z.B. e<strong>in</strong> Wertansatz zu berichtigen, wenn es sich bei<br />
dem fehlerhaften Ansatz um e<strong>in</strong>en wesentlichen Wertbetrag handelt (vgl. Abbildung).<br />
Berichtigung der Werte der geme<strong>in</strong>dlichen Eröffnungsbilanz<br />
Vermögensgegenstände oder Sonderposten oder Schulden <strong>in</strong> der Eröffnungsbilanz<br />
Können berichtigt werden,<br />
- bei e<strong>in</strong>em zu niedrigen Wert,<br />
- bei e<strong>in</strong>em zu hohen Wert,<br />
- sie zu Unrecht angesetzt oder<br />
- zu Unrecht nicht angesetzt worden s<strong>in</strong>d.<br />
Abbildung 102 „Berichtigung der Werte der geme<strong>in</strong>dlichen Eröffnungsbilanz“<br />
Die Notwendigkeit der Berichtigung fehlerhafter Ansätze oder ihrer Nachholung ergibt sich aus der Aufgabe der<br />
Eröffnungsbilanz, e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage<br />
der Geme<strong>in</strong>de zu vermitteln. Daher s<strong>in</strong>d alle wesentlichen Fehler <strong>in</strong> der Eröffnungsbilanz zu korrigieren. Die unwesentlichen<br />
Fehler können dabei unberücksichtigt bleiben. Aufgrund der Tatsache, dass fehlerhafte Ansätze zu<br />
korrigieren s<strong>in</strong>d, ist e<strong>in</strong>e nachträgliche Ausübung von Wahlrechten bzw. Ermessensspielräumen nicht zulässig.<br />
In den Fällen der Nachholung e<strong>in</strong>es Wertansatzes besteht wie bei der Erstbilanzierung die Möglichkeit zur Ausübung<br />
von Wahlrechten. Da die Aufstellung der Eröffnungsbilanz nicht mit der Ermittlung e<strong>in</strong>es Gew<strong>in</strong>ns oder<br />
Verlustes verbunden ist, ist es konsequent, dass die Berichtigung der Eröffnungsbilanzwerte ebenfalls nicht ergebniswirksam<br />
vorzunehmen bzw. zu buchen ist. Daher soll die Ergebnisrechnung durch e<strong>in</strong>e Berichtigung der<br />
Eröffnungsbilanz nicht berührt werden. Durch diese Vorgabe wird die Durchführung oder Unterlassung e<strong>in</strong>er<br />
Bilanzberichtigung auf Grund von ergebnispolitischen Motiven der Geme<strong>in</strong>de verh<strong>in</strong>dert.<br />
Die Notwendigkeit e<strong>in</strong>er Berichtigung der geme<strong>in</strong>dlichen Eröffnungsbilanz kann sich auch erst bei der Aufstellung<br />
späterer Jahresabschlüsse herausstellen. Wenn am späteren Abschlussstichtag die fehlerhaft angesetzten Vermögensgegenstände<br />
nicht mehr vorhanden s<strong>in</strong>d oder die Schulden nicht mehr bestehen, soll gleichwohl e<strong>in</strong>e<br />
GEMEINDEORDNUNG 513
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 92 GO <strong>NRW</strong><br />
Berichtigung der geme<strong>in</strong>dlichen Eröffnungsbilanz erfolgen. Ist e<strong>in</strong>e Berichtigung vorzunehmen, so ist e<strong>in</strong>e sich<br />
daraus ergebende Wertänderung ergebnisneutral und unmittelbar mit der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage zu verrechnen.<br />
Die vorgenommenen Wertberichtigungen oder Wertnachholungen s<strong>in</strong>d im Anhang im des aufzustellenden Jahresabschluss<br />
(vgl. § 44 GemHVO <strong>NRW</strong>) von der Geme<strong>in</strong>de gesondert anzugeben.<br />
7.2 Zu Satz 2 (Geltung der Berichtigung und Nachholung von Wertansätzen):<br />
Nach der Vorschrift gilt die geme<strong>in</strong>dliche Eröffnungsbilanz als geändert, wenn bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse<br />
der Geme<strong>in</strong>de, die <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Eröffnungsbilanz enthaltenen Wertansätze für geme<strong>in</strong>dliche<br />
Vermögensgegenstände oder Sonderposten oder Schulden der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> zulässiger Weise berichtigt<br />
oder nachgeholt werden. Auch diese ausdrückliche Festlegung der Wirkung e<strong>in</strong>er Berichtigung und Nachholung<br />
von Wertansätzen bedeutet nicht, dass alle nach der Eröffnungsbilanz der Geme<strong>in</strong>de aufgestellten geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Jahresabschlüsse zu ändern s<strong>in</strong>d.<br />
Im Rahmen des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses, <strong>in</strong> dem die Berichtigung der geme<strong>in</strong>dlichen Eröffnungsbilanz<br />
vorgenommen wird, s<strong>in</strong>d im Anhang nicht nur Erläuterungen über die Durchführung der Berichtigung und Nachholung<br />
von Wertansätzen der geme<strong>in</strong>dlichen Eröffnungsbilanz zu geben, sondern es s<strong>in</strong>d auch deren Wirkungen<br />
für den Zeitraum zwischen der Eröffnungsbilanz der Geme<strong>in</strong>de und dem Abschlussstichtag dieses Jahresabschlusses<br />
anzugeben (vgl. § 44 i.V.m. § 57 Abs. 2 S. 2 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
7.3 Zu Satz 3 (Frist der Berichtigung und Nachholung von Wertansätzen):<br />
Die Vorschrift sieht e<strong>in</strong>e zeitliche Befristung der Berichtigung und Nachholung von Wertansätzen der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Eröffnungsbilanz vor, denn es wird ausdrücklich bestimmt, dass e<strong>in</strong>e Berichtigung letztmals im vierten der<br />
Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden kann. Sie ist aus dem D-Markbilanzgesetz<br />
übernommen worden. Diese gesetzliche Festlegung ist als sachgerecht anzusehen, denn der vom Gesetzgeber<br />
e<strong>in</strong>geräumte Zeitraum gewährt die erforderliche Sicherheit für die weitere Ausführung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft,<br />
die auf der Eröffnungsbilanz der Geme<strong>in</strong>de als Ausgangsgrundlage aufbaut. Die Geme<strong>in</strong>de müsste<br />
<strong>in</strong> der Zeit mehrerer geme<strong>in</strong>dlicher Haushaltsjahre über ausreichende Erfahrungen und ggf. Erkenntnisse verfügen,<br />
um die Notwendigkeit e<strong>in</strong>er Änderung ihrer Eröffnungsbilanz beurteilen zu können.<br />
Nach Ablauf e<strong>in</strong>es Zeitraumes von vier Jahren nach dem Bilanzstichtag der geme<strong>in</strong>dlichen Eröffnungsbilanz ist<br />
nicht zu erwarten, dass noch Korrekturen erforderlich werden, die zw<strong>in</strong>gend auf Fehler <strong>in</strong> der Eröffnungsbilanz als<br />
Ausgangsgrundlage zurückzuführen s<strong>in</strong>d. Daher ist die Möglichkeit der Bilanzberichtigung auf den genannten<br />
Zeitraum beschränkt worden. E<strong>in</strong>e Berichtigung oder Nachholung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz <strong>in</strong> den<br />
späteren Jahresabschlüssen wirkt auf die Eröffnungsbilanz zurück, erfordert aber nicht, die bestandskräftigen<br />
Jahresabschlüsse im Zeitraum zwischen der geme<strong>in</strong>dlichen Eröffnungsbilanz und der Berichtigung oder Nachholung<br />
von Wertansätzen zu ändern. Maßgeblich für die Beurteilung der Fehlerhaftigkeit s<strong>in</strong>d jedoch immer die zum<br />
Eröffnungsbilanzstichtag bei der Geme<strong>in</strong>de bestehenden objektiven Verhältnisse.<br />
7.4 Zu Satz 4 (Erleichterung bei der Berichtigung und Nachholung von Wertansätzen):<br />
Die Vorschrift sieht ausdrücklich vor, dass vorherige Jahresabschlüsse der Geme<strong>in</strong>de, also geme<strong>in</strong>dliche Jahresabschlüsse<br />
<strong>in</strong> dem Zeitraum zwischen der geme<strong>in</strong>dlichen Eröffnungsbilanz und dem Jahresabschluss der Geme<strong>in</strong>de,<br />
<strong>in</strong> dem von der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>e Berichtigung ihrer Eröffnungsbilanz vorgenommen wird oder e<strong>in</strong>e Nachholung<br />
von Wertansätzen <strong>in</strong> der Eröffnungsbilanz erfolgt, nicht berichtigt werden müssen. Gleichwohl ist diese<br />
Zeit bei der Festlegung der Wertgrößen, die dann als Wertansätze <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz ausgewiesen<br />
werden, zu berücksichtigen. Mit der Vorschrift soll den Geme<strong>in</strong>den e<strong>in</strong>e Erleichterung an die Hand gegeben wer-<br />
GEMEINDEORDNUNG 514
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 92 GO <strong>NRW</strong><br />
den, um den zusätzlichen Aufwand zu vermeiden. Dadurch wird vermieden, die bereits bekannt gemachten geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Jahresabschlüsse nochmals durch den Kämmerer neu aufzustellen und vom Bürgermeister zu bestätigen<br />
sowie vom Rechnungsprüfungsausschuss zu prüfen und vom Rat festzustellen.<br />
In besonderen örtlichen E<strong>in</strong>zelfällen kann sich aber durchaus e<strong>in</strong> Bedürfnis für e<strong>in</strong>e solche umfangreiche Berichtigungsreihe<br />
ergeben. Die Fehlerhaftigkeit der geme<strong>in</strong>dlichen Eröffnungsbilanz muss so groß und gravierend<br />
se<strong>in</strong>, dass unter dem Gesichtspunkt der Wesentlichkeit und der Aufgabe der geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlüsse,<br />
e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der wirtschaftlichen Lage der Geme<strong>in</strong>de zu vermitteln,<br />
sowie des Informations<strong>in</strong>teresses der Adressaten der geme<strong>in</strong>dlichen Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse<br />
der Geme<strong>in</strong>de, die Vornahme e<strong>in</strong>er Berichtigung aller Abschlüsse als zw<strong>in</strong>gend anzusehen ist. E<strong>in</strong> Ansatz dafür<br />
oder dagegen bieten jeweils der Tenor, der im Rahmen der Prüfung der geme<strong>in</strong>dlichen Abschlüsse nach § 92<br />
Abs. 5 und § 101 GO <strong>NRW</strong> zu erteilenden Bestätigungsvermerke, die Gegenstand der Feststellung durch den<br />
Rat, aber auch Grundlage für die Entlastung des Bürgermeisters s<strong>in</strong>d (vgl. § 96 GO <strong>NRW</strong>).<br />
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ<br />
GEMEINDEORDNUNG 515
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 93 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 93<br />
F<strong>in</strong>anzbuchhaltung<br />
(1) 1 Die F<strong>in</strong>anzbuchhaltung hat die Buchführung und die Zahlungsabwicklung der Geme<strong>in</strong>de zu erledigen. 2 Die<br />
Buchführung muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung so beschaffen se<strong>in</strong>, dass<br />
<strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>er angemessenen Zeit e<strong>in</strong> Überblick über die wirtschaftliche Lage der Geme<strong>in</strong>de gegeben werden<br />
kann. 3 Die Zahlungsabwicklung ist ordnungsgemäß und sicher zu erledigen.<br />
(2) Die Geme<strong>in</strong>de hat, wenn sie ihre F<strong>in</strong>anzbuchhaltung nicht nach § 94 durch e<strong>in</strong>e Stelle außerhalb der Geme<strong>in</strong>deverwaltung<br />
besorgen lässt, dafür e<strong>in</strong>en Verantwortlichen und e<strong>in</strong>en Stellvertreter zu bestellen.<br />
(3) 1 Soweit die ordnungsgemäße Erledigung und die Prüfung gewährleistet s<strong>in</strong>d, kann die F<strong>in</strong>anzbuchhaltung für<br />
funktional begrenzte Aufgabenbereiche auch durch mehrere Stellen der Verwaltung erfolgen. 2 Absatz 2 bleibt<br />
unberührt.<br />
(4) 1 Die mit der Prüfung und Feststellung des Zahlungsanspruches und der Zahlungsverpflichtung beauftragten<br />
Bediensteten dürfen nicht Zahlungen der Geme<strong>in</strong>de abwickeln. 2 Das Gleiche gilt für die mit der Rechnungsprüfung<br />
beauftragten Bediensteten.<br />
(5) Der Verantwortliche für die Zahlungsabwicklung und se<strong>in</strong> Stellvertreter dürfen nicht Angehörige des Bürgermeisters,<br />
des Kämmerers, der Leitung und der Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung sowie mit der Prüfung<br />
beauftragter Dritter se<strong>in</strong>.<br />
(6) Die Geschäftsvorfälle der Sondervermögen und der Treuhandvermögen s<strong>in</strong>d gesondert abzuwickeln, wenn für<br />
diese gesonderte Jahresabschlüsse aufgestellt werden.<br />
Erläuterungen zu § 93:<br />
I. Allgeme<strong>in</strong>es<br />
1. Die örtliche F<strong>in</strong>anzbuchhaltung<br />
1.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die E<strong>in</strong>führung des Ressourcenverbrauchskonzepts im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsrecht und des kaufmännischen<br />
Rechnungsstils der doppelten Buchführung für Geme<strong>in</strong>den hat <strong>in</strong> Anlehnung an das kaufmännische Rechnungswesen<br />
dazu geführt, besondere Regelungen über e<strong>in</strong>e F<strong>in</strong>anzbuchhaltung zu erlassen. In der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
F<strong>in</strong>anzbuchhaltung sollen alle geme<strong>in</strong>dlichen Geschäftsvorfälle und die dadurch bed<strong>in</strong>gten Veränderungen der<br />
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de erfasst werden. Sie hat die Angaben zu machen<br />
und die Daten zu liefern, die e<strong>in</strong>e Grundlage für den geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan mit Ergebnisplan und den<br />
F<strong>in</strong>anzplan sowie für den Jahresabschluss der Geme<strong>in</strong>de mit Ergebnisrechnung, F<strong>in</strong>anzrechnung und der Bilanz<br />
bilden sollen.<br />
Die Kosten- und Leistungsrechnung der Geme<strong>in</strong>de stellt neben der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzbuchhaltung den zweiten<br />
Hauptbereich des geme<strong>in</strong>dlichen Rechnungswesens und e<strong>in</strong>en eigenen Rechnungskreis für die Geme<strong>in</strong>de<br />
dar (vgl. § 18 GemHVO <strong>NRW</strong>). Zur geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzbuchhaltung s<strong>in</strong>d daher Umfang, Form und Inhalt <strong>in</strong><br />
Grundsätzen und unter Sicherheitsaspekten auch besondere Vorgaben für die Zahlungsabwicklung bestimmt<br />
worden.<br />
GEMEINDEORDNUNG 516
1.2 Die Ausgestaltung der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 93 GO <strong>NRW</strong><br />
Die Regelungen zur geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzbuchhaltung s<strong>in</strong>d unter E<strong>in</strong>beziehung der örtlichen Gegebenheiten von<br />
der Geme<strong>in</strong>de eigenverantwortlich weiter auszugestalten. Sie enthalten deshalb ke<strong>in</strong>e Festlegungen über die<br />
organisatorische Ausgestaltung der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung vor Ort, sondern eröffnen Gestaltungsspielräume für die<br />
Geme<strong>in</strong>de. Die örtliche Entscheidung für e<strong>in</strong>e bestimmte Organisationsform wird dabei maßgeblich durch die von<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzbuchhaltung zu erfüllenden Aufgaben bestimmt. Die von der Geme<strong>in</strong>de gewählte Organisationsform<br />
soll funktionsgerecht und <strong>in</strong> die geme<strong>in</strong>dliche Verwaltung <strong>in</strong>tegrierbar se<strong>in</strong>.<br />
Die aus der Aufgabe der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzbuchhaltung bestehende funktionale Aufgabenteilung zwischen<br />
dem orig<strong>in</strong>ären Buchungsgeschäft der Geme<strong>in</strong>de und dem geme<strong>in</strong>dlichen Zahlungsverkehr macht regelmäßig<br />
e<strong>in</strong>e sachbezogene Gliederung der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung <strong>in</strong> die Aufgabenbereiche "Buchführung" und „Zahlungsabwicklung"<br />
notwendig, denn die Organisationsform sollte an der Funktion orientiert werden. Diese sachgerechte<br />
Trennung sollte aber nicht dazu führen, die beiden Aufgabenbereiche <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung als organisatorisch<br />
selbstständige E<strong>in</strong>heiten vorzusehen.<br />
Es ist e<strong>in</strong>e Pflicht jeder Geme<strong>in</strong>de, ihre örtliche F<strong>in</strong>anzbuchhaltung so auszugestalten, dass die ordnungsgemäße<br />
Erledigung der Aufgaben gesichert ist und die Verantwortlichen dafür genau genug abgegrenzt und bestimmt<br />
werden. Dazu gehört auch, das erforderliche technische und kaufmännische Fachwissen verfügbar zu haben und<br />
die Qualität der Buchführung zu gewährleisten sowie dafür Sorge zu tragen, dass die Kosten der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung<br />
sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em verträglichen Rahmen bewegen.<br />
Die rechtlichen Pflichten und Gestaltungsmöglichkeiten der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung sowie die Vorgaben für die Umsetzung<br />
von Sicherheitsstandards s<strong>in</strong>d im E<strong>in</strong>zelnen <strong>in</strong> den Vorschriften des § 27 „Buchführung“, des § 30 „Zahlungsabwicklung,<br />
Liquiditätsplanung“ und des § 31 „Sicherheitsstandards und <strong>in</strong>terne Aufsicht“ der Geme<strong>in</strong>dehaushaltsverordnung<br />
enthalten. Auch die Vorschriften über die Bewirtschaftung und die Überwachung der im<br />
Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen sowie über den Umgang mit geme<strong>in</strong>dlichen Ansprüchen (vgl. §§ 23<br />
und 26 GemHVO <strong>NRW</strong>) s<strong>in</strong>d dabei nicht unbeachtlich.<br />
2. Rechengrößen im NKF<br />
2.1 Erträge und Aufwendungen als Rechengrößen<br />
2.1.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Mit dem Neuen Kommunalen <strong>F<strong>in</strong>anzmanagement</strong> (NKF) wird über Aufwendungen und Erträge das Ressourcenaufkommen<br />
und den Ressourcenverbrauch der Geme<strong>in</strong>de erfasst und der tatsächliche Werteverzehr über Abschreibungen<br />
vollständig abgebildet. Unter E<strong>in</strong>beziehung der Produktorientierung wird der Geme<strong>in</strong>de damit die<br />
haushaltsmäßige Erfassung und Darstellung des Ressourcenverbrauchs und des Ressourcenaufkommens bezogen<br />
auf ihre Aufgabenerfüllung möglich. Gleichzeitig soll die Ausrichtung der F<strong>in</strong>anzpolitik der Geme<strong>in</strong>den auf das<br />
Pr<strong>in</strong>zip der <strong>in</strong>tergenerativen Gerechtigkeit erreichen, dass der gesamte Ressourcenverbrauch e<strong>in</strong>er Periode regelmäßig<br />
durch Erträge derselben Periode gedeckt wird, um nachfolgende Generationen nicht zu überlasten.<br />
Die im NKF verwendeten Rechengrößen „Erträge“ und „Aufwendungen“ stellen den zutreffenden Buchungsstoff<br />
für den Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung der Geme<strong>in</strong>de dar. Sie s<strong>in</strong>d die zutreffenden Größen für e<strong>in</strong>e<br />
geme<strong>in</strong>dliche „Re<strong>in</strong>vermögensrechnung“, die das Geldvermögen und das Sachvermögen der Geme<strong>in</strong>de betrifft,<br />
wenn e<strong>in</strong> Vorgang bei der Geme<strong>in</strong>de das geme<strong>in</strong>dliche Eigenkapital erhöht oder verm<strong>in</strong>dert (Erhöhung: Ertrag;<br />
Verm<strong>in</strong>derung; Aufwand). Die Rechengrößen „Erträge“ und „Aufwendungen“ s<strong>in</strong>d daher von zentraler Bedeutung<br />
für die geme<strong>in</strong>dliche Ergebnisermittlung. In diesem Zusammenhang s<strong>in</strong>d auch die <strong>in</strong>ternen Leistungsbeziehungen<br />
der Geme<strong>in</strong>de zu beachten, die über die Rechengrößen „Erträge“ und „Aufwendungen“ erfasst werden, wenn die<br />
GEMEINDEORDNUNG 517
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 93 GO <strong>NRW</strong><br />
Geme<strong>in</strong>de diese zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs <strong>in</strong> ihrem Haushalt veranschlagt (vgl. §<br />
17 GemHVO <strong>NRW</strong>). Der <strong>in</strong>terne Charakter dieser örtlichen Leistungsbeziehungen steht der Anwendung der Rechengrößen<br />
nicht entgegen.<br />
2.1.2 Die Rechengröße „Erträge“<br />
Unter der geme<strong>in</strong>dlichen Rechengröße „Erträge“ wird betriebswirtschaftlich die bewertete Leistungserstellung der<br />
Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Haushaltsjahr (Geschäfts- bzw. Wirtschaftsjahr) verstanden. E<strong>in</strong>en Ertrag stellt dabei jeder<br />
geme<strong>in</strong>dliche Vorgang dar, der das Nettovermögen bzw. das Eigenkapital der Geme<strong>in</strong>de erhöht. Mit der Rechengröße<br />
werden aber auch die der Geme<strong>in</strong>de zustehenden Steuere<strong>in</strong>nahmen und die ihr gewährten Zuwendungen<br />
erfasst, denn diese stellen e<strong>in</strong>en erheblichen Anteil an den geme<strong>in</strong>dlichen E<strong>in</strong>nahmen dar.<br />
Die geme<strong>in</strong>dlichen Erträge s<strong>in</strong>d aber auch an Zahlungsvorgänge gebunden, so dass bei der Geme<strong>in</strong>de vielfach<br />
e<strong>in</strong>zahlungsgleiche Erträge entstehen. Die Rechengrößen „Ertrag“ und „E<strong>in</strong>nahme“ s<strong>in</strong>d dann deckungsgleich,<br />
wenn die gleiche Periode bzw. das gleiche Haushaltsjahr der Geme<strong>in</strong>de betroffen ist. Die Zahlungsvorgänge<br />
können aber auch <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er anderen Periode liegen. Die Geme<strong>in</strong>de erzielt dann <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Haushaltsjahr e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>nahme,<br />
die ke<strong>in</strong>en Ertrag darstellt, wenn entweder ke<strong>in</strong>e Leistungserstellung durch die Geme<strong>in</strong>de vorliegt oder<br />
wenn die Leistungserstellung und die dazugehörige E<strong>in</strong>nahme <strong>in</strong> unterschiedliche Haushaltsjahre fallen, z.B.<br />
Rechnungsabgrenzung bei Mietvorauszahlungen (vgl. § 42 GemHVO <strong>NRW</strong>). Die Begriffspaare „Erträge“ und<br />
„E<strong>in</strong>nahmen“ können im geme<strong>in</strong>dlichen Bereich wie folgt unterschieden werden (vgl. Abbildung).<br />
Ertrag, der nicht gleichzeitig<br />
e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>nahme ist<br />
Ertrag<br />
2.1.3 Die Rechengröße „Aufwendungen“<br />
Rechengröße „Erträge“<br />
Ertrag, der gleichzeitig<br />
e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>nahme ist<br />
E<strong>in</strong>nahme, die gleichzeitig<br />
e<strong>in</strong> Ertrag ist<br />
E<strong>in</strong>nahme<br />
Abbildung 103 „Rechengröße Erträge“<br />
E<strong>in</strong>nahme, die nicht gleichzeitig<br />
e<strong>in</strong> Ertrag ist<br />
Unter der geme<strong>in</strong>dlichen Rechengröße „Aufwendungen“ wird betriebswirtschaftlich der bewertete Güterverzehr<br />
der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Haushaltsjahr verstanden. Zu Aufwendungen führt daher jeder geme<strong>in</strong>dliche Vorgang,<br />
der das Nettovermögen bzw. das Eigenkapital der Geme<strong>in</strong>de verm<strong>in</strong>dert. Die geme<strong>in</strong>dlichen Aufwendungen s<strong>in</strong>d<br />
aber auch an Zahlungsvorgänge gebunden, so dass bei der Geme<strong>in</strong>de vielfach auszahlungsgleiche Aufwendungen<br />
entstehen. Die Zahlungsvorgänge können aber auch <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er anderen Periode liegen.<br />
Die Rechengrößen „Aufwand“ und „Ausgabe“ s<strong>in</strong>d dann deckungsgleich, wenn die gleiche Periode bzw. das<br />
gleiche Haushaltsjahr der Geme<strong>in</strong>de betroffen ist, z.B. wenn von der Geme<strong>in</strong>de die Gehälter, das Material, die<br />
Energie u.a. zu bezahlen ist. Die Geme<strong>in</strong>de leistet dann <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Haushaltsjahr e<strong>in</strong>e Ausgabe, die ke<strong>in</strong>en Auf-<br />
GEMEINDEORDNUNG 518
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 93 GO <strong>NRW</strong><br />
wand darstellt, wenn z.B. z.B. die im Dezember des Haushaltsjahres für den Januar des Folgejahres zu zahlende<br />
Beamtenbesoldung. Die Aufwendungen der Geme<strong>in</strong>de und die dazugehörige Ausgabe fallen dabei <strong>in</strong> unterschiedliche<br />
Haushaltsjahre (vgl. aktive Rechnungsabgrenzung nach § 42 GemHVO <strong>NRW</strong>). Die Begriffspaare<br />
„Aufwendungen“ und „Ausgaben“ können im geme<strong>in</strong>dlichen Bereich wie folgt unterschieden werden (vgl. Abbildung).<br />
Aufwand, der nicht gleichzeitig<br />
e<strong>in</strong>e Ausgabe ist<br />
Rechengröße „Aufwendungen“<br />
Aufwand<br />
Aufwand, der gleichzeitig<br />
e<strong>in</strong>e Ausgabe ist<br />
Ausgabe, die gleichzeitig<br />
e<strong>in</strong> Aufwand ist<br />
Ausgabe<br />
Abbildung 104 „Rechengröße Aufwendungen“<br />
2.2 E<strong>in</strong>zahlungen und Auszahlungen als Rechengrößen<br />
2.2.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Ausgabe, die nicht gleichzeitig<br />
e<strong>in</strong> Aufwand ist<br />
Die F<strong>in</strong>anzrechnung der Geme<strong>in</strong>de soll Auskunft über die tatsächliche f<strong>in</strong>anzielle Lage der Geme<strong>in</strong>de geben und<br />
dabei auch die F<strong>in</strong>anzierungsquellen sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes der Geme<strong>in</strong>de (Liquide<br />
Mittel) aufzeigen. Dadurch stellt die F<strong>in</strong>anzrechnung e<strong>in</strong>e Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsrechnung der<br />
Geme<strong>in</strong>de dar, bei der die Zahlungsströme ausschlaggebend s<strong>in</strong>d. Auf Grund dessen kommen bei der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
F<strong>in</strong>anzrechnung die Rechengrößen „E<strong>in</strong>zahlungen“ und „Auszahlungen“ als zutreffender Buchungsstoff zur<br />
Anwendung.<br />
Außerdem s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzrechnung die E<strong>in</strong>zahlungen und Auszahlungen unter Beachtung des<br />
Kassenwirksamkeitspr<strong>in</strong>zips zu erfassen. Dieses Pr<strong>in</strong>zip ist, vergleichbar mit der Entwicklung der Kassenkredite<br />
zu Krediten für die Liquiditätssicherung, zum Liquiditätsänderungspr<strong>in</strong>zip weiterentwickelt worden. Deshalb dürfen<br />
unter den Haushaltspositionen im F<strong>in</strong>anzplan nur Beträge <strong>in</strong> Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich e<strong>in</strong>gehenden<br />
oder zu leistenden Zahlungen ausgewiesen werden, die e<strong>in</strong>e Änderung der Liquidität der Geme<strong>in</strong>de<br />
bewirken.<br />
2.2.2 Die Rechengröße „E<strong>in</strong>zahlungen“<br />
Unter der geme<strong>in</strong>dlichen Rechengröße „E<strong>in</strong>zahlungen“ wird der tatsächliche Zahlungsmittelzufluss bei der Geme<strong>in</strong>de<br />
im Haushaltsjahr erfasst, der zu e<strong>in</strong>er Erhöhung des geme<strong>in</strong>dlichen Zahlungsmittelbestandes durch den<br />
Zugang liquider Mittel, die <strong>in</strong> Form von Bargeld oder Buchgeld der Geme<strong>in</strong>de zufließen, führt. Nicht als E<strong>in</strong>zahlung<br />
gilt die Erhöhung des Kassenbestandes der Geme<strong>in</strong>de durch e<strong>in</strong>e Barabhebung von e<strong>in</strong>em Bankkonto der<br />
Geme<strong>in</strong>de, weil dadurch der Zahlungsmittelbestand der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong>sgesamt nicht verändert wird.<br />
GEMEINDEORDNUNG 519
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 93 GO <strong>NRW</strong><br />
In diesem Zusammenhang liegen beim E<strong>in</strong>satz der Rechengrößen „E<strong>in</strong>zahlungen“ und „E<strong>in</strong>nahme“ im geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Rechnungswesen dann nicht e<strong>in</strong>nahmewirksame E<strong>in</strong>zahlungen vor, wenn es <strong>in</strong> gleicher Höhe zu e<strong>in</strong>er zu<br />
e<strong>in</strong>er Abnahme der geme<strong>in</strong>dlichen Forderungen oder zu e<strong>in</strong>er Erhöhung der geme<strong>in</strong>dlichen Verb<strong>in</strong>dlichkeiten<br />
kommt. Die Begriffspaare „E<strong>in</strong>zahlungen“ und „E<strong>in</strong>nahmen“ können im geme<strong>in</strong>dlichen Bereich wie folgt unterschieden<br />
werden (vgl. Abbildung).<br />
E<strong>in</strong>zahlung, die nicht gleichzeitig<br />
e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>nahme ist<br />
E<strong>in</strong>zahlung<br />
2.2.3 Die Rechengröße „Auszahlungen“<br />
Rechengröße „E<strong>in</strong>zahlungen“<br />
E<strong>in</strong>zahlung, die gleichzeitig<br />
e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>nahme ist<br />
E<strong>in</strong>nahme, die gleichzeitig<br />
e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>zahlung ist<br />
E<strong>in</strong>nahme<br />
Abbildung 105 „Rechengröße E<strong>in</strong>zahlungen“<br />
E<strong>in</strong>nahme, die nicht gleichzeitig<br />
e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>zahlung ist<br />
Unter der geme<strong>in</strong>dlichen Rechengröße „Auszahlungen“ wird der tatsächliche Zahlungsmittelabfluss bei der Geme<strong>in</strong>de<br />
im Haushaltsjahr erfasst, der zu e<strong>in</strong>er Verm<strong>in</strong>derung des geme<strong>in</strong>dlichen Zahlungsmittelbestandes durch<br />
den Abgang liquider Mittel führt. Die Abgabe von F<strong>in</strong>anzmitteln durch die Geme<strong>in</strong>de kann <strong>in</strong> Form von Bargeld<br />
oder Buchgeld erfolgen. Die Begriffspaare „Aufwendungen“ und „Ausgaben“ können im geme<strong>in</strong>dlichen Bereich<br />
wie folgt unterschieden werden (vgl. Abbildung).<br />
Aufzahlung, die nicht gleichzeitig<br />
ausgabewirksam ist<br />
Rechengröße „Auszahlungen“<br />
Auszahlung<br />
Auszahlung, die gleichzeitig<br />
ausgabewirksam ist<br />
Ausgabe, die gleichzeitig<br />
auszahlungswirksam ist<br />
Ausgabe<br />
Abbildung 106 „Rechengröße Auszahlungen“<br />
Ausgabe, die nicht gleichzeitig<br />
auszahlungswirksam ist<br />
In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass beim E<strong>in</strong>satz der Rechengrößen „Auszahlungen“ und „Ausgabe“<br />
auch dann ke<strong>in</strong>e ausgabewirksamen Auszahlungen vorliegen, wenn es <strong>in</strong> gleicher Höhe zu e<strong>in</strong>er zu e<strong>in</strong>er M<strong>in</strong>derung<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Verb<strong>in</strong>dlichkeiten oder zu e<strong>in</strong>er Zunahme der geme<strong>in</strong>dlichen Forderungen kommt. Auch<br />
GEMEINDEORDNUNG 520
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 93 GO <strong>NRW</strong><br />
e<strong>in</strong>e Verm<strong>in</strong>derung des Kassenbestandes der Geme<strong>in</strong>de durch e<strong>in</strong>e Bare<strong>in</strong>zahlung auf e<strong>in</strong> Bankkonto der Geme<strong>in</strong>de<br />
gilt nicht als geme<strong>in</strong>dliche Auszahlung, weil durch diesen Vorgang der Zahlungsmittelbestand der Geme<strong>in</strong>de<br />
<strong>in</strong>sgesamt nicht verändert wird.<br />
3. Der Kontenrahmen für die geme<strong>in</strong>dliche Buchführung<br />
3.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung bei der Buchführung der Geme<strong>in</strong>de erfordert,<br />
diese nach e<strong>in</strong>heitlichen Maßstäben zu gewährleisten. Es bedarf deshalb e<strong>in</strong>es systematischen Aufbaus der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Buchführung nach e<strong>in</strong>em Kontenplan, der aus dem NKF-Kontenrahmen abzuleiten ist (vgl. § 27<br />
Abs. 7 GemHVO <strong>NRW</strong>). Die von der Geme<strong>in</strong>de gebildeten Konten s<strong>in</strong>d gegen Manipulationen <strong>in</strong> Abhängigkeit<br />
von der e<strong>in</strong>gesetzten elektronischen Datenverarbeitung zu schützen.<br />
Das Gebot der vollständigen und verständlichen Aufzeichnung der geme<strong>in</strong>dlichen Geschäftsvorfälle <strong>in</strong> den Büchern<br />
der Geme<strong>in</strong>de ist auch e<strong>in</strong> Teil der Generalnorm. Ebenso f<strong>in</strong>det der Beleggrundsatz se<strong>in</strong>en Ausgangspunkt<br />
<strong>in</strong> der Generalnorm. Nicht zuletzt gehört auch die E<strong>in</strong>haltung der Aufbewahrungsfristen dazu (vgl. § 58 GemHVO<br />
<strong>NRW</strong>). Es gilt, die Zuverlässigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens der Geme<strong>in</strong>de zu sichern und<br />
die vorgesehenen Verwaltungsabläufe zu überwachen. Dieses Anliegen kommt auch <strong>in</strong> den weiteren haushaltsrechtlichen<br />
Vorschriften zum Ausdruck, z.B. durch die Vorgaben für die Zahlungsabwicklung <strong>in</strong> § 30, die Sicherheitsstandards<br />
<strong>in</strong> § 31 u.a. <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>dehaushaltsverordnung.<br />
3.2 Die Kontenklassen im NKF-Kontenrahmen<br />
3.2.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Im NKF-Kontenrahmen s<strong>in</strong>d die Kontenklassen 0 bis 8 für die Durchführung der „Geschäftsbuchführung“ belegt.<br />
Sie s<strong>in</strong>d nach dem Abschlussgliederungspr<strong>in</strong>zip aufgebaut und bilden e<strong>in</strong>en <strong>in</strong> sich geschlossenen Rechnungskreis,<br />
der selbstständig abgeschlossen wird. Außerdem spiegeln die Kontenklassen die geme<strong>in</strong>dliche Bilanz mit<br />
ihren Posten, die Ergebnisrechnung und die F<strong>in</strong>anzrechnung mit ihren Haushaltspositionen wieder. Auf dieser<br />
Grundlage ist zudem die Struktur der Kontengruppen als erster Gliederungsstufe der Kontenklassen aufgebaut,<br />
so dass die gebildeten Kontengruppen auch mit den e<strong>in</strong>schlägigen Bestimmungen über die Haushaltspositionen<br />
und Bilanzposten <strong>in</strong> den §§ 2, 3 und 41 GemHVO <strong>NRW</strong> <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang stehen.<br />
3.2.2 Die Kontenklassen für die Bilanz<br />
Für die notwendigen Bestandskonten der Bilanz wurden im NKF-Kontenrahmen die Kontenklassen 0 bis 3 e<strong>in</strong>gerichtet.<br />
Die vier Kontenklassen werden <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Vielzahl von Kontenarten untergliedert, die nachfolgend beispielhaft<br />
und nicht vollständig aufgezeigt werden:<br />
- Kontenklasse 0 <strong>in</strong> die Kontenarten „Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen“, „Unbebaute<br />
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“, „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“, „Infrastrukturvermögen“;<br />
- Kontenklasse 1 <strong>in</strong> die Kontenarten „ Anteile an verbundenen Unternehmen“, „Beteiligungen“, „Sondervermögen“,<br />
„Wertpapiere“, „Vorräte“, „Forderungen“, „Liquide Mittel“;<br />
- Kontenklasse 2 <strong>in</strong> die Kontenarten „Eigenkapital“, „Sonderposten“ und „Rückstellungen“;<br />
- Kontenklasse 3 <strong>in</strong> die Kontenarten „Verb<strong>in</strong>dlichkeiten aus Krediten für Investitionen“, „Verb<strong>in</strong>dlichkeiten aus<br />
Krediten zur Liquiditätssicherung“ „Passive Rechnungsabgrenzung.<br />
GEMEINDEORDNUNG 521
3.2.3 Die Kontenklassen für die Ergebnisrechnung<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 93 GO <strong>NRW</strong><br />
Für die notwendigen Ergebniskonten der Ergebnisrechnung wurden im NKF-Kontenrahmen die Kontenklassen 4<br />
und 5 e<strong>in</strong>gerichtet. Die beiden Kontenklassen werden <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Vielzahl von Kontenarten untergliedert, die nachfolgend<br />
beispielhaft und nicht vollständig aufgezeigt werden:<br />
- Kontenklasse 4 „Erträge“ <strong>in</strong> die Kontenarten „Steuern“, „Zuwendungen“, „Leistungsentgelte“, „F<strong>in</strong>anzerträge“,<br />
„Erträge aus <strong>in</strong>ternen Leistungsbeziehungen“, „Außerordentliche Erträge,<br />
- Kontenklasse 5 „Aufwendungen“ <strong>in</strong> die Kontenarten „Personalaufwendungen“, „Aufwendungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen“, „Z<strong>in</strong>sen“, „Bilanzielle Abschreibungen“, „Außerordentliche Aufwendungen“.<br />
3.2.4 Die Kontenklassen für die F<strong>in</strong>anzrechnung<br />
Für die notwendigen Zahlungskonten der F<strong>in</strong>anzrechnung wurden im NKF-Kontenrahmen die Kontenklassen 6<br />
und 7 e<strong>in</strong>gerichtet. Die beiden Kontenklassen werden <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Vielzahl von Kontenarten untergliedert, die nachfolgend<br />
beispielhaft und nicht vollständig aufgezeigt werden:<br />
- Kontenklasse 6 „E<strong>in</strong>zahlungen“ <strong>in</strong> die Kontenarten wie <strong>in</strong> Kontenklasse 4, jedoch noch zusätzlich die Kontenarten<br />
„E<strong>in</strong>zahlungen aus Investitionstätigkeit“ und „E<strong>in</strong>zahlungen aus F<strong>in</strong>anzierungstätigkeit“;<br />
- Kontenklasse 7 „Auszahlungen“ <strong>in</strong> die Kontenarten wie <strong>in</strong> Kontenklasse 5, jedoch noch zusätzlich die Kontenarten<br />
„Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ und „Auszahlungen aus F<strong>in</strong>anzierungstätigkeit“.<br />
3.2.5 Weitere Kontenklassen<br />
Die Kontenklasse „Abschlusskonten“ und die Kontenklasse „Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)“ stellen die<br />
beiden letzten Kontenklassen des NKF-Kontenrahmens dar. Sie s<strong>in</strong>d von der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> eigener Verantwortung<br />
auszugestalten und zu füllen.<br />
4. Der Liquiditätsverbund bzw. Cashpool<strong>in</strong>g<br />
Für die Geme<strong>in</strong>den besteht grundsätzlich die Möglichkeit, e<strong>in</strong>en Liquiditätsverbund bzw. e<strong>in</strong> Cashpool<strong>in</strong>g mit<br />
e<strong>in</strong>em Masteraccountkonto zwischen der Kernverwaltung und ihren wirtschaftlichen Unternehmen (§ 114 GO<br />
<strong>NRW</strong>), den organisatorisch verselbstständige E<strong>in</strong>richtungen (§ 107 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>) und rechtlich selbstständigen<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Unternehmen im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>es Konzerns e<strong>in</strong>zurichten. Nach Auskunft der Bundesanstalt für<br />
F<strong>in</strong>anzdienstleistungsaufsicht (BaF<strong>in</strong>) ist die Ausnahmeregelung <strong>in</strong> § 2 Abs. 1 Nr. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen<br />
(Kreditwesengesetz - KWG) vom 09.09.1998 (BGBl. I S. 2776) auch auf Geme<strong>in</strong>den anwendbar. Damit<br />
ist die Tätigkeit der Geme<strong>in</strong>de im Rahmen e<strong>in</strong>es Liquiditätsverbundes zwischen den o.a. geme<strong>in</strong>dlichen Beteiligten<br />
nicht als Tätigkeit e<strong>in</strong>es Kredit<strong>in</strong>stituts zu bewerten. Die Vorschrift des § 107 Abs. 6 GO <strong>NRW</strong>, nach dem die<br />
Geme<strong>in</strong>den ke<strong>in</strong> Bankunternehmen errichten, übernehmen oder betreiben dürfen, steht der E<strong>in</strong>richtung e<strong>in</strong>es<br />
Liquiditätsverbundes bzw. e<strong>in</strong>es Cashpool<strong>in</strong>gs nicht entgegen.<br />
Die Nutzung des Konzernprivilegs für die Abwicklung von Geldgeschäften <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Liquiditätsverbund der Geme<strong>in</strong>de<br />
setzt jedoch das Bestehen e<strong>in</strong>er Alle<strong>in</strong>- oder Mehrheitsgesellschafterstellung der Geme<strong>in</strong>de bei den betreffenden<br />
kommunalen Betrieben oder die verpflichtende E<strong>in</strong>beziehung dieser Betriebe <strong>in</strong> die Vollkonsolidierung<br />
für den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses voraus. E<strong>in</strong> solcher Liquiditätsverbund darf nicht dazu führen, dass<br />
die Geme<strong>in</strong>de Kredite zur Liquiditätssicherung oberhalb ihres eigenen haushaltsmäßigen Bedarfs aufnimmt.<br />
Die E<strong>in</strong>richtung e<strong>in</strong>es Liquiditätsverbund bzw. e<strong>in</strong>es Cashpool<strong>in</strong>gs durch die Geme<strong>in</strong>de bedarf e<strong>in</strong>er Abstimmung<br />
über die Abwicklung der Geldgeschäfte und der Festlegung von Verantwortlichkeiten zwischen den Beteiligten,<br />
e<strong>in</strong>schließlich der ggf. beauftragten Bank. Dieses Gebot gilt <strong>in</strong>sbesondere dann, wenn auch rechtlich selbststän-<br />
GEMEINDEORDNUNG 522
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 93 GO <strong>NRW</strong><br />
dige Betriebe der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en solchen Liquiditätsverbund e<strong>in</strong>bezogen werden. In diesen Fällen kann die<br />
f<strong>in</strong>anzwirtschaftliche Verantwortung nicht alle<strong>in</strong>e von der Kernverwaltung der Geme<strong>in</strong>de getragen werden. Sollen<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em solchen Liquiditätsverbund die Abwicklung der Geldgeschäfte über die Kernverwaltung der Geme<strong>in</strong>de<br />
erfolgen, tritt die Geme<strong>in</strong>de für die rechtlich selbstständigen Betriebe als „<strong>in</strong>nere“ Bank auf.<br />
5. Das Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz<br />
Im Rahmen der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgabenerfüllung, <strong>in</strong>sbesondere bei der Erledigung ihrer Zahlungsabwicklung,<br />
haben die Geme<strong>in</strong>den auch das Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz zu beachten, mit dem die Richtl<strong>in</strong>ie<br />
2007/64/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. November 2007 über Zahlungsdienste im<br />
B<strong>in</strong>nenmarkt umgesetzt worden ist. Die Zahlungsdiensterichtl<strong>in</strong>ie unterscheidet sechs Kategorien von Zahlungsdienstleistern.<br />
Unter e<strong>in</strong>en Erlaubnisvorbehalt stellt die Richtl<strong>in</strong>ie jedoch nur die Zahlungs<strong>in</strong>stitute als sonstige<br />
Zahlungsdienstleister. Soweit jedoch die Geme<strong>in</strong>den (auch Bund und Länder) nicht hoheitlich handelt, werden<br />
auch sie als Zahlungsdienstleister angesehen (vgl. § 1 Abs. 1 Nr. 3 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz - ZAG).<br />
Diese E<strong>in</strong>ordnung hat zur Folge, dass auch die Geme<strong>in</strong>de, die z.B. durch e<strong>in</strong>en Regie- oder Eigenbetrieb eigene<br />
Zahlungsdienste erbr<strong>in</strong>gt oder erbr<strong>in</strong>gen will, nicht unter den gesetzlichen Erlaubnisvorbehalt und die anderen<br />
besonderen Bestimmungen für Zahlungs<strong>in</strong>stitute fällt, Die Geme<strong>in</strong>de hat <strong>in</strong> diesen Fällen aber gleichwohl die<br />
allgeme<strong>in</strong>en Bestimmungen für Zahlungsdienstleister bei Qualifizierung ihres Handelns zu beachten. Unter die<br />
Kategorie des § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 ZAG fallen jedoch nicht die rechtlich selbständigen Betriebe der Geme<strong>in</strong>de,<br />
die ke<strong>in</strong>e hoheitlichen Aufgaben wahrnehmen, auch wenn sie sich zu 100 Prozent im Besitz der Geme<strong>in</strong>de bef<strong>in</strong>den.<br />
In diesem Zusammenhang enthält § 1 Abs. 2 ZAG e<strong>in</strong>en Katalog von Zahlungsdiensten, die privatrechtlich begründete<br />
Dienstleistungen e<strong>in</strong>es an e<strong>in</strong>em gegebenen Grundgeschäft nicht beteiligten Dritten zu erfassen und die<br />
dem Zahler helfen oder ihn erst <strong>in</strong> den Stand versetzen sollen, Bar-, elektronisches oder Buchgeld von ihm auf<br />
den Zahlungsempfänger zu übertragen. Mit der Vorschrift werden Dienstleistungen e<strong>in</strong>es Dritten erfasst, die die<br />
Ausführung e<strong>in</strong>er Zahlung zwischen zwei Parteien, dem Zahler und dem Zahlungsempfänger, unterstützen. Auf<br />
die rechtliche Ausgestaltung des Verhältnisses zwischen Zahler und Zahlungsempfänger (sogenanntes Valutaverhältnis)<br />
kommt es dabei nicht an. Dem Zahlungsvorgang kann dabei e<strong>in</strong>e familiäre „Verb<strong>in</strong>dlichkeit“, e<strong>in</strong>e Naturalobligation,<br />
e<strong>in</strong> bloßes Gefälligkeitsverhältnis, e<strong>in</strong>e Spende oder etwas anderes zu Grunde liegen. Entscheidend<br />
ist nur, dass e<strong>in</strong> Geldbetrag se<strong>in</strong>en Besitzer mit Hilfe e<strong>in</strong>es Dritten wechseln soll. Die nach dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz<br />
def<strong>in</strong>ierten Zahlungsdienste werden nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung).<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
Arten von Zahlungsdiensten<br />
Dienste, mit denen Bare<strong>in</strong>zahlungen auf e<strong>in</strong> Zahlungskonto (vgl. § 1 Abs. 3 ZAG)<br />
oder Barauszahlungen von e<strong>in</strong>em Zahlungskonto ermöglicht werden, sowie alle für<br />
die Führung e<strong>in</strong>es Zahlungskontos erforderlichen Vorgänge (E<strong>in</strong>- oder Auszahlungsgeschäft).<br />
Ausführung von Zahlungsvorgängen e<strong>in</strong>schließlich der Übermittlung von Geldbeträgen<br />
auf e<strong>in</strong> Zahlungskonto beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsdienstnutzers<br />
oder bei e<strong>in</strong>em anderen Zahlungsdienstleister durch<br />
a) die Ausführung von Lastschriften (vgl. § 1 Abs. 4 ZAG) e<strong>in</strong>schließlich e<strong>in</strong>maliger<br />
Lastschriften (Lastschriftgeschäft),<br />
b) die Ausführung von Überweisungen e<strong>in</strong>schließlich Daueraufträgen (Überweisungsgeschäft),<br />
c) die Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels e<strong>in</strong>er Zahlungskarte oder e<strong>in</strong>es<br />
ähnlichen Zahlungs<strong>in</strong>struments (Zahlungskartengeschäft),<br />
ohne Kreditgewährung (Zahlungsgeschäft)<br />
GEMEINDEORDNUNG 523
4.<br />
5.<br />
6.<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 93 GO <strong>NRW</strong><br />
Ausführung der <strong>in</strong> Nummer 2 genannten Zahlungsvorgänge mit Kreditgewährung<br />
im S<strong>in</strong>ne des § 2 Abs. 3 (Zahlungsgeschäft mit Kreditgewährung).<br />
Ausgabe von Zahlungsauthentifizierungs<strong>in</strong>strumenten (vgl. § 1 Abs. 5 ZAG) oder<br />
die Annahme und Abrechnung von mit Zahlungsauthentifizierungs<strong>in</strong>strumenten<br />
ausgelösten Zahlungsvorgängen (Zahlungsauthentifizierungsgeschäft),<br />
Ausführung von Zahlungsvorgängen, bei denen die Zustimmung des Zahlers zur<br />
Ausführung e<strong>in</strong>es Zahlungsvorgangs über e<strong>in</strong> Telekommunikations-, Digital-, oder<br />
IT-Gerät übermittelt wird und die Zahlung an den Betreiber des Telekommunikations-<br />
oder IT-Systems oder IT-Netzes erfolgt, sofern der Betreiber ausschließlich<br />
als zwischengeschaltete Stelle zwischen dem Zahlungsdienstnutzer und dem<br />
Lieferanten der Waren oder Dienstleistungen tätig ist (digitalisiertes Zahlungsgeschäft).<br />
Dienste, bei denen ohne E<strong>in</strong>richtung e<strong>in</strong>es Zahlungskontos auf den Namen e<strong>in</strong>es<br />
Zahlers oder e<strong>in</strong>es Zahlungsempfängers e<strong>in</strong> Geldbetrag des Zahlers ausschließlich<br />
zur Übermittlung e<strong>in</strong>es entsprechenden Betrags an den Zahlungsempfänger oder<br />
an e<strong>in</strong>en anderen, im Namen des Zahlungsempfängers handelnden Zahlungsdienstleister<br />
entgegengenommen wird oder bei dem der Geldbetrag im Namen des<br />
Zahlungsempfängers entgegengenommen und diesem verfügbar gemacht wird<br />
(F<strong>in</strong>anztransfergeschäft).<br />
Abbildung 107 „Arten von Zahlungsdiensten“<br />
Jeder der e<strong>in</strong>zelnen Tatbestände des Zahlungsdienstekatalogs knüpft dabei an die (beabsichtigte) Übermittlung<br />
von gesetzlichen Zahlungsmitteln (Bargeld), (gesetzliche Zahlungsmittel vertretendes) Buchgeld oder elektronischem<br />
Geld, das im Austausch für Bargeld, Buchgeld oder anderen, sich letztlich aber auch von Bargeld oder<br />
Buchgeld ableitenden elektronischen Geld geschaffen worden ist (siehe auch die Def<strong>in</strong>ition von „Geldbetrag“ <strong>in</strong><br />
Artikel 4 Abs. 15 der Zahlungsdiensterichtl<strong>in</strong>ie). In diesem Zusammenhang ist auch zu beachten, dass e<strong>in</strong> Zahlungssystem<br />
im S<strong>in</strong>ne des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes e<strong>in</strong> System zum Zwecke von Verarbeitung, Clear<strong>in</strong>g,<br />
Verrechnung und Abwicklung von Zahlungsvorgängen auf Basis e<strong>in</strong>er förmlichen Vere<strong>in</strong>barung mit geme<strong>in</strong>samen<br />
Regeln, die zwischen e<strong>in</strong>er Partei, die das System betreibt (Betreiber) und m<strong>in</strong>destens drei Teilnehmern<br />
zur Übermittlung von Geldbeträgen getroffen wurde; dabei wird e<strong>in</strong>e etwaige von dem Betreiber verselbständigte<br />
Ver- und Abrechnungsstelle, zentrale Vertragspartei oder Clear<strong>in</strong>gstelle nicht mitgerechnet. Zudem können Teilnehmer<br />
nur Zahlungsdienstleister se<strong>in</strong> (vgl. § 1 Abs. 6 ZAG).<br />
Die „privaten Währungen“, um e<strong>in</strong> auf regionalen Märkten ausgerichtetes Tauschmittel zu realisieren, s<strong>in</strong>d nicht<br />
als e<strong>in</strong> Zahlungsdienst im S<strong>in</strong>ne des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes anzusehen, solange die Rechnungse<strong>in</strong>heiten<br />
nicht zu irgende<strong>in</strong>em Zeitpunkt, und sei es nur bei E<strong>in</strong>tritt <strong>in</strong> oder Austritt aus diesem Markt <strong>in</strong> Euro, die<br />
Währung e<strong>in</strong>es Mitgliedstaats oder Vertragsstaats außerhalb der Euro-Zone oder e<strong>in</strong>es Drittstaats umgerechnet<br />
und e<strong>in</strong>gezahlt oder ausgezahlt werden. Steht jedoch am Ende e<strong>in</strong>e Abrechnung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em gesetzlichen Zahlungsmittel,<br />
und sei es auch nur bei e<strong>in</strong>em Austritt aus dem Verbund, so erbr<strong>in</strong>gt der Betreiber bei diesen wie bei<br />
jedem anderen Drei-Parteien- oder komplexeren Zahlungssystem Zahlungsdienste im S<strong>in</strong>ne dieses Gesetzes,<br />
wenn das Geschäftsmodell nicht bereits so ausgerichtet ist oder noch ausgerichtet wird, dass es unter e<strong>in</strong>e Bereichsausnahme<br />
des § 1 Abs. 10 ZAG passt.<br />
II. Erläuterungen im E<strong>in</strong>zelnen<br />
1. Zu Absatz 1 (Zweck und Inhalte der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung):<br />
1.1 Zu Satz 1 (Aufgabe der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung):<br />
Durch diese Vorschrift wird bestimmt, dass die F<strong>in</strong>anzbuchhaltung die Buchführung und die Zahlungsabwicklung<br />
der Geme<strong>in</strong>de zu erledigen hat. Die F<strong>in</strong>anzbuchhaltung hat die Geschäftsvorfälle der Geme<strong>in</strong>de systematisch<br />
GEMEINDEORDNUNG 524
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 93 GO <strong>NRW</strong><br />
und lückenlos nach bestimmten Regeln und Ordnungskriterien wertmäßig zu erfassen. Das neue Haushaltsrecht<br />
bedient sich dabei der kaufmännischen (doppelten) Buchführung, soweit nicht die Besonderheiten des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltswesens Abweichungen davon erforderlich machen.<br />
1.2 Zu Satz 2 (Beschaffenheit der Buchführung):<br />
1.2.1 Erfassung der Geschäftsvorfälle der Geme<strong>in</strong>de<br />
Die F<strong>in</strong>anzbuchhaltung muss die Entwicklung e<strong>in</strong>er Vermögens- (Bilanz) und e<strong>in</strong>er Ergebnisübersicht (Ergebnisrechnung)<br />
sowie e<strong>in</strong>er F<strong>in</strong>anzübersicht (F<strong>in</strong>anzrechnung) über e<strong>in</strong> „geschlossenes“ Kontensystem nach dem<br />
System der doppelten Buchführung ermöglichen, damit daraus der Jahresabschluss erstellt werden kann und<br />
dieser e<strong>in</strong> Bild der wirtschaftlichen Lage der Geme<strong>in</strong>de vermittelt. Es ist sachgerecht und angemessen, dass die<br />
Geschäftsvorfälle ausdrücklich unter Anwendung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) zu bearbeiten<br />
s<strong>in</strong>d. Auch damit soll gewährleistet werden, dass <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>er angemessenen Zeit e<strong>in</strong> Überblick über<br />
die wirtschaftliche Lage der Geme<strong>in</strong>de gegeben werden kann.<br />
1.2.2 Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB)<br />
1.2.2.1 Das Regelsystem der Grundsätze<br />
Im kaufmännischen System ist trotz der Vorschriften über die Buchführung und den Jahresabschluss e<strong>in</strong> Spielraum<br />
geblieben, aus dem durch Auslegungen und Interpretationen die gesetzesergänzenden „Grundsätze ordnungsmäßiger<br />
Buchführung (GoB)“ entwickelt worden s<strong>in</strong>d. Sie s<strong>in</strong>d Regeln, nach denen zu verfahren ist, damit<br />
e<strong>in</strong>e dem Gesetzeszweck entsprechende Buchführung vorgenommen und e<strong>in</strong> Jahresabschluss sowie e<strong>in</strong> Gesamtabschluss<br />
aufgestellt werden. Außerdem s<strong>in</strong>d sie Beurteilungsmaßstäbe für die Entscheidung, ob die Buchführung<br />
und der Jahresabschluss sowie der Gesamtabschluss ordnungsgemäß s<strong>in</strong>d, d.h. ob sie formell und materiell<br />
den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.<br />
Das geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsrecht macht - wie das Handelsrecht - die GoB zur Grundlage der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Buchführung, da beide Rechtsvorschriften nicht alle bilanzierungsfähigen und -pflichtigen Sachverhalte sowie die<br />
dazu erforderlichen Grundsätze detailliert regeln können. Bestehen gesetzliche Regelungen gehen diese den<br />
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung vor. Die GoB s<strong>in</strong>d daher e<strong>in</strong> gesetzlich verankertes Regelungssystem,<br />
stehen jedoch nicht über dem Gesetz. Sie können sich als unbestimmte Rechtsbegriffe nur im Rahmen der<br />
gesetzlichen Regelungen unter Beachtung von S<strong>in</strong>n und Zweck des Gesetzes oder e<strong>in</strong>zelner Vorschriften weiter<br />
entwickeln. Zur Auslegung s<strong>in</strong>d i.d.R. die juristischen Auslegungskriterien heranzuziehen.<br />
Als GoB ist daher jedes Verfahren und jede Methode anzuerkennen, die dazu führen, dass gesetzliche Regelungen<br />
im E<strong>in</strong>zelfall ihrem S<strong>in</strong>n und Zweck entsprechend angewandt werden. Mit der Verwendung des unbestimmten<br />
Rechtsbegriffs der GoB wird gewährleistet, dass auf neue Sachverhalte <strong>in</strong> der Praxis den gesetzlichen Anforderungen<br />
gemäß reagiert werden kann. Auf e<strong>in</strong>e abschließende Regelung über die GoB hat der Gesetzgeber<br />
bewusst verzichtet, um die fortlaufende Entwicklung und Veränderung nicht zu bee<strong>in</strong>trächtigen. Die GoB sollen<br />
sicherstellen, dass e<strong>in</strong> sachverständiger Dritter sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er angemessenen Zeit e<strong>in</strong>en Überblick über die Aufzeichnung<br />
von Buchungsvorfällen und die Aufzeichnung von Vermögens- und Schuldenpositionen verschaffen<br />
kann und Manipulationsmöglichkeiten verh<strong>in</strong>dert werden, aber auch, dass diesem Dritten e<strong>in</strong> qualifizierter E<strong>in</strong>blick<br />
<strong>in</strong> die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de möglich ist.<br />
Es ist dazu nicht festgelegt worden, welches Maß an Sachverstand erforderlich se<strong>in</strong> muss, um die geme<strong>in</strong>dliche<br />
Tätigkeit im jeweils betroffenen Produkt- bzw. Aufgabenbereich beurteilen und nachvollziehen zu können. Allgeme<strong>in</strong><br />
wird davon auszugehen se<strong>in</strong>, dass e<strong>in</strong> sachverständiger Dritter ausreichende Kenntnisse über die geme<strong>in</strong>d-<br />
GEMEINDEORDNUNG 525
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 93 GO <strong>NRW</strong><br />
liche Haushaltswirtschaft bzw. das Rechnungswesen der Geme<strong>in</strong>de besitzen muss, damit er die Ausführung der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft und deren Ergebnis im geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss sowie im Gesamtabschluss<br />
der Geme<strong>in</strong>de verstehen und beurteilen kann. Dabei wird auch die Größe der Geme<strong>in</strong>de sowie die Größe<br />
und Komplexität der geme<strong>in</strong>dlichen Buchführung e<strong>in</strong>schließlich der Art der örtlichen DV-Buchführung zu berücksichtigen<br />
se<strong>in</strong>.<br />
Bei der Beurteilung, ob e<strong>in</strong> sachverständiger Dritter sich <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>er angemessenen Zeit e<strong>in</strong>en Überblick über<br />
die Vorgehensweise und die Ergebnisse verschaffen kann, ist ebenfalls von den vorhandenen örtlichen Gegebenheiten<br />
auszugehen. Die Bestimmung der angemessenen Zeit ist somit auch von der Größe der Geme<strong>in</strong>de<br />
sowie der Größe und Komplexität der geme<strong>in</strong>dlichen Buchführung e<strong>in</strong>schließlich der Art der örtlichen DV-<br />
Buchführung abhängig. Außerdem sollen Manipulationsmöglichkeiten verh<strong>in</strong>dert werden, damit dem Dritten e<strong>in</strong><br />
qualifizierter E<strong>in</strong>blick <strong>in</strong> die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anz(gesamt)lage der Geme<strong>in</strong>de möglich ist.<br />
Zudem sorgt die Auslegung der GoB durch Rechtsprechung und Literatur mittelbar für e<strong>in</strong>e dynamische Anpassung<br />
des Rechts über das geme<strong>in</strong>dliche Rechnungswesen an die aktuellen nationalen und <strong>in</strong>ternationalen Entwicklungen.<br />
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung werden dann weiterentwickelt, wenn aus neuen<br />
Sachverhalten heraus dafür e<strong>in</strong> Erfordernis besteht.<br />
1.2.2.2 Die Inhalte der Grundsätze<br />
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung s<strong>in</strong>d Regeln, nach denen auch im NKF zu verfahren ist, damit<br />
e<strong>in</strong>e dem Zweck des geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsrechts entsprechende Buchführung durch die Geme<strong>in</strong>den vorgenommen<br />
und e<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>dlicher Jahresabschluss (vgl. § 95 GO <strong>NRW</strong>) sowie e<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>dlicher Gesamtabschluss<br />
(vgl. § 116 GO <strong>NRW</strong>) aufgestellt werden können. Die GoB s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong> gesetzlich verankertes Regelungssystem. Sie<br />
können sich als unbestimmte Rechtsbegriffe nur im Rahmen der gesetzlichen Regelungen unter Beachtung von<br />
S<strong>in</strong>n und Zweck des Gesetzes oder e<strong>in</strong>zelner Vorschriften weiter entwickeln.<br />
Die GoB bedeuten ke<strong>in</strong>e Gesetzeslücke, sondern e<strong>in</strong>en gewünschten und wichtigen Verweis auf nicht gesetzliche<br />
Normen und Erkenntnisse. Vielfach s<strong>in</strong>d aber auch bereits Inhalte der GoB zu gesetzlichen Regelungen (gesetzlich<br />
bestimmten Grundsätzen) geworden. Außerdem werden die GoB als Beurteilungsmaßstäbe für die Entscheidung<br />
benötigt, ob die Buchführung und der Jahresabschluss sowie der Gesamtabschluss der Geme<strong>in</strong>de ordnungsgemäß<br />
s<strong>in</strong>d, denn sie müssen sowohl formell als auch materiell den haushaltsrechtlichen Anforderungen<br />
entsprechen. Die GoB im engeren S<strong>in</strong>ne stehen daher unmittelbar im Zusammenhang mit der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung<br />
der Geme<strong>in</strong>de. Folgende Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung gelten für die Geme<strong>in</strong>den (vgl. Abbildung).<br />
Grundsatz der Vollständigkeit<br />
Grundsatz der Richtigkeit und<br />
Willkürfreiheit<br />
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB)<br />
GEMEINDEORDNUNG 526<br />
In der Buchführung s<strong>in</strong>d alle Geschäftsvorfälle sowie die Vermögens-<br />
und Schuldenlage vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet<br />
zu erfassen und zu dokumentieren. Daraus folgt das Erfordernis<br />
des systematischen Aufbaus der Buchführung unter Aufstellung<br />
e<strong>in</strong>es Kontenplans, das Pr<strong>in</strong>zip der vollständigen und verständlichen<br />
Aufzeichnung sowie das Belegpr<strong>in</strong>zip, d.h. die Grundlage für<br />
die Richtigkeit der Buchung bildet den Buchungsbeleg mit der<br />
Festlegung „Ke<strong>in</strong>e Buchung ohne Beleg.“ Dazu zählt auch die<br />
E<strong>in</strong>haltung der vorgesehenen Aufbewahrungsfristen.<br />
Die Aufzeichnungen über die Geschäftsvorfälle durch die Geme<strong>in</strong>de<br />
müssen die Realität möglichst genau abbilden, so dass die Informationen<br />
daraus begründbar und nachvollziehbar sowie objektiv richtig<br />
und willkürfrei s<strong>in</strong>d. Sie müssen sich <strong>in</strong> ihren Aussagen mit den zu<br />
Grunde liegenden Dokumenten decken und der Buchführungspflichtige<br />
bestätigen kann, dass die Buchführung e<strong>in</strong>e getreue<br />
Dokumentation se<strong>in</strong>er Geschäftsvorfälle nach den rechtlichen
Grundsatz der Verständlichkeit<br />
Grundsatz der Aktualität<br />
Grundsatz der Relevanz<br />
Grundsatz der Stetigkeit<br />
Grundsatz des Nachweises<br />
der Recht- und Ordnungsmäßigkeit<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 93 GO <strong>NRW</strong><br />
Bestimmungen und den GoB erfolgt.<br />
Die Informationen des Rechnungswesens s<strong>in</strong>d für den Rat und die<br />
Bürger als Öffentlichkeit so aufzubereiten und verfügbar zu machen,<br />
dass die wesentlichen Informationen über die Vermögens-<br />
und Schuldenlage klar ersichtlich und verständlich s<strong>in</strong>d.<br />
Es ist e<strong>in</strong> enger zeitlicher Bezug zwischen dem Zeitraum, über den<br />
Rechenschaft gegeben wird, und der Veröffentlichung der Rechenschaft<br />
herzustellen.<br />
Das Rechnungswesen muss die Informationen bieten, die zur<br />
Rechenschaft notwendig s<strong>in</strong>d, sich jedoch im H<strong>in</strong>blick auf die Wirtschaftlichkeit<br />
und Verständlichkeit auf die relevanten Daten beschränken.<br />
Dabei soll der Aufwand der Informationsbeschaffung <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>em angemessenen Verhältnis zum Nutzen der Informationsbereitstellung<br />
stehen.<br />
Die Grundlagen des Rechnungswesens, <strong>in</strong>sbesondere die Methoden<br />
für Ansatz und Bewertung des Vermögens, sollen <strong>in</strong> der Regel<br />
unverändert bleiben, so dass e<strong>in</strong>e Stetigkeit im Zeitablauf erreicht<br />
wird. Notwendige Anpassungen s<strong>in</strong>d besonders kenntlich zu machen.<br />
Im Jahresabschluss ist über die Recht- und Ordnungsmäßigkeit der<br />
Haushaltswirtschaft Rechenschaft abzulegen.<br />
Abbildung 108 „Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB)“<br />
Durch die GoB wird jedoch ke<strong>in</strong> bestimmtes Buchführungssystem vorgeschrieben. Vielmehr entspricht e<strong>in</strong> Buchführungssystem<br />
dann den GoB, wenn es so beschaffen ist, dass es e<strong>in</strong>en Überblick über die geme<strong>in</strong>dlichen Geschäftsvorfälle<br />
und die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de vermitteln kann und die<br />
Geschäftsvorfälle sich <strong>in</strong> ihrer Entstehung und sachlichen Zuordnung bzw. Abwicklung nachverfolgen lassen. Da<br />
sich aus diesen Rahmengrundsätzen ggf. Zielkonflikte ergeben können, ist es bei der örtlichen Ausgestaltung des<br />
Rechnungswesens notwendig, bei konkurrierenden Sachverhalten e<strong>in</strong>e Abwägung vorzunehmen.<br />
1.2.3 Der Grundsatz der <strong>in</strong>tergenerativen Gerechtigkeit<br />
Im Zusammenhang mit den gesetzlich bestimmten Grundsätzen und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung<br />
ist gesondert der Grundsatz der <strong>in</strong>tergenerativen Gerechtigkeit gesetzlich bestimmt worden (vgl. § 1 Abs.<br />
1 S. 3 GO <strong>NRW</strong>). Dieser Grundsatz wird dadurch ergänzt, dass bestimmt worden ist, „Die Geme<strong>in</strong>den haben ihr<br />
Vermögen und ihre E<strong>in</strong>künfte so zu verwalten, dass die Geme<strong>in</strong>def<strong>in</strong>anzen gesund bleiben“ (vgl. § 10 S. 1 GO<br />
<strong>NRW</strong>). Er be<strong>in</strong>haltet, dass die Geme<strong>in</strong>den <strong>in</strong> Verantwortung für die künftigen Generationen handeln müssen,<br />
denn die Perspektive der ausreichenden F<strong>in</strong>anzierung künftiger Aufgaben wurde für die Geme<strong>in</strong>de mit dem Konzept<br />
der Generationengerechtigkeit verknüpft (vgl. Abbildung).<br />
Intergenerative Gerechtigkeit<br />
Grundsatz der <strong>in</strong>tergenerativen Gerechtigkeit<br />
§ 1 Abs. 1 S. 3 GO <strong>NRW</strong><br />
Abbildung 109 „Intergenerative Gerechtigkeit“<br />
GEMEINDEORDNUNG 527
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 93 GO <strong>NRW</strong><br />
Es gilt dabei zu beurteilen, <strong>in</strong> welchem Umfang künftige Generationen von den Auswirkungen gegenwärtiger<br />
geme<strong>in</strong>dliche Haushaltspolitik betroffen s<strong>in</strong>d und welche Leistungskraft der Geme<strong>in</strong>de künftig noch vorhanden<br />
se<strong>in</strong> wird. Der Grundsatz der <strong>in</strong>tergenerativen Gerechtigkeit erfordert daher u.a. die zeitliche Verteilung von Nutzen<br />
und Lasten im geme<strong>in</strong>dlichen Bereich sowie die Tragfähigkeit der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzen auch für die Zukunft.<br />
Die Geme<strong>in</strong>de muss deshalb bei ihrer Haushaltsplanung und Haushaltsausführung unter Beachtung der<br />
übrigen geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsgrundsätze immer im Blick haben muss, auch ausreichende Handlungsmöglichkeiten<br />
für die künftigen Generationen zu erhalten. Der Grundsatz be<strong>in</strong>haltet deshalb u.a. auch, dass die Geme<strong>in</strong>de<br />
ke<strong>in</strong>e rücksichtslose Inanspruchnahme der Abgabepflichtigen vornehmen darf.<br />
1.2.4 Wichtige gesetzlich bestimmte Grundsätze<br />
Die wichtigsten Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung s<strong>in</strong>d für die Umsetzung durch die Geme<strong>in</strong>den <strong>in</strong> vielen<br />
Vorschriften der Geme<strong>in</strong>deordnung und der Geme<strong>in</strong>dehaushaltsverordnung konkretisiert worden. Zu den <strong>in</strong><br />
diesen Vorschriften gesetzlich bestimmten Grundsätzen über die geme<strong>in</strong>dliche Buchführung, die geme<strong>in</strong>dliche<br />
Bilanz (Jahresabschluss) und den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>e Vielzahl von Grundsätzen zu zählen<br />
(vgl. Abbildung).<br />
Wichtige gesetzlich bestimmte Grundsätze<br />
Bezeichnung<br />
Grundsätze zur geme<strong>in</strong>dlichen Buchführung<br />
Grundsatz der Klarheit<br />
Grundsatz der Richtigkeit<br />
Grundsatz der Buchführungswahrheit<br />
Grundsatz der Übersichtlichkeit<br />
Grundsatz der Aktualität<br />
Grundsatz der Verständlichkeit<br />
Grundsatz der Vollständigkeit<br />
Belegpr<strong>in</strong>zip<br />
Vorschriften<br />
§ 27 Abs. 1, § 41 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 27 Abs. 2 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 27 Abs. 2 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 27 Abs. 2 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 96, § 116 GO <strong>NRW</strong>, § 27 Abs. 2<br />
GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 27 Abs. 2 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 91 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>, § 27 Abs. 1 und<br />
2, § 41 Abs. 1 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 27 Abs. 3 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
Grundsätze zur geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz (Jahresabschluss)<br />
Aktivierungsgrundsatz<br />
Passivierungsgrundsatz<br />
Grundsatz der Stetigkeit<br />
Grundsatz der Bilanzidentität<br />
GEMEINDEORDNUNG 528<br />
§ 41 Abs. 1 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 41 Abs. 1 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 32 Abs. 1 Nr. 5, § 41 Abs. 5 GemHVO<br />
<strong>NRW</strong><br />
§ 32 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO <strong>NRW</strong>
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 93 GO <strong>NRW</strong><br />
(formelle Bilanzkont<strong>in</strong>uität)<br />
Grundsatz der Bilanzierungswahrheit<br />
Stichtagspr<strong>in</strong>zip<br />
Grundsatz der Bilanzidentität<br />
Grundsatz der E<strong>in</strong>zelbewertung<br />
Grundsatz der Vorsicht<br />
Grundsatz der Periodenabgrenzung<br />
Grundsatz der Bewertungsstetigkeit<br />
(materielle Bilanzkont<strong>in</strong>uität)<br />
Anschaffungswertpr<strong>in</strong>zip<br />
Grundsatz des Saldierungsverbots<br />
Grundsatz des Nachweises<br />
der Recht- und Ordnungsmäßigkeit<br />
§ 95, § 116 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 95 Abs. 1, § 116 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 32 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 32 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 91 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>, § 32 Abs. 1 Nr. 3,<br />
§ 35 Abs. 7 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 32 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 32 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 91 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 41 Abs. 2 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 95 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong><br />
Grundsätze zum geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss<br />
Grundsatz der Fiktion der rechtlichen E<strong>in</strong>heit<br />
Grundsatz der E<strong>in</strong>heitlichkeit des Ausweises<br />
1.2.5 Weitere wichtige Grundsätze<br />
Grundsatz der Vollständigkeit<br />
des Konsolidierungskreises<br />
Grundsatz der Elim<strong>in</strong>ierung<br />
„konzern<strong>in</strong>terner“ Beziehungen<br />
Grundsatz der Wesentlichkeit<br />
§ 116 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 49 Abs. 3 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 116 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 50 GemHVO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 303 HGB<br />
§ 116 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong><br />
Abbildung 110 „Wichtige gesetzlich bestimmte Grundsätze“<br />
Neben den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB), die die eigentlichen Grundsätze darstellen und<br />
die sich auf die laufende Buchführung beziehen und die Art der Erfassung und Darstellung der Geschäftsvorfälle<br />
sowie deren Schutz vor Verlust und Verfälschung regeln, s<strong>in</strong>d weitere wichtige Grundsätze entwickelt worden, die<br />
nicht gesetzlich konkretisiert worden s<strong>in</strong>d. Jeder dieser Grundsätze soll sicherstellen, dass e<strong>in</strong> sachverständiger<br />
Dritter sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er angemessenen Zeit e<strong>in</strong>en Überblick über die Aufzeichnung von Buchungsvorfällen und die<br />
Aufzeichnung von Vermögens- und Schuldenpositionen verschaffen kann und Manipulationsmöglichkeiten verh<strong>in</strong>dert<br />
werden, aber auch, dass diesem Dritten e<strong>in</strong> qualifizierter E<strong>in</strong>blick <strong>in</strong> die Vermögens-, Schulden-, Ertrags-<br />
und F<strong>in</strong>anz(gesamt)lage der Geme<strong>in</strong>de möglich ist (vgl. Abbildung).<br />
GEMEINDEORDNUNG 529
Grundsätze<br />
ordnungsmäßiger<br />
DV-gestützter<br />
Buchführungssysteme (GoBS)<br />
Grundsätze<br />
ordnungsmäßiger<br />
Inventur (GoI)<br />
Grundsätze<br />
ordnungsmäßiger<br />
Bilanzierung (GoBi)<br />
Grundsätze<br />
ordnungsmäßiger<br />
Lageberichterstattung (GoL)<br />
Grundsätze<br />
ordnungsmäßiger<br />
Abschlussprüfungen (GoA)<br />
Grundsätze<br />
ordnungsmäßiger<br />
Konzernrechnungslegung (GoK)<br />
Grundsätze<br />
ordnungsmäßiger<br />
Risikoüberwachung (GoR)<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 93 GO <strong>NRW</strong><br />
Weitere wichtige Grundsätze<br />
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sollen sicherzustellen,<br />
dass die Buchungen und sonstigen Aufzeichnungen vollständig, richtig,<br />
zeitgerecht und geordnet vorgenommen werden, wenn die Buchführung<br />
mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung erfolgt (vgl. § 27 Abs. 5<br />
GemHVO <strong>NRW</strong>)<br />
Die Grundsätze beziehen sich auf die Erstellung des Inventars und<br />
sollen sicherstellen, dass <strong>in</strong> der Inventur e<strong>in</strong>e vollständige Erfassung des<br />
Vermögens und der Schulden erfolgt (vgl. § 91 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 28 und<br />
29 GemHVO <strong>NRW</strong>)<br />
Die Grundsätze der Aktivierung, Passivierung und Bewertung werden<br />
weiter detailliert. Dazu gehören auch die Grundsätze für die Bilanzgliederung<br />
(vgl. z.B. § 41 bis 43 GemHVO <strong>NRW</strong>)<br />
Die Grundsätze spezifizieren die Anforderungen für die durch den Lagebericht<br />
vorzunehmende Informationsvermittlung (vgl. § 48 GemHVO<br />
<strong>NRW</strong>)<br />
Die Grundsätze f<strong>in</strong>den h<strong>in</strong>sichtlich der jährlichen Abschlussprüfung<br />
Anwendung. Diese be<strong>in</strong>halten u.a. Festlegungen zu den Prüfungshandlungen.<br />
Außerdem bestehen noch weitere Ergänzungen dieser Grundsätze<br />
durch die „Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei<br />
Abschlussprüfungen“ sowie die „Grundsätze für die ordnungsmäßige<br />
Erteilung von Bestätigungsvermerken bei Abschlussprüfungen“.<br />
Die Grundsätze f<strong>in</strong>den bei der Aufstellung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses<br />
Anwendung (vgl. § 116 GO <strong>NRW</strong>)<br />
Die Grundsätze s<strong>in</strong>d für die pflichtgemäße Risikoüberwachung entwickelt<br />
worden. Sie be<strong>in</strong>halten die allgeme<strong>in</strong>en Handlungsvorgaben bzw.<br />
Handlungsempfehlungen zur Ausgestaltung e<strong>in</strong>es Risikoüberwachungssystems.<br />
Abbildung 111 „Weitere wichtige Grundsätze“<br />
Die Auslegung der GoB durch Rechtsprechung und Literatur sorgt zudem mittelbar für e<strong>in</strong>e dynamische Anpassung<br />
des Rechts über das geme<strong>in</strong>dliche Rechnungswesen an die aktuellen nationalen und <strong>in</strong>ternationalen Entwicklungen.<br />
1.2.6 Sachgerechte Anwendung der Grundsätze<br />
Die sachgerechte Anwendung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung unter Beachtung ihrer qualitativen<br />
Merkmale führt grundsätzlich zu e<strong>in</strong>er wirklichkeitsgetreuen Darstellung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und<br />
F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de. Soweit sich die örtlichen Entscheidungen an diesen Grundsätzen orientieren, entstehen<br />
relevante, verlässliche und verständliche Informationen über die wirtschaftliche Lage der Geme<strong>in</strong>de. Um<br />
dieses sicherzustellen s<strong>in</strong>d u.a. die Gliederungsvorschriften zur geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz <strong>in</strong> § 41 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
konkretisiert worden z.B. die Grundsätze „Klarheit“ und „Übersichtlichkeit“. Die Bewertungsvorschriften <strong>in</strong> den §§<br />
32 bis 36, 42 und 43 GemHVO <strong>NRW</strong> prägen dabei das Vorsichtspr<strong>in</strong>zip weiter aus.<br />
GEMEINDEORDNUNG 530
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 93 GO <strong>NRW</strong><br />
Zur Auslegung der GOB s<strong>in</strong>d i.d.R. die juristischen Auslegungskriterien heranzuziehen. Als GoB ist daher jedes<br />
Verfahren und jede Methode anzuerkennen, die dazu führen, dass gesetzliche Regelungen im E<strong>in</strong>zelfall ihrem<br />
S<strong>in</strong>n und Zweck entsprechend angewandt werden. Mit der Verwendung des unbestimmten Rechtsbegriffs der<br />
GoB wird gewährleistet, dass auf neue Sachverhalte <strong>in</strong> der Praxis den gesetzlichen Anforderungen gemäß reagiert<br />
werden kann. Auf e<strong>in</strong>e abschließende Regelung über die GoB hat der Gesetzgeber bewusst verzichtet, um<br />
die fortlaufende Entwicklung und Veränderung nicht zu bee<strong>in</strong>trächtigen. Ausgehend vom allgeme<strong>in</strong>en Schutzzweck<br />
des Rechnungswesens können die für das kaufmännische Rechnungswesen anerkannten Ziele „Dokumentation“,<br />
„Rechenschaft“ und „Kapitalerhaltung“ auch im Rechnungswesen der Geme<strong>in</strong>den e<strong>in</strong>e entsprechende<br />
Anwendung f<strong>in</strong>den.<br />
Die grundsätzliche Übere<strong>in</strong>stimmung des Rechnungszwecks ist darauf zurückzuführen, dass das Verhältnis zwischen<br />
Rechnungslegendem und Rechnungsadressaten auch im geme<strong>in</strong>dlichen Bereich e<strong>in</strong>e klassische Stellvertreterbeziehung<br />
aufweist, denn hier verwaltet die Geme<strong>in</strong>de wie e<strong>in</strong> Beauftragter das Vermögen de ihrer Bürger<br />
treuhänderisch. Daraus lassen sich die Rahmengrundsätze ableiten, die für die Erfassung und Darstellung der<br />
Geschäftsvorfälle sowie deren Sicherung gegen Verlust und Verfälschung gelten und somit die materielle und<br />
formelle Ordnungsmäßigkeit der Buchführung sichern.<br />
1.3 Zu Satz 3 (Ordnungsmäßigkeit der Zahlungsabwicklung):<br />
Die Trennung zwischen der Buchung der Geschäftsvorfälle und dem Zahlungsverkehr und damit die E<strong>in</strong>haltung<br />
des Vier-Augen-Pr<strong>in</strong>zips s<strong>in</strong>d aus dem bisherigen Recht übernommen worden. Sie ist durch die Teilung der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung<br />
<strong>in</strong> die beiden Verantwortungsbereiche gewährleistet. Wegen der besonderen Bedeutung des<br />
Zahlungsverkehrs für die Geme<strong>in</strong>de und unter Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten ist es geboten, zu bestimmen,<br />
dass die Zahlungsabwicklung der Geme<strong>in</strong>de ordnungsgemäß und sicher zu erledigen ist.<br />
2. Zu Absatz 2 (Verantwortlichkeiten für die F<strong>in</strong>anzbuchhaltung):<br />
2.1 Die Bestellung e<strong>in</strong>es Verantwortlichen und e<strong>in</strong>es Stellvertreters<br />
Nach der Vorschrift hat die Geme<strong>in</strong>de hat, wenn sie ihre F<strong>in</strong>anzbuchhaltung nicht nach § 94 durch e<strong>in</strong>e Stelle<br />
außerhalb der Geme<strong>in</strong>deverwaltung besorgen lässt, dafür e<strong>in</strong>en Verantwortlichen und e<strong>in</strong>en Stellvertreter zu<br />
bestellen. Die Bestellung e<strong>in</strong>es Verantwortlichen und e<strong>in</strong>es Stellvertreters für die F<strong>in</strong>anzbuchhaltung als Organisationse<strong>in</strong>heit<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung wird vom Bürgermeister vorgenommen. Sie ist nicht wie bei der<br />
örtlichen Rechnungsprüfung dem Rat vorbehalten. Die Bestellung e<strong>in</strong>es Verantwortlichen ist zur Sicherstellung<br />
e<strong>in</strong>er ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung, d.h. der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und der Zahlungsabwicklung,<br />
erforderlich. Auch bei e<strong>in</strong>er dezentral organisierten F<strong>in</strong>anzbuchhaltung muss es, <strong>in</strong>sbesondere aus<br />
Sicherheitsgesichtspunkten heraus, e<strong>in</strong>e Gesamtverantwortung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Hand geben. Nicht nur dieser Fall macht<br />
die Vorgabe der Bestellung e<strong>in</strong>es Verantwortlichen notwendig.<br />
Werden die beiden Aufgabenbereiche der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung „Buchführung“ und „Zahlungsabwicklung“ <strong>in</strong> der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung nicht organisatorisch eigenständig geführt, s<strong>in</strong>d der bestellte Verantwortliche und se<strong>in</strong><br />
Stellvertreter die Verantwortlichen für beide Aufgabenbereiche. Durch ihre Verantwortlichkeiten für die geme<strong>in</strong>dliche<br />
Zahlungsabwicklung und unterliegen sie dem Verwandtschaftsverbot zwischen bestimmten Beschäftigten <strong>in</strong><br />
der Geme<strong>in</strong>deverwaltung nach Absatz 5 der Vorschrift. Dieses Verbot ist unter Sicherheitsgesichtspunkten erlassen<br />
worden. Es ist beim Verwandtschaftsverbot zu beachten, dass dieses nicht nur bei e<strong>in</strong>er Verb<strong>in</strong>dung durch<br />
e<strong>in</strong>e Ehe gilt, sondern auch auf diejenigen Personen Anwendung f<strong>in</strong>det, die durch e<strong>in</strong>e Lebenspartnerschaft nach<br />
dem Lebenspartnerschaftsgesetz verbunden s<strong>in</strong>d. Durch diese Erweiterung wird den Regelungen des Gesetzes<br />
über die E<strong>in</strong>getragene Lebenspartnerschaft (Lebenspartnerschaftsgesetz - LPartG) vom 16. Februar 2001 (BGBl.<br />
GEMEINDEORDNUNG 531
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 93 GO <strong>NRW</strong><br />
I S. 266) Rechnung getragen. Das Verbot soll <strong>in</strong>sgesamt gesehen mögliche Interessenkonflikte durch persönliche<br />
B<strong>in</strong>dungen von vornhere<strong>in</strong> ausschließen.<br />
2.2 Die Bestellung e<strong>in</strong>es Verantwortlicher für die Zahlungsabwicklung<br />
Es ist von der organisatorischen Gestaltung der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung abhängig, ob neben dem Verantwortlichen für<br />
die F<strong>in</strong>anzbuchhaltung und se<strong>in</strong>em Stellvertreter ggf. zusätzlich e<strong>in</strong> Verantwortlicher für die Zahlungsabwicklung<br />
zu bestellen ist, wenn nicht bereits der Stellvertreter für die geme<strong>in</strong>dliche Zahlungsabwicklung zuständig ist. Diese<br />
besondere Bestellung e<strong>in</strong>es Verantwortlichen für die Zahlungsabwicklung beruht darauf, dass nach Absatz 5<br />
der Vorschrift unter Sicherheitsgesichtspunkten e<strong>in</strong> Verwandtschaftsverbot zwischen bestimmten Beschäftigten <strong>in</strong><br />
der Geme<strong>in</strong>deverwaltung besteht.<br />
Bei e<strong>in</strong>er organisatorischen Eigenständigkeit von Buchführung und Zahlungsabwicklung <strong>in</strong>nerhalb der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Verwaltung unterliegen nur der Verantwortliche für den gesonderten Aufgabenbereich „Zahlungsabwicklung“<br />
und se<strong>in</strong> Stellvertreter dem gesetzlichen Verwandtschaftsverbot. Gleichwohl muss auch bei e<strong>in</strong>er solchen Gestaltung<br />
der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung e<strong>in</strong>e Gesamtverantwortung <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>de bestehen, um wegen der selbst geschaffenen<br />
Aufgabentrennung e<strong>in</strong> <strong>in</strong>e<strong>in</strong>andergreifen der Abwicklung der geme<strong>in</strong>dlichen Geschäftsvorfälle und die<br />
daraus entstehenden Abschlüsse zu sichern.<br />
2.3 Verantwortung bei e<strong>in</strong>er Aufgabenerledigung durch Dritte<br />
Die Vorschrift des § 94 GO <strong>NRW</strong> ermöglicht es den Geme<strong>in</strong>den ihre F<strong>in</strong>anzbuchhaltung durch Stellen außerhalb<br />
der Geme<strong>in</strong>deverwaltung erledigen zu lassen. Dabei kommt es nicht auf die Rechtsform der beauftragten Stelle,<br />
sondern nur auf die Form der Übertragung an. Es ist dabei zu unterscheiden, ob die Übertragung der Besorgung<br />
der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung nach öffentlichem Recht oder nach den Gestaltungsmöglichkeiten des Privatrechts vorgenommen<br />
wird. Mit der Erledigung der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzbuchhaltung oder Teilen davon sollen auch nur Stellen<br />
beauftragt werden, die e<strong>in</strong>e Gewähr für deren ordnungsgemäße Abwicklung bieten und dies wirtschaftlicher<br />
und zweckmäßiger erledigt werden kann. Die geme<strong>in</strong>dliche Aufgabenerfüllung darf dadurch nicht bee<strong>in</strong>trächtigt<br />
werden.<br />
Die Rechte und Pflichten der Geme<strong>in</strong>de als Aufgabenträger<strong>in</strong> für die Durchführung der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung bleiben<br />
dabei unberührt. Sie ist auch bei e<strong>in</strong>er Aufgabenübertragung weiterh<strong>in</strong> für die ordnungsgemäße Erledigung<br />
dieser Aufgabe verantwortlich und muss sich <strong>in</strong> ihrem Verhältnis zu den Bürger<strong>in</strong>nen und Bürgern das Handeln<br />
der beauftragten Stelle als ihr eigenes Handeln anrechnen lassen. Aus der Funktion der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung ergibt<br />
sich, dass die ordnungsgemäße Erledigung nur angenommen werden kann, wenn die Funktion der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung<br />
im doppischen Rechnungswesen der Geme<strong>in</strong>de auch bei der Übertragung auf Dritte <strong>in</strong> vollem Umfang<br />
erhalten bleibt. Beim Vorliegen dieser Tatbestände kann die Geme<strong>in</strong>de auf die förmliche Bestellung e<strong>in</strong>es Verantwortlichen<br />
und e<strong>in</strong>es Stellvertreters für ihre F<strong>in</strong>anzbuchhaltung verzichten. Gleichwohl bedarf es e<strong>in</strong>er zuständigen<br />
Organisationse<strong>in</strong>heit <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung, von der die Ergebnisse aus der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Geschäftstätigkeit <strong>in</strong> die Aufstellung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses und ggf. des Gesamtabschlusses der<br />
Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>gebracht werden.<br />
3. Zu Absatz 3 (Dezentrale Aufgabenerledigung):<br />
3.1 Zu Satz 1 (Dezentrale F<strong>in</strong>anzbuchhaltung):<br />
Im Rahmen der örtlichen F<strong>in</strong>anzbuchhaltung ist ausgehend, dass die Geme<strong>in</strong>den ausgehend von den Erprobungen<br />
der dezentralen Ressourcenverantwortung <strong>in</strong> unterschiedlicher Weise e<strong>in</strong>e dezentrale Buchführung und<br />
GEMEINDEORDNUNG 532
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 93 GO <strong>NRW</strong><br />
Zahlungsabwicklung e<strong>in</strong>richten. Es wurde deshalb auf die gesetzliche Vorgabe e<strong>in</strong>er zentralen F<strong>in</strong>anzbuchhaltung<br />
verzichtet und ihre Gestaltung der Organisationshoheit der Geme<strong>in</strong>de überlassen. Die Vorschrift stellt dies<br />
durch die Regelung klar, dass die F<strong>in</strong>anzbuchhaltung für funktional begrenzte Aufgabenbereiche auch durch<br />
mehrere Stellen der Verwaltung erfolgen kann, soweit die ordnungsgemäße Erledigung und die Prüfung gewährleistet<br />
s<strong>in</strong>d. Gleichwohl muss e<strong>in</strong>e zentrale Stelle <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung bestehen, bei der die Gesamtverantwortung<br />
bestehen bleibt.<br />
Diese Abgrenzung wurde <strong>in</strong> der Praxis <strong>in</strong>sbesondere vielfach für bestimmte Fachbereiche vorgenommen, denen<br />
neben der Haushaltsbewirtschaftung auch die Zahlungsabwicklung über geme<strong>in</strong>deeigene Bankkonten erlaubt<br />
wurde. Im NKF muss bei der Dezentralisierung der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung im E<strong>in</strong>zelfall vor Ort geklärt werden, ob bei<br />
der Umsetzung der dezentralen Ressourcenverantwortung <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung nicht nur die Bewirtschaftung,<br />
sondern auch das Buchungsgeschäft, ggf. auch die Zahlungsabwicklung, mit übernommen werden<br />
sollen. Bereits für die Abwicklung des Buchungsgeschäftes ist zu klären, ob die dezentrale Stelle nur e<strong>in</strong>e „Vorbuchung“<br />
vornehmen soll, so dass jeder Geschäftsvorfall orig<strong>in</strong>är <strong>in</strong> der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung der Geme<strong>in</strong>de zu<br />
erfassen ist oder die Geschäftsvorfälle gebucht werden dürfen und nur das Gesamtergebnis e<strong>in</strong>es vorher bestimmten<br />
Zeitraumes, z.B. e<strong>in</strong> Quartal, <strong>in</strong> die „orig<strong>in</strong>äre“ F<strong>in</strong>anzbuchhaltung der Geme<strong>in</strong>de übernommen werden<br />
soll.<br />
Diese Gestaltung der geme<strong>in</strong>dlichen Buchführung ist nicht von der Umsetzung der dezentralen Ressourcenverantwortung<br />
abhängig. Sie ist möglich, ohne dass die dezentrale Stelle das geme<strong>in</strong>dliche Buchungsgeschäft und<br />
ggf. auch noch die Zahlungsabwicklung übernimmt. In e<strong>in</strong>igen Praxisfällen, <strong>in</strong> denen es gewollt war, die Buchungen<br />
und die Zahlungsabwicklung dezentral abzuwickeln, hat es sich bewährt, wenn die Abwicklung, <strong>in</strong>sbesondere<br />
aber die Geldversorgung nach dem Pr<strong>in</strong>zip „Abwicklung von Vorschüssen“ gestaltet worden ist. So konnte regelmäßig<br />
überwacht werden, ob auch sämtliche haushaltsrechtlichen Anforderungen e<strong>in</strong>schließlich der Verantwortlichkeiten,<br />
z.B. Unterschriftsbefugnisse, e<strong>in</strong>gehalten wurden. War auch die Zahlungsabwicklung zentral organisiert,<br />
gab es oftmals erhebliche Schwierigkeiten bei der Liquiditätsversorgung, wenn ke<strong>in</strong>e entsprechende Liquiditätsplanung<br />
durchgeführt wurde oder auch die zentrale „Gesamtversorgung“ nicht über Zugriffsberechtigungen für<br />
alle geme<strong>in</strong>dlichen Bankkonten verfügte.<br />
3.2 Zu Satz 2 (Verweis auf Absatz 2):<br />
Durch den Verweis auf Absatz 2 <strong>in</strong> dieser Vorschrift soll sichergestellt werden, dass auch <strong>in</strong> den Fällen, <strong>in</strong> denen<br />
die Aufgaben der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzbuchhaltung durch mehrere Stellen der Verwaltung für funktional begrenzte<br />
Aufgabenbereiche erledigt werden, ausreichende Verantwortlichkeiten bestimmt werden. Die Geme<strong>in</strong>de<br />
hat deshalb auch <strong>in</strong> den Fällen e<strong>in</strong>er dezentral geführten F<strong>in</strong>anzbuchhaltung e<strong>in</strong>en Verantwortlichen und e<strong>in</strong>en<br />
Stellvertreter für ihre geme<strong>in</strong>dliche F<strong>in</strong>anzbuchhaltung zu bestellen. Die Geme<strong>in</strong>de kann sich wie <strong>in</strong> den Fällen, <strong>in</strong><br />
denen sie ihre F<strong>in</strong>anzbuchhaltung durch e<strong>in</strong>e Stelle außerhalb der Geme<strong>in</strong>deverwaltung besorgen lässt, nicht<br />
selbst aus ihrer Gesamtverantwortung für das geme<strong>in</strong>dliche Buchungsgeschäft und die geme<strong>in</strong>dliche Zahlungsabwicklung<br />
selbst entlassen. Diese Vorgabe besteht nicht alle<strong>in</strong> deshalb, um für diese Bereiche die ordnungsgemäße<br />
Erledigung und die Prüfung zu gewährleisten, vielmehr gebietet es auch die geme<strong>in</strong>dliche Pflicht zur Sicherstellung<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgabenerfüllung, dass der Bürgermeister die Gesamtverantwortung für das<br />
haushaltswirtschaftliche Handeln nicht aus der Hand geben kann (vgl. § 62 GO <strong>NRW</strong>).<br />
4. Zu Absatz 4 (Trennung von Entscheidung und Zahlungsabwicklung):<br />
4.1 Zu Satz 1 (Geltung des Grundsatzes bei der Zahlungsabwicklung):<br />
Nach der Vorschrift dürfen die Bediensteten der Geme<strong>in</strong>de, die mit der Prüfung und Feststellung des Zahlungsanspruches<br />
und der Zahlungsverpflichtung beauftragt s<strong>in</strong>d, nicht geme<strong>in</strong>dliche Zahlungen abwickeln. Dieser<br />
GEMEINDEORDNUNG 533
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 93 GO <strong>NRW</strong><br />
gesetzliche Grundsatz stellt nicht nur e<strong>in</strong>e Vorgabe für e<strong>in</strong>e sachdienliche Gestaltung des geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltungsablaufs<br />
bei der Abwicklung der Geschäftsvorfälle der Geme<strong>in</strong>de dar, sondern ist auch Ausdruck dafür, dass<br />
verpflichtende Erklärungen bzw. Zahlungen zu Lasten der Geme<strong>in</strong>de im Alle<strong>in</strong>gang e<strong>in</strong>es Beschäftigten zu vermeiden<br />
s<strong>in</strong>d.<br />
Die getroffene gesetzliche Regelung ist daher e<strong>in</strong>e Ausprägung des Grundsatzes der Trennung von fachlicher<br />
Entscheidung und Durchführung der Zahlungsabwicklung. Sie ist nicht erst mit dem NKF e<strong>in</strong>geführt worden, sondern<br />
wegen se<strong>in</strong>er Bedeutung nunmehr gesetzlich verankert worden. Es war auch aus Sicherheitsgesichtspunkten<br />
heraus erforderlich, e<strong>in</strong> solches Verbot <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>deordnung zu verankern. Das Gebot, das <strong>in</strong> der Praxis<br />
auch als „Vier-Augen-Pr<strong>in</strong>zip“ bezeichnet wird, soll die E<strong>in</strong>haltung der Trennung zwischen Bewirtschaftung der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsmittel und Zahlungsabwicklung der Geme<strong>in</strong>de gewährleisten. Außerdem wird durch<br />
diese Regelung auch erfasst, dass die genannten Bediensteten nicht gleichzeitig die Stellung des Verantwortlichen<br />
für die Zahlungsabwicklung oder se<strong>in</strong>es Stellvertreters <strong>in</strong>nehaben können.<br />
4.2 Zu Satz 2 (Geltung des Grundsatzes bei der Rechnungsprüfung):<br />
Nach der Vorschrift dürfen die Bediensteten der Geme<strong>in</strong>de, die mit Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung<br />
beauftragt s<strong>in</strong>d, nicht geme<strong>in</strong>dliche Zahlungen abwickeln. Dieser gesetzliche Grundsatz stellt nicht nur e<strong>in</strong>e Vorgabe<br />
für e<strong>in</strong>e sachdienliche Gestaltung des geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltungsablaufs bei der Abwicklung der Geschäftsvorfälle<br />
der Geme<strong>in</strong>de dar, sondern ist auch Ausdruck dafür, dass auch die Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung<br />
nicht über verpflichtende Erklärungen bzw. Zahlungen zu Lasten der Geme<strong>in</strong>de entscheiden sollen,<br />
bei denen ihnen gleichzeitig die Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Geschäftsvorfalls obliegt.<br />
Der Grundsatz der Trennung von fachlicher Entscheidung bei der geme<strong>in</strong>dlichen Zahlungsabwicklung und der<br />
Durchführung der Rechnungsprüfung gilt wegen der Sonderstellung der örtlichen Rechnungsprüfung auch für die<br />
damit beauftragten Bediensteten (vgl. § 104 GO <strong>NRW</strong>). Er soll die E<strong>in</strong>haltung der Trennung zwischen Bewirtschaftung<br />
der Haushaltsmittel und örtlicher Rechnungsprüfung gewährleisten. Außerdem wird durch diese Regelung<br />
auch erfasst, dass die Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung nicht gleichzeitig die Stellung des Verantwortlichen<br />
für die Zahlungsabwicklung oder se<strong>in</strong>es Stellvertreters <strong>in</strong>nehaben können.<br />
5. Zu Absatz 5 (Verwandtschaftsverbot zur Vermeidung von Interessenkonflikten):<br />
Unter Sicherheitsgesichtspunkten ist auch das Verwandtschaftsverbot zwischen bestimmten Beschäftigten <strong>in</strong> der<br />
Geme<strong>in</strong>deverwaltung zu sehen. Das Gebot gilt für den Verantwortlichen der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung und se<strong>in</strong>en Stellvertreter<br />
(vgl. Absatz 2), die nicht nur Verantwortliche für die Buchführung, sondern gleichzeitig auch Verantwortliche<br />
für die Zahlungsabwicklung s<strong>in</strong>d. Es ist beim Verwandtschaftsverbot zu beachten, dass dieses nicht nur bei<br />
e<strong>in</strong>er Verb<strong>in</strong>dung durch e<strong>in</strong>e Ehe gilt, sondern auch auf diejenigen Personen Anwendung f<strong>in</strong>det, die durch e<strong>in</strong>e<br />
Lebenspartnerschaft nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz verbunden s<strong>in</strong>d. Durch diese Erweiterung wird den<br />
Regelungen des Gesetzes über die E<strong>in</strong>getragene Lebenspartnerschaft (Lebenspartnerschaftsgesetz - LPartG)<br />
vom 16. Februar 2001 (BGBl. I S. 266) Rechnung getragen.<br />
Das Verbot <strong>in</strong> dieser Vorschrift soll <strong>in</strong>sgesamt gesehen mögliche Interessenkonflikte durch persönliche B<strong>in</strong>dungen<br />
von vornhere<strong>in</strong> ausschließen. Es steht zudem mit § 31 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong> <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung, denn durch diese<br />
Vorschrift wird bestimmt, welche verwandtschaftlichen Verhältnisse unter dem Begriff „Angehöriger“ im S<strong>in</strong>ne der<br />
Geme<strong>in</strong>deordnung zu subsumieren s<strong>in</strong>d. Im Rahmen der erweiterten gesetzlichen Delegationsmöglichkeiten<br />
sowie der Beauftragung Dritter wird das Verwandtschaftsverbot <strong>in</strong> dieser Vorschrift ausgedehnt, weil es auf<br />
Grund der örtlichen Organisationshoheit der Geme<strong>in</strong>de zulässig ist, die beiden Teile der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung<br />
„Buchführung“ und „Zahlungsabwicklung“ <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung organisatorisch eigenständig zu füh-<br />
GEMEINDEORDNUNG 534
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 93 GO <strong>NRW</strong><br />
ren. Dies geschieht oftmals dadurch, dass nur die Buchführung dem Kämmerer, der die F<strong>in</strong>anzverantwortung <strong>in</strong><br />
der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong>ne hat bzw. dem Aufgabenbereich „Kämmerei“ zugeordnet wird.<br />
In diesen Fällen wird vielfach, auch wegen der E<strong>in</strong>haltung der Trennung zwischen der Buchung der Geschäftsvorfälle<br />
und dem Zahlungsverkehr, die Gesamtverantwortung für die F<strong>in</strong>anzbuchhaltung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Verantwortung für<br />
die „Buchführung“ und e<strong>in</strong>e Verantwortung für die „Zahlungsabwicklung“ aufgeteilt. Dies erfordert wegen des<br />
historisch gewachsenen Verwandtschaftsverbotes unter Sicherheitsgesichtspunkten dann die zusätzliche Bestellung<br />
e<strong>in</strong>es Verantwortlichen und e<strong>in</strong>es Stellvertreters für den Bereich der Zahlungsabwicklung. Wird die F<strong>in</strong>anzbuchhaltung<br />
ganz oder teilweise dem Aufgabenbereich des Kämmerers zugeordnet, darf dieser nicht mehr die<br />
ihm zugeordnete Aufsichtsfunktion über die F<strong>in</strong>anzbuchhaltung nach § 31 Abs. 4 GemHVO <strong>NRW</strong> wahrnehmen.<br />
Die Aufsicht über die F<strong>in</strong>anzbuchhaltung obliegt dann dem Bürgermeister, wenn er sie nicht e<strong>in</strong>em anderen Beschäftigten<br />
übertragen hat (vgl. § 31 Abs. 4 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
6. Zu Absatz 6 (Rechnungskreise bei Sondervermögen und Treuhandvermögen):<br />
Die Bildung besonderer Sonderkassen für Sondervermögen und Treuhandvermögen durch die Geme<strong>in</strong>de ist<br />
zukünftig nicht mehr vorgesehen. Auch ist nicht mehr zw<strong>in</strong>gend e<strong>in</strong>e eigene (organisatorisch getrennte) Buchhaltung<br />
für jedes Sondervermögen oder Treuhandvermögen der Geme<strong>in</strong>de vorgesehen. Es ist ausreichend, wenn<br />
die Geme<strong>in</strong>de die Geschäftsvorfälle dieser besonderen Vermögensbereiche so abwickelt, dass für diese gesonderte<br />
Jahresabschlüsse aufgestellt werden können, soweit diese vorgeschrieben s<strong>in</strong>d, z.B. für die Eigenbetriebe<br />
als Sondervermögen nach § 97 Abs. 1 Nr. 3 GO <strong>NRW</strong>, die organisatorisch selbstständig s<strong>in</strong>d. Damit wird der<br />
gesetzlich vorgesehenen Separierung dieser Vermögen durch die Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> ausreichendem Maße Rechnung<br />
getragen.<br />
Für die anderen Sondervermögen, die Teil des geme<strong>in</strong>dlichen Haushalts s<strong>in</strong>d, z.B. die Geme<strong>in</strong>degliedervermögen<br />
oder die rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen, muss von der Geme<strong>in</strong>de zusätzliche zur haushaltswirtschaftlichen<br />
Abwicklung e<strong>in</strong> Nachweis über die E<strong>in</strong>haltung des verb<strong>in</strong>dlich gesetzten Zwecks erbracht werden.<br />
Dieser Nachweis erfordert nicht gesonderte Buchungsunterlagen, wenn aus den haushaltswirtschaftlichen Daten<br />
e<strong>in</strong> prüffähiger (Verwendungs-) Nachweis erbracht werden kann.<br />
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ<br />
GEMEINDEORDNUNG 535
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 94 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 94<br />
Übertragung der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung<br />
1Die Geme<strong>in</strong>de kann ihre F<strong>in</strong>anzbuchhaltung ganz oder zum Teil von e<strong>in</strong>er Stelle außerhalb der Geme<strong>in</strong>deverwaltung<br />
besorgen lassen, wenn die ordnungsgemäße Erledigung und die Prüfung nach den für die Geme<strong>in</strong>de<br />
geltenden Vorschriften gewährleistet s<strong>in</strong>d. 2 Satz 1 gilt nicht für die Zwangsvollstreckung. 3 Die Vorschriften des<br />
Gesetzes über kommunale Geme<strong>in</strong>schaftsarbeit bleiben unberührt.<br />
Erläuterungen zu § 94:<br />
I. Allgeme<strong>in</strong>es<br />
1. Die Übertragung von Aufgaben der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung an Dritte<br />
Im Rahmen der gesetzlichen Aufgabe der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzbuchhaltung, die Buchführung und die Zahlungsabwicklung<br />
der Geme<strong>in</strong>de zu erledigen, muss die Geme<strong>in</strong>de als Aufgabenträger grundsätzlich selbst handeln,<br />
denn der Gesetzgeber hat ihr ausdrücklich die dafür erforderlichen Kompetenzen e<strong>in</strong>geräumt. Er hat die Geme<strong>in</strong>de<br />
als geeignet angesehen, die ihr zugewiesenen Verwaltungsaufgaben mit der notwendigen personellen und<br />
sächlichen Ausstattung erfüllen und den ordnungsgemäßen Gang der Geschäftsvorfälle sicherstellen zu können.<br />
Die Vorschrift ermöglicht es aber der Geme<strong>in</strong>de ihre F<strong>in</strong>anzbuchhaltung durch Stellen außerhalb der Geme<strong>in</strong>deverwaltung<br />
erledigen zu lassen.<br />
Der Dritte, der diese Aufgabe übernimmt, trägt die Verantwortung für die Durchführung bzw. die ordnungsgemäße<br />
Erledigung der übernommenen Aufgabe regelmäßig im Rahmen e<strong>in</strong>es Geschäftsbesorgungsvertrages. Er wird <strong>in</strong><br />
diesem Zusammenhang daher, abhängig von der örtlichen Gestaltung der vertraglichen Übertragung, mit der<br />
Wahrnehmung e<strong>in</strong>er öffentlichen Aufgabe betraut und oftmals nicht als Erfüllungsgehilfe der Geme<strong>in</strong>de tätig. In<br />
diesen Fällen ist entscheidend, dass die Geme<strong>in</strong>de nicht durch eigenes Personal tätig wird. Die Abgrenzung<br />
dafür ist im örtlichen E<strong>in</strong>zelfall unter Beachtung der verwaltungsrechtlichen Gegebenheiten vorzunehmen. Die<br />
Geme<strong>in</strong>de kann sich gleichwohl durch die Übertragung der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung auf e<strong>in</strong>en Dritten nicht aus ihrer<br />
Verantwortung für die Aufgabenerledigung der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung selbst entlassen. Sie trägt weiterh<strong>in</strong> die Gesamtverantwortung<br />
für ihre F<strong>in</strong>anzbuchhaltung und muss sicherstellen, dass ihr alle notwendigen Daten rechtzeitig<br />
zur Verfügung stehen, um ihre Pflicht zur Aufstellung e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses nach Ablauf des<br />
Haushaltsjahres rechtzeitig nachkommen zu können.<br />
Von der gesetzlichen Möglichkeit der Übertragung von Aufgaben der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzbuchhaltung an Dritte<br />
sollte die Geme<strong>in</strong>de nur Gebrauch machen, wenn es wirtschaftlicher und zweckmäßiger ist, die geme<strong>in</strong>dliche<br />
Aufgabenerfüllung dadurch nicht bee<strong>in</strong>trächtigt wird und die für die Geme<strong>in</strong>de geltenden Vorschriften von dem<br />
Dritten e<strong>in</strong>gehalten werden können. Bei e<strong>in</strong>er Übertragung der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzbuchhaltung auf Dritte<br />
kommt es zudem nicht auf die Rechtsform der beauftragten Stelle, sondern nur auf die Form der Übertragung an.<br />
Von der Geme<strong>in</strong>de ist bei der Übertragung von Aufgaben der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung an Dritte zudem zu unterscheiden,<br />
ob die Übertragung der Besorgung der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung nach öffentlichem Recht oder nach den Gestaltungsmöglichkeiten<br />
des Privatrechts vorgenommen wird. Die privatrechtlichen Möglichen nach dieser Vorschrift<br />
schließen nicht die Möglichkeiten der Übertragung der Aufgaben <strong>in</strong> öffentlich-rechtlicher Form nach den Vorschriften<br />
des Gesetzes über kommunale Geme<strong>in</strong>schaftsarbeit aus. Außerdem ist <strong>in</strong> diesem Zusammenhang die<br />
Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung vom 12.03.2010 von Bedeutung (vgl. BGBl. I S. 267).<br />
GEMEINDEORDNUNG 536
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 94 GO <strong>NRW</strong><br />
2. Dezentrale Erledigung von Aufgaben der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung<br />
Unter diese Vorschrift fällt nicht die dezentrale Erledigung der Aufgaben der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung <strong>in</strong>nerhalb der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung, auch wenn mit e<strong>in</strong>er solchen Dezentralisierung <strong>in</strong>nerhalb der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung<br />
die E<strong>in</strong>richtung von Zahlstellen, Handvorschüssen oder Sonderkonten verbunden ist. Die Leitung der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung<br />
hat <strong>in</strong> solchen Fällen dafür Sorge zu tragen, dass auch diese Stellen nach den für die F<strong>in</strong>anzbuchhaltung<br />
geltenden Vorgaben ihre Aufgabe erledigen und die Gesamtverantwortung bei der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
F<strong>in</strong>anzbuchhaltung erhalten bleibt. E<strong>in</strong>e solche örtliche Gestaltung der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung <strong>in</strong> eigener Verantwortung<br />
der Geme<strong>in</strong>de muss auch <strong>in</strong> entsprechender Weise <strong>in</strong> den nach § 31 GemHVO <strong>NRW</strong> zu erlassenden örtlichen<br />
Vorschriften verankert werden.<br />
3. Übernahme von Aufgaben der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung von Dritten<br />
Die Geme<strong>in</strong>de kann ihre F<strong>in</strong>anzbuchhaltung nicht nur von e<strong>in</strong>er Stelle außerhalb der Geme<strong>in</strong>deverwaltung besorgen<br />
lassen, sie kann auch die F<strong>in</strong>anzbuchhaltung Dritter übernehmen. Dies gilt nicht nur für Übernahmen von<br />
ihren organisatorisch selbstständigen Sondervermögen (vgl. § 97 GO <strong>NRW</strong>) oder den <strong>in</strong> ihrer Verwaltung stehenden<br />
Treuhandvermögen (vgl. § 98 GO <strong>NRW</strong>). Auch durch Fachgesetze wird es Dritten ermöglicht, die Geme<strong>in</strong>de<br />
mit der Abwicklung ihrer Haushaltswirtschaft zu beauftragen. Die Tätigkeit der Geme<strong>in</strong>de ist dann i.d.R. entgeltpflichtig<br />
und die Geme<strong>in</strong>de hat <strong>in</strong> der Sache e<strong>in</strong>e Entscheidungsfreiheit. Sie dürfte die Übernahme e<strong>in</strong>er solchen<br />
Aufgabe jedoch dann kaum ablehnen, wenn sie z.B. selbst e<strong>in</strong>em Zusammenschluss angehört, für den es wichtig<br />
ist, dass die ordnungsgemäße Erledigung se<strong>in</strong>er Haushaltswirtschaft gesichert ist.<br />
Bei der Übernahme der Durchführung haushaltswirtschaftlicher Aufgaben von Dritten kann die Geme<strong>in</strong>de auch<br />
die dazu erforderlichen Vollstreckungsaufgaben wahrnehmen, denn die Geme<strong>in</strong>de ist e<strong>in</strong>e nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz<br />
mögliche Vollstreckungsbehörde. So sieht z.B. das Geme<strong>in</strong>schaftswaldgesetz <strong>in</strong> § 20<br />
Abs. 3 vor, dass die Geme<strong>in</strong>den für die Waldgenossenschaften die zuständigen Vollstreckungsbehörden im S<strong>in</strong>ne<br />
des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen s<strong>in</strong>d. Auch für andere öffentlichrechtliche<br />
Körperschaften kann die Geme<strong>in</strong>de Vollstreckungsaufgaben erledigen.<br />
II. Erläuterungen im E<strong>in</strong>zelnen<br />
1. Zu Satz 1 (Übertragung von Aufgaben der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung auf Dritte):<br />
1.1 Die Geschäftsbesorgung <strong>in</strong> privatrechtlicher Form<br />
Der Geme<strong>in</strong>de stehen daher mehrere Möglichkeiten offen, ihre Aufgabe „F<strong>in</strong>anzbuchhaltung zu erledigen. Die<br />
Vorschrift ermöglicht es daher, die geme<strong>in</strong>dliche F<strong>in</strong>anzbuchhaltung durch e<strong>in</strong>e Stelle außerhalb der Geme<strong>in</strong>deverwaltung<br />
auf der Grundlage e<strong>in</strong>es privatrechtlichen Vertrages (Geschäftsbesorgungsvertrages) erledigen zu<br />
lassen. Der Begriff „besorgen lassen“ <strong>in</strong> dieser Vorschrift soll dabei e<strong>in</strong>erseits zum Ausdruck br<strong>in</strong>gen, dass die<br />
Stelle außerhalb der Geme<strong>in</strong>deverwaltung die Geschäfte selbstständig und eigenverantwortlich erledigt, die Verantwortung<br />
der Geme<strong>in</strong>de zur Wahrnehmung dieser Aufgaben gleichwohl unberührt bleibt. Andererseits aber<br />
auch zum Ausdruck gebracht werden soll, dass die Geme<strong>in</strong>de nach dieser Vorschrift ke<strong>in</strong>e Befugnisse der Geme<strong>in</strong>de<br />
an Dritte übertragen werden kann, die E<strong>in</strong>griffe <strong>in</strong> Rechte Dritter ermöglichen.<br />
Mit der Erledigung der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzbuchhaltung oder Teilen davon sollen auch nur Stellen beauftragt<br />
werden, die e<strong>in</strong>e Gewähr für deren ordnungsgemäße Abwicklung bieten und dies wirtschaftlicher und zweckmäßiger<br />
erledigt werden kann. Die geme<strong>in</strong>dliche Aufgabenerfüllung darf dadurch nicht bee<strong>in</strong>trächtigt werden. Entscheidet<br />
sich die Geme<strong>in</strong>de für die privatrechtliche Form nach dieser Vorschrift, kommt <strong>in</strong> der Regel der Abschluss<br />
e<strong>in</strong>es Geschäftsbesorgungsvertrages <strong>in</strong> Betracht, der e<strong>in</strong>e sorgfältige Auswahl des Geschäftspartners<br />
GEMEINDEORDNUNG 537
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 94 GO <strong>NRW</strong><br />
voraus gehen sollte. In den Fällen, <strong>in</strong> denen sich die Geme<strong>in</strong>de aber nur der technischen E<strong>in</strong>richtungen e<strong>in</strong>er<br />
anderen Stelle bedient, stellt diese ke<strong>in</strong>e Besorgung der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzbuchhaltung im S<strong>in</strong>ne dieser Vorschrift<br />
dar. Die Besorgung der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung nach dieser Vorschrift ist aber auch dann nicht mehr gegeben,<br />
wenn wegen der Weisungsvorbehalte der Geme<strong>in</strong>de der anderen Stelle ke<strong>in</strong> eigener Gestaltungsraum mehr bei<br />
der Erledigung ihrer Aufgaben verbleibt.<br />
1.2 Die Sicherung der ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung<br />
Die Rechte und Pflichten der Geme<strong>in</strong>de als Aufgabenträger<strong>in</strong> für die Durchführung der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung bleiben<br />
bei e<strong>in</strong>er Übertragung der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzbuchhaltung an Dritte grundsätzlich unberührt. Die Geme<strong>in</strong>de<br />
ist daher auch bei e<strong>in</strong>er solchen Aufgabenerledigung weiterh<strong>in</strong> für die ordnungsgemäße Durchführung dieser<br />
Aufgabe verantwortlich. Sie muss sich <strong>in</strong> ihrem Verhältnis zu den Bürger<strong>in</strong>nen und Bürgern das Handeln der<br />
beauftragten Stelle als ihr eigenes Handeln anrechnen lassen.<br />
Aus der Funktion der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung ergibt sich, dass die ordnungsgemäße Erledigung nur angenommen<br />
werden kann, wenn die Funktion der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung im doppischen Rechnungswesen der Geme<strong>in</strong>de auch<br />
bei der Übertragung auf Dritte <strong>in</strong> vollem Umfang erhalten bleibt. D.h., die beauftragte Stelle muss die Geschäftsabwicklung<br />
so vornehmen, dass die vorgesehene Haushaltsplanung und Haushaltsausführung durch die Geme<strong>in</strong>de<br />
möglich wird sowie der vorgeschriebene Jahresabschluss und der Gesamtabschluss nicht bee<strong>in</strong>trächtigt<br />
werden. Außerdem muss auch die beauftragte Stelle die E<strong>in</strong>haltung der haushaltsrechtlichen Sicherheitsstandards<br />
gewährleisten (vgl. § 31 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
Für e<strong>in</strong>e von der Geme<strong>in</strong>de beauftragte Stelle besteht nur dann e<strong>in</strong>e rechtliche Verpflichtung zur Beachtung und<br />
E<strong>in</strong>haltung der haushaltsrechtlichen Vorschriften, wenn die Geme<strong>in</strong>de dieses ausdrücklich vere<strong>in</strong>bart. Die Geme<strong>in</strong>de<br />
muss im Rahmen des abzuschließenden Geschäftbesorgungsvertrages nicht nur sicherstellen, dass die<br />
beauftragte Stelle die e<strong>in</strong>schlägigen haushaltsrechtlichen Bestimmungen e<strong>in</strong>hält, die auch von der Geme<strong>in</strong>de zu<br />
beachten s<strong>in</strong>d. Es muss auch gewährleistet se<strong>in</strong>, dass diese Stelle die Aufgaben, die von der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
F<strong>in</strong>anzbuchhaltung im Rahmen der Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de zu erledigen s<strong>in</strong>d, sachgerecht erfüllt.<br />
Dieses erfordert, dass sich die Geme<strong>in</strong>de umfassende Weisungs- und Kontrollrechte vorbehalten und e<strong>in</strong>e ausreichende<br />
laufende Überwachung der dem Dritten übertragenen Aufgabenerledigung sicherstellen muss.<br />
Die Geme<strong>in</strong>de sollte deshalb sollte e<strong>in</strong>erseits e<strong>in</strong>en Aufgabenkatalog zum Gegenstand der abzuschließenden<br />
Vere<strong>in</strong>barung machen und andererseits die Melde- und Nachweispflichten der beauftragten Stelle konkret bestimmen.<br />
Zu e<strong>in</strong>em konkreten Aufgabenkatalog gehören u. a. Abstimmungs- und Abrechnungsterm<strong>in</strong>e, <strong>in</strong>sbesondere<br />
wegen der Aufstellung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses, die Nachweisführung des Dritten, Datenschutz-<br />
und Haftungsregelungen sowie sonstige Befugnisse des Dritten, die zur Aufgabenerledigung notwendig<br />
s<strong>in</strong>d. Dazu gehören auch Vorgaben für die eigene Verwaltung, z.B. dass Geschäftsunterlagen, die an die erledigende<br />
Stelle abgegeben werden, zuvor zu registrieren s<strong>in</strong>d.<br />
1.3 Die Durchführung von Prüfungen<br />
E<strong>in</strong> Dritter, der Aufgaben der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung für die Geme<strong>in</strong>de erledigt, muss im Rahmen der übertragenen<br />
Aufgaben h<strong>in</strong>nehmen, dass bei ihm auch Prüfungen nach den für die Geme<strong>in</strong>de geltenden haushaltsrechtlichen<br />
Vorschriften, z.B. durch die örtliche Rechnungsprüfung der Geme<strong>in</strong>de und durch die Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt<br />
als überörtliche Prüfung, durchgeführt werden. Er muss daher die übertragenen Geschäfte so führen, dass bei<br />
ihm e<strong>in</strong>e Prüfung nach den für die Geme<strong>in</strong>de geltenden haushaltsrechtlichen Vorschriften möglich ist. Dafür hat<br />
er die aus se<strong>in</strong>er Aufgabenerledigung für die Geme<strong>in</strong>de vorhandenen Unterlagen vorzulegen und den Prüfern e<strong>in</strong><br />
Betreten der Räume im notwendigen Umfang zu gestatten.<br />
GEMEINDEORDNUNG 538
1.4 Die Aufbewahrungspflichten<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 94 GO <strong>NRW</strong><br />
Die Geme<strong>in</strong>de hat im Rahmen der vertraglichen Übertragung von Aufgaben der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzbuchhaltung<br />
an e<strong>in</strong>en Dritten auch sicherzustellen, dass die Bestimmungen über die Aufbewahrung der Geschäftsunterlagen<br />
e<strong>in</strong>gehalten werden (vgl. § 58 GemHVO <strong>NRW</strong>). Insbesondere bei e<strong>in</strong>er DV-Buchführung ist der Dokumentationsumfang<br />
bereits vor der Übertragung der Geschäftsbesorgung durch den Dritten festzulegen. In den Bestimmungen<br />
sollten sowohl der Ort und die Zeitdauer der Aufbewahrung, als auch die Zugangsberechtigungen<br />
und E<strong>in</strong>sichtsrechte bei den örtlichen Geschäftsunterlagen geregelt se<strong>in</strong>. Zu den notwendigen Regelungstatbeständen<br />
gehören auch Zutrittsrechte Dritter, z.B. im Rahmen der überörtlichen Prüfung der Geme<strong>in</strong>de.<br />
2. Zu Satz 2 (Ke<strong>in</strong>e Übertragung von Aufgaben der Zwangsvollstreckung):<br />
2.1 Die Pflicht zur örtlichen Erledigung<br />
Die Übertragung der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung durch die Geme<strong>in</strong>de auf private Dritte darf nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz<br />
nicht gleichzeitig die Befugnis zum E<strong>in</strong>griff <strong>in</strong> Rechte Dritter enthalten. Die Beitreibung von<br />
Geldforderungen der Geme<strong>in</strong>de (vgl. § 1 VwVG <strong>NRW</strong>) ist Aufgabe der gesetzlich bestimmten Vollstreckungsbehörden<br />
(vgl. § 2 VwVG). Als Konkretisierung des § 2 Abs. 1 Nr. 2 VwVG <strong>NRW</strong> muss die Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>e zentrale<br />
Stelle als Vollstreckungsbehörde bestimmen, die für das Mahn- und Vollstreckungsverfahren zuständig ist.<br />
Ausgehend davon, dass im Bereich „Zahlungsabwicklung“ der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung nicht mehr alle<strong>in</strong> die Buchungen<br />
vorgenommen werden, sondern diese vielfach im Bereich „Geschäftsbuchführung“ erledigt werden, ist die<br />
F<strong>in</strong>anzbuchhaltung <strong>in</strong>sgesamt als die für das Mahn- und Vollstreckungsverfahren zentrale Stelle anzusehen. Es<br />
muss durch e<strong>in</strong>e örtliche Bestimmung gewährleistet werden, dass e<strong>in</strong>e organisatorische Trennung von Geschäftsbuchführung<br />
und Zahlungsabwicklung nicht zu „zwei Vollstreckungsbehörden“ führt, e<strong>in</strong>e zuständig für das<br />
Mahnverfahren, die andere für die übrigen Vollstreckungsverfahren (vgl. § 31 Abs. 2 Nr. 1.9 GemHVO <strong>NRW</strong>). Die<br />
örtlich festgelegte Zuständigkeit muss die Umsetzung der Vorgabe des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes sicherstellen.<br />
2.2 Der Ausschluss der Übertragung<br />
Durch die Vorschrift wird die Vorgabe des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes wiederholt, dass die Zwangsvollstreckung<br />
als hoheitliche Maßnahme von der Übertragung auf (private) Dritte ausgeschlossen ist. Die Geme<strong>in</strong>de<br />
darf daher im Rahmen ihrer Übertragung von Aufgaben der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzbuchhaltung an private Dritte<br />
ggf. unselbstständige Dienste dem Dritten übertragen, soweit dieser Tätigkeit nicht Vorschriften zur geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Zwangsvollstreckung entgegenstehen.<br />
Die Geme<strong>in</strong>de muss daher bei e<strong>in</strong>er Übertragung von Aufgaben der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung auf Dritte prüfen, ob sie<br />
die Vollstreckungsmaßnahmen entweder weiterh<strong>in</strong> selbst vornimmt oder durch e<strong>in</strong>e andere Geme<strong>in</strong>de oder den<br />
Kreis als nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz zulässige Stelle erledigen lässt, z.B. im Rahmen der Vorschriften<br />
des Gesetzes über kommunale Geme<strong>in</strong>schaftsarbeit (GkG). Im Zusammenhang mit der Aufgabenübertragung<br />
ist <strong>in</strong>sbesondere auch zu berücksichtigen, dass regelmäßig mit schutzwürdigen personenbezogenen<br />
Daten umgegangen werden muss, so dass bei e<strong>in</strong>er Tätigkeit Dritter diesem die E<strong>in</strong>haltung der datenschutzrechtlichen<br />
Bestimmungen aufzugeben und die E<strong>in</strong>haltung regelmäßig zu kontrollieren ist.<br />
Im E<strong>in</strong>zelfall kann von der Geme<strong>in</strong>de ggf. aber das Instrument des Verwaltungsgehilfen genutzt werden, wenn es<br />
aus Sicht der Geme<strong>in</strong>de s<strong>in</strong>nvoll und sachgerecht ist, z.B. im Rahmen e<strong>in</strong>er Auftragsdatenverarbeitung sich die<br />
Aufgabe auf die Durchführung der Datenverarbeitung erstreckt. Dem Dritten darf <strong>in</strong> solchen Fällen nicht die Ent-<br />
GEMEINDEORDNUNG 539
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 94 GO <strong>NRW</strong><br />
scheidungsbefugnis über die Daten übertragen werden, vielmehr muss er bei der Verarbeitung der Daten unselbstständig<br />
tätig und den Weisungen der Geme<strong>in</strong>de unterworfen se<strong>in</strong>.<br />
Der Dritte muss dah<strong>in</strong>gehend gebunden se<strong>in</strong>, dass er nach den Vorgaben der Geme<strong>in</strong>de die Daten erhebt und<br />
verarbeitet und daher nur Hilfs- oder Unterstützungsfunktionen für die Geme<strong>in</strong>de ausübt. Der Dritte darf daher<br />
ke<strong>in</strong>e eigenständigen Entscheidungen mit den Schuldner der Geme<strong>in</strong>de treffen, denn dann würde die Grenze<br />
e<strong>in</strong>er zulässigen Aufgabenübertragung durch die Geme<strong>in</strong>de überschritten. Die örtliche Entscheidung ist daher<br />
immer auf der Grundlage des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes und nicht auf der Grundlage des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltsrechts zu beurteilen.<br />
3. Zu Satz 3 (Geschäftsbesorgung <strong>in</strong> öffentlich-rechtlicher Form):<br />
In den Fällen, <strong>in</strong> denen die Geme<strong>in</strong>de ihre F<strong>in</strong>anzbuchhaltung ganz oder zum Teil von e<strong>in</strong>er Stelle außerhalb der<br />
Geme<strong>in</strong>deverwaltung besorgen lässt, bleiben die Vorschriften des Gesetzes über kommunale Geme<strong>in</strong>schaftsarbeit<br />
(GkG) unberührt. Mit diesem Gesetz soll die Erledigung geme<strong>in</strong>dlicher Aufgaben gesichert werden, wenn<br />
e<strong>in</strong>e Geme<strong>in</strong>de nicht oder nicht erfolgreich wahrgenommen werden kann. E<strong>in</strong> Anlass dafür kann se<strong>in</strong>, dass e<strong>in</strong>e<br />
Aufgabe die Leistungskraft e<strong>in</strong>er Geme<strong>in</strong>de übersteigt oder dass Sachzwänge bestehen, die zu Interesse an<br />
e<strong>in</strong>er geme<strong>in</strong>samen Erledigung der Aufgabe zusammen mit e<strong>in</strong>er anderen Geme<strong>in</strong>de führen. Dazu hält das Gesetz<br />
unterschiedliche Formen für die geme<strong>in</strong>dliche Zusammenarbeit bereit. So können Geme<strong>in</strong>den die Aufgaben,<br />
zu deren Erfüllung sie berechtigt oder verpflichtet s<strong>in</strong>d, nach den Vorschriften des Gesetzes geme<strong>in</strong>sam wahrnehmen.<br />
Diese Möglichkeit besteht jedoch nicht, wenn durch e<strong>in</strong> Gesetz e<strong>in</strong>e besondere Rechtsform für die Zusammenarbeit<br />
vorgeschrieben oder die geme<strong>in</strong>same Wahrnehmung e<strong>in</strong>er Aufgabe ausgeschlossen ist. Auch können zur<br />
geme<strong>in</strong>samen Wahrnehmung von Aufgaben Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaften begründet, Zweckverbände und geme<strong>in</strong>same<br />
Kommunalunternehmen gebildet sowie öffentlich-rechtliche Vere<strong>in</strong>barungen geschlossen werden. Dabei bleibt<br />
die Befugnis, zur geme<strong>in</strong>samen Wahrnehmung von Aufgaben die Gestaltungsmöglichkeiten des Privatrechts zu<br />
benutzen, unberührt. Die Möglichkeiten nach dem „Gesetz über kommunale Geme<strong>in</strong>schaftsarbeit (GKG) werden<br />
im E<strong>in</strong>zelnen hier nicht näher erläutert.<br />
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ<br />
GEMEINDEORDNUNG 540
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 95 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 95<br />
Jahresabschluss<br />
(1) 1 Die Geme<strong>in</strong>de hat zum Schluss e<strong>in</strong>es jeden Haushaltsjahres e<strong>in</strong>en Jahresabschluss aufzustellen, <strong>in</strong> dem das<br />
Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. 2 Er muss unter Beachtung der Grundsätze<br />
ordnungsmäßiger Buchführung e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,<br />
Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de vermitteln und ist zu erläutern. 3 Der Jahresabschluss besteht<br />
aus der Ergebnisrechnung, der F<strong>in</strong>anzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. 4 Ihm ist e<strong>in</strong><br />
Lagebericht beizufügen.<br />
(2) 1 Am Schluss des Lageberichtes s<strong>in</strong>d für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands nach § 70, soweit dieser<br />
nicht zu bilden ist für den Bürgermeister und den Kämmerer, sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen<br />
im Haushaltsjahr ausgeschieden s<strong>in</strong>d, anzugeben,<br />
1. der Familienname mit m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>em ausgeschriebenen Vornamen,<br />
2. der ausgeübte Beruf,<br />
3. die Mitgliedschaften <strong>in</strong> Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,<br />
4. die Mitgliedschaft <strong>in</strong> Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> öffentlichrechtlicher<br />
oder privatrechtlicher Form,<br />
5. die Mitgliedschaft <strong>in</strong> Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.<br />
2 § 43 Abs. 2 Nrn. 5 und 6 gelten entsprechend.<br />
(3) 1 Der Entwurf des Jahresabschlusses wird vom Kämmerer aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung<br />
vorgelegt. 2 Der Bürgermeister leitet den von ihm bestätigten Entwurf <strong>in</strong>nerhalb von drei Monaten nach Ablauf des<br />
Haushaltsjahres dem Rat zur Feststellung zu. 3 Soweit er von dem ihm vorgelegten Entwurf abweicht, kann der<br />
Kämmerer dazu e<strong>in</strong>e Stellungnahme abgeben. 4 Wird von diesem Recht Gebrauch gemacht, hat der Bürgermeister<br />
die Stellungnahme mit dem Entwurf dem Rat vorzulegen.<br />
Erläuterungen zu § 95:<br />
I. Allgeme<strong>in</strong>es<br />
1. Inhalt der Jahresabschlussvorschriften<br />
1.1 Zwecke des Jahresabschlusses<br />
Die Vorschriften über den Jahresabschluss ergeben sich zw<strong>in</strong>gend aus dem System der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft,<br />
denn e<strong>in</strong>e Grundlage dafür ist der jährliche Haushaltsplan, an den sich der geme<strong>in</strong>dliche Jahresabschluss<br />
anschließt. Aus der ausschlaggebenden Bedeutung, die der Haushaltsplan für die Ausführung der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft hat, ergeben sich die Art und das Ausmaß der Erfüllung der Aufgaben der<br />
Geme<strong>in</strong>de. Dabei stellt der Abschlussstichtag für den geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss ke<strong>in</strong>en willkürlichen Schnitt<br />
durch das geme<strong>in</strong>dliche Verwaltungshandeln bzw. die Geschäftstätigkeit der Geme<strong>in</strong>de dar, auch wenn unmittelbar<br />
zuvor und nach dem Abschlussstichtag von der Geme<strong>in</strong>de Erträge erzielt und Aufwendungen entstehen sowie<br />
Zahlungen erhalten und geleistet werden.<br />
Aus den Vorgaben des Rates der Geme<strong>in</strong>de für die Ausführung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft ergibt sich<br />
zudem die Notwendigkeit, dass der Bürgermeister nach dem Ende se<strong>in</strong>es auf e<strong>in</strong> Jahr begrenzten Auftrages, die<br />
Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de nach der geltenden Haushaltssatzung zu führen, darüber Rechenschaft gegenüber<br />
dem Rat ablegen muss. Er muss durch den Jahresabschluss darlegen, wie er se<strong>in</strong>en Auftrag ausgeführt<br />
hat und zu welchem Ergebnis die Haushaltswirtschaft im Verlaufe des Haushaltsjahres geführt hat, welche Aus-<br />
GEMEINDEORDNUNG 541
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 95 GO <strong>NRW</strong><br />
wirkungen sich daraus auf das Vermögen und die Schulden der Geme<strong>in</strong>de ergeben, aber auch, welche Chancen<br />
und Risiken für die künftige Entwicklung der Geme<strong>in</strong>de bestehen.<br />
Diese Kriterien bestimmen den Inhalt des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses, denn er ist Teil des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushalts mit der besonderen Aufgabe der Ergebnisdarstellung für das abgelaufene Haushaltsjahr. Diese Vorschrift<br />
bestimmt deshalb den Inhalt und den Zweck des Jahresabschlusses der Geme<strong>in</strong>de näher, so dass der<br />
geme<strong>in</strong>dliche Jahresanschluss sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden sowie Rechnungsabgrenzungsposten<br />
und die Aufwendungen und Erträge der Geme<strong>in</strong>de, die dem Haushaltsjahr zuzurechnen s<strong>in</strong>d, enthalten<br />
muss (Vollständigkeitsgebot). Durch den neuen umfangreichen geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss wird die Qualität<br />
der Rechenschaft über das abgelaufene Haushaltsjahr bzw. den geme<strong>in</strong>dlichen Haushalt gegenüber den bisherigen<br />
kameralen Jahresrechnungen wesentlich erhöht. Er trägt gleichzeitig zu e<strong>in</strong>er Verbesserung der Steuerungsmöglichkeiten<br />
der Geme<strong>in</strong>de bei.<br />
1.2 Aufgaben des Jahresabschlusses<br />
Der geme<strong>in</strong>dliche Jahresabschluss lehnt sich an den handelsrechtlichen Jahresabschluss für große Kapitalgesellschaften<br />
an. Dessen Funktion ist deshalb <strong>in</strong> das geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsrecht übernommen worden. Mit se<strong>in</strong>en<br />
Bestandteilen und den Anlagen hat der Jahresabschluss der Geme<strong>in</strong>de daher e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen<br />
entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de zu vermitteln.<br />
Die im geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss anzugebenden Beträge <strong>in</strong> Gelde<strong>in</strong>heit müssen <strong>in</strong> Euro als gesetzliche<br />
Währung angeben werden, auch wenn darüber ke<strong>in</strong>e ausdrückliche haushaltsrechtliche Regelung besteht. Mit<br />
dem Jahresabschluss wird den Adressaten der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft ermöglicht, sich e<strong>in</strong> Bild über<br />
die Ergebnisse und den Stand der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres zu<br />
machen.<br />
Für die Geme<strong>in</strong>de, die e<strong>in</strong>en geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss aufzustellen hat, gilt daher, dass dieser unter Beachtung<br />
der rechtlichen Vorschriften und des Maßgeblichkeitspr<strong>in</strong>zips sowie des Vollständigkeitsgebots so aufgebaut<br />
und ausgestaltet ist, dass er für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Geme<strong>in</strong>de, aber auch für<br />
sonstige geme<strong>in</strong>derechtliche Fragestellungen, dienen kann. Daher wurde für den Jahresabschluss im NKF festgelegt,<br />
dass die Aufgabe der jahresbezogenen Ergebnisermittlung und die Informationsfunktion gleichrangig<br />
nebene<strong>in</strong>ander stehen. Weitere Bestimmungen über den Jahresabschluss der Geme<strong>in</strong>de und se<strong>in</strong>e Bestandteile<br />
s<strong>in</strong>d im sechsten Abschnitt der Geme<strong>in</strong>dehaushaltsverordnung enthalten.<br />
2. Die Schritte zum Jahresabschluss<br />
Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfordert e<strong>in</strong>e Vielzahl von „technischen“ Schritten und <strong>in</strong>haltlichen Abgrenzungen,<br />
damit der geme<strong>in</strong>dliche Jahresabschluss e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild<br />
der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de und auch e<strong>in</strong> Bild über die geme<strong>in</strong>dliche<br />
Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres vermitteln kann. Wichtige Schritte zur Aufstellung des<br />
Jahresabschlusses s<strong>in</strong>d die Durchführung der Inventur, die Erstellung e<strong>in</strong>es Inventars, der Ansatz/Ist-Vergleich <strong>in</strong><br />
der Ergebnisrechnung und der F<strong>in</strong>anzrechnung, zutreffende Wertansätze <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz sowie e<strong>in</strong>e<br />
verständliche und nachvollziehbare Berichterstattung im Anhang und im Lagebericht.<br />
Der geme<strong>in</strong>dliche Jahresabschluss muss se<strong>in</strong>er Aufgabe, das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen<br />
Haushaltsjahres nachzuweisen und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung e<strong>in</strong> den<br />
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de<br />
zu vermitteln, gerecht werden. Diese Aufgabe ist im notwendigen Umfang, ggf. ergänzend zum Anhang,<br />
besonders zu erläutern. Mit dem nachfolgendem Schema werden die Schritte für die Erstellung des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Jahresabschlusses vorgestellt (vgl. Abbildung).<br />
GEMEINDEORDNUNG 542
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 95 GO <strong>NRW</strong><br />
Schritte zum geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss<br />
Durchführung der Inventur<br />
- Mengen- und wertmäßige Erfassung des Vermögens<br />
- Mengen- und wertmäßige Erfassung der Schulden<br />
Erstellen e<strong>in</strong>es Inventars der Geme<strong>in</strong>de<br />
- Mengen- und wertmäßige E<strong>in</strong>zeldarstellung der Vermögensposten<br />
- Mengen- und wertmäßige E<strong>in</strong>zeldarstellung der Schuldenposten<br />
Aufstellung der Ergebnisrechnung<br />
- Abstimmung der Kontenbewegungen und Kontensalden<br />
- Vollständigkeitsprüfung<br />
- Periodenabgrenzung<br />
- Ansatz/Ist-Vergleich<br />
- Ausweisprüfung (richtig erfasst und zugeordnet)<br />
Aufstellung der F<strong>in</strong>anzrechnung<br />
- Abstimmung der Kontenbewegungen und Kontensalden<br />
- Vollständigkeitsprüfung<br />
- Kassenwirksamkeit<br />
- Ansatz/Ist-Vergleich<br />
- Ausweisprüfung (richtig erfasst und zugeordnet)<br />
Aufstellung der Bilanz<br />
- Abstimmung der Kontenbewegungen und Kontensalden<br />
- Vollständigkeitsprüfung<br />
- Bewertung und Ansatz von Vermögen und Schulden<br />
- Beachtung von Bilanzierungsgeboten und Bilanzierungsverboten<br />
- Aktive und passive Rechnungsabgrenzung<br />
- Ausweisprüfung (richtig erfasst und zugeordnet)<br />
Erstellung des Anhangs und des Lageberichtes<br />
- Zusammenstellung von Daten und Unterlagen<br />
- Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben<br />
- Zutreffende Berichterstattung<br />
- Erstellung des Forderungsspiegels<br />
- Erstellung des Anlagenspiegels<br />
- Erstellung des Verb<strong>in</strong>dlichkeitsspiegels<br />
Jahresabschluss<br />
- Ergebnisrechnung<br />
- F<strong>in</strong>anzrechnung<br />
- Teilrechnungen<br />
- Bilanz<br />
- Anhang<br />
mit Forderungsspiegel, Anlagenspiegel und Verb<strong>in</strong>dlichkeitsspiegel als Anlagen<br />
- Lagebericht<br />
- (beizufügen, wenn ke<strong>in</strong> Gesamtanschluss: Beteiligungsbericht)<br />
-<br />
Abbildung 112 „Schritte zum geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss“<br />
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses s<strong>in</strong>d aber auch die örtlichen Besonderheiten der Geme<strong>in</strong>de zu berücksichtigen.<br />
Sie werden die Arbeiten zur Aufstellung des Gesamtabschlusses <strong>in</strong> fachlicher und zeitlicher H<strong>in</strong>sicht<br />
wesentlich bee<strong>in</strong>flussen.<br />
GEMEINDEORDNUNG 543
3. Die Unterrichtung des Rates<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 95 GO <strong>NRW</strong><br />
Die Aufstellung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses und se<strong>in</strong>e Feststellung durch den Rat s<strong>in</strong>d gesetzlich<br />
bestimmten Fristen unterworfen worden (vgl. § 95 und 96 GO <strong>NRW</strong>). Die <strong>in</strong> diesem gesetzlichen Rahmen festgelegten<br />
Aufstellungsfristen stellen dabei nicht nur e<strong>in</strong>e Grenze für den Abschluss der örtlichen Arbeiten dar. Mit<br />
diesen Fristen wird auch bezweckt, dass im Rahmen des jährlich wiederkehrenden Haushaltskreislaufs der Rat<br />
der Geme<strong>in</strong>de frühzeitig durch e<strong>in</strong>en aktuellen Jahresabschluss über die weitere Entwicklung der Geme<strong>in</strong>de<br />
<strong>in</strong>formiert wird. Dieses hat die Geme<strong>in</strong>de zu beachten, wenn aus zw<strong>in</strong>genden örtlichen und sachlogischen Gründen<br />
die gesetzten Fristen überschritten werden müssen. In diesen Fällen obliegt dem Bürgermeister die Unterrichtungspflicht,<br />
denn er hat den Rat der Geme<strong>in</strong>de über alle wichtigen Geme<strong>in</strong>deangelegenheiten zu unterrichten<br />
(vgl. § 62 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong>).<br />
4. Die Übersicht über das Aufstellungsverfahren<br />
Die haushaltsrechtlichen Vorschriften regeln die Aufstellung des Entwurfs des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses<br />
durch den Kämmerer und die Bestätigung des Entwurfs durch den Bürgermeister. Sie regeln auch die sich daran<br />
anschließende Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss, die Beschlussfassung bzw. Feststellung durch<br />
den Rat der Geme<strong>in</strong>de bis zur öffentlichen Bekanntmachung und dem Verfügbarhalten des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses.<br />
Die Aufstellung des Jahresabschlusses bedarf deshalb neben der notwendigen Aufgabenverteilung<br />
<strong>in</strong>nerhalb der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung auch e<strong>in</strong>er konkreten Zeitplanung. Bei der Festlegung des zeitlichen<br />
Ablaufes des Aufstellungsverfahrens ist zu beachten, dass die Feststellung des Jahresabschlusses spätestens<br />
bis zum 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres zu erfolgen hat (§ 96 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>).<br />
Das Nachhalten der aufgezeigten Verfahrensschritte, die term<strong>in</strong>lich bestimmt se<strong>in</strong> müssen, soll durch nachfolgende<br />
Übersicht auch für die Geme<strong>in</strong>de erleichtert werden (vgl. Abbildung).<br />
Aufstellungsverfahren zur Feststellung des Jahresabschlusses<br />
Aufstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses<br />
durch den Kämmerer und Bestätigung durch den Bürgermeister (§ 95 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong>) unter Mitwirkung<br />
des Verwaltungsvorstands (vgl. § 70 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>) - vergleichbar der Haushaltsplanaufstellung<br />
-<br />
Anzeige e<strong>in</strong>es Fehlbetrages der Ergebnisrechnung<br />
ei der Aufsichtsbehörde, wenn ke<strong>in</strong> Fehlbetrag im Ergebnisplan oder der Fehlbetrag höher als geplant<br />
ist (§ 75 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong>), zu beachten:<br />
Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes (§ 76 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>)<br />
Zuleitung des Entwurfs des Jahresabschlusses<br />
an den Rat (§ 95 Abs. 3 Satz 2 GO <strong>NRW</strong>; sie soll <strong>in</strong>nerhalb von drei Monaten nach Ablauf des<br />
Haushaltsjahres erfolgen)<br />
Prüfung des Jahresabschlusses<br />
durch den Rechnungsprüfungsausschuss (§ 101 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>) Welcher Bestätigungsvermerk<br />
liegt vor (§ 101 Abs. 4 und 5 GO <strong>NRW</strong>)?<br />
Beratung und Feststellung des Jahresabschlusses<br />
durch den Rat (§ 96 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>; bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr<br />
folgenden Jahres), Entlastung des Bürgermeisters (§ 96 Abs. 1 Satz 4 GO <strong>NRW</strong>)<br />
Anzeige des Jahresabschlusses mit se<strong>in</strong>en Anlagen<br />
bei der Aufsichtsbehörde (§ 96 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>)<br />
GEMEINDEORDNUNG 544
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 95 GO <strong>NRW</strong><br />
Bekanntmachung und Verfügbarhalten des Jahresabschlusses<br />
(§ 96 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>; er soll bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses verfügbar<br />
gehalten werden)<br />
Abbildung 113 „Aufstellungsverfahren zur Feststellung des Jahresabschlusses“<br />
Über diese Verfahrensschritte der Aufstellung der Haushaltssatzung soll sich die Aufsichtsbehörde im Rahmen<br />
der Anzeige der Haushaltssatzung <strong>in</strong>formieren, denn diese Satzung ist von ihr als Rechtsaufsichtsbehörde über<br />
die Geme<strong>in</strong>de zu prüfen. Die Aufsichtsbehörde soll auch feststellen, ob das gesetzlich bestimmte Verfahren ordnungsgemäß<br />
abgelaufen ist und ggf. aufgetretene Rechtsverstöße beanstanden.<br />
5. Anzeigepflichten bei Fehlbetrag <strong>in</strong> der Ergebnisrechnung<br />
5.1 Die Anzeigepflicht gegenüber der Aufsichtsbehörde<br />
Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> erstreckt sich nicht nur auf die Planung,<br />
sondern auch auf die Rechnungslegung. Daher hat der Bürgermeister bei se<strong>in</strong>er Bestätigung des Entwurfs des<br />
Jahresabschlusses zu berücksichtigen, ob die Ergebnisrechnung nach § 38 GemHVO <strong>NRW</strong> trotz e<strong>in</strong>es ursprünglich<br />
ausgeglichenen Ergebnisplans nach § 2 GemHVO <strong>NRW</strong> e<strong>in</strong>en Fehlbetrag oder e<strong>in</strong>en höheren Fehlbetrag als<br />
im Ergebnisplan ausgewiesen ausweist. Ist dies der Fall, besteht für die Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>e Anzeigepflicht gegenüber<br />
ihrer Aufsichtsbehörde.<br />
Die Aufsichtsbehörde der Geme<strong>in</strong>de kann wegen des entstandenen schlechteren Jahresergebnisses bzw. Fehlbetrages<br />
die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um e<strong>in</strong>e geordnete Haushaltswirtschaft durch die Geme<strong>in</strong>de<br />
wieder herzustellen. Gleichzeitig muss die Geme<strong>in</strong>de auf Grund ihrer Kenntnis über die Haushaltswirtschaft des<br />
abgelaufenen Jahres sofort Maßnahmen ergreifen, z.B. durch e<strong>in</strong>e Haushaltssperre, um e<strong>in</strong>er weiteren defizitären<br />
Haushaltswirtschaft entgegen zu wirken und den jährlichen Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong><br />
wieder zu erreichen sowie die dauerhafte Leistungsfähigkeit (Gebot <strong>in</strong> § 75 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>) wieder zu sichern.<br />
5.2 Fehlbetrag und Haushaltssicherungskonzept<br />
5.2.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Bei der Bestätigung des Jahresabschlusses <strong>in</strong> der Ergebnisrechnung kann e<strong>in</strong> Fehlbetrag oder e<strong>in</strong> höherer Fehlbetrag<br />
als geplant als Ausweis der Veränderung der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres so<br />
erheblich se<strong>in</strong>, dass zum Abschlussstichtag am Ende dieses Haushaltsjahres der <strong>in</strong> der Schlussbilanz des Vorjahres<br />
enthaltene Ansatz der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage um mehr als e<strong>in</strong> Viertel zu verr<strong>in</strong>gert ist. Wird <strong>in</strong> diesem Fall<br />
der Schwellenwert des § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO <strong>NRW</strong> überschritten, löst dies für die Geme<strong>in</strong>de unmittelbar die Verpflichtung<br />
zur Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes aus (vgl. § 5 GemHVO <strong>NRW</strong>). Auch kann sich auf<br />
Grund des höheren Fehlbetrages <strong>in</strong> der Ergebnisrechnung und der daraus entstehenden größeren Verr<strong>in</strong>gerung<br />
der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage e<strong>in</strong>e andere anteilige Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage <strong>in</strong> den Folgejahren des<br />
Haushaltsjahres ergeben.<br />
Die neue Sachlage kann daher zu Folge haben, dass nicht aus dem Haushaltsjahr heraus, sondern aus der geplanten<br />
Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de nunmehr die Pflicht zur Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes<br />
nach § 76 GO <strong>NRW</strong> entsteht bzw. bereits entstanden ist. Dies erfordert es, dass bei e<strong>in</strong>em solchen Sachverhalt<br />
die Aufsichtsbehörde die notwendigen Anordnungen treffen kann. Ob es im E<strong>in</strong>zelfall tatsächlich erforderlich<br />
werden könnte, dass die Aufsichtsbehörde ihre Anordnungen selbst durchführen muss oder – wenn und solange<br />
diese Befugnisse nicht ausreichen – sogar e<strong>in</strong>en Beauftragten bestellen muss, kann offen bleiben (vgl. auch §§<br />
GEMEINDEORDNUNG 545
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 95 GO <strong>NRW</strong><br />
119 ff. GO <strong>NRW</strong>). Die vorhandenen Bestimmungen bieten dafür lediglich die erforderlichen Ermächtigungen für<br />
das im E<strong>in</strong>zelfall möglichst erfolgreiche Handeln der Aufsichtsbehörde.<br />
5.2.2 Das Haushaltssicherungskonzept als Sanierungskonzept<br />
Für e<strong>in</strong>e Geme<strong>in</strong>de besteht auch bei schlechter haushaltswirtschaftlicher Lage besteht grundsätzlich e<strong>in</strong>e positive<br />
Fortführungsprognose. Trotz e<strong>in</strong>er akuten und aktuellen Krisensituation, auch wenn diese mehrjährig ist, hat die<br />
Geme<strong>in</strong>de trotz stark angespannter Liquidität bzw. Liquiditätsdefiziten grundsätzlich die Substanz und die Potenziale,<br />
um wieder den jährlichen Haushaltsausgleich zu erreichen und die stetige Aufgabenerfüllung auf Dauer zu<br />
sichern. Die Voraussetzungen dafür s<strong>in</strong>d generell gegeben, denn Sanieren bedeutet, die Krisenkennzeichen<br />
wahrzunehmen, die Ursachen zu erkennen, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen und Wiederholungen vorzubeugen.<br />
Dabei gilt es, die Sanierungswürdigkeit und die Sanierungsfähigkeit aller Elemente der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Aufgabenerfüllung zu prüfen und zu bewerten, so dass e<strong>in</strong> umfassendes Sanierungskonzept zur wirtschaftlichen<br />
Gesundung und Zukunftssicherung der Geme<strong>in</strong>de auf den Weg gebracht wird.<br />
Die Geme<strong>in</strong>de muss die notwendigen und vielfachen Veränderungen vor Ort angehen und diese schnell, gezielt<br />
und konsequent <strong>in</strong> der erforderlichen Reihenfolge beg<strong>in</strong>nen umzusetzen. E<strong>in</strong> Haushaltssicherungskonzept als<br />
umfassendes Sanierungskonzept dient dabei als zukunftsorientierter Leitfaden (Gesamtkonzept), <strong>in</strong> dem die<br />
grundsätzlichen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen für die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung der Geme<strong>in</strong>de und die<br />
Steuerung des Haushalts, dass er <strong>in</strong> Zukunft dauerhaft ausgeglichen se<strong>in</strong> wird, festgelegt werden. Gleichzeitig<br />
muss das Sanierungskonzept e<strong>in</strong> erweitertes Planungssystem als der Haushaltsplan enthalten, das als Handlungsrichtschnur<br />
dienen soll und deshalb die konkreten und akuten Schritte aufzuzeigen hat, die sofort und <strong>in</strong> der<br />
weiteren Zukunft zu gehen s<strong>in</strong>d. Besondere Eckpunkte sowie die Chancen und Risiken für die Geme<strong>in</strong>de s<strong>in</strong>d<br />
dabei besonders herauszustellen. Das Sanierungskonzept ist e<strong>in</strong>e Leitl<strong>in</strong>ie für das Handeln der Geme<strong>in</strong>de und<br />
muss e<strong>in</strong>e betriebswirtschaftliche Logik enthalten.<br />
5.2.3 Die Stufen e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Sanierungsplans<br />
E<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>dliche Krisensituation hat e<strong>in</strong>e große Bedeutung für den Rat und die Verwaltung sowie die Bürger<strong>in</strong>nen<br />
und Bürger der Geme<strong>in</strong>de. Deshalb muss e<strong>in</strong>e Struktur erarbeitet werden, die den gesamten Ablauf der<br />
Bewältigung der wirtschaftlichen Krise der Geme<strong>in</strong>de be<strong>in</strong>haltet und die Grundlage für die notwendigen Handlungen<br />
bietet. Die möglichen fünf Abschnitte e<strong>in</strong>es Sanierungsplans der Geme<strong>in</strong>de zur Krisenbewältigung und zur<br />
stetigen Entwicklung können, wenn nicht weiter differenziert wird, Folgende se<strong>in</strong> (vgl. Abbildung).<br />
Stufe 1<br />
Stufe 2<br />
Stufe 3<br />
Stufe 4<br />
Stufen e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Sanierungsplans<br />
Gesamtkonzept der Geme<strong>in</strong>de zur Krisenbewältigung (Sanierungsplan)<br />
Sensibilisierung/ Krisenerkenntnis<br />
(Befangenheit der Betroffenen)<br />
Krisenursachen identifizieren<br />
(Sanierungswürdigkeit und Sanierungsfähigkeit feststellen)<br />
Sanierungsplan - Leitl<strong>in</strong>ie für e<strong>in</strong>e Sanierung<br />
(Ursachen - Analyse - Lage - Ziele)<br />
Implementierung des Sanierungsplans<br />
(leistungs- und f<strong>in</strong>anzwirtschaftliche, organisatorische<br />
GEMEINDEORDNUNG 546<br />
Bedrohung erkennen<br />
und ernst nehmen<br />
Sich schlüssig auf wesentliche<br />
Kernfragen<br />
konzentrieren<br />
Perspektive und Vision<br />
der Sanierung vermitteln<br />
Zustimmung und Motivation<br />
der Beteiligten<br />
auslösen
Stufe 5<br />
Maßnahmen)<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 95 GO <strong>NRW</strong><br />
Sanierungscontroll<strong>in</strong>g<br />
(Identifizierung des Sanierungserfolges, Kennzahlen,<br />
Planungsrechnungen und Planbilanz)<br />
Abbildung 114 „Stufen e<strong>in</strong>es Sanierungsplans“<br />
Erfolgreiche Umsetzung<br />
messen, Chancen und<br />
Risiken neu e<strong>in</strong>schätzen<br />
E<strong>in</strong> erfolgreicher Sanierungsprozess bei der Geme<strong>in</strong>de besteht u.a. dar<strong>in</strong>, dass sie die Bewältigung der Krise<br />
ihrer haushaltswirtschaftlichen Lage selbst so durchführt, dass die Geme<strong>in</strong>de die dauernde Leistungsfähigkeit<br />
erreicht, die künftigen Generationen nicht unnötig belastet sowie deren Zukunft sichert und dadurch den Grundsatz<br />
der <strong>in</strong>tergenerativen Gerechtigkeit e<strong>in</strong>hält.<br />
5.3 Der Beg<strong>in</strong>n der Frist zur Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs<br />
Bei der Bestätigung des Entwurfs des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses durch den Bürgermeister kann für die<br />
Geme<strong>in</strong>de die Pflicht zur Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes entstehen. Sie bewirkt die B<strong>in</strong>dung<br />
des Haushaltssicherungskonzeptes an den Haushaltsplan und löst wie bei der Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes<br />
im Rahmen der Haushaltsplanung e<strong>in</strong>e Frist von drei Jahren nach dem Ursachenjahr aus, die zur<br />
Erreichung des Haushaltsausgleichs e<strong>in</strong>zuhalten ist, damit e<strong>in</strong>e Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssicherungskonzeptes<br />
gegeben ist. Die Haushaltsbewirtschaftung des abgeschlossenen Haushaltsjahres kann zwar als<br />
Auslöser der Ursache für die Pflicht zur Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes angesehen werden,<br />
gleichwohl entsteht diese Pflicht erst dann, wenn dafür die notwendige Kenntnis bei der Geme<strong>in</strong>de vorliegt.<br />
Diese Kenntnis erlangt die Geme<strong>in</strong>de erst im Rahmen der Aufstellung und Bestätigung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses<br />
für das abgelaufene Haushaltsjahr. Erst zu diesem Zeitpunkt im Folgejahr des Haushaltsjahres ist<br />
e<strong>in</strong>e Beurteilung möglich, welchen Eigenkapitalverzehr der ggf. nicht geplante Fehlbetrag für das abgelaufene<br />
Haushaltsjahr bewirkt und wie er sich auf die folgenden Jahre auswirkt, z.B. ob dadurch die <strong>in</strong> § 76 GO <strong>NRW</strong><br />
bestimmten Schwellenwerte überschritten werden. Der Fristbeg<strong>in</strong>n für die Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs<br />
sowie das Haushaltsjahr, <strong>in</strong> dem der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden muss, lässt sich i.d.R.<br />
erst <strong>in</strong> Abhängigkeit von der tatsächlichen Fallgestaltung bzw. den e<strong>in</strong>zelnen Jahresergebnissen der Geme<strong>in</strong>de<br />
genau bestimmen. In diesem Zusammenhang ist vom Gesetzgeber mit der Vorschrift nicht beabsichtigt worden,<br />
e<strong>in</strong> bereits durch den bestätigten Jahresabschluss abgeschlossenes Haushaltsjahr wieder zu öffnen, um es dann<br />
als Ursachenjahr für die Frist zur Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs heranziehen zu können.<br />
5.4 Die Zuordnung des Haushaltssicherungskonzeptes zum Haushaltsjahr<br />
In den Fällen, <strong>in</strong> denen e<strong>in</strong> Haushaltssicherungskonzept im Rahmen der Bestätigung über den Jahresabschluss<br />
aufzustellen ist, bewirkt die B<strong>in</strong>dung des Haushaltssicherungskonzeptes an den Haushaltsplan nach § 79 Abs. 2<br />
Satz 2 GO <strong>NRW</strong>, dass auch dieses Haushaltssicherungskonzept Bestandteil e<strong>in</strong>es Haushaltsplans se<strong>in</strong> muss.<br />
Für das Haushaltsjahr, <strong>in</strong> dem der Jahresabschluss für das vorherige Haushaltsjahr aufgestellt wird, existiert<br />
i.d.R. bereits e<strong>in</strong>e geltende Haushaltssatzung und damit auch e<strong>in</strong>e bestandskräftiger Haushaltsplan. Es ist daher<br />
sachgerecht und vertretbar, das aufgestellte Haushaltssicherungskonzept zum Bestandteil des nächsten der<br />
Bestätigung des Jahresabschlusses folgenden Haushaltsjahres zu machen. Diese haushaltsrechtliche Zuordnung<br />
gibt jedoch ke<strong>in</strong>e Berechtigung, die auf das Ursachenjahr bezogene Fristsetzung für die Wiederherstellung des<br />
Haushaltsausgleichs zu verändern bzw. zu verlängern.<br />
Die Geme<strong>in</strong>de, die auf Grund ihrer Kenntnis über das negative Jahresergebnis des abgelaufenen Haushaltsjahres<br />
und der daraus ggf. entstehenden Pflicht zur Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes die notwendigen<br />
Gegenmaßnahmen sofort e<strong>in</strong>leiten muss, um den jährlichen Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong><br />
GEMEINDEORDNUNG 547
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 95 GO <strong>NRW</strong><br />
wieder zu erreichen und ihre dauernde Leistungsfähigkeit (Gebot <strong>in</strong> § 75 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>) wieder zu sichern,<br />
kann bereits im laufenden Haushaltsjahr durch e<strong>in</strong>e freiwillige Nachtragssatzung e<strong>in</strong> genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept<br />
auch zum Bestandteil des Haushaltsplans dieses Haushaltsjahres machen. Diese Vorgehensweise<br />
dürfte <strong>in</strong> vielen Fällen s<strong>in</strong>nvoll se<strong>in</strong>, um auch die Sofortmaßnahmen der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> die Gesamtstrategie<br />
des Haushaltssicherungskonzeptes bzw. <strong>in</strong> das örtliche Haushaltsgeschehen förmlich e<strong>in</strong>zub<strong>in</strong>den.<br />
6. Änderungen oder Berichtigungen des Jahresabschlusses<br />
6.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Unter die Vorschrift über die Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz fallen nicht<br />
Bilanzänderungen und Bilanzberichtigungen, die nach der Feststellung des Jahresabschlusses im Rahmen und<br />
zur E<strong>in</strong>haltung des Haushaltsrechts der Geme<strong>in</strong>den notwendig werden. Jedoch zeigt bereits die auf die Eröffnungsbilanz<br />
bezogene Vorschrift auf, dass unrichtige Bilanzansätze bzw. fehlerhafte Wertansätze bei der Aufgabe<br />
e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage<br />
der Geme<strong>in</strong>de zu vermitteln, auch bei den zukünftigen Jahresabschlüssen nicht ausgeschlossen werden können.<br />
E<strong>in</strong>e Korrektur von aufgetretenen Bilanzierungsfehlern darf jedoch nicht dadurch umgangen oder ersetzt werden,<br />
dass stattdessen e<strong>in</strong>e Zuschreibung nach § 35 Abs. 8 GemHVO <strong>NRW</strong> vorgenommen wird. Sie ist vielmehr immer<br />
nach den Regeln der Bilanzberichtigung vorzunehmen.<br />
Bei den Geme<strong>in</strong>den können fehlerhafte oder unrichtige Jahresabschlüsse entstehen, weil die am Abschlussstichtag<br />
gegebenen objektiven Verhältnisse bei der Aufstellung und Feststellung des Jahresabschlusses nicht erkannt<br />
wurden. Für die Beurteilung dieses Sachverhaltes ist auf die Feststellung des Jahresabschlusses abzustellen,<br />
denn im Zeitraum von der Aufstellung des Jahresabschlusses bis zu se<strong>in</strong>er Feststellung liegt nur e<strong>in</strong> Entwurf vor,<br />
der noch verändert werden kann. Liegen die Erkenntnisse über e<strong>in</strong>en Änderung- oder Berichtigungsbedarf erst zu<br />
e<strong>in</strong>em späteren Zeitpunkt vor, soll e<strong>in</strong>e Berichtigung grundsätzlich im am weitesten zurückliegenden, noch nicht<br />
bestandskräftigen Jahresabschluss vorgenommen werden.<br />
Es kann bei Unwesentlichkeit des aufgetretenen Fehlers auch ausreichend se<strong>in</strong>, diesen im nächsten Jahresabschluss<br />
zu berichtigen. Diese Fehlerbeseitigung eröffnet jedoch nicht die Möglichkeit zu e<strong>in</strong>er nachträglichen<br />
neuen Sachverhaltsgestaltung. Bei der Prüfung, <strong>in</strong> welcher Form e<strong>in</strong>e Fehlerbeseitigung zu erfolgen hat, ist auch<br />
das Informationsbedürfnis der Adressaten des Jahresabschlusses zu berücksichtigen. Zu beachten ist, dass die<br />
Änderung e<strong>in</strong>es fehlerfreien Jahresabschlusses, der den gesetzlichen Anforderungen und den GoB entspricht<br />
und vom Rat der Geme<strong>in</strong>de festgestellt wurde, grundsätzlich unzulässig ist.<br />
6.2 Die erneute Feststellung des Jahresabschlusses<br />
Die Änderung e<strong>in</strong>es festgestellten Jahresabschlusses kann z.B. auch wegen materieller Folgewirkungen oder<br />
wegen wesentlicher Rechtsverstöße, erforderlich werden. Ist dieses der Fall, bedarf es e<strong>in</strong>er erneuten Feststellung<br />
des (berichtigten) geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses durch den Rat der Geme<strong>in</strong>de. Auch dieser Feststellung<br />
muss e<strong>in</strong>e Prüfung der vorgenommenen Änderungen vorausgehen. Über e<strong>in</strong>e solche zusätzliche Prüfung ist e<strong>in</strong><br />
eigenständiger Prüfungsbericht zu erstellen. Das Ergebnis dieser Prüfung kann ggf. auch zu e<strong>in</strong>er Änderung des<br />
bereits erteilten Bestätigungsvermerks führen.<br />
Der geänderte Jahresabschluss der Geme<strong>in</strong>de muss als solcher gekennzeichnet werden, um diese besondere<br />
Gegebenheiten für Dritte als Adressaten des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses deutlich zu machen. Die vorgenommenen<br />
Änderungen s<strong>in</strong>d im Anhang dieses neuen Jahresabschlusses anzugeben und es ist deren Umfang<br />
und Notwendigkeit zu erläutern. In den Fällen jedoch, <strong>in</strong> denen die vorgenommenen Änderungen<br />
des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses ke<strong>in</strong>e Auswirkungen auf den Beschluss über die Ergebnisverwendung und<br />
GEMEINDEORDNUNG 548
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 95 GO <strong>NRW</strong><br />
/oder auf die Entlastung des Bürgermeisters haben (vgl. § 96 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>), ist darüber e<strong>in</strong>e erneute Beschlussfassung<br />
durch den Rat entbehrlich. E<strong>in</strong> geänderter Jahresabschluss der Geme<strong>in</strong>de unterliegt erneut der<br />
Anzeige an die Aufsichtsbehörde, der öffentlichen Bekanntmachung und ist zur E<strong>in</strong>sichtnahme verfügbar zu halten<br />
(vgl. § 96 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>).<br />
II. Erläuterungen im E<strong>in</strong>zelnen<br />
1. Zu Absatz 1 (Pflicht zur Aufstellung e<strong>in</strong>es Jahresabschlusses):<br />
1.1 Zu Satz 1 (Inhalte des Jahresabschlusses):<br />
1.1.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
In der Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de kommt dem geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss e<strong>in</strong>e große Bedeutung zu,<br />
denn nach der Vorschrift hat die Geme<strong>in</strong>de zum Schluss e<strong>in</strong>es jeden Haushaltsjahres e<strong>in</strong>en Jahresabschluss<br />
aufzustellen, <strong>in</strong> dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen und die wirtschaftliche<br />
Lage der Geme<strong>in</strong>de aufzuzeigen ist. Der geme<strong>in</strong>dliche Jahresabschluss besteht aus der der Ergebnisrechnung,<br />
der F<strong>in</strong>anzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang (vgl. § 37 GemHVO <strong>NRW</strong>). Dem<br />
Jahresabschluss ist zudem e<strong>in</strong> Lagebericht nach § 48 GemHVO <strong>NRW</strong> beizufügen (vgl. Abbildung).<br />
Ergebnisrechnung<br />
Mit der Ergebnisrechnung<br />
werden die im<br />
Haushaltsjahr erzielten<br />
Erträge und entstandenen<br />
Aufwendungen<br />
nachgewiesen. Sie<br />
<strong>in</strong>formiert dadurch über<br />
das geme<strong>in</strong>dliche<br />
Ressourcenaufkommen<br />
und den Ressourcenverbrauch<br />
sowie über<br />
das daraus entstandene<br />
Jahresergebnis.<br />
Wegen der <strong>in</strong> der<br />
Ergebnisrechnung<br />
enthaltenen Ergebnisspaltung<br />
ist zudem<br />
zwischen ordentlichem<br />
und außerordentlichem<br />
Ergebnis zu trennen.<br />
Lagebericht<br />
Weitere örtliche Anlagen:<br />
Bestandteile und Anlagen des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses<br />
F<strong>in</strong>anzrechnung<br />
Mit der F<strong>in</strong>anzrechnung<br />
werden die im<br />
Haushaltsjahr<br />
e<strong>in</strong>gegangenen<br />
E<strong>in</strong>zahlungen und<br />
geleisteten Auszahlungen<br />
erfasst. Sie<br />
<strong>in</strong>formiert über die<br />
F<strong>in</strong>anzmittelherkunft<br />
und F<strong>in</strong>anzmittelverwendung<br />
getrennt nach den<br />
Bereichen „LaufendeVerwaltungstätigkeit“,„Investitionstätigkeit“<br />
und<br />
„F<strong>in</strong>anzierungstätigkeit“.<br />
Teilrechnungen<br />
Mit den produktorientiertenTeilrechnungen<br />
werden<br />
Nachweise über die<br />
Ausführung der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltswirtschaft<br />
nach den <strong>in</strong> den<br />
Teilplänen im Haushaltsplanenthaltenen<br />
Ermächtigungen<br />
und sonstigen Leistungsangabenerbracht.<br />
Sie s<strong>in</strong>d<br />
nicht getrennt nach<br />
Ergebnisrechnung<br />
und F<strong>in</strong>anzrechnung<br />
aufzustellen, sondern<br />
stellen e<strong>in</strong><br />
aufgabenbezogenes<br />
Gesamtbild dar.<br />
Bilanz<br />
Die Bilanz ist e<strong>in</strong>e<br />
Gegenüberstellung<br />
von Vermögen<br />
(Aktivseite)<br />
und den F<strong>in</strong>anzierungsmitteln(Passivseite)<br />
und e<strong>in</strong>e<br />
auf den jährlichen<br />
Abschlussstichtag<br />
bezogene Zeitpunktrechnung.<br />
Mit ihr soll stichtagsbezogen<br />
e<strong>in</strong><br />
Bild über das<br />
Vermögens- und<br />
Schuldenlage der<br />
Geme<strong>in</strong>de vermittelt<br />
werden Die<br />
Gliederung der<br />
Bilanz erfolgt<br />
sowohl auf der<br />
Aktivseite als auch<br />
auf der Passivseite<br />
nach Fristigkeiten.<br />
Abbildung 115 „Bestandteile und Anlagen des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses“<br />
GEMEINDEORDNUNG 549<br />
Anhang<br />
Der Anhang als<br />
fünftes Element des<br />
Jahresabschlusses<br />
enthält <strong>in</strong>sbesondere<br />
Erläuterungen zu<br />
e<strong>in</strong>zelnen Bilanzposten<br />
und den Positionen<br />
der Ergebnisrechnung.<br />
Ihm s<strong>in</strong>d<br />
e<strong>in</strong> Anlagenspiegel<br />
nach § 45 GemHVO<br />
<strong>NRW</strong>, e<strong>in</strong> Forderungsspiegel<br />
nach §<br />
46 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
und e<strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dlichkeitenspiegel<br />
§ 47<br />
GemHVO <strong>NRW</strong><br />
beizufügen.
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 95 GO <strong>NRW</strong><br />
Im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsrecht der Geme<strong>in</strong>deordnung ist jedoch der Rahmenbegriff „Haushaltswirtschaft“ (der<br />
Geme<strong>in</strong>de) nicht ausdrücklich gesetzlich def<strong>in</strong>iert worden. Nach allgeme<strong>in</strong>er Auffassung fallen daher unter diesen<br />
Begriff alle D<strong>in</strong>ge und Tätigkeiten, die zur Vorbereitung, Ausführung und Abrechnung der jährlichen Haushaltswirtschaft<br />
der Geme<strong>in</strong>de gehören, also auch die Aufstellung und Feststellung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses.<br />
Als geme<strong>in</strong>dliches Haushaltsjahr gilt das Kalenderjahr (vgl. § 78 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong>). Das Haushaltsjahr<br />
ist daher mit dem Wirtschaftjahr der geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe identisch. Außerdem s<strong>in</strong>d bei der Aufstellung des<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses von der Geme<strong>in</strong>de alle Tatbestände zu berücksichtigen und offen zu legen, die<br />
e<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>fluss auf das geme<strong>in</strong>dliche Jahresergebnis haben und wegen ihres Aussagewertes auch für die Adressaten<br />
des Jahresabschlusses von Bedeutung s<strong>in</strong>d.<br />
1.1.2 Der Begriff „Schluss des Haushaltsjahres“<br />
Nach der Vorschrift hat die Geme<strong>in</strong>de zum Schluss e<strong>in</strong>es jeden Haushaltsjahres e<strong>in</strong>en Jahresabschluss aufzustellen,<br />
<strong>in</strong> dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Als Schluss des<br />
Haushaltsjahres gilt der 31. Dezember (24.00 UHR) als letzter Tag des Kalenderjahres, denn durch die haushaltsrechtliche<br />
Vorschrift des § 78 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong> wird bestimmt dass das Haushaltsjahr dem Kalenderjahr<br />
entspricht. Mit diesem Tag endet daher das geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsjahr, für das anschließend e<strong>in</strong> Jahresabschluss<br />
aufzustellen ist.<br />
1.1.3 Das Stichtagspr<strong>in</strong>zip<br />
Im Rahmen der gesetzlich bestimmten Aufstellung des Jahresabschlusses durch die Geme<strong>in</strong>de ist auch das<br />
Stichtagspr<strong>in</strong>zip zu beachten. Es besagt, dass im geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss die Geschäftsvorfälle der Geme<strong>in</strong>de<br />
zu berücksichtigen s<strong>in</strong>d, die im abgelaufenen Haushaltsjahr angefallen s<strong>in</strong>d. Außerdem wirkt sich das<br />
Stichtagspr<strong>in</strong>zip noch dah<strong>in</strong>gehend aus, dass dem geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss die Verhältnisse zu Grunde<br />
zu legen s<strong>in</strong>d, die bei der Geme<strong>in</strong>de am letzten Tag des Haushaltsjahres (31. Dezember) bestehen.<br />
Im geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss s<strong>in</strong>d auch noch die Verhältnisse nach dem Abschlussstichtag zu berücksichtigen.<br />
Dabei ist auch das Wertaufhellungspr<strong>in</strong>zip zu beachten, das sicherstellen soll, dass sämtliche am Abschlussstichtag<br />
objektiv bestehende Tatsachen bei der späteren Aufstellung des Jahresabschlusses von der<br />
Geme<strong>in</strong>de berücksichtigt werden. Dagegen s<strong>in</strong>d nachträgliche örtliche Entwicklungen, welche den Stand zum<br />
Abschlussstichtag verändern und dadurch als wertbegründende oder wertbee<strong>in</strong>flussende Tatbestände zu behandeln<br />
s<strong>in</strong>d, nicht <strong>in</strong> den geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss e<strong>in</strong>zubeziehen.<br />
1.1.4 Das Ergebnis der Haushaltswirtschaft<br />
Der geme<strong>in</strong>dliche Jahresabschluss zeigt das Ergebnis des wirtschaftlichen Handelns der Geme<strong>in</strong>de im abgelaufenen<br />
Haushaltsjahr nach festgelegten haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Regeln und unter Beachtung<br />
haushaltsrechtlicher und betriebswirtschaftlicher Grundsätze <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Ergebnisrechnung<br />
auf. Das <strong>in</strong> der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis umfasst die ordentlichen Aufwendungen und<br />
Erträge, die F<strong>in</strong>anzaufwendungen und -erträge sowie die außerordentlichen Aufwendungen und Erträge und<br />
bildet dadurch das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch der Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de<br />
unter Beachtung des Grundsatzes der Gesamtdeckung nach § 20 GemHVO <strong>NRW</strong> ab. Das Jahresergebnis wird<br />
entweder als Jahresüberschuss (Die Erträge s<strong>in</strong>d höher als die Aufwendungen) oder als Jahresfehlbetrag (Die<br />
Aufwendungen s<strong>in</strong>d höher als die Erträge) <strong>in</strong> die geme<strong>in</strong>dliche Bilanz übernommen und zeigt dort die Veränderung<br />
des Eigenkapitals der Geme<strong>in</strong>de auf.<br />
GEMEINDEORDNUNG 550
1.1.5 Der Begriff „Haushaltsjahr“<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 95 GO <strong>NRW</strong><br />
Durch die haushaltsrechtliche Vorschrift des § 78 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong> wird unter Berücksichtigung des Jährlichkeitspr<strong>in</strong>zips<br />
als Haushaltsjahr das Kalenderjahr bestimmt. Das Haushaltsjahr umfasst deshalb den Zeitraum vom 1.<br />
Januar bis 31. Dezember, der der jahresbezogenen geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft zu Grunde zu legen ist.<br />
Die haushaltswirtschaftliche Periode des geme<strong>in</strong>dlichen Haushalts als Geschäftsjahr wird dabei auf e<strong>in</strong>en Zeitraum<br />
von zwölf Monaten ausgerichtet, bei der auf der Grundlage der vom Rat beschlossenen Haushaltssatzung<br />
vorzunehmen die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsbewirtschaftung vorzunehmen ist und nach Ablauf der Periode e<strong>in</strong>e<br />
Abrechnung erfolgen muss bzw. e<strong>in</strong> Jahresabschluss (vgl. § 95 GO <strong>NRW</strong>) aufzustellen ist.<br />
Durch diese verb<strong>in</strong>dliche zeitliche Deckung des Haushaltsjahres mit dem Kalenderjahr werden die periodengerechte<br />
Zuordnung und Buchung von Erträgen und Abwendungen, die Rechnungsabgrenzung sowie der Rahmen<br />
der Buchungen von E<strong>in</strong>zahlungen und Auszahlungen bestimmt. Durch die getroffene Regelung besteht außerdem<br />
e<strong>in</strong>e Übere<strong>in</strong>stimmung der haushaltswirtschaftlichen Periode des geme<strong>in</strong>dlichen Haushalts mit den sonstigen<br />
öffentlichen Haushalten sowie mit dem Steuerjahr und dem <strong>in</strong> der Privatwirtschaft allgeme<strong>in</strong> üblichen Wirtschaftsjahr,<br />
das auch dort regelmäßig dem Kalenderjahr entspricht. Auch <strong>in</strong> der Forstwirtschaft besteht gegenüber<br />
dem geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsjahr ke<strong>in</strong> abweichendes Wirtschaftsjahr (vgl. § 34 des Landesforstgesetzes für<br />
das Land Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen; SGV. <strong>NRW</strong>. 790).<br />
Die Übere<strong>in</strong>stimmung des Haushaltsjahres mit dem Kalenderjahr besteht auch bei den meisten geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Betrieben, die zu konsolidieren s<strong>in</strong>d. Die geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe, die dem Handelsrecht unterliegen, können zwar<br />
eigenverantwortlich ihr Geschäftsjahr festlegen, das jedoch regelmäßig für die gleiche Periode (Kalenderjahr) wie<br />
bei der geme<strong>in</strong>dlichen Kernverwaltung festgelegt worden ist. Weichen im E<strong>in</strong>zelfall die geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe<br />
davon ab, ist zu klären, welche Auswirkungen das auf die Aufstellung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses hat.<br />
E<strong>in</strong> gleiches Geschäftsjahr von geme<strong>in</strong>dlicher Kernverwaltung und geme<strong>in</strong>dlichen Betrieben erleichtert die Aufstellung<br />
des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss, weil bei diesem der Abschlussstichtag der geme<strong>in</strong>dlichen Kernverwaltung<br />
ausschlaggebend ist.<br />
1.2 Zu Satz 2 (Aufgabe des Jahresabschlusses):<br />
1.2.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Der geme<strong>in</strong>dliche Jahresabschluss zeigt das Ergebnis des wirtschaftlichen Handelns der Geme<strong>in</strong>de im abgelaufenen<br />
Haushaltsjahr nach festgelegten haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Regeln und unter Beachtung<br />
haushaltsrechtlicher und betriebswirtschaftlicher Grundsätze auf. Diese Vorschrift stellt daher e<strong>in</strong>en allgeme<strong>in</strong>en<br />
Rechnungslegungsgrundsatz dar, der als Generalnorm die Vorlage e<strong>in</strong>es den tatsächlichen Verhältnissen<br />
entsprechenden Bildes der wirtschaftlichen Lage der Geme<strong>in</strong>de gewährleisten soll.<br />
Der Jahresabschluss der Geme<strong>in</strong>de muss daher unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung<br />
e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage<br />
der Geme<strong>in</strong>de vermitteln. Außerdem gibt er Rechenschaft über die tatsächliche Aufgabenerledigung, die E<strong>in</strong>haltung<br />
des Haushaltsplans und soll e<strong>in</strong> zutreffendes Bild über die wirtschaftliche Lage und die Entwicklung der<br />
Geme<strong>in</strong>de abgeben. In diesem Zusammenhang ist z.B. der Grundsatz der Wesentlichkeit immer dann anzuwenden,<br />
wenn dadurch der E<strong>in</strong>blick <strong>in</strong> die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de verbessert<br />
wird. Der notwendige Abwägungsprozess ist von der Geme<strong>in</strong>de unter Berücksichtigung der vorliegenden örtlichen<br />
Gegebenheiten vorzunehmen.<br />
Der geme<strong>in</strong>dliche Jahresabschluss steht zudem <strong>in</strong> unmittelbarer Verb<strong>in</strong>dung zur geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplanung,<br />
denn die Geme<strong>in</strong>de muss jährliche e<strong>in</strong>e Haushaltssatzung nach § 78 GO <strong>NRW</strong> aufstellen. Mit dieser jährlichen<br />
Satzung können bei e<strong>in</strong>em besonderen örtlichen Bedarf ggf. auch e<strong>in</strong>mal Festsetzungen für zwei Haushalts-<br />
GEMEINDEORDNUNG 551
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 95 GO <strong>NRW</strong><br />
jahre getroffen werden. umfassen kann. Es ist <strong>in</strong> diesen Fällen aber nicht zulässig, im Rahmen der Ausführung<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft aus beiden Haushaltsjahren e<strong>in</strong>e Rechnungsperiode zu machen und<br />
entsprechend nur e<strong>in</strong>en geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss gem. § 95 GO <strong>NRW</strong> aufzustellen. Es muss immer nach<br />
Ablauf des jeweiligen Haushaltsjahres von der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong> haushaltsjahrbezogener Jahresabschluss, aber<br />
auch e<strong>in</strong> auf dieses Jahr bezogener Gesamtabschluss gem. § 116 GO <strong>NRW</strong>, aufgestellt werden.<br />
1.2.2 Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB)<br />
1.2.2.1 Das Regelsystem der GoB<br />
Das geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsrecht stellt wie das Handelsrecht die GoB <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en Zusammenhang mit den gesetzlichen<br />
Vorschriften über den Jahresabschluss der Geme<strong>in</strong>de. Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung s<strong>in</strong>d<br />
e<strong>in</strong> gesetzlich verankertes Regelungssystem, stehen jedoch nicht über dem Gesetz. Sie können sich als unbestimmter<br />
Rechtsbegriff nur im Rahmen der gesetzlichen Regelungen unter Beachtung von S<strong>in</strong>n und Zweck des<br />
Gesetzes oder e<strong>in</strong>zelner Vorschriften entwickeln.<br />
Als Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ist daher jedes Verfahren und jede Methode anzuerkennen, die<br />
dazu führen, dass gesetzliche Regelungen im E<strong>in</strong>zelfall ihrem S<strong>in</strong>n und Zweck entsprechend angewandt werden.<br />
Die GoB sollen sicherstellen, dass e<strong>in</strong> sachverständiger Dritter sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er angemessenen Zeit e<strong>in</strong>en Überblick<br />
über die Aufzeichnung von Buchungsvorfällen und die Aufzeichnung von Vermögens- und Schuldenpositionen<br />
verschaffen kann und Manipulationsmöglichkeiten verh<strong>in</strong>dert werden, aber auch, dass diesem Dritten e<strong>in</strong> qualifizierter<br />
E<strong>in</strong>blick <strong>in</strong> die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de möglich ist. Folgende allgeme<strong>in</strong>e<br />
Grundsätze gelten als Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (vgl. Abbildung).<br />
Grundsatz<br />
der Vollständigkeit<br />
Grundsatz<br />
der Richtigkeit<br />
und Willkürfreiheit<br />
Grundsatz<br />
der Verständlichkeit<br />
Grundsatz<br />
der Aktualität<br />
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB)<br />
GEMEINDEORDNUNG 552<br />
In der Buchführung s<strong>in</strong>d alle Geschäftsvorfälle sowie die Vermögens-<br />
und Schuldenlage vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet<br />
zu erfassen und zu dokumentieren. Daraus folgt das Erfordernis<br />
des systematischen Aufbaus der Buchführung unter Aufstellung<br />
e<strong>in</strong>es Kontenplans, das Pr<strong>in</strong>zip der vollständigen und verständlichen<br />
Aufzeichnung sowie das Belegpr<strong>in</strong>zip, d.h. die Grundlage für<br />
die Richtigkeit der Buchung bildet den Buchungsbeleg mit der<br />
Festlegung „Ke<strong>in</strong>e Buchung ohne Beleg.“ Dazu zählt auch die<br />
E<strong>in</strong>haltung der vorgesehenen Aufbewahrungsfristen.<br />
Die Aufzeichnungen über die Geschäftsvorfälle durch die Geme<strong>in</strong>de<br />
müssen die Realität möglichst genau abbilden, so dass die Informationen<br />
daraus begründbar und nachvollziehbar sowie objektiv richtig<br />
und willkürfrei s<strong>in</strong>d. Sie müssen sich <strong>in</strong> ihren Aussagen mit den zu<br />
Grunde liegenden Dokumenten decken und der Buchführungspflichtige<br />
bestätigen kann, dass die Buchführung e<strong>in</strong>e getreue<br />
Dokumentation se<strong>in</strong>er Geschäftsvorfälle nach den rechtlichen<br />
Bestimmungen und den GoB erfolgt.<br />
Die Informationen des Rechnungswesens s<strong>in</strong>d für den Rat und die<br />
Bürger als Öffentlichkeit so aufzubereiten und verfügbar zu machen,<br />
dass die wesentlichen Informationen über die Vermögens-<br />
und Schuldenlage klar ersichtlich und verständlich s<strong>in</strong>d.<br />
Es ist e<strong>in</strong> enger zeitlicher Bezug zwischen dem Zeitraum, über den<br />
Rechenschaft gegeben wird, und der Veröffentlichung der Rechenschaft<br />
herzustellen.
Grundsatz<br />
der Relevanz<br />
Grundsatz<br />
der Stetigkeit<br />
Grundsatz<br />
des Nachweises der Recht-<br />
und Ordnungsmäßigkeit<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 95 GO <strong>NRW</strong><br />
Das Rechnungswesen muss die Informationen bieten, die zur<br />
Rechenschaft notwendig s<strong>in</strong>d, sich jedoch im H<strong>in</strong>blick auf die Wirtschaftlichkeit<br />
und Verständlichkeit auf die relevanten Daten beschränken.<br />
Dabei soll der Aufwand der Informationsbeschaffung <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>em angemessenen Verhältnis zum Nutzen der Informationsbereitstellung<br />
stehen.<br />
Die Grundlagen des Rechnungswesens, <strong>in</strong>sbesondere die Methoden<br />
für Ansatz und Bewertung des Vermögens, sollen <strong>in</strong> der Regel<br />
unverändert bleiben, so dass e<strong>in</strong>e Stetigkeit im Zeitablauf erreicht<br />
wird. Notwendige Anpassungen s<strong>in</strong>d besonders kenntlich zu machen.<br />
Im Jahresabschluss ist über die Recht- und Ordnungsmäßigkeit der<br />
Haushaltswirtschaft Rechenschaft abzulegen.<br />
Abbildung 116 „Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB)“<br />
Im Rahmen der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft können sich ggf. Zielkonflikte ergeben. Es ist dann bei der<br />
örtlichen Ausgestaltung des Rechnungswesens notwendig, zwischen konkurrierenden Sachverhalten unter Beachtung<br />
der o.a. Grundsätze e<strong>in</strong>e Abwägung vorzunehmen. Bedarf es dabei e<strong>in</strong>er Auslegung der Grundsätze,<br />
s<strong>in</strong>d i.d.R. die juristischen Auslegungskriterien heranzuziehen. Es ist dazu nicht festgelegt worden, welches Maß<br />
an Sachverstand erforderlich se<strong>in</strong> muss, um die geme<strong>in</strong>dliche Tätigkeit im jeweils betroffenen Produkt- bzw. Aufgabenbereich<br />
beurteilen und nachvollziehen zu können. Allgeme<strong>in</strong> wird davon auszugehen se<strong>in</strong>, dass e<strong>in</strong> sachverständiger<br />
Dritter ausreichende Kenntnisse über die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft bzw. das Rechnungswesen<br />
der Geme<strong>in</strong>de besitzen muss, damit er die Ausführung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft und deren<br />
Ergebnis im geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss sowie im Gesamtabschluss der Geme<strong>in</strong>de verstehen und beurteilen<br />
kann. Dabei wird auch die Größe der Geme<strong>in</strong>de sowie die Größe und Komplexität der geme<strong>in</strong>dlichen Buchführung<br />
e<strong>in</strong>schließlich der Art der örtlichen DV-Buchführung zu berücksichtigen se<strong>in</strong>.<br />
Bei der Beurteilung, ob e<strong>in</strong> sachverständiger Dritter sich <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>er angemessenen Zeit e<strong>in</strong>en Überblick über<br />
die Vorgehensweise und die Ergebnisse verschaffen kann, ist ebenfalls von den vorhandenen örtlichen Gegebenheiten<br />
auszugehen. Die Bestimmung der angemessenen Zeit ist somit auch von der Größe der Geme<strong>in</strong>de<br />
sowie der Größe und Komplexität der geme<strong>in</strong>dlichen Buchführung e<strong>in</strong>schließlich der Art der örtlichen DV-<br />
Buchführung abhängig.<br />
Außerdem sollen Manipulationsmöglichkeiten verh<strong>in</strong>dert werden, damit dem Dritten e<strong>in</strong> qualifizierter E<strong>in</strong>blick <strong>in</strong><br />
die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anz(gesamt)lage der Geme<strong>in</strong>de möglich ist. Zudem sorgt die Auslegung<br />
der GoB durch Rechtsprechung und Literatur mittelbar für e<strong>in</strong>e dynamische Anpassung des Rechts über<br />
das geme<strong>in</strong>dliche Rechnungswesen an die aktuellen nationalen und <strong>in</strong>ternationalen Entwicklungen. Die Grundsätze<br />
ordnungsmäßiger Buchführung werden dann weiterentwickelt, wenn aus neuen Sachverhalten heraus dafür<br />
e<strong>in</strong> Erfordernis besteht.<br />
1.2.2.2 Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze<br />
Für den geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss spielen außerdem auch die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze<br />
e<strong>in</strong>e wichtige Rolle. Jeder dieser Grundsätze soll sicherstellen, dass e<strong>in</strong> sachverständiger Dritter sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
angemessenen Zeit e<strong>in</strong>en Überblick über die Aufzeichnung von geme<strong>in</strong>dlichen Geschäftsvorfällen und die Aufzeichnung<br />
von Vermögens- und Schuldenpositionen verschaffen kann. Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze<br />
bilden e<strong>in</strong>en Teil der GoB und lassen sich <strong>in</strong> folgende Grundsätze untergliedern (vgl. Abbildung).<br />
GEMEINDEORDNUNG 553
Allgeme<strong>in</strong><br />
geltende Grundsätze<br />
Bilanzierungsgrundsätze<br />
Bewertungsgrundsätze<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 95 GO <strong>NRW</strong><br />
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze<br />
- Grundsatz der Bilanzidentität;<br />
- Grundsatz der Bilanzkont<strong>in</strong>uität,<br />
- Grundsatz der Wesentlichkeit,<br />
- Grundsatz der Wirtschaftlichkeit,<br />
- Aktivierungsgrundsatz,<br />
- Passivierungsgrundsatz,<br />
- Grundsatz der Vollständigkeit,<br />
- Grundsatz des Saldierungsverbots,<br />
- Grundsatz der Pagatorik,<br />
- Grundsatz der stichtagsbezogenen Bewertung,<br />
- Grundsatz der E<strong>in</strong>zelbewertung<br />
- Grundsatz der Vorsicht, auch als<br />
- Realisationspr<strong>in</strong>zip,<br />
- Imparitätspr<strong>in</strong>zip,<br />
- Niederstwertpr<strong>in</strong>zip,<br />
- Höchstwertpr<strong>in</strong>zip,<br />
- Grundsatz der Bewertungsstetigkeit.<br />
Abbildung 117 „Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze“<br />
Durch die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sollen außerdem Manipulationsmöglichkeiten verh<strong>in</strong>dert<br />
werden. Es muss aber auch e<strong>in</strong>em sachverständigen Dritten e<strong>in</strong> qualifizierter E<strong>in</strong>blick <strong>in</strong> die Vermögens-, Schulden-,<br />
Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de möglich se<strong>in</strong>. Zudem sorgt die Auslegung der GoB durch Rechtsprechung<br />
und Literatur mittelbar für e<strong>in</strong>e dynamische Anpassung des Rechts über die geme<strong>in</strong>dliche Rechnungslegung<br />
an die aktuellen nationalen und <strong>in</strong>ternationalen Entwicklungen, soweit nicht die Grundsätze kodifiziert<br />
wurden. Bei e<strong>in</strong>er rechtlichen Ausgestaltung bedarf es dann ggf. e<strong>in</strong>es dafür vorgesehen Anpassungs- bzw. Änderungsverfahrens.<br />
1.2.2.3 Sachgerechte Anwendung der Grundsätze<br />
Die sachgerechte Anwendung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung unter Beachtung ihrer qualitativen<br />
Merkmale führt grundsätzlich zu e<strong>in</strong>er wirklichkeitsgetreuen Darstellung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und<br />
F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de. Soweit sich die örtlichen Entscheidungen an diesen Grundsätzen orientieren, entstehen<br />
relevante, verlässliche und verständliche Informationen über die wirtschaftliche Lage der Geme<strong>in</strong>de. Um<br />
diese Erfordernisse sicherzustellen s<strong>in</strong>d u.a. die Gliederungsvorschriften zur geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz <strong>in</strong> § 41<br />
GemHVO <strong>NRW</strong> konkretisiert worden z.B. die Grundsätze „Klarheit“ und „Übersichtlichkeit“. Die Bewertungsvorschriften<br />
<strong>in</strong> den §§ 32 bis 36, 42 und 43 GemHVO <strong>NRW</strong> prägen dabei das Vorsichtspr<strong>in</strong>zip weiter aus.<br />
1.2.3 Die „Generalnorm“<br />
1.2.3.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die Regelung <strong>in</strong> der Vorschrift, dass der geme<strong>in</strong>dliche Jahresabschluss e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes<br />
Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de vermitteln muss, stellt die<br />
„Generalnorm“ für die Aufstellung und Feststellung des Jahresabschlusses der Geme<strong>in</strong>de dar. Unter Berücksichtigung<br />
dieser Norm s<strong>in</strong>d Zweifelsfragen bei der Auslegung und Anwendung von haushaltsrechtlichen E<strong>in</strong>zelvorschriften<br />
zu klären. Sie ersetzt dadurch aber nicht die e<strong>in</strong>zelnen Bestimmungen. Gleichwohl kann sie im E<strong>in</strong>zelfall<br />
GEMEINDEORDNUNG 554
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 95 GO <strong>NRW</strong><br />
bewirken, dass die Geme<strong>in</strong>de im Anhang nach § 44 GemHVO <strong>NRW</strong> weitere Informationen über wichtige örtliche<br />
Sachverhalte geben muss.<br />
Der geme<strong>in</strong>dliche Jahresabschluss soll zudem die von ihm gesetzlich geforderte Aussagekraft h<strong>in</strong>sichtlich der<br />
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de als e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes<br />
Bild der wirtschaftlichen Lage der Geme<strong>in</strong>de möglichst zutreffend erreicht. Dazu gilt, dass die tatsächlichen<br />
Verhältnisse bei der Geme<strong>in</strong>de objektiv festzustellen s<strong>in</strong>d. Es besteht zudem bei den vier e<strong>in</strong>zelnen Bereichen<br />
der wirtschaftlichen Lage der Geme<strong>in</strong>de ke<strong>in</strong>e Rangfolge, so dass der geme<strong>in</strong>dliche Jahresabschluss für<br />
alle Bereiche e<strong>in</strong> entsprechendes Bild der jeweiligen Lage vermitteln muss. Die Geme<strong>in</strong>de hat deshalb dafür<br />
Sorge zu tragen, dass möglichst ke<strong>in</strong>er dieser Bereiche zu Gunsten anderer Bereiche vernachlässigt wird.<br />
Die im geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss geforderte Betrachtung der Vermögenslage, der Schuldenlage, der Ertragslage<br />
und der F<strong>in</strong>anzlage darf nicht nur im E<strong>in</strong>zelnen erfolgen, sondern diese geme<strong>in</strong>dlichen "Teillagen" müssen<br />
auch zu e<strong>in</strong>em Gesamtbild zusammen geführt werden, denn sie s<strong>in</strong>d als gleichwertig zu betrachten und eng<br />
mite<strong>in</strong>ander verknüpft. Ke<strong>in</strong>e dieser Teillagen hat e<strong>in</strong>e höhere Wertigkeit als die anderen. Es bietet sich für die<br />
Adressaten des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses an, diese Teillagen wegen ihrer gleichen Bedeutung<br />
entsprechend ihrer Aufzählung <strong>in</strong> der Vorschrift zu beurteilen. Dabei gilt es aber zu berücksichtigen, dass<br />
sich erst aus der Gesamtbetrachtung e<strong>in</strong> Bild der wirtschaftlichen Lage der Geme<strong>in</strong>de ergibt, denn das Zusammenwirken<br />
und die B<strong>in</strong>dung der Teillagen spiegelt das Drei-Komponentensystem des NKF (Ergebnisrechnung,<br />
Bilanz und F<strong>in</strong>anzrechnung) wieder.<br />
1.2.3.2 Der Begriff „tatsächliche Verhältnisse“<br />
Der geme<strong>in</strong>dliche Jahresabschluss muss unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Vorschriften und der GoB e<strong>in</strong><br />
den tatsächlichen Verhältnissen der Geme<strong>in</strong>de entsprechendes Bild vermitteln, um die notwendige Aussagekraft<br />
des Jahresabschlusses zu erreichen. Für diese Beurteilung ist es erforderlich, die bei der Geme<strong>in</strong>de maßgebenden<br />
tatsächlichen Verhältnisse sorgfältig im Rahmen der Aufstellung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses zu<br />
ermitteln. Unter den „tatsächlichen Verhältnissen“ s<strong>in</strong>d i.d.R. die ökonomischen Gegebenheiten der Geme<strong>in</strong>de zu<br />
erfassen e<strong>in</strong>schließlich aller örtlichen Belange und Umstände, die sich darauf auswirken.<br />
Es kann dabei nicht alle<strong>in</strong> auf das Rechnungswesen der Geme<strong>in</strong>de abgestellt werden, sondern es s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>e Vielzahl<br />
von Faktoren zu berücksichtigen, die auf das wirtschaftliche Handeln und das wirtschaftliche Umfeld der<br />
Geme<strong>in</strong>de E<strong>in</strong>fluss nehmen. Dabei ist u.a. abzuwägen, welche Relevanz den e<strong>in</strong>zelnen Gegebenheiten zu<br />
kommt und zu versuchen, e<strong>in</strong> möglichst objektives Ergebnis zu ermitteln. In diesem Zusammenhang ist zu erläutern,<br />
von welchem Standpunkt aus die Betrachtung erfolgt und <strong>in</strong> welcher Art und Weise die adressatenbezogenen<br />
Informationen zusammengestellt worden s<strong>in</strong>d.<br />
1.2.3.3 Der Begriff „Vermögenslage“<br />
Das Haushaltsrecht für Geme<strong>in</strong>den orientiert sich bei der Auslegung des Begriffs „Vermögenslage“, für den es<br />
ke<strong>in</strong>e gesetzliche Def<strong>in</strong>ition und ke<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>heitliche Begriffsbestimmung gibt, an der kaufmännischen Auslegung<br />
und damit an den Regelungen für die Vermögensgegenstände, die auf der Aktivseite der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz<br />
anzusetzen s<strong>in</strong>d (vgl. §§ 33 ff. GemHVO <strong>NRW</strong>). Dabei ist zu berücksichtigen, dass im allgeme<strong>in</strong>en Wirtschaftsleben<br />
e<strong>in</strong> Wirtschaftsgut dadurch als Vermögensgegenstand charakterisiert wird, das mit ihm e<strong>in</strong> wirtschaftlicher<br />
Wert vorliegt, das Wirtschaftsgut selbstständig nutzungsfähig und bewertbar ist. Die auf der Aktivseite der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Bilanz angesetzten Vermögensgegenstände dienen daher dazu, dass die Bilanz damit e<strong>in</strong> den tatsächlichen<br />
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenslage der Geme<strong>in</strong>de vermitteln kann. Ergänzende<br />
Angaben zum Vermögen der Geme<strong>in</strong>de enthält der Anhang nach § 44 GemHVO <strong>NRW</strong>.<br />
GEMEINDEORDNUNG 555
1.2.3.4 Der Begriff „Schuldenlage“<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 95 GO <strong>NRW</strong><br />
Das Haushaltsrecht für Geme<strong>in</strong>den orientiert sich bei der Auslegung beim Begriff „Schuldenlage“ ebenso wie<br />
beim Begriff „Vermögenslage““ an der kaufmännischen Auslegung. Auch für diesen Begriff gibt es ke<strong>in</strong>e gesetzliche<br />
Def<strong>in</strong>ition und ke<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>heitliche Begriffsbestimmung. Die geme<strong>in</strong>dlichen Schulden s<strong>in</strong>d auf der Passivseite<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz anzusetzen (vgl. §§ 33 ff. GemHVO <strong>NRW</strong>). Der Begriff "Schulden" wird <strong>in</strong> vielfältiger<br />
Weise im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswesen e<strong>in</strong>gesetzt. Darunter werden allgeme<strong>in</strong> die bestehende und die h<strong>in</strong>reichend<br />
sicher zu erwartenden wirtschaftlichen Belastungen der Geme<strong>in</strong>de verstanden, die auf e<strong>in</strong>er rechtlichen<br />
oder wirtschaftlichen Leistungsverpflichtung der Geme<strong>in</strong>de beruhen und selbstständig bewertbar sowie abgrenzbar,<br />
d.h. nicht nur e<strong>in</strong> allgeme<strong>in</strong>es Risiko für die Geme<strong>in</strong>de darstellen.<br />
In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass im allgeme<strong>in</strong>en Wirtschaftsleben, ausgehend von der<br />
Passivseite der Bilanz der Begriff „Schulden“ u.a. auch dadurch abgegrenzt wird, dass nicht das Eigenkapital und<br />
die Sonderposten sowie die passive Rechnungsabgrenzung dazu zu zählen s<strong>in</strong>d. Die auf der Passivseite der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz angesetzten Verb<strong>in</strong>dlichkeiten und die Rückstellungen der Geme<strong>in</strong>de dienen daher dazu,<br />
dass die Bilanz damit e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Schuldenlage der Geme<strong>in</strong>de<br />
vermitteln kann.<br />
1.2.3.5 Der Begriff „Ertragslage“<br />
Das Haushaltsrecht für Geme<strong>in</strong>den orientiert sich bei der Auslegung des Begriffs „Ertragslage“, für den es ke<strong>in</strong>e<br />
gesetzliche Def<strong>in</strong>ition und ke<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>heitliche Begriffsbestimmung gibt, an der kaufmännischen Auslegung und<br />
damit an den Regelungen über den geme<strong>in</strong>dlichen Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung, denn diese beiden<br />
Werke stellen e<strong>in</strong>e zeitraumbezogene Planung und Rechnung dar, <strong>in</strong> der das Zustandekommen des Erfolgs der<br />
Geme<strong>in</strong>de nach Arten, Höhe und Quellen abgebildet wird. Der geme<strong>in</strong>dliche Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung<br />
s<strong>in</strong>d unter Beachtung des Grundsatzes der Ergebnisspaltung aufgebaut, so dass die ordentlichen und die<br />
außerordentlichen Ergebniskomponenten dar<strong>in</strong> getrennt vone<strong>in</strong>ander aufgezeigt werden. Dadurch werden Informationen<br />
darüber geliefert, <strong>in</strong> welchem Umfang und aus welchem Anlass sich das Eigenkapital der Geme<strong>in</strong>de<br />
<strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>es Haushaltsjahres verändert hat. Die Ertragslage weist daher das Ergebnis des abgelaufenen<br />
Haushaltsjahres der Geme<strong>in</strong>de aus.<br />
1.2.3.6 Der Begriff „F<strong>in</strong>anzlage“<br />
Das Haushaltsrecht für Geme<strong>in</strong>den orientiert sich bei der Auslegung des Begriffs „F<strong>in</strong>anzlage“, für den es ke<strong>in</strong>e<br />
gesetzliche Def<strong>in</strong>ition und ke<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>heitliche Begriffsbestimmung gibt, an der kaufmännischen Auslegung und<br />
damit an den Regelungen über den geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzplan und die F<strong>in</strong>anzrechnung, denn diesen beiden<br />
Werke stellen e<strong>in</strong>e zeitraumbezogene Planung und Rechnung dar, <strong>in</strong> der Zustandekommen der Liquidität der<br />
Geme<strong>in</strong>de nach Arten, Höhe und Quellen abgebildet wird. Der geme<strong>in</strong>dliche F<strong>in</strong>anzplan und die F<strong>in</strong>anzrechnung<br />
s<strong>in</strong>d unter Beachtung e<strong>in</strong>er Mittelherkunfts- und –verwendungsrechnung aufgebaut, so dass die E<strong>in</strong>zahlungs- und<br />
Auszahlungsströme nach Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und F<strong>in</strong>anzierungstätigkeit<br />
zu trennen s<strong>in</strong>d. Die F<strong>in</strong>anzrechnung kann dadurch aussagekräftige Informationen über die tatsächliche<br />
F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de liefern.<br />
1.2.4 Die Erläuterungspflichten<br />
Für die Beurteilung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses kann es erforderlich werden, neben den Darstellungen<br />
im Anhang (vgl. § 44 GemHVO <strong>NRW</strong>) und im Lagebericht (vgl. § 48 GemHVO <strong>NRW</strong>) weitere wesentliche Inhalte<br />
und E<strong>in</strong>zelergebnisse zu erläutern. Dieses dient u.a. dazu relevante Details unter Berücksichtigung der haus-<br />
GEMEINDEORDNUNG 556
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 95 GO <strong>NRW</strong><br />
haltswirtschaftlichen Produktorientierung zu verdeutlichen und <strong>in</strong>sbesondere ergänzende Informationen zur Ausführung<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft zu vermitteln. Diese Informationen müssen sich nicht unbed<strong>in</strong>gt<br />
und unmittelbar aus dem Zahlenwerk ergeben. Sie s<strong>in</strong>d gleichwohl für die Beurteilung der Haushaltswirtschaft<br />
des abgelaufenen Haushaltsjahres bzw. der daraus entstandenen wirtschaftlichen Lage der Geme<strong>in</strong>de von Bedeutung.<br />
Welche örtlichen Sachverhalte <strong>in</strong> welchem Umfang zu erläutern s<strong>in</strong>d, hat die Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> eigener Verantwortung<br />
zu entscheiden. Sie muss bei ihrer Abwägung und Entscheidung das Informations<strong>in</strong>teresse aller Adressaten<br />
des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses berücksichtigen.<br />
1.3 Zu Satz 3 (Bestandteile des Jahresabschlusses):<br />
1.3.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Nach dieser Vorschrift besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der F<strong>in</strong>anzrechnung, den Teilrechnungen,<br />
der Bilanz und dem Anhang. Die Bilanz gibt umfassend Auskunft über das Vermögen und die<br />
Schulden der Geme<strong>in</strong>de. Dies ermöglicht es der Geme<strong>in</strong>de, verbesserte Erkenntnisse über die haushaltswirtschaftlichen<br />
Auswirkungen des vergangenen Jahres zu erlangen, die auch für die Zukunft von Bedeutung s<strong>in</strong>d.<br />
Der Anhang und der Lagebericht sollen durch ihre Angaben und Erläuterungen dazu beitragen.<br />
1.3.2 Die Ergebnisrechnung<br />
In der Ergebnisrechnung nach § 38 GemHVO <strong>NRW</strong> s<strong>in</strong>d für die Ertrags- und Aufwandsarten, jeweils Jahressummen<br />
auszuweisen, um das tatsächliche Ressourcenaufkommen und den tatsächlichen Ressourcenverbrauch im<br />
Haushaltsjahr abzubilden. Dabei ist die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> sowie<br />
die Regelung <strong>in</strong> § 96 Abs. 1 S. 2 GO <strong>NRW</strong> zu beachten, dass der Rat über die Verwendung des Jahresüberschusses<br />
oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages zu beschließen hat.<br />
In der geme<strong>in</strong>dlichen Ergebnisrechnung ist zudem wie im Ergebnisplan durch die Bildung von Salden das Ergebnis<br />
der laufenden Verwaltungstätigkeit und das F<strong>in</strong>anzergebnis sowie aus beiden Ergebnissen das ordentliche<br />
Ergebnis festzustellen. Außerdem wird durch den Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen<br />
Aufwendungen das außerordentliche Ergebnis ermittelt. Zudem ist es zur Vervollständigung des Gesamtbildes<br />
über die Haushaltswirtschaft des Jahres erforderlich, das ordentliche Ergebnis und das außerordentliche Ergebnis<br />
zu e<strong>in</strong>em Jahresergebnis zusammen zu führen.<br />
E<strong>in</strong>e haushaltswirtschaftliche „Abrechnung“ für das abgelaufene Haushaltsjahr ist jedoch nur vollständig, wenn <strong>in</strong><br />
der Ergebnisrechnung auch e<strong>in</strong> Plan-/Ist-Vergleich vorgenommen wird, d.h. Planabweichungen durch die Gegenüberstellung<br />
von den im Haushaltsplan ausgewiesenen Positionen mit den Ist-Werten gesondert festgestellt und<br />
ausgewiesen werden. Den Geme<strong>in</strong>den wird empfohlen, bei Bedarf nicht nur die nach § 38 Abs. 2 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
auszuweisenden übertragenen Ermächtigungen <strong>in</strong> dem Plan-/Ist-Vergleich gesondert auszuweisen. Diese Veränderungen<br />
s<strong>in</strong>d Planfortschreibungen und haben die ursprünglich vom Rat beschlossenen Haushaltspositionen auf<br />
Grund von zulässigen haushaltswirtschaftlichen Maßnahmen und Entscheidungen verändert.<br />
Zu diesem Plan-/Ist-Vergleich gehört auch, dass das aktuelle Ergebnis <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en Zusammenhang mit den Vorjahren<br />
gestellt wird, um die Ergebnisse des abgelaufenen Haushaltsjahres besser bewerten zu können. Außerdem<br />
ist es erforderlich, zu den nachzuweisenden Ist-Ergebnissen des Haushaltsjahres auch die Ergebnisse der Rechnung<br />
des Vorjahres anzugeben. Auch andere Veränderungen seit Beg<strong>in</strong>n der Ausführung des beschlossenen<br />
Haushaltsplans s<strong>in</strong>d aufzuzeigen, z.B. Erhöhungen oder M<strong>in</strong>derungen der Haushaltspositionen, deren Ursache <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>er Nachtragssatzung oder <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Haushaltssperre liegen. Die Komponenten der geme<strong>in</strong>dlichen Ergebnisrechnung<br />
werden nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung).<br />
GEMEINDEORDNUNG 557
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 95 GO <strong>NRW</strong><br />
Gestaltung der geme<strong>in</strong>dlichen Ergebnisrechnung<br />
Ergebnisrechnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
mit Ergebnis der<br />
lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
F<strong>in</strong>anzergebnis<br />
Ordentliches<br />
Ergebnis<br />
Außerordentliches<br />
Ergebnis<br />
Jahresergebnis<br />
Ergebnis<br />
des Vorjahres<br />
EUR<br />
Fortge-<br />
schriebener<br />
Ansatz<br />
des Haushaltsjahres<br />
EUR<br />
Ist-<br />
Ergebnis<br />
des<br />
Haushalts-<br />
jahres<br />
EUR<br />
Vergleich<br />
Ansatz/Ist<br />
EUR<br />
Abbildung 118 „Gestaltung der geme<strong>in</strong>dlichen Ergebnisrechnung“<br />
Diese rechtlichen Vorgaben s<strong>in</strong>d bei der Aufstellung der Ergebnisrechnung von der Geme<strong>in</strong>de zu beachten. Das<br />
Muster wird zur Anwendung empfohlen (vgl. Nummern 1.6.1 und 1.6.2 des Runderlasses vom 24.02.2005, SMBl.<br />
<strong>NRW</strong>. 6300).<br />
1.3.3 Die F<strong>in</strong>anzrechnung<br />
In der F<strong>in</strong>anzrechnung nach § 39 GemHVO <strong>NRW</strong> s<strong>in</strong>d für sämtliche E<strong>in</strong>zahlungs- und Auszahlungsarten jeweils<br />
Jahressummen auszuweisen, um die tatsächlichen E<strong>in</strong>zahlungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr nach Arten<br />
aufzuzeigen und <strong>in</strong>sgesamt die erfolgte Änderung des Bestandes an F<strong>in</strong>anzmitteln nachzuweisen. Dazu ist wie<br />
im F<strong>in</strong>anzplan der Saldo für die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Saldo für die Zahlungen aus<br />
der Investitionstätigkeit und aus beiden der F<strong>in</strong>anzmittelüberschuss oder F<strong>in</strong>anzmittelfehlbetrag zu ermitteln.<br />
Es ist jedoch zur Vervollständigung des Gesamtbildes erforderlich, den Bestand am Anfang des Haushaltsjahres<br />
mit der Änderung des Bestandes im abgelaufenen Haushaltsjahr und dem Bestand an fremden F<strong>in</strong>anzmitteln<br />
zusammen zu führen, um damit den Endbestand der F<strong>in</strong>anzmittel sowie den F<strong>in</strong>anzmittelflusses <strong>in</strong>sgesamt zu<br />
ermitteln und abzubilden. Der Endbestand an F<strong>in</strong>anzmitteln fließt <strong>in</strong> den Posten „Liquide Mittel“ <strong>in</strong> der Schlussbilanz<br />
des Haushaltsjahres e<strong>in</strong>.<br />
Durch die E<strong>in</strong>beziehung des Saldos aus der F<strong>in</strong>anzierungstätigkeit, aus den Zahlungen aus der Aufnahme und<br />
der Tilgung von Krediten für Investitionen und Krediten zur Liquiditätssicherung, lässt sich dann die Änderung des<br />
Bestandes an eigenen F<strong>in</strong>anzmitteln feststellen und ausweisen. Die Komponenten der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzrechnung<br />
werden nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung).<br />
GEMEINDEORDNUNG 558
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 95 GO <strong>NRW</strong><br />
Gestaltung der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzrechnung<br />
F<strong>in</strong>anzrechnung<br />
E<strong>in</strong>zahlungen<br />
Auszahlungen<br />
mit Saldo aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
E<strong>in</strong>zahlungen<br />
Auszahlungen<br />
mit Saldo aus<br />
Investitionstätigkeit<br />
Darlehensaufnahme<br />
Tilgungen<br />
mit Saldo aus<br />
F<strong>in</strong>anzierungstätigkeit<br />
Liquide Mittel<br />
Ergebnis<br />
des Vorjahres<br />
EUR<br />
Fortge-<br />
schriebener<br />
Ansatz<br />
des Haushaltsjahres<br />
EUR<br />
Ist-<br />
Ergebnis<br />
des<br />
Haushalts-<br />
jahres<br />
EUR<br />
Vergleich<br />
Ansatz/Ist<br />
EUR<br />
Abbildung 119 „Gestaltung der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzrechnung“<br />
In der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzrechnung s<strong>in</strong>d auch die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres abzubilden. Zudem<br />
ist e<strong>in</strong> Planvergleich wie bei der Ergebnisrechnung vorzunehmen, der entsprechend den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung<br />
erweitert werden sollte. Diese rechtlichen Vorgaben s<strong>in</strong>d bei der Aufstellung der F<strong>in</strong>anzrechnung<br />
zu beachten. Das Muster wird zur Anwendung empfohlen (vgl. Nummern 1.6.1 und 1.6.2 des Runderlasses vom<br />
24.02.2005, SMBl. <strong>NRW</strong>. 6300).<br />
1.3.4 Die Teilrechnungen<br />
1.3.4.1 Die Teilergebnisrechnung<br />
Die Teilergebnisrechnungen nach § 40 GemHVO <strong>NRW</strong> s<strong>in</strong>d entsprechend der Ergebnisrechnung zu gliedern. In<br />
diesen Rechnungen s<strong>in</strong>d die Erträge und Aufwendungen aus <strong>in</strong>ternen Leistungsbeziehungen auszuweisen, wenn<br />
diese im Teilergebnisplan enthalten s<strong>in</strong>d, weil die Geme<strong>in</strong>de sie für ihre Haushaltsbewirtschaftung erfasst hat.<br />
E<strong>in</strong>e Verpflichtung für e<strong>in</strong>e gesonderte Erfassung der Erträge und Aufwendungen aus <strong>in</strong>ternen Leistungsbeziehungen<br />
durch die Geme<strong>in</strong>de besteht allerd<strong>in</strong>gs nicht (vgl. § 17 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
S<strong>in</strong>d <strong>in</strong> den Teilplänen zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs die <strong>in</strong>ternen Leistungsbeziehungen<br />
erfasst, s<strong>in</strong>d diese dem Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung h<strong>in</strong>zuzufügen und müssen sich <strong>in</strong> der<br />
Ergebnisrechnung <strong>in</strong>sgesamt ausgleichen. Diese Vorgaben s<strong>in</strong>d bei der Aufstellung der Teilergebnisrechnungen<br />
zu beachten. Das Muster wird zur Anwendung empfohlen (vgl. Nummer 1.6.2 des Runderlasses vom 24.02.2005,<br />
SMBl. <strong>NRW</strong>. 6300).<br />
GEMEINDEORDNUNG 559
1.3.4.2 Die Teilf<strong>in</strong>anzrechnung<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 95 GO <strong>NRW</strong><br />
Die Teilf<strong>in</strong>anzrechnungen nach § 40 GemHVO <strong>NRW</strong> s<strong>in</strong>d entsprechend der F<strong>in</strong>anzrechnung zu gliedern. Sie<br />
bestehen wie die Teilf<strong>in</strong>anzpläne aus zwei Teilen. Der Teil A (Zahlungsnachweis) enthält die E<strong>in</strong>zahlungen und<br />
Auszahlungen nach Arten aus der Investitionstätigkeit e<strong>in</strong>schließlich der damit verbundenen Verpflichtungsermächtigungen.<br />
Der Geme<strong>in</strong>de bleibt es freigestellt, dar<strong>in</strong> auch alle oder nur e<strong>in</strong>zelne E<strong>in</strong>zahlungen und Auszahlungen<br />
aus laufender Verwaltungstätigkeit abzubilden.<br />
Der Teil B (Nachweis e<strong>in</strong>zelner Investitionsmaßnahmen) enthält die konkrete Abrechnung der e<strong>in</strong>zelnen Investitionsmaßnahmen<br />
mit den diesen zugeordneten E<strong>in</strong>- und Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen und den<br />
bereitgestellten Mitteln sowie den gesamten getätigten Zahlungen, entsprechend dem Stand am Ende des Haushaltsjahres.<br />
Diese rechtlichen Vorgaben s<strong>in</strong>d bei der Aufstellung der Teilf<strong>in</strong>anzrechnungen zu beachten. Das<br />
Muster wird zur Anwendung empfohlen (vgl. Nummer 1.6.4 des Runderlasses vom 24.02.2005, SMBl. <strong>NRW</strong>.<br />
6300).<br />
1.3.4.3 Gestaltung der Teilrechnungen<br />
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses werden Teilrechnungen benötigt, die entsprechend den im Haushaltsplan<br />
enthaltenen produktorientierten Teilplänen aufzustellen s<strong>in</strong>d. Daher wird darauf verwiesen. Das nachfolgende<br />
Muster zeigt die Grundzüge der Gliederung e<strong>in</strong>er Teilrechnung anhand e<strong>in</strong>es Produktbereiches schematisch<br />
auf (vgl. Abbildung).<br />
Jahresabschluss ... Fachliche Zuständigkeit:<br />
Frau/Herr<br />
Gesundheitsdienste<br />
Produktbereich 07<br />
Inhalte des Produktbereiches<br />
Beschreibung und Zielsetzung:<br />
Zielgruppe(n):<br />
Besonderheiten im Haushaltsjahr:<br />
Produktbereichsübersicht<br />
Produktgruppen mit<br />
- den wesentlichen beschriebenen Produkten:<br />
- den e<strong>in</strong>zelnen Zielen:<br />
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung<br />
Ziele Kennzahl Soll-Kennzahl Ist-Kennzahl Abweichungs-<br />
Vorjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr analyse<br />
(Die Kennzahlen und ggf. die Leistungsmengen sollen nach Arten und möglichst entsprechend der Zeitreihe nach<br />
§ 38 Abs. 2 GemHVO <strong>NRW</strong> gegliedert werden.)<br />
Personale<strong>in</strong>satz<br />
(Angaben zum e<strong>in</strong>gesetzten Personal - Auszug aus der Stellenübersicht nach § 8 GemHVO <strong>NRW</strong> - mit Angaben<br />
nach Beschäftigungsverhältnissen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Zeitreihe nach § 8 Abs. 2 GemHVO <strong>NRW</strong>)<br />
Haushalts-<br />
positionen<br />
Teilergebnisrechnung<br />
Vor-<br />
jahr<br />
Fortgeschriebener<br />
Ansatz des<br />
Haushaltsjahres<br />
Ist-Ergebnis<br />
des<br />
Haushaltsjahres<br />
Vergleich<br />
Ansatz /Ist<br />
(Die Teilergebnisrechnung muss die vorgegebene M<strong>in</strong>destgliederung enthalten (vgl. Nr. 1.6.2 des Runderlasses<br />
vom 24.02.2005, SMBl. <strong>NRW</strong>. 6300).<br />
Haushalts-<br />
positionen<br />
Teilf<strong>in</strong>anzrechnung<br />
Vor-<br />
jahr<br />
GEMEINDEORDNUNG 560<br />
Fortgeschriebener<br />
Ansatz des<br />
Haushaltsjahres<br />
Ist-Ergebnis<br />
des<br />
Haushaltsjahres<br />
Vergleich<br />
Ansatz /Ist
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 95 GO <strong>NRW</strong><br />
(Die Teilf<strong>in</strong>anzrechnung muss die vorgegebene M<strong>in</strong>destgliederung enthalten (vgl. Nr. 1.6.4 des Runderlasses vom<br />
24.02.2005, SMBl. <strong>NRW</strong>. 6300).<br />
Allgeme<strong>in</strong>e Erläuterungen<br />
zur Teilrechnung<br />
Erläuterungen<br />
zu e<strong>in</strong>zelnen wesentlichen Haushaltspositionen<br />
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse<br />
1.3.5 Die Bilanz<br />
Sonstiges:<br />
Sonstiges:<br />
Für die Teilergebnisrechnung:<br />
Für die Teilf<strong>in</strong>anzrechnung:<br />
Für die Teilergebnisrechnung:<br />
Für die Teilf<strong>in</strong>anzrechnung:<br />
Abbildung 120 „Beispiel zur Gestaltung der geme<strong>in</strong>dlichen Teilrechnungen“<br />
Die Bilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen und F<strong>in</strong>anzierungsmitteln der Geme<strong>in</strong>de zum Abschlussstichtag<br />
e<strong>in</strong> wesentlicher Bestandteil des doppischen Rechnungssystems (vgl. § 41 GemHVO <strong>NRW</strong>). Sie enthält Informationen<br />
über das geme<strong>in</strong>dliche Vermögen und sämtliche Schulden der Geme<strong>in</strong>de. Dazu ist festgelegt, dass<br />
die Posten „Anlagevermögen“, „Umlaufvermögen“, „Eigenkapital“, Schulden“ und „Rechnungsabgrenzungsposten“<br />
<strong>in</strong> jede geme<strong>in</strong>dliche Bilanz gehören und diese <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Aktivseite und e<strong>in</strong>e Passivseite zu gliedern ist. Die<br />
Bilanzgliederung baut deshalb auf dem nachfolgenden Bilanzgliederungsschema auf (vgl. Abbildung).<br />
Bilanzposten<br />
AKTIVA<br />
1. Anlagevermögen<br />
1.1 Immaterielle Vermögens-<br />
gegenstände<br />
1.2 Sachanlagen<br />
1.3 F<strong>in</strong>anzanlagen<br />
2. Umlaufvermögen<br />
2.1 Vorräte<br />
2.2 Forderungen<br />
2.3 Sonstige Vermögensgegen-<br />
stände<br />
2.4 Wertpapiere des Umlauf-<br />
vermögens<br />
2.5 Liquide Mittel<br />
3. Aktive Rechnungsabgrenzung<br />
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter<br />
Fehlbetrag<br />
Gestaltung der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz<br />
Haus-<br />
halts-<br />
jahr<br />
EUR<br />
Vor-<br />
jahr<br />
EUR<br />
Bilanzposten<br />
PASSIVA<br />
1. Eigenkapital<br />
1.1 Allgeme<strong>in</strong>e Rücklage<br />
1.2 Sonderrücklagen<br />
1.3 Ausgleichsrücklage<br />
1.4 Jahresüberschuss/Jahres-<br />
fehlbetrag<br />
2. Sonderposten<br />
3. Rückstellungen<br />
4. Verb<strong>in</strong>dlichkeiten<br />
5. Passive Rechnungsabgrenzung<br />
Abbildung 121 „Gestaltung der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz“<br />
Haus-<br />
halts-<br />
jahr<br />
Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen der Geme<strong>in</strong>de mit den zum Abschlussstichtag ermittelten Werten<br />
angesetzt. Damit wird die Mittelverwendung der Geme<strong>in</strong>de dokumentiert. Auf der Passivseite der Bilanz werden<br />
die Verb<strong>in</strong>dlichkeiten der Geme<strong>in</strong>de und ihr Eigenkapital gezeigt. Dadurch wird die Mittelherkunft bzw. die<br />
GEMEINDEORDNUNG 561<br />
EUR<br />
Vor-<br />
jahr<br />
EUR
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 95 GO <strong>NRW</strong><br />
F<strong>in</strong>anzierung des Vermögens offengelegt und dokumentiert. Die Gliederung der Bilanz erfolgt dabei auf beiden<br />
Seiten nach Fristigkeiten. So wird auf der Aktivseite zwischen Anlagevermögen (langfristig) und Umlaufvermögen<br />
(kurzfristig) unterschieden. Auf der Passivseite werden zuerst das Eigenkapital und dann das Fremdkapital gezeigt.<br />
Auch auf dieser Seite gilt das Pr<strong>in</strong>zip der Fristigkeit, denn die allgeme<strong>in</strong>e Rücklage steht vor der Ausgleichsrücklage<br />
(im Eigenkapital) und die Kredite für Investitionen stehen vor den Krediten zur Liquiditätssicherung<br />
der Geme<strong>in</strong>de.<br />
Unter Beachtung der Fristigkeit müssen die Bilanzposten <strong>in</strong> s<strong>in</strong>nvoller Weise aufe<strong>in</strong>ander folgen und untere<strong>in</strong>ander<br />
gesetzt se<strong>in</strong>. Diese Aufgliederung kann von der Geme<strong>in</strong>de je nach Bedeutung e<strong>in</strong>zelner Posten durch „davon-<br />
Vermerke“ weiter untergliedert werden, wenn dies <strong>in</strong> Bezug auf ihre Aufgabenerfüllung sachgerecht und <strong>in</strong> Bezug<br />
auf das Gesamtbild der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz vertretbar ist. Außerdem muss nach dem Grundsatz der Klarheit<br />
und Übersichtlichkeit die Bezeichnung der e<strong>in</strong>zelnen Posten klar und verständlich se<strong>in</strong>. Aus den gewählten Bezeichnungen<br />
müssen jeweils die Begriffs<strong>in</strong>halte transparent und nachvollziehbar se<strong>in</strong>.<br />
In der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz muss zudem jeder Posten mit e<strong>in</strong>er eigenen Ziffer gekennzeichnet und mit dem dazugehörigen<br />
Wertansatz (<strong>in</strong> Ziffern ausgedrückter Betrag) <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er eigenen Zeile stehen. Bei der Festlegung der<br />
e<strong>in</strong>zelnen Bilanzposten s<strong>in</strong>d aber auch die verb<strong>in</strong>dlichen Zuordnungsvorschriften, die durch den kommunalen<br />
Kontierungsplan näher bestimmt s<strong>in</strong>d, von der Geme<strong>in</strong>de zu beachten (vgl. Nummer 1.6.5 des Runderlasses vom<br />
24.02.2005; SMBl. <strong>NRW</strong>. 6300).<br />
1.3.6 Der Anhang<br />
In Anlehnung an die Vorschriften über das kaufmännische Rechnungswesen enthält der Anhang die besonderen<br />
Erläuterungen zu e<strong>in</strong>zelnen Bilanzpositionen, die neben der Beschreibung e<strong>in</strong>e Ergänzung, Korrektur und Entlastung<br />
von Bilanz bezwecken und deren Interpretation unterstützen sollen (vgl. § 44 GemHVO <strong>NRW</strong>). In den Anhang<br />
gehören deshalb <strong>in</strong>sbesondere auch Erläuterungen zu den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.<br />
Die erforderlichen Informationen sollen im sachlichen Zusammenhang mit den Teilen der Ergebnisrechnung<br />
und der Bilanz sowie ihren Untergliederungen stehen. Gleichzeitig s<strong>in</strong>d im Anhang die Zusatz<strong>in</strong>formationen<br />
anzugeben, die für die Beurteilung der Ergebnisrechnung und der Bilanz e<strong>in</strong>e besondere Bedeutung haben und<br />
zu e<strong>in</strong>em besseren Verständnis e<strong>in</strong>zelner Sachverhalte führen. Das nachfolgende Schema soll e<strong>in</strong>e Möglichkeit<br />
der Gliederung des Anhangs im geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss aufzeigen (vgl. Abbildung).<br />
1 Allgeme<strong>in</strong>e Angaben<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
Gestaltung des geme<strong>in</strong>dlichen Anhangs<br />
Bilanzierungs- und<br />
Bewertungsmethoden<br />
Erläuterungen<br />
zur Bilanz<br />
Erläuterungen<br />
zur Ergebnisrechnung<br />
Erläuterungen<br />
zur F<strong>in</strong>anzrechnung<br />
6 Sonstige Angaben<br />
GEMEINDEORDNUNG 562<br />
E<strong>in</strong>führung, Erläuterungspflichten, gesetzliche und<br />
örtliche Vorschriften u.a.<br />
Angaben zu genutzten Ansatzwahlrechten und<br />
Bewertungswahlrechten u.a.<br />
gegliedert nach Anlage- und Umlaufvermögen,<br />
Eigenkapital und Fremdkapital u.a.<br />
gegliedert nach Arten der Erträge und der Aufwendungen<br />
gegliedert nach Arten der E<strong>in</strong>zahlungen und der<br />
Auszahlungen<br />
z.B. nicht bilanzierungsfähige Sachverhalte, die
7<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 95 GO <strong>NRW</strong><br />
H<strong>in</strong>weise<br />
auf sonstige Unterlagen<br />
8 H<strong>in</strong>weis auf Verantwortliche<br />
9 Weitere Besonderheiten<br />
aber wirtschaftliche Bedeutung haben<br />
z.B. Anlagenspiegel u.a., wenn nicht bereits unter<br />
den vorherigen Abschnitten<br />
z.B. auf Nennung der Verantwortlichen am<br />
Schluss des Lageberichts nach § 95 Abs. 2 GO<br />
<strong>NRW</strong><br />
Wichtige örtliche Sachverhalte, die nicht bereits<br />
anzugeben waren<br />
Abbildung 122 „Gestaltung des geme<strong>in</strong>dlichen Anhangs“<br />
Dem Anhang sollen e<strong>in</strong> Anlagenspiegel, e<strong>in</strong> Forderungsspiegel und e<strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dlichkeitenspiegel, der z.B. auch<br />
die nicht <strong>in</strong> der Bilanz ersche<strong>in</strong>enden Haftungsverhältnisse, z.B. Bürgschaftsverpflichtungen, enthält, beigefügt<br />
werden, um das zu vermittelnde Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Geme<strong>in</strong>de klar und verständlich<br />
darzustellen. Für die äußere Gestaltung des Anhangs der Geme<strong>in</strong>de, se<strong>in</strong>en Aufbau und Umfang s<strong>in</strong>d jedoch<br />
ke<strong>in</strong>e besonderen Formvorgaben vorgesehen. Bei der Erarbeitung ist aber der spätere Adressatenkreis des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Jahresabschlusses (Rat, Bürger<strong>in</strong>nen und Bürger) zu berücksichtigen.<br />
1.3.7 Übersicht zu den Jahresabschlussunterlagen<br />
Dem Rat e<strong>in</strong>er Geme<strong>in</strong>de und den zuständigen Ausschüssen müssen zur Beratung und Feststellung des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Jahresabschlusses dieses Werk entsprechend den gesetzlich bestimmten Bestandteilen sowie Anlagen<br />
vorgelegt werden. Die nachfolgend aufgezeigten Unterlagen s<strong>in</strong>d für die Vermittlung e<strong>in</strong>es den tatsächlichen<br />
Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de unverzichtbar<br />
und ermöglichen e<strong>in</strong>en aktuellen Überblick über die wirtschaftliche Lage der e<strong>in</strong>zelnen Geme<strong>in</strong>de (vgl.<br />
Abbildung).<br />
Übersicht über die geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlussunterlagen<br />
Ergebnisrechnung<br />
F<strong>in</strong>anzrechnung<br />
Teilrechnungen<br />
Bilanz<br />
Anhang<br />
Bestandteile des Jahresabschlusses<br />
GEMEINDEORDNUNG 563<br />
§ 95 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 37 Abs. 1 Nr. 1 und § 38<br />
sowie § 22 Abs. 4 GemHVO <strong>NRW</strong> und Nr. 1.6.1 des<br />
Runderlasses vom 24.02.2005<br />
§ 95 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 37 Abs. 1 Nr. 2 und § 39<br />
sowie § 22 Abs. 4 GemHVO <strong>NRW</strong> und Nr. 1.6.3 des<br />
Runderlasses vom 24.02.2005<br />
§ 95 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 37 Abs. 1 Nr. 3 und § 40<br />
GemHVO <strong>NRW</strong> sowie den Nrn. 1.6.2 und Nr. 1.6.4 des<br />
Runderlasses vom 24.02.2005<br />
§<br />
95 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 37 Abs. 1 Nr. 4 und §§ 41<br />
bis 43 GemHVO <strong>NRW</strong> sowie den Nr. 1.6.5 des Runderlasses<br />
vom 24.02.2005<br />
§ 95 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 37 Abs. 1 Nr. 5 und § 44<br />
GemHVO <strong>NRW</strong>
Anlagenspiegel<br />
Forderungsspiegel<br />
Verb<strong>in</strong>dlichkeitenspiegel<br />
Lagebericht<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 95 GO <strong>NRW</strong><br />
Anlagen im Jahresabschluss<br />
§ 44 Abs. 3 und § 45 GemHVO <strong>NRW</strong> sowie Nr. 1.6.6<br />
des Runderlasses vom 24.02.2005<br />
§ 44 Abs. 3 und § 46 GemHVO <strong>NRW</strong> sowie Nr. 1.6.7<br />
des Runderlasses vom 24.02.2005<br />
§ 44 Abs. 3 und § 47 GemHVO <strong>NRW</strong> sowie Nr. 1.6.8<br />
des Runderlasses vom 24.02.2005<br />
§ 95 Abs. 1 und 2 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 48 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
Abbildung 123 „Jahresabschlussunterlagen der Geme<strong>in</strong>de“<br />
Der Jahresabschluss der Geme<strong>in</strong>de muss neben dem Rat der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>e unbegrenzte Zahl von Adressaten<br />
erreichen und muss daher für e<strong>in</strong>e Unterrichtung der Bürger<strong>in</strong>nen und Bürger sowie zur Anzeige bei der Aufsichtsbehörde<br />
der Geme<strong>in</strong>de geeignet se<strong>in</strong>. Der Geme<strong>in</strong>de ist es daher freigestellt, nach ihren örtlichen Bedürfnissen<br />
dem geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss auch noch weitere Unterlagen über ihre wirtschaftliche Lage beizufügen,<br />
z.B. e<strong>in</strong>en Geschäftsbericht. Diese Unterlagen müssen mit den haushaltsrechtlich vorgesehenen Unterlagen<br />
komb<strong>in</strong>ierbar se<strong>in</strong> und dürfen nicht die Informationsqualität für die Adressaten des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses<br />
bee<strong>in</strong>trächtigen.<br />
1.4 Zu Satz 4 (Beifügung des Lageberichtes zum Jahresabschluss):<br />
1.4.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Nach dieser Vorschrift ist dem geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss e<strong>in</strong> Lagebericht beizufügen. Diese ausdrückliche<br />
Vorgabe bedeutet, dass der Lagebericht zu den Jahresabschlussunterlagen der Geme<strong>in</strong>de zu zählen ist. Er stellt<br />
damit auch e<strong>in</strong>en Prüfungsgegenstand <strong>in</strong> der Jahresabschlussprüfung dar, denn durch § 101 Abs. 6 i.V.m. § 103<br />
Abs. 1 Nr. 1 GO <strong>NRW</strong> wird dieses ausdrücklich bestimmt. Der Lagebericht der Geme<strong>in</strong>de ist dabei auch unter<br />
dem Gesichtspunkt der Übere<strong>in</strong>stimmung mit dem Jahresabschluss zu bewerten. Die Vorgabe über die Beifügung<br />
des geme<strong>in</strong>dlichen Lageberichtes zum Jahresabschluss der Geme<strong>in</strong>de bedeutet aber auch, dass der Lagebericht<br />
im Zusammenhang mit der Bekanntmachung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses <strong>in</strong> entsprechender<br />
Weise zur E<strong>in</strong>sichtnahme verfügbar zu halten ist.<br />
In diesem Zusammenhang hat der jährliche Lagebericht e<strong>in</strong>e umfassende und vielfältige Funktion. Auch kann der<br />
geme<strong>in</strong>dliche Lagebericht als e<strong>in</strong> strategisches Instrument der Steuerung der Geme<strong>in</strong>de angesehen werden. Die<br />
Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de kann mit Hilfe betriebswirtschaftlicher<br />
Kennzahlen erfolgen. Es bleibt der Geme<strong>in</strong>de aber überlassen, mit welchen Kennzahlen sie arbeiten will, um<br />
ihre wirtschaftliche Lage zu beurteilen. Den Informationsbedürfnissen der Bürger<strong>in</strong>nen und Bürger und des Rates<br />
sowie der Aufsichtsbehörde ist dabei <strong>in</strong> ausreichendem Maße Rechnung zu tragen.<br />
1.4.2 Die Gestaltung des Lageberichts<br />
Der geme<strong>in</strong>dliche Lagebericht ist nach § 48 GemHVO <strong>NRW</strong> von der Geme<strong>in</strong>de so zu fassen, dass er e<strong>in</strong> den<br />
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de<br />
vermittelt. E<strong>in</strong>erseits ist im Lagebericht e<strong>in</strong> Rückblick auf das Haushaltsjahr zu geben, denn er hat die<br />
Aufgabe, den Verlauf der laufenden Verwaltungs-, Investitions- und F<strong>in</strong>anzierungstätigkeit der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> zusammengefasster<br />
Form darzustellen. Andererseits soll er auch Schlussfolgerungen für die zukünftige Haushalts-<br />
GEMEINDEORDNUNG 564
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 95 GO <strong>NRW</strong><br />
wirtschaft enthalten. Der geme<strong>in</strong>dliche Lagebericht kann die Jahresabschlussanalyse erleichtern und offenlegen,<br />
ob e<strong>in</strong> nachhaltiges wirtschaftliches Handeln von der Geme<strong>in</strong>de angestrebt bzw. vorgenommen wird. Diese Möglichkeiten<br />
s<strong>in</strong>d jedoch auf die Bedürfnisse e<strong>in</strong>er Berichterstattung über das vergangene und zukünftige Handeln<br />
der Kernverwaltung der Geme<strong>in</strong>de sachgerecht weiter zu entwickeln. Die Fülle der Informationen verlangt aber<br />
e<strong>in</strong>e grundlegende Strukturierung. Das nachfolgende Schema soll dazu beitragen, dass die Inhalte des Lageberichts<br />
möglichst systematisch aufgebaut und für die Adressaten transparent und nachvollziehbar gemacht werden<br />
(vgl. Abbildung).<br />
Abschnitt<br />
Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Ergebnisüberblick<br />
und Rechenschaft<br />
Steuerung und<br />
Produktorientierung<br />
Überblick über die<br />
wirtschaftliche Lage<br />
Wichtige Vorgänge<br />
und Nachträge<br />
Chancen<br />
Risiken<br />
Örtliche<br />
Besonderheiten<br />
Verantwortlichkeiten<br />
Anlagen<br />
Gestaltung des geme<strong>in</strong>dlichen Lageberichts<br />
Gesamtüberblick über die wirtschaftliche Lage und die künftigen Chancen<br />
und Risiken der Geme<strong>in</strong>de<br />
Allgeme<strong>in</strong>e örtliche Verhältnisse und Besonderheiten<br />
Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft<br />
über die Haushaltswirtschaft<br />
Ausgewogene und umfassende, dem Umfang der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgabenerfüllung<br />
entsprechende Analyse der produktorientierten Haushaltswirtschaft unter E<strong>in</strong>beziehung<br />
der Ziele und Leistungskennzahlen<br />
Ausgewogene und umfassende, dem Umfang der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgabenerfüllung<br />
entsprechende Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der<br />
Geme<strong>in</strong>de unter E<strong>in</strong>beziehung der produktorientierten Ziele und Leistungskennzahlen,<br />
ggf. auch Angaben über e<strong>in</strong>e Krise<br />
Bericht über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss<br />
des Haushaltsjahres e<strong>in</strong>getreten s<strong>in</strong>d, und deren Wirkungen auf die Haushaltswirtschaft<br />
Chancen für die künftige Entwicklung der Geme<strong>in</strong>de mit Angabe der zu Grunde<br />
liegenden Annahmen<br />
Risiken für die künftige Entwicklung der Geme<strong>in</strong>de mit Angabe der zu Grunde liegende<br />
Annahmen, ggf. auch der Gegenmaßnahmen und der Risikoüberwachung<br />
Umsetzung e<strong>in</strong>es Sanierungskonzeptes zur Wiedererreichung und dauerhaften<br />
Sicherung des Haushaltsausgleichs und/oder zum Aufbau von Eigenkapital (Beseitigung<br />
der Überschuldung)<br />
Angaben zu den Mitgliedern des Verwaltungsvorstands bzw. zum Bürgermeister<br />
und Kämmerer sowie zu den Ratsmitgliedern nach § 95 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong><br />
z.B. Jahresergebnisse im Zeitvergleich<br />
Kennzahlen im Zeitvergleich<br />
Prognosen im Zeitvergleich<br />
Abbildung 124 „Gestaltung des geme<strong>in</strong>dlichen Lageberichts“<br />
Für die äußere Gestaltung des Lageberichts, se<strong>in</strong>en Aufbau und Umfang s<strong>in</strong>d ke<strong>in</strong>e besonderen Formvorgaben<br />
vorgegeben worden. Die Fülle der Informationen verlangt aber e<strong>in</strong>e grundlegende Strukturierung. Die Gliederung<br />
GEMEINDEORDNUNG 565
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 95 GO <strong>NRW</strong><br />
des Lageberichts <strong>in</strong> e<strong>in</strong>zelne Elemente muss deshalb dazu beitragen, dass dieser e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen<br />
entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de vermittelt.<br />
2. Zu Absatz 2 (Angabe der Verantwortlichen im Lagebericht):<br />
2.1 Zu Satz 1 (Allgeme<strong>in</strong>e Angabepflichten):<br />
2.1.1 Inhalte der Angabepflichten<br />
Nach der Vorschrift haben die Mitglieder des Verwaltungsvorstands nach § 70 GO <strong>NRW</strong>, soweit dieser nicht zu<br />
bilden ist, der Bürgermeister und der Kämmerer sowie die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr<br />
ausgeschieden s<strong>in</strong>d, am Schluss des Lageberichtes zum geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss ausgewählte Angaben<br />
über ihre persönlichen Verhältnisse zu machen. Die Vorschrift ist dem § 285 (Nummer 10) HGB nachgebildet.<br />
Sie dient dazu, Dritten gegenüber, <strong>in</strong>sbesondere gegenüber den Bürger<strong>in</strong>nen und Bürgern der Geme<strong>in</strong>de,<br />
die Verantwortlichkeit für den Jahresabschluss hervorzuheben. Zu jedem Jahresabschluss der Geme<strong>in</strong>de s<strong>in</strong>d<br />
am Schluss des Lageberichtes von jedem E<strong>in</strong>zelnen aus dem <strong>in</strong> der Vorschrift benannten Personenkreis unter<br />
Nennung des Namens <strong>in</strong>dividualisierte Angaben zu machen, um Auskunft über die persönlichen Verhältnisse <strong>in</strong><br />
Bezug auf die Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de zu geben (vgl. Abbildung).<br />
Angabepflichten der Verantwortlichen <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>de<br />
Von jedem aus dem aufgezählten Personenkreis<br />
s<strong>in</strong>d die folgenden Angaben zu machen:<br />
- Familienname mit m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>em ausgeschriebenen Vornamen<br />
- der ausgeübte Beruf<br />
- die Mitgliedschaften <strong>in</strong> Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1<br />
Satz 3 des Aktiengesetzes<br />
- die Mitgliedschaft <strong>in</strong> Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Geme<strong>in</strong>de<br />
<strong>in</strong> öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form<br />
- die Mitgliedschaft <strong>in</strong> Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen<br />
Abbildung 125 „Angabepflichten der Verantwortlichen <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>de“<br />
Unter die Angabepflichten fallen <strong>in</strong>sbesondere personenbezogene Mandate, die von dem benannten Personenkreis<br />
<strong>in</strong> vielfältiger Form ausgeübt werden. Daher können hier nur Beispiele aufgezählt werden, z.B. Aufsichtsratsmandate,<br />
Beiratsmandate, Geschäftsführer- oder Vorstandstätigkeiten, Mitgliedschaften <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Gesellschafterversammlung<br />
oder e<strong>in</strong>er Verbandsversammlung, Mitgliedschaften im Verwaltungsräten, Mitgliedschaften im<br />
Kreditausschuss von Sparkassen, Mitgliedschaften im Kuratorium von Stiftungen. Dazu ist ggf. auch die ausgeübte<br />
Funktion anzugeben, z.B. Mitglied oder Vorsitz im Aufsichtsrat. Dazu kann ggf. auch die Vorstandstätigkeit <strong>in</strong><br />
Vere<strong>in</strong>en zählen, wenn deren f<strong>in</strong>anzielle Existenz auf Grund rechtlicher Verpflichtungen wesentlich durch die<br />
Geme<strong>in</strong>de gesichert wird (<strong>in</strong>stitutionelle F<strong>in</strong>anzunterstützung).<br />
Angabepflichtig im geme<strong>in</strong>dlichen Lagebericht s<strong>in</strong>d dagegen nicht das Innehaben von Aktien und damit die<br />
grundsätzliche Zugehörigkeit zur Hauptversammlung e<strong>in</strong>er Aktiengesellschaft. Auch wenn die versammelten<br />
Aktionäre als Verbund dieses Organ bilden, ist dieses Gremium nicht personenbezogen wie die anderen Organe<br />
der Aktiengesellschaft, die allesamt nach Namen gebildet werden. Die Verb<strong>in</strong>dung der e<strong>in</strong>zelnen Personen (Akti-<br />
GEMEINDEORDNUNG 566
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 95 GO <strong>NRW</strong><br />
onäre) zur Hauptversammlung wird nur durch das Innehaben von Aktien und nicht durch Namen, Ämter oder<br />
Funktionen bestimmt.<br />
Über die <strong>in</strong> der Vorschrift bestimmten Pflichtangaben wird auf mögliche typische Interessenkonflikte der Verantwortlichen<br />
h<strong>in</strong>gewiesen, die im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit stehen und dafür von Bedeutung<br />
s<strong>in</strong>d. Mit den Angaben soll die berufliche Belastung der verantwortlichen Personen aufgezeigt und deren Kompetenz<br />
erkennbar gemacht werden. E<strong>in</strong> Verzicht auf diese Angaben ist nicht zulässig. Auch besteht ke<strong>in</strong>e Schutzklausel,<br />
nach der <strong>in</strong> besonderen Fällen lediglich nur e<strong>in</strong>geschränkte Angaben gemacht werden dürfen, außer das<br />
Wohl der Bundesrepublik Deutschland oder e<strong>in</strong>es ihrer Länder würde gefährdet.<br />
Weitere über die Pflichtangaben h<strong>in</strong>ausgehende Angaben, z.B. Angaben über die Höhe der Entgelte für die Tätigkeit<br />
<strong>in</strong> Organen, werden im Zusammenhang mit dem im Lagebericht zu machenden Angaben nicht gefordert.<br />
Die Angaben hängen nicht vom pflichtgemäßen Ermessen der betreffenden Personen ab, denn es kommt nicht<br />
darauf an, ob dieser Teil der geme<strong>in</strong>dlichen Berichterstattung zum Verständnis des Jahresabschlusses notwendig<br />
ist. Die zu machenden Angaben s<strong>in</strong>d daher aus dem Blickw<strong>in</strong>kel der Adressaten des Jahresabschlusses und<br />
nicht aus dem Blickw<strong>in</strong>kel der Organmitglieder zu betrachten und zu prüfen.<br />
2.1.2 Auskünfte über die Geschäftsführung der Geme<strong>in</strong>de<br />
Für die Geme<strong>in</strong>de besteht die gesetzliche Verpflichtung, am Schluss des Lageberichtes ausgewählte Angaben<br />
über diese Verantwortlichen <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>de zu machen, um auf mögliche typische Interessenkonflikte h<strong>in</strong>zuweisen,<br />
die im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit stehen und dafür von Bedeutung s<strong>in</strong>d. Diese Angabepflichten<br />
bieten sich als Anlass an, im Lagebericht auch Aussagen über die ordnungsgemäße Geschäftsführung<br />
dieser Verantwortlichen zu machen. Dazu gehören u.a. auch Angaben über e<strong>in</strong>e ausreichende Informationsversorgung<br />
und die Erfüllung der Berichtspflichten sowie Kontrollen im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>es wirtschaftlichen Verwaltungshandelns<br />
zum Wohle der Geme<strong>in</strong>de. Es können daher Angaben über die Arbeitsweise der Organe und über Führungspraktiken,<br />
ggf. unter Benennung gesetzlicher Standards, gemacht werden.<br />
Unter Berücksichtigung der Verantwortung der gesetzlich vorgesehenen Gremien der Geme<strong>in</strong>de bedarf es entsprechender<br />
Angaben über die Arbeit des gesamten Gremiums und nicht e<strong>in</strong>er personenbezogenen Zuordnung<br />
auf se<strong>in</strong>e Mitglieder. Zudem müssen nicht die sachlichen Beratungs<strong>in</strong>halte von Sitzungen und Beratungen zum<br />
Gegenstand der Berichterstattung gemacht werden. Den Angaben über das tatsächliche Zusammenwirken nicht<br />
nur zwischen dem Rat der Geme<strong>in</strong>de und der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung, sondern auch zwischen dem Rat und<br />
se<strong>in</strong>en Ausschüssen sowie dem Bürgermeister und dem Verwaltungsvorstand kommt e<strong>in</strong>e besondere Bedeutung<br />
zu. Unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten bedarf es dazu ggf. auch verb<strong>in</strong>dlicher Regelungen, um<br />
Informationen sicher zu stellen. Zu berücksichtigen ist, dass der geme<strong>in</strong>dliche Lagebericht ke<strong>in</strong> Market<strong>in</strong>g<strong>in</strong>strument<br />
darstellt.<br />
2.2 Zu Satz 2 (Verweis auf die Vorschrift des § 43 GO <strong>NRW</strong>):<br />
2.2.1 Der Verweis auf § 43 Abs. 2 Nr. 5 GO <strong>NRW</strong><br />
Nach der Vorschrift gelten die Regelungen <strong>in</strong> § 43 Abs. 2 Nr. 5 GO <strong>NRW</strong> für die Mitglieder des Rates der Geme<strong>in</strong>de<br />
entsprechend, soweit sie Angaben im Zusammenhang mit dem Lagebericht zum geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss<br />
machen müssen. Der Verweis auf diese Regelung bewirkt, dass e<strong>in</strong> Verstoß gegen die Vorschrift über<br />
die Angabepflichten durch den Rat, die Bezirksvertretung oder e<strong>in</strong>en Ausschuss zu prüfen und festzustellen ist.<br />
GEMEINDEORDNUNG 567
2.2.2 Der Verweis auf § 43 Abs. 2 Nr. 6 GO <strong>NRW</strong><br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 95 GO <strong>NRW</strong><br />
Nach der Vorschrift gelten die Regelungen <strong>in</strong> § 43 Abs. 2 Nr. 6 GO <strong>NRW</strong> für die Mitglieder des Rates der Geme<strong>in</strong>de<br />
entsprechend, soweit sie Angaben im Zusammenhang mit dem Lagebericht zum geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss<br />
machen müssen. Der Verweis auf diese Regelung bewirkt, dass die Mitglieder der Bezirksvertretungen<br />
sowie sachkundige Bürger und sachkundige E<strong>in</strong>wohner als Mitglieder von Ausschüssen Ansprüche anderer gegen<br />
die Geme<strong>in</strong>de nur dann nicht geltend machen können, wenn diese im Zusammenhang mit ihren Aufgaben<br />
stehen. Ob diese Voraussetzungen vorliegen, entscheidet die Bezirksvertretung beziehungsweise der Ausschuss.<br />
3. Zu Absatz 3 (Aufstellung des Jahresabschlusses):<br />
3.1 Zu Satz 1 (Aufstellungsverfahren)<br />
3.1.1 Aufstellung des Entwurfs durch den Kämmerer<br />
3.1.1.1 Zuständigkeiten<br />
Nach der Vorschrift ist der Entwurf des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses mit se<strong>in</strong>en Anlagen vom Kämmerer der<br />
Geme<strong>in</strong>de aufzustellen, der die F<strong>in</strong>anzverantwortung <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong>nehat. Er hat dabei die Generalnorm zu<br />
beachten, nach der der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung e<strong>in</strong><br />
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der<br />
Geme<strong>in</strong>de vermitteln muss. Dieses Gebot kann nur unter Beachtung des Vollständigkeitsgebots nur dann erfüllt<br />
werden, wenn der Entwurf des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses alle vorgesehenen Bestandteile und Anlagen<br />
umfasst. Nach der Fertigstellung des Entwurfs des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses hat der Kämmerer diesen<br />
zu unterzeichnen und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorzulegen.<br />
Der Kämmerer hat bei der Aufstellung des Entwurfs des Jahresabschluss der Geme<strong>in</strong>de zu beachten, dass der<br />
Bürgermeister den von ihm bestätigten Entwurf <strong>in</strong>nerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem<br />
Rat zur Feststellung zuzuleiten hat. Das gesamte Aufstellungsverfahren des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses<br />
erfordert daher e<strong>in</strong>e klare Aufgabenverteilung und Term<strong>in</strong>planung. Es ist deshalb von der Geme<strong>in</strong>de örtlich festzulegen,<br />
wer welche Abschlussarbeiten bis zu welchem Term<strong>in</strong> zu erbr<strong>in</strong>gen hat. Dabei ist e<strong>in</strong> Zusammenhang<br />
mit den für den Jahresabschluss notwendigen Abstimmungsarbeiten und den zu klärenden Sachverhalten herzustellen.<br />
Auch s<strong>in</strong>d die Erfordernisse zur Aufstellung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses bei der Aufgaben-<br />
und Zeitplanung der Geme<strong>in</strong>de zu berücksichtigen.<br />
3.1.1.2 Inhaltliche Anforderungen<br />
Der Kämmerer der Geme<strong>in</strong>de hat bei der Aufstellung des Entwurfs des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses die<br />
Generalnorm <strong>in</strong> Absatz 1 Satz 2 der Vorschrift zu beachten, nach der der Jahresabschluss unter Beachtung der<br />
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,<br />
Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de zu vermitteln muss. Zu den Bestandteilen des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Jahresabschlusses vgl. Erläuterungen zu § 95 Abs. 1 S. 3 GemHVO <strong>NRW</strong>). Bei der Aufstellung des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Jahresabschlusses s<strong>in</strong>d daher nicht nur die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, sondern<br />
auch das Anschaffungskostenpr<strong>in</strong>zip, der Grundsatz der Wesentlichkeit sowie weitere Schutzklauseln bzw. Pr<strong>in</strong>zipien<br />
und haushaltswirtschaftliche Regelungen zu beachten. Dazu gehört z.B. das Vollständigkeitsgebot, nachdem<br />
der Entwurf des Jahresabschlusses alle vorgesehenen Bestandteile und Anlagen umfassen muss.<br />
In diesem Zusammenhang bedarf es z.B. bei notwendigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen - auch<br />
erheblichen – die erst im Rahmen des Jahresabschlusses dem abgelaufenen Haushaltsjahr wirtschaftlich zuge-<br />
GEMEINDEORDNUNG 568
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 95 GO <strong>NRW</strong><br />
ordnet werden können, nicht noch zusätzlich des <strong>in</strong> § 83 GO <strong>NRW</strong> bestimmten Verfahrens. Die <strong>in</strong> dieser Vorschrift<br />
enthaltenen Bestimmungen s<strong>in</strong>d auf die Ausführung des Haushaltsplans <strong>in</strong>nerhalb des Haushaltsjahres<br />
ausgerichtet. Soweit aber im Rahmen der Aufstellung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses zu entscheiden ist,<br />
kann dies der Kämmerer im Rahmen se<strong>in</strong>er Zuständigkeit für die Aufstellung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses.<br />
Es bedarf dieser Möglichkeit jedoch nicht bei über- und außerplanmäßigen Auszahlungen, denn diese s<strong>in</strong>d<br />
nach dem Kassenwirksamkeitspr<strong>in</strong>zip dem jeweils aktuellen Haushaltsjahr zuzuordnen.<br />
3.1.2 Bestätigung des Entwurfs durch den Bürgermeister<br />
3.1.2.1 Inhalte der Bestätigung<br />
Nach der Vorschrift hat der Bürgermeister den ihm vom Kämmerer vorgelegten Entwurf des Jahresabschlusses<br />
zu bestätigen. Für diese Bestätigung ist ke<strong>in</strong>e bestimmte Form vorgeschrieben. Der Bürgermeister ist jedoch<br />
nicht verpflichtet, den Entwurf des Kämmerers unverändert dem Rat zuzuleiten. Wenn aus se<strong>in</strong>er Sicht e<strong>in</strong> Bedarf<br />
für Änderungen des Entwurfs des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses besteht, kann er eigenverantwortlich entscheiden,<br />
ob diese Änderungen erfolgen sollen. Er kann zum Entwurf auch E<strong>in</strong>schränkungen machen oder weitere<br />
H<strong>in</strong>weise geben. E<strong>in</strong>e Abstimmung mit dem Kämmerer ist s<strong>in</strong>nvoll und sachgerecht, aber nicht verpflichtend.<br />
Die Vornahme der Bestätigung des Entwurfs des Jahresabschlusses stellt e<strong>in</strong>e funktionale und ke<strong>in</strong>e persönliche<br />
Rechtshandlung des Bürgermeisters der Geme<strong>in</strong>de dar. Soweit der Bürgermeister diese gesetzliche Pflicht aus<br />
persönlichen Gründen nicht wahrnehmen kann, ist <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em solchen Falle die Bestätigung des Entwurfs des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Jahresabschlusses unter Beachtung der geltenden Vertretungsregelungen durch den dann Vertretungsberechtigten<br />
vorzunehmen (vgl. § 68 GO <strong>NRW</strong>).<br />
Die Bestätigung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses durch den Bürgermeister kommt dadurch zum Ausdruck,<br />
dass dieser den ihm vorgelegten Entwurf zu unterzeichnen hat. Er erfüllt mit se<strong>in</strong>er Bestätigung e<strong>in</strong>e öffentlichrechtliche<br />
Verpflichtung und br<strong>in</strong>gt damit zum Ausdruck, dass der Entwurf aus se<strong>in</strong>er Verantwortung heraus richtig<br />
und vollständig ist, sofern er dazu ke<strong>in</strong>e besonderen E<strong>in</strong>schränkungen macht oder H<strong>in</strong>weise gibt. Se<strong>in</strong>e Unterzeichnung<br />
be<strong>in</strong>haltet daher e<strong>in</strong>e Vollständigkeitserklärung dah<strong>in</strong>gehend, dass der Entwurf des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Jahresabschlusses alle Bestandteile und Anlagen zur Erfüllung se<strong>in</strong>er Aufgabe enthält, die dafür vorgeschrieben<br />
bzw. notwendig s<strong>in</strong>d. Der Bürgermeister hat bei der Erteilung se<strong>in</strong>er Bestätigung darauf zu achten, dass er den<br />
von ihm bestätigten Entwurf des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses <strong>in</strong>nerhalb von drei Monaten nach dem Abschlussstichtag<br />
dem Rat zur Prüfung und Feststellung zuzuleiten hat.<br />
In diesem Rahmen kann der Bürgermeister auch noch den erforderlich gewordenen Aufwendungen zustimmen,<br />
denn die <strong>in</strong> § 83 GO <strong>NRW</strong> enthaltenen Verfahrensregelungen und Zuständigkeiten für über- und außerplanmäßige<br />
Aufwendungen s<strong>in</strong>d nur auf Erfordernisse und die Ausführung des Haushaltsplans <strong>in</strong>nerhalb des Haushaltsjahres<br />
ausgelegt. Soweit Aufwendungen - auch erhebliche – aber erst im Rahmen des Jahresabschlusses dem<br />
abgelaufenen Haushaltsjahr wirtschaftlich zugeordnet werden können, bedarf es dann nicht des <strong>in</strong> § 83 GO <strong>NRW</strong><br />
bestimmten Verfahrens. Dieses trifft jedoch nicht über- und außerplanmäßige Auszahlungen, denn diese s<strong>in</strong>d<br />
nach dem Kassenwirksamkeitspr<strong>in</strong>zip dem jeweils aktuellen Haushaltsjahr zuzuordnen.<br />
3.1.2.2 Informationspflichten des Bürgermeisters<br />
Der Bürgermeister hat das Recht, vom dem ihm vom Kämmerer vorgelegten Entwurf des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses<br />
abzuweichen, bevor er diese dem Rat der Geme<strong>in</strong>de zuleitet. Weicht der Bürgermeister von dem<br />
ihm vorgelegten Entwurf ab, hat er vor der Zuleitung des Entwurfs an den Rat der Geme<strong>in</strong>de den Kämmerer über<br />
se<strong>in</strong>e abweichende Auffassung zu <strong>in</strong>formieren und ihm die sich daraus ergebenden oder bereits von ihm vorge-<br />
GEMEINDEORDNUNG 569
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 95 GO <strong>NRW</strong><br />
nommenen Änderungen des Entwurfs offen zu legen. Dem Kämmerer steht <strong>in</strong> diesem Falle das Recht zu, e<strong>in</strong>e<br />
Stellungnahme zu dem durch den Bürgermeister geänderten Entwurf des Jahresabschlusses abzugeben.<br />
Die Befugnis des Bürgermeisters, Änderungen an dem ihm vom Kämmerer vorgelegten Entwurf des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Jahresabschlusses vornehmen zu dürfen, geht jedoch nicht so weit, dass er wegen des möglicherweise<br />
weitreichenden Umfangs se<strong>in</strong>er für notwendig angesehenen Änderungen eigenständig e<strong>in</strong>en neuen Entwurf des<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses aufstellen darf. Das Recht zur Aufstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses<br />
der Geme<strong>in</strong>de steht gesetzlich nur dem Kämmerer und nicht dem Bürgermeister zu. Bei offenen Differenzen<br />
zwischen dem Kämmerer und dem Bürgermeister über die Entwurfsfassung, s<strong>in</strong>d diese im Rahmen der Beratungen<br />
des Rates über den Entwurf des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses auszuräumen.<br />
3.1.3 Wirkungen der Unterzeichnungen<br />
Mit ihren Unterschriften auf dem von ihnen aufgestellten und bestätigten Entwurfs des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses<br />
erfüllen der Kämmerer und der Bürgermeister e<strong>in</strong>e öffentlich-rechtliche Verpflichtung und haben ausreichend<br />
ihre Verantwortung als Nachweis im S<strong>in</strong>ne der Vorschrift dokumentiert. Beide Personen br<strong>in</strong>gen damit<br />
zum Ausdruck, dass der von ihnen aufgestellte Entwurf des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss aus ihrer Verantwortung<br />
heraus richtig und vollständig ist, dieser das Ergebnis des wirtschaftlichen Handelns der Geme<strong>in</strong>de im abgelaufenen<br />
Haushaltsjahr nach festgelegten haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Regeln aufzeigt und<br />
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes<br />
Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de vermittelt. Die Verpflichtung zur<br />
Unterzeichnung des Entwurfs be<strong>in</strong>haltet dabei nicht, dass der Kämmerer und der Bürgermeister sämtliche Bestandteile<br />
und Anlagen des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses e<strong>in</strong>zeln zu unterzeichnen haben. Der Jahresabschluss<br />
ist vielmehr buchtechnisch so zusammen zu fassen, dass erkennbar und nachvollziehbar wird, dass sich<br />
die Unterschriften des Kämmerers und des Bürgermeisters auf die Gesamtheit aller Teile beziehen.<br />
3.1.4 Die Stellungnahme des Kämmerers<br />
Der Kämmerer kann ggf. e<strong>in</strong>e Stellungnahme zum Entwurf des Jahresabschlusses abgeben, soweit der Bürgermeister<br />
von dem ihm vorgelegten Entwurf abweicht. Hat der Kämmerer e<strong>in</strong>e Stellungnahme abgegeben, muss<br />
der Bürgermeister diese Stellungnahme mit dem Entwurf des Jahresabschlusses dem Rat vorzulegen. Der Kämmerer<br />
kann dann se<strong>in</strong>e abweichende Auffassung <strong>in</strong> den Beratungen des Rates vertreten (vgl. § 96 Abs. 1 S. 3<br />
GO <strong>NRW</strong>). Ihm steht dieses Recht persönlich zu und kann nicht vom Bürgermeister übernommen oder <strong>in</strong> Vertretung<br />
wahrgenommen werden.<br />
3.2 Zu Satz 2 (Zuleitung des Entwurfs des Jahresabschlusses an den Rat):<br />
3.2.1 Zwecke und Inhalte der Zuleitung<br />
Die <strong>in</strong> der Vorschrift geregelte Zuleitung des Entwurfs des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses an den Rat der<br />
Geme<strong>in</strong>de dient e<strong>in</strong>erseits der Feststellung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses, denn der Rat hat die Pflicht,<br />
nach Abschluss des Haushaltsjahres, die Ausführung des Haushaltsplans, soweit sie sich im Jahresabschluss<br />
niederschlägt, zu überprüfen und über das Ergebnis sowie über die Verwendung des Jahresüberschusses bzw.<br />
die Behandlung des Jahresfehlbetrages e<strong>in</strong>en Beschluss zu fassen (vgl. § 96 Abs. 1 S. 1 und 2 GO <strong>NRW</strong>). Durch<br />
den geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss legt der Bürgermeister deshalb Rechenschaft gegenüber dem Rat ab und<br />
legt dar, wie er se<strong>in</strong>en Auftrag ausgeführt hat, zu welchem Ergebnis die Haushaltswirtschaft im Verlaufe des<br />
Haushaltsjahres geführt hat, welche Auswirkungen sich daraus auf das Vermögen und die Schulden der Geme<strong>in</strong>de<br />
ergeben und welche Chancen und Risiken sich <strong>in</strong>sgesamt für die künftige Entwicklung der Geme<strong>in</strong>de ergeben.<br />
GEMEINDEORDNUNG 570
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 95 GO <strong>NRW</strong><br />
Die Zuleitung des Entwurfs des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses an den Rat dient daher dazu, dem Rat die<br />
Informationen für se<strong>in</strong>e gesetzlich vorgesehene Beschlussfassung zukommen zu lassen. Sie bedeutet jedoch<br />
nicht, dass der Rat den Entwurf (des Jahresabschlusses) unmittelbar festzustellen hat. Vielmehr nimmt der Rat<br />
den Entwurf im Rahmen der Zuleitung nur entgegen, um ihm dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung<br />
(vgl. § 101 GO <strong>NRW</strong>) weiterzuleiten. Erst nach Durchführung der gesetzlich vorgesehenen Prüfung hat der Rat<br />
die Feststellung des ihm vom Bürgermeister vorgelegten Jahresabschlusses vornehmen (vgl. § 96 Abs. 1 S. 1<br />
GO <strong>NRW</strong>).<br />
Andererseits dient die Zuleitung der geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlussunterlagen an den Rat auch dazu, den<br />
Ratsmitgliedern die nötigen Informationen über die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft zu geben, damit diese über<br />
die gesetzlich vorgesehene Entlastung des Bürgermeisters entscheiden können (vgl. § 96 Abs. 1 S. 4 GO <strong>NRW</strong>).<br />
Der Bürgermeister, der die Zuleitung des Entwurfs des Jahresabschlusses an den Rat veranlasst, kann im Rahmen<br />
se<strong>in</strong>er Vorlage bereits darlegen, dass und wie von ihm die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft entsprechend<br />
dem Auftrag des Rates ordnungsgemäß ausgeführt wurde und ke<strong>in</strong>e Erkenntnisse vorliegen, die gegen se<strong>in</strong>e<br />
Entlastung sprechen.<br />
3.2.2 Der Vollzug der Zuleitung<br />
Nach der Vorschrift hat der Bürgermeister den von ihm bestätigten Entwurf des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses<br />
mit se<strong>in</strong>en Anlagen dem Rat der Geme<strong>in</strong>de zuzuleiten. Der Adressat der Vorlage ist damit der Rat als Kollegialorgan,<br />
das se<strong>in</strong>e Beschlüsse <strong>in</strong> Sitzungen fasst (Sitzungspr<strong>in</strong>zip) und nicht das e<strong>in</strong>zelne Ratsmitglied. Die<br />
Zuleitung des bestätigten Entwurfs des Jahresabschlusses mit se<strong>in</strong>en Anlagen an den Rat der Geme<strong>in</strong>de wird <strong>in</strong><br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Praxis i.d.R. dadurch vollzogen, dass durch den Bürgermeister e<strong>in</strong> entsprechender Tagesordnungspunkt<br />
auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Rates gesetzt wird, denn er hat die Ratssitzungen<br />
e<strong>in</strong>zuberufen (vgl. § 47 Abs. 1 S. 1 GO <strong>NRW</strong>) und die Tagesordnung <strong>in</strong> eigener Verantwortung festzulegen (vgl. §<br />
48 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>). Im Rahmen der beschlussfähigen Zusammenkunft des Rates (Sitzung) kann dann die Zuleitung<br />
des Entwurfs des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses als erledigt betrachtet werden.<br />
Für die weiteren Beratungen bzw. die Verweisung an den Rechnungsprüfungsausschuss ist es wichtig, dass<br />
jedes Ratsmitglied über ausreichende Beratungsunterlagen über die abgeschlossene geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft<br />
verfügen kann, denn ihm stehen h<strong>in</strong>sichtlich der Beschlussfassung eigene Mitwirkungsrechte zu. Es<br />
muss daher gewährleistet werden, dass der Rat der Geme<strong>in</strong>de nach der Prüfung sachgerecht die Feststellung<br />
des ihm vorgelegten Jahresabschlusses mit se<strong>in</strong>en Anlagen treffen kann. Der Bürgermeister hat daher auch die<br />
Stellungnahme des Kämmerers mit vorzulegen, wenn der Kämmerer von der ihm gesetzlich e<strong>in</strong>geräumten Möglichkeit<br />
Gebrauch gemacht hat, e<strong>in</strong>e abweichende Stellungnahme zu dem vom Bürgermeister bestätigten Entwurf<br />
des Jahresabschlusses abzugeben.<br />
3.2.3 Der Zeitraum der Aufstellung und Bestätigung des Jahresabschlusses<br />
Nach der Vorschrift hat der Bürgermeister den von ihm bestätigten Entwurf <strong>in</strong>nerhalb von drei Monaten nach<br />
Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zur Feststellung zuzuleiten. Grundsätzlich gilt der 31. März des dem Haushaltsjahr<br />
folgenden Jahres als letzter Tag für die Aufstellung des Jahresabschlusses. Dies setzt u.a. voraus, dass<br />
der Kämmerer den Entwurf des Jahresabschlusses rechtzeitig aufgestellt hat, der dafür gesetzlich die Verantwortung<br />
trägt. Das gesamte Aufstellungsverfahren des Jahresabschlusses erfordert e<strong>in</strong>e klare Aufgabenverteilung<br />
und Term<strong>in</strong>planung, so dass örtlich von der Geme<strong>in</strong>de festzulegen ist, wer welche Abschlussarbeiten bis zu welchem<br />
Term<strong>in</strong> zu erbr<strong>in</strong>gen hat. Dabei ist e<strong>in</strong> Zusammenhang mit den für den Jahresabschluss notwendigen Abstimmungsarbeiten<br />
und den zu klärenden Sachverhalten herzustellen.<br />
GEMEINDEORDNUNG 571
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 95 GO <strong>NRW</strong><br />
Die seit Jahrzehnten unveränderte dreimonatige Frist für die Zuleitung des Entwurfs des Jahresabschlusses an<br />
den Rat ist im mit der gleichen Zeitdauer im Handelsrecht für Unternehmen festgelegt. Sie dient dazu, den Jahresabschluss<br />
technisch vorzubereiten und im Rahmen der Aufstellung die erforderlichen Entscheidungen zu treffen.<br />
Außerdem hat der Rat e<strong>in</strong>en Anspruch darauf, möglichst zeitnah an das Ende des Haushaltsjahres über das<br />
Ergebnis und den Vollzug der Haushaltswirtschaft <strong>in</strong>formiert zu werden. Die Fristvorgabe soll daher den Bedürfnissen<br />
des Rates und der Verwaltung der Geme<strong>in</strong>de Rechnung tragen, die wirtschaftliche Entscheidungen zeitnah<br />
zu treffen haben und dafür die Ist-Ergebnisse aus dem Handeln des vergangenen Haushaltsjahres sowie die<br />
neuen daraus resultierenden Wertansätze der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz schnellstmöglich kennen müssen.<br />
Die E<strong>in</strong>haltung der Aufstellungsfrist gehört ebenfalls zur ordnungsmäßigen Buchführung der Geme<strong>in</strong>de, so dass<br />
bei e<strong>in</strong>er Überschreitung der Frist die geme<strong>in</strong>dliche Buchführung nicht mehr als ordnungsmäßig angesehen werden<br />
kann, auch wenn wegen bei e<strong>in</strong>er tatsächlich e<strong>in</strong>getretenen Überschreitung ke<strong>in</strong>e aufsichtsrechtlichen Maßnahmen<br />
ergriffen werden. Die <strong>in</strong> der Vorschrift geregelte Zuleitung bedeutet jedoch nicht, dass der Rat den Entwurf<br />
(des Jahresabschlusses) festzustellen hat. Vielmehr nimmt der Rat den Entwurf nur entgegen, um ihm dem<br />
Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung weiterzuleiten. Erst nach Durchführung der gesetzlich vorgesehenen<br />
Prüfung hat der Rat dann die Feststellung des ihm vom Bürgermeister vorgelegten geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses<br />
vornehmen.<br />
3.2.4 Der Zeitraum der Aufstellung und Wertaufhellungspr<strong>in</strong>zip<br />
Die Vorgabe <strong>in</strong> § 32 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO <strong>NRW</strong>, alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag<br />
entstanden s<strong>in</strong>d, sowie Gew<strong>in</strong>ne, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert s<strong>in</strong>d, im Rahmen der<br />
Aufstellung des Jahresabschlusses zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag<br />
und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden s<strong>in</strong>d (Pr<strong>in</strong>zip der Wertaufhellung), darf<br />
nicht dazu führen, die Aufstellung und Bestätigung des Jahresabschlusses sowie die Zuleitung an den Rat bewusst<br />
zu verspäten.<br />
Die Fristsetzung zur Aufstellung des Jahresabschlusses nach der Vorschrift (Zuleitung des bestätigten Entwurfs<br />
des Jahresabschlusses an den Rat zur Feststellung <strong>in</strong>nerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres)<br />
soll <strong>in</strong> diesem Zusammenhang die Geme<strong>in</strong>de davon abhalten, auf mögliche Erkenntnisse <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er unbestimmten<br />
Zeit zu hoffen, um das Ergebnis des abgelaufenen Haushaltsjahres noch nach eigenen Wünschen zu<br />
bee<strong>in</strong>flussen. Die Vorgabe e<strong>in</strong>er zeitlichen Begrenzung ist auch sachgerecht, weil es nicht vom zeitlichen Ablauf<br />
der Aufstellungsarbeiten zum Jahresabschluss bzw. se<strong>in</strong>er Fertigstellung <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>de abhängig se<strong>in</strong> kann,<br />
ob, wann und auf welche Art die ertrags-, aufwands- oder vermögenswirksame Sachverhalte <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e ggf. vorzunehmende<br />
Periodenabgrenzung e<strong>in</strong>bezogen werden. Die Anwendung des Pr<strong>in</strong>zips der Wertaufhellung durch die<br />
Geme<strong>in</strong>de muss vielmehr willkürfrei se<strong>in</strong>.<br />
3.2.5 Der Zeitraum der Aufstellung und Haushaltssicherung<br />
E<strong>in</strong>e erhebliche Bedeutung erhält die Fristvorgabe <strong>in</strong> dieser Vorschrift bei Geme<strong>in</strong>den, die e<strong>in</strong> Haushaltssicherungskonzept<br />
umzusetzen haben. Bei diesen Geme<strong>in</strong>den darf die Anwendung des Wertaufhellungspr<strong>in</strong>zips nicht<br />
dazu genutzt werden, die Feststellung von Erfolg oder der Misserfolg der Sanierungsmaßnahmen im abgelaufenen<br />
Haushaltsjahr und damit die Aufstellung und Bestätigung des Jahresabschlusses sowie die Zuleitung an den<br />
Rat der Geme<strong>in</strong>de bewusst zu verspäten oder auf unbestimmte Zeit zu verschieben.<br />
Der aktuelle Stand der Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de bzw. die Ergebnisse der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen<br />
Haushaltsjahres müssen vielmehr besonders zeitnah und unverzüglich nach Ablauf des Haushaltsjahres<br />
erkennbar und transparent gemacht werden. Nur dann können schnellstmöglich notwendig gewordene Konsequenzen<br />
für die Zukunft gezogen und Anpassungsmaßnahmen e<strong>in</strong>geleitet und umgesetzt werden. Ggf. kann es<br />
GEMEINDEORDNUNG 572
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 95 GO <strong>NRW</strong><br />
deshalb auch notwendig werden, <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er kürzeren Frist als gesetzlich vorgegeben (31. März des dem Haushaltsjahr<br />
folgenden Jahres), den Jahresabschluss aufzustellen und auf e<strong>in</strong>e i.d.R. mögliche längere Zeit zur Anwendung<br />
des Wertaufhellungspr<strong>in</strong>zips zu verzichten.<br />
3.3. Zu Satz 3 (Abweichende Stellungnahme des Kämmerers):<br />
Nach der Vorschrift kann der Kämmerer, soweit der Bürgermeister von dem ihm vom Kämmerer vorgelegten<br />
Entwurf des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses abweicht, dazu e<strong>in</strong>e Stellungnahme abgeben. Für den Kämmerer<br />
besteht damit die Möglichkeit, die Ergebnisse der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres<br />
und die damit verbundene Zielerreichung sowie die Chancen und Risiken für die Geme<strong>in</strong>de aus se<strong>in</strong>er<br />
Sichten gegenüber dem Rat der Geme<strong>in</strong>de darzustellen.<br />
3.4 Zu Satz 4 (Vorlage der Stellungnahme an den Rat):<br />
Nach der Vorschrift hat der Bürgermeister die Stellungnahme des Kämmerers zum Entwurf des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Jahresabschlusses dem Rat vorzulegen, wenn der Kämmerer von se<strong>in</strong>em Recht Gebrauch gemacht hat, e<strong>in</strong>e<br />
abweichende Stellungnahme zu dem vom Bürgermeister bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses abzugeben.<br />
In der betreffenden Ratssitzung besteht dann für Bürgermeister und für den Kämmerer e<strong>in</strong> Rederecht, so dass<br />
die Ergebnisse aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr und die damit verbundene Zielerreichung sowie die Chancen<br />
und Risiken für die Geme<strong>in</strong>de ggf. aus unterschiedlichen Sichten gegenüber dem Rat der Geme<strong>in</strong>de dargestellt<br />
werden können.<br />
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ<br />
GEMEINDEORDNUNG 573
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 96 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 96<br />
Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung<br />
(1) 1 Der Rat stellt bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den vom Rechnungsprüfungsausschuss<br />
geprüften Jahresabschluss durch Beschluss fest. 2 Zugleich beschließt er über die Verwendung<br />
des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages. 3 In der Beratung des Rates<br />
über den Jahresabschluss kann der Kämmerer se<strong>in</strong>e abweichende Auffassung vertreten. 4 Die Ratsmitglieder<br />
entscheiden über die Entlastung des Bürgermeisters. 5 Verweigern sie die Entlastung oder sprechen sie diese mit<br />
E<strong>in</strong>schränkungen aus, so haben sie dafür die Gründe anzugeben. 6 Wird die Feststellung des Jahresabschlusses<br />
vom Rat verweigert, so s<strong>in</strong>d die Gründe dafür gegenüber dem Bürgermeister anzugeben.<br />
(2) 1 Der vom Rat festgestellte Jahresabschluss ist der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen. 2 Der Jahresabschluss<br />
ist öffentlich bekannt zu machen und danach bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur<br />
E<strong>in</strong>sichtnahme verfügbar zu halten.<br />
Erläuterungen zu § 96:<br />
I. Allgeme<strong>in</strong>es<br />
1. Zwecke der Feststellung des Jahresabschlusses<br />
Der Bürgermeister der Geme<strong>in</strong>de ist e<strong>in</strong>erseits verantwortlich für die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs<br />
der gesamten Verwaltung (vgl. § 62 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>). Andererseits hat er die Beschlüsse des Rates vorzubereiten<br />
und diese unter Kontrolle des Rates und ihm gegenüber durchzuführen (vgl. § 62 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>).<br />
Die Beauftragung des Bürgermeisters durch den Rat be<strong>in</strong>haltet für den Rat auch e<strong>in</strong>e entsprechende Prüfungspflicht.<br />
Der Rat der Geme<strong>in</strong>de hat deshalb nach Abschluss des jeweiligen Haushaltsjahres die Ausführung des<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplans, soweit sie sich im Jahresabschluss der Geme<strong>in</strong>de niederschlägt, zu überprüfen<br />
und über das Ergebnis e<strong>in</strong>en Beschluss zu fassen. Dabei stellt der Abschlussstichtag für den geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Jahresabschluss ke<strong>in</strong>en willkürlichen Schnitt durch das geme<strong>in</strong>dliche Verwaltungshandeln bzw. die Geschäftstätigkeit<br />
der Geme<strong>in</strong>de dar, auch wenn unmittelbar zuvor und danach Erträge erzielt und Aufwendungen entstehen<br />
sowie Zahlungen erhalten und geleistet werden.<br />
Diesen Vorgaben entsprechend obliegt die ratsbezogene Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses dem<br />
Rechnungsprüfungsausschuss als Pflichtausschuss des Rates (vgl. § 57 Abs. 2 i.V.m. § 59 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong>). Die<br />
sich daran anschließende Beschlussfassung des Rates erfolgt <strong>in</strong> Form der Feststellung des Jahresabschlusses<br />
und der Entscheidung über die Verwendung des Jahresüberschusses bzw. der Behandlung des Jahresfehlbetrages<br />
sowie der Entlastung der Bürgermeister<strong>in</strong> oder des Bürgermeisters. Die aufgeführten Aufgaben darf der Rat<br />
nicht auf Dritte übertragen (vgl. § 41 Abs. 1 Buchstabe j GO <strong>NRW</strong>).<br />
Der Rat kann im Rahmen se<strong>in</strong>er Beschlussfassung aber festlegen, ob er über die Feststellung des Jahresabschluss<br />
und die Entlastung des Bürgermeisters zwei eigenständige Beschlüsse fassen oder die beiden Beschlussgegenstände<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Beschluss zusammenfassen will. Mit der Feststellung des Jahresabschlusses und<br />
der Entlastung des Bürgermeisters kann die Geme<strong>in</strong>de ihre Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres<br />
<strong>in</strong>tern als abgeschlossen betrachten. Aus der Anzeige des Jahresabschlusses an die zuständige Aufsichtsbehörde<br />
sowie aus der überörtlichen Prüfung der Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen können sich<br />
gleichwohl noch Maßnahmen für die Geme<strong>in</strong>de ergeben, die haushaltswirtschaftliche Auswirkungen entfalten<br />
können.<br />
GEMEINDEORDNUNG 574
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 96 GO <strong>NRW</strong><br />
2. Änderung oder Berichtigung des Jahresabschlusses<br />
2.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Bei den Geme<strong>in</strong>den können fehlerhafte oder unrichtige Jahresabschlüsse entstehen, weil die am Abschlussstichtag<br />
gegebenen objektiven Verhältnisse bei der Aufstellung und Feststellung des Jahresabschlusses nicht erkannt<br />
wurden. Für die Beurteilung dieses Sachverhaltes ist auf die Feststellung des Jahresabschlusses als örtlicher<br />
Entscheidungszeitpunkt abzustellen, denn im Zeitraum von der Aufstellung des Jahresabschlusses bis zu se<strong>in</strong>er<br />
Feststellung liegt nur e<strong>in</strong> Entwurf vor, der noch verändert werden kann. Die sich an die Feststellung des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Jahresabschlusses anschließende Bekanntmachung sowie se<strong>in</strong>e Anzeige an die Aufsichtsbehörde nach §<br />
96 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> verändern nicht die vom Rat der Geme<strong>in</strong>de getroffene Feststellung und können daher bei der<br />
Beurteilung der Durchführung des Zeitpunktes e<strong>in</strong>er Berichtigung grundsätzlich außer Betracht bleiben. Zu beachten<br />
ist, dass die Änderung e<strong>in</strong>es fehlerfreien Jahresabschlusses, der den gesetzlichen Anforderungen und<br />
den GoB entspricht und vom Rat der Geme<strong>in</strong>de festgestellt wurde, grundsätzlich unzulässig ist.<br />
Liegen die Erkenntnisse über e<strong>in</strong>en Änderungs- oder Berichtigungsbedarf erst nach der Feststellung des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Jahresabschlusses bzw. zu e<strong>in</strong>em noch späteren Zeitpunkt vor, soll e<strong>in</strong>e Berichtigung grundsätzlich<br />
im dann am weitesten zurückliegenden, noch nicht festgestellten Jahresabschluss vorgenommen werden. Bei<br />
Unwesentlichkeit des aufgetretenen Fehlers kann es ausreichend se<strong>in</strong>, diesen, trotz e<strong>in</strong>es noch nicht festgestellten<br />
Jahresabschlusses der Geme<strong>in</strong>de, erst im nächsten von der Geme<strong>in</strong>de aufzustellenden Jahresabschluss zu<br />
berichtigen. Die notwendige Fehlerbeseitigung im geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss eröffnet für die Geme<strong>in</strong>de<br />
jedoch nicht die Möglichkeit zu e<strong>in</strong>er nachträglichen neuen Sachverhaltsgestaltung. Bei der Prüfung durch die<br />
Geme<strong>in</strong>de, <strong>in</strong> welcher Form e<strong>in</strong>e Fehlerbeseitigung zu erfolgen hat, ist auch das Informationsbedürfnis der Adressaten<br />
des Jahresabschlusses zu berücksichtigen.<br />
Im E<strong>in</strong>zelfall können ggf. Bilanzierungsfehler auftreten, die sich auf die Aufgabe des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses<br />
auswirken, e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags-<br />
und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de zu vermitteln. Daraus können Berichtigungspflichten von Wertansätzen<br />
ergeben, die im Rahmen und zur E<strong>in</strong>haltung der haushaltsrechtlichen Vorschriften durch die Geme<strong>in</strong>de notwendig<br />
s<strong>in</strong>d. In diesen Fällen s<strong>in</strong>d Bilanzierungsfehler immer nach den Regeln der Bilanzberichtigung und somit<br />
ergebniswirksam <strong>in</strong> dem Haushaltsjahr zu korrigieren, <strong>in</strong> dem sie bekannt werden. E<strong>in</strong>e Korrektur darf z.B. nicht<br />
dadurch umgangen oder ersetzt werden, dass stattdessen bei e<strong>in</strong>em geme<strong>in</strong>dlichen Vermögensgegenstand e<strong>in</strong>e<br />
Zuschreibung nach § 35 Abs. 8 GemHVO <strong>NRW</strong> vorgenommen wird.<br />
2.2 Die erneute Feststellung des Jahresabschlusses<br />
In örtlichen E<strong>in</strong>zelfällen kann es aus sachlichen oder rechtlichen Gründen erforderlich werden, e<strong>in</strong>en bereits festgestellten<br />
Jahresabschluss zu ändern. Die Änderung e<strong>in</strong>es festgestellten Jahresabschlusse kann z.B. auch wegen<br />
materieller Folgewirkungen oder wegen wesentlicher Rechtsverstöße, erforderlich werden. Ist dieses der Fall,<br />
bedarf es e<strong>in</strong>er Prüfung des örtlichen Änderungssachverhaltes durch den zuständigen Rechnungsprüfungsausschuss<br />
(vgl. § 101 GO <strong>NRW</strong>) und e<strong>in</strong>er erneuten Feststellung des (berichtigten) geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses<br />
durch den Rat der Geme<strong>in</strong>de. Haben die Änderungen des Jahresabschlusses dagegen ke<strong>in</strong>e Auswirkungen<br />
auf den Beschluss über die Ergebnisverwendung und /oder auf die Entlastung des Bürgermeisters (vgl. § 96 Abs.<br />
1 GO <strong>NRW</strong>), kann e<strong>in</strong>e erneute Beschlussfassung über den geänderten geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss als<br />
entbehrlich betrachtet werden.<br />
Der geänderte Jahresabschluss der Geme<strong>in</strong>de muss als solcher gekennzeichnet werden, um dieses auch für<br />
Dritte bzw. die Adressaten des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses deutlich zu machen. Die vorgenommenen<br />
Änderungen sowie deren Umfang und Notwendigkeit s<strong>in</strong>d zudem im Anhang des berichtigten (neuen) Jahresabschlusses<br />
anzugeben bzw. zu erläutern. Außerdem unterliegt e<strong>in</strong> solcher Jahresabschluss erneut der Anzeige an<br />
GEMEINDEORDNUNG 575
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 96 GO <strong>NRW</strong><br />
die Aufsichtsbehörde und der öffentlichen Bekanntmachung und ist zur E<strong>in</strong>sichtnahme verfügbar zu halten (vgl. §<br />
96 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>).<br />
II. Erläuterungen im E<strong>in</strong>zelnen<br />
1. Zu Absatz 1 (Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung):<br />
1.1 Zu Satz 1 (Feststellung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses)<br />
1.1.1 Zwecke der Feststellung des Jahresabschlusses<br />
Der Bürgermeister hat zum Ende des auf e<strong>in</strong> Jahr begrenzten Auftrages, die Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de<br />
nach der beschlossenen Haushaltssatzung auszuführen, dem Rat e<strong>in</strong>en Jahresabschluss vorzulegen. Er muss<br />
darlegen, wie er den Auftrag des Rates ausgeführt hat, zu welchem Ergebnis die Haushaltswirtschaft im Verlaufe<br />
des Haushaltsjahres geführt hat, welche Auswirkungen sich daraus auf das Vermögen und die Schulden der<br />
Geme<strong>in</strong>de ergeben und welche Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Geme<strong>in</strong>de bestehen.<br />
In der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft kommt dem Jahresabschluss - wie im kaufmännischen Rechnungswesen<br />
- e<strong>in</strong>e große Bedeutung zu. Der geme<strong>in</strong>dliche Jahresabschluss gibt e<strong>in</strong>en Überblick über die tatsächliche<br />
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de und deren weitere wirtschaftliche Entwicklung.<br />
Er gibt auch Rechenschaft über die tatsächliche Aufgabenerledigung und die E<strong>in</strong>haltung des Haushaltsplans. Der<br />
Jahresabschluss besteht daher nach § 95 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> aus der Ergebnisrechnung, der F<strong>in</strong>anzrechnung, den<br />
Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang.<br />
1.1.2 Die Fristsetzung für die Feststellung des Jahresabschlusses<br />
Nach der Vorschrift hat der Rat der Geme<strong>in</strong>de bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden<br />
Jahres den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss festzustellen. Dieser<br />
Zeitbezug begrenzt kalendermäßig den Feststellungszeitpunkt und soll zu e<strong>in</strong>em möglichst zeitnahen Beschluss<br />
des Rates beitragen. Die örtliche Umsetzung darf sich dabei nicht alle<strong>in</strong> an dieser gesetzlichen Term<strong>in</strong>ierung<br />
ausrichten, sondern muss auch berücksichtigen, dass die Geme<strong>in</strong>de spätestens e<strong>in</strong>en Monat vor Beg<strong>in</strong>n e<strong>in</strong>es<br />
neuen Haushaltsjahres ihrer Aufsichtsbehörde die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen anzuzeigen hat und zum<br />
gleichen Term<strong>in</strong> (31. Dezember) der Rat der Geme<strong>in</strong>de den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss zu bestätigen hat<br />
(vgl. § 116 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>).<br />
E<strong>in</strong> Zusammenhang zwischen den beiden gesetzlichen Fristen wird dadurch hergestellt, dass nach § 1 Abs. 3<br />
GemHVO <strong>NRW</strong> den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen<br />
sowie E<strong>in</strong>zahlungen und Auszahlungen u.a. die Ergebnisse der Rechnung des Vorvorjahres voranzustellen s<strong>in</strong>d<br />
und diesem Haushaltsplan die Bilanz des Vorvorjahres beizufügen ist. Daraus ergibt sich z.B. bei e<strong>in</strong>er Haushaltssatzung<br />
für das Haushaltsjahr 2011 für den geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2009<br />
(Vorvorjahr von 2011), dass dieser bis zum Beg<strong>in</strong>n der <strong>in</strong> § 80 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong> genannten Anzeigefrist (1. Dezember<br />
2010) festgestellt se<strong>in</strong> sollte. Kommt es aber zu term<strong>in</strong>lichen Überschneidungen muss örtlich sichergestellt<br />
werden, dass die Angaben im neuen geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan auf belastbaren Daten aufbauen.<br />
Bei der Entscheidung, zu welchem Zeitpunkt der Rat den Jahresabschluss der geme<strong>in</strong>dlichen Kernverwaltung<br />
feststellen soll, ist außerdem zu berücksichtigen, dass dieser Jahresabschluss <strong>in</strong> den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss<br />
e<strong>in</strong>zubeziehen ist bzw. dessen Ausgangsgrundlage darstellt und der Gesamtabschluss der Geme<strong>in</strong>de<br />
durch den Rat ebenfalls bis spätestens 31. Dezember des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres durch den Rat zu<br />
bestätigen ist (vgl. § 116 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>). Dieses erfordert e<strong>in</strong> zeitliches Zusammenspiel und e<strong>in</strong> aufe<strong>in</strong>ander<br />
GEMEINDEORDNUNG 576
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 96 GO <strong>NRW</strong><br />
abstimmen sowohl der Aufstellung und der Bestätigung als auch der Prüfung beider Abschlüsse. Es bietet sich<br />
daher sachgerecht an, den Jahresabschluss der geme<strong>in</strong>dlichen Kernverwaltung möglichst bis zum 30. September<br />
des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres durch den Rat feststellen zu lassen und dabei zudem zu berücksichtigen,<br />
dass bis zu diesem Zeitpunkt der geme<strong>in</strong>dliche Gesamtabschluss zum Rat zur Bestätigung zuzuleiten ist<br />
(vgl. § 116 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong>).<br />
1.1.3 Die Zuleitung an den Rat<br />
Die Zuleitung des Entwurfs des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses an den Rat der Geme<strong>in</strong>de wird <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Praxis i.d.R. dadurch vollzogen, dass durch den Bürgermeister e<strong>in</strong> entsprechender Tagesordnungspunkt<br />
auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Rates gesetzt wird, denn er hat diese Tagesordnung <strong>in</strong><br />
eigener Verantwortung festzulegen (vgl. § 48 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>). In der betreffenden Ratssitzung besteht dann für<br />
den Bürgermeister, oftmals ergänzend auch für den Kämmerer, e<strong>in</strong> Rederecht, so dass das Ergebnis der Haushaltswirtschaft<br />
des abgelaufenen Haushaltsjahres sowie die damit verbundene Zielerreichung, aber auch Chancen<br />
und Risiken für die Zukunft der Geme<strong>in</strong>de, vorgestellt werden können. Für die weiteren Beratungen bzw. die<br />
Verweisung an die zuständigen Ausschüsse muss jedes Ratsmitglied über ausreichende Beratungsunterlagen<br />
verfügen. Es muss gewährleistet se<strong>in</strong>, dass der Rat der Geme<strong>in</strong>de sachgerecht den zuvor geprüften Jahresabschluss<br />
feststellen kann.<br />
1.1.4 Die Prüfung des Jahresabschlusses vor se<strong>in</strong>er Feststellung<br />
1.1.4.1 Aufgaben des Rechnungsprüfungsausschusses<br />
Die Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses durch den Rechnungsprüfungsausschuss ist Voraussetzung<br />
für die Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat der Geme<strong>in</strong>de. Bevor der Rat den Jahresabschluss<br />
der Geme<strong>in</strong>de durch Beschluss feststellen kann, ist dieser Jahresabschluss durch den Rechnungsprüfungsausschuss<br />
(vgl. § 59 GO <strong>NRW</strong>) zu prüfen. Diese Prüfung ist e<strong>in</strong>e pflichtige Aufgabe des Rechnungsprüfungsausschusses<br />
nach § 101 GO <strong>NRW</strong>. In dieser Vorschrift s<strong>in</strong>d auch der Inhalt und die Durchführung sowie die Darstellung<br />
des Ergebnisses der Prüfung geregelt.<br />
Der Gegenstand der Jahresabschlussprüfung schließt neben se<strong>in</strong>en Bestandteilen und Anlagen auch die zu<br />
Grunde liegende Buchführung e<strong>in</strong>. Sie hat dazu beizutragen, dass der Jahresabschluss e<strong>in</strong> den tatsächlichen<br />
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de unter<br />
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelt. Daher muss die Buchführung den an sie<br />
gestellten Anforderungen entsprechen, damit der Jahresabschluss <strong>in</strong> der vorgeschriebenen Form aufgestellt<br />
werden kann, die vorgesehenen Angaben enthält und dafür die Vermögensgegenstände und Schulden richtig<br />
bewertet worden s<strong>in</strong>d.<br />
In der Vorschrift wird deshalb ausdrücklich bestimmt, dass <strong>in</strong> die Prüfung die Buchführung, die Inventur, das Inventar<br />
und die Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände e<strong>in</strong>zubeziehen<br />
s<strong>in</strong>d. Die Prüfung der Beachtung der gesetzlichen haushaltsrechtlichen Vorschriften, der Regelungen der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltssatzung sowie ergänzender Satzungen, aber auch weiterer ortsrechtlicher Bestimmungen<br />
ist ebenfalls e<strong>in</strong> wichtiger Gegenstand der Jahresabschlussprüfung. Zudem ist zu prüfen, ob muss der Lagebericht<br />
mit dem Jahresabschluss und den Erkenntnissen des Prüfers <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang steht. Die Angaben im Lagebericht<br />
dürfen nicht e<strong>in</strong>e falsche Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de<br />
erwecken und außerdem muss zu den künftigen Chancen und Risiken der Geme<strong>in</strong>de Auskunft gegeben werden.<br />
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat außerdem über Art und Umfang der Prüfung sowie über das Ergebnis der<br />
Prüfung e<strong>in</strong>en Prüfungsbericht zu erstellen. Der Bestätigungsvermerk oder der Vermerk über se<strong>in</strong>e Versagung ist<br />
GEMEINDEORDNUNG 577
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 96 GO <strong>NRW</strong><br />
<strong>in</strong> den Prüfungsbericht aufzunehmen. Diese Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss dient der Beratung<br />
des Rates und damit der Vorbereitung des Ratsbeschlusses.<br />
1.1.4.2 Die Übergabe des Prüfungsergebnisses<br />
Für die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses durch den Rat der Geme<strong>in</strong>de bedarf es der Rückgabe der<br />
dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung überlassenen Unterlagen und der Übergabe des erstellten Prüfungsberichtes<br />
(vgl. § 101 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>) sowie des vom Ausschussvorsitzenden unterzeichneten Bestätigungsvermerks<br />
(vgl. § 101 Abs. 7 GO <strong>NRW</strong>). Die Übergabe dieser Unterlagen an den Rat der Geme<strong>in</strong>de wird <strong>in</strong><br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Praxis i.d.R. dadurch vollzogen, dass durch den Bürgermeister e<strong>in</strong> entsprechender Tagesordnungspunkt<br />
auf die Tagesordnung der Sitzung des Rates gesetzt wird, denn sie oder er hat diese Tagesordnung<br />
<strong>in</strong> eigener Verantwortung festzulegen (vgl. § 48 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>). Im Rahmen der beschlussfähigen Zusammenkunft<br />
des Rates (Sitzung) kann dann die Übergabe als erledigt betrachtet werden. Sie ist aber dann nicht vollzogen,<br />
wenn nur den e<strong>in</strong>zelnen Ratsmitgliedern das Prüfungsergebnis zugesandt wird, auch wenn es wichtig ist,<br />
dass das Ratsmitglied über das Prüfungsergebnis <strong>in</strong>formiert ist.<br />
1.1.4.3 Die Stellungnahmen des Bürgermeisters und des Kämmerers<br />
E<strong>in</strong>e gute Zusammenarbeit zwischen dem Rechnungsprüfungsausschuss als Prüfungs<strong>in</strong>stanz und der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Verwaltung im Rahmen der örtlichen Rechnungsprüfung kann helfen, aufgetretene Fehler im geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Jahresabschluss, die der Vermittlung e<strong>in</strong>es den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bildes der Vermögens-,<br />
Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de entgegen stehen, zu beseitigen. Dadurch können Prüfungsbemerkungen<br />
auf die Fälle beschränkt werden, <strong>in</strong> denen trotz Erläuterungen seitens der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Verwaltung die Bedenken des Rechnungsprüfungsausschusses weiter bestehen. Dieses erfordert, dass der Bürgermeister<br />
und der Kämmerer den Entwurf des Prüfungsberichtes sowie des Prüfungsergebnisses vor der Abgabe<br />
an den Rat der Geme<strong>in</strong>de zur Kenntnisnahme erhalten, um ggf. e<strong>in</strong>e Stellungnahme abgeben zu können,<br />
denn ihnen ist das Recht dazu e<strong>in</strong>geräumt worden (vgl. § 101 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>).<br />
E<strong>in</strong>e solche Stellungnahme verändert nicht zwar unmittelbar das Ergebnis der Prüfung oder den Prüfungsbericht,<br />
der Rechnungsprüfungsausschuss hat diese aber <strong>in</strong> se<strong>in</strong>e Arbeit e<strong>in</strong>zubeziehen. Der Ausschuss erhält durch die<br />
Abgabe der Stellungnahme noch e<strong>in</strong>mal e<strong>in</strong>e Gelegenheit, se<strong>in</strong>e Arbeit zu überprüfen und sich zu entscheiden,<br />
ob er bei dem erzielten Ergebnis bleibt und dieses dem Rat als Prüfungsergebnis vorlegt. Gibt der Bürgermeister<br />
und/oder der Kämmerer e<strong>in</strong>e Stellungnahme ab, sollte der Rechnungsprüfungsausschuss diese zusammen mit<br />
se<strong>in</strong>em Prüfungsbericht dem Rat vorlegen, selbst dann, wenn er den Anregungen des Bürgermeisters und/oder<br />
des Kämmerers gefolgt ist. Diese Information stärkt die Zusammenarbeit zwischen dem Rat der Geme<strong>in</strong>de und<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung.<br />
1.1.5 Die Feststellung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses<br />
1.1.5.1 Beratungen über den geprüften Jahresabschlusses<br />
Die Bedeutung des Jahresabschlusses der Geme<strong>in</strong>de br<strong>in</strong>gt es mit sich, dass der Rat der Geme<strong>in</strong>de diesen nach<br />
der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss festzustellen hat. Mit dem geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss<br />
wird der Rat <strong>in</strong> die Lage versetzt, die wirtschaftliche Lage der Geme<strong>in</strong>de anhand von Ist-Werten und nicht nach<br />
den Plan-Werten des Haushaltsplans beurteilen zu können. Auf Grund des ihm von der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung<br />
vorgelegten und vom Rechnungsprüfungsausschusses geprüften Jahresabschlusses muss der Rat sich e<strong>in</strong><br />
Bild darüber machen, ob der Jahresabschluss e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bildes der<br />
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de vermittelt. Den Ratsmitgliedern wird mit dem<br />
GEMEINDEORDNUNG 578
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 96 GO <strong>NRW</strong><br />
Jahresabschluss und dem Lagebericht e<strong>in</strong> Überblick über die wichtigsten Ergebnisse der Haushaltswirtschaft im<br />
abgelaufenen Jahr und Rechenschaft darüber gegeben. Sie erhalten dadurch e<strong>in</strong> umfassendes und zutreffendes<br />
Bild über die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft. Daraus können sich H<strong>in</strong>weise für künftige Entscheidungen ergeben,<br />
die ggf. auch zu Belastungen der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft führen können. Dieses be<strong>in</strong>haltet, dass<br />
der Rat über das Prüfungsergebnis des Rechnungsprüfungsausschuss e<strong>in</strong>e eigene Me<strong>in</strong>ungsbildung herbeizuführen<br />
hat.<br />
Die Feststellung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses erfordert zuvor e<strong>in</strong>e Beratung des Rates, denn diese<br />
sichert die Entscheidungskompetenz der Ratsmitglieder, die nach Absatz 1 Satz 4 der Vorschrift zusätzlich noch<br />
über die Entlastung des Bürgermeisters zu entscheiden und bei e<strong>in</strong>er Verweigerung oder e<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>schränkung<br />
der Entlastung dafür die Gründe anzugeben haben. Den Ratsmitgliedern müssen deshalb die relevanten Unterlagen<br />
über den geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss verfügbar gemacht werden. Dabei s<strong>in</strong>d sie ggf. auf besondere<br />
Sachverhalte oder Umstände aufmerksam zu machen, die für ihre Entscheidung von Bedeutung s<strong>in</strong>d. In se<strong>in</strong>e<br />
Beratungen hat der Rat aber auch das Ergebnis der Prüfung des Rechnungsprüfungsausschusses nach § 101<br />
GO <strong>NRW</strong> e<strong>in</strong>zubeziehen. Dafür bedarf es der Rückgabe der dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung<br />
überlassenen Unterlagen an den Rat und der Übergabe des erstellten Prüfungsberichtes sowie e<strong>in</strong>es Bestätigungsvermerks.<br />
In diesem Zusammenhang ist auch die Kenntnis über die Beschlussvorschläge der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Verwaltung s<strong>in</strong>nvoll, die sich auf die Feststellung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses und auf die Entlastung<br />
des Bürgermeisters beziehen müssen.<br />
In die Ratsentscheidung über die Feststellung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses ist ggf. die Stellungnahme<br />
des Bürgermeisters und/oder des Kämmerers zum Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsausschusses zu<br />
berücksichtigen. Dieses ist <strong>in</strong>sbesondere dann sachgerecht, wenn der Rechnungsprüfungsausschuss e<strong>in</strong>en e<strong>in</strong>geschränkten<br />
Bestätigungsvermerk erteilt hat, der Bestätigungsvermerk auf Grund von Beanstandungen versagt<br />
worden ist oder der Bestätigungsvermerk deshalb versagt wurde, weil der Ausschuss als Prüfer nicht <strong>in</strong> der Lage<br />
war, e<strong>in</strong>e Beurteilung vorzunehmen. Die schriftlich geäußerte Auffassung des Bürgermeisters und/oder des<br />
Kämmerers zum Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsausschusses ist aber auch dann im Rahmen der Beratungen<br />
zu berücksichtigen, wenn bereits zuvor durch e<strong>in</strong>e Zusammenarbeit zwischen dem Rechnungsprüfungsausschuss<br />
als Prüfungs<strong>in</strong>stanz und der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung aufgetretene Fehler im Jahresabschluss, die<br />
der Vermittlung e<strong>in</strong>es den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags-<br />
und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de entgegen stehen, beseitigt worden s<strong>in</strong>d.<br />
1.1.5.2 Die Mitwirkung von Verfahrensbeteiligten<br />
1.1.5.2.1 Die Mitwirkung des Bürgermeisters<br />
Für die Mitwirkung des Bürgermeisters am Feststellungsbeschluss des Rates der Geme<strong>in</strong>de über den geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Jahresabschluss ist örtlich zu beurteilen, ob diese Mitwirkung sachlich geboten ist. E<strong>in</strong>erseits ist die Vorschrift<br />
des § 40 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> zu beachten, nach der der Bürgermeister e<strong>in</strong> Mitglied im Rat der Geme<strong>in</strong>de kraft<br />
Gesetzes ist und ihm e<strong>in</strong> Stimmrecht zusteht. Andererseits schränkt die Vorschrift die Rechte des Bürgermeisters<br />
nur für den Fall wieder e<strong>in</strong>, dass die Ratsmitglieder über se<strong>in</strong>e Entlastung entscheiden, denn <strong>in</strong> der Sache gilt er<br />
dann als befangen. Durch die Vorschrift wird daher der Bürgermeister nicht ausdrücklich von der Teilnahme an<br />
der Abstimmung über die Feststellung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses ausgeschlossen.<br />
In der Sache „Feststellung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses“ dürfte es jedoch aus Verfahrensgründen heraus<br />
geboten se<strong>in</strong>, dass der Bürgermeister auf die Ausübung des ihm nach § 40 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> zustehenden<br />
Stimmrechtes verzichtet. Nach § 95 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong> hat der Bürgermeister den ihm vom Kämmerer vorgelegten<br />
Entwurf des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses zu bestätigen, bevor er diesen dem Rat zuleitet. Er kommt dieser<br />
Pflicht durch se<strong>in</strong>e Unterzeichnung des Entwurfs nach und übernimmt damit die verwaltungsmäßige Verantwortung,<br />
denn er ist verantwortlich für die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwal-<br />
GEMEINDEORDNUNG 579
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 96 GO <strong>NRW</strong><br />
tung (vgl. § 62 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>). Außerdem steht dem Bürgermeister <strong>in</strong> diesem Zusammenhang neben se<strong>in</strong>er<br />
Verantwortung für den geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss auch e<strong>in</strong> Änderungsrecht bezogen auf den Entwurf des<br />
Kämmerers zu.<br />
1.1.5.2.2 Die Mitwirkung des Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses<br />
Für die Mitwirkung des Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses am Feststellungsbeschluss des Rates<br />
der Geme<strong>in</strong>de über den geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss ist örtlich zu beurteilen, ob diese Mitwirkung sachlich<br />
geboten ist. E<strong>in</strong>erseits ist der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses e<strong>in</strong> Mitglied im Rat der Geme<strong>in</strong>de<br />
und ihm steht daher e<strong>in</strong> Stimmrecht zu. Andererseits schränkt die Vorschrift des § 31 die Rechte von Ratsmitgliedern<br />
nur für den Fall e<strong>in</strong>, dass die <strong>in</strong> der Vorschrift genannten Ausschließungsgründe vorliegen, so dass die<br />
betreffenden Ratsmitglieder dann <strong>in</strong> der Sache als befangen gelten. In ke<strong>in</strong>er Vorschrift der Geme<strong>in</strong>deordnung<br />
wird aber der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses ausdrücklich von der Teilnahme an der Abstimmung<br />
über die Feststellung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses ausgeschlossen.<br />
In der Sache „Feststellung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses“ dürfte es jedoch aus Verfahrensgründen heraus<br />
geboten se<strong>in</strong>, dass der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses auf die Ausübung se<strong>in</strong>es ihm zustehenden<br />
Stimmrechtes verzichtet. Nach § 101 Abs. 7 GO <strong>NRW</strong> hat der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses<br />
nach der Prüfung des ihm vom Rat übergebenen Entwurf des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses<br />
den dazugehörigen Bestätigungsvermerk zu unterzeichnen, bevor er den geprüften Entwurf wieder dem Rat<br />
zurückgibt. Diese Pflicht ist ausdrücklich <strong>in</strong> der Vorschrift bestimmt worden. Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses<br />
übernimmt durch se<strong>in</strong>e Unterzeichnung die Verantwortung für das Ergebnis der Abschlussprüfung,<br />
denn der Ausschuss ist gesetzlich für diese Prüfung zuständig (vgl. § 59 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong>).<br />
1.1.5.3 Der Feststellungsbeschluss<br />
Der Rat der Geme<strong>in</strong>de hat nach se<strong>in</strong>en Beratungen, <strong>in</strong> denen bestehende Bedenken ausreichend erörtert oder<br />
ausgeräumt worden s<strong>in</strong>d, und der vorgenommenen Me<strong>in</strong>ungsbildung, die e<strong>in</strong>e Prüfung des vorgelegten Jahresabschlusses<br />
und E<strong>in</strong>beziehung des förmlichen Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss be<strong>in</strong>haltet, den<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss durch Beschluss festzustellen. Dieser Beschluss kann auf Vorschlägen aufbauen,<br />
die sich auf die Feststellung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses und auf die Entlastung des Bürgermeisters<br />
beziehen müssen und im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung entstanden s<strong>in</strong>d. Der Beschluss ist<br />
durch den Rat zu fassen, denn er kann diese Aufgabe nicht auf e<strong>in</strong>en se<strong>in</strong>er Ausschüsse übertragen (vgl. § 41<br />
Abs. 1 S. Buchst. J) GO <strong>NRW</strong>).<br />
Die Vornahme der Feststellung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses stellt e<strong>in</strong>e Erklärung des Rates der Geme<strong>in</strong>de<br />
dar, dass der ihm zugeleitete Jahresabschluss den gesetzlichen Anforderungen entspricht, das erreichte<br />
Ergebnis der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr und die Auswirkungen daraus<br />
auf das Vermögen und die Schulden der Geme<strong>in</strong>de sowie die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung<br />
der Geme<strong>in</strong>de zutreffend dargestellt s<strong>in</strong>d. Hat sich aus der Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses oder<br />
aus der Beratung des Rates über den Jahresabschluss aber noch e<strong>in</strong> Änderungsbedarf ergeben, muss vor der<br />
Beschlussfassung über die Feststellung der geme<strong>in</strong>dliche Jahresabschluss nicht zw<strong>in</strong>gend <strong>in</strong> entsprechender<br />
Weise überarbeitet werden.<br />
In den Fällen, <strong>in</strong> denen sich der Änderungsbedarf klar und e<strong>in</strong>deutig bestimmen lässt, kann es als ausreichend<br />
angesehen werden, wenn im Ratsbeschluss über die Feststellung e<strong>in</strong>e oder mehrere Maßgaben für die Vornahme<br />
der Änderungen des Jahresabschlusses im S<strong>in</strong>ne des Rates enthalten s<strong>in</strong>d. Es entsteht dadurch e<strong>in</strong> Auftrag<br />
an die geme<strong>in</strong>dliche Verwaltung und obliegt dann dem Bürgermeister für die Erledigung dieses Auftrages Sorge<br />
zu tragen und den geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss <strong>in</strong> die vom Rat beschlossene Form zu br<strong>in</strong>gen. Erst nach<br />
GEMEINDEORDNUNG 580
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 96 GO <strong>NRW</strong><br />
Erledigung dieses Auftrages liegt e<strong>in</strong>e Fassung des Jahresabschlusses der Geme<strong>in</strong>de vor, die zum Gegenstand<br />
der Anzeige an die Aufsichtsbehörde und zum Gegenstand der gesetzlich vorgesehenen Bekanntmachung gemacht<br />
werden kann.<br />
Die Feststellung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses be<strong>in</strong>haltet zudem die noch fehlenden Zustimmungen des<br />
Rates zur Ausführung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr. E<strong>in</strong>e erforderliche<br />
Zustimmung zu über oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen kann nach der Feststellung als<br />
erteilt angesehen werden. Der Rat muss sich daher im Rahmen der Feststellung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses<br />
entscheiden, ob er diese Zustimmungen nachträglich erteilen will oder ob er ihr Fehlen <strong>in</strong> E<strong>in</strong>zelfällen<br />
als unwichtig und deshalb nicht entscheidend für die Feststellung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses ansehen<br />
will oder ob er deshalb die Feststellung ggf. sogar e<strong>in</strong>schränken will.<br />
Der Rat hat für se<strong>in</strong>e Beratungstätigkeit sowie für die Erledigung der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss<br />
die zeitliche Begrenzung <strong>in</strong> dieser Vorschrift zu beachten, nach der er die Feststellung des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Jahresabschlusses bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres vorzunehmen hat.<br />
Die zeitliche Begrenzung <strong>in</strong> der Vorschrift soll gewährleisten, dass ggf. noch Auswirkungen auf die künftige<br />
Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de unverzüglich umgesetzt werden können. Außerdem soll der Zeitraum zwischen<br />
dem jeweiligen Abschlussstichtag und der Feststellung des Jahresabschlusses noch vertretbar bleiben und<br />
örtlich auch nicht unnötig ausgeweitet werden. Unter diesen Gesichtspunkten bietet es sich an, die Feststellung<br />
des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses so früh wie möglich vorzunehmen und nicht damit bis zum letzten gesetzlich<br />
zulässigen Zeitpunkt zu warten.<br />
1.2 Zu Satz 2 (Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses):<br />
1.2.1 Die Verpflichtung zur Beschlussfassung<br />
Die Vorschrift verpflichtet den Rat der Geme<strong>in</strong>de, im Zusammenhang mit se<strong>in</strong>er Feststellung des Jahresabschlusses<br />
für das abgelaufene Haushaltsjahr auch über die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung<br />
des Jahresfehlbetrages zu beschließen. Das Jahresergebnis des wirtschaftlichen Handelns der Geme<strong>in</strong>de<br />
ist als Saldo aus den im abgelaufenen Haushaltsjahr erzielten Erträgen und entstandenen Aufwendungen<br />
<strong>in</strong> der Ergebnisrechnung als Bestandteil des Jahresabschlusses enthalten. Mit der Ergebnisrechnung werden der<br />
Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen der Geme<strong>in</strong>de im abgelaufenen Haushaltsjahr transparent<br />
und nachvollziehbar gemacht. Außerdem wird durch das Jahresergebnis nachgewiesen, ob und wie die<br />
Geme<strong>in</strong>de ihre Verpflichtung zum Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> erfüllt hat.<br />
1.2.2 Der Vorschlag des Bürgermeisters für die Beschlussfassung<br />
Der Bürgermeister hat dem Rat der Geme<strong>in</strong>de grundsätzlich e<strong>in</strong>e Bilanz ohne vorweggenommene Verwendung<br />
des Jahresergebnisses vorzulegen, so dass die Bilanz i.d.R. noch ke<strong>in</strong>en Bilanzposten „Bilanzgew<strong>in</strong>n“ oder „Bilanzverlust“<br />
aufweisen sollte und der Rat eigenständig und eigenverantwortlich über das erzielte haushaltswirtschaftliche<br />
Jahresergebnis der Geme<strong>in</strong>de entscheiden kann. Wenn aber vor Ort ausreichend sicher ist, dass der<br />
Rat der Beschlussempfehlung des Bürgermeisters zur Ergebnisverwendung folgen wird und der Rechnungsprüfungsausschuss<br />
gegen die Feststellung des Jahresabschlusses mit e<strong>in</strong>er dar<strong>in</strong> enthaltenen Empfehlung ke<strong>in</strong>e<br />
Bedenken hat, ist es vertretbar, <strong>in</strong> der Bilanz im geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss bereits die Ergebnisverwendung<br />
vorzunehmen und das aus der Verrechnung entstandene Ergebnis gesondert nach dem Bilanzposten „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“<br />
unter dem zusätzlichen Bilanzposten „Bilanzgew<strong>in</strong>n/Bilanzverlust“ anzusetzen.<br />
GEMEINDEORDNUNG 581
1.2.3 Möglicher Inhalt des Verwendungsbeschlusses<br />
1.2.3.1 Die Verwendung des Jahresüberschusses<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 96 GO <strong>NRW</strong><br />
1.2.3.1.1 Zuführung zur Ausgleichsrücklage/allgeme<strong>in</strong>en Rücklage<br />
Im Rahmen se<strong>in</strong>er Beschlussfassung über die Verwendung des erzielten haushaltswirtschaftlichen Jahresergebnisses<br />
der Geme<strong>in</strong>de hat der Rat mehrere Möglichkeiten. Er kann grundsätzlich beschließen, den Jahresüberschuss<br />
der Ausgleichsrücklage oder der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage ggf. auch der Sonderrücklage zur Sicherung der<br />
Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen zuzuführen. E<strong>in</strong>e Zuführung des Jahresüberschuss zur Ausgleichsrücklage<br />
ist immer dann vorzunehmen, wenn die Ausgleichsrücklage nicht den <strong>in</strong> der Eröffnungsbilanz<br />
zulässigen Bestand mehr erreicht (vgl. § 75 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong>), weil mit der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage<br />
der fiktive Haushaltsausgleich erreicht werden kann. E<strong>in</strong>e Aufteilung der Zuführung des Jahresüberschusses<br />
auf die Ausgleichsrücklage und die allgeme<strong>in</strong>e Rücklage ist dann möglich, wenn der erzielte Jahresüberschuss<br />
den möglichen Auffüllbetrag für die Ausgleichsrücklage übersteigt. Wenn beschlossen werden soll, den<br />
erzielten Jahresüberschuss <strong>in</strong> voller Höhe der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage zuzuführen, sollte zuvor geprüft worden<br />
se<strong>in</strong>, <strong>in</strong> welchem Umfang <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz noch die Ausgleichsrücklage besteht.<br />
Bei dem örtlichen Verwendungsbeschluss ist zu beachten, dass sich das geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsausgleichssystem<br />
nach § 75 GO <strong>NRW</strong> unmittelbar auf die Behandlung bzw. Verwendung des erzielten Jahresüberschusses<br />
auswirkt. Wird bei e<strong>in</strong>er nur sehr ger<strong>in</strong>gen Ausgleichsrücklage ausschließlich e<strong>in</strong>e Zuführung zur allgeme<strong>in</strong>en<br />
Rücklage vorgenommen, besteht das Risiko, dass die Geme<strong>in</strong>de bei e<strong>in</strong>em Fehlbetrag <strong>in</strong> der Ergebnisrechnung<br />
nicht mehr ihrer Verpflichtung zum Haushaltsausgleich nachkommt, obwohl ihr das durch entsprechende Verwendungsbeschlüsse<br />
<strong>in</strong> den Vorjahren möglich gewesen wäre.<br />
Diese Betrachtung gilt nicht nur für den orig<strong>in</strong>ären Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>, sondern auch<br />
für den „fiktiven“ Ausgleich nach Absatz 3 der genannten Vorschrift. Außerdem ist zu beachten, dass unter Berücksichtigung<br />
der Haushaltsausgleichsregelung <strong>in</strong> § 75 GO <strong>NRW</strong> <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz ke<strong>in</strong>e weitere<br />
Rücklage für die Gestaltung des jährlichen Haushaltausgleichs angesetzt werden darf. Es ist daher nicht zulässig,<br />
im geme<strong>in</strong>dlichen Eigenkapital z.B. e<strong>in</strong>e Gew<strong>in</strong>nverwendungsrücklage anzusetzen, denn dadurch würde die<br />
ausdrücklich gesetzlich bestimmten Funktionen der Ausgleichsrücklage und der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage bee<strong>in</strong>trächtigt.<br />
1.2.3.1.2 Zuführung zur Sonderrücklage (Re<strong>in</strong>vestitionsrücklage)<br />
Im Rahmen se<strong>in</strong>er Beschlussfassung über die Verwendung des erzielten haushaltswirtschaftlichen Jahresergebnisses<br />
der Geme<strong>in</strong>de kann der Rat auch beschließen, den Jahresüberschuss (<strong>in</strong> voller Höhe oder anteilig) e<strong>in</strong>er<br />
Sonderrücklage nach § 43 Abs. 4 GemHVO <strong>NRW</strong> zuzuführen. E<strong>in</strong>e solche Sonderrücklage darf von der Geme<strong>in</strong>de<br />
gebildet werden, um die vom Rat beschlossene Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen<br />
zu sichern (Re<strong>in</strong>vestitionsrücklage). Deshalb können dieser Sonderrücklage z.B. „Gew<strong>in</strong>ne“ aus der Veräußerung<br />
von geme<strong>in</strong>dlichen Vermögensgegenständen, die im Jahresergebnis der Geme<strong>in</strong>de enthalten s<strong>in</strong>d, zugeführt<br />
werden. Für die Zuführung zu e<strong>in</strong>er solchen Sonderrücklage könnten z.B. Erträge genutzt werden, die dadurch<br />
entstehen können, dass für geme<strong>in</strong>dliche Grundstücke, die mit ihrem Anschaffungspreis bilanziert s<strong>in</strong>d und ke<strong>in</strong>er<br />
Abschreibung unterliegen, e<strong>in</strong> Veräußerungserlös erzielt wird, der über dem Buchwert liegt.<br />
1.2.3.2 Die Abdeckung des Jahresfehlbetrages<br />
Im Rahmen se<strong>in</strong>er Beschlussfassung über die Verwendung des erzielten haushaltswirtschaftlichen Jahresergebnisses<br />
der Geme<strong>in</strong>de soll der Rat über dessen Verwendung beschließen. Schließt die geme<strong>in</strong>dliche Ergebnis-<br />
GEMEINDEORDNUNG 582
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 96 GO <strong>NRW</strong><br />
rechnung mit e<strong>in</strong>em Jahresfehlbetrag ab, eröffnen sich für den Rat der Geme<strong>in</strong>de - anders als bei e<strong>in</strong>em ausgewiesenen<br />
Jahresüberschuss - zwar grundsätzliche, aber ke<strong>in</strong>e tatsächlichen Entscheidungsmöglichkeiten. Die<br />
B<strong>in</strong>dung des Rates entsteht <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em solchen Fall durch die e<strong>in</strong>schlägigen haushaltsrechtlichen Vorschriften. Der<br />
Rat hat zu beachten, dass aus der “Pufferfunktion“ der Ausgleichsrücklage und ihrem Ansatz als gesonderter<br />
Posten <strong>in</strong>nerhalb des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz sich die Verpflichtung zur vorrangigen Inanspruchnahme<br />
der Ausgleichsrücklage vor der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage bei e<strong>in</strong>em Jahresfehlbetrag ableiten.<br />
Dieses Vorgehen hat der Gesetzgeber mit der Ausgleichsfiktion der Ausgleichsrücklage nach § 75 Abs. 2 S. 3<br />
GO <strong>NRW</strong> deutlich zum Ausdruck gebracht, die auch für den Jahresabschluss gelten soll, denn <strong>in</strong> jedem Jahr<br />
muss der geme<strong>in</strong>dliche Haushalt auch <strong>in</strong> der Rechnung ausgeglichen se<strong>in</strong> (vgl. § 75 Abs. 2 S. 1 GO <strong>NRW</strong>). Bildet<br />
die Kommune e<strong>in</strong>e Ausgleichsrücklage, ist sie nach der Haushaltssystematik der gestuften Ausgleichsregelungen<br />
verpflichtet, die Ausgleichsrücklage vor der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage zur Abdeckung ihres Jahresfehlbetrages <strong>in</strong><br />
Anspruch zu nehmen.<br />
E<strong>in</strong>e Wahlmöglichkeit steht der Geme<strong>in</strong>de dabei wegen der gesetzlichen Ausgleichsverpflichtung nicht zu. Kann<br />
die Geme<strong>in</strong>de dieser Verpflichtung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gem. § 75 Abs. 2 S. 3 GO<br />
<strong>NRW</strong> nachkommen, bleibt ke<strong>in</strong> Raum für die Inanspruchnahme der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage, mit deren Hilfe gerade<br />
nicht der (fiktive) Haushaltsausgleich herbeigeführt werden kann. Die Verpflichtung zur vorrangigen Inanspruchnahme<br />
zur Abdeckung e<strong>in</strong>es Jahresfehlbetrages besteht auch dann, wenn die Mittel der Ausgleichsrücklage nicht<br />
zur Deckung ausreichen und zusätzlich die allgeme<strong>in</strong>e Rücklage <strong>in</strong> Anspruch dafür genommen werden muss. Die<br />
Nebenbestimmungen der Genehmigung zur Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage s<strong>in</strong>d dann so zu fassen,<br />
dass sie geeignet s<strong>in</strong>d, das Ziel, den jährlichen Haushaltsausgleich mit Hilfe von Konsolidierungsmaßnahmen<br />
wiederherzustellen, zu erreichen. Die vorrangige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist auch bei der Beurteilung<br />
e<strong>in</strong>es Haushaltssicherungskonzeptes zu beachten.<br />
1.3 Zu Satz 3 (Stellungnahme des Kämmerers zum Jahresabschluss):<br />
Dem Kämmerer ist - wie beim Erlass der Haushaltssatzung (vgl. § 80 GO <strong>NRW</strong>) - auch bei der Feststellung des<br />
Jahresabschlusses e<strong>in</strong> gesetzliches Anhörungsrecht im Rat e<strong>in</strong>geräumt worden, wenn er zuvor e<strong>in</strong>e Stellungnahme<br />
über se<strong>in</strong>e abweichende Auffassung über den Jahresabschluss gegenüber dem Bürgermeister abgegeben<br />
hat (vgl. § 95 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong>). Weicht der Bürgermeister von dem ihm vom Kämmerer vorgelegten Entwurf<br />
des Jahresabschlusses ab, und macht der Kämmerer von dem Recht Gebrauch, se<strong>in</strong>e abweichende Auffassung<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er schriftlichen Stellungnahme darzulegen, ist der Bürgermeister verpflichtet, diese mit dem Entwurf des<br />
Jahresabschlusses dem Rat vorzulegen. Die Stellungnahme des Kämmerers ist dabei nicht e<strong>in</strong> Teil des Entwurfs<br />
des Jahresabschlusses. Sie berührt lediglich das Aufstellungsverfahren des Entwurfs des Jahresabschlusses mit<br />
se<strong>in</strong>en Anlagen, den der Rat festzustellen hat. Es ist ausreichend, wenn der Rat vor der Feststellung des Jahresabschlusses<br />
über die abweichende Auffassung des Kämmerers zum Entwurf <strong>in</strong>formiert worden ist.<br />
Die schriftliche Stellungnahme des Kämmerers über se<strong>in</strong>e abweichende Auffassung ist e<strong>in</strong> Teil der vom Bürgermeister<br />
erstellten Beschlussvorlage und nicht e<strong>in</strong> Teil des Entwurfs des Jahresabschlusses, auch dann nicht,<br />
wenn im Ergebnis der Rat der Auffassung des Kämmerers folgt. Das Recht des Kämmerers, e<strong>in</strong>e abweichende<br />
Auffassung zum durch den Bürgermeister veränderten Entwurf im Rat der Geme<strong>in</strong>de zu vertreten, setzt jedoch<br />
voraus, dass er zuvor <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er schriftlichen Stellungnahme se<strong>in</strong>e abweichende Auffassung dargelegt hat. Liegt<br />
e<strong>in</strong>e schriftliche Stellungnahme des Kämmerers vor, kann die dar<strong>in</strong> geäußerte abweichende Auffassung zum<br />
Entwurf des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses nicht vom Bürgermeister im Rat der Geme<strong>in</strong>de vorgetragen werden,<br />
sondern nur vom Kämmerer selbst, der dafür anwesend se<strong>in</strong> muss. Diese Handhabung f<strong>in</strong>det auch <strong>in</strong> den<br />
Fällen Anwendung, <strong>in</strong> denen der Kämmerer e<strong>in</strong>e schriftliche Stellungnahme nach § 101 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> zum<br />
Prüfungsergebnis des Rechnungsprüfungsausschusses über den Jahresabschluss abgegeben hat.<br />
GEMEINDEORDNUNG 583
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 96 GO <strong>NRW</strong><br />
1.4 Zu den Satz 4 (Entlastung des Bürgermeisters durch die Ratsmitglieder):<br />
1.4.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die Ratsmitglieder im Rat der Geme<strong>in</strong>de entscheiden über die Entlastung des Bürgermeisters. Die Entlastung ist<br />
e<strong>in</strong>e Festlegung der Ratsmitglieder dah<strong>in</strong>gehend, dass auf Grund des vorgelegten Jahresabschlusses und der<br />
vorgenommen Prüfung ke<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>wendungen gegen die Haushaltsführung des Bürgermeisters erhoben werden. In<br />
diesem Zusammenhang ist die Vorschrift des § 40 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> zu beachten, nach der der Bürgermeister<br />
kraft Gesetzes e<strong>in</strong> Mitglied im Rat der Geme<strong>in</strong>de ist und ihm e<strong>in</strong> Stimmrecht zu steht. Die Vorschrift schränkt aber<br />
gleichzeitig die Stimmrechte des Bürgermeisters wieder e<strong>in</strong>, denn er gilt, wenn die Ratsmitglieder durch Beschluss<br />
über se<strong>in</strong>e Entlastung entscheiden, <strong>in</strong> der Sache als befangen. Durch die Vorschrift wird daher der Bürgermeister<br />
ausdrücklich von der Teilnahme an der Abstimmung über se<strong>in</strong>e Entlastung ausgeschlossen.<br />
Im Rahmen ihrer Beratungen über den geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss und ihrer Entscheidung über die Entlastung<br />
des Bürgermeisters haben sie die Haushaltsführung des Bürgermeisters zu würdigen. E<strong>in</strong>e sorgfältige Beurteilung<br />
der Sachlage zur Entlastung des Bürgermeisters ist <strong>in</strong>sbesondere dann notwendig, wenn der Rechnungsprüfungsausschuss<br />
e<strong>in</strong>en e<strong>in</strong>geschränkten Bestätigungsvermerk erteilt hat, der Bestätigungsvermerk auf Grund<br />
von Beanstandungen von ihm versagt worden ist oder der Bestätigungsvermerk deshalb von ihm versagt wurde,<br />
weil der Ausschuss nicht <strong>in</strong> der Lage war, e<strong>in</strong>e Beurteilung über den geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss vorzunehmen.<br />
Auf diese Sorgfaltspflicht kann nicht deswegen verzichtet werden, weil bereits zuvor durch e<strong>in</strong>e Zusammenarbeit<br />
zwischen dem Rechnungsprüfungsausschuss als zuständige Prüfungs<strong>in</strong>stanz und der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Verwaltung versucht wurde, die im Jahresabschluss aufgetretenen Fehler zu beseitigen.<br />
E<strong>in</strong>e Entlastung des Bürgermeisters ersetzt aber nicht gleichzeitig die fehlenden Zustimmungen des Rates für die<br />
Ausführung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft. Der Rat muss sich vielmehr bereits im Rahmen der Feststellung<br />
des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses entscheiden, ob er noch nicht erteilte Zustimmungen nachträglich<br />
erteilen will bzw. <strong>in</strong> se<strong>in</strong>e Feststellung e<strong>in</strong>schließt oder ob er ihr Fehlen <strong>in</strong> E<strong>in</strong>zelfällen als unwichtig und deshalb<br />
nicht entscheidend für die Art der Entlastung des Bürgermeisters ansehen will oder ob er deshalb die Entlastung<br />
des Bürgermeisters e<strong>in</strong>schränken will. Dem Bürgermeister wird aber grundsätzlich e<strong>in</strong> Anspruch auf se<strong>in</strong>e Entlastung<br />
zugestanden, wenn von ihm die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr ordnungsgemäß<br />
geführt worden ist. Die Entlastung des Bürgermeisters kann vorbehaltlos oder mit Vorbehalten ausgesprochen,<br />
aber auch verweigert werden.<br />
1.4.2 Der Entlastungsbeschluss ohne Vorbehalte<br />
E<strong>in</strong> vorbehaltloser Entlastungsbeschluss br<strong>in</strong>gt zum Ausdruck, dass sich der Rat bzw. die Ratsmitglieder mit der<br />
Haushaltswirtschaft, wie sie sich aus der Prüfung des Jahresabschlusses durch den Rechnungsprüfungsausschuss<br />
darstellt, e<strong>in</strong>verstanden erklären und das Ergebnis der Haushaltswirtschaft billigen. Mit der Erteilung der<br />
Entlastung verzichten die Ratsmitglieder darauf, die bei der Prüfung festgestellten und nicht ausgeräumten Mängel<br />
nicht weiter zu beanstanden. Das bedeutet allerd<strong>in</strong>gs nicht, dass diese Mängel, soweit sie im Prüfungsbericht<br />
benannt s<strong>in</strong>d, als beseitigt anzusehen s<strong>in</strong>d. Soweit e<strong>in</strong>e Behebung möglich ist, muss vom Bürgermeister für die<br />
Ausräumung solcher Beanstandungen Sorge getragen werden. Soweit e<strong>in</strong>e Behebung möglich ist, muss vom<br />
Bürgermeister für die Ausräumung solcher Beanstandungen Sorge getragen werden.<br />
1.4.3 Der Entlastungsbeschluss mit Vorbehalten<br />
Die Ratsmitglieder können die Entlastung des Bürgermeisters auch mit Vorbehalten oder mit E<strong>in</strong>schränkungen<br />
aussprechen. E<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>schränkung wird i.d.R. dann notwendig se<strong>in</strong>, wenn festgestellte Mängel bei der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltswirtschaft bis zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Entlastung des Bürgermeisters noch<br />
GEMEINDEORDNUNG 584
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 96 GO <strong>NRW</strong><br />
nicht ausgeräumt werden konnten und deren Gewicht/Bedeutung aber so groß ist, dass e<strong>in</strong>e une<strong>in</strong>geschränkte<br />
Entlastung nicht geboten ist. So könnte e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>schränkung der Entlastung des Bürgermeisters dann vorzunehmen<br />
se<strong>in</strong>, wenn aus Sicht des Rates e<strong>in</strong>e fehlerhafte Haushaltsführung im abgelaufenen Haushaltsjahr entstanden<br />
ist, die z.B. ohne Zustimmung des Rates zu erheblichen geme<strong>in</strong>dlichen Belastungen führen wird.<br />
Bei der Entscheidung über e<strong>in</strong>e Entlastung des Bürgermeisters, die mit E<strong>in</strong>schränkungen ausgesprochen werden<br />
soll, ist ggf. die Stellungnahme des Bürgermeisters und/oder des Kämmerers zum Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsausschusses<br />
zu berücksichtigen, <strong>in</strong>sbesondere dann, wenn der Rechnungsprüfungsausschuss<br />
e<strong>in</strong>en e<strong>in</strong>geschränkten Bestätigungsvermerk erteilt hat. Dies gilt auch dann, wenn zuvor bereits durch e<strong>in</strong>e Zusammenarbeit<br />
zwischen der Prüfungs<strong>in</strong>stanz und der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung die im Jahresabschluss aufgetretenen<br />
Fehler beseitigt worden s<strong>in</strong>d. Wird die Entlastung des Bürgermeisters mit Vorbehalten oder E<strong>in</strong>schränkungen<br />
ausgesprochen, s<strong>in</strong>d die Gründe dafür gegenüber dem Bürgermeister anzugeben. In solchen Fällen kann<br />
dann der Rat der Geme<strong>in</strong>de die notwendigen Anordnungen und Maßnahmen treffen, die der Beseitigung der<br />
festgestellten Mängel dienen müssen.<br />
1.5 Zu Satz 5 (Verweigerung der Entlastung des Bürgermeisters):<br />
Nach der Vorschrift haben die Ratsmitglieder auch die Möglichkeit, die Entlastung des Bürgermeisters zu verweigern<br />
oder diese mit E<strong>in</strong>schränkungen auszusprechen. E<strong>in</strong>e Verweigerung der Entlastung dürfte sich jedoch i.d.R.<br />
auf die Fälle beschränken, <strong>in</strong> denen schwerwiegende Verstöße vorliegen, die dienstrechtliche Maßnahmen und<br />
Schadensersatzansprüche notwendig machen. Dabei kommt es auch darauf an, welches Gewicht die Summe<br />
dieser Verstöße im Rahmen der gesamten Haushaltswirtschaft hat und ob die Verweigerung der Entlastung nach<br />
dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der Mittel vertretbar und geboten ist.<br />
Bei der Entscheidung über die Verweigerung der Entlastung des Bürgermeisters ist ggf. se<strong>in</strong>e Stellungnahme<br />
und/oder des Kämmerers zum Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsausschusses zu berücksichtigen, <strong>in</strong>sbesondere<br />
dann, wenn der Rechnungsprüfungsausschuss den Bestätigungsvermerk auf Grund von Beanstandungen<br />
versagt hat oder der Bestätigungsvermerk deshalb versagt wurde, weil der Ausschuss als Prüfer nicht <strong>in</strong> der<br />
Lage war, e<strong>in</strong>e Beurteilung vorzunehmen. Dies gilt auch dann, wenn zuvor bereits durch e<strong>in</strong>e Zusammenarbeit<br />
zwischen der Prüfungs<strong>in</strong>stanz und der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung die im Jahresabschluss aufgetretenen Fehler<br />
beseitigt worden s<strong>in</strong>d.<br />
Es muss <strong>in</strong> den Fällen der Verweigerung der Entlastung des Bürgermeisters durch die Ratsmitglieder konkret<br />
dargelegt werden, welche Verhaltensweisen des Verantwortlichen <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>de oder welche Ergebnisse der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft als Verstoß gegen die beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen<br />
bewertet werden und weshalb sie als so erheblich e<strong>in</strong>gestuft werden, dass dadurch dem Bürgermeister die Entlastung<br />
verweigert wird. Die Ratsmitglieder haben deshalb bei e<strong>in</strong>er Verweigerung der Entlastung des Bürgermeisters,<br />
ihm gegenüber die Gründe dafür anzugeben. In solchen Fällen hat der Rat der Geme<strong>in</strong>de dann die<br />
notwendigen Anordnungen und Maßnahmen zu treffen, die der Beseitigung der festgestellten Mängel dienen<br />
müssen.<br />
1.6 Zu Satz 6 (Verweigerung der Feststellung des Jahresabschlusses):<br />
Dem Rat der Geme<strong>in</strong>de steht das Recht zu, die Feststellung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses nicht nur<br />
vorbehaltlos oder mit Vorbehalten auszusprechen, sondern auch zu verweigern. E<strong>in</strong>e Verweigerung der Feststellung<br />
dürfte sich i.d.R. auf die Fälle beschränken, <strong>in</strong> denen schwerwiegende Verstöße bei der Ausführung der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft vorliegen, die ggf. auch Schadensersatzansprüche notwendig machen. Dabei<br />
kommt es auch darauf an, welches Gewicht die Summe dieser Verstöße im Rahmen der gesamten Haushalts-<br />
GEMEINDEORDNUNG 585
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 96 GO <strong>NRW</strong><br />
wirtschaft hat. Bestehen für den Rat e<strong>in</strong> oder mehrere Anlässe, die Feststellung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses<br />
zu verweigern, so hat er die Gründe dafür gegenüber dem Bürgermeister anzugeben.<br />
Dem Bürgermeister wird e<strong>in</strong> Anspruch gegenüber dem Rat der Geme<strong>in</strong>de auf e<strong>in</strong>e Begründung bei der Verweigerung<br />
der Feststellung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses oder bei e<strong>in</strong>er Feststellung mit E<strong>in</strong>schränkungen<br />
zugestanden. Vom Rat der Geme<strong>in</strong>de muss <strong>in</strong> diesen Fällen konkret dargelegt werden, welche Verhaltensweisen<br />
oder Ergebnisse der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft als Verstoß gegen die beschlossene Haushaltssatzung<br />
mit ihren Anlagen oder gegen den Jahresabschluss gewertet wurden oder welche Mängel <strong>in</strong> der Haushaltsführung<br />
von so erheblichem Gewicht s<strong>in</strong>d, dass die Feststellung des Jahresabschlusses zu verweigern oder e<strong>in</strong>zuschränken<br />
ist. In diesen Fällen kann der Rat weitere Anordnungen treffen, die der Beseitigung der festgestellten<br />
Verstöße dienen müssen.<br />
2. Zu Absatz 2 (Anzeige und Veröffentlichung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses):<br />
2.01 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die Vorschrift sieht vor, dass der vom Rat festgestellte Jahresabschluss der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen<br />
und öffentlich bekannt zu machen ist. Wegen der Bedeutung des Jahresabschlusses für die Haushaltswirtschaft<br />
der Geme<strong>in</strong>de sollte dieser möglichst nicht vor der Anzeige an die Aufsichtsbehörde öffentlich bekannt<br />
gemacht werden. Es sollte zudem durch geeignete Informationen vor der Veröffentlichung des Jahresabschlusses<br />
möglichst sichergestellt werden, dass die Aufsichtsbehörde ke<strong>in</strong>e rechtlichen Bedenken gegen den festgestellten<br />
Jahresabschluss erheben wird. Nach se<strong>in</strong>er öffentlichen Bekanntmachung ist der Jahresabschluss bis zur<br />
Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur E<strong>in</strong>sichtnahme verfügbar zu halten.<br />
2.1 Zu Satz 1 (Anzeige des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses):<br />
2.1.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Aus der ausschlaggebenden Bedeutung, die der Jahresabschluss für den Nachweis der Erfüllung der kommunalen<br />
Aufgaben hat, ergibt sich die Notwendigkeit für die Aufsichtsbehörde, sich jeweils zum Ende e<strong>in</strong>es Haushaltsjahres<br />
e<strong>in</strong>en Überblick über die wirtschaftliche Lage der Geme<strong>in</strong>de zu verschaffen. Die mit dem Jahresabschluss<br />
der Aufsichtsbehörde der Geme<strong>in</strong>de vorzulegenden Unterlagen s<strong>in</strong>d für e<strong>in</strong>e Gesamtübersicht über die Vermögens-,<br />
Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de, die auch die Aufsichtsbehörde haben sollte, unverzichtbar.<br />
Dieses bedeutet, dass der Aufsichtsbehörde der Jahresabschluss mit allen se<strong>in</strong>en Bestandteilen und<br />
Anlagen, die auch dem Rat bei se<strong>in</strong>er Feststellung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses vorlagen, vorzulegen<br />
s<strong>in</strong>d, e<strong>in</strong>schließlich des geme<strong>in</strong>dlichen Lageberichts.<br />
Die Regelung <strong>in</strong> § 95 Abs. 1 S. 4 GO <strong>NRW</strong> bietet durch den dar<strong>in</strong> enthaltene Begriff „beizufügen“ ke<strong>in</strong>en Anlass,<br />
auf e<strong>in</strong>e Übersendung des Lageberichtes an die Aufsichtsbehörde zu verzichten. Es entsteht <strong>in</strong>sbesondere durch<br />
die Pflichtangaben im Lagebericht nach § 95 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> für die Aufsichtsbehörde als Rechtsaufsicht über<br />
die Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong> Bedürfnis für Informationen aus dem gesamten Lagebericht. Kommt der Rat der Geme<strong>in</strong>de<br />
se<strong>in</strong>er gesetzlichen Verpflichtung zur Feststellung des Jahresabschlusses bis zu dem <strong>in</strong> Absatz 1 festgelegten<br />
Term<strong>in</strong> nicht nach, so dass die Anzeige des Jahresabschlusses bei der Aufsichtsbehörde nicht spätestens unverzüglich<br />
nach diesem Term<strong>in</strong> erfolgen kann, hat die Geme<strong>in</strong>de ihre Aufsichtsbehörde darüber zu unterrichten und<br />
die Anzeige baldmöglichst vorzunehmen. Sie hat <strong>in</strong> ihrem Bericht an die Aufsichtsbehörde die Gründe für das<br />
Versäumnis anzugeben sowie aufzuzeigen, welcher Verfahrensstand zur Feststellung des Jahresabschlusses<br />
besteht, wann die Feststellung durch den Rat vorgesehen ist und bis zu welchem schnellstmöglichen Zeitpunkt<br />
die Anzeige bei der Aufsichtsbehörde nachgeholt wird.<br />
GEMEINDEORDNUNG 586
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 96 GO <strong>NRW</strong><br />
2.1.2 Die aufsichtsrechtliche Prüfung des Jahresabschlusses<br />
Die Aufsichtsbehörde hat aber den ihr nach § 96 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> angezeigten Jahresabschluss mit se<strong>in</strong>en Anlagen<br />
grundsätzlich dah<strong>in</strong>gehend zu prüfen, ob dieser formal und <strong>in</strong>haltlich den e<strong>in</strong>schlägigen Rechtsvorschriften<br />
entspricht. Der eigentlichen Abschlussanalyse soll daher e<strong>in</strong>e formelle Prüfung vorausgehen, bei der auf die<br />
Ordnungsmäßigkeit des vom Rat festgestellten Jahresabschlusses abzustellen ist. Die Aufsichtsbehörde hat nicht<br />
nur die Vollständigkeit der vorgelegten Abschlussunterlagen, sondern auch das Vorliegen e<strong>in</strong>er ausreichenden<br />
<strong>in</strong>haltlichen Bestimmtheit und Aussagekraft dieser Unterlagen zu prüfen, denn der Jahresabschluss hat unter<br />
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes<br />
Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de zu vermitteln.<br />
Die Tätigkeit der Aufsichtsbehörde erfordert zudem, auch das Verfahren der Aufstellung des Jahresabschlusses<br />
der Geme<strong>in</strong>de zu kennen, um ggf. erkannte Rechtsverstöße mit den verfügbaren Mitteln beanstanden zu können.<br />
Sie hat die E<strong>in</strong>haltung der rechtlichen Vorgaben zu überprüfen und dabei das Ermessen der Geme<strong>in</strong>de zu beachten.<br />
Dies gilt unabhängig davon, dass im Rahmen der Haushaltsplanung e<strong>in</strong>e Genehmigungspflicht für die Verr<strong>in</strong>gerung<br />
der allgeme<strong>in</strong>en Rücklage (vgl. § 75 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong>) und für das Haushaltssicherungskonzept (vgl. §<br />
76 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>) besteht. Daher ist von der Aufsichtsbehörde auch zu prüfen, ob die Geme<strong>in</strong>de sich nicht bei<br />
der Ausführung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft außerhalb der ihr zustehenden Ermessensspielräume<br />
bewegt hat, so rechtlich erhebliche Fehler entstanden s<strong>in</strong>d, denn der geme<strong>in</strong>dliche Jahresabschluss muss auch<br />
aufzeigen, ob die Anforderungen der stetigen Aufgabenerfüllung und Leistungsfähigkeit der Geme<strong>in</strong>de (vgl. § 75<br />
Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>) erfüllt worden s<strong>in</strong>d.<br />
2.1.3 Die aufsichtsrechtliche Prüfung und Bestätigungsvermerk<br />
Im Rahmen der aufsichtsrechtlichen Prüfung der Anzeige des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses hat die Aufsichtsbehörde<br />
das Ergebnis der Prüfung des Rechnungsprüfungsausschusses zu berücksichtigen. Dieses gilt<br />
sowohl wenn der Rechnungsprüfungsausschuss e<strong>in</strong>en une<strong>in</strong>geschränkten Bestätigungsvermerk, aber <strong>in</strong>sbesondere<br />
dann, wenn der Rechnungsprüfungsausschuss e<strong>in</strong>en e<strong>in</strong>geschränkten Bestätigungsvermerk erteilt hat, der<br />
Bestätigungsvermerk auf Grund von Beanstandungen versagt worden ist oder der Bestätigungsvermerk deshalb<br />
versagt wurde, weil der Ausschuss nicht <strong>in</strong> der Lage war, als Prüfer e<strong>in</strong>e Beurteilung vorzunehmen.<br />
Dieser Sachverhalt kann auch dann gegeben se<strong>in</strong>, wenn bereits zuvor durch e<strong>in</strong>e Zusammenarbeit zwischen der<br />
Prüfungs<strong>in</strong>stanz und der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung im Jahresabschluss aufgetretene Fehler, die der Vermittlung<br />
e<strong>in</strong>es den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage<br />
der Geme<strong>in</strong>de entgegenstanden, beseitigt worden s<strong>in</strong>d. In sämtlichen Fällen muss geprüft werden, ob Verstöße<br />
gegen haushaltsrechtliche Vorschriften vorliegen. Ist dieses der Fall müssen Ursache und Wirkung von der<br />
Geme<strong>in</strong>de transparent gemacht werden. In dieser aufsichtsrechtlichen Prüfung s<strong>in</strong>d dann auch die abgegebenen<br />
Stellungnahmen des Bürgermeisters und/oder des Kämmerers zum Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsausschusses<br />
zu berücksichtigen.<br />
2.1.4 Die Anzeige der Entlastung des Bürgermeisters<br />
Für die Anzeige des vom Rat der Geme<strong>in</strong>de festgestellten Jahresabschlusses an die Aufsichtsbehörde ist nicht<br />
ausdrücklich geregelt, dass der Beschluss über die Entlastung des Bürgermeisters der Aufsichtsbehörde anzuzeigen<br />
ist. Die Entscheidung der Ratsmitglieder verfehlt aber ihren Zweck, wenn nicht auch die Aufsichtsbehörde<br />
der Geme<strong>in</strong>de im Rahmen der Anzeige des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses über die Entlastung des Bürgermeisters<br />
<strong>in</strong>formiert wird. Auch wenn ke<strong>in</strong>e ausdrückliche gesetzliche Informationspflicht besteht, bietet es sich an,<br />
die Information über die Entlastung des Bürgermeisters oder deren Verweigerung der Aufsichtsbehörde immer im<br />
Rahmen der Anzeige des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses zukommen zu lassen.<br />
GEMEINDEORDNUNG 587
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 96 GO <strong>NRW</strong><br />
E<strong>in</strong>e solche Verfahrensweise ist auch zweckmäßig, denn die Entlastungsentscheidung steht <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em unmittelbaren<br />
Zusammenhang mit der Feststellung des Jahresabschlusses der Geme<strong>in</strong>de durch den Rat und wird üblicherweise<br />
<strong>in</strong> Abhängigkeit davon getroffen. Im Rahmen der Anzeige des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses hat die<br />
Aufsichtsbehörde daher zu berücksichtigen, ob und wie die Ratsmitglieder über die Entlastung des Bürgermeisters<br />
entschieden haben und ob das Ergebnis der Prüfung des Rechnungsprüfungsausschusses dabei berücksichtigt<br />
worden ist. Dieses gilt sowohl wenn der Rechnungsprüfungsausschuss e<strong>in</strong>en une<strong>in</strong>geschränkten Bestätigungsvermerk,<br />
aber <strong>in</strong>sbesondere dann, wenn dieser Ausschuss e<strong>in</strong>en e<strong>in</strong>geschränkten Bestätigungsvermerk<br />
erteilt oder e<strong>in</strong>en Bestätigungsvermerk versagt hat.<br />
2.2 Zu Satz 2 (Bekanntmachung des Jahresabschlusses und Verfügbarhalten):<br />
2.2.1 Bekanntmachung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses<br />
2.2.1.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Mit der Neufassung dieser Vorschrift soll erreicht werden, dass die E<strong>in</strong>wohner und Abgabepflichtigen bürgerfreundlich<br />
und bürgernah über den Jahresabschluss als Ergebnis der abgeschlossenen Haushaltswirtschaft des<br />
vergangenen Jahres <strong>in</strong>formiert werden. Die Bürger<strong>in</strong>nen und Bürger s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>erseits Adressaten des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Handelns und sollen andererseits die Arbeit von Rat und Verwaltung der Geme<strong>in</strong>de unterstützen. Daher<br />
besteht e<strong>in</strong> berechtigtes Interesse der Öffentlichkeit an Informationen über die wirtschaftliche Lage der Geme<strong>in</strong>de<br />
als auch über die das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres.<br />
Aus diesem Grund wird auf die befristete Auslegung des Jahresabschlusses verzichtet, er soll vielmehr bis zur<br />
Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur E<strong>in</strong>sichtnahme verfügbar gehalten werden. Damit wird dem<br />
Grundsatz der Öffentlichkeit, der sich durch die gesamte Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de zieht, ausreichend<br />
Rechnung getragen. Bei der Bekanntmachung des Jahresabschlusses durch die Geme<strong>in</strong>de ist die Verordnung<br />
über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung - BekanntmVO)<br />
vom 26.08.1999 (GV. <strong>NRW</strong>. S. 516), <strong>in</strong> ihrer geltenden Fassung (SGV. <strong>NRW</strong>. 2023), zu beachten.<br />
2.2.1.2 Zwecke der Bekanntmachung<br />
Die Bekanntmachung des Jahresabschlusses erfüllt als Information an die E<strong>in</strong>wohner und Abgabepflichtigen aber<br />
nur dann ihren Zweck, wenn dar<strong>in</strong> auch die wichtigsten Ergebnisse aus der Ergebnisrechnung und aus der F<strong>in</strong>anzrechnung<br />
sowie das Bilanzvolumen und die wichtigsten Bilanzposten öffentlich gemacht werden. Es ist dazu<br />
aber nicht erforderlich, den gesamten geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss mit se<strong>in</strong>en Anlagen zum Inhalt der Bekanntmachung,<br />
z.B. im Amtsblatt der Geme<strong>in</strong>de, zu machen. Die Bekanntmachungsverordnung lässt es zu, dass<br />
bestimmte Materialien, die zum geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss gehören, stattdessen zu jedermanns E<strong>in</strong>sicht an<br />
e<strong>in</strong>er bestimmten Stelle der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung ausgelegt werden (vgl. § 3 Abs. 2 BekanntmVO). Die<br />
E<strong>in</strong>wohner und Abgabepflichtigen können sich dann entsprechend ihrem Bedarf weitere Kenntnisse über den<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss und damit über die wirtschaftliche Lage der Geme<strong>in</strong>de verschaffen.<br />
Als Folge der Bekanntmachung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses müssen die Unterlagen über den Jahresabschluss<br />
der Geme<strong>in</strong>de mit allen dazugehörigen Bestandteilen und Anlagen, die auch dem Rat bei se<strong>in</strong>er Feststellung<br />
vorlagen, öffentlich zugänglich se<strong>in</strong>. Dieses schließt auch den geme<strong>in</strong>dlichen Lagebericht e<strong>in</strong>, denn die<br />
Regelung <strong>in</strong> § 95 Abs. 1 S. 4 GO <strong>NRW</strong> bietet durch den dar<strong>in</strong> enthaltene Begriff „beizufügen“ ke<strong>in</strong>en Anlass, den<br />
Lagebericht nicht den Adressaten des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses verfügbar zu machen. Es dürfte vielmehr,<br />
<strong>in</strong>sbesondere durch die Pflichtangaben im Lagebericht nach § 95 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>, e<strong>in</strong> Bedürfnis für Informationen<br />
aus dem gesamten Lagebericht bestehen.<br />
GEMEINDEORDNUNG 588
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 96 GO <strong>NRW</strong><br />
Mit e<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>sichtnahme <strong>in</strong> den geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss können die E<strong>in</strong>wohner und Abgabepflichtigen e<strong>in</strong><br />
umfassendes Bild über die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft und über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und<br />
F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de erhalten. Welche haushaltswirtschaftlichen Informationen bereits im Rahmen der Bekanntmachung<br />
gegeben werden, bleibt aber der Entscheidung der Geme<strong>in</strong>de unter Berücksichtigung der örtlichen<br />
Gegebenheiten überlassen. Auch muss sie eigenverantwortlich festlegen, ob sie den Jahresabschluss <strong>in</strong><br />
herkömmlicher Weise als Druckwerk oder im Internet barrierefrei verfügbar macht oder <strong>in</strong> sonstiger Weise über<br />
ihre wirtschaftliche Lage und das Ergebnis des abgelaufenen Haushaltsjahres <strong>in</strong>formiert.<br />
2.2.1.3 Die Erweiterung der Bekanntmachung<br />
Die Bekanntmachung des Jahresabschlusses als Information an die E<strong>in</strong>wohner und Abgabepflichtigen bedarf<br />
e<strong>in</strong>er Erweiterung für den Fall, dass e<strong>in</strong> Verzicht auf die Aufstellung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses<br />
dadurch entsteht, dass die Geme<strong>in</strong>de über ke<strong>in</strong>en voll zu konsolidieren Betrieb verfügt, denn dann liegt die wichtigste<br />
Voraussetzung für e<strong>in</strong>en geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss, dass e<strong>in</strong> Mutter-Tochter-Verhältnis zwischen<br />
der Kernverwaltung der Geme<strong>in</strong>de und e<strong>in</strong>em ihrer Betriebe besteht, nicht vor. Das Fehlen dieser Voraussetzung<br />
kann nicht dadurch geheilt werden, dass die betreffende Geme<strong>in</strong>de über Betriebe verfügt, die nach der Equity-<br />
Methode zu konsolidieren wären.<br />
In solchen Fällen entfällt die gesonderte Bekanntmachungspflicht der Geme<strong>in</strong>de. Der Wegfall ist <strong>in</strong> jedem Haushaltsjahr<br />
für den Abschlussstichtag 31. Dezember, zu dem ke<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>dlicher Gesamtabschluss aufzustellen ist,<br />
erneut zu prüfen. Bei e<strong>in</strong>em zulässigen Verzicht auf die Aufstellung e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses<br />
müssen gleichwohl die Adressaten des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses darüber <strong>in</strong> Kenntnis gesetzt werden.<br />
In den Fällen des Verzichts ist es als vertretbar und sachgerecht anzusehen, wenn die Information über den Verzicht<br />
auf die Aufstellung des Gesamtabschlusses <strong>in</strong> die Bekanntmachung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses<br />
e<strong>in</strong>gebunden wird, denn regelmäßig dürfte durch die beiden geme<strong>in</strong>dlichen Abschlüsse der gleiche Adressatenkreis<br />
angesprochen werden.<br />
2.2.1.4 H<strong>in</strong>dernisse für die Bekanntmachung<br />
Für die Bekanntmachung des Jahresabschlusses können H<strong>in</strong>dernisse dadurch entstehen, dass zwar e<strong>in</strong> Beschluss<br />
des Rates der Geme<strong>in</strong>de über die Feststellung des Jahresabschlusses vorliegt, jedoch die Ratsmitglieder<br />
nicht die gesetzlich vorgesehene Entlastung des Bürgermeisters ausgesprochen haben, sie aber auch nicht verweigert<br />
haben. In diesen Fällen liegen nicht die notwendigen Beschlüsse vor, die für e<strong>in</strong>e Bekanntmachung des<br />
Jahresabschlusses notwendig s<strong>in</strong>d. Erst wenn beide Entscheidungen getroffen wurden, besteht ke<strong>in</strong> H<strong>in</strong>dernis für<br />
die öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses mehr.<br />
E<strong>in</strong> H<strong>in</strong>dernis für die Bekanntmachung kann auch bestehen, wenn der Jahresabschluss der Geme<strong>in</strong>de nicht alle<br />
gesetzlich vorgesehenen Bestandteile, Anlagen oder Unterlagen umfasst. Ist ggf. e<strong>in</strong>e gesetzlich vorgesehene<br />
Anlage, z.B. der Anlagenspiegel (vgl. § 45 GemHVO <strong>NRW</strong>), nicht Teil des Beschlusses des Rates über die Feststellung<br />
des Jahresabschlusses, ist damit e<strong>in</strong> Ratsbeschluss zustande gekommen, der e<strong>in</strong>e Bekanntmachung<br />
des Jahresabschlusses nicht zulässt. Erst nach Beseitigung e<strong>in</strong>es solchen H<strong>in</strong>dernisses darf der Jahresabschluss<br />
öffentlich bekannt gemacht werden.<br />
2.2.1.5 Der Vollzug der Bekanntmachung<br />
Die öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses ist mit Ablauf des Ersche<strong>in</strong>ungstages des Amtsblattes<br />
oder der Zeitung vollzogen. Erfolgt die Bekanntmachung <strong>in</strong> mehreren Zeitungen, ist die Bekanntmachung mit<br />
GEMEINDEORDNUNG 589
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 96 GO <strong>NRW</strong><br />
Ablauf des Tages der zuletzt erschienenen Zeitung vollzogen (vgl. § 6 BekanntmVO). Die Öffentlichkeit kann<br />
nicht <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>e bestimmten Auslegungsfrist von dem vom Rat festgestellten Jahresabschluss Kenntnis nehmen,<br />
sondern sich im Rahmen e<strong>in</strong>es langfristigen Verfügbarhaltens des Jahresabschlusses und der E<strong>in</strong>sichtnahme<br />
<strong>in</strong>formieren. Auch bei diesem langfristigen Verfügbarhalten des Jahresabschlusses ist die Bekanntmachung<br />
mit Ablauf des Ersche<strong>in</strong>ungstages vollzogen.<br />
2.2.1.6 Die Veröffentlichung von sonstigen Informationen<br />
2.2.1.6.1 Ke<strong>in</strong>e Bekanntgabe des Prüfungsberichtes<br />
Dem Rat der Geme<strong>in</strong>de werden als Adressaten der Jahresabschlussprüfung im Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsausschusses<br />
nach § 101 GO <strong>NRW</strong> i.d.R. auch konkrete Empfehlungen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit,<br />
der Ordnungsmäßigkeit und der Funktionsfähigkeit des Verwaltungshandelns der Geme<strong>in</strong>de gegeben.<br />
Damit werden ihm entscheidungsrelevante Informationen zur Verfügung gestellt, die vor der Feststellung des<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses beraten und <strong>in</strong> se<strong>in</strong>e Beschlussfassung e<strong>in</strong>fließen sollen.<br />
Aus dem gesetzlichen Prüfungsauftrag zwischen dem Rat und se<strong>in</strong>em Rechnungsprüfungsausschuss entstehen<br />
ke<strong>in</strong>e gesonderten Pflichten für die Geme<strong>in</strong>de, den Bürger<strong>in</strong>nen und Bürgern den Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsausschusses<br />
<strong>in</strong> vollem Umfang im Rahmen des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses bekannt zu<br />
machen oder auf andere Weise zur Verfügung zu stellen. Der Adressat des Prüfungsberichtes über den geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Jahresabschluss ist der Rat als geme<strong>in</strong>dliches Organ, der den Rechnungsprüfungsausschuss mit dieser<br />
Prüfung beauftragt hat.<br />
In diesem Zusammenhang ist gleichwohl e<strong>in</strong>e Öffentlichkeit für den Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsausschusses<br />
gegeben. Der Rat der Geme<strong>in</strong>de, dessen Sitzungen öffentlich s<strong>in</strong>d (vgl. § 48 Abs. 2 S. 1 GO <strong>NRW</strong>), hat<br />
daher <strong>in</strong> öffentlicher Sitzung über das Ergebnis der Abschlussprüfung zu beraten und unter E<strong>in</strong>beziehung des<br />
Prüfungsergebnisses den Jahresabschluss der Geme<strong>in</strong>de festzustellen. Der Prüfungsbericht wird durch die E<strong>in</strong>beziehung<br />
<strong>in</strong> die Beratungen des Rates über geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss nicht zu e<strong>in</strong>em Bestandteil des<br />
festgestellten Jahresabschlusses, noch entsteht durch die Ratsberatungen e<strong>in</strong>e Beifügungspflicht für die Geme<strong>in</strong>de.<br />
2.2.1.6.2 Informationen über das Prüfungsergebnis<br />
Im Rahmen der Beratungen des Rates über den geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss wird e<strong>in</strong>e ausreichende Öffentlichkeit<br />
über die durchgeführte Prüfung des Jahresabschlusses hergestellt und gewährleistet, dass ausreichende<br />
Informationen über die durchgeführte Jahresabschlussprüfung gegeben werden. E<strong>in</strong>er gesonderten Bekanntmachung<br />
des Prüfungsberichtes des Rechnungsprüfungsausschusses bedarf es deshalb nicht. Es ist auch haushaltsrechtlich<br />
nicht vorgeben, den Prüfungsbericht im Rahmen der Bekanntmachung des Jahresabschlusses der<br />
Geme<strong>in</strong>de öffentlich zur Verfügung zu stellen. Auch bei der Anzeige des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses an<br />
die Aufsichtsbehörde ist die Vorlage des Prüfungsberichtes nicht vorgesehen.<br />
Unter örtlichen Gesichtspunkten kann es aber im E<strong>in</strong>zelfall s<strong>in</strong>nvoll und sachgerecht se<strong>in</strong>, das Prüfungsergebnis<br />
oder ggf. auch den gesamten Prüfungsbericht allen Adressaten des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses, z.B. der<br />
Öffentlichkeit und der Aufsichtsbehörde verfügbar zu machen. In solchen Fällen könnte der Prüfungsbericht des<br />
Rechnungsprüfungsausschusses nach der öffentlichen Bekanntmachung des Jahresabschlusses aber auch<br />
zusammen mit dem Jahresabschluss zur E<strong>in</strong>sichtnahme durch Interessierte verfügbar gehalten werden. Dabei<br />
muss dann nicht ausdrücklich erkennbar gemacht werden, ob und wie der Rat der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Feststellung<br />
des Jahresabschlusses das Prüfungsergebnis berücksichtigt hat.<br />
GEMEINDEORDNUNG 590
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 96 GO <strong>NRW</strong><br />
Im Rahmen des Verfügbarhaltens des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses durch die Geme<strong>in</strong>de bietet es sich auch<br />
an, den Bestätigungsvermerk aus der Jahresabschlussprüfung, <strong>in</strong> dem das Prüfungsergebnis nach § 101 Abs. 3<br />
GO <strong>NRW</strong> zusammenzufassen ist, öffentlich zu machen. Mit diesem Bestätigungsvermerk, der dem geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Jahresabschluss im Rahmen der Anzeige an die zuständige Aufsichtsbehörde sowie der Bekanntmachung<br />
des Jahresabschlusses (vgl. nach § 96 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>) beigefügt werden sollte, wird dem Informationsbedürfnis<br />
des Adressatenkreises des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses sachgerecht und <strong>in</strong> ausreichendem Maße und<br />
Umfang genüge getan. Es wird dadurch e<strong>in</strong> gesonderter Nachweis aus der Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses<br />
geführt, dass das haushaltswirtschaftliche Handeln der Geme<strong>in</strong>de ordnungsgemäß war.<br />
2.2.1.6.3 Informationen über die Entlastung des Bürgermeisters<br />
Die Entscheidung der Ratsmitglieder über die Entlastung des Bürgermeisters steht <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em unmittelbaren Zusammenhang<br />
mit der Feststellung des Jahresabschlusses der Geme<strong>in</strong>de durch den Rat und wird üblicherweise <strong>in</strong><br />
Abhängigkeit davon getroffen. Ob die Öffentlichkeit über diese Entscheidung im Zusammenhang mit der Bekanntmachung<br />
des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses oder gesondert darüber <strong>in</strong>formiert wird, hat die Geme<strong>in</strong>de<br />
<strong>in</strong> eigener Verantwortung zu entscheiden. Die Entscheidung der Ratsmitglieder könnte aber ihren Zweck verfehlen,<br />
wenn nicht auch die Öffentlichkeit darüber <strong>in</strong>formiert wird, auch wenn ke<strong>in</strong>e ausdrückliche gesetzliche Informationspflicht<br />
dazu besteht.<br />
2.2.2 Verfügbarhalten des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses<br />
2.2.2.1 Zwecke und Zeitraum des Verfügbarhaltens<br />
Nach der Vorschrift ist der Jahresabschluss nach se<strong>in</strong>er öffentlichen Bekanntmachung bis zur Feststellung des<br />
folgenden Jahresabschlusses zur E<strong>in</strong>sichtnahme verfügbar zu halten und nicht nur an wenigen Tagen auszulegen.<br />
Durch das nachfolgende Beispiel soll deutlich werden, dass der Jahresabschluss solange verfügbar zu halten<br />
ist, wie noch ke<strong>in</strong> weiterer festgestellter Jahresabschluss besteht. Der Zeitraum des Verfügbarhaltens des<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2011 wird nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung).<br />
Zeitraum des Verfügbarhaltens des Jahresabschlusses 2011<br />
Aufgabe<br />
Aufstellung und Zuleitung<br />
des Entwurfs des Jahresabschlusses an den Rat<br />
Prüfung des Entwurfs des Jahresabschlusses<br />
durch den Rechnungsprüfungsausschuss<br />
Feststellung des Jahresabschlusses<br />
durch den Rat<br />
Anzeige des Jahresabschlusses<br />
an die Aufsichtsbehörde<br />
Bekanntmachung<br />
des Jahresabschlusses<br />
GEMEINDEORDNUNG 591<br />
Datum<br />
Bis zum 31. März 2012<br />
Örtliche Fristsetzung<br />
Bis zum 31. Dezember 2012<br />
Unverzüglich nach Feststellung<br />
Nach Feststellung<br />
Bis zum 31. Dezember 2013
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 96 GO <strong>NRW</strong><br />
Verfügbarhalten des Jahresabschlusses<br />
bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses<br />
Abbildung 126 „Zeitraum des Verfügbarhaltens des Jahresabschlusses 2011“<br />
Mit der öffentlichen Bereitstellung und dem E<strong>in</strong>sichtsrecht <strong>in</strong> diese „Basis“ für das künftige geme<strong>in</strong>dliche Handeln<br />
wird dem Grundsatz der Öffentlichkeit ausreichend Rechnung getragen, der sich durch das gesamte geme<strong>in</strong>dliche<br />
Haushaltsverfahren zieht. Auch der mit dem Jahresabschluss <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung stehende Haushaltsplan des<br />
gleichen Haushaltsjahres muss <strong>in</strong> dieser Zeit verfügbar gehalten werden. Insgesamt gesehen steht den Bürger<strong>in</strong>nen<br />
und Bürgern der Jahresabschluss <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Zeitraum zu Verfügung, <strong>in</strong> dem das weitere haushaltswirtschaftliche<br />
Handeln der Geme<strong>in</strong>de i.d.R. auf dem erstellten Jahresabschluss aufbaut. Das Zusammenführen von Haushaltsplan<br />
und Jahresabschluss des gleichen Haushaltsjahres erleichtert den vollständigen Überblick über die<br />
Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> dem betreffenden Haushaltsjahr.<br />
Es ist dabei unerheblich, dass <strong>in</strong> der Zeit nach der Beschlussfassung des Rates ke<strong>in</strong> unmittelbares E<strong>in</strong>wendungsrecht<br />
mehr für die E<strong>in</strong>wohner und Abgabepflichtigen besteht. Der Zeitraum von <strong>in</strong>sgesamt etwa drei Jahren, <strong>in</strong><br />
dem anfangs nur der Haushaltsplan und später auch der Jahresabschluss für die Bürger zur E<strong>in</strong>sichtnahme verfügbar<br />
gehalten werden muss, eröffnet neue Möglichkeiten des politischen Mite<strong>in</strong>anders <strong>in</strong> den Geme<strong>in</strong>den. Er<br />
verstärkt die mit der Darstellung des Ressourcenverbrauchs gewollte Transparenz des geme<strong>in</strong>dlichen Handelns<br />
und trägt zur Bürgerfreundlichkeit von Rat und Verwaltung bei. Es bleibt aber der Geme<strong>in</strong>de überlassen, ob sie<br />
den festgestellten Jahresabschluss <strong>in</strong> herkömmlicher Weise als Druckwerk bereithält oder im Internet verfügbar<br />
macht.<br />
2.2.2.2 Das Verfügbarhalten im Internet<br />
Die Geme<strong>in</strong>de muss beim ihrem Informationsangebot über den geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss im Internet (Verfügbarhalten<br />
im Internet), aber auch bei ihren sonstigen Onl<strong>in</strong>e-Auftritten und -Angeboten sowie bei den von ihr<br />
zur Verfügung gestellten Programmoberflächen im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung berücksichtigen,<br />
dass deren technische Gestaltung auch die Nutzung durch Menschen mit Beh<strong>in</strong>derung ermöglicht (vgl. § 1<br />
i.V.m. § 10 BGG <strong>NRW</strong>). Die Geme<strong>in</strong>de muss daher nach bestem Bemühen die Erstellung e<strong>in</strong>es barrierefreien<br />
Angebotes vornehmen.<br />
Die Inhalte und das Ersche<strong>in</strong>ungsbild des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses im Internet s<strong>in</strong>d daher so zu gestalten,<br />
dass sie für alle Interessierten wahrnehmbar s<strong>in</strong>d (vgl. § 2 BITV <strong>NRW</strong>). Als Barrierefreiheit wird dabei die<br />
Auff<strong>in</strong>dbarkeit, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der gestalteten von der Geme<strong>in</strong>de Lebensbereiche für alle Menschen<br />
angesehen, so dass der Zugang und die Nutzung für Menschen mit Beh<strong>in</strong>derung <strong>in</strong> der allgeme<strong>in</strong> üblichen<br />
Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe möglich se<strong>in</strong> müssen. Zu den zu gestalteten<br />
Lebensbereichen gehören nicht nur bauliche Anlagen und technische Gebrauchsgegenstände, sondern<br />
auch die Systeme der Informationsverarbeitung.<br />
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ<br />
GEMEINDEORDNUNG 592
1. Allgeme<strong>in</strong>es<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
9. Teil GO <strong>NRW</strong><br />
9. Teil<br />
Sondervermögen, Treuhandvermögen<br />
Im 9. Teil der Geme<strong>in</strong>deordnung f<strong>in</strong>den sich Sonderregelungen über das vom freien Geme<strong>in</strong>devermögen zu<br />
separieren geme<strong>in</strong>dliche Vermögen, das als Sondervermögen bezeichnet wird und <strong>in</strong> vielfältigen Formen vorhanden<br />
ist. Der Charakter des geme<strong>in</strong>dlichen Sondervermögens wird dadurch bestimmt, dass es sich um Vermögen<br />
der Geme<strong>in</strong>de handelt, das für die Erfüllung bestimmter Zwecke vom Haushalt der Geme<strong>in</strong>de abgesondert oder<br />
von e<strong>in</strong>em Dritten an die Geme<strong>in</strong>de für e<strong>in</strong>en bestimmten Zweck übereignet oder durch sonstige Rechtsakte<br />
unter Zweckb<strong>in</strong>dung auf die Geme<strong>in</strong>de übergegangen ist. Auf Grund ihrer Verschiedenheit und unterschiedlichen<br />
öffentlichen Zwecksetzungen s<strong>in</strong>d die e<strong>in</strong>zelnen <strong>in</strong> § 97 GO <strong>NRW</strong> benannten Gruppen von geme<strong>in</strong>dlichem Sondervermögen<br />
haushaltsmäßig unterschiedlich zu behandeln.<br />
Aus se<strong>in</strong>er besonderen Zwecksetzung oder Zweckb<strong>in</strong>dung folgt, dass Sondervermögen vom übrigen Geme<strong>in</strong>devermögen<br />
abzusondern s<strong>in</strong>d und dieses Vermögen daher nur bed<strong>in</strong>gt e<strong>in</strong>en Bestandteil des „Kernhaushalts“ der<br />
Geme<strong>in</strong>de darstellt. Die geme<strong>in</strong>dlichen Sondervermögen stellen vielfach aber auch selbstständige Wirtschaftse<strong>in</strong>heiten<br />
der Geme<strong>in</strong>de dar, so dass diese mit dem geme<strong>in</strong>dlichen Haushalt lediglich durch Leistungsbeziehungen<br />
verbunden s<strong>in</strong>d. Derartige Leistungsbeziehungen s<strong>in</strong>d von der Geme<strong>in</strong>de haushaltsmäßig korrekt zu erfassen,<br />
zu bewerten und abzurechnen. Sie ke<strong>in</strong>e <strong>in</strong>ternen Leistungsbeziehungen der Geme<strong>in</strong>de im S<strong>in</strong>ne der Vorschrift<br />
des § 17 GemHVO <strong>NRW</strong> dar.<br />
2. Die Vorschriften über das geme<strong>in</strong>dliche Sondervermögen<br />
2.1 Die Gesamtübersicht über die Vorschriften<br />
Zu den Sondervermögen und den Treuhandvermögen der Geme<strong>in</strong>de enthält der 9. Teil der Geme<strong>in</strong>deordnung<br />
folgende Vorschriften (vgl. Abbildung).<br />
Haushaltsrechtliche Vorschriften im 9. Teil der Geme<strong>in</strong>deordnung<br />
9. Teil<br />
Sondervermögen,<br />
Treuhandvermögen<br />
§ 97 Sondervermögen<br />
§ 98 Treuhandvermögen<br />
§ 99 Geme<strong>in</strong>degliedervermögen<br />
§ 100 Örtliche Stiftungen<br />
Abbildung 127 „Haushaltsrechtliche Vorschriften im 9. Teil der Geme<strong>in</strong>deordnung“<br />
2.2 Die Vorschriften im E<strong>in</strong>zelnen<br />
Der 9. Teil der Geme<strong>in</strong>deordnung enthält im E<strong>in</strong>zelnen folgende Vorschriften:<br />
- § 97 Sondervermögen<br />
Auf Grund ihrer unterschiedlichen Zweckbestimmung werden die e<strong>in</strong>zelnen Gruppen von Sondervermögen<br />
haushaltswirtschaftlich und damit auch h<strong>in</strong>sichtlich ihrer Bilanzierung unterschiedlich behandelt. Für das Geme<strong>in</strong>degliedervermögen<br />
und die rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen, die Teil des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushalts s<strong>in</strong>d, müssen die diesen Sondervermögen zuzurechnenden Vermögensgegenstände unter den im<br />
GEMEINDEORDNUNG 593
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
9. Teil GO <strong>NRW</strong><br />
E<strong>in</strong>zelnen zutreffenden Bilanzposten angesetzt werden. Die Erhaltung des Zwecks bei diesen beiden Arten<br />
von Sondervermögen erfordert von der Geme<strong>in</strong>de ke<strong>in</strong>en gesonderten Nachweis durch e<strong>in</strong>en zusammengefassten<br />
Ansatz <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz, sondern ist von der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong>tern zu belegen. Im Jahresabschluss<br />
bedarf es aber zu diesen beiden Arten von Sondervermögen der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>er Angabe und Erläuterung<br />
im Anhang. Entsprechend ist im Gesamtabschluss zu verfahren.<br />
- § 98 Treuhandvermögen<br />
Bei Treuhandvermögen werden von der Geme<strong>in</strong>de Vermögensgegenstände treuhänderisch gehalten. Diese<br />
werden im eigenen Namen für fremde Rechnung verwaltet. Für die Geme<strong>in</strong>de folgt aus ihrer Tätigkeit als<br />
Treuhänder, dass sie gegenüber dem Treugeber für e<strong>in</strong>e ordnungsgemäße Verwaltung des Treuhandvermögens<br />
haftet.<br />
- § 99 Geme<strong>in</strong>degliedervermögen<br />
Zum Geme<strong>in</strong>degliedervermögen gehören auf dem Grundeigentum lastende Nutzungsberechtigungen, z.B. bei<br />
Wald- und Wegegrundstücken, die aus der geschichtlichen Entwicklung der Geme<strong>in</strong>de heraus heute noch bestehen<br />
können. Auch kann <strong>in</strong> E<strong>in</strong>zelfällen das Nutzungsrecht nicht allen, sondern nur e<strong>in</strong>er Gruppe von E<strong>in</strong>wohnern<br />
der Geme<strong>in</strong>de zu stehen (Geme<strong>in</strong>degliederklassenvermögen). Der Geme<strong>in</strong>de obliegt aber die<br />
Pflicht, dieses Vermögen zu verwalten. Bei diesen Vermögen bezieht sich die Fortgeltung der (historischen)<br />
Vorschriften und Gewohnheiten nur auf die Nutzung des Geme<strong>in</strong>degliedervermögens, nicht auf se<strong>in</strong>e Verwaltung<br />
durch die Geme<strong>in</strong>de, wie sie <strong>in</strong> § 97 GO <strong>NRW</strong> geregelt ist.<br />
- § 100 Örtliche Stiftungen<br />
Die Vorschrift über örtliche Stiftungen ist wegen der E<strong>in</strong>führung des NKF nicht verändert worden. E<strong>in</strong>e Stiftung<br />
gilt als örtliche Stiftung, wenn es sich um e<strong>in</strong>e selbstständige oder unselbstständige Stiftung handelt, die nach<br />
dem Willen des Stifters von der Geme<strong>in</strong>de verwaltet wird und die überwiegend Zwecken dient, die von der<br />
Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> ihrem Bereich erfüllt werden können. Damit wird deutlich, dass der Stiftungszweck auf Aufgaben<br />
gerichtet se<strong>in</strong> muss, die auch von der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> ihrem sachlichen und räumlichen Zuständigkeitsbereich<br />
selbst vorgenommen werden können. Neben dem Begriff „Örtliche Stiftungen“ ist vielfach auch der Begriff<br />
„Kommunale Stiftungen“ im Gebrauch.<br />
Nach dem Bundesverband Deutscher Stiftungen werden unter dem Begriff „Kommunale Stiftungen“ alle Stiftungen<br />
unabhängig von ihrer Rechtsform subsumiert, die geme<strong>in</strong>wohlorientiert für die Bürger<strong>in</strong>nen und Bürger<br />
e<strong>in</strong>er Kommune auf Grund privater oder öffentlicher Initiative errichtet worden s<strong>in</strong>d. Sie müssen zum Wirkungskreis<br />
e<strong>in</strong>er Kommune gehören und sich durch e<strong>in</strong>e besondere Nähe zur Kommunalverwaltung auszeichnen.<br />
Ihr Aktionsgebiet ist auf das Geme<strong>in</strong>wesen e<strong>in</strong>er Kommune beschränkt. Diese Begriffsverwendung<br />
ist nicht <strong>in</strong>s kommunale Haushaltsrecht von Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen übernommen worden. Haushaltsrechtlich<br />
wird dann von e<strong>in</strong>er kommunalen Stiftung gesprochen, wenn e<strong>in</strong>e oder mehrere Geme<strong>in</strong>de selbst als Stifter<br />
auftreten und Geme<strong>in</strong>devermögen <strong>in</strong> die von Ihnen errichtete Stiftung e<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gen. Auch gilt nach dieser Vorschrift<br />
das Örtlichkeitspr<strong>in</strong>zip.<br />
In diesem Zusammenhang ist auch § 59 GemHVO <strong>NRW</strong> zu beachten. Durch diese Vorschrift wird bestimmt, dass<br />
die Geme<strong>in</strong>dehaushaltsverordnung s<strong>in</strong>ngemäß auch auf geme<strong>in</strong>dliche Sondervermögen und Treuhandvermögen<br />
der Geme<strong>in</strong>de Anwendung f<strong>in</strong>det, soweit für diese geme<strong>in</strong>dlichen Vermögensformen die gesetzlichen Vorschriften<br />
über die Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>den Anwendung f<strong>in</strong>den.<br />
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ<br />
GEMEINDEORDNUNG 594
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
9. Teil GO <strong>NRW</strong><br />
GEMEINDEORDNUNG 595
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 97 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 97<br />
Sondervermögen<br />
(1) Sondervermögen der Geme<strong>in</strong>de s<strong>in</strong>d<br />
1. das Geme<strong>in</strong>degliedervermögen,<br />
2. das Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen,<br />
3. wirtschaftliche Unternehmen (§ 114) und organisatorisch verselbstständigte E<strong>in</strong>richtungen (§ 107 Abs. 2)<br />
ohne eigene Rechtspersönlichkeit,<br />
4. rechtlich unselbstständige Versorgungs- und Versicherungse<strong>in</strong>richtungen.<br />
(2) Sondervermögen nach Absatz 1 Nrn. 1 und 2 unterliegen den Vorschriften über die Haushaltswirtschaft. Sie<br />
s<strong>in</strong>d im Haushaltsplan der Geme<strong>in</strong>de gesondert nachzuweisen.<br />
(3) Für Sondervermögen nach Absatz 1 Nr. 3 s<strong>in</strong>d die Vorschriften des § 75 Abs. 1, Abs. 2 Sätze 1 und 2, Abs. 6<br />
und 7, der §§ 84 bis 90, des § 92 Abs. 3 und 7 und der §§ 93, 94 und 96 s<strong>in</strong>ngemäß anzuwenden.<br />
(4) 1 Für Sondervermögen nach Absatz 1 Nr. 4 können die für die Wirtschaftführung und das Rechnungswesen<br />
der Eigenbetriebe geltenden Vorschriften s<strong>in</strong>ngemäß angewendet werden. 2 Absatz 3 gilt s<strong>in</strong>ngemäß.<br />
Erläuterungen zu § 97:<br />
I. Allgeme<strong>in</strong>es<br />
1. Abgesondertes Vermögen der Geme<strong>in</strong>de<br />
Das geme<strong>in</strong>dliche Vermögen dient der Erfüllung der öffentlichen Aufgaben der Geme<strong>in</strong>de. Es hat den Zweck,<br />
Leistungen und Nutzen für den Bürger zu erbr<strong>in</strong>gen. Die Geme<strong>in</strong>de hat deshalb ihre Vermögensgegenstände so<br />
zu verwalten, dass die Geme<strong>in</strong>def<strong>in</strong>anzen gesund bleiben (vgl. § 10 GO <strong>NRW</strong>). Zum Vermögen der Geme<strong>in</strong>de im<br />
haushaltsrechtlichen S<strong>in</strong>n ist die Gesamtheit aller Sachen und Rechte zu zählen, die der Geme<strong>in</strong>de gehören oder<br />
ihr zustehen oder sie davon der wirtschaftlicher Eigentümer ist, soweit die geme<strong>in</strong>dlichen Vermögensgegenstände<br />
nicht auf Grund ausdrücklicher Vorschriften gesondert zu behandeln s<strong>in</strong>d. Die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft<br />
sowie die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung der Geme<strong>in</strong>de erfordern daher e<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>dliches<br />
Vermögensmanagement.<br />
Das geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsrecht orientiert sich bei der Vermögensdef<strong>in</strong>ition am kaufmännischen Begriff des<br />
Vermögensgegenstandes, für den bisher ke<strong>in</strong>e gesetzliche Def<strong>in</strong>ition und ke<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>heitliche Begriffsbestimmung<br />
gibt (vgl. § 33 GemHVO <strong>NRW</strong>). Außerdem müssen für das geme<strong>in</strong>dliche Vermögen grundsätzlich die Werterhaltung<br />
und der Substanzverzehr dokumentiert und e<strong>in</strong>e ordnungsgemäße Verwaltung nachgewiesen werden. Diese<br />
Gegebenheiten wirken sich auch auf die jährliche Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de aus. Dabei ist von Bedeutung,<br />
dass bestimmte Vermögensformen nicht dem allgeme<strong>in</strong>en Vermögen der Geme<strong>in</strong>de zuzuordnen s<strong>in</strong>d, sondern<br />
zur Erfüllung bestimmter Zwecke davon zu trennen (abzusondern) s<strong>in</strong>d. Derartiges Vermögen ist i.d.R. der<br />
Geme<strong>in</strong>de von Dritten unter e<strong>in</strong>er bestimmten Zwecksetzung oder Zweckb<strong>in</strong>dung übertragen worden und muss<br />
dementsprechend von der Geme<strong>in</strong>de auch haushaltswirtschaftlich ggf. gesondert behandelt werden. In weiteren<br />
Vorschriften der Geme<strong>in</strong>deordnung und der Geme<strong>in</strong>dehaushaltsverordnung wird dieser Tatsache <strong>in</strong> ausreichendem<br />
Maße Rechnung getragen.<br />
Die Abbildung des Ressourcenverbrauchs bei den Sondervermögen der Geme<strong>in</strong>de erfordert zudem auch bei<br />
diesem geme<strong>in</strong>dlichen Vermögen die Anwendung der Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de.<br />
Diesen Vorschriften unterliegen grundsätzlich die unter den Nummern 1 und 2 des Absatzes 1 der Vorschrift<br />
aufgeführten Sondervermögen. Die Sondervermögen nach Absatz 1 Nr. 3 der Vorschrift unterliegen dagegen<br />
GEMEINDEORDNUNG 595
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 97 GO <strong>NRW</strong><br />
nicht nur den gesetzlichen Vorgaben des Absatzes 3, sondern auch den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung.<br />
Die Sondervermögen nach Absatz 1 Nr. 4 unterliegen grundsätzlich den Vorschriften über die Haushaltswirtschaft<br />
der Geme<strong>in</strong>de. Es wurden jedoch Ausnahmen davon zugelassen, so dass bei e<strong>in</strong>e rechtlich unselbstständige<br />
Versorgungs- und Versicherungse<strong>in</strong>richtung der Geme<strong>in</strong>de auch die Wirtschaftführung und das Rechnungswesen<br />
nach dem für die Eigenbetriebe geltenden Vorschriften s<strong>in</strong>ngemäß angewendet werden kann.<br />
2. Die Gruppen der Sondervermögen<br />
Die e<strong>in</strong>zelnen Gruppen geme<strong>in</strong>dlicher Sondervermögen s<strong>in</strong>d auf Grund ihrer unterschiedlichen Zweckbestimmung<br />
von der Geme<strong>in</strong>de haushaltswirtschaftlich unterschiedlich zu behandelt. Sie werden entweder <strong>in</strong> die Haushaltsplan<br />
der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>bezogen und s<strong>in</strong>d dann auch im geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss nachzuweisen oder<br />
sie verfügen über e<strong>in</strong>en eigenen Rechnungskreis mit e<strong>in</strong>em eigenen Jahresabschluss (vgl. Abbildung).<br />
Arten von geme<strong>in</strong>dlichem Sondervermögen<br />
Geme<strong>in</strong>degliedervermögen<br />
Rechtlich unselbstständige<br />
örtliche Stiftungen<br />
Wirtschaftliche Unternehmen<br />
der Geme<strong>in</strong>de<br />
(nach § 114 GO <strong>NRW</strong>)<br />
Organisatorisch<br />
verselbstständigte E<strong>in</strong>richtungen<br />
ohne eigene<br />
Rechtspersönlichkeit<br />
(§ 107 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>)<br />
Rechtlich unselbstständige<br />
Versorgungs- und<br />
Versicherungse<strong>in</strong>richtungen.<br />
Teil des geme<strong>in</strong>dlichen Haushalts<br />
Teil des geme<strong>in</strong>dlichen Haushalts<br />
Eigener Rechnungskreis<br />
Eigener Rechnungskreis<br />
Wahlmöglichkeit:<br />
Teil des geme<strong>in</strong>dlichen Haushalts<br />
Oder Eigener Rechnungskreis<br />
Abbildung 128 „Arten von geme<strong>in</strong>dlichem Sondervermögen“<br />
Für das Geme<strong>in</strong>degliedervermögen und die rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen, die Teil des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushalts s<strong>in</strong>d, müssen die diesen Sondervermögen zuzurechnenden Vermögensgegenstände <strong>in</strong><br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz unter den im E<strong>in</strong>zelnen nach der Vermögensart zutreffenden Bilanzposten angesetzt<br />
werden. Die Erhaltung des Zwecks bei diesen beiden Arten von geme<strong>in</strong>dlichem Sondervermögen erfordert von<br />
der Geme<strong>in</strong>de ke<strong>in</strong>en gesonderten Nachweis durch e<strong>in</strong>en zusammengefassten Ansatz <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Bilanz oder den Ansatz als Gesamtheit im Bilanzbereich „F<strong>in</strong>anzanlagen“. Die E<strong>in</strong>haltung der Zwecksetzung bzw.<br />
Zweckb<strong>in</strong>dung, z.B. bei den rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen ist von der Geme<strong>in</strong>de nur <strong>in</strong>tern<br />
prüffähig nachzuhalten (vgl. § 103 Abs. 1 Nr. 2 GO <strong>NRW</strong>).<br />
Im geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss (vgl. § 95 GO <strong>NRW</strong>) bedarf es aber zu diesen beiden Arten von Sondervermögen<br />
der Geme<strong>in</strong>de entsprechender Angaben und Erläuterungen im Anhang (Vgl. § 44 GemHVO <strong>NRW</strong>). In<br />
E<strong>in</strong>beziehung <strong>in</strong> den geme<strong>in</strong>dlichen Haushalt bed<strong>in</strong>gt dabei, dass die Geme<strong>in</strong>de ke<strong>in</strong>e Verb<strong>in</strong>dlichkeit passivieren<br />
muss, weil sie das Vermögen von Dritten erhalten hat. Die Geme<strong>in</strong>de ist bei diesen beiden Sondervermögen nicht<br />
zur Rückgabe verpflichtet, denn das Vermögen wurde ihr auch zivilrechtlich übertragen, z.B. die Vermögensgegenstände<br />
bei rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen. Entsprechend ist auch beim geme<strong>in</strong>dlichen Ge-<br />
GEMEINDEORDNUNG 596
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 97 GO <strong>NRW</strong><br />
samtabschluss zu verfahren. Dabei dürfte regelmäßig von e<strong>in</strong>er Konsolidierung der geme<strong>in</strong>dlichen Sondervermögen<br />
als verselbstständigte Aufgabenbereiche <strong>in</strong> öffentlich-rechtlicher Organisationsform auszugehen se<strong>in</strong> (vgl. §<br />
50 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
3. Die gesondert zu bilanzierende Sondervermögen<br />
Die wirtschaftlichen Unternehmen der Geme<strong>in</strong>de (§ 114 GO <strong>NRW</strong>) und die organisatorisch verselbstständigten<br />
E<strong>in</strong>richtungen der Geme<strong>in</strong>de (§ 107 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>) sowie die rechtlich unselbstständigen Versorgungs- und<br />
Versicherungse<strong>in</strong>richtungen der Geme<strong>in</strong>de (§ 97 Abs. 1 Nr. 4 GO <strong>NRW</strong>) s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz im<br />
Bilanzbereich „F<strong>in</strong>anzanlagen“ unter dem Bilanzposten „Sondervermögen“ anzusetzen. Zu diesen geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Sondervermögen gehören auch die geme<strong>in</strong>dlichen Krankenhäuser, die als organisatorisch und wirtschaftlich<br />
eigenständige E<strong>in</strong>richtungen von der Geme<strong>in</strong>de zu betreiben s<strong>in</strong>d (vgl. §§ 1 und 10 GemKHBVO).<br />
In der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz werden im Bilanzbereich „F<strong>in</strong>anzanlagen“ grundsätzlich nur die geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe,<br />
die über e<strong>in</strong>en eigenen Rechnungskreis verfügen und m<strong>in</strong>destens organisatorisch selbstständig s<strong>in</strong>d.<br />
Diese Erfordernisse werden bei den oben genannten Arten von geme<strong>in</strong>dlichem Sondervermögen erfüllt. Die Anwendung<br />
des NKF br<strong>in</strong>gt es mit sich, dass sich die Errichtung e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Sondervermögens oder se<strong>in</strong>e<br />
Veränderung sich künftig auch <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz für die Kernverwaltung niederschlagen wird.<br />
Die Überführung des allgeme<strong>in</strong>en geme<strong>in</strong>dlichem Vermögen <strong>in</strong> e<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>dliches Sondervermögen nach § 97<br />
GO <strong>NRW</strong> ist zudem vergleichbar e<strong>in</strong>er Abgabe von geme<strong>in</strong>dlichem Vermögen unter Beachtung des § 90 GO<br />
<strong>NRW</strong>. So kann z.B. ke<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>fache Übernahme von geme<strong>in</strong>dlichen Buchwerten <strong>in</strong> Betracht kommen, weil es für<br />
e<strong>in</strong>e solche „Betriebsaufspaltung“ nicht den Grundsatz der übere<strong>in</strong>stimmenden Bilanzierung gibt.<br />
Jede Organisationse<strong>in</strong>heit hat nach den für sie geltenden Regelungen zu bilanzieren, auch wenn dabei ggf. teilweise<br />
Übere<strong>in</strong>stimmungen bestehen und die Geme<strong>in</strong>de der Rechtsträger für beide Organisationse<strong>in</strong>heiten ist.<br />
Daher müssen die Anschaffungskosten für die neue Organisationse<strong>in</strong>heit zutreffend unter Beachtung der e<strong>in</strong>schlägigen<br />
Vorschriften, z.B. § 97 Abs. 3 i.V.m § 92 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong>, ermittelt werden. Jedoch müssen sich die<br />
Ansprüche und Verb<strong>in</strong>dlichkeiten zwischen der Kernverwaltung und der neuen Organisationse<strong>in</strong>heit müssen <strong>in</strong><br />
diesen Fällen entsprechen.<br />
4. Die Prüfung der Jahresabschlüsse der Sondervermögen<br />
4.01 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Nach der Vorschrift des § 103 Abs. 1 Nr. 2 GO <strong>NRW</strong> s<strong>in</strong>d die Jahresabschlüsse der <strong>in</strong> § 97 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 4<br />
GO <strong>NRW</strong> benannten Sondervermögen e<strong>in</strong>e Pflichtaufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung. Zu diesen benannten<br />
Sondervermögen der Geme<strong>in</strong>de gehören das Geme<strong>in</strong>degliedervermögen, das Vermögen der rechtlich unselbstständigen<br />
örtlichen Stiftungen und die rechtlich unselbstständigen Versorgungs- und Versicherungse<strong>in</strong>richtungen.<br />
Die örtliche Rechnungsprüfung hat bei diesen geme<strong>in</strong>dlichen Sondervermögen zu prüfen, <strong>in</strong>wieweit die<br />
Zwecksetzung und die Zweckb<strong>in</strong>dung dieser Sondervermögen durch die Geme<strong>in</strong>de erfüllt wurden.<br />
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe (vgl. § 97<br />
Abs. 1 Nr. 3 GO <strong>NRW</strong>) nach den Vorschriften des § 106 GO <strong>NRW</strong> vorzunehmen ist. In die durchzuführende Prüfung<br />
s<strong>in</strong>d alle Bestandteile des Jahresabschlusses des jeweiligen Sondervermögens der Geme<strong>in</strong>de sowie die<br />
dazugehörigen Anlagen e<strong>in</strong>zubeziehen. Diese Gegebenheiten können ggf. auch bei geme<strong>in</strong>dlichen Versicherungs-<br />
und Versorgungse<strong>in</strong>richtungen vorliegen (vgl. § 97 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong>).<br />
GEMEINDEORDNUNG 597
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 97 GO <strong>NRW</strong><br />
4.1 Jahresabschluss des Geme<strong>in</strong>degliedervermögens<br />
Die Vorschrift des § 103 Abs. 1 Nr. 2 GO <strong>NRW</strong> enthält zwar ausdrücklich den Begriff „Jahresabschluss“ unter<br />
Bezugnahme auf das Geme<strong>in</strong>degliedervermögen als Sondervermögen nach § 97 Abs. 1 Nr. 1 GO <strong>NRW</strong>. Diese<br />
Festlegung führt jedoch nicht zu der Verpflichtung der Geme<strong>in</strong>de, für dieses geme<strong>in</strong>dliche Sondervermögen auch<br />
e<strong>in</strong>en eigenständigen Jahresabschlusses aufzustellen. Das Sondervermögen unterliegt ausdrücklich den Vorschriften<br />
über die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft und ist Teil des Haushalts der Geme<strong>in</strong>de. Es ist daher h<strong>in</strong>sichtlich<br />
se<strong>in</strong>er Erträge und Aufwendungen sowie der Vermögens- und Schuldenlage <strong>in</strong> den Jahresabschluss der<br />
Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>zubeziehen.<br />
Die Geme<strong>in</strong>de hat ggf. für dieses Sondervermögen e<strong>in</strong>en gesonderten Nachweis darüber zu führen, dass die<br />
Zwecksetzungen und Zweckb<strong>in</strong>dungen des Sondervermögens im abgelaufenen Haushaltsjahr e<strong>in</strong>gehalten wurden.<br />
Diese Vorgaben können im E<strong>in</strong>zelfall zu e<strong>in</strong>em gesonderten Jahresergebnis oder zu e<strong>in</strong>em von der Geme<strong>in</strong>de<br />
gesondert aufzustellenden Abschluss führen. E<strong>in</strong> solcher Abschluss wäre dann mit e<strong>in</strong>er dazu gehörenden<br />
Übersicht über die zurechenbaren Vermögen und Schulden zum Gegenstand der örtlichen Rechnungsprüfung<br />
zu machen (vgl. § 103 Abs. 1 Nr. 2 GO <strong>NRW</strong>).<br />
4.2 Jahresabschluss der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen<br />
Die Vorschrift des § 103 Abs. 1 Nr. 2 GO <strong>NRW</strong> enthält zwar ausdrücklich den Begriff „Jahresabschluss“ unter<br />
Bezugnahme auf die rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen als Sondervermögen nach § 97 Abs. 1 Nrn.<br />
2 GO <strong>NRW</strong>. Diese Festlegung führt jedoch nicht zu der Verpflichtung der Geme<strong>in</strong>de, für dieses geme<strong>in</strong>dliche<br />
Sondervermögen auch e<strong>in</strong>en eigenständigen Jahresabschlusses aufzustellen. Das Sondervermögen unterliegt<br />
ausdrücklich den Vorschriften über die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft und ist Teil des Haushalts der Geme<strong>in</strong>de.<br />
Es ist daher h<strong>in</strong>sichtlich ihrer Erträge und Aufwendungen sowie der Vermögens- und Schuldenlage <strong>in</strong> den<br />
Jahresabschluss der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>zubeziehen.<br />
Die Geme<strong>in</strong>de hat jedoch für diese Sondervermögen e<strong>in</strong>en gesonderten Nachweis darüber zu führen, dass die<br />
Zwecksetzungen und Zweckb<strong>in</strong>dungen des jeweiligen Sondervermögens im abgelaufenen Haushaltsjahr e<strong>in</strong>gehalten<br />
wurden. Diese Vorgaben können im E<strong>in</strong>zelfall zu e<strong>in</strong>em gesonderten Jahresergebnis oder zu e<strong>in</strong>em von<br />
der Geme<strong>in</strong>de gesondert aufzustellenden Abschluss führen. E<strong>in</strong> solcher Abschluss wäre dann mit e<strong>in</strong>er dazu<br />
gehörenden Übersicht über die zurechenbaren Vermögen und Schulden zum Gegenstand der örtlichen Rechnungsprüfung<br />
zu machen (vgl. § 103 Abs. 1 Nr. 2 GO <strong>NRW</strong>).<br />
4.3 Jahresabschluss der Unternehmen und E<strong>in</strong>richtungen<br />
Bei wirtschaftlichen Unternehmen der Geme<strong>in</strong>de (§ 114 GO <strong>NRW</strong>) und organisatorisch verselbstständigten E<strong>in</strong>richtungen<br />
der Geme<strong>in</strong>de (§ 107 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>) s<strong>in</strong>d die Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen E<strong>in</strong>richtungen<br />
die wichtigsten geme<strong>in</strong>dlichen Organisationsgebilde, die entsprechend den Vorschriften über die wirtschaftliche<br />
und nichtwirtschaftliche Betätigung der Geme<strong>in</strong>den als Sondervermögen errichtet werden und zu den geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Betrieben zu zählen s<strong>in</strong>d. Diese Betriebe s<strong>in</strong>d unter Beachtung der Vorschriften der Eigenbetriebsordnung<br />
(EigVO <strong>NRW</strong>) wirtschaftlich und verwaltungsmäßig selbstständig. Zu dieser Art von geme<strong>in</strong>dlichem<br />
Sondervermögen gehören auch die geme<strong>in</strong>dlichen Krankenhäuser, die wie geme<strong>in</strong>dliche Eigenbetriebe als organisatorisch<br />
und wirtschaftlich eigenständige E<strong>in</strong>richtungen bzw. geme<strong>in</strong>dliche Betriebe geführt werden (vgl. §§ 1<br />
und 10 GemKHBVO).<br />
Für die Jahresabschlussprüfung der geme<strong>in</strong>dlichen Eigenbetriebe wurden jedoch Sonderregelungen getroffen, so<br />
dass deren Jahresabschlussprüfung nicht der örtlichen Rechnungsprüfung obliegt. Vielmehr obliegt der Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt<br />
diese Jahresabschlussprüfung, die sich dazu e<strong>in</strong>es Wirtschaftsprüfers, e<strong>in</strong>er Wirtschaftsprü-<br />
GEMEINDEORDNUNG 598
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 97 GO <strong>NRW</strong><br />
fungsgesellschaft oder <strong>in</strong> E<strong>in</strong>zelfällen e<strong>in</strong>es hierzu befähigten eigenen Prüfers bedienen kann (vgl. § 106 GO<br />
<strong>NRW</strong>). Die Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt hat das Prüfungsergebnis <strong>in</strong> Form des Prüfungsberichts der betroffenen<br />
Geme<strong>in</strong>de mitzuteilen. Wenn Veranlassung dazu besteht oder auf Anforderung muss die Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt<br />
ihr Prüfungsergebnis auch den Kommunal- und den Fachaufsichtsbehörden mitteilen. Diese Regelungen<br />
gelten entsprechend auch für E<strong>in</strong>richtungen, die gemäß § 107 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> entsprechend den Vorschriften<br />
über das Rechnungswesen der Eigenbetriebe geführt werden.<br />
4.4 Jahresabschluss der Versorgungs- und Versicherungse<strong>in</strong>richtungen<br />
Die Prüfung e<strong>in</strong>es förmlichen Jahresabschlusses, wie diese für die Geme<strong>in</strong>de selbst vorgesehen ist, ist für Sondervermögen<br />
nach § 97 Abs. 1 Nr. 4 GO <strong>NRW</strong> ist nur dann erforderlich, wenn für e<strong>in</strong>e unter diese Vorschrift fallende<br />
Versorgungs- und Versicherungse<strong>in</strong>richtung der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong> eigener Rechnungskreis besteht, weil e<strong>in</strong>e<br />
entsprechend abgesonderte Haushalts- und Wirtschaftsführung erforderlich ist, z.B. für e<strong>in</strong>e eigene Zusatzversorgungskasse<br />
oder e<strong>in</strong>e Eigenunfallversicherung. Solche geme<strong>in</strong>dlichen E<strong>in</strong>richtungen, die aber Teil des Haushalts<br />
der Geme<strong>in</strong>de und damit im Jahresabschluss der Geme<strong>in</strong>de enthalten s<strong>in</strong>d, bedürfen dann ke<strong>in</strong>es eigenständigen<br />
Jahresabschlusses.<br />
Die Geme<strong>in</strong>de hat aber gleichwohl für diese Sondervermögen e<strong>in</strong>en Nachweis darüber zu führen, dass im abgelaufenen<br />
Haushaltsjahr die Zwecksetzung des jeweiligen Sondervermögens e<strong>in</strong>gehalten wurde. Dieser Nachweis<br />
kann durch e<strong>in</strong> gesondertes Jahresergebnis (Abschluss) mit e<strong>in</strong>er dazu gehörenden Übersicht über die zurechenbaren<br />
Vermögen und Schulden geführt werden, so dass auch diese Unterlagen zum Gegenstand der Prüfung<br />
zu machen s<strong>in</strong>d (vgl. § 103 Abs. 1 Nr. 2 GO <strong>NRW</strong>). E<strong>in</strong>e jahresbezogene Ergebnisdarstellung dürfte aber <strong>in</strong><br />
vielen Fällen aus haushaltsrechtlicher Sicht ausreichend se<strong>in</strong>.<br />
II. Erläuterungen im E<strong>in</strong>zelnen<br />
1. Zu Absatz 1 (Arten der Sondervermögen):<br />
1.0 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Das geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsrecht kennt neben dem Geme<strong>in</strong>devermögen im haushaltsrechtlichen S<strong>in</strong>ne als weitere<br />
Art des geme<strong>in</strong>dlichen Vermögens das Sondervermögen. In dieser Vorschrift wird die Abgrenzung des Sondervermögens<br />
von den übrigen Arten des geme<strong>in</strong>dlichen Vermögens bestimmt und die möglichen Arten geme<strong>in</strong>dlicher<br />
Sondervermögen abschließend aufgezählt. Der Charakter des geme<strong>in</strong>dlichen Sondervermögens wird <strong>in</strong><br />
diesem Zusammenhang dadurch bestimmt, dass es sich bei geme<strong>in</strong>dlichem Sondervermögen um Vermögen der<br />
Geme<strong>in</strong>de handelt, das für die Erfüllung bestimmter Zwecke vom Haushalt der Geme<strong>in</strong>de abgesondert oder von<br />
e<strong>in</strong>em Dritten an die Geme<strong>in</strong>de für e<strong>in</strong>en bestimmten Zweck übereignet oder durch sonstige Rechtsakte unter<br />
Zweckb<strong>in</strong>dung auf die Geme<strong>in</strong>de übergegangen ist. Aus se<strong>in</strong>er besonderen Zwecksetzung oder e<strong>in</strong>er Zweckb<strong>in</strong>dung<br />
des besonderen geme<strong>in</strong>dlichen Vermögens folgt, dass Sondervermögen vom übrigen Geme<strong>in</strong>devermögen<br />
abzutrennen ist und dieses Vermögen daher nur bed<strong>in</strong>gt e<strong>in</strong>en Bestandteil des „Kernhaushalts“ der Geme<strong>in</strong>de<br />
darstellt. Auf Grund ihrer Verschiedenheiten und unterschiedlichen öffentlichen Zwecksetzungen s<strong>in</strong>d die e<strong>in</strong>zelnen<br />
benannten Gruppen von Sondervermögen deshalb haushaltsmäßig unterschiedlich zu behandeln.<br />
1.1 Zu Nummer 1 (Geme<strong>in</strong>degliedervermögen):<br />
Das Geme<strong>in</strong>degliedervermögen ist zwar Vermögen der Geme<strong>in</strong>de, jedoch steht es auf Grund besonderer Berechtigungen<br />
den Geme<strong>in</strong>dee<strong>in</strong>wohnern und nicht allgeme<strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>de zur Nutzung zu. Zum Geme<strong>in</strong>degliedervermögen<br />
gehören daher auf dem Grundeigentum der Geme<strong>in</strong>de lastende Nutzungsberechtigungen, z.B. bei<br />
GEMEINDEORDNUNG 599
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 97 GO <strong>NRW</strong><br />
Wald- und Wegegrundstücken, die aus der geschichtlichen Entwicklung der Geme<strong>in</strong>de heraus heute noch bestehen<br />
können. Auch kann <strong>in</strong> E<strong>in</strong>zelfällen das Nutzungsrecht nicht allen, sondern nur e<strong>in</strong>er Gruppe von E<strong>in</strong>wohnern<br />
der Geme<strong>in</strong>de zu stehen (Geme<strong>in</strong>degliederklassenvermögen). Der Geme<strong>in</strong>de obliegt gleichwohl aber die Pflicht,<br />
auch dieses Vermögen zu verwalten. Zum Geme<strong>in</strong>degliedervermögen enthält der § 99 GO <strong>NRW</strong> besondere Regelungen.<br />
1.2 Zu Nummer 2 (Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen):<br />
1.2.1 Übernommenes Vermögen<br />
Bei rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen (fiduziarische Stiftungen) werden i.d.R. durch e<strong>in</strong>en Dritten als<br />
Stifter der Geme<strong>in</strong>de Vermögensgegenstände mit e<strong>in</strong>er bestimmten Zwecksetzung (Stifterwillen) zu Eigentum<br />
übertragen. In diesen Fällen hat der Stifter die <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Eigentum bef<strong>in</strong>dlichen Vermögenswerte zu Gunsten<br />
e<strong>in</strong>es uneigennützigen, auf Dauer e<strong>in</strong>gerichteten Zwecks entäußert, der nach se<strong>in</strong>em Willen durch die Geme<strong>in</strong>de<br />
zu erfüllen ist. Diese Zwecksetzung führt dazu, dass die Geme<strong>in</strong>de nach außen im eigenen Namen auftritt, im<br />
Innenverhältnis zum Stifter aber an den jeweiligen Stifterwillen gebunden ist. Die Geme<strong>in</strong>de darf das mit dem<br />
Stiftungsvermögen erworbene Recht im eigenen Namen ausüben und hat bei der Nutzung des angenommenen<br />
Vermögens die Interessen des Stifters zu beachten.<br />
1.2.2 Abgegebenes geme<strong>in</strong>dliches Vermögen<br />
Die Geme<strong>in</strong>de kann aber auch selbst als Stifter auftreten und Vermögen zu Gunsten e<strong>in</strong>es uneigennützigen,<br />
auf Dauer e<strong>in</strong>gerichteten Zwecks entäußern, der nach ihrem Willen durch e<strong>in</strong>en Dritten zu erfüllen ist. Die Geme<strong>in</strong>de<br />
kann dabei Vermögen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e von ihr selbst errichtete rechtlich unselbstständige örtliche Stiftung e<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gen.<br />
In solchen besonderen E<strong>in</strong>zelfällen müssen jedoch die Voraussetzungen des § 100 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong><br />
erfüllt se<strong>in</strong>. Danach darf Geme<strong>in</strong>devermögen nur im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Geme<strong>in</strong>de und nur<br />
dann <strong>in</strong> e<strong>in</strong> Stiftungsvermögen e<strong>in</strong>gebracht werden, wenn der mit der Stiftung verfolgte Zweck auf andere Weise<br />
nicht erreicht werden kann.<br />
1.3 Zu Nummer 3 (Unternehmen und E<strong>in</strong>richtungen):<br />
1.3.1 Inhalte der Vorschrift<br />
Bei wirtschaftlichen Unternehmen (§ 114 GO <strong>NRW</strong>) und organisatorisch verselbstständigte E<strong>in</strong>richtungen (§ 107<br />
Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>) ohne eigene Rechtspersönlichkeit s<strong>in</strong>d die Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche E<strong>in</strong>richtungen<br />
wichtige Organisationsgebilde, die entsprechend den Vorschriften über die wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche<br />
Betätigung der Geme<strong>in</strong>den als Sondervermögen errichtet werden. Diese s<strong>in</strong>d unter Beachtung der Eigenbetriebsordnung<br />
(EigVO <strong>NRW</strong>) wirtschaftlich und verwaltungsmäßig selbstständig. Zu dieser Art von Sondervermögen<br />
gehören auch die geme<strong>in</strong>dlichen Krankenhäuser, die wie geme<strong>in</strong>dliche Eigenbetriebe als organisatorisch und<br />
wirtschaftlich eigenständige E<strong>in</strong>richtungen bzw. geme<strong>in</strong>dliche Betriebe geführt werden (vgl. §§ 1 und 10 der Geme<strong>in</strong>dekrankenhausbetriebsverordnung<br />
– GemKHBVO).<br />
Die geme<strong>in</strong>dliche Organisationsform „Eigenbetrieb“ ist als Alternative zu den privaten Unternehmensformen entwickelt<br />
worden. Wenn die Geme<strong>in</strong>de sich zulässigerweise wirtschaftlich betätigen will, soll es ihr durch e<strong>in</strong>e organisatorische<br />
Abgrenzung von der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung ermöglicht werden, bei dieser Tätigkeit nicht <strong>in</strong> die<br />
Entscheidungszwänge der öffentlichen Verwaltung e<strong>in</strong>gebunden zu se<strong>in</strong>. Gleichwohl sollen Grundzüge, Vorschriften<br />
und andere Bestandteile der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung erhalten bleiben. Das Eigenbetriebsrecht <strong>in</strong> Form des<br />
GEMEINDEORDNUNG 600
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 97 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 114 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. der Eigenbetriebsverordnung setzt dafür den rechtlichen Rahmen sowohl h<strong>in</strong>sichtlich der<br />
Verantwortung für die Wirtschaftsführung als auch für die Form des Rechnungswesens.<br />
1.3.2 Die Abgrenzung der nicht e<strong>in</strong>bezogenen Betriebe<br />
Zu den Betrieben nach dieser Vorschrift zählen nicht unselbstständige Betriebe <strong>in</strong>nerhalb der öffentlichen Verwaltung.<br />
Diese Regiebetriebe s<strong>in</strong>d als Verwaltungsbetriebe rechtlich und wirtschaftlich unselbstständige Betriebe, bei<br />
denen nur die Geme<strong>in</strong>de als Rechtsträger die erforderlichen Rechtsbeziehungen mit Dritten als Wirtschaftpartner<br />
e<strong>in</strong>gehen kann. Diese Betriebe s<strong>in</strong>d deshalb Teil der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung und an den Haushaltsplan der<br />
Geme<strong>in</strong>de gebunden. Die ihnen zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen sowie die kassenmäßigen Zahlungen<br />
s<strong>in</strong>d daher im Ergebnisplan (vgl. § 2 GemHVO <strong>NRW</strong>) bzw. F<strong>in</strong>anzplan (vgl. § 3 GemHVO <strong>NRW</strong>) des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltsplans enthalten (vgl. § 79 GO <strong>NRW</strong>).<br />
Unter diese Vorschrift fallen auch nicht die <strong>in</strong> der öffentlichen Verwaltung bestehenden Betriebe gewerblicher Art<br />
(BgA). Die Sonderform „Betrieb gewerblicher Art“ entsteht wegen der steuerlich relevanten Tätigkeiten der Geme<strong>in</strong>de,<br />
denn nach § 4 i.V.m. § 1 Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes (KStG) stellt e<strong>in</strong>e Tätigkeit e<strong>in</strong>er Geme<strong>in</strong>de<br />
dann e<strong>in</strong>en „Betrieb gewerblicher Art“ dar, wenn e<strong>in</strong>e nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeit der Geme<strong>in</strong>de<br />
zur Erzielung von E<strong>in</strong>nahmen außerhalb der Land- und Forstwirtschaft vorliegt, die sich aus der Tätigkeit der<br />
Geme<strong>in</strong>de wirtschaftlich heraushebt und <strong>in</strong> analoger Anwendung des § 14 AO ke<strong>in</strong>e vermögensverwaltende<br />
Tätigkeit der Geme<strong>in</strong>de ist (vgl. steuerrechtliche Literatur). Die geme<strong>in</strong>dlichen „Betriebe gewerblicher Art“ stellen<br />
daher nur e<strong>in</strong>e steuerrechtliche und ke<strong>in</strong>e bilanzierungsfähige geme<strong>in</strong>dliche Sonderform dar.<br />
1.4 Zu Nummer 4 (Versorgungs- und Versicherungse<strong>in</strong>richtungen):<br />
Die rechtlich unselbstständige Versorgungs- und Versicherungse<strong>in</strong>richtungen, die von der Geme<strong>in</strong>de errichtet<br />
worden s<strong>in</strong>d, nehmen wirtschaftlich gesehen e<strong>in</strong>e Sonderstellung e<strong>in</strong>. Diese geme<strong>in</strong>dlichen E<strong>in</strong>richtungen, z.B.<br />
eigene Zusatzversorgungskassen oder Eigenunfallversicherungen, können e<strong>in</strong>e entsprechend abgesonderte<br />
Haushalts- und Wirtschaftsführung und damit e<strong>in</strong>en eigenen Rechnungskreis und e<strong>in</strong>en eigenständigen Jahresabschluss<br />
erfordern. Ob diese E<strong>in</strong>richtungen <strong>in</strong> diesem S<strong>in</strong>ne eigenständig geführt werden sollen, von der Geme<strong>in</strong>de<br />
örtlich geklärt und entschieden werden.<br />
2. Zu Absatz 2 (Haushaltsvorschriften für Geme<strong>in</strong>degliedervermögen und Stiftungen):<br />
2.1 Zu Satz 1 (E<strong>in</strong>beziehung <strong>in</strong> die Haushaltswirtschaft):<br />
Für das Geme<strong>in</strong>degliedervermögen und das Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen als<br />
Sondervermögen nach Absatz 1 Nrn. 1 und 2 der Vorschrift gelten alle Vorschriften der haushaltsrechtlichen<br />
Vorschriften über die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft. Es kommen daher für die beiden Vermögensformen<br />
ke<strong>in</strong>e besonderen Haushaltspläne, Sonderrechnungen oder e<strong>in</strong>e eigenständige Bilanz oder e<strong>in</strong> Jahresabschluss<br />
nach haushaltsrechtlichen Vorschriften <strong>in</strong> Betracht. Die dem Geme<strong>in</strong>degliedervermögen und dem Vermögen der<br />
rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen als geme<strong>in</strong>dliche Vermögensformen zuzuordnenden Erträge und<br />
Aufwendungen s<strong>in</strong>d deshalb <strong>in</strong> der Ergebnisrechnung der Geme<strong>in</strong>de enthalten. Die Zahlungen für die Vermögensformen<br />
werden <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzrechnung erfasst. Das vorhandene Vermögen wird nach Arten<br />
und nicht als e<strong>in</strong>e Gesamtheit <strong>in</strong> der Bilanz der Geme<strong>in</strong>de angesetzt. Gleichwohl muss für diese Vermögensarten,<br />
auch wenn sie <strong>in</strong> die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft e<strong>in</strong>zubeziehen s<strong>in</strong>d, gewährleistet se<strong>in</strong>, dass die Zwecke<br />
dieser Sondervermögen durch die Geme<strong>in</strong>de erfüllt worden s<strong>in</strong>d. Ggf. ist dafür <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Nebenrechnung auch e<strong>in</strong><br />
besonderer Nachweis zu führen.<br />
GEMEINDEORDNUNG 601
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 97 GO <strong>NRW</strong><br />
2.2 Zu Satz 2 (Abbildung im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan):<br />
2.2.1 Die Abbildung im produktorientierten Teilplan<br />
Für das Geme<strong>in</strong>degliedervermögen der Geme<strong>in</strong>de gilt, dass es <strong>in</strong> dem produktorientierten Teilplan abzubilden ist,<br />
zudem die sachliche Aufgabenzugehörigkeit besteht (vgl. § 4 GemHVO <strong>NRW</strong>). Wenn z.B. das Geme<strong>in</strong>degliedervermögen<br />
ausschließlich aus land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken besteht, ist dieses im Produktbereich<br />
„Natur und Landschaftspflege“, ggf. als gesonderte Produktgruppe oder als Produkte nachzuweisen. Bei den<br />
rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen der Geme<strong>in</strong>de macht die Vorgabe der E<strong>in</strong>haltung der e<strong>in</strong>er Stiftung<br />
mitgegebenen Zwecksetzung e<strong>in</strong>en gesonderten Nachweis <strong>in</strong>nerhalb des Haushalts der Geme<strong>in</strong>de erforderlich.<br />
Der Erfüllung dieser Vorgabe dient u.a. der Produktbereich „Stiftungen“, der nach § 4 Abs. 1 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
für die Aufstellung der Teilpläne des geme<strong>in</strong>dlichen Haushalts verb<strong>in</strong>dlich vorgeben ist (vgl. Nr. 1.2.5 des Runderlasses<br />
des Innenm<strong>in</strong>isteriums vom 24.02.2005; SMBl. <strong>NRW</strong>. 6300).<br />
2.2.2 Ke<strong>in</strong> gesonderter Jahresabschluss<br />
Die Regelung <strong>in</strong> § 103 Abs. 1 Nr. 2 GO <strong>NRW</strong> sieht e<strong>in</strong>e Prüfungspflicht der örtlichen Rechnungsprüfung für die<br />
Jahresabschlüsse der Sondervermögen der Geme<strong>in</strong>de vor. Der <strong>in</strong> dieser Vorschrift für diese Aufgabe benutzte<br />
Begriff „Jahresabschluss“ soll sicherstellen, dass e<strong>in</strong> ggf. gesondert zu führender jahresbezogener Nachweis<br />
beim Geme<strong>in</strong>degliedervermögen und bei den rechtlich unselbstständigen Stiftungen auch örtlich geprüft wird. Die<br />
Verwendung des Begriffs „Jahresabschluss“ führt jedoch nicht zur Verpflichtung der Geme<strong>in</strong>de, für diese Vermögensarten<br />
e<strong>in</strong>en förmlichen Jahresabschluss nach den für die Geme<strong>in</strong>de geltenden haushaltsmäßigen Regelungen<br />
aufzustellen. Die Geme<strong>in</strong>de hat unabhängig von ihrem eigenen Jahresabschluss für jedes dieser Sondervermögen<br />
e<strong>in</strong> gesondertes jährliches Ergebnis fest- bzw. aufzustellen. Solche Ergebnisse für jedes Sondervermögen<br />
e<strong>in</strong>schließlich e<strong>in</strong>er Übersicht über die zurechenbaren Vermögen und Schulden reichen aus haushaltsrechtlicher<br />
Sicht für e<strong>in</strong>en Nachweis der vorhandenen Zwecksetzung und Zweckb<strong>in</strong>dung für diese beiden Vermögensarten<br />
aus. Sollte bei diesen Sondervermögen jedoch e<strong>in</strong>e gesonderte Steuerpflicht bestehen, kann e<strong>in</strong> solcher<br />
„haushaltsrechtlicher“ Nachweis im E<strong>in</strong>zelfall den Steuerbehörden ggf. nicht ausreichend se<strong>in</strong>.<br />
3. Zu Absatz 3 (Haushaltsvorschriften für Unternehmen und E<strong>in</strong>richtungen):<br />
Die Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de können bei wirtschaftlichen Unternehmen (§ 114 GO<br />
<strong>NRW</strong>) und organisatorisch verselbstständigten E<strong>in</strong>richtungen (§ 107 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>) als geme<strong>in</strong>dliche Betriebe<br />
nicht une<strong>in</strong>geschränkt gelten. Es ist zu berücksichtigen, dass diese Betriebe der Geme<strong>in</strong>de haushaltswirtschaftlich<br />
wie Kaufleute auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches handeln sollen. Nach der Aufzählung <strong>in</strong> der Vorschrift<br />
s<strong>in</strong>d diese geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe verpflichtet, die nachfolgend genannten Vorschriften s<strong>in</strong>ngemäß anzuwenden<br />
(vgl. Abbildung).<br />
Haushaltsvorschriften für Betriebe nach § 114 und § 107 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong><br />
Vorgaben<br />
Das wirtschaftliche Handeln so zu planen und zu führen,<br />
dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.<br />
Die Planung und Rechnung auszugleichen, so dass der<br />
jahresbezogene Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des<br />
Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.<br />
GEMEINDEORDNUNG 602<br />
Vorschriften<br />
§ 75 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 75 Abs. 2 Sätze 1 und 2 GO <strong>NRW</strong>
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 97 GO <strong>NRW</strong><br />
Die Liquidität e<strong>in</strong>schließlich der F<strong>in</strong>anzierung der Investitionen<br />
sicherzustellen.<br />
E<strong>in</strong>e Überschuldung nicht e<strong>in</strong>treten zu lassen.<br />
E<strong>in</strong>e mittelfristige Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung vorzunehmen.<br />
Bei Bedarf Verpflichtungsermächtigungen e<strong>in</strong>zusetzen.<br />
Kredite nur für Investitionen aufzunehmen.<br />
Die E<strong>in</strong>schränkungen bei der Bestellung von Sicherheiten<br />
und Gewährleistung für Dritte zu beachten.<br />
Für dem Grunde oder der Höhe nach ungewisse Verb<strong>in</strong>dlichkeiten,<br />
für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften<br />
oder laufenden Verfahren oder für bestimmte<br />
Aufwendungen Rückstellungen zu bilden.<br />
Ihre Zahlungsfähigkeit durch e<strong>in</strong>e angemessene Liquiditätsplanung<br />
sicherzustellen, ggf. auch Kredite zur Liquiditätssicherung<br />
aufzunehmen.<br />
Vermögensgegenstände nur zu erwerben, soweit dies zur<br />
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist oder wird und die<br />
Gegenstände pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten; bei<br />
Geldanlagen auf e<strong>in</strong>e ausreichende Sicherheit zu achten,<br />
Vermögensgegenstände <strong>in</strong> der Regel nur zu ihrem vollen<br />
Wert zu veräußern.<br />
Bei der Errichtung die Ermittlung der Wertansätze für die<br />
Eröffnungsbilanz auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten<br />
Zeitwerten vorzunehmen, die dann für die künftigen<br />
Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten<br />
gelten, dies gilt jedoch nicht bei e<strong>in</strong>er Erweiterung<br />
e<strong>in</strong>es bestehenden Eigenbetriebes.<br />
Ggf. e<strong>in</strong>e Wertberichtung der Eröffnungsbilanz vorzunehmen.<br />
E<strong>in</strong>e F<strong>in</strong>anzbuchhaltung e<strong>in</strong>zurichten.<br />
Ggf. die F<strong>in</strong>anzbuchhaltung von e<strong>in</strong>er anderen Stelle besorgen<br />
zu lassen.<br />
Den Jahresabschluss feststellen zu lassen.<br />
Darüber h<strong>in</strong>aus f<strong>in</strong>det die Eigenbetriebsverordnung Anwendung.<br />
Auch ist § 106 GO <strong>NRW</strong> h<strong>in</strong>sichtlich des Jahresabschlusses<br />
von Eigenbetrieben zu beachten.<br />
§ 75 Abs. 6 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 75 Abs. 7 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 84 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 85 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 86 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 87 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 88 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 89 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 90 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 92 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 92 Abs. 7 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 93 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 94 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 96 GO <strong>NRW</strong><br />
Abbildung 129 „Haushaltsvorschriften für Betriebe nach § 114 und § 107 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>“<br />
GEMEINDEORDNUNG 603
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 97 GO <strong>NRW</strong><br />
Diese Sachlage bed<strong>in</strong>gt, dass gesetzlich bestimmt worden ist, welche Vorschriften für die Haushaltswirtschaft der<br />
Geme<strong>in</strong>den s<strong>in</strong>ngemäß auch für diese Unternehmen und E<strong>in</strong>richtungen Anwendung f<strong>in</strong>den sollen. Die vorgenommene<br />
Festlegung bee<strong>in</strong>trächtigt nicht die gewollte Verknüpfung mit den handelsrechtlichen Vorschriften.<br />
4. Zu Absatz 4 (Haushaltsvorschriften für Versorgungs- und Versicherungse<strong>in</strong>richtungen):<br />
4.1 Zu Satz 1 (Wirtschaftsführung der Versorgungs- und Versicherungse<strong>in</strong>richtungen):<br />
Die rechtlich unselbstständige Versorgungs- und Versicherungse<strong>in</strong>richtungen nehmen wirtschaftlich gesehen e<strong>in</strong>e<br />
Sonderstellung e<strong>in</strong>, z.B. eigene Zusatzversorgungskassen oder Eigenunfallversicherungen. Diese können daher<br />
e<strong>in</strong>e entsprechend abgesonderte Haushalts- und Wirtschaftsführung erfordern. Für diese Sondervermögen wird<br />
deshalb durch die Vorschrift zugelassen, dass die für die Wirtschaftführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe<br />
geltenden Vorschriften s<strong>in</strong>ngemäß angewendet werden können. Das Rechnungswesen ist wie beim<br />
Eigenbetrieb auch für die Versorgungs- und Versicherungse<strong>in</strong>richtungen von zentraler Bedeutung.<br />
Der Eigenbetrieb führt se<strong>in</strong>e Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung. Die Buchführung<br />
muss den handelsrechtlichen Grundsätzen oder den für das Neue Kommunale <strong>F<strong>in</strong>anzmanagement</strong> geltenden<br />
Grundsätzen entsprechen. Die angewandte kaufmännische Buchführung muss daher e<strong>in</strong>e vollständige<br />
Abbildung der Vermögenslage und Erträge und Aufwendungen liefern. Zudem soll mit der Aufstellung des Wirtschaftsplans<br />
und des Jahresabschlusses soll daher die notwendige Transparenz geschaffen werden, die dafür<br />
klare Verantwortlichkeiten erfordert. Dies ist auf Grund dieser Vorschrift von den Versorgungs- und Versicherungse<strong>in</strong>richtungen<br />
der Geme<strong>in</strong>den umzusetzen.<br />
4.2 Zu Satz 2 (Verweis auf Absatz 3):<br />
Die Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de können bei wirtschaftlich tätigen und organisatorisch<br />
verselbstständigten Versorgungs- und Versicherungse<strong>in</strong>richtungen nicht une<strong>in</strong>geschränkt gelten. Es ist vielmehr<br />
zu berücksichtigen, dass diese E<strong>in</strong>richtungen haushaltswirtschaftlich wie Kaufleute auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches<br />
handeln sollen. Daher ist durch den Verweis auf Absatz 3 gesetzlich bestimmt worden, welche<br />
Vorschriften für die Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>den s<strong>in</strong>ngemäß auch für diese E<strong>in</strong>richtungen Anwendung<br />
f<strong>in</strong>den sollen. Die vorgenommene Festlegung bee<strong>in</strong>trächtigt nicht die Anwendung von handelsrechtlichen Vorschriften.<br />
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ<br />
GEMEINDEORDNUNG 604
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 98 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 98<br />
Treuhandvermögen<br />
(1) 1 Für rechtlich selbständige örtliche Stiftungen sowie Vermögen, die die Geme<strong>in</strong>de nach besonderem Recht<br />
treuhänderisch zu verwalten hat, s<strong>in</strong>d besondere Haushaltspläne aufzustellen und Sonderrechnungen zu führen.<br />
2 Die Vorschriften des § 75 Abs. 1, Abs. 2 Sätze 1 und 2, Abs. 6 und 7, der §§ 78 bis 80, 82 bis 87, 89, 90,<br />
93 und 94 sowie § 96 Abs. 1 s<strong>in</strong>d s<strong>in</strong>ngemäß anzuwenden, soweit nicht Vorschriften des Stiftungsgesetzes<br />
entgegen stehen. 3 Die §§ 78 und 80 s<strong>in</strong>d mit der Maßgabe s<strong>in</strong>ngemäß anzuwenden, dass an die Stelle der<br />
Haushaltssatzung der Beschluss über den Haushaltsplan tritt und von der öffentlichen Bekanntgabe und dem<br />
Verfügbarhalten zur E<strong>in</strong>sichtnahme nach § 80 Abs. 3 und 6 abgesehen werden kann.<br />
(2) Unbedeutendes Treuhandvermögen kann im Haushalt der Geme<strong>in</strong>de gesondert nachgewiesen werden.<br />
(3) Mündelvermögen s<strong>in</strong>d abweichend von den Absätzen 1 und 2 nur im Jahresabschluss gesondert nachzuweisen.<br />
(4) Besondere gesetzliche Vorschriften oder Bestimmungen des Stifters bleiben unberührt.<br />
Erläuterungen zu § 98:<br />
I. Allgeme<strong>in</strong>es<br />
1. Das Treuhandvermögen bei der Geme<strong>in</strong>de<br />
Neben dem allgeme<strong>in</strong>en Geme<strong>in</strong>devermögen im haushaltsrechtlichen S<strong>in</strong>n kennt das geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsrecht<br />
als e<strong>in</strong>e weitere Art von geme<strong>in</strong>dlichen Vermögen das Treuhandvermögen der Geme<strong>in</strong>de. Bei Treuhandvermögen<br />
werden von der Geme<strong>in</strong>de fremde Vermögensgegenstände treuhänderisch gehalten, denn sie ist von<br />
Dritten beauftragt worden oder gesetzlich verpflichtet, das ihr übergebene Vermögen zu verwalten und nicht für<br />
eigene Zwecke zu verwenden. Die Geme<strong>in</strong>de hat das ihr übergebene Vermögen (Treuhandvermögen) dann im<br />
eigenen Namen und für fremde Rechnung zu verwalten.<br />
Für die Geme<strong>in</strong>de folgt aus ihrer Tätigkeit als Treuhänder, dass sie gegenüber dem Dritten als Treugeber für e<strong>in</strong>e<br />
ordnungsgemäße Verwaltung des Treuhandvermögens haftet. Daher ist die gesonderte Behandlung von bei der<br />
Geme<strong>in</strong>de vorhandenem Treuhandvermögen und Mündelvermögen haushaltsrechtlich und haushaltswirtschaftlich<br />
geboten. Zur Vere<strong>in</strong>fachung der treuhänderischen Verwaltung von unbedeutendem Treuhandvermögen wird<br />
durch die Vorschrift jedoch ausdrücklich e<strong>in</strong>e Ausnahme von der sonst notwendigen Separierung von Treuhandvermögen<br />
vom übrigen Geme<strong>in</strong>devermögen zugelassen (vgl. Absatz 2).<br />
2. Der Begriff „Treuhand“<br />
Der Begriff „Treuhand“ ist gesetzlich nicht def<strong>in</strong>iert und wird daher <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Vielzahl von unterschiedlichen Ausprägungen<br />
und Zusammenhängen verwendet. So liegt e<strong>in</strong> Treuhandverhältnis vor, wenn durch e<strong>in</strong>e Abrede der<br />
Treuhänder der Inhaber von Vermögensrechten wird, die ihm „zu treuen Händen“ vom Treugeber übertragen<br />
werden. Im Verhältnis zu Dritten (Außenverhältnis) hat der Treuhänder, z.B. das Eigentum an e<strong>in</strong>er Sache, und<br />
damit die volle Rechtsstellung des Eigentümers. Im Verhältnis zum Treugeber ist der Treuhänder h<strong>in</strong>sichtlich der<br />
Verfügung über die Sache durch e<strong>in</strong>en Treuhandvertrag gebunden, so dass die Sache im S<strong>in</strong>ne des Treugebers<br />
zu verwalten ist und der Treuhänder nur vertragsgemäße Verfügungen vornehmen darf.<br />
GEMEINDEORDNUNG 605
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 98 GO <strong>NRW</strong><br />
Im Baurecht s<strong>in</strong>d Treuhandverhältnisse weit verbreitet. So wird z.B. bestimmt, dass e<strong>in</strong> Sanierungsträger, dem<br />
e<strong>in</strong>e Aufgabe als Treuhänder von der Geme<strong>in</strong>de übertragen wurde, diese Aufgabe <strong>in</strong> eigenem Namen für Rechnung<br />
der Geme<strong>in</strong>de erfüllt. Der Sanierungsträger erhält von der Geme<strong>in</strong>de für den Rechtsverkehr e<strong>in</strong>e Besche<strong>in</strong>igung<br />
über die Übertragung der Aufgabe als Treuhänder. Er soll bei Erfüllung der Aufgabe se<strong>in</strong>em Namen e<strong>in</strong>en<br />
das Treuhandverhältnis kennzeichnenden Zusatz h<strong>in</strong>zufügen. So hat der als Treuhänder tätige Sanierungsträger<br />
das <strong>in</strong> Erfüllung der Aufgabe gebildete Treuhandvermögen getrennt von anderem Vermögen zu verwalten. Aber<br />
die Geme<strong>in</strong>de gewährleistet auch die Erfüllung der Verb<strong>in</strong>dlichkeiten (vgl. § 160 des BauGB).<br />
3. Die Bilanzierung des Treuhandvermögens<br />
3.1 Die Bilanzierung bei der Geme<strong>in</strong>de als Treuhänder<br />
3.1.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Bei Treuhandvermögen werden von der Geme<strong>in</strong>de fremde Vermögensgegenstände treuhänderisch gehalten,<br />
denn sie ist von Dritten beauftragt worden oder gesetzlich verpflichtet, das ihr übergebene Vermögen zu verwalten<br />
und nicht für eigene Zwecke zu verwenden (Ermächtigungstreuhand). E<strong>in</strong>em solchen Treuhandverhältnis liegt<br />
die der Geme<strong>in</strong>de (Treuhänder) anvertraute Verfügung über Sachen und Rechte zu Grunde, diese im Interesse<br />
des betreffenden Dritten (Treugeber) auszuüben.<br />
Nach den allgeme<strong>in</strong>en Bilanzierungsgrundsätzen ist das Treuhandvermögen <strong>in</strong> der Bilanz des Treugebers anzusetzen,<br />
weil dieser weiterh<strong>in</strong> als rechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer zu betrachten ist. Dieses gilt auch,<br />
wenn die Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>e Verwaltungstreuhand als Vollrechtstreuhand <strong>in</strong>nehat. In solchen Fällen erwirbt die Geme<strong>in</strong>de<br />
das rechtliche Eigentum an dem Treugut, obwohl die vertraglichen Beziehungen regelmäßig vorsehen,<br />
dass die Risiken des Untergangs sowie die Nutzungen und Lasten beim Treugeber verbleiben. In diesen Fällen<br />
bleibt der Treugeber wirtschaftlicher Eigentümer, so dass das Treugut nicht bei der Geme<strong>in</strong>de zu bilanzieren ist.<br />
Für die Geme<strong>in</strong>de folgt aus ihrer Tätigkeit als Treuhänder, dass sie gegenüber dem Dritten als Treugeber für e<strong>in</strong>e<br />
ordnungsgemäße Verwaltung des Treuhandvermögens haftet und e<strong>in</strong>e Herausgabeverpflichtung besteht. E<strong>in</strong>e<br />
zweifache Bilanzierung des Treuhandvermögens, also zusätzlich zum Treugeber auch bei der Geme<strong>in</strong>de als<br />
Treuhänder, ist wegen der gesonderten Verwaltung des Treuhandvermögens außerhalb des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushalts nicht erforderlich. Daher ist die gesonderte Behandlung von bei der Geme<strong>in</strong>de vorhandenem Treuhandvermögen<br />
und Mündelvermögen haushaltsrechtlich und haushaltswirtschaftlich geboten.<br />
3.1.2 Ausweispflichten und Buchführung<br />
Für den Ausweis von Treuhandvermögen und Treuhandverb<strong>in</strong>dlichkeiten <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz bedarf es<br />
daher ke<strong>in</strong>er besonderen Regelung. Werden von der Geme<strong>in</strong>de fremde Vermögensgegenstände treuhänderisch<br />
gehalten, ist es geboten, dies im Anhang oder im Verb<strong>in</strong>dlichkeitenspiegel unter den Haftungsverhältnissen anzugeben.<br />
Bei der Geme<strong>in</strong>de kann aus ihrer Tätigkeit als Treuhänder e<strong>in</strong> gesondertes Buchungserfordernis entstehen,<br />
wenn der Umfang ihres Treuhandauftrages e<strong>in</strong>e eigene Rechnungslegung erfordert. Diese kann dar<strong>in</strong><br />
bestehen, dass e<strong>in</strong>e Treuhandbuchführung e<strong>in</strong>gerichtet wird oder <strong>in</strong> der eigenen Buchführung der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong><br />
eigener Rechnungskreis mit besonderen Konten (Treuhandtätigkeit) e<strong>in</strong>gerichtet wird. In e<strong>in</strong>em solchen Fall ist<br />
dann auf e<strong>in</strong>e strikte Trennung im Buchungsgeschehen zu achten. In der eigenen F<strong>in</strong>anzbuchhaltung ist dann<br />
nur der ggf. bestehende Anspruch auf Vergütung als Treuhänder zu erfassen.<br />
E<strong>in</strong> Bedarf für e<strong>in</strong>e Bilanzierungsregelung für Geme<strong>in</strong>den wurde bisher nicht für erforderlich angesehen. E<strong>in</strong>e<br />
solche Regelung besteht nur für Kredit<strong>in</strong>stitute als erforderlich angesehen, wenn diese als Treuhänder gegenüber<br />
Dritten tätig s<strong>in</strong>d. Diese Institute haben das von ihnen zu verwaltende Treuhandvermögen <strong>in</strong> ihrer Bilanz anzuset-<br />
GEMEINDEORDNUNG 606
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 98 GO <strong>NRW</strong><br />
zen. Dem Vermögensansatz auf der Aktivseite ihrer Bilanz muss jedoch <strong>in</strong> gleicher Höhe e<strong>in</strong>e Treuhandverb<strong>in</strong>dlichkeit<br />
auf der Passivseite ihrer Bilanz gegenüber stehen. Durch diese Bilanzierung soll die Herausgabeverpflichtung<br />
des Treuhänders für das übernommene Treugut gegenüber dem Treugeber offen gelegt werden (vgl. § 6<br />
RechKredV).<br />
3.2 Die Bilanzierung bei der Geme<strong>in</strong>de als Treugeber<br />
Die Geme<strong>in</strong>de kann aber auch e<strong>in</strong>em Dritten eigene Vermögensteile überlassen, z.B. e<strong>in</strong>em Sanierungsträger<br />
(vgl. § 157 BauGB), so dass sie als Treugeber auftritt. Erfüllt der Dritte die ihm von der Geme<strong>in</strong>de übertragenen<br />
Aufgaben im eigenen Namen auf Rechnung der Geme<strong>in</strong>de wird der Sanierungsträger als Treuhänder der Geme<strong>in</strong>de<br />
tätig (vgl. § 159 BauGB). Zum Treuhandvermögen gehört dabei das Vermögen, das die Geme<strong>in</strong>de zur<br />
Erfüllung der Aufgabe durch den Dritten bereitstellt. In diesen Fällen f<strong>in</strong>den die allgeme<strong>in</strong>en Bilanzierungsgrundsätze<br />
Anwendung, so dass die Geme<strong>in</strong>de bei solchen Treuhandverhältnissen wirtschaftlicher Eigentümer der<br />
übergebenen Vermögensgegenstände bleibt und diese bei ihr als Treugeber zu bilanzieren s<strong>in</strong>d.<br />
Diese Grundsätze gelten auch für den Fall, dass Treugut von e<strong>in</strong>em Dritten zu treuen Händen des Treugebers<br />
erworben wird. Im Auftrag des Treugebers übernommene Verpflichtungen s<strong>in</strong>d beim Treuhänder anzusetzen, ggf.<br />
auch die gegen die Geme<strong>in</strong>de als Treugeber bestehenden Forderungen auf Freistellung von den Verpflichtungen.<br />
Wegen der vielfältigen Ausgestaltungsmöglichkeiten von Treuhandverhältnissen muss aber bei der Aufstellung<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz die Aufgabenübertragung an e<strong>in</strong>en Sanierungsträger und e<strong>in</strong> bestehendes Treuhandverhältnis<br />
sowie dessen Auflösung immer im E<strong>in</strong>zelnen unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse betrachtet<br />
und bewertet werden.<br />
3.3 Treuhandverhältnisse und Pensionsrückstellungen<br />
Im Zusammenhang mit der Bilanzierung geme<strong>in</strong>dlicher Treuhandverhältnisse ist darauf h<strong>in</strong>zuweisen, dass die<br />
Geme<strong>in</strong>de durch e<strong>in</strong> Treuhandverhältnis zur H<strong>in</strong>terlegung von Pensionsverpflichtungen weder auf die notwendige<br />
Liquiditätsvorsorge für die zu zahlenden Versorgungsleistungen (vgl. § 75 Abs. 6 GO <strong>NRW</strong>) verzichten noch ihre<br />
Pensionsrückstellungen m<strong>in</strong>dern kann. Auch die sog. Treuhandlösung „Contractual Trust Arrangements“ (CTA)<br />
zur Absicherung und F<strong>in</strong>anzierung langfristig fällig werdender Pensionsverpflichtungen stellen ke<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>derechtlich<br />
zulässige Besicherung dar, die zur M<strong>in</strong>derung der von der Geme<strong>in</strong>de zu bilanzierenden Pensionsrückstellungen<br />
führen kann, auch wenn dabei e<strong>in</strong> unabhängiger Rechtsträger e<strong>in</strong>e treuhänderische Verwaltung vornimmt.<br />
II. Erläuterungen im E<strong>in</strong>zelnen<br />
1. Zu Absatz 1 (Verwaltung von Treuhandvermögen):<br />
Die Geme<strong>in</strong>de ist vielfach gesetzlich als Vermögensverwalter bestimmt oder von Dritten beauftragt worden,<br />
dass ihr übergebene fremde Vermögen zu verwalten (Treuhandvermögen). Zur Vere<strong>in</strong>fachung der Verwaltungsaufgabe<br />
wird durch die Vorschrift im E<strong>in</strong>zelnen bestimmt, dass die Geme<strong>in</strong>de dabei ausgewählte haushaltsrechtliche<br />
Vorschriften anzuwenden hat (vgl. Sätze 2 und 3 der Vorschrift). Sie muss deshalb im Rahmen<br />
ihrer Tätigkeit gewährleisten, dass das von ihr zu verwaltende Vermögen nicht unterscheidungslos im sonstigen<br />
(freien) Vermögen der Geme<strong>in</strong>de aufgeht. Die Separierung dieses Vermögens muss jederzeit sichergestellt<br />
werden.<br />
GEMEINDEORDNUNG 607
1.1 Zu Satz 1 (Treuhandvermögen):<br />
1.1.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 98 GO <strong>NRW</strong><br />
In dieser Vorschrift werden unter dem Begriff „Treuhandvermögen“ die rechtlich selbstständigen Stiftungen und<br />
das sonstige treuhänderisch zu verwaltende Vermögen zusammengefasst. Dabei ist ausschlaggebend, dass<br />
das Treuhandvermögen zivilrechtlich nicht im Eigentum der Geme<strong>in</strong>de steht, ihr aber zur eigenverantwortlichen<br />
Verwaltung gesetzlich anvertraut ist und durch e<strong>in</strong>e besondere Zwecksetzung die Vermögensverwaltung im<br />
Interesse von Dritten der Geme<strong>in</strong>de als Pflicht auferlegt wird. Hier kommt <strong>in</strong>sbesondere das Mündelvermögen <strong>in</strong><br />
Betracht, das die Geme<strong>in</strong>de als Träger der öffentlichen Jugendhilfe zu verwalten haben.<br />
Zum Treuhandvermögen zählen nicht die Vermögensgegenstände, die der Geme<strong>in</strong>de im Rahmen übertragener<br />
Aufgaben zur Verfügung gestellt werden. Auch wenn die Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>em Dritten treuhänderisch Vermögensteile<br />
überlässt, z.B. e<strong>in</strong>em Sanierungsträger, stellt dies ke<strong>in</strong> Treuhandvermögen der Geme<strong>in</strong>de dar. Es werden<br />
durch diese Vorschrift nur die Fälle erfasst, <strong>in</strong> denen die Geme<strong>in</strong>de selbst Treuhänder ist. Die wichtigsten Formen<br />
von Treuhandvermögen bei Geme<strong>in</strong>den s<strong>in</strong>d selbständige örtliche Stiftungen sowie Mündelvermögen.<br />
1.1.2 Rechtlich selbständige örtliche Stiftungen als geme<strong>in</strong>dliches Treuhandvermögen<br />
E<strong>in</strong>e Stiftung gilt als örtliche Stiftung, wenn es sich um e<strong>in</strong>e unselbstständige oder rechtlich selbstständige Stiftung<br />
handelt, die nach dem Willen des Stifters von der Geme<strong>in</strong>de verwaltet wird und die überwiegend Zwecken<br />
dient, die von der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> ihrem Bereich erfüllt werden können. Damit wird deutlich, dass der Stiftungszweck<br />
immer auf Aufgaben gerichtet se<strong>in</strong> muss, die auch von der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> ihrem sachlichen und räumlichen Zuständigkeitsbereich<br />
selbst vorgenommen werden können. Bei rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen<br />
(fiduziarische Stiftungen) werden i.d.R. durch e<strong>in</strong>en Dritten als Stifter der Geme<strong>in</strong>de Vermögensgegenstände mit<br />
e<strong>in</strong>er bestimmten Zwecksetzung (Stifterwillen) zu Eigentum übertragen. Derartige Stiftungen hat die Geme<strong>in</strong>de<br />
als Sondervermögen zu führen (vgl. § 97 GO <strong>NRW</strong>). Dagegen f<strong>in</strong>det bei rechtlich selbstständigen örtlichen Stiftungen<br />
ke<strong>in</strong>e Vermögensübertragung an die Geme<strong>in</strong>de statt, sie kann vielmehr nur treuhänderisch als Verwalter<br />
e<strong>in</strong>er selbstständigen Stiftung tätig werden. Dies hat u.a. zur Folge, dass <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e solche Stiftung die Geme<strong>in</strong>den<br />
selbst Teile ihres Vermögens e<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gen darf (vgl. § 100 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong>). Die Verwaltung der Stiftungen durch<br />
die Geme<strong>in</strong>de dient der nachhaltigen Verwirklichung der von den Stiftern gesetzten Zwecke und soll diese auf<br />
Dauer sicherstellen.<br />
1.1.3 Mündelvermögen als geme<strong>in</strong>dliches Treuhandvermögen<br />
E<strong>in</strong> Mündelvermögen, das von der Geme<strong>in</strong>de treuhänderisch zu verwalten ist, ist e<strong>in</strong>e besondere Form des Treuhandvermögens.<br />
Es liegt i.d.R. dann bei der Geme<strong>in</strong>de vor, wenn e<strong>in</strong> M<strong>in</strong>derjähriger der Vormundschaft bedarf,<br />
diese durch das örtliche Jugendamt ausgeübt wird, z.B. e<strong>in</strong>e gesetzliche Amtsvormundschaft nach § 1791c BGB,<br />
und der M<strong>in</strong>derjährige vermögend ist. In Ausübung der Amtsvormundschaft ist z.B. das Vermögen e<strong>in</strong>es Mündels,<br />
das bei der Anordnung der Vormundschaft vorhanden ist oder später dem Mündel zufällt, zu verzeichnen (vgl. §<br />
1802 BGB). Der Vormund e<strong>in</strong>es Mündels hat zudem das zum Vermögen des Mündels gehörende Geld verz<strong>in</strong>slich<br />
anzulegen, soweit es nicht zur Bestreitung von Ausgaben bereitzuhalten ist. Er ist zudem bei der Geldanlage<br />
an bestimmte Anlageformen gebunden, damit diese mündelsicher ist (vgl. §§ 1806 und 1807 BGB).<br />
1.2 Zu Satz 2 (Anwendung haushaltsrechtlicher Vorschriften):<br />
Zur Vere<strong>in</strong>fachung der Aufgabe der Geme<strong>in</strong>de, fremdes Vermögen treuhänderisch zu verwalten, s<strong>in</strong>d nach der<br />
Vorschrift ausgewählte haushaltsrechtliche Vorschriften für Geme<strong>in</strong>den s<strong>in</strong>ngemäß anzuwenden, soweit nicht<br />
GEMEINDEORDNUNG 608
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 98 GO <strong>NRW</strong><br />
Vorschriften des Stiftungsgesetzes entgegen stehen. Aus dem Sachzusammenhang und dem Zweck der Vermögensverwaltung<br />
s<strong>in</strong>d die nachfolgenden haushaltsrechtlichen Vorschriften der Geme<strong>in</strong>deordnung zur s<strong>in</strong>ngemäßen<br />
Anwendung bestimmt worden (vgl. Abbildung).<br />
Haushaltsvorschriften für Unternehmen und E<strong>in</strong>richtungen<br />
Vorgaben<br />
Allgeme<strong>in</strong>e Haushaltsgrundsätze<br />
Verpflichtung zum Haushaltsausgleich<br />
Verpflichtung zur Sicherstellung der Liquidität<br />
Verbot der bilanziellen Überschuldung<br />
Verpflichtung zur Aufstellung e<strong>in</strong>er Haushaltssatzung<br />
Verpflichtung zur Aufstellung e<strong>in</strong>es Haushaltsplan<br />
E<strong>in</strong>haltung des Verfahrens der Haushaltsaufstellung<br />
Beachtung der vorläufigen Haushaltsführung<br />
Über- und außerpl. Aufwendungen und Auszahlungen<br />
Verpflichtung zur mittelfr. Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung<br />
Gebrauch von Verpflichtungsermächtigungen<br />
Aufnahme von Krediten für Investitionen<br />
Bestellung von Sicherheiten und Gewährleistung für Dritte<br />
Sicherung der Liquidität<br />
Umgang mit Vermögensgegenständen<br />
GEMEINDEORDNUNG 609<br />
Vorschriften<br />
§ 75 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 75 Abs. 2 S. 1 und 2 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 75 Abs. 6 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 75 Abs. 7 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 78 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 79 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 80 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 82 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 83 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 84 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 85 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 86 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 87 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 89 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 90 GO <strong>NRW</strong>
Aufgaben der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung<br />
Übertragung der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung<br />
Feststellung des Jahresabschlusses<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 98 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 93 GO<strong>NRW</strong><br />
§ 94 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 96 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong><br />
Abbildung 130 „Haushaltsvorschriften für Treuhandvermögen“<br />
In diesem Zusammenhang ist auch der § 103 Abs. 1 Nr. 5 GO <strong>NRW</strong> zu beachten, dass zur Aufgabe der örtlichen<br />
Rechnungsprüfung gehört, die Zahlungsabwicklung der Geme<strong>in</strong>de dauernd zu überwachen und zu prüfen, aber<br />
auch die Prüfung der (DV-Buchführungsprogramme vor ihrer Anwendung vorzunehmen, wenn die F<strong>in</strong>anzbuchhaltung<br />
mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung erfolgt. Davon s<strong>in</strong>d auch die von der Geme<strong>in</strong>de verwalteten<br />
Treuhandvermögen berührt, weil sie haushaltsmäßig von der Geme<strong>in</strong>de bewirtschaftet werden.<br />
1.3 Weitere haushaltsmäßige Maßgaben<br />
Nach der Vorschrift s<strong>in</strong>d die haushaltsrechtlichen Vorgaben <strong>in</strong> den § 78 GO <strong>NRW</strong> bei Treuhandvermögen der<br />
Geme<strong>in</strong>de s<strong>in</strong>d mit der Maßgabe s<strong>in</strong>ngemäß anzuwenden, dass an die Stelle der Haushaltssatzung der Beschluss<br />
über den Haushaltsplan des Treuhandvermögens tritt. Auch die Vorgaben <strong>in</strong> § 80 GO <strong>NRW</strong> s<strong>in</strong>d mit der<br />
Maßgabe s<strong>in</strong>ngemäß anzuwenden, dass von der öffentlichen Bekanntgabe des Entwurfs zur Erhebung von E<strong>in</strong>wendungen<br />
(vgl. § 80 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong>) abgesehen werden kann. E<strong>in</strong>e Abweichung besteht zudem von den<br />
Vorgaben zum Verfügbarhalten zur E<strong>in</strong>sichtnahme <strong>in</strong> den Haushaltsplan nach § 80 Abs. 6 GO <strong>NRW</strong>, so dass von<br />
e<strong>in</strong>em langfristigen Verfügbarhalten des Haushaltsplans jedes Treuhandvermögens, das von der Geme<strong>in</strong>de verwaltet<br />
wird, abgesehen werden kann.<br />
2. Zu Absatz 2 (Haushaltsmäßige Behandlung von unbedeutendem Treuhandvermögen):<br />
Durch die Vorschrift wird zur Vere<strong>in</strong>fachung der treuhänderischen Verwaltung von Treuhandvermögen für die<br />
Geme<strong>in</strong>den ausdrücklich zugelassen, dass unbedeutendes Treuhandvermögen im Haushalt der Geme<strong>in</strong>de<br />
gesondert nachgewiesen werden kann. Diese Besonderheit stellt e<strong>in</strong>e Ausnahme von der sonst notwendigen<br />
Separierung von Treuhandvermögen vom übrigen Geme<strong>in</strong>devermögen dar. Die Eigenart des Treuhandvermögens<br />
erfordert i.d.R. e<strong>in</strong>e vom Kernhaushalt der Geme<strong>in</strong>de abgesonderte Wirtschaftsführung, so dass für das<br />
Treuhandvermögen üblicherweise gesonderte Haushaltspläne aufzustellen und Sonderrechnungen zu führen<br />
s<strong>in</strong>d. Wird von der Vere<strong>in</strong>fachungsregelung Gebrauch gemacht, ist dieses Treuhandvermögen im geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushalt dem Produktbereich „Stiftungen“ zuzuordnen. Dadurch den Besonderheiten wird <strong>in</strong> ausreichendem<br />
Maße dem Besonderheiten von Treuhandvermögen Genüge getan.<br />
3. Zu Absatz 3 (Haushaltsmäßige Behandlung von Mündelvermögen):<br />
Durch die Vorschrift wird zur Vere<strong>in</strong>fachung der Verwaltung von Mündelvermögen für die Geme<strong>in</strong>de ausdrücklich<br />
zugelassen, dass Mündelvermögen nur im geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss gesondert nachzuweisen. ist.<br />
Dies be<strong>in</strong>haltet jedoch e<strong>in</strong>e Erläuterungspflicht für die Geme<strong>in</strong>de und erfordert daher e<strong>in</strong>e entsprechende Angabe<br />
im Anhang. Gleichwohl muss auch im Rahmen der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft die sichere Verwaltung<br />
von Mündelgeld, die Trennbarkeit und Rechnungslegung des Geldes e<strong>in</strong>schließlich der Z<strong>in</strong>sen jederzeit<br />
gewährleistet se<strong>in</strong> (vgl. § 56 Abs. 3 SGB VIII). Auch deshalb ist e<strong>in</strong>e gesonderte Behandlung von Mündelvermögen<br />
<strong>in</strong>nerhalb der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft geboten.<br />
GEMEINDEORDNUNG 610
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 98 GO <strong>NRW</strong><br />
4. Zu Absatz 4 (Besondere Vorgaben für die Verwaltung von Stiftungen):<br />
Die Verwaltung von Treuhandvermögen durch die Geme<strong>in</strong>de be<strong>in</strong>haltet, dafür Sorge zu tragen, dass die besonderen<br />
Zweckbestimmungen e<strong>in</strong>gehalten werden. Auch die Verwaltung dieser besonderen Vermögen der Geme<strong>in</strong>den<br />
obliegt eigenem Recht. So müssen die besonderen Vorschriften - bei Stiftungen der Wille des Stifters -<br />
von der Geme<strong>in</strong>de bei der Vermögensverwaltung beachtet werden. Daraus kann sich ergeben, dass im E<strong>in</strong>zelfall<br />
e<strong>in</strong> Vorrang der besonderen Vorschriften bzw. des Stifterwillens vor e<strong>in</strong>er möglichen Verwaltungsentscheidung<br />
der Geme<strong>in</strong>de besteht. Die Vorschrift stellt diese Maßgaben noch e<strong>in</strong>mal ausdrücklich heraus.<br />
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ<br />
GEMEINDEORDNUNG 611
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 99 GO<br />
§ 99<br />
Geme<strong>in</strong>degliedervermögen<br />
(1) Für die Nutzung des Geme<strong>in</strong>devermögens, dessen Ertrag nach bisherigem Recht nicht der Geme<strong>in</strong>de, sondern<br />
sonstigen Berechtigten zusteht (Geme<strong>in</strong>degliedervermögen), bleiben die bisherigen Vorschriften und Gewohnheiten<br />
unberührt.<br />
(2) 1 Geme<strong>in</strong>degliedervermögen darf nicht <strong>in</strong> Privatvermögen der Nutzungsberechtigten umgewandelt werden.<br />
2 Es kann <strong>in</strong> freies Geme<strong>in</strong>devermögen umgewandelt werden, wenn die Umwandlung aus Gründen des Geme<strong>in</strong>wohls<br />
geboten ist. 3 Den bisher Berechtigten ist e<strong>in</strong> E<strong>in</strong>kaufsgeld zurückzuzahlen, durch welches sie das<br />
Recht zur Teilnahme an der Nutzung des Geme<strong>in</strong>degliedervermögens erworben haben. 4 Soweit nach den bisher<br />
geltenden rechtlichen Vorschriften Nutzungsrechte am Geme<strong>in</strong>degliedervermögen den Berechtigten gegen<br />
ihren Willen nicht entzogen oder geschmälert werden dürfen, muss von der Geme<strong>in</strong>de bei der Umwandlung<br />
e<strong>in</strong>e angemessene Entschädigung gezahlt werden. 5 Handelt es sich um Nutzungsrechte an landwirtschaftlich<br />
genutzten Grundstücken, so kann die Entschädigung auch durch H<strong>in</strong>gabe e<strong>in</strong>es Teils derjenigen Grundstücke<br />
gewährt werden, an denen die Nutzungsrechte bestehen.<br />
(3) Geme<strong>in</strong>devermögen darf nicht <strong>in</strong> Geme<strong>in</strong>degliedervermögen umgewandelt werden.<br />
Erläuterungen zu § 99:<br />
I. Allgeme<strong>in</strong>es<br />
1. Begriff „Geme<strong>in</strong>degliedervermögen“<br />
Das geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsrecht kennt neben dem Geme<strong>in</strong>devermögen im haushaltsrechtlichen S<strong>in</strong>ne als weitere<br />
Art des geme<strong>in</strong>dlichen Vermögens die Sondervermögen (vgl. § 97 GO <strong>NRW</strong>). In dieser Vorschrift wird die<br />
Abgrenzung des Sondervermögens von den übrigen Arten des Vermögens der Geme<strong>in</strong>de geregelt. Auf Grund<br />
ihrer Verschiedenheiten und unterschiedlichen öffentlichen Zwecksetzungen s<strong>in</strong>d die e<strong>in</strong>zelnen <strong>in</strong> der o.a. Vorschrift<br />
benannten Gruppen von Sondervermögen haushaltsmäßig unterschiedlich zu behandeln. So folgt aus<br />
se<strong>in</strong>er besonderen Zwecksetzung oder Zweckb<strong>in</strong>dung, dass geme<strong>in</strong>dliches Sondervermögen, zu dem auch das<br />
Geme<strong>in</strong>degliedervermögen gehört, vom übrigen Geme<strong>in</strong>devermögen abzusondern ist und dieses Vermögen nur<br />
bed<strong>in</strong>gt im „Kernhaushalt“ der Geme<strong>in</strong>de zu erfassen ist.<br />
Das Geme<strong>in</strong>degliedervermögen ist zwar Vermögen der Geme<strong>in</strong>de, das jedoch auf Grund besonderer Berechtigungen<br />
von den Geme<strong>in</strong>dee<strong>in</strong>wohnern und nicht von der Geme<strong>in</strong>de selbst genutzt wird, weil historisch gewachsen<br />
es vielfältigen örtlichen Allgeme<strong>in</strong>besitz und Nutzungsberechtigungen gab. Zum Geme<strong>in</strong>degliedervermögen<br />
gehören auf dem geme<strong>in</strong>dlichen Grundeigentum lastende Nutzungsberechtigungen, z.B. bei Wald- und Wegegrundstücken<br />
sowie Weide, die aus der geschichtlichen Entwicklung der Geme<strong>in</strong>de heraus auch heute noch<br />
bestehen können. Mögliche Nutzungen der Berechtigten s<strong>in</strong>d z.B. Berechtigungen zur Weide oder Hutung, zur<br />
Holzgew<strong>in</strong>nung, zum Fruchtgew<strong>in</strong>n. Auch kann <strong>in</strong> E<strong>in</strong>zelfällen das Nutzungsrecht nicht allen Geme<strong>in</strong>dee<strong>in</strong>wohnern,<br />
sondern nur e<strong>in</strong>er Gruppe von E<strong>in</strong>wohnern der Geme<strong>in</strong>de zu stehen (Geme<strong>in</strong>degliederklassenvermögen).<br />
Der Geme<strong>in</strong>de obliegt aber <strong>in</strong> allen diesen Fällen die Pflicht, dieses geme<strong>in</strong>dliche Vermögen zu verwalten.<br />
2. Die Prüfung des Jahresabschlusses<br />
Nach der Vorschrift des § 103 Abs. 1 Nr. 2 GO <strong>NRW</strong> ist die Prüfung der Jahresabschlüsse der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Sondervermögen e<strong>in</strong>e Pflichtaufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung. Die Vorschrift enthält zwar ausdrücklich<br />
den Begriff „Jahresabschluss“, jedoch ist für das Geme<strong>in</strong>degliedervermögen ke<strong>in</strong> Jahresabschluss nach den für<br />
GEMEINDEORDNUNG 612
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 99 GO<br />
die Geme<strong>in</strong>de geltenden Vorschriften aufzustellen. Vielmehr ist das Geme<strong>in</strong>degliedervermögen e<strong>in</strong> Teil des<br />
Haushalts der Geme<strong>in</strong>de, so dass die daraus entstehenden Erträge und Aufwendungen sowie die Vermögens-<br />
und Schuldenlage im Jahresabschluss der Geme<strong>in</strong>de enthalten s<strong>in</strong>d.<br />
Die Geme<strong>in</strong>de hat für das Geme<strong>in</strong>degliedervermögen wie für andere geme<strong>in</strong>dliche Sondervermögen jährlich<br />
e<strong>in</strong>en gesonderten Nachweis über die E<strong>in</strong>haltung der Zwecksetzung des jeweiligen Sondervermögens im abgelaufenen<br />
Haushaltsjahr zu führen. Sie muss <strong>in</strong> diesem Rahmen auch belegen, mit welchem Ergebnis das e<strong>in</strong>zelne<br />
Sondervermögen das Haushaltsjahr abgeschlossen hat. Diese Vorgaben bedeuten, dass e<strong>in</strong> gesondertes<br />
Jahresergebnis aufzustellen und mit e<strong>in</strong>er dazu gehörenden Übersicht über die zurechenbaren Vermögen und<br />
Schulden zum Gegenstand der örtlichen Rechnungsprüfung zu machen ist. Diese hat bei dann bei e<strong>in</strong>em Geme<strong>in</strong>degliedervermögen<br />
zu prüfen, ob und <strong>in</strong>wieweit der Zweck dieses Sondervermögens durch die Geme<strong>in</strong>de<br />
erfüllt wurde.<br />
II. Erläuterungen im E<strong>in</strong>zelnen<br />
1. Zu Absatz 1 (Weitergeltung von Nutzungsberechtigungen):<br />
Die Vorschrift über das Geme<strong>in</strong>degliedervermögen, das zwar Vermögen der Geme<strong>in</strong>de ist, aber auf Grund besonderer<br />
Nutzungsberechtigungen nur von den Geme<strong>in</strong>dee<strong>in</strong>wohnern und nicht von der Geme<strong>in</strong>de selbst genutzt<br />
wird, stellt e<strong>in</strong>e Besonderheit dar. Zum Geme<strong>in</strong>degliedervermögen gehören auf dem Grundeigentum lastende<br />
Nutzungsberechtigungen, z.B. bei Wald- und Wegegrundstücken, die aus der geschichtlichen Entwicklung der<br />
Geme<strong>in</strong>de heraus heute noch bestehen können. In E<strong>in</strong>zelfällen kann das Nutzungsrecht auch nicht allen, sondern<br />
nur e<strong>in</strong>er Gruppe von E<strong>in</strong>wohnern der Geme<strong>in</strong>de zu stehen (Geme<strong>in</strong>degliederklassenvermögen). Die Nutzungsberechtigten<br />
s<strong>in</strong>d zur ordnungsgemäßen Nutzung verpflichtet. Verletzt e<strong>in</strong> Nutzungsberechtigter trotz schriftlicher<br />
Mahnung gröblich se<strong>in</strong>e Pflicht zur ordnungsgemäßen Nutzung, so kann ihm se<strong>in</strong> Nutzungsrecht von der Geme<strong>in</strong>de<br />
entschädigungslos entzogen werden.<br />
Der Geme<strong>in</strong>de obliegt aber die Pflicht, dieses Vermögen zu verwalten. Bei diesen Vermögen bezieht sich die<br />
Fortgeltung der (historischen) Vorschriften und Gewohnheiten nur auf die Nutzung des Geme<strong>in</strong>degliedervermögens,<br />
nicht auf se<strong>in</strong>e Verwaltung durch die Geme<strong>in</strong>de, wie sie <strong>in</strong> § 97 GO <strong>NRW</strong> geregelt ist. E<strong>in</strong>e Aufnahme <strong>in</strong> e<strong>in</strong><br />
solches Nutzungsrecht und e<strong>in</strong>e Zulassung zur Teilnahme an den diesbezüglichen besonderen Geme<strong>in</strong>denutzungen<br />
f<strong>in</strong>den nicht mehr statt. Die Rechte der Nutzungsberechtigten bleiben erhalten; auf diese Rechte ist das<br />
bisherige Recht weiter anzuwenden. Der Wert des e<strong>in</strong>zelnen Nutzungsanteils darf nicht erhöht werden, so dass<br />
z.B. e<strong>in</strong> Vorrücken <strong>in</strong> höhere Nutzungsklassen nicht durchgeführt werden darf oder freiwerdende Lose der Geme<strong>in</strong>de<br />
zufallen.<br />
2. Zu Absatz 2 (Umwandlung von Geme<strong>in</strong>degliedervermögen):<br />
2.1 Zu Satz 1 (Umwandlung <strong>in</strong> Privatvermögen):<br />
Im Interesse der Erhaltung des Geme<strong>in</strong>devermögens ist die Umwandlung von Geme<strong>in</strong>degliedervermögen <strong>in</strong><br />
Privatvermögen der Nutzungsberechtigten nicht zulässig und daher auch durch die Vorschrift als Verbot ausgestaltet.<br />
Dieses Verbot ist entstanden, um persönliche Vorteile aus e<strong>in</strong>em geme<strong>in</strong>schaftlichen Vermögen auszuschließen,<br />
denn das geme<strong>in</strong>schaftliche Vermögen soll der Allgeme<strong>in</strong>heit erhalten bleiben. Vielfach wurde das<br />
Geme<strong>in</strong>schaftsvermögen bereits für öffentliche Zwecke der Geme<strong>in</strong>de verwendet, z.B. für die E<strong>in</strong>richtung und<br />
Erhaltung von Beleuchtung, Wasserleitung, Straßen und Plätzen, auch die Erträgnisse aus dem geme<strong>in</strong>schaftlichen<br />
Vermögen den Mitgliedern der Vermögensgeme<strong>in</strong>schaft zu Gute kam.<br />
GEMEINDEORDNUNG 613
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 99 GO<br />
2.2 Zu Satz 2 (Umwandlung <strong>in</strong> freies Geme<strong>in</strong>devermögen):<br />
Die Vorschrift lässt zu, dass Geme<strong>in</strong>dgliedervermögen <strong>in</strong> freies Geme<strong>in</strong>devermögen umgewandelt werden kann,<br />
wenn die Umwandlung aus Gründen des Geme<strong>in</strong>wohls geboten ist. Dies ist vielfach im Rahmen von Flurbere<strong>in</strong>igungsmaßnahmen<br />
erfolgt, oftmals auch auf gesetzlicher Grundlage und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen,<br />
z.B. Satzungen der Geme<strong>in</strong>de. Es liegt <strong>in</strong> der Verantwortung der Geme<strong>in</strong>de über die Art der Durchführung der<br />
Umwandlung (Umwandlungsverfahren) zu entscheiden. E<strong>in</strong>e Umwandlung des Geme<strong>in</strong>degliedervermögens <strong>in</strong><br />
freies Geme<strong>in</strong>devermögen sollte regelmäßig <strong>in</strong> Form e<strong>in</strong>er örtlichen Satzung erfolgen. Diese Satzung bedarf<br />
zudem der Beschlussfassung durch den Rat (vgl. § 41 Abs. 1 Buchstabe o) GO <strong>NRW</strong>).<br />
2.3 Zu den Sätzen 3 bis 5 (Entschädigung der bisherigen Nutzungsberechtigten):<br />
Nach der Vorschrift erfordert die Veränderung der Nutzungsrechte am Geme<strong>in</strong>degliedervermögen, z.B. durch<br />
e<strong>in</strong>e Umwandlung <strong>in</strong> freies Geme<strong>in</strong>devermögen, die Festlegung e<strong>in</strong>er angemessenen Entschädigung. Auch <strong>in</strong><br />
den Fällen, <strong>in</strong> denen nach den bisher geltenden rechtlichen Vorschriften die Nutzungsrechte der Berechtigten<br />
am Geme<strong>in</strong>degliedervermögen gegen ihren Willen nicht entzogen oder geschmälert werden dürfen, muss auf<br />
Grund der Entscheidung des Rates zur Umwandlung von Geme<strong>in</strong>degliedervermögen e<strong>in</strong>e angemessene Entschädigung<br />
an die bisher Berechtigten gezahlt werden.<br />
In Fällen der Umwandlung ist z.B. den bisher Berechtigten e<strong>in</strong> E<strong>in</strong>kaufsgeld zurückzuzahlen, durch welches sie<br />
das Recht zur Teilnahme an der Nutzung des Geme<strong>in</strong>degliedervermögens erworben haben. Handelt es sich um<br />
Nutzungsrechte an landwirtschaftlich genutzten Grundstücken, so kann die Entschädigung an die bisher Berechtigten<br />
auch durch H<strong>in</strong>gabe e<strong>in</strong>es Teils derjenigen Grundstücke gewährt werden, an denen die Nutzungsrechte<br />
bestehen. Die Festlegung e<strong>in</strong>er angemessenen Entschädigung für die bisherigen Nutzungsrechte am<br />
Geme<strong>in</strong>degliedervermögen an die Berechtigten bedarf der Beschlussfassung durch den Rat (vgl. § 41 Abs. 1<br />
Buchstabe o) GO <strong>NRW</strong>).<br />
In diesem Zusammenhang ist § 19 GtG <strong>NRW</strong> zu beachten, nach dem Nutzungsrechte von Geme<strong>in</strong>debürgern<br />
oder bestimmten Gruppen von Geme<strong>in</strong>debürgern an land- oder forstwirtschaftlich genutzten<br />
Grundstücken der Geme<strong>in</strong>de (Geme<strong>in</strong>degliedervermögen, Geme<strong>in</strong>degliederklassenvermögen) auf<br />
Antrag der Geme<strong>in</strong>de oder der Mehrheit der Nutzungsberechtigten nach den Vorschriften des Ersten<br />
Abschnittes des Geme<strong>in</strong>teilungsgesetzes abgelöst werden können. Dieses gilt auch dann, wenn die<br />
Rechte Reallasten oder reallastenähnlich s<strong>in</strong>d. Die Mehrheit der Nutzungsberechtigten ist dabei nach<br />
den Anteilen am Gesamtnutzungsrecht zu ermitteln. In diesem Zusammenhang dürfen Abf<strong>in</strong>dungen<br />
<strong>in</strong> Waldgrundstücken den Berechtigten nur als Eigentum zur gesamten Hand zugeteilt werden.<br />
3. Zu Absatz 3 (Verbot der Umwandlung von Geme<strong>in</strong>devermögen):<br />
Die Vorschrift verbietet ausdrücklich, vorhandenes freies Geme<strong>in</strong>devermögen <strong>in</strong> Geme<strong>in</strong>degliedervermögen<br />
umzuwandeln. Dieses Verbot liegt im Interesse der Allgeme<strong>in</strong>heit und dient der Aufgabenerfüllung der Geme<strong>in</strong>de,<br />
die durch e<strong>in</strong>e solche Umwandlung e<strong>in</strong>geschränkt werden könnte. Dieses Verbot bedeutet daher auch, dass<br />
bestehendes Geme<strong>in</strong>degliedervermögen bzw. geltende Nutzungsberechtigungen am Geme<strong>in</strong>devermögen nicht<br />
erweitert werden dürfen.<br />
Das Verbot bezieht sich deshalb nicht nur auf freies Vermögen der Geme<strong>in</strong>de, sondern auch auf vorhandenes<br />
Sondervermögen der Geme<strong>in</strong>de. Die Unzulässigkeit der Umwandlung von Geme<strong>in</strong>devermögen oder Sondervermögen<br />
der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> Geme<strong>in</strong>degliedervermögen soll verh<strong>in</strong>dern, dass dadurch die freie Verfügung der<br />
Geme<strong>in</strong>de über ihr Vermögen e<strong>in</strong>geschränkt wird. Gleichzeitig soll durch die Bestimmung gewährleistet werden,<br />
dass die Vermögenserträge aus dem geme<strong>in</strong>dlichen Vermögen der Geme<strong>in</strong>de bzw. dem Haushalt der Geme<strong>in</strong>-<br />
GEMEINDEORDNUNG 614
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 99 GO<br />
de zur Verfügung stehen und nicht e<strong>in</strong>zelnen Nutzungsberechtigten zu fließen. Außerdem soll mit dem Umwandlungsgebot<br />
verh<strong>in</strong>dert werden, dass von der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong>teressenbezogen e<strong>in</strong>e Erweiterung der Nutzungsberechtigten<br />
vorgenommen wird.<br />
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ<br />
GEMEINDEORDNUNG 615
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 100 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 100<br />
Örtliche Stiftungen<br />
(1) 1 Örtliche Stiftungen s<strong>in</strong>d die Stiftungen des privaten Rechts, die nach dem Willen des Stifters von e<strong>in</strong>er Geme<strong>in</strong>de<br />
verwaltet werden und die überwiegend örtlichen Zwecken dienen. 2 Die Geme<strong>in</strong>de hat die örtlichen Stiftungen<br />
nach den Vorschriften dieses Gesetzes zu verwalten, soweit nicht durch Gesetz oder Stifter anderes<br />
bestimmt ist. 3 Das Stiftungsvermögen ist von dem übrigen Geme<strong>in</strong>devermögen getrennt zu halten und so anzulegen,<br />
daß es für se<strong>in</strong>en Verwendungszweck greifbar ist.<br />
(2) Die Umwandlung des Stiftungszwecks, die Zusammenlegung und die Aufhebung von rechtlich unselbständigen<br />
Stiftungen stehen der Geme<strong>in</strong>de zu; sie bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.<br />
(3) Geme<strong>in</strong>devermögen darf nur im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Geme<strong>in</strong>de und nur dann <strong>in</strong> Stiftungsvermögen<br />
e<strong>in</strong>gebracht werden, wenn der mit der Stiftung verfolgte Zweck auf andere Weise nicht erreicht werden<br />
kann.<br />
Erläuterungen zu § 100:<br />
I. Allgeme<strong>in</strong>es<br />
1. Der Begriff „Örtliche Stiftungen“<br />
Die Vorschrift ist wegen der E<strong>in</strong>führung des NKF nicht verändert worden. Sie def<strong>in</strong>iert die örtlichen Stiftungen als<br />
Stiftungen des privaten Rechts, die nach dem Willen des Stifters von e<strong>in</strong>er Geme<strong>in</strong>de verwaltet werden und die<br />
überwiegend örtlichen Zwecken dienen. Damit wird deutlich, dass die Verwaltung der Stiftungen durch die Geme<strong>in</strong>de<br />
der nachhaltigen Verwirklichung der von den Stiftern gesetzten Zwecke dienen muss. Die Umsetzung<br />
dieses Gebotes wird dadurch erleichtert, dass der Stiftungszweck auf den Wirkungskreis der Geme<strong>in</strong>de bzw. auf<br />
die geme<strong>in</strong>dliche Aufgabenerfüllung vor Ort ausgerichtet se<strong>in</strong> muss (örtliche Stiftungen. E<strong>in</strong>e örtliche Stiftung<br />
kann zudem als selbstständige oder unselbstständige Stiftung errichtet worden se<strong>in</strong>.<br />
Die e<strong>in</strong>e örtliche Stiftung verwaltende Geme<strong>in</strong>de br<strong>in</strong>gt oftmals selbst Teile ihres Vermögens <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e örtliche Stiftung<br />
e<strong>in</strong>. Dadurch werden vorhandene geme<strong>in</strong>dliche Vermögenswerte zu Gunsten e<strong>in</strong>es uneigennützigen, auf<br />
Dauer e<strong>in</strong>gerichteten Zwecks von der Geme<strong>in</strong>de als Stifter entäußert. Dieser Zweck soll dabei nach dem Willen<br />
der Geme<strong>in</strong>de durch e<strong>in</strong>en Dritten erfüllt werden, z.B. durch die Errichtung e<strong>in</strong>er rechtlich unselbstständigen örtlichen<br />
Stiftung durch die Geme<strong>in</strong>de selbst. H<strong>in</strong>sichtlich der E<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gung von Vermögensgegenständen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e<br />
örtliche Stiftung müssen die Voraussetzungen des Absatzes 3 dieser Vorschrift erfüllt se<strong>in</strong>.<br />
2. Der Begriff „Kommunale Stiftungen“<br />
Neben dem Begriff „Örtliche Stiftungen“ ist vielfach auch der Begriff „Kommunale Stiftungen“ im Gebrauch. Nach<br />
dem Bundesverband Deutscher Stiftungen werden unter dem Begriff „Kommunale Stiftungen“ alle Stiftungen<br />
unabhängig von ihrer Rechtsform subsumiert, die geme<strong>in</strong>wohlorientiert für die Bürger<strong>in</strong>nen und Bürger e<strong>in</strong>er<br />
Kommune auf Grund privater oder öffentlicher Initiative errichtet worden s<strong>in</strong>d. Sie müssen zum Wirkungskreis<br />
e<strong>in</strong>er Kommune gehören und sich durch e<strong>in</strong>e besondere Nähe zur Kommunalverwaltung auszeichnen. Ihr Aktionsgebiet<br />
ist auf das Geme<strong>in</strong>wesen e<strong>in</strong>er Kommune beschränkt Örtlichkeitspr<strong>in</strong>zip).<br />
Diese Begriffsverwendung ist nicht <strong>in</strong>s kommunale Haushaltsrecht von Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen übernommen worden.<br />
Haushaltsrechtlich wird dann von e<strong>in</strong>er kommunalen Stiftung gesprochen, wenn e<strong>in</strong>e oder mehrere Geme<strong>in</strong>de<br />
selbst als Stifter auftreten und Geme<strong>in</strong>devermögen <strong>in</strong> die von Ihnen errichtete Stiftung e<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gen. Auch gilt<br />
GEMEINDEORDNUNG 616
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 100 GO <strong>NRW</strong><br />
nach dieser Vorschrift das Örtlichkeitspr<strong>in</strong>zip. Die Nähe zur geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung ist jedoch ke<strong>in</strong> Zuordnungskriterium,<br />
so dass rechtlich selbständige örtliche Stiftungen, die die Geme<strong>in</strong>de nach besonderem Recht<br />
treuhänderisch zu verwalten hat (vgl. § 98 GO <strong>NRW</strong>), sowie rechtlich unselbständige Stiftungen <strong>in</strong> der Verwaltung<br />
der Geme<strong>in</strong>de (vgl. § 97 Abs. 1 Nr. 2 GO <strong>NRW</strong>) nicht als kommunale Stiftungen bezeichnet werden. E<strong>in</strong>e solche<br />
vermögensorientierte Sicht und Verwendung des Begriffes „Kommunale Stiftungen“ im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltrecht<br />
ist geboten, um die rechtlich selbstständigen Stiftungen, die zum geme<strong>in</strong>dlichen Konsolidierungskreis für<br />
den Gesamtabschluss nach § 116 GO <strong>NRW</strong> gehören, zutreffend bestimmen zu können.<br />
3. Die Bilanzierung von Stiftungen<br />
3.1 Die Bilanzierung rechtlich unselbstständiger örtlicher Stiftungen<br />
Die Geme<strong>in</strong>de verfügt oftmals noch über weitere besondere Sondervermögen. Zu diesen geme<strong>in</strong>dlichen Sondervermögen<br />
s<strong>in</strong>d das Geme<strong>in</strong>degliedervermögen (vgl. § 97 Abs. 1 Nr. 1 GO <strong>NRW</strong>) sowie das Vermögen der rechtlich<br />
unselbstständigen örtlichen Stiftungen (vgl. § 97 Abs. 1 Nr. 2 GO <strong>NRW</strong>) zu zählen. Diese beiden geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Sondervermögen stellen jedoch ke<strong>in</strong>e selbstständigen Aufgabenbereiche (Organisationse<strong>in</strong>heiten) der Geme<strong>in</strong>de<br />
dar und verfügen daher auch nicht über e<strong>in</strong>en eigenen Rechnungskreis. Sie s<strong>in</strong>d vielmehr Teil des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushalts, so dass daraus entstehende Erträge und Aufwendungen sowie Zahlungen im Haushaltsplan<br />
der Geme<strong>in</strong>de zu erfassen s<strong>in</strong>d (vgl. z.B. Produktbereich 17 „Stiftungen“ i.V.m. § 4 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
Das Geme<strong>in</strong>degliedervermögen sowie das Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen s<strong>in</strong>d<br />
daher haushaltsrechtlich wie die sonstigen Vermögensgegenstände der Geme<strong>in</strong>de zu behandeln. Dies führt dazu,<br />
dass diese Vermögen der Geme<strong>in</strong>de nicht gesondert unter dem Bilanzposten „Sondervermögen“ anzusetzen<br />
s<strong>in</strong>d, auch nicht als „Davon-Vermerk“. Die diesen geme<strong>in</strong>dlichen Sondervermögen zuzurechnende Vermögensgegenstände<br />
s<strong>in</strong>d vielmehr <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz unter den jeweils zutreffenden Bilanzposten (nach Vermögensarten)<br />
anzusetzen.<br />
Die Verpflichtung der Geme<strong>in</strong>de zur Erhaltung der Zwecke dieser beiden Sondervermögen, z.B. bei rechtlich<br />
unselbstständigen örtlichen Stiftungen durch Stifterwillen festgelegt, erfordert von der Geme<strong>in</strong>de zwar e<strong>in</strong>en<br />
Nachweis darüber, dieser ist jedoch nicht haushaltsrechtlich zu erbr<strong>in</strong>gen, so dass auf gesonderte Rechnungskreise<br />
oder auf gesonderte Bilanzposten verzichtet werden kann. Es ist ausreichend, den erforderlichen Nachweis<br />
geme<strong>in</strong>de<strong>in</strong>tern zu führen und zu dokumentieren. Es bedarf es deshalb bei den genannten Sondervermögen<br />
auch nicht der Passivierung von Verb<strong>in</strong>dlichkeiten, denn die Geme<strong>in</strong>de ist nicht zur Rückgabe des ihr überlassenen<br />
Vermögens verpflichtet. So hat z.B. bei rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen der Stifter der Geme<strong>in</strong>de<br />
e<strong>in</strong> Vermögen auf Dauer übertragen.<br />
3.2 Die Bilanzierung rechtlich selbstständiger örtlicher Stiftungen<br />
3.2.1 Die Bilanzierung kommunaler Stiftungen<br />
3.2.1.1 Die Aktivierung bei kommunalen Stiftungen<br />
Unter dem Bilanzposten „Verbundene Unternehmen“, ggf. auch unter dem Bilanzposten „Beteiligungen“, hat die<br />
Geme<strong>in</strong>de, abhängig von den örtlichen Verhältnissen, e<strong>in</strong>e rechtlich selbstständige Stiftung anzusetzen, wenn sie<br />
selbst Stifter oder Mitstifter ist. E<strong>in</strong> solcher besonderer geme<strong>in</strong>dlicher Sachverhalt ist anzunehmen, wenn e<strong>in</strong>e<br />
Geme<strong>in</strong>de z.B. e<strong>in</strong>en Aufgabenbereich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e rechtlich selbstständige örtliche (kommunale) Stiftung überführt<br />
hat. Als e<strong>in</strong>e kommunale Stiftung ist e<strong>in</strong>e rechtsfähige Stiftung nach § 80 BGB anzusehen, die von e<strong>in</strong>er Geme<strong>in</strong>de<br />
alle<strong>in</strong>e oder zusammen mit Dritten, z.B. weitere Geme<strong>in</strong>den, errichtet hat und die durch die zuständige Stiftungsaufsichtsbehörde<br />
anerkannt wurde. E<strong>in</strong>e solche Stiftung stellt e<strong>in</strong>e ausgegliederte Vermögensmasse der<br />
GEMEINDEORDNUNG 617
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 100 GO <strong>NRW</strong><br />
Geme<strong>in</strong>de dar, bei dem e<strong>in</strong> eigener Rechnungskreis besteht und der Geme<strong>in</strong>de h<strong>in</strong>sichtlich der Aufgabenerfüllung<br />
noch Rechte e<strong>in</strong>geräumt s<strong>in</strong>d.<br />
3.2.1.2 Die Passivierung bei kommunalen Stiftungen<br />
Das Stiftungsrecht lässt es nicht zu, dass das Stiftungsvermögen wie die anderen Vermögen der Geme<strong>in</strong>de für<br />
ihre Zwecke <strong>in</strong> Anspruch genommen werden kann. Gleichwohl vermehrt das Stiftungsvermögen das Anlagevermögen<br />
der Geme<strong>in</strong>de, auch wenn es durch den Stifterwillen der Geme<strong>in</strong>de nur bestimmten Zwecken dient, mit<br />
der Auswirkung e<strong>in</strong>es höheren Eigenkapitals <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz. Diese Nutzungsbeschränkung aus dem<br />
Stiftungsgeschäft und Stiftungsrecht bed<strong>in</strong>gt, dass dem zweckbezogenen Vermögenswert auf der Aktivseite der<br />
Bilanz e<strong>in</strong>e entsprechende E<strong>in</strong>schränkung auf der Passivseite folgen muss. Auch wenn im Stiftungsgesetz für<br />
geme<strong>in</strong>dliche Stiftungen ke<strong>in</strong>e ausdrückliche Regelung für ihren Umgang im neuen Rechnungswesen der Geme<strong>in</strong>den<br />
getroffen wurde, kann aus S<strong>in</strong>n und Zweck des Stiftungsrechts nur abgeleitet werden, dass die Eigenkapitalmehrung<br />
der Geme<strong>in</strong>de aus dem Stiftungsgeschäft haushaltsmäßig nicht frei verfügbar ist.<br />
Im Eigenkapital der Geme<strong>in</strong>de ist daher e<strong>in</strong>e Verwendungsbeschränkung vorzunehmen, mit der Folge, dass dort<br />
<strong>in</strong> Höhe des Wertansatzes der rechtlich selbstständigen Stiftungen der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>e Sonderrücklage anzusetzen<br />
ist. Diese Bilanzierung ist sachgerecht und vertretbar, denn sie stärkt den Zusammenhang mit der Aufgabenerfüllung<br />
der Geme<strong>in</strong>de, denn solche kommunalen Stiftungen s<strong>in</strong>d auch <strong>in</strong> den Gesamtabschluss der Geme<strong>in</strong>de<br />
nach § 116 GO <strong>NRW</strong> e<strong>in</strong>zubeziehen. Auch die für die Bilanzierung zu beachtenden Grundsätze erfordern die<br />
vorgenommene Auslegung des Stiftungsrechts und den daran anknüpfenden Ansatz <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz.<br />
3.2.2 Die rechtlich selbstständige örtliche Stiftung als Treuhandvermögen<br />
Der Geme<strong>in</strong>de werden oftmals fremde Vermögensgegenstände oder rechtlich selbstständige örtliche Stiftungen<br />
zur Verwaltung übergeben, denn sie ist gesetzlich verpflichtet oder von Dritten beauftragt worden, das ihr übergebene<br />
Vermögen (Treuhandvermögen) im eigenen Namen und für fremde Rechnung zu verwalten. Sie darf<br />
dieses Vermögen nicht für eigene Zwecke zu verwenden (vgl. § 98 GO <strong>NRW</strong>). Die fremden Vermögensgegenstände,<br />
die von der Geme<strong>in</strong>de treuhänderisch gehalten werden, s<strong>in</strong>d nach den allgeme<strong>in</strong>en Bilanzierungsgrundsätzen<br />
nicht <strong>in</strong> der Bilanz der Geme<strong>in</strong>de, sondern <strong>in</strong> der Bilanz des Treugebers anzusetzen, weil dieser<br />
auch bei treuhänderischer Verwaltung durch e<strong>in</strong>en Dritten weiterh<strong>in</strong> als wirtschaftlicher Eigentümer der Vermögensgegenstände<br />
zu betrachten ist.<br />
4. Die E<strong>in</strong>beziehung von örtlichen Stiftungen <strong>in</strong> den Gesamtabschluss<br />
Das E<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gen von Geme<strong>in</strong>devermögen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e rechtlich selbstständige Stiftung, also <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e andere Organisationse<strong>in</strong>heit,<br />
stellt e<strong>in</strong>e Ausgliederung von geme<strong>in</strong>dlichen Vermögen aus dem geme<strong>in</strong>dlichen Kernbereich dar. Weil<br />
die E<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gung aber nur im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Geme<strong>in</strong>de zulässig ist, sollen rechtlich selbstständige<br />
örtliche Stiftungen, bei denen die Geme<strong>in</strong>de selbst Stifter ist, <strong>in</strong> den Konsolidierungskreis für den geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Gesamtabschluss e<strong>in</strong>bezogen werden (vgl. § 116 GO <strong>NRW</strong>).<br />
Im geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss ist e<strong>in</strong>erseits die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der e<strong>in</strong>bezogenen<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe so darzustellen, als ob diese Betriebe zusammen mit der Kernverwaltung der<br />
Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>zige wirtschaftliche und rechtliche E<strong>in</strong>heit wären. Anderseits soll gewährleistet werden, dass<br />
der Gesamtabschluss e<strong>in</strong> aus den Jahresabschlüssen der e<strong>in</strong>bezogenen Organisationse<strong>in</strong>heiten abgeleiteter<br />
eigenständiger Abschluss der gesamten wirtschaftlichen Gesamtheit „Geme<strong>in</strong>de“ ist, der e<strong>in</strong> den tatsächlichen<br />
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzgesamtlage der Geme<strong>in</strong>de zu<br />
GEMEINDEORDNUNG 618
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 100 GO <strong>NRW</strong><br />
vermitteln hat. Durch diese Vorgaben ist auch die E<strong>in</strong>beziehung von örtlichen Stiftungen im geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss<br />
zu begründen, wenn durch diese geme<strong>in</strong>dliche Aufgaben erledigt werden.<br />
II. Erläuterungen im E<strong>in</strong>zelnen<br />
1. Zu Absatz 1 (Örtliche Stiftungen):<br />
1.1 Zu Satz 1 (Stiftungen und örtliche Zwecke):<br />
Nach der Vorschrift s<strong>in</strong>d örtliche Stiftungen die Stiftungen des privaten Rechts, die nach dem Willen des Stifters<br />
von e<strong>in</strong>er Geme<strong>in</strong>de verwaltet werden und die überwiegend örtlichen Zwecken dienen. Dabei ist zwischen rechtlich<br />
selbstständigen Stiftungen und rechtlich unselbstständigen Stiftungen zu unterscheiden.<br />
1.1.1 Die örtlichen Zwecke<br />
Die Vorgabe, dass e<strong>in</strong>e örtliche Stiftungen überwiegend örtlichen Zwecken dienen muss, steht im Zusammenhang<br />
mit der Vorschrift über den Wirkungskreis der Geme<strong>in</strong>den, nach der die Geme<strong>in</strong>den ausschließliche und<br />
eigenverantwortliche Träger der öffentlichen Verwaltung <strong>in</strong> ihrem Gebiet s<strong>in</strong>d (vgl. § 2 GO <strong>NRW</strong>). Der Zweck<br />
e<strong>in</strong>er örtlichen Stiftung muss sich daher im Rahmen des örtlichen Aufgabenbereiches der Geme<strong>in</strong>de halten, für<br />
den die Geme<strong>in</strong>de sachlich und räumlich zuständig ist. Der Stiftungszweck muss daher e<strong>in</strong>erseits auf Aufgaben<br />
ausgerichtet se<strong>in</strong>, die von der Geme<strong>in</strong>de auch selbst erfüllt werden könnten. Andererseits wird dadurch abgegrenzt,<br />
dass e<strong>in</strong> örtlicher Zweck dann nicht mehr gegeben se<strong>in</strong> dürfte, wenn die Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> diesem Bereich<br />
sich selbst nicht mehr betätigen dürfte.<br />
1.1.2 Die rechtlich selbstständige örtliche Stiftung<br />
Die rechtlich selbstständigen örtlichen Stiftungen entstehen gem. §§ 80 ff. BGB durch das Stiftungsgeschäft<br />
i.V.m. mit e<strong>in</strong>er staatlichen Genehmigung. So ist nach § 2 StiftG <strong>NRW</strong> zur Entstehung e<strong>in</strong>er rechtsfähigen Stiftung<br />
im S<strong>in</strong>ne des Stiftungsgesetzes die Anerkennung der neuen Stiftung durch die zuständige Stiftungsaufsichtsbehörde<br />
gemäß § 80 Abs. 1 und 2 BGB erforderlich. Die rechtlich selbstständigen örtlichen Stiftungen zählen zum<br />
Treuhandvermögen der Geme<strong>in</strong>de, wenn diese von der Geme<strong>in</strong>de verwaltet werden (vgl. § 98 GO <strong>NRW</strong>).<br />
E<strong>in</strong>e rechtlich selbstständige Stiftung entsteht durch das Stiftungsgeschäft als e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>seitige Willenserklärung<br />
des Stifters. Dar<strong>in</strong> erklärt der Stifter, e<strong>in</strong> bestimmtes Vermögen auf Dauer e<strong>in</strong>em bestimmten Zweck zu widmen.<br />
Dieser Vorgang wird als Stiftungsakt bezeichnet. Er kann sowohl mit Wirkung unter Lebenden oder aber auch mit<br />
Wirkung von Todes wegen vorgenommen werden. Der Stifter als die zentrale Figur der Stiftung bestimmt die<br />
maßgeblichen Vorgaben der Stiftung, also sowohl den Stiftungszweck als auch die Festlegung des zu übertragenen<br />
Vermögens. Für die Stiftung ist e<strong>in</strong>e Satzung zu erlassen, <strong>in</strong> der zum<strong>in</strong>dest Name und Sitz der Stiftung sowie<br />
der Zweck und das Grundstockvermögen angegeben werden müssen. Zugleich s<strong>in</strong>d Regelungen zur Bildung des<br />
Vorstandes der Stiftung zu treffen.<br />
1.1.3 Die rechtlich unselbstständige örtliche Stiftung<br />
Bei rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen (fiduziarische Stiftungen) werden i.d.R. durch e<strong>in</strong>en Dritten als<br />
Stifter der Geme<strong>in</strong>de Vermögensgegenstände mit e<strong>in</strong>er bestimmten Zwecksetzung (Stifterwillen) zu Eigentum<br />
übertragen. In diesen Fällen hat der Stifter die <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Eigentum bef<strong>in</strong>dlichen Vermögenswerte zu Gunsten<br />
e<strong>in</strong>es uneigennützigen, auf Dauer e<strong>in</strong>gerichteten Zwecks entäußert, der nach se<strong>in</strong>em Willen durch die Geme<strong>in</strong>de<br />
GEMEINDEORDNUNG 619
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 100 GO <strong>NRW</strong><br />
zu erfüllen ist. Diese Zwecksetzung führt dazu, dass die Geme<strong>in</strong>de nach außen im eigenen Namen auftritt, im<br />
Innenverhältnis zum Stifter aber an den Stifterwillen gebunden ist.<br />
E<strong>in</strong>e rechtlich unselbstständige Stiftung entsteht durch e<strong>in</strong>en Vertrag zwischen dem Stifter und dem von ihm<br />
ausgewählten Rechtsträger, z.B. die Geme<strong>in</strong>de. Die Vermögenswerte werden dabei auf e<strong>in</strong>e andere (natürliche<br />
oder juristische) Person mit Maßgaben übertragen, wie diese Stelle das übertragene Vermögen verwalten und<br />
verwenden soll. In diesem Vertrag verpflichtet sich der Stifter andererseits, dem Träger die zur Erfüllung des<br />
Stiftungszwecks erforderlichen Vermögensgegenstände zu übertragen.<br />
Der Träger verpflichtet sich im Gegenzug, diese Vermögenswerte dem Stiftungszweck entsprechend zu verwenden.<br />
Das Stiftungsgeschäft unterliegt somit den Vorschriften des Schuldrechts. Das Stiftungsgeschäft kann dabei<br />
unterschiedlich ausgestaltet werden, z.B. als Treuhandvertrag <strong>in</strong> Form e<strong>in</strong>es Auftrages, als Dienstvertrag, Geschäftsbesorgungsvertrages<br />
oder als Schenkung. Es besteht für die Vertragspartner e<strong>in</strong> großer Gestaltungsspielraum,<br />
der jedoch von der Geme<strong>in</strong>de wegen der B<strong>in</strong>dung an ihre Aufgabenerfüllung nicht <strong>in</strong> vollem Umfang genutzt<br />
werden kann.<br />
1.2 Zu Satz 2 (Verwaltung der örtlichen Stiftungen durch die Geme<strong>in</strong>de):<br />
Die Geme<strong>in</strong>de hat die örtlichen Stiftungen nach den Vorschriften der Geme<strong>in</strong>deordnung zu verwalten, soweit<br />
nicht durch e<strong>in</strong> Gesetz oder den Stifter etwas anderes bestimmt ist. Daraus folgt, dass nur die Stiftungen von<br />
der Geme<strong>in</strong>de verwaltet werden dürfen, die örtlichen Zwecken dienen, also im S<strong>in</strong>ne der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgabenerfüllung<br />
tätig s<strong>in</strong>d oder den E<strong>in</strong>wohnern und Bürgern der Geme<strong>in</strong>de zu Gute kommen. Die Geme<strong>in</strong>de hat<br />
daher bei der Übernahme der Verwaltung von Stiftungen zu prüfen, ob es sich um e<strong>in</strong>e örtliche Stiftung im S<strong>in</strong>ne<br />
dieser Vorschrift der Geme<strong>in</strong>deordnung handelt.<br />
1.3 Zu Satz 3 (Trennung des Stiftungsvermögens vom Geme<strong>in</strong>devermögen):<br />
Das geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsrecht kennt als weitere Art des geme<strong>in</strong>dlichen Vermögens das Sondervermögen<br />
(vgl. § 97 GO <strong>NRW</strong>). Zum Sondervermögen ist auch das Stiftungsvermögen zu zählen, das nach dieser Vorschrift<br />
vom übrigen Geme<strong>in</strong>devermögen getrennt zu halten und so anzulegen, dass es für se<strong>in</strong>en Verwendungszweck<br />
greifbar ist. Der Charakter e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Sondervermögens wird dadurch bestimmt, dass es<br />
sich um Vermögen der Geme<strong>in</strong>de handelt, das für die Erfüllung bestimmter Zwecke vom Haushalt der Geme<strong>in</strong>de<br />
abgesondert oder von e<strong>in</strong>em Dritten an die Geme<strong>in</strong>de für e<strong>in</strong>en bestimmten Zweck übereignet oder durch<br />
sonstige Rechtsakte unter Zweckb<strong>in</strong>dung auf die Geme<strong>in</strong>de übergegangen ist.<br />
Aus se<strong>in</strong>er besonderen Zwecksetzung oder Zweckb<strong>in</strong>dung folgt, dass Sondervermögen vom übrigen Geme<strong>in</strong>devermögen<br />
abzusondern s<strong>in</strong>d und dieses Vermögen daher nur bed<strong>in</strong>gt e<strong>in</strong>en Bestandteil des „Kernhaushalts“<br />
der Geme<strong>in</strong>de darstellt. Auf Grund ihrer Verschiedenheiten und unterschiedlichen öffentlichen Zwecksetzungen<br />
s<strong>in</strong>d die örtlichen Stiftungen, u.a. auch abhängig davon, ob e<strong>in</strong>e rechtlich selbstständige Stiftung oder rechtlich<br />
unselbstständige Stiftung besteht, von der Geme<strong>in</strong>de haushaltsmäßig unterschiedlich zu behandeln, z.B. im<br />
Jahresabschluss nach § 96 GO <strong>NRW</strong> oder im Gesamtabschluss nach § 116 GO <strong>NRW</strong>).<br />
2. Zu Absatz 2 (Genehmigung für die Umwandlung des Stiftungszwecks):<br />
Nach der Vorschrift kann die Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> eigener Verantwortung über die Umwandlung e<strong>in</strong>es Stiftungszwecks,<br />
die Zusammenlegung und die Aufhebung von rechtlich unselbständigen Stiftungen entscheiden. Bei rechtlich<br />
unselbstständigen örtlichen Stiftungen (fiduziarische Stiftungen), auf die sich diese Vorschrift ausschließlich bezieht,<br />
werden i.d.R. durch e<strong>in</strong>en Dritten als Stifter der Geme<strong>in</strong>de Vermögensgegenstände mit e<strong>in</strong>er bestimmten<br />
GEMEINDEORDNUNG 620
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 100 GO <strong>NRW</strong><br />
Zwecksetzung (Stifterwillen) durch e<strong>in</strong>en Vertrag zu Eigentum übertragen. In diesen Fällen hat der Stifter bestimmte<br />
Vermögenswerte zu Gunsten e<strong>in</strong>es uneigennützigen, auf Dauer e<strong>in</strong>gerichteten Zwecks entäußert, der<br />
nach se<strong>in</strong>em Willen durch die Geme<strong>in</strong>de als Vertragspartner zu erfüllen ist. Dies führt dazu, dass die Geme<strong>in</strong>de<br />
nach außen im eigenen Namen auftritt, im Innenverhältnis zum Stifter aber an den Stifterwillen gebunden ist.<br />
Die Umwandlung e<strong>in</strong>es Stiftungszwecks, die Zusammenlegung und die Aufhebung von rechtlich unselbständigen<br />
Stiftungen bedeuten e<strong>in</strong>en erheblichen E<strong>in</strong>griff <strong>in</strong> den Stifterwillen, dem sich die Geme<strong>in</strong>de zuvor durch die Annahme<br />
der Stiftung unterworfen hat. So soll z.B. bei e<strong>in</strong>er Umwandlung e<strong>in</strong>es Stiftungszwecks, der Zusammenlegung<br />
regelmäßig angestrebt werden, die Erträge des Stiftungsvermögens dem zugedachten Personenkreis zu<br />
erhalten, ggf. auch auf andere Art und Weise als <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Stiftungsform.<br />
Es bedarf daher bei e<strong>in</strong>er Umwandlung e<strong>in</strong>es Stiftungszwecks, der Zusammenlegung und der Aufhebung von<br />
rechtlich unselbständigen Stiftungen der Beschlussfassung durch den Rat (vgl. § 41 Abs. 1 Buchstabe n) GO<br />
<strong>NRW</strong>) sowie der Genehmigung der für die Geme<strong>in</strong>de zuständigen Aufsichtsbehörde. Dabei muss bei e<strong>in</strong>er Aufhebung<br />
von rechtlich unselbständigen Stiftungen der Rat auch über die Verwendung des Stiftungsvermögens<br />
e<strong>in</strong>e Entscheidung treffen. In diesen Fällen wird davon ausgegangen, dass sich das Stiftungsvermögen bereits im<br />
Eigentum der Geme<strong>in</strong>de bef<strong>in</strong>det.<br />
3. Zu Absatz 3 (E<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gung von Geme<strong>in</strong>devermögen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Stiftung):<br />
3.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Nach der Vorschrift darf die Geme<strong>in</strong>de nur dann Geme<strong>in</strong>devermögen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Stiftung e<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gen, wenn dies im<br />
Rahmen der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgabenerfüllung erfolgt und wenn der mit der Stiftung verfolgte Zweck der Geme<strong>in</strong>de<br />
auf andere Weise nicht erreicht werden kann. Durch die Regelungen werden alle Rechtsformen von Stiftungen<br />
erfasst, denen e<strong>in</strong> örtlicher Charakter zukommt, denn der Begriff „Stiftung“ wird <strong>in</strong> der Vorschrift nicht näher e<strong>in</strong>gegrenzt.<br />
Daher werden von der Regelung über die Übertragung von geme<strong>in</strong>dlichem Vermögen <strong>in</strong> Stiftungen<br />
sowohl rechtlich selbstständige örtliche Stiftungen als auch rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen erfasst.<br />
3.2 Festlegung von Entscheidungskriterien<br />
Die Geme<strong>in</strong>de hat eigenverantwortlich e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>schätzung vorzunehmen und e<strong>in</strong>e Prognoseentscheidung zu<br />
treffen, ob der mit der Stiftung verfolgte Zweck auf andere Weise nicht erreicht werden kann, bevor sie Geme<strong>in</strong>devermögen<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Stiftung e<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gt. Sie muss <strong>in</strong> diesem Zusammenhang berücksichtigen, dass e<strong>in</strong>e Rücknahme<br />
ihres Vermögens auch zukünftig nicht möglich ist und künftige Generationen an diese Entscheidung<br />
gebunden werden. Weiterh<strong>in</strong> gilt es festzustellen, auch zukünftig werde sich diese Art der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgabenerfüllung<br />
nicht wandeln und davon auszugehen ist, dass die Art der Aufgabenerfüllung dauerhaft nur <strong>in</strong> Form<br />
e<strong>in</strong>er Stiftung wahrzunehmen ist. Es ist jedoch nicht erforderlich, dass der mit der Vermögensabgabe angestrebte<br />
Zweck der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgabenerfüllung auf andere Weise überhaupt nicht erfüllt werden kann.<br />
Diese Vorgaben stellen zw<strong>in</strong>gende Voraussetzungen für die E<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gung von Geme<strong>in</strong>devermögen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Stiftung<br />
dar, denn es können unterschiedliche Zielsetzungen zwischen dem haushaltswirtschaftlichen Handeln der<br />
Geme<strong>in</strong>de und dem Handeln e<strong>in</strong>er Stiftung bestehen. Jegliche E<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gung von geme<strong>in</strong>dlichem Vermögen <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>e Stiftung muss daher haushaltswirtschaftlich verträglich se<strong>in</strong> und darf <strong>in</strong> ke<strong>in</strong>er Weise die Aufgabenerfüllung<br />
der Geme<strong>in</strong>de bee<strong>in</strong>trächtigen. Es muss außerdem gewährleistet werden, dass nicht ohne besonderen Grund<br />
geme<strong>in</strong>dliches Vermögen <strong>in</strong> Stiftungen gebunden wird, das ggf. später für e<strong>in</strong>en anderen dr<strong>in</strong>genderen Bedarf<br />
dann fehlt. Auch darf dem Rat der Geme<strong>in</strong>de nicht die Verfügungshoheit über geme<strong>in</strong>dliches Vermögen entzogen<br />
werden.<br />
GEMEINDEORDNUNG 621
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 100 GO <strong>NRW</strong><br />
Die ausdrückliche Vorgabe für die E<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gung von Geme<strong>in</strong>devermögen <strong>in</strong> e<strong>in</strong> Stiftungsvermögen, der mit der<br />
Stiftung verfolgte Zweck kann nicht auf andere Weise erreicht werden, ist weit auszulegen. Sie schränkt das<br />
Auswahlermessen der Geme<strong>in</strong>de über ihre Organisationsformen nicht e<strong>in</strong>, sondern ist so zu verstehen, dass<br />
auch e<strong>in</strong>e Stiftung grundsätzlich e<strong>in</strong>e zulässige Form der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgabenerfüllung darstellt. Die Geme<strong>in</strong>de<br />
muss bei der E<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gung von Geme<strong>in</strong>devermögen aber zweckbezogen beurteilen, ob andere Organisationsformen<br />
als die Organisationsform „Stiftung“ ggf. nachteiliger für die Erledigung der Aufgabenerfüllung durch<br />
die Geme<strong>in</strong>de s<strong>in</strong>d.<br />
3.3 Die Zulässigkeit der Vermögensabgabe (E<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gung)<br />
Der Geme<strong>in</strong>de obliegt es eigenverantwortlich, h<strong>in</strong>sichtlich des E<strong>in</strong>satzes ihres Vermögens (Anschaffung, Erhalt<br />
oder Veräußerung) oder auch ihrer Vermögenserträge die erforderlichen Festsetzungen zu treffen. Bei ihrem<br />
wichtigen Interesse an e<strong>in</strong>er Stiftung hat die Geme<strong>in</strong>de auch zu beurteilen, wie sich e<strong>in</strong>e vorzunehmende Vermögensabgabe<br />
auf die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft auswirkt. Außerdem muss die Vermögensübertragung<br />
<strong>in</strong> dem Umfang erfolgen, der zur Erreichung des Stiftungszwecks ausreichend und erforderlich ist.<br />
E<strong>in</strong> Engagement der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Stiftung im S<strong>in</strong>ne der Vorschrift wird als zulässig anzusehen se<strong>in</strong>, wenn<br />
dadurch e<strong>in</strong> wesentlicher Mehrwert für die Geme<strong>in</strong>de erzielt wird. Das ist z.B. bei e<strong>in</strong>er Mitstiftung oder Zustiftung<br />
dann der Fall, wenn der von Privaten <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Stiftung e<strong>in</strong>zubr<strong>in</strong>gende Vermögensanteil im Verhältnis zu<br />
dem durch die Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>zubr<strong>in</strong>genden F<strong>in</strong>anzvermögen und/oder Sachvermögen m<strong>in</strong>destens 50% beträgt.<br />
Sollte die 50%-Quote nicht erreicht werden, kann oftmals aufgrund besonderer Umstände gleichwohl e<strong>in</strong> wesentlicher<br />
Mehrwert entstehen, <strong>in</strong>sbesondere dann, wenn der private Anteil an F<strong>in</strong>anz- oder Sachvermögen<br />
nach sicherer Erwartung (objektive Umstände) zu e<strong>in</strong>em späteren Zeitpunkt erbracht werden wird.<br />
Von der Geme<strong>in</strong>de sollte angestrebt werden, dass die Privaten vor ihrer beabsichtigten Mitstiftung oder Zustiftung<br />
gegenüber der Geme<strong>in</strong>de Zusagen mit dem größtmöglichen Grad an Verb<strong>in</strong>dlichkeit abgeben. Wenn nach den<br />
Umständen des E<strong>in</strong>zelfalls e<strong>in</strong>e verb<strong>in</strong>dliche Zusage, die gerichtlich durchsetzbar wäre, von den Privaten nicht<br />
erlangt werden kann, ist e<strong>in</strong>e geeignete Erklärung <strong>in</strong> Schriftform notwendig, aus der die Mitstiftung oder Zustiftung<br />
<strong>in</strong> ihrer Höhe sowie der Zahlungszeitpunkt hervorgehen.<br />
Zu beachten ist, dass bei der Geme<strong>in</strong>de die besondere Organisationsform „Stiftung“ abhängig von ihrer Ausgestaltung<br />
zu E<strong>in</strong>schränkungen bei der Ausführung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft und der Budgethoheit des<br />
Rates der Geme<strong>in</strong>de führen kann. Auf die E<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gung von F<strong>in</strong>anz- oder Sachvermögens <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Stiftung durch<br />
die Geme<strong>in</strong>de muss daher z.B. verzichtet werden, wenn die besonderen Umstände vor Ort für die Abgabe von<br />
geme<strong>in</strong>dlichem Vermögen nicht schlüssig vorliegen.<br />
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ<br />
GEMEINDEORDNUNG 622
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
10. Teil GO <strong>NRW</strong><br />
10. Teil<br />
RechnungsprÄfung<br />
1. Die Årtliche PrÄfung als geme<strong>in</strong>dliche Eigenkontrolle<br />
Im 10. Teil der Geme<strong>in</strong>deordnung f<strong>in</strong>den sich die Vorschriften Äber die Kontrolle des Haushalts der Geme<strong>in</strong>de. In<br />
diesem GefÄge der gesetzlichen Verpflichtungen zur PrÄfung des haushaltswirtschaftlichen Handelns der Geme<strong>in</strong>de<br />
ist zwischen der Årtlichen PrÄfung und der ÄberÅrtlichen PrÄfung zu unterscheiden. WÇhrend die ÄberÅrtliche<br />
PrÄfung der Geme<strong>in</strong>deprÄfungsanstalt Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen (GPA <strong>NRW</strong>) Äbertragen worden ist (vgl. É 105<br />
GO <strong>NRW</strong>), obliegt die Årtliche PrÄfung der Geme<strong>in</strong>de selbst und stellt e<strong>in</strong>e Eigenkontrolle der Geme<strong>in</strong>de dar. Die<br />
Årtliche PrÄfung der Geme<strong>in</strong>de ist e<strong>in</strong> unverzichtbares Instrument fÄr e<strong>in</strong>e zeitnahe Kontrolle der Gesetz- und<br />
OrdnungsmÇÑigkeit des wirtschaftlichen Handelns der Geme<strong>in</strong>de sowie der haushaltswirtschaftlichen GeschÇftsvorfÇlle<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung.<br />
Der Landesgesetzgeber hat den Begriff „Ürtliche PrÄfung“ zwar nicht nÇher bestimmt, doch hat er festgelegt,<br />
dass der Rat e<strong>in</strong>en RechnungsprÄfungsausschuss zu bilden hat, und er hat diesem bestimmte Aufgaben zugewiesen<br />
(vgl. É 57 i.V.m. É 59 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong>). Auch hat er bestimmt, dass die Geme<strong>in</strong>deverwaltung <strong>in</strong>nerhalb<br />
ihrer Organisation e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>heit fÄr die eigene PrÄfung zu bilden hat (vgl. É 102 GO <strong>NRW</strong>). Daraus folgt, dass<br />
sowohl der Rat als Verfassungsorgan als auch die geme<strong>in</strong>dliche Verwaltung an der Årtlichen PrÄfung beteiligt<br />
se<strong>in</strong> mÄssen. Die Årtliche PrÄfung umfasst daher die TÇtigkeit des RechnungsprÄfungsausschusses und der<br />
„Ürtlichen RechnungsprÄfung“.<br />
Beide PrÄfungsberechtigte stehen <strong>in</strong> unmittelbarer Verb<strong>in</strong>dung mit dem Rat der Geme<strong>in</strong>de. Der RechnungsprÄfungsausschuss<br />
ist e<strong>in</strong> Ausschuss des Rates und die Årtliche RechnungsprÄfung ist dem Rat gegenÄber verantwortlich<br />
und ihm <strong>in</strong> ihrer sachlichen TÇtigkeit unmittelbar unterstellt. Beide wirken deshalb als entscheidungsvorbereitende<br />
Stellen und Informationsquellen fÄr den Rat der Geme<strong>in</strong>de. Dieses wird bestÇrkt durch die Festlegung,<br />
dass <strong>in</strong> kle<strong>in</strong>eren Geme<strong>in</strong>den, bei denen <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung ke<strong>in</strong>e Årtlichen RechnungsprÄfung (vgl.<br />
É 102 GO <strong>NRW</strong>) besteht, sich der RechnungsprÄfungsausschuss auch unmittelbar Dritter gem. É 103 Abs. 5 GO<br />
<strong>NRW</strong> bedienen kann.<br />
2. Der RechnungsprÄfungsausschuss des Rates<br />
2.1 Die gesetzlichen Aufgaben<br />
Dem Rat der Geme<strong>in</strong>de bzw. der Geme<strong>in</strong>de obliegt im Rahmen ihrer eigenstÇndigen und eigenverantwortlichen<br />
Haushaltswirtschaft nicht nur die Entscheidung, mit welchen Aufwendungen welche Leistungen erbracht werden,<br />
sondern auch die Årtliche PrÄfung, ob ihre Haushaltswirtschaft ordnungsgemÇÑ gefÄhrt worden ist und diese den<br />
gesetzlichen Vorschriften, Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen entspricht und unter Beachtung<br />
der GrundsÇtze ordnungsmÇÑiger BuchfÄhrung e<strong>in</strong> den tatsÇchlichen VerhÇltnissen entsprechendes Bild der<br />
VermÅgens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de vermittelt.<br />
Dem Rat kommt damit neben se<strong>in</strong>em Budgetrecht auch e<strong>in</strong>e Kontrollaufgabe zu. Die PrÄfungsaufgabe ist dem<br />
RechnungsprÄfungsausschuss als e<strong>in</strong>en von drei PflichtausschÄssen des Rates gesetzlich Äbertragen worden<br />
(vgl. É 57 i.V.m. É 59 GO <strong>NRW</strong>). Der RechnungsprÄfungsausschuss soll zeitnah zu den geme<strong>in</strong>dlichen AbschlÄssen<br />
se<strong>in</strong>e PrÄfungstÇtigkeit durchfÄhren und zur Entlastung und Erleichterung der Arbeit des Rates der Geme<strong>in</strong>de<br />
beitragen. Er soll aber auch - wie die anderen AusschÄsse des Rates - die BeschlÄsse des Rates sachverstÇndig<br />
vorbereiten und zu den Vorlagen der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung sachgerechte Stellungnahmen und Empfehlungen<br />
abgeben.<br />
GEMEINDEORDNUNG 623
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
10. Teil GO <strong>NRW</strong><br />
Dem RechnungsprÄfungsausschuss ist ausdrÄcklich die PrÄfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses und des<br />
Gesamtabschlusses der Geme<strong>in</strong>de als Aufgabe Äbertragen worden (vgl. É 59 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong>). Die PrÄfung der<br />
ErÅffnungsbilanz der Geme<strong>in</strong>de gehÅrt ebenfalls zu se<strong>in</strong>en Aufgaben (vgl. É 92 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong>). Die dem RechnungsprÄfungsausschuss<br />
obliegende PrÄfungstÇtigkeit soll zeitnah an die jeweiligen geme<strong>in</strong>dlichen AbschlÄsse<br />
erfolgen und zur ErhÅhung der EffektivitÇt und Effizienz der Arbeit des Rates beitragen.<br />
Se<strong>in</strong>e TÇtigkeit beg<strong>in</strong>nt i.d.R. mit e<strong>in</strong>em PrÄfungsauftrag des Rates, fÄr dessen ErfÄllung sich der Ausschuss der<br />
Årtlichen RechnungsprÄfung (vgl. ÉÉ 102 bis 104 GO <strong>NRW</strong>) bedienen kann. Die PrÄfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses<br />
stellt dabei vorrangig e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>de<strong>in</strong>terne, verwaltungstechnische Kontrolle dar. E<strong>in</strong>e politische<br />
Bewertung und Entscheidung steht dem RechnungsprÄfungsausschuss dabei nicht zu, sondern obliegt dem Rat<br />
und den FachausschÄssen auf der Grundlage des vom RechnungsprÄfungsausschuss erstellten und vorgelegten<br />
PrÄfungsberichts, ggf. unter E<strong>in</strong>beziehung der Stellungnahmen des BÄrgermeisters und des KÇmmerers.<br />
2.2 Die eigenverantwortliche AufgabenerfÄllung<br />
Der RechnungsprÄfungsausschuss hat grundsÇtzlich Art und Umfang der erforderlichen PrÄfungshandlungen<br />
unter BerÄcksichtigung der Gegebenheiten bei der Geme<strong>in</strong>de eigenverantwortlich <strong>in</strong> Kenntnis der AufgabenerfÄllung<br />
der Geme<strong>in</strong>de nach pflichtgemÇÑem Ermessen sorgfÇltig zu bestimmen, so dass von ihm PrÄfungsaussagen<br />
mit h<strong>in</strong>reichender Sicherheit getroffen werden kÅnnen. Dabei ist das Ermessen der Ausschussmitglieder bei der<br />
Wahl der PrÄfungsmethoden und der PrÄfungstiefe relativ groÑ. Es ist abhÇngig von den zu prÄfenden Sachverhalten<br />
und vorliegenden Bed<strong>in</strong>gungen im Rahmen der PrÄfungstÇtigkeit des Ausschusses so auszugestalten,<br />
dass subjektive PrÄfungen und E<strong>in</strong>schÇtzungen vermieden werden.<br />
Mit se<strong>in</strong>er PrÄfungstÇtigkeit trÇgt der Ausschuss z.B. auch zur VerlÇsslichkeit der im Jahresabschluss enthaltenen<br />
Informationen bei, denn se<strong>in</strong>e PrÄfungstÇtigkeit hat e<strong>in</strong>e Kontroll-, Informations-, àberwachungs- und Beglaubigungsfunktion.<br />
Se<strong>in</strong>e àberwachungstÇtigkeit bezieht sich dabei auf den gesamten PrÄfungsablauf, denn er bedient<br />
sich z.B. bei se<strong>in</strong>en Aufgaben der Årtlichen RechnungsprÄfung (vgl. É 59 Abs. 3 S. 2 GO <strong>NRW</strong>). Zu se<strong>in</strong>en<br />
Aufgaben gehÅrt auch die KlÇrung von Fragen zur UnabhÇngigkeit von Dritten als AbschlussprÄfer (vgl. É 103<br />
Abs. 7 GO <strong>NRW</strong>), wenn diese auf Grund e<strong>in</strong>er Beauftragung durch die Årtliche RechnungsprÄfung (vgl. É 103<br />
Abs. 5 GO <strong>NRW</strong>) oder im Rahmen der Beauftragung durch den Ausschuss (vgl. É 59 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong>) tÇtig s<strong>in</strong>d.<br />
Bei solchen Beteiligungen von Dritten an den PrÄfungsaufgaben bleibt die Verantwortung des RechnungsprÄfungsausschusses<br />
unberÄhrt. Se<strong>in</strong>e eigene Befassung, z.B. mit der PrÄfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses<br />
oder des Gesamtabschlusses, muss so ausgestaltet und ausreichend se<strong>in</strong>, dass der Ausschuss auf Grund<br />
se<strong>in</strong>er ErkenntnismÅglichkeiten e<strong>in</strong> eigenverantwortliches Urteil zum jeweiligen PrÄfungsgegenstand fÇllen und<br />
e<strong>in</strong>en BestÇtigungsvermerk abgeben kann.<br />
2.3 PrÄfungsbericht und BestÇtigungsvermerk<br />
Der RechnungsprÄfungsausschuss hat zudem Äber se<strong>in</strong>e jeweilige PrÄfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses<br />
und des Gesamtabschlusses der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>en PrÄfungsbericht zu erstellen. Dazu hat er h<strong>in</strong>sichtlich des<br />
PrÄfungsergebnisses e<strong>in</strong>e Feststellung zu treffen, durch die e<strong>in</strong>e BestÇtigung der OrdnungsmÇÑigkeit des Verwaltungshandels<br />
oder e<strong>in</strong>e Unbedenklichkeit h<strong>in</strong>sichtlich der AusfÄhrung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft<br />
ausgesprochen wird. Diese Feststellung <strong>in</strong> Form e<strong>in</strong>es BestÇtigungsvermerks kann der Ausschuss auch mit E<strong>in</strong>schrÇnkungen<br />
abgegeben, aber auch verweigern.<br />
Der BestÇtigungsvermerk oder der Vermerk Äber se<strong>in</strong>e Versagung ist vom Vorsitzenden des RechnungsprÄfungsausschusses<br />
eigenhÇndig zu unterzeichnen, soweit er nicht verh<strong>in</strong>dert ist (vgl. É 101 Abs. 7 GO <strong>NRW</strong>). Der<br />
Ausschussvorsitzende br<strong>in</strong>gt deshalb mit se<strong>in</strong>er Unterschrift im S<strong>in</strong>ne der PrÄfungszustÇndigkeit des Ausschus-<br />
GEMEINDEORDNUNG 624
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
10. Teil GO <strong>NRW</strong><br />
ses zum Ausdruck, dass die PrÄfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses durch das Gremium „RechnungsprÄfungsausschuss“<br />
abgeschlossen ist und aus der Verantwortung des Ausschusses und nicht der des Vorsitzenden<br />
heraus der BestÇtigungsvermerk richtig und vollstÇndig ist. Der RechnungsprÄfungsausschuss kann zudem fÄr<br />
die DurchfÄhrung se<strong>in</strong>er PrÄfungen die AufklÇrung und Nachweise vom BÄrgermeister verlangen, die fÄr e<strong>in</strong>e<br />
sorgfÇltige PrÄfung notwendig s<strong>in</strong>d (vgl. É 103 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong>). Diese Rechte sowie e<strong>in</strong> E<strong>in</strong>sichtsrecht <strong>in</strong> die<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Unterlagen stehen dem RechnungsprÄfungsausschuss als Organ, aber nicht e<strong>in</strong>em e<strong>in</strong>zelnen<br />
Ausschussmitglied persÅnlich zu.<br />
2.4 Die Anforderungen an die Ausschussmitglieder<br />
FÄr die TÇtigkeit im RechnungsprÄfungsausschuss des Rates der Geme<strong>in</strong>de s<strong>in</strong>d im E<strong>in</strong>zelnen ke<strong>in</strong>e fachlichen<br />
und persÅnlichen Voraussetzungen fÄr die Mitglieder des RechnungsprÄfungsausschusses bestimmt worden, wie<br />
sie z.B. fÄr die Mitglieder im Verwaltungsrat e<strong>in</strong>er Sparkasse bestehen (vgl. É 12 SpkG <strong>NRW</strong>). E<strong>in</strong> sachverstÇndiges<br />
Mitglied des RechnungsprÄfungsausschusses muss gleichwohl fachlich <strong>in</strong> der Lage se<strong>in</strong>, die von der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Verwaltung gegebenen Informationen kritisch zu h<strong>in</strong>terfragen und se<strong>in</strong>er PrÄfungsverpflichtung<br />
nachkommen kÅnnen. Daher sollten die Mitglieder des RechnungsprÄfungsausschusses Äber e<strong>in</strong>e ausreichende<br />
Sachkenntnis Äber die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft verfÄgen und VerstÇndnis fÄr die wirtschaftlichen und<br />
rechtlichen AblÇufe im haushaltswirtschaftlichen Geschehen e<strong>in</strong>er Geme<strong>in</strong>de sowie fÄr Fragen der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Rechnungslegung (Jahresabschluss und Gesamtabschluss) und der produktorientierten Steuerung besitzen, um<br />
e<strong>in</strong>e mÅglichst objektive PrÄfungstÇtigkeit zu gewÇhrleisten.<br />
Die Beurteilung darÄber obliegt dem Rat der Geme<strong>in</strong>de, denn der RechnungsprÄfungsausschuss ist e<strong>in</strong> Pflichtausschuss<br />
des Rates (vgl. É 57 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>) und der Rat regelt die Zusammensetzung der AusschÄsse (vgl.<br />
É 58 GO <strong>NRW</strong>). Neue Mitglieder des RechnungsprÄfungsausschusses sollten deshalb, soweit erforderlich, <strong>in</strong> die<br />
Aufgabenbereiche des Ausschusses <strong>in</strong> geeigneter Weise e<strong>in</strong>gefÄhrt werden. Dabei sollte ihnen e<strong>in</strong> umfassender<br />
àberblick Äber die PrÄfungstÇtigkeit des Ausschusses sowie Äber ihre Verantwortlichkeiten gegeben werden.<br />
Dazu gehÅren auch Informationen Äber die Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de, die geme<strong>in</strong>dlichen GeschÇftsbeziehungen<br />
sowie die Chancen und Risiken fÄr die Entwicklung der Geme<strong>in</strong>de.<br />
Die AusschusstÇtigkeit erfordert zudem m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>e UnabhÇngigkeit der Ausschussmitglieder gegenÄber<br />
dem BÄrgermeister als Leiter der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung. Sie sollten auch nicht <strong>in</strong> wesentlichen GeschÇftsbeziehungen<br />
zu der Geme<strong>in</strong>de stehen, die im Rahmen ihrer AusschusstÇtigkeit dann e<strong>in</strong> PrÄfungsgegenstand se<strong>in</strong><br />
kÅnnen. Es sollen deshalb grundsÇtzlich ke<strong>in</strong>e wesentlichen geschÇftlichen, f<strong>in</strong>anziellen und persÅnlichen Beziehungen<br />
der e<strong>in</strong>zelnen Mitglieder des RechnungsprÄfungsausschusses zum BÄrgermeister oder zur Geme<strong>in</strong>de<br />
bestehen.<br />
2.5 Die Zusammenarbeit mit Dritten als AbschlussprÄfer<br />
Die ZustÇndigkeit des RechnungsprÄfungsausschusses fÄr die PrÄfung des Jahresabschlusses ist ausdrÄcklich<br />
bestimmt worden (Absatz 1). ErgÇnzend dazu ist festgelegt, dass <strong>in</strong> Geme<strong>in</strong>den, <strong>in</strong> denen e<strong>in</strong>e Årtliche RechnungsprÄfung<br />
besteht, sich der RechnungsprÄfungsausschuss zur DurchfÄhrung der PrÄfung dieser RechnungsprÄfung<br />
bedient. Wird die JahresabschlussprÄfung nicht von der Årtlichen RechnungsprÄfung vorgenommen,<br />
sondern bedient sich diese Dritte als PrÄfer (vgl. É 103 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong>), muss e<strong>in</strong>e Zusammenarbeit zwischen<br />
der Årtlichen RechnungsprÄfung und dem AbschlussprÄfer herbeigefÄhrt werden. E<strong>in</strong>e zutreffende Urteilsgew<strong>in</strong>nung<br />
Äber den Jahresabschluss ist mÅglich, wenn die unterschiedlichen Informationen beider PrÄf<strong>in</strong>stanzen im<br />
Interesse e<strong>in</strong>er wirksamen und wirtschaftlichen PrÄfung zusammengefÄhrt werden.<br />
Die Verantwortung fÄr das PrÄfungsurteil verbleibt dabei beim AbschlussprÄfer im Rahmen se<strong>in</strong>es PrÄfauftrages.<br />
In diesem S<strong>in</strong>ne muss bei der JahresabschlussprÄfung e<strong>in</strong> bloÑes Nebene<strong>in</strong>ander von Årtlicher RechnungsprÄ-<br />
GEMEINDEORDNUNG 625
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
10. Teil GO <strong>NRW</strong><br />
fung und AbschlussprÄfer vermieden werden. E<strong>in</strong>e bloÑe Entgegennahme von Informationen durch den AbschlussprÄfer<br />
dient nicht der Sache. Es muss m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>e gezielte ZusammenfÄhrung der verfÄgbaren Informationen<br />
sowie gezielte Abstimmungen Äber das PrÄfungsgeschehen geben. Dieser Austausch kann noch<br />
dadurch verbessert werden, dass er <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Kooperation ÄberfÄhrt wird, bei der z.B. von beiden Beteiligten e<strong>in</strong>e<br />
geme<strong>in</strong>same Risikobeurteilung vorgenommen wird. Auch e<strong>in</strong>e noch <strong>in</strong>tensivere Zusammenarbeit arbeitet ist mÅglich,<br />
wenn dabei die e<strong>in</strong>schlÇgigen Vorschriften zur Erhaltung der UnabhÇngigkeit der PrÄfer und zur Vermeidung<br />
von typischen Interessenkonflikte im Zusammenhang mit der PrÄfungstÇtigkeit beachtet werden.<br />
2.6 Die Beteiligung des F<strong>in</strong>anzausschusses des Rates<br />
Aus der haushaltswirtschaftlichen Bedeutung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses<br />
der Geme<strong>in</strong>de heraus ist es geboten, nach der PrÄfung durch den RechnungsprÄfungsausschuss, aber vor<br />
der Feststellung oder BestÇtigung dieser Werke durch den Rat, e<strong>in</strong>e Beteiligung des F<strong>in</strong>anzausschusses durchzufÄhren.<br />
E<strong>in</strong>e solche Aufgabe wÄrde der dem F<strong>in</strong>anzausschuss gesetzlich obliegenden Aufgabe (Vorbereitung<br />
der Haushaltssatzung) folgen. Der F<strong>in</strong>anzausschuss kann das PrÄfungsergebnis des RechnungsprÄfungsausschusses<br />
beraten und dazu e<strong>in</strong>e Stellungnahme oder Empfehlungen fÄr die Feststellung oder BestÇtigung durch<br />
den Rat abgeben.<br />
3. Die Aufgaben der Årtlichen RechnungsprÄfung<br />
Die Årtliche PrÄfung der Geme<strong>in</strong>de erfÄllt verschiedene Aufgaben und nimmt daher unterschiedliche Funktionen<br />
wahr. Sie erfolgt nicht nur zum Zwecke der eigenen Steuerung des Haushalts, sondern sie soll auch feststellen,<br />
ob im abgelaufenen Haushaltsjahr die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft entsprechend dem Auftrag des Rates<br />
ordnungsgemÇÑ ausgefÄhrt wurde und der daraus entstehende Jahresabschluss unter Beachtung der GrundsÇtze<br />
ordnungsmÇÑiger BuchfÄhrung e<strong>in</strong> den tatsÇchlichen VerhÇltnissen entsprechendes Bild der VermÅgens-,<br />
Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de ergibt. Daher ist im Rahmen der PrÄfung auch festzustellen,<br />
ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergÇnzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen<br />
von der Geme<strong>in</strong>de bei der AusfÄhrung ihrer Haushaltswirtschaft beachtet worden s<strong>in</strong>d. Die MÅglichkeit, auch<br />
Dritte fÄr die Årtliche PrÄfung heranzuziehen, verbessert die ObjektivitÇt der PrÄfungen.<br />
Mit ihrer UnabhÇngigkeit gewÇhrleistet die Årtliche RechnungsprÄfung gegenÄber dem Rat der Geme<strong>in</strong>de, dass<br />
Verwaltungsprozesse ordnungsgemÇÑ ablaufen, dabei die rechtlichen Vorgaben beachtet werden und der Rat<br />
sich bei se<strong>in</strong>en Entscheidungen darauf verlassen kann (Vertrauensfunktion). Zugleich schafft die Årtliche RechnungsprÄfung<br />
Transparenz Äber das Verwaltungshandeln zur UnterstÄtzung der Verantwortlichen <strong>in</strong> der Verwaltung<br />
und fÄr den Rat (Informationsfunktion). Dies erfordert, dass sie dem KÇmmerer und dem BÄrgermeister die<br />
MÅglichkeit zur Abgabe e<strong>in</strong>er Stellungnahme e<strong>in</strong>rÇumt, bevor sie ihren BestÇtigungsvermerk bei e<strong>in</strong>er JahresabschlussprÄfung<br />
erstellt. In e<strong>in</strong>er Schlussbesprechung kÅnnen dann ggf. noch Me<strong>in</strong>ungsverschiedenheiten und<br />
Unklarheiten beseitigt werden, die aus unterschiedlichen GrÄnden und Gegebenheiten entstanden s<strong>in</strong>d und<br />
Auswirkungen auf das vorgesehene PrÄfungsergebnis haben kÅnnten.<br />
Durch ihre TÇtigkeit wird die Årtliche RechnungsprÄfung aber auch vorbeugend bzw. verhÄtend dah<strong>in</strong>gehend<br />
tÇtig, dass fÄr die Nichte<strong>in</strong>haltung von Rechtsvorschriften und fÄr unzulÇssige Handlungen e<strong>in</strong> Entdeckungsrisiko<br />
besteht (PrÇventivfunktion). Zu diesen genannten TÇtigkeiten der Årtlichen RechnungsprÄfung muss noch<br />
e<strong>in</strong>e Beratungsaufgabe h<strong>in</strong>zukommen, denn es ist zweckmÇÑig, frÄhzeitig den mÅglichen Fehlentwicklungen <strong>in</strong><br />
der Geme<strong>in</strong>de vorzubeugen, damit alle am Handeln der Geme<strong>in</strong>de Beteiligten zum Wohle der Geme<strong>in</strong>de tÇtig<br />
s<strong>in</strong>d (Beratungsfunktion). AuÑerdem wird durch die PrÄfungstÇtigkeit der Årtlichen RechnungsprÄfung die Steuerung<br />
der Geme<strong>in</strong>de unterstÄtzt, denn die PrÄfungsergebnisse sollen u.a. diesem Zweck dienen. Insgesamt gesehen<br />
erledigt die Årtliche RechnungsprÄfung z.B. Kontroll-, UnterstÄtzungs-, Beratungs- und PrÇventivaufgaben<br />
im Rahmen des haushaltswirtschaftlichen Handelns der Geme<strong>in</strong>de.<br />
GEMEINDEORDNUNG 626
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
10. Teil GO <strong>NRW</strong><br />
Die Årtliche RechnungsprÄfung stellt jedoch ke<strong>in</strong> unmittelbares Controll<strong>in</strong>g der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung dar,<br />
dem e<strong>in</strong>e Aufbereitung und Auswahl von Steuerungs<strong>in</strong>formationen zukommt. Es gilt, den Verantwortlichen der<br />
Geme<strong>in</strong>de ermÅglichen, von der Planung abweichende Entwicklungen und Tendenzen zu erkennen und GeschÇftsprozesse<br />
und VerwaltungsablÇufe der erforderlichen geme<strong>in</strong>dlichen AufgabenerfÄllung anzupassen.<br />
Daher ist auch die Årtliche RechnungsprÄfung e<strong>in</strong> Teil des geme<strong>in</strong>dlichen Steuerungs- und àberwachungssystems,<br />
die <strong>in</strong>sbesondere unter strategischen Gesichtspunkten fÄr e<strong>in</strong>e Weiterentwicklung offen se<strong>in</strong> muss. Der<br />
Nutzen aus der Arbeit der Årtlichen RechnungsprÄfung muss erkennbar gemacht werden, auch wenn dieser<br />
nicht <strong>in</strong> jedem E<strong>in</strong>zelfall <strong>in</strong> Gelde<strong>in</strong>heiten messbar wird. Dieses erfordert e<strong>in</strong>e entsprechende Kommunikation mit<br />
den Verantwortlichen <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung fÄr die zu prÄfenden Sachverhalte.<br />
4. Die Årtliche RechnungsprÄfungsordnung<br />
4.1 Inhalte e<strong>in</strong>er RechnungsprÄfungsordnung<br />
Die Aufgaben, Befugnisse und PrÄfungshandlungen der Årtlichen RechnungsprÄfung kÅnnen von der Geme<strong>in</strong>de<br />
zur besseren Nachvollziehbar der Handlungen und Verfahren <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er RechnungsprÄfungsordnung zusammengefasst<br />
werden. Dieses Regelwerk stellt dann e<strong>in</strong>erseits e<strong>in</strong>e àbersicht dar, weil der Årtlichen RechnungsprÄfung<br />
vielfach auch durch andere Rechtsvorschriften als die Geme<strong>in</strong>deordnung besondere PrÄfungsaufgaben zugewiesen<br />
werden.<br />
Andererseits werden Verfahren und Aufgaben der Årtlichen RechnungsprÄfung nachvollziehbar, gemacht, denn<br />
der Rat der Geme<strong>in</strong>de und der BÄrgermeister kÅnnen nach den <strong>in</strong> É 103 Abs. 2 und 3 GO <strong>NRW</strong> ausdrÄcklich<br />
enthaltenen Bestimmungen der Årtlichen RechnungsprÄfung weitere Aufgaben Äbertragen. FÄr die Årtliche Ausgestaltung<br />
e<strong>in</strong>er RechnungsprÄfungsordnung bietet sich z.B. die RechnungsprÄfungsordnung fÄr den Landschaftsverband<br />
Rhe<strong>in</strong>land vom 28.09.2001 <strong>in</strong> ihrer geltenden Fassung (SGV. <strong>NRW</strong>. 630) an. MÅgliche Regelungs<strong>in</strong>halte<br />
fÄr e<strong>in</strong>e Årtliche RechnungsprÄfungsordnung werden nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung).<br />
Inhalte e<strong>in</strong>er Årtlichen RechnungsprÄfungsordnung<br />
Geltungsbereich - Rahmen und GrundsÇtze fÄr die TÇtigkeit<br />
Rechtliche Stellung<br />
Organisationsform<br />
PersÅnliche Anforderungen<br />
GEMEINDEORDNUNG 627<br />
- Unmittelbare Verantwortlichkeit gegenÄber dem Rat und<br />
sachliche Unterstellung (vgl. É 104 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>)<br />
- E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung <strong>in</strong> die geme<strong>in</strong>dliche Verwaltung, Dienstvorgesetzter<br />
der PrÄfer<strong>in</strong>nen und PrÄfer<br />
- Verwandtschaftsverbot (vgl. É 104 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong>)<br />
- fachliche Eignung<br />
- SelbstprÄfungsverbot<br />
- AusschlussgrÄnde (vgl. É 103 Abs. 7 GO <strong>NRW</strong>)<br />
Gesetzliche Aufgaben - Aufgabenkatalog nach É 103 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong><br />
Ébertragene Aufgaben<br />
- Aufgaben durch den Rat und BÄrgermeister Äbertragen<br />
(vgl. É 103 Abs. 2 und 3 GO <strong>NRW</strong>)<br />
VorprÄfung - PrÄfung der F<strong>in</strong>anzvorfÇlle gemÇÑ É 100 Abs. 4 der<br />
Landeshaushaltsordnung
Auskunftsrecht<br />
Unterlagen<br />
Zutrittsrechte<br />
AufgabenÄbertragung<br />
an Dritte<br />
PrÄfungsberichte<br />
Unterrichtungspflicht<br />
Geltungsdauer<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
10. Teil GO <strong>NRW</strong><br />
GEMEINDEORDNUNG 628<br />
- Recht auf AufklÇrung und Informationen, die fÄr e<strong>in</strong>e<br />
sorgfÇltige RechnungsprÄfung notwendig s<strong>in</strong>d<br />
- Recht auf Vorlage von Vorschriften, VerfÄgungen und<br />
Nachweisen, die fÄr e<strong>in</strong>e sorgfÇltige RechnungsprÄfung<br />
notwendig s<strong>in</strong>d<br />
- Recht auf Zutritt zu den GeschÇftsrÇumen, wenn dieses<br />
fÄr e<strong>in</strong>e sorgfÇltige RechnungsprÄfung notwendig ist<br />
- E<strong>in</strong>schaltung Dritter als PrÄfer, Auswahlverfahren, Beteiligung<br />
des RechnungsprÄfungsausschusses (vgl. É 103<br />
Abs. 5 GO <strong>NRW</strong>)<br />
- Erstellung von PrÄfungsberichten entsprechend der<br />
PrÄfungsaufgaben<br />
- Erstellung e<strong>in</strong>es jÇhrlichen TÇtigkeitsberichtes<br />
- Vorlagepflichten<br />
- Gesetzliche und vere<strong>in</strong>barte Unterrichtungspflichten<br />
gegenÄber, z.B. Rat, AusschÄsse, BÄrgermeister u.a.<br />
- In-Kraft-Treten und zeitliche Bestimmung des AuÑer-<br />
Kraft-Tretens oder der Geltungsdauer<br />
Abbildung 131 „Inhalte e<strong>in</strong>er Årtlichen RechnungsprÇfungsordnung)“<br />
In e<strong>in</strong>er Årtlichen RechnungsprÄfungsordnung kann auch geregelt werden, dass die geme<strong>in</strong>dliche Verwaltung<br />
beim Vorliegen bestimmter Sachverhalte zu Informationen gegenÄber der Årtlichen RechnungsprÄfung verpflichtet<br />
ist. Auch kann e<strong>in</strong>e RechnungsprÄfungsordnung Verpflichtungen fÄr die Årtliche RechnungsprÄfung enthalten,<br />
<strong>in</strong> bestimmten FÇllen den RechnungsprÄfungsausschuss oder den Rat darÄber zu unterrichten. E<strong>in</strong>e Årtliche<br />
RechnungsprÄfungsordnung dÄrfte zudem auch die Stellung der Årtlichen RechnungsprÄfung <strong>in</strong>nerhalb der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Verwaltung verdeutlichen.<br />
4.2 Die ErgÇnzung durch e<strong>in</strong>e Dienstanweisung<br />
E<strong>in</strong>e solche RechnungsprÄfungsordnung kann noch um e<strong>in</strong>e Dienstanweisung ergÇnzt werden, um den <strong>in</strong>neren<br />
Dienstbetrieb und die Aufgabenwahrnehmung nÇher zu bestimmen. Die Dienstanweisung soll daher die Erledigung<br />
des PrÄfungsgeschÇftes zum Inhalt haben, z.B. Vorgaben zur Gestaltung der PrÄfungsberichte, zu dessen<br />
Unterzeichnung, zur Befangenheit der PrÄfer, zur Aufbewahrung der Unterlagen u.a. neben e<strong>in</strong>er RechnungsprÄfungsordnung<br />
oder auch bei e<strong>in</strong>em Verzicht auf e<strong>in</strong>e RechnungsprÄfungsordnung e<strong>in</strong> Erlass e<strong>in</strong>er Årtlichen<br />
Dienstanweisung erforderlich und sachgerecht ist und von wem sie erlassen wird, ggf. auch im E<strong>in</strong>vernehmen,<br />
muss <strong>in</strong> Zusammenarbeit zwischen dem Rat der Geme<strong>in</strong>de und dem BÄrgermeister geklÇrt werden, denn die<br />
Årtliche RechnungsprÄfung ist dem Rat unmittelbar verantwortlich und <strong>in</strong> ihrer sachlichen TÇtigkeit ihm unmittelbar<br />
unterstellt (vgl. É 104 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>).
5. Vorschriften Äber die Årtliche RechnungsprÄfung<br />
5.1 Die GesamtÄbersicht Äber die Vorschriften<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
10. Teil GO <strong>NRW</strong><br />
Der 10. Teil der Geme<strong>in</strong>deordnung enthÇlt folgende Vorschriften (vgl. Abbildung).<br />
Haushaltsrechtliche Vorschriften im 10. Teil der Geme<strong>in</strong>deordnung<br />
10. Teil<br />
RechnungsprÄfung<br />
GEMEINDEORDNUNG 629<br />
É 101 PrÄfung des Jahresabschlusses, BestÇtigungsvermerk<br />
É 102 Ürtliche RechnungsprÄfung<br />
É 103 Aufgaben der Årtlichen RechnungsprÄfung<br />
É 104 Leitung und PrÄfer der Årtlichen RechnungsprÄfung<br />
É 105 àberÅrtliche PrÄfung<br />
Abbildung 132 „Haushaltsrechtliche Vorschriften im 10. Teil der Geme<strong>in</strong>deordnung“<br />
5.2 Die Vorschriften im E<strong>in</strong>zelnen<br />
Der 10. Teil der Geme<strong>in</strong>deordnung enthÇlt im E<strong>in</strong>zelnen folgende Vorschriften zur RechnungsprÄfung:<br />
- É 101 PrÄfung des Jahresabschlusses, BestÇtigungsvermerk<br />
Der Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat nach É 96 GO <strong>NRW</strong> muss e<strong>in</strong>e PrÄfung als e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>de<strong>in</strong>terne<br />
verwaltungstechnische Kontrolle vorausgehen. Das Ergebnis der PrÄfung spiegelt sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
BestÇtigungsvermerk wieder, der une<strong>in</strong>geschrÇnkt oder e<strong>in</strong>geschrÇnkt erteilt oder versagt werden kann.<br />
- É 102 Ürtliche RechnungsprÄfung<br />
Es besteht e<strong>in</strong>e Verpflichtung der Geme<strong>in</strong>de, die Aufgabe „Ürtliche RechnungsprÄfung“ zu erfÄllen. Die Årtliche<br />
RechnungsprÄfung bleibt daher organisatorisch e<strong>in</strong> aufgabenbezogenes Teilgebiet der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Verwaltung, auch wenn die RechnungsprÄfung nach É 104 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> unmittelbar dem Rat gegenÄber<br />
verantwortlich und ihm <strong>in</strong> ihrer sachlichen TÇtigkeit unmittelbar unterstellt ist.<br />
- É 103 Aufgaben der Årtlichen RechnungsprÄfung<br />
Es besteht e<strong>in</strong>e Vielzahl von gesetzlich bestimmten Aufgaben der Årtlichen RechnungsprÄfung. Auch die Auftragserteilung<br />
durch den Rat und den BÄrgermeister an die Årtliche RechnungsprÄfung sowie die Festlegung,<br />
unter welchen Voraussetzungen e<strong>in</strong> Dritter nicht PrÄfer se<strong>in</strong> darf, ist Gegenstand e<strong>in</strong>er ausdrÄcklichen gesetzlichen<br />
Regelung.<br />
- É 104 Leitung und PrÄfer der Årtlichen RechnungsprÄfung<br />
Die Årtliche RechnungsprÄfung hat <strong>in</strong>nerhalb der Geme<strong>in</strong>deverwaltung e<strong>in</strong>e Sonderstellung <strong>in</strong>ne. Die UnabhÇngigkeit<br />
der PrÄfer ist fÄr die Anerkennung der PrÄfungsergebnisse durch den Rat und die BÄrger<strong>in</strong>nen<br />
und BÄrger als Adressaten von grundlegender Bedeutung. Sie erhÅht fÄr die Adressaten den Wert der gegebenen<br />
Informationen Äber die formelle und materielle Richtigkeit der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft sowie<br />
Äber die wirtschaftliche Lage der Geme<strong>in</strong>de.<br />
- É 105 àberÅrtliche PrÄfung<br />
Die ÄberÅrtliche PrÄfung ist Aufgabe der Geme<strong>in</strong>deprÄfungsanstalt. Sie wird damit, anders als die Årtliche<br />
PrÄfung, durch e<strong>in</strong>e auÑerhalb der Geme<strong>in</strong>de stehende Stelle durchgefÄhrt. AuÑerdem bestehen Unterschiede<br />
zwischen der Årtlichen PrÄfung und der ÄberÅrtlichen PrÄfung, da vone<strong>in</strong>ander abweichende Kriterien<br />
und e<strong>in</strong>e andere Betrachtungsweise <strong>in</strong> die PrÄfung e<strong>in</strong>bezogen wird bzw. e<strong>in</strong>bezogen werden muss.
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
10. Teil GO <strong>NRW</strong><br />
6. Der Grundsatz der Wesentlichkeit bei der Årtlichen PrÄfung<br />
Bei der Årtlichen PrÄfung kann es notwendig werden, zwischen konkurrierenden Sachverhalten e<strong>in</strong>e AbwÇgung<br />
nach vernÄnftiger kaufmÇnnischer Beurteilung vorzunehmen, weil sich aus den Konsolidierungspflichten, -<br />
wahlrechten und -verboten i.V.m. den zu beachtenden GrundsÇtzen ggf. Zielkonflikte ergeben kÅnnen und e<strong>in</strong>e<br />
Konzentration auf entscheidungsrelevante Sachverhalte erfolgen soll. Die RechnungsprÄfung muss <strong>in</strong> sich<br />
schlÄssig und willkÄrfrei se<strong>in</strong>, so dass das Ergebnis aus objektiven Gegebenheiten logisch ableitbar ist. In den<br />
geme<strong>in</strong>dlichen AbschlÄssen mÄssen zwar grundsÇtzlich alle Bilanzierungssachverhalte (e<strong>in</strong>zeln) erfasst werden,<br />
jedoch muss unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit zwischen den Kosten der Rechnungslegung und dem Informationszuwachs<br />
e<strong>in</strong> angemessenes VerhÇltnis bestehen.<br />
Die PrÄfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses sowie des Gesamtabschlusses der Geme<strong>in</strong>de be<strong>in</strong>haltet auch<br />
die Beachtung des Vorsichtspr<strong>in</strong>zips, des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und des Grundsatzes der Wesentlichkeit.<br />
Der Grundsatz der Wesentlichkeit konkretisiert den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit <strong>in</strong>soweit, als er bestimmt,<br />
dass aus der Anwendung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit nur dann Vere<strong>in</strong>fachungen der Rechnungslegung<br />
begrÄndet werden kÅnnen, wenn sich hieraus ke<strong>in</strong>e Informationsnachteile fÄr die Adressaten des<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses ergeben. Der Grundsatz kann dabei quantitativ <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em bestimmten Wert als<br />
auch qualitativ <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Eigenschaft zur Anwendung kommen.<br />
Die Wesentlichkeitsgrenze ist dabei aus der Bedeutung des jeweiligen Årtlichen Sachverhaltes im Rahmen des<br />
jeweiligen Gesamtabschlusses der Geme<strong>in</strong>de abzuleiten. Sie ist davon abhÇngig, wie sich die wirtschaftlichen<br />
Entscheidungen und die daraus entstehenden Informationen sich auf die Adressaten der geme<strong>in</strong>dlichen AbschlÄsse<br />
auswirken. Dabei ist auch zu berÄcksichtigen, dass mehrere Abweichungen fÄr sich alle<strong>in</strong> betrachtet als<br />
unwesentlich anzusehen s<strong>in</strong>d, zusammen aber durchaus als wesentlich zu bewerten s<strong>in</strong>d. Im Zweifelsfall ist erforderlich,<br />
zutreffende Informationen Äber die Abweichung zu erhalten, so dass ggf. fÄr die notwendig gewordene<br />
Entscheidung e<strong>in</strong>e ÄberschlÇgige Ermittlung erforderlich werden kann. Die im Rahmen der geme<strong>in</strong>dlichen AbschlÄsse<br />
zu gebenden Informationen s<strong>in</strong>d dann als wesentlich anzusehen, wenn durch ihr Weglassen oder ihre<br />
fehlerhafte oder unvollstÇndige Darstellung die auf der Basis des Gesamtabschlusses getroffenen wirtschaftlichen<br />
Entscheidungen der Abschlussadressaten bee<strong>in</strong>flussen kÅnnen.<br />
E<strong>in</strong>e Relevanz ist daher z.B. anzunehmen, wenn die Informationen dadurch die Adressaten bee<strong>in</strong>flussen, dass<br />
sie ihnen bei der Beurteilung von vergangenen, aktuellen oder zukÄnftigen Ereignissen helfen oder ihre Beurteilung<br />
bestÇtigten oder korrigieren. Entscheidungsrelevante Informationen sollen deshalb <strong>in</strong> den geme<strong>in</strong>dlichen<br />
AbschlÄssen ausgewiesen werden. Die geme<strong>in</strong>dlichen AbschlÄsse s<strong>in</strong>d ist nur verstÇndlich und akzeptabel und<br />
die Informationen bedeutsam, wenn alle wesentlichen Informationen gegeben werden.<br />
7. PrÄfungsansÇtze der Årtlichen PrÄfung<br />
Im Rahmen der Årtlichen PrÄfung bzw. der Årtlichen RechnungsprÄfung bestehen je nach PrÄfungsgegenstand<br />
unterschiedliche PrÄfungsmethoden und PrÄfungsansÇtze. So kann bei e<strong>in</strong>er JahresabschlussprÄfung unterschiedlich<br />
verfahren werden, und zwar abhÇngig davon, ob und wie die laufende PrÄfung der VorgÇnge <strong>in</strong> der<br />
F<strong>in</strong>anzbuchhaltung und die dauernde àberwachung der Zahlungsabwicklung der Geme<strong>in</strong>de sowie die ProgrammprÄfung<br />
fÄr die DurchfÄhrung der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung (DV-<br />
BuchfÄhrung) der Vorbereitung der PrÄfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses gedient haben (vgl. É 103<br />
Abs. 1 Nrn. 4 bis 6 GO <strong>NRW</strong>).<br />
Vor diesem H<strong>in</strong>tergrund wird die AbschlussprÄfung nicht mehr an den e<strong>in</strong>zelnen GeschÇftsvorfÇllen der Geme<strong>in</strong>de<br />
ausgerichtet. Vielmehr werden die PrÄfungshandlungen systemorientiert ausgestaltet, so dass e<strong>in</strong>e Angemes-<br />
GEMEINDEORDNUNG 630
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
10. Teil GO <strong>NRW</strong><br />
senheits- und WirksamkeitsprÄfung stattf<strong>in</strong>det, also die FunktionsfÇhigkeit und die ZweckmÇÑigkeit des von der<br />
Geme<strong>in</strong>de „angewandten Systems“ zur PrÄfungsgrundlage wird. Die DurchfÄhrung erfordert, dass dem PrÄfungsablauf<br />
bei der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>e Analyse mÅglicherweise dort auftretender Fehler und Risiken vorangeht. Die Erkenntnisse<br />
aus e<strong>in</strong>er solchen Beurteilung bestimmen dann die Vorgehensweise bei der DurchfÄhrung der AbschlussprÄfung<br />
(PrÄfungsstrategie und PrÄfungsprogramm). S<strong>in</strong>d z.B. MÇngel der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzbuchhaltung<br />
aus der Abwicklung der geme<strong>in</strong>dlichen GeschÇftsvorfÇlle bekannt, bee<strong>in</strong>flusst e<strong>in</strong>e solche Erkenntnis die<br />
dort durchzufÄhrende PrÄfung.<br />
Im Rahmen der AbschlussprÄfung kÅnnen Risiken bestehen, so dass trotz wesentlicher Fehler im geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Jahresabschluss e<strong>in</strong> positives PrÄfungsurteil durch den AbschlussprÄfer abgegeben wird. Der AbschlussprÄfer<br />
benÅtigt daher vielfach spezifisches Wissen Äber die Geme<strong>in</strong>de, um die Årtlichen Systeme und VerwaltungsablÇufe,<br />
Ressourcen und Verantwortlichkeiten begutachten zu kÅnnen. Er sollte sich daher e<strong>in</strong> Bild Äber die GeschÇftstÇtigkeit<br />
der Geme<strong>in</strong>de sowie ihr Umfeld verschaffen und ggf. auch e<strong>in</strong>en Zeitreihenvergleich aufbauen.<br />
Dabei gilt es, wÇhrend der gesamten DurchfÄhrung der AbschlussprÄfung kont<strong>in</strong>uierlich weitere Informationen zu<br />
sammeln und h<strong>in</strong>sichtlich ihrer E<strong>in</strong>beziehung <strong>in</strong> das PrÄfungsgeschehen zu wÄrdigen. Insbesondere prÇgen erhaltene<br />
Indizien fÄr erhÅhte Risiken im Rahmen der PrÄfung die PrÄfungshandlungen.<br />
AbhÇngig von den Årtlichen Gegebenheiten kann es zudem erforderlich se<strong>in</strong>, e<strong>in</strong>en mehrstufigen Informationsund<br />
Entscheidungsprozess vor Ort durchzufÄhren, um festzustellen, ob die vorgefundenen Gegebenheiten den<br />
jeweils geltenden Normen entsprechen. Insbesondere <strong>in</strong> den FÇllen, <strong>in</strong> denen ke<strong>in</strong>e analytischen PrÄfungshandlungen<br />
mÅglich s<strong>in</strong>d oder nicht zu ausreichenden PrÄfungsaussagen fÄhren, s<strong>in</strong>d ggf. e<strong>in</strong>zelfallbezogene PrÄfungshandlungen<br />
durch den AbschlussprÄfer geboten. Zu solchen PrÄfungshandlungen s<strong>in</strong>d z.B. die Inventurbeobachtung,<br />
Vorlage von SaldenbestÇtigungen, eigene Berechnungen als NachprÄfung der Abwicklung von GeschÇftsvorfÇllen,<br />
Anwendung von geme<strong>in</strong>deeigenen KontrollmaÑnahmen im Nachvollzug, Vorlage von geme<strong>in</strong>deeigenen<br />
PrÄfungsnachweisen, zu zÇhlen. In diesen Zusammenhang stehen auch die Bestimmung von Wesentlichkeitsgrenzen<br />
sowie die daraus zu ziehenden Schlussfolgerungen.<br />
Im Rahmen von SystemprÄfungsansÇtzen bei der JahresabschlussprÄfung mÄssen aussagefÇhige Informationen<br />
vorliegen, die e<strong>in</strong>e h<strong>in</strong>reichende Sicherheit fÄr die bei e<strong>in</strong>er AbschlussprÄfung zu treffenden PrÄfungsaussagen<br />
bieten. Der PrÄfungsbericht und der BestÇtigungsvermerk baut i.d.R. auf sollen „Nachweisen“ auf. Dazu kann,<br />
z.B. <strong>in</strong>sbesondere im Rahmen der PrÄfung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses (vgl. É 116 Abs. 6 GO <strong>NRW</strong>)<br />
oder bei der Beauftragung Dritter (vgl. É 103 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong>), die Verwendung von PrÄfungsarbeiten Dritter oder<br />
auch von SachverstÇndigen kommen.<br />
In solchen FÇllen muss der AbschlussprÄfer m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>e Beurteilung der ihm vorgelegten Arbeitsergebnisse<br />
(PlausibilitÇtsprÄfung) durchfÄhren. Daher gilt bei SystemprÄfungsansÇtzen generell, durch e<strong>in</strong>e gezielte Komb<strong>in</strong>ation<br />
von PrÄfungsmethoden und zu prÄfendem Aufgabengebiet das bestehende PrÄfungsrisiko so weit wie<br />
mÅglich zu m<strong>in</strong>imieren. Dazu sollen auch die im Rahmen von geme<strong>in</strong>dlichen AbschlussprÄfungen anzuwendenden<br />
der GrundsÇtze ordnungsmÇÑiger AbschlussprÄfungen (GoA) beitragen.<br />
8. Die VerÅffentlichung von PrÄfungsberichten<br />
8.1 Die VerÅffentlichung des PrÄfungsergebnisses<br />
Der Rat und die BÄrger<strong>in</strong>nen und BÄrger als Adressaten des Jahresabschlusses verlangen aus der AbschlussprÄfung<br />
konkrete Empfehlungen und Informationen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, der OrdnungsmÇÑigkeit<br />
und der FunktionsfÇhigkeit des Verwaltungshandelns der Geme<strong>in</strong>de. FÄr sie sollen daher im jeweiligen PrÄfungsbericht<br />
entscheidungsrelevante Informationen zur VerfÄgung gestellt werden. FÄr die PrÄfung des Jahresabschlusses<br />
bedeutet dieses regelmÇÑig, dass die Årtliche PrÄfung nicht alle<strong>in</strong> auf „verwaltungs<strong>in</strong>terne“ Informa-<br />
GEMEINDEORDNUNG 631
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
10. Teil GO <strong>NRW</strong><br />
tionsbedÄrfnisse bzw. auf die Ratsmitglieder ausgerichtet werden darf, sondern bei der DurchfÄhrung der PrÄfung<br />
gleichermaÑen auch die Interessen der BÄrger<strong>in</strong>nen und BÄrger zu berÄcksichtigen s<strong>in</strong>d.<br />
Als Adressat und Auftraggeber der PrÄfung des Jahresabschlusses ist dem Rat, der den RechnungsprÄfungsausschuss<br />
mit der PrÄfung beauftragt hat, das PrÄfungsergebnis bekannt zu geben. Dieses wird regelmÇÑig <strong>in</strong><br />
Åffentlicher Sitzung beraten, denn der Rat hat unter E<strong>in</strong>beziehung des vom RechnungsprÄfungsausschuss vorgelegten<br />
PrÄfungsergebnisses den geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss festzustellen. FÄr die Information Äber die Bewertung<br />
des geme<strong>in</strong>dlichen Handelns im abgelaufenen Haushaltsjahr ist im Rahmen der Beratungen des Rates<br />
Äber die Feststellung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses e<strong>in</strong>e ausreichende Üffentlichkeit gewÇhrleistet. Damit<br />
ist e<strong>in</strong>e Åffentliche Information Äber die Art, Umfang und Inhalte der durchgefÄhrten PrÄfung ausreichend<br />
gewÇhrleistet, soweit nicht E<strong>in</strong>zelne von ihrem Informationsrecht nach dem Informationsfreiheitsgesetz des Landes<br />
Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen Gebrauch machen.<br />
Es bietet sich deshalb an, das PrÄfungsergebnis dem gleichen Adressatenkreis verfÄgbar zu machen, der im<br />
Rahmen der Åffentlichen Bekanntmachung des Jahresabschlusses zu <strong>in</strong>formieren ist oder sich <strong>in</strong>formieren will. In<br />
diesem Zusammenhang bietet es sich an, das PrÄfungsergebnis, dass <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em BestÇtigungsvermerk zusammengefasst<br />
ist (vgl. É 101 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong>) der AufsichtsbehÅrde mit dem nach É 96 Abs. 2 S. 1 GO <strong>NRW</strong> anzuzeigenden<br />
Jahresabschluss vorzulegen. Von der Geme<strong>in</strong>de kann Årtlich entschieden werden, den BestÇtigungsvermerk<br />
auch dem nach se<strong>in</strong>er Bekanntmachung zur E<strong>in</strong>sichtnahme verfÄgbar zu haltenden Jahresabschluss<br />
(bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses) beizufÄgen (vgl. É 96 Abs. 2 S. 2 GO <strong>NRW</strong>). Damit wÄrde<br />
dem InformationsbedÄrfnis der Adressaten Äber den geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss sowie Äber die dazu durchgefÄhrte<br />
PrÄfung <strong>in</strong> ausreichendem Umfang genÄge getan.<br />
8.2 Die VerÅffentlichung des PrÄfungsberichtes<br />
8.2.1 Ke<strong>in</strong>e Pflicht zur VerÅffentlichung<br />
Aus der weiten Zielvorgabe fÄr die JahresabschlussprÄfung entsteht ke<strong>in</strong>e ausdrÄckliche Pflicht fÄr die Geme<strong>in</strong>de,<br />
ihren BÄrger<strong>in</strong>nen und BÄrgern zusÇtzlich zum PrÄfungsergebnis auch den PrÄfungsbericht des RechnungsprÄfungsausschusses<br />
<strong>in</strong> vollem Umfang verfÄgbar zu machen. Als Adressat und Auftraggeber der PrÄfung des<br />
Jahresabschlusses ist der PrÄfungsbericht nur dem Rat, der den RechnungsprÄfungsausschuss mit der PrÄfung<br />
beauftragt hat, zu Äbergeben. E<strong>in</strong>er pflichtigen Zusatz<strong>in</strong>formation der Üffentlichkeit Äber die vom RechnungsprÄfungsausschuss<br />
durchgefÄhrte PrÄfung und das PrÄfungsergebnis durch e<strong>in</strong>e allgeme<strong>in</strong>e Bekanntgabe des PrÄfungsberichtes<br />
bedarf es deshalb nicht. Der PrÄfungsbericht muss daher auch nicht <strong>in</strong> der Zeit zur E<strong>in</strong>sichtnahme<br />
verfÄgbar gemacht werden, die sich an die Åffentliche Bekanntmachung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses<br />
anschlieÑt.<br />
In Åffentlicher Sitzung hat der Rat Äber den geprÄften geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss zu beraten, denn er hat<br />
unter E<strong>in</strong>beziehung des Ergebnisses der AbschlussprÄfung bzw. des BestÇtigungsvermerks den Jahresabschluss<br />
der Geme<strong>in</strong>de festzustellen. In diesem Zusammenhang stÄtzen sich die Ratsmitglieder bei ihrer Entscheidung<br />
Äber die Entlastung des BÄrgermeisters nach É 96 Abs. 1 S. 4 GO <strong>NRW</strong> vielfach auch auf das vom RechnungsprÄfungsausschuss<br />
festgestellte PrÄfungsergebnis bzw. den BestÇtigungsvermerk. Damit ist fÄr die Information<br />
Äber die Art, Umfang und Inhalte der durchgefÄhrten PrÄfung unter E<strong>in</strong>beziehung des BestÇtigungsvermerks e<strong>in</strong>e<br />
ausreichende Üffentlichkeit fÄr das vom RechnungsprÄfungsausschuss festgestellte PrÄfungsergebnis bzw. den<br />
PrÄfbericht gewÇhrleistet. Auch wenn darÄber nicht ausdrÄcklich e<strong>in</strong>e haushaltsrechtliche Regelung besteht, ist<br />
nicht von e<strong>in</strong>em allgeme<strong>in</strong>en Rechtsanspruch der BÄrger<strong>in</strong>nen und BÄrger auf e<strong>in</strong>e eigenstÇndige VerÅffentlichung<br />
von PrÄfberichten aus der Årtlichen PrÄfung auszugehen.<br />
GEMEINDEORDNUNG 632
8.2.2 Freiwillige VerÅffentlichung<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
10. Teil GO <strong>NRW</strong><br />
Die Geme<strong>in</strong>de kann anhand der Gegebenheiten vor Ort eigenverantwortlich entscheiden, ob sie zusÇtzlich zum<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss auch den vom RechnungsprÄfungsausschuss erstellten PrÄfungsbericht verÅffentlicht.<br />
Ist e<strong>in</strong>e VerÅffentlichung von der Geme<strong>in</strong>de unter Transparenzgesichtspunkten beabsichtigt, sollten<br />
zuvor die Interessen der E<strong>in</strong>sichtsberechtigten mit den schutzwÄrdigen Gegebenheiten (z.B. Datenschutz, GeschÇftsgeheimnisse)<br />
abgewogen und darÄber entschieden werden, was verÅffentlicht wird. Der Rat als Adressat<br />
und „Inhaber“ des PrÄfungsberichtes se<strong>in</strong>es Ausschusses sollte daher Äber e<strong>in</strong>e vollstÇndige oder teilweise allgeme<strong>in</strong>e<br />
E<strong>in</strong>sichtnahme <strong>in</strong> den ihm Äbergebenen PrÄfungsbericht bzw. se<strong>in</strong>e VerÅffentlichung entscheiden. Ggf.<br />
kann es auch <strong>in</strong> diesen FÇllen ausreichend se<strong>in</strong>, wenn der RechnungsprÄfungsausschuss und der Rat ke<strong>in</strong>e<br />
allgeme<strong>in</strong>en Bedenken gegen e<strong>in</strong>e VerÅffentlichung erhoben haben.<br />
Vor e<strong>in</strong>er VerÅffentlichung des PrÄfungsberichtes sollte von der Geme<strong>in</strong>de aber immer geprÄft werden, wie die<br />
VerÅffentlichung von personenbezogenen und anderen re<strong>in</strong> dienstlichen oder betrieblichen Inhalten, die <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
PrÄfungsbericht enthalten se<strong>in</strong> kÅnnen, vermieden werden, z.B. aus DatenschutzgrÄnden. Es bedarf daher e<strong>in</strong>er<br />
Entscheidung, <strong>in</strong> welcher Art und Weise die nicht der Geme<strong>in</strong>haltung unterliegende Teile des PrÄfungsberichts<br />
zur E<strong>in</strong>sichtnahme verfÄgbar gemacht werden. Ürtlich kÅnnen aber auch andere wichtige GrÄnde vorliegen, die<br />
dazu fÄhren, nicht nur auf die VerÅffentlichung bestimmter Teile e<strong>in</strong>es PrÄfberichtes, sondern des gesamten PrÄfungsberichtes<br />
zu verzichten. So kÅnnen z.B. die betrieblichen Interessen der e<strong>in</strong>zelnen geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe<br />
dazu fÄhren, dass der PrÄfungsbericht Äber den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses (vgl. É 116 Abs. 6 GO <strong>NRW</strong>)<br />
nicht verÅffentlicht werden kann. Es ist dabei aber auch zu prÄfen, ob auch aus Datenschutz- und/oder anderen<br />
GeheimhaltungsgrÄnden (vgl. z.B. É 6 GO <strong>NRW</strong>) bestimmte PrÄfungsergebnisse und Erkenntnisse nicht Åffentlich<br />
gemacht werden dÄrfen.<br />
In den FÇllen, <strong>in</strong> denen die Geme<strong>in</strong>de beabsichtigt, e<strong>in</strong>zelne Teile e<strong>in</strong>es PrÄfungsberichtes oder den gesamten<br />
PrÄfungsbericht, z.B. Äber die PrÄfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses oder die PrÄfung des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Gesamtabschlusses zu verÅffentlichen, bietet es sich an, den betreffenden PrÄfungsbericht zusammen mit<br />
dem dazugehÅrigen geme<strong>in</strong>dlichen Abschluss e<strong>in</strong>sehbar zu machen und nicht davon losgelÅst vom betreffenden<br />
Abschluss als eigenstÇndiges Werk zu verÅffentlichen. Von der Geme<strong>in</strong>de wÇre dabei zu prÄfen, ob und ggf. auf<br />
welche PrÄfungsergebnisse und Erkenntnisse oder auf ânderungen des Jahresabschlusses auf Grund von PrÄfungen<br />
bei e<strong>in</strong>er solchen VerÅffentlichung besonders h<strong>in</strong>gewiesen wird. Diese H<strong>in</strong>weise gelten entsprechend,<br />
wenn Beanstandungen, aus denen heraus Anlass bestand, den aufgestellten Jahresabschluss anzupassen,<br />
verÅffentlicht werden sollen.<br />
������������<br />
GEMEINDEORDNUNG 633
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 101 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 101<br />
Prüfung des Jahresabschlusses, Bestätigungsvermerk<br />
(1) 1 Der Jahresabschluss ist vom Rechnungsprüfungsausschuss dah<strong>in</strong>gehend zu prüfen, ob er e<strong>in</strong> den tatsächlichen<br />
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de<br />
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ergibt. 2 Die Prüfung des Jahresabschlusses<br />
erstreckt sich darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen<br />
Bestimmungen beachtet worden s<strong>in</strong>d. 3 In die Prüfung s<strong>in</strong>d die Buchführung, die Inventur, das Inventar<br />
und die Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände e<strong>in</strong>zubeziehen. 4 Der<br />
Lagebericht ist darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang steht und ob se<strong>in</strong>e sonstigen Angaben<br />
nicht e<strong>in</strong>e falsche Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de erwecken.<br />
5 Der Rechnungsprüfungsausschuss hat über Art und Umfang der Prüfung sowie über das Ergebnis der<br />
Prüfung e<strong>in</strong>en Prüfungsbericht zu erstellen. 6 Der Bestätigungsvermerk oder der Vermerk über se<strong>in</strong>e Versagung<br />
ist <strong>in</strong> den Prüfungsbericht aufzunehmen.<br />
(2) 1 Vor Abgabe des Prüfungsberichtes durch den Rechnungsprüfungsausschuss an den Rat ist dem Bürgermeister<br />
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Prüfungsergebnis zu geben. 2 Soweit der Kämmerer von se<strong>in</strong>em<br />
Recht nach § 95 Abs. 3 Satz 3 Gebrauch gemacht hat, ist ihm ebenfalls Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.<br />
(3) 1 Der Rechnungsprüfungsausschuss hat das Ergebnis der Prüfung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Bestätigungsvermerk zusammenzufassen.<br />
2 Der Bestätigungsvermerk hat Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung zu beschreiben und dabei die<br />
angewandten Rechnungslegungsgrundsätze und Prüfungsgrundsätze anzugeben. 3 Er hat ferner e<strong>in</strong>e Beurteilung<br />
des Prüfungsergebnisses zu enthalten, die zweifelsfrei ergeben muss, ob<br />
1. e<strong>in</strong> une<strong>in</strong>geschränkter Bestätigungsvermerk erteilt wird,<br />
2. e<strong>in</strong> e<strong>in</strong>geschränkter Bestätigungsvermerk erteilt wird,<br />
3. der Bestätigungsvermerk auf Grund von Beanstandungen versagt wird oder<br />
4. der Bestätigungsvermerk deshalb versagt wird, weil der Prüfer nicht <strong>in</strong> der Lage ist, e<strong>in</strong>e Beurteilung vorzunehmen.<br />
4 Die Beurteilung des Prüfungsergebnisses soll allgeme<strong>in</strong>verständlich und problemorientiert unter Berücksichtigung<br />
des Umstandes erfolgen, dass Rat und Verwaltungsvorstand den Abschluss zu verantworten haben. 5 Auf<br />
Risiken, die die stetige Aufgabenerfüllung und die Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de gefährden, ist gesondert<br />
e<strong>in</strong>zugehen.<br />
(4) 1 In e<strong>in</strong>em une<strong>in</strong>geschränkten Bestätigungsvermerk (Absatz 3 Satz 3 Nr. 1) ist zu erklären, dass die durchgeführte<br />
Prüfung zu ke<strong>in</strong>en Beanstandungen geführt hat, der Jahresabschluss auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen<br />
Erkenntnisse den gesetzlichen Vorschriften, Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen<br />
entspricht und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen<br />
entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de vermittelt. 2 Dieser<br />
Bestätigungsvermerk kann um H<strong>in</strong>weise ergänzt werden, die ihn nicht e<strong>in</strong>schränken.<br />
(5) 1 Werden Beanstandungen ausgesprochen, ist die Erklärung nach Absatz 4 Satz 1 e<strong>in</strong>zuschränken oder zu<br />
versagen. 2 E<strong>in</strong> e<strong>in</strong>geschränkter Bestätigungsvermerk darf nur erteilt werden, wenn der geprüfte Jahresabschluss<br />
unter Beachtung der vom Prüfer vorgenommenen, <strong>in</strong> ihrer Tragweite erkennbaren E<strong>in</strong>schränkung e<strong>in</strong> den tatsächlichen<br />
Verhältnissen im Wesentlichen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage<br />
der Geme<strong>in</strong>de vermittelt (Absatz 3 Satz 3 Nr. 2). 3 S<strong>in</strong>d die Beanstandungen so erheblich, dass ke<strong>in</strong> den<br />
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de<br />
mehr vermittelt wird, ist der Bestätigungsvermerk zu versagen (Absatz 3 Satz 3 Nr. 3). 4 Der Bestätigungsvermerk<br />
ist auch dann zu versagen, wenn der Prüfer nach Ausschöpfung aller angemessenen Möglichkeiten<br />
zur Klärung des Sachverhaltes nicht <strong>in</strong> der Lage ist, e<strong>in</strong>e Beurteilung abzugeben (Absatz 3 Satz 3 Nr. 4). 5 Die<br />
GEMEINDEORDNUNG 634
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 101 GO <strong>NRW</strong><br />
Versagung ist <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Vermerk, der nicht als Bestätigungsvermerk zu bezeichnen ist, aufzunehmen. 6 Die E<strong>in</strong>schränkung<br />
oder Versagung ist zu begründen.<br />
(6) 1 Die Beurteilung des Prüfungsergebnisses hat sich auch darauf zu erstrecken, ob der Lagebericht mit dem<br />
Jahresabschluss <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang steht und <strong>in</strong>sgesamt e<strong>in</strong>e zutreffende Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-,<br />
Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de vermittelt. 2 Dabei ist auch darauf e<strong>in</strong>zugehen, ob die Chancen und Risiken<br />
für die künftige Entwicklung der Geme<strong>in</strong>de zutreffend dargestellt s<strong>in</strong>d.<br />
(7) Der Bestätigungsvermerk oder der Vermerk über die Versagung ist unter Angabe von Ort und Tag vom Vorsitzenden<br />
des Rechnungsprüfungsausschusses zu unterzeichnen.<br />
(8) 1 In Geme<strong>in</strong>den, <strong>in</strong> denen e<strong>in</strong>e örtliche Rechnungsprüfung besteht, bedient sich der Rechnungsprüfungsausschuss<br />
zur Durchführung der Prüfung dieser Rechnungsprüfung. 2 Die örtliche Rechnungsprüfung oder Dritte als<br />
Prüfer haben im Rahmen ihrer Prüfung e<strong>in</strong>en Bestätigungsvermerk oder e<strong>in</strong>en Vermerk über se<strong>in</strong>e Versagung<br />
nach den Absätzen 3 bis 7 abzugeben.<br />
Erläuterungen zu § 101:<br />
I. Allgeme<strong>in</strong>es<br />
1. Prüfungspflichten beim Jahresabschluss<br />
1.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Zum Budgetrecht des Rates der Geme<strong>in</strong>de, den Rahmen und die Bed<strong>in</strong>gungen zur Ausführung der jährlichen<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft zu bestimmen, gehört auch se<strong>in</strong>e Zuständigkeit, nach Ablauf des Haushaltsjahres<br />
das Ergebnis der Haushaltswirtschaft dieses Jahres <strong>in</strong> Form des geme<strong>in</strong>dlichen den Jahresabschluss<br />
festzustellen (vgl. § 96 GO <strong>NRW</strong>). Dieses Recht be<strong>in</strong>haltet aber auch die Pflicht des Rates, vor der Feststellung<br />
des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses e<strong>in</strong>e Prüfung <strong>in</strong> der Sache durchzuführen.<br />
Die Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses obliegt dabei dem Rechnungsprüfungsausschuss, e<strong>in</strong>em<br />
Pflichtausschuss des Rates (vgl. § 57 i.V.m. den § 59 GO <strong>NRW</strong>). Sie stellt vorrangig e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>de<strong>in</strong>terne und<br />
verwaltungstechnische Kontrolle sowie e<strong>in</strong>e vorbereitende Maßnahme für den Beschluss des Rates über die<br />
Feststellung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses dar. Dieser Sachverhalt bed<strong>in</strong>gt, dass der Bürgermeister<br />
nach Ablauf des Haushaltsjahres den von ihm bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses dem Rat zur Feststellung<br />
zuleitet (vgl. § 95 Abs. 3 S. 2 GO <strong>NRW</strong>). Der Gegenstand der pflichtigen örtlichen Prüfung ist daher der<br />
aufgestellte und dem Rat zugeleitete „Entwurf des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses“, auch wenn <strong>in</strong> der Vorschrift<br />
dieser Begriff nicht mehr ausdrücklich verwendet wird.<br />
Die Vorschrift konkretisiert dazu Ziel und Zweck der Abschlussprüfung und die allgeme<strong>in</strong>en Prüfungsaufgaben<br />
sowie die Darstellung der Prüfungsergebnisse durch den Rechnungsprüfungsausschuss. Sie enthält für den<br />
Ausschuss auch das Recht, die für diese Prüfung erforderlichen Unterlagen von der geme<strong>in</strong>dlichen Kernverwaltung<br />
verlangen zu können. Die Prüfung der geme<strong>in</strong>dlichen Jahresergebnisse soll als moderne Abschlussprüfung<br />
durchgeführt werden. Ihr Umfang und die Intensität sowie die Methoden der Abschlussprüfung s<strong>in</strong>d unter Berücksichtigung<br />
des Prüfungsgegenstandes und des Zieles festzulegen. Im Rahmen der geme<strong>in</strong>dlichen Abschlussprüfung<br />
gilt es, relevante Prüfungsaussagen mit h<strong>in</strong>reichender Sicherheit unter Beachtung des Grundsatzes der<br />
Wesentlichkeit und des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit treffen zu können. Auch soll im Rahmen der Jahresabschlussprüfung<br />
e<strong>in</strong>e zukunftsorientierte Beurteilung der Chancen und Risiken aus der aktuellen Haushaltswirtschaft<br />
der Geme<strong>in</strong>de vorgenommen werden.<br />
GEMEINDEORDNUNG 635
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 101 GO <strong>NRW</strong><br />
In die geme<strong>in</strong>dliche Jahresabschlussprüfung sollen auch qualitative sowie zukunftsbezogene, aber auch prozessorientierte<br />
E<strong>in</strong>flussfaktoren, die sich auf die Geme<strong>in</strong>de auswirken, e<strong>in</strong>bezogen und beurteilt werden. E<strong>in</strong>e<br />
Entscheidung über e<strong>in</strong>en risikoorientierten Prüfungsansatz ist im Zusammenspiel mit den gesetzlichen Prüfungsaufgaben,<br />
e<strong>in</strong>e laufende Prüfung der Vorgänge <strong>in</strong> der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses<br />
durchzuführen und die Zahlungsabwicklung der Geme<strong>in</strong>de dauernd zu überwachen (vgl. § 103<br />
Abs. 1 Nr. 4 und 5 GO <strong>NRW</strong>), zu treffen. E<strong>in</strong>e lückenlose Prüfung sollte nur dann beabsichtigt werden, wenn das<br />
Ziel der Abschlussprüfung nicht anders erreicht werden kann.<br />
1.2 Der Rahmen der Abschlussprüfung<br />
Der Rahmen der Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses wird auch dadurch bestimmt, dass durch die<br />
Prüfung die im Jahresabschluss und im Lagebericht enthaltenen Informationen bestätigt sowie deren Glaubwürdigkeit<br />
erhöht werden. Die Verlässlichkeit der Informationen schließt deshalb auch ihre Ordnungsmäßigkeit e<strong>in</strong>,<br />
denn der Rat sowie die Aufsichtsbehörde der Geme<strong>in</strong>de sollen die Ergebnisse der Prüfung bei ihren Entscheidungen<br />
berücksichtigen. Über die Art und den Umfang der Jahresabschlussprüfung sowie über das Ergebnis der<br />
Prüfung ist deshalb vom Rechnungsprüfungsausschuss e<strong>in</strong> Prüfungsbericht zu erstellen. . Der gesetzlich bestimmte<br />
Prüfungsumfang darf dabei weder von der Geme<strong>in</strong>de noch von den Abschlussprüfern auf eigene Veranlassung<br />
e<strong>in</strong>geschränkt werden.<br />
In den Prüfungsbericht ist der Bestätigungsvermerk oder der Vermerk über se<strong>in</strong>e Versagung aufzunehmen. Auch<br />
wenn sich der Gegenstand und der Umfang der Prüfung aus den gesetzlichen Vorschriften ableiten, liegt es im<br />
pflichtgemäßen Ermessen der Prüfer, im E<strong>in</strong>zelfall die Art und den Umfang der Prüfungsdurchführung zu bestimmen.<br />
Die Regelungen über den Bestätigungsvermerk des Prüfers des Jahresabschlusses s<strong>in</strong>d an <strong>in</strong>ternationale<br />
Rechnungslegungsstandards angelehnt und <strong>in</strong> den Richtl<strong>in</strong>ien der Europäischen Union (EU) enthalten, die <strong>in</strong><br />
europäisches und deutsches Bilanzrecht umgesetzt werden.<br />
Im Rahmen der geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlussprüfung müssen dabei Prüfungsaussagen mit h<strong>in</strong>reichender<br />
Sicherheit getroffen werden. Es gilt daher, die Geme<strong>in</strong>de mit ihrer Aufgabenerfüllung und Verwaltung als E<strong>in</strong>heit<br />
zu betrachten, bei der regelmäßig e<strong>in</strong>e hohe fachliche und technische Komplexität vorherrscht, um e<strong>in</strong>e Beurteilung<br />
des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses vorzunehmen, die durch den Bestätigungs- oder den Versagungsvermerk<br />
zum Ausdruck kommt. Ohne solide Kenntnisse des geme<strong>in</strong>dlichen Geschehens ist e<strong>in</strong>e Jahresabschlussprüfung<br />
kaum zu erfüllen.<br />
1.3 Die Berücksichtigung von Ereignissen nach dem Abschlussstichtag<br />
Zur Jahresabschlussprüfung gehört auch die Prüfung von Sachverhalten, die im Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag<br />
und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses für das abgelaufene Haushaltsjahres bekannt<br />
geworden s<strong>in</strong>d, wenn diese berücksichtigt worden s<strong>in</strong>d, weil sie sich auf Gegebenheiten im abgelaufenen<br />
Haushaltsjahr (vor dem Abschlussstichtag) beziehen (wertaufhellende Informationen). Derartige Tatsachen bee<strong>in</strong>flussen<br />
nicht den Wert, sondern zeigen die geme<strong>in</strong>dlichen Verhältnisse zum Abschlussstichtag so, wie sie zu<br />
diesem Zeitpunkt waren.<br />
Von der Geme<strong>in</strong>de dürfen dagegen Informationen, die im Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag und dem<br />
Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses für das abgelaufene Haushaltsjahres bekannt werden, und sich auf<br />
Gegebenheiten nach dem Abschlussstichtag beziehen, also auf die Zeit zwischen dem Abschlussstichtag und<br />
dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses, nicht im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses berücksichtigt<br />
werden (wertbegründende Informationen). Derartige Tatsachen bee<strong>in</strong>flussen den von der Geme<strong>in</strong>de<br />
zu bilanzierenden Wert und zeigen die geme<strong>in</strong>dlichen Verhältnisse zum Abschlussstichtag nicht mehr so, wie sie<br />
zu diesem Zeitpunkt waren.<br />
GEMEINDEORDNUNG 636
1.4 Die Nachtragsprüfungen<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 101 GO <strong>NRW</strong><br />
Im Falle e<strong>in</strong>er Änderung e<strong>in</strong>es geprüften Jahresabschlusses ist e<strong>in</strong>e erneute Prüfung vorzunehmen, soweit es die<br />
vorgenommenen Änderungen erfordern und gewichtige Gründe für die Änderungen vorliegen. Der Umfang e<strong>in</strong>er<br />
Nachtragsprüfung hängt dabei vom Umfang der vorgenommenen Änderungen ab. Die von den Änderungen betroffen<br />
Jahresabschlussunterlagen s<strong>in</strong>d erneut zu prüfen. In diese Prüfung ist auch die Prüfung der Zulässigkeit<br />
der vorgenommenen Änderungen e<strong>in</strong>zubeziehen. Außerdem muss überprüft werden, ob weitere Anpassungen<br />
wegen des Gesamtbildes erforderlich s<strong>in</strong>d und der Jahresabschluss noch se<strong>in</strong>er Aufgabe gerecht wird, e<strong>in</strong> den<br />
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de<br />
zu vermitteln, gerecht wird.<br />
Das Ergebnis e<strong>in</strong>er solchen Nachtragsprüfung ist dann <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Nachprüfungsbericht darzustellen und die Art<br />
und der Umfang dieser Prüfung s<strong>in</strong>d zu erläutern. Soweit Dritte als Abschlussprüfer auch an der Nachtragsprüfung<br />
beteiligt werden, bedarf es ke<strong>in</strong>er erneuten Bestellung, weil sich deren Prüfungsauftrag grundsätzlich auf<br />
den Jahresabschluss <strong>in</strong>sgesamt vor dem Zeitpunkt se<strong>in</strong>er Feststellung bezieht, wenn nicht lediglich e<strong>in</strong> fachlicher<br />
Teilauftrag erteilt wurde. Der erstellte Bestätigungsvermerk bleibt jedoch grundsätzlich wirksam. Er ist jedoch ggf.<br />
entsprechend zu ergänzen bzw. anzupassen. Führt die Nachprüfung zu dem Ergebnis, dass der ursprüngliche<br />
Bestätigungsvermerk aufrechterhalten werden kann, soll dies durch e<strong>in</strong>e entsprechende Ergänzung deutlich<br />
werden. Auch E<strong>in</strong>schränkungen oder Versagungen des Bestätigungsvermerks auf Grund der nachträglichen<br />
Änderungen s<strong>in</strong>d entsprechend zu kennzeichnen.<br />
1.5 Der Abschluss der Prüfung<br />
Die für die Feststellung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses erforderliche örtliche Prüfung ist erst dann vom<br />
örtlichen Rechnungsprüfungsausschuss ordnungsgemäß durchgeführt worden, wenn dem Rat der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong><br />
Prüfungsbericht und e<strong>in</strong> Bestätigungsvermerk oder der Vermerk über die Versagung, der unter Angabe von Ort<br />
und Tag vom Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses zu unterzeichnen ist, vorgelegt worden ist.<br />
Dabei hat nach dieser Vorschrift der Rechnungsprüfungsausschuss se<strong>in</strong>en Bestätigungsvermerk <strong>in</strong> den Prüfungsbericht<br />
aufzunehmen. Er hat bei der Festlegung der Inhalte und Abgrenzungen des Bestätigungsvermerks<br />
oder des Vermerks über se<strong>in</strong>e Versagung die Vorschriften de§ 101 Absatz 4 bis 7 GO <strong>NRW</strong> zu beachten (vgl.<br />
Erläuterungen zu diesen Vorschriften). Die „Grundsätze für die ordnungsmäßige Erteilung von Bestätigungsvermerken“<br />
können dabei als Beurteilungsmaßstäbe herangezogen werden.<br />
2. Die Prüfungsgrundsätze für Abschlussprüfungen<br />
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung werden h<strong>in</strong>sichtlich der jährlichen Abschlussprüfung noch ergänzt.<br />
Für diese Abschlussprüfungen haben sich die „Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfungen (GoA)“<br />
entwickelt, die bei den Prüfungen des Jahresabschlusses entsprechende Anwendung f<strong>in</strong>den können. Diese be<strong>in</strong>halten<br />
Festlegungen zur Durchführung von Abschlussprüfungen sowie zu den Prüfungshandlungen. Außerdem<br />
bestehen noch weitere Ergänzungen durch die „Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen“<br />
sowie die „Grundsätze für die ordnungsmäßige Erteilung von Bestätigungsvermerken bei Abschlussprüfungen“.<br />
Die Ziele der Prüfung und der Prüfungsgegenstand bestimmen dabei die Prüfungs<strong>in</strong>halte, so dass sich wie bisher<br />
der Umfang und der Inhalt der Prüfung grundsätzlich auf die E<strong>in</strong>haltung der gesetzlichen Vorschriften über die<br />
geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft erstrecken müssen. ES muss <strong>in</strong> der Abschlussprüfung beurteilt werden, ob der<br />
Jahresabschluss den gesetzten Vorgaben entspricht und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger<br />
Buchführung e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und<br />
F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de vermittelt.<br />
GEMEINDEORDNUNG 637
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 101 GO <strong>NRW</strong><br />
Durch die Prüfung wird die Verlässlichkeit der im Jahresabschluss enthaltenen Informationen erhöht, denn die<br />
Prüfung stellt e<strong>in</strong>e Kontroll-, Informations- und Beglaubigungsfunktion dar. Nach diesen Prüfungsgrundsätzen ist<br />
die e<strong>in</strong>zelne Abschlussprüfung auch angemessen zu dokumentieren. Dies dient u.a. dazu, Informationen, die zum<br />
Prüfungsergebnis und zu e<strong>in</strong>zelnen Prüfungsfeststellungen geführt haben, zu stützen und nachvollziehbar zu<br />
machen. Die Unterlagen des Abschlussprüfers über die jeweilige Jahresabschlussprüfung s<strong>in</strong>d, soweit der Prüfer<br />
der örtlichen Rechnungsprüfung der Geme<strong>in</strong>de angehört, entsprechend den Vorschriften über die Aufbewahrung<br />
von geme<strong>in</strong>dlichen Unterlagen aufzubewahren (vgl. § 58 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
II. Erläuterungen im E<strong>in</strong>zelnen<br />
1. Zu Absatz 1 (Prüfungsrahmen):<br />
1.1 Zu Satz 1 (Prüfungszuständigkeit und Prüfungs<strong>in</strong>halte):<br />
1.1.1 Die Zuständigkeiten des Rechnungsprüfungsausschusses<br />
Nach der Vorschrift ist der Jahresabschluss vom Rechnungsprüfungsausschuss dah<strong>in</strong>gehend zu prüfen, ob er e<strong>in</strong><br />
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der<br />
Geme<strong>in</strong>de unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ergibt. Damit wird die dem örtlichen<br />
Rechnungsprüfungsausschusses obliegende Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses (vgl. § 59 Abs. 3<br />
GO <strong>NRW</strong>) nochmals ausdrücklich hervorgehoben. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat bei der Jahresabschlussprüfung<br />
zu beachten, dass der Rat der Geme<strong>in</strong>de bis zum 31. Dezember des dem Haushaltsjahr folgenden<br />
Jahres den Jahresabschluss festzustellen hat (vgl. § 96 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>). Er hat daher den Ablauf se<strong>in</strong>er<br />
Prüfung entsprechend zu gestalten.<br />
Die Verantwortlichkeit des Rechnungsprüfungsausschuss für die Prüfung des Jahresabschlusses wird auch dadurch<br />
deutlich, dass der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses den Bestätigungsvermerk, der entsprechend<br />
des durchgeführten Prüfungsumfanges und des Prüfungsergebnisses zu formulieren ist, mit Angabe<br />
des Ortes und des Datums eigenhändig zu unterzeichnen hat (vgl. § 101 Abs. 7 GO <strong>NRW</strong>). Um den Zielen und<br />
Zwecken der geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlussprüfung nachzukommen, muss dieser Abschlussprüfung nicht nur<br />
e<strong>in</strong>e vielfältige Informationsbeschaffung vorausgehen, sondern auch die Vorbereitung der Abschlussprüfung<br />
muss abgestimmt zwischen der Geme<strong>in</strong>deverwaltung, dem Rechnungsprüfungsausschuss und den Abschlussprüfern<br />
erfolgen, denen sich der Rechnungsprüfungsausschuss bedient (vgl. § 59 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong>).<br />
1.1.2 Inhalte der Jahresabschlussprüfung<br />
Die Vorschrift benennt auch ausdrücklich die Prüfungs<strong>in</strong>halte, denn der geme<strong>in</strong>dliche Jahresabschluss ist dah<strong>in</strong>gehend<br />
zu prüfen, ob er e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-,<br />
Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ergibt.<br />
Diese Beschreibung stellt zwar den Ausgangspunkt für e<strong>in</strong>e Gesetz- und Ordnungsmäßigkeitsprüfung dar, wenn<br />
lediglich die E<strong>in</strong>haltung der gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen im Blickfeld stehen. Es<br />
muss jedoch die Besonderheit im geme<strong>in</strong>dlichen Bereich berücksichtigt werden, dass die jährliche Haushaltssatzung<br />
nicht für sich alle<strong>in</strong>e steht, sondern durch den damit <strong>in</strong> unmittelbarer Verb<strong>in</strong>dung stehenden Haushaltsplan<br />
näher ausgestaltet wird. Daraus entsteht, dass auch die Ausführung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft und<br />
nicht nur deren Ergebnis, das <strong>in</strong> der Ergebnisrechnung und der F<strong>in</strong>anzrechnung sowie <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz<br />
wieder gegeben wird, <strong>in</strong> die Jahresabschlussprüfung e<strong>in</strong>zubeziehen ist.<br />
GEMEINDEORDNUNG 638
1.1.3 Die Durchführung der Jahresabschlussprüfung<br />
1.1.3.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 101 GO <strong>NRW</strong><br />
Die Aufgabe „Durchführung der Jahresabschlussprüfung“ erfordert von allen daran Beteiligten e<strong>in</strong>e sachliche und<br />
zeitliche Prüfungsplanung und die Festlegung von Informationsbeschaffungsprozessen. Die Prüfung setzt aber<br />
auch e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>schätzung des Prüfungsrisikos sowie e<strong>in</strong>e Prüfungsstrategie voraus, um die Richtigkeit der zu treffenden<br />
Prüfungsaussagen zu gewährleisten. Auch die Festlegung von Wesentlichkeitsgrenzen sowie und Plausibilitätsbeurteilungen<br />
gehören zu den notwendigen Vorbereitungen. Ebenso sollte <strong>in</strong> die Vorüberlegungen für die<br />
örtliche Prüfung e<strong>in</strong>bezogen werden, welche kompetenten Personen bei der Klärung von Zweifelsfragen h<strong>in</strong>zugezogen<br />
werden können, um Fehle<strong>in</strong>schätzungen entgegen zu wirken. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung ist<br />
daher auch den Grundsätzen der risikoorientierten Prüfung und der Wesentlichkeit <strong>in</strong> ausreichendem Maße<br />
Rechnung zu tragen. Dabei ist die örtliche Situation der Geme<strong>in</strong>de, deren Umfang und Form der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltswirtschaft, die Komplexität der geme<strong>in</strong>dlichen Geschäfte sowie deren Risikogehalt zu berücksichtigen.<br />
Zu den Prüfungsvorbereitungen gehört aber auch die Beauftragung Dritter nach § 103 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong>, wenn<br />
sich die örtliche Rechnungsprüfung zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen will. Sie hat dabei auch das<br />
Vorliegen von Ausschlussgründen zu prüfen (vgl. § 103 Abs. 7 GO <strong>NRW</strong>). Außerdem ist auch auf e<strong>in</strong>e ausreichende<br />
Dokumentation der Vorgänge bei der Ausführung der Prüfungstätigkeiten im Rahmen der Jahresabschlussprüfung<br />
zu achten. Es ist nicht ausreichend, nur das Ergebnis der durchgeführten Prüfung durch den<br />
Prüfungsbericht und den Bestätigungsvermerk nach § 101 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong> zu dokumentieren. Entstandene<br />
Dokumente <strong>in</strong> Papierform können dabei auch e<strong>in</strong>gescannt werden, damit sie <strong>in</strong> elektronischer Form verfügbar<br />
s<strong>in</strong>d, jedoch muss immer der vollständige Inhalt auf dem Datenträger ersichtlich se<strong>in</strong>.<br />
1.1.3.2 Der Zeitraum der Jahresabschlussprüfung<br />
Für die Durchführung der Jahresabschlussprüfung ist gesetzlich nicht ausdrücklich e<strong>in</strong> abgegrenzter Zeitraum<br />
bestimmt worden. Gleichwohl ergibt sich aus der E<strong>in</strong>ordnung der Prüfung des Jahresabschlusses <strong>in</strong> den Verfahrensablauf<br />
der Aufstellung und Feststellung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses, dass für die Durchführung<br />
der Prüfung nur e<strong>in</strong> begrenzter Zeitraum zur Verfügung steht. Zu berücksichtigen ist e<strong>in</strong>erseits, dass der Bürgermeister<br />
den Entwurf des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses <strong>in</strong>nerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres<br />
folgenden Jahres dem Rat zuzuleiten hat (vgl. § 95 Abs. 3 S. 2 GO <strong>NRW</strong>). Andererseits hat der Rat<br />
der Geme<strong>in</strong>de spätestens bis zum 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den vom Rechnungsprüfungsausschuss<br />
geprüften Jahresabschluss durch Beschluss festzustellen (vgl. § 96 Abs. 1 S. 1 GO<br />
<strong>NRW</strong>).<br />
In diesem Zeitraum muss die Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss erfolgen, wobei zu berücksichtigen ist,<br />
sich der dafür zuständige Rechnungsprüfungsausschuss (vgl. § 59 Abs. 3 i.V.m. § 101 GO <strong>NRW</strong>) der örtlichen<br />
Rechnungsprüfung zu bedienen hat oder, soweit e<strong>in</strong>e solche nicht besteht, sich Dritter gem. § 103 Abs. 5 bedienen<br />
kann (vgl. § 59 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong>). Zu berücksichtigen ist dabei, dass die geme<strong>in</strong>dlichen Organe die gesetzlich<br />
zugelassenen Fristen nicht vollausschöpfen müssen, so dass sich die für die tatsächliche Durchführung der<br />
Jahresabschlussprüfung verfügbare Zeit noch reduzieren kann. E<strong>in</strong>e schnelle und kurzfristige Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Jahresabschlusses ist auch vom Gesetzgeber gewollt, denn die Ergebnisse des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses<br />
sollen so schnell wie möglich <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplanung und Haushaltsausführung<br />
Berücksichtigung f<strong>in</strong>den. Auch die geme<strong>in</strong>dliche Aufsichtsbehörde ist daher an e<strong>in</strong>er zeitnahen Anzeige des festgestellten<br />
Jahresabschlusses nach Ablauf des betreffenden Haushaltsjahres sehr <strong>in</strong>teressiert.<br />
GEMEINDEORDNUNG 639
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 101 GO <strong>NRW</strong><br />
1.2 Zu Satz 2 (Recht- und Ordnungsmäßigkeitsprüfung):<br />
1.2.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Nach der Vorschrift erstreckt sich die Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses darauf, ob die gesetzlichen<br />
Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden<br />
s<strong>in</strong>d. Die Prüfung der von der Geme<strong>in</strong>de zu beachtenden rechtlichen Vorschriften stellt daher auch e<strong>in</strong>e Recht-<br />
und Ordnungsmäßigkeitsprüfung der gesamten Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de des abgelaufenen Haushaltsjahres<br />
im Rahmen der geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlussprüfung dar. Dabei umfasst die Rechtmäßigkeitsprüfung<br />
regelmäßig die Beurteilung des geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltungshandelns dah<strong>in</strong>gehend, ob die rechtlichen Vorgaben<br />
bei der Ausführung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft e<strong>in</strong>gehalten worden s<strong>in</strong>d. E<strong>in</strong>e Ordnungsmäßigkeitsprüfung<br />
soll feststellen, ob das haushaltswirtschaftliche Handeln der Geme<strong>in</strong>de vollständig und richtig nachgewiesen<br />
wird.<br />
Diese Gegebenheiten ändern sich auch nicht durch das Prüfungsziel, ob der Jahresabschluss der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong><br />
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der<br />
Geme<strong>in</strong>de unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ergibt. Es muss für den geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Bereich die Besonderheit berücksichtigt werden, dass die jährliche Haushaltssatzung nicht für sich alle<strong>in</strong>e<br />
steht, sondern durch den damit <strong>in</strong> unmittelbarer Verb<strong>in</strong>dung stehenden Haushaltsplan näher ausgestaltet wird,<br />
der verb<strong>in</strong>dlich für die geme<strong>in</strong>dliche Verwaltung ist (vgl. § 79 Abs. 3 S. 2 GO <strong>NRW</strong>). Außerdem steht die von den<br />
Ratsmitgliedern zu beschließende Entlastung des Bürgermeisters damit <strong>in</strong> Zusammenhang (vgl. § 96 Abs. 1 S. 4<br />
GO <strong>NRW</strong>).<br />
Im Rahmen der Gesetz- und Ordnungsmäßigkeitsprüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses kann sich zudem<br />
ergeben, dass die Geme<strong>in</strong>de auch zur Aufstellung e<strong>in</strong>es Gesamtabschlusses verpflichtet ist, dieser Verpflichtung<br />
aber noch nicht nachgekommen ist. In diesen Fällen s<strong>in</strong>d dem Bürgermeister der Geme<strong>in</strong>de entsprechende<br />
H<strong>in</strong>weise zu geben. Dieser Verstoß gegen gesetzliche Pflichten ist jedoch nicht Gegenstand der orig<strong>in</strong>ären<br />
Jahresabschlussprüfung und berührt diese daher nicht. Der Verstoß kann daher auch nicht zu e<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>schränkung<br />
des Bestätigungsvermerks aus der Jahresabschlussprüfung führen.<br />
1.2.2 Die gesetzlichen Haushaltsvorschriften<br />
1.2.2.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses durch den Rechnungsprüfungsausschuss erstreckt sich nach<br />
der Vorschrift auch darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften beachtet worden s<strong>in</strong>d. Diese Regelung soll nach<br />
ihrem S<strong>in</strong>n und Zweck bewirken, dass bei der Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses die gesamten Vorschriften<br />
über die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft berücksichtigt werden. Daraus folgt, dass die <strong>in</strong> den haushaltsrechtlichen<br />
Vorschriften enthalten Bestimmungen über die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsplanung, die Haushaltsausführung<br />
und die Haushaltsrechnung, soweit sie bei der Geme<strong>in</strong>de zur Anwendung kamen, <strong>in</strong> die haushaltsjahrbezogene<br />
Abschlussprüfung e<strong>in</strong>zubeziehen s<strong>in</strong>d.<br />
1.2.2.2 Die Vorschriften für die Haushaltsplanung<br />
Bei der Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses durch den Rechnungsprüfungsausschuss müssen die <strong>in</strong><br />
den haushaltsrechtlichen Vorschriften enthalten Bestimmungen über die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsplanung, soweit<br />
sie bei der Geme<strong>in</strong>de zur Anwendung kamen, <strong>in</strong> die Jahresabschlussprüfung e<strong>in</strong>bezogen werden (vgl. nachfolgende<br />
Abbildung).<br />
GEMEINDEORDNUNG 640
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 101 GO <strong>NRW</strong><br />
Haushaltsrechtliche Vorschriften für die Haushaltsplanung<br />
Haushaltsplanung<br />
<strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>deordnung<br />
8. Teil<br />
Haushaltswirtschaft<br />
§ 75 Allgeme<strong>in</strong>e Haushaltsgrundsätze<br />
§ 76 Haushaltssicherungskonzept<br />
§ 77 Grundsätze der F<strong>in</strong>anzmittelbeschaffung<br />
§ 78 Haushaltssatzung<br />
§ 79 Haushaltsplan<br />
§ 80 Erlass der Haushaltssatzung<br />
§ 81 Nachtragssatzung<br />
§ 82 Vorläufige Haushaltsführung<br />
§ 83 Überplanmäßige und außerplanmäßige<br />
Aufwendungen und Auszahlungen<br />
§ 84 Mittelfristige Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung<br />
§ 85 Verpflichtungsermächtigungen<br />
§ 86 Kredite<br />
9. Teil<br />
Sondervermögen,<br />
Treuhandvermögen<br />
§ 97 Sondervermögen<br />
§ 98 Treuhandvermögen<br />
§ 99 Geme<strong>in</strong>degliedervermögen<br />
§ 100 Örtliche Stiftungen<br />
Haushaltsplanung<br />
<strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>dehaushaltsverordnung<br />
Erster Abschnitt<br />
Haushaltsplan<br />
§ 1 Haushaltsplan<br />
§ 2 Ergebnisplan<br />
§ 3 F<strong>in</strong>anzplan<br />
§ 4 Teilpläne<br />
§ 5 Haushaltssicherungskonzept<br />
§ 6 Mittelfristige Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung<br />
§ 7 Vorbericht<br />
§ 8 Stellenplan<br />
§ 9 Haushaltsplan für zwei Jahre<br />
§ 10 Nachtragshaushaltsplan<br />
Zweiter Abschnitt<br />
Planungsgrundsätze und Ziele<br />
§ 11 Allgeme<strong>in</strong>e Planungsgrundsätze<br />
§ 12 Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung<br />
§ 13 Verpflichtungsermächtigungen<br />
§ 14 Investitionen<br />
§ 15 Verfügungsmittel<br />
§ 16 Fremde F<strong>in</strong>anzmittel<br />
§ 17 Interne Leistungsbeziehungen<br />
§ 18 Kosten- und Leistungsrechnung<br />
§ 19 Weitere Vorschriften für die Haushaltsplanung<br />
§ 35 Abschreibungen<br />
§ 36 Rückstellungen<br />
Fünfter Abschnitt<br />
Vermögen und Schulden<br />
Abbildung 133 „Haushaltsrechtliche Vorschriften für die Haushaltsplanung“<br />
1.2.2.3 Die Vorschriften für die Haushaltsausführung<br />
Bei der Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses durch den Rechnungsprüfungsausschuss müssen die <strong>in</strong><br />
den haushaltsrechtlichen Vorschriften enthalten Bestimmungen über die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsausführung,<br />
soweit sie bei der Geme<strong>in</strong>de zur Anwendung kamen, <strong>in</strong> die Jahresabschlussprüfung e<strong>in</strong>bezogen werden. Die<br />
Ausführung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft bildet e<strong>in</strong>e Grundlage für die Erfüllung der Aufgaben der Geme<strong>in</strong>de.<br />
Die Geme<strong>in</strong>de hat auch bei der Ausführung ihrer geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr darauf<br />
Rücksicht zu nehmen, dass die Kosten der Leistungen und der E<strong>in</strong>richtungen letztlich von den Bürgern durch<br />
Steuern und Abgaben aufgebracht werden. Dies verpflichtet sie ganz besonders zu e<strong>in</strong>er wirtschaftlichen, effizienten<br />
und sparsamen Haushaltsführung (vgl. § 75 Abs. 1 S. 2 GO <strong>NRW</strong>). Das geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsrecht<br />
sieht dafür e<strong>in</strong>e Reihe von Grundsätzen und Geboten sowohl <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>deordnung als auch <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>dehaushaltsverordnung<br />
vor, die nachfolgend beispielhaft aufgezeigt werden (vgl. Abbildung).<br />
GEMEINDEORDNUNG 641
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 101 GO <strong>NRW</strong><br />
Haushaltsrechtliche Vorschriften für die Haushaltsausführung<br />
Haushaltsausführung<br />
<strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>deordnung<br />
8. Teil<br />
Haushaltswirtschaft<br />
§ 86 Kredite<br />
§ 87 Sicherheiten und Gewährleistung für<br />
Dritte<br />
§ 89 Liquidität<br />
§ 90 Vermögensgegenstände<br />
§ 93 F<strong>in</strong>anzbuchhaltung<br />
§ 94 Übertragung der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung<br />
10. Teil<br />
Rechnungsprüfung<br />
§ 102 Örtliche Rechnungsprüfung<br />
§ 103 Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung<br />
9. Teil<br />
Sondervermögen,<br />
Treuhandvermögen<br />
§ 97 Sondervermögen<br />
§ 98 Treuhandvermögen<br />
§ 99 Geme<strong>in</strong>degliedervermögen<br />
§ 100 Örtliche Stiftungen<br />
Haushaltsausführung<br />
<strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>dehaushaltsverordnung<br />
Dritter Abschnitt<br />
Besondere Vorschriften<br />
für die Haushaltswirtschaft<br />
§ 20 Grundsatz der Gesamtdeckung<br />
§ 21 Bildung von Budgets<br />
§ 22 Ermächtigungsübertragung<br />
§ 23 Bewirtschaftung und Überwachung<br />
§ 24 Haushaltswirtschaftliche Sperre,<br />
Unterrichtungspflicht<br />
§ 25 Vergabe von Aufträgen<br />
§ 26 Stundung, Niederschlagung und Erlass<br />
Vierter Abschnitt<br />
Buchführung, Inventar,<br />
Zahlungsabwicklung<br />
27 Buchführung<br />
§ 28 Inventur, Inventar<br />
§ 29 Inventurvere<strong>in</strong>fachungsverfahren<br />
§ 30 Zahlungsabwicklung, Liquiditätsplanung<br />
§ 31 Sicherheitsstandards und <strong>in</strong>terne Aufsicht<br />
Abbildung 134 „Haushaltsrechtliche Vorschriften für die Haushaltsausführung“<br />
1.2.2.4 Die Vorschriften für die Haushaltsrechnung<br />
Bei der Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses durch den Rechnungsprüfungsausschuss müssen die <strong>in</strong><br />
den haushaltsrechtlichen Vorschriften enthalten Bestimmungen über die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsrechnung, soweit<br />
sie bei der Geme<strong>in</strong>de zur Anwendung kamen, <strong>in</strong> die Jahresabschlussprüfung e<strong>in</strong>bezogen werden. Aus den Vorgaben<br />
des Rates der Geme<strong>in</strong>de für die Ausführung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft ergibt sich zudem die<br />
Notwendigkeit, dass der Bürgermeister nach dem Ende se<strong>in</strong>es auf e<strong>in</strong> Jahr begrenzten Auftrages, die Haushaltswirtschaft<br />
der Geme<strong>in</strong>de nach der geltenden Haushaltssatzung zu führen, darüber Rechenschaft gegenüber dem<br />
Rat ablegen muss. Dafür bestehen im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsrecht e<strong>in</strong>e Reihe von Grundsätzen und Geboten<br />
(vgl. Abbildung).<br />
Haushaltsrechtliche Vorschriften für die Haushaltsrechnung<br />
Haushaltsrechnung<br />
<strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>deordnung<br />
GEMEINDEORDNUNG 642<br />
Haushaltsrechnung<br />
<strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>dehaushaltsverordnung
8. Teil<br />
Haushaltswirtschaft<br />
§ 88 Rückstellungen<br />
§ 89 Liquidität<br />
§ 90 Vermögensgegenstände<br />
§ 91 Inventur, Inventar und<br />
Vermögensbewertung<br />
§ 95 Jahresabschluss<br />
§ 96 Feststellung des Jahresabschlusses<br />
und Entlastung<br />
9. Teil<br />
Sondervermögen,<br />
Treuhandvermögen<br />
§ 97 Sondervermögen<br />
§ 98 Treuhandvermögen<br />
§ 99 Geme<strong>in</strong>degliedervermögen<br />
§ 100 Örtliche Stiftungen<br />
10. Teil<br />
Rechnungsprüfung<br />
§ 101 Prüfung des Jahresabschlusses,<br />
Bestätigungsvermerk<br />
§ 102 Örtliche Rechnungsprüfung<br />
§ 103 Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung<br />
§ 105 Überörtliche Prüfung<br />
12. Teil<br />
Gesamtabschluss<br />
§ 116 Gesamtabschluss<br />
§ 117 Beteiligungsbericht<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 101 GO <strong>NRW</strong><br />
Fünfter Abschnitt<br />
Vermögen und Schulden<br />
§ 32 Allgeme<strong>in</strong>e Bewertungsanforderungen<br />
§ 33 Wertansätze für Vermögensgegenstände<br />
§ 34 Bewertungsvere<strong>in</strong>fachungsverfahren<br />
§ 35 Abschreibungen<br />
§ 36 Rückstellungen<br />
Sechster Abschnitt<br />
Jahresabschluss<br />
§ 37 Jahresabschluss<br />
§ 38 Ergebnisrechnung<br />
§ 39 F<strong>in</strong>anzrechnung<br />
§ 40 Teilrechnungen<br />
§ 41 Bilanz<br />
§ 42 Rechnungsabgrenzungsposten<br />
§ 43 Weitere Vorschriften zu e<strong>in</strong>zelnen Bilanzposten<br />
§ 44 Anhang<br />
§ 45 Anlagenspiegel<br />
§ 46 Forderungsspiegel<br />
§ 47 Verb<strong>in</strong>dlichkeitenspiegel<br />
§ 48 Lagebericht<br />
Siebter Abschnitt<br />
Gesamtabschluss<br />
§ 49 Gesamtabschluss<br />
§ 50 Konsolidierung<br />
§ 51 Gesamtlagebericht, Gesamtanhang<br />
§ 52 Beteiligungsbericht<br />
Neunter Abschnitt<br />
Schlussvorschriften<br />
§ 58 Aufbewahrung von Unterlagen,<br />
Aufbewahrungsfristen<br />
Abbildung 135 „Haushaltsrechtliche Vorschriften für die Haushaltsrechnung“<br />
Nach dem Ende des geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsjahres ist daher vom Kämmerer e<strong>in</strong> Jahresabschluss aufzustellen,<br />
vom Bürgermeister zu bestätigen. Der Bürgermeister hat dann den von ihm bestätigten Entwurf <strong>in</strong>nerhalb von drei<br />
Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zur Feststellung zuzuleiten. (vgl. § 95 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong>).<br />
1.2.3 Örtliche Satzungen<br />
1.2.3.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Nach der Vorschrift erstreckt sich die Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses durch den Rechnungsprüfungsausschuss<br />
auch darauf, ob die die gesetzlichen Vorschriften ergänzenden Satzungen beachtet worden s<strong>in</strong>d.<br />
Die Geme<strong>in</strong>den können nach § 7 GO <strong>NRW</strong> ihre Angelegenheiten durch Satzung regeln. Neben dieser Ermächtigung<br />
bestehen aber <strong>in</strong> Fachgesetzen weitere Ermächtigungen zum Erlass von geme<strong>in</strong>dlichen Satzungen, z.B. <strong>in</strong><br />
§ 2 KAG <strong>NRW</strong> oder für Erschließungsbeitragssatzung <strong>in</strong> § 132 BauGB. Zu solchen geme<strong>in</strong>dlichen Satzungen<br />
GEMEINDEORDNUNG 643
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 101 GO <strong>NRW</strong><br />
gehören vor allem die Hauptsatzung nach § 7 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong> und die jährliche Haushaltssatzung nach § 78 GO<br />
<strong>NRW</strong>.<br />
1.2.3.2 Die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung<br />
Die jährliche Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de erfordert e<strong>in</strong>e b<strong>in</strong>dende Grundlage für ihre Ausführung durch die<br />
geme<strong>in</strong>dliche Verwaltung. Diese Grundlage schafft der Rat der Geme<strong>in</strong>de im Rahmen se<strong>in</strong>es Budgetrechtes<br />
durch den jährlichen Erlass e<strong>in</strong>er Haushaltssatzung nach § 78 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> (vgl. § 41 Abs. 1 Buchstabe h)<br />
GO <strong>NRW</strong>). E<strong>in</strong> auf der beschlossenen Haushaltsatzung aufbauender geme<strong>in</strong>dlicher Haushalt ist Ausdruck der<br />
F<strong>in</strong>anzhoheit der Geme<strong>in</strong>de und der geme<strong>in</strong>dlichen Selbstverwaltung. Es muss dabei von der Geme<strong>in</strong>de gewährleistet<br />
werden, dass durch die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen m<strong>in</strong>destens alle gesetzlich bestimmten Festsetzungen<br />
getroffen werden und diese alle Ermächtigungen für die geme<strong>in</strong>dliche Verwaltung enthält, die zur<br />
Ausführung und E<strong>in</strong>haltung des Haushaltsplans der Geme<strong>in</strong>de im betreffenden Haushaltsjahr notwendig s<strong>in</strong>d.<br />
Aus diesen Vorgaben entsteht, dass <strong>in</strong> die Prüfung der E<strong>in</strong>haltung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung auch die<br />
E<strong>in</strong>haltung des Haushaltsplans und damit die Ausführung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft zu prüfen ist. Es<br />
muss als nicht ausreichend angesehen werden, wenn lediglich nur die Ergebnisse der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft,<br />
die <strong>in</strong> der Ergebnisrechnung und der F<strong>in</strong>anzrechnung sowie <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz wieder gegeben<br />
werden, <strong>in</strong> die Jahresabschlussprüfung e<strong>in</strong>bezogen werden. So gehört z.B. zur Prüfung, ob die haushaltswirtschaftlichen<br />
Vorschriften e<strong>in</strong>gehalten worden s<strong>in</strong>d, die Prüfung der E<strong>in</strong>haltung der <strong>in</strong> der Haushaltssatzung<br />
enthaltenen Kreditermächtigung und anderer örtlich bezogener Bewirtschaftungsvorgaben.<br />
Zu den Prüfungsaufgaben gehört auch die Prüfung, ob außerhalb der vom Rat beschlossenen Haushaltssatzung<br />
örtliche haushaltswirtschaftliche Maßnahmen veranlasst wurden und sich im zulässigen Rahmen der haushaltsrechtlichen<br />
Vorgaben halten, z.B. über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen. Dadurch wird<br />
deutlich, dass sich die Prüfung der E<strong>in</strong>haltung der rechtlichen Bestimmungen im Rahmen der Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Jahresabschlusses nicht alle<strong>in</strong> auf die Vorschriften über die Rechnungslegung beziehen darf.<br />
1.2.4 Sonstige ortsrechtliche Bestimmungen<br />
1.2.4.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses durch den Rechnungsprüfungsausschuss erstreckt sich nach<br />
der Vorschrift auch darauf, ob die sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden s<strong>in</strong>d. Derartige örtliche<br />
Regelungen werden durch Verordnungen, Tarife, Richtl<strong>in</strong>ien u.a. <strong>in</strong> eigener Verantwortung der Geme<strong>in</strong>de<br />
festgelegt. Solche ortsrechtlichen Bestimmungen s<strong>in</strong>d nach § 1 Abs. 2 BekanntmVO <strong>NRW</strong> wie geme<strong>in</strong>dliche<br />
Satzungen bekannt zu machen.<br />
1.2.4.2 Besondere Ratsbeschlüsse<br />
Zu den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen s<strong>in</strong>d auch besondere Ratsbeschlüsse zu zählen, die auf Grund<br />
ihrer Inhalte eigene haushaltswirtschaftliche Auswirkungen für das gleiche Haushaltsjahr oder auch für künftige<br />
Haushaltsjahre haben, z.B. über geme<strong>in</strong>dliche Investitionen oder über überplanmäßige und außerplanmäßige<br />
Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>.<br />
GEMEINDEORDNUNG 644
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 101 GO <strong>NRW</strong><br />
1.3 Zu Satz 3 (Prüfung der Buchführung und der Inventur):<br />
1.3.1 Die Prüfung der geme<strong>in</strong>dlichen Buchführung<br />
Nach der Vorschrift ist <strong>in</strong> die Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses die Buchführung der Geme<strong>in</strong>de<br />
e<strong>in</strong>zubeziehen. Die Jahresabschlussprüfung hat daher bei der Prüfung der Bestandteile und Anlagen des Jahresabschlusses<br />
auch die der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft zu Grunde liegende Buchführung zu berücksichtigen.<br />
Die Buchführung der Geme<strong>in</strong>de hat nach § 27 GemHVO <strong>NRW</strong> dazu beizutragen, dass der Jahresabschluss<br />
e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage<br />
der Geme<strong>in</strong>de unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelt.<br />
Die geme<strong>in</strong>dliche Buchführung muss daher den an sie gestellten Anforderungen entsprechen, damit der Jahresabschluss<br />
<strong>in</strong> der vorgeschriebenen Form aufgestellt werden kann, die vorgesehenen Angaben enthält und dafür<br />
die Vermögensgegenstände und Schulden richtig bewertet worden s<strong>in</strong>d. Die F<strong>in</strong>anzbuchhaltung der Geme<strong>in</strong>de<br />
hat deshalb das Datenmaterial zu liefern, das die Grundlage für den Jahresabschluss mit Ergebnisrechnung,<br />
F<strong>in</strong>anzrechnung und der Bilanz bilden soll. Das geme<strong>in</strong>dliche Buchführungsverfahren ist somit auf den Nachweis<br />
und die Ermittlung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Geme<strong>in</strong>de auszurichten.<br />
Im Rahmen des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses kann daher i.d.R. e<strong>in</strong>e Aufbau- und Funktionsprüfung der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Buchführung stattf<strong>in</strong>den, <strong>in</strong> der die notwendigen Prüfungsaussagen gewonnen werden. In die<br />
örtliche Prüfung sollen deshalb die rechnungslegungsrelevanten Elemente der geme<strong>in</strong>dlichen Buchführung e<strong>in</strong>bezogen<br />
werden, die Daten über die Geschäftsvorfälle der Geme<strong>in</strong>de verarbeiten, e<strong>in</strong>schließlich der Erfordernisse<br />
der Datensicherheit. Es ist jedoch nicht erforderlich, jeden geme<strong>in</strong>dlichen Geschäftsvorfall, der im abgelaufenen<br />
Haushaltsjahr entstanden ist nachzuprüfen.<br />
E<strong>in</strong>e solche Prüfung obliegt zudem der örtlichen Rechnungsprüfung, denn sie hat die gesetzliche Aufgabe, die<br />
Vorgänge <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzbuchhaltung laufend zu prüfen sowie die geme<strong>in</strong>dliche Zahlungsabwicklung<br />
dauernd zu überwachen (vgl. § 103 Abs. 1 Nrn. und 5 GO <strong>NRW</strong>). Diese gesetzlichen Aufgaben s<strong>in</strong>d untrennbar<br />
mite<strong>in</strong>ander verbunden, denn die Aufgabe „Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung“ hat nur<br />
aus Sicherheitsgesichtspunkten heraus e<strong>in</strong>e eigenständige Bedeutung. Dieses gesamte Prüfungsgeschehen<br />
dient der Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses der Geme<strong>in</strong>de, so dass auch diese Prüfungen unter<br />
den Aspekten des § 101 GO <strong>NRW</strong> durchzuführen s<strong>in</strong>d.<br />
Bei e<strong>in</strong>er Buchführung mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung (DV-Buchführung) muss geprüft werden, ob<br />
auch bei der DV-gestützten Buchführung die Grundsätze e<strong>in</strong>gehalten werden, die <strong>in</strong> § 27 Absatz 1 bis 3 näher<br />
bestimmt s<strong>in</strong>d. Die Geme<strong>in</strong>de muss solche organisatorischen und technischen Maßnahmen umsetzen, die geeignet<br />
s<strong>in</strong>d, die Sicherheit der für die Rechnungslegung relevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten. Die<br />
GoBS f<strong>in</strong>den bei der geme<strong>in</strong>dlichen Buchführung mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung Anwendung, unabhängig<br />
davon, ob diese zentral oder dezentral, vollständig oder nur <strong>in</strong> Teilschritten erfolgt.<br />
Die GoBS gelten zudem - wie im kaufmännischen Rechnungswesen - auch für die Prozesse außerhalb des eigentlichen<br />
Buchführungsbereichs, <strong>in</strong>nerhalb derer buchführungsrelevante Daten erfasst, erzeugt, übermittelt oder<br />
verarbeitet werden. Dazu werden mehrere Voraussetzungen bestimmt, von der Pflicht, fachlich geprüfte Programme<br />
und freigegebene Verfahren e<strong>in</strong>zusetzen, bis h<strong>in</strong> zur verantwortlichen Abgrenzung der Verwaltung von<br />
Informationssystemen und automatisierten Verfahren von der fachlichen Sachbearbeitung und der Erledigung von<br />
Aufgaben der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung, durch die e<strong>in</strong>e notwendige Ordnungsmäßigkeit dieser Buchführung sichergestellt<br />
werden soll.<br />
GEMEINDEORDNUNG 645
1.3.2 Die Prüfung der geme<strong>in</strong>dlichen Inventur<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 101 GO <strong>NRW</strong><br />
In der Vorschrift wird deshalb ausdrücklich bestimmt, dass zur Jahresabschlussprüfung auch die Prüfung der<br />
Inventur gehört. Die Inventur der Geme<strong>in</strong>de stellt dabei als Bestandsaufnahme e<strong>in</strong>e lückenlose, mengen- und<br />
wertmäßige Erfassung des Vermögens und der Schulden e<strong>in</strong>er Geme<strong>in</strong>de zu e<strong>in</strong>em bestimmten Stichtag durch<br />
e<strong>in</strong>e Inaugensche<strong>in</strong>nahme <strong>in</strong> Form von Messen, Wiegen usw. dar. E<strong>in</strong>e solche Stichtags<strong>in</strong>ventur ist <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
angemessenen und abgegrenzten Zeitraum um den Abschlussstichtag durchzuführen. Die Vorschrift des § 28<br />
GemHVO <strong>NRW</strong> ist daher darauf abgestellt, dass die Geme<strong>in</strong>de durch die Inventur e<strong>in</strong>en Überblick über ihr gesamtes<br />
Vermögen erhält, <strong>in</strong> dem zum Schluss e<strong>in</strong>es jeden Haushaltsjahres die im wirtschaftlichen Eigentum<br />
stehenden Vermögensgegenstände, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten unter Beachtung der<br />
Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur vollständig aufgenommen werden.<br />
Ergänzend zu den Bestimmungen über die Durchführung der Inventur <strong>in</strong> § 28 GemHVO <strong>NRW</strong> s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> Anlehnung<br />
an das Handelsrecht und um die Wirtschaftlichkeit der Inventur zu erhöhen, Inventurvere<strong>in</strong>fachungen für die Geme<strong>in</strong>den<br />
zugelassen worden. Jede der zugelassenen Vere<strong>in</strong>fachungen ist jedoch an bestimmte Voraussetzungen<br />
gebunden. Dieses soll dazu beitragen, dass die Inventurzwecke auch dann erfüllt werden, wenn e<strong>in</strong>e Vere<strong>in</strong>fachungsmöglichkeit<br />
angewendet wird. In den Fällen, <strong>in</strong> denen von e<strong>in</strong>er Vere<strong>in</strong>fachungsmöglichkeit Gebrauch<br />
gemacht werden soll, ist von der Geme<strong>in</strong>de zuvor zu prüfen, ob die vorgesehene Maßnahme zu mehr Wirtschaftlichkeit<br />
beiträgt als die normale Inventur und der Grundsatz der Vollständigkeit sowie der Grundsatz der Richtigkeit<br />
nicht unvertretbar bee<strong>in</strong>trächtigt werden. Die Prüfungshandlungen des Abschlussprüfers s<strong>in</strong>d daher an der<br />
örtlich tatsächlich gestalteten Inventur auszurichten.<br />
1.3.3 Die Prüfung des aufgestellten Inventars<br />
Die Vorgabe In § 28 Abs. 1 S. 2 GemHVO <strong>NRW</strong>, den Wert der e<strong>in</strong>zelnen <strong>in</strong> der Inventur zum Schluss e<strong>in</strong>es jeden<br />
Haushaltsjahres erfassten Vermögensgegenstände und Schulden <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Bestandsverzeichnis (Inventar) anzugeben,<br />
dient der zutreffenden Darstellung der Vermögens- und Schuldenlage der Geme<strong>in</strong>de im geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Jahresabschluss und ist Gegenstand der Abschlussprüfung. Das Inventar ist das geme<strong>in</strong>dliche Verzeichnis, das<br />
Auskunft über das Ergebnis der geme<strong>in</strong>dlichen Inventur nach Art, Menge und Wert gibt. Es ist als Bestandsverzeichnis<br />
daher zeitnah zum Abschlussstichtag 31. Dezember aufzustellen. Es bildet die Grundlage für die aufzustellende<br />
Bilanz und den Anhang im geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss. Die o.a. Vorschrift enthält aber ke<strong>in</strong>e Formvorschriften<br />
über das Inventar, jedoch s<strong>in</strong>d die Vermögensgegenstände und die Schulden immer getrennt vone<strong>in</strong>ander<br />
aufzuführen. Die Beachtung der GoB bei der Aufstellung verlangen Klarheit, Übersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit<br />
<strong>in</strong> der Darstellung, so dass die Gliederung des Inventars diesen Anforderungen entsprechen muss.<br />
1.3.4 Die Prüfung der örtlichen Abschreibungstabelle<br />
Nach der Vorschrift ist <strong>in</strong> die Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses auch die Übersicht über die örtlich<br />
festgelegten Nutzungsdauern der geme<strong>in</strong>dlichen Vermögensgegenstände Örtliche Abschreibungstabelle) e<strong>in</strong>zubeziehen.<br />
Die Geme<strong>in</strong>de hat nach § 27 Abs. 3 GemHVO <strong>NRW</strong> für ihre Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer<br />
ihrer abnutzbaren Vermögensgegenständen den vom Innenm<strong>in</strong>isterium bekannt gegebenen „NKF-<br />
Rahmen für kommunale Abschreibungen“ zu Grunde zu legen und sich bei der Erstellung ihrer örtlichen Übersicht<br />
(Abschreibungstabelle) i.d.R. <strong>in</strong>nerhalb des vorgegebenen Rahmens zu bewegen. Die örtlichen Festlegungen<br />
über die Nutzungsdauern der geme<strong>in</strong>dlichen Vermögensgegenstände sollen dadurch transparent und für die<br />
Anwendung verb<strong>in</strong>dlich gemacht werden. Die Prüfung der örtlichen Abschreibungstabelle wird sich daher i.d.R.<br />
auf die E<strong>in</strong>haltung dieser allgeme<strong>in</strong>en Vorgaben beschränken können.<br />
GEMEINDEORDNUNG 646
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 101 GO <strong>NRW</strong><br />
1.4 Zu Satz 4 (Prüfung des Lageberichtes der Geme<strong>in</strong>de):<br />
Der Lagebericht ist daraufh<strong>in</strong> zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang steht und ob se<strong>in</strong>e sonstigen<br />
Angaben nicht e<strong>in</strong>e falsche Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de<br />
erwecken. Die Angaben im Lagebericht dürfen nicht ke<strong>in</strong>e falsche Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-,<br />
Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de erwecken. Außerdem muss im Lagebericht auch zu den künftigen Chancen<br />
und Risiken der Geme<strong>in</strong>de Auskunft gegeben werden, die der Prüfer e<strong>in</strong>zuschätzen hat. Dabei kann er die<br />
„Grundsätze ordnungsmäßiger Lageberichterstattung“ als Beurteilungsmaßstäbe heranziehen.<br />
Der jährliche Lagebericht der Geme<strong>in</strong>de hat daher e<strong>in</strong>e umfassende und vielfältige Ergänzungsfunktion zum<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss. Se<strong>in</strong>e Aussagen müssen daher klar, sorgfältig abgewogen und zeitnah se<strong>in</strong>. Bei<br />
se<strong>in</strong>er Aufstellung s<strong>in</strong>d die Grundsätze ordnungsmäßiger Lageberichterstattung (GoL) zu beachten. Für die äußere<br />
Gestaltung des Lageberichts, se<strong>in</strong>en Aufbau und Umfang s<strong>in</strong>d jedoch ke<strong>in</strong>e besonderen Formvorgaben vorgegeben<br />
worden. Die Fülle der Informationen verlangt aber e<strong>in</strong>e grundlegende Strukturierung. Auch die Gliederung<br />
des Lageberichts muss mit ihren e<strong>in</strong>zelnen Elementen dazu beitragen, dass der Lagebericht der Geme<strong>in</strong>de im<br />
Zusammenhang mit dem geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes<br />
Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de vermittelt.<br />
Die Prüfungshandlungen s<strong>in</strong>d nach den gleichen Grundsätzen vorzunehmen, wie sie bei der Prüfung der Bestandteile<br />
des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses zur Anwendung kommen. Dar<strong>in</strong> e<strong>in</strong>zubeziehen s<strong>in</strong>d grundsätzlich<br />
alle im Lagebericht der Geme<strong>in</strong>de gemachten Angaben. Enthält der geme<strong>in</strong>dliche Lagebericht gleichwohl<br />
Informationen, die nicht der Abschlussprüfung unterliegen, sollten solche Angaben <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em gesonderten Abschnitt<br />
des Lageberichtes dargestellt werden. Vermitteln solche Informationen aber ggf. im E<strong>in</strong>zelfall e<strong>in</strong>en falschen<br />
E<strong>in</strong>druck von der wirtschaftlichen Lage der Geme<strong>in</strong>de, sollte der Abschlussprüfer e<strong>in</strong>e Richtigstellung dieser<br />
Inhalte des Lageberichtes veranlassen.<br />
1.5 Zu Satz 5 (Prüfungsbericht):<br />
1.5.1 Die Prüfungsaussagen<br />
Nach der Vorschrift hat der Rechnungsprüfungsausschuss über Art und Umfang der Prüfung des Jahresabschlusses<br />
sowie über das Ergebnis der Prüfung e<strong>in</strong>en Prüfungsbericht zu erstellen. Er hat daher Art und Umfang<br />
der erforderlichen Prüfungshandlungen unter Berücksichtigung der Gegebenheiten bei der Geme<strong>in</strong>de eigenverantwortlich<br />
<strong>in</strong> Kenntnis der Aufgabenerfüllung der Geme<strong>in</strong>de und der Buchführung der Geme<strong>in</strong>de nach pflichtgemäßem<br />
Ermessen sorgfältig zu bestimmen, so dass Prüfungsaussagen mit h<strong>in</strong>reichender Sicherheit getroffen<br />
werden können und e<strong>in</strong> Prüfungsbericht erstellt werden kann. Beispiele dazu s<strong>in</strong>d nachfolgend aufgezeigt (vgl.<br />
Abbildung).<br />
Beispiele für Prüfungsaussagen zum Jahresabschluss<br />
- Darstellung, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen,<br />
<strong>in</strong>sbesondere die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung, und sonstigen ortsrechtlichen<br />
Bestimmungen beachtet worden s<strong>in</strong>d,<br />
- Darstellung, ob die Bilanz, die Ergebnisrechnung und die F<strong>in</strong>anzrechnung ausreichend<br />
ausgegliedert und ihre Posten und Positionen ausreichend erläutert wurden,<br />
- Darstellung, ob der Anhang den an ihn gestellten Anforderungen entspricht und<br />
<strong>in</strong>sbesondere die gesonderten zu machenden Angaben zutreffend enthält,<br />
GEMEINDEORDNUNG 647
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 101 GO <strong>NRW</strong><br />
- Darstellung, ob die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die Übersicht über<br />
örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände den rechtlichen<br />
Anforderungen entsprechend und das durch den Jahresabschluss zu vermittelnde<br />
Bild der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> ausreichendem Maße ermöglichen,<br />
- Aussage, ob der Lagebericht mit dem Jahresabschluss <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang steht und ob<br />
se<strong>in</strong>e sonstigen Angaben nicht e<strong>in</strong>e falsche Vorstellung von der Vermögens-,<br />
Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de erwecken, e<strong>in</strong>en Überblick über<br />
die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die<br />
Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr gibt und auf die Chancen und Risiken<br />
für die künftige Entwicklung der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>geht,<br />
- Darstellung von Unrichtigkeiten und Verstößen, die sich auf die weitere Entwicklung<br />
der Geme<strong>in</strong>de wesentlich auswirken oder sie bee<strong>in</strong>flussen können,<br />
- eigene Beurteilung der Lage der Geme<strong>in</strong>de,<br />
Abbildung 136 „Beispiele für Prüfungsaussagen zum Jahresabschluss“<br />
Für die Darstellungen im Prüfungsbericht sowie für se<strong>in</strong>e Gestaltung bestehen jedoch über die genannten Vorschriften<br />
h<strong>in</strong>aus ke<strong>in</strong>e weiteren Vorgaben. Der Prüfungsbericht über die geme<strong>in</strong>dliche Abschlussprüfung sollte<br />
daher e<strong>in</strong>e Vielzahl von Prüfungsaussagen zur wirtschaftlichen Lage der Geme<strong>in</strong>de enthalten. Der Umfang der<br />
Berichterstattung des Abschlussprüfers sollte daher unter Berücksichtigung der e<strong>in</strong>schlägigen Bestimmungen, der<br />
Bedeutung und dem Risikogehalt der dargestellten Sachverhalte entsprechen. Soweit erläuternde Darstellungen<br />
notwendig werden, können diese als Anlagen dem Prüfungsbericht beigefügt werden, wenn im Prüfungsbericht<br />
selbst e<strong>in</strong>e h<strong>in</strong>reichende Beurteilung vorgenommen und durch die Anlagen die Berichterstattung nicht unübersichtlich<br />
wird.<br />
Der Prüfungsbericht ist von der Geme<strong>in</strong>de bzw. von den Verantwortlichen für die Jahresabschlussprüfung nach<br />
örtlichen Bedürfnissen eigenverantwortlich auszugestalten und zu unterzeichnen. Er sollte durch se<strong>in</strong>e besonderen<br />
Aussagen und Darstellungen auch e<strong>in</strong>e vorbeugende Wirkung, <strong>in</strong>sbesondere h<strong>in</strong>sichtlich der aufgedeckten<br />
Unregelmäßigkeiten entfalten und zur Verh<strong>in</strong>derung von Unregelmäßigkeiten beitragen. Gleichwohl kann er deren<br />
künftige Vermeidung aber nicht garantieren.<br />
1.5.2 Die Grundsätze der Berichterstattung<br />
Für die Darstellungen im Prüfungsbericht sowie für se<strong>in</strong>e Gestaltung bestehen nach der Vorschrift ke<strong>in</strong>e besonderen<br />
Vorgaben. Jedoch muss der Prüfungsbericht e<strong>in</strong>deutige Formulierungen zu den geprüften örtlichen Sachverhalten<br />
enthalten, um Fehl<strong>in</strong>terpretationen und Fehldeutungen zu vermeiden. Um die E<strong>in</strong>haltung dieser Erfordernisse<br />
sicher zu stellen, haben sich Berichtsgrundsätze entwickelt, die auch bei der Erarbeitung von geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Prüfungsberichten beachtet werden sollten, denn der Prüfungsbericht soll sowohl formell als auch materiell<br />
den haushaltsrechtlichen Anforderungen entsprechen. Folgende allgeme<strong>in</strong>e Grundsätze der Berichterstattung<br />
bestehen (vgl. Abbildung).<br />
Grundsatz der<br />
Schriftlichkeit<br />
Berichtsgrundsätze für den Prüfungsbericht<br />
GEMEINDEORDNUNG 648<br />
Nach diesem Grundsatz ist der Prüfungsbericht schriftlich zu erstatten.<br />
Dieses bedeutet u.a., dass der Prüfungsbericht <strong>in</strong> Papierform<br />
vorliegen muss. Wenn mündlich berichtet wird, müssen die gegebenen<br />
Informationen gleichwohl im Prüfungsbericht enthalten se<strong>in</strong>.<br />
Außerdem be<strong>in</strong>haltet der Grundsatz, dass das Prüfungsergebnis<br />
bzw. der Bestätigungsvermerk vom Prüfer zu unterzeichnen ist.
Grundsatz der<br />
Klarheit<br />
Grundsatz der<br />
Wahrheit<br />
Grundsatz der<br />
Vollständigkeit<br />
Grundsatz der<br />
Verständlichkeit<br />
Grundsatz der<br />
Unparteilichkeit<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 101 GO <strong>NRW</strong><br />
Nach diesem Grundsatz ist die Berichterstattung über die Prüfung<br />
im Prüfungsbericht für den Rat und die Bürger als Öffentlichkeit so<br />
e<strong>in</strong>deutig und problemorientiert zu machen, dass e<strong>in</strong>e übersichtliche<br />
Gliederung des Berichtes und e<strong>in</strong> sachlicher Stil zu verwenden<br />
ist und ggf. ergänzende Unterlagen zur Verfügung zu stellen s<strong>in</strong>d<br />
(z.B. als Anlagen zum Prüfungsbericht.<br />
Nach diesem Grundsatz muss der Inhalt des Prüfungsberichtes den<br />
tatsächlichen Gegebenheiten bei der zu prüfenden Stelle entsprechen.<br />
Die Prüfungstätigkeit muss sich mit den Aussagen darüber<br />
und den dafür zu Grunde liegenden Dokumenten decken. Der<br />
Berichtspflichtige muss ggf. bestätigen, dass e<strong>in</strong>zelne Sachverhalte<br />
nicht geprüft werden konnten.<br />
Nach diesem Grundsatz muss der Prüfungsbericht alle wesentlichen<br />
Ergebnisse und E<strong>in</strong>wendungen enthalten. Dabei ist zu entscheiden,<br />
wie mit vertraulichen Angaben und personenbezogenen<br />
Daten umzugehen ist. Der Grundsatz umfasst auch die Vorgabe,<br />
dass der Prüfungsbericht als Gesamtwerk erstellt wird und nicht <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>zelne Berichte aufgeteilt wird, die ggf. nicht mite<strong>in</strong>ander <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung<br />
stehen.<br />
Nach diesem Grundsatz s<strong>in</strong>d die Informationen der Prüfung für den<br />
Rat und die Bürger als Öffentlichkeit so aufzubereiten und verfügbar<br />
zu machen, dass die wesentlichen Informationen über die Prüfung<br />
auch für die Adressaten der Berichterstattung verständlich s<strong>in</strong>d.<br />
Nach diesem Grundsatz hat der Abschlussprüfer unter Berücksichtigung<br />
der verfügbaren Informationen unvore<strong>in</strong>genommen, sachlich<br />
und möglichst objektiv über die durchgeführte Prüfung zu berichten,<br />
ggf. auch Aussagen zum Selbstprüfungsverbot bzw. se<strong>in</strong>er eigenen<br />
Unabhängigkeit zu machen.<br />
Abbildung 137 „Berichtsgrundsätze für den Prüfungsbericht“<br />
1.6 Zu Satz 6 (Prüfungsbericht und Bestätigungsvermerk):<br />
Nach dieser Vorschrift hat der Rechnungsprüfungsausschuss den Bestätigungsvermerk <strong>in</strong> den Prüfungsbericht<br />
aufzunehmen. Dieser muss e<strong>in</strong>e klar und schriftlich zu formulierende Gesamtbeurteilung des Prüfungsergebnisses<br />
über den geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss enthalten. Außerdem entfaltet er e<strong>in</strong>e rechtliche Wirkung dadurch,<br />
dass erst nach se<strong>in</strong>er Erstellung und Unterzeichnung die Jahresabschlussprüfung als abgeschlossen und der<br />
geme<strong>in</strong>dliche Jahresabschluss als geprüft gilt und erst dann durch den Rat der Geme<strong>in</strong>de festgestellt werden<br />
kann (vgl. § 96 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>). Bei der Festlegung der Inhalte und Abgrenzungen des Bestätigungsvermerks<br />
oder des Vermerks über se<strong>in</strong>e Versagung s<strong>in</strong>d die Vorschriften der Absätze 4 bis 7 zu beachten (vgl. Erläuterungen<br />
zu diesen Vorschriften). Die „Grundsätze für die ordnungsmäßige Erteilung von Bestätigungsvermerken“<br />
können dabei als Beurteilungsmaßstäbe herangezogen werden.<br />
2. Zu Absatz 2 (Stellungnahmen zum Prüfungsergebnis):<br />
2.01 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
E<strong>in</strong>e Zusammenarbeit zwischen dem Rechnungsprüfungsausschuss des Rates und der örtlichen Rechnungsprüfung<br />
als örtliche Prüfungs<strong>in</strong>stanzen zur Erledigung der anstehenden Prüfungsarbeiten ist gesetzlich erwünscht.<br />
Insbesondere im Rahmen der Abschlussprüfungen (Jahresabschluss und Gesamtabschluss der Geme<strong>in</strong>de) ist<br />
auch e<strong>in</strong>e Zusammenarbeit der Prüfungs<strong>in</strong>stanzen mit der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung notwendig. Die <strong>in</strong>nerge-<br />
GEMEINDEORDNUNG 649
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 101 GO <strong>NRW</strong><br />
me<strong>in</strong>dliche Zusammenarbeit kann z.B. helfen, aufgetretene Fehler und Unstimmigkeiten im geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss,<br />
die der Vermittlung e<strong>in</strong>es den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bildes der Vermögens-,<br />
Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de entgegenstehen, vor der Feststellung des Jahresabschlusses<br />
zu beseitigen. Die Zusammenarbeit erfordert aber, dass der Bürgermeister und der Kämmerer den Entwurf des<br />
Prüfungsberichtes sowie des Prüfungsergebnisses vor der Abgabe an den Rat der Geme<strong>in</strong>de zur Kenntnisnahme<br />
erhalten, um ggf. e<strong>in</strong>e Stellungnahme dazu abgeben zu können.<br />
Der Rechnungsprüfungsausschuss kann dadurch se<strong>in</strong>e Prüfungsbemerkungen und Beanstandungen auf die<br />
wesentlichen Fälle beschränken, <strong>in</strong> denen trotz Erläuterungen und Bereitstellung von Nachweisen und Informationen<br />
seitens der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung die Bedenken der Abschlussprüfer nicht ausgeräumt werden konnten<br />
und daher weiter bestehen. Geben der Bürgermeister und/oder der Kämmerer e<strong>in</strong>e Stellungnahme zum Prüfungsbericht<br />
des Rechnungsprüfungsausschusses ab, sollte der Rechnungsprüfungsausschuss diese zusammen<br />
mit se<strong>in</strong>em Prüfungsbericht dem Rat vorlegen, selbst dann, wenn er den Anregungen des Bürgermeisters<br />
und/oder des Kämmerers gefolgt ist.<br />
Dieses Informationsgebaren stärkt die Zusammenarbeit zwischen dem Rat der Geme<strong>in</strong>de und der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Verwaltung. E<strong>in</strong> Ziel dieser Vorschrift ist es deshalb auch, möglichst unnötige Prüfungsfeststellungen zu vermeiden,<br />
wenn seitens des Bürgermeisters und des Kämmerers bereits im Vorfeld der Feststellung des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Jahresabschlusses entstandene Unstimmigkeiten ausgeräumt werden können. Die örtliche Zusammenarbeit<br />
sollte daher während der gesamten Prüfungszeit bestehen und <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er geme<strong>in</strong>samen Schlussbesprechung enden,<br />
die zur gegenseitigen Anerkennung des erarbeiteten Prüfungsergebnisses führen kann. Dieses gilt entsprechend<br />
auch für den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss, der <strong>in</strong> der gleichen Art und Weise aufzustellen und zu<br />
prüfen ist wie der geme<strong>in</strong>dliche Jahresabschluss.<br />
2.1 Zu Satz 1 (Stellungnahme des Bürgermeisters):<br />
Nach der Vorschrift ist dem Bürgermeister vor Abgabe des Prüfungsberichtes durch den Rechnungsprüfungsausschuss<br />
an den Rat e<strong>in</strong>e Gelegenheit zur Stellungnahme zum Prüfungsergebnis zu geben. Dieses Recht des<br />
Bürgermeisters ist beibehalten worden, denn er ist für die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der<br />
gesamten geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung verantwortlich und verteilt die Geschäfte (vgl. § 62 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>). Er ist<br />
dadurch von dem durch den Rechnungsprüfungsausschuss festgestellten Prüfungsergebnis betroffen. Der Bürgermeister<br />
ist aber auch dadurch unmittelbar <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Amtsfunktion betroffen, dass auf Grund des geprüften<br />
Jahresabschlusses die Ratsmitglieder über se<strong>in</strong>e Entlastung entscheiden. Diese Entlastung ist e<strong>in</strong>e Festlegung<br />
der Ratsmitglieder dah<strong>in</strong>gehend, dass auf Grund des vorgelegten Jahresabschlusses und der vorgenommen<br />
Prüfung ke<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>wendungen gegen die Haushaltsführung des Bürgermeisters erhoben werden. Dem Bürgermeister<br />
wird daher e<strong>in</strong> Anspruch zugestanden, vor Abgabe des Prüfungsberichtes durch den Rechnungsprüfungsausschuss<br />
e<strong>in</strong>e Stellungnahme dazu abgeben zu können.<br />
2.2 Zu Satz 2 (Stellungnahme des Kämmerers)<br />
Nach der Vorschrift ist auch dem Kämmerer vor Abgabe des Prüfungsberichtes durch den Rechnungsprüfungsausschuss<br />
an den Rat e<strong>in</strong>e Gelegenheit zur Stellungnahme zum Prüfungsergebnis zu geben, wenn er von se<strong>in</strong>em<br />
Recht nach § 95 Abs. 3 Satz 3 Gebrauch gemacht hat. Diese Regelung ist erforderlich, denn dem Kämmerer<br />
der Geme<strong>in</strong>de steht das Recht zu, sowohl bei der Aufstellung des Entwurfs der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung<br />
als auch bei der Aufstellung des Entwurfs des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses e<strong>in</strong>e von der Me<strong>in</strong>ung des Bürgermeisters<br />
abweichende Auffassung zu vertreten. Dem Kämmerer muss wegen der Bedeutung des Prüfungsergebnisses<br />
für die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft ebenfalls das Recht e<strong>in</strong>geräumt werden, e<strong>in</strong>e Stellungnahme<br />
zum Prüfungsergebnis über den geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss abgeben zu können. Diese Vorgabe ist sachlich<br />
s<strong>in</strong>nvoll und kann auf freiwilliger Basis immer erfolgen. Sie aber dann sachlich geboten, wenn der Kämmerer<br />
GEMEINDEORDNUNG 650
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 101 GO <strong>NRW</strong><br />
bereits zuvor e<strong>in</strong>e Stellungnahme zum Entwurf des Jahresabschlusses abgegeben hat (vgl. § 95 Abs. 3 Satz 3<br />
GO <strong>NRW</strong>).<br />
2.3 Die Stellungnahme der örtlichen Rechnungsprüfung<br />
Der Rechnungsprüfungsausschuss bedient sich regelmäßig zur Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses<br />
der örtlichen Rechnungsprüfung (vgl. § 59 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong>). Er baut dabei i.d.R. se<strong>in</strong>e Abschlussprüfung auf<br />
dem Prüfungsergebnis der der örtlichen Rechnungsprüfung auf, das ihm durch e<strong>in</strong>en Prüfungsbericht und e<strong>in</strong>en<br />
Bestätigungsvermerk vorgelegt wird. Dabei kann es vorkommen, dass das Prüfungsergebnis des Rechnungsprüfungsausschusses<br />
erheblich vom Prüfungsergebnis der örtlichen Rechnungsprüfung abwichen kann. In solchen<br />
Fällen sollte der Rechnungsprüfungsausschuss mit se<strong>in</strong>em Prüfungsbericht und se<strong>in</strong>em Bestätigungsvermerk<br />
auch die (abweichende) Auffassung der örtlichen Rechnungsprüfung zum geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss dem<br />
Rat zur Kenntnisnahme mit vorlegen. Dieses ist sachgerecht und geboten, denn die örtliche Rechnungsprüfung<br />
ist dem Rat unmittelbar verantwortlich und <strong>in</strong> ihrer sachlichen Tätigkeit unmittelbar unterstellt.<br />
3. Zu Absatz 3 (Inhalt und Aussage des Bestätigungsvermerks):<br />
3.1 Zu Satz 1 (Ergebnis der Prüfung im Bestätigungsvermerk):<br />
Die Regelung <strong>in</strong> der Vorschrift stellt ausdrücklich klar, dass der Rechnungsprüfungsausschuss das Ergebnis der<br />
Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Bestätigungsvermerk zusammenzufassen hat. Dieser<br />
Bestätigungsvermerk enthält damit e<strong>in</strong> Gesamturteil über das Prüfungsergebnis unter E<strong>in</strong>beziehung des im E<strong>in</strong>zelnen<br />
<strong>in</strong> Absatz 1 der Vorschrift def<strong>in</strong>ierten Prüfungsumfangs (Prüfungsurteil). Dabei soll das Gesamturteil nicht<br />
als Addition vieler E<strong>in</strong>zelurteile verstanden werden, sondern durch Gewichtung der Beurteilung e<strong>in</strong>zelner Prüfungsergebnisse,<br />
z.B. ob der geme<strong>in</strong>dliche Jahresabschluss e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes<br />
Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger<br />
Buchführung ergibt, gebildet werden. Das Ergebnis der Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses<br />
soll dabei regelmäßig <strong>in</strong> positiver Form dargestellt werden. Nur bei Verstößen s<strong>in</strong>d E<strong>in</strong>schränkungen<br />
möglich, z.B. wenn gesetzliche Vorschriften, Satzungen oder sonstige ortsrechtliche Bestimmungen nicht beachtet<br />
worden s<strong>in</strong>d.<br />
Der Rechnungsprüfungsausschuss darf se<strong>in</strong>en Bestätigungsvermerk erst erteilen, wenn er se<strong>in</strong>e Prüfung materiell<br />
abgeschlossen hat. Soweit im E<strong>in</strong>zelfall erforderlich, können aber zwischenzeitliche Informationen über den<br />
Stand der Prüfungsarbeiten gegeben werden. Dabei kann die Information je nach Stand der Prüfung möglicherweise<br />
bereits geäußert werden, dass auf Grund der vorliegenden Prüfungsergebnisse voraussichtliche ke<strong>in</strong>e<br />
E<strong>in</strong>wendungen erhoben werden und ggf. e<strong>in</strong> une<strong>in</strong>geschränkter Bestätigungsvermerk erteilt werden wird, wenn<br />
die weitere Prüfung das bisherige Prüfungsergebnis bestätigt. Nach Abschluss der Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Jahresabschlusses hat der Rechnungsprüfungsausschuss das Ergebnis se<strong>in</strong>er Prüfung im Bestätigungsvermerk<br />
zusammen mit se<strong>in</strong>em Prüfungsbericht dem Rat der Geme<strong>in</strong>de als Auftraggeber zuzuleiten. Mit diesem Bestätigungsvermerk<br />
aus der Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses wird im Übrigen e<strong>in</strong> unbegrenzter Adressatenkreis<br />
über das Ergebnis der Jahresabschlussprüfung <strong>in</strong>formiert, denn die Beratungen des Rates über das<br />
Prüfungsergebnis f<strong>in</strong>den regelmäßig <strong>in</strong> öffentlicher Sitzung statt. Damit wird der Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsausschusses<br />
ebenfalls öffentlich gemacht.<br />
3.2 Zu Satz 2 (Kernelemente des Bestätigungsvermerks):<br />
Die Vorschrift benennt die Kernelemente des im Rahmen der geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlussprüfung aufzustellenden<br />
Bestätigungsvermerks des Rechnungsprüfungsausschusses. In dessen Bestätigungsvermerk s<strong>in</strong>d neben<br />
GEMEINDEORDNUNG 651
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 101 GO <strong>NRW</strong><br />
Beschreibung des Prüfungsgegenstandes auch die Art und der Umfang se<strong>in</strong>er Prüfung zu beschreiben. Dabei<br />
s<strong>in</strong>d die angewandten Rechnungslegungsgrundsätze und Prüfungsgrundsätze anzugeben. Diese Festlegungen<br />
stellen die Grundlage dafür dar, dass im Bestätigungsvermerk z.B. die Aussage getroffen werden kann, der Jahresabschluss<br />
der Geme<strong>in</strong>de für das Haushaltsjahr ..., bestehend aus Ergebnisrechnung, F<strong>in</strong>anzrechnung und<br />
den Teilrechnungen sowie der Bilanz und dem Anhang wurde unter E<strong>in</strong>beziehung der Buchführung, der Inventur,<br />
des Inventars, der Übersicht über örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und des<br />
Lageberichts der Geme<strong>in</strong>de geprüft.<br />
Im Rahmen der geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlussprüfung ist auch die Aussage wichtig, ob <strong>in</strong> die Prüfung die<br />
Haushaltssatzung sowie weitere Bestimmungen von Satzungen der Geme<strong>in</strong>de und die sonstigen ortsrechtlichen<br />
Bestimmungen e<strong>in</strong>bezogen worden s<strong>in</strong>d. Auch e<strong>in</strong>e Aussage über die Prüfungshandlungen ist erforderlich, z.B.<br />
dass im Rahmen der Prüfung die Nachweise für die Angaben <strong>in</strong> Buchführung, Inventar, Übersicht über örtlich<br />
festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der<br />
Basis von Stichproben beurteilt wurden. Diese Verpflichtungen erfordern, dass im Rahmen der Durchführung der<br />
Jahresabschlussprüfung auch e<strong>in</strong>e entsprechende Dokumentation durch den Abschlussprüfer erfolgt, um zutreffend<br />
die nach der Vorschrift erforderlichen Prüfungsaussagen machen zu können.<br />
3.3 Zu Satz 3 (Tenorierung des Bestätigungsvermerks):<br />
Nach der Vorschrift soll der abzugebende Bestätigungsvermerk auch e<strong>in</strong>e zweifelsfreie Beurteilung des Prüfungsergebnisses<br />
enthalten. Dazu benennt die Vorschrift vier Möglichkeiten der Tenorierung des Bestätigungsvermerks,<br />
von der une<strong>in</strong>geschränkten Bestätigung bis zur Erklärung des Rechnungsprüfungsausschusses, dass<br />
er sich außerstande sieht, e<strong>in</strong> Urteil über den geprüften Abschluss abzugeben. Die Inhalte der e<strong>in</strong>zelnen Tenorierungen<br />
des Bestätigungsvermerks über die geme<strong>in</strong>dliche Abschlussprüfung werden <strong>in</strong> den Absätzen 4 und 5 der<br />
Vorschrift näher bestimmt. Folgende Möglichkeiten der Tenorierung bestehen (vgl. Abbildung).<br />
Möglichkeiten der Tenorierung des Bestätigungsvermerks<br />
Aus dem Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschuss<br />
muss sich zweifelsfrei ergeben,<br />
- ob e<strong>in</strong> une<strong>in</strong>geschränkter Bestätigungsvermerk erteilt wird (vgl. Nummer 1) oder<br />
- e<strong>in</strong> e<strong>in</strong>geschränkter Bestätigungsvermerk erteilt wird (vgl. Nummer 2) oder<br />
- der Bestätigungsvermerk auf Grund von Beanstandungen versagt wird (vgl. Nummer 3) oder<br />
- der Bestätigungsvermerk deshalb versagt wird, weil sich der Ausschuss als Prüfungsgremium<br />
nicht <strong>in</strong> der Lage ist, e<strong>in</strong>e Beurteilung vorzunehmen (vgl. Nummer 4).<br />
Abbildung 138 „Möglichkeiten der Tenorierung des Bestätigungsvermerks“<br />
Auf Grund der fachlichen Grundsätze entstehen Klarstellungen und dadurch detaillierte Aussagen im Bestätigungsvermerk,<br />
denn dieser soll das getroffene Gesamturteil wieder spiegelt. Der Inhalt des Bestätigungsvermerks<br />
wird dabei durch das Ziel der Jahresabschlussprüfung bestimmt. Außerdem entfaltet er e<strong>in</strong>e rechtliche<br />
Wirkung dadurch, dass nach se<strong>in</strong>er Erstellung und Unterzeichnung gilt die Jahresabschlussprüfung als abgeschlossen<br />
und der geme<strong>in</strong>dliche Jahresabschluss als geprüft. Erst danach kann der geme<strong>in</strong>dliche Jahresabschluss<br />
vom Rat der Geme<strong>in</strong>de festgestellt werden (vgl. § 96 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>).<br />
GEMEINDEORDNUNG 652
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 101 GO <strong>NRW</strong><br />
3.4 Zu Satz 4 (Beurteilung des Prüfungsergebnisses):<br />
Nach der Vorschrift ist der Rechnungsprüfungsausschuss gefordert, se<strong>in</strong>e Beurteilung des Prüfungsergebnisses<br />
allgeme<strong>in</strong>verständlich und problemorientiert unter Berücksichtigung des Umstandes vorzunehmen, dass Rat und<br />
Verwaltungsvorstand den geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss zu verantworten haben. Diese ausdrückliche Regelung<br />
soll e<strong>in</strong>erseits dazu beitragen, dass zwischen der Verantwortung des Abschlussprüfers und der des Rates und<br />
des Verwaltungsvorstands der Geme<strong>in</strong>de abgegrenzt werden kann, denn der geme<strong>in</strong>dliche Jahresabschluss und<br />
<strong>in</strong>sbesondere der Lagebericht sollen aus Sicht der Verantwortlichen <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong> Bild der wirtschaftlichen<br />
Verhältnisse der Geme<strong>in</strong>de zeigen.<br />
Im Rahmen der geme<strong>in</strong>dlichen Abschlussprüfung muss e<strong>in</strong> Gesamturteil entstehen, das aus verschiedenen Teilen<br />
entsteht, aber auch e<strong>in</strong>e Wertung des Abschlussprüfers enthalten muss. Ausgehend von den <strong>in</strong> der Vorschrift<br />
benannten Tenorierungen des Bestätigungsvermerks kommen daher ggf. Begründungen und h<strong>in</strong>weisende Zusätze<br />
durch den Abschlussprüfer <strong>in</strong> Betracht, um adressatenbezogen zutreffende Prüfungsaussagen zu erreichen.<br />
Dabei ist abzuschätzen, ob ggf. auch Vorbehalte <strong>in</strong> Betracht kommen, wenn bis zum Ende der Prüfung von der<br />
Geme<strong>in</strong>de bestehende Bed<strong>in</strong>gungen, z.B. Vertragsbed<strong>in</strong>gungen, noch nicht erfüllt worden s<strong>in</strong>d.<br />
Der Abschlussprüfer kann zusätzlich zu se<strong>in</strong>er Prüfungsaussage „Die Prüfung hat zu ke<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>wendungen geführt.“<br />
Auch z.B. feststellen, dass nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen der Jahresabschluss den<br />
gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen<br />
Bestimmungen entspricht und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung e<strong>in</strong> den tatsächlichen<br />
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de<br />
vermittelt. Auch zum geme<strong>in</strong>dlichen Lagebericht sollte e<strong>in</strong>e Prüfungsaussage durch den Abschlussprüfer erfolgen,<br />
z.B., dass der geme<strong>in</strong>dliche Lagebericht <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang mit dem Jahresabschluss der Geme<strong>in</strong>de steht, <strong>in</strong>sgesamt<br />
e<strong>in</strong> zutreffendes Bild von der wirtschaftlichen Lage der Geme<strong>in</strong>de vermittelt und die Chancen und Risiken<br />
der zukünftigen Entwicklung der Geme<strong>in</strong>de zutreffend darstellt.<br />
3.5 Zu Satz 5 (Angabe und Beurteilung von Risiken):<br />
3.5.1 Die Pflichten des Abschlussprüfers<br />
Nach der Vorschrift soll der Rechnungsprüfungsausschuss <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Prüfungsbericht bzw. im Bestätigungsvermerk<br />
gesondert auf die Risiken für die Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>gehen, die die stetige Aufgabenerfüllung und die Haushaltswirtschaft<br />
der Geme<strong>in</strong>de gefährden. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung müssen die aus Sicht der Prüfer<br />
bestehenden Risiken für die Geme<strong>in</strong>de benannt und bewertet werden, z.B. Risiken aus langfristigen Verträgen<br />
der Geme<strong>in</strong>de. E<strong>in</strong> H<strong>in</strong>weis des Abschlussprüfers auf die Angaben zu den geme<strong>in</strong>dlichen Risiken im Lagebericht<br />
der Geme<strong>in</strong>de reicht dabei nicht aus. Die Darstellung von Risiken für die Geme<strong>in</strong>de erfolgt im Bestätigungsvermerk<br />
vielfach nach dem Prüfungsurteil, ohne dass dies gleichzeitig e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>schränkung des Prüfungsurteils des<br />
Abschlussprüfers bedeutet.<br />
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass bei Vorkenntnissen des Prüfers über mögliche Risiken für die<br />
Aufgabenerfüllung und die Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de oder auch bei Erkenntnissen des Prüfers aus se<strong>in</strong>er<br />
Prüfung e<strong>in</strong>erseits die Prüfungshandlungen daraus ausgerichtet werden müssen. Andererseits müssen die<br />
Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung oder Dritte als Prüfer die Kenntnisse über Risiken für die Geme<strong>in</strong>de haben<br />
entsprechende H<strong>in</strong>weise im Rahmen ihres Prüfungsauftrages und ihrer vorzunehmenden Beurteilung des<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses <strong>in</strong> ihrem Bestätigungsvermerk abgeben. E<strong>in</strong> Bestätigungsvermerk hat <strong>in</strong> diesem<br />
S<strong>in</strong>ne immer Außenwirkung, weil durch e<strong>in</strong>en solchen Vermerk das Ergebnis der Prüfung dokumentiert und<br />
dem Auftraggeber gegenüber offengelegt wird. Diese Gegebenheiten erfordern, abhängig vom jeweiligen Prüfungsergebnis,<br />
dass jeder an der Jahresabschlussprüfung beteiligte Prüfer oder Prüfungsstelle e<strong>in</strong>en Bestäti-<br />
GEMEINDEORDNUNG 653
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 101 GO <strong>NRW</strong><br />
gungsvermerk zu erstellen hat. Darauf kann grundsätzlich nicht verzichtet werden. Auch ist vom Prüfer oder der<br />
Prüfungsstelle eigenverantwortlich über die Form der Ausfertigung des Bestätigungsvermerks und die Formulierung<br />
zu entscheiden.<br />
3.5.2 Die Sicherung der Aufgabenerfüllung<br />
Die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft ist ke<strong>in</strong> Selbstzweck, sondern dient stets der „Sicherung der Aufgabenerfüllung“<br />
(vgl. § 75 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>). Diese Zweckbestimmung ist umfassend und deshalb als tragender Haushaltsgrundsatz<br />
anzusehen. Als Anknüpfungspunkt für die Aufgabenbestimmung ist § 3 GO <strong>NRW</strong> heranzuziehen,<br />
durch den die Aufgaben der Geme<strong>in</strong>de bestimmt und abgegrenzt werden. Wegen der Vielzahl und der Verschiedenartigkeit<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgaben mit e<strong>in</strong>em theoretisch unbegrenzten Bedarf an F<strong>in</strong>anzmitteln ist e<strong>in</strong>e<br />
ständige Bedarfsprüfung unter Berücksichtigung der örtlichen Aufgabenstellungen und der f<strong>in</strong>anziellen Leistungsfähigkeit<br />
<strong>in</strong> jeder Geme<strong>in</strong>de notwendig. Die <strong>in</strong> die Zukunft gerichtete Forderung nach Sicherung der Aufgabenerfüllung<br />
setzt e<strong>in</strong>e sorgfältige Planung nicht nur für das nächste Haushaltsjahr, sondern auch für die weiteren Jahre<br />
im Rahmen der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Geme<strong>in</strong>de voraus. Daher war e<strong>in</strong> Bestandteil der Reform<br />
des Haushaltsrechts, dass die mittelfristige Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung <strong>in</strong> den Haushaltsplan <strong>in</strong>tegriert<br />
wird (vgl. § 84 GO <strong>NRW</strong>). Unter diesen Gesichtspunkten besteht für die Geme<strong>in</strong>de im Rahmen der Sicherung der<br />
Leistungsfähigkeit e<strong>in</strong>e Verpflichtung zur Nachhaltigkeit ihrer Haushaltswirtschaft, die sich nicht nur im jährlichen<br />
Haushaltsausgleich nach Absatz 2 ausdrücken darf.<br />
3.5.3 Die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft<br />
Der Begriff „Haushaltswirtschaft“ ist haushaltsrechtlich nicht geregelt. Nach allgeme<strong>in</strong>er Auffassung gehören<br />
hierzu alle D<strong>in</strong>ge und Tätigkeiten der Geme<strong>in</strong>de, die mit der Vorbereitung, Aufstellung und Ausführung des jährlichen<br />
Haushaltsplans (Ergebnisplan und F<strong>in</strong>anzplan sowie Anlagen) sowie mit der Vorbereitung, Aufstellung und<br />
Prüfung des Jahresabschlusses (Ergebnisrechnung, F<strong>in</strong>anzrechnung und Bilanz sowie Anlagen) zusammenhängen.<br />
Auch die Verwaltung des geme<strong>in</strong>dlichen Vermögens und der Schulden gehört dazu, denn diese Aufgabe<br />
entsteht aus dem jährlichen Haushaltskreislauf. Außerdem hat die Geme<strong>in</strong>de ihre Haushaltswirtschaft wirtschaftlich,<br />
effizient und sparsam zu führen.<br />
In diesem Zusammenhang muss berücksichtigt werden, dass der Haushalt für die Geme<strong>in</strong>de das zentrale Steuerungs-<br />
und Rechenschafts<strong>in</strong>strument <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft ist und bleibt. Auch ist es erforderlich,<br />
dass die Geme<strong>in</strong>de den gesetzlich vorgesehenen Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> sowie<br />
auch für die drei dem Haushaltsjahr folgenden Planungsjahre der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung<br />
erreicht (vgl. § 84 GO <strong>NRW</strong>), ihre Verpflichtungen für Verlustübernahmen für geme<strong>in</strong>dliche Betriebe, soweit sie<br />
anfallen, auch von der Geme<strong>in</strong>de gedeckt werden können, e<strong>in</strong>e entsprechende Vorsorge trifft, um Risiken aus<br />
den Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre für die Geme<strong>in</strong>de soweit wie möglich zu m<strong>in</strong>imieren, ihre Haushaltswirtschaft<br />
so plant und ausführt, dass heute und für die Zukunft stetig e<strong>in</strong> ausreichendes Eigenkapital vorhanden<br />
ist und sie nicht gegen das Überschuldungsverbot <strong>in</strong> § 75 Abs. 7 GO <strong>NRW</strong> verstößt.<br />
4. Zu Absatz 4 (Une<strong>in</strong>geschränkter Bestätigungsvermerk):<br />
4.1 Zu Satz 1 (Erklärungs<strong>in</strong>halt des Bestätigungsvermerks):<br />
4.1.1 Die Verantwortlichkeit des Abschlussprüfers<br />
Die Formulierung und Ausgestaltung des Bestätigungsvermerks ist vom Abschlussprüfer immer im Rahmen se<strong>in</strong>es<br />
Prüfungsauftrages und der Durchführung der Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses unter Berück-<br />
GEMEINDEORDNUNG 654
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 101 GO <strong>NRW</strong><br />
sichtigung der örtlichen Verhältnisse und der Ergebnisse se<strong>in</strong>er Prüfung eigenverantwortlich vorzunehmen. Die<br />
Erklärung des Prüfers muss außer auf gesetzliche Vorschriften, die Haushaltssatzung sowie weitere Bestimmungen<br />
von Satzungen der Geme<strong>in</strong>de und auf sonstige ortsrechtliche Bestimmungen auch auf die Grundsätze ordnungsmäßiger<br />
Buchführung und sonstige maßgebliche Rechnungslegungsgrundsätze sowie auf die Haushaltsgrundsätze<br />
Bezug nehmen. In den Fällen, <strong>in</strong> denen der Abschlussprüfer ke<strong>in</strong>e wesentlichen E<strong>in</strong>wendungen gegen<br />
die Buchführung, den Jahresabschluss und den Lagebericht der Geme<strong>in</strong>de zu erheben hat und im Rahmen<br />
der Prüfungsarbeiten ke<strong>in</strong>e besonderen Umstände vorliegen, auf Grund derer bestimmte Teile der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Rechnungslegung nicht geprüft werden können (Prüfungshemmnisse), kann vom Prüfer e<strong>in</strong> une<strong>in</strong>geschränkter<br />
Bestätigungsvermerk erteilt werden.<br />
4.1.2 Die Gestaltung des Bestätigungsvermerks<br />
Die Vorschrift regelt das Nähere über die Formulierung e<strong>in</strong>es une<strong>in</strong>geschränkten Bestätigungsvermerks. Er ist<br />
vom Rechnungsprüfungsausschuss sachverhaltsabhängig im Rahmen se<strong>in</strong>er Abschlussprüfung zu gestalten und<br />
von se<strong>in</strong>em Vorsitzenden zu unterzeichnen. Die „Grundsätze für die ordnungsmäßige Erteilung von Bestätigungsvermerken“,<br />
die bei den Wirtschaftsprüfern zur Anwendung kommen, können für den geme<strong>in</strong>dlichen Bestätigungsvermerk<br />
als Beurteilungsmaßstäbe herangezogen werden. Auch wenn der Bestätigungsvermerk <strong>in</strong> eigener<br />
Verantwortung von der Geme<strong>in</strong>de gestaltet werden kann, sollte dieser nicht bei jedem neuen Jahresabschluss<br />
e<strong>in</strong>e neue Form erhalten. Es bietet sich deshalb für den Bestätigungsvermerk e<strong>in</strong>e Grundgliederung aus<br />
Überschrift, E<strong>in</strong>leitung und Sachverhaltsdarstellung sowie e<strong>in</strong>er daran anschließenden Beurteilung an. Daran<br />
können sich dann weitere H<strong>in</strong>weise des Abschlussprüfers anschließen.<br />
Mit e<strong>in</strong>em une<strong>in</strong>geschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers zum geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss<br />
wird von ihm unter E<strong>in</strong>beziehung des Lageberichtes festgestellt, dass die Prüfung zu ke<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>wendungen geführt<br />
hat und der Jahresabschluss e<strong>in</strong> zutreffendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der<br />
Geme<strong>in</strong>de vermittelt. Dieses Ergebnis soll auf den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen des Abschlussprüfers<br />
aufbauen und bestätigen, dass der geme<strong>in</strong>dliche Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften, Satzungen<br />
und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen entspricht. Es wird damit e<strong>in</strong>e positive Gesamtaussage zum<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss dah<strong>in</strong>gehend getroffen, dass dieser <strong>in</strong>sgesamt e<strong>in</strong> zutreffendes Bild von der<br />
wirtschaftlichen Lage der Geme<strong>in</strong>de vermittelt und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Geme<strong>in</strong>de<br />
zutreffend dargestellt s<strong>in</strong>d. E<strong>in</strong> une<strong>in</strong>geschränkter Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers kann z.B.<br />
folgende Fassung haben (vgl. Abbildung).<br />
Beispiel für e<strong>in</strong>en Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss<br />
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers<br />
Der Jahresabschluss der Geme<strong>in</strong>de … für das Haushaltsjahr ..., bestehend aus der Ergebnisrechnung,<br />
der F<strong>in</strong>anzrechnung und den Teilrechnungen sowie der Bilanz und dem Anhang wurde nach § 101<br />
i.V.m. § 95 GO <strong>NRW</strong> unter E<strong>in</strong>beziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars, der Übersicht<br />
über örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und des Lageberichts geprüft. In<br />
die Prüfung s<strong>in</strong>d die haushaltsrechtlichen Vorschriften, die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr …<br />
sowie ergänzende Regelungen von örtlichen Satzungen und sonstige ortsrechtliche Bestimmungen,<br />
soweit sich diese auf die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft beziehen, e<strong>in</strong>bezogen worden. Die Prüfung<br />
wurde so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des<br />
durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch<br />
den Lagebericht zu vermittelnden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der<br />
Geme<strong>in</strong>de … wesentlich auswirken, mit h<strong>in</strong>reichender Sicherheit erkannt werden konnten. Bei der<br />
Festlegung der Prüfungshandlungen s<strong>in</strong>d die Kenntnisse über die Verwaltungstätigkeit und über das<br />
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Geme<strong>in</strong>de sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt<br />
worden. Im Rahmen der Prüfung wurden die Nachweise für die Angaben <strong>in</strong> Buchführung,<br />
Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss<br />
und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung hat die<br />
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen E<strong>in</strong>schätzungen des<br />
GEMEINDEORDNUNG 655
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 101 GO <strong>NRW</strong><br />
Bürgermeisters der Geme<strong>in</strong>de sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und<br />
des Lageberichts umfasst.<br />
Die Prüfung hat zu ke<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>wendungen geführt.<br />
Nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen entspricht der Jahresabschluss den haushaltsrechtlichen<br />
Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der örtlichen Satzungen und sonstigen<br />
ortsrechtlichen Bestimmungen, soweit sich diese auf die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft beziehen.<br />
Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung e<strong>in</strong> den<br />
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage<br />
der Geme<strong>in</strong>de …. Der Lagebericht steht <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang mit dem Jahresabschluss und vermittelt <strong>in</strong>sgesamt<br />
auch e<strong>in</strong> zutreffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de …<br />
In diesem Bericht werden die Chancen und Risiken der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung der<br />
Geme<strong>in</strong>de zutreffend dargestellt.<br />
Abbildung 139 „Beispiel für e<strong>in</strong>en Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss“<br />
Der aufzustellende Bestätigungsvermerk ist aber dann e<strong>in</strong>zuschränken oder zu versagen, wenn vom Abschlussprüfer<br />
Beanstandungen festgestellt und ausgesprochen werden. E<strong>in</strong> e<strong>in</strong>geschränkter Bestätigungsvermerk darf<br />
nur erteilt werden, wenn der geprüfte Jahresabschluss unter Beachtung der vom Prüfer vorgenommenen, <strong>in</strong> ihrer<br />
Tragweite erkennbaren E<strong>in</strong>schränkung e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen im Wesentlichen entsprechendes Bild<br />
der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de vermittelt. S<strong>in</strong>d die Beanstandungen so erheblich,<br />
dass ke<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und<br />
F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de mehr vermittelt wird, hat der Abschlussprüfer den Bestätigungsvermerk zu versagen.<br />
Der Bestätigungsvermerk ist auch dann vom Abschlussprüfer zu versagen, wenn der Prüfer nach Ausschöpfung<br />
aller angemessenen Möglichkeiten zur Klärung des Sachverhaltes nicht <strong>in</strong> der Lage ist, e<strong>in</strong>e Beurteilung abzugeben.<br />
Die Versagung ist dann <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Vermerk, der nicht als Bestätigungsvermerk zu bezeichnen ist, aufzunehmen.<br />
Die E<strong>in</strong>schränkung oder Versagung ist zu begründen. Der Bestätigungsvermerk ist außerdem durch den<br />
Prüfer, die örtliche Rechnungsprüfung sowie durch den Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses mit<br />
Angabe des Ortes und des Datums zu unterzeichnen, jedoch abhängig davon, <strong>in</strong> welchem Umfang von ihnen<br />
Prüfungsaufgaben erledigt wurden (vgl. Absatz 7 dieser Vorschrift i.V.m. § 103 Abs. 6 GO <strong>NRW</strong>). Er ist dann<br />
dementsprechend zu formulieren.<br />
4.2 Zu Satz 2 (H<strong>in</strong>weise zum Bestätigungsvermerk):<br />
Nach der Vorschrift kann der Rechnungsprüfungsausschuss se<strong>in</strong>en Bestätigungsvermerk um H<strong>in</strong>weise ergänzen,<br />
die ihn nicht e<strong>in</strong>schränken. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung können Umstände auftreten, die den Abschlussprüfer<br />
veranlassen können, H<strong>in</strong>weise auf solche Umstände zu geben, auf die er <strong>in</strong> besonderer Weise<br />
aufmerksam machen will, die aber se<strong>in</strong> positives Prüfungsurteil über den Gesamtabschluss nicht e<strong>in</strong>schränken.<br />
Daher kann auch e<strong>in</strong> une<strong>in</strong>geschränkter Bestätigungsvermerk ergänzt werden, ohne dass er zugleich als e<strong>in</strong>geschränkter<br />
Bestätigungsvermerk zu gelten hat. Dazu gehören z.B. H<strong>in</strong>weise auf aus der Prüfung verbleibende<br />
wesentliche Unsicherheiten, auf noch laufende Verhandlungen bei wesentlichen Verträgen für die Geme<strong>in</strong>de, auf<br />
laufende Gerichtsverfahren u.a.<br />
5. Zu Absatz 5 (E<strong>in</strong>schränkungen des Bestätigungsvermerks):<br />
5.01 Inhalte der Vorschrift<br />
Die Vorschrift regelt das Nähere über die Pflicht zur Vornahme e<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>schränkung des Bestätigungsvermerks<br />
sowie über dessen Versagung im Rahmen der Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses. Sie präzisiert die<br />
Voraussetzungen für die Erteilung e<strong>in</strong>es e<strong>in</strong>geschränkten Bestätigungsvermerks. Die Vorschrift legt diese ebenfalls<br />
für die Fälle fest, <strong>in</strong> denen der Abschlussprüfer zu e<strong>in</strong>em negativen Prüfungsurteil im Rahmen se<strong>in</strong>er Prüfung<br />
GEMEINDEORDNUNG 656
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 101 GO <strong>NRW</strong><br />
des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses gelangt. Bei möglichen E<strong>in</strong>schränkungen se<strong>in</strong>es Bestätigungsvermerks<br />
muss der Abschlussprüfer neben dem i.d.R. positiven Befund se<strong>in</strong>er Prüfung auch den Inhalt und den Umfang<br />
der von ihm vorgenommenen E<strong>in</strong>schränkungen klar erkennen lassen. Derartige E<strong>in</strong>schränkungen s<strong>in</strong>d deshalb<br />
vom Abschlussprüfer so darzustellen, dass deren Tragweite auch für die Adressaten des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses<br />
erkennbar wird.<br />
5.1 Zu Satz 1 (Pflicht zur E<strong>in</strong>schränkung e<strong>in</strong>es Bestätigungsvermerks):<br />
Nach dieser Vorschrift ist die une<strong>in</strong>geschränkte Erklärung im Rahmen der Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses,<br />
dass die durchgeführte Prüfung zu ke<strong>in</strong>en Beanstandungen geführt hat, der Jahresabschluss auf<br />
Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse den gesetzlichen Vorschriften, Satzungen und sonstigen<br />
ortsrechtlichen Bestimmungen entspricht und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung<br />
e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage<br />
der Geme<strong>in</strong>de vermittelt (Erklärung nach Absatz 4 Satz 1 der Vorschrift), e<strong>in</strong>zuschränken oder zu versagen, wenn<br />
Beanstandungen ausgesprochen werden.<br />
Im Rahmen e<strong>in</strong>er geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlussprüfung können sich mögliche Beanstandungen daraus ergeben,<br />
dass Mängel bezüglich der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung bekannt geworden s<strong>in</strong>d, Verstöße gegen<br />
Ansatz-, Bewertungs- und Ausweisvorschriften für den Jahresabschluss, e<strong>in</strong>e Nichtbeachtung von Angabepflichten<br />
im Anhang, e<strong>in</strong> unvollständiger oder unzutreffender Lagebericht, Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften<br />
sowie gegen ergänzende Bestimmungen der Satzungen der Geme<strong>in</strong>de, z.B. die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung,<br />
und die sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen u.a. E<strong>in</strong>schränkungen können sich aber auch daraus ergeben,<br />
dass Teile des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses oder der Lagebericht entgegen den gesetzlichen Vorgaben<br />
nicht aufgestellt worden s<strong>in</strong>d.<br />
5.2 Zu Satz 2 (Erteilung e<strong>in</strong>es e<strong>in</strong>geschränkten Bestätigungsvermerks):<br />
Nach der Vorschrift darf vom Abschlussprüfer nur e<strong>in</strong> e<strong>in</strong>geschränkter Bestätigungsvermerk erteilt werden, wenn<br />
der von ihm geprüfte Jahresabschluss unter Beachtung der vom Prüfer vorgenommenen, <strong>in</strong> ihrer Tragweite erkennbaren<br />
E<strong>in</strong>schränkung e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen im Wesentlichen entsprechendes Bild der Vermögens-,<br />
Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de vermittelt. E<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>schränkung des Bestätigungsvermerks<br />
setzt voraus, dass die festgestellten Bestandungen und der betroffene abgrenzbare Bereich von wesentlicher<br />
Bedeutung für die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de s<strong>in</strong>d. Daher s<strong>in</strong>d auch die<br />
Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage der Geme<strong>in</strong>de festzustellen und zu beurteilen. Liegen mehrere Mängel<br />
vor, die für sich alle<strong>in</strong> genommen unwesentliche Mängel darstellen, so können diese <strong>in</strong> ihrer Gesamtheit so wesentlich<br />
se<strong>in</strong>, dass e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>schränkung des Bestätigungsvermerks geboten ist. Dies gilt entsprechend für die<br />
Feststellung, dass nicht beurteilbare Bereiche bei der Geme<strong>in</strong>de vorhanden s<strong>in</strong>d.<br />
Bei e<strong>in</strong>em e<strong>in</strong>geschränkten Bestätigungsvermerk muss für den Prüfer aber noch e<strong>in</strong> Positivbefund zu wesentlichen<br />
Teilen der geme<strong>in</strong>dlichen Rechnungslegung möglich se<strong>in</strong>. Jedoch können ggf. örtliche Anlässe dafür bestehen,<br />
dass durch den Prüfer e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>wendung zu erheben ist. E<strong>in</strong> Sachverhalt, der im Rahmen der Jahresabschlussprüfung<br />
beanstandet werden soll, muss auch noch zum Zeitpunkt des Abschlusses der Prüfung vorliegen.<br />
Werden dagegen festgestellte Fehler im Ablauf der Prüfung durch die Geme<strong>in</strong>de korrigiert, führt dies nicht zu<br />
e<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>schränkung des Bestätigungsvermerks. E<strong>in</strong> e<strong>in</strong>geschränkter Bestätigungsvermerk wird deshalb nur dann<br />
erteilt, wenn der Jahresabschluss zum Zeitpunkt des Abschlusses der örtlichen Prüfung unter Beachtung der vom<br />
Prüfer vorgenommenen und <strong>in</strong> ihrer Tragweite erkennbaren E<strong>in</strong>schränkungen e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen<br />
im Wesentlichen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de vermittelt.<br />
In diesen Fällen ist es dem Abschlussprüfer trotz wesentlicher Beanstandungen noch möglich, e<strong>in</strong>e positive<br />
Gesamtaussage zu treffen.<br />
GEMEINDEORDNUNG 657
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 101 GO <strong>NRW</strong><br />
5.3 Zu Satz 3 (Versagung des Bestätigungsvermerks):<br />
Die Vorschrift verlangt, dass <strong>in</strong> den Fällen, <strong>in</strong> denen im Rahmen der Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses<br />
die Beanstandungen so erheblich s<strong>in</strong>d, dass durch den geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss ke<strong>in</strong> den tatsächlichen<br />
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de<br />
mehr vermittelt wird, ist der Bestätigungsvermerk zu versagen. Der entscheidende Unterschied zu e<strong>in</strong>em e<strong>in</strong>geschränkten<br />
Bestätigungsvermerk besteht dar<strong>in</strong>, dass der Abschlussprüfer ke<strong>in</strong>e positive Gesamtaussage mehr<br />
zum geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss treffen kann. Im Rahmen der örtlichen Abschlussprüfung s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> diesen<br />
Fällen weder die Erfordernisse für e<strong>in</strong>en une<strong>in</strong>geschränkten Bestätigungsvermerk noch für e<strong>in</strong>en e<strong>in</strong>geschränkten<br />
Bestätigungsvermerk erfüllt.<br />
In diesen Fällen erfüllt der geme<strong>in</strong>dliche Jahresabschluss nicht mehr se<strong>in</strong>e Aufgabe, so dass unter Berücksichtigung<br />
der vom Prüfer vorgenommenen E<strong>in</strong>schränkung des Bestätigungsvermerks der Abschlussprüfer verpflichtet<br />
ist, den Bestätigungsvermerk im Rahmen se<strong>in</strong>er Jahresabschlussprüfung zu versagen. Die erheblichen Beanstandungen<br />
führen damit zu e<strong>in</strong>em negativen Prüfungsurteil des Abschlussprüfers und zur Erstellung e<strong>in</strong>es Versagungsvermerks<br />
und nicht zu e<strong>in</strong>em Bestätigungsvermerk. E<strong>in</strong>e Verpflichtung des Abschlussprüfers, gleichwohl<br />
für ordnungsmäßige Teile des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses bzw. für Teile der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft<br />
sowie der Rechnungslegung der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>e positive Aussage zu treffen, besteht dabei nicht. Würde<br />
e<strong>in</strong> Abschlussprüfer unterschiedliche Teilergebnisse im Rahmen se<strong>in</strong>er Prüfung vorstellen, ohne daraus e<strong>in</strong> Gesamtbild<br />
zu entwickeln, könnten daraus ggf. unnötige Missverständnisse bei den Adressaten des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Jahresabschlusses entstehen.<br />
5.4 Zu Satz 4 (Weitere Möglichkeit der Versagung):<br />
Nach der Vorschrift ist im Rahmen der Jahresabschlussprüfung e<strong>in</strong> Bestätigungsvermerk auch dann zu versagen,<br />
wenn der Prüfer nach Ausschöpfung aller angemessenen Möglichkeiten zur Klärung des Sachverhaltes nicht <strong>in</strong><br />
der Lage ist, e<strong>in</strong>e Beurteilung abzugeben. Die Regelung bedeutet zwar auch e<strong>in</strong>e Versagung des Bestätigungsvermerks,<br />
sie be<strong>in</strong>haltet aber ke<strong>in</strong> negatives Prüfungsurteil. Sie br<strong>in</strong>gt vielmehr zum Ausdruck, dass der Prüfer<br />
nicht <strong>in</strong> der Lage ist, e<strong>in</strong> Prüfungsurteil abzugeben. In diesen Fällen muss der Prüfer alle rechtlich zulässigen und<br />
die wirtschaftlich vertretbaren Möglichkeiten zur Klärung des Sachverhalts ausgeschöpft haben. Auch <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
solchem Fall ist vom Abschlussprüfer e<strong>in</strong> Versagungsvermerk zu erstellen.<br />
5.5 Zu Satz 5 (Erstellung e<strong>in</strong>es Versagungsvermerks):<br />
Die Vorschrift verlangt, dass <strong>in</strong> den Fällen, <strong>in</strong> denen im Rahmen der Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses<br />
der Bestätigungsvermerks zu versagen ist, die Versagung ist <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Vermerk, der nicht als Bestätigungsvermerk<br />
zu bezeichnen ist, aufzunehmen ist. Die Versagung e<strong>in</strong>es Bestätigungsvermerks stellt deshalb e<strong>in</strong>erseits<br />
ke<strong>in</strong>en Bestätigungsvermerk dar. Andererseits ist der vom Abschlussprüfer zu erstellende Vermerk als „Versagungsvermerk“<br />
zu bezeichnen. In e<strong>in</strong>em Versagungsvermerk s<strong>in</strong>d vom Abschlussprüfer alle wesentlichen Gründe<br />
für die Versagung zu beschreiben und zu erläutern. Ist der Prüfer nicht <strong>in</strong> der Lage ist, e<strong>in</strong> Prüfungsurteil abzugeben,<br />
hat er <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Versagungsvermerk die Prüfungshemmnisse zu benennen und ihre Auswirkungen<br />
aufzuzeigen. Er sollte auch darlegen, dass er alle rechtlich zulässigen und die wirtschaftlich vertretbaren Möglichkeiten<br />
zur Klärung des Sachverhalts ausgeschöpft hat, um e<strong>in</strong>en Bestätigungsvermerk erteilen zu können.<br />
5.6 Zu Satz 6 (Pflicht zur Begründung der E<strong>in</strong>schränkung oder Versagung):<br />
Nach der Vorschrift ist die E<strong>in</strong>schränkung oder Versagung e<strong>in</strong>es Bestätigungsvermerks im Rahmen der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Abschlussprüfung zu begründen. Diese gesonderte gesetzliche Vorgabe e<strong>in</strong>er Begründungspflicht ist we-<br />
GEMEINDEORDNUNG 658
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 101 GO <strong>NRW</strong><br />
gen der Bedeutung der E<strong>in</strong>schränkung e<strong>in</strong>es Bestätigungsvermerks oder se<strong>in</strong>er Versagung durch den Abschlussprüfer<br />
sachgerecht. Die E<strong>in</strong>schränkung oder die Versagung e<strong>in</strong>es Bestätigungsvermerks muss durch den<br />
Abschlussprüfer so formuliert werden, dass die wesentlichen Gründe für die E<strong>in</strong>schränkung oder Versagung für<br />
die Adressaten des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses klar erkennbar werden. E<strong>in</strong>e Darstellung der Tragweite der<br />
Versagung unter der Angabe der Größe der festgestellten Mängel, die zur Versagung des Bestätigungsvermerks<br />
geführt haben, sollte wegen des Interesses der Geme<strong>in</strong>de an der Beseitigung festgestellter Mängel erfolgen. Der<br />
Umfang der Darstellung liegt dabei im Ermessen des Abschlussprüfers, gleichwohl sollten die Teile der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Rechnungslegung ausdrücklich vom Abschlussprüfer benannt werden, auf Grund dessen er se<strong>in</strong>en Bestätigungsvermerk<br />
e<strong>in</strong>geschränkt oder ihn versagt hat.<br />
6. Zu Absatz 6 (E<strong>in</strong>beziehung des Lageberichtes <strong>in</strong> die Abschlussprüfung):<br />
6.1 Zu Satz 1 (Beurteilung des Lageberichtes):<br />
Nach der Vorschrift hat sich die Beurteilung des Prüfungsergebnisses im Rahmen des vom Abschlussprüfer zu<br />
erstellenden Bestätigungsvermerks auch darauf zu erstrecken, ob der Lagebericht mit dem geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss<br />
<strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang steht und <strong>in</strong>sgesamt e<strong>in</strong>e zutreffende Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags-<br />
und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de vermittelt. Die Regelung befasst sich mit der Pflicht des Abschlussprüfers,<br />
die Ausführungen im Lagebericht der Geme<strong>in</strong>de zu beurteilen. Er soll danach den geme<strong>in</strong>dlichen Lagebericht<br />
auch unter dem Gesichtpunkt der Übere<strong>in</strong>stimmung mit dem Jahresabschluss der Geme<strong>in</strong>de bewerten.<br />
6.2 Zu Satz 2 (Beurteilung der Darstellung der geme<strong>in</strong>dlichen Entwicklung):<br />
Nach der Vorschrift hat der Prüfer des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses im Rahmen se<strong>in</strong>er Beurteilung des<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Lageberichtes auch darauf e<strong>in</strong>zugehen, ob die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung<br />
der Geme<strong>in</strong>de zutreffend im Lagebericht dargestellt s<strong>in</strong>d. Wegen der Bedeutung des Jahresabschlusses für die<br />
künftige Entwicklung der Geme<strong>in</strong>de soll der Abschlussprüfer auch die Darstellung der Geme<strong>in</strong>de über ihre Chancen<br />
und Risiken <strong>in</strong> se<strong>in</strong>e Beurteilung e<strong>in</strong>beziehen.<br />
E<strong>in</strong>e Grundlage der Beurteilung der künftigen wirtschaftlichen Lage der Geme<strong>in</strong>de stellen <strong>in</strong>sbesondere die Vermögenslage<br />
und die F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de dar. Negative Entwicklungen <strong>in</strong> der Vermögens- und Kapitalstruktur,<br />
e<strong>in</strong>e starke Verr<strong>in</strong>gerung des Eigenkapitals, hohe außerplanmäßige Abschreibungen, e<strong>in</strong> starker Anstieg der<br />
Belastung von Vermögenswerten zur Sicherung von Verb<strong>in</strong>dlichkeiten, geben im Rahmen der vorzunehmenden<br />
Abschlussprüfung e<strong>in</strong>en Anlass, ke<strong>in</strong>e globalen H<strong>in</strong>weise dazu zu geben, sondern e<strong>in</strong>e konkretere Analyse und<br />
Bewertung vorzunehmen. Dazu bietet sich auch die Verwendung von Kennzahlen an, <strong>in</strong>sbesondere dann, wenn<br />
durch e<strong>in</strong>en Vergleich über e<strong>in</strong>en längeren Zeitraum e<strong>in</strong> Trend erkennbar gemacht werden soll.<br />
7. Zu Absatz 7 (Unterzeichnung des Bestätigungsvermerks):<br />
7.1 Zwecke der Unterzeichnung<br />
7.1.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Der Bestätigungsvermerk, <strong>in</strong> dem der Rechnungsprüfungsausschuss se<strong>in</strong> Prüfungsergebnis über den geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Jahresabschluss zusammenfasst (vgl. § 101 Abs. 3 S. 1 GO <strong>NRW</strong>) oder der Vermerk über die Versagung<br />
des Bestätigungsvermerks ist nach der Vorschrift unter Angabe von Ort und Tag vom Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses<br />
zu unterzeichnen. Diese ausdrückliche Vorgabe soll die Verantwortlichkeit des<br />
Rechnungsprüfungsausschusses verdeutlichen und dient als Beweisfunktion für die Prüfungstätigkeit dieses<br />
GEMEINDEORDNUNG 659
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 101 GO <strong>NRW</strong><br />
Ausschusses sowie der Dokumentation se<strong>in</strong>er Prüfungstätigkeit. E<strong>in</strong> solcher Bestätigungsvermerk ist entsprechend<br />
des durchgeführten Prüfungsumfanges und des Prüfungsergebnisses zu formulieren (vgl. § 101 Abs. 3 bis<br />
5 GO <strong>NRW</strong>).<br />
Die Unterzeichnungspflicht stellt e<strong>in</strong>e ausdrückliche M<strong>in</strong>destanforderung dar, die vor der Feststellung geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Jahresabschluss nach § 96 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> zu erfüllen ist. In denen Fällen, <strong>in</strong> denen ke<strong>in</strong> unterzeichneter<br />
Bestätigungsvermerk oder ke<strong>in</strong> unterzeichneter Vermerk über die Versagung vorliegen, ist die örtliche Prüfung<br />
des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses als noch nicht abgeschlossen zu bewerten. In diesen Fällen darf der Rat<br />
der Geme<strong>in</strong>de den geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss noch nicht feststellen und die Ratsmitglieder dürfen auch<br />
noch ke<strong>in</strong>e Entlastung des Bürgermeisters beschließen (vgl. § 96 GO <strong>NRW</strong>). Der Bestätigungsvermerk sollte <strong>in</strong><br />
allen Fällen jeweils das Datum des Tages tragen, an dem für die Prüfer<strong>in</strong> oder den Prüfer jeweils die Prüfung des<br />
Jahresabschlusses materiell abgeschlossen ist.<br />
7.1.2 E<strong>in</strong>e oder mehrere Unterschriften<br />
Durch die Unterzeichnung des Bestätigungsvermerks wird dokumentiert, ob und <strong>in</strong>wieweit vorherige auftragsbezogene<br />
Prüfungsergebnisse <strong>in</strong> den Bestätigungsvermerks e<strong>in</strong>bezogen werden. Abhängig vom jeweiligen Prüfungsergebnis<br />
ist zuvor durch jede an der örtlichen Prüfung beteiligte Stelle zu entscheiden, ob und <strong>in</strong> welchem<br />
Umfang der ihr vorgelegte Bestätigungsvermerk übernommen wird. Soweit ke<strong>in</strong>e Änderungen oder Ergänzungen<br />
des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers durch die nächste Prüf<strong>in</strong>stanz, z.B. die örtliche Rechnungsprüfung<br />
oder der Rechnungsprüfungsausschuss, erforderlich s<strong>in</strong>d, bedarf es nicht jeweils e<strong>in</strong>es eigenständigen Bestätigungsvermerks.<br />
In diesen Fällen kann der im Rahmen der Prüfung zuerst erstellte Bestätigungsvermerk unter<br />
Angabe des Ortes und des Datums durch eigenhändige Unterzeichnungen der Verantwortlichen der jeweiligen<br />
Prüfungs<strong>in</strong>stanz entsprechend ergänzt werden.<br />
7.2 Wirkungen der Unterzeichnung<br />
7.2.1 Allgeme<strong>in</strong>e Verantwortlichkeiten<br />
Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses als zuständige Prüf<strong>in</strong>stanz erfüllt mit der Unterzeichnung<br />
des Bestätigungsvermerks e<strong>in</strong>e öffentlich-rechtliche Verpflichtung. Damit wird ausreichend die Verantwortung des<br />
Ausschusses als Nachweis im S<strong>in</strong>ne der Vorschrift dokumentiert. Die Unterzeichnung spiegelt nicht die persönliche<br />
Verantwortlichkeit des Ausschussvorsitzenden als Ratsmitglied wieder, sondern obliegt auch der Treuepflicht<br />
nach § 32 GO <strong>NRW</strong>. Der Ausschussvorsitzende br<strong>in</strong>gt mit se<strong>in</strong>er Unterschrift im S<strong>in</strong>ne der Prüfungszuständigkeit<br />
des Ausschusses daher zum Ausdruck, dass die Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses durch den<br />
Rechnungsprüfungsausschuss abgeschlossen und aus der Verantwortung des Ausschusses heraus der Bestätigungsvermerk<br />
richtig und vollständig ist.<br />
Mit der Unterzeichnung des Bestätigungsvermerks wird zudem festgestellt, dass das Ergebnis des wirtschaftlichen<br />
Handelns der Geme<strong>in</strong>de im abgelaufenen Haushaltsjahr nach festgelegten haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen<br />
Regeln erfolgt und nachgewiesen worden ist. Außerdem wird bestätigt, dass durch den<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung e<strong>in</strong> den tatsächlichen<br />
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de<br />
vermittelt wird. Auch wird festgestellt, dass aus der Verantwortung des Ausschusses heraus der Bestätigungsvermerk<br />
oder der Vermerk über se<strong>in</strong>e Versagung richtig und vollständig ist, sofern dazu ke<strong>in</strong>e besonderen E<strong>in</strong>schränkungen<br />
durch den Ausschuss gemacht oder ggf. ergänzende H<strong>in</strong>weise dazu gegeben werden.<br />
Die Verpflichtung zur Unterzeichnung des Bestätigungsvermerks be<strong>in</strong>haltet dabei nicht, dass der Vorsitzende des<br />
Rechnungsprüfungsausschusses auch sämtliche Bestandteile und Anlagen des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlus-<br />
GEMEINDEORDNUNG 660
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 101 GO <strong>NRW</strong><br />
ses durch se<strong>in</strong>e Unterschrift besonders kennzeichnen muss. Es bietet sich jedoch an, den geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss<br />
und den Bestätigungsvermerks als Prüfungsergebnis ggf. buchtechnisch so zusammen zu fassen,<br />
dass erkennbar und nachvollziehbar wird, ob sich die Unterschrift des Ausschussvorsitzenden auf die Gesamtheit<br />
aller Teile des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss bezieht.<br />
7.2.2 Die Mitwirkung bei der Feststellung<br />
Für die Mitwirkung des Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses am Feststellungsbeschluss des Rates<br />
der Geme<strong>in</strong>de über den geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss ist örtlich zu beurteilen, ob diese Mitwirkung sachlich<br />
geboten ist. E<strong>in</strong>erseits ist der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses e<strong>in</strong> Mitglied im Rat der Geme<strong>in</strong>de<br />
und ihm steht daher e<strong>in</strong> Stimmrecht zu. Andererseits schränkt die Vorschrift des § 31 die Rechte von Ratsmitgliedern<br />
nur für den Fall e<strong>in</strong>, dass die <strong>in</strong> der Vorschrift genannten Ausschließungsgründe vorliegen, so dass die<br />
betreffenden Ratsmitglieder dann <strong>in</strong> der Sache als befangen gelten. In ke<strong>in</strong>er Vorschrift der Geme<strong>in</strong>deordnung<br />
wird aber der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses ausdrücklich von der Teilnahme an der Abstimmung<br />
über die Feststellung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses ausgeschlossen.<br />
In der Sache „Feststellung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses“ dürfte es jedoch aus Verfahrensgründen heraus<br />
geboten se<strong>in</strong>, dass der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses auf die Ausübung se<strong>in</strong>es ihm zustehenden<br />
Stimmrechtes verzichtet. Nach § 101 Abs. 7 GO <strong>NRW</strong> hat der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses<br />
nach der Prüfung des ihm vom Rat übergebenen Entwurf des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses<br />
den dazugehörigen Bestätigungsvermerk zu unterzeichnen, bevor er den geprüften Entwurf wieder dem Rat<br />
zurückgibt. Diese Pflicht ist ausdrücklich <strong>in</strong> der Vorschrift bestimmt worden. Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses<br />
übernimmt durch se<strong>in</strong>e Unterzeichnung die Verantwortung für das Ergebnis der Abschlussprüfung,<br />
denn der Ausschuss ist gesetzlich für diese Prüfung zuständig (vgl. § 59 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong>).<br />
8. Zu Absatz 8 (Beteiligung der örtlichen Rechnungsprüfung):<br />
8.1 Zu Satz 1 (Durchführung der Prüfung):<br />
Nach der der Vorschrift bedient sich der Rechnungsprüfungsausschuss im Rahmen se<strong>in</strong>er Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Jahresabschlusses der örtlichen Rechnungsprüfung. Dadurch wird die allgeme<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>deverfassungsrechtliche<br />
Regelung <strong>in</strong> § 59 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong> nochmals ausdrücklich für die Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses<br />
wiederholt. Es wird zudem dadurch klargestellt, dass dem örtlichen Rechnungsprüfungsausschuss<br />
die Gesamtverantwortung für die Jahresabschlussprüfung obliegt. Er trägt auch die Verantwortung für die Durchführung<br />
der Prüfung, wenn er sich der örtlichen Rechnungsprüfung oder für die Durchführung der Abschlussprüfung<br />
e<strong>in</strong>es Dritter bedient. Auch bei E<strong>in</strong>schaltung e<strong>in</strong>es Dritten durch die örtliche Rechnungsprüfung kommt es<br />
nicht zur Reduzierung se<strong>in</strong>er Prüfungsverantwortung, denn die örtliche Rechnungsprüfung kann sich nur mit<br />
Zustimmung des Rechnungsprüfungsausschusses e<strong>in</strong>es Dritten bedienen (vgl. § 103 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong>).<br />
8.2 Zu Satz 2 (Bestätigungsvermerk im Rahmen des Prüfungsauftrages):<br />
8.2.1 Die Pflicht zur Abgabe e<strong>in</strong>es Bestätigungsvermerks<br />
Durch den Verweis auf die Absätze 3 bis 7 dieser Vorschrift ist ausdrücklich bestimmt worden, dass bereits die<br />
Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung oder Dritte als Prüfer im Rahmen ihres Prüfungsauftrages und ihrer vorzunehmenden<br />
Beurteilung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses e<strong>in</strong>en Bestätigungsvermerk abzugeben haben.<br />
E<strong>in</strong> Bestätigungsvermerk hat immer Außenwirkung, weil durch e<strong>in</strong>en solchen Vermerk das Ergebnis der Prüfung<br />
dokumentiert und dem Auftraggeber gegenüber offengelegt wird. Diese Gegebenheiten erfordern, abhängig vom<br />
GEMEINDEORDNUNG 661
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 101 GO <strong>NRW</strong><br />
jeweiligen Prüfungsergebnis, dass jeder an der Jahresabschlussprüfung beteiligte Prüfer oder Prüfungsstelle<br />
e<strong>in</strong>en Bestätigungsvermerk zu erstellen hat. Darauf kann grundsätzlich nicht verzichtet werden. Auch ist vom<br />
Prüfer oder der Prüfungsstelle eigenverantwortlich über die Form der Ausfertigung des Bestätigungsvermerks und<br />
die Formulierung zu entscheiden.<br />
8.2.2 Die Vorlage auftragsbezogener Bestätigungsvermerke<br />
Dem Rechnungsprüfungsausschuss der Geme<strong>in</strong>de müssen im Rahmen der geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlussprüfung<br />
nicht alle erstellten auftragsbezogenen Bestätigungsvermerke der beteiligten Dritten vorgelegt werden. Es ist<br />
vielmehr ausreichend, wenn die für die örtliche Rechnungsprüfung als regelmäßig für die Durchführung der Abschlussprüfung<br />
verantwortliche letzte Stelle e<strong>in</strong>en auf ihr Prüfungsergebnis bezogenen Bestätigungsvermerk<br />
verfasst. Sie hat diesen Bestätigungsvermerk dem Rechnungsprüfungsausschuss vorzulegen, der die Gesamtverantwortung<br />
für die ordnungsgemäße Prüfung des Jahresabschlusses gegenüber dem Rat der Geme<strong>in</strong>de trägt.<br />
In diesem Bestätigungsvermerk s<strong>in</strong>d aber auch die Prüfungsergebnisse bzw. Bestätigungsvermerke der an der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlussprüfung zuvor beteiligten anderen Abschlussprüfer zu berücksichtigen. In E<strong>in</strong>zelfällen<br />
kann es s<strong>in</strong>nvoll se<strong>in</strong>, auch auf auftragsbezogene Bestätigungsvermerke zu verweisen und diese dann<br />
auch dem eigenen Bestätigungsvermerk beizufügen.<br />
Dem Rechnungsprüfungsausschuss steht <strong>in</strong> diesem Verfahren das Recht zu, beim Auftreten von Mängeln oder<br />
wenn er aus sonstigen Gründen das <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Bestätigungsvermerk verankerte Prüfungsergebnis nicht mitgetragen<br />
kann, <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Bestätigungsvermerk das aus se<strong>in</strong>er Sicht zutreffende Ergebnis darzustellen. E<strong>in</strong> Recht der<br />
vorher Beteiligten sich dazu zu äußern, steht diesem im Rahmen der Beratungen über die Feststellung des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Jahresabschlusses nur dann zu, wenn diese gesondert im Rahmen der Tätigkeit des Rates der Geme<strong>in</strong>de<br />
vorgesehen ist.<br />
8.2.3 Der Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses<br />
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat eigenverantwortlich zu entscheiden, ob er sich bei se<strong>in</strong>er Prüfung des<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses auf den ihm vorgelegten Bestätigungsvermerk der örtlichen Rechnungsprüfung<br />
stützen will. Er kann diesen durch e<strong>in</strong>e entsprechende Ergänzung auch zu se<strong>in</strong>em eigenen Bestätigungsvermerk<br />
machen. Dieses gilt entsprechend für die örtliche Rechnungsprüfung, wenn sie für ihre Prüfung e<strong>in</strong>en<br />
Dritten beauftragt hat (vgl. § 103 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong>). Es liegt immer <strong>in</strong> der Verantwortung des jeweiligen Auftraggebers,<br />
ob er den ihm vorgelegten Bestätigungsvermerk <strong>in</strong> vollem Umfang übernimmt oder diesen ergänzt, ändert<br />
oder ihm e<strong>in</strong>e eigene Form gibt.<br />
Dem Rat der Geme<strong>in</strong>de kann daher auch e<strong>in</strong> Bestätigungsvermerk vorgelegt werden, der von mehreren Prüfern<br />
oder Prüfungsstellen nach den Regeln des Absatzes 7 unterzeichnet wurde. Sie s<strong>in</strong>d aber <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em solchen Fall<br />
gleichwohl zu e<strong>in</strong>er eigenen Prüfung verpflichtet, um zu entscheiden, ob e<strong>in</strong> vorgelegter Bestätigungsvermerk <strong>in</strong><br />
vollem Umfang <strong>in</strong>haltlich übernommen, abgeändert oder ergänzt wird. Das Prüfungsergebnis muss dann auf dem<br />
betreffenden Bestätigungsvermerk durch e<strong>in</strong>e entsprechende Ergänzung und e<strong>in</strong>e Unterzeichnung nach Absatz 7<br />
nachvollziehbar und transparent gemacht werden. Die besondere Verpflichtung der Prüfer und prüfenden Stellen,<br />
e<strong>in</strong>en auf ihre Prüfung bezogenen Bestätigungsvermerk zu verfassen, ist im Gefüge des geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsrechts<br />
wegen ihrer Verantwortung als Abschlussprüfer des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses geboten.<br />
8.2.4 Die Unterzeichnungspflicht beim Bestätigungsvermerk<br />
Die Unterzeichnungspflicht für den Bestätigungsvermerk oder der Versagungsvermerk zur Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Jahresabschlusses besteht für alle an der Jahresabschlussprüfung beteiligten Prüfer und Prüf<strong>in</strong>stanzen.<br />
GEMEINDEORDNUNG 662
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 101 GO <strong>NRW</strong><br />
Auch bei ihnen sollte der Bestätigungsvermerk oder der Vermerk über se<strong>in</strong>e Versagung jeweils das Datum des<br />
Tages tragen, an dem für sie die Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses materiell abgeschlossen ist. Mit<br />
der Unterzeichnung des Bestätigungsvermerks erfüllen auch sie im Rahmen ihrer Prüfung ihre Verpflichtung und<br />
br<strong>in</strong>gen damit zum Ausdruck, dass für sie die Prüfung des Jahresabschlusses abgeschlossen ist und aus ihrer<br />
Verantwortung heraus der Bestätigungsvermerk oder der Vermerk oder se<strong>in</strong>e Versagung richtig und vollständig<br />
ist, sofern von ihnen dazu ke<strong>in</strong>e besonderen E<strong>in</strong>schränkungen gemacht worden s<strong>in</strong>d oder H<strong>in</strong>weise gegeben<br />
werden.<br />
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ<br />
GEMEINDEORDNUNG 663
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 102 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 102<br />
Örtliche Rechnungsprüfung<br />
(1) 1 Kreisfreie Städte, Große und Mittlere kreisangehörige Städte haben e<strong>in</strong>e örtliche Rechnungsprüfung e<strong>in</strong>zurichten.<br />
2 Die übrigen Geme<strong>in</strong>den sollen sie e<strong>in</strong>richten, wenn e<strong>in</strong> Bedürfnis hierfür besteht und die Kosten <strong>in</strong> angemessenem<br />
Verhältnis zum Nutzen stehen.<br />
(2) 1 Kreisangehörige Geme<strong>in</strong>den können mit dem Kreis e<strong>in</strong>e öffentlich-rechtliche Vere<strong>in</strong>barung mit dem Inhalt<br />
abschließen, dass die örtliche Rechnungsprüfung des Kreises die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>er Geme<strong>in</strong>de gegen Kostenerstattung wahrnimmt. 2 Die Vere<strong>in</strong>barung kann auch vorsehen, dass die Rechnungsprüfung<br />
des Kreises nur e<strong>in</strong>zelne Aufgabengebiete der Rechnungsprüfung <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>de wahrnimmt.<br />
3 Soweit die örtliche Rechnungsprüfung des Kreises die Rechnungsprüfung <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>de wahrnimmt, bedient<br />
sich der Rechnungsprüfungsausschuss der Geme<strong>in</strong>de bei der Erfüllung se<strong>in</strong>er Aufgaben der Rechnungsprüfung<br />
des Kreises.<br />
(3) Absatz 1 f<strong>in</strong>det für kreisangehörige Geme<strong>in</strong>den ke<strong>in</strong>e Anwendung, bei denen die örtliche Rechnungsprüfung<br />
des Kreises gemäß Absatz 2 Satz 1 die örtliche Rechnungsprüfung bei der Geme<strong>in</strong>de wahrnimmt.<br />
Erläuterungen zu § 102:<br />
I. Allgeme<strong>in</strong>es<br />
1. Die Pflicht der Geme<strong>in</strong>de zur eigenen örtlichen Rechnungsprüfung<br />
1.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die örtliche Rechnungsprüfung ist bei den kreisfreien Städten, den Großen und den Mittleren kreisangehörigen<br />
Städten regelmäßig e<strong>in</strong>e Organisationse<strong>in</strong>heit <strong>in</strong>nerhalb der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung, denn diese Städte haben<br />
e<strong>in</strong>e örtliche Rechnungsprüfung e<strong>in</strong>zurichten. Die übrigen Geme<strong>in</strong>den sollen e<strong>in</strong>e Organisationse<strong>in</strong>heit „Örtliche<br />
Rechnungsprüfung“ e<strong>in</strong>richten, wenn bei ihnen dafür e<strong>in</strong> Bedürfnis besteht und die Kosten <strong>in</strong> angemessenem<br />
Verhältnis zum Nutzen stehen. Grundsätzlich muss daher die Geme<strong>in</strong>de als Aufgabenträger handeln, denn der<br />
Gesetzgeber hat ihr ausdrücklich die dafür erforderlichen Kompetenzen e<strong>in</strong>geräumt. Er hat die Geme<strong>in</strong>de als<br />
geeignet angesehen, dass sie die ihr zugewiesenen Prüfungsaufgaben mit der notwendigen personellen und<br />
sächlichen Ausstattung erfüllen und den ordnungsgemäßen Gang der Prüfungsgeschäfte sicherstellen kann.<br />
Im NKF ist daher nach den gesetzlichen Bestimmungen das haushaltswirtschaftliche Handeln der Geme<strong>in</strong>de<br />
örtlich durch die Geme<strong>in</strong>de selbst und überörtlich durch die Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen zu<br />
prüfen. Die örtliche Prüfung der Geme<strong>in</strong>de ist dabei e<strong>in</strong> unverzichtbares Instrument für e<strong>in</strong>e zeitnahe Kontrolle der<br />
Gesetz- und Ordnungsmäßigkeit des wirtschaftlichen Handelns der Geme<strong>in</strong>de sowie der Behandlung der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Geschäftsvorfälle mit haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen.<br />
1.2 Die Gestaltung der örtlichen Prüfung<br />
1.2.1 Der Begriff „Örtliche Prüfung“<br />
Der Landesgesetzgeber hat den Begriff „Örtliche Prüfung“ zwar nicht näher bestimmt, doch hat er <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>deordnung<br />
festgelegt, dass <strong>in</strong> jeder Geme<strong>in</strong>de der Rat e<strong>in</strong>en Rechnungsprüfungsausschuss zu bilden hat (vgl. §<br />
57 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>). Diesem Ausschuss s<strong>in</strong>d zudem bestimmte Aufgaben zugewiesen worden (vgl. § 59 Abs. 3<br />
GO <strong>NRW</strong>), die Gegenstand der örtlichen Prüfung <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>de se<strong>in</strong> sollen. Durch den Landesgesetzgeber<br />
GEMEINDEORDNUNG 664
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 102 GO <strong>NRW</strong><br />
wurde zudem bestimmt, dass Geme<strong>in</strong>den ab e<strong>in</strong>er bestimmten Größe zusätzlich e<strong>in</strong>e örtliche Rechnungsprüfung<br />
e<strong>in</strong>zurichten haben, d.h. <strong>in</strong>nerhalb der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung muss e<strong>in</strong>e eigenständige Organisationse<strong>in</strong>heit<br />
für die Durchführung der gesetzlich vorgesehenen Prüfungen bestehen.<br />
Aus diesen Vorgaben folgt, dass sowohl der Rat als Verfassungsorgan als auch die geme<strong>in</strong>dliche Verwaltung an<br />
der örtlichen Prüfung beteiligt se<strong>in</strong> müssen. Die örtliche Prüfung umfasst daher die mite<strong>in</strong>ander verknüpfte Tätigkeit<br />
des Rechnungsprüfungsausschusses des Rates und der „Örtlichen Rechnungsprüfung“. Beide Prüfungsberechtigte<br />
stehen <strong>in</strong> unmittelbarer Verb<strong>in</strong>dung mit dem Rat der Geme<strong>in</strong>de. Die Durchführung der örtlichen Prüfung<br />
setzt e<strong>in</strong>e unabhängige Stellung der örtlichen Rechnungsprüfung voraus, denn beide E<strong>in</strong>heiten wirken als entscheidungsvorbereitende<br />
Stellen und Informationsquellen für den Rat der Geme<strong>in</strong>de, auch wenn die örtliche<br />
Rechnungsprüfung im Rahmen der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung erledigt wird (vgl. § 104 GO <strong>NRW</strong>),<br />
1.2.2 Der Rechnungsprüfungsausschuss<br />
Dem Rat der Geme<strong>in</strong>de kommt neben se<strong>in</strong>em Budgetrecht auch e<strong>in</strong>e Kontrollaufgabe zu. Die Prüfungsaufgabe<br />
ist dem Rechnungsprüfungsausschuss als e<strong>in</strong>en von drei Pflichtausschüssen des Rates gesetzlich übertragen<br />
worden (vgl. § 57 i.V.m. § 59 GO <strong>NRW</strong>). Der Rechnungsprüfungsausschuss soll zeitnah zu den geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Abschlüssen se<strong>in</strong>e Prüfungstätigkeit durchführen und zur Entlastung und Erleichterung der Arbeit des Rates der<br />
Geme<strong>in</strong>de beitragen. Er soll aber auch - wie die anderen Ausschüsse des Rates - die Beschlüsse des Rates<br />
sachverständig vorbereiten und zu den Vorlagen der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung sachgerechte Stellungnahmen<br />
und Empfehlungen abgeben.<br />
Diese Sachlage wird bestärkt durch die Festlegung, dass <strong>in</strong> kle<strong>in</strong>eren Geme<strong>in</strong>den, bei denen <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Verwaltung ke<strong>in</strong>e örtlichen Rechnungsprüfung (vgl. § 102 GO <strong>NRW</strong>) besteht, sich der Rechnungsprüfungsausschuss<br />
auch unmittelbar Dritter gem. § 103 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong> bedienen kann. Beide prüfungsberechtigte Stellen<br />
stehen <strong>in</strong> unmittelbarer Verb<strong>in</strong>dung zue<strong>in</strong>ander und arbeiten dem Rat der Geme<strong>in</strong>de zu (vgl. § 57 Abs. 2 und<br />
§ 104 GO <strong>NRW</strong>). Die Aufgaben der örtlichen Prüfung s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> § 103 GO <strong>NRW</strong> näher bestimmt worden.<br />
1.2.3 Die örtliche Rechnungsprüfung<br />
Bei der Festlegung der Verpflichtung zur E<strong>in</strong>richtung e<strong>in</strong>er örtlichen Rechnungsprüfung durch kreisfreie Städte,<br />
Große und Mittlere kreisangehörige Städte ist davon ausgegangen worden, dass die umfangreichen örtlichen<br />
Verwaltungsaufgaben, die <strong>in</strong>sbesondere durch die notwendige Dase<strong>in</strong>svorsorge und die Erledigung von Pflichtaufgaben<br />
bestimmt werden, e<strong>in</strong>e örtliche Prüfung erfordern. Die übrigen kreisangehörigen können dagegen e<strong>in</strong>e<br />
örtliche Rechnungsprüfung e<strong>in</strong>richten, wenn dafür e<strong>in</strong> Bedürfnis besteht. Die Vorschrift wurde deshalb <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en<br />
Zusammenhang mit dem gesetzlich bestimmten Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung (vgl. § 103 GO <strong>NRW</strong>)<br />
und der gesetzlich bestimmten Stellung der Leitung und der Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung (vgl. § 104<br />
GO <strong>NRW</strong>) gestellt.<br />
Die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung gehen <strong>in</strong>sgesamt weit über die Vorgaben <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>deordnung<br />
h<strong>in</strong>aus, denn vielfach werden der örtlichen Rechnungsprüfung auch Aufgaben durch Fachgesetze oder andere<br />
Vorschriften zugewiesen, die zu e<strong>in</strong>em sich weiter zu entwickelnden Anforderungsprofil an die Aufgabenerledigung<br />
und an die Prüfer führen. Auch die E<strong>in</strong>führung komplexer Verfahren <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung erfordert<br />
zeitgemäße, sachlich und fachlich zweckmäßige Handlungsweisen. Die örtliche Prüfung stellt daher vielfach<br />
bereits e<strong>in</strong>e „begleitende“ Prüfung dar und wird nicht erst zu e<strong>in</strong>em Zeitpunkt aktiv, zu dem Verwaltungsentscheidungen<br />
kaum noch umkehrbar s<strong>in</strong>d.<br />
Aus diesen Pflichten folgt auch die Pflicht der Geme<strong>in</strong>de, ihre örtliche Rechnungsprüfung ausreichend mit fachlich<br />
qualifizierten Personal und Sachmitteln auszustatten, um die ordnungsgemäße Aufgabenerledigung der ge-<br />
GEMEINDEORDNUNG 665
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 102 GO <strong>NRW</strong><br />
setzlichen Aufgaben (vgl. § 103 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>) und der übertragenen Aufgaben (vgl. § 103 Abs. 2 und 3 GO<br />
<strong>NRW</strong>) sicher zu stellen. In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass sich die örtliche Rechnungsprüfung<br />
mit Zustimmung des Rechnungsprüfungsausschusses ggf. Dritter als Prüfer bedienen kann (vgl. §<br />
103 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong>).<br />
2. Die überörtliche Prüfung<br />
Die überörtliche Prüfung ist - wie die örtliche Prüfung der Geme<strong>in</strong>de - e<strong>in</strong> unverzichtbares Instrument für e<strong>in</strong>e<br />
Kontrolle der Gesetz- und Ordnungsmäßigkeit des wirtschaftlichen Handelns der Geme<strong>in</strong>de sowie der haushaltswirtschaftlichen<br />
Geschäftsvorfälle der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung. Sie ist Teil der staatlichen Aufsicht des<br />
Landes über die Geme<strong>in</strong>den und wird durch die Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen ausgeübt. In die<br />
Durchführung der überörtlichen Prüfung s<strong>in</strong>d die vorhandenen Ergebnisse der örtlichen Rechnungsprüfung zu<br />
berücksichtigen (vgl. § 105 Abs. 3 S. 2 GO <strong>NRW</strong>). Die örtliche Rechnungsprüfung der Geme<strong>in</strong>de stellt daher<br />
e<strong>in</strong>e Informationsquelle für die überörtliche Prüfung der Geme<strong>in</strong>de dar.<br />
Die überörtliche Prüfung soll e<strong>in</strong>e fachkundige Prüfung der Geme<strong>in</strong>den unter den Gesichtspunkten der staatlichen<br />
Aufsicht ermöglichen. Wegen dieser außerhalb der Aufsichtsbehörden der Geme<strong>in</strong>den liegenden Tätigkeit<br />
der Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt ist es geboten, die Aufsichtsbehörden möglichst frühzeitig <strong>in</strong> die vorgesehenen<br />
Prüfungen bei den Geme<strong>in</strong>den e<strong>in</strong>zub<strong>in</strong>den und nicht erst - wie es gesetzlich als M<strong>in</strong>destvorgabe vorgesehen<br />
ist - <strong>in</strong> das Prüfungsgeschehen e<strong>in</strong>gebunden werden, wenn die überörtliche Prüfung bei den Geme<strong>in</strong>den abgeschlossen<br />
ist. Die Aufgaben der überörtlichen Prüfung sowie das Verfahren zu den Ergebnissen dieser Prüfung<br />
s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> § 105 GO <strong>NRW</strong> näher bestimmt worden.<br />
3. Sonstige Formen der Durchführung der örtlichen Rechnungsprüfung<br />
3.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die Vorschriften über die Ausübung und Ausgestaltung der Pflicht zur örtlichen Rechnungsprüfung durch die<br />
Geme<strong>in</strong>de stehen e<strong>in</strong>er Erledigung von Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung durch Dritte, z.B. die örtliche<br />
Rechnungsprüfung e<strong>in</strong>er anderen Geme<strong>in</strong>de oder Wirtschaftsprüfern als private Dritte nicht entgegen. Die Geme<strong>in</strong>den,<br />
die zur E<strong>in</strong>richtung e<strong>in</strong>er örtlichen Rechnungsprüfung verpflichtet s<strong>in</strong>d, dürfen sich bei der Ausgestaltung<br />
solcher Aufträge, z.B. im Rahmen e<strong>in</strong>er öffentlich-rechtlichen Vere<strong>in</strong>barung, jedoch nicht aus ihrer Gesamtverantwortung<br />
für die örtliche Rechnungsprüfung selbst entlassen.<br />
E<strong>in</strong>e Geme<strong>in</strong>de, die örtliche Prüfungsaufgaben durch Dritte erledigen lässt, bleibt immer für die ordnungsgemäße<br />
Aufgabenerledigung der örtlichen Rechnungsprüfung verantwortlich. Dieses ist auch geboten, denn bei e<strong>in</strong>er<br />
Zusammenarbeit mit Dritten kann die örtliche Rechnungsprüfung e<strong>in</strong>er fremden Geme<strong>in</strong>de nicht unmittelbar dem<br />
Rat der Geme<strong>in</strong>de gegenüber verantwortlich und ihm <strong>in</strong> ihrer sachlichen Tätigkeit unmittelbar unterstellt se<strong>in</strong> (vgl.<br />
§ 104 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>). Die geme<strong>in</strong>deübergreifende Zusammenarbeit bei der örtlichen Rechnungsprüfung lässt<br />
sich trotzdem auf unterschiedliche Art und Weise gestalten.<br />
3.2 Die Beauftragung nach § 103 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong><br />
Mit der E<strong>in</strong>führung des NKF wurde zugelassen, dass sich die örtliche Rechnungsprüfung der Geme<strong>in</strong>de auch der<br />
Hilfe Dritter als Prüfer bedienen darf (vgl. § 103 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong>). Diese gesetzliche Regelung erfolgte auf Vorschlag<br />
der Geme<strong>in</strong>den und des Fachverbandes der Rechnungsprüfer, um zukünftig besser e<strong>in</strong>e flexible und<br />
wirtschaftliche Aufgabenerledigung der örtlichen Rechnungsprüfung zu erreichen. Durch e<strong>in</strong>e solche Beauftragung<br />
darf jedoch die Tätigkeit der gewählten Organe der Geme<strong>in</strong>de nicht tangiert werden. Die neue Regelung <strong>in</strong><br />
GEMEINDEORDNUNG 666
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 102 GO <strong>NRW</strong><br />
der Geme<strong>in</strong>deordnung soll die Möglichkeiten der Zusammenarbeit von örtlichen Rechnungsprüfungen der Geme<strong>in</strong>den<br />
erweitern. Deshalb ist e<strong>in</strong>erseits e<strong>in</strong>e Beauftragung Dritter als Prüfer nicht auf bestimmte Prüfungstätigkeiten<br />
im E<strong>in</strong>zelfall beschränkt worden. Andererseits s<strong>in</strong>d gesetzlich ke<strong>in</strong>e fachlichen Voraussetzungen für die<br />
Tätigkeit als beauftragter Prüfer bestimmt worden. „Dritte als Prüfer“ können daher z.B. Wirtschaftprüfer oder<br />
Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung e<strong>in</strong>er anderen Geme<strong>in</strong>de se<strong>in</strong>. Bei der Ausgestaltung e<strong>in</strong>er Beauftragung<br />
nach dieser Vorschrift bleibt aber die Gesamtverantwortung für die örtliche Rechnungsprüfung bei der Geme<strong>in</strong>de.<br />
Sie kann sich <strong>in</strong> diesen Fällen nicht aus ihrer Verantwortung selbst entlassen. Vielmehr muss die örtliche Rechnungsprüfung<br />
auf Grund ihrer Prüfung e<strong>in</strong>en eigenen Bestätigungsvermerk erstellen. Sie kann aber auch den<br />
Bestätigungsvermerk des beauftragten Dritten vollständig übernehmen, muss dies dann aber durch e<strong>in</strong>e entsprechende<br />
Ergänzung klarstellen. Außerdem s<strong>in</strong>d weitere Ergänzungen möglich, wenn durch die zusätzlichen Bemerkungen<br />
das Prüfungsergebnis nachvollziehbarer wird.<br />
3.3 Die Zusammenarbeit im E<strong>in</strong>zelfall (Amtshilfe) nach § 4 ff. VwVfG<br />
E<strong>in</strong>e notwendige Zusammenarbeit der örtlichen Rechnungsprüfung zweier Geme<strong>in</strong>den kann im E<strong>in</strong>zelfall auch im<br />
Wege der Amtshilfe nach den §§ 4 ff. des VwVfG <strong>NRW</strong> erfolgen. Unter Amtshilfe ist dabei die Vornahme von<br />
Handlungen rechtlicher und tatsächlicher Art auf das Ersuchen e<strong>in</strong>er Behörde durch e<strong>in</strong>e andere Behörde zur<br />
Unterstützung e<strong>in</strong>er Amtshandlung der ersuchenden Behörde im E<strong>in</strong>zelfall zu verstehen. Die Amtshilfe stellt e<strong>in</strong>e<br />
ergänzende Hilfe für die zuständige örtliche Rechnungsprüfung dar, die von e<strong>in</strong>er anderen örtlichen Rechnungsprüfung<br />
nach dem Gleichordnungsverhältnis geleistet wird, denn <strong>in</strong> dieser Zusammenarbeit besteht ke<strong>in</strong> Über-<br />
und Unterordnungsverhältnis der Prüfungsstellen. Sie dient der Erleichterung, Beschleunigung und Verbilligung<br />
des örtlichen Prüfungsverfahrens. E<strong>in</strong>e Geme<strong>in</strong>de kann daher im Wege der Amtshilfe e<strong>in</strong>e auf den E<strong>in</strong>zelfall<br />
beschränkte Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung, z.B. e<strong>in</strong>e Bauprüfung, für e<strong>in</strong>e andere Geme<strong>in</strong>de wahrnehmen.<br />
Der beauftragten örtlichen Rechnungsprüfung können jedoch ggf. Ansprüche aus ihrer Tätigkeit als<br />
Auslagenersatz oder Gebühren zustehen. Als E<strong>in</strong>zelfall der Amtshilfe nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz<br />
gelten dabei jedoch nicht die dem Rechnungsprüfungsausschuss gesetzlich übertragenen Prüfungsaufgaben.<br />
3.4 Ke<strong>in</strong>e Zusammenarbeit nach § 3 Abs. 5 oder § 4 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong><br />
Die Erledigung von Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung durch e<strong>in</strong>e andere Geme<strong>in</strong>de lässt sich nicht unter<br />
den Rahmen e<strong>in</strong>er Vere<strong>in</strong>barung nach § 3 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong> (zur Effizienzsteigerung) oder nach § 4 Abs. 8 GO<br />
<strong>NRW</strong> (Übernahme von Aufgaben anderer Geme<strong>in</strong>den) subsumieren. Diese Vorschriften stellen auf übertragbare<br />
geme<strong>in</strong>dliche Aufgaben ab, die von der Geme<strong>in</strong>de für ihre Bürger und E<strong>in</strong>wohner <strong>in</strong> Verfolgung öffentlicher Zwecke<br />
wahrzunehmen s<strong>in</strong>d. Die örtliche Rechnungsprüfung ist dagegen e<strong>in</strong>e verwaltungsorganisatorische Aufgabe,<br />
welche der <strong>in</strong>ternen Kontrolle der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Geme<strong>in</strong>de dient. Es ist deshalb auch im<br />
Rahmen des Gesetzes über kommunale Geme<strong>in</strong>schaftsarbeit nicht möglich, die Aufgabe „Örtliche Rechnungsprüfung“<br />
vollständig an e<strong>in</strong>en Dritten abzugeben und sich der Verantwortung dafür zu entziehen. Die Geme<strong>in</strong>de<br />
kann sich lediglich Dritter als Prüfer bedienen (vgl. § 103 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong>). Sie muss dafür <strong>in</strong> eigener Verantwortung<br />
die notwendigen organisatorischen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen für die örtliche Rechnungsprüfung schaffen.<br />
II. Erläuterungen im E<strong>in</strong>zelnen<br />
1. Zu Absatz 1 (Pflichtaufgabe örtliche Rechnungsprüfung):<br />
1.01 Abgrenzung der Aufgabenträger<br />
Nach der Vorschrift haben kreisfreie Städte, Große und Mittlere kreisangehörige Städte e<strong>in</strong>e örtliche Rechnungsprüfung<br />
e<strong>in</strong>zurichten. Bei der Festlegung der zur E<strong>in</strong>richtung e<strong>in</strong>er örtlichen Rechnungsprüfung verpflichteten<br />
GEMEINDEORDNUNG 667
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 102 GO <strong>NRW</strong><br />
Geme<strong>in</strong>den ist davon ausgegangen worden, dass die umfangreichen örtlichen Verwaltungsaufgaben, die <strong>in</strong>sbesondere<br />
durch die notwendige Dase<strong>in</strong>svorsorge und die Erledigung von Pflichtaufgaben bestimmt werden, e<strong>in</strong>e<br />
gesonderte Prüfung vor der Feststellung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses und der Entscheidung über die<br />
Entlastung des Bürgermeisters erfordern.<br />
Die Städte <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen, die als Große oder Mittlere kreisangehörige Städte gelten, werden im E<strong>in</strong>zelnen<br />
<strong>in</strong> der Verordnung zur Bestimmung der Großen kreisangehörigen Städte und der Mittleren kreisangehörigen<br />
Städte nach § 4 der Geme<strong>in</strong>deordnung für das Land Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen vom 13. November 1979 (GV. <strong>NRW</strong>. S.<br />
867) <strong>in</strong> der jeweils aktuellen Fassung (vgl. SGV. <strong>NRW</strong>. 2023)benannt. In § 1 der Verordnung s<strong>in</strong>d die Großen<br />
kreisangehörigen Städte und <strong>in</strong> § 2 die Mittleren kreisangehörigen Städte <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen benannt.<br />
1.1 Zu Satz 1 (Pflicht bei Großen und Mittleren kreisangehörigen Städten)<br />
1.1.1 Inhalte der Pflicht<br />
Die Pflicht zur örtlichen Rechnungsprüfung entsteht auch auf Grund der Pflicht der Geme<strong>in</strong>den zur sparsamen<br />
und wirtschaftlichen Haushaltsführung gemäß § 75 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>. Sie entsteht zudem aus der Pflicht zur Aufstellung<br />
e<strong>in</strong>es Jahresabschlusses gemäß § 95 GO <strong>NRW</strong>, denn mit dem geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss übt der<br />
Rat der Geme<strong>in</strong>de se<strong>in</strong>e Befugnis als oberstes Kontrollorgan der Geme<strong>in</strong>de über die Ausführung der von ihm<br />
durch die jährliche Haushaltssatzung beschlossenen geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft aus.<br />
Der Rat hat sich vor se<strong>in</strong>er Feststellung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses nicht nur von der Ordnungsmäßigkeit<br />
des aufgestellten geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses zu überzeugen, sondern auch vor se<strong>in</strong>er Beschlussfassung<br />
e<strong>in</strong>e örtliche Prüfung durchführen zu lassen. Nur dann ist die Feststellung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses<br />
und die Entlastung des Bürgermeisters durch die Ratsmitglieder zulässig (vgl. § 96 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>).<br />
Die Prüfung hat der Rechnungsprüfungsausschuss des Rates (vgl. § 57 i.V.m. § 59 GO <strong>NRW</strong>) unter Beteiligung<br />
der örtlichen Rechnungsprüfung durchzuführen. Die Pflichtaufgabe „Örtliche Rechnungsprüfung“ br<strong>in</strong>gt dabei mit<br />
sich, dass deren Ausübung und Ausgestaltung an den örtlichen Verhältnissen zu orientieren ist und im Rahmen<br />
der bestehenden Verantwortung der Geme<strong>in</strong>de auch Dritte mit der Prüfung beauftrag werden können.<br />
1.1.2 Ausübung und Ausgestaltung der Pflicht<br />
Die Ausübung der Pflicht zur örtlichen Rechnungsprüfung wird durch die E<strong>in</strong>richtung e<strong>in</strong>er Organisationse<strong>in</strong>heit<br />
„Rechnungsprüfung“ <strong>in</strong> der Verwaltung der Geme<strong>in</strong>de unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten gefördert<br />
und vorbereitet (vgl. §§ 103 und 104 GO <strong>NRW</strong>). Auch die weiteren Funktionen der örtlichen Rechnungsprüfung<br />
dienen der Unterstützung des o.a. Zweckes und sollen zudem e<strong>in</strong>e nicht h<strong>in</strong>nehmbare Verantwortungslosigkeit<br />
im E<strong>in</strong>zelfall verh<strong>in</strong>dern. Die örtliche Rechnungsprüfung ist zwar organisatorisch <strong>in</strong> die Geme<strong>in</strong>deverwaltung<br />
e<strong>in</strong>gebunden, gleichwohl nimmt sie aber wegen der Stellung des Leiters und der Prüfer sowie der unmittelbaren<br />
Verantwortung gegenüber dem Rat e<strong>in</strong>e besondere Stellung e<strong>in</strong>. Sie kann dadurch ke<strong>in</strong>er anderen Organisationse<strong>in</strong>heit<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung unterstellt werden.<br />
Die Ausgestaltung der örtlichen Rechnungsprüfung muss sich dabei an dem nach dem Gesetz zugewiesenen<br />
Aufgaben und den ggf. zusätzlich vom Rat (vgl. § 103 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>) oder vom Bürgermeister übertragenen<br />
Aufgaben (vgl. § 103 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong>) ausrichten. Dies wirkt sich auch auf die erforderliche Qualifikation der<br />
Prüfer aus. Organisatorisch ist die örtliche Rechnungsprüfung e<strong>in</strong> Teil der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung, die wegen<br />
ihrer notwendigen Unabhängigkeit jedoch e<strong>in</strong>e Sonderstellung <strong>in</strong>nehat. Unberührt von ihrer unabhängigen Stellung<br />
bleibt die dienstaufsichtliche Stellung des Bürgermeisters gegenüber der Leitung und den Prüfern der örtlichen<br />
Rechnungsprüfung.<br />
GEMEINDEORDNUNG 668
1.1.3 Ke<strong>in</strong>e Abgabe der Prüfungsverantwortung<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 102 GO <strong>NRW</strong><br />
Die Selbstverantwortung und das Erfordernis des ordnungsmäßigen Handelns der Geme<strong>in</strong>den, das auch durch<br />
die örtliche Rechnungsprüfung gewährleistet wird, lassen es nicht zu, dass Geme<strong>in</strong>den sich durch die Abgabe der<br />
Prüfungsaufgaben an e<strong>in</strong>e andere Geme<strong>in</strong>de von dieser pflichtigen Aufgabe zurückziehen können. Würden sich<br />
die e<strong>in</strong>zelne Geme<strong>in</strong>de durch e<strong>in</strong>e Zusammenarbeit aus ihrer Gesamtverantwortung für die örtliche Prüfung<br />
selbst entlassen können, würde bei ihnen e<strong>in</strong>e nicht h<strong>in</strong>nehmbare Verantwortungslosigkeit entstehen und die<br />
Tätigkeit der gewählten Organe tangieren.<br />
Insbesondere, wenn kreisangehörige Geme<strong>in</strong>den e<strong>in</strong>e andere kreisangehörige Geme<strong>in</strong>de vollständig mit der<br />
Erledigung der örtlichen Rechnungsprüfung beauftragen könnten, entsteht wegen des oftmals örtlich vorhandenen<br />
„Konkurrenzkampfes“, z.B. im Bauwesen und bei Gewerbeansiedlungen, schnell die Frage der Verlässlichkeit<br />
der Rechnungsprüfung. E<strong>in</strong>e wirksame örtliche Rechnungsprüfung setzt daher e<strong>in</strong>e unabhängige Stelle <strong>in</strong>nerhalb<br />
der kreisfreien Städte, Großen und Mittleren kreisangehörigen Städte voraus.<br />
1.2 Zu Satz 2 (Pflicht bei den übrigen kreisangehörigen Geme<strong>in</strong>den)<br />
Nach der Vorschrift sollen die übrigen Geme<strong>in</strong>den e<strong>in</strong>e örtliche Rechnungsprüfung e<strong>in</strong>richten, wenn e<strong>in</strong> Bedürfnis<br />
hierfür besteht und die Kosten <strong>in</strong> angemessenem Verhältnis zum Nutzen stehen. Für die örtlich erforderliche<br />
Feststellung, ob e<strong>in</strong> Bedürfnis für e<strong>in</strong>e örtliche Rechnungsprüfung besteht und die Kosten <strong>in</strong> angemessenem<br />
Verhältnis zum Nutzen stehen, bestehen ke<strong>in</strong>e landesweit anwendbaren bzw. allgeme<strong>in</strong>e Kriterien. E<strong>in</strong>e Klärung<br />
ist ausschließlich unter örtlichen Gesichtspunkten und von den Geme<strong>in</strong>den unter Beteiligung des Rechnungsprüfungsausschusses<br />
nach § 57 i.V.m. § 59 GO <strong>NRW</strong> herbeizuführen, die nicht <strong>in</strong> der Verordnung zur Bestimmung<br />
der Großen kreisangehörigen Städte und der Mittleren kreisangehörigen Städte nach § 4 der Geme<strong>in</strong>deordnung<br />
für das Land Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen benannt s<strong>in</strong>d.<br />
E<strong>in</strong> Bedürfnis könnte z.B. aus dem Aufgabenkatalog des § 103 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> entstehen, <strong>in</strong>sbesondere wenn<br />
e<strong>in</strong>e laufende Prüfung der Vorgänge <strong>in</strong> der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses,<br />
e<strong>in</strong>e dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Geme<strong>in</strong>de sowie die Prüfung von Vergaben<br />
nicht durch Dritte erfolgen soll. Bei der Frage, ob die Kosten e<strong>in</strong>er örtlichen Rechnungsprüfung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em angemessenem<br />
Verhältnis zum Nutzen stehen, kann e<strong>in</strong>e Klärung z.B. mit Hilfe e<strong>in</strong>es Vergleichs und Informationsaustausches<br />
mit anderen Geme<strong>in</strong>den herbeigeführt werden.<br />
In die Beurteilung ist auch die Möglichkeit des Rates der Geme<strong>in</strong>de, der örtlichen Rechnungsprüfung nach § 103<br />
Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> Aufgaben übertragen zu können, z.B. die Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit<br />
oder die Prüfung der Betätigung der Geme<strong>in</strong>de als Gesellschafter, Aktionär oder Mitglied <strong>in</strong> Gesellschaften<br />
und anderen Vere<strong>in</strong>igungen des privaten Rechts oder <strong>in</strong> der Rechtsform der Anstalt des öffentlichen<br />
Rechts, e<strong>in</strong>zubeziehen. Ebenso die Möglichkeit des Bürgermeisters nach § 103 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong>, der örtlichen<br />
Rechnungsprüfung eigene Prüfungsaufträge unter Mitteilung an den Rechnungsprüfungsausschuss erteilen zu<br />
können, darf nicht unberücksichtigt bleiben.<br />
In diesem Zusammenhang ist von der Geme<strong>in</strong>den, die ke<strong>in</strong>e örtliche Rechnungsprüfung e<strong>in</strong>gerichtet hat, zu beachten,<br />
dass dann der Rechnungsprüfungsausschuss nach § 59 GO <strong>NRW</strong> das Recht zu kommt, sich h<strong>in</strong>sichtlich<br />
der Durchführung se<strong>in</strong>er Aufgabe e<strong>in</strong>es Dritten gem. § 103 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong> bedienen zu können, wenn nicht von<br />
der Möglichkeit des Absatzes 2, e<strong>in</strong>e öffentlich-rechtliche Vere<strong>in</strong>barung mit dem Kreis abschließen, so dass die<br />
örtliche Rechnungsprüfung des Kreises die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung der Geme<strong>in</strong>de wahrnimmt,<br />
Gebrauch gemacht wird.<br />
GEMEINDEORDNUNG 669
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 102 GO <strong>NRW</strong><br />
2. Zu Absatz 2 (Örtliche Rechnungsprüfung durch den Kreis):<br />
2.1 Zu Satz 1 (Erledigung der Prüfungsaufgaben durch den eigenen Kreis):<br />
2.1.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Nach dieser Vorschrift können kreisangehörige Geme<strong>in</strong>den mit dem Kreis e<strong>in</strong>e öffentlich-rechtliche Vere<strong>in</strong>barung<br />
mit dem Inhalt abschließen, dass die örtliche Rechnungsprüfung des Kreises die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Geme<strong>in</strong>de gegen Kostenerstattung wahrnimmt. Diese Regelung ist als Konsequenz aus<br />
der Errichtung der Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt im Jahre 2002 <strong>in</strong> die Geme<strong>in</strong>deordnung aufgenommen worden.<br />
Damit wurde die Möglichkeit der Abgabe der örtlichen Rechnungsprüfung an den eigenen Kreis sowie e<strong>in</strong>e leichtere<br />
Zusammenarbeit der örtlichen Rechnungsprüfung der kreisangehörigen Geme<strong>in</strong>den mit der örtlichen Rechnungsprüfung<br />
des Kreises geschaffen. Sie ist auch vertretbar, denn der Kreis übt die allgeme<strong>in</strong>e staatliche Aufsicht<br />
über die kreisangehörigen Geme<strong>in</strong>den nach dem 13. Teil der Geme<strong>in</strong>deordnung aus (vgl. §§ 119 ff. GO<br />
<strong>NRW</strong>).<br />
Die kreisangehörige Geme<strong>in</strong>de kann sich nach dieser Vorschrift durch e<strong>in</strong>e öffentlich-rechtliche Vere<strong>in</strong>barung mit<br />
dem eigenen Kreis aus der Durchführung von Prüfungsaufgaben zurückziehen. Sie kann sich jedoch durch e<strong>in</strong>e<br />
solche Vere<strong>in</strong>barung nicht aus ihrer Gesamtverantwortung für das haushaltswirtschaftliche Handeln und damit<br />
auch nicht aus ihrer Gesamtverantwortung für die Durchführung der Prüfung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft<br />
entlassen. Auch bei e<strong>in</strong>er vollständigen Erledigung der örtlichen Rechnungsprüfung durch den eigenen<br />
Kreis bleibt die Geme<strong>in</strong>de aus Gründen der Selbstverwaltung sowie dem Erfordernis des ordnungsmäßigen Handelns<br />
mitverantwortlich für das Prüfungsgeschehen. Durch die Erledigung der örtlichen Rechnungsprüfung durch<br />
den eigenen Kreis darf zudem die Tätigkeit der gewählten Organe der Geme<strong>in</strong>de nicht tangiert werden.<br />
2.1.2 Der Abschluss e<strong>in</strong>er öffentlich-rechtlichen Vere<strong>in</strong>barung<br />
2.1.2.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die Möglichkeiten der Zusammenarbeit von Geme<strong>in</strong>den im Rahmen ihrer örtlichen Rechnungsprüfung werden<br />
durch die Geme<strong>in</strong>deordnung und das Gesetz über kommunale Geme<strong>in</strong>schaftsarbeit abschließend bestimmt.<br />
Durch den Abschluss e<strong>in</strong>er öffentlich-rechtlichen Vere<strong>in</strong>barung der kreisangehörigen Geme<strong>in</strong>de mit dem Kreis<br />
kann die örtliche Rechnungsprüfung des Kreises die Rechnungsprüfung bei der Geme<strong>in</strong>de wahrnehmen. Mit In-<br />
Kraft-Treten der öffentlich-rechtlichen Vere<strong>in</strong>barung übernimmt der Kreis die örtliche Rechnungsprüfung der Geme<strong>in</strong>de<br />
<strong>in</strong> se<strong>in</strong>e Zuständigkeit, so dass das Recht und die Pflicht zur Erfüllung dieser Aufgabe auf den Kreis übergehen.<br />
In dieser Vere<strong>in</strong>barung sollte sich die Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong> Mitwirkungsrecht bei der Erfüllung oder Durchführung der<br />
Aufgaben e<strong>in</strong>räumen lassen. Auch muss die Vere<strong>in</strong>barung e<strong>in</strong>e angemessene Kostenerstattung bzw. Entschädigung<br />
vorsehen, die <strong>in</strong> der Regel so zu bemessen ist, dass die durch die Übernahme oder Durchführung entstehenden<br />
Kosten gedeckt werden. Außerdem sollte die Geltungsdauer der Vere<strong>in</strong>barung bestimmt werden sowie<br />
deren Auflösung geregelt bzw. festgelegt werden, unter welchen Voraussetzungen und <strong>in</strong> welcher Form sie von<br />
e<strong>in</strong>em Beteiligten gekündigt werden kann.<br />
2.1.2.2 Öffentlich-rechtliche Vere<strong>in</strong>barung und Vergaberecht<br />
E<strong>in</strong>e Aufgabenübertragung der Geme<strong>in</strong>de an Dritte unterliegt als öffentlicher Auftrag dem Vergaberecht, sofern<br />
ke<strong>in</strong>e Ausnahmetatbestände vorliegen (vgl. § 25 GemHVO <strong>NRW</strong>). Die für e<strong>in</strong>e Übertragung der örtlichen Rechnungsprüfung<br />
an den Kreis erforderliche öffentlich-rechtliche Vere<strong>in</strong>barung stellt dabei als Vertragsform ke<strong>in</strong>en<br />
GEMEINDEORDNUNG 670
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 102 GO <strong>NRW</strong><br />
Ausnahmetatbestand dar. Nach der Vorschrift kann aber als Vertragspartner für die Übernahme der örtlichen<br />
Rechnungsprüfung der kreisangehörigen Geme<strong>in</strong>de nur der Kreis <strong>in</strong> Betracht kommen, dem die Geme<strong>in</strong>de verfassungsmäßig<br />
angehört. Die ausdrückliche Wortwahl <strong>in</strong> der Vorschrift „mit dem Kreis“ be<strong>in</strong>haltet diese gesetzliche<br />
Beschränkung, so dass e<strong>in</strong>e kreisangehörige Geme<strong>in</strong>de nur ihrem eigenen Kreis die geme<strong>in</strong>dliche Aufgabe<br />
„Rechnungsprüfung“ (ganz oder teilweise) im Rahmen e<strong>in</strong>er öffentlich-rechtlichen Vere<strong>in</strong>barung übertragen darf.<br />
E<strong>in</strong>e Vielzahl von möglichen Vertragspartnern der kreisangehörigen Geme<strong>in</strong>de besteht daher, anders als bei<br />
e<strong>in</strong>er Beauftragung Dritter nach § 103 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong>, nicht.<br />
Diese gesetzliche Beschränkung der Übertragung dieser geme<strong>in</strong>dlichen Aufgaben auf nur e<strong>in</strong>e öffentlichrechtliche<br />
Stelle (eigener Kreis) stellt e<strong>in</strong>en Ausnahmetatbestand dar, der dazu führt, dass vor der Aufgabenübertragung<br />
durch die kreisangehörige Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong> Vergabeverfahren nicht erforderlich bzw. der Verzicht darauf<br />
zulässig ist. In diesen Fällen steht, anders als bei der Beauftragung Dritter nach § 103 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong>, die Erledigung<br />
von Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung durch den Kreis, dem die kreisangehörige Geme<strong>in</strong>de verfassungsmäßig<br />
angehört, nicht für den allgeme<strong>in</strong>en Wettbewerb offen (vgl. Runderlass des Innenm<strong>in</strong>isteriums<br />
vom 18.12.2007). Wird aber von e<strong>in</strong>er kreisangehörigen Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>e Vere<strong>in</strong>barung über die Aufgabenerledigung<br />
der örtlichen Rechnungsprüfung mit anderen Kreis als dem eigenen getroffen, kann diese Auftragsvergabe<br />
nur auf der Grundlage des § 103 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong> erfolgen und unterliegt dann dem Vergaberecht.<br />
2.1.2.3 Öffentlich-rechtliche Vere<strong>in</strong>barung und Verfahren nach GkG<br />
Öffentlich-rechtliche Vere<strong>in</strong>barung der Geme<strong>in</strong>den und Geme<strong>in</strong>deverbände werden i.d.R. auf der Grundlage des<br />
Gesetzes über kommunale Geme<strong>in</strong>schaftsarbeit (GkG) abgeschlossen. Derartige Vere<strong>in</strong>barungen unterliegen<br />
den Verfahrensvorschriften des GkG und bedürfen daher e<strong>in</strong>er Genehmigung nach § 24 Abs. 2 GkG und der<br />
Bekanntmachung nach § 24 Abs. 3 GkG. Dies ist zu beachten, wenn neben den Aufgaben der Geme<strong>in</strong>de nach<br />
den §§ 2 und 3 GO <strong>NRW</strong> e<strong>in</strong>e durch Gesetz oder Rechtsverordnung übertragene zusätzliche Aufgabe von e<strong>in</strong>er<br />
Mittleren oder Großen kreisangehörigen Stadt mit dem Kreis gemäß den §§ 23 ff. des Gesetzes über kommunale<br />
Geme<strong>in</strong>schaftsarbeit vere<strong>in</strong>bart wird, dass diese Aufgabe der Kreis übernimmt.<br />
Die örtliche Rechnungsprüfung ist ke<strong>in</strong>e solche Aufgabe, so dass beim Abschluss e<strong>in</strong>er öffentlich-rechtlichen<br />
Vere<strong>in</strong>barung mit dem Kreis über die Durchführung der örtlichen Rechnungsprüfung die Vorschrift des § 4 Abs. 8<br />
S. 1 Buchstabe b) GO <strong>NRW</strong> und somit auch die Vorschriften des GkG ke<strong>in</strong>e Anwendung f<strong>in</strong>den. E<strong>in</strong>e öffentlichrechtliche<br />
Vere<strong>in</strong>barung über die Übernahme von Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung durch den Kreis auf<br />
der Grundlage des § 102 GO <strong>NRW</strong> stellt bereits deshalb ke<strong>in</strong>e Vere<strong>in</strong>barung dar, die den Verfahrensvorschriften<br />
des GkG unterliegt. Für diesen Fall fehlt es <strong>in</strong> der Vorschrift der Geme<strong>in</strong>deordnung an e<strong>in</strong>em ausdrücklichen<br />
Verweis auf die Vorschriften des vierten Teils des GkG. Die Übertragung der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgabe „Rechnungsprüfung“<br />
ganz oder teilweise im Rahmen e<strong>in</strong>er öffentlich-rechtlichen Vere<strong>in</strong>barung von e<strong>in</strong>er kreisangehörigen<br />
Geme<strong>in</strong>de auf ihren eigenen Kreis nach dem § 102 GO bedarf daher ke<strong>in</strong>er Genehmigung nach § 24 Abs. 2<br />
GkG und auch ke<strong>in</strong>er Bekanntmachung nach § 24 Abs. 3 GkG.<br />
2.2 Zu Satz 2 (Übertragung e<strong>in</strong>zelner Prüfungsaufgaben auf den eigenen Kreis):<br />
Nach der Vorschrift kann die öffentlich-rechtliche Vere<strong>in</strong>barung der kreisangehörigen Geme<strong>in</strong>de mit dem Kreis<br />
auch vorsehen, dass die Rechnungsprüfung des Kreises nur e<strong>in</strong>zelne Aufgabengebiete der örtlichen Rechnungsprüfung<br />
<strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>de wahrnimmt. Auch <strong>in</strong> diesen Fällen der Übertragung von Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung<br />
auf den Kreis, dem die Geme<strong>in</strong>de verfassungsmäßig angehört, wird die kreisangehörige Geme<strong>in</strong>de<br />
nicht aus ihrer Gesamtverantwortung für die örtliche Rechnungsprüfung entlassen.<br />
E<strong>in</strong>e solche Vere<strong>in</strong>barung muss entsprechend der Inanspruchnahme des Kreises e<strong>in</strong>e Kostenerstattung vorsehen.<br />
Auch <strong>in</strong> diesen Fällen ist für die Übertragung von geme<strong>in</strong>dlichen Aufgaben auf den eigenen Kreis ke<strong>in</strong> Ver-<br />
GEMEINDEORDNUNG 671
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 102 GO <strong>NRW</strong><br />
gabeverfahren erforderlich, denn diese Erledigung von Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung durch den<br />
Kreis ist nicht offen für den allgeme<strong>in</strong>en Wettbewerb. Wird aber von e<strong>in</strong>er kreisangehörigen Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>e Vere<strong>in</strong>barung<br />
über die Aufgabenerledigung der örtlichen Rechnungsprüfung mit anderen Kreis als dem eigenen<br />
getroffen, kann diese Auftragsvergabe nur auf der Grundlage des § 103 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong> erfolgen und unterliegt<br />
dann dem Vergaberecht.<br />
2.3 Zu Satz 3 (Rechnungsprüfungsausschuss und örtliche Rechnungsprüfung des Kreises):<br />
2.3.1 Der Rechnungsprüfungsausschuss nach § 57 i.V.m. § 59 GO <strong>NRW</strong><br />
Nach § 57 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> muss der Rat <strong>in</strong> jeder Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>en Rechnungsprüfungsausschuss bilden. Dieser<br />
Ausschuss hat den Jahresabschluss und den Gesamtabschluss der Geme<strong>in</strong>de zu prüfen (vgl. § 59 Abs. 3 GO<br />
<strong>NRW</strong>). Dazu kommt die Prüfung der Eröffnungsbilanz der Geme<strong>in</strong>de nach § 92 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong>. Der Rechnungsprüfungsausschuss<br />
bedient sich dabei der örtlichen Rechnungsprüfung wie sie <strong>in</strong> dieser Vorschrift bestimmt<br />
wird. Nach § 59 Abs. 3 S. 2 GO <strong>NRW</strong> kann sich der Rechnungsprüfungsausschuss auch Dritter gem. §<br />
103 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong> bedienen, wenn <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>de ke<strong>in</strong>e örtliche Rechnungsprüfung besteht. Mit diesen<br />
Regelungen kommt dem Rechnungsprüfungsausschuss unmittelbar e<strong>in</strong>e Prüfungstätigkeit zu, die zur Erhöhung<br />
der Effektivität und Effizienz der Arbeit des Rates beitragen soll.<br />
2.3.2 Die Heranziehung der örtlichen Rechnungsprüfung des Kreises<br />
Nach der Vorschrift bedient sich der Rechnungsprüfungsausschuss der Geme<strong>in</strong>de bei der Erfüllung se<strong>in</strong>er Aufgaben<br />
der Rechnungsprüfung des Kreises, soweit die örtliche Rechnungsprüfung des Kreises die Rechnungsprüfung<br />
<strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>de wahrnimmt. Wird die örtliche Rechnungsprüfung der Geme<strong>in</strong>de durch die örtliche Rechnungsprüfung<br />
des Kreises <strong>in</strong>sgesamt ersetzt und die Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> entsprechender Weise von ihrer Prüfungsverpflichtung<br />
entbunden, sollte die Art und Weise der E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung <strong>in</strong> das Verfahren<br />
auch Gegenstand der öffentlich-rechtlichen Vere<strong>in</strong>barung se<strong>in</strong>. In den Fällen, <strong>in</strong> denen nur e<strong>in</strong>zelne Prüfungsaufgaben<br />
durch die örtliche Rechnungsprüfung des Kreises erledigt werden, erfordert dieses e<strong>in</strong> ausgeprägtes Zusammenspiel<br />
zwischen der örtlichen Rechnungsprüfung des Kreises und der örtlichen Rechnungsprüfung der<br />
Geme<strong>in</strong>de. In diesen Fällen muss sich der Rechnungsprüfungsausschuss zur Erledigung se<strong>in</strong>er Aufgaben beider<br />
E<strong>in</strong>richtungen gleichzeitig bedienen.<br />
3. Zu Absatz 3 (Verzicht auf örtliche Rechnungsprüfung bei kreisangehörigen Städten):<br />
Nach dieser Vorschrift werden die Großen und die Mittleren kreisangehörigen Städte, die nach Absatz 1 e<strong>in</strong>e<br />
örtliche Rechnungsprüfung e<strong>in</strong>zurichten haben, als kreisangehörige Geme<strong>in</strong>den von dieser Verpflichtung entbunden,<br />
wenn die örtliche Rechnungsprüfung ihres Kreises gemäß Absatz 2 Satz 1 diese Aufgabe wahrnimmt. Vor<br />
dem Abschluss e<strong>in</strong>er Vere<strong>in</strong>barung mit dem Kreis sollte <strong>in</strong> die Abwägung über die Art und den Umfang der Aufgabenerledigung<br />
u.a. e<strong>in</strong>bezogen werden, ob nicht wegen besonderer örtlicher Gegebenheiten oder Aufgaben<br />
gleichwohl noch e<strong>in</strong> Bedürfnis für e<strong>in</strong>e eigene örtliche Rechnungsprüfung besteht. Auch e<strong>in</strong> Vergleich, ob bei<br />
e<strong>in</strong>er Erledigung der örtlichen Rechnungsprüfung durch Dritte die Kosten <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em angemessenen Verhältnis zum<br />
Nutzen stehen, kann zur Entscheidungsf<strong>in</strong>dung beitragen.<br />
Die Aufgabenübertragung an den eigenen Kreis muss durch e<strong>in</strong>e öffentlich-rechtliche Vere<strong>in</strong>barung im S<strong>in</strong>ne des<br />
§ 102 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> erfolgen. Sie sollte auch Regelungen enthalten, um im E<strong>in</strong>zelfall oder bei örtlichem Bedarf<br />
von der Vere<strong>in</strong>barung ganz oder teilweise zurücktreten zu können. E<strong>in</strong>e kreisangehörige Geme<strong>in</strong>de kann sich<br />
durch e<strong>in</strong>e öffentlich-rechtliche Vere<strong>in</strong>barung mit dem eigenen Kreis nach dieser Vorschrift aus der eigenen<br />
Durchführung von Prüfungsaufgaben zurückziehen. Sie kann sich aber nicht aus ihrer Gesamtverantwortung für<br />
GEMEINDEORDNUNG 672
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 102 GO <strong>NRW</strong><br />
das haushaltswirtschaftliche Handeln und damit auch nicht aus ihrer Gesamtverantwortung für die Prüfung der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft entlassen. Aus Gründen der Selbstverantwortung und dem Erfordernis des<br />
ordnungsmäßigen Handelns der Geme<strong>in</strong>de darf aber auch bei e<strong>in</strong>er vollständigen Erledigung von Aufgaben der<br />
örtlichen Rechnungsprüfung durch den eigenen Kreis ke<strong>in</strong>e nicht h<strong>in</strong>nehmbare Verantwortungslosigkeit entstehen.<br />
Außerdem darf durch e<strong>in</strong>en Verzicht auf örtliche Rechnungsprüfung die Tätigkeit der gewählten Organe der<br />
Geme<strong>in</strong>de nicht tangiert werden.<br />
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ<br />
GEMEINDEORDNUNG 673
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 103 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 103<br />
Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung<br />
(1) 1 Die örtliche Rechnungsprüfung hat folgende Aufgaben:<br />
1. die Prüfung des Jahresabschlusses der Geme<strong>in</strong>de,<br />
2. die Prüfung der Jahresabschlüsse der <strong>in</strong> § 97 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 4 benannten Sondervermögen,<br />
3. die Prüfung des Gesamtabschlusses,<br />
4. die laufende Prüfung der Vorgänge <strong>in</strong> der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses,<br />
5. die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Geme<strong>in</strong>de und ihrer Sondervermögen sowie die<br />
Vornahme der Prüfungen,<br />
6. bei Durchführung der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung (DV-Buchführung) der<br />
Geme<strong>in</strong>de und ihrer Sondervermögen die Prüfung der Programme vor ihrer Anwendung,<br />
7. die Prüfung der F<strong>in</strong>anzvorfälle gemäß § 100 Abs. 4 der Landeshaushaltsordnung,<br />
8. die Prüfung von Vergaben.<br />
2 In die Prüfung des Jahresabschlusses nach Nummer 1 s<strong>in</strong>d die Entscheidungen und Verwaltungsvorgänge aus<br />
delegierten Aufgaben auch dann e<strong>in</strong>zubeziehen, wenn die Zahlungsvorgänge selbst durch den Träger der Aufgabe<br />
vorgenommen werden und <strong>in</strong>sgesamt f<strong>in</strong>anziell von erheblicher Bedeutung s<strong>in</strong>d.<br />
(2) Der Rat kann der örtlichen Rechnungsprüfung weitere Aufgaben übertragen, <strong>in</strong>sbesondere<br />
1. die Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit,<br />
2. die Prüfung der Betätigung der Geme<strong>in</strong>de als Gesellschafter, Aktionär oder Mitglied <strong>in</strong> Gesellschaften und<br />
anderen Vere<strong>in</strong>igungen des privaten Rechts oder <strong>in</strong> der Rechtsform der Anstalt des öffentlichen Rechts gemäß<br />
§ 114a sowie die Buch- und Betriebsprüfung, die sich die Geme<strong>in</strong>de bei e<strong>in</strong>er Beteiligung, bei der H<strong>in</strong>gabe<br />
e<strong>in</strong>es Darlehens oder sonst vorbehalten hat.<br />
(3) Der Bürgermeister kann <strong>in</strong>nerhalb se<strong>in</strong>es Amtsbereichs unter Mitteilung an den Rechnungsprüfungsausschuss<br />
der örtlichen Rechnungsprüfung Aufträge zur Prüfung erteilen.<br />
(4) 1 Der Prüfer kann für die Durchführung se<strong>in</strong>er Prüfung nach den Absätzen 1 bis 3 Aufklärung und Nachweise<br />
verlangen, die für e<strong>in</strong>e sorgfältige Prüfung notwendig s<strong>in</strong>d. 2 Der Prüfer hat die Rechte nach Satz 1 auch gegenüber<br />
den Abschlussprüfern der verselbstständigten Aufgabenbereiche.<br />
(5) Die örtliche Rechnungsprüfung kann sich mit Zustimmung des Rechnungsprüfungsausschusses Dritter als<br />
Prüfer bedienen.<br />
(6) Bei den Aufgaben nach § 103 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 haben die Prüfer im Rahmen ihrer Prüfung e<strong>in</strong>en Bestätigungsvermerk<br />
oder e<strong>in</strong>en Vermerk über se<strong>in</strong>e Versagung nach § 101 Abs. 3 bis 7 abzugeben.<br />
(7) 1 E<strong>in</strong> Dritter darf nicht Prüfer se<strong>in</strong>,<br />
1. wenn er Mitglied des Rates, Angehöriger des Bürgermeisters, des Kämmerers oder des Verantwortlichen für<br />
die Zahlungsabwicklung oder se<strong>in</strong>es Stellvertreters ist,<br />
2. wenn er Beschäftigter der verselbstständigten Aufgabenbereiche der Geme<strong>in</strong>de ist, die <strong>in</strong> öffentlichrechtlicher<br />
oder privatrechtlicher Form geführt werden, oder diesen <strong>in</strong> den letzten drei Jahren vor der Bestellung<br />
als Prüfer angehört hat,<br />
3. wenn er <strong>in</strong> den letzten fünf Jahren mehr als dreißig vom Hundert der Gesamte<strong>in</strong>nahmen aus se<strong>in</strong>er beruflichen<br />
Tätigkeit aus der Prüfung und Beratung der zu prüfenden Geme<strong>in</strong>de und der verselbstständigten Aufgabenbereiche<br />
der Geme<strong>in</strong>de, die <strong>in</strong> öffentlich-rechtlicher oder <strong>in</strong> privatrechtlicher Form geführt werden, bezogen<br />
hat und dies auch im laufenden Jahr zu erwarten ist. Verselbstständigte Aufgabenbereiche der Geme<strong>in</strong>de<br />
<strong>in</strong> privatrechtlicher Form müssen nur e<strong>in</strong>bezogen werden, wenn die Geme<strong>in</strong>de mehr als zwanzig<br />
vom Hundert der Anteile daran besitzt.<br />
GEMEINDEORDNUNG 674
2 § 104 Abs. 4 gilt entsprechend.<br />
Erläuterungen zu § 103:<br />
I. Allgeme<strong>in</strong>es<br />
1.Die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung<br />
1.1 Die gesetzlichen Pflichtaufgaben<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 103 GO <strong>NRW</strong><br />
Die Vorschrift enthält die gesetzlich bestimmten Pflichtaufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung unter Berücksichtigung<br />
der gesamten geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft, die förmlich, sachlich und rechnerisch zu prüfen<br />
s<strong>in</strong>d. Im S<strong>in</strong>ne dieser Vorschrift s<strong>in</strong>d unter dem Begriff „Prüfung“ die Tätigkeiten zu verstehen, die als Überwachungsmaßnahmen<br />
unabhängig von den Arbeitsabläufen <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung vorgenommen werden<br />
und durch die festgestellt werden soll, ob das wirtschaftliche Handeln der Geme<strong>in</strong>de normgerecht erfolgt. Mit<br />
der örtlichen Rechnungsprüfung wird daher das Ziel der Sicherstellung von Richtigkeit und Ordnungsmäßigkeit,<br />
ggf. auch von Zweckmäßigkeit, bei der Ausführung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft verfolgt. In diesem<br />
Rahmen ist es unerheblich, ob die Geme<strong>in</strong>de zur E<strong>in</strong>richtung e<strong>in</strong>er örtlichen Rechnungsprüfung gesetzlich verpflichtet<br />
ist oder diese freiwillig e<strong>in</strong>gerichtet hat.<br />
Die Vorschrift enthält daher e<strong>in</strong>e breite Übersicht über die Prüfung der mit der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgabenerfüllung<br />
zusammenhängenden Sachverhalte. Diese gesetzlich bestimmten Prüfungsaufgaben führen u.a. zu e<strong>in</strong>er Rechtmäßigkeitsprüfung<br />
des haushaltswirtschaftlichen Handelns der Geme<strong>in</strong>de, die aber auch die E<strong>in</strong>haltung der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltsgrundsätze umfasst, z.B. den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit (vgl. § 75<br />
Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>).<br />
1.2 Prioritätensetzung für die Aufgabenerfüllung<br />
In diesem Zusammenhang stellt der Aufbau der Vorschrift e<strong>in</strong>e Prioritätensetzung h<strong>in</strong>sichtlich der Aufgabenerfüllung<br />
der örtlichen Rechnungsprüfung dar. Deshalb werden <strong>in</strong> Absatz 1 der Vorschrift die gesetzlich bestimmten<br />
Prüfungsaufgaben benannt, die e<strong>in</strong>e erhebliche Bedeutung für die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft haben und<br />
für das ordnungsmäßige Verwaltungshandeln der Geme<strong>in</strong>de unverzichtbar s<strong>in</strong>d. Der Rat der Geme<strong>in</strong>de kann<br />
dann nach Absatz 2 der Vorschrift der örtlichen Rechnungsprüfung weitere Aufgaben übertragen, denn die örtliche<br />
Rechnungsprüfung ist dem Rat unmittelbar verantwortlich und <strong>in</strong> ihrer sachlichen Tätigkeit ihm unmittelbar<br />
unterstellt (vgl. § 104 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>). Diese Aufgabenübertragung darf aber nicht zu E<strong>in</strong>schränkungen bei der<br />
Erledigung der gesetzlichen Aufgaben führen.<br />
Die Prioritätensetzung <strong>in</strong> der Vorschrift führt dazu, dass das Recht des Bürgermeisters nach Absatz 3 der Vorschrift,<br />
der örtlichen Rechnungsprüfung unter Mitteilung an den Rechnungsprüfungsausschuss Aufträge zur Prüfung<br />
erteilen zu können, für die Erledigung der Prüfungstätigkeit nachrangig gegenüber den gesetzlichen Aufgaben<br />
und der Aufgabenübertragung durch den Rat der Geme<strong>in</strong>de ist. Diese E<strong>in</strong>ordnung wird ausdrücklich dadurch<br />
deutlich gemacht, dass dem Bürgermeister nicht das Recht e<strong>in</strong>geräumt worden ist, der örtlichen Rechnungsprüfung<br />
Prüfungsaufgaben übertragen, sondern er dieser Stelle lediglich Prüfungsaufträge erteilen darf.<br />
Die Prüfer haben grundsätzlich die Art und den Umfang der erforderlichen Prüfungshandlungen eigenverantwortlich<br />
unter Berücksichtigung der Gegebenheiten bei der Geme<strong>in</strong>de und <strong>in</strong> Kenntnis der Aufgabenerfüllung der<br />
Geme<strong>in</strong>de nach ihrem pflichtgemäßen Ermessen sorgfältig zu bestimmen. Ohne solide Kenntnisse des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Geschehens ist e<strong>in</strong>e Jahresabschlussprüfung mit der Erfassung e<strong>in</strong>es wirtschaftlich zutreffenden Ergebnisses<br />
kaum zu erfüllen. Von ihnen müssen die Prüfungsaussagen mit h<strong>in</strong>reichender Sicherheit getroffen werden<br />
GEMEINDEORDNUNG 675
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 103 GO <strong>NRW</strong><br />
können. Die Prüfer haben auch zu berücksichtigen, dass die Geme<strong>in</strong>de mit ihrer Aufgabenerfüllung und Verwaltung<br />
als E<strong>in</strong>heit bzw. Gesamtheit zu betrachten ist, bei der regelmäßig e<strong>in</strong>e hohe fachliche und technische Komplexität<br />
vorherrscht. Solche örtlichen Gegebenheiten s<strong>in</strong>d regelmäßig <strong>in</strong> die Beurteilung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses<br />
e<strong>in</strong>zubeziehen, damit die örtliche wirtschaftliche Situation zum Abschlussstichtag zutreffend<br />
durch den Bestätigungs- oder den Versagungsvermerk zum Ausdruck kommt.<br />
1.3 Besondere Aufgaben<br />
1.3.1 Weitere Prüfungstätigkeiten<br />
Die Vorschrift lässt auch die Übertragung von Prüfungsaufgaben durch den Rat der Geme<strong>in</strong>de und die Erteilung<br />
von Prüfungsaufträgen durch den Bürgermeister an die örtliche Rechnungsprüfung ausdrücklich zu (vgl. Absätze<br />
2 und 3 der Vorschrift). Sie hebt dabei besonders die Prüfung der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung auf Zweckmäßigkeit<br />
und Wirtschaftlichkeit durch e<strong>in</strong>e gesonderte Regelung hervor (vgl. Absatz 2 Nummer 1 der Vorschrift). Der Begriff<br />
„Wirtschaftlichkeit“ ergänzt dabei nicht die Regelungen über die gesetzlichen Prüfungsaufträge <strong>in</strong> Absatz 1 der<br />
Vorschrift, sondern bezieht sich auf das allgeme<strong>in</strong>e Verwaltungshandeln.<br />
Der örtlichen Rechnungsprüfung können darüber h<strong>in</strong>aus aber noch weitere besondere Aufgaben obliegen, wenn<br />
diese <strong>in</strong> anderen rechtlichen Vorschriften bestimmt worden s<strong>in</strong>d. Dazu gehört z.B. § 2 KorruptionsbG, weil auch<br />
im örtlichen Bereich dort korruptionsgefährdete Bereiche besonders anzunehmen s<strong>in</strong>d, wo auf Aufträge, Fördermittel<br />
und Genehmigungen der Geme<strong>in</strong>de E<strong>in</strong>fluss genommen werden kann. Außerdem wird <strong>in</strong> der Vorschrift<br />
bestimmt, unter welchen Voraussetzungen e<strong>in</strong> Dritter nicht als Prüfer tätig se<strong>in</strong> darf (vgl. Absatz 7 der Vorschrift).<br />
1.3.2 Die Kontrolle von Ausgleichszahlungen<br />
Nach Artikel 87-89 EG-Vertrag s<strong>in</strong>d vorbehaltlich abweichender Bestimmungen des Vertrages "staatliche oder<br />
aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen<br />
oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Geme<strong>in</strong>samen<br />
Markt unvere<strong>in</strong>bar, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten bee<strong>in</strong>trächtigen". Es soll deshalb e<strong>in</strong>e Beihilfenkontrolle<br />
stattf<strong>in</strong>den, um faire Wettbewerbsbed<strong>in</strong>gungen im Europäischen B<strong>in</strong>nenmarkt sicher zu stellen. Dabei<br />
muss e<strong>in</strong> sachgerechter Ausgleich mit der im europäischen Recht anerkannten Funktion der Mitgliedstaaten zu<br />
Leistung und Ausgestaltung der Dase<strong>in</strong>svorsorge (Dienstleistungen von allgeme<strong>in</strong>em wirtschaftlichem Interesse)<br />
herbeigeführt werden.<br />
Bei den nach Artikel 6 der Freistellungsentscheidung der Kommission vom 28. November 2005 (2005/842 EG)<br />
vorzunehmenden regelmäßigen Kontrollen ist zu prüfen, ob e<strong>in</strong>e unzulässige Ausgleichszahlung gewährt worden<br />
ist. Die im Rahmen der regelmäßigen Kontrollen zu treffende Entscheidung über die Zulässigkeit der Ausgleichszahlung<br />
ist von der gewährenden und nicht von der empfangenden Stelle vorzunehmen. Die Geme<strong>in</strong>den haben<br />
die regelmäßigen Kontrollen durchzuführen. Die örtliche Rechnungsprüfung kann dabei im Rahmen ihrer gesetzlichen<br />
Aufgaben e<strong>in</strong>e Kontrolle im S<strong>in</strong>ne der Freistellungsentscheidung gewährleisten. Sie kann sich ggf. auch<br />
fachlich geeigneter Stellen bedienen (vgl. Geme<strong>in</strong>samer Runderlass des M<strong>in</strong>isteriums für Wirtschaft, Mittelstand<br />
und Energie und des Innenm<strong>in</strong>isteriums vom 30.5.2008; SMBl. <strong>NRW</strong>. 651).<br />
1.3.3 Weitere Aufgaben<br />
Der örtlichen Rechnungsprüfung obliegen vielfach weitere Aufgaben, die z.B. durch Bundesrecht oder Europarecht<br />
bestimmt se<strong>in</strong> können, bei denen aber e<strong>in</strong>e Umsetzung durch das Land bzw. se<strong>in</strong>e Geme<strong>in</strong>den gefordert<br />
ist. So soll oftmals die zweckentsprechende Verwendung von EU-Fördermitteln durch die örtliche Rechnungsprü-<br />
GEMEINDEORDNUNG 676
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 103 GO <strong>NRW</strong><br />
fung im Rahmen des Verwendungsnachweises der Geme<strong>in</strong>de bereits besche<strong>in</strong>igt werden. Diese Tätigkeit der<br />
örtlichen Rechnungsprüfung stellt nach außen h<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e „Vorprüfung“ durch die Geme<strong>in</strong>de dar.<br />
In diesen Fällen vollzieht die örtliche Rechnungsprüfung ke<strong>in</strong>e verwaltungsmäßige Prüfung im Zuwendungsverfahren,<br />
denn diese obliegt üblicherweise der Bewilligungsbehörde im Rahmen des ihr vom Zuwendungsempfänger<br />
vorzulegenden Verwendungsnachweise (vgl. Nr. 11 der VVG zu § 44 LHO <strong>NRW</strong>). Die örtliche Rechnungsprüfung<br />
ist <strong>in</strong> diesem Zusammenhang vielmehr e<strong>in</strong>e „Vorprüfstelle“, deren Tätigkeit der laufenden Prüfung der Vorgänge<br />
<strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzbuchhaltung zuzurechnen ist (vgl. § 103 Abs. 1 Nr. 4 GO <strong>NRW</strong>). Die Prüfungstätigkeit<br />
ist daher auch nicht als Vorprüfung im S<strong>in</strong>ne der Prüfung der F<strong>in</strong>anzvorfälle gemäß § 100 Abs. 4 LHO<br />
<strong>NRW</strong> anzusehen, wie sie gesetzlich als Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung bestimmt wurde (vgl. § 103<br />
Abs. 1 Nr. 7 GO <strong>NRW</strong>).<br />
Die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung gehen <strong>in</strong>sgesamt weit über die Vorgaben <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>deordnung<br />
h<strong>in</strong>aus, denn vielfach werden der örtlichen Rechnungsprüfung auch Aufgaben durch Fachgesetze oder andere<br />
Vorschriften zugewiesen, die zu e<strong>in</strong>em sich weiter zu entwickelnden Anforderungsprofil an die Aufgabenerledigung<br />
und an die Prüfer führen. Auch die E<strong>in</strong>führung komplexer Verfahren <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung erfordert<br />
zeitgemäße, sachlich und fachlich zweckmäßige Handlungsweisen. Die örtliche Prüfung stellt daher vielfach<br />
bereits e<strong>in</strong>e „begleitende“ Prüfung dar und wird nicht erst zu e<strong>in</strong>em Zeitpunkt aktiv, zu dem Verwaltungsentscheidungen<br />
kaum noch umkehrbar s<strong>in</strong>d.<br />
1.4 Die Dokumentationspflichten<br />
Nach den Prüfungsgrundsätzen für Abschlussprüfungen ist die e<strong>in</strong>zelne Abschlussprüfung auch angemessen<br />
durch die Prüfungs<strong>in</strong>stanz zu dokumentieren. Dies dient u.a. dazu, Informationen, die zum Prüfungsergebnis und<br />
zu e<strong>in</strong>zelnen Prüfungsfeststellungen geführt haben, zu stützen und nachvollziehbar zu machen. Die Abschlussprüfer<br />
des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses haben deshalb über ihre Prüfung auch e<strong>in</strong>en Prüfungsbericht zu<br />
erstellen. Dabei soll im Rahmen des Prüfungsergebnisses e<strong>in</strong>e Feststellung getroffen werden, mit der die Ordnungsmäßigkeit<br />
des Verwaltungshandelns bestätigt oder mit der e<strong>in</strong>e Unbedenklichkeit im haushaltsrechtlichen<br />
S<strong>in</strong>ne ausgesprochen wird. Diese Feststellung kann im E<strong>in</strong>zelfall mit E<strong>in</strong>schränkungen versehen oder auch verweigert<br />
werden. E<strong>in</strong>e Orientierung an den Abstufungen des Bestätigungsvermerks nach § 101 GO <strong>NRW</strong> ist dabei<br />
möglich.<br />
Die Unterlagen des Abschlussprüfers über die jeweilige Jahresabschlussprüfung s<strong>in</strong>d, soweit der Prüfer der örtlichen<br />
Rechnungsprüfung der Geme<strong>in</strong>de angehört, entsprechend den Vorschriften über die Aufbewahrung von<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Unterlagen aufzubewahren, denn sie stellen Unterlagen der Geme<strong>in</strong>de über den jeweiligen Prüfungsgegenstand,<br />
z.B. Jahresabschluss, dar (vgl. § 58 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
2. Der Prüfungszeitraum bei Abschlussprüfungen<br />
Die örtliche Rechnungsprüfung hat nach der Vorschrift des Absatzes 1 <strong>in</strong>sbesondere die Aufgabe, den Jahresabschluss<br />
und den Gesamtabschluss der Geme<strong>in</strong>de sowie die Jahresabschlüsse der <strong>in</strong> § 97 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 4<br />
benannten Sondervermögen zu prüfen, denn der Rechnungsprüfungsausschusses des Rates der Geme<strong>in</strong>de soll<br />
sich nach § 59 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong> für se<strong>in</strong>e Abschlussprüfungen (vgl. § 101 Abs. 1 und § 116 Abs. 6 GO <strong>NRW</strong>) der<br />
örtlichen Rechnungsprüfung bedienen. Für diese Abschlussprüfungen steht der örtlichen Rechnungsprüfung nur<br />
e<strong>in</strong> begrenzter Zeitraum nach Ablauf des betreffenden Haushaltsjahres zur Verfügung. Dieser Zeitraum für die<br />
Durchführung der Prüfung wird e<strong>in</strong>erseits durch den Term<strong>in</strong> der Zuleitung des Entwurfs des Jahresabschlusses<br />
bzw. Gesamtabschlusses bestimmt.<br />
GEMEINDEORDNUNG 677
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 103 GO <strong>NRW</strong><br />
Der vom Bürgermeister bestätigte geme<strong>in</strong>dliche Jahresabschluss ist <strong>in</strong>nerhalb von drei Monaten nach Ablauf des<br />
Haushaltsjahres dem Rat zur Feststellung zuzuleiten (vgl. § 95 Abs. 3 S. 2 GO <strong>NRW</strong>) und der geme<strong>in</strong>dliche Gesamtabschluss<br />
spätestens nach neun Monaten nach dem Abschlussstichtag. Andererseits wird der Zeitraum<br />
durch die gesetzliche Vorgabe bestimmt, dass der Rat der Geme<strong>in</strong>de den geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss bis<br />
spätestens zum 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den vom Rechnungsprüfungsausschuss<br />
geprüften Jahresabschluss festzustellen hat (vgl. § 96 Abs. 1 S. 1 GO <strong>NRW</strong>). Dieser Endterm<strong>in</strong> gilt entsprechend<br />
auch für den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss (vgl. Verweis <strong>in</strong> § 116 Abs. 1 S. 4 GO <strong>NRW</strong>). Jedoch<br />
sollte der Rat der Geme<strong>in</strong>de nicht den letztmöglichen Term<strong>in</strong> zur Beschlussfassung nutzen, damit Erkenntnisse<br />
und Erfahrungen aus der Ausführung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft e<strong>in</strong>schließlich des dabei erzielten<br />
Jahresergebnisse so schnell wie möglich <strong>in</strong> der aktuellen Haushaltswirtschaft umgesetzt werden.<br />
Aus dem Zusammenspiel der Vorschriften sowie der gesetzlichen Prüfungszuständigkeit des Rechnungsprüfungsausschusses<br />
(vgl. § 59 Abs. 3 i.V.m. § 101 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> für den Jahresabschluss und § 59 Abs. 3 i.V.m.<br />
§ 116 Abs. 6 GO <strong>NRW</strong> für den Gesamtabschluss) ergibt sich unter Berücksichtigung der örtlichen Sitzungsterm<strong>in</strong>e<br />
für den Rechnungsprüfungsausschuss und den Rat der Geme<strong>in</strong>de der konkrete tatsächlich nutzbare Prüfungszeitraum.<br />
Da die örtliche Rechnungsprüfung nicht nur e<strong>in</strong>e nachrangige Prüfungstätigkeit, sondern auch<br />
e<strong>in</strong>e begleitende Prüfungstätigkeit <strong>in</strong>nehat, sollte sie selbst den Anstoß geben, möglichst von Anfang an, jedenfalls<br />
frühzeitig genug, <strong>in</strong> die Abschlussarbeiten e<strong>in</strong>bezogen und begleitend tätig zu werden.<br />
II. Erläuterungen im E<strong>in</strong>zelnen<br />
1. Zu Absatz 1 (Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung):<br />
1.1 Zu Satz 1 (Aufgabenkatalog der örtlichen Rechnungsprüfung):<br />
Die <strong>in</strong> Absatz 1 der Vorschrift aufgezählten Prüfungsaufgaben stellen abgegrenzte und eigenständige Sachverhalte<br />
<strong>in</strong> Form e<strong>in</strong>es Aufgabenkataloges der örtlichen Rechnungsprüfung dar. Die Prüfaufgaben <strong>in</strong> den Nummern<br />
4 bis 8 des Absatzes 1 der Vorschrift s<strong>in</strong>d nur <strong>in</strong>soweit <strong>in</strong> die jeweilige Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses<br />
oder des Gesamtabschlusses der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>zubeziehen bzw. dieser zuzurechnen, wie sie zw<strong>in</strong>gend<br />
für die Durchführung der Prüfung erforderlich s<strong>in</strong>d. Diese gesetzlich bestimmten Zwecke werden z.B. durch<br />
die Bestimmungen <strong>in</strong> § 101 Abs. 1 Satz 3 GO <strong>NRW</strong> deutlich, <strong>in</strong> dem ausdrücklich bestimmt wird, dass <strong>in</strong> die Prüfung<br />
des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses auch die Buchführung der Geme<strong>in</strong>de, die durchgeführte Inventur, das<br />
Inventar und die Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände der Geme<strong>in</strong>de<br />
e<strong>in</strong>zubeziehen s<strong>in</strong>d.<br />
Die Aufzählung stellt dabei jedoch ke<strong>in</strong>en vollständigen Katalog der Prüfungsaufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung<br />
im Rahmen der Jahresabschlussprüfung dar. Im Zusammenhang mit dem Aufgabenkatalog der örtlichen<br />
Rechnungsprüfung kommt h<strong>in</strong>zu, dass nach Absatz 2 der Vorschrift der Rat der Geme<strong>in</strong>de der örtlichen Rechnungsprüfung<br />
weitere Aufgaben übertragen und nach Absatz 3 der Vorschrift der Bürgermeister der örtlichen<br />
Rechnungsprüfung ebenfalls Prüfaufträge erteilen darf.<br />
1.1.1 Zu Nummer 1 (Prüfung des Jahresabschlusses der Geme<strong>in</strong>de):<br />
1.1.1.1 Inhalte der Jahresabschlussprüfung<br />
Die Prüfung des Jahresabschlusses ist Pflichtaufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung und Voraussetzung für die<br />
Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat sowie für die Entlastung des Bürgermeisters (vgl. § 96 GO<br />
<strong>NRW</strong>). Der Inhalt und die Durchführung der Prüfung sowie die Zuständigkeit für die Durchführung der Prüfung,<br />
aber auch die Behandlung des Prüfungsergebnisses s<strong>in</strong>d gesondert <strong>in</strong> § 101 GO <strong>NRW</strong> „Prüfung des Jahresab-<br />
GEMEINDEORDNUNG 678
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 103 GO <strong>NRW</strong><br />
schlusses, Bestätigungsvermerk“ geregelt. Der Jahresabschluss der Geme<strong>in</strong>de ist danach vom Rechnungsprüfungsausschuss<br />
dah<strong>in</strong>gehend zu prüfen, ob er e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,<br />
Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger<br />
Buchführung ergibt.<br />
Die Prüfung des Jahresabschlusses erstreckt sich auch darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden<br />
Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden s<strong>in</strong>d. Es ist aber auch das<br />
Ergebnis der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr zu prüfen, denn die Geme<strong>in</strong>de<br />
hat zum Schluss e<strong>in</strong>es jeden Haushaltsjahres e<strong>in</strong>en Jahresabschluss aufzustellen, <strong>in</strong> dem das Ergebnis<br />
der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist (vgl. § 95 Abs. 1 S. 1 GO <strong>NRW</strong>). In die vorzunehmende<br />
Prüfung s<strong>in</strong>d aber auch alle Bestandteile des Jahresabschlusses der Geme<strong>in</strong>de sowie die dazugehörigen<br />
Anlagen e<strong>in</strong>zubeziehen. Dar<strong>in</strong> s<strong>in</strong>d aber auch die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die Übersicht über<br />
örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände e<strong>in</strong>zubeziehen. Der Lagebericht ist darauf zu<br />
prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang steht und ob se<strong>in</strong>e sonstigen Angaben nicht e<strong>in</strong>e falsche Vorstellung<br />
von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de erwecken.<br />
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat über Art und Umfang der Prüfung sowie über das Ergebnis der Prüfung<br />
e<strong>in</strong>en Prüfungsbericht zu erstellen. Der Bestätigungsvermerk oder der Vermerk über se<strong>in</strong>e Versagung ist <strong>in</strong> den<br />
Prüfungsbericht aufzunehmen. Der Rechnungsprüfungsausschuss bzw. der Abschlussprüfer hat sich deshalb<br />
e<strong>in</strong>en Überblick über die rechtlichen und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Geme<strong>in</strong>de zu verschaffen. Aus ihrer<br />
abschließenden E<strong>in</strong>schätzung haben die Abschlussprüfer dann das von ihnen durchzuführende Prüfungsprogramm<br />
zu entwickeln. Besondere Bed<strong>in</strong>gungen seitens der Geme<strong>in</strong>de s<strong>in</strong>d dabei zu beachten.<br />
1.1.1.2 Die Prüfungsgrundsätze für Abschlussprüfungen<br />
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung werden h<strong>in</strong>sichtlich der jährlichen Abschlussprüfung noch ergänzt.<br />
Für diese Abschlussprüfungen haben sich die „Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfungen (GoA)“<br />
entwickelt. Diese be<strong>in</strong>halten Festlegungen zur Durchführung von Abschlussprüfungen sowie zu den Prüfungshandlungen.<br />
Außerdem bestehen noch weitere Ergänzungen durch die „Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung<br />
bei Abschlussprüfungen“ sowie die „Grundsätze für die ordnungsmäßige Erteilung von Bestätigungsvermerken<br />
bei Abschlussprüfungen“. Nach diesen Prüfungsgrundsätzen ist die Abschlussprüfung u.a. angemessen<br />
durch die Prüfungs<strong>in</strong>stanz zu dokumentieren.<br />
In diesem Zusammenhang sollen die Informationen, die zum Prüfungsergebnis und zu e<strong>in</strong>zelnen Prüfungsfeststellungen<br />
geführt haben, nachvollziehbar gemacht werden. Die Unterlagen des Abschlussprüfers über se<strong>in</strong>e<br />
Prüfung s<strong>in</strong>d entsprechend den Vorschriften über die Aufbewahrung von geme<strong>in</strong>dlichen Unterlagen aufzubewahren,<br />
soweit der Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung der Geme<strong>in</strong>de angehört (vgl. § 58 GemHVO <strong>NRW</strong>). Die<br />
Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses ist deshalb e<strong>in</strong> <strong>in</strong> mehrere Abschnitte zu unterteilender Vorgang,<br />
der sich von der Prüfungsplanung bis zur Berichterstattung über die durchgeführte Abschlussprüfung erstreckt.<br />
1.1.1.3 Der Umfang der Jahresabschlussprüfung<br />
1.1.1.3.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die Jahresabschlussprüfung schließt neben den Bestandteilen des Jahresabschlusses und se<strong>in</strong>en Anlagen auch<br />
die zu Grunde liegende Buchführung e<strong>in</strong>. Sie hat dazu beizutragen, dass der Jahresabschluss e<strong>in</strong> den tatsächlichen<br />
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de<br />
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelt. Die geme<strong>in</strong>dliche Buchführung muss<br />
daher den an sie gestellten Anforderungen entsprechen, damit der Jahresabschluss <strong>in</strong> der vorgeschriebenen<br />
GEMEINDEORDNUNG 679
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 103 GO <strong>NRW</strong><br />
Form aufgestellt werden kann, die vorgesehenen Angaben enthält und dafür die Vermögensgegenstände und<br />
Schulden richtig bewertet worden s<strong>in</strong>d. In der Vorschrift wird deshalb ausdrücklich bestimmt, dass <strong>in</strong> die Prüfung<br />
die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände<br />
e<strong>in</strong>zubeziehen s<strong>in</strong>d.<br />
Die Prüfung der Beachtung der gesetzlichen haushaltsrechtlichen Vorschriften, der Regelungen der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltssatzung sowie ergänzender Satzungen, aber auch weiterer ortsrechtlicher Bestimmungen ist<br />
ebenfalls e<strong>in</strong> wichtiger Gegenstand der Jahresabschlussprüfung. Zudem ist zu prüfen, ob muss der Lagebericht<br />
mit dem Jahresabschluss und den Erkenntnissen des Prüfers <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang steht. Die Angaben im Lagebericht<br />
dürfen nicht e<strong>in</strong>e falsche Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de<br />
erwecken und außerdem muss zu den künftigen Chancen und Risiken der Geme<strong>in</strong>de Auskunft gegeben werden.<br />
1.1.1.3.2 Die Prüfungsgegenstände<br />
1.1.1.3.2.1 Die Ergebnisrechnung<br />
Das Ressourcenverbrauchskonzept wird durch die Geme<strong>in</strong>de dadurch angemessen umgesetzt, dass für die Ausführung<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr e<strong>in</strong> Ergebnisplan mit den Rechengrößen „Aufwand“<br />
und „Ertrag“ zur Planung des Ressourcenverbrauchs und des Ressourcenaufkommens aufzustellen ist. In<br />
der Ergebnisrechnung nach § 38 GemHVO <strong>NRW</strong> s<strong>in</strong>d daher getrennt nach den Ertrags- und Aufwandsarten das<br />
tatsächliche Ressourcenaufkommen und der tatsächliche Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr <strong>in</strong> Jahressummen<br />
nachzuweisen.<br />
Die geme<strong>in</strong>dliche Ergebnisrechnung ist dabei entsprechend dem Ergebnisplan aufzubauen, so dass auch zwischen<br />
den ordentlichen und außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen zu trennen ist (vgl. § 38 Abs. 2 i.V.m.<br />
§ 2 GemHVO <strong>NRW</strong>). E<strong>in</strong>e solche „Abrechnung“ ist jedoch nur vollständig, wenn auch e<strong>in</strong> Plan-/Ist-Vergleich vorgenommen<br />
wird, d.h. Planabweichungen durch die Gegenüberstellung von der im Haushaltsplan ausgewiesenen<br />
Positionen mit den Ist-Werten gesondert festgestellt und ausgewiesen werden. In diesem Plan-/Ist-Vergleich s<strong>in</strong>d<br />
die nach § 22 Abs. 1 GemHVO <strong>NRW</strong> übertragenen Aufwandsermächtigungen gesondert auszuweisen (vgl. § 38<br />
Abs. 2 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
1.1.1.3.2.2 Die F<strong>in</strong>anzrechnung<br />
In der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzrechnung nach § 39 GemHVO <strong>NRW</strong> s<strong>in</strong>d für sämtliche E<strong>in</strong>zahlungs- und Auszahlungsarten<br />
jeweils Jahressummen auszuweisen, um die tatsächlichen E<strong>in</strong>zahlungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr<br />
nach Arten aufzuzeigen und <strong>in</strong>sgesamt die erfolgte Änderung des Bestandes an F<strong>in</strong>anzmitteln nachzuweisen.<br />
Dazu ist wie im F<strong>in</strong>anzplan der Saldo für die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Saldo für<br />
die Zahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus beiden der F<strong>in</strong>anzmittelüberschuss oder F<strong>in</strong>anzmittelfehlbetrag<br />
zu ermitteln.<br />
Durch die E<strong>in</strong>beziehung des Saldos aus der F<strong>in</strong>anzierungstätigkeit, aus den Zahlungen aus der Aufnahme und<br />
der Tilgung von Krediten für Investitionen und Krediten zur Liquiditätssicherung, lässt sich dann die Änderung des<br />
Bestandes an eigenen F<strong>in</strong>anzmitteln feststellen und ausweisen. E<strong>in</strong>e solche „Abrechnung“ ist jedoch nur vollständig,<br />
wenn auch e<strong>in</strong> Plan-/Ist-Vergleich vorgenommen wird, d.h. Planabweichungen durch die Gegenüberstellung<br />
von der im Haushaltsplan ausgewiesenen Positionen mit den Ist-Werten gesondert festgestellt und ausgewiesen<br />
werden. In diesem Plan-/Ist-Vergleich s<strong>in</strong>d die nach § 22 Abs. 1 GemHVO <strong>NRW</strong> übertragenen Auszahlungsermächtigungen<br />
gesondert auszuweisen (vgl. § 39 S. 3 i.V.m. § 38 Abs. 2 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
GEMEINDEORDNUNG 680
1.1.1.3.2.3 Die Bilanz<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 103 GO <strong>NRW</strong><br />
Die geme<strong>in</strong>dliche Bilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden der Geme<strong>in</strong>de zum Abschlussstichtag<br />
e<strong>in</strong> wesentlicher Bestandteil des NKF. Sie muss bestimmte Bilanzposten m<strong>in</strong>destens enthalten und auf<br />
der Aktivseite <strong>in</strong> die Bilanzbereiche „Anlagevermögen“, „Umlaufvermögen“ und „Rechnungsabgrenzungsposten“<br />
sowie auf der Passivseite <strong>in</strong> die Bilanzbereiche „Eigenkapital“, Verb<strong>in</strong>dlichkeiten“ und „Rechnungsabgrenzungsposten“<br />
gegliedert se<strong>in</strong> (vgl. § 41 GemHVO <strong>NRW</strong>). Die Gliederung der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz erfolgt dabei auf<br />
ihren beiden Seiten nach Fristigkeiten.<br />
Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen der Geme<strong>in</strong>de mit den zum Abschlussstichtag ermittelten Werten<br />
angesetzt. Damit wird die Mittelverwendung der Geme<strong>in</strong>de dokumentiert und zwischen Anlagevermögen<br />
(langfristig) und Umlaufvermögen (kurzfristig) unterschieden. Auf der Passivseite der Bilanz werden die Verb<strong>in</strong>dlichkeiten<br />
der Geme<strong>in</strong>de und ihr Eigenkapital gezeigt. Dadurch wird die Mittelherkunft bzw. die F<strong>in</strong>anzierung des<br />
Vermögens offengelegt und zuerst das Eigenkapital und dann das Fremdkapital gezeigt. Die Fristigkeit wird <strong>in</strong>nerhalb<br />
der Bilanzbereich gezeigt, so dass im Eigenkapital die allgeme<strong>in</strong>e Rücklage vor der Ausgleichsrücklage<br />
und bei den Verb<strong>in</strong>dlichkeiten die Kredite für Investitionen der Geme<strong>in</strong>de vor den Krediten zur Liquiditätssicherung<br />
stehen.<br />
1.1.1.3.2.4 Der Anhang<br />
Der Anhang enthält <strong>in</strong> Anlehnung an die Vorschriften über das kaufmännische Rechnungswesen besondere<br />
Erläuterungen. Die erforderlichen Informationen sollen im sachlichen Zusammenhang mit den Teilen des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Jahresabschlusses und se<strong>in</strong>en Bestandteilen und Anlagen stehen. So s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>sbesondere Angaben<br />
zu e<strong>in</strong>zelnen Bilanzpositionen und Ergebnispositionen zu machen, die neben der Beschreibung e<strong>in</strong>e Ergänzung,<br />
Korrektur und Entlastung der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz (vgl. § 44 GemHVO <strong>NRW</strong>) und Ergebnisrechnung (vgl. § 38<br />
GemHVO <strong>NRW</strong>) bezwecken und deren Interpretation unterstützen sollen.<br />
In den geme<strong>in</strong>dlichen Anhang gehören aber auch Erläuterungen zu den von der Geme<strong>in</strong>de angewandten Bilanzierungs-<br />
und Bewertungsmethoden. Gleichzeitig s<strong>in</strong>d im Anhang die Zusatz<strong>in</strong>formationen anzugeben, die für die<br />
Beurteilung des Jahresabschlusses e<strong>in</strong>e besondere Bedeutung haben und zu e<strong>in</strong>em besseren Verständnis e<strong>in</strong>zelner<br />
Sachverhalte führen. Für die äußere Gestaltung des Anhangs, se<strong>in</strong>en Aufbau und Umfang s<strong>in</strong>d jedoch<br />
ke<strong>in</strong>e besonderen Formvorgaben vorgesehen worden.<br />
Die Geme<strong>in</strong>de hat den Anhang eigenverantwortlich zu gestalten. Sie hat bei der Erarbeitung des Anhangs aber<br />
auch den Adressatenkreis des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses (Rat, Bürger<strong>in</strong>nen und Bürger) zu berücksichtigen.<br />
Um das zu vermittelnde Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Geme<strong>in</strong>de klar und verständlich darzustellen,<br />
sollen dem Anhang e<strong>in</strong> Anlagenspiegel, e<strong>in</strong> Forderungsspiegel und e<strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dlichkeitenspiegel beigefügt<br />
werden. Der Verb<strong>in</strong>dlichkeitenspiegel enthält dabei auch die nicht <strong>in</strong> der Bilanz ersche<strong>in</strong>enden Haftungsverhältnisse,<br />
z.B. Bürgschaftsverpflichtungen.<br />
1.1.1.3.2.5 Der Lagebericht<br />
Der Lagebericht ist nach § 48 GemHVO <strong>NRW</strong> so zu fassen, dass er e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes<br />
Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de vermittelt. E<strong>in</strong>erseits ist im<br />
Lagebericht e<strong>in</strong> Rückblick auf das Haushaltsjahr zu geben, denn er hat die Aufgabe, den Verlauf der laufenden<br />
Verwaltungs-, Investitions- und F<strong>in</strong>anzierungstätigkeit <strong>in</strong> zusammengefasster Form darzustellen. Die Analyse der<br />
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de im Lagebericht kann mit Hilfe betriebswirtschaftlicher<br />
Kennzahlen erfolgen.<br />
GEMEINDEORDNUNG 681
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 103 GO <strong>NRW</strong><br />
Es bleibt der Geme<strong>in</strong>de aber überlassen, mit welchen Kennzahlen sie arbeiten will, um ihre wirtschaftliche Lage<br />
zu beurteilen. Andererseits soll der Lagebericht auch Schlussfolgerungen für die zukünftige Haushaltswirtschaft<br />
enthalten. Dadurch kann er die Jahresabschlussanalyse erleichtern und offenlegen, ob e<strong>in</strong> nachhaltiges wirtschaftliches<br />
Handeln von der Geme<strong>in</strong>de angestrebt bzw. vorgenommen wird. In diesem Zusammenhang hat der<br />
jährliche Lagebericht e<strong>in</strong>e umfassende und vielfältige Ergänzungsfunktion. Auch kann er als e<strong>in</strong> strategisches<br />
Instrument der Steuerung der Geme<strong>in</strong>de angesehen werden.<br />
1.1.1.3.2.6 Die Anlagen zum Jahresabschluss<br />
Der geme<strong>in</strong>dliche Jahresabschluss soll möglichst e<strong>in</strong>e zutreffende Rechenschaft über die tatsächliche Ausführung<br />
und die Ergebnisse der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft im Zusammenhang mit der Sicherung der stetigen<br />
Aufgabenerledigung der Geme<strong>in</strong>de geben. Dieses erfordert, zu den gesetzlich bestimmten Bestandteilen des<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses die notwendigen Anlagen beizufügen (vgl. Abbildung).<br />
Übersicht über die geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlussunterlagen<br />
Bestandteile des Jahresabschlusses<br />
Ergebnisrechnung<br />
Prüfungsauftrag:<br />
Entspricht die Ergebnisrechnung den Anforderungen und enthält<br />
m<strong>in</strong>destens die vorgesehenen Haushaltspositionen sowie die Ist-<br />
Ergebnisse und Planansätze?<br />
F<strong>in</strong>anzrechnung<br />
Prüfungsauftrag:<br />
Entspricht die F<strong>in</strong>anzrechnung den Anforderungen und enthält m<strong>in</strong>destens<br />
die vorgesehenen Haushaltspositionen sowie die Ist-Ergebnisse<br />
und Planansätze?<br />
Teilrechnungen<br />
Prüfungsauftrag:<br />
Entspricht die Gliederung den im Haushaltsplan ausgewiesenen produktorientierten<br />
Teilplänen? Enthält jede e<strong>in</strong>zelne Teilrechnung die Ist-<br />
Zahlen zu Leistungsmengen und Kennzahlen <strong>in</strong> den Teilplänen?<br />
Bilanz<br />
Prüfungsauftrag:<br />
Entspricht die Gliederung der Bilanz den Anforderungen? Wird auf der<br />
Aktivseite e<strong>in</strong> „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ ausgewiesen?<br />
Anhang<br />
Prüfungsauftrag:<br />
Enthält er ausreichende Erläuterungen zu den Posten der Bilanz und<br />
der Ergebnisrechnung?<br />
Wurden Vere<strong>in</strong>fachungsverfahren angewandt?<br />
Erfüllt er die übrigen Anforderungen?<br />
Anlagen beim Jahresabschluss<br />
Anlagenspiegel<br />
Prüfungsauftrag:<br />
Ist die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens dargestellt?<br />
Werden die übrigen Anforderungen erfüllt?<br />
GEMEINDEORDNUNG 682<br />
§ 95 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. §<br />
37 Abs. 1 Nr. 1 und § 38 sowie<br />
§ 22 Abs. 4 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
und Nr. 1.6.1 des Runderlasses<br />
vom 24.02.2005<br />
§ 95 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. §<br />
37 Abs. 1 Nr. 2 und § 39 sowie<br />
§ 22 Abs. 4 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
und Nr. 1.6.3 des Runderlasses<br />
vom 24.02.2005<br />
§ 95 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. §<br />
37 Abs. 1 Nr. 3 und § 40<br />
GemHVO <strong>NRW</strong> sowie den<br />
Nrn. 1.6.2 und Nr. 1.6.4 des<br />
Runderlasses vom 24.02.2005<br />
§<br />
95 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. §<br />
37 Abs. 1 Nr. 4 und §§ 41 bis<br />
43 GemHVO <strong>NRW</strong> sowie den<br />
Nr. 1.6.5 des Runderlasses<br />
vom 24.02.2005<br />
§ 95 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. §<br />
37 Abs. 1 Nr. 5 und § 44<br />
GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 44 Abs. 3 und § 45 GemH-<br />
VO <strong>NRW</strong> sowie Nr. 1.6.6 des<br />
Runderlasses vom 24.02.2005
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 103 GO <strong>NRW</strong><br />
Forderungsspiegel<br />
Prüfungsauftrag:<br />
Wird e<strong>in</strong>e ausreichende Übersicht über den Stand der Forderung<br />
gegeben? Werden die übrigen Anforderungen erfüllt?<br />
Verb<strong>in</strong>dlichkeitenspiegel<br />
Prüfungsauftrag:<br />
Wird e<strong>in</strong>e ausreichende Übersicht über den Stand der Verb<strong>in</strong>dlichkeiten<br />
gegeben? Werden die übrigen Anforderungen erfüllt?<br />
Lagebericht<br />
Prüfungsauftrag:<br />
Wird e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der<br />
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Kommune gegeben?<br />
Werden die übrigen Anforderungen erfüllt?<br />
Abbildung 140 „Jahresabschlussunterlagen der Geme<strong>in</strong>de“<br />
1.1.1.3.2.7 Die Prüfung der gesamten Haushaltswirtschaft<br />
§ 44 Abs. 3 und § 46 GemH-<br />
VO <strong>NRW</strong> sowie Nr. 1.6.7 des<br />
Runderlasses vom 24.02.2005<br />
§ 44 Abs. 3 und § 47 GemH-<br />
VO <strong>NRW</strong> sowie Nr. 1.6.8 des<br />
Runderlasses vom 24.02.2005<br />
§ 95 Abs. 1 und 2 GO <strong>NRW</strong><br />
i.V.m. § 48 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
Im Rahmen der Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses, <strong>in</strong>sbesondere <strong>in</strong> der Prüfungsaufgabe, ob die<br />
gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet<br />
worden s<strong>in</strong>d, ist e<strong>in</strong>e Recht- und Ordnungsmäßigkeitsprüfung der gesamten Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de<br />
zu verstehen. Dabei umfasst die Rechtmäßigkeitsprüfung regelmäßig die Beurteilung des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Verwaltungshandelns dah<strong>in</strong>gehend, ob die rechtlichen Vorgaben bei der Ausführung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft<br />
e<strong>in</strong>gehalten worden s<strong>in</strong>d. E<strong>in</strong>e Ordnungsmäßigkeitsprüfung soll feststellen, ob das haushaltswirtschaftliche<br />
Handeln der Geme<strong>in</strong>de vollständig und richtig nachgewiesen wird.<br />
Diese Gegebenheiten ändern sich auch nicht durch das Prüfungsziel, ob der Jahresabschluss der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong><br />
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der<br />
Geme<strong>in</strong>de unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ergibt. Es muss für den geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Bereich die Besonderheit berücksichtigt werden, dass die jährliche Haushaltssatzung nicht für sich alle<strong>in</strong>e<br />
steht, sondern durch den damit <strong>in</strong> unmittelbarer Verb<strong>in</strong>dung stehenden Haushaltsplan näher ausgestaltet wird,<br />
der verb<strong>in</strong>dlich für die geme<strong>in</strong>dliche Verwaltung ist (vgl. § 79 Abs. 3 S. 2 GO <strong>NRW</strong>). Außerdem steht die von den<br />
Ratsmitgliedern zu beschließende Entlastung des Bürgermeisters damit <strong>in</strong> Zusammenhang (vgl. § 96 Abs. 1 S. 4<br />
GO <strong>NRW</strong>).<br />
Im Rahmen der Gesetz- und Ordnungsmäßigkeitsprüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses kann sich ergeben,<br />
dass die Geme<strong>in</strong>de auch zur Aufstellung e<strong>in</strong>es Gesamtabschlusses verpflichtet ist, dieser Verpflichtung aber<br />
noch nicht nachgekommen ist. In diesen Fällen s<strong>in</strong>d dem Bürgermeister der Geme<strong>in</strong>de entsprechende H<strong>in</strong>weise<br />
zu geben. Dieser Verstoß gegen gesetzliche Pflichten ist jedoch nicht Gegenstand der orig<strong>in</strong>ären Jahresabschlussprüfung<br />
und berührt diese daher nicht. Der Verstoß kann daher auch nicht zu e<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>schränkung des<br />
Bestätigungsvermerks aus der Jahresabschlussprüfung führen.<br />
1.1.1.4 Prüfungshandlungen und Prüfungsergebnis<br />
1.1.1.4.1 Die Prüfungshandlungen<br />
Der Abschlussprüfer hat Art und Umfang der erforderlichen Prüfungshandlungen sowie die Intensität und die<br />
Methoden der Abschlussprüfung unter Berücksichtigung des Prüfungsgegenstandes und des Zieles der Abschlussprüfung<br />
eigenverantwortlich und <strong>in</strong> Kenntnis der Aufgabenerfüllung der Geme<strong>in</strong>de und der für das abzurechnende<br />
Haushaltsjahr geplanten Haushaltswirtschaft sowie der Buchführung der Geme<strong>in</strong>de nach pflichtgemä-<br />
GEMEINDEORDNUNG 683
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 103 GO <strong>NRW</strong><br />
ßem Ermessen festzulegen. Er hat dabei auch besondere Gegebenheiten bei der Geme<strong>in</strong>de zu berücksichtigen,<br />
dem im Rahmen der geme<strong>in</strong>dlichen Abschlussprüfung gilt es, relevante Prüfungsaussagen unter Beachtung des<br />
Grundsatzes der Wesentlichkeit und des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit treffen zu können.<br />
Der Abschlussprüfer soll aber auch e<strong>in</strong>e zukunftsorientierte Beurteilung der Chancen und Risiken aus der aktuellen<br />
Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de vorgenommen werden. Daher sollen qualitative sowie zukunftsbezogene,<br />
aber auch prozessorientierte E<strong>in</strong>flussfaktoren auf die Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> die geme<strong>in</strong>dliche Jahresabschlussprüfung<br />
e<strong>in</strong>bezogen und beurteilt werden. E<strong>in</strong>e Entscheidung über e<strong>in</strong>en risikoorientierten Prüfungsansatz ist daher im<br />
Zusammenspiel mit den gesetzlichen Prüfungsaufgaben, e<strong>in</strong>e laufende Prüfung der Vorgänge <strong>in</strong> der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung<br />
zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses durchzuführen und die Zahlungsabwicklung der<br />
Geme<strong>in</strong>de dauernd zu überwachen (vgl. § 103 Abs. 1 Nr. 4 und 5 GO <strong>NRW</strong>), zu treffen.<br />
E<strong>in</strong>e lückenlose Prüfung sollte nur dann vom Abschlussprüfer beabsichtigt werden, wenn das Ziel der Abschlussprüfung<br />
nicht anders erreicht werden kann. Aus der Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses müssen daher<br />
vom Abschlussprüfer relevante Prüfungsaussagen zum Jahresabschluss mit h<strong>in</strong>reichender Sicherheit getroffen<br />
werden können. Deshalb gehören zur Abschlussprüfung z.B.<br />
- die Prüfung des Vorhandense<strong>in</strong>s bestimmter Vermögensgegenstände,<br />
- die Prüfung des Erwerbs von Vermögensgegenständen,<br />
- die Prüfung der Vollständigkeit der Vermögensgegenstände und Schulden,<br />
- die Prüfung der Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden,<br />
um die ordnungsgemäße Ausführung der vom Rat ermächtigten Haushaltswirtschaft unter Berücksichtigung ihrer<br />
Ergebnisse feststellen zu können. Neben den Prüfungshandlungen zur Prüfung der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz s<strong>in</strong>d<br />
daher auch die <strong>in</strong> der Ergebnisrechnung nachgewiesenen Aufwendungen und Erträge sowie die <strong>in</strong> der F<strong>in</strong>anzrechnung<br />
nachgewiesenen Auszahlungen und E<strong>in</strong>zahlungen unter E<strong>in</strong>beziehung der Haushaltssatzung und der<br />
weiteren haushaltswirtschaftlichen Bestimmungen zu prüfen.<br />
Im Rahmen se<strong>in</strong>er Informationsrechte kann der verantwortliche Abschlussprüfer für den geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss<br />
auch Arbeiten e<strong>in</strong>es anderen Abschlussprüfers übernehmen. Er hat <strong>in</strong> diesen Fällen immer <strong>in</strong> geeigneter<br />
Weise zu überprüfen, ob die ihm überlassenen Unterlagen auch für e<strong>in</strong>e Übernahme <strong>in</strong> se<strong>in</strong>e Prüfung geeignet<br />
s<strong>in</strong>d und welcher Prüfer ihm die Unterlagen überlassen hat. In diesem Rahmen ist e<strong>in</strong> Zusammenhang mit den<br />
eigenen Prüfungshandlungen herzustellen, so dass die Inhalte und das Ausmaß der Übernahme zutreffend abgewogen<br />
werden kann. Das Ergebnis dieser Überprüfung ist vom Abschlussprüfer zu dokumentieren.<br />
1.1.1.4.2 Das Prüfungsergebnis<br />
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat über Art und Umfang der Prüfung des Jahresabschlusses sowie über das<br />
Ergebnis der Prüfung e<strong>in</strong>en Prüfungsbericht zu erstellen und den Bestätigungsvermerk <strong>in</strong> den Prüfungsbericht<br />
aufzunehmen. Bei der Festlegung der Inhalte und Abgrenzungen des Bestätigungsvermerks oder des Vermerks<br />
über se<strong>in</strong>e Versagung s<strong>in</strong>d die Vorschriften des § 101 Abs. 4 bis 7 GO <strong>NRW</strong> zu beachten (vgl. auch Erläuterungen<br />
zu § 116 Abs. 6 GO <strong>NRW</strong>). Die „Grundsätze für die ordnungsmäßige Erteilung von Bestätigungsvermerken“<br />
können dabei als Beurteilungsmaßstäbe herangezogen werden. Für die Darstellungen im Prüfungsbericht sowie<br />
für se<strong>in</strong>e Gestaltung bestehen über die genannten Vorschriften h<strong>in</strong>aus ke<strong>in</strong>e weiteren Vorgaben. Der Prüfungsbericht<br />
ist daher von der Geme<strong>in</strong>de bzw. von den Verantwortlichen für die Jahresabschlussprüfung nach örtlichen<br />
Bedürfnissen eigenverantwortlich auszugestalten.<br />
1.1.1.5 Der Zeitraum der Jahresabschlussprüfung<br />
Für die Durchführung der Jahresabschlussprüfung ist gesetzlich nicht ausdrücklich e<strong>in</strong> abgegrenzter Zeitraum<br />
bestimmt worden. Gleichwohl ergibt sich aus der E<strong>in</strong>ordnung der Prüfung des Jahresabschlusses <strong>in</strong> den Verfah-<br />
GEMEINDEORDNUNG 684
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 103 GO <strong>NRW</strong><br />
rensablauf der Aufstellung und Feststellung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses, dass für die Durchführung<br />
der Prüfung nur e<strong>in</strong> begrenzter Zeitraum zur Verfügung steht. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen,<br />
dass der Bürgermeister den Entwurf des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses <strong>in</strong>nerhalb von drei Monaten nach<br />
Ablauf des Haushaltsjahres folgenden Jahres dem Rat zuzuleiten hat (vgl. § 95 Abs. 3 S. 2 GO <strong>NRW</strong>). Andererseits<br />
hat der Rat der Geme<strong>in</strong>de spätestens bis zum 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres<br />
den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss festzustellen (vgl. § 96 Abs.<br />
1 S. 1 GO <strong>NRW</strong>).<br />
Die Geme<strong>in</strong>de hat außerdem dafür Sorge zu tragen, dass <strong>in</strong> dem genannten Zeitraum auch die Prüfung des<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss erfolgen muss. Es ist dabei zu berücksichtigen, dass sich der dafür zuständige<br />
Rechnungsprüfungsausschuss (vgl. § 59 Abs. 3 i.V.m. § 101 GO <strong>NRW</strong>) der örtlichen Rechnungsprüfung zu bedienen<br />
hat oder, soweit e<strong>in</strong>e solche nicht besteht, sich Dritter gem. § 103 Abs. 5 bedienen kann (vgl. § 59 Abs. 3<br />
GO <strong>NRW</strong>). Zu berücksichtigen ist auch, dass die geme<strong>in</strong>dlichen Organe die gesetzlich zugelassenen Fristen nicht<br />
vollausschöpfen müssen, so dass sich die für die tatsächliche Durchführung der Jahresabschlussprüfung verfügbare<br />
Zeit noch reduzieren kann.<br />
E<strong>in</strong>e schnelle und kurzfristige Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses ist vom Gesetzgeber gewollt, denn<br />
die Ergebnisse des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses sollen so schnell wie möglich <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplanung<br />
und bei der Haushaltsausführung der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>e entsprechende Berücksichtigung f<strong>in</strong>den. Die<br />
geme<strong>in</strong>dliche Aufsichtsbehörde ist daher an e<strong>in</strong>er zeitnahen Anzeige des festgestellten Jahresabschlusses sehr<br />
<strong>in</strong>teressiert.<br />
1.1.2 Zu Nummer 2 (Prüfung der Jahresabschlüsse von Sondervermögen):<br />
1.1.2.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Nach dieser Vorschrift s<strong>in</strong>d die Jahresabschlüsse der <strong>in</strong> § 97 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 4 GO <strong>NRW</strong> benannten Sondervermögen<br />
e<strong>in</strong>e Pflichtaufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung. Zu diesen Sondervermögen der Geme<strong>in</strong>de gehören<br />
das Geme<strong>in</strong>degliedervermögen, das Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen und die<br />
rechtlich unselbstständigen Versorgungs- und Versicherungse<strong>in</strong>richtungen. Die örtliche Rechnungsprüfung hat<br />
bei diesen Sondervermögen zu prüfen, <strong>in</strong>wieweit die Zwecke dieser Sondervermögen durch die Geme<strong>in</strong>de erfüllt<br />
wurden. Außerdem ist zu beachten, dass die Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe (vgl. § 97 Abs. 1<br />
Nr. 3 GO <strong>NRW</strong>) nach den Vorschriften des § 106 GO <strong>NRW</strong> vorzunehmen ist. In die vorzunehmende Prüfung s<strong>in</strong>d<br />
alle Bestandteile des Jahresabschlusses de Sondervermögens der Geme<strong>in</strong>de sowie die dazugehörigen Anlagen<br />
e<strong>in</strong>zubeziehen.<br />
1.1.2.2 Die Sondervermögen nach § 97 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 GO <strong>NRW</strong><br />
1.1.2.2.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Diese Vorschrift enthält zwar ausdrücklich den Begriff „Jahresabschluss“ unter Bezugnahme auf die Sondervermögen<br />
nach § 97 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 GO <strong>NRW</strong>. Diese Festlegung führt jedoch nicht zur Verpflichtung der Geme<strong>in</strong>de<br />
für dieser geme<strong>in</strong>dlichen Sondervermögen auch e<strong>in</strong>en eigenständigen Jahresabschluss aufzustellen,<br />
denn diese Sondervermögen s<strong>in</strong>d im Haushalt der Geme<strong>in</strong>de enthalten. Sie s<strong>in</strong>d damit auch h<strong>in</strong>sichtlich ihrer<br />
Erträge und Aufwendungen sowie ihrer Vermögens- und Schuldenlage im Jahresabschluss der Geme<strong>in</strong>de auszuweisen.<br />
Die Geme<strong>in</strong>de hat aber gleichwohl für jedes dieser Sondervermögen e<strong>in</strong>en gesonderten Nachweis<br />
über die E<strong>in</strong>haltung der Zwecksetzung des Sondervermögens im abgelaufenen Haushaltsjahr zu führen, weil die<br />
Sondervermögen vom allgeme<strong>in</strong>en Geme<strong>in</strong>devermögen abgesondert s<strong>in</strong>d. Diese Vorgabe kann im E<strong>in</strong>zelfall<br />
bedeuten, z.B. bei größeren rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen (vgl. § 97 Abs. 1 Nr. 2 GO <strong>NRW</strong>),<br />
GEMEINDEORDNUNG 685
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 103 GO <strong>NRW</strong><br />
dass ggf. e<strong>in</strong> gesondertes Jahresergebnis (Abschluss) fest- bzw. aufzustellen und mit e<strong>in</strong>er dazu gehörenden<br />
Übersicht über die zurechenbaren Vermögen und Schulden zum Gegenstand der örtlichen Prüfung zu machen<br />
ist.<br />
1.1.2.2.2 Das Geme<strong>in</strong>degliedervermögen<br />
Das Geme<strong>in</strong>degliedervermögen ist zwar Vermögen der Geme<strong>in</strong>de, das jedoch auf Grund besonderer Berechtigungen<br />
von den Geme<strong>in</strong>dee<strong>in</strong>wohnern und nicht von der Geme<strong>in</strong>de selbst genutzt wird. Zum Geme<strong>in</strong>degliedervermögen<br />
gehören auf dem Grundeigentum lastende Nutzungsberechtigungen, z.B. bei Wald- und Wegegrundstücken,<br />
die aus der geschichtlichen Entwicklung der Geme<strong>in</strong>de heraus heute noch bestehen können. Auch<br />
kann <strong>in</strong> E<strong>in</strong>zelfällen das Nutzungsrecht nicht allen, sondern nur e<strong>in</strong>er Gruppe von E<strong>in</strong>wohnern der Geme<strong>in</strong>de zu<br />
stehen (Geme<strong>in</strong>degliederklassenvermögen). Der Geme<strong>in</strong>de obliegt aber die Pflicht, dieses Vermögen zu verwalten.<br />
Zum Geme<strong>in</strong>degliedervermögen enthält § 99 GO <strong>NRW</strong> besondere Regelungen.<br />
1.1.2.2.3 Die rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen<br />
Bei rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen (fiduziarische Stiftungen) werden i.d.R. durch e<strong>in</strong>en Dritten als<br />
Stifter der Geme<strong>in</strong>de Vermögensgegenstände mit e<strong>in</strong>er bestimmten Zwecksetzung (Stifterwillen) zu Eigentum<br />
übertragen. In diesen Fällen hat der Stifter die <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Eigentum bef<strong>in</strong>dlichen Vermögenswerte zu Gunsten<br />
e<strong>in</strong>es uneigennützigen, auf Dauer e<strong>in</strong>gerichteten Zwecks entäußert, der nach se<strong>in</strong>em Willen durch die Geme<strong>in</strong>de<br />
zu erfüllen ist.<br />
Diese Gegebenheiten führen dazu, dass die Geme<strong>in</strong>de nach außen im eigenen Namen auftritt, im Innenverhältnis<br />
zum Stifter aber an den Stifterwillen gebunden ist. Werden dagegen aber von der Geme<strong>in</strong>de als Stifter vorhandene<br />
Vermögenswerte zu Gunsten e<strong>in</strong>es uneigennützigen, auf Dauer e<strong>in</strong>gerichteten Zwecks entäußert, der nach<br />
ihrem Willen durch e<strong>in</strong>en Dritten zu erfüllen ist (Errichtung e<strong>in</strong>er rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftung<br />
durch die Geme<strong>in</strong>de selbst), müssen h<strong>in</strong>sichtlich der E<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gung von Vermögensgegenständen <strong>in</strong> diese Stiftung<br />
die Voraussetzungen des § 100 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong> erfüllt se<strong>in</strong>.<br />
1.1.2.3 Die Sondervermögen nach § 97 Abs. 1 Nr. 3 GO <strong>NRW</strong><br />
Bei wirtschaftlichen Unternehmen (§ 114 GO <strong>NRW</strong>) und organisatorisch verselbstständigte E<strong>in</strong>richtungen (§ 107<br />
Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>) ohne eigene Rechtspersönlichkeit s<strong>in</strong>d die Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen E<strong>in</strong>richtungen<br />
wichtige Organisationsgebilde der Geme<strong>in</strong>de, die entsprechend den Vorschriften über die wirtschaftliche<br />
und nichtwirtschaftliche Betätigung der Geme<strong>in</strong>den als Sondervermögen errichtet werden. Diese geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Vermögensformen s<strong>in</strong>d unter Beachtung der Eigenbetriebsordnung (EigVO <strong>NRW</strong>) wirtschaftlich und verwaltungsmäßig<br />
selbstständig. Zu den geme<strong>in</strong>dlichen Sondervermögen nach dieser Nummer gehören auch die geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Krankenhäuser, die wie geme<strong>in</strong>dliche Eigenbetriebe als organisatorisch und wirtschaftlich eigenständige<br />
E<strong>in</strong>richtungen von der Geme<strong>in</strong>de zu betreiben s<strong>in</strong>d (vgl. §§ 1 und 10 der Geme<strong>in</strong>dekrankenhausbetriebsverordnung<br />
- GemKHBVO).<br />
Für die Jahresabschlussprüfung dieser geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe wurden jedoch Sonderregelungen getroffen, so<br />
dass deren Jahresabschlussprüfung nicht der örtlichen Rechnungsprüfung obliegt (vgl. § 106 GO <strong>NRW</strong>). Sie s<strong>in</strong>d<br />
deshalb auch nicht <strong>in</strong> der Aufzählung <strong>in</strong> Absatz 1 enthalten (vgl. § 97 Abs. 1 Nr. 3 GO <strong>NRW</strong>). Nach der Vorschrift<br />
obliegt der Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt die Jahresabschlussprüfung, die sich dazu e<strong>in</strong>es Wirtschaftsprüfers, e<strong>in</strong>er<br />
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder <strong>in</strong> E<strong>in</strong>zelfällen e<strong>in</strong>es hierzu befähigten eigenen Prüfers bedient. Die Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt<br />
hat das Prüfungsergebnis <strong>in</strong> Form des Prüfungsberichts der betroffenen Geme<strong>in</strong>de mitzuteilen.<br />
Wenn Veranlassung dazu besteht oder auf Anforderung, teilt die Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt das Prüfungs-<br />
GEMEINDEORDNUNG 686
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 103 GO <strong>NRW</strong><br />
ergebnis den Kommunal- und den Fachaufsichtsbehörden mit. Diese Regelungen gelten entsprechend auch für<br />
E<strong>in</strong>richtungen, die gemäß § 107 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> entsprechend den Vorschriften über das Rechnungswesen der<br />
Eigenbetriebe geführt werden.<br />
Zu den Unternehmen nach dieser Vorschrift zählen jedoch nicht unselbstständige Unternehmen <strong>in</strong>nerhalb der<br />
öffentlichen Verwaltung. Diese Regiebetriebe s<strong>in</strong>d als Verwaltungsbetriebe rechtlich und wirtschaftlich unselbstständigen<br />
Unternehmen, bei denen nur die Geme<strong>in</strong>de Rechtsbeziehungen mit dem Wirtschaftpartner e<strong>in</strong>gehen<br />
kann. Sie s<strong>in</strong>d Teil der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung und s<strong>in</strong>d an den Haushaltsplan der Geme<strong>in</strong>de gebunden. Die<br />
ihnen zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen sowie die Zahlungen s<strong>in</strong>d daher im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan<br />
enthalten. Auch die <strong>in</strong> der öffentlichen Verwaltung bestehen auch Betriebe gewerblicher Art (BgA), die lediglich<br />
für steuerrechtliche Zwecke „verselbstständigt“ worden s<strong>in</strong>d, z.B. zur Erfüllung der Körperschaftssteuer,<br />
fallen nicht unter diese Vorschrift.<br />
1.1.2.4 Die Sondervermögen nach § 97 Abs. 1 Nr. 4 GO <strong>NRW</strong><br />
Die Prüfung e<strong>in</strong>es förmlichen Jahresabschlusses, wie er für die Geme<strong>in</strong>de selbst vorgesehen ist, ist für Sondervermögen<br />
nach § 97 Abs. 1 Nr. 4 GO <strong>NRW</strong> ist nur dann erforderlich, wenn für e<strong>in</strong>e unter diese Vorschrift fallende<br />
Versorgungs- und Versicherungse<strong>in</strong>richtung der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong> eigener Rechnungskreis besteht, z.B. für e<strong>in</strong>e<br />
eigene Zusatzversorgungskasse oder e<strong>in</strong>e Eigenunfallversicherung. Diese können e<strong>in</strong>e entsprechend abgesonderte<br />
Haushalts- und Wirtschaftsführung erfordern.<br />
Bei geme<strong>in</strong>dlichen E<strong>in</strong>richtungen, die Teil des Haushalts der Geme<strong>in</strong>de und damit im Jahresabschluss der Geme<strong>in</strong>de<br />
enthalten s<strong>in</strong>d, bedarf es ke<strong>in</strong>es eigenständigen Jahresabschlusses. Die Geme<strong>in</strong>de hat aber gleichwohl<br />
für diese Sondervermögen e<strong>in</strong>en Nachweis zu führen, dass die Zwecksetzung des Sondervermögens im abgelaufenen<br />
Haushaltsjahr e<strong>in</strong>gehalten wurde. Dies kann durch e<strong>in</strong> gesondertes Jahresergebnis (Abschluss) mit e<strong>in</strong>er<br />
dazu gehörenden Übersicht über die zurechenbaren Vermögen und Schulden festgestellt werden, so dass diese<br />
Unterlagen zum Gegenstand der Prüfung zu machen s<strong>in</strong>d. E<strong>in</strong>e solche Ergebnisdarstellung reicht aus haushaltsrechtlicher<br />
Sicht aus.<br />
1.1.3 Zu Nummer 3 (Prüfung des Gesamtabschlusses):<br />
1.1.3.1 Inhalte der Gesamtabschlussprüfung<br />
Die Prüfung des Gesamtabschlusses ist Pflichtaufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung und Voraussetzung für<br />
die Bestätigung des Gesamtabschlusses durch den Rat sowie für die Entlastung des Bürgermeisters (vgl. § 116<br />
i.V.m. § 96 GO <strong>NRW</strong>). Der Inhalt und die Durchführung der Prüfung s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> § 116 Abs. 6 GO <strong>NRW</strong> geregelt. Dar<strong>in</strong><br />
wird zudem auf die Vorschrift des § 101 Abs. 2 bis 8 GO <strong>NRW</strong> verwiesen, so dass wegen der E<strong>in</strong>zelheiten auf die<br />
Erläuterungen zur Prüfung des Jahresabschlusses und den Bestätigungsvermerk verwiesen wird. Der Gesamtabschluss<br />
der Geme<strong>in</strong>de ist danach vom Rechnungsprüfungsausschuss dah<strong>in</strong>gehend zu prüfen, ob er e<strong>in</strong> den<br />
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzgesamtlage der<br />
Geme<strong>in</strong>de unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ergibt.<br />
Die Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses erstreckt sich darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und<br />
die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden s<strong>in</strong>d. Der Gesamtlagebericht<br />
ist auch darauf zu prüfen, ob er mit dem Gesamtabschluss <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang steht und ob se<strong>in</strong>e sonstigen<br />
Angaben nicht e<strong>in</strong>e falsche Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzgesamtlage der<br />
Geme<strong>in</strong>de erwecken. In die vorzunehmende Prüfung s<strong>in</strong>d alle Bestandteile des Gesamtabschlusses der Geme<strong>in</strong>de<br />
sowie die dazugehörigen Anlagen e<strong>in</strong>zubeziehen. Der Rechnungsprüfungsausschuss bzw. der Abschlussprüfer<br />
hat sich deshalb e<strong>in</strong>en Überblick über die rechtlichen und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Geme<strong>in</strong>de zu<br />
GEMEINDEORDNUNG 687
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 103 GO <strong>NRW</strong><br />
verschaffen. Aus ihrer abschließenden E<strong>in</strong>schätzung haben die Abschlussprüfer dann das von ihnen durchzuführende<br />
Prüfungsprogramm zu entwickeln. Besondere Bed<strong>in</strong>gungen seitens der Geme<strong>in</strong>de s<strong>in</strong>d dabei zu beachten.<br />
1.1.3.2 Die Prüfungsgrundsätze für Abschlussprüfungen<br />
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung werden h<strong>in</strong>sichtlich der jährlichen Abschlussprüfung noch ergänzt.<br />
Für diese Abschlussprüfungen haben sich die „Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfungen (GoA)“<br />
entwickelt. Diese be<strong>in</strong>halten Festlegungen zur Durchführung von Abschlussprüfungen sowie zu den Prüfungshandlungen.<br />
Außerdem bestehen noch weitere Ergänzungen durch die „Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung<br />
bei Abschlussprüfungen“ sowie die „Grundsätze für die ordnungsmäßige Erteilung von Bestätigungsvermerken<br />
bei Abschlussprüfungen“. Nach diesen Prüfungsgrundsätzen ist die Abschlussprüfung u.a. angemessen<br />
durch die Prüfungs<strong>in</strong>stanz zu dokumentieren.<br />
Mit der Dokumentation sollen die Informationen, die zum Prüfungsergebnis und zu e<strong>in</strong>zelnen Prüfungsfeststellungen<br />
geführt haben, nachvollziehbar gemacht werden. Die Unterlagen des Abschlussprüfers über se<strong>in</strong>e Prüfung<br />
s<strong>in</strong>d entsprechend den Vorschriften über die Aufbewahrung von geme<strong>in</strong>dlichen Unterlagen aufzubewahren, soweit<br />
der Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung der Geme<strong>in</strong>de angehört (vgl. § 58 GemHVO <strong>NRW</strong>). Die Prüfung<br />
des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses ist deshalb e<strong>in</strong> <strong>in</strong> mehrere Abschnitte zu unterteilender Vorgang, der sich<br />
von der Prüfungsplanung bis zur Berichterstattung über die durchgeführte Abschlussprüfung erstreckt.<br />
1.1.3.3 Der Umfang der Gesamtabschlussprüfung<br />
1.1.3.3.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die Gesamtabschlussprüfung schließt neben den Bestandteilen des Gesamtabschlusses und se<strong>in</strong>en Anlagen<br />
auch die die Prüfung der Beachtung der dafür geltenden haushaltsrechtlichen Vorschriften sowie ergänzender<br />
Bestimmungen von Gesellschaftsverträgen und geme<strong>in</strong>dlichen Satzungen e<strong>in</strong>, denn der Gesamtabschluss muss<br />
e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzgesamtlage<br />
der Geme<strong>in</strong>de unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermitteln. Zu den<br />
Prüfungsgegenständen gehört e<strong>in</strong>e Vielzahl von geme<strong>in</strong>dlichen Sachverhalten, die hier nicht im E<strong>in</strong>zelnen aufgeführt<br />
werden können. Beispielhaft können benannt werden: Der Konsolidierungskreis mit den geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Betrieben, die zum Vollkonsolidierungskreis zählen und denen, die nach der Equity-Methode konsolidiert werden.<br />
E<strong>in</strong> Prüfungsgegenstand s<strong>in</strong>d auch die Festlegungen der geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe, denen im H<strong>in</strong>blick auf den<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss e<strong>in</strong>e untergeordnete Bedeutung zukommt. Die Gesamtabschlussprüfung umfasst<br />
auch die Durchführung der Vollkonsolidierung sowie der Equity-Konsolidierung. Zu prüfen ist aber auch, ob<br />
der Gesamtlagebericht mit dem Gesamtabschluss und den Erkenntnissen des Prüfers <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang steht. Die Angaben<br />
im Gesamtlagebericht dürfen nicht e<strong>in</strong>e falsche Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und<br />
F<strong>in</strong>anzgesamtlage der Geme<strong>in</strong>de erwecken. Mit diesem Bericht müssen auch aussagekräftige Auskünfte zu den<br />
künftigen Chancen und Risiken der Geme<strong>in</strong>de gegeben werden.<br />
1.1.3.3.2 Die Prüfungsgegenstände<br />
1.1.3.3.1.1 Die Gesamtergebnisrechnung<br />
Die Gesamtergebnisrechnung entspricht der handelsrechtlichen Konzern-Gew<strong>in</strong>n- und Verlustrechnung, die jedoch<br />
an die geme<strong>in</strong>dlichen Besonderheiten angepasst worden ist. Nach § 49 Abs. 3 GemHVO <strong>NRW</strong> f<strong>in</strong>det für die<br />
Gesamtergebnisrechnung die Vorschrift über die geme<strong>in</strong>dliche Ergebnisrechnung nach § 38 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
GEMEINDEORDNUNG 688
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 103 GO <strong>NRW</strong><br />
Anwendung, so dass die Gesamtergebnisrechnung entsprechend aufzubauen ist. Entsprechend wird auch <strong>in</strong> der<br />
Gesamtergebnisrechnung e<strong>in</strong>e M<strong>in</strong>deste<strong>in</strong>heitlichkeit bei den Gesamtergebnisrechnungen der Geme<strong>in</strong>den gewährleistet.<br />
Es verbleiben der Geme<strong>in</strong>de aber noch ausreichend Gestaltungsspielräume. Außerdem s<strong>in</strong>d von der<br />
Geme<strong>in</strong>de die Bezifferung von Ertrags- und Aufwandspositionen sowie von Summen und Salden unter Berücksichtigung<br />
der örtlichen Gegebenheiten eigenverantwortlich <strong>in</strong> fachlicher und technischer H<strong>in</strong>sicht festzulegen.<br />
1.1.3.3.1.2 Die Gesamtbilanz<br />
Die Gesamtbilanz ist der Konzernbilanz nachgebildet. Sie soll umfassend Auskunft über das gesamte Vermögen<br />
und sämtliche Schulden der Geme<strong>in</strong>de geben. Der Aufbau der geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtbilanz ist auf die wichtigen<br />
Bilanzposten ausgerichtet worden, die nach § 41 GemHVO <strong>NRW</strong> auch <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz enthalten se<strong>in</strong><br />
sollen, denn auch im Gesamtabschluss muss e<strong>in</strong>e M<strong>in</strong>deste<strong>in</strong>heitlichkeit bei der Gliederung der Gesamtbilanz<br />
durch die Geme<strong>in</strong>den gewährleistet werden (vgl. § 49 Abs. 3 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />
Die örtlichen Gegebenheiten können so gewichtig se<strong>in</strong>, dass diese bei der Gestaltung der Bestandteile des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Gesamtabschlusses nicht außer Betracht bleiben können. So ist <strong>in</strong> der örtlichen Praxis z.B. zu prüfen,<br />
ob den mit e<strong>in</strong>er vierstelligen Nummer versehenen Bilanzposten ggf. e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>ge Bedeutung zu kommt, so<br />
dass e<strong>in</strong> Ansatz als gesonderter Posten entbehrlich ist, wenn im Anhang ausreichende Angaben zu diesem Bilanzbereich<br />
gemacht werden. Außerdem s<strong>in</strong>d für die örtliche Anwendung die Bezifferung der Aktiv- und Passivposten<br />
von der Geme<strong>in</strong>de unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten eigenverantwortlich <strong>in</strong> fachlicher<br />
und technischer H<strong>in</strong>sicht festzulegen.<br />
1.1.3.3.1.3 Der Gesamtanhang<br />
Der Gesamtanhang entspricht dem Konzernanhang. In ihm f<strong>in</strong>den sich die erforderlichen zusätzlichen Erläuterungen<br />
zum Gesamtabschluss, z.B. die Darstellung der nicht <strong>in</strong> den Gesamtabschluss e<strong>in</strong>bezogenen verselbstständigten<br />
Aufgabenbereiche. Die Erläuterungen im Gesamtanhang s<strong>in</strong>d so zu fassen, dass sachverständige<br />
Dritte die Wertansätze beurteilen können. Für die äußere Gestaltung des Anhangs, se<strong>in</strong>en Aufbau und Umfang<br />
s<strong>in</strong>d ke<strong>in</strong>e besonderen Formvorgaben vorgegeben worden.<br />
Die Fülle der Informationen verlangt jedoch e<strong>in</strong>e grundlegende Strukturierung unter Beachtung des Grundsatzes<br />
der Klarheit und Übersichtlichkeit. Die erforderlichen Informationen sollen im sachlichen Zusammenhang mit den<br />
Teilen des Gesamtabschlusses und se<strong>in</strong>er Gliederung stehen. Es bietet sich z.B. an, mit allgeme<strong>in</strong>en Angaben<br />
zum aufgestellten Gesamtabschluss und zu den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu beg<strong>in</strong>nen,<br />
um daran anknüpfend spezielle Erläuterungen zur Gesamtbilanz und zur Gesamtergebnisrechnung zu<br />
geben.<br />
1.1.3.3.1.4 Die Gesamtkapitalflussrechnung<br />
Der Gesamtabschluss wird mit e<strong>in</strong>er Gesamtkapitalflussrechnung zusätzlich zur Gesamtbilanz und Gesamtergebnisrechnung<br />
se<strong>in</strong>er Aufgabe besser gerecht, e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der<br />
Vermögens-, Schulden- und Ertrags- und F<strong>in</strong>anzgesamtlage der Geme<strong>in</strong>de zu vermitteln. E<strong>in</strong>e Abbildung der<br />
Zahlungsströme ist aber entsprechend den handelsrechtlichen Regelungen erforderlich, denn e<strong>in</strong>e (Gesamt-)<br />
F<strong>in</strong>anzrechnung ist für den Gesamtabschluss nicht vorgesehen.<br />
Im geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss ist daher nach § 51 Abs. 3 GemHVO <strong>NRW</strong> die geforderte Gesamtkapitalflussrechnung<br />
unter Beachtung des Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 2 (DRS 2) <strong>in</strong> der vom Bundesm<strong>in</strong>isterium<br />
der Justiz (BMJ) nach § 342 Abs. 2 HGB bekannt gemachten Form aufzustellen. Nach diesem Rech-<br />
GEMEINDEORDNUNG 689
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 103 GO <strong>NRW</strong><br />
nungslegungsstandard stellt die Gesamtkapitalflussrechnung zeitbezogen die Zahlungsströme der wirtschaftlichen<br />
Gesamtheit „Geme<strong>in</strong>de“ dar, die zur Veränderung des Zahlungsmittelbestandes führen, und gibt Auskunft<br />
darüber, wie die Kernverwaltung der Geme<strong>in</strong>de zusammen mit ihren Betrieben, soweit diese <strong>in</strong> den Gesamtabschluss<br />
e<strong>in</strong>bezogen s<strong>in</strong>d, die f<strong>in</strong>anziellen Mittel erwirtschaftet. Die Gesamtkapitalflussrechnung ist als zusätzliches<br />
Instrument für den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss nur brauchbar, wenn sie sich auch auf dessen festgelegten<br />
Konsolidierungskreis bezieht. Außerdem dürfen nach dem beim Gesamtabschluss geltenden Grundsatz<br />
der E<strong>in</strong>heit alle Zahlungsströme zwischen der Kernverwaltung der Geme<strong>in</strong>de und den <strong>in</strong> den Gesamtabschluss<br />
e<strong>in</strong>bezogenen Betriebe sowie zwischen diesen Betrieben nicht <strong>in</strong> der Gesamtkapitalflussrechnung enthalten se<strong>in</strong>.<br />
Mit diesem Werk werden vielmehr nur Zahlungsströme erfasst, die mit außerhalb des Gesamtabschlusses stehenden<br />
Dritten bestehen.<br />
Die Auswahl der <strong>in</strong> die Gesamtkapitalflussrechnung e<strong>in</strong>zuziehenden Zahlungsströme der Betriebe ist daher anhand<br />
der jeweils angewandten Konsolidierungsmethode vorzunehmen. Die Gesamtkapitalflussrechnung als Instrument<br />
erleichtert die f<strong>in</strong>anzwirtschaftliche Gesamtbeurteilung der Geme<strong>in</strong>de sowie die Beurteilung ihres zukünftigen<br />
Liquiditätsbedarfs. Sie muss dafür jedoch auch h<strong>in</strong>sichtlich ihrer Ausgestaltung auf den Gesamtabschluss<br />
der Geme<strong>in</strong>de ausgerichtet werden. Die Daten für die <strong>in</strong> der Gesamtkapitalflussrechnung darzustellenden<br />
Zahlungsströme können unmittelbar aus den Buchungen <strong>in</strong> der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung (orig<strong>in</strong>äre Ermittlung) oder<br />
aus den Bestandteilen des Gesamtabschlusses (derivative Ermittlung) abgeleitet werden. Dieses erfordert, dass<br />
die Zahlungen, z.B. durch e<strong>in</strong>e entsprechende Kontoführung oder Buchungsschlüssel oder durch Abfragen abgegrenzt<br />
werden können. Im Rahmen der Gesamtkapitalflussrechnung s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>e orig<strong>in</strong>äre und e<strong>in</strong>e derivative Ermittlung<br />
möglich. Die Anwendung der orig<strong>in</strong>ären Ermittlung der Zahlungsströme erfordert, dass den Buchungen<br />
spezielle Buchungsschlüssel beigefügt werden, um e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>fache Auswertung vornehmen zu können.<br />
Die derivative Ermittlung der Zahlungsströme baut dagegen auf dem aufgestellten Gesamtabschluss bzw. den<br />
e<strong>in</strong>zelnen Jahresabschlüssen auf. Die Angaben müssen dabei um zahlungsunwirksame Vorgänge bere<strong>in</strong>igt werden.<br />
Außerdem kann die Ermittlung der Zahlungsströme für die Gesamtkapitalflussrechnung aus den Ergebnissen<br />
aus der „F<strong>in</strong>anzrechnung“ der geme<strong>in</strong>dlichen Kernverwaltung und den Kapitalflussrechnungen der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Betriebe vorgenommen werden. Diese Methode wird als Bottom-up-Konzept bezeichnet. E<strong>in</strong>e weitere Ableitungsmöglichkeit<br />
im Rahmen der Gesamtkapitalflussrechnung wird als Top-down-Konzept bezeichnet. Bei dieser<br />
Methode stellen die geme<strong>in</strong>dliche Gesamtbilanz und die Gesamtergebnisrechnung die Ausgangsbasis für die<br />
Erstellung der Kapitalflussrechnung dar.<br />
1.1.3.3.1.5 Der Gesamtlagebericht<br />
Der Gesamtabschluss ist um e<strong>in</strong>en Gesamtlagebericht zu ergänzen (vgl. § 51 Abs. 1 GemHVO <strong>NRW</strong>), der vergleichbar<br />
mit dem handelsrechtlichen Konzernlagebericht (§ 315 HGB) zum<strong>in</strong>dest den Geschäftsablauf und die<br />
Gesamtlage der Geme<strong>in</strong>de darstellt und erläutert. Der geme<strong>in</strong>dliche Gesamtlagebericht soll zudem e<strong>in</strong>e ausgewogene<br />
und umfassende, dem Umfang der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft<br />
unter E<strong>in</strong>beziehung der geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe und der wirtschaftlichen Gesamtlage enthalten. Im<br />
Gesamtlagebericht ist von der Geme<strong>in</strong>de deshalb über alle Tatsachen und Sachverhalte zu berichten, die für die<br />
Gesamtbeurteilung der wirtschaftlichen Gesamtlage der Geme<strong>in</strong>de erforderlich s<strong>in</strong>d. Diesem örtlichen Bericht<br />
kommen somit umfassende und vielfältige Funktionen zu.<br />
Der geme<strong>in</strong>dliche Gesamtlagebericht muss auch e<strong>in</strong>e ausgewogene und umfassende, dem Umfang der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft unter E<strong>in</strong>beziehung der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Betriebe und der wirtschaftlichen Gesamtlage der Geme<strong>in</strong>de enthalten. Er soll zudem die notwendigen Erläuterungen<br />
zu den Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung der Geme<strong>in</strong>de enthalten se<strong>in</strong>. Es gilt dabei,<br />
nicht nur e<strong>in</strong>en Zusammenhang zu den produktorientierten Zielen und Leistungskennzahlen nach § 12 GemHVO<br />
<strong>NRW</strong> herzustellen, soweit diese bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzgesamtlage<br />
der Geme<strong>in</strong>de s<strong>in</strong>d, sondern auch e<strong>in</strong>e Bezugnahme auf die im Gesamtabschluss enthaltenen Ergebnisse<br />
GEMEINDEORDNUNG 690
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 103 GO <strong>NRW</strong><br />
zu erreichen. Am Schluss des Gesamtlageberichts sollen auch Angaben zu den Verantwortlichen <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>de<br />
gemacht werden (vgl. § 116 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong>).<br />
1.1.3.3.1.6 Die Anlagen zum Gesamtabschluss<br />
Der geme<strong>in</strong>dliche Gesamtabschluss soll möglichst e<strong>in</strong>e zutreffende Rechenschaft über die Ergebnisse der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltswirtschaft unter Berücksichtigung der Aufgabenerledigung geben. Dieses erfordert ggf. von<br />
der Geme<strong>in</strong>de, dem geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss örtlich wichtige Anlagen beizufügen, z.B. e<strong>in</strong> Gesamtanlagenspiegel<br />
oder e<strong>in</strong>e Eigenkapitalveränderungsrechnung. Die Bestandteile des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses<br />
sowie se<strong>in</strong>e gesetzlich bestimmten Anlagen werden nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung).<br />
Übersicht über die geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlussunterlagen<br />
Bestandteile des Gesamtabschlusses<br />
Gesamtergebnisrechnung<br />
Prüfungsauftrag:<br />
Entspricht die Gesamtergebnisrechnung den Anforderungen und<br />
enthält m<strong>in</strong>destens die vorgesehenen Positionen mit den Ist-<br />
Ergebnissen?<br />
Gesamtbilanz<br />
Prüfungsauftrag:<br />
Entspricht die Gliederung der Gesamtbilanz den Anforderungen?<br />
Gesamtanhang<br />
Prüfungsauftrag:<br />
Enthält er ausreichende Erläuterungen zu den Posten der Gesamtbilanz<br />
und der Gesamtergebnisrechnung?<br />
Ist e<strong>in</strong>e Kapitalflussrechnung beigefügt?<br />
Anlagen im Gesamtabschluss<br />
Gesamtlagebericht<br />
Prüfungsauftrag:<br />
Wird e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der<br />
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Kommune gegeben?<br />
Werden die übrigen Anforderungen erfüllt?<br />
Beteiligungsbericht<br />
Prüfungsauftrag:<br />
Wird e<strong>in</strong>e ausreichende Übersicht über die Beteiligungen gegeben?<br />
Werden die übrigen Anforderungen erfüllt?<br />
Gesamtkapitalflussrechnung<br />
Prüfungsauftrag:<br />
Wird der F<strong>in</strong>anzmittelfonds zutreffend dargestellt und ist er zutreffend<br />
ermittelt worden?<br />
Verb<strong>in</strong>dlichkeitenspiegel<br />
Prüfungsauftrag:<br />
Wird e<strong>in</strong>e ausreichende Übersicht über den Stand der Verb<strong>in</strong>dlichkeiten<br />
gegeben? Werden die übrigen Anforderungen erfüllt?<br />
Abbildung 141 „Gesamtabschlussunterlagen der Geme<strong>in</strong>de<br />
GEMEINDEORDNUNG 691<br />
§ 116 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> i.V.m.<br />
§ 49 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3<br />
GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 116 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> i.V.m.<br />
§ 49 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3<br />
GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 116 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> i.V.m.<br />
§ 49 Abs. 1 Nr. 3 und § 51<br />
Abs. 2 und 3 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 116 Abs. 1 und 4 GO <strong>NRW</strong><br />
i.V.m. § 49 Abs. 2 und § 51<br />
Abs. 1 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 117 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 49<br />
Abs. 2 und § 52 GemHVO<br />
<strong>NRW</strong><br />
§ 116 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> i.V.m.<br />
§ 51 Abs. 3 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 116 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> i.V.m.<br />
§ 49 Abs. 2 und § 47 GemH-<br />
VO <strong>NRW</strong>
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 103 GO <strong>NRW</strong><br />
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass der dem geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss beizufügende Beteiligungsbericht<br />
der Geme<strong>in</strong>de dagegen ke<strong>in</strong> eigenständiger Prüfungsgegenstand für die örtliche Rechnungsprüfung<br />
ist, auch wenn dieser Bericht dem geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss als Anlage beizufügen ist (vgl. § 117 Abs. 1<br />
S. 2 GO <strong>NRW</strong>). Gleichwohl kann der geme<strong>in</strong>dliche Beteiligungsbericht <strong>in</strong> die örtliche Prüfung des Gesamtabschlusses<br />
der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>bezogen werden, denn er enthält wichtige örtliche Angaben, die für se<strong>in</strong>e Prüfung<br />
relevant se<strong>in</strong> können. Dieser Beurteilung stellt die Vorschrift des § 116 Abs. 6 GO <strong>NRW</strong> nicht entgegen, weil die<br />
Absätze 1 und 6 des § 116 GO <strong>NRW</strong> nur die <strong>in</strong> die Gesamtabschlussprüfung e<strong>in</strong>zubeziehenden Teile als Prüfungsgegenstände<br />
ausdrücklich benennen, zu denen aber nicht der Beteiligungsbericht der Geme<strong>in</strong>de gehört.<br />
1.1.3.3.2 Weitere wichtige prüfungsrelevante Sachverhalte<br />
1.1.3.3.2.1 Die Prüfung von Zwischenabschlüssen<br />
Im geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss soll die wirtschaftliche Gesamtlage der Geme<strong>in</strong>de zum Abschlussstichtag<br />
gezeigt und die Geme<strong>in</strong>de mit ihren Betrieben so dargestellt werden, als ob sie e<strong>in</strong>e Gesamtheit darstellt. Um<br />
dies zu erreichen, sollen auch geme<strong>in</strong>dliche Betriebe, die e<strong>in</strong> vom Kalenderjahr abweichendes Geschäftsjahr<br />
haben, <strong>in</strong> den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss e<strong>in</strong>bezogen werden. Die für die E<strong>in</strong>beziehung <strong>in</strong> den geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Gesamtabschluss notwendige Übere<strong>in</strong>stimmung wird dadurch geschaffen, dass der betreffende Betrieb<br />
verpflichtet wird, e<strong>in</strong>en gesonderten Zwischenabschluss, bezogen auf den Abschlussstichtag des Gesamtabschlusses<br />
der Geme<strong>in</strong>de aufzustellen.<br />
Für die Prüfung, ob e<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>dlicher Betrieb e<strong>in</strong>en Zwischenabschluss aufzustellen hat, ist dessen Abschlussstichtag<br />
ausschlaggebend, denn es ist zu unterscheiden, ob der Abschlussstichtag zwischen dem 30. September<br />
und dem 31. Dezember oder vor dem 30. September liegt. Ggf. kann im E<strong>in</strong>zelfall auch e<strong>in</strong> anderer Abschlussstichtag<br />
bestehen, der als sachgerecht und vertretbar bewertet werden kann, z. B. bei Betrieben im Kulturbereich,<br />
bei denen ke<strong>in</strong>e untergeordnete Bedeutung vorliegt.<br />
Der Zwischenabschluss schafft e<strong>in</strong>e stichtagsbezogene Grundlage, die für die notwendigen Konsolidierungsschritte<br />
zw<strong>in</strong>gend erforderlich ist. Die erhebliche Zeitdifferenz zwischen dem Abschlussstichtag des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Betriebes und dem Abschlussstichtag des Gesamtabschlusses wird dadurch überbrückt, dass der Jahresabschluss<br />
des Betriebes auf den Abschlussstichtag des Gesamtabschlusses fortzuschreiben ist. Dadurch wird e<strong>in</strong><br />
auf den Abschlussstichtag und den Zeitraum des Gesamtabschlusses (Geschäftsjahr der Geme<strong>in</strong>de) gleicher<br />
„Abrechnungszeitraum“ für den geme<strong>in</strong>dlichen Betrieb geschaffen und gewährleistet.<br />
E<strong>in</strong> solcher Zwischenabschluss muss zwar orientiert an den Erfordernissen des Jahresabschlusses des betreffenden<br />
Betriebes aufgestellt werden, bei se<strong>in</strong>er Aufstellung durch den geme<strong>in</strong>dlichen Betrieb müssen jedoch<br />
bereits die für den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss geltenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zur<br />
Anwendung kommen, auch wenn der Zwischenabschluss aus den Büchern des geme<strong>in</strong>dlichen Betriebes zu<br />
entwickeln ist. E<strong>in</strong> solcher Zwischenabschluss stellt daher ke<strong>in</strong>en unterjährigen Jahresabschluss des betreffenden<br />
Betriebes der Geme<strong>in</strong>de dar, denn se<strong>in</strong>e Ableitung bzw. Aufstellung dient ausschließlich der Erstellung des<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss.<br />
Der Zwischenabschluss e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Betriebes unterliegt daher nicht der Pflicht zur Jahresabschlussprüfung<br />
beim betreffenden Betrieb. Die Prüfung des Zwischenabschlusses kann aber dem Jahresabschlussprüfer<br />
des betreffenden geme<strong>in</strong>dlichen Betriebes nach § 103 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong> übertragen werden. Wegen se<strong>in</strong>er gesamtabschlussbezogenen<br />
Aufstellung unterliegt e<strong>in</strong> Zwischenabschluss der Prüfungspflicht des Abschlussprüfers<br />
des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat daher die Prüfungsverantwortung<br />
nicht nur für den aufgestellten geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss, sondern für alle die dem Gesamtabschluss<br />
zu Grunde liegenden Abschlüsse, die nicht nach anderen Vorschriften geprüft worden s<strong>in</strong>d. Dieses gilt auch<br />
GEMEINDEORDNUNG 692
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 103 GO <strong>NRW</strong><br />
dann, wenn e<strong>in</strong> Zwischenabschluss vom Jahresabschlussprüfer des betreffenden geme<strong>in</strong>dlichen Betriebes geprüft<br />
worden ist.<br />
1.1.3.3.2.2 Die Prüfung der Entbehrlichkeit des Gesamtabschlusses<br />
Die Vorschrift des § 116 GO <strong>NRW</strong> enthält ke<strong>in</strong>e gesonderte Ausnahmeregelung, die es ermöglicht, dass die Geme<strong>in</strong>de<br />
generell von der Aufstellung e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses befreit ist. Bei e<strong>in</strong>zelnen Geme<strong>in</strong>den<br />
können besondere Fallgestaltungen im Rahmen ihrer Beteiligungen vorliegen, die dazu führen, dass für die<br />
Geme<strong>in</strong>de die Aufstellung e<strong>in</strong>es Gesamtabschlusses entbehrlich wird. E<strong>in</strong> solcher Sachverhalt liegt z.B. vor,<br />
wenn die Geme<strong>in</strong>de über ke<strong>in</strong>en voll zu konsolidieren Betrieb verfügt, denn dann liegt die wichtigste Voraussetzung<br />
für e<strong>in</strong>en geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss, dass e<strong>in</strong> Mutter-Tochter-Verhältnis zwischen der Kernverwaltung<br />
der Geme<strong>in</strong>de und e<strong>in</strong>em ihrer Betriebe besteht, nicht vor.<br />
Das Fehlen dieser Voraussetzung kann nicht dadurch geheilt werden, dass die betreffende Geme<strong>in</strong>de über Betriebe<br />
verfügt, die nach der Equity-Methode zu konsolidieren wären. Zwar erlischt <strong>in</strong> solchen Fällen die Pflicht zur<br />
Aufstellung e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses, jedoch nicht die <strong>in</strong> dieser Vorschrift enthaltene ausdrückliche<br />
Prüfungspflicht. Sie ist dann von der örtlichen Rechnungsprüfung <strong>in</strong> der Art und Weise auszuüben, dass<br />
geprüft wird, ob örtlich die Voraussetzungen für e<strong>in</strong>en Verzicht auf die Aufstellung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses<br />
vorliegen.<br />
Bei der örtlichen Abwägung ist auch zu prüfen und festzustellen, ob das daraus entstandene Ergebnis (Verzicht<br />
auf die Aufstellung e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses) zutreffend ist. Wird im Rahmen der örtlichen Prüfung<br />
jedoch festgestellt, dass für die Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>e Verpflichtung zur Aufstellung e<strong>in</strong>es örtlichen Gesamtabschlusses<br />
besteht, ist vom Bürgermeister das Notwendige zu veranlassen.<br />
1.1.3.3.2.3 Sonstige Prüfungssachverhalte<br />
Die Gesamtabschlussprüfung schließt neben den Bestandteilen des Gesamtabschlusses und se<strong>in</strong>en Anlagen<br />
auch die die Prüfung der Beachtung der dafür geltenden haushaltsrechtlichen Vorschriften sowie ergänzender<br />
Bestimmungen von Gesellschaftsverträgen und geme<strong>in</strong>dlichen Satzungen e<strong>in</strong>, denn der Gesamtabschluss muss<br />
e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzgesamtlage<br />
der Geme<strong>in</strong>de unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermitteln.<br />
Die örtliche Gesamtabschlussrichtl<strong>in</strong>ie ist <strong>in</strong> die Durchführung der Prüfung e<strong>in</strong>zubeziehen. Zu den Prüfungsgegenständen<br />
im Rahmen des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses gehören noch e<strong>in</strong>e Vielzahl von weiteren geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Sachverhalten, je nach den örtlichen Gegebenheiten und Verhältnissen. Außerdem können sich<br />
noch weitere spezielle örtliche Sachverhalte und Gegebenheiten ergeben, die für den Abschlussprüfer e<strong>in</strong>en<br />
Prüfungsgegenstand darstellen können. Diese können hier nicht im E<strong>in</strong>zelnen benannt werden, sondern nur<br />
beispielhaft vorgestellt werden (vgl. Abbildung).<br />
Beispiele für Prüfungssachverhalte beim Gesamtabschluss<br />
- die Festlegung und Abgrenzung des örtlichen Konsolidierungskreises mit der<br />
Auswahl der geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe, die zum Vollkonsolidierungskreis zählen<br />
und denen, die nach der Equity-Methode konsolidiert werden sowie die Betriebe,<br />
die im H<strong>in</strong>blick auf den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss von untergeordneter<br />
Bedeutung s<strong>in</strong>d,<br />
- die Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Konzernrechnungslegung,<br />
GEMEINDEORDNUNG 693
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 103 GO <strong>NRW</strong><br />
- die Durchführung der Kapitalkonsolidierung, der Schuldenkonsolidierung, der<br />
Zwischenergebniselim<strong>in</strong>ierung,<br />
- die Ermittlung der Anteile fremder Gesellschafter,<br />
- die zutreffende Aufstellung der Gesamtbilanz und der Gesamtergebnisrechnung<br />
e<strong>in</strong>schließlich des Gesamtanhangs mit den Inhalten der Kapitalflussrechnung<br />
sowie den beigefügten Spiegeln, z.B. Gesamtverb<strong>in</strong>dlichkeitenspiegel,<br />
Gesamtanlagenspiegel, Gesamteigenkapitalspiegel,<br />
- die zutreffende Anwendung von Wahlrechten und Vere<strong>in</strong>fachungen.<br />
Abbildung 142 „Beispiele für Prüfungssachverhalte beim Gesamtabschluss“<br />
Zu den prüfungspflichtigen Sachverhalten gehören <strong>in</strong>sbesondere auch die örtliche Auslegung und Anwendung<br />
der unbestimmten Rechtsbegriffe <strong>in</strong> den bei der Aufstellung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses zu beachtenden<br />
Rechtsvorschriften, z.B. „untergeordnete Bedeutung“, „Wesentlichkeit“, „Wirtschaftlichkeit“ u.a., die zudem<br />
zu dokumentieren ist.<br />
1.1.3.4 Prüfungshandlungen und Prüfungsaussagen<br />
1.1.3.4.1 Die Prüfungshandlungen<br />
1.1.3.4.1.1 Die Verantwortung des Abschlussprüfers<br />
Der Abschlussprüfer hat Art und Umfang der erforderlichen Prüfungshandlungen sowie die Intensität und die<br />
Methoden der Abschlussprüfung unter Berücksichtigung des Prüfungsgegenstandes und des Zieles der Abschlussprüfung<br />
unter Berücksichtigung der Gegebenheiten bei der Geme<strong>in</strong>de eigenverantwortlich und <strong>in</strong> Kenntnis<br />
der Aufgabenerfüllung der Geme<strong>in</strong>de der Geme<strong>in</strong>de nach pflichtgemäßem Ermessen sorgfältig zu bestimmen, so<br />
dass Prüfungsaussagen zum Gesamtabschluss mit h<strong>in</strong>reichender Sicherheit getroffen werden können. Dazu<br />
gehört i.d.R. auch e<strong>in</strong>e Beurteilung der e<strong>in</strong>zelnen Jahresabschlüsse der <strong>in</strong> den Gesamtabschluss der Geme<strong>in</strong>de<br />
e<strong>in</strong>bezogenen geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe.<br />
1.1.3.4.1.2 Die Verwertung von Arbeiten Dritter<br />
Im Rahmen se<strong>in</strong>er Informationsrechte kann der Abschlussprüfer für den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss im<br />
Rahmen se<strong>in</strong>er Eigenverantwortung die Arbeit e<strong>in</strong>es anderen Jahresabschlussprüfers verwerten. Dabei ist auch<br />
e<strong>in</strong> Zusammenhang mit den eigenen Prüfungshandlungen herzustellen, so dass das Ausmaß der Übernahme<br />
zutreffend abgewogen werden kann. Er hat jedoch immer <strong>in</strong> geeigneter Weise zu überprüfen, ob die ihm vorgelegten<br />
Unterlagen auch für e<strong>in</strong>e Verwertung geeignet s<strong>in</strong>d. Dabei ist e<strong>in</strong> Zusammenhang mit den eigenen Prüfungshandlungen<br />
herzustellen, so dass das Ausmaß der Übernahme zutreffend abgewogen werden kann. Das<br />
Ergebnis dieser Überprüfung sowie das Ausmaß der Verwertung bzw. Gewichtung der Arbeit hat der Abschlussprüfer<br />
zu dokumentieren.<br />
Die dem Abschlussprüfer des Gesamtabschlusses vorgelegten Jahresabschlüsse müssen daher für ihn nachvollziehbar<br />
und akzeptabel se<strong>in</strong>. Dies gilt <strong>in</strong>sbesondere für die Überleitung der HB I <strong>in</strong> die KB II. Daraus folgt, dass<br />
der Abschlussprüfer des Gesamtabschlusses die Arbeit der Abschlussprüfer der Jahresabschlüsse der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Betriebe zu überprüfen hat. Das Ergebnis dieser Arbeit ist von ihm zu dokumentieren. In den Fällen, <strong>in</strong><br />
denen sich jedoch Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der betrieblichen Jahresabschlüsse ergeben, muss der<br />
GEMEINDEORDNUNG 694
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 103 GO <strong>NRW</strong><br />
Abschlussprüfer für den Gesamtabschluss ggf. zusätzliche Prüfungshandlungen und eventuell unter Berücksichtigung<br />
des Grundsatzes der Wesentlichkeit auch e<strong>in</strong>e Korrektur vornehmen.<br />
1.1.3.4.1.3 Die Übernahme von Arbeiten Dritter<br />
Der verantwortliche Abschlussprüfer für den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss kann im Rahmen se<strong>in</strong>er Informationsrechte<br />
auch Arbeiten e<strong>in</strong>es anderen Abschlussprüfers übernehmen, <strong>in</strong>sbesondere Ergebnisse aus den Jahresabschlussprüfungen<br />
bei der geme<strong>in</strong>dlichen Kernverwaltung und den Betrieben der Geme<strong>in</strong>de. Er hat <strong>in</strong> diesen<br />
Fällen immer <strong>in</strong> geeigneter Weise zu überprüfen, ob die ihm überlassenen Unterlagen auch für e<strong>in</strong>e Übernahme<br />
<strong>in</strong> se<strong>in</strong>e Prüfung geeignet s<strong>in</strong>d und welcher Prüfer ihm die Unterlagen überlassen hat. In diesem Rahmen ist e<strong>in</strong><br />
Zusammenhang mit den eigenen Prüfungshandlungen herzustellen, so dass die Inhalte und das Ausmaß der<br />
Übernahme zutreffend abgewogen werden kann. Das Ergebnis dieser Überprüfung ist vom Abschlussprüfer zu<br />
dokumentieren.<br />
1.1.3.4.2 Die Prüfungsaussagen<br />
Im Rahmen der geme<strong>in</strong>dlichen Abschlussprüfung gilt es, relevante Prüfungsaussagen unter Beachtung des<br />
Grundsatzes der Wesentlichkeit und des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit treffen zu können. In den Fällen, <strong>in</strong><br />
den der Abschlussprüfer e<strong>in</strong>es e<strong>in</strong>zelnen Jahresabschlusses se<strong>in</strong>en Bestätigungsvermerk e<strong>in</strong>geschränkt oder<br />
versagt hat, muss der Abschlussprüfer des Gesamtabschlusses eigene Prüfungsfeststellungen treffen, ob und<br />
ggf. wie weit dadurch die Ordnungsmäßigkeit des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses berührt wird.<br />
E<strong>in</strong> solcher Sachverhalt kann ggf. dazu führen, dass auch der Bestätigungsvermerk zum Gesamtabschluss e<strong>in</strong>zuschränken<br />
ist. Für se<strong>in</strong>e Urteilsbildung kann der Abschlussprüfer des Gesamtabschlusses ggf. Prüfungsfeststellungen<br />
bei den geme<strong>in</strong>dlichen Betrieben treffen, die <strong>in</strong> den Gesamtabschluss e<strong>in</strong>bezogen werden. Es ist deshalb<br />
als geboten angesehen worden, durch e<strong>in</strong>e gesetzliche Regelung die Durchsetzung der Rechte der Prüfer,<br />
die für e<strong>in</strong>e sorgfältige Prüfung notwendig en Nachweise und Informationen zu erhalten, auch gegenüber den<br />
Abschlussprüfern der geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe zu gewährleisten (vgl. § 103 Abs. 4 S. 2 GO <strong>NRW</strong>).<br />
1.1.3.4.3 Der Prüfungsbericht<br />
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat über Art und Umfang der Prüfung des Gesamtabschlusses sowie über<br />
das Ergebnis der Prüfung e<strong>in</strong>en Prüfungsbericht zu erstellen und den Bestätigungsvermerk <strong>in</strong> den Prüfungsbericht<br />
aufzunehmen. Bei der Festlegung der Inhalte und Abgrenzungen des Bestätigungsvermerks oder des Vermerks<br />
über se<strong>in</strong>e Versagung s<strong>in</strong>d die Vorschriften des § 101 Abs. 4 bis 7 GO <strong>NRW</strong> zu beachten (vgl. auch Erläuterungen<br />
zu § 116 Abs. 6 GO <strong>NRW</strong>).<br />
Die „Grundsätze für die ordnungsmäßige Erteilung von Bestätigungsvermerken“ können dabei als Beurteilungsmaßstäbe<br />
herangezogen werden. Für die Darstellungen im Prüfungsbericht sowie für se<strong>in</strong>e Gestaltung bestehen<br />
über die genannten Vorschriften h<strong>in</strong>aus ke<strong>in</strong>e weiteren Vorgaben. Der Prüfungsbericht ist daher von der Geme<strong>in</strong>de<br />
bzw. von den Verantwortlichen für die Jahresabschlussprüfung nach örtlichen Bedürfnissen eigenverantwortlich<br />
auszugestalten.<br />
1.1.3.5 Der Zeitraum der Gesamtabschlussprüfung<br />
Für die Durchführung der Gesamtabschlussprüfung ist gesetzlich nicht ausdrücklich e<strong>in</strong> genau abgegrenzter<br />
Zeitraum bestimmt worden. Gleichwohl ergibt sich aus der E<strong>in</strong>ordnung der Prüfung des Gesamtabschlusses <strong>in</strong><br />
GEMEINDEORDNUNG 695
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 103 GO <strong>NRW</strong><br />
den Verfahrensablauf der Aufstellung und Bestätigung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses, dass für die<br />
Durchführung der Prüfung nur e<strong>in</strong> begrenzter Zeitraum zur Verfügung steht. Zu berücksichtigen ist e<strong>in</strong>erseits,<br />
dass der Bürgermeister den Entwurf des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses <strong>in</strong>nerhalb von drei Monaten nach<br />
Ablauf des Haushaltsjahres folgenden Jahres dem Rat zuzuleiten hat (vgl. § 116 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong>). Andererseits<br />
hat der Rat der Geme<strong>in</strong>de spätestens bis zum 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den<br />
vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Gesamtabschluss durch Beschluss zu bestätigen (vgl. § 116 Abs.<br />
1 S. 2 GO <strong>NRW</strong>). In diesem Zeitraum muss die Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss erfolgen.<br />
Der für die Gesamtabschlussprüfung zuständige Rechnungsprüfungsausschuss (vgl. § 59 Abs. 3 i.V.m. § 116<br />
Abs. 6 GO <strong>NRW</strong>) hat im Rahmen se<strong>in</strong>er Tätigkeit zu berücksichtigen, dass er sich der örtlichen Rechnungsprüfung<br />
zu bedienen hat oder, soweit e<strong>in</strong>e solche nicht besteht, sich Dritter gem. § 103 Abs. 5 bedienen kann (vgl. §<br />
59 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong>). Zu berücksichtigen ist auch, dass die geme<strong>in</strong>dlichen Organe die gesetzlich zugelassenen<br />
Fristen nicht vollausschöpfen müssen, so dass sich die für die tatsächliche Durchführung der Gesamtabschlussprüfung<br />
verfügbare Zeit noch reduzieren kann. Auch ist zu beachten, dass die Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses<br />
nur die Aufstellungsschritte und Gegebenheiten umfasst, die notwendig s<strong>in</strong>d, um e<strong>in</strong>en aussagekräftigen<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss zu erstellen.<br />
Die dem geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss zu Grunde liegenden Jahresabschlüsse der geme<strong>in</strong>dlichen Kernverwaltung<br />
und der geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe s<strong>in</strong>d grundsätzlich ke<strong>in</strong> Bestandteil der Gesamtabschlussprüfung. Entsprechend<br />
kann der Abschlussprüfer des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses von den Abschlussprüfer der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Betriebe die für die Gesamtabschlussprüfung notwendigen Nachweise und Informationen verlangen<br />
(vgl. § 103 Abs. 4 S. 2 GO <strong>NRW</strong>).<br />
E<strong>in</strong>e schnelle und kurzfristige Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses ist vom Gesetzgeber gewollt, denn<br />
die Ergebnisse des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses sollen so schnell wie möglich <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplanung<br />
und bei der Haushaltsausführung der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>e entsprechende Berücksichtigung f<strong>in</strong>den. Die<br />
geme<strong>in</strong>dliche Aufsichtsbehörde ist daher an e<strong>in</strong>er zeitnahen Anzeige des bestätigten Gesamtabschlusses nach<br />
der Beschlussfassung durch den Rat der Geme<strong>in</strong>de sehr <strong>in</strong>teressiert.<br />
1.1.4 Zu Nummer 4 (Laufende Prüfung <strong>in</strong> der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung):<br />
Die Zielsetzung der laufenden Prüfung der Vorgänge <strong>in</strong> der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung, die die Buchungen e<strong>in</strong>schließlich<br />
der Belege und die Zahlungsabwicklung umfasst, wird dadurch die ausdrückliche Zwecksetzung „zur Vorbereitung<br />
der Prüfung des Jahresabschlusses“ bereits besonders hervorgehoben. Es wird damit klargestellt, dass<br />
diese Prüfungsaufgabe unter den Aspekten der Bestimmungen des § 101 GO <strong>NRW</strong> durchzuführen ist. Gleichzeitig<br />
soll auch e<strong>in</strong>e zeitnahe Prüfung der Geschäftsvorfälle im Ablauf des Haushaltsjahres durchgeführt werden.<br />
In diesem S<strong>in</strong>ne sollen bereits bei der Abwicklung der geme<strong>in</strong>dlichen Geschäftsvorfälle auftretende Fehler behoben<br />
werden und e<strong>in</strong>e spätere Nacharbeitung oder e<strong>in</strong> förmliches Beanstandungsverfahren zu ihrer Beseitigung<br />
vermieden werden. Die laufende Prüfung der Geschäftsvorfälle trägt daher zur Erleichterung der Prüfung des<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses durch den Rückgriff auf vorliegende Prüfungsergebnisse bei, z.B. zu geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Maßnahmen, die fremdf<strong>in</strong>anziert werden. Dadurch kann der Umfang der Jahresabschlussprüfung ggf.<br />
erheblich verm<strong>in</strong>dert werden.<br />
Zur laufenden Prüfung s<strong>in</strong>d auch die regelmäßigen Kontrollen nach dem Gem. Runderlass des MWME <strong>NRW</strong> und<br />
des IM <strong>NRW</strong> „Regelmäßige Kontrollen nach Artikel 6 der Freistellungsentscheidung der Kommission vom 28.<br />
November 2005 (2005/842 EG) zur Vermeidung von Überkompensationen bei der Gewährung von Ausgleichszahlungen<br />
an bestimmte Unternehmen, die mit der Erbr<strong>in</strong>gung von Dienstleistungen von allgeme<strong>in</strong>em wirtschaftlichen<br />
Interesse betraut worden“ vom 30.05.2008 (SMBl. <strong>NRW</strong>. 651) zu zählen, die von der örtlichen Rechnungsprüfung<br />
im Rahmen ihres Aufgabenvollzugs erfolgen.<br />
GEMEINDEORDNUNG 696
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 103 GO <strong>NRW</strong><br />
Nach europäischer Rechtsprechung dürfen geme<strong>in</strong>dliche Betriebe, die Dienstleistungen von allgeme<strong>in</strong>em wirtschaftlichem<br />
Interesse erbr<strong>in</strong>gen, zudem nur auf Grund e<strong>in</strong>es Betrauungsaktes tätig werden. Dafür müssen Parameter,<br />
anhand derer der Ausgleich berechnet wird, vorab festgelegt und durch regelmäßige Kontrolle geprüft<br />
werden, um e<strong>in</strong>e Überkompensation zu vermeiden. Die örtliche Rechnungsprüfung kann sich dabei ggf. fachlicher<br />
geeigneter Stellen bedienen.<br />
1.1.5 Zu Nummer 5 (Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung):<br />
Diese Pflichtaufgabe wird besonders herausgestellt, da es aus Sicherheitsgesichtspunkten heraus grundsätzlich<br />
notwendig ist, nicht nur e<strong>in</strong>mal jährlich die Zahlungsabwicklung zu prüfen. Es ist vielmehr notwendig, die Zahlungsabwicklung<br />
der Geme<strong>in</strong>de und ihrer Sondervermögen im Laufe des Haushaltsjahres dauernd zu überwachen.<br />
Als unabhängige Stelle ist die örtliche Rechnungsprüfung dafür gut geeignet. Weil diese gesetzliche Aufgabe<br />
zudem untrennbar mit der Zielsetzung der Aufgabe „laufende Prüfung der Vorgänge <strong>in</strong> der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung“<br />
verbunden ist, kann sie auch als e<strong>in</strong>e Teilaufgabe davon betrachtet werden, die aber aus Sicherheitsgesichtspunkten<br />
e<strong>in</strong>e eigenständige Bedeutung hat.<br />
Diese E<strong>in</strong>schätzung gilt nicht nur bei der Geme<strong>in</strong>de, sondern auch bei ihren Sondervermögen, weil die örtliche<br />
Rechnungsprüfung durch die Prüfung der Jahresabschlüsse der Sondervermögen (vgl. Nummer 2 der Vorschrift<br />
sowie §§ 97 und 106 GO <strong>NRW</strong>) die notwendigen Kenntnisse über die Geschäftsvorfälle bei diesen Sondervermögen<br />
erhält. Soweit zwischen der Geme<strong>in</strong>de und ihren Sondervermögen e<strong>in</strong> Liquiditätsverbund zur Bereitstellung<br />
von benötigten Zahlungsmitteln besteht, kann bereits aus dem Zusammenspiel der täglichen Zahlungsgeschäfte<br />
von Geme<strong>in</strong>de und Sondervermögen die dauernde Überwachung notwendig se<strong>in</strong> und e<strong>in</strong> Prüfungsbedarf<br />
entstehen.<br />
In den Fällen e<strong>in</strong>er dauernden Überwachung der Zahlungsabwicklung kann auf die e<strong>in</strong>mal jährlich vorzunehmende<br />
unvermutete Prüfung der Zahlungsabwicklung verzichtet werden kann (vgl. § 30 Abs. 5 GemHVO <strong>NRW</strong>), zumal<br />
die örtliche Rechnungsprüfung durch ihre Überwachungstätigkeit mit gewährleisten kann, dass die Aufsicht<br />
über die F<strong>in</strong>anzbuchhaltung nach § 31 Abs. 4 GemHVO <strong>NRW</strong> ordnungsgemäß wahr genommen werden kann.<br />
Die Entscheidung darüber obliegt der Geme<strong>in</strong>de, die aber gleichwohl über die M<strong>in</strong>destanforderungen h<strong>in</strong>aus,<br />
weitere Prüfungen vornehmen lassen kann, wenn aus örtlichen Gegebenheiten heraus dazu e<strong>in</strong> Anlass besteht.<br />
1.1.6 Zu Nummer 6 (Prüfung der DV-Buchführungsprogramme vor ihrer Anwendung):<br />
1.1.6.1 Der Umfang der Prüfungspflicht<br />
Die Vorschrift be<strong>in</strong>haltet, dass alle DV-Buchführungsprogramme für die automatisierte Datenverarbeitung, soweit<br />
sie unmittelbare Auswirkungen auf die Rechnungssysteme der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung haben, unter dieses gesetzliche<br />
Prüfungsgebot fallen (vgl. § 27 Abs. 5 GemHVO <strong>NRW</strong>). Die Prüfungspflicht besteht dabei sowohl für selbsterstellte<br />
als auch für von Dritten bezogene IT-Produkte. Die Prüfung soll dabei nicht unabhängig von der Implementierung<br />
und Produktivsetzung bei der Geme<strong>in</strong>de vorgenommen werden, denn abhängig von ihrem Funktionsumfang<br />
und E<strong>in</strong>satzgebiet haben Softwareprodukte Auswirkungen auf die geme<strong>in</strong>dliche F<strong>in</strong>anzbuchhaltung.<br />
Die notwendige Programmprüfung soll daher i.d.R. vor dem ersten Praxise<strong>in</strong>satz e<strong>in</strong>es DV-Programms, aber<br />
auch vor jeder neuen Programmversion, durchgeführt werden. Das Ziel der Programmprüfung besteht dar<strong>in</strong>, die<br />
organisatorisch gesicherte Funktionsfähigkeit der Systeme der Buchführung und der Zahlungsabwicklung und der<br />
Zuliefersysteme zu prüfen und zu beurteilen, damit die geme<strong>in</strong>dliche Aufgabenerfüllung gewährleistet werden<br />
kann. Die Art und der Umfang der erforderlichen Prüfungshandlungen s<strong>in</strong>d dabei <strong>in</strong>sbesondere abhängig von der<br />
Wesentlichkeit des Programms im Rahmen des von der Geme<strong>in</strong>de für ihre F<strong>in</strong>anzbuchhaltung e<strong>in</strong>gesetzten IT-<br />
Systems von der Komplexität des Programmablaufs bzw. des örtlichen IT-Systems.<br />
GEMEINDEORDNUNG 697
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 103 GO <strong>NRW</strong><br />
Der Prüfungspflicht der örtlichen Rechnungsprüfung unterliegen dadurch e<strong>in</strong>erseits DV-Programme, die <strong>in</strong> der<br />
F<strong>in</strong>anzbuchhaltung der Geme<strong>in</strong>de unmittelbar Anwendung f<strong>in</strong>den. Andererseits besteht für die Geme<strong>in</strong>de auch<br />
die Pflicht, die außerhalb der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung e<strong>in</strong>gesetzten Zulieferprogramme <strong>in</strong> die Programmprüfung e<strong>in</strong>zubeziehen,<br />
falls mit deren Hilfe etwaige Ansprüche und Verpflichtungen der Geme<strong>in</strong>de ermittelt werden sollen.<br />
Solche Zulieferprogramme müssen daher unmittelbar zur Weiterverarbeitung von Daten <strong>in</strong> der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung<br />
notwendig se<strong>in</strong> und der Erfassung oder dem Nachweis von Aufwendungen und Erträgen bzw. E<strong>in</strong>zahlungen und<br />
Auszahlungen der Geme<strong>in</strong>de dienen. Wenn diese Voraussetzungen örtlich vorliegen, z.B. bei e<strong>in</strong>er DV-<br />
Vorbuchführung, wird dadurch e<strong>in</strong>e Prüfungspflicht für diese Programme ausgelöst.<br />
1.1.6.2 Die Durchführung der Programmprüfung<br />
Die Prüfung der <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzbuchhaltung e<strong>in</strong>gesetzten Programme zur Abwicklung der Haushaltswirtschaft<br />
der Geme<strong>in</strong>de können auf verschiedene Art und Weise geprüft werden. Die Regelung enthält<br />
daher ke<strong>in</strong>e ausdrückliche Vorgabe für e<strong>in</strong>e bestimmte Vorgehensweise bei der Durchführung der Programmprüfung.<br />
Sie verpflichtet aber zur Feststellung, ob das Programm alle <strong>in</strong> der örtlichen Praxis der Geme<strong>in</strong>de vorkommenden<br />
Fälle erfasst und im Arbeits- und Programmablauf alle vorgesehenen Kontrollen ausreichen und funktionsfähig<br />
s<strong>in</strong>d. Die Programmprüfung kann somit nach Zulassungskriterien und weiteren Prüfkriterien, ausgerichtet<br />
auf die vorgesehenen Anwendungen, z.B. anhand von Testfällen, vorgenommen werden.<br />
Die Programmprüfung kann auch als e<strong>in</strong>e System- und Prozessprüfung bzw. ergebnisorientierte Prüfung durchgeführt<br />
werden, <strong>in</strong> die alle relevanten DV-Systemkomponenten e<strong>in</strong>zubeziehen s<strong>in</strong>d. Dabei werden die Funktionalitäten<br />
und Angemessenheit als auch das Kontrollgefüge der automatisiert ausgeführten f<strong>in</strong>anzbuchhalterischen<br />
Tätigkeiten, d.h. die E<strong>in</strong>gabe, Verarbeitung und Ausgabe sowie die Aufbewahrung von Daten e<strong>in</strong>schließlich der<br />
Zugriffs- und Bearbeitungsrechte <strong>in</strong> die Prüfung e<strong>in</strong>zubeziehen se<strong>in</strong> (Aufbau- und Funktionsprüfung). Es muss bei<br />
e<strong>in</strong>er geme<strong>in</strong>dlichen DV-Buchführung gewährleistet se<strong>in</strong>, dass die örtlichen Daten der Geme<strong>in</strong>de vollständig und<br />
richtig erfasst, verarbeitet und gespeichert werden.<br />
Die vorhandenen Sicherungssysteme der automatisierten Datenverarbeitung s<strong>in</strong>d deshalb unter Berücksichtigung<br />
der <strong>in</strong> § 27 GemHVO <strong>NRW</strong> bestimmten Vorgaben sowie die auf Grund des § 31 GemHVO <strong>NRW</strong> erlassenen<br />
örtlichen Vorschriften <strong>in</strong> die Programmprüfung e<strong>in</strong>zubeziehen (Prüfung der Datensicherheit und der Dokumentation).<br />
Das örtliche Prüfungsprogramm soll so, auch durch eigene Testfälle (beispielhafte Geschäftsvorfälle der<br />
Geme<strong>in</strong>de) ausgestaltete werden, so dass <strong>in</strong>sgesamt betrachtet ist die Ordnungsmäßigkeit und die Sicherheit<br />
rechnungslegungsbezogener Programmfunktionen mit Blick auf die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft geprüft<br />
werden kann.<br />
E<strong>in</strong>e genaue organisatorische Abgrenzung lässt sich wegen der Querschnittsfunktion der automatisierten Datenverarbeitung<br />
sowie der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzbuchhaltung nicht <strong>in</strong> allgeme<strong>in</strong>er Form im Rahmen e<strong>in</strong>er Prüfung<br />
vornehmen. Dadurch wird nicht die Frage berührt, dass regelmäßig die „Fachdienstelle“ <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Verwaltung als anwendende Stelle für die Prüfung und Freigabe der örtlich e<strong>in</strong>zusetzenden Programme zuständig<br />
ist. Dieses ist bei der Programmprüfung durch die örtliche Rechnungsprüfung zu berücksichtigen.<br />
Für die Programmprüfung s<strong>in</strong>d aber auch die Verwaltungsarbeiten <strong>in</strong> den Fachbereichen der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung<br />
relevant soweit die auch Vorarbeiten für die Buchungen und Zahlungen durch die geme<strong>in</strong>dliche F<strong>in</strong>anzbuchhaltung<br />
be<strong>in</strong>halten. und diese vom Anfang bis zum Ende durch automatisierte Weiterleitung bzw. Weiterverarbeitung<br />
mite<strong>in</strong>ander verbunden s<strong>in</strong>d (DV-Vorbuchführung), kann sich die Programmprüfung der örtlichen Rechnungsprüfung<br />
nicht alle<strong>in</strong> auf den Durchlauf bzw. die Arbeitsgänge <strong>in</strong> der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung beschränken. Bereits<br />
die Erfassung und Bearbeitung der fachlichen Daten, die fast immer die Grundlagen für die Ansprüche und<br />
Verpflichtungen der Geme<strong>in</strong>de bilden und für die Buchführung und Zahlungsabwicklung relevant s<strong>in</strong>d, müssen <strong>in</strong><br />
die DV-Programmprüfung e<strong>in</strong>bezogen werden.<br />
GEMEINDEORDNUNG 698
1.1.6.3 Dokumentation der Prüfungsergebnisse<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 103 GO <strong>NRW</strong><br />
Die verwaltungsrechtlichen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen, Sicherheitsgesichtspunkte und auch spezielle örtliche Gegebenheiten<br />
erfordern, dass über die örtliche Prüfung der DV-Buchführung e<strong>in</strong> Prüfungsbericht erstellt und Prüfungsaussagen<br />
getroffen werden. Im Prüfungsbericht s<strong>in</strong>d die Prüfungsergebnisse und der Prüfungsablauf sowie<br />
die Prüfungsumgebung darzustellen und zu dokumentieren. Außerdem soll dabei h<strong>in</strong>sichtlich des ermittelten<br />
Prüfungsergebnisses e<strong>in</strong>e abschließende Feststellung getroffen werden. Sie kann z.B. zum Inhalt haben, dass<br />
nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen das Programm bei sachgerechter Anwendung e<strong>in</strong>e den<br />
haushaltsrechtlichen Grundsätzen und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechende Rechnungslegung<br />
ermöglicht.<br />
Diese Feststellung kann auch mit E<strong>in</strong>schränkungen im S<strong>in</strong>ne des Bestätigungsvermerks nach § 101 Abs. 3 GO<br />
<strong>NRW</strong> abgegeben, aber auch verweigert werden. E<strong>in</strong>e Orientierung an den <strong>in</strong>haltlichen Abstufungen des Bestätigungsvermerks<br />
sowie an se<strong>in</strong>em Aufbau ist dabei möglich. Werden wegen bestehende Mängel e<strong>in</strong>es Programms<br />
notwendige E<strong>in</strong>schränkungen bei der abzugebenden Feststellung gemacht, sollten dazu die Gründe angegeben<br />
werden. Aber auch ggf. bestehende Prüfungshemmnisse s<strong>in</strong>d zu benennen. Die sich aus der Programmprüfung<br />
ergebende Dokumentation kann sich aus den folgenden Bestandteilen zusammensetzen (vgl. Abbildung).<br />
Darstellung<br />
der sachlichen<br />
Anwenderanforderungen<br />
Darstellung<br />
der Programmtechnik<br />
Darstellung<br />
der Programmidentität<br />
Darstellung<br />
der Datensicherheit<br />
Darstellung<br />
der Arbeitsanweisungen<br />
Inhalte der Dokumentation zur Programmprüfung<br />
- Aufgabenstellung<br />
- Anwenderoberflächen für Datene<strong>in</strong>gabe und -ausgabe<br />
- Datenbestände<br />
- Verarbeitungsregeln<br />
- Datenaustausch mit Dritten<br />
- Kontrollen (masch<strong>in</strong>ell und manuell)<br />
- Fehlermeldungen und die Beseitigungsmaßnahmen<br />
- Umsetzung der sachlichen Erfordernis <strong>in</strong> das IT-Programm<br />
- Auswirkungen auf andere Programme<br />
- Auswirkungen auf die Verwaltungsorganisation<br />
- Mögliche masch<strong>in</strong>elle und manuelle Kontrollen<br />
- Nachweis der Verfahrensbeschreibung<br />
- Nachweis der Schnittstellen zu anderen Systemen<br />
- Nachweis des Freigabeverfahrens, der Kompetenzen, Testläufe und<br />
E<strong>in</strong>satzkontrollen<br />
- Nachweis der masch<strong>in</strong>ellen Kontrollen<br />
- Nachweis der Datenwiedergabe<br />
- Maßnahmen zur Verh<strong>in</strong>derung von unbefugten Datenänderungen<br />
- Maßnahmen zur Verh<strong>in</strong>derung von unbefugten Systemänderungen<br />
- Verfahren der Erteilung der Zugriffsberechtigungen<br />
- Nachweis der sachgerechten Erteilung der Zugriffsberechtigungen<br />
- Zuständigkeitsbereiche des Anwenders<br />
- Verantwortlichkeiten des Anwenders<br />
- Vorgesehene Abstimmungen<br />
- Vorgesehene manuelle Kontrollen<br />
- Maßnahmen bei Fehlermeldungen<br />
- Aufbewahrungspflichten und - fristen<br />
Abbildung 143 „Dokumentation zur Programmprüfung“<br />
Die Geme<strong>in</strong>de kann weitere Informationen geben, die für die örtliche Buchprüfung erforderlich s<strong>in</strong>d. Soweit diese<br />
<strong>in</strong> die Programmprüfung e<strong>in</strong>bezogen werden, sollen diese auch E<strong>in</strong>gang <strong>in</strong> die Dokumentation f<strong>in</strong>den. E<strong>in</strong>e<br />
GEMEINDEORDNUNG 699
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 103 GO <strong>NRW</strong><br />
Checkliste für die Durchführung der DV-Programmprüfung, <strong>in</strong> der M<strong>in</strong>destanforderungen für die Durchführung der<br />
Prüfung aufgezeigt werden, wurde <strong>in</strong> Zusammenarbeit von Rechnungsprüfern und der Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt<br />
<strong>NRW</strong> erarbeitet und veröffentlicht.<br />
1.1.6.4 Folgeprüfungen<br />
Die Ergebnisse e<strong>in</strong>er Programmprüfung können sich immer nur auf die jeweils aktuelle Version beziehen. S<strong>in</strong>d<br />
anschließend wesentliche Erweiterungen oder Änderungen vorgenommen worden, so ergibt sich heraus die<br />
Notwendigkeit e<strong>in</strong>er erneuten Prüfung des von der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>gesetzten Programms. Das Erfordernis e<strong>in</strong>er<br />
Folgeprüfung besteht unabhängig davon, ob bei den e<strong>in</strong>gesetzten geme<strong>in</strong>dlichen Programmen der Softwarehersteller<br />
weitere Programmfunktionen geschaffen hat oder die Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>dividuelle Lösung erarbeitet hat.<br />
Zusätzliche Anforderungen können sich dabei aus der fachlichen Anwendung bzw. der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgabenerfüllung<br />
ergeben. In diesem Zusammenhang ist es zweckmäßig, e<strong>in</strong>e Dokumentation der Veränderung verfügbar<br />
zu haben, um die Unterschiede zwischen den Programmversionen transparent zu machen und e<strong>in</strong>deutig bestimmen<br />
zu können. Über die Folgeprüfungen ist ebenfalls e<strong>in</strong> Prüfungsbericht zu erstellen und e<strong>in</strong>e Feststellung zu<br />
treffen.<br />
1.1.7 Zu Nummer 7 (Vorprüfung nach der Landeshaushaltsordnung <strong>NRW</strong>):<br />
1.1.7.1 Allgeme<strong>in</strong>e Grundlagen<br />
Die Haushalts- und Wirtschaftführung des Landes Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen unterliegt nach den haushaltsrechtlichen<br />
Vorschriften der Nachprüfung durch den Landesrechnungshof Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen (LHR <strong>NRW</strong>) als selbstständige<br />
oberste Landesbehörde (vgl. §§ 88 LHO <strong>NRW</strong>). So steht dem Landesrechnungshof e<strong>in</strong> Prüfungsrecht bei den<br />
Geme<strong>in</strong>den zu, wenn diese als Stellen außerhalb der Landesverwaltung z.B. Teile des Landeshaushaltsplans<br />
ausführen oder Landesmittel verwalten. E<strong>in</strong> Prüfungsrecht des LRH besteht aber z.B. auch dann, wenn die Geme<strong>in</strong>den<br />
vom Land Zuwendungen erhalten (vgl. § 91 Abs. 1 LHO <strong>NRW</strong>).<br />
In allen Fällen erstreckt sich die Prüfung auf die bestimmungsmäßige und wirtschaftliche Verwaltung und Verwendung<br />
der Landesmittel (vgl. § 91 Abs. 2 S. 1 LHO <strong>NRW</strong>). E<strong>in</strong>e solche Vorprüfung hat den Zweck, die Prüfung<br />
durch den Landesrechnungshof vorzubereiten und zu ergänzen. Bei der Vorprüfung s<strong>in</strong>d deshalb von der Geme<strong>in</strong>de<br />
die landesrechtlichen Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit mit dem Landesrechnungshof<br />
nichts anderes vere<strong>in</strong>bart ist. In diesem Zusammenhang können die Geme<strong>in</strong>den ohne eigene örtliche Rechnungsprüfung<br />
auch entsprechend den Bestimmungen des GkG e<strong>in</strong>e öffentlich-rechtliche Vere<strong>in</strong>barung mit e<strong>in</strong>er<br />
Geme<strong>in</strong>de mit örtlicher Rechnungsprüfung abschließen, um die gesetzliche Prüfungspflicht zu erfüllen. Außerdem<br />
f<strong>in</strong>det e<strong>in</strong>e Vorprüfung durch die Geme<strong>in</strong>den für den Bundesrechnungshof seit dem Haushaltsrechtsfortentwicklungsgesetz<br />
von 1997 nicht mehr statt.<br />
1.1.7.2 Die Vorprüfung durch die Geme<strong>in</strong>de<br />
1.1.7.2.1 Zuständigkeiten<br />
Die Geme<strong>in</strong>den, die Teile des Haushaltsplans des Landes ausführen oder vom Land Ersatz von Aufwendungen<br />
erhalten oder Mittel oder Vermögensgegenstände des Landes verwalten, s<strong>in</strong>d gesetzlich dazu verpflichtet worden,<br />
e<strong>in</strong>e Vorprüfung durchzuführen (vgl. § 104 Abs. 4 der LHO <strong>NRW</strong>). Diese geme<strong>in</strong>dliche Pflicht wird durch die<br />
Aufnahme <strong>in</strong> den Aufgabenkatalog der örtlichen Rechnungsprüfung nochmals verdeutlicht, auch wenn die Prüfung<br />
im Interesse des Landes vorgenommen wird. Die örtliche Rechnungsprüfung ist <strong>in</strong> diesen Fällen dem Lan-<br />
GEMEINDEORDNUNG 700
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 103 GO <strong>NRW</strong><br />
desrechnungshof fachlich unterstellt und verpflichtet, dessen fachliche Anweisungen zu befolgen. Ihre Unabhängigkeit<br />
wird durch die Vorprüfung nicht e<strong>in</strong>geschränkt, sondern baut <strong>in</strong> diesen Fällen auf den Gegebenheiten der<br />
Landesrechnungsprüfung auf, so dass auch die Prüfungszuständigkeiten bzw. Prüfungsaufgaben des Landesrechnungshofs<br />
zu beachten s<strong>in</strong>d (vgl. z.B. § 91 LHO <strong>NRW</strong>).<br />
In diesem Zusammenhang ist <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>deordnung Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen gesetzlich klargestellt worden, dass<br />
die Prüfung, ob die Geme<strong>in</strong>de die erhaltenen zweckgebundenen Staatszuweisungen bestimmungsgemäß verwendet<br />
hat, der überörtlichen Prüfung obliegt (vgl. § 105 Abs. 3 Nr. 1 GO <strong>NRW</strong>) und damit e<strong>in</strong>e Aufgabe der<br />
Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen darstellt. E<strong>in</strong>e Prüfung der Staatszuweisungen durch die örtliche<br />
Rechnungsprüfung würde daher die angeführte überörtliche Prüfung nicht ersetzen, sondern nur zu e<strong>in</strong>er Doppelprüfung<br />
führen. Daher kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass der örtlichen Rechnungsprüfung<br />
<strong>in</strong> den Fällen von zweckgebundenen Staatszuweisungen auch nicht die Verwendungsnachweisprüfung obliegt.<br />
Diese zuwendungsrechtliche Prüfung ist bei Zuwendungen des Landes vielmehr Aufgabe der vom Land bestimmten<br />
Bewilligungsbehörde.<br />
1.1.7.2.2 Durchführung<br />
Die Geme<strong>in</strong>de hat die durch sie gesetzlich vorgesehene Vorprüfung <strong>in</strong> entsprechender Anwendung der für den<br />
Landesrechnungshof geltenden Bestimmungen und nach se<strong>in</strong>en fachlichen Weisungen durchzuführen. So s<strong>in</strong>d<br />
z.B. von der Geme<strong>in</strong>de über die von ihr durchgeführten Vorprüfungen entsprechende Vorprüfungsniederschriften<br />
anzufertigen. Außerdem ist dem Landesrechnungshof jährlich über die Prüfungsergebnisse und die Zahl der<br />
Vorprüfungen zu berichten.<br />
Der Landesrechnungshof verlangt derzeit jährliche Berichte über die Prüfungsergebnisse und ggf. e<strong>in</strong>e anlassbezogene<br />
Berichterstattung, z.B. bei Prüfungsergebnissen von besonderer Bedeutung. In diesem Zusammenhang<br />
aktualisiert er bei Bedarf se<strong>in</strong>e Übersicht über die gem. § 100 LHO <strong>NRW</strong> vorzuprüfenden F<strong>in</strong>anzvorfälle. Der<br />
Landesrechnungshof kann sich aber auch jederzeit weitere Prüfungen und Berichte über den Umgang mit den zu<br />
bewirtschaftenden Landesmitteln verlangen und sich die abschließende Entscheidung über e<strong>in</strong>e Prüfung auf<br />
Grund landesrechtlicher Bestimmungen vorbehalten.<br />
1.1.8 Zu Nummer 8 (Prüfung von Vergaben):<br />
Diese Vorschrift beruht darauf, dass von der Geme<strong>in</strong>de bestimmte Vergabegrundsätze anzuwenden s<strong>in</strong>d, die das<br />
Innenm<strong>in</strong>isterium bekannt gibt. So besteht e<strong>in</strong>e Ausschreibungspflicht vor der Vergabe e<strong>in</strong>es öffentlichen Auftrages,<br />
sofern nicht Ausnahmetatbestände vorliegen (vgl. § 25 GemHVO <strong>NRW</strong>). Die Vergabevorschriften erfassen<br />
sämtliche Vergaben von Aufträgen der Geme<strong>in</strong>de, also alle Lieferungen und Leistungen, die unterhalb der<br />
Schwellenwerte (ohne Umsatzsteuer) der Europäischen Union von der Geme<strong>in</strong>de beauftragt werden. Die aktuellen<br />
Schwellenwerte ergeben sich aus § 100 Abs. 1 GWB i.V.m. § 2 der Verordnung über die Vergabe öffentlicher<br />
Aufträge (VgV) <strong>in</strong> der jeweils im Bundesgesetzblatt (BGBl) veröffentlichten Form.<br />
Mit diesen Vorschriften werden die Richtl<strong>in</strong>ien des Europäischen Parlamentes und des Rates <strong>in</strong> deutsches Recht<br />
umgesetzt. Die Vergabevorschriften s<strong>in</strong>d auch von der Geme<strong>in</strong>de zu beachten, so dass die Feststellung, ob diese<br />
Vorschriften e<strong>in</strong>gehalten worden s<strong>in</strong>d, auch e<strong>in</strong>e Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung darstellt. Die Vergabekontrolle<br />
der örtlichen Rechnungsprüfung erstreckt sich dabei auf die Rechtmäßigkeit und die Wirtschaftlichkeit<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Vergaben. Die Vergabeprüfung ist daher nicht nachträglich, sondern vor der Rechtswirksamkeit<br />
der Verträge, also vor der tatsächlichen Auftragsvergabe, durchzuführen. Zu den Grundsätzen zur Vergabe<br />
von Aufträgen durch die Geme<strong>in</strong>de unterhalb der EU-Schwellenwerte wird auf die Erläuterungen zu § 25 GemH-<br />
VO <strong>NRW</strong> „Vergabe von Aufträgen“ verwiesen.<br />
GEMEINDEORDNUNG 701
1.2 Zu Satz 2 (Prüfung bei Aufgabendelegation):<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 103 GO <strong>NRW</strong><br />
Durch diese Vorschrift wird bestimmt, dass <strong>in</strong> die Prüfung des Jahresabschlusses die Entscheidungen und Verwaltungsvorgänge<br />
aus delegierten Aufgaben auch dann e<strong>in</strong>zubeziehen s<strong>in</strong>d, wenn die Zahlungsvorgänge selbst<br />
durch den Träger der Aufgabe vorgenommen werden und <strong>in</strong>sgesamt f<strong>in</strong>anziell von erheblicher Bedeutung s<strong>in</strong>d.<br />
Diese Verpflichtung zur Prüfung umfasst alle delegierten Aufgaben, die f<strong>in</strong>anziell von erheblicher Bedeutung für<br />
die Geme<strong>in</strong>de s<strong>in</strong>d. Dieses ist allgeme<strong>in</strong> geboten, denn viele übertragene Aufgaben haben f<strong>in</strong>anziell erhebliche<br />
Auswirkungen.<br />
2. Zu Absatz 2 (Beauftragung der örtlichen Rechnungsprüfung durch den Rat):<br />
2.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Der Rat der Geme<strong>in</strong>de kann nach dieser Vorschrift die örtliche Rechnungsprüfung mit eigenständigen Prüfungsaufgaben<br />
beauftragen. Von der örtlichen Rechnungsprüfung s<strong>in</strong>d die Prüfungsaufgaben des Rates der Geme<strong>in</strong>de<br />
neben ihren gesetzlichen Aufgaben, z.B. Prüfung des Jahresabschlusses nach § 103 Abs. 1 Nr. 1 GO <strong>NRW</strong>, zu<br />
erledigen. Der Rat, der die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung überträgt, ist bei den <strong>in</strong> der Vorschrift genannten<br />
Aufträgen sowohl der Auftraggeber auch der Adressat des Prüfungsberichtes mit den dar<strong>in</strong> enthaltenen<br />
Prüfungsergebnissen. Er hat daher auch über den Umgang mit dem Prüfungsbericht sowie über daraus abzuleitende<br />
Maßnahmen zu entscheiden.<br />
2.2 Die Übertragung von Prüfungsaufgaben<br />
Nach der Vorschrift kann der Rat der Geme<strong>in</strong>de der örtlichen Rechnungsprüfung <strong>in</strong>sbesondere die Prüfung der<br />
Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit und die Prüfung der wirtschaftlichen Betätigung der Geme<strong>in</strong>de<br />
übertragen. Die Aufzählung <strong>in</strong> der haushaltsrechtlichen Vorschrift ist jedoch lediglich beispielhaft und<br />
nicht abschließend. Dabei wird wegen ihrer Bedeutung für die örtliche Aufgabenerfüllung und den Geschäftsablauf<br />
<strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung die Aufgabe „Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit“<br />
besonders herausgehoben (vgl. Nummer 1). Wird e<strong>in</strong>e solche Prüfung vorgenommen, vermittelt sie dem<br />
Rat der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>en umfassenden E<strong>in</strong>blick <strong>in</strong> die geme<strong>in</strong>dliche Verwaltung.<br />
In diesem Zusammenhang stellen die Prüfungen der Betätigung der Geme<strong>in</strong>de als Gesellschafter, Aktionär oder<br />
Mitglied <strong>in</strong> Gesellschaften und anderen Vere<strong>in</strong>igungen des privaten Rechts oder <strong>in</strong> der Rechtsform der Anstalt<br />
des öffentlichen Rechts gemäß § 114a sowie die Buch- und Betriebsprüfung, die sich die Geme<strong>in</strong>de bei e<strong>in</strong>er<br />
Beteiligung, bei der H<strong>in</strong>gabe e<strong>in</strong>es Darlehens oder sonst vorbehalten hat, herausragende Aufgaben für die örtliche<br />
Rechnungsprüfung dar, die mit dem geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss im Zusammenhang stehen.<br />
2.3 Die Beteiligung Dritter<br />
E<strong>in</strong> Recht des Bürgermeisters und/oder des Kämmerers, e<strong>in</strong>e Stellungnahme zum Ergebnis der Prüfungen, weil<br />
der Rat der Geme<strong>in</strong>de der örtlichen Rechnungsprüfung besondere Aufgaben übertragen hat, enthält die Vorschrift<br />
jedoch nicht. In diesen Angelegenheiten kann e<strong>in</strong>e Beteiligung der benannten Personen auch nicht aus der<br />
Vorschrift des § 101 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> abgeleitet werden. Diese Vorschrift trifft lediglich für die Jahresabschlussprüfung<br />
e<strong>in</strong>e gesonderte Regelung, die <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit § 116 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong> auch für den geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Gesamtabschluss gilt. Der Rat kann aber bei örtlichem Bedarf oder aus sonstigem Anlass bereits bei der Beauftragung<br />
der örtlichen Rechnungsprüfung e<strong>in</strong>e Beteiligung des Bürgermeisters und/oder des Kämmerers gesondert<br />
festlegen.<br />
GEMEINDEORDNUNG 702
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 103 GO <strong>NRW</strong><br />
3. Zu Absatz 3 (Beauftragung der örtlichen Rechnungsprüfung durch den Bürgermeister):<br />
3.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Nach der Vorschrift kann der Bürgermeister <strong>in</strong>nerhalb se<strong>in</strong>es Amtsbereichs unter Mitteilung an den Rechnungsprüfungsausschuss<br />
der örtlichen Rechnungsprüfung eigene Prüfungsaufträge erteilen. Dieses gesetzliche Recht<br />
des Bürgermeisters ist geboten, denn er ist verantwortlich für die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs<br />
der gesamten Verwaltung (vgl. § 62 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>). Der Begriff „Amtsbereich“ umfasst die gesamte<br />
geme<strong>in</strong>dliche Verwaltung und nicht nur die Aufgaben und Angelegenheiten, die er sich zur eigenen Bearbeitung<br />
vorbehalten hat (vgl. § 62 Abs. 1 S. 4 GO <strong>NRW</strong>). Der Adressat des Prüfungsberichtes der örtlichen Rechnungsprüfung<br />
bleibt aber wegen der von ihm erteilten Prüfungsaufträge ausschließlich der Bürgermeister.<br />
Die Beauftragung der örtlichen Rechnungsprüfung durch den Bürgermeister macht dabei deutlich, dass dieser<br />
sich bei se<strong>in</strong>en Prüfaufträgen dieser unabhängigen Stelle bedienen will, denn die örtliche Rechnungsprüfung ist<br />
dem Rat unmittelbar verantwortlich, ihm <strong>in</strong> ihrer sachlichen Tätigkeit unmittelbar unterstellt und frei von fachlichen<br />
Weisungen (vgl. § 104 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>). In den Fällen, <strong>in</strong> denen der Bürgermeister diese örtlichen Gegebenheiten<br />
nutzen will, unterwirft er sich diesen und kann dann i.d.R. ke<strong>in</strong>e Vorgaben mehr zur Art und Weise der Prüfung,<br />
z.B. zu e<strong>in</strong>zusetzenden Prüfern oder zur Prüfungsmethode, machen. Dieser Grundsatz verbietet ke<strong>in</strong>e<br />
Abweichungen. Vor Ort auftretende Zweifelsfälle können daher nur zwischen den Beteiligten geklärt werden.<br />
3.2 Die Prüfungsaufträge<br />
Die Aufträge des Bürgermeisters s<strong>in</strong>d von der örtlichen Rechnungsprüfung neben ihren gesetzlichen Aufgaben,<br />
z.B. Prüfung des Jahresabschlusses nach § 103 Abs. 1 Nr. 1 GO <strong>NRW</strong>, zu erledigen. Die Vorschrift enthält jedoch<br />
ke<strong>in</strong>e Aufzählung möglicher Prüfungsaufträge. So sollen <strong>in</strong> Abhängigkeit von den örtlichen Verhältnissen<br />
bestimmt werden. Der Bürgermeister kann z.B. die örtliche Rechnungsprüfung mit e<strong>in</strong>er Organisationsprüfung der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung beauftragen.<br />
In den Fällen, <strong>in</strong> denen der örtlichen Rechnungsprüfung weitere Aufgaben vom Rat übertragen worden s<strong>in</strong>d,<br />
stehen diese e<strong>in</strong>er Beauftragung der örtlichen Rechnungsprüfung durch den Bürgermeister grundsätzlich nicht<br />
entgegen. Widersprechen sich aber die übertragenen Prüfungsaufgaben des Rates mit den Prüfungsaufträgen<br />
des Bürgermeisters, so soll von der örtlichen Rechnungsprüfung den für den Rat zu erledigenden Aufgaben e<strong>in</strong><br />
Vorrang e<strong>in</strong>geräumt werden. So haben auch die gesetzlichen Prüfaufgaben auch regelmäßig e<strong>in</strong>en Vorrang vor<br />
den beauftragten Prüfungen. Diese E<strong>in</strong>schätzung wird auch durch die Reihenfolge der Aufgaben der örtlichen<br />
Rechnungsprüfung <strong>in</strong> der Vorschrift verdeutlicht.<br />
3.3 Die Beteiligung Dritter<br />
Über die Aufträge des Bürgermeisters an die örtliche Rechnungsprüfung ist wegen der Sachnähe der örtliche<br />
Rechnungsprüfungsausschuss zu unterrichten. Die Vorschrift schließt aber nicht aus, dass der Bürgermeister<br />
auch den F<strong>in</strong>anzausschuss über die von ihm der örtlichen Rechnungsprüfung erteilten Aufträge <strong>in</strong>formiert. Die<br />
Unterrichtungspflicht be<strong>in</strong>haltet aber ke<strong>in</strong> E<strong>in</strong>spruchsrecht des Rechnungsprüfungsausschusses gegen die Erteilung<br />
des Prüfungsauftrages.<br />
E<strong>in</strong>e Pflicht zur Unterrichtung des Rates der Geme<strong>in</strong>de über Prüfungsaufträge des Bürgermeisters an die örtliche<br />
Rechnungsprüfung ist gesetzlich nicht vorgesehen. Sie kann aber unter dem Gesichtspunkt, dass die örtliche<br />
Rechnungsprüfung dem Rat unmittelbar verantwortlich und <strong>in</strong> ihrer sachlichen Tätigkeit ihm unterstellt ist (vgl. §<br />
104 Abs. 1 S. 1 GO <strong>NRW</strong>), und unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten durch den Bürgermeister<br />
GEMEINDEORDNUNG 703
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 103 GO <strong>NRW</strong><br />
erfolgen, denn es obliegt dem Bürgermeister, den Rat der Geme<strong>in</strong>de über alle wichtigen Geme<strong>in</strong>deangelegenheiten<br />
der Geme<strong>in</strong>de zu unterrichten (vgl. § 62 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong>).<br />
Die Vorschrift enthält zudem ke<strong>in</strong> Recht des Kämmerers auf Erhalt des Prüfungsberichtes oder der Abgabe e<strong>in</strong>er<br />
Stellungnahme zum Auftrag des Bürgermeisters an die örtliche Rechnungsprüfung oder zum dem Bürgermeister<br />
übermittelten Prüfungsergebnis, wie es nach § 101 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> bei der geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlussprüfung<br />
vorgesehen ist. Der Bürgermeister hat bei Bedarf e<strong>in</strong>e Beteiligung oder e<strong>in</strong>e Information an den Kämmerer<br />
bei der Vergabe se<strong>in</strong>er Aufträge an die örtliche Rechnungsprüfung gesondert festzulegen. In diesem Gesamtzusammenhang<br />
gebietet es die verpflichtende vorherige Beteiligung des Rechnungsprüfungsausschusses bei der<br />
Auftragsvergabe an die örtliche Rechnungsprüfung, dass der Ausschuss nicht nur über die Auftragsvergabe,<br />
sondern über das von der örtlichen Rechnungsprüfung festgestellte Prüfungsergebnis unterrichtet wird.<br />
4. Zu Absatz 4 (Sicherstellung der Informationsrechte der Prüfer):<br />
4.1 Zu Satz 1 (Recht auf Vorlage von Nachweisen und Informationen):<br />
4.1.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die Vorschrift soll für die Abschlussprüfer sicherstellen, dass diese <strong>in</strong>sbesondere die Nachweise und Informationen<br />
erhalten, die für ihre sorgfältige Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses der Geme<strong>in</strong>de<br />
notwendig s<strong>in</strong>d. Die Regelungen dienen daher dem Schutz der Abschlussprüfer und sollen e<strong>in</strong>e sorgfältige Prüfung<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Abschlüsse ermöglichen sowie die Qualität und Verlässlichkeit der Prüfungsarbeiten<br />
gewährleisten. Das Recht e<strong>in</strong>es Abschlussprüfers auf Vorlage von Nachweisen und Informationen be<strong>in</strong>haltet aber<br />
auch besondere Mitwirkungspflichten des Rates der Geme<strong>in</strong>de sowie des Bürgermeisters e<strong>in</strong>schließlich der Beschäftigten<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung, auch wenn <strong>in</strong> der Vorschrift dieses nicht ausdrücklich hervorgehoben<br />
wird.<br />
Der Abschlussprüfer ist bei der Durchführung e<strong>in</strong>er Jahresabschlussprüfung immer auf die Mitwirkung der „geprüften<br />
Verwaltungsstellen“ sowie des Rechnungsprüfungsausschusses bzw. des Rates der Geme<strong>in</strong>de als Auftraggeber<br />
angewiesen. In den Fällen, <strong>in</strong> denen seitens der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung notwendige Unterlagen<br />
zurückgehalten oder auch dem Prüfer die erbetenen Informationen verweigert werden, ist der Bürgermeister als<br />
Verantwortlicher für die Leitung und den Geschäftsgang der gesamten geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung der Ansprechpartner,<br />
soweit er sich die Angelegenheit selbst vorbehalten hat (vgl. § 62 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>).<br />
In Ausnahmefällen kann auch der Rechnungsprüfungsausschuss bzw. der Rat der Geme<strong>in</strong>de unmittelbar als<br />
Auftraggeber zum Ansprechpartner der örtlichen Rechnungsprüfung werden. Diese Beteiligung kann <strong>in</strong>sbesondere<br />
<strong>in</strong> den Fällen geboten se<strong>in</strong>, <strong>in</strong> denen dem Abschlussprüfer die von ihm gewünschten Nachweise und Informationen<br />
nicht zur Verfügung gestellt werden und er deshalb diese Gegebenheit als e<strong>in</strong> Prüfungshemmnis bewerten<br />
will, das aus se<strong>in</strong>er Sicht zur Versagung des notwendigen Bestätigungsvermerks für den geme<strong>in</strong>dlichen Abschluss<br />
führen soll (vgl. § 101 Abs. 3 und 5 GO <strong>NRW</strong>).<br />
Dem Prüfer steht mit dem Recht auf Vorlage von Nachweisen und Informationen aber nicht e<strong>in</strong> une<strong>in</strong>geschränktes<br />
Recht zur E<strong>in</strong>sichtnahme <strong>in</strong> geme<strong>in</strong>dliche Unterlagen zu. Bei e<strong>in</strong>er möglichen Forderung nach Nachweisen<br />
und Informationen im Rahmen se<strong>in</strong>er Abschlussprüfung hat er zu berücksichtigen, dass bei der Durchführung der<br />
Abschlussprüfung auch der Grundsatz der Wesentlichkeit sowie der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit Anwendung<br />
f<strong>in</strong>det. Diese Grundsätze beschränken regelmäßig die Rechte des Prüfers, so dass er z.B. nicht eigenständig<br />
e<strong>in</strong>e Suche nach brauchbaren Unterlagen der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung vornehmen darf.<br />
GEMEINDEORDNUNG 704
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 103 GO <strong>NRW</strong><br />
4.1.2 Absicherung der Vollständigkeit der zu prüfenden Unterlagen<br />
Im Rahmen der ordnungsmäßigen Durchführung von Abschlussprüfungen besteht vielfach e<strong>in</strong> Erfordernis für den<br />
Prüfer, sich versichern zu lassen, dass die ihm vorgelegten geme<strong>in</strong>dlichen Unterlagen sowie die Nachweise und<br />
die ihm erteilten Informationen richtig und vollständig s<strong>in</strong>d. E<strong>in</strong> Abschlussprüfer hat vor se<strong>in</strong>er Aufforderung nach<br />
Abgabe e<strong>in</strong>er solchen Absicherungserklärung (Vollständigkeitserklärung) zu berücksichtigen, dass der Bürgermeister<br />
durch se<strong>in</strong>e Bestätigung des Entwurfs des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses nach § 95 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong><br />
e<strong>in</strong>e öffentlich-rechtliche Verpflichtung erfüllt und mit se<strong>in</strong>er Unterschrift zum Ausdruck br<strong>in</strong>gt, dass der Entwurf<br />
aus se<strong>in</strong>er Verantwortung heraus richtig und vollständig ist, sofern er dazu ke<strong>in</strong>e besonderen E<strong>in</strong>schränkungen<br />
macht oder H<strong>in</strong>weise gibt.<br />
Zur Abgabe e<strong>in</strong>er Vollständigkeitserklärung besteht jedoch ke<strong>in</strong>e gesetzliche Verpflichtung für die Geme<strong>in</strong>de. Der<br />
Bürgermeister kann neben se<strong>in</strong>er Bestätigung des Entwurfs des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses aber freiwillig<br />
e<strong>in</strong>e solche weitere Erklärung gegenüber dem Abschlussprüfer bzw. der örtlichen Rechnungsprüfung oder gegenüber<br />
dem von ihr nach § 103 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong> beauftragten Prüfer abgeben. In den Fällen, <strong>in</strong> denen vom<br />
Rechnungsprüfungsausschuss der Geme<strong>in</strong>de oder von der örtlichen Rechnungsprüfung e<strong>in</strong> Wirtschaftsprüfer mit<br />
der Durchführung e<strong>in</strong>er Abschlussprüfung beauftragt wird (vgl. § 59 Abs. 3 und § 103 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong>), dürfte<br />
dieser Abschlussprüfer i.d.R. e<strong>in</strong>e solche Vollständigkeitserklärung im Rahmen se<strong>in</strong>er Beauftragung und unter<br />
der Anwendung der Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfungen verlangen.<br />
4.1.3 Bedarfsprüfung vor der Abgabe e<strong>in</strong>er Vollständigkeitserklärung<br />
Die Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses, der vom Kämmerer aufgestellt und vom Bürgermeister nach<br />
se<strong>in</strong>er Bestätigung dem Rat der Geme<strong>in</strong>de zugeleitet worden ist (vgl. § 95 Abs. 3 GO<strong>NRW</strong>), umfasst e<strong>in</strong>e formelle<br />
und materielle Beurteilung durch die Prüfer (vgl. § 101 GO <strong>NRW</strong>) und baut auf den der örtlichen Rechnungsprüfung<br />
vorgelegten Unterlagen auf. Der Abschlussprüfer kann daher im Rahmen se<strong>in</strong>er Prüfungstätigkeit und bei<br />
entsprechendem Bedarf die notwendige Aufklärung verlangen. Um von se<strong>in</strong>em Recht Gebrauch machen zu können,<br />
muss er zuvor sorgfältig prüfen, ob und <strong>in</strong> welchem Umfang weitere Nachweise und Informationen von der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung zur Erledigung se<strong>in</strong>er Prüfungsaufgaben benötigt werden.<br />
Bei dieser Bedarfsprüfung hat der Prüfer u.a. zu berücksichtigen, dass der Kämmerer der Geme<strong>in</strong>de, der für das<br />
F<strong>in</strong>anzwesen <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>de zuständig ist bzw. die F<strong>in</strong>anzverantwortung <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong>nehat, vor der<br />
Zuleitung des von ihm aufgestellten Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen an den Bürgermeister<br />
se<strong>in</strong>en Entwurf zu unterzeichnet und damit zum Ausdruck gebracht hat, dass der von ihm aufgestellte Entwurf<br />
aus se<strong>in</strong>er F<strong>in</strong>anzverantwortung heraus den gesetzlichen Vorgaben entspricht und richtig und vollständig ist.<br />
Der Abschlussprüfer hat im Rahmen se<strong>in</strong>er Bedarfsprüfung die Bestätigung des Entwurfs des Jahresabschlusses<br />
durch den Bürgermeister zu berücksichtigen, denn diese umfasst e<strong>in</strong>e vergleichbare Bestätigung. Der Kämmerer<br />
sowie der Bürgermeister erfüllen mit ihrer Unterzeichnung e<strong>in</strong>e öffentlich-rechtliche Verpflichtung und br<strong>in</strong>gen mit<br />
ihren Unterschriften zum Ausdruck, dass der Entwurf des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses aus ihrer Verantwortung<br />
heraus richtig und vollständig ist, sofern sie dazu ke<strong>in</strong>e besonderen E<strong>in</strong>schränkungen machen. E<strong>in</strong> Prüfer<br />
der örtlichen Rechnungsprüfung kann daher von se<strong>in</strong>em Recht nach Abgabe e<strong>in</strong>er zusätzlichen Erklärung nur<br />
Gebrauch machen, wenn im E<strong>in</strong>zelfall nach se<strong>in</strong>er Bedarfsprüfung bei ihm noch erhebliche Zweifel an der Richtigkeit<br />
der ihm vorgelegten Unterlagen bestehen und diese nicht auf e<strong>in</strong>e andere Art und Weise ausgeräumt werden<br />
können und der Sachverhalt für den geme<strong>in</strong>dlichen Abschluss wesentlich ist.<br />
Das E<strong>in</strong>holen e<strong>in</strong>er zusätzlichen Erklärung ist dabei <strong>in</strong> das Ermessen des Prüfers gestellt, jedoch hat er ke<strong>in</strong>en<br />
Rechtsanspruch darauf. Wird vom Prüfer e<strong>in</strong>e solche Erklärung verlangt, sollte diese auf e<strong>in</strong>em gesonderten<br />
Dokument abgegeben werden. Das örtliche Erfordernis und der Umfang e<strong>in</strong>er solchen zusätzlichen Erklärung im<br />
Rahmen der Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses muss an den Verantwortlichkeiten für den geme<strong>in</strong>d-<br />
GEMEINDEORDNUNG 705
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 103 GO <strong>NRW</strong><br />
lichen Jahresabschlusses gemessen werden. Die Abgabe e<strong>in</strong>er solchen Erklärung führt nicht zum Verzicht der<br />
Vorlage benötigter Nachweise und Informationen, denn sie stellt ke<strong>in</strong>en Ersatz für die vom Prüfer für erforderlich<br />
gehaltenen Unterlagen dar.<br />
4.1.4 Inhalte e<strong>in</strong>er Vollständigkeitserklärung<br />
Der Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung kann zum Nachweis, dass ihm von der Geme<strong>in</strong>de alle erforderlichen<br />
Unterlagen für se<strong>in</strong>e Prüfung, z.B. des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses, vorgelegt worden s<strong>in</strong>d, e<strong>in</strong>e entsprechende<br />
Erklärung verlangen (Vollständigkeitserklärung). E<strong>in</strong>e solche Erklärung, die i.d.R. vom Bürgermeister<br />
abzugeben ist, kann zum Inhalt haben, dass dem Abschlussprüfer alle für se<strong>in</strong>e Prüfung erforderlichen Unterlagen,<br />
Nachweise und Bestimmungen sowie Auskünfte gegeben bzw. zur Verfügung gestellt wurden.<br />
E<strong>in</strong>e Vollständigkeitserklärung ist von der Geme<strong>in</strong>de unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten eigenverantwortlich<br />
zu gestalten und kann bei Bedarf durch fachliche Zusatzerklärungen ergänzt werden, wenn dieses<br />
Instrument von der Geme<strong>in</strong>de genutzt werden soll. In diesem Zusammenhang kann die Geme<strong>in</strong>de die Abgabe<br />
e<strong>in</strong>er Vollständigkeitserklärung durch die e<strong>in</strong>zelnen Fachbereiche vorsehen, wenn dafür ggf. e<strong>in</strong> örtliches Erfordernis<br />
im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung und des daraus zu entwickelnden geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Jahresabschlusses besteht.<br />
4.2 Zu Satz 2 (Informationsrechte gegenüber betrieblichen Abschlussprüfern):<br />
Nach der Vorschrift hat e<strong>in</strong> Abschlussprüfer des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses oder des Gesamtabschlusses<br />
der Geme<strong>in</strong>de auch gegenüber den Abschlussprüfern der geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe (verselbstständigte Aufgabenbereiche<br />
der Geme<strong>in</strong>de) das Recht, von diesen die Aufklärung und Nachweise zu verlangen, die für e<strong>in</strong>e sorgfältige<br />
Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses oder des Gesamtabschlusses der Geme<strong>in</strong>de notwendig s<strong>in</strong>d.<br />
Insbesondere bei der Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses besteht e<strong>in</strong> enger Sachzusammenhang zu<br />
den Abschlussprüfungen der geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe, weil mit dem geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss die Vermögens-,<br />
Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong>sgesamt so darzustellen ist, als ob es sich bei der<br />
Geme<strong>in</strong>de um e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>zige wirtschaftliche „E<strong>in</strong>heit“ handeln würde. Der Gesetzgeber hat es deshalb als geboten<br />
angesehen, durch e<strong>in</strong>e weitere gesetzliche Regelung die Durchsetzung der Rechte der Prüfer auch gegenüber<br />
den Abschlussprüfern der geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe zu gewährleisten.<br />
Im Rahmen se<strong>in</strong>er Informationsrechte soll der verantwortliche Abschlussprüfer bei der Geme<strong>in</strong>de deshalb bei<br />
Bedarf die notwendige Aufklärung und Nachweise über Prüfungsgegenstände und Prüfungshandlungen e<strong>in</strong>es<br />
Dritten als Prüfer verlangen können, die für se<strong>in</strong>e (geme<strong>in</strong>dliche) Prüfung notwendig s<strong>in</strong>d bzw. auf andere Weise<br />
zur Durchführung se<strong>in</strong>er Abschlussprüfung erforderlich s<strong>in</strong>d. Der gesetzliche Anspruch des geme<strong>in</strong>dlichen Abschlussprüfers<br />
richtet sich dabei nur gegen den betrieblichen Abschlussprüfer und nicht gegen den geprüften<br />
Betrieb selbst. Außerdem muss der mögliche Informationsbedarf und das Auskunftsersuchen im Rahmen der<br />
jeweiligen Abschlussprüfung dokumentiert werden.<br />
Die Umsetzung dieser Vorgabe erfordert aber im Vorfeld, dass die Geme<strong>in</strong>de (geme<strong>in</strong>dliche Kernverwaltung als<br />
Muttere<strong>in</strong>heit) gegenüber ihren Betrieben entsprechende Vorgaben macht und ihre Betriebe verpflichtet, diese<br />
Vorgaben im Rahmen der Auswahl ihrer Abschlussprüfer zu berücksichtigen und mit dem Prüfer derartige Informationspflichten<br />
zu vere<strong>in</strong>baren. Nur e<strong>in</strong>e solche Grundlage ermöglicht dem Abschlussprüfer des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Gesamtabschluss von den Abschlussprüfern der geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe die Aufklärung und Nachweise zu verlangen,<br />
die für se<strong>in</strong>e sorgfältige Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses der Geme<strong>in</strong>de notwendig s<strong>in</strong>d.<br />
In diesem Zusammenhang kann es s<strong>in</strong>nvoll se<strong>in</strong>, dass der Abschlussprüfer des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses<br />
auch an den Schlussbesprechungen der Abschlussprüfung bei wichtigen geme<strong>in</strong>dlichen Betrieben teilnimmt,<br />
die im Rahmen des Gesamtabschlusses voll zu konsolidieren s<strong>in</strong>d.<br />
GEMEINDEORDNUNG 706
4.2.2 Die Verwertung erhaltener Informationen<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 103 GO <strong>NRW</strong><br />
E<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>dlicher Rechnungsprüfer kann grundsätzlich nicht davon ausgehen, dass die ihm durch andere Prüfer<br />
zugeleiteten Informationen, auch wenn die Dritten diese im Rahmen ihrer Prüfungstätigkeit erlangt haben, ohne<br />
vorherige Zusatzprüfung <strong>in</strong> die eigenen Prüfungshandlungen e<strong>in</strong>bezogen werden können. E<strong>in</strong>er unmittelbaren<br />
ungeprüften E<strong>in</strong>beziehung bzw. Übernahme <strong>in</strong> die eigenen Arbeiten steht die Eigenverantwortlichkeit der örtlichen<br />
Rechnungsprüfung entgegen, denn diese muss von ihrem gesetzlichen Auftrag her e<strong>in</strong> eigenverantwortliches<br />
Urteil auf Grund ihrer Erkenntnismöglichkeiten abgeben. Der Prüfer hat deshalb <strong>in</strong> den Fällen, <strong>in</strong> denen er<br />
Aufklärung oder Nachweise von Dritten verlangt, immer <strong>in</strong> geeigneter Weise zu überprüfen, ob die ihm überlassenen<br />
Informationen und Unterlagen auch für e<strong>in</strong>e Verwertung <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er eigenen Prüfung geeignet s<strong>in</strong>d und welcher<br />
Prüfer ihm die Informationen bzw. Unterlagen überlassen hat.<br />
In diesem Rahmen s<strong>in</strong>d auch die e<strong>in</strong>schlägigen Datenschutzbestimmungen sowie Festlegungen über Betriebsgeheimnisse<br />
zu berücksichtigen. Vom geme<strong>in</strong>dlichen Abschlussprüfer ist zudem e<strong>in</strong> Zusammenhang mit den<br />
eigenen Prüfungshandlungen bei se<strong>in</strong>er Abschlussprüfung herzustellen, so dass die Inhalte und das Ausmaß der<br />
Verwertung zutreffend und nachvollziehbar abgewogen werden können. Das Ergebnis dieser Überprüfung sowie<br />
das Ausmaß der Verwertung bzw. die Gewichtung der der erhaltenen Informationen s<strong>in</strong>d vom Abschlussprüfer zu<br />
dokumentieren.<br />
5. Zu Absatz 5 (Beauftragung Dritter als Prüfer):<br />
5.1 Zwecke der Vorschrift<br />
5.1.1 Örtliche Rechnungsprüfung als Aufgabe<br />
Die örtliche Rechnungsprüfung ist bei den kreisfreien Städten, den Großen und den Mittleren kreisangehörigen<br />
Städten regelmäßig e<strong>in</strong>e Organisationse<strong>in</strong>heit <strong>in</strong>nerhalb der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung, denn diese Städte haben<br />
e<strong>in</strong>e örtliche Rechnungsprüfung e<strong>in</strong>zurichten (vgl. § 102 Abs. 1 S. 1 GO <strong>NRW</strong>). Die übrigen Geme<strong>in</strong>den sollen<br />
e<strong>in</strong>e Organisationse<strong>in</strong>heit „Örtliche Rechnungsprüfung“ e<strong>in</strong>richten, wenn bei ihnen dafür e<strong>in</strong> Bedürfnis besteht<br />
und die Kosten <strong>in</strong> angemessenem Verhältnis zum Nutzen stehen. Grundsätzlich muss daher die Geme<strong>in</strong>de als<br />
Aufgabenträger handeln, denn der Gesetzgeber hat ihr ausdrücklich die dafür erforderlichen Kompetenzen e<strong>in</strong>geräumt.<br />
Er hat die Geme<strong>in</strong>de als geeignet angesehen, dass sie die ihr zugewiesenen Prüfungsaufgaben mit der<br />
notwendigen personellen und sächlichen Ausstattung erfüllen und den ordnungsgemäßen Gang der Prüfungsgeschäfte<br />
sicherstellen kann.<br />
Die örtliche Rechnungsprüfung nimmt aber als Organisationse<strong>in</strong>heit e<strong>in</strong>e Sonderstellung <strong>in</strong>nerhalb der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Verwaltung e<strong>in</strong>, weil <strong>in</strong> der Vorschrift des § 104 GO <strong>NRW</strong> bestimmt wird, dass die örtliche Rechnungsprüfung<br />
dem Rat unmittelbar verantwortlich und <strong>in</strong> ihrer sachlichen Tätigkeit ihm unmittelbar unterstellt sowie von<br />
fachlichen Weisungen frei ist. Die Vorschrift enthält außerdem besondere die Unabhängigkeit der Prüfer sichernde<br />
Bestimmungen, um den Ausschluss jeglicher E<strong>in</strong>flussnahme der von der örtlichen Rechnungsprüfung zu prüfenden<br />
Stellen zu erreichen und um e<strong>in</strong>e s<strong>in</strong>nvolle und effektive Prüfung zu gewährleisten.<br />
5.1.2 Die E<strong>in</strong>schaltung Dritter als Prüfer<br />
Die Vorschrift bestimmt <strong>in</strong> diesem Zusammenhang, dass sich die örtliche Rechnungsprüfung der Geme<strong>in</strong>de mit<br />
Zustimmung des Rechnungsprüfungsausschusses e<strong>in</strong>es Dritten als Prüfer bedienen kann. Die Anwendung des<br />
NKF e<strong>in</strong>schließlich des Systems der doppelten Buchführung sowie der Anforderungen an e<strong>in</strong>e begleitende und<br />
nicht nachrangige Prüfung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft erfordert entsprechend qualifizierte und erfahrene<br />
Prüfer, von denen e<strong>in</strong> entsprechender Nachweis bei e<strong>in</strong>er Auftragung durch die Geme<strong>in</strong>de gefordert werden<br />
GEMEINDEORDNUNG 707
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 103 GO <strong>NRW</strong><br />
sollte. Bei den Beteiligungen von Dritten an den Prüfungsaufgaben bleibt die Verantwortung der örtlichen Rechnungsprüfung<br />
unberührt. Ihre eigene Befassung, z.B. mit der Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses oder<br />
des Gesamtabschlusses, muss so ausgestaltet und ausreichend se<strong>in</strong>, dass sie auf Grund ihrer Erkenntnismöglichkeiten<br />
e<strong>in</strong> eigenverantwortliches Urteil zum jeweiligen Prüfungsgegenstand fällen und e<strong>in</strong>en Bestätigungsvermerk<br />
abgeben kann.<br />
Im Rahmen se<strong>in</strong>er Beauftragung wird e<strong>in</strong> Dritter als Prüfer regelmäßig eigenverantwortlich tätig. Er im Rahmen<br />
der Beauftragung die betreffenden geme<strong>in</strong>dlichen Sachverhalte und ggf. auch Geschäftsvorfälle der Geme<strong>in</strong>de<br />
mit se<strong>in</strong>em üblichen Prüfungsansatz umfassend zu prüfen, soweit nicht gesonderte Erfordernisse vere<strong>in</strong>bart werden.<br />
Zudem hat er e<strong>in</strong>en Prüfungsbericht zu erstellen und zu se<strong>in</strong>em festgestellten Prüfungsergebnis e<strong>in</strong>en Bestätigungsvermerk<br />
oder e<strong>in</strong>en Vermerk über se<strong>in</strong>e Versagung nach § 101 Abs. 3 bis 7 GO <strong>NRW</strong> abzugeben.<br />
Die Regelung beschränkt die Beauftragung Dritter als Prüfer nicht auf geme<strong>in</strong>dliche Abschlussprüfungen. Vielmehr<br />
kann e<strong>in</strong> Dritter auch mit anderen Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung beauftragt werden. Der örtlichen<br />
Rechnungsprüfung wird daher bereits dadurch e<strong>in</strong>e flexible und wirtschaftliche Aufgabenerledigung ermöglicht,<br />
dass sie sich Dritter als Prüfer bedienen kann. Die Vorschrift soll diesem Sachverhalt besonders auch dadurch<br />
Rechnung tragen, dass die Verantwortung über die Entscheidung der Beauftragung e<strong>in</strong>es Dritten der örtlichen<br />
Rechnungsprüfung obliegt.<br />
5.1.3 Sonstige Aspekte<br />
Die Anwendung des NKF e<strong>in</strong>schließlich des Systems der doppelten Buchführung sowie der Anforderungen an<br />
e<strong>in</strong>e begleitende und nicht nachrangige Prüfung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft erfordert entsprechend<br />
qualifizierte und erfahrene Prüfer, von denen e<strong>in</strong> entsprechender Nachweis bei e<strong>in</strong>er Auftragung durch die Geme<strong>in</strong>de<br />
gefordert werden sollte. So wird z.B. durch Art. 13 der EU-Richtl<strong>in</strong>ie vom 09.06.2006 (Abschlussprüferrichtl<strong>in</strong>ie)<br />
e<strong>in</strong>e kont<strong>in</strong>uierliche Fortbildung der Abschlussprüfer im Rahmen angemessener Programme gefordert,<br />
um ihre theoretischen Kenntnisse und ihre beruflichen Fertigkeiten und Wertmaßstäbe auf e<strong>in</strong>em ausreichend<br />
hohen Stand zu halten.<br />
In diesem Zusammenhang muss die Geme<strong>in</strong>de die für ihr Personal erforderlichen Maßnahmen und Beteiligungen<br />
durchführen, wenn wegen der Inanspruchnahme der Prüfer<strong>in</strong>nen und Prüfer personal- und dienstrechtlichen<br />
Vorschriften berührt werden. In diesem Zusammenhang müssen auch die Kosten <strong>in</strong> dem Umfange getragen<br />
werden, wie es zur Durchführung der abgegebenen Prüfungsaufgaben erforderlich ist bzw. Erstattungen für die<br />
übernommenen Prüfungsaufgaben geltend gemacht werden können.<br />
Unter diese Vorschrift fällt jedoch nicht die Heranziehung e<strong>in</strong>es Dritten als kompetenter Gesprächspartner, wenn<br />
bei der Durchführung e<strong>in</strong>er örtlichen Prüfung etwa Zweifelsfragen aufgetreten s<strong>in</strong>d, die es zu klären gilt, um Fehle<strong>in</strong>schätzungen<br />
bei der Prüfung vorzubeugen. Abhängig von der tatsächlichen E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung e<strong>in</strong>es Dritten s<strong>in</strong>d<br />
daher dessen Prüfungsbeteiligung und die Ergebnisse se<strong>in</strong>er Tätigkeit nachvollziehbar zu dokumentieren.<br />
5.2 Die Anwendung des Vergaberechts<br />
Die Tätigkeit e<strong>in</strong>es Dritten als Prüfer im Rahmen der örtlichen Rechnungsprüfung stellt für die Geme<strong>in</strong>de den<br />
E<strong>in</strong>kauf e<strong>in</strong>er Dienstleistung dar. Für e<strong>in</strong>e solche Dienstleistung ist der Wettbewerb offen, so dass e<strong>in</strong> entsprechender<br />
geme<strong>in</strong>dlicher (öffentlicher) Auftrag den vergaberechtlichen Bestimmungen unterliegt (vgl. § 25 GemH-<br />
VO <strong>NRW</strong>). Es ist dabei nicht als ausreichend anzusehen, den Prüfungsauftrag nur auf die e<strong>in</strong>gereichten Unterlagen<br />
abzustellen. Vielmehr muss deren Inhalt mit den haushaltsrechtlichen und örtlichen Prüfungsvorgaben abgeglichen<br />
werden, so dass ggf. auch der Umfang der durchzuführenden Prüfung eigenverantwortlich bestimmt wer-<br />
GEMEINDEORDNUNG 708
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 103 GO <strong>NRW</strong><br />
den muss. Das gesamte Verfahren, von der Auswahl e<strong>in</strong>es Dritten für die Tätigkeit als Prüfer für die örtliche<br />
Rechnungsprüfung der Geme<strong>in</strong>de bis Abschluss se<strong>in</strong>er Tätigkeit, ist zudem nachvollziehbar zu dokumentieren.<br />
Diese Pflicht gilt entsprechend, wenn der Rechnungsprüfungsausschuss unmittelbar e<strong>in</strong>en Dritten als Prüfer<br />
beauftragt hat (vgl. § 59 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong>). In diesem Zusammenhang ist bei der Auswahl von Dritten als Prüfer<br />
auch zu prüfen, ob ggf. Ausschlussgründe nach § 103 Abs. 7 GO <strong>NRW</strong> bestehen. Es kann daher im E<strong>in</strong>zelfall<br />
s<strong>in</strong>nvoll und sachgerecht se<strong>in</strong>, bereits vor der Beauftragung e<strong>in</strong>es vorgesehenen Prüfers sich von diesem e<strong>in</strong>e<br />
Erklärung darüber e<strong>in</strong>zuholen, ob und ggf. welche geschäftlichen, f<strong>in</strong>anziellen, persönlichen oder sonstigen Beziehungen<br />
zwischen ihm und der Geme<strong>in</strong>de bestehen.<br />
5.3 Fachliche Entscheidungen über die Beauftragung des Dritten<br />
5.3.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die ausdrückliche Regelung <strong>in</strong> dieser Vorschrift, dass sich die örtliche Rechnungsprüfung e<strong>in</strong>es Dritten als Prüfer<br />
bedienen kann, legt die fachliche Entscheidung über die Beauftragung des Dritten <strong>in</strong> die Hand der örtlichen<br />
Rechnungsprüfung. Die Auswahl des Dritten sowie se<strong>in</strong>e Beauftragung zur Durchführung von Prüfungsaufgaben<br />
der örtlichen Rechnungsprüfung fallen daher <strong>in</strong> die Zuständigkeit der örtlichen Rechnungsprüfung. Wird das für<br />
die Beauftragung notwendige Verwaltungsverfahren organisatorisch vom Bürgermeister im Rahmen der allgeme<strong>in</strong>en<br />
Verwaltung abgewickelt, bedarf es dabei des E<strong>in</strong>vernehmens mit der örtlichen Rechnungsprüfung.<br />
Die für die Beauftragung e<strong>in</strong>es Dritten ausdrücklich vorgesehene Zustimmung des Rechnungsprüfungsausschusses<br />
steht der fachlichen Entscheidungszuständigkeit der örtlichen Rechnungsprüfung nicht entgegen. Der Rechnungsprüfungsausschuss,<br />
der sich im Rahmen se<strong>in</strong>er Prüfungszuständigkeit (vgl. § 101 GO <strong>NRW</strong>) der örtlichen<br />
Rechnungsprüfung bedienen muss (vgl. § 59 Abs. 3 S. 2 GO <strong>NRW</strong>), soll jedoch bei der Beauftragung e<strong>in</strong>es Dritten<br />
mitwirken. Nur <strong>in</strong> den Fällen der unmittelbaren Beauftragung e<strong>in</strong>es Dritten durch den Rechnungsprüfungsausschuss<br />
selbst (vgl. § 59 Abs. 3 S. 3 i.V.m. § 103 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong>), obliegt dem Ausschuss sowohl die fachliche<br />
Entscheidung über die Beauftragung des Dritten als auch dessen Auswahl.<br />
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass <strong>in</strong> den Fällen, <strong>in</strong> denen bei der örtlichen Prüfung e<strong>in</strong> Bestätigungsvermerk<br />
oder e<strong>in</strong> Vermerk über se<strong>in</strong>e Versagung entsprechend der Prüfungsaufgaben nach § 103 Abs. 1<br />
Nrn. 1 bis 3 GO <strong>NRW</strong> abzugeben ist, die Pflicht dazu auch für den Dritten im Rahmen des übernommenen Prüfauftrages<br />
besteht. Außerdem s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> diesem Zusammenhang auch die Ausschlussgründe für Prüfer<strong>in</strong>nen und<br />
Prüfer nach § 103 Abs. 7 GO <strong>NRW</strong> und § 104 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong> zu beachten.<br />
5.3.2 Ausschluss oder Befangenheit des Prüfers<br />
Bei e<strong>in</strong>em Dritten als Prüfer können mögliche Ausschluss- oder Befangenheitsgründe bereits vor der Durchführung<br />
der örtlichen Prüfungsaufgabe, aber ggf. auch erst während oder nach se<strong>in</strong>er Prüfungstätigkeit auftreten<br />
oder bekannt werden. In solchen Fällen sollte auch der Rechnungsprüfungsausschuss unterrichtet werden, wenn<br />
die dafür entstandenen Gegebenheiten nicht unverzüglich beseitigt werden können. Die für den Prüfer geltenden<br />
persönlichen Ausschließungsgründe s<strong>in</strong>d an das Handelsrecht angelehnt worden und berücksichtigen die Besonderheiten<br />
des Geme<strong>in</strong>derechts. E<strong>in</strong> Dritter darf deshalb z.B.<br />
- als Mitglied des Rates der Geme<strong>in</strong>de,<br />
- als Angehöriger des Bürgermeisters oder des Kämmerers,<br />
- als Angehöriger des Verantwortlichen für die Zahlungsabwicklung oder se<strong>in</strong>es Stellvertreters,<br />
- als Beschäftigter der verselbstständigten Aufgabenbereiche der Geme<strong>in</strong>de,<br />
nicht als Prüfer tätig se<strong>in</strong>. Bei e<strong>in</strong>er Verwirklichung der <strong>in</strong> dieser Vorschrift aufgezählten Ausschlusstatbestände<br />
besteht für die betreffende Person e<strong>in</strong> Verbot, an der örtlichen Abschlussprüfung mitzuwirken. Außerdem soll<br />
GEMEINDEORDNUNG 709
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 103 GO <strong>NRW</strong><br />
durch e<strong>in</strong>e Selbstkontrolle des Prüfers gewährleistet werden, dass Sachverhalte nicht von denselben Personen<br />
geprüft werden, die selbst unmittelbar an der Entstehung beteiligt waren.<br />
5.3.3 Der Auftragsumfang des Prüfers<br />
Im Rahmen der fachlichen Entscheidung über die Beauftragung e<strong>in</strong>es Dritten als Abschlussprüfer s<strong>in</strong>d der Auftragsgegenstand<br />
sowie der Prüfungsumfang nachvollziehbar zu konkretisieren. Es ist dabei nicht als ausreichend<br />
anzusehen, nur auf die e<strong>in</strong>gereichten Prüfungsangebote abzustellen. Vielmehr ist deren Inhalt mit den haushaltsrechtlichen<br />
Prüfungsvorgaben abzugleichen und ggf. ist der Umfang der Jahresabschlussprüfung eigenverantwortlich<br />
festzulegen. Nicht nur <strong>in</strong> den Fällen e<strong>in</strong>er Beteiligung Dritter als Prüfer ist zu berücksichtigen, dass nicht<br />
alle<strong>in</strong> die Rechnungslegung der Gegenstand der Jahresabschlussprüfung ist. Vielmehr ist der geme<strong>in</strong>dliche Jahresabschluss<br />
ist dah<strong>in</strong>gehend zu prüfen, ob er e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,<br />
Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger<br />
Buchführung ergibt.<br />
Die Prüfung des Jahresabschlusses erstreckt sich dabei darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie<br />
ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden s<strong>in</strong>d. In e<strong>in</strong>e solche umfassende<br />
haushaltswirtschaftliche Prüfung s<strong>in</strong>d die Buchführung, die Inventur, das Inventar der Geme<strong>in</strong>de sowie<br />
die Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände e<strong>in</strong>zubeziehen. Dabei muss<br />
auch der geme<strong>in</strong>dliche Lagebericht berücksichtigt werden, denn er ist darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss<br />
der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang steht und ob se<strong>in</strong>e sonstigen Angaben nicht e<strong>in</strong>e falsche Vorstellung von der<br />
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de erwecken.<br />
Im Rahmen der Beauftragung e<strong>in</strong>es Dritten ist aber auch zu beachten, dass <strong>in</strong> den Fällen, <strong>in</strong> denen bei der örtlichen<br />
Prüfung e<strong>in</strong> Bestätigungsvermerk oder e<strong>in</strong> Vermerk über se<strong>in</strong>e Versagung entsprechend der Prüfungsaufgaben<br />
nach § 103 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 GO <strong>NRW</strong> abzugeben ist, die Pflicht dazu auch für den Dritten im Rahmen<br />
des übernommenen Prüfauftrages besteht. Außerdem s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> diesem Zusammenhang auch die Ausschlussgründe<br />
für Prüfer<strong>in</strong>nen und Prüfer nach § 103 Abs. 7 GO <strong>NRW</strong> und § 104 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong> zu beachten.<br />
5.4 Die Beauftragung der örtlichen Rechnungsprüfung e<strong>in</strong>er anderen Geme<strong>in</strong>de<br />
Wenn e<strong>in</strong>e Geme<strong>in</strong>de bei der Durchführung der Aufgaben ihrer örtlichen Rechnungsprüfung sich bei Bedarf e<strong>in</strong>es<br />
Dritten, z.B. der Prüfung der örtlichen Rechnungsprüfung e<strong>in</strong>er anderen Geme<strong>in</strong>de bedienen will, kann sie auf der<br />
Grundlage des § 103 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong> e<strong>in</strong>e entsprechende Vere<strong>in</strong>barung abschließen. Diese Vere<strong>in</strong>barung kann<br />
Aufgaben enthalten, die der Rat se<strong>in</strong>er örtlichen Rechnungsprüfung nach § 103 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> übertragen hat.<br />
Soweit e<strong>in</strong>e Vere<strong>in</strong>barung nach dieser Vorschrift als öffentlich-rechtliche Vere<strong>in</strong>barung ausgestaltet ist, stellt sie<br />
ke<strong>in</strong>e Vere<strong>in</strong>barung dar, die den Verfahrensvorschriften des Gesetzes über kommunale Geme<strong>in</strong>schaftsarbeit<br />
unterliegt. Dafür bedürfte es e<strong>in</strong>es ausdrücklichen Verweises auf dieses Gesetz. Die Vere<strong>in</strong>barung bedarf daher<br />
auch ke<strong>in</strong>er Genehmigung nach § 24 GkG.<br />
Die Übertragung von Prüfungsaufgaben auf e<strong>in</strong>e andere Geme<strong>in</strong>de kann <strong>in</strong> vollem Aufgabenumfang oder für<br />
Teilaufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung erfolgen. Zu beachten ist dabei, dass <strong>in</strong> den Fällen, <strong>in</strong> denen bei<br />
der Prüfung e<strong>in</strong> Bestätigungsvermerk oder e<strong>in</strong> Vermerk über se<strong>in</strong>e Versagung Aufgaben nach § 103 Abs. 1 Nrn.<br />
1 bis 3 GO <strong>NRW</strong> abzugeben ist, die Pflicht dazu auch für den Prüfer der anderen Geme<strong>in</strong>de im Rahmen des<br />
übernommenen Prüfauftrages besteht. Außerdem s<strong>in</strong>d auch die Ausschlussgründe für Prüfer<strong>in</strong>nen und Prüfer<br />
nach § 103 Abs. 7 GO <strong>NRW</strong> und § 104 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong> zu beachten, denn durch die Beauftragung hat die andere<br />
Geme<strong>in</strong>de die Stellung e<strong>in</strong>es Dritten im S<strong>in</strong>ne dieser Vorschrift <strong>in</strong>ne. Es kann daher im E<strong>in</strong>zelfall s<strong>in</strong>nvoll und<br />
sachgerecht se<strong>in</strong>, bereits vor der Beauftragung e<strong>in</strong>er anderen Geme<strong>in</strong>de sich von dieser e<strong>in</strong>e Erklärung darüber<br />
e<strong>in</strong>zuholen, ob und ggf. welche geschäftlichen, f<strong>in</strong>anziellen, persönlichen oder sonstigen Beziehungen zwischen<br />
GEMEINDEORDNUNG 710
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 103 GO <strong>NRW</strong><br />
den dann tätigen Prüfern und der Geme<strong>in</strong>de als Auftraggeber bestehen. Die Vere<strong>in</strong>barung über die Beauftrag der<br />
örtlichen Rechnungsprüfung e<strong>in</strong>er anderen Geme<strong>in</strong>de auf der Grundlage des § 103 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong> kann folgende<br />
beispielhafte Inhalte haben (vgl. Abbildung).<br />
Beauftragung der örtlichen Rechnungsprüfung e<strong>in</strong>er anderen Geme<strong>in</strong>de<br />
Präambel<br />
§ 1<br />
Vertragsgegenstand<br />
§ 2<br />
Art und Umfang<br />
der Zusammenarbeit<br />
§ 3<br />
Durchführung<br />
der Prüfaufgaben<br />
§ 4<br />
Personalmaßnahmen<br />
§ 5<br />
Kostenerstattung<br />
§ 6<br />
Übergangsfrist<br />
GEMEINDEORDNUNG 711<br />
Die Städte ... und ... streben e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>terkommunale Zusammenarbeit für ihre<br />
Aufgabenbereiche „Örtliche Rechnungsprüfung“ an. Dieses Vorhaben wird<br />
vom jeweiligen Rechnungsprüfungsausschuss mitgetragen. Die örtlichen<br />
Rechnungsprüfungen sollen sich bei ihrer Aufgabenerfüllung der Prüfer der<br />
jeweils anderen örtlichen Rechenprüfung als „Dritte“ im Rahmen der gesetzlichen<br />
Bestimmung bedienen können. Dabei wird die Nutzung von Synergieeffekten<br />
durch e<strong>in</strong>en stetigen Erfahrungsaustausch, die Entwicklung geme<strong>in</strong>samer<br />
Prüfstandards und –strategien sowie e<strong>in</strong>en möglichst flexiblen Mitarbeitere<strong>in</strong>satz<br />
im Rahmen der übernommenen Prüfungsaufgaben auf der Grundlage<br />
e<strong>in</strong>er abgestimmten Prüfungsplanung angestrebt. In diesem S<strong>in</strong>ne soll<br />
auch durch e<strong>in</strong>e umfassende Aufgabenkritik e<strong>in</strong>e Effizienzsteigerung erreicht<br />
werden.<br />
Die Städte ... und ... vere<strong>in</strong>baren, bei der Durchführung der Aufgaben ihrer<br />
örtlichen Rechnungsprüfung sich bei Bedarf der Prüfung der örtlichen Rechnungsprüfung<br />
des Vertragspartners nach § 103 Abs. 5 GO zu bedienen.<br />
Die jeweilige örtliche Rechnungsprüfung kann sich nach gegenseitiger Abstimmung<br />
der anderen örtlichen Rechnungsprüfung zur Durchführung der<br />
gesetzlich zugewiesenen Aufgaben nach § 103 Abs. 1 GO bedienen. Dies<br />
kann auch erfolgen, wenn der Rat e<strong>in</strong>er örtlichen Rechnungsprüfung weitere<br />
Aufgaben nach § 103 Abs. 2 GO übertragen hat. Die Übernahme der Prüfungsaufgaben<br />
kann nach geme<strong>in</strong>samer Abstimmung <strong>in</strong> vollem Aufgabenumfang<br />
oder für Teilaufgaben erfolgen. Soweit bei den Aufgaben nach § 103<br />
Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 e<strong>in</strong> Bestätigungsvermerk oder e<strong>in</strong> Vermerk über se<strong>in</strong>e<br />
Versagung abzugeben ist, obliegt diese Pflicht der örtlichen Rechnungsprüfung<br />
bzw. der jeweiligen Prüfer<strong>in</strong> oder dem jeweiligen Prüfer im Rahmen des<br />
übernommenen Prüfauftrages. Die Ausschlussgründe für Prüfer<strong>in</strong>nen und<br />
Prüfer nach § 103 Abs. 7 GO s<strong>in</strong>d zu beachten.<br />
Die Leiter der beiden örtlichen Rechnungsprüfungen verständigen sich jährlich<br />
untere<strong>in</strong>ander über die von der anderen örtlichen Rechnungsprüfung zu<br />
übernehmenden Aufgaben. Sie stimmen sich über die Durchführung der<br />
Prüfungen und die sonstige Art und Weise der Zusammenarbeit ab und sichern<br />
die Erledigung der übernommenen Prüfaufgaben. Die Leiter stellen für<br />
jedes Haushaltsjahr e<strong>in</strong>e Prüfungsplanung auf, <strong>in</strong> der die übernommenen<br />
Prüfaufgaben getrennt von den sonstigen jeweiligen örtlichen Prüfaufgaben<br />
auszuweisen s<strong>in</strong>d. Diese Prüfungsplanung ist dem jeweiligen Rechnungsprüfungsausschuss<br />
im Rahmen der Berichtspflicht nach § 7 zur Kenntnis zu<br />
geben.<br />
Soweit wegen der Inanspruchnahme der Prüfer<strong>in</strong>nen und Prüfer aus dieser<br />
Vere<strong>in</strong>barung personal- und dienstrechtlichen Vorschriften berührt werden,<br />
führt die jeweilige Stadt die daraus für ihr Personal erforderlichen Maßnahmen<br />
und Beteiligungen durch.<br />
E<strong>in</strong>e Kostenerstattung <strong>in</strong> Ausführung dieser Vere<strong>in</strong>barung f<strong>in</strong>det <strong>in</strong> dem Umfange<br />
statt, wie es zur Durchführung der vom Vertragspartner übernommenen<br />
Prüfungsaufgaben erforderlich ist. Für die Ermittlung der Kosten s<strong>in</strong>d jeweils<br />
die Grundlagen der prüfenden Stadt heranzuziehen.<br />
Es wird e<strong>in</strong>e Übergangsfrist vom 01.01.2006 bis zum 31.12.2007 vere<strong>in</strong>bart.<br />
Nach Abschluss der Prüfung des Jahresabschlusses des Haushaltsjahres<br />
2006 jeder Stadt, spätestens zum 30.09.2007, ist von der örtlichen Rechnungsprüfung<br />
ihrem Rechnungsprüfungsausschuss e<strong>in</strong> Erfahrungsbericht<br />
vorzulegen, der e<strong>in</strong>en Vorschlag die weitere Zusammenarbeit bzw. Übernah-
§ 7<br />
Zustimmung durch die<br />
Rechnungsprüfungsausschüsse<br />
§ 9<br />
Inkrafttreten / Kündigung<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 103 GO <strong>NRW</strong><br />
me von Prüfungsaufgaben enthalten soll.<br />
Jeder Vertragspartner verpflichtet sich, die für diese Vere<strong>in</strong>barung erforderliche<br />
Zustimmung ihres örtlichen Rechnungsprüfungsausschusses nach § 103<br />
Abs. 5 GO e<strong>in</strong>zuholen. Stimmt e<strong>in</strong>er dieser Ausschüsse der Vere<strong>in</strong>barung<br />
nicht zu, gilt die Vere<strong>in</strong>barung als nicht geschlossen. Wird die Zustimmung<br />
von e<strong>in</strong>em örtlichen Rechnungsprüfungsausschuss widerrufen, endet die<br />
Vere<strong>in</strong>barung am Ende des Haushaltjahres, <strong>in</strong> dem der Widerruf erfolgt.<br />
Soweit die Vere<strong>in</strong>barung über die <strong>in</strong> § 6 genannte Übergangsfrist h<strong>in</strong>aus<br />
fortgesetzt wird, ist dem jeweiligen Rechnungsprüfungsausschuss über Art<br />
und Umfang der Inanspruchnahme des Vertragspartners bei der örtlichen<br />
Prüfung jährlich für das abgelaufene Haushaltsjahr zu berichten. Dem Bericht<br />
ist e<strong>in</strong>e Übersicht über die tatsächlich durchgeführten Prüfungen und die<br />
Abweichungen von der Planung der übernommenen Aufgaben beizufügen.<br />
Diese Vere<strong>in</strong>barung tritt nach Zustimmung aller zustimmungspflichtigen Gremien,<br />
frühesten jedoch am 01.01.2006 <strong>in</strong> Kraft. Sie wird bis zum 31.12.2010<br />
abgeschlossen und ist auf der Grundlage e<strong>in</strong>es entsprechenden Beschlusses<br />
des Rechnungsprüfungsausschusses bis zum 30.06. e<strong>in</strong>es jeden Jahres mit<br />
Wirkung zum 01.01. des folgenden Kalenderjahres kündbar. Darüber h<strong>in</strong>aus<br />
ist die Vere<strong>in</strong>barung <strong>in</strong>nerhalb der Übergangsfrist unter Ausschluss hieraus<br />
resultierender Ansprüche jederzeit e<strong>in</strong>seitig kündbar. Wird die Vere<strong>in</strong>barung<br />
nicht gekündigt und bleibt die gesetzliche Vorschrift des § 103 Abs. 5 GO<br />
unverändert, so verlängert sich die Vere<strong>in</strong>barung jeweils um e<strong>in</strong> Kalenderjahr.<br />
Abbildung 144 „Beauftragung der örtlichen Rechnungsprüfung e<strong>in</strong>er anderen Geme<strong>in</strong>de“<br />
Mögliche Ausschluss- oder Befangenheitsgründe der Prüfer können aber auch erst während der Prüfungstätigkeit<br />
auftreten. In solchen Fällen sollte ggf. auch der Rechnungsprüfungsausschuss unterrichtet werden, wenn die<br />
dafür entstandenen Gegebenheiten nicht unverzüglich beseitigt werden können. Soweit wegen der Inanspruchnahme<br />
der Prüfer<strong>in</strong>nen und Prüfer personal- und dienstrechtlichen Vorschriften berührt werden, muss die Geme<strong>in</strong>de<br />
die daraus für ihr Personal erforderlichen Maßnahmen und Beteiligungen durchführen. In diesem Zusammenhang<br />
müssen auch die Kosten <strong>in</strong> dem Umfange getragen werden, wie es zur Durchführung der abgegebenen<br />
Prüfungsaufgaben erforderlich ist bzw. Erstattungen für die übernommenen Prüfungsaufgaben geltend<br />
gemacht werden können.<br />
5.5 Die Beteiligung des Rechnungsprüfungsausschusses bei der Beauftragung<br />
Die Beauftragung Dritter nach dieser Vorschrift bed<strong>in</strong>gt, dass bei der Gestaltung entsprechender Verträge auch<br />
die Rechte des Rechnungsprüfungsausschusses der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> das Vertragswerk e<strong>in</strong>fließen müssen, denn er<br />
ist zu m<strong>in</strong>destens h<strong>in</strong>sichtlich der Eröffnungsbilanz, der Jahresabschlüsse und der Gesamtabschlüsse die zuständige<br />
Prüfungs<strong>in</strong>stanz. Es ist deshalb geboten, bei e<strong>in</strong>er über den E<strong>in</strong>zelfall h<strong>in</strong>ausgehenden umfangreichen<br />
Zusammenarbeit der örtlichen Rechnungsprüfung mit Dritten e<strong>in</strong>ige Kriterien zu beachten. Wenn sich die örtliche<br />
Rechnungsprüfung langfristig b<strong>in</strong>den will, s<strong>in</strong>d neben dem Inkrafttreten der Vere<strong>in</strong>barung, die befristete Laufzeit<br />
die Kündigungsmodalitäten, aber auch örtliche Besonderheiten sowie die Beteiligung des Rechnungsprüfungsausschusses<br />
festzulegen.<br />
In jedem Fall ist es bei e<strong>in</strong>er Beauftragung Dritter bzw. der Abgabe von Prüfungsaufgaben erforderlich, die Zustimmung<br />
des Rechnungsprüfungsausschusses nach § 103 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong> e<strong>in</strong>zuholen. Stimmt der Ausschuss<br />
nicht zu, kann der Auftrag, der ggf. auch ausschreibungspflichtig se<strong>in</strong> kann, weil e<strong>in</strong>e Dienstleistung von Dritten<br />
e<strong>in</strong>gekauft wird, nicht vergeben werden. Auch steht dem Rechnungsprüfungsausschuss das Recht zu, se<strong>in</strong>e<br />
erteilte Zustimmung zu widerrufen. Bei e<strong>in</strong>er mehrjährigen Vere<strong>in</strong>barung über die Aufgabe „Rechnungsprüfung“<br />
zwischen e<strong>in</strong>zelnen Geme<strong>in</strong>den soll zwischen den Vertragspartnern e<strong>in</strong>e jährliche Absprache über die übertragenen<br />
bzw. übernommenen Prüfungsaufgaben erfolgen.<br />
GEMEINDEORDNUNG 712
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 103 GO <strong>NRW</strong><br />
E<strong>in</strong>e Unterrichtung des jeweiligen Rechnungsprüfungsausschusses über Art und Umfang der Inanspruchnahme<br />
des Vertragspartners ist sachgerecht. E<strong>in</strong>e solche Abstimmung über die Durchführung der abgegebenen bzw. der<br />
übernommenen Prüfaufgaben schafft <strong>in</strong> der Prüfungsplanung e<strong>in</strong>e Übersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit auch<br />
über die sonstigen noch bestehenden eigenen örtlichen Prüfaufgaben. In diesem Zusammenhang ist auch die<br />
Information des Rechnungsprüfungsausschusses über die tatsächlichen Prüfungstätigkeiten für Dritte notwendig.<br />
5.6 Ke<strong>in</strong> Verzicht auf Verantwortlichkeiten<br />
In den Fällen, <strong>in</strong> denen sich die örtliche Rechnungsprüfung mit Zustimmung des Rechnungsprüfungsausschusses<br />
Dritter als Prüfer bedient, trägt die örtliche Rechnungsprüfung weiterh<strong>in</strong> die Gesamtverantwortung für die Durchführung<br />
bzw. die ordnungsgemäße Erledigung der übertragenen Aufgabe. Der Dritte wird unabhängig von der<br />
örtlichen Gestaltung der vertraglichen Übertragung regelmäßig nur als Erfüllungsgehilfe der Geme<strong>in</strong>de tätig. Die<br />
örtliche Rechnungsprüfung kann sich daher durch die Übertragung der Abschlussprüfung (ganz oder teilweise)<br />
auf e<strong>in</strong>en Dritten nicht aus ihrer Verantwortung für die Jahresabschlussprüfung selbst entlassen. Sie muss weiterh<strong>in</strong><br />
sicherstellen, dass ihr alle notwendigen Prüfungsdaten und Prüfungsergebnisse rechtzeitig zur Verfügung<br />
stehen, um ihrer gesetzlichen Prüfungspflicht rechtzeitig bis zur Feststellung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses<br />
(31. Dezember) nachkommen zu können.<br />
Der Erhalt der Verantwortlichkeiten wird auch dadurch deutlich, dass e<strong>in</strong> Dritter als Abschlussprüfer (vgl. Aufgaben<br />
nach § 103 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 GO <strong>NRW</strong>) im Rahmen se<strong>in</strong>er Prüfung e<strong>in</strong>en Bestätigungsvermerk oder e<strong>in</strong>en<br />
Vermerk über se<strong>in</strong>e Versagung nach § 101 Abs. 3 bis 7 GO <strong>NRW</strong> abzugeben hat. Dem Rechnungsprüfungsausschuss<br />
der Geme<strong>in</strong>de müssen im Rahmen der geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlussprüfung nicht alle erstellten auftragsbezogenen<br />
Bestätigungsvermerke der beteiligten Dritten vorgelegt werden. Es ist vielmehr ausreichend,<br />
wenn die für die örtliche Rechnungsprüfung als letzte für die Durchführung der Abschlussprüfung verantwortliche<br />
Stelle (vor dem Rechnungsprüfungsausschuss) e<strong>in</strong>en auf ihr Prüfungsergebnis bezogenen Bestätigungsvermerk<br />
verfasst und diesen dem Rechnungsprüfungsausschuss vorgelegt<br />
Der Rechnungsprüfungsausschuss, der die Gesamtverantwortung für die ordnungsgemäße Prüfung des Jahresabschlusses<br />
gegenüber dem Rat der Geme<strong>in</strong>de trägt, hat deshalb e<strong>in</strong>en eigenen Bestätigungsvermerk zu verfassen.<br />
In diesem Bestätigungsvermerk s<strong>in</strong>d aber die Prüfungsergebnisse bzw. Bestätigungsvermerke der an der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlussprüfung beteiligten anderen Abschlussprüfer zu berücksichtigen. In E<strong>in</strong>zelfällen<br />
kann es s<strong>in</strong>nvoll se<strong>in</strong>, auf auftragsbezogene Bestätigungsvermerke zu verweisen und diese dann auch dem eigenen<br />
Bestätigungsvermerk beizufügen.<br />
Dem Rechnungsprüfungsausschuss steht <strong>in</strong> diesem Verfahren das Recht zu, beim Auftreten von Mängeln oder<br />
wenn er aus sonstigen Gründen das <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Bestätigungsvermerk verankerte Prüfungsergebnis nicht mitgetragen<br />
kann, <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Bestätigungsvermerk das aus se<strong>in</strong>er Sicht zutreffende Ergebnis darzustellen. E<strong>in</strong> Recht der<br />
vorher Beteiligten sich dazu zu äußern, steht diesem im Rahmen der Beratungen über die Feststellung des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Jahresabschlusses nur dann zu, wenn diese gesondert im Rahmen der Tätigkeit des Rates der Geme<strong>in</strong>de<br />
vorgesehen ist.<br />
6. Zu Absatz 6 (Bestätigungsvermerk und Abschlussprüfung):<br />
6.1 Die Pflichten der Abschlussprüfer<br />
Die Vorschrift, dass die Prüfer bei der Durchführung von Prüfungsaufgaben, die <strong>in</strong> § 103 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 GO<br />
<strong>NRW</strong> bestimmt s<strong>in</strong>d, e<strong>in</strong>en Bestätigungsvermerk oder e<strong>in</strong>en Vermerk über se<strong>in</strong>e Versagung nach § 101 Abs. 3<br />
bis 7 GO <strong>NRW</strong> abzugeben haben, dient der Klarstellung. Sie betrifft z.B. die Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung<br />
oder beauftragte Dritte als Prüfer, die bei geme<strong>in</strong>dlichen Abschlüssen als Abschlussprüfer tätig s<strong>in</strong>d.<br />
GEMEINDEORDNUNG 713
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 103 GO <strong>NRW</strong><br />
6.2 Der Verweis auf § 103 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 GO <strong>NRW</strong><br />
6.2.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die <strong>in</strong> dieser Vorschrift aufgezählten Prüfungsaufgaben stellen abgegrenzte und eigenständige Sachverhalte dar,<br />
die zum Aufgabenkatalog der örtlichen Rechnungsprüfung gehören. Dazu werden die Prüfung des Jahresabschlusses<br />
der Geme<strong>in</strong>de, die Prüfung der Jahresabschlüsse der <strong>in</strong> § 97 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 4 benannten Sondervermögen<br />
und die Prüfung des Gesamtabschlusses der Geme<strong>in</strong>de als wichtigste Aufgaben der örtlichen<br />
Rechnungsprüfung ausdrücklich benannt.<br />
6.2.2 Der Umfang der Jahresabschlussprüfung<br />
Die Jahresabschlussprüfung schließt neben den Bestandteilen des Jahresabschlusses und se<strong>in</strong>en Anlagen auch<br />
die zu Grunde liegende Buchführung e<strong>in</strong>. Diese hat dazu beizutragen, dass der Jahresabschluss e<strong>in</strong> den tatsächlichen<br />
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de<br />
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelt. Die geme<strong>in</strong>dliche Buchführung muss<br />
deshalb den <strong>in</strong> mehreren Vorschriften bestimmten Anforderungen entsprechen. Werden die Anforderungen von<br />
der Geme<strong>in</strong>de erfüllt, kann der Jahresabschluss der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> der vorgeschriebenen Form aufgestellt werden,<br />
die vorgesehenen Angaben und die zutreffenden Ansätze für die geme<strong>in</strong>dlichen Vermögensgegenstände und<br />
Schulden enthalten.<br />
In der Vorschrift wird deshalb ausdrücklich bestimmt, dass <strong>in</strong> die Prüfung die Buchführung, die Inventur, das Inventar<br />
und die Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände e<strong>in</strong>zubeziehen<br />
s<strong>in</strong>d. Die Prüfung der Beachtung der gesetzlichen haushaltsrechtlichen Vorschriften, der Regelungen der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltssatzung sowie ergänzender Satzungen, aber auch weiterer ortsrechtlicher Bestimmungen<br />
ist ebenfalls e<strong>in</strong> wichtiger Gegenstand der Jahresabschlussprüfung.<br />
In diesem Zusammenhang ist zudem zu prüfen, ob muss der geme<strong>in</strong>dliche Lagebericht mit dem Jahresabschluss<br />
und den Erkenntnissen des Prüfers <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang steht. Die Angaben im Lagebericht der Geme<strong>in</strong>de dürfen ke<strong>in</strong>e<br />
falsche Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de bei den Adressaten<br />
des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses erwecken. Außerdem muss im geme<strong>in</strong>dlichen Lagebericht auch e<strong>in</strong>e ausreichende<br />
Auskunft zu den künftigen Chancen und Risiken der Geme<strong>in</strong>de gegeben werden.<br />
6.2.3 Die Jahresabschlüsse der Sondervermögen<br />
Die Jahresabschlüsse der <strong>in</strong> § 97 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 4 GO <strong>NRW</strong> benannten Sondervermögen s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>e Pflichtaufgabe<br />
der örtlichen Rechnungsprüfung. Zu diesen Sondervermögen der Geme<strong>in</strong>de gehören das Geme<strong>in</strong>degliedervermögen,<br />
das Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen und die rechtlich unselbstständigen<br />
Versorgungs- und Versicherungse<strong>in</strong>richtungen. Die örtliche Rechnungsprüfung hat bei diesen Sondervermögen<br />
zu prüfen, <strong>in</strong>wieweit die Zwecke dieser Sondervermögen durch die Geme<strong>in</strong>de erfüllt wurden. Für die<br />
Jahresabschlussprüfung der wirtschaftlichen Unternehmen (§ 114 GO <strong>NRW</strong>) und organisatorisch verselbstständigte<br />
E<strong>in</strong>richtungen (§ 107 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>) ohne eigene Rechtspersönlichkeit als geme<strong>in</strong>dliche Betriebe (vgl. §<br />
97 Abs. 1 Nr. 3 GO <strong>NRW</strong>) wurden jedoch Sonderregelungen getroffen, so dass deren Jahresabschlussprüfung<br />
nicht der örtlichen Rechnungsprüfung obliegt (vgl. § 106 GO <strong>NRW</strong>).<br />
Nach dieser Vorschrift obliegt der Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt die Jahresabschlussprüfung, die sich dazu e<strong>in</strong>es<br />
Wirtschaftsprüfers, e<strong>in</strong>er Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder <strong>in</strong> E<strong>in</strong>zelfällen e<strong>in</strong>es hierzu befähigten eigenen<br />
Prüfers bedient. Die Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt hat dazu das Prüfungsergebnis <strong>in</strong> Form des Prüfungsberichts der<br />
betroffenen Geme<strong>in</strong>de mitzuteilen. Wenn Veranlassung dazu besteht oder auf Anforderung, teilt die Geme<strong>in</strong>de-<br />
GEMEINDEORDNUNG 714
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 103 GO <strong>NRW</strong><br />
prüfungsanstalt das Prüfungsergebnis den Kommunal- und den Fachaufsichtsbehörden mit. Diese Regelungen<br />
gelten entsprechend auch für E<strong>in</strong>richtungen, die gemäß § 107 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> entsprechend den Vorschriften<br />
über das Rechnungswesen der Eigenbetriebe geführt werden.<br />
6.2.4 Der Umfang der Gesamtabschlussprüfung<br />
Die Gesamtabschlussprüfung schließt neben den Bestandteilen des Gesamtabschlusses und se<strong>in</strong>en Anlagen<br />
auch die die Prüfung der Beachtung der dafür geltenden haushaltsrechtlichen Vorschriften sowie ergänzender<br />
Bestimmungen von Gesellschaftsverträgen und geme<strong>in</strong>dlichen Satzungen e<strong>in</strong>, denn der Gesamtabschluss muss<br />
e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzgesamtlage<br />
der Geme<strong>in</strong>de unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermitteln. Zu den<br />
Prüfungsgegenständen gehört e<strong>in</strong>e Vielzahl von geme<strong>in</strong>dlichen Sachverhalten, die hier nicht im E<strong>in</strong>zelnen aufgeführt<br />
werden können. Beispielhaft können benannt werden: Der Konsolidierungskreis mit den geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Betrieben, die zum Vollkonsolidierungskreis zählen und denen, die nach der Equity-Methode konsolidiert werden.<br />
Auch die Festlegungen der geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe, denen im H<strong>in</strong>blick auf den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss<br />
e<strong>in</strong>e untergeordnete Bedeutung zukommt, s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong> Prüfungsgegenstand.<br />
Die Gesamtabschlussprüfung umfasst auch die Durchführung der Vollkonsolidierung sowie der Equity-<br />
Konsolidierung. Zu prüfen ist aber auch, ob der Gesamtlagebericht mit dem Gesamtabschluss und den Erkenntnissen<br />
des Prüfers <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang steht. Die Angaben im Gesamtlagebericht dürfen nicht e<strong>in</strong>e falsche Vorstellung<br />
von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzgesamtlage der Geme<strong>in</strong>de erwecken. Mit diesem Bericht<br />
müssen auch aussagekräftige Auskünfte zu den künftigen Chancen und Risiken der Geme<strong>in</strong>de gegeben werden.<br />
Die Prüfung von Zwischenabschlüssen gehört auch zu den Aufgaben, denn im geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss<br />
soll die wirtschaftliche Gesamtlage der Geme<strong>in</strong>de zum Abschlussstichtag gezeigt und die Geme<strong>in</strong>de mit ihren<br />
Betrieben so dargestellt werden, als ob sie e<strong>in</strong>e Gesamtheit darstellt. Um dieses zu erreichen, sollen geme<strong>in</strong>dliche<br />
Betriebe, die e<strong>in</strong> vom Kalenderjahr abweichendes Geschäftsjahr haben, durch e<strong>in</strong>en Zwischenabschluss <strong>in</strong><br />
den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss e<strong>in</strong>bezogen werden. Damit werden die für die E<strong>in</strong>beziehung <strong>in</strong> den geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Gesamtabschluss notwendige Übere<strong>in</strong>stimmung geschaffen. Ebenso gehört die Prüfung der Entbehrlichkeit<br />
des Gesamtabschlusses zu den Prüfungsaufgaben für den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss.<br />
Die Vorschrift des § 116 GO <strong>NRW</strong> enthält ke<strong>in</strong>e gesonderte Ausnahmeregelung, die es ermöglicht, dass die Geme<strong>in</strong>de<br />
generell von der Aufstellung e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses befreit ist. Bei e<strong>in</strong>zelnen Geme<strong>in</strong>den<br />
können besondere Fallgestaltungen im Rahmen ihrer Beteiligungen vorliegen, die dazu führen, dass für die<br />
Geme<strong>in</strong>de die Aufstellung e<strong>in</strong>es Gesamtabschlusses entbehrlich wird. E<strong>in</strong> solcher Sachverhalt liegt z.B. vor,<br />
wenn die Geme<strong>in</strong>de über ke<strong>in</strong>en voll zu konsolidieren Betrieb verfügt, denn dann liegt die wichtigste Voraussetzung<br />
für e<strong>in</strong>en geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss, dass e<strong>in</strong> Mutter-Tochter-Verhältnis zwischen der Kernverwaltung<br />
der Geme<strong>in</strong>de und e<strong>in</strong>em ihrer Betriebe besteht, nicht vor.<br />
6.3 Der Verweis auf § 101 Abs. 3 bis 7 GO <strong>NRW</strong><br />
Durch Verweis auf § 101 Abs. 3 bis 7 GO <strong>NRW</strong> werden die Verpflichtungen des Abschlussprüfers ausdrücklich<br />
klargestellt. Sie s<strong>in</strong>d wegen des erweiterten Prüfungsgegenstandes und Prüfungsumfanges im Rahmen der Abschlussprüfungen<br />
sowie wegen der gewachsenen Bedeutung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses und des<br />
Gesamtabschlusses der Geme<strong>in</strong>de im Gefüge des geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsrechts geboten. Auch wenn mehrere<br />
Beteiligte an e<strong>in</strong>er Abschlussprüfung mitgewirkt haben, hat der Rechnungsprüfungsausschuss das Prüfungsergebnis<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em eigenen Bestätigungsvermerk zusammen zu fassen (vgl. § 101 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong>). Der Rechnungsprüfungsausschuss<br />
kann dabei auf den Bestätigungsvermerk aufbauen, den die Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung<br />
oder Dritte als Prüfer im Rahmen ihres Prüfungsauftrages und ihrer vorzunehmenden Beurteilung<br />
GEMEINDEORDNUNG 715
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 103 GO <strong>NRW</strong><br />
abzugeben haben. Bedient sich wiederum die örtliche Rechnungsprüfung e<strong>in</strong>es Dritten nach § 103 Abs. 5 GO<br />
<strong>NRW</strong> muss dieser den vorzulegenden Prüfungsbericht mit e<strong>in</strong>em der Prüfungsaufgabe entsprechenden Bestätigungsvermerk<br />
mit Angabe des Datums unterzeichnen.<br />
In diesen Fällen muss die örtliche Rechnungsprüfung ke<strong>in</strong>e nochmalige Prüfung durchführen, sondern nur im<br />
Rahmen ihres eigenen Bestätigungsvermerks beurteilen, ob das Prüfungsergebnis übernommen werden kann.<br />
E<strong>in</strong>e solche Überprüfung durch die örtliche Rechnungsprüfung muss aus dem Bestätigungsvermerk unter Angabe<br />
des mit der Durchführung der Jahresabschlussprüfung beauftragten Prüfers ersichtlich se<strong>in</strong>. Die örtliche Rechnungsprüfung<br />
kann auf Grund ihrer Prüfung e<strong>in</strong>en eigenen Bestätigungsvermerk erstellen. Sie kann aber auch<br />
den Bestätigungsvermerk des Dritten vollständig übernehmen, muss dies dann aber durch e<strong>in</strong>e entsprechende<br />
Ergänzung klarstellen.<br />
Weitere Ergänzungen s<strong>in</strong>d möglich, wenn durch die zusätzlichen Bemerkungen das Prüfungsergebnis nachvollziehbarer<br />
wird. Der „abschließende“ Bestätigungsvermerk der örtlichen Rechnungsprüfung ist mit dem Prüfungsbericht<br />
zu verb<strong>in</strong>den und dem Rechnungsprüfungsausschuss zur weiteren Prüfung vorzulegen. Bedient sich der<br />
Rechnungsprüfungsausschuss der örtlichen Rechungsprüfung, ist es ausreichend, wenn gegenüber dem Rechnungsprüfungsausschuss<br />
die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung den Bestätigungsvermerk mit Angabe des<br />
Datums unterzeichnet.<br />
7. Zu Absatz 7 (Unabhängigkeit des Dritten als Prüfer):<br />
7.1 Zu Satz 1 (Ausschlussgründe):<br />
7.1.1 Inhalte der Vorschrift<br />
E<strong>in</strong> Prüfer ist nach der Vorschrift grundsätzlich von der örtlichen Prüfung ausgeschlossen, wenn Gründe, <strong>in</strong>sbesondere<br />
Beziehungen geschäftlicher, f<strong>in</strong>anzieller oder persönlicher Art, vorliegen, nach denen die Besorgnis der<br />
Befangenheit besteht. Bei e<strong>in</strong>er Verwirklichung der aufgezählten Ausschlusstatbestände besteht für die betreffende<br />
Person e<strong>in</strong> Verbot, an der Abschlussprüfung mitzuwirken. Die Regelung dient dazu, die Unabhängigkeit der<br />
verantwortlich zeichnenden Prüfer zu gewährleisten und typische Interessenkonflikte im Zusammenhang mit der<br />
Prüfungstätigkeit auszuschließen. Damit soll erreicht werden, dass das Prüferurteil frei von unsachgemäßen<br />
Erwägungen gebildet werden kann und die unbefangene Urteilsfähigkeit des Prüfers nicht durch f<strong>in</strong>anzielle Interessen<br />
bee<strong>in</strong>trächtigt wird. Die persönlichen Ausschließungsgründe bei e<strong>in</strong>em Dritten als Prüfer für die Geme<strong>in</strong>de<br />
lehnen sich an das Handelsrecht an und berücksichtigen die Besonderheiten des Geme<strong>in</strong>derechts (vgl. Abbildung).<br />
E<strong>in</strong> Dritter darf z.B. ke<strong>in</strong> Prüfer se<strong>in</strong>,<br />
- als Mitglied des Rates der Geme<strong>in</strong>de<br />
Ausschluss und Befangenheit des Prüfers<br />
- als Angehöriger des Bürgermeisters oder des Kämmerers<br />
- als Angehöriger des Verantwortlichen für die Zahlungsabwicklung oder se<strong>in</strong>es Stellvertreters<br />
- als Beschäftigter der Betriebe der Geme<strong>in</strong>de (verselbstständigte Aufgabenbereiche)<br />
GEMEINDEORDNUNG 716
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 103 GO <strong>NRW</strong><br />
- wenn er im Haushaltsjahr bei Führung der Bücher der Geme<strong>in</strong>de oder bei der Aufstellung des<br />
Jahresabschlusses mitgewirkt hat<br />
- wenn er im Haushaltsjahr F<strong>in</strong>anzdienstleistungen oder Steuerberatungsleistungen für die Geme<strong>in</strong>de<br />
erbracht oder e<strong>in</strong>e Rechtsberatung außerhalb der Prüfungstätigkeit durchgeführt hat<br />
- wenn er im Haushaltsjahr Bewertungsleistungen für die Geme<strong>in</strong>de erbracht hat, die sich auf den<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss auswirken<br />
- wenn er an der Entwicklung, E<strong>in</strong>richtung und E<strong>in</strong>führung von Rechnungslegungs<strong>in</strong>formationssystemen<br />
der Geme<strong>in</strong>de beteiligt war (Verfahren der Verarbeitung von Geschäftsvorfällen)<br />
Abbildung 145 „Ausschluss und Befangenheit des Prüfers“<br />
Von der Geme<strong>in</strong>de ist <strong>in</strong> diesem Zusammenhang noch zu berücksichtigen, dass das Verbot, als Prüfer nicht Mitglied<br />
des Rates, Angehöriger des Bürgermeisters, des Kämmerers oder des Verantwortlichen für die Zahlungsabwicklung<br />
oder se<strong>in</strong>es Stellvertreters se<strong>in</strong> zu dürfen, nicht nur bei e<strong>in</strong>er Verb<strong>in</strong>dung durch e<strong>in</strong>e Ehe gilt, sondern<br />
auch bei denjenigen Personen Anwendung f<strong>in</strong>det, die durch e<strong>in</strong>e Lebenspartnerschaft nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz<br />
verbunden s<strong>in</strong>d. Durch diese Erweiterung wird den Regelungen des Gesetzes über die E<strong>in</strong>getragene<br />
Lebenspartnerschaft (Lebenspartnerschaftsgesetz - LPartG) vom 16. Februar 2001 (BGBl. I S. 266) Rechnung<br />
getragen. Das Verbot soll <strong>in</strong>sgesamt gesehen mögliche Interessenkonflikte durch persönliche B<strong>in</strong>dungen<br />
von vornhere<strong>in</strong> ausschließen und die persönliche Unabhängigkeit des Dritten als Prüfer gewährleisten.<br />
Die Vorgabe steht zudem mit § 31 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong> <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung, denn durch diese Vorschrift wird bestimmt,<br />
welche verwandtschaftlichen Verhältnisse unter dem Begriff „Angehöriger“ im S<strong>in</strong>ne der Geme<strong>in</strong>deordnung zu<br />
subsumieren s<strong>in</strong>d. Es bietet sich deshalb an, vor der Auftragsvergabe an e<strong>in</strong>en Dritten als Prüfer, spätestens aber<br />
vor Beg<strong>in</strong>n der Prüfungsarbeiten, von e<strong>in</strong>em Dritten als Abschlussprüfer e<strong>in</strong>e Unabhängigkeitserklärung zu verlangen<br />
und dafür auch entsprechende vertragliche Vere<strong>in</strong>barungen zu treffen. Dieses ist im Rahmen der Beauftragung<br />
des Dritten als Prüfer zu dokumentieren. Durch e<strong>in</strong>e Selbstkontrolle soll außerdem gesichert werden,<br />
dass Sachverhalte nicht von denselben Personen geprüft werden, die selbst unmittelbar an der Entstehung beteiligt<br />
waren.<br />
7.1.2 Das Selbstprüfungsverbot für Prüfer<br />
Die Zurückhaltung der verantwortlich zeichnenden Prüfer ist notwendig, um ihre Unabhängigkeit zu wahren und<br />
sie nicht zu Prüfern für eigene Sachentscheidungen zu machen. So sollen Prüfer nicht Mitglieder von Entscheidungsgremien<br />
se<strong>in</strong>, <strong>in</strong> denen die Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden festgelegt werden. Auch sollen Prüfer<br />
im Rahmen ihrer beratenden Begleitung, z.B. im Rahmen der Aufstellung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses,<br />
ke<strong>in</strong>e Entscheidungsvorlagen erarbeiten oder dieses mit unterzeichnen. Ob e<strong>in</strong>e Tätigkeit des Prüfers über e<strong>in</strong>e<br />
Prüfungstätigkeit h<strong>in</strong>ausgeht und diese Tätigkeit nicht nur von untergeordneter Bedeutung ist, so dass e<strong>in</strong> Fall<br />
e<strong>in</strong>es Selbstprüfungsverbots gegeben ist, kann nur im E<strong>in</strong>zelfall unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten<br />
beurteilt werden.<br />
Der Abschlussprüfer soll daher se<strong>in</strong>e Maßnahmen zur Prüfung se<strong>in</strong>er Unabhängigkeit für die Dauer der Abschlussprüfung<br />
und die se<strong>in</strong>e Unabhängigkeit gefährdenden Umstände sowie die von ihm ergriffenen Schutzmaßnahmen<br />
dokumentieren und dazu im von ihm zu erstellenden Prüfungsbericht Angaben machen. Er braucht<br />
dabei nicht die von ihm durchgeführten Maßnahmen im E<strong>in</strong>zelnen anzugeben. Vielmehr ist es als ausreichend<br />
anzusehen, wenn er im Prüfungsbericht bestätigt, dass er die auf die Unabhängigkeit anwendbaren Regelungen<br />
beachtet hat. E<strong>in</strong> solcher Fall entsteht außerdem nicht alle<strong>in</strong> im Zeitablauf, <strong>in</strong> dem durch e<strong>in</strong>e Vielzahl von gezeichneten<br />
Bestätigungsvermerken e<strong>in</strong> Selbstprüfungsverbot hervorgerufen werden könnte.<br />
GEMEINDEORDNUNG 717
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 103 GO <strong>NRW</strong><br />
Die Vorschrift enthält dazu ke<strong>in</strong>e Vorgabe, e<strong>in</strong>en regelmäßigen Austausch des verantwortlich zeichnenden Prüfers<br />
vorzunehmen. Daher dürfen auch Dritte als Prüfer längerfristig beschäftigt werden, so lange ke<strong>in</strong>e sonstigen<br />
Ausschlussgründe bestehen. Im der Privatwirtschaft ist durch das BilMoG e<strong>in</strong>e Änderung des HGB dah<strong>in</strong>gehend<br />
vorgenommen worden, dass e<strong>in</strong> Abschlussprüfer von der Prüfung ausgeschlossen ist, wenn er für die Abschlussprüfung<br />
bereits <strong>in</strong> sieben oder mehr Fällen verantwortlich war (vgl. § 319a Abs. 1 Nr. 4 HGB). Dieses gilt jedoch<br />
nicht, wenn seit der letzten Beteiligung des Prüfers an der Abschlussprüfung drei oder mehr Jahre vergangen<br />
s<strong>in</strong>d.<br />
Als verantwortlicher Prüfungspartner gilt dabei für den Konzernabschluss auch, wer als Wirtschaftsprüfer auf der<br />
Ebene bedeutender Tochterunternehmen als für die Durchführung von deren Abschlussprüfung vorrangig verantwortlich<br />
bestimmt worden ist. F<strong>in</strong>det e<strong>in</strong> Wechsel des Abschlussprüfers statt, sollte der bisherige Abschlussprüfer<br />
dem neuen Abschlussprüfer über das Ergebnis der bisherigen Prüfungen berichten. Das Selbstprüfungsverbot<br />
gilt aber auch für Prüfer der Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt, wenn diese im Wege der Beauftragung die Aufgaben<br />
der örtlichen Rechnungsprüfung erledigen, z.B. die Prüfung der Eröffnungsbilanz (vgl. § 105 Abs. 8 GO<br />
<strong>NRW</strong>). E<strong>in</strong>e Mitwirkung des gleichen Prüfers bei der überörtlichen Prüfung des gleichen Prüfungsgegenstandes<br />
ist dann nicht zulässig (vgl. § 105 Abs. 8 GO <strong>NRW</strong>).<br />
7.1.3 Zusammenschlüsse von Wirtschaftsprüfern<br />
Das Selbstprüfungsverbot als Unabhängigkeitsverständnis wirkt sich auch auf Zusammenschlüsse von Wirtschaftprüfern<br />
aus, z.B. bei Bürogeme<strong>in</strong>schaften, Kooperationen und Netzwerken, wenn der e<strong>in</strong>zelne Prüfer auf<br />
das Ergebnis der durchzuführenden Abschlussprüfung E<strong>in</strong>fluss nehmen kann. In diesem Zusammenhang ist<br />
immer die Frage zu klären, ob der Sachverhalt von e<strong>in</strong>em sachverständigen Dritten beurteilt werden kann, um<br />
das Vorliegen der Besorgnis der Befangenheit als objektiv gegeben ansehen zu können. Für jeden Prüfer besteht<br />
e<strong>in</strong>e Nachweis- und Dokumentationspflicht, dass im Rahmen se<strong>in</strong>es Prüfungsauftrages das Besorgnis der Befangenheit<br />
nicht besteht.<br />
Bei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die Wirtschaftsprüfern die Möglichkeit bieten, sich zur Berufsausübung<br />
zusammen zu schließen, ist u.a. darauf abzustellen, ob die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die von e<strong>in</strong>em verantwortlichen<br />
Wirtschaftsprüfer geführt werden muss, selbst beauftragt wird oder e<strong>in</strong> bestimmter Wirtschaftsprüfer<br />
dieser Gesellschaft (vgl. § 319 Abs. 4 HGB). Bei Netzwerken ist darauf abzustellen, ob die Personen bei ihrer<br />
Berufsausübung zur Verfolgung geme<strong>in</strong>samer wirtschaftlicher Interessen für e<strong>in</strong>e gewisse Dauer zusammenwirken<br />
(vgl. § 319b Abs. 1 S. 3 HGB).<br />
Die Regelung <strong>in</strong> dieser Vorschrift ist auf den tatsächlich tätigen und verantwortlich zeichnenden Prüfer abgestellt,<br />
so dass das Selbstprüfungsverbot dann unmittelbar auch auf e<strong>in</strong>e Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wirken kann,<br />
wenn deren gesetzlicher Vertreter oder e<strong>in</strong>er ihrer Gesellschafter unter den gleichen Bed<strong>in</strong>gungen persönlich von<br />
e<strong>in</strong>er Prüfung ausgeschlossen wäre. E<strong>in</strong> Selbstprüfungsverbot kann auch für Prüfer entstehen, die <strong>in</strong> sonstigen<br />
Kooperationen zusammen wirken, wenn die Kriterien dafür tatsächlich und bezogen auf den Abschlussprüfer<br />
vorliegen.<br />
7.2 Zu Satz 2 (Verweis auf § 104 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong>)<br />
Nach der Vorschrift des § 104 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong> dürfen die Prüfer nicht an der Führung der Bücher oder an der<br />
Aufstellung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses oder des Gesamtabschlusses der Geme<strong>in</strong>de mitgewirkt haben,<br />
wenn mit der Abschlussprüfung als e<strong>in</strong>e Aufgabe nach § 103 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 GO <strong>NRW</strong> beauftragt werden<br />
sollen. Die Vorschrift schützt daher die Unabhängigkeit der Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung. Diese<br />
Vorgabe besteht <strong>in</strong> Anlehnung an die handelsrechtlichen Regelungen. E<strong>in</strong> solcher Ausschluss von der Prüfungstätigkeit<br />
ist auch im <strong>in</strong>ternationalen Bereich üblich. Die Besorgnis der Befangenheit des Prüfers und daher e<strong>in</strong>e<br />
GEMEINDEORDNUNG 718
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 103 GO <strong>NRW</strong><br />
Unvere<strong>in</strong>barkeit der Prüfungstätigkeit mit der sonstigen Tätigkeit entsteht <strong>in</strong> den Fällen, <strong>in</strong> denen der Prüfer e<strong>in</strong>en<br />
Sachverhalt zu beurteilen hat, an dessen Entstehung er selbst mitgewirkt hat und se<strong>in</strong>e Beteiligung von Bedeutung<br />
ist. Davon abzugrenzen ist die zulässige Beratung. Sie stellt e<strong>in</strong>e Entscheidungshilfe dar und berührt nicht<br />
die Prüfungstätigkeit, solange der Geme<strong>in</strong>de als zu beratende Stelle die Entscheidung vorbehalten bleibt.<br />
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ<br />
GEMEINDEORDNUNG 719
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 104 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 104<br />
Leitung und Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung<br />
(1) 1 Die örtliche Rechnungsprüfung ist dem Rat unmittelbar verantwortlich und <strong>in</strong> ihrer sachlichen Tätigkeit ihm<br />
unmittelbar unterstellt. 2 Sie ist von fachlichen Weisungen frei.<br />
(2) 1 Der Rat bestellt die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung und die Prüfer und beruft sie ab. 2 Die Leitung<br />
und die Prüfer können nicht Mitglieder des Rates se<strong>in</strong> und dürfen e<strong>in</strong>e andere Stellung <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>de nur <strong>in</strong>nehaben,<br />
wenn dies mit ihren Prüfungsaufgaben vere<strong>in</strong>bar ist. 3 Sie dürfen nicht Zahlungen der Geme<strong>in</strong>de abwickeln.<br />
(3) 1 Die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung darf nicht Angehöriger des Bürgermeisters, des Kämmerers<br />
oder des für die Zahlungsabwicklung Verantwortlichen und dessen Stellvertreters se<strong>in</strong>.<br />
(4) Für die Aufgaben nach § 103 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 dürfen die Prüfer nicht an der Führung der Bücher oder an<br />
der Aufstellung des Jahresabschlusses oder des Gesamtabschlusses mitgewirkt haben.<br />
Erläuterungen zu § 104:<br />
I. Allgeme<strong>in</strong>es<br />
1. Die örtliche Rechnungsprüfung als Aufgabenbereich<br />
Die örtliche Rechnungsprüfung ist bei den kreisfreien Städten, den Großen und den Mittleren kreisangehörigen<br />
Städten regelmäßig e<strong>in</strong>e Organisationse<strong>in</strong>heit <strong>in</strong>nerhalb der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung, denn diese Städte haben<br />
e<strong>in</strong>e örtliche Rechnungsprüfung e<strong>in</strong>zurichten (vgl. § 102 Abs. 1 S. 1 GO <strong>NRW</strong>). Die übrigen Geme<strong>in</strong>den sollen<br />
e<strong>in</strong>e Organisationse<strong>in</strong>heit „Örtliche Rechnungsprüfung“ e<strong>in</strong>richten, wenn bei ihnen dafür e<strong>in</strong> Bedürfnis besteht<br />
und die Kosten <strong>in</strong> angemessenem Verhältnis zum Nutzen stehen. Grundsätzlich muss daher die Geme<strong>in</strong>de als<br />
Aufgabenträger handeln, denn der Gesetzgeber hat ihr ausdrücklich die dafür erforderlichen Kompetenzen e<strong>in</strong>geräumt.<br />
Er hat die Geme<strong>in</strong>de als geeignet angesehen, dass sie die ihr zugewiesenen Prüfungsaufgaben mit der<br />
notwendigen personellen und sächlichen Ausstattung erfüllen und den ordnungsgemäßen Gang der Prüfungsgeschäfte<br />
sicherstellen kann.<br />
Die örtliche Rechnungsprüfung nimmt aber als Organisationse<strong>in</strong>heit e<strong>in</strong>e Sonderstellung <strong>in</strong>nerhalb der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Verwaltung e<strong>in</strong>, weil <strong>in</strong> der Vorschrift des § 104 GO <strong>NRW</strong> bestimmt wird, dass die örtliche Rechnungsprüfung<br />
dem Rat unmittelbar verantwortlich und <strong>in</strong> ihrer sachlichen Tätigkeit ihm unmittelbar unterstellt sowie von<br />
fachlichen Weisungen frei ist. Die Vorschrift enthält außerdem besondere die Unabhängigkeit der Prüfer sichernde<br />
Bestimmungen, um den Ausschluss jeglicher E<strong>in</strong>flussnahme der von der örtlichen Rechnungsprüfung zu prüfenden<br />
Stellen zu erreichen, damit e<strong>in</strong>e objektive und effektive Prüfung durchgeführt wird.<br />
2. Die Unabhängigkeit der Prüfer<br />
Die Unabhängigkeit der Prüfer ist für die Anerkennung der Prüfungsergebnisse durch den Rat und die Bürger<strong>in</strong>nen<br />
und Bürger als Adressaten des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses von grundlegender<br />
Bedeutung. Sie erhöht für die Adressaten den Wert der gegebenen Informationen über die formelle und<br />
materielle Richtigkeit der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft sowie über die wirtschaftliche Lage der Geme<strong>in</strong>de.<br />
So müssen die Prüfer<strong>in</strong>nen und Prüfer als Bedienste der Geme<strong>in</strong>de die für ihren Arbeitsbereich erforderlichen<br />
fachlichen und persönlichen Voraussetzungen erfüllen (vgl. § 74 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>), um e<strong>in</strong>e zutreffende und unparteiisch<br />
vorzunehmende Prüfung zu gewährleisten.<br />
GEMEINDEORDNUNG 720
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 104 GO <strong>NRW</strong><br />
Der besondere Status der örtlichen Rechnungsprüfung be<strong>in</strong>haltet auch Anforderungen an die Qualität von Prüfungsleistungen.<br />
In Abhängigkeit von den örtlichen Verhältnissen bedarf es e<strong>in</strong>er Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle,<br />
die von der Geme<strong>in</strong>de eigenverantwortlich gestaltet und durchgeführt werden kann. Diese dienen<br />
dazu, die Unabhängigkeit der örtlichen Rechnungsprüfung zu wahren, ihre Unparteilichkeit zu erhalten und das<br />
Besorgnis der Befangenheit bei den Prüfern zu vermeiden.<br />
Die Aufgabe des Bürgermeisters beschränkt sich im Rahmen se<strong>in</strong>er Organisationshoheit auf die Tätigkeit des<br />
Dienstvorgesetzten, soweit er nicht als Leiter der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung der örtlichen Rechnungsprüfung<br />
Aufträge zur Prüfung erteilt hat (vgl. § 103 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong>). Die Bestellung und Abberufung der Prüfer der örtlichen<br />
Rechnungsprüfung durch den Rat der Geme<strong>in</strong>de schränkt das Geschäftsverteilungsrechts des Bürgermeisters<br />
nach § 62 GO <strong>NRW</strong> e<strong>in</strong>. Bei der Bestellung und Abberufung von Prüfer<strong>in</strong>nen und Prüfern bietet sich e<strong>in</strong>e<br />
örtliche Abstimmung zwischen dem Rat der Geme<strong>in</strong>de und dem Bürgermeister <strong>in</strong>sbesondere dann an, wenn<br />
e<strong>in</strong>em Beschäftigten der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung e<strong>in</strong>e Prüfungstätigkeit im Rahmen der örtlichen Rechnungsprüfung<br />
übertragen werden soll.<br />
Der Unabhängigkeit der Prüfer dient aber auch Regelung <strong>in</strong> § 103 Abs. 7 GO <strong>NRW</strong>, dass e<strong>in</strong> Dritter nicht Prüfer<br />
se<strong>in</strong> darf, wenn bestimmte persönliche Ausschließungsgründe vorliegen. Außerdem unterliegt auch die örtliche<br />
Rechnungsprüfung unterliegt h<strong>in</strong>sichtlich ihrer Tätigkeit und Arbeitsergebnisse der überörtlichen Prüfung, ohne<br />
jedoch dabei die <strong>in</strong>haltliche Aufgabenwahrnehmung zum Gegenstand zu haben.<br />
II. Erläuterungen im E<strong>in</strong>zelnen<br />
1. Zu Absatz 1 (Unabhängigkeit der örtlichen Rechnungsprüfung):<br />
1.1 Zu Satz 1 (Verantwortlichkeiten gegenüber dem Rat):<br />
1.1.1 Unmittelbare Verantwortlichkeiten<br />
Nach der Vorschrift ist die örtliche Rechnungsprüfung dem Rat unmittelbar verantwortlich und <strong>in</strong> ihrer sachlichen<br />
Tätigkeit ihm unmittelbar unterstellt. Diese Vorgabe ist sachgerecht, denn die örtliche Rechnungsprüfung ist organisatorisch<br />
<strong>in</strong> die Geme<strong>in</strong>deverwaltung e<strong>in</strong>gegliedert und hat wegen ihrer Prüfung der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltungsaufgaben<br />
e<strong>in</strong>e Sonderstellung <strong>in</strong>ne.<br />
Die Vorschrift verdeutlicht diesen Sachverhalt und weist ausdrücklich auf die unmittelbare Verantwortlichkeit gegenüber<br />
dem Rat aus. Sie sichert dadurch für die Leitung sowie die Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung die<br />
notwendige Unabhängigkeit. Es ist dabei Aufgabe des Bürgermeisters als Dienstvorgesetzten zu prüfen, ob die<br />
örtliche Rechnungsprüfung ihre Pflicht erfüllt. Ist dies z.B. nicht zeitnah genug, kann er e<strong>in</strong>greifen. Auch kann er <strong>in</strong><br />
Ausnahmefällen dem Rat die Abberufung der Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung vorschlagen.<br />
1.1.2 Verantwortlichkeit und E<strong>in</strong>schaltung Dritter<br />
Die Vorschriften über die Ausübung und Ausgestaltung der Pflicht zur örtlichen Rechnungsprüfung durch die<br />
Geme<strong>in</strong>de stehen e<strong>in</strong>er Erledigung von Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung durch Dritte, z.B. die örtliche<br />
Rechnungsprüfung e<strong>in</strong>er anderen Geme<strong>in</strong>de oder Wirtschaftsprüfern als private Dritte nicht entgegen. Die Geme<strong>in</strong>den,<br />
die zur E<strong>in</strong>richtung e<strong>in</strong>er örtlichen Rechnungsprüfung verpflichtet s<strong>in</strong>d, dürfen sich bei der Ausgestaltung<br />
solcher Aufträge, z.B. im Rahmen e<strong>in</strong>er öffentlich-rechtlichen Vere<strong>in</strong>barung, jedoch nicht aus ihrer Gesamtverantwortung<br />
für die örtliche Rechnungsprüfung selbst entlassen.<br />
GEMEINDEORDNUNG 721
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 104 GO <strong>NRW</strong><br />
E<strong>in</strong>e Geme<strong>in</strong>de, die örtliche Prüfungsaufgaben durch Dritte erledigen lässt, bleibt immer für die ordnungsgemäße<br />
Aufgabenerledigung der örtlichen Rechnungsprüfung verantwortlich. Dieses ist auch geboten, denn bei e<strong>in</strong>er<br />
Zusammenarbeit mit Dritten kann die örtliche Rechnungsprüfung e<strong>in</strong>er fremden Geme<strong>in</strong>de nicht unmittelbar dem<br />
Rat der Geme<strong>in</strong>de gegenüber verantwortlich und ihm <strong>in</strong> ihrer sachlichen Tätigkeit unmittelbar unterstellt se<strong>in</strong> (vgl.<br />
§ 104 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>). Die geme<strong>in</strong>deübergreifende Zusammenarbeit bei der örtlichen Rechnungsprüfung lässt<br />
sich trotzdem auf unterschiedliche Art und Weise gestalten.<br />
1.2 Zu Satz 2 (Fachliche Weisungsfreiheit):<br />
Durch die ausdrückliche Regelung <strong>in</strong> dieser Vorschrift, dass die örtliche Rechnungsprüfung frei von fachlichen<br />
Weisungen durch Dritte ist, soll neben der persönlichen Unabhängigkeit auch die sachliche Unabhängigkeit der<br />
örtlichen Rechnungsprüfung gewährleistet werden. Außerdem wird e<strong>in</strong> E<strong>in</strong>griffsverbot <strong>in</strong> die Prüfungstätigkeit aus<br />
fachlichen Gesichtspunkten bestimmt. Dadurch soll e<strong>in</strong>e s<strong>in</strong>nvolle und effektive Prüfung bei der Geme<strong>in</strong>de durch<br />
Ausschluss der fachlichen E<strong>in</strong>flussnahme der zu prüfenden Stellen garantiert werden.<br />
Der örtlichen Rechnungsprüfung steht damit e<strong>in</strong> umfassendes Prüfungs- und Informationsrecht zu. Außerdem ist<br />
das Ermessen der Prüfer bei der Wahl der Prüfungsmethoden und der Prüfungstiefe relativ groß. Es ist jeweils im<br />
Rahmen der örtlichen Prüfungstätigkeit, abhängig von den zu prüfenden Sachverhalten und vorliegenden Bed<strong>in</strong>gungen,<br />
auszugestalten. Bestehen örtliche Prüfungsvorschriften stellen diese ke<strong>in</strong>e Schutzvorschriften zu Gunsten<br />
Dritter dar.<br />
2. Zu Absatz 2 (Leitung und Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung):<br />
2.1 Zu Satz 1 (Bestellung und Abberufung):<br />
2.1.1 Die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung<br />
Nach der Vorschrift bestellt der Rat der Geme<strong>in</strong>de die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>de.<br />
Ihm steht aber auch das Recht der Abberufung der Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung zu. Die Bestellung<br />
sowie die Abberufung von Leitung und Prüfer s<strong>in</strong>d vom Rat mit e<strong>in</strong>em Beschluss bei e<strong>in</strong>facher Mehrheit vorzunehmen.<br />
In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass der Begriff „Leitung“ nur dah<strong>in</strong>gehend zu verstehen<br />
ist, dass dadurch auf geschlechtsspezifische Bezeichnungen verzichtet werden konnte.<br />
Der Begriff „Leitung“ umfasst nicht die Stellvertretung der Leitung, da nach der Vorschrift ke<strong>in</strong> allgeme<strong>in</strong>er Vertreter<br />
für die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung vorgesehen und durch den Rat zu bestellen ist, wie es z.B. für<br />
den Bürgermeister ausdrücklich bestimmt wurde (vgl. § 68 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>). E<strong>in</strong>e Vertretung der Leitung der<br />
örtlichen Rechnungsprüfung soll vielmehr nur für die Abwesenheit der Leitung vorhanden se<strong>in</strong>. Dessen Bestellung<br />
ist daher nicht durch den Rat vorzunehmen, der ja bereits die Leitung und die Prüfer bestellt hat, sondern<br />
lediglich als <strong>in</strong>nerorganisatorische Maßnahme anzusehen, die zudem durch die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung<br />
vorzunehmen ist.<br />
2.1.2 Die Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung<br />
Nach der Vorschrift bestellt der Rat der Geme<strong>in</strong>de die Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>de.<br />
Ihm steht aber auch das Recht der Abberufung der Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung zu. Die Bestellung<br />
sowie die Abberufung der Prüfer s<strong>in</strong>d vom Rat mit e<strong>in</strong>em Beschluss bei e<strong>in</strong>facher Mehrheit vorzunehmen. Die<br />
Vorschrift bestimmt ke<strong>in</strong>e fachlichen und persönlichen Voraussetzungen für die Prüfer<strong>in</strong>nen und Prüfer im E<strong>in</strong>zelnen.<br />
Diese Personen müssen aber über e<strong>in</strong>e für ihre Prüfungstätigkeit ausreichende Sachkenntnis verfügen.<br />
GEMEINDEORDNUNG 722
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 104 GO <strong>NRW</strong><br />
Diese Vorgabe bedeutet, dass die Personen mit den zu prüfenden Sachverhalten, mit den e<strong>in</strong>schlägigen gesetzlichen<br />
und aufsichtsrechtlichen Regelungen sowie mit der Geschäftstätigkeit der Geme<strong>in</strong>de im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung<br />
und ihrem wirtschaftlichen Umfeld, <strong>in</strong> dem sie tätig s<strong>in</strong>d, vertraut se<strong>in</strong> müssen.<br />
2.2 Zu Satz 2 (Sicherung der persönlichen Unabhängigkeit):<br />
Nach der Vorschrift dürfen die Leitung und die Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung e<strong>in</strong>er Geme<strong>in</strong>de nicht Mitglieder<br />
des Rates dieser Geme<strong>in</strong>de se<strong>in</strong> und dürfen auch e<strong>in</strong>e andere Stellung <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>de nur <strong>in</strong>nehaben,<br />
wenn dieses mit ihren Prüfungsaufgaben vere<strong>in</strong>bar ist. Das Verbot „Die Leitung und die Prüfer können nicht Mitglieder<br />
des Rates se<strong>in</strong>“ soll <strong>in</strong>sgesamt gesehen mögliche Interessenkonflikte von vornhere<strong>in</strong> ausschließen und<br />
die persönliche Unabhängigkeit der Leitung und der Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung gewährleisten.<br />
Über diese Vorgaben h<strong>in</strong>aus bestehen noch <strong>in</strong> weiteren Vorschriften spezielle E<strong>in</strong>schränkungen, die zur Sicherung<br />
der persönlichen Unabhängigkeit der Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung beitragen sollen. So dürfen die<br />
mit der Rechnungsprüfung beauftragten Bediensteten der Geme<strong>in</strong>de ke<strong>in</strong>e Zahlungen der Geme<strong>in</strong>de abwickeln,<br />
denn der örtlichen Rechnungsprüfung obliegt die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Geme<strong>in</strong>de<br />
(vgl. § 93 Abs. 4 i.V.m. § 103 Abs. 1 Nr. 5 GO <strong>NRW</strong>). Auch dürfen der Verantwortliche für die geme<strong>in</strong>dliche Zahlungsabwicklung<br />
und se<strong>in</strong> Stellvertreter auch nicht Angehörige der Leitung und der Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung<br />
se<strong>in</strong> (vgl. § 93 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong>).<br />
In diesem Zusammenhang hat die Bürgermeister<strong>in</strong> oder der Bürgermeister zu prüfen, ob Beschäftigten der örtlichen<br />
Rechnungsprüfung die Befugnis für die sachliche und rechnerische Feststellung erteilt werden kann, denn<br />
jeder Zahlungsanspruch und jede Zahlungsverpflichtung der Geme<strong>in</strong>de s<strong>in</strong>d auf ihren Grund und ihre Höhe zu<br />
prüfen und sachlich und rechnerisch festzustellen (vgl. § 30 Abs. 2 GemHVO <strong>NRW</strong>). Dabei könnte die Regelung<br />
<strong>in</strong> § 30 Abs. 3 S. 2 GemHVO <strong>NRW</strong> hilfreich se<strong>in</strong> bzw. entsprechend zur Anwendung kommen. Dann dürfte die<br />
Befugnis zur sachlichen und rechnerischen Feststellung den Beschäftigten der örtlichen Rechnungsprüfung nur<br />
übertragen werden, wenn und soweit der Sachverhalt nur von ihnen beurteilt werden kann.<br />
Der Rat der Geme<strong>in</strong>de hat eigenverantwortlich zu entscheiden, ob Beamte oder andere Beschäftigte mit den<br />
örtlichen Prüfungsaufgaben betraut werden, denn es bestehen ke<strong>in</strong>e dienstrechtlichen Vorgaben für die Ausgestaltung<br />
der Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung sowie <strong>in</strong> Form von Anforderungen für die Prüfer. Auch bestehen<br />
zudem ke<strong>in</strong>e speziellen Haftungsbestimmungen für diesen Personenkreis. Sie haben aber bei Vorsatz<br />
oder grober Fahrlässigkeit zu haften, soweit sie z.B. Beamte s<strong>in</strong>d (vgl. § 48 BeamStG). Werden von der örtlichen<br />
Rechnungsprüfung Dritte mit Prüfungsaufgaben beauftragt (vgl. § 103 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong>), hat die Geme<strong>in</strong>de eigenverantwortlich<br />
notwendige Haftungsregelungen vertraglich zu vere<strong>in</strong>baren.<br />
2.3 Zu Satz 3 (Verbot der Zahlungsabwicklung):<br />
Nach der Vorschrift dürfen die Leitung und die Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung e<strong>in</strong>er Geme<strong>in</strong>de nicht Zahlungen<br />
der Geme<strong>in</strong>de abwickeln. Diese ausdrückliche Vorgabe stellt den Zusammenhang mit der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
F<strong>in</strong>anzbuchhaltung nach § 93 GO <strong>NRW</strong> her. Dieser gesetzliche Grundsatz stellt nicht nur e<strong>in</strong>e Vorgabe für e<strong>in</strong>e<br />
sachdienliche Gestaltung des geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltungsablaufs bei der Abwicklung der Geschäftsvorfälle der<br />
Geme<strong>in</strong>de dar, sondern ist auch Ausdruck dafür, dass auch die Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung nicht über<br />
verpflichtende Erklärungen bzw. Zahlungen zu Lasten der Geme<strong>in</strong>de entscheiden sollen, bei denen ihnen gleichzeitig<br />
die Prüfung des betreffenden geme<strong>in</strong>dlichen Geschäftsvorfalls obliegt.<br />
Der Grundsatz der Trennung von fachlicher Entscheidung bei der geme<strong>in</strong>dlichen Zahlungsabwicklung und der<br />
Durchführung der Rechnungsprüfung gilt wegen der Sonderstellung der örtlichen Rechnungsprüfung auch für die<br />
damit beauftragten Bediensteten. Dadurch soll die E<strong>in</strong>haltung der Trennung zwischen Bewirtschaftung der Haus-<br />
GEMEINDEORDNUNG 723
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 104 GO <strong>NRW</strong><br />
haltsmittel und örtlicher Rechnungsprüfung gewährleisten. Außerdem wird durch diese Regelung auch erfasst,<br />
dass die Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung nicht gleichzeitig die Stellung des Verantwortlichen für die Zahlungsabwicklung<br />
oder se<strong>in</strong>es Stellvertreters <strong>in</strong>nehaben können.<br />
3. Zu Absatz 3 (Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung):<br />
Die Vorschrift sichert die Unabhängigkeit der Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung. Für sie bestehen ke<strong>in</strong>e<br />
dienstrechtlichen Vorgaben, so dass der Rat der Geme<strong>in</strong>de eigenverantwortlich zu entscheiden hat, ob Beamte<br />
oder andere Beschäftigte mit der Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung betraut werden. Es ist dabei noch zu<br />
berücksichtigen, dass das Verbot, als Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung nicht Angehöriger des Bürgermeisters,<br />
des Kämmerers oder des für die Zahlungsabwicklung Verantwortlichen und dessen Stellvertreters se<strong>in</strong> zu<br />
dürfen, nicht nur bei e<strong>in</strong>er Verb<strong>in</strong>dung durch e<strong>in</strong>e Ehe gilt, sondern auch bei denjenigen Personen Anwendung<br />
f<strong>in</strong>det, die durch e<strong>in</strong>e Lebenspartnerschaft nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz verbunden s<strong>in</strong>d.<br />
Durch diese Erweiterung wird den Regelungen des Gesetzes über die E<strong>in</strong>getragene Lebenspartnerschaft (Lebenspartnerschaftsgesetz<br />
- LPartG) vom 16. Februar 2001 (BGBl. I S. 266) Rechnung getragen. Das Verbot soll<br />
<strong>in</strong>sgesamt gesehen mögliche Interessenkonflikte durch persönliche B<strong>in</strong>dungen von vornhere<strong>in</strong> ausschließen und<br />
die persönliche Unabhängigkeit der Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung gewährleisten. Es steht zudem mit §<br />
31 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong> <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung, denn durch diese Vorschrift wird bestimmt, welche verwandtschaftlichen Verhältnisse<br />
unter dem Begriff „Angehöriger“ im S<strong>in</strong>ne der Geme<strong>in</strong>deordnung zu subsumieren s<strong>in</strong>d.<br />
4. Zu Absatz 4 (Mitwirkungsverbot für die Prüfer):<br />
4.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die Vorschrift schützt die Unabhängigkeit der Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung. In Anlehnung an die handelsrechtlichen<br />
Regelungen ist festgelegt, dass sie nicht als Prüfer des Jahresabschlusses der Geme<strong>in</strong>de und<br />
bestimmter Sondervermögen sowie des Gesamtabschlusses der Geme<strong>in</strong>de tätig werden dürfen, wenn sie an der<br />
Führung der Bücher oder an der Aufstellung des zu prüfenden Abschlusses mitgewirkt haben. E<strong>in</strong> solcher Ausschluss<br />
von der Prüfungstätigkeit ist auch im <strong>in</strong>ternationalen Bereich üblich.<br />
Die Besorgnis der Befangenheit des Prüfers und daher e<strong>in</strong>e Unvere<strong>in</strong>barkeit der Prüfungstätigkeit mit der sonstigen<br />
Tätigkeit entsteht <strong>in</strong> den Fällen, <strong>in</strong> denen der Prüfer e<strong>in</strong>en Sachverhalt zu beurteilen hat, an dessen Entstehung<br />
er selbst mitgewirkt hat und se<strong>in</strong>e Beteiligung von Bedeutung ist. Davon abzugrenzen ist die zulässige Beratung.<br />
Sie stellt e<strong>in</strong>e Entscheidungshilfe dar und berührt nicht die Prüfungstätigkeit, solange der Geme<strong>in</strong>de als<br />
zu beratende Stelle die Entscheidung vorbehalten bleibt.<br />
4.2 Das Selbstprüfungsverbot<br />
Die Zurückhaltung der Prüfer ist notwendig, um ihre Unabhängigkeit zu wahren und sie nicht zu Prüfern für eigene<br />
Sachentscheidungen zu machen. So sollen Prüfer nicht Mitglieder von Entscheidungsgremien se<strong>in</strong>, <strong>in</strong> denen<br />
die Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden festgelegt werden. Auch sollen Prüfer im Rahmen ihrer beratenden<br />
Begleitung, z.B. im Rahmen der Aufstellung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses, ke<strong>in</strong>e Entscheidungsvorlagen<br />
erarbeiten oder dieses mit unterzeichnen.<br />
E<strong>in</strong> Abschlussprüfer verstößt gegen das Selbstprüfungsverbot, wenn er z.B. den Anhang im geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss<br />
selbst erstellt hat und im Rahmen se<strong>in</strong>er Abschlussprüfung prüfen soll. Der Prüfer ist <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em solchen<br />
Fall geh<strong>in</strong>dert, über das Ergebnis der Abschlussprüfung zu berichten und das ergebnis der Prüfung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
GEMEINDEORDNUNG 724
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 104 GO <strong>NRW</strong><br />
Bestätigungsvermerk nach § 101 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong> zusammen zu fassen. Ob e<strong>in</strong>e Tätigkeit des Prüfers über e<strong>in</strong>e<br />
Prüfungstätigkeit h<strong>in</strong>ausgeht und diese Tätigkeit nicht nur von untergeordneter Bedeutung ist, so dass e<strong>in</strong> Fall<br />
e<strong>in</strong>es Selbstprüfungsverbots gegeben ist, kann nur im E<strong>in</strong>zelfall unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten<br />
beurteilt werden.<br />
E<strong>in</strong> solcher Fall entsteht nicht alle<strong>in</strong> im Zeitablauf, <strong>in</strong> dem durch e<strong>in</strong>e Vielzahl von gezeichneten Bestätigungsvermerken<br />
e<strong>in</strong> Selbstprüfungsverbot hervorgerufen werden könnte. Die Vorschrift enthält dazu ke<strong>in</strong>e Vorgabe, e<strong>in</strong>en<br />
regelmäßigen Austausch des verantwortlich zeichnenden Prüfers vorzunehmen. Daher dürfen auch Dritte als<br />
Prüfer längerfristig beschäftigt werden, so lange ke<strong>in</strong>e sonstigen Ausschlussgründe bestehen. Das Selbstprüfungsverbot<br />
gilt auch für Prüfer der Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt, wenn diese im Wege der Beauftragung die Aufgaben<br />
der örtlichen Rechnungsprüfung erledigen, z.B. die Prüfung der Eröffnungsbilanz. E<strong>in</strong>e Mitwirkung des gleichen<br />
Prüfers bei der überörtlichen Prüfung des gleichen Prüfungsgegenstandes ist dann nicht zulässig (vgl. § 105<br />
Abs. 8 GO <strong>NRW</strong>).<br />
4.3 Zusammenschlüsse von Wirtschaftsprüfern<br />
Das Selbstprüfungsverbot als Unabhängigkeitsverständnis wirkt sich auch auf Zusammenschlüsse von Wirtschaftprüfern<br />
aus, z.B. bei Bürogeme<strong>in</strong>schaften, Kooperationen und Netzwerken, wenn der e<strong>in</strong>zelne Prüfer auf<br />
das Ergebnis der durchzuführenden Abschlussprüfung E<strong>in</strong>fluss nehmen kann. In diesem Zusammenhang ist<br />
immer die Frage zu klären, ob der Sachverhalt von e<strong>in</strong>em sachverständigen Dritten beurteilt werden kann, um<br />
das Vorliegen der Besorgnis der Befangenheit als objektiv gegeben ansehen zu können. Für jeden Prüfer besteht<br />
e<strong>in</strong>e Nachweis- und Dokumentationspflicht, dass im Rahmen se<strong>in</strong>es Prüfungsauftrages das Besorgnis der Befangenheit<br />
nicht besteht.<br />
Bei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die Wirtschaftsprüfern die Möglichkeit bieten, sich zur Berufsausübung<br />
zusammen zu schließen, ist u.a. darauf abzustellen, ob die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die von e<strong>in</strong>em verantwortlichen<br />
Wirtschaftsprüfer geführt werden muss, selbst beauftragt wird oder e<strong>in</strong> bestimmter Wirtschaftsprüfer<br />
dieser Gesellschaft (vgl. § 319 Abs. 4 HGB). Bei Netzwerken ist darauf abzustellen, ob die Personen bei ihrer<br />
Berufsausübung zur Verfolgung geme<strong>in</strong>samer wirtschaftlicher Interessen für e<strong>in</strong>e gewisse Dauer zusammenwirken<br />
(vgl. § 319b Abs. 1 S. 3 HGB).<br />
Die Regelung <strong>in</strong> dieser Vorschrift ist auf den tatsächlich tätigen und verantwortlich zeichnenden Prüfer abgestellt,<br />
so dass das Selbstprüfungsverbot dann unmittelbar auch auf e<strong>in</strong>e Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wirken kann,<br />
wenn deren gesetzlicher Vertreter oder e<strong>in</strong>er ihrer Gesellschafter unter den gleichen Bed<strong>in</strong>gungen persönlich von<br />
e<strong>in</strong>er Prüfung ausgeschlossen wäre. E<strong>in</strong> Selbstprüfungsverbot kann auch für Prüfer entstehen, die <strong>in</strong> sonstigen<br />
Kooperationen zusammen wirken, wenn die Kriterien dafür tatsächlich und bezogen auf den Abschlussprüfer<br />
vorliegen.<br />
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ<br />
GEMEINDEORDNUNG 725
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 105 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 105<br />
Überörtliche Prüfung<br />
(1) Die überörtliche Prüfung als Teil der allgeme<strong>in</strong>en Aufsicht des Landes über die Geme<strong>in</strong>den ist Aufgabe der<br />
Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt.<br />
(2) Die Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt ist bei der Durchführung ihrer Aufgaben unabhängig und an Weisungen nicht<br />
gebunden.<br />
(3) 1 Die überörtliche Prüfung erstreckt sich darauf, ob<br />
1. bei der Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>den sowie ihrer Sondervermögen die Gesetze und die zur Erfüllung<br />
von Aufgaben ergangenen Weisungen (§ 3 Abs. 2) e<strong>in</strong>gehalten und die zweckgebundenen Staatszuweisungen<br />
bestimmungsgemäß verwendet worden s<strong>in</strong>d,<br />
2. die Buchführung und die Zahlungsabwicklung ordnungsgemäß durchgeführt worden s<strong>in</strong>d.<br />
3. Die überörtliche Prüfung stellt zudem fest, ob die Geme<strong>in</strong>de sachgerecht und wirtschaftlich verwaltet wird.<br />
Dies kann auch auf vergleichender Grundlage geschehen.<br />
2 Bei der Prüfung s<strong>in</strong>d vorhandene Ergebnisse der örtlichen Rechnungsprüfung zu berücksichtigen.<br />
(4) Die Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt teilt das Prüfungsergebnis <strong>in</strong> Form e<strong>in</strong>es Prüfberichts<br />
1. der geprüften Geme<strong>in</strong>de,<br />
2. den Aufsichtsbehörden und<br />
3. den Fachaufsichtsbehörden, soweit ihre Zuständigkeit berührt ist,<br />
mit.<br />
(5) 1 Der Bürgermeister legt den Prüfungsbericht dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Beratung vor. 2 Der<br />
Rechnungsprüfungsausschuss unterrichtet den Rat über den wesentlichen Inhalt des Prüfungsberichts sowie<br />
über das Ergebnis se<strong>in</strong>er Beratungen.<br />
(6) Die Geme<strong>in</strong>de hat zu den Beanstandungen des Prüfungsberichts gegenüber der Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt<br />
und der Aufsichtsbehörde <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>er dafür bestimmten Frist Stellung zu nehmen.<br />
(7) Die Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt soll Körperschaften, Anstalten, Stiftungen und Verbände und E<strong>in</strong>richtungen<br />
des öffentlichen Rechts<br />
1. <strong>in</strong> Fragen der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung und<br />
2. <strong>in</strong> bautechnischen Fragen, die mit der Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von baulichen Maßnahmen<br />
zusammenhängen auf Antrag beraten. Sonstige im öffentlichen Interesse tätige juristische Personen kann sie<br />
<strong>in</strong> diesen Fragen auf Antrag beraten.<br />
(8) Werden Prüfungsaufgaben nach § 92 Abs. 5 oder nach § 103 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 durch Prüfer der Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt<br />
bei den Geme<strong>in</strong>den durchgeführt oder haben sie daran mitgewirkt, dürfen diese Prüfer nicht an<br />
der überörtlichen Prüfung der Geme<strong>in</strong>de mitwirken.<br />
Erläuterungen zu § 105:<br />
I. Allgeme<strong>in</strong>es<br />
1. Die überörtliche Prüfung<br />
Im 10. Teil der Geme<strong>in</strong>deordnung f<strong>in</strong>den sich die Vorschriften über die Kontrolle des Haushalts der Geme<strong>in</strong>de.<br />
In diesem Gefüge der gesetzlichen Verpflichtungen zur Prüfung des haushaltswirtschaftlichen Handelns der<br />
GEMEINDEORDNUNG 726
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 105 GO <strong>NRW</strong><br />
Geme<strong>in</strong>de ist zwischen der örtlichen Prüfung und der überörtlichen Prüfung zu unterscheiden. Während die<br />
örtliche Prüfung der Geme<strong>in</strong>de selbst obliegt und e<strong>in</strong>e Eigenkontrolle der Geme<strong>in</strong>de darstellt, ist die überörtliche<br />
Prüfung der Geme<strong>in</strong>den Teil der Aufsicht des Landes über die Geme<strong>in</strong>den (vgl. §§ 119 ff. GO <strong>NRW</strong>). Sie ist der<br />
Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen (GPA <strong>NRW</strong>) gesetzlich übertragen worden ist (vgl. § 105 GO<br />
<strong>NRW</strong>).<br />
Die überörtliche Prüfung ist - wie die örtliche Prüfung der Geme<strong>in</strong>de - e<strong>in</strong> unverzichtbares Instrument für e<strong>in</strong>e<br />
Kontrolle der Gesetz- und Ordnungsmäßigkeit des wirtschaftlichen Handelns der Geme<strong>in</strong>de sowie der haushaltswirtschaftlichen<br />
Geschäftsvorfälle der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung. Die überörtliche Prüfung soll e<strong>in</strong>e fachkundige<br />
Prüfung der Geme<strong>in</strong>den unter den Gesichtspunkten der staatlichen Aufsicht ermöglichen. Wegen dieser<br />
außerhalb der Aufsichtsbehörden der Geme<strong>in</strong>den liegenden Tätigkeit der Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt ist es<br />
geboten, die Aufsichtsbehörden möglichst frühzeitig <strong>in</strong> die vorgesehenen Prüfungen bei den Geme<strong>in</strong>den e<strong>in</strong>zub<strong>in</strong>den<br />
und nicht erst - wie es gesetzlich als M<strong>in</strong>destvorgabe vorgesehen ist - <strong>in</strong> das Prüfungsgeschehen e<strong>in</strong>gebunden<br />
werden, wenn die überörtliche Prüfung bei den Geme<strong>in</strong>den abgeschlossen ist.<br />
2. Die Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen<br />
Die überörtliche Prüfung der Geme<strong>in</strong>den <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen wurde der Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt Nordrhe<strong>in</strong>-<br />
Westfalen zur zentralen Aufgabenerledigung durch das Gesetz über die Errichtung e<strong>in</strong>er Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt<br />
übertragen. Die Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt ist dazu als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts errichtet<br />
worden (vgl. § 1 GPAG). Sie ist Teil der <strong>in</strong> den §§ 119 ff. GO <strong>NRW</strong> geregelten Kommunalaufsicht der Geme<strong>in</strong>den,<br />
jedoch gleichzeitig bei der Durchführung ihrer Aufgaben unabhängig und an Weisungen nicht gebunden ist.<br />
Sie untersteht der Rechtsaufsicht des Innenm<strong>in</strong>isteriums <strong>NRW</strong> (vgl. § 12 GPAG).<br />
Als Organe der Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt s<strong>in</strong>d der Verwaltungsrat und der Präsident bestimmt worden, wobei im<br />
Verwaltungsrat die Geme<strong>in</strong>den durch Vertreter ihrer Spitzenverbände repräsentiert werden, der über organisatorische<br />
und wirtschaftliche Angelegenheiten der Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt beschließt. Wie bei der Vergabe von<br />
Prüfungsaufträgen an Dritte s<strong>in</strong>d von den Geme<strong>in</strong>den für die überörtliche Prüfung durch die Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt<br />
Gebühren zu zahlen, die <strong>in</strong> entsprechender Anwendung des Kommunalabgabengesetzes erheben werden<br />
(vgl. § 10 Abs. 1 GPAG). Die Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt darf aber auch beratend tätig werden. Wie bei der Vergabe<br />
von Beratungsaufträgen an Dritte ist dann auch für die Beratung durch die Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt e<strong>in</strong> Entgelt<br />
zu zahlen, das m<strong>in</strong>destens kostendeckend se<strong>in</strong> soll (vgl. § 10 Abs. 2 GPAG).<br />
II. Erläuterungen im E<strong>in</strong>zelnen<br />
1. Zu Absatz 1 (Status der überörtlichen Prüfung):<br />
Die überörtliche Prüfung ist Teil der Aufsicht des Landes über die Geme<strong>in</strong>den. Sie ist jedoch <strong>in</strong>haltlich nicht Teil<br />
der Aufsicht nach den Vorschriften der §§ 119 ff. GO <strong>NRW</strong> (13. Teil der GO <strong>NRW</strong>), denn die Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt<br />
kann sich nicht der <strong>in</strong> den zuvor genannten Vorschriften aufgeführten Aufsichtsmittel bedienen. Sie unterscheidet<br />
sich zudem von der örtlichen Rechnungsprüfung dadurch, dass sie zentral von der GPA <strong>NRW</strong> als e<strong>in</strong>er<br />
außerhalb der Geme<strong>in</strong>deverwaltung stehenden Stelle durchgeführt wird, während die örtliche Rechnungsprüfung<br />
der Geme<strong>in</strong>de obliegt. Zwischen der örtlichen Prüfung und der überörtlichen Prüfung bestehen auch deshalb<br />
Unterschiede, da vone<strong>in</strong>ander abweichende Kriterien und e<strong>in</strong>e andere Betrachtungsweise <strong>in</strong> die Prüfungen e<strong>in</strong>bezogen<br />
wird bzw. e<strong>in</strong>bezogen werden müssen. Die überörtliche Prüfung der Haushaltsführung von Geme<strong>in</strong>den<br />
setzt daher grundsätzlich e<strong>in</strong>e abgeschlossene jahresbezogene örtliche Prüfung voraus.<br />
Die überörtliche Prüfung durch die Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt schafft e<strong>in</strong>e Verb<strong>in</strong>dung zwischen der Aufsicht des<br />
Landes und der haushaltswirtschaftlichen Tätigkeit der Geme<strong>in</strong>den. Die Prüfungstätigkeit der Geme<strong>in</strong>deprü-<br />
GEMEINDEORDNUNG 727
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 105 GO <strong>NRW</strong><br />
fungsanstalt kann daher e<strong>in</strong>e Informationsquelle für die Beurteilung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft darstellen.<br />
Zur Kontrolle und Prüfung der Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>den bedienen sich die Aufsichtsbehörden<br />
daher der Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt (GPA) als zuständige überörtliche Prüfungs<strong>in</strong>stanz. E<strong>in</strong>e solche Prüfungs<strong>in</strong>stanz<br />
kann e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>heitlichkeit <strong>in</strong> der Rechtsanwendung sichern und auch ausreichendes Spezialwissen <strong>in</strong> betriebswirtschaftlicher<br />
und steuerrechtlicher H<strong>in</strong>sicht bereitstellen. Die organisationsrechtliche E<strong>in</strong>ordnung der<br />
Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt außerhalb des eigentlichen Staatsaufbaus des Landes <strong>NRW</strong> und die rechtliche Selbstständigkeit<br />
(Unabhängigkeit und Weisungsfreiheit) führen zudem zu e<strong>in</strong>er größeren Nähe zu den Geme<strong>in</strong>den.<br />
2. Zu Absatz 2 (Unabhängigkeit der Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt):<br />
Das Gesetz über die Errichtung e<strong>in</strong>er Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt enthält <strong>in</strong> Artikel 2 das Gesetz über die Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt<br />
(GPAG). Danach ist die Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen<br />
Rechts errichtet worden (vgl. § 1 GPAG). Um ihren Prüfungsauftrag möglichst objektiv gegenüber den<br />
betroffenen Geme<strong>in</strong>den erledigen zu können, enthält dieser Absatz die Regelung, dass die Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt<br />
bei der Durchführung ihrer Aufgaben unabhängig und an Weisungen nicht gebunden ist. Die Unabhängigkeit<br />
der Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt ist für die Anerkennung der überörtlichen Prüfungsergebnisse durch den<br />
Rat der Geme<strong>in</strong>de als Adressaten von grundlegender Bedeutung (vgl. Absatz 5 der Vorschrift). Sie erhöht für<br />
die Adressaten der Prüfungsergebnisse den Wert der gegebenen Informationen über die formelle und materielle<br />
Richtigkeit der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft sowie über die wirtschaftliche Lage der Geme<strong>in</strong>de.<br />
Die Unabhängigkeit der Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt umfasst auch e<strong>in</strong>e sachliche Unabhängigkeit und somit e<strong>in</strong><br />
E<strong>in</strong>griffsverbot <strong>in</strong> die Prüfungstätigkeit aus fachlichen Gesichtspunkten heraus. Dadurch soll e<strong>in</strong>e s<strong>in</strong>nvolle und<br />
effektive Prüfung bei der Geme<strong>in</strong>de durch Ausschluss der fachlichen E<strong>in</strong>flussnahme der zu prüfenden Stellen<br />
garantiert werden. Diese Sachlage erfordert e<strong>in</strong>erseits e<strong>in</strong> umfassendes Prüfungs- und Informationsrecht für die<br />
überörtliche Prüfung, andererseits ist das Ermessen der Prüfer<strong>in</strong>nen und Prüfer bei der Wahl der Prüfungsmethoden<br />
und der Prüfungstiefe relativ groß. Es ist jeweils im Rahmen der überörtlichen Prüfungstätigkeit der Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt,<br />
abhängig von den zu prüfenden Sachverhalten und vorliegenden Bed<strong>in</strong>gungen bei den<br />
zu prüfenden Geme<strong>in</strong>den auszugestalten.<br />
3. Zu Absatz 3 (Aufgabenkatalog der überörtlichen Prüfung):<br />
3.1 Zu Satz 1 (Hervorgehobene Prüfungsaufgaben):<br />
3.1.01 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
In dieser Vorschrift wird der Aufgabenkatalog der überörtlichen Prüfung beschrieben. Die Erledigung der Aufgaben<br />
der überörtlichen Prüfung setzt auch voraus, dass die Geme<strong>in</strong>de die dafür notwendigen Informationen bereitstellt.<br />
Im Rahmen der Prüfung hat die Geme<strong>in</strong>de daher alle für die Prüfung erforderlichen Unterlagen vorzulegen<br />
und alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Der Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt steht e<strong>in</strong> umfassendes Informationsrecht<br />
im Rahmen der Durchführung der überörtlichen Prüfung zu. Dabei werden der Prüfung Leitfäden zu Grunde<br />
gelegt, die zusammen mit kommunalen Praktikern erarbeitet wurden.<br />
Die Ergebnisse der überörtlichen Prüfung werden von der Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt der Geme<strong>in</strong>de und ihrer<br />
Aufsichtsbehörde <strong>in</strong> Form e<strong>in</strong>es Prüfberichts mitgeteilt. Ggf. hat die Geme<strong>in</strong>de gegenüber der Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt<br />
und der Aufsichtsbehörde <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>er dafür bestimmten Frist Stellung zu nehmen, wenn der<br />
Prüfungsbericht der überörtlichen Prüfung Beanstandungen enthält (vgl. Absätze 4 bis 6 der Vorschrift.<br />
GEMEINDEORDNUNG 728
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 105 GO <strong>NRW</strong><br />
3.1.1 Zu Nummer 1 (Prüfung der E<strong>in</strong>haltung rechtlicher Vorgaben und von Staatszuweisungen):<br />
3.1.1.1 Die Prüfung der E<strong>in</strong>haltung rechtlicher Vorgaben<br />
Nach der Vorschrift erstreckt sich die überörtliche Prüfung darauf, ob bei der Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>den<br />
sowie ihrer Sondervermögen die Gesetze und die zur Erfüllung von Aufgaben ergangenen Weisungen (§ 3 Abs. 2<br />
GO <strong>NRW</strong>) e<strong>in</strong>gehalten worden s<strong>in</strong>d. Die E<strong>in</strong>haltung der Gesetze umfasst dabei die gesetzlichen Vorschriften und<br />
die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen. Die Prüfung der von der Geme<strong>in</strong>de<br />
zu beachtenden rechtlichen Vorschriften stellt daher e<strong>in</strong>e re<strong>in</strong>e Gesetz- und Ordnungsmäßigkeitsprüfung dar.<br />
Jedoch muss für den geme<strong>in</strong>dlichen Bereich die Besonderheit berücksichtigt werden, dass die jährliche Haushaltssatzung<br />
nicht für sich alle<strong>in</strong>e steht, sondern durch den damit <strong>in</strong> unmittelbarer Verb<strong>in</strong>dung stehenden Haushaltsplan<br />
näher ausgestaltet wird.<br />
3.1.1.2 Die Prüfung der Verwendung von Staatszuweisungen<br />
Die Vorschrift enthält für die überörtliche Prüfung die weitere besondere Aufgabe, die bestimmungsgemäße Verwendung<br />
der zweckgebundenen Staatszuweisungen (Bundes- und Landesmittel sowie F<strong>in</strong>anzmittel der Europäischen<br />
Union) bei den Geme<strong>in</strong>den zu prüfen. Diese staatlichen F<strong>in</strong>anzmittel werden den Geme<strong>in</strong>den regelmäßig<br />
im Rahmen des staatlichen Zuwendungsrechts gewährt. Sie stellen e<strong>in</strong>en großen Anteil an den gesamten verfügbaren<br />
F<strong>in</strong>anzmitteln der Geme<strong>in</strong>de dar. Die überörtliche erfolgt dabei unabhängig von der örtlichen Rechnungsprüfung,<br />
der als Vorprüfungsstelle die Prüfung der F<strong>in</strong>anzvorfälle gemäß § 100 Abs. 4 der Landeshaushaltsordnung<br />
obliegt (Vgl. § 103 Abs. 1 Nr. 7 GO <strong>NRW</strong>).<br />
Unter dem Begriff „Staatszuweisungen“ s<strong>in</strong>d dabei alle Zuweisungen an die Geme<strong>in</strong>de nach den entsprechenden<br />
staatlichen haushaltsrechtlichen Vorschriften zu verstehen, denn Zuweisungen s<strong>in</strong>d Leistungen an Stellen<br />
außerhalb der Staatsverwaltung. Die Prüfung erstreckt sich darauf, ob die Zuwendungsbed<strong>in</strong>gungen von der<br />
Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>gehalten wurden und ob bei der Verwendung der F<strong>in</strong>anzmittel entsprechend verfahren wurde. Die<br />
Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung der staatlichen Förderungsmittel bei der Geme<strong>in</strong>de ist dabei<br />
unabhängig davon vorzunehmen, ob der Geme<strong>in</strong>de die Staatszuweisungen pauschal oder zweckgerichtet auf<br />
e<strong>in</strong>zelne Maßnahmen gewährt wurden. Bei der Prüfung s<strong>in</strong>d vorhandene Ergebnisse der örtlichen Rechnungsprüfung<br />
zu berücksichtigen.<br />
3.1.2 Zu Nummer 2 (Prüfung der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung):<br />
Nach der Vorschrift erstreckt sich die überörtliche Prüfung auch darauf, ob die Buchführung und die Zahlungsabwicklung<br />
der Geme<strong>in</strong>de ordnungsgemäß durchgeführt worden s<strong>in</strong>d. Diese Prüfung baut auf der örtlichen Rechnungsprüfung<br />
auf, denn die laufende Prüfung der Vorgänge <strong>in</strong> der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung<br />
des Jahresabschlusses und die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Geme<strong>in</strong>de und ihrer<br />
Sondervermögen sowie die Vornahme der Prüfungen obliegen der örtlichen Rechnungsprüfung (vgl. § 103 Abs. 3<br />
Nrn. 4 und 5 GO <strong>NRW</strong>). Dabei ist zu berücksichtigen, dass <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzbuchhaltung alle geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Geschäftsvorfälle und die dadurch bed<strong>in</strong>gten Veränderungen der Vermögens-, Schulden-, Ertrags-<br />
und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de erfasst werden sollen.<br />
Die F<strong>in</strong>anzbuchhaltung der Geme<strong>in</strong>de hat daher die für die überörtliche Prüfung notwendigen Angaben zu machen<br />
und die Daten zu liefern, denn das örtliche Buchungsgeschehen bildet die Grundlage für den geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltsplan mit Ergebnisplan und den F<strong>in</strong>anzplan sowie für den Jahresabschluss der Geme<strong>in</strong>de mit Ergebnisrechnung,<br />
F<strong>in</strong>anzrechnung und der Bilanz bilden sollen. Außerdem ist auch die örtliche Aufgabenteilung zwischen<br />
dem orig<strong>in</strong>ären Buchungsgeschäft der Geme<strong>in</strong>de und dem geme<strong>in</strong>dlichen Zahlungsverkehr <strong>in</strong> die überörtliche<br />
Prüfung e<strong>in</strong>zubeziehen.<br />
GEMEINDEORDNUNG 729
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 105 GO <strong>NRW</strong><br />
Es ist e<strong>in</strong>e Pflicht jeder Geme<strong>in</strong>de, ihre örtliche F<strong>in</strong>anzbuchhaltung so auszugestalten, dass die ordnungsgemäße<br />
Erledigung der Aufgaben gesichert ist und die Verantwortlichen dafür bestimmt s<strong>in</strong>d. Dazu gehört auch, das erforderliche<br />
technische und kaufmännische Fachwissen verfügbar zu haben und die Qualität der Buchführung zu<br />
gewährleisten sowie dafür Sorge zu tragen, dass die Kosten der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em verträglichen<br />
Rahmen bewegen.<br />
3.1.3 Zu Nummer 3 (Prüfung auf sachgerechte und wirtschaftliche Verwaltung):<br />
Nach der Vorschrift soll die überörtliche Prüfung zudem feststellen, ob die Geme<strong>in</strong>de sachgerecht und wirtschaftlich<br />
verwaltet wird (vgl. § 10 GO <strong>NRW</strong>). Durch die zusätzliche E<strong>in</strong>räumung der Prüfungstätigkeit auf<br />
Sachgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit auch auf vergleichender Grundlage werden der überörtlichen Prüfung<br />
neue Möglichkeiten e<strong>in</strong>geräumt. Es ist damit nicht mehr <strong>in</strong> jedem E<strong>in</strong>zelfall auch e<strong>in</strong>e „Nachprüfung“ der Prüfung<br />
der örtlichen Rechnungsprüfung erforderlich, sondern die Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong>sgesamt rückt <strong>in</strong>s Blickfeld der Prüfung.<br />
E<strong>in</strong>e vergleichende Prüfung kann auch besser Schwachstellen im Verwaltungsablauf der Geme<strong>in</strong>de offen legen.<br />
Da die Prüfungserkenntnisse auch <strong>in</strong> Kennzahlen e<strong>in</strong>fließen, bietet die überörtliche Prüfung durch die gewonnenen<br />
Erkenntnisse der geprüften Geme<strong>in</strong>de auch Ansätze zu möglichen (notwendigen) Veränderungen vor Ort.<br />
3.2 Zu Satz 2 (E<strong>in</strong>beziehung vorhandener Prüfungsergebnisse):<br />
Nach der Vorschrift sollen bei der überörtlichen Prüfung die vorhandenen Ergebnisse der örtlichen Rechnungsprüfung<br />
aus der Erledigung ihrer Aufgaben berücksichtigt werden. Daher muss der Aufgabenkatalog der örtlichen<br />
Rechnungsprüfung <strong>in</strong> die Betrachtung e<strong>in</strong>bezogen werden. Die Vorschrift des § 103 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> enthält e<strong>in</strong>e<br />
Aufzählung von Aufgaben für die örtliche Rechnungsprüfung. Dazu gehören neben der Prüfung des Jahresabschlusses<br />
der Geme<strong>in</strong>de und des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses die laufende Prüfung der Vorgänge <strong>in</strong> der<br />
F<strong>in</strong>anzbuchhaltung und die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Geme<strong>in</strong>de sowie weitere Prüfungsaufgaben.<br />
Die überörtliche Prüfung hat außerdem zu berücksichtigen, dass der Rat der Geme<strong>in</strong>de der örtlichen Rechnungsprüfung<br />
weitere Aufgaben übertragen und der Bürgermeister <strong>in</strong>nerhalb se<strong>in</strong>es Amtsbereichs unter Mitteilung an<br />
den Rechnungsprüfungsausschuss der örtlichen Rechnungsprüfung gesonderte Aufträge zur Prüfung erteilen<br />
können. Die <strong>in</strong> der Vorschrift getroffene Regelung soll daher unter Berücksichtigung der Ortsbezogenheit helfen,<br />
mögliche Doppelprüfungen bei der Geme<strong>in</strong>de zu vermeiden. Es kommt dadurch auch zum Ausdruck, dass die<br />
örtliche Prüfung (Rechnungsprüfungsausschuss und örtliche Rechnungsprüfung) und die überörtliche Prüfung<br />
zwei eigenständige Institutionen s<strong>in</strong>d, die aber im Rahmen der Kontrolle des haushaltswirtschaftlichen Handelns<br />
der Geme<strong>in</strong>de zusammen wirken sollen.<br />
4. Zu Absatz 4 (Offenlegung des Prüfungsergebnisses):<br />
4.01 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Nach dieser Vorschrift hat die Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt das aus ihrer überörtlichen Prüfung festgestelltes Prüfungsergebnis<br />
<strong>in</strong> Form e<strong>in</strong>es Prüfberichts mehreren Stellen mitzuteilen, die nachfolgend aufgezeigt werden. Diese<br />
Stellen können vom dem Prüfungsergebnis der geprüften Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> unterschiedlicher Weise betroffen se<strong>in</strong>. So<br />
muss z.B. die Aufsichtsbehörde der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> E<strong>in</strong>zelfällen ggf. über die Ausräumung von Beanstandungen,<br />
die aus der Prüfung der Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt hervorgehen, entscheiden. Der Prüfungsbericht der Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt<br />
über die überörtliche Prüfung bei der Geme<strong>in</strong>de soll dafür e<strong>in</strong>erseits e<strong>in</strong>en schnellen Überblick<br />
GEMEINDEORDNUNG 730
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 105 GO <strong>NRW</strong><br />
über die Prüfungsergebnisse bieten, andererseits aber auch die erzielten Ergebnisse im E<strong>in</strong>zelnen darstellen<br />
sowie e<strong>in</strong> Gesamtergebnis aufzeigen.<br />
Die gesetzliche Regelung legt damit die erste Stufe e<strong>in</strong>es Informations- und Entscheidungsverfahrens fest, das<br />
sich an die überörtliche Prüfung der Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt anschließt. Damit wird dem Informationsbedürfnissen<br />
bestimmter Adressaten des Prüfungsberichtes ausreichend Rechnung getragen. E<strong>in</strong>e allgeme<strong>in</strong>e Veröffentlichungspflicht<br />
des Prüfungsberichtes besteht weder für die Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt noch für die geprüfte Geme<strong>in</strong>de.<br />
4.1 Zu Nummer 1 (Prüfungs<strong>in</strong>formationen an die geprüfte Geme<strong>in</strong>de):<br />
Für die Geme<strong>in</strong>de als Betroffene ist es sehr wichtig, über das Prüfungsergebnis der überörtlichen Prüfung <strong>in</strong>formiert<br />
zu werden. Da sich aus den Prüfungen ggf. Veränderungen für die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft oder<br />
für Verfahrensabläufe <strong>in</strong>nerhalb der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung ergeben können, ist die Offenlegung des Prüfungsergebnisses<br />
der überörtlichen Prüfung gegenüber der Geme<strong>in</strong>de ausdrücklich gesetzlich verankert worden.<br />
Die Ergebnisse der vorgenommenen Analyse werden von der Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt im Rahmen ihres Prüfungsberichtes<br />
als „Feststellung“ bezeichnet. Mit diesen kann sowohl e<strong>in</strong>e positive als auch e<strong>in</strong>e negative Wertung<br />
verbunden se<strong>in</strong>. Zusätzlich werden im Prüfungsbericht von der GPA <strong>NRW</strong> anerkannte Verbesserungspotenziale<br />
als „Empfehlung“ ausgewiesen.<br />
Abhängig von den örtlichen Gegebenheiten wird das Prüfungsergebnis von den Prüfern mit den beteiligten Mitarbeiter<strong>in</strong>nen<br />
und Mitarbeitern <strong>in</strong> den betroffenen Organisationse<strong>in</strong>heiten der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung erörtert.<br />
Auch wird bereits der Entwurf des Prüfungsberichtes der geprüften Geme<strong>in</strong>de zur Kenntnis zugeleitet, so dass<br />
ggf. aufgetretene Missverständnisse vor der Herausgabe der endgültigen Fassung ausgeräumt werden können.<br />
Weitere Informationen erhält die Geme<strong>in</strong>de im Rahmen e<strong>in</strong>er Schlussbesprechung, <strong>in</strong> der von der Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt<br />
das Ergebnis präsentiert wird. Die Ergebnisse der überörtlichen Prüfung sollen den Verantwortlichen<br />
<strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>de möglichst steuerungsrelevante Informationen und Handlungsempfehlungen liefern.<br />
4.2 Zu Nummer 2 (Prüfungs<strong>in</strong>formationen an die Aufsichtsbehörde):<br />
Nach der Vorschrift besteht für die Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt die Verpflichtung, das Prüfungsergebnis über die<br />
im Rahmen der überörtlichen Prüfung geprüfte Geme<strong>in</strong>de der gesetzlich zuständigen Aufsichtsbehörde unmittelbar<br />
mitzuteilen. Diese Pflicht soll e<strong>in</strong>erseits dem Unterrichtungsrecht der Aufsichtsbehörde nach § 121 GO<br />
<strong>NRW</strong> Rechnung tragen und andererseits die Aufsichtsbehörde darauf vorbereiten, dass ggf. e<strong>in</strong>e aufsichtsrechtliche<br />
Entscheidung zu treffen ist, wenn die Geme<strong>in</strong>de die durch die überörtliche Prüfung ausgesprochenen<br />
Beanstandungen nicht beseitigen kann oder will. Für diese Fälle enthält der Absatz 6 dieser Vorschrift besondere<br />
Bestimmungen.<br />
4.3 Zu Nummer 3 (Prüfungs<strong>in</strong>formationen an Fachaufsichtsbehörden):<br />
Nach der Vorschrift besteht für die Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt auch e<strong>in</strong>e Informationspflicht gegenüber den<br />
Fachaufsichtsbehörden, wenn e<strong>in</strong>e unmittelbare fachliche Betroffenheit wegen des Prüfungsergebnisses besteht.<br />
Diese Pflicht gilt auch im Rahmen der Prüfung von zweckgebundenen Staatszuweisungen (Bundes- und<br />
Landesmittel sowie F<strong>in</strong>anzmittel der Europäischen Union), die nach Nummer 1 <strong>in</strong> Absatz 3 der Vorschrift e<strong>in</strong>en<br />
ausdrücklich benannten Prüfungsgegenstand für die überörtliche Prüfung darstellen. Solche F<strong>in</strong>anzmittel werden<br />
im Rahmen des staatlichen Zuwendungsrechts zweckbezogen der Geme<strong>in</strong>de gewährt.<br />
GEMEINDEORDNUNG 731
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 105 GO <strong>NRW</strong><br />
5. Zu Absatz 5 (Verteilung des Prüfungsberichtes <strong>in</strong>nerhalb der Geme<strong>in</strong>de):<br />
5.1 Zu Satz 1 (Weitergabe des Prüfungsberichtes):<br />
5.1.1 Weitergabe an den Rechnungsprüfungsausschuss<br />
Nach der Vorschrift hat der Bürgermeister den von der Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt erhaltenen Prüfungsbericht aus<br />
der <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>de durchgeführten überörtlichen Prüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Beratung<br />
vorzulegen. Dadurch wird der Aufgabe des Rechnungsprüfungsausschusses Rechnung getragen, denn er ist<br />
nach § 57 i.V.m. § 59 sowie 101 und 116 GO <strong>NRW</strong> das zuständige Prüfungsorgan im Rahmen der örtlichen Prüfung<br />
des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses sowie des Gesamtabschlusses der Geme<strong>in</strong>de. Er ist deshalb e<strong>in</strong>er<br />
der wichtigsten Adressaten des Prüfungsberichtes der Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen.<br />
5.1.2 Weitergabe an Sonstige<br />
Die Vorschrift sieht zwar nur ausdrücklich vor, dass der Bürgermeister den Prüfungsbericht der Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt<br />
Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Beratung vorzulegen hat, diese Vorgabe<br />
schließt aber nicht die Weitergabe an andere Gremien oder Beteiligte aus. Als weiterer Adressat könnte aber<br />
z.B. der F<strong>in</strong>anzausschuss nach § 57 i.V.m. § 59 GO <strong>NRW</strong> <strong>in</strong> Betracht kommen, denn dieser Ausschuss hat nach<br />
§ 59 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> die gesetzliche Aufgabe, die Haushaltssatzung der Geme<strong>in</strong>de vorzubereiten und die für die<br />
Ausführung des Haushaltsplans erforderlichen Entscheidungen zu treffen.<br />
In § 59 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> ist dem F<strong>in</strong>anzausschuss bisher zwar nur die Vorbereitung die Haushaltssatzung der<br />
Geme<strong>in</strong>de ausdrücklich zugeordnet. Es ist aber auf Grund des haushaltswirtschaftlichen Stellenwertes des Jahresabschlusses<br />
(auch der Eröffnungsbilanz) im NKF vor deren Feststellung (vgl. § 96 Abs. 1 sowie § 92 Abs. 1<br />
GO <strong>NRW</strong>) e<strong>in</strong>e Vorbereitung durch den F<strong>in</strong>anzausschuss geboten. Dieses Gebot gilt entsprechend für den Gesamtabschluss,<br />
vor dessen Bestätigung (vgl. § 116 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>). Dem F<strong>in</strong>anzausschuss kommt damit unmittelbar<br />
e<strong>in</strong>e entscheidungsvorbereitende Tätigkeit für den Rat der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> haushaltswirtschaftlichen Fragen<br />
und Sachverhalten zu. Nach dieser Aufgabenzuordnung ist es sachlogisch, den F<strong>in</strong>anzausschuss auch über die<br />
Ergebnisse der überörtlichen Prüfung zu unterrichten.<br />
In der Entscheidung des Rechnungsprüfungsausschusses liegt es, auch noch weitere Ausschüsse des Rates der<br />
Geme<strong>in</strong>de ausdrücklich über die Prüfungsergebnisse der überörtlichen Prüfung zu <strong>in</strong>formieren. Dieser Ausschuss<br />
hat nach Satz 2 lediglich die Pflicht, den Rat über die wesentlichen Inhalte des Prüfungsberichtes sowie über das<br />
Ergebnis der Ausschussberatungen zu <strong>in</strong>formieren. Somit besteht ke<strong>in</strong> Anspruch anderer Ausschüsse des Rates<br />
der Geme<strong>in</strong>de ausdrücklich über Prüfungsergebnisse <strong>in</strong>formiert zu werden, denn der Rat als se<strong>in</strong>en Ausschüssen<br />
übergeordnetes Gremium wird <strong>in</strong>formiert.<br />
5.2 Zu Satz 2 (Unterrichtung des Rates):<br />
Nach der Vorschrift obliegt dem Rechnungsprüfungsausschuss als zuständiges Prüfungsorgan des Rates der<br />
Geme<strong>in</strong>de die Pflicht, den Rat über den wesentlichen Inhalt des Prüfungsberichts sowie über das Ergebnis der<br />
Ausschussberatungen zu unterrichten. Diese Vorgabe baut e<strong>in</strong>erseits auf der gesetzlichen Zuständigkeit des<br />
Rechnungsprüfungsausschusses als Pflichtausschuss des Rates auf (vgl. § 57 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>) und andererseits<br />
auf den allgeme<strong>in</strong>en Informationspflichten im Rahmen se<strong>in</strong>er eigenen Ausschusstätigkeit auf. Mit dieser<br />
Regelung wird den Informationsbedürfnissen des Rates der Geme<strong>in</strong>de im Rahmen se<strong>in</strong>er Budgethoheit ausreichend<br />
Rechnung getragen. E<strong>in</strong>e allgeme<strong>in</strong>e Veröffentlichungspflicht, um auch die E<strong>in</strong>wohner und Bürger über<br />
die Ergebnisse der überörtlichen Prüfung der Geme<strong>in</strong>de zu <strong>in</strong>formieren, besteht aber nicht. Die notwendige<br />
GEMEINDEORDNUNG 732
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 105 GO <strong>NRW</strong><br />
Öffentlichkeit zur überörtlichen Prüfung wird regelmäßig durch die Beratungen im Rat sowie se<strong>in</strong>en Ausschüssen<br />
hergestellt.<br />
6. Zu Absatz 6 (Umgang mit E<strong>in</strong>wendungen der überörtlichen Prüfung):<br />
Der Prüfungsbericht der überörtlichen Prüfung über die Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de kann E<strong>in</strong>wendungen<br />
oder Feststellungen und H<strong>in</strong>weise oder Empfehlungen enthalten. Nach Erhalt e<strong>in</strong>es Prüfungsberichtes, der<br />
E<strong>in</strong>wendungen enthält, hat die Geme<strong>in</strong>de die gesetzliche Pflicht und das Recht, gegenüber der Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt<br />
und ihrer Aufsichtsbehörde <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>er dafür bestimmten Frist e<strong>in</strong>e Stellungnahme zu diesem<br />
Prüfungsbericht bzw. den dar<strong>in</strong> enthaltenen E<strong>in</strong>wendungen abzugeben. Die Geme<strong>in</strong>de muss <strong>in</strong> ihrer Stellungnahme<br />
darlegen, wie sie den E<strong>in</strong>wendungen abhilft und ihre Haushaltswirtschaft so führt, dass sie sich <strong>in</strong> der<br />
Zukunft im zulässigen haushaltsrechtlichen Rahmen bewegt. Die Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt hat der Geme<strong>in</strong>de<br />
sollte der Geme<strong>in</strong>de dazu e<strong>in</strong>e Antwort geben.<br />
Kann die Geme<strong>in</strong>de den von der überörtlichen Prüfung vorgetragenen E<strong>in</strong>wendungen nicht nachkommen oder<br />
vertrifft sie zu den im Prüfungsbericht angesprochenen Sachverhalten e<strong>in</strong>e andere Auffassung als von der Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt<br />
im Prüfungsbericht ausgeführt, muss sie dieses <strong>in</strong> ihrer Stellungnahme ausdrücklich<br />
darlegen. Hält die Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt nach dieser geme<strong>in</strong>dlichen Stellungnahme weiterh<strong>in</strong> an ihrer Auffassung<br />
fest, hat sie dieses der Geme<strong>in</strong>de mitzuteilen und sollte gleichzeitig auch die Aufsichtsbehörde der<br />
Geme<strong>in</strong>de darüber <strong>in</strong>formieren. In diesen Fällen hat dann die Geme<strong>in</strong>de ihre Aufsichtsbehörde um e<strong>in</strong>e Entscheidung<br />
<strong>in</strong> der Sache zu bitten. Über das dabei erzielte Ergebnis ist auch die Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt zu<br />
unterrichten. Die von der Aufsichtsbehörde getroffene Entscheidung ist von der Geme<strong>in</strong>de - auch bei gegenteiliger<br />
Auffassung - umzusetzen.<br />
Durch diese Vorschrift wird e<strong>in</strong>e Gleichbehandlung der Geme<strong>in</strong>den beim Auftreten von E<strong>in</strong>wendungen im Rahmen<br />
der überörtlichen Prüfung gewährleistet. Das gesetzlich vorgesehene Verfahren über die Beseitigung der<br />
von der Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt ausgesprochenen E<strong>in</strong>wendungen dürfte sich auf E<strong>in</strong>zelfälle beschränken.<br />
Bereits im Rahmen der Durchführung der überörtlichen Prüfung sollte versucht werden, vorhandene Differenzen<br />
über Sachverhalte der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft auszuräumen. Oftmals enthält daher der Prüfungsbericht<br />
daher nur noch H<strong>in</strong>weise und Empfehlungen, aber ke<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>wendungen mehr, weil bereits im gegenseitigen<br />
E<strong>in</strong>vernehmen zwischen der Geme<strong>in</strong>de und der Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt sowie ggf. der Aufsichtsbehörde<br />
mögliche E<strong>in</strong>wendungen bereits ausgeräumt werden konnten.<br />
7. Zu Absatz 7 (Beratungsrecht der Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt):<br />
7.1 Zu Satz 1 (Beratung bei unterschiedlichen Fragestellungen):<br />
7.01 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Das Gesetz über die Errichtung e<strong>in</strong>er Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt hat dieser auch die Möglichkeit der Beratung von<br />
Körperschaften, Anstalten, Stiftungen und Verbände und E<strong>in</strong>richtungen des öffentlichen Rechts e<strong>in</strong>geräumt, zu<br />
denen auch die Geme<strong>in</strong>den zu zählen s<strong>in</strong>d. E<strong>in</strong>e solche Beratung baut nicht auf e<strong>in</strong>er gesetzlichen Verpflichtung<br />
auf, sondern setzt bei den betreffenden Institutionen e<strong>in</strong>en Bedarf und e<strong>in</strong>e Entscheidung voraus, dass die Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt<br />
als geeignete Stelle diese Aufgabe wahrnehmen soll. Diese Beratung muss von der jeweiligen<br />
Institution auf freiwilliger Basis beauftragt werden. Um diese Aufgabenstellung der Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt<br />
transparent zu machen und klarstellend von der gesetzlichen überörtlichen Prüfung abzugrenzen, enthält diese<br />
Vorschrift die Vorgabe, dass e<strong>in</strong>e Beratung durch die Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt e<strong>in</strong>es vorherigen Antrags der<br />
betreffenden Institution bedarf. Außerdem werden <strong>in</strong> der Vorschrift zwei Beratungsfelder besonders herausgestellt.<br />
GEMEINDEORDNUNG 733
7.1.1 Zu Nummer 1 (Beratung <strong>in</strong> Verwaltungsfragen):<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 105 GO <strong>NRW</strong><br />
Die Vorschrift lässt e<strong>in</strong>e Beratung der Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt <strong>in</strong> Fragen der Organisation und Wirtschaftlichkeit<br />
der öffentlichen Verwaltung bei den genannten Institutionen zu. Diese Beratung kann sich über die gesamten<br />
Möglichkeiten der öffentlich-rechtlichen Verwaltungstätigkeit erstrecken soweit dabei die Fragen der Organisation<br />
und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung im Mittelpunkt der Beratung stehen. Dabei sollen auch Erkenntnisse aus<br />
der überörtlichen Prüfung der Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt <strong>in</strong> die Beratung e<strong>in</strong>fließen, um anhand fundierter Kenntnisse<br />
und praktischer Erfahrungen die notwendigen Beratungsleistungen erbr<strong>in</strong>gen zu können.<br />
7.1.2 Zu Nummer 2 (Beratung <strong>in</strong> bautechnischen Fragen):<br />
Die Beratung der Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt kann bei den genannten Institutionen sich auch auf bautechnische<br />
Fragen erstrecken sowie auf Fragen, die mit der Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von baulichen Maßnahmen<br />
zusammenhängen. Diese Fachkenntnisse, die bei manchen Geme<strong>in</strong>den oftmals nur anlassbezogen<br />
benötigt werden, können daher im E<strong>in</strong>zelfall bei der Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt abgerufen werden. Die Geme<strong>in</strong>de<br />
erspart sich dabei aber das Vorhalten e<strong>in</strong>er Vielzahl von besondere baufachliche Kenntnisse und Unterlagen.<br />
7.2 Zu Satz 2 (Beratung von im öffentlichen Interesse tätigen juristischen Personen):<br />
Die Vorschrift lässt auch e<strong>in</strong>e Beratung durch die Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt bei sonstigen im öffentlichen Interesse<br />
tätigen juristischen Personen zu und erweitert damit den möglichen Kreis von Institutionen und Stellen, die auf<br />
freiwilliger Basis besondere Leistungen der Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt <strong>in</strong> Anspruch nehmen können. Auch hier<br />
kann - wie zuvor bei dem durch Satz 1 der Vorschrift bestimmten Adressatenkreis - nur e<strong>in</strong>e Beratung von der<br />
Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt durchgeführt werden, wenn dieses zuvor von der juristischen Person beantragt wurde.<br />
Die Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt kann außerdem die juristische Person sowohl <strong>in</strong> Verwaltungsfragen als auch <strong>in</strong><br />
bautechnischen Fragen beraten, auch wenn <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>deordnung - anders als im Gesetz über die Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt<br />
- der Satz 2 technisch an die e<strong>in</strong>gerückte Nummer 2 des Satz 1 angefügt worden ist. Es ist <strong>in</strong><br />
diesen Fall sachgerecht, die Vorschrift des Satzes 2 nach ihrer Fassung im Gesetz über die Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt<br />
, also auf die Nummern 1 und 2 des Satzes 1 anzuwenden und nicht nur auf die Nummer 2 dieses Satzes.<br />
8. Zu Absatz 8 (Sicherung der Unabhängigkeit der Prüfer):<br />
8.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Nach der Vorschrift dürfen Prüfer der Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt, die bei den Geme<strong>in</strong>den Prüfungsaufgaben nach<br />
§ 92 Abs. 5 oder nach § 103 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 GO <strong>NRW</strong> durchgeführt oder daran mitgewirkt haben, nicht an<br />
der überörtlichen Prüfung der Geme<strong>in</strong>de mitwirken. Um die Unabhängigkeit der Prüfer bei der überörtlichen Prüfung<br />
zu erhalten, ist deshalb e<strong>in</strong> Mitwirkungsverbot für die Prüfer an e<strong>in</strong>er überörtlichen Prüfung gesetzlich verankert<br />
worden. Damit soll e<strong>in</strong> Selbstprüfungsverbot gewährleistet und sichergestellt werden, dass Prüfer der Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt,<br />
die bereits als Dritte an örtlichen Prüfungen dieser Geme<strong>in</strong>de mitgewirkt haben, nicht als<br />
Prüfer bei der überörtlichen Prüfung derselben Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>gesetzt werden.<br />
Diese Vorschrift verweist nicht ausdrücklich auf die Vorschrift des § 103 Abs. 7 GO <strong>NRW</strong>. Gleichwohl sollten die<br />
Ausschlussgründe für Prüfer auch bei e<strong>in</strong>er überörtlichen Prüfung der Geme<strong>in</strong>de Anwendung f<strong>in</strong>den. Daher sollten<br />
auch die Prüfer nicht an e<strong>in</strong>er überörtlichen Prüfung der Geme<strong>in</strong>de mitwirken, wenn sie z.B. Mitglied des<br />
Rates der Geme<strong>in</strong>de, Angehöriger des Bürgermeisters, des Kämmerers oder des Verantwortlichen für die Zahlungsabwicklung<br />
oder se<strong>in</strong>es Stellvertreters s<strong>in</strong>d.<br />
GEMEINDEORDNUNG 734
8.2 Betroffene Prüfungsaufgaben<br />
8.2.1 Der Verweis auf § 92 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong><br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 105 GO <strong>NRW</strong><br />
Nach der Vorschrift hat der Rechnungsprüfungsausschuss des Rates der Geme<strong>in</strong>de die Eröffnungsbilanz vor<br />
ihrer Feststellung zu prüfen. Er hat die Inventur, das Inventar und die Übersicht über örtlich festgelegte Restnutzungsdauern<br />
der Vermögensgegenstände <strong>in</strong> se<strong>in</strong>e Prüfung e<strong>in</strong>zubeziehen und über Art und Umfang der Prüfung<br />
sowie über das Ergebnis der Prüfung ist e<strong>in</strong> Prüfungsbericht zu erstellen. Der Umfang und der Inhalt der Prüfung<br />
der Eröffnungsbilanz erstrecken sich grundsätzlich auf die E<strong>in</strong>haltung der gesetzlichen Vorschriften. Daher s<strong>in</strong>d<br />
die Eröffnungsbilanz und der Anhang dah<strong>in</strong>gehend zu prüfen, ob sie unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger<br />
Buchführung e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und der Schuldenlage<br />
der Geme<strong>in</strong>de zu vermitteln.<br />
Die örtliche Prüfung der geme<strong>in</strong>dlichen Eröffnungsbilanz hat aber auch e<strong>in</strong>e Kontroll-, Informations- und Beglaubigungsfunktion<br />
(vgl. § 322 HGB) und f<strong>in</strong>det ihre spätere Fortsetzung <strong>in</strong> der Prüfung der jährlichen Bilanz, die<br />
Bestandteil des Jahresabschlusses der Geme<strong>in</strong>de ist. Dieser örtlichen Prüfung folgt dann noch die überörtliche<br />
Prüfung der geme<strong>in</strong>dlichen Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 6 GO <strong>NRW</strong> durch Prüfer der Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt.<br />
Durch den Verweis <strong>in</strong> der Vorschrift soll daher e<strong>in</strong> Selbstprüfungsverbot von Prüfern sichergestellt werden.<br />
8.2.2 Der Verweis auf § 103 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong><br />
8.2.2.1 Der Verweis auf § 103 Abs. 1 Nr. 1 GO <strong>NRW</strong><br />
Die Prüfung des Jahresabschlusses ist nach der Vorschrift e<strong>in</strong>e Pflichtaufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung<br />
und Voraussetzung für die Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat sowie für die Entlastung des Bürgermeisters<br />
(vgl. § 96 GO <strong>NRW</strong>). Der Inhalt und die Durchführung der Prüfung sowie die Zuständigkeit für die<br />
Durchführung der Prüfung, aber auch die Behandlung des Prüfungsergebnisses s<strong>in</strong>d gesondert <strong>in</strong> § 101 GO<br />
<strong>NRW</strong> „Prüfung des Jahresabschlusses, Bestätigungsvermerk“ geregelt. Der Jahresabschluss der Geme<strong>in</strong>de ist<br />
danach vom Rechnungsprüfungsausschuss dah<strong>in</strong>gehend zu prüfen, ob er e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen<br />
entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de unter Beachtung der<br />
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ergibt.<br />
Die Prüfung des Jahresabschlusses erstreckt sich darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden<br />
Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden s<strong>in</strong>d. Es ist aber auch das Ergebnis<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr zu prüfen, denn die Geme<strong>in</strong>de<br />
hat zum Schluss e<strong>in</strong>es jeden Haushaltsjahres e<strong>in</strong>en Jahresabschluss aufzustellen, <strong>in</strong> dem das Ergebnis der<br />
Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist (vgl. § 95 Abs. 1 S. 1 GO <strong>NRW</strong>). In die Prüfung s<strong>in</strong>d<br />
die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände<br />
e<strong>in</strong>zubeziehen. Der Lagebericht ist darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss <strong>in</strong><br />
E<strong>in</strong>klang steht und ob se<strong>in</strong>e sonstigen Angaben nicht e<strong>in</strong>e falsche Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-,<br />
Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de erwecken.<br />
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat über Art und Umfang der Prüfung sowie über das Ergebnis der Prüfung<br />
e<strong>in</strong>en Prüfungsbericht zu erstellen. Der Bestätigungsvermerk oder der Vermerk über se<strong>in</strong>e Versagung ist <strong>in</strong> den<br />
Prüfungsbericht aufzunehmen. In die vorzunehmende Prüfung s<strong>in</strong>d alle Bestandteile des Jahresabschlusses der<br />
Geme<strong>in</strong>de sowie die dazugehörigen Anlagen e<strong>in</strong>zubeziehen. Die für den Rechnungsprüfungsausschuss tätigen<br />
Abschlussprüfer haben sich deshalb e<strong>in</strong>en Überblick über die rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der<br />
Geme<strong>in</strong>de zu verschaffen. Aus der abschließenden E<strong>in</strong>schätzung ist dann das durchzuführende Prüfungsprogramm<br />
zu entwickeln. Die örtliche Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses als jährlich durchzuführende<br />
Abschlussprüfung hat zudem e<strong>in</strong>e Kontroll-, Informations- und Beglaubigungsfunktion (vgl. § 322 HGB). Ihr folgt<br />
GEMEINDEORDNUNG 735
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 105 GO <strong>NRW</strong><br />
dann noch die überörtliche Prüfung durch Prüfer der Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt. Durch den Verweis <strong>in</strong> der Vorschrift<br />
soll daher e<strong>in</strong> Selbstprüfungsverbot von Prüfern sichergestellt werden.<br />
8.2.2.2 Der Verweis auf § 103 Abs. 1 Nr. 3 GO <strong>NRW</strong><br />
Die Prüfung des Gesamtabschlusses ist Pflichtaufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung und Voraussetzung für<br />
die Bestätigung des Gesamtabschlusses durch den Rat sowie für die Entlastung des Bürgermeisters (vgl. § 116<br />
i.V.m. § 96 GO <strong>NRW</strong>). Der Inhalt und die Durchführung der Prüfung s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> § 116 Abs. 6 GO <strong>NRW</strong> geregelt. In<br />
diesen Vorschriften wird zudem auf die Vorschrift des § 101 Abs. 2 bis 8 GO <strong>NRW</strong> verwiesen, so dass wegen der<br />
E<strong>in</strong>zelheiten auf die Erläuterungen zur Prüfung des Jahresabschlusses und den Bestätigungsvermerk verwiesen<br />
wird.<br />
Der Gesamtabschluss der Geme<strong>in</strong>de ist danach vom Rechnungsprüfungsausschuss dah<strong>in</strong>gehend zu prüfen, ob<br />
er e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzgesamtlage<br />
der Geme<strong>in</strong>de unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ergibt. Die Prüfung des<br />
Gesamtabschlusses erstreckt sich darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen<br />
und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden s<strong>in</strong>d.<br />
Der Gesamtlagebericht ist auch darauf zu prüfen, ob er mit dem Gesamtabschluss <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang steht und ob se<strong>in</strong>e<br />
sonstigen Angaben nicht e<strong>in</strong>e falsche Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzgesamtlage<br />
der Geme<strong>in</strong>de erwecken. In die vorzunehmende Prüfung s<strong>in</strong>d alle Bestandteile des Gesamtabschlusses der<br />
Geme<strong>in</strong>de sowie die dazugehörigen Anlagen e<strong>in</strong>zubeziehen. Der Abschlussprüfer hat sich deshalb e<strong>in</strong>en Überblick<br />
über die rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Geme<strong>in</strong>de zu verschaffen. Aus der abschließenden<br />
E<strong>in</strong>schätzung ist dann das durchzuführende Prüfungsprogramm zu entwickeln.<br />
Die örtliche Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses als jährlich durchzuführende Abschlussprüfung hat<br />
zudem e<strong>in</strong>e Kontroll-, Informations- und Beglaubigungsfunktion (vgl. § 322 HGB). Dieser Prüfung folgt dann noch<br />
die überörtliche Prüfung durch Prüfer der Geme<strong>in</strong>deprüfungsanstalt. Durch den Verweis <strong>in</strong> der Vorschrift soll<br />
daher e<strong>in</strong> Selbstprüfungsverbot von Prüfern sichergestellt werden.<br />
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ<br />
GEMEINDEORDNUNG 736
1. Allgeme<strong>in</strong>es<br />
1.1 Zwecke des Gesamtabschlusses<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
12. Teil GO <strong>NRW</strong><br />
12. Teil<br />
Gesamtabschluss<br />
Mit diesem neu e<strong>in</strong>gefÄgten Teil der Geme<strong>in</strong>deordnung wird e<strong>in</strong> wichtiges Ziel der Reform des Haushaltsrechts,<br />
nÅmlich die Erreichung bzw. RÄckgew<strong>in</strong>nung des GesamtÄberblicks Äber die VermÇgens-, Schulden-, F<strong>in</strong>anzund<br />
Ertragslage der Geme<strong>in</strong>de, umgesetzt. Die Geme<strong>in</strong>de hat zu diesem Zweck zukÄnftig jÅhrlich e<strong>in</strong>en Gesamtabschluss<br />
zu erstellen, der ihre geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe (verselbststÅndigte Aufgabenbereiche) erfasst und sich<br />
an die handelsrechtlichen Vorschriften Äber den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht (vgl. ÉÉ 290 ff.<br />
HGB) anlehnt. Der bisherige Beteiligungsbericht stellt wegen des engen Sachzusammenhangs zum Gesamtabschluss<br />
e<strong>in</strong>e ErgÅnzung dazu dar und ist daher diesem beizufÄgen (vgl. É 117 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>).<br />
Im geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss werden die JahresabschlÄsse der Çffentlich-rechtlichen und der privatrechtlichen<br />
Betriebe der Geme<strong>in</strong>de zusammen mit dem Jahresabschluss der geme<strong>in</strong>dlichen Kernverwaltung konsolidiert<br />
und dadurch e<strong>in</strong> Bild Äber die wirtschaftliche Gesamtlage der Geme<strong>in</strong>de geschaffen. Das nachfolgende<br />
angepasste Schaubild (Quelle: NKF-Dokumentation 2003 S. 477) verdeutlicht die geme<strong>in</strong>dliche E<strong>in</strong>heit aus den<br />
Çffentlich-rechtlichen und den privatrechtlichen Betrieben der Geme<strong>in</strong>de, die zusammen mit der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Kernverwaltung den „Konzern Kommune“ bilden (vgl. Abbildung).<br />
Kernverwaltung<br />
“Konzern Kommune”<br />
Privatrechtliche<br />
Betriebe<br />
Kapitalgesellschaften<br />
Rechtlich selbst- ,<br />
stÄndige Stiftungen<br />
GEMEINDEORDNUNG 737<br />
SelbststÄndige “Kommunale Betriebe”<br />
Anstalten des<br />
Åffentlichen Rechts<br />
Abbildung 146 „Kommunaler Konzern“<br />
Éffentlich-rechtliche Betriebe<br />
Eigenbetriebe und<br />
eigenbetriebsÄhnliche<br />
E<strong>in</strong>richtungen<br />
ZweckverbÄnde<br />
Durch die Zusammenfassung der JahresabschlÄsse im geme<strong>in</strong>dlichen Bereich sollen InformationsmÅngel aus<br />
dem Jahresabschluss der geme<strong>in</strong>dlichen Kernverwaltung und den JahresabschlÄssen der geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe<br />
<strong>in</strong> Bezug auf die Gesamtlage der Geme<strong>in</strong>de behoben werden. Die gewÅhlte Bezeichnung „Gesamtabschluss“<br />
verkÇrpert dabei auch den E<strong>in</strong>heitsgedanken und dient diesem Ziel.<br />
1.2 Der Begriff „Gesamtabschluss“<br />
Die Zielsetzung und der Zweck, e<strong>in</strong>en GesamtÄberblick Äber die VermÇgens-, Schulden-, F<strong>in</strong>anz- und Ertragslage<br />
der Geme<strong>in</strong>de (wirtschaftliche Lage der Geme<strong>in</strong>de) zu gew<strong>in</strong>nen, erforderte, dem neu geschaffenen Informations<strong>in</strong>strument<br />
e<strong>in</strong>e zutreffende Bezeichnung zu geben. In Anlehnung an das Referenzmodell HGB, aus dem die<br />
Bestandteile sowie e<strong>in</strong>ige Vorschriften Äber die Inhalte und die Aufstellung dieses Informations<strong>in</strong>strument Äber-
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
12. Teil GO <strong>NRW</strong><br />
nommen bzw. abgeleitet wurden, entstand fÄr den handelsrechtlichen Begriff „Konzernabschluss“ die Bezeichnung<br />
„Gesamtabschluss“ fÄr den geme<strong>in</strong>dlichen Bereich. Diese Bezeichnung soll e<strong>in</strong>erseits verdeutlichen, dass<br />
mit dem geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss e<strong>in</strong>e zusammenfassende Darstellung der wirtschaftlichen Gesamtlage<br />
der Geme<strong>in</strong>de erfolgt. Andererseits sollte der Begriff dem Zweck und den Bestandteilen e<strong>in</strong>es Abschlusses nach<br />
Ablauf e<strong>in</strong>es GeschÅftsjahres bzw. e<strong>in</strong>es Haushaltsjahres <strong>in</strong> ausreichendem MaÜe gerecht werden. Auch sollen<br />
durch den Begriff die Besonderheiten wiedergespiegelt werden, die im Çffentlichen Bereich gegenÄber dem privatrechtlichen<br />
Bereich bestehen.<br />
1.3 Anwendung der E<strong>in</strong>heitsgrundsÇtze<br />
1.3.1 Der Grundsatz „Fiktion der wirtschaftlichen E<strong>in</strong>heit“<br />
Die gesetzliche Festlegung von Ziel und Zweck des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses soll zu e<strong>in</strong>em Gesamt-<br />
Äberblick Äber die VermÇgens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de fÄhren, mit dem auch e<strong>in</strong><br />
haushaltswirtschaftlich zutreffendes Ergebnis der gesamten jahresbezogenen TÅtigkeit (AufgabenerfÄllung) der<br />
Geme<strong>in</strong>de darzustellen ist. Diese rechtlichen Vorgaben zielen darauf ab, dass dem geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss<br />
die „Fiktion der wirtschaftlichen E<strong>in</strong>heit“ zu Grunde zu legen ist. Das Vorliegen e<strong>in</strong>e faktischen wirtschaftlichen<br />
E<strong>in</strong>heit kann i.d.R. nicht angenommen werden, denn viele geme<strong>in</strong>dliche Betriebe des Vollkonsolidierungskreises<br />
fÄhren zwar geme<strong>in</strong>dliche Aufgaben durch, doch dieses selbststÅndig und s<strong>in</strong>d wirtschaftlich betrachtet<br />
nicht wie e<strong>in</strong> Fachbereich oder e<strong>in</strong>e Abteilung der geme<strong>in</strong>dlichen Kernverwaltung tÅtig. Dieser Betrachtung bedarf<br />
es aber fÄr den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss, so dass die E<strong>in</strong>heitstheorie <strong>in</strong> Form der „Fiktion der wirtschaftlichen<br />
E<strong>in</strong>heit“ durch die Geme<strong>in</strong>de umzusetzen ist.<br />
Um e<strong>in</strong>e „wirtschaftliche E<strong>in</strong>heit“ zwischen den Betrieben der Geme<strong>in</strong>de und der geme<strong>in</strong>dlichen Kernverwaltung<br />
zu schaffen, genÄgt es nicht, die e<strong>in</strong>zelnen JahresabschlÄsse unkoord<strong>in</strong>iert zusammen zu rechnen. Vielmehr ist<br />
unter BerÄcksichtigung der Verflechtungen zwischen der geme<strong>in</strong>dlichen Kernverwaltung und den Betrieben der<br />
Geme<strong>in</strong>de sowie zwischen den Betrieben selbst vergleichbar dem Jahresabschluss der geme<strong>in</strong>dlichen Kernverwaltung<br />
e<strong>in</strong> haushaltswirtschaftliches Ergebnis fÄr die gesamte TÅtigkeit der Geme<strong>in</strong>de sowie die daraus entstandene<br />
VermÇgens- und Schuldengesamtlage zu ermitteln. Es bedarf dazu der e<strong>in</strong>heitlichen Anwendung von Ansatz-,<br />
Bewertungs- und Ausweisregeln sowie der Abgrenzung und Elim<strong>in</strong>ierung „konzern<strong>in</strong>terner“ Beziehungen.<br />
Der geme<strong>in</strong>dliche Gesamtabschluss macht dabei die JahresabschlÄsse der geme<strong>in</strong>dlichen Kernverwaltung und<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe nicht ÄberflÄssig.<br />
1.3.2 Verzicht auf Grundsatz „Fiktion der rechtlichen E<strong>in</strong>heit“<br />
Dem E<strong>in</strong>heitsgedanken wird durch die Konsolidierung der JahresabschlÄsse der geme<strong>in</strong>dlichen Kernverwaltung<br />
und der Betriebe der Geme<strong>in</strong>de zwar vollstÅndig Rechnung getragen, durch das Nebene<strong>in</strong>ander von Çffentlichrechtlichen<br />
und privatrechtlichen Betrieben ist jedoch die s<strong>in</strong>nvolle Schaffung e<strong>in</strong>er rechtlich zu betrachtenden<br />
E<strong>in</strong>heit „Geme<strong>in</strong>de“ erschwert, auch wenn „Unternehmensverb<strong>in</strong>dungen“ auch im geme<strong>in</strong>dlichen Bereich bestehen.<br />
Auch die „Fiktion der rechtlichen E<strong>in</strong>heit“ wird durch die tatsÅchlichen rechtlichen VerhÅltnisse <strong>in</strong> Form von<br />
Çffentlichem und privatem Recht sowie von Bundes- und Landesrecht nur e<strong>in</strong>geschrÅnkt anwendbar. Gleichwohl<br />
wirkt sich die „Fiktion der rechtlichen E<strong>in</strong>heit“ beim geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss m<strong>in</strong>destens mittelbar aus.<br />
Die Auswirkungen zeigen sich <strong>in</strong>sbesondere dann, wenn die „konzern<strong>in</strong>ternen“ Beziehungen, z.B. aus Lieferungen<br />
und Leistungen zwischen den Betrieben und der geme<strong>in</strong>dlichen Kernverwaltung zu elim<strong>in</strong>ieren bzw. aufzurechnen<br />
s<strong>in</strong>d. FÅnde aber der Grundsatz der „Fiktion der rechtlichen E<strong>in</strong>heit“ <strong>in</strong> vollem Umfang auch beim geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Gesamtabschluss Anwendung, wÅre e<strong>in</strong> strenger MaÜstab an die Umsetzung der „E<strong>in</strong>heitlichkeit“<br />
und an den Umgang mit Ansatz-, Bewertungs- und Ausweissachverhalten bei der geme<strong>in</strong>dlichen Kernverwaltung<br />
und den geme<strong>in</strong>dlichen Betrieben nach den Vorgaben fÄr den Jahresabschluss der geme<strong>in</strong>dlichen Kernverwal-<br />
GEMEINDEORDNUNG 738
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
12. Teil GO <strong>NRW</strong><br />
tung anzulegen. Der Verzicht auf den Grundsatz kÇnnte deshalb u.a. auch die Aufstellung des Gesamtabschlusses<br />
erleichtern.<br />
2. Das Mutter-Tochter-VerhÇltnis im geme<strong>in</strong>dlichen Bereich<br />
2.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Im Gesamtabschluss der Geme<strong>in</strong>de sollen die VermÇgens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der <strong>in</strong> den Gesamtabschluss<br />
e<strong>in</strong>bezogenen geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe und der Geme<strong>in</strong>de (Kernverwaltung) <strong>in</strong>sgesamt so dargestellt<br />
werden, als ob es sich bei der Geme<strong>in</strong>de um e<strong>in</strong> e<strong>in</strong>ziges wirtschaftliches „Unternehmen“ handeln wÄrde.<br />
Dies erfordert e<strong>in</strong>erseits, die organisatorischen Gegebenheiten der Geme<strong>in</strong>de bei ihrer AufgabenerfÄllung h<strong>in</strong>sichtlich<br />
des Vorliegens e<strong>in</strong>es Mutter-Tochter-VerhÅltnisses zu prÄfen. Unter E<strong>in</strong>beziehung der konzeptionellen<br />
Vorschrift des É 116 GO <strong>NRW</strong> ist die Geme<strong>in</strong>de als Çffentlich-rechtliche „Muttere<strong>in</strong>heit“ e<strong>in</strong>zustufen. Dieser E<strong>in</strong>heit<br />
obliegt dann die Pflicht, jÅhrlich e<strong>in</strong>en Gesamtabschluss unter E<strong>in</strong>beziehung ihrer Çffentlichen Tochtere<strong>in</strong>heiten<br />
(Betriebe) aufzustellen. Dieses kommt u.a. dann zum Ausdruck, dass e<strong>in</strong>e Vollkonsolidierung im S<strong>in</strong>ne des É<br />
50 Abs. 1 und 2 GemHVO <strong>NRW</strong> vorzunehmen ist. Andererseits entsteht dadurch e<strong>in</strong>e Gesamtsicht der Geme<strong>in</strong>de,<br />
die bei zu klÅrenden Fragestellungen dadurch zum Ausdruck kommt, dass mit Blick zu prÄfen ist: „Wie wÄrde<br />
gehandelt bzw. entschieden, wenn der jeweilige geme<strong>in</strong>dliche Betrieb noch e<strong>in</strong> Teil der geme<strong>in</strong>dlichen Kernverwaltung<br />
wÅre“.<br />
Im S<strong>in</strong>ne des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses wird jede wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche BetÅtigung der<br />
Geme<strong>in</strong>de auÜerhalb ihrer Kernverwaltung und zwar unabhÅngig davon, ob diese BetÅtigung <strong>in</strong> Çffentlichrechtlicher<br />
oder privatrechtlicher Form erfolgt, als „geme<strong>in</strong>dlicher Betrieb“ bezeichnet. Solche geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Betriebe kÇnnen daher als Çffentliche Tochtere<strong>in</strong>heiten betrachtet werden, soweit jeweils die dafÄr e<strong>in</strong>schlÅgigen<br />
Voraussetzungen im S<strong>in</strong>ne des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses vorliegen. E<strong>in</strong> Mutter-Tochter-VerhÅltnis<br />
zwischen der Geme<strong>in</strong>de und ihren Betrieben wird deshalb nicht nur <strong>in</strong> den Formen des Privatrechts - wie nach<br />
dem HGB -, sondern auch <strong>in</strong> Çffentlich-rechtlicher Form begrÄndet. Dadurch kÇnnen nicht nur unmittelbare, sondern<br />
auch mittelbare Beziehungen und VerknÄpfungen zwischen der Geme<strong>in</strong>de und ihren Betrieben sowie zwischen<br />
den geme<strong>in</strong>dlichen Betrieben entstehen. In diesem Zusammenhang ist deshalb auch zwischen verbundenen<br />
Unternehmen, Beteiligungen und SondervermÇgen zu unterscheiden.<br />
2.2 Verbundene Unternehmen als geme<strong>in</strong>dliche Tochtere<strong>in</strong>heiten<br />
Als „verbundene Unternehmen“ s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz jene Betriebe der Geme<strong>in</strong>de gesondert anzusetzen,<br />
die im geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss voll zu konsolidieren s<strong>in</strong>d. Dies ist bei geme<strong>in</strong>dlichen Betrieben des<br />
privaten Rechts der Fall, wenn diese unter der e<strong>in</strong>heitlichen Leitung der Geme<strong>in</strong>de stehen bzw. die Geme<strong>in</strong>de auf<br />
das Unternehmen e<strong>in</strong>en beherrschenden E<strong>in</strong>fluss ausÄbt (vgl. É 15 ff. AktG sowie É 290 HGB). E<strong>in</strong> solcher E<strong>in</strong>fluss<br />
der Geme<strong>in</strong>de auf e<strong>in</strong>en Betrieb ist i.d.R. anzunehmen, wenn e<strong>in</strong>e Beteiligung an dem Betrieb von mehr als<br />
50 % vorliegt oder andere GrÄnde, z.B. e<strong>in</strong> Vertrag, fÄr e<strong>in</strong>en solchen E<strong>in</strong>fluss sprechen. Die Eigengesellschaften<br />
der Geme<strong>in</strong>de, die dadurch gekennzeichnet s<strong>in</strong>d, dass die Geme<strong>in</strong>de alle<strong>in</strong>ige Gesellschafter<strong>in</strong> des Unternehmens<br />
ist (Beteiligungsquote von 100 v.H.), s<strong>in</strong>d regelmÅÜig als verbundene Unternehmen e<strong>in</strong>zuordnen. In diesem<br />
Zusammenhang ist darauf zu verweisen, dass e<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>dlicher Betrieb <strong>in</strong> der Form des privaten Rechts, der<br />
e<strong>in</strong>e Tochtere<strong>in</strong>heit der Geme<strong>in</strong>de ist, nicht die PrÄfungsbefreiung fÄr se<strong>in</strong>en Jahresabschluss nach É 264 Abs. 3<br />
HGB <strong>in</strong> Anspruch nehmen kann.<br />
GEMEINDEORDNUNG 739
2.3 Beteiligungen als geme<strong>in</strong>dliche Tochtere<strong>in</strong>heiten<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
12. Teil GO <strong>NRW</strong><br />
Als „Beteiligungen“ s<strong>in</strong>d alle Anteile der Geme<strong>in</strong>de, d.h. die mitgliedschaftlichen VermÇgens- und Verwaltungsrechte<br />
an geme<strong>in</strong>dlichen Betrieben e<strong>in</strong>zuordnen, die <strong>in</strong> der Absicht gehalten werden, e<strong>in</strong>e dauernde Verb<strong>in</strong>dung<br />
zu diesem Betrieb herzustellen. E<strong>in</strong> Ansatz <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz setzt dabei voraus, dass diese Verb<strong>in</strong>dung<br />
dem geme<strong>in</strong>dlichen GeschÅftsbetrieb dient und e<strong>in</strong>en Beitrag zur AufgabenerfÄllung der Geme<strong>in</strong>de leistet<br />
oder leisten kann. E<strong>in</strong>e Beteiligung der Geme<strong>in</strong>de liegt i.d.R. vor, wenn sie an e<strong>in</strong>em Unternehmen mit mehr als<br />
20 v.H. beteiligt ist (vgl. É 271 Abs. 1 HGB). Als Beteiligungen kommen dabei <strong>in</strong> Betracht:<br />
- Anteile an Kapitalgesellschaften (dies betrifft auch geme<strong>in</strong>nÄtzige Gesellschaften) und<br />
- Anteile an sonstigen juristischen Personen.<br />
E<strong>in</strong>e Trennung <strong>in</strong> Unternehmen und E<strong>in</strong>richtungen nach den É 107 GO <strong>NRW</strong> (ZulÅssigkeit wirtschaftlicher BetÅtigung)<br />
und É 108 GO <strong>NRW</strong> (Unternehmen und E<strong>in</strong>richtungen des privaten Rechts) ist hier nicht relevant. Soweit<br />
dabei geme<strong>in</strong>dliche Betriebe <strong>in</strong> der Rechtsform des privaten Rechts e<strong>in</strong>zubeziehen s<strong>in</strong>d, ist der Unternehmensbegriff<br />
im handelsrechtlichen S<strong>in</strong>ne anzuwenden. Entsprechend dem Handelsrecht ist es dabei unerheblich, ob<br />
die Anteile an diesen geme<strong>in</strong>dlichen Betrieben <strong>in</strong> Wertpapieren verbrieft s<strong>in</strong>d oder nicht.<br />
2.4 SondervermÉgen als geme<strong>in</strong>dliche Tochtere<strong>in</strong>heiten<br />
Zu den geme<strong>in</strong>dlichen „SondervermÇgen“ (vgl. nach É 97 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>), die <strong>in</strong> den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss<br />
e<strong>in</strong>bezogen werden, gehÇren die wirtschaftlichen Unternehmen (vgl. É 114 GO <strong>NRW</strong>) und die organisatorisch<br />
verselbststÅndigten E<strong>in</strong>richtungen (vgl. É 107 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>) ohne eigene RechtspersÇnlichkeit (vgl. É 97<br />
Abs. 1 Nr. 3 GO <strong>NRW</strong>). Diese Betriebe (Eigenbetriebe und eigenbetriebsÅhnliche E<strong>in</strong>richtungen) s<strong>in</strong>d wichtige<br />
Organisationsgebilde der Geme<strong>in</strong>de, die wirtschaftlich und verwaltungsmÅÜig selbststÅndig s<strong>in</strong>d (vgl. Eigenbetriebsverordnung<br />
(EigVO <strong>NRW</strong>). FÄr diese geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe werden Sonderrechnungen und eigene JahresabschlÄsse<br />
verlangt. Auch die rechtlich unselbststÅndigen Versorgungs- und Versicherungse<strong>in</strong>richtungen<br />
stellen <strong>in</strong> den Gesamtabschluss e<strong>in</strong>zubeziehende SondervermÇgen der Geme<strong>in</strong>de dar, z.B. eigene Zusatzversorgungskassen<br />
oder Eigenunfallversicherungen, anzusetzen, wenn fÄr diese e<strong>in</strong>e entsprechend abgesonderte<br />
Haushalts- und WirtschaftsfÄhrung mit e<strong>in</strong>em eigenen Jahresabschluss erfolgt (vgl. É 97 Abs. 1 Nr. 4 GO <strong>NRW</strong>).<br />
3. Die Schritte zum geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss<br />
Die Geme<strong>in</strong>den s<strong>in</strong>d nach É 116 GO <strong>NRW</strong> verpflichtet, jÅhrlich zu e<strong>in</strong>em festen Abschlussstichtag e<strong>in</strong>en Gesamtabschluss<br />
unter Beachtung der GrundsÅtze ordnungsmÅÜiger BuchfÄhrung (GoB) aufzustellen. Neben diesen<br />
GrundsÅtzen hat die Geme<strong>in</strong>de fÄr ihren Gesamtabschluss auch die GrundsÅtze ordnungsmÅÜiger Konzernrechnungslegung<br />
(GoK), die sich <strong>in</strong> der <strong>in</strong> der Privatwirtschaft entwickelt haben, zu beachten. Bei der Aufstellung des<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses s<strong>in</strong>d auÜerdem die Çrtlichen Besonderheiten zu berÄcksichtigen. Sie werden<br />
die Arbeiten zur Aufstellung des Gesamtabschlusses <strong>in</strong> fachlicher und zeitlicher H<strong>in</strong>sicht wesentlich bee<strong>in</strong>flussen.<br />
Die Aufstellung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses erfordert daher mehrere Schritte, die aufe<strong>in</strong>ander aufbauen<br />
und aufe<strong>in</strong>ander abgestimmt se<strong>in</strong> mÄssen.<br />
E<strong>in</strong>es der wichtigsten Schritte zur Aufstellung des Gesamtabschlusses ist die Erstellung e<strong>in</strong>es Summenabschlusses.<br />
Dieser wird als Geme<strong>in</strong>debilanz II (GB II) bezeichnet, um e<strong>in</strong>e Abgrenzung zu den JahresabschlÄssen der<br />
e<strong>in</strong>zelnen geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe zu erreichen. Der aus der Addition der JahresabschlÄsse der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Betriebe gewonnene Summenabschluss ist durch KonsolidierungsmaÜnahmen zu e<strong>in</strong>em Gesamtabschluss umzuformen.<br />
Dazu gehÇren <strong>in</strong>sbesondere die BilanzansÅtze der <strong>in</strong> den Gesamtabschluss e<strong>in</strong>bezogenen geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Betriebe mit dem Eigenkapital des jeweiligen Betriebes zu verrechnen (Kapitalkonsolidierung). Auch die<br />
Forderungen und Verb<strong>in</strong>dlichkeiten der <strong>in</strong> den Gesamtabschluss e<strong>in</strong>bezogenen geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe, s<strong>in</strong>d<br />
gegene<strong>in</strong>ander aufzurechnen (Schuldenkonsolidierung). H<strong>in</strong>zu kommt die Aufrechnung von Aufwendungen und<br />
ErtrÅgen aus GeschÅften zwischen den <strong>in</strong> den Gesamtabschluss e<strong>in</strong>bezogenen geme<strong>in</strong>dlichen Betrieben und der<br />
GEMEINDEORDNUNG 740
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
12. Teil GO <strong>NRW</strong><br />
geme<strong>in</strong>dlichen Kernverwaltung (Aufwands- und Ertragskonsolidierung). Auch die aus „Konzernsicht“ nicht realisierten<br />
Gew<strong>in</strong>ne und Verluste s<strong>in</strong>d aus den BestÅnden zu elem<strong>in</strong>ieren (Zwischenergebniselim<strong>in</strong>ierung).<br />
Bei diesen Konsolidierungsarbeiten ist wesentlich, dass durch die rechnerische Zusammenfassung der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Kernverwaltung mit ihren Betrieben ke<strong>in</strong>e neue eigenstÅndige RechtspersÇnlichkeit, auch nicht <strong>in</strong> fiktiver<br />
Form, entsteht. Zudem hat auch der geme<strong>in</strong>dliche Gesamtabschluss ke<strong>in</strong>e Zahlungsbemessungsfunktion, z.B. fÄr<br />
die Berechnung von AusschÄttungen oder Verlustabdeckungen und ist auch nicht Grundlage fÄr Zwecke der<br />
Besteuerung, denn der Gesamtabschluss der Geme<strong>in</strong>de dient ausschlieÜlich der Information Äber die wirtschaftliche<br />
Gesamtlage der Geme<strong>in</strong>de an die betreffenden Interessenten. Der geme<strong>in</strong>dliche Gesamtabschluss ersetzt<br />
daher auch nicht die e<strong>in</strong>zelnen JahresabschlÄsse der Geme<strong>in</strong>de und ihrer Betriebe.<br />
Die Aufstellung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses bzw. die dafÄr notwendige Konsolidierung erfordert zudem<br />
e<strong>in</strong>e Vielzahl von „technischen“ Schritten, um das notwendige Zusammenspiel zwischen geme<strong>in</strong>dlicher<br />
Kernverwaltung und den geme<strong>in</strong>dlichen Betrieben zu erreichen und den gesetzlich geforderten Gesamtabschluss<br />
fÄr jede Geme<strong>in</strong>de zu ermÇglichen. Dabei ist <strong>in</strong>sbesondere die Abgrenzung des geme<strong>in</strong>dlichen Konsolidierungskreises<br />
e<strong>in</strong> sehr wichtiger Schritt. Mit dem nachfolgenden Schema werden e<strong>in</strong>ige wichtige Schritte, die fÄr die<br />
Erstellung des Gesamtabschlusses notwendig s<strong>in</strong>d, <strong>in</strong> allgeme<strong>in</strong>er Form vorgestellt (vgl. Abbildung).<br />
Abgrenzung<br />
des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Konsolidierungskreises<br />
Aufbereitung<br />
der E<strong>in</strong>zelabschlÑsse<br />
der E<strong>in</strong>heiten<br />
des Konsolidierungskreises<br />
Erstellen<br />
e<strong>in</strong>es Summenabschlusses<br />
DurchfÑhrung<br />
der KonsolidierungsmaÖnahmen<br />
Gesamtabschluss<br />
Schritte zum geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss<br />
GEMEINDEORDNUNG 741<br />
Festlegungen:<br />
- welche geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe mit der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>e Rechtse<strong>in</strong>heit<br />
bilden,<br />
- an geme<strong>in</strong>dlichen Betrieben und VermÇgensmassen mit Nennkapital<br />
die Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>e Beteiligung hÅlt,<br />
- welche Anstalten von der Geme<strong>in</strong>de auf der Grundlage der Verordnung<br />
Äber kommunale Unternehmen und E<strong>in</strong>richtungen als Anstalt<br />
des Çffentlichen Rechts getragen werden,<br />
- welche Mitgliedschaften <strong>in</strong> ZweckverbÅnden bestehen,<br />
- welche rechtlich selbststÅndigen kommunalen Stiftungen bestehen,<br />
bei denen die Geme<strong>in</strong>de Stifter ist,<br />
- bei welchen sonstigen rechtlich selbststÅndigen AufgabentrÅgern<br />
die Geme<strong>in</strong>de auf Grund<br />
rechtlicher Verpflichtung deren f<strong>in</strong>anzielle Existenz wesentlich sichert.<br />
- Vere<strong>in</strong>heitlichung des Bilanzstichtags<br />
- Anpassen an die geme<strong>in</strong>dliche Bilanzierung und Bewertung (Geme<strong>in</strong>debilanz<br />
II – GB II)<br />
- Anpassen an die geme<strong>in</strong>dliche Ertrags- und Aufwandserfassung<br />
(Ergebnisrechnung II – ER II)<br />
- Addition der aktiven und passiven Bilanzposten aller e<strong>in</strong>zelnen<br />
Bilanzen auf der Basis der GB II - Addition der Ertrags- und<br />
Aufwandspositionen der e<strong>in</strong>zelnen GUV auf der Basis der ER II<br />
- Vollkonsolidierung<br />
(Kapitalkonsolidierung nach der Erwerbsmethode)<br />
(Schuldenkonsolidierung) (Zwischenergebniselim<strong>in</strong>ierung) Aufwands-<br />
und Ertragskonsolidierung)<br />
- Konsolidierung nach der Equity-Methode<br />
(Kapitalanteilsmethode)<br />
- Gesamtergebnisrechnung<br />
- Gesamtbilanz<br />
- Gesamtanhang<br />
- beizufÄgen:<br />
- Gesamtlagebericht,
Gesamtsteuerung<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
12. Teil GO <strong>NRW</strong><br />
GEMEINDEORDNUNG 742<br />
- Beteiligungsbericht<br />
- Gesamtabschluss- bzw. Gesamtbilanzanalyse fÄr die Ausgestaltung<br />
der Çrtlichen Steuerung<br />
Abbildung 147 „Schritte zum Gesamtabschluss“<br />
4. Ke<strong>in</strong>e befreiende Wirkung des Gesamtabschlusses<br />
In den Gesamtabschluss der Geme<strong>in</strong>de s<strong>in</strong>d nicht nur die Çffentlich-rechtlichen Betriebe der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>zubeziehen,<br />
sondern auch die geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe, die nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches e<strong>in</strong> Mutterunternehmen<br />
s<strong>in</strong>d und mit ihren Tochterunternehmen zur Aufstellung e<strong>in</strong>es Konzernabschlusses nach É 290<br />
HGB verpflichtet s<strong>in</strong>d. Auch wenn die Geme<strong>in</strong>de zur „Konzernrechnungslegung“ nach den e<strong>in</strong>schlÅgigen handelsrechtlichen<br />
Vorschriften verpflichtet ist, tritt dadurch fÄr ihre Betriebe, die Tochterunternehmen im S<strong>in</strong>ne der handelsrechtlichen<br />
Vorschriften s<strong>in</strong>d, ke<strong>in</strong>e befreiende Wirkung nach É 291 Abs. 1 S. 1 HGB e<strong>in</strong>.<br />
E<strong>in</strong>e solche befreiende Wirkung tritt zwar generell unabhÅngig von der Rechtsform und der GrÇÜe des Mutterunternehmens<br />
nach dem Handelsrecht e<strong>in</strong>. Es besteht dafÄr aber die Bed<strong>in</strong>gung, dass es sich bei demjenigen, der<br />
e<strong>in</strong>e befreiende Wirkung durch se<strong>in</strong>e Konzernrechnungslegung auslÇst, um e<strong>in</strong> Unternehmen <strong>in</strong> der Rechtsform<br />
e<strong>in</strong>er Kapitalgesellschaft handeln muss und dieses Unternehmen zur Konzernrechnungslegung nach dem Handelsrecht<br />
verpflichtet ist. Als Mutterunternehmen, die e<strong>in</strong>en befreienden Konzernabschluss erstellen kÇnnen,<br />
scheiden daher die Geme<strong>in</strong>den, aber auch Bund und LÅnder, sowie Privatpersonen aus. Dadurch wird z.B. auch<br />
e<strong>in</strong>e PrÄfung Äber das Vorliegen von Befreiungsvoraussetzungen nach den handelsrechtlichen Vorschriften entbehrlich.<br />
5. Der erste Gesamtabschluss der Geme<strong>in</strong>de<br />
5.1 Die Festlegung des Abschlussstichtages<br />
Den ersten geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss nach É 116 GO <strong>NRW</strong> haben die Geme<strong>in</strong>den spÅtestens zum Stichtag<br />
31. Dezember 2010 aufzustellen, wenn sie n dafÄr ke<strong>in</strong>en frÄheren Term<strong>in</strong> wÅhlen (vgl. É 2 NKFEG; Art. 1<br />
des NKFG vom 16.11.2004). Sie kÇnnen jedoch bereits <strong>in</strong> der Zeit vom In-Kraft-Treten des NKFG zum<br />
01.01.2005 bis zum genannten Stichtag e<strong>in</strong>en Gesamtabschluss jeweils zum Schluss e<strong>in</strong>es Haushaltsjahres<br />
aufstellen, wenn zuvor bereits e<strong>in</strong> Jahresabschluss nach É 95 GO <strong>NRW</strong> aufgestellt worden ist. Der gesetzlich<br />
bestimmte Stichtag soll e<strong>in</strong>e zÄgige und e<strong>in</strong>heitliche Erstellung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses durch die<br />
Geme<strong>in</strong>den zu gewÅhrleisten.<br />
5.2 Die Erstkonsolidierung<br />
5.2.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die Aufstellung des ersten Gesamtabschlusses wird als Erstkonsolidierung bezeichnet, weil zum ersten Mal die<br />
geme<strong>in</strong>dliche Kernverwaltung und die geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe <strong>in</strong> den Gesamtabschluss der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>bezogen<br />
werden und dabei die Anteile der Geme<strong>in</strong>de an diesen Betrieben gegen das anteilige Eigenkapital aufgerechnet<br />
(konsolidiert) werden. D.h. der Beteiligungsbuchwert <strong>in</strong> der Schlussbilanz der Geme<strong>in</strong>de wird durch die<br />
e<strong>in</strong>zelnen VermÇgensgegenstÅnde und Schulden der jeweils e<strong>in</strong>bezogenen geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe ersetzt, weil<br />
sich die Aufstellung des Gesamtabschlusses unter BerÄcksichtigung von geme<strong>in</strong>dlichen Besonderheiten an den
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
12. Teil GO <strong>NRW</strong><br />
privatwirtschaftlichen Regelungen Äber die Konzernrechnungslegung orientiert. Dabei muss sich die Konsolidierung<br />
an den Bed<strong>in</strong>gungen orientieren, die fÄr die Geme<strong>in</strong>de als Çffentliche Muttere<strong>in</strong>heit gelten. Die geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Betriebe als Çffentliche Tochtere<strong>in</strong>heiten mÄssen deshalb ggf. Anpassungen bei ihren WertansÅtzen vornehmen.<br />
Der E<strong>in</strong>beziehung der geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe <strong>in</strong> den Gesamtabschluss der Geme<strong>in</strong>de s<strong>in</strong>d die WertverhÅltnisse<br />
im Zeitpunkt der Wertermittlung (Erwerbsstichtag) zu Grunde zu legen, so dass e<strong>in</strong>e Gesamtbilanz als „GesamterÇffnungsbilanz“<br />
erstellt werden kann. Zu berÄcksichtigen ist, dass vor dem o.a. Zeitpunkt noch ke<strong>in</strong>e ErtrÅge<br />
und Aufwendungen sowie Zahlungen bei den geme<strong>in</strong>dlichen Betrieben im S<strong>in</strong>ne der wirtschaftlichen E<strong>in</strong>heit<br />
„Konzern Kommune“ entstanden se<strong>in</strong> sollen, die dieser zuzurechnen s<strong>in</strong>d und damit <strong>in</strong> die Gesamtergebnisrechnung<br />
sowie Gesamtkapitalflussrechnung e<strong>in</strong>flieÜen kÇnnen.<br />
5.2.2 Die Festlegung e<strong>in</strong>es Erwerbsstichtages<br />
5.2.2.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die erstmalige Aufstellung e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses nach den Vorschriften des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Haushaltsrechts und unter Anwendung von Vorschriften des Handelsgesetzbuches stellt e<strong>in</strong>e besondere Fallgestaltung<br />
fÄr die Geme<strong>in</strong>de dar. Sie erfordert e<strong>in</strong>e Festlegung des Beg<strong>in</strong>ns des Zeitraums der wirtschaftlichen<br />
E<strong>in</strong>heit, damit auch der erste geme<strong>in</strong>dliche Gesamtabschluss se<strong>in</strong>e ihm obliegende Aufgabe, e<strong>in</strong> den tatsÅchlichen<br />
VerhÅltnissen entsprechendes Bild der VermÇgens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzgesamtlage der Geme<strong>in</strong>de<br />
zu vermitteln, erfÄllen kann. Dieser Zeitpunkt wird als Erwerbsstichtag bezeichnet, zu dem fÄr die erste<br />
Konsolidierung die bilanziellen WertansÅtze auf der Grundlage der tatsÅchlichen VerhÅltnisse, betrachtet als<br />
„fiktive“ Anschaffung oder Errichtung e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Betriebes, bestimmt werden. Dadurch kann e<strong>in</strong> „Konzernwirtschaftjahr“<br />
beg<strong>in</strong>nen, dass entsprechende Abstimmung zwischen der geme<strong>in</strong>dlichen Kernverwaltung und<br />
den geme<strong>in</strong>dlichen Betrieben erfordert. AuÜerdem wird durch die Festlegung des Zeitpunktes die fÄr den geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Gesamtabschluss vorgesehene Kapitalflussrechnung ermÇglicht.<br />
Unter BerÄcksichtigung, dass zwar letztmÇgliche Stichtag fÄr den ersten Gesamtabschluss gesetzlich bestimmt<br />
wurde (nach É 2 NKFEG der 31. Dezember 2010), anders bei der E<strong>in</strong>fÄhrung des NKF auf der Ebene der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Kernverwaltung jedoch nicht gleichzeitig festgelegt wurde, wann die Betrachtung und Bewertung der<br />
wirtschaftlichen Gesamtlage der Geme<strong>in</strong>de beg<strong>in</strong>nt, muss aus dem o.a. Datum der sachgerechte Erwerbsstichtag<br />
festgelegt werden. Dabei ist es <strong>in</strong> Anlehnung an die E<strong>in</strong>fÄhrung des NKF s<strong>in</strong>nvoll, entweder den ErÇffnungsbilanzstichtag<br />
oder den Jahresbeg<strong>in</strong>n vor dem ersten Abschlussstichtag fÄr den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss<br />
zu bestimmen.<br />
5.2.2.2 Der ErÉffnungsbilanzstichtag als Erwerbszeitpunkt<br />
Der Erwerbsstichtag stellt den Ausgangspunkt fÄr die E<strong>in</strong>beziehung der geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe <strong>in</strong> den Çrtlichen<br />
Gesamtabschluss dar. Dieser kÇnnte <strong>in</strong> Zusammenhang mit der E<strong>in</strong>fÄhrung des NKF gebracht werden, so dass<br />
der jeweilige ErÇffnungsbilanzstichtag der Geme<strong>in</strong>de auch den Erwerbsstichtag darstellen wÄrde. FÄr e<strong>in</strong>en solchen<br />
Erwerbsstichtag spricht, dass die geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe fÄr diesen Zeitpunkt mit dem vorsichtig geschÅtzten<br />
Zeitpunkt zu bewerten waren und daher e<strong>in</strong> „Marktwert“ festzustellen bzw. diesem nahe zu kommen war,<br />
auch wenn gesetzlich Bewertungsvorgaben gemacht wurden und Bewertungsvere<strong>in</strong>fachungen zugelassen waren.<br />
AuÜerdem gelten die fÄr den ErÇffnungsbilanzstichtag ermittelten vorsichtig geschÅtzten Zeitwerte fÄr die<br />
kÄnftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten fÄr das geme<strong>in</strong>dliche VermÇgen, denn dieses<br />
ist gesetzlich bestimmt worden (vgl. É 92 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong>).<br />
GEMEINDEORDNUNG 743
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
12. Teil GO <strong>NRW</strong><br />
Mit dieser Festlegung wÅre der Vorteil verbunden, dass alle geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe stichtagsbezogen bewertet<br />
und entsprechend ihrer Zweckbestimmung aus Sicht der Geme<strong>in</strong>de unter den „F<strong>in</strong>anzanlagen“ <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
ErÇffnungsbilanz angesetzt wurden. AuÜerdem die fÄr die geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe ermittelten Werte als<br />
Anschaffungskosten dem der Geme<strong>in</strong>de zustehenden anteiligen Eigenkapital <strong>in</strong> der jeweiligen Bilanz der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Betriebe. Dieser Sachverhalt wÄrde bewirken, dass im Pr<strong>in</strong>zip fÄr alle Geme<strong>in</strong>den e<strong>in</strong>e vergleichbare<br />
Ausgangslage besteht, auch wenn e<strong>in</strong>zelne Geme<strong>in</strong>den von der MÇglichkeit Gebrauch gemacht haben, e<strong>in</strong>en vor<br />
dem letztmÇglichen Stichtag (1. Januar 2009) liegenden Jahresbeg<strong>in</strong>n (frÄhestens der 1. Januar 2005) fÄr ihre<br />
ErÇffnungsbilanz zu wÅhlen. Aber auch <strong>in</strong> diesen FÅllen liegt aber e<strong>in</strong> fiktiver Erwerb der geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe<br />
vor, deren Werte (fiktive Anschaffungskosten) ebenso bis zum Çrtlich festgelegten Konsolidierungszeitpunkt fortzufÄhren<br />
s<strong>in</strong>d.<br />
5.2.2.3 Der Erwerbszeitpunkt im Jahr des Abschlussstichtages<br />
Nach der Vorschrift des É 2 NKFEG ist spÅtestens zum Stichtag 31. Dezember 2010 von der Geme<strong>in</strong>de der erste<br />
Gesamtabschluss aufzustellen. Im Zusammenhang mit den Vorschriften Äber den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss<br />
<strong>in</strong> É 116 GO <strong>NRW</strong> und mit der ausdrÄcklichen Verwendung des Wortes „Gesamtabschluss“ <strong>in</strong> der o.a.<br />
Vorschrift hat der Gesetzgeber zum Ausdruck gebracht, dass auch der erste geme<strong>in</strong>dliche Gesamtabschluss aus<br />
allen se<strong>in</strong>en gesetzlich bestimmten Teilen bestehen, also vollstÅndig se<strong>in</strong> muss. Dieses br<strong>in</strong>gt es mit sich, dass<br />
der Erwerbszeitpunkt m<strong>in</strong>destens so bestimmt se<strong>in</strong> muss, dass auch e<strong>in</strong>e Gesamtergebnisrechnung und e<strong>in</strong>e<br />
Gesamtkapitalflussrechnung aufstellbar s<strong>in</strong>d.<br />
In diesem Zusammenhang wÅre <strong>in</strong> Anlehnung an die mÇgliche erstmalige E<strong>in</strong>beziehung e<strong>in</strong>es Tochterunternehmens<br />
nach den handelsrechtlichen Vorschriften <strong>in</strong> den Konzernabschluss der Zeitpunkt 1. Januar des Jahres, <strong>in</strong><br />
dem am 31. Dezember der Stichtag des ersten Gesamtabschlusses liegt, der zutreffende Erwerbsstichtag. Dies<br />
ermÇglicht, zum Abschlussstichtag e<strong>in</strong>en geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss mit allen se<strong>in</strong>en Bestandteilen aufzustellen.<br />
Diese Festlegung bewirkt, dass die Geme<strong>in</strong>de fÄr das betreffende Haushaltsjahr und zum Stichtag 1.<br />
Januar e<strong>in</strong>e GesamterÇffnungsbilanz aufzustellen hat.<br />
5.2.2.4 Gesamtabschluss und JahreserÉffnungsbilanz<br />
Die Notwendigkeit fÄr die Geme<strong>in</strong>de, vor dem ersten geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss e<strong>in</strong> GesamtgeschÅftsjahr<br />
zu bilden, um m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>e zutreffende Gesamtergebnisrechnung und e<strong>in</strong>e Gesamtkapitalflussrechnung zu<br />
erreichen, erfordert wie zu Beg<strong>in</strong>n e<strong>in</strong>es jeden geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsjahres e<strong>in</strong>e ErÇffnungsbilanz fÄr das<br />
GesamtgeschÅftsjahr. Diese ErÇffnungsbilanz stellt haushaltsrechtlich ke<strong>in</strong>e GesamterÇffnungsbilanz im S<strong>in</strong>ne<br />
der ersten NKF-ErÇffnungsbilanz nach É 92 GO <strong>NRW</strong> dar, auch wenn im Sprachgebrauch dieser Begriff benutzt<br />
wird. Die GesamterÇffnungsbilanz stellt lediglich e<strong>in</strong>e ErÇffnungsbilanz dar, die zu Beg<strong>in</strong>n e<strong>in</strong>es jeden Haushaltsjahres<br />
von der Geme<strong>in</strong>de und zu Beg<strong>in</strong>n e<strong>in</strong>es jeden Wirtschaftsjahres von den geme<strong>in</strong>dlichen Betrieben aufzustellen<br />
ist. Sie bedarf daher auch ke<strong>in</strong>er gesonderten Çrtlichen und ÄberÇrtlichen PrÄfung sowie e<strong>in</strong>es gesonderten<br />
Ratsbeschlusses und wird auch nicht Çffentlich bekannt gemacht.<br />
5.2.2.5 Nicht vertretbare Erwerbszeitpunkte<br />
5.2.2.5.1 Der tatsÇchliche Anschaffungszeitpunkt<br />
E<strong>in</strong> mÇglicher Zeitpunkt fÄr den Erwerbsstichtag ist der Zeitpunkt, <strong>in</strong> dem die Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>en Betrieb tatsÅchlich<br />
errichtet oder erworben hat. Dabei wÄrde ausreichend berÄcksichtigt, dass die Geme<strong>in</strong>den i.d.R. bereits Äber<br />
sehr lange Zeit (z.T. mehrere Jahrzehnte) Äber ihre Betriebe verfÄgen. Die vielfach lange Zeit dÄrfte jedoch wiederum<br />
bewirken, dass es voraussichtlich sehr aufwÅndig oder <strong>in</strong> manchen FÅllen sogar kaum machbar ist, die<br />
GEMEINDEORDNUNG 744
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
12. Teil GO <strong>NRW</strong><br />
Anschaffungskosten zum <strong>in</strong> der Vergangenheit liegenden tatsÅchlichen Zeitpunkt des Erwerbs e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Betriebes zu ermitteln und mit anderen Werten bis zum Çrtlich festgelegten Konsolidierungszeitpunkt fortzufÄhren.<br />
Gegen e<strong>in</strong>en solchen Zeitpunkt sprechen auch die Erfahrungen aus der E<strong>in</strong>fÄhrung des NKF, denn deshalb wurde<br />
von vornhere<strong>in</strong> nicht die Ermittlung der tatsÅchlichen Anschaffungskosten fÄr die Bilanzierung geme<strong>in</strong>dlicher<br />
VermÇgensgegenstÅnde verlangt. Werden solche Aufarbeitungen der Vergangenheit verlangt, dÄrften diese umfangreichen<br />
Arbeiten auch im H<strong>in</strong>blick auf die noch nicht vollendeten Arbeiten aus der E<strong>in</strong>fÄhrung des NKF <strong>in</strong> den<br />
Geme<strong>in</strong>den nicht zu rechtfertigen se<strong>in</strong>.<br />
5.2.2.3.2 Der Abschlussstichtag des ersten Gesamtabschlusses<br />
Als letzte MÇglichkeit fÄr den Zeitpunkt des Erwerbsstichtages bliebe unter Beachtung der gesetzlichen Festlegung<br />
des letztmÇglichen Abschlussstichtages fÄr den ersten Gesamtabschluss der Geme<strong>in</strong>de (31. Dezember<br />
2010 nach É 2 NKFEG) und <strong>in</strong> Anlehnung an handelsrechtliche Vorschriften, den gesetzlich bestimmten Abschlussstichtag<br />
31.12.2010 als „fiktiven“ Erwerbsstichtag anzusehen. Dies wÄrde mit sich br<strong>in</strong>gen, dass die Anforderungen<br />
der Vorschrift Äber die Aufstellung des ersten geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses (vgl. É 2 NKFEG<br />
<strong>NRW</strong>) nicht <strong>in</strong> vollem Umfang erfÄllt werden kÇnnten.<br />
Die Gesamtergebnisrechnung wÄrde nicht konsolidiert und wÄrde wegen der notwendigen Anpassung e<strong>in</strong>en<br />
geschÅtzten Ausgleichsposten enthalten. Die Gesamtkapitalflussrechnung mÄsste <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em solchen Fall entfallen.<br />
Deshalb wÅre die Darstellung der Ertrags- und der F<strong>in</strong>anzgesamtlage der Geme<strong>in</strong>de als unzureichend zu bewerten,<br />
denn sie wÄrde mit den Zielsetzungen des NKF, <strong>in</strong>sbesondere mit dem Ziel „AktualitÅt“ nicht <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang<br />
stehen. Deshalb bleibt auch fraglich, ob e<strong>in</strong>e solche Vorgehensweise fÄr e<strong>in</strong>zelne Geme<strong>in</strong>den wirklich zur Erleichterung<br />
der Aufstellung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses beitragen wÄrde.<br />
5.2.3 Ausnahmen von der Neubewertungspflicht fÑr die Erstkonsolidierung<br />
Nach É 308 HGB s<strong>in</strong>d Ausnahmen von der e<strong>in</strong>heitlichen Bewertung mÇglich, z.B. wegen der Besonderheiten<br />
e<strong>in</strong>zelner GeschÅftszweige. In der Vorschrift werden dazu nur die Kredit<strong>in</strong>stitute und Versicherungsunternehmen<br />
ausdrÄcklich erwÅhnt. Ob <strong>in</strong> analoger Anwendung fÄr den geme<strong>in</strong>dlichen Bereich auch besondere Bereiche der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen AufgabenerfÄllung <strong>in</strong> Betracht kommen kÇnnen, wenn besondere BuchfÄhrungspflichten bestehen,<br />
z.B. fÄr KrankenhÅuser und Pflegee<strong>in</strong>richtungen, bedarf noch e<strong>in</strong>er weiteren PrÄfung. E<strong>in</strong>e allgeme<strong>in</strong>e Regelung,<br />
dass <strong>in</strong> den FÅllen, <strong>in</strong> denen fÄr Posten der Bilanz unterschiedliche Vorschriften fÄr die Geme<strong>in</strong>de und die geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Betriebe bestehen, dies fÄr die Aufstellung des Gesamtabschlusses unerheblich sei, dÄrfte den Zwecken<br />
und Zielen des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses sowie der damit verbundenen E<strong>in</strong>heitstheorie zu wider<br />
laufen.<br />
In diesem Zusammenhang wÄrde e<strong>in</strong>e entsprechende Anwendung der Ausnahmeregelung fÄr bestimmte geme<strong>in</strong>dliche<br />
Betriebe unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit <strong>in</strong> besonderen E<strong>in</strong>zelfÅllen ermÇglichen,<br />
dass die im Jahresabschluss des betreffenden Betriebes angewandten Bewertungsmethoden fÄr die Erstkonsolidierung<br />
beibehalten werden dÄrften. Die im Jahresabschluss des betreffenden Betriebes angesetzten<br />
Werte fÄr VermÇgensgegenstÅnde und Schulden dÄrfen <strong>in</strong> den ersten Gesamtabschluss Äbernommen werden,<br />
ohne sie zuvor h<strong>in</strong>sichtlich stiller Reserven ÄberprÄft zu haben. Kommt e<strong>in</strong>e solche Ausnahme zur Anwendung,<br />
s<strong>in</strong>d von der Geme<strong>in</strong>de dazu entsprechende Angaben im Gesamtanhang zu machen.<br />
GEMEINDEORDNUNG 745
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
12. Teil GO <strong>NRW</strong><br />
6. Vorschriften fÑr den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses<br />
6.1 Die GesamtÑbersicht Ñber die Vorschriften<br />
Die Vorschriften Äber den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss sollen gewÅhrleisten, dass jÅhrlich die VermÇgens-,<br />
F<strong>in</strong>anz- und Ertragslage der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong>sgesamt so dargestellt wird, als ob es sich bei der Geme<strong>in</strong>de um e<strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>ziges wirtschaftliches „Unternehmen“ - vergleichbar mit e<strong>in</strong>em Konzern - handeln wÄrde, so dass die Geme<strong>in</strong>de<br />
auch h<strong>in</strong>sichtlich ihrer AufgabenerfÄllung, unabhÅngig von den organisatorischen Gegebenheiten, als Gesamtheit<br />
gezeigt wird. Daher ist fÄr diese Bestimmungen e<strong>in</strong> gesonderter Teil <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>deordnung geschaffen<br />
worden, der wegen des sachlichen Zusammenhangs h<strong>in</strong>ter die gesetzlichen Vorschriften Äber die Haushaltswirtschaft<br />
(8. Teil) und die wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche BetÅtigung (11. Teil) <strong>in</strong> die Geme<strong>in</strong>deordnung<br />
e<strong>in</strong>geordnet worden ist.<br />
Diese E<strong>in</strong>ordnung stellt sicher, dass im Gesamtabschluss die Informationsdefizite der E<strong>in</strong>zelabschlÄsse der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Betriebe beseitigt und im Gesamtabschluss die Vermittlung entscheidungsrelevanter Informationen<br />
unter Beachtung der GrundsÅtze ordnungsmÅÜiger BuchfÄhrung (GoB) <strong>in</strong> den Vordergrund gestellt werden. Die<br />
Adressaten des Gesamtabschlusses sollen beurteilen kÇnnen, ob die Geme<strong>in</strong>de zukÄnftig <strong>in</strong> der Lage ist, Äber<br />
die DurchfÄhrung durch ihre Kernverwaltung h<strong>in</strong>aus, also <strong>in</strong>sgesamt gesehen, ihre Aufgaben erfÄllen kann (vgl.<br />
Abbildung).<br />
Haushaltsrechtliche Vorschriften im 12. Teil der Geme<strong>in</strong>deordnung<br />
12. Teil<br />
Gesamtabschluss<br />
GEMEINDEORDNUNG 746<br />
É 116 Gesamtabschluss<br />
É 117 Beteiligungsbericht<br />
É 118 Vorlage- und Auskunftspflichten<br />
Abbildung 148 „Haushaltsrechtliche Vorschriften im 12. Teil der Geme<strong>in</strong>deordnung“<br />
6.2 Die Vorschriften im E<strong>in</strong>zelnen<br />
Der 12. Teil der Geme<strong>in</strong>deordnung enthÅlt daher grundlegende, nachfolgend vorgestellte Vorschriften zum geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Gesamtabschluss, die durch die Vorschriften des 7. Abschnitts der Geme<strong>in</strong>dehaushaltsverordnung<br />
nÅher bestimmt werden.<br />
- É 116 Gesamtabschluss<br />
Die Vorschrift bestimmt den Inhalt und den Zweck des Gesamtabschlusses nÅher. Sie ist der handelsrechtlichen<br />
Vorschrift fÄr den Konzernabschluss (É 290 HGB) nachgebildet worden. Durch den Gesamtabschluss<br />
wird die QualitÅt der Rechenschaft Äber die Aufgabenerledigung der Geme<strong>in</strong>de im abgelaufenen Haushaltsjahr<br />
wesentlich erhÇht. Er trÅgt gleichzeitig zu e<strong>in</strong>er Verbesserung der SteuerungsmÇglichkeiten bei. Die<br />
Funktion des Gesamtabschlusses besteht <strong>in</strong> der Vermittlung des den tatsÅchlichen VerhÅltnissen entsprechenden<br />
Bildes der gesamten VermÇgens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de. Die weiteren<br />
Voraussetzungen und GestaltungsmÇglichkeiten des Gesamtabschlusses sowie die Vorgaben fÄr die Umsetzung<br />
der Konsolidierung s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> den ÉÉ 49 bis 52 des siebten Abschnitts der Geme<strong>in</strong>dehaushaltsverordnung<br />
<strong>NRW</strong> nÅher bestimmt.<br />
- É 117 Beteiligungsbericht<br />
Auf Grund zahlreicher Ausgliederungen und Beteiligungen weisen die Geme<strong>in</strong>den heute vielfach konzern-<br />
Åhnliche Strukturen auf. Der Beteiligungsbericht soll daher den Blick der Geme<strong>in</strong>de vom Gesamtabschluss<br />
auf die e<strong>in</strong>zelnen verselbststÅndigten Aufgabenbereiche (geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe) lenken. Daher muss der<br />
Bericht auch Angaben Äber alle geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe umfassen, unabhÅngig davon, ob diese <strong>in</strong> den Kon-
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
12. Teil GO <strong>NRW</strong><br />
solidierungskreis fÄr den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss e<strong>in</strong>zubeziehen s<strong>in</strong>d. Dazu dÄrfte es nicht ausreichend<br />
se<strong>in</strong>, lediglich <strong>in</strong> tabellarischer Form die Ziele der geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe, die ErfÄllung des Çffentlichen<br />
Zwecks, die BeteiligungsverhÅltnisse, die Entwicklung der Bilanzen und der Gew<strong>in</strong>n- und Verlustrechnungen,<br />
die Leistungen der geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe, die wesentlichen F<strong>in</strong>anz- und Leistungsbeziehungen<br />
u.a. anzugeben und zu erlÅutern.<br />
Der Beteiligungsbericht soll aber auch vertiefte und notwendige Erkenntnisse fÄr die produktorientierte Gesamtsteuerung<br />
der Geme<strong>in</strong>de ermÇglichen. Dies erfordert e<strong>in</strong>e aufgabenbezogene Darstellung und Gliederung<br />
im Beteiligungsbericht, m<strong>in</strong>destens anhand der fÄr die Kernverwaltung verb<strong>in</strong>dlichen Produktbereiche<br />
(vgl. É 4 GemHVO <strong>NRW</strong>). Damit wÄrde e<strong>in</strong>e GesamtÄbersicht Äber die ErfÄllung der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgaben<br />
durch die geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe auÜerhalb der Kernverwaltung erreicht, unabhÅngig davon, von welchem<br />
Betrieb die e<strong>in</strong>zelne geme<strong>in</strong>dliche Aufgabe erledigt wird. Entsprechend gegliederte Informationen erlauben<br />
e<strong>in</strong>e bessere E<strong>in</strong>schÅtzung und differenzierte Beurteilung der wirtschaftlichen Gesamtlage der Geme<strong>in</strong>de<br />
sowie ihrer Chancen und Risiken, bezogen auf die stetige AufgabenerfÄllung <strong>in</strong> den e<strong>in</strong>zelnen geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Aufgaben- (Produkt-) bereichen.<br />
- É 118 Vorlage- und Auskunftspflichten<br />
Auf der Grundlage, dass der Gesamtabschluss die VermÇgens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der<br />
Geme<strong>in</strong>de zusammen mit der VermÇgens-, F<strong>in</strong>anz- und Ertragslage der <strong>in</strong> den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss<br />
e<strong>in</strong>bezogenen geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe so darzustellen hat, als ob die Geme<strong>in</strong>de mit ihren Betrieben<br />
e<strong>in</strong>e wirtschaftliche E<strong>in</strong>heit wÅre, ist es fÄr die Aufstellung e<strong>in</strong>es solchen Gesamtabschlusses zw<strong>in</strong>gend erforderlich,<br />
auch die dafÄr notwendigen Informationen und Unterlagen von den beteiligten geme<strong>in</strong>dlichen Betrieben<br />
zu erhalten. Dabei werden nach dem Grundsatz der geme<strong>in</strong>dlichen E<strong>in</strong>heit an den Gesamtabschluss<br />
der Geme<strong>in</strong>de ke<strong>in</strong>e hÇheren Anforderungen gestellt, als an ihren E<strong>in</strong>zelabschluss. AuÜerdem baut die Vorschrift<br />
auf der Regelung <strong>in</strong> É 113 GO <strong>NRW</strong> auf, nach der zur Vertretung der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> Unternehmen und<br />
E<strong>in</strong>richtungen die erforderlichen Vorgaben getroffen werden, um die notwendige Vernetzung zwischen mittelbarer<br />
und unmittelbarer geme<strong>in</strong>dlicher Verwaltung sicherzustellen.<br />
7. Die Anwendung von allgeme<strong>in</strong>en GrundsÇtzen<br />
7.1 Die GrundsÇtze ordnungsmÇÖiger Konzernrechnungslegung (GoK)<br />
Die Aufstellung des Gesamtabschlusses ist unter Beachtung der GrundsÅtze ordnungsmÅÜiger BuchfÄhrung<br />
(GoB) vorzunehmen. Handelsrechtlich haben sich aber zum privatrechtlichen Konzernabschluss noch die<br />
GrundsÅtze ordnungsmÅÜiger Konzernrechnungslegung (GoK) entwickelt. Die GoK ergÅnzen <strong>in</strong> diesem S<strong>in</strong>ne die<br />
fÄr den Gesamtabschluss e<strong>in</strong>schlÅgigen Vorschriften sowie die GrundsÅtze ordnungsmÅÜiger BuchfÄhrung<br />
(GoB). Die folgenden GoK s<strong>in</strong>d auch beim geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss zu beachten (vgl. Abbildung).<br />
GrundsÇtze ordnungsmÇÖiger Konzernrechnungslegung (GoK)<br />
Grundsatz der Fiktion der rechtlichen E<strong>in</strong>heit (E<strong>in</strong>heitstheorie)<br />
Grundsatz der E<strong>in</strong>heitlichkeit (der Abschlussstichtage, der WÅhrung, des Ausweises<br />
Grundsatz der VollstÅndigkeit (des Konsolidierungskreises)<br />
Grundsatz der E<strong>in</strong>heitlichkeit der Bilanzierung und Bewertung<br />
GEMEINDEORDNUNG 747
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
12. Teil GO <strong>NRW</strong><br />
Grundsatz der Stetigkeit der Konsolidierungsmethoden (zeitlich und sachlich)<br />
Grundsatz der Elim<strong>in</strong>ierung konzern<strong>in</strong>terner Beziehungen<br />
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Wesentlichkeit<br />
Abbildung 149 „GrundsÇtze ordnungsmÇÉiger Konzernrechnungslegung (GoK)“<br />
Diese GrundsÅtze sollen im Rahmen des Gesamtabschlusses gewÅhrleisten, dass die Zusammenfassung der<br />
JahresabschlÄsse der e<strong>in</strong>bezogenen Betriebe unter Anwendung der maÜgeblichen E<strong>in</strong>heitstheorie erfolgt und der<br />
Gesamtabschluss e<strong>in</strong> Bild Äber die wirtschaftliche Gesamtlage der Geme<strong>in</strong>de vermittelt, als wÅre die Kernverwaltung<br />
der Geme<strong>in</strong>de zusammen mit den geme<strong>in</strong>dlichen Betrieben e<strong>in</strong>e wirtschaftliche E<strong>in</strong>heit. DarÄber h<strong>in</strong>aus<br />
kommen durch die Verweise auf geme<strong>in</strong>dliche Vorschriften Äber den Jahresabschluss auch haushaltsrechtliche<br />
GrundsÅtze zur Anwendung.<br />
7.2 AusgewÇhlte deutsche Rechnungslegungsstandards<br />
Im geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss ist nach der Vorschrift die geforderte Gesamtkapitalflussrechnung unter<br />
Beachtung des Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 2 (DRS 2) <strong>in</strong> der vom Bundesm<strong>in</strong>isterium der Justiz<br />
(BMJ) nach É 342 Abs. 2 HGB bekannt gemachten Form aufzustellen. Neben diesem Rechnungslegungsstandard<br />
bestehen noch weitere Standards, die fÄr die <strong>in</strong>haltliche Gestaltung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses<br />
genutzt werden kÇnnen (vgl. Abbildung).<br />
AusgewÇhlte deutsche Rechnungslegungsstandards<br />
Nummer Bezeichnung<br />
DRS 3 Segmentberichterstattung<br />
DRS 4 Unternehmenserwerbe im Konzernabschluss<br />
DRS 5 Risikoberichterstattung<br />
DRS 7 Konzerneigenkapital und Konzernergebnis<br />
DRS 8 Bilanzierung von Anteilen an assoziierten Unternehmen im Konzernabschluss<br />
DRS 12 Immaterielle VermÇgensgegenstÅnde des AnlagevermÇgens<br />
DRS 13 Grundsatz der Stetigkeit und Berichtigung von Fehlern<br />
DRS 14 WÅhrungsumrechnung<br />
DRS 15 Lageberichterstattung<br />
Abbildung 150 „AusgewÇhlte deutsche Rechnungslegungsstandards“<br />
GEMEINDEORDNUNG 748
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
12. Teil GO <strong>NRW</strong><br />
Zu beachten ist, dass die Rechnungslegungsstandards stÅndig weiter zu entwickeln s<strong>in</strong>d, um deren AktualitÅt<br />
und Anwendbarkeit zu sichern. Die verabschiedeten Standards sowie ihre ànderungen werden vom Bundesm<strong>in</strong>isterium<br />
der Justiz im Bundesanzeiger bekannt gemacht.<br />
8. ZulÇssiger Verzicht auf e<strong>in</strong>en Gesamtabschluss<br />
Die Vorschrift des É 116 GO <strong>NRW</strong> enthÅlt ke<strong>in</strong>e gesonderte Ausnahmeregelung oder Kriterien, die es ermÇglichen,<br />
dass die Geme<strong>in</strong>de von der Aufstellung e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses generell befreit ist. Bei<br />
e<strong>in</strong>zelnen Geme<strong>in</strong>den kÇnnen sich aber durchaus besondere Fallgestaltungen im Rahmen ihrer Beteiligungen<br />
vorliegen, die dazu fÄhren, dass fÄr die Geme<strong>in</strong>de die Aufstellung e<strong>in</strong>es Gesamtabschlusses entbehrlich wird (vgl.<br />
Abbildung).<br />
ZulÇssiger Verzicht auf e<strong>in</strong>en Gesamtabschluss<br />
- Die Geme<strong>in</strong>de (Geme<strong>in</strong>dliche Kernverwaltung als Muttere<strong>in</strong>heit) verfÄgt Äber ke<strong>in</strong>en voll zu konsolidierenden<br />
Betrieb, der e<strong>in</strong>e Tochtere<strong>in</strong>heit darstellt, so dass e<strong>in</strong> erforderliches Mutter-Tochter-VerhÅltnis<br />
nicht vorliegt.<br />
- Die Geme<strong>in</strong>de (Muttere<strong>in</strong>heit) verfÄgt Äber voll zu konsolidierende Betriebe, ihre Tochtere<strong>in</strong>heiten s<strong>in</strong>d<br />
aber wegen der untergeordneten Bedeutung <strong>in</strong>sgesamt nicht voll zu konsolidieren.<br />
- Die Geme<strong>in</strong>de verfÄgt nur Äber Beteiligungen, die nach der Equity-Methode zu konsolidieren s<strong>in</strong>d.<br />
Abbildung 151 „ZulÇssiger Verzicht auf e<strong>in</strong>en Gesamtabschluss“<br />
In den FÅllen, <strong>in</strong> denen die Geme<strong>in</strong>de zwar Äber mehrere Betriebe, aber Äber ke<strong>in</strong>en voll zu konsolidieren Betrieb<br />
verfÄgt, und ke<strong>in</strong> Mutter-Tochter-VerhÅltnis zwischen der Kernverwaltung der Geme<strong>in</strong>de und m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>em<br />
ihrer Betriebe besteht, kann das Fehlen dieser Voraussetzung nicht dadurch geheilt werden, dass die betreffende<br />
Geme<strong>in</strong>de Äber Betriebe verfÄgt, die nach der Equity-Methode zu konsolidieren wÅren.<br />
Bei e<strong>in</strong>em zulÅssigen Verzicht auf die Aufstellung e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses erlischt jedoch nicht<br />
die <strong>in</strong> dieser Vorschrift enthaltene ausdrÄckliche Pflicht zur PrÄfung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss. Vielmehr<br />
ist sie dann vom RechnungsprÄfungsausschuss <strong>in</strong> der Art und Weise auszuÄben, dass zu prÄfen ist, ob<br />
Çrtlich die Voraussetzungen fÄr e<strong>in</strong>en Verzicht auf die Aufstellung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses vorliegen.<br />
Er hat dabei die Çrtlichen AbwÅgungen zu prÄfen und festzustellen, ob das daraus entstandene Ergebnis<br />
zutreffend ist.<br />
8. Vom Gesamtabschluss zur Gesamtsteuerung<br />
Die ErfÄllung der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgaben (vgl. É 3 GO <strong>NRW</strong>) e<strong>in</strong>schlieÜlich der Verpflichtung der Geme<strong>in</strong>de ihre<br />
Haushaltswirtschaft so zu planen und zu fÄhren, dass die stetige AufgabenerfÄllung gesichert ist (vgl. É 75 Abs. 1<br />
GO <strong>NRW</strong>), erfordert e<strong>in</strong>en âberblick Äber die wirtschaftliche Gesamtlage vor Ort und e<strong>in</strong> darauf ausgerichtetes<br />
Handeln der Verantwortlichen <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>de. Die auf den gesetzlich vorgesehenen Gesamtabschluss aufbauende<br />
Gesamtsteuerung ist dabei jedoch nicht als e<strong>in</strong>e Addition von Verwaltungsprozessen anzusehen, sondern<br />
stellt e<strong>in</strong> verantwortliches ganzheitliches geme<strong>in</strong>debezogenes Verwaltungsmanagement dar. Mit e<strong>in</strong>em solchen<br />
Management kÇnnen die geme<strong>in</strong>dlichen GeschÅftsteile „Kernverwaltung“ und „Betriebe“ als e<strong>in</strong>e Gesamtheit<br />
betrachtet und der geme<strong>in</strong>dliche Gesamtabschluss als aussagekrÅftige und steuerungsrelevante Informationsbasis<br />
genutzt werden, um als Geme<strong>in</strong>de zukunftsorientiert und wirtschaftlich handeln zu kÇnnen. Die geme<strong>in</strong>dliche<br />
Gesamtsteuerung geht daher Äber die heutige Haushaltssteuerung und e<strong>in</strong>e re<strong>in</strong>e Beteiligungsverwaltung der<br />
Geme<strong>in</strong>de h<strong>in</strong>aus.<br />
GEMEINDEORDNUNG 749
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
12. Teil GO <strong>NRW</strong><br />
Auf dieser Basis muss der Rat als oberstes Leitungsorgan der Geme<strong>in</strong>de nicht nur auf die geme<strong>in</strong>dliche Kernverwaltung,<br />
sondern gleichermaÜen auch auf die Betriebe als verselbststÅndigte Aufgabenbereiche der Geme<strong>in</strong>de<br />
e<strong>in</strong>wirken, um die fÄr die Erledigung der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgaben notwendige Steuerungskultur zu schaffen<br />
und Steuerungs<strong>in</strong>strumente im S<strong>in</strong>ne se<strong>in</strong>er AllzustÅndigkeit e<strong>in</strong>zusetzen (vgl. É 41 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>). E<strong>in</strong>e entsprechende<br />
Verpflichtung trifft den BÄrgermeister als Verantwortlichen fÄr die gesamte geme<strong>in</strong>dliche Verwaltung<br />
(vgl. É 62 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>).<br />
Im Rahmen dieser Verantwortlichkeiten ist e<strong>in</strong> strategisches Management mit strategischer Planung zu entwickeln<br />
und unter BerÄcksichtigung der Çrtlichen Gegebenheiten organisatorisch auszugestalten. Diese Aufgaben<br />
erfordern u.a. die Çrtliche Ausgestaltung von messbaren Leistungs- und F<strong>in</strong>anzzielen sowie e<strong>in</strong> entsprechendes<br />
geme<strong>in</strong>debezogenes Berichtswesen. Dazu gilt es, die Weiterentwicklung der geme<strong>in</strong>dlichen Kernverwaltung und<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe unter BerÄcksichtigung der dezentralen Ressourcenverantwortung und der produktorientierten<br />
Haushaltswirtschaft <strong>in</strong> die Çrtliche Gesamtsteuerung e<strong>in</strong>zubeziehen, damit diese erfolgreich se<strong>in</strong><br />
kann..<br />
Diese Zielsetzung bedarf vielerorts auch e<strong>in</strong>er ànderung <strong>in</strong> der Verwaltungskultur und e<strong>in</strong>es neuen verwaltungsmÅÜigen<br />
Zusammenwirkens zwischen der geme<strong>in</strong>dlichen Kernverwaltung und den geme<strong>in</strong>dlichen Betrieben. E<strong>in</strong><br />
geme<strong>in</strong>sames LiquiditÅts- und Cash-Management, e<strong>in</strong> Z<strong>in</strong>s- und Schuldenmanagement, e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>same Investitionsplanung,<br />
aber auch e<strong>in</strong> Risikomanagement kÇnnen <strong>in</strong> diesem S<strong>in</strong>ne fÄr den Zusammenhalt <strong>in</strong> der wirtschaftlichen<br />
E<strong>in</strong>heit bzw. der Gesamtheit „Geme<strong>in</strong>de“ hilfreich se<strong>in</strong>. Unter BerÄcksichtigung der Çrtlichen Gegebenheiten<br />
bedarf es dazu ggf. auch verb<strong>in</strong>dlicher Regelungen, um <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong>sgesamt e<strong>in</strong> wirtschaftliches<br />
Verwaltungshandeln und e<strong>in</strong>e ordnungsmÅÜige GeschÅftsfÄhrung der Verantwortlichen zu sichern.<br />
Im Çrtlichen E<strong>in</strong>zelfall kÇnnen zum jeweils aktuellen Abschlussstichtag aber UmstÅnde vorliegen, die dazu fÄhren,<br />
dass die Aufstellung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses entbehrlich wird. Dieser Sachverhalt bed<strong>in</strong>gt dann<br />
nicht, dass die Geme<strong>in</strong>de jetzt auf e<strong>in</strong>e Gesamtsteuerung verzichten kann. Bei e<strong>in</strong>er wirtschaftlichen E<strong>in</strong>heit aus<br />
geme<strong>in</strong>dlicher Kernverwaltung und geme<strong>in</strong>dlichen Betrieben besteht grundsÅtzlich e<strong>in</strong> Bedarf fÄr e<strong>in</strong>e Gesamtsteuerung<br />
durch die Geme<strong>in</strong>de, auch wenn fÄr diese Gesamtheit aktuell ke<strong>in</strong> gesonderter Abschluss unter Beachtung<br />
der e<strong>in</strong>schlÅgigen haushaltsrechtlichen Vorschriften aufzustellen ist.<br />
������������<br />
GEMEINDEORDNUNG 750
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 116<br />
Gesamtabschluss<br />
(1) 1 Die Geme<strong>in</strong>de hat <strong>in</strong> jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember e<strong>in</strong>en Gesamtabschluss<br />
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen. 2 Er besteht aus der Gesamtergebnisrechnung,<br />
der Gesamtbilanz und dem Gesamtanhang und ist um e<strong>in</strong>en Gesamtlagebericht zu ergänzen. 3 Der<br />
Rat bestätigt den geprüften Gesamtabschluss durch Beschluss. 4 § 96 f<strong>in</strong>det entsprechende Anwendung.<br />
(2) 1 Zu dem Gesamtabschluss hat die Geme<strong>in</strong>de ihren Jahresabschluss nach § 95 und die Jahresabschlüsse des<br />
gleichen Geschäftsjahres aller verselbstständigten Aufgabenbereiche <strong>in</strong> öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher<br />
Form zu konsolidieren. 2 Auf den Gesamtabschluss s<strong>in</strong>d, soweit se<strong>in</strong>e Eigenart ke<strong>in</strong>e Abweichung erfordert,<br />
§ 88 und § 91 Abs. 2 entsprechend anzuwenden.<br />
(3) 1 In den Gesamtabschluss müssen verselbstständigte Aufgabenbereiche nach Absatz 2 nicht e<strong>in</strong>bezogen<br />
werden, wenn sie für die Verpflichtung, e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,<br />
Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzgesamtlage der Geme<strong>in</strong>de zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung s<strong>in</strong>d.<br />
2 Dies ist im Gesamtanhang darzustellen.<br />
(4) Am Schluss des Gesamtlageberichtes s<strong>in</strong>d für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands nach § 70, soweit<br />
dieser nicht zu bilden ist, für den Bürgermeister und den Kämmerer, sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die<br />
Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden s<strong>in</strong>d, anzugeben:<br />
1. der Familienname mit m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>em ausgeschriebenen Vornamen,<br />
2. der ausgeübte Beruf,<br />
3. die Mitgliedschaften <strong>in</strong> Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,<br />
4. die Mitgliedschaft <strong>in</strong> Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> öffentlichrechtlicher<br />
oder privatrechtlicher Form,<br />
5. die Mitgliedschaft <strong>in</strong> Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.<br />
(5) 1 Der Gesamtabschluss ist <strong>in</strong>nerhalb der ersten neun Monate nach dem Abschlussstichtag aufzustellen. 2 § 95<br />
Abs. 3 f<strong>in</strong>det für die Aufstellung des Gesamtabschlusses entsprechende Anwendung.<br />
(6) 1 Der Gesamtabschluss ist vom Rechnungsprüfungsausschuss dah<strong>in</strong>gehend zu prüfen, ob er e<strong>in</strong> den tatsächlichen<br />
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzgesamtlage der Geme<strong>in</strong>de<br />
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ergibt. 2 Die Prüfung des Gesamtabschlusses<br />
erstreckt sich darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen<br />
ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden s<strong>in</strong>d. 3 Der Gesamtlagebericht ist darauf zu prüfen, ob er mit<br />
dem Gesamtabschluss <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang steht und ob se<strong>in</strong>e sonstigen Angaben nicht e<strong>in</strong>e falsche Vorstellung von der<br />
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzgesamtlage der Geme<strong>in</strong>de erwecken. 4 § 101 Abs. 2 bis 8 gilt entsprechend.<br />
(7) In die Prüfung nach Absatz 6 müssen die Jahresabschlüsse der verselbstständigten Aufgabenbereiche nicht<br />
e<strong>in</strong>bezogen werden, wenn diese nach gesetzlichen Vorschriften geprüft worden s<strong>in</strong>d.<br />
GEMEINDEORDNUNG 751
Erläuterungen zu § 116:<br />
I. Allgeme<strong>in</strong>es<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
1. Inhalte und Zwecke des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses<br />
Die Vorschrift bestimmt den Inhalt und den Zweck des Gesamtabschlusses näher. Sie ist der handelsrechtlichen<br />
Vorschrift für den Konzernabschluss (§ 290 HGB) nachgebildet worden. Durch den Gesamtabschluss wird die<br />
Qualität der Rechenschaft über die Aufgabenerledigung der Geme<strong>in</strong>de im abgelaufenen Haushaltsjahr wesentlich<br />
erhöht. Er trägt gleichzeitig zu e<strong>in</strong>er Verbesserung der Steuerungsmöglichkeiten bei. Die Funktion des Gesamtabschlusses<br />
besteht <strong>in</strong> der Vermittlung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der gesamten<br />
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de.<br />
Die weiteren Voraussetzungen und Gestaltungsmöglichkeiten des Gesamtabschlusses sowie die Vorgaben für<br />
die Umsetzung der Konsolidierung s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> den §§ 49 bis 52 des siebten Abschnitts der Geme<strong>in</strong>dehaushaltsverordnung<br />
<strong>NRW</strong> näher bestimmt. Wesentlich ist bei den getroffenen Festlegungen, dass durch die rechnerische<br />
Zusammenfassung der Geme<strong>in</strong>de mit ihren Betrieben ke<strong>in</strong>e eigenständige Rechtspersönlichkeit entsteht. Zudem<br />
hat auch der geme<strong>in</strong>dliche Gesamtabschluss ke<strong>in</strong>e Zahlungsbemessungsfunktion, z.B. für die Berechnung von<br />
Ausschüttungen oder Verlustabdeckungen und ist auch nicht Grundlage für Zwecke der Besteuerung, denn der<br />
Gesamtabschluss der Geme<strong>in</strong>de dient der Information über die wirtschaftliche Gesamtlage der Geme<strong>in</strong>de und<br />
ersetzt nicht die e<strong>in</strong>zelnen Jahresabschlüsse der Geme<strong>in</strong>de und ihrer Betriebe.<br />
2. Der Verzicht auf e<strong>in</strong>en Gesamtabschluss<br />
Die Vorschrift enthält ke<strong>in</strong>e gesonderte Ausnahmeregelung, die es ermöglicht, dass die Geme<strong>in</strong>de generell von<br />
der Aufstellung e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses befreit ist. Bei e<strong>in</strong>zelnen Geme<strong>in</strong>den kann e<strong>in</strong> Verzicht<br />
aber möglich se<strong>in</strong>, wenn die Geme<strong>in</strong>de über ke<strong>in</strong>en voll zu konsolidieren Betrieb verfügt, denn dann liegt die<br />
wichtigste Voraussetzung für e<strong>in</strong>en geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss, dass e<strong>in</strong> Mutter-Tochter-Verhältnis zwischen<br />
der Kernverwaltung der Geme<strong>in</strong>de und e<strong>in</strong>em ihrer Betriebe besteht, nicht vor. Das Fehlen dieser Voraussetzung<br />
kann nicht dadurch geheilt werden, dass die betreffende Geme<strong>in</strong>de über Betriebe verfügt, die nach der<br />
Equity-Methode zu konsolidieren wären. Das Vorliegen der Voraussetzungen ist aber zu jedem neuen Abschlussstichtag<br />
von der Geme<strong>in</strong>de erneut zu prüfen.<br />
In den Verzichtsfällen entsteht e<strong>in</strong>e besondere Unterrichtungspflicht gegenüber dem Rat, denn dieser soll den <strong>in</strong><br />
jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember i.d.R. aufzustellenden geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss<br />
bestätigen, wird aber durch den Verzicht von se<strong>in</strong>er Aufgabe befreit. Weil <strong>in</strong> den Fällen des Verzichts auf<br />
die Aufstellung des Gesamtabschlusses nicht die grundsätzliche Prüfungspflicht erlischt, sondern sich nur darauf<br />
ausrichtet, ob örtlich die Voraussetzungen für e<strong>in</strong>en Verzicht auf die Aufstellung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses<br />
vorliegen, sollte die Unterrichtspflicht des Rates sachlich und verfahrensmäßig entsprechend der ansonsten<br />
notwendigen Zuleitung des Entwurfs des Gesamtabschlusses an den Rat erfolgen.<br />
3. Die Prüfung der Entbehrlichkeit des Gesamtabschlusses<br />
Die Vorschrift des § 116 GO <strong>NRW</strong> enthält ke<strong>in</strong>e gesonderte Ausnahmeregelung, die es ermöglicht, dass die Geme<strong>in</strong>de<br />
generell von der Aufstellung e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses befreit ist. Bei e<strong>in</strong>zelnen Geme<strong>in</strong>den<br />
können besondere Fallgestaltungen im Rahmen ihrer Beteiligungen vorliegen, die dazu führen, dass für die<br />
Geme<strong>in</strong>de die Aufstellung e<strong>in</strong>es Gesamtabschlusses entbehrlich wird. E<strong>in</strong> solcher Sachverhalt liegt z.B. vor,<br />
wenn die Geme<strong>in</strong>de über ke<strong>in</strong>en voll zu konsolidieren Betrieb verfügt, denn dann liegt die wichtigste Vorausset-<br />
GEMEINDEORDNUNG 752
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
zung für e<strong>in</strong>en geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss, dass e<strong>in</strong> Mutter-Tochter-Verhältnis zwischen der Kernverwaltung<br />
der Geme<strong>in</strong>de und e<strong>in</strong>em ihrer Betriebe besteht, nicht vor.<br />
Das Fehlen dieser Voraussetzung kann nicht dadurch geheilt werden, dass die betreffende Geme<strong>in</strong>de über Betriebe<br />
verfügt, die nach der Equity-Methode zu konsolidieren wären. Zwar erlischt <strong>in</strong> solchen Fällen die Pflicht zur<br />
Aufstellung e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses, jedoch nicht die <strong>in</strong> dieser Vorschrift enthaltene ausdrückliche<br />
Prüfungspflicht. Sie ist dann von der örtlichen Rechnungsprüfung <strong>in</strong> der Art und Weise auszuüben, dass<br />
geprüft wird, ob örtlich die Voraussetzungen für e<strong>in</strong>en Verzicht auf die Aufstellung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses<br />
vorliegen.<br />
Bei der örtlichen Abwägung ist auch zu prüfen und festzustellen, ob das daraus entstandene Ergebnis (Verzicht<br />
auf die Aufstellung e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses) zutreffend ist. Wird im Rahmen der örtlichen Prüfung<br />
jedoch festgestellt, dass für die Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>e Verpflichtung zur Aufstellung e<strong>in</strong>es örtlichen Gesamtabschlusses<br />
besteht, ist vom Bürgermeister das Notwendige zu veranlassen.<br />
4. Die Unterrichtung des Rates<br />
Die Aufstellung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses und se<strong>in</strong>e Bestätigung durch den Rat s<strong>in</strong>d gesetzlich<br />
bestimmten Fristen unterworfen worden (vgl. § 116 GO <strong>NRW</strong>). Die <strong>in</strong> diesem gesetzlichen Rahmen festgelegten<br />
Aufstellungsfristen stellen dabei nicht nur e<strong>in</strong>e Grenze für den Abschluss der örtlichen Arbeiten dar. Mit diesen<br />
Fristen wird auch bezweckt, dass im Rahmen des jährlich wiederkehrenden Haushaltskreislaufs der Rat der Geme<strong>in</strong>de<br />
frühzeitig durch e<strong>in</strong>en aktuellen Gesamtabschluss über die weitere Entwicklung der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong>formiert<br />
wird. Dieses hat die Geme<strong>in</strong>de zu beachten, wenn aus zw<strong>in</strong>genden örtlichen und sachlogischen Gründen die<br />
gesetzten Fristen überschritten werden müssen. In diesen Fällen obliegt dem Bürgermeister die Unterrichtungspflicht,<br />
denn er hat den Rat der Geme<strong>in</strong>de über alle wichtigen Geme<strong>in</strong>deangelegenheiten zu unterrichten (vgl. §<br />
62 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong>).<br />
II. Erläuterungen im E<strong>in</strong>zelnen<br />
1. Zu Absatz 1 (Gesamtabschluss):<br />
Diese Vorschrift stellt <strong>in</strong>sbesondere durch Satz 1 e<strong>in</strong>en allgeme<strong>in</strong>en Rechnungslegungsgrundsatz dar, der als<br />
Generalnorm die Vorlage e<strong>in</strong>es den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der wirtschaftlichen Gesamtlage<br />
der Geme<strong>in</strong>de durch den Gesamtabschluss gewährleisten soll. Daher ist nach Absatz 6 dieser Vorschrift<br />
auch Prüfungsgegenstand, ob der Gesamtabschluss e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes<br />
Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzgesamtlage der Geme<strong>in</strong>de unter Beachtung der Grundsätze<br />
ordnungsmäßiger Buchführung ergibt.<br />
1.1 Zu Satz 1 (Pflicht der Geme<strong>in</strong>de zur Aufstellung des Gesamtabschlusses):<br />
1.1.1 Das Verfahren zur Bestätigung des Gesamtabschlusses<br />
Nach dieser Vorschrift hat die Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember e<strong>in</strong>en<br />
Gesamtabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen. Die nachfolgende<br />
Übersicht zeigt dies schematisch auf (vgl. Abbildung).<br />
GEMEINDEORDNUNG 753
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
Aufstellungsverfahren zur Bestätigung des Gesamtabschlusses<br />
Aufstellung des Entwurfes des Gesamtabschlusses durch den Kämmerer und Bestätigung durch<br />
den Bürgermeister (§ 116 Abs. 5 i.V.m. § 95 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong>)<br />
Zuleitung des Entwurfes des Gesamtabschlusses an den Rat (§ 116 i.V.m. § 95 Abs. 3 Satz 2<br />
GO <strong>NRW</strong>; soll <strong>in</strong>nerhalb von neun Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres erfolgen)<br />
Prüfung des Gesamtabschlusses durch den Rechnungsprüfungsausschuss (§ 116 Abs. 5 GO<br />
<strong>NRW</strong>) Welcher Bestätigungsvermerk liegt vor? (§ 101 Abs. 4 und 5 GO <strong>NRW</strong>)<br />
Beratung und Bestätigung des Gesamtabschlusses durch den Rat (§ 116 Abs. 1GO <strong>NRW</strong>; bis<br />
spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres), Entlastung des Bürgermeisters<br />
(§ 116 Abs. 1 i.V.m. § 96 Abs. 1 Satz 4 GO <strong>NRW</strong>)<br />
Anzeige des Gesamtabschlusses bei der Aufsichtsbehörde (§ 116 Abs. 1 i.V.m. § 96 Abs. 2 GO<br />
<strong>NRW</strong>)<br />
Bekanntmachung des Gesamtabschlusses (§ 116 Abs. 1 i.V.m. § 96 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>; soll verfügbar<br />
gehalten werden)<br />
Bekanntmachung und Verfügbarhalten des Jahresabschlusses<br />
(§ 96 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>; er soll bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses verfügbar<br />
gehalten werden)<br />
Abbildung 152 „Aufstellungsverfahren zur Bestätigung des Gesamtabschlusses“<br />
Der Entwurf des Gesamtabschlusses wird vom Kämmerer aufgestellt, dem Bürgermeister zur Bestätigung zugeleitet<br />
und nach se<strong>in</strong>er Prüfung vom Rat bestätigt (vgl. § 116 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong>). Der Bestätigung des Gesamtabschlusses<br />
der Geme<strong>in</strong>de gehen mehrere Verfahrensschritte, die term<strong>in</strong>lich bestimmt se<strong>in</strong> müssen, voraus.<br />
1.1.2 Die Zwecke des Gesamtabschlusses<br />
Im öffentlichen Rechnungswesen der Geme<strong>in</strong>den kommt dem Gesamtabschluss - wie im kaufmännischen Rechnungswesen<br />
der Konzernabschluss - e<strong>in</strong>e große Bedeutung zu. Er gibt Rechenschaft über die tatsächliche Aufgabenerledigung<br />
und die wirtschaftliche Entwicklung der Geme<strong>in</strong>de unter E<strong>in</strong>beziehung ihrer verselbstständigten<br />
Aufgabenbereiche. Die Geme<strong>in</strong>de ist daher verpflichtet, jährlich zu dem festen Stichtag 31. Dezember e<strong>in</strong>en Gesamtabschluss<br />
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen, der e<strong>in</strong> den tatsächlichen<br />
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzgesamtlage der<br />
Geme<strong>in</strong>de unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermitteln muss.<br />
In den Gesamtabschluss der Geme<strong>in</strong>de s<strong>in</strong>d deshalb die Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten<br />
sowie die Erträge und Aufwendungen der dar<strong>in</strong> e<strong>in</strong>bezogenen Betriebe der Geme<strong>in</strong>de, unabhängig<br />
von ihrer Berücksichtigung <strong>in</strong> eigenen Jahresabschlüssen, vollständig aufzunehmen. Die Bilanzierungspflichten<br />
richten sich unter Beachtung der GoB nach den für den Jahreabschluss der Geme<strong>in</strong>de geltenden Vorschriften,<br />
e<strong>in</strong>schließlich der möglichen Bilanzierungswahlrechte und Bilanzierungsverbote.<br />
GEMEINDEORDNUNG 754
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
1.1.3 Die Grundsätze für den ordnungsgemäßen Gesamtabschluss<br />
1.1.3.1 Die Grundsätze ordnungsmäßiger Konzernrechnungslegung<br />
Die Aufstellung des Gesamtabschlusses ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung<br />
(GoB) vorzunehmen. Handelsrechtlich haben sich zum Konzernabschluss die Grundsätze ordnungsmäßiger<br />
Konzernrechnungslegung (GoK) entwickelt, die auch beim Gesamtabschluss der Geme<strong>in</strong>de zu beachten s<strong>in</strong>d<br />
(vgl. Abbildung).<br />
Grundsätze ordnungsmäßiger Konzernrechnungslegung (GoK)<br />
Grundsatz der Fiktion der rechtlichen E<strong>in</strong>heit (E<strong>in</strong>heitstheorie)<br />
Grundsatz der E<strong>in</strong>heitlichkeit (der Abschlussstichtage, der Währung, des Ausweises<br />
Grundsatz der Vollständigkeit (des Konsolidierungskreises)<br />
Grundsatz der E<strong>in</strong>heitlichkeit der Bilanzierung und Bewertung<br />
Grundsatz der Stetigkeit der Konsolidierungsmethoden (zeitlich und sachlich)<br />
Grundsatz der Elim<strong>in</strong>ierung konzern<strong>in</strong>terner Beziehungen<br />
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Wesentlichkeit<br />
Abbildung 153 „Grundsätze ordnungsmäßiger Konzernrechnungslegung (GoK)“<br />
Diese Grundsätze sollen im Rahmen des Gesamtabschlusses gewährleisten, dass die Zusammenfassung der<br />
Jahresabschlüsse der e<strong>in</strong>bezogenen Betriebe unter Anwendung der maßgeblichen E<strong>in</strong>heitstheorie erfolgt und der<br />
Gesamtabschluss e<strong>in</strong> Bild über die wirtschaftliche Lage der Geme<strong>in</strong>de vermittelt, als wäre die Kernverwaltung der<br />
Geme<strong>in</strong>de zusammen mit den e<strong>in</strong>bezogenen Betriebe nur e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>heit. Die GoK ergänzen <strong>in</strong> diesem S<strong>in</strong>ne die für<br />
den Gesamtabschluss e<strong>in</strong>schlägigen Vorschriften sowie die GoB. Bei der örtlichen Aufstellung des Gesamtabschlusses<br />
kann es daher notwendig werden, zwischen konkurrierenden Sachverhalten e<strong>in</strong>e Abwägung nach<br />
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung vorzunehmen, weil sich aus den Konsolidierungspflichten, -wahlrechten<br />
und -verboten i.V.m. den zu beachtenden Grundsätzen ggf. Zielkonflikte ergeben können.<br />
Die vernünftige Beurteilung be<strong>in</strong>haltet die Prüfung von Chancen und Risiken unter Beachtung des Vorsichtspr<strong>in</strong>zips,<br />
des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und des Grundsatzes der Wesentlichkeit. Sie muss <strong>in</strong> sich schlüssig<br />
und willkürfrei se<strong>in</strong>, so dass das Ergebnis aus objektiven Gegebenheiten logisch ableitbar ist. Im geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Gesamtabschluss müssen zwar grundsätzlich alle Bilanzierungssachverhalte (e<strong>in</strong>zeln) erfasst werden, jedoch<br />
muss unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit zwischen den Kosten der Rechnungslegung und dem Informationszuwachs<br />
e<strong>in</strong> angemessenes Verhältnis bestehen.<br />
Zu den Grundsätzen der ordnungsmäßigen Konzernrechnungslegung gehören auch die Deutschen Rechnungslegungsstandards,<br />
z.B. DRS 2, denn diese gelten als Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung auch für den<br />
Gesamtabschluss, wenn sie vom Bundesm<strong>in</strong>isterium der Justiz (BMJ) nach § 342 Abs. 2 HGB bekannt gemacht<br />
worden s<strong>in</strong>d Die Textfassung des DRS 2 ist im Kapitel „Haushaltsrechtliche Regelungstexte“ enthalten.<br />
GEMEINDEORDNUNG 755
1.1.3.2 Der Grundsatz der Wesentlichkeit<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
Der Grundsatz der Wesentlichkeit konkretisiert den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit <strong>in</strong>soweit, als er bestimmt,<br />
dass aus der Anwendung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit nur dann Vere<strong>in</strong>fachungen der Rechnungslegung<br />
begründet werden können, wenn sich hieraus ke<strong>in</strong>e Informationsnachteile für die Adressaten des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Gesamtabschlusses ergeben. Er kann dabei quantitativ <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em bestimmten Wert als auch qualitativ <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>er Eigenschaft zur Anwendung kommen. Die Wesentlichkeitsgrenze ist dabei aus der Bedeutung des jeweiligen<br />
örtlichen Sachverhaltes im Rahmen des Gesamtabschlusses der Geme<strong>in</strong>de abzuleiten.<br />
Die Anwendung der Wesentlichkeit ist davon abhängig, wie sich die wirtschaftlichen Entscheidungen und die<br />
daraus entstehenden Informationen sich auf die Adressaten des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses auswirken.<br />
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass mehrere Abweichungen für sich alle<strong>in</strong> betrachtet als unwesentlich anzusehen<br />
s<strong>in</strong>d, zusammen aber durchaus als wesentlich zu bewerten s<strong>in</strong>d. Im Zweifelsfall ist erforderlich, zutreffende<br />
Informationen über die Abweichung zu erhalten, so dass ggf. für die notwendig gewordene Entscheidung e<strong>in</strong>e<br />
überschlägige Ermittlung erforderlich werden kann.<br />
Die im Rahmen des Gesamtabschlusses zu gebenden Informationen s<strong>in</strong>d dann als wesentlich anzusehen, wenn<br />
durch ihr Weglassen oder ihre fehlerhafte oder unvollständige Darstellung die auf der Basis des Gesamtabschlusses<br />
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen der Abschlussadressaten bee<strong>in</strong>flussen können. E<strong>in</strong>e<br />
Relevanz ist daher z.B. anzunehmen, wenn die Informationen dadurch die Adressaten bee<strong>in</strong>flussen, dass sie<br />
ihnen bei der Beurteilung von vergangenen, aktuellen oder zukünftigen Ereignissen helfen oder ihre Beurteilung<br />
bestätigten oder korrigieren. Entscheidungsrelevante Informationen sollen deshalb im geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss<br />
ausgewiesen werden. Der geme<strong>in</strong>dliche Gesamtabschluss ist nur verständlich und akzeptabel und se<strong>in</strong>e<br />
Informationen bedeutsam, wenn alle wesentlichen Informationen gegeben werden.<br />
1.1.3.3 Sachgerechte Anwendung der Grundsätze<br />
Die sachgerechte Anwendung der Grundsätze bei der Aufstellung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses führt<br />
unter Beachtung ihrer qualitativen Merkmale grundsätzlich zu e<strong>in</strong>er wirklichkeitsgetreuen Darstellung der Vermögens-,<br />
Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzgesamtlage der Geme<strong>in</strong>de. Soweit sich die örtlichen Entscheidungen an<br />
diesen Grundsätzen orientieren, entstehen relevante, verlässliche und verständliche Informationen über die wirtschaftliche<br />
Gesamtlage der Geme<strong>in</strong>de. Um dieses sicherzustellen s<strong>in</strong>d z.B. die Gliederungsvorschriften zur geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Bilanz <strong>in</strong> § 41 GemHVO <strong>NRW</strong> konkretisiert worden, bei denen der Grundsatz der Klarheit und der<br />
Grundsatz der Übersichtlichkeit zu beachten ist. Die Bewertungsvorschriften <strong>in</strong> den §§ 32 bis 36, 42 und 43<br />
GemHVO <strong>NRW</strong> prägen dabei das Vorsichtspr<strong>in</strong>zip weiter aus. Diese Vorschriften f<strong>in</strong>den auch auf den geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Gesamtabschluss Anwendung.<br />
1.1.4 Der Gesamtabschluss bei fehlender Vollkonsolidierung<br />
Die Geme<strong>in</strong>de hat <strong>in</strong> jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember e<strong>in</strong>en Gesamtabschluss unter<br />
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen. Zu dieser geme<strong>in</strong>dlichen Verpflichtung<br />
enthält die Vorschrift ke<strong>in</strong>e gesonderten Ausnahmeregelungen. Deshalb müsste die Geme<strong>in</strong>de auch dann e<strong>in</strong>en<br />
Gesamtabschluss aufstellen, wenn sie über ke<strong>in</strong>en voll zu konsolidieren Betrieb verfügt. In solchen Fällen würde<br />
dann der geme<strong>in</strong>dliche Gesamtabschluss aus dem Jahresabschluss der Kernverwaltung und den Jahresabschlüssen<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe, die nach der Equity-Methode zu konsolidieren s<strong>in</strong>d, entstehen. Diese<br />
Verkürzung würde jedoch nicht mit dem S<strong>in</strong>n und Zweck des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang<br />
stehen, denn die Geme<strong>in</strong>de soll nach Absatz 2 der Vorschrift ihren Jahresabschluss und die Jahresabschlüsse<br />
des gleichen Geschäftsjahres aller verselbstständigten Aufgabenbereiche <strong>in</strong> öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher<br />
Form zum geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss konsolidieren.<br />
GEMEINDEORDNUNG 756
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
Die Aufstellung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses setzt aber voraus, dass neben der Kernverwaltung der<br />
Geme<strong>in</strong>de m<strong>in</strong>destens noch e<strong>in</strong> weiterer geme<strong>in</strong>dlicher Betrieb besteht, der voll zu konsolidieren ist. Diese Voraussetzung<br />
kann jedoch nicht durch e<strong>in</strong>en nach der Equity- Methode zu konsolidieren Betrieb erfüllt werden,<br />
denn sie ist dadurch charakterisiert, dass der Wertansatz für den geme<strong>in</strong>dlichen Betrieb entsprechend der Entwicklung<br />
des anteiligen bilanziellen Eigenkapitals des Betriebes fortgeschrieben wird. Anders als bei der Vollkonsolidierung<br />
werden aber Vermögen, Schulden sowie Aufwendungen und Erträge des assoziierten geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Betriebes nicht <strong>in</strong> den Gesamtabschluss übernommen. Daraus kann abgeleitet werden, dass von der Geme<strong>in</strong>de<br />
ke<strong>in</strong> Gesamtabschluss aufzustellen ist, wenn sie über ke<strong>in</strong>en Betrieb verfügt, der voll zu konsolidieren ist.<br />
1.1.5 Der Gesamtabschluss bei Betrieben von untergeordneter Bedeutung<br />
E<strong>in</strong> Verzicht auf e<strong>in</strong>en geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss kann <strong>in</strong> Betracht kommen, wenn die Geme<strong>in</strong>de nur über<br />
geme<strong>in</strong>dliche Betriebe von untergeordneter Bedeutung im S<strong>in</strong>ne des Absatzes 3 dieser Vorschrift verfügt. Ist für<br />
mehrere geme<strong>in</strong>dliche Betriebe zweifelhaft, ob sie für die Geme<strong>in</strong>de von untergeordneter Bedeutung s<strong>in</strong>d, ist die<br />
Frage nicht e<strong>in</strong>zeln für jeden Betrieb, sondern für alle betroffenen Betriebe geme<strong>in</strong>sam zu beantworten. E<strong>in</strong> e<strong>in</strong>zelner<br />
Betrieb kann für sich genommen von untergeordneter Bedeutung se<strong>in</strong>, e<strong>in</strong>e Vielzahl davon kann aber <strong>in</strong><br />
ihrer Gesamtheit durchaus Bedeutung für den Gesamtabschluss der Geme<strong>in</strong>de haben. Die dafür notwendige<br />
Prüfung muss sehr sorgfältig vorgenommen werden. Bei der Entscheidung über die untergeordnete Bedeutung<br />
von mehreren geme<strong>in</strong>dlichen Betrieben darf zudem das Informations<strong>in</strong>teresse der Adressaten des Gesamtabschlusses<br />
nicht außer Betracht bleiben.<br />
1.2 Zu Satz 2 (Bestandteile des Gesamtabschlusses):<br />
1.2.1 Die e<strong>in</strong>zelnen Bestandteile und Anlagen<br />
Die Vorschrift legt die Bestandteile des Gesamtabschlusses der Geme<strong>in</strong>de, der jährlich zu erstellen ist, fest. Er<br />
besteht aus der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtbilanz und dem Gesamtanhang. Der geme<strong>in</strong>dliche Gesamtabschluss<br />
ist zudem um e<strong>in</strong>en Gesamtlagebericht zu ergänzen. Die nähere Ausgestaltung des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Gesamtabschlusses wird <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>dehaushaltsverordnung bestimmt. Die Vorschrift <strong>in</strong> § 49 GemHVO<br />
<strong>NRW</strong> benennt dazu nochmals die Bestandteile des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses und legt durch die <strong>in</strong><br />
Absatz 3 enthaltenen Verweise e<strong>in</strong>en Rahmen für deren Ausgestaltung fest.<br />
Für die Gesamtergebnisrechnung wird auf den § 38 GemHVO <strong>NRW</strong> (Ergebnisrechnung) und für die Gesamtbilanz<br />
auf den § 41 GemHVO <strong>NRW</strong> (Bilanz) verwiesen. Dadurch wird deutlich, dass der geme<strong>in</strong>dliche Gesamtabschluss<br />
nicht nur materiell, sondern auch formell auf den Strukturen, die für den geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss<br />
gelten, aufbaut. Diese Sachlage gilt auch für den Gesamtanhang und den Gesamtlagebericht, auch wenn dafür<br />
eigene Vorschriften geschaffen worden s<strong>in</strong>d (vgl. § 116 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 51GemHVO <strong>NRW</strong>). Außerdem<br />
ist dem geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss e<strong>in</strong> Beteiligungsbericht nach § 117 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> beizufügen.<br />
1.2.1.1 Die Gesamtergebnisrechnung<br />
Die geme<strong>in</strong>dliche Gesamtergebnisrechnung ist aus der handelsrechtlichen Konzern-Gew<strong>in</strong>n- und Verlustrechnung<br />
abgeleitet und an die geme<strong>in</strong>dlichen Besonderheiten angepasst worden. In der Gesamtergebnisrechnung,<br />
die nach § 49 Abs. 2 i.V.m § 38 GemHVO <strong>NRW</strong> aufzustellen ist, s<strong>in</strong>d für die geme<strong>in</strong>dlichen und betrieblichen<br />
Ertrags- und Aufwandsarten, jeweils Jahressummen auszuweisen. Dadurch werden das tatsächliche Ressourcenaufkommen<br />
und der tatsächlichen Ressourcenverbrauch für die gesamte Aufgabenerfüllung der Geme<strong>in</strong>de im<br />
GEMEINDEORDNUNG 757
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
abgelaufenen Haushaltsjahr abgebildet. Die Struktur der geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtergebnisrechnung wird nachfolgend<br />
aufgezeigt (vgl. Abbildung).<br />
Ordentliche<br />
Gesamterträge<br />
Ordentliche<br />
Gesamtaufwendungen<br />
Ordentliches<br />
Gesamtergebnis<br />
Gesamtf<strong>in</strong>anzergebnis<br />
Gesamtergebnis<br />
der laufenden Geschäftstätigkeit<br />
Außerordentliches<br />
Gesamtergebnis<br />
Gesamtjahresergebnis<br />
Gesamtbilanzgew<strong>in</strong>n/<br />
Gesamtbilanzverlust<br />
Struktur der Gesamtergebnisrechnung<br />
Steuern und ähnliche Abgaben<br />
Zuwendungen und allgeme<strong>in</strong>e Umlagen<br />
Sonstige Transfererträge<br />
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
Aktivierte Eigenleistungen<br />
Bestandsveränderungen<br />
Personalaufwendungen<br />
Versorgungsaufwendungen<br />
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
Bilanzielle Abschreibungen<br />
Transferaufwendungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
Saldo aus<br />
Summe der ordentlichen Gesamterträge<br />
Summe der ordentlichen Gesamtaufwendungen<br />
Saldo aus<br />
F<strong>in</strong>anzerträge<br />
Erträge aus assoziierten Beteiligungen<br />
F<strong>in</strong>anzaufwendungen<br />
Aufwendungen aus assoziierten Beteiligungen<br />
Summe aus<br />
Ordentlichem Gesamtergebnis<br />
Gesamtf<strong>in</strong>anzergebnis<br />
Saldo aus<br />
Außerordentlichen Erträge<br />
Außerordentlichen Aufwendungen<br />
Summe aus<br />
Ordentlichem Gesamtergebnis<br />
Außerordentlichem Gesamtergebnis<br />
Abbildung 154 „Struktur der geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtergebnisrechnung“<br />
In der geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtergebnisrechnung s<strong>in</strong>d aber auch wie <strong>in</strong> der Ergebnisrechnung der Geme<strong>in</strong>de mehrere<br />
Salden zu bilden, um das Gesamtergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit der Geme<strong>in</strong>de und das F<strong>in</strong>anzergebnis<br />
sowie aus beiden Ergebnissen das ordentliche Gesamtergebnis festzustellen. Gleichzeitig wird durch<br />
den Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen das außerordentliche Ergebnis<br />
ermittelt. Zur Vervollständigung des Gesamtbildes über die Haushaltswirtschaft des Jahres ist es dann erforderlich,<br />
das ordentliche Gesamtergebnis und das außerordentliche Gesamtergebnis zu e<strong>in</strong>em Jahresgesamtergebnis<br />
zusammen zu führen.<br />
GEMEINDEORDNUNG 758
1.2.1.2 Die Gesamtbilanz<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
Die Gesamtbilanz ist der Konzernbilanz nachgebildet. Die Bilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen und<br />
F<strong>in</strong>anzierungsmitteln der Geme<strong>in</strong>de zum Abschlussstichtag e<strong>in</strong> wesentlicher Bestandteil des doppischen Rechnungssystems<br />
(vgl. § 49 Abs. 2 i.V.m. § 41 GemHVO <strong>NRW</strong>). Die Gesamtbilanzen der Geme<strong>in</strong>den müssen e<strong>in</strong>heitlich<br />
gegliedert se<strong>in</strong>. Daher ist festgelegt, dass die Posten „Anlagevermögen“, „Umlaufvermögen“, „Eigenkapital“,<br />
Schulden“ und „Rechnungsabgrenzungsposten“ <strong>in</strong> jede geme<strong>in</strong>dliche Gesamtbilanz gehören und diese <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>e Aktivseite und e<strong>in</strong>e Passivseite zu gliedern ist. Die Gliederung der beiden Seiten der Bilanz erfolgt nach<br />
Fristigkeiten.<br />
Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen der Geme<strong>in</strong>de mit den zum Abschlussstichtag ermittelten Werten<br />
angesetzt und es wird zwischen Anlagevermögen (langfristig) und Umlaufvermögen (kurzfristig) unterschieden.<br />
Damit wird die Mittelverwendung der Geme<strong>in</strong>de dokumentiert. Auf der Passivseite werden zuerst das Eigenkapital<br />
und dann das Fremdkapital gezeigt. Auch auf dieser Seite gilt das Pr<strong>in</strong>zip der Fristigkeit, denn die allgeme<strong>in</strong>e<br />
Rücklage steht vor der Ausgleichsrücklage (im Eigenkapital) und die Kredite für Investitionen stehen vor<br />
den Krediten zur Liquiditätssicherung. Dadurch wird die Mittelherkunft bzw. die F<strong>in</strong>anzierung des Vermögens<br />
offengelegt und dokumentiert.<br />
Die Aufgliederung der geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtbilanz kann von der Geme<strong>in</strong>de je nach Bedeutung e<strong>in</strong>zelner Posten<br />
durch „davon-Vermerke“ weiter untergliedert werden, wenn dies <strong>in</strong> Bezug auf ihre Aufgabenerfüllung sachgerecht<br />
und <strong>in</strong> Bezug auf das Gesamtbild der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz vertretbar ist. Sie soll umfassend Auskunft über das<br />
gesamte Vermögen und sämtliche Schulden der Geme<strong>in</strong>de geben. Dieses ermöglicht es der Geme<strong>in</strong>de, noch<br />
besser als bisher Erkenntnisse über die bisherige Entwicklung der Geme<strong>in</strong>de zu erlangen und diese für die Zukunft<br />
zu nutzen. Die Struktur der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz wird nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung).<br />
Struktur der geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtbilanz<br />
AKTIVA<br />
1. Anlagevermögen<br />
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände<br />
1.2 Sachanlagen<br />
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grund-<br />
stücksgleiche Rechte<br />
(örtlich weiter zu untergliedern)<br />
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grund-<br />
stücksgleiche Rechte<br />
(örtlich weiter zu untergliedern)<br />
1.2.3 Infrastrukturvermögen<br />
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastruktur-<br />
vermögens<br />
1.2.3.2 Bauten des Infrastrukturvermögens<br />
(örtlich weiter zu untergliedern)<br />
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden<br />
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler<br />
1.2.6 Masch<strong>in</strong>en und technische Anlagen,<br />
Fahrzeuge<br />
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und<br />
Anlagen im Bau<br />
1.3 F<strong>in</strong>anzanlagen<br />
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen<br />
1.3.2 Anteile an assoziierten Unternehmen<br />
1.3.3 Übrige Beteiligungen<br />
1.3.4 Sondervermögen<br />
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens<br />
1.3.6 Ausleihungen<br />
2. Umlaufvermögen<br />
GEMEINDEORDNUNG 759<br />
PASSIVA<br />
1. Eigenkapital<br />
1.1 Allgeme<strong>in</strong>e Rücklage<br />
1.2 Sonderrücklagen<br />
1.3 Ausgleichsrücklage<br />
1.4 Ergebnisvorträge<br />
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag<br />
1.6 Ausgleichsposten für die Anteile anderer<br />
Gesellschafter<br />
1.7 Gesamtbilanzgew<strong>in</strong>n/Gesamtbilanzverlust<br />
2. Sonderposten<br />
2.1 Sonderposten für Zuwendungen<br />
2.2 Sonderposten für Beiträge<br />
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich<br />
2.4 Sonstige Sonderposten<br />
3. Rückstellungen<br />
3.1 Pensionsrückstellungen<br />
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten<br />
3.3 Instandhaltungsrückstellungen<br />
3.4 Steuerrückstellungen<br />
3.5 Sonstige Rückstellungen<br />
4. Verb<strong>in</strong>dlichkeiten<br />
4.1 Anleihen<br />
4.2 Verb<strong>in</strong>dlichkeiten aus Krediten für<br />
Investitionen<br />
4.3 Verb<strong>in</strong>dlichkeiten aus Krediten zur<br />
Liquiditätssicherung<br />
4.4 Verb<strong>in</strong>dlichkeiten aus Vorgängen, die
2.1 Vorräte<br />
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren<br />
2.1.2 Geleistete Anzahlungen<br />
2.2 Forderungen und sonstige<br />
Vermögensgegenstände<br />
2.2.1 Forderungen<br />
2.2.2 Sonstige Vermögensgegenstände<br />
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens<br />
2.4 Liquide Mittel<br />
3. Aktive Rechnungsabgrenzung<br />
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter<br />
Fehlbetrag<br />
5. Aktive latente Steuern<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br />
gleichkommen<br />
4.5 Verb<strong>in</strong>dlichkeiten aus Lieferungen und<br />
Leistungen<br />
4.6 Sonstige Verb<strong>in</strong>dlichkeiten<br />
5. Passive Rechnungsabgrenzung<br />
Abbildung 155 „Struktur der geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtbilanz“<br />
Die Bezifferung der Aktiv- und Passivposten <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtbilanz ist von der Geme<strong>in</strong>de unter Berücksichtigung<br />
der örtlichen Gegebenheiten eigenverantwortlich <strong>in</strong> fachlicher und technischer H<strong>in</strong>sicht festzulegen<br />
ist. Nach dem Grundsatz der Klarheit und Übersichtlichkeit müssen zudem die Bezeichnungen der e<strong>in</strong>zelnen<br />
Bilanzposten klar und verständlich se<strong>in</strong>. Durch die gewählten Bezeichnungen müssen jeweils die begrifflichen<br />
Inhalte erkennbar und nachvollziehbar se<strong>in</strong>. Auch muss jeder Bilanzposten mit e<strong>in</strong>er eigenen Ziffer gekennzeichnet<br />
werden und mit dem dazugehörigen Wertansatz (<strong>in</strong> Ziffern ausgedrückter Betrag) <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er eigenen Zeile stehen.<br />
Entsprechend der Fristigkeit müssen die Bilanzposten <strong>in</strong> s<strong>in</strong>nvoller Weise aufe<strong>in</strong>ander folgen und untere<strong>in</strong>ander<br />
gesetzt se<strong>in</strong>.<br />
1.2.1.3 Der Gesamtanhang<br />
Der Gesamtanhang entspricht dem Konzernanhang. In ihm f<strong>in</strong>den sich die erforderlichen zusätzlichen Erläuterungen<br />
zum Gesamtabschluss, z.B. die Darstellung der nicht <strong>in</strong> den Gesamtabschluss e<strong>in</strong>bezogenen Betriebe der<br />
Geme<strong>in</strong>de. In Anlehnung an die Vorschriften über das kaufmännische Rechnungswesen enthält daher der Gesamtanhang<br />
die besonderen Erläuterungen zu e<strong>in</strong>zelnen Bilanzpositionen, die neben der Beschreibung e<strong>in</strong>e<br />
Ergänzung, Korrektur und Entlastung von Bilanz bezwecken und deren Interpretation unterstützen sollen (vgl. §<br />
49 Abs. 2 i.V.m. § 44 GemHVO <strong>NRW</strong>). In den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtanhang gehören deshalb <strong>in</strong>sbesondere<br />
auch Erläuterungen zu den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Gleichzeitig s<strong>in</strong>d im Gesamtanhang<br />
die Zusatz<strong>in</strong>formationen anzugeben, die für die Beurteilung der Eröffnungsbilanz e<strong>in</strong>e besondere Bedeutung<br />
haben und zu e<strong>in</strong>em besseren Verständnis e<strong>in</strong>zelner Sachverhalte führen. Das nachfolgende Schema soll<br />
e<strong>in</strong>e mögliche Gliederung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtanhangs aufzeigen (vgl. Abbildung).<br />
Gestaltung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtanhangs<br />
1 Allgeme<strong>in</strong>e Angaben<br />
2<br />
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden<br />
3 Erläuterungen zur Gesamtbilanz<br />
4<br />
Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung<br />
GEMEINDEORDNUNG 760<br />
E<strong>in</strong>führung, Erläuterungspflichten,<br />
gesetzliche und örtliche Vorschriften<br />
u.a.<br />
Angaben zu genutzten Ansatzwahlrechten<br />
und Bewertungswahlrechten u.a.<br />
gegliedert nach Anlage- und Umlaufvermögen,<br />
Eigenkapital und Fremdkapital<br />
u.a.<br />
gegliedert nach Arten der Erträge und
5<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung<br />
6 Sonstige Angaben<br />
7 H<strong>in</strong>weise auf sonstige Unterlagen<br />
8 H<strong>in</strong>weis auf Verantwortliche<br />
9 Weitere Besonderheiten<br />
der Aufwendungen<br />
gegliedert nach Arten des Cashflow <strong>in</strong><br />
den drei Bereichen<br />
z.B. nicht bilanzierungsfähige Sachverhalte,<br />
aber wirtschaftliche Bedeutung<br />
haben<br />
z.B. Gesamtanlagenspiegel u.a., wenn<br />
nicht bereits unter den vorherigen<br />
Abschnitten , oder Gesamteigenkapitalspiegel<br />
z.B. auf Nennung der Verantwortlichen<br />
am Schluss des Lageberichts nach §<br />
116Abs. 4 GO <strong>NRW</strong><br />
Wichtige örtliche Sachverhalte, die nicht<br />
bereits anzugeben waren<br />
Abbildung 156 „Gestaltung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtanhangs“<br />
Für die äußere Gestaltung des Gesamtanhangs, se<strong>in</strong>en Aufbau und Umfang s<strong>in</strong>d ke<strong>in</strong>e besonderen Formvorgaben<br />
vorgesehen. Die erforderlichen Informationen sollen im sachlichen Zusammenhang mit den Teilen der Gesamtergebnisrechnung<br />
und der Gesamtbilanz sowie ihren Untergliederungen stehen. Bei der Erarbeitung ist der<br />
spätere Adressatenkreis (Rat, Bürger<strong>in</strong>nen und Bürger) zu berücksichtigen. Um das zu vermittelnde Bild der<br />
Vermögens- und Schuldenlage der Geme<strong>in</strong>de klar und verständlich darzustellen, sollen dem Gesamtanhang e<strong>in</strong><br />
Gesamtanlagenspiegel beigefügt werden. Die von der Geme<strong>in</strong>de bestimmte grundlegende Gliederungsstruktur<br />
für den Gesamtanhang sollte möglichst jährlich beibehalten werden, um die Nachvollziehbarkeit durch Dritte als<br />
Adressaten der Rechnungslegung zu erleichtern. Bei der Erarbeitung und Gestaltung des Gesamtanhangs ist<br />
zudem der Adressatenkreis des Gesamtabschlusses (Rat, Bürger<strong>in</strong>nen und Bürger, Aufsichtsbehörde) zu berücksichtigen.<br />
1.2.1.4 Der Gesamtlagebericht<br />
Der geme<strong>in</strong>dliche Gesamtabschluss ist um e<strong>in</strong>en Gesamtlagebericht zu ergänzen, <strong>in</strong> dem der Geschäftsablauf<br />
und die wirtschaftliche Gesamtlage der Geme<strong>in</strong>de darzustellen und zu erläutern ist. Das nachfolgende Schema<br />
soll mögliche thematische Inhalte des Gesamtlageberichts aufzeigen (vgl. Abbildung).<br />
Gestaltung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtlageberichts<br />
Abschnitt Inhalte<br />
Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Ergebnisüberblick<br />
und Rechenschaft<br />
Steuerung und<br />
Produktorientierung<br />
GEMEINDEORDNUNG 761<br />
Allgeme<strong>in</strong>e örtliche Verhältnisse und Besonderheiten<br />
Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Gesamtabschlusses und<br />
Rechenschaft über die gesamte Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>schließlich<br />
der E<strong>in</strong>haltung der öffentlichen Zwecksetzung durch die geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Betriebe<br />
Ausgewogene und umfassende, dem Umfang der geme<strong>in</strong>dlichen Aufga-
Überblick über die<br />
wirtschaftliche Gesamtlage<br />
Wichtige Vorgänge<br />
und Nachträge<br />
Chancen<br />
Risiken<br />
Örtliche<br />
Besonderheiten<br />
Verantwortlichkeiten<br />
Anlagen<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
benerfüllung entsprechende Analyse der produktorientierten Haushaltswirtschaft<br />
von Kernverwaltung und Betrieben unter E<strong>in</strong>beziehung der Ziele und<br />
Kennzahlen<br />
Ausgewogene und umfassende, dem Umfang der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgabenerfüllung<br />
entsprechende Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags-<br />
und F<strong>in</strong>anzgesamtlage der Geme<strong>in</strong>de unter E<strong>in</strong>beziehung der produktorientierten<br />
Ziele und Leistungskennzahlen, ggf. Angaben über e<strong>in</strong>e Krise<br />
Bericht über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach<br />
Schluss des Haushaltsjahres e<strong>in</strong>getreten s<strong>in</strong>d, und deren Wirkungen auf<br />
die Haushaltswirtschaft von Kernverwaltung und Betrieben<br />
Chancen für die künftige Gesamtentwicklung der Geme<strong>in</strong>de mit Angabe der<br />
zu Grunde liegenden Annahmen<br />
Risiken für die künftige Gesamtentwicklung der Geme<strong>in</strong>de mit Angabe der<br />
zu Grunde liegende Annahmen, ggf. auch der Gegenmaßnahmen und der<br />
Risikoüberwachung<br />
Umsetzung e<strong>in</strong>es Sanierungskonzeptes zur Wiedererreichung und dauerhaften<br />
Sicherung des Haushaltsausgleichs und/oder zum Aufbau von Eigenkapital<br />
(Beseitigung der Überschuldung), z.B. bei der Kernverwaltung<br />
Angaben zu den Mitgliedern des Verwaltungsvorstands und Bürgermeister<br />
und Kämmerer sowie zu den Ratsmitgliedern nach § 95 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>,<br />
ggf. auch zur Geschäftsführung der geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe des Vollkonsolidierungskreises<br />
z.B. Gesamtergebnisse im Zeitvergleich, Kennzahlen im Zeitvergleich,<br />
Prognosen im Zeitvergleich<br />
Abbildung 157 „Gestaltung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtlageberichts“<br />
Die Inhalte des Gesamtlageberichts werden <strong>in</strong> § 51 Abs. 1 GemHVO <strong>NRW</strong> näher bestimmt. Der Gesamtlagebericht<br />
ist danach so zu fassen, dass er e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,<br />
Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzgesamtlage der Geme<strong>in</strong>de vermittelt, denn der Gesamtabschluss der Geme<strong>in</strong>de<br />
bietet die Möglichkeit, Informationen über die wirtschaftlichen Verhältnisse der Geme<strong>in</strong>de (aus der Kernverwaltung<br />
und den geme<strong>in</strong>dlichen Betrieben) <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Zahlenwerk zusammen zu fassen. Dieser <strong>in</strong>tegrierten Gesamtsicht<br />
soll auch der Gesamtlagebericht Rechnung tragen. Die Analyse der zum Abschlussstichtag vorliegenden<br />
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzgesamtlage der Geme<strong>in</strong>de kann mit Hilfe betriebswirtschaftlicher<br />
Kennzahlen erfolgen. Es bleibt der Geme<strong>in</strong>de aber überlassen, mit welchen Kennzahlen sie arbeiten will, um ihre<br />
wirtschaftliche Gesamtlage zu beurteilen<br />
Den Informationsbedürfnissen der Bürger<strong>in</strong>nen und Bürger und des Rates sowie der Aufsichtsbehörde ist dabei <strong>in</strong><br />
ausreichendem Maße Rechnung zu tragen. Weil die Anforderungen an den Gesamtlagebericht <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang mit<br />
dem Handelsrecht stehen, können zur Konkretisierung und Ausgestaltung des Gesamtlageberichtes Erfahrungen<br />
und Erkenntnisse aus der Berichterstattung der geme<strong>in</strong>dlichen Unternehmen und E<strong>in</strong>richtungen genutzt werden.<br />
Diese s<strong>in</strong>d jedoch auf die Bedürfnisse e<strong>in</strong>er Berichterstattung über das vergangene und zukünftige Handeln der<br />
Kernverwaltung der Geme<strong>in</strong>de sachgerecht weiter zu entwickeln.<br />
Für die äußere Gestaltung des Gesamtlageberichts, se<strong>in</strong>en Aufbau und Umfang s<strong>in</strong>d jedoch ke<strong>in</strong>e besonderen<br />
Formvorgaben vorgegeben worden. Die Fülle der Informationen verlangt aber e<strong>in</strong>e grundlegende Strukturierung.<br />
Die Gliederung des Gesamtlageberichts <strong>in</strong> e<strong>in</strong>zelne Elemente muss deshalb dazu beitragen, dass dieser e<strong>in</strong> den<br />
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzgesamtlage der<br />
GEMEINDEORDNUNG 762
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
Geme<strong>in</strong>de vermittelt. Die Inhalte des Lageberichts sollen möglichst systematisch aufgebaut und für die Adressaten<br />
transparent und nachvollziehbar gemacht werden.<br />
1.2.1.5 Der Beteiligungsbericht<br />
Unter E<strong>in</strong>beziehung des § 117 Abs. 1 Satz 2 GO <strong>NRW</strong> hat die Geme<strong>in</strong>de ihren Beteiligungsbericht, <strong>in</strong> dem sie<br />
ihre wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung erläutert, dem Gesamtabschluss beizufügen. Der Beteiligungsbericht<br />
soll den Blick der Geme<strong>in</strong>de vom Gesamtabschluss auf die e<strong>in</strong>zelnen geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe lenken.<br />
Daher umfasst er Angaben über jeden Betrieb der Geme<strong>in</strong>de, unabhängig davon, ob er <strong>in</strong> den Konsolidierungskreis<br />
für den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses e<strong>in</strong>zubeziehen ist. Der Bericht ermöglicht dadurch vertiefte<br />
und notwendige Erkenntnisse für die Gesamtsteuerung der Geme<strong>in</strong>de.<br />
Im geme<strong>in</strong>dlichen Beteiligungsbericht steht daher die Lage jedes e<strong>in</strong>zelnen geme<strong>in</strong>dlichen Betriebes und nicht die<br />
Gesamtlage der Geme<strong>in</strong>de zum Stichtag des Gesamtabschlusses nach § 116 GO <strong>NRW</strong> im Blickpunkt. Um die<br />
differenzierte Betrachtung zu gewährleisten, muss der Beteiligungsbericht bestimmte Informationen, z.B. über<br />
Ziele und Leistungen, die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, der geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe enthalten. Er darf außerdem<br />
nicht als e<strong>in</strong> Werk betrachtet werden, dass jedes Jahr als neue Aufgabe zu erledigen ist. Die Fortführung<br />
der Aufgabenerledigung erfordert, dass der Bericht durch den Aufbau e<strong>in</strong>er Zeitreihe e<strong>in</strong>e Vergleichbarkeit der<br />
Ergebnisse sichert und die Entwicklung transparent macht. Daher ist der Beteiligungsbericht jährlich bezogen auf<br />
den Abschlussstichtag des Gesamtabschlusses fortzuschreiben.<br />
1.2.2 Die Gesamtabschlussunterlagen<br />
1.2.2.1 Die Übersicht über die haushaltsrechtlichen Gesamtabschlussunterlagen<br />
Nach den e<strong>in</strong>schlägigen haushaltsrechtlichen Vorschriften hat die Geme<strong>in</strong>de ihrer Aufsichtsbehörde nachfolgend<br />
aufgeführte Gesamtabschlussunterlagen vorzulegen. Die <strong>in</strong> der Übersicht aufgeführten Unterlagen s<strong>in</strong>d für die<br />
Vermittlung e<strong>in</strong>es den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags-<br />
und F<strong>in</strong>anzgesamtlage der Geme<strong>in</strong>de unverzichtbar und ermöglichen e<strong>in</strong>en aktuellen Überblick über die wirtschaftliche<br />
Gesamtlage der Geme<strong>in</strong>de aus der geme<strong>in</strong>dlichen Kernverwaltung e<strong>in</strong>schließlich der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Betriebe (vgl. Abbildung).<br />
Übersicht über die geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlussunterlagen<br />
Gesamtergebnisrechnung<br />
Gesamtbilanz<br />
Gesamtanhang<br />
Gesamtlagebericht<br />
Beteiligungsbericht<br />
Bestandteile des Gesamtabschlusses<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 49 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 49 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 49 Abs. 1 und § 51 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
Anlagen im Gesamtabschluss<br />
GEMEINDEORDNUNG 763<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 49 Abs. 2 und § 51 Abs. 1 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 117 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 49 Abs. 2 und § 52 GemHVO <strong>NRW</strong>
Gesamtkapitalflussrechnung<br />
Gesamtverb<strong>in</strong>dlichkeitenspiegel<br />
1.2.2.2 Ergänzende Gesamtabschlussunterlagen<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 51 Abs. 3 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 49 Abs. 2 und § 47 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
Abbildung 158 „Gesamtabschlussunterlagen der Geme<strong>in</strong>de“<br />
1.2.2.2.1 Die Übersicht über den geme<strong>in</strong>dlichen Konsolidierungskreis<br />
Den Adressaten des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses muss e<strong>in</strong> Überblick über den Konsolidierungskreis der<br />
Geme<strong>in</strong>de gegeben werden, damit für diese auch auf e<strong>in</strong>fache Art nachvollziehbar wird, welche geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Betriebe nach § 116 GO <strong>NRW</strong> i.V.m. § 50 GemHVO <strong>NRW</strong> <strong>in</strong> den Gesamtabschluss e<strong>in</strong>bezogen worden s<strong>in</strong>d. Die<br />
Übersicht über die gesamte Beteiligungsstruktur e<strong>in</strong>er Geme<strong>in</strong>de, die dem Beteiligungsbericht nach § 52 Abs. 1<br />
Nr. 3 GemHVO <strong>NRW</strong> unter Angabe der Höhe der Anteile an jeder Beteiligung (<strong>in</strong> Prozent) beizufügen ist, geht<br />
über dieses Erfordernis h<strong>in</strong>aus.<br />
Der aufzustellende Beteiligungsbericht soll alle Betriebe der Geme<strong>in</strong>de enthalten, unabhängig davon, ob diese <strong>in</strong><br />
den Gesamtabschluss e<strong>in</strong>zubeziehen s<strong>in</strong>d oder nicht. Die Beurteilung des Gesamtabschlusses macht aber e<strong>in</strong>en<br />
e<strong>in</strong>fachen und zutreffenden Überblick über die <strong>in</strong> den Gesamtabschluss e<strong>in</strong>bezogenen Betriebe erforderlich, so<br />
dass entsprechend der angesprochenen Übersicht über die geme<strong>in</strong>dliche Beteiligungsstruktur e<strong>in</strong>e zusätzliche<br />
Übersicht über den tatsächlichen Konsolidierungskreis der Geme<strong>in</strong>de geschaffen werden sollte.<br />
1.2.2.2.2 Der Eigenkapitalspiegel für den Gesamtabschluss<br />
Die Weiterentwicklung des Handelsgesetzbuches, nach der nunmehr auch e<strong>in</strong> Eigenkapitalspiegel e<strong>in</strong> Bestandteil<br />
des Konzernabschlusses ist, br<strong>in</strong>gt es mit sich, e<strong>in</strong> solches Werk auch dem geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss<br />
beizufügen. Durch den Eigenkapitalspiegel sollen für die Adressaten detaillierte Informationen über alle Veränderungen<br />
des „Konzerneigenkapitals“ bezogen auf die e<strong>in</strong>zelnen Eigenkapitalposten <strong>in</strong> systematischer Form erhalten.<br />
Dabei s<strong>in</strong>d die wesentlichen Größen, die sich auf die e<strong>in</strong>zelnen Eigenkapitalposten im Gesamtabschluss<br />
auswirken, differenziert darzustellen und zu beschreiben. Die Ausgestaltung des Eigenkapitalspiegels im Gesamtabschluss<br />
kann nach Bedarf <strong>in</strong> s<strong>in</strong>nvoller Anwendung der Vorgaben der IAS 1.96 bis 101 für kapitalmarktorientierte<br />
Mutterunternehmen und an dem Deutschen Rechnungslegungsstandard Nr. 7 (DRS 7) für nicht kapitalmarktorientierte<br />
Mutterunternehmen vorgenommen werden.<br />
1.3 Zu Satz 3 (Bestätigung des Gesamtabschlusses durch den Rat):<br />
1.3.1 Beratung und Entscheidung<br />
Nach der Vorschrift hat der Rat der Geme<strong>in</strong>de den geprüften Gesamtabschluss durch Beschluss zu bestätigen<br />
und nicht - wie den Jahresabschluss der Geme<strong>in</strong>de – festzustellen. Diese Besonderheit ist wegen der <strong>in</strong> den<br />
Gesamtabschluss e<strong>in</strong>bezogenen geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe, deren festgestellte Jahresabschlüsse dadurch konsolidiert<br />
werden, sachgerecht und angemessen. Die Bestätigung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses stellt e<strong>in</strong>e<br />
Erklärung des Rates der Geme<strong>in</strong>de dar, dass der ihm zugeleitete Gesamtabschluss den gesetzlichen Anforderungen<br />
entspricht, das erreichte Ergebnis der gesamten geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft im abgelaufenen<br />
Haushaltsjahr und die Auswirkungen daraus auf das Vermögen und die Schulden der Geme<strong>in</strong>de sowie die Chancen<br />
und Risiken für die künftige Gesamtentwicklung der Geme<strong>in</strong>de zutreffend dargestellt s<strong>in</strong>d.<br />
GEMEINDEORDNUNG 764
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
Dem Rat der Geme<strong>in</strong>de und den zuständigen Ausschüssen müssen m<strong>in</strong>destens alle haushaltsrechtlich bestimmten<br />
Gesamtabschlussunterlagen zur Beratung vorgelegt werden, um die Bestätigung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses<br />
durch den Rat ermöglichen. Diese Unterlagen s<strong>in</strong>d für die Vermittlung e<strong>in</strong>es den tatsächlichen Verhältnissen<br />
entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzgesamtlage der Geme<strong>in</strong>de<br />
gegenüber der Öffentlichkeit unverzichtbar. Sie ermöglichen den Interessenten e<strong>in</strong>en aktuellen Überblick über die<br />
wirtschaftliche Gesamtlage der e<strong>in</strong>zelnen Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>schließlich ihrer Betriebe.<br />
1.3.2 Der Gegenstand des Bestätigungsbeschlusses<br />
Der Gegenstand des Bestätigungsbeschlusses des Rates der Geme<strong>in</strong>de über den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss<br />
ist der ihm vom Bürgermeister zugeleitete Entwurf. Bestehen seitens des Rates ke<strong>in</strong>e Bedenken gegen<br />
diese Vorlage, kann er den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss unter Berücksichtigung des erzielten Prüfungsergebnisses<br />
des Rechnungsprüfungsausschusses durch Beschluss bestätigen. Hat sich aus der Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Gesamtabschlusses oder aus der Beratung des Rates über den Gesamtabschluss aber noch e<strong>in</strong><br />
Änderungsbedarf ergeben, muss vor der Beschlussfassung über die Bestätigung der geme<strong>in</strong>dliche Gesamtabschluss<br />
nicht zw<strong>in</strong>gend <strong>in</strong> entsprechender Weise überarbeitet werden, wenn sich der Änderungsbedarf klar und<br />
e<strong>in</strong>deutig bestimmen lässt.<br />
In solchen Fällen dürfte es als ausreichend angesehen werden können, wenn im Ratsbeschluss über die Bestätigung<br />
e<strong>in</strong>e oder mehrere Maßgaben für die Vornahme der Änderungen des Gesamtabschlusses im S<strong>in</strong>ne des<br />
Rates enthalten s<strong>in</strong>d. Es entsteht dadurch e<strong>in</strong> Auftrag des Rates an die geme<strong>in</strong>dliche Verwaltung, bei dem es<br />
dann dem Bürgermeister obliegt, für die Erledigung dieses Auftrages Sorge zu tragen und den geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Gesamtabschluss <strong>in</strong> die vom Rat beschlossene Form zu br<strong>in</strong>gen. Erst nach Erledigung dieses Auftrages liegt<br />
e<strong>in</strong>e Fassung des Gesamtabschlusses der Geme<strong>in</strong>de vor, die zum Gegenstand sowohl der Anzeige an die Aufsichtsbehörde<br />
als auch für die gesetzlich vorgesehene Bekanntmachung gemacht werden kann.<br />
1.3.3 Die Mitwirkung von Verfahrensbeteiligten<br />
1.3.3.1 Die Mitwirkung des Bürgermeisters<br />
Für die Mitwirkung des Bürgermeisters am Bestätigungsbeschluss des Rates der Geme<strong>in</strong>de über den geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Gesamtabschluss ist örtlich zu beurteilen, ob diese Mitwirkung sachlich geboten ist. E<strong>in</strong>erseits ist die Vorschrift<br />
des § 40 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> zu beachten, nach der der Bürgermeister e<strong>in</strong> Mitglied im Rat der Geme<strong>in</strong>de kraft<br />
Gesetzes ist und ihm e<strong>in</strong> Stimmrecht zusteht. Andererseits schränkt die Vorschrift die Rechte des Bürgermeisters<br />
nur für den Fall wieder e<strong>in</strong>, dass die Ratsmitglieder über se<strong>in</strong>e Entlastung entscheiden, denn <strong>in</strong> der Sache gilt er<br />
dann als befangen. Durch die Vorschrift wird daher der Bürgermeister nicht ausdrücklich von der Teilnahme an<br />
der Abstimmung über die Bestätigung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses ausgeschlossen.<br />
In der Sache „Bestätigung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses“ dürfte es jedoch aus Verfahrensgründen<br />
heraus geboten se<strong>in</strong>, dass der Bürgermeister auf die Ausübung des ihm nach § 40 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> zustehenden<br />
Stimmrechtes verzichtet. Nach § 116 Abs. 5 S. 2 i.V.m. § 95 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong> hat der Bürgermeister den ihm vom<br />
Kämmerer vorgelegten Entwurf des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses zu bestätigen, bevor er diesen dem Rat<br />
zuleitet. Er kommt dieser Pflicht durch se<strong>in</strong>e Unterzeichnung des Entwurfs nach und übernimmt damit die verwaltungsmäßige<br />
Verantwortung, denn er ist verantwortlich für die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs<br />
der gesamten Verwaltung (vgl. § 62 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>). Außerdem steht dem Bürgermeister <strong>in</strong> diesem Zusammenhang<br />
neben se<strong>in</strong>er Verantwortung für den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss auch e<strong>in</strong> Änderungsrecht bezogen<br />
auf den Entwurf des Kämmerers zu.<br />
GEMEINDEORDNUNG 765
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
1.3.3.2 Die Mitwirkung des Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses<br />
Für die Mitwirkung des Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses am Bestätigungsbeschluss des Rates<br />
der Geme<strong>in</strong>de über den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss ist örtlich zu beurteilen, ob diese Mitwirkung sachlich<br />
geboten ist. E<strong>in</strong>erseits ist der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses e<strong>in</strong> Mitglied im Rat der Geme<strong>in</strong>de<br />
und ihm steht daher e<strong>in</strong> Stimmrecht zu. Andererseits schränkt die Vorschrift des § 31 die Rechte von Ratsmitgliedern<br />
nur für den Fall e<strong>in</strong>, dass die <strong>in</strong> der Vorschrift genannten Ausschließungsgründe vorliegen, so dass die<br />
betreffenden Ratsmitglieder dann <strong>in</strong> der Sache als befangen gelten. In ke<strong>in</strong>er Vorschrift der Geme<strong>in</strong>deordnung<br />
wird aber der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses ausdrücklich von der Teilnahme an der Abstimmung<br />
über die Bestätigung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses ausgeschlossen.<br />
In der Sache „Bestätigung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses“ dürfte es jedoch aus Verfahrensgründen<br />
heraus geboten se<strong>in</strong>, dass der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses auf die Ausübung se<strong>in</strong>es ihm<br />
zustehenden Stimmrechtes verzichtet. Nach § 116 Abs. 6 i.V.m. § 101 Abs. 7 GO <strong>NRW</strong> hat der Vorsitzende des<br />
Rechnungsprüfungsausschusses nach der Prüfung des ihm vom Rat übergebenen Entwurf des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Gesamtabschlusses den dazugehörigen Bestätigungsvermerk zu unterzeichnen, bevor er den geprüften Entwurf<br />
wieder dem Rat zurückgibt. Diese Pflicht ist ausdrücklich <strong>in</strong> der Vorschrift bestimmt worden. Der Vorsitzende des<br />
Rechnungsprüfungsausschusses übernimmt durch se<strong>in</strong>e Unterzeichnung die Verantwortung für das Ergebnis der<br />
Abschlussprüfung, denn der Ausschuss ist gesetzlich für diese Prüfung zuständig (vgl. § 59 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong>).<br />
1.4 Zu Satz 4 (Anwendung des § 96 GO <strong>NRW</strong>):<br />
1.4.1 Die Frist der Bestätigung des Gesamtabschlusses<br />
Die Verweisung auf § 96 GO <strong>NRW</strong> <strong>in</strong> der Vorschrift soll ergänzend zur Bestätigung des Gesamtabschlusses<br />
durch den Rat der Geme<strong>in</strong>de nach Satz 3 sicherstellen, dass die weiteren Aufgaben des Rates beim Gesamtabschluss<br />
die Gleichen wie beim Jahresabschluss s<strong>in</strong>d. Außerdem sollen die Bürger<strong>in</strong>nen und Bürger und die Aufsichtsbehörde<br />
über den Gesamtabschluss <strong>in</strong>formiert werden. Der Gesamtabschluss muss deshalb auch für e<strong>in</strong>e<br />
Unterrichtung der Bürger<strong>in</strong>nen und Bürger sowie zur Anzeige an die Aufsichtsbehörde geeignet se<strong>in</strong>. Der Rat der<br />
Geme<strong>in</strong>de hat bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den vom Rechnungsprüfungsausschuss<br />
geprüften Gesamtabschluss durch Beschluss festzustellen.<br />
Die zeitliche Begrenzung <strong>in</strong> dieser Vorschrift soll gewährleisten, dass der zeitliche Unterschied zwischen dem<br />
Abschlussstichtag und der Bestätigung des Gesamtabschluss noch vertretbar bleibt, um ggf. auch Auswirkungen<br />
auf die künftige Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de und das Beteiligungsmanagement unverzüglich umsetzen zu<br />
können. Wird vom Rat die Bestätigung des Gesamtabschlusses verweigert, so s<strong>in</strong>d wie bei der Feststellung des<br />
Jahresabschlusses die Gründe dafür gegenüber dem Bürgermeister anzugeben.<br />
1.4.2 Die Behandlung des Gesamtergebnisses<br />
Der Rat der Geme<strong>in</strong>de hat im Rahmen se<strong>in</strong>er Bestätigung des Gesamtabschlusses festzulegen, wie der <strong>in</strong> der<br />
Gesamtergebnisrechnung ausgewiesene Gesamtüberschuss verwendet oder der Gesamtfehlbetrag gedeckt<br />
werden soll. Der Bürgermeister soll dazu möglichst e<strong>in</strong>e Beschlussempfehlung abgegeben. Wenn ausreichend<br />
sicher ist, dass der Rat nicht von der vorgeschlagenen Gesamtergebnisverwendung abweicht, bestehen ke<strong>in</strong>e<br />
Bedenken, die Gesamtergebnisverwendung bereits <strong>in</strong> der vorgelegten Gesamtbilanz darzustellen und dabei auch<br />
e<strong>in</strong>en „Gesamtbilanzgew<strong>in</strong>n“ auszuweisen.<br />
GEMEINDEORDNUNG 766
1.4.3 Die Stellungnahme des Kämmerers<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
Dem Kämmerer ist wie bei der Feststellung des Jahresabschlusses e<strong>in</strong> gesetzliches Anhörungsrecht im Rat e<strong>in</strong>geräumt<br />
worden, wenn er zuvor e<strong>in</strong>e Stellungnahme über se<strong>in</strong>e abweichende Auffassung über den Gesamtabschluss<br />
gegenüber dem Bürgermeister abgegeben hat (vgl. § 95 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong>). Weicht der Bürgermeister von<br />
dem ihm vom Kämmerer vorgelegten Entwurf des Gesamtabschlusses ab, und macht der Kämmerer von dem<br />
Recht Gebrauch, se<strong>in</strong>e abweichende Auffassung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er schriftlichen Stellungnahme darzulegen, ist der Bürgermeister<br />
verpflichtet, diese mit dem Entwurf des Gesamtabschlusses dem Rat vorzulegen. Der Kämmerer kann <strong>in</strong><br />
den Beratungen des Rates der Geme<strong>in</strong>de über den Gesamtabschluss se<strong>in</strong>e Auffassung dazu vertreten.<br />
1.4.4 Die Entlastung des Bürgermeisters<br />
Im Zusammenhang mit der Bestätigung des Gesamtabschluss durch den Rat der Geme<strong>in</strong>de entscheiden die<br />
Ratsmitglieder auch über die Entlastung des Bürgermeisters. Die Entlastung ist e<strong>in</strong>e Festlegung der Ratsmitglieder<br />
dah<strong>in</strong>gehend, dass auf Grund des vorgelegten Gesamtabschlusses und der vorgenommen Prüfung ke<strong>in</strong>e<br />
E<strong>in</strong>wendungen gegen die Haushaltsführung des Bürgermeisters erhoben werden. In diesem Zusammenhang ist<br />
die Vorschrift des § 40 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> zu beachten, nach der der Bürgermeister kraft Gesetzes e<strong>in</strong> Mitglied im<br />
Rat der Geme<strong>in</strong>de ist und ihm e<strong>in</strong> Stimmrecht zu steht. Die Vorschrift schränkt aber gleichzeitig die Stimmrechte<br />
des Bürgermeisters wieder e<strong>in</strong>, denn er gilt, wenn die Ratsmitglieder durch Beschluss über se<strong>in</strong>e Entlastung<br />
entscheiden, <strong>in</strong> der Sache als befangen. Durch die Vorschrift wird daher der Bürgermeister ausdrücklich von der<br />
Teilnahme an der Abstimmung über se<strong>in</strong>e Entlastung ausgeschlossen.<br />
Im Rahmen ihrer Beratungen über den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss und ihrer Entscheidung über die Entlastung<br />
des Bürgermeisters haben sie die Haushaltsführung des Bürgermeisters zu würdigen. E<strong>in</strong>e sorgfältige Beurteilung<br />
der Sachlage zur Entlastung des Bürgermeisters ist <strong>in</strong>sbesondere dann notwendig, wenn der Rechnungsprüfungsausschuss<br />
e<strong>in</strong>en e<strong>in</strong>geschränkten Bestätigungsvermerk erteilt hat, der Bestätigungsvermerk auf Grund<br />
von Beanstandungen von ihm versagt worden ist oder der Bestätigungsvermerk deshalb von ihm versagt wurde,<br />
weil der Ausschuss nicht <strong>in</strong> der Lage war, e<strong>in</strong>e Beurteilung über den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss vorzunehmen.<br />
Auf diese Sorgfaltspflicht kann nicht deswegen verzichtet werden, weil bereits zuvor durch e<strong>in</strong>e Zusammenarbeit<br />
zwischen dem Rechnungsprüfungsausschuss als zuständige Prüfungs<strong>in</strong>stanz und der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung<br />
versucht wurde, die im Gesamtabschluss aufgetretenen Fehler zu beseitigen. Dem Bürgermeister wird aber<br />
grundsätzlich e<strong>in</strong> Anspruch auf se<strong>in</strong>e Entlastung zugestanden, wenn von ihm die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft<br />
im abgelaufenen Haushaltsjahr ordnungsgemäß geführt worden ist. Die Entlastung des Bürgermeisters<br />
kann vorbehaltlos oder mit Vorbehalten ausgesprochen, aber auch verweigert werden.<br />
1.4.5 Die Anzeige des Gesamtabschlusses bei der Aufsichtsbehörde<br />
1.4.5.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Aus der ausschlaggebenden Bedeutung der Art und des Ausmaßes der Erfüllung der kommunalen Aufgaben, die<br />
im Gesamtabschluss gezeigt wird, ergibt sich die Pflicht der Geme<strong>in</strong>de, den vom Rat bestätigten Gesamtabschluss<br />
der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen. Es besteht aber auch die Notwendigkeit für die Aufsichtsbehörde,<br />
sich jeweils zum Ende e<strong>in</strong>es Haushaltsjahres e<strong>in</strong>en Überblick über die gesamte wirtschaftliche<br />
Lage der Geme<strong>in</strong>de zu verschaffen. Die mit dem Gesamtabschluss der Aufsichtsbehörde der Geme<strong>in</strong>de vorzulegenden<br />
Unterlagen s<strong>in</strong>d für e<strong>in</strong>e Gesamtübersicht über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzgesamtlage<br />
der Geme<strong>in</strong>de, die auch die Aufsichtsbehörde haben sollte, unverzichtbar.<br />
GEMEINDEORDNUNG 767
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
Die Geme<strong>in</strong>de hat <strong>in</strong> den Fällen, <strong>in</strong> denen der Rat der Geme<strong>in</strong>de se<strong>in</strong>er gesetzlichen Verpflichtung zur Bestätigung<br />
des Gesamtabschlusses bis zu dem <strong>in</strong> § 96 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> festgelegten Term<strong>in</strong> nicht nachkommt, so dass<br />
die Anzeige des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses bei der Aufsichtsbehörde nicht spätestens unverzüglich nach<br />
diesem Term<strong>in</strong> erfolgen kann, ihre Aufsichtsbehörde darüber zu unterrichten und anschließend die Anzeige des<br />
ihres Gesamtabschlusses baldmöglichst vorzunehmen. In dem Bericht an die Aufsichtsbehörde hat die Geme<strong>in</strong>de<br />
die Gründe für das Versäumnis anzugeben sowie aufzuzeigen, welcher Verfahrensstand zur Bestätigung des<br />
Gesamtabschlusses besteht, wann die Bestätigung durch den Rat vorgesehen ist und bis zu welchem schnellstmöglichen<br />
Zeitpunkt die Anzeige bei der Aufsichtsbehörde nachgeholt wird.<br />
1.4.5.2 Die Anzeige bei Verzicht auf e<strong>in</strong>en Gesamtabschluss<br />
Die Vorschrift enthält ke<strong>in</strong>e gesonderte Ausnahmeregelung, die es ermöglicht, dass die Geme<strong>in</strong>de generell von<br />
der Aufstellung e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses befreit ist. Bei e<strong>in</strong>zelnen Geme<strong>in</strong>den kann e<strong>in</strong> Verzicht<br />
aber möglich se<strong>in</strong>, wenn die Geme<strong>in</strong>de über ke<strong>in</strong>en voll zu konsolidieren Betrieb verfügt, denn dann liegt die<br />
wichtigste Voraussetzung für e<strong>in</strong>en geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss, dass e<strong>in</strong> Mutter-Tochter-Verhältnis zwischen<br />
der Kernverwaltung der Geme<strong>in</strong>de und e<strong>in</strong>em ihrer Betriebe besteht, nicht vor. Das Fehlen dieser Voraussetzung<br />
kann nicht dadurch geheilt werden, dass die betreffende Geme<strong>in</strong>de über Betriebe verfügt, die nach der<br />
Equity-Methode zu konsolidieren wären.<br />
In solchen Fällen entfällt nicht die Anzeigepflicht gegenüber der Aufsichtsbehörde der Geme<strong>in</strong>de, denn diese soll<br />
den <strong>in</strong> jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember i.d.R. aufzustellenden geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss<br />
vorgelegt bekommen. Vielmehr muss bei e<strong>in</strong>em zulässigen Verzicht auf die Aufstellung e<strong>in</strong>es<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses auch darüber <strong>in</strong> Kenntnis gesetzt werden. Weil <strong>in</strong> den Fällen des Verzichts<br />
auf die Aufstellung des Gesamtabschlusses auch nicht die grundsätzliche Prüfungspflicht erlischt, sondern sich<br />
nur darauf ausrichtet, ob örtlich die Voraussetzungen für e<strong>in</strong>en Verzicht auf die Aufstellung des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Gesamtabschlusses vorliegen, sollte die Anzeigepflicht sachlich und verfahrensmäßig darauf ausgerichtet se<strong>in</strong>,<br />
dass die Aufsichtsbehörde e<strong>in</strong>e geprüfte Verzichtserklärung im Rahmen des vorgesehenen Anzeigeverfahrens<br />
vorgelegt wird.<br />
1.4.5.2 Die aufsichtsrechtliche Prüfung des Gesamtabschlusses der Geme<strong>in</strong>de<br />
1.4.5.2.1 Allgeme<strong>in</strong>e Prüfungsgesichtspunkte<br />
Die Aufsichtsbehörde hat aber den ihr nach § 116 Abs. 1 i.V.m. 96 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> angezeigten Gesamtabschluss<br />
mit se<strong>in</strong>en Anlagen grundsätzlich dah<strong>in</strong>gehend zu prüfen, ob dieser formal und <strong>in</strong>haltlich den e<strong>in</strong>schlägigen<br />
Rechtsvorschriften entspricht. Der eigentlichen Abschlussanalyse soll daher e<strong>in</strong>e formelle Prüfung vorausgehen,<br />
bei der auf die Ordnungsmäßigkeit des vom Rat bestätigten Gesamtsabschlusses abzustellen ist.<br />
Die Aufsichtsbehörde hat nicht nur die Vollständigkeit der vorgelegten Abschlussunterlagen, sondern auch das<br />
Vorliegen e<strong>in</strong>er ausreichenden <strong>in</strong>haltlichen Bestimmtheit und Aussagekraft dieser Unterlagen zu prüfen, denn der<br />
geme<strong>in</strong>dliche Gesamtabschluss hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung e<strong>in</strong> den<br />
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzgesamtlage der<br />
Geme<strong>in</strong>de zu vermitteln. Die Tätigkeit der Aufsichtsbehörde erfordert zudem, auch das Verfahren der Aufstellung<br />
des Gesamtabschlusses der Geme<strong>in</strong>de zu kennen, um ggf. erkannte Rechtsverstöße mit den verfügbaren Mitteln<br />
beanstanden zu können.<br />
GEMEINDEORDNUNG 768
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
1.4.5.2.2 Die Prüfung bei e<strong>in</strong>geschränktem oder anderen Bestätigungsvermerken<br />
Im Rahmen der Anzeige des Gesamtabschlusses hat die Aufsichtsbehörde auch zu berücksichtigen, ob und wie<br />
bei der Entscheidung über die Bestätigung des Gesamtabschlusses und der Entlastung des Bürgermeisters das<br />
Ergebnis der Prüfung des Rechnungsprüfungsausschusses berücksichtigt worden ist, soweit dieser Ausschuss<br />
ke<strong>in</strong>en une<strong>in</strong>geschränkten Bestätigungsvermerk erteilt hat. Insbesondere dann, wenn Verstöße gegen haushaltsrechtliche<br />
Vorschriften vorliegen, müssen Ursache und Wirkung von der Geme<strong>in</strong>de auch gegenüber ihrer Aufsichtsbehörde<br />
transparent gemacht werden.<br />
In solchen Fällen ist ggf. auch die Stellungnahme des Bürgermeisters und/oder des Kämmerers zum Prüfungsbericht<br />
des Rechnungsprüfungsausschusses zu berücksichtigen, wenn e<strong>in</strong>e solche im Rahmen der Aufstellung und<br />
Feststellung des Jahresabschlusses abgegeben wurde. Insbesondere <strong>in</strong> den Fällen, <strong>in</strong> denen der Rechnungsprüfungsausschuss<br />
e<strong>in</strong>en e<strong>in</strong>geschränkten Bestätigungsvermerk erteilt hat, der Bestätigungsvermerk auf Grund von<br />
Beanstandungen versagt worden ist oder der Bestätigungsvermerk deshalb versagt wurde, weil der Ausschuss<br />
nicht <strong>in</strong> der Lage war, e<strong>in</strong>e Beurteilung vorzunehmen, bedarf es für die aufsichtsrechtliche Beurteilung auch e<strong>in</strong>er<br />
Beteiligung des Kämmerers und des Bürgermeisters.<br />
Diese Beteiligung sollte auch dann erfolgen, wenn bereits zuvor durch e<strong>in</strong>e Zusammenarbeit zwischen der Prüfungs<strong>in</strong>stanz<br />
und der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung im Gesamtabschluss e<strong>in</strong>ige aufgetretene Fehler, die der Vermittlung<br />
e<strong>in</strong>es den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und<br />
F<strong>in</strong>anzgesamtlage der Geme<strong>in</strong>de entgegen standen, beseitigt worden s<strong>in</strong>d. Bei e<strong>in</strong>em e<strong>in</strong>geschränkten oder<br />
anderem Bestätigungsvermerk durch den Rechnungsprüfungsausschuss muss auch die Tragweite der E<strong>in</strong>schränkung<br />
oder Versagung begründet und erkennbar se<strong>in</strong>. Dar<strong>in</strong> muss die Bedeutung von Mängeln und mögliche<br />
nicht beurteilbare Bereiche zum Ausdruck gebracht werden, so dass die gemachten E<strong>in</strong>schränkungen von<br />
der Aufsichtsbehörde gewichtet und gewürdigt werden können.<br />
1.4.6 Die Bekanntmachung des Gesamtabschlusses<br />
1.4.6.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Durch den Verweis auf § 96 GO <strong>NRW</strong> besteht für die Geme<strong>in</strong>de die Pflicht, ihren Gesamtabschluss öffentlich<br />
bekannt zu machen und danach bis zur Bestätigung des folgenden Gesamtabschlusses zur E<strong>in</strong>sichtnahme verfügbar<br />
zu halten. Damit sollen die E<strong>in</strong>wohner und Abgabepflichtigen bürgerfreundlich und bürgernah über den<br />
Gesamtabschluss des abgelaufenen Haushaltsjahres <strong>in</strong>formiert werden. Die Bürger<strong>in</strong>nen und Bürger s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>erseits<br />
Adressaten des geme<strong>in</strong>dlichen Handelns und sollen andererseits die Arbeit von Rat und Verwaltung der<br />
Geme<strong>in</strong>de unterstützen. Daher besteht e<strong>in</strong> berechtigtes Interesse der Öffentlichkeit an Informationen über die<br />
gesamte wirtschaftliche Lage der Geme<strong>in</strong>de.<br />
Aus diesem Grund soll der geme<strong>in</strong>dliche Gesamtabschluss bis zur Bestätigung des folgenden Gesamtabschlusses<br />
zur E<strong>in</strong>sichtnahme verfügbar gehalten werden. Damit wird dem Grundsatz der Öffentlichkeit Rechnung getragen,<br />
der sich durch die gesamte Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de zieht. Bei der Bekanntmachung des Gesamtabschlusses<br />
durch die Geme<strong>in</strong>de ist zudem die Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem<br />
Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung - BekanntmVO) vom 26.08.1999 (GV. <strong>NRW</strong>. S. 516), zuletzt geändert<br />
durch Gesetz vom 05.04.2005 (GV. <strong>NRW</strong>. S. 332), zu beachten, die Regelungen zu den Formen und dem<br />
Vollzug der Bekanntmachung enthält.<br />
GEMEINDEORDNUNG 769
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
1.4.6.2 Zwecke der Bekanntmachung des Gesamtabschlusses<br />
Die Bekanntmachung des Gesamtabschlusses erfüllt als Information an die E<strong>in</strong>wohner und Abgabepflichtigen<br />
aber nur dann ihren Zweck, wenn dar<strong>in</strong> auch die wichtigsten Ergebnisse aus der Gesamtergebnisrechnung und<br />
aus der Gesamtbilanz öffentlich gemacht werden. Es ist dazu aber nicht erforderlich, den gesamten geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Gesamtabschluss mit se<strong>in</strong>en Anlagen zum Inhalt der Bekanntmachung, z.B. im Amtsblatt der Geme<strong>in</strong>de, zu<br />
machen. Die Bekanntmachungsverordnung lässt es zu, dass bestimmte Materialien, die zum geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss<br />
gehören, stattdessen zu jedermanns E<strong>in</strong>sicht an e<strong>in</strong>er bestimmten Stelle der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung<br />
ausgelegt werden (vgl. § 3 Abs. 2 BekanntmVO).<br />
Die E<strong>in</strong>wohner und Abgabepflichtigen können sich dann entsprechend ihrem Bedarf weitere Kenntnisse über den<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss und damit über die wirtschaftliche Gesamtlage der Geme<strong>in</strong>de verschaffen. Es<br />
bleibt der Geme<strong>in</strong>de überlassen, ob sie den Jahresabschluss <strong>in</strong> herkömmlicher Weise als Druckwerk oder im<br />
Internet verfügbar macht oder <strong>in</strong> sonstiger Weise ihre E<strong>in</strong>wohner und Abgabepflichtigen über ihre wirtschaftliche<br />
Lage und das Ergebnis des abgelaufenen Haushaltsjahres <strong>in</strong>formiert. Diese besondere Vorschrift über den Zugang<br />
zu amtlichen Unterlagen der Geme<strong>in</strong>de lässt die Vorschriften des Informationsfreiheitsgesetzes Nordrhe<strong>in</strong>-<br />
Westfalen (IFG <strong>NRW</strong>) unberührt.<br />
1.4.6.3 Der Vollzug der Bekanntmachung<br />
Die öffentliche Bekanntmachung des Gesamtabschlusses ist mit Ablauf des Ersche<strong>in</strong>ungstages des Amtsblattes<br />
oder der Zeitung vollzogen. Erfolgt die Bekanntmachung <strong>in</strong> mehreren Zeitungen, ist die Bekanntmachung mit<br />
Ablauf des Tages der zuletzt erschienenen Zeitung vollzogen (vgl. § 6 BekanntmVO). Die Öffentlichkeit kann<br />
nicht <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>e bestimmten Auslegungsfrist von dem vom Rat bestätigten Gesamtabschluss Kenntnis nehmen,<br />
sondern soll sich im Rahmen des langfristigen Verfügbarhaltens des Gesamtabschlusses und der E<strong>in</strong>sichtnahme<br />
<strong>in</strong>formieren. Auch bei diesem Verfügbarhalten des Gesamtabschlusses ist die Bekanntmachung mit Ablauf<br />
des Ersche<strong>in</strong>ungstages vollzogen.<br />
1.4.6.4 Der Verzicht auf die Bekanntmachung<br />
Bei e<strong>in</strong>zelnen Geme<strong>in</strong>den kann e<strong>in</strong> Verzicht auf die Bekanntmachung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses<br />
dadurch möglich se<strong>in</strong>, dass die Geme<strong>in</strong>de über ke<strong>in</strong>en voll zu konsolidieren Betrieb verfügt, denn dann liegt die<br />
wichtigste Voraussetzung für e<strong>in</strong>en geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss, dass e<strong>in</strong> Mutter-Tochter-Verhältnis zwischen<br />
der Kernverwaltung der Geme<strong>in</strong>de und e<strong>in</strong>em ihrer Betriebe besteht, nicht vor. Das Fehlen dieser Voraussetzung<br />
kann nicht dadurch geheilt werden, dass die betreffende Geme<strong>in</strong>de über Betriebe verfügt, die nach der<br />
Equity-Methode zu konsolidieren wären. In solchen Fällen entfällt die gesonderte Bekanntmachungspflicht der<br />
Geme<strong>in</strong>de.<br />
Der Wegfall ist <strong>in</strong> jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember, zu dem ke<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>dlicher Gesamtabschluss<br />
aufzustellen ist, erneut zu prüfen. Bei e<strong>in</strong>em zulässigen Verzicht auf die Aufstellung e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Gesamtabschlusses müssen gleichwohl die Adressaten des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses<br />
darüber <strong>in</strong> Kenntnis gesetzt werden. In den Fällen des Verzichts ist es als vertretbar und sachgerecht anzusehen,<br />
wenn die Information über den Verzicht auf die Aufstellung des Gesamtabschlusses <strong>in</strong> die Bekanntmachung des<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses e<strong>in</strong>gebunden wird, denn regelmäßig dürfte durch die beiden geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Abschlüsse der gleiche Adressatenkreis angesprochen werden.<br />
GEMEINDEORDNUNG 770
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
1.4.7 Unmittelbare Informationen über die Gesamtabschlussprüfung<br />
1.4.7.1 Ke<strong>in</strong>e Bekanntgabe des Prüfungsberichtes<br />
Für die Bekanntmachung des Gesamtabschlusses ist zu berücksichtigen, dass wie der Rat auch die Bürger<strong>in</strong>nen<br />
und Bürger als Adressaten aus der Gesamtabschlussprüfung nach § 116 Abs. 6 GO <strong>NRW</strong> konkrete Empfehlungen<br />
zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, der Ordnungsmäßigkeit und der Funktionsfähigkeit des Verwaltungshandelns<br />
der Geme<strong>in</strong>de verlangen, damit für sie entscheidungsrelevante Informationen zur Verfügung stehen.<br />
Aus dieser weiten Zielvorgabe für die Gesamtabschlussprüfung entsteht jedoch ke<strong>in</strong>e gesonderte Pflicht für<br />
die Geme<strong>in</strong>de, den Bürger<strong>in</strong>nen und Bürgern den Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsausschusses <strong>in</strong> vollem<br />
Umfang verfügbar zu machen.<br />
Bei der Entscheidung der Geme<strong>in</strong>de, ob und ggf. <strong>in</strong> welchem Umfang e<strong>in</strong> Prüfungsbericht über den geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Gesamtabschluss der Öffentlichkeit allgeme<strong>in</strong> zugänglich gemacht werden soll, ist zu berücksichtigen, dass<br />
nur der Rat der Geme<strong>in</strong>de der Adressat des Prüfungsberichtes, denn er hat den Rechnungsprüfungsausschuss<br />
mit der Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses beauftragt. Auch ist zu beachten, dass der Rat <strong>in</strong> öffentlicher<br />
Sitzung über das Ergebnis der Abschlussprüfung berät und se<strong>in</strong>e Bestätigung des Gesamtabschlusses unter<br />
E<strong>in</strong>beziehung des Prüfungsergebnisses zu erfolgen hat. Mit dieser öffentlichen Tätigkeit des Rates dürfte bereits<br />
e<strong>in</strong>e ausreichende Information für die Öffentlichkeit über die Art und den Umfang der durchgeführten Prüfung des<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses gewährleistet se<strong>in</strong>.<br />
1.4.7.2 Informationen über das Prüfungsergebnis<br />
Das Prüfungsergebnis der Gesamtabschlussprüfung sollte dem o.a. Adressatenkreis verfügbar gemacht werden,<br />
der im Rahmen der öffentlichen Bekanntmachung des Gesamtabschlusses <strong>in</strong>formiert werden möchte oder sich<br />
<strong>in</strong>formiert. Da das Prüfungsergebnis nach § 116 Abs. 6 i.V.m. § 101 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Bestätigungsvermerk<br />
zusammenzufassen ist, bietet es sich an, diesen Bestätigungsvermerk dem der Aufsichtsbehörde nach §<br />
116 Abs. 1 i.V.m. § 96 Abs. 2 S. 1 GO <strong>NRW</strong> anzuzeigenden Gesamtabschluss sowie der Bekanntmachung des<br />
Gesamtabschlusses nach § 116 Abs. 1 i.V.m. 96 Abs. 2 S. 2 GO <strong>NRW</strong> beizufügen. Damit wird dem Informationsbedürfnis<br />
des oben genannten Adressatenkreises <strong>in</strong> ausreichendem Umfang genüge getan.<br />
1.4.8 Das Verfügbarhalten des Gesamtabschlusses der Geme<strong>in</strong>de<br />
1.4.8.1 Zwecke und Zeitraum des Verfügbarhaltens<br />
Der Gesamtabschluss ist nach se<strong>in</strong>er öffentlichen Bekanntmachung bis zur Bestätigung des folgenden Gesamtabschlusses<br />
zur E<strong>in</strong>sichtnahme verfügbar zu halten und nicht nur an wenigen Tagen auszulegen. Insgesamt<br />
gesehen steht den Bürger<strong>in</strong>nen und Bürgern der Jahresabschluss damit <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Zeitraum zu Verfügung, <strong>in</strong> dem<br />
das weitere haushaltswirtschaftliche Handeln der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung auf dem erstellten Gesamtabschluss<br />
aufbaut. Durch das nachfolgende Beispiel soll deutlich werden, dass der geme<strong>in</strong>dliche Gesamtabschluss<br />
solange verfügbar zu halten ist, wie noch ke<strong>in</strong> weiterer bestätigter Gesamtabschluss besteht (vgl. Abbildung).<br />
Zeitraum des Verfügbarhaltens des Gesamtabschlusses 2011<br />
Aufgabe Datum<br />
Aufstellung und Zuleitung<br />
des Entwurfs des Gesamtabschlusses an den Rat<br />
GEMEINDEORDNUNG 771<br />
Bis zum 30. September 2012
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
Prüfung des Entwurfs des Gesamtabschlusses<br />
durch den Rechnungsprüfungsausschuss<br />
Bestätigung des Gesamtabschlusses<br />
durch den Rat<br />
Anzeige des Gesamtabschlusses<br />
an die Aufsichtsbehörde<br />
Bekanntmachung<br />
des Gesamtabschlusses<br />
Verfügbarhalten des Gesamtabschlusses<br />
bis zur Feststellung des folgenden Gesamtabschlusses<br />
Örtliche Fristsetzung<br />
Bis zum 31. Dezember 2012<br />
Nach Bestätigung durch den Rat<br />
Nach Bestätigung durch den Rat<br />
Bis zum 31. Dezember 2013<br />
Abbildung 159 „Zeitraum des Verfügbarhaltens des Gesamtabschlusses 2011“<br />
Insgesamt gesehen steht den Bürger<strong>in</strong>nen und Bürgern der Gesamtabschluss damit <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Zeitraum zu Verfügung,<br />
<strong>in</strong> dem das weitere haushaltswirtschaftliche Handeln der Geme<strong>in</strong>de i.d.R. auch auf dem erstellten Gesamtabschluss<br />
aufbaut. Mit der öffentlichen Bereitstellung und dem E<strong>in</strong>sichtsrecht <strong>in</strong> diese „Basis“ für das künftige<br />
geme<strong>in</strong>dliche Handeln wird dem Grundsatz der Öffentlichkeit ausreichend Rechnung getragen, der sich durch<br />
das gesamte geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsverfahren zieht. Es bleibt aber der Geme<strong>in</strong>de überlassen, ob sie den bestätigten<br />
Gesamtabschluss <strong>in</strong> herkömmlicher Weise als Druckwerk bereithält oder im Internet verfügbar macht.<br />
1.4.8.2 Das Verfügbarhalten im Internet<br />
Die Geme<strong>in</strong>de muss beim ihrem Informationsangebot über den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss im Internet<br />
(Verfügbarhalten im Internet) wie bei ihren sonstigen Onl<strong>in</strong>e-Auftritten und -Angeboten sowie bei den von ihr zur<br />
Verfügung gestellten Programmoberflächen im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung berücksichtigen,<br />
dass deren technische Gestaltung auch die Nutzung durch Menschen mit Beh<strong>in</strong>derung ermöglicht (vgl. § 1 i.V.m.<br />
§ 10 BGG <strong>NRW</strong>). Daraus folgt, dass die Geme<strong>in</strong>de nach bestem Bemühen die Erstellung e<strong>in</strong>es barrierefreien<br />
Angebotes vornehmen muss, bei dem z.B. die Inhalte und das Ersche<strong>in</strong>ungsbild des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses<br />
so zu gestalten s<strong>in</strong>d, dass sie für alle Interessierten wahrnehmbar s<strong>in</strong>d (vgl. § 2 BITV <strong>NRW</strong>).<br />
Als Barrierefreiheit wird die Auff<strong>in</strong>dbarkeit, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der gestalteten Lebensbereiche für alle<br />
Menschen angesehen, so dass der Zugang und die Nutzung für Menschen mit Beh<strong>in</strong>derung <strong>in</strong> der allgeme<strong>in</strong><br />
üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe möglich se<strong>in</strong> müssen. Zu den<br />
zu gestalteten Lebensbereichen gehören nicht nur bauliche Anlagen und technische Gebrauchsgegenstände,<br />
sondern auch die Systeme der Informationsverarbeitung.<br />
2. Zu Absatz 2 (Konsolidierungskreis für den Gesamtabschluss):<br />
2.1 Zu Satz 1 (Konsolidierung der Jahresabschlüsse):<br />
2.1.1 Die wirtschaftliche E<strong>in</strong>heit „Geme<strong>in</strong>de“<br />
Nach dieser Vorschrift hat die Geme<strong>in</strong>de ihren Jahresabschluss (Kernverwaltung) und die Jahresabschlüsse des<br />
gleichen Geschäftsjahres aller verselbstständigten Aufgabenbereiche <strong>in</strong> öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher<br />
Form (geme<strong>in</strong>dliche Betriebe) zu e<strong>in</strong>em Gesamtabschluss zu konsolidieren (Fiktion der wirtschaftlichen<br />
E<strong>in</strong>heit). Unter dem Begriff „Wirtschaftliche E<strong>in</strong>heit“ wird dabei regelmäßig e<strong>in</strong>e organisatorische Gesamtheit von<br />
GEMEINDEORDNUNG 772
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
Personen und/oder Sachen verstanden, bei denen die Ausübung der wirtschaftlichen Tätigkeit auf Dauer ausgelegt<br />
ist und e<strong>in</strong>e eigene Zielsetzung verfolgt wird. Im geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss kann die Fiktion der wirtschaftlichen<br />
E<strong>in</strong>heit als gegeben angesehen werden, denn die Geme<strong>in</strong>de ist öffentlich-rechtlich der „Inhaber“ ihrer<br />
Kernverwaltung und alle<strong>in</strong>e oder zusammen mit Dritten der privatrechtliche „Inhaber“ ihrer Betriebe.<br />
Die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der <strong>in</strong> den Gesamtabschluss der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>bezogenen<br />
Kernverwaltung soll daher zusammen mit den geme<strong>in</strong>dlichen Betrieben so dargestellt werden, als ob es sich bei<br />
der Geme<strong>in</strong>de um e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>zige wirtschaftliche E<strong>in</strong>heit handelt. Außerdem soll der geme<strong>in</strong>dliche Gesamtabschluss<br />
e<strong>in</strong>en aus den Jahresabschlüssen der e<strong>in</strong>bezogenen geme<strong>in</strong>dlichen Kernverwaltung und Betriebe abgeleiteten<br />
eigenständigen Abschluss darstellen (E<strong>in</strong>heitstheorie). Dieses setzt für die E<strong>in</strong>beziehung von geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Betrieben <strong>in</strong> den Gesamtabschluss der Geme<strong>in</strong>de generell e<strong>in</strong> Mutter-Tochter-Verhältnis zwischen der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Kernverwaltung und den geme<strong>in</strong>dlichen Betrieben voraus.<br />
Die beschriebene „Generalnorm“ hat erhebliche Bedeutung, auch wenn sie nicht ausdrücklich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er e<strong>in</strong>zigen<br />
Vorschrift enthalten ist. Vielmehr ist sie <strong>in</strong> vielen E<strong>in</strong>zelvorschriften enthalten, die im Rahmen der Aufstellung,<br />
Prüfung und Bestätigung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses zur Anwendung kommen. Daher stellt der geme<strong>in</strong>dliche<br />
Gesamtabschluss e<strong>in</strong>en aus den Jahresabschlüssen der Kernverwaltung und der <strong>in</strong> den Gesamtabschluss<br />
e<strong>in</strong>bezogenen geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe abgeleiteten eigenständigen Abschluss der gesamten wirtschaftlichen<br />
E<strong>in</strong>heit „Geme<strong>in</strong>de“ dar. Dabei ist zu berücksichtigen, dass dann die verselbstständigten Aufgabenbereiche<br />
nicht <strong>in</strong> den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss e<strong>in</strong>bezogen werden müssen, wenn sie für die Verpflichtung, e<strong>in</strong> den<br />
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzgesamtlage der<br />
Geme<strong>in</strong>de zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung s<strong>in</strong>d.<br />
Vor diesem H<strong>in</strong>tergrund s<strong>in</strong>d deshalb auftretende örtliche Zweifelsfragen bei der Aufstellung des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Gesamtabschlusses immer unter Beachtung dieser Generalnorm zu lösen, d.h. bildlich gesehen, ist die e<strong>in</strong>zelne<br />
Frage unter dem Gesichtspunkt zu klären, als ob die geme<strong>in</strong>dliche Kernverwaltung um die geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe<br />
erweitert worden wäre. Diese Sachlage br<strong>in</strong>gt es z.B. mit sich, dass die Leistungsbeziehungen <strong>in</strong>nerhalb des<br />
„Konzerns Geme<strong>in</strong>de“ elim<strong>in</strong>iert werden müssen. Wegen der öffentlich-rechtlichen Verhältnisse bei den Geme<strong>in</strong>den<br />
kann es im Rahmen des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses jedoch ke<strong>in</strong>e Fiktion der rechtlichen E<strong>in</strong>heit<br />
geben. Anders als im privatwirtschaftlichen Bereich kommt es bei den Geme<strong>in</strong>den auch faktisch nicht zu e<strong>in</strong>em<br />
tatsächlichen Konzernverbund.<br />
2.1.2 Die Zusammensetzung des Konsolidierungskreises<br />
2.1.2.1 Die geme<strong>in</strong>dliche Ausgangslage<br />
Das geme<strong>in</strong>dewirtschaftliche Handeln wird durch geme<strong>in</strong>derechtliche und durch gesellschaftsrechtliche Vorschriften<br />
geprägt. Als Geme<strong>in</strong>dewirtschaftsrecht bildet es e<strong>in</strong>en eigenständigen Teilbereich <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>deordnung<br />
(vgl. 11. Teil der GO <strong>NRW</strong>). Dieser Teilbereich enthält <strong>in</strong>sbesondere Bestimmungen zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen<br />
Betätigung der Geme<strong>in</strong>de, durch die auch e<strong>in</strong>e Abgrenzung zwischen wirtschaftlicher und nichtwirtschaftlicher<br />
Betätigung erfolgt (vgl. § 107 GO <strong>NRW</strong>) und die Normierung der öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen<br />
Organisationsformen (vgl. § 108 GO <strong>NRW</strong>), die für die wirtschaftliche und nicht-wirtschaftliche Betätigung<br />
der Geme<strong>in</strong>de zur Verfügung stehen sowie die Voraussetzungen, unter denen privatrechtliche organisierte<br />
geme<strong>in</strong>dliche Betriebe möglich s<strong>in</strong>d. Diese Zulassung geme<strong>in</strong>dewirtschaftlicher Betriebe bestimmt auch die örtliche<br />
Zusammensetzung des Konsolidierungskreises der Geme<strong>in</strong>de, der zusammen mit der geme<strong>in</strong>dlichen Kernverwaltung<br />
die Ausgangslage für den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss bildet.<br />
In der Vorschrift ist <strong>in</strong> Anlehnung an das Handelsgesetzbuch (§ 294) bestimmt worden, welche geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Betriebe mit ihren Jahresabschlüssen <strong>in</strong> den Gesamtabschluss der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>bezogen werden. Dabei wird<br />
der Grundsatz der Vollständigkeit beachtet, denn zum geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss sollen neben der ge-<br />
GEMEINDEORDNUNG 773
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
me<strong>in</strong>dlichen Kernverwaltung alle verselbstständigten Aufgabenbereiche <strong>in</strong> öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher<br />
Form zusammen geführt werden. In diesem Zusammenhang s<strong>in</strong>d unter dem gesetzlichen Begriff „Verselbstständigte<br />
Aufgabenbereiche“ organisatorisch abgegrenzte geme<strong>in</strong>dliche Aufgaben zu verstehen, die nicht <strong>in</strong> der<br />
Kernverwaltung der Geme<strong>in</strong>de, sondern <strong>in</strong> öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich ausgestalteten Betriebe erledigt<br />
werden. Die Aufgaben der Geme<strong>in</strong>de werden im Rahmen geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses wieder zu e<strong>in</strong>em<br />
Gesamtbild zusammen geführt.<br />
2.1.2.2 Die Abgrenzung des Konsolidierungskreises<br />
Der Konsolidierungskreis wird bei geme<strong>in</strong>dlichen Unternehmen und E<strong>in</strong>richtungen des privaten Rechts vergleichbar<br />
dem Handelsrecht abgegrenzt. Derartige geme<strong>in</strong>dliche Betriebe s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> den Gesamtabschluss nur e<strong>in</strong>zubeziehen,<br />
wenn sie unter der e<strong>in</strong>heitlichen Leitung der Geme<strong>in</strong>de stehen oder die Geme<strong>in</strong>de auf sie e<strong>in</strong>en beherrschenden<br />
E<strong>in</strong>fluss hat. Die geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe, die <strong>in</strong> den Gesamtabschluss der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>zubeziehen<br />
s<strong>in</strong>d, müssen für die Erfüllung der Aufgabe des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses, e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen<br />
entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzgesamtlage der Geme<strong>in</strong>de zu<br />
vermitteln, von Bedeutung se<strong>in</strong>. Die möglichen Konsolidierungse<strong>in</strong>heiten werden nachfolgend aufgezeigt (vgl.<br />
Abbildung).<br />
Konsolidierungse<strong>in</strong>heiten<br />
Mit dem Jahresabschluss der geme<strong>in</strong>dlichen Kernverwaltung s<strong>in</strong>d zu konsolidieren<br />
- der geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe, die mit der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>e Rechtse<strong>in</strong>heit bilden<br />
- der geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe und Vermögensmassen mit Nennkapital, an denen die<br />
Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>e Beteiligung hält<br />
- der Anstalten, die von der Geme<strong>in</strong>de auf der Grundlage rechtlicher Vorschriften als<br />
Anstalt des öffentlichen Rechts (AÖR) alle<strong>in</strong>e oder zusammen mit anderen Geme<strong>in</strong>den<br />
oder sonstigen Dritten getragen werden<br />
-<br />
- der Zweckverbände, <strong>in</strong> denen die Geme<strong>in</strong>de Mitglied ist<br />
- der rechtlich selbstständigen kommunalen Stiftungen, bei denen die Geme<strong>in</strong>de Stifter ist<br />
- der sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger, deren f<strong>in</strong>anzielle Existenz auf<br />
Grund rechtlicher Verpflichtungen wesentlich durch die Geme<strong>in</strong>de gesichert wird, so<br />
dass e<strong>in</strong> Abhängigkeitsverhältnis zur Geme<strong>in</strong>de besteht (<strong>in</strong>stitutionelle F<strong>in</strong>anzunterstützung)<br />
Abbildung 160 „Konsolidierungse<strong>in</strong>heiten“<br />
Beim geme<strong>in</strong>dlichen Konsolidierungskreis ist außerdem zu berücksichtigen, dass dieser <strong>in</strong> Zukunft auch Veränderungen<br />
unterliegen kann, z.B. wenn durch e<strong>in</strong>e Veräußerung e<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>dlicher Betrieb aufgegeben wird, der<br />
dann aus dem geme<strong>in</strong>dlichen Konsolidierungskreis ausscheidet. Auch durch die Errichtung oder den Erwerb<br />
neuer geme<strong>in</strong>dliche Betriebe, die dann <strong>in</strong> den Gesamtabschluss e<strong>in</strong>zubeziehen s<strong>in</strong>d, verändert sich der geme<strong>in</strong>dliche<br />
Konsolidierungskreis. Zu jedem Abschlussstichtag ist daher von der Geme<strong>in</strong>de der für den davorliegenden<br />
Gesamtabschluss gebildete Konsolidierungskreis zu überprüfen und ggf. anzupassen. Die Betriebe gewerblicher<br />
Art (BgA) als ausschließliche steuerrechtliche Betriebsform sowie die geme<strong>in</strong>dlichen Regiebetriebe (Teil der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Kernverwaltung) stellen zwar Betriebsformen dar. Sie s<strong>in</strong>d aber, weil sie ke<strong>in</strong>e eigenständigen ge-<br />
GEMEINDEORDNUNG 774
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
me<strong>in</strong>derechtlichen Organisationsformen darstellen, nicht <strong>in</strong> den Konsolidierungskreis für den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss<br />
e<strong>in</strong>zubeziehen.<br />
2.1.2.3 Sparkassen und Konsolidierungskreis<br />
2.1.2.3.1 Ke<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>beziehung der Sparkassen<br />
E<strong>in</strong>e Besonderheit bei den Geme<strong>in</strong>den stellen die Sparkassen <strong>in</strong> der Rechtsform e<strong>in</strong>er landesrechtlichen Anstalt<br />
öffentlichen Rechts <strong>in</strong> der Trägerschaft der Geme<strong>in</strong>de dar (vgl. § 1 Abs. 1 S. 1 SpkG <strong>NRW</strong>). Der Landesgesetzgeber<br />
hat erstmals im Sparkassengesetz vom 18.11.2008 (GV. <strong>NRW</strong>. S. 696) entschieden, dass die geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Sparkassen nicht im Jahresabschluss der Geme<strong>in</strong>den anzusetzen s<strong>in</strong>d (vgl. § 1 Abs. 1 S. 2 SpkG <strong>NRW</strong>). In<br />
der Begründung zum NKFG vom 16.11.2004 ist dieser Wille des Landesgesetzgebers bereits zum Ausdruck<br />
gebracht worden, dass die geme<strong>in</strong>dlichen Sparkassen nicht zu bilanzieren s<strong>in</strong>d und daher auch nicht <strong>in</strong> den geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Gesamtabschluss e<strong>in</strong>bezogen werden sollen. Die damalige Willensbekundung des Gesetzgebers<br />
folgte e<strong>in</strong>er Entscheidung der Länder im Rahmen der Bemühungen um e<strong>in</strong>e Reform des geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsrechts.<br />
Dieser Festlegung steht nicht entgegen, dass nach § 1 Abs. 1 S. 1 SpkG <strong>NRW</strong> die Sparkassen als wirtschaftliche<br />
Unternehmen der Geme<strong>in</strong>den e<strong>in</strong>gestuft werden und daher als e<strong>in</strong>e Vermögensmasse der Geme<strong>in</strong>den zu betrachten<br />
s<strong>in</strong>d, die <strong>in</strong> den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss e<strong>in</strong>bezogen werden müsste. Das o.a. gesetzliche Verbot<br />
lässt es aber gleichwohl nicht zu, e<strong>in</strong>e Sparkasse <strong>in</strong> der Trägerschaft der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> den Konsolidierungskreis<br />
für ihren geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss aufzunehmen. In diesem Zusammenhang erfordert es das<br />
Transparenzgebot, dass die Geme<strong>in</strong>de entsprechende Angaben im Gesamtanhang zu machen, wenn sie Träger<strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>er Sparkasse ist.<br />
2.1.2.3.2 Ke<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>beziehung der Beteiligungen der Sparkassen<br />
Die geme<strong>in</strong>dlichen Sparkassen besitzen vielfach Unternehmen und weitere Beteiligungen. Die Festlegung des<br />
Gesetzgebers, die Sparkassen nicht <strong>in</strong> den Gesamtabschluss e<strong>in</strong>zubeziehen, umfasst <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em S<strong>in</strong>ne nicht<br />
durch nur die orig<strong>in</strong>äre öffentlich-rechtliche Anstalt „Sparkasse“, sondern auch die Unternehmen und Beteiligungen<br />
sowie die sonstigen Anteilsverhältnisse der Sparkasse. Unter Berücksichtigung dieser Verhältnisse und der<br />
Aufgabe des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses ist die Festlegung entstanden, nicht nur die orig<strong>in</strong>äre öffentlichrechtliche<br />
Anstalt „Sparkasse“ nicht <strong>in</strong> den Gesamtabschluss der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>zubeziehen, sondern die gesamte<br />
„Gruppe“ Sparkasse, d.h. die Sparkasse e<strong>in</strong>schließlich der ihr zugehörigen Betriebe.<br />
In den Fällen, <strong>in</strong> denen die Geme<strong>in</strong>de jedoch selbst unmittelbar oder mittelbar über e<strong>in</strong>en geme<strong>in</strong>dlichen Betrieb<br />
an e<strong>in</strong>em Unternehmen der Sparkasse beteiligt ist, muss dieser geme<strong>in</strong>dliche Anteil von der Geme<strong>in</strong>de unter<br />
Anwendung der zutreffenden Konsolidierungsmethode <strong>in</strong> ihren Gesamtabschluss e<strong>in</strong>bezogen werden. Diese<br />
Festlegung entspricht dem Willen des Landesgesetzgebers, der <strong>in</strong> der Begründung zum NKFG ausdrücklich<br />
bekundet hat, die geme<strong>in</strong>dlichen Sparkassen nicht <strong>in</strong> den Gesamtabschluss der Geme<strong>in</strong>den e<strong>in</strong>zubeziehen.<br />
2.1.2.3.3 Sparkassenzweckverbände und Konsolidierungskreis<br />
Aus der Nichte<strong>in</strong>beziehung der Sparkassen <strong>in</strong> den Konsolidierungskreis für den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss<br />
ist jedoch nicht der Schluss zu ziehen, dass auch die Mitgliedschaft der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Sparkassenzweckverband<br />
nicht <strong>in</strong> den Gesamtabschluss e<strong>in</strong>zubeziehen ist. Die geme<strong>in</strong>dlichen Zweckverbände, zu denen auch<br />
Sparkassenzweckverbände gehören, stellen e<strong>in</strong>e öffentlich-rechtliche Organisationsform dar, deren Wert je nach<br />
GEMEINDEORDNUNG 775
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
E<strong>in</strong>fluss der Mitglieder <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtbilanz wie e<strong>in</strong> verbundenes Unternehmen oder e<strong>in</strong>e Beteiligung<br />
anzusetzen und daher regelmäßig zu konsolidieren s<strong>in</strong>d.<br />
Für die E<strong>in</strong>beziehung <strong>in</strong> den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss ist wie bei allen geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe als wirtschaftliche<br />
oder nicht wirtschaftliche Tochtere<strong>in</strong>heiten der Geme<strong>in</strong>de nicht die gewählte Organisationsform ausschlaggebend,<br />
sondern die von der Geme<strong>in</strong>de für den e<strong>in</strong>zelnen Betrieb bestimmte öffentliche Zwecksetzung. Ob<br />
und <strong>in</strong> welcher Form e<strong>in</strong> Sparkassenzweckverband <strong>in</strong> den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss e<strong>in</strong>zubeziehen ist,<br />
hängt daher örtlich u.a. auch von der wirtschaftlichen Bedeutung der e<strong>in</strong>zelnen Mitgliedschaft der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>em Sparkassenzweckverband ab.<br />
2.1.2.4 Geme<strong>in</strong>dliche Betriebe als Teilkonzerne<br />
Im Rahmen der Bestimmung des geme<strong>in</strong>dlichen Konsolidierungskreises, <strong>in</strong> den die Kernverwaltung der Geme<strong>in</strong>de<br />
als Muttere<strong>in</strong>heit und die geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe als Tochtere<strong>in</strong>heiten e<strong>in</strong>bezogen werden, kann der Sachverhalt<br />
bekannt werden, dass e<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>dlicher Betrieb <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Rechtsform des privaten Rechts bereits nach den<br />
handelsrechtlichen Vorschriften e<strong>in</strong> Mutterunternehmen darstellt und deshalb zur Aufstellung e<strong>in</strong>es handelsrechtlichen<br />
Konzernabschlusses verpflichtet ist (vgl. §§ 290 ff. HGB). In e<strong>in</strong>em solchen Fall kommt es auf die Rechtsform<br />
der Tochterunternehmen dieses geme<strong>in</strong>dlichen Betriebes nicht an.<br />
Der eigenständige handelsrechtliche Konzernabschluss wäre dann der Abschluss dieses geme<strong>in</strong>dlichen Betriebes<br />
und wäre haushaltsrechtlich als „Teilkonzernabschluss“ zu behandeln und entsprechend zu konsolidieren.<br />
Dieses würde ermöglichen, dass e<strong>in</strong>e gesonderte Konsolidierung der e<strong>in</strong>zelnen Jahresabschlüsse mehrerer geme<strong>in</strong>dlicher<br />
Betriebe, die dem handelsrechtlichen Konzern angehören, entbehrlich wäre. Aus der Transparenz-<br />
und Informationsgründen müsste der handelsrechtliche Konzernabschluss dann dah<strong>in</strong>gehend gekennzeichnet<br />
werden, dass er geme<strong>in</strong>debezogen e<strong>in</strong>en „Teilkonzernabschluss“ darstellt, denn dieses ist für die Adressaten<br />
nicht unmittelbar erkennbar.<br />
Diese örtliche Gegebenheit führt weder dazu, dass auf den handelsrechtlichen Konzernabschluss noch auf den<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss verzichtet werden kann. Die Sachlage ermöglicht vielmehr, dass <strong>in</strong> den geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Gesamtabschluss nicht jeder geme<strong>in</strong>dliche Betrieb, der dem handelsrechtlich geprägten „Konzern“<br />
angehört, sondern das nur das Mutterunternehmen (geme<strong>in</strong>dlicher Betrieb) mit se<strong>in</strong>em Konzernabschluss e<strong>in</strong>bezogen<br />
werden müsste. Der geme<strong>in</strong>dliche Gesamtabschluss würde dann <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em solchen Fall nach e<strong>in</strong>em Stufenkonzept<br />
- vergleichbar dem handelsrechtlichen Konzept - aufgebaut werden können.<br />
E<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>dlicher Betrieb, der handelsrechtlich e<strong>in</strong> Mutterunternehmen darstellt, wäre dann gleichzeitig e<strong>in</strong>e<br />
Tochtere<strong>in</strong>heit <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Verhältnis zur geme<strong>in</strong>dlichen Kernverwaltung als Muttere<strong>in</strong>heit und würde e<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>dlicher<br />
„Teilkonzern“ im Gesamtabschluss se<strong>in</strong>. Die zulässige E<strong>in</strong>beziehung e<strong>in</strong>es solchen „Teilkonzernabschlusses“<br />
<strong>in</strong> den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss erfordert aber auch die Beachtung folgender wichtiger Voraussetzungen<br />
(vgl. Abbildung).<br />
Voraussetzungen bei E<strong>in</strong>beziehung e<strong>in</strong>es „Teilkonzernabschlusses“<br />
1. Voraussetzung<br />
2. Voraussetzung<br />
GEMEINDEORDNUNG 776<br />
Es wird e<strong>in</strong> vollständiger handelsrechtlicher Konzernabschluss<br />
e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Betriebes aufgestellt.<br />
Die Kapitalverflechtungen und Leistungsbeziehungen zwischen<br />
den im Teilkonzern voll zu konsolidierenden Betrieben und der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Kernverwaltung müssen aufgedeckt und berücksichtigt<br />
werden.
3. Voraussetzung<br />
4. Voraussetzung<br />
5. Voraussetzung<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
Die Kapitalverflechtungen und Leistungsbeziehungen zwischen<br />
den im Teilkonzern voll zu konsolidierenden Betrieben und anderen<br />
voll zu konsolidierenden geme<strong>in</strong>dlichen Betrieben müssen<br />
aufgedeckt und berücksichtigt werden.<br />
Änderungen der Konsolidierungsstruktur im Vergleich zum Abschluss<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Kernverwaltung müssen berücksichtigt<br />
werden.<br />
Im handelsrechtlichen Konzern aufgedeckte stille Reserven müssen<br />
auf Ebene des geme<strong>in</strong>dlichen „Teilkonzerns“ fortgeschrieben<br />
werden.<br />
Abbildung 161 „Voraussetzungen bei E<strong>in</strong>beziehung e<strong>in</strong>es „Teilkonzernabschlusses“<br />
In diesem Zusammenhang ist für den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss zu beachten, dass <strong>in</strong> den Fällen, <strong>in</strong> denen<br />
assoziierte Betriebe der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>en handelsrechtlichen Konzernabschluss aufstellen, e<strong>in</strong>e besondere Regelung<br />
<strong>in</strong> § 312 Abs. 6 HGB besteht. Danach ist für den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss nicht vom Jahresabschluss<br />
des Betriebes auszugehen, sondern von dem von diesem Betrieb aufgestellten Konzernabschluss.<br />
2.1.2.5 Besonderheiten bei f<strong>in</strong>anziellen Abhängigkeitsverhältnissen<br />
Die sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger außerhalb der Geme<strong>in</strong>de, deren f<strong>in</strong>anzielle Existenz auf<br />
Grund rechtlicher Verpflichtungen aber wesentlich durch die Geme<strong>in</strong>de gesichert wird, sollen regelmäßig <strong>in</strong> den<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss e<strong>in</strong>bezogen werden. Dieses erfordert e<strong>in</strong>e erweiterte Betrachtung. Im Rahmen<br />
der IMK-Arbeiten <strong>in</strong> 2003 war es nicht beabsichtigt, jeden Aufgabenträger, der e<strong>in</strong>en Zuschuss der Geme<strong>in</strong>de<br />
erhält, auf Grund dieser geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzleistung <strong>in</strong> den Gesamtabschluss der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>zubeziehen. So<br />
soll e<strong>in</strong> Aufgabenträger, der e<strong>in</strong>en Zuschuss zu se<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>richtung, z.B. K<strong>in</strong>dergarten, nicht deshalb konsolidierungspflichtig<br />
se<strong>in</strong>, wenn e<strong>in</strong> solcher Zuschuss, wie im Beispiel, im Grundsatz unabhängig davon zu gewähren ist,<br />
um welchen Träger des K<strong>in</strong>dergartens es sich handelt, weil es alle<strong>in</strong> auf die Trägerschaft e<strong>in</strong>er solchen E<strong>in</strong>richtung<br />
ankommt.<br />
Die ausschlaggebende Voraussetzung für die E<strong>in</strong>beziehung e<strong>in</strong>es Dritten als Aufgabenträger <strong>in</strong> den geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Gesamtabschluss soll aber e<strong>in</strong> f<strong>in</strong>anzielles Abhängigkeitsverhältnis se<strong>in</strong>. E<strong>in</strong> solches kann nur dann als<br />
gegeben angesehen werden, wenn die f<strong>in</strong>anziellen Beziehungen zwischen der Geme<strong>in</strong>de und dem Aufgabenträger<br />
dar<strong>in</strong> bestehen und den geme<strong>in</strong>dlichen Zweck haben, den betreffenden Aufgabenträger als örtliche Institution<br />
zu erhalten. Aus dem bestehenden Verhältnis zwischen der Geme<strong>in</strong>de und dem Aufgabenträger muss daher<br />
erkennbar und nachvollziehbar se<strong>in</strong>, dass e<strong>in</strong> <strong>in</strong>stitutionelles (f<strong>in</strong>anzielles) Abhängigkeitsverhältnis des Aufgabenträgers<br />
von der Geme<strong>in</strong>de besteht, z.B. dadurch, dass die Geme<strong>in</strong>de jährlich F<strong>in</strong>anzleistungen an den Aufgabenträger<br />
zu erbr<strong>in</strong>gen hat, die dazu führen, dass diese Erträge überwiegend die Aufwendungen des Aufgabenträgers<br />
decken. Außerdem müssen auch die sonstigen Voraussetzungen für die E<strong>in</strong>beziehung von Aufgabenträgern<br />
<strong>in</strong> den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss erfüllt werden.<br />
Aus diesen Grundlagen lässt sich für e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>beziehung <strong>in</strong> den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss z.B. ableiten,<br />
dass bei e<strong>in</strong>em fremden Aufgabenträger, der als Institution f<strong>in</strong>anziell von der Geme<strong>in</strong>de abhängig ist, die Geme<strong>in</strong>de<br />
auch <strong>in</strong> dessen Entscheidungsgremien vertreten se<strong>in</strong> müsste. Ist dieses vor Ort nicht gegeben, spricht<br />
dieses Indiz, unabhängig von der f<strong>in</strong>anziellen Größenordnung der geme<strong>in</strong>dlichen Zuschüsse, dafür, dass dieser<br />
Aufgabenträger für die Geme<strong>in</strong>de aus ihrer "Gesamtabschlusssicht" heraus, von untergeordneter Bedeutung ist.<br />
E<strong>in</strong>e solche Abgrenzung oder Ausgrenzung muss aber im Zusammenhang und <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang mit den sonstigen<br />
Gegebenheiten, die zu e<strong>in</strong>em Verzicht auf die E<strong>in</strong>beziehung geme<strong>in</strong>dlicher Betriebe oder anderer Dritter <strong>in</strong> den<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Konsolidierungskreis führen stehen. Sie muss mit diesen Gegebenheiten aber nicht identisch se<strong>in</strong>.<br />
GEMEINDEORDNUNG 777
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
Außerdem ist <strong>in</strong> die Betrachtung e<strong>in</strong>zubeziehen, ob die f<strong>in</strong>anzielle Abhängigkeit von der Geme<strong>in</strong>de nur aus der<br />
laufenden Geschäftstätigkeit des sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträgers besteht oder auch aus<br />
se<strong>in</strong>er Investitionstätigkeit und/oder der F<strong>in</strong>anzierungstätigkeit heraus besteht.<br />
Bei e<strong>in</strong>er ausschließlichen f<strong>in</strong>anziellen Abhängigkeit aus der laufenden Geschäftstätigkeit des Aufgabenträgers<br />
heraus dürfte auf Grund der aufwandswirksamen F<strong>in</strong>anzleistungen der Geme<strong>in</strong>de, die auch <strong>in</strong> die Gesamtergebnisrechnung<br />
e<strong>in</strong>fließen, i.d.R. e<strong>in</strong>e vollständige E<strong>in</strong>beziehung des Aufgabenträgers <strong>in</strong> den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss<br />
nur <strong>in</strong> Betracht kommen, wenn zusätzlich e<strong>in</strong>e besondere Bedeutung des Aufgabenträgers h<strong>in</strong>sichtlich<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgabenerfüllung besteht. Dieses zusätzlichen Sachverhaltes bedarf es auch dann,<br />
wenn e<strong>in</strong>e f<strong>in</strong>anzielle Abhängigkeit aus der Investitionstätigkeit und/oder der F<strong>in</strong>anzierungstätigkeit des Aufgabenträger<br />
heraus besteht und die Geme<strong>in</strong>de z.B. ihre f<strong>in</strong>anziellen Investitionsleistungen nicht als Rechnungsabgrenzungsposten<br />
bilanzieren kann oder nicht wirtschaftlicher Eigentümer der angeschafften Vermögensgegenstände<br />
geworden ist.<br />
2.1.2.6 Eckpunkte zum Konsolidierungskreis<br />
Die Aufstellung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses erfordert von der Geme<strong>in</strong>de die Beachtung e<strong>in</strong>er Vielzahl<br />
von Eckpunkten, um unter Berücksichtigung ihrer tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die wirtschaftliche Gesamtheit<br />
zu schaffen (vgl. Abbildung).<br />
Vollständigkeitsgrundsatz<br />
Weltabschlusspr<strong>in</strong>zip<br />
Vollkonsolidierung<br />
Equity-Konsolidierung<br />
F<strong>in</strong>anzanlagevermögen<br />
Sparkassen und ihre Beteiligungen<br />
Betriebe als Teilkonzerne<br />
Eckpunkte zum Konsolidierungskreis<br />
GEMEINDEORDNUNG 778<br />
Die Kernverwaltung der Geme<strong>in</strong>de und die geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Betriebe <strong>in</strong> öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form<br />
s<strong>in</strong>d zusammen zu fassen.<br />
In den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss s<strong>in</strong>d grundsätzlich<br />
alle Betriebe der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>zubeziehen.<br />
Betriebe, die unter der e<strong>in</strong>heitlichen Leitung der Geme<strong>in</strong>de<br />
stehen oder auf die sie e<strong>in</strong>en beherrschenden E<strong>in</strong>fluss<br />
ausübt (§ 50 Abs. 1 und 2 GemHVO <strong>NRW</strong>) werden im Rahmen<br />
der Vollkonsolidierung <strong>in</strong> den Gesamtabschluss e<strong>in</strong>bezogen.<br />
Betriebe unter maßgeblichem E<strong>in</strong>fluss der Geme<strong>in</strong>de werden<br />
at Equity <strong>in</strong> den Gesamtabschluss e<strong>in</strong>bezogen.<br />
Alle übrigen Betriebe werden unter der Gesamtbilanzposition<br />
„F<strong>in</strong>anzanlagevermögen“ ausgewiesen.<br />
Sparkassen werden auf Grund der (neuen) gesetzlichen<br />
Regelung und ihre Beteiligungen aufgrund e<strong>in</strong>er Konvention<br />
nicht <strong>in</strong> den Gesamtabschluss e<strong>in</strong>bezogen.<br />
Unter Beachtung e<strong>in</strong>iger Voraussetzungen und der Durchführung<br />
daraus folgender Arbeitsschritte kann e<strong>in</strong> handelsrechtlicher<br />
Konzernabschluss e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Betriebes<br />
<strong>in</strong> den Gesamtabschluss e<strong>in</strong>bezogen werden.
Untergeordnete Bedeutung<br />
F<strong>in</strong>anzielle Abhängigkeit<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
Betriebe, die für die Vermittlung e<strong>in</strong>es den tatsächlichen<br />
Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-,<br />
Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzgesamtlage der Geme<strong>in</strong>de<br />
von untergeordneter Bedeutung s<strong>in</strong>d, brauchen nicht e<strong>in</strong>bezogen<br />
werden.<br />
Der sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger,<br />
deren f<strong>in</strong>anzielle Existenz auf Grund rechtlicher Verpflichtungen<br />
wesentlich durch die Geme<strong>in</strong>de gesichert wird, so<br />
dass e<strong>in</strong> Abhängigkeitsverhältnis zur Geme<strong>in</strong>de besteht<br />
(<strong>in</strong>stitutionelle F<strong>in</strong>anzunterstützung).<br />
Abbildung 162 „Eckpunkte für den geme<strong>in</strong>dlichen Konsolidierungskreis“<br />
2.1.2.7 Veränderungen des Konsolidierungskreises<br />
Der Konsolidierungskreis für den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss kann <strong>in</strong> Zukunft Veränderungen unterliegen,<br />
wenn z.B. durch e<strong>in</strong>e Veräußerung e<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>dlicher Betrieb aufgegeben wird, so dass dieser dann aus dem<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Konsolidierungskreis ausscheidet. Auch durch Errichtung oder Erwerb neuer Betriebe durch die<br />
Geme<strong>in</strong>de verändert sich der geme<strong>in</strong>dliche Konsolidierungskreis ab dem Zeitpunkt, ab dem die neuen Betriebe <strong>in</strong><br />
die geme<strong>in</strong>dliche Konsolidierung e<strong>in</strong>bezogen werden müssen. Der Konsolidierungskreis ist daher von der Geme<strong>in</strong>de<br />
zu jedem Abschlussstichtag zu überprüfen und ggf. anzupassen.<br />
2.1.3 E<strong>in</strong>beziehung der Jahresabschlüsse des gleichen Geschäftsjahres<br />
2.1.3.1 Der e<strong>in</strong>heitliche Abschlussstichtag<br />
Der geme<strong>in</strong>dliche Gesamtabschluss setzt sich aus dem Jahresabschluss der Geme<strong>in</strong>de nach § 95 GO <strong>NRW</strong> und<br />
den Jahresabschlüssen des gleichen Geschäftsjahres aller geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe <strong>in</strong> öffentlich-rechtlicher oder<br />
privatrechtlicher Form zusammen. Die Aufgabe des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses, die Vermögens-, Schulden-,<br />
Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der e<strong>in</strong>bezogenen Betriebe so darzustellen, als ob die Geme<strong>in</strong>de mit ihren Betrieben<br />
<strong>in</strong>sgesamt e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>zige wirtschaftliche und rechtliche E<strong>in</strong>heit wäre, erfordert, dass die Jahresabschlüsse der<br />
am Gesamtabschluss Beteiligten grundsätzlich bezogen auf den gleichen Abschlussstichtag (Stichtag der Geme<strong>in</strong>de)<br />
aufgestellt werden.<br />
Die E<strong>in</strong>heitlichkeit des Abschlussstichtages ist e<strong>in</strong> wichtiger Tatbestand, um e<strong>in</strong>em möglichst aussagefähigen<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss aufzustellen. Die Festlegung des geme<strong>in</strong>dlichen e<strong>in</strong>heitlichen Abschlussstichtages<br />
31. Dezember <strong>in</strong> jedem Haushaltsjahr berücksichtigt, dass nach § 78 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong> für die geme<strong>in</strong>dliche<br />
Haushaltswirtschaft das Kalenderjahr das Haushaltsjahr und für viele geme<strong>in</strong>dliche Betriebe das Kalenderjahr<br />
das Geschäftsjahr darstellt. Gleichwohl besteht bei e<strong>in</strong>zelnen Betrieben e<strong>in</strong> vom Kalenderjahr abweichendes<br />
Geschäftsjahr, weil z.B. die betrieblichen Bedürfnisse dies erfordern. Diese Abweichung stellt jedoch ke<strong>in</strong> H<strong>in</strong>dernis<br />
für die E<strong>in</strong>beziehung e<strong>in</strong>es Betriebes <strong>in</strong> den Gesamtabschluss dar.<br />
2.1.3.2 Die Aufstellung e<strong>in</strong>es Zwischenabschlusses<br />
2.1.3.2.1 Die zeitliche Abgrenzung<br />
Im NKF soll die wirtschaftliche E<strong>in</strong>heit der Geme<strong>in</strong>de mit ihren Betrieben u.a. dadurch erreicht werden, dass auch<br />
die geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe, die e<strong>in</strong> vom Kalenderjahr abweichendes Geschäftsjahr haben, vom Gesamtabschluss<br />
der Geme<strong>in</strong>de nicht ausgeschlossen werden. E<strong>in</strong> abweichendes Geschäftsjahr e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen<br />
GEMEINDEORDNUNG 779
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
Betriebes kann zu Problemen bei der Durchführung der Konsolidierung durch die Geme<strong>in</strong>de führen, weil z.B.<br />
„konzern<strong>in</strong>terne“ Aufrechnungen zwischen der Kernverwaltung und solchen geme<strong>in</strong>dlichen Betrieben sehr<br />
schwierig, ggf. auch nicht möglich s<strong>in</strong>d.<br />
In den Fällen, <strong>in</strong> denen das abweichende Geschäftsjahr <strong>in</strong> der Zeit vom 30. September bis zum 31. Dezember<br />
endet, weil z.B. die betrieblichen Bedürfnisse dies erfordern, wird unterstellt, dass durch besondere konsolidierungstechnische<br />
Buchungen die notwendigen Elim<strong>in</strong>ierungen „konzern<strong>in</strong>terner“ Vorgänge erreicht werden können.<br />
Ob dies auch noch gel<strong>in</strong>gt, wenn, wie bei vielen geme<strong>in</strong>dlichen Kulturbetrieben üblich, der Abschlussstichtag<br />
der 31. Juli ist, ist fraglich. Auch wenn ke<strong>in</strong>e gesonderte Vorschrift über e<strong>in</strong>en dann aufzustellenden Zwischenabschluss<br />
besteht, bietet sich dieser jedenfalls für die geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe mit diesem Abschlussstichtag an, die<br />
zum Vollkonsolidierungskreis für den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss gehören.<br />
Unter Berücksichtigung des Hauptzweckes des Gesamtabschlusses der Geme<strong>in</strong>de, e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen<br />
entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzgesamtlage der Geme<strong>in</strong>de zu<br />
vermitteln, sowie unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit muss die E<strong>in</strong>beziehung e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Betriebes <strong>in</strong> den Gesamtabschluss der Geme<strong>in</strong>de von ihr örtlich e<strong>in</strong>geschätzt und über e<strong>in</strong>en Zwischenabschluss<br />
entschieden werden, wenn der Betrieb e<strong>in</strong> um weniger als drei Monate vom Haushaltsjahr der Geme<strong>in</strong>de<br />
abweichendes Geschäftsjahr hat. Das Ergebnis der örtlichen Abwägung kann aber auch dar<strong>in</strong> bestehen, dass e<strong>in</strong><br />
Betrieb ke<strong>in</strong>en Zwischenabschluss aufzustellen hat. Beim Vorliegen e<strong>in</strong>er solchen Sachlage müssen die Vorgänge<br />
von besonderer Bedeutung für die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzgesamtlage der Geme<strong>in</strong>de, die<br />
zwischen dem Abschlussstichtag des geme<strong>in</strong>dlichen Betriebes und dem Abschlussstichtag des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Gesamtabschlusses e<strong>in</strong>getreten s<strong>in</strong>d, <strong>in</strong> der Gesamtbilanz und der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt oder<br />
im Gesamtanhang des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses angegeben werden.<br />
2.1.3.2.2 Die Pflicht zur Aufstellung<br />
In den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss sollen - vergleichbar den handelsrechtlichen Vorschriften (vgl. § 299 Abs.<br />
2 S. 2 HGB) - auch die Jahresabschlüsse der geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe e<strong>in</strong>bezogen werden, deren Jahresabschluss<br />
um mehr als drei Monate vor dem Abschlussstichtag 31. Dezember liegt. Um trotz der unterschiedlichen<br />
Geschäftsjahre der Geme<strong>in</strong>de und des betreffenden Betriebes die notwendige Übere<strong>in</strong>stimmung für den geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Gesamtabschluss zu erreichen, ist <strong>in</strong> diesen Fällen die Aufstellung e<strong>in</strong>es gesonderten Zwischenabschlusses,<br />
bezogen auf den Abschlussstichtag des Gesamtabschlusses erforderlich. Die erhebliche Zeitdifferenz<br />
zwischen den Abschlussstichtagen wird <strong>in</strong> diesen Fällen dadurch überbrückt, dass der Jahresabschluss des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Betriebes auf den Abschlussstichtag des Gesamtabschlusses fortgeschrieben wird.<br />
Von geme<strong>in</strong>dlichen Betrieben, deren Geschäftsjahr zu e<strong>in</strong>em Zeitpunkt endet, bei dem e<strong>in</strong>e erhebliche Zeitdifferenz<br />
zum Abschlussstichtag des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses besteht, z.B. Kulturbetriebe mit dem Abschlussstichtag<br />
31. Juli, muss deshalb e<strong>in</strong> Zwischenabschluss als Fortschreibung des jeweiligen Jahresabschlusses<br />
verlangt werden. Dadurch wird e<strong>in</strong> auf den Abschlussstichtag und den Zeitraum des Gesamtabschlusses<br />
gleicher „Abrechnungszeitraum“ geschaffen und gewährleistet. An den Inhalt e<strong>in</strong>es Zwischenabschlusses s<strong>in</strong>d<br />
dabei die gleichen Qualitäts- und Quantitätsanforderungen zu stellen, wie an den orig<strong>in</strong>ären Jahresabschluss.<br />
Dieses auch deshalb, weil e<strong>in</strong> betrieblicher Zwischenabschluss auf dem jeweiligen tatsächlichen Jahresabschluss<br />
aufgebaut wird und damit ordnungsgemäß aus den Büchern und sonstigen Unterlagen des betreffenden geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Betriebes zu entwickeln ist, aber z.B. e<strong>in</strong>e zeitanteilige Gew<strong>in</strong>n- und Verlustrechnung enthält.<br />
E<strong>in</strong> Zwischenabschluss stellt daher ke<strong>in</strong>en unterjährigen Jahresabschluss des betreffenden Betriebes der Geme<strong>in</strong>de<br />
dar, denn se<strong>in</strong>e Ableitung bzw. Aufstellung dient ausschließlich der Erstellung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss.<br />
Der Zwischenabschluss e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Betriebes unterliegt daher nicht der Pflicht zur Jahresabschlussprüfung<br />
beim betreffenden Betrieb. Vielmehr unterliegt e<strong>in</strong> Zwischenabschluss wegen se<strong>in</strong>er gesamtabschlussbezogenen<br />
Aufstellung der Prüfungspflicht des Abschlussprüfers des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtab-<br />
GEMEINDEORDNUNG 780
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
schlusses. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat daher die Prüfungsverantwortung nicht nur für den aufgestellten<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss, sondern für alle die dem Gesamtabschluss zu Grunde liegenden Abschlüsse,<br />
die nicht nach anderen Vorschriften geprüft worden s<strong>in</strong>d.<br />
2.1.3.2.3 Anwendung des § 266 HGB (Abbildung der Bilanzen)<br />
Nach dieser handelsrechtlichen Vorschrift ist die Bilanz <strong>in</strong> Kontoform aufzustellen. Dabei können die Darstellungen<br />
<strong>in</strong> der Bilanz auf die <strong>in</strong> § 266 des Handelsgesetzbuches <strong>in</strong> den Absätzen 2 und 3 mit Buchstaben und römischen<br />
Zahlen bezeichneten Posten <strong>in</strong> der vorgeschriebenen Reihenfolge beschränkt werden. Die großen und<br />
mittelgroßen Kapitalgesellschaften (vgl. § 267 Abs. 3 HGB) haben auf der Aktivseite ihrer Bilanz die <strong>in</strong> Absatz 2<br />
und auf der Passivseite die <strong>in</strong> Absatz 3 bezeichneten Posten gesondert und <strong>in</strong> der vorgeschriebenen Reihenfolge<br />
auszuweisen.<br />
Kle<strong>in</strong>e Kapitalgesellschaften (vgl. § 267 Abs. 1 HGB) brauchen nur e<strong>in</strong>e verkürzte Bilanz aufzustellen, <strong>in</strong> die nur<br />
die <strong>in</strong> den Absätzen 2 und 3 mit Buchstaben und römischen Zahlen bezeichneten Posten gesondert und <strong>in</strong> der<br />
vorgeschriebenen Reihenfolge aufgenommen werden. So müssen m<strong>in</strong>destens <strong>in</strong> der Bilanz der e<strong>in</strong>zelnen geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Betriebe folgende Posten ausgewiesen se<strong>in</strong> (vgl. Abbildung).<br />
AKTIVA<br />
A. Anlagevermögen,<br />
I. Immaterielle Vermögensgegenstände,<br />
II. Sachanlagen,<br />
III. F<strong>in</strong>anzanlagen,<br />
B. Umlaufvermögen,<br />
I. Vorräte,<br />
II. Forderungen und sonstige<br />
Vermögensgegenstände,<br />
III. Wertpapiere,<br />
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,<br />
Guthaben bei Kredit<strong>in</strong>stituten und Schecks,<br />
C. Rechnungsabgrenzungsposten<br />
Struktur der Bilanz nach § 266 HGB<br />
PASSIVA<br />
A. Eigenkapital:<br />
I. Gezeichnetes Kapital;<br />
II. Kapitalrücklage;<br />
III. Gew<strong>in</strong>nrücklagen:<br />
IV. Gew<strong>in</strong>nvortrag/Verlustvortrag;<br />
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.<br />
B. Rückstellungen:<br />
C. Verb<strong>in</strong>dlichkeiten:<br />
D. Rechnungsabgrenzungsposten.<br />
Abbildung 163 „Struktur der Bilanz nach § 266 HGB“<br />
Diese reduzierte Darstellung der Bilanz kann unabhängig von der Größe der Kapitalgesellschaften für jedes Unternehmen<br />
und jede E<strong>in</strong>richtung im Beteiligungsbericht abgebildet werden, wenn nicht e<strong>in</strong>e für die Jahresabschlussanalyse<br />
aufgestellte Strukturbilanz ausreichend ist.<br />
2.1.3.2.4 Die Anwendung des § 276 HGB (Abbildung der Gew<strong>in</strong>n- und Verlustrechnungen)<br />
2.1.3.2.4.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die Vorschrift lässt auch zu, dass für die Abbildung der Gew<strong>in</strong>n- und Verlustrechnungen der Unternehmen und<br />
E<strong>in</strong>richtungen die Erleichterungen nach § 276 des Handelsgesetzbuches <strong>in</strong> Anspruch genommen werden können.<br />
Nach dieser handelsrechtlichen Vorschrift dürfen kle<strong>in</strong>e und mittelgroße Kapitalgesellschaften die Posten<br />
nach § 275 Abs. 2 Nr. 1 bis 5 oder Abs. 3 Nr. 1 bis 3 und 6 HGB zu e<strong>in</strong>em Posten unter der Bezeichnung "Rohergebnis"<br />
zusammenfassen. Kle<strong>in</strong>e Kapitalgesellschaften brauchen außerdem die <strong>in</strong> § 277 Abs. 4 Satz 2 und 3<br />
HGB verlangten Erläuterungen zu den Posten "außerordentliche Erträge" und "außerordentliche Aufwendungen"<br />
nicht zu machen.<br />
GEMEINDEORDNUNG 781
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
Bei der Aufstellung der Gew<strong>in</strong>n- und Verlustrechnungen der Unternehmen und E<strong>in</strong>richtungen ist noch zu beachten,<br />
ob das Gesamtkostenverfahren oder das Umsatzkostenverfahren zur Anwendung kommt. Bei der Auswahl<br />
des Verfahrens kommen als Kriterien regelmäßig deren Aussagefähigkeit, die Transparenz und die Vergleichbarkeit<br />
sowie das Informations<strong>in</strong>teresse der Adressaten des betrieblichen Jahresabschlusses <strong>in</strong> Betracht. Zu berücksichtigen<br />
ist aber auch, ob von der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong> Gesamtabschluss aufzustellen ist.<br />
2.1.3.2.4.2 Die Gliederung beim Gesamtkostenverfahren<br />
Das Gesamtkostenverfahren (GKV) ist leistungsbezogen und weist alle Herstellungskosten des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Betriebes unabhängig davon aus, ob die betriebliche Gesamtleistung (Produkte und sonstige Leistungen) auch<br />
am Markt abgesetzt worden s<strong>in</strong>d. Die Gegenüberstellung der gesamten Produktionskosten und der Gesamtleistung<br />
führt z.B. dazu, dass der Ausweis der Umsatzerlöse um Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen<br />
erweitert werden muss. Der entstandene Aufwand wird dabei nach den wichtigsten Aufwandsarten verteilt.<br />
Nach § 276 Abs. 2 HGB s<strong>in</strong>d bei Anwendung des Gesamtkostenverfahrens <strong>in</strong> der Gew<strong>in</strong>n- und Verlustrechnung<br />
der e<strong>in</strong>zelnen geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe e<strong>in</strong>e Vielzahl von Posten auszuweisen (vgl. Abbildung).<br />
Gliederung der GuV beim Gesamtkostenverfahren<br />
1. Umsatzerlöse<br />
2. Erhöhung oder Verm<strong>in</strong>derung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen<br />
3. andere aktivierte Eigenleistungen<br />
4. sonstige betriebliche Erträge<br />
5. Materialaufwand:<br />
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren<br />
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen<br />
6. Personalaufwand:<br />
a) Löhne und Gehälter<br />
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,<br />
davon für Altersversorgung<br />
7. Abschreibungen:<br />
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen<br />
sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung<br />
des Geschäftsbetriebs<br />
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die <strong>in</strong> der Kapitalgesellschaft<br />
üblichen Abschreibungen überschreiten<br />
8. sonstige betriebliche Aufwendungen<br />
9. Erträge aus Beteiligungen,<br />
davon aus verbundenen Unternehmen<br />
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des F<strong>in</strong>anzanlagevermögens,<br />
davon aus verbundenen Unternehmen<br />
11. sonstige Z<strong>in</strong>sen und ähnliche Erträge,<br />
davon aus verbundenen Unternehmen<br />
12. Abschreibungen auf F<strong>in</strong>anzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens<br />
13. Z<strong>in</strong>sen und ähnliche Aufwendungen,<br />
davon an verbundene Unternehmen<br />
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit<br />
15. außerordentliche Erträge<br />
16. außerordentliche Aufwendungen<br />
17. außerordentliches Ergebnis<br />
18. Steuern vom E<strong>in</strong>kommen und vom Ertrag<br />
19. sonstige Steuern<br />
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag<br />
Abbildung 164 „Gliederung der GuV beim Gesamtkostenverfahren“<br />
E<strong>in</strong>e reduzierte Darstellung der Gew<strong>in</strong>n- und Verlustrechnungen der Unternehmen und E<strong>in</strong>richtungen darf die<br />
erwünschten Informationen nicht bee<strong>in</strong>trächtigen.<br />
GEMEINDEORDNUNG 782
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
2.1.3.2.4.3 Die Gliederung beim Umsatzkostenverfahren<br />
Nach § 276 Abs. 3 HGB s<strong>in</strong>d bei Anwendung des Umsatzkostenverfahrens (UKV) <strong>in</strong> der Gew<strong>in</strong>n- und Verlustrechnung<br />
der e<strong>in</strong>zelnen geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe e<strong>in</strong>e Vielzahl von Posten auszuweisen (vgl. Abbildung).<br />
Gliederung der GuV beim Umsatzkostenverfahren<br />
1. Umsatzerlöse<br />
2. Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen<br />
3. Bruttoergebnis vom Umsatz<br />
4. Vertriebskosten<br />
5. allgeme<strong>in</strong>e Verwaltungskosten<br />
6. sonstige betriebliche Erträge<br />
7. sonstige betriebliche Aufwendungen<br />
8. Erträge aus Beteiligungen,<br />
davon aus verbundenen Unternehmen<br />
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des F<strong>in</strong>anzanlagevermögens,<br />
davon aus verbundenen Unternehmen<br />
10. sonstige Z<strong>in</strong>sen und ähnliche Erträge,<br />
davon aus verbundenen Unternehmen<br />
11. Abschreibungen auf F<strong>in</strong>anzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens<br />
12. Z<strong>in</strong>sen und ähnliche Aufwendungen,<br />
davon an verbundene Unternehmen<br />
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit<br />
14. außerordentliche Erträge<br />
15. außerordentliche Aufwendungen<br />
16. außerordentliches Ergebnis<br />
17. Steuern vom E<strong>in</strong>kommen und vom Ertrag<br />
18. sonstige Steuern<br />
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.<br />
Abbildung 165 „Gliederung der GuV beim Umsatzkostenverfahren“<br />
Das Umsatzkostenverfahren ist grundsätzlich umsatzbezogen, denn es weist die Herstellungskosten des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Betriebes abhängig davon aus, <strong>in</strong> welchem Umfang die betrieblichen Produkte und Leistungen am<br />
Markt abgesetzt worden s<strong>in</strong>d, und unabhängig davon <strong>in</strong> welchem Wirtschaftsjahr die Herstellungskosten für den<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Betrieb entstanden s<strong>in</strong>d. Die Herstellungskosten der nicht verkauften betrieblichen Erzeugnisse<br />
werden deshalb nicht <strong>in</strong> der Gew<strong>in</strong>n- und Verlustrechnung des Betriebes, sondern <strong>in</strong> der Bilanz als Halb- oder<br />
Fertigfabrikate angesetzt. Der entstandene Aufwand wird dabei nach den betrieblichen Arbeitsbereichen verteilt.<br />
E<strong>in</strong>e reduzierte Darstellung der Gew<strong>in</strong>n- und Verlustrechnungen der Unternehmen und E<strong>in</strong>richtungen darf die<br />
erwünschten Informationen nicht bee<strong>in</strong>trächtigen.<br />
2.1.3.2.5 Angleichungsmaßnahmen bei e<strong>in</strong>em Verzicht<br />
Bei der örtlichen Entscheidung der Geme<strong>in</strong>de über e<strong>in</strong>en Verzicht e<strong>in</strong>es Zwischenabschlusses durch e<strong>in</strong>en geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Betrieb ist immer zu berücksichtigen, ob es möglich ist, durch besondere konsolidierungstechnische<br />
Buchungen wichtige betriebliche Vorgänge aus der Zeit zwischen dem Abschlussstichtag des betrieblichen Jahresabschlusses<br />
und dem Abschlussstichtag des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses, <strong>in</strong> der Gesamtbilanz und der<br />
Gesamtergebnisrechnung der Geme<strong>in</strong>de zu berücksichtigen. Dabei müssen diese Vorgänge bedeutend für den<br />
Betrieb se<strong>in</strong>. In diesem Zusammenhang kann die Wesentlichkeit mit Hilfe der Summe der „betrieblichen“ Geschäftsvorfälle<br />
bestimmt werden, die für die Frage der Berücksichtigung <strong>in</strong> Betracht kommen.<br />
In bestimmten Fällen kann auch die zeitliche Hauptgeschäftstätigkeit e<strong>in</strong>es Betriebes dafür ausschlaggebend<br />
se<strong>in</strong>, dass der betriebliche Abschlussstichtag regelmäßig nach dem Abschlussstichtag der Geme<strong>in</strong>de liegt, z.B.<br />
GEMEINDEORDNUNG 783
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
bei Betrieben mit Saisongeschäften. Dann müssen die notwendigen Elim<strong>in</strong>ierungen „konzern<strong>in</strong>terner“ Vorgänge<br />
erreicht werden, auf e<strong>in</strong>en Zwischenabschluss zu verzichten. In diesen Fällen muss durch die Geme<strong>in</strong>de sichergestellt<br />
und gewährleistet werden, dass ke<strong>in</strong>e Informationslücke über die wirtschaftliche Gesamtlage der Geme<strong>in</strong>de<br />
entsteht und Missbräuche ausgeschlossen werden, weil Jahresabschlüsse mit vone<strong>in</strong>ander abweichendem<br />
Zeitbezug mite<strong>in</strong>ander konsolidiert werden.<br />
2.2 Zu Satz 2 (Verweis auf § 88 und § 91 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>):<br />
2.2.1 Der Verweis auf § 88 GO <strong>NRW</strong><br />
Für den Gesamtabschluss der Geme<strong>in</strong>de sollen grundsätzlich die Vorschriften und Sonderregelungen für den<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss gelten, soweit die Eigenart des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses ke<strong>in</strong>e Abweichung<br />
notwendig macht, die zusätzliche oder besondere Regelungen erfordert. Durch die ausdrückliche Verweisung<br />
<strong>in</strong> der Vorschrift auf § 88 GO <strong>NRW</strong> sollen die Regelungen über die im geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss auszuweisenden<br />
Rückstellungen der Geme<strong>in</strong>de auch für den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss gelten. Zum vollständigen<br />
Ressourcenverbrauch der Geme<strong>in</strong>de gehört auch die Bildung von Rückstellungen für Verpflichtungen,<br />
deren E<strong>in</strong>tritt dem Grunde nach zu erwarten ist, deren Höhe und Fälligkeitsterm<strong>in</strong> jedoch noch ungewiss, aber<br />
dennoch ausreichend sicher s<strong>in</strong>d, die wirtschaftliche Ursache aber bereits e<strong>in</strong>getreten ist.<br />
Durch die Bildung von Rückstellungen durch die Geme<strong>in</strong>de werden die geme<strong>in</strong>dlichen Aufwendungen der Verursachungsperiode<br />
zugerechnet, obwohl die entsprechenden Leistungen der Geme<strong>in</strong>de erst zu e<strong>in</strong>em späteren<br />
Zeitpunkt erfolgen. Diese Vorgaben setzen im jeweiligen Haushaltsjahr e<strong>in</strong> „verpflichtendes Ereignis“ der Geme<strong>in</strong>de<br />
gegenüber Dritten (Außenverpflichtung) oder gegenüber sich selbst (Innenverpflichtung) voraus. E<strong>in</strong><br />
solches geme<strong>in</strong>dliches Ereignis schafft e<strong>in</strong>e rechtliche oder faktische Verpflichtung für die Geme<strong>in</strong>de, auf Grund<br />
dessen sie ke<strong>in</strong>e rechtliche Alternative zur Erfüllung der Verpflichtung hat, so dass von ihr Rückstellungen zu<br />
bilden und zu bilanzieren s<strong>in</strong>d.<br />
2.2.2 Der Verweis auf § 91 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong><br />
Für den Gesamtabschluss der Geme<strong>in</strong>de sollen grundsätzlich die Vorschriften und Sonderregelungen für den<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss gelten, soweit die Eigenart des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses ke<strong>in</strong>e Abweichung<br />
notwendig macht, die zusätzliche oder besondere Regelungen erfordert. Durch die ausdrückliche Verweisung<br />
<strong>in</strong> der Vorschrift auf § 91 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> sollen die Regelungen über die im geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss<br />
auszuweisenden Wertansätze für Vermögensgegenstände und Verb<strong>in</strong>dlichkeiten der Geme<strong>in</strong>de auch für<br />
den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss gelten.<br />
Im Jahresabschluss der Geme<strong>in</strong>de kommt der Bilanz e<strong>in</strong>e große Bedeutung zu. Sie gibt umfassend Auskunft<br />
über das Vermögen und die Schulden der Geme<strong>in</strong>de. Grundsätzlich s<strong>in</strong>d dar<strong>in</strong> das Vermögen und die Schulden<br />
der Geme<strong>in</strong>de nach der zivilen Rechtslage zu bilanzieren, so dass Forderungen beim Anspruchsberechtigten zu<br />
aktivieren und Verb<strong>in</strong>dlichkeiten beim Schuldner zu passivieren s<strong>in</strong>d. Die Eignung e<strong>in</strong>es Vermögensgegenstandes<br />
oder e<strong>in</strong>er Verb<strong>in</strong>dlichkeit, dem Grunde nach <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz angesetzt werden zu können, wird<br />
mit dem Begriff „Bilanzierungsfähigkeit“ umschrieben. Da das geme<strong>in</strong>dliche Vermögen auf der Aktivseite der<br />
Bilanz anzusetzen ist, wird deshalb auch der Begriff „Aktivierungsfähigkeit“ verwendet und <strong>in</strong> entsprechender<br />
Weise der Begriff „Passiervierungsfähigkeit“ für die auf der Passivseite der geme<strong>in</strong>dlichen Bilanz anzusetzenden<br />
Verb<strong>in</strong>dlichkeiten.<br />
GEMEINDEORDNUNG 784
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
3. Zu Absatz 3 (Ke<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>beziehung von Betrieben bei untergeordneter Bedeutung):<br />
3.1 Zu Satz 1 (Verzicht auf die E<strong>in</strong>beziehung von geme<strong>in</strong>dlichen Betrieben):<br />
3.1.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsrecht ist <strong>in</strong> Anlehnung an das Handelsrecht (vgl. § 296 HGB) bestimmt worden, dass<br />
geme<strong>in</strong>dliche Betriebe (vgl. Absatz 2 der Vorschrift) - wie bei e<strong>in</strong>em handelsrechtlichen Konzern - nicht <strong>in</strong> den<br />
Gesamtabschluss der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>zubeziehen s<strong>in</strong>d, wenn sie die für die Erfüllung der Verpflichtung der Geme<strong>in</strong>de,<br />
e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzgesamtlage<br />
der Geme<strong>in</strong>de zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung s<strong>in</strong>d. Die Vorschrift konkretisiert<br />
den für den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss allgeme<strong>in</strong> geltenden Grundsatz der Wesentlichkeit, enthält aber<br />
weder e<strong>in</strong>e Def<strong>in</strong>ition des Begriffes „Untergeordnete Bedeutung“ noch allgeme<strong>in</strong> Messgrößen oder Kennzahlen<br />
zur örtlichen Handhabung dieser Abgrenzung.<br />
Für die örtliche Prüfung und Entscheidung der Geme<strong>in</strong>de, ob diese Vorschrift vor Ort zur Anwendung kommen<br />
kann, können nur e<strong>in</strong>ige allgeme<strong>in</strong> anwendbare Kriterien zur Verfügung gestellt werden. Allgeme<strong>in</strong>e Kriterien<br />
könnten auch problematisch se<strong>in</strong>, weil die untergeordnete Bedeutung e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Betriebes für den<br />
Gesamtabschluss der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong>sbesondere von den örtlichen Verhältnissen <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>de und dem Gesamtbild<br />
der relevanten Umstände vor Ort abhängig ist. Andererseits verh<strong>in</strong>dert diese Vorschrift im Rahmen der<br />
Aufstellung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses e<strong>in</strong>en nicht vertretbaren Aufwand bei der Geme<strong>in</strong>de, denn<br />
die Jahresabschlüsse der geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe <strong>in</strong> öffentlich-rechtlichen Organisationsformen oder <strong>in</strong> Formen<br />
des privaten Rechts müssen nicht alle<strong>in</strong> wegen der geme<strong>in</strong>dlichen Besitzverhältnisse zu e<strong>in</strong>em Gesamtabschluss<br />
vollkonsolidiert werden.<br />
3.1.2 Der Zusammenhang zu § 311 HGB<br />
Die Vorschrift ermöglicht für sämtliche geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe <strong>in</strong> öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,<br />
dass diese nicht <strong>in</strong> den Gesamtabschluss der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>zubeziehen s<strong>in</strong>d, wenn e<strong>in</strong> oder mehrere Betriebe<br />
zusammen für die Verpflichtung der Geme<strong>in</strong>de, mit ihrem Gesamtabschluss e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen<br />
entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzgesamtlage der Geme<strong>in</strong>de zu vermitteln,<br />
von untergeordneter Bedeutung s<strong>in</strong>d. Zusätzlich zu dieser Vorschrift besteht im Zusammenhang mit der Anwendung<br />
der Equity-Methode nach § 311 Abs. 2 HGB e<strong>in</strong>e gesonderte handelsrechtliche Regelung über die untergeordnete<br />
Bedeutung von Betrieben, die über die Regelung <strong>in</strong> der haushaltsrechtlichen Vorschrift unmittelbar zur<br />
Anwendung kommt. Diese HGB-Vorschrift ersetzt weder die GO-Vorschrift für den Bereich der Konsolidierung<br />
nach der Equity-Methode, noch schränkt die handelsrechtliche Vorschrift die Regelung <strong>in</strong> § 116 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong><br />
dah<strong>in</strong>gehend e<strong>in</strong>, dass die GO-Vorschrift sich nur auf geme<strong>in</strong>dliche Betriebe bezieht, die als Tochtere<strong>in</strong>heit der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Kernverwaltung und daher <strong>in</strong> Form der Vollkonsolidierung (vgl. §§ 300 bis 309) <strong>in</strong> den geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Gesamtabschluss e<strong>in</strong>bezogen werden. Bei e<strong>in</strong>em Verzicht auf die E<strong>in</strong>beziehung von geme<strong>in</strong>dlichen Betrieben<br />
<strong>in</strong> öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form <strong>in</strong> den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss im Rahmen der<br />
Equity-Methode bedarf es daher ke<strong>in</strong>er Anwendung des § 311 HGB.<br />
3.1.3 Der Begriff „Untergeordnete Bedeutung“<br />
3.1.3.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die Geme<strong>in</strong>de hat im Rahmen ihrer Beurteilung, ob und wie e<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>dlicher Betrieb <strong>in</strong> den Gesamtabschluss<br />
der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>zubeziehen ist, e<strong>in</strong>e Abgrenzung mit Hilfe des Begriffs „Untergeordnete Bedeutung“ aus Sicht<br />
des Gesamtabschlusses der Geme<strong>in</strong>de vorzunehmen. Dieser Begriff drückt den Grundsatz der Wesentlichkeit im<br />
GEMEINDEORDNUNG 785
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
Gefüge des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses aus und konkretisiert ihn. Nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit<br />
ist e<strong>in</strong>e Information im geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss wesentlich, wenn durch ihr Weglassen oder ihre<br />
fehlerhafte Darstellung wirtschaftliche Entscheidungen bee<strong>in</strong>flusst werden können. Grundsätzlich s<strong>in</strong>d daher an<br />
e<strong>in</strong>en möglichen Verzicht der E<strong>in</strong>beziehung e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Betriebes <strong>in</strong> den Gesamtabschluss der Geme<strong>in</strong>de<br />
strenge Anforderungen zu stellen. Es muss bei der Inanspruchnahme der gesetzlichen Befreiungsregelung<br />
immer sowohl die Vermögenslage, die Schuldenlage, die Ertragslage sowie die F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de<br />
betroffen se<strong>in</strong>.<br />
Für die Anwendung des Begriffes „Untergeordnete Bedeutung“ im Rahmen der Abgrenzung und Bestimmung des<br />
örtlichen Konsolidierungskreises gilt z.B., dass e<strong>in</strong>e untergeordnete Bedeutung e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Betriebes<br />
nicht bereits dann gegeben ist, wenn von der Geme<strong>in</strong>de nur e<strong>in</strong> ger<strong>in</strong>ger Anteil an e<strong>in</strong>em solchen Betrieb gehalten<br />
wird. Der Beteiligungsanteil der Geme<strong>in</strong>de an e<strong>in</strong>em Betrieb kann lediglich e<strong>in</strong>en ersten E<strong>in</strong>stieg <strong>in</strong> die Prüfung<br />
bieten, welche Bedeutung dem Betrieb tatsächlich <strong>in</strong> Bezug auf den Gesamtabschluss die Abbildung der<br />
wirtschaftlichen Gesamtlage der Geme<strong>in</strong>de zukommt. E<strong>in</strong> ger<strong>in</strong>ger Beteiligungsumfang der Geme<strong>in</strong>de an e<strong>in</strong>em<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Betrieb kann z.B. zur Folge haben, dass die Durchsetzung der Geschäftspolitik der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>em solchen Betrieb nicht mehr möglich ist und e<strong>in</strong> „Control“-Verhältnis nicht mehr ausgeübt werden kann.<br />
Die untergeordnete Bedeutung e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Betriebes für den Gesamtabschluss der Geme<strong>in</strong>de ist <strong>in</strong>s<br />
besondere von den örtlichen Verhältnissen <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>de und dem Gesamtbild der relevanten Umstände abhängig.<br />
So s<strong>in</strong>d z:B. <strong>in</strong> die Beurteilung e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Betriebes mit Tochtere<strong>in</strong>heiten diese auch <strong>in</strong> die<br />
Betrachtung e<strong>in</strong>zubeziehen. Die örtliche Beurteilung muss daher e<strong>in</strong> Gesamtbild aller Umstände schaffen und ist<br />
daher entsprechend aufzubauen und zu dokumentieren. Ob die Voraussetzungen für e<strong>in</strong>e Nichte<strong>in</strong>beziehung<br />
e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Betriebes <strong>in</strong> den Gesamtabschluss sachlich vor Ort gegeben s<strong>in</strong>d, muss von der Geme<strong>in</strong>de<br />
unter Beachtung der e<strong>in</strong>schlägigen geme<strong>in</strong>derechtlichen Vorschriften und unter Berücksichtigung der örtlichen<br />
Verhältnisse geprüft und entschieden werden.<br />
3.1.3.2 Die Beurteilung der untergeordneten Bedeutung e<strong>in</strong>es Betriebes<br />
Die Beurteilung der untergeordneten Bedeutung ist auf den e<strong>in</strong>zelnen geme<strong>in</strong>dlichen Betrieb sowie auf das Gesamtbild<br />
aller Umstände und nicht auf die starren Zahlen des jeweiligen Beteiligungsverhältnisses der Geme<strong>in</strong>de<br />
abzustellen. Die Bedeutung e<strong>in</strong>es e<strong>in</strong>zelnen Betriebes kann zudem nur im Zusammenhang mit der gesamten<br />
Geschäftstätigkeit der Geme<strong>in</strong>de als „Konzern“, bezogen auf den Abschlussstichtag, bewertet werden. Deshalb<br />
ist die untergeordnete Bedeutung e<strong>in</strong>es Betriebes nicht alle<strong>in</strong> über das Verhältnis der betreffenden Bilanzsummen<br />
zu beurteilen. Von der Geme<strong>in</strong>de muss vielmehr im E<strong>in</strong>zelnen die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage<br />
des zu beurteilenden geme<strong>in</strong>dlichen Betriebes im Verhältnis zum geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss gemessen<br />
werden, damit die E<strong>in</strong>flüsse der Konsolidierung des betreffenden Betriebes auf das geme<strong>in</strong>dliche Gesamtergebnis<br />
bewertet werden können. Auch kann im E<strong>in</strong>zelfall die Aufgabenerfüllung von Bedeutung se<strong>in</strong> und darf<br />
daher bei der Beurteilung der untergeordneten Bedeutung e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Betriebes nicht unberücksichtigt<br />
bleiben.<br />
Für die vorzunehmende Beurteilung können verschiedene Messgrößen <strong>in</strong> Betracht kommen, z.B. die Bilanzsumme,<br />
der Wert des Anlagevermögens, der Umfang der Verb<strong>in</strong>dlichkeiten sowie der Rückstellungen, aber auch die<br />
Summe der Erträge sowie der Aufwendungen, das erzielte Jahresergebnis oder der Beitrag zur geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Aufgabenerfüllung im S<strong>in</strong>ne der Gesamtsteuerung der Geme<strong>in</strong>de. Die zu ermittelnden Verhältniszahlen sollten<br />
sich im Bereich zwischen 0 bis 3 % der Gesamtbilanzsumme der Geme<strong>in</strong>de bewegen, um von der allgeme<strong>in</strong>en<br />
Gesamtlage her, von e<strong>in</strong>er untergeordneten Bedeutung ausgehen zu können. Diese Gegebenheiten müssen aber<br />
nicht <strong>in</strong> jedem E<strong>in</strong>zelfall zutreffend se<strong>in</strong>. Werden Messgrößen oder Kennzahlen im Rahmen der Beurteilung genutzt,<br />
gilt es, zwischen den ausgewählten Wert- bzw. Messgrößen e<strong>in</strong>e Beziehung herzustellen und die Ergebnisse<br />
um e<strong>in</strong>e qualitative Beurteilung unter Berücksichtigung aller örtlichen Umstände zu ergänzen. Nur e<strong>in</strong>e<br />
GEMEINDEORDNUNG 786
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
Gesamtbetrachtung ermöglicht e<strong>in</strong>e örtliche Feststellung, ob ggf. e<strong>in</strong>e untergeordnete Bedeutung e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Betriebes vorliegt. Mögliche Messgrößen werden nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung).<br />
Messgrößen zur Feststellung der untergeordneten Bedeutung<br />
Vermögensstand<br />
Schuldenstand<br />
Ertragslage<br />
F<strong>in</strong>anzlage<br />
Aufgabenerfüllung<br />
Das Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen des Betriebes <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er<br />
Abschlussbilanz und der Gesamtbilanzsumme der Geme<strong>in</strong>de.<br />
Das Verhältnis zwischen den Verb<strong>in</strong>dlichkeiten des Betriebes <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er<br />
Abschlussbilanz und der Gesamtbilanzsumme der Geme<strong>in</strong>de.<br />
Die Summe der ordentlichen Erträge <strong>in</strong> der „Ergebnisrechnung“ (GuV)<br />
im Verhältnis zur Summe der ordentlichen Erträge <strong>in</strong> der Gesamtergebnisrechnung,<br />
die Summe der Personalaufwendungen <strong>in</strong> der „Ergebnisrechnung“<br />
(GuV) im Verhältnis zur Summe der Personalaufwendungen<br />
<strong>in</strong> der Gesamtergebnisrechnung sowie die Summe der Abschreibungen<br />
<strong>in</strong> der „Ergebnisrechnung“ (GuV) im Verhältnis zur Summe der Abschreibungen<br />
<strong>in</strong> der Gesamtergebnisrechnung.<br />
Den Casflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit, den Casflow aus der<br />
Investitionstätigkeit sowie den Cashflow aus der F<strong>in</strong>anzierungstätigkeit.<br />
Der e<strong>in</strong>zelne Beitrag zur Aufgabenerfüllung der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> Bezug auf<br />
das gesamte geme<strong>in</strong>dliche Aufgabenspektrum.<br />
Abbildung 166 „Messgrößen zur Feststellung der untergeordneten Bedeutung“<br />
Es sollten für die örtliche Beurteilung von der Geme<strong>in</strong>de aber auch weitere oder andere Vergleichsgrößen und<br />
Kennzahlen als quantitative und qualitative Messgrößen herangezogen werden, wenn diese e<strong>in</strong>e zutreffendere<br />
Betrachtung der Bedeutung e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Betriebes ermöglichen. Dazu gehört z.B., dass das Gesamtergebnis<br />
mit Verlusten behaftet ist, weil e<strong>in</strong> Betrieb ständiger Zuschüsse bedarf. Auch wenn im Falle des Verzichts<br />
auf die E<strong>in</strong>beziehung e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>dlichen Betriebes <strong>in</strong> den Gesamtabschluss wesentliche Verpflichtungen oder<br />
Risiken der Geme<strong>in</strong>de nicht abgebildet werden, z.B. bei Projektgesellschaften. Ebenso sollte e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>beziehung<br />
<strong>in</strong> den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss erfolgen, wenn sonst wesentliche Vermögensteile der Geme<strong>in</strong>de im<br />
Gesamtabschluss unberücksichtigt bleiben.<br />
Die E<strong>in</strong>beziehung e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Betriebes <strong>in</strong> den Gesamtabschluss ist daher unter Betrachtung der örtlichen<br />
Verhältnisse sowie bei auftretenden Abweichungen von den o.a. Messgrößen im E<strong>in</strong>zelfall zu beurteilen und<br />
vorzunehmen, wenn nicht andere gewichtige Gründe dagegen stehen. Deshalb ist <strong>in</strong> der Beurteilung zu berücksichtigen,<br />
ob „konzern<strong>in</strong>terne“ Beziehungen mit dem ggf. nicht <strong>in</strong> den Gesamtabschluss e<strong>in</strong>zubeziehenden Betrieb<br />
bestehen. Auch darf bei der Entscheidung über die untergeordnete Bedeutung von geme<strong>in</strong>dlichen Betrieben<br />
das Informations<strong>in</strong>teresse der Adressaten des Gesamtabschlusses der Geme<strong>in</strong>de nicht außer Betracht bleiben.<br />
Diese Sachlage zeigt, dass bei der örtlichen Prüfung und Beurteilung der Frage der untergeordneten Bedeutung<br />
von der Geme<strong>in</strong>de unterschiedliche Aspekte zu berücksichtigen s<strong>in</strong>d.<br />
3.1.3.3 Die Beurteilung der untergeordneten Bedeutung mehrerer Betriebe<br />
Bei e<strong>in</strong>em Verzicht auf die E<strong>in</strong>beziehung von mehreren geme<strong>in</strong>dlichen Betrieben <strong>in</strong> den Gesamtabschluss der<br />
Geme<strong>in</strong>de muss die Betrachtung der e<strong>in</strong>zelnen betroffenen Betriebe von untergeordneter Bedeutung durch e<strong>in</strong>e<br />
Gesamtbetrachtung aller betroffenen Betriebe ergänzt werden. E<strong>in</strong> e<strong>in</strong>zelner geme<strong>in</strong>dlicher Betrieb kann isoliert<br />
für sich betrachtet von untergeordneter Bedeutung für die wirtschaftliche Gesamtlage der Geme<strong>in</strong>de se<strong>in</strong>, e<strong>in</strong>e<br />
Vielzahl davon kann dann aber <strong>in</strong> der Gesamtheit durchaus Bedeutung erlangen und ihr E<strong>in</strong>fluss auf die Vermö-<br />
GEMEINDEORDNUNG 787
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
gens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzgesamtlage wesentlich se<strong>in</strong>, so dass diese geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe <strong>in</strong> ihrer<br />
Gesamtheit <strong>in</strong> den Gesamtabschluss der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>zubeziehen s<strong>in</strong>d.<br />
Die untergeordnete Bedeutung mehrerer geme<strong>in</strong>dlicher Betriebe darf – wie bei e<strong>in</strong>em e<strong>in</strong>zelnen Betrieb - nicht<br />
alle<strong>in</strong> an den Verhältnissen der Bilanzsummen gemessen werden. Es ist vielmehr geboten, unter E<strong>in</strong>beziehung<br />
qualitativer Messgrößen die jeweiligen „Gesamtverhältnisse“ bezogen die Vermögensgesamtlage, die Schuldengesamtlage,<br />
die Ertragsgesamtlage und F<strong>in</strong>anzgesamtlage der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Gesamtbetrachtung e<strong>in</strong>zubeziehen<br />
und zu beurteilen. Auch bieten sich dafür Verhältniszahlen an, die sich im Bereich zwischen 0 bis 3 % der<br />
jeweils zu bildenden Summen bewegen sollten. Bei Überschreitungen der Messgrößen <strong>in</strong> den artenbezogenen<br />
Betrachtungen kann <strong>in</strong> Zweifelsfällen auch e<strong>in</strong>e Durchschnittsbildung als Hilfsgröße zu e<strong>in</strong>er angemessenen<br />
Entscheidung im Zusammenhang mit der Aufgabe des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses, e<strong>in</strong> den tatsächlichen<br />
Verhältnissen entsprechendes Bild zu vermitteln, beitragen.<br />
In der geme<strong>in</strong>dlichen Praxis dürfte es vielfach sachgerecht se<strong>in</strong>, bei der Beurteilung der untergeordneten Bedeutung<br />
mehrerer geme<strong>in</strong>dlicher Betriebe auch die durch diese Betriebe zu erbr<strong>in</strong>genden Beiträge für die geme<strong>in</strong>dliche<br />
Aufgabenerfüllung <strong>in</strong> der Beurteilung zu berücksichtigen. Die notwendige Prüfung dazu muss sehr sorgfältig<br />
vorgenommen werden. Insbesondere dann, wenn örtlich davon ausgegangen wird, dass alle vorhandenen geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Betriebe von untergeordneter Bedeutung seien und deshalb auch e<strong>in</strong> Verzicht auf die Aufstellung<br />
des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses <strong>in</strong>sgesamt <strong>in</strong> Betracht kommen könnte, muss die E<strong>in</strong>beziehung aller<br />
Kriterien <strong>in</strong> die geme<strong>in</strong>dliche Beurteilung sichergestellt werden. Ob die Voraussetzungen für die Nichte<strong>in</strong>beziehung<br />
mehrerer geme<strong>in</strong>dlicher Betriebe <strong>in</strong> den Gesamtabschluss sachlich gegeben s<strong>in</strong>d, muss dabei von der Geme<strong>in</strong>de<br />
unter Beachtung der e<strong>in</strong>schlägigen geme<strong>in</strong>derechtlichen Vorschriften und unter Berücksichtigung der<br />
örtlichen Verhältnisse geprüft und entschieden werden.<br />
3.1.3.4 Berücksichtigung der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgabenerfüllung<br />
In die Prüfung, ob e<strong>in</strong> oder mehrere geme<strong>in</strong>dliche Betriebe von untergeordneter Bedeutung im Rahmen der Aufstellung<br />
des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses s<strong>in</strong>d, ist auch zu berücksichtigen, welchen Beitrag der e<strong>in</strong>zelne<br />
Betrieb für die geme<strong>in</strong>dliche Aufgabenerfüllung <strong>in</strong> Bezug auf das gesamte geme<strong>in</strong>dliche Aufgabenspektrum erbr<strong>in</strong>gt.<br />
Werden mehrere geme<strong>in</strong>dliche Betriebe oder e<strong>in</strong> Betrieb mit Tochtere<strong>in</strong>heiten als von untergeordneter<br />
Bedeutung e<strong>in</strong>gestuft und soll auf ihre E<strong>in</strong>beziehung <strong>in</strong> den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss verzichtet werden,<br />
bedarf es zuvor der Prüfung, ob dadurch dann nicht das Bild der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgabenerfüllung <strong>in</strong> Bezug auf<br />
die Darstellung der gesamten wirtschaftlichen Lage der Geme<strong>in</strong>de verfälscht wird bzw. ob der Verzicht mit dem<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Aufgabenspektrum noch <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang steht. Bei dieser Gesamtbetrachtung soll von der Geme<strong>in</strong>de<br />
berücksichtigt werden, dass die Gesamtsteuerung der Geme<strong>in</strong>de nicht alle<strong>in</strong> auf dem Gesamtabschluss aufbaut,<br />
sondern auch auf den von der Geme<strong>in</strong>de zu erfüllenden Aufgaben. Im Zusammenhang mit dem geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Gesamtabschluss muss daher e<strong>in</strong>er Verfälschung des Bildes der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgabenerfüllung entgegen<br />
gewirkt werden. Ggf. muss deshalb <strong>in</strong> Betracht gezogen werden, dass gleichwohl bestimmte geme<strong>in</strong>dliche Betriebe,<br />
die nach anderen Kriterien als von untergeordneter Bedeutung zu bewerten s<strong>in</strong>d, <strong>in</strong> den geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Gesamtabschluss e<strong>in</strong>bezogen werden. Wird <strong>in</strong> solchen Fällen gleichwohl auf die förmliche E<strong>in</strong>beziehung der nicht<br />
so bedeutenden geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe <strong>in</strong> den Gesamtabschluss der Geme<strong>in</strong>de verzichtet, muss durch zusätzliche<br />
Erläuterungen im Gesamtanhang gewährleistet werden, dass dieser Tatbestand nicht zu e<strong>in</strong>er Verfälschung<br />
des durch den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss zu vermittelnden Bildes und/oder zu e<strong>in</strong>em Informationsverlust<br />
für die Adressaten des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses führt.<br />
3.1.3.5 Wirkungen der untergeordneten Bedeutung<br />
Die Entscheidung der Geme<strong>in</strong>de, dass e<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>dlicher Betrieb wegen se<strong>in</strong>er tatsächlichen untergeordneten<br />
Bedeutung nicht <strong>in</strong> ihren Gesamtabschluss e<strong>in</strong>zubeziehen ist, führt zum Verzicht auf die Vollkonsolidierung die-<br />
GEMEINDEORDNUNG 788
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
ses Betriebes im Rahmen der Aufstellung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses. Sie führt jedoch nicht zu e<strong>in</strong>em<br />
Ansatzverzicht des Beteiligungswertes <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtbilanz. In den Fällen der untergeordneten<br />
Bedeutung e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Betriebes ist dieser mit se<strong>in</strong>en fortgeführten Anschaffungskosten <strong>in</strong> den<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss e<strong>in</strong>zubeziehen (At-Cost-Konsolidierung). Dieses bedeutet z.B., dass Beteiligungserträge<br />
sich nicht auf den Beteiligungsbuchwert auswirken, sondern <strong>in</strong> der Ergebnisrechnung der Geme<strong>in</strong>de<br />
als Muttere<strong>in</strong>heit zu erfassen s<strong>in</strong>d.<br />
3.1.3.6 Die untergeordnete Bedeutung bei der Equity-Methode<br />
Die unmittelbare Anwendung des § 311HGB bei der Konsolidierung nach der Equity-Methode lässt e<strong>in</strong>en Verzicht<br />
auf die E<strong>in</strong>beziehung von geme<strong>in</strong>dlichen Betrieben <strong>in</strong> den Gesamtabschluss der Geme<strong>in</strong>de zu, wenn e<strong>in</strong> oder<br />
mehrere Betriebe zusammen für die Vermittlung e<strong>in</strong>es den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes<br />
der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzgesamtlage der Geme<strong>in</strong>de von untergeordneter Bedeutung s<strong>in</strong>d<br />
(vgl. § 311 Abs. 2 HGB).<br />
Diese handelsrechtliche Vorschrift besteht zusätzlich zur Regelung des § 116 GO <strong>NRW</strong>, denn bereits die geme<strong>in</strong>dliche<br />
Vorschrift lässt e<strong>in</strong>en Verzicht der E<strong>in</strong>beziehung e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Betriebes <strong>in</strong> den Gesamtabschluss<br />
der Geme<strong>in</strong>de zu, wenn dieser für die Verpflichtung der Geme<strong>in</strong>de, mit ihrem Gesamtabschluss e<strong>in</strong> den<br />
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzgesamtlage der<br />
Geme<strong>in</strong>de zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung ist. Zudem ist die geme<strong>in</strong>derechtliche Vorschrift unabhängig<br />
von der anzuwendenden Konsolidierungsmethode, so dass es <strong>in</strong> diesem S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>er Anwendung der<br />
HGB-Vorschrift nicht <strong>in</strong> jedem E<strong>in</strong>zelfall bedarf. Aus diesem Nebene<strong>in</strong>ander der Vorschriften kann jedoch nicht<br />
geschlossen werden, dass sich die Vorschrift des § 116 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong> nur auf geme<strong>in</strong>dliche Betriebe bezieht,<br />
die voll zu konsolidieren s<strong>in</strong>d.<br />
3.2 Zu Satz 2 (Erläuterungspflichten im Gesamtanhang):<br />
Die Vorschrift verpflichtet die Geme<strong>in</strong>de, im Gesamtanhang darzustellen und zu erläutern, welche ihrer Betriebe<br />
wegen e<strong>in</strong>er untergeordneten Bedeutung nicht <strong>in</strong> den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss e<strong>in</strong>bezogen worden s<strong>in</strong>d.<br />
Dies s<strong>in</strong>d wichtige Angaben, die für die Aufgabe des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses, e<strong>in</strong> den tatsächlichen<br />
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzgesamtlage der Geme<strong>in</strong>de zu<br />
vermitteln, notwendig s<strong>in</strong>d. Ohne diese Angaben könnte das abzugebende Bild bee<strong>in</strong>trächtigt se<strong>in</strong>. Im Gesamtanhang<br />
kann, ausgehend von der Übersicht über alle Betriebe der Geme<strong>in</strong>de im Beteiligungsbericht nach § 117<br />
GO <strong>NRW</strong>, e<strong>in</strong> Überblick über die geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe von untergeordneter Bedeutung geschaffen werden. In<br />
welcher Art und Weise sowie <strong>in</strong> welchem Umfang die Geme<strong>in</strong>de örtlich über die Abgrenzung der Betriebe von<br />
untergeordneter Bedeutung im Gesamtanhang <strong>in</strong>formiert, muss unter Berücksichtigung der gegebenen örtlichen<br />
Verhältnisse abgewogen und von der Geme<strong>in</strong>de eigenverantwortlich festgelegt werden. Die Erläuterungen im<br />
Gesamtanhang zu den getroffenen Entscheidungen über die untergeordnete Bedeutung von geme<strong>in</strong>dlichen Betrieben<br />
müssen nachvollziehbar und auf die Adressaten des Gesamtabschlusses ausgerichtet se<strong>in</strong>.<br />
4. Zu Absatz 4 (Angabe der Verantwortlichen im Gesamtlagebericht):<br />
4.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die Vorschrift dient dazu, Dritten gegenüber, <strong>in</strong>sbesondere gegenüber den Bürger<strong>in</strong>nen und Bürgern sowie der<br />
Aufsichtsbehörde der Geme<strong>in</strong>de, die Verantwortlichkeit für den Gesamtabschluss hervorzuheben. Zu jedem Gesamtabschluss<br />
s<strong>in</strong>d am Schluss des Gesamtlageberichtes für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands bzw. für<br />
den Bürgermeister und den Kämmerer, sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr<br />
GEMEINDEORDNUNG 789
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
ausgeschieden s<strong>in</strong>d, unter Nennung des Namens <strong>in</strong>dividualisierte Angaben zu machen, um Auskunft über die<br />
persönlichen Verhältnisse <strong>in</strong> Bezug auf die Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de zu geben (vgl. Abbildung).<br />
Angabepflichten der Verantwortlichen <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>de<br />
Von jedem aus dem aufgezählten Personenkreis s<strong>in</strong>d die folgenden Angaben zu<br />
machen:<br />
- Familienname mit m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>em ausgeschriebenen Vornamen<br />
- der ausgeübte Beruf<br />
- die Mitgliedschaften <strong>in</strong> Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1<br />
Satz 3 des Aktiengesetzes<br />
- die Mitgliedschaft <strong>in</strong> Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Geme<strong>in</strong>de<br />
<strong>in</strong> öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form<br />
- die Mitgliedschaft <strong>in</strong> Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen<br />
Abbildung 167 „Angabepflichten der Verantwortlichen <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>de“<br />
Unter die Angabepflicht fallen daher auch nur personenbezogene Mandate, die <strong>in</strong> vielfältiger Form ausgeübt<br />
werden. Daher können hier nur Beispiele aufgezählt werden, z.B. Aufsichtsratsmandate, Beiratsmandate, Geschäftsführer-<br />
oder Vorstandstätigkeiten, Mitgliedschaften <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Gesellschafterversammlung oder e<strong>in</strong>er Verbandsversammlung,<br />
Mitgliedschaften im Verwaltungsräten, Mitgliedschaften im Kreditausschuss von Sparkassen,<br />
Mitgliedschaften im Kuratorium von Stiftungen. Dazu ist ggf. auch die ausgeübte Funktion anzugeben, z.B. Mitglied<br />
oder Vorsitz im Aufsichtsrat. Angabepflichtig s<strong>in</strong>d dagegen nicht das Innehaben von Aktien und damit die<br />
grundsätzliche Zugehörigkeit zur Hauptversammlung e<strong>in</strong>er Aktiengesellschaft. Auch wenn die versammelten<br />
Aktionäre als Verbund dieses Organ bilden, ist dieses Gremium nicht personenbezogen wie die anderen Organe<br />
der Aktiengesellschaft, die allesamt nach Namen gebildet werden. Die Verb<strong>in</strong>dung der e<strong>in</strong>zelnen Personen als<br />
berechtigte Teilnehmer der Hauptversammlung (Aktionäre) wird nur durch das Innehaben von Aktien des betreffenden<br />
Unternehmens und nicht durch Namen, Ämter oder Funktionen bestimmt.<br />
Über die <strong>in</strong> der Vorschrift bestimmten Pflichtangaben wird auf mögliche typische Interessenkonflikte der Verantwortlichen<br />
h<strong>in</strong>gewiesen, die im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit stehen und dafür von Bedeutung<br />
s<strong>in</strong>d. Mit den Angaben soll die berufliche Belastung der verantwortlichen Personen aufgezeigt und deren Kompetenz<br />
erkennbar gemacht werden. E<strong>in</strong> Verzicht auf diese Angaben ist nicht zulässig. Auch besteht ke<strong>in</strong>e Schutzklausel,<br />
nach der <strong>in</strong> besonderen Fällen lediglich nur e<strong>in</strong>geschränkte Angaben gemacht werden dürfen, außer das<br />
Wohl der Bundesrepublik Deutschland oder e<strong>in</strong>es ihrer Länder würde gefährdet. Weitere über die Pflichtangaben<br />
h<strong>in</strong>ausgehende Angaben, z.B. Angaben über die Höhe der Entgelte für die Tätigkeit <strong>in</strong> Organen, werden im Zusammenhang<br />
mit dem im Gesamtlagebericht zu machenden Angaben nicht gefordert. Die Angaben hängen nicht<br />
vom pflichtgemäßen Ermessen der betreffenden Personen ab, denn es kommt nicht darauf an, ob dieser Teil der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Berichterstattung zum Verständnis des Jahresabschlusses notwendig ist. Die zu machenden Angaben<br />
s<strong>in</strong>d daher aus dem Blickw<strong>in</strong>kel der Adressaten des Jahresabschlusses und nicht aus dem Blickw<strong>in</strong>kel der<br />
Organmitglieder zu betrachten und zu prüfen.<br />
4.2 Auskünfte der Mitglieder des Rates nach § 43 GO <strong>NRW</strong><br />
Nach der derzeitigen Rechtslage s<strong>in</strong>d die Mitglieder des Rates und der Ausschüsse verpflichtet, Auskünfte über<br />
ihre wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse zu geben, soweit das für die Ausübung ihres Mandats von<br />
GEMEINDEORDNUNG 790
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
Bedeutung se<strong>in</strong> kann. Dabei können Name, Anschrift, der ausgeübte Beruf sowie andere vergütete und ehrenamtliche<br />
Tätigkeiten veröffentlicht werden (vgl. § 43 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong>). Die Pflicht zu persönlichen Angaben, öffentlich<br />
gemacht werden dürfen, wird durch die o.a. Vorschriften für den Bereich der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft<br />
näher bestimmt. Damit wird die notwendige Transparenz über mögliche Verflechtungen der Verantwortlichen<br />
<strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>de gewährleistet, die Auswirkungen auf das haushaltswirtschaftliche Handeln der Geme<strong>in</strong>de<br />
haben können.<br />
4.3 Auskünfte über die Geschäftsführung der Geme<strong>in</strong>de<br />
Für die Geme<strong>in</strong>de besteht die gesetzliche Verpflichtung, am Schluss des Gesamtlageberichtes ausgewählte<br />
Angaben über diese Verantwortlichen <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>de zu machen, um auf mögliche typische Interessenkonflikte<br />
h<strong>in</strong>zuweisen, die im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit stehen und dafür von Bedeutung s<strong>in</strong>d (vgl. §<br />
116 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong>). Diese Angabepflichten bieten sich als Anlass an, im Lagebericht auch Aussagen über die<br />
ordnungsgemäße Geschäftsführung dieser Verantwortlichen zu machen. Dazu gehören u.a. auch Angaben über<br />
e<strong>in</strong>e ausreichende Informationsversorgung und die Erfüllung der Berichtspflichten sowie Kontrollen im S<strong>in</strong>ne<br />
e<strong>in</strong>es wirtschaftlichen Verwaltungshandelns zum Wohle der Geme<strong>in</strong>de. Es können Angaben über die Arbeitsweise<br />
der Organe und über Führungspraktiken, ggf. unter Benennung gesetzlicher Standards, gemacht werden.<br />
Es bedarf nur entsprechender Angaben über die Arbeit des gesamten Gremiums und nicht e<strong>in</strong>er personenbezogenen<br />
Zuordnung auf se<strong>in</strong>e Mitglieder, soweit die gesetzlich vorgesehenen Gremien der Geme<strong>in</strong>de die Verantwortung<br />
tragen. Zudem müssen nicht die sachlichen Beratungs<strong>in</strong>halte von Sitzungen und Beratungen zum Gegenstand<br />
der Berichterstattung gemacht werden. Den Angaben über das tatsächliche Zusammenwirken nicht nur<br />
zwischen dem Rat der Geme<strong>in</strong>de, der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung und den geme<strong>in</strong>dlichen Betrieben, sondern<br />
auch zwischen dem Rat und se<strong>in</strong>en Ausschüssen sowie dem Bürgermeister und dem Verwaltungsvorstand<br />
kommt e<strong>in</strong>e besondere Bedeutung zu. Unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten bedarf es dazu ggf.<br />
auch verb<strong>in</strong>dlicher Regelungen, um Informationen sicher zu stellen. Zu berücksichtigen ist, dass der geme<strong>in</strong>dliche<br />
Gesamtlagebericht ke<strong>in</strong> Market<strong>in</strong>g<strong>in</strong>strument darstellt.<br />
5. Zu Absatz 5 (Aufstellung des Entwurfs des Gesamtabschlusses):<br />
5.1 Zu Satz 1 (Aufstellungsfrist):<br />
Nach der Vorschrift ist der Gesamtabschluss ist <strong>in</strong>nerhalb der ersten neun Monate nach dem Abschlussstichtag<br />
(31. Dezember) aufzustellen. Er baut auf dem Jahresabschluss der geme<strong>in</strong>dlichen Kernverwaltung und den Jahresabschlüssen<br />
der <strong>in</strong> den Gesamtabschluss e<strong>in</strong>zubeziehenden geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe auf. Die Fristbestimmung<br />
<strong>in</strong> dieser Vorschrift berücksichtigt, dass nur festgestellte Jahresabschlüsse der Betriebe <strong>in</strong> den Gesamtabschluss<br />
e<strong>in</strong>bezogen werden dürfen. Nachfolgende werden e<strong>in</strong>ige Eckpunkte für den örtlichen Zeitplan aufgezeigt<br />
(vgl. Abbildung).<br />
Eckpunkte für den örtlichen Zeitplan für den Gesamtabschluss<br />
Term<strong>in</strong> für die Gesamtabschlussrichtl<strong>in</strong>ie e<strong>in</strong>schließlich Änderungen und Ergänzungen<br />
Term<strong>in</strong> für die Durchführung der letzten Zahlungen und Buchungen<br />
Term<strong>in</strong> für die Saldenabstimmungen<br />
Term<strong>in</strong> für festgestellte Jahresabschlüsse und Geme<strong>in</strong>debilanzen II<br />
GEMEINDEORDNUNG 791
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
Term<strong>in</strong> für ergänzende Informationen und Berichte, z.B. für den Gesamtlagebericht<br />
Term<strong>in</strong> für die Durchführung der konsolidierungsvorbereitenden Maßnahmen<br />
Term<strong>in</strong> für die Durchführung der Konsolidierung<br />
Term<strong>in</strong> für die Vorlage des aufgestellten Gesamtabschlusses an den Bürgermeister<br />
Term<strong>in</strong> für die Zuleitung an den Rat der Geme<strong>in</strong>de<br />
Term<strong>in</strong> für die Bestätigung des Gesamtabschlusses durch den Rat<br />
Term<strong>in</strong> für die Anzeige an die Aufsicht und die öffentliche Bekanntmachung<br />
Abbildung 168 „Eckpunkte für den örtlichen Zeitplan für den Gesamtabschluss“<br />
Zur Fristwahrung nach dieser Vorschrift müssen der Geme<strong>in</strong>de die notwendigen Unterlagen und Informationen<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe rechtzeitig vorliegen müssen. Soweit die betrieblichen Jahresabschlüsse nach HGB-<br />
Vorschriften aufzustellen s<strong>in</strong>d, müssen diese wie der geme<strong>in</strong>dliche Jahresabschluss nach § 95 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong><br />
i.d.R. <strong>in</strong>nerhalb der ersten drei Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres aufgestellt se<strong>in</strong>. Sie werden anschließend<br />
geprüft und festgestellt. Es ist zulässig, bereits während der Aufstellungsphase die Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Gesamtabschluss e<strong>in</strong>zuleiten.<br />
Die Geme<strong>in</strong>de sollte aber dazu e<strong>in</strong>e laufende Überwachung durchführen, um den gesetzlich bestimmten Term<strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>halten zu können. Dafür bietet sich die Aufstellung e<strong>in</strong>es eigenen Term<strong>in</strong>plans für den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss<br />
an, der ggf. jährlich kalendermäßig zu aktualisieren ist. Sie muss dabei beachten, dass der geme<strong>in</strong>dliche<br />
Gesamtabschluss, bezogen auf den jährlichen Abschlussstichtag 31. Dezember, <strong>in</strong>nerhalb der ersten neun<br />
Monate nach dem Abschlussstichtag aufzustellen ist und der Rat bis spätestens 31. Dezember des auf das<br />
Haushaltsjahr folgenden Jahres den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Gesamtabschluss durch Beschluss<br />
zu bestätigen hat.<br />
5.2 Zu Satz 2 (Verweis auf § 95 Abs. 3 <strong>NRW</strong>):<br />
5.2.1 Die Aufstellung durch den Kämmerer<br />
Für die Aufstellung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses s<strong>in</strong>d die Vorschriften über die Aufstellung des Jahresabschlusses<br />
der Geme<strong>in</strong>de entsprechend anzuwenden. Die Verweisung <strong>in</strong> dieser Vorschrift soll dieses sicherstellen.<br />
Der Kämmerer hat daher <strong>in</strong> Anwendung des § 95 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong> den Entwurf des Gesamtabschlusses<br />
der Geme<strong>in</strong>de aufzustellen. Er hat dabei die Generalnorm <strong>in</strong> Absatz 6 dieser Vorschrift zu beachten, nach der der<br />
Gesamtabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen<br />
entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzgesamtlage der Geme<strong>in</strong>de vermitteln<br />
muss. Dieses Gebot kann nur unter Beachtung des Vollständigkeitsgebots nur dann erfüllt werden, wenn<br />
der Entwurf des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses alle vorgesehenen Bestandteile und Anlagen umfasst.<br />
Nach der Fertigstellung des Entwurfs des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses hat der Kämmerer diesen zu unterzeichnen<br />
und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorzulegen. Er hat bei der Aufstellung des Entwurfs des Gesamtabschluss<br />
der Geme<strong>in</strong>de zu beachten, dass der Bürgermeister den von ihm bestätigten Entwurf <strong>in</strong>nerhalb<br />
von neun Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zur Bestätigung zuzuleiten hat. Das gesamte Auf-<br />
GEMEINDEORDNUNG 792
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
stellungsverfahren des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses erfordert daher e<strong>in</strong>e klare Aufgabenverteilung und<br />
Term<strong>in</strong>planung. Es ist deshalb von der Geme<strong>in</strong>de örtlich festzulegen, wer welche Abschlussarbeiten bis zu welchem<br />
Term<strong>in</strong> zu erbr<strong>in</strong>gen hat. Dabei ist e<strong>in</strong> Zusammenhang mit den für den Jahresabschluss notwendigen Abstimmungsarbeiten<br />
und den zu klärenden Sachverhalten herzustellen.<br />
5.2.2 Die Bestätigung durch den Bürgermeister<br />
5.2.2.1 Inhalte der Bestätigung<br />
Der Bürgermeister hat den vom Kämmerer aufgestellten und ihm vorgelegten Entwurf des Gesamtabschlusses zu<br />
bestätigen. Für diese Bestätigung ist ke<strong>in</strong>e bestimmte Form vorgeschrieben. Der Bürgermeister hat im Rahmen<br />
se<strong>in</strong>er Tätigkeit das Recht, von dem ihm vom vorgelegten Entwurf abzuweichen. Wenn aus se<strong>in</strong>er Sicht e<strong>in</strong> Bedarf<br />
für Änderungen des Entwurfs der Haushaltssatzung besteht, kann er eigenverantwortlich entscheiden, ob<br />
diese Änderungen erfolgen sollen. Er kann aber zum Entwurf auch E<strong>in</strong>schränkungen machen oder auch weitere<br />
H<strong>in</strong>weise geben. E<strong>in</strong>e Abstimmung mit dem Kämmerer ist s<strong>in</strong>nvoll und sachgerecht, aber nicht verpflichtend.<br />
Die Vornahme der Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung stellt e<strong>in</strong>e funktionale und ke<strong>in</strong>e persönliche<br />
Rechtshandlung des Bürgermeisters der Geme<strong>in</strong>de dar. Soweit der Bürgermeister diese gesetzliche Pflicht aus<br />
persönlichen Gründen nicht wahrnehmen kann, ist <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em solchen Falle die Bestätigung des Entwurfs der<br />
Haushaltssatzung unter Beachtung der geltenden Vertretungsregelungen durch den dann Vertretungsberechtigten<br />
vorzunehmen (vgl. § 68 GO <strong>NRW</strong>).<br />
Die Bestätigung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses durch den Bürgermeister kommt dadurch zum Ausdruck,<br />
dass dieser den ihm vorgelegten Entwurf zu unterzeichnen hat. Er erfüllt mit se<strong>in</strong>er Bestätigung e<strong>in</strong>e öffentlichrechtliche<br />
Verpflichtung und br<strong>in</strong>gt damit zum Ausdruck, dass der Entwurf aus se<strong>in</strong>er Verantwortung heraus richtig<br />
und vollständig ist, sofern er dazu ke<strong>in</strong>e besonderen E<strong>in</strong>schränkungen macht oder H<strong>in</strong>weise gibt. Se<strong>in</strong>e Unterzeichnung<br />
be<strong>in</strong>haltet daher e<strong>in</strong>e Vollständigkeitserklärung dah<strong>in</strong>gehend, dass der Entwurf des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Gesamtabschlusses alle Bestandteile und Anlagen zur Erfüllung se<strong>in</strong>er Aufgabe enthält, die dafür vorgeschrieben<br />
bzw. notwendig s<strong>in</strong>d. Der Bürgermeister hat bei der Erteilung se<strong>in</strong>er Bestätigung darauf zu achten, dass er den<br />
von ihm bestätigten Entwurf des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses <strong>in</strong>nerhalb von neun Monaten nach dem<br />
Abschlussstichtag dem Rat zur Prüfung und Bestätigung zuzuleiten hat.<br />
5.2.2.2 Die Informationspflichten des Bürgermeisters<br />
Der Bürgermeister hat das Recht, vom dem ihm vom Kämmerer vorgelegten Entwurf des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses<br />
abzuweichen, bevor er diese dem Rat der Geme<strong>in</strong>de zuleitet. Weicht der Bürgermeister von<br />
dem ihm vorgelegten Entwurf ab, hat er vor der Zuleitung des Entwurfs an den Rat der Geme<strong>in</strong>de den Kämmerer<br />
über se<strong>in</strong>e abweichende Auffassung zu <strong>in</strong>formieren und ihm die sich daraus ergebenden oder bereits von ihm<br />
vorgenommenen Änderungen des Entwurfs offen zu legen. Dem Kämmerer steht <strong>in</strong> diesem Falle das Recht zu,<br />
e<strong>in</strong>e Stellungnahme zu dem durch den Bürgermeister geänderten Entwurf des Gesamtabschlusses abzugeben.<br />
Die Befugnis des Bürgermeisters, Änderungen an dem ihm vom Kämmerer vorgelegten Entwurf des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Gesamtabschlusses vornehmen zu dürfen, geht jedoch nicht so weit, dass er wegen des möglicherweise<br />
weitreichenden Umfangs se<strong>in</strong>er für notwendig angesehenen Änderungen eigenständig e<strong>in</strong>en neuen Entwurf des<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses aufstellen darf. Das Recht zur Aufstellung des Entwurfs des Gesamtabschlusses<br />
der Geme<strong>in</strong>de steht gesetzlich nur dem Kämmerer und nicht dem Bürgermeister zu. Bleiben wegen der<br />
Änderungen der Entwurfsfassung noch Differenzen zwischen dem Kämmerer und dem Bürgermeister bestehen,<br />
s<strong>in</strong>d diese im Rahmen der Beratungen des Rates über den Entwurf des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses auszuräumen.<br />
GEMEINDEORDNUNG 793
5.2.3 Wirkungen der Unterzeichnungen<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
Mit ihren Unterschriften auf dem von ihnen aufgestellten und bestätigten Entwurfs des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses<br />
erfüllen der Kämmerer und der Bürgermeister e<strong>in</strong>e öffentlich-rechtliche Verpflichtung und haben damit<br />
ausreichend ihre Verantwortung als Nachweis im S<strong>in</strong>ne der Vorschrift dokumentiert. Sie br<strong>in</strong>gen damit zum Ausdruck,<br />
dass der von ihnen aufgestellte Entwurf des Gesamtabschlusses aus ihrer Verantwortung heraus richtig<br />
und vollständig ist. Außerdem wird das Ergebnis des gesamten wirtschaftlichen Handelns der Geme<strong>in</strong>de im abgelaufenen<br />
Haushaltsjahr nach festgelegten haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Regeln aufzeigt.<br />
In diesem Zusammenhang gilt, dass der geme<strong>in</strong>dliche Gesamtabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger<br />
Buchführung e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-<br />
, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzgesamtlage der Geme<strong>in</strong>de vermitteln ist, sofern der Kämmerer und/oder der Bürgermeister<br />
dazu ke<strong>in</strong>e besonderen E<strong>in</strong>schränkungen machen oder H<strong>in</strong>weise geben. Die Verpflichtung zur Unterzeichnung<br />
des Entwurfs be<strong>in</strong>haltet dabei nicht, dass der Kämmerer und der Bürgermeister sämtliche Bestandteile und Anlagen<br />
des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses e<strong>in</strong>zeln zu unterzeichnen haben. Der Gesamtabschluss ist vielmehr<br />
buchtechnisch so zusammen zu fassen, dass erkennbar und nachvollziehbar wird, dass sich die Unterschriften<br />
des Kämmerers und des Bürgermeisters auf die Gesamtheit aller Teile beziehen.<br />
5.2.4 Die Zuleitung an den Rat<br />
Der Bürgermeister hat <strong>in</strong> Anwendung des § 95 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong> den Entwurf des Gesamtabschlusses an den Rat<br />
zu Bestätigung zuzuleiten. Durch den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss legt der Bürgermeister deshalb Rechenschaft<br />
gegenüber dem Rat ab und legt dar, wie er se<strong>in</strong>en Auftrag ausgeführt hat, zu welchem Ergebnis die gesamte<br />
Haushaltswirtschaft im Verlaufe des Haushaltsjahres geführt hat, welche Auswirkungen sich daraus auf<br />
das gesamte Vermögen und die gesamten Schulden der Geme<strong>in</strong>de ergeben und welche Chancen und Risiken<br />
sich <strong>in</strong>sgesamt für die künftige Gesamtentwicklung der Geme<strong>in</strong>de ergeben.<br />
Die Zuleitung des Entwurfs des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses an den Rat dient daher dazu, dem Rat die<br />
Informationen für se<strong>in</strong>e gesetzlich vorgesehene Beschlussfassung zukommen zu lassen. Sie bedeutet jedoch<br />
nicht, dass der Rat den Entwurf (des Gesamtabschlusses) unmittelbar festzustellen hat. Vielmehr nimmt der Rat<br />
den Entwurf im Rahmen der Zuleitung nur entgegen, um ihm dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung<br />
weiterzuleiten. Nach Durchführung der gesetzlich vorgesehenen Prüfung hat der Rat die Feststellung des ihm<br />
vom Bürgermeister vorgelegten Gesamtabschlusses vornehmen.<br />
Andererseits dient die Zuleitung der geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlussunterlagen an den Rat auch dazu, den<br />
Ratsmitgliedern die nötigen Informationen über die gesamte geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft zu geben, damit<br />
diese die ihnen zustehende eigene Mitwirkung bei der Bestätigung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses ausüben<br />
können. Der Bürgermeister, der die Zuleitung des Entwurfs des Gesamtabschlusses an den Rat veranlasst,<br />
kann im Rahmen se<strong>in</strong>er Vorlage bereits darlegen, dass und wie von ihm die gesamte geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft<br />
entsprechend dem Auftrag des Rates ordnungsgemäß ausgeführt wurde.<br />
5.2.5 Der Vollzug der Zuleitung<br />
Der Adressat der Zuleitung des vom Bürgermeister bestätigten Entwurfs des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses<br />
mit se<strong>in</strong>en Anlagen ist der Rat der Geme<strong>in</strong>de, als Kollegialorgan, das se<strong>in</strong>e Beschlüsse <strong>in</strong> Sitzungen fasst (Sitzungspr<strong>in</strong>zip)<br />
und nicht das e<strong>in</strong>zelne Ratsmitglied. Die Zuleitung des bestätigten Entwurfs des Gesamtabschlusses<br />
mit se<strong>in</strong>en Anlagen an den Rat der Geme<strong>in</strong>de wird <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Praxis i.d.R. dadurch vollzogen,<br />
GEMEINDEORDNUNG 794
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
dass durch den Bürgermeister e<strong>in</strong> entsprechender Tagesordnungspunkt auf die Tagesordnung der nächsten<br />
Sitzung des Rates gesetzt wird, denn er hat die Ratssitzungen e<strong>in</strong>zuberufen (vgl. § 47 Abs. 1 S. 1 GO <strong>NRW</strong>) und<br />
die Tagesordnung <strong>in</strong> eigener Verantwortung festzulegen (vgl. § 48 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>). Im Rahmen der beschlussfähigen<br />
Zusammenkunft des Rates (Sitzung) kann dann die Zuleitung des Entwurfs des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses<br />
als erledigt betrachtet werden.<br />
Für die weiteren Beratungen bzw. die Verweisung an den Rechnungsprüfungsausschuss ist es wichtig, dass<br />
jedes Ratsmitglied über ausreichende Beratungsunterlagen über die abgeschlossene gesamte geme<strong>in</strong>dliche<br />
Haushaltswirtschaft verfügen kann, denn ihm stehen h<strong>in</strong>sichtlich der Beschlussfassung eigene Mitwirkungsrechte<br />
zu. Es muss daher gewährleistet werden, dass der Rat der Geme<strong>in</strong>de nach der Prüfung sachgerecht die Bestätigung<br />
des ihm vorgelegten Gesamtabschlusses mit se<strong>in</strong>en Anlagen treffen kann. In den Fällen, <strong>in</strong> denen der<br />
Kämmerer von der ihm gesetzlich e<strong>in</strong>geräumten Möglichkeit Gebrauch macht, e<strong>in</strong>e abweichende Stellungnahme<br />
zu dem vom Bürgermeister bestätigten Entwurf des Gesamtabschlusses abzugeben, ist der Bürgermeister verpflichtet,<br />
diese Stellungnahme mit dem Entwurf des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses dem Rat vorzulegen. In<br />
der betreffenden Ratssitzung besteht dann für Bürgermeister und auch für den Kämmerer e<strong>in</strong> Rederecht, so dass<br />
die Ergebnisse aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr und die damit verbundene Zielerreichung sowie die Chancen<br />
und Risiken für die wirtschaftliche Gesamtentwicklung der Geme<strong>in</strong>de ggf. aus unterschiedlichen Sichten<br />
dargestellt werden.<br />
6. Zu Absatz 6 (Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses):<br />
6.1 Zu Satz 1 (Zwecke der Prüfung des Gesamtabschlusses):<br />
6.1.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
In Anlehnung an das Handelsrecht (§ 322 HGB) ist der Inhalt der Prüfung sowie die Darstellung des Ergebnisses<br />
der Prüfung <strong>in</strong> dieser Vorschrift bestimmt worden. Es ist unter Bezugnahme auf den Prüfungsgegenstand klargestellt<br />
worden, dass <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Bestätigungsvermerk das Ergebnis der Prüfung zusammengefasst und beurteilt wird,<br />
ob der Gesamtabschluss den rechtlichen Bestimmungen entspricht und dieser unter Beachtung der Grundsätze<br />
ordnungsmäßiger Buchführung e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-,<br />
Ertrags- und F<strong>in</strong>anzgesamtlage der Geme<strong>in</strong>de vermittelt. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat bei der<br />
Gesamtabschlussprüfung zu beachten, dass der Rat der Geme<strong>in</strong>de bis zum 31. Dezember des dem Haushaltsjahr<br />
folgenden Jahres den Gesamtabschluss zu bestätigen hat (vgl. § 116 Abs. 1 i.V.m. § 96 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>). Er<br />
hat daher den Ablauf se<strong>in</strong>er Prüfung entsprechend zu gestalten.<br />
Durch diese Zielbestimmung bekommt die Prüfung des Gesamtabschlusses durch den Rechnungsprüfungsausschuss<br />
e<strong>in</strong>e Kontroll-, Informations- und Beglaubigungsfunktion. Diese Vorschrift stellt e<strong>in</strong>en allgeme<strong>in</strong>en Rechnungslegungsgrundsatz<br />
dar, der als Generalnorm die Vorlage e<strong>in</strong>es den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden<br />
Bildes der wirtschaftlichen Lage der Geme<strong>in</strong>de gewährleisten soll. So ist z.B. der Grundsatz der Wesentlichkeit<br />
immer dann anzuwenden, wenn dadurch der E<strong>in</strong>blick <strong>in</strong> die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und<br />
F<strong>in</strong>anzgesamtlage der Geme<strong>in</strong>de verbessert wird. Der notwendige Abwägungsprozess ist von der Geme<strong>in</strong>de<br />
unter Berücksichtigung der vorliegenden örtlichen Gegebenheiten vorzunehmen.<br />
6.1.2 Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung<br />
6.1.2.1 Das Regelsystem der GoB<br />
Das geme<strong>in</strong>dliche Haushaltsrecht stellt wie das Handelsrecht die GoB <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en Zusammenhang mit den gesetzlichen<br />
Vorschriften über den Jahresabschluss der Geme<strong>in</strong>de. Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung s<strong>in</strong>d<br />
GEMEINDEORDNUNG 795
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
e<strong>in</strong> gesetzlich verankertes Regelungssystem, stehen jedoch nicht über dem Gesetz. Sie können sich als unbestimmter<br />
Rechtsbegriff nur im Rahmen der gesetzlichen Regelungen unter Beachtung von S<strong>in</strong>n und Zweck des<br />
Gesetzes oder e<strong>in</strong>zelner Vorschriften entwickeln. Als Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ist daher jedes<br />
Verfahren und jede Methode anzuerkennen, die dazu führen, dass gesetzliche Regelungen im E<strong>in</strong>zelfall ihrem<br />
S<strong>in</strong>n und Zweck entsprechend angewandt werden. Folgende allgeme<strong>in</strong>e Grundsätze gelten als Grundsätze ordnungsmäßiger<br />
Buchführung (vgl. Abbildung).<br />
Grundsatz<br />
der Vollständigkeit<br />
Grundsatz<br />
der Richtigkeit<br />
und Willkürfreiheit<br />
Grundsatz<br />
der Verständlichkeit<br />
Grundsatz<br />
der Aktualität<br />
Grundsatz<br />
der Relevanz<br />
Grundsatz<br />
der Stetigkeit<br />
Grundsatz<br />
des Nachweises<br />
der Recht- und<br />
Ordnungsmäßigkeit<br />
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB)<br />
In der Buchführung s<strong>in</strong>d alle Geschäftsvorfälle sowie die Vermögens-<br />
und Schuldenlage vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet<br />
zu erfassen und zu dokumentieren. Daraus folgt das Erfordernis<br />
des systematischen Aufbaus der Buchführung unter Aufstellung<br />
e<strong>in</strong>es Kontenplans, das Pr<strong>in</strong>zip der vollständigen und verständlichen<br />
Aufzeichnung sowie das Belegpr<strong>in</strong>zip, d.h. die Grundlage für<br />
die Richtigkeit der Buchung bildet den Buchungsbeleg mit der<br />
Festlegung „Ke<strong>in</strong>e Buchung ohne Beleg.“ Dazu zählt auch die<br />
E<strong>in</strong>haltung der vorgesehenen Aufbewahrungsfristen.<br />
Die Aufzeichnungen über die Geschäftsvorfälle durch die Geme<strong>in</strong>de<br />
müssen die Realität möglichst genau abbilden, so dass die Informationen<br />
daraus begründbar und nachvollziehbar sowie objektiv richtig<br />
und willkürfrei s<strong>in</strong>d. Sie müssen sich <strong>in</strong> ihren Aussagen mit den zu<br />
Grunde liegenden Dokumenten decken und der Buchführungspflichtige<br />
bestätigen kann, dass die Buchführung e<strong>in</strong>e getreue<br />
Dokumentation se<strong>in</strong>er Geschäftsvorfälle nach den rechtlichen<br />
Bestimmungen und den GoB erfolgt.<br />
Die Informationen des Rechnungswesens s<strong>in</strong>d für den Rat und die<br />
Bürger als Öffentlichkeit so aufzubereiten und verfügbar zu machen,<br />
dass die wesentlichen Informationen über die Vermögens-<br />
und Schuldenlage klar ersichtlich und verständlich s<strong>in</strong>d.<br />
Es ist e<strong>in</strong> enger zeitlicher Bezug zwischen dem Zeitraum, über den<br />
Rechenschaft gegeben wird, und der Veröffentlichung der Rechenschaft<br />
herzustellen.<br />
Das Rechnungswesen muss die Informationen bieten, die zur<br />
Rechenschaft notwendig s<strong>in</strong>d, sich jedoch im H<strong>in</strong>blick auf die Wirtschaftlichkeit<br />
und Verständlichkeit auf die relevanten Daten beschränken.<br />
Dabei soll der Aufwand der Informationsbeschaffung <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>em angemessenen Verhältnis zum Nutzen der Informationsbereitstellung<br />
stehen.<br />
Die Grundlagen des Rechnungswesens, <strong>in</strong>sbesondere die Methoden<br />
für Ansatz und Bewertung des Vermögens, sollen <strong>in</strong> der Regel<br />
unverändert bleiben, so dass e<strong>in</strong>e Stetigkeit im Zeitablauf erreicht<br />
wird. Notwendige Anpassungen s<strong>in</strong>d besonders kenntlich zu machen.<br />
Im Jahresabschluss ist über die Recht- und Ordnungsmäßigkeit der<br />
Haushaltswirtschaft Rechenschaft abzulegen.<br />
Abbildung 169 „Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB)“<br />
Die GoB sollen sicherstellen, dass e<strong>in</strong> sachverständiger Dritter sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er angemessenen Zeit e<strong>in</strong>en Überblick<br />
über die Aufzeichnung von Buchungsvorfällen und die Aufzeichnung von Vermögens- und Schuldenpositionen<br />
GEMEINDEORDNUNG 796
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
verschaffen kann und Manipulationsmöglichkeiten verh<strong>in</strong>dert werden, aber auch, dass diesem Dritten e<strong>in</strong> qualifizierter<br />
E<strong>in</strong>blick <strong>in</strong> die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de möglich ist. Da sich bei der<br />
praktischen Anwendung ggf. Zielkonflikte ergeben können, ist es bei der örtlichen Ausgestaltung des Rechnungswesens<br />
notwendig, zwischen konkurrierenden Sachverhalten unter Beachtung der o.a. Grundsätze e<strong>in</strong>e<br />
Abwägung vorzunehmen. Bedarf es dabei e<strong>in</strong>er Auslegung der Grundsätze, s<strong>in</strong>d i.d.R. die juristischen Auslegungskriterien<br />
heranzuziehen.<br />
6.1.2.2 Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze<br />
Für den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss spielen außerdem auch die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze<br />
e<strong>in</strong>e wichtige Rolle. Jeder dieser Grundsätze soll sicherstellen, dass e<strong>in</strong> sachverständiger Dritter sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
angemessenen Zeit e<strong>in</strong>en Überblick über die Aufzeichnung von geme<strong>in</strong>dlichen Geschäftsvorfällen und die Aufzeichnung<br />
von Vermögens- und Schuldenpositionen verschaffen kann. Es sollen dadurch Manipulationsmöglichkeiten<br />
verh<strong>in</strong>dert werden.<br />
Erreicht werden soll aber auch, dass diesem Dritten e<strong>in</strong> qualifizierter E<strong>in</strong>blick <strong>in</strong> die Vermögens-, Schulden-, Ertrags-<br />
und F<strong>in</strong>anzgesamtlage der Geme<strong>in</strong>de möglich ist. Zudem sorgt die Auslegung der GoB durch Rechtsprechung<br />
und Literatur mittelbar für e<strong>in</strong>e dynamische Anpassung des Rechts über das geme<strong>in</strong>dliche Rechnungswesen<br />
an die aktuellen nationalen und <strong>in</strong>ternationalen Entwicklungen. Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze<br />
lassen sich <strong>in</strong> folgende Grundsätze untergliedern (vgl. Abbildung).<br />
Allgeme<strong>in</strong> geltende Grundsätze:<br />
Bilanzierungsgrundsätze:<br />
Bewertungsgrundsätze:<br />
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze<br />
- Grundsatz der Bilanzidentität;<br />
- Grundsatz der Bilanzkont<strong>in</strong>uität,<br />
- Grundsatz der Wesentlichkeit,<br />
- Grundsatz der Wirtschaftlichkeit,<br />
- Aktivierungsgrundsatz,<br />
- Passivierungsgrundsatz,<br />
- Grundsatz der Vollständigkeit,<br />
- Grundsatz des Saldierungsverbots,<br />
- Grundsatz der Pagatorik,<br />
- Grundsatz der stichtagsbezogenen Bewertung,<br />
- Grundsatz der E<strong>in</strong>zelbewertung<br />
- Grundsatz der Vorsicht, auch als<br />
- Realisationspr<strong>in</strong>zip,<br />
- Imparitätspr<strong>in</strong>zip,<br />
- Niederstwertpr<strong>in</strong>zip,<br />
- Höchstwertpr<strong>in</strong>zip,<br />
- Grundsatz der Bewertungsstetigkeit.<br />
Abbildung 170 „Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze“<br />
6.1.2.3 Die Grundsätze ordnungsmäßiger Konzernrechnungslegung<br />
Handelsrechtlich haben sich zum Konzernabschluss die Grundsätze ordnungsmäßiger Konzernrechnungslegung<br />
(GoK) entwickelt, die auch beim Gesamtabschluss der Geme<strong>in</strong>de zu beachten s<strong>in</strong>d (vgl. Abbildung).<br />
GEMEINDEORDNUNG 797
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
Grundsätze ordnungsmäßiger Konzernrechnungslegung (GoK)<br />
Grundsatz der Fiktion der rechtlichen E<strong>in</strong>heit (E<strong>in</strong>heitstheorie)<br />
Grundsatz der E<strong>in</strong>heitlichkeit (der Abschlussstichtage, der Währung, des Ausweises<br />
Grundsatz der Vollständigkeit (des Konsolidierungskreises)<br />
Grundsatz der E<strong>in</strong>heitlichkeit der Bilanzierung und Bewertung<br />
Grundsatz der Stetigkeit der Konsolidierungsmethoden (zeitlich und sachlich)<br />
Grundsatz der Elim<strong>in</strong>ierung konzern<strong>in</strong>terner Beziehungen<br />
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Wesentlichkeit<br />
Abbildung 171 „Grundsätze ordnungsmäßiger Konzernrechnungslegung (GoK)“<br />
Diese Grundsätze sollen im Rahmen des Gesamtabschlusses gewährleisten, dass die Zusammenfassung der<br />
Jahresabschlüsse der e<strong>in</strong>bezogenen Betriebe unter Anwendung der maßgeblichen E<strong>in</strong>heitstheorie erfolgt und der<br />
Gesamtabschluss e<strong>in</strong> Bild über die wirtschaftliche Lage der Geme<strong>in</strong>de vermittelt, als wäre die Kernverwaltung der<br />
Geme<strong>in</strong>de zusammen mit den e<strong>in</strong>bezogenen Betriebe nur e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>heit. Die GoK ergänzen <strong>in</strong> diesem S<strong>in</strong>ne die für<br />
den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss e<strong>in</strong>schlägigen Vorschriften sowie die von der Geme<strong>in</strong>de anzuwendenden<br />
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Über diese Grundsätze h<strong>in</strong>aus kommen durch die Verweise auf<br />
geme<strong>in</strong>dliche Vorschriften über den Jahresabschluss auch haushaltsrechtliche Grundsätze zur Anwendung.<br />
6.1.3 Die „Generalnorm“<br />
6.1.3.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die Regelung <strong>in</strong> der Vorschrift, dass der geme<strong>in</strong>dliche Gesamtabschluss e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen<br />
entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzgesamtlage der Geme<strong>in</strong>de vermitteln muss,<br />
stellt die „Generalnorm“ für die Aufstellung und Feststellung des Gesamtabschlusses der Geme<strong>in</strong>de dar. Unter<br />
Berücksichtigung dieser Norm s<strong>in</strong>d Zweifelsfragen bei der Auslegung und Anwendung von haushaltsrechtlichen<br />
E<strong>in</strong>zelvorschriften zu klären. Sie ersetzt dadurch aber nicht die e<strong>in</strong>zelnen Bestimmungen.<br />
Die Norm kann im E<strong>in</strong>zelfall bewirken, dass die Geme<strong>in</strong>de im Gesamtanhang nach § 51 Abs. 2 GemHVO <strong>NRW</strong><br />
weitere Informationen über wichtige örtliche Sachverhalte geben muss, damit der geme<strong>in</strong>dliche Gesamtabschluss<br />
die von ihm gesetzlich geforderte Aussagekraft h<strong>in</strong>sichtlich der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzgesamtlage<br />
der Geme<strong>in</strong>de als Bild der wirtschaftlichen Gesamtlage der Geme<strong>in</strong>de erreicht. Dabei gilt, dass bei<br />
diesen vier Bereichen ke<strong>in</strong>e Rangfolge besteht und der geme<strong>in</strong>dliche Gesamtabschluss deshalb für diese vier<br />
Bereiche gleichwertig e<strong>in</strong> entsprechendes Bild der jeweiligen Lage vermitteln muss. Die Geme<strong>in</strong>de hat dafür<br />
Sorge zu tragen, dass möglichst ke<strong>in</strong>er dieser Bereiche zu Gunsten anderer Bereiche vernachlässigt wird.<br />
GEMEINDEORDNUNG 798
6.1.3.2 Der Begriff „Vermögensgesamtlage“<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
Das Haushaltsrecht für Geme<strong>in</strong>den orientiert sich bei der Auslegung des Begriffs „Vermögensgesamtlage“, für<br />
den es ke<strong>in</strong>e gesetzliche Def<strong>in</strong>ition und ke<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>heitliche Begriffsbestimmung gibt, an der kaufmännischen Auslegung<br />
und damit an den Regelungen für die Vermögensgegenstände, die auf der Aktivseite der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Gesamtbilanz anzusetzen s<strong>in</strong>d. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im allgeme<strong>in</strong>en Wirtschaftsleben e<strong>in</strong> Wirtschaftsgut<br />
dadurch als Vermögensgegenstand charakterisiert wird, das mit ihm e<strong>in</strong> wirtschaftlicher Wert vorliegt,<br />
das Wirtschaftsgut selbstständig nutzungsfähig und bewertbar ist. Die auf der Aktivseite der geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtbilanz<br />
angesetzten Vermögensgegenstände dienen daher dazu, dass die Gesamtbilanz damit e<strong>in</strong> den tatsächlichen<br />
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögensgesamtlage der Geme<strong>in</strong>de vermitteln kann. Ergänzende<br />
Angaben zum Vermögen der Geme<strong>in</strong>de enthält der Gesamtanhang nach § 51 Abs. 2 GemHVO <strong>NRW</strong>.<br />
6.1.3.3 Der Begriff „Schuldengesamtlage“<br />
Das Haushaltsrecht für Geme<strong>in</strong>den orientiert sich bei der Auslegung des Begriffs „Schuldengesamtlage“ auf<br />
Grund der Passivseite der geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtbilanz ebenso wie bei der Auslegung des Begriffs „Vermögensgesamtlage“<br />
auf Grund der Aktivseite der geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtbilanz, für die es ke<strong>in</strong>e gesetzliche Def<strong>in</strong>itionen<br />
und ke<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>heitliche Begriffsbestimmungen gibt, an der kaufmännischen Auslegung. Dabei ist zu berücksichtigen,<br />
dass im allgeme<strong>in</strong>en Wirtschaftsleben, ausgehend von der Gesamtbilanz der Begriff „Schuldengesamtlage“<br />
dadurch abgegrenzt wird, dass nicht das Eigenkapital und die Sonderposten sowie die passive Rechnungsabgrenzung<br />
dazu zu zählen s<strong>in</strong>d. Die auf der Passivseite der geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtbilanz angesetzten Verb<strong>in</strong>dlichkeiten<br />
dienen daher dazu, dass die Gesamtbilanz damit e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild<br />
der Schuldengesamtlage der Geme<strong>in</strong>de vermitteln kann.<br />
6.1.3.4 Der Begriff „Ertragsgesamtlage“<br />
Das Haushaltsrecht für Geme<strong>in</strong>den orientiert sich bei der Auslegung des Begriffs „Ertragsgesamtlage“, für den es<br />
ke<strong>in</strong>e gesetzliche Def<strong>in</strong>ition und ke<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>heitliche Begriffsbestimmung gibt, an der kaufmännischen Auslegung<br />
und damit an den Regelungen über die geme<strong>in</strong>dliche Gesamtergebnisrechnung, denn dieses Werk stellt e<strong>in</strong>e<br />
zeitraumbezogene Rechnung dar, <strong>in</strong> der das Zustandekommen des Erfolgs der Geme<strong>in</strong>de nach Arten, Höhe und<br />
Quellen abgebildet wird. Die Gesamtergebnisrechnung ist unter Beachtung des Grundsatzes der Ergebnisspaltung<br />
aufgebaut, so dass die ordentlichen und die außerordentlichen Ergebniskomponenten dar<strong>in</strong> getrennt vone<strong>in</strong>ander<br />
aufgezeigt werden. Dadurch werden Informationen darüber geliefert, <strong>in</strong> welchem Umfang und aus welchem<br />
Anlass sich das Eigenkapital der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>es Haushaltsjahres verändert hat. Die Ertragslage<br />
weist daher das Gesamtergebnis des abgelaufenen Haushaltsjahres der Geme<strong>in</strong>de aus.<br />
6.1.3.5 Der Begriff „F<strong>in</strong>anzgesamtlage“<br />
Das Haushaltsrecht für Geme<strong>in</strong>den orientiert sich bei der Auslegung des Begriffs „F<strong>in</strong>anzgesamtlage“, für den es<br />
ke<strong>in</strong>e gesetzliche Def<strong>in</strong>ition und ke<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>heitliche Begriffsbestimmung gibt, an der kaufmännischen Auslegung<br />
und damit an den Regelungen über die Kapitalflussrechnung nach DRS 2. Dieses ermöglicht e<strong>in</strong>e zeitraumbezogene<br />
Rechnung zur Bestimmung des F<strong>in</strong>anzmittelfonds, denn im Rahmen des Gesamtabschlusses der Geme<strong>in</strong>de<br />
wird die geme<strong>in</strong>dliche F<strong>in</strong>anzgesamtlage auf der Grundlage der Veränderungen des F<strong>in</strong>anzmittelfonds beurteilt.<br />
Die dazu die geforderte Gesamtkapitalflussrechnung (vgl. § 51 Abs. 3 GemHVO <strong>NRW</strong> ist nach der Vorschrift<br />
unter Beachtung des Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 2 (DRS 2) <strong>in</strong> der vom Bundesm<strong>in</strong>isterium der<br />
Justiz (BMJ) nach § 342 Abs. 2 HGB bekannt gemachten Form aufzustellen.<br />
GEMEINDEORDNUNG 799
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
Nach diesem Rechnungslegungsstandard stellt die Kapitalflussrechnung zeitbezogen die Zahlungsströme der<br />
wirtschaftlichen Gesamtheit „Geme<strong>in</strong>de“ dar, die zur Veränderung des Zahlungsmittelbestandes führen, und gibt<br />
Auskunft darüber, wie die Kernverwaltung der Geme<strong>in</strong>de zusammen mit ihren Betrieben, soweit diese <strong>in</strong> den<br />
Gesamtabschluss e<strong>in</strong>bezogen s<strong>in</strong>d, die f<strong>in</strong>anziellen Mittel erwirtschaftet. Der geme<strong>in</strong>dliche Gesamtabschluss wird<br />
mit e<strong>in</strong>er Gesamtkapitalflussrechnung zusätzlich zur Gesamtbilanz und Gesamtergebnisrechnung se<strong>in</strong>er Aufgabe<br />
besser gerecht.<br />
6.1.4 Die Prüfung bei Entbehrlichkeit des Gesamtabschlusses<br />
Die Vorschrift des § 116 GO <strong>NRW</strong> enthält ke<strong>in</strong>e gesonderte Ausnahmeregelung, die es ermöglicht, dass die Geme<strong>in</strong>de<br />
generell von der Aufstellung e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses befreit ist. Bei e<strong>in</strong>zelnen Geme<strong>in</strong>den<br />
können besondere Fallgestaltungen im Rahmen ihrer Beteiligungen vorliegen, die dazu führen, dass für die<br />
Geme<strong>in</strong>de die Aufstellung e<strong>in</strong>es Gesamtabschlusses entbehrlich wird. E<strong>in</strong> solcher Sachverhalt liegt z.B. vor,<br />
wenn die Geme<strong>in</strong>de über ke<strong>in</strong>en voll zu konsolidieren Betrieb verfügt, denn dann liegt die wichtigste Voraussetzung<br />
für e<strong>in</strong>en geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss, dass e<strong>in</strong> Mutter-Tochter-Verhältnis zwischen der Kernverwaltung<br />
der Geme<strong>in</strong>de und e<strong>in</strong>em ihrer Betriebe besteht, nicht vor.<br />
Das Fehlen dieser Voraussetzung kann nicht dadurch geheilt werden, dass die betreffende Geme<strong>in</strong>de über Betriebe<br />
verfügt, die nach der Equity-Methode zu konsolidieren wären. In solchen Fällen erlischt jedoch nicht die <strong>in</strong><br />
dieser Vorschrift enthaltene ausdrückliche Pflicht zur Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss. Vielmehr ist<br />
sie dann vom Rechnungsprüfungsausschuss <strong>in</strong> der Art und Weise auszuüben, dass zu prüfen ist, ob örtlich die<br />
Voraussetzungen für e<strong>in</strong>en Verzicht auf die Aufstellung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses vorliegen. Er hat<br />
dabei die örtliche Abwägung zu prüfen und festzustellen, ob das daraus entstandene Ergebnis zutreffend ist.<br />
6.2 Zu Satz 2 (Recht- und Ordnungsmäßigkeitsprüfung):<br />
Nach der Vorschrift erstreckt sich die Prüfung des Gesamtabschlusses darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften<br />
und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden s<strong>in</strong>d. Die<br />
Prüfung der von der Geme<strong>in</strong>de zu beachtenden rechtlichen Vorschriften stellt daher e<strong>in</strong>e re<strong>in</strong>e Recht- und Ordnungsmäßigkeitsprüfung<br />
im Rahmen der geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlussprüfung dar. Diese Vorgabe ändert<br />
sich auch nicht durch das Prüfungsziel, ob der Gesamtabschluss der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen<br />
entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzgesamtlage der Geme<strong>in</strong>de unter Beachtung<br />
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ergibt. Die Prüfung der E<strong>in</strong>haltung der rechtlichen Bestimmungen<br />
im Rahmen der Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses bezieht sich auf die Vorschriften<br />
über die Rechnungslegung, solange es noch ke<strong>in</strong>e verb<strong>in</strong>dlichen Vorgaben über e<strong>in</strong>e Gesamtplanung und haushaltsmäßige<br />
Ausführung auf der Ebene des Gesamtabschlusses gibt.<br />
6.3 Zu Satz 3 (Prüfung des Gesamtlageberichtes):<br />
Der Gesamtlagebericht ist daraufh<strong>in</strong> zu prüfen, ob er mit dem geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang steht<br />
und ob se<strong>in</strong>e sonstigen Angaben nicht e<strong>in</strong>e falsche Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und<br />
F<strong>in</strong>anzgesamtlage der Geme<strong>in</strong>de erwecken. Die Angaben im Gesamtlagebericht dürfen nicht ke<strong>in</strong>e falsche Vorstellung<br />
von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzgesamtlage der Geme<strong>in</strong>de erwecken. Außerdem<br />
muss im Gesamtlagebericht auch zu den künftigen Chancen und Risiken der Geme<strong>in</strong>de Auskunft gegeben werden,<br />
die der Prüfer e<strong>in</strong>zuschätzen hat. Dabei kann er die „Grundsätze ordnungsmäßiger Lageberichterstattung“<br />
als Beurteilungsmaßstäbe heranziehen. Der jährliche Gesamtlagebericht der Geme<strong>in</strong>de hat daher e<strong>in</strong>e umfassende<br />
und vielfältige Ergänzungsfunktion zum geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss. Se<strong>in</strong>e Aussagen müssen daher<br />
klar, sorgfältig abgewogen und zeitnah se<strong>in</strong>.<br />
GEMEINDEORDNUNG 800
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
Bei se<strong>in</strong>er Aufstellung s<strong>in</strong>d die Grundsätze ordnungsmäßiger Lageberichterstattung (GoL) zu beachten. Für die<br />
äußere Gestaltung des Gesamtlageberichts, se<strong>in</strong>en Aufbau und Umfang s<strong>in</strong>d jedoch ke<strong>in</strong>e besonderen Formvorgaben<br />
vorgegeben worden. Die Fülle der Informationen verlangt aber e<strong>in</strong>e grundlegende Strukturierung. Auch die<br />
Gliederung des Gesamtlageberichts muss mit ihren e<strong>in</strong>zelnen Elementen dazu beitragen, dass der Gesamtlagebericht<br />
der Geme<strong>in</strong>de im Zusammenhang mit dem geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss e<strong>in</strong> den tatsächlichen Verhältnissen<br />
entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzgesamtlage der Geme<strong>in</strong>de vermittelt.<br />
Die Prüfungshandlungen s<strong>in</strong>d nach den gleichen Grundsätzen vorzunehmen, wie sie bei der Prüfung der<br />
Bestandteile des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses zur Anwendung kommen. Dar<strong>in</strong> e<strong>in</strong>zubeziehen s<strong>in</strong>d alle im<br />
Gesamtlagebericht der Geme<strong>in</strong>de gemachten Angaben.<br />
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass der Beteiligungsbericht der Geme<strong>in</strong>de ke<strong>in</strong> Prüfungsgegenstand<br />
ist, auch wenn dieser Bericht dem geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss als Anlage beizufügen ist (vgl. § 117 GO<br />
<strong>NRW</strong>). Diese Nichte<strong>in</strong>beziehung des geme<strong>in</strong>dlichen Beteiligungsberichtes <strong>in</strong> die Prüfung des Gesamtabschlusses<br />
der Geme<strong>in</strong>de nach § 116 Abs. 6 GO <strong>NRW</strong> lässt sich aus den Absätzen 1 und 6 des § 116 GO <strong>NRW</strong> ableiten,<br />
denn diese benennen ausdrücklich die <strong>in</strong> die Gesamtabschlussprüfungen e<strong>in</strong>zubeziehenden Teile, zu denen nicht<br />
der Beteiligungsbericht gehört.<br />
6.4 Zu Satz 4 (Verweis auf § 101 Abs. 2 bis 8 GO <strong>NRW</strong>):<br />
6.4.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die Verweisung <strong>in</strong> der Vorschrift auf § 101 Abs. 2 - 8 GO <strong>NRW</strong> stellt klar, dass die Regelungen über die Prüfung<br />
des Jahresabschlusses auf den Gesamtabschluss entsprechend anzuwenden s<strong>in</strong>d. Von der Möglichkeit der Stellungnahme<br />
des Bürgermeisters (vgl. § 101 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>) über die Beurteilung des Prüfungsergebnisses mit<br />
Bestätigungsvermerk (vgl. § 101 Abs. 3 - 5 GO <strong>NRW</strong>) sowie des Lageberichtes und der Chancen und Risiken der<br />
Geme<strong>in</strong>de (vgl. § 101 Abs. 6 GO <strong>NRW</strong>) bis zur Festlegung, dass sich der Rechnungsprüfungsausschuss zur<br />
Durchführung der Prüfung der örtlichen Rechnungsprüfung bedienen soll, soll e<strong>in</strong>e entsprechende Anwendung<br />
der Prüfungshandlungen bestehen.<br />
6.4.2 Inhalte des Bestätigungsvermerks für den Gesamtabschluss<br />
Über Art und Umfang der Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses sowie über das Ergebnis der Prüfung<br />
ist e<strong>in</strong> Prüfungsbericht durch den Rechnungsprüfungsausschuss zu erstellen(vgl. § 101 GO <strong>NRW</strong>). Dieser hat<br />
das Ergebnis der Prüfung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Bestätigungsvermerk zusammenzufassen. Dabei soll der Bestätigungsvermerk<br />
den Gegenstand, die Art und den Umfang der Prüfung beschreiben und es s<strong>in</strong>d dabei die angewandten<br />
Rechnungslegungsgrundsätze und Prüfungsgrundsätze anzugeben. Der abzugebende Bestätigungsvermerk soll<br />
aber auch e<strong>in</strong>e Beurteilung des Prüfungsergebnisses enthalten. Durch die Tenorierung entstehen fachliche<br />
Grundsätze und Klarstellungen, damit detaillierte Aussagen im Bestätigungsvermerk gemacht werden und dieser<br />
das getroffene Gesamturteil wieder spiegelt, denn der Inhalt des Bestätigungsvermerks wird durch das Ziel der<br />
Gesamtabschlussprüfung bestimmt.<br />
Der Bestätigungsvermerk entfaltet e<strong>in</strong>e rechtliche Wirkung dadurch, dass erst nach se<strong>in</strong>er Erstellung und Unterzeichnung<br />
gilt die Gesamtabschlussprüfung als abgeschlossen und der geme<strong>in</strong>dliche Gesamtabschluss als geprüft.<br />
Erst danach kann der geme<strong>in</strong>dliche Gesamtabschluss vom Rat der Geme<strong>in</strong>de bestätigt werden. Zudem soll<br />
die Beurteilung des Prüfungsergebnisses allgeme<strong>in</strong>verständlich und problemorientiert unter Berücksichtigung des<br />
Umstandes erfolgen, dass Rat und Verwaltungsvorstand der Geme<strong>in</strong>de den Gesamtabschluss zu verantworten<br />
haben. Dabei ist auf Risiken, die die stetige Aufgabenerfüllung und die Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong>sgesamt<br />
gefährden, gesondert e<strong>in</strong>zugehen. Dazu benennt die Vorschrift vier Möglichkeiten der Tenorierung des<br />
GEMEINDEORDNUNG 801
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
Bestätigungsvermerks, von der une<strong>in</strong>geschränkten Bestätigung bis zur Erklärung des Rechnungsprüfungsausschusses,<br />
dass er sich außerstande sieht, e<strong>in</strong> Urteil über den geprüften Abschluss abzugeben (vgl. Abbildung).<br />
Möglichkeiten der Tenorierung des Bestätigungsvermerks<br />
Aus dem Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschuss<br />
muss sich deshalb zweifelsfrei ergeben<br />
- ob der e<strong>in</strong>en une<strong>in</strong>geschränkten Bestätigungsvermerk oder<br />
- e<strong>in</strong>en e<strong>in</strong>geschränkten Bestätigungsvermerk erteilt oder<br />
- den Bestätigungsvermerk auf Grund von Beanstandungen versagt oder<br />
- der Bestätigungsvermerk deshalb versagt wird, weil sich der Ausschuss als Prüfungsgremium<br />
nicht <strong>in</strong> der Lage ist, e<strong>in</strong>e Beurteilung vorzunehmen.<br />
Abbildung 172 „Möglichkeiten der Tenorierung des Bestätigungsvermerks“<br />
In den Fällen, <strong>in</strong> denen Beanstandungen ausgesprochen werden, ist der Bestätigungsvermerk e<strong>in</strong>zuschränken<br />
oder zu versagen. E<strong>in</strong> e<strong>in</strong>geschränkter Bestätigungsvermerk darf nur erteilt werden, wenn der geprüfte Jahresabschluss<br />
unter Beachtung der vom Prüfer vorgenommenen, <strong>in</strong> ihrer Tragweite erkennbaren E<strong>in</strong>schränkung e<strong>in</strong> den<br />
tatsächlichen Verhältnissen im Wesentlichen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzgesamtlage<br />
der Geme<strong>in</strong>de vermittelt. S<strong>in</strong>d die Beanstandungen so erheblich, dass ke<strong>in</strong> den tatsächlichen<br />
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzgesamtlage der Geme<strong>in</strong>de<br />
mehr vermittelt wird, ist der Bestätigungsvermerk zu versagen. Der Bestätigungsvermerk ist auch dann zu versagen,<br />
wenn der Prüfer nach Ausschöpfung aller angemessenen Möglichkeiten zur Klärung des Sachverhaltes nicht<br />
<strong>in</strong> der Lage ist, e<strong>in</strong>e Beurteilung abzugeben. Die Versagung ist dann <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Vermerk, der nicht als Bestätigungsvermerk<br />
zu bezeichnen ist, aufzunehmen. Die E<strong>in</strong>schränkung oder Versagung ist zu begründen.<br />
6.4.3 Die Ausgestaltung des Bestätigungsvermerks<br />
Der Bestätigungsvermerk ist vom Rechnungsprüfungsausschuss sachverhaltsabhängig im Rahmen se<strong>in</strong>er Abschlussprüfung<br />
zu gestalten und von se<strong>in</strong>em Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses zu unterzeichnen.<br />
Die „Grundsätze für die ordnungsmäßige Erteilung von Bestätigungsvermerken“, die bei den Wirtschaftsprüfern<br />
zur Anwendung kommen, können für den geme<strong>in</strong>dlichen Bestätigungsvermerk als Beurteilungsmaßstäbe<br />
herangezogen werden. Auch wenn der Bestätigungsvermerk <strong>in</strong> eigener Verantwortung von der Geme<strong>in</strong>de gestaltet<br />
werden kann, sollte dieser nicht bei jedem neuen Jahresabschluss e<strong>in</strong>e neue Form erhalten. Es bietet sich<br />
deshalb für den Bestätigungsvermerk e<strong>in</strong>e Grundgliederung aus Überschrift, E<strong>in</strong>leitung und Sachverhaltsdarstellung<br />
sowie e<strong>in</strong>er daran anschließenden Beurteilung an. Der Prüfer kann auch zu e<strong>in</strong>em une<strong>in</strong>geschränkten Bestätigungsvermerk<br />
H<strong>in</strong>weise auf Umstände aufnehmen, auf die er <strong>in</strong> besonderer Weise aufmerksam machen will,<br />
die aber se<strong>in</strong> positives Prüfungsurteil über den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss nicht e<strong>in</strong>schränken.<br />
Dem Rechnungsprüfungsausschuss müssen auch nicht alle auftragsbezogenen Bestätigungsvermerke von Dritten<br />
vorgelegt werden. Es ist vielmehr ausreichend, wenn die für die Prüfung des Gesamtabschlusses verantwortliche<br />
Stelle e<strong>in</strong>en darauf bezogenen Bestätigungsvermerk verfasst und diesen dem Rechnungsprüfungsausschuss<br />
vorgelegt, der die Gesamtverantwortung für die ordnungsgemäße Prüfung des Gesamtabschlusses der<br />
Geme<strong>in</strong>de trägt. Bei der Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses kann sich der Rechnungsprüfungsausschuss<br />
auf den ihm vorgelegten Bestätigungsvermerk der örtlichen Rechnungsprüfung stützen. Er kann diesen<br />
Bestätigungsvermerk durch e<strong>in</strong>e entsprechende Ergänzung zu se<strong>in</strong>em eigenen Bestätigungsvermerk machen.<br />
GEMEINDEORDNUNG 802
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
Diese Vorgabe gilt entsprechend für die örtliche Rechnungsprüfung, wenn sie für ihre Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Gesamtabschlusses e<strong>in</strong>en Dritten beauftragt hat (vgl. § 103 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong>). Es liegt jedoch immer <strong>in</strong> der Verantwortung<br />
des jeweiligen Auftraggebers, ob er den ihm vom Abschlussprüfer vorgelegten Bestätigungsvermerk<br />
<strong>in</strong> vollem Umfang übernimmt oder diesen ergänzt, ändert oder ihm auch e<strong>in</strong>e eigene Form gibt. E<strong>in</strong> une<strong>in</strong>geschränkter<br />
Bestätigungsvermerk kann dabei z.B. folgende Fassung haben (vgl. Abbildung).<br />
Beispiel für e<strong>in</strong>en Bestätigungsvermerk für den Gesamtabschluss<br />
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers<br />
Der Gesamtabschluss der Geme<strong>in</strong>de … für das Haushaltsjahr ..., bestehend aus der Gesamtergebnisrechnung,<br />
der Gesamtbilanz und dem Gesamtanhang, wurde nach § 116 Abs. 6 i.V.m. § 103 Abs. 5 und<br />
6 GO <strong>NRW</strong> unter E<strong>in</strong>beziehung des Gesamtlageberichts geprüft. In die Prüfung s<strong>in</strong>d die haushaltsrechtlichen<br />
Vorschriften sowie ergänzende Regelungen der örtlichen Satzungen und sonstige ortsrechtliche<br />
Bestimmungen, soweit sich diese auf die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft beziehen, e<strong>in</strong>bezogen worden.<br />
Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die<br />
Darstellung des durch den Gesamtabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung<br />
und durch den Gesamtlagebericht zu vermittelnden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags-<br />
und F<strong>in</strong>anzgesamtlage der Geme<strong>in</strong>de … wesentlich auswirken, mit h<strong>in</strong>reichender Sicherheit erkannt<br />
werden konnten. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen s<strong>in</strong>d die Kenntnisse über die Geschäfts-<br />
und Verwaltungstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>schließlich<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt worden. Im Rahmen<br />
der Prüfung wurden die Nachweise für die Angaben im Gesamtabschluss und Gesamtlagebericht<br />
überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung hat die Beurteilung der Jahresabschlüsse<br />
der <strong>in</strong> den Gesamtabschluss e<strong>in</strong>bezogenen geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe, der Abgrenzung des<br />
Konsolidierungskreises, der angewandten Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze und Konsolidierungsmethoden<br />
sowie der wesentlichen E<strong>in</strong>schätzungen des Bürgermeisters der Geme<strong>in</strong>de sowie e<strong>in</strong>e<br />
Würdigung der Gesamtdarstellung des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichts umfasst.<br />
Die Prüfung hat zu ke<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>wendungen geführt.<br />
Nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen entspricht der Gesamtabschluss den haushaltsrechtlichen<br />
Vorschriften sowie den ergänzenden Regelungen der örtlichen Satzungen und den sonstigen<br />
ortsrechtlichen Bestimmungen, soweit diese sich auf die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft beziehen. Der<br />
Gesamtabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung e<strong>in</strong> den<br />
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzgesamtlage<br />
der Geme<strong>in</strong>de … e<strong>in</strong>schließlich der geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe. Der Gesamtlagebericht steht <strong>in</strong><br />
E<strong>in</strong>klang mit dem Gesamtabschluss und vermittelt <strong>in</strong>sgesamt auch e<strong>in</strong> zutreffendes Bild von der Vermögens-,<br />
Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzgesamtlage der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>schließlich der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Betriebe. In diesem Bericht werden die Chancen und Risiken der zukünftigen wirtschaftlichen Gesamtentwicklung<br />
der Geme<strong>in</strong>de … zutreffend dargestellt.<br />
Abbildung 173 „Beispiel für e<strong>in</strong>en Bestätigungsvermerk für den Gesamtabschluss“<br />
Dem Rat der Geme<strong>in</strong>de kann daher auch e<strong>in</strong> Bestätigungsvermerk vorgelegt werden, der von mehreren Prüfern<br />
oder Prüfungsstellen nach den Regeln des § 101 Abs. 7 GO <strong>NRW</strong> unterzeichnet wurde. Sie s<strong>in</strong>d aber <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
solchen Fall gleichwohl zu e<strong>in</strong>er eigenen Prüfung verpflichtet, um zu entscheiden, ob e<strong>in</strong> vorgelegter Bestätigungsvermerk<br />
<strong>in</strong> vollem Umfang <strong>in</strong>haltlich übernommen, abgeändert oder ergänzt wird. Das Prüfungsergebnis<br />
muss dann auf dem betreffenden Bestätigungsvermerk durch e<strong>in</strong>e entsprechende Ergänzung und e<strong>in</strong>e Unterzeichnung<br />
nach § 101 Abs. 7 GO <strong>NRW</strong> nachvollziehbar und transparent gemacht werden. Die besondere Verpflichtung<br />
der Prüfer und prüfenden Stellen, e<strong>in</strong>en auf ihre Prüfung bezogenen Bestätigungsvermerk zu verfassen,<br />
ist wegen ihrer Verantwortung als Abschlussprüfer des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses geboten.<br />
6.4.4 Die Erstellung e<strong>in</strong>es Prüfungsberichtes<br />
Die Vorschrift über die Prüfungsaufgaben des Rechnungsprüfungsausschusses enthält nicht ausdrücklich die<br />
Vorgabe, über Art und Umfang der Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses sowie über das Ergebnis der<br />
GEMEINDEORDNUNG 803
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
Prüfung e<strong>in</strong>en Prüfungsbericht zu erstellen wie sie <strong>in</strong> der Vorschrift des § 101 Abs. 1 S. 5 und 6 enthalten s<strong>in</strong>d.<br />
Die Vorgaben <strong>in</strong> dieser Vorschrift, dass der Rechnungsprüfungsausschuss über Art und Umfang der Prüfung<br />
sowie über das Ergebnis der Prüfung e<strong>in</strong>en Prüfungsbericht zu erstellen hat und der Bestätigungsvermerk oder<br />
der Vermerk über se<strong>in</strong>e Versagung ist <strong>in</strong> den Prüfungsbericht aufzunehmen ist, sollte daher bei der Gesamtabschlussprüfung<br />
über den Verweis auf den § 101 GO <strong>NRW</strong> entsprechend zur Anwendung kommen. Der Prüfungsbericht<br />
über die geme<strong>in</strong>dliche Gesamtabschlussprüfung sollte e<strong>in</strong>e Vielzahl von Prüfungsaussagen zur wirtschaftlichen<br />
Gesamtlage der Geme<strong>in</strong>de enthalten.<br />
Der Abschlussprüfer hat daher Art und Umfang der erforderlichen Prüfungshandlungen unter Berücksichtigung<br />
der Gegebenheiten bei der Geme<strong>in</strong>de eigenverantwortlich <strong>in</strong> Kenntnis der Aufgabenerfüllung der Geme<strong>in</strong>de und<br />
der Buchführung der Geme<strong>in</strong>de nach pflichtgemäßem Ermessen sorgfältig zu bestimmen, so dass Prüfungsaussagen<br />
mit h<strong>in</strong>reichender Sicherheit getroffen werden können und e<strong>in</strong> Prüfungsbericht erstellt werden kann. Für<br />
die Darstellungen im Prüfungsbericht sowie für se<strong>in</strong>e Gestaltung bestehen jedoch ke<strong>in</strong>e Vorgaben.<br />
Der Prüfungsbericht ist daher von der Geme<strong>in</strong>de bzw. von den Verantwortlichen für die Gesamtabschlussprüfung<br />
nach örtlichen Bedürfnissen eigenverantwortlich auszugestalten und zu unterzeichnen. Er sollte durch se<strong>in</strong>e besonderen<br />
Aussagen und Darstellungen auch e<strong>in</strong>e vorbeugende Wirkung, <strong>in</strong>sbesondere h<strong>in</strong>sichtlich der aufgedeckten<br />
Unregelmäßigkeiten entfalten und zur Verh<strong>in</strong>derung von Unregelmäßigkeiten beitragen. Gleichwohl kann<br />
er deren künftige Vermeidung aber nicht garantieren.<br />
6.4.5 Unmittelbare Informationen über die Gesamtabschlussprüfung<br />
6.4.5.1 Ke<strong>in</strong>e Bekanntgabe des Prüfungsberichtes<br />
Für die Bekanntmachung des Gesamtabschlusses ist zu berücksichtigen, dass wie der Rat auch die Bürger<strong>in</strong>nen<br />
und Bürger als Adressaten aus der Gesamtabschlussprüfung nach § 116 Abs. 6 GO <strong>NRW</strong> konkrete Empfehlungen<br />
zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, der Ordnungsmäßigkeit und der Funktionsfähigkeit des Verwaltungshandelns<br />
der Geme<strong>in</strong>de verlangen, damit auch für sie entscheidungsrelevante Informationen zur Verfügung<br />
stehen. Aus dieser weiten Zielvorgabe für die Gesamtabschlussprüfung entsteht jedoch ke<strong>in</strong>e gesonderte Pflicht<br />
für die Geme<strong>in</strong>de, den Bürger<strong>in</strong>nen und Bürgern den Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsausschusses <strong>in</strong><br />
vollem Umfang verfügbar zu machen.<br />
Der Adressat dieses Prüfungsberichtes ist der Rat, der den Rechnungsprüfungsausschuss mit der Prüfung des<br />
Gesamtabschlusses beauftragt, <strong>in</strong> öffentlicher Sitzung über das Ergebnis der Abschlussprüfung berät und unter<br />
E<strong>in</strong>beziehung des Prüfungsergebnisses den Gesamtabschluss zu bestätigen hat. Damit ist für die Information<br />
über die Art und den Umfang der durchgeführten Prüfung e<strong>in</strong>e ausreichende Öffentlichkeit gewährleistet.<br />
6.4.4.5 Information über das Prüfungsergebnis<br />
Das Prüfungsergebnis dagegen sollte dem o.a. Adressatenkreis verfügbar gemacht werden, der im Rahmen der<br />
öffentlichen Bekanntmachung des Gesamtabschlusses <strong>in</strong>formiert werden möchte oder sich <strong>in</strong>formiert. Da das<br />
Prüfungsergebnis nach § 116 Abs. 6 i.V.m. § 101 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Bestätigungsvermerk zusammenzufassen<br />
ist, bietet es sich an, diesen Bestätigungsvermerk dem der Aufsichtsbehörde nach § 116 Abs. 1 i.V.m. §<br />
96 Abs. 2 S. 1 GO <strong>NRW</strong> anzuzeigenden Gesamtabschluss sowie der Bekanntmachung des Gesamtabschlusses<br />
nach § 116 Abs. 1 i.V.m. 96 Abs. 2 S. 2 GO <strong>NRW</strong> beizufügen. Damit wird dem Informationsbedürfnis des oben<br />
genannten Adressatenkreises <strong>in</strong> ausreichendem Umfang genüge getan.<br />
GEMEINDEORDNUNG 804
7. Zu Absatz 7 (Prüfung der E<strong>in</strong>zelabschlüsse):<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
7.1 Der Verzicht auf nochmalige Prüfung der E<strong>in</strong>zelabschlüsse<br />
Die Vorschrift stellt entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften klar, dass im Rahmen der Prüfung des<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses die geprüften Jahresabschlüsse der geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe nicht noch e<strong>in</strong>mal<br />
vollständig zu prüfen s<strong>in</strong>d. Damit werden Doppelprüfungen durch die Abschlussprüfer vermieden. Dieses<br />
setzt jedoch voraus, dass die Jahresabschlussprüfung des E<strong>in</strong>zelabschlusses ordnungsgemäß erfolgt und ke<strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>schränkender Bestätigungsvermerkt erteilt worden ist. In diesen Fällen wird der Abschlussprüfer des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Gesamtabschluss nicht grundsätzlich von e<strong>in</strong>er Prüfungspflicht der E<strong>in</strong>zelabschlüsse der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Betriebe freigestellt, denn er trägt die Gesamtverantwortung für die Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses.<br />
In geeigneter Weise ist deshalb e<strong>in</strong>e Überprüfung der E<strong>in</strong>zelabschlüsse durch den Abschlussprüfer dah<strong>in</strong>gehend<br />
erforderlich, ob die e<strong>in</strong>zelnen Jahresabschlussprüfungen den Vorschriften entsprechen und ob die Vorschriften<br />
für e<strong>in</strong>e Übernahme dieser Abschlüsse <strong>in</strong> den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss beachtet worden s<strong>in</strong>d. Diese<br />
Aufgabe ist vom Abschlussprüfer <strong>in</strong> eigener Verantwortung und nach pflichtgemäßem Ermessen vorzunehmen.<br />
Insgesamt gesehen müssen die dem Abschlussprüfer des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses vorgelegten Jahresabschlüsse<br />
für ihn nachvollziehbar und akzeptabel se<strong>in</strong>.<br />
Dieses gilt <strong>in</strong>sbesondere für die Überleitung der HB I <strong>in</strong> die KB II. Daraus folgt, dass der Abschlussprüfer des<br />
Gesamtabschlusses die Arbeit der Abschlussprüfer der Jahresabschlüsse der geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe zu überprüfen<br />
hat. Das Ergebnis dieser Arbeit ist von ihm zu dokumentieren. In den Fällen, <strong>in</strong> denen sich jedoch Zweifel<br />
an der Ordnungsmäßigkeit der betrieblichen Jahresabschlüsse ergeben, muss der Abschlussprüfer für den Gesamtabschluss<br />
ggf. zusätzliche Prüfungshandlungen und eventuell unter Berücksichtigung des Grundsatzes der<br />
Wesentlichkeit auch e<strong>in</strong>e Korrektur vornehmen.<br />
In den Fällen, <strong>in</strong> den der Abschlussprüfer e<strong>in</strong>es e<strong>in</strong>zelnen Jahresabschlusses se<strong>in</strong>en Bestätigungsvermerk e<strong>in</strong>geschränkt<br />
oder versagt hat, muss der Abschlussprüfer des Gesamtabschlusses eigene Prüfungsfeststellungen<br />
treffen, ob und ggf. wie weit dadurch die Ordnungsmäßigkeit des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses berührt<br />
wird. E<strong>in</strong> solcher Sachverhalt kann ggf. dazu führen, dass auch der Bestätigungsvermerk zum Gesamtabschluss<br />
e<strong>in</strong>zuschränken ist. Für se<strong>in</strong>e Urteilsbildung kann der Abschlussprüfer des Gesamtabschlusses ggf. Prüfungsfeststellungen<br />
bei den geme<strong>in</strong>dlichen Betrieben treffen, die <strong>in</strong> den Gesamtabschluss e<strong>in</strong>bezogen werden. Es war<br />
deshalb geboten, durch e<strong>in</strong>e gesetzliche Regelung die Durchsetzung der Rechte der Prüfer, die für e<strong>in</strong>e sorgfältige<br />
Prüfung notwendigen Nachweise und Informationen zu erhalten, auch gegenüber den Abschlussprüfern der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe zu gewährleisten (vgl. § 103 Abs. 4 S. 2 GO <strong>NRW</strong>).<br />
Diese Überprüfung ist Teil der Prüfungstätigkeit des Abschlussprüfers des Gesamtabschlusses, denn es müssen<br />
die möglichen Auswirkungen auf Prüfungsfeststellungen des Abschlussprüfers beurteilt werden. Auch dieser Teil<br />
der Abschlussprüfung ist zu dokumentieren. Der Abschlussprüfer hat <strong>in</strong> diesen Fällen die Möglichkeit, die Arbeiten<br />
e<strong>in</strong>es anderen Prüfers eigenverantwortlich und aus se<strong>in</strong>er Sicht als Abschlussprüfer des Gesamtabschlusses<br />
zu verwerten. In welchem Ausmaß und mit welcher Gewichtung e<strong>in</strong>e Verwertung vorgenommen wird, hängt u.a.<br />
auch davon, ob und wie die geprüfte geme<strong>in</strong>dliche Organisationse<strong>in</strong>heit <strong>in</strong> den Gesamtabschuss der Geme<strong>in</strong>de<br />
e<strong>in</strong>bezogen wird. Daher ist auch die Dokumentation der Überprüfung durch den Abschlussprüfer des Gesamtabschlusses<br />
von Bedeutung, zumal dieser Prüfer volle Verantwortung für den Bestätigungsvermerk für den Gesamtabschluss<br />
trägt. Dies gilt entsprechend auch für aufgestellte Zwischenabschlüsse.<br />
In diesem Zusammenhang steht auch die Verpflichtung des Abschlussprüfers festzustellen, ob geme<strong>in</strong>dliche<br />
Betriebe von der Prüfungsbefreiung des § 264 Abs. 3 HGB Gebrauch gemacht haben und entsprechende Angaben<br />
im Gesamtanhang enthalten s<strong>in</strong>d. Er hat <strong>in</strong> diesen Fällen nicht die Pflicht zur Prüfung, ob die Voraussetzungen<br />
für die handelsrechtliche Erleichterung bei jeweiligen betreffenden Betrieb vorgelegen haben. E<strong>in</strong>e solche<br />
GEMEINDEORDNUNG 805
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 116 GO <strong>NRW</strong><br />
Prüfungsaufgabe würde nicht mit dem Zweck der Anhangsangabe <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang stehen und nicht die Ordnungsmäßigkeit<br />
des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses berühren. Andererseits besteht aber für den Abschlussprüfer e<strong>in</strong>e<br />
H<strong>in</strong>weispflicht, wenn er erkennt, dass die Voraussetzungen für e<strong>in</strong>e solche Befreiung nicht vorlagen.<br />
7.2 Die Prüfung der Zwischenabschlüsse<br />
Im geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss soll die wirtschaftliche Gesamtlage der Geme<strong>in</strong>de zum Abschlussstichtag<br />
gezeigt und die Geme<strong>in</strong>de mit ihren Betrieben so dargestellt werden, als ob sie e<strong>in</strong>e Gesamtheit darstellt. Um<br />
dieses zu erreichen, sollen auch geme<strong>in</strong>dliche Betriebe, die e<strong>in</strong> vom Kalenderjahr abweichendes Geschäftsjahr<br />
haben, <strong>in</strong> den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss e<strong>in</strong>bezogen werden. Die für die E<strong>in</strong>beziehung <strong>in</strong> den geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Gesamtabschluss notwendige Übere<strong>in</strong>stimmung wird dadurch geschaffen, dass der betreffende Betrieb<br />
verpflichtet wird, e<strong>in</strong>en gesonderten Zwischenabschluss, bezogen auf den Abschlussstichtag des Gesamtabschlusses<br />
der Geme<strong>in</strong>de, aufzustellen. Der Zwischenabschluss schafft e<strong>in</strong>e stichtagsbezogene Grundlage, die für<br />
die notwendigen Konsolidierungsschritte zw<strong>in</strong>gend erforderlich ist.<br />
Die erhebliche Zeitdifferenz zwischen dem Abschlussstichtag des geme<strong>in</strong>dlichen Betriebes und dem Abschlussstichtag<br />
des Gesamtabschlusses wird dadurch überbrückt, dass der Jahresabschluss des Betriebes auf den Abschlussstichtag<br />
des Gesamtabschlusses fortzuschreiben ist. Dadurch wird e<strong>in</strong> auf den Abschlussstichtag und den<br />
Zeitraum des Gesamtabschlusses (Geschäftsjahr der Geme<strong>in</strong>de) gleicher „Abrechnungszeitraum“ für den geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Betrieb geschaffen und gewährleistet. Für die Prüfung, ob e<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>dlicher Betrieb e<strong>in</strong>en Zwischenabschluss<br />
aufzustellen hat, ist dessen Abschlussstichtag ausschlaggebend, denn es ist zu unterscheiden,<br />
ob der Abschlussstichtag zwischen dem 30. September und dem 31. Dezember oder vor dem 30. September<br />
liegt oder ob ggf. im E<strong>in</strong>zelfall auch e<strong>in</strong> anderer Abschlussstichtag besteht.<br />
E<strong>in</strong> solcher Zwischenabschluss muss zwar orientiert an den Erfordernissen des Jahresabschlusses des betreffenden<br />
Betriebes aufgestellt werden, bei se<strong>in</strong>er Aufstellung durch den geme<strong>in</strong>dlichen Betrieb müssen jedoch<br />
bereits die für den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss geltenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zur<br />
Anwendung kommen, auch wenn der Zwischenabschluss aus den Büchern des geme<strong>in</strong>dlichen Betriebes zu<br />
entwickeln ist. Er stellt jedoch ke<strong>in</strong>en unterjährigen Jahresabschluss des betreffenden Betriebes der Geme<strong>in</strong>de<br />
dar, denn se<strong>in</strong>e Ableitung bzw. Aufstellung dient ausschließlich der Erstellung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss.<br />
Der Zwischenabschluss e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Betriebes unterliegt daher nicht der Pflicht zur Jahresabschlussprüfung<br />
beim betreffenden Betrieb nach den handelsrechtlichen Vorschriften.<br />
Die Prüfung des Zwischenabschlusses kann aber dem Jahresabschlussprüfer des betreffenden geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Betriebes nach § 103 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong> übertragen werden. Wegen se<strong>in</strong>er gesamtabschlussbezogenen Aufstellung<br />
unterliegt e<strong>in</strong> solcher Zwischenabschluss vielmehr der Prüfungspflicht des Abschlussprüfers des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Gesamtabschlusses. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat daher die Prüfungsverantwortung nicht nur für<br />
den aufgestellten geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss, sondern für alle die dem Gesamtabschluss zu Grunde liegenden<br />
Abschlüsse, die nicht nach anderen Vorschriften geprüft worden s<strong>in</strong>d. Dieses gilt auch dann, wenn e<strong>in</strong><br />
Zwischenabschluss vom Jahresabschlussprüfer des betreffenden geme<strong>in</strong>dlichen Betriebes geprüft worden ist.<br />
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ<br />
GEMEINDEORDNUNG 806
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 117 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 117<br />
Beteiligungsbericht<br />
(1) 1 Die Geme<strong>in</strong>de hat e<strong>in</strong>en Beteiligungsbericht zu erstellen, <strong>in</strong> dem ihre wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche<br />
Betätigung, unabhängig davon, ob verselbstständigte Aufgabenbereiche dem Konsolidierungskreis des Gesamtabschlusses<br />
angehören, zu erläutern ist. 2 Dieser Bericht ist jährlich bezogen auf den Abschlussstichtag des Gesamtabschlusses<br />
fortzuschreiben und dem Gesamtabschluss beizufügen.<br />
(2) 1 Der Beteiligungsbericht ist dem Rat und den E<strong>in</strong>wohnern zur Kenntnis zu br<strong>in</strong>gen. 2 Die Geme<strong>in</strong>de hat zu<br />
diesem Zweck den Bericht zur E<strong>in</strong>sichtnahme verfügbar zu halten. 3 Auf die Möglichkeit zur E<strong>in</strong>sichtnahme ist <strong>in</strong><br />
geeigneter Weise öffentlich h<strong>in</strong>zuweisen.<br />
Erläuterungen zu § 117:<br />
I. Allgeme<strong>in</strong>es<br />
1. Zwecke der Vorschrift<br />
Die Geme<strong>in</strong>den weisen heute auf Grund zahlreicher Ausgliederungen und Beteiligungen vielfach konzernähnliche<br />
Strukturen auf, um ihre geme<strong>in</strong>dlichen Aufgaben zu erfüllen. Der gesetzlich bestimmte Beteiligungsbericht soll<br />
daher den Blick der Geme<strong>in</strong>de vom Gesamtabschluss (vgl. § 116 GO <strong>NRW</strong>) auf die e<strong>in</strong>zelnen geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Betriebe lenken, unabhängig von ihrer öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Rechtsform. Der geme<strong>in</strong>dliche<br />
Beteiligungsbericht muss daher Angaben über alle geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe aus der Gesamtsicht der Geme<strong>in</strong>de<br />
enthalten. Diese Informationspflicht für den Beteiligungsbericht der Geme<strong>in</strong>de besteht e<strong>in</strong>erseits unabhängig<br />
davon, ob und wie die geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe <strong>in</strong> den Konsolidierungskreis für den Gesamtabschluss der Geme<strong>in</strong>de<br />
e<strong>in</strong>bezogen werden (vgl. § 50 GemHVO <strong>NRW</strong>). Andererseits aber auch unabhängig davon, ob die geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Betriebe <strong>in</strong> öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Rechtsform geführt werden, so dass h<strong>in</strong>sichtlich<br />
des Inhalts des Beteiligungsbericht nicht alle<strong>in</strong> auf die Vorschriften der §§ 107 und 108 GO <strong>NRW</strong> oder auf<br />
andere anzuwendende Vorschriften abzustellen ist.<br />
In vielen Fällen dürfte es, abhängig von den örtlichen Gegebenheiten und den Erfordernissen des geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Gesamtabschlusses ausreichend se<strong>in</strong>, im geme<strong>in</strong>dlichen Beteiligungsbericht die Ziele der geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe,<br />
die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse, die Entwicklung der Bilanzen und der<br />
Gew<strong>in</strong>n- und Verlustrechnungen, die Leistungen der Beteiligungen, die wesentlichen F<strong>in</strong>anz- und Leistungsbeziehungen<br />
u.a., lediglich <strong>in</strong> tabellarischer Form anzugeben und zu erläutern (vgl. § 52 GemHVO <strong>NRW</strong>). Es muss<br />
aber von der Geme<strong>in</strong>de gewährleistet werden, dass der geme<strong>in</strong>dliche Beteiligungsbericht die <strong>in</strong> der Vorschrift des<br />
§ 52 Abs. 1 GemHVO <strong>NRW</strong> allgeme<strong>in</strong> bestimmten Angaben zu jedem geme<strong>in</strong>dlichen Betrieb enthält. Der Geme<strong>in</strong>de<br />
steht es dabei nicht zu, die offen zu legenden Informationen <strong>in</strong> Abhängigkeit von deren jeweils zu erfüllender<br />
Aufgabe oder abhängig von der Größe e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Betriebes auswählen zu können.<br />
2. Ke<strong>in</strong> Verzicht auf den Beteiligungsbericht<br />
Auf die Erstellung e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Beteiligungsberichts, der regelmäßig und stichtagsbezogen dem geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Gesamtabschluss beizufügen ist, kann die Geme<strong>in</strong>de nicht verzichten. In den Fällen, <strong>in</strong> denen haushaltsjahrbezogen<br />
betrachtet, von der Geme<strong>in</strong>de ke<strong>in</strong> Gesamtabschluss aufzustellen ist, soll der Beteiligungsbericht<br />
dem jeweiligen Jahresabschluss der Geme<strong>in</strong>de (vgl. § 95 GO <strong>NRW</strong>) beigefügt werden. Diese Handhabung<br />
ist sachgerecht, denn durch die Bilanz im geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss, <strong>in</strong> der die geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe<br />
angesetzt s<strong>in</strong>d (vgl. § 41 Abs. 3 Nr. 1.3 GemHVO <strong>NRW</strong>), wird e<strong>in</strong>e Verb<strong>in</strong>dung zum Beteiligungsbericht der Geme<strong>in</strong>de<br />
hergestellt.<br />
GEMEINDEORDNUNG 807
II. Erläuterungen im E<strong>in</strong>zelnen<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 117 GO <strong>NRW</strong><br />
1. Zu Absatz 1 (Pflicht zur Erstellung e<strong>in</strong>es Beteiligungsberichtes):<br />
1.1 Zu Satz 1 (Bericht über wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung):<br />
1.1.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die bisherige Vorschrift über die Erstellung e<strong>in</strong>es Beteiligungsberichtes ist angepasst und dem Gesamtabschluss<br />
zugeordnet worden. Wie bisher hat die Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>en Beteiligungsbericht zu erstellen, <strong>in</strong> dem ihre wirtschaftliche<br />
und nichtwirtschaftliche Betätigung, unabhängig davon, ob verselbstständigte Aufgabenbereiche dem Konsolidierungskreis<br />
des Gesamtabschlusses angehören, zu erläutern ist. Dadurch wird die Gesamtübersicht über die<br />
Betriebe der Geme<strong>in</strong>de hergestellt und die Informationslücke zum Gesamtlagebericht, der dem Gesamtabschluss<br />
beizufügen ist (vgl. § 116 Abs. 1 S. 2 GO <strong>NRW</strong>), geschlossen. Im Beteiligungsbericht sollen daher die Geme<strong>in</strong>den<br />
auch ihre gesamte Beteiligungsstruktur aufzeigen, unabhängig davon, ob sie außerhalb ihrer Kernverwaltung<br />
<strong>in</strong> öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form tätig s<strong>in</strong>d. Die gesetzlich bestimmten wichtigen Informationen<br />
im geme<strong>in</strong>dlichen Beteiligungsbericht werden nachfolgend dargestellt (vgl. Abbildung).<br />
Inhalte des geme<strong>in</strong>dlichen Beteiligungsberichts<br />
Der Beteiligungsbericht der Geme<strong>in</strong>de soll Auskunft geben über:<br />
- die Ziele der geme<strong>in</strong>dlichen Betätigung <strong>in</strong> Form von Betrieben<br />
- die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch jeden Betrieb<br />
- die Beteiligungsverhältnisse zu jedem Betrieb<br />
- die Entwicklung der Bilanzen und der Gew<strong>in</strong>n- und Verlustrechnungen der e<strong>in</strong>zelnen Betriebe<br />
- die Leistungen der e<strong>in</strong>zelnen Betriebe<br />
- die wesentlichen F<strong>in</strong>anz- und Leistungsbeziehungen der Betriebe untere<strong>in</strong>ander und mit<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Kernverwaltung<br />
- der Zusammensetzung der Organe der e<strong>in</strong>zelnen Betriebe<br />
- den Personalbestand e<strong>in</strong>es jeden Betriebes<br />
Abbildung 174 „Inhalte des geme<strong>in</strong>dlichen Beteiligungsberichts“<br />
1.1.2 Die Ausrichtung des Beteiligungsberichtes<br />
In e<strong>in</strong>em Beteiligungsbericht steht daher die Lage jedes e<strong>in</strong>zelnen geme<strong>in</strong>dlichen Betriebes und nicht die Gesamtlage<br />
der Geme<strong>in</strong>de im Blickpunkt. Um die differenzierte Betrachtung zu gewährleisten, muss der Beteiligungsbericht<br />
bestimmte Informationen, z.B. über Ziele und Leistungen, die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe enthalten. Er darf außerdem nicht als e<strong>in</strong> Werk betrachtet werden, dass jedes Jahr als<br />
GEMEINDEORDNUNG 808
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 117 GO <strong>NRW</strong><br />
neue Aufgabe zu erledigen ist. Die Fortführung der Aufgabenerledigung erfordert, dass der Bericht durch den<br />
Aufbau e<strong>in</strong>er Zeitreihe e<strong>in</strong>e Vergleichbarkeit der Ergebnisse sichert und die Entwicklung transparent macht.<br />
Der Beteiligungsbericht der Geme<strong>in</strong>de ist jährlich, bezogen auf den Abschlussstichtag des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses,<br />
fortzuschreiben. Auch ist zu berücksichtigen, dass die betriebliche Struktur der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong><br />
Zukunft ggf. Veränderungen unterliegen kann, z.B. wenn durch e<strong>in</strong>e Veräußerung e<strong>in</strong> Betrieb von der Geme<strong>in</strong>de<br />
aufgegeben wird, der dann ggf. auch aus dem Konsolidierungskreis ausscheidet. Auch durch Errichtung oder<br />
Erwerb neuer Betriebe verändert sich die Beteiligungsstruktur und ggf. der Konsolidierungskreis, wenn die neuen<br />
Betriebe dar<strong>in</strong> aufgenommen werden müssen. Die geme<strong>in</strong>dliche Beteiligungsstruktur ist daher <strong>in</strong> Bezug auf den<br />
Konsolidierungskreis zu jedem Abschlussstichtag von der Geme<strong>in</strong>de zu überprüfen und ggf. anzupassen.<br />
1.1.3 Beteiligungsbericht und Gesamtsteuerung<br />
Der Beteiligungsbericht soll aber auch vertiefte und notwendige Erkenntnisse für die produktorientierte Gesamtsteuerung<br />
der Geme<strong>in</strong>de ermöglichen. Dies erfordert e<strong>in</strong>e aufgabenbezogene Darstellung und Gliederung im<br />
Beteiligungsbericht, m<strong>in</strong>destens anhand der für die Kernverwaltung verb<strong>in</strong>dlichen Produktbereiche (vgl. § 4<br />
GemHVO <strong>NRW</strong>). Damit würde e<strong>in</strong>e Gesamtübersicht über die Erfüllung der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgaben durch die<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe außerhalb der Kernverwaltung erreicht, unabhängig davon, von welchen Betrieben die<br />
e<strong>in</strong>zelnen Aufgaben erledigt werden. Entsprechend gegliederte Informationen dürften e<strong>in</strong>e bessere E<strong>in</strong>schätzung<br />
und differenzierte Beurteilung der gesamten wirtschaftlichen Lage der Geme<strong>in</strong>de sowie ihrer Chancen und Risiken,<br />
bezogen auf die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung <strong>in</strong> den e<strong>in</strong>zelnen geme<strong>in</strong>dlichen Aufgaben- (Produkt-)<br />
bereichen, erlauben.<br />
Den Geme<strong>in</strong>den bleibt es dabei freigestellt, über die gesetzlichen <strong>in</strong>haltlichen Anforderungen h<strong>in</strong>ausgehende<br />
Informationen <strong>in</strong> den Beteiligungsbericht aufzunehmen, der zum Stichtag des Gesamtabschlusses nach § 116<br />
GO <strong>NRW</strong> aufzustellen ist. Diese Ergänzungen sollten dann dazu beitragen, das Bild über die Aufgabenerledigung<br />
durch die geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe zu verbessern und das Verständnis für die Geschäftsaktivitäten der Geme<strong>in</strong>de<br />
zu fördern.<br />
1.1.4 Die Abbildung der geme<strong>in</strong>dlichen Beteiligungsstruktur<br />
Die Geme<strong>in</strong>de kann die gesetzliche Pflicht, ihre wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung zu erläutern,<br />
dadurch gut umsetzen, dass die textlichen Erläuterungen durch bildhafte Darstellungen ihres Betätigungsumfanges<br />
ergänzen. E<strong>in</strong>e solche Übersicht wäre jedoch noch um die geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe <strong>in</strong> öffentlich-rechtlicher<br />
Form zu ergänzen, denn die örtliche Übersicht, die dem Beteiligungsbericht beizufügen wäre, muss alle Betriebe<br />
der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form aufzeigen.<br />
Aus e<strong>in</strong>er solchen gesamten Übersicht lässt sich dann e<strong>in</strong> Auszug für den Gesamtabschluss erstellen, mit dem<br />
e<strong>in</strong> Überblick über die <strong>in</strong> die Konsolidierung e<strong>in</strong>bezogenen Betriebe der Geme<strong>in</strong>de gegeben werden kann. E<strong>in</strong>e<br />
solche Übersicht sollte <strong>in</strong> mehreren Teilen aufzeigen, welche geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe dem „Vollkonsolidierungskreis“<br />
angehören und welche Betriebe „At-Equity“ zu konsolidieren s<strong>in</strong>d sowie die Betriebe, die nach § 116 Abs. 3<br />
GO <strong>NRW</strong> nicht <strong>in</strong> den Gesamtabschluss e<strong>in</strong>bezogen werden. Die nachfolgende Abbildung zeigt beispielhaft die<br />
privatrechtliche Beteiligungsstruktur e<strong>in</strong>er Stadt auf (Quelle: Organigramm der Stadt Münster).<br />
GEMEINDEORDNUNG 809
100 %<br />
100 %<br />
92,09 %<br />
45,41%<br />
1 %<br />
10 %<br />
10 %<br />
33,33 %<br />
4,02 %<br />
0,45 %<br />
37,16%<br />
33,33%<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 117 GO <strong>NRW</strong><br />
Wohn + Stadtbau,<br />
Wohnungsunternehmen der Stadt<br />
Stadthalle GmbH<br />
Zoologischer Garten GmbH<br />
Institut für Biosensorik GmbH<br />
Museum Heimathaus GmbH<br />
Airportparken GmbH<br />
Regionalverkehr GmbH<br />
100%<br />
1,27 %<br />
0,001 %<br />
1 % Pferdemuseum GmbH<br />
100 %<br />
16,67%<br />
100 %<br />
100 %<br />
100%<br />
E<strong>in</strong>kaufszentrale GmbH<br />
Gewerbepark Lohenheide GmbH<br />
Stadtsparkasse<br />
Gewerbepark GmbH<br />
WRW GmbH (1)<br />
LEG GmbH (2)<br />
Verkehrsdienst<br />
GmbH<br />
Entwicklungsgesellschaft Stadtmitte<br />
GmbH<br />
Theater Grafenhaus GmbH<br />
88,22 %<br />
70 %<br />
AWS Abfallwirtschaft<br />
(Eigenbetrieb)<br />
Stadtmarket<strong>in</strong>g (Eigenbetrieb)<br />
ITVB (Eigenbetrieb)<br />
GEMEINDEORDNUNG 810<br />
Stadt .........<br />
32,29 %<br />
50 %<br />
50 %<br />
99 %<br />
35,22 %<br />
53,33 %<br />
1,64 %<br />
3,02 %<br />
25 %<br />
50 %<br />
100 %<br />
5,89 %<br />
5,89 %<br />
15 %<br />
20 %<br />
Stadtwerke GmbH<br />
Energiehandelsgesellschaft<br />
mbH<br />
W<strong>in</strong>dkraft GmbH<br />
Fernwärmeversorgung<br />
GmbH<br />
Bau<strong>in</strong>dustrie GmbH<br />
Flughafen GmbH<br />
Intermobil GmbH<br />
Vere<strong>in</strong>igung ehemaliger<br />
kommunaler Aktionäre<br />
GmbH<br />
Landeseisenbahn GmbH<br />
Lokalradio<br />
GmbH & Co.KG<br />
NDIX GmbH<br />
Verkehrs GmbH<br />
CET GmbH<br />
79 %<br />
Technologiepark GmbH<br />
Wirtschaftsförderung<br />
GmbH<br />
10 %<br />
100 %<br />
100 %<br />
33,33%<br />
33,33%<br />
100 %<br />
100 %<br />
100 %<br />
100 %<br />
AHS GmbH<br />
Park<strong>in</strong>g Services<br />
GmbH<br />
Luftfahrt GmbH<br />
Cargo Services<br />
GmbH<br />
Passenger<br />
GmbH<br />
AS Services<br />
GmbH<br />
Security Services<br />
GmbH<br />
WL Spedition<br />
GmbH<br />
Lokalradio<br />
Betriebsgesellschaft<br />
mbH
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 117 GO <strong>NRW</strong><br />
Abbildung 175 „Beispiel e<strong>in</strong>er städtischen Beteiligungsstruktur“<br />
1.2<br />
Zu Satz 2 (Fortschreibung des Beteiligungsberichtes):<br />
1.2.1<br />
Die Fortschreibung des Beteiligungsberichtes<br />
Nach der Vorschrift ist der geme<strong>in</strong>dliche Beteiligungsbericht jährlich, bezogen auf den Abschlussstichtag des<br />
Gesamtabschlusses (31. Dezember), fortzuschreiben. Die geme<strong>in</strong>dliche Pflicht ist sachgerecht, denn durch die<br />
jährlichen Abschlüsse der Geme<strong>in</strong>de und ihrer geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe wird zu jedem Abschlussstichtag e<strong>in</strong> aktuelles<br />
Bild ermöglicht, dass es im Beteiligungsbericht abzubilden gilt. Mit dem Beteiligungsbericht soll e<strong>in</strong>e differenzierte<br />
Darstellung der Leistungsfähigkeit der Geme<strong>in</strong>de durch die Abbildung der Daten der e<strong>in</strong>zelnen geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Betriebe erreicht werden. Der Beteiligungsbericht hat daher immer zeitnahe Angaben zu den e<strong>in</strong>zelnen<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Betrieben zu enthalten, so dass e<strong>in</strong>e Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den<br />
dah<strong>in</strong>terstehenden Aufgaben möglich ist<br />
und durch die Fortschreibung des Beteiligungsberichtes jährlich die<br />
notwendige<br />
Aktualität hergestellt wird.<br />
1.2.2<br />
Beteiligungsbericht und Gesamtabschluss<br />
Die Vorschrift legt ausdrücklich fest, dass der Beteiligungsbericht der Geme<strong>in</strong>de dem geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss<br />
beizufügen ist. Diese besondere Regelung ist Ausdruck dessen, dass e<strong>in</strong>e alle<strong>in</strong>ige Betrachtung der<br />
wirtschaftlichen Gesamtlage der Geme<strong>in</strong>de nicht immer ausreichend ist, da ggf., abhängig von den örtlichen Verhältnissen,<br />
e<strong>in</strong>e Informationslücke zwischen Gesamtlagebericht (vgl. § 51 Abs. 1 GemHVO <strong>NRW</strong>) bestehen<br />
könnte. E<strong>in</strong>e solche Lücke gilt es zu schließen, denn im Beteiligungsbericht steht die Lage jedes e<strong>in</strong>zelnen geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Betriebes im Blickpunkt.<br />
Er ermöglicht dadurch auch vertiefte und notwendige Erkenntnisse für die<br />
geme<strong>in</strong>dliche<br />
Gesamtsteuerung.<br />
2.<br />
Zu Absatz 2 (Veröffentlichung des Beteiligungsberichtes):<br />
2.1<br />
Zu Satz 1 (Informationspflichten der Geme<strong>in</strong>de):<br />
Die Vorschrift verpflichtet die Geme<strong>in</strong>de, dem Rat und den E<strong>in</strong>wohnern den aufgestellten Beteiligungsbericht zur<br />
Kenntnis zu br<strong>in</strong>gen. Diese Informationspflichten der Geme<strong>in</strong>de gegenüber dem Rat und den E<strong>in</strong>wohnern soll<br />
gewährleisten, dass die Geme<strong>in</strong>de diesen Adressatenkreis nicht nur über das haushaltswirtschaftliche Geschehen<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Kernverwaltung unterrichtet (vgl. § 80 und 96 GO <strong>NRW</strong>), sondern auch über den Umfang<br />
ihrer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung. Diese gesetzliche Vorgabe schränkt jedoch den Gestaltungsfreiraum<br />
der Geme<strong>in</strong>den nicht e<strong>in</strong>. Der Beteiligungsbericht<br />
muss aber für e<strong>in</strong>e Unterrichtung des Rates<br />
sowie<br />
der Bürger<strong>in</strong>nen und Bürger geeignet se<strong>in</strong>.<br />
Mit dem Beteiligungsbericht werden den Adressaten verlässliche und geeignete Informationen zur Verfügung<br />
gestellt, die die Chancen und Risiken der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong>sgesamt transparent machen und e<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>blick über die<br />
im Gesamtabschluss darzustellende Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzgesamtlage h<strong>in</strong>aus ermöglichen.<br />
Der Beteiligungsbericht steht daher <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Gesamtzusammenhang mit dem geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss.<br />
Er muss deshalb so gestaltet se<strong>in</strong>, dass er für e<strong>in</strong>e Unterrichtung des Rates und der Bürger<strong>in</strong>nen und<br />
Bürger geeignet ist. Es soll durch e<strong>in</strong>en lesbaren und verständlichen geme<strong>in</strong>dlichen Beteiligungsbericht erreicht<br />
werden, dass die Adressaten bürgerfreundlich und bürgernah über die vielfältigen<br />
Formen der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Aufgabenerfüllung<br />
des vergangenen Haushaltsjahres <strong>in</strong>formiert werden.<br />
Aus diesem Grund soll der Beteiligungsbericht mit dem Gesamtabschluss zur E<strong>in</strong>sichtnahme verfügbar gehalten<br />
werden. Damit wird dem Grundsatz der Öffentlichkeit Rechnung getragen, der sich durch die gesamte Haushaltswirtschaft<br />
der Geme<strong>in</strong>de zieht. Die Bekanntmachung des Gesamtabschlusses erfüllt als Information an die<br />
GEMEINDEORDNUNG 811
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 117 GO <strong>NRW</strong><br />
Bürger<strong>in</strong>nen und Bürger aber nur ihren Zweck, wenn die Interessenten ausreichende Informationsmöglichkeiten<br />
geboten werden. Dabei bleibt es der Geme<strong>in</strong>de überlassen, ob sie <strong>in</strong> herkömmlicher Weise e<strong>in</strong> Druckwerk auslegt,<br />
den Beteiligungsbericht im Internet verfügbar macht oder <strong>in</strong> sonstiger Weise <strong>in</strong>formiert. Diese besondere<br />
Vorschrift über den Zugang zu amtlichen Unterlagen der Geme<strong>in</strong>de lässt die Vorschriften des Informationsfrei-<br />
heitsgesetzes<br />
unberührt.<br />
2.2<br />
Zu Satz 2 (Öffentliche E<strong>in</strong>sichtnahme <strong>in</strong> den Bericht):<br />
Nach der Vorschrift hat die Geme<strong>in</strong>de den Beteiligungsbericht zur E<strong>in</strong>sichtnahme verfügbar zu halten. Die Geme<strong>in</strong>de<br />
muss es deshalb jedermann ermöglichen, E<strong>in</strong>sicht <strong>in</strong> den Beteiligungsbericht nehmen zu können. Sie<br />
wird diesen Bericht deshalb regelmäßig an e<strong>in</strong>er bestimmten Stelle der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung auslegen. Die<br />
Bürger<strong>in</strong>nen und Bürger können sich dann entsprechend ihrem Bedarf weitere Kenntnisse über die wirtschaftliche<br />
und nichtwirtschaftliche Betätigung der Geme<strong>in</strong>de verschaffen. Es bleibt aber der Geme<strong>in</strong>de überlassen, ob sie<br />
den Beteiligungsbericht <strong>in</strong> herkömmlicher Weise als Druckwerk oder im Internet verfügbar macht oder <strong>in</strong> sonstiger<br />
Weise<br />
ihre Bürger<strong>in</strong>nen und Bürger <strong>in</strong>formiert.<br />
Diese besondere Vorschrift über den Zugang zu amtlichen Unterlagen der Geme<strong>in</strong>de lässt die Vorschriften des<br />
Informationsfreiheitsgesetzes Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen (IFG <strong>NRW</strong>) unberührt. Die gesetzliche Vorgabe über die E<strong>in</strong>sichtnahme<br />
<strong>in</strong> den Beteiligungsbericht muss <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en Zusammenhang mit dem geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss<br />
gestellt werden, denn der Beteiligungsbericht der Geme<strong>in</strong>de ist nach der Regelung <strong>in</strong> Absatz 1 Satz 2 der Vorschrift<br />
dem Gesamtabschluss beizufügen. Von daher bedarf es ke<strong>in</strong>er weiteren gesonderten Regelung über die<br />
Schaffung von Möglichkeiten der E<strong>in</strong>sichtnahme, denn die e<strong>in</strong>schlägigen Regelungen <strong>in</strong> § 116 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>,<br />
die<br />
auf die Vorschrift des § 96 GO <strong>NRW</strong> verweisen, kommen dabei zur Anwendung.<br />
Durch den Verweis besteht für die Geme<strong>in</strong>de die Pflicht, ihren Gesamtabschluss öffentlich bekannt zu machen<br />
und danach bis zur Bestätigung des folgenden Gesamtabschlusses zur E<strong>in</strong>sichtnahme verfügbar zu halten. Damit<br />
sollen die E<strong>in</strong>wohner und Abgabepflichtigen bürgerfreundlich und bürgernah über den Gesamtabschluss des<br />
abgelaufenen Haushaltsjahres <strong>in</strong>formiert werden. Die Bürger<strong>in</strong>nen und Bürger s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>erseits Adressaten des<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Handelns und sollen andererseits die Arbeit von Rat und Verwaltung der Geme<strong>in</strong>de unterstützen.<br />
Daher besteht e<strong>in</strong> berechtigtes Interesse der Öffentlichkeit an Informationen über die gesamte wirtschaftliche<br />
Lage der Geme<strong>in</strong>de. Aus diesem Grund soll der Gesamtabschluss bis zur Bestätigung des folgenden Gesamtabschlusses<br />
zur E<strong>in</strong>sichtnahme verfügbar gehalten werden. In dieser Zeit soll auch die E<strong>in</strong>sichtnahme <strong>in</strong> den Beteiligungsbericht<br />
der Geme<strong>in</strong>de möglich se<strong>in</strong>. Damit wird dem Grund satz der Öffentlichkeit Rechnung getragen, der<br />
sich<br />
durch die gesamte Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de zieht.<br />
2.3<br />
Zu Satz 3 (Bekanntgabe der E<strong>in</strong>sichtnahme):<br />
2.3.1<br />
Zwecke der Bekanntgabe<br />
Die Geme<strong>in</strong>de ist durch die Vorschrift verpflichtet, auf die Möglichkeit zur E<strong>in</strong>sichtnahme ist <strong>in</strong> geeigneter Weise<br />
öffentlich h<strong>in</strong>zuweisen. Die Informationen über die wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung s<strong>in</strong>d regelmäßig<br />
nur dann den Bürger<strong>in</strong>nen und Bürgern zugänglich, wenn diese auch über die Möglichkeit der E<strong>in</strong>sichtnahme<br />
<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>dliche Unterlagen bzw. den Beteiligungsbericht unterrichtet werden. Erst dann können sich<br />
diese entsprechend ihrem Bedarf die Kenntnisse über die wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung der<br />
Geme<strong>in</strong>de im Rahmen des langfristigen Verfügbarhaltens des Gesamtabschlusses verschaffen. Die Bekanntgabe<br />
des Beteiligungsberichtes kann <strong>in</strong> die Bekanntmachung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses e<strong>in</strong>gebunden<br />
wird, denn dieser Bericht ist dem geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Gesamtabschluss beizufügen und regelmäßig dürfte der gleiche<br />
Adressatenkreis<br />
angesprochen werden.<br />
GEMEINDEORDNUNG 812
2.3.2 Die Bekanntgabe ohne Gesamtabschluss<br />
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 117 GO <strong>NRW</strong><br />
Bei e<strong>in</strong>zelnen Geme<strong>in</strong>den kann e<strong>in</strong> Verzicht der Bekanntmachung des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses dadurch<br />
möglich se<strong>in</strong>, dass die Geme<strong>in</strong>de über ke<strong>in</strong>en voll zu konsolidieren Betrieb verfügt, denn dann liegt die<br />
wichtigste Voraussetzung für e<strong>in</strong>en geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss, dass e<strong>in</strong> Mutter-Tochter-Verhältnis zwischen<br />
der Kernverwaltung der Geme<strong>in</strong>de und e<strong>in</strong>em ihrer Betriebe besteht, nicht vor. Das Fehlen dieser Voraussetzung<br />
kann nicht dadurch geheilt werden, dass die betreffende Geme<strong>in</strong>de über Betriebe verfügt, die nach der<br />
Equity-Methode zu konsolidieren wären. In solchen Fällen entfällt nicht die gesonderte Bekanntgabepflicht der<br />
Geme<strong>in</strong>de beim Beteiligungsbericht. Bei e<strong>in</strong>em zulässigen Verzicht auf die Aufstellung e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses<br />
müssen gleichwohl die Bürger<strong>in</strong>nen und Bürger über die E<strong>in</strong>sichtnahme <strong>in</strong> den geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Beteiligungsbericht <strong>in</strong> Kenntnis gesetzt werden. In den Fällen dieses Verzichts ist es als vertretbar und sachgerecht<br />
anzusehen, wenn die Bekanntgabe der E<strong>in</strong>sichtnahme<br />
<strong>in</strong> den Beteiligungsbericht <strong>in</strong> die Bekanntmachung<br />
des<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses e<strong>in</strong>gebunden wird.<br />
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ<br />
GEMEINDEORDNUNG 813
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />
§ 118 GO <strong>NRW</strong><br />
§ 118<br />
Vorlage- und Auskunftspflichten<br />
Die Geme<strong>in</strong>de ist verpflichtet, bei der Ausgestaltung von Gründungsverträgen oder Satzungen für die <strong>in</strong> § 116<br />
bezeichneten Organisationse<strong>in</strong>heiten darauf h<strong>in</strong>zuwirken, dass ihr das Recht e<strong>in</strong>geräumt wird, von diesen Aufklärung<br />
und Nachweise zu verlangen, die die Aufstellung des Gesamtabschlusses erfordert.<br />
Erläuterungen zu § 118:<br />
1. Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Auf der Grundlage, dass der Gesamtabschluss die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und F<strong>in</strong>anzlage der Geme<strong>in</strong>de<br />
zusammen mit der Vermögens-, F<strong>in</strong>anz- und Ertragslage der <strong>in</strong> den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss<br />
e<strong>in</strong>bezogenen Betriebe so darzustellen hat, als ob die Geme<strong>in</strong>de mit ihren geme<strong>in</strong>dlichen Betrieben e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>heit<br />
wäre, ist es für die Aufstellung e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses zw<strong>in</strong>gend erforderlich, auch die dafür<br />
notwendigen Informationen und Unterlagen von den beteiligten Betrieben zu erhalten. Dabei werden an den Gesamtabschluss<br />
nach dem Grundsatz der geme<strong>in</strong>dlichen E<strong>in</strong>heit ke<strong>in</strong>e höheren Anforderungen gestellt, als an den<br />
jeweiligen E<strong>in</strong>zelabschluss e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen Betriebes.<br />
Diese Vorschrift baut zudem auf dem § 113 GO <strong>NRW</strong> auf, die zur Vertretung der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> Unternehmen und<br />
E<strong>in</strong>richtungen die erforderlichen Vorgaben trifft, um die notwendige Vernetzung zwischen mittelbarer und unmittelbarer<br />
geme<strong>in</strong>dlicher Verwaltung sicherzustellen. In diesem S<strong>in</strong>ne müssen bei der Ausgestaltung von Gründungsverträgen<br />
oder Satzungen die Interessen der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> ausreichendem Maße verfolgt werden. Darüber<br />
h<strong>in</strong>aus haben die Vertreter der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> Unternehmen und E<strong>in</strong>richtungen den Rat über alle Angelegenheiten<br />
von besonderer Bedeutung frühzeitig zu unterrichten. Dies soll die Anb<strong>in</strong>dung der Unternehmen und E<strong>in</strong>richtungen<br />
an die Geme<strong>in</strong>de verbessern, soweit dies nicht unternehmensrechtlich e<strong>in</strong>geschränkt ist.<br />
2. Die Verpflichtungen der Geme<strong>in</strong>de<br />
Mit dieser Vorschrift wird die Geme<strong>in</strong>de verpflichtet, im Rahmen ihrer Möglichkeiten darauf h<strong>in</strong>zuwirken, dass ihr<br />
von den geme<strong>in</strong>dlichen Betrieben alle notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung gestellt werden,<br />
die für die Aufstellung des Gesamtabschlusses erforderlich s<strong>in</strong>d. Sie soll der ordnungsgemäßen Durchführung<br />
dienen und die Aufstellung des Gesamtabschlusses sichern. Die landesrechtliche Regelung lässt die geltenden<br />
handelsrechtlichen und gesellschaftsrechtlichen Vorschriften unberührt. Dies bed<strong>in</strong>gt auch bei dieser Vorschrift,<br />
dass die Geme<strong>in</strong>de durch die Landesregelung ke<strong>in</strong> unmittelbares E<strong>in</strong>griffsrecht auf ihre Betriebe hat, soweit die<br />
bundesrechtlichen Vorschriften etwas anderes be<strong>in</strong>halten. Sie muss sich aber bei der Ausgestaltung von Gründungsverträgen<br />
oder Satzungen für ihre geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe auch ihre Informationsrechte sichern.<br />
Diese Verpflichtung der Geme<strong>in</strong>de soll gewährleisten, dass die geme<strong>in</strong>dlichen Betriebe die von der Kernverwaltung<br />
der Geme<strong>in</strong>de für die Aufstellung des Gesamtabschlusses benötigten Informationen tatsächlich zur Verfügung<br />
stellen. Ob <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Praxis diese gesetzliche Vorgabe e<strong>in</strong>e große Bedeutung erlangt, muss<br />
abgewartet werden. Ausgehend davon, dass die geme<strong>in</strong>dliche Kernverwaltung als Muttere<strong>in</strong>heit über den geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Betrieben als Tochtere<strong>in</strong>heiten steht, hat sie auf Grund e<strong>in</strong>es Beherrschungsverhältnisses die Möglichkeit,<br />
<strong>in</strong> diesem Rahmen die benötigten Informationen von ihren Betrieben zu verlangen.<br />
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ<br />
GEMEINDEORDNUNG 814