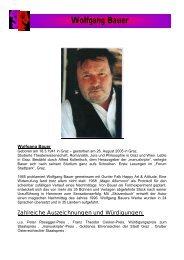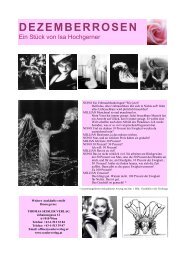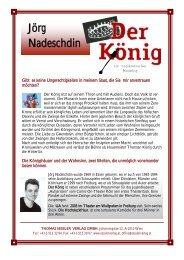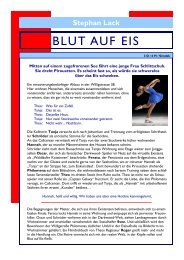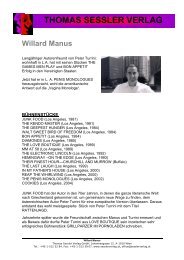Wolfgang Bauer - THOMAS SESSLER - Verlag
Wolfgang Bauer - THOMAS SESSLER - Verlag
Wolfgang Bauer - THOMAS SESSLER - Verlag
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Wolfgang</strong> <strong>Bauer</strong><br />
<strong>Wolfgang</strong> <strong>Bauer</strong><br />
Geboren am 18.3.1941 in Graz – gestorben am 26. August 2005 in Graz.<br />
Studierte Theaterwissenschaft, Romanistik, Jura und Philosophie in Graz und Wien. Lebte<br />
in Graz. Bestärkt durch Alfred Kolleritsch, dem Herausgeber der „manuskripte“, verlegte<br />
<strong>Bauer</strong> sich nach seinem Studium ganz aufs Schreiben. Erste Lesungen im „Forum<br />
Stadtpark“, Graz.<br />
1965 proklamiert <strong>Wolfgang</strong> <strong>Bauer</strong> gemeinsam mit Gunter Falk Happy Art & Attitude. Eine<br />
Widerrufung fand trotz allem nicht statt. 1968 „Magic Afternoon“ als Protokoll für den<br />
scheinbar zufälligen Verlauf eines Nachmittags. Von <strong>Bauer</strong> als Formexperiment geplant,<br />
entwickelt sich das von mehr als 35 Bühnen und <strong>Verlag</strong>en abgelehnte Stück nach seiner<br />
Uraufführung in Hannover zum Sensationserfolg. Mit „Skizzenbuch“ entwirft der Autor<br />
einen magischen Nachmittag des Jahres 1996. <strong>Wolfgang</strong> <strong>Bauer</strong>s Werke wurden in 24<br />
Sprachen übersetzt und in 35 Ländern aufgeführt.<br />
Zahlreiche Auszeichnungen und Würdigungen:<br />
u.a. Peter Rosegger-Preis , Franz Theodor Csokor-Preis, Würdigungspreis zum<br />
Staatspreis , „manuskripte“-Preis , Goldenes Ehrenzeichen der Stadt Graz , Großer<br />
Österreichischer Staatspreis .
Die frühen Jahre<br />
1962 bis 1982<br />
Die wilden Stücke im Kopf<br />
1982-2000:<br />
WOHER KOMMEN WIR? WAS SIND WIR? WOHIN GEHEN WIR?<br />
DAS KURZE LEBEN DER SCHNEEWOLKEN<br />
HERR FAUST SPIELT ROULETTE<br />
ACH, ARMER ORPHEUS!<br />
DAS LÄCHELN DES BRIAN DE PALMA<br />
DIE KANTINE – Capriccio à la Habsburg<br />
INSALATA MISTA<br />
SKIZZENBUCH<br />
DIE MENSCHENFABRIK<br />
CAFE TAMAGOTCHI
THEATERSTÜCKE<br />
DER SCHWEINETRANSPORT/MALER UND FARBE, zwei Einakter<br />
UA Forum Stadtpark, Graz, 24.11.1962. Regie: Bernd Fischerauer.<br />
ZWEI FLIEGEN AUF EINEM GLEIS<br />
UA Forum Stadtpark, Graz, 24.11.1962. Regie: <strong>Wolfgang</strong> <strong>Bauer</strong> und Horst Zankl.<br />
KATHARINA DOPPELKOPF<br />
UA Theater im Keller, Graz, 23.01.1964. Regie: <strong>Wolfgang</strong> <strong>Bauer</strong> und Horst Zankl.<br />
DIE MENSCHENFRESSER<br />
UA Schauspielhaus Graz, 04.04.1967. Regie: Claus Homschak.<br />
PARTY FOR SIX<br />
UA Landestheater Innsbruck, 09.05.1965. Regie: Hermann Schmid.<br />
MAGIC AFTERNOON<br />
UA Landestheater Hannover, 12.09.1968. Regie: Horst Zankl.<br />
CHANGE<br />
UA Volkstheater Wien, 26.09.1969.Regie: Bernd Fischerauer.<br />
FILM UND FRAU<br />
UA Deutsches Schauspielhaus, Hamburg, 16.04.1971. Regie: Horst Zankl.<br />
SILVESTER oder DAS MASSAKER IM HOTEL SACHER<br />
UA Volkstheater Wien, 24.09.1971. Regie: Bernd Fischerauer.<br />
GESPENSTER<br />
UA Kammerspiele München, 05.06.1974. Regie: Bernd Fischerauer.<br />
TV-Aufzeichnung ORF.<br />
MAGNETKÜSSE<br />
UA Akademietheater Wien, 31.03.1976. Regie: Fritz Zecha.<br />
MEMORY HOTEL<br />
UA Schauspielhaus Graz, 12.04.1980. Regie: <strong>Wolfgang</strong> <strong>Bauer</strong>.<br />
TV-Aufzeichnung ORF.<br />
BATYSCAPHE oder DIE HOLLE IST OBEN<br />
UA Theater im Keller, Graz, 27.08.1982. Regie: Heinz Hartwig.<br />
WOHER KOMMEN WIR? WAS SIND WIR? WOHIN GEHEN WIR?<br />
UA Bühnen der Stadt Bonn, Kammerspiele Bad Godesberg, 28.08.1982. Regie: Karl-<br />
Heinz Kubik.
EIN FRÖHLICHER MORGEN BEIM FRISEUR<br />
UA Schauspielhaus Graz, 25.09.1983. Regie: <strong>Wolfgang</strong> <strong>Bauer</strong>.<br />
PFNACHT<br />
UA Schauspielhaus Graz, 13.April 1985. Regie: Kurt Josef Schildknecht.<br />
TV-Aufzeichnung ORF.<br />
DAS KURZE LEBEN DER SCHNEEWOLKEN<br />
UA Württembergisches Staatstheater, Stuttgart, 31.10.1983. Regie: Ulrich Waller und<br />
Elke Lang.<br />
HERR FAUST SPIELT ROULETTE<br />
UA Akademietheater Wien, 25.01.1987. Regie: <strong>Wolfgang</strong> <strong>Bauer</strong>.<br />
DAS LÄCHELN DES BRIAN DE PALMA<br />
UA Schauspielhaus Graz, Steirischer Herbst, 01.12.1991. Regie: <strong>Wolfgang</strong> <strong>Bauer</strong>.<br />
ACH, ARMER ORPHEUS!<br />
UA Neues Schauspielhaus Wien, 02.05.1991. Regie: Hans Gratzer.<br />
INSALATA MISTA<br />
UA Ohio Theatre New York, 1.12.1993. Regie: Kurt Palm.<br />
DIE MENSCHENFABRIK<br />
UA Schauspielhaus Graz, 21.9.1996. Regie: Thomas Thieme.<br />
TV-Aufzeichnung ORF.<br />
DIE KANTINE – Capriccio à la Habsburg<br />
UA Schauspielhaus Graz, 8.5.1993. Regie: Karl Paryla.<br />
TV-Aufzeichnung ORF.<br />
SKIZZENBUCH<br />
UA Neues Schauspielhaus Wien, 9.5.1996. Regie: Stefan Bachmann.<br />
DER TOD DES HERRN INGENIEUR HABERNIK AUS LINZ<br />
UA Ateliertheater Wien, 1984, Regie: Peter Janisch<br />
EIN SCHRECKLICHER TRAUM<br />
UA Berlin, 1986<br />
TOTU-WA-BOTU<br />
UA Theater Experiment am Liechtenwerd Wien, 1992<br />
CAFÈ MUSEUM-DIE ERLEUCHTUNG<br />
(Musik Kurt Schwertsik), UA Deutschlandsberg, 09.10.1993<br />
CAFE TAMAGOTCHI<br />
UA Rabenhof.THEATER Wien, 17.03.2001, Regie: Georg Staudacher
FOYER<br />
UA Steirischer Herbst, Graz, Herbst 2004<br />
FILME<br />
MAGIC AFTERNOON. Regie: Bernd Fischerauer. ORF, 13.05.1969.<br />
MAGIC AFTERNOON. Fernsehspiel. Regie: <strong>Wolfgang</strong> <strong>Bauer</strong>. ARD, 08.03.1971.<br />
DIE EDEGGER-FAMILIE. Fernsehfilm. Buch und Regie: <strong>Wolfgang</strong> <strong>Bauer</strong>. ARD/SDR,<br />
21.03.1972.<br />
ES WAR NICHT DIE NACHTIGALL ... Kinofilm. Regie: Sigi Rothemund. 1974.<br />
CHANGE: TV-Film, Regie: Franz Peter Wirth. WDR/ARD, 1971.<br />
CHANGE. Kinofilm. Regie: Bernd Fischerauer. 1975.<br />
REISE ZUM GEHIRN. Fernsehfilm. Regie: Claus Homschak. ORF, 13.06.1975.<br />
IN ZEITEN WIE DIESEN. Fernsehfilm. Buch und Regie: <strong>Wolfgang</strong> <strong>Bauer</strong>. ORF/ARD,<br />
22.03.1984, vier Fortsetzungen, ORF.<br />
CHANGE. TV-Aufzeichnung der Produktion aus dem Wiener Volkstheater 2005.<br />
SCHALLPLATTEN<br />
(<strong>Wolfgang</strong> <strong>Bauer</strong> liest, an der Orgel Herbert Feuerstein. Beilage zu:)<br />
DAS STILLE SCHIFF. Frankfurt/Main (Bärmeier & Nikel), 1969.<br />
<strong>Wolfgang</strong> <strong>Bauer</strong> liest MIKRODRAMEN von <strong>Wolfgang</strong> <strong>Bauer</strong>. Stuttgart (Intercord),<br />
1975.<br />
<strong>Wolfgang</strong> <strong>Bauer</strong>/H.C. Artmann: HIRN MIT EI. Lyrik und Jazz. Graz (Droschl <strong>Verlag</strong>),<br />
1981 (=Manuskripte Edition).<br />
CD DIE SCHLACHT AN DER BERESINA UND ANDERE MIKRODRAMEN; Sammlung<br />
Stimme des Autors, TSV/Extraplatte Musikproduktions- und <strong>Verlag</strong>s GmbH, 1999.<br />
CD MAGIC AFTERNOON Hörspiel, TSV/waku word, 2000.
„Mikrodramen“, 1964.<br />
„Der Fieberkopf“, Roman in Briefen, 1967.<br />
DRUCK – UND BUCHAUSGABEN<br />
„Das stille Schiff, Ein schlechtes Meisterwerk“: schlechte Texte mit schlechten<br />
Zeichnungen und einer schlechten Schallplatte, 1969.<br />
„Magic Afternoon“, „Change“, „Party for six“, drei Stücke, 1969.<br />
„Romeo und Julia“, „Mikrodramen“, ausgestattet mit 21 Holzschnitten und einer<br />
bunten Kulisse von U.Bremer, A. Schindehütte, J. Vennekamp und A. Waldschmidt,<br />
1969.<br />
„Katharina Doppelkopf“ und andere Eisenbahnstücke, Illustration von Peter Sengl,<br />
1973.<br />
„Gespenster“, „Silvester“ oder „Das Massaker im Hotel Sacher“, „Film und Frau“,<br />
drei Stücke, Nachwort von Hubert Fichte, 1974.<br />
„Die Sumpftänzer“, Dramen, Prosa, Lyrik aus zwei Jahrzehnten, 1978.<br />
„Pfnacht“, Komödie in 3 Akten, 1980.<br />
„Batyscaphe 17-26“ oder „Die Hölle ist oben“, 1980.<br />
„Woher kommen wir? Was sind wir? Wohin gehen wir?“ Stück, 1981.<br />
„Das Herz“, Gedichte, 1981, Residenz <strong>Verlag</strong>.<br />
„Woher kommen wir? Wohin gehen wir?, Dramen und Prosa mit bisher<br />
unveröffentlichten und neuen Stücken, 1982.<br />
„Ein fröhlicher Morgen beim Friseur“, Text, Materialien, Fotos, 1983.<br />
„In Zeiten wie diesen“, ein Drehbuch, 1984.<br />
„Herr Faust spielt Roulette“, 1986, Burgtheaterproduktion.<br />
Über den Buchhandel zu bestellen:<br />
Werke in acht Bänden, Hrsg. von Gerhard Melzer, Erstausgabe 1986, Droschl <strong>Verlag</strong>
<strong>Wolfgang</strong><br />
<strong>Bauer</strong><br />
F O Y E R<br />
„Im Albtraum kommt ihm die Idee für ein<br />
geniales Theaterstück...nämlich, dass sein<br />
Leben das Theaterstück selbst ist und sich<br />
aus sich selbst dauernd erneuert....es ist<br />
meines Erachtens die erste Selbstzeugung<br />
eines Autors, seit der Zeit als der liebe<br />
Gott sich selbst erschaffen hat. Nicht dass<br />
der Autor ein Gott wäre.....bei Gott<br />
nicht,....“<br />
(Otto, der Theaterkritiker)<br />
11 H / 5 D<br />
FOYER ist die Auseinandersetzung Wolfi <strong>Bauer</strong>s mit dem Leben als Dichter, mit Theater und dem Phänomen der<br />
Reality-Soaps. Das Leben in Echtzeit für ein Publikum dargestellt, wird bei <strong>Bauer</strong> nicht in den Medien, sondern im<br />
Theater gezeigt. Der Autor, als Ausbeuter seiner eigenen Biografie, wird ebenso in der Wolfi <strong>Bauer</strong> eigenen Art<br />
ironisiert, wie die Funktion des Autors als Portraitist unserer Gesellschaft und Befindlichkeit.<br />
Aus der Perspektive des FOYERS lässt uns Wolfi <strong>Bauer</strong> an einem Theaterabend teilhaben, der sich hinter den<br />
Türen des „Foyers“ im Zuschauerraum, auf der Bühne und im Foyer abspielt,...<br />
Charlie Dodler, ca 70 Jahre alt, betritt das etwas heruntergekommene, schwach beleuchtete Foyer des Blue Star<br />
Theaters. Für die Uraufführung seines autobiografischen Stücks hat er sich ziemlich fein gemacht.<br />
Das Personal des Theaters kennt keine Uraufführung und für den Autor ist für die ewig ausverkaufte Vorstellung<br />
auch keine Karte hinterlegt. Seit 70 Jahren spielt sich „DAS TOLLDREISTE LEBEN“ Charlie Dodlers auf dieser<br />
Bühne ab.<br />
Der Barkeeper, der als Lieblingsgetränk der Theaterbesucher den Drink „Foyer“ kreiert hat, und die Garderobiere<br />
und Kassafrau gehen abwechselnd vom Foyer auf die Bühne, um Personen aus dem Leben des Dichters zu<br />
spielen. Dodler selbst darf jedoch die Bühne seines Lebens und den Zuschauerraum nicht betreten. „Vielleicht,<br />
weil man sich beim Leben selbst net zuschauen kann“ wie der eigentlich schon tote Kritiker Otto meint. Irgendwie<br />
wird dem Dichter gar teuflisch mitgespielt. Ja der Teufel selbst tritt in Erscheinung in Gestalt des Regisseurs Peter<br />
van Mief. Im Zuschauerraum konnte das Publikum unter Lachen und heftigem Beifall die Szene erleben, in der<br />
Charlie der Blinddarm ins Gehirn transplantiert wird. Die Ehefrau Dodler hat eine Karte für das Theater<br />
bekommen, geht in den Zuschauerraum und wird sogleich auf der Bühne gebraucht. Charlie kann nur aus dem<br />
Foyer hören, wie der Regisseur eine Szene, die nicht von ihm, sondern von Edward Albee stammt, in der<br />
Inszenierung verwendet. Seine Frau treibt es auf der Bühne mit DER ZIEGE,...<br />
In der Pause besucht das Publikum, alle Teilnehmer eines Ärztekongresses, das Foyer. Charlie Dodler klagt dem<br />
Primar, Spezialist für Transplantationen aller Art, sein Leid. Ihm ist sein ICH abhanden gekommen, ihm scheint, er<br />
hat kein ICH mehr. Die Ärzte beschließen also eine Notoperation für eine EGO-Transplantation. Als dann noch<br />
George Bush aus dem brennenden Theaterraum ins Foyer kommt, hat der unpolitische Autor Dodler endgültig<br />
das Gefühl, dass ihm sein Stück entgleist….<br />
Im finalen Showdown zieht Wolfi <strong>Bauer</strong> alle Register seiner dramatischen Fantasie. Die Komödie, die sich im<br />
Laufe der Handlung zur Tragödie wandelt, wird zum eigentlichen Drama.<br />
Zitat <strong>Wolfgang</strong> Hofer - STEIRISCHER HERBST:<br />
Wolfi <strong>Bauer</strong>s „Foyer“ ist etwas zwischen apokalypse und alptraum, groteske und<br />
schwärzestem nonsense, eine aberwitzige komödie zum karussell einer<br />
surrealen tragödie. das absurde ist das reale und das reale vollkommen absurd.<br />
freilich immer quasi mit doppeltem boden. jedenfalls kann man sagen: die welt<br />
ist die hölle, und das sind wir und die anderen. und wenn schließlich das theater<br />
brennt, scheint klar, daß diese theater-welt wirklich die hölle ist. was aber ist<br />
dann das foyer? zumindest die vorhölle.<br />
Weitere Auskünfte erteilt<br />
Ihnen gerne:<br />
<strong>THOMAS</strong> <strong>SESSLER</strong> VERLAG<br />
Johannesgasse 12<br />
A-1010 Wien<br />
Telefon: +43-1-512 32 84<br />
Telefax: +43-1-513 39 07<br />
Email: office@sesslerverlag.at<br />
www.sesslerverlag.at
DIE KANTINE<br />
Capriccio à la Habsburg<br />
17 H, 6 D UA 8.Mai 1993,<br />
Schauspielhaus Graz<br />
Die Kantine ist in jedem Theater der Welt Zufluchtsort, Arena für öffentliche und<br />
private Auseinandersetzungen, Diskussionsforum, Schauplatz für Leidenschaften<br />
aller Art. Ein Fremder würde glauben, in einen (Alp-)traum geraten zu sein.<br />
Menschen aus den unterschiedlichsten Epochen in monströsester Verkleidung<br />
bestellen ihr Bier an der Theke.<br />
Bei <strong>Wolfgang</strong> <strong>Bauer</strong> memorieren die Schauspieler des Habsburg-Stücks über<br />
Johann Orth „Die Elemente“ je nach Temperament ihren Text. Der Intendant heißt<br />
nicht umsonst Horst Schludermann und ist aus Deutschland, Tatjana Interprescu<br />
muß radebrechend ihr Regiekonzept verteidigen, Starschauspieler und<br />
Theatersternchen stehen in rätselhaften Beziehungen. Bunter und vielfältiger kann<br />
das „reale“ Leben nicht sein, hier spielt sich auf kleinstem Raum und in kurzer Zeit<br />
ab, was „draußen“ Jahre und Generationen dauert.<br />
Zu all dem gelingt es <strong>Bauer</strong>, lächerliche völkische Auseinandersetzungen auf<br />
Schauspieler und ihre Herkunft zu übertragen. Schließlich prügeln sich die<br />
Österreicher/Habsburger/Johann Strauß und die Deutschen/Schludermann/<br />
Coburg. „Johann Strauß intoniert einen Walzer, Coburg würgt ihn, Strauß<br />
zerschmettert seine Geige auf dessen Schädel. „Sägmann: „Jetzt ist es hin, euer<br />
Violinchen!“, Holm: (gibt Sägmann einen Haken) „Du Kunstnazi!“.<br />
Weil wir am Theater sind, ist dieser ethnische Kampf sehr bald vorbei und der Autor<br />
Bierhoff staunt: „...was mein Stück alles auslösen kann... gar net so ungefährlich,<br />
die Literatur.“ Schließlich tritt noch Otto von Habsburg mit Sohn Karl und dessen<br />
Frau Francesca auf - und ist sehr gütig. Leider muß er ins Europaparlament nach<br />
Straßburg, „aber Karl kann bleiben“.<br />
Am Ende ist die Kantine wieder leer, der debile Schankgehilfe Otto hat sich als<br />
Johanna verkleidet, ein Kästchen erinnert an Mayerling, selbstverständlich ist es<br />
leer – Theater... Nur der rührende alte Autor glaubt unverdrossen an die historische<br />
Bedeutung seines Stücks – und hat schon ein neues im Kopf...
ACH, ARMER ORPHEUS!<br />
8 D, 9 H, SIM-DEK UA 2.Mai 1991<br />
Neues Schauspielhaus Wien<br />
Cary (Orpheus) steht für den ewigen Sänger-Dichter und zugleich schlechthin für<br />
die Dichtung. „Ich bin gut zu lesen... Ich bin ein Gedicht“, heißt es im<br />
mehrschichtigen Werk, das auch jede Menge ironischer Anspielungen und –<br />
ähnlich wie in <strong>Bauer</strong>s „Herr Faust spielt Roulette“ – (rituelle?) Schlachtungen parat<br />
hält. Mit einem Gott im selbstgewählten, versperrten Käfig ist <strong>Bauer</strong>s Personage<br />
wieder einmal recht üppig geraten.<br />
Gerhard Melzer, Grazer Universitätsdozent für Germanistik: ACH, ARMER ORPHEUS!,<br />
in diesem Werk bringt <strong>Wolfgang</strong> <strong>Bauer</strong> rückhaltloser denn je die quälende<br />
Zwischenexistenz des Künstlers zur Sprache, dessen rauschhaft-zerstörerische<br />
Entäußerung an die Kunst, die er sucht und flieht zugleich. Dieser Schwebezustand<br />
zwischen Traum und Wirklichkeit, Diesseits und Jenseits, Innen- und Außenwelt<br />
bestimmt auch die Form des Stücks, und es ist gewiß kein Zufall, daß <strong>Bauer</strong>s Text<br />
dem Jazzmusiker Miles Davis zugeeignet ist: die assoziative, scheinbar willkürliche<br />
Tonfolge des „Free Jazz“ bezeichnet auch die Ordnung, der <strong>Bauer</strong>s Stück<br />
verpflichtet ist. Hinter den Bildentwürfen freilich verbirgt sich eine tieftraurige und<br />
aberwitzige Meditation über das Wesen der Kunst und des Künstlers, und es bleibt<br />
sehr zu hoffen, daß Dramaturgen, Theaterdirektoren und die Kollegen von der<br />
Theaterkritik sich endlich dazu bequemen, die Image-Mauer des alten „Magic-<br />
Wolfi“ zu überspringen: jenseits des angegrauten Gemäuers warten die weiten,<br />
unentdeckten Theaterlandschaften <strong>Bauer</strong>s auf Erkundung.
DAS LÄCHELN DES BRIAN DE PALMA<br />
2 D, 8 H, 1 DEK UA 1.Dezember 1991<br />
Schauspielhaus Graz<br />
Wieder einmal heben sich bei <strong>Wolfgang</strong> <strong>Bauer</strong> Raum und Zeit auf. Ägypten, die<br />
Pyramiden, eine Mumie sind Versatzstücke, handelnde Personen und Funktionen.<br />
Das Glück ist zum leisen Weinen geworden, das bis in die Wohnung eines alt<br />
gewordenen Hippie-Archäologenpaares weht. Es ist zum Weinen geworden, weil<br />
das Vergessen es eingesperrt hat. Es muß eine Möglichkeit geben, das Glück zu<br />
befreien. Die absurdesten Begegnungen, Gespräche und Situationen ergeben<br />
sich: der Archäologe Odo spricht plötzlich die Sprache des Falkengottes Horus, die<br />
Mumie ist zugleich Darsteller in einem Film, die Unterwelt ist die Oberwelt, Ägypten<br />
ist hier und überall. Und der Hollywood-Regisseur Brian de Palma dreht überall das,<br />
mit all dem und mit ihnen allen einen Film: „Alles zugleich“.<br />
WOHER KOMMEN WIR?<br />
WAS SIND WIR? WOHIN GEHEN WIR?<br />
4 D, 6 H UA 30.Oktober 1982<br />
Bühnen der Stadt Bonn/<br />
Kammerspiele Bad Godesberg<br />
Drei Paare in einem Hotel in Singapur, eigentlich der Vorhof zum Jenseits. Aber<br />
keines der Paare nimmt die anderen wahr. Die drei Titelfragen werden gestellt,<br />
doch ohne Antwort – die Gesetze der Logik sind auf geheimnisvolle Weise außer<br />
Kraft gesetzt.<br />
Als das Umeinander zu versanden droht, erscheinen van Gogh und Gauguin, von<br />
denen der erste die „Vernichtung der Zeit“ proklamiert. Das kann nicht ohne<br />
Auswirkung auf Raum und auf das Erkenntnisvermögen der Menschen bleiben;<br />
schließlich werden alle aus der Sechsergruppe unter eine Guillotine geführt –<br />
zurück bleibt nur ein sich langweilender Gott.<br />
Presse: Mit dem neuen Stück ist <strong>Bauer</strong> ein dramaturgisch großartiger und<br />
menschlich tief berührender Schluß gelungen.<br />
<strong>Bauer</strong> träumt auf seiner immerwährenden rauschhaften Flucht aus der Realität von<br />
der verlorenen Wärme in der Eihaut. Er geht auf einer Spirale, deren Drehungen<br />
auf einer immer höheren Ebene über immer derselben Anfangsdrehung kreisen.
DAS KURZE LEBEN DER SCHNEEWOLKEN<br />
1 D, 4 H UA 28.Oktober 1982<br />
Staatstheater Stuttgart<br />
Eine Liebesgeschichte zwischen Lilly und Balduin, die sich abseits aller alltäglichen<br />
Beziehungen abspielt, freiwillig abgeschlossen von der Umwelt in einem<br />
abgelegenen Holzhaus im Schnee...<br />
Ihr innigster Wunsch, einander zu lieben, wird ständig verhindert. Zwischen ihnen<br />
stehen ihre Gedanken, die niemals zum Gesagten passen. Sie werden<br />
ausgesprochen, stehen belastend dazwischen und werden vom anderen nicht<br />
gehört – „Das Schicksal paßt nicht in unser Leben“ (Balduin). Wie dunkle<br />
Schneewolken steht ihr Leben, ihre Liebe über dem, was wirklich passiert: ihre<br />
gegenseitige Brutalität, ihr Masochismus. Übrig bleibt die unbedingte, immer<br />
unerfüllte Sehnsucht, zu einander zärtlich zu werden.<br />
Zwischen Genet und Edgar Allan Poe läßt <strong>Wolfgang</strong> <strong>Bauer</strong> Figuren aus ihrem<br />
früheren bürgerlichen Vorleben auftreten: Lillys früheren Liebhaber in der Gestalt<br />
eines Jägers und ihren Ehemann Robert in der Maskenballkostümierung eines<br />
Vampirs, die den Haß der beiden auf das Nichtzustandekommen ihrer Liebe in<br />
Wahnsinn ausarten läßt. Lilly tötet den Jäger und – angesteckt von der grotesken<br />
Vitalität Roberts – wird sie selbst zum Vampir und ermordet ihren Geliebten Balduin<br />
durch einen tödlichen Biß.<br />
HERR FAUST SPIELT ROULETTE<br />
2 D, 18 H, 1AKT UA 25.Jänner 1987<br />
Akademietheater Wien<br />
Herr Faust, Mathematiker, spielt täglich in einem abgewirtschafteten,<br />
verkommenen Casino und hofft auf den großen Gewinn. Er trifft dort Freunde und<br />
Bekannte; Hansi, einen englischen Kauderwelsch plappernden Irren und den<br />
Architekten, der nie setzt, sondern immer nur ein todsicheres, kompliziertes System<br />
austüftelt. Zwei Arbeiter, die opiumtrunken an einer Stützsäule arbeiten, Irre aus der<br />
Narrenanstalt im ersten Stock, die durch das Casinofenster ins Leere springen, ein<br />
Mönch, der vogelgleich durch den Raum flattert. Gretl, Fausts Frau, stößt zu der<br />
illustren Casinorunde, kündigt an, daß das Gulasch fertig ist und verführt den<br />
Ehegatten mit Lustgestöhn‘ am Roulettetisch. Alle Freunde Fausts treffen – nun wie<br />
Gretl in wallende Geistergewänder gekleidet – zum großen Fressen ein. Auch der<br />
große Pudel ist dabei. Laut schmatzend und prustend werden die Eingeweide<br />
eines Spions von der Ostsee verzehrt. Faust soll seinen eigenen Kopf essen, aber
der Appetit ist ihm vergangen. Die steigende Hitze läßt alle die Geisterklamotten<br />
abwerfen. Jetzt gesellen sich zu den anderen auch Goethe, Dostojewskij und die<br />
Gebrüder Karamasow. Das Gespann verdrischt seinen Schöpfer Wolfi, <strong>Bauer</strong><br />
diskutiert mit Goethe einen würdigen Schluß. Plötzlich erstarrt die Szene, zwei<br />
Arbeiter suchen den Fehler. Einer haut <strong>Bauer</strong> auf den Kopf: „Wackelkontakt!!!!“<br />
Presse: Blödelnd, trivialisierend und mit der Realität jonglierend gibt sich <strong>Bauer</strong>s<br />
„Faust“ zwar den Anschein eines theatralischen Nichts, ist aber eine gallbittere<br />
Satire auf die Sinnsuche des Menschen.....<br />
Der hohe Reiz des Stückes liegt in <strong>Bauer</strong>s ungebrochener Freude an der Nutzung<br />
des Mediums Theater als Spielwiese und eben an seiner souveränen sprachlichen<br />
und bildlichen Bewältigung dieses seines ganz persönlichen Vergnügens.<br />
DIE MENSCHENFABRIK<br />
6 D, 12 H, NR, STAT UA 21.September 1996<br />
Schauspielhaus Graz im Rahmen<br />
des steirischen herbstes<br />
Das Grazer Reisebüro „Columbia“ wirbt für ein Schloßhotel in Südfrankreich mit<br />
Schlagwörtern wie „auf letztem technischem Stand, ausgesuchtes Publikum“. Das<br />
Grazer Ehepaar Fritz und Gunda Fraggern – er ist Universitätsprofessor und sie hat<br />
etwas mit Kunst zu tun – macht sich in der Hoffnung auf einen entspannenden<br />
Sommerurlaub auf die Reise. Außerdem wollen sie in besagtem Schloßhotel auf<br />
den mit ihnen befreundeten Grazer Dichter Ulf von Langzeit treffen.<br />
Bei seiner Ankunft widerfährt dem Ehepaar jedoch Ungewöhnliches. Die nicht<br />
besetzte Rezeption kümmert sie nur kurz, weil sie gleich darauf einen menschlichen<br />
Rumpf finden. Eine große Spiegelwand entpuppt sich als Videowall, auf dem das<br />
verschreckte Ehepaar sich selbst beim Gespräch über diesen grausigen Fund<br />
bestaunen kann. Als auch noch ein menschengroßes Ohr auf Zehenspitzen durch<br />
die Eingangshalle schleicht, um sich ins nächstgelegene Bistro abzusetzen,<br />
bestätigen sich die Vermutungen der beiden, daß einiges wirklich nicht in Ordnung<br />
sein kann.<br />
Ein gefangen gehaltener Gott versucht Klarheit zu bringen: Der berühmte<br />
Wissenschafter für vergleichende Fleischphysik Dr. Liedermacher (Nobelpreis für die<br />
Theorie der todlosen Welt) ist nicht schon lange tot, wie Gunda und Fritz denken,<br />
sondern lebt durch Überschreitung von Vergessensschwellen in anderen Universen<br />
parallel weiter. Die Nachfrage nach geklonten prominenten Menschen in den<br />
Paralleluniversen ist so groß, daß Dr. Liedermacher gemeinsam mit dem<br />
Hotelbesitzer Kapitän Henri Clews diese Marktlücke füllt und das Schloß hinter der<br />
Fassade zur Menschenfabrik umgerüstet hat. Arglose Touristen werden als
Fleischbasis zur Herstellung von dutzenden Mozarts, hunderten Hölderlins und jeder<br />
Menge Schillers benützt.<br />
Dem Dichter Ulf kommt die Aufgabe zu, durch die Kraft seiner Poesie dem Cyber-<br />
Spuk ein Ende zu bereiten.<br />
SKIZZENBUCH<br />
3 D, 5 H, 1 DEK UA 9.Mai 1996<br />
Neues Schauspielhaus Wien<br />
im Rahmen der Wiener Festwochen<br />
...Zum Auftakt von „1000 Jahre Paralyse“ gab’s im Schauspielhaus die Uraufführung<br />
des neuen Stücks von <strong>Wolfgang</strong> <strong>Bauer</strong>, der damit wieder einmal ein glanzvolles<br />
Comeback feierte. <strong>Bauer</strong> ist immer dann am besten, wenn er möglichst nahe bei<br />
sich selbst bleibt; die tollsten Stücke handeln entweder im eigenen Wohnzimmer<br />
(„Magic Afternoon“, 1968) oder im eigenen Kopf („Ach, armer Orpheus!“, 1991).<br />
Sein dreißigstes Stück, das szenische Selbstportrait „Skizzenbuch“, handelt nun im<br />
Wohnzimmer und im Kopf des Autors zugleich.<br />
Ein Dichter schreibt ein Stück, in dem er selbst gerade eben dieses Stück schreibt:<br />
Natürlich ist das, wie jede Perpetuum-mobile-Konstruktion, zum Scheitern verurteilt.<br />
Und natürlich weiß das <strong>Bauer</strong> selbst am besten. Daß er es trotzdem versucht, kann<br />
man tollkühn, paralytisch, naiv oder genial nennen. Zunächst einmal ist es vor<br />
allem ziemlich komisch. Wenn dem Autor, der rauchend am Schreibtisch sitzt, eine<br />
Szene nicht gefällt, schreibt er sie eben um und wir sehen sie – zurück zum Start –<br />
gleich noch einmal. Wenn es ihm gerade einfällt, dreht er sich – oder seinem<br />
Gesprächspartner – einfach den Ton ab und wir sehen nur die Mundbewegungen<br />
der Schauspieler. Und wenn er – ratsch! – eine Seite von seinem Skizzenbuch<br />
abreißt, geht das Licht aus: Szenenwechsel.
INSALATA MISTA<br />
Boulevard-Komödie<br />
2 D, 8 H, 1 DEK UA 1.Dezember 1993<br />
Ohio Theatre New York,<br />
DSEA 26.Oktober 1997<br />
Volkstheater Wien<br />
Eine Bar in New York. Die Menschen unterhalten sich ausschließlich innerhalb ihres<br />
„Sprachbezirks“: Tony, der Barkeeper und sein Koch Miguel mittels Zahlen, die<br />
Nutte Nancy favorisiert Körperteile, der ehemalige Gewerkschafter kulinarische<br />
und der Agent James kriminalistische Begriffe. Der Cop beherrscht nur mehr<br />
Gefängnissprache. Man versteht einander, man amüsiert sich. Das Publikum hat<br />
längst gelernt, den Code zu entschlüsseln. Ein abgefeimter, alter Filmproduzent tritt<br />
auf, sein blondes Begleitsternchen versteht nur Bahnhof. Sie hat keinen Code, sie<br />
kennt keinen Code, sie verwendet keinen Code – sie ist ratlos.<br />
Der Terrorist erscheint, er plaziert eine Bombe auf dem TV-Gerät, in dem gerade<br />
ein japanischer Tycoon den Ankauf von ganz New York angekündigt. Er muß gekillt<br />
werden – große Aufregung, große Spannung – break.<br />
Der Hollywood-Regisseur unterbricht. Plötzlich reden alle normal, gehen hinaus,<br />
hinein, werden kritisiert, korrigiert – eine völlig normale Probe. Alles beginnt wieder<br />
von vorne....<br />
CAFE TAMAGOTCHI<br />
1 D, 6 H, STAT. UA: Theater im Rabenhof, Wien<br />
17.März 2001<br />
Das Cafe Tamagotchi hat seltsame Gäste. Frau Leer ist tatsächlich ohne jeden<br />
Inhalt, Herr Niemand ist wie er heißt, Herr Blackhole könnte in sein eigenes<br />
schwarzes Loch fallen. Offenbar sind sie und die anderen Gäste vom Menschen<br />
erfunden, vielleicht Maschinen, vielleicht aber auch nur Kopf und Gedanken, aus<br />
sich selbst existierend, über sich selbst redend und nur deshalb vorhanden. Alles<br />
hat die Idee des japanischen Tamagotchi, alles ist Ei-förmig, ohne Anfang, ohne<br />
Ende, von sich ausgehend, in sich zurückkehrend.<br />
Blackhole: „Die Menschen denken, schuften, überlegen, kämpfen, ändern,<br />
morden, etc., etc..... bis sie nach langem Schnaufen ihr Schicksal beisammen
haben.... Ihr Schicksal! Bis sie das zusammengebastelt haben, was schon längst<br />
ist....“ Die Kreaturen der Menschen haben sich längst über diese erhoben und<br />
spielen ihr eigenes Spiel, immer wieder und immer wieder – im Cafe Tamagotchi.<br />
<strong>Bauer</strong> spielt selbst, trickst seine gambler aus, läßt sie im zweiten Teil wieder zu<br />
„normalen“ Besuchern eines „normalen“ Kaffeehauses werden, immer wieder<br />
aber fährt ein Erinnerungsblitz durch den einen oder anderen und am Ende sitzen<br />
sie wieder als ihre eigene Kunstfigur im Cafe Tamagotchi und lassen ihre Batterien<br />
von einem Tamagotchi-Über-Ich wieder füllen.