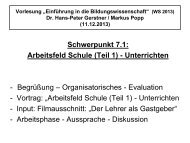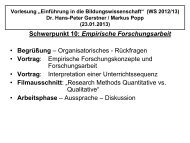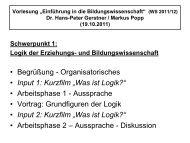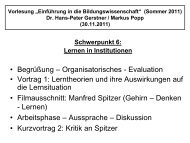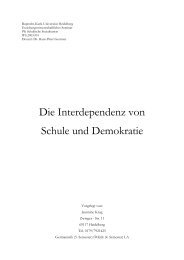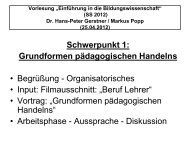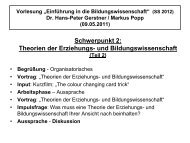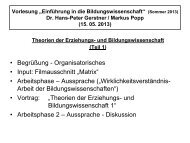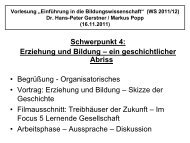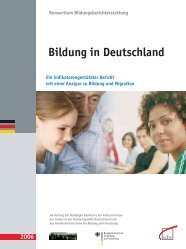Heidehof-Stiftung: Umgang mit Sexualität, Körperlichkeit und Macht
Heidehof-Stiftung: Umgang mit Sexualität, Körperlichkeit und Macht
Heidehof-Stiftung: Umgang mit Sexualität, Körperlichkeit und Macht
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
5. Forum<br />
<strong>Umgang</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sexualität</strong>, <strong>Körperlichkeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Macht</strong> in<br />
pädagogischen Kontexten<br />
Reader der Vorträge<br />
9. November 2011<br />
Kontakt:<br />
<strong>Heidehof</strong> <strong>Stiftung</strong> GmbH<br />
<strong>Heidehof</strong>str. 35 A<br />
D‐70184 Stuttgart<br />
Telefon: +49 (0)711 993756‐10<br />
Fax: +49 (0)711 993756‐25<br />
www.<strong>Heidehof</strong>‐<strong>Stiftung</strong>.de
Inhaltsverzeichnis:<br />
Begrüßung Alexander Urban (<strong>Heidehof</strong> <strong>Stiftung</strong> GmbH) ................................... Seite 1<br />
Ulrich Herrmann (Universität Tübingen): Die Ambivalenz pädagogischer Beziehung.<br />
Gefahrenzonen <strong>und</strong> Tatorte sexueller Gewalt im Hinblick auf Präventionsmöglichkeiten –<br />
hier: Missbrauch pädagogischer Beziehungen durch sexuelle Gewalt .............. Seite 3<br />
Elisabeth Helming (DJI, München): Sexuelle Gewalt gegen Mädchen <strong>und</strong> Jungen in<br />
Institutionen – Ausgewählte Ergebnisse aus dem DJI‐Projekt ........................... Seite 30<br />
Benno Hafeneger (Universität Marburg): <strong>Macht</strong> <strong>und</strong> <strong>Sexualität</strong> in der pädagogischen<br />
Diskussion .......................................................................................................... Seite 76<br />
Claudia Nikodem (Universität Köln): Zur Schwierigkeit <strong>Macht</strong>verhältnisse in der Schule zu<br />
benennen. Zur Prävention von sexueller Gewalt ............................................... Seite 90<br />
Hannelore Faulstich‐Wieland (Universität Hamburg):<br />
Missbrauch <strong>und</strong> Geschlecht ............................................................................... Seite 100<br />
Katrin Höhmann (PH Ludwigsburg): Eine Schule auf dem Weg:<br />
Lernen aus dem Missbrauch .............................................................................. Seite 117<br />
Hubert Liebhardt (Universitätsklinikum Ulm) <strong>und</strong> Christoph Röhl (Berlin): Konzept eines<br />
Filmseminars "Und wir sind nicht die Einzigen..." zum <strong>Umgang</strong> <strong>mit</strong> sexuellem<br />
Kindesmissbrauch für pädagogische Berufe ...................................................... Seite 147
Begrüßung zum 5. Forum der <strong>Heidehof</strong> <strong>Stiftung</strong> am Mi, 9.9.2011<br />
Dr. Alexander Urban<br />
Sehr geehrte Damen <strong>und</strong> Herren,<br />
liebe Fre<strong>und</strong>e <strong>und</strong> Partner der <strong>Heidehof</strong> <strong>Stiftung</strong>,<br />
ich freue mich, dass Sie so zahlreich unserer Einladung zum nunmehr 5. <strong>Heidehof</strong> Forum gefolgt<br />
sind <strong>und</strong> begrüße Sie sehr herzlich hier in den Räumen der Baden Württembergischen Bank.<br />
Besonderer Dank gilt unserer Hausbank, vertreten durch Herrn Egeler, für die großzügige<br />
Gastfre<strong>und</strong>schaft.<br />
Mit der Durchführung der seit 2007 jährlich im Herbst stattfindenden Foren verbinden wir im<br />
wesentlichen 2 Intentionen:<br />
1. zum einen möchten wir Institutionen, die von uns gefördert werden <strong>und</strong> sich auf gleichen oder<br />
ähnlichen Feldern engagieren, zusammenbringen, da<strong>mit</strong> sie voneinander lernen <strong>und</strong> Erfahrungen<br />
austauschen können.<br />
2. zum anderen möchten auch wir von der <strong>Heidehof</strong> <strong>Stiftung</strong> Orientierung bekommen für die<br />
Weiterentwicklung unserer Förderlinien.<br />
Die Forums‐Themen der vergangenen Jahre beziehen sich auf Förderschwerpunkte, die <strong>mit</strong>tel‐ <strong>und</strong><br />
langfristig angelegt sind <strong>und</strong> zum Teil auch seit geraumer Zeit bestehen:<br />
‐ Nachhaltige Entwicklung, insbesondere „BNE“<br />
‐ Interkulturelle Umweltbildung<br />
‐ Schulentwicklung am speziellen Beispiel einer Stuttgarter Schule<br />
‐ Chancengleichheit durch Inklusion? – Grenzen <strong>und</strong> Ausblick.<br />
Dieses Jahr <strong>und</strong> heute:<br />
<strong>Umgang</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sexualität</strong>, <strong>Körperlichkeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Macht</strong> in pädagogischen Kontexten<br />
Dieses Thema hatten wir bislang nicht in unserem engeren Fokus. Warum also jetzt?<br />
Wie Sie alle wissen, sind die Robert Bosch <strong>Stiftung</strong> <strong>und</strong> die <strong>Heidehof</strong> Stftung die Initiatoren <strong>und</strong><br />
Träger des Deutschen Schulpreises, der seit 2006 jährlich verliehen wird. Die Gründe, warum wir<br />
gemeinsam diesen Preis aus der Taufe hoben gehen zurück auf die jeweils eigenständige aber<br />
Jahrzehnte währende Förderung der Schulpädagogik durch die beiden <strong>Stiftung</strong>en. Aus diesen<br />
Programmen entwickelten sich seit den Achtziger Jahren produktive Beziehungen zu Schulen, die<br />
sich besonders für die Weiterentwicklung des Lernens <strong>und</strong> Lebens in der Schule engagierten <strong>und</strong><br />
zur Avant Garde gehörten (� Helene Lange Schule, Frau Riegel) .<br />
Es w<strong>und</strong>ert nicht, dass gerade diese Schulen, sofern sie sich beim Deutschen Schulpreis beworben<br />
haben, in einigen Fällen auch erfolgreich waren. Und viele von ihnen nahmen ihre Entwicklung<br />
ausgehend von Ideen <strong>und</strong> Konzepten der Reformpädagogik. Nachdem die schlimmen sexuellen<br />
Übergriffe an kirchlichen <strong>und</strong> nicht‐kirchlichen Internaten in 2010 <strong>mit</strong><br />
Seite 1
großer Medienresonanz öffentlich wurden, wurde auch von einigen überregionalen Zeitungen eine<br />
unselige, eine fragwürdige <strong>und</strong> aus meiner Sicht unzutreffende Kausalkette gezimmert, die da<br />
heißt:<br />
Pädosexueller Missbrauch – Internatsschulen ‐ Reformpädagogik – Deutscher Schulpreis<br />
Dabei wurde von den Schreibern verkannt, oder bewusst unterschlagen, dass vieles, das aus der<br />
reformpädagogischen Tradition stammt, zum Teil seit langem Einzug in die öffentlichen Schulen<br />
gehalten hat, wie etwa individuelles <strong>und</strong> selbständiges Lernen, jahrgangsübergreifendes Lernen,<br />
differenzierte Leistungsrückmeldung, Lernen in Projekten, etc.<br />
Die <strong>Heidehof</strong> <strong>Stiftung</strong> sieht es nicht als ihre Aufgabe, bei der weiteren Aufklärung vergangenen<br />
Unrechts <strong>mit</strong>zuwirken oder die Diskussion darüber zu moderieren. Dazu sind andere berufen.<br />
Es kann aber vielmehr eine Aufgabe für uns sein, dabei <strong>mit</strong>zuhelfen, dass Übergriffe innerhalb<br />
pädagogischen Wirkens möglichst nicht mehr stattfinden. Und „Übergriffe“ umfasst freilich mehr<br />
als schiere pädosexuelle Gewalt, die zwar die schlimmste, aber nicht die einzige Art von<br />
Übergriffen ist. Sicherlich ist die Sensibilisierung in Aus‐ <strong>und</strong> Fortbildung von pädagogisch tätigen<br />
Personen, insbesondere von Lehrern <strong>und</strong> Lehrerinnen eine notwendige Voraussetzung für<br />
wirksame Prävention.<br />
Ich freue mich, dass uns kompetente Referentinnen <strong>und</strong> Referenten zugesagt haben, die Thematik<br />
aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten <strong>und</strong> uns aufzuzeigen, wo die künftigen<br />
Aufgaben liegen könnten. Ihnen möchte ich an dieser Stelle besonders herzlich danken.<br />
Seite 2
Ulrich Herrmann<br />
Missbrauch pädagogischer Beziehungen durch sexuelle Gewalt<br />
Die Differenz von Straftatbestand <strong>und</strong> ambivalenter Gr<strong>und</strong>struktur pädagogischen Handelns<br />
Ausgearbeiteter Eröffnungsvortrag auf dem Workshop der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft am 3./4. Feb‐<br />
ruar 2011 in Berlin: <strong>Sexualität</strong> <strong>und</strong> <strong>Macht</strong> in pädagogischen Kontexten. Bedingungen, Strukturen <strong>und</strong> Erscheinungsformen<br />
von sexuellen Übergriffen <strong>und</strong> sexueller Gewalt in pädagogischen Institutionen.<br />
Der Anlass<br />
Andreas Gruschka zum 60. Geburtstag<br />
Sexuelle Gewalt in pädagogischen Einrichtungen, aber nicht nur in diesen, war im Jahre 2010 das The‐<br />
ma der Massenmedien in Deutschland. Die Odenwaldschule erwies sich als einer der Haupttatorte. Da<br />
sie sich immer als ein Leuchtturm der Reformpädagogik stilisiert <strong>und</strong> gegen genaueres Hinsehen immu‐<br />
nisiert hatte, war das für so manchen (auch prominenten) Erziehungswissenschaftler 1 <strong>und</strong> einige Journa‐<br />
listen eine willkommene Gelegenheit, durch einen unterstellten Zusammenhang von sexueller Gewalt<br />
<strong>und</strong> Reformpädagogik ein Denkmal zu stürzen <strong>und</strong> einen Bildersturm zu entfachen. 2 Was kriminelle<br />
Handlungen nach §§ 174 <strong>und</strong> 176 StGB (sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen über 14 Jahren<br />
bzw. von Kindern unter 14 Jahren) <strong>mit</strong> Reformpädagogik im allgemeinen <strong>und</strong> der Landerziehungsheim‐<br />
pädagogik im speziellen zu tun haben könnten, blieb im Dunstkreis vager Zuschreibungen, Vermutun‐<br />
1 Jürgen Oelkers: Nach der Reformpädagogik. In: FAZ,, 15.3.2010, S. 23. – Heinz-Elmar Tenorth: Die B<strong>und</strong>esrepublik als<br />
Internat. In: FAZ, 17.3.2010, S. N 5. – Weitere Stimmen: Interview von Katja Irle <strong>mit</strong> Oskar Negt: „Sie haben die Augen verschlossen<br />
– <strong>und</strong> es gewollt“. In: Frankfurter R<strong>und</strong>schau, 18.3.2010, S. 20 f. – Friedrich Wilhelm Graf: Klöster antimoderner<br />
Ganzheitlichkeit. In: FAZ, 18.3.2010, S. 8. – Eine prominente Gegenposition: Bernhard Bueb: „Der Reformpädagogik gehört<br />
die Zukunft“. Interview <strong>mit</strong> Wolfgang Messner. In: Stuttgarter Zeitung, 30.4.2010. – Jürgen Oelkers: Utopie adé. Ist die Reformpädagogik<br />
am Ende? AULA SWR HF 2, 13.6.2010. – Gegenposition: Ulrich Herrmann: Das Ende der Reformpädagogik?<br />
Die Odenwaldschule auf dem Prüfstand. AULA SWR HF 2, 6.6.2010. – Kompilation des Früheren: Jürgen Oelkers: Zur Neubewertung<br />
der Reformpädagogik. Vortrag Universität Bielefeld 28.1.2011. – Ders.: Vorlesung an der Universität Zürich im<br />
Herbstsemester 2010 zur Kritik der Reformpädagogik, eine Kompilation pädagogischer Verirrungen <strong>und</strong> Vergehen von Lehrkräften<br />
an Landerziehungsheimen, ohne argumentierende Begründung, was das <strong>mit</strong> Reformpädagogik zu tun hat, <strong>und</strong> ohne<br />
analytische Aufklärung über die Täter- <strong>und</strong> Tatort-Hintergründe. – Kontrovers: Pro <strong>und</strong> Kontra: Brauchen wir heute noch<br />
Reformpädagogik? Pro: Heinz-Elmar Tenorth, Kontra Jürgen Oelkers. In: Erziehung & Wissenschaft. [Zs. der GEW],<br />
4.6.2010. – Gabriele Behler: Lehrer müssen nicht geliebt werden. Die Reformpädagogik hat versagt. In: DIE ZEIT, 23.9.2010.<br />
Dagegen: Ulrich Herrmann: „Schönen Dank für die Anregung, Frau Behler“. In: SPIEGEL ONLINE, 24.9.2010; Hans Brügelmann<br />
<strong>und</strong> Bernhard Bueb: Eine abenteuerliche Attacke. In: DIE ZEIT, 7.10.2010, S. 72.<br />
2 Dagegen der immer noch bemerkenswerteste Artikel aus dieser Medienwelle derjenige von Tanjev Schultz: Zeugnistage.<br />
[Bericht von einem Interview <strong>mit</strong> Hartmut von Hentig] In: Süddeutsche Zeitung, 12.3.2010, S. 3. – Reinhard Kahl: Hartmut<br />
von Hentig muss reden: In: DIE ZEIT, 22.4.2010. – Darauf eine Äußerung von Hentigs, die ihn diskreditiert hat: „Was habe<br />
ich da<strong>mit</strong> zu tun?“ In: DIE ZEIT, 25.3.2010, S. 19. – Heike Schmoll: Führer der Verführten. In: FAZ, 22.6.2010, S. 8. Dazu<br />
Gruschka 2010 (wie Anm. 7), S. 18 ff.<br />
Seite 3
gen, Behauptungen. (Darauf wird unten bei der Betrachtung von Täter <strong>und</strong> Tatort zurückzukommen<br />
sein.)<br />
Demzufolge musste nun auch die hauptberufliche akademische Erziehungswissenschaft reagie‐<br />
ren. 3 Das hat sie in der Vergangenheit nicht getan: sexuelle Gewalt („Missbrauch“) wurde gar nicht als<br />
pädagogisch bzw. erziehungswissenschaftlich relevant wahrgenommen, sondern den Psychotherapeu‐<br />
ten, Sexualforschern, Kriminologen <strong>und</strong> Strafrechtlern zugeordnet. Nicht übersehen werden darf im<br />
Rückblick aber die Tatsache, dass das Thema in der Heimkampagne Ende der 1960er Jahre ins Visier der<br />
Sozialpädagogik geraten war 4 , <strong>und</strong> dass sich einzelne Erziehungswissenschaftler dieses Themas ange‐<br />
nommen hatten, in der Regel bezogen auf innerfamiliaren „sexuellen Missbrauch“ – Väter<br />
„miss“brauchen Töchter, als dürften sie ihre Ehefrauen „ge“brauchen –, <strong>und</strong> neben Standardwerken<br />
<strong>und</strong> Handbüchern 5 der 1990er Jahre findet sich schon 1995 in einer Monographie von Hans‐Christian<br />
Harten 6 der entscheidende Hinweis: Wer schützt Kinder vor Erfahrungen, die sie nicht verstehen können<br />
<strong>und</strong> deren Folgen unabsehbar sind?<br />
Das überraschend energische Interesse der universitären Erziehungswissenschaft am Thema „se‐<br />
xuelle Gewalt“ darf übrigens behutsam in die richtigen Bahnen gelenkt werden. Andreas Gruschka<br />
macht darauf aufmerksam, dass es zu diesem auffälligen Interesse, das auf einer Medienwelle hochge‐<br />
schwappt ist, eine Hinterbühne gibt: das Fehlen einer empirisch‐pädagogischen Wirkungsforschung von<br />
pädagogischen Interaktionen, Prozessen <strong>und</strong> Strukturen u. zw. nicht nur im Hinblick auf gelingende,<br />
sondern eben auch misslingende oder gar zerstörerische Folgen. 7 Gruschka schreibt:<br />
„Man kann […] fragen, wo Studien der Erziehungswissenschaft vorliegen, die sich <strong>mit</strong> den Weisen <strong>und</strong><br />
Wirkungen von Erziehung überhaupt beschäftigt haben. Sofern es sich nicht um historische Untersu‐<br />
3<br />
Stellungnahmen von Fachgesellschaften: Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (zur Verletzung der psychischen<br />
<strong>und</strong> physischen Integrität von Heranwachsenden in pädagogischen Institutionen“, März 2010. –Stellungnahme der Deutschen<br />
Gesellschaft für Demokratiepädagogik: Extremer Vertrauensbruch. In: PÄDAGOGIK, Heft 5/2010, S. 56. – Stellungnahme<br />
der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung zu sexueller Gewalt gegenüber Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen in institutionellen<br />
Kontexten, August 2010. – Stellungnahmen der Reformschulen: Erklärung der Vereinigung Deutscher Landerziehungsheime:<br />
Reformschulen – Liberalität <strong>und</strong> Erfolge nicht infrage stellen. 22. 3. 2010. – Erklärung des Schulverb<strong>und</strong>s „Blick über den<br />
Zaun“ zu sexueller Gewalt gegenüber Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen. 4. 5. 2010.<br />
4<br />
Zusammenfassend Manfred Kappeler: Fürsorge- <strong>und</strong> Heimerziehung – Skandalisierung <strong>und</strong> Reformfolgen. In: Meike Sophia<br />
Baader/Ulrich Herrmann (Hrsg.): 68 – Engagierte Jugend <strong>und</strong> Kritische Pädagogik. Impulse <strong>und</strong> Folgen eines kulturellen Umbruchs<br />
in der Geschichte der B<strong>und</strong>esrepublik. Weinheim/München 2011, S. 65–87.<br />
5<br />
Statt vieler: Michael-Sebastian Honig: Verhäuslichte Gewalt. Frankfurt/M. 1986, TB-Ausgabe ebd. 1992. – Dirk Bange: Die<br />
dunkle Seite der Kindheit. Sexueller Missbrauch an Jungen <strong>und</strong> Mädchen. Ausmaß – Hintergründe – Folgen. Köln 1992. –<br />
Ulrike Brockhaus/Maren Kolshorn: Sexuelle Gewalt gegen Mädchen <strong>und</strong> Jungen. Mythen, Fakten, Theorien. Frankfurt/New<br />
York 1993. – Dirk Bange/Günther Deegener: Sexueller Missbrauch an Kindern. Weinheim 1996. – Gabriele Amann/Rudolf<br />
Wipplinger (Hrsg.): Sexueller Missbrauch. Überblick zu Forschung, Beratung <strong>und</strong> Therapie. Ein Handbuch. Tübingen 1997.<br />
6<br />
Hans-Christian Harten: <strong>Sexualität</strong>, Missbrauch <strong>und</strong> Gewalt. Das Geschlechterverhältnis <strong>und</strong> die Sexualisierung von Aggressionen.<br />
Opladen 1995, S. 228 ff.<br />
7<br />
Andreas Gruschka: „Erregte Aufklärung“ – ein pädagogisches <strong>und</strong> publizistisches Desaster – in memoriam Katharina<br />
Rutschky. In: Pädagogische Korrespondenz, H. 42, Leverkusen 2010, S. 5–22. – Der Titel dieses Aufsatzes ist Zitat eines Buches<br />
von Katharina Rutschky: Erregte Aufklärung. Kindesmissbrauch: Fakten <strong>und</strong> Fiktionen. Hamburg 1992.<br />
Seite 4
chungen handelt […], lässt sich keine das Fach bestimmende Aufmerksamkeit für Erziehung in ihren<br />
praktischen Ausgestaltungen ausmachen. Man denke sich etwas Vergleichbares bei den Psychologen:<br />
etwa eine Marginalität von Studien zum Lernen, zur Entwicklung, zum Gedächtnis usf. Unmöglich!<br />
[…] warum existieren keine Studien zur Realität der Interaktionslogik alltäglicher Erziehungsprak‐<br />
tiken in Familien, in Kindergärten, in Schulen, in besonderen Settings wie den Internaten […]?<br />
Ich vermute, die Distanz entsteht bereits weit vor der Reaktion auf die spektakulären Anlässe wie<br />
die Missbrauchshandlungen. Sie ist gr<strong>und</strong>legend als eine Abwehr gegenüber dem Schmuddeligen, dem<br />
allzu oft repressiv Prekären, dem Hilflosen <strong>und</strong> Sinnlosen, dem oft Schädlichen der faktischen Erziehung.<br />
Wer sich <strong>mit</strong> diesen Formen der Erziehung beschäftigt, blickt nicht auf den Glanz der pädagogischen<br />
Praxis.<br />
Als implizite Antwort auf das Unbehagen an erzieherischen Missständen könnte dagegen ein<br />
analytisches Durchdringen des Gegensatzes, der guten Erziehung, erwartet werden. Da<strong>mit</strong> könnte ge‐<br />
zeigt werden, was man positiv tun kann. Das bearbeitet die forschende Erziehungswissenschaft eben‐<br />
sowenig <strong>und</strong> überlässt das Thema der Flut der mehr oder weniger bei allem Pathos leeren oder törich‐<br />
ten Ratgeberliteratur. […]<br />
Vor diesem Hintergr<strong>und</strong> ist die wie eine Selbstanklage formulierte Rede von den Versäumnissen<br />
der eigenen Zunft eine heikle Angelegenheit. Sie hat etwas von einer Heuchelei, wo sie nicht einhergeht<br />
<strong>mit</strong> dem Eingedenken darin, dass sich die Pädagogik bis heute primär <strong>mit</strong> der Kritik an den ihr von außen<br />
angetanen Überformungen durch Politik <strong>und</strong> Wirtschaft beschäftigt sowie <strong>mit</strong> notorischen Ansagen des<br />
Wahren <strong>und</strong> Richtigen. Sie ist auf die Modellierung der vermeintlich richtigen Praxis abonniert, nicht<br />
aber auf die erschließende Kritik einer Praxis, die nicht ist, was sie sein sollte. Es fehlt bis heute dieser<br />
Impuls der Aufklärung.“ 8<br />
Siegfried Bernfeld hat dieses Fehlen als Mangel an „Tabestandsgesinnung“ identifiziert. Unten (Ende<br />
Kap. II) wird zu erklären sein, welchen systematischen Gr<strong>und</strong> das „Abonnement auf das vermeintlich<br />
Richtige“ in der Entfaltung des „pädagogischen Bezugs“ hat, woraus sich zugleich das hier von Gruschka<br />
konstatierte Defizit systematisch erklären lässt.<br />
I. Sexuelle Gewalt – § 176 StGB<br />
Sexuelle Gewalt wird herkömmlicherweise als „sexueller Missbrauch“ bezeichnet – so auch die in unse‐<br />
rem Zusammenhang einschlägigen §§ 174 <strong>und</strong> 176 StGB. Manfred Kappeler hat jüngst überzeugend<br />
dargetan 9 , dass <strong>mit</strong> „Missbrauch“ die abwegige Vorstellung von angemessenem Gebrauch einhergehen<br />
könnte. Vor 40 Jahren, in Zeiten der „sexuellen Revolution“ 10 , war man davon aber gar nicht weit ent‐<br />
fernt 11 – im Gegenteil.<br />
8<br />
Ebd., S. 16–18.<br />
9<br />
Manfred Kappeler: Anvertraut <strong>und</strong> Ausgeliefert. Sexuelle Gewalt in pädagogischen Einrichtungen. Berlin 2011, S. 7 ff.<br />
10<br />
Axel Schildt/Detlef Siegfried: Deutsche Kulturgeschichte. Die B<strong>und</strong>esrepublik von 1945 bis zur Gegenwart. München<br />
2009, S. 260 ff.<br />
11<br />
Philip Eppelsheim: „Kinder gehörten zu seinem Leben.“ In: FAZ, 23.1.2011, S. 4. Ein Artikel über einen pädophilen Odenwaldschul-Lehrer<br />
<strong>und</strong> Mitbegründer der taz. „Dort galt Pädophilie damals als ‚Verbrechen ohne Opfer’.“ – Heute zum sexuel-<br />
Seite 5
1. Pädophilie: ein kurzer Rückblick<br />
Die Zeitschrift „betrifft:erziehung“ eröffnete in Heft 4/1973 die Diskussion zum Thema „Pädophilie: Ver‐<br />
brechen ohne Opfer“ 12 einen Themenschwerpunkt <strong>mit</strong> einem Beitrag des niederländischen klinischen<br />
Psychologen Frits Bernard, der der Frage nachgegangen war, ob sexuelle Erfahrungen von Kindern <strong>mit</strong><br />
Erwachsenen beeinträchtigende Spätfolgen haben. Anhand einer Auswahl von 30 „Fällen“ kam Bernard<br />
zu dem Schluss, dass dies nicht der Fall sei. Sie, die „Opfer“, die also gar keine seien, schienen „durch die<br />
sexuellen Beziehungen in den Jugendjahren freier <strong>und</strong> harmonischer geworden… Es scheint so, als ob sie<br />
sich besser kennen, selbstkritischer <strong>und</strong> weniger defensiv sind.“ 13 Und weiter: „Die psychologische Un‐<br />
tersuchung [welche „Untersuchung“?] hat gezeigt, dass junge Menschen [das ist reichlich vage] sexuelle<br />
Kontakte <strong>und</strong> Beziehungen zu Erwachsenen oft als positiv erleben. Sie suchen neben dem sexuellen As‐<br />
pekt auch Zuneigung, Gefühl <strong>und</strong> Geborgenheit. Ein traumatisierender Einfluss oder Angstgefühle ge‐<br />
genüber Erwachsenen sind nicht nachweisbar. Die spätere sexuelle Triebrichtung wird offenbar nicht<br />
beeinflusst. … Manchmal bleibt die fre<strong>und</strong>schaftliche Verbindung nach der sexuell gefärbten Periode<br />
fortbestehen, in einigen Fällen das ganze Leben. Von schädlichen Folgen kann also nicht gesprochen<br />
werden. Und schließlich: Die Haltung der Gesellschaft [sic!] gegenüber pädophilen Beziehungen wirkt<br />
sich negativ aus. Eine Veränderung ist pädagogisch wünschenswert.“ 14 Die Nürnberger „Indianerkom‐<br />
mune“ forderte 1980 auf dem Karlsruher Parteitag der GRÜNEN, <strong>mit</strong> der Abschaffung des § 175 StGB die<br />
Bestrafung sexuellen <strong>Umgang</strong>s <strong>mit</strong> Kindern (§ 176 StGB) ebenfalls zu streichen 15 (so auch noch einmal<br />
1985 auf einem NRW‐Parteitag 16 ). Günter Amendt nannte dies schändliche Vorhaben beim Namen: „Sie<br />
reden von der ‚Befreiung der Kindheit’, meinen aber nichts anderes als die Freiheit von Erwachsenen,<br />
sexuelle Beziehungen zu Kindern unterhalten zu dürfen.“ 17 Es hagelte Proteste, von den GRÜNEN selber,<br />
die Angelegenheit verschwand von der Tagesordnung.<br />
Diesem b:e‐Artikel waren zustimmende <strong>und</strong> kritische gefolgt; der Strafrechtler Günther Kaiser 18<br />
rückte die Dinge wieder zurecht: Zum einen spotte die Bernard’sche Untersuchung in methodischer Hin‐<br />
len Missbrauch: Adolf Muschg: Nähe ist ein Lebens<strong>mit</strong>tel. In: DER TAGESSPIEGEL, 15.3.2010; dazu Jürgen Kaube in der<br />
FAZ, 17.3.2010, S. 31.<br />
12 Der damalige b:e-Redakteur Peter E. Kalb (später Verlagsleiter des Beltz-Verlags) berichtet, b:e-Chefredakteur Horst Speichert<br />
habe das von ihm, PEK, hinter den Thementitel gesetzte Fragezeichen gestrichen. Das entsprach der These des Eröffnungsbeitrags<br />
von Bernard (s.o.).<br />
13 Fritz Bernard: Pädophilie – eine Krankheit? Folgen für die Entwicklung der kindlichen Psyche. In: b:e 6 (1973), H. 4, S. 21–<br />
23 (<strong>mit</strong> bibl. Nachweis der Originalstudie), hier S. 22.<br />
14 Ebd., S. 23.<br />
15 Bericht aus der Rückschau u.d.T. „Der Urknall“ im TAGESSPIEGEL vom 13.1.2005.<br />
16 Bericht im SPIEGEL 13/1985 S. 47 <strong>und</strong> 50.<br />
17 Ebd., S. 50.<br />
18 Leiter der Forschungsgruppe Kriminologie im MPI für ausländisches <strong>und</strong> internationales Strafrecht in Freiburg i. Br.<br />
Seite 6
sicht jeder Beschreibung, zum andern beantworte sich auf diese Weise doch gar nicht die Frage, „ob<br />
man Kinder den sexuellen Zumutungen der Erwachsenen schutzlos preisgeben soll. Selbst dort, <strong>und</strong> das<br />
ist die Minderheit der Fälle, wo die Initiative vom Kind ausgeht, oder wo eine Art partnerschaftlicher<br />
Beziehung vorliegt, bedarf es der Klärung, ob das Kind nur [?] den Sexualpartner sucht oder vor allem<br />
die väterliche Ersatzperson <strong>und</strong> den Fre<strong>und</strong>, bei dem gegebenenfalls die Sexualbeziehung <strong>mit</strong> in Kauf<br />
genommen wird.“ 19<br />
2. Die pädophile Gefahrenzone<br />
Was da 1973 in b:e als „pädagogisch wünschenswert“ hingestellt wurde, zielte auf nichts anderes als die<br />
Abschaffung u. a. der einschlägigen Strafrechts‐Paragraphen. Was damals sozusagen „Zeitgeist“ war,<br />
konnte man schon zwei Jahre früher Schwarz auf Weiß lesen: Aufgaben des sozialen Lernens in der<br />
Schule seien u. a.<br />
„– Freude am eigenen Körper zu empfinden, zu erhalten <strong>und</strong> zu steigern lernen<br />
– <strong>mit</strong> Genuss<strong>mit</strong>teln, Medikamenten, Drogen, Rausch<strong>mit</strong>teln sinnvoll umgehen lernen (die eigenen Mo‐<br />
tive analysieren können, zwanghaften Bedürfnissen widerstehen lernen, Entscheidungen verantwor‐<br />
tungsbewusst gegenüber sich selbst <strong>und</strong> anderen treffen, lieber zu vorsichtig als zu unvorsichtig sein)<br />
– <strong>mit</strong> der eigenen Triebwelt vertraut <strong>und</strong> ‚befre<strong>und</strong>et’ sein (die Erfahrung der eigenen Triebregungen,<br />
besonders der Aggressivität, der Angst, der <strong>Sexualität</strong>, <strong>mit</strong> Gelassenheit machen können, den Trieben<br />
‚soziale’ Ziele geben können)<br />
– die eigene <strong>Sexualität</strong> bejahen <strong>und</strong> genießen lernen“<br />
Der Text lässt stutzen. Kann das als schulische Erziehungsaufgabe ernst gemeint sein?<br />
• Was ist <strong>mit</strong> dem eigenen Körper? Ein Kind ist sein Leib; es lernt ihn kennen, entdeckt ihn, hat ihn 20 ,<br />
um da<strong>mit</strong> auch bewusst umzugehen. Die eigene Leiblichkeit (<strong>und</strong> Geschlechtlichkeit) wird in einem<br />
psycho‐sozialen Entwicklungs‐ <strong>und</strong> Reifungsprozess erfahren, in dem normalerweise kein Beglei‐<br />
tungs‐, geschweige denn ein Erziehungsauftrag wahrzunehmen ist.<br />
• Den eigenen Körper hat man (in jedem Lebensalter) <strong>mit</strong> mehr oder weniger Selbstverständlichkeit<br />
oder Aufmerksamkeit, mehr oder weniger Akzeptanz oder auch Schwierigkeiten bei Besonderheiten;<br />
unser Körper entwickelt <strong>und</strong> verändert sich ohne unser Zutun, <strong>und</strong> was uns dabei auffällt oder ge‐<br />
fällt oder auch nicht, was uns dabei widerfährt <strong>und</strong> worüber wir uns <strong>mit</strong> uns selber <strong>und</strong> <strong>mit</strong> anderen<br />
verständigen müssen, stellt im Kindes‐ <strong>und</strong> Jugendalter eine spezifische „Entwicklungsaufgabe“ <strong>und</strong> ‐<br />
herausforderung dar: unseren Körper bewohnen <strong>und</strong> den <strong>Umgang</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sexualität</strong> lernen 21 .<br />
19 Günther Kaiser: Ungenau, fragwürdig, zweifelhaft… Bernards Methodengenauigkeit. In: Ebd., S. 29 f., hier S. 30. – Es folgt<br />
dann in diesem b:e-Heft ein Artikel von Jürgen Roth über Kinderheime!<br />
20 Das ist die Plessner’schen Unterscheidung, dass der Mensch ein Leib ist <strong>und</strong> einen Leib hat.<br />
21 Helmut Fend: Entwicklungspsychologie des Jugendalters. Opladen 2000, S. 222 ff., 254 ff.<br />
Seite 7
• Dabei kann <strong>und</strong> darf es keine Erziehungsmaßnahmen im Sinne von fremdbestimmten Manipulierun‐<br />
gen des Erlebens <strong>und</strong> Verhaltens geben, weil es sich hier um einen Bereich der personalen autono‐<br />
men Selbstbestimmung handelt, für dessen Modellierung es im Zweifelsfall um zustimmungspflichti‐<br />
ge Beratung <strong>und</strong> Therapie gehen mag (Zustimmung durch die Erziehungsberechtigten) <strong>und</strong> weil bei<br />
einem Kind eine wissentliche Zustimmung zu einem manipulativen Eingriff in den ihm unbekannten<br />
<strong>und</strong> daher zunächst auch unverstandenen Reifungsprozess seiner <strong>Sexualität</strong> nicht unterstellt werden<br />
kann. 22<br />
• Der <strong>Umgang</strong> <strong>mit</strong> Genuss<strong>mit</strong>teln sollte gelernt werden, gewiss; Medikamente nimmt man nach Vor‐<br />
schrift; Drogen <strong>und</strong> Rausch<strong>mit</strong>tel sind strikt zu meiden, jedenfalls kann <strong>mit</strong> ihnen nicht „sinnvoll“<br />
umgegangen werden, weshalb hier auch nichts zu lernen ist als nur dies: Vermeidung. (Was nicht<br />
heißt, dass es hier nichts zu lernen gibt, wenn der Fall der Suchterkrankung eingetreten ist: Konsum‐<br />
verminderung <strong>und</strong> ‐vermeidung beruhen auf erfolgreichen Lernprozessen.)<br />
• Mit der „eigenen Triebwelt“ kann man als Kind <strong>und</strong> Heranwachsender nicht „vertraut“, sondern eher<br />
wohl verunsichert oder gar verwirrt sein, weshalb man sich gewiss <strong>mit</strong> sich selbst anfre<strong>und</strong>en muss –<br />
aber was heißt das, <strong>und</strong> wie geht das konkret? Und was heißt gar „Gelassenheit“ im höchst prekären<br />
<strong>und</strong> labilen Umbau des psycho‐sozialen „Ich“ in der Pubertät?<br />
• „die eigene <strong>Sexualität</strong> bejahen <strong>und</strong> genießen lernen“ – ja gewiss, aber wann <strong>und</strong> wie <strong>und</strong> –<strong>mit</strong> wem?<br />
Aber unter pädagogischer Anleitung??<br />
Einige der hier zitierten gedanklichen Verirrungen gehen aufs Konto einer rein ideologischen Überdeh‐<br />
nung der damaligen „antiautoritären Erziehung“, die zum einen zwar ganz richtig gegen überkommene<br />
Sexualfeindlichkeit <strong>und</strong> ‐unterdrückung vorging (Oswald Kolle lieferte <strong>mit</strong> seinen Kino‐Filmen die nötige<br />
massenmediale Resonanz), zum andern aber auch berufen zu sein glaubte, „die“ „kindliche <strong>Sexualität</strong>“<br />
„befreien“ zu sollen 23 – „die“: welche? Und „befreien“: wovon <strong>und</strong> wozu? Und kann etwas „befreit“<br />
werden, das erst im Werden ist? Und wie geht man achtsam <strong>mit</strong> der Latenzphase um, der Lebensspanne<br />
der späteren Kindheit im Übergang in die Pubertät?<br />
Angezeigt ist hier eine eingehendere sensible Beschäftigung <strong>mit</strong> der Anthropologie des Kindes in<br />
seinen sensiblen Phasen <strong>und</strong> den entsprechenden Statuspassagen. 24 Es würde sich rasch erweisen, dass<br />
das Ensemble der psychischen Erfahrungen von „Fühlen“ als „Erleben“ <strong>und</strong> als „Selbsterfahrung“ kom‐<br />
22 Sabine Lehmann (FachInstitut für Angewandte Psychotraumatologie FIFAP, Münster i.W.): Traumatisierung von Kindern<br />
<strong>und</strong> Jugendlichen durch sexuelle Gewalt. Typoskr. 2010, S. 28: „Generell gilt: Kinder können aufgr<strong>und</strong> der subtilen Strategien<br />
der Täter bestenfalls willentlich (simple consent), nicht jedoch wissentlich (informed consent) den Sexualhandlungen zustimmen,<br />
da sie a) die Täterstrategie nicht als solche erkennen können <strong>und</strong> ihnen b) das Relevanzbewusstsein fehlt, also die Fähigkeit,<br />
Bedeutungen <strong>und</strong> langfristige Konsequenzen der – manipulativ erwirkten Zustimmung – angemessen einzuschätzen. Das<br />
bedeutet: Es gibt keine einvernehmlichen Sexualkontakte zwischen Kindern <strong>und</strong> Erwachsenen! Sie sind von einem Erwachsenen<br />
unter Ausnutzung des kindlichen Vertrauens <strong>und</strong> kindlicher Neugier absichtsvoll herbei geführt, um sich selbst sexuell zu<br />
befriedigen.“ (Hervorheb. im Orig.)<br />
23 Anleitung für eine revolutionäre Erziehung herausgegeben vom Zentralrat der sozialistischen Kinderläden West-Berlin, Nr.<br />
4: Annie Reich: Für die Befreiung der kindlichen <strong>Sexualität</strong>. O.O., o. J. – Hierher gehört auch die damalige Wiederentdeckung<br />
der Psychoanalytischen Pädagogik, vgl. zuletzt: Johannes Bilstein: Psychoanalyse <strong>und</strong> Pädagogik: Kritische Theorie des Subjekts<br />
<strong>und</strong> Antiautoritäre Erziehung. Die Wiederaneignung der Psychoanalytischen Pädagogik in pädagogischen Diskursen der<br />
später 1960er- <strong>und</strong> frühen 1970er-Jahren. In: Baader/Herrmann 2011 (wie Anm. 4), S. 217–231.<br />
24 Ein immer noch unterbelichtetes Thema z. B. in Handbüchern. Statt vieler: Rolf Oeter/Leo Montada (Hrsg.): Entwicklungspsychologie.<br />
Weinheim/Basel 6 2008, darin sehr summarisch Kap. 26: Jochen Hardt/Anette Engfer: Vernachlässigung, Misshandlung<br />
<strong>und</strong> Missbrauch von Kindern, S. 803 ff., Abschn. 4: Sexueller Missbrauch, S. 812–821.<br />
Seite 8
plexer Natur ist („ganzheitlich“) <strong>und</strong> sich im Verlauf des Kindesalters in allen Bereichen von körperlicher<br />
<strong>und</strong> emotionaler „Zuwendung“ nicht in eindimensionale Dimensionen von z. B. „Zuneigung“ oder „Ver‐<br />
traulichkeit“, „Liebe“ oder „Erotik“ bzw. „<strong>Sexualität</strong>“ usw. auflösen lässt. Der Erfahrungsmodus des „In‐<br />
newerdens“ (Erlebens) dieser Empfindungen unterscheidet nämlich die verschiedenen Komponenten<br />
<strong>und</strong> Medien der Erfahrung gar nicht, das Erleben ist eine ganzheitliche Gestimmtheit eines Wohlbefin‐<br />
dens aufgr<strong>und</strong> einer Beziehungsqualität von Person zu Person, die sich über „Angenommensein“, „Zu‐<br />
flucht“ <strong>und</strong> „Geborgenheit“, „Wärme“ <strong>und</strong> „Sicherheit“ einstellt <strong>und</strong> vor allem auch in körperlicher Nä‐<br />
he erlebt wird. Diese Nähe, die nur Schutz <strong>und</strong> keine Zumutung oder Herausforderung <strong>mit</strong>teilt, ist ab‐<br />
sichtslos <strong>und</strong> selbstlos. Pestalozzi nannte dies die Mutterliebe: Sie will für sich nichts, für das Kind alles.<br />
Bei der Pädophilie verhält es sich genau umgekehrt!<br />
3. Der Straftatbestand<br />
Mit „körperlicher Nähe“ bewegen wir uns nicht nur in einer potentiellen Gefahrenzone: Es kann sich<br />
auch um einen Sachverhalt handeln, der in § 176 StGB formuliert ist:<br />
Sexueller Missbrauch von Kindern<br />
(1) Wer sexuelle Handlungen an einer Person unter 14 Jahren (Kind) vornimmt oder an sich von dem<br />
Kind vornehmen lässt, wird <strong>mit</strong> Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 10 Jahren bestraft.<br />
(2) Ebenso wird bestraft, wer ein Kind dazu bestimmt, dass es sexuelle Handlungen an einem Dritten<br />
vornimmt oder von einem Dritten an sich vornehmen lässt.<br />
(3) in besonders schweren Fällen ist auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr zu erkennen.<br />
(4) Mit Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 5 Jahren wird bestraft, wer<br />
1. sexuelle Handlung vor einem Kind vornimmt,<br />
2. ein Kind dazu bestimmt, dass es sexuelle Handlungen vornimmt, soweit die<br />
Tat nicht nach Absatz 1 oder Absatz 2 <strong>mit</strong> Strafe bedroht ist,<br />
[…]<br />
(5) […]<br />
(6) Der Versuch ist strafbar […].<br />
Was das Strafgesetzbuch hier definiert <strong>und</strong> sanktioniert, sind Straftaten, die die „Beeinträchtigung der<br />
Freiheit sexueller Selbstbestimmung durch Eingriffe in die sexuelle Entwicklung“ von Kindern (i. S. der<br />
formaljuristischen Definition Personen unter 14 Jahren) zur Folge haben oder haben können 25 – die Be‐<br />
einträchtigung ist eine „<strong>mit</strong>telbare Bedrohung“, weil ihre Folgen erst sehr viel später auftreten können 26<br />
–, so dass es hier im Kern um den „Schutz Minderjähriger vor Eingriffen in ihre ungestörte sexuelle Ent‐<br />
25 Karl Heinz Gössel: Das neue Sexualstrafrecht. Berlin 2005, zu §§ 176 ff. hier S. 159 ff.<br />
26 Weshalb die derzeit geltende Verjährung abzuschaffen ist.<br />
Seite 9
wicklung“ geht 27 . Der Gesetzgeber unterstellt – im Lichte dieser Auslegung – als Norm der Selbstbe‐<br />
stimmung die „ungestörte“ Entwicklung für die autonome Selbstentwicklung, so dass die Tathandlung<br />
der „Störung“ den Straftatbestand ausmacht <strong>und</strong> es zum Zeitpunkt eines Strafverfahrens nicht um die<br />
akuten, sondern (auch) um die gar nicht absehbaren oder womöglich gar nicht eintretenden Folgen der<br />
Straftat beim Opfer geht. Folgerichtig ist der Versuch strafbar.<br />
Alles was – <strong>mit</strong> Pestalozzi – die ganzheitliche „Gr<strong>und</strong>besorgung“ des Kindes in sexueller Hinsicht<br />
überschreitet, „lässt sich nicht als Ausdruck von Pädagogik rechtfertigen. Es handelt sich um kriminelle<br />
Verfehlungen […] Das Vergehen wiegt so ungemein schwer, weil es von Pädagogen gegenüber Schutzbe‐<br />
fohlenen begangen wird. Bei sexuellem Missbrauch handelt es sich um die willentliche ausbeutende<br />
Zerstörung derjenigen, denen der Erwachsene <strong>mit</strong> Zuneigung begegnet. Diese dient nicht dem Wohl der<br />
Kinder, sondern wird dazu eingesetzt, diese sich zu Diensten zu machen.“ 28<br />
4. Ein Täter<br />
Mir dieser Feststellung kehren wir zu dem Text über die angeblichen Aufgaben der Sexualerziehung in<br />
der Schule zurück <strong>und</strong> fragen nach seinem Autor. Es handelt sich um Gerold Becker, zum Zeitpunkt sei‐<br />
ner Veröffentlichung (1971) seit zwei Jahren Lehrer an der Odenwaldschule, ein Jahr später deren Leiter.<br />
Nach dem, was wir heute über ihn wissen, lassen sich diese Zeilen auch anders lesen, nämlich<br />
• als Rechtfertigung pädophilen <strong>Umgang</strong>s <strong>mit</strong> Kindern <strong>und</strong> Heranwachsenden, gradezu als eines päda‐<br />
gogischen Auftrags, Kinder „Freude am eigenen Körper empfinden“ zu lassen <strong>und</strong> sie „<strong>mit</strong> der eige‐<br />
nen Triebwelt vertraut“ zu machen – durch ihn nämlich, was in Wahrheit aber nichts anderes war als<br />
die Befriedigung seiner eigenen sexuellen Bedürfnisse.<br />
• Sie offenbaren vielleicht auch ungewollt das Gr<strong>und</strong>problem ihres Urhebers, das er nicht in den Griff<br />
bekam: „zwanghaften Bedürfnissen widerstehen lernen“ 29 ;<br />
• sie offenbaren ungewollt Beckers Vorgehensweise, sich an Kinder heranzumachen: er verschaffte<br />
ihnen Genuss<strong>mit</strong>tel <strong>und</strong> (den Zugang zu) Drogen, erlaubte ihren (auch exzessiven) Genuss <strong>und</strong> auch<br />
andere Dinge, die in anderen OSO‐Familien nicht erlaubt waren 30 .<br />
27 Ebd. (wie Anm. 25).<br />
28 Gruschka (wie Anm. 7), S. 6<br />
29 Becker hatte eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, seine Pädophilie ist in der internationalen Klassifikation der Krankheiten<br />
(ICD-10-GM 2010) unter DSM-IV-TR aufgeführt. – Vgl. RA Claudia Burgsmüller (Wiesbaden)/Brigitte Tilmann<br />
(Darmstadt, Präsidentin a. D. des OLG Frankfurt/M.): Abschlussbericht über die bisherigen Mitteilungen über sexuelle Ausbeutung<br />
von Schülern <strong>und</strong> Schülerinnen an der Odenwaldschule im Zeitraum 1960 bis 2010. Vervielf. Typoskr. Wiesbaden/Darmstadt<br />
2010. – DSM-IV als Klassifikation <strong>und</strong> Diagnose psychischer Störungen ist nicht unangefochten anerkannt.<br />
30 Mitteilung des ehemaligen OSO-Lehrers Dr. Salman Ansari (Heppenheim) an den Vf. – Dr. Ansari hatte darauf gedrungen,<br />
dass die „Familien“-Praxis der Becker-Familie sich ändern müsse. Daraufhin war ihm das Verlassen der Schule nahegelegt<br />
worden. – Dr. Ansari weist im übrigen darauf hin, dass er zu diesem Zeitpunkt (1976) seiner Intervention von sexuellem Missbrauch<br />
in der Becker-Familie keine Ahnung hatte <strong>und</strong> dass sich niemand in der OSO diesen Missbrauch in dieser Form <strong>und</strong><br />
Seite 10
In dieses Bild von Beckers „Täterstrategien“ passt genau dasjenige, was die Auswertung der einschlägi‐<br />
gen Literatur ergibt 31 :<br />
1. Bedingungen schaffen, die sexuelle Gewalt ermöglichen<br />
• Wahl eines Berufs, der <strong>mit</strong> Kindern zu tun hat<br />
• sich als „Kinderfre<strong>und</strong>“ herausheben <strong>und</strong> Vertrauen schaffen<br />
• Kinder aussuchen, die leicht zu manipulieren sind bzw. von sich aus auf der Suche<br />
nach Nähe <strong>und</strong> Bindung sind („Vaterfigur“, Anerkennung durch einen männlichen Erwachse‐<br />
nen)<br />
Gerold Becker wurde Pädagoge, wurde als Kinderfre<strong>und</strong> <strong>und</strong> charismatischer Erzieher wahr‐<br />
genommen. Die OSO als unter seiner Leitung betriebene Einrichtung der Jugendhilfe sorgte<br />
für Zugang von Kindern, deren Anfälligkeit <strong>und</strong> Verfügbarkeit Becker in seinem Sinne beein‐<br />
flussen <strong>und</strong> schließlich missbrauchen konnte.<br />
2. Annäherung an das/die Opfer <strong>und</strong> „Einschleichen“ in sexuelle Gewalt<br />
• Vertrauen gewinnen<br />
• Bevorzugungen spüren lassen<br />
• Isolierung des Opfers<br />
• Geheimhaltung<br />
Gerold Becker operierte <strong>mit</strong> Bevorzugungen (<strong>und</strong> dem Gegenteil: Androhungen); eine Geheim‐<br />
haltung gelang im Herder‐Haus der OSO dadurch, dass ein Komplize als „Familienhaupt“ die an‐<br />
dere Wohnung im Herder‐Haus ebenso wie Becker für sexuelle Gewalt (nicht nur) gegenüber<br />
Kindern seiner „Familie“ nutzte. – Beide „Familienhäupter“ fungierten als solche ohne einen<br />
zweiten Erwachsenen: Kontrolle entfiel, Geheimhaltung war erleichtert. 32<br />
3. Zugang zum Opfer <strong>und</strong> dauerhafte Verfügbarkeit<br />
• Verführung<br />
• die Wahrnehmung des Geschehens verwirren <strong>und</strong> vernebeln<br />
• das/die Opfer kontrollieren<br />
• den Missbrauch zum gemeinsamen Geheimnis erklären <strong>und</strong> das/die Opfer zum Schweigen<br />
bringen<br />
• eine „Täterlobby“ schaffen<br />
diesem Ausmaß hätte vorstellen können. – Dr. Ansari ist die einzige Vertrauensperson aus dem Kollegium der OSO, das von<br />
den Missbrauchsbetroffenen zu den ersten Berichten an Dritte beigezogen wurde.<br />
31 Lehmann 2010 (wie Anm. 22), S. 17 ff., nach A. Heiliger: Täterstrategien <strong>und</strong> Prävention. Sexueller Missbrauch an Mädchen<br />
innerhalb familialer <strong>und</strong> familienähnlicher Strukturen. München 2000. – Analoge Ausführungen auch bei RA Ursula<br />
Raue: Bericht über Fälle sexuellen Missbrauchs an Schulen <strong>und</strong> anderen Einrichtungen des Jesuitenordens, 27. Mai 2010.<br />
Vervielf. Typoskript 2010. – Der Bericht „Sexuelle <strong>und</strong> sonstige körperliche Übergriffe durch Priester, Diakone <strong>und</strong> sonstige<br />
pastorale Mitarbeiter im Verantwortungsbereich der Erzdiözese München <strong>und</strong> Freising in der Zeit von 1945 bis 2009. Bestandsaufnahme<br />
– Bewertung – Konsequenz“ der RA-Kanzlei Westphahl u. Koll. (München) ist der Öffentlichkeit nicht zugänglich;<br />
Kernaussagen in einer Presse<strong>mit</strong>teilung vom 3.12.2010 (im Internet).<br />
32 Was „man“ in der Odenwaldschule über die Straftaten einzelner Lehrer gem. § 176 StGB wissen konnte bzw. wusste <strong>und</strong><br />
was nicht – darüber gibt es irritierend abweichende glaubhafte Äußerungen. In vielen Fällen wird das Nichtwissen nicht zuletzt<br />
darauf zurückzuführen sein, dass eine Vorstellung davon fehlte, was eigentlich vor sich ging!<br />
Seite 11
Die Verführung geschah emotional durch besondere Zuwendung <strong>und</strong> Anerkennung, materiell<br />
durch Ermöglichung des Zugangs zu Genuss<strong>mit</strong>teln <strong>und</strong> Drogen, durch Geschenke usw.<br />
Opfer schweigen aus Scham, Sprachlosigkeit (Verwirrung), Angst vor Verlust einer aus anderen<br />
Gründen starken Beziehung<br />
Opfer konnten zum Schweigen gebracht werden durch angedrohte Wegweisung von der Schule<br />
Gerold Becker konnte eine „Täterlobby“ dadurch wenn nicht schaffen, so doch stabilisieren, dass<br />
er als Mitglied des Aufsichtsgremiums der OSO seine Kontrolle als Schulleiter durch dieses Gre‐<br />
mium selber kontrollieren konnte. Da es auch keine hauptamtliche Heimleitung für das OSO‐<br />
Internat gab (<strong>und</strong> bis heute nicht gibt), entfiel eine zweite mögliche Kontrollinstanz.– Und dritte<br />
<strong>und</strong> weitere waren nicht vorgesehen. Und so nahm das Unheil seinen Lauf.<br />
Diese <strong>und</strong> noch aufzuklärende „Täterstrategien“ erlauben es, von einem „System“ zu sprechen, das Be‐<br />
cker aufbaute <strong>und</strong> in dem er sich bewegen konnte, so dass Burgsmüller/Tilmann hinsichtlich der sexuel‐<br />
len Gewalt im Sinne der §§ 174 <strong>und</strong> 176 StGB von einem „geschlossenen System der Odenwaldschule“<br />
sprechen. 33 Ob <strong>und</strong> inwieweit <strong>und</strong> warum es „geschlossen“ war, gehört zu den vorrangig aufklärungsbe‐<br />
dürftigen Sachverhalten dieses gesamten Komplexes 34 , besonders auch im Lichte des Sachverhalts, dass<br />
Pädophile in der Regel (extreme) Wiederholungstäter sind: „Nicht viele Täter missbrauchen einzelne<br />
Kinder, sondern einzelne Täter missbrauchen viele Kinder.“ 35<br />
5. Ein Tatort<br />
Die Aufarbeitung dieses Themas darf nicht bedeuten, sich nur auf Täter <strong>und</strong> Opfer zu konzentrieren –<br />
Interaktionen, Intentionen, Folgen usw. –, sondern muss die Tatorte <strong>mit</strong> in den Blick nehmen. Es geht ja<br />
bei Tätern nicht nur um das, was sie wollten, taten <strong>und</strong> bewirkten, <strong>und</strong> bei den Opfern nicht nur um das,<br />
was sie erdulden mussten <strong>und</strong> was ihnen als Folgewirkungen auferlegt wurde. Sexuelle Gewalttaten in<br />
Institutionen haben auf der einen Seite eindeutige Verursacher (die belangt werden können), auf der<br />
anderen Seite aber immer auch institutionelle strukturelle <strong>und</strong> systemische Ermöglichungs‐ <strong>und</strong> Gelin‐<br />
gensbedingungen, die in den Blick genommen werden müssen, wenn künftig in Institutionen sexueller<br />
Gewaltanwendung wirksam Einhalt geboten werden soll.<br />
Der Tatort ist nicht der Täter. Täter können immer nur Personen sein, nur sie führen Handlungen<br />
aus <strong>und</strong> haben sie zu verantworten. Es gibt keinen verursachenden Zusammenhang zwischen sexueller<br />
Gewalt <strong>und</strong> Reform‐ bzw. Landerziehungsheim‐Pädagogik. Zu fragen ist aber nach ermöglichenden oder<br />
erschwerenden, begünstigenden oder verhindernden Strukturen <strong>und</strong> pädagogischen Praxen in Lander‐<br />
33 Wie Anm. 29, S. 25.<br />
34 So auch Gruschka (wie Anm. 7), S. 15.<br />
35 Burgsmüller/Tilmann 2010 (wie Anm. 29), S. 8.<br />
Seite 12
ziehungsheimen (<strong>und</strong> nicht nur dort). Mit anderen Worten: Die Unterstellung eines Zusammenhangs<br />
„sexueller Missbrauch <strong>und</strong> Reformpädagogik“ bzw. „Landerziehungsheim“ soll nicht einfach als Unter‐<br />
stellung <strong>und</strong> Denunziation zurückgewiesen werden, sondern es soll gefragt werden, um welche Struktu‐<br />
ren <strong>und</strong> Praxen es geht, wenn – in unserem Zusammenhang – Täter Täter <strong>und</strong> Opfer Opfer werden.<br />
Ein Landerziehungsheim oder ein Internat gehört wahrscheinlich zu einem bevorzugten potenti‐<br />
ellen Tatort für (pädophile) sexuelle Gewalttäter. Peter Dudek stellt <strong>mit</strong> Recht fest: „Landerziehungs‐<br />
heime oder kirchliche Einrichtungen nach den jüngsten Erkenntnissen nun unter Generalverdacht zu<br />
stellen, wäre fahrlässig. Die Fälle als Einzelfälle abzutun ebenso. Der Zusammenhang ist weder zufällig<br />
noch zwangsläufig.“ 36 Wie konnte die Odenwaldschule – oder ein beliebiges anderes Landerziehungs‐<br />
heim oder Internat – Tatort werden? Es sollen zwei Strukturmerkmale hervorgehoben werden:<br />
(1) Die Reformpädagogik übernahm aus der Jugendbewegung das Erlebnis der Fre<strong>und</strong>schaft <strong>und</strong> Kame‐<br />
radschaft als Leitbild des Lehrers: Fre<strong>und</strong> <strong>und</strong> Helfer „im Dienst der werdenden Persönlichkeit“ (Gaudig<br />
1917), <strong>und</strong> vor allem in der Sozialarbeit hieß das „Leitbild: Kamerad <strong>und</strong> Helfer“ 37 . Konnte durch „Kame‐<br />
radschaft“ das Verhältnis der Geschlechter ein Stück weit entsexualisiert werden, trat <strong>mit</strong> der männer‐<br />
bündischen Fre<strong>und</strong>schaft das Phänomen der homoerotischen Beziehungen auf, sei es aufgr<strong>und</strong> direkter<br />
libidinöser Gefühle, sei es, weil Kontakte zu Mädchen nicht möglich oder erlaubt waren oder wegen an‐<br />
steckender Geschlechtskrankheiten gemieden wurden. 38 Fre<strong>und</strong>schaft wurde <strong>und</strong> wird empf<strong>und</strong>en als<br />
die Erweiterung des Ich durch ein Du in einem Gleichklang der Interessen, Gefühle <strong>und</strong> Erlebnisse,<br />
Selbst‐ <strong>und</strong> Weltdeutungen. Deshalb ist sie besonders für die „Suchenden“ im Jugendalter so wichtig,<br />
weil Fre<strong>und</strong>schaft Stabilisierung <strong>und</strong> Entfaltung, Selbstvergewisserung <strong>und</strong> Klärung von Selbstzweifel<br />
bedeutet, so dass eine lebenslange innige Beziehung bestehen bleiben kann. 39<br />
(2) Die Landerziehungsheime übernahmen das Prinzip der „pädagogischen Familie“ anstelle der Form<br />
einer Unterbringung wie in Heimen oder Klosterschulen: die Kinder/Schüler in Schlafsälen, getrennt vom<br />
Privatleben des pädagogischen Personals. Wenn das Zusammenleben familienförmig organisiert wird,<br />
dann wird <strong>mit</strong> der Verwirklichung eines sinnvollen pädagogischen Konzepts zugleich ein Problem instal‐<br />
liert. Die „natürliche“ <strong>und</strong> die „pädagogische“ Familie sind Orte des Schutzes <strong>und</strong> der Gefährdung: der<br />
Ort der häufigsten sexuellen Übergriffe <strong>und</strong> Missbrauchsfälle ist nämlich die Familie. Sie ist im Normal‐<br />
fall für Kinder <strong>und</strong> Heranwachsende der sichere Hafen der Gefühle <strong>und</strong> des Vertrauens, der Geborgen‐<br />
heit <strong>und</strong> der Zuflucht. Misstrauen gegen das, was Vater <strong>und</strong> Mutter <strong>und</strong> andere Familienangehörige tun<br />
<strong>und</strong> unterlassen, wird hier nicht gelernt. Deshalb sind die zunächst vertrauensseligen <strong>und</strong> dann miss‐<br />
brauchten Kinder <strong>und</strong> Heranwachsenden ihrem Unheil <strong>und</strong> ihren Peinigern mehr oder weniger schutzlos<br />
ausgeliefert. Ausweich‐ oder Fluchtmöglichkeiten gibt es praktisch nicht. Die Vergehen an den Kindern<br />
36 Peter Dudek: Abschied vom pädagogischen Eros. In: DER TAGESSPIEGEL (Berlin), 18.3.2010.<br />
37 So der Titel des Buches von Peter Dudek über die Gilde Soziale Arbeit (Frankfurt/M. 1988).<br />
38 Dazu immer noch sehr lesenswert: Elisabeth Busse-Wilson: Stufen der Jugendbewegung. Jena 1925, darin bes. Liebe <strong>und</strong><br />
Kameradschaft, S. 93 ff. sowie über George <strong>und</strong> Wyneken im Kap. „Die Religionen des 20. Jhs. <strong>und</strong> ihre Wirkung auf die<br />
Jugendbewegung“, S. 124 ff. – Über die Vfn. vgl. die biographischen Bemerkungen von Irmgard Klönne in dem von ihr hrsg.<br />
Nachdruck von E. Busse-Wilson: Die Frau <strong>und</strong> die Jugendbewegung. Zuerst Hamburg 1920, Münster i.W. 1988, S. 113 ff.<br />
39 Vgl. Art. Fre<strong>und</strong>schaft, Abschn. III, 3, von Ch. Seidel, in: Histor. WB der Philos. 2 (1972), Spp. 1113 f., <strong>mit</strong> dem wichtigen<br />
Hinweis auf Tenbruck. – Ulfried Geuter: Homosexualität in der deutschen Jugendbewegung. Jungenfre<strong>und</strong>schaft <strong>und</strong> <strong>Sexualität</strong><br />
im Diskurs von Jugendbewegung, Psychoanalyse <strong>und</strong> Jugendpsychologie am Beginn des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts. Frankfurt/M.<br />
1994.<br />
Seite 13
sind von einer Mauer des Wegsehens <strong>und</strong> des schamvollen Verheimlichens umgeben: der „gute Ruf“ der<br />
Familie soll keinen Schaden nehmen.<br />
Die Familie ist eine Institution <strong>mit</strong> geringer Außenkontrolle, die Eingriffsmöglichkeiten z. B. der Jugend‐<br />
ämter sind sehr begrenzt. Und so geschehen Übergriffe <strong>und</strong> sexueller Missbrauch auch in analogen Insti‐<br />
tutionen <strong>mit</strong> geringer Außenkontrolle: in Klöstern, Kasernen <strong>und</strong> Gefängnissen, bei den Pfadfindern <strong>und</strong><br />
in Sportvereinen, in Landerziehungsheimen <strong>und</strong> Klosterschulen, in Waisenhäusern <strong>und</strong> Kinderheimen.<br />
(Übrigens geschehen Übergriffe <strong>und</strong> Missbrauch dort auch in den (unkontrollierten bzw. unkontrollier‐<br />
baren) Konstellationen Gleichaltriger, so dass z. B. der Ausschluss der Erwachsenen aus der Struktur <strong>und</strong><br />
den Häusern der Wohngemeinschaften, den „Kameraden“‐Familien, für sich genommen noch keine Si‐<br />
cherheitsgewähr darstellt.) In der Institutionensoziologie heißen diese Institutionen <strong>mit</strong> Erving Goffman<br />
bekanntlich „totale“. 40 Die in „totalen Institutionen“ in Abhängigkeit <strong>und</strong> sehr eingeschränkten Außen‐<br />
kontakten 41 lebenden Menschen – Internatsschüler, Strafgefangene, Rekruten usw. – haben aus mehre‐<br />
ren Gründen wenig Schutz vor sexueller Gewalt; denn es gibt, von Ausnahmen abgesehen, kaum bzw.<br />
keine Möglichkeiten des internen Ausweichens oder der Flucht nach außen. Durch internes Ausweichen,<br />
sofern überhaupt möglich, droht die Gefahr des Außenseitertums, was verstärkte <strong>und</strong> vermehrte Ge‐<br />
fährdung bedeuten kann; die Flucht nach außen setzt eine Auffangstation voraus, die im Zweifel nicht<br />
gegeben ist. Im Falle der Odenwaldschule: Jemand konnte sich vielleicht zur Wehr setzen <strong>und</strong> die „Fami‐<br />
lie“ wechseln, aber um welchen Preis? Woher hätten, je nach biographischem Hintergr<strong>und</strong>, Mut <strong>und</strong><br />
Stärke, aber auch ermutigende <strong>und</strong> beschützende Unterstützung kommen können? Hier müsste es übri‐<br />
gens heißen: herkommen müssen! Wo waren die Eltern? 42 Und welche Chancen hatten jene Kinder, für<br />
die die Odenwaldschule selber die letzte Auffangstation war? Welches Kind, welcher Halbwüchsige kann<br />
sich <strong>mit</strong> seiner beschämenden Beschädigung welchem Erwachsenen anvertrauen? Zumal wenn er ja<br />
wohl weiß, dass er <strong>mit</strong> seinem Problem hinter einer Mauer des Beschweigens <strong>und</strong> einer „Kultur“ – rich‐<br />
tiger: einer Unkultur – des Wegsehens alleingelassen ist? Und dass er sich vielleicht auch dankbar, min‐<br />
40<br />
Erving Goffman: Asyle. Über die soziale Situation psychiatrischer Patienten <strong>und</strong> anderer Insassen. (Aus dem Amerikan.,<br />
Chicago 1961) Frankfurt/M. 1972 (u.ö.) – RA Ursula Raue schreibt in ihrem „Bericht“ (wie Anm. 31 ), S. 21: „Der Eindruck<br />
drängt sich auf, dass sich die kirchliche Einrichtung <strong>mit</strong> ihren eigenen, spirituellen Erziehungs- <strong>und</strong> Bildungsidealen im quasi<br />
geschlossenen Raum glaubte genügen zu können.“ Dieser „geschlossene Raum“ mag einer (durchaus bedenklichen) pädagogischen<br />
„Selbstgenügsamkeit“ entsprochen haben, funktional aber war er eine wichtige Voraussetzung für die Vorgehensweisen<br />
einer „totalen Institution“, in der nicht nur Täter zu Tätern <strong>und</strong> Opfer zu Opfern werden konnten, sondern sexueller Missbrauch<br />
verheimlicht werden konnte.<br />
41<br />
Im Hinblick auf Landerziehungsheime <strong>und</strong> Internate ist dies heute durch die Möglichkeiten der Handy- <strong>und</strong> Internet-<br />
Kommunikation beträchtlich zu relativieren.<br />
42<br />
Johannes von Doynanyi: Die Kälte der Eltern. Missbrauch im Internat: Warum manche Väter <strong>und</strong> Mütter <strong>mit</strong>schuldig sind.<br />
Eine Anklage. In: DIE ZEIT Nr. 16, 15.4.2010, S. 8. – Kerstin Kohlenberg: „Das bedauere ich“. Alexander Drescher wurde an<br />
der Odenwaldschule missbraucht. Er ist sich sicher: Seine Eltern wussten davon – <strong>und</strong> schwiegen. In: Ebd.<br />
Seite 14
destens aber nach außen loyal zu verhalten hat, um den „guten Ruf“ der Odenwaldschule nicht zu<br />
schädigen?<br />
Dies sind einige Komponenten der Prozesse in „totalen Institutionen“, die Goffman begrifflich so<br />
gefasst hat: Anpassung, Kolonisierung (Umprägung des Selbstbewusstseins), Loyalisierung. Dabei han‐<br />
delt es sich um massive Zwänge, <strong>und</strong> das angestrebte <strong>und</strong> in vielen Fällen auch erzielte Ergebnis ist die<br />
„Beschränkung des Selbst“, richtiger: eine Beschädigung des Selbst. Mit der Einrichtung eines Lander‐<br />
ziehungsheims <strong>und</strong> <strong>mit</strong> der familienförmigen Organisation des Zusammenlebens von Erwachsenen <strong>und</strong><br />
Heranwachsenden 43 wird <strong>mit</strong> „Familie“ neben dem emotionalen Schutzraum auch ein Gefährdungs‐<br />
raum 44 installiert. Dies nicht von Anbeginn an bedacht zu haben, ist ein Vorwurf, den sich die damaligen<br />
Gründer <strong>und</strong> die heutigen Betreiber dieser (<strong>und</strong> verwandter) Einrichtungen gefallen lassen müssen.<br />
Denn <strong>mit</strong> „Familie“ kann leicht eine Verwischung des Problems von Nähe <strong>und</strong> Distanz einhergehen. Ar‐<br />
min Lüthi, ehemaliger Leiter der von Geheeb gegründeten École d’Humanité in Goldern im Berner Ober‐<br />
land, suchte daher (erfolglos) nach einer anderen Bezeichnung für Wohngemeinschaft anstelle von<br />
„Familie“; denn: „Es ist keine Familie, es soll keine sein. Wir sind Angestellte. Das darf man nicht verges‐<br />
sen.“ 45 Was nichts anderes heißt als: Liebe <strong>und</strong> Zuneigung zwischen Eltern <strong>und</strong> Kindern <strong>und</strong> Geschwis‐<br />
tern untereinander müssen sich unterscheiden von denen zwischen Lehrern bzw. Erziehern <strong>und</strong> Schü‐<br />
lern bzw. Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen im Internat, sie müssen unterschiedliche Ausdrucksformen <strong>und</strong><br />
Grenzen beachten. –<br />
Bei den bisherigen Ausführungen konnte es sich nur um erste Annäherungen an eine Täterstra‐<br />
tegie <strong>und</strong> einen Tatort handeln. Eine genauere Analyse steht noch aus. Sie ist unerlässlich für die Etab‐<br />
lierung eines wirksamen Systems von Prävention <strong>und</strong> Intervention, Supervision, Beratung <strong>und</strong> Kontrol‐<br />
le. 46 Eines sollte klar geworden sein: Nicht reformpädagogische Ideen oder Praxen stehen hier auf dem<br />
Prüfstand, sondern die Konstruktionsmerkmale einer „totalen Institution“, in der sexuelle Gewalt mög‐<br />
lich ist. Und da dabei das Landerziehungsheim kein Alleinstellungsmerkmal hat, kann der Bezug auf Re‐<br />
formpädagogik zur Klärung nichts beitragen.<br />
43 Woran nach eigenem Bek<strong>und</strong>en die derzeitigen OSO-Schülerinnen <strong>und</strong> -Schüler unbedingt festhalten wollen.<br />
44 Dieser Gefährdungsraum ergibt sich baulich – auch dies eine entscheidende Ermöglichungsbedingung für sexuelle Übergriffe<br />
bzw. Missbrauch – schon dadurch, wenn keine Räume vorhanden sind, zu denen auch in einer Wohn-„Familie“ die Erwachsenen<br />
keinen Zutritt haben.<br />
45 Zit. in: Michèle Roten: Die Schule als Lebensgemeinschaft. Wie nah dürfen sich Schüler <strong>und</strong> Lehrer sein? In: DAS MAGA-<br />
ZIN [Wochenendbeilage schweizer Tageszeitungen] 23/2010, S. 15–23, hier S. 20.<br />
46 Annette Haardt-Becker/Julia von Weiler: Proaktiver <strong>Umgang</strong> <strong>mit</strong> dem Thema „(sexuelle) Gewalt in Institutionen“ am Beispiel<br />
der stationären Jugendhilfe. Broschüre von Innocence in danger. Köln 2010.<br />
Seite 15
6. „Pädagogischer Eros?“<br />
Es gibt Pädagogen, die diesen Verstoß gegen das pädagogische Ethos des Erziehers <strong>mit</strong> dem Verweis auf<br />
den „pädagogischen Eros“ herunterspielen wollen. Unter Bezugnahme auf die antike Knabenliebe wur‐<br />
de die libidinöse Beziehung (wenn sie es denn war) zwischen „Erzieher <strong>und</strong> Zögling“ zu einer auch in die<br />
„platonische“ <strong>Sexualität</strong> hineinreichenden überhöht: „Dann aber wird man auch fühlen, dass hier der<br />
Leib ganz andere Geltung hat als in der Welt; dass er ganz un<strong>mit</strong>telbar in das Leben (in das geistige Le‐<br />
ben) dieser Gemeinschaft [seiner Freien Schulgemeinde Wickersdorf] <strong>mit</strong> einbezogen ist. […] Leib ist<br />
Entfaltung der einsam in sich verschlossenen Seele im Raum […], er ist Aufblühen in Farbe <strong>und</strong> Klang, in<br />
Bindungen <strong>und</strong> Schwingungen, er ist Gnade, Hingabe, Liebe, Schönheit, Glück. […] wir wissen, dass der<br />
Liebesb<strong>und</strong> der Knaben <strong>mit</strong> seinem Führer das Schönste ist, was der Jugend beschieden sein kann.“<br />
So schrieb Gustav Wyneken 1921 in seiner „Eros“‐Schrift 47 , <strong>mit</strong> der er sich gegen die Verurteilung<br />
wegen sexueller Übergriffe durch das Landgericht Rudolstadt rechtfertigen wollte. 48 Das Thema gleich‐<br />
geschlechtlicher homoerotischer (<strong>und</strong> keineswegs per se homosexueller) Beziehungen lag gleichsam in<br />
der Luft, nachdem Hans Blüher die Wandervogelbewegung als „erotisches Phänomen“ <strong>und</strong> allgemeiner<br />
die Rolle der Erotik in männerbündischen Gesellungsformen analysiert hatte. 49 Für die Zeitgenossen war<br />
das Phänomen der homoerotischen Beziehungen entwicklungs‐ <strong>und</strong> jugendpsychologisch unter dem<br />
Gesichtspunkt der „Normalität“ der psycho‐sozialen Entwicklung im Jugendalter nicht recht interpre‐<br />
tierbar, weil dieses männerbündische Verhalten neu <strong>und</strong> ungewohnt <strong>und</strong> so<strong>mit</strong> unklar war, ob eine<br />
gleichgeschlechtliche libidinöse homoerotische (nicht homosexuelle!) Beziehung zur Normalität dieser<br />
Reifungsphase gehören könne bzw. ohnehin nur eine Passage in der Entwicklung zur „normalen“ Hete‐<br />
rosexualität darstelle. William Stern führt die „’Inversions’‐Welle“ auf die psycho‐soziale Instabilität der<br />
Wandervogel‐Generation vor, im <strong>und</strong> nach dem Ersten Weltkrieg zurück. 50<br />
Ein aufschlussreiches Beispiel dafür ist „Eros. Ein Gespräch“ von Felix Oehler in der in Basel erscheinen‐<br />
den Zeitschrift der schweizerischen Studentenschaft „Die junge Schweiz ∙ La jeune Suisse“. 51 Diese Zeit‐<br />
schrift stand Wyneken <strong>und</strong> seinem Jugendkultur‐Programm nahe, <strong>und</strong> was wir über „Eros“ erfahren, ist<br />
47 Lauenburg 1921, S. 67, 71.<br />
48 Diese Verurteilung <strong>und</strong> die spätere Aufhebung des Urteils löste übrigens in der deutschen Öffentlichkeit heftige Debatten<br />
aus <strong>und</strong> die Forderung nach Abschaffung des § 175 StGB. Wyneken war Päderast, aber kein Pädophiler (§ 176 StGB). – Geuter<br />
(wie Anm. 39), S. 195 ff.: Pädagogischer Eros <strong>und</strong> Päderastie – Der „Fall Wyneken“. – Peter Dudek: „Versuchsacker für<br />
eine neue Jugend“. Die Freie Schulgemeinde Wickersdorf 1906–1945. Bad Heilbrunn 2009, S. 276 ff.<br />
49 Hans Blüher: Wandervogel. Geschichte einer Jugendbewegung. 3 Bde., zuerst 1912 ff.; Ausgabe in 1 Bd., Frankfurt/M.<br />
1976; darin: Die deutsche Wandervogelbewegung als erotisches Phänomen. Ein Beitrag zur Erkenntnis der sexuellen Inversion.<br />
– Ders.: Die Rolle der Erotik in der männlichen Gesellschaft. Jena 1917.<br />
50 William Stern: Die „Inversions“-Welle. Ein zeitgeschichtlicher Beitrag zur Jugendpsychologie. In: Zeitschrift für pädagogische<br />
Psychologie <strong>und</strong> Jugendk<strong>und</strong>e 21 (1920), S. 161 – 170.<br />
51 1. Jg., H. 5, Oktober 1919, S. 117–132.<br />
Seite 16
ganz in seinem Sinn: Es gibt in jedem Menschen eine erotische Neigung zum eigenen <strong>und</strong> eine zum an‐<br />
deren Geschlecht. Der „Eros zum Manne“ ist nicht unnatürlich oder gar unsittlich, sondern er ist „der<br />
Eros der Fre<strong>und</strong>schaft, er lebte in reinster Form im sokratischen Kreise <strong>und</strong> in der platonischen Akade‐<br />
mie […] zahllose ihrer [der Weltgeschichte] größten Führergestalten in allen ihren Lebensgebieten sind<br />
vom mannmännlichen Eros beseelt. Sie lieben die männliche starke Tat, die abgründige Tiefe <strong>und</strong> die<br />
strenge herbe Schönheit. […] erweist seinen Sinn in der schöpferischen <strong>und</strong> kulturhegenden Männer‐<br />
gemeinschaft“. Dieser Eros erwache in der „Freude am ges<strong>und</strong>en <strong>und</strong> schöngebauten Körper“, in sei‐<br />
nem „schönsten Gewande, der Nacktheit“. 52<br />
Trat nun in der „neuen Erziehung“ das kameradschaftliche Verhältnis von Lehrer <strong>und</strong> Schüler an die Stel‐<br />
le des autoritären, war es zum „pädagogischen Eros“ nicht weit, zumal viele Reformpädagogen aus der<br />
Jugendbewegung kamen. In seiner Schrift „Vom erziehenden Eros“ (1919) schreibt der aus dem Ham‐<br />
burger Wandervogel stammende Reformpädagoge Kurt Zeidler, Angehöriger des Hamburger Wende‐<br />
kreises 53 : „Einen Menschen erziehen heißt: ihn lieben.“ 54 Zeidler erörtert dann ausführlich Erotik in der<br />
Jugendbewegung <strong>und</strong> plädiert für einen neuen, unbefangenen <strong>Umgang</strong> der Geschlechter <strong>mit</strong>einander,<br />
auch <strong>mit</strong> ihrer <strong>Körperlichkeit</strong>. Jedoch: Die „liebende“ Beziehung zwischen Lehrern <strong>und</strong> Schülern unter‐<br />
scheidet sich davon:<br />
„Wenn ich zum erstenmal in eine Schulklasse trete, so spüre ich nach kurzer Zeit diesem <strong>und</strong> jenem Kin‐<br />
de gegenüber: Da ist etwas, das uns <strong>mit</strong>einander verbindet. Sicher sind es nicht immer die besten Schü‐<br />
ler im Sinne der alten Schule, die so siegesgewiss in unser Herz hineinspazieren. Liebe fragt nicht nach<br />
einem Gr<strong>und</strong>e; sie ist da oder sie ist nicht da. […] Und ich weiß, dass in diesem Augenblick auch in dem<br />
jungen Menschen vor mir etwas entzündet worden ist, das als lebendige Kraft, als eine heilige Flamme<br />
fortwirken wird in ihm […] Ich weiß, dass ich immer <strong>mit</strong> einer großen Freude in diesen Kreis treten wer‐<br />
de, dass ich mein Bestes ausbreiten werde vor diesen Kindern <strong>und</strong> dass ich sie beschenken werde aus<br />
meinem Reichtum, wie sie mich reich beschenken. Der Erzieher, der aus der Liebe kommt, geht wie ein<br />
segenspendender Gott [!] durchs Leben.“ 55<br />
„Das größte Hindernis aber auf dem Weg zur neuen Schule ist das Heer der handwerksmäßigen Erzie‐<br />
her. Menschenbildung ist keine Verrichtung, die erlernbar ist, sondern innerer Beruf. Wer jenen trieb‐<br />
haften Zug zur Jugend [!] nicht in sich spürt, der taugt nicht zum Erzieher.“ 56<br />
An diesen Formulierungen lässt sich ablesen, welches „Feuer“ die Lehrer <strong>und</strong> Erzieher des Wende‐<br />
Kreises 57 beseelte, dem sie <strong>mit</strong> expressionistischer Attitüde Ausdruck verliehen 58 . Diese Formulierungen<br />
52<br />
Dieser Text brachte der Redaktion „eine Flut von Anfragen, Verdächtigungen, Protesten ins Haus“ (Erklärung der Redaktion,<br />
H. 6, Nov. 1919, S. 145). Sie erklärte, man müsse diese weit verbreiteten Gedanken „unvorbem<strong>und</strong>et“ zu Wort kommen<br />
lassen, denn die Zeitschrift sei „ein Blatt der Jugend, nicht für die Jugend.“ (Das ist eine Formulierung von Siegfried Bernfeld<br />
<strong>und</strong> Georg Gretor in Anlehnung an den „Anfang“ von 1913/14.)<br />
53<br />
Kurt Zeidler: Vom erziehenden Eros. Hamburg 1919. – Über Zeidler vgl. die biographischen Hinweis von Uwe Sandfuchs<br />
in seiner Neuausgabe von Zeidlers „Die Wiederentdeckung der Grenze“, Hildesheim/New York 1985.<br />
54<br />
1919, S. 5.<br />
55<br />
Ebd., S. 19.<br />
56<br />
Ebd., S. 27.<br />
Seite 17
lassen aber auch aufhorchen: Der „triebhafte Zug zur Jugend“ kann ja durchaus Unterschiedliches, Be‐<br />
denkliches, Verwerfliches bedeuten – <strong>und</strong> wo werden dann Grenzen gezogen: durch Selbstbeherr‐<br />
schung, durch die Institution, durch welche anderen Vorkehrungen? Diese Fragen haben sich alle päda‐<br />
gogischen Institutionen über Jahrzehnte nicht vorgelegt, deshalb gehören sie allesamt auf den Prüf‐<br />
stand. Nicht „die Reformpädagogik“ hat versagt, sondern in der pädagogischen Professionalität ganz<br />
allgemein blieb ein offenk<strong>und</strong>iger blinder Fleck unentdeckt. Allerdings hatte schon William Stern gleich‐<br />
zeitig <strong>mit</strong> dem Aufkommen der Rede vom (pädagogischen) „Eros“ <strong>mit</strong> aller Entschiedenheit dargelegt,<br />
dass ihm die durch „Eros“ bei Zeidler gestiftete Verwirrung nicht nur bedenklich, sondern pädagogisch<br />
widersinnig erscheine: 59<br />
Erziehung als einer „rein sachlichen, stofflichen, mechanischen Beziehung zwischen Lehrer <strong>und</strong> Schüler“<br />
kann nicht funktionieren. „Dass nur der zum Jugenderzieher innerlich berufen sei, der der Liebe zu sei‐<br />
nen Schülern fähig ist, das ist eine unbedingte Wahrheit. Aber es kommt darauf an, wie man diese Liebe<br />
versteht. Und da ist nun allerdings ihre sexuelle Umdeutung [als Eros] eine Verzerrung der Wahrheit […]<br />
Es gehört wahrlich Kühnheit dazu, allen jenen Erziehern, in deren Verhältnis zum Kinde jene ‚erotische’<br />
Note fehlt, auch die Liebe abzusprechen! Wir sollten vielmehr deutlich scheiden zwischen ‚erziehendem<br />
Eros’ (im Zeidlerschen Sinne) <strong>und</strong> erziehender Liebe. […] Alle Erotik ist auslesend <strong>und</strong> ausschließend,<br />
<strong>und</strong> der erotische Erzieher kann sich nur <strong>mit</strong> diesem oder jenem unter seinen Zöglingen in erotischen<br />
Zärtlichkeitsregungen verb<strong>und</strong>en fühlen. Und die anderen Kinder? Sollen sie warten oder gar auf die<br />
Suche gehen, bis sie auf Lehrer stoßen, <strong>mit</strong> dem sie ein erotisches Fluidum verknüpft? […] Die pädagogi‐<br />
sche Liebe, die den echten Erzieher kennzeichnet, unterscheidet sich von der Erotik eben dadurch, dass<br />
sie nicht nur sympathetischer, sondern sozialer Natur ist, dass sie nicht diesem oder jenem Einzelnen<br />
gilt, sondern der Jugend, dem werdenden Menschen <strong>und</strong> der Gemeinschaft werdender Menschen. Pä‐<br />
dagogische Liebe ist Einfühlungsfähigkeit in das Kind <strong>und</strong> Mitfühlungseignung <strong>mit</strong> dem Kinde, Liebe zur<br />
gegenwärtigen Kindlichkeit des Zöglings <strong>und</strong> zu seiner zukünftigen Entwicklungshöhe, der man ihn ent‐<br />
gegenführen möchte […]“.<br />
In diesem Sinne hat auch Martin Buber in seiner Rede „Über das Erzieherische“ „Eros“ zurückgewiesen:<br />
„Eros ist Wahl, Wahl aus Neigung. Erziehertum ist eben dies nicht. Der in Eris Liebende kürt den Gelieb‐<br />
ten, der Erzieher, der heutige Erzieher findet den Zögling vor. Ich sehe von dieser unerotischen Situation<br />
aus die Größe [Hervorheb. im Orig.] des modernen Erziehers – am deutlichsten, wo er Lehrer ist.“ 60<br />
57 Heiner Ullrich: Schulreform aus dem Geiste der Jugendbewegung: der Hamburger „Wendekreis“. In: Ulrich Herrmann<br />
(Hrsg.): „Mit uns zieht die neue Zeit…“ Der Wandervogel in der deutschen Jugendbewegung. Weinheim/München 2006, S.<br />
377–402.<br />
58 Jöde, Fritz: Pädagogik Deines Wesens. Gedanken der Erneuerung aus dem Wendekreis. Hamburg 1919. – Erich Lüth: Die<br />
Entfesselung der Schule. Werther o.J. – Friedrich Schlünz: Die Entfesselung der Seele. Ansage an die vorrevolutionäre Gesellschaft<br />
<strong>und</strong> ihr Bildungswesen. Hamburg 1919. – Ulrich Herrmann: „Neue Schulen“ für „neue Menschen“. In: Cornelia Nowak,<br />
u.a. (Hrsg.): Expressionismus in Thüringen. Erfurt 1999, S. 186–191.<br />
59 Wie Anm. 53, S. 166 f.<br />
60 In seiner Rede „Über das Erzieherische“ (1919), in: Ders.: Reden über Erziehung. Gütersloh 1953 u.ö., S. 11–49, hier S. 32.<br />
– So auch Bollnow (wie Anm. 61): Die Tugenden des Erziehers, S. 52 ff.: „Der Eros schließt gradezu die Erziehung aus, weil<br />
ein vergötterter <strong>und</strong> angebeteter Gegenstand notwendig den erzieherischen Willen lahm legen muss. Wie kann man das Vollkommene<br />
noch erziehen wollen. So scheint mir trotz der ehrwürdigen Herkunft dieser Auslegung der Begriff des pädagogischen<br />
Eros ungeeignet, die Gefühlszuwendung des Erziehers zu seinem Kind angemessen zu bezeichnen.“ (S. 52) – Klärend:<br />
Seite 18
Erziehung ist „Umfassung“ von Erzieher <strong>und</strong> Educandus in einem „dialogischen Verhältnis“, das das er‐<br />
zieherische Verhältnis konstituiert: Vertrauen <strong>und</strong> Gegenseitigkeit. Auf die gr<strong>und</strong>sätzliche Untauglichkeit<br />
des „Eros“‐Konzepts für die Erziehung hat später Otto Friedrich Bollnow aufmerksam gemacht, an etwas<br />
versteckter <strong>und</strong> heute weitgehend vergessener Stelle. 61 Im Anschluss an „Das Vertrauen zum Kind“ be‐<br />
handelt Bollnow unter den „Tugenden des Erziehers“ die „erzieherische Liebe“:<br />
„… das Problem der Tugenden des Erziehers ist bisher erstaunlich wenig durchdacht worden. Die einzige<br />
Tugend, die bisher stärker in das Blickfeld der Erziehungstheoretiker getreten ist, ist die Liebe. Aber gra‐<br />
de hier ist unter dem missverständlichen Namen einer pädagogischen Liebe im Gr<strong>und</strong>e mehr Verwirrung<br />
als Klärung angerichtet worden, <strong>und</strong> wir müssen uns erst durch eine kritische Besinnung den unbefan‐<br />
genen Blick auf diese Zusammenhänge freilegen.<br />
Auf der einen Seite sprach man gern von einem pädagogischen Eros, ohne zu fragen, wie weit<br />
man <strong>mit</strong> diesem Wort eine zeitbedingte griechische Auffassung aufnahm <strong>und</strong> an dem griechischen Ver‐<br />
ständnis auch da orientiert blieb, wo man das Wort in einer allgemeineren Fassung zu gebrauchen<br />
glaubte. Vor allem in der pädagogischen Bewegung zu Anfang unsres Jahrh<strong>und</strong>erts ist dieser Gedanke<br />
sehr leidenschaftlich aufgenommen worden, aber wohl kaum zum Vorteil der Sache; denn man geriet so<br />
in die Gefahr einer – wenn auch noch so vergeistigten – Erotisierung der Erziehung. Der Begriff des Eros<br />
erscheint mir aus einem mehrfachen Gr<strong>und</strong>e zur Bezeichnung der erzieherischen Gr<strong>und</strong>haltung unge‐<br />
eignet. Einmal bedeutet dieser Begriff, wie sublimiert man ihn auch nehmen mag, die Zuwendung zum<br />
einzelnen, ausgewählten <strong>und</strong> von den andern ausgezeichneten Menschen. Ihm eignet eine Ausschließ‐<br />
lichkeit, die der wahren erzieherischen Liebe abgeht, ja diese unmöglich macht, <strong>und</strong> diese Ausschließ‐<br />
lichkeit ist umso gefährlicher, wo der Erzieher, etwa der Lehrer einer Klasse, einer ganzen Schar von Kin‐<br />
dern gegenübersteht <strong>und</strong> diese gerecht zu behandeln hat. Eros ist weiterhin nicht nur ein besonders<br />
gefühlsmäßiges, sondern darüber hinaus ein betont subjektives Verhalten, das als solches nicht nur dem<br />
Gerechtigkeitsstreben, sondern auch <strong>mit</strong> der Sachlichkeit der echten Erziehung in Widerstreit geraten<br />
muss. Und Eros ist endlich die aufschauende Liebe zur leiblichen <strong>und</strong> seelischen Vollkommenheit des<br />
geliebten Wesens, er ist in dieser Weise immer <strong>mit</strong> einem Zusatz der ‚Verliebtheit’ <strong>und</strong> ‚Vergötterung’<br />
verb<strong>und</strong>en, <strong>und</strong> auch dieses würde die Natur der erzieherischen Liebe entstellen. Der Eros schließt<br />
gradezu die Erziehung aus, weil ein vergötterter <strong>und</strong> angebeteter Gegenstand notwendig den erzieheri‐<br />
schen Willen lahm legen muss. Wie kann man das Vollkommene noch erziehen wollen? So scheint mir<br />
trotz der ehrwürdigen Herkunft dieser Auslegung der Begriff des pädagogischen Eros ungeeignet, die<br />
Gefühlszuwendung des Erziehers zu seinem Kind angemessen zu bezeichnen. […]<br />
[…] ebenso irreführend ist es, die erzieherische Liebe an dem christlichen Begriff der Caritas zu<br />
orientieren. Caritas ist die erbarmende Liebe, die sich helfend zum armen, elenden <strong>und</strong> schwachen<br />
Menschen hinabneigt, aus einem allgemeinen Gefühl menschlicher Verb<strong>und</strong>enheit erwachsen, so wie<br />
sie im ‚barmherzigen Samariter’ ihr leuchtendes Vorbild gef<strong>und</strong>en hat. Wohl gibt es in jeder Erziehung –<br />
was die Redeweise vom Eros verdeckt – eine unaufhebbare natürliche Überlegenheit des Erziehenden<br />
gegenüber dem Erzogenen. Aber diese ist völlig andrer Art <strong>und</strong> hat <strong>mit</strong> Mitleid <strong>und</strong> Erbarmen nichts zu<br />
tun. Erzieherische Liebe ist ein sehr ursprünglicheres <strong>und</strong> selbstverständlicheres Verhältnis. Der Erzieher<br />
erbarmt sich nicht des Kindes in seiner Unerfahrenheit <strong>und</strong> Unerzogenheit, <strong>und</strong> wenn er sich liebend zu<br />
ihm hinabneigt, so ist das ein völlig anderes Verhalten. Es ist eine strahlende, freudige, von aller Be‐<br />
drücktheit des <strong>mit</strong>leidigen Verhältnisses befreite Liebe.<br />
Albert von Schirnding: Begehren <strong>und</strong> Verdacht. Was ist eigentlich „pädagogischer Eros“? In: Süddeutsche Zeitung vom<br />
9.3.2010, S. 11. – Abwegig: Jürgen Oelkers: Eros <strong>und</strong> Herrschaft. Ein anderer Blick auf die Reformpädagogik. Vortrag Universität<br />
Bielefeld, 23.7.2010 (Volltext im Internet).<br />
61 Otto Friedrich Bollnow: Die pädagogische Atmosphäre. Heidelberg 2 1965, Zitat S. 52–54.<br />
Seite 19
Weder vom Eros noch von der Caritas her ist also das Entscheidende des pädagogischen Bezugs<br />
zu erfassen. Vielleicht ist es einfach die schlicht menschliche Liebe, die als solche noch keineswegs spezi‐<br />
fisch erzieherisch ist, aber die als unerläßliche Voraussetzung (im Sinn unsrer Betrachtungen) das erzie‐<br />
herische Verhältnis trägt <strong>und</strong> möglich macht, sofern ihr vom Kind her eine entsprechende Liebe entge‐<br />
genkommt <strong>und</strong> sich <strong>mit</strong> ihr zu einem einheitlichen Verhältnis verbindet. Und so war es schließlich auch<br />
bei Pestalozzi gemeint: daß eine Atmosphäre gegenseitiger Liebe zwischen Mutter <strong>und</strong> Kind – <strong>und</strong> dann<br />
entsprechend allgemein zwischen Erzieher <strong>und</strong> Zögling – den Boden bildet, der als Gr<strong>und</strong>lage vorhanden<br />
sein muss <strong>und</strong> auf dem dann die Erziehung gedeiht.“<br />
Aus der sachlichen <strong>und</strong> begrifflichen Klarstellung Bollnows ergibt sich, dass wir es – <strong>mit</strong> Siegfried Bern‐<br />
feld zu reden – bei der Reaktion des Erziehers/Lehrers auf die (libidinöse) Zuwendung des Schülers zu<br />
ihm (et vice versa, wie Zeidler ausführte) um eine elementare zwischenmenschliche Beziehung zu tun<br />
haben. 62 Sie ist auf der einen Seite pädagogisch <strong>und</strong> erzieherisch höchst nötig <strong>und</strong> wirkungsvoll, auf der<br />
anderen Seite wirft sie das Problem von Nähe <strong>und</strong> Distanz auf, in einem Beruf, wo – wie Adorno sarkas‐<br />
tisch bemerkte – „die Idee des Lehrers <strong>mit</strong> dem untadeligen Leben als Vorbild für Unreife ihn wirklich zu<br />
mehr an erotischer Askese nötigt, als in vielen anderen Berufen, etwa dem des Vertreters“. 63<br />
II. Erziehung ruht auf Beziehung<br />
Auch hier sei <strong>mit</strong> einem Zitat begonnen:<br />
„Das natürliche Ziel der Motivationssysteme sind soziale Gemeinschaft <strong>und</strong> gelingende Beziehungen <strong>mit</strong><br />
anderen Individuen, wobei dies nicht nur persönliche Beziehungen betrifft, Zärtlichkeit <strong>und</strong> Liebe einge‐<br />
schlossen, sondern alle Formen sozialen Zusammenwirkens. Für den Menschen bedeutet dies: Kern aller<br />
Motivation ist es, zwischenmenschliche Anerkennung, Wertschätzung, Zuwendung oder Zuneigung zu<br />
finden <strong>und</strong> zu geben. Wir sind – aus neurobiologischer Sicht – auf soziale Resonanz <strong>und</strong> Kooperation<br />
angelegte Wesen.“ „Nichts aktiviert die Motivationssysteme so sehr wie der Wunsch, von anderen ge‐<br />
sehen zu werden, die Aussicht auf soziale Anerkennung, das Erleben positiver Zuwendung <strong>und</strong> – erst<br />
recht – die Erfahrung von Liebe.“ 64<br />
62 10<br />
Siegfried Bernfeld: Sisyphos oder die Grenzen der Erziehung. Zuerst 1925, zuletzt Frankfurt/M. 2006.<br />
63<br />
Theodor W. Adorno: Tabus über dem Lehrberuf. In: Ders.: Erziehung zur Mündigkeit. Frankfurt/M. 1971, S. 70–87, hier S.<br />
79. Der Text geht zurück auf einen Vortrag im Mai 1965 im MPI für Bildungsforschung, zu dessen Beirat Adorno gehörte.<br />
Gruschka (wie Anm. 7, S. 17) berichtet von der Ernüchterung des Institutsdirektors Hellmut Becker, dass sich von den Instituts<strong>mit</strong>arbeitern<br />
niemand für Adornos Anregungen interessiert habe. Und so nahm denn auch dort die „empirische Bildungsforschung“<br />
ihren Lauf: seit Jahrzehnten werden die immer gleichen Lehrerqualifikationen <strong>und</strong> -kompetenzen notiert, <strong>und</strong> die<br />
psychologisch-psychoanalytische Dimension des Lehrers in seinen ex- <strong>und</strong> internen Beziehungsgeflechten bleibt weitgehend<br />
eine terra incognita, immer noch Bernfelds Grenze der Erziehung im Erzieher (in „Sisypos“ 1925).<br />
64<br />
Joachim Bauer: Prinzip Menschlichkeit. Hamburg 2006, S. 34 f. – So auch in: Ders.: Lob der Schule. Hamburg 2007 (u.ö.),<br />
S. 16 ff.<br />
Seite 20
Joachim Bauer, der wohl wichtigste Neurobiologe <strong>und</strong> ‐psychologe als Gesprächspartner der Pädagogik,<br />
formuliert hier eine Voraussetzung erfolgreichen Erziehungsgeschehens. Auch hier lässt sich eine pro‐<br />
minente Position aus der Geschichte der Pädagogik anführen:<br />
Für den Freud‐Schüler Siegfried Bernfeld stand die überragende pädagogische Bedeutung des<br />
Zusammenlebens von Kindern <strong>und</strong> Heranwachsenden fern ihrer Herkunftsfamilie unter der Leitung von<br />
„charismatischen Führern“ außer Frage – er gab seine zwei Töchter zu dem von ihm verehrten Wyneken<br />
in die Freie Schulgemeinde Wickersdorf 65 . Zumal die Schulgemeindeerfahrung sollte für eine junge so‐<br />
zialistische Elite eine herausragende Rolle in Schul‐ <strong>und</strong> Gesellschaftsreform haben. Das gilt für Bernfeld<br />
an hervorragender Stelle für den Aufbau der jüdischen Heimstatt in Palästina. In einem Text von 1916<br />
„Zum Problem der jüdischen Erziehung“ 66 (in Palästina) führt Bernfeld aus, dass Jugend auf Führung an‐<br />
gewiesen ist; sie kann keine „neuen Werte“ aus sich schaffen, dazu bedarf sie „hingebender Gefolg‐<br />
schaft“. „Denn der Eros der Jugend […] findet seine reinste <strong>und</strong> jugendgemäßeste Gestaltung in der<br />
Ehrfurcht der Jünger vor dem Meister der Worte, vor ihrem Führer auf der rechten Bahn.“ Bernfeld ist<br />
nicht im Traum auf die Idee gekommen, das, was er <strong>mit</strong> seinem „Eros“‐Pathos ganz richtig als System<br />
„libidinöser Beziehungen“ beschrieb, auch in seinem Gefährdungspotential zu betrachten.<br />
Für den Aufbau der Lehrerausbildung in Palästina/Israel empfahl Bernfeld 1922 67 , künftige Lehrer unter<br />
den Angehörigen der Jugendbewegung zu suchen, weil sie – aus „Liebe zur Kindheit“ 68 – die richtige Ein‐<br />
stellung zum <strong>Umgang</strong> <strong>mit</strong> Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen <strong>mit</strong>bringen würden: „Kameradschaftlichkeit <strong>und</strong><br />
Gemeinschaft“, u. zw. für die soziale Organisation der Erziehung in einem „Internat <strong>mit</strong> Sympathiegrup‐<br />
pen [Hervorheb. im Orig.]; das ist die Losung der Schule, in der die produktivsten <strong>und</strong> dauernsten Wir‐<br />
kungen erreicht werden […]; denn es zeigt sich zum Beispiel, dass ein Kind allemal nur das lernt <strong>und</strong> von<br />
dem Menschen, den es liebt“, so dass eine „sehr starke Bindung zu einem Lehrer“ absolut wünschens‐<br />
wert ist.<br />
In seiner Schrift „Die Schulgemeinde <strong>und</strong> ihre Funktion im Klassenkampf“ 69 (Berlin 1928) wurde<br />
Bernfeld noch deutlicher:<br />
„Der pädagogische Erfolg des Schulheims [Landerziehungsheim] erweist sich [im Unterschied zur<br />
‚natürlichen’ Familie] darin, dass Kinder <strong>und</strong> Jugendliche in ihm (der Regel nach) bald zur Fügsamkeit<br />
[sic!] gelangen; sie verstoßen nicht selten gegen die Ordnung des Heimes (Zeiteinteilung, Tracht usw.,),<br />
sie erfüllen mindestens leidlich die Forderungen, die in bezug auf Lernen, Arbeit, Sport, Verwaltungs‐<br />
funktionen an sie herantreten […] Ihre Fügsamkeit hat nicht den Charakter der Gleichgültigkeit oder gar<br />
der Resignation, sondern wird als lebendige, freiwillige Beziehung erlebt. Das Individuum, das in seinem<br />
früheren Milieu isoliert war oder sich neben Haus <strong>und</strong> Schule im B<strong>und</strong> oder Verein eine Gemeinschaft<br />
schuf, die für einige Wochenst<strong>und</strong>en die Einsamkeit aufhob – steht nun bejahend <strong>und</strong> lebendig <strong>mit</strong>ten<br />
in einer Gemeinschaft, die sein ganzes Leben, meist auch seine ganze Liebe [sic!] <strong>und</strong> alle seine Interes‐<br />
sen umfasst. […] Es gelingt ihnen die gleiche Umwandlung, die der Erfolg, der berechtigte Stolz der Ju‐<br />
65<br />
Dudek (wie Anm. 48), S. 170 ff.<br />
66<br />
Demnächst in: Ders.: Werkausgabe Bd. 3, Gießen 2011.<br />
67<br />
Über die Lehrerausbildung. In: Die Arbeit 4 (1922), S. 43–48. Demnächst in: Ders.: Werkausgabe Bd. 3, Gießen 2011.<br />
68<br />
In der Literatur sollte der differente Sprachgebrauch von Kindheit“ <strong>und</strong> „Kind/Kinder“ beachtet werden.<br />
69<br />
Berlin 1928, hier S. 43 f.<br />
Seite 21
gendbewegung ist. Offenbar gibt hier wie dort die gleiche Einrichtung diese Möglichkeit zur Entwicklung<br />
des Gefühlslebens. Im Schulheim (ebenso wie im B<strong>und</strong>) findet das Kind <strong>und</strong> der Jugendliche Führer<br />
[sic!]. Er findet Erwachsene, denen es Neigung, Sympathie, Fre<strong>und</strong>schaft, Liebe, Verehrung zuwenden<br />
kann […] Der Führer im Schulheim […] besitzt Fähigkeiten, die dem Schulheimbürger von Anfang an als<br />
höchst schätzenswert erscheinen oder ihm allmählich als Werte aufgehen. Er besitzt jugendliche Quali‐<br />
täten: sportliche, körperliche, sachliche, soziale […] So werden sich notwendigerweise Keime von Zunei‐<br />
gung des Zöglings zu einem oder dem anderen Erzieher ansetzen.“<br />
Bernfeld führt „das Entstehen dieser libidinösen Beziehung[en]“ 70 noch weiter aus <strong>und</strong> weist vor<br />
allem darauf hin, dass sie keineswegs nur auf Landerziehungsheime beschränkt sind, sondern sich auch<br />
in ganz normalen öffentlichen Staatsschulen einstellen können. Wichtig ist Bernfeld, dass sich diese ein‐<br />
zelnen libidinösen Beziehungen nicht auf die Person des betreffenden Erziehers beziehen – dann sind<br />
nämlich die Heranwachsenden Konkurrenten –, sondern umgelenkt werden auf eine Idee, repräsentiert<br />
durch das Charisma des Führers, so dass er als Führer das Überich einer Gefolgschaft wird, die eine ge‐<br />
meinsame geistige Ausrichtung anstrebt. 71<br />
Was Bernfeld hier anpreist, ist in nuce nichts anderes als der Kerngedanke einer manipulativen Bewusst‐<br />
seins‐ <strong>und</strong> Verhaltensformung, die eben nicht Emanzipation <strong>und</strong> Autonomie zum Ziel hat, sondern Ein‐<br />
gliederung <strong>und</strong> Unterordnung. Das ist das Gegenteil von freiheitlicher <strong>und</strong> befreiender Erziehung i.e.S.,<br />
die sich vollzieht als gerechtfertigtes Eingreifen bzw. Gestalten des Erlebens <strong>und</strong> Verhaltens, Denkens<br />
<strong>und</strong> Handelns von Hilfsbedürftigen <strong>und</strong> Unmündigen, von Hilfesuchenden <strong>und</strong> Heranwachsenden im<br />
Kindes‐ <strong>und</strong> Jugendalter zu deren sozialer Distanzierungsfähigkeit, intellektueller Urteilsfähigkeit <strong>und</strong><br />
moralischer Selbstbestimmungsfähigkeit. Nur dieser letztere <strong>Umgang</strong> von Erwachsenen <strong>mit</strong> den ihnen<br />
anvertrauen Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen ist erlaubt, weil er geboten ist aufgr<strong>und</strong> der unabweisbaren Ein‐<br />
hilfe in ein praktisch gelingendes Leben <strong>und</strong> dasjenige, was Martinus J. Langeveld die Persona‐Genese<br />
genannt hat. 72 Wilhelm Flitner formuliert dies so: Es „zeigt die Erfahrung, dass Erziehung sein muss;<br />
dann muss sie auch sittlich erlaubt sein, <strong>und</strong> zwar – <strong>und</strong> das ist gleich als Grenze <strong>mit</strong>gedacht – gerade<br />
weil sie <strong>und</strong> sofern sie zum Aufbau selbständigen Lebens hilft, zum Gebrauch von Vernunft, zum Eingang<br />
in die Wechselwirkung <strong>mit</strong> anderen mündigen Personen, zum Verstehen ihrer Sprache <strong>und</strong> Lebensord‐<br />
nungen, zur Teilnahme an ihrer Wertsicht. Erlaubt ist die Fremdbestimmung also, weil sie zur Freiheit<br />
führt“. 73 Die Grenze der Erziehung ist das Person‐Sein des Kindes, <strong>und</strong> die Grenzen des erziehenden<br />
<strong>Umgang</strong>s sind die Menschen‐ <strong>und</strong> Kinderrechte, die in der Form von UN‐Konventionen bei uns geltendes<br />
Recht sind.<br />
70 Ebd., S. 46.<br />
71 Ebd., S. 50 f.<br />
72 Martinus J. Langeveld: Einführung in die (theoretische) Pädagogik. Stuttgart 1951, 9 1978.<br />
73 Wilhelm Flitner: Ist Erziehung sittlich erlaubt? (1979) Wiederabgedr. in: Ders.: Theoretische Schriften. Hrsg. von Ulrich<br />
Herrmann. (Ges. Schriften, Bd. 3) Paderborn 1989, S. 190–197, hier S. 191. – Hier <strong>und</strong> zum ff.: Sabine Seichter: Pädagogische<br />
Liebe. Erfindung, Blütezeit, Verschwinden eines pädagogischen Deutungsmusters. Paderborn 2007, S. 138 ff.: Personale Momente<br />
in der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik.<br />
Seite 22
Die Formulierungen von Bauer zeigen, welche Voraussetzungen für solches zwischenmenschli‐<br />
ches Handeln gegeben sein müssen, wenn es im Sinne der Intentionen <strong>und</strong> Ziele erfolgreich sein will. Er<br />
bestätigt alte pädagogische Erfahrungen <strong>und</strong> Einsichten: Die Wirksamkeit der förderlichen erziehlichen<br />
<strong>und</strong> bildenden Einwirkung der Erziehung hängt ab von positiven Beziehungen, vom „Takt“ <strong>und</strong> der<br />
„Kunst“ des Erziehers, um, wie Herbart sich ausdrückte 74 , im Educandus eine „entgegenkommende Ein‐<br />
stimmung“ hervorzurufen. Für das seitherige moderne pädagogische Denken, das aus der Pädagogi‐<br />
schen Bewegung des ersten Drittels des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts hervorgegangen ist, ist dieser „pädagogische<br />
Bezug“ das Merkmal zwischenmenschlicher Interaktionen zwischen Älteren <strong>und</strong> Jüngeren, die sich als<br />
Erziehung <strong>und</strong> Bildung identifizieren lassen, <strong>und</strong> zugleich die Gr<strong>und</strong>lage der Entfaltung der Pädagogik in<br />
Theorie <strong>und</strong> Praxis. Bei Herman Nohl heißt es:<br />
„Die Gr<strong>und</strong>lage der Erziehung ist […] das leidenschaftliche Verhältnis eines reifen Menschen zu einem<br />
werdenden Menschen <strong>und</strong> zwar um seiner selbst willen, dass er zu seinem Leben <strong>und</strong> seiner Form<br />
komme.“ „Das Verhältnis des Erziehers zum Kind ist immer doppelt bestimmt; von der Liebe zu ihm in<br />
seiner Wirklichkeit <strong>und</strong> von der Liebe zu seinem Ziel, dem Ideal des Kindes, beides aber nun nicht als<br />
Getrenntes, sondern als ein Einheitliches: aus diesem Kinde machen, was aus ihm zu machen ist, das<br />
höhere Leben in ihm entfachen“. 75<br />
Dass Bauer <strong>mit</strong> „Liebe“ in diesem Zusammenhang nicht das sexuelle Begehren meint, versteht sich. No‐<br />
hls „leidenschaftliches Verhältnis“ zum anvertrauten Kind <strong>und</strong> Jugendlichen hat nicht <strong>mit</strong> „pädagogi‐<br />
schem Eros“ zu tun – die „Leidenschaft“, d. h. das von Herzen kommende Engagement für ein Kind, ei‐<br />
nen Schüler, das große Interesse an seiner Förderung usw. will ja nichts für sich selbst, sondern alles für<br />
das Kind, dient also keiner narzisstischen Befriedigung.<br />
In diesem Sinne darf das pädagogische Verhältnis nicht unter den permanenten Verdacht des<br />
Scheiterns oder gar des Missbrauchs gestellt werden:<br />
„Von einem Lehrer <strong>und</strong> Erzieher nehmen wir als Schüler <strong>und</strong> Kinder wie auch als Eltern an, dass er<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich weiß, was im <strong>Umgang</strong> geboten <strong>und</strong> was nicht erlaubt ist. Er steht unter der Verpflichtung<br />
des Bemühens um das Gelingen der gemeinsamen Praxis. Wir müssen davon ausgehen können, dass er<br />
seine Pflichten erfüllt. Diese Haltung steht in Spannung zu der Erfahrung, dass diese Erwartung, zuwei‐<br />
len in schrecklichem Sinne, enttäuscht wird. Aber auch dann müssen wir an der Erwartung festhalten,<br />
Kinder würden sonst die Achtung vor dem Erzieher verlieren, Eltern müssten ihre Kinder vor diesem<br />
schützen. Pädagogik kann nur, <strong>und</strong> sei es als kontrafaktische Erwartung ihrer positiven Möglichkeit er‐<br />
lebt <strong>und</strong> begleitet werden. […]“ Unausgesetzter Verdacht „wäre die Haltung eines pädagogischen Pes‐<br />
74 In seiner „Allgemeinen Pädagogik“ von 1806. Vgl. dazu Ulrich Herrmann: Hermeneutische Pädagogik. In: Friedrich Kümmel<br />
(Hrsg.): O. F. Bollnow. Hermeneutische Philosophie <strong>und</strong> Pädagogik. Freiburg/München 1997, S. 189–200.<br />
75 Herman Nohl: Die Theorie der Bildung. In: Ders./Ludwig Pallat (Hrsg.): Handbuch der Pädagogik. Bd. I, Langensalza 1933,<br />
S. 3–80, hier S. 22 f.; zit. auch bei Hermann Giesecke: Die Pädagogische Beziehung. Pädagogische Professionalität <strong>und</strong> die<br />
Emanzipation des Kindes. Weinheim/München 1997, S. 217 ff., hier S. 223 f.<br />
Seite 23
simismus, <strong>mit</strong> dem man vielleicht in der Praxis einige Zeit als Zyniker überleben kann, aber nicht mehr<br />
als das. Sie zerstört die in der Praxis vorauszusetzende Gr<strong>und</strong>einstellung, pädagogisches Handeln könne<br />
gelingen. Man muss nach Horkheimer theoretischer Pessimist sein, aber man kann nicht praktischer<br />
Pessimist sein, ohne in der Praxis zu scheitern.“ 76<br />
Vielmehr kommt es darauf an, in den verschiedenen Entwicklungsphasen im Kindes‐ <strong>und</strong> Jugendalter die<br />
phasengemäßen Bindungserfahrungen zu ermöglichen <strong>und</strong> zu unterstützen, die zu einer ges<strong>und</strong>en<br />
Selbstentwicklung erforderlich sind. 77 Aber wie will man herausfinden, was einer individuellen Selbst‐<br />
entwicklung durch erziehliche Einwirkung (Zuwendung oder Unterlassung) dienlich oder hinderlich ist?<br />
Hier ist hinzuweisen auf Schleiermachers Bemerkung von der „Unentschiedenheit der anthropologi‐<br />
schen Voraussetzungen“ der Erziehung 78 , richtiger: der Unentscheidbarkeit hinsichtlich der tatsächlich<br />
eintretenden wünschenswerten oder auch nicht wünschenswerten Folgen (oder beides) des aktuellen<br />
erzieherischen Handelns.<br />
III. Die ambivalente Gr<strong>und</strong>struktur pädagogischen Handelns: am Beispiel von Nähe <strong>und</strong> Distanz<br />
1. Nähe <strong>und</strong> Distanz<br />
In dem oben zitierten Essay von Zeidler fährt der Text nach den zitierten Eingangssätzen folgenderma‐<br />
ßen fort 79 :<br />
„Vor Jahren lernte ich in der Schule einen Knaben kennen, zwölf oder dreizehn Jahre alt, der mir durch<br />
die Frische <strong>und</strong> Anmut seines Wesens gefiel. Ich hatte damals eine Unterklasse. Er besuchte mich oft in<br />
den Pausen <strong>und</strong> half mir beim Ordnen. Unter seinem Klassenlehrer hatte er sehr zu leiden. Der war ei‐<br />
ner jener Erbpächter der Oberstufe, die bei Behörden <strong>und</strong> Kollegenschaft in dem Ansehen stehen, be‐<br />
sonders erfolgreich zu sein, <strong>und</strong> die brutal sind. Der Junge war unbegabt im Sinne der Lernschule <strong>und</strong>,<br />
wie es natürlich war, unfleißig in solchem Betriebe. Es verging kaum eine Woche, ohne dass er die ro‐<br />
hesten Misshandlungen von seinem Lehrer zu erdulden hatte. Das Herz kehrte sich mir herum, dass ich<br />
solches erleben musste, <strong>und</strong> der Junge, der sein Schicksal <strong>mit</strong> ich möchte fast sagen: heroischem<br />
Gleichmut <strong>und</strong> überlegen verzeihender Milde trug, hatte meine Hochachtung <strong>und</strong> mein grenzenloses<br />
Mitleid.“<br />
76<br />
Gruschka (wie Anm. 7), S. 12 f.<br />
77 16<br />
Remo H. Largo: Kinderjahre. Die Individualität des Kindes als erzieherische Herausforderung. München 2008, S. 95 ff.:<br />
Gr<strong>und</strong>bedürfnisse <strong>und</strong> Bindungsverhalten.<br />
78<br />
Friedrich Schleiermacher: Gr<strong>und</strong>züge der Erziehungskunst (Vorlesungen 1826). Jetzt in: Ders.: Texte zur Pädagogik. Hrsg.<br />
von Michael Winkler <strong>und</strong> Jens Brachmann. Bd. 2, Frankfurt/M. 2000, S. 21.<br />
79<br />
Wie Anm. 53, S. 5.<br />
Seite 24
Diese kleine Geschichte ist für das Thema „Nähe <strong>und</strong> Distanz“ in mehrfacher Hinsicht aufschlussreich:<br />
Ein Junge im Lebensalter zwischen Kindheit <strong>und</strong> Jugendalter braucht Nähe <strong>und</strong> förderliche Beziehung,<br />
um durch Bindungserfahrungen die vor ihm liegenden Entwicklungsaufgaben erfolgreich meistern zu<br />
können. Eine wichtige Person (der Klassenlehrer) versagt ihm dies (<strong>und</strong> bemerkt nicht, dass er dadurch<br />
als Pädagoge versagt). Der Junge findet einen Ausweg: sich bei einem anderen Lehrer nützlich machen;<br />
ihm zeigen, dass er doch etwas kann – in der Hoffnung, dass er auf Resonanz stößt (was auch glückt).<br />
Der Junge musste für seine ges<strong>und</strong>e emotional‐soziale Entwicklung einen Ausweg suchen; denn die exis‐<br />
tentiellen Fragen, die junge Menschen in diesem Alter umtreiben, lauten: Wer bin ich? Wer mag mich?<br />
Was kann ich? Was kann ich werden? Wo gehöre ich hin? Die Schule wird daher primär gar nicht als Ort<br />
des Lernens wahrgenommen, sondern als sozialer Ort, wo man Fre<strong>und</strong>e <strong>und</strong> Fre<strong>und</strong>innen trifft. Eben<br />
dies unterscheidet das Landerziehungsheim <strong>und</strong> die Ganztagsschule vom „normalen“ Halbtagsbetrieb:<br />
der junge Mensch rückt <strong>mit</strong> allen seinen Bedürfnissen ins Zentrum! 80 Es versteht sich, dass ein junger<br />
Mensch dann auch eine libidinöse Beziehung zum Erwachsenen/Lehrer aufbaut, die nicht immer so lus‐<br />
tig daher kommt wie diejenige, die A.S. Neill Anfang der 1920er Jahre in seiner Schule in Dresden‐<br />
Hellerau passierte:<br />
„Ich hielt den Mädchen von der Eurhythmieabteilung Vorträge über Psychologie. Eines Tages kam eine<br />
junge Russin von ihnen in mein Büro, warf die Arme um mich <strong>und</strong> sagte: ‚Herr Neill, ich liebe Sie.’ Ich<br />
wusste nicht einmal ihren Namen <strong>und</strong> war etwas entsetzt, eine Liebeserklärung von jemandem zu be‐<br />
kommen, den ich persönlich gar nicht kannte. Mein Entsetzen schlug in Panik um, als sie fortfuhr: ‚Ich<br />
habe es meinem Mann geschrieben, <strong>und</strong> er wird am Samstag kommen, um sich <strong>mit</strong> Ihnen zu schießen.’<br />
Als ich zwei Tage später morgens zur Schule hinüberging, sah ich sie <strong>mit</strong> ihrem Mann…herankommen.<br />
Sie stellte uns einander vor, <strong>und</strong> er schüttelte mir herzlich, wenn auch schmerzhaft, die Hand. Das arme<br />
Kind hatte eine Übertragungsbeziehung zu mir entwickelt <strong>und</strong> ein ganzes Phantasiegebäude um mich<br />
errichtet.“ 81<br />
Nähe entsteht nicht aufgr<strong>und</strong> eines „triebhaften Zuges zur Jugend“ (wie Zeidler sich missverständlich<br />
ausdrückte), sondern aus liebevoller Achtung, unter Umständen gepaart <strong>mit</strong> Mitleid, in jedem Fall aus<br />
Interesse an <strong>und</strong> Respekt vor der Individualität dieses Kindes – dem die Schule <strong>und</strong> der Klassenlehrer<br />
nicht gerecht wurde – <strong>und</strong> aus Solidarität angesichts seiner Herabwürdigung <strong>und</strong> Misshandlung (das<br />
Stäupen „<strong>mit</strong> geistigen Ruten“, sagt Zeidler; es geht auch psychisch: Misshandeln durch Nichtbeachtung,<br />
kalten Blick usw.).<br />
80 Ulrich Herrmann: „täglich ganztägig“ – Prinzipien des reformpädagogischen Lebens-Lern-Alltags. In: Thilo Fitzner, u.a.<br />
(Hrsg.): Ganztagsschule – Ganztagsbildung. Bad Boll 2005, S. 24–47.<br />
81 Neill, Alexander Sutherland: Die aufregendste Zeit meines Lebens. In: Ehrhardt Heinold/Günther Großer (Hrsg.): Helllerau<br />
leuchtete. Zeitzeugenberichte <strong>und</strong> Erinnerungen. Dresden 2007, S. 378–385, hier S. 381; wiederabgedr. aus: Ders.: Neill, Neill,<br />
Birnenstiel. Reinbek 1973.<br />
Seite 25
„Schneidend definiert Blüher: Liebe ist Bejahung eines Menschen, abgesehen von seinem Wert. Wo fin‐<br />
den wir in unsern Schulen heute die Erzieher, die ihre Schüler so lieben? Wir lieben ihren Wert… Wir<br />
tragen ein aus den Beschränktheiten der Zeit konstruiertes Bild vom Menschen <strong>mit</strong> uns herum, das den<br />
meisten sich darstellt als eine Sammlung irgendwie dienlicher Fähigkeiten, Fertigkeiten <strong>und</strong> Kenntnisse.<br />
Wenn wir weitherzig sind, dulden wir eine Reihe Variationen dieses Bildes. In dem Maß nun, wie der<br />
junge Mensch nach einem dieser Urbilder hin sich entwickelt, wie er täppischem Entdeckerhochmut<br />
langsam sich entpuppt als Bündel achtbarer Anlagen, in dem Maße erfährt er unsere Wertschätzung <strong>und</strong><br />
wohlwollende Zuneigung. Wo aber jugendliches Leben unserm Urteil, unsern Maßstäben sich entwin‐<br />
det, da gewinnen wir, wenn’s hoch kommt, ein leutselig lächelndes Gewährenlassen über uns. Hätte ich<br />
jenen Schulmeister, von dem ich sprach, zur Rede gestellt, er hätte geantwortet, dass er aus Verantwor‐<br />
tungsgefühl der Zukunft des Knaben gegenüber, dass er aus Liebe so handeln müsse.<br />
Diese Art Liebe reißt aus euern Herzen. Die Jugend bedarf ihrer nicht. Fre<strong>und</strong> <strong>und</strong> Helfer kann ihr<br />
nur sein, wer das große Verstehen in sich trägt, die Liebe, die ganz im Wesen des jungen Menschen auf‐<br />
geht, die ihn bejaht <strong>mit</strong> all seinen Fehlern <strong>und</strong> Schwächen, <strong>mit</strong> all seinen Unvollkommenheiten <strong>und</strong> Un‐<br />
sicherheiten, die niemals das Vertrauen verliert <strong>und</strong> niemals den Glauben an die göttliche Kraft der jun‐<br />
gen Seele.<br />
Diese Liebe aber ist den meisten heute ein verschlossenes Land.“ 82<br />
Lässt man das Pathos beiseite („segenspendender Gott“, „göttliche Kraft“), so hat Zeidler doch das ent‐<br />
scheidende Stichwort geliefert: Ausdruck der pädagogischen „Liebe“ ist die Bejahung des Kindes, des<br />
Schülers in seinem Sosein, in einem Verhältnis als „Kamerad <strong>und</strong> Helfer“ in der Kombination von Selbst‐<br />
losigkeit <strong>und</strong> Hilfestellung. Sie beruht auf Respekt. Der Erzieher, der Lehrer will nichts für sich, aber alles<br />
für das Kind, den Schüler. Das ist diejenige „pädagogische Liebe“ im Sinne von Pestalozzi, auf die Boll‐<br />
now schon verwiesen hatte.<br />
2. Ambivalenz<br />
Dies verweist auf die ambivalente Gr<strong>und</strong>struktur pädagogischen Handelns <strong>und</strong> auf ihm zugr<strong>und</strong>e liegen‐<br />
de Sachverhalte et vice versa: Ambivalenz bedeutet Doppelwertigkeit eines Sachverhalts oder seiner<br />
bewertenden Einschätzung bzw. aufgr<strong>und</strong> der doppelwertigen Bedeutung eines anscheinend eindeuti‐<br />
gen Sachverhalts. Mit anderen Worten: Die unserer Wahrnehmung zugängliche eindeutige Wirklichkeit<br />
kann bei näherer Betrachtung uneindeutig oder gar mehrdeutig sein, <strong>und</strong> demzufolge kann die Deutung<br />
einer Wirklichkeit zunächst zwar ein‐eindeutig sein, muss jedoch gr<strong>und</strong>sätzlich <strong>mit</strong> der Möglichkeit von<br />
Mehrdeutigkeit rechnen.<br />
Dieser Ambivalenz‐Erfahrung aus der Akteurs‐Perspektive (des Kindes) entspricht die Ambivalenz<br />
der Bedeutungszuschreibung aus der Beobachter‐Perspektive (des Erziehers). Es ist nämlich meist nicht<br />
eindeutig, was ein Kind grade „denkt“ <strong>und</strong> „tut“, wenn es exploriert <strong>und</strong> experimentiert, weil uns als<br />
82 Wie Anm. 53, S. 6.<br />
Seite 26
Beobachtern die Akteurs‐Intention häufig verborgen („unsinnig“) oder unklar („seltsam“) erscheint. Es<br />
ist das alte Thema: Verstehen wir Kinder wirklich? 83<br />
Für die pädagogische Alltagspraxis bedeutet dies, dass Lehrer <strong>und</strong> Erzieher sich über die Bedeu‐<br />
tung <strong>und</strong> Wirkung ihres eigenen „nahen“ <strong>und</strong> „distanten“ Verhaltens Rechenschaft geben müssen: wa‐<br />
rum sie so reagieren, wie Zeidler oben beschrieben hat, oder ähnlich oder gar nicht oder gegenteilig;<br />
welche Resonanz‐Signale sie wem gegenüber (nicht!) aussenden bzw. warum <strong>und</strong> wie sie auf wessen<br />
Resonanzen reagieren; Schulkinder z.B. begreifen sehr rasch, dass positive Resonanzen der wichtigste<br />
Faktor bei der Noten‐„Findung“ sind… – Was die Gründer <strong>und</strong> Praktiker der Landerziehungsheime schon<br />
vor 100 Jahren begriffen hatten – die Bedeutung der zwischenmenschlichen Zuwendung zur Hervorbrin‐<br />
gung von Erfolgszuversicht <strong>und</strong> Selbstwirksamkeitsüberzeugungen –, ist durch die neueste neurowissen‐<br />
schaftliche Forschung glänzend bestätigt worden. Für die pädagogische Praxis bedeutet es des Weite‐<br />
ren, dass Lehrer <strong>und</strong> Erzieher sich in Balint‐ <strong>und</strong> Supervisionsgruppen über die Bedeutung <strong>und</strong> Wirkung<br />
der analogen Verhaltensweisen der Schüler/innen Rechenschaft geben sollten. Nicht zufällig hat Zeidler<br />
<strong>mit</strong> dieser Perspektive begonnen, getreu der reformpädagogischen Devise der „Pädagogik vom Kinde<br />
aus“, jetzt als „Schule vom Schüler aus“.<br />
Daraus muss die pädagogische Maxime gefolgert werden, dass alle aktiven Re‐Akteurs‐Aktionen,<br />
die in Wahrheit auf gar keine verstehbaren Akteurs‐Signale antworten, zunächst einmal unerlaubte<br />
Übergriffe darstellen. Diese Maxime kann jedoch pragmatisch den potentiellen Problemen des explorie‐<br />
renden Akteurs meist nicht gerecht werden: ihm müssen ja vielleicht auch Anreize <strong>und</strong> Hinweise gebo‐<br />
ten werden; er muss vor bestimmten Folgen (Unversehrtheit an Leib <strong>und</strong> Leben) bewahrt werden. Und<br />
so oszilliert der proaktive <strong>und</strong> reaktive <strong>Umgang</strong> eines Erziehers <strong>mit</strong> dem ihm anvertrauten Kind oder<br />
Jugendlichen zunächst zwischen belebenden <strong>und</strong> richtunggebenden, unterstützenden, behütenden <strong>und</strong><br />
gegenwirkenden Impulsen, dann zwischen belehrenden <strong>und</strong> verbessernden, schließlich zwischen for‐<br />
dernden <strong>und</strong> herausfordernden 84 – immer <strong>mit</strong> dem Ziel der zunehmenden Selbstbestimmung des<br />
Schutzbefohlenen. Demzufolge ist in der Beobachter‐Perspektive unablässig zu reflektieren <strong>und</strong> zu prü‐<br />
fen, was angemessen <strong>und</strong> unangemessen, vertretbar <strong>und</strong> abzulehnen ist, dem pädagogischen Kategori‐<br />
schen Imperativ folgend: Der Erzieher darf nur so handeln, dass der Zögling, wäre er einsichts‐ <strong>und</strong> ur‐<br />
teilsfähig, diesem Handeln zustimmen würde. Eine besondere Erschwerung dieser Abschätzung ist der<br />
Umstand – wie schon Herbart in seiner „Allgemeinen Pädagogik“ von 1806 wusste: die Fehler der Erzie‐<br />
hung werden erst im „Mannesalter“ sichtbar –, dass un<strong>mit</strong>telbare kausale Zuschreibungen von pädago‐<br />
83 Wilhelm Flitner: Verstehen wir unsere Kinder wirklich? (1958) Wiederabgedr. in: Ders. (wie Anm. 73), S. 378–387. – Ulrich<br />
Herrmann: Können wir Kinder verstehen? Rousseau <strong>und</strong> die Folgen. In: Z. f. Päd. 43 (1997), S. 187–196.<br />
84 Vgl. die pädagogische „Kategorientafel“ zu Schleiermachers Pädagogik bei Ernst Lichtenstein (Hrsg.): F.D. E. Schleiermacher:<br />
Ausgewählte pädagogische Schriften. Paderborn 1959 (angeb<strong>und</strong>ene Tafel).<br />
Seite 27
gischen Handlungen <strong>und</strong> deren (un<strong>mit</strong>telbaren oder Langzeit‐) Wirkungen nur ausnahmsweise möglich<br />
sind. Pädagogische Praxis als personale Interaktion ist immer experimentell, <strong>mit</strong> offenem Ausgang. We‐<br />
gen der unbekannten <strong>und</strong> unerwünschten Nebenwirkungen muss dem Grad der Unsicherheit <strong>und</strong> das<br />
Maß des Respekts vor Ambivalenz die ethische Besonnenheit des pädagogisch Handelnden entsprechen,<br />
was sich an seiner Reflektiertheit <strong>und</strong> Zurückhaltung, seiner Empathie <strong>und</strong> Dialogfähigkeit ablesen lässt.<br />
Daraus resultiert, dass unüberlegte bzw. unzulässige Handlungen einen „potentiellen Gefähr‐<br />
dungstatbestand“ darstellen (wie § 176 StGB), so dass das Unterlassungsgebot durch die Strafbarkeit<br />
des Versuchs unterstrichen wird. Das aber meint nichts anderes, als was zu § 176 StGB ausgeführt wur‐<br />
de: Es handelt sich bei sexueller Gewalt um einen Eingriff in die Selbstbestimmung des Kindes als Per‐<br />
son. Missbrauch gem. §§ 174 <strong>und</strong> 176 ist keine pädagogisch argumentierbare Verletzung von Nähe <strong>und</strong><br />
Distanz oder eine entschuldbare Verfehlung eines Abwägungsproblems, dem man nicht gerecht gewor‐<br />
den ist. Es handelt sich vielmehr um geplante <strong>und</strong> in der Regel Wiederholungstaten, deren Täter für ihre<br />
Zwecke der sexuellen Selbstbefriedigung gezielt Distanz ab‐ <strong>und</strong> Nähe aufbauten. Der „charismatische<br />
Führer“ wird zum Verführer <strong>und</strong> Straftäter. Die Reaktion darauf kann nur Strafverfolgung <strong>und</strong> Berufs‐<br />
verbot sein.<br />
Nähe <strong>und</strong> Distanz in pädagogischen Abwägungen kann nicht pauschal, sondern muss im Hinblick<br />
auf die Jüngeren <strong>und</strong> die Älteren aus deren jeweiliger Sicht, in unterschiedlichen Stadien <strong>und</strong> Formen<br />
pädagogischer Beziehungen, angesichts akuter situativer Herausforderungen ganz unterschiedlich be‐<br />
antwortet werden.<br />
Jüngere suchen Nähe – z. B. weil sie Anlehnung, Schutz, Anerkennung suchen; Ältere suchen Nähe – z. B.<br />
weil sie die Jüngeren verstehen wollen, weil sie selber „Jugendlichkeit“ bewahren, auf „einer Wellenlän‐<br />
ge“ bleiben wollen. Es kann sich bei den Jüngeren aber auch um existentielle Krisen handeln, durch de‐<br />
ren Offenbarung sie auch verletzlich werden, wo sie Schutz brauchen <strong>und</strong> keine gefährdende „Fre<strong>und</strong>‐<br />
schaft“. – Unbefangenheit, Schamhaftigkeit, Freizügigkeit – das sind in Erotik <strong>und</strong> <strong>Sexualität</strong>, Kindheit,<br />
Pubertät <strong>und</strong> Jugendalter – höchst unterschiedliche Befindlichkeiten im Verhältnis zu anderen <strong>und</strong> zu<br />
sich selbst, in die ungebetene Eingriffe wie überwältigende Einbrüche wirken können <strong>mit</strong> unabsehbaren<br />
Folgen 85 – oder auch nicht – <strong>und</strong> deshalb sind sie unstatthaft!<br />
Nähe <strong>und</strong> Distanz (statt „<strong>und</strong>“ richtiger „oder“?) darf nicht affirmativ verstanden werden – als verding‐<br />
lichte Entgegensetzung –, sondern muss über die Denkfigur der Ambivalenz argumentativ ins Spiel ge‐<br />
bracht werden: als heuristisches Instrument der Antizipation des Unerwarteten, Unvorhergesehenen,<br />
85 Statt vieler: Ferdinand von Schirach: Was übrig bleibt. In: DER SPIEGEL 6/2010, S. 136 f. – Bodo Kirchhoff: Sprachloses<br />
Kind. Was damals im Internat wirklich geschah. In. DER SPIEGEL 11/2010, S. 150 f. – Amélie Fried: Die rettende Hölle. In:<br />
FAZ, 14.3.2010, wiederabgedr. in: Margarita Kaufmann/Alexander Priebe (Hrsg.): 100 Jahre Odenwaldschule. Berlin 2010, S.<br />
364–368.<br />
Seite 28
„Unmöglichen“. Demzufolge müsste hier ein ganzes Repertoire von ambivalenten pädagogischen Situa‐<br />
tionen <strong>und</strong> Interaktionen, Problemlagen <strong>und</strong> Herausforderungen institutionenspezifisch durchdekliniert<br />
werden. Dies entspräche jenem Impuls von disziplinärer Selbstaufklärung, den Andreas Gruschka ver‐<br />
misst. 86<br />
* * *<br />
Die Intention der akademisch‐pädagogischen Forschung scheint es aus gegebenem Anlass zu sein, sexu‐<br />
elle Gewalt in pädagogischen Institutionen aufarbeiten zu wollen. Die gr<strong>und</strong>legende Schwierigkeit wird<br />
darin bestehen, (Selbst‐)Berichte oder andere Ego‐Dokumente von Tätern <strong>und</strong> Opfern zu bekommen,<br />
um daraus institutionsspezifische Täterstrategien <strong>und</strong> Opferkarrieren in einem jeweiligen Ermögli‐<br />
chungsrahmen zu rekonstruieren.<br />
Mit Andreas Gruschka sei daran erinnert, dass es sich dabei nur um besonders krasse Fälle von<br />
zerstörerischer Einflussnahme auf Lebensläufe Heranwachsender handelt. Die alltägliche Misshandlung<br />
von Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen in den öffentlichen Schulen durch Nichtbeachtung <strong>und</strong> Entmutigung, Her‐<br />
abwürdigung <strong>und</strong> Abweisung kann in ihren Folgen im Einzelfall womöglich nicht weniger gravierend<br />
sein. 87 Die überraschend energische Hinwendung der akademischen Erziehungswissenschaft zu kriminel‐<br />
len Pädophilen <strong>und</strong> Sadisten belegt nur, dass die alltäglichen psycho‐sozialen Misshandlungen von Kin‐<br />
dern <strong>und</strong> Jugendlichen in den staatlichen öffentlichen Schulen von der akademischen Pädagogik <strong>und</strong><br />
erziehungswissenschaftlichen Forschung als system‐charakteristische immer noch nicht hinreichend<br />
thematisiert worden sind. 88<br />
86 Wie Anm. 7. – Vgl. Robert Leicht: Distanz muss sein. Nach den Missbrauchsfällen sollte neu darüber nachgedacht werden,<br />
wie viel Nähe Lehrern <strong>und</strong> Schülern gut tut. In: DIE ZEIT, 25.3.2010, S. 77.<br />
87 Deswegen ist das Thema einer Bielefelder ZiF-Tagung am 26./27.1.2011 richtig überschrieben: Zerstörerische Vorgänge.<br />
Wenn Kinder <strong>und</strong> Jugendliche Missachtung <strong>und</strong> sexuelle Gewalt in sozialen Institutionen erfahren.<br />
88 So der klare <strong>und</strong> nachdrückliche Hinweis von Rita Süßmuth anlässlich einer Tagung zur Reformpädagogik Mitte Dezember<br />
2010 in der Ev. Akademie Bad Boll.<br />
Seite 29
Sexuelle Gewalt gegen Mädchen <strong>und</strong><br />
Jungen in Ins6tu6onen –<br />
Ausgewählte Ergebnisse<br />
Forschungsprojekt des Deutschen Jugendins6tuts/Abt. Familie<br />
im AuErag der Unabhängigen BeauEragten zur Aufarbeitung<br />
sexuellen Kindesmissbrauchs<br />
5. Forum der <strong>Heidehof</strong> S6Eung GmbH: „<strong>Umgang</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sexualität</strong>,<br />
<strong>Körperlichkeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Macht</strong> in pädagogischen Kontexten“<br />
StuRgart, 9. November 2011<br />
Seite 30<br />
Elisabeth Helming, Dipl.Soziologin, Deutsches Jugendins6tut, München
Übersicht über die Themen<br />
1) Das Projekt „Sexuelle Gewalt gegen Mädchen <strong>und</strong><br />
Jungen in Ins6tu6onen: www.dji.de/sgmj<br />
2) Vorkommen: Verdachtsfälle sexueller Gewalt in<br />
Ins6tu6onen<br />
3) Entstehung des Verdachts; Aufdeckung <strong>und</strong><br />
Aufdeckungshindernisse<br />
4) Präven6on<br />
DJI e.V. München, Projekt: Sexuelle Gewalt gegen Mädchen <strong>und</strong> Jungen in Institutionen<br />
Seite 31
Das Forschungsprojekt<br />
Laufzeit: 01.07.2010 – 31.07.2011<br />
Förderung: UBSKM, BMBF<br />
Zentrale Fragestellungen<br />
� Wo <strong>und</strong> wie ist sexuelle Gewalt in den Ins6tu6onen bekannt geworden, wie<br />
viele Verdachtsfälle gab es? Um welche Form/ welchen Grad der<br />
Übergriffigkeit ging es dabei? <strong>Umgang</strong> <strong>mit</strong> Verdachtsfällen?<br />
� Welches Vorgehen, welche Regelungen, welche Koopera6onsstrukturen der<br />
Präven6on <strong>und</strong> Interven6on gibt es?<br />
� Welchen Bedarf sehen die Ins6tu6onen hinsichtlich der Weiterentwicklung<br />
von Präven6onsmaßnahmen <strong>und</strong> Qualitätsstandards?<br />
DJI e.V. München, Projekt: Sexuelle Gewalt gegen Mädchen <strong>und</strong> Jungen in Institutionen Seite 32
Bisherige Erkenntnisse zum Problem<br />
sexueller Gewalt in Institutionen<br />
� Noch keine systema6sche Erfassung von sexueller Gewalt in<br />
ins6tu6onellen Kontexten.<br />
� Für die Gegenwart belegen wenige kleinere Studien aus dem<br />
Ausland (USA <strong>und</strong> Irland) das Vorkommen sexueller Gewalt in<br />
sta6onären Maßnahmen der Kinder‐ <strong>und</strong> Jugendhilfe <strong>und</strong> in<br />
Internaten.<br />
� Für Deutschland haben wir Zusammenstellungen von Fällen in<br />
bes6mmten, bekannt gewordenen Ins6tu6onen.<br />
DJI e.V. München, Projekt: Sexuelle Gewalt gegen Mädchen <strong>und</strong> Jungen in Ins6tu6onen<br />
Seite 33
Drei Module:<br />
Methodisches Design<br />
� 3 Literaturexper6sen zum Forschungsstand zu sexueller Gewalt<br />
<strong>und</strong> Aufarbeitung der aktuellen Praxisdiskurse<br />
� Fokusgruppen <strong>mit</strong> Opfervertretungen, Betroffenen <strong>und</strong><br />
FachkräMen<br />
� Standardisierte Ins6tu6onen‐Befragung zum Vorkommen von<br />
Verdachtsfällen <strong>und</strong> zum <strong>Umgang</strong> <strong>mit</strong> sexueller Gewalt<br />
ProjekReam: Elisabeth Helming, Heinz Kindler, Alexandra Langmeyer, Marina<br />
Mayer, Peter Mosser, Chris6ne Entleitner; unter Mitarbeit von: Sabina SchuPer,<br />
Mechthild Wolff<br />
DJI e.V. München, Projekt: Sexuelle Gewalt gegen Mädchen <strong>und</strong> Jungen in Institutionen<br />
Seite 34
Ins6tu6onen‐Befragung: Rücklauf<br />
Informand Befragt<br />
SchulleiterInnen 1.128<br />
LehrkräEe 702<br />
Internatsleitungen 97<br />
Aktuelle SchülervertreterInnen 53<br />
Ehemalige SchülervertreterInnen 24<br />
HeimleiterInnen 324<br />
Gesamt Rücklauf 1818<br />
(Quelle: Helming u.a. 2011) Seite 35<br />
DJI e.V. München, Projekt: Sexuelle Gewalt gegen Mädchen <strong>und</strong> Jungen in Institutionen
Gefragt wurde nach drei Formen von<br />
bekannt gewordenen Verdachtsfällen<br />
� Sexuelle Gewalt durch an der Einrichtung tä6ge<br />
erwachsene Personen,<br />
� durch andere Kinder <strong>und</strong> Jugendliche,<br />
� Verdachtsfälle sexueller Gewalt, die außerhalb der<br />
Einrichtung staRgef<strong>und</strong>en haben, z. B. in der Familie,<br />
aber in der Einrichtung bekannt geworden sind.<br />
DJI e.V. München, Projekt: Sexuelle Gewalt gegen Mädchen <strong>und</strong> Jungen in Institutionen<br />
Seite 36
Mindestens einen Verdachtsfall gaben an:<br />
43 %<br />
Schulleitung<br />
Lehrkraft<br />
Internat<br />
Heim<br />
40%<br />
49%<br />
In den letzten drei Jahren<br />
70%<br />
DJI e.V. München, Projekt: Sexuelle Gewalt gegen Mädchen <strong>und</strong> Jungen in Institutionen<br />
Seite 37
C: Außerhalb der<br />
Einrichtung<br />
B: Zwischen Kindern/-<br />
Jugendlichen<br />
A: durch an der<br />
Einrichtung tätige<br />
erwachsene Personen<br />
Verdachtsfälle im Vergleich<br />
Mindestens einen Verdachtsfall gaben an<br />
3%<br />
4%<br />
10%<br />
16%<br />
28%<br />
32%<br />
34%<br />
39%<br />
Heime<br />
Internate<br />
Schulen<br />
DJI e.V. München, Projekt: Sexuelle Gewalt gegen Mädchen <strong>und</strong> Jungen in Institutionen<br />
49%<br />
Seite 38
Wie ist der Verdacht entstanden?<br />
� Ein Verdacht entsteht in etwa der HälEe der Fälle, weil<br />
betroffene Kinder selbst ak6v werden <strong>und</strong> sich einer Lehr‐ oder<br />
FachkraE anvertrauen.<br />
� In anderen Fällen müssen FachkräEe ak6v werden <strong>und</strong> auf<br />
Kinder zugehen, die ihre Betroffenheit nur indirekt durch<br />
Andeutungen <strong>und</strong>/oder auffälliges Verhalten zeigen.<br />
� Eine manchmal bedeutende Rolle bei der Aufdeckung sexueller<br />
Gewalt spielen informierte Gleichaltrige, die von betroffenen<br />
Kindern zunächst eingeweiht wurden.<br />
� Eine weitere wich6ge Quelle des Bekanntwerdens von<br />
Verdachtsfällen in Schulen sind Eltern.<br />
DJI e.V. München, Projekt: Sexuelle Gewalt gegen Mädchen <strong>und</strong> Jungen in Institutionen<br />
Seite 39
20%<br />
Was folgte aus dem Verdachtsfall?<br />
Arbeits- oder strafrechtliche<br />
Konsequenzen bei den<br />
genannten Verdachtsfällen<br />
auf Übergriffe durch<br />
erwachsene<br />
MitarbeiterInnen<br />
33% 33%<br />
Schulen Internate Heime<br />
Konsequenzen bei den<br />
genannten Verdachtsfällen<br />
auf Übergriffe durch<br />
heranwachsende<br />
TäterInnen<br />
DJI e.V. München, Projekt: Sexuelle Gewalt gegen Mädchen <strong>und</strong> Jungen in Institutionen<br />
67%<br />
69%<br />
74%<br />
Schulen Internate Heime<br />
Seite 40
Bef<strong>und</strong>e aus der Forschung zu<br />
Aufdeckungsraten<br />
� Viele Fälle sexueller Gewalt gegen Mädchen <strong>und</strong> Jungen<br />
werden den Erwachsenen nicht bekannt, das kann als<br />
durchgängiges Fazit etlicher Studien konsta6ert werden.<br />
� Aufdeckungs‐Raten schwanken zwischen 58 % <strong>und</strong> 72 %, wenn<br />
man Erwachsene retrospek6v befragt, ob sie irgendwann einmal<br />
in ihrem Leben die Gewalt aufgedeckt haben.<br />
� 42 % der Jugendlichen haben in einer schwedischen Studie<br />
(Priebe & Svedin 2008) angegeben, dass sie lediglich <strong>mit</strong> einer<br />
Fre<strong>und</strong>In ihres eigenen Alters gesprochen haben <strong>und</strong> <strong>mit</strong> sonst<br />
niemandem. DJI e.V. München, Projekt: Sexuelle Gewalt gegen Mädchen <strong>und</strong> Jungen in Institutionen<br />
Seite 41
Aufdeckungshindernisse auf Seiten der<br />
� Alter der Kinder<br />
� Behinderung<br />
Kinder <strong>und</strong> Jugendlichen<br />
� Männlichkeitsvorstellungen<br />
(Nach Paine & Hansen 2002)<br />
� Zugehörigkeit zu einer ethnischen Minderheit<br />
� Wenig oder überfürsorglich‐kontrollierender familiärer<br />
Hintergr<strong>und</strong><br />
� Die Beziehung zwischen Opfer <strong>und</strong> Täter<br />
� Je schwerer die sexuelle Gewalt <strong>und</strong> je länger sie andauert,<br />
desto weniger öffnen sich Kinder<br />
DJI e.V. München, Projekt: Sexuelle Gewalt gegen Mädchen <strong>und</strong> Jungen in Institutionen<br />
Seite 42
Aufdeckungshindernisse (Erwachsene)<br />
Schweigen, das auf Angst beruht:<br />
� um Konflikte zu vermeiden, um sich nicht angreiuar zu machen,<br />
weil man nega6ve Konsequenzen fürchtet.<br />
Schweigen, das auf Resigna6on beruht,<br />
� weil sich sowieso nichts ändern wird; weil die Vorgesetzten<br />
nicht offen sind, was Vorschläge oder Besorgnis oder Ähnliches<br />
betrix.<br />
Schweigen, das auf Koopera6on beruht,<br />
� um die Gefühle von KollegInnen <strong>und</strong> Vorgesetzten nicht zu<br />
verletzen; um zu vermeiden, andere zu beschämen; weil man<br />
einer Beziehung zu KollegInnen <strong>und</strong> Vorgesetzten nicht schaden<br />
möchte. DJI e.V. München, Projekt: Sexuelle Gewalt gegen Mädchen <strong>und</strong> Jungen in Institutionen<br />
Seite 43
Anteile genannter kindbezogener Präven6onsanstrengungen in<br />
Schulen, Internaten <strong>und</strong> Heimen (in Prozent, Mehrfachnennungen)<br />
Schulen<br />
(Leitung)<br />
Schulen<br />
(LehrkraE)<br />
Internate Heime<br />
Veranstaltungen <strong>mit</strong><br />
Kindern<br />
Selbstverteidigung<br />
Fortbildung<br />
Kollegium/Team<br />
Sexualpädagogische<br />
Konzepte<br />
36 30 25 31<br />
28 27 35 26<br />
20 17 35 35<br />
21 22 24 29<br />
DJI e.V. München, Projekt: Sexuelle Gewalt gegen Mädchen <strong>und</strong> Jungen in Institutionen<br />
Seite 44
Anteile genannter Hilfestellungen für FachkräEe in Schulen,<br />
Internaten <strong>und</strong> Heimen zum <strong>Umgang</strong> <strong>mit</strong> Verdachtsfällen (in %)<br />
Schulen<br />
(Leitung)<br />
Schulen<br />
(LehrkräEe)<br />
Internate Heime<br />
Handreichung 21 17 27 39<br />
Supervision 7 8 41 70<br />
Spez.<br />
FachkraE<br />
intern<br />
30 29 50 53<br />
Spez. Beratung<br />
extern 49 48 45 53<br />
DJI e.V. München, Projekt: Sexuelle Gewalt gegen Mädchen <strong>und</strong> Jungen in Institutionen<br />
Seite 45
Welche Präven6on wirkt?<br />
� Größere Effekte zeigen Programme, die mehrmals<br />
durchgeführt werden, länger dauern <strong>und</strong><br />
Beteiligungsmöglichkeiten bieten.<br />
� Veranstaltungen haben kurzfris6ge Effekte, aber oE keinen<br />
Effekt im Ein‐Jahres‐Follow‐Up.<br />
� VersteXgung, IntegraXon in den pädagogischen Alltag<br />
� Fehlende Erkenntnisse zu unspezifischen Angeboten<br />
(z.B. über Selbstbewusstsein).<br />
DJI e.V. München, Projekt: Sexuelle Gewalt gegen Mädchen <strong>und</strong> Jungen in Institutionen<br />
Seite 46
»Aber was geblieben ist, ist einfach dieses Schmutzigsein. Am Tag kann ich<br />
meine Gedanken beherrschen, wenn ich zum Beispiel über die Medien<br />
höre, dass ein Kind verschw<strong>und</strong>en ist oder missbraucht ist, dann kann ich<br />
entkatastrophisieren, das hab ich gelernt. Aber nachts nicht. […] Ich wach<br />
dann auf, ich muss mich übergeben, ich hab das Gefühl, ich hab Sperma<br />
im M<strong>und</strong>, ich geh auf die ToileGe, mir tut dann alles weh, das geht erst<br />
nach drei Tagen wieder zurück, der Schmerz, ich kratz mich, ich dusch die<br />
halbe Nacht, ich geh an den Kühlschrank <strong>und</strong> ess alles auf, was ich finde.<br />
Ich übergeb mich wieder, also ich esse, um diesen inneren Schmutz<br />
rauszukriegen. Wenn ich merk, ich hab nichts mehr drinnen, aber ich fühl<br />
mich noch schmutzig, dann muss ich einfach was essen, […] das krieg ich<br />
nicht hin. Da muss es doch was geben, das ist so eine Belastung, auch<br />
organisch. Aber das, das wär mein größter Wunsch, auch die Nächte zu<br />
beherrschen. Aber das haut einfach nicht hin. Was soll man machen?«<br />
Quelle: Helming u.a. 2011; DJI e.V. München, Projekt: Sexuelle Gewalt gegen Mädchen <strong>und</strong> Jungen in Ins6tu6onen<br />
Seite 47
Fazit<br />
Ein erster Einblick in das Hellfeld<br />
„Sexuelle Gewalt gegen Mädchen <strong>und</strong><br />
Jungen in Ins6tu6onen“<br />
Weitere Forschungsanstrengungen sind<br />
notwendig, insbesondere auch in Bezug auf<br />
Prävalenz <strong>und</strong> die Evalua6on von<br />
Präven6onsmaßnahmen.<br />
www.dji.de/sgmj<br />
DJI e.V. München, Projekt: Sexuelle Gewalt gegen Mädchen <strong>und</strong> Jungen in Institutionen<br />
Seite 48
Literatur<br />
� Helming, Elisabeth / Kindler, Heinz / Langmeyer, Alexandra / Mayer, Marina / Entleitner,<br />
Chris6ne / Mosser, Peter / Wolff, Mech6ld (2011): Sexuelle Gewalt gegen Mädchen <strong>und</strong> Jungen<br />
in Ins6tu6onen. Rohdatenbericht. München: DJI. Download in Kürze unter: www.dji.de/sgmj<br />
� B<strong>und</strong>schuh, Claudia (2011): Sexualisierte Gewalt gegen Kinder in Ins6tu6onen. Na6onaler <strong>und</strong><br />
interna6onaler Forschungsstand. Exper6se im Rahmen des Projekts „Sexuelle Gewalt gegen<br />
Mädchen <strong>und</strong> Jungen in Ins6tu6onen“München: DJI. Download unter:<br />
www.dji.de/sgmj/Exper6se_B<strong>und</strong>schuh.pdf<br />
� Kindler Heinz / Schmidt‐Ndasi Daniela (2011): Wirksamkeit von Maßnahmen zur Präven6on <strong>und</strong><br />
Interven6on im Fall sexueller Gewalt gegen Kinder. Exper6se im Rahmen des Projekts „Sexuelle<br />
Gewalt gegen Mädchen <strong>und</strong> Jungen in Ins6tu6onen“. Herausgegeben von Amyna e.V. München:<br />
DJI. Download unter: www.dji.de/sgmj/Exper6se_Amyna.pdf<br />
� Zimmermann, Peter (2010): Sexualisierte Gewalt gegen Kinder in Familien <strong>und</strong> im familialen<br />
Umfeld. Exper6se im Rahmen des Projekts „Sexuelle Gewalt gegen Mädchen <strong>und</strong> Jungen in<br />
Ins6tu6onen“. Unter Mitarbeit von Dr. Anna Neumann/Dipl.‐Psych. Fatma Çelik. Exper6se im<br />
Rahmen des Projekts „Sexuelle Gewalt gegen Mädchen <strong>und</strong> Jungen in Ins6tu6onen“. München:<br />
DJI. Download unRer: www.dji.de/sgmj/Exper6se_Zimmermann.pdf<br />
DJI e.V. München, Projekt: Sexuelle Gewalt gegen Mädchen <strong>und</strong> Jungen in Institutionen<br />
Seite 49
Auswirkungen<br />
Sexuelle Gewalt verletzt<br />
� Grenzen der Selbstbes6mmung<br />
� gewal}örmig<br />
� bedrohend<br />
� manipula6v<br />
� Ges<strong>und</strong>heit<br />
� Lebensqualität, Lebenschancen<br />
� Rechte<br />
Seite 50
Literatur<br />
� Kavemann, Barbara (2009): Das Kind als Opfer von Gewalt <strong>und</strong> Vernachlässigung –<br />
Anforderungen an die Rechtspraxis, das Hilfesystem <strong>und</strong> die Öffentlichkeit. Erschienen in „Neue<br />
KriminalpoliQk“ 3/09.<br />
� Paine, M. L. & Hansen, D. J. (2002). Factors influencing children to self‐disclose sexual abuse.<br />
Clinical Psychology Review, 22(2), 271‐295.<br />
� Priebe, Gisela/Svedin, Carl Göran (2008): Child sexual abuse ist largely hideen from the adult<br />
society. An epidemological study of adolescents’ disclosures. In: Child Abuse and Neglect 32<br />
(2008), S. 1095‐ 1108<br />
DJI e.V. München, Projekt: Sexuelle Gewalt gegen Mädchen <strong>und</strong> Jungen in Institutionen<br />
Seite 51
Literatur<br />
� Reemtsma, J. P. (2008): Vertrauen <strong>und</strong> Gewalt. Versuch über eine besondere Konstella6on der<br />
Moderne. Hamburg: Hamburger Edi6on – HIS‐VerlagsgesellschaE.<br />
� Reemtsma, Jan‐Philipp (2002): Die Gewalt spricht nicht. StuRgart: Reclam<br />
� SchröRle, Monika (2005): Gewalt gegen Frauen in Deutschland – Ergebnisse der ersten<br />
b<strong>und</strong>esdeutschen Repräsenta6vbefragung. In: ZeitschriE für Frauenforschung <strong>und</strong><br />
Geschlechterstudien, HeE 1+2/2005, S. 9‐24<br />
� SchröRle, Monika/Müller, Ursula (2004): Lebenssitua6on, Sicherheit <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit von Frauen<br />
in Deutschland. Eine repräsenta6ve Untersuchung zu Gewalt gegen Frauen in Deutschland. Im<br />
AuErag des B<strong>und</strong>esministerium für Familie, Senioren, Frauen <strong>und</strong> Jugend.<br />
� Wetzels, P. (1997): Gewalterfahrungen in der Kindheit. Baden‐Baden.<br />
� Wolff, M. (2007): Sexualisierte Gewalt durch Professionelle in Ins6tu6onen. In: IzKK‐Nachrichten,<br />
HeE 1, S. 4 – 7<br />
DJI e.V. München, Projekt: Sexuelle Gewalt gegen Mädchen <strong>und</strong> Jungen in Institutionen<br />
Seite 52
Gewalt kann trauma6sch wirken<br />
� Keine automa6sche Trauma6sierung, ABER:<br />
� Gewalt hat gr<strong>und</strong>sätzlich trauma6sierendes Poten6al<br />
� Trauma kann auch kumula6v entstehen<br />
� Auch Folgen der Gewalt wie Drogenkonsum, Depression,<br />
Essstörungen, Krankheiten sind zerstörerisch<br />
� Bindungsstörungen durch frühe Gewalt sind extrem<br />
belastend, es bedarf spezifischer Angebote, die vor<br />
kon6nuierlicher Revik6misierung schützen können.<br />
� Ausschlussprozesse: Aus der Familie, aus Bildungsangeboten,<br />
aus Verbänden/Vereinen …<br />
� Nicht iden6fizierte Verhaltensauffälligkeiten von Kindern<br />
Seite 53
Sexueller Missbrauch in Ins6tu6onen<br />
� Kinder in der Heimerziehung <strong>und</strong> teilweise in Internaten<br />
bzw. in Einrichtungen der Behindertenhilfe sind eine<br />
besonders vulnerable Gruppe<br />
� Risiko für Jungen ist in diesem Kontext erhöht<br />
� Besonderes Risiko für Kinder <strong>mit</strong> körperlichen<br />
Behinderungen oder Lernbehinderungen<br />
� Aufdeckung des Missbrauchs bedeutet in der Regel einen<br />
erneuten Bruch im Leben<br />
(Quelle: Kindler/Schmidt‐Ndasi 2011) Seite 54
Risiko‐Strukturen in Ins6tu6onen<br />
Strukturen in Ins6tu6onen, die die Reduk6on innerer <strong>und</strong><br />
äußerer Hemmschwellen begüns6gen: u.a.<br />
Geschlossenheit<br />
spezifische Leitungsstrukturen (autoritär/wenig strukturiert)<br />
Pädagogische Haltungen <strong>und</strong> Konzepte:<br />
‐ Unreflek6erte <strong>Macht</strong>verhältnisse<br />
‐ Fehlende Leitlinien für den professionellen<br />
<strong>Umgang</strong> <strong>mit</strong> Distanz <strong>und</strong> Nähe<br />
‐ Fehlende sexualpädagogische Konzepte<br />
Besondere Vulnerabilität von Kindern<br />
(Quelle: Helming u.a. 2011)<br />
DJI e.V. München, Projekt: Sexuelle Gewalt gegen Mädchen <strong>und</strong> Jungen in Ins6tu6onen<br />
Seite 55
Tatkonstella6onen<br />
� Aufwertung <strong>und</strong> Demü6gung<br />
� Gefälligmachen durch Geschenke, Versprechungen (sexueller<br />
Missbrauch als Gegenleistung)<br />
� Sexuelle Übergriffe oEmals spielerisch getarnt als Rangeleien<br />
<strong>und</strong> Kämpfe<br />
� Ausnutzung von Situa6onen, in denen das Kind alleine ist (zu<br />
Hause) oder in einer ungeschützten körperlichen Situa6on<br />
(Sauna, Urlaub)<br />
� Häufig Schweigen, Wegsehen <strong>und</strong> Leugnen sowohl in der Familie<br />
als auch in Ins6tu6onen<br />
(Quelle: Auswertung der Anlaufstelle der UBSKM)<br />
DJI e.V. München, Projekt: Sexuelle Gewalt gegen Mädchen <strong>und</strong> Jungen in Institutionen<br />
Seite 56
Tatkonstella6onen in Ins6tu6onen<br />
� Es wird von arrangierten Situa6onen durch Lehrpersonal im<br />
schulischen Kontext berichtet, in der das Kind <strong>mit</strong> der LehrkraE<br />
alleine in einem Raum sein musste (in der Schule, aber auch bei<br />
der LehrkraE alleine zu Hause)<br />
� Täter bzw. Täterin baut häufig eine besondere Beziehung zum<br />
Kind auf durch Belohnung, aber auch Bedrohung (z.B. im<br />
Sportbereich)<br />
� Im medizinischen Bereich werden sexuelle Übergriffe häufig als<br />
notwendige medizinische Untersuchungen getarnt, es wird dort<br />
auch von Hypnose <strong>und</strong> direkten Übergriffen <strong>und</strong><br />
Seite 57<br />
Vergewal6gungen berichtet (Quelle: Auswertung der Anlaufstelle der UBSKM)<br />
DJI e.V. München, Projekt: Sexuelle Gewalt gegen Mädchen <strong>und</strong> Jungen in Institutionen
Tatkonstella6onen in Ins6tu6onen<br />
� Betroffene, die innerhalb der Familie Missbrauch erlebt haben<br />
<strong>und</strong> sich Personen im kirchlichen <strong>und</strong>/oder therapeu6schen<br />
Kontext anvertraut haben, berichten von erneutem Missbrauch<br />
durch die dor6gen Vertrauenspersonen (Übergriffe im Rahmen<br />
der Beichte, in der Therapie)<br />
� Berichte über sexuelle Übergriffe bei Freizeiten, im Heim <strong>und</strong> im<br />
Krankenhaus bis hin zur Vergewal6gung (nachts, im Zelt, im<br />
Waschraum, im Schlafraum<br />
(Quelle: Auswertung der Anlaufstelle der UBSKM)<br />
DJI e.V. München, Projekt: Sexuelle Gewalt gegen Mädchen <strong>und</strong> Jungen in Institutionen<br />
Seite 58
Prävalenz <strong>und</strong> Überschneidung <strong>mit</strong> anderen<br />
Gefährdungsformen in der Familie <strong>und</strong> im<br />
familialen Umfeld<br />
� Prävalenzrate berichteter Fälle bei Frauen in deutschen Studien<br />
zwischen 2,6 % <strong>und</strong> 5,1 % <strong>und</strong> bei Männern von 0,3 % bis 0,9 %.<br />
� Nahezu nur interna6onale Bef<strong>und</strong>e zur Überschneidung <strong>mit</strong><br />
anderen Formen von Gefährdung, v.a. Sicherheit nach bekannt<br />
gewordener Gefährdung unbekannt.<br />
� Missbrauch in der Familie beginnt tendenziell früh im Leben,<br />
hohes Risiko späterer Revik6misierung<br />
� Dieser Missbrauch dauert in der Regel längere Zeit an <strong>und</strong> ist als<br />
schwerwiegend zu betrachten.<br />
(Quelle: Zimmermann 2011)<br />
Seite 59
Kri6k von Kindern an Gerichtsverfahren:<br />
� Nega6v ist wenn man Geschichte ständig neu erzählen<br />
muss<br />
� Wenig Wissen über den Prozess<br />
� Zu wenig Einfluss auf Entscheidungen<br />
� Wenig Sensibilität der Autoritäten<br />
� Verlust von Zeit<br />
� Verlust von Privatheit<br />
� Zu wenig Wissen über Abläufe <strong>und</strong> Verfahren<br />
(Asher 2011)<br />
DJI e.V. München, Projekt: Sexuelle Gewalt gegen Mädchen <strong>und</strong> Jungen in Institutionen<br />
Seite 60
Was brauchen Kinder in Gerichtsprozessen?<br />
� Respekt – Unterstützung – Gerech6gkeit<br />
� Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen geht es um eine Unterstützung, die sie<br />
als handlungs‐ <strong>und</strong> entscheidungsfähige Subjekte wahrnimmt<br />
� Kinder wollten: Informa6on, Erklärung, Unterstützung, es sollte<br />
schnell gehen, da<strong>mit</strong> es bald vorbei ist.<br />
� Eltern: Unterstützung, Erklärung, Informa6on<br />
� Fairness des Verfahrens ist extrem wich6g für Menschen, dann<br />
sind sie auch eher <strong>mit</strong> Ergebnis zufrieden, sowohl TäterInnen als<br />
auch Opfer. (Asher 2011, Kavemann 2009, o.J.)<br />
DJI e.V. München, Projekt: Sexuelle Gewalt gegen Mädchen <strong>und</strong> Jungen in Institutionen<br />
Seite 61
Risikofaktoren:<br />
ÜberdurchschniRlich gefährdet sind Kinder,<br />
� die aufgr<strong>und</strong> körperlicher oder geis6ger Einschränkungen über<br />
geminderte Selbstschutz‐ oder MiReilungsfähigkeiten verfügen,<br />
� die Grenzen im <strong>Umgang</strong> <strong>mit</strong> anderen schlechter einschätzen<br />
können <strong>und</strong> deren Vertrauen zu Bezugs‐ <strong>und</strong> Autoritätspersonen<br />
deshalb einschränkt ist,<br />
� deren familiäre Bezugspersonen wenig emo6onalen Rückhalt<br />
bieten, die selbst Impulse schlecht kontrollieren können bzw.<br />
die in ihrer Erziehungsfähigkeit durch chronische Belastungen<br />
oder akute Konflikte eingeschränkt erscheinen.<br />
(Quelle: Schmidt‐Ndasi 2011).<br />
DJI e.V. München, Projekt: Sexuelle Gewalt gegen Mädchen <strong>und</strong> Jungen in Institutionen<br />
Seite 62
Mul6ples Gewalterleben<br />
� Mädchen <strong>und</strong> Jungen, die Opfer sexuellen Missbrauchs sind,<br />
erleben etwa doppelt so oE Gewalt zwischen den Eltern.<br />
� Die Mehrheit der Mädchen <strong>und</strong> Jungen, die sexuell<br />
missbraucht wurden, erliR gleichzei6g besonders intensive<br />
körperliche Gewalt durch die Eltern.<br />
� Wenn Eltern körperliche Gewalt gegen Kinder ausüben,<br />
wächst deren Risiko, auch sexuell missbraucht zu werden.<br />
(Pfeiffer/Wetzels 1997; Deegener 2006, nach Kavemann 2009, o.J.)<br />
C Barbara Kavemann<br />
Seite 63
Grenzen der Gerech6gkeit<br />
„Das Rechtsdenken kennt das Opfer so gut wie nicht,<br />
das Gerech6gkeitsempfinden lebt von der<br />
emo6onellen Nähe <strong>mit</strong> dem Opfer.“<br />
(Jan Phillip Reemtsma, zit. nach Kavemann 2009)<br />
Seite 64
Betroffene, Täter <strong>und</strong> TäterInnen<br />
� In allen drei Verdachtsfällen sind überwiegend<br />
Mädchen betroffen, zu ca. 80 %;<br />
� Die Täter sind überwiegend männlich; nur wenn es um<br />
sexuelle Übergriffe der Kinder <strong>und</strong> Jugendlichen<br />
untereinander geht, werden zu 23 % auch Mädchen als<br />
Täterinnen genannt.<br />
Auswertung der Anlaufstelle der UBSKM<br />
� Weibliche Betroffene: überwiegend Täter (92 %)<br />
� Männliche Betroffene: überwiegend Täter (80%), aber häufiger auch Missbrauch<br />
durch Täterinnen (14 %) als weibliche Betroffene (3 %)<br />
� Männer erleben mehr in Ins6tu6onen, Frauen mehr in Familie <strong>und</strong> Familialem Umfeld<br />
sexuelle Gewalt DJI e.V. München, Projekt: Sexuelle Gewalt gegen Mädchen <strong>und</strong> Jungen in Institutionen<br />
Seite 65
Was soll passiert sein?<br />
� Sexuelle Gewalt durch an der Einrichtung tä6ge<br />
erwachsene Personen: überwiegend strafrechtlich<br />
schwer fassbare Vorwürfe; bei Heimen: 20 % der Fälle<br />
Penetra6on<br />
� Sexuelle Gewalt/sexuelle Übergriffe durch andere<br />
Kinder bzw. Jugendliche: überwiegend Vorwürfe von<br />
Berührungen am Körper bzw. an den Geschlechtsteilen<br />
DJI e.V. München, Projekt: Sexuelle Gewalt gegen Mädchen <strong>und</strong> Jungen in Institutionen<br />
Seite 66
Mul6ple Grenzverletzungen<br />
Mädchen, die vor dem 16. Lebensjahr sexuell missbraucht<br />
worden waren, …..<br />
� wurden als Frau viermal häufiger Opfer von sexualisierter Gewalt (41%<br />
im Vergleich zu 10%),<br />
� wurden mehr als doppelt so oE Opfer der Gewalt durch<br />
Beziehungspartner,<br />
� erlebten deutlich häufiger Mehrfachvik6misierung (66% im Vergleich zu<br />
34%), vor allem dann, wenn die Täter Familienangehörige waren (78%).<br />
(SchröRle/Müller 2004, nach Kavemann 2011)<br />
Seite 67
Das Dilemma der Opfer<br />
Es besteht darin, dass von Gewalt Betroffene<br />
einerseits wollen <strong>und</strong> brauchen, dass ihr<br />
Opferstatus anerkannt wird, andererseits wollen sie<br />
nicht auf den Opferstatus festgelegt werden.<br />
(Jan‐Philipp Reemtsma, nach Kavemann 2009)<br />
Seite 68
Ausgrenzung der Betroffenen durch<br />
S6gma6sierung<br />
� Opfer sind anders<br />
� „Opfer“ gelten als hilflos <strong>und</strong> machtlos<br />
� „Opfer“ sein ist nicht cool<br />
� „Opfer“ bedeutet in der Jugendsprache „Idiot“ oder<br />
„TroRel“<br />
� Zuschreibungen von Opferklischees erschweren die<br />
Hilfesuche <strong>und</strong> verhindern das Erkennen von Betroffenen<br />
(Kavemann 2009)<br />
C Barbara Kavemann<br />
Seite 69
Unglück oder Unrecht?<br />
„Die Strauarkeit der Tat drückt die Solidarität der<br />
GesellschaE <strong>mit</strong> dem Opfer aus.“<br />
(Jan Phillip Reemtsma, nach Kavemann 2009)<br />
Seite 70
Grenzen des Rechts<br />
� Nicht jede Grenzverletzung genügt den strengen<br />
Kriterien des Strafrechts<br />
� Auch Unterstützung <strong>und</strong> Anerkennung drücken die<br />
Solidarität der GesellschaE aus<br />
(Kavemann 2009)<br />
Seite 71
Hilfen für betroffene Kinder<br />
� Unklar: sek<strong>und</strong>äre Trauma6sierungen durch Schutzmaßnahmen<br />
� Moderat posi6ve Effekte Psychotherapien; differen6elle<br />
Bewertung Therapieverfahren aber bislang nur bzgl. PTSD<br />
möglich<br />
� Sehr schwache Bef<strong>und</strong>lage zu Erziehungshilfen<br />
� Ungelöst: Re‐Vik6misierungsrisiken<br />
� Ungelöst: Jungen suchen weniger Hilfe (sind aber genauso<br />
problembelastet)<br />
� Ungelöst: Therapien ohne Effekt auf Aussage<br />
(Quelle: Kindler/Schmidt‐Ndasi 2011).<br />
Seite 72
Tatkonstella6onen in den Familien<br />
� Einige Betroffene berichten, dass Männer gezielt Beziehungen<br />
<strong>mit</strong> alleinerziehenden MüRern eingegangen sind, um Kinder<br />
missbrauchen zu können<br />
� OEmals werden Betroffene als Partnerinnen‐ bzw. Partnerersatz<br />
benutzt (mehrfach Berichte, dass Töchter im BeR der Väter<br />
schlafen müssen <strong>und</strong> dort missbraucht werden, wenn die MuRer<br />
z.B. in der Klinik ist)<br />
� Häusliche Gewalt (oEmals verb<strong>und</strong>en <strong>mit</strong> Alkohol)<br />
� Reihenfolge der Übergriffe oEmals: Anfassen, Masturba6on vor<br />
Opfer, Penetra6on<br />
(Quelle: Auswertung der Anlaufstelle der UBSKM)<br />
DJI e.V. München, Projekt: Sexuelle Gewalt gegen Mädchen <strong>und</strong> Jungen in InstitutionQuelleen<br />
Seite 73
Tatkonstella6onen in den Familien<br />
� OEmals mehrere Betroffene <strong>und</strong> mehrere Täter bzw.<br />
Täterinnen, häufig genera6onenübergreifend<br />
� Missbrauch meist über Jahre hinweg<br />
� Täter bzw. Täterinnen sind fast immer Personen, die älter sind<br />
<strong>und</strong> von denen das Kind abhängt (Eltern, Großeltern, Tante bzw.<br />
Onkel, ältere Geschwister)<br />
� OEmals sind Väter die Täter <strong>und</strong> die MüRer unterstützen diese<br />
bzw. lassen es zu<br />
(Quelle: Auswertung der Anlaufstelle der UBSKM)<br />
DJI e.V. München, Projekt: Sexuelle Gewalt gegen Mädchen <strong>und</strong> Jungen in Institutionen<br />
Seite 74
Tatkonstella6onen in den Familien<br />
� Betroffene werden oEmals zu Zeuginnen bzw. Zeugen des<br />
Missbrauchs an anderen Familien<strong>mit</strong>gliedern gemacht<br />
� In einigen Fällen vermiRelten die Täter bzw. Täterinnen die<br />
Betroffenen an weitere außerfamiliäre Täter bzw. Täterinnen<br />
(Bekannte, Kollegen bzw. Kolleginnen, bis hin zu Pros6tu6on<br />
<strong>und</strong> organisiertem Missbrauch)<br />
� Filmen des Missbrauchs (auch als Instrument der Erpressung zu<br />
schweigen)<br />
� Gewalt‐ <strong>und</strong> Morddrohungen (gegenüber der MuRer, Übergriffe<br />
an Geschwistern)<br />
� Drohen <strong>mit</strong> dem Auseinanderbrechen der Familie<br />
� (Quelle: Auswertung der Anlaufstelle der UBSKM)<br />
DJI e.V. München, Projekt: Sexuelle Gewalt gegen Mädchen <strong>und</strong> Jungen in Institutionen<br />
Seite 75
Prof. Dr. Benno Hafeneger<br />
Philipps‐Universität Marburg<br />
<strong>Macht</strong> <strong>und</strong> <strong>Sexualität</strong> in der pädagogischen Diskussion<br />
Ich will <strong>mit</strong> sieben Punkten bzw. Diskursen skizzenhaft markieren, wie der Zusammenhang von „Gewalt,<br />
<strong>Macht</strong> <strong>und</strong> <strong>Sexualität</strong>“ in der pädagogischen Diskussion verortet ist <strong>und</strong> <strong>mit</strong> welchen Akzenten er sich<br />
identifizieren lässt. Sie deuten zugleich an, wo weiterer Klärungs‐ <strong>und</strong> Forschungsbedarf besteht.<br />
Den Zusammenhang von „Gewalt, <strong>Macht</strong> <strong>und</strong> <strong>Sexualität</strong>“ hat es in pädagogischen Institutionen <strong>und</strong><br />
Einrichtungen schon immer gegeben, aber wir wissen empirisch (noch) wenig <strong>und</strong> die Forschung beginnt<br />
– stimuliert durch die Berichte <strong>und</strong> öffentliche Debatte im Jahr 2010 sowie die Förderung durch das<br />
BMBF – gerade erst. Aber erste Publikationen zeigen bereits, in welchem Ausmaß <strong>und</strong> <strong>mit</strong> welchen<br />
Legitimationen wir „Gewalt“ in der Pädagogik“ vorfinden. Dies meint die vom pädagogischen Personal in<br />
pädagogischen Einrichtungen ausgehende Gewalt <strong>und</strong> <strong>Macht</strong> (nicht Gewalt unter bzw. von<br />
Kinder/Jugendlichen, oder auch als Gewalt gegen Pädagogen). Es gibt erheblichen Forschungs‐ <strong>und</strong><br />
Klärungsbedarf. Systematische Studien <strong>und</strong> Dunkelfelduntersuchungen werden hier Auskunft geben<br />
können; derzeit liegen zahlreiche Berichte (zur Heimerziehung, über die OSO, Kirchen, Orden, Internate,<br />
aus der Jugendhilfe) vor. Es waren <strong>und</strong> sind aber vor allem die journalistischen Recherchen <strong>und</strong> ersten<br />
Berichte sowie Erkenntnisse über „Fälle“ aus dem kirchlichen <strong>und</strong> privaten Internatsbereich, vereinzelt<br />
auch aus der Kinder‐ <strong>und</strong> Jugendhilfe/‐arbeit – Kindertagesstätten <strong>und</strong> dem Sport <strong>und</strong> aus<br />
Ferienfreizeiten –, die für die öffentliche Diskussion gesorgt haben.<br />
1. Diskurs: Gewalt gegen „Körper <strong>und</strong> Seele“ – immer ein <strong>Macht</strong>‐/Gewaltverhältnis<br />
- als prügelnde, züchtigende Gewalt (breit <strong>und</strong> normal)<br />
- als sexualisierte Gewalt (als eine Gewaltform)<br />
- als beschämende Gewalt (Beschämungspädagogik)<br />
Es sind in der langen Geschichte der Pädagogik weniger die spezifischen, besonders erniedrigenden<br />
sexualisierten Gewaltformen, sondern eher andere <strong>Macht</strong>‐ <strong>und</strong> Gewaltformen, die in der pädagogischen<br />
Diskussion – seit es die moderne Pädagogik gibt – publizistisch verhandelt <strong>und</strong> in der Praxis angewandt<br />
wurden; <strong>und</strong> die zum Alltag der professionellen Pädagogik gehörten. Das waren bis in die 1960er Jahre<br />
Seite 76
strafen, prügeln, dann bloßstellen <strong>und</strong> erniedrigen – demütigende <strong>und</strong> missachtende – Gewaltformen,<br />
als gewaltförmiger <strong>Umgang</strong> <strong>mit</strong> dem kindlichen <strong>und</strong> jugendlichen Körper – <strong>und</strong> seiner Seele. Die Strafe<br />
war auf den Körper fixiert <strong>und</strong> zentriert <strong>und</strong> meinte immer auch die Seele – das ganze Kind, den ganzen<br />
Jugendlichen (die es zu unterwerfen, deren Wollen es zu brechen galt). Der Körper war in der Pädagogik<br />
bis weit ins 20. Jahrh<strong>und</strong>ert Adressat von Zurichtung <strong>und</strong> Normalisierung/Zivilisierung, von sozialer<br />
Kontrolle, von Gewalt, Misshandlungen, Strafen <strong>und</strong> Züchtigungen (Schlägen, Ohrfeigen u. a.). Sie<br />
gehörten als soziale <strong>und</strong> erzieherische Medien <strong>und</strong> Praxen in Familien, Schulen <strong>und</strong> Heimen („die Väter<br />
hielten fest Zucht“) zu den dominierenden <strong>Umgang</strong>sformen <strong>mit</strong> dem jungen – vor allem männlichen –<br />
Körper. Er sollte angepasst, unterworfen <strong>und</strong> diszipliniert werden. Der strafende <strong>und</strong> züchtigende<br />
<strong>Umgang</strong> <strong>mit</strong> dem Körper war lange Zeit das zentrale Medium im pädagogischen Alltag; <strong>mit</strong> ihm wurde<br />
die pädagogische Autorität durchgesetzt. So stammen denn auch die in den letzten Jahren enthüllten<br />
Fälle sexueller <strong>und</strong> weiterer körperlicher Gewalt gegenüber Kindern <strong>und</strong> Schülern durch Pädagogen,<br />
Geistliche, Heimerzieher <strong>und</strong> andere Erziehungsberechtigte – ob in katholisch‐elitären, konservativen<br />
oder reformpädagogischen Einrichtungen, oder auch in Kinderheimen <strong>und</strong> „Jugendwerkhöfen“ der DDR<br />
– nicht nur, aber vor allem aus den ersten Nachkriegsjahrzehnten. Mit den gesellschaftlichen <strong>und</strong><br />
kulturellen Modernisierungsprozessen veränderten sich ab Mitte der 1960er Jahre auch die<br />
Einstellungen in der Erziehung. Sie wurden toleranter, liberaler <strong>und</strong> dialogischer; dies ging auch <strong>mit</strong><br />
einem neuen – respektvollen <strong>und</strong> <strong>mit</strong> der Würdigung von Unversehrtheit <strong>und</strong> Integrität einhergehenden<br />
– Blick auf den kindlichen <strong>und</strong> jugendlichen Körper einher. Dabei lösten andere Bestrafungsformen die<br />
körperlichen Strafen ab; es sind die Beschämung <strong>und</strong> eine Beschämungspädagogik (<strong>mit</strong> Praxen <strong>und</strong><br />
sprachlich ausagiert), die herabsetzen, erniedrigen, demütigen, ausgrenzen, mobben, ethnisieren,<br />
bloßstellen.<br />
2. Diskurs: Historische Vergegenwärtigung<br />
Die umfängliche <strong>und</strong> kaum überschaubare pädagogische Literatur <strong>und</strong> die öffentliche Diskussion über<br />
den Sinn <strong>und</strong> die Bedeutung von „Strafe“ <strong>und</strong> strafenden „Maßnahmen“, über die Prügelstrafe bzw.<br />
körperliche Züchtigung <strong>und</strong> Prügelpädagogik sind seit dem 19. Jahrh<strong>und</strong>ert bis in die 60er Jahre des 20.<br />
Jahrh<strong>und</strong>erts immer auch kontrovers. Die Spanne reicht – <strong>mit</strong> unterschiedlichen Begründungen <strong>und</strong><br />
Differenzierungen – von deutlichen Bekenntnissen zur Strafe <strong>und</strong> körperlichen Züchtigung bis hin zur<br />
strikten Ablehnung. Die Autoren beziehen sich in ihrem Für <strong>und</strong> Wider auf die häusliche, schulische <strong>und</strong><br />
berufsbildende Erziehung sowie die Fürsorge‐/Heimerziehung vor allem von Jungen. Körperliche Strafe<br />
Seite 77
ist <strong>mit</strong> der Hoffnung auf „Schuldeinsicht“ <strong>und</strong> „Besserung“ sowie <strong>mit</strong> der Durchsetzung von „Disziplin<br />
<strong>und</strong> Ordnung“ im Sozialgefüge der Familie, Schule <strong>und</strong> Klasse, in Betrieb oder Heim verb<strong>und</strong>en.<br />
In der Literatur wird wiederholt die Diskussion zur „Strafe als Problem der Erziehung“ referiert, weiter<br />
werden das „Wesen“, der „Sinn“, die „Formen“, die „Stufen“ <strong>und</strong> das „Problem“ der Strafe, die „innere<br />
<strong>und</strong> äußere Disziplin“, die „Psychologie der Strafe <strong>und</strong> des Strafens“ sowie die „pädagogische Autorität“<br />
behandelt. In fast allen Schriften werden bis Mitte der 1960er Jahre die Strafen bzw. unterschiedlichen<br />
Strafphänomene erzieherisch befürwortet – von der Belehrung, Verwarnung, Drohung, über den<br />
Verweis, das Schimpfen, Bloßstellen, Wegsperren, bis hin zu unterschiedlichen Formen <strong>und</strong> Härten von<br />
körperlichen Strafen. Der gemeinsame Tenor ist, dass zur Gewährleistung von „Ordnung <strong>und</strong> Disziplin“<br />
in der Schule ein abgestuftes Strafsystem notwendig <strong>und</strong> begründet ist. Weiter besteht weitgehend<br />
Konsens, dass „nur“ die „von der herrschenden Sitte genormten zugelassenen“, die „verdienten“ <strong>und</strong><br />
„gerechten“, die „planmäßigen“ <strong>und</strong> „erzieherisch“ begründeten Strafen auf bestimmte Körperstellen, z.<br />
B. Schläge auf die Innenseite der Hände oder das Gesäß „<strong>mit</strong>tels der flachen Hand als auch durch<br />
bestimmte Instrumente“ wie Rute oder Stock, methodisch begründet, notwendig <strong>und</strong> legitim sind. Dies<br />
wird im Unterschied zu durchweg abgelehnten „rohen <strong>und</strong> unüberlegten“, sadistischen, „verwerflichen<br />
<strong>und</strong> willkürlichen“ Strafen, Misshandlungen <strong>und</strong> Körperverletzungen oder auch zum Schlagen auf den<br />
Kopf gesehen.<br />
Dabei zeigen zahlreiche Berichte, <strong>mit</strong> welcher Akribie über die Anwendung der Zucht<strong>mit</strong>tel nachgedacht<br />
wurde. Einige Autoren listen pädagogisch‐technisch auf, was die Anlässe <strong>und</strong> Gründe der Strafen sind,<br />
wie das Ausmaß der Strafe sich legitimiert <strong>und</strong> auszusehen hat, welche Straf<strong>mit</strong>tel die richtigen sind;<br />
dann wie die Strafe sich <strong>mit</strong> der Schulform, dem Alter, Geschlecht <strong>und</strong> der Konstitution des Kindes <strong>und</strong><br />
Jugendlichen begründet. Meist geht es – in der Schule – um das „Verprügeln des Gesäßes“ oder der<br />
„inneren Handflächen“ (weniger des Kopfes). Hingewiesen wird u. a. auf die Einschränkung der<br />
Bewegungsfreiheit – „den Kopf oder Oberkörper des jungen Sünders zwischen die Beine des Erziehers“,<br />
„übers Knie legen“ – während des „Strafvollzuges“ (Hävernick 1964, S. 90); im Strafmaß für die Schulen<br />
wird „von 3, selten von 4 oder 6 Schlägen“ (ebda., S. 94) <strong>mit</strong> dem Rohrstock oder der Rute „auf das<br />
Hinterteil“ gesprochen. Das „Schlagen auf die flache Hand“ wird aus den Bedürfnissen des<br />
Schulbetriebes <strong>und</strong> als wenig anstößige Züchtigung erklärt; viele Strafen werden „gleich an Ort <strong>und</strong><br />
Stelle“ (vor der Klasse) vollstreckt, härtere Strafen „unter vier Augen“.<br />
Seite 78
In der Diskussion kommen einige Autoren immer wieder – so hier beispielhaft Sachse (1879/1913) – zu<br />
dem Ergebnis, dass die „körperliche Züchtigung im allgemeinen gerechtfertigt, in vielen Fällen<br />
empfehlenswert, in manchen Fällen sogar unentbehrlich ist“ (S. 174). Sie wird auch in der Schule als<br />
rechtlich zulässig <strong>und</strong> pädagogisch gerechtfertigt gesehen (Stettner 1958, Willmann‐Institut 1967) <strong>und</strong><br />
gleichzeitig als eine „üble Strafart“ charakterisiert (Scheibe 1967, S. 205), die nur dann angewandt<br />
werden soll (so auch die landesrechtlichen Vorgaben), wenn alle anderen Erziehungsmaßnahmen <strong>und</strong><br />
Schulstrafen versagt haben. Bohl (1949) warnt vor „Mißbräuchen <strong>und</strong> Überschreitungen des<br />
Züchtigungsrechtes“, sieht aber eine „prinzipielle Berechtigung einer vernünftigen körperlichen<br />
Bestrafung (…), weil Mißbrauch den vernünftigen Gebrauch nicht außer Frage stellt“ (S. 10). Es ist die<br />
„letzte Stufe einer langen Skala von Schulstrafen“ <strong>und</strong> pädagogischen Maßnahmen (Schaller 1968, S.<br />
307); <strong>und</strong> zur strafrechtlichen Würdigung heißt es, dass neben einer „raschen Ohrfeige“ vor allem<br />
„Schläge <strong>mit</strong> dem Rohrstock auf die Hand oder auf das Gesäß“ wegen ihrer Ungefährlichkeit als<br />
zweckmäßige Erziehungs<strong>mit</strong>tel angesehen werden (Willmann‐Institut 1967, S. 121).<br />
Die körperliche Züchtigung wird aus der Erziehungspflicht des Lehrers <strong>und</strong> aus dem Gewohnheitsrecht<br />
abgeleitet <strong>und</strong> begründet; wenn er rechtlich befugt ist <strong>und</strong> sich innerhalb der Grenzen der Befugnis<br />
bewegt, wird er – in strafrechtlichen Verfahren – in der Regel freigesprochen. Die Züchtigungsbefugnis<br />
wird als Übertragung der väterlichen Gewalt auf den Lehrer für die Dauer des Unterrichts verstanden<br />
<strong>und</strong> ist da<strong>mit</strong> „die dem Lehrer übertragene Berechtigung, bei gegebener Veranlassung die Schüler durch<br />
Schläge zu strafen (Züchtigungsrecht des Lehrers)“.<br />
Die pädagogische Ratgeberliteratur folgt bis in die 1960er Jahre dem Paradigma der „Kinderfehler“<br />
(danach sind sie schuld <strong>und</strong> verantwortlich für die angeblich notwendigen Strafen), weniger dem der<br />
„Elternfehler“ oder generell der „Erzieherfehler“. In dieser Literatur ist zur „Durchsetzung der Ordnung“<br />
das Erziehungs<strong>mit</strong>tel „körperliche Strafe“ (Züchtigung) bzw. eine Dressurpädagogik <strong>mit</strong> „Schlägen als<br />
Strafe“ (Hävernick 1964) ein zentrales Thema. Die physische <strong>und</strong> geistig‐sittliche Erziehung hin zu<br />
Anpassung <strong>und</strong> Abhärtung, zu Gehorsam <strong>und</strong> Unterordnung, zur Herausbildung des Gewissens u. a. war<br />
in der Literatur verknüpft <strong>mit</strong> einem gestuften System körperlicher Strafen; die Empfehlungen reichten<br />
von der Ermahnung <strong>und</strong> Belehrung bis hin zur körperlichen Strafe <strong>und</strong> Züchtigung.<br />
Seite 79
3. Diskurs: Pädagogischer Eros – ein Herrschaftsinstrument<br />
Im Rahmen der aktuellen Diskussion über sexualisierte Gewalt („Missbrauch“) richtet sich der Blick vor<br />
allem auf die „Reformpädagogik respektive Landerziehungsheime“ (s. Oelkers <strong>mit</strong> seinen vier<br />
Fallstudien) <strong>und</strong> die katholische Internatserziehung. Für die Reformpädagogik ist vor allem die Figur des<br />
„pädagogischen Eros“ thematisiert <strong>und</strong> problematisiert worden. Er dient als Legitimation <strong>und</strong><br />
„Einfallstor“ für Entwicklungen, die sexualisierte Gewalt ermöglichen, begünstigen – hier gibt es<br />
erziehungshistorisch noch viel Forschungsbedarf. Der „pädagogische Eros“ gehört zum<br />
Sinnstiftungsinstrument <strong>und</strong> Zentrum der Konzeptionen der schulpädagogischen Reformbewegung <strong>und</strong><br />
Landerziehungsheime <strong>mit</strong> ihren Gründungen <strong>und</strong> Begründern im ersten Drittel des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts,<br />
worin neben nationalen Ambitionen vor allem Natur‐ <strong>und</strong> Körperbezüge <strong>mit</strong>schwingen (Namen wie<br />
Lietz, Geheeb, Wyneken stehen für diese Denktradition). Beschworen werden ein leidenschaftliches, <strong>mit</strong><br />
Begeisterung <strong>und</strong> Hingebung verb<strong>und</strong>enes (erotisches) Fre<strong>und</strong>schaftsverhältnis von Erziehern <strong>und</strong><br />
Zöglingen sowie „der Eros des Pädagogen, (…) sich auf den Anderen einzulassen <strong>und</strong> ihn auf einem<br />
Stufenweg über die Lust an der leiblichen Schönheit zur seelischen <strong>und</strong> geistigen Schönheit zu drängen“<br />
(Thiersch 1996, S. 34).<br />
Oelkers Bef<strong>und</strong> fällt ernüchternd aus: Der „pädagogische Eros“ war <strong>und</strong> ist nichts anderes als die<br />
Metapher oder „das Theorem der Rechtfertigung“ sexueller Übergriffe, <strong>und</strong> gleichzeitig besorgt es die<br />
Legitimation des Wegschauens <strong>und</strong> Verschweigens, des Herunterspielens <strong>und</strong> Vertuschen unter einer<br />
zum elitären intellektuellen Korpsgeist verbrämten Kumpanei – also jenes Systems, das als „System<br />
Becker“ die Odenwaldschule regierte <strong>und</strong> es noch bis vor kurzen <strong>mit</strong> dem Mantel des Schweigens hüllte.<br />
Um was ging es? – ein paar Stichworte<br />
Der erotische „begeisterte echte Lehrer“ wird in der Reformpädagogik plakativ den unerotischen<br />
„inhaltlosen Pflichtmaschinen“ in den Schulen gegenübergestellt, also den staatlichen Lehrkräften, die<br />
sich nicht für ihre Schüler interessieren <strong>und</strong> so nicht ihre geistige Entwicklung, sondern nur ihre<br />
Unterdrückung vor Augen haben. Da<strong>mit</strong> war ein plakativer Dualismus in die Welt gesetzt, der den<br />
„pädagogischen Eros“ nur gut aussehen lassen konnte.<br />
Seite 80
Es soll dabei nur um ein tiefes „gleichgeschlechtliches Empfingen“ gehen, das sich auch der<br />
Vergänglichkeit des Glücks in der „Liebe des reifen Mannes zum Knaben“ bewusst ist. Auf dieser Linie<br />
schrieb Kiefer schließlich auch über „die Rolle der Erotik in der männlichen Gesellschaft“ (Kiefer 1918,<br />
1919, 1920); das Thema ist 1924 dann auf die Landerziehungsheime ausgedehnt worden. Das geschah<br />
nicht nur bei Kiefer, sondern bei allen einschlägigen Autoren unter Rückgriff auf das griechische Konzept<br />
der platonischen „Knabenliebe“, die theoretisch – <strong>und</strong> auf der Linie der Berufung auf Sokrates – von<br />
manifesten sexuellen Handlungen abgegrenzt wurde. Nur so konnte überhaupt von einem<br />
„pädagogischen Eros“ die Rede sein, der sich nicht gleich vom Begriff her verdächtig macht. Dieser nicht‐<br />
sexuelle Eros wurde als Gr<strong>und</strong>lage der Erziehung verstanden <strong>und</strong> konnte als „notwendige Forderung<br />
einer wirklich modernen Erziehungsanstalt“ hingestellt werden.<br />
Betont wird die tiefe Fre<strong>und</strong>schaft zwischen Lehrern <strong>und</strong> männlichen Schülern; sie wurde neben<br />
„Kameradschaft“ als Voraussetzung für gelingende Erziehungs‐ <strong>und</strong> Bildungsprozesse gesehen <strong>und</strong> war<br />
die angestrebte Sozialform im Lehrer‐Schüler‐Verhältnis (auch in der bürgerlichen Jugendbewegung).<br />
Nach Wyneken kann dem Knaben „nichts besseres (…) in diesem Alter begegnen, nichts tiefer sein<br />
geistiges Leben <strong>und</strong> Schicksal bestimmen, als wenn seine Liebe den Mann umfasst, der Träger <strong>und</strong><br />
Erzeuger hohen geistigen Lebens ist (…). Wir pflegen ein solches Verhältnis von der einen Seite<br />
Führerschaft, von der anderen Jüngertum <strong>und</strong> Gefolgschaft zu nennen. Durch das Führertum, <strong>und</strong> nur<br />
durch dieses, vollzieht sich die höchste <strong>und</strong> wertvollste Erziehung“ (Wyneken 1921, S. 52).<br />
Sexuelle Beziehungen sollte es in Landerziehungsheimen nicht geben, wenigstens nicht solche, die<br />
illegitim waren, wo<strong>mit</strong> über Toleranzzonen <strong>und</strong> Wegschauen nichts gesagt ist. Für die Schülerinnen <strong>und</strong><br />
Schüler galt ein Kode der strikten Enthaltsamkeit, Übergriffe seitens der Lehrkräfte wurden theoretisch<br />
ausgeschlossen <strong>und</strong> <strong>Sexualität</strong> zwischen den Schülern sollte nicht stattfinden. Die körperliche<br />
Freizügigkeit betraf nur eine asketisch <strong>und</strong> gerade nicht erotisch gemeinte Nacktheit. Der „pädagogische<br />
Eros“ sollte dafür der Garant sein. Geistige Bildung sollte einhergehen <strong>mit</strong> Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Abhärtung<br />
<strong>und</strong> das unter ständiger Überwachung.<br />
Sexuelle Übergriffe von Lehrern <strong>und</strong> Schülern kamen in der verzweigten Szene der<br />
Landerziehungsheime in Deutschland wiederholt vor. Die genaue Zahl dürfte schwer zu er<strong>mit</strong>teln sein,<br />
aber es waren nicht nur Gerüchte, die diese Schulen von Anfang an begleitet haben. Und es waren auch<br />
nicht nur interne Begebenheiten, die vertuscht werden konnten <strong>und</strong> wenn, dann nur zufällig bekannt<br />
Seite 81
wurden. Manche Fälle wurden gerichtsnotorisch <strong>und</strong> gelangten so an die Öffentlichkeit. Die<br />
Abgelegenheit des Ortes <strong>und</strong> die Organisation in abgeschotteten „Familien“ oder „Kameradschaften“<br />
sorgen dafür, dass klandestine Verhältnisse herrschten.<br />
Herrschaft, <strong>Macht</strong> <strong>und</strong> Realität<br />
Welche Praxis sich <strong>mit</strong> dem „pädagogischen Eros“ verb<strong>und</strong>en hat, ist nie auch nur zwischen den<br />
Landerziehungsheimen vergleichend untersucht worden. Die große Zahl von sexualisierter Gewalt<br />
betroffenen Schüler <strong>und</strong> die Missbrauchsdebatte haben zweierlei provoziert bzw. stimuliert:<br />
‐ zwischen pädagogischem Pathos, schöner Rhetorik auf der einen Seite <strong>und</strong> der pädagogischen<br />
Wirklichkeit zu unterscheiden (empirischer <strong>und</strong> systematischer Forschungsbedarf),<br />
‐ Strukturen, Strategien <strong>und</strong> Alltag pädagogischer Realität – hier <strong>mit</strong> zugewandter, liebender,<br />
einfühlender …Pädagogik, so das Vokabular – als <strong>Macht</strong>verhältnisse empirisch‐seriös genauer in den<br />
Blick zu nehmen.<br />
Die rituelle Herrschaft von Älteren über Jüngere, die sich anpassen <strong>und</strong> unterwerfen müssen, hat in<br />
Schulen wie bereits erwähnt eine lange Tradition, die bis auf das Mittelalter zurückreicht. Noch im 19.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert ist diese Praxis durchgehend als „Pennalismus“ bezeichnet worden. Neben den<br />
Universitäten bezog sich der Begriff auch auf Internate, in denen erprobte Techniken der<br />
<strong>Macht</strong>ausübung zur Verfügung standen, die als „Schülerrohheiten“ unter Strafe standen, wenn sie ans<br />
Licht kamen, <strong>und</strong> die gleichwohl nie verschw<strong>und</strong>en sind. Gemeint sind aggressive Übergriffe von Älteren<br />
auf Jüngere, zu denen immer wieder auch sexuelle Handlungen zählten, die oft als „Doktorspiele“<br />
verharmlost wurden.<br />
4. Diskurs: Intimisierte pädagogische Orte, Räume <strong>und</strong> Beziehungen<br />
Insbesondere in Arbeitsfeldern der Betreuung, Erziehung, Beratung, Therapie <strong>und</strong> Pflege, in denen<br />
intensive Kontakte zwischen Kindern/Jugendlichen <strong>und</strong> Erwachsenen stattfinden, können schnell<br />
Abhängigkeitsverhältnisse entstehen <strong>und</strong> durch die enge Beziehungsarbeit bedingte<br />
Gelegenheitsstrukturen ausgenutzt werden. Von potenziellen Sexualstraftätern – Erwachsenen <strong>mit</strong><br />
pädophilen Neigungen – ist bekannt, dass diese gezielt solche Arbeitsfelder suchen, die ihnen die<br />
Möglichkeit der Kontakt‐ <strong>und</strong> Beziehungsaufnahme zu Mädchen <strong>und</strong> Jungen bieten.<br />
Seite 82
Auffallend ist an den gegenwärtig diskutierten Fällen, dass bezüglich der Sexualmoral zwei so<br />
unterschiedliche Wertemodelle <strong>und</strong> Lernorte wie katholische <strong>und</strong> reformpädagogische Institutionen<br />
gleichermaßen vom Phänomen der sexualisierter Gewalt gegenüber Kindern (<strong>und</strong> Jugendlichen)<br />
betroffen sind.<br />
Es liegt auf der Hand, dass in stationären sozialen <strong>und</strong> pädagogischen Institutionen wie z. B. Internaten,<br />
die Nähe in unterschiedlicher Dimension eine besondere Rolle spielt. Es handelt sich um Einrichtungen,<br />
die die Lebenstotalität umfassen, <strong>und</strong> in diesem gesamten (schulischen <strong>und</strong> familialisierten) Alltagsleben<br />
kommen sich Menschen unweigerlich sehr nahe: geistig, emotional sowie körperlich. In solchen sozialen<br />
<strong>und</strong> pädagogischen Einrichtungen wird „r<strong>und</strong> um die Uhr“ zusammen gelehrt <strong>und</strong> gelernt; <strong>mit</strong>einander<br />
gefeiert <strong>und</strong> gelacht; dabei werden auch <strong>Körperlichkeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Sexualität</strong> ge‐ <strong>und</strong> erlebt. Überall stellen<br />
sich Situationen <strong>und</strong> Formen von Nähe ein, die immer auch sexuell missbraucht werden können.<br />
Das Leben in „totalen Institutionen“ (Goffmann) ist ein Leben im Verborgenen (ohne Demokratie,<br />
Öffentlichkeit, Kontrolle – <strong>und</strong> unterschiedlichen Lebenswelten wie Schule, Familie, Freizeit). Verborgen<br />
ist aber auch das sexuelle Leben, insofern das Schamgefühl den Schutz vor fremder Einflussnahme<br />
einfordert. Und verborgen ist immer auch das Verbrechen <strong>und</strong> bedarf der Verheimlichung. Es liegt nahe,<br />
dass sich diese drei Ebenen von Verborgenheit leicht überlappen. Die totale Institution bildet das<br />
perfekte Setting, um öffentlich sanktionierte sexuelle Bedürfnisse ungesehen von der Öffentlichkeit<br />
auszuleben.<br />
Moralische <strong>und</strong> pädagogische Idealität überblendet die wenig bis nicht bewussten Dynamiken der<br />
Wirklichkeit <strong>und</strong> führt infolgedessen zu ihrer ungehinderten Entfaltung. Die moralische <strong>und</strong><br />
pädagogisierende Überblendung von mehr oder weniger sichtbaren Herrschaftsmechanismen führt<br />
nicht zur Herrschaftsfreiheit, sondern viel eher zur Herrschaftsausübung in moralisierendem <strong>und</strong><br />
pädagogisierendem Gewand. Eine solche Überblendung der pädagogischen Beziehung führt nicht nur<br />
zur vergeistigten Fre<strong>und</strong>schaft zwischen Pädagogen <strong>und</strong> Schülern, sondern begünstigt auch das<br />
unkontrollierte Ausleben der eigenen Triebhaftigkeit. Das Böse, so macht bereits Arendt deutlich, tritt in<br />
der Regel in der Welt nicht in Form des radikalen Bösen auf, sondern vielmehr im Gewand der Banalität,<br />
die in ihrer Banalität gleichwohl monströse Folgen haben kann.<br />
Seite 83
5. Diskurs: Kinder‐ <strong>und</strong> Jugendbilder<br />
Die Autoritäts‐ <strong>und</strong> Strafpädagogik ist der erzieherische Teil eines Obrigkeitsstaates, <strong>und</strong> dazu gehörte<br />
auch lange Zeit – <strong>und</strong> bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts hinein – die Vorstellung, dass<br />
das Kind <strong>und</strong> der Jugendliche (pädagogisch inspiriert <strong>und</strong> legitimiert) geschlagen, geprügelt, <strong>mit</strong> einer als<br />
notwendig erachteten Härte <strong>und</strong> strategischen Gefühlskälte erzogen werden müsse, um es<br />
gesellschaftlich zu „zähmen“ <strong>und</strong> zu einem wertvollen, nützlichen, angepassten Mitglied der<br />
Gesellschaft zu machen. Dabei wird in einer allgemeinen – mehr anthropologisch <strong>und</strong> philosophisch<br />
orientierten – Reflexion <strong>und</strong> als pädagogische Begründung angeboten, dass „Strafen notwendig sind auf<br />
dem Weg des Menschen zu seiner Menschlichkeit“ (Schaller 1968,S. 315). Die leitende Metapher war,<br />
den „Willen des Kindes zu brechen“.<br />
Mit der wissenschaftlichen Entdeckung von Jugend <strong>und</strong> dem „Bild des Jugendalters als eines<br />
Krisenalters“ (als Gefahr <strong>und</strong> Gefährdung) beginnt auch die „Entdeckung der Pathologien des<br />
Jugendalters“ (Dudek 1990, S. 49). Negative <strong>und</strong> positive Bilder von der jungen Generation sind in<br />
Zeitdiagnosen eingebettet, die kultur‐ <strong>und</strong> zivilisationskritisch sind, vielfach den kulturellen Niedergang<br />
<strong>und</strong> soziale Pathologien beschwören oder aber die junge Generation pädagogisch „aufladen“ <strong>und</strong> <strong>mit</strong><br />
Fortschrittsmythen (des „Neuen“) belegen<br />
In Zeiten der Krise, des Umbruchs, der Erosion des bisherigen mentalen Gesamtklimas, wenn die<br />
Gesellschaft „aus dem Tritt“ zu geraten scheint, wird <strong>mit</strong> dieser negativen Gr<strong>und</strong>figur „die“ Jugend zum<br />
(Sicherheits‐)Risiko, zur Gefahr <strong>und</strong> Gefährdung; sie wird als Phase <strong>und</strong> Kraft ,,potentieller Devianz“<br />
(Eisenstadt) vorgestellt. Mit dieser Legendenbildung <strong>und</strong> negativen Mystifizierung wird Jugend –<br />
eingeb<strong>und</strong>en in die Denkfigur einer negativen Anthropologie <strong>und</strong> des Zukunftspessimismus – zur<br />
Projektionsfigur (Bühne, Leinwand) für Verdorbenheit in aufgebauten Szenarien der Gefährdung von<br />
Staat, Gesellschaft <strong>und</strong> Kultur: ,,Immer geht es um die Frage, wie es <strong>mit</strong> der Gesellschaft in Zukunft<br />
weitergeht, <strong>und</strong> immer ist Jugend ein Teil des Risikos dieser Zukunft“ (Abels 1993, S. 27). Nach diesem<br />
Bild (<strong>mit</strong> entsprechenden Fremdzuschreibungen, theoriegeleiteten Spekulationen) drohen eine ,,ganze<br />
Jugend“ oder Teile von ihr Leistungen, Kultur <strong>und</strong> Werte der Erwachsenengeneration, das hierarchische<br />
Generationenverhältnis <strong>und</strong> die kontrollierte Kontinuität gesellschaftlicher Entwicklung (<strong>mit</strong> der<br />
regulativen Idee von Gegenseitigkeitszyklen) zu gefährden. Die jeweiligen zeitbezogenen ökonomischen,<br />
gesellschaftlichen <strong>und</strong> kulturellen Dynamiken im 20. Jahrh<strong>und</strong>ert sind <strong>mit</strong> Generationsdynamiken<br />
verwoben, die der erwachsenen Generation vielfach unbewusst <strong>und</strong> unverstanden bleiben. Im<br />
Pathologieverdacht, in Ängsten vor Veränderung <strong>und</strong> Beschleunigung drücken sich Ohnmachts‐ <strong>und</strong><br />
Seite 84
Verzweiflungsgefühle der Erwachsenen aus: dass ihnen „die Welt davonläuft“. In den negativen Formeln<br />
<strong>und</strong> Metaphern über die junge Generation <strong>und</strong> deren bedrohtes Seelenheil schwingt die Sorge <strong>mit</strong>, dass<br />
die Erwachsenen die Kontrolle <strong>und</strong> Deutungshoheit über die gesellschaftliche Entwicklung, die<br />
beunruhigende Beschleunigung <strong>und</strong> Zukunft verlieren. Nach diesem Bild müssen die Erwachsenen ihre<br />
gesellschaftliche Vorherrschaft gegen die junge Generation verteidigen <strong>und</strong> sichern.<br />
Dem steht ein positives, idealisiertes Jugendbild gegenüber, wie es auch von der Reformpädagogik<br />
kreiert wurde. Erwachsene Pädagogen idealisieren <strong>und</strong> mystifizieren „die“ Jugend sowie die<br />
„pädagogische Beziehung“. Sie machen die junge Generation (instrumentalisierend) zum<br />
Hoffnungsträger <strong>und</strong> zu Wunschfiguren des gelingenden pädagogischen Lebens; auch dies ist ein<br />
Herrschaftsbild.<br />
6. Diskurs: Gesellschaft <strong>und</strong> Recht<br />
Was heute juristisch als Straftat gilt, moralische Empörung hervorruft, Aufklärung einfordert <strong>und</strong><br />
Rücktritte begründet, war noch in den 50er <strong>und</strong> 60er Jahren des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts normal <strong>und</strong> üblich;<br />
was als „Watschen“, „Klaps“ oder „Ohrfeige“ in den letzten Jahren öffentlich geworden ist <strong>und</strong> für<br />
Empörung gesorgt hat, hätte damals kaum zu einer Anklage oder gar zu einer Verurteilung geführt. Wir<br />
haben es <strong>mit</strong> einem langsamen Abschied vom – <strong>mit</strong> Gewohnheit <strong>und</strong> Wiederholung verb<strong>und</strong>enen –<br />
Züchtigungsrecht <strong>und</strong> von den juristischen Rechtfertigungen für körperliche Strafen zu tun. Die<br />
Rechtsprechung berief sich in ihren Begründungen auch auf Gewohnheitsrecht <strong>und</strong> Moral sowie auf die<br />
„elterliche Gewalt“, die die Eltern zu „Gewalthabern“ macht.<br />
Anfang des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts beginnt <strong>mit</strong> der sukzessiven Verrechtlichung der Kindheit <strong>und</strong> Jugend eine<br />
Entwicklung, in der zunächst – nach dem Leitbild des BGB von 1900 – der Vater das Familienoberhaupt<br />
war, dem eine umfassende <strong>und</strong> weitgehend unbeschränkte elterliche Gewalt (Unantastbarkeit des<br />
Elternrechts) eingeräumt wurde.<br />
Vom Lehrer (in der Schule) <strong>und</strong> vom Meister (in der beruflichen Ausbildung) erwarteten Eltern eine<br />
gelegentliche „Tracht Prügel“, Ohrfeigen <strong>und</strong> Kopfnüsse für ihre Kinder; an diese Erzieher wurde ein<br />
autoritär‐strafendes Generationenverhältnis delegiert. Ein solches Verhalten hat sich im 19. <strong>und</strong> 20.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert tief in den Mentalitätsstrukturen der Gesellschaft verankert <strong>und</strong> ist <strong>mit</strong> einer langen<br />
Tradierungsgeschichte verb<strong>und</strong>en. Vor diesem Hintergr<strong>und</strong> waren staatliche Eingriffe – bei<br />
Kindeswohlgefährdung – nur in extremen Ausnahme‐ <strong>und</strong> Notfällen möglich <strong>und</strong> an spezifische<br />
Seite 85
Regelungen geknüpft. Die Autonomie des Vaters in der Erziehung ging später auf beide Elternteile über<br />
<strong>und</strong> wurde als Familienautonomie zur Gr<strong>und</strong>position der Gesetzgebung, die bis heute gilt (Art. 6 Abs. 2<br />
GG, dann im BGB); dabei soll(te) die Kinder‐ <strong>und</strong> Jugendhilfe die Familie unterstützen.<br />
In der Adenauerzeit herrschten im „Goldenen Zeitalter der bürgerlichen Familie“ (Hradil) bis in die<br />
1960er Jahre auch in der Pädagogik, den erziehenden Institutionen <strong>und</strong> dem Professionsverständnis<br />
deutlich „restaurative Tendenzen“. Diese zeigten sich in den autoritären Familien‐ <strong>und</strong><br />
Schulverhältnissen <strong>und</strong> – als Misshandlung <strong>mit</strong> System – vor allem auch in der geschlossenen Heim‐<br />
bzw. Fürsorgeerziehung. Das Recht des Lehrherrn zur väterlichen Züchtigung der Lehrlinge wurde im<br />
Jahr 1951 abgeschafft, <strong>und</strong> die schulischen Körperstrafen wurden im Jahr 1973 umfassend verboten <strong>und</strong><br />
dann auch in den Schulgesetzen geregelt. Mit Blick auf die Beziehungsverhältnisse, in denen Kinder<br />
erzogen wurden, sind zwei weitere Daten in der Geschichte der B<strong>und</strong>esrepublik interessant: Das Recht<br />
des Ehemanns zur Züchtigung seiner Ehefrau wurde erst im Jahr 1947 abgeschafft, <strong>und</strong> erst seit 1977<br />
dürfen Frauen auch gegen den Willen des Ehemanns einen Arbeitsvertrag unterschreiben.<br />
Mit der Sorgerechtsreform von 1979 wurde nur ein Verbot „entwürdigender Erziehungsmaßnahmen“<br />
eingeführt. Körperliche Züchtigung war nicht schon als solche entwürdigend, der Klaps auf die Hand, die<br />
Ohrfeige oder die „verdiente Tracht Prügel“ blieben zulässige Erziehungs<strong>mit</strong>tel. In einer Entscheidung<br />
des BGH wird noch im Jahr 1978 eine gelegentliche Züchtigung <strong>mit</strong> einer „Tracht Prügel“ für zulässig<br />
erklärt. Dies wurde – so die Begründung – eingegrenzt, indem die „subjektiven <strong>und</strong> objektiven<br />
Umstände des Tatgeschehens“ zu prüfen seien; aber das Strafen <strong>mit</strong> „stockähnlichen Gegenständen“<br />
stieß weiterhin auf das Verständnis der Richter. Im BGB wurde 1980 aus der „elterlichen Gewalt“ die<br />
„elterliche Sorge“, <strong>und</strong> seit 1998 ist das Schlagen von Kindern in Deutschland gesetzlich verboten. Nach<br />
§ 1631 Abs. 2 BGB sind entwürdigende Erziehungsmaßnahmen, insbesondere körperliche <strong>und</strong> seelische<br />
Misshandlungen, verboten, <strong>und</strong> im Jahr 2000 wurde festgelegt, dass Kinder ein Recht auf gewaltfreie<br />
Erziehung haben. Seitdem sind Kinder vor häuslicher Misshandlung gesetzlich geschützt; erst jetzt sind<br />
sämtliche Körperstrafen verboten.<br />
Seite 86
7. Diskurs: <strong>Umgang</strong>sformen<br />
Die identifizierbaren Varianten <strong>und</strong> Muster kehren historisch wieder <strong>und</strong> zeigen u. a. wie eine<br />
betroffene Erwachsenengesellschaft <strong>und</strong> deren Institutionen sowie Repräsentanten <strong>und</strong> Professionen<br />
<strong>mit</strong> der jungen Generation umgehen bzw. bisher umgegangen ist.<br />
a. Verdrängung, Vertuschung, Verharmlosung<br />
Erste wiederkehrende Reaktionen waren <strong>und</strong> sind zunächst Versuche <strong>und</strong> Strategien, die<br />
notwendige Aufklärung zu verhindern (so z. B. mehrere Schulleiter an der Odenwaldschule oder<br />
Kirchenvertreter); es gab auch Ausnahmen, mutige Akteure <strong>mit</strong> Zivilcourage. Der externe – <strong>und</strong><br />
bisher einzige vorliegende – Bericht für das Erzbistum München <strong>und</strong> Freising zeigt, dass im<br />
Untersuchungszeitraum systematisch weggesehen, geschwiegen, vertuscht <strong>und</strong> Akten vernichtet,<br />
Taten verharmlost <strong>und</strong> homosexuelle Mitarbeiter erpresst wurden. Ein erster Bericht über die OSO<br />
zeigt – unvollständig – das Ausmaß sexualisierter Gewalt. Aufklärer in Institutionen wurden als<br />
„Nestbeschmutzer“ beschimpft <strong>und</strong> unter Druck gesetzt. Für die Kirche <strong>und</strong> die OSO galt es<br />
wiederholt <strong>und</strong> lange Zeit wegsehen, tolerieren, vertuschen, nicht gewusst haben.<br />
b. Umkehrung (Opfer werden zu Tätern)<br />
In einer Verkehrung wurde auch versucht, Opfer zu Tätern zu machen; sie wurden als<br />
„Nestbeschmutzer“ beschimpft <strong>und</strong> zu „Feinden“ der Kirche oder der reformpädagogischen Ideen<br />
erklärt. An der Odenwaldschule wurden z. B. Schüler, die sich beklagten, eingeschüchtert, verfolgt<br />
<strong>und</strong> bestraft (<strong>und</strong> es gab Eltern, die ihren Kindern Hilfe verweigerten oder ihr Wissen für sich<br />
behielten). Die Institutionen wollen „brave“, „bittende“, resignative Opfer – keine, die sich<br />
selbstbewusst <strong>und</strong> hartnäckig wehren, <strong>mit</strong> aggressiver Vernunft aufklären <strong>und</strong> sich selbst<br />
organisieren.<br />
c. Personalisierung/Pathologisierung (nicht Strukturen, Abhängigkeiten, Hierarchien,<br />
<strong>Macht</strong>verhältnisse…)<br />
Es galt, die „Vorwürfe“ abzuwehren oder auch „auszusitzen“ (so Hartmut von Hentig nach der FAZ,<br />
19. Dez. 2010, FAZ, 23. Nov. 2011). Diese Haltung ist verb<strong>und</strong>en <strong>mit</strong> der Deutung, die „Vorfälle“ zu<br />
individualisieren, pathologisieren (als krankhafte Veranlagung von Einzelnen) <strong>und</strong> zu relativieren.<br />
Die fallbezogenen Problemdiagnosen <strong>und</strong> die individualisierte Diskussion über einzelne fehlbare –<br />
Seite 87
unreife, berufsdeformierte, pädophile – Erzieher/Amtspersonen <strong>und</strong> deren „Abwege“ lassen sowohl<br />
die institutionellen Strukturen der Erziehung als auch die Lebenslagen, die gesellschaftlichen<br />
Bedingungen des Aufwachsens „aus dem Blick geraten“; vor allem aber das Leiden <strong>und</strong> Schicksal der<br />
betroffenen Kinder <strong>und</strong> Jugendlichen.<br />
Da<strong>mit</strong> ging es vor allem darum, in der Ursachendiagnose die Strukturen <strong>und</strong> Institutionen – so das<br />
„System Kirche“, das „Amt“ des Priesters oder die pädagogischen Einrichtungen <strong>mit</strong> ihrer „Idee“ –<br />
von den Taten abzuspalten.<br />
Es dominiert die „Sorge um die Kirche als Institution“ oder um die reformpädagogische Einrichtung.<br />
Vielfach wurden die Täter zurückgezogen, versetzt <strong>und</strong> abgeschirmt; zunächst ist eher ein<br />
Institutionen‐ <strong>und</strong> Täterschutz denn Hilfe für Opfer zu konstatieren.<br />
Ein weiteres Merkmal liegt in Versuchen das Image der Institution <strong>und</strong> der Entscheidungsträger zu<br />
erhalten, in dem argumentiert wird, dass man eigentlich alles richtig gemacht habe; man habe alles<br />
notwendige „nach bestem Wissen <strong>und</strong> Gewissen getan“ um weiteren Schaden zu verhindern.<br />
d. fehlende Opferperspektive<br />
Von besonderer Bedeutung ist, ob <strong>und</strong> wie sich Institutionen, deren Repräsentanten <strong>und</strong> Täter auf<br />
die Perspektive der Opfer einlassen. Die Berichte zeigen die Tiefe <strong>und</strong> Dauer der Beschämung,<br />
Traumatisierung, Verletzung <strong>und</strong> Erniedrigung. Die „Gretchenfrage“ für wirkliche Lern‐ <strong>und</strong> (auch<br />
materielle) Hilfeprozesse ist an diese Perspektive geb<strong>und</strong>en. Sie ernst zu nehmen <strong>und</strong> einzubinden<br />
ist die wirkliche Herausforderung für Dialogstrukturen zu ziehende Folgen innerhalb von Strukturen,<br />
Institutionen.<br />
e. neue Wege, erste Schritte – Reichweite(n)<br />
Erst nach öffentlichem Druck <strong>und</strong> der Häufung von „Vorfällen“ <strong>und</strong> Berichten – <strong>und</strong> nachdem ein<br />
System der sexualisierten Gewalt deutlich wurde <strong>und</strong> akzeptiert werden musste – wurden weitere<br />
Konsequenzen gezogen. Der Distanzierung von den Tätern folgte die Bereitschaft – unterschiedlich<br />
akzentuiert –, aufzuklären <strong>und</strong> – so in der Odenwaldschule <strong>und</strong> im Erzbistum München –<br />
unabhängige Untersuchungen in Auftrag zu geben. Vertreter der katholischen Kirche – <strong>und</strong> vor<br />
allem auch der Papst sowie der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz – sprachen<br />
(ontologisierend) von „furchtbaren Verbrechen“, einer „schweren Sünde“ <strong>und</strong> „tiefen Krise der<br />
Kirche“; das unglaubliche Ausmaß des Missbrauchsskandals habe zu einer „Kirchen‐ <strong>und</strong><br />
Glaubenskrise“ geführt. Angeboten werden allgemein Umkehr zum Bewährten, Erneuerung in<br />
Seite 88
Tradition, ein „neuer Dialog“ (aber kein verändertes Priesterbild oder mehr Demokratie) <strong>und</strong> das<br />
Nachdenken über Täterprofile in der Kirche. Weiter wurden Entschädigungsleistungen für die Opfer<br />
in Aussicht gestellt.<br />
Schließlich entstanden veränderte Richtlinien, es kam zu unterschiedlichen Formen der offenen<br />
Debatte, Beauftragte (auch Präventionsbeauftragte) wurden bzw. werden eingesetzt, <strong>und</strong> es gab<br />
Ankündigungen, neue Dialogstrukturen zu suchen, angstfreie <strong>und</strong> offene Gesprächskulturen zu<br />
entwickeln.<br />
Es bleibt abzuwarten, wohin die Reise geht; vor allem, wenn es um strukturierte, institutionelle<br />
folgenreiche Veränderungen gehen soll. Schnell scheint das öffentliche Interesse abzuklingen <strong>und</strong><br />
nach dem (vorläufigen) Ende der Aufgeregtheit <strong>und</strong> Unsicherheiten scheint „Normalität“ Einkehr zu<br />
halten. Ein bekannter Mechanismus im <strong>Umgang</strong> <strong>mit</strong> der jungen Generation, der die Frage aufwirft,<br />
was sich wirklich verändert (hat).<br />
Seite 89
Dr. Claudia Nikodem: Zur Schwierigkeit <strong>Macht</strong>verhältnisse in der Schule zu benennen.<br />
Zur Prävention von sexueller Gewalt.<br />
In den letzten zwei Jahren ist das Thema sexualisierte Gewalt in der Öffentlichkeit sehr präsent.<br />
Unterschiedliche Einrichtungen wie das Deutsche Jugendinstitut in München, die (ehemalige)<br />
„Missbrauchsbeauftragte“ Christine Bergmann, oder das Kriminologische Institut in Hannover<br />
haben Expertisen vorgelegt. Besonders in den Blick geraten sind einerseits kirchliche<br />
Einrichtungen, andererseits Schulen - Internate <strong>und</strong> Privatschulen - wie die Odenwaldschule 1<br />
oder kirchlich geführte Schulen wie die der Jesuiten in Bonn oder Berlin. Wenn über<br />
sexualisierte Gewalt nachgedacht wird, erscheint es unerlässlich, dass dabei die bestehenden<br />
<strong>Macht</strong>verhältnisse innerhalb der Schulen auf dem Prüfstand stehen müssen.<br />
Ein blinder Fleck – <strong>und</strong> dies kann auch der Expertise von Claudia B<strong>und</strong>schuh vom DJI<br />
entnommen werden – stellt jedoch die Frage nach sexualisierter Gewalt in staatlichen Schulen<br />
dar. 2 Dies verw<strong>und</strong>ert nicht zuletzt deshalb, da unter Experten darüber Einigkeit besteht, dass<br />
beeinträchtigte <strong>und</strong> behinderte Kinder in spezifischem Maße von sexuellen Übergriffen betroffen<br />
sind. Aber auch dort existiert keine systematische Analyse <strong>und</strong> Reflexion des Themas. Das<br />
Nicht-ins-Auge-fassen, die Tabuisierung von sexualisierter Gewalt in Regel- <strong>und</strong> Förderschulen<br />
kann auf mehreren Ebenen festgestellt werden: Einerseits besteht im wissenschaftlichen<br />
Bereich so etwas wie ein blinder Fleck in Bezug auf sexualisierte Gewalt in der Schule,<br />
andererseits wird in vielen Schulen die Prävention von sexualisierter Gewalt nicht als ein<br />
inhärenter Bestandteil der schulischen Notwendigkeiten gesehen. Selbst die Curricula in den<br />
verschiedenen B<strong>und</strong>esländern weisen keine eindeutige Richtung auf. Lehrer <strong>und</strong> Lehrerinnen<br />
verlagern die Auseinandersetzung <strong>mit</strong> sexueller Gewalt eher nach außen, in dem das Thema<br />
<strong>mit</strong> Experten in Form einer Projektwoche, eines Projekttages oder eines Theaterstückes den<br />
Kindern präsentiert wird. Die Botschaft ist eindeutig <strong>und</strong> auch für Kinder offensichtlich. Sie<br />
lautet: Mit sexualisierter Gewalt <strong>und</strong> ihrer Prävention brauchen sich Erwachsene nicht zu<br />
beschäftigen, das geht nur Kinder etwas an. Wenn sich Erwachsene, seien es Eltern, seien es<br />
Lehrer oder Lehrerinnen nicht <strong>mit</strong> sexualisierter Gewalt <strong>und</strong> ihrer Prävention<br />
auseinandersetzen, bedeutet das aber auch, dass keine innovativen Konzepte entwickelt<br />
werden, wie Erwachsene diese Thematik in ihrer Erziehung anders ver<strong>mit</strong>teln als durch die<br />
bekannten Konzepte des Wegschauens <strong>und</strong> der Erzeugung von Angst. Die andere Botschaft ist<br />
die: „Bei uns gibt es so etwas nicht.“ Das Schweigen über sexualisierte Gewalt an Schulen kann<br />
bei Betroffenen natürlich zu Irritationen führen <strong>und</strong> dazu, dass keine Worte für das gef<strong>und</strong>en<br />
werden, was <strong>mit</strong> ihnen geschieht. Das Schweigen trägt den Charakter der Vernebelung.<br />
1 Vgl. Christian Füller (2011): Sündenfall. Wie die Reformschule ihre Ideale missbrauchte. Köln.<br />
2 Vgl. Claudia B<strong>und</strong>schuh (2011): Sexualisierte Gewalt gegen Kinder in Institutionen. Nationaler <strong>und</strong> internationaler<br />
Forschungstand. Expertise im Rahmen des DJI-Projekts „ Sexualisierte Gewalt gegen Mädchen <strong>und</strong> Jungen in<br />
Institutionen.“ München.<br />
Seite 90
Eine Vernebelungsstrategie wie sie aus den Täterstrategien von Anita Heiliger bekannt ist 3 .<br />
Diskurstheoretisch - nach Judith Butler - formuliert, könnte festgehalten werden, dass ein nicht<br />
geführter Diskurs <strong>mit</strong> einem Nicht-Existenz-Sein einhergeht. Paula Villa zitiert Judith Butler <strong>mit</strong><br />
den Worten: „Wir erkennen in der Welt immer das, wofür wir sprachlich-diskursive Kategorien<br />
haben. Der Diskurs also ist es, der den Dingen einen Namen <strong>und</strong> da<strong>mit</strong> eine Bedeutung<br />
zuweist.“ 4<br />
Bevor ich mich weiter den Schulen zuwende, erscheint es notwendig die Bedingungen von<br />
Gewalt- <strong>und</strong> <strong>Macht</strong>verhältnissen zu diskutieren.<br />
Als Soziologin <strong>und</strong> Pädagogin suche ich nach der gesellschaftlichen Einbettung von<br />
sexualisierter Gewalt <strong>und</strong> pädagogischen Handlungsstrategien. Dabei lege ich den Fokus nicht<br />
auf die Frage der sexuellen Gewalt als eine Form der <strong>Sexualität</strong>, sondern als eine Form der<br />
<strong>Macht</strong>ausübung, die sich der <strong>Sexualität</strong> von Kindern bedient. Wenngleich die Frage, inwieweit<br />
sich die sexuellen Bedürfnisse von Menschen entwickeln <strong>und</strong> welche Möglichkeiten sich für<br />
Pädagoginnen im erzieherischen Prozess diesbezüglich ergeben durchaus von Interesse sind.<br />
Ich nutze den Begriff der sexualisierten Gewalt – da dieser besser als der des sexuellen<br />
Missbrauchs erläutert, dass es sich bei den Handlungen nicht um vereinzelte sexuelle Irrwege<br />
handelt, sondern um eine Form der Gewalt. Gewalt, die sich der <strong>Sexualität</strong> der Kinder, der<br />
Mädchen <strong>und</strong> Jungen bedient. Auch wenn der Fokus auf den Aspekt der Gewalt gelegt wird, so<br />
bedeutet das nicht, dass diese Gewalt keine Auswirkungen auf das sexuelle Erleben <strong>und</strong><br />
Empfinden der Betroffenen haben wird. Ganz im Gegenteil. Die Gewalt wird in den Körper<br />
inkorporiert. Sowohl die Opfer sexueller Gewalt können keinen „ges<strong>und</strong>en Zugang“ zu ihrem<br />
Körper <strong>und</strong> ihrer <strong>Sexualität</strong> finden. Ebenso wenig erlernen die Täter eine angemessene<br />
<strong>Sexualität</strong>. Trotzdem, das Begehren ist nicht der Hauptimpuls für den Täter, sondern das<br />
Bedürfnis der <strong>Macht</strong>ausübung über <strong>Sexualität</strong>. Bereits in frühester Kindheit wird ein Wissen<br />
darüber angeeignet, dass der Körper <strong>und</strong> die <strong>Sexualität</strong> besonders verletzungsoffen sind.<br />
Deutlich wird dies bereits in Kindergärten <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>schulen, in denen Kinder eine sexualisierte<br />
Sprache nutzen um andere zu verletzen. Dies oftmals unter der Duldung von Pädagoginnen<br />
<strong>und</strong> Pädagogen.<br />
Gewalt: Gewalt ist einer der Schlüsselbegriffe, um die es in diesem Kontext geht. Ein Verdienst<br />
der Frauenbewegung ist es, Gewalt – <strong>und</strong> das gilt dann auch für sexualisierte Gewalt – als ein<br />
vergeschlechtlichtes, ein strukturelles Phänomen zu begreifen <strong>und</strong> zu benennen. 5<br />
Da<strong>mit</strong> ist nicht gemeint, dass es spezifische körperbezogene oder hormonell bedingte<br />
Eigenschaften eines biologischen Geschlechtes sind, die den Menschen gewalttätig werden<br />
3 Vgl. Anita Heiliger (2003): Täterstrategien <strong>und</strong> Prävention. München<br />
4 Paula Irene Villa (2003): Judith Butler. Frankfurt am Main. S. 18f.<br />
5 Vgl. Ilse Lenz (Hrsg.) (2008): Die Neue Frauenbewegung in Deutschland. Abschied vom kleinen Unterschied. Eine<br />
Quellensammlung. Wiesbaden.<br />
Seite 91
lassen. Viel eher möchte ich darauf verweisen, dass die Ausübung von Gewalt auch heute noch<br />
primär Männern vorbehalten bleibt. Das betrifft im speziellen die unterschiedlichen Formen der<br />
legitimen Gewaltausübung wie Militär oder Polizei, zwei Organisationen, in denen die<br />
Beteiligung von Frauen lange Zeit nicht vorgesehen war. 6 Werfen wir einen Blick auf Gewalt<br />
unter Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen, so wird deutlich, dass auch hier geschlechtstypische<br />
Zuschreibungen vorgenommen werden <strong>und</strong> Gewalt unter Jungen kaum konsequent sanktioniert<br />
wird <strong>und</strong> selbst von vielen Lehrerinnen <strong>und</strong> Lehrern eher noch in einer quasi natürlichen Weise<br />
legitimiert wird. „Das sind doch Jungen“.<br />
Und hier finden sich meines Erachtens Parallelen zum <strong>Umgang</strong> <strong>mit</strong> sexualisierter Gewalt.<br />
Gewalt wird in der Schule nicht als ein strukturelles Phänomen betrachtet, sondern<br />
individualisiert. Zwar finden wir in vielen Schulen Konzepte der Gewaltprävention, doch betrifft<br />
dies fast ausschließlich die Gewalt unter Kindern. Und auch diese Gewalt wird, wie eben<br />
formuliert, teilweise bagatellisiert <strong>und</strong> zu wenig <strong>und</strong> konsequent in den Blick genommen.<br />
Gerade was sexualisierte Gewalt betrifft <strong>und</strong> hier neuere Formen des Bullying <strong>und</strong> der Gewalt<br />
via neuer Medien scheint fehlendes Wissen der Lehrkräfte ein Problem zu sein.<br />
Auch wenn innerhalb der Geschlechterforschung inzwischen davon Abstand genommen,<br />
Frauen lediglich als Opfer wahrzunehmen <strong>und</strong> Täterschaft eher männlich zu konnotieren, so<br />
liefert gerade die Männlichkeitsforschung neue Impulse dafür, welche Bedeutung Gewalt für die<br />
Konstruktion von Männlichkeiten haben kann. Verb<strong>und</strong>en <strong>mit</strong> diesen Ansätzen sind die<br />
Forschungen von Bourdieu 7 <strong>und</strong> Cornell, die beide homosoziale Formen von männlicher<br />
Herrschaft in den Blick nehmen zudem aber auch aufzeigen, wie wichtig Gewalt bei der<br />
Etablierung einer hegemonialen Männlichkeit in Bezug auf Frauen <strong>und</strong> Männer ist. Gerade die<br />
Männlichkeitsforschung <strong>und</strong> hier im spezifischen die Studien zur männlichen Herrschaft von<br />
Bourdieu. Bourdieu <strong>und</strong> Cornell betonen beide dass zur Durchsetzung eines hegemonialen<br />
Männlichkeitsmodus oder männlichen Herrschaft (gegenüber anderen Männern <strong>und</strong> gegenüber<br />
Frauen) keine offene, rohe Gewalt eingesetzt werden muss. Über- <strong>und</strong> Unterordnung folgen<br />
hier viel eher kulturellen Aushandlungsprozessen, die durch eine präreflexibe, inkorporierte<br />
Selbstunterwerfung der der Beherrschten gekennzeichnet wird (symbolische Gewalt).<br />
Entsprechend Bourdieus Habituskonzept kann auf der einen Seite so etwas wie ein Habitus des<br />
Täters <strong>und</strong> des Opfers festgestellt werden, die entsprechend der Männlichkeitsforschung<br />
männlich beziehungsweise weiblich besetzt sind. 8<br />
Was bedeutet dies nun für die Thematisierung von <strong>Macht</strong>strukturen innerhalb der Schule <strong>und</strong><br />
der möglichen Prävention von sexualisierter Gewalt? Sind diese theoretischen Gr<strong>und</strong>lagen<br />
6 Vgl. Mechthild Bereswill. Zum Verhältnis von Gewalt <strong>und</strong> Geschlecht: Entwicklungen <strong>und</strong> Perspektiven der<br />
soziologischen Geschlechterforschung. In: Barbara Rendtorff u.a. (Hrsg.) (2011): Geschlechterforschung. Theorien,<br />
Thesen, Themen zur Einführung. Stuttgart. S. 201f.<br />
7 Pierre Bourdieu (2005): Die männliche Herrschaft. Frankfurt am Main.<br />
8 Vgl. Mechthild Bereswill. A.a.O. S. 203<br />
Seite 92
sinnvoll oder verfestigen sie nicht eher Positionierungen von Tätern <strong>und</strong> Opfern?<br />
Wichtige Fragen, die sich an dieser Stelle jedoch nicht abschließend klären lassen.<br />
<strong>Macht</strong>strukturen innerhalb der Schule<br />
In Bezug auf sexualisierte Gewalt <strong>und</strong> Schule bisher erst Ergebnisse vor, die sich auf eher<br />
geschlossene Schulsysteme wie bsp. Internate beziehen, beziehungsweise Schulen, die <strong>mit</strong><br />
einem spezifischen pädagogischen Konzept arbeiten. Neben den familienähnlichen Strukturen<br />
in Internaten, verb<strong>und</strong>en <strong>mit</strong> gr<strong>und</strong>sätzlichen Erfahrungen der Bedürftigkeit der SchülerInnen<br />
<strong>und</strong> Schüler an diesen Schultypen, kann auch die vielfach eingeschworene Gemeinschaft<br />
begünstigend für Täter <strong>und</strong> Täterinnen wirken. Die Annahme einer gr<strong>und</strong>sätzlich eher<br />
vorfindbaren Bedürftigkeit von Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen in Internaten leite ich von der<br />
Tatsache ab, dass diese Kinder auf der Suche nach neuen emotionalen Bindungen sind <strong>und</strong><br />
deshalb <strong>mit</strong> einer Offenheit den neuen Bezugspersonen begegnen. 9<br />
Auch wenn es gute Gründe dafür gibt, sexualisierte Gewalt vor allem in familienähnlichen<br />
strukturierten Schulen zu suchen, so heißt das nicht, dass in Regel- <strong>und</strong> Förderschulen keine<br />
Strukturen gegeben wären, die sexualisierte Gewalt begünstigen könnten <strong>und</strong> darüber hinaus<br />
sexualisierte Gewalt dort nicht stattfindet beziehungsweise keiner Thematisierung bedürfte.<br />
In der aktuellen Debatte um sexualisierte Gewalt ist jedoch eines zu erkennen: Es ist so etwas<br />
wie ein Aufatmen bei den Schulen <strong>und</strong> Einrichtungen sichtbar, an denen bisher sexualisierte<br />
Gewalt nicht entdeckt wurde. Sexualisierte Gewalt wird zum Thema der katholischen Kirche<br />
<strong>und</strong> der Reformschulen. Und die Gründe scheinen zumindest dann, wenn man sexualisierte<br />
Gewalt als eine Form der <strong>Sexualität</strong> begreift auf dem Tisch zu liegen: Bei den katholischer<br />
Priestern wird der Zölibat, als Ursache genommen, bei den Reformschulen wird die sexuelle<br />
Befreiungsbewegung, also die Spätfolge der 68er als Ursache vermutet. Zwei<br />
Ursachenstränge, die unterschiedlicher nicht sein können, beide aber eines nicht thematisieren:<br />
Nämlich Gewalt. Und etwas anderes, <strong>und</strong> für diese Argumentation wichtigeres geschieht:<br />
Sexualisierte Gewalt wird immer noch als ein Thema der anderen <strong>und</strong> nicht als ein Thema, das<br />
inhärenter Bestandteil von Schule <strong>und</strong> anderen Einrichtungen pädagogischer Art ist, gedeutet.<br />
Was könnte anders sein, wenn sich eine Schule <strong>mit</strong> einer potentiell gegebenen sexualisierten<br />
Gewalt auseinandersetzen beziehungsweise das Thema „einfach“ als wichtiges Thema<br />
benennen?<br />
Wenn sexualisierte Gewalt in der Schule ernsthaft als ein Phänomen anerkannt wird, wird es<br />
notwendig die an den Schulen existierenden <strong>Macht</strong>strukturen zu benennen <strong>und</strong> zu hinterfragen.<br />
9<br />
Vgl. hierzu auch Christoph Röhl (2010): Und wir sind nicht die Einzigen. Kino Dokumentarfilm, 90min, Herbstfilm,<br />
3Sat.<br />
Seite 93
Bereits eingangs habe ich versucht, den <strong>Macht</strong>begriff zu umkreisen, möchte an dieser Stelle<br />
aber nochmals Bezug auf den Soziologen Heinz Popitz nehmen, der <strong>Macht</strong> in Verbindung <strong>mit</strong><br />
Verletzungsmächtigkeit einerseits <strong>und</strong> Verletzungsoffenheit andererseits bringt: „Er vertritt die<br />
Ansicht, dass alle Menschen über die Möglichkeit verfügen, andere zu verletzen <strong>und</strong> durch<br />
andere verletzt zu werden. <strong>Macht</strong>, in letzter Konsequenz ausgeübt durch un<strong>mit</strong>telbare,<br />
physische Gewalt ist so<strong>mit</strong> an die Aktionsmacht des einzelnen Gesellschafts<strong>mit</strong>glieder<br />
geb<strong>und</strong>en, deren Möglichkeiten, sich verletzungsmächtig oder verletzungsoffen zu zeigen <strong>und</strong><br />
zu erleben, durch die Chancestrukturen <strong>und</strong> die soziale Ordnung einer Gesellschaft bestimmt<br />
werden. Verletzungsmächtigkeit <strong>und</strong> –offenheit korrespondieren dabei stets <strong>mit</strong>einander<br />
insofern „die Verletzbarkeit des Menschen durch Menschen .. nicht aufhebbar ist.“ 10<br />
Diese Definition von Popitz ist deshalb sinnvoll, da in ihr die Verletzungsmächtigkeit als eine<br />
generelle Möglichkeit des Handelns eingestuft wird. Lehrer <strong>und</strong> Lehrerinnen an Schulen sollten<br />
um die eigene Verletzungsmächtigkeit wissen. Die soziale Ordnung der Gesellschaft weist<br />
Lehrerinnnen <strong>und</strong> Lehrern eine legitime Verletzungsmächtigkeit zu, die aber zu einer illegitimen<br />
avancieren kann. Und ähnlich könnte man auch Max Weber lesen, der ganz explizit von<br />
legitimen Formen der Herrschaft spricht <strong>und</strong> dabei die legale Herrschaft (auch von Lehrern <strong>und</strong><br />
LehrerInnen) nicht als Person, aber als Amtsträger meint.<br />
Werden wir konkret: Von welcher <strong>Macht</strong> ist in der Schule die rede?<br />
1. An Schulen besteht zunächst einmal eine <strong>Macht</strong> aufgr<strong>und</strong> des gegebenen<br />
Altersunterschiedes zwischen LehrerInnen <strong>und</strong> SchülerInnen. Dieser Altersunterschied<br />
ist zugleich verb<strong>und</strong>en <strong>mit</strong> unterschiedlichen physischen, psychischen <strong>und</strong> kognitiven<br />
Kompetenzen.<br />
2. Eine symbolische <strong>Macht</strong> besteht darüber hinaus durch das selektive Schulsystem, das<br />
den Zugang durch Leistung <strong>und</strong> Bewertung regelt.<br />
3. Wie in allen gesellschaftlichen Systemen ist auch an der Schule ein<br />
geschlechtsspezifischer <strong>Umgang</strong> <strong>mit</strong> <strong>Macht</strong> <strong>und</strong> Gewalt beobachtbar, der Teil einer<br />
gesellschaftlichen Ordnung von Geschlechterverhältnissen ist.<br />
4. Die Rolle des Lehrers, der Lehrerin ist zugleich eine, die nur in Bezug auf Bildung greift,<br />
sondern die <strong>mit</strong> erzieherischen Aufgaben betraut ist, die die Unterstützung der Kinder in<br />
den unterschiedlichen Lebenssituationen bedeutet.<br />
5. Das <strong>Macht</strong>gefälle ist dort am größten wo Kinder auf eine Betreuung angewiesen sind,<br />
die über das „Normale“ hinaus gehen. Das betrifft insbesondere die Situation an<br />
Förderschulen für Kinder, deren Kommunikationsfähigkeit eingeschränkt ist.<br />
6. Thematisiert wird lediglich die Gewalt, die unter Kindern sichtbar ist.<br />
10 Vgl. Mechthild Bereswill (2011). A.a.O. S.211.<br />
Seite 94
Aus meiner Perspektive würden sich hier nun zwei Fragen anschließen:<br />
1. Warum wird die Verletzungsmächtigkeit der Lehrer <strong>und</strong> Lehrerinnen nicht thematisiert?<br />
2. Welche Möglichkeiten der Thematisierung würde es geben?<br />
Lehrer <strong>und</strong> Lehrerinnen verstehen sich zunehmend eher als Begleiter der Schülerinnen <strong>und</strong><br />
Schüler denn als belehrender <strong>und</strong> strafender Pädagoge. Die eigene Dominanz wird dann<br />
ausgeblendet. Wenn sie aber ausgeblendet wird, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht<br />
existiert. Aus anderen Forschungszweigen ist die Reflexion über eigene Dominanzen<br />
zwischenzeitlich als eine wichtige Erkenntnis in die Forschung eingegangen. Verweisen möchte<br />
ich auf Ergebnisse der kritischen Weißseinsforschung, die verdeutlicht wie wichtig die<br />
Auseinandersetzung <strong>mit</strong> der eigenen Überlegenheit sein kann.<br />
Die Anerkennung von <strong>Macht</strong>verhältnissen <strong>und</strong> Dominanzen innerhalb der Schule könnte zur<br />
Konsequenz haben, dass das idealisierte Bild des Lehrers in Frage gestellt wird <strong>und</strong> es so<strong>mit</strong><br />
möglich sein könnte, Phänomene, die sich aus <strong>Macht</strong>verhältnissen ergeben könnten zu<br />
thematisieren. Denn im Gr<strong>und</strong>e genommen ist es jedem Lehrer <strong>und</strong> jeder Lehrerin bewusst,<br />
dass es Grenzüberschreitungen auch in Form von sexualisierter Gewalt an Schulen gibt. Statt<br />
aber lediglich darüber zu tuscheln oder zu schweigen, kann nur ein offener <strong>Umgang</strong> zu einer<br />
Veränderung führen. Und hier setzt dann das an, was eben als die Bedeutung der Diskurse<br />
skizziert wurde. Erst das Benennen von sexualisierter Gewalt nimmt diese ernst <strong>und</strong> nimmt<br />
auch die Opfer in den Blick <strong>und</strong> gibt diesen die Möglichkeit, den Opferstatus zu entkommen.<br />
Präventionsarbeit in der Schule<br />
Für eine produktive Präventionsarbeit ergeben sich daraus die folgenden Konsequenzen.. Es<br />
sollte deutlich geworden, sein, dass ich dafür plädiere, dass die Prävention von sexueller<br />
Gewalt nur dann gelingen kann, wenn eigene Dominanzverhältnisse reflektiert werden, aber<br />
auch Situationen, in denen bsp. aufgr<strong>und</strong> geschlechtsspezifischer Zuweisungen<br />
Unterordnungen gefordert sind beziehungsweise Ungleichgewichte existieren.<br />
Schulische Prävention von sexueller Gewalt muss als eine Gr<strong>und</strong>haltung von Lehrern <strong>und</strong><br />
Lehrerinnen entwickelt werden. Prävention im schulischen Kontext - so meine These – muss<br />
als erstes beim Personal ansetzen. Lehrerinnen <strong>und</strong> Lehrer müssen zunächst einmal eine<br />
Haltung, einen Wissensbestand über sexualisierte Gewalt entwickeln, um dieses Wissen dann<br />
in reflektierter Form weiterzugeben. Lehrer <strong>und</strong> Lehrerinnen haben auch in dieser Hinsicht eine<br />
Vorbildfunktion, <strong>mit</strong> der sie an die Kinder herantreten.<br />
Sexuelle Gewalt wird als Thema innerhalb der Schule oft verdrängt. Dennoch sind fast alle<br />
Lehrerinnen <strong>und</strong> Lehrer <strong>mit</strong> ihr konfrontiert. Sei es, dass eine Schülerin, ein Schüler Opfer<br />
Seite 95
sexueller Gewalt wird, sei es, dass Kollegen übergriffig werden oder einem solchen Verdacht<br />
ausgesetzt sind. Die Schule als ein Ort in dem sexuelle Gewalt stattfindet, wurde in den letzten<br />
Monaten in den Medien immer wieder thematisiert.<br />
Sexuelle Gewalthandlungen haben zwei wesentliche Bedingungsfaktoren: Zum einen das<br />
bestehende <strong>Macht</strong>verhältnis, zum anderen eine Vertrautheit zwischen Täter <strong>und</strong> Opfer. Beides<br />
sind Faktoren, die an Schulen gegeben sind. Was das <strong>Macht</strong>gefälle zwischen Lehrern <strong>und</strong><br />
Schülern betrifft, so ist dieses bereits durch die schulische Benotung gegeben.<br />
Schulen sind ein Ort, der sich besonders für Übergriffe eignet. Denn entsprechend den von<br />
Anita Heiliger entwickelten Täterstrategien suchen sich Täter Orte <strong>und</strong> Handlungsfelder aus, die<br />
ihnen einen Kontakt zu Kindern ermöglichen. Nicht selten arbeiten sie in pädagogischen<br />
Bereichen. Sie begegnen den Jungen <strong>und</strong> Mädchen an der Schule als Lehrer, als Pädagoge in<br />
der Hausaufgabenbetreuung oder als Hausmeister. Besonders gefährdet sind Kinder <strong>und</strong><br />
Jugendliche, die aufgr<strong>und</strong> einer körperlichen Beeinträchtigung in speziellem Maße betreut<br />
werden müssen <strong>und</strong> bei denen die körperliche Pflege <strong>mit</strong> zu den Aufgaben der Pädagogen<br />
gehört oder von Pflegepersonal der schulischen Einrichtung übernommen wird. Gerade aber<br />
diesen „Helfern“ wird weder innerhalb des Schulsystems noch von Außenstehenden etwas<br />
negatives zugetraut.<br />
Neben den skizzierten Gewalthandlungen zwischen Lehrern <strong>und</strong> Schülern wird zunehmend<br />
das Phänomen von Übergriffen unter den Kindern beobachtet. Bullying, Mobbing, Fotografieren<br />
in Umkleidekabinen <strong>und</strong> Duschen bis hin zu körperlichen Übergriffen, bei denen die<br />
körperlichen <strong>und</strong> sexuellen Grenzen bewusst überschritten werden, nehmen zu. Lehrer<br />
berichten von Übergriffen auf dem Schulhof, bei denen primär Jungen als Täter auftreten <strong>und</strong><br />
Mädchen <strong>und</strong> Jungen zum Oper gemacht werden. In all diesen Situationen ist ein <strong>Macht</strong>gefälle<br />
die Gr<strong>und</strong>lage. Die Abhängigkeit des Opfers zum Täter ist dabei unübersehbar. Dreh- <strong>und</strong><br />
Angelpunkt bleibt demnach die <strong>Macht</strong>ausübung als ein Ziel der sexuellen Gewalt. Als ein<br />
Herrschaftsinstrument wird Gewalt genutzt, um Mädchen <strong>und</strong> Jungen in eine untergeordnete<br />
Position zu bringen <strong>und</strong> dort verharren zu lassen. Die Ohnmacht der Opfer ist Ziel dieser<br />
Übergriffe.<br />
Neben diesen Situationen, an denen die Schule zum Austragungsort <strong>und</strong> Auslöser sexueller<br />
Übergriffe wird kann die Schule auch ein Raum sein an dem sexuelle Gewalt offenbart <strong>und</strong><br />
<strong>mit</strong>geteilt wird. Nicht nur, dass Lehrer <strong>und</strong> Schüler den Missbrauch von Kindern „zufällig“<br />
erfahren. Gerade Lehrer haben eine Vertrauensposition für ihre Schülerinnen, so dass sich<br />
diese ihnen bei erfahrener Gewalt anvertrauen können. Vor dem Hintergr<strong>und</strong>, dass ein Opfer<br />
sexualisierter Gewalt durchschnittlich sieben Personen ansprechen muss, bis dass reagiert<br />
wird, ist die Beschäftigung <strong>mit</strong> dem Thema für Lehrer unabdingbar.<br />
Seite 96
Ansatzpunkte für eine Präventionsarbeit<br />
Prävention von sexualisierter Gewalt muss als eine wesentliche Erziehungshaltung in die<br />
pädagogische Arbeit der Schule <strong>mit</strong> einfließen. Eine Haltung, die die Selbstbestimmung von<br />
Kindern in den Mittelpunkt rückt <strong>und</strong> fördert <strong>und</strong> dabei sowohl mögliche Opfer als auch<br />
potentielle Täter als Adressaten wählt. Es gehört also zu den Aufgaben der Erwachsenen, den<br />
Lehrern den Pädagogen, dass sie sich zunächst einmal <strong>mit</strong> den Phänomen der sexualisierten<br />
Gewalt beschäftigen. Sie müssen eine parteiliche Gr<strong>und</strong>haltung entwickeln, die sie offen für die<br />
Wahrnehmung sexualisierter Gewalt macht.<br />
Diese Kriterien können als eine Basis für die Präventionsarbeit gedeutet werden. Aber auch hier<br />
wird deutlich, dass erst einmal die Professionellen Pädagoginnen <strong>und</strong> Pädagogen gefragt sind.<br />
An ihnen ist es, an einer geschlechtergerechten Schule zu arbeiten, in der sexualisierte Gewalt<br />
als solche benannt wird.<br />
1. Auf struktureller Ebene sollte das politische Konzept des gendermainstreaming <strong>und</strong> der<br />
Geschlechtergerechtigkeit umgesetzt werden <strong>und</strong> in das Schulprogramm aufgenommen<br />
werden. Lehrern, Eltern <strong>und</strong> Schülern muss von Anfang an klar sein, dass sie sich an<br />
einer Schule befinden, in der die Gleichberechtigung der Geschlechter im Mittelpunkt<br />
steht. Darüber hinaus sollte die Schule ganz klar formulieren, dass das Phänomen der<br />
sexualisierten Gewalt ein Thema für die Schule ist, dem man sich entgegenstellen wird.<br />
2. In einer Erklärung der Institution Schule sollte diese sich nicht nur als eine<br />
geschlechtergerechte Schule verstehen, sondern als eine, in der sexualisierte Gewalt,<br />
beginnend <strong>mit</strong> einer sexualisierten Sprache bis hin zu sexuellen Übergriffen nicht<br />
geduldet wird.<br />
3. Fortbildungen zur Entwicklung gendersensiblen Verhaltens <strong>und</strong> sexualisierter Gewalt<br />
müssen verpflichtend sein <strong>und</strong> in das Schulprogramm aufgenommen werden.<br />
4. (Eigen-) Verpflichtung der Lehrer zum restriktiven <strong>Umgang</strong> <strong>mit</strong> Grenzüberschreitungen<br />
<strong>und</strong> sexualisierter Gewalt<br />
5. Sexualerziehung, gekoppelt <strong>mit</strong> einer Ich-Stärkung muss konsequent in den<br />
Schulunterricht integriert werden.<br />
6. Prävention von sexueller Gewalt nicht dem Zufall überlassen, sondern in den Schulalltag<br />
<strong>mit</strong> ein bauen.<br />
Das wäre für mich eine wichtige erste Erkenntnis: Prävention beginnt bei den Erzieherinnen,<br />
den Lehrerinnen <strong>und</strong> Eltern <strong>und</strong> geht von diesen dann zu den Kindern. Das klingt vielleicht<br />
einfach <strong>und</strong> doch erfordert es von den Lehrern mehr als eine Präventionsmaßnahme in Form<br />
einer Projektwoche oder einer einmaligen Unterrichtseinheit zum Thema.<br />
Seite 97
Ausbildung von Lehrerinnen <strong>und</strong> Lehrern<br />
In der universitären Ausbildung von Lehrern <strong>und</strong> Lehrerinnen wurde bisher kaum auf strukturell<br />
bedingte sexuelle Gewalt konsequent reagiert. Ansatzpunkte für gr<strong>und</strong>legende Veränderungen<br />
liegen in einer geschlechtergerechten Erziehung, die als Basis nicht die Aufrechterhaltung<br />
bestehender Geschlechternormen hat, sondern die Infragestellung. Gerade die männliche<br />
Sozialisation muss dabei in den Blick genommen werden. Die Auseinanderssetzung <strong>mit</strong> einer<br />
gendersensiblen Schule <strong>und</strong> der Frage der sexualisierten Gewalt darf dabei nicht abhängig von<br />
dem persönlichen Interesse der Lehrenden sein, sondern muss ein gr<strong>und</strong>sätzlicher Bestandteil<br />
innerhalb der Lehrerausbildung sein. Hier ist eine gendersensible Didaktik gefragt, an deren<br />
Konzeptionalisierung jedoch – so meine Einschätzung – noch weiterer Forschungsbedarf<br />
besteht.<br />
Weiterhin besteht die Notwendigkeit, dass sich angehende Lehrer <strong>mit</strong> ihren eigenen<br />
rollenspezifischen Verhalten auseinandersetzen <strong>und</strong> dieses thematisieren. Es ist zu<br />
beobachten, dass viele Studierende eine geschlechter-hierarchisierende Gesellschaft nicht<br />
wahrnehmen. Junge Studentinnen sind sich sicher, in einer postfeministischen Gesellschaft zu<br />
leben, einer gleichberechtigten Partnerschaft zu leben <strong>und</strong> ordnen Gewalt eher den unteren<br />
sozialen Milieus zu. Sie belächeln die Frauen der Frauenbewegung <strong>und</strong> sagen „wir haben alles<br />
erreicht“. Und auch die männlichen Studenten sehen nur selten die Benachteiligung von<br />
Frauen, viel eher sagen sie „Mädchen sind die Gewinner“. Hier muss eine Prävention ansetzen,<br />
die fruchten kann.<br />
Die Bewusstseinsbildung gerade bei Studierenden ist sehr wichtig <strong>und</strong> kann auch erfolgreich<br />
sein. In einem Seminar zum Thema „Familie <strong>und</strong> Gewalt“ haben Studentinnen von ihren<br />
eigenen Gewalterfahrungen berichtet. Fast alle konnten mehrere Situationen von sexuellen,<br />
körperlichen oder Verbalen Übergriffen erzählen, die ihnen widerfahren sind. Dabei sind es<br />
dann nicht unbedingt häusliche Gewalterfahrungen, aber Gewalterfahrungen im öffentlichen<br />
Raum, die ihnen dann die unterschiedlichen Positionierungen innerhalb der Gesellschaft<br />
verdeutlichen.<br />
Neben die geschlechtersensible Ausbildung von Lehrern, die das Ziel des Aufbrechens starrer<br />
Geschlechterkonstruktionen hat, besteht die Notwendigkeit, dass angehende Lehrer <strong>und</strong><br />
Lehrerinnen in die theoretischen <strong>und</strong> empirischen Bef<strong>und</strong>e von sexualisierter Gewalt <strong>und</strong> ihrer<br />
Prävention eingearbeitet werden. Die Auseinandersetzung <strong>mit</strong> diesen Fakten kann für<br />
Lehrende <strong>mit</strong> Überwindung verb<strong>und</strong>en sein, da eigene emotionale Grenzen angegriffen werden.<br />
Seite 98
Fazit<br />
Für den Beitrag wir folgendes bedeutsam:<br />
1. Sexualisierte Gewalt muss in allen Schulen thematisiert werden<br />
2. Prävention von sexueller Gewalt beginnt <strong>mit</strong> einer Gr<strong>und</strong>haltung der LehrerInnen <strong>und</strong><br />
dem Bewusstwerden geschlechterhierarchischer Denkstrukturen<br />
3. Als Gr<strong>und</strong>haltung fließt sie in den Alltag der Schule <strong>mit</strong> ein<br />
4. Sexuelle Gewalt ist kein Thema der Anderen, sondern ein Thema für das alle<br />
Pädagoginnen ausgebildet sein sollen.<br />
Literatur:<br />
Bereswill, Mechthild (2011): Zum Verhältnis von Gewalt <strong>und</strong> Geschlecht: Entwicklungen <strong>und</strong><br />
Perspektiven der soziologischen Geschlechterforschung. In: Barbara Rendtorff u.a. (Hrsg.):<br />
Geschlechterforschung. Theorien, Thesen, Themen zur Einführung. Stuttgart. S. 201f.<br />
Bourdieu, Pierre (2005): Die männliche Herrschaft. Frankfurt am Main.<br />
B<strong>und</strong>schuh, Claudia (2011): Sexualisierte Gewalt gegen Kinder in Institutionen. Nationaler <strong>und</strong><br />
internationaler Forschungstand. Expertise im Rahmen des DJI-Projekts „ Sexualisierte Gewalt<br />
gegen Mädchen <strong>und</strong> Jungen in Institutionen.“ München.<br />
Füller, Christian (2011): Sündenfall. Wie die Reformschule ihre Ideale missbrauchte. Köln.<br />
Heiliger, Anita (2003): Täterstrategien <strong>und</strong> Prävention. München.<br />
Lenz, Ilse (Hrsg.) (2008): Die Neue Frauenbewegung in Deutschland. Abschied vom kleinen<br />
Unterschied. Eine Quellensammlung. Wiesbaden.<br />
Röhl, Christoph (2010): Und wir sind nicht die Einzigen. Kino Dokumentarfilm, 90min,<br />
Herbstfilm, 3Sat.<br />
Seite 99
Prof Dr. Hannelore Faulstich‐Wieland<br />
Missbrauch <strong>und</strong> Geschlecht<br />
Impulsbeitrag auf dem Forum „<strong>Umgang</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sexualität</strong>, <strong>Körperlichkeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Macht</strong> in pädagogischen<br />
Kontexten“ am 9.11.11<br />
Ich möchte <strong>mit</strong> einem Zitat beginnen, <strong>mit</strong> einer Aussage, die Michaela Ralser, Professorin für<br />
Gender‐, Cultural‐ <strong>und</strong> Science‐Studies im Heft 03/2011 des Magazins der Fakultät für<br />
Bildungswissenschaften an der Universität Innsbruck zur Debatte um sexualisierte Gewalt in<br />
pädagogischen Einrichtungen trifft:<br />
„Die Geschlechterfrage wird in der aktuellen Debatte nicht gestellt – auch nicht hinsichtlich der<br />
Produktion <strong>und</strong> Reproduktion von Männlichkeiten, in deren Rahmen auch Gewalt (im Binnenraum der<br />
Genusgruppe Männer wie im Geschlechterverhältnis) eine nicht unwesentlich Rolle spielt. Und dies,<br />
obwohl die Debatte fast ausschließlich von Männern geführt wird <strong>und</strong> eigentümlich ohne Frauen bleibt.<br />
Nur r<strong>und</strong> fünf Prozent der Debattenbeiträge stammen von Frauen. Als feministische Stimmen fehlen sie<br />
ganz. Auch an den R<strong>und</strong>en Tischen sind in Expertenrolle wieder die ‚alten‘ Herren zurückgekehrt: als<br />
Psychiater <strong>und</strong> Sexualwissenschaftler, als Juristen <strong>und</strong> Pädagogen.“ (Ralser 2011, S. 10).<br />
Frau Ralser bezieht sich hier vor allem auf die Medienberichte im letzten Jahr. Auf dieser Veranstaltung<br />
haben sich die Organisatoren sehr wohl die Frage nach der Bedeutung, die dem Geschlecht zukommt,<br />
gestellt <strong>und</strong> mir die Aufgabe gegeben, dazu einiges in die Diskussion einzubringen. Das will ich gerne<br />
versuchen, wenngleich es angesichts von 20 Minuten Vortragszeit nur schlaglichtartig sein kann.<br />
Will man analysieren, welche Rolle das Geschlecht bei sexualisierter Gewalt spielt, dann betrifft das<br />
zunächst einmal die Frage danach, wer die Opfer <strong>und</strong> wer die Täter oder Täterinnen sind. Ich will also<br />
zunächst ganz kurz auf einige Statistiken eingehen, die durchaus einiges über das Geschlecht sagen.<br />
Dann zeige ich auf, dass die Beschäftigung <strong>mit</strong> Geschlecht <strong>und</strong> Gewalt ein zentrales Thema der zweiten<br />
Frauenbewegung ist. Die da<strong>mit</strong> verb<strong>und</strong>enen Vorstellungen von Weiblichkeit <strong>und</strong> Männlichkeit gingen<br />
von einer klaren Differenz aus. Gendertheoretisch hat es hier deutliche Weiterentwicklungen gegeben,<br />
<strong>mit</strong> denen ich mich im dritten Schritt befasse. Auf Basis solcher Ansätze versuche ich dann einige<br />
Erkenntnisse zu den verschiedenen Beziehungsformen von Gewalt <strong>und</strong> Geschlecht aufzuzeigen.<br />
Bevor ich auf meinen ersten Punkt zu den Statistiken komme, möchte ich eine Vorbemerkung zur<br />
Begrifflichkeit machen: In den meisten abstracts für die Beiträge heute wird von „sexueller Gewalt“<br />
gesprochen, ich habe den juristischen Begriff des „sexuellen Missbrauchs“ verwendet. Es gibt durchaus<br />
eine Auseinandersetzung darum, wie man das, worum es geht, bezeichnen kann ohne schon<br />
möglicherweise ungewollte Interpretationen zu liefern: „Sexueller Missbrauch“ impliziert, es gäbe einen<br />
richtigen <strong>und</strong> einen falschen Gebrauch von <strong>Sexualität</strong> – was zweifellos eine problematische Annahme<br />
ist. Zugleich ist es der Terminus, der in der Rechtsprechung verwendet wird, also Gr<strong>und</strong>lage auch für<br />
offizielle Statistiken bildet. „Sexuelle Gewalt“ impliziert u.U., dass ein sexueller Trieb als natürlich<br />
angenommen wird, dem man nicht gewachsen ist <strong>und</strong> er sich dann in Gewalt verwandelt. Solche Fälle<br />
gibt es sicherlich, sie sind auch Bestandteil von psychiatrischen <strong>und</strong> medizinischen Behandlungen, die<br />
Mehrheit fällt jedoch nicht darunter. Ralser hat den Begriff „sexualisierte Gewalt“ verwendet, der mir in<br />
den Erläuterungen, die ich dazu auch an anderen Stellen gef<strong>und</strong>en habe, sehr einleuchtet: Gemeint ist<br />
dann, dass sexuelles Begehren – worauf auch immer gerichtet – durchaus ein biologisch<br />
funktionierender, „natürlicher“ Vorgang ist. Die Art <strong>und</strong> Weise, wie ich dann jedoch da<strong>mit</strong> umgehe, ist<br />
eine bewusste <strong>und</strong> in meiner Verantwortung stehende Handlung. Barbara Kavemann, Professorin an der<br />
Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin <strong>und</strong> eine der ersten, die sich wissenschaftlich <strong>mit</strong><br />
Gewalt im Geschlechterverhältnis befasst hat, schreibt dazu: Mit dem Begriff „sexualisierte Gewalt“<br />
„wird klargestellt, dass diese Gewalt nicht einfach sexuelle ist, sondern von einer Person, die dafür<br />
Seite 100
Verantwortung trägt, aktiv sexualisiert wird“ (Kavemann 1996, S. 18 – zitiert nach Herzig 2010, S. 3). Die<br />
Leiterin des Jugendamtes Karlsruhe, Dr. Susanne Heynen, ergänzt dies folgendermaßen: „Sexualisierte<br />
Gewalt betont primär, dass die Gewalt im Vordergr<strong>und</strong> steht <strong>und</strong> sexualisiert wird. Sexuelle Gewalt hebt<br />
im Vergleich zu physischer <strong>und</strong> psychischer Gewalt hervor, dass die Gewalt <strong>mit</strong> sexuellen Mitteln<br />
ausgeübt wird“ (Heynen 2000, S. 20 – zitiert nach ebd.).<br />
1. Statistiken zu sexualisierter Gewalt <strong>und</strong> Geschlecht<br />
Zur Frage der Statistiken: Diese haben zunächst einmal das große Problem, dass vieles unklar ist. Es gibt<br />
die Polizeiliche Kriminalstatistik, die Auskunft gibt über das sogenannte „Hellfeld“, also die polizeilich<br />
gemeldeten Fälle <strong>und</strong> deren Aufklärung. Man kann zwar sehen, dass über die letzten Jahrzehnte hinweg<br />
ein deutlicher Anstieg der gemeldeten Fälle erfolgt ist – also sich immer mehr Personen getraut haben,<br />
die ihnen widerfahrene Gewalt anzuzeigen ‐, dennoch kann man davon ausgehen, dass nach wie vor<br />
viele Fälle aus Scham nicht angezeigt werden. Es gibt als zweites die Strafverfolgungsstatistik, die<br />
Auskunft gibt über die Verurteilten <strong>und</strong> die verhängten Strafen. Es gibt weiterhin wissenschaftliche<br />
Forschungen sowohl zum Hellfeld wie insbesondere zum sogenannten Dunkelfeld, also den nicht<br />
gemeldeten Fällen.<br />
Die Polizeiliche Kriminalstatistik besagt, dass die Opfer sexualisierter Gewalt zu 75‐80% weiblich, die<br />
Tatverdächtigen zu 96% männlich waren (ebd., S. 9). Eine Zusammenstellung von internationalen<br />
Studien im einschlägigen Handbuch „Sexueller Missbrauch“ (Amann <strong>und</strong> Wipplinger 2005) ergab, dass<br />
wenigstens 7% der Frauen <strong>und</strong> 3% der Männer Missbrauchserfahrungen gemacht haben (Finkelhor<br />
2005, S. 84). 1<br />
Die gerade vorgelegte neue Repräsentativstudie des Kriminologischen Forschungsinstituts<br />
Niedersachsen über sexuellen Missbrauch stellt gegenüber der letzten Studie von 1992 einen Rückgang<br />
sexualisierter Gewalt fest. Von den 11.428 befragten Personen haben 683 angegeben, mindestens<br />
einmal in ihrer Kindheit ein sexuelle Missbrauchserfahrung gehabt zu haben. Auf diese Daten bezieht<br />
sich die erste Auswertung (Bieneck et al. 2011). Missbrauchserfahrungen <strong>mit</strong> Körperkontakt wurden von<br />
6,4% der Frauen <strong>und</strong> 1,3% der Männer berichtet (ebd., S. 40), d.h. auch hier sind die Opfer zu deutlich<br />
größerem Anteil weiblich. Bei den Tätern dominieren die Männer, <strong>und</strong> zwar insbesondere die Männer<br />
aus dem familiären Umfeld bzw. aus dem Bekanntenkreis (ebd., S. 30).<br />
2. Sexualisierte Gewalt als Thema der Frauenbewegung<br />
Der Zusammenhang von sexualisierter Gewalt <strong>und</strong> Geschlecht ist keineswegs ein neues Thema 2 . In den<br />
ersten autonomen Selbsterfahrungsgruppen der zweiten Frauenbewegung brachte der Austausch<br />
untereinander eine über alle Schichten hinweg vorhandene Erfahrung von Gewalt im familiären Kontext.<br />
Die Einrichtung von Frauenhäusern, die Frauen <strong>mit</strong> Gewalterfahrungen Schutz boten, war denn auch<br />
eine der ersten konkreten Aktivitäten der Frauenbewegung (vgl. Brückner 2010). Dabei war man sich<br />
einig darüber, dass Gr<strong>und</strong>lage der Gewalt gegen Frauen – die auch sexualisierte Gewalt einschloss – das<br />
Patriarchat war, d.h. Männer die Täter <strong>und</strong> Frauen die Opfer waren (vgl. die Einordnung bei Wipplinger<br />
<strong>und</strong> Amann 2005, S. 30f. sowie bei Brockhaus <strong>und</strong> Kolshorn 2005). Parteiliche Arbeit <strong>mit</strong> Frauen war<br />
deshalb das Gr<strong>und</strong>prinzip dieser Arbeit. Meines Wissens gab es dann 1994 erstmals eine Tagung der<br />
Landesarbeitsgemeinschaft autonomer Mädchenhäuser NRW, die sich <strong>mit</strong> dem Thema „Täterinnen“<br />
1<br />
Hertha Richter-Appelt, Professorin an der Universität Hamburg <strong>und</strong> 2. Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft<br />
für Sexualforschung, schreibt in ihrem gemeinsamen Beitrag <strong>mit</strong> Prof. Peer Briken, dem Direktor des Instituts für<br />
Sexualforschung am UKE der Universität Hamburg, dass Studien in Deutschland zu Missbrauchserfahrungen vor<br />
dem 14. Lebensjahr Häufigkeitsangaben von zwischen 11,9% <strong>und</strong> 23% bei jungen Frauen <strong>und</strong> zwischen 2,1% <strong>und</strong><br />
5,8% bei jungen Männern ergeben. In allen Studien sind Mädchen deutlich häufiger betroffen als Jungen (Briken<br />
<strong>und</strong> Richter-Appelt 2010, S. 29f.).<br />
2<br />
Eine historische Darstellung bei Trube-Becker zeigt, dass Kinder – sowohl Mädchen wie Jungen - von der Antike<br />
an als Sexobjekte benutzt wurden (Trube-Becker 2005).<br />
Seite 101
efasste (LAG Autonome Frauenhäuser NRW 1994). 3 Die Beiträge in der Dokumentation spiegeln das<br />
Entsetzen darüber, dass es Frauen gibt, die sexuelle Gewalt ausüben. Das für die feministische<br />
Bewegung gültige Frauenbild geriet ins Wanken. Sexuelle Gewalt wurde als die schlimmste Form der<br />
Gewalt angesehen, die zudem <strong>mit</strong> einer <strong>Macht</strong>position einhergeht. Sowohl die Solidarität von Frauen<br />
wie die Wahrnehmung, dass Frauen keine <strong>Macht</strong> hätten – oder haben sollten – wurde durch Täterinnen<br />
in Frage gestellt.<br />
Man kann diese Diskussionen auch als Teil einer Differenzierung <strong>und</strong> Weiterentwicklung der<br />
Geschlechterbilder ansehen, die im Kontext der Genderforschung aufgegriffen wurden.<br />
Genderforschung ist hervorgegangen aus der Frauenforschung, deren Entstehen untrennbar <strong>mit</strong> der<br />
neuen Frauenbewegung verb<strong>und</strong>en war. Hauptanliegen von Frauenforschung war es, Frauen sichtbar zu<br />
machen, <strong>und</strong> zwar als Forschungssubjekte wie als „Forschungsobjekte“. Wesentliche theoretische<br />
Leistung dazu war, Geschlecht als soziale Kategorie, die unterhalb aller anderen Kategorisierungen liegt,<br />
zu analysieren <strong>und</strong> die Differenzen der Geschlechter herauszuarbeiten.<br />
3. Gendertheoretische Entwicklungen<br />
Als „Mainstream“ der beginnenden Frauenforschung kann man den „Differenzfeminismus“ bezeichnen.<br />
Die Kritik an der männlich zentrierten Moderne <strong>und</strong> die Absage an Analysen, die Frauen als defizitär<br />
gemessen an männlichen Normen ansahen, führte zur Suche nach positiven Bestimmungen des<br />
Weiblichen. „Mütterlichkeit“ stellte einen Kristallisationspunkt dar, der – in Weiterentwicklung<br />
psychoanalytischer Ansätze – die Bedeutung von Bindung <strong>und</strong> Verantwortung für menschliches<br />
Zusammenleben hervorhob. In diesem Punkt knüpfte die Frauenforschung auch an Positionen des<br />
bürgerlichen Teils der ersten Frauenbewegung an: Mit dem Stichwort „geistige Mütterlichkeit“ wurde<br />
den Frauen eine besondere Qualität zugeschrieben, die zugleich als ihre gesellschaftliche Aufgabe<br />
angesehen wurde. Die polare Geschlechterkonstruktion fand hierin ihren deutlichen Ausdruck.<br />
Die Auseinandersetzung <strong>mit</strong> den Differenzkonzepten führte zu einer reflexiven Kritik an der<br />
Zweigeschlechtlichkeit. Ein zentraler theoretischer Ansatz ist die konstruktivistisch‐interaktionistische<br />
Geschlechtertheorie – die auch die Veränderung von der Frauenforschung zur Genderforschung<br />
beinhaltet. Sie geht davon aus, dass man nicht ein Geschlecht „hat“, also Geschlechterdifferenzen nicht<br />
„natürlich“ sind, sondern die Zugehörigkeit zu einem Geschlecht „erworben“ <strong>und</strong> dann immer wieder<br />
„getan“ wird ‐ doing gender. In den alltäglichen Interaktionen erfolgt ständig eine Inszenierung bzw.<br />
Darstellung von Geschlecht wie zugleich eine Zuschreibung der Gleich‐ oder Gegengeschlechtlichkeit.<br />
Beides beruht auf, reproduziert <strong>und</strong> produziert das Wissen um die „Normalität“ der<br />
Geschlechterverhältnisse. In den Blick kommen also beide Geschlechter <strong>und</strong> ihr relationales Verhältnis<br />
im jeweiligen Kontext.<br />
Zentrale Gr<strong>und</strong>lagen des gesellschaftlich mehr oder weniger geteilten Bildes von den Geschlechtern sind<br />
drei Annahmen: Zum einen, dass es nur zwei Geschlechter gibt, also eine Dichotomie vorherrscht. Zum<br />
zweiten werden diese beiden Geschlechter oppositionell definiert: Was männlich ist, kann nicht weiblich<br />
sein <strong>und</strong> umgekehrt. Drittens schließlich gilt immer noch eine hierarchische Wahrnehmung: männliches<br />
ist mehr wert als weibliches.<br />
Trotz aller Ausdifferenzierungen <strong>und</strong> gendertheoretischer Weiterentwicklungen bleibt insofern der<br />
ursprüngliche, politisch intendierte Ausgangspunkt der Frauenforschung erhalten, der sich gegen die<br />
Ungleichheit <strong>und</strong> ungleiche Wertigkeit der Geschlechter wandte: Nach wie vor geht es um den Abbau<br />
von Hierarchien. Dabei steht keine Suche nach einer wie immer definierbaren „Weiblichkeit“ oder<br />
„Männlichkeit“ mehr im Vordergr<strong>und</strong>, sondern die Suche nach den Mechanismen, die zur Produktion<br />
<strong>und</strong> Reproduktion von Geschlecht <strong>und</strong> Geschlechterverhältnissen führen.<br />
3 Allerdings gab es in der Frauenbewegung <strong>und</strong> Frauenforschung bereits seit dem Beitrag von Tina Thürmer-Rohr<br />
zur „Mittäterschaft“ eine Auseinandersetzung über die Frage, ob Frauen nur Opfer seien oder auch aktiv an der<br />
Produktion <strong>und</strong> Reproduktion von Herrschaftsverhältnissen beteiligt seien (vgl. Thürmer-Rohr 1988).<br />
Seite 102
Auf Basis eines solchen Ansatzes gilt es dann auch, die Frage der sexualisierten Gewalt <strong>mit</strong> Blick auf die<br />
Bedeutung von Geschlecht zu betrachten <strong>und</strong> Geschlecht nicht auszuklammern in der Diskussion.<br />
Drei Aspekte lassen sich dabei unterscheiden:<br />
• Sexualisierte Gewalt gegenüber Mädchen bzw. Frauen durch Männer<br />
• Sexualisierte Gewalt durch Frauen – Frauen als Täterinnen.<br />
• Sexualisierte Gewalt gegenüber Jungen durch Männer<br />
3.1. Sexualisierte Gewalt gegenüber Mädchen bzw. Frauen durch Männer<br />
Beginnen wir <strong>mit</strong> dem ersten Aspekt, der laut Statistiken der Normalfall ist. Was lässt sich aus einer<br />
neueren gendertheoretischen Perspektive dazu anmerken? Dr. Sandra Glammeier vom<br />
Interdisziplinären Zentrum für Frauen‐ <strong>und</strong> Geschlechterforschung der Universität Bielefeld hat im<br />
neuesten Heft der Zeitschrift „Gender“ über eine qualitative Studie zur Gewalt gegen Frauen berichtet.<br />
In ihrem theoretischen Ansatz zeigt sie auf, wie die symbolische Ordnung, die auch dem doing gender<br />
zugr<strong>und</strong>e liegt, eine Verleiblichung von Herrschaft herstellt. „Herrschaft wird in Differenzierungs‐ <strong>und</strong><br />
(Des‐)Identifikationsprozessen verleiblicht, in denen die Ich‐Werdung des Jungen als Abgrenzung<br />
sexualisiert wird <strong>und</strong> er <strong>mit</strong> der Aneignung einer verdinglichenden Haltung gegenüber dem weiblichen<br />
Geschlecht Gefahr läuft, die Fähigkeit zu wechselseitiger Anerkennung zu verlieren“ (Glammeier 2011, S.<br />
11). Die Begehrensposition wird als die des Mannes, die Begehrtwerden‐Position als die der Frau<br />
vorgesehen – die Zuschreibung von aktiv <strong>und</strong> passiv zieht sich auch durch weitere<br />
Vergeschlechtlichungen durch. Verletzungsmächtigkeit <strong>und</strong> Verletzungsoffenheit sind dabei ebenfalls<br />
die beiden Seiten, die dem Geschlechterverhältnis zugeordnet werden. Mädchen erfahren in ihrer<br />
Sozialisation 4 wohl noch immer, dass sie auf die Unversehrtheit ihres Körpers zu achten haben, während<br />
Jungen das Ausreizen von Körperkräften abverlangt wird <strong>und</strong> Versehrtheit nicht gezeigt werden darf –<br />
„Indianer kennen keinen Schmerz“!<br />
Gepaart <strong>mit</strong> einem Verständnis von <strong>Sexualität</strong> als Trieb werden Mädchen <strong>und</strong> Frauen zu Objekten,<br />
deren Verhalten als Herausforderung für die Inszenierung von Männlichkeit betrachtet wird.<br />
Vergewaltigungsopfer kämpfen nach wie vor <strong>mit</strong> einer solchen Sichtweise, wenn sie die ihnen angetane<br />
Gewalt zur Anzeige bringen wollen. Glammeier spricht davon, dass in der „Passivierung <strong>und</strong><br />
Verdinglichung der Opfer – <strong>und</strong> zwar nicht nur in der Gewaltsituation selbst, sondern auch im<br />
Nachhinein ‐ … ein wichtiger Aspekt dessen zu liegen (scheint), was (sexuelle) Gewalt ‚so schlimm‘<br />
macht“ (ebd., S. 14). Das „Schlimme daran“ geht jedoch noch wesentlich weiter, weil die Zuschreibung<br />
der Subjektposition an die Männer <strong>und</strong> der Objektposition an die Frauen die sexuellen Normen in die<br />
Definitionsmacht der Männer legt <strong>und</strong> Frauen dies gar nicht mehr problematisieren können. Die Grenze<br />
zwischen hierarchischen Verhältnissen <strong>und</strong> Gewaltverhältnissen wird dann unklar. Glammeiers<br />
Perspektiven erfordern, Mädchen <strong>und</strong> Frauen die Möglichkeit von Widerstand zu geben. Dazu müssen<br />
sie als Subjekte des Begehrens anerkannt werden, wozu durchaus auch gehört, dass sie Subjekte der<br />
Gewalt sein können.<br />
3.2. Sexualisierte Gewalt durch Frauen – Frauen als Täterinnen<br />
Da<strong>mit</strong> ist allerdings nicht gemeint, dass Frauen nun Täterinnen sexualisierter Gewalt werden sollen.<br />
Aber: da<strong>mit</strong> komme ich zu meinem zweiten Fall, der zwar eher selten sein soll – in den von David<br />
Finkelhor zusammengestellten internationalen Studien kommt er gar nicht vor (Finkelhor 2005) –, für<br />
den man aber durchaus eine unbekannte Dunkelziffer annehmen kann: Es gibt sehr wohl auch<br />
sexualisierte Gewalt durch Frauen.<br />
Simone de Beauvoir hatte darauf hingewiesen, dass Mädchen <strong>und</strong> Frauen nicht in die „Lehre der<br />
Gewalt“ (zit. nach Glammeier 2011) gehen. Zum „geschlechtsadäquaten“ Verhalten von Mädchen<br />
4 Vgl. auch den Beitrag von Harten, der die Sozialisation von Jungen als gefährdeter beschreibt <strong>und</strong> aus ihr die<br />
stärkere Anfälligkeit für aggressive <strong>Sexualität</strong> begründet (Harten 2005).<br />
Seite 103
gehört nach wie vor nicht, körperliche Gewalt auszuüben. Stattdessen gehört es dazu, einfühlsam <strong>und</strong><br />
empathisch sein zu sollen. Die Zuschreibung von Mütterlichkeit – die vielen nach wie vor als natürliche<br />
Eigenschaft erscheint – bewirkt über die Sozialisation ein doing gender bei Mädchen <strong>und</strong> Frauen, dass<br />
sich zum Teil tatsächlich von dem bei Jungen <strong>und</strong> Männern unterscheidet. Zum Teil allerdings werden<br />
Verhaltensweisen auch nicht wahrgenommen, die nicht ins Schema passen (in Bezug auf<br />
Verhaltensweisen im schulischen Kontext konnten wir das in ethnografischen Studien durchaus zeigen –<br />
vgl. z.B. Budde et al. 2007)).<br />
Ein möglicherweise großes Problem besteht tatsächlich darin, dass Täterinnen nicht erkannt werden –<br />
<strong>und</strong> so weder den betroffenen Kindern geholfen noch <strong>mit</strong> den Frauen letztlich gearbeitet wird. Im<br />
Kontext des Projektes „Sexuelle Gewalt gegen Mädchen <strong>und</strong> Jungen in Institutionen“ am DJI wurde in<br />
den Fokusgruppen auch das Geschlecht thematisiert. Es zeigte sich deutlich, dass die Fachkräfte sich<br />
Frauen wesentlich weniger als Täterinnen vorstellen konnten <strong>und</strong> dass „Verdeckungszusammenhänge“<br />
eine weniger kritische Beobachtung bewirken würden: Körperliche Berührungen seien unter Mädchen<br />
unverdächtiger, Pflegehandlungen von Frauen würden eher nicht <strong>mit</strong> Grenzüberschreitungen<br />
verb<strong>und</strong>en (Mayer 2011).<br />
Frauen, die Opfer sexualisierter Gewalt durch Täterinnen waren, erleben – so zumindest Berichte aus<br />
Beratungsstellen – diese Gewalt subjektiv als schlimmer als einen Missbrauch durch Männer (Birke<br />
2004). Auch wird sie stärker tabuisiert. Offensichtlich verträgt sich auch für die Opfer das Frauenbild<br />
nicht da<strong>mit</strong>, dass Frauen sexualisierte Gewalt ausüben könnten. Betroffene Mädchen sind entsprechend<br />
häufig verunsichert, ab wann sie Erlebnisse tatsächlich als sexualisierte Gewalt empfinden (ebd., S. 11). 5<br />
In der neuen Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen sind die Opfer sexuellen<br />
Missbrauchs durch Frauen allerdings vor allem Jungen (Bieneck et al. 2011, S. 30). Forschungen darüber<br />
habe ich nicht finden können. In einem Beitrag von Thomas Schlingmann, Berater bei „Tauwetter“, einer<br />
Berliner „Anlaufstelle für Männer, die als Jungen missbraucht wurden“, berichtet er von Erfahrungen<br />
aus der Beratungsarbeit (Schlingmann 2003, S. 11; Schlingmann 2004): Danach leiden Männer, die als<br />
Kind von einer Frau missbraucht wurden, zu größeren Anteilen unter Angst vor anderen Menschen <strong>und</strong><br />
haben öfter ein gestörtes Selbstwertgefühl. Auch entwickeln sie eher extreme Reaktionen, <strong>und</strong> zwar<br />
entweder eine aggressive Opferidentität oder eine Hypermaskulinität. Auch äußern sie häufiger<br />
Frauenhass. Schlingmann erklärt sich diese Reaktionen <strong>mit</strong> der stärkeren Verunsicherung der<br />
missbrauchten Jungen im Blick auf ihre Geschlechtsidentität: „Jede Form von sexueller Gewalt gegen<br />
Jungen stellt einen massiven Angriff auf seine Männlichkeit dar. Es gilt: Ein Mann ist kein Opfer“ (ebd., S.<br />
6). Wenn Männlichkeit <strong>mit</strong> Dominanz verb<strong>und</strong>en ist, so ist der Missbrauch durch eine Täterin ein<br />
doppelter Angriff – nicht nur ist man Opfer, sondern wird auch noch durch jemand dazu gemacht, der in<br />
der Hierarchie die untergeordnete Rolle zukommt.<br />
Ähnlich argumentiert Hans‐Christian Harten, apl. Professor für Erziehungswissenschaft an der FU Berlin,<br />
wenn er sozialisationsbedingte Gründe für die Entwicklung einer sexualisierten Aggression bei Männern<br />
anführt – zu den wichtigsten Ursachen gehören seiner Meinung nach Ängste vor Frauen. Werden diese<br />
zudem zu Täterinnen, so verstärkt sich diese Angst nochmal mehr: „insbesondere eine verführerische<br />
Mutter erzeugt überwältigende Ängste im Sohn, den Anforderungen der männlichen Rolle nicht<br />
gewachsen zu sein, Ängste, die später auf andere Frauen verschoben werden“ (Harten 2005, S. 121).<br />
3.3. Sexualisierte Gewalt gegenüber Jungen durch Männer<br />
Die im letzten Jahr in den Medien bekannt gewordenen Fälle betrafen überwiegend sexualisierte Gewalt<br />
gegenüber Jungen durch Männer. Neben der bereits angesprochenen Problematik, dass es für Jungen<br />
unverträglich ist, nicht stark, sondern hilflos <strong>und</strong> gefangen zu sein – insofern die männliche Identität<br />
5 Kendall-Tackett u.a. berichten aus der Forschung, dass es keine konsistenten Unterschiede bei Mädchen <strong>und</strong><br />
Jungen bezogen auf die Folgen sexualisierter Gewalt gäbe, dies aber eigentlich angesichts von fehlenden Studien<br />
eher ein Forschungsdesiderat darstellt (Kendall-Tackett et al. 2005, S. 194).<br />
Seite 104
da<strong>mit</strong> bedroht wird ‐, kommt hinzu, dass die sexuelle Identität verunsichert wird, diese Jungen nicht<br />
wissen, ob sie homosexuell sind. Da Homophobie nach wie vor ein starkes Mittel der Herstellung von<br />
Männlichkeit darstellt, geht die Verunsicherung in der Regel auch <strong>mit</strong> Angst einher, schwul zu sein<br />
<strong>und</strong>/oder darüber ausgegrenzt zu werden (vgl. Bange <strong>und</strong> Boehme 2005, Bösch 2003; Schlingmann<br />
2003). Das Selbstwertgefühl der betroffenen Männer ist erheblich geschwächt, zugleich – so Christian<br />
Pfeiffer in der ZEIT v. 14.7.11 würden sie „sich mehr schämen“, was insbesondere die Suche nach Hilfe<br />
<strong>und</strong> Unterstützung erschwert. Auch hierfür ist das vorherrschende Männlichkeitsbild handlungsleitend<br />
bzw. in dem Fall handlungsbehindernd. Dirk Bange <strong>und</strong> Ulfert Boehme berichten im Handbuch<br />
„Sexueller Missbrauch“, dass Fachkräfte durchaus Geschlechtsrollen‐Klischees unterliegen – zu denen<br />
z.B. gehört, Jungen könnten sich wehren oder ihnen schade sexuelle Gewalt nicht – <strong>und</strong> dies einen<br />
unterstützenden <strong>Umgang</strong> <strong>mit</strong> Betroffenen erschwert (Bange <strong>und</strong> Boehme 2005, S. 818).<br />
4. Schlussfolgerungen<br />
Mit meinen Ausführungen wollte ich einige Schlaglichter auf die Bedeutung des Geschlechts – korrekter<br />
eigentlich der Geschlechterbilder, die unser alltägliches doing gender bestimmen – werfen <strong>und</strong> zeigen,<br />
wie wichtig das Wissen um solche Zusammenhänge ist, wenn pädagogisches Fachpersonal professionell<br />
<strong>mit</strong> von sexualisierter Gewalt betroffenen Menschen arbeitet. Nur ein differenzierter Blick auf die<br />
unterschiedlichen Zusammenhänge, d.h. auf das Geschlecht der Opfer wie auf das Geschlecht der<br />
Täter/innen kann helfen, sowohl sexualisierte Gewalt überhaupt zu erkennen wie auch angemessen <strong>mit</strong><br />
den Betroffenen umzugehen.<br />
Anhang:<br />
Verteilung der zusammengefassten Tätergruppen nach Geschlecht<br />
Quelle: (Bieneck et al. 2011), S. 30<br />
Zitierte Literatur<br />
Amann, Gabriele; Wipplinger, Rudolf (Hg.) (2005): Sexueller Missbrauch. Überblick zu<br />
Forschung, Beratung <strong>und</strong> Therapie; ein Handbuch. 3., überarb. <strong>und</strong> erw. Tübingen: dgvt‐Verl.<br />
Bange, Dirk; Boehme, Ulfert (2005): Sexuelle Gewalt an Jungen. In: Amann; Wipplinger, S. 809–823.<br />
Bieneck, Steffen; Stadler, Lena; Pfeiffer, Christian (2011): Erster Forschungsbericht zur<br />
Repräsentativbefragung Sexueller Mißbrauch 2011. Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen.<br />
Hannover.<br />
Birke, Susanne (2004): Alles halb so wild? Folgen sexueller Ausbeutung von Mädchen durch Frauen,<br />
insbesondere durch Mütter. In: Prävention, 2004 (2), S. 6–12.<br />
Bösch, Christoph (2003): Männliche Opfer, männliche Täter ‐ gesellschaftliche Hintergründe. In:<br />
Prävention, 2003 (3), S. 15–18.<br />
Briken, Peer; Richter‐Appelt, Hertha (2010): Sexueller Missbrauch ‐ Betroffene <strong>und</strong> Täter. In:<br />
B<strong>und</strong>eszentrale für ges<strong>und</strong>heitliche Aufklärung (Hg.): Sexueller Missbrauch. BZgA Forum<br />
Sexualaufklärung <strong>und</strong> Familienplanung (3). Köln, S. 39–44.<br />
Seite 105
Brockhaus, Ulrike; Kolshorn, Maren (2005): Die Ursachen sexueller Gewalt. In: Amann; Wipplinger, S.<br />
97–113.<br />
Brückner, Margrit: Erfolg <strong>und</strong> Eigensinn. Zur Geschichte der Frauenhäuser. In: Bereswill,<br />
Mechthild/Stecklina, Gerd (Hg.): Geschlechtersperspektiven für die Soziale Arbeit. Zum<br />
Spannungsverhältnis von Frauenbewegungen <strong>und</strong> Professionalisierungsprozessen. Weinheim: Juventa<br />
2010, S. 61–79.<br />
Budde, Jürgen; Faulstich‐Wieland, Hannelore; Scholand, Barbara (2007): Geschlechtergerechtigkeit in<br />
der Schule ‐ ein Forschungsprojekt. In: Dietlind Fischer <strong>und</strong> Volker Elsenbast (Hg.): Zur Gerechtigkeit im<br />
Bildungssystem. Münster: Waxmann (Veröffentlichung des Comenius‐Instituts), S. 145–150.<br />
Finkelhor, David (2005): Zur internationalen Epidemiologie von sexuellem Missbrauch an Kindern. In:<br />
Amann; Wipplinger, S. 81–94.<br />
Glammeier, Sandra (2011): Widerstand angesichts verleiblichter Herrschaft? Subjektpositionen<br />
gewaltbetroffener Frauen im Kampf um Anerkennung <strong>und</strong> ihre Bedeutung für die Prävention<br />
von Gewalt. In: Gender 3, 2011 (2), S. 9–24.<br />
Harten, Hans‐Christian (2005): Zur Zementierung der Geschlechterrollen als mögliche Ursache für<br />
sexuellen Missbrauch ‐ sozialisationstheoretische Überlegungen zur Missbrauchsforschung. In: Amann;<br />
Wipplinger, S. 115–130.<br />
Herzig, Sabine (2010): Sexuelle Gewalt gegen Mädchen <strong>und</strong> Jungen ‐ Begriffe, Definitionen, Zahlen <strong>und</strong><br />
Auswirkungen. In: B<strong>und</strong>eszentrale für ges<strong>und</strong>heitliche Aufklärung (Hg.): Sexueller Missbrauch. BZgA<br />
Forum Sexualaufklärung <strong>und</strong> Familienplanung (3). Köln, S. 3–6.<br />
Kendall‐Tackett, Kathleen A.; Williams, Linda Meyer; Finkelhor, David (2005): Die Folgen von sexuellem<br />
Missbrauch bei Kindern: Review <strong>und</strong> Synthese neuerer empirischer Studien. In: Amann; Wipplinger, S.<br />
179–212.<br />
Landesarbeitsgemeinschaft Autonome Mädchenhäuser NRW e.v. (Hg.): Täterinnen. Frauen, die<br />
Mädchen <strong>und</strong> Jungen sexuell missbrauchen. Köln 1994.<br />
Mayer, Marina (2011): Die <strong>Macht</strong> der Rollenbilder. In: DJI (Hg.): Sexuelle Gewalt gegen Kinder.<br />
DJI Impulse (3). München, S. 24–26.<br />
Ralser, Michaela (2011): Verstecken durch Zeigen. Zur Debatte um sexualisierte Gewalt in<br />
pädagogischen Einrichtungen. In: BiWi ‐ Das Magazin der Fakultät für Bildungswissenschaften an der<br />
Universität Innsbruck, 2011 (03), S. 10–11.<br />
Schlingmann, Thomas (2003): Verarbeitungsmöglichkeiten für männliche Opfer sexualisierter Gewalt. In:<br />
Prävention, 2003 (3), S. 7–13.<br />
Schlingmann, Thomas (2004): Und wenn es eine Frau war? Sexuelle Gewalt gegen Jungen durch Frauen.<br />
In: Prävention, 2004 (2), S. 5–8.<br />
Thürmer‐Rohr, Christina (1988): Mittäterschaft von Frauen ‐ ein Konzept feministischer Forschung <strong>und</strong><br />
Ausbildung. In: Beiträge zur feministischen Theorie <strong>und</strong> Praxis (21/22), S. 211–214.<br />
Trube‐Becker, Elisabeth (2005): Historische Perspektive sexueller Kontakte zwischen Erwachsenen <strong>und</strong><br />
Kindern/ Jugendlichen <strong>und</strong> die soziale Akzeptanz dieses Phänomens von der Zeit der Römer <strong>und</strong><br />
Griechen bis heute. In: Amann; Wipplinger, S. 45–57.<br />
Wipplinger, Rudolf; Amann, Gabriele (2005): Sexueller Missbrauch: Begriffe <strong>und</strong> Definitionen In: Amann;<br />
Wipplinger, S. 17–43.<br />
Seite 106
Missbrauch <strong>und</strong> Geschlecht<br />
Prof. Dr. Hannelore Faulstich-Wieland<br />
Universität Hamburg<br />
Impulsbeitrag am 9.11.11<br />
Seite 107
Gliederung<br />
1. Statistiken zu sexualisierter Gewalt <strong>und</strong><br />
Geschlecht<br />
2. Sexualisierte Gewalt als Thema der<br />
Frauenbewegung<br />
3. Gendertheoretische Entwicklungen<br />
◦ Sexualisierte Gewalt gegenüber Mädchen/ Frauen<br />
durch Männer<br />
◦ Sexualisierte Gewalt durch Frauen – Frauen als<br />
Täterinnen<br />
◦ Sexualisierte Gewalt gegenüber Jungen durch<br />
Männer<br />
4. Kurze Schlussfolgerungen<br />
Seite 108
1.Statistiken zur sexualisierten<br />
Gewalt<br />
� Polizeiliche Kriminalstatistik – „Hellfeld“<br />
◦ deutlicher Anstieg von Anzeigen<br />
� Strafverfolgungsstatistik<br />
� Wissenschaftliche Forschungen<br />
� 75-80% der Opfer weiblich, 96% der Täter<br />
männlich<br />
� International: 7% der Frauen, 3% der Männer<br />
haben Missbrauchserfahrungen gemacht<br />
� KFN: 6,4% der Frauen, 1,3% der Männer –<br />
Täter vor allem aus nahem Umfeld<br />
Seite 109
2. Zweite Frauenbewegung<br />
� Autonome Selbsterfahrungsgruppen<br />
� Einrichtung von Frauenhäusern<br />
� Gr<strong>und</strong>lage der Gewalt gegen Frauen:<br />
Patriarchat<br />
� 1994 Tagung zu „Täterinnen“<br />
◦ Frauenbild geriet ins Wanken<br />
� Differenzierung <strong>und</strong> Weiterentwicklung in<br />
Genderforschung<br />
Seite 110
3. Gendertheoretische Entwicklung<br />
� Differenzfeminismus<br />
◦ geistige Mütterlichkeit<br />
� Reflexive Kritik der Zweigeschlechtlichkeit<br />
◦ doing gender<br />
� Gr<strong>und</strong>legende Alltagsannahmen:<br />
◦ Dichotomie der Geschlechter<br />
◦ Oppositionelle Bestimmung<br />
◦ Geschlechterhierarchie<br />
� Gendertheorie: Suche nach den<br />
Mechanismen der Produktion <strong>und</strong><br />
Reproduktion von Geschlecht<br />
Seite 111
3.1 Sexualisierte Gewalt gegenüber<br />
Mädchen <strong>und</strong> Frauen durch Männer<br />
� Symbolische Ordnung der<br />
Geschlechterverhältnisse stellt<br />
Verleiblichung von Herrschaft her<br />
◦ Begehrensposition liegt beim Mann<br />
◦ Begehrtwerden-Position liegt bei der Frau<br />
◦ Verletzungsmächtigkeit – Verletzungsoffenheit<br />
� Subjektposition für die Männer,<br />
Objektposition für die Frauen<br />
� Widerstand: Frauen als Subjekte des<br />
Begehrens<br />
Seite 112
3.2 Sexualisierte Gewalt durch<br />
Frauen – Frauen als Täterinnen<br />
� doing gender: „geschlechtsadäquates“<br />
Verhalten<br />
� Zuschreibung an Frauen: Mütterlichkeit<br />
◦ Aneignung im Sozialisationsprozess<br />
◦ „Übersehen“ von „inadäquatem“ Verhalten<br />
� „Verdeckungszusammenhänge“ z.B. in<br />
Pflegehandlungen<br />
� Weibliche Opfer: starke subjektive<br />
Betroffenheit, Verunsicherung<br />
Seite 113
3.2 Sexualisierte Gewalt durch<br />
Frauen – Frauen als Täterinnen<br />
� Männliche Opfer – vor allem Jungen<br />
◦ Angst vor anderen Menschen, gestörtes<br />
Selbstwertgefühl<br />
◦ Aggressive Opferidentität oder<br />
Hypermaskulinität<br />
◦ Auf jeden Fall: Angriff auf männliche Identität<br />
◦ Doppelter Angriff bei Täterinnen<br />
Seite 114
3.3 Sexualisierte Gewalt gegenüber<br />
Jungen durch Männer<br />
� Bedrohung der männlichen Identität<br />
� Bedrohung der sexuellen Identität bei<br />
heterosexuellen Jungen<br />
� geschwächtes Selbstwertgefühl<br />
� Beratung <strong>und</strong> Hilfe ist eher „unmännlich“<br />
� Fachkräfte sehen Jungen/Männer u.U.<br />
ebenfalls <strong>mit</strong> der „Männlichkeitsbrille“<br />
Seite 115
4. Schlussfolgerungen<br />
� Geschlechterbilder bestimmen unser<br />
alltägliches doing gender<br />
� Genderwissen ist notwendig für<br />
professionelles Handeln<br />
� Differenzierte Blicke auf Geschlecht der<br />
Opfer wie der Täter ist notwendig<br />
Seite 116
Eine Schule auf dem Weg: Lernen aus dem Missbrauch<br />
Prof. Dr. Katrin Höhmann (PH Ludwigsburg)<br />
Seite 117
• Gr<strong>und</strong>lage<br />
• OrganisaDonsstrukturen<br />
• Handlungsfelder allgemein<br />
• 3 Handlungsfelder konkret<br />
Seite 118
Gr<strong>und</strong>lage meiner Arbeit<br />
o Gespräche <strong>mit</strong> r<strong>und</strong> 70 Mitgliedern aus Kollegium <strong>und</strong> zentralen<br />
Einrichtungen<br />
o Gespräch <strong>mit</strong> 6 Schülergruppen <strong>und</strong> 10 Einzelgespräche <strong>mit</strong> SchülerInnen<br />
o Unterrichtsbesuche<br />
o Lesen von Curricula <strong>und</strong> anderer Dokumenten<br />
o R<strong>und</strong>gang durch alle Klassenräume<br />
o Teilnahme an 18 Konferenzen (Teekonferenz kommt noch dazu)<br />
o Beschäftigung <strong>mit</strong> den Daten von SEIS, der DIPF-Untersuchung, Blick über<br />
den Zaun, Vergleichsarbeiten<br />
o Beschäftigung <strong>mit</strong> den Ergebnissen der letzten drei Schulentwicklungsberatungen<br />
o Gespräche <strong>mit</strong> Schulaufsicht <strong>und</strong> Heimaufsicht<br />
o Teilnahme an Schulveranstaltungen<br />
Seite 119
Stärken der Odenwaldschule<br />
Die Kinder <strong>und</strong> Jugendlichen<br />
Das Kollegium <strong>und</strong> die MitarbeiterInnen<br />
Die Vielfalt, Individualität <strong>und</strong> Qualifikation der Menschen<br />
Die großen Potentiale<br />
Das Familiensystem<br />
Bildung <strong>und</strong> Bindung<br />
Dass man an die Entwicklungsmöglichkeiten von SchülerInnen<br />
glaubt<br />
Die Natur <strong>und</strong> das Gelände<br />
Die Werkstätten <strong>und</strong> den Werkstattgedanken<br />
Dass es eine Gesamtschule ist<br />
Seite 120
Worin kann die Odenwaldschule für andere wichtig werden?<br />
o Die Odenwaldschule als pädagogische Einrichtung, die zeigt wie<br />
durchdachte . <strong>und</strong> differenzierte Prävention aussehen können.;<br />
o Die Odenwaldschule als Mahnung <strong>und</strong> als pädagogische Einrichtung, die<br />
auch zeigt wie Aufarbeitung <strong>und</strong> Erinnerung die Wurzeln eines<br />
zukunftsfähigen Konzepts werden können<br />
o Die Odenwaldschule als Gesamtschule, die wirklich integriert arbeitet.<br />
o Die Odenwaldschule als Ganztagsschule <strong>mit</strong> einem umfassenden<br />
Bildungsanspruch <strong>und</strong> k<strong>und</strong>enorientierten Betreuungsangebot.<br />
o Die Odenwaldschule als Beispiel für die Flexibilisierung, Individualisierung<br />
<strong>und</strong> Differenzierung von Bildungswegen.<br />
o Die Odenwaldschule als eine Antwort auf die Frage nach einer sinnvollen<br />
Mittelstufendidaktik <strong>und</strong> als Vorbild für den Werkstatt-gedanken als<br />
didaktisches Prinzip.<br />
o Die Odenwaldschule als Ort der Kreativität <strong>und</strong> eines profilierten Konzepts<br />
kultureller <strong>und</strong> ökologischer Bildung.<br />
o Die Odenwaldschule als Ort gelebter Demokratie <strong>und</strong> Partizipation.<br />
Seite 121
• Gr<strong>und</strong>lage<br />
• OrganisaDonsstrukturen<br />
• Handlungsfelder allgemein<br />
• 4 Handlungsfelder konkret<br />
Seite 122
OrganisaDonsstruktur PrävenDon, Betroffenenhilfe, wiss. Aufarbeitung<br />
Trägerverein<br />
Vorstand<br />
Stabstelle<br />
wissenscha5liche<br />
Aufarbeitung<br />
Altschülerverein<br />
Leitungsteam<br />
Odenwaldschule<br />
• Leitungsausschuss<br />
• PrävenDonskommission<br />
• Ausschuss gegen<br />
sexualisierte Gewalt ,<br />
Rechtsausschuss,<br />
• Beratungs‐ <strong>und</strong><br />
Begleitungsteam (für<br />
Betroffene)<br />
• TherapeuDsches Team (für<br />
Kinder <strong>und</strong> Jugend‐liche)<br />
• Archiv<br />
SDUung<br />
Anlaufstelle Burgsmüller<br />
Ombudsfrau,<br />
Ombudsmann<br />
Wiss. Aufarbeitung Schule <strong>und</strong> Internat Betroffenenhilfe<br />
Seite 123
Angebote für<br />
Betroffene<br />
Seite 125
Angebote<br />
Fortbildung <strong>und</strong><br />
Forschung<br />
Seite 127
Archiv<br />
Angebote<br />
Fortbildung <strong>und</strong><br />
Forschung<br />
Wissenscha5liche Aufarbeitung<br />
Die Ergebnisse der wissenscha5lichen<br />
Aufarbeitung der Vergangenheit sind eine<br />
wich?ge Basis für zukun5sfähige<br />
Konzeptveränderungen<br />
Das Archiv ist ein Gedächtnis der Schule. Die<br />
Aufarbeitung der Dokumente ist ein großes<br />
Anliegen<br />
Die Angebote im Bereich Forschung werden federführend von<br />
einer an den Vorstand ange‐gliederte Stabsstelle koordiniert <strong>und</strong><br />
einem Mitglied des Vorstands vertreten; zur Zeit sind dies Frau<br />
Kaufmann <strong>und</strong> Frau Salmon –Könnecke., zu erreichen unter<br />
Forschung@odenwaldschule.de.<br />
Fortbildungen werden von der Odenwaldschule (Schule <strong>und</strong><br />
Internat) konzipiert. Dieser Bereich befindet sich im Audau.:<br />
Nachfragen unter Leitung@odenwaldschule .de.<br />
Angebote<br />
Fortbildung <strong>und</strong><br />
Forschung<br />
Forschung: Präven?on u.a.<br />
Die Ergebnisse der SchulbegleiCorschungen<br />
haben die Aufgabe zu überprüfen, ob die<br />
Maßnahmen der Neuausrichtung greifen.<br />
Fortbildung<br />
Die Odenwaldschule macht es sich zur<br />
Aufgabe, Lernanlass‐ <strong>und</strong> –möglichkeit für<br />
Seite 128<br />
andere Ins?tu?onen zu sein.
Angebote<br />
für Schülerinnen<br />
<strong>und</strong> Schüler<br />
Seite 129
Angebote für<br />
Schülerinnen <strong>und</strong><br />
Schüler<br />
Organisa?on<br />
Entscheidungen über Kinder <strong>und</strong> Jugendliche<br />
fallen gr<strong>und</strong>sätzlich im Team. Sind transparent<br />
<strong>und</strong> werden dokumen?ert.<br />
Ansprechpartner<br />
Niemand ist allein, es gibt viele Wege sich<br />
wegen sexuelle Über‐griffe geschützt<br />
anzuvertrauen.<br />
Die Angebote für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler werden federführend<br />
von der Odenwaldschule (Schule <strong>und</strong> Internat) konzipiert ,<br />
koordiniert <strong>und</strong> verantwortet. Zuständig ist das Leitungs‐team der<br />
Odenwaldschule: Katrin Höhmann (Schulleiter), Roland Kubitza<br />
(Internat); Meto Salijevic (Verwaltung) zu erreichen unter:<br />
Leitung@odenwaldschule.de<br />
Angebote<br />
für Schülerinnen<br />
<strong>und</strong> Schüler<br />
MitarbeiterInnen<br />
Genau Hinsehen <strong>und</strong> konsequent Handeln,<br />
diesen beiden Gr<strong>und</strong>prinzipien sind alle<br />
MitarbeiterInnen verpflichtet<br />
Persönlichkeitsstärkung<br />
Ein zentrales Präven?onselement ist die<br />
Stärkung von Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen<br />
Seite 130
• Gr<strong>und</strong>lage<br />
• OrganisaDonsstrukturen<br />
• 4 Handlungsfelder allgemein<br />
• Handlungsfelder konkret<br />
Seite 131
Blick von außen durch nicht in die tägl. Arbeit involv. OrganisaDonen<br />
Supervisions‐Team <strong>und</strong> Beratungsteam für Erwachsene (Veränderung / Audau)<br />
Leitungs‐<br />
team<br />
Leitungs‐<br />
ausschuss<br />
DidakDscher‐<br />
ausschuss<br />
Internats‐<br />
ausschuss<br />
Infrastruktur<br />
‐ausschuss<br />
Allgemeine Konferenz<br />
Jahrgangs‐<br />
teams<br />
Fach‐<br />
teams<br />
DiagnosD‐<br />
sches Team<br />
Pädagogi‐<br />
scher Dienst<br />
Häuser‐<br />
teams<br />
Abteilungs‐<br />
leiterteam<br />
TherapeuDsches Team für Kinder <strong>und</strong> Jugendliche<br />
Kinder <strong>und</strong><br />
Jugendliche<br />
Schülerinnen<br />
<strong>und</strong> Schüler<br />
<strong>und</strong> ihre<br />
Gremien<br />
Waschhaus<br />
Küche<br />
Technik<br />
Verwaltung<br />
Seite 135<br />
Eltern
• Gr<strong>und</strong>lage<br />
• OrganisaDonsstrukturen<br />
• Handlungsfelder allgemein<br />
• 4 Handlungsfelder konkret<br />
Seite 136
SCHLIESSANLAGE<br />
Vertrauen ist etwas anderes als eine immer offene Tür<br />
SDchpunkte:<br />
Wie verbindlich ist das STOP‐Schild<br />
Frage<br />
Gelingt es, eine neue Vertrauenskultur auf der Basis einer veränderten<br />
Gestaltung von Nähe <strong>und</strong> Distanz zu etablieren?<br />
Seite 137
SELBSTVERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG<br />
Frage<br />
Wird es gelingen, dass die Selbstverpflichtungserklärung aus<br />
Überzeugung gelebt wird?<br />
Seite 138
SELBSTVERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG<br />
Ich verpflichte mich, die gegenseiDge Privatsphäre im gemeinsamen<br />
Wohnen <strong>und</strong> Arbeiten zu respekDeren (z. B. Anklopfen vor dem Betreten<br />
der Räume der Kinder, kein Eindringen in die InDmsphäre). Ich werde<br />
beachten, dass Räume, in denen mir anvertraute junge Menschen <strong>mit</strong> mir<br />
allein sind, nicht abgeschlossen sind, da<strong>mit</strong> sie jederzeit den Raum<br />
verlassen können.<br />
Frage<br />
Wird es gelingen, dass die Selbstverpflichtungserklärung aus<br />
Überzeugung gelebt wird?<br />
Seite 139
HÄUSERTEAMS / DOPPELTE FAMILIENFÜHRUNG<br />
Soz.Päd<br />
Soz.Päd<br />
Pädagogischer Dienst<br />
Soz.Päd<br />
Häuser‐<br />
teams<br />
Soz.Päd<br />
Soz.Päd<br />
Internatsleiter<br />
Internats‐<br />
ausschuss<br />
TherapeuDsches<br />
Team<br />
Supervision<br />
Frage<br />
Wird es gelingen, dass IrriDerendes <strong>und</strong> Auffälliges auch gesagt wird?<br />
Seite 140
Jahrgangsmischung ausbauen <strong>und</strong> Teams stärken<br />
Förderdiagnostik <strong>und</strong> Übergabeverfahren etablieren<br />
Modellvorschlag: Gliederung: Jahrgangsübergreifende Einheiten<br />
Stufe I<br />
Die Welt entdecken<br />
Jahrgang 5<br />
Jahrgang 6<br />
Jahrgang 7<br />
Stufe II<br />
Die Welt erfahren<br />
Stufe III<br />
Die Welt gestalten<br />
Jahrgang 8 Jahrgang 11<br />
Jahrgang 9 Jahrgang 12<br />
Jahrgang 10 Jahrgang 13<br />
Jede Stufe hat bzw. bietet unter anderem<br />
o ein verantwortliches Kernteam (jeder Lehrer, jede Lehrerin ist nur in EINEM<br />
Team.<br />
o einen Teamsprecher (für II ist dies die Minelstufen‐Leitung, für Stufe III ist dies<br />
die Oberstufen‐Leitung<br />
o ein über drei Jahre angelegtes Spiralcurriculum<br />
o die Flexibilität, diese Phase in zwei, drei oder vier Jahren zu durchlaufen<br />
o Es eine gezielte Eingangsdiagnos?k<br />
o Bei der Übergabe von der einen in die andere Stufe systema?sche<br />
Übergabegespräche/‐verfahren<br />
Seite 141
Frage<br />
Gelingt der Weg zu Verfahren, in denen das Engagement für SchülerInnen<br />
individualisiert, stärkenorienDert, systemaDsch <strong>und</strong> transparent ist?<br />
Seite 142
Wissenscha5liche Aufarbeitung<br />
Die WissenschaUliche Aufarbei‐tung hat die<br />
Aufgabe, der Frage nachzugehen, wie es zu<br />
dieser Häufung von Missbrauchsfällen<br />
kommen konnte, welche Fakto‐ren z.B. auf<br />
der OrganisaDons‐ <strong>und</strong> der<br />
KommunikaDonsebene diese begünsDgt<br />
haben. Eine weitere zentrale PerspekDve ist<br />
die wissenschaUliche Auseinan‐dersetzung<br />
<strong>mit</strong> den Biografien der Betroffenen.<br />
Die Ergebnisse der wissen‐scha5lichen<br />
Aufarbeitung der Vergangenheit sind die<br />
Basis für zukun5sfähige Konzepte.<br />
Archiv<br />
Die Schule hat ein umfassendes Archiv, in dem<br />
wichDge Dokumente sind, die als Quelle zum<br />
Verständnis der damaligen Odenwaldschule,<br />
ihrer Wider‐sprüche <strong>und</strong> der Gr<strong>und</strong>lage für die<br />
Missbrauchsmöglichkeiten wichDg sind. Das<br />
Archiv wird bereits jetzt gut geführt <strong>und</strong> steht<br />
der Forschung zur Verfü‐gung. Eine Weiterent‐<br />
wickung zu einem DokumentaDonszentrum ist<br />
ein möglicher nächster Schrin<br />
Das Archiv ist ein Gedächtnis der Schule. Die<br />
Aufarbeitung der Dokumente ein großes<br />
Anliegen<br />
Forschung <strong>und</strong> Fortbildung<br />
Forschung: Präven?on u.a.<br />
Schulbegleirorschung gehört zu den<br />
TradiDonen der Odenwald‐schule, war sie<br />
bisher vor allem auf Fragen von<br />
Unterrichtsent‐wicklung gerichtet, wird in den<br />
nächsten Jahren u.a. die PrävenDon eine<br />
zentrale Rolle spielen. Aber auch Untersu‐<br />
chungen zum Schulklima <strong>und</strong> zur Schüler‐ <strong>und</strong><br />
Elternzu‐friedenheit können in den Fokus<br />
kommen.<br />
Die Ergebnisse der SchulbegleiCorschungen<br />
haben die Aufgabe zu überprüfen, ob die<br />
Maßnahmen der Neuausrichtung greifen.<br />
Fortbildung<br />
Die Odenwaldschule heue hat sich zur Aufgabe<br />
gemacht, aus der Vergangenheit für die<br />
ZukunU in Internat <strong>und</strong> Schule zu lernen <strong>und</strong><br />
zu zeigen, wie eine pädagogische InsDtuDon<br />
aufgestellt sein muss, in der Kinder <strong>und</strong><br />
Jugendliche vor sexueller Gewalt soweit wie<br />
irgend möglich geschützt sind. Dieses Wissen<br />
gibt sie anderen päd. Einrichtungen weiter.<br />
Die Odenwaldschule macht es sich zur<br />
Aufgabe, Lernanlass‐ <strong>und</strong> –möglichkeit für<br />
andere Ins?tu?onen zu sein.<br />
Seite 145
Aktuelle Situation<br />
Stärken der Odenwaldschule<br />
Seite 146
09.11.2011<br />
Seite 148
09.11.2011<br />
Leitfragen<br />
• Was bedeutet es, wenn ein Kind missbraucht wird?<br />
• Wovon reden wir eigentlich?<br />
• Warum schweigen Betroffene?<br />
• Wie sehen Mechanismen aus, die es Tätern anscheinend<br />
möglich machen, über Jahre hinweg Kinder sexuell zu<br />
missbrauchen?<br />
Seite 149
09.11.2011<br />
Ziel des Projekts<br />
Verwendung des Films als Präventionsinstrument, durch Bearbeitung<br />
in Workshops <strong>mit</strong> fachlicher Begleitung<br />
Etablierung eines standardisierten & evaluierten Schulungskonzepts<br />
zum <strong>Umgang</strong> <strong>mit</strong> sexuellem Kindesmissbrauch<br />
Integration des Schulungskonzepts in ausgewählte<br />
Bildungseinrichtungen für pädagogische Fachkräfte<br />
Sensibilisierung pädagogischer Fachkräfte für den <strong>Umgang</strong> <strong>mit</strong><br />
sexuellem Kindesmissbrauch<br />
Seite 150
09.11.2011<br />
Didaktische Überlegungen<br />
Einführungsvortrag<br />
Vorführung von Filmausschnitten<br />
Diskussion der Interviewinhalte<br />
Bereitstellung eines Begleittextes zum Thema & zu den Inhalten des<br />
Films als Gedächtnisstütze zum Mitnehmen<br />
Gespräch über Konsequenzen die Prävention<br />
Seite 151
09.11.2011<br />
Inhaltliche Schwerpunkte<br />
Der Film als Medium<br />
Die Aussagen<br />
• Auswahl der Opfer, Annäherung (grooming), Verführung<br />
Erleben des Missbrauchs durch die Opfer<br />
• Mittelfristige/ langfristige Folgen<br />
Das System des Schweigens<br />
• Schüler, Lehrer<br />
Die Offenbarung & ihre Geschichte<br />
Die Aufarbeitung<br />
• Notwendigkeit, Wege, Widerstände<br />
Konsequenzen<br />
Seite 152
09.11.2011<br />
Portfolie an Lerneinheiten<br />
Was bedeutet es, wenn ein Kind missbraucht wird?<br />
Themenschwerpunkt: Entwicklungsprozesse von Kindern<br />
• Interpretation von Verhalten in Abhängigkeit von Alter & Kontext<br />
• Resilienz<br />
Themenschwerpunkt: Soforthilfe<br />
• Unverzügliches Eingreifen vs. überdachtes Handeln<br />
• Hilfe für Mitarbeiter/-innen in Institutionen<br />
Themenschwerpunkt: Vernetzung & Weiterentwicklung<br />
• Kenntnisse über eigene Kompetenzbereiche<br />
• Hilfsmöglichkeiten & Grenzen relevanter Ansprechpartner<br />
Themenschwerpunkt: <strong>Umgang</strong> <strong>mit</strong> betroffenen Kindern<br />
• Kompetenzen erkennen<br />
• Gelingende Bewältigung von Missbrauchserfahrungen<br />
Seite 156
09.11.2011<br />
Portfolie an Lerneinheiten<br />
Wovon reden wir eigentlich?<br />
Themenschwerpunkt: Begriffe & Definitionen<br />
• Beschreibung der Nutzung verschiedener Definitionen für sexuelle<br />
Handlungen <strong>mit</strong> Kindern im jeweiligen kontextuellen<br />
Zusammenhang<br />
Themenschwerpunkt: Rechtliche Aspekte<br />
• Rechtvorschriften auf internationaler, EU- & B<strong>und</strong>esebene<br />
Seite 157
09.11.2011<br />
Portfolie an Lerneinheiten<br />
Warum schweigen Betroffene?<br />
Themenschwerpunkt: Ethik & innere Haltung<br />
• Auseinandersetzung <strong>mit</strong> der eigenen Haltung/ Biographie<br />
• Einhaltung einer professionellen Distanz<br />
Themenschwerpunkt: Vermutung & Verdacht<br />
• <strong>Umgang</strong> <strong>mit</strong> Anfangsverdacht<br />
• Einbeziehung der Eltern<br />
• <strong>Umgang</strong> <strong>mit</strong> Verdacht, der weder entkräftet noch erhärtet werden<br />
kann<br />
Themenschwerpunkt: Qualitätsmanagement in Einrichtungen<br />
• Risiko-, Beschwerde- <strong>und</strong> Krisenmanagement;<br />
• Dialog & Partizipation der Kinder & Jugendlichen<br />
Seite 158
09.11.2011<br />
Portfolie an Lerneinheiten<br />
Wie sehen Mechanismen aus, die es Tätern anscheinend möglich<br />
machen, über Jahre hinweg Kinder sexuell zu missbrauchen?<br />
Themenschwerpunkt: Individuelle Risikofaktoren für Täter- &<br />
Opferschaft<br />
• Besonderheiten von verschiedenen Opfer- & Tätergruppen sowie<br />
Tatkonstellationen<br />
Themenschwerpunkt: Risikofaktoren in Familien & Institutionen<br />
• Intrafamilialer Missbrauch<br />
• Missbrauchsbegünstigende Strukturen in Institutionen<br />
Themenschwerpunkt: Aussagenpsychologische Gr<strong>und</strong>lagen<br />
• Freier Vortrag des Kindes<br />
• Motivation der Aussage des Kindes<br />
Seite 159
09.11.2011<br />
Ablaufplan<br />
Jahr Monat Produktion Forschung Kommunikation<br />
2011/2012<br />
01.10.2011<br />
–<br />
28.02.2012<br />
01.03.2012<br />
–<br />
31.03.2012<br />
01.04.2012<br />
–<br />
31.07.2012<br />
01.08.2012<br />
–<br />
30.09.2012<br />
Lektionierung der<br />
Schulungsmaß-<br />
nahme anhand des<br />
Films<br />
Fertigstellung des<br />
Filmmaterials<br />
Durchführung der<br />
Schulungsmaß-<br />
nahmen<br />
Ergebnisauswertung,<br />
Zertifizierung &<br />
Ergebnispräsentation<br />
Design Prä-<br />
Post-<br />
Befragung<br />
Prä- Post-<br />
Befragung<br />
Auswertung Abschlusstagung<br />
Seite 160
Kontakt<br />
Dr. Hubert Liebhardt<br />
Kinder- <strong>und</strong> Jugendpsychiatrie / Psychotherapie<br />
Universität Ulm<br />
Steinhövelstrasse 5<br />
89075 Ulm<br />
hubert.liebhardt@uniklinik-ulm.de<br />
www.uniklinik-ulm.de/kjpp<br />
Vielen Dank für Ihre<br />
Aufmerksamkeit!