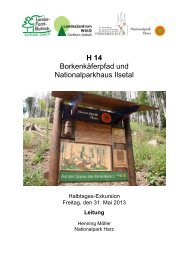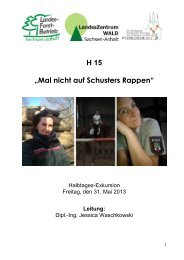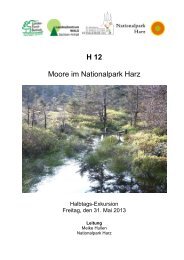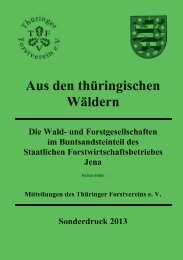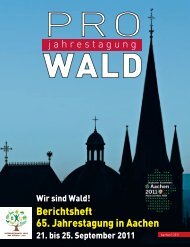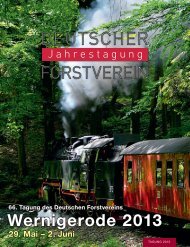Jahresbericht des Thüringer Forstvereins e.V. für das Jahr 2010
Jahresbericht des Thüringer Forstvereins e.V. für das Jahr 2010
Jahresbericht des Thüringer Forstvereins e.V. für das Jahr 2010
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong><strong>Jahr</strong>esbericht</strong><br />
<strong>des</strong><br />
<strong>Thüringer</strong><br />
<strong>Forstvereins</strong> e.V.<br />
<strong>für</strong> <strong>das</strong> <strong>Jahr</strong><br />
<strong>2010</strong>
Impressum:<br />
Zusammenstellung der<br />
Beiträge und<br />
Redaktionelle Bearbeitung: Horst Geisler<br />
Druck und Buchbinderische:<br />
Weiterverarbeitung<br />
ISSN: 0943 - 7304<br />
Eine geringe Anzahl <strong>des</strong> <strong><strong>Jahr</strong>esbericht</strong>es kann neben der kostenlosen<br />
Abgabe an die Mitglieder <strong>des</strong> <strong>Thüringer</strong> <strong>Forstvereins</strong> e.V. gegen eine<br />
Schutzgebühr von 5,00 € bezogen werden.<br />
© 2011<br />
2
Inhaltsverzeichnis:<br />
Vorwort <strong>des</strong> Vorsitzenden <strong>des</strong> <strong>Thüringer</strong> <strong>Forstvereins</strong> e.V.<br />
Hagen Dargel<br />
Seite: 6<br />
20 <strong>Jahr</strong>e <strong>Thüringer</strong> Forstverein e.V.<br />
Jubiläumstagung am 10. und 12. Juni <strong>2010</strong><br />
Lan<strong>des</strong>sportschule Bad Blankenburg<br />
20 <strong>Jahr</strong>e <strong>Thüringer</strong> Forstverein<br />
Enstehung – Entwicklung – Ereignisse<br />
Wolfgang Heyn und Gerhard Bleyer<br />
Grußwort anlässlich „20 <strong>Jahr</strong>e <strong>Thüringer</strong> Forstverein“<br />
Herr Volker Gebhardt<br />
4<br />
Seite: 10<br />
Seite: 17<br />
20 gute <strong>Jahr</strong>e!<br />
Forstvereine und Forstwirtschaft im vereinigten Deutschland<br />
Festvortrag von Herrn Dr. Wolfgang Dertz<br />
Ehrenpräsident <strong>des</strong> Deutschen <strong>Forstvereins</strong> e.V.<br />
Seite: 35<br />
Statement <strong>des</strong> Ehrenvorsitzenden <strong>des</strong> <strong>Thüringer</strong> <strong>Forstvereins</strong> e.V.<br />
anlässlich der Gesprächsrunde<br />
„20 <strong>Jahr</strong>e <strong>Thüringer</strong> Forstverein – Zeitzeugen erinnern sich“<br />
Dr. Wolfgang Henkel<br />
Seite: 41<br />
Klimawandel und Forstwirtschaft<br />
E.-D. Schulze, MPI-Biogeochemie, Jena<br />
Seite: 45<br />
Klimawandel und Forstwirtschaft – Antworten auf schwierige<br />
Fragen<br />
Ingolf Profft, TLWJF Gotha<br />
Seite: 70
Seniorentreffen <strong>des</strong> <strong>Thüringer</strong> <strong>Forstvereins</strong> e.V. und BdF<br />
Thüringen am 12. August <strong>2010</strong> in Walkenried<br />
Gerhard Bleyer<br />
Seite: 76<br />
Fachexkursion <strong>Thüringer</strong> Forstverein vom<br />
8. bis 12. September <strong>2010</strong> nach Hitzacker/Elbe<br />
Susanne Floßmann und Heiko Buse<br />
5<br />
Seite: 86<br />
Jubilare <strong>2010</strong> Seite: 120<br />
Mitglieder <strong>des</strong> <strong>Thüringer</strong> <strong>Forstvereins</strong><br />
Aktuelles Mitgliederverzeichnis per 31.12. <strong>2010</strong> Seite: 125<br />
Schlussbild Seite: 134
Vorwort zum <strong><strong>Jahr</strong>esbericht</strong> <strong>2010</strong><br />
Liebe Mitglieder <strong>des</strong> <strong>Thüringer</strong> Forstverein e.V.,<br />
<strong>das</strong> <strong>Jahr</strong> 2011 ist noch sehr jung und dennoch halten Sie bereits den <strong><strong>Jahr</strong>esbericht</strong><br />
<strong>2010</strong> in Händen. Dank pünktlich erstellter Beiträge unserer Mitglieder und<br />
Beteiligten an den Tagungen und dank der professionellen Koordinierung und<br />
Zusammenstellung durch Horst Geisler haben wir schon jetzt die Möglichkeit,<br />
auf <strong>das</strong> vergangene <strong>Jahr</strong> zurückzublicken. <strong>2010</strong> war ein <strong>Jahr</strong>, in dem der <strong>Thüringer</strong><br />
Forstverein vor allem forstpolitisch aktiv wurde, um entsprechend seiner<br />
Satzungsziele Fürsorge <strong>für</strong> den Wald zu betreiben. Dazu bestand mehr als einmal<br />
Grund und Anlass.<br />
Bereits im Januar baten wir in einer Rund-Mail die Abgeordneten <strong>des</strong> <strong>Thüringer</strong><br />
Landtags, die Pläne der Lan<strong>des</strong>regierung zur Ausgliederung der Waldarbeiter in<br />
eine GmbH kritisch zu hinterfragen. Wir sehen nachhaltige Waldwirtschaft als<br />
wichtige Zukunftsaufgabe, die verlässliche und stabile Strukturen benötigt und<br />
forderten daher die Politiker auf, Bewährtes nicht unnötig zu zerschlagen. Der<br />
<strong>Thüringer</strong> Forstverein hat dabei mitgeholfen, diese Pläne schnell zu begraben.<br />
Doch nicht lange darauf ergab sich wiederum neuer Diskussionsbedarf. Minister<br />
Reinholz kündigte an, die Lan<strong>des</strong>forstverwaltung in eine Anstalt öffentlichen<br />
Rechts umzuwandeln. Angesichts <strong>des</strong> zunehmenden Personalmangels bei THÜ-<br />
RINGENFORST und <strong>des</strong> in der Regierungserklärung festgeschriebenen weiteren<br />
Personalabbaus in der Lan<strong>des</strong>verwaltung sieht unser Minister in dieser Umwandlung<br />
die einzige Chance, THÜRINGENFORST zukunftsfähig aufzustellen,<br />
um die Fülle der Aufgaben weiterhin in guter (weil vielfach gelobter) Qualität<br />
zu erfüllen. Gleichzeitig bat er alle Beschäftigten, ihn dabei zu unterstützen.<br />
Der Forstverein hofft und fordert, die neu zu gründende Anstalt von Beginn an<br />
mit möglichst großen Handlungsspielräumen und finanzieller Flexibilität auszustatten<br />
und wird sich weiterhin beim Diskussionsprozess aktiv einbringen.<br />
Im <strong>Jahr</strong> <strong>2010</strong> verschärfte sich auch die Diskussion um <strong>das</strong> Thema Jagd. Seitens<br />
<strong>des</strong> Lan<strong>des</strong>jagdverban<strong>des</strong> formierte sich der Widerstand gegen ein Verbundprojekt<br />
zur Erprobung neuer Jagdzeiten und -methoden. Mit einem offenen Brief an<br />
den Präsidenten <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong>jagdverban<strong>des</strong> Thüringen e.V. versuchte ich, zwischen<br />
den sich verhärtenden Fronten zu vermitteln um die Durchführung <strong>des</strong><br />
wissenschaftlich begleiteten Projekts zu ermöglichen. Von Seiten <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong>jagdverbands<br />
wird <strong>das</strong> Projekt leider weiterhin abgelehnt, was ich sehr bedauere.<br />
Die Zuspitzung der Diskussion auf <strong>das</strong> alleinige Thema „Bockjagd“ verkennt<br />
die Chancen angepasster Jagdstrategien und ignoriert damit völlig die berechtigten<br />
Interessen der Waldbesitzer. Für Forstleute ist dies so nicht hinnehmbar! Ich<br />
sehe hier auch weiterhin die Notwendigkeit der Beteiligung im Diskussionsprozess<br />
seitens <strong>des</strong> <strong>Forstvereins</strong>.<br />
6
Der Höhepunkt in diesem <strong>Jahr</strong> war zweifellos unsere Jubiläumstagung zum<br />
20jährigen Bestehen <strong>des</strong> TFV. Es war eine perfekt organisierte Tagung mit einem<br />
exzellenten Festvortrag vom Ehrenpräsidenten <strong>des</strong> Deutschen <strong>Forstvereins</strong><br />
Dr. Dertz, einer kompetent durch Oberkirchenrat a.D. Große moderierten Diskussionsrunde<br />
zur Vereinsgeschichte und beeindruckenden Fachvorträgen zum<br />
Klimawandel. Ein geselliger Abend mit dem Präsidenten <strong>des</strong> Deutschen <strong>Forstvereins</strong><br />
Carsten Wilke führte uns bis spät in die Nacht. Seine zu Herzen gehenden<br />
Worte überzeugten unsere Mitglieder und haben sicherlich auch die Bedeutung<br />
<strong>des</strong> Deutschen <strong>Forstvereins</strong> <strong>für</strong> Thüringen hervorgehoben. Sehr gefreut habe<br />
ich mich auch über unsere Gäste aus Rumänien und Litauen. Zwei sehr interessante<br />
Exkursionen im Forstamt Paulinzella schlossen sich am zweiten Tag an<br />
und rundeten die Veranstaltung ab. Von dieser Stelle nochmals vielen Dank an<br />
alle Organisatoren und Helfer! Bedauerlich war einzig die gegenüber den Erwartungen<br />
deutlich geringere Teilnehmerzahl, was nicht an der Qualität <strong>des</strong> Gebotenen<br />
gelegen haben kann.<br />
Der Vorsitzende und der Geschäftsführer konnten im Sommer an einer Dienstreise<br />
unseres Ministeriums nach Ungarn teilnehmen. Wir besprachen Pläne <strong>für</strong><br />
eine weitergehende Zusammenarbeit mit der Regionalgruppe Budapest <strong>des</strong> Ungarischen<br />
<strong>Forstvereins</strong>, als Teil der gemeinsamen Kooperation mit der Lan<strong>des</strong>forstverwaltung.<br />
Mithilfe eines Projektantrags an unser Ministerium halfen wir bei der Organisation<br />
eines Aufenthalts Rumänischer Schulkinder in Thüringen. In der Mitarbeiterzeitung<br />
der Lan<strong>des</strong>forstverwaltung wurde darüber berichtet.<br />
Auch am Diskussionsprozess „Wald im Wandel“ beteiligten wir uns und waren<br />
unter den Unterzeichnern <strong>des</strong> Papiers in der <strong>Thüringer</strong> Staatskanzlei dabei.<br />
Die gemeinsame Seniorentagung mit dem Bund Deutscher Forstleute Thüringens<br />
im Kloster Walkenried am 12. August wurde durch die Teilnehmer sehr<br />
gelobt.<br />
Die <strong>Jahr</strong>esexkursion <strong>2010</strong> führte uns im September in die Heimat unseres Geschäftsführers<br />
Dr. Andreas Niepagen, der wirklich keine Mühe gescheut hatte,<br />
uns ein umfassend interessantes und trotzdem kurzweiliges Programm zu organisieren.<br />
Im vorliegenden <strong><strong>Jahr</strong>esbericht</strong> können Sie umfangreich nachlesen sein,<br />
was wir in den wenigen Tagen alles gesehen, gehört und erlebt haben. Es war<br />
wiederum eine gelungene Mischung aus Fachlichem, Kulturellem, Geselligem<br />
und im Hinblick auf die Kernkraftdiskussion in Deutschland auch aktuell Politischem.<br />
Auch <strong>das</strong> gemeinsame Internetangebot der Forstvereine in Deutschland wurde<br />
aktualisiert und bietet viele aktuelle Informationen, unter anderem auch Vorankündigungen<br />
und Kurzberichte unserer Veranstaltungen. Ich wünsche mir, <strong>das</strong>s<br />
diese Medien verbunden mit Mundpropaganda und informativen Veranstaltungen<br />
zu mehr Mitgliedern im <strong>Thüringer</strong> Forstverein führen werden. Aber auch<br />
alle Mitglieder sind aufgerufen, aktiv Werbung <strong>für</strong> unseren Verein zu betreiben.<br />
Alles in allem denke ich, <strong>das</strong>s <strong>2010</strong> <strong>für</strong> den <strong>Thüringer</strong> Forstverein wiederum ein<br />
erfolgreiches <strong>Jahr</strong> war.<br />
7
Die Grundlage da<strong>für</strong> ist immer eine kontinuierliche und gewissenhafte Vorstands-<br />
und Geschäftsführertätigkeit, die von vielen unserer Mitglieder getragen<br />
wird. Daher vielen Dank an all’ unseren aktiven Mitglieder! Zum Schluss noch<br />
ein Wunsch an alle Mitglieder: der Vorstand wünscht sich seitens der Mitglieder<br />
mehr Resonanz auf sein Handeln. Helfen Sie uns durch Ihre Meinungsäußerung,<br />
sei es mündlich im Gespräch, sei es per Anruf oder E-Mail, unsere Arbeit zugunsten<br />
<strong>des</strong> <strong>Thüringer</strong> <strong>Forstvereins</strong> zu verbessern!<br />
Euer Vorsitzender<br />
Hagen Dargel<br />
8
9<br />
20 <strong>Jahr</strong>e <strong>Thüringer</strong> Forstverein e.V.<br />
Jubiläumstagung am 11. und 12. Juni <strong>2010</strong><br />
Lan<strong>des</strong>sportschule Bad Blankenburg
Presseinformation vom 11.06.<strong>2010</strong><br />
20 <strong>Jahr</strong>e <strong>Thüringer</strong> Forstverein<br />
Entstehung – Entwicklung – Ereignisse<br />
Gründung:<br />
Der <strong>Thüringer</strong> Forstverein wurde von 77 Forstleuten am 31.03.1990 in Schwarzburg<br />
gegründet.<br />
Dr. Wolfgang Henkel wurde zum 1. Vorsitzenden, Dr. Eberhard Lucke zum 2.<br />
Vorsitzenden, Gerhard Bleyer zum 3. Vorsitzenden, Arnd Puschmann zum<br />
Geschäftsführer und Herbert Bach zum Schatzmeister gewählt. Der neu gebildete<br />
Verein gab sich in seiner Satzung u.a. folgende Aufgaben: Fürsorge <strong>für</strong> den<br />
heimatlichen Wald, Förderung der Forstwirtschaft und Forstwissenschaft, forstliche<br />
Fortbildung und Pflege <strong>des</strong> forstgeschichtlichen Erbes.<br />
Der <strong>Thüringer</strong> Forstverein wurde als erster Verein der neuen Bun<strong>des</strong>länder in den<br />
Deutschen Forstverein aufgenommen. Ab 1995 leiteten Prof. Martin Heinze und ab<br />
2007 Hagen Dargel den Forstverein. Geschäftsführer waren von 1995 bis 2003 Dieter<br />
Hermann, bis 2007 Uli Klüßendorf und ab 2007 Andreas Niepagen. Als Schatzmeister<br />
fungierten ab 1991 Helmut Witticke, ab 1995 Inge Knoll und seit 2003 Petra<br />
Beck.<br />
Vereinsleben – Ereignisse:<br />
Das Vereinsleben besteht im Wesentlichen aus den Frühjahrs- und<br />
Herbstveranstaltungen, Fachexkursionen der Mitglieder, den Seniorentreffen und der<br />
Herausgabe von Schriften.<br />
Viele Veranstaltungen <strong>des</strong> Vereins haben sich mit Problemen der Forstwirtschaft und<br />
der Forstwissenschaft, u.a. forstpolitischen Themen wie der Zukunft der <strong>Thüringer</strong><br />
Forstverwaltung, aber auch mit historischen Belangen beschäftigt.<br />
Veranstaltungen zu folgenden Themen ragen heraus:<br />
1997 „Förster in den roten Zahlen – Ist <strong>das</strong> richtig?“<br />
1999 „Orkankatastrophe und Borkenkäferkalamität<br />
1946 – 1954 im <strong>Thüringer</strong> Wald – 50 <strong>Jahr</strong>e danach“<br />
„Hoheit und Betreuung – unverzichtbare Aufgabe der Lan<strong>des</strong>forstverwaltung“<br />
2001 Eisenach: „150 <strong>Jahr</strong>e <strong>Thüringer</strong> Forstverein“<br />
2002 Forsthoheitliches Handeln auf Revier- und Forstamtsebene<br />
2004 Gedanken zur Zukunft der Forstverwaltung – vor der Landtagswahl<br />
2005 Tagung <strong>des</strong> Deutschen <strong>Forstvereins</strong> in Weimar<br />
2006 Die Zukunft der Privatwaldbewirtschaftung in Thüringen<br />
10
Die anderen Veranstaltungen <strong>des</strong> <strong>Forstvereins</strong> waren folgenden Themen gewidmet:<br />
1991 Grundsatzfragen der Forstwirtschaft in Bayern und Thüringen<br />
1991 Leitlinien einer naturnahen Waldbewirtschaftung in Thüringen<br />
1992 Bewirtschaftung <strong>des</strong> Privat-, Kommunal- und Körperschaftswal<strong>des</strong><br />
1992 Wild, Wald und Jagd in Thüringen<br />
1993 Vorstellung der Forsteinrichtungs- und Versuchsanstalt Gotha und der<br />
Fachhochschule <strong>für</strong> Forstwirtschaft in Schwarzburg<br />
1993 Naturnahe Forstwirtschaft und Naturschutz im Wald<br />
1994 Gemeinsame <strong>Jahr</strong>estagung <strong>des</strong> Deutschen <strong>Forstvereins</strong> in Hessen und<br />
Thüringen<br />
1995 Bewirtschaftung <strong>des</strong> Kommunal- und Privatwal<strong>des</strong> Thüringen –<br />
Modellforstamt Hildburghausen<br />
1995 Forst- und Holzwirtschaft – enge Partner …<br />
1996 50 <strong>Jahr</strong>e Forstschule Schwarzburg<br />
1997 70 <strong>Jahr</strong>e Forstliche Standorterkundung in Thüringen<br />
1998 Neuaufforstung in waldarmen Gebieten<br />
1998 Die Buche – gut Holz <strong>für</strong> Forst und Gewerbe<br />
2000 10 <strong>Jahr</strong>e <strong>Thüringer</strong> Forstverein<br />
2001 Holznutzung und Naturschutz im Wald am Beispiel <strong>des</strong> Kyffhäusers<br />
2003 Brauchen wir heute noch eine Ertragstafel ?<br />
2003 Die Zukunft der Holzvermarktung in Thüringen<br />
2004 Wald, Wild und Jagd<br />
2005 200 <strong>Jahr</strong>e forstliche Ausbildung in Ruhla<br />
2006 Waldumbau in Thüringen<br />
2007 Die Forstwirtschaft im ländlichen Raum<br />
2007 Die Zukunft der <strong>Thüringer</strong> Wälder nach dem Sturm „Kyrill“<br />
2008 Waldumbau und Jagd- …nach Kyrill - Wie agieren Thüringens Waldbesitzer?<br />
2008 Betreuung privater/ kommunaler Waldbesitzer- wie viel Staat ist notwendig?<br />
2009 Die Zukunft der „Hohen Schrecke“<br />
2009 Würden Sie Ihrem Kind raten, Förster zu werden?<br />
Die häufig sehr große Teilnehmerzahl zeigt die hohe Attraktivität der<br />
Veranstaltungsthemen. Mitglieder und Gäste haben die Veranstaltungen <strong>des</strong> Vereins<br />
auch genutzt, um Kollegen wiederzutreffen und sich mit ihnen auszutauschen.<br />
11
Fachexkursionen:<br />
Seit 1993 wurde je<strong>des</strong> <strong>Jahr</strong> min<strong>des</strong>tens eine Busfahrt mit 40 bis 50 Teilnehmern<br />
organisiert. Als Reiseleiter fungierte viele <strong>Jahr</strong>e Klaus Freudenberg, später Hagen<br />
Dargel bzw. Uli Klüßendorf. Die Exkursionen verfolgten immer <strong>das</strong> Ziel, Wald und<br />
Forstwirtschaft <strong>des</strong> besuchten Lan<strong>des</strong> und ihre Einbettung in <strong>das</strong> soziale und<br />
kulturelle Umfeld kennenzulernen. Geprägt haben diese Exkursionen immer <strong>das</strong><br />
Zusammentreffen mit Forstleuten der Gastländer. Häufig kamen die Führer von dort.<br />
Unvergessen sind Frank Rowley in Wales, der Gurker Bürgermeister Kampl in<br />
Kärnten, Franz Schaffnik in Slowenien (mit dem morgendlichen Schnapstrinken<br />
gegen Zecken) und der schon legendäre Gustav Ginzel im Isergebirge.<br />
Ziele der Exkursionen waren 1992 Tirol, 1993 Ungarn mit 92 Teilnehmern, 1994<br />
Schleswig-Holstein und Dänemark, 1995 Schweiz sowie Rheinland-Pfalz /Elsass-<br />
Lothringen, 1996 Südtirol, 1997 Slowenien, 1998 Kärnten, 1999 Iser- und<br />
Riesengebirge, 2000 Tirol sowie Bialowieza (Polen) als „Jugendreise“, 2001<br />
Südböhmen sowie Litauen, 2002 Belgien sowie Slowakei (Jugendexkursion), 2003<br />
südliches Bayern, 2004 Wales, 2005 Baden-Württemberg, 2006 Slowakei, 2007<br />
Frankreich, 2008 Ungarn und 2009 Rumänien. Auch diese Reisen haben natürlich<br />
den Zusammenhalt <strong>des</strong> Vereins gefördert.<br />
Seniorentreffen:<br />
Ab 1993 organisierte der Verein, teilweise in Zusammenarbeit mit dem BDF, jährlich<br />
einmal ein Treffen <strong>für</strong> die aus dem aktiven Dienst ausgeschiedenen Forstleute in<br />
folgenden Orten: Paulinzella, Kissel, Rathsfeld, Leutenberg, Großlohra, Tabarz,<br />
Kaltennordheim, Großkochberg, Gotha, Nationalpark Hainich, Unterweißbach,<br />
Katzhütte- Oelze, Creuzburg, Leinefelde, Ronneburg, Wasungen, Erfurt.<br />
Forstchef Dr. Volker Düssel bzw. sein Stellvertreter Karl-Heinz Müller haben über<br />
viele <strong>Jahr</strong>e diese Treffen durch ihre Ausführungen zur aktuellen Forstpolitik<br />
bereichert, jetzt nimmt der stellvertretende Abteilungsleiter Forsten und Naturschutz<br />
Volker Gebhardt diese Aufgabe. Neben einem Vortragsteil wurde durch die örtlichen<br />
Forstämter immer eine Exkursion angeboten. Die Seniorentreffen erfreuen sich einer<br />
großen Beliebtheit.<br />
Forstpolitik:<br />
Satzungsgemäß hat sich der Forstverein immer wieder mit der Forstpolitik<br />
beschäftigt. Schon 1994 wurde folgende Position vertreten: Erhalt <strong>des</strong> Einheitsforstamtes,<br />
gegen Extreme in der Forstorganisation, <strong>für</strong> Modellvorhaben zur<br />
Überprüfung der Größen der Reviere und Forstämter, gegen eine Privatisierung <strong>des</strong><br />
Lan<strong>des</strong>wal<strong>des</strong>. Auf der Tagung 2007 wurde die Bedeutung <strong>des</strong> Forstamtes und <strong>des</strong><br />
Revierförsters eindringlich herausgestellt.<br />
12
Der Vereinsvorstand versucht, über Gespräche mit den Landtagsfraktionen und dem<br />
Agrarminister noch mehr Einfluss auf die Forstpolitik auszuüben.<br />
Der Verein gibt als regelmäßige Veröffentlichungen je<strong>des</strong> <strong>Jahr</strong> einen <strong><strong>Jahr</strong>esbericht</strong><br />
heraus.<br />
Dazu kommen Sonderhefte zu verschiedenen Themen und Anlässen, u.a.:<br />
- 150 <strong>Jahr</strong>e <strong>Thüringer</strong> Forstverein<br />
- Gottlob König und seine Forstlehranstalt in Ruhla und Eisenach<br />
- Heinrich Cotta<br />
- Überblick über die forstlichen Verhältnisse Thüringens 1944 ( Schaper, Haselhuhn)<br />
- Orkankatastrophe und Borkenkäferkalamität 1946 bis 1954<br />
- Lebensbilder bedeutender <strong>Thüringer</strong> Forstleute: Johann Matthäus Bechstein<br />
- Die Weimarer Klassik und <strong>das</strong> Forstwesen in Thüringen – Weihnachten 1975 –<br />
Goethe im Forsthaus Waldeck<br />
Wolfgang Heyn / Gerhard Bleyer<br />
13
Parforcehornbläser begrüßten 2007 in Frankreich die Reiseteilnehmer im Jagdschloss<br />
von Chambord, ein ergreifen<strong>des</strong> Erlebnis<br />
Fast 200 Förster und Waldbesitzer füllten 2006 den Saal der TH Ilmenau zum Thema<br />
Privatwaldbewirtschaftung.<br />
14
Alter und neuer Vorstand <strong>des</strong> <strong>Forstvereins</strong> im <strong>Jahr</strong> 2007:<br />
v.l.: ehemaliger stellv. Vors. Gerhard Bleyer, Ehrenvorsitzender Dr. Wolfgang<br />
Henkel, stellv. Vors. Wolfgang Heyn, Schatzmeisterin Petra Beck, neuer<br />
Vorsitzender Hagen Dargel, Horst Geisler, neuer Geschäftsführer Dr. Andreas<br />
Niepagen, Prof. Helmut Witticke, ehemaliger GF Uli Klüßendorf und ehemaliger<br />
Vors. und neuer 1. Stellv. Prof. Martin Heinze<br />
15
Die Reisegruppe 2006 vor der Hohen Tatra<br />
Herbsttagung 2008 in Gotha<br />
16
20 <strong>Jahr</strong>e <strong>Thüringer</strong> Forstverein<br />
Grußwort<br />
Volker Gebhardt<br />
<strong>Thüringer</strong> Ministerium <strong>für</strong> Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz<br />
Stellvertretender Abteilungsleiter Forsten und Naturschutz<br />
Meine sehr geehrten Damen und Herren,<br />
werte Bedienstete und Freunde der Forstverwaltung,<br />
der Anlass <strong>für</strong> die heutige Veranstaltung liegt bereits zwanzig <strong>Jahr</strong>e zurück.<br />
Ich erinnere an die bewegte Zeit nach dem Fall der innerdeutschen Grenze, an den<br />
Neuanfang und die <strong>für</strong> den Aufbau der Lan<strong>des</strong>forstverwaltung aber auch <strong>für</strong> den<br />
Aufbau der <strong>Thüringer</strong> Verbände und Vereine zahlreich erfahrene Hilfe von<br />
Forstkollegen aus den Altbun<strong>des</strong>ländern. Ganz besonders freue ich mich <strong>des</strong>halb,<br />
<strong>das</strong>s am heutigen Tag einige dieser ehemaligen Helfer und auch langjährigen<br />
Wegbegleiter anwesend sind.<br />
Der <strong>Thüringer</strong> Forstverein hat in diesen zwanzig <strong>Jahr</strong>en die Zusammenarbeit mit der<br />
Lan<strong>des</strong>forstverwaltung angestrebt und gepflegt. Er hat sich zu einer Plattform der<br />
gemeinsamen Weiterbildung, <strong>des</strong> fachlichen Meinungsaustausches, aber auch der<br />
Lösung von Interessenkonflikten entwickelt.<br />
Probleme und Interessenkonflikte gab es und gibt es da reichlich. Ganz aktuell<br />
bewegt uns alle zum Beispiel die Frage, wie es gelingen kann, angesichts <strong>des</strong><br />
Personalmangels und der schwierigen Finanzlage Thüringens die Lan<strong>des</strong>forstverwaltung<br />
in eine sichere Zukunft zu führen.<br />
17
Forststruktur<br />
Aufgrund einer nachhaltigen Entwicklung der Lan<strong>des</strong>forstverwaltung hat Herr<br />
Minister Jürgen Reinholz am 16. Februar dieses <strong>Jahr</strong>es der Fachabteilung einen<br />
Auftrag erteilt, sowohl die Ausgangslage und Rahmenbedingungen der<br />
Lan<strong>des</strong>forstverwaltung zu analysieren als auch die daraus abgeleitete Notwendigkeit<br />
einer umfassenden Neuausrichtung derselben darzustellen. Künftige Ziele und<br />
Maßgaben galt es zu formulieren. Mögliche Rechts- und Organisationsformen unter<br />
Abwägung von Vor- und Nachteilen waren zu bewerten. Die Vorschläge der<br />
Arbeitsgruppe sollten bis Anfang Mai vorliegen, um diese bei der Haushaltsplanaufstellung<br />
2011 ausreichend berücksichtigen zu können.<br />
Die verwaltungsinterne Arbeitsgruppe bestand weitgehend aus Vertretern aller<br />
Beschäftigungsgruppen und der Personalvertretung sowie einem externen Steuerberater.<br />
Innerhalb der drei gebildeten Arbeitskreise wurden zu Fachthemen weitere<br />
Mitarbeiter hinzugezogen.<br />
Am 3. Mai <strong>2010</strong> wurde der gemeinsam erarbeitete Bericht Herrn Minister Reinholz<br />
übergeben und bereits am 12. Mai Frau Ministerpräsidentin Lieberknecht sowie dem<br />
Arbeitskreis Forsten, Umwelt und Naturschutz der CDU-Fraktion vorgestellt. Seit<br />
dem 17. Mai haben alle Beschäftigten der Lan<strong>des</strong>forstverwaltung Gelegenheit, über<br />
<strong>das</strong> Intranet sich mit den Ergebnissen der AG vertraut zu machen.<br />
Als Fazit der AG ergeben sich folgende zwei Handlungsoptionen:<br />
a) Beibehaltung <strong>des</strong> Gemeinschaftsforstamtes mit dem bisherigen Aufgabenspektrum<br />
als Einheitsforstverwaltung mit Regiebetrieb:<br />
Bewertung:<br />
sozialverträglich, nicht haushaltsneutral<br />
Aufstockung <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong>haushalts um min<strong>des</strong>tens 218 Einstellungen (ohne<br />
Waldarbeiter) in den nächsten 10 <strong>Jahr</strong>en<br />
Sicherung eines jährlichen Einstellungskorridors von 5 bis 10 Waldarbeitern<br />
weitere Haushaltsaufstockungen im Sachmittel- und Personalkostenbereich um<br />
min<strong>des</strong>tens 5 Mio. € pro <strong>Jahr</strong>.<br />
Erforderliche Schritte:<br />
Kommunikation/Durchsetzung der erhöhten Haushaltsansätze in der Haushaltsplanaufstellung<br />
2011 sowie Bestätigung und Sicherung der Haushaltsansätze vor<br />
Haushaltssperren im laufenden Haushaltsvollzug.<br />
18
) Beibehaltung <strong>des</strong> Gemeinschaftsforstamtes mit dem bisherigen Aufgabenspektrum<br />
und Rechtsformwechsel in eine Anstalt öffentlichen Rechts<br />
Bewertung:<br />
sozialverträglich, haushaltsneutral,<br />
Streichung von 777 Stellen zuzüglich 820 Waldarbeiter (Basis HHJ <strong>2010</strong>),<br />
Verkürzung <strong>des</strong> Haushaltsvolumens um 55 Mio. €,<br />
Personaleinstellungen im größeren Umfang als in der bisherigen Struktur,<br />
Lan<strong>des</strong>zuführung unter voller Kontrolle <strong>des</strong> Landtages und der Lan<strong>des</strong>regierung,<br />
effiziente, transparente und flexible Steuerung auf die gewünschte Produkterbringung,<br />
bei voller Leistungserbringung und ausreichenden Einstellungen Zuschussreduzierung<br />
bis 2020.<br />
Erforderliche Schritte:<br />
kurzfristige Abstimmung innerhalb der Lan<strong>des</strong>regierung (Fraktion, Koalitionsarbeitskreis),<br />
mit dem AfLFUN, mit allen Landtagsfraktionen und mit den Interessenverbänden<br />
Abstimmung der finanziellen Eckpunkte mit dem TFM (haushaltsformelle<br />
Berücksichtigung bereits 2011)<br />
Einsetzen eines Aufbaustabes zur Erarbeitung <strong>des</strong> Errichtungsgesetzes mit AöR-<br />
Satzung und Organisationsentwurf,<br />
Erarbeitung der Grundzüge „Unternehmensstrategie“ (Effizienzpotenziale)<br />
Abstimmung einer mittelfristigen Finanzplanung (Zuschussbedarf der nächsten 5<br />
<strong>Jahr</strong>e)<br />
Der Erhalt <strong>des</strong> Gemeinschaftsforstamtes als Organisationsform steht somit,<br />
unabhängig von der künftigen Rechtsform, außer Frage. Das Gemeinschaftsforstamt<br />
in Thüringen ist auf vielfältigste Weise ein Erfolgsmodell, <strong>das</strong> es zu erhalten gilt.<br />
Dies findet sich auch ausdrücklich in der Koalitionsvereinbarung wieder.<br />
Die politische Entscheidung zur künftigen Forststruktur ist noch nicht gefallen.<br />
Derzeit befinden wir uns in einem regen Informations- und Diskussionsprozess mit<br />
allen Beteiligten und ich bin optimistisch gestimmt, <strong>das</strong>s wir die<br />
Lan<strong>des</strong>forstverwaltung gemeinsam in eine gute Zukunft führen.<br />
Frau Ministerpräsidentin hat jedoch erst vor wenigen Tagen ab dem <strong>Jahr</strong> 2011 eine<br />
strikte Haushaltskonsolidierung angekündigt, die nur durch weitere Ausgabenreduzierung<br />
umsetzbar sein wird.<br />
Jagd<br />
Das Forum „Strategien <strong>für</strong> eine nachhaltige Wald- und Wildbewirtschaftung in<br />
Thüringen“ wurde im März 2008 vom damaligen Ressortminister, Herrn Dr. Volker<br />
Sklenar, ins Leben gerufen. Das Forum tagt min<strong>des</strong>tens einmal jährlich, meist im<br />
Rahmen der Erfurter Messe „Reiten, Jagen, Fischen“. Die diesjährige Veranstaltung<br />
steht noch aus.<br />
19
Teilnehmer <strong>des</strong> o. g. Forums sind der Gemeinde- und Städtebund, Lan<strong>des</strong>jagdverband,<br />
Verband der Jagdgenossenschaften und Eigenjagdbezirksinhaber,<br />
Waldbesitzerverband, die Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft,<br />
Abteilung Forsten und Naturschutz <strong>des</strong> TMLFUN, Technische Universität Dresden,<br />
Fachhochschule Erfurt, <strong>das</strong> von Thünen Institut Braunschweig/Eberswalde und die<br />
TLWJF Gotha.<br />
Das o. g. Forum dient zum Austausch von Meinungen, zur Erarbeitung von<br />
wissenschaftlich abgesicherten Vorschlägen, zur Diskussion und Annährung von<br />
Standpunkten und vor allem zum Entwickeln eines besseren Verständnisses <strong>für</strong><br />
einander.<br />
Die von der Abt. 2 in Auftrag gegebenen, wissenschaftlichen Begleitprojekte <strong>des</strong><br />
Forums untersuchen neue Jagdstrategien, aktuelle wildbiologische Aspekte, den<br />
Populationsumsatz von Rot-, Dam- und Muffelwild als Grundlage <strong>für</strong> eine effektivere<br />
Bewirtschaftung lebensraumangepasster Wildbestände, Biotop verbessernde<br />
Maßnahmen und Entstörungen <strong>für</strong> <strong>das</strong> Wild sowie die verwaltungsseitige Deregulierung<br />
mit einer Stärkung der Interaktion zwischen Grundeigentümer und<br />
Jagdausübungsberechtigtem.<br />
Alle Begleitprojekte <strong>des</strong> Forums dienen der Erarbeitung ganzheitlicher Managementkonzepte<br />
<strong>für</strong> eine nachhaltige Wald- und Wildbewirtschaftung in Thüringen, um<br />
damit <strong>das</strong> Gelingen <strong>des</strong> Waldumbaus und der Wiederbewaldung von Schadflächen in<br />
Thüringen zu unterstützen.<br />
Das von der TU Dresden betreute Projekt „Integratives Konzept zur Untersuchung<br />
von Strategien der Jagdausübung unter besonderer Berücksichtigung von<br />
Wildeinfluss, Waldentwicklung, Interessen der Wald- und Jagdbesitzer sowie<br />
Waldschäden durch Schalenwild in ausgewählten Forstämtern/Hegegemeinschaften<br />
<strong>des</strong> Freistaats Thüringen“ untersucht <strong>das</strong> vorgenannte Spannungsfeld und soll dem<br />
Forum entsprechende Lösungsvorschläge u. a. auf der Grundlage neuester<br />
wildökologischer und jagdmethodischer Erkenntnisse unterbreiten. Dazu gehört auch<br />
eine an den Biorhythmus <strong>des</strong> Wil<strong>des</strong> angepasste Ausrichtung der Jagdzeiten.<br />
Vorgesehen ist, <strong>das</strong>s die Jagd in Zeiten günstigen Nahrungsangebotes und damit<br />
geringer Störung <strong>für</strong> <strong>das</strong> Wild intensiviert und in Zeiten <strong>des</strong> Nahrungsmangels und<br />
hoher Störungssensibilität <strong>für</strong> <strong>das</strong> Wild, wie z. B. in den Setz- und Aufzuchtzeiten,<br />
reduziert werden soll.<br />
Nach zweijähriger Projektlaufzeit wurden im Februar <strong>2010</strong> durch die TU Dresden<br />
Anträge auf Einzelanordnungen zur Aufhebung von Schonzeiten <strong>für</strong> Rot-, Dam-,<br />
Muffel-, Schwarz- und Rehwild bei den unteren Jagdbehörden gestellt. Die Anträge<br />
beziehen sich ausnahmslos auf 7 Versuchsreviere innerhalb der Lan<strong>des</strong>jagdbezirke,<br />
in welchen entsprechende Probeflächen zur Beurteilung der Waldverjüngung und der<br />
Auswirkung von unterschiedlichen Jagdstrategien untersucht werden. Die<br />
20
wissenschaftliche Gesamtversuchsfläche beträgt ca. 6.500 ha, was 0,5 % der<br />
gesamten Jagdfläche Thüringens ausmacht.<br />
Generell gilt, <strong>das</strong>s Verstöße gegen den Tierschutz zu jeder Jagdzeit auszuschließen<br />
sind, wobei <strong>das</strong> Erlegen führender Stücke (Muttertiere) gesetzlich untersagt und <strong>das</strong><br />
Erlegen von trächtigen Stücken aus jagdethischen Gründen auszuschließen ist. Für<br />
jeden Jäger gilt, <strong>das</strong>s ein Schuss auf Wild in der Jagdzeit zu unterbleiben hat, sofern<br />
die sichere Ansprache <strong>des</strong> Stückes oder die allgemeine Sicherheit nicht gegeben ist.<br />
Nach Einwendungen <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong>jagdverban<strong>des</strong> wurde Ende Februar der Projektteil<br />
Jagdzeitenänderung ausgesetzt. Im Fortgang dazu fand ein Ministergespräch mit allen<br />
am Forum beteiligten Verbänden und der Forstverwaltung statt. Zur Lösung <strong>des</strong><br />
Konflikts gibt es derzeit weitere Gespräche zwischen Herrn Minister und den<br />
Verbandspräsidenten.<br />
Herr Minister hat nach einem dieser Gespräche mit dem Präsidenten <strong>des</strong> LJVT die<br />
Abteilung Forsten und Naturschutz beauftragt, bis Mitte Juli dieses <strong>Jahr</strong>es mit Prof.<br />
Dr. Müller vom Tharandter Institut <strong>für</strong> Waldbau und Forstschutz den bisherigen<br />
Forschungsansatz entsprechend zu modulieren. Im Zuge <strong>des</strong>sen wird, wie bereits von<br />
Herrn Staatssekretär Roland Richwien seit drei Monaten vorläufig angeordnet,<br />
gänzlich auf die Aufhebung der Schonzeit <strong>für</strong> Rot-, Dam-, Muffel- und Rehwild im<br />
Monat April verzichtet. Sobald die Modulation abgeschlossen ist, wir der LJVT von<br />
Herrn Abteilungsleiter Prof. Dr. Thöne darüber in Kenntnis gesetzt.<br />
Darüber hinaus sind auch die lan<strong>des</strong>weite Verlängerung der Jagdzeit <strong>für</strong> männliches<br />
Rehwild bis zum 15. Januar und die jahreszeitliche Einschränkung der<br />
Wildbeunruhigung durch die Jagd (Bewegungsjagden auf herbivore Schalenwildarten<br />
bis 31.Dezember) in der Diskussion.<br />
Im Sinne der Koalitionsvereinbarung ist <strong>das</strong> konstruktive Zusammenwirken der<br />
Verbände im o. g. Forum fortzuführen. Die „Jagdstrategie auf Schadflächen“ ist ein<br />
geeignetes Mittel, um auf die waldbaulichen Herausforderungen der Zukunft zu<br />
reagieren. Jagdstrategie und Forum sind somit wesentliche Bestandteile einer<br />
ordnungsgemäßen Forstwirtschaft. Ich bitte Sie daher, bei Anfragen von<br />
Waldbesitzern, Jägern und deren Interessenvertretern sowie der Öffentlichkeit und<br />
Presse stets zur Versachlichung der Diskussion beizutragen.<br />
Holzmarkt<br />
Der Holzmarkt in Deutschland ist geprägt von einem deutlichen Nachfrageüberhang<br />
bei der Baumart Fichte. Die lebhafte Nachfrage vor allem nach Fichtenstammholz<br />
kann vielerorts nicht annähernd befriedigt werden. Dies führt natürlich überall zu<br />
anhaltend steigenden Preisen bei nahezu allen Sortimenten bis hin zum Energieholz.<br />
Die im letzten Monat von der Lan<strong>des</strong>forstverwaltung mit den Rundholz<br />
verarbeitenden Unternehmen in Thüringen geführten Verhandlungen brachten zum<br />
Teil erhebliche Preissteigerungen. Bei einzelnen Sortimenten stiegen die Preise bis zu<br />
21
30 % gegenüber dem Vorjahr. Für <strong>das</strong> Leitsortiment Fichte Langholzabschnitte 2b,<br />
Güte B/C wurde ein Preisrahmen von 77,00 bis 80,00 €/fm frei Waldstraße erzielt.<br />
Palettensortimente werden mittlerweile zu Preisen zwischen 46,00 und 50,00 €/fm<br />
verkauft.<br />
In der Kiefer sind nun auch die Preise über 60,00 €/fm in der Stärkeklasse 2b wieder<br />
auf einem Niveau, mit dem der Waldbesitz zufrieden sein kann.<br />
Der Trend steigender Nadelrundholzpreise ist bun<strong>des</strong>weit zu verzeichnen und wird<br />
voraussichtlich noch länger anhalten. Selbst der Preisabschlag <strong>für</strong> Langholz wurde<br />
erstmals aufgegeben. Interessant dabei ist, <strong>das</strong>s es kaum noch ein preisliches Nord-<br />
Süd-Gefälle gibt. Unter Beachtung der jeweiligen Sortierungen unterschiedlicher<br />
Bun<strong>des</strong>länder kann davon ausgegangen werden, <strong>das</strong>s die <strong>Thüringer</strong> Holzpreise dem<br />
Spitzenvergleich standhalten. Verantwortlich <strong>für</strong> den Aufwind ist zum einen eine<br />
enorme Konkurrenz der rundholzverarbeitenden Betriebe um den wertvollen<br />
Rohstoff Holz, zum anderen ein aus Gründen der Nachhaltigkeit reduzierter<br />
Einschlag in allen Waldbesitzarten bei anziehender Nachfrage nach Schnittholzprodukten.<br />
Zugleich sind mehrere Langfristverträge in den ersten Monaten dieses<br />
<strong>Jahr</strong>es ausgelaufen.<br />
Die Geschäftslage bei Laubholzsägern ist weiterhin schwierig. Viele Betriebe gehen<br />
von einer anhaltend schwierigen bzw. sich noch verschlechternden<br />
Abverkaufssituation aus. Der Anteil der Betriebe mit zu großen Fertigwarenbeständen<br />
hat sich im letzten Monat wieder erhöht. Demzufolge kam es zu weiteren<br />
Produktionskürzungen.<br />
Vor dem Hintergrund dieser Marktentwicklung wird die Lan<strong>des</strong>forstverwaltung<br />
keinem Sägewerk einen Vorrang einräumen. Aufgrund der immer stärker werdenden<br />
Konkurrenz zwischen stofflicher und energetischer Verwertung hat sich die<br />
Forstverwaltung dazu entschlossen, die Preise <strong>für</strong> Brennholz in Selbstwerbung um<br />
2,00 €/fm anzuheben. Dies ist vor dem Hintergrund steigender Preise im<br />
Industrieholzsektor durchaus gerechtfertigt. Freie Industrieholzmengen im Laub- und<br />
Nadelholzbereich haben eine enorme Nachfrage. Die letzten Abschlüsse im Laubholz<br />
liegen über 43,00 €/fm. Im Nadelholz konnten beim ISFK Preise zwischen 23,00 und<br />
24,00 €/rm und beim Schleifholz zwischen 28,00 und 30,00 €/rm erzielt werden.<br />
Die Pressemeldungen der letzten Wochen zeigen, <strong>das</strong>s die Holzindustrie in der Lage<br />
war, ihre Produktpreise anzuheben, aber die Preissteigerung beim Rundholzeinkauf<br />
(außer beim Zellstoffholz) nicht in vollem Umfang an die Kunden weitergeben<br />
konnte. Demzufolge ist der wirtschaftliche Druck auf die Unternehmen nach wie vor<br />
sehr hoch.<br />
Für den Verkauf von Rundholz bieten sich im Moment gute Bedingungen, in jedem<br />
Fall hat der Verkäufer eine optimale Verhandlungsposition.<br />
22
Stand der Wiederbewaldung nach Schadereignissen<br />
Die Schäden nach den schweren Orkanstürmen „Kyrill“ und „Emma“ aus den <strong>Jahr</strong>en<br />
2007 und 2008 prägen die <strong>Thüringer</strong> Forstwirtschaft zwei bzw. drei <strong>Jahr</strong>e später noch<br />
deutlich. Während die Holzmengen schon längst im Kreislauf der Verwertung<br />
verschwunden sind, ist die Wiederbewaldung der Schadflächen als Arbeitsfeld<br />
geblieben.<br />
Leitbild der Wiederaufforstung ist die Etablierung von standortgerechten Baumarten.<br />
Auf den Kahlflächen werden, wo immer standörtlich möglich, vorzugsweise<br />
Lichtbaumarten wie Eiche, Ahorn und Kirsche gepflanzt, welche beim regulären<br />
Waldumbau unter dem Schirm <strong>des</strong> Altbestan<strong>des</strong> weniger zum Einsatz kommen. In<br />
verlichtete Bestände werden vorzugsweise Schattbaumarten wie Buche und<br />
Weißtanne eingebracht. Hier gilt es, Schadereignisse als Chancen <strong>für</strong> einen<br />
großflächigen Waldumbau zu nutzen.<br />
Grundsätzlich erfolgen künstliche Verjüngungsmaßnahmen nur auf Flächen, die<br />
keine Naturverjüngung aufweisen oder aufgrund <strong>des</strong> wüchsigen Standortes zur<br />
„Verunkrautung bzw. Vergrasung“ neigen. Flächen ohne bereits vorhandene Naturverjüngung<br />
jedoch mit guter Ausgangslage <strong>für</strong> eine natürliche Wiederbewaldung<br />
wurden zunächst zurückgestellt.<br />
In den von der Baumschule Breitenworbis im Frühjahr <strong>2010</strong> an die Forstämter<br />
ausgelieferten Pflanzenzahlen spiegelt sich dieser Ansatz wider. 43 % aller Pflanzen<br />
waren Buchen, 10 % Traubeneichen, 7 % Weißtannen. Beträchtlich ist allerdings<br />
noch immer der Anteil der Fichte, die 24 % aller ausgelieferten Pflanzen ausmachte.<br />
Augenscheinlich gibt es auf manchen höher gelegenen Standorten <strong>des</strong> <strong>Thüringer</strong><br />
Wal<strong>des</strong> keine mit vertretbarem Schutzaufwand einzubringende Alternative.<br />
Das noch abzuarbeitende Soll an Wiederaufforstungsfläche belief sich zum<br />
<strong>Jahr</strong>eswechsel 2009/<strong>2010</strong> auf ca. 950 ha.<br />
Im vergangenen Frühjahr sind bereits auf 470 ha 729.000 Pflanzen in den Boden<br />
gekommen. Das Wetter sorgte <strong>für</strong> eine willkommene Verlängerung der<br />
Pflanzungsmöglichkeit. Die noch verbleibenden ca. 480 ha können voraussichtlich<br />
mit der Herbstpflanzung bewältigt werden.<br />
Bei der Wiederbewaldung von Schadflächen setzen wir zunehmend auf „moderne<br />
Verfahren“ der Teilflächen- und Trupppflanzung. Das heißt, nicht die gesamte<br />
Schadfläche wird bepflanzt, sondern nur Teile davon, vorhandene Verjüngungskegel<br />
und Befahrungslinien werden ausgelassen. Daraus resultieren nicht nur geringere<br />
Kulturkosten, sondern auch der Natur wird mehr Raum <strong>für</strong> natürliche Sukzessionen –<br />
etwa mit den Pionierbaumarten Birke und Eberesche – eingeräumt.<br />
23
Forstschutz – Borkenkäfer und Eschentriebsterben<br />
Die bereits vor „Kyrill“ bedrohliche Borkenkäfersituation erfuhr mit dem riesigen<br />
Angebot an Brutmaterial infolge Wurf- und Bruchholz eine dramatische<br />
Entwicklung. Im Folgejahr 2008 erreichte die Menge <strong>des</strong> stehend befallenden Holzes<br />
mit knapp 400.000 fm fast den Wert aus dem Trockenjahr 2003. Die feuchte<br />
Witterung im August 2009 sowie eine zeitlich befristete Personalaufstockung <strong>für</strong> die<br />
Beseitigung von Käfernestern kamen jedoch den Fichtenbeständen zugute und<br />
verhinderten ein weiteres Anwachsen der Käferpopulation. Nach Auswertung der<br />
diesjährigen Fangergebnisse aus den Pheromonfallen zeigt sich eine Entspannung der<br />
Gefährdung durch Borkenkäfer. Auch hier war der Regen und die Kühle <strong>des</strong><br />
Frühjahrs ein Segen.<br />
Große Sorge bereitet mir dagegen ein anderes Forstschutzproblem.<br />
Seit Mitte der 90er <strong>Jahr</strong>e wird in den baltischen Staaten und Polen <strong>das</strong> Eschentriebsterben<br />
beobachtet, welches nun auch Thüringen erreicht hat. Auffälligstes<br />
Symptom ist ein Welken der Blätter, die letztlich am Zweig hängend vertrocknen.<br />
Bei genauerer Betrachtung der Triebe können auch absterbende Rindenteile<br />
festgestellt werden. Erreger der Krankheit ist <strong>das</strong> Weiße Stengelbecherchen, ein<br />
bislang völlig unauffälliger Totholz-Pilz an der Esche.<br />
Die Ursache <strong>für</strong> <strong>das</strong> nunmehr aggressive Verhalten <strong>des</strong> Pilzes ist noch ungeklärt.<br />
Zurzeit wird durch die Forstinspektionen eine Stichprobeninventur durchgeführt,<br />
welche die Verbreitung <strong>des</strong> Symptoms in Thüringen aufzeigen soll. Erwartet wird ein<br />
flächiges Vorhandensein <strong>des</strong> Schaderregers. Da der Wissenstand hierzu noch gering<br />
ist, gilt es verstärkt weiter zu beobachten und zu forschen.<br />
Für jeden Waldbesitzer ergibt sich aus diesem Geschehen die Frage, ob die Baumart<br />
Esche <strong>für</strong> Aufforstungen noch verwandt werden soll. Ich meine, <strong>das</strong>s Vorsicht<br />
angeraten und ein Abwarten sinnvoll ist. Seitens <strong>des</strong> Ministeriums kann hinsichtlich<br />
geförderter Aufforstungen mit Esche beruhigt werden. Der Ausfall von Kulturen<br />
durch <strong>das</strong> Eschentriebsterben wird in der Regel nicht zu Fördermittelrückforderungen<br />
führen. Grundsätzlich ist jedoch der Anbau standortgerechter Baumarten zu forcieren,<br />
um die Anfälligkeit künftiger Waldgenerationen gegenüber Schadereignissen zu<br />
verringern.<br />
Situation und Ergebnisse beim Waldumbau<br />
Während in den letzen <strong>Jahr</strong>en der aktive Waldumbau zu Gunsten der<br />
Naturverjüngung und Wiederbewaldung mit Mischbaumarten zurückgefahren wurde,<br />
soll noch in dieser Legislatur im Sinne der Koalitionsvereinbarung darin wieder ein<br />
Schwerpunkt gesetzt werden. 100.000 ha Nadelholz-Reinbestände sind in<br />
standortgerechte Mischbestände zu überführen. Hinter diesem Flächenumfang<br />
verbirgt sich ein immenser finanzieller und personeller Aufwand. Leistbar ist ein<br />
solches Vorhaben also nur bei Bereitstellung von zusätzlichen Haushaltsmitteln. Die<br />
TLWJF erarbeitet zurzeit ein Konzept, wie <strong>das</strong> Vorhaben zunächst auf den besonders<br />
24
<strong>für</strong> die Fichte ungeeigneten Standorten und in älteren Beständen umgesetzt werden<br />
kann. Im Staatswald wurden bereits 20.000 ha solcher Flächen identifiziert.<br />
Ich hoffe Ihnen einen kleinen Ausblick auf die forstliche Situation in Thüringen<br />
gegeben zu haben und wünsche den Feierlichkeiten zum 20-jährigen Bestehen <strong>des</strong><br />
<strong>Thüringer</strong> <strong>Forstvereins</strong> weiterhin einen guten Verlauf.<br />
25
Von Volker Gebhardt<br />
anlässlich der Jubiläumstagung 20. <strong>Jahr</strong>e <strong>Thüringer</strong> Forstverein e.V.<br />
während seines Grußwortes gezeigte Präsentation:<br />
Bericht aus der<br />
Abteilung Naturschutz und Forsten:<br />
1. Bedeutung <strong>des</strong> <strong>Thüringer</strong> <strong>Forstvereins</strong><br />
2. Überlegungen zur künftigen Forststruktur<br />
3. Diskussion zur Jagdstrategie und den<br />
Jagdzeiten<br />
4. Lage auf dem Holzmarkt<br />
5. Ergebnisse in der Wiederbewaldung<br />
6. Situation im Forstschutz<br />
7. Ausblick auf den Waldumbau<br />
<strong>Thüringer</strong> Forstverein<br />
20 <strong>Jahr</strong>e der Zusammenarbeit<br />
=<br />
20 <strong>Jahr</strong>e eine Plattform<br />
•der gemeinsamen Weiterbildung<br />
•<strong>des</strong> fachlichen Meinungsaustausches<br />
•der Lösung von Interessenkonflikten<br />
26
1991:<br />
2.556 Beschäftigte<br />
2500<br />
60 Forstämter<br />
487 Reviere<br />
Überlegungen zur künftigen Forststruktur<br />
Personalentwicklung - Personalabbau<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
0<br />
27<br />
Höherer Dienst<br />
Gehobener Dienst<br />
Arbeiter Treuh./ NPV<br />
Arbeiter Staatswald<br />
Angestellte und MTArb<br />
<strong>2010</strong>:<br />
1.597 Beschäftigte<br />
28 Forstämter<br />
299 Reviere<br />
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 <strong>2010</strong>*<br />
Höherer Dienst 203 202 197 196 192 190 188 188 187 179 177 172 163 162 149 148 145<br />
Gehobener Dienst 547 546 544 538 528 526 524 524 524 517 514 509 504 499 489 487 484<br />
Arbeiter Treuh./ NPV 228 222 198 119 44 35 20 17 0 0 0 15 15 20 25 25 25<br />
Arbeiter Staatswald 1182 1154 1088 991 1005 975 964 950 940 916 890 855 835 822 828 823 815<br />
Angestellte und MTArb 253 254 248 241 234 235 234 234 234 225 225 215 209 208 200 200 188<br />
Überlegungen zur künftigen Forststruktur
Überlegungen zur künftigen Forststruktur<br />
Neuausrichtung oder Handlungsunfähigkeit!<br />
Personalkennzahlen von Lan<strong>des</strong>forstverwaltungen (Testbetriebsnetz) mit dem<br />
Organisationsprinzip Gemeinschaftsforstamt und vergleichbarem<br />
Aufgabenspektrum<br />
Bun<strong>des</strong>land<br />
Hessen<br />
RP<br />
MVP<br />
Thüringen<br />
BaWü<br />
Brandenburg<br />
NRW<br />
Kapitel<br />
0921<br />
Forstämter<br />
0922<br />
Waldarbeiter<br />
0923 FH<br />
0924 TLWJF<br />
0925 FBZ<br />
0927 NP<br />
Hainich<br />
Summe<br />
ha<br />
895.000<br />
833.000<br />
512.000<br />
537.000<br />
1.386.000<br />
1.091.000<br />
916.000<br />
Gesamtwald<br />
Besch./Tha<br />
ohne WA<br />
1,62<br />
1,41<br />
1,41<br />
1,12<br />
1,56<br />
1,21<br />
0,55*<br />
28<br />
ha (HB)<br />
342.000<br />
230.000<br />
180.000<br />
185.000<br />
333.000<br />
273.000<br />
119.000<br />
Staatswald<br />
Besch./Tha<br />
ohne WA<br />
4,25<br />
5,71<br />
4,02<br />
3,26<br />
6,58<br />
5,04<br />
4,20<br />
Überlegungen zur künftigen Forststruktur<br />
Abbaupfad aus der Behördenstrukturreform (SSL)<br />
<strong>des</strong> <strong>Jahr</strong>es 2005 bis 2020<br />
Vorgesehener<br />
Abbau SSL<br />
159<br />
122<br />
17<br />
25<br />
3<br />
1<br />
327<br />
01.01.10<br />
bereits<br />
erbracht<br />
32<br />
54<br />
12<br />
4<br />
2<br />
0<br />
104<br />
Verbleibender<br />
Abbau<br />
132 2<br />
68<br />
0<br />
21<br />
1<br />
1 3<br />
223 4<br />
Stellen/Personal<br />
zum 01.01.10<br />
653<br />
795 1<br />
0<br />
100<br />
11<br />
38 3<br />
1597<br />
Besch./Tha<br />
nur WA<br />
2,85<br />
3,39<br />
5,97<br />
4,45<br />
4,16<br />
5,24<br />
3,61<br />
verbleibende<br />
Stellen/Personal<br />
zum 01.01.21<br />
521<br />
727<br />
0<br />
79<br />
10<br />
38 4<br />
(13 + 25)<br />
1.375 4
Überlegungen zur künftigen Forststruktur<br />
Aus der Situationsanalyse ergeben sich zwei<br />
Handlungsoptionen:<br />
Beibehaltung <strong>des</strong> Gemeinschaftsforstamtes mit dem bisherigen<br />
Aufgabenspektrum und der bisherigen Rechtsform als<br />
Lan<strong>des</strong>forstverwaltung mit Regiebetrieb<br />
Beibehaltung <strong>des</strong> Gemeinschaftsforstamtes mit dem bisherigen<br />
Aufgabenspektrum und Rechtsformwechsel der<br />
Lan<strong>des</strong>forstverwaltung in eine Anstalt öffentlichen Rechts<br />
Überlegungen zur künftigen Forststruktur<br />
1. Beibehaltung <strong>des</strong> Gemeinschaftsforstamtes mit dem bisherigen<br />
Aufgabenspektrum und der bisherigen Rechtsform als Verwaltung mit<br />
Regiebetrieb:<br />
� sozialverträglich<br />
� nicht haushaltsneutral<br />
� Aufstockung <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong>haushalts um min<strong>des</strong>tens 218 Einstellungen in den<br />
nächsten 10 <strong>Jahr</strong>en (22 Einstellungen pro <strong>Jahr</strong> ohne Waldarbeiter)<br />
� Sicherung eines jährlichen Einstellungskorridors von 5 bis 10 Waldarbeitern<br />
� weitere Haushaltsaufstockungen im Sachmittel- und Personalkostenbereich<br />
um min<strong>des</strong>tens 5 Mio. € pro <strong>Jahr</strong>.<br />
Erforderlich Schritte :<br />
� Kommunikation und Berücksichtigung der erhöhten Ansätze in der<br />
Haushaltplanaufstellung 2011<br />
� Absicherung der Haushaltsansätze vor Haushaltssperren im laufenden<br />
Haushaltsvollzug<br />
29
Überlegungen zur künftigen Forststruktur<br />
2. Beibehaltung <strong>des</strong> Gemeinschaftsforstamtes mit dem bisherigen Aufgabenspektrum<br />
und Rechtsformwechsel der Lan<strong>des</strong>forstverwaltung in eine Anstalt öffentlichen Rechts<br />
� sozialverträglich und haushaltsneutral,<br />
� Streichung von 777 Stellen zuzüglich 820 Waldarbeitern (Basis HHJ <strong>2010</strong>),<br />
� Verkürzung <strong>des</strong> Haushaltsvolumens um 55 Mio. €,<br />
� neue Personaleinstellungen im größeren Umfang als in der bisherigen Struktur,<br />
� Lan<strong>des</strong>zuführung unter voller Kontrolle <strong>des</strong> Landtages und der Lan<strong>des</strong>regierung,<br />
� effiziente, transparente und flexible Steuerung auf die gewünschte Produkterbringung,<br />
� bei voller Leistungserbringung und ausreichenden Einstellungen Zuschussreduzierung bis 2020<br />
Erforderliche Schritte:<br />
� kurzfristige Abstimmung innerhalb der Lan<strong>des</strong>regierung (Fraktion, Koalitionsarbeitskreis),<br />
mit dem AfLFUN und allen Landtagsfraktionen sowie den Interessenverbänden<br />
� Abstimmung der finanziellen Eckpunkte mit dem TFM<br />
(haushaltsformelle Berücksichtigung bereits 2011)<br />
� Einsetzen eines Aufbaustabes,<br />
� Erarbeitung <strong>des</strong> Errichtungsgesetzes mit AöR-Satzung und Organisationsentwurf,<br />
� Erarbeitung der Grundzüge einer „Unternehmensstrategie“ (Effizienzpotenziale)<br />
� Abstimmung einer mittelfristigen Finanzplanung (Zuschussbedarf der nächsten 5 <strong>Jahr</strong>e)<br />
� bei Bedarf die Besetzung von Dienstposten im vereinfachten Verfahren der Interessenbekundung<br />
Jagdstrategie und Jagdzeiten<br />
1. Schritt - 2007<br />
1. Erarbeitung, Abstimmung<br />
und Unterzeichnung der von<br />
den Verbänden und der<br />
Forstverwaltung gemeinsam<br />
getragenen Strategie:<br />
„Jagd auf Schadflächen im Freistaat Thüringen“<br />
30
Jagdstrategie und Jagdzeiten<br />
•2. Schritt - 2008<br />
Gründung <strong>des</strong> Forums „Strategien zur nachhaltigen Waldund<br />
Wildbewirtschaftung in Thüringen“<br />
3. Schritt – 2009<br />
31<br />
1. Informationsaustausch<br />
und Diskussion<br />
Jagdstrategie und Jagdzeiten<br />
•Vorstellung der neuen<br />
Jagdnutzungsanweisung<br />
2. Initiierung<br />
wissenschaftlicher<br />
Projekte zur Erarbeitung<br />
ganzheitlicher<br />
Managementkonzepte<br />
•Information über begleitende Initiativen und<br />
Maßnahmen der Lan<strong>des</strong>forstverwaltung zur besseren Umsetzung der Strategie<br />
„Schwerpunktjagd auf Schadflächen“
4. Schritt – <strong>2010</strong><br />
Jagdstrategie und Jagdzeiten<br />
Herr Prof. Müller beantragt im Rahmen <strong>des</strong> TU-Projekts und nach<br />
Abstimmung mit dem TMLFUN die Aufhebung von Schonzeiten <strong>für</strong> 7<br />
staatliche Reviere mit der Gesamtfläche von 6.500 ha (0,5 % der<br />
Jagdfläche Thüringens)<br />
vorläufiger Stopp <strong>des</strong> Antrags aufgrund der massiven Ablehnung einer<br />
versuchsweisen Jagdzeitenänderung durch den Vorstand <strong>des</strong> LJVT,<br />
heftige Diskussion im Rahmen <strong>des</strong> Forums, z. T. in der Presse geführt,<br />
Offener Brief <strong>des</strong> <strong>Thüringer</strong> <strong>Forstvereins</strong> an den LJVT<br />
bilaterale Gespräche <strong>des</strong> Ministers mit den Verbandspräsidenten<br />
bisherige Ergebnisse:<br />
- Fortführung eines in den Jagdzeiten modulierten TU-Projektes<br />
- Änderung der lan<strong>des</strong>weiten Jagdzeit auf den Rehbock angestrebt<br />
Lage auf dem Holzmarkt<br />
deutlicher Nachfrageüberhang beim Nadelholz<br />
Preise frei Waldstraße:<br />
Fichte LAS 2b B/C = 77 bis 80 €/fm<br />
Kiefer LAS 2b über 60 €/fm<br />
Palette 46 bis 50 €/fm<br />
Laub-IS über 43 €/fm, Ndh-ISFK 23-24 €/rm<br />
weitere Preissteigerungen <strong>für</strong> Nadelholz möglich<br />
Laubsägeholzabsatz bleibt schwierig (hohe<br />
Lagerbestände, schleppender Schnittholzverkauf)<br />
32
Ergebnisse in der Wiederbewaldung<br />
• Leitbild der Wiederbewaldung ist die Etablierung von<br />
standortgerechten Baumarten<br />
• konsequente Schadflächenbejagung<br />
• Künstliche Verjüngungen erfolgen nur auf Flächen, die keine<br />
Naturverjüngung aufweisen oder aufgrund <strong>des</strong> wüchsigen<br />
Standortes zur „Vergrasung“ neigen.<br />
- Kahlflächen mit Lichtbaumarten, wie z. B. Eiche, Ahorn und<br />
Kirsche<br />
- Verlichtete Bestände mit Schattbaumarten, wie z. B. Buche und<br />
Weißtanne<br />
Ergebnisse in der Wiederbewaldung<br />
Wiederaufforstungsflächen-Soll ca. 900 ha<br />
davon WA-Ist im Frühjahr <strong>2010</strong> ca. 470 ha mit 729.000 Pflanzen<br />
durch FBS Breitenworbis im Frühjahr <strong>2010</strong> ausgelieferte Pflanzen :<br />
• 43 % Buchen,<br />
• 24 % Fichten<br />
• 10 % Traubeneichen,<br />
• 7 % Weißtannen<br />
• 16 % Sonstige<br />
33
Situation im Forstschutz<br />
Eschentriebsterben: Welken der Blätter, absterbende Rindenteile<br />
Weißes Stengelbecherchen - ein bislang völlig unauffälliger Totholz-Pilz<br />
Ausblick auf den Waldumbau<br />
• Aufgabe: Überführung von 100.000 ha Nadelholz-<br />
Reinbeständen in standortgerechte Mischbestände<br />
(bestätigt in der Koalitionsvereinbarung der<br />
Lan<strong>des</strong>regierung)<br />
• Aktiver Waldumbau = immenser finanzieller und<br />
personeller Aufwand<br />
• leistbar nur bei Bereitstellung von zusätzlichen<br />
Haushaltsmitteln<br />
• TLWJF erarbeitet hierzu ein Umsetzungskonzept<br />
Bearbeitung und Umsetzung der Präsentation in druckfähige Datei: Horst Geisler<br />
34
20 <strong>Jahr</strong>e <strong>Thüringer</strong> Forstverein<br />
20 gute <strong>Jahr</strong>e!<br />
Forstvereine und Forstwirtschaft<br />
im vereinigten Deutschland<br />
Festvortrag von Dr. Wolfgang DERTZ<br />
Dr. Wolfgang Dertz,<br />
Ehrenpräsident <strong>des</strong> Deutschen <strong>Forstvereins</strong> e.V.<br />
Es ist mir eine große Freude, Ihnen, dem <strong>Thüringer</strong> Forstverein, zum 20-jährigen<br />
Bestehen seiner Neugründung zu gratulieren und als Zeitzeuge mit Ihnen die Zeit<br />
nach 1990 ein wenig zu beleuchten.<br />
Als 1989 der damalige Präsident <strong>des</strong> Deutschen <strong>Forstvereins</strong>, Freiherr Riederer von<br />
Paar, zu mir nach Wiesbaden kam, um mir <strong>für</strong> 1990 sein Amt anzutragen und ich<br />
zusagte, wusste keiner, welche bewegenden und geschichtlich einmaligen <strong>Jahr</strong>e uns,<br />
den Deutschen, und damit auch dem Deutschen Forstverein bevorstanden.<br />
Am 9. November 1989 fiel die Mauer. Eine machtvolle Entwicklung „von unten“,<br />
deren Vollzug keine der vier Siegermächte verweigern konnte, und ein Geschenk der<br />
Geschichte!<br />
Ganz unter diesem Eindruck beschäftigte sich im Dezember 1989 die zentrale<br />
Fachkommission mit der weiteren Entwicklung der AWIG 1 .<br />
1 AWIG = Agrarwissenschaftliche Gesellschaft der DDR<br />
35
Man favorisierte den Namen „Forstverein“. Im November 1989 forderte der Leiter<br />
der Bezirksfachkommission, Dr. Wolfgang Henkel, die Gründung eines selbständigen<br />
<strong>Thüringer</strong> <strong>Forstvereins</strong>. Im März 1990 in Grillenburg beschloss man dann, einen<br />
zentralen Forstverein der DDR e.V. zu gründen. Prof. Prien wurde Vorsitzender.<br />
Unabhängig davon wurden Kontakte zum Deutschen Forstverein geknüpft. Schon im<br />
Januar 1990 informierte Prien Riederer von Paar über die geplante Gründung <strong>des</strong><br />
DDR-<strong>Forstvereins</strong> und der Länderforstvereine. Im März kam es zur ersten Begegnung<br />
in Oberhof. Herr Hartmann aus Bayern und Herr Gatzen aus Rheinland-Pfalz, heute<br />
hier anwesend, waren dabei.<br />
Die Dinge überstürzten sich. Am 31.März 1990 wurde in Schwarzburg der <strong>Thüringer</strong>,<br />
am 12. Juni in Kyritz der Brandenburgische Forstverein gegründet. Mecklenburg-<br />
Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt folgten im Laufe <strong>des</strong> <strong>Jahr</strong>es.<br />
Aber <strong>das</strong> wissen Sie, teilweise als Zeitzeugen, sicher besser als ich, der <strong>das</strong> weitere<br />
Geschehen erst ab 1990 miterlebt hat. Die Wiedervereinigung rückte unausweichlich<br />
näher, der Forstverein der DDR konnte keinen Bestand haben. Es fanden<br />
Begegnungen zwischen beiden Seiten statt. Am 19.9.1990 trug Flöhr <strong>für</strong> Prien in<br />
Eberswalde bei der <strong>Jahr</strong>estagung der AWIG bzw. <strong>des</strong> <strong>Forstvereins</strong> der DDR einen<br />
Beschluss vor, nach dem die Länderforstvereine der DDR ihren Austritt aus der<br />
AWIG erklären, der Geschäftsführende Vorstand seine Tätigkeit zum <strong>Jahr</strong>esende<br />
einstellt und den auf dem Territorium der DDR gebildeten Forstvereinen empfohlen<br />
wird, zum frühestmöglichen Termin geordnet dem Deutschen Forstverein als neuer<br />
Dachorganisation beizutreten.<br />
Ich darf Ihnen aus eigenem Erleben sagen, es war mehr als bewegend, als im Oktober<br />
1990 der scheidende Präsident Riederer v. Paar in seiner Begrüßungsansprache in<br />
Hannover sagte: „Ohne Übertreibung ist dieses <strong>Jahr</strong> <strong>für</strong> uns historisch. 450 Kollegen<br />
aus den Ländern Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt,<br />
Thüringen und Sachsen sind zu unserer Tagung hier in Hannover im Saal. Ihnen gilt<br />
unser ganz besonderer Willkommensgruß. Erinnern wir uns: Vor zwei <strong>Jahr</strong>en in<br />
München konnte ein Kollege aus der DDR kommen. Was hat sich alles inzwischen<br />
geändert! Für mich als den derzeitigen Präsidenten <strong>des</strong> DFV ist dies heute, da sich<br />
wirklich die „deutsche Forstwirtschaft“ hier versammelt hat, ein erhebender Tag,<br />
und meine Amtszeit als Präsident dieses Vereins hätte mit keinem beglückenderen und<br />
schöneren Ereignis zu Ende gehen können als mit dieser gesamtdeutschen Tagung“.<br />
Und speziell begrüßte er <strong>für</strong> den Forstverein der DDR Prof. Dr. Flöhr, <strong>für</strong><br />
Mecklenburg-Vorpommern Ofm. Beindorf, <strong>für</strong> Brandenburg Ofm. Reschke, <strong>für</strong><br />
Sachsen-Anhalt Prof. Dr. Morawietz, Sie , Herrn Dr. Henkel, <strong>für</strong> Thüringen und Ofm.<br />
Ackermann <strong>für</strong> Sachsen. „Die Freude ist riesengroß, Sie hier zu haben.“<br />
Und ich sagte in der Mitgliederversammlung zu meinem Vorgänger: „Dieses<br />
Schicksalsgeschenk, <strong>das</strong>s alle deutschen Forstleute wieder an einem Strang ziehen<br />
können, Herr Präsident, ist sicher die schönste Gabe, die Ihnen zum Ende Ihrer<br />
Amtstätigkeit beschert war.“<br />
36
Bei der Mitgliederversammlung in Hannover stellten Sie, lieber Herr Dr. Henkel, als<br />
Vorsitzender den Antrag, den neugegründeten <strong>Thüringer</strong> Forstverein in den DFV<br />
aufzunehmen. Dies wurde einstimmig mit Freude beschlossen. Gleichzeitig wurde der<br />
Vorstand DFV ermächtigt, zum nächstmöglichen Termin die Forstvereine der<br />
anderen vier Länder aufzunehmen. Dies geschah dann im Februar 1991 bei der<br />
Wiesbadener Vorstandssitzung. Und nun hatte der DFV 8000 Mitglieder und neue<br />
Aufgaben.<br />
Mit Freude kann ich <strong>für</strong> die Folgezeit feststellen, es gab nie Probleme im DFV und<br />
seinen Gremien zwischen den Vertretern <strong>des</strong> „alten“ <strong>Forstvereins</strong> und den Freunden<br />
aus den neuen Ländern.<br />
Die erste Gelegenheit nutzten wir, als Prof. Löffler ausschied, mit Dr. Eberhardt aus<br />
Sachsen-Anhalt einen Vertreter der neuen Länder in den Vorstand zu holen. Und<br />
Prof. Höppner ist seit vielen <strong>Jahr</strong>en ein sehr aktiver Vizepräsident. Schließlich haben<br />
Sie, lieber Herr Henkel, und dann Sie, lieber Prof. Heinze, wichtige Rollen im<br />
Länderbeirat <strong>des</strong> DFV gespielt. Ich möchte diese Zeit nicht missen!<br />
Bei Dr. Eberhardt fällt mir ein: Damals dümpelte <strong>das</strong> begonnene Atomkraftwerk<br />
Arneburg bei Stendal vor sich hin. Riesiges Gelände an der Elbe, große Probleme<br />
beim Absatz von Schwachholz. Aber es ging nicht voran. Dr. Eberhardt und ich<br />
nahmen uns der Sache an. Bei Bun<strong>des</strong>minister Borchert trugen wir zwei die<br />
Notwendigkeit eines Zellstoffwerks vor. Mit dem einsamen Verwalter <strong>des</strong> Terrains,<br />
Herr Gatzke, hielten wir eine Presse-Konferenz vor Ort ab und schwammen gegen<br />
den Strom. Allmählich kam die Sache ins Rollen. Heute steht da ein modernes<br />
Zellstoffwerk. Wir haben es natürlich nicht erbaut. Aber wir haben <strong>das</strong> sonst<br />
gemiedene Thema durch Beharrlichkeit in die Öffentlichkeit gebracht – als<br />
Forstverein.<br />
Ob es um Tagungen ging, Beiträge, Veranstaltungen, Ehrungen, in den zwanzig<br />
<strong>Jahr</strong>en nach der forstlichen Wiedervereinigung haben die elf Forstvereine immer an<br />
einem Strang gezogen und Lösungen gefunden. Sehr früh wurden in meiner Zeit die<br />
<strong>Jahr</strong>estagungen in die neuen Länder gelegt, so Kassel <strong>für</strong> Thüringen mit,<br />
Berlin/Brandenburg, Schwerin und Dresden.<br />
Der <strong>Thüringer</strong> Forstverein entwickelte sich zahlenmäßig und inhaltlich prächtig.<br />
Lebendige, gute Veranstaltungen und hervorragen<strong>des</strong> Presse-Echo, attraktive Fahrten<br />
und Zusammenarbeit mit der Lan<strong>des</strong>forstverwaltung zeichneten ihn aus. So wurden<br />
Sie von außen wahrgenommen, von den Beteiligten werden wir ja gleich noch mehr<br />
hören.<br />
Ich denke, es waren 20 gute <strong>Jahr</strong>e <strong>für</strong> die Forstvereine und mit Einschränkungen <strong>für</strong><br />
die Forstwirtschaft, sieht man von Orkanen (vom Himmel oder aus der Politik) ab.<br />
Aber wer ist ohne Probleme?<br />
37
Wenn es weniger Forstleute gibt, haben die Forstvereine auch weniger Mitglieder.<br />
Je<strong>des</strong> Mal nach einer Wahl fällt Politikern ein, ihre Forstverwaltung mit einer Reform<br />
zu überziehen, stets verbunden mit Personalbbau. Ich habe nie verstanden, warum<br />
man immer die treuesten und passioniertesten Teile der Verwaltung trifft. Gibt es eine<br />
andere Verwaltung, in der die Mitarbeiter so an ihrer Arbeit hängen, den Begriff<br />
Freizeit nicht kennen, da sie sich an jedem Wochentag <strong>für</strong> ihren Wald zuständig<br />
fühlen? Und nicht zum Widerstand neigen! Und was <strong>für</strong> Strukturen fallen den Leuten<br />
alle ein!<br />
Wenn man früher mit Peruanern und Tasmaniern zusammenkam, tauschte man sich<br />
darüber aus, wie die jeweilige Forstverwaltung aufgebaut ist. Trifft man heute einen<br />
Schwaben, Sachsen oder Westfalen, fragt man zunächst: „Wer ist denn bei Euch z. Zt.<br />
<strong>für</strong> was zuständig?“ Und alles scheint denkbar! Vom Hoch-Profit-Forst bis zum<br />
verschenkten Öko-Biodiversitäts-Wald ist alles vertreten!<br />
Ich habe gegrübelt, warum Politiker sich mit so besonderer Zuwendung mit den<br />
Förstern beschäftigen.<br />
Es scheint drei Gründe zu geben:<br />
1. Man kann ohne große Kosten etwas ändern und den Eindruck vermitteln, <strong>für</strong> die<br />
Umwelt eine Großtat vollbracht zu haben. Ergebnis: Die Intensität der Betreuung<br />
wird geschmälert, die Motivation wird zerstört. In jedem Land andere Strukturen!<br />
2. Man will Geld und Personal einsparen.<br />
Ergebnis: Wenn man 10 Forstämter beseitigt, sind <strong>das</strong> ca. 100 Stellen. Da<strong>für</strong> werden<br />
mit einem Federstrich 1000 neue Lehrer eingestellt und 500 Polizisten.<br />
3. Man will neue Strukturen schaffen, trennt Betrieb, Hoheit und Betreuung oder<br />
verlagert den Betrieb in reine Verwaltungsbehörden.<br />
Ergebnis: Totales Chaos, Besitzarten werden auseinandergetrieben<br />
Es ist ja ehrenwert, <strong>das</strong>s wir in Zukunft in Deutschland nicht weiter mehr Schulden<br />
haben wollen, als die Wertschöpfung beträgt, <strong>das</strong>s wir also sparen wollen. In guten<br />
<strong>Jahr</strong>en ist dies nicht realisiert worden. Nun versucht man es in schlechten. Warum<br />
aber nur mit Kosmetik wie bei den nicht ins Gewicht fallenden Forstverwaltungen?<br />
Warum geht niemand z.B. an eine Länderreform heran? 16 Länder mit Parlamenten,<br />
Ministerien, Gerichtsbarkeit und entsprechenden Partnern! Hier wären Milliarden zu<br />
gewinnen, die wir uns jetzt leihen müssen, um sie anderen Staaten zu leihen, die noch<br />
mehr geaast haben! Für die Landkreise gilt Ähnliches!<br />
Ergebnis dieser Reform-Wut ist: Inzwischen gibt es als Organisationsform <strong>für</strong> die<br />
Forsten alles: Stiftung, Anstalt, Lan<strong>des</strong>betrieb, AG, Eingliederung in die allgemeine<br />
Verwaltung <strong>des</strong> Landrats, Einverleibung in die Landwirtschaftsverwaltung usw. usw.<br />
Manche wollen den Staatswald privatisieren, andere einen hochprofitablen<br />
Forstbetrieb schaffen, wiederum andere schenken ihn weg an Verbände zur<br />
Rückentwicklung in Richtung nacheiszeitlicher Glückseligkeit ohne den gestaltenden<br />
Menschen.<br />
38
Ich denke, der normale Weg ist, die komplexen Aufgaben der Forstwirtschaft in einer<br />
reinen Organisation gut ausgebildeter Forstleute mit weitgehender Selbständigkeit zu<br />
bündeln mit einer Zuständigkeit <strong>für</strong> alle Besitzarten gemeinsam, d.h. Management im<br />
Staatswald, Betreuung und Beratung <strong>des</strong> Kommunalwal<strong>des</strong> und Privatwal<strong>des</strong>, soweit<br />
erwünscht, und Hoheitliche Aufgaben, Aufsicht, Schulung und Förderung im<br />
Nichtstaatswald.<br />
Wenn es <strong>das</strong> Einheitsforstamt nicht schon gäbe, man müsste es auf ganzer Fläche<br />
erfinden. Gerade bei Besitzzersplitterung gibt es keine bessere und billigere Lösung,<br />
als den wirtschaftenden Förster <strong>des</strong> Staatswal<strong>des</strong> sozusagen nebenbei Maßnahmen im<br />
danebenliegenden Gemeindewald ergreifen zu lassen und gleichzeitig Forstschutz<br />
oder Schulung im Genossenschaftswald mitmachen zu lassen. Gibt es denn einen<br />
besseren Betreuer im Nichtstaatswald als den Praktiker, der seine Erkenntnisse im<br />
„eigenen Wald“ dem Nachbarn zugute kommen lässt und immer up to date ist? – und<br />
der <strong>das</strong> Vertrauen der Besitzer genießt? Soll <strong>für</strong> eine kleine Kontrolle ein Spezialist<br />
einer anderen Behörde von fern anreisen? Für alle Bereiche, meine ich, ist es <strong>das</strong><br />
größte Übel, <strong>das</strong>s <strong>das</strong> Gemeinsame der Besitzarten aufgegeben wird. Die<br />
Zersplitterung der Interessen <strong>des</strong> Waldeigentums ist der Keim <strong>des</strong> Zugriffs von<br />
anderer Seite.<br />
Aber zurück zu den daraus entstehenden Problemen der Forstvereine. Schon seit<br />
<strong>Jahr</strong>en haben wir uns als Forstverein, auch wegen der schwindenden<br />
Mitgliederzahlen, <strong>für</strong> Nicht-Forstleute geöffnet. Ich denke, wir sollten aktiv um<br />
Menschen werben, die sich sonst militanten Umweltverbänden zuwenden und die uns<br />
akzeptieren, so wie wir sind. Dazu gehört eine intensive Öffentlichkeitsarbeit.<br />
Speziell die Jugend müssen wir ansprechen!<br />
In Hannover 1990 hat eine Mitgliederbefragung ergeben, <strong>das</strong>s wir nicht mehr nur der<br />
Fortbildungsverein der Lan<strong>des</strong>forstverwaltungen sein wollen, sondern ein<br />
kompetentes Organ, <strong>das</strong> sich zu allen forst- und umweltpolitischen Fragen Gehör<br />
verschafft, der Politik gegenüber und in der Öffentlichkeit. Wir haben den Vorteil,<br />
nicht Partikularinteressen zu vertreten. Mittel dazu sind Presse-Erklärungen,<br />
Broschüren, Presse-Konferenzen, Bücher, Aktionen aller Art. Eine Einladung an die<br />
Presse am Waldweg ist weniger attraktiv als ein Presse-Gespräch in den Baum-<br />
Kronen! Der DFV mit seinen Länderforstvereinen ist da auf gutem Weg.<br />
Ein interessanter Versuch findet durch Frau Lerner im Bayrischen Forstverein statt,<br />
die Freitags-Wanderungen mit Forstleuten und normalen Bürgern anbietet.<br />
Ein weiterer Schritt, den wir eingeleitet haben und der vom Präsidenten Wilke<br />
weitergetrieben wird, ist die Schmiedung von Allianzen. Sie erinnern sich: Berliner<br />
Erklärung zusammen mit WWF, BAUM, BDH und weiteren Partnern.<br />
So ist die Zusammenarbeit mit dem DFWR unabdingbar, auch mit der AGDW und<br />
den Jagdverbänden. Trotz manches Dissenses darf man nicht vergessen, <strong>das</strong>s es<br />
39
300.000 Jäger in Deutschland gibt. Geborene Partner sind natürlich die Verbände <strong>des</strong><br />
umweltfreundlichen Rohstoffes Holz.<br />
Besonders wirksam ist die Verbindung von sympathischen Prominenten mit unseren<br />
Aussagen, wie wir es mit dem Buch „Waldfacetten“ praktiziert haben. Dass die<br />
Maikäfer-Bekämpfung wichtig und nötig ist, glaubt <strong>das</strong> Publikum weniger gern – mit<br />
Verlaub – dem Präsidenten als z.B. Lena Meyer-Landrut, Carmen Nebel oder<br />
Gunther Emmerlich.<br />
Und, liebe Freunde, wir müssen die Forstwirtschaft so darstellen, wie sie ist.<br />
Management der Wälder mit modernen Mitteln zur Holzerzeugung bei gleichzeitiger<br />
kostengünstiger Erbringung aller Wünsche nach Biodiversität, Artenschutz,<br />
Wohlfahrtswirkungen, Pädagogik und gefühlsmäßiger Verbundenheit. Diese<br />
Fähigkeit <strong>des</strong> Forstmanns müssen wir glaubwürdig vermitteln und dazu die uns<br />
angeborene Zurückhaltung aufgeben. Warum nicht mal z.B. eine Anzeige in einer<br />
Tageszeitung oder Illustrierten? Oder ein wohlwollender Bericht in der auflagenstärksten<br />
Zeitung, der Apotheken-Zeitung oder dem ADAC-Blatt? Zufrieden können<br />
wir erst sein, wenn Fluggäste in den Bordbüchern der Lufthansa Aussagen und<br />
Aktionen der Forstvereine finden.<br />
Ich halte es im Übrigen <strong>für</strong> einen Fehler, <strong>das</strong>s die Förster ihre Waldbluse und den<br />
Fürst-Pless-Hut abgelegt haben und nur noch im Freizeit-Look auftreten, z.B.<br />
sorgenzerfurcht sich um einen traumatisierten Siebenschläfer kümmern. Dies können<br />
die neuen Ranger mit Sheriff-Stern, Fernglas und Stenton-Hut genauso. Wir müssen<br />
zeigen: Der Förster ist der allround-manager und controller <strong>für</strong> die rohstoffreichen<br />
Wälder, die vielseitige Natur und <strong>das</strong> Wohlgefühl von Jung und Alt im Wald.<br />
Ich denke, alle Forstvereine sollten und müssen, wenn sie fortbestehen wollen, hier<br />
neue Ideen entwickeln, wie es der DFV tut, um die Menschen mehr <strong>für</strong> den<br />
multifunktionalen Wald und seine kompetenten und sympathischen Sachwalter, die<br />
Forstleute, zu interessieren.<br />
Da<strong>für</strong> wünsche ich Ihnen eine glückliche Hand.<br />
Speziell dem vor 20 <strong>Jahr</strong>en neu begründeten <strong>Thüringer</strong> Forstverein herzliche<br />
Glückwünsche!<br />
Ad multos annos!<br />
40
Statement<br />
<strong>des</strong> Ehrenvorsitzenden <strong>des</strong> <strong>Thüringer</strong> <strong>Forstvereins</strong> e.V.<br />
Dr. Wolfgang Henkel<br />
anlässlich der Gesprächsrunde<br />
„20 <strong>Jahr</strong>e <strong>Thüringer</strong> Forstverein – Zeitzeugen erinnern sich“<br />
Die Gesprächsrunde v.l.:<br />
Prof. Dr. Martin Heinze, Dr. Wolfgang Henkel, Gerhard Bleyer, OKR i.R. Ludwig Große, Hagen Dargel<br />
Unsere forstlichen Altvorderen haben wie wir sehr bewegte Zeiten durchlebt<br />
und ihren Forstdienst in unterschiedlichen politischen Systemen ausgeübt.<br />
Voraussetzung <strong>für</strong> ihr Bestehen im Wandel der Geschichte war ihr Bewusstsein,<br />
einem höheren Ziel zu dienen, ihr hohes Fachwissen und ihr lauterer Charakter.<br />
Uns ist es nicht anders ergangen. Das gilt auch heute und wird sicherlich immer<br />
so sein. Auch wir, vor allem die Älteren, waren in der jüngeren Geschichte und<br />
besonders Forstgeschichte mit ihren verschiedenen Etappen in den einzelnen<br />
Abschnitten unseres Berufslebens involviert. Dazu muss angemerkt werden,<br />
<strong>das</strong>s wohl keiner, der in der zweiten Hälfte <strong>des</strong> 20. <strong>Jahr</strong>hunderts gelebt,<br />
gearbeitet und auch geleitet hat, sich dem politischen Geschehen dieser Zeit<br />
völlig entziehen konnte, es sei denn, er stellte sich ohne Rücksicht auf seine<br />
Qualifikation und Familie, bewusst ins Abseits. Während der politischen Wende<br />
im Herbst 1989 und Winter 1989/90 musste jeder persönlich selbst erst einmal<br />
politisch ins Reine kommen. Vorderst ging es hierbei um eine ehrliche<br />
Vergangenheitsbewältigung ohne Wenn und Aber. Die Kenntnis von<br />
Missbrauch <strong>für</strong> diverse Aufgaben, Funktionen, Ämter u. dgl. m. durch Partei,<br />
Staatsapparat etc., besonders mitunter durch schamhafte Ausnutzung <strong>des</strong><br />
forstlichen Berufsethos und vor allem <strong>des</strong> Forstleuten im Allgemeinen eigenen<br />
Idealismus, wogegen ein kategorisches Nein so gut wie Selbstmord bedeutet<br />
hätte, tat sehr weh und belastete emotional den einen mehr, den anderen weniger<br />
stark.<br />
Das alles musste erst einmal verdaut werden.<br />
Und es wurde verdaut!<br />
41
Wie viele meiner ehemaligen Fach- und Berufskollegen – inklusive auch noch<br />
höhere forstliche Entscheidungsträger (!) – zeigte ich seit je stets großes<br />
Interesse <strong>für</strong> Forstvereine ihre Geschichte, ihre Gründung, ihre Tätigkeit und ihr<br />
Wirken. Der Wunsch nach Forstvereinen in der DDR-Zeit stand mir persönlich<br />
immer näher als nur der Vater <strong>des</strong> Gedankens. Wie gesagt, vielen Kollegen<br />
erging es damals ebenso. Wir konnten, ja durften aber nicht wegen <strong>des</strong><br />
Vereinsverbotes <strong>des</strong> SMAD - Prikasses Nr. 40 vom 25. August 1945. Als es<br />
dann so weit war, <strong>das</strong>s Forstvereine auf dem damaligen Territorium der noch<br />
existierenden DDR gegründet werden konnten (durften?), machten plötzlich auf<br />
einmal einige der früheren Be<strong>für</strong>worter <strong>für</strong> Forstverein(e) einfach nicht mehr<br />
mit.<br />
Ja, und dann entwickelten sich die Dinge in Thüringen so, wie in meinem<br />
Vortrag zum 10. <strong>Jahr</strong>estag <strong>des</strong> TFV e.V. 2000 in Bad Blankenburg dargestellt<br />
und im <strong><strong>Jahr</strong>esbericht</strong> <strong>des</strong> TFV e.V. 2000 in den Mitteilungen <strong>des</strong> TFV e.V. Heft<br />
12/2001, S. 16 – 27 publiziert.<br />
Mein Vorschlag zur Gründung eines <strong>Forstvereins</strong> im Land Thüringen, <strong>des</strong><br />
<strong>Thüringer</strong> <strong>Forstvereins</strong>, analog den Forstvereinen in der alten BRD im awig -<br />
Gespräch Mitte November 1989 in Weimar war – ganz schlicht und einfach<br />
gesagt – meine wohlüberlegte und durchdachte umgehende spontane Reaktion<br />
auf den Mauerfall am 9. November 1989. Ich war bass erstaunt über die<br />
zustimmende Erklärung <strong>des</strong> anwesenden Sekretärs <strong>des</strong> AWIG – Zentralvorstan<strong>des</strong><br />
Dr. Werner Baumgarten zu meinem Vorschlag. Damit hatte ich nicht<br />
gerechnet. Jedenfalls wurde mit diesem Vorschlag die sich bietende günstige<br />
Gelegenheit beim Schopfe gepackt, die Gunst der Stunde genutzt, die einmalige<br />
Chance: Einen seit <strong>Jahr</strong>en und <strong>Jahr</strong>zehnten gehegten Wunsch nach<br />
Verwirklichung eines lang ersehnten Anliegens endlich in die Tat umzusetzen.<br />
Der Tragweite der Bildung <strong>des</strong> <strong>Thüringer</strong> <strong>Forstvereins</strong> e.V. waren wir drei vom<br />
damaligen Gründungskomitee – nennen wir es einmal so – uns voll und ganz<br />
bewusst.<br />
Sie erforderte:<br />
- Viel Zivilcourage, zumal in dieser brisanten politischen Wendezeit,<br />
- hohes persönliches Engagement und große Einsatzbereitschaft,<br />
- viel Mut zum Risiko.<br />
Als wir mit den Vorbereitungen zur <strong>Forstvereins</strong>gründung begannen, war doch<br />
politisch so gut wie Alles noch offen, zumin<strong>des</strong>t noch sehr Vieles.<br />
Die Anforderungen stiegen mit der Order: Der <strong>Thüringer</strong> Forstverein muss der<br />
erste Forstverein in den neuen Bun<strong>des</strong>ländern sein und im I. Quartal 1990<br />
gegründet werden. (Auftrag Prof. Prien, Leiter der awig ZFK Forstwirtschaft –<br />
im background <strong>des</strong> neu zu gründenden <strong>Forstvereins</strong> der noch-DDR)<br />
42
Hinzu kam noch eine nicht unwichtige persönliche Seite der drei eigentlichen<br />
„Gründer“, ihre zunehmend ungeklärte hauptberufliche Tätigkeit / Perspektive:<br />
Alternierende Zeiten mit Warteschleife, befristete Arbeitsverträge u.o.dgl. Ihre<br />
weitere, endgültige Bestallung erhielten die anfänglichen drei Vorsitzenden <strong>des</strong><br />
TFV erst im Sommer/Herbst 1991 durch die <strong>Thüringer</strong> Lan<strong>des</strong>forstverwaltung.<br />
Nichts<strong>des</strong>totrotz: Der neugegründete junge <strong>Thüringer</strong> Forstverein musste geleitet,<br />
geführt und zügig aus den Kinderschuhen herausgemanagt werden. Er<br />
wurde es, schon wegen seiner Vorreiterrolle <strong>für</strong> die Länderforstvereinsgründungen<br />
in den anderen neuen Bun<strong>des</strong>ländern musste er <strong>das</strong>.<br />
Die Hauptverantwortung <strong>für</strong> den Wald, wie es mit dem Wald und der<br />
Forstwirtschaft bei uns weiter geht, liegt bei der Forstpolitik. Sie muss da<strong>für</strong><br />
sorgen, <strong>das</strong>s der Wald nicht vor Förstern geschützt wird, sondern einerseits vor<br />
Raubbau durch Turbo-Kapitalisten, Turbo-Bankern, Turbo-Ökonomen, mitunter<br />
auch Turbo-Sägern und ihresgleichen und andererseits aber auch gleichermaßen<br />
vor Super- Natur- und -Umweltschützern, Super-Naturschwärmern, um nicht zu<br />
sagen Naturspinnern , -fantasten und ihresgleichen, die nicht nur unseren Wald,<br />
sondern unsere mehrtausendjährige Kulturlandschaft wieder in eine Wildnis<br />
zurück verwandeln wollen. Wozu, wo<strong>für</strong>, <strong>für</strong> wen eigentlich ? Wem nützt <strong>das</strong>?<br />
Aus gegebenem aktuellen Anlässen hat die Forstpolitik u. a. weiters auch da<strong>für</strong><br />
zu sorgen, <strong>das</strong>s der Wald nicht zum „Sportgerät“ u./o. zur „Spielwiese“ durch<br />
visionell überspannte Forderungen bzw. bereits existierende Projekte nach<br />
ausuferndem, bald nicht mehr überschaubarem und nicht mehr zu beherrschendem<br />
Massentourismus sommers wie auch vor allem winters noch weiter<br />
degradiert wird. Hierbei muss vor dem „großen Geschäft“ als Vater <strong>des</strong><br />
Gedankens entschieden gewarnt werden, denn <strong>das</strong> pure Naturerlebnis wird da<strong>für</strong><br />
eher immer nebensächlicher. Wenn <strong>das</strong> so weiter geht und nichts dagegen<br />
unternommen wird, ist bald eine geregelte ordnungsgemäße Forstwirtschaft,<br />
inkl. Jagdbewirtschaftung mit der guten forstlichen Praxis nicht mehr zu<br />
betreiben; noch dazu, wenn die Forstbetriebsgrößen noch weiter ansteigen und<br />
der Personalabbau vor allem bei den Revierbeamten weiter geführt wird.<br />
Sparsamkeit in allen Ehren, jedoch nicht um jeden Preis!<br />
Mit Nachhaltigkeit hat <strong>das</strong> alles wahrlich überhaupt nichts mehr zu tun. Umso<br />
wiederholter wird der Begriff „Nachhaltigkeit“ strapaziert und inflationär<br />
verwendet, d. h. missbraucht.<br />
In unserer krisengeschüttelten Zeit besteht der zunehmende Trend, <strong>das</strong>s<br />
gestandene Politiker ihren eigentlichen Platz in der Politik verlassen, fortlaufen<br />
und z.B. in die Wirtschaft gehen, überwechseln.<br />
43
Ich meine, <strong>für</strong> unser gesamtes Forstwesen wäre ein umgekehrter Trend sinnvoll,<br />
ja unbedingt notwendig, nämlich der, <strong>das</strong>s wieder mehr voll ausgebildete und<br />
gestandene eigentliche, d.h. fach- und sachkompetente Forstwirtschafter und<br />
Forstwissenschaftler in die Politik gehen sollten. Sie sollten jedoch bleiben, wo<br />
sie sind, d.h. ihren angestammten Platz behalten, ihn ausbauen, stärken und nicht<br />
wie jene davonlaufen. Ich halte <strong>das</strong> <strong>für</strong> unbedingt erforderlich, wenn die<br />
Forstpolitik ihrer o.g. Grundsatzverantwortung gerecht werden soll.<br />
Unter dem Motto: Wir bewahren zwar die Asche unserer Forstgeschichte, tragen<br />
aber <strong>das</strong> Feuer weiter zur weiteren Vorsorge <strong>für</strong> unsere thüringischen Wälder<br />
und zum bleibenden allseitigen Wohle <strong>des</strong> <strong>Thüringer</strong> Forstwesens.<br />
Viele schöne Erfolge im dritten <strong>Jahr</strong>zehnt <strong>des</strong> <strong>Thüringer</strong> <strong>Forstvereins</strong> e.V.!<br />
Wie sagte doch bereits vor über 90 <strong>Jahr</strong>en MAX ENDRES am Schluss seines<br />
Beitrages zum I. Weltforstkongreß 1926:<br />
"Die Waldwirtschaft ist auf Liebe angewiesen"<br />
(zit. bei KÖSTLER, J.N.: Waldbau. 1950, S.398). Tun wir Alles, <strong>das</strong>s <strong>das</strong> so<br />
bleibt.<br />
44
Klimawandel und Forstwirtschaft<br />
Der folgende Vortrag zeigt<br />
Bad Blankenburg, 11.Juni <strong>2010</strong><br />
E.-D. Schulze MPI-Biogeochemie, Jena<br />
Anzeichen und Vorhersagen <strong>für</strong> den Klimawandel in Thüringen<br />
(Folie 3-9)<br />
Kohlenstoff und Spurengasbilanzen von Wald, Grünland und Agrarland<br />
(Folie 10-23)<br />
Möglichkeiten und Grenzen der Forstwirtschaft<br />
(Folie 24-32<br />
Einflüsse einer unzureichenden Jagd<br />
(Folie 33 – 36)<br />
Eine Zusammenfassung<br />
(Folie 37)<br />
Im Wesentlichen geht es im Forst darum<br />
Die Baumartenvielfalt als Versicherung gegen Risiken zu erhalten<br />
Die sonstigen Leistungen <strong>des</strong> Wal<strong>des</strong> zu verrechnen, um die Lücke zwischen<br />
wirtschaftlichen Anforderungen und den Anforderungen der Gesellschaft zu<br />
schließen<br />
Die Verrechnung der Leitungen <strong>des</strong> Wal<strong>des</strong> als Kohlenstoffsenke dem<br />
Eigentümer direkt zukommen zu lassen.<br />
Bisher verrechnet der Staat als Nation diese Einnahmen, und gibt nur einen<br />
Teil weiter als Subventionen.<br />
Dies ist aber keine Vergütung von Leistungen, den Subventionen finanzieren<br />
auch Dinge, die zu Emissionen führen (Kalkung)<br />
Die direkte Verwendung von Biomasse als Energieerzeugung wird kritisch<br />
gesehen, denn die Umsetzungseffizienz von Solarzellen ist um den Faktor 100<br />
bis 1000 größer, und damit der Flächenbedarf geringer.<br />
Biomasse sollte erst nach einer Verwendung in einer Produktkette energetisch<br />
genutzt werden<br />
45
Änderungen in der Temperatur, dem Meeresspiegel und der Schneebedeckung<br />
in den letzten 150 <strong>Jahr</strong>en zeigen deutliche Trends, die den jetzt bereits<br />
laufenden Klimawandel anzeigen.<br />
46
Änderungen im CO2,<br />
Methan<br />
und N2O<br />
über die letzten 10000 <strong>Jahr</strong>e.<br />
47
Nach WBGU <strong>Jahr</strong>esgutachten 1997, S. 61<br />
Die Erde erhält Sonnenenergie im kurzwelligen Bereich <strong>des</strong><br />
Spektrums, und sie gibt Energie ab im langwelligen Licht.<br />
Dieses „Ausstrahlungsfenster“ wird geschlossen durch die<br />
Absorptionslinien von CO2 , Ozon, Methan, Lachgas und FCKW‘s.<br />
Damit erwärmt sich die Erde.<br />
48
Das obere Bild zeigt die zu erwartenden Klimaänderungen und unten die noch<br />
vorhandenen Reserven an fossilen Brennstoffen.<br />
Kohle ist noch in großen Mengen vorhanden aber in der Nutzung wegen der<br />
geringen Energiedichte bedenklich<br />
49<br />
Meinshausen, Nature 458, 2009
Relative Niederschlagsänderung in %, 2051/2080 bzw. 1961/1990<br />
D. Jacob, 2006<br />
Winter<br />
Sommer<br />
Thüringen bleibt von dramatischen Änderungen verschont.<br />
50
Es ändern sich aber die Extreme. Hier die Änderung im Klima seit 1901<br />
51<br />
UBA 2006
Vor diesem Hintergrund werde ich im Folgenden auf die Spurengas-Bilanz<br />
Europas eingehen.<br />
Diese Bilanz ist wichtig, da die Schwellenländer fordern, <strong>das</strong>s die<br />
Industrienationen mit der Einschränkung von Emissionen beginnen.<br />
Die Kohlenstoffbilanz einer Einzelpflanze ist einfach die Summe aus<br />
Photosynthese und Atmung.<br />
Auf Ökosystemebene und auf Landschaftsebene kommen weitere<br />
Spurengase hinzu, vor allem Methan und Lachgas.<br />
52
Hier als Beispiel die Emissionen aus fossilen Brennstoffen. Deutschland ist<br />
„Spitze“ bei den fossilen Emissionen<br />
Man sieht sehr gut die Grenze zwischen Frankreich und Deutschland wegen<br />
der unterschiedlichen Nutzung der Atomenergie<br />
53
Im Folgenden müssen wir uns auf bestimmte Definitionen einigen:<br />
Hier die Begriffe, die verwendet werden.<br />
Pfeile nach oben zeigen Emissionen an, Pfeile nach unten sind<br />
Senken.<br />
Bruttoprimärproduktion kennzeichnet die Photosynthese,<br />
Nettoprimärproduktion steht <strong>für</strong> Pflanzenwachstum,<br />
Nettobiomproduktion steht <strong>für</strong> die Bilanz auf Landschaftsebene.<br />
54
Kronendach<br />
GPP ist<br />
unabhängig<br />
von der<br />
Landnutzung<br />
Der Wald<br />
speichert<br />
in der<br />
Holzmasse.<br />
Dies ist<br />
aber keine<br />
sichere<br />
Senke<br />
55
Kohlenstoff-Vorräte in Europäischen Naturwäldern<br />
- Thüringen: Hainich 14 bis 30 kgC/m2<br />
- Karpaten: Rozok 14 bis 20<br />
- Karpaten: Havezova 16 bis 19<br />
In den letzten <strong>Jahr</strong>zehnten stiegen die Vorräte trotz Ernte ständig an. Dies liegt<br />
an den Kahlschlägen nach dem 2. Weltkrieg. Diese Bestände kommen jetzt ins<br />
erntefähige Alter<br />
56
NatureGeoscience<br />
Schulze et al., 2009<br />
57<br />
C: grass ><br />
forest<br />
GHG: grass<br />
Die Landwirtschaft ist als einzige Landnutzung ein Emittent.<br />
Die Emissionen sind so hoch, <strong>das</strong>s sie die Senke von Wald und Grasland<br />
ausgleichen.<br />
NatureGeoscience<br />
Schulze et al., 2009<br />
58<br />
other GHGs<br />
- reduce the<br />
grassland<br />
sink<br />
- increase<br />
cropland<br />
losses
Ungeklärt war bislang, ob Waldböden tatsächlich eine Senke sind.<br />
In einer sehr großen Untersuchung mit wiederholter Probenahme konnte<br />
nunmehr gezeigt werden, <strong>das</strong>s z.B. im Hainich die C-Vorräte im Boden<br />
steigen.<br />
Hainich Flux site gC m-2yr-1<br />
Mund & Schulze (2006): 20 to 50 (Transektstudie)<br />
Kutsch et al. (2009): 1 to 35 (Modellrechnung)<br />
Schrumpf (2009): 50 to 60 (direkte Beobachtung)<br />
Zusammenfassung der Bilanzuntersuchungen<br />
• GPP ist 1.25% der Sonnenenergie<br />
• NPP ist 0.5% der Sonnenenergie<br />
• Ernte ist 1 ‰ der Sonnenenergie<br />
• Eine Solarzelle nutzt Sonnennergie zu 30%<br />
• Solarzellen nutzen mit 20% Sonnenenergie<br />
• Die Emissionen von N2O-CO2-Ceq entsprechen<br />
dem Düngereintrag.<br />
Die Kalkung im Forst wirkt in gleicher Richtung<br />
• Europäische Böden und Sedimente sind eine Netto<br />
Quelle von etwa 25 Tg yr-1<br />
59
– Landwirtschaft erzeugt<br />
• 50% <strong>des</strong> CH4,<br />
• 70% <strong>des</strong> N2O<br />
• 90% <strong>des</strong> NH3<br />
– Die biologischen Emissionen machen 30%<br />
der Klimabilanz aus<br />
– Bislang steht die Landwirtschaft unter dem<br />
Schutz der „Common Agricultural Policy“<br />
mit der Alleinstellungsmerkmal der<br />
Ernährungssicherheit, d.h. Deutschland<br />
verrechnet nicht die Emission der<br />
Landwirtschaft<br />
– Ob die zulässig ist <strong>für</strong> industrielle<br />
Bioenergieerzeung ist strittig<br />
• Wie groß ist der GHG-footprint von<br />
Europa?<br />
- Sibirien re-assimiliert nur ca 20% <strong>des</strong> N2 O<br />
- Sibirien re-assimiliert nur ca 50% <strong>des</strong> CO2<br />
60
Was ist die Stellung der Forstwirtschaft<br />
Holzwirtschaft Deutschland 2004<br />
61
Die Bioenergienutzung wird die Emissionen aus der<br />
Landnutzung sowohl im Forst als auch in der Landwirtschaft<br />
verstärken.<br />
Pappelkulturen haben erhebliche N2 O Emissionen<br />
� Energieverbrauch in Europa 75,4 1018 J yr -1<br />
� Energiegehalt der Ernte, Europa: 37,3 1018 J yr -1<br />
� Energiegehalt forstlicher Nutzung 4,9 1018 J yr -1<br />
Es ist völlig ausgeschlossen, <strong>das</strong>s die Forstwirtschaft den<br />
Energiebedarf Europas deckt.<br />
� Deutschland hat die Senken-Wirkung der Wälder zur<br />
Verrechnung gegen industrielle Emissionen zugelassen,<br />
aber nicht die Emissionen aus der Landwirtschaft.<br />
� Die Einnahmen aus der Senkenwirkung <strong>des</strong> Wal<strong>des</strong> gehen<br />
an den Staat und nicht an den Eigentümer, der <strong>das</strong> Land<br />
bewirtschaftet.<br />
� Daraus ergibt sich <strong>das</strong> sogenannte „Management Gap“.<br />
62
Der Landeigentümer folgt ökonomischen Zwängen. Die Gesellschaft<br />
verlangt aber eine Vielzahl zusätzlicher Leistungen ohne <strong>für</strong> diese<br />
Leitungen den Eigentümer direkt zu vergüten<br />
63
Bioenergie sollte aus Holz erst nach Nutzung in einer<br />
Produktkette erzeugt werden:<br />
Direkte Vergütung <strong>für</strong> Ökosystemleistungen:<br />
- Für Senken, Biodiversität, Toursimus<br />
- Nicht als Subvention sondern als<br />
Bezahlung<br />
- fehlt<br />
64
Ökostrom aus Holz ist ökologisch nicht vertretbar, sofern dies zur<br />
Nutzung <strong>des</strong> Kronenholzes führt. Die Wirkung ist Vergleichbar mit<br />
der alten Streunutzung.<br />
Was wären vernünftige Vermeidungsstrategien<br />
- Regionale Extensivierung der Landwirtschaft<br />
- Industrielle Verbrennung von Biomasse nur am Ende einer<br />
Produktkette<br />
- Internalisierung der Kosten:<br />
Emissionen müssen beim Verursacher als Kosten erscheinen.<br />
Senken müssen beim „Erzeuger“ einen Gewinn erbringen,<br />
sowohl in der Land- wie auch in der Forstwirtschaft<br />
65
Eine Internalisierung der Kosten und Nutzen würde die<br />
Umweltsituation sofort verbessern.<br />
Aber<br />
50% <strong>des</strong> Zuwachses im Wald stammt aus der N-Deposition<br />
- Muss der Forst der Landwirtschaft etwas zahlen<br />
- Oder muss die Landwirtschaft dem Forst die<br />
Reinigung der Luft bezahlen<br />
Streitpunkt ist die Bioenergie<br />
Die Landverteilung wird sich ändern<br />
<strong>2010</strong> 2020 (geschätzt)<br />
Wirtschaftwald 30% 25%<br />
Grünland 25% 10%<br />
Bioenergie 5% 20%<br />
Naturschutz 1% 5% (bis 10%)<br />
Acker 30% 25%<br />
Infrastruktur 10% 15%<br />
Die Folge ist eine Intensivierung der Restflächen<br />
66
Es gibt im Augenblick aber weitere gravierende Probleme durch die<br />
unzureichende Jagd. In der natürlichen Sukzession würden die<br />
Begleitbaumarten der Buche bis zum Baumholz Dominieren. Die<br />
Buche wird erst im späten Alter vorherrschend (grüne Linie).<br />
Wir beobachten aber etwas völlig anderes: Die Baumartenzahl ist am<br />
geringsten bei sehr niedriger Grundfläche (roter Pfeil). Diese<br />
Beobachtung ist bedingt durch den selektiven Verbiss der<br />
Edellaubbaumarten durch überhöhte Wildbestände!<br />
67
Der schwarze Pfeil verdeutlicht den Einfluss <strong>des</strong> Wil<strong>des</strong> auf die<br />
Baumartenvielfalt<br />
In Thüringen bestimmt der Jagdpächter und nicht der Förster über<br />
die Zusammensetzung <strong>des</strong> Wal<strong>des</strong>.<br />
68
Es geht nicht um die<br />
abgefressene<br />
Biomasse, sondern<br />
um den Verlust an<br />
Produktionszeit:<br />
Diese Esche ist 25<br />
<strong>Jahr</strong>e alt, sie müsste<br />
15 m hoch sein, sie<br />
hat 25% ihrer<br />
Umtriebszeit hinter<br />
sich.<br />
Maximale Alter von<br />
verbissenen Bonsai:<br />
45 <strong>Jahr</strong>e<br />
Von Carlowitz verfügte 1732:<br />
„Wo <strong>das</strong> Holz verbissen, soll es wieder abtreiben, denn<br />
<strong>das</strong> Verbissene wächst noch einmal so langsam als <strong>das</strong><br />
unverbissene“<br />
Zusammenfassung:<br />
• Alles spricht gegen eine unmittelbare energetische Nutzung<br />
von Holz und Biomasse<br />
• Eine zusätzliche Intensivierung der Forstwirtschaft über <strong>das</strong><br />
derzeitige Niveau könnte <strong>das</strong> Nachhaltigkeitsprinzip verletzen<br />
• Die Erhaltung eines baumartenreichen Baumbestan<strong>des</strong> ist die<br />
beste Versicherung gegen Klimaschäden.<br />
• Dieses Ziel wird wegen der Wildschäden selbst bei<br />
Unterschutzstellung nicht erreicht.<br />
69
Begleittext zur Präsentation Klimawandel & Forstwirtschaft -<br />
Antworten auf schwierige Fragen<br />
von<br />
Ingolf Profft, TLWJF Gotha<br />
„Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer!“<br />
Dieses alte Sprichwort kann man in Zeiten <strong>des</strong> Klimawandels auch<br />
uminterpretieren: „Ein heißer, trockener Sommer macht noch keinen<br />
Klimawandel und ebenso wird der Fakt der Klimaänderung durch einen kalten,<br />
schneereichen Winter nicht in Frage gestellt.“<br />
Wir alle neigen dazu, aufgrund unserer Erinnerungen und unserer aktuellen<br />
Wahrnehmungen aus dem Wetter auf den Klimawandel zu schließen bzw. ihn in<br />
Frage zu stellen. Und die Medien unterstützen uns dabei, in dem sie in einem<br />
Hitzesommer deutliche Anzeichen <strong>für</strong> die Klimaänderung sehen oder bei<br />
klirrender Kälte die Frage stellen, wo denn der Klimawandel bleibt.<br />
Für eine fundierte Auseinandersetzung mit dem Thema Klimawandel ist daher<br />
eine wichtige Klarstellung vorweg notwendig: die Trennung zwischen Wetter,<br />
Witterung und Klima.<br />
Diese Trennung zeigt, <strong>das</strong>s wir erst dann Aussagen zum Klima und damit zu<br />
<strong>des</strong>sen Veränderungen treffen können, wenn wir<br />
(I) über eine Vielzahl an Klimadaten, also lange Messzeitreihen zum Wetter,<br />
möglichst <strong>für</strong> eine größere Region, zur Verfügung haben und<br />
(II) diese mit Methoden der Statistik auswerten.<br />
70
Ein gängiges Verfahren ist dabei der Periodenvergleich, in dem man Mittelwerte<br />
einer Ausgangsperiode mit Mittelwerten einer Vergleichsperiode miteinander<br />
vergleicht. Die Meteorologie hat hier<strong>für</strong> sogenannte Klimanormalperioden<br />
definiert, die jeweils einen Zeitraum von 30 <strong>Jahr</strong>en umfassen. Momentan ist die<br />
Klimanormalperiode 1961-1990, also vom 01.01.1961 bis zum 31.12.1990, die<br />
aktuellste, abgeleitet davon wird <strong>des</strong> Öfteren jedoch auch die Periode 1971-2000<br />
verwendet, da sie aktueller ist (aber keine Klimanormalperiode im engeren<br />
Sinne).<br />
Vergleicht man nun statistisch aufbereitete Messwerte dieser Periode –<br />
vorausgesetzt die Zeitreihen weisen nicht zu viele Lücken auf – mit<br />
entsprechenden Werten einer früheren Periode, so lassen sich wissenschaftlich<br />
fundierte Aussagen zur Konstanz oder zu Veränderungen <strong>des</strong> Klimas treffen.<br />
Diese Betrachtungen stehen grundsätzlich am Anfang einer jeden<br />
Auseinandersetzung mit dem Klima, hier<strong>für</strong> sind keinerlei Modelle erforderlich<br />
und die Ergebnisse sind <strong>für</strong> jeden nachvollziehbar und verständlich. Und die<br />
Analyse dieser Daten zeigt bereits auch <strong>für</strong> Thüringen deutliche Veränderungen<br />
bei Temperatur und Niederschlag in den zurückliegenden 50 <strong>Jahr</strong>en.<br />
Wenn sich nun bereits deutliche Veränderungen in der Vergangenheit zeigen, so<br />
wäre es gerade <strong>für</strong> die Forstwirtschaft sehr fahrlässig, nicht die Frage nach den<br />
möglichen Umwelt-, in erster Linie dabei Klimaveränderungen <strong>für</strong> die Zukunft<br />
zu stellen. Denn die Forstwirtschaft weist eine Reihe an Besonderheiten<br />
hinsichtlich der Rahmenbedingungen, unter denen sie aktiv ist, gegenüber<br />
anderen Bereichen <strong>des</strong> gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens, auf:<br />
� Starke Abhängigkeit von Umweltbedingungen & Standortsfaktoren,<br />
� Feste räumliche Bindung mit großer Flächenausdehnung,<br />
� Vielfache gesellschaftliche, ökologische & ökonomische Erwartungen und<br />
daraus resultierende Einschränkungen bei Entscheidungen & Maßnahmen,<br />
� Länge von Wald- und Baumgenerationen,<br />
� Langfristigkeit forstlicher Entscheidungen & langfristige Kapitalbindung<br />
sowie<br />
� Aktueller Waldzustand (AKl- und Bestan<strong>des</strong>struktur, Gesundheitszustand).<br />
Darüber hinaus basieren die dem Förster zur Verfügung stehenden<br />
waldbaulichen und ökologischen Entscheidungshilfen (z. B. pnV, Biotop- und<br />
Standortskartierung) auf retrospektiven, also in die Vergangenheit blickenden<br />
Daten. Sie bilden nicht die aktuellen Umwelt- und somit Wuchsbedingungen ab<br />
und können demzufolge nicht <strong>für</strong> weit in die Zukunft reichende forstliche<br />
Planungen zu Rate gezogen werden.<br />
71
Natürlich sollte die Forstwirtschaft aufgrund der genannten Aspekte ihre<br />
Entscheidungen auch oftmals auf dem Wissen und den Erfahrungen aus der<br />
Forstpraxis aufbauen. Aufgrund der veränderten Ausgangslage hinsichtlich <strong>des</strong><br />
Klimawandels darf sie sich bei ihrer Arbeit jedoch nicht ausschließlich auf diese<br />
Erkenntnisse zurückliegender Epochen verlassen, sondern sollte auch <strong>das</strong><br />
heutige Wissen bei ihren Entscheidungen berücksichtigen. Die praktischen<br />
Erfahrungen aus dem eigenen Wald, dem eigenen Revier, mögen sie noch so<br />
weit in die Vergangenheit reichen, werden durch den Klimawandel relativiert, so<br />
<strong>das</strong>s <strong>das</strong> „Gesetz <strong>des</strong> Örtlichen“ weit stärker an Bedeutung verliert, als vielen<br />
<strong>das</strong> momentan bewusst ist.<br />
Natürlich kann auch in der Wissenschaft niemand die Veränderungen <strong>des</strong><br />
Klimas vorhersagen, jedoch kann sie sich ausgereifter Hilfsmittel bedienen:<br />
Klimamodelle. Wie je<strong>des</strong> Modell, so können auch die Klimamodelle die<br />
Realität, d.h. die Natur nur vereinfacht abbilden. Aber mehr als 30 <strong>Jahr</strong>e<br />
Klimaforschung und Modellentwicklung liefern uns Modelle, die neben den<br />
einfachsten Zusammenhängen der Natur, wie sie in den 1970er-<strong>Jahr</strong>en<br />
Ausgangspunkt der Betrachtungen zum Klima waren, auch Wirkungen der<br />
Atmosphäre, der Wolkendecke sowie die Art der Landoberfläche und Aspekte,<br />
wie Luftverschmutzung und CO2-Kreislauf, integrieren. Damit sind sie sehr<br />
wohl <strong>für</strong> verlässliche Abschätzung der zukünftigen Entwicklung geeignet, wohl<br />
wissend, <strong>das</strong>s sie nie die Komplexität der Natur in Gänze abbilden können und<br />
<strong>das</strong>s ihre Ergebnisse entscheidend von den Festlegungen der Grundannahmen<br />
abhängen. Diese Grundannahmen sind quasi die Eingangsparameter <strong>für</strong> den<br />
Start der Berechnungen. Bei den globalen Klimamodellen sind dies<br />
beispielsweise Bevölkerungsentwicklung, technologische Fortschritte, Quellen<br />
der Energieversorgung (erneuerbar, fossil, atomar etc.) sowie Entwicklung der<br />
Landnutzung (z.B. Entwaldung). Alle diese Faktoren haben Einfluss auf die<br />
Menge an Treibhausgasen, die durch <strong>das</strong> menschliche Handeln freigesetzt<br />
werden und Hauptursache der Klimaveränderung sind.<br />
Die Ergebnisse aus den globalen Klimamodellen, die räumlich nur eine<br />
unzureichende Auflösung, also einen zu ungenauen Informationswert <strong>für</strong><br />
kleinere regionale Bereiche, haben, können in regionalen Modellen<br />
weiterverarbeitet werden. Diese bauen wiederum auf physikalischen<br />
Grundgesetzen auf, beispielsweise dem Zusammenhang zwischen abnehmender<br />
Temperatur bei ansteigender Meereshöhe.<br />
Diese Modelle werden <strong>für</strong> Abschätzungen zur zukünftigen Klimaentwicklung<br />
<strong>für</strong> Thüringen genutzt. Gleichzeitig bilden sie die Basis <strong>für</strong> die Bearbeitung der<br />
forstlichen Fragestellungen zum Klimawandel an der <strong>Thüringer</strong> Lan<strong>des</strong>anstalt<br />
<strong>für</strong> Wald, Jagd und Fischerei.<br />
72
Hier<strong>für</strong> wurden sie jedoch vorab unter Einbeziehung der Informationen der<br />
forstlichen Standortskartierung in Thüringen weiter aufbereitet, um<br />
regionalspezifische Aussagen ableiten zu können, die beispielsweise auch die<br />
Luv-/Lee-Effekte beim Niederschlag berücksichtigen.<br />
Aufgrund der oben bereits aufgezeigten Besonderheiten der Forstwirtschaft<br />
muss die Auseinandersetzung mit dem Thema Klimawandel min<strong>des</strong>tens in zwei<br />
Richtungen erfolgen:<br />
(I) Räumlich differenzierte Risikoanalyse basierend auf der aktuellen<br />
Baumarten- und Altersstruktur der <strong>Thüringer</strong> Wälder mit Hilfe der zur<br />
Verfügung stehenden Daten zu Klimaveränderungen<br />
(II) Erarbeitung von langfristig tragfähigen Baumartenempfehlungen unter<br />
Berücksichtigung sich verändernder Klimaparameter und von angepassten<br />
Bewirtschaftungskonzepten <strong>für</strong> die <strong>Thüringer</strong> Waldbesitzer<br />
Bei dem ersten Punkt geht es um die Frage der Bewertung <strong>des</strong> Risikos, <strong>das</strong> sich<br />
aus dem Klimawandel <strong>für</strong> die aktuell in Thüringen vorhandenen Waldbestände<br />
und Baumarten ergibt. Darauf aufbauend müssen waldbauliche<br />
Anpassungsmaßnahmen <strong>für</strong> die risikogefährdeten Bereiche und Baumarten<br />
entwickelt werden. Innerhalb <strong>des</strong> zweiten Punktes gilt es abzuschätzen, welche<br />
Baumarten langfristig <strong>für</strong> den Anbau in Thüringen – differenziert nach den<br />
unterschiedlichen Naturräumen und forstlichen Standorten – geeignet sind, also<br />
Baumartenempfehlungen zu erarbeiten, die dem Waldbesitzer als<br />
Entscheidungshilfe bei der Baumartenwahl zur Verfügung stehen.<br />
Die <strong>Thüringer</strong> Lan<strong>des</strong>anstalt <strong>für</strong> Wald, Jagd und Fischerei hat <strong>für</strong> die<br />
schrittweise Bearbeitung dieser Fragestellungen eine neue<br />
Klimastufengliederung entwickelt. Diese basiert auf den Parametern<br />
Vegetationszeitlänge und klimatische Wasserbilanz (Niederschlag abzüglich der<br />
in erster Linie temperaturabhängigen Verdunstung). Diese beiden Parameter<br />
sind wesentlich spezifischer <strong>für</strong> <strong>das</strong> Baumwachstum, als die bisherige<br />
Gliederung mit ihren wesentlichen Merkmalen <strong>Jahr</strong>esmitteltemperatur und<br />
<strong>Jahr</strong>esniederschlagssumme. Diese neue Klimastufengliederung erlaubt es nun,<br />
die klimatischen Wuchsbedingungen in Thüringen <strong>für</strong> die Gegenwart (Periode<br />
1971-2000; auf Basis realer Messungen) und <strong>für</strong> die Zukunft (Periode 2041-<br />
2070 auf Basis der Modellberechnungen) zu bewerten.<br />
Unter Verwendung einer Vielzahl an Informationen und Fakten aus der<br />
Forstwirtschaft und der Waldökologie wurden mit dem Blick auf die Zukunft<br />
bisher neue Baumartenempfehlungen <strong>für</strong> Thüringen erarbeitet. Ausgehend von<br />
einer soliden Datengrundlage und einer wissenschaftlich fundierten Methodik<br />
sollte der Erarbeitungsprozess transparent und nachvollziehbar gestaltet werden,<br />
so <strong>das</strong>s einerseits die Ergebnisse jederzeit reproduzierbar sind und andererseits<br />
ihre Vermittlung in die Praxis vereinfacht wird.<br />
73
Von Beginn der Bearbeitung an wurde daher auch Wert auf eine ausführliche<br />
Dokumentation der Arbeitsschritte sowie die Integration von Erfahrungen aus<br />
der Praxis gelegt. Die einzelnen Schritte <strong>für</strong> den entsprechenden neuen<br />
Bestan<strong>des</strong>zieltypenkatalog können in verschiedenen Veröffentlichungen<br />
nachgelesen werden (z.B. in der Mitarbeiterzeitschrift der <strong>Thüringer</strong><br />
Forstverwaltung „DasBlatt“, in der Zeitschrift „Forst und Holz“, Ausgaben<br />
9/2008, 10/2008, 4/2009 und 4/<strong>2010</strong> sowie im Internet unter<br />
www.waldundklima.net/klima/tlwjf_tas_wald_01.php).<br />
Auch wenn dieser neue Baumartenkatalog auf einer neuen<br />
Klimastufengliederung und nach einer neuen Methodik entwickelt wurde, so<br />
sind die Ergebnisse weit weniger exotisch oder gar praxisfern, als dies der Titel<br />
im Zusammenhang mit Klimawandel vermuten lässt. Schon beim ersten Blick in<br />
den Katalog fällt auf, <strong>das</strong>s er weder fremdländische Baumarten, <strong>für</strong> die es bisher<br />
keine forstlichen Erfahrungen in Deutschland gibt, noch bisher unbekannte<br />
Bestan<strong>des</strong>zieltypen, also waldbaulich unerprobte Baumartenkombinationen<br />
beinhaltet.<br />
Vielmehr werden die Grundsätze einer standortsgerechten Baumartenwahl unter<br />
Berücksichtigung der Klimaänderung konsequent umgesetzt. Der neue BZT-<br />
Katalog bildet die Basis <strong>für</strong> die langfristige Bewertung der Anbauempfehlungen<br />
<strong>für</strong> die jeweilige Standortssituation aus Bodeninformation und zukünftigem<br />
Klima der Periode 2041-2070 der Waldstandorte im Freistaat. Für die<br />
Waldbesitzer in Thüringen dient er als wichtige Orientierungshilfe bei ihrer<br />
Waldbewirtschaftung, reduziert er doch die gerade mit dem Klimawandel<br />
verbundenen Gefahren nach gegenwärtigem Wissensstand bestmöglich.<br />
74
Durch die Angabe mehrerer BZT-Alternativen und gleichzeitig variierender<br />
bestan<strong>des</strong>bildender Hauptbaumarten eröffnet sich dem Waldbesitzer bzw. dem<br />
Bewirtschafter ein großer Spielraum in seinen waldbaulichen Entscheidungen,<br />
ohne überdurchschnittlich hohe Risiken in Kauf nehmen zu müssen.<br />
Der Klimawandel und die damit verbundenen Standortsveränderungen dürfen<br />
jedoch weder als linear-kontinuierlicher Veränderungsprozess noch als Prozess<br />
hin zu einem neuen, stabilen Klimazustand verstanden werden. Aus diesem<br />
Grund gilt es, die Gültigkeit der neuen Baumartenempfehlungen regelmäßig zu<br />
überprüfen und bei neuen Erkenntnissen der Klima-, aber auch der forstlichen<br />
Forschung die gegebenen Empfehlungen wiederum diesen Veränderungen<br />
anzupassen. Die <strong>Thüringer</strong> Lan<strong>des</strong>anstalt <strong>für</strong> Wald, Jagd und Fischerei setzt<br />
auch hier nach der Fertigstellung <strong>des</strong> neuen BZT-Katalogs und <strong>des</strong>sen<br />
Einführung in die Praxis ihre Arbeiten auf diesem Gebiet fort. Dies betrifft<br />
sowohl die Evaluierung bisheriger Ergebnisse entsprechend <strong>des</strong><br />
Erkenntnisfortschritts aus Klima-, Ökosystem- und forstlicher Forschung, als<br />
auch die Erarbeitung von geeigneten waldbaulichen Behandlungskonzepten, die<br />
die klimawandelbedingten Risiken <strong>für</strong> junge und mittelalte Waldbestände<br />
vermindern.<br />
Falls Sie Fragen rund um <strong>das</strong> Thema Klimawandel und Forstwirtschaft haben,<br />
empfehlen wir Ihnen einen Blick in <strong>das</strong> Wissensportal "Wald & Klima" (unter<br />
www.waldundklima.net) oder <strong>das</strong> Ende <strong>2010</strong> erschienene Mitteilungsheft<br />
30/<strong>2010</strong> der Lan<strong>des</strong>anstalt mit dem Titel „Forstwirtschaft in Zeiten <strong>des</strong><br />
Klimawandel – Von Anpassung bis Klimaschutz“.<br />
Gern können Sie sich aber auch direkt an uns wenden:<br />
<strong>Thüringer</strong> Lan<strong>des</strong>anstalt <strong>für</strong> Wald, Jagd und Fischerei<br />
Projektgruppe Klimaschutz & Klimafolgen<br />
Jägerstraße 1<br />
99867 Gotha<br />
Tel.: 036 21/225 – 152<br />
Fax: 036 21/225 – 222<br />
e-Mail: ingolf.profft@forst.thueringen.de<br />
75
Seniorentreffen <strong>des</strong> <strong>Thüringer</strong> <strong>Forstvereins</strong> e.V.<br />
und BdF ( Thüringen )<br />
am 12. August <strong>2010</strong> in Walkenried<br />
Gerhard Bleyer, Rudolstadt<br />
Wieder lud der <strong>Thüringer</strong> Forstverein e.V., in Abstimmung mit dem Bund<br />
deutscher Forstleute, Lan<strong>des</strong>verband Thüringen, seine Mitglieder im<br />
Seniorenalter zu dem jährlichen Treffen ein, diesmal nach Walkenried.<br />
Am Donnerstag, den 12. August <strong>2010</strong>, trafen sich etwa vierzig Senioren beider<br />
Organisationen am Rande <strong>des</strong> Südharzes in „Kutzhütte“, einem Ortsteil von<br />
Walkenried im niedersächsischen Landkreis Osterode, knappe hundert Meter<br />
nördlich der thüringischen Lan<strong>des</strong>grenze gelegen. Es war nunmehr <strong>das</strong> 17.<br />
Treffen seit 1993. Es genießt mittlerweile schon „Bestan<strong>des</strong>schutz“ und ist aus<br />
dem Vereinsleben nicht mehr wegzudenken. Der Wunsch der Senioren ist –<br />
weiter so.<br />
Nach den individuellen Begrüßungen und den ersten Gesprächen und<br />
Diskussionen im kleinen Kreis wurden die Teilnehmer <strong>des</strong> Treffens im Auftrag<br />
<strong>des</strong> Vorstan<strong>des</strong> <strong>des</strong> <strong>Thüringer</strong> <strong>Forstvereins</strong> e.V. vom Geschäftsführer, Dr.<br />
Andreas Niepagen, in Vertretung <strong>des</strong> Vorsitzenden Hagen Dargel, herzlich<br />
begrüßt und mit dem Tagesablauf vertraut gemacht.<br />
Auf dem Programm stand zunächst eine etwa zweistündige Besichtigung <strong>des</strong><br />
Gipswerks Kutzhütte der Saint Gobian Formula GmbH.<br />
76
Ausgerüstet mit vom Werk leihweise bereitgestellten orangefarbenen Schutzwesten<br />
und –helmen führte nach kurzem Fußmarsch die Wanderung zu zweien<br />
von mehreren von der Firma betriebenen Gipssteinbrüchen.<br />
Der Werkleiter der “Kutzhütte“, Herr Elmar Zimmer, führte die Gruppe der<br />
Teilnehmer <strong>des</strong> Seniorentreffens. Umfangreich und verständlich erläuterte er<br />
Gipsabbau und Gipsverarbeitung.<br />
Nach der stufenweise durchgeführten Rodung der über den Lagerstätten<br />
stockenden Bestände (immer nur kleine, ca. 0,5 ha große Flächen) erfolgt der<br />
Gipsabbau im Tagebaubetrieb durch Sprengung, Vorselektierung <strong>des</strong> Materials,<br />
Verladung auf Kipperfahrzeuge und dem anschließenden Transport ins Werk, in<br />
dem die Weiterverarbeitung stattfindet. Dabei ist der reine, weiße Gips <strong>für</strong> die<br />
weitere Verarbeitung der gefragteste.<br />
77
Durch die kleinflächige Inanspruchnahme durch die Bergbaumaßnahmen sind<br />
im Abbaugebiet alle Stadien der Gewinnung, d.h. von der Rodung der Flächen<br />
bis zur Renaturierung der Areale sichtbar. Besonders <strong>für</strong> uns Forstleute war<br />
natürlich die Renaturierung der abgebauten Flächen interessant.<br />
78
Ein Höhepunkt <strong>des</strong> Beganges war zweifellos die Besichtigung <strong>des</strong><br />
„Sachsensteins“ bei Bad Sachsa, ein natürlich anstehender Gipssteilhang, der<br />
nicht aus einem Abbau hervorgegangen ist.<br />
Leider ist von der ursprünglichen Waldgesellschaft nicht mehr viel zu sehen,<br />
Kleingruppen von Schwarzkiefer (Pinus nigra) haben sich am Steilhang<br />
angesiedelt. Blaugras (Sesleria albicans) und Stängellose Kratzdistel (Cirsium<br />
acaule) und auch Kriechen<strong>des</strong> Gipskraut (Gypsophila repens) sind zu finden.<br />
Die nicht unbegrenzt zur Verfügung stehende Zeit zwang dazu, zum Werk<br />
„Kutzhütte“ zur Werksbesichtigung zurück zu gehen.<br />
79
Werkleiter Zimmer gab einen Einblick in die Produktpalette und erklärte<br />
während <strong>des</strong> Rundganges die Produktion. Nach der Übernahme <strong>des</strong> alten<br />
Gipswerks durch die weltweit operierende Saint-Gobian-Gruppe im Dezember<br />
2005 erhielt <strong>das</strong> Werk sein heutiges Aussehen und die derzeitige<br />
Produktionsstruktur.<br />
So wird der in den Steinbrüchen gewonnene Gips zu<br />
38,3 % <strong>für</strong> Baugips<br />
34,3 % <strong>für</strong> Keramik, z.B. Formen<br />
11,2 % <strong>für</strong> Medizin<br />
9,2 % <strong>für</strong> Intragroup<br />
4,2 % <strong>für</strong> Kunst und Dekoration, z.B. Stuck<br />
1,9 % <strong>für</strong> Sonderanwendungen<br />
und 0,9 % <strong>für</strong> Lebensmittel und Umwelt,<br />
z.B. Zusatzstoffe in Nahrungsmitteln<br />
verarbeitet und einem breit gefächerten Abnehmerkreis zur Verfügung gestellt.<br />
Die wichtigsten Werksanlagen wie Steinbrüche, Vorzerkleinerung, Alpha und<br />
Beta Plaster ( Gipsverarbeitungsstufen ), Mischerei, Verpackung und Lager<br />
konnten von den Senioren besichtigt werden.<br />
80
Nach einem Dankeschön an Werkleiter Elmar Zimmer <strong>für</strong> seine Führung und<br />
seine Erläuterungen und der Rückgabe der orangefarbenen Schutzutensilien<br />
setzte sich die Fahrzeugkolonne der Teilnehmer <strong>des</strong> Treffens in Richtung <strong>des</strong><br />
nur in kurzer Entfernung liegenden Klosters Walkenried in Bewegung.<br />
Im noch erhaltenen, ehemaligen Refektorium <strong>des</strong> Klosters, jetzt als moderne<br />
Speisegaststätte mit mittelalterlichem Ambiente genutzt, wartete <strong>das</strong><br />
Mittagessen auf die Reisegruppe.<br />
81
Nach einer Begrüßung seitens der Vertreterin <strong>des</strong> BDF, Frau Uta Krispin, gab<br />
diese <strong>das</strong> Wort weiter an Herrn Volker Gebhardt, Leiter <strong>des</strong> Bereiches<br />
Forstwirtschaft im TMLFUN Erfurt, zu seinem traditionellen Bericht über die<br />
aktuelle Situation der Forstwirtschaft in Thüringen. In seinen Aussagen ging er<br />
auf die anstehenden Probleme ein und andeutungsweise gab er einen Ausblick<br />
auf zukünftige, in mancher Hinsicht noch unklare Zielstellungen, so z.B. neue<br />
Verwaltungsstrukturen <strong>für</strong> die Forstwirtschaft. Zum Zeitpunkt <strong>des</strong><br />
Seniorentreffens wurde der angedachte Rechtsformwechsel noch zurückgestellt;<br />
da aber alles im Fluss ist - ?<br />
Die Finanzprobleme <strong>des</strong> Freistaates Thüringen zeigen auch ihre Auswirkungen<br />
<strong>für</strong> die Forstwirtschaft. Einsparungen werden auch am Bereich Forstwirtschaft<br />
nicht spurlos vorübergehen.<br />
Als beruhigend wurde die Mitteilung empfunden, <strong>das</strong>s <strong>das</strong> Gemeinschaftsforstamt<br />
erhalten bleiben soll, unbekannt aber in welcher Anzahl. In seinen<br />
weiteren Ausführungen ging Herr Gebhardt auch auf Fragen der Personalstruktur,<br />
<strong>des</strong> Holzmarktgeschehens, <strong>des</strong> Forstschutzes, der Betreuungsaufgaben<br />
bezüglich Privat- und Kommunalwald und anderes mehr ein. Seitens der<br />
Senioren an ihn gestellte Fragen wurden im Rahmen einer kurzen Diskussionsrunde<br />
beantwortet.<br />
Der Teilnehmerkreis <strong>des</strong> Seniorentreffens vertraut darauf, auch beim nächsten<br />
Treffen wieder aktuell und umfangreich die Forstprobleme Thüringens aus<br />
erster Hand dargelegt zu bekommen.<br />
Am frühen Nachmittag schloss sich <strong>für</strong> die Senioren eine in zwei Gruppen<br />
geführte Besichtigung <strong>des</strong> ehemaligen Klosters an. So vermittelte Frau Silke<br />
Bosse mit großem Fachwissen und sichtlicher Liebe zu ihrer Tätigkeit der einen<br />
Gruppe ein sehr interessantes Porträt <strong>des</strong> ehemaligen Zisterzienserklosters<br />
Walkenried. Nur wenige Hundert Meter nördlich der <strong>Thüringer</strong> Lan<strong>des</strong>grenze<br />
gelegen, hat sich <strong>für</strong> die meisten <strong>Thüringer</strong> erst in den letzten zwanzig <strong>Jahr</strong>en<br />
die Möglichkeit eröffnet, dieses mittelalterliche Kleinod und sein erst in den<br />
letzten <strong>Jahr</strong>en in diesem großem Umfang gestaltetes Museum kennen zu lernen.<br />
82
Zu vielschichtig und umfangreich war <strong>das</strong> bei der Führung durch Frau Bosse<br />
über <strong>das</strong> einstige Kloster und <strong>das</strong> modern eingerichtete Museum vermittelte<br />
Wissen, um darüber detailliert zu berichten. Der Verfasser dieses Berichtes kann<br />
Interessenten nur dazu raten, den Besuch dieses inzwischen zum Weltkulturerbe<br />
gehörenden Bauwerkes mit viel Zeit noch einmal zu wiederholen, um die Fülle<br />
<strong>des</strong> Dargebotenen richtig erfassen zu können.<br />
83
Die von der Stiftung Braunschweigerischer Kulturbesitz und dem<br />
niedersächsischen Landkreis Osterode getragene und als Museum geführte<br />
Einrichtung dokumentiert sehr anschaulich, wie Kloster und Mönche<br />
maßgeblich die wirtschaftliche, frühindustrielle Entwicklung <strong>des</strong> Harzes im<br />
Mittelalter zu einer bedeuteten Wirtschaftsregion beeinflussten.<br />
Im <strong>Jahr</strong>e 1129 von Mönchen <strong>des</strong> Zisterzienserklosters Kamp ( am Niederrhein<br />
gelegen ) nach Stiftung von Landflächen durch Adelheid von Walkenried<br />
gegründet und durch weitere Spenden und straffe Leitung und Organisation<br />
schnell wachsend, war es mit etwa hundert Mönchen und über zweihundert<br />
Angestellten zu seiner Blütezeit im 13. <strong>Jahr</strong>hundert eines der wichtigsten<br />
Zisterzienserklöster. Neben der Bautätigkeit im Kloster bestimmten<br />
Urbarmachungen und Trockenlegungen, Anlegen von Fischteichen, Gründungen<br />
von Wirtschaftshöfen, Betreiben von Bergbau und Hüttenwesen die<br />
wirtschaftliche Tätigkeit <strong>des</strong> Klosters.<br />
Aber mit Beginn der Krise <strong>des</strong> Harzer Bergbaus etwa 250 <strong>Jahr</strong>e nach der<br />
Klostergründung begann auch der Niedergang der Abtei, der im Bauerkrieg<br />
1525 mit der Erstürmung <strong>des</strong> Klosters und der starken Beschädigung der großen<br />
Kirche durch aufständige Bauern seinen Tiefpunkt erreichte.<br />
Diese und andere Beeinträchtigungen wie Reformation, Besitzwechsel und<br />
wilder Abriss bis 1817 ließen <strong>das</strong> Kloster bedeutungslos werden. Erste<br />
Renovierungsarbeiten im 19. <strong>Jahr</strong>hundert und grundlegende Sanierungs- und<br />
Restaurierungsmaßnahmen ab 1977 führten zum heutigen, gepflegten Zustand<br />
bis hin zur Eröffnung <strong>des</strong> Museums 2006.<br />
Zahlreiche Veröffentlichungen und <strong>das</strong> Internet geben umfangreiche<br />
Informationen zum Zisterzienserkloster Walkenried, <strong>das</strong> heute eines der<br />
84
informativsten Museen zum Thema Klosterleben und <strong>des</strong>sen Einwirkung auf die<br />
umgebende Region eindrucksvoll darstellt.<br />
Nach dem Kloster- und Museumsrundgang bei fortgeschrittener Zeit und der<br />
Verabschiedung der Teilnehmer <strong>des</strong> Seniorentreffens <strong>2010</strong> durch Dr. A.<br />
Niepagen, dem <strong>für</strong> die Organisation <strong>des</strong> Treffens Dank zu sagen ist, traten alle<br />
die Heimreise an, in der Hoffnung bzw. Gewissheit, sich 2011 wieder zu einer<br />
Seniorenveranstaltung mit interessanter Thematik zu treffen.<br />
Fotos: Gerhard Bleyer<br />
85
Fachexkursion <strong>Thüringer</strong> Forstverein<br />
vom 8. bis 12. September <strong>2010</strong><br />
nach Hitzacker / Elbe<br />
Der 08. September <strong>2010</strong> brach an, gerade 6.00 Uhr morgens und der Bus <strong>des</strong><br />
Fuhrunternehmens Häfner bog vor dem Gebäude der FBZ Gehren ein. Mit<br />
einem Lächeln <strong>des</strong> Busfahrers Andreas, der jetzt auch stolzes Mitglied <strong>des</strong><br />
<strong>Thüringer</strong> <strong>Forstvereins</strong> ist, begleitete er <strong>das</strong> Einladen der Gepäckstücke wie<br />
immer professionell, übersichtlich und schnell, es ist allzeit wieder<br />
bewundernswert. Die Reisegesellschaft, gut gerüstet, ging auf große Fahrt in den<br />
Norden von Deutschland.<br />
Der Himmel bewölkt und nicht gerade einladend, in der Hoffnung auf besseres<br />
Wetter, passierten wir die A 71, die A38 mit einem kleinen Abstecher nach<br />
Halle über die B80 weiter auf der A 14. Es dauerte dennoch eine Stunde länger<br />
als eigentlich beabsichtigt und vor uns erschien <strong>das</strong> Eingangsschild von<br />
Arneburg. Das Zellstoffwerk Stendal mit seinen immensen Ausmaßen war<br />
schon von weitem zu sehen. Je näher man kam, umso größer und gewaltiger<br />
erschien es. Eigentlich eine Stadt <strong>für</strong> sich.<br />
Eine herzliche Begrüßung durch Martin Stöhr erwartete den <strong>Thüringer</strong><br />
Forstverein in der Empfangshalle <strong>des</strong> Werkes.<br />
86
Weiter ging es im Auditorium zu einer umfassenden Einführung, die nicht nur<br />
Informationen zum Zellstoffwerk Stendal, sondern auch zum Zellstoffwerk<br />
Blankenstein beinhaltete.<br />
Die Zellstoffwerke Stendal und Blankenstein sind die größten Biomassekraftwerke<br />
Europas. Hier wird nicht nur auf 650 ha Zellulose produziert, sondern<br />
auch Strom erzeugt, die nicht benötigte Restmenge wird in <strong>das</strong> öffentliche Netz<br />
eingespeist.<br />
Die Produktion von reißfestem, langfaserigem Sulfatzellstoff läuft seit sechs<br />
<strong>Jahr</strong>en, in diesem <strong>Jahr</strong> werden ca. 900.000 Tonnen Zellstoff im NBSK Market<br />
Segment produziert. Das Zellstoffwerk ist <strong>das</strong> jüngste weltweit, besitzt einen<br />
eigenen Hafen und einen Bahnanschluss, bei<strong>des</strong> sehr gute Voraussetzungen. Es<br />
wurde in zwei <strong>Jahr</strong>en gebaut, war die größte Einzelinvestition Deutschlands mit<br />
über einer Milliarde Euro, beschäftigt heute ca. 600 Mitarbeiter, produziert pro<br />
Tag 1.800 Tonnen Zellstoff und im Durchschnitt pro <strong>Jahr</strong> 610.000 Tonnen<br />
Zellstoff.<br />
Die Produktion in Blankenstein beträgt mit 315.000 Tonnen Zellstoff pro <strong>Jahr</strong><br />
etwa die Hälfte, 940 Tonnen pro Tag und beschäftigt rund 400 Mitarbeiter. Die<br />
Erneuerungsinvestition belief sich hier auf 360 Millionen Euro.<br />
Für die qualitäts- und mengenmäßige Absicherung der Rohstoffversorgung ist<br />
die Zellstoff Stendal Holz-GmbH zuständig. Sie ist <strong>für</strong> den Einkauf von<br />
Rundholz und Hackschnitzel aus PEFC – bzw. FSC – zertifizierten Beständen,<br />
aus Forstbetrieben, die nachweislich nachhaltige und umweltschonende<br />
Bewirtschaftung betreiben, verantwortlich. Außerdem sorgt sie <strong>für</strong> Holzerntemaßnahmen,<br />
Rückung, Logistik und Disposition der Holztransporte.<br />
Die Dimensionen werden erst durch den Verbrauch ersichtlich. Der Einkauf <strong>des</strong><br />
Rohholzes erfolgt in einem Umkreis von ca. 600 km um Stendal sowie über<br />
Importe. Das Werk benötigt im <strong>Jahr</strong> zwei Millionen Festmeter Rundholz und<br />
eine Million Festmeter Hackschnitzel. Das heißt, am Tag werden 9.000<br />
Festmeter Holz verbraucht und <strong>das</strong> 355 Tage im <strong>Jahr</strong>. In der Hauptsache setzen<br />
sich die Hölzer aus etwa 60 % der Baumart Kiefer und 40 % aus der Baumart<br />
Fichte zusammen. Dimensionen mit einem Durchmesser von sieben bis 75 cm<br />
und einer Länge von drei bis sechs Metern stellen kein Problem dar.<br />
Der Einkauf erfolgt frei Waldstraße, frei Werk, frei Waggon oder frei<br />
Hafenkante, dann im Anschluss die Abrechnung.<br />
Ganzzüge kommen ebenfalls zum Einsatz, rund 2.000 Raummeter Rundholz<br />
werden in einem solchen transportiert und diese Menge ca. 1500 Mal pro <strong>Jahr</strong>.<br />
Das Holz wird zu 55 % mit der Bahn und zu 45 % mit LKW bewegt.<br />
87
Der Transport auf Schiffen über den Stromhafen an der Elbe, dem<br />
Mittellandkanal und der Oder werden genutzt. Die Elbe ist ca. 200 Tage im <strong>Jahr</strong><br />
schiffbar.<br />
Die Zellstoff Stendal Holz GmbH betreibt außerdem zehn eigene<br />
Maschinenpaare, bestehend aus Kranvollernter und Tragschlepper in zwei<br />
Schichten. Der Produktionsprozess ist nicht so einfach: In kurzen Worten<br />
geschildert, erfolgt die Entrindung <strong>des</strong> Holzes, dann <strong>das</strong> Hacken mit einem<br />
bestimmten Winkel, um die optimale „Chip“-größe und -form zu bekommen,<br />
nach der Sortierung wird <strong>das</strong> Holz zusammen mit Natriumlauge und Sulfid bei<br />
470 °C gekocht. So entstehen die Rohstoffe Schwarzlauge und Zellstoff. Die<br />
Schwarzlauge ist sehr energiereich, vergleichbar Rohöl, diese wird verbrannt.<br />
Die Rückführung der Chemikalien erfolgt in geschlossenen Kreisläufen, <strong>des</strong>halb<br />
auch die großen Schwierigkeiten bei geschlossenen Kreisläufen, wenn der<br />
Produktionsprozess unterbrochen werden muss. Die Abwasserbehandlung<br />
würde <strong>für</strong> 600.000 Einwohner einer Stadt, z. B. wie Frankfurt/Main ausreichen.<br />
Das Holzlager umfasst 100.000 Festmeter, diese Masse reicht <strong>für</strong> zehn Tage<br />
Produktion. Weltweit ist <strong>das</strong> Zellstoffwerk Stendal ein Vorbild im<br />
Umweltschutz, es weist die niedrigsten Schadstoffwerte aus. Nach vielen<br />
interessanten Informationen, die kaum vorstellbare Dimensionen beinhalteten,<br />
freuten sich die Mitglieder über ein sehr gutes Mittagessen in der Werkskantine,<br />
ein Rundgang durch <strong>das</strong> Werk setzte den Besuch im Zellstoffwerk Stendal fort.<br />
Ausgerüstet mit Helm, Gehörschutz und Sicherheitsbrille, verfolgten die<br />
Mitreisenden die einzelnen Punkte <strong>des</strong> Produktionsablaufs vom Holzlagerplatz<br />
im Werk, über den Holztransport auf ein riesiges Laufband mit einem Fahrzeug<br />
88
mit Greifarm, in einer Dimension, was sicher einige noch nie gesehen hatten.<br />
Weiter mit dem Entrinden und dem Hacken, dem Bleichen, dem Sortieren, dem<br />
Pressen, dem Sichten, <strong>das</strong> Versetzen mit Chemikalien, <strong>das</strong> Kochen, bis endlich<br />
ein gelblicher Zellstoff mit Wasser gelagert auf einem Vlies zu sehen war, <strong>das</strong><br />
wiederum gepresst zu einem Zelluloseband durch einen Trockner, weiter<br />
verarbeitet zu Bögen geschnitten und verpackt wurde. Sicher ist die gesamte<br />
Produktion viel komplizierter und in kurzen Worten nur schwer zu beschreiben.<br />
Das Zellstoffwerk stellt gebleichten Langfaserzellstoff her, der in der<br />
Papierindustrie zu Fein- und Druckpapieren oder hochwertigen Hygienepapieren<br />
verarbeitet wird. Außerdem trägt der Zellstoff zur Verstärkung <strong>des</strong> Anteils bei<br />
der Wiederverarbeitung von Altpapier bei.<br />
Mit Eindrücken, die man nicht so leicht vergessen kann, fuhren wir zu unserer<br />
nächsten Station. Das Parkhotel Hitzacker empfing seine Gäste und nach kurzer<br />
Zeit führte uns die Stadtbesichtigung zu den ersten Impressionen dieser Region.<br />
Hitzacker ist ein Kneippkurort an der Elbe, 5.000 Einwohner finden hier ihre<br />
Heimat. Die Ortsteile: Bahrendorf, Grabau, Harlingen, Kähmen, Nienwedel,<br />
Pussade, Tießau, Tiesmeslang, Wietzetze und Wussegel gehören ebenfalls zur<br />
Stadt Hitzacker. Die Stadt schaut auf eine lange Geschichte zurück, die bis in<br />
<strong>das</strong> <strong>Jahr</strong> 1258, als am 28. Februar <strong>des</strong> gleichen <strong>Jahr</strong>es im Vertrag von<br />
Breitenfeld der westelbische Herzog Albrecht von Braunschweig die Burg<br />
89
Hitzacker an den ostelbischen Herzog Albrecht von Sachsen abgab, der kurz<br />
darauf starb. Der Herzog sicherte sich damit einen Brückenkopf am Westufer<br />
der Elbe. Erstmalig erwähnt wurde Hitzacker schon im <strong>Jahr</strong> 1162,<br />
Siedlungsspuren, die im archäologischen Zentrum Hitzacker nachweislich sind,<br />
greifen bis in die Steinzeit zurück. Das Leben in Hitzacker war immer mit dem<br />
Fluss Elbe verbunden. Sie stellt nicht nur eine natürliche, sondern auch eine<br />
politische Grenze dar.<br />
Das Gebiet um Hitzacker ist geologisch gesehen in der Weichseleiszeit bei Kalt-<br />
und Warmphasen in der letzten Eiszeit durch eine Stauchmoräne entstanden. Die<br />
Moräne besitzt eine Höhe von siebzig Metern, durch Sand und Geröll<br />
aufgestaut. Unser Fremdenführer bezeichnete den Namen als Numataka „Berg<br />
über der Endmoräne“. Einen herrlichen natürlichen Aussichtspunkt über die<br />
Elbe und den Innenstadtkern von Hitzacker bildet <strong>das</strong> Wahrzeichen – der<br />
Weinberg. Er heißt nicht nur so, sondern hier werden wirklich 99 Weinreben<br />
gehegt und gepflegt, es gibt sogar eine Weinprinzessin und jährlich wird die<br />
Lese mit einem Stadtfest gefeiert. Bis 1460 stand auf dem Weinberg eine<br />
holzbefestigte Burganlage. Steigt man von dort in die Stadt hinab über einen<br />
romantischen Pfad führt der Weg vorbei am Zwergenbrunnen. Der<br />
Innenstadtkern wird durch alte schöne Häuser geprägt, die mit der Geschichte<br />
Hitzackers einhergehen. Die Stadtbesichtigung direkt oder auch vom Weinberg<br />
aus mit vielen interessanten Informationen beendeten den ersten Tag zusammen<br />
mit einem angenehmen Aben<strong>des</strong>sen in unserem Hotel.<br />
90
Der 09. September führte die Reisegesellschaft in die Gräflich von<br />
Bernstorff‘sche Forstverwaltung in den Gartower Wald. Der Besitzer und<br />
Forstbetriebsleiter Andreas Graf von Bernstorff gab einen kurzen<br />
geschichtlichen Abriss über die Forstverwaltung, die eng mit der<br />
Familiengeschichte verbunden war.<br />
Schon im <strong>Jahr</strong>e 1694 kam durch Andreas Gottlieb von Bernstorff der Besitz in<br />
die Familie. Er setzte Grenzsteine, klärte die Lage und setzte Strukturen der<br />
Entwicklung fest. Er baute außerdem die Wasserburg und Gebäude <strong>des</strong> heutigen<br />
Familiensitzes. Alle Besitzer der Familie setzten immer auf Kontinuität,<br />
Flexibilität und Tradition. Der Gartower Wald bestand ursprünglich aus Heiden<br />
und Mooren, bis zum Ende <strong>des</strong> 18. <strong>Jahr</strong>hunderts gab es hier keine planmäßige<br />
Forstwirtschaft. Nur die Hälfte der Fläche war mit etwas Kiefer, Eiche, Birke<br />
und Erle locker bestockt. Der erste Schritt zu einer planmäßigen Forstwirtschaft<br />
wurde mit dem Anlegen von Entwässerungsgräben getan. Unter Oberförster<br />
Schmidt setzte um 1830 mit Aufgabe der landwirtschaftlichen Vorwerke in Wirl<br />
und Rucksmoor eine Aufforstung ein, die bis zum <strong>Jahr</strong>e 1870 im Wesentlichen<br />
abgeschlossen war. Anfang <strong>des</strong> 20. <strong>Jahr</strong>hunderts setzte unter dem reitenden<br />
Oberförster C. Junack die Durchforstung durch Bestan<strong>des</strong>pflege ein. Er<br />
promovierte im hohen Alter und <strong>das</strong> Werk „Waldwirtschaft im 18. <strong>Jahr</strong>hundert“<br />
zeugt von seinem großartigen zukunftsorientierten Schaffen. Die Kiefer wurde<br />
in diesem Gebiet zwischen 1900 und 1940 im Kahlschlagsverfahren<br />
91
ewirtschaftet und meist mit breitwürfigen Streifensaaten im Pflugstreifen oder<br />
Ballenpflanzen wieder begrünt. Die Ergebnisse waren in guter, manchmal auch<br />
hervorragender Qualität. Das Gebiet ist geprägt von ausgedehnten Talsandgebieten<br />
mit geringen Erhebungen, entstanden durch die Dünenbildung. Die<br />
Geschichte <strong>des</strong> Betriebes setzte sich fort mit der Übernahme im <strong>Jahr</strong> 1972 von<br />
Andreas Graf von Bernstorff. Im gleichen <strong>Jahr</strong> erlebte der Betrieb einen Sturm<br />
mit erheblichen Schäden, kaum drei <strong>Jahr</strong>e später brannte der Wald auf 600 ha<br />
ab. So entstand auf Freiflächen eine Naturverjüngungswirtschaft, die sich sehen<br />
lassen kann. Die Naturverjüngung wurde fast flächendeckend übernommen und<br />
auf Einzelflächen mit ertragsreichen Nadelhölzern z. B. Douglasie unterbaut.<br />
Eine Stichprobeninventur im Betrieb von 1988 wurde im <strong>Jahr</strong> 2008 wiederholt.<br />
Die Zuwächse übersteigen bei weitem die Erwartungen. Die<br />
Bewirtschaftungsweise erfolgt durch die Auswahl von Pflegeblöcken, die in<br />
einem Rhythmus von fünf <strong>Jahr</strong>en wiederholt wird, so entsteht eine intensive<br />
Entwicklung mit enormen Ergebnissen.<br />
Graf von Bernstorff begleitete uns im Bus zum ersten Exkursionspunkt. Die<br />
Fahrt dorthin schien sehr kurzweilig, da er mit eindringlichen Worten über<br />
seinen Besitz sprach bis zu einem bestimmten Punkt.<br />
92
An seinem Besitz befindet sich <strong>das</strong> Atommüll-„Endlager“ Gorleben, die<br />
Reisegesellschaft hatte bereits auf dem Weg dorthin schon eine ganze Menge<br />
gehört und gesehen.<br />
Gorleben, ein kleiner Ort, in dem ca. 300 Einwohner wohnen, ist verbunden in<br />
Medien und Presse mit diesem atomaren Zwischen- und Endlager. Gelbe Kreuze<br />
zeigen den Protest der Einwohner und die ständige Präsenz der Polizei am<br />
Endlager wirkte befremdend. Wir waren nur Gäste <strong>für</strong> eine kurze Zeit, doch<br />
dieses Erlebnis stimmte doch sehr nachdenklich. Graf von Bernstorff besitzt<br />
Schürfrechte <strong>für</strong> den Salzstock in Gorleben, der als Endlager dienen soll, hier<br />
besteht der Wunsch Salz zu gewinnen, ständige Anträge wurden negativ<br />
beschieden. Die Familie <strong>des</strong> Grafen von Bernstorff kämpft seit vielen <strong>Jahr</strong>en<br />
zusammen mit der Bevölkerung dieser Region gegen <strong>das</strong> Zwischen- und<br />
Endlager Gorleben.<br />
93
Herr Ralf Abbas, Betriebsleiter <strong>des</strong> Forstbetriebes, führte die Exkursion fort. Mit<br />
einer Betriebsfläche von 5.700 ha und einem weiteren Revier in Sachsen-Anhalt<br />
von 350 ha ist der Aufgabenschwerpunkt abgesteckt. Der Gesamtbetrieb wird<br />
nach den Grundsätzen der ANW ohne Kahlschlag bewirtschaftet.<br />
Der erste Exkursionspunkt beinhaltete ein Waldbild, <strong>das</strong>s neue Wege in der<br />
Erstdurchforstung der Kiefer zeigte. Die Kiefernbestände waren mit 10-15.000<br />
Kiefern pro Hektar begründet worden, bisher war keine kostendeckende<br />
Durchforstung möglich, erst mit der Auswahl verschiedener Arbeitsverfahren<br />
und Eigenvermarktung gelang es, einen positiven Deckungsbeitrag zu<br />
erwirtschaften. Ziel dieser Bestände ist der Aufbau von mehrstufigen<br />
Bestan<strong>des</strong>strukturen. Die Waldbrandkontrolle wird zurzeit von mit Personal<br />
besetzten Wachtürmen auf mit Kameras bestückte umgestellt. Neben der<br />
forstlichen Tätigkeit spielt die Jagd eine besondere Rolle. Im <strong>Jahr</strong> werden im<br />
Betrieb ca. 650 Stück Schalenwild (Damwild, Rotwild, Schwarzwild und<br />
Muffel) erlegt. Auch hier erfolgt der überwiegende Teil der Vermarktung durch<br />
den eigenen Hofladen.<br />
94
Der nächste Punkt war sehr interessant, sicher auf kleiner Fläche und bei<br />
optimaler Nutzung <strong>des</strong> vorhandenen Bestan<strong>des</strong>, öffnete man doch den Horizont.<br />
Wald besteht eben nicht nur aus Bäumen, auch unter und bis Kniehöhe findet<br />
man Produkte, die zu vermarkten sind. Herr Abbas zeigte uns Nebennutzungen,<br />
deren finanzielle Ergebnisse, jährlich wiederkehrend, nicht zu unterschätzen<br />
sind.<br />
So werden jährlich nicht nur unterschiedliche Holzsortimente vermarktet,<br />
sondern auch Saatgut gewonnen, Wildlinge geworben, Heidelbeersträucher,<br />
Moos und Reisig vermarktet. Einen Verkauf <strong>des</strong> Holzes in Containerform wird<br />
jährlich in mehreren Tausend Festmetern weit über Europa hinaus organisiert.<br />
Herr Abbas gab der Reisegesellschaft noch so viele Informationen über<br />
Holzernte, Holzverkauf, Naturschutz und seine Konflikte, die man an dieser<br />
Stelle nicht alle aufzeigen kann.<br />
95
Ein sehr interessanter Punkt war die Bereitstellung eines markanten<br />
Altholzbestan<strong>des</strong> <strong>für</strong> die Nutzung als Ruheforst. Die Fläche umfasst acht Hektar,<br />
wurde aus der Nutzung genommen. Es dauerte eine geraume Zeit, um diese<br />
Fläche dieser Nutzung zuzuführen, neben der Beteiligung von 32 Verbänden,<br />
Beachtung <strong>des</strong> Friedhofgesetzes, wurde ein Baumkataster erstellt. Das Konzept<br />
wurde durch die Firma „Ruheforst“ vorgegeben. Eine Grabstätte besteht aus<br />
einem Baum mit zwölf Einzelgräbern, die Zählung im Norden beginnend und<br />
auf 99 <strong>Jahr</strong>e festgelegt. Kleine Tafeln am Baum befestigt, zeigen den Namen,<br />
<strong>das</strong> Geburts- und Sterbejahr <strong>des</strong> Beigesetzten. Es besteht die Möglichkeit, eine<br />
Einzelgrabstätte oder einen Baum mit 12 Grabstätten (Familien) käuflich zu<br />
erwerben. Man nimmt davon Abstand, künstliche Blumen oder Gestecke<br />
abzulegen, sollte es doch vorkommen, werden diese nach einer gewissen Zeit<br />
geräumt. Die beigesetzten Urnen bestehen aus Holz, Ton oder Zellulose. Der<br />
Wald bleibt in seiner Ruhe und Vergänglichkeit erhalten.<br />
96
Dieser Punkt regte zum Nachdenken an, keiner möchte gern über dieses Thema<br />
reden, doch dieser schöne Ort mit den alten Bäumen ist eine echte Alternative zu<br />
vorhandenen Friedhöfen und eine Anregung, auch im Land Thüringen solche<br />
Möglichkeiten in Erwägung zu ziehen.<br />
Noch ein bisschen nachdenklich fuhr die Reisegesellschaft zurück zur Gräflich<br />
v. Bernstorff‘schen Forstverwaltung Gartow, nach einem guten Mittagessen und<br />
dem traditionellen Jagdhornblasen, zum Abschied vor einer herrlichen Kulisse,<br />
wobei sogar Graf von Bernstorff mitblies, führte uns die Fahrt am Nachmittag<br />
weiter in <strong>das</strong> niedersächsische Forstamt Göhrde.<br />
Im Wald begrüßte uns Herr Kelm – Funktionsbeamter <strong>für</strong> Waldnaturschutz –<br />
nach seiner Auskunft der „Ökofuzzi“ <strong>des</strong> Forstamtes. Herr Ebeling, der<br />
Revierleiter <strong>des</strong> Revieres, war ebenfalls anwesend. Das Forstamt Göhrde<br />
umfasst eine Fläche von 19.000 ha, die Hauptbaumarten setzen sich aus Kiefer,<br />
Erle und Esche zusammen, der Einschlag beläuft sich auf vier bis fünf Festmeter<br />
pro <strong>Jahr</strong> und Hektar. Wir befanden uns auf dem Ventower Berg, der vor ca. 200<br />
<strong>Jahr</strong>en noch Acker war und königliche Schäferei. Es erfolgte eine<br />
Kiefernaufforstung auf einer Endmoräne. Vorherrschend sind arme Sande mit<br />
Lehmlinsen, der Standort wird in die mittlere Nährstoffversorgung eingestuft.<br />
97
Es ist nunmehr schon die zweite Waldgeneration, die dort stockt. Der Bestand<br />
mit 23 Hektar setzt sich aus Stieleiche, Birke, Buche und Kiefer im Altbestand<br />
zusammen. Der Eichelhäher war in erster Linie Verbreiter <strong>für</strong> die Eicheln, bei<br />
Mastjahren konnte deutlich registriert werden, <strong>das</strong>s es auch ein übergroße Zahl<br />
an Eichelhähern gab. Sie lagern die Eicheln in Blaubeerkraut ab, dort bestehen<br />
die besten geschützten Wuchsbedingungen. Der lockere Stand <strong>des</strong> Kiefernaltbestan<strong>des</strong><br />
brachte genügend Licht und unumgänglich war eine massive<br />
Rehwildbejagung während <strong>des</strong> Aufwuchses der Eichen. Heute sind ca. 70 bis 90<br />
Z-Stämme der Kiefer im Altbestand vorhanden. Die Buche wurde durch<br />
Pflanzung eingebracht, die Rückegassen gemulcht und die letzte Durchforstung<br />
wurde im <strong>Jahr</strong> 2004 durchgeführt, die nächste ist im <strong>Jahr</strong> 2011, zusammen mit<br />
einer Ausleseläuterung zur Förderung der Eiche, zur ersten Zielstärkennutzung<br />
der Kiefer geplant. Die Rückung wird mit einem Pferd durchgeführt, pro<br />
Festmeter werden ca. 5 € angenommen. Eine Leistung pro Pferd und Stunde<br />
wird mit 6,5 Festmeter geplant. Bei Einspännern wird mit 25 €, bei<br />
Zweispännern mit 30 € pro Stunde gerechnet. Für den Gesamtbestand wurde die<br />
Entscheidung getroffen, <strong>das</strong>s die Eiche verbleiben soll und die Altkiefer<br />
schrittweise über mehrere <strong>Jahr</strong>e entnommen wird.<br />
Der zweite Punkt führte uns zur Pretzeter Landwehr.<br />
98
Die Geschichte <strong>des</strong> Wal<strong>des</strong> begann ebenfalls durch eine Aufforstung vor 200<br />
<strong>Jahr</strong>en. Es wurde von einem historischen, alten Waldstandort gesprochen auf<br />
einer Fläche von 250 ha, davon sind 100 ha Naturwaldreservat ausgewiesen.<br />
Die Standorte sind Talsande mit hoch anstehendem Grundwasser, in nassen<br />
<strong>Jahr</strong>en sogar oberflächennah. Die Buche findet man sehr selten, maximal auf<br />
kleineren Höhen, die Hainbuche ist in Beimischung vorhanden und die<br />
Bezeichnung ist ein armer Eichen – Hainbuchenwald.<br />
Das erste Naturwaldreservat umfasste einen früheren Hutewald. Zur Erforschung<br />
<strong>des</strong> Gebietes wurden Dauerprobeflächen eingerichtet und eine<br />
regelmäßige Probekreisinventur wird durchgeführt.<br />
99
Ein Hauptergebnis bei der Erforschung von Naturwäldern in Niedersachsen ist<br />
der Nachweis, <strong>das</strong>s fast auf allen Flächen die Buche vorhanden ist. Vereinzelt<br />
kommen Moorbirken vor. In den Naturwäldern wird nicht gepflegt und nicht<br />
gepflanzt. Die Einrichtung von Weisergattern <strong>für</strong> die Kontrolle von<br />
Naturverjüngungen sind wichtig, um den Verbissdruck einschätzen und die<br />
entsprechende Jagdintensität nachsteuern zu können. Wildarten wie Dam-, Rot-<br />
und Rehwild finden hier ihren Lebensraum. Der Naturwald in Niedersachen<br />
dient der Forschung und Entwicklung.<br />
Ein schöner Morgen mit Sonnenschein begrüßte die Reisegesellschaft am 10.<br />
September <strong>2010</strong>. Die Fahrt ging zum Forstamt Uelzen. Der Vormittag führte die<br />
Reisenden in ein Gebiet der Waldmärker Uelzen und zeigte durchorganisierten<br />
Technikeinsatz mit höchster Wertsteigerung. Neben den Erläuterungen durch<br />
den Forstamtsleiter Herrn Menge, dem Revierleiter Herrn Friebe, Dr. Markus<br />
Hecker, Geschäftsführer der Forstwirtschaftlichen Vereinigung Lüneburg<br />
(FVL), und Herrn Hoffmann, Einsatzleiter, führte die vor Ort stationierte<br />
Holzerntetechnik und Transporttechnik anschaulich vor.<br />
Die Vereinigung der Waldmärker benötigt keinen Holzhändler. Der Grundsatz<br />
der Frei-Werk-Lieferung gilt <strong>für</strong> alle laufenden Lieferverträge. Der Revierleiter<br />
bereitet den Einsatz vor.<br />
100
Es werden Übersichtskarten erstellt, die Arbeitsblöcke von 20 bis 30 Hektar<br />
beinhalten, außerdem werden die Sortimente als Bezugspunkt (Bedarfsermittlung<br />
mit der Holzindustrie), Einsatzplanung festgelegt und Arbeitsaufträge<br />
erteilt. Der Einsatz erfolgt dann mit zwei Harvestern, zwei Forwardern und<br />
sechs LKW mit 39 Trailern.<br />
Die LKW werden durch Unternehmer abgesichert, die sofort den Abtransport<br />
übernehmen. Das Trailersystem erfasst 90 % und die Lagerung im Wald 10 %<br />
<strong>des</strong> Stammholzes. Die Rückemaschine beinhaltet Kosten in Höhe von 80 € pro<br />
Stunde, die <strong>des</strong> Trailers 30 € pro Stunde. Die örtlichen Voraussetzungen sind<br />
zum einen ein ausreichen<strong>des</strong> Lichtraumprofil, trockene LKW-befahrbare Wege,<br />
es werden keine Kräne benötigt, die Trailer werden sofort bestückt, zum anderen<br />
sind die Zeiteinsparung und Nachfolgekosten bei Holzlagerungen enorm. Die<br />
Vermessung erfolgt neben dem Harvester auch durch eine<br />
Werkseingangsvermessung. Die Kontrolle erfolgt fünffach durch den Rücker,<br />
den Fuhrmann, <strong>das</strong> Werk, den Revierleiter und die Zentrale. Der Revierleiter ist<br />
der Endkontrolleur, der <strong>das</strong> Harvesterprotokoll mit dem Lieferschein, die<br />
Nummernbücher und <strong>das</strong> Werkseingangsmaß vergleicht: Erst dann erfolgt die<br />
Meldung zur Endabrechnung an die Zentrale. Die LKW werden maximal mit 40<br />
Tonnen beladen, <strong>das</strong> System arbeitet in Doppelschichten. Der Souverän ist<br />
immer der Revier- und Waldbesitzer.<br />
101
Es dauerte sehr lange bei den Privatwaldbesitzern, bevor <strong>das</strong> Techniksystem<br />
zum Einsatz kam. Der Revierleiter führte die Besitzer soweit durch eine gezielte<br />
Öffentlichkeitsarbeit, wenn es sein musste auch mit jedem Einzelnen.<br />
Die aufwändige Vorarbeit hat sich am Ende doch gelohnt. Die Ausschreibung<br />
von Unternehmern entfällt, es werden gleiche Unternehmen angeheuert und<br />
gehalten. Grundsätzlich spricht man von einer Dienstleistung nicht von<br />
Selbstwerbung. Es werden Direktverträge mit der Industrie abgeschlossen. Die<br />
Summe der betreuten Fläche beläuft sich in der Zwischenzeit auf 50.000 ha, im<br />
Revier gehören zu 2.500 ha ca. 300 Waldbesitzern, die zufrieden sind mit den<br />
Ergebnissen.<br />
Nach einer kurzen Busfahrt nach Höhenbünsdorf zum Gasthaus Wilhelms,<br />
stellte Forstamtsleiter Herr Menge ein paar Eckzahlen zum Forstamt Uelzen vor.<br />
Das Forstamt Uelzen der Landwirtschaftskammer Niedersachen mit 20<br />
Bezirksförstereien betreut rund 6.000 Waldbesitzer mit insgesamt 61.000 ha<br />
Privat- und Körperschaftswald. Die Privatwaldbetreuung erfolgt in Kooperation<br />
mit der FVL (Forstwirtschaftliche Vereinigung Lüneburger GmbH). Der<br />
Forstamtsbezirk Uelzen erstreckt sich über den Landkreis Uelzen, Großteile <strong>des</strong><br />
Landkreises Lüneburg und Teilbereiche von Lüchow-Dannenberg.<br />
102
Im Zuständigkeitsbereich liegt die FVL mit der Waldmärkerschaft Uelzen eG<br />
und fünf weiteren Forstbetriebsgemeinschaften.<br />
Das Forstamt befindet sich im Wuchsgebiet Ostniedersächsisches Tiefland, <strong>das</strong><br />
Klima ordnet sich im Übergang von atlantischem zum kontinentalen Klima ein,<br />
Niederschläge liegen bei 500 bis 650 mm bei einer mittleren <strong>Jahr</strong>estemperatur<br />
von 8,5 °C. Die maximale Höhe bis zu 135 m über NN werden erreicht, <strong>das</strong><br />
Uelzner Becken mit Höhenlagen von bis zu 50 m über NN ist als<br />
Endmoränengebiet überwiegend mit Wald bedeckt.<br />
Am Fuße dieser Endmoräne entspringen viele Flüsse, die sich in <strong>das</strong> Elbe-<br />
Urstromtal ergießen. Die Waldgeschichte ist durch die Salzgewinnung im frühen<br />
Mittelalter geprägt. Der enorme Holzverbrauch führte zu großräumig<br />
devastierten Flächen, es entwickelte sich eine karge Landschaft. Die<br />
Wirtschaftszweige änderten sich zu Schafzucht, Bienenweide, Flachsanbau und<br />
kargem Ackerbau. So prägten großflächig Heidelandschaften <strong>das</strong> Bild.<br />
Mitte <strong>des</strong> 19. <strong>Jahr</strong>hunderts entstanden großflächige Pionierwälder aus Kiefer.<br />
Die Hauptbaumart im Forstamt ist die Kiefer mit 74 %. Die Rohholzsortimente<br />
teilen sich momentan so auf: Dem Sägeholz sind 54 % und dem Industrieholz 46<br />
% zuzuordnen.<br />
Es wird auf lange Frist durch <strong>das</strong> Hineinwachsen der Bestände in höhere<br />
Altersklassen eine Verschiebung in Richtung Sägeholz geben, was sich natürlich<br />
<strong>für</strong> eine bessere Ertragssituation <strong>für</strong> den Waldbesitzer widerspiegelt. Zurzeit<br />
wachsen rund 7 Efm/ha zu und in Nutzung sind 4,5 Efm/ha, <strong>das</strong> führt zu einem<br />
langfristigen Vorratsaufbau.<br />
Die direkten Ansprechpartner sind die Bezirksförster vor Ort <strong>für</strong> die<br />
Waldbesitzer <strong>für</strong> Aufgabenbereiche der Bereitstellung und Vermarktung von<br />
Rohholz, Planung und Durchführung waldbaulicher Maßnahmen, Beratung und<br />
Dienstleistung in allen Fragen der forstlichen Förderung, forstlicher Wegebau,<br />
Waldschutz, Waldkalkung, Vertrags-Naturschutz, fachbehördliche Aufgaben,<br />
Stellungsnahmen als Träger öffentlicher Belange und Waldbrandvorsorge.<br />
103
Im Anschluss berichtete Dr. Markus Hecker über die Forstwirtschaftlichen<br />
Vereinigung Lüneburg (FVL). Die Mitgliedsfläche beläuft sich auf 55.000 ha<br />
mit rund 2.500 Mitgliedern und einer jährlichen Holzvermarktung von 280.000<br />
Festmetern. Er stellte noch einmal den Technikkomplex vor und den Aufbau der<br />
Geschäftsstelle.<br />
Die Geschäftsstelle ist folgendermaßen in ihren Aufgabenbereichen gegliedert:<br />
Finanzbuchhaltung (Abschlussarbeiten, Steuerwesen, Lohn- und Anlagenbuchhaltung,<br />
Kontenführung und Zahlungsverkehr), Fuhrpark, Forstbuchhaltung<br />
(Holzverkauf und -abrechnung, EDV Steuerung, Unternehmereinsatz,<br />
Abrechnung, Werksgutschriften). Alle Mitarbeiter der Geschäftsstelle<br />
unterlagen einer kaufmännischen Aus- und Fortbildung z.B. Lehre zum Großhandelskaufmann,<br />
Warenfachkaufmann, Handelsfachwirt, Betriebswirt bis zum<br />
Bilanzbuchhalter. Folgende Aufgabenbereiche umfasst die FVL: forstfachliche<br />
Betreuung, Absatz <strong>des</strong> Rohholzes, Beschaffung und Einsatz von Maschinen,<br />
Frei-Werk-Lieferung von Rohholz, Fakturierung und Abrechnung, Vorfinanzierung<br />
von Maßnahmen, Übernahme <strong>des</strong> Förderungsausfallrisikos,<br />
Geschäftsbesorgung <strong>für</strong> Gesellschafter usw.<br />
104
Nach einem anschließenden Mittagessen verließen wir dieses Gebiet und fuhren<br />
in die Stadt Lüneburg zu einer Besichtigung.<br />
Das Rathaus von Lüneburg stammt aus der Backsteingotik, ein sehr imposantes<br />
und beeindrucken<strong>des</strong> Gebäude, eine Führung brachte uns diesen äußeren<br />
Eindruck noch näher. Der älteste erhaltene Bauteil ist <strong>das</strong> Gewandhaus aus dem<br />
frühen 13. <strong>Jahr</strong>hundert, die Gerichtslaube mit den Glasfenstern aus dem 14.<br />
<strong>Jahr</strong>hundert, zusammen mit dem Fußboden- und Heizsystem sowie die Decken-<br />
und Wandmalereien der Renaissance. Erste Erwähnung fand Lüneburg um 956,<br />
als sehr reiche Stadt aufgrund <strong>des</strong> weißen Gol<strong>des</strong> – durch <strong>das</strong> Salz erreichte im<br />
14. bis 16. <strong>Jahr</strong>hundert die Hansestadt Lüneburg einen großen Bekanntheitsgrad.<br />
Am Rathaus wurde fast 500 <strong>Jahr</strong>e gebaut und es wurde während <strong>des</strong> Krieges<br />
nicht zerstört. Das Rathaus ist eines der größten in Deutschland. Der Rundgang<br />
ging weiter im Gewandhaus, hier wurde die Decke erst 1956 gemalt. Der<br />
Silberschatz von Lüneburg war legendär, von 250 Stücken sind nur noch 38<br />
übrig geblieben. Die Originale befinden sich in Berlin, im Gewandhaus findet<br />
man nur noch Kopien dieser Stücke. Der nächste Punkt war die Gerichtslaube,<br />
die 1330 erbaut wurde. Hier fanden die Gerichtstage statt, der Sitz der<br />
Ratsherren, die über die Bürger richteten, eine herrliche Decken- und<br />
Wandbemalung ziert den Raum und die neun guten Helden (drei Juden, drei<br />
Christen, drei Heiden) finden sich im Fensterbild wieder, dieses kommt aus<br />
Frankreich.<br />
105
Ein Bild „Weltgerichtsbild“ symbolisiert die Gerechtigkeit (irdisch und<br />
himmlisch). Ein Spruch bestimmt die Bedeutung dieses Raumes: „Lasse<br />
Gerechtigkeit walten, höre auch den anderen Teil, Gerechtigkeit <strong>für</strong> alle Seiten“.<br />
Fast versteckt in den Wänden befinden sich Schränke auf der einen Seite <strong>für</strong> die<br />
früheren Gerichtsakten, auf der anderen Seite <strong>für</strong> die Aufbewahrung <strong>des</strong><br />
Silberschatzes, die bei Besuchern nur zur Präsentation geöffnet wurden.<br />
Aufmerksamkeit im Auge <strong>des</strong> Betrachters zieht der Steinfußboden auf sich,<br />
dreidimensionale Würfel werden gezeigt, die augenscheinlich zu einer Treppe<br />
ansteigen, außerdem sind ein Kleeblatt und der belgische Löwe eingearbeitet.<br />
Eine massive Eichentür ziert den Raum, die durch eine überlegte Bauweise mit<br />
steinernen Begrenzungen nicht aus den Angeln gehoben werden kann. Dahinter<br />
befindet sich zur Sicherheit noch eine Metalltür. Die Körkammer diente zur<br />
Wahl der Bürgermeister und Ratsherren, nur wer Salz herstellte, kam als solcher<br />
in Betracht. Es befinden sich drei Türen hintereinander, absolut abhörsicher, die<br />
Wahl war nur bei Einigkeit gelungen. Die Fensterbilder in diesem Raum stellten<br />
die Erbauer (Ratsherren) der Gerichtslaube dar. Die kleine Schreibstube wurde<br />
1450 erbaut, später als Abstellkammer genutzt, hinter der Gitterwand saßen der<br />
Notarius und die Ratsherren. Auch hier befinden sich Einbauschränke und ein<br />
Schlüsselschrank, der nur durch den Notarius geöffnet werden durfte. Im 17.<br />
<strong>Jahr</strong>hundert sammelte man in den Kästen Rechnungen, die noch bezahlt werden<br />
mussten.<br />
Salz befindet sich flüssig unter der Stadt und wird als Sole abgebaut, unter dem<br />
Rathaus befinden sich nach 40 Metern Sand geschätzte vier km Salzlager. Laut<br />
einer Sage entdeckte ein Wildschwein diese Sole und wurde bekannt als die<br />
„Lüneburger Salzsau“, die knöchernen Überreste hängen in diesem Raum. Bei<br />
schwereren Bestrafungen wurde außerhalb der Stadt geköpft, auf der Straße<br />
befand sich der Schandpfahl, bei größeren Strafen wurde zusätzlich eine<br />
Schandflasche dem Menschen an den Hals umgehängt mit sehr großem<br />
Gewicht. Geständnisse wurden zum Teil erzwungen, u.a. findet man in der<br />
Ausstellung heute noch Foltergeräte wie Daumenschrauben. Ein sehr imposanter<br />
Saal ist der 1450 erbaute Festsaal mit einer selbsttragenden Decke. Die<br />
damaligen Feste bestanden aus 20-30 Gängen. Sitzbänke befinden sich rings um<br />
den Saal angeordnet, Fußbänke schützen vor der Kälte <strong>des</strong> Steinfußbodens. Auf<br />
den Wänden befinden sich die Bilder von den Herzögen von Lüneburg und<br />
Braunschweig, alle etwas anders als naturgegeben dargestellt, meist sehr<br />
elegant, majestätisch und wohlhabend. Die Beleuchtung erfolgte durch Kerzen,<br />
wenn alle brannten, leuchteten 300 Kerzen den Festsaal aus. Für die damalige<br />
Zeit schon ein Vermögen.<br />
106
Heute wird der Raum <strong>für</strong> besondere Empfänge <strong>des</strong> Bürgermeisters genutzt – der<br />
Fürstensaal – häufig finden hier auch Konzerte statt. Der Ausgang im Flur<br />
wurde durch <strong>das</strong> Bild „Der gute und der schlechte Richter“ von Daniel Freese<br />
begleitet. Anschließend zeigte man uns die große Ratsstube im Ratshaus, die<br />
1560 erbaut und erst im 18 <strong>Jahr</strong>hundert fertig gestellt wurde. Grund waren die<br />
aufwendigen Schnitzereien aus Eiche zum Thema Gerechtigkeit, auch hier malte<br />
Freese die Bilder. Das erste Bild zeigte <strong>für</strong> die Stadt Lüneburg symbolisch <strong>das</strong><br />
Gemeinwesen, die Eintracht, den Frieden und die Gerechtigkeit. Das zweite Bild<br />
stellte die tugendhafte Stadt Lüneburg dar und <strong>das</strong> dritte Bild eine allgemeine<br />
Darstellung. Die Schnitzereien aus Eiche zeigen wieder die neun guten Helden<br />
(drei Juden, drei Christen, drei Heiden) auf der einen Seite und Jesus auf dem<br />
Regenbogen aus einem Stück Eiche geschnitten auf der anderen Seite.<br />
Nach der Führung im Rathaus besuchte die Reisegesellschaft, jeder <strong>für</strong> sich die<br />
Stadt Lüneburg auf Schusters Rappen, man stellte wieder fest, <strong>das</strong>s die Zeit viel<br />
zu kurz war, um alle Sehenswürdigkeiten anzusehen, doch es blieben<br />
unvergessene Eindrücke dieser hübschen, altehrwürdigen Hansestadt.<br />
107
Der neue Tag, der 11. September <strong>2010</strong>, lies uns mit einem Gästeführer<br />
zusammentreffen, dem schon einiges in seinem Leben widerfuhr. Der Weg<br />
führte uns wieder in <strong>das</strong> niedersächsische Forstamt Göhrde, die Göhrde wird<br />
alters her immer mit dem Kaiser in Verbindung gebracht, der Forstamtsleiter<br />
übernimmt sogar heute noch in gemeindefreien Teilen die Pflichten eines<br />
Bürgermeisters.<br />
Herr Peter Brauer erzählte uns aus seiner Lebensgeschichte einige Episoden u.<br />
a., <strong>das</strong>s er als armer, meist hungriger junger Mann hier in der Gegend ankam<br />
und immer durch die Küchendamen in seiner Unterkunft unterstützt wurde. Er<br />
sagte: „Jeder Jüngling hat einen Hang zum Küchenpersonal.“ Am Anfang fand<br />
keine Besiedlung in der Göhrde statt, es gab lange Wassermangel, also wurde<br />
<strong>das</strong> Gebiet anderer Nutzung zugeführt. Unser zweiter Begleiter war wieder<br />
Hans-Jürgen Kelm aus dem Forstamt, wir besuchten während der Wanderung<br />
<strong>das</strong> Naturschutzgebiet Breeser Grund, die letzte offene Heidelandschaft, Eiche<br />
mit einem sehr milden Holz säumte die Flächen, <strong>das</strong> zum Schnitzen verwendbar<br />
war (meist in Kirchen zum Schnitzen von Figuren verwendet) und mit einer<br />
Umtriebszeit von 150 <strong>Jahr</strong>en Spitzenwerte erreichte. Die spätere<br />
Heidelandschaft wurde <strong>Jahr</strong>hunderte von den Bauern <strong>des</strong> Gebietes zur<br />
Weidewirtschaft genutzt, schon damals standen auf der Heidefläche alte<br />
breitkronige Eichen, deren Eicheln im Herbst <strong>für</strong> die Mast der Schweine genutzt<br />
wurden. Im <strong>Jahr</strong> 1885 kauften die kaiserlichen Hofjäger die Weiderechte den<br />
108
Bauern ab. Die Eicheln sollten nun dem Wild zugutekommen, in den<br />
Kaiserjagden trieb man in großer Anzahl Hirsche und Wildschweine in<br />
Wildgattern zusammen, fütterte sie an, um später bei einem Zwangswechsel der<br />
Lappjagd große Jagderfolge vorzuweisen. Die letzte Rotwildjagd fand 1913 an<br />
diesem Platz statt. Schon 1848 wurde <strong>das</strong> Jagdrecht <strong>des</strong> Adels abgeschafft und<br />
an den Grund und Boden gebunden. Die Göhrde wurde 1849/50 eingezäunt, ab<br />
1850 bis 1918 bestand ein Wildgatter, in dem <strong>das</strong> Wild gefüttert wurde. Danach<br />
fiel diese Nutzungsform weg und die Heide drohte durch Birken, Kiefern und<br />
Fichten zuzuwachsen.<br />
Der Schutz <strong>des</strong> Gebietes stand als oberstes Ziel fest und wurde in<br />
Managementplänen festgeschrieben, heute beweidet ein Schäfer dieses<br />
Naturschutzgebiet und damit wird die Heidelandschaft erhalten. Die Leitarten<br />
sind Hirschkäfer und Eremit. Der Lebensraum <strong>für</strong> die Nachtschwalbe, die<br />
Heidelerche, <strong>für</strong> Wald- und Zauneidechse, Blindschleiche und Glattnatter und<br />
nicht zuletzt <strong>für</strong> den Hirschkäfer bleibt so bestehen. Dieses Gebiet ist ornithologisch<br />
sehr interessant, denn neben Nachweisen von Mauersegler, Schwarzspecht<br />
in Buchen, sind Hohltauben, Rauhfußkauz, Mittelspecht und als Nachnutzer<br />
Hornissen und Ameisen bekannt. Bereits im 13. <strong>Jahr</strong>hundert nutzten die<br />
Bauern die Eichen mit einem Alter von ca. 250 bis 350 <strong>Jahr</strong>en, <strong>für</strong> jede Eiche<br />
mussten drei Eichenheister neu gepflanzt werden.<br />
109
Die Saateicheln wurden weiter gesammelt. Um der Traubeneiche eine gewisse<br />
Nährstoffzuführung zu geben, setzte man Phosphor ein. Ergebnis war <strong>das</strong><br />
übermäßige Ankommen von Blaubeersträuchern, was heute gerade in der<br />
Herbstzeit die Landschaftsästhetik in diesem Gebiet besonders hervorhebt. Das<br />
Vorkommen von Wacholder wurde durch einen Schmetterlingsfachmann<br />
nachgewiesen. Der Hirschkäfer kommt an Todholzbäumen vor, Probleme gab es<br />
durch den Fraß von Hirschkäferlarven durch die Wildschweine.<br />
Zum Schutz wurden Altholzkronenteile um den Stammfuß gezogen, die die<br />
Larven so schützten. Ein schöner Vormittag neigte sich dem Ende. Je<strong>des</strong> Bild<br />
dieser Landschaft prägte sich wie ein Postkartenfoto in <strong>das</strong> Gedächtnis ein.<br />
110
Mit einer Elbquerung durch eine Fähre setzte sich der Weg fort in <strong>das</strong> Amt<br />
Neuhaus, durch einen Staatsvertrag gelangte <strong>das</strong> Gebiet vom ehemaligen StFB<br />
Hagenow in den Besitz <strong>des</strong> Forstamtes Göhrde. Kiefern, vierter und schlechterer<br />
Bonität bestimmen auf einer Wanderdüne <strong>das</strong> Bild.<br />
Die Dünenstandorte werden freigehalten, um auch ärmste Standorte und seine<br />
Bewohner zu erhalten. Das Gebiet wird als Nichtholzboden eingestuft.<br />
111
Der nächste Punkt in der Exkursion war der Besuch der Stixer Wanderdüne,<br />
eine vom Wind aufgetürmte Düne, die nach der letzten Eiszeit entstanden ist.<br />
Durch Winderosion wurden Talsande vor ca. 10.000 <strong>Jahr</strong>en aus dem Elbe-<br />
Urstromtal fortgetragen, die gebildete Pflanzendecke in der Elbtalaue beendete<br />
den Vorgang.<br />
Das Gebiet stand schon 1977 unter Schutz, ab 1982 zum Naturschutzgebiet und<br />
im <strong>Jahr</strong> 1998 durch <strong>das</strong> Niedersächsische Umweltministerium zum Nationalpark<br />
Elbtalaue erklärt.<br />
Viele sehr seltene Arten sind in dieser Dünenlandschaft zu finden: die<br />
Heidelerche, der Ziegenmelker, Sandbienenarten, Wegwespen, Stierkäfer,<br />
Heuschrecken, Ameisenlöwen, Ödlandschrecken, Steppengrashüpfer usw. Nach<br />
der Verabschiedung von Herrn Kelm führte uns der Weg zum Schiffsanleger<br />
nach Bitter, hier setzten wir mit dem Schiff nach Dömitz bei einem guten Kaffee<br />
und Kuchen über.<br />
112
Das Schiff hieß MS Hilde und gehört zur Reederei A. Heckert, es wurde 1928<br />
bei der Schottewerft in Spay am Rhein gebaut. Die Fahrgebiete sind der Rhein,<br />
die Mosel, die Elbe bis nach Holland. Es gab 100 Salon- und 50 Freideckplätze.<br />
Von den Ausmaßen nahm <strong>das</strong> Schiff eine Länge von 25 Metern ein, die Breite<br />
lag bei sechs Metern und 0,8 Meter Tiefgang. Zwei Merce<strong>des</strong> Benz Motoren mit<br />
184 KW trieben <strong>das</strong> Schiff an. Für eine Gesamtauslastung von 150 Personen<br />
zugelassen, eignet es sich besonders zum Erkunden, Entdecken der einmaligen<br />
Flusslandschaft Elbe und ihrer vielfältigen abwechslungsreichen Naturräume.<br />
Die Gesamtlänge der Elbe ist mit 1.165 km und davon 700 km auf deutschem<br />
Gebiet festgeschrieben.<br />
113
Die Elbe ist der längste deutsche Fluss, sie hat durch die weltpolitischen<br />
Großereignisse <strong>des</strong> letzten <strong>Jahr</strong>hunderts ihre Ursprünglichkeit bewahrt.<br />
Der Flussabschnitt zwischen Hitzacker und Dömitz wird als Restausbaustrecke<br />
bezeichnet, dies bedeutet, <strong>das</strong>s die Elbe seit 1920 nicht mehr industriell<br />
ausgebaut wurde. Die Elbe war immer eine Schnittstelle <strong>des</strong> menschlichen<br />
Strebens. Römer - Christianisierung: Martin Luther; Zweiter Weltkrieg,<br />
deutsche Teilung, Kalter Krieg; Gorleben 1966, um nur einige Beispiele zu<br />
nennen. Die Stimmung kann man heute noch wahrnehmen. Der Bus brachte die<br />
Reisegesellschaft sicher und zuverlässig zurück nach Hitzacker, um den Tag bei<br />
einem schönen Aben<strong>des</strong>sen ausklingen zu lassen.<br />
114
Der Sonntag am 12. September <strong>2010</strong> verband die Abreise aus Hitzacker mit<br />
einem letzten Exkursionstag, der uns in Bleckede in die Elbaue zu einer<br />
Wanderung und zum Besuch <strong>des</strong> Informationszentrums Biosphärenreservat<br />
Niedersächsische Elbtalaue führte. Herr Klaus Koerth begrüßte die Reisegesellschaft.<br />
In diesem Gebiet ist die Graugans als Brutvogel und als Wintergans<br />
bekannt. Ein Altarm der Elbe bestimmt dieses Gebiet, der Deich selbst erbaut<br />
von den Einwohnern von Bleckede um <strong>das</strong> 16. <strong>Jahr</strong>hundert. Er wird heute mit<br />
Schafen beweidet. Im angrenzenden Hartholzauewald aus Eichen und Erlen<br />
brütet der Seeadler und findet eine Graureiherkolonie ihren Lebensraum.<br />
Nach mehreren Flutkatastrophen wurde der Deich in den 70-iger <strong>Jahr</strong>en erhöht<br />
und erneuert.<br />
Die Flussmarsch wird durch eine glaziale Landschaft geprägt und ist in der<br />
letzten Eiszeit entstanden, <strong>das</strong> Urstromtal lag hier in der Elbe. Die Vorkommen<br />
von Sanden ist hier typisch. Man spricht im Auwald von Qualm- und<br />
Grundwasser. Der Sand lässt Wasser durch den Deich in den Auwald sickern.<br />
Ein Sommerdeich ist ein kleinerer Deich im Vorland, der vor Sommerhochwasser<br />
schützen soll. Es ist etwas Natürliches, <strong>das</strong>s die Elbe Sommerhochwasser<br />
mittlerer Ausbildung führt. Im Winter ist es durchaus möglich, <strong>das</strong>s<br />
Eisschollen den Deich aufreißen und es zu einem Eisstau kommt, wie bei dem<br />
Eishochwasser 2003. In Sachsen-Anhalt wurden 2006 die Deiche erneuert und<br />
danach eine gemeinsame Hochwasserkommission der Anlieger gebildet.<br />
115
Neue Bibervorkommen sind festgestellt worden und werden gefördert. Das<br />
Gebiet weist unumstritten Besonderheiten auf, aber trotzdem gibt es an der einen<br />
oder anderen Stelle Diskussionen und Konflikte, wie z. B. <strong>das</strong>s <strong>das</strong> Abflussverhalten<br />
der Elbe sich geändert hat durch die Weichholzaue, die geschützt ist.<br />
116
Es kommt durch <strong>das</strong> Wachstum der Weichlaubholzaue im Vorland zu<br />
Verengungen, <strong>das</strong> bis zu einem halben Meter mehr Hochwasser erkennen lässt,<br />
laut einem Gutachten. Das Vorkommen <strong>des</strong> Bibers in der Fischereinutzung.<br />
Die Wanderung öffnet Horizonte, die Flugbilder der Gänse, die zwitschernden<br />
Vögel, <strong>das</strong> Sonnenlicht auf dem gleißenden Wasser und die Ruhe, alles <strong>das</strong> führt<br />
dazu, <strong>das</strong>s man wirklich die Gedanken loslassen kann und die zweistündige<br />
Wanderung sehr genoss. Eine Beweidung mit Kühen wird wegen der<br />
Dioxinbelastung vermieden. Es gab bei unserer Wanderung auch ein paar lustige<br />
Bemerkungen, die man an dieser Stelle anbringen kann: Herr Koerth bemerkte:<br />
„So ein großer weißer Vogel fällt durchaus auf“ …dabei… (Silberreiher) oder<br />
(Moorfrosch) „Zur Paarungszeit wird <strong>das</strong> Männchen blau …dabei… nur eine<br />
Woche blau – zur Abschreckung“.<br />
Die touristische Nutzung hat besonders in den letzten <strong>Jahr</strong>en zugenommen durch<br />
den Elberadwanderweg, er ist der beliebteste Radwanderweg Deutschlands. Die<br />
Wanderung führte weiter zum Schloss Bleckede, im 12. <strong>Jahr</strong>hundert erbaut als<br />
Wasserburg. Kurz vor dem Eingang der Wasserburg findet sich ein<br />
Brückenschlag nach Thüringen: Auf einem Schild ist der Peter-Eckermann-Weg<br />
beschrieben, ein enger Vertrauter Goethes, geboren in Winsen/Luhe.<br />
117
Im Schloss Bleckede wartete ein herrliches Mittagessen und später die<br />
Ausstellung <strong>des</strong> Biosphärenreservates Niedersächsische Elbtalaue auf die<br />
Reisegesellschaft. Ein Rundgang durch die Ausstellung vermittelte auf hohem<br />
Niveau die Themenbereiche, die <strong>das</strong> Biosphärenreservat Niedersächsische<br />
Elbtalaue beschreiben.<br />
Ein Gesamtüberblick, gezeigt durch ein Luftbild, beschreibt die Ausdehnungen<br />
<strong>des</strong> Gebietes. Das Fliegen fasziniert seit Menschengedenken und die<br />
schwingenden Federn beeindruckten. Die Naturnähe der Elbe ist von<br />
Großwetterlagen abhängig, es wurden Wasserüberflutungen am Modell gezeigt<br />
und ein Sommerhochwasser künstlich herbeigeführt, ein jahreszeitlicher<br />
Rundgang zeigte die Anwesenheit von verschiedenen Vögeln im <strong>Jahr</strong>esablauf,<br />
so die Bläßgans, die nur Wintergast ist, es kommen aber auch Saatgänse,<br />
Graugänse, der Große Brachvogel, der Grau- und Silberreiher und Kormorane<br />
vor. Nicht nur Rotmilan, auch seltene Vorkommen <strong>des</strong> Schwarzmilans und<br />
natürlich mit einer majestätischen Spannweite von 2,50 bis 2,60 Meter der<br />
Seeadler mit seinem keilförmigen Stoß. Alle Ausstellungsflächen kann man<br />
nicht beschreiben, die Vorstellung verschiedener Berufsgruppen wie Landwirt,<br />
Schäfer, Korbflechter, Reetdachdecker, Fischer usw. und ein Besuch in der<br />
Räucherkammer im Dachgeschoß mit interessanten Ausführungen zum<br />
1742/1743 errichteten Walmdach rundeten <strong>das</strong> Bild ab.<br />
118
Mit vielen Eindrücken der fünftägigen Exkursion fuhr die Reisegesellschaft<br />
zurück nach Thüringen.<br />
An dieser Stelle vielen Dank <strong>für</strong> die ausgezeichnete Organisation und gelungene<br />
Themenwahl, die sicher <strong>für</strong> die Organisatoren <strong>des</strong> <strong>Thüringer</strong> <strong>Forstvereins</strong> viel<br />
Zeit und Arbeit kostete. Die Mühe hat sich gelohnt! Herzlichen Dank an <strong>das</strong><br />
Busunternehmen Häfner <strong>für</strong> die freundliche, zuvorkommende und sichere<br />
Reisebegleitung durch ihren Mitarbeiter. Wir freuen uns schon auf die nächste<br />
Exkursion, bis dahin haben wir viele Höhepunkte dieser Reise in guter<br />
Erinnerung.<br />
Susanne Floßmann und Heiko Buse<br />
Fotos: Horst Geisler<br />
119
Jubilare<br />
<strong>2010</strong><br />
120
Wir gratulieren zum 50. Geburtstag<br />
Herrn Bernd von der Weth am 12.05.<br />
Frau Elke Sattler am 21.05.<br />
Herrn Andreas Uschmann am 04.08.<br />
Frau Niepagen Heike am 11.10.<br />
Herrn André Pasold am 22.12.<br />
Wir gratulieren zum 60. Geburtstag<br />
Frau Ingeborg Knoll am 18.01.<br />
Herrn Werner Aderhold am 21.02.<br />
Herrn Manfred Ziegenfuß am 14.06.<br />
Herrn Manfred Assmann am 01.07.<br />
Herrn Gert Nothnagel am 05.07.<br />
Herrn Reinhard Rother am 11.10.<br />
121
Wir gratulieren zum 65. Geburtstag<br />
Herrn Hanspeter Nicolai am 23.02.<br />
Herrn Martin Lapp am 01.09.<br />
Wir gratulieren zum 70. Geburtstag<br />
Herrn Jürgen Neupert am 09.01.<br />
Herrn Wolfgang Krauss am 28.02.<br />
Herrn Jürgen Mandler am 28.02.<br />
Herrn Wolfgang v. Zenker am 02.07.<br />
Herrn Peter Schwöbel am 23.08.<br />
Herrn Bernd Kasper am 02.09.<br />
Frau Ingrid Bleyer am 26.10.<br />
122
Wir gratulieren zum 75. Geburtstag<br />
Herrn Günther Hofmann am 05.01.<br />
Herrn Joachim Seidel am 20.01.<br />
Herrn Hans Geitner am 13.02.<br />
Herrn Friedrich Eichler am 23.02.<br />
Herrn Joachim Zimmer am 12.04.<br />
Herrn Günter Kliebe am 11.05.<br />
Herrn Franz Wohlleben am 13.06.<br />
Herrn Achim Stief am 27.06.<br />
Herrn Klaus Lische am 06.09.<br />
Frau Ingeborg Möller am 29.09.<br />
Herrn Bernhard Fahrig am 15.11.<br />
Herrn Rudi Hähner am 02.12.<br />
Herrn Martin Kauffmann am 29.12.<br />
123
Wir gratulieren zum 80. Geburtstag<br />
Herrn Artur Köber am 04.03.<br />
Herrn Eduard Fritze am 21.03.<br />
Herrn Rolf Riedel am 04.12.<br />
124
Mitglieder <strong>des</strong> <strong>Thüringer</strong> <strong>Forstvereins</strong> e.V.<br />
Stand: 31.12.<strong>2010</strong><br />
Name Vorname Ort<br />
A<br />
Aderhold Werner Steinach<br />
Ahbe Claus-Jürgen Marksuhl<br />
Ahbe Jörg Marksuhl<br />
Alt Wolfgang Crawinkel<br />
Amelung Prof. Dr. Günter Hameln/Weser<br />
Amthor Eberhard Jena<br />
Apel Jochen Lauscha<br />
Arand Marita Burgwalde<br />
Arenhövel Wolfgang Legefeld<br />
Assmann Manfred Sachsenbrunn<br />
B<br />
Bach Herbert Wolfsburg-Unkeroda<br />
Bach Martin Tabarz<br />
Baier Dr. Ulf Ichtershausen<br />
Baldauf Carmen Mohlsdorf<br />
Baldauf Lutz Mohlsdorf<br />
Baldauf Reiner Mohlsdorf<br />
Baldauf Timo Greiz-Gommla<br />
Barfod Marcus Weimar<br />
Bartl Gerhard Neuhaus/Rwg.<br />
Bauer Michael Oberwind<br />
Baumgart Holger Schmiedefeld<br />
Beck Petra Creuzburg<br />
Beerhold Dr. med. Gerhild Bibra<br />
Behm Silvio Saalfeld<br />
Berkemeier Wilhelm Erfurt<br />
Biehl Hubertus Mühlhausen<br />
Biehl Susann Langula<br />
Blaurock Helmut Bottrop<br />
Bleyer Ingrid und Gerhard Rudolstadt<br />
Böer Andrea Birkigt<br />
Böhmcker Wulf Zillbach<br />
Börner Gunter Eckhardtshausen<br />
Böttger Alexander Berka v.d.H.<br />
125
Böttger Otto Unterellen<br />
Brauer Andreas Tharandt<br />
Broska Annette und Eckhardt Uhlstedt-Kirchhhasel<br />
Burkhardt Sascha Jena<br />
Buschold Gisela und Reinhard Greiz<br />
Buse Heiko Ilmenau - OT Manebach<br />
Butzert Ute Bad Berka<br />
C<br />
Clasen Christian Freising<br />
Coch Anette Katzhütte<br />
D<br />
Dahlke Jochen Großlohra 3<br />
Dargel Ines und Hagen Ilmenau OT Manebach<br />
Deilmann Thomas Heldrungen<br />
Deiters Anette Gotha<br />
Dragoschy Eckhard Scheibe-Alsbach<br />
Düring Jens Erfurt<br />
Düssel Dr. Volker Erfurt<br />
E<br />
Eberle Erich Bleicherode<br />
Eckardt Lutz Tonndorf<br />
Eckhardt Harald Kleinschmalkalden<br />
Ehrling Bernd Oberstadt<br />
Eichhorn Lutz Sondershausen<br />
Eichler Friedrich Weida<br />
Emmel Lothar Sonneberg<br />
Engelhardt Arno Sonneberg<br />
Erhardt Joachim Bibra<br />
Erteld Thomas Gospiteroda<br />
Eulenstein Jürgen Volkmannsdorf<br />
F<br />
Fahrig Bernhard Niederorschel<br />
Färber Jörg Bad Salzungen<br />
FBG Hermannsfeld,<br />
Vors. Kümpel Erich Rhönblick<br />
126
Fischer Fritz Suhl<br />
Fischer Kurt Lutter OT Fürstenhagen<br />
Floßmann Susanne Suhl<br />
Freudenberger Klaus Meiningen<br />
Friedrich Regina und Wolfgang Eineborn<br />
Fritze Eduard Wachstedt<br />
Froelich Dr. Bernhard Sondershausen<br />
Fulge Horst Kaltennordheim<br />
Funke Armin Riechheim<br />
G<br />
Gaudecker v. Leo Buchfahrt<br />
Gebhardt Volker Weimar<br />
Gehringer Martin Hildburghausen<br />
Geisler Horst Uhlstädt-Kirchhasel<br />
Geitner Hans Lichtenbrunn<br />
Glaser Albrecht Kaltensundheim<br />
Gödel Harald Floh<br />
Goldacker Hubertus Frankenroda<br />
Göring Jörg Mechterstädt<br />
Göthe Klaus Jenaprießnitz<br />
Götze Max Dresden<br />
Grade Wolfgang Bad Berka<br />
Grimm Armin Saalfelder Höhe<br />
Grimm Carola und Gerhard Wilhelmsdorf<br />
Grob Sonja und Karl-Heinz Neuhaus am Rwg.<br />
Günther Gerd Oppurg<br />
H<br />
Omnibusbetrieb<br />
Häfner Werner Struth-Helmershof<br />
Hähner Rudi Unterwirbach<br />
Hänsel Bernd Benshausen<br />
Harrweg Harry Bad Klosterlausnitz<br />
Harseim Lutz Eisenach<br />
Haudeck Thomas Bibra<br />
Heil Prof. Klaus Ilmenau<br />
Heinze<br />
Prof. Dr. Martin und<br />
Annerose Wolfersdorf<br />
Heinze Susanne Eibenstock<br />
Hellmann Wolfgang Bad Berka OT Tannroda<br />
Helmboldt Lutz Stadtilm<br />
127
Henkel Dr. Wolfgang Erfurt<br />
Henkel Heidi Oberweißbach<br />
Henkel Lutz Bad Blankenburg<br />
Hergenhan Klaus Kühndorf<br />
Hermann Wolf-Dieter Uder<br />
Herrnkind Jörg Oberhof<br />
Heuer Wolfgang Schmalkalden<br />
Heyn Kurt Leinefelde<br />
Heyn Wolfgang Ohrdruf<br />
Hilt Jerg Stuttgart<br />
Höfer Bernd Jena OT Jenaprießnitz<br />
Hofmann Günther Drognitz<br />
Höhn Helmut Sonneberg<br />
Hölzer Anita Steinheid<br />
Hoyer Bruno Mühltroff<br />
Hübner Gerald Schwarzburg<br />
Huhn Joachim Bad Klosterlausnitz<br />
Huster Jacqueline Stadtroda<br />
I<br />
Ichtershausen Jochen Gotha<br />
J<br />
Jacob Ronald Erfurt<br />
Jäger Tobias Bischofrod<br />
Jarski Manfred Ifta<br />
Jendrusiak Axel Schmalkalden<br />
Jeschkeit Leonhard Bleicherode<br />
Jungklaus<br />
Traute und Hans-<br />
Joachim Schalkau<br />
K<br />
Kahlert Karina Ruhla<br />
Kammer Katja Bad Berka OT Tannroda<br />
Kasper Bernd Gehren<br />
Kauffmann Martin<br />
Mittelstille, OT<br />
Breitenbach<br />
Kaufmann Horst Freienorla<br />
Kaul André Saalfeld/Saale<br />
Kettner Rolf Witzenhausen<br />
128
Kinne Eike Flarchheim<br />
Klein Prof. Dr. Erwin Freising<br />
Kliebe Günter Großbrüchter<br />
Klüßendorf Dieter Jena<br />
Klüßendorf Uli Sondershausen<br />
Knoll Ingeborg und Richard Rudolstadt<br />
Köber Artur Dorndorf<br />
Köhler Gerhard Volkenroda<br />
Kohlus Manfred Weimar<br />
Krauss Wolfgang Schmalkalden<br />
Kreibich Eugen Dietzhausen<br />
Kreuter Florian Gotha<br />
Krüger Andreas Schmidtmühlen<br />
L<br />
Langer Wolfgang Burgk<br />
Lanz Prof. Dr. Werner Hann. Münden<br />
Lapp Martin Benshausen<br />
Leber Roswitha Herschdorf<br />
Leißner Carl-Heinrich Rudolstadt<br />
Leiteritz Achim Steinach<br />
Lemke Ralf Wölferbütt<br />
Leonhardt Stefan Wiesenfeld<br />
Liebold Hartmut Quirla<br />
Lindner Wolfgang Weimar<br />
Linke Gerhard Liebengrün<br />
Lippmann Karl-Heinz Scheibe-Alsbach<br />
Lische Ursula und Klaus Sondershausen<br />
Listing Martin Göttingen<br />
Luc Ronny Langewiesen<br />
Lüpke Marion Landsendorf<br />
Lux Andreas Jena<br />
M<br />
Mackensen Dietrich Bad Salzungen<br />
Mandler Jürgen Eckhardts<br />
Mannhardt Andreas Viernau<br />
Marbach Matthias Fladungen<br />
Martens Günther Bad Lobenstein<br />
Meisgeier Dirk Schleiz<br />
Memmler Beate Haina<br />
Messerschmidt Roland Erfurt-Marbach<br />
129
Messner Clemens Bad Klosterlausnitz<br />
Meyer Markus Elxleben<br />
Meyer Thomas Paulinenaue<br />
Möller Ingeborg und Martin Sondershausen<br />
Müller Karl-Heinz Geschwenda<br />
Müller Monika und Hubertus Sonneberg<br />
Müller Rainer Leinefelde<br />
Müller Reinhard Mellenbach<br />
N<br />
Neumann Mathias Lengefeld<br />
Neumann Matthias Oberweißbach<br />
Neupert Jürgen Crawinkel<br />
Nicke Prof. Dr. Anka Schwarzburg<br />
Nicolai Hanspeter Saalfeld<br />
Niepagen Dr. Andreas und Heike Bleicherode<br />
Nothnagel Gert Gera<br />
O<br />
Oelschlegel Lutz Wurzbach<br />
P<br />
Paritzsch Wolfgang Nobitz OT Klausa<br />
Pasold André Burgk<br />
Pätzold Markus Erfurt<br />
Pernutz Pier Schönberg<br />
Pimmer Reinhard Ipsheim<br />
Prasse Wolfgang Bad Klosterlausnitz<br />
Pur<strong>für</strong>st Manfred Suhl<br />
Puschmann Arnd-Eckart Gehren<br />
R<br />
Rahmig Frank Kleingölitz<br />
Ramm Achim Hohenfelden<br />
Rauscher Jochen Katzhütte<br />
Redel Holger Schleiz<br />
Reichenbächer Andreas Landsendorf<br />
Reinhardt Frank Uhlstädt-Kirchhasel<br />
Reinkober Andreas Neukloster<br />
130
Reitzenstein, Freiherr von Rupprecht Issigau<br />
Ressel Renate und Hartmut Leutenberg<br />
Riedel Rolf Gera<br />
Ripken Jörn Heinrich Georgenthal<br />
Rose Rolf Heubach<br />
Rother Reinhard Unterweißbach<br />
Rotter Peter Rohrbach<br />
S<br />
Sachsen-Weimar, Prinz v. Michael-Benedict Mannheim<br />
Sailer Eckart Berlin<br />
Sattler Elke Stotternheim<br />
Sauer Tino Gierstädt<br />
Schade Bettina<br />
Schirmberg/OT<br />
Martinfeld<br />
Schäfer Ronald Kranichfeld<br />
Schaller Norman Sebnitz<br />
Scheibe Olaf Merkers-Kieselbach<br />
Scherbaum Brita und Manfred Meiningen<br />
Schinkitz Jens Gehren<br />
Schmidt Heinrich Schwarzburg<br />
Schmidt Kati Jüchsen<br />
Schneider Achim Tabarz<br />
Schöler Andreas Großkochberg<br />
Schönfeld Heinz Sondershausen<br />
Schröder Gerhard Gössitz<br />
Schröder Karsten Hohenleuben<br />
Schubert Friedolt Leutenberg<br />
Schubert Hermann Langenbernsdorf<br />
Schulz Richarda und Bodo Wüstheuterode<br />
Schurg Uwe Heldburg<br />
Schwalbe Konrad Schwarzburg<br />
Schwarz Hermann Lichtenfels<br />
Schwimmer Matthias Rudolstadt<br />
Schwöbel Peter Wahlhausen<br />
Seidel Joachim Kranichfeld<br />
Seidel Verena Lobenstein<br />
Seifferth Udo Masserberg<br />
Simon Rosemarie und Horst Marksuhl<br />
Simon Uwe Marksuhl<br />
Sklenar Dr. Volker Weimar<br />
Spinner Karsten Schwarzburg<br />
Stehle Peter Crispendorf<br />
131
Steiner Josef Hetschburg<br />
Stephan Eckhard Wiesenthal<br />
Stief Achim Suhl-Goldlauter<br />
Strohschein Anja Luisenthal<br />
Stubenrauch Kurt Erfurt<br />
Sturm Hagen Essleben<br />
Suhr Petra Georgenthal<br />
Szlosarek Kathrin Merkers-Kieselbach<br />
T<br />
Taubert Bernd Schwallungen<br />
Tenner Siegfried Kaltenwestheim/Rhön<br />
Thieme Manfred Kranichfeld<br />
U<br />
Ullrich Ingwart Hildburghausen<br />
Topfstedt OT<br />
Unrein Dirk<br />
Niedertopfstedt<br />
Uschmann Andreas Erfurt<br />
Uth Jörn Eisenach<br />
V<br />
Veckenstedt Torsten Hummelshain<br />
von Bockum Kasper Herringsen-Ostheide<br />
W<br />
Wächter Manuel Tharandt<br />
Wächter Rudolf Meiningen<br />
Wagner Hans-Jörg Tabarz<br />
Waldthausen v. Constantin Hannover<br />
Wanderer Otto Neuhaus/Rwg.<br />
Weber Georg Ernst Schleiz<br />
Wehner Helmut Seelingstädt<br />
Weide Klaus Schleiz<br />
Weidig Johannes Tharandt<br />
Weigand Martin Erfurt<br />
Weiner Erich Steinbach-Hallenberg<br />
Weist Sebastian Jena<br />
Weller Eberhard Weida<br />
132
Wennrich Michael Meura<br />
Wermann Ernst Bad Honnef<br />
Weth, von der Bernd Schönbrunn<br />
Wiebke Torsten Suhl<br />
Wildenhayn Frank Hermannsfeld<br />
Wilhelm Bernd Zella-Mehlis<br />
Winzer Christiane Schnepfenthal<br />
Wittenberg Stefan Gräfenthal<br />
Witticke Prof. Helmut Schwarzburg<br />
Wittig Karl-Heinz Eisenach<br />
Wohlleben Helga und Franz Judenbach<br />
Wolf Stefan Gotha<br />
Wolfer Siegfried Georgenthal<br />
Wunder Wolf Bad Blankenburg<br />
Wunderlich Gert Rudolstadt<br />
Z<br />
Zehner Ilona und Uwe Sonneberg<br />
Zeisberger André Breitungen<br />
Zeisberger Peter Breitungen<br />
Zenker v. Wolfgang Damelang<br />
Ziegenfuß Manfred Helmsdorf<br />
Ziermann Tobias Großneundorf<br />
Zimmer Joachim Erfurt<br />
Probemitgliedschaften <strong>2010</strong><br />
Bohlander Prof. Dr. Frank Erfurt<br />
Burghoff Lothar Hummelshain<br />
Chmara Sergej Gotha<br />
Freise Dr. Chris Gotha<br />
Thomsen Gerd Ilmenau<br />
Thöne Dr. Karl-Friedrich Erfurt<br />
133
134<br />
Foto: Tobias Guckuck<br />
So ratlos, wie mancher Wanderer vor diesem Wegweiser stehen mag,<br />
schauen viele junge und alte Forstleute in die Zukunft:<br />
„Quo vadis Forstwirtschaft Thüringens?“<br />
(eingesandt von unserem langjährigen Vereinsmitglied Hans-Jörg Wagner, Tabarz)


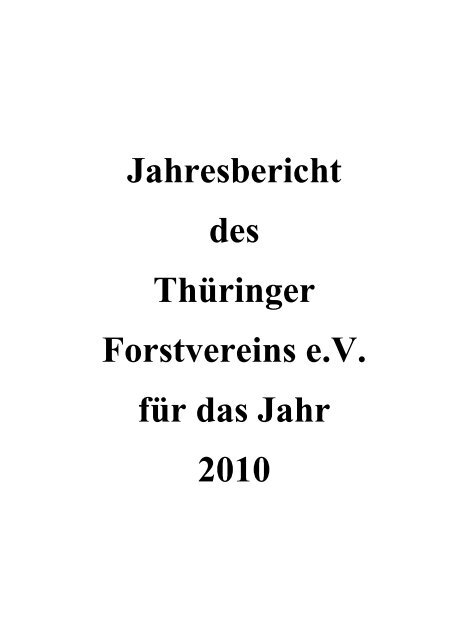
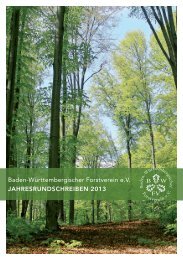
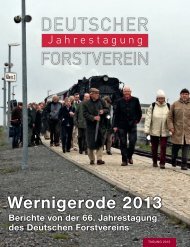
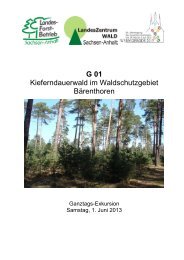
![Vortrag_Ullrich_warendorf_20130305 [Kompatibilitätsmodus]](https://img.yumpu.com/22691664/1/184x260/vortrag-ullrich-warendorf-20130305-kompatibilitatsmodus.jpg?quality=85)