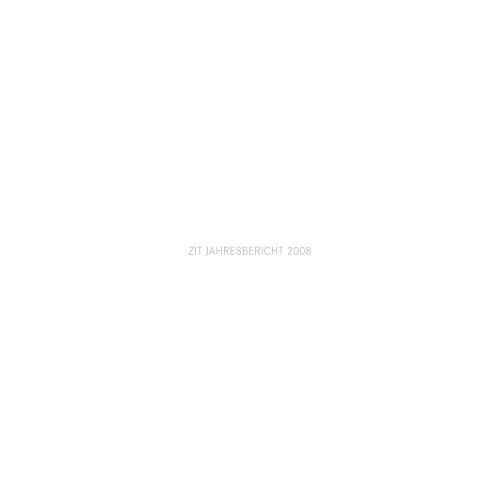ZIT JAHRESBERICHT 2008
ZIT JAHRESBERICHT 2008
ZIT JAHRESBERICHT 2008
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>ZIT</strong> <strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong>
Impressum<br />
Herausgegeben von:<br />
<strong>ZIT</strong> Zentrum für Innovation und Technologie GmbH<br />
© 2009<br />
Ebendorferstraße 4 | 1010 Wien<br />
T +43 [1] 4000 86 165 | F +43 [1] 4000 86 587<br />
office@zit.co.at | www.zit.co.at<br />
Die Technologieagentur der Stadt Wien.<br />
Ein Unternehmen des Wiener Wirtschaftsförderungsfonds.<br />
Fotos: Ludwig Rusch<br />
Konzept und Grafik: Ludwig Rusch | Andrea Hochstrasser<br />
Alle Rechte vorbehalten.
05 Vorwort Bürgermeister Dr. Michael Häupl<br />
05 Vorwort Vizebürgermeisterin Mag. a Renate Brauner<br />
06 Vorwort KommR in Brigitte Jank<br />
07 Vorwort DI Dr. Bernd Rießland<br />
08 Mission Statement<br />
10 Das <strong>ZIT</strong>-Team<br />
15 Wer braucht schon eine Wissensbilanz?<br />
18 „Wir haben uns für das ‚Selbermachen‘ entschieden.“<br />
20 Alles forscht<br />
24 8+6=51<br />
26 Vom besonderen Glanz<br />
31 Wien Wins<br />
32 Populär, forsch, sterblich. Das sind Neue Medien<br />
35 „Spiele sind ein Kulturmedium.“<br />
38 Eine neue Zielgruppe für das <strong>ZIT</strong><br />
41 Es bleibt kein Backstein auf dem anderen<br />
43 Insel der Seligen? Vielleicht Ulrich Seidl<br />
44 User Innovation Junior-Prof Dr. Reinhard Prügl<br />
48 „Ein Passwort ist genau 1 Mal sicher.<br />
Beim 2. Mal könnte es schon ein Hacker sein.“<br />
52 Informations- und Kommunikationstechnologien<br />
jetzt und demnächst<br />
55 Forschung findet Stadt…<br />
56 Von Wärmepumpen und Asthma-Impfstoffen<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
<strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong> 3
4 <strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong>
Wien soll DIE Forschungshauptstadt<br />
Mitteleuropas werden – dieses Ziel<br />
ist in der im Jahr 2007 beschlossenen<br />
Stra tegie für Forschung, Technologie<br />
und Innovation „Wien denkt Zukunft“<br />
prominent formuliert. Im Laufe des Jahres <strong>2008</strong>, dem ersten Jahr der<br />
Umsetzung dieser Strategie, sind wir diesem Anspruch ein wichtiges<br />
Stück näher gekommen. Einen nicht unwesentlichen Anteil daran<br />
trägt das <strong>ZIT</strong> Zentrum für Innovation und Technologie. Zwei zentrale<br />
und als Startprojekte definierte Maßnahmen, für die das <strong>ZIT</strong> die<br />
Ver antwortung trug, wurden bereits realisiert: Die Aktualisierung<br />
der betrieblichen Forschungs- und Innovationsförderung mit einem<br />
stärkeren Fokus auf die große Zielgruppe der innovierenden Unternehmen<br />
und den gesellschaftspolitischen Aspekt der Forschungsförderung,<br />
sowie die äußerst erfolgreiche Durchführung des Wiener Forschungsfestes<br />
als Kernprojekt des verstärkten öffentlichen Dia logs<br />
zu den Themen Forschung und Technologie.<br />
Darüber hinaus wurden auch in anderen Bereichen, für die das <strong>ZIT</strong><br />
die Verantwortung trägt, wesentliche Fortschritte erzielt. Dies gilt<br />
für die innovative Beschaffung – das heißt die verstärkte Miteinbeziehung<br />
des Innovationsgehaltes von Produkten bei Kaufentscheidungen<br />
durch die Stadtverwaltung – oder die zusätzliche Ausstat<br />
tung von Wiener Forschungsstandorten mit hochwertiger<br />
Ge r äte infrastruktur. Insgesamt hat das große Engagement und die<br />
hohe Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des <strong>ZIT</strong> die<br />
Stadt ein Stück weitergebracht im vergangenen Jahr. Dieser Erfolg<br />
möge dem <strong>ZIT</strong> auch in Zukunft beschieden sein!<br />
Dr. Michael Häupl<br />
Bürgermeister und Landeshauptmann von Wien<br />
Die Wiener Wirtschaftspolitik setzt<br />
konse quent auf Investitionen in Forschung,<br />
Technologie und Innovation.<br />
Die Tur bu lenzen an den internationalen<br />
Fi nanz märkten, die auch auf die<br />
Real wirtschaft durchzuschlagen beginnen, machen natürlich auch<br />
vor den Toren Wiens nicht halt. Um diesen Problemen so gut wie<br />
möglich zu begegnen, helfen alle Anstrengungen für Qualifizierung,<br />
Forschung und Innovation in Wien. Denn im internationalen Wettbewerb<br />
können wir nicht als die Billigsten, sondern nur als die Besten<br />
erfolgreich bestehen.<br />
Das <strong>ZIT</strong> war und ist ein zentrales Instrument der Wiener Wirtschaftspolitik<br />
für wissensbasierte und innovationsorientierte Unternehmen<br />
mit ihren hier entwickelten und international angebotenen Produkten<br />
und Dienstleistungen. Gerade im vergangenen Jahr wurden erneut<br />
spannende Akzente gesetzt. Dem Anspruch, die Zahl jener Wiener<br />
Unternehmen, die regelmäßig Innovationen durchführen, noch zu<br />
erhöhen und sie dabei bestmöglich zu unterstützen, wurde mehrfach<br />
Rechnung getragen:<br />
Mit dem neuen Förderprogramm <strong>ZIT</strong>08 plus, das die Zielgruppe der<br />
<strong>ZIT</strong>-KundInnen deutlich erweitert, und dem neuen Angebot der Technologieberatung,<br />
mit dessen Hilfe Kooperationen von Wiener KMU<br />
mit wissenschaftlichen Einrichtungen gefördert werden. Weil innovative<br />
Unternehmen auch Raum brauchen, wurde die Errichtung des<br />
Media Quarter Marx gestartet – neues Leben für den alten Schlachthof<br />
St. Marx. Nicht zuletzt wurden Forschung und Technologie der<br />
Bevölkerung mit dem vom <strong>ZIT</strong> organisierten Wiener Forschungsfest<br />
näher gebracht – eine wichtige Maßnahme, deren Bedeutung nicht<br />
hoch genug bewertet werden kann, denn wie jeder andere Politikbereich<br />
braucht auch die For sch ungs- und Technologiepolitik den<br />
Rückhalt und das Verständnis jener Menschen, die sie letztendlich<br />
mit ihren Steuergeldern finanzieren.<br />
Mag. a Renate Brauner<br />
Vizebürgermeisterin und Finanz- und Wirtschaftsstadträtin<br />
<strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong> 5
Angesichts der aktuellen schwierigen<br />
wirtschaftlichen Situation sind wirtschaftspolitische<br />
Akzente für die Wiener<br />
Unternehmen, vor allem die Kleinen und<br />
Mittleren Unternehmen, ganz besonders<br />
not wendig. Mit dem im vergangenen Jahr deutlich ausgeweiteten<br />
Angebot des <strong>ZIT</strong> haben die Stadt Wien und die Wiener Wirtschaftskammer<br />
bereits ein wirksames Instrumentarium zur Verfügung.<br />
An erster Stelle sind die Maßnahmen zu nennen, die dem Anspruch<br />
der Vergrößerung jener Ziel grup pe, die mit der Technologie- und<br />
Inno vationsförderung adressiert werden soll, Rechnung tragen:<br />
Im Rahmen der neuen Förderschiene INNOVATION, die sich nicht<br />
primär an forschende Unternehmen, dafür umso nachdrücklicher<br />
an die große Anzahl von KMU richtet, die Innovationen hinsichtlich<br />
ihrer Produkte oder Dienstleistungen planen, wurden etwa mehr als<br />
3 Millionen Euro aufgewendet, die 21 Unternehmen zugute kamen.<br />
Das ebenfalls neue Angebot der Technologieberatung – das <strong>ZIT</strong> ist<br />
hier Unternehmen bei der Suche nach Kooperationspartnern bei der<br />
Realisierung von Innovationsvorhaben behilflich – erreicht bereits<br />
im Jahr seiner Pilotphase 68 Unternehmen. Gerade die Kombination<br />
der beiden neuen Maßnahmen stellt für die Wiener KMU einen ganz<br />
besonderen Mehrwert dar.<br />
Für die Wirtschaftskammer Wien als langjährigem Kooperationspartner<br />
des <strong>ZIT</strong> ist der unmittelbare und unbürokratische Zugang zu den<br />
Unternehmen ganz besonders wichtig. Die Angebote des <strong>ZIT</strong> und<br />
auch das Engagement seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
garantieren dies.<br />
6 <strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong><br />
KommR in Brigitte Jank<br />
Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien
Beziehungstechnisch gelten Eltern-<br />
Kind-Beziehungen oft als schwierig. Im<br />
Fall von Wiener Wirtschaftsförderungsfonds<br />
und <strong>ZIT</strong> Zentrum für Innovation<br />
und Technologie sind die Verhältnisse<br />
allerdings mehr als erfreulich. Ist doch die Erfolgsbilanz der Wiener<br />
Technologieagentur ein steter Anlass zur Freude - für die stolze Muttergesellschaft<br />
wie auch den Wirtschaftsstandort. Besonders schön<br />
ist es dann natürlich, wenn diese Freude und der Erfolg von außen<br />
bestätigt werden. Jüngst geschehen im Fall des Wiener Biotech-<br />
Unternehmens AFFiRiS - spezialisiert auf dem Gebiet der Alzheimer-<br />
Forschung. Das Unternehmen, das in seiner Gründungsphase vom<br />
<strong>ZIT</strong> unterstützt wurde und im Campus Vienna Biocenter beheimatet<br />
ist, konnte sein in der Testphase befindliches Alzheimermedikament<br />
für 430 Millionen Euro - bei Erreichen bestimmter Meilensteine - an<br />
GlaxoSmithKline lizenzieren. Wichtiges Geld für das weitere Wachstum<br />
des erfolgreichen Unternehmens am Campus Vienna Biocenter.<br />
Dieser Standort wird in den nächsten Jahren mit modernster Forschungsinfrastruktur<br />
weiter ausgebaut. Auch das ist zu erheblichen<br />
Teilen ein Verdienst des <strong>ZIT</strong>. Wie überhaupt der Ausbau des gesamten<br />
Campus ohne Initiativen und Projektentwicklung von <strong>ZIT</strong> und<br />
WWFF nicht möglich gewesen wäre.<br />
Darauf dürfen wir durchaus stolz sein. Auf die Tochter sowieso.<br />
Denn - um einen dummen Spruch positiv zu wandeln - so schöne<br />
Töchter hat keine andere Mutter.<br />
DI Dr. Bernd Rießland<br />
Geschäftsführer des Wiener Wirtschaftsförderungsfonds (WWFF)<br />
<strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong> 7
Mission Statement<br />
Von der Pflicht, am Ball zu bleiben…<br />
War das Jahr 2007 noch von der Planung und Konzeption einer<br />
Reihe neuer und erneuerter Angebote gekennzeichnet, so ging es<br />
im vergangenen Jahr in die Umsetzungsphase. Immer eine spannende<br />
Frage, ob das im Trockentraining Erdachte dann auch wirklich<br />
so funktioniert, wie man es sich vorgestellt hat. Um es vorweg zu<br />
nehmen: wir sind zufrieden mit uns – andernfalls hätte ich auch ein<br />
anderes Thema für diesen Eingangstext zu unserem Jahresbericht<br />
gewählt.<br />
Nicht ganz zufällig wurden im vergangenen Jahr in allen unseren<br />
Schwerpunktbereichen – Förderungen, Dienstleistungen, Immobilien<br />
- neue Angebote implementiert. Denn wir waren vor allem bestrebt,<br />
gemäß unserem Motto „Alles aus einer Hand“, die Synergien zwischen<br />
diesen Bereichen weiter zu verstärken. Nicht zuletzt wurde<br />
das in unserem Portfolio junge Thema Medien noch wesentlich<br />
intensiver bearbeitet, und zwar, dem obigen Grundsatz folgend, ganz<br />
besonders bereichsübergreifend.<br />
Der Reihe nach: Unser Angebot monetärer Förderungen wurde mit<br />
der seit Anfang <strong>2008</strong> gültigen Richtlinie <strong>ZIT</strong>08 plus weiter verbessert,<br />
insbesondere wurden neue Zielgruppen erschlossen. Denn mit<br />
dem Programm INNOVATION adressieren wir nicht primär unsere<br />
bisherigen HauptkundInnen, die forschenden und entwickelnden<br />
Unternehmen (unser bewährtes Angebot für diese Zielgruppe, die<br />
Calls für betriebliche Forschung und Entwicklung, wird natürlich<br />
weitergeführt - siehe Seite 56), sondern Klein- und Mittelbetriebe,<br />
die sich in Richtung vermehrter, kontinuierlicher Innovationstätigkeit<br />
entwickeln wollen. Wie groß das diesbezügliche Potenzial ist, zeigt<br />
zum einen die große Inanspruchnahme dieses Angebots, zum anderen,<br />
und das freut besonders, die hohe Zahl an neuen KundInnen,<br />
die wir damit gewinnen konnten. Im Immobilienbereich wurde die<br />
Erweiterung des Media Quarter Marx gestartet – 37.000 m² Fläche,<br />
verteilt auf zwei Gebäude, werden gerade errichtet. Damit wird<br />
ein Medienstandort geschaffen, der bereits jetzt auf allergrößtes<br />
Interesse stößt. Und im deutlich ausgebauten Dienstleistungsbereich<br />
tat sich ganz besonders viel: Mit der Implementierung des Angebots<br />
der Technologieberatung finden Wiener KMU im <strong>ZIT</strong> einen Mittler<br />
zu Forschungseinrichtungen, der rasch bei der Klärung technologischer<br />
Fragestellungen unterstützen kann. Im Rahmen von „Innovationsgesprächen“<br />
zu verschiedenen Themen wie beispielsweise<br />
Wissens- und Innovationsmanagement versuchten wir mit Hilfe<br />
8 <strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong>
…und der Freude, wenn Neues gelingt.<br />
von ExpertInnen unseren KundInnen entsprechende Informationen<br />
anzubieten – und die KundInnen auch gleich noch besser kennen<br />
zu lernen. Schließlich wollen wir mit der Initiative „Innovative Beschaffung“<br />
dazu beitragen, dass die Stadt Wien mit ihrem enormen<br />
Nachfragepotenzial - noch mehr als bisher - innovative Produkte<br />
und Dienstleistungen ankauft. Damit können innovative, oft junge<br />
Unternehmen auf eine ganz wichtige Referenzkundin verweisen, was<br />
für die Gewinnung weiterer KundInnen natürlich von großem Vorteil<br />
ist. Trotz der rechtlichen und administrativen Herausforderungen, die<br />
mit einem solchen Ansatz verbunden sind, konnten, vor allem durch<br />
die Aufgeschlossenheit und das Engagement der Stadtverwaltung,<br />
bereits wichtige Erfolge erzielt werden.<br />
War das jetzt ein Mission Statement? Nun, ich hoffe, dass unsere<br />
Mission - oder, um es etwas weniger pathetisch und metaphysisch<br />
zu sagen - unsere Aufgabe und Zielrichtung aus unserem Tun klar<br />
wird: Bestmögliche Rahmenbedingungen für Technologie und Innovation<br />
in Wien zu schaffen.<br />
Dr. Claus Hofer<br />
<strong>ZIT</strong> Geschäftsführung<br />
<strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong> 9
Das <strong>ZIT</strong>-Team<br />
Christian Bartik<br />
Peter Halwachs<br />
Claus Hofer<br />
10 <strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong><br />
Thomas Berndt<br />
Sandra Hämmerle<br />
Stephanie Jansen<br />
Eva Czernohorszky<br />
Evelyn Hemmer<br />
Robert Mayer-Unterholzner<br />
Fabian Fußeis<br />
Nadja Hermann<br />
Sigrid Nitsch<br />
Daniela Perl Antoinette Rhomberg Manuela Schein Astrid Stakne<br />
Tanja Steinhauser Bernhard Steinmayer Kristina Wrohlich Dieter Zabrana<br />
Geschäftsführung<br />
Dr. Claus Hofer<br />
Assistenz<br />
Mag. a Evelyn Hemmer<br />
Nadja Hermann<br />
Kommunikation<br />
Stephanie Jansen<br />
DI in Kristina Wrohlich<br />
Wissensmanagement | Controlling<br />
Dieter Zabrana (Leitung)<br />
Robert Mayer-Unterholzner<br />
Förderungen<br />
Mag. Christian Bartik (Leitung)<br />
Sandra Hämmerle<br />
Mag. a Daniela Perl<br />
Mag. a Manuela Schein<br />
Mag. a Astrid Stakne<br />
Tanja Steinhauser<br />
Dr. Bernhard Steinmayer<br />
Dienstleistungen<br />
Mag. a Eva Czernohorszky (Leitung)<br />
Mag. Fabian Fußeis<br />
DI Peter Halwachs<br />
Mag. a Sigrid Nitsch<br />
Antoinette Rhomberg<br />
Immobilien<br />
Dipl.-Geogr. Thomas Berndt (Leitung)<br />
DI in Kristina Wrohlich
<strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong> 11
12 <strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong>
<strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong> 13
14 <strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong>
Wer braucht schon eine Wissensbilanz?<br />
Ein Werkstattbericht.<br />
Erstmals liegt dem Jahresbericht des <strong>ZIT</strong> ein zweiter, schmälerer<br />
Band bei: eine Wissensbilanz. Zwei Gründe waren ausschlaggebend<br />
für unseren Entschluss, eine Wissensbilanz für das <strong>ZIT</strong> zu erstellen:<br />
weil wir wollten und weil wir mussten. Eine glückliche Kombination,<br />
wie sich herausstellen sollte. Drei Schlussfolgerungen können wir<br />
jetzt aus dem Prozess der Wissensbilanzierung im <strong>ZIT</strong> ziehen – und<br />
die wollen wir Ihnen nicht vorenthalten.<br />
I CuI Bono?<br />
Wir mussten eine Wissensbilanz für das <strong>ZIT</strong> erstellen, weil wir als<br />
Schöpfer und Abwickler eines unter dem Namen WISSEN publizierten<br />
Förderungsprogramms der Stadt Wien für die erstmalige<br />
Erstellung von Wissensbilanzen in Wiener Unternehmen eine<br />
Vorbildwirkung einnehmen. Wir fühlen uns unserem Firmenwortlaut<br />
und dem Auftrag verpflichtet, den wir als Technologieagentur der<br />
Stadt Wien haben: nicht nur Innovation zu fördern, sondern sie auch<br />
selbst zu leben.<br />
Von den Wiener UnternehmerInnen können wir nur das verlangen,<br />
was wir auch selbst bereit sind zu tun. Und wir könnten die vorgelegten<br />
Förderungsprojekte kaum in der geforderten Qualität<br />
bewerten, hätten wir nicht den theoretischen Background und die<br />
praktische Erfahrung aus der Umsetzung.<br />
Wir wollten eine Wissensbilanz für das <strong>ZIT</strong> machen, weil wir davon<br />
überzeugt sind, dass sie für ein wissensbasiertes Unternehmen ein<br />
geeignetes strategisches Steuerungs- und Profilierungsinstrument<br />
ist, das es uns erlaubt, bessere Leistungen mit höherer Wertschöpfung<br />
zu erbringen - die so auch besser an KundInnen und AuftraggeberInnen<br />
vermittelt werden können. Diese aus vielen Recherchen<br />
und Gesprächen resultierende Überzeugung war ja schließlich<br />
aus schlaggebend für die Schaffung des Förderungsprogramms<br />
WISSEN.<br />
Die Finanz- und Wirtschaftskrise macht deutlich, wie wichtig es für<br />
die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens sein kann, neben seinem<br />
materiellen auch das intellektuelle Kapital darstellen und steuern zu<br />
können. Die meisten etablierten Kennzahlen- und Ratingsysteme<br />
haben sich nicht gerade bewährt – auch weil sie nicht in der Lage<br />
sind, Kernkompetenzen und Wissenspotenziale von Unternehmen<br />
richtig einzuschätzen.<br />
Was bisher nur GründerInnen und deren Financiers tun mussten,<br />
werden künftig wohl immer öfter auch Banken und Förderagenturen<br />
tun, bevor sie ihr gutes Geld in „gestandene“ Unternehmen stecken:<br />
deren Kernkompetenzen untersuchen, deren Wissen, Fähigkeiten<br />
und Beziehungen analysieren und Rückschlüsse auf die Marktfähigkeit<br />
der Leistungen und deren Wertschöpfung ziehen. Kurzum: eine<br />
Wissensbilanz machen (bzw. verlangen).<br />
I Wollen & Müssen und der HalBe WeG<br />
Gut, dass wir die Wissensbilanz unbedingt machen wollten: nur<br />
dadurch gelang es, den anfangs klar unterschätzten Aufwand an Zeit<br />
und Energie durch besonderen Einsatz der MitarbeiterInnen auszugleichen.<br />
Die ursprünglich gewählte Projektstruktur, die WissensträgerInnen<br />
aus allen Bereichen des <strong>ZIT</strong> dazu brachte, in groß angelegten<br />
Workshops wenig produktive generische Prozesse zu durchlaufen,<br />
mussten wir bald in eine flexible Clusterstruktur überleiten, wo<br />
Arbeitspakete von einzelnen oder einer kleinen Gruppe von MitarbeiterInnen<br />
erledigt und von der Projektleitung gemeinsam mit einem<br />
externen Berater ergänzt und an die richtigen Stellen des Ganzen<br />
eingefügt wurden.<br />
Gut, dass wir die Wissensbilanz machen mussten, wir wären sonst<br />
vielleicht auf halbem Weg stehen geblieben, hätten uns aus Zeitnot<br />
und wegen anderer Prioritäten (unsere KundInnen!) damit zufrieden<br />
gegeben, eh schon zu wissen, was wir wissen und bloß unser<br />
Wissensmanagementsystem weiter verbessert.<br />
Das wäre nicht schlimm und für viele Unternehmen ausreichend.<br />
Aber damit kann man die Kernkompetenzen eines Unternehmens<br />
nicht optimal steuern, damit fehlt die Möglichkeit, durch den<br />
Vergleich der letztjährigen mit der heurigen Wissensbilanz Veränderungen<br />
im intellektuellen Kapital bemerken und analysieren zu<br />
können, Ausgangspunkte für strategische Entscheidungen zu haben<br />
und schließlich auch Belege für deren Richtigkeit (oder deren<br />
Fehlschlagen).<br />
I vor der WIssensBIlanZ IsT naCH der WIssensBIlanZ<br />
Wer vor der Wissensbilanzierung organisatorisch noch nicht so<br />
aufgestellt ist, dass das für die angebotenen Leistungen erforder-<br />
<strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong> 15
Wer braucht schon eine Wissensbilanz?<br />
liche Wissen regelmäßig und strukturiert gesammelt, aufbewahrt,<br />
ausgetauscht und zugänglich gemacht wird, muss einfach mehr Zeit<br />
vorsehen. Gibt es bereits Datenbanken, Bibliotheken, regelmäßige<br />
(und protokollierte!) Treffen der WissensträgerInnen, Dokumentenmanagement,<br />
etc., lässt sich die Wissensbilanz recht zügig erstellen.<br />
Das <strong>ZIT</strong> war durchaus gut vorbereitet, es gab bereits eine große Zahl<br />
gut integrierter Bestandteile eines Wissensmanagements im Unternehmen.<br />
Dennoch war gerade die Vielfalt unserer unterschiedlichen<br />
Wissensmanagement-Tools und deren unzureichende Abstimmung<br />
auch eine der Ursachen für Verzögerungen im Wissensbilanzierungsprozess.<br />
Beim Analysieren unserer Kernkompetenzen bemerkten wir schnell,<br />
dass unser properes, wirtschaftswissenschaftlich und politisch gut<br />
unterfüttertes Zielsystem doch noch Lücken hatte. Nicht immer<br />
ließ sich die bei der Wissensbilanzierung entscheidende Frage<br />
ohne Weiteres beantworten: „Welches Team, welche Beziehungen,<br />
welche Strukturen und Prozesse haben und brauchen wir, um eine<br />
bestimmte Leistung so erbringen zu können, dass sie die größtmögliche<br />
Wertschöpfung auslöst - bei unseren KundInnen, innovationsaktiven<br />
Wiener Unternehmen, wie auch bei unseren Auftrag geber-<br />
Innen, der Stadt Wien und zahlreichen ProjektpartnerInnen?“<br />
Wer sich nach der Wissensbilanzierung zufrieden zurücklehnt, vergibt<br />
eine große Chance: Wissensbilanzen sind nämlich auch und vor<br />
allem Steuerungsinstrumente. Sie zeigen dem Management durch<br />
Indikatoren die Veränderungen im intellektuellen Kapital, bei den<br />
damit erbrachten Leistungen und den so erzielten Wirkungen – wenn<br />
die Wissensbilanz mit den üblichen Controllingkreisläufen eines<br />
Unternehmens verbunden wird. Konkret haben wir den Prozess der<br />
jährlichen Wissensbilanzierung mit den vorhandenen Prozessen des<br />
Finanzcontrollings, der Personalentwicklung und der Strategie- und<br />
Projektplanung verquickt – in den kommenden Monaten muss dieser<br />
Controllingkreislauf dann im „real life“ seine Bewährungsprobe<br />
bestehen…<br />
I ZuvIel salZ In dIe suppe…<br />
Die Wissensbilanz nach dem „Modell Prof. Koch“ ist zwar hierzulande<br />
ein Quasi-Standard. Doch niemand - außer den österreichischen<br />
Universitäten – ist dazu verpflichtet, eine Wissensbilanz zu erstellen<br />
16 <strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong><br />
und es gibt in diesem Modell und auch außerhalb davon viele - auch<br />
ganz gut geeignete - Möglichkeiten, mehr oder weniger Aufwand zu<br />
treiben, um zum Ziel zu kommen.<br />
Ob und wie sehr man diesem Modell folgt, hängt also von den vorher<br />
gewissenhaft zu analysierenden Zielen und Möglichkeiten ab, für<br />
manche Unternehmen werden die hinter den Begriffen „Prozessmanagement“,<br />
„Wissensmanagement“ oder „Qualitätsmanagement“<br />
stehenden Konzepte wohl ausreichend oder gar besser geeignet<br />
sein als das Instrument der Wissensbilanz (die allerdings eine gute<br />
Ergänzung zu all diesen Modellen sein kann!).<br />
Wissensbilanz ja oder nein? Suchen Sie Rat bei einer der (noch<br />
raren) in Sachen „Wissensbilanzierung“ erfahrenen Beratungsfirmen,<br />
aber tun Sie das nicht unvorbereitet.<br />
Fragen Sie sich<br />
n Wie stark hängt der Erfolg unseres Unternehmens vom<br />
intellektuellen Kapital ab - von unserem Team, unseren KundInnen<br />
und anderen Netzwerken, von unseren Leistungsprozessen?<br />
Wie gefährdet ist unsere Wettbewerbsposition, z.B. bei<br />
Ver lust von SchlüsselmitarbeiterInnen, bei Zunahme von Kund-<br />
Innen-Beschwerden, etc.?<br />
n Wie stark ist der Wettbewerb in unserem Markt, und damit der<br />
Druck, kontinuierlich zu innovieren, sich von MitbewerberInnen<br />
auch in der Außendarstellung positiv abzuheben, KundInnen zu<br />
binden und deren Vertrauen in uns zu festigen?<br />
n Wie stark ist unser eigener Anspruch (z.B. in einer bestimmten<br />
Firmenkultur) oder der Druck unserer EigentümerInnen und<br />
Financiers, die „inneren Werte“ des Unternehmens besser zu<br />
kennen und deren Entwicklung aktiv zu steuern?<br />
Wir haben uns diese Fragen gestellt, uns gewissenhaft vorbereitet<br />
und wir haben einen erfahrenen Berater gefunden. Dennoch<br />
erlebten wir unsere Überraschungen, machten unsere Fehler und<br />
haben viel daraus gelernt – das Ergebnis dieses Prozesses der<br />
Wissensbilanzierung liegt diesem Jahresbericht bei.<br />
Dieter Zabrana
<strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong> 17
„Wir haben uns für das ,Selbermachen‘ entschieden.“<br />
Walter Schmidt, Geschäftsführer AFFiRiS, im Gespräch.<br />
Walter Schmidt ist seit Ende 2003 Mitbegründer und Geschäftsführer<br />
des gar nicht mehr so kleinen Wiener Biotechnologieunternehmens<br />
AFFiRiS. Das <strong>ZIT</strong> hat das Unternehmen von Beginn an unterstützt.<br />
Dass das Vertrauen mehr als gerechtfertigt gewesen ist, beweist<br />
der größte Biotech-Lizenzdeal eines österreichischen Unternehmens<br />
überhaupt, abgeschlossen mit dem britischen Pharma-Riesen<br />
GlaxoSmithKline.<br />
Georg Brockmeyer: AFFiRiS - wofür steht der Name eigentlich?<br />
Und warum die 2 kleinen “ii”?<br />
Walter Schmidt: Der Name AFFiRiS ist ein Kunstwort. Man kann<br />
das mit Affinität assoziieren und es sollte auch ein bisschen peppig<br />
klingen. Und das mit den kleinen “i“, das hat sich mit der Zeit<br />
entwickelt. Es erhöht auf jeden Fall die Aufmerksamkeit.<br />
Brockmeyer: Ihr Schwerpunkt ist die Impfstoffentwicklung?<br />
Schmidt: Wir entwickeln sogenannte maßgeschneiderte Impfstoffe.<br />
Unsere Impfstoffsubstanzen sind chemisch gesprochen Peptide<br />
und synthetischer Natur. Wir haben für sie die Marke AFFITOP ®<br />
geschützt. Die Plattform-Technologie, die die Impfstoff-Kandidaten<br />
liefert, heißt AFFITOM ® Technologie. Das kann man sich so vorstellen:<br />
ein AFFITOM ® ist ein großer Pool von möglichen Impfstoff-<br />
Produktkandidaten, zugeschnitten auf die jeweilige Krankheit, wie<br />
z.B. Alzheimer. In dieser Indikation ist AFFiRiS in der Forschung und<br />
Entwicklung auch am Weitesten fortgeschritten. Gleich zwei<br />
AFFI TOPE ® befinden sich in der klinischen Phase I, deren finale<br />
Ergebnisse spätestens im Herbst dieses Jahres vorliegen sollten.<br />
Die finanzielle Unterstützung des <strong>ZIT</strong> war uns für diese Studien natürlich<br />
eine sehr große Hilfe.<br />
Das Interessante an dieser Technologie ist die Vielzahl der möglichen<br />
Produktkandidaten, die sie jeweils zur Verfügung stellt. Sollte sich<br />
wider unserer Erwartungen beispielsweise in der klinischen Entwicklung<br />
herausstellen, dass ein AFFITOP ® nicht zum gewünschten Erfolg<br />
führt, dann können wir mit Hilfe unserer AFFITOM ® Technologie<br />
einfach neue Kandidaten an Impfstoffen nachliefern.<br />
Das kann unsere Konkurrenz so nicht.<br />
Brockmeyer: Sie gehen nicht von dem Krankheitserreger, sondern<br />
von dem sogenannten Antigen aus?<br />
Schmidt: Das ist richtig. Wir haben keine Infektionskrankheiten im<br />
Programm, sondern erforschen und entwickeln Impfungen gegen<br />
18 <strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong><br />
chronische Krankheiten. Hier ist häufig eine körpereigene Struktur<br />
das Problem und von dieser Problemstruktur gehen wir aus.<br />
Des Weiteren ist für die Auswahl unserer Projekte wichtig, dass ein<br />
dringender medizinischer Bedarf vorliegt und dass es auch etwas<br />
zu verdienen gibt. Da bin ich ganz ehrlich: wir wollen mit unserer<br />
Forschung und Entwicklung auch Geld verdienen. Damit wollen wir<br />
wachsen, unseren technologischen Ansatz weiter entwickeln, unser<br />
Team vergrößern und verstärken und so fort, letztendlich alles auf<br />
die Beine stellen, was zu einem erfolgreichen Biotechnologie Unternehmen<br />
eben dazugehört.<br />
Um aus kommerzieller Sicht noch einmal das Beispiel Alzheimer<br />
zu bemühen: mit den am Markt befindlichen Medikamenten, die<br />
lediglich die Symptome lindern, aber letztendlich keine ursächliche<br />
Wirkung zeigen, wurde allein im vergangenen Jahr weltweit ein<br />
Umsatz von rund 4,5 Milliarden Euro gemacht. Mit wirksamen Impfstoffansätzen<br />
könnte ein Markvolumen von bis zu 15 Milliarden Euro<br />
adressiert werden.<br />
Brockmeyer: Wie sind Sie auf diese Idee gekommen? Was gab den<br />
Ausschlag zur Gründung von AFFiRiS?<br />
Schmidt: Die Idee kam uns, als wir uns die Aktivitäten der irischen<br />
Pharmafirma Elan genauer anschauten. Elan hatte einen Alzheimerimpfstoff<br />
in die klinische Entwicklung gebracht und schwerwiegende<br />
Nebenwirkungen ausgelöst. Frank Mattner und mir war rasch klar,<br />
wo „der Hase im Pfeffer lag“ und wie die Technologie, später<br />
AFFITOM ® Technologie genannt, aussehen müsste, die wirksame<br />
und sichere Impfstoffe ohne schwerwiegende Nebenwirkungen<br />
liefern kann.<br />
Nachdem wir bald festgestellt hatten, dass noch niemand in diese<br />
Richtung gedacht hatte, es auch keine Patentanmeldungen gab,<br />
standen wir vor der Frage: Machen wir das selbst? Wir haben uns<br />
für das „Selbermachen“ entschieden.<br />
Brockmeyer: Wie leicht war dieses „Selbermachen“? Wie wichtig<br />
waren Förderungen?<br />
Schmidt: Förderungen waren essentiell. Wir hätten das Unternehmen<br />
sonst nicht auf die Beine stellen können. Um an private Geldgeber<br />
zu kommen, ist das Erreichen eines gewissen Entwicklungsstadiums<br />
notwendig.<br />
Als Biotechfirma hätten wir auch von keiner Bank einen Kredit<br />
bekommen, weil wir natürlich keine Sicherheiten hatten, mit denen
eine Bank irgendetwas anfangen hätte können. Deshalb waren<br />
Förderungen von <strong>ZIT</strong>, AWS und FFG notwendig für uns. Dann kamen<br />
jedoch recht rasch auch die privaten Geldgeber. Mit dem Venture<br />
Kapital haben wir es dann geschafft, unser Alzheimer-Projekt soweit<br />
voran zu treiben, dass es auch für einen großen Partner interessant<br />
wurde.<br />
Brockmeyer: Da kommen wir jetzt zum Thema ganz großes Geld:<br />
Wir sprechen von bis zu 430 Millionen Euro...<br />
Schmidt: Ja, die können wir von unserem Pharmapartner<br />
GlaxoSmithKline für alle Rechte an unserer Alzheimerimpfung<br />
bekommen, wenn die Entwicklung zum positiven Abschluss kommt.<br />
Noch mal kurz das Attraktive der AFFITOM ® Technologie: Wir haben<br />
nicht nur eine einzige potenzielle Substanz, sondern wir haben einen<br />
ganzen Pool. Bei potenziellen Problemen können wir neue Impfstoffkandidaten<br />
ins Rennen schicken.<br />
Das Lizenzabkommen ist für uns sehr wichtig - die umfangreiche<br />
Phase III der klinischen Erprobung wäre sonst nicht finanzier- und<br />
umsetzbar.<br />
Wenn dann ein Impfstoffkandidat die Entwicklung erfolgreich<br />
durchläuft und sich am Markt durchsetzt, werden insgesamt 430<br />
Millionen Euro geflossen sein. Dafür haben wir Meilensteinzahlungen<br />
vereinbart. Die erste Zahlung betrug 22,5 Millionen Euro.<br />
Wir wollen nachhaltig wachsen. Unser Ziel ist es ganz bestimmt<br />
nicht, die Firma zu verkaufen.<br />
Brockmeyer: Stichwort nachhaltiger Aufbau: Was kommt nach<br />
Alzheimer?<br />
Schmidt: Wie ja bereits angesprochen befinden sich die beiden<br />
Produktkandidaten unserer Alzheimer-Impfung „im Endspurt“ der<br />
klinischen Phase I Studie. Impfstoff-Kandidaten zur Behandlung von<br />
Atherosklerose, sowie einer zu Behandlung von Parkinson, befinden<br />
sich in der präklinischen Entwicklung. Darüber hinaus haben wir<br />
noch vier weitere Projekte im Köcher und ich gehe davon aus, dass<br />
innerhalb der nächsten 2-3 Jahre noch weitere dazukommen werden.<br />
Wir haben zusätzliche Flächen angemietet und uns auf knapp 1.700<br />
m² vergrößert. Denn Raum brauchen wir, um neue Projekte zu<br />
entwickeln, immer unter derselben Prämisse: dringender medizinischer<br />
Bedarf und attraktives Marktvolumen.<br />
„Wir haben uns für das ‚Selbermachen‘ entschieden.“<br />
Brockmeyer: Bei Ihrem Bedarf an Fläche und Entwicklung wird die<br />
Erweiterung des Campus Vienna Biocenter durch die „Vision 2020“<br />
(siehe Seite 24) relativ wichtig für sie sein?<br />
Schmidt: Ja, der Campus ist wichtig für uns, denn er beherbergt jetzt<br />
schon eine kritische Masse an akademischen Instituten mit exzellenter<br />
Grundlagenforschung dicht an dicht mit kommerziell ausgerichteten<br />
Biotechnologieunternehmen. Die Infrastruktur passt.<br />
Darüber hinaus bietet der Campus die Möglichkeit zu kontinuierlichem<br />
Wachstum. Wir wollen auch wachsen - substantiell und<br />
vernünftig. Und diese Grundlagen sind am Campus gegeben. Der<br />
Blick nach Basel zeigt, wo die Reise hin gehen könnte. Dort gibt es<br />
eine umfangreiche Life Science Szene, darunter sehr viele Biotech-<br />
Firmen, die einfach entstanden sind. Warum? Weil das Umfeld da<br />
war, die kritische Masse und die Infrastruktur, so wie jetzt hier am<br />
Campus auch. Ich sehe die besten Voraussetzungen, dass hier in<br />
Wien in den nächsten Jahren etwas Ähnliches entstehen könnte.<br />
Brockmeyer: Wie wichtig ist der Campus Standort für Ihr Unternehmen?<br />
Schmidt: Sehr wichtig. Der Campus bietet uns wie gesagt die<br />
entsprechende Infrastruktur, auf die wir zurückgreifen können und<br />
auch müssen! Konkret geht es darum, dass wir nicht nur Büros<br />
brauchen, sondern vor allem auch Labors für unsere Forschung und<br />
Entwicklung. Verglichen mit klassischen Wohn- oder Bürobauten sind<br />
Laborgebäude ein kleines Marktsegment. Dazu kommt das Risiko<br />
der Wiedervermietung im Insolvenzfall. Die Biotech-Branche muss<br />
mit diesem Risiko leben. Schließlich sind wir hochinnovativ, quasi an<br />
vorderster Front. Da kann es keine Erfolgsgarantie geben. Das<br />
Scheitern gehört zur Innovation genauso dazu wie der bahnbrechende<br />
Erfolg.<br />
Vor diesem Hintergrund bin ich sehr froh, dass die Stadt Wien,<br />
namentlich das <strong>ZIT</strong>, diesen Risikoweg mit uns und durch den<br />
Campus gegangen ist.<br />
<strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong> 19
Alles forscht<br />
Spitzenstandorte sprießen rund um den Globus. Wien im Vergleich der Giganten.<br />
I japan.<br />
Rund 60 km nordöstlich von Tokyo liegt die Tsukuba Science City,<br />
eines der weltweit beeindruckendsten Forschungsstandort-Projekte.<br />
Es umfasst ein Areal von etwa 28.400 ha (284 km² - im Vergleich<br />
Wien: 415 km²), die Bevölkerung liegt derzeit bei rund 200.000<br />
Menschen und soll bis 2030 auf 350.000 Menschen anwachsen. In<br />
Sachen Forschung und Entwicklung kann die Tsukuba Science City<br />
mit enormen Fakten aufwarten: Aktuell sind dort 46 nationale<br />
Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen beheimatet. Etwa<br />
13.000 Beschäftigte arbeiten in diesen Einrichtungen, 8.500 von<br />
ihnen sind ForscherInnen im engeren Sinne. Weitere 4.500<br />
Forscher Innen sind in privaten Unternehmen beschäftigt, die sich<br />
sowohl direkt im sogenannten „research and education district“,<br />
aber auch im weiteren Stadtbild angesiedelt haben.<br />
I china.<br />
Der Guangzhou Hi-Tech Industrial Development Zone (GHIDZ) sind<br />
mittlerweile viele ihrer Art gefolgt, doch Mitte der 1990er Jahre<br />
wurde die GHIDZ als eine der ersten industriellen Entwicklungszonen<br />
für Spitzentechnologie in China entwickelt. Sie liegt im Osten der<br />
Stadt Guangzhou – einer Stadt im Süden Chinas, deren EinwohnerInnenzahl<br />
jener Österreichs gleicht. Mit ihren fünf verschiedenen<br />
Technologie- und Wissenschaftsparks umfasst sie eine Fläche von<br />
37,34 km² und beherbergt in den einzelnen Parks und Inkubatoren<br />
insgesamt 3.700 Unternehmen. Die thematischen Schwerpunkte<br />
reichen in dem gigantischen Park von Computer- und Software-<br />
Industrie über Life Sciences bis hin zur optischen Industrie.<br />
I Singapur.<br />
Biopolis, ein 2003 eröffneter monumentaler Glas-Beton-Komplex für<br />
rund 250 Millionen Euro: neidvoll blickt Europa auf Singapur.<br />
Bio polis gilt als Schlaraffenland für den ForscherInnengeist, ca.<br />
2.000 WissenschaftlerInnen arbeiten hier auf 22 ha Fläche. „Eine<br />
großzügige Infrastruktur mit hightechverwöhnten Laborarbeitsplätzen<br />
inklusive biomedizinischer Großgeräte und jeder Menge luxuriöser<br />
Forschungsatmosphäre“, so beschreibt die „Medical Tribune“<br />
20 <strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong><br />
Singapurs wichtigsten Forschungsstandort für Life Sciences. Auch<br />
hier im Biopolis arbeiten private und staatliche Forschungseinrichtungen<br />
neben-, aber vor allem eng miteinander. Das Biopolis ist Teil<br />
eines Zwei-Milliarden-Dollar-Programms, um die Wirtschaft des<br />
Landes umzukrempeln.<br />
I uSa.<br />
Das Massachusetts Institute of Technology (MIT) gilt als eine der<br />
weltweit führenden Universitäten im Bereich technologischer<br />
Forschung und Lehre. Das MIT ist Mitglied der Association of<br />
American Universities, einem seit 1900 bestehenden Verbund<br />
führender forschungsintensiver nordamerikanischer Universitäten.<br />
Auch das MIT beeindruckt mit Zahlen: 998 Professuren in 34<br />
Fachbereichen, rund 10.000 StudentInnen (davon ca. 60 % Postgraduates)<br />
und rund 10.000 wissenschaftliche MitarbeiterInnen. Und<br />
– wohl einsame Spitze: 63 NobelpreisträgerInnen. Und der Campus<br />
des MIT braucht gerade mal 0,679 km² an Fläche.<br />
I Wien. CaMpus vIenna BIoCenTer.<br />
Im Oktober <strong>2008</strong> gelingt dem Wiener Biotech-Unternehmen AFFiRiS<br />
(siehe Seite 18) der größte Biotech-Coup der österreichischen<br />
Geschichte: der belgische Pharmariese GlaxoSmithKline zahlt für die<br />
exklusiven Rechte an AFFiRiS Alzheimer-Impfungen bei Erreichen<br />
bestimmter Meilensteine bis zu 430 Millionen Euro – obwohl sich<br />
diese erst in Phase I befinden und obwohl AFFiRiS keinen einzigen<br />
Unternehmensanteil verkauft hat.<br />
Ja, Wien ist eben anders. Denn auch mit – im internationalen<br />
Vergleich - bescheideneren Dimensionen lassen sich Erfolgsgeschichten<br />
schreiben. Die der AFFiRiS ist <strong>2008</strong> sicherlich die<br />
spektakulärste – aber auch andere Erfolgsgeschichten schreibt der<br />
Campus Vienna Biocenter mit seinen 1.400 WissenschaftlerInnen<br />
auf 67.200 m² Labor- und Bürofläche. So wurde beispielsweise im<br />
Dezember bekannt, dass mit Magnus Nordborg einer der weltweit<br />
führenden Forscher auf dem Gebiet der molekularen Pflanzenbiologie<br />
von der Southern University in L.A. nach St. Marx zieht, als neuer<br />
Direktor des Gregor-Mendel-Instituts für Molekulare Pflanzenbiolo-
gie. Oder die Intercell AG, die <strong>2008</strong> ein brandneues Gebäude am<br />
Campus bezogen hat (siehe Seite 26): Sie wurde nicht nur vom<br />
World Economic Forum zum „Technology Pioneer 2009“ ernannt,<br />
sondern erhielt 12,5 Millionen Dollar vom US Department of Health<br />
and Human Services für die weitere Entwicklung des Impfpflasters<br />
gegen pandemische Grippe. Und mit dieser Auswahl werden nur<br />
einige sehr wenige genannt.<br />
Für Wien wird es auch in Zukunft nicht darum gehen, mit den<br />
finanziellen Mammutschritten im asiatischen Raum mitzuhalten,<br />
sondern gezielt Investitionen in Infrastruktur, Ausbildung und<br />
Projekte zu tätigen, um die jeweils exzellenten Kompetenzen weiter<br />
zu stärken. Der Campus Vienna Biocenter ist dahingehend ein<br />
Vorzeigeprojekt. Hier ist es gelungen, Unternehmen, außeruniversitäre<br />
und universitäre Forschung sowie die Ausbildung miteinander zu<br />
verknüpfen und internationale Sichtbarkeit zu erlangen.<br />
Nicht zuletzt haben die Entwicklungen am Campus Vienna Biocenter<br />
dazu beigetragen, dass der stadtplanerische Entwicklungsprozess im<br />
Gebiet St. Marx so erfolgreich verlief. Wie wichtig das Thema für<br />
Stadtentwicklung geworden ist, erkennt man auch daran, dass vier<br />
von 13 Wiener Zielgebieten für ihre zukünftige Entwicklung auf die<br />
Themen Forschung, Technologie, Innovation und Kreativität setzen<br />
und sich in ihren Leitbildern darauf festlegen.<br />
Dipl.-Geogr. Thomas Berndt<br />
„Die der AFFiRiS ist <strong>2008</strong> sicherlich die spekta-<br />
kulärste – aber auch andere Erfolgsgeschichten<br />
schreibt der Campus Vienna Biocenter mit seinen<br />
1.400 WissenschaftlerInnen auf 67.200 m²<br />
Labor- und Bürofläche.“<br />
<strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong> 21
22 <strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong>
<strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong> 23
8+6=51*<br />
Die Umsetzung der Vision 2020 am Campus Vienna Biocenter.<br />
Die Erfolgsgeschichte des Campus Vienna Biocenter (CVBC) begann<br />
in den 1980er Jahren mit der Gründung des Forschungsinstituts für<br />
Molekulare Pathologie, dem Wiener Grundlagenforschungszentrum<br />
von Boehringer Ingelheim. Seit der Ansiedelung von fünf Universitätsinstituten,<br />
die jetzt die Max F. Perutz Laboratories bilden, wächst der<br />
Campus kontinuierlich. Neben der Fachhochschule FH Campus Wien<br />
profitieren auch zwei neue Institute der Österreichischen Akademie<br />
der Wissenschaften von den Vorzügen dieses Standorts: Das Institut<br />
für Molekulare Biotechnologie und das Gregor Mendel Institut für<br />
Molekulare Pflanzenbiologie zählen inzwischen zu den renommiertesten<br />
Forschungseinrichtungen Österreichs.<br />
Die Ausbildungs- und Forschungsaktivitäten dieser Institutionen<br />
verbinden sich am Campus Vienna Biocenter mit den Strategien<br />
erfolgreicher Unternehmen. Die Erfolgsgeschichte der international<br />
etablierten, börsennotierten Intercell sorgt weit über die Grenzen<br />
Europas hinaus für Aufsehen. Auch die bereits auf den weltweiten<br />
Märkten erfolgreichen Unternehmen Bender MedSystems und VBC<br />
Genomics schätzen die Synergiepotenziale am Campus. Vielversprechende<br />
Produktideen weiterer Start-ups wie der Venture Capitalfinanzierten<br />
AFFiRiS, die erst jüngst einen Lizenzdeal mit dem<br />
Phar ma unternehmen GlaxoSmithKline abschließen konnte (siehe<br />
Seite 18), lassen auch in der Zukunft interessante Entwicklungen<br />
erwarten.<br />
Am Campus Vienna Biocenter wird aber nicht nur exzellente Forschung<br />
betrieben, sondern auch dafür gesorgt, dass deren Nutzen<br />
für die Gesellschaft sichtbar wird: die öffentlich finanzierte Einrichtung<br />
dialoggentechnik stellt gemeinsam mit dem Institut für<br />
Molekulare Biotechnologie einen Ort des Dialogs zwischen Wissenschaft<br />
und Öffentlichkeit zur Verfügung: das Vienna Open Lab.<br />
Die Forschungseinrichtungen am 67.200 m² großen Campus Vienna<br />
Biocenter beschäftigen inklusive DoktorandInnen rund 900 MitarbeiterInnen.<br />
Dazu kommen etwa 880 Studierende der Universität Wien,<br />
der Medizinischen Universität Wien und der Fachhochschule. In den<br />
Unternehmen und Spezialeinrichtungen am Campus sind zusätzlich<br />
über 300 Personen tätig.<br />
In der Vision 2020 haben die vier am Campus ansässigen Forschungseinrichtungen<br />
gemeinsam mit sechs Unternehmen und fünf<br />
intermediären Institutionen gemeinsame Pläne vorgelegt, wie die<br />
24 <strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong><br />
infrastrukturelle Ausstattung des Campus Vienna Biocenter verbessert,<br />
und so die Weichen für eine Weiterentwicklung des Campus<br />
Vienna Biocenter zu einem international nicht mehr wegzudenkenden<br />
Standort für Spitzenforschung auf dem Gebiet der Life Sciences<br />
gestellt werden können. Ziel ist der gemeinsame Ausbau der<br />
Forschungsinfrastruktur in einer Campus-weiten Gesellschaft (CSF).<br />
Diese Gesellschaft soll eine gemeinschaftliche Nutzung von hochwertigen<br />
Forschungsgeräten durch Forschungseinrichtungen und<br />
Unternehmen ermöglichen. Die daraus resultierenden Synergieeffekte<br />
sollen zukünftig laufende Investitionen ermöglichen, um<br />
anhaltend eine Ausstattung am letzten Stand der Forschung zu<br />
garantieren. Die gemeinsamen Pläne reichen dabei von der Beschaffung<br />
millionenschwerer Forschungsgeräte über den Aufbau von<br />
Personal, das Expertise mit dem Umgang dieser Hightech Forschungsinfrastruktur<br />
aufbaut, bis hin zur Einrichtung eines Betriebskindergartens<br />
und den Ausbau des Vienna Open Labs, um sicherzustellen,<br />
dass die Forschungsaktivitäten und -ergebnisse auch einer<br />
breiten Öffentlichkeit bekannt werden.<br />
Im Auftrag von Wissenschaftsminister Dr. Johannes Hahn und<br />
Finanz- und Wirtschaftsstadträtin Vizebürgermeisterin Mag. a Renate<br />
Brauner wurde die Vision 2020 durch die Life Science Clusterinitiative<br />
LISA VR unter Einbindung internationaler ExpertInnen<br />
evaluiert. Fünf internationale FachexpertInnen unter dem Vorsitz des<br />
renommierten Genforschers Prof. Dr. Martin Hrabé de Angelis 1<br />
haben dem Campus Vienna Biocenter und den gemeinsam vorgelegten<br />
Plänen ein beeindruckendes Zeugnis ausgestellt: Die JurorInnen<br />
zeigten sich äußerst beeindruckt von der Entwicklung des<br />
CVBC in den letzten Jahren. Die vorgeschlagenen Infrastrukturinvestitionen<br />
seien der kritische nächste Schritt für den Campus, um die<br />
wissenschaftlichen Arbeiten auf Weltspitzen-Niveau fortzusetzen und<br />
auszubauen. Die ausgebaute Infrastruktur könne mit dazu beitragen,<br />
talentierte WissenschafterInnen nach Wien zu holen und die Erfolgsgeschichte<br />
des CVBC fortzusetzen. Die pointierte Zusammenfassung<br />
der Jury: „The jury is very enthusiastic regarding Vision 2020 and<br />
strongly recommends funding.“<br />
Am 18. Dezember <strong>2008</strong> gaben Brauner und Hahn öffentlich<br />
bekannt, den Empfehlungen der Jury zu folgen und die geplanten<br />
Investitionen in modernste Forschungseinrichtungen und soziale<br />
Infrastruktur am Campus Vienna Biocenter in den nächsten
10 Jahren mit 51,7 Millio nen Euro zu unterstützen. Schon 2009 soll<br />
eine Gesellschaft errichtet werden, die die Großgeräte anschafft<br />
und ein Modell entwickelt, wie die neue Forschungsinfrastruktur<br />
gemeinschaftlich genutzt werden kann.<br />
Mit diesem Investment zeigen der Bund und die Stadt Wien, dass<br />
Investitionen in den Forschungsstandort Wien auch in wirtschaftlich<br />
schwierigeren Zeiten einen wichtigen Wachstums- und Beschäftigungsmotor<br />
darstellen.<br />
Mag. a Eva Czernohorszky<br />
„Am 18. Dezember <strong>2008</strong> gaben Brauner und<br />
Hahn öffentlich bekannt, den Empfehlungen der<br />
Jury zu folgen und die geplanten Investitionen in<br />
modernste Forschungseinrichtungen und soziale<br />
Infrastruktur am Campus Vienna Biocenter in den<br />
nächsten 10 Jahren mit 51,7 Millionen Euro zu<br />
unterstützen.“<br />
8+6=51<br />
*8 wissenschaftliche Einrichtungen und 6 Unternehmen haben gemeinsame eine<br />
Vision für den Campus Vienna Biocenter entworfen, die von Bund und Stadt Wien mit<br />
51,7 Millionen Euro unterstützt wird.<br />
1 Prof. Dr. Martin Hrabé de Angelis ist Direktor des Institutes für Experimentelle<br />
Genetik in München und Direktor des Europäischen Mausmutantenarchivs (EMMA),<br />
außerdem Mitgründer von INGENIUM Biopharmaceuticals AG.<br />
<strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong> 25
Vom besonderen Glanz<br />
Spezifisches Know-how für die Errichtung von Laborgebäuden.<br />
Mit dem Laborgebäude „Campus Vienna Biocenter 3“ (CVBC 3) wurde<br />
an Österreichs Life Sciences Forschungsstandort Nummer 1 ein<br />
Lehrstück einer modernen Laborimmobilie umgesetzt, das – so wie<br />
auch schon der CVBC 2 – neue Maßstäbe setzt. Forscherinnen und<br />
Forscher entsprechen heute bei Weitem nicht mehr dem Labor kittel<br />
und Schutzbrille tragenden Klischee, das viele von uns noch von<br />
unseren ChemielehrerInnen aus der Schulzeit in Erinnerung haben.<br />
Nein, geforscht wird heute unter höchst kreativen Bedingungen – es<br />
braucht Licht, es braucht Farbe, es braucht Form.<br />
Der CVBC 3 ist eine maßgeschneiderte Laborimmobilie. Die Grundrisse<br />
sowie die laborspezifische technische Ausstattung wurden im<br />
gesamten Gebäude individuell auf die Anforderungen der Nutzer und<br />
Nutzerinnen abgestimmt. Das Gebäude unterstützt so die internen<br />
Abläufe einzelner Forschungsgruppen sowie des gesamten Unternehmens.<br />
Seit Oktober <strong>2008</strong> profitiert nun die Intercell von diesen optimalen<br />
Bedingungen. Und es war kein kleines Stück Arbeit: in intensiver<br />
Abstimmung mit den Errichtern PRISMA und Hypo Tirol wurde quasi<br />
iterativ geplant, verworfen, nachjustiert, umgeplant – ein Maßanzug<br />
braucht eben seine Zeit. Im Endergebnis ist der Campus Vienna<br />
Biocenter aber um ein architektonisch anspruchsvolles und technisch<br />
ausgereiftes Laborgebäude reicher. Weitere 7.500 m² Büro-<br />
und Laborfläche werden mit Forschungskompetenz gefüllt und<br />
erhöhen damit nochmals die kritische Masse am Campus.<br />
Das Gebäude mit H-förmigem Grundriss – entworfen von Boris<br />
Podrecca – liegt im Zentrum des Campus Areals. Die Architektur ist<br />
auf ein Optimum an natürlich belichteter Fläche ausgerichtet.<br />
Während entlang der Fassade attraktive Laborzonen situiert sind,<br />
gruppieren sich die für den Laborbetrieb erforderlichen Nebenräume<br />
im Bereich der Stiegenhauskerne. Der verglaste Mittelteil des<br />
Hauses öffnet sich zum Campusinnenhof hin mit einer zweigeschossigen<br />
Lobby. Die Lobby selbst ist als multifunktionaler Bereich<br />
konzipiert, in dem Präsentationen, Ausstellungen und ähnliche<br />
Events stattfinden können.<br />
Um dies alles zu ermöglichen, muss das Gebäude spezifische<br />
statische Komponenten erfüllen. Nur so können die größeren<br />
Raumhöhen und –tiefen umgesetzt werden. Mit einer Deckentraglast<br />
26 <strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong><br />
von 5 kN/m² liegen die Anforderungen im Laborgebäudebau deutlich<br />
über denen des üblichen Bürostandards. Ebenso bedarf es eines<br />
labortauglichen Rastermaßes, das insbesondere die typische<br />
Mö b lier ung, wie Werkbänke und Autoklaven, einbezieht.<br />
Die Ansprüche an die Haustechnik sind enorm: leistungsstarke<br />
Kühlsysteme müssen überdurchschnittlich hohe Wärmelasten<br />
bewältigen. Gegenüber einem bürotypischen 1-fachen Luftwechsel<br />
ist ein mindestens 5-facher einzuplanen. Die Bereitstellung von<br />
Sondermedien wie Druckluft, Erdgas, CO 2 usw. muss berücksichtigt<br />
werden. Themen wie Brandschutz sowie die Ausfallsicherheit der<br />
haustechnischen Anlagen runden die anspruchsvolle Planung ab.<br />
Die Investitionen für die Errichtung belaufen sich auf 17,5 Millionen<br />
Euro. Die Errichtungsgesellschaft (PRISMA und Hypo Tirol) hat<br />
gemeinsam mit dem <strong>ZIT</strong> und dem WWFF weitere 600.000 Euro in die<br />
Hand genommen, um im Zuge der Fertigstellung des CVBC 3 auch<br />
die Gestaltung des Campus Areals vorzunehmen und damit die<br />
Aufenthaltsqualität für Studierende, Forschende und Gäste deutlich<br />
zu verbessern. Abgerundet wurden diese Maßnahmen mit der<br />
Umsetzung eines Leit- und Orientierungssystems: bisher eher<br />
zurückhaltend, kündigt nun eine gut sichtbare, fünf Meter hohe Stele<br />
in Form einer stilisierten Doppelhelix den Campus Vienna Biocenter<br />
von der Viehmarktgasse sowie vom Rennweg aus an.<br />
Denn allein an Sichtbarkeit hat es bislang noch gefehlt: mit der<br />
Doppelhelix als Symbol für Life Sciences wird endlich auch lokal<br />
sichtbar, dass am alten Schlachthof St. Marx internationale Spitzenforschung<br />
betrieben wird.<br />
Dipl.-Geogr. Thomas Berndt
„Die Errichtungsgesellschaft (PRISMA und Hypo<br />
Tirol) hat gemeinsam mit dem <strong>ZIT</strong> und dem<br />
WWFF weitere 600.000 Euro in die Hand<br />
genommen, um im Zuge der Fertigstellung des<br />
CVBC 3 auch die Gestaltung des Campus Areals<br />
vorzunehmen und damit die Aufenthaltsqualität<br />
für Studierende, Forschende und Gäste deutlich<br />
zu verbessern.“<br />
<strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong> 27
28 <strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong>
<strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong> 29
30 <strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong><br />
„Die Stadt Wien investiert jährlich über drei<br />
Milliarden Euro für Produkte und Dienst-<br />
leistungen, die die öffentliche Hand benötigt.<br />
Das ist eine Nachfragesumme am Wiener Markt,<br />
die den Standort nachhaltig stützt und ein wich-<br />
tiges Instrument nachfrageorientierter Wirt-<br />
schaftsförderung darstellt.“
Wien Wins<br />
Win-Win Potenziale zwischen Technologieförderung und Beschaffung.<br />
Seit seinem Bestehen hat das <strong>ZIT</strong> mehr als tausend Projekte von<br />
Unternehmen gefördert, die ihre Produkte und Dienstleistungen<br />
erneuern oder neue Produktideen verwirklichen wollen. Einige – zum<br />
Glück nur wenige - dieser Projekte konnten nicht zu einem erfolgreichen<br />
Ende gebracht werden. Die wenigsten, weil die Entwickler-<br />
Innen ihre Ideen nicht technisch umsetzen können. Wer scheitert,<br />
scheitert beim Markteintritt - weil es nicht gelingt, ausreichend Nachfrage<br />
nach den neuen Produkten zu stimulieren.<br />
Die ersten ReferenzkundInnen sind für die Neugründung oder<br />
Neupositionierung eines Unternehmens von zentraler Bedeutung,<br />
weil prominente PilotanwenderInnen die beste Werbung für neue<br />
Produkte sind. Etliche Unternehmen, deren Technologien auch für<br />
die Stadt Wien als Kundin interessant sind, bemühen sich deshalb<br />
darum, diese von ihren Produkten zu überzeugen. Viele auch mit<br />
Erfolg, wie zum Beispiel das Wiener Unternehmen Emcools, dessen<br />
Kühlmatten bei HerzinfarktpatientInnen die Sterberate und langfristige<br />
Gewebeschäden minimieren. Mittlerweile sind alle Notarztwägen<br />
der Wiener Rettung und etliche Notaufnahmen der Wiener<br />
Krankenhäuser mit den Kühlmatten von Emcools ausgestattet, deren<br />
Entwicklung im Rahmen der Technologieförderung unterstützt wurde.<br />
Bei anderen Unternehmen gehen Technologieförderung und öffentliche<br />
Nachfrage nicht so nahtlos ineinander über. Das Wiener<br />
Unternehmen iku windows hat mit einer <strong>ZIT</strong>-Förderung selbstreinigende<br />
Glasfassadenelemente für Hochhäuser entwickelt. Das<br />
Unternehmen hat mittlerweile KundInnen aus Dubai, Taiwan und<br />
Saudi-Arabien. Auch mit dem Wiener Krankenanstaltenverbund gab<br />
es bei der Sanierung des Otto Wagner Spitals eine erfolgreiche<br />
Kooperation. Für das Wiener Unternehmen ist es aber noch keine<br />
Selbstverständlichkeit, dass die einzigartigen Technologien des<br />
Unternehmens bei Wiener Bauprojekten mitgedacht werden.<br />
Die Stadt Wien investiert jährlich über drei Milliarden Euro für<br />
Produkte und Dienstleistungen, die die öffentliche Hand benötigt.<br />
Das ist eine Nachfragesumme am Wiener Markt, die den Standort<br />
nachhaltig stützt und ein wichtiges Instrument nachfrageorientierter<br />
Wirtschaftsförderung darstellt. Die überwiegend dezentrale Vergabepolitik<br />
der Stadt Wien hat dabei Vor- und Nachteile für Unternehmen,<br />
die Innovationen anzubieten haben. Der Vorteil besteht darin, dass<br />
die MitarbeiterInnen in den Fachabteilungen eine sehr hohe Experti-<br />
se in ihrem Fach haben und sich über neue Technologien am<br />
Laufenden halten. Ein Nachteil kann sich aber vor allem für TechnologieanbieterInnen,<br />
deren Produkte oder Dienstleistungen für<br />
mehrere Magistratsabteilungen oder Unternehmen der Stadt Wien<br />
geeignet sind, daraus ergeben, dass es extrem aufwändig ist, überall<br />
die richtigen AnsprechpartnerInnen zu finden und zu erreichen.<br />
Genau da will das <strong>ZIT</strong> in Zukunft ansetzen, um einen nachhaltigen<br />
Markterfolg der geförderten Innovationen und Technologieentwicklungen<br />
und damit Beschäftigungs- und Umsatzwachstum am<br />
Standort Wien zu forcieren. Ziel ist ein systematischer Informationsaustausch<br />
zwischen der Wirtschafts- und Technologieförderung und<br />
der Beschaffung der Stadt Wien und ihrer Unternehmen. Die Vorteile<br />
dieser Initiative liegen auf der Hand: Die Stadt erhält durch diese Praxis<br />
maßgeschneiderte Lösungen für Produkte, Bauten und Dienstleistungen.<br />
Gleichzeitig stärkt sie ihr Image als zukunftsorientierte,<br />
inno vative und einzigartige Metropole. Die Unternehmen werden<br />
motiviert, in Forschung und Entwicklung zu investieren und in ihren<br />
Markt- und Wachstumschancen gestärkt, da sie eine anerkannte und<br />
große Referenzkundin erhalten. Und nicht zuletzt bindet eine solche<br />
Vorgehensweise die innovativen Unternehmen an den Standort.<br />
Unter der Patenschaft von Vizebürgermeisterin Renate Brauner und<br />
Stadträtin Sandra Frauenberger hat das <strong>ZIT</strong> <strong>2008</strong> gemeinsam mit<br />
ExpertInnen des Magistrats Ideen erarbeitet, wie ein systematischer<br />
Informationsaustausch über innovative Stadttechnologien organisiert<br />
werden kann. Schon im ersten Quartal 2009 werden gemeinsame<br />
Aktivitäten des <strong>ZIT</strong> und des Magistrats gestartet. Damit die Effekte<br />
von Fördermaßnahmen nachhaltiger und die Leistungen und<br />
Angebote der Stadt Wien noch besser werden.<br />
Mag. a Eva Czernohorszky<br />
<strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong> 31
Populär, forsch, sterblich. Das sind Neue Medien<br />
Logbuch eines Jahres.<br />
„Beim Bundespresseball feiert man trotzig gegen die Krise an“,<br />
titelten deutsche Medien Ende <strong>2008</strong> und sprachen damit die gebeutelte<br />
Medienbranche an, deren Wanken nicht nur auf die Finanzkrise<br />
zurückzuführen ist. Im Gegenteil: Dass klas sische Medien mit ihren<br />
Finanzierungsmodellen zunehmend in Sackgassen geraten, ist für<br />
Zeitungen, Fernsehen und Film eine große Herausforderung, deren<br />
Kunde bereits seit einiger Zeit in der Medienbranche umgeht. Und<br />
wer gewinnt? Neue Medien. Immer mehr KMU machen mit neuen<br />
Marktsegmenten wie Online Gaming, Musikplattformen oder Mobile<br />
TV immer mehr Geld. Im Laufe des letzten Jahres haben wir uns<br />
einigen dieser neuen Marktsegmente genähert.<br />
I neujahr, Wien. MedIen? prInT, rundfunk, WerBunG.<br />
Um die Unwahrheit dieser Dreifaltigkeit gleich zu Beginn eines neuen<br />
Jahres zu beseitigen, gibt das <strong>ZIT</strong> eine Mediennutzungsstudie bei<br />
Karoline Simonitsch, Expertin für New Media, in Auftrag.<br />
Wir bemerken, dass Web 2.0 nicht das letzte Schlagwort ist, wenn<br />
es um Medien geht. Wesentlich ist, dass sich mit zunehmender<br />
Digitalisierung das NutzerInnenverhalten, und auch die ökonomischen<br />
Rahmenbedingungen, ändern - sehr anschaulich anhand<br />
der US-Präsidentschaftskampagne von Barack Obama zu beobachten.<br />
Der Kontakt potenzieller WählerInnen erfolgte per SMS vor<br />
wichtigen Bekanntgaben, per bahnbrechendem Internetauftritt, per<br />
täglicher E-Mail mit persönlicher Note, per Infomercials im Fernsehen<br />
- die Antwort oft per YouTube Videoclip.<br />
I märz, Berlin. Make love, noT WarCrafT.<br />
Schicke eine Nicht-Spielerin auf eine der größten deutschen Games-<br />
Konferenzen und warte auf das Ende des Experimentes. Die Quo<br />
Vadis in Berlin ermöglicht einen gelungenen Einstieg in die Themen<br />
des heute größten Segmentes am Unterhaltungsmarkt. Denn es<br />
ist mittlerweile zum Gemeinplatz geworden, dass Grand Theft Auto<br />
IV bei seiner Veröffentlichung <strong>2008</strong> in der ersten Verkaufswoche<br />
mit 500 Millionen Dollar mehr eingespielt hat als der erfolgreichste<br />
Hollywood Blockbuster aller Zeiten, Batman - The Dark Knight. Man<br />
glaube nur den Zahlen: Mittlerweile spielen 65% der amerikanischen<br />
Haushalte, die Hälfte der GamerInnen ist zwischen 18 und 49 Jahren<br />
32 <strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong><br />
alt. Auch das Vorurteil, dass nur männliche Jugendliche spielen, ist<br />
hinfällig: <strong>2008</strong> waren 40% aller SpielerInnen Frauen. Die Zahlen verraten<br />
auch etwas über die Zukunft: Während früher Computerspiele<br />
führend waren, ist das wichtigste Marktsegment heute das Online-<br />
Game auf einer Konsole des Vertrauens: 59% aller SpielerInnen<br />
spielen bereits mit einer weiteren Person gemeinsam – und diese<br />
sitzt selten neben ihnen. Die Kreativität von Games-EntwicklerInnen<br />
bei Workshoptiteln auf Konferenzen („Make Love, not Warcraft“ war<br />
der Titel eines Panels) sollte angesichts dieser neuen Vielfalt auch in<br />
den Spielen selbst Eingang finden: auf dass für Mädchen nicht nur<br />
„Auf dem Ponyhof“ bleibt.<br />
I auguSt, Wieder Berlin. neue MedIen koMMen IM<br />
reTro-GeWand.<br />
Die Medienwoche Berlin Brandenburg dieses Jahr erstmals gemeinsam<br />
mit der IFA (Internationale Funk Ausstellung) im ICC – einem<br />
Messegelände, das in den 60er Jahren in Gestalt eines wahrhaftigen<br />
UFOs in Westberlin gelandet ist – zu veranstalten, erweist sich als<br />
gute Idee. Auf diese Weise wird der Beweis erbracht, dass nicht<br />
immer Technologien Inhalte überholen – zuweilen ist es auch umgekehrt.<br />
Während in riesigen Hallen immer größere Flachbildschirme<br />
als Neuerungen gepriesen werden, hört man nebenan über wahre<br />
Innovationen: Fernsehen ist schon jetzt nicht mehr so, wie es war.<br />
Film wird folgen, Radio auch.<br />
Während deutsche Fernseh-Granden – öffentlich-rechtliche und<br />
private - wie Markus Schächter, Intendant des ZDF, oder Marcus<br />
Englert, ProSiebenSat1, predigen, dass „Fernsehprogramm allein<br />
fürs Fernsehen zu machen, gestern war“, hat Achim Berg, CEO<br />
Microsoft Deutschland, eine klare Vorstellung von der Fernsehzukunft:<br />
„Aus reinen ZuschauerInnen werden AkteurInnen, die sich<br />
ihr Programm gestalten und durch zahlreiche Angebote des Webs<br />
ergänzen können.“<br />
I SeptemBer, dieSmal Wien. MedIenMesse, TreffpunkT<br />
WoHnZIMMer.<br />
Das <strong>ZIT</strong> nimmt die Medienmesse Wien zum Anlass, einige Themen<br />
zur Diskussion zu stellen. Sieht man Zahlen über die Unterhaltungs-
anche, so wird schnell klar, dass der rasant wachsende Markt<br />
Games wohl verstärkt Arbeitskräfte braucht. Nachwuchs, der in Österreich<br />
nicht genügend Ausbildungsmöglichkeiten vorfindet. Dieses<br />
Themas hat sich eine Gruppe um Harald Riegler, CEO Sproing, und<br />
Hans Solar, Leiter des Games College Wien, angenommen. Nach<br />
dem Gespräch auf der Medienmesse Wien wurde auf der Gamecity<br />
Vienna eifrig für den Beruf „Games-EntwicklerIn“ geworben.<br />
I OktOBer, Wien. kleInsTer GeMeInsaMer nenner.<br />
Der Mobile Content Day findet nach jahrelangen erfolgreichen<br />
Veranstaltungsreihen in München und Hamburg erstmals in Wien<br />
statt. 4 Milliarden Menschen weltweit sind mobil, schon 2005<br />
überholten Handys PCs. Es liegt auf der Hand, dass es – aus Sicht<br />
der WerberInnen und MedienproduzentInnen - keine bessere<br />
Plattform für Information und Werbung gibt als die mobile, schließlich<br />
„legt niemand das Ding weg“, wie sich Maks Giordano, verantwortlich<br />
für den Bereich Mobile bei ProSiebenSat1, ausdrückt.<br />
Warum sich der Markt für mobile Internet-Anwendungen trotzdem so<br />
langsam entwickelt hat, hängt mit vielen Faktoren zusammen, allen<br />
voran den Tarifstrukturen. Noch heute wird in diesem Bereich am<br />
meisten experimentiert: Sind Mobisodes besser als lange Episodes?<br />
Muss neuer Content her, um der kurzen Aufmerksamkeitsspanne<br />
der Handy-BesitzerInnen gerecht zu werden? Vielleicht weist uns<br />
Japan die Zukunft: Die mobile Gemeinde der Social Network<br />
Platform Mixi hat die Internet-Gemeinde bereits überholt. Aber man<br />
muss nicht so weit blicken, um Trends zu erkennen: der von den<br />
Salzburger Nachrichten betriebene Blog mein.salzburg.com – der<br />
von Nutzung durch mobile UserInnen lebt - übertrifft die LeserInnenschaft<br />
der klassischen Zeitung um 100%.<br />
Zum Abschluss einige Schritte zurück: Der Wiener Medienphilosoph<br />
Frank Hartmann beschloss einen seiner Vorträge über Identität in<br />
der Cybermoderne mit der Einschätzung, dass wir trotz allem erst im<br />
Biedermeier des Medienzeitalters leben. So gesehen sind weder<br />
Massive Multiplayer Online Games noch Mobisodes besonders<br />
aufregend. Vielmehr bleibt abzuwarten, was kommt – und was das<br />
für uns bedeutet.<br />
DI in Kristina Wrohlich<br />
„Denn es ist mittlerweile zum Gemeinplatz<br />
geworden, dass Grand Theft Auto IV bei seiner<br />
Ver öffentlichung <strong>2008</strong> in der ersten Verkaufs-<br />
woche mit 500 Millionen Dollar mehr eingespielt<br />
hat als der erfolgreichste Hollywood Blockbuster<br />
aller Zeiten, Batman – The Dark Knight.“<br />
<strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong> 33
34 <strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong>
„Spiele sind ein Kulturmedium.“<br />
Harald Riegler, Geschäftsführer Sproing, im Gespräch.<br />
Sproing ist ein gar nicht mehr so junges Wiener Studio, das erfolgreich<br />
Spiele entwickelt - Computerspiele. Das <strong>ZIT</strong> hat das Unternehmen<br />
<strong>2008</strong> im Rahmen des Calls Motion Media Vienna gefördert.<br />
Georg Brockmeyer: Herr Riegler, Sie entwickeln Computerspiele.<br />
Keine klassische Branche in Wien. Doch offensichtlich erfolgreich,<br />
warum?<br />
Harald Riegler: Dieser Eindruck täuscht, es gibt in Wien durchaus<br />
auch andere sehr erfolgreiche Spieleentwickler. In den letzten Jahren<br />
ist regelrecht ein kleiner Cluster entstanden. Ich denke, unser Erfolg<br />
im Speziellen beruht hauptsächlich auf unserer Geduld, organisch<br />
und nachhaltig zu wachsen und den Dingen die Zeit zu geben, die sie<br />
brauchen. Es ist in dieser Branche sehr leicht, zu schnell zu ambitioniert<br />
zu werden, weshalb auch viele Unternehmen scheitern. Kreative<br />
Teams brauchen eine gewisse Zeit um zusammenzuwachsen, dann<br />
kann Großartiges entstehen.<br />
Brockmeyer: Vor welchen Herausforderungen steht die Games<br />
Industrie in Österreich?<br />
Riegler: Sie steht im uneingeschränkten internationalen Wettbewerb<br />
mit vielen anderen Ländern, da kein relevanter Heimatmarkt<br />
vorhanden ist. Alle österreichischen Studios entwickeln deshalb<br />
Spiele, die weltweit vertrieben werden. Dort stehen wir dann in<br />
Konkurrenz mit Entwicklern aus aller Welt. Eine der Herausforderungen<br />
ist es, den Entwicklern aus Asien und Osteuropa die Stirn zu<br />
bieten. Die können nämlich viel günstiger produzieren als wir - das<br />
Budget einer Spieleentwicklung sind zu 90% Personalkosten.<br />
Da Spiele aber sehr stark kulturell geprägt sind, ist es für diese Länder<br />
derzeit noch schwierig, Spiele zu entwickeln, die der westlichen<br />
Kultur entsprechen. Die zweite Herausforderung ist der Konkurrenzkampf<br />
gegen Länder wie z.B. Kanada, die die Branche stark<br />
subventionieren um weltweit führend zu werden. In Folge dessen<br />
haben große Spielefirmen in Kanada dutzende high-end Studios mit<br />
tausenden Mitarbeitern pro Studio aufgebaut. Dabei liegen die Personalkosten<br />
durch die Subventionen bei weniger als der Hälfte der<br />
Kosten von Wien, und das bei qualitativ am Puls der Zeit liegenden<br />
Entwicklungsteams. Hier ist es notwendig, mit unseren Verbänden<br />
über die EU-Politik entsprechenden Druck aufzubauen, um diese<br />
extremen Wettbewerbsverzerrungen zu unterbinden. Darüber hinaus<br />
gilt es, die Ausbildungssituation im Games-Bereich zu verbessern, da<br />
wir in Österreich noch mehr Qualität wie auch Quantität brauchen.<br />
Brockmeyer: Games, mehr als Ballerspiele?<br />
Riegler: Filme, mehr als Actionmovies? Bücher, mehr als Horrorschinken?<br />
Musik, mehr als Heavy Metal? Natürlich! Es gibt Spiele für<br />
Kinder, für Erwachsene, für Frauen und für Männer, anspruchsvolle<br />
oder seichte, verspielte oder brutale, solche die man alleine spielt<br />
oder mit Millionen anderen, großartige wie auch furchtbar schlechte.<br />
Die Liste lässt sich endlos fortsetzen. Spiele sind ein Kulturmedium<br />
geworden, das es in allen Farben und Formen gibt. Werfen Sie einen<br />
Blick auf die Spiele auf unserer Webseite, um einen Eindruck von der<br />
großen Vielseitigkeit allein nur unseres Studios zu bekommen.<br />
Brockmeyer: Wie kann ich denn Spieleentwicklerin oder Spieleentwickler<br />
werden?<br />
Riegler: Ähnlich wie man im Film Drehbuchautor, Regisseur,<br />
Kameramann, Komponist, Schauspieler oder Special-Effects<br />
Spezialist werden kann, muss man auch im Spielebereich zuerst eine<br />
Berufswahl treffen. Beispielsweise 3D Grafiker, 3D Animator,<br />
Concept Artist, Produzent, Programmierer, Musiker, Sound Designer,<br />
Game Designer, Level Designer, Tester, usw. Für diese gibt es die<br />
unterschiedlichsten Ausbildungen (Grafik: Diverse Kunstausbildungen;<br />
Programmierung: TU, FH; Produzent: FH, TU; Game Design:<br />
TU, FH, Gamescollege; Tester: Gamescollege). Unsere Akademikerquote<br />
liegt bei über 50 Prozent, und wir legen sehr viel Wert auf<br />
ehrgeizige, motivierte und hochqualifizierte Mitarbeiter.<br />
Brockmeyer: Sie haben vom <strong>ZIT</strong> eine Förderung erhalten. Wie<br />
wichtig ist für Ihre noch junge Branche die Wirtschaftsförderung?<br />
Riegler: Äußerst wichtig, weil wir so den Abstand zu anderen<br />
Ländern verkürzen können, die das Potenzial dieser Branche früher<br />
erkannt haben und auch schon früh unterstützt haben. Unser<br />
Forschungs- & Entwicklungsaufwand ist sehr hoch für ein KMU, aber<br />
dringend notwendig, um den neuesten Entwicklungen nicht nur<br />
hinterher, sondern immer wieder auch einen Schritt voraus zu sein.<br />
Da wir uns allein aus dem Cash-Flow finanzieren, gibt uns die<br />
<strong>ZIT</strong>-Förderung die Möglichkeit, dieses Jahr eine ambitioniertere<br />
Technologieentwicklung zu betreiben als wir das sonst gekonnt<br />
hätten.<br />
Brockmeyer: Sie entwickeln mit der Förderung eine neue Prozesstechnologie<br />
für die Spieleentwicklung. Was darf ich mir darunter<br />
vorstellen?<br />
<strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong> 35
„Spiele sind ein Kulturmedium.“<br />
Riegler: Spieleentwicklung ist hochkomplex geworden. Es geht um<br />
Millionenbudgets und daher kommt der Effizienz des Personaleinsatzes<br />
und den Tools, um möglichst schnell kreative Ideen testen zu<br />
können, eine große Bedeutung zu. Unsere Prozesstechnologie<br />
Athena erlaubt es unserem Team, schnell, einfach und vernetzt<br />
gemeinsam am Spiel zu entwickeln - und das sogar während das<br />
Spiel läuft. Die Iterationszeiten, in denen man das Spiel verbessert,<br />
sinken dadurch, und die Qualität steigt. Am ehesten kann man sich<br />
Athena als ein Editoren- und Softwaresystem vorstellen, mit dem das<br />
Spiel in Echtzeit ‚gebaut‘ wird.<br />
Brockmeyer: Sie kommen gerade von einer Geschäftsreise aus den<br />
USA zurück. Worum ging es?<br />
Riegler: Ich komme gerade von der ‚Oskarverleihung‘ der Gamesbranche<br />
und der dazugehörenden Fachkonferenz D.I.C.E. aus Las<br />
Vegas. Eine großartige Veranstaltung! Außerdem habe ich die<br />
Gelegenheit genutzt um einige Gespräche mit unseren existierenden<br />
Publishingpartnern sowie potenziellen neuen Publishern zu führen.<br />
Da wir in Österreich kaum Kunden haben, sind wir generell viel in der<br />
Welt unterwegs, um unsere Partner zu treffen. Den USA kommt<br />
dabei als größter einheitlicher Gamesmarkt eine ganz besondere<br />
Bedeutung zu, weshalb wir mehrmals pro Jahr vor Ort sind.<br />
Brockmeyer: Eine Frage zum Schluss: Sproing - woher kommt<br />
dieser Name und was wollen Sie damit ausdrücken?<br />
Riegler: Sproing war der Name eines der ersten Spiele meines<br />
Partners Gerhard Seiler auf einem Atari ST Homecomputer, bei dem<br />
man mit einem kleinen Gummiball durch diverse Spielewelten hüpfte.<br />
Das ist mittlerweile fast unglaubliche 20 Jahre her. Grundsätzlich ist<br />
Sproing übrigens ein Comic-Sound wenn es aufspringt - was gut zu<br />
diesem Spiel passte. Wir mochten an diesem Namen seine Eingängigkeit<br />
und die positive Dynamik. Deshalb haben wir ihn für unsere<br />
Firma gewählt. Erst deutlich später kam dann der springende Frosch<br />
als Logo dazu.<br />
36 <strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong>
<strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong> 37
Eine neue Zielgruppe für das <strong>ZIT</strong><br />
Erste Erfahrungen mit dem neuen Förderprogramm INNOVATION.<br />
Seit Beginn <strong>2008</strong> bietet das <strong>ZIT</strong> ein neues Förderprogramm an.<br />
INNOVATION war die augenscheinlichste Neuerung im Rahmen des<br />
neuen Förderangebots <strong>ZIT</strong>08 plus, war es doch das Ziel, mit diesem<br />
Programm eine neue Zielgruppe für das <strong>ZIT</strong> zu erschließen. Angesprochen<br />
werden sollten Kleine und Mittlere Unternehmen, die<br />
Innovationsvorhaben durchführen. Die gute Inanspruchnahme und<br />
spannende geförderte Projekte zeigen, dass dies gelungen ist.<br />
Die forschenden Wiener Unternehmen waren bekannterweise seit<br />
Beginn die primäre Zielgruppe des <strong>ZIT</strong>. Wir behaupten auch selbstbewusst,<br />
dass wir diese kennen und sie uns. Und so positiv die<br />
Entwicklung des Forschungsstandortes Wien in den letzten Jahren<br />
verlaufen ist: Man muss auch zur Kenntnis nehmen, dass die Anzahl<br />
dieser im engeren Sinn forschenden Unternehmen eine überschaubare<br />
ist – je nach Zählweise bewegt sie sich zwischen 300 und 500.<br />
Demgegenüber gibt es eine sehr große Anzahl an Unternehmen, die<br />
regelmäßig oder zumindest sporadisch Innovationsvorhaben<br />
realisieren. Innovationsvorhaben, die in der Regel nicht den strengen<br />
und auch engen Kriterien der Forschungsförderung entsprechen<br />
(wissenschaftliche Neuheit, absolute Marktneuheit), nichtsdestoweniger<br />
aber eine ebenso zentrale Voraussetzung für den Erhalt und<br />
die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit sind. Während das<br />
Angebot für forschende Unternehmen ein sehr breites ist (freilich<br />
nicht nur durch die Stadt Wien, sondern in noch größerem Ausmaß<br />
durch den Bund, insbesondere die Forschungsförderungsgesellschaft,<br />
und auch durch die EU), sind monetäre Unterstützungsangebote<br />
für den Innovationsbereich deutlich dünner gesät. Dies waren<br />
die Motive für das Anbieten des neuen Förderprogramms. Angesichts<br />
der Größe der Zielgruppe ist es nicht möglich, jegliche neuen<br />
Projekte in einem Unternehmen zu unterstützen. Im Zentrum stehen<br />
daher Vorhaben, die in eine gesamtunternehmerische Strategie zur<br />
nachhaltigen Innovationsorientierung eingebunden sind. Damit kann<br />
der in vielen Fällen sehr wichtige „change of behaviour“ in Richtung<br />
verstärkte und vor allem kontinuierliche Innovation, und in manchen<br />
Fällen in weiterer Folge Forschung, unterstützt werden.<br />
I Bedarf BesTäTIGT.<br />
Trotz der neuen Zielgruppe, bei der der Bekanntheitsgrad des <strong>ZIT</strong><br />
natürlich deutlich geringer war als bei der „Stammkundschaft“,<br />
38 <strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong><br />
wurde das neue Angebot von Beginn weg intensiv angenommen.<br />
Insgesamt 52 Vorhaben wurden im Laufe des letzten Jahres zur<br />
Förderung eingereicht, 21 davon konnten unterstützt werden. 1<br />
Die Zusagequote von 40% zeigt einerseits einen durchaus harten<br />
Wettbewerb, liegt aber andererseits bei einer Größenordnung, die die<br />
realistischen Chancen von guten Projekten für eine Förderung zeigt.<br />
Sehr bewusst adressiert das Programm alle Wirtschaftsbereiche und<br />
schließt neben Produkt- auch Verfahrens- und insbesondere<br />
Dienstleistungsinnovationen mit ein. Entsprechend vielfältig sind die<br />
Inhalte der geförderten Projekte. Will man einen einzelnen Sektor<br />
herausgreifen, so ist der IKT-Bereich ganz besonders stark vertreten.<br />
Dies hat seinen Grund sicher in der großen Bedeutung des Sektors<br />
für die Wiener Wirtschaft und der – zwangsweise - hohen Innovationsorientierung<br />
vieler IKT-Unternehmen, aber wohl auch darin, dass<br />
diese Unternehmen es in höherem Maße „gewohnt“ sind, sich in der<br />
Förderlandschaft umzusehen. Zielsetzung für die Zukunft ist jedenfalls,<br />
noch stärker auch andere Branchen anzusprechen – selbstverständlich<br />
nicht auf Kosten der IKT-Unternehmen, sondern zusätzlich.<br />
Entsprechend wurde für 2009 für diese Förderung ein höheres<br />
Budget vorgesehen, als dies <strong>2008</strong> der Fall war.<br />
I BeIspIele GeförderTer vorHaBen.<br />
Iku intelligente Fenstersysteme<br />
Das Unternehmen entwickelt und vermarktet intelligente Fenster-<br />
und Fassadensysteme. Im Rahmen des geförderten Vorhabens wird<br />
ein zentrales Produkt von Iku, die selbstreinigende Glasfassade,<br />
weiter verbessert und an unterschiedliche Kundenerfordernisse<br />
angepasst. Dabei werden auch neue Märkte erschlossen, insbesondere<br />
für den arabischen Raum werden entsprechende Designs und<br />
technische Adaptionen entwickelt.<br />
News on Video<br />
Das neu gegründete Unternehmen hat eine Ausbildung für VideojournalistInnen<br />
entwickelt und bietet diese auch selbst an. Bei VideojournalistInnen<br />
liegt der gesamte Gestaltungsprozess eines Beitrags, also<br />
Dreh, Schnitt und Redaktion, in einer Hand. Durch dieses System<br />
entstehen ein größerer kreativer Spielraum und kostengünstige<br />
Produktionsbedingungen für z. B. Onlineplattformen. Mit der
Realisierung des Projekts wird erstmals eine organisierte Ausbildung<br />
für dieses neue Arbeitsfeld angeboten.<br />
Compact electric<br />
Das seit 1965 bestehende Unternehmen produziert bislang konventionelle<br />
Schaltanlagen, Relais und Störmeldeanlagen. Um auch auf<br />
neuen, zukunftsträchtigen Märkten Fuß zu fassen, wird auf Basis von<br />
RFID-Technologie ein System entwickelt, das kritische Positionsveränderungen<br />
von hilfsbedürftigen Personen automatisch feststellen<br />
und einen entsprechenden Alarm auslösen kann. Während bisher<br />
solche Systeme händisch ausgelöst werden müssen, ist der entscheidende<br />
Vorteil, das dies bei dieser Entwicklung nicht notwendig<br />
ist. Angestrebte KundInnen sind vor allem Alters- und Pflegeanstalten<br />
und Heimpflegedienste.<br />
Sense Product<br />
Das junge Unternehmen verfügt derzeit über ein Patent auf ein selbst<br />
entwickeltes, einzigartiges Gleichgewichts-Trainingsgerät: Es besteht<br />
aus einer auf einem Luftkissen schwebenden Therapieplatte, die ein<br />
3-dimensionales, dynamisches Training des Gleichgewichtssinns –<br />
vorstellbar wie ein Sturzsimulator – erlaubt. Nun soll in das Gerät ein<br />
Mess-System eingebaut werden und die entsprechende Anzeige von<br />
Mess-Daten auf einem Monitor dargestellt werden. Im Sportbereich<br />
kann damit ein verbessertes Trainings-Monitoring angeboten werden,<br />
in der medizinischen Anwendung, die ebenso möglich ist (insbesondere<br />
bei Krankheiten mit Gleichgewichtsstörungen), kann der<br />
Therapieerfolg objektiviert gemessen werden. Damit wird das<br />
Alleinstellungsmerkmal des Produkts ausgebaut.<br />
I darüBer hinauS: Call MoTIon MedIa vIenna <strong>2008</strong>.<br />
Erfolgt die Einreichung von Projekten im Rahmen des Programms<br />
INNOVATION grundsätzlich laufend, so haben wir uns aber auch hier<br />
die Möglichkeit der Durchführung von themenspezifischen Calls<br />
offengehalten. Hintergedanke dabei: Themen, die für die Stadt Wien<br />
von besonderer Bedeutung sind und/oder die eine besondere<br />
öffentliche Wahrnehmung verdienen, inhaltlich aber nicht dem<br />
Forschungsbereich, sondern eben der Zielsetzung in diesem<br />
Programm zuzuordnen sind, sollen in Form öffentlichkeitswirksamer<br />
Wettbewerbe bearbeitet werden können. Aufgrund des Medien-<br />
Eine neue Zielgruppe für das <strong>ZIT</strong><br />
schwerpunktes, der sich in spezifischen Immobilien, einem wachsenden<br />
Dienstleistungsangebot und eben auch monetären Fördermaßnahmen<br />
äußert, war die Durchführung eines „Mediencalls“ eine<br />
naheliegende Sache. Zumal wir damit den bereits 2007 begonnenen<br />
Weg fortsetzten.<br />
Spezifisches Thema war „Bewegtbild“ angesichts der Tatsache, dass<br />
gerade in diesem Bereich, auch Dank neuer technischer Möglichkeiten<br />
und vor allem crossmedia-Entwicklungen, spannende Dinge<br />
im Gang sind. So war es denn auch: von 33 eingereichten Projekten<br />
konnten 15 mit insgesamt knapp 1,2 Millionen Euro unterstützt<br />
werden. Ein Interview mit dem Sieger des Calls, der Firma Sproing<br />
Interactive Media, einem der innovativen Wiener Gamesentwickler,<br />
lesen Sie auf Seite 35.<br />
„Damit kann der in vielen Fällen sehr wichtige<br />
,change of behaviour‘ in Richtung verstärkte und<br />
vor allem kontinuierliche Innovation, und in man-<br />
chen Fällen in weiterer Folge Forschung, unter-<br />
stützt werden.“<br />
1 In dieser Zahl sind jene Projekte nicht inkludiert, die zwar <strong>2008</strong> eingereicht wurden,<br />
über die aber erst zu Beginn 2009 eine Entscheidung getroffen werden konnte.<br />
<strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong> 39
40 <strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong>
Es bleibt kein Backstein auf dem anderen<br />
Zum Wachstum des Media Quarter Marx.<br />
Bevor 51.000 Kubikmeter Erde einem Medienzentrum weichen,<br />
bedarf es einiger Meilensteine: eines privaten Partners, mit dem<br />
das Projekt gemeinsam in Angriff genommen werden kann.<br />
Eines kompetenten PlanerInnenteams, das mit Rat und Tat zur<br />
Seite steht. Einer Planung von der ersten Entwurfsfassung bis<br />
hin zur finalen Einreichplanung. Die Baugenehmigung ist auch<br />
nicht gänzlich irrelevant. Und erst dann geht es richtig los: Es<br />
folgen die Ausschreibungen. Nach Aushub und Transport besagter<br />
Erde werden 18.640 Kubikmeter an Stahlbeton benötigt, es müssen<br />
mehr als 4.000 m² Glasfassade errichtet werden. Neben dem<br />
eigentlichen Baugeschäft müssen 35.000 m² Bruttogeschossfläche<br />
schließlich vermarktet werden; und auch den MietinteressentInnen<br />
aus den diversen Segmenten - von Werbung über Multimedia bis hin<br />
zu TV- und Film-Produktion - gilt ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit.<br />
Betrachtet man das Jahr <strong>2008</strong>, so haben wir die oben genannten<br />
Hürden erfolgreich genommen und können uns nun auch einmal<br />
zurücklehnen und mit großer Erwartung beobachten, wie das Media<br />
Quarter Marx nun Meter um Meter wächst. Trotzdem gibt es auch<br />
weiterhin viel zu tun, damit das Media Quarter Marx Ende 2010 die<br />
hohen Erwartungen erfüllt.<br />
I ZukunfT BrauCHT HerkunfT.<br />
Damit aber auch in der Zwischenzeit die Dynamik aufrecht erhalten<br />
werden kann, hat das <strong>ZIT</strong> ein weiteres denkmalgeschütztes Objekt<br />
erworben und dessen Sanierung in die Wege geleitet. Mit dem<br />
sogenannten Parteiengebäude 3, einem Verwaltungsgebäude des<br />
ehemaligen Schlachthofes, werden ab etwa Mai 2009 ca. 1.200 m²<br />
vermietbarer Fläche zur Verfügung stehen. Damit reagiert die Stadt<br />
Wien auf die ungebrochen starke Nachfrage nach Flächen im Media<br />
Quarter Marx. Erste Unternehmen, die sich zwischenzeitlich sogar im<br />
benachbarten T-Center eingemietet haben, finden nun ihr Zuhause<br />
im Media Quarter Marx.<br />
Mit dem bereits 2004 denkmalgerecht sanierten Medienzentrum in<br />
der Maria Jacobi Gasse 2 besteht schon ein Gebäude mit viel<br />
Charisma und Geschichte. Darum freut es uns umso mehr, dass wir<br />
mit dem Parteiengebäude 3 ebenfalls einen der letzten Backsteinbauten<br />
des ehemaligen Viehmarktes St. Marx für das Media Quarter<br />
Marx sichern konnten. Ohne Frage bilden die beiden historischen<br />
Gebäude eine wichtige Klammer für Wiens neuen Medienstandort<br />
und betonen: Zukunft braucht Herkunft. Rund 3,2<br />
Millionen Euro wird das <strong>ZIT</strong> über die Marx Realitäten<br />
GmbH (86% <strong>ZIT</strong>) in den Standort investieren. Wie<br />
wichtig dieser Schritt ist, zeigt die Tatsache, dass die<br />
Flächen bereits im Oktober vollständig vermietet<br />
waren. Doch die 1.200 m² sind nur ein Tropfen auf den<br />
heißen Stein: Zahlreichen weiteren Anfragen von<br />
Medienunternehmen kann erst im nächsten Schritt – mit Fertigstellung<br />
des Erweiterungsprojektes – entsprochen werden.<br />
I GespräCHe aM sCHlaCHTHof.<br />
In dem sanierten Parteiengebäude 3 wird das <strong>ZIT</strong> selbst ein Zimmer<br />
beziehen. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass ab 2010 nahezu<br />
40.000 m² Fläche für Medien und Creative Industries Unternehmen<br />
zur Verfügung stehen, ist es an der Zeit, vor Ort Präsenz zu zeigen.<br />
Beratungsgespräche zu Förderthemen, Technologieberatung und<br />
Beratung zu innovativer Beschaffung können direkt an Wiens neuem<br />
Medienstandort erfolgen. Darüber hinaus ist es unser Ziel, das Media<br />
Quarter Marx verstärkt zum Ort der Diskussion zu machen: Wo<br />
bewegt sich der Medienstandort Wien hin? Was sind die großen<br />
Herausforderungen und Chancen?<br />
Dipl.-Geogr. Thomas Berndt<br />
„Mit dem sogenannten Parteiengebäude 3,<br />
einem Verwaltungsgebäude des ehemaligen<br />
Schlachthofes, werden ab etwa Mai 2009 ca.<br />
1.200 m² vermietbarer Fläche zur Verfügung<br />
stehen. Damit reagiert die Stadt Wien auf die<br />
ungebrochen starke Nachfrage nach Flächen im<br />
Media Quarter Marx.“<br />
<strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong> 41
42 <strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong>
Insel der Seligen? Vielleicht<br />
Ein Medienstandort für heutige Ansprüche.<br />
Nähert man sich dieser Tage dem Media Quarter Marx durch den<br />
Eingang des ehemaligen Schlachthofs St.Marx, passiert man zwei<br />
restaurierte Stiere und sieht zu seiner Rechten ein altes Backsteingebäude.<br />
Zur Linken klafft ein großes Loch, wo der Medienstandort im<br />
dritten Bezirk innerhalb der nächsten zwei Jahre um 35.000 Quadratmeter<br />
erweitert wird. Dahinter ein weiteres Backsteingebäude. Es<br />
bleibt noch viel dem geistigen Auge überlassen, im Hintergrund<br />
ragen Kräne und Bagger gen Himmel, letzte Reste des Fleischmarktes<br />
werden abgerissen. Ein Detail bleibt hängen: Auf dem<br />
Balkon des restaurierten Medienzentrums stehen Container,<br />
auffälligstes Zeichen der Überbelegung des bestehenden Media<br />
Quarter Marx. Wo Nachfrage ist, muss Angebot geschaffen werden<br />
– daher die Erweiterung. Es erinnert wenig daran, dass selbst die<br />
Nachfrage einmal geschaffen werden musste. Vor einem Jahrzehnt<br />
noch hätte kaum jemand in Wien der Sinnhaftigkeit eines Media<br />
Quarters zugestimmt, <strong>2008</strong> baut man an einem Großmedienzentrum<br />
mit drei geräumigen Studios, restauriert ein weiteres ehemaliges<br />
Verwaltungsgebäude des Schlachthofes und denkt an Modelle,<br />
Kreativen und Medienschaffenden ein geeignetes Umfeld zu bieten.<br />
Das <strong>ZIT</strong> Zentrum für Innovation und Technologie hat findige Medienschaffende<br />
bei der ursprünglichen Idee des Media Quarter Marx als<br />
Ort der TV- und Filmproduktion mit Sharing-Möglichkeiten unterstützt.<br />
Jetzt ist es dabei, dieser Idee einige weitere anzufügen.<br />
Denn die alte Kunde des Schmelztiegels gilt auch für die Kreativen:<br />
Einer ist gern neben dem Anderen, Heterogenität ist gewollt. Für den<br />
Web-TV-Produzenten mit 2 MitarbeiterInnen ist es interessant, drei<br />
GrafikerInnen vier Stockwerke über sich zu haben; für den traditionellen<br />
Verlag, der sich neu aufstellen will, ist wiederum der Web-TV-<br />
Produzent wichtig. Wenn es dann noch ein Café gibt, wo sich alle<br />
treffen können, umso besser.<br />
Ulrich Seidl<br />
Filme wie „Hundstage“, „Import Export“ oder „Good News“, um nur einige zu nennen,<br />
zählen bereits jetzt zum Standard des anspruchsvollen österreichischen Films. Der<br />
unter anderem mit dem Silbernen Löwen (Venedig) ausgezeichnete Produzent und<br />
Regisseur wird ab Juni dieses Jahres auch ein Büro in St. Marx beziehen.<br />
<strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong> 43
User Innovation<br />
Anwender und Anwenderinnen als Quelle innovativer Geschäftsideen?<br />
Was haben so unterschiedliche Produkte wie das Snowboard, Viagra,<br />
Computerchips oder Geox-Schuhe gemeinsam? Nun: Der zündende<br />
Funke für diese Innovationen stammt NICHT von einem etablierten<br />
Anbieter oder einer etablierten Anbieterin, sondern überraschenderweise<br />
von einfachen AnwenderInnen. Was ist bis dato bekannt zu<br />
diesem spannenden Phänomen? Welche Konsequenzen hat dies für<br />
die unternehmerische Praxis?<br />
Die traditionelle Vorstellung: Etablierte Herstellerfirmen sind die<br />
(ausschließlichen) Innovatoren.<br />
Diese Vorstellung war und ist in der unternehmerischen Praxis weit<br />
verbreitet. Aber auch die betriebswirtschaftliche Forschung hat sich<br />
lange Zeit in diesem Paradigma bewegt – Fragestellungen fokussierten<br />
beispielsweise darauf, ob und warum denn nun kleinere oder<br />
größere Herstellerfirmen über eine höhere Innovationskraft verfügen.<br />
Die aktive Rolle im Innovationsprozess lag dabei – quasi naturgegeben<br />
- immer bei der Herstellerfirma. Alle anderen wurden als passiv<br />
angesehen. Dadurch wurde das Innovationspotenzial der KundInnen,<br />
der AnwenderInnen, der ProduktnutzerInnen sträflich unterschätzt<br />
(und beispielsweise auf die Beurteilung bereits von der Herstellerfirma<br />
entwickelter Produktkonzepte beschränkt).<br />
I die „revOlutiOn“: user verfüGen üBer eIn enorMes<br />
InnovaTIonspoTenZIal.<br />
Erst dem MIT-Professor Eric von Hippel und seinen KollegInnen<br />
gelang es seit den 1970er Jahren, die oben geschilderte, verkrustete<br />
Denkweise sukzessive aufzubrechen. Zahlreiche neue Produkte<br />
wurden nicht von Herstellerfirmen entdeckt – vor allem die User sind<br />
häufig die eigentlichen Innovatoren. In umfassenden empirischen<br />
Studien konnte gezeigt werden, dass User nicht mehr nur passiv<br />
Auskunft geben, sondern aktiv die Entwicklung neuer Produkte<br />
vorantreiben können. Diese Studien erstrecken sich auf sehr<br />
unter schiedliche Branchen und betreffen sowohl Industriegütermärkte<br />
als auch Konsumgütermärkte. Die Innovationstätigkeit von<br />
Usern ist also ein weitverbreitetes Phänomen mit bedeutenden<br />
Auswirkungen auf die unternehmerische Praxis.<br />
Ein Beispiel: Das Snowboard wurde nicht, wie man nachvollziehbar<br />
vermuten könnte, von einem etablierten Skihersteller erfunden. Nein,<br />
44 <strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong><br />
es waren Sportfreaks, denen reines Skifahren schlicht und einfach zu<br />
langweilig wurde und die das Bedürfnis hatten, das sommerliche<br />
Surferlebnis in den Winter zu übertragen. Sie begannen zu probieren,<br />
zu experimentieren und das Resultat waren erste Prototypen des<br />
Snowboards. Erst sehr viel später wurde der Trend von der Skiindustrie<br />
aufgegriffen. Eine Vielzahl von Sportarten entstand auf diese<br />
Weise, vom Tauchen über das Mountainbike bis zu Kitesurfen und<br />
Skateboard. Somit kann festgehalten werden:<br />
(1) User haben oftmals völlig neue Ideen.<br />
Ein weiteres Beispiel: Das Nervengift Botalinum-Toxin reduziert die<br />
Signalübermittlung zwischen Nervenenden und deren Zielzellen. Ein<br />
Hersteller setzte Botox zur Reduktion von Spasmen ein. Das<br />
tatsächliche Innovationspotenzial wurde aber erst von Usern<br />
gehoben – diese fanden heraus, dass Botox auch zur Glättung von<br />
Falten hilft. Dies wiederum führte zu einer Steigerung des Umsatzes<br />
um satte 80 Prozent. Weitere bekannte Beispiele für durch User<br />
entdeckte und nicht von der Herstellerfirma intendierte Anwendungen<br />
sind Aspirin und Viagra – eine aktuelle Studie zeigt gar, dass<br />
im Pharmabereich 60% der sogenannten „Off-label“ Anwendungen<br />
durch User entdeckt wurden. Wir halten fest: (2) User machen<br />
ungewöhnliche Entdeckungen.<br />
Und noch ein Beispiel: Open-Source-Software wie Linux oder Apache<br />
– hier liegt der Quellcode offen, somit kann jede und jeder nach<br />
Belieben modifizieren, erweitern, weitergeben und muss dann den<br />
Quellcode ebenfalls offenlegen. Tausende über das Internet vernetzte<br />
User weltweit arbeiten an der Software, diskutieren Probleme<br />
in Foren, erweitern und testen die Software immer wieder. Noch<br />
dazu ist die entwickelte Software meist kostenlos. Und das Resultat<br />
kann sich sehen lassen: Es entsteht überaus innovative, leistungsfähige<br />
Software. Ein ähnliches Phänomen ist die bekannte Online-<br />
Enzyklopädie Wikipedia. Wenn also User auch die Produktion<br />
übernehmen können, ist unter Umständen gar keine Herstellerfirma<br />
mehr nötig. Somit: (3) User nehmen die Sache oft gleich selbst in<br />
die Hand.<br />
Die Konsequenz: Neue Chancen für UnternehmerInnen durch neue<br />
Innovationstools.<br />
Zahlreiche User haben völlig neue Ideen – und sind auch bereit,<br />
diese Ideen Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Die Vorteile
<strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong> 45
46 <strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong>
durch die Einbeziehung von Usern in den Neuproduktentwicklungsprozess<br />
zeigen sich in vielen Praxisprojekten. Sie sind auch wissenschaftlich<br />
dokumentiert. Insbesondere können User einen wertvollen<br />
Beitrag in den frühen Phasen des Neuproduktentwicklungsprozesses<br />
leisten. Um die Innovationsfähigkeit von NutzerInnen systematisch in<br />
den Innovationsprozess einzubinden, bieten sich verschiedene<br />
Möglichkeiten und Tools an.<br />
(1) user haben völlig neue Ideen:<br />
die Lead User Methode<br />
Die Suche nach radikalen Innovationen kann mit der Lead User<br />
Methode sehr effizient gestaltet werden. Im Zentrum der Methode<br />
stehen nicht DurchschnittskundInnen aus dem Zielmarkt, sondern<br />
besonders fortschrittliche AnwenderInnen, sogenannte Lead User.<br />
Die Lead User Methode beschleunigt den Informationstransfer vom<br />
User Innovator zur Herstellerfirma. Im Vergleich zur Marktforschung<br />
werden mit der Lead User Methode nicht nur Bedürfnisse gesucht,<br />
sondern bereits systematisch konkrete Lösungskonzepte für diese<br />
Bedürfnisse entwickelt. Eine empirische Überprüfung der Lead User<br />
Methode hat ergeben, dass Lead User Ideen ein über achtfach<br />
höheres Umsatzpotenzial aufweisen als Ideen, die mit herkömmlichen<br />
Methoden entwickelt wurden.<br />
(2) user machen ungewöhnliche entdeckungen:<br />
die ISAA-Methode<br />
Kürzer werdende Produktlebenszyklen in Verbindung mit immer<br />
stärker steigenden Kosten für Forschung und Entwicklung sind eine<br />
zentrale Herausforderung, mit der Unternehmen heute in zunehmendem<br />
Maße konfrontiert werden. Ein Lösungsansatz dazu ist, entwickelte<br />
Technologien besser zu nutzen, indem F&E-Ausgaben optimal<br />
gehebelt werden. Mit anderen Worten: Das Ziel ist es, bestehende<br />
technologische Lösungen in unterschiedlichen Märkten einzusetzen.<br />
Damit reduziert sich die Herausforderung zunächst auf die Frage, wie<br />
denn diese zusätzlichen Geschäftsfelder gefunden werden können.<br />
Innovative User sind - wie oben gezeigt – offenbar dazu in der Lage,<br />
neue Anwendungsbereiche für bestehende (technologische) Lösungen<br />
zu entdecken. Diese Tatsache nutzt die sogenannte ISAA-<br />
Methode (steht für Intelligent Search for Additional Applications). In<br />
zahlreichen Projekten in der unternehmerischen Praxis konnte die<br />
Methode erfolgreich eingesetzt werden, um systematisch neue<br />
Geschäftsfelder zu identifizieren.<br />
User Innovation<br />
(3) user nehmen die sache selbst in die Hand:<br />
Toolkits und User-Netzwerke<br />
„User Innovationen“ entstehen dann, wenn die NutzerInnen (a)<br />
innovative, von bestehenden Marktangeboten nicht befriedigte<br />
Bedürfnisse haben und (b) die Fähigkeit zur Verwirklichung ihrer<br />
Ideen haben. Nicht immer jedoch haben innovative NutzerInnen<br />
diese Befähigung zur Innovation. In der traditionellen Marktforschung<br />
versuchen Herstellerfirmen daher, die Bedürfnisse der Anwender-<br />
Innen zur Herstellerfirma zu transferieren. Dies ist oft problematisch<br />
(„Sticky Information“). Unter Toolkits 1 und User-Netzwerken versteht<br />
man Methoden, mit denen der umgekehrte Weg beschritten wird:<br />
Statt bedürfnisbezogene Information vom Kunden oder von der<br />
Kundin zu der Herstellerfirma zu transferieren, stattet man die<br />
NutzerInnen mit lösungsbezogener Kompetenz aus. Ziel dieser<br />
Übertragung ist einerseits, die differenzierten Bedürfnisse möglichst<br />
optimal zu befriedigen, und andererseits, die durch langwierige<br />
Entwicklungs- und Marktforschungsprozesse entstehenden Kosten<br />
zu verringern.<br />
Junior-Prof. Dr. Reinhard Prügl<br />
Inhaber des Lehrstuhls für Innovation, Technologie und<br />
Entrepreneurship Zeppelin Universität Friedrichshafen<br />
1 Toolkits sind (oftmals webbasierte) „Werkzeuge“, häufig in der Form einer Software,<br />
mit deren Hilfe der User sein eigenes Produkt aus einer bestimmten Anzahl an<br />
Lösungsvorschlägen selbst erstellen kann. Durch einen „Trial-and-Error“ Prozess kann<br />
er sein Produkt so lange modifizieren, bis es genau seinen eigenen Ideen und<br />
Bedürfnissen entspricht. Der Einsatz von Toolkits eignet sich vor allem für heterogene<br />
Märkte, um differenzierte Kundenbedürfnisse zu befriedigen.<br />
<strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong> 47
„Ein Passwort ist genau 1 Mal sicher. Beim 2. Mal könnte es schon ein Hacker sein.“<br />
Ein Gespräch über Assoziationen, Sicherheit und die Technologieberatung des <strong>ZIT</strong>.<br />
Ein Nachmittag im Palais Harrach, Hauptquartier des Wiener Kompetenzzentrums<br />
Secure Business Austria (SBA). Die Mathematiker-<br />
Innen von SBA haben soeben die Endergebnisse ihrer Analyse des<br />
Sicherheitssystems SecLookOn des Wiener Unternehmens MERLINnovations<br />
präsentiert. Bei Kaffee und Kuchen spricht man nun über<br />
Abgründe von Passwortsystemen, und über den Wert des Dritten,<br />
durch den sich zwei treffen. Denn man kennt einander zwar in Wien,<br />
aber für ein konkretes Projekt zusammen zu finden ist schon eine<br />
höhere Kunst. Dafür gibt’s die Technologieberatung des <strong>ZIT</strong>.<br />
Helmut Schluderbacher (GF MERLINnovations), Peter Heinz Trykar<br />
(MERLINnovations) und Edgar Weippl (Secure Business Austria) im<br />
Gespräch.<br />
<strong>ZIT</strong>: Herr Schluderbacher, was ist der Kern Ihres Unternehmens?<br />
Was macht MERLINnovations?<br />
Helmut Schluderbacher: MERLINnovations entwickelte und<br />
vertreibt ein national und international mehrfach ausgezeichnetes<br />
Login-Verfahren namens SecLookOn. Der große Sicherheitsvorteil<br />
von SecLookOn gegenüber anderen wissensbasierten Authentifizierungstechniken<br />
ist, dass das Zugriff gewährende Geheimnis nicht<br />
abgefragt wird, wie etwa bei PIN oder Passwort. Stattdessen muss<br />
der Nutzer oder die Nutzerin beweisen, dass er/sie das Geheimnis<br />
kennt – aber ohne es preiszugeben. Das ist vergleichbar mit einem<br />
Wächter, der eine Zutritt verlangende Person nach dem Passwort<br />
fragt, ihr aber verbietet, es auszusprechen. Was wie die Quadratur<br />
des Kreises klingt, ist in der Anwendung ganz einfach: Der Nutzer<br />
verbindet individuell bestimmte Bilder mit den richtigen geometrischen<br />
Formen und Farben. Mehrmals angewandt generieren diese<br />
persönlich festgelegten Assoziationen den Passcode – aber bei<br />
jedem Login einen anderen.<br />
<strong>ZIT</strong>: Die persönliche Zuordnung von einem der knallbunten Kästchen<br />
von SecLookOn und einem Bild ergibt dann meinen Passcode?<br />
Schluderbacher: Genau, der Gedanke ist das Passwort! Jedes Mal,<br />
wenn Sie sich einloggen, füllt sich ihr Bildschirm mit vielen Bildern<br />
und Kästchen mit Formen, Ziffern und Farben. Welches Bild zu<br />
welcher Farbe oder geometrischen Form gehört, weiß aber nur die<br />
berechtigte Person, denn nur die Person erinnert sich an die<br />
ursprüngliche Assoziation. Selbst jemand, der bei der Eingabe der<br />
Ziffernfolge zusieht, kann also das zugrunde liegende System nicht<br />
erkennen.<br />
48 <strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong><br />
<strong>ZIT</strong>: Eine Sicherheitslösung für welche Anwendung?<br />
Das Internet?<br />
Schluderbacher: Fokussiert im Augenblick auf das Internet - ja,<br />
aber nicht nur. Im Prinzip ist unser Verfahren auf jeder graphischen<br />
Schnittstelle, also sprich an jedem graphischen Bildschirm, denkbar<br />
und einsetzbar. Überall dort, wo Sie Daten schützen wollen, können<br />
Sie SecLookOn verwenden - ganz einfach. Und vor allem ist es<br />
gleichgültig, wo Sie Sicherheitsdaten weitergeben und mit welchem<br />
Content, ob Internetbanking oder bei anderen Anwendungen.<br />
<strong>ZIT</strong>: Magna Österreich setzt SecLookOn ein…<br />
Schluderbacher: Die HeimmitarbeiterInnen, d.h. Leute, die vom<br />
Heimoffice aus arbeiten, setzen SecLookOn ein, und zwar weltweit.<br />
<strong>ZIT</strong>: Ich habe Ihre Lösung so verstanden, dass sie ihre ganze Kraft<br />
entfalten kann, wenn man das Passwort jeden Tag braucht. Online-<br />
Banking macht man vielleicht nicht jeden Tag. Gehen Sie davon aus,<br />
dass man sich den Schlüssel ohne Weiteres merkt?<br />
Heinz Trykar: Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass sich die Anwender<br />
den SecLookOn-Schlüssel besser merken als z.B. ein Passwort oder<br />
einen Zahlencode. Es gab einen Test-User, der einen Schlüssel<br />
erstellt hat. Ihm sind dann Umzugsarbeiten dazwischen gekommen.<br />
Vier Wochen später hat er gemeint, “Da war doch etwas”, er hat das<br />
System gestartet und siehe da: Der Schlüssel ist ihm sofort eingefallen.<br />
Sie können sich einen vierstelligen PIN-Code durchlesen und<br />
vier Wochen später möchten Sie ihn anwenden. Sagen Sie mir, wie<br />
hoch die Chance ist, dass Sie den PIN überhaupt noch kennen.<br />
SecLookOn entspricht jedoch einer Sicherheit eines 109stelligen<br />
PIN-Codes.<br />
<strong>ZIT</strong>: Warum Technologieberatung? Wie sind Sie darauf gekommen?<br />
Warum war das überhaupt noch notwendig, wenn man überzeugt ist<br />
von seinem Produkt? Sie haben Ihr Produkt ja auch auf andere Arten<br />
testen lassen – beispielsweise mit einem Hackerwettbewerb.<br />
Schluderbacher: Wir hatten sehr, sehr viele Personen, die sich<br />
unsere Wettbewerbs-Seite angeschaut haben, wir hatten auch sehr<br />
viele Downloads. Nicht ganz so viele haben sich dann angemeldet.<br />
Denn ein Hacker hat ja schließlich einen Ruf zu verlieren und wird<br />
sich nur dann anmelden, wenn er die Chance vermutet, es zu<br />
hacken!<br />
Zur Technologieberatung: Ich glaube, dass ein Angebot wie diese
„Ein Passwort ist genau 1 Mal sicher. Beim 2. Mal könnte es schon ein Hacker sein.“<br />
Dienstleistung - nämlich für eine technologische Fragestellung den<br />
richtigen Partner zu vermitteln - extrem wichtig ist. Auch wenn sich<br />
zwei Organisationen bereits kennen, heißt das noch lange nicht,<br />
dass man auch auf die richtige Idee kommt. Es ist wirklich wichtig,<br />
dass es dann einen Dritten wie die Technologieberaterin des <strong>ZIT</strong><br />
gibt, die sagt: “Wäre das nicht eine Idee?”. Wenn man niemanden<br />
kennt, dann ist es sowieso eine wichtige Hilfe und eine wichtige<br />
Information, aber selbst wenn man jemanden kennt, kann das<br />
ausschlaggebend für die Entscheidung sein: “Ach ja, das könnten<br />
wir ja mit diesem Partner machen!“<br />
<strong>ZIT</strong>: Damit gleich zum Forschungspartner in diesem Projekt - Secure<br />
Business Austria (SBA). Secure Business Austria ist ein in Wien<br />
ansässiges, renommiertes IT-Sicherheits-Kompetenzzentrum mit<br />
vielen akademischen und industriellen Partnerschaften. Die natürlich<br />
spannendste Frage: Herr Weippl, konnten Sie das System mittels<br />
Mathematik überlisten?<br />
Edgar Weippl (SBA): Nun, ich würde es so ausdrücken: SecLookOn<br />
ist deutlich sicherer als ein herkömmliches Passwortverfahren. Für<br />
uns war einfach die Zusammenarbeit mit MERLINnovations sehr<br />
spannend, weil die rein mathematisch-theoretische Betrachtung des<br />
Systems eine zwar eher seltene aber dafür sehr herausfordernde<br />
Analysemethode erforderte.<br />
<strong>ZIT</strong>: Muss das Produkt überarbeitet werden auf Grund dieser<br />
Ergebnisse?<br />
Weippl: Also wir sind sehr zufrieden mit der Sicherheit von Sec-<br />
LookOn. Aufgrund der rein mathematischen Analyse könnte man<br />
sagen: das System ist tausend Mal sicherer als ein Passwort.<br />
<strong>ZIT</strong>: Herr Schluderbacher, zu guter Letzt: Wie geht es jetzt weiter mit<br />
SecLookOn?<br />
Schluderbacher: Also aufgrund der Untersuchung und der Analyse<br />
werden wir noch das eine oder andere verbessern können, und das<br />
ist sehr schön, weil das Produkt dabei immer weiter wächst und<br />
besser wird. Durch solche Untersuchungen wie diese mit dem<br />
Kompetenzzentrum Secure Business Austria wird klar: Selbst wenn<br />
Sie ein Jahr beobachtet werden, kann niemand Ihr Geheimnis<br />
knacken. Und das ist schon eine phantastische Vorstellung. Wenn<br />
Sie heute fragen: “Wie oft kann ich mein Passwort eingeben?”, muss<br />
ich sagen: ”Genau ein Mal”. Sie können es nur ein einziges Mal<br />
gesichert eingeben. Bei der zweiten Anmeldung könnte es schon ein<br />
Hacker sein. Wir arbeiten darauf hinaus, dass Sie sich in Zukunft auf<br />
ganz lange Zeit ein einziges Geheimnis überlegen und dann jahrelang<br />
damit arbeiten können.<br />
Es gibt Analysen, die zeigen, wenn 1.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen<br />
ihr Passwort statt alle 30 Tage alle 60 Tage ändern würden,<br />
könnten bis zu 66.000 € eingespart werden. Also alleine dadurch,<br />
dass das Intervall von einem Passwort von 30 auf 60 Tage verlängert<br />
wird. Es geht also auch um eine enorme Kosteneffizienz.<br />
Jetzt ist nicht die Zeit für hohe Investitionen, aber für hohe Sicherheit!<br />
Gerade heute, wo überall eingespart werden muss, bringt<br />
SecLookOn die dringend benötigte Sicherheit.<br />
<strong>ZIT</strong>: Vielen Dank für das Gespräch.<br />
Interview: DI in Kristina Wrohlich<br />
Technologieberatung:<br />
Die Technologieberatung ist eine kostenlose Dienstleistung<br />
der <strong>ZIT</strong> Zentrum für Innovation und Technologie GmbH und<br />
richtet sich an Wiener Unternehmen, die jetzt oder in naher<br />
Zukunft ihre Dienstleistungen, Produkte oder Prozesse<br />
verbessern, neu – oder weiterentwickeln wollen. Bei technologischen<br />
Fragestellungen eines Innovationsprojektes<br />
vermittelt das <strong>ZIT</strong> dem Unternehmen kostenlos die richtigen<br />
ExpertInnen. Diese ExpertInnen kommen aus den Wiener<br />
Kompetenzzentren, den Universitäten und außeruniversitären<br />
Forschungseinrichtungen. Neben der Vermittlung von<br />
technologischem Know-how werden ebenso Förderoptionen<br />
für das Projekt gesucht und vorgeschlagen.<br />
<strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong> 49
50 <strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong>
<strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong> 51
Informations- und Kommunikationstechnologien jetzt und demnächst<br />
Und was bieten wir?<br />
Thin Clients, Web 2.0, Service Oriented Architecture (SOA), Unified<br />
Communications, Green IT, Cloud Computing, Simulation, Semantic<br />
Web und noch vieles mehr. Welche Technologien werden wir in<br />
Zukunft so selbstverständlich nutzen wie heute das Internet? Welche<br />
Bereiche werden von Innovationen, die von neuen Informations- und<br />
Kommunikationstechnologien (IKT) ausgehen, besonders betroffen<br />
sein? Wie wird sich unsere Gesellschaft verändern und welchen<br />
Einfluss haben Wissenschaft, Forschung und öffentliche Förderinstitutionen<br />
wie das <strong>ZIT</strong> darauf?<br />
Warum wir uns beim <strong>ZIT</strong> diese Fragen stellen, ist anhand der<br />
folgenden Fakten leicht zu erklären. Der IKT Standort Wien ist nach<br />
London und München der drittgrößte in Europa und beschäftigt mit<br />
ca. 64.000 MitarbeiterInnen in rund 5.300 Unternehmen etwa 9%<br />
aller ArbeitnehmerInnen in Wien. Ein weiteres wesentliches Merkmal<br />
in Wien ist, dass 99% der Unternehmen im IKT-Sektor klassische<br />
Klein- und Mittelunternehmen (weniger als 250 MitarbeiterInnen und<br />
max. 50 Millionen Euro Umsatz) sind. Der BIP Anteil des IKT-Sektors<br />
beträgt in Wien ca. 35%. 1<br />
Aber nicht nur aufgrund der beeindruckenden wirtschaftlichen<br />
Fakten setzt das <strong>ZIT</strong> einen großen Fokus auf diesen Sektor. Technische<br />
Innovationen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologien<br />
prägen unsere Gesellschaft. Neben neuen Anwendungen<br />
für die Arbeitswelt werden auch Bereiche wie Bildung,<br />
Soziales, Verkehr und Medizin stark beeinflusst. Der Laptop in der<br />
Schulklasse ist vielerorts bereits wesentlicher Teil des Unterrichts.<br />
Google und Wikipedia haben schon manchem/r SchülerIn und<br />
StudentIn bei der Recherche wertvolle Dienste erwiesen. Ein<br />
weiteres Beispiel gefällig? Handys gehören heute zum alltäglichen<br />
Leben. Handys ermöglichen neben der Kommunikation im Sinne von<br />
Telefongesprächen auch mobiles Arbeiten, Informationssuche, Chat,<br />
SMS und andere Dienste.<br />
Durch die neueste Generation von mobilen kleinen Handheld<br />
Devices mit genügend Rechenpower und ansprechendem Display -<br />
wie z.B. das iPhone oder der iPod von Apple - wurden bereits und<br />
werden weiterhin eine Vielzahl an neuen Diensten und Anwendungen<br />
generiert. Die Mobile Marketing Branche steht in den Startlöchern.<br />
Mobile TV/DVB-H und Mobile Internet machen jetzt erst richtig<br />
Sinn. Durch ein aktives Sponsoring des Mobile Content Days <strong>2008</strong><br />
52 <strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong><br />
in Wien will das <strong>ZIT</strong> von Beginn an die AkteurInnen in diesem Bereich<br />
unterstützen.<br />
Gerade Handys zeigen – in Zusammenhang mit dem Thema Embedded<br />
Systems - wie weit Software in Kombination mit Mikroprozessoren<br />
in unserer Gesellschaft verbreitet ist. Waschmaschine,<br />
Mikrowellenherd, Kühlschrank, Fernseher, DVD-Player, Digitaler TV<br />
Receiver oder allgemein alle Geräte der Unterhaltungselektronik.<br />
Alle diese Produkte des täglichen Lebens sind Embedded Systems<br />
oder enthalten mehrere Embedded Systems. Miniaturisierung,<br />
Vernetzung und neue Sensoren zum Erfassen der Umwelt werden<br />
neue, spannende Anwendungen durch Embedded Systems erzeugen.<br />
Nicht zu vergessen, welche Innovationen in der Medizintechnik<br />
zu erwarten sind. Intelligente Prothesen sowie genauere und<br />
leistungsfähigere Geräte für eine vereinfachte Diagnose durch den<br />
Arzt oder die Ärztin lassen auf eine deutlich verbesserte Lebensqualität<br />
von kranken Menschen hoffen. Mit dem Call Patients in Focus<br />
2009 fördert das <strong>ZIT</strong> interdisziplinäre Projekte zwischen Medizintechnik,<br />
Biotechnologie und IT.<br />
Ein weiterer spannender Teilbereich der IKT Branche ist der Sektor<br />
Games. Bis vor kurzem noch von vielen belächelt, sind Games heute<br />
ein enormer Wirtschaftsfaktor. Immer mehr Menschen beschäftigen<br />
sich mit Games, was sicher auch dadurch zu erklären ist, dass<br />
gerade in diesem Bereich eine Vielzahl an Innovationen auf den<br />
Markt gekommen ist. Die Nintendo Wii Spielkonsole ist ein hervorragendes<br />
Beispiel dafür. Durch diese innovative Methode mit dem<br />
Computer zu kommunizieren, ergeben sich unzählige neue Anwendungsbereiche.<br />
Des Weiteren gibt es in Wien gerade einen vielversprechenden<br />
Versuch, mobile Spielkonsolen als ergänzendes<br />
Medium im Volksschulunterricht zu verwenden. Die Stadt Wien<br />
unterstützt diese Branche ganz gezielt, was sich unter anderem<br />
durch die verschiedenen Aktivitäten des <strong>ZIT</strong> im Rahmen der Wiener<br />
Medienmesse und der Gamecity Vienna zeigt.<br />
Ganz eng verbunden mit dem Bereich Games ist ein weiteres<br />
Spezialgebiet aus dem IT Sektor, die Visualisierung bzw. Simulation.<br />
PilotInnen trainieren am Flugsimulator, ChirurgInnen planen an<br />
3D-Grafiken einen operativen Eingriff, ChemikerInnen entwerfen<br />
neue Werkstoffe, KlimaforscherInnen simulieren die Folgen des<br />
Klimawandels, ArchitektInnen präsentieren ihre Entwürfe in der<br />
simulierten Umgebung, KonstrukteurInnen testen das Crashverhal-
ten von Fahrzeugen. Oberflächenformen und Materialstrukturen<br />
werden hinsichtlich Funktionalität, Haltbarkeit, Stabilität oder<br />
Verformbarkeit geprüft. Prozesse, die in der Realität nicht sichtbar,<br />
versteckt oder zu schnell ablaufen, werden verständlich gemacht.<br />
Die traditionelle Vorgehensweise von Versuch und Irrtum wird damit<br />
durch realitätsnahe Computersimulationen und -visualisierungen<br />
ersetzt. Die Vorteile der Nutzung dieser Technologien sind Kosteneinsparungen,<br />
vor allem aber eine Beschleunigung des Entwicklungsprozesses<br />
sowie die Verbesserungen der Qualität von Produkten.<br />
Durch die aktive Förderung des Kompetenzzentrums VRVis im<br />
Rahmen der COMET-Richtlinie stellt das <strong>ZIT</strong> sicher, dass im Bereich<br />
Visualisierung weltweit anerkannte Spitzenforschung in Wien<br />
vorhanden ist. Durch die kostenlose Dienstleistung Technologieberatung<br />
des <strong>ZIT</strong> kann dieses Spitzen-Know-How den Wiener KMU zur<br />
Verfügung gestellt werden.<br />
Der vermehrte Einsatz von Computern und Elektronik für alle<br />
Lebensbereiche hat aber auch zur Folge, dass der Energieverbrauch<br />
stetig steigt. Schon jetzt erzeugt die IKT Branche weltweit gesehen<br />
ca. 2% der CO 2 -Emissionen, und damit in etwa genauso viel wie der<br />
gesamte Flugverkehr! Durch die exorbitant gestiegenen Energiepreise<br />
hat die Branche jetzt auch einen triftigen Grund, sich über<br />
dieses Thema ernsthaft Gedanken zu machen. Vor allem, wenn man<br />
bedenkt, dass die Anzahl an Computern in den nächsten Jahren<br />
deutlich steigen wird. Die Europäische Kommission hat zudem einen<br />
Beschluss im Rahmen der Ökodesign-Richtlinie gefasst, dass<br />
Computer ab 2010 im Stand-by-Betrieb maximal 1 Watt pro Stunde<br />
verbrauchen dürfen. Weitere Richtlinien wie die Energieeffizienzrichtlinie<br />
oder das EU-Energy Star-Programm zwingen HerstellerInnen<br />
von IKT Produkten, sich über den Energieverbrauch ihrer Produkte<br />
nicht nur Gedanken zu machen, sondern rasch zu handeln. Um die<br />
Entwicklung und Forschung im Bereich ökonomischer und ökologischer<br />
Produkte, Dienstleistungen und Verfahren bestmöglich<br />
unterstützen zu können, plant das <strong>ZIT</strong> für Mitte 2009 einen speziellen<br />
Call im Rahmen des Förderprogramms FORSCHUNG.<br />
Diesen Artikel könnte man beliebig lange weiterführen und<br />
manchem/r LeserIn wird eine Erwähnung von Semantic Web, Web<br />
3.0, ERP oder anderem in diesem Beitrag vermissen. Das bedeutet<br />
aber auf keinen Fall, dass das <strong>ZIT</strong> wenig Wert auf diese Technologien<br />
legt. Ganz im Gegenteil. Durch unser Förderprogramm INNOVATION<br />
Informations- und Kommunikationstechnologien jetzt und demnächst<br />
unterstützen wir schon heute direkt und wirkungsvoll die Entwicklung<br />
von Innovationen in allen Bereichen der IKT.<br />
Als Technologieagentur der Stadt Wien setzen wir uns das Ziel, der<br />
IKT Branche mit Förderungen, Dienstleistungen und Immobilien<br />
optimale Rahmenbedingungen zu bieten, damit Wien auch in Zukunft<br />
ein idealer Standort für die Entwicklung von innovativen IKT Lösungen<br />
bleibt.<br />
DI Peter Halwachs<br />
„Der IKT Standort Wien ist nach London und<br />
München der drittgrößte in Europa und beschäf-<br />
tigt mit ca. 64.000 MitarbeiterInnen in rund<br />
5.300 Unternehmen etwa 9% aller<br />
ArbeitnehmerInnen in Wien.“<br />
1 KMU Forschung Austria: „IKT Standort Wien im Vergleich“. Wien, 2007.<br />
<strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong> 53
54 <strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong>
Forschung findet Stadt…<br />
und unzählige interessierte Wienerinnen und Wiener.<br />
Das Wiener Forschungsfest im Oktober <strong>2008</strong> zeigte, auf welch<br />
großes Interesse Forschung und Technologie in der Öffentlichkeit<br />
stoßen. Mehr als 20.000 Menschen besuchten die zweitägige<br />
Veranstaltung am Rathausplatz und machten sich ein Bild von den<br />
Forschungsleistungen der Wiener Unternehmen und wissenschaftlichen<br />
Einrichtungen.<br />
Forschung und Technologie nicht als Geheimwissenschaft für Eliten,<br />
sondern als für alle erfahrbarer und relevanter Bestandteil des<br />
alltäglichen Lebens und einer modernen Stadt – dies zu vermitteln<br />
ist seit Langem das Ziel der Stadt Wien. Denn letztlich wird ein<br />
Forschungsstandort nur dann erfolgreich sein, wenn nicht nur an der<br />
Spitze hervorragende Forschungsleistungen erbracht werden,<br />
sondern auch die Breite zunimmt - Forschung und Innovation im<br />
alltäglichen Wirtschaftsgeschehen einen noch breiteren Raum<br />
einnehmen. Voraussetzung dafür ist, dass die breite Bevölkerung<br />
dies mitträgt. Durch Neugier und das Interesse, selbst ein Teil davon<br />
zu werden, durch Offenheit für neue Entwicklungen und nicht zuletzt<br />
durch die Bereitschaft, die wirtschaftspolitischen Anstrengungen<br />
durch Steuerleistungen mit zu finanzieren.<br />
Forschung und Technologie „zum Angreifen“ soll dazu beitragen,<br />
dies zu erreichen. Das Wiener Forschungsfest <strong>2008</strong> war der<br />
vorläufige Höhepunkt der diesbezüglichen Anstrengungen der Stadt<br />
Wien beziehungsweise des <strong>ZIT</strong>. Zentrum der Veranstaltung am<br />
Rathausplatz war das Forschungszelt, in dem mehr als 30 Wiener<br />
Unternehmen und wissenschaftliche Einrichtungen Ergebnisse ihrer<br />
Forschungsarbeiten ausstellten. Die Palette reichte von Siemens<br />
über das ebenso erfolgreiche wie junge Biotechunternehmen<br />
AFFiRiS bis zur TU Wien und den Wiener Linien. Nicht trockenmuseal,<br />
sondern in einer Form, die Lust auf Interaktion machte.<br />
„Berühren erwünscht“ war das Motto vieler Stationen, die Forschung<br />
und ihren Nutzen im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar machten.<br />
Dabei war es nicht nur für die BesucherInnen interessant, mit<br />
Forscherinnen und Forschern ins Gespräch zu kommen, sondern für<br />
diese war es eine ebenso spannende Erfahrung, dass es sehr wohl<br />
möglich ist, komplexe Zusammenhänge auch Laien verständlich zu<br />
machen – und das Interesse und die Begeisterung dieser Laien vor<br />
Augen geführt zu bekommen.<br />
Einen besonderen Ansturm erlebten die Angebote für Kinder. Es war<br />
die klare Zielsetzung, das Kinderprogramm nicht als Add-On auch<br />
noch irgendwo unterzubringen, sondern zentral in die Ausstellungs-<br />
dramaturgie zu integrieren - waren doch gerade Familien eine<br />
wesentliche Zielgruppe. Und so experimentierten, forschten und<br />
fragten Kinder an 16 dafür vorgesehenen Stationen möglicherweise<br />
länger als es Mama oder Papa lieb war - und nahmen angesichts des<br />
großen Andrangs gemeinsam mit ihren Eltern lange Wartezeiten in<br />
Kauf.<br />
Neben den Attraktionen - ja, das ist das passende Wort und sollte<br />
vielleicht auch im Forschungszusammenhang öfter verwendet<br />
werden – im Zelt konnten sich Hartgesottene auch die Liveübertragung<br />
einer Herzoperation ansehen, Nervenkitzel anderer Art durch<br />
die Teilnahme am „Wiener Forschungsquiz“ erzeugen – und mit einer<br />
Reise ins CERN belohnt werden. Oder sich beim Musik- und<br />
Kabarettprogramm entspannen.<br />
Nicht nur die große BesucherInnenzahl dokumentiert den Erfolg der<br />
Veranstaltung. Die durchgeführte Evaluierung zeigt, dass es auch<br />
gefallen hat. 95% waren insgesamt sehr zufrieden oder zufrieden,<br />
ganz besonders gut schnitt das vom Zoom Kindermuseum und dem<br />
Kinderbüro der Universität Wien gestaltete Kinderprogramm ab.<br />
Fazit: Wien forscht und Wien interessiert sich auch für Forschung.<br />
Mag. Christian Bartik<br />
„Mehr als 20.000 Menschen besuchten die<br />
zweitägige Veranstaltung am Rathausplatz und<br />
machten sich ein Bild von den<br />
Forschungsleistungen der Wiener Unternehmen<br />
und wissenschaftlichen Einrichtungen.“<br />
<strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong> 55
Von Wärmepumpen und Asthma-Impfstoffen<br />
Die Calls des Jahres <strong>2008</strong> im Zeichen von Umwelt und Kooperation.<br />
Ein bisschen wie im Hamsterrad kommt man sich manchmal vor, als<br />
Förderer im <strong>ZIT</strong>, weil kaum ist ein Call fertig, pocht schon der<br />
nächste ungeduldig und unmissverständlich fordernd, dass man sich<br />
seiner jetzt aber doch endlich bitte schleunigst annehmen sollte,<br />
weil es ginge schließlich um die KundInnen und überhaupt, ans<br />
Gewissen. Aber dann macht es doch immer auch Spaß, sie durchzuführen,<br />
nicht zuletzt weil man Sinnvolles tut und dabei jede Menge<br />
lernt.<br />
Forschungscall Nummer 19 und 20 (wir haben das Jubiläum irgendwie<br />
nicht bemerkt) waren die Wettbewerbe Call Vienna Environment<br />
<strong>2008</strong> und Call CoOperate enlarged - Vienna <strong>2008</strong>. Daher natürlich<br />
schon auch eine Routinesache, aber trotzdem neu und spannend.<br />
Weil jeder neue Call spannend ist, insbesondere wenn es sich um<br />
ein neues Thema handelt wie beim Call Vienna Environment <strong>2008</strong>,<br />
aber auch weil es doch einige Veränderungen gab. Diese betreffen<br />
die rechtlichen Rahmenbedingungen, aber auch die inhaltlichen<br />
Schwerpunktsetzungen. Wir nutzen die Möglichkeiten, die uns der<br />
Rechtsrahmen der EU bietet, noch besser aus (insbesondere durch<br />
die höhere Förderung von kooperativen Projekten) und können seit<br />
Beginn <strong>2008</strong> nicht nur Produkt- und Dienstleistungs-, sondern auch<br />
Verfahrensinnovationen, die nicht unmittelbar am Markt verkauft<br />
werden, unterstützen. Und <strong>2008</strong> war das erste Jahr, in dem wir uns<br />
im Forschungsbereich ausnahmslos auf technologiefeldübergreifende<br />
Themen mit besonderer, auch gesellschaftspolitischer Relevanz<br />
konzentriert haben.<br />
I SOnnenkOllektOren, paSSivhauStechnOlOgien Oder<br />
neue Wärmepumpen – spannende klIMa- und uMWelTrelevanTe<br />
enTWICklunGen IM Call vIenna<br />
envIronMenT <strong>2008</strong><br />
Klima- und Umweltschutz im urbanen Raum war das Thema dieses<br />
Calls, den wir mit großer Unterstützung der Umweltabteilung der<br />
Stadt Wien, der MA 22, durchgeführt haben und für den wir die<br />
Klimaexpertin schlechthin, Frau Prof. in Kromp-Kolb, als Vorsitzende<br />
der ExpertInnenjury gewinnen konnten. Mehr als 40 Projekte wurden<br />
eingereicht und wie angestrebt kamen diese aus den verschie-<br />
56 <strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong><br />
densten Technologiebereichen – von Telematik über die Gewinnung<br />
erneuerbarer Energie, einem möglichst effizienten Energieeinsatz,<br />
bis hin zur 0-Energie reicht die thematische Bandbreite der geförderten<br />
Projekte. 14 Projekte wurden mit insgesamt knapp 1,7<br />
Millionen Euro gefördert. Gewinnerin des Calls war die Firma Siblik<br />
Elektrik GmbH mit einem Projekt, das es zum Ziel hat, die Spannungsschwankungen<br />
bei der Energiegewinnung durch Photovoltaik<br />
wesentlich zu reduzieren.<br />
I nachhaltige internatiOnale kOOperatiOnen zWiSchen<br />
WirtSchaFt und WiSSenSchaFt – Call CooperaTe<br />
enlarGed - vIenna <strong>2008</strong><br />
Zum zweiten Mal nach 2005 wurde ein Call zu dieser Thematik<br />
durchgeführt. Ziel war es, Kooperationen zwischen Wirtschaft und<br />
Wissenschaft, insbesondere aber Kooperationen von Wiener Unternehmen<br />
mit PartnerInnen aus Mittel- und Osteuropa zu initiieren und<br />
zu unterstützen. Gerade im Hinblick auf letztere besteht weiterhin ein<br />
großes Ausbaupotenzial, ist doch die Zusammenarbeit von AkteurInnen<br />
dieses Raumes in der Forschung noch deutlich weniger ausgeprägt<br />
als in anderen Bereichen. Acht Projekte, von denen vier in<br />
Kooperation mit einem oder mehreren mittel- und osteuropäischen<br />
PartnerInnen durchgeführt werden, konnten mit insgesamt 1,7<br />
Millionen Euro unterstützt werden. Erfahrungsgemäß sind im Rahmen<br />
von Calls mit einer solch strukturellen Zielsetzung Life Science Unternehmen<br />
stark vertreten. Dies war auch diesmal der Fall und zeigt<br />
sich auch in der Siegerin des Calls, der Firma Vela, deren Projekt es<br />
zum Ziel hat, einen Impfstoff gegen bestimmte allergische Krankheiten<br />
(z.B. Asthma) zu entwickeln.<br />
Dass bei beiden Calls die Anzahl der sehr guten Projekte so hoch<br />
war, dass die Jury beide Male die Aufstockung des zur Verfügung<br />
stehenden Budgets empfahl, bestätigt zum einen die Themenwahl<br />
und dokumentiert zum anderen die hohe Forschungskompetenz der<br />
Wiener Unternehmen. Beide Themen werden auch in Zukunft<br />
bearbeitet werden, der Bereich Umwelt/Ressourcen bereits in der<br />
zweiten Jahreshälfte 2009.<br />
Mag. Christian Bartik
„Wir nutzen die Möglichkeiten, die uns der Rechts-<br />
rahmen der EU bietet, noch besser aus (insbesondere<br />
durch die höhere Förderung von kooperativen<br />
Projekten) und können seit Beginn <strong>2008</strong> nicht nur<br />
Produkt- und Dienst leistungs-, sondern auch<br />
Verfahrens inno va tionen, die nicht unmittelbar am<br />
Markt verkauft werden, unterstützen.“<br />
<strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong> 57
58 <strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong>
<strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong> 59
Das Artwork dieses Jahresberichtes<br />
Die Leiden des jungen L. – „digitale Artefakte“<br />
Die Arbeiten dieses Jahresberichts sind digitale Artefakte. Die neue, digitale Technologie bietet<br />
uns sehr viele Möglichkeiten und bereitet große Freude. Aber oft treibt diese uns auch in eine<br />
innere Verzweiflung und größeren Wahnsinn (– in diesem Fall sind sie doch ein Segen).<br />
Diese Artefakte passieren häufig bei Datenübertragung ohne Komprimierung durch das Internet.<br />
Ein komprimiertes File erhält eine „checksum“ (Prüfsumme). Wird eine komprimierte Datei<br />
(File) geöffnet, überprüft der Computer zuerst die Datei mit der mitgelieferten Summe auf<br />
Funktionalität. Bei nicht komprimierten Dateien kann der Datenstamm durch die Über tragung<br />
beschädigt werden und ist dadurch nicht mehr lesbar.<br />
Eine normale Übertragung ist bei binärer Übertragung 8 Bit. (besteht aus nur 8 Segmenten<br />
– aus 0 und 1, darin sind sämtliche Informationen enthalten. Moderne Geräte können bis<br />
zu 128 Bit gleichzeitig verarbeiten.) Wenn auch nur ein Segment (0 oder 1) zerstört ist, kann<br />
diese Datei nicht mehr komplett dargestellt werden.<br />
60 <strong>JAHRESBERICHT</strong> <strong>2008</strong><br />
Ludwig Rusch, Fotograf