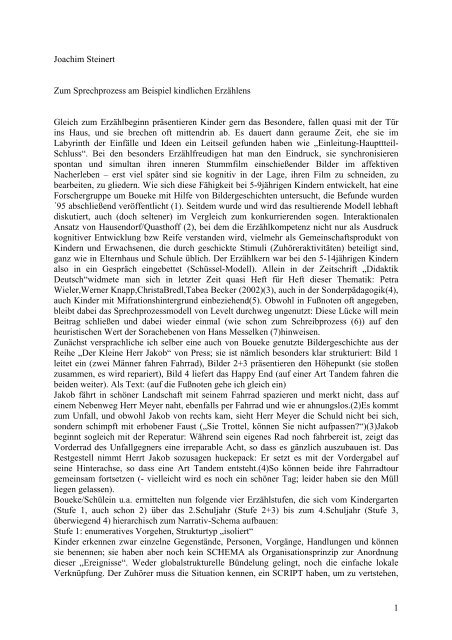1 Joachim Steinert Zum Sprechprozess am Beispiel kindlichen ...
1 Joachim Steinert Zum Sprechprozess am Beispiel kindlichen ...
1 Joachim Steinert Zum Sprechprozess am Beispiel kindlichen ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Joachim</strong> <strong>Steinert</strong><br />
<strong>Zum</strong> <strong>Sprechprozess</strong> <strong>am</strong> <strong>Beispiel</strong> <strong>kindlichen</strong> Erzählens<br />
Gleich zum Erzählbeginn präsentieren Kinder gern das Besondere, fallen quasi mit der Tür<br />
ins Haus, und sie brechen oft mittendrin ab. Es dauert dann geraume Zeit, ehe sie im<br />
Labyrinth der Einfälle und Ideen ein Leitseil gefunden haben wie „Einleitung-Haupttteil-<br />
Schluss“. Bei den besonders Erzählfreudigen hat man den Eindruck, sie synchronisieren<br />
spontan und simultan ihren inneren Stummfilm einschießender Bilder im affektiven<br />
Nacherleben – erst viel später sind sie kognitiv in der Lage, ihren Film zu schneiden, zu<br />
bearbeiten, zu gliedern. Wie sich diese Fähigkeit bei 5-9jährigen Kindern entwickelt, hat eine<br />
Forschergruppe um Boueke mit Hilfe von Bildergeschichten untersucht, die Befunde wurden<br />
´95 abschließend veröffentlicht (1). Seitdem wurde und wird das resultierende Modell lebhaft<br />
diskutiert, auch (doch seltener) im Vergleich zum konkurrierenden sogen. Interaktionalen<br />
Ansatz von Hausendorf/Quasthoff (2), bei dem die Erzählkompetenz nicht nur als Ausdruck<br />
kognitiver Entwicklung bzw Reife verstanden wird, vielmehr als Gemeinschaftsprodukt von<br />
Kindern und Erwachsenen, die durch geschickte Stimuli (Zuhöreraktivitäten) beteiligt sind,<br />
ganz wie in Elternhaus und Schule üblich. Der Erzählkern war bei den 5-14jährigen Kindern<br />
also in ein Gespräch eingebettet (Schüssel-Modell). Allein in der Zeitschrift „Didaktik<br />
Deutsch“widmete man sich in letzter Zeit quasi Heft für Heft dieser Thematik: Petra<br />
Wieler,Werner Knapp,ChristaBredl,Tabea Becker (2002)(3), auch in der Sonderpädagogik(4),<br />
auch Kinder mit Mifrationshintergrund einbeziehend(5). Obwohl in Fußnoten oft angegeben,<br />
bleibt dabei das <strong>Sprechprozess</strong>modell von Levelt durchweg ungenutzt: Diese Lücke will mein<br />
Beitrag schließen und dabei wieder einmal (wie schon zum Schreibprozess (6)) auf den<br />
heuristischen Wert der Sorachebenen von Hans Messelken (7)hinweisen.<br />
Zunächst versprachliche ich selber eine auch von Boueke genutzte Bildergeschichte aus der<br />
Reihe „Der Kleine Herr Jakob“ von Press; sie ist nämlich besonders klar strukturiert: Bild 1<br />
leitet ein (zwei Männer fahren Fahrrad), Bilder 2+3 präsentieren den Höhepunkt (sie stoßen<br />
zus<strong>am</strong>men, es wird repariert), Bild 4 liefert das Happy End (auf einer Art Tandem fahren die<br />
beiden weiter). Als Text: (auf die Fußnoten gehe ich gleich ein)<br />
Jakob fährt in schöner Landschaft mit seinem Fahrrad spazieren und merkt nicht, dass auf<br />
einem Nebenweg Herr Meyer naht, ebenfalls per Fahrrad und wie er ahnungslos.(2)Es kommt<br />
zum Unfall, und obwohl Jakob von rechts k<strong>am</strong>, sieht Herr Meyer die Schuld nicht bei sich,<br />
sondern schimpft mit erhobener Faust („Sie Trottel, können Sie nicht aufpassen?“)(3)Jakob<br />
beginnt sogleich mit der Reperatur: Während sein eigenes Rad noch fahrbereit ist, zeigt das<br />
Vorderrad des Unfallgegners eine irreparable Acht, so dass es gänzlich auszubauen ist. Das<br />
Restgestell nimmt Herrt Jakob sozusagen huckepack: Er setzt es mit der Vordergabel auf<br />
seine Hinterachse, so dass eine Art Tandem entsteht.(4)So können beide ihre Fahrradtour<br />
gemeins<strong>am</strong> fortsetzen (- vielleicht wird es noch ein schöner Tag; leider haben sie den Müll<br />
liegen gelassen).<br />
Boueke/Schülein u.a. ermittelten nun folgende vier Erzählstufen, die sich vom Kindergarten<br />
(Stufe 1, auch schon 2) über das 2.Schuljahr (Stufe 2+3) bis zum 4.Schuljahr (Stufe 3,<br />
überwiegend 4) hierarchisch zum Narrativ-Schema aufbauen:<br />
Stufe 1: enumeratives Vorgehen, Strukturtyp „isoliert“<br />
Kinder erkennen zwar einzelne Gegenstände, Personen, Vorgänge, Handlungen und können<br />
sie benennen; sie haben aber noch kein SCHEMA als Organisationsprinzip zur Anordnung<br />
dieser „Ereignisse“. Weder globalstrukturelle Bündelung gelingt, noch die einfache lokale<br />
Verknüpfung. Der Zuhörer muss die Situation kennen, ein SCRIPT haben, um zu vertstehen,<br />
1
um das „isoliert“ Aufgezählte zu verbinden. Auffällig sind deiktische Partikeln (da,hier) und<br />
nahe Inferenz: sie finden keinen Abstand zu den Bildern.<br />
Stufe 2: Sequenzierungsstrategie, Strukturtyp „linear“<br />
Die einzelnen Ereignisse werden zu Ereignisfolgen verbunden, und zwar meist temporal mit<br />
Hilfe der Verknüpfung „und dann – und dann“. Der Ablauf der Dinge wird hier schon eher<br />
deutlich ; sprachfunktional löst das Es (referentiell) das Ich ab, statt affektiv-subjektiver<br />
Spontansprache nun Hinwendung zum Sachverhalt.<br />
Stufe 3: Kontrastierungsstrategie, Strukturtyp „strukturiert“(handlungslogisch verknüpft)<br />
Die Kinder auf dieser Stufe sind kognitiv in der Lage, eine Diskontinuität zu erkennen und zu<br />
markieren: Der „normal course of events“ im Setting (Radtour) wird durch eine Episode<br />
(Unfall) durchbrochen, der Kontrast zwischen Vorher-Planbruch-Nachher wird mit<br />
Ereignisstruktur- bzw E-Markierungen verdeutlicht, beim Abschluss erfolgt oft eine<br />
Rückbindung ans Setting (Wieder fahren sie Rad, doch jetzt auf einem).Das Qualitätsmerkmal<br />
dieser Stufe ist GLIEDERUNG.<br />
Stufe 4: Involvierungsstrategie, Strukturtyp „narrativ“<br />
Nun erst wird erzählt, nicht mehr berichtet: die Diskontinuität wird durch affektive<br />
Markierungen erlebbar gestaltet, der Zuhörer hat das Gefühl de Dabeiseins. Die Kinder<br />
können sich auf dieser Höchststufe in die Gefühle und Gedanken der Aktanten<br />
hineinversetzen: direkte und innere Rede ermöglichen auch PSYCOLOGISCHE NÄHE zum<br />
Zuhörer. Erwartbar sind positive Konnotationen (Begleitgefühle) bei der Exposition, negative<br />
bei der Komplikation (zB Schimpfen beim Unfall) und wieder positive bei der Auflösung<br />
(Happy End). Wenn dies gelingt, ist VALENZ gegeben. Drittes Kriterium ist die<br />
PLÖTZLICHKEIT, zB des Planbruchs, wobei natürlich wertvoller als das Adverb „plötzlich“<br />
die sensible Spannungserzeugung erscheint (A-Markierungen).<br />
Die Basis des Modells bilden Welt-, Sprach- sowie Interaktionswissen bzw referentielle ES-<br />
Funktion, Metasprachfunktion sowie phatische WIR-Funktion. Auch sind die Erzählstufen<br />
nicht isoliert zu sehen, sondern eingebunden in eine Entwicklung im Sinne von Piaget, wobei<br />
Assimilation hier die Anpassung der Ereignisse an das jeweils erreichte Schema meint,<br />
Akkomodation die Anpassung des Schemas an die (neuen) Differenzierungsmöglichkeiten<br />
durch Umstrukturierung und Weiterentwicklung. Auslöser ist jeweils die Unzufriedenheit mit<br />
dem alten Schema, erstrebt wird die Äquilibration, wo kognitive Reife und sprachlicher<br />
Ausdruck übereinstimmen.<br />
Unsere Projekte zeigen, dass die Kinder oft mental weiter als sprachlich entwickelt sind: In<br />
einer Äußerung wie „und da haben die mich hingeschubst und da hab ich denen gar nichts<br />
getan“ kann das concessive „obwohl“ gemeint sein, auch wenn es sprachlich als<br />
Kohäsionsmittel noch nicht zur Verfügung steht.<br />
Wenn Kritiker sagen, bei Bilergeschichten würde lediglich „nacherzählt“, so möge man<br />
bedenken, wie sehr es vom sprachgedanklichen Vorwissen abhängt, wie differenziert die<br />
Kinder die Bilder wahrnehmen, ob sie zB den Höhepunkt und die Gliederung erkennen, wie<br />
weit sie sich von den Bildern lösen und den Hörer einbeziehen können.<br />
Bevor ich auf eine Erzählung sprechprozessual eingehe, daher zuvor ein „Blitzlicht“ aus<br />
einem 2.Schuljahr, zeigt es doch, wie weit die Kompetenzen in einer einzigen Klasse<br />
auseinanderliegen – alle zu unserer Bildergeschichte:<br />
1) Ann-Kathrin (8;4)<br />
Zwei Radfahrer…mh, die stoßen zus<strong>am</strong>m..äh. Da fluch der .. ganz doll, weil der muss ja<br />
aufpassn..der will dem…da is der auf.aufm Rad schon wieda.und..und der davor…da fahrn<br />
die weg<br />
2)Daniela (7;8)<br />
Da is n Mann…darf ich noch mal anfang? Da (zeigt drauf) fahrn se Fahrrad,ne?...äh,äh.und<br />
krachen da (zeigt drauf) zus<strong>am</strong>m, hier, da krachen die ja zus<strong>am</strong>m, siehste?..gaaanz plööötzlich<br />
2
(langs<strong>am</strong> gesprochen!) Und dann hat der (zeigt drauf) gleich n Plattn..Der is <strong>am</strong><br />
Lachen..,mitm schwarzn Hut der..Und da wollten die das pum..p…müssen der n neues<br />
Fahrrad haben..neuen Reifen..Und dann fahrn se weiter,ne? (schnell gesprochen)<br />
3)Sarah (8;3)<br />
Aaalso, die..fahrn so Fahrrad, und dann knarren (betont) die gegennanda und dann fallen<br />
beide hin. Und dann streiten die sich da..ähm..nee,nur der schimpft..der,der lacht ja. Und dann<br />
is das Ra..der Reifen kaputt. Dann machen die das gegenanda wieda heile..Und dann fahrn se<br />
d<strong>am</strong>it wieda weg.<br />
4)Phillip (8;7)<br />
Es waren einmal zwei Männer, die einen Fahrradausflug machten. Und einer k<strong>am</strong> von rechts<br />
und einer von oben..Da knallten die auf einmal zus<strong>am</strong>m (sehr schnell) und der sag, einer<br />
sagte: „Hey, pass doch auf! Mein schönes Fahrrad is kaputt, du Idiot!..Dann aber war..hat der<br />
sich entschuldigt, hat sich n Schraubenschlüssel rausgeholt und die beiden Fahrräder<br />
repariert..Und dann sind se mit..mitm..mit so’m Zweierfahrrad friedlich weitergefahrn.<br />
Für meine <strong>Sprechprozess</strong>analse wähle ich bewusst eine Transcription aus Boueke ´95 (Heike,<br />
4.Kl.,Alter 9;6 – eingestuft Stufe 3), um zu zeigen (über 17 Fußnoten), wie viel Mehrwert<br />
eine solche Analyse ermöglicht, bis hin zur Rekonstruktion eines Laut-Denk-Protokolls:<br />
Also (1) es (2) kommt ein Mann von einem Wie/Seitenweg (3) also noch mal (4):<br />
Also Herr Jakob fährt auf einem Feldweg. Da kommt ein anderer Mann (5) der fährt auf einen<br />
(6) Seitenweg. Und dann stoßen se (7) mit´m (auf´n Fahrrad fahrn die beiden (8))..dann<br />
stoßen se zus<strong>am</strong>m und der andere Mann hat ein/ne Acht im Reifen (9)..und dann überleg/<br />
dann überleg/ dann überlegt (10) der Herr Jakob un.baut das an un/ (also ers er’s ruf/flucht der<br />
eine Mann) (11) und dann überlegt Herr Jakob und baut das andere (12) baut bei / die Acht.<br />
eh (13) den Reifen der die Acht hat.. baut den Reifen aus..un.und baut mh baut das Gestell<br />
(14) wo vorne der Reifen dran war auch an sein Fahrrad hinten dran..und dann h<strong>am</strong>se (15)<br />
nen sozusagen Zweierfahrrad..Trimm.Trimm.eh.eh.Trimmrad oder wie das da heißt (16)<br />
dann fahrn se zus<strong>am</strong>m .weiter (17)<br />
Ein herrlicher Text, nicht wahr? Man spürt, wie Heike um das Glücken ihrer Erzählung<br />
regelrecht ringt, und dies bei dem Stress, keine längeren Pausen machen zu dürfen, auch nicht<br />
– wie es im Schriftlichen möglich wäre – überarbeiten, also nach Belieben streichen, ersetzen,<br />
ergänzen zu können. Doch gucken wir genauer hin (Tonbänder, gar Videos – wie sie in<br />
unseren Projekten Standard sind – gibt es zu diesem Buch nicht):<br />
Zu Fußnote (1): Heike eröffnet mit der Partikel „also“, um ihre – ja gar nicht<br />
selbstverständliche – Erzählbereitschaft zu signalisieren, und zwar einem Adressaten,<br />
eventuell sich selber, jedenfalls auf einer Metaebene außerhalb der Erzählung.<br />
Zu (2): Das „es“ in „es kommt ein Mann“ beweist – im Unterschied zu dem viel häufigeren<br />
„da“ – dass Heike Distanz zu der Vorlage hat, man spricht von „weiter Inferenz“ (im<br />
Unterschied zur nahen Inferenz des „da“, wo man den Fingerzeig spürt oder gar sieht). Bereits<br />
hier ist zu erwarten, dass Heike sich nicht von Bild zu Bild „durchhangeln“ wird, sondern<br />
wirklich eine Geschichte erzählen will. Eine Steigerung wäre die Märchen-Formel „es war<br />
einmal“, wo die Bilder nur noch wie durch ein umgedrehtes Fernglas beachtet würden.<br />
Zu (3): Allerdings missglückt ihr der Einstieg: Sie spürt (Levelt spricht hier von<br />
audition/Hörselbstwahrnehmung), dass sie geschickter mit dem Hauptaktanten beginnt und<br />
diesem einen N<strong>am</strong>en gibt (Herr Jakob), ferner den Seitenweg für den Nebenaktanten<br />
reserviert. Diesen führt sie aber leider ohne N<strong>am</strong>en, also indefinit ein. Dies führt später dazu,<br />
dass sie den „anderen“ Mann auch „der eine Mann“ nennen muss.<br />
3
Zu (4): Die Hörselbstwahrnehmung (audition) führte hier also bereits zu einer spontanen<br />
lexikalischen Korrektur (Wiesenweg zu Seitenweg) sowie zu einem sogenannten „fresh start“,<br />
einem Neubeginn aufgrund der Beurteilung des Erzählbeginns. So etwas ist im<strong>Sprechprozess</strong><br />
nur sehr <strong>am</strong> Anfang möglich, später nicht mehr. Wieder haben die Partikeln „also,noch mal“<br />
nichts mit dem Erzählstoff zu tun, stellen eher einen zwar geäußerten, im Grunde aber<br />
inneren Steuerungsappell dar. „Heike, beginne besser neu!“ Es ähnelt trotz der Kürze dem<br />
Lauten Denken bzw der Inneren Sprache bei Levelt.<br />
Zu (5): „ein anderer Mann, der fährt“: Die Wiederaufnahme des Subjekts ist im Mündlichen<br />
auch allgemein üblich wegen des Vorteils, einfache Hauptsätze bilden zu können, statt der<br />
Relativsatz-Kl<strong>am</strong>mer „.., der auf einem Seitenweg fährt“. (Sogar nach „weil“ folgen<br />
inzwischen Hauptsätze – horribile dictu!)<br />
Zu (6): Korrekt hieße es „auf einem Weg’’ (lokales Adverbial). Wir haben hier eine<br />
gr<strong>am</strong>matische Fehlcodierung: Heike verwechselt im „Mentalen Lexikon“ (Levelt), welches<br />
mein Arbeitskreis mit den sechs Sprachebenen von Messelken sowie meinen sechs<br />
Sprachfunktionen, wie wir noch sehen werden, untergliedert, morphematisch die Kasus,<br />
syntagmatisch die Satzglieder „lokales versus direktionales Adverbial“, sprachfunktional<br />
„metasprachlich“ die Leitfragen „wo versus wohin“.<br />
Zu (7): Zur Typik der Mündlichkeit gehören phonetische Reduktionen (se / nen / zus<strong>am</strong>m)<br />
sowie Verschleifungen von Präposition/Artikel (mit´m, auf´n) sowie bei Konjugationsformen<br />
(h<strong>am</strong>se /sinse).<br />
Zu (8): Die von mir (und leider nicht im Original bei Boueke) gesetzte Kl<strong>am</strong>mer soll den<br />
Einschub andeuten, die Parenthese, die eine wichtige Information nachreicht. In der<br />
Hörselbstwahrnehmung fällt Heike hier auf, dass die Fahrzeugfrage noch nicht geklärt wurde:<br />
Es hätten ja Motor- statt Fahrräder sein können. Beim Schreiben hätte man Gedankenstriche<br />
setzen und das Modaladverbial „auf dem Fahrrad“ nachträglich einsetzen können, im<br />
Mündlichen geht das nicht, wirkt die Aufeinanderfolge der Wörter hier wie ein Logikbruch<br />
(Anakoluth): „..stoßen se mitm aufn Fahrrad“. Die ursprüngliche Satzplanung war sicher<br />
„dann stoßen sie mit den Rädern zus<strong>am</strong>men“. Im Grunde löst Heike das Problem recht<br />
souverän, ausführliche Exkurse wie „ich vergaß eben darauf hinzuweisen, dass..“ wären<br />
erzählstrategisch wesentlich ungünstiger, der rote Faden ginge verloren.<br />
Zu (9): „der andere Mann hat ne Acht“: Wenn zwei zus<strong>am</strong>menstoßen, wer ist dann „der<br />
andere“? Hier rächt sich – wie oben bereits vorhergesagt – die indefinite Einführung des<br />
Nebenaktanten (der bei mir Herr Meyer heißt). Heike bleibt nun sehr im Zeigefeld der<br />
Bildvorlage und focussiert typischerweise die Schadensklärung (das nennt man deiktisches<br />
Erzählen). Strategisch viel wirkungsvoller wäre gewesen, statt technischer Details (die viele<br />
gar nicht interessieren) verstärkt Emotionen, affektive wörtliche Rede (Schimpfwörter würden<br />
als Verstärker bzw „intensifier“ gewertet), Dialoge zu präsentieren.<br />
Zu (10) Irgendwie merkt Heike diesen Nachteil und verschafft sich erst einmal Reflexionszeit,<br />
und zwar unglaublich geschickt: Sie lässt Herrn Jakob überlegen und mit ihm sich selbst.<br />
Linguistisch hochinteressant ist hierbei, dass sie zunächst das Flexionsmorphem offen lässt,<br />
zweimal nennt sie nur den Verbst<strong>am</strong>m ohne Endung („überleg“) – bevor sie sich für den<br />
Singular (überlegt) entscheidet (Indikativ,Präsens,Aktiv). Übrigens eine lobenswerte Abhör-<br />
Leistung, sie möge als Vorbild wirken!<br />
Zu (11): Die fehlende affektive Markierung holt Heike im Einschub nach (wir haben also die<br />
zweite Parenthese), allerdings reduziert sie eine mögliche Schimpf- und<br />
Streitauseinandersetzung auf das Verb „fluchen“, in lexikalischer Spontan-Umcodierung von<br />
„rufen“, sprachfunktional im Wechsel vom Neutral-Denotativen zum Emotiv-Konnotativen,<br />
um Begleitgefühle beim Hörer zu ermöglichen. Es blitzt quasi kurz Valenz (farbiger<br />
Ausdruck) auf, doch schafft dieses einzelne Starkwort nicht wirklich die wünschenswerte<br />
psychologische Nähe: Um zu involvieren, ein Gefühl des Dabeiseins zu bewirken, hätte es<br />
eines Dialoges bedurft. Heike schmückt ihr Erzählen insges<strong>am</strong>t wenig aus (kaum A-<br />
4
Markierungen), beschränkt sich auf handlungslogische Verknüpfungen, auf das Berichten<br />
(statt Erzählen) des Unfall- und Reperaturhergangs, wiewohl durchaus mit klarer Hinführung<br />
und kurzem Abschluss, mithin klar strukturiert ,weshalb sie auf Stufe 3 ihren Platz fand).<br />
Zu (12): Die Reperaturmaßnahme findet Heikes Hauptinteresse, und in der Tat ist die<br />
technische Lösung sprachlich auch schwierig zu fassen: Auf die Hinterachse des intakten<br />
Fahrrads von Jakob wird das vorderradlose Gestell des Kontrahenten aufgebockt, so dass eine<br />
Art Tandem mit drei Rädern entsteht. Heike produziert hierzu ein Überangebot, eine<br />
Redundanz an Beschreibungsansätzen, und doch resultiert nicht wirklich Klarheit. Umso<br />
mehr ist ihr Bemühen zu loben, über Details nicht einfach hinwegreden zu wollen.<br />
Diagnostisch offenbart sich hier das Validitätsproblem dieser Bildervorlage, nicht gleichzeitig<br />
und gleichgewichtig Exaktheit und Eloquenz zum Ziel erklären zu können.<br />
Zu (13): „eh“ wie auch „mh“ und „eh,eh“ nennt man Indifferenzlaute, die – einmal<br />
konstruktiv gedeutet – ein wenig Zeit zum Überlegen bzw zur Codierungsreflexion<br />
verschaffen, Schweigen wiederum unterbräche den Redefluss.<br />
Zu (14): „das Gestell, wo vorne der Reifen dran war“: Konstruktionen dieser Art<br />
(Interrogativadverb statt Relativpronomen) sind typisch für direkt umgesetzte conceptuale<br />
Mündlichkeit. Exakt wäre: „das Gestell, an dessem Vorderteil der Reifen befestigt war“ – das<br />
wäre conceptuale Schriftlichkeit und hieße, wie gedruckt zu sprechen.<br />
Zu (15): „dann h<strong>am</strong>se nen sozusagen Zweierfahrrad“ ist einerseits erzählstrategisch gekonnt,<br />
weil es die Wir-Perspektive (phatische Funktion) pfeilgeschwind und treffsicher einbringt:<br />
eine gemeins<strong>am</strong>e Lösung assoziiert friedliche Harmonie, mithin positive Konnotationen.<br />
Andererseits birgt die Formulierung einen sprechprozessual typischen Gr<strong>am</strong>matikfehler: Statt<br />
des Adverbs „sozusagen“ – das ja nicht attribuierbar ist – hätte das semantisch kompatible<br />
„sogenanntes“ gewählt werden müssen, um es an das Nomen koppeln zu können („ein<br />
sogenanntes Zweierfahrrad“). Im Schriftlichen hätte Heike durch einen schlichten Pfeil das<br />
Adverb an die korrekte Stelle verweisen können („dann h<strong>am</strong>se sozusagen nen<br />
Zweierfahrrad“), im Sprechvollzug sind derlei Korrekturen nicht möglich.<br />
Zu (16): „oder wie das da heißt“ ist für <strong>Sprechprozess</strong>analysen ein kleines Highlight: Heike<br />
befragt indirekt – quasi von außen nach innen – ihr mentales Lexikon nach dem Fachausdruck<br />
TANDEM; ein Stück Gedankensprache bzw innere Sprache ist zu vermerken. Bei etwas mehr<br />
Zeit, wie sie beim Schreiben gegeben wäre, könnte ihre Suche erfolgreich verlaufen<br />
(Funktion: metasprachlich – Nachdenken über Sprache; Ebene: Lexematik).<br />
Zu (17): Der Schlussatz ist erzählstrategisch immens wichtig, liefert er doch das ersehnte<br />
Happy End. Er sichert auch die Kohärenz, die inhaltliche Geschlossenheit des Textes, durch<br />
Rückbindung an das Setting, den Beginn der Geschichte: Wieder fahren beide Rad, doch nun<br />
auf einem Fahrrad und gemeins<strong>am</strong>, in geglückter Auflösung der spannenden zentralen<br />
Komplikation, des Unfalls.<br />
Es ist nun, so denke ich, genügend Interesse <strong>am</strong> <strong>Sprechprozess</strong>modell von Levelt geweckt:<br />
Ich habe die relevanten Infos aus den über 400 Seiten seines Buches „From Intention to<br />
Articulation“ übersetzt (8): Unterschieden werden zwei Kreisläufe, die nachfolgenden Punkte<br />
1 bis 5 skizzieren den inneren Sprechvollzug, die Punkte 6 und 7 integrieren den äußeren. Der<br />
Sprecher prüft permanent, ob das Gedachte bzw Gesagte seinen Intentionen entspricht<br />
(monitoring), und zwar nach Inhalt und Form, und nicht erst bei geäußerter Sprache, sondern<br />
bereits im inneren Sprechen. In Kurzform:<br />
1) Vorwissen beachten<br />
2) Konzept generieren (vorsprachlich, mit Binnenkontrolle durch Monitor)<br />
3) Formulieren mit Hilfe des Mentalen Lexikons (untergliedert mit 6 Sprachebenen und<br />
6Sprachfunktionen); Output: inneres Sprechen<br />
4) Kontrollieren, wieder mit Hilfe des Mentalen Lexikons, auf Klarheit und<br />
Verständlichkeit hin („Sprach-TÜV“); Output: bereinigte Sprache<br />
5
5) Abgleichen mit Konzept (s.o.2); der innere Kreislauf ist somit geschlossen<br />
Der Weg von 3) nach 4) kann ergänzt werden durch geäußerte Sprache:<br />
6) Artikulieren<br />
7) Hörselbstwahrnehmung (audition), die zusätzlich Äußerungen von<br />
Gesprächsteilnehmern integriert<br />
Diese Punkte gilt es nachfolgend zu erläutern:<br />
Zu 1 und 2): Die Konzept-Komponente (conceptualizer) schöpft aus einem Speicher, der –<br />
so nenne ich dies – Pragma- und Systemvorwissen enthält. Der Pragma-Aspekt bündelt<br />
aus der Lebenserfahrung Inhaltswissen, Situationseinschätzung, Adressatenkenntnis etc,<br />
der System-Aspekt bezieht sich auf sprachlich-formale Kompetenz (zB wie unterscheiden<br />
sich Bericht und Erzählung, mit welchen Sprachmitteln bewirkt man affektive<br />
Involvierung). Als Output liefert die Konzept-Komponente ein vorsprachlihes Konzept ,<br />
also semantische Fragmente, Vorstellungen (Propositionen), noch ohne gr<strong>am</strong>matischphonetisch<br />
feste Form und noch ungeäußert.<br />
Zu 3): Diese vorsprachlich erzeugte Botschaft ist gleichzeitig Input für den Formulator.<br />
Er übersetzt die Konzeptstruktur in eine sprachliche, und zwar in zwei Schritten: Der<br />
gr<strong>am</strong>matische Codierer führt zu einer sprachlichen Oberflächenstruktur, und der<br />
phonologische Codierer setzt diese in einen phonetischen Plan um, führt somit zur inneren<br />
Sprache. Beide Codierungen erfolgen in Rückkopplung zu einem Mentalen Lexikon,<br />
welches sowohl begrifflich-semantische Differenzierungen (lemmata) wie auch<br />
Wortbildungen und Satzbaupläne (forms) enthält.<br />
Gespeichert ist zB nach Levelt, dass ein Spatz ein Vogel ist, dass „geben“ ein Verb mit<br />
bestimmter Valenz darstellt – wer gibt wem was -, dass man Pausen und Betonungen nicht<br />
beliebig setzen kann. Geordneter und wirkungsvoller lässt sich hier mit Messelkens<br />
Sprachebenen und meinen Funktionen, also zwölffach präzise differenzieren.<br />
Endprodukt dieser Komponente ist jedenfalls ein Artikulationsplan.<br />
Zu 6): Dieser Plan ist wiederum Input für den Artikulator, der ihn nun mit Hilfe<br />
neuromuskularer Befehle und Progr<strong>am</strong>me ausführt, so dass als Produkt dieser<br />
Komponente die äußere Sprache empirisch greifbar, konservierbar, analysierbar wird, im<br />
Sprechvollzug auch für den Sprecher hörbar.<br />
Zu 7): Als Sprecher ist man stets zugleich sein eigener Hörer, doch ist die<br />
Hörselbstwahrnehmung (audition) auch Eingangsstelle für Äußerungen etwaiger<br />
Gesprächsteilnehmer (interlocuters), man registriert und verarbeitet deren Einwürfe,<br />
Kommentare, Reaktionen etc. (Nimmt man das Ges<strong>am</strong>tmodell auf Seite des Hörers als<br />
Spegelbild, so entsteht ein Kommunikationsmodell hoher Differenziertheit.)<br />
Zu 4): Über ein sogenanntes phonetisches Seil gelangen wir nun zur Kontroll-Instanz, die<br />
die ich „Sprach-TÜV“ nenne. Doch kann der Weg dorthin auch ohne artikulierte<br />
Äußerung direkt von der inneren Sprache aus (s.o.3) erfolgen. In beiden Fällen bedient<br />
sich der Sprach-TÜV bei Worterkennung und Bedeutungsüberprüfung wieder des<br />
Mentalen Lexikons (Ist zB Zweierfahrrad/Tandem korrekt, sage ich fluchen statt rufen, ist<br />
mein Satzplan korrekt, die Textkohärenz gesichert?) Output, also Ausgabe dieser<br />
Kontroll-Instanz ist die bereinigte Sprache, eine nach den Regeln der Phonologie,<br />
Morphologie, Syntax und Semantik aufgebaute Repräsentation der Input-Sprache. Da im<br />
Sprach-TÜV sowohl interne wie externe Sprache analytisch überprüft werden, ist es dem<br />
Sprecher im Sprechvollzug durchaus möglich, Unklarheiten aufzudecken, noch bevor sie<br />
artikuliert sind. Hier ist der Ort für Laut-Denk-Protokolle, dazu gleich ein Heike-<strong>Beispiel</strong>.<br />
Zu 5): Es schließt sich nun der Kreis im <strong>Sprechprozess</strong>modell nach Levelt: Der Output<br />
des Sprach-TÜV – die bereinigte Sprache – wird Input für die Konzept-Komponente, mit<br />
der wir begonnen haben (s.o.1+2). Hier wird die Hauptarbeit geleistet, zu Beginn wurde<br />
das Gemeinte, nun wird das Formulierte und Überprüfte mit den Intentionen in<br />
6
Übereinstimmung gebracht. Dazu dient ein Monitor, der quasi einen zusätzlichen internen<br />
dritten Kreislauf darstellt.<br />
Jede dieser Prozess-Komponenten wird als autonomer Spezialist bezeichnet, also<br />
unabhängig von anderen Komponenten arbeitend, mit jeweils charakteristischem Input:<br />
� der gr<strong>am</strong>matische Codierer hat vorsprachliche Konzeptstrukturen als Input<br />
� der phonologische Codierer arbeitet auf der Basis der gr<strong>am</strong>matisch erzeugten<br />
Oberflächenstrukturen<br />
� der Artikulator hat die innere Sprache als Input<br />
� in die Kontrollintanz, den „Sprach-TÜV“, münden sowohl innere, als auch äußere<br />
Sprache<br />
� die Konzept-Komponente nimmt den Output des Sprach-TÜV auf, generiert aber auch<br />
selbstständig in Selbstkontrolle (Monitor)<br />
Gerade weil die Komponenten derart spezialisiert und autonom arbeiten, ist die enorme<br />
Sprechgeschwindigkeit (pro Sekunde ca 15 Phoneme bzw 2 bis drei Wörter, ausgewählt<br />
und bearbeitet aus Tausenden des Mentalen Lexikons) überhaupt zu bewältigen. Und in<br />
der Zentrale, der Konzept-Komponente, beschleunigt quasi ein „Zusatz-Turbo“.<br />
Als sehr hilfreich und effektiv haben sich in meinem Arbeitskreis DEUTSCH-EW (seit<br />
´93, dem Jahr erster Veröffentlichung hilfreicher Analysemodelle, bis heute 88 Projekte;<br />
meine Abstracts stehen im Internet unseres Seminars) Versuche der Rekonstruktion von<br />
Laut-Denk-Protokollen zu Kindererzählungen erwiesen. Hier ein kleiner Versuch zu<br />
Heikes Erzählung:<br />
„Also (ich bin bereit zu erzählen) es kommt ein Mann (nicht „da“, schließlich habe ich<br />
Abstand zu den Bildern) auf einem Wie/Seitenweg (Moment, ich schicke besser den<br />
anderen auf den Seitenweg und erzähle aus Jakobs Sicht) (deshalb fange ich besser von<br />
vorn an)…(Vorsicht, jetzt habe ich den Zus<strong>am</strong>menstoß genannt, ohne zu klären, dass es<br />
sich um Fahrräder handelt, das muss ich nachtragen; schließlich soll man die Geschichte<br />
auch ohne Bildervorlage verstehen)…(Nun ist der Schaden geklärt: eine Acht im Reifen.<br />
Aber wie verläuft die Reperatur ganz präzise?)…(Puh, ist das kompliziert. Am besten, ich<br />
überlege erst einmal, oder besser: Ich lasse den Jakob mit mir zus<strong>am</strong>men<br />
überlegen)…(Also, der Jakob baut das an, aber was und woran genau?)…(O weh, ich<br />
muss die beiden ja erst streiten lassen, der eine ist ja total verärgert und wütend)…(Aber<br />
diese hässlichen Schimpfwörter und Sprüche liegen mir gar nicht, zu Hause darf ich ja<br />
auch nicht so reden)…(Ich sage einfach „fluchen“, da kann sich ja jeder ausmalen, was er<br />
will)…(Mich interessiert die Radmontage viel mehr, die ist echt originell)…(Also, nicht<br />
die Acht wird ausgebaut, sondern das Rad mit der Acht)…(Den Rest nenne ich Gestell;<br />
das kommt hinten an Jakobs Fahrrad dran, denn das ist ja noch okey)…dann h<strong>am</strong>se nen<br />
sozusagen Zweierfahrrad…(Super, die Wir-Form, das verbindet, und elegant gelaufen; auf<br />
den Adjektiv-Fehler kann ich jetzt keine Rücksicht nehmen, ist gelaufen, beim Aufsatz<br />
wüsste ich, was ich mache)…(Wie heißt bloß das Fachwort für Zweierfahrrad? Fällt mir<br />
jetzt auf die Schnelle nicht ein)…(Jetzt nur nicht den Schluss vergessen, Happy Ends sind<br />
wichtig, runden schön ab)“<br />
Wir halten Rekonstruktionen dieser Art für ideale Brücken zum <strong>kindlichen</strong> Denken, oft<br />
befragen wir die AutorInnen persönlich (was hier leider nicht möglich ist).<br />
Man könnte all unsere Einzelbeobachtungen (zu unseren 17 Fußnoten) den sechs<br />
Sprachebenen von Messelken sowie meinen sechs Sprachfunktionen zuordnen:<br />
1) Auf Textebene fielen Kohärenz und geglückte Struktur der Erzählung von Heike auf.<br />
Allerdings, wie gedruckt zu erzählen, ist aus Stress-Gründen kaum erwartbar in<br />
diesem Alter, eher geht es darum, möglichst elaboriert, nicht allzu restringiert die<br />
conceptuale Mündlichkeit zu präsentieren. Zur Optimierung der Textkohäsion wären<br />
7
erweiterte Kenntnisse von Adverbien und Konjunktionen, über das „und dann – und<br />
dann“ hinaus, außerordentlich hilfreich. Doch sind die makrosemantischen<br />
Schnittstellen zwischen Vorher-Unfall-Nachher erkennbar, Heike ist fähig zu gliedern<br />
und den Sachverhalt berichtend zu klären, die Merkmale von Stufe 3 nach Boueke<br />
sind erfüllt. Einzelne A-Markierungen weisen darauf hin, dass sie der Stufe<br />
nachfolgender Entwicklung zustrebt, doch kann von Involvierung noch nicht wirklich<br />
gesprochen werden, dazu fehlt es an reicherer Valenz und Aufbau psychologischer<br />
Nähe, zB durch wörtliche Rede oder Gedankenrede, um dem Hörer das Gefühl des<br />
Dabeiseins zu ermöglichen.<br />
2) Auf der Ebene des Wortschatzes k<strong>am</strong>en Blockierungen vor („Tandem“), aber auch<br />
Glücksgriffe („ne Acht im Reifen“). Das Fachvokabular zur Radreperatur wäre<br />
hilfreich gewesen, gerade weil dieser Vorgang sie über alle Maßen interessiert. Mein<br />
Arbeitskreis berechnet zu dieser Ebene den TTR-Wert (Types dividiert durch Token;<br />
d.h.die Zahl unterschiedlicher Wörter dividiert durch die Ges<strong>am</strong>tzahl der Wörter, und<br />
zwar getrennt nach Nomen, Verben, Adjektive; je näher der Wert dem Grenzwert 1<br />
kommt, desto größer die Valenz).<br />
3) und 4) Auf die Ebenen der Wort- und Satzgr<strong>am</strong>matik (Morphematik/Syntagmatik)<br />
gehören die meisten unserer Einzelbeobachtungen: Besonders beeindruckend war das<br />
Offenhalten von Singular und Plural zum Verb „überleg-en“. <strong>Sprechprozess</strong>ual<br />
typisch erschienen Satzabbrüche, Satzfehlkonstellationen, im Wortbereich<br />
Verschleifungen, alles<strong>am</strong>t mitbegründet durch Sprechtempo bzw dem Mangel an Zeit<br />
zur Codierungsreflexion.<br />
5) Zur Laut – Buchstaben – Korrespondenz (Phonematik / Graphematik) ist anzumerken,<br />
dass die Transcription „bereinigt“ vorliegt, d.h. Ideolektale und Dialektale wurden<br />
dem Standard angepasst, was natürlich zu bedauern ist. Immerhin sind die phonetischen<br />
Reduktionen deutlich geworden; auch sie erklären sich in der Regel aus der<br />
Sprechgeschwinigkeit. Indifferenzlaute (eh, mh) sind durchweg schwierig zu<br />
transcribieren.<br />
6) Zu Aussprache, Betonung, Satzmelodie etc (Prosodie) wären Video und Tonband, wie<br />
sie in meinem Arbeitskreis Standard sind, zur Publikation von Boueke eigentlich<br />
unverzichtbar gewesen, präsentieren sie doch ein Plus an affektiven Markierungen,<br />
mithin zusätzliche Interpretationsmöglichkeiten: Gerade Kinder erzählen auch über<br />
Mimik, Gestik, mit allem, was ihnen zur Verfügung steht.<br />
Auch die Sprachfunktionen weisen auf wichtige Aspekte hin:<br />
1) ICH – Funktion (mit Betonung von Selbstbewusstsein und Wollen)<br />
(Bühler: Symptom; Jakobson: emotiv; Halliday: Personal-u.Instrumental-Modell)<br />
Die anthropogenen und soziokulturellen Voraussetzungen bei Heike wirken sich<br />
mehrfach aus: Sie spart sich und uns die wörtliche Rede zum Stimulus „fluchen“ aus,<br />
sie vermag sich von den Bildern zu lösen und in Distanz zu erzählen – das will gelernt<br />
sein -, und sie bringt ihr Erzählen trotz eingeflochtenen Ringens um Reperaturdetails<br />
gut gegliedert zum glücklichen Abschluss: ein starkes Ich mit starker Erzählintention.<br />
Auffällig ist auch ihr besonderes Interesse an technischen Details.<br />
2) DU – Funktion (Bühler: Signal; Jakobson: conativ; Halliday: Regulativ-Modell)<br />
Heike möchte, dass der Hörer die Geschichte auch ohne Bildervorlage versteht: So<br />
klärt sie zB die Fahrzeugfrage, obwohl man die Fahrräder ja sieht, und sie ordnet ihre<br />
ersten Sätze neu, um den Adressaten nicht zu verwirren.<br />
3) ES – Funktion, untergliedert in Realität, Fantasie und Erkenntnis<br />
(Bühler: Symbol; Jakobson: referentiell; Halliday: Repräsentativ-, Imaginativ- und<br />
Heuristik-Modell)<br />
8
Das oben bereits beklagte Validitätsproblem der Bildergeschichte lässt sich<br />
sprachfunktional besonders klar fassen: Die realen Reperaturdetails kann man nicht<br />
fantasievoll ausschmücken, die Bildervorlage motiviert also stärker zum Berichten als<br />
zum involvierenden Erzählen. Interessant ist auch der heuristische Aspekt: Im Vollzug<br />
des Sprechens versucht sich Heike Klarheit über den Reperaturvorgang zu erarbeiten,<br />
sie erzählt mithin nicht ohne Erkenntnisgewinn.<br />
4) WIR – Funktion (Jakobson: phatisch; Halliday: Interaktional-Modell)<br />
Zwar blendet Heike die Opfer-Täter-Interaktion weitgehend aus, doch signalisiert die<br />
Formel „dann h<strong>am</strong>se nen Zweierfahrrad“ eine Gemeinschaftslösung im Glücken eines<br />
WIR – Gefühls, und zwar kurz und prägnant.<br />
5) WIE – Funktion (Jakobson: poetisch/stilistisch)<br />
Heikes Stilistik leidet stark unter den Ungereimtheiten der Syntax aus dem Ringen um<br />
Reperatur-Klarheit heraus (typisch sind Abbrüche, Logikfehler), doch ist dies<br />
vornehmlich d<strong>am</strong>it zu begründen, dass Heike sich einem Bereich widmet, zu dem ihr<br />
das Fachvokabular fehlt. Gute Stilistik konstituiert sich bekanntlich dadurch, dass aus<br />
einem großen Reservoir bedeutungsähnlicher Wörter (Paradigma, Wortfeld) dasjenige<br />
ausgewählt werden kann, welches im Satz (Syntagma) einen möglichst poetischen<br />
Effekt auslöst. Heikes Mentales Lexikon hingegen ist nicht sehr reichhaltig bestückt.<br />
Als sehr positiv ist andererseits ihre Gliederung (Setting-Episode-Abschluss) zu<br />
qualifizieren.<br />
6) METASPRACH – Funktion (Jakobson: metasprachlich)<br />
Das Nachdenken über Sprache tritt hier eindrucksvoll hervor, es ist kennzeichnend für<br />
Heikes Erzählen. Permanent und mit großem Ehrgeiz ringt sie um den adäquaten<br />
Sprachausdruck (Sie befragt sich sogar selber: Wie heißt das?), ohne jedoch im<br />
Mentalen Lexikon genügend Auswahl vorzufinden<br />
In der Summe ist nun deutlich geworden, dass es sich bei Bildergeschichten keineswegs – wie<br />
Kritiker zu behaupten nicht müde werden – um bloßes Nacherzählen handelt. Sprachliche<br />
Differenziertheit springt nicht aus den Bildern heraus, quasi der Erzählerin entgegen. Eher<br />
lässt sich sagen: Je differenzierter und vernetzter die sprachbegrifflichen Kompetenzen, je<br />
reichhaltiger die Eintragungen im Mentalen Lexikon, desto detaillierter und präziser wird der<br />
Gegenstand oder Vorgang (hier die Reperatur) wahrgenommen. Heike kämpft regelrecht um<br />
das treffende Wort, die passende Formulierung – obwohl die Bilder doch klar vor ihr liegen.<br />
Fahrrad-Experten mit Reperaturerfahrungen hätten es hier sicher leichter, was aber nicht<br />
heißt, dass ihre Erzählleistung allein dadurch besser ausfiele.<br />
Nach so sehr viel Diagnostik zum Abschluss ein kurzer didaktischer Ausblick, denn welchen<br />
Wert hätten Wegweiser ohne Wege? In Skizze also ein Förder-<strong>Beispiel</strong> aus der Fülle unserer<br />
Projekte: Im Jahr der Maus (2ooo) brachten sich Judith Sagel und ihre Zweitklässler auf die<br />
Idee, einen Zeichentrickfilm zu Abenteuern von Maus, Elefant und Entchen selber<br />
herzustellen. Zunächst ging es um sachkundliche Hinführungen, von Medienkunde bis<br />
Daumenkino – unsere Erfahrung ist, dass dies die Motivationsbasis für kreative Prozesse<br />
herstellt. Sodann produzierten die Kinder eine Folge von dreißig Bildern zu ihren lebhaft<br />
diskutierten Ideen, und zwar in handlungslogischer Verknüpfung von Einzelszenen bis hin<br />
zum aus Kindersicht unverzichtbaren Happy End. Dann wurde getextet, passend zur<br />
Chronologie der visualisierten Ereignisse (Der Film steht mit Text im Internet zu unserem<br />
Seminar inclusive meinem Abstract zur Verfügung)(12). Pro Bild wurde das Textstück auch<br />
ins Mündliche übertragen. Wir können hier nicht ausführlich werden, doch halten wir fest:<br />
Über die für Zweitklässler nach Boueke typische Sequenzierungsstrategie des Erzählens<br />
(„und dann – und dann“) hinauszukommen, muss keineswegs der Individualreifung<br />
überlassen bleiben. Effektiver ist es unseres Erachtens, mit den Kindern gemeins<strong>am</strong> – eben<br />
9
auch interaktional (vgl Modell Hausendorf/Quasthoff) – ein GERÜST zu bauen (Bruner:<br />
scaffolding), innerhalb dessen der Einzelne sich emporarbeiten kann. Der Motivationssog<br />
lässt sich in der Sprechsprache des einzelnen Zweitklässlers vielleicht so skizzieren: Ich weiß,<br />
dass wir gemeins<strong>am</strong> eine höherwertige Erzählung gemeistert haben (mit Gliederung und<br />
voller Wechselgespräche zwischen Maus, Elefat und Entchen), unser Projektprodukt, an dem<br />
ich empirisch nachweisbar beteigt war, steht mir allzeit vor Augen, und ich studiere es oft und<br />
gerne. Nun will auch ich persönlich fortan in dieser Weise erzählen, jedenfalls bemühe ich<br />
mich intensiv, dieses Ziel zu erreichen.<br />
Unnötig zu erwähnen, dass in der Klasse „unterwegs“ immer wieder Erzählkonferenzen<br />
stattgefunden haben, nicht nur zur Auswahl der Inhalte, sondern auch zum Wechselbezug von<br />
Bild und Sprache, zur metasprachlichen Funktion also. <strong>Zum</strong> <strong>Beispiel</strong> erkannten die<br />
Zweitklässler, dass mit Hilfe der Sprache Bewegung, Dyn<strong>am</strong>ik in die ja oft statischen Bilder<br />
transportiert werden kann. Und dass man einen roten Faden im Erzählablauf, eine Gliederung<br />
(zB nach Einleitung – Höhepunkt (hier ergaben sich gleich mehrere) – Happy End) benötigt,<br />
muss ja nun wirklich nicht jede/r Einzelne eins<strong>am</strong>, still, für sich erkennen.<br />
Wenn die neuen Grundschulrichtlinien NRW (Stand Okt.2oo2) bis zum Ende des 4.Schuljahrs<br />
acht Projekte (eines pro Halbjahr) vorsehen und die Freude an mündlichem und schriftlichem<br />
Ausdruck für besonders wichtig erachten, so ist mit meinem didaktischen Fingerzeig<br />
vielleicht nicht nur ein Abschluss, sondern – was mir wichtiger wäre – ein Ausblick geglückt.<br />
Anmerkungen<br />
1)Boueke/Schülein u.a.(1995): Wie Kinder erzählen. Untersuchungen zur Erzähltheorie und<br />
zur Entwicklung narrativer Fähigkeiten. München<br />
2)Hausendorf/Quasthoff (1996): Sprachentwicklung und Interaktion. Eine linguistische Studie<br />
zum Erwerb von Diskursfähigkeit. Hallstadt<br />
Hausendorf/Wolf (1998): Erzählentwicklung und Didaktik. Kognitions- und<br />
interaktionstheoretische Perspektiven. In: Der Deutschunterricht, Heft 1, S.38-52<br />
3)Symposion Deutschdidaktik (Hg):Zeitschrift Didaktik Deutsch (2000-2002): Hefte 8,10-13.<br />
Baltmannsweiler<br />
4)Weingarten/Günther (1998): Schriftspracherwerb (darin der Aufsatz von K.B.Günther).<br />
Opladen<br />
5)K<strong>am</strong>mler/Knapp(Hg) (2oo2): Empirische Unterrichtsforschung und Deutschdidaktik<br />
(darin der Aufsatz von Margarete Ott),<br />
Baltmannsweiler<br />
6)<strong>Steinert</strong> (1995): Hilfreiche Modelle zur Analyse von Sprachunterricht. In:<br />
Becher/Bennack(Hg): Taschenbuch Grundschule. Zweite Auflage, Baltmannsweiler<br />
7)Messelken (1971): Empirische Sprachdidaktik, Heidelberg<br />
Ders. (1973): Zur Planung von Sprachunterricht. In: Grundschulrichtlinien NRW<br />
8)Levelt (1995): Speaking – From Intention to Articulation. Fourth edition, Massachusetts<br />
9)s.o. Fußnote 7<br />
10)s.o. Fußnote 6<br />
11)vgl.Hörmann (1971): Psychologie der Sprache, Berlin<br />
12)Arbeitskreis DEUTSCH-EW, Uni Köln (2ooo): Projekt von Judith Sagel mit linguistischdidaktischer<br />
Analyse, unveröff.Ex<strong>am</strong>ensarbeit; mein Abstract dazu sowie zu allen 88<br />
Projekten und Analysen Quantitativer und Qualitativer Sprachdiagnostik habe ich ins Internet<br />
unseres Seminars gestellt.<br />
(veröffentlicht in der Festschrift für Prof.Dr.Messelken zu seinem 65.Geburtstag:<br />
Burkhardt/Fink (Hg): Didaktik der Sprache und Sprache der Didaktik, Würzburg 2003)<br />
10